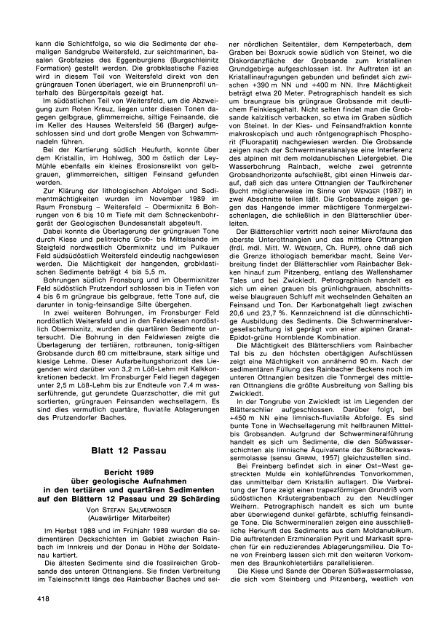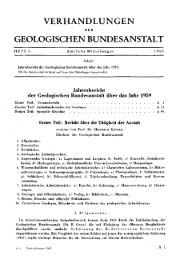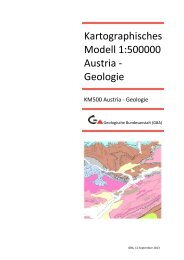DOWNLOAD - Geologische Bundesanstalt
DOWNLOAD - Geologische Bundesanstalt
DOWNLOAD - Geologische Bundesanstalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
kann die Schichtfolge, so wie die Sedimente der ehemaligen<br />
Sandgrube Weitersfeld, zur seichtmarinen, basalen<br />
Grobfazies des Eggenburgiens (Burgschleinitz<br />
Formation) gestellt werden. Die grobklastische Fazies<br />
wird in diesem Teil von Weitersfeld direkt von den<br />
grüngrauen Tonen überlagert, wie ein Brunnenprofil unterhalb<br />
des Bürgerspitals gezeigt hat.<br />
Im südöstlichen Teil von Weitersfeld, um die Abzweigung<br />
zum Roten Kreuz, liegen unter diesen Tonen dagegen<br />
gelbgraue, glimmerreiche, siltige Feinsande, die<br />
im Keller des Hauses Weitersfeld 56 (Barger) aufgeschlossen<br />
sind und dort große Mengen von Schwammnadeln<br />
führen.<br />
Bei der Kartierung südlich Heufurth, konnte über<br />
dem Kristallin, im Hohlweg, 300 m östlich der Ley-<br />
Mühle ebenfalls ein kleines Erosionsrelikt von gelbgrauen,<br />
glimmerreichen, siltigen Feinsand gefunden<br />
werden.<br />
Zur Klärung der lithologischen Abfolgen und Sedimentmächtigkeiten<br />
wurden im November 1989 im<br />
Raum Fronsburg - Weitersfeld - Obermixnitz 6 Bohrungen<br />
von 6 bis 10m Tiefe mit dem Schnecken bohrgerät<br />
der <strong>Geologische</strong>n <strong>Bundesanstalt</strong> abgeteuft.<br />
Dabei konnte die Überlagerung der grüngrauen Tone<br />
durch Kiese und pelitreiche Grob- bis Mittelsande im<br />
Steigfeld nordwestlich Obermixnitz und im Pulkauer<br />
Feld südsüdöstlich Weitersfeld eindeutig nachgewiesen<br />
werden. Die Mächtigkeit der hangenden, grobklastischen<br />
Sedimente beträgt 4 bis 5,5 m.<br />
Bohrungen südlich Fronsburg und im Obermixnitzer<br />
Feld südöstlich Prutzendorf schlossen bis in Tiefen von<br />
4 bis 6 m grüngraue bis gelbgraue, fette Tone auf, die<br />
darunter in tonig-feinsandige Silte übergehen.<br />
In zwei weiteren Bohrungen, im Fronsburger Feld<br />
nordöstlich Weitersfeld und in den Feldwiesen nordöstlich<br />
Obermixnitz, wurden die quartären Sedimente untersucht.<br />
Die Bohrung in den Feldwiesen zeigte die<br />
Überlagerung der tertiären, rotbraunen, tonig-siltigen<br />
Grobsande durch 80 cm mittel braune, stark siltige und<br />
kiesige Lehme. Dieser Aufarbeitungshorizont des liegenden<br />
wird darüber von 3,2 m Löß-Lehm mit Kalkkonkretionen<br />
bedeckt. Im Fronsburger Feld liegen dagegen<br />
unter 2,5 m Löß-Lehm bis zur Endteufe von 7,4 m wasserführende,<br />
gut gerundete Quarzschotter, die mit gut<br />
sortierten, grüngrauen Feinsanden wechsellagern. Es<br />
sind dies vermutlich quartäre, fluviatile Ablagerungen<br />
des Prutzendorfer Baches.<br />
Blatt 12 Passau<br />
Bericht 1989<br />
über geologische Aufnahmen<br />
in den tertiären und quartären Sedimenten<br />
auf den Blättern 12 Passau und 29 Schärding<br />
Von STEFANSALVERMOSER<br />
(Auswärtiger Mitarbeiter)<br />
Im Herbst 1988 und im Frühjahr 1989 wurden die sedimentären<br />
Deckschichten im Gebiet zwischen Rainbach<br />
im Innkreis und der Donau in Höhe der Soldatenau<br />
kartiert.<br />
Die ältesten Sedimente sind die fossilreichen Grobsande<br />
des unteren Ottnangiens. Sie finden Verbreitung<br />
im Taleinschnitt längs des Rainbacher Baches und sei-<br />
418<br />
ner nördlichen Seitentäler, dem Kernpeterbach, dem<br />
Graben bei Boxruck sowie südlich von Steinet, wo die<br />
Diskordanzfläche der Grobsande zum kristallinen<br />
Grundgebirge aufgeschlossen ist. Ihr Auftreten ist an<br />
Kristallinaufragungen gebunden und befindet sich zwischen<br />
+390 m NN und +400 m NN. Ihre Mächtigkeit<br />
beträgt etwa 20 Meter. Petrographisch handelt es sich<br />
um braungraue bis grüngraue Grobsande mit deutlichem<br />
Feinkiesgehalt. Nicht selten findet man die Grobsande<br />
kalzitisch verbacken, so etwa im Graben südlich<br />
von Steinet. In der Kies- und Feinsandfraktion konnte<br />
makroskopisch und auch röntgenographisch Phosphorit<br />
(Fluorapatit) nachgewiesen werden. Die Grobsande<br />
zeigen nach der Schwermineralanalyse eine Interferenz<br />
des alpinen mit dem moldanubischen Liefergebiet. Die<br />
Wasserbohrung Rainbach, welche zwei getrennte<br />
Grobsandhorizonte aufschließt, gibt einen Hinweis darauf,<br />
daß sich das untere Ottnangien der Taufkirchener<br />
Bucht möglicherweise im Sinne von WENGER(1987) in<br />
zwei Abschnitte teilen läßt. Die Grobsande zeigen gegen<br />
das Hangende immer mächtigere Tonmergelzwischenlagen,<br />
die schließlich in den Blätterschlier überleiten.<br />
Der Blätterschlier vertritt nach seiner Mikrofauna das<br />
oberste Unterottnangien und das mittlere Ottnangien<br />
(frdl. mdl. Mitt. W. WENGER,eh. Rupp), ohne daß sich<br />
die Grenze lithologisch bemerkbar macht. Seine Verbreitung<br />
findet der Blätterschlier vom Rainbacher Bekken<br />
hinauf zum Pitzenberg, entlang des Wallenshamer<br />
Tales und bei Zwickledt. Petrographisch handelt es<br />
sich um einen grauen bis grünlichgrauen, abschnittsweise<br />
blaugrauen Schluff mit wechselnden Gehalten an<br />
Feinsand und Ton. Der Karbonatgehalt liegt zwischen<br />
20,6 und 23,7 %. Kennzeichnend ist die dünnschichtige<br />
Ausbildung des Sediments. Die Schwermineralvergesellschaftung<br />
ist geprägt von einer alpinen Granat-<br />
Epidot-grüne Hornblende Kombination.<br />
Die Mächtigkeit des Blätterschliers vom Rainbacher<br />
Tal bis zu den höchsten obertägigen Aufschlüssen<br />
zeigt eine Mächtigkeit von annähernd 90 m. Nach der<br />
sedimentären Füllung des Rainbacher Beckens noch im<br />
unteren Ottnangien besitzen die Tonmergel des mittleren<br />
Ottnangiens die größte Ausbreitung von Salling bis<br />
Zwickledt.<br />
In der Tongrube von Zwickledt ist im Liegenden der<br />
Blätterschlier aufgeschlossen. Darüber folgt, bei<br />
+450 m NN eine limnisch-fluviatile Abfolge. Es sind<br />
bunte Tone in Wechsellagerung mit hellbraunen MitteIbis<br />
Grobsanden. Aufgrund der Schwermineralführung<br />
handelt es sich um Sedimente, die den Süßwasserschichten<br />
als limnische Äquivalente der Süßbrackwassermolasse<br />
(sensu GRIMM, 1957) gleichzustellen sind.<br />
Bei Freinberg befindet sich in einer Ost-West gestreckten<br />
Mulde ein kohleführendes Tonvorkommen,<br />
das unmittelbar dem Kristallin auflagert. Die Verbreitung<br />
der Tone zeigt einen trapezförmigen Grundriß vom<br />
südöstlichen Kräutergrabenbach zu den Neudlinger<br />
Weihern. Petrographisch handelt es sich um bunte<br />
aber überwiegend dunkel gefärbte, schluffig feinsandige<br />
Tone. Die Schwermineralien zeigen eine ausschließliche<br />
Herkunft des Sediments aus dem Moldanubikum.<br />
Die auftretenden Erzmineralien Pyrit und Markasit sprechen<br />
für ein reduzierendes Ablagerungsmilieu. Die Tone<br />
von Freinberg lassen sich mit den weiteren Vorkommen<br />
des Braunkohletertiärs parallelisieren.<br />
Die Kiese und Sande der Oberen Süßwassermolasse,<br />
die sich vom Steinberg und Pitzenberg, westlich von
Münzkirchen bis Freinberg erstrecken konnten mit Hilfe<br />
der Schwermineralanalyse erstmals gegliedert werden:<br />
1) Die tiefste Einheit bilden weißgraue Mittel- bis<br />
Grobsande, die durch ihren hohen Feldspatgehalt<br />
eine arkoseartige Zusammensetzung erhalten. Das<br />
Schwermineralbild wird von einer Zirkon-Monazit-<br />
Assoziation dominiert und belegt somit eine Herkunft<br />
aus dem Moldanubikum. Die Sande treten im<br />
Gebiet um Höh, südlich von Freinberg und bei Reikersham<br />
mit einer Mächtigkeit von 15-20 m auf.<br />
2) Unmittelbar über den Sanden folgt dann die<br />
schichtflutartige Schüttung des Pitzenberg Schotters.<br />
Dieses äußerst grobkörnige Sediment wurde<br />
mit hohen Sedimentationsraten abgelagert.<br />
Der Pitzenberg Schotter findet Verbreitung am Pitzenberg<br />
bei Münzkirchen und in einem schmalen<br />
Streifen von Bach über Hareth - Edtwald nach<br />
Freinberg. Am Pitzenberg, bei Bach, Stöckl und<br />
südöstlich von Pühret finden sich größere Gruben,<br />
die noch im Abbau stehen. Der Schotter zeigt eine<br />
deutliche Kaolinverwitterung sowie einen ausgesprochenen<br />
Restschottercharakter. 90-95 % der<br />
Gerölle bestehen aus Quarz und Quarzit. Daneben<br />
finden sich stark zersetzte Restgerölle wie Gneise,<br />
Serpentinite, metamorphe Grüngesteine und rote<br />
quarzitische Sandsteine. Die in-situ-Verwitterung<br />
führte auch zu einer Eliminierung der instabilen<br />
Schwermineralien, sowie zu einer Anreicherung der<br />
stabilen und extrem stabilen Mineralien. Im derart<br />
veränderten Schwermineralspektrum bildete sich<br />
eine Staurolith-Rutil-Disthen-Kombination im Sediment.<br />
Im Zusammenhang mit der Kaolinverwitterung entstand<br />
ein Einkieselungshorizont in den hangenden<br />
Schotterpartien. Dieses kieselig zementierte Quarzkonglomerat<br />
findet sich einzig am Pitzenberg in<br />
einer in-situ-lagerung an der Oberkante des Schotters.<br />
Es zeigt makroskopisch denselben petrographischen<br />
Bestand wie der unverfestigte Schotter.<br />
Um die Ortschaft Steinberg und längs der Straße<br />
Schärding - Münzkirchen, etwa von Stöckl an der<br />
Straße bis Schacherwirt, befindet sich ein reliktisches<br />
Schottervorkommen. Dieser sogenannte<br />
Steinberg Schotter ist ein Restschotter alpiner Herkunft,<br />
dessen Schwermineralbild von einem Staurolith-Disthen<br />
Maximum geprägt ist. Der Geröllbestand<br />
setzt sich zu 88 % aus Quarz und Quarziten<br />
zusammen. Aufgrund seiner petrographischen Ähnlichkeit<br />
mit dem Pitzenberg Schotter wird er diesem<br />
gleichgestellt.<br />
Die Untergrenzen des Pitzenberg Schotters liegen<br />
am Pitzenberg bei +510 m NN, im Verbreitungsgebiet<br />
Bach - Freinberg und am Steinberg bei +460 m<br />
NN. Da eine fluviatile Umlagerung nach der Restschotterbildung<br />
aufgrund schwermineralanalytischer<br />
Ergebnisse ausscheidet, scheinen tektonische Bewegungen<br />
für eine Hochlage des Pitzenbergs zu<br />
seiner näheren Umgebung verantwortlich zu sein,<br />
zumal ein tektonisches Lineament längs des Wallenshamer<br />
Tales die Schotter am Pitzenberg und am<br />
Steinberg trennt.<br />
Zur Frage, ob sich marine Sedimente oder kristallines<br />
Grundgebirge im Liegenden der Schotter im<br />
Verbreitungsgebiet am Pitzenberg befinden, konnten<br />
Bohrberichte der Fa. Gebr. Dorfner, Hirschau/<br />
Oberpfalz ausgewertet werden. Die Verteilung der<br />
Bohrungen zeigt, daß im Süden marine Tonmergel<br />
und im Norden kristalline Gesteine überlagert werden.<br />
3) Von Windpessl - Asing bis etwa Buchet, östlich von<br />
Schardenberg befindet sich ein Schotterriedei, der<br />
sich deutlich vom Pitzenberg Schotter unterscheidet.<br />
Petrographisch handelt es sich bei diesem Sediment<br />
um einen stark grobsandigen Mittelkies mit<br />
maximalen Geröllgrößen bis 19 cm 0. Die Geröllanalyse<br />
zeigt 76 % Quarz und Quarzite und 20 %<br />
Kristallingerölle. In der Grobsandfraktion finden sich<br />
frische Feldspäte angereichert. Ein wesentliches<br />
Merkmal ist die starke Eisenschüssigkeit des Schotters.<br />
Die Schwermineralanalysen zeigen die Mischung<br />
zweier Populationen: Eine direkte moldanubische<br />
Schüttung steht im Wechsel mit einer Aufarbeitung<br />
des älteren Restschotters.<br />
Der Schotter lagert bei +490 m NN mit einer Mächtigkeit<br />
von 20 m. Im Südwesten der Verbreitungsgrenze,<br />
bei Schwendt, zeigt er einen rinnenförmigen<br />
Kontakt zum kristallinen Sockel. Petrographie und<br />
lagerungsverhältnisse zeigen auch eine erosive Eintiefung<br />
in den Pitzenberg Schotter zwischen Windpessl<br />
und Bach.<br />
An der Donau, bei Parz, findet sich eine pleistozäne<br />
Hochterrasse mit geringer Ausdehnung bei +315 m NN.<br />
Sie ist im östlichen Teil überlagert von löß. Der löß<br />
weist einen Karbonatgehalt von 29,5 % auf und führt<br />
eine reiche Molluskenfauna. In einem tieferen Niveau<br />
werden, ebenfalls bei Parz, Niederterrassenschotter<br />
abgelagert. Die höhergelegene Terrasse lagert bei<br />
+305 m NN, die tiefere, als Erosionsform der höheren,<br />
bei +295 m NN.<br />
Große Verbreitung finden Deckschichten aus lehm<br />
und Fließerden. Die Fließerden treten an den Kanten<br />
der Schotterhochflächen auf, wobei Mächtigkeiten bis<br />
2 m beobachtet wurden. Neben lehmigem Material führen<br />
sie Schotter und Kiese, die oft als Geröllschnüre<br />
eingeregelt sind. Solifluktionsdecken sind besonders<br />
gut aufgeschlossen an der Straße von Reitern nach<br />
Straß sowie im Hangenden der Schliergrube südlich<br />
von Wallensham. Verwitterungslehme und Staublehm<br />
konnten, auch durch sedimentpetrographische Untersuchungen<br />
nicht durchgehend getrennt werden. Deren<br />
Mächtigkeit war stets geringer als bei den Fließerdedecken.<br />
Holozäne Sedimente finden sich entlang der Donau,<br />
wobei die größten Areale von der Donauinsel Soldatenau,<br />
sowie am rechten Donauufer von der Soldatenau<br />
bis Parz gebildet werden. Petrographisch handelt es<br />
sich dabei um Sande und Kiese im Wechsel mit schluffigen<br />
Sanden.<br />
Bericht 1989<br />
über geologische Aufnahmen<br />
im Tertiär des Gebietes um Münzkirchen<br />
auf den Blättern 12 Passau, 13 Engelhartszell,<br />
29 Schärding und 30 Neumarkt i.H.<br />
Von WILFRIED WALSER<br />
(Auswärtiger Mitarbeiter)<br />
Das Kartiergebiet, ca. 10 km nordöstlich von Schärding<br />
,gelegen, erstreckt sich über Teilgebiete der Gemeinden<br />
Esternberg, Münzkirchen, Rainbach und St.<br />
Roman. Die tertiären Sedimente in der Umgebung von<br />
419
Münzkirchen bis Freinberg erstrecken konnten mit Hilfe<br />
der Schwermineralanalyse erstmals gegliedert werden:<br />
1) Die tiefste Einheit bilden weißgraue Mittel- bis<br />
Grobsande, die durch ihren hohen Feldspatgehalt<br />
eine arkoseartige Zusammensetzung erhalten. Das<br />
Schwermineralbild wird von einer Zirkon-Monazit-<br />
Assoziation dominiert und belegt somit eine Herkunft<br />
aus dem Moldanubikum. Die Sande treten im<br />
Gebiet um Höh, südlich von Freinberg und bei Reikersham<br />
mit einer Mächtigkeit von 15-20 m auf.<br />
2) Unmittelbar über den Sanden folgt dann die<br />
schichtflutartige Schüttung des Pitzenberg Schotters.<br />
Dieses äußerst grobkörnige Sediment wurde<br />
mit hohen Sedimentationsraten abgelagert.<br />
Der Pitzenberg Schotter findet Verbreitung am Pitzenberg<br />
bei Münzkirchen und in einem schmalen<br />
Streifen von Bach über Hareth - Edtwald nach<br />
Freinberg. Am Pitzenberg, bei Bach, Stöckl und<br />
südöstlich von Pühret finden sich größere Gruben,<br />
die noch im Abbau stehen. Der Schotter zeigt eine<br />
deutliche Kaolinverwitterung sowie einen ausgesprochenen<br />
Restschottercharakter. 90-95 % der<br />
Gerölle bestehen aus Quarz und Quarzit. Daneben<br />
finden sich stark zersetzte Restgerölle wie Gneise,<br />
Serpentinite, metamorphe Grüngesteine und rote<br />
quarzitische Sandsteine. Die in-situ-Verwitterung<br />
führte auch zu einer Eliminierung der instabilen<br />
Schwermineralien, sowie zu einer Anreicherung der<br />
stabilen und extrem stabilen Mineralien. Im derart<br />
veränderten Schwermineralspektrum bildete sich<br />
eine Staurolith-Rutil-Disthen-Kombination im Sediment.<br />
Im Zusammenhang mit der Kaolinverwitterung entstand<br />
ein Einkieselungshorizont in den hangenden<br />
Schotterpartien. Dieses kieselig zementierte Quarzkonglomerat<br />
findet sich einzig am Pitzenberg in<br />
einer in-situ-lagerung an der Oberkante des Schotters.<br />
Es zeigt makroskopisch denselben petrographischen<br />
Bestand wie der unverfestigte Schotter.<br />
Um die Ortschaft Steinberg und längs der Straße<br />
Schärding - Münzkirchen, etwa von Stöckl an der<br />
Straße bis Schacherwirt, befindet sich ein reliktisches<br />
Schottervorkommen. Dieser sogenannte<br />
Steinberg Schotter ist ein Restschotter alpiner Herkunft,<br />
dessen Schwermineralbild von einem Staurolith-Disthen<br />
Maximum geprägt ist. Der Geröllbestand<br />
setzt sich zu 88 % aus Quarz und Quarziten<br />
zusammen. Aufgrund seiner petrographischen Ähnlichkeit<br />
mit dem Pitzenberg Schotter wird er diesem<br />
gleichgestellt.<br />
Die Untergrenzen des Pitzenberg Schotters liegen<br />
am Pitzenberg bei +510 m NN, im Verbreitungsgebiet<br />
Bach - Freinberg und am Steinberg bei +460 m<br />
NN. Da eine fluviatile Umlagerung nach der Restschotterbildung<br />
aufgrund schwermineralanalytischer<br />
Ergebnisse ausscheidet, scheinen tektonische Bewegungen<br />
für eine Hochlage des Pitzenbergs zu<br />
seiner näheren Umgebung verantwortlich zu sein,<br />
zumal ein tektonisches Lineament längs des Wallenshamer<br />
Tales die Schotter am Pitzenberg und am<br />
Steinberg trennt.<br />
Zur Frage, ob sich marine Sedimente oder kristallines<br />
Grundgebirge im Liegenden der Schotter im<br />
Verbreitungsgebiet am Pitzenberg befinden, konnten<br />
Bohrberichte der Fa. Gebr. Dorfner, Hirschau/<br />
Oberpfalz ausgewertet werden. Die Verteilung der<br />
Bohrungen zeigt, daß im Süden marine Tonmergel<br />
und im Norden kristalline Gesteine überlagert werden.<br />
3) Von Windpessl - Asing bis etwa Buchet, östlich von<br />
Schardenberg befindet sich ein Schotterriedei, der<br />
sich deutlich vom Pitzenberg Schotter unterscheidet.<br />
Petrographisch handelt es sich bei diesem Sediment<br />
um einen stark grobsandigen Mittelkies mit<br />
maximalen Geröllgrößen bis 19 cm 0. Die Geröllanalyse<br />
zeigt 76 % Quarz und Quarzite und 20 %<br />
Kristallingerölle. In der Grobsandfraktion finden sich<br />
frische Feldspäte angereichert. Ein wesentliches<br />
Merkmal ist die starke Eisenschüssigkeit des Schotters.<br />
Die Schwermineralanalysen zeigen die Mischung<br />
zweier Populationen: Eine direkte moldanubische<br />
Schüttung steht im Wechsel mit einer Aufarbeitung<br />
des älteren Restschotters.<br />
Der Schotter lagert bei +490 m NN mit einer Mächtigkeit<br />
von 20 m. Im Südwesten der Verbreitungsgrenze,<br />
bei Schwendt, zeigt er einen rinnenförmigen<br />
Kontakt zum kristallinen Sockel. Petrographie und<br />
lagerungsverhältnisse zeigen auch eine erosive Eintiefung<br />
in den Pitzenberg Schotter zwischen Windpessl<br />
und Bach.<br />
An der Donau, bei Parz, findet sich eine pleistozäne<br />
Hochterrasse mit geringer Ausdehnung bei +315 m NN.<br />
Sie ist im östlichen Teil überlagert von löß. Der löß<br />
weist einen Karbonatgehalt von 29,5 % auf und führt<br />
eine reiche Molluskenfauna. In einem tieferen Niveau<br />
werden, ebenfalls bei Parz, Niederterrassenschotter<br />
abgelagert. Die höhergelegene Terrasse lagert bei<br />
+305 m NN, die tiefere, als Erosionsform der höheren,<br />
bei +295 m NN.<br />
Große Verbreitung finden Deckschichten aus lehm<br />
und Fließerden. Die Fließerden treten an den Kanten<br />
der Schotterhochflächen auf, wobei Mächtigkeiten bis<br />
2 m beobachtet wurden. Neben lehmigem Material führen<br />
sie Schotter und Kiese, die oft als Geröllschnüre<br />
eingeregelt sind. Solifluktionsdecken sind besonders<br />
gut aufgeschlossen an der Straße von Reitern nach<br />
Straß sowie im Hangenden der Schliergrube südlich<br />
von Wallensham. Verwitterungslehme und Staublehm<br />
konnten, auch durch sedimentpetrographische Untersuchungen<br />
nicht durchgehend getrennt werden. Deren<br />
Mächtigkeit war stets geringer als bei den Fließerdedecken.<br />
Holozäne Sedimente finden sich entlang der Donau,<br />
wobei die größten Areale von der Donauinsel Soldatenau,<br />
sowie am rechten Donauufer von der Soldatenau<br />
bis Parz gebildet werden. Petrographisch handelt es<br />
sich dabei um Sande und Kiese im Wechsel mit schluffigen<br />
Sanden.<br />
Bericht 1989<br />
über geologische Aufnahmen<br />
im Tertiär des Gebietes um Münzkirchen<br />
auf den Blättern 12 Passau, 13 Engelhartszell,<br />
29 Schärding und 30 Neumarkt i.H.<br />
Von WILFRIED WALSER<br />
(Auswärtiger Mitarbeiter)<br />
Das Kartiergebiet, ca. 10 km nordöstlich von Schärding<br />
,gelegen, erstreckt sich über Teilgebiete der Gemeinden<br />
Esternberg, Münzkirchen, Rainbach und St.<br />
Roman. Die tertiären Sedimente in der Umgebung von<br />
419
Münzkirchen, die außer im Südwesten vom Kristallin<br />
der Böhmischen Masse umgeben sind, wurden im<br />
Maßstab 1 : 10.000 kartiert und stratigraphisch gegliedert.<br />
Fossilreiche Grobsande<br />
Die fossilreichen Grobsande sind marine Transgressionsbildungen<br />
des Unter-Ottnangiens. Es handelt sich<br />
um braungraue bis grünlichgraue, teilweise schwach<br />
feinkiesige, grobe Quarzsande, in die grünlichgraue,<br />
tonig-siltige Zwischen lagen eingeschaltet sind. Meist<br />
ist eine Schrägschichtung mit flachen Winkeln ausgebildet.<br />
An der Basis können die Pelit-Zwischenlagen<br />
fehlen. Vereinzelt ist in kleineren Bereichen die Schichtung<br />
durch Aufarbeitung und anschließende Resedimentation<br />
zerstört. Pelitklasten und teilweise auch<br />
Quarzgerölle sind dann wirr in die Mittel- bis Grobsande<br />
eingelagert.<br />
Die Sedimente treten im Südwesten des Kartiergebietes<br />
in einzelnen kleinflächigen Bereichen, wie z.B.<br />
bei Espernberg, zwischen Steinet und Boxruck, entlang<br />
des Boxruckbaches und in einem Streifen, der vom Gehöft<br />
Hofer über Strößberg Richtung Rainbach zieht,<br />
auf. Meist lagern die Sedimente unmittelbar dem Kristallin<br />
auf. Stellenweise haben sich über dem Grundgebirge<br />
ausgeprägte Transgressionslagen mit einzelnen<br />
Geröllkomponenten bis zu 30 cm Durchmesser entwikkelt,<br />
wie im Aufschluß beim Gehöft Hofer, 500 m nördlich<br />
von Strößberg zu beobachten ist. Die liegendgrenze<br />
der fossilreichen Grobsande ist, in Abhängigkeit<br />
vom Grundgebirgsrelief, stark schwankend. Ihre maximale<br />
Mächtigkeit wird im Untersuchungsgebiet auf ca.<br />
20 m geschätzt.<br />
Tonmergel des Ottnangiens<br />
Die Tonmergel sind im Südwesten des Kartiergebietes,<br />
vom Pitzenberg bis hinab zum Rainbachtal verbreitet.<br />
Das östlichste Vorkommen liegt in der Umgebung<br />
von Sumetsrad. Es handelt sich um grünlichgraue, teilweise<br />
auch blaugraue, tonig-sandige Silte bis Tonsilte,<br />
die durch mm-mächtige Feinsandbestege eine ausgezeichnete<br />
Schichtung aufweisen. Wie durch mikropaläontologische<br />
Untersuchungen festgestellt wurde, bestehen<br />
die Tonmergel in den tieferen Partien aus Robulusschlier<br />
s.1. und in den hangenden Bereichen aus Rotalienschlier.<br />
Aufgeschlossen sind die marinen Pelite<br />
hauptsächlich in ehemaligen Schliergruben, wie z.B.<br />
östlich von Hingsham, westlich von Salling, westlich<br />
von Steinet und westlich von Sumetsrad. In der Mergelgrube<br />
600 m östlich von Hingsham sind die Tonmergel<br />
bis in eine Höhe von 485 m ü.NN aufgeschlossen.<br />
Der Grenzbereich zu den Pitzenberg-Schottern ist unaufgeschlossen<br />
und zudem durch Fließerden verhüllt.<br />
Die Auswertung einer Bohrung an der Schärdinger<br />
Straße weist jedoch darauf hin, daß die Tonmergel<br />
noch deutlich weiter nach Norden reichen und in einer<br />
Höhe von 510-520 m Ü. NN von den Pitzenberg-Schottern<br />
überlagert werden.<br />
Meist gehen die marinen Pelite an der Basis, durch<br />
häufiger werdende Einschaltung von Grobsandlagen, in<br />
die Fazies der fossilreichen Grobsande über. Teilweise<br />
lagern sie, hauptsächlich im nördlichen Verbreitungsgebiet,<br />
unmittelbar dem Grundgebirge auf. Obwohl die<br />
Tonmergel über eine vertikale Spannweite von mehr als<br />
100 m verbreitet sind, dürfte ihre reelle Mächtigkeit<br />
30 m nicht überschreiten.<br />
420<br />
Liegendsande<br />
Bei Gersdorf, Reikersham, Ludham und Ficht treten<br />
in einer Höhe zwischen 490-530 m Ü. NN fluviatile<br />
Sande auf, die unmittelbar dem Grundgebirge auflagern.<br />
Sie werden von den Pitzenberg-Schottern überlagert.<br />
Gute Aufschlüsse befinden sich nordwestlich von<br />
Reikersham, östlich von Gersdorf und in Ludham. Die<br />
Sande von Reikersham und Ludham sind sehr ähnlich<br />
ausgebildet. Teilweise Feinkies führende, graue und<br />
gelbbraune Grobsande wechsellagern mit weißgrauen<br />
und braunen fein- bis mittelgroben Sanden im Zentimeter-<br />
bis Dezimeterbereich. Hin und wieder sind dünne<br />
Tonlinsen sowie aufgearbeitete Tone in Form von Tongeröllen<br />
enthalten. Die Sande zeigen eine wellige,<br />
nichtparallele Schichtung. Bei Gersdorf ist hingegen<br />
ein homogener, gut sortierter Fein- bis Mittelsand mit<br />
intensiv gelber Farbe aufgeschlossen.<br />
Der Leichtmineralbestand der Sande setzt sich<br />
hauptsächlich aus Quarz, Glimmer und Mikroklin zusammen.<br />
Das Schwermineralspektrum beweist die moldanubische<br />
Herkunft der Liegendsande. Sie wurden<br />
von regionalen Mäander-Flüssen abgelagert. Da die<br />
Sedimente im Liegenden der Pitzenberg-Schotter auftreten,<br />
sind sie älter als die alpinen Restschotter. Eine<br />
genaue zeitliche Einstufung läßt sich aufgrund der Lagerungsverhältnisse<br />
jedoch nicht vornehmen.<br />
Braunkohlentertiär<br />
Bei Oberzeilberg und Ringlholz treten in einer Höhe<br />
zwischen 490-520 m ü.NN gelblichbraune, stellenweise<br />
auch graue Mittel- bis Grobsande auf, in die hellgraue<br />
und blaugraue, sandige Tone eingeschaltet sind. Die<br />
Sedimente liegen unmittelbar dem Kristallin auf und<br />
werden von den Pitzenberg-Schottern überlagert.<br />
Die Hauptbestandteile der Sande bilden Quarz, Mikroklin<br />
und Glimmer, als Aufarbeitungsprodukte des<br />
moldanubischen Kristallins. Auch die Schwermineralverteilung<br />
weist auf einen moldanubischen Ursprung<br />
des Sediments hin. Der Ton zeigt in der Fraktion
ter. Quarze und Quarzite stellen mindestens 92 %<br />
(meist 97-100 %) des Geröllspektrums. Kristallingerölle<br />
und andere Nichtquarze sind meist vergrust. Das<br />
Schotter-Zwischen mittel enthält in der Fraktion
l rn_~_. _1J_~_[;)_CD_00GJ_. C\!J J<br />
Bericht 1992<br />
über Revisionsbegehungen<br />
auf den Blättern 12 Passau, 29 Schärding,<br />
30 Neumarkt und 31 Eferding<br />
OTTOTHIELE<br />
(Auswärtiger Mitarbeiter)<br />
Als Beitrag für die <strong>Geologische</strong> Karte1: 200.000 Blatt<br />
Passau des Bayerischen <strong>Geologische</strong>n Landesamtes wurden<br />
im Bereich des Kristallinen Grundgebirges des Sauwaldes<br />
Revisionsbegehungen durchgeführt.<br />
Es betrifft dies, wie im Titel erwähnt, Anteile der österreichischen<br />
Kartenblätter 1 : 50.000 Nr. 12,29,30 und 31.<br />
Vor allem wurden dabei die auf der Übersichtskarte des<br />
Kristallins des westlichen Mühlviertels und des SauwaIdes<br />
von der <strong>Geologische</strong>n Karte1: 75.000 von F. SCHAD-<br />
LER übernommenen Granitvorkommen des Blattes Eferding<br />
begangen und überprüft.<br />
Bei allen bemusterten Vorkommen scheint es sich um<br />
keine echten Granite, sondern eher um mehr oder minder<br />
stark homogenisierte, granitähnliche Perlgneise zu handeln.<br />
Stellenweise werden diese allerdings von schmächtigen<br />
jüngeren sauren Ganggraniten durchsetzt, die aber<br />
im Detail nicht kartenmäßig ausscheidbar sind.<br />
Gelegentlich dieser Aufnahmen wurden die im westlichen<br />
Sauwald dem Kristallin auflagernden mächtigen<br />
Quarzrestschotter ("Pitzenbergschotter") nochmals in<br />
Augenschein genommen und studiert. Hierbei wurden -<br />
zum Teil außerhalb der von der <strong>Geologische</strong>n <strong>Bundesanstalt</strong><br />
vergüteten Aufnahmstage - die Schottergruben Pitzenberg-Salling<br />
(ÖK 29), Zeilberg-Ringelholz, Windpessl-Kugelbuchedt,<br />
Bach, Stöckl und Silbering (alle ÖK<br />
12) sowie die Reste der schon stark verfallenenen, zum Teil<br />
schon eingeebneten Gruben von Höh und Hareth studiert.<br />
In Silbering ist die Schottergewinnung noch im Gange, bei<br />
allen anderen Gruben ruht zur Zeit der Abbau.<br />
Die in Frage stehenden Schotter wurden in den vergangenen<br />
Jahren von St. SALVERMOSERund W. WALSERim Rahmen<br />
zweier Diplomarbeiten der Universität München und<br />
damit verbundener Kartierungsaufträge der <strong>Geologische</strong>n<br />
<strong>Bundesanstalt</strong> genauer kartiert und sedimentpetrographisch<br />
untersucht. Älteren Ansichten folgend wurden die<br />
Schotter des Pitzenberges mit den Quarzrestschottern<br />
der ost-niederbayerischen Molasse gleichgesetzt und<br />
stratigraphisch ins obere Baden bis tiefere Sarmat eingestuft.<br />
Nach meinen Beobachtungen ist diese Parallelisierung<br />
unzutreffend. Folgende Unterschiede sind zu beachten:<br />
1) Die Pitzenbergschotter überlagern ausschließlich -<br />
mittel- oder unmittelbar - das kristalline Grundgebirge<br />
der Böhmischen Masse, die ost-niederbayerischen<br />
Quarzrestschotter hingegen stets alpine Molassesedimente.<br />
2) Die sandigen Schichten, welche an der Basis der Pitzenbergschotter<br />
auftreten, zeigen Schwermineralspektren<br />
(Zirkon/Monazitmaxima), wie sie für außeralpine<br />
Sedimente typische sind, im Gegensatz zu den<br />
"alpinen" Schwermineralvergesellschaftungen, die aus<br />
den Basissanden der ostniederbayerischen Quarzrestschotter<br />
beschrieben werden.<br />
542<br />
3) Auch Schwermineralspektren aus höheren Schotterschichten<br />
der Pitzenberger Serie unterscheiden sich,<br />
vor allem durch einen oft erheblichen Sillimanit-Gehalt,<br />
deutlich von denen der alpinen Molassesedimente, für<br />
die dieses Mineral untypisch ist.<br />
4) Last but not least weisen die Nicht-Quarzgerölle der<br />
Pitzenbergschotter eindeutig auf eine außeralpine Herkunft<br />
der Schüttung hin; die alpine Herkunft der ostniederbayerischen<br />
Quarzrestschotter ist hingegen<br />
unbestritten.<br />
ad 1)<br />
Für die schon von älteren Autoren und auch von SALVER-<br />
MaSER wieder getroffene Annahme, daß die Pitzenbergschotter<br />
nördlich von Hingsham - Salling dem Schlier<br />
auflagern, gibt es im Gelände keinerlei Anhaltspunkte. Im<br />
Gegenteil: Die Basis der Schotterdecke liegt in diesem<br />
Bereich bei ca. 515 m SH., der Schlier reicht nur bis etwa<br />
490 m SH. hinauf. Die dem Schlier westlich von Hingsham<br />
in ca. 460-470 m SH. tatsächlich auflagernden Schotter<br />
("Steinbergschotter") unterscheiden sich von denen des<br />
Pitzenbergs nicht nur in ihrer Höhenlage, sondern auch<br />
petrographisch deutlich. Wohl sind auch sie Quarzrestschotter,<br />
es fehlten ihnen aber die für die Pitzenbergschotter<br />
typischen starken Verkieselungen; es fehlt (bis auf<br />
Spuren, welche seinerzeit von W. FUCHSgemeldet wurden)<br />
die Kaolinisierung, die in den Pitzenbergschottern eine<br />
große Rolle spielt. Auch im Geröllspektrum gibt es deutliche<br />
Unterschiede. Im Steinbergschotter finden sich geringe<br />
Mengen von vermutlich kalkalpinem Kieselkalk und<br />
Radiolarit, während der Pitzenbergschotter frei von kalkalpinen<br />
Geröllen ist.<br />
Auch nach den reichlich vorhandenen Bohrdaten, die im<br />
Zuge der Kaolinprospektion der Kamig sowie der Untersuchungen<br />
zur Wasserversorgung Münzkirchens angefallen<br />
sind, läßt sich keine Unterlagerung der Pitzenbergschotter<br />
durch Schlier, Blättermergel oder sonstige Tertiärsedimente<br />
erkennen. Wo immer die Schotterserie durchörtert<br />
worden ist, wurde kristalliner Untergrund angetroffen.<br />
ad 2)<br />
Extrem an Zirkon und Monazit reiche Schwermineralspektren<br />
hat schon G. WOLETZ anhand von von mir in der<br />
nun verfallenen Ziegelei von Zeilberg und der verfallenen<br />
Sandgrube bei Höh gesammelten Sandproben gefunden:<br />
Zeilberg 1: 28 % Zirkon, 56 % Monazit, (4 % Tu, 4 % Ru,<br />
3 % Si, 3 % At)<br />
Zeilberg 3: 25 % Zirkon, 46 % Monazit (6 % Tu, 13 %<br />
Sill.,2 % Gr, 4 % At)<br />
Höh: 53 % Zirkon, 33 % Monazit (1 % Tu, 5 % Ru,<br />
2 % Si, 2 % St)<br />
Ich habe nochmals die Sande bei Höh und bei Gersdorf<br />
(N' Ringelholz) bemustert und Zirkonanteile von 50-75 %<br />
der durchleuchtbaren Schwerminerale gefunden sowie<br />
Monazitanteile (bei Gersdorf) zwischen 15 und 35 %. Auch<br />
St. SALVERMOSERhat in seinen bei Höh, Gersdorf und Reikersham<br />
entnommenen SM-Proben von "Liegendsanden"<br />
ähnlich hohe bis extreme Zirkonmaxima zusammen mit<br />
auffälligen Monazitwerten festgestellt.<br />
ad 3)<br />
SALVERMOSERmeldet von manchen SM-Proben aus Kies<br />
vom Pitzenberg Zirkongehalte bis gegen 25 %, Sillimanitgehalte<br />
bis zu über 40 % und Andalusitgehalte bis über
20 %; in Sand- und Kieslagen von Ringelholz-Zeilberg<br />
fand er Werte für Zirkon bis zu über 37 %, für Sillimanit bis<br />
gegen 20 %.<br />
ad4)<br />
Die häufigsten Nicht-Quarz-Komponenten der Pitzenbergschotter<br />
sind grünliche, hellgraue oder weiße Quarzite,<br />
meist mittel- bis feinkörnig, seltener grobkörnig, gelegentlich<br />
mit vereinzelten Feinkieskomponenten. Sie zeigen<br />
meist deutliche bis ausgeprägte Schieferung und lineation.<br />
Als Glimmer findet sich weißer oder hellgrünlicher<br />
Serizit (Muskowit + (?)Phengit). Nicht eben selten sind rosa<br />
oder rötliche Quarzkörner. Ausnahmsweise findet sich<br />
konglomeratischer Quarzit mit dicht gepackten und in B<br />
gelängten Fein- bis Mittelkieskomponenten (aus Quarz).<br />
Deutlich gegenüber den hellen Quarziten zurücktretend<br />
sind Gerölle von Sandsteinen (Quarzsandstein). Sie sind<br />
mittelgrau, gelblich, rosa, rötlich oder auch bräunlich. Feine<br />
bis mittlere Körnung ist vorherrschend, gröberes Korn<br />
oder Kieseinstreuungen eher selten. Mitunter ist Feinschichtung<br />
beobachtbar. Etwa ebenso großes Gewicht<br />
wie die Sandsteine haben Graphitquarzite, Graphitschiefer<br />
und dunkle Phyllite. Sie sind in der Regel straff geschiefert.<br />
Grauer Phyllit, der durch Quarzlagen fein oder<br />
grob gebändert erscheint, dürfte eine graphitärmere Varietät<br />
derselben Serie sein. Mitunter finden sich in solchem<br />
Phyllit enge Verfaltungen mit faltenachsenparalleler<br />
Lineation. Nicht eben selten ist auch schwarzer Lydit. Weniger<br />
häufig bis selten sind Gerölle von rot/braun/<br />
schwarzbraun gebändertem Kieselschiefer, Karneol, Jaspis,<br />
verkieseltem saurem Vulkanit, Tuffit (zum Teil innerhalb<br />
eines Gerölles mit Karneol oder Jaspis vergesellschaftet!)<br />
sowie Turmalinquarzit. Von Amphibolit, Serpentinit,<br />
Grüngestein und Pegmatit, die aus den ost-nie-<br />
Bericht 1993<br />
über diatomeenführende Ablagerungen<br />
der Limberg-Subformation<br />
im Raum Eggenburg<br />
auf Blatt 22 Hollabrunn<br />
ZOENKAREHAKovA<br />
(Auswärtige Mitarbeiterin)<br />
derbayerischen Quarzrestschottern als charakteristische<br />
Gerölle beschrieben werden, konnte ich nicht ein einziges<br />
Exemplar finden (amphibolitverdächtige Gerölle erwiesen<br />
sich unter dem Binokular stets als Turmalinquarzit, Serpentinit-ähnliche<br />
Gerölle als unreine Quarzkiesel).<br />
Die einzigen Gerölle der Pitzenbergschotter, denen man<br />
alpine Herkunft zuschreiben möchte, sind die grünlichen<br />
bis grünlichgrauen Quarzite, die der penninischen oder<br />
unterostalpinen Permotrias ähnlich sehen. Alles andere,<br />
insbesondere die graphitführenden Gesteine, dunklen<br />
Kieselschiefer und Lydite wird man kaum aus den Alpen<br />
beziehen wollen. Es ist daher naheliegend, daß auch die<br />
Quarzite außeralpiner Herkunft sind und etwa vom metamorphen<br />
Altpaläozoikum des Variszikums her stammen.<br />
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Pitzenbergschotter<br />
weder mit den ost-niederbayerischen Quarzrestschottern,<br />
noch mit irgendeinem anderen tertiären<br />
Molassesediment vergleichbar sind.<br />
Außeralpine Schüttung, die bei unserer grobklastischen<br />
Serie von allem Anfang an eine entscheidende, wenn nicht<br />
gar, wie ich glaube, die alleinige Rolle spielt, macht sich<br />
nach den Beschreibungen der österreichischen und bayerischen<br />
Molassesedimente erst relativ spät im Jungtertiär<br />
bemerkbar ("Mischserie", "Moldanubische Serie", oberes<br />
Sarmat-Pannon). Ein so junges Alter anzunehmen verbieten<br />
aber die starken Verkieselungen in den Pitzenbergschottern,<br />
für die es aus dieser Zeit keine Beispiele mehr<br />
gibt. Man wird also Vergleiche mit älteren grobklastischen<br />
Serien aus dem außeralpinen Bereich suchen müssen, wobei<br />
oberkretazische nicht ausgeschlossen werden dürfen!<br />
( 8_;;O_GJ_ilil_~_lJ _GiJ_0_ O<br />
enJU J<br />
Siehe Bericht zu Blatt 9 Retz von L. SMoLiKovA (S. 541).<br />
( 8_0_GJilil_~_~_GiJ_0_00_GJ_[£)_[jD!J_Qi)_Qi) J<br />
Im Anschluß an die mikropaläontologischen Untersuchungen<br />
der Diatomite von Limberg im Jahre 1992 (Z.<br />
ÄEHAKovA,Jb. Geol. B.-A., 1993) wurde ein weiteres Vorkommen<br />
dieser Sedimente der Limberg-Subformation im<br />
Bereich des Kartenblattes 22 Hollabrunn Süd bearbeitet.<br />
Die diatomeenführenden Ablagerungen gehören dem ausgedehnten<br />
Sediment-Komplex der Zellerndorf-Formation<br />
am Außenrand der Eggenburger Bucht an, wo sie eine Einschaltung<br />
innerhalb der Tonmergel dieser Formation<br />
bilden.<br />
Die diatomeenführenden Sedimente, kurz Diatomite,<br />
liegen im Gemeindegebiet von Parisdorf, ca. 3 km SSW<br />
von Limberg und wurden durch einen Diatomitbergbau<br />
aufgeschlossen. Aus der steilen SE-Wand der Grube, etwa<br />
500 m SE der Kirche von Parisdorf, wurde in Zusammenarbeit<br />
mit R. ROETZELein Profil in der Mächtigkeit von<br />
8,80 m aufgenommen.<br />
Vom Liegenden zum Hangenden wurden im Abstand<br />
von 20 cm insgesamt 40 orientierte Proben gewonnen, die<br />
in der Folge nach dem Iithologischen Charakter der Sedimente<br />
in weitere kleinere Sub-Proben zerteilt wurden.<br />
Das Liegende der Diatomite besteht aus hellgrauen Tonen<br />
von ziemlich fester Konsistenz, die aber an der Profilentnahmestelle<br />
nicht zugänglich waren. Ins Hangende gehen<br />
die Diatomite allmählich in gelbliche oder grünlichbraune<br />
Tonmergel der Zellerndorf-Formation über. Diese<br />
Tonmergel (im Profil ab 6,50 m) enthalten kalkiges Nannoplankton<br />
und eine kleinwüchsige Foraminiferenfauna, die<br />
543