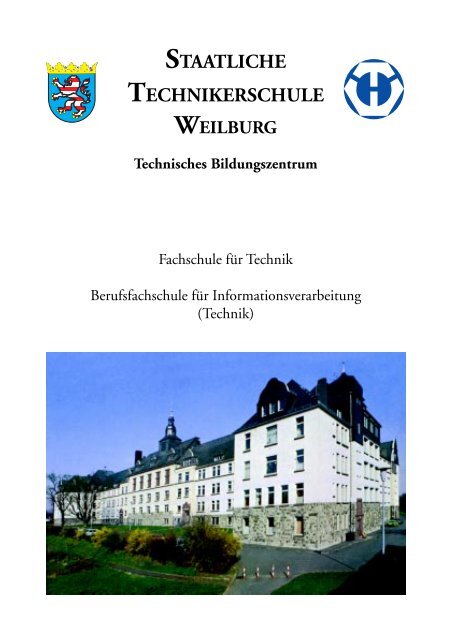staatliche technikerschule weilburg - emu!
staatliche technikerschule weilburg - emu!
staatliche technikerschule weilburg - emu!
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STAATLICHE<br />
TECHNIKERSCHULE<br />
WEILBURG<br />
Technisches Bildungszentrum<br />
Fachschule für Technik<br />
Berufsfachschule für Informationsverarbeitung<br />
(Technik)<br />
1
Herausgeber: Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
Druck: Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
Stand: November 2001<br />
2<br />
Diese Broschüre wurde mit finanzieller Unterstützung der<br />
Weilburger Techniker-Schulvereinigung WeiTe e.V. hergestellt.
STAATLICHE<br />
TECHNIKERSCHULE<br />
WEILBURG<br />
Technisches Bildungszentrum<br />
Fachschule für Technik<br />
Elektrotechnik<br />
Computersystem- und Netzwerktechnik<br />
Informations- und Kommunikationstechnik<br />
Energietechnik und Prozessautomatisierung<br />
Prozessleittechnik / Mess- und Regelungstechnik<br />
Mechatronik<br />
Maschinentechnik<br />
Produktions- und Qualitätsmanagement<br />
Konstruktion<br />
Verfahrens- und Umwelttechnik<br />
Technische Informatik<br />
Medien- und Informationssystemtechnik<br />
Berufsfachschule für Informationsverarbeitung<br />
Computersysteme und Netzwerktechnik<br />
Medien- und Dokumentationstechnik<br />
3
Inhalt<br />
Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
Seite<br />
1.1 Adressen und Kontakte 07<br />
1.2 Unsere Schule 09<br />
1.3 Bildungsziele 10<br />
1.4 Schulausstattung 11<br />
1.5 Studierendenwohnheim „Windhof“ 11<br />
1.6 Studierendenvertretung 12<br />
1.7 Freizeitangebote 12<br />
1.8 Weilburger Technikerschulvereinigung e.V. (WeiTe) 13<br />
1.9 Weilburg - Stadt und Umgebung 14<br />
Fachschule für Technik<br />
2. Studium<br />
2.1 Allgemeines zum Studium 15<br />
2.2 Aufnahmevoraussetzungen für das Technikerstudium 15<br />
2.3 Studienbeginn und Bewerbungstermine 16<br />
2.4 Bewerbungsunterlagen 16<br />
2.5 Prüfungen 16<br />
2.6 Kosten 17<br />
2.7 Finanzielle Förderung 18<br />
2.8 Studiengänge<br />
Computersystem- und Netzwerktechnik 20<br />
Energietechnik und Prozessautomatisierung 22<br />
Informations- und Kommunikationstechnik 24<br />
Prozessleittechnik / Mess- und Regelungstechnik 26<br />
Mechatronik 28<br />
Produktions- und Qualitätsmanagement 30<br />
Konstruktion 32<br />
Verfahrens- und Umwelttechnik 34<br />
Medien- und Informationssystemtechnik 36<br />
Zusatzausbildung zur Meisterprüfung 38<br />
weitere Zusatz-/Ergänzungsausbildungen 39<br />
Berufsfachschule für Informationsverarbeitung (Technik)<br />
3. Ausbildung 41<br />
3.1 Allgemeines zur Assistentenausbildung 41<br />
3.2 Aufnahmevoraussetzungen für Assistentenausbildung 41<br />
3.3 Ausbildungsbeginn und Bewerbungstermine 42<br />
3.4 Bewerbungsunterlagen 42<br />
5.5 Prüfungen 42<br />
3.6 Kosten 42<br />
3.7 Finanzielle Förderung 43<br />
3.8 Ausbildungsgänge<br />
Computersysteme und Netzwerktechnik 44<br />
Medien- und Dokumentationstechnik 46<br />
Zusatzausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife 48<br />
5
1.1 Adressen und Kontakte<br />
Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
Technisches Bildungszentrum<br />
Anschrift Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
Technisches Bildungszentrum<br />
Frankfurter Straße 40<br />
35781 Weilburg/Lahn<br />
Telefon (0 6471) 92 61 - 0<br />
Telefax (0 6471) 92 61 - 55<br />
Internet www.sts<strong>weilburg</strong>.de<br />
Mail verwaltung@sts<strong>weilburg</strong>.de<br />
Sprechzeiten Mo. bis Do. 8. 00 bis 13. 00 Uhr<br />
14. 00 bis 16. 00 Uhr<br />
Fr. 8. 00 bis 13. 00 Uhr<br />
Sie können uns jederzeit Nachrichten per Fax oder Email zukommen lassen.<br />
Beratung 14-tägig ausführliche Beratung in unserem Hause<br />
Termininformationen über das Sekretariat<br />
(0 64 71) 92 61 - 0 Frau Rössner<br />
Träger Land Hessen<br />
Schulleitung Wolfgang Hill (Schulleiter)<br />
Edgar Schüller (stv. Schulleiter)<br />
Astrid Häring-Heckelmann (Abteilungsleiterin)<br />
Herbert Machmerth (Abteilungsleiter)<br />
Verwaltungsleitung Uwe Hölzgen<br />
7
Studierendenwohnheim „Windhof“<br />
Anschrift Studierendenwohnheim<br />
der Staatlichen Technikerschule Weilburg<br />
Johann-Ernst-Straße 12<br />
35781 Weilburg/Lahn<br />
Leitung Helmut Beck / Rainer Weigel<br />
Studierendenvertretung<br />
Anschrift Studierendenrat<br />
der Staatlichen Technikerschule Weilburg<br />
Johann-Ernst-Straße 12<br />
35781 Weilburg/Lahn<br />
str.vorstand@sts<strong>weilburg</strong>.de<br />
Die Staatliche Technikerschule Weilburg<br />
8
1.2 Unsere Schule<br />
Die STAATLICHE TECHNIKERSCHULE WEILBURG (STSW), eine Fachschule mit Tradition und Zukunftsperspektiven,<br />
wurde 1963 als Fachschule für Maschinenbau, Elektrotechnik und Mess- und Regelungstechnik gegründet.<br />
In den Jahren seit der Gründung entwickelte sich die Fachschule zu einer der größten Fachschulen für<br />
Technik des Bundesgebietes und zur größten eigenständigen Fachschule in Hessen. Sie ist heute eine Fachschule<br />
für berufliche Weiterbildung in den Bereichen Maschinen-, Elektro-, Informationstechnik und<br />
Mechatronik. Hinzu gekommen ist die berufliche Erstausbildung für Informationstechnische Assistentinnen<br />
und Assistenten.<br />
Unsere Hauszeitung "STSW aktuell" informiert in regelmäßigen Abständen über Veranstaltungen, Veränderungen<br />
und Aktivitäten an unserer Schule.<br />
Heute stehen mehr als 500 Studienplätze zur Verfügung. Der Unterricht findet praxisorientiert in integrierten<br />
Fachräumen, modern ausgestatteten Unterrichtsräumen und Laborräumen statt. Deren Einrichtung wird kontinuierlich<br />
an den neuesten Stand der Technik angepasst. Die ca. 40 Dozentinnen und Dozenten verfügen<br />
neben ihrer pädagogischen Ausbildung meist auch über eine mehrjährige Ingenieurpraxis. Für spezielle Lehrveranstaltungen<br />
werden Fachleute aus Industrie und Verwaltung eingesetzt. Industriequalifikationen können<br />
auch während des Studiums in Zusammenarbeit mit anderen Ausbildungseinrichtungen (z.B. Qualitätsmanagementbeauftragte/r,<br />
Europäische/r Schweißtechniker/in Teil 1) erreicht werden.<br />
Ziel der Fachschule ist es, Facharbeiterinnen und Facharbeitern aus Metall-, Elektro-, Chemie-, Informationstechnik-<br />
und Medienberufen eine qualifizierte theoretische und zugleich praxisorientierte Ausbildung zu geben.<br />
Sie sollen befähigt werden, in ihrer späteren Tätigkeit Mittler zwischen Theorie und Praxis zu sein. Unsere<br />
Absolventen/innen sind für Führungsaufgaben im mittleren Management vorbereitet. Deshalb orientiert sich<br />
die Ausbildung zur Technikerin / zum Techniker sowohl an der Fachhochschulausbildung als auch an den<br />
Aufgabenbereichen der angestrebten Berufsfelder bzw. späteren Einsatzgebiete. Besonderer Wert wird auf Sozial-<br />
und Lernkompetenz gelegt.<br />
Ihre Partnerinnen und Partner an der Staatlichen Technikerschule Weilburg<br />
9
Über 8000 Absolventinnen und Absolventen haben die Fachschule bisher als Staatlich geprüfte Technikerinnen<br />
und Techniker verlassen. Davon ist ein erheblicher Teil in ingenieurmäßige Funktionen aufgestiegen und<br />
hat leitende Positionen im mittleren Management der Wirtschaft erreicht. Dieser Erfolg der Fachschule beruht<br />
wesentlich auf dem hohen Anspruch an die Studierenden, auf intensiver Betreuung, auf der Spezialisierung der<br />
Lehrkräfte und auf der Praxisorientierung der Ausbildung dank großzügig ausgestatteter Labors und der Pflege<br />
von Firmenkontakten. Das Zusammenleben in dem der Fachschule angeschlossenen Studierendenwohnheim<br />
schafft dabei erwachsenengemäße Lernbedingungen. Aber auch modernste Informations- und Kommunikationstechniken<br />
haben Einzug gehalten; so sind alle Zimmer des Wohnheimes an das Intranet der Staatlichen<br />
Technikerschule Weilburg angeschlossen und mit Internetzugang ausgestattet.<br />
Technikerinnen und Techniker mit einer soliden und flexiblen Ausbildung sind auch in konjunkturell schwachen<br />
Zeiten weniger als andere Berufsgruppen von Arbeitslosigkeit bedroht, insbesondere wenn sie bezüglich<br />
ihres Arbeitsortes mobil sind. Die höhere Qualifikation erweist sich als gute Zukunftsinvestition, da sie vielseitige<br />
Möglichkeiten des späteren beruflichen Einsatzes eröffnet.<br />
Ziel der Berufsfachschule ist es, Personen mit mindestens mittlerem Bildungsabschluss eine qualifizierte theoretische<br />
und zugleich praxisorientierte Erstausbildung zu geben. Diese soll sie befähigen, in ihrer späteren<br />
Tätigkeit die ihnen übertragenen Aufgaben weitgehend selbständig zu erledigen. In einem mehrwöchigen<br />
Betriebspraktikum während der Ausbildung lernen die Schülerinnen und Schüler (in unserem Hause ebenfalls<br />
'Studierende' genannt) betriebliche Wirklichkeit kennen und wenden das bis dahin Gelernte in der Praxis an.<br />
Die bisherigen Absolventen unserer Berufsfachschule erhielten auf dem Arbeitsmarkt durchweg gute Arbeitsstellen.<br />
1.3 Bildungsziele<br />
Unsere wichtigsten Ziele sind in obiger Grafik zusammengefasst.<br />
10
1.4 Schulausstattung<br />
Zur Durchführung einer praxisorientierten Ausbildung verfügt die Fachschule über:<br />
• mehr als 30 großzügig ausgestattete, integrierte Fachräume<br />
• moderne Unterrichtsräume mit audiovisuellen Darstellungsmöglichkeiten<br />
• eine Präsenzbibliothek zum Selbststudium neben der obligatorischen Lernmittelfreiheit<br />
1.5 Studierendenwohnheim „Windhof“<br />
Die STAATLICHE TECHNIKERSCHULE WEILBURG verfügt mit dem ehemaligen Jagdschloss „Windhof“ in reizvoller<br />
Landschaft über ein Studierendenwohnheim mit rund 170 Plätzen, vorwiegend in Einzelzimmern. Eigene<br />
Parkflächen stehen zur Verfügung. Dem Studierendenwohnheim ist eine Mensa mit eigener Küche angeschlossen,<br />
die während der Schulzeiten drei Mahlzeiten anbietet. Auch Studierende, die nicht im „Windhof“<br />
wohnen, können an der Verpflegung teilnehmen.<br />
Studierendenwohnheim Windhof<br />
Das Studierendenwohnheim ist durch die Möglichkeit des gemeinsamen helfenden Lernens ein zusätzlicher<br />
Lernort der STSW. Seine Sportanlagen, Gemeinschaftsräume und die Initiativen des Studierendenrats eröffnen<br />
ein weites Feld sinnvoller Freizeitgestaltung. Das kollegiale Zusammenleben und das verantwortliche Mitwirken<br />
bei der Lösung von Gemeinschaftsaufgaben ist ein gutes Training für die künftigen beruflichen Aufgaben<br />
der Absolventinnen und Absolventen im Bereich der Menschenführung, der Übernahme von Verantwortung<br />
und der Entwicklung von Eigeninitiativen.<br />
11
Die Heimleitung bietet den Bewohnern des „Windhofes“, aber auch allen anderen Studierenden Hilfe durch:<br />
• Bildungsberatung • Studienberatung<br />
• Sozialberatung • Karriereberatung<br />
Daneben werden Studienfahrten, Exkursionen sowie Firmen- und Messebesuche organisiert.<br />
1.6 Studierendenvertretung<br />
Die Studierendenvertretung - der Studierendenrat STR - setzt sich aus Studierenden der Fachschule (FS) und<br />
der Berufsfachschule (BFS) zusammen, die sich freiwillig und ehrenamtlich zur Verfügung stellen und von der<br />
Studierendenschaft gewählt werden. Der Vorstand vertritt die Studierenden gegenüber der Schulleitung und<br />
der Öffentlichkeit im Rahmen seiner Kompetenzen. Die Referenten helfen den Studierenden bei Problemen<br />
mit Krankenkassen, Arbeitsämtern usw. Sie organisieren gesellige, kulturelle und sportliche Veranstaltungen.<br />
Die Studierendenschaft gibt die Studierendenzeitung „tangente“ heraus. Darüber hinaus sind die Studierenden<br />
(FS) auch im Landesstudierendenrat organisiert.<br />
1.7 Freizeitangebote<br />
Zum Studierendenwohnheim „Windhof“ gehören neben eigener Mensa, Garten-, Wiesen- und Sportanlagen/<br />
Sportplatz, Turn- und Gymnastikhalle. Geselligkeit wird an vielen Orten, insbesondere in dem von den Studierenden<br />
betriebenen „Ricks-Café“ gepflegt. Seit vielen Semestern sind auch Veranstaltungen wie die jährlichen<br />
Feste und Feten „Open Air im Windhof “, „Inselfest“, „Faschingsfete in der Sporthalle“ sehr beliebt.<br />
Open Air Fest im Windhof<br />
12
Weilburg/Lahn<br />
1.8 Weilburger Technikerschulvereinigung e.V. (WeiTe)<br />
Die Weilburger Technikerschulvereinigung e.V. ist ein eingetragener Verein mit gemeinnütziger Zielsetzung:<br />
• Förderung der STAATLICHEN TECHNIKERSCHULE WEILBURG<br />
• Erweiterung der Zusammenarbeit mit anderen Schulen<br />
• Förderung von bedürftigen Studierenden.<br />
• Berufliche Weiterbildung insbesondere von Technikerinnen und Technikern in Kooperation mit<br />
Wirtschaft, Verbänden und Öffentlichkeit<br />
Diese in der Satzung niedergelegte Zielsetzung wird verwirklicht durch technisch-wissenschaftliche Fachtagungen,<br />
Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung, Arbeitskreise, materielle und ideelle Unterstützung<br />
der STAATLICHEN TECHNIKERSCHULE WEILBURG. Die Vereinigung WeiTe organisiert das jährlich stattfindende<br />
Absolvententreffen in Verbindung mit dem „Open Air“ und dem „Tag der offenen Tür“.<br />
Anschrift WeiTe e.V.<br />
Frankfurter Straße 40<br />
35781 Weilburg / Lahn<br />
Telefon: (0 64 71) 92 61 0<br />
über das Sekretariat der Staatlichen Technikerschule<br />
Beiträge und Spenden derzeitiger Mitgliedsbeitrag EUR 14,-- (pro Jahr)<br />
Bank Kreissparkasse Weilburg<br />
BLZ 511 519 19<br />
Konto 101 007 987<br />
13
1.9 Weilburg - Stadt und Umgebung<br />
Die "Perle an der Lahn"<br />
Von drei Seiten umfließt die mittlere Lahn in ihrem engen, vielgewundenen Tal zwischen Taunus und Westerwald<br />
den historischen Kern der Residenzstadt Weilburg. Seit mehr als tausend Jahren birgt die Stadt überall<br />
Zeugen der Vergangenheit: Das Renaissance-Schloss der Grafen von Nassau mit seinen Plätzen, Höfen und<br />
großzügigen Gärten im französischen und englischen Stil; dem barocken Marktplatz mit dem alten Rathaus<br />
und dem Neptunbrunnen; die Zollhäuser am Ende der „Steinernen Brücke“; die Heilig-Grab-Kapelle; das<br />
barocke Jagdschloss „Windhof“ und viele andere.<br />
Weilburg mit seiner Umgebung ist heute ein beliebtes Feriengebiet für Erholungssuchende aus den benachbarten<br />
Ballungsgebieten an Rhein, Main und Ruhr. Neben Ruhe und Entspannung in industriearmer und waldreicher<br />
Umgebung bietet Weilburg interessante Abwechslungen durch historische Besichtigungen, kulturelle<br />
und gesellschaftliche Veranstaltungen sowie viele Möglichkeiten der sportlichen Betätigung: Schwimmen in<br />
Frei- und Hallenbädern, Rudern, Kanufahrten und Wasserskilauf auf der Lahn, Radwege, Reiten, Tennis,<br />
Tanzen, Kegeln, Ski- und Eislauf.<br />
In seiner unmittelbaren Umgebung liegen die bekannte touristisch erschlossene Kubacher Kristallhöhle, die<br />
Grube "Fortuna" sowie ein Tierpark mit großem Freigehege und der einzige Schiffstunnel Deutschlands.<br />
14
Fachschule für Technik<br />
2. Studium<br />
2.1 Allgemeines zum Technikerstudium<br />
(Allgemeines zur Assistentenausbildung siehe Seite 37)<br />
Das Studium an der STAATLICHEN TECHNIKERSCHULE WEILBURG umfasst allgemeine und fachrichtungsbezogene<br />
Lernbereiche. Die Unterrichtsorganisation erfolgt aufgrund von Rahmenstundentafeln, die bei den nachfolgenden<br />
Bildungsgängen wiedergegeben sind. Es gibt einen Pflicht-, Wahlpflicht- sowie einen Wahlbereich.<br />
Der Pflichtbereich umfasst: den allgemeinen Grundlagenbereich mit den Fächern:<br />
Deutsch<br />
Englisch<br />
Politik, Wirtschaft, Recht und Umwelt<br />
Berufs- und Arbeitspädagogik<br />
Diese Fächer werden über 2 Jahre unterrichtet.<br />
Den fachrichtungsbezogenen Anwendungsbereich mit den Fächern, deren Qualifikations- und Bildungsziele<br />
die Grundlage für den projekt- und praxisbezogenen Unterricht legen sowie den Fächern, die die Kenntnisse<br />
und Fertigkeiten für das angestrebte Ausbildungsziel vertiefen. Ein Großteil der Fächer wird lernfeldorientiert<br />
unterrichtet.<br />
Im Wahlpflichtbereich wird der Mathematik-Zusatzkurs zur Erlangung der Fachhochschulreife oder alternativ<br />
der Kurs „Existenzgründung und Unternehmensführung“ angeboten.<br />
Der Wahlbereich umfasst ergänzende Angebote wie z.B.<br />
Ausbilder-Eignungsprüfung<br />
Teile der Meisterprüfung<br />
Ergänzungen und Vertiefungen des Pflichtbereiches.<br />
Der Unterricht ist in Doppelstunden (90 Minuten) oder größeren Unterrichtsblöcken organisiert. Die<br />
Unterrichtszeit liegt Montag bis Donnerstag zwischen 7. 45 Uhr und 17. 25 Uhr, Freitag zwischen 7. 45 Uhr und<br />
12. 50 Uhr.<br />
Mit dem Besuch von Zusatzkursen im Fach Mathematik und der erfolgreichen Teilnahme an einer Prüfung in<br />
diesem Fach kann die Fachhochschulreife (FHSR) erlangt werden.<br />
2.2 Aufnahmevoraussetzungen für Technikerstudium<br />
(Auszug aus der Verordnung des Hessischen Kultusministeriums für Zweijährige Fachschulen vom 8.8.95<br />
i.d.F. vom 19.12.97)<br />
Die Zulassung zu einem Technikerstudium setzt voraus:<br />
• Das Abschlusszeugnis der Berufsschule oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis<br />
• Die Abschlussprüfung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf<br />
• Eine weitere einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens 1 Jahr. Entsprechende berufspraktische Tätigkeit<br />
bei der Bundeswehr (Zivildienst) kann angerechnet werden.<br />
15
Bewerber/innen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können, sofern sie eine mindestens 7jährige einschlägige<br />
berufliche Tätigkeit nachweisen, in die Fachschule aufgenommen werden, wenn in einer Prüfung<br />
ihre fachliche Eignung festgestellt wird.<br />
2.3 Studienbeginn und Bewerbungstermine<br />
Der Studienbeginn für fast alle Studienrichtungen ist jeweils der 01. Februar und der 01. August. Der Unterricht<br />
beginnt im August nach den allgemeinen Schulsommerferien des Landes Hessen.<br />
Die Bewerbung um einen Studienplatz soll möglichst ein halbes Jahr vor dem gewünschten Studienbeginn<br />
vorliegen. Wenn die Zahl der Bewerber/innen größer ist als die Zahl der verfügbaren Studienplätze, findet ein<br />
Auswahlverfahren statt.<br />
2.4 Bewerbungsunterlagen<br />
Die Bewerbung ist beim Sekretariat der STAATLICHEN TECHNIKERSCHULE WEILBURG auf dem von der Fachschule<br />
ausgegebenen Bewerbungsformular einzureichen.<br />
Der Bewerbung sind beizufügen:<br />
• Lebenslauf in tabellarischer Form<br />
• Abschlusszeugnis der Berufsschule oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis<br />
• Nachweis über die Abschlussprüfung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf (Facharbeiter- oder Gesellenbrief)<br />
• Bescheinigungen über Art und Dauer der beruflichen Tätigkeiten<br />
• 2 Passbilder neueren Datums<br />
! Alle Kopien von Zeugnissen bzw. Bescheinigungen müssen amtlich beglaubigt sein !<br />
2.5 Prüfungen<br />
Es können folgende Prüfungen abgelegt werden:<br />
• Abschlussprüfung (Staatliche Technikerprüfung): Diese umfasst eine schriftliche Prüfung in 4 Fächern und<br />
eine mündliche Prüfung in den Fächern der Lernbereiche. Die erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung berechtigt<br />
zur Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Technikerin/Techniker“ der entsprechenden<br />
Studienrichtung<br />
• Ausbildereignungsprüfung<br />
• Handwerksmeisterprüfung: Wirtschafts- u. rechtskundlicher Teil (Teil III) in Zusammenarbeit mit der zuständigen<br />
Handwerkskammer<br />
• Prüfung zur Europäischen Schweißtechnikerin / zum Europäischen Schweißtechniker - Teil 1<br />
! nicht alle aufgeführten Prüfungen sind kostenfrei !<br />
16
2.6 Kosten<br />
Allgemeines<br />
Es werden keine Studiengebühren von den Studierenden erhoben. Lediglich zu Beginn eines jeden Studienhalbjahres<br />
fällt eine Umlage in Höhe von zur Zeit EUR 40,00 für Beschaffungen (Verbrauchsmaterial, Laborbedarf,<br />
...) und allgemeine Auslagen an.<br />
Für die Prüfungen des unmittelbaren Studiengangs werden von Studierenden der Fachschule keine Prüfungsgebühren<br />
erhoben. Externen-Prüfungen sind jedoch gebührenpflichtig. Lernmittelfreiheit (Bücher) besteht<br />
für alle Studierenden.<br />
Studierendenwohnheim<br />
Das Nutzungsentgelt incl. Nebenkosten beträgt für<br />
Einzelzimmer (monatl.) z.Z. EUR 61,50<br />
einen Platz in einem 2-Bett-Zimmer (monatl.) z.Z. EUR 51,--<br />
Mit der Unterbringung im Studierendenwohnheim ist die Teilnahme an der Vollverpflegung in der Mensa<br />
verbunden. Schon- bzw. Diätkost wird nicht angeboten. Eine Kostenreduzierung bei Nichtteilnahme an der<br />
Vollverpflegung ist nicht möglich!<br />
Kosten für Vollverpflegung (monatl.) z.Z. EUR 105,--<br />
Nutzungsentgelt und Vollverpflegungskosten sind Pauschalbeträge, diese werden pro Semester mit je 6 Monatsbeträgen<br />
erhoben.<br />
Durch eine Einzugsermächtigung von Ihrem Konto werden die fälligen Zahlungen im Lastschriftverfahren<br />
abgebucht.<br />
Speisesaal der Mensa<br />
17
Mensa<br />
Die Mensa ist an regulären Unterrichtstagen geöffnet. An der Verpflegung kann jeder teilnehmen ( Studierende,<br />
Assistenten, Gäste,...). Die Bezahlung erfolgt über Chipkarten mit Wertguthaben, die in der Schulverwaltung<br />
erhältlich sind. Die Preise für die einzelnen Mahlzeiten betragen z.Z.:<br />
2.7 Finanzielle Förderung<br />
18<br />
Frühstück EUR 1,70<br />
Mittagessen EUR 3,00<br />
Abendessen EUR 2,40<br />
Es besteht Rechtsanspruch auf BAföG-Förderung als Schüler-BAföG oder Meister-BAföG.<br />
Das Schüler-BAföG kann beim zuständigen Landratsamt beantragt werden, das Meister-BAföG beim zuständigen<br />
Studentenwerk.<br />
Ballonfestival - Start am Windhof
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, von der „Deutschen Ausgleichsbank“ ein Studiendarlehen zu erhalten<br />
(Antrag vor Studienbeginn über die eigene Hausbank).<br />
Alle Studienrichtungen sind für die Förderung durch das AFG zugelassen. Die Förderung nach dem AFG ist<br />
bei dem für den Wohnsitz der Bewerberin / des Bewerbers zuständigen Arbeitsamt zu beantragen.<br />
Maßnahmen zur Rehabilitation werden ebenfalls beim zuständigen Arbeitsamt beantragt.<br />
Zeitsoldaten wenden sich an die Berufsförderungsdienste der Bundeswehr.<br />
19
Ausbildungsschwerpunkte<br />
• Projektierung, Installation und Programmierung<br />
von Computersystemen als Einzelplatzsystem<br />
• Projektierung eines lokalen Netzwerkes auf der<br />
Grundlage einer gegebenen betrieblichen Organisationsstruktur<br />
und der Analyse des Ressourcenbedarfs<br />
• Globale Kommunikations- und Weitverkehrstechnologien<br />
zur Nutzung weltweiter Ressourcen<br />
einsetzen mit Planung und Umsetzung eines<br />
Firewallsystems<br />
• Server für unterschiedliche Dienste projektieren und<br />
einrichten<br />
• Datenbanken für Intranet und Internet entwerfen<br />
und wichtige Zugriffsverfahren implementieren<br />
• Beachtung von Unternehmensstrukturen und<br />
Geschäftsprozessen bei der Durchführung der obigen<br />
Aufgaben<br />
20<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Computersystem- und Netzwerktechnik<br />
Konfiguration von Netzwerkservern<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Computer werden in Betrieben zu Computernetzen<br />
verbunden. Dabei findet die Verbindung nicht nur<br />
innerhalb eines Gebäudes, sondern weltweit statt.<br />
Innerhalb der Computernetze befinden sich je nach<br />
Bedarf und Anwendung die unterschiedlichsten<br />
Computersysteme, Betriebssysteme, Anwendungsprogramme<br />
und Netzwerktechniken. Die Techniken<br />
werden immer komplexer und leistungsfähiger. Sie<br />
entwickeln sich in immer kürzeren Abständen weiter.<br />
In diesem komplexen Umfeld werden Technikerinnen<br />
und Techniker gebraucht, díe diese Systeme projektieren,<br />
installieren, für die Bedürfnisse der Anwender<br />
anpassen, administrieren, programmieren, in Betrieb<br />
nehmen und warten können.<br />
Der Bedarf an Fachkräften ist groß; nicht nur in Betrieben,<br />
die Computersysteme und Netzwerke anbieten,<br />
sondern auch als Administrator/innen der Systeme<br />
in den Betrieben, als Programmierer/innen der<br />
Systeme, um Informationen für die Mitarbeiter/innen<br />
und Kunden über das Computernetz bereitstellen<br />
zu können.
Ihre Ausbildung bei uns<br />
Verkabelung des Intranetzes<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Elektroberuf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Die Ausbildung in diesem Schwerpunkt soll die zukünftige<br />
Technikerin, den zukünftigen Techniker in<br />
die Lage versetzen, Computersysteme und Netzwerke<br />
zu konzipieren, aufzubauen, einzurichten und in<br />
Betrieb zu halten. Um diese umfassenden Aufgaben<br />
einzuüben, wird besonders in diesem Schwerpunkt<br />
mittels realer Projektarbeiten die Komplexität der Aufgabenstellungen<br />
erarbeitet. Hinzu kommt, dass durch<br />
die schnellen Entwicklungszyklen der Techniken das<br />
ständige Aneignen neuen Wissens über den Erfolg<br />
im Beruf entscheidet. Deshalb ist schon in der Ausbildung<br />
die ständige Informationsbeschaffung über<br />
Fachzeitschriften, Fachbücher und das Internet für<br />
den Ausbildungserfolg unabdingbar.<br />
Allgemeiner Bereich Berufsbezogener Bereich<br />
Deutsch 160 Mathematik 160<br />
Englisch 240 Betriebswirtschaft 200<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Betriebssysteme 360<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Computersysteme 320<br />
Netzwerktechnik 320<br />
Programmierung 360<br />
Projekt 200<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
21
Ausbildungsschwerpunkte<br />
22<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Energietechnik und Prozessautomatisierung<br />
Anhand praktischer Problemstellungen eignen sich<br />
die Studierenden das notwendige Wissen und die<br />
Fertigkeiten an, um Automatisierungssysteme zu projektieren,<br />
einzurichten und zu warten. Dies umfaßt<br />
Arbeiten an modernen Regelungseinrichtungen,<br />
Steuerungsanlagen und Antriebseinheiten mit den<br />
entsprechenden Stromrichtern und<br />
Energieversorgungseinheiten.<br />
Moderne Antriebseinheiten ermöglichen es, das Zusammenwirken<br />
der verschiedenen Komponenten praxisnah<br />
zu untersuchen. Besonderes Gewicht erhalten<br />
dabei die speicherprogrammierbare Steuerung und<br />
die Systemkommunikation über prozessnahe BUS-<br />
Systeme.<br />
Die digitale Datenverarbeitung ist die Grundlage fast<br />
aller Geräte in der Automatisierungstechnik. Entsprechend<br />
hoch ist ihr Anteil auch in dieser Ausbildung.<br />
Auswerten von Steuerungssignalen<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Produktionsanlagen sind mit elektrischen Antrieben<br />
und Maschinen ausgestattet, die von<br />
Automatisierungsgeräten angesteuert werden. Die<br />
Technikerinnen und Techniker, die diese Anlagen<br />
einrichten, in Betrieb nehmen und betreuen, müssen<br />
sich mit elektrischen Maschinen und deren Ansteuerelektronik<br />
sowie der notwendigen Energieversorgung<br />
auskennen. Zudem müssen sie auch in der<br />
Lage sein, die Automatisierungseinrichtungen zu projektieren<br />
und zu programmieren.<br />
Als bevorzugte Arbeitsbereiche sind zu nennen:<br />
• Projektierung<br />
• Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung von<br />
Automatisierungssystemen sowie Steuerungsanlagen<br />
• Vertriebs- und Ausbildertätigkeiten in den genannten<br />
Bereichen
Endkontrolle des Schaltschrankes<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Elektroberuf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Von der Erzeugung, über die Verteilung bis zur Umsetzung,<br />
z.B. in Antrieben, ist die elektrische Energie<br />
der Leitgedanke der Weiterbildung in diesem<br />
Schwerpunkt. Beim Einsatz der Energie wird verstärkt<br />
auf Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz geachtet.<br />
Um dies zu erreichen sind höhere Wirkungsgrade und<br />
der Einsatz von Automatisierungsgeräten notwendig.<br />
Die Nutzung von Computern für die vielfältigsten<br />
Aufgaben ist auch in der Energietechnik alltäglich.<br />
Dies wird in dieser Weiterbildung durch den großen<br />
Anteil an Automatisierungstechnik und Datenverarbeitung<br />
in dem Ausbildungsplan deutlich.<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Mathematik 240 Energietechnik 260<br />
Englisch 200 Techn. Physik 120 Prozessautomatisierung 260<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt160 Chemie 40 Messtechnik 160<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Elektrotechnik 240 Datenverarbeitungstechnik 160<br />
Elektronik 160 Projektarbeit 160<br />
Informationsverarbeitung 160<br />
Betriebsorganisation 40<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
23
Ausbildungsschwerpunkte<br />
24<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Informations- und Kommunikationstechnik<br />
Der Schwerpunkt ist überwiegend als techno-logieorientierte<br />
Vertiefung der neugestalteten IT-Berufe<br />
konzipiert.<br />
Er umfasst Projektierung, Einrichtung, Inbetriebnahme<br />
und Wartung von vernetzten Systemen, insbesondere<br />
von<br />
• lokalen Netzen (LAN)<br />
• Weitverkehrsnetzen (WAN)<br />
• Funknetzen und<br />
• Netzen in der industriellen Produktion.<br />
Die Ausbildung erfolgt überwiegend an realen Systemen.<br />
Die Inhalte auch der Grundlagenfächer werden<br />
kontuierlich aktualisiert und aneinander<br />
angepasst.<br />
Überwachen der Systemfunktionen<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Moderne Netzwerke umfassen heute wesentlich mehr<br />
Komponenten als das klassische LAN. Insbesondere<br />
in den Bereichen Funknetze, Weitverkehrstechnik<br />
und Fertigungs-Automatisierung finden umgreifende<br />
Veränderungen statt, die von qualifizierten Mitarbeitern<br />
gestaltet und begleitet werden müssen.<br />
Die Vielfalt der Ausbildung erlaubt einen Einsatz in<br />
allen genannten Arbeitsbereichen. Die Absolventen<br />
haben deshalb Vorteile beim Stellenwechsel und in<br />
Branchenkrisen.
Integration einer ISDN Verbindung<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem elektro- oder<br />
informationstechnischen Beruf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Allgemeiner Bereich Berufsbezogener Bereich<br />
Deutsch 160 Mathematik 240 Weitverkehrs- und Funktechnik 200<br />
Englisch 200 Techn. Physik 120 Betriebssysteme, Programmierung 240<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Informationsverarbeitung 160 Projektarbeit 160<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Elektrotechnik 240<br />
Elektronik 160<br />
Industrielle Kommunikation 160<br />
Kommunikation im Intranet 240<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
Die Ausbildung im Schwerpunkt Informations- und<br />
Kommunikationstechnik ist inhaltlich breit angelegt.<br />
So konzipieren die Studierenden ein Intranet unter<br />
den Aspekten der Lastverteilung, Administrierbarkeit,<br />
Kostenreduktion und Sicherheit und bauen es mit<br />
vorhandenen PCs und Netzkoppelgeräten der Schule<br />
auf. Sie nutzen Spezial-Messgeräte sowie Dokumentations-<br />
und Managementwerkzeuge.<br />
Sie realisieren eine Internet-Anbindung über WAN-<br />
Schnittstellen und analysieren z.B. Protokolltechniken<br />
und Modulationsarten. Dabei nutzen sie<br />
sowohl spezielle Kommunikations-Analysatoren als<br />
auch Universalgeräte wie Spektrumanalysatoren.<br />
Bei den genannten Tätigkeiten installieren sie verschiedene<br />
Betriebssysteme, schreiben Skripte und<br />
Programmroutinen.<br />
25
Ausbildungsschwerpunkte<br />
26<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Prozessleittechnik / Mess- und Regelungstechnik<br />
Um auf gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen<br />
der Arbeitswelt für Techniker/innen zu reagieren,<br />
werden neben den allgemeinbildenden und<br />
technischen Grundlagen folgende Inhalte vermittelt.<br />
Im ersten Studienabschnitt:<br />
• Produktbezogene Daten mit Office-Techniken<br />
aufbereiten und präsentieren<br />
• Bedienungsanleitungen und technische Berichte<br />
erstellen<br />
• Grundschulung im Umgang mit dem Internet<br />
• Zugriff auf Daten und Programme, die im Internet<br />
bereitgestellt werden<br />
• Produktbezogene Daten und Programme internetfähig<br />
machen<br />
Im zweiten Studienabschnitt<br />
• Prozessdaten über einen Feldbus aufnehmen, in einer<br />
Speicherprogrammierbaren Steuerung verarbeiten<br />
und Steuerbefehle über den Feldbus ausgeben<br />
• Eine Prozessleitanlage planen, konfigurieren,<br />
parametrieren und in Betrieb nehmen<br />
• Prozessdaten mit einem Prozessleitsystem erfassen,<br />
visualisieren und auswerten<br />
Regleroptimierung einer Wasserstandsregelung<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Die fortschreitende Digitalisierung und die immer<br />
kostengünstigeren Automatisierungseinheiten führen<br />
dazu, immer kleinere technische Anlagen zu automatisieren.<br />
Das Vorliegen der digitalen Pro-zessdaten,<br />
der immer stärkere Einsatz von Büro-software und<br />
der Erfolg des Internets fördern eine immer weitergehende<br />
Aufbereitung der Pro-zessdaten, auch nach<br />
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.<br />
Mit den nebenstehenden Lehrinhalten werden für unsere<br />
Absolventinnen und Absolventen die Grundlagen<br />
geschaffen, um auf dem veränderten Markt bevorzugt<br />
einen Arbeitsplatz zu finden.<br />
Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr weit gestreut, z.B.<br />
• Planung, Projektierung von Automatisierungsanlagen<br />
und deren Inbetriebnahme<br />
• Erstellung von Programmen für Steuerungsanlagen<br />
und deren Inbetriebnahme<br />
• Aufbau von Vernetzungsstrukturen zwischen<br />
Automatisierungsgeräten<br />
• Wartung und Fernwartung vom Büro mit sachkundiger<br />
Unterstützung der Anlagenbetreiber<br />
• Tätigkeiten im Vertrieb
Programmierung einer Leitanlage<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Elektroberuf oder<br />
Maschinentechnikberuf, wenn berufsprak-tische<br />
Erfahrungen in der Elektrotechnik vorhanden sind<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Das spätere Arbeitsgebiet der Absolventinnen und<br />
Absoventen in diesem Schwerpunkt ist sehr breit gefächert.<br />
Automatisierungstechnik in Altanlagen muß<br />
betriebsbereit gehalten und modernisiert werden. In<br />
Neuanlagen wird modernste Technik eingesetzt. So<br />
sind Netzwerktechnik beziehungsweise Bussysteme<br />
in der Automatisierungstechnik heute Standard.<br />
Die Einsatzgebiete sind u.a. in der Produktion der<br />
chemischen Industrie, in der Hausleittechnik und zunehmend<br />
in der Umwelttechnik zu finden.<br />
Die Ausbildung an unserer Schule trägt diesen Anforderungen<br />
Rechnung, indem traditionelle analoge<br />
Regelungs- und Steuerungstechnik ebenso wie moderne<br />
Rechnertechnologien Schwerpunkte des Unterrichtes<br />
sind.<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Mathematik 240 Leittechnik 240<br />
Englisch 200 Techn. Physik 120 Steuerungs- , Antriebstechnik 240<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Chemie 40 Regelungstechnik 200<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Elektrotechnik 240 Prozessmesstechnik 160<br />
Elektronik 160 Projektarbeit 160<br />
Informationsverarbeitung 160<br />
Betriebsorganisation 40<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
27
Ausbildungsschwerpunkte<br />
Die technischen Inhalte der Mechatronik liegen in<br />
der Schnittmenge von Mechanik, Elektronik und<br />
Optik. Die Mechatronik ist somit für das Zusammenwirken<br />
dieser Bereiche zuständig. Ihre<br />
Handlungsfelder sind komplexe Systeme oder auch<br />
Teile von maschinentechnischen und/oder elektrotechnischen<br />
Anlagen und Geräten, wobei dem Informationsaustausch<br />
zwischen den Komponenten<br />
besondere Bedeutung zukommt.<br />
Leitidee dieser zukunftsweisenden Ausbildung ist die<br />
Vermittlung von soliden Grundkenntnissen aus den<br />
Bereichen Elektrotechnik/Elektronik und<br />
Maschinentechnik, kombiniert mit den modernen<br />
Methoden der Problemlösung in technischen Betrieben.<br />
Es werden Fachkräfte ausgebildet, die technische<br />
und organisatorische Aufgaben fachrichtungsübergreifend<br />
bearbeiten.<br />
Durch die Vielfalt in der Fachrichtung Mechatronik<br />
ist die wichtigste Übung “ständiges Lernen wie man<br />
lernt”. Somit eröffnet sich für die berufliche Praxis<br />
die Chance, sich schnell neuen Bedingungen in den<br />
Betrieben anpassen zu können.<br />
28<br />
Mechatronik auf einen Blick<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Mechatronik<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Mechatroniker/innen sind Experten, wenn es darum<br />
geht, Systeme, Anlagen und Geräte zu verstehen, zu<br />
modifizieren und instandzuhalten. Projektorientiertes<br />
Arbeiten und ein systematischer und zielorientierter<br />
Arbeitsstil sind für sie selbstverständlich.<br />
Die unten gezeigte Grafik gibt einen Überblick über<br />
den Tätigkeitsbereich:<br />
• Es werden Steuerungen in verschiedenen Technologien<br />
(Prozessverwaltung) für den Produktionsablauf<br />
(Prozessebene) entwickelt<br />
• Es werden Produktionsprozesse organisiert<br />
• Es wird für die Sicherung der Produktqualität gesorgt.<br />
Dabei sind die Schnittstellen zwischen der Elektrotechnik<br />
und der Maschinentechnik (Sensorik und<br />
Aktorik) ein besonders typisches Betätigungsfeld der<br />
Mechatroniker/innen.
Projekt: Lasertechnik in der Industrie<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen und systemorientiert<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem<br />
Metall- oder Elektroberuf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Mathematik 240 Informationstechnik 240<br />
Englisch 200 Technische Kommunikation 200 Automatisierungstechnik 240<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Elektrotechnik / Elektronik 240 Produktionstechnik 200<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Technische Mechanik 160 Mechatronische Konstruktionen 160<br />
Techn. Optik / Lasertechnik 160 Projektarbeit 160<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
Mechatroniker/innen gehören wegen ihrer übergeordneten<br />
systemorientierten Denkweise weder dem<br />
Berufsfeld Elektrotechnik noch dem Berufsfeld Metall<br />
an, sondern sie sind eigenständig. Sie sind auf<br />
Grund ihrer Ausbildung bei uns in Bezug auf die Sicherheit<br />
am Arbeitsplatz auch Elektrofachkräfte für<br />
den Bereich der Mechatronik.<br />
29
Ausbildungsschwerpunkte und berufliche<br />
Tätigkeiten<br />
Die Ausbildung wendet sich an Facharbeiter/innen<br />
des Berufsfeldes Metall, die eine höherqualifizierte<br />
produktionsorientierte Tätigkeit anstreben.<br />
Das Ausbildungsprofil baut einerseits auf den Erfahrungen<br />
des traditionellen Schwerpunktes Fertigungstechnik<br />
auf, orientiert sich andererseits aber mehr an<br />
den Erfordernissen von Arbeitsprozessen des globalen<br />
Marktes. Dabei stehen Bereiche betrieblicher<br />
Tätigkeiten im Mittelpunkt. Für den Schwerpunkt<br />
Produktions- und Qualitätsmanagement gliedern sich<br />
diese Bereiche wie folgt:<br />
· Produktentwicklung begleiten sowie Betriebsmittel<br />
(Werkzeuge, Handhabungsgeräte) gestalten und<br />
bereitstellen<br />
· Produktion planen und steuern<br />
· Produktionsprozesse optimieren und automatisieren<br />
· Qualität und Kosten organisieren<br />
30<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Produktions- und Qualitätsmanagement<br />
Programmierung („Teachen“) eines Knickarmroboters<br />
Der Praxisbezug wird besonders dadurch erreicht,<br />
dass technische Grundlagen und betriebliche Tätigkeiten<br />
zusammenhängend betrachtet und unterrichtet<br />
werden. Exemplarische Arbeitsprozesse ziehen<br />
sich als Leitaufgaben wie ein roter Faden durch die<br />
Lerneinheiten. Selbstverständlich spielt dabei die<br />
computerunterstützte innerbetriebliche Information<br />
und Kommunikation eine große Rolle.<br />
Die Absolventinnen und Absolventen dieses neuen<br />
Schwerpunktes finden ihren zukünftigen Arbeitsplatz<br />
in den produktionsorientierten Unternehmen<br />
der Metall- und Elektroindustrie sowie in anderen<br />
verarbeitenden Gewerben.
Fräsen im Rahmen einer Projektaufgabe<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Metallberuf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Um eine praxisnahe und praxistaugliche Ausbildung<br />
sicherzustellen, wird die Projektarbeit im Bereich<br />
Produktions- und Qualitätsmanagement als<br />
Industrieprojekt durchgeführt.<br />
Allgemeiner Grundlagenbereich Fachrichtungsbezogener Anwendungsbereich<br />
Deutsch 160 Technische Unterlagen anfertigen, auswerten, präsentieren u. archivieren 120<br />
Englisch 240 Werkstoffe beanspruchungsgerecht auswählen u. Bauteilfestigkeit überprüfen 280<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Betriebsmittel entwerfen und konstruieren 160<br />
Mathematik 160 Computerunterstützte innerbetr. Informations- u. Kommunikationstechniken 200<br />
Produktionsprozesse, Arbeitsplätze und Werkstätten planen 220<br />
Produktionsprozesse steuern 80<br />
Maschinen und Verfahren anwendungsgerecht auswählen 160<br />
Handhabungs- und Automatisierungsvorgänge planen und durchführen 200<br />
Abläufe und Prozesse qualitätsgerecht gestalten 200<br />
Produktionskosten ermitteln und minimieren 80<br />
Projektarbeit 200<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
31
Ausbildungsschwerpunkte<br />
Die Ausbildung beinhaltet die Entwicklung<br />
maschinentechnischer Produkte von der ersten Idee<br />
bis zur Fertigungsfreigabe.<br />
Methodik des Konstruierens, technische Grundlagen<br />
sowie Kreativität führen zu optimalen Produkten, die<br />
mit 2D- und 3D-Systemen dargestellt werden.<br />
Das Projekt wird in Gruppenarbeit durchgeführt.<br />
Dabei werden praxisbezogene Aufgaben aus Unternehmen<br />
bearbeitet.<br />
Dies alles ermöglicht es der Technikerin / dem Techniker,<br />
in modernen Konstruktions- und Planungsbüros<br />
tätig zu werden.<br />
32<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Konstruktion<br />
Konstruktion einer Getriebeeinheit in 3D-CAD<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Denken in komplexen Funktionsabläufen ist heute<br />
eine wichtige Voraussetzung für Konstrukteurinnen<br />
/ Konstrukteure. Daneben müssen vor allem die Kostenentwicklung<br />
und Qualitätssicherung bereits während<br />
der Entwicklungsphase berücksichtigt werden.<br />
Die Ausbildung ist entsprechend breit gefächert. Die<br />
Technikerin bzw. der Techniker findet damit vielfältige<br />
Einsatzmöglichkeiten - ausgehend von der<br />
Produktplanung bis zur Inbetriebnahme:<br />
• Planung<br />
• Dimensionierung von Bauteilen<br />
• Entwurf<br />
• Projektmanagement<br />
• Montage und Instandhaltung<br />
• Dokumentation und Präsentation<br />
Bei entsprechender Qualifikation ist auch eine Tätigkeit<br />
als Ausbilder/in im Konstruktionsbereich möglich.
Aufbau einer Bearbeitungsvorrichtung<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Metallberuf<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Mathematik 160 Automatisierungstechnik 160<br />
Englisch 200 Techn. Physik 80 Fertigungstechnik /<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Werkstoffe 100 Qualitätssicherung 240<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Techn. Mechanik 200 Konstruktion 320<br />
Techn. Kommunikation 120 Produktionsorganisation 120<br />
Elektrotechnik 120 Projektarbeit 200<br />
Steuerungs-/Informationstechnik120<br />
Wahlpflicht 100<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
Projekte werden in Zusammenarbeit mit Betrieben<br />
aus der näheren Umgebung durchgeführt.Dadurch<br />
wird eine aktuelle und praxisnahe Aufgabenstellung<br />
erreicht.<br />
33
Ausbildungsschwerpunkte<br />
Sie lernen bei uns:<br />
• systematisches und zielorientiertes<br />
Arbeiten<br />
• Selbständiges und kreatives Denken<br />
im techn. u. gesellschaftl. Kontext<br />
(z.B. Umweltmanagement, Öko-Audit)<br />
• Verständnis von Systemen, Anlagen<br />
und Geräten<br />
Ihre zentralen Lerninhalte sind:<br />
• Verfahrens- und Umwelttechnik<br />
• Automatisierungstechnik<br />
• Konstruktion u. Anlagenplanung<br />
• Projektmanagement u. Fertigung<br />
Ihr technisches Know-How wird abgerundet<br />
durch allgemeinbildende Lerninhalte:<br />
• Deutsch<br />
• Englisch<br />
• Politik, Wirtschaft, Recht, Umwelt<br />
• Berufs- und Arbeitpädagogik<br />
34<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Verfahrens- und Umwelttechnik<br />
Inbetriebnahme einer Wärmepumpe<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Der Verfahrenstechniker und die Verfahrenstechnikerin<br />
sind universell ausgebildete Fachkräfte<br />
und können daher in sehr vielen Bereichen der Wirtschaft<br />
tätig werden. Durch ihre vielseitige Ausbildung<br />
sind sie in vielen unterschiedlichen Branchen beschäftigt,<br />
z.B. in der chemischen Industrie, im Apparateund<br />
Anlagenbau, in der Wasser- und Abwasserbehandlung,<br />
dem Umweltschutz und beim Recycling<br />
oder im technischen Vertrieb.<br />
In naher Zukunft werden sich die Einsatzschwerpunkte<br />
zunehmend an Einsparung und optimierter<br />
Ausnutzung von Rohstoff und Energie orientieren.<br />
Deshalb werden immer mehr verfahrenstechnisch<br />
ausgebildete Fachkräfte benötigt, die das<br />
Know-How der Verfahrenstechnik beherrschen.
Untersuchungen mit einer Umkehrosmoseanlage<br />
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen projektbezogen<br />
statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Metallberuf oder als<br />
Chemikant/in<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16)<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
Insbesondere in der Projektarbeit wird der umfassende<br />
Bildungsansatz dadurch realisiert, dass ein verfahrenstechnischer<br />
Prozess ausgelegt, in eine Anlagenplanung<br />
umgesetzt, steuerungstechnisch begleitet, umweltrechtlich<br />
überprüft sowie mit den Methoden des Projektmanagements<br />
automatisiert wird. Dabei ist der<br />
Einsatz von fachspezifischer Software - CAD,<br />
Prozesssimulation, Projektmanagement - selbstverständlich.<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Mathematik 160 Automatisierungstechnik 160<br />
Englisch 200 Techn. Physik 80 Konstruktion und<br />
Politik, Wirtschaft, Recht, Umwelt 160 Werkstofftechnik 100 Anlagenplanung 220<br />
Berufs- u. Arbeitspädagogik 40 Techn. Mechanik 200 Projektmanagement<br />
Techn. Kommunikation 120 und Fertigung 120<br />
Elektrotechnik/Elektronik 120 Verfahrens- und Umwelttechnik 300<br />
Steuerungs- und<br />
Informationstechnik 120<br />
Wahlpflicht 100<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
35
Ausbildungsschwerpunkte:<br />
Computersysteme<br />
• Kriterien für die Analyse und Bewertung von Computersystemen<br />
• Funktionsgruppen in Computersystemen und ihre<br />
Steuerung<br />
• Konfiguration von Computersystemen für Problemlösungen<br />
Netzwerktechnik<br />
• Physikalische Grundlagen der Datenübertragung<br />
• Netzwerkdesign<br />
• Netzwerkprojektierung<br />
• Übertragungsprotokolle und Internetdienste<br />
Betriebswirtschaftliche Grundlagen<br />
• Gründung und Management eines Dienstleistungsunternehmens<br />
• Rechtsformen<br />
• Marketing und Werbung im Internet<br />
• Kostenrechnung und Kalkulation<br />
Kommunikationstechnik<br />
• Audio- und Videotechnik<br />
• WAN-Zugang und –kommunikation<br />
• Internet-/Intranetanbindung von Informationssystemen<br />
• Ressourcenverwaltung und Benutzerverwaltung in<br />
Netzwerken<br />
• Netzwerkmanagement<br />
Projektmanagement<br />
• Projekttypen<br />
• Organisationsformen im PM (Aufbauorganisation<br />
/ Ablauforganisation)<br />
• Strukturierung von Projekten und Prozessen<br />
• Werkzeuge des PM, Visualisierungsformen, Netzplantechnik<br />
• Projektdokumentation nach VDI/ VDE<br />
36<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Medien- und Informationssystemtechnik<br />
Der Schwerpunkt berücksichtigt die Entwicklung, unserer Gesellschaft zu einer Informationsgesellschaft. Die<br />
Kombination bisher gesonderter Medien (Text, Grafik, Ton, Bewegtbild) durch Multimediatechniken und die<br />
mögliche Vernetzung mit computergestützen Systemen eröffnen neue Anwendungsfelder der Informationsund<br />
Kommunikationstechniken. Die Medien-und Informationssystemtechnik integriert Aufgaben im Bereich<br />
der betrieblichen Informations- bzw. Kommunikationssysteme. Sie gestaltet die Interaktion zwischen Betrieb<br />
und Kunde und stellt die notwendige informations- und kommunikationstechnische Infrastruktur zur Verfügung.<br />
Informationssystemtechnik<br />
• Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen an Informationssysteme<br />
• Datensicherheit und Datenschutz<br />
• Datenbankstrukturen<br />
• Entwicklung eines relationalen Datenbankmanagementsystems<br />
• Einführung in SQL<br />
• Arbeiten mit einer Datenbank über das Internet/<br />
Intranet<br />
• Objekt- und Ereignisgesteuerte Programmierung<br />
von Datenbanken<br />
Multimediales Publishing<br />
• Grundlagen der DTP-Anwendungen<br />
• Digitale Fotografie, Videosequenzen und Bildbearbeitung<br />
• Text-, Bild- und Tonabläufe im World Wide Web<br />
• Bild-, Text- und Ton-Dateiarchivierungen<br />
• Benutzeroberflächen und Benutzerführungen<br />
• Erstellen von Druckvorlagen / Broschüren / Werbemitteln<br />
• Dramaturgie interaktiver Medien
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre (Vollzeit)<br />
• ist praxisbezogen<br />
• findet auch in Betrieben oder Institutionen<br />
projektbezogen statt<br />
und erfordert<br />
• eine Ausbildung in einem Beruf der Kommunikations-<br />
oder Elektrotechnik, Informations- oder<br />
Medienwirtschaft (Mediengestalter/in für Digitalu.<br />
Printmedien) oder eine Ausbildung in einem der<br />
neuen IT-Berufe<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Fachschule - Seite 15/16).<br />
Ausbildungsplan<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Multimedia ist inzwischen nicht mehr nur ein Schlagwort,<br />
sondern der Name einer Dienstleistungsindustrie,<br />
in der mehr und mehr Arbeitsplätze geschaffen<br />
werden. Auch Firmen aus “herkömmlichem”<br />
Gewerbe stellen fest, dass eine moderne<br />
und leistungsfähige Darstellung des Unternehmens<br />
nach innen und außen ohne die neuen Techniken<br />
nicht mehr möglich ist.<br />
In diesem Spannungsfeld liegen die Einsatzgebiete<br />
eines Medien- und Informationssystemtechnikers.<br />
Im Design:<br />
• von multimedialen Präsentationen im Web<br />
• von Plakaten, Flyern und anderen Printprodukten,<br />
• von technischen Dokumentationen/Contentmanagement<br />
Im Marketing:<br />
• Projektmanagement,<br />
• bei der Firmenpräsentation online und offline,<br />
• im Post-Sales-Service,<br />
• bei der Mitarbeiterschulung,<br />
In der Fertigung:<br />
• bei der Planung und dem Aufbau von Kommunikationsinfrastruktur<br />
im Unternehmen,<br />
• bei der Vernetzung komplexer Arbeitsabläufe,<br />
• in der Verfahrensdokumentation,<br />
• beim Qualitätsmanagement<br />
Lernbereich I Lernbereich II Lernbereich III<br />
Deutsch 160 Techn. Mathematik 240 Kommunikationstechnik 160<br />
Englisch 200 Techn. Physik 120 Projektmanagement 160<br />
Politik,Wirtschaft,Recht,Umwelt 160 Informationssysteme 240 Informationssystemtechnik 280<br />
Berufs- und Arbeitspädagogik 40 Netzwerktechnik 160 Multimediales Publishing 360<br />
Betriebswirtsch. Grundlagen 80 Praktikum / Projekt 200<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
37
Ausbildungsschwerpunkte<br />
In Kooperation mit dem Förderverein der Schule<br />
(WeiTe e.V.) und den Handwerkskammern werden<br />
Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung<br />
(Handwerk) angeboten.<br />
Können nach der Berufsausbildung bestimmte Mindestzeiten<br />
an Berufspraxis oder berufsnahem Einsatz<br />
bei der Bundeswehr nachgewiesen werden, ist es<br />
möglich, den Meisterabschluss zu erwerben. Dazu<br />
werden vom Förderverein der Schule parallel zur<br />
Technikerausbildung Vorbereitungskurse (gegen Gebühr)<br />
angeboten, die in Ergänzung der Unterrichtsinhalte<br />
auf den Teil I und den Teil III der Meisterprüfung<br />
bezogen sind.<br />
Da durch die Technikerausbildung gleichartige Teile<br />
der Meisterprüfung anerkannt werden, sind in der<br />
Regel nur noch 2 Prüfungsteile vor der Handwerkskammer<br />
abzulegen:<br />
Teil I<br />
Praktische Meisterprüfung, kann nach Abschluss des<br />
Studiums, auch bei einer wohnortnahen Handwerkskammer,<br />
abgelegt werden. Für den Meisterabschluss<br />
Elektroinstallateur wird in der Regel im 3.-4. Semester<br />
ein Vorbereitungskurs durch den Schulverein<br />
angeboten.<br />
38<br />
Frischgebackene Meister<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
Zusatzausbildung zur Meisterprüfung<br />
Teil III<br />
Rechtlicher und wirtschaftlicher Teil der Meisterprüfung,<br />
hier wird ein Vorbereitungskurs für alle<br />
Meisterabschlüsse im 1.-2. Semester durch den<br />
Schulverein angeboten.<br />
Folgende Prüfungsteile werden in der Regel angerechnet:<br />
Teil II<br />
Theoretische Meisterprüfung, wird bei entsprechendem<br />
Fachrichtungsschwerpunkt bei Vorlage des<br />
Technikerzeugnisses anerkannt.<br />
Teil IV<br />
Berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, dieser<br />
Teil kann durch Besuch des Wahlunterrichts im<br />
Fach Berufs- und Arbeitspädagogik und der anschließenden<br />
Ausbildereignungsprüfung angerechnet<br />
werden.<br />
Somit ist es Studierenden möglich, mit dem Erwerb<br />
des Meisterbriefs eine grundlegende Voraussetzung<br />
für die spätere Selbständigkeit im Handwerksbereich<br />
zu schaffen.
Ausbildereignungsprüfung - ADA<br />
Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br />
weitere Zusatz-/ Ergänzungsausbildungen<br />
Im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik werden im<br />
zweiten und dritten Semester im Wahlbereich insgesamt<br />
ca. 80 Unterrichtsstunden zur Vorbereitung auf<br />
die Ausbildereignungsprüfung angeboten. Diese Prüfung<br />
kann schulintern abgelegt werden; sie ist kostenlos.<br />
Mit dieser Prüfung wird der Nachweis der pädagogischen<br />
Eignung für eine Ausbildertätigkeit in<br />
Industrie und Handwerk erbracht.<br />
Unterweisung als Vorbereitung zur ADA-Prüfung<br />
weitere Angebote:<br />
• Arbeitsgemeinschaften und Projekte zur Erweiterung<br />
und Vertiefung in Einzelbereichen der Fachgebiete,<br />
z.B.<br />
- Computernetze<br />
- erneuerbare Energien<br />
- Lasertechnik<br />
• Vertiefungskurse im Grundlagenbereich<br />
• Projektarbeiten / Projektierungen in Zusammenarbeit<br />
mit Betrieben<br />
• Technikerabschluss in einer 2. Studienrichtung<br />
(Ergänzungsstudium)<br />
• Ergänzungsstudiengänge, z.B. Wirtschaft<br />
• Qualitätsmanagementbeauftragte(r)<br />
• Zertifikat Lasertechnik<br />
• weitere Industrie- und Verbandszertifikate<br />
• Rhetorik- und Präsentationskurse<br />
• Netzwerkkurse (z.B. Novell Netware)<br />
• Unternehmensgründungsseminare<br />
39
Berufsfachschule für Informationsverarbeitung (Technik)<br />
3. Ausbildung<br />
3.1 Allgemeines zur Assistentenausbildung<br />
Die Ausbildung in der Berufsfachschule für Informationsverarbeitung - Fachrichtung Technik dauert zwei<br />
Jahre. Die Unterrichtsorganisation erfolgt aufgrund von Rahmenstundentafeln, die bei den nachfolgenden<br />
Bildungsgängen wiedergegeben sind. Dabei gibt es einen Pflicht- und einen Wahlbereich:<br />
Der Pflichtbereich enthält zwei unterschiedliche Fächergruppen:<br />
a) allgemeinen Bereich<br />
hierzu gehören Deutsch, Politik/Wirtschaft, Religion/Ethik und Sport.<br />
b) berufsbezogenen Bereich<br />
hierzu gehören die schwerpunktspezifischen Fächer.<br />
Der Wahlbereich umfasst folgende Angebote:<br />
• Zusatzkurse für die Fachhochschulreife<br />
• Ergänzungen und Vertiefungen des Pflichtbereichs<br />
Der Unterricht ist in Doppelstunden (90 Minuten) organisiert. Die Unterrichtszeit liegt Montag bis Donnerstag<br />
zwischen 7. 45 Uhr und 17. 25 Uhr, Freitag zwischen 7. 45 Uhr und 12. 50 Uhr.<br />
weitere Angebote:<br />
Rhetorik- und Präsentationskurse<br />
Netzwerkkurse (z.B. Novell Netware)<br />
Unternehmensgründungsseminare<br />
…<br />
3.2 Aufnahmevoraussetzungen für Assistentenausbildung<br />
Die Aufnahme in die zweijährige Berufsfachschule, die auf einem Mittleren Abschluss aufbaut, setzt voraus:<br />
• ein Versetzungszeugnis nach Jahrgangsstufe 11 einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasialen<br />
Oberstufe oder<br />
• ein Zeugnis über den Mittleren Abschluss (Realschulabschluss) oder<br />
• ein Abschlusszeugnis der zweijährigen Berufsfachschule oder<br />
• ein Zeugnis der Fachschulreife oder<br />
• ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis.<br />
Aufgenommen werden kann nur, wer bis zum 15. Februar das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;<br />
über Ausnahmen entscheidet das Staatliche Schulamt.<br />
Die Aufnahme ist auch davon abhängig, dass Bewerberinnen und Bewerber in einem der oben geforderten<br />
Bildungsabschlüsse mindestens befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik<br />
nachweisen, wobei in keinem der genannten Fächer die Leistungen schlechter als ausreichend sein dürfen.<br />
Bewerberinnen und Bewerber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen sich einem Auswahlverfahren<br />
unterziehen.<br />
(Auszug aus der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den zweijährigen Berufsfachschulen, die auf<br />
einem Mittleren Abschluss aufbauen vom 17.02.2000)<br />
41
3.3 Ausbildungsbeginn und Bewerbungstermine<br />
Ausbildungsbeginn ist jeweils der 01. August. Der Unterricht beginnt nach den allgemeinen Schulsommerferien<br />
des Landes Hessen.<br />
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz müssen bis zum 15. Februar des jeweiligen Jahres vorliegen. Ein<br />
Auswahlverfahren findet statt, wenn die Zahl der Bewerber größer ist als die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplätze.<br />
3.4 Bewerbungsunterlagen<br />
Die Bewerbung ist beim Sekretariat der Staatlichen Technikerschule Weilburg auf dem von der Schule ausgegebenen<br />
Bewerbungsformular einzureichen. Beizufügen sind:<br />
• Lebenslauf in tabellarischer Form<br />
• Abschlusszeugnis des mittleren Bildungsabschlusses oder ggf. das Zeugnis eines höheren Bildungsabschlusses<br />
(Schüler/innen der 9./10. Klasse der Realschule/Gesamtschule fügen das Halbjahreszeugnis<br />
bei)<br />
• 2 Passbilder<br />
• Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Bewerbern)<br />
! Alle Kopien von Zeugnissen bzw. Bescheinigungen müssen amtlich beglaubigt sein !<br />
3.5 Prüfungen<br />
Es können folgende Prüfungen abgelegt werden:<br />
• Abschlussprüfung: Sie umfasst eine schriftliche Prüfung in vier Fächern und eine mündliche Prüfung in den<br />
Fächern der Lernbereiche des zweiten Ausbildungsjahres (mit Ausnahme des Faches Sport).<br />
Die erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung<br />
„Staatlich geprüfte(r) technische(r) Assistent(in) für Informationsverarbeitung“<br />
(ergänzt um die Schwerpunktsbezeichnung).<br />
• Zusatzprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife<br />
3.6 Kosten<br />
Allgemeines<br />
Es werden keine Gebühren für den Schulbesuch und für die Prüfungen erhoben. Externen-Prüfungen sind<br />
jedoch gebührenpflichtig. Lernmittelfreiheit besteht für alle Schülerinnen und Schüler. Damit sind jedoch nur<br />
Lernbücher und Drucke der Schule gemeint. Schreibzeug und Taschenrechner müssen selbst bezahlt werden.<br />
Studierendenwohnheim<br />
Das Nutzungsentgelt einschließlich aller Nebenkosten beträgt für<br />
42<br />
• ein Einzelzimmer z.Z. EUR 61,50 pro Monat<br />
• einen Platz in einem 2-Bett-Zimmer z.Z. EUR 51,00 pro Monat
Mit der Unterbringung im Studierendenwohnheim ist die Teilnahme an der Vollverpflegung in der Mensa<br />
verbunden. Schon- bzw. Diätkost wird nicht angeboten. Eine Kostenreduzierung bei Nichtteilnahme an der<br />
Vollverpflegung ist nicht möglich!<br />
Kosten für Vollverpflegung (monatl.) z.Z. EUR 105,--<br />
Nutzungsentgelt und Vollverpflegungskosten sind Pauschalbeträge, diese werden pro Semester mit je 6 Monatsbeträgen<br />
erhoben.<br />
Durch eine Einzugsermächtigung von Ihrem Konto werden die fälligen Zahlungen im Lastschriftverfahren<br />
abgebucht.<br />
Mensa<br />
Die Mensa ist an regulären Unterrichtstagen geöffnet. An der Verpflegung kann jeder teilnehmen ( Studierende,<br />
Assistenten, Gäste,...). Die Bezahlung erfolgt über Chipkarten mit Wertguthaben, die in der Schulverwaltung<br />
erhältlich sind. Die Preise für die einzelnen Mahlzeiten betragen z.Z.:<br />
3.7 Finanzielle Förderung<br />
Frühstück EUR 1,70<br />
Mittagessen EUR 3,00<br />
Abendessen EUR 2,40<br />
Die Ausbildung kann durch BAföG-Förderung (als Zuschuss, elternabhängig) unterstützt werden.<br />
Es kann bei dem zuständigen BAföG - Amt (dem Landratsamt des Wohnhauses) Schüler-BAföG beantragt<br />
werden. Das Schüler-BAföG wird als Zuschuss gewährt.<br />
Der Förderungsbetrag beträgt z.Z. (2001) maximal:<br />
• 192,-- EUR/Monat (bei den Eltern wohnend)<br />
• 348,-- EUR/Monat (bei auswärtiger Unterbringung)<br />
Das eigene Einkommen und das der Eltern wird angerechnet. Grundlage ist beim Antrag das Einkommen aus<br />
dem vorletzten Jahr.<br />
43
Ausbildungsschwerpunkte<br />
44<br />
Technische/r Assistent/in für Informationsverarbeitung<br />
Computersysteme und Netzwerktechnik<br />
Die Ausbildung umfasst die Einführung in Computersysteme<br />
über den Hardwareaufbau von PC´s,<br />
RISC-Computer, Peripheriegeräte hin zur<br />
Betriebssystemsoftware, deren Installation und Anpassung<br />
auf die Kundenerfordernisse sowie die Anpassung<br />
von Kundensoftware.<br />
Weitere Schwerpunkte sind die Projektierung, Installation<br />
und Pflege von Computernetzen unter den verschiedenen<br />
Betriebssystemen (Windows, UNIX, ... )<br />
sowie unterschiedlichen Protokollen (TCP/IP, IPX,<br />
... ) . Des weiteren werden die Anbindung an das<br />
Internet mit seinen unterschiedlichen Diensten<br />
(WWW, FTP TELNET, EMAIL, ... ) durchgeführt.<br />
Um Schnittstellenanpassungen vornehmen zu können<br />
oder Seiten für das WWW erstellen zu können,<br />
lernen Sie die Programmiersprachen (C/ C++; Java,<br />
HTML, ... ).<br />
Nacharbeiten der Unterrichtsinhalte am PC<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Lokale Computernetze wachsen, werden zu größeren<br />
Netzen verbunden, werden an das weltweite Internet<br />
angeschlossen, die Zahl der Computernetze<br />
nimmt ständig zu, und damit steigt der Bedarf an<br />
Serviceleistungen im Hard- und Softwarebereich,<br />
der nur von gut ausgebildeten Fachkräften befriedigt<br />
werden kann.<br />
Insbesondere auch auf der Hardwareebene geschulte<br />
Assistentinnen und Assistenten können mit guten<br />
Angeboten rechnen. Mobilität wird aber sicher erwartet.<br />
Das exponentielle Wachstum im Internetbereich unterstützt<br />
diesen Trend massiv. Netzwerkhersteller und<br />
Netzwerkbetreiber bestätigen uns den Bedarf an<br />
Computer- und Netzwerkfachleuten.
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre<br />
• ist praxisbezogen<br />
• enthält Projektarbeiten, Laborübungen und ein<br />
Betriebspraktikum<br />
und erfordert<br />
• einen mittleren Bildungsabschluss (Abschluss der<br />
Realschule/Gesamtschule, Versetzung nach Klasse<br />
11 oder höher)<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Berufsfachschule - Seite 41/42).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
allgemeiner Bereich berufsbezogener Bereich<br />
Deutsch 80 Englisch 160 Programmierung zur Anpassung<br />
Politik / Wirtschaft 80 Mathematik 200 von Anwenderprogrammen und<br />
Religion / Ethik 80 Physik 80 Netzwerk-/Betriebssystemen 320<br />
Sport 80 Konfiguration von Computer- Projektierung, Installation und<br />
systemen 160 Inbetriebnahme von Netzwerken 320<br />
Administration von Computer- Administration und Wartung<br />
systemen 200 von Netzwerken 320<br />
Betriebs- /Arbeitsorganisation 160 Projektarbeit 400<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
Ihre möglichen Arbeitgeber können sein: Computer-<br />
und Netzwerkvertriebsfirmen, Netzwerkservice-<br />
Firmen, Ingenieurbüros für Netzwerktechnik, große<br />
Netzwerkanwender, z.B. Verwaltungen, Krankenhäuser,<br />
Rechenzentren von Universitäten und Großbetrieben;<br />
Internet-Service-Provider<br />
Ihre späteren Tätigkeiten – als Selbstständiger oder<br />
Angestellter - können sein: Computer aus einzelnen<br />
Komponenten aufbauen; Wartung und Reparatur;<br />
Betriebssysteme und Anwendungssoftware installieren<br />
sowie Benutzeroberflächen für den Benutzer anpassen;<br />
Netzwerksysteme installieren und<br />
konfigurieren; Netzwerkgeräte, wie Router und<br />
Bridges, in Netze integrieren; Fehlersuche, Fehleranalyse<br />
und Fehlerbehebung in Netzen; Verkabelungen<br />
zusammen mit Ingenieuren planen, Kabel verlegen<br />
und Netze testen; Kunden beraten; Vertrieb von<br />
Produkten und Dienstleistungen.<br />
45
Ausbildungsschwerpunkte<br />
46<br />
Technische/r Assistent/in für Informationsverarbeitung<br />
Medien- und Dokumentationstechnik<br />
In Ihrer Ausbildung werden Sie unter Zuhilfenahme<br />
von EDV-Werkzeugen eigenständig Vorgaben und<br />
Vorlagen sachgerecht in technische Dokumente<br />
(Technische Zeichnungen, Gebrauchsanleitungen,<br />
Präsentationsunterlagen, Werbebroschüren, Informationsunterlagen,<br />
On-Line-Hilfesysteme in z.B.<br />
Hypertext-Format) umsetzen und pflegen. Sie werden<br />
dabei auch im Team arbeiten.<br />
Sie erlernen auch - im Bereich der Technischen Dokumentation<br />
- das Desktop-Publishing von Printmedien<br />
und elektronischen Medien sowie die computergestützte<br />
Präsentation (Multimedia). Besonderer<br />
Schwerpunkt liegt auf dem eigenständigen Einarbeiten<br />
in das Handling der EDV-Werkzeuge sowie auf<br />
der selbständigen Organisation Ihrer Arbeitsabläufe<br />
an Ihrem Arbeitsplatz. Praxisorientiert erhalten Sie<br />
Einblicke in technische Systeme, Anlagen und Geräte<br />
zur Erstellung von Einzelteilen und Produkten. Für<br />
die Erstellung technischer Dokumente benötigen Sie<br />
vielfältige Informationen. Sie lernen daher, wie Sie<br />
z.B. mittels EDV-gestützter Recherchen Datenbanken<br />
nutzen und deren Daten sinnvoll aufbereiten können.<br />
Entwurf einer Montageanleitung<br />
Berufsaussichten und Tätigkeiten<br />
Der Weg von der Produktions- in die Informationsgesellschaft<br />
bedingt eine schnellere, bessere und andere<br />
Aufbereitung von Informationen. Neben Printmedien<br />
erhalten elektronisch verbreitete Informationen<br />
eine immer größere Bedeutung. Hinzu kommt<br />
ein Trend zu “virtuellen Welten” mit Multimedia und<br />
Internet. Dadurch entsteht auch ein größerer Bedarf<br />
an technischen Dokumenten (Technische Zeichnungen,<br />
Stücklisten, Bedienungsanleitungen, Serviceanleitungen,<br />
Prüfberichte,...), und es werden zunehmend<br />
höhere Anforderungen an solche Dokumente<br />
gestellt. Technische Zeichnungen und Stücklisten sind<br />
nach wie vor zentrale Dokumente über technische<br />
Produkte. Aber auch andere technische Dokumente<br />
wie Bedienungsanleitungen, Serviceanleitungen,<br />
Wartungsanweisungen, Montageanleitungen und<br />
Aufstellungsanleitungen sowie Werbematerial und<br />
Präsentationsfolien sind von zunehmend entscheidender<br />
Bedeutung für den Erfolg oder Nichterfolg der<br />
Firmen am Markt. Der Bedarf an Fachkräften wächst,<br />
die diese Dokumente kostengünstig und professionell<br />
erstellen.
Ihre Ausbildung bei uns<br />
• dauert 2 Jahre<br />
• ist praxisbezogen<br />
• enthält Projektarbeiten, Laborübungen und ein<br />
Betriebspraktikum<br />
und erfordert<br />
• einen mittleren Bildungsabschluss (Abschluss der<br />
Realschule/Gesamtschule, Versetzung nach Klasse<br />
11 - oder höher)<br />
(Es gelten die allgemeinen Zulassungsbedingungen<br />
für die Zweijährige Berufsfachschule - Seite 41/42).<br />
Ausbildungsplan<br />
Bemerkungen<br />
allgemeiner Bereich berufsbezogener Bereich<br />
Deutsch 80 Englisch 200 Techn. Systeme, Anlagen und<br />
Politik / Wirtschaft 80 Mathematik 160 Geräte in der Maschinen-<br />
Religion / Ethik 80 Techn. Physik 160 und Elektrotechnik 480<br />
Sport 80 Techn. Kommunikation und Betriebswirtschaft und<br />
Dokumentengestaltung 520 Arbeitsorganisation 160<br />
Computer und Netzwerke 160 Erstellung techn. Dokumente<br />
Praktikum / Projekt 480<br />
Die Zahlenangaben sind die Gesamtstundenzahlen innerhalb der zweijährigen Ausbildung.<br />
Folgende typische Tätigkeiten können Sie unter Beachtung<br />
vorgegebener Regeln, Normen und Vorschriften<br />
- als Selbstständiger oder als Angestellter<br />
– ausführen:<br />
• Erstellen technischer Zeichnungen, Explosionszeichnungen,<br />
Prospektgestaltung<br />
• Erstellen und Verwalten von Dokumenten, z.B. im<br />
Rahmen des Öko-Audits und der Umwelterklärungen<br />
auf neuen Datenträgern (Maschinenrichtlinie,...)<br />
• Aufbereitung von Dokumenten und Präsentationen<br />
für elektronische Medien (z.B. CD-ROM; PC-<br />
Netze, ...)<br />
• Online-Hilfesysteme für Anwender erstellen, Benutzeroberflächen<br />
einrichten, Bilder und Folien für<br />
Vorträge und Präsentationen erstellen<br />
• Anwenderprogramme für die Gestaltung von Texten<br />
und Grafiken installieren und sich in die Nutzung<br />
dieser Programme einarbeiten, ...<br />
47
Ausbildungsschwerpunkte<br />
Berufsfachschüler mit einem mittleren<br />
Bildungsabschluss haben die Möglichkeit, durch Zusatzkurse<br />
den schulischen Teil der Fachhochschulreife<br />
zu erwerben. Die Zusatzkurse finden in den Fächern<br />
Deutsch, Englisch und Politik/Wirtschaft statt.<br />
Der Besuch der Berufsfachschule für<br />
Informationverarbeitung an der Staatlichen Technikerschule<br />
Weilburg öffnet dadurch den Weg zum<br />
Fachhochschulbereich in allen Bundesländern.<br />
Doch auch für Berufsfachschüler/-innen, die nicht<br />
an ein Studium nach dem Besuch der Berufsfachschule<br />
denken, erweist sich die Zusatzausbildung als<br />
sehr vorteilhaft. Sicherheit in der deutschen Sprache<br />
und fundierte Kenntnisse in Englisch runden das<br />
Profil ab und schaffen bessere Startbedingungen in<br />
Industrie und Verwaltung.<br />
Die schulische Ausbildung schließt mit einer schriftlichen<br />
Prüfung in den Fächern Deutsch und Englisch<br />
sowie einer mündlichen Prüfung. Die mündliche<br />
Prüfung erstreckt sich auf die im Zusatzkurs unterrichteten<br />
Fächer.<br />
Das Zeugnis der Fachschulreife gilt nur in Verbindung<br />
mit dem Zeugnis der Berufsfachschule für Informationsverarbeitung<br />
und dem Nachweis einer ausreichenden<br />
beruflichen Tätigkeit.<br />
48<br />
Technische/r Assistent/in für Informationsverarbeitung<br />
Zusatzausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife<br />
Denkpause<br />
Der Nachweis einer ausreichenden beruflichen Tätigkeit<br />
kann erbracht werden durch:<br />
• die Abschlussprüfung in einem anerkannten einschlägigen<br />
Ausbildungsberuf oder<br />
• eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst oder<br />
• eine mindestens zweijährige einschlägige Berufstätigkeit<br />
oder<br />
• eine mindestens halbjährige ununterbrochene<br />
Praktikantentätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb<br />
oder einer öffentlichen Verwaltung.<br />
Das Praktikum ist durch einen Praktikan-tenvertrag<br />
zu begründen und sein erfolgreicher Abschluss<br />
durch ein Praktikantenzeugnis zu belegen.<br />
(Auszug aus der Verordnung über die Ausbildung und<br />
Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen, die auf<br />
einen Mittleren Abschluss aufbauen, vom<br />
17.02.2000)<br />
Ausbildungsplan<br />
Deutsch 80<br />
Englisch 80<br />
Politik / Wirtschaft 80
N o t i z e n<br />
49
50<br />
N o t i z e n
Besuchen Sie uns doch einmal, rufen Sie an oder schreiben Sie uns:<br />
52<br />
STAATLICHE TECHNIKERSCHULE WEILBURG<br />
Technisches Bildungszentrum<br />
Frankfurter Straße 40<br />
35781 Weilburg / Lahn<br />
Telefon (0 64 71) 92 61 - 0<br />
Telefax (0 64 71) 92 61 - 55<br />
Internet www.sts<strong>weilburg</strong>.de