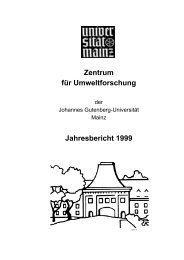Abschlussbericht des Graduiertenkollegs (pdf) - Zentrum für ...
Abschlussbericht des Graduiertenkollegs (pdf) - Zentrum für ...
Abschlussbericht des Graduiertenkollegs (pdf) - Zentrum für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Johannes Gutenberg - Universität – <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> Umweltforschung<br />
DFG-Graduiertenkolleg<br />
KREISLÄUFE, AUSTAUSCHPROZESSE UND WIRKUNGEN<br />
VON STOFFEN IN DER UMWELT<br />
Abschlußbericht<br />
Mainz, den 20. Dezember 2000<br />
Bearbeitung:<br />
Dr. J. Eichhorn<br />
Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Allgemeine Angaben 8<br />
1.1 Sprecher und beteiligte Hochschullehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
1.2 Zusammensetzung <strong>des</strong> Kollegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
2 Umsetzung der Zielsetzung und Konzeption <strong>des</strong> Kollegs 8<br />
3 Auswahl der Stipendiaten und Kollegiaten 10<br />
4 Durchführung <strong>des</strong> Ausbildungsprogramms 11<br />
4.1 Ringvorlesung ” Kreisläufe in der Natur“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
4.2 Ringvorlesung ” Umweltanalytik“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
4.3 Praktikum ” Analytik“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
4.4 Kolloquium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
4.5 Interne Tagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
4.6 Erfolgskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
5 Gastwissenschaftlerprogramm 15<br />
6 Projekte am Fachbereich 18 (Physik) 17<br />
6.1 Aerosolphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
6.1.1 Größenverteilung und chemische Zusammensetzung von Partikeln in Wolkenwasser<br />
und der umgebenden Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
6.1.2 Vertikalprofile von Größenverteilungen und chemischer Zusammensetzung <strong>des</strong> atmosphärischen<br />
Aerosols in mariner und kontinentaler Luft . . . . . . . . . . . . . 17<br />
6.1.3 Messungen <strong>des</strong> remote continental Aerosols in Sibirien . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
6.1.4 Holografie von Wolkenvolumina sowie deren automatisierte Auswertung . . . . . . 19<br />
6.1.5 In-situ Messung großer Hydrometeore mit Hilfe der In-line-Holographie . . . . . . . 20<br />
6.1.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 21<br />
6.2 Wolkenphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
6.2.1 Eine experimentelle und theoretische Untersuchung zur gekoppelten Aufnahme von<br />
Ammoniak, Kohlendioxid und Schwefeldioxid in Wassertropfen . . . . . . . . . . . 21<br />
6.2.2 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 22<br />
6.3 Stadtklima- und Regionalmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
6.3.1 Bodenrandbedingungen in mesoskaligen Klimamodellen . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
6.3.2 Die Boundary Element Methode (BEM) zur Simulation atmosphärischer Strömungen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
6.3.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 24<br />
6.4 Spurenanalytik in Umweltproben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
2
6.4.1 Resonanzionisationsmassenspektroskopie an Technetium und Plutonium mit einer<br />
Laserionenquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
6.4.2 Hochempfindlicher Technetiumnachweis mittels Resonanzionisations - Massenspektrometrie<br />
in Verbindung mit einer Laserionenquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
6.4.3 Resonante Laserionisations-Massenspektrometrie an Gadolinium zur Isotopenhäufigkeitsanalyse<br />
mit geringsten Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
6.4.4 Empfindlicher Nachweis toxischer Elemente mittels einer Laserionenquelle . . . . . 27<br />
6.4.5 Messung von 90 Sr in Umweltproben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
6.4.6 Selektiver Ultraspurennachweis von 41 Ca mittels schmalbandiger Resonanzionisations-Massenspektroskopie<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
6.4.7 Weiterentwicklung <strong>des</strong> 89,89 Sr-Spurennachweises und erste Analyse synthetischer<br />
Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
6.4.8 Bestimmung von 89 Sr und 90 Sr mit Resonanz-Ionisations-Spektroskopie in kollinearer<br />
Geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
6.4.9 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 31<br />
7 Projekte am Fachbereich 19 (Chemie) 35<br />
7.1 Kernchemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
7.1.1 Ultraspurenanalyse von Aktinoiden mittels Laser-Massenspektrometrie . . . . . . . 35<br />
7.1.2 Bestimmung der Ionisationsenergien von Curium und Plutonium . . . . . . . . . . 36<br />
7.1.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 37<br />
7.2 Physikalische Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
7.2.1 Speziesanalytik quecksilberorganischer Verbindungen und deren Anwendung auf biotische<br />
und abiotische Matrizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
7.2.2 Entwicklung einer neuartigen, direkt potentiometrischen Immunoelektrode gegen<br />
Atrazin, die auf einem kompetitiven Format beruht . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
7.2.3 Auswirkungen der organischen Fremdstoffbelastung eines eutrophen Sees in der Region<br />
dos Lagos/Brasilien auf die Kontamination <strong>des</strong> Grund- und Trinkwassers . . 39<br />
7.2.4 Qualifizierung und Quantifizierung von Fremdstoffen in Wasser und Fischen aus<br />
unterschiedlich belasteten Gewässern mittels Gaschromatographie / Massenspektroskopie<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
7.2.5 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 40<br />
8 Projekte am Fachbereich 21 (Biologie) 41<br />
8.1 Photosynthese, physiologische Ökologie, Streßphysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
8.1.1 Ökophysiologische Untersuchungen <strong>des</strong> Photosyntheseapparates bei Fichte (Picea<br />
abies (L.) Karst) mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenz-Meßtechnik . . . . . . . . . 41<br />
8.1.2 Untersuchungen zum Stickstoff-Assimilationspotential bei Buche in Abhängigkeit<br />
von der Stickstoff-Zufuhr und bei Eiche unter der Einwirkung von Ozon, Kohlendioxid<br />
und Trockenstreß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
3
8.1.3 Die Douglasienerkrankung - eine manganinduzierte Nährstoffstörung? Untersuchungen<br />
unter besonderer Berücksichtigung <strong>des</strong> Eisenhaushaltes . . . . . . . . . . . . . 43<br />
8.1.4 Untersuchung <strong>des</strong> Stickstoff-Stoffwechsels an Fichten (Picea abies), Buchen (Fagus<br />
sylvatica) und Eichen (Quercus petraea) im Zusammenhang mit dem Auftreten<br />
Neuartiger Waldschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
8.1.5 Kausalanalyse und Bioindikation der Neuartigen Waldschäden anhand <strong>des</strong> Polyamin-<br />
sowie <strong>des</strong> <strong>des</strong> Phenolstatus am Beispiel von Picea abies (Fichte), Abies alba<br />
(Weißtanne) und Quercus petraea (Eiche): - Okulare Bonitur versus Bioindikation? 45<br />
8.1.6 Untersuchungen zum Gehalt an Ascorbat, α-Tocopherol, Polyaminen und Mineralien<br />
in Fichtennadeln von 46 Freilandstandorten in der BRD. Bioindikation im Zusammenhang<br />
mit den ” Neuartigen Waldschäden“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
8.1.7 Planung und Aufbau computergesteuerter Expositionskammern zur Umweltsimulation<br />
<strong>für</strong> Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
8.1.8 Vergleichende Untersuchungen der Chlorophyllfluoreszenz bei Buchen (Fagus sylvatica),<br />
Eichen (Quercus petraea) und Fichten (Picea abies) in Zusammenhang mit<br />
den Neuartigen Waldschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
8.1.9 Untersuchungen über die Ursachen <strong>des</strong> ” Eichensterbens“ an drei Stieleichenbeständen<br />
(Quercus robur L.) im Westerwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
8.1.10 Vergleichende Untersuchung zum Photosyntheseapparat an Fichten und Eichen unterschiedlicher<br />
Freilandstandorte im Zusammenhang mit den Neuartigen Waldschäden 51<br />
8.1.11 Biochemische Schadinidkation der neuartigen Waldschäden bei Fichten . . . . . . 52<br />
8.1.12 Untersuchungen zum molekularen Mechanismus der Photosystem II-Photoinhibition<br />
an Spinat (Spinacia oleracea L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
8.1.13 Ethylenmetabolismus in Waldbäumen: Untersuchungen zum Gehalt an 1-Aminocyclopropan-Carboxylsäure<br />
(ACC), N - Malonylaminocyclopropan - Carboxylsäure<br />
(MACC) und zur Ethylenproduktion in unterschiedlich geschädigten Fichten, Tannen<br />
und Eiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
8.1.14 Molekularbiologische Untersuchungen der Multigenfamilie der Glutamin-Synthetase<br />
aus Brassica napus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
8.1.15 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 56<br />
8.2 Analyse <strong>des</strong> Photosyntheseapparates und biochemische Charakterisierung phototropher Algen 59<br />
8.2.1 In-Vivo Chlorophyll a-fluoreszenz von einzelligen Algen zur quantitativen Erfassung<br />
von Herbiziden in Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
8.2.2 DMSP-Gehalt und -Produktion der marinen Nanoalge Prymnesium parvum in<br />
Abhängigkeit von Umweltfaktoren und der Stoffwechselaktivität . . . . . . . . . . 60<br />
8.2.3 Die Wirkung von UV-B Strahlen auf die Produktivität der Planktonalge Phaeodactylum<br />
tricornutum im Vergleich zur Wirkung von starkem Weißlicht: Hemmeffekte<br />
auf den Phytosyntheseapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
8.2.4 Physiologische Charakterisierung von Planktonalgen aus unterschiedlichen Expositionstiefen<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
8.2.5 Molekulare Analyse <strong>des</strong> Photosyntheseapparates von Phytoplanktonalgen unter<br />
freiland-nahen Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
4
8.2.6 Untersuchung der Auswirkungen von UV-B und hoher Lichtstrahlung auf die Produktivität<br />
<strong>des</strong> Phytoplanktons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
8.2.7 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 64<br />
8.3 Ökotoxikologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
8.3.1 Bioakkumulation und Metabolismus von γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (Lindan)<br />
und 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure (Dichlorprop) beim Regenwurm Lumbricus<br />
rubellus (Oligochaeta, Lunbricidea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
8.3.2 Toxikokinetik von Umweltchemikalien mit unterschiedlichen Wirkmechanismen bei<br />
der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />
8.3.3 Bioakkumulation und Verteilung von 3,4-Dichloranilin und α-Endosulfan im aquatischen<br />
Laborsystem: ein Vergleich zwischen Einzelspezies- und Mikrokosmos-<br />
Experimenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
8.3.4 Qualifizierung und Quantifizierung von Fremdstoffen in Wasser und Fischen aus<br />
unterschiedlich belasteten Gewässern mittels Gaschromatographie / Massenspektroskopie<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
8.3.5 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 67<br />
8.4 Populationsbiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
8.4.1 Entwicklung eines Schätzverfahrens <strong>für</strong> die effektive Populationsgröße einer räumlich<br />
strukturierten Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
8.4.2 Modellierung strukturierter Insektenpopulationen. Ein vereinfachter Ansatz im Rahmen<br />
der standardisierten Populationsprognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
8.4.3 Untersuchung von genetischen Austauschprozessen bei der Ausbreitung und Evolution<br />
von periodisch-sozialen und sozialen Spinnen der Familie Eresidae . . . . . . . 69<br />
8.4.4 Genetische Variabilität bei Bachforellen (Salmo trutta forma fario) in Rheinland -<br />
Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
8.4.5 Untersuchung historischen und rezenten Genaustauschs zwischen südostasiatischen<br />
Festlands- und Inselpopulationen ökologisch unterschiedlich angepaßter Froscharten 70<br />
8.4.6 Modellierung und Simulation der Wirkungen von Fremdstoffen in einem See . . . . 71<br />
8.4.7 Genetische Populationsstruktur und Arealsystemanalyse <strong>des</strong> Silbergrünen Bläulings<br />
Polyommatus coridon und <strong>des</strong> Rundaugen-Mohrenfalters Erebia medusa . . . . . . 72<br />
8.4.8 Austauschprozesse zwischen und genetische Struktur von Flußbarschpopulationen 73<br />
8.4.9 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 74<br />
9 Projekte am Fachbereich 22 (Geowissenschaften) 76<br />
9.1 Ökologie und Planung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
9.1.1 Ökosystemare Bewertung <strong>des</strong> Bodens - Integrierter Bodenschutz anhand systematisch<br />
entwickelter Bodenqualitätsziele - Ein Betrag zur Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
(UVP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
9.1.2 Eine neue Methode der Informationsverknüpfung zur Klassifizierung der Landnutzung<br />
auf der Grundlage hochauflösender Satellitenbilddaten am Beispiel von Landau<br />
und Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />
9.2 Altlasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />
5
9.2.1 Standortdifferenzierte Abschätzung von Versickerungsraten <strong>für</strong> Einzugsgebiete mittlerer<br />
Größe in Hessen als Beitrag zur Ermittlung von Stofffrachten aus dem Boden 78<br />
9.3 Sedimentologie, Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
9.3.1 Mobilität von Seltenen-Erd-Elementen (SEE) und deren Fixierung in Karbonatphasen 78<br />
9.4 Angewandte Geologie, Hydrogeologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
9.4.1 Modellierung von Porenraumgeometrien und Transport in korngestützten porösen<br />
Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
9.4.2 Mobilisation von Schwermetallen aus Fahlerzen in Grundwässern im Bereich Rheinhessisches<br />
Hügelland als Folge anthropogen bedingten Nitrateintrages . . . . . . . 81<br />
9.4.3 Analyse möglicher Grundwasserkontaminationen durch ehemalige Rüstungsstandorte:<br />
Gefährdungsabschätzung mit GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
9.4.4 Sorption, Migration und Transportverhalten von Sprengstoffen (2,4,6-Trinitrotoluol<br />
und 1,3 - Dinitrobenzol) in der ungesättigten Zone - Experimentelle Studien und<br />
Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />
9.4.5 Bestimmung und chemische Modellierung der Sorptions-Mechanismen von TNT und<br />
DNB unter definierten Randbedingungen an unterschiedlichen Bodenmaterialien . 84<br />
9.4.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 85<br />
9.5 Bindung und Mobilität ökotoxischer Metalle und Metalloide im Bereich von Lagerstätten<br />
und Halden in Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
9.5.1 Bindungsformen, Mobilität und Aufnahmeverhalten von Uran in Vererzungen, Böden<br />
und Pflanzen im Saar-Nahe-Gebiet, Rheinland-Pfalz . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
9.5.2 Erfassung und Quantifizierung von Quecksilber-, Arsen- und Antimonverbindungen<br />
im Bereich Boden - Pflanze eines historischen Quecksilber-Bergbaugebietes im Nordpfälzer<br />
Bergland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
10 Projekte am Max-Planck-Institut <strong>für</strong> Chemie 89<br />
10.1 Biogeochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />
10.1.1 Messungen von Lachgas (N2O) und Methan (CH4) in europaeischen Nebenmeeren 89<br />
10.1.2 Die Abgabe von organischen Säuren an die Atmosphäre durch Pflanzen verschiedener<br />
Entwicklungsstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />
10.1.3 Modellierung der biogenen Emissionen von Stickoxiden und flüchtigen organischen<br />
Verbindungen aus Ökosystemen <strong>des</strong> Amazonasgebietes . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
10.1.4 Spurengasaustausch klimarelevanter reduzierter Schwefelverbindungen zwischen<br />
Biosphäre und Atmosphäre: COS Transfer der Flechten und anderer biotischer Kompartimente<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />
10.1.5 Herkunft und Massenbilanz von Blei in metallreichen Sediemnten . . . . . . . . . 91<br />
10.1.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 92<br />
10.2 Luftchemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
10.2.1 Messung und Interpretation von 13 C, 14 C, 17 O und 18 O Variationen in Atmosphärischem<br />
Kohlenmonoxid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
10.2.2 Anomalien ozonchemisch relevanter Spurengase, Feldmessungen und Modellierung 96<br />
6
10.2.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg . . . . . . . 96<br />
11 Statistische Angaben zu Kollegiaten / Stipendiaten 99<br />
12 Zusammenfassende Bewertung 120<br />
7
1 Allgemeine Angaben<br />
Das Graduiertenkolleg ” Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt“ wurde<br />
am 6. August 1990 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft <strong>für</strong> zunächst drei Jahre, beginnend mit<br />
dem 1. Oktober 1990, bewilligt. Es folgten zwei Verlängerungen um jeweils 3 Jahre, so daß die reguläre<br />
Förderungszeit am 30. September 1999 endete. Fristgerecht begonnene Dissertationsvorhaben wurden im<br />
Rahmen einer Auslauffinanzierung maximal 12 weitere Monate gefördert. Zum 30. September 2000 endete<br />
damit die Förderung <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong> durch die DFG endgültig.<br />
Der vorliegende Arbeitsbericht gibt einen Überblick über die im Laufe der Förderungsperiode abgelaufenen<br />
Aktivitäten und über die beteiligten Forschungsprojekte.<br />
1.1 Sprecher und beteiligte Hochschullehrer<br />
Das Graduiertenkolleg wird getragen von den Fachbereichen (FB) 18 (Physik), 19 (Chemie und Pharmazie),<br />
21 (Biologie) und 22 (Geowissenschaften) der Johannes Gutenberg - Universität Mainz sowie dem Max-<br />
Planck-Institut <strong>für</strong> Chemie in Mainz (MPI), eine Liste aller beteiligten Dozenten ist auf Seite 9 zu finden.<br />
Sprecher<br />
Prof. Dr. Ruprecht Jaenicke<br />
Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Becherweg 21<br />
55099 Mainz<br />
Organisation<br />
Dr. J. Eichhorn<br />
Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
1.2 Zusammensetzung <strong>des</strong> Kollegs<br />
Die Sollstärke <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong> betrug gemäß Bewilligungsbescheid vom 28. Juni 1993 18 Doktoranden<br />
sowie 2 Postdoktoranden, jeweils mit Stipendium. In der ersten Förderperiode betrug die Zahl der<br />
Doktorandenstipendien 15. Durch die zu unterschiedlichen Zeiten ausscheidenden Doktoranden aus der<br />
ersten Förderungsperiode, sowie teilweise eintretende Verzögerungen bei der Neubesetzung von Stipendien<br />
ergab sich eine ausgeprägte Fluktuation bei der Zusammensetzung <strong>des</strong> Kollegs.<br />
Insgesamt wurden während der Laufzeit <strong>des</strong> Kollegs 59 Doktoranden sowie 20 Postdoktoranden zeitweise<br />
finanziell gefördert, 11 weitere Doktoranden haben als Kollegiaten ohne finanzielle Förderung an den<br />
Veranstaltungen <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong> teilgenommen.<br />
Berichte zu allen abgeschlossenen bzw. bei Ende der Auslauffinanzierung noch laufenden Projekten sind<br />
in den Abschnitten 6 bis 10 zu finden, Daten zu Studienabschluß, Förderungsdauer, Promotion etc. der<br />
beteiligten Stipendiaten und Kollegiaten folgen als Ergänzung in Abschnitt 11.<br />
2 Umsetzung der Zielsetzung und Konzeption <strong>des</strong> Kollegs<br />
Die Umsetzung der Zielvorgabe erfolgte durch<br />
• Ringvorlesungen,<br />
• Angebot an relevanten Forschungsthemen,<br />
8
Beteiligte Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
FB 18<br />
Prof. Dr. R. Jaenicke Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Prof. Dr. G. Huber Institut <strong>für</strong> Physik ab 1995<br />
Prof. Dr. H.J. Kluge Institut <strong>für</strong> Physik bis 1994<br />
Prof. Dr. E. Otten Institut <strong>für</strong> Physik ab 1994<br />
Prof. Dr. H. Pruppacher Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre bis 1996<br />
Prof. Dr. E. Rühl Institut <strong>für</strong> Physik 1995 bis 1996<br />
Prof. Dr. W. Zdunkowski Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre bis 1999<br />
Prof. Dr. G. Zimmermann Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre ab 1992<br />
FB 19<br />
Prof. Dr. W. Baumann Institut <strong>für</strong> Physikalische Chemie<br />
Prof. Dr. G. Herrmann Institut <strong>für</strong> Kernchemie bis 1994<br />
Dr. N. Trautmann Institut <strong>für</strong> Kernchemie<br />
FB 21<br />
Prof. Dr. R. Nagel Institut <strong>für</strong> Zoologie bis 1995<br />
Prof. Dr. H.-J. Poethke Institut <strong>für</strong> Zoologie 1996 bis 1997<br />
Prof. Dr. A. Seitz Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Prof. Dr. A. Wild Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Prof. Dr. C. Wilhelm Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik bis 1996<br />
FB 22<br />
Prof. Dr. M. Domrös Geographisches Institut<br />
Prof. Dr. W. Dosch Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften bis 1994<br />
Prof. Dr. R. Gaupp Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften bis 1997<br />
Priv.-Doz. Dr. V. Heidt Geographisches Institut<br />
Prof. Dr. W. Hofmeister Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften ab 1997<br />
Prof. Dr. R. Oberhänsli Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften bis 1995<br />
Prof. Dr. H.v. Platen Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften bis 1994<br />
Prof. Dr. J. Preuß Geographisches Institut ab 1998<br />
Prof. Dr. D. Schenk Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften ab 1993<br />
MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Prof. Dr. M.O. Andreae Abteilung Biogeochemie<br />
Prof. Dr. P. Crutzen Abteilung Luftchemie<br />
Dr. G. Helas Abteilung Luftchemie ab 1996<br />
Priv.-Doz. Dr. J. Kesselmeier Abteilung Biogeochemie<br />
Dr. F.-X. Meixner Abteilung Luftchemie ab 1996<br />
Dr. D. Perner Abteilung Luftchemie<br />
Prof. Dr. P. Warneck Abteilung Luftchemie bis 1994<br />
9
• Kolloquien mit der Vorstellung und Diskussion der Forschungsarbeiten,<br />
• Kolloquien mit geladenen Gästen,<br />
• gemeinsame Arbeiten mit Besuchern,<br />
• intensive Betreuung durch die beteiligten Hochschullehrer, wobei nach Möglichkeit jeweils zwei Betreuer<br />
aus unterschiedlichen Instituten benannt wurden,<br />
• sowie durch Einbindung der Kollegiaten in die Planung durch Wahl von Doktorandenvertretern zum<br />
Kollegium.<br />
Das in den ersten drei Förderungsjahren entwickelte Konzept wurde in den Folgejahren beibehalten, wobei<br />
auf Anregung der Gutachter <strong>des</strong> ersten Verlängerungsantrages die Betonung interdisziplinärer Aktivitäten<br />
verstärkt wurde. Die ausgeprägte Interdisziplinarität verlangte, daß erhebliche Aktivitäten auf die Gewinnung<br />
und den Erhalt einer gemeinsamen Sprache und wissenschaftlichen Verständigung aufgewandt<br />
werden müssen. Daher waren auch alle Kollegen zu einer regelmäßigen Teilnahme an den Veranstaltungen<br />
aufgerufen, was zu einer erhöhten Mehrbelastung führte.<br />
Den Abschluß der Ausbildung bildete die Promotion nach der gemeinsamen Promotionsordnung der Fachbereiche<br />
17 bis 22 der Universität Mainz. Auf diese Weise wurde die Kompatibilität zu bestehenden<br />
Abschlüssen erreicht, jedoch auch eine zu einschränkende Spezialisierung vermieden.<br />
3 Auswahl der Stipendiaten und Kollegiaten<br />
Nachdem <strong>für</strong> die Erstbesetzung der Stipendien eine Anzeige in einer überregionalen Zeitschrift geschaltet,<br />
sowie direkte Anschreiben an Hochschulen und Forschungseinrichtungen gerichtet wurden, ergab sich im<br />
weiteren Verlauf eine gewisse Eigendynamik bei der Neubesetzung von Stipendien. Dies ist bedingt durch<br />
das unregelmäßige Ausscheiden der Stipendiaten aufgrund unterschiedlicher Promotionszeiten bzw. durch<br />
die in Einzelfällen vorgenommene Kündigung von Stipendien. Neuanträge auf Einrichtung von Forschungsprojekten<br />
und Zuweisung von Stipendien wurden daher nach Bedarf im Rahmen der Kollegiumssitzungen<br />
behandelt. Bei der Vergabe wurden dieselben Kriterien zugrunde gelegt, die auch <strong>für</strong> die Erstbesetzung<br />
galten:<br />
• die vorgegebene Altersgrenze,<br />
• eine Benotung der Diplomprüfung mit gut und besser,<br />
• ein zügiger Ablauf <strong>des</strong> Studiums bis zum Diplom,<br />
• die fachliche Eignung und das vorherrschende Interesse,<br />
• der Zugang von außerhalb der Universität Mainz.<br />
Durch die nicht mehr bun<strong>des</strong>weit ausgeschriebenen Stipendien verringerte sich naturgemäß der Anteil von<br />
nicht der Universität Mainz entstammenden Doktoranden. Allerdings wurden regelmäßig weitere Anfragen<br />
nach Stipendienmöglichkeiten von außen an das Graduiertenkolleg herangetragen, von denen einige auch<br />
positiv beschieden werden konnten. Auch <strong>für</strong> die Auswahl der nicht finanzierten Kollegiaten wurden die<br />
oben genannten Kriterien angewendet. Allerdings wurde hier vorrangig aus dem Pool der bereits in den<br />
Arbeitsgruppen arbeitenden Wissenschaftler geschöpft. Gelegentlich zeigten sich auch völlig außerhalb<br />
stehende Interessenten. Bei Eignung und Interesse wurden sie dem Kollegium zur Aufnahme vorgeschlagen.<br />
10
Das bereits im ersten Bewilligungszeitraum aufgetretene Problem <strong>des</strong> kurzfristigen Ausscheidens von<br />
Stipendiaten bzw. der Absage von aufgenommenen Kandidaten setzte sich in den Folgejahren fort.<br />
Bei einigen bewilligten Dissertationsprojekten ergaben sich hierdurch Verzögerungen bei der Besetzung.<br />
Überwiegend wurden bessere finanzielle Möglichkeiten auf anderen Stellen oder die Aussicht auf eine dauerhafte<br />
Beschäftigung als Grund <strong>für</strong> ein vorzeitiges Ausscheiden oder <strong>für</strong> die Ablehnung eines angebotenen<br />
Stipendiums angegeben.<br />
Der Anteil weiblicher Kollegiate betrug ca. 33 %. Dieser Anteil konnte ohne gezielte Maßnahmen erreicht<br />
werden. Der Anteil von außerhalb Mainz kommender Kollegiaten ist aufgrund der beschriebenen<br />
Problematik der Neubesetzungen von anfänglich ca. 35 % auf durchschnittlich 25 % gesunken.<br />
4 Durchführung <strong>des</strong> Ausbildungsprogramms<br />
Das Ausbildungsprogramm <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong> ” Kreisläufe, Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen<br />
in der Umwelt“ umfaßte zwei Ringvorlesungen, ein Praktikum sowie ein Kolloquium, in welchem einerseits<br />
die Kollegiaten über den Fortgang ihrer Arbeiten berichteten, andererseits Gastwissenschaftler in<br />
Sondervorträgen ihre Arbeitsgebiete vorstellten. Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über<br />
Umfang und Inhalte dieser Lehrveranstaltungen.<br />
4.1 Ringvorlesung ” Kreisläufe in der Natur“<br />
Im folgenden sind die in der Vorlesung ” Kreisläufe in der Natur“ abgehandelten Themen aufgelistet. Für<br />
je<strong>des</strong> Thema standen insgesamt 4 Vorlesungsstunden zur Verfügung. Die vorgesehene Dauer der Vorlesung<br />
wurde aufgrund der Themenvielfalt jeweils um einige Wochen überschritten.<br />
• Spurengaskreisläufe in der Atmosphäre (P. Warneck)<br />
• Kreisläufe in der Natur - Beispiel Atmosphäre (R. Jaenicke)<br />
• Photochemie und Strahlungsprozesse in der Stratosphäre und Mesosphäre (P. Crutzen)<br />
• Naßdeposition von Aerosolpartikeln und Schadstoffgasen (H. Pruppacher)<br />
• Austauschprozesse zwischen Ozean und Atmosphäre (M. Andreae)<br />
• Einfluß der terrestrischen Vegetation auf die Atmosphäre (J. Kesselmeier)<br />
• Biomassenverbrennung (J.G. Goldammer, Gastvortrag)<br />
• Numerische Modellierung der regionalen und lokalen atmosphärischen Zirkulationen sowie der Ausbreitung<br />
von Schadstoffen (W. Zdunkowski, J. Eichhorn)<br />
• Globale Ausbreitungsvorgänge (G. Zimmermann)<br />
• Stadtökologie, Luftreinhaltung, Immissionsökologie (M. Domrös)<br />
• Landschaftsplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung (V. Heidt)<br />
• Die Rolle der photoautotrophen Pflanzen in den Stoff- kreisläufen <strong>des</strong> Kohlenstoffs, Sauerstoffs,<br />
Stickstoffs und Schwefels (A. Wild)<br />
• Physiologie ökologisch relevanter Austauschprozesse zwischen Pflanzen und Umwelt unter besonderer<br />
Berücksichtigung von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwermetallen (C. Wilhelm)<br />
11
• Wechselwirkungen zwischen Fremdstoffen und Tieren (R. Nagel)<br />
• Austauschprozesse in und zwischen Populationen (A. Seitz)<br />
• Mineralbestand der magmatischen und metamorphen Gesteine der oberen Erdkruste (H. v. Platen)<br />
• Geochemische Austauschprozesse und Stofftransport in der Kruste (R. Oberhänsli)<br />
• Tonminerale (W. Dosch)<br />
• Sedimentologie (R. Gaupp)<br />
• Hydrogeologie (D. Schenk)<br />
• Umweltradioaktivität (G. Herrmann, N. Trautmann)<br />
4.2 Ringvorlesung ” Umweltanalytik“<br />
Die Vorlesung ” Umweltanalytik“ beinhaltete die folgenden Einzelbeiträge.<br />
• Neutronenaktivierunganalyse (N. Aras, Gastvortrag)<br />
• Versuchsplanung (W. Baumann)<br />
• Chromatographie (W. Baumann)<br />
• Massenspektroskopie (H.-J. Kluge)<br />
• Optische Methoden (H.-J. Kluge)<br />
• Radiochemische Methoden (K. Lützenkirchen, Institut <strong>für</strong> Physik, Gastvortrag)<br />
• Elektrochemie (K. Lützenkirchen, Institut <strong>für</strong> Physik, Gastvortrag)<br />
• Organische Spurenanalytik (W. Dünges, Institut <strong>für</strong> Anorganische Chemie und Analytische Chemie,<br />
gastvortrag)<br />
• Röntgenspektroskopische Methoden (R. Oberhänsli)<br />
• Analytik in Pflanzen und Tieren (C. Wilhelm)<br />
• Statistik (C. Wilhelm)<br />
4.3 Praktikum ” Analytik“<br />
Das Praktikum über Analytische Methoden wurde insgesamt dreimal durchgeführt. Aufgrund der<br />
veränderlichen Kollegiumszusammensetzung und der damit verbundenen geringfügigen Verlagerungen der<br />
Forschungsschwerpunkte ergaben sich teilweise unterschiedliche Inhalte. Die Praktika wurden jeweils innerhalb<br />
der vorlesungsfreien Zeit innerhalb von fünf Tagen durchgeführt.<br />
Eine Zusammenstellung der angebotenen Versuchsblöcke ist der Tabelle auf Seite 13 zu entnehmen.<br />
12
Praktikum ” Analytik“<br />
Nagel, Ternes GC-MS: Qualifizierung und Quantifizierung von Atrazin in Wasser;<br />
Extraktionsverfahren; Anreicherung<br />
Wilhelm, Wild HPLC: Qualifizierung und Quantifizierung von Atrazin in Wasser; Extraktionsverfahren;<br />
Anreicherung; Standards, Trennungsoptimierung<br />
Kratz, Trautmann RFA/Neutronenaktivierung: Nachweis von Cu und Hg in<br />
v.Platen, Kritsotakis<br />
Klärschlamm; Referenzproben, Reaktorbesichtigung<br />
AAS, ICP,RFA: Nachweis von Cu und Hg in Böden und Gestein; simultaner<br />
Mehrelementnachweis<br />
Kluge, Wendt MS: Massenfilter, Besichtigung; Nachweis von SF6, Methan, org.<br />
Lösungsmitteln (Atrazin)<br />
Baumann,<br />
Jaenicke<br />
Holthues, Weiß, Immunoassay: Atrazin in Wasser, Sammlung von Regenwasser<br />
Schenk Eintagesexkursion: Probenahme mit Rücksicht auf spätere Analysen<br />
Schenk sequentielle Bindungsformanalyse, Ionenchromatographie<br />
Kritsotakis AAs, ICP, Wasser- und Sedimentproben<br />
Wilhelm Analysen zur Charakterisierung der Trophie von Gewässern (Biovolumen,<br />
Chlorophyll, Phytoplankton)<br />
Kratz, Trautmann, Wendt Neutronenaktivierunganalyse, hochselektive Laser-MS<br />
4.4 Kolloquium<br />
Im Kolloquium <strong>des</strong> GK mußten alle Kollegiaten unabhängig von einer finanziellen Förderung ca. einmal<br />
jährlich in einem kurzen Referat über den Fortgang ihrer Arbeiten berichten. Im ersten Turnus dieser<br />
Vortragsreihe wurden die Einzelveranstaltungen jeweils von den betreuenden Hochschullehrern eröffnet,<br />
die eine Beschreibung der Aktivitäten der jeweiligen Arbeitsgruppe gaben. Den Kollegiaten verblieb die<br />
Aufgabe, die Ziele ihrer Arbeiten darzustellen. Derartige Übersichtsvorträge wurden auch bei Neueintritt<br />
von Hochschullehrern in das Graduiertenkolleg angesetzt. Aufgrund der relativ hohen Gesamtzahl von<br />
Doktoranden (inklusive der nicht geförderten Kollegiaten zeitweise ca. 30) konnte die angestrebte Zahl von<br />
einem Vortrag pro Jahr und Kollegiat nicht eingehalten werden, statt<strong>des</strong>sen wurden von den Doktoranden<br />
jeweils zwei Vorträge, einer nach ca. einem Jahr Zugehörigkeit zum Kolleg, ein weiterer kurz vor oder nach<br />
Abschluß der Dissertation, gehalten.<br />
Das von den Kollegiaten gestaltete Kolloquium fand in wöchentlichem Rhythmus statt. Unterbrechungen<br />
dieses Turnus ergeben sich durch Gastvorträge sowie erforderlichenfalls <strong>für</strong> die Planungs- und Koordinationssitzungen<br />
der beteiligten Hochschullehrer.<br />
4.5 Interne Tagung<br />
Am 24. Oktober 1994 wurde in Obermoschel einmalig eine interne Tagung der <strong>Graduiertenkollegs</strong>teilnehmer<br />
durchgeführt. Diese wurde in Form eines workshop training abgehalten. Für ein hypothetisch vorgegebenes<br />
Hauptthema (Forschungs- und Untersuchungsaufgaben im Zuge eines angenommenen Ausbaus<br />
<strong>des</strong> Mainzer Flugplatzes) wurden drei Arbeitskreise gebildet, die zu den ihnen zugewiesenen Einzelthemen<br />
Arbeitskonzepte erstellen bzw. diskutieren sollten. Im einzelnen wurden die Themenkreise<br />
• Bestandsaufnahme bestehender Umweltbelastungen<br />
• Prognose zukünftiger Belastungen<br />
• Ergebniswertung, ” Schnittstelle“ zur Politik<br />
13
ehandelt. Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen wurden zum Abschluß in einer gemeinsamen<br />
Besprechung zusammengeführt.<br />
Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Posterausstellung, in der alle Doktoranden den gegenwärtigen<br />
Stand ihrer Arbeiten dokumentierten. Der Verlauf der Tagung wurde von allen Beteiligten als positiv gewertet,<br />
einzig die zeitliche Beschränkung auf einen Tag wurde als Hindernis <strong>für</strong> eine ausführliche Diskussion<br />
der einzelnen Themen empfunden.<br />
4.6 Erfolgskontrolle<br />
Eine Erfolgskontrolle wurde durch die regelmäßigen Kolloquien und Berichterstattung erreicht, <strong>des</strong> weiteren<br />
durch die Diskussion mit den betreuenden und begleitenden Hochschullehrern und Ansprechpartnern, die<br />
regelmäßige Teilnahme an den Kolloquien und Vorlesungen und einer thematisch selektierten Teilnahme<br />
am Umwelttag der Universität mit Vorträgen und Postern.<br />
Als Abschlußprüfung gilt die Promotion gemäß der gemeinsamen Promotionsordnung. Die durchschnittliche<br />
Zeitspanne zwischen Beginn eines Dissertationsprojektes und Promotion betrug 40 Monate. Damit konnte<br />
gegenüber der in den naturwissenschaftlichen Fächern üblichen Promotionsdauer von 4 - 5 Jahren eine<br />
deutliche Verkürzung erreicht werden. Die Stipendiendauer von normalerweise 3 Jahren erscheint in diesem<br />
Zusammenhang als angemessen. Nicht berücksichtigt wurden bei dieser Statistik die dem Graduiertenkolleg<br />
ohne finanzielle Förderung angehörenden Doktoranden.<br />
14
5 Gastwissenschaftlerprogramm<br />
Gastwissenschaftler wurden eingeladen zu Vorträgen und Diskussionen im Rahmen <strong>des</strong> GK - Kolloquiums,<br />
sowie auch zu längerfristigen Besuchen, bei denen eine aktive Mitarbeit in den besuchten Arbeitsgruppen<br />
und eine intensive Zusammenarbeit mit den Kollegiaten praktiziert wurde. Die folgenden Wissenschaftler<br />
waren als Gäste <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong> tätig:<br />
Prof. Dr. N. Aras (Ankara, Türkei), Arbeitsgruppe Kluge, Aufenthaltsdauer 3 Monate (1991)<br />
Prof. Dr. R. J. Silva (Livermore, USA), Arbeitsgruppe Herrmann/Trautmann (1991)<br />
Priv.-Doz. Dr. W. Pietsch (Dresden) Gastvortrag (1991)<br />
Dr. B. Jansyk (Prag, CSFR) Gastvortrag (1991)<br />
Prof. Dr. A. Rebello-Wagner (Rio de Janeiro, Brasilien) Arbeitsgruppe Baumann, Gastvortrag (1991)<br />
Elke Haase (Oldenburg) Gastvortrag (1992)<br />
Prof. Dr. H. Roeser (Ouro Petro, Brasilien) Arbeitsgruppe Baumann, Gastvortrag (1992 und 1997)<br />
Dr. Stephan Borrmann (National Center of Atmospheric Research, Boulder, Colrado / USA) Arbeitsgruppe<br />
Jaenicke, Gastvortrag (1993)<br />
Prof. Dr. A. Miguel (Universität São Paulo, Brasilien) Gastvortrag (1993)<br />
Prof. Dr. H. D. Schorscher (Universität São Paulo, Brasilien) Arbeitsgruppe Oberhänsli, mehrere Vorträge<br />
im GK-Seminar (1993 und 1994)<br />
Prof. Dr. T. H. Nash (Department of Botany, Arizona State University, Tempe, USA) Arbeitsgruppe<br />
Kesselmeier, (1993 und 1995)<br />
Prof. Dr. M. D. Fox (School of Geography, University of New South Wales, Australien) Arbeitsgruppe<br />
Domrös, Gastvortrag, (1994)<br />
Dr. N. T. Tin (Water Quality Laboratory, Sub-Institute of Water Resources, Planning and Management,<br />
Ho Chi Minh City, Vietnam) Arbeitsgruppe Domrös (1994)<br />
Prof. Dr. W. C. Purdy (Department of Chemistry, McGill University, Montreal, Canada) Gastvortrag<br />
(1995)<br />
Prof. Dr. K. Rahn (Center for Atmosheric Chemistry Studies, Graduate School of Oceanography, University<br />
of Rhode Island, Narragansett, USA) Arbeitsgruppe Jaenicke (1995)<br />
Prof. Dr. J. Sturdevant (Universität Niteroi, Brasilien) Arbeitsgruppen Baumann, Wilhelm, Schenk<br />
(1995)<br />
Dr. Gyula Surányi (Institute of Plant Biology, Hungarian Academy of Sciences, Szeged) Arbeitsgruppe<br />
Wilhelm (1995)<br />
Prof. Dr. M. X. Wang (Academica Sinica, Institute of Atmospheric Physics, Beijing, VR China) Arbeitsgruppe<br />
Jaenicke (1996 und 1997)<br />
S. Skouratov (Zentrales Aerologisches Observatorium, Dolgoprudny, Rußland) , Arbeitsgruppe Jaenicke<br />
(1996)<br />
Dr. B. A. Bushaw (Richland, WA 99352, USA) Arbeitsgruppe Otten (1997)<br />
15
Dr. S. Torr (Natural Resources Institute, Insect Chemistry Group, Kent, U.K.) Arbeitsgruppe Meixner<br />
(1997)<br />
S. Caquineau (LISA, Universität Paris, Frankreich) Arbeitsgruppe Jaenicke, Gastvortrag (1997)<br />
Dr. V. I. Mishin (Institute of Spectroscopy, Russian Academy of Science) Arbeitsgruppe Huber (1998)<br />
Dr. W. X. Yang (US Department of Agriculture) Arbeitsgruppe Meixner (1998)<br />
Prof. S. V. Rodriques (Instituto de Quimica, Departmento Federal Fluminense, Outeiro Sao Batista,<br />
24020-007 Niteroi / Brasilien) Arbeitsgruppe Baumann (1999)<br />
Dr. L. Pibida (National Institute of Standards, NIST, Gaithersburg / USA) Arbeitsgruppe Otten, Gastvortrag<br />
(1999)<br />
16
6 Projekte am Fachbereich 18 (Physik)<br />
6.1 Aerosolphysik<br />
Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre)<br />
6.1.1 Größenverteilung und chemische Zusammensetzung von Partikeln in Wolkenwasser und<br />
der umgebenden Luft<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Met. Jutta Brinkmann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke<br />
Mit einem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Freistromimpaktor wurden im Sommer 1992 vom Flugzeug<br />
aus Wolkenwasserproben gewonnen. Diese Proben wurden auf verschiedene chemische und physikalische<br />
Parameter hin untersucht. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Größenverteilung der einzelnen<br />
unlöslichen Teilchen und deren Elementzusammensetzung. Die Größenverteilungen wurden größtenteils in<br />
einem Raster-Elektronen-Mikroskop bestimmt. Über energiedispersive Röntgenanalyse wurde die Elementzusammensetzung<br />
der Einzelpartikel ermittelt, morphologische Betrachtungen gaben in Kombination mit<br />
der Elementanalyse Aufschluß über die mineralogische oder biologische Erscheinungsform der unlöslichen<br />
Teilchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden unter Berücksichtigung der löslichen Bestandteile<br />
im Wolkenwasser und der meteorologischen Bedingungen zur Zeit der Messung mit den Eigenschaften der<br />
interstitiellen Aerosolpartikel, ihrer Größenverteilung und chemischen Zusammensetzung, verglichen. Die<br />
Aerosolpartikel waren während derselben Flüge gesammelt worden.<br />
Zum Vergleich mit anderen Wetterlagen und Wolkenbedingungen wurden mit einer bereits vorhandenen<br />
Apparatur auch Nebelproben vom Boden aus gesammelt. Die Auswertung der Wasserproben erfolgte nach<br />
den gleichen Prinzipien wie bei den Flugmessungen.<br />
Anhand der so gewonnenen Daten konnten Aussagen zur Aktivierung von Aerosolpartikeln und zur Inkorporation<br />
unlöslicher Bestandteile in das Wolkenwasser getroffen werden. Es konnten verschiedene physikalische<br />
und chemische Prozesse innerhalb der Wolkentropfen identifiziert werden.<br />
Es wurde eine erste Bilanzierung hinsichtlich der Quellen der Wolkeninhaltsstoffe vorgenommen.<br />
Folgeprojekt: Im Rahmen <strong>des</strong> Postdoktorandenstipendiums wurden Frau Brinkmann die folgenden Aufgaben<br />
übertragen:<br />
• Veröffentlichung der Ergebnisse der Dissertation in wissenschaftlichen Zeitschriften.<br />
• Weitergabe von Erfahrungen im Bereich der Mikroanalyse an Diplomanden und Doktoranden.<br />
• Ergänzung der Dissertationsarbeit durch weitere Aufschlüsselung der vorhandenen Wolkenwasserproben<br />
nach Wolkeneinzelereignissen hinsichtlich Elemente und Ionen, sowie<br />
• Teilnahme an Meßkampagnen im Jahr 1995, Einweisung von Mitarbeitern.<br />
6.1.2 Vertikalprofile von Größenverteilungen und chemischer Zusammensetzung <strong>des</strong> atmosphärischen<br />
Aerosols in mariner und kontinentaler Luft<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Met. Sabine Gruber<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke<br />
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war, die Größenverteilungen <strong>des</strong> gesamten und <strong>des</strong> biologischen Aerosols<br />
zu bestimmen. Diese wurde um die chemische Charakterisierung der Partikel mit Radien kleiner als 2 µm<br />
17
erweitert. Anhand von Flugmessungen wurde der Einfluß der Höhe auf Größenverteilung und chemische<br />
Zusammensetzung untersucht. Da die Aerosolmessungen im Rahmen der NORDEX-Kampagne in der<br />
deutschen Nordseebucht durchgeführt wurden, war es zudem möglich, sowohl kontinentales als auch marines<br />
Aerosol zu analysieren.<br />
Aufgrund <strong>des</strong> großen Radienbereichs der zu untersuchenden Aerosolpartikel, wurden zur Auswertung zwei<br />
Verfahren verwendet:<br />
• Teilchen mit Radien zwischen 2,0 µm und 41,6 µm wurden an einem Lichtmikroskop ausgewertet.<br />
Biologische Aerosolpartikel wurden mit einem Proteinfarbstoff markiert und konnten dadurch von<br />
nichtbiologischen Teilchen unterschieden werden.<br />
• Die Größenverteilung der Partikel mit Radien zwischen 0,2 µm und 2,2 µm wurde durch Auszählung an<br />
einem Rasterelektronenmikroskop bestimmt. Anhand von energiedispersiver Röntgenspektralanalyse<br />
konnte die Elementzusammensetzung je<strong>des</strong> Teilchens erkannt werden. Mittels dieser Information<br />
wurden die Teilchen in sechs verschiedene Aerosolgruppen (Seesalz, Calciumsulfat, mineralische AP,<br />
kohlenstoffhaltige AP, biologische AP und sonstige AP) eingeteilt.<br />
Die mittlere Gesamtkonzentration der atmosphärischen Aerosolpartikel auf Helgoland (r > 0, 2µm) betrug<br />
Nges = 6,12 cm −3 . Konzentrationsänderungen traten sowohl bei sich ändernden Luftmassen als ” -auch<br />
mit zunehmender Probenahmehöhe auf:<br />
• Die Konzentration in kontinental beeinflußten Luftmassen lag deutlich höher als die in mariner Luft.<br />
Die Größenverteilung <strong>des</strong> marinen Aerosols zeigte einen flacheren Verlauf als die <strong>des</strong> kontinentalen.<br />
• Es wurde ein deutliches Vertikalprofil der Teilchenkonzentration festgestellt. In der atmosphärischen<br />
Reibungsschicht war sie aufgrund guter Mischung relativ konstant, doch nahm sie oberhalb der<br />
Grenzschicht um bis zu eine Größenordnung ab.<br />
Die Zusammensetzung <strong>des</strong> atmosphärischen Aerosols war stark abhängig vom Luftmassenursprung und der<br />
Teilchengröße. Es konnte dagegen keine tendenzielle Zu- oder Abnahme einzelner Aerosolgruppen mit der<br />
Höhe festgestellt werden:<br />
• Kontinentale Luftmassen wurden von den kohlenstoffhaltigen -, biologischen -, mineralischen -<br />
und Calciumsulfatteilchen dominiert. In mariner Luft traten neben den Seesalzteilchen auch<br />
Calciumsulfat- und biologische Teilchen auf.<br />
• Aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsprozesse der Aerosolgruppen wurde eine starke Radienabhängigkeit<br />
der chemischen Zusammensetzung der Partikel festgestellt. Die bevorzugt durch<br />
gas-to-particle conversion entstehenden kohlenstoffhaltigen Teilchen dominierten das Aerosol im Submikrometerbereich.<br />
Der prozentuale Anteil der durch bulk-to-particle conversion produzierten Aerosolgruppen<br />
(mineralische - und Seesalzteilchen) stieg dagegen mit wachsendem Partikelradius an.<br />
Biologische Aerosolpartikel treten dagegen in allen Größenbereichen zwischen wenigen Nanometern<br />
(Viren) und mehreren Hundert Mikrometern (Pollen, Fragmente) auf.<br />
6.1.3 Messungen <strong>des</strong> remote continental Aerosols in Sibirien<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Pjotr Koutsenoguii<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke<br />
Atmospheric aerosols are produced by mechanical disintegration and gas-to-particle conversion. They act<br />
in the atmosphere, influencing the formation of clouds, the radiation budget and thus the climate and<br />
18
are finally removed to the surface. Their mass transfer is part of a geochemical cycle. One of the most<br />
important parameters of the aerosol is the size distribution. Atmospheric aerosols are <strong>des</strong>cribed with size<br />
distribution models: marine, stratospheric, <strong>des</strong>ert, remote continental etc. The least investigated one is the<br />
remote continental aerosol. The purpose of this study was to measure and document the size distribution<br />
and nature of the remote continental aerosol.<br />
Measurments were carried out in summer of 1990, 1991 and 1992. Siberia is part of the large continent<br />
Asia, where different locations were used for the measurments: two near Lake Baikal and another near the<br />
city of Novosibirsk.<br />
Size distributions were obtained using screen diffusion battery and impactor techniques in the size range<br />
from few nm to about 100 µm. The mean total aerosol number concentration was about 10 4 cm −3 . The<br />
aerosol number size distribution may be approximated with the sum of three lognormal functions.<br />
The possibility of using the screen diffusion battery (SDB) was carefully studied. Different algorithms of<br />
the SDB data inversion were tested. It was found that one set of SDB measurments can provide only a<br />
maximum of 6 independent informations.<br />
The behaviour of the total aerosol number concentration and aerosol size distributions may be explained<br />
using the major path of condensation nuclei formation (gas-to-particle conversion) and the major path of<br />
removal (coagulation). A simple kinetic model developed explains the typical evolution of aerosol number<br />
concentrations during a day.<br />
The number size distribution of recent measurments of remote continental, polar and urban cendensation<br />
nuclei were compared to previously published measurments. All distributions are two-modal. The parameters<br />
of the distributions are in rather good agreement with each other. The size distributions differ from<br />
each other only in the number concentrations of the mo<strong>des</strong>. This is taken as an indication, that the physical<br />
processes responsible for aerosol formation and removal are similar in the rather vast areas of Siberia.<br />
6.1.4 Holografie von Wolkenvolumina sowie deren automatisierte Auswertung<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Phys. Eva-Maria Uhlig<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke<br />
Mit der Holographieanlage HODAR wurden in-situ Messungen (Einfach- und Doppelpulshologramme) in<br />
aufliegenden Wolken auf dem Kleinen Feldberg im Taunus zur Untersuchung der Wolkenmikrostruktur<br />
durchgeführt. Für die Quantifizierung der räumlichen Tropfenanordnung wurden die Abstands- und Konzentrationshäufigkeitsverteilungen<br />
aufgestellt. Aus ihrem Vergleich mit der Poissonstatistik, die eine adäquate<br />
Beschreibung der zufallsverteilten Tropfenanordnung liefert, wird die räumliche Homogenität beurteilt. Aus<br />
den Anzahlgrößenverteilungen der Wolkentropfen konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen stratiformen<br />
und konvektiven Wolken aufgezeigt werden.<br />
Die Abstandsverteilungen der ersten nächsten Nachbarn der Wolkentropfen weichen in allen Hologrammen<br />
von der Poissonstatistik ab. Der Anteil kleiner Tropfenabstände ist wesentlich höher als in einem zufallsverteilten<br />
Tropfenkollektiv. Die Konzentrationshäufigkeitsverteilungen zeigen bei einer Unterteilung in kleine<br />
Volumenelemente (Kantenlänge < 2000 µm) nur geringe Abweichungen zur Poissonstatistik, dagegen ist<br />
bei großen Volumenelementen die Abweichung tendenziell steigend. Die Ergebnisse beschränken sich auf<br />
den mikroskaligen Bereich und zeigen, daß die Poissonstatistik dort die räumliche Tropfenanordnung nicht<br />
korrekt beschreibt.<br />
Aus den Doppelpulshologrammen wurden zusätzlich die Bewegungsgeschwindigkeiten und -richtungen der<br />
Tropfen ermittelt. Aufgrund fehlender Turbulenzeigenschaften, die ein Hologramm als Momentaufnahme<br />
nicht erfassen kann, visualisieren die holographischen Aufnahmen nur die momentanen Bewegungseigenschaften<br />
der Tropfen. Sie geben kein vollständiges Bild der Tropfenbewegungen in der Strömung der<br />
19
atmosphärischen Grundschicht.<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das HODAR mit dem automatischen Bildanalysesystem DROP-<br />
CAT weiterentwickelt. Die aktive Tätigkeit eines Beobachters während der zeitintensiven Auswertung eines<br />
Hologramms wird von DROPCAT übernommen. Es wurde erstmalig <strong>für</strong> Wolkentropfenhologramme eingesetzt<br />
und auf seine Anwendbarkeit <strong>für</strong> polydisperse Wolkentropfen getestet. Die Suchstrategie basiert<br />
auf der Erfassung <strong>des</strong> fokussierten Tropfenquerschnittes aus einer Vielzahl von Bildebenen mit Hilfe <strong>des</strong><br />
Schwellwert- und Schärfekriteriums und der anschließenden Überprüfung der extrahierten Objekte durch<br />
erneutes manuelles Anfahren ihrer Bildebene. Fehlsegmentierungen, die dem granulären Bildhintergrund<br />
oder unscharfen Tropfenbildern zuzuordnen sind, werden im zweiten Schritt der Suchstrategie eliminiert.<br />
Der Fehler der automatischen Bildanalyse <strong>für</strong> die Wolkentropfen wird auf 20 % abgeschätzt. Die untere<br />
Grenze der automatisch erkannten Tropfengröße beträgt deff = 8 µm. Das Auflösungsvermögen <strong>des</strong><br />
HODAR liegt bei deff = 6 µm, so daß die Wolkentropfen mit 6 µm ≤ deff ≤ 8 µm nur in interaktiver<br />
Auswertung erfaßt werden.<br />
6.1.5 In-situ Messung großer Hydrometeore mit Hilfe der In-line-Holographie<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Hermann Vössing<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Jaenicke<br />
Für das Wettergeschehen, aber auch <strong>für</strong> die Stoffkreisläufe in der Atmosphäre, haben Wolken und die darin<br />
enthaltenen Wasserteilchen, die Hydrometeore, eine entscheidende Bedeutung. Einmal in die Atmosphäre<br />
gelangte Stoffe werden im wesentlichen vom Niederschlag wieder aus ihr entfernt. Für das Verständnis der<br />
Niederschlagsprozesse ist die Kenntnis der Mikrophysik der Tröpfchen und Tropfen bzw. Eisteilchen, also<br />
der Hydrometeore, wichtig.<br />
Regentropfen zum Beispiel sind keine einfachen Gebilde aus Wasser, die in der sogenannten ” Tropfen- oder<br />
Tränenform“ zu Boden fallen. Im Gegenteil ist ihre Form eher ein oblates Sphäroid (ungefähr die Form<br />
einer Linse oder Dicken Bohne, sie sind breiter als hoch!) und die Regentropfen zeigen ein komplexes<br />
dynamisches Verhalten.<br />
Um die Eigenschaften nicht nur der Regentropfen, sondern auch der anderen Hydrometeore, wie Schneeflocken,<br />
Graupel und Hagelkörner untersuchen zu können, wird in der vorliegenden Arbeit eine Apparatur<br />
zur holographischen In-situ-Aufnahme großer Hydrometeore vorgestellt.<br />
Die Holographie liefert eine dauerhafte Abbildung <strong>des</strong> Objektes und <strong>des</strong>sen räumlicher Position im Probevolumen.<br />
Mit Hilfe von Doppelbelichtungen können auch die Geschwindigkeitsvektoren der einzelnen<br />
Objekte bestimmt werden.<br />
Auf dem HODAR (HOlographic Droplet and Aerosol Recording) (Borrmann,1991) basierend, wurde <strong>für</strong><br />
diese Arbeit ein erweitertes HODAR <strong>für</strong> die großen Hydrometeore, wie Regentropfen und Schneeflocken,<br />
entwickelt und erprobt. Das Meßvolumen wurde dazu erstmalig von 1 auf etwa 500 Liter vergrößert. Heute<br />
stehen zwei Apparaturen in einer bereit: die großvolumige zur Aufnahme von großen Hydrometeoren wie<br />
Regentropfen und Schneeflocken und die kleinvolumige zur Aufnahme von Nebel bzw. aufliegenden Wolken.<br />
Es wurden an ausgewählten Hologrammen:<br />
• die Größenverteilung,<br />
• die Form und Art,<br />
• die Geschwindigkeitsvektoren und<br />
• die räumliche Verteilung<br />
20
der darin abgebildeten Hydrometeore bestimmt.<br />
Dabei wurden Abweichungen von der im Windkanal ermittelten Fallgeschwindigkeit (TSV) von Regentropfen<br />
gefunden. Auch sind Regentropfen im Raum nicht völlig gemäß der Poissonverteilung zufallsverteilt.<br />
6.1.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Jaenicke, R. (1992): Vertical Distribution of Atmospheric Aerosols. In: Nucleation and Atmospheric<br />
Aerosols (N. Fukuta, P. Wagner, eds) Deepak Publ., 417-425<br />
Jaenicke, R., P.K. Koutsenogii (1992): Measurements of Atmospheric Aerosol in Siberia. In: Nucleation<br />
and Atmospheric Aerosols (N. Fukuta, P. Wagner, eds) Deepak Publ., 435-438<br />
Mikkelsen, T., H.E. Jorgensen, W. aufm Kampe, H. Weber, S. Borrmann (1990): The Effect of Finite<br />
Sampling Volumes on Measured Probability Density Functions. 9th Symposium on Turbulence and<br />
Diffusion, Riso, Denmark<br />
Uhlig, E.M., M. Stettler, W. von Hoyningen-Huene (1992): Experimental Studies on the Variability of the<br />
Extinction Coefficient by Different Air Masses. Conference on Visibility and Fine Particles, Wien<br />
Vössing, H., S. Borrmann, R. Jaenicke, In-line Holography of Cloud Volumes applied to the Measuremant<br />
of Raindrops and Snowflakes, Atmos. Res., Vol. 29, 1998, p. 199-212.<br />
Konferenzbeitrag: Poster, zur DPG-Frühjahrstagung in Regensburg, Holographische In-situ Messungen von<br />
Hydrometeoren, Verhandl.DPG (VI) 33, SYA 2.59, 1998,<br />
Konferenzbeitrag: Vortrag, zur EAC’97 in Hamburg, HODAR - In line Holography of Hydrometeors ,<br />
Journal of Aerosol Sciences, Vol. 28, 1997, p. 327<br />
6.2 Wolkenphysik<br />
Univ.-Prof. Dr. H. R. Pruppacher und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre)<br />
6.2.1 Eine experimentelle und theoretische Untersuchung zur gekoppelten Aufnahme von Ammoniak,<br />
Kohlendioxid und Schwefeldioxid in Wassertropfen<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Met. Anke Hannemann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H.-R. Pruppacher<br />
Diese Arbeit beschreibt die Dynamik und Chemie der gekoppelten Aufnahme von Schwefeldioxid und Ammoniak<br />
durch frei fallende Wolken- und Regentropfen. Tropfen werden in einem vertikalen Windkanal mit<br />
definierten SO2- und NH3-Konzentrationen frei ausgeschwebt und anschließend ionenchromatographisch<br />
untersucht. Die experimentellen Resultate werden mit umfangreichen theoretischen Studien verglichen, die<br />
auf eigens hier<strong>für</strong> entwickelten Modellen basieren . Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit sind:<br />
• Das Kronig-Brink-Modell, das die laminare innere Zirkulation <strong>des</strong> Tropfens berücksichtigt, ist <strong>für</strong> alle<br />
untersuchten Gase <strong>für</strong> Absorption und Desorption von Wassertropfen bestätigt worden (Abweichungen<br />
innerhalb der experimentellen Unsicherheiten im allgemeinen < 10 %).<br />
• Die korrekte Beschreibung der NH3-Aufnahme ohne Anwesenheit von SO2 erfordert, daß die gleichzeitige<br />
Aufnahme von Kohlendioxid (CO2) aus der Luft detailliert erfaßt wird. Dabei muß die langsame,<br />
kinetisch gehemmte Bildung <strong>des</strong> Kohlensäure-Intermediärs (H2CO3) berücksichtigt werden.<br />
• Bei SO2-Konzentrationen unter 1 ppmv ist ein Modell, das die innere Tropfenzirkulation durch die<br />
Annahme instantaner Durchmischung ersetzt, bestätigt worden. Über 1 ppmv und Tropfenradien<br />
21
von r > 250 mm wird die Gasaufnahme durch dieses Modell systematisch überschätzt (bis zu einem<br />
Faktor 2) und es muß das Kronig-Brink-Modell angewendet werden. Dasselbe gilt <strong>für</strong> die Aufnahme<br />
von NH3 allein.<br />
• Tropfen mit r > 500 mm erfordern <strong>für</strong> die theoretische Beschreibung der Gasaufnahme ein Modell, das<br />
periodisch zwischen einem Zustand mit laminarer innerer Zirkulation und einem Zustand vollständiger<br />
Durchmischung wechselt und somit die regelmäßigen Turbulenzstöße der sich vom Tropfen ablösenden<br />
Wirbel beschreibt.<br />
• Im Gegensatz zur Gasaufnahme unterliegt die Desorption aus den Tropfen in die Gasphase einer gehemmten<br />
Dynamik (Absorptions-Desorptions-Asymmetrie), die die die Benutzung <strong>des</strong> Kronig-Brink-<br />
Modells notwendig macht, außer bei niedrigen Konzentrationen unter atmosphärischen Bedingungen.<br />
• Bei atmospärisch relevanten Gaskonzentrationen (einige ppbv) und Tropfenradien (r ≈ 250 mm)<br />
läßt sich die Gasaufnahme befriedigend mit Hilfe <strong>des</strong> vereinfachten Modells ohne innere Zirkulation<br />
beschreiben (vollständig durchmischter Tropfen).<br />
• Durch die gleichzeitige Anwesenheit von NH3 und SO2 in der Atmosphäre werden deren Aufnahmeraten<br />
verstärkt.<br />
Die in dieser Arbeit aufgeführten Ergebnisse finden unmittelbar Anwendung in der Formulierung regionaler<br />
Wolken- und Niederschlagsmodelle, die den Spurentransport in der Gas- und Flüssigphase der Atmosphäre<br />
beschreiben und sich dabei aktuellen Themen, wie zum Beispiel dem sauren Regen, widmen.<br />
6.2.2 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
S. K. Mitra, A. Waltrop, A. Hannemann, A. I. Floßmann, H. R. Pruppacher (1992): A wind tunnel and<br />
theoretical study to test various theories for the absorption of SO2 by drops of pure water and water drops<br />
untaining H2O2 and (NH4)2SO4. In: Precipitation Scavenging and Atmospheric Surface Exchange. Vol.<br />
1, Eds. S. E. Schwartz, W. G. N. Slinn, p. 123 - 141<br />
6.3 Stadtklima- und Regionalmodelle<br />
Univ.-Prof. Dr. W. Zdunkowski und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre)<br />
6.3.1 Bodenrandbedingungen in mesoskaligen Klimamodellen<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Thomas Kandlbinder<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Zdunkowski<br />
Atmosphärische Phänomene in der Mesoskala (1 km 2 10 4 km 2 ) werden hauptsäachlich durch Temperaturgradienten<br />
am Boden hervorgerufen. Diese entstehen durch Erwärmung der Erdoberfläche tagsüber<br />
bzw. durch Abkühlung nachts. Die Erwärmungs bzw. Abkühlungsraten ergeben sich durch die Bilanz<br />
der Enerigeflüsse (Strahlungsenergiefluß, latente und sensible Energieflüsse und Bodenwärmefluß) an der<br />
Erdoberfläche.<br />
Ziel dieser Arbeit war es, Bilanzgleichungen an der Erdoberfläche in Abhängigkeit von verschiedenen Bodenbedeckungen<br />
wie z.B. Wälder, Städte oder Gewässer zu formulieren und damit Bodenrandwerte <strong>für</strong> Temperatur<br />
und spezifische Feuchte eines mesoskaligen Prognosemodells zu liefern. Besonderes Augenmerk wurde<br />
hierbei auf die Modellierung von Gebäuden gelegt, da hierzu in der Literatur nur sehr vereinfachte Ansätze<br />
zu finden sind. Um die RechenRoutine <strong>für</strong> die Berechnung der Bodenrandwerte zu testen, wurde diese an<br />
22
ein eindimensionales Atmosphärenmodell gekoppelt und die damit berechneten Energieflüsse am Boden mit<br />
Messungen verglichen. Es stellte sich heraus, daß die Rechnungen sowohl <strong>für</strong> pflanzenbedeckte als auch <strong>für</strong><br />
bebaute Oberflächen sehr gute Resultate lieferten. Im Falle dieser Vergleichsrechnungen waren allerdings<br />
die nötigen Parameter wie Bodenwassergehalt, Pflanzenbestands bzw. Gebäudehöhe, Blattflächendichte<br />
und Stomatawiderstand relativ genau gegeben. Dies ist bei der Modellierung von Windfeldern in mesoskaligen<br />
Gebieten i.a. nicht der Fall und man ist hier auf Abschätzungen angewiesen. Aus diesem Grund wurde<br />
auch untersucht, wie sich Variationen in den Modellparametern auf das Ergebnis auswirken. Es zeigte sich,<br />
daß vor allem eine Veränderung <strong>des</strong> Bodenwassergehaltes eine starke Auswirkung auf die Energiebilanz hat.<br />
Die so getestete Bodenroutine wurde nun in ein dreidimensionales Prognosemodell integriert und die damit<br />
berechneten Wind und Temperaturfelder mit Messungen, die im Oberrheintal durchgeführt worden waren,<br />
verglichen. Es stellte sich heraus, daß das Modell sehr gut in der Lage war die charakteristischen Phänomene,<br />
wie Hangauf und abwinde, sowie die Kanalisierung <strong>des</strong> Windfel<strong>des</strong> durch das Rheintal im Rahmen der<br />
Meßunsicherheit und der Modellauflösung zu reproduzieren. Weiterhin zeigte sich, daß einige Meßergebnisse<br />
wegen der großen Streuung der Werte erst mit Hilfe der Ergebnisse der Modellrechnung zu interpretieren<br />
waren.<br />
Außerdem wurde der Einfluß, den unterschiedliche Bodenbedeckungen auf mesoskalige Phänomene, wie<br />
Hangwinde oder Kanalisierung haben können, untersucht. Zum Schluß wurde noch ein Konzept vorgestellt,<br />
mit dem es möglich ist, Bodenbewuchs nicht nur als Randbedingung, sondern mit Gitterzellen<br />
aufzulösen. D.h. es werden prognostische Gleichungen <strong>für</strong> Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit<br />
innerhalb einer Pflanzenschicht berechnet. Die Ergebnisse dieses Modells konnten allerdings<br />
nur mit unvollständigen Meßdaten verglichen werden, da ein zur Validierung notwendiger Datensatz nicht<br />
zur Verfügung stand. Die gemessenen Tagesgänge von Temperatur und relativer Feuchte konnten jedoch<br />
zufriedenstellend reproduziert werden.<br />
6.3.2 Die Boundary Element Methode (BEM) zur Simulation atmosphärischer Strömungen<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Christoph Seligmann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Zdunkowski<br />
Zur Simulation von atmosphärischen Stömungen im mikro- und mesoskaligen Bereich existieren am Institut<br />
<strong>für</strong> Physik der Atmosphäre der Johannes-Gutenberg Universität in Mainz bereits die beiden Klimamodelle<br />
MISKAM und KLIMM. Diese beiden Modelle haben sich in vielen meteorologischen Fragestellungen bewährt<br />
und liefern zuverlässige Vorhersagen. Infolge der Diskretisierung <strong>des</strong> Integrationsbereiches mit Rechtecken<br />
ergeben sich jedoch Probleme bei der Beschreibung von komplizierteren Strukturen.<br />
Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Boundary-Element Methode (BEM) verspricht beliebige Hindernisformen,<br />
mit wesentlich weniger numerischem Aufwand als die ihr verwandte Methode der finiten<br />
Elemente, zu beschreiben.<br />
Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt darin, die Theorie der BEM auf die meteorologischen Grundgleichungen<br />
anzuwenden. Dabei wurde, im Gegensatz zu allen bekannten Simulationen von Hindernisüberströmungen<br />
mit Hilfe der BEM, ein räumlich variabler turbulenter Austauschkoeffizient angenommen. Daraus resultieren<br />
Zusatzterme sowie kompliziertere Ausdrücke <strong>für</strong> die bereits von anderen Autoren hergeleiteten Integrale.<br />
Alle in dieser Arbeit auftretenden Randintegrale wurden sowohl analytisch als auch numerisch berechnet;<br />
somit ist ein Fehler bei der Auswertung dieser Integrale ausgeschlossen. Auch <strong>für</strong> die zweidimensionalen<br />
Integrale, welche sich sowohl aus Nichtlinearitäten als auch aus der Annahme eines variablen Austauschkoeffizienten<br />
ergeben, wurden <strong>für</strong> spezielle Fälle Tests durchgeführt.<br />
Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Computerprogramm ist in der Lage, realistische zweidimensionale<br />
Überströmungssimulationen von Einzelgebäuden und Straßenschluchten durchzuführen. Dazu wurde<br />
ein logarithmisches Windprofil und ein linear mit der Höhe anwachsender turbulenter Austauschkoeffizi-<br />
23
ent verwendet und die Ergebnisse der Kastenüberströmungen mit Vorhersagen von MISKAM überprüft.<br />
Zusätzlich wurden Überströmungen von Häusern mit beliebiger Dachneigung simuliert und die prinzipiellen<br />
Unterschiede zur Kastenüberströmung herausgearbeitet.<br />
Unter Verwendung <strong>des</strong> gekoppelten Systems aus Wärme- und Bewegungsgleichung wurden erste Rechnungen<br />
zur Simulation von Bergüberströmungen durchgeführt. Die Ergebnisse, welche qualitativ mit KLIMM-<br />
Resultaten übereinstimmen, wurden mit einem linearem Einströmprofil sowie konstanten Austauschkoeffizienten<br />
erhalten.<br />
Weiter verbesserte Ergebnisse lassen sich unter Verwendung einer wesentlich feineren Gitterauflösung, sowie<br />
eines bedeutend höheren Modellgebietes bei Bergüberströmungen, erreichen. Allerdings standen die dazu<br />
benötigten Rechnerkapazitäten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zur Verfügung.<br />
6.3.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Bott, A., U. Sievers und W. Zdunkowski (1990): A radiation fog model with a detailed treatment of the<br />
interaction between radiative transfer and fog microphysics. J. Atmos. Sci., 47, No. 18, 2153-2166<br />
Eichhorn, J., K. Cui, M. Flender, T. Kandlbinder, W.-G. Panhans, R. Ries, J. Siebert, T. Trautmann, N.<br />
Wedi and W. G. Zdunkowski (1997): A Three–Dimensional Viscous Topography Mesoscale Model. Beitr<br />
Phys. Atmosph., 70, 301-318.<br />
Siebert, J., U. Sievers und W. Zdunkowski (1992): A One-Dimensional Simulation of the Interaction<br />
between Land Surface Processes and the Atmosphere. Boundary LAyer Meteor., 59, 1-34<br />
Siebert. J., A. Bott und W. Zdunkowski (1992): Influence of a Vegetation-Soil Model on the Simulation<br />
of Radiation Fog. Beitr. Phys. Atmosph., Vol. 65, No. 2, 93-106<br />
Zdunkowski, W. und J. Eichhorn (1992): Die Simulation <strong>des</strong> urbanen Klimas mit Mainzer Rechenmodellen.<br />
Forschungsmagazin der Universität Mainz, 1/92, 44-49<br />
Zdunkowski, W. (1992): Das Mainzer urbane Klimamodell. Akademie der WIssenschaften. Symposium<br />
Ökosystemanalyse und Umweltforschung in Rheinland-Pfalz<br />
6.4 Spurenanalytik in Umweltproben<br />
Univ.-Prof. Dr. G. Huber, Univ.-Prof. Dr. H.-J. Kluge, Univ.-Prof. Dr. E. Otten, Univ.-Prof. Dr. E. Rühl<br />
(Institut <strong>für</strong> Physik);<br />
Univ.-Prof. Dr. G. Herrmann, Dr. N. Trautmann (Institut <strong>für</strong> Kernchemie)<br />
6.4.1 Resonanzionisationsmassenspektroskopie an Technetium und Plutonium mit einer Laserionenquelle<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Frank Albus<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H.-J. Kluge<br />
Die empfindliche Spurenanalyse radiotoxischer Nuklide gewinnt nicht zuletzt seit dem Reaktorunfall von<br />
Tschernobyl 1986 immer mehr an Bedeutung. Auch die nach dem 2. Weltkrieg durchgeführten oberirdischen<br />
Kernwaffentests haben zu einer Belastung der Umwelt durch künstliche Radionuklide, u.a. Technetium und<br />
Plutonium, geführt. Daneben bietet eine empfindliche und selektive Isotopenanalyse <strong>des</strong> Technetiums<br />
in einer Molybdänerzprobe die Möglichkeit der Messung <strong>des</strong> integralen solaren 8 B-Neutrinoflusses. Die<br />
beiden Isotope 97 Tc und 98 Tc werden hierbei aus den isobaren Molybdänisotopen durch inversen β-Zerfall<br />
gebildet. Nach der chemischen Abtrennung <strong>des</strong> Technetiums aus 10000 t Molybdänerz erwartet man nach<br />
24
dem Standardsonnenmodell etwa 10 8 Atome der beiden Isotope 97,98 Tc und etwa 10 11 -10 12 Atome <strong>des</strong><br />
Isotops 99 Tc. Daneben verbleibt ein Restgehalt an isobarem Molybdäan von mehr als 10 12 Atomen. Zur<br />
Analyse ist <strong>des</strong>wegen eine Methode sowohl hoher Empfindlichkeit als auch hoher Selektivität erforderlich.<br />
Eine äußerst effiziente und selektive Methode stellt die Resonanzionisationsmassenspektroskopie dar. Hierbei<br />
werden die Atome der Probe zunächst bei einer geeigneten Temperatur verdampft, nachfolgend in<br />
mehreren Schritten durch resonant eingestrahltes Laserlicht ionisiert und die erzeugten Photoionen massenselektiv<br />
nachgewiesen. Die hohe Empfindlichkeit ist durch die hohen optischen Wirkungsquerschnitte<br />
bedingt. Die zur Sättigung der resonanten Anregungsschritte erforderlichen Photonenflüsse lassen sich<br />
durch Farbstofflaser, die von Kupferdampflasern hoher Repetitionsrate (νrep = 6.5 kHz) gepumpt werden,<br />
erreichen. Die optische Selektivität beträgt etwa 10 5 pro resonantem Anregungsschritt. Neben der Atomstrahltechnik,<br />
bei der die Probe von einem geheizten Filament verdampft wird und der erzeugte thermische<br />
Atomstrahl senkrecht von den (gepulsten) Laserstrahlen durchsetzt wird, läßt sich dieses Konzept durch<br />
Verwendung einer Laserionenquelle (LIQ) erweitern. Hierbei wird die Probe in einer heißen Kammer verdampft.<br />
Die Laserstrahlen zur resonanten Ionisation werden durch eine kleine Öffnung eingespiegelt. Da die<br />
Atome erst nach im Mittel etwa 40 Wandstößen aus der Kammer diffundieren, haben sie die Möglichkeit,<br />
mehrmals mit dem Laserlicht wechselzuwirken, was zu einer gesteigerten Empfindlichkeit im Vergleich zur<br />
Atomstrahlmethode führt. Prinzipiell läßt sich eine Effizienz von nahezu 100 % erreichen.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine LIQ, bestehend aus einer Kammer aus höchstreinem, pyrolytisch<br />
beschichtetem Graphit, aufgebaut. Im Experiment am Technetium konnte hiermit eine Quelleneffizienz<br />
von nur εLIQ = 0.4 % erreicht werden, da die optischen Übergänge mit den zur Verfügung stehenden<br />
Laserleistungen nicht gesättigt werden konnten. Aus der erreichten Gesamteffizienz von εT OT = 2 · 10 −5 ,<br />
die durch Transmissionsverluste in der Apparatur limitiert war, konnte eine Nachweisgrenze von 5 · 10 6<br />
Atomen 99 Tc bei einer eingesetzten Menge von 3.2 · 10 −8 Atomen 99 Tc extrapoliert werden. Dieser Wert<br />
ist um mehr als 3 Größenordnungen besser als der der konventionellen radiometrischen Methode, der β-<br />
Spektroskopie. Die maximal erreichte Selektivität gegenüber oberflächenionisiertem Molybdän wurde zu S<br />
= 4 · 10 4 (T = 1860 K) bestimmt. Bei den zur Verdampfung <strong>des</strong> Technetiums erforderlichen Temperaturen<br />
reduzierte sich die Selektivität auf S = 3 · 10 3 (T = 2150 K). Die Meßzeiten pro Probe lagen bei weniger<br />
als einer Stunde.<br />
Beim Plutonium wurde eine Quelleneffizienz von weniger als 0.1 % erreicht. Als limitierend erwies sich das<br />
niedrige Ionisationspotential <strong>des</strong> Plutoniums von W P u<br />
I = 6.0 eV, was dazu führte, daß die Plutoniumatome<br />
sehr effizient an der Graphitoberfläche oberflächenionisiert wurden.<br />
6.4.2 Hochempfindlicher Technetiumnachweis mittels Resonanzionisations - Massenspektrometrie<br />
in Verbindung mit einer Laserionenquelle<br />
Bearbeiter: Dr. Friedhelm Ames<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H.-J. Kluge<br />
Die Resonanzionisations-Massenspektrometrie stellt ein empfindliches und selektives Verfahren zum Nachweis<br />
geringster Mengen eines Elements dar. Zur weiteren Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit wurde<br />
der Einsatz einer Hochtemperatur-Laserionenquelle untersucht. Bei der Laserionenquelle wird die zu untersuchende<br />
Probe in einer heißen Kammer verdampft und die Probenatome werden mittels Laserlicht, welches<br />
in eine kleine Öffnung in der Kammer eingespiegelt wird, resonant angeregt und schließlich ionisiert. Die so<br />
erzeugten Photoionen können dann nach Extraktion in einem Massenspektrometer nachgewiesen werden.<br />
Eine solche Anordnung wurde zur spurenanalytischen Bestimmung von Technetium, welches zunehmend in<br />
der Umweltanalytik an Bedeutung gewinnt, eingesetzt. Die mit der Laserionenquelle erzielte Ionisationseffizienz<br />
<strong>für</strong> Technetium liegt bei einer Kammertemperatur von 2500 K bei 14 %.<br />
Zunächst wurde eine Wolframkammer benutzt, die den Nachteil hat, daß Störungen durch Molybdän<br />
25
auftreten, welches als Verunreinigung in Wolfram vorliegt und nach Diffusion an der heißen Oberfläche<br />
ionisiert wird. Weiterhin erschweren die gemessenen langen Wandhaftungszeiten von Technetium an Wolframoberflächen<br />
eine sehr empfindliche Bestimmung. Deshalb wurde damit begonnen, eine Graphitkammer<br />
aufzubauen, um einmal den Molybdänhintergrund zu reduzieren und zum anderen die Wnadhaftungszeiten<br />
zu verkürzen. Mit dieser neuen Kammer wurde untersucht, welche Empfindlichkeitssteigerung <strong>für</strong> die<br />
Spurenanalyse <strong>des</strong> Technetiums und anderer radiotoxischer Elemente erzielt werden kann.<br />
6.4.3 Resonante Laserionisations-Massenspektrometrie an Gadolinium zur Isotopenhäufigkeitsanalyse<br />
mit geringsten Mengen<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Klaus Blaum<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. E. Otten<br />
Die selektive Spuren- und Ultraspurenanalyse <strong>des</strong> Erdalkalielements Gadolinium eröffnet eine Vielzahl<br />
von Anwendungen in der Biomedizin, der Kosmochemie und der Umweltanalytik. Diese erfordern hohe<br />
Isotopen- und Isobarenselektivitaten im Bereich von etwa 10 7 sowie Gesamteffizienzen von ε > 10 −6 , die<br />
mit herkömmlichen Massenspektrometrieverfahren nicht oder nur schwer erreicht werden können. Aus<br />
diesem Grund wurde der Einsatz der resonanten Laserionisations-Massenspektrometrie untersucht. Die<br />
Promotionsarbeit beschäftigte sich dabei mit den Schwerpunkten: Weiterentwicklung und Anpassung <strong>des</strong><br />
existierenden Diodenlaser-Quadrupol-nachweissystems auf die Fragestellungen, Spezifizierung <strong>des</strong> Quadrupolmassenspektrometers<br />
im Massenbereich bis 160 amu, experimentelle Realisation und Charakterisierung<br />
eines effizienten dreistufig resonanten Ionisationsschemas <strong>für</strong> Gd sowie Anwendung <strong>des</strong> Verfahrens und<br />
Durchführung von analytischen Studien.<br />
Im theoretischen Teil der Arbeit wurden die Bewegungsgleichungen <strong>für</strong> den idealen hyperbolischen und den<br />
realen Quadrupolmassenfilter mit runder Stabgeometrie abgeleitet. Die Auswirkungen von Feldabweichungen<br />
auf die Form der Massenpeaks wurden diskutiert. Zudem wurden die <strong>für</strong> die spektroskopischen Studien<br />
relevanten Größen Isotopieverschiebung und Hyperfeinstruktur sowie die Linienform autoionisierender Resonanzen<br />
erörtert.<br />
Ein großer Teil der Arbeit beschäftigte sich mit Computersimulationen <strong>des</strong> vollständigen, realen Quadrupol-<br />
Massenspektrometers, bestehend aus Ionenquelle, Quadrupol-Massenfilter und Detektor. Zur Berechnung<br />
der Feldabweichungen und der Ionenflugbahnen wurden zwei unterschiedliche Simulationsprogramme eingesetzt.<br />
Im Mittelpunkt stand die Vorhersage der erreichbaren Nachbarmassenunterdrückung und die<br />
Bestimmung der absoluten Transmission in Abhängigkeit von der Auflösung.<br />
Der experimentelle Teil umfasste die apparative Weiterentwicklung insbesondere der Atomstrahlquelle und<br />
<strong>des</strong> Lasersystems, die experimentelle Charakterisierung <strong>des</strong> Quadrupol-Massenspektrometers hinsichtlich<br />
der genannten Größen sowie die laserspektroskopischen Studien zum Auffinden eines effizienten dreifach<br />
resonanten Anregungsschemas. Bei letzterem wurden die Isotopieverschiebungen und Hyperfeinstrukturen<br />
aller stabilen Gadoliniumisotope in zahlreichen Übergängen <strong>für</strong> die einfach, zweifach und dreifach resonante<br />
Ionisation präzise vermessen. Das aufgenommene Spektrum autoionisierender Resonanzen im Bereich<br />
von 7.5 THz zeigte etwa 150 bislang nicht bekannte Zustände mit Resonanzüberhöhungen von bis zu<br />
fünf Größenordnungen im Ionisationswirkungsquerschnitt. Durch Hyperfeinzustandsselektion wurde eine<br />
Methode entwickelt, die die Bestimmung der Drehimpulsquantenzahl J der autoionisierenden Resonanzen<br />
ermöglichte.<br />
Die analytische Charakterisierung der dreistufig resonanten Ionisation [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 9 D6 → 6s 6p 9 F7<br />
→ 6s 8s 9 D6 → AI (49663.576 cm −1 ) von Gadolinium ergab eine Isotopen- und Isobarenselektivitat von<br />
SIsotop > 10 12 und SIsobar ≈ 1 · 10 7 . Die mit dem Diodenlasersystem erreichte Nachweiseffizienz von<br />
ε = 3 · 10 −6 mit einer untergrundlimitierten Nachweisgrenze von wenigen 10 9 Atomen 158 Gd erlaubte erste<br />
Demonstrationsmessungen an medizinischen Gewebeproben.<br />
26
6.4.4 Empfindlicher Nachweis toxischer Elemente mittels einer Laserionenquelle<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Hans-Ulrich Hasse<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. G. Huber<br />
Die Spurenanalyse von Schwermetallen in Umweltproben ist von vielfältigem Interesse und wird in vielen<br />
Fällen routinemäßig durchgeführt. Mit Methoden großer Nachweisempfindlichkeit kann man durch die Bestimmung<br />
von Bleigehalten in Bohrkernen aus antarktischem und alpinem Eis Aufschluß über zurückliegende<br />
Klimaveränderungen erhalten. Durch den isotopenselektiven Nachweis wird dabei eine Altersbestimmung<br />
über das Isotop 210 Pb möglich. Eine Bestimmung <strong>des</strong> Gehalts von 210 Pb in menschlichem Gewebe erlaubt<br />
außerdem Rückschlüsse auf eventuelle Radonbelastungen.<br />
Zur Vermessung solcher Proben wird eine isotopenselektive Nachweismethode mit einer Nachweisgrenze<br />
von weniger als 10 7 Atomen Blei benötigt. Die Resonanzionisations-Massenspektroskopie (RIMS) in Verbindung<br />
mit einer Laserionenquelle (LIQ) ist eine solche Methode, die durch Wahl der Laserfrequenzen<br />
und geeignete atomare Präparationen <strong>für</strong> viele Elemente zur Anwendung gebracht wird. Hierbei wird die<br />
Probe in einer heißen Kammer mit einem Loch zur Einspiegelung der Laserstrahlen atomar verdampft. Die<br />
Ionisation erfolgt durch eine dreistufige resonante Laseranregung. Die erzeugten Ionen werden mit einem<br />
elektrischen Feld aus der Kammer extrahiert und in einem doppelt fokussierenden Massenspektrometer massenselektiv<br />
nachgewiesen. Die Empfindlichkeit dieser Methode wurde in unserer Arbeitsgruppe am Beispiel<br />
<strong>des</strong> Radionuklids 99 Tc (Technetium) mit einer Nachweisgrenze (3σ) von 2·10 5 Atomen gezeigt. Erste Tests<br />
am schweren Radionuklid 239 Pu (Plutonium) ergaben eine Nachweisgrenze von 2·10 6 Atomen. Die von der<br />
Theorie vorhergesagten Photoionisationseffizienzen von einigen Prozent konnten bestätigt werden. An Blei<br />
wurden verschiedene Anregungsleitern <strong>für</strong> die Laseranregung getestet. Für die Photoionisation besonders<br />
geeignet ist die Anregung vom 6p 2 -Grundzustand in den 6p7s(1/2, 1/2)1-Zustand (Anregungswellenlänge<br />
λ = 283.3 nm) und von dort in den 6p8p(1/2, 3/2)2-Zustand mit λ = 600.2 nm. Da im Spektrum <strong>des</strong><br />
Bleis keine geeigneten autoionisierenden Zustände zugänglich sind, ist durch den 3. Anregungsschritt mit<br />
dem vorhandenen Lasersystem keine Ionisation mit optimaler Effizienz möglich. Daher ist im Vergleich<br />
zum Technetium eine etwas geringere Nachweiseffizienz zu erwarten. Die Messungen an Radionukliden<br />
haben gezeigt, daß radioaktive Tracer zur Absoluteichung der Nachweiseffizienz wünschenswert sind. Bei<br />
Technetium soll 95 Tc, das durch eine (α,2n)-Reaktion aus Niob hergestellt werden kann, als Tracer getestet<br />
werden. Im Falle von Blei werden entsprechende Möglichkeiten diskutiert.<br />
6.4.5 Messung von 90 Sr in Umweltproben<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Jörg Lantzsch<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. E. Otten<br />
Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 wurde deutlich, daß die üblichen radiochemischen Nachweisverfahren<br />
zum Nachweis von Kontaminationen in der Umwelt <strong>für</strong> einige Radionuklide unzureichend sind.<br />
Insbesondere der Nachweis der beiden reinen β-Strahler 89 Sr und 90 Sr erwies sich als viel zu zeitaufwendig.<br />
Es entstand daraufhin von Seiten der überwachenden Behörden der Wunsch nach einer neuen, schnellen<br />
und empfindlichen Methode zum Spurennachweis der Radionuklide 89,90 Sr. Im Vordergrund stand dabei<br />
der Nachweis von Kontaminationen in der Luft bzw. in atmosphärischen Aerosolen, da die Luft als primäres<br />
Transportmedium eine schnelle und weiträumige Verbreitung von Kontaminatoren ermöglicht.<br />
Seit 1989 wurde am Institut <strong>für</strong> Physik der Universität Mainz in Zusammenarbeit mit dem Institut <strong>für</strong><br />
Kernchemie eine Methode entwickelt, die einen empfindlichen Spurennachweis der beiden Isotope 89,90 Sr<br />
innerhalb eines Tages ermöglicht. Diese Methode beruht auf einer Kombination von konventioneller Massenspektrometrie,<br />
kollinearer Laseranregung am schnellen Atomstrahl und einem Feldionisationsnachweis.<br />
Dabei werden die nachzuweisenden Isotope nicht durch einen radioaktiven Zerfall identifiziert, sondern unter<br />
27
Ausnutzung ihrer atomphysikalischen Eigenschaften nachgewiesen. Dieser Ansatz hat zwei entscheidende<br />
Vorteile.<br />
• Durch die hohe Elementselektivität einer laserspektroskopischen Methode ist eine Störung der Messung<br />
durch radioaktive Isotope anderer Elemente ausgeschlossen.<br />
• Da der radioaktive Zerfall nicht ausgenutzt wird, ist die Geschwindigkeit einer solchen Methode<br />
unabhängig von der Halbwertszeit <strong>des</strong> zu untersuchenden Isotops. Wenn das Element - wie im Fall<br />
<strong>des</strong> Strontiums - außer den nachzuweisenden radioaktiven Isotopen auch noch stabile Isotope besitzt,<br />
muß allerdings eine sehr hohe Isotopenselektivität erreicht werden.<br />
Primäres Ziel dieser Arbeit war es, die praktische Anwendbarkeit der Methode zu demonstrieren. Dazu<br />
wurden verschiedene Umweltproben auf ihren 90 Sr-Gehalt hin untersucht. Außer der Bestimmung <strong>des</strong> 90 Sr-<br />
Gehalts in Luftfilterproben wurden Messungen an Bodenproben durchgeführt. Durch Weiterentwicklung<br />
der Methode konnte weiterhin eine Verbesserung der Nachweisgrenze erreicht werden.<br />
6.4.6 Selektiver Ultraspurennachweis von 41 Ca mittels schmalbandiger Resonanzionisations-<br />
Massenspektroskopie<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Peter Müller<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. E. Otten<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Projektes wurde eine Apparatur zum Spurennachweis <strong>des</strong> langlebigen Radionukli<strong>des</strong> 41 Ca<br />
aufgebaut und getestet, die <strong>für</strong> Routinemessung geeignet ist. Diese Apparatur setzt sich im wesentlichen<br />
aus einem Lasersystem, einem Quadrupolmassenspektrometer und einer Atomstrahlquelle in einer<br />
Vakuumkammer, sowie einer entsprechenden Ansteuerungselektronik zur Kontrolle aller Betriebsparameter<br />
zusammen.<br />
Für die Anwendung <strong>des</strong> Ultraspurennachweises von 41 Ca ergeben sich momentan vier Anwendungsbereiche:<br />
• 41 Ca als biomedizinisches Tracerisotop zur Studie der Calciumkinetik im menschlichen Körper<br />
• 41 Ca-Bestimmung im Beton von stillgelegten Kernreaktoren<br />
• Messung der 41 Ca Konzentration in Meteoriten zur Bestimmung ihrer Expositionshistorie sowie parallel<br />
dazu Bestimmung von 41 Ca in künstlich bestrahlten Proben zur Messung der energieabhängigen<br />
Bildungswirkungsquerschnitte<br />
• 41 Ca-Bestimmung in natürlichen Proben und Fossilien, zur Untersuchung der Möglichkeiten zur Radiodatierung<br />
mittels 41 Ca<br />
Je nach Anwendung müssen dabei Isotopenverhältnisse von 41 Ca/ 40 Ca im Bereich von 10 −9 bis zu 10 −16<br />
nachgewiesen werden.<br />
Der apparative Teil der Arbeit umfaßte nach der Lieferung <strong>des</strong> kommerziellen Quadrupolmassenspektrometer<br />
im Frühjahr 1997 den Einbau in eine speziell angepaßte Vakuumkammer, die Spezifikation <strong>des</strong><br />
Massenspektrometers sowie die Konstruktion einer eigenen Atomstrahlquelle. Ein weiterer apparativer<br />
Schwerpunkt lag auf der Entwicklung und dem Aufbau eines Diodenlasersystems zur mehrstufigen resonanten<br />
Anregung sowie der zugehörigen Frequenzstabilisierung. Zur Durchführung von Routinemessungen war<br />
weiterhin die Erstellung eines computergestütztes Meßprogramm erforderlich, das alle Apparaturparameter<br />
ansteuern und automatische Messsequenzen durchführen kann. Im Anschluß konnten erste Testmessungen<br />
zur erreichbaren Gesamteffizienz und Genauigkeit bei Isotopenverhältnismessung <strong>für</strong> Calcium Isotope in<br />
einem einfach bzw. zweifach resonanten Anregungsschema durchgeführt werden.<br />
28
Basierend auf der zweifach resonanten Anregung, wurden erste analytische Messungen von 41 Ca an Betonproben<br />
durchgeführt. Diese stammten aus dem biologischen Schild eines im Rückbau befindlichen Forschungsreaktors<br />
und sollten auf die spezifische 41 Ca Aktivität untersucht werden. Aufgrund der begrenzten<br />
optischen Isotopenselektivität der zweifach resonanten Anregung von etwa 10 4 konnte bei allen Proben<br />
lediglich ein oberer Grenzwert von etwa 150 mBq/g Beton <strong>für</strong> die spezifische 41 Ca Aktivität (bzw. eine<br />
relative 41 Ca-Häufigkeit von ca. 5·10 −10 ) angegeben werden. Dieser Wert liegt jedoch schon deutlich unter<br />
den Nachweisgrenzen, die mit herkömmlichen radiometrischen Verfahren erreicht werden können und reicht<br />
<strong>für</strong> eine korrekte Klassifizierung <strong>des</strong> Betons zur entsprechenden Entsorgung bei weitem aus. Messung an<br />
Betonproben, die künstlich mit 41 Ca versetzt wurden, zeigten eine gute Genauigkeit und Reproduzierbarkeit<br />
der Messergebnisse bei 41 Ca Gehalten im Bereich von ca. 1-2 Bq/g bzw. 5·10 −9 .<br />
Um eine höhere Isotopenselektivität und Gesamteffizienz beim Ultraspurennachweis von 41 Ca zu erreichen<br />
ist eine dreifach resonante Anregung notwendig. Diese führt in hochangeregte Rydbergzustände <strong>des</strong><br />
Calcium Atoms, von denen mit den zur Verfügung stehenden Laserwellenlängen eine ganze Reihe angeregt<br />
werden können. Entsprechend wurden zuerst in vorbereitenden spektroskopischen Messungen die<br />
Isotopieverschiebungs- und Hyperfeinstrukturkonstanten der erreichbaren Zustände bestimmt, ihre Werte<br />
mit theoretischen Berechnungen verglichen und die bezüglich Effizienz und Selektivität am besten geeigneten<br />
Zustände ausgewählt. Die erreichbaren optischen Isotopenselektivitäten liegen dabei über 10 11 und<br />
die Gesamteffizienz erreicht Werte von mehr als 10 −4 <strong>für</strong> 41 Ca.<br />
Inzwischen konnten mit dem dreifach resonanten Anregungsschema die erreichbaren Genauigkeiten im<br />
Isotopenverhältnis anhand von Standardproben bestimmt werden, sowie etliche analytische 41 Ca Messungen<br />
durchgeführt werden. Dabei ergab die erneute Messung der Betonproben ein eindeutiges Ergebnis im<br />
Bereich von 30 bis 60 mBq/g mit einer Nachweisgrenzen von unter 10 mBq/g. Weiterhin konnten eine<br />
Serie von biomedizinischen Urinproben auf ihren Gehalt von 41 Ca untersucht werden und damit die zeitliche<br />
Abnahme <strong>des</strong> 41 Ca-Gehaltes im Urin eines Probanden nach der Gabe einer bestimmten Menge 41 Ca Tracers<br />
über 100 Tage verfolgt werden. Diese Abnahme erlaubt detaillierte Rückschlüsse über die Calcium-Kinetik.<br />
Ebenso konnten erste Messungen von Wirkungsquerschnittsproben durchgeführt werden.<br />
Insgesamt können inzwischen routinemäßig analytische 41 Ca Messungen mit einer Gesamteffizienz von<br />
5·10 −5 und einer Nachweisgrenze von bis zu 2·10 −13 durchgeführt werden. Diese Spezifikationen sind<br />
ausreichend <strong>für</strong> alle angestrebten Anwendungen außer der Radiodatierung, bei der 41 Ca in natürlichen<br />
Häufigkeiten von 10 −14 bis 10 −16 nachgewiesen werden muß, und sind einerseits durch die verfügbare<br />
Laserleistung im dritten Anregungsschritt sowie Untergrundeffekte begrenzt. An beiden Limitationen wird<br />
zur Zeit sowohl durch Entwicklung eines leistungsfähigeren Diodenlasers als auch durch einen Umbau<br />
<strong>des</strong> Massenspektrometers gearbeitet. Diese Arbeiten sind jedoch neben weiteren analytischen Messungen<br />
Thema einer sich anschließenden Dissertation.<br />
6.4.7 Weiterentwicklung <strong>des</strong> 89,89 Sr-Spurennachweises und erste Analyse synthetischer Proben<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Phys. Judith Stenner<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H.-J. Kluge<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der schnelle Spurennachweis <strong>des</strong> Radionuklids 90 Sr mit Hilfe der Resonanzionisationsspektroskopie<br />
in kollinearer Geometrie erprobt. Durch die Analyse synthetischer Proben,<br />
die sowohl das Isotop 90 Sr als auch natürliches Strontium enthielten, wurde die Nachweisgrenze <strong>für</strong> 90 Sr<br />
bestimmt. Dazu wurden die wesentlichen Kenngrößen <strong>des</strong> Verfahrens, wie Effizienz, Untergrundzählrate<br />
und Selektivität, untersucht.<br />
Nach Abschluß <strong>des</strong> experimentellen Aufbaus <strong>des</strong> RISIKO-Experiments wurden einzelne Apparaturkomponenten<br />
getestet und optimiert. So konnte die Zuverlässigkeit der Ionenquelle erheblich gesteigert und der<br />
Ladungsaustauschprozeß quantitativ untersucht werden. Ein Großteil <strong>des</strong> Untergrunds wurde von laseran-<br />
29
geregten Rydbergzuständen verursacht, die durch Stark-Effekt verschoben wurden. Um eine Laseranregung<br />
in elektrischen Feldern zu vermeiden, wurde die Apparatur so umgebaut, daß sich Laser- und Atomstrahl<br />
unter einem Winkel von 178◦ schneiden. Weiterhin wurde erstmals die optische Anregung mit einem<br />
Argonionenlaser durchgeführt. Dies brachte einen deutliche Fortschritt sowohl in der Handhabung und<br />
Zuverlässigkeit <strong>des</strong> Systems, als auch in der Nachweisempfindlichkeit mit sich. Da<strong>für</strong> war der Aufbau<br />
einer elektronischen Frequenzstabilisierung nötig, mit der die Frequenzdrift <strong>des</strong> Gaslasers von etwa 150<br />
MHz/h auf weniger als 5 MHz/h reduziert werden konnte. Gleichzeitig wurde dabei die Amplitude <strong>des</strong><br />
” Frequenzjitters“ von (30)11 MHz auf 12(5) MHz verringert. Mit diesem Festfrequenzlaser können bei Beschleunigungsspannungen<br />
von 29.2 kV und 32 kV die Übergänge 5s4d 3D2 → 5s23f 3F3 und 5s4d 3D3 →<br />
5s23f 3F4 angeregt werden. Es konnte gezeigt werden, daß der Übergang in das 5s23f 3F3-Niveau das<br />
günstigere Signal-Untergrund-Verhältnis aufweist.<br />
Der Nachweis von 10 8 Atomen 90 Sr in bis zu 10 18 Teilchen stabilen Strontiums erfordert eine Selektivität<br />
gegenüber dem Isotop 88 Sr von mehr als 10 10 . Für einen statistischen Fehler von nicht mehl als 10 % müssen<br />
wenigstens 100 Teilchen <strong>des</strong> Radionuklids detektiert werden, was eine Gesamteffizienz von min<strong>des</strong>tens 10 −6<br />
bedeutet. Die im Rahmen dieser Arbeit festgestellte Nachweisgrenze beträgt 5·10 7 Teilchen 90 Sr in 10 17<br />
Teilchen natürlichen Strontiums. In 10 18 Teilchen stabilen Strontiums konnten 10 8 Teilchen 90 Sr detektiert<br />
werden. Die Meßzeit betrug dabei weniger als 2 Stunden. Die erreichte Gesamteffizienz betrug etwa 10 −6<br />
und konnte damit gegenüber dem im RISIKO-Experiment erreichten Wert um mehr als eine Größenordnung<br />
verbessert werden.<br />
Die Selektivität in schräger Geometrie wird durch Untergrundereignisse begrenzt, die von der Lasereinstrahlung<br />
unabhängig sind. Den größten Beitrag von etwa 90 % liefern Rydbergatome, die durch Stöße<br />
mit Restgas und nicht durch Laserlicht in der optischen Anregungsstrecke erzeugt werden. Die restlichen<br />
10 % der Untergrundzählrate werden durch Rydbergatome verursacht, die beim Ladungsaustausch produziert<br />
und nicht im ” Rydbergfilter“ ionisiert wurden. Einen verschwindenden Beitrag verursachen Stöße mit<br />
Restgas in der Feldionisationsregion. Damit beträgt der vom Ionenstrahl abhängige Untergrund 6(2)·10 −9<br />
Ereignisse pro Strahlion hinter dem Massenseparator. Dazu kommt ein zur Meßdauer proportionaler Anteil,<br />
der durch die Dunkelzählrate <strong>des</strong> Detektors von 5 mHz verursacht wird. Mit 1.9(5)·10 11 wurde die<br />
geforderte Selektivität <strong>für</strong> 90 Sr deutlich überschritten. Für 88 Sr wurde sie mit 3.0(1.3)·10 10 erreicht.<br />
Durch die vorliegenden Messungen konnte gezeigt werden, daß große Effizienzverluste im Apparaturteil zur<br />
kollinearen Spektroskopie durch Verformungen der Ionenquelle und eine Dejustage der Extraktionselektrode<br />
verursacht wurden. Große systhematische Fehler bei der Bestimmung der in der Probe vorhandenen Menge<br />
<strong>des</strong> Radionuklids konnten auf Ungenauigkeiten bei der Einstellung <strong>des</strong> Magnetfelds zurückgeführt werden,<br />
die durch Hystereseeffekte bedingt sind.<br />
6.4.8 Bestimmung von 89 Sr und 90 Sr mit Resonanz-Ionisations-Spektroskopie in kollinearer Geometrie<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Klaus Zimmer<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H.-J. Kluge<br />
In Zusammenarbeit <strong>des</strong> Instituts <strong>für</strong> Kernchemie und <strong>des</strong> Instituts <strong>für</strong> Physik wurde eine neue, laserspektroskopische<br />
Methode zur empfindlichen Bestimmung der radiotoxischen Isotope 89,90 Sr entwickelt. Ziel<br />
der vorliegenden Arbeit war die erstmalige Anwendung dieses Verfahrens zur 90 Sr-Bestimmung in Luftfilterproben,<br />
die während und unmittelbar nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 im Norden Münchens<br />
gesammelt wurden. Ein experimenteller Schwerpunkt lag auf der Entwicklung einer Ionenquelle, die eine<br />
effiziente Erzeugung eines Strontiumionenstrahls gewährleistet.<br />
Nach Fertigstellung <strong>des</strong> experimentellen Aufbaus der RISIKO-Apparatur wurde eine zweistufige, widerstandsgeheizte<br />
Ionenquelle entwickelt. Bei einer Probenmenge von 10 17 Atomen Strontium wurden Ionen-<br />
30
quelleneffizienzen von typisch ≈ 5 bis 10 % bei Ionisatortemperaturen im Bereich 2500 K erreicht. Unter<br />
Einsatz dieser Ionenquelle wurde im Mai / Juni 1993 erstmals der 90 Sr-Gehalt in realen Umweltproben<br />
bestimmt. Es wurde ein 90 Sr-Gehalt von 1,5 mBq/m 3 mit einem mittleren statistischen Fehler (3σ) von ±<br />
45,3 % und einem Fehler der Relativmessung von +8,0 % / -17,2 % ermittelt. Die Gesamteffizienz dieser<br />
Messungen betrug maximal 1,7 · 10 −7 .<br />
Zur Steigerung der Ionenquellen- und damit Gesamt-Nachweiseffizienz <strong>des</strong> Verfahrens wurde ein in Dubna<br />
entwickelter Ionenquellentyp mit einem elektronenstoßgeheizten Wolframionisator an die RISIKO-Apparatur<br />
angepaßt und installiert. Bei Ionisatortemperaturen um 3000 K wurden mit Probenmengen von 10 17<br />
Atomen Strontium Ionenquelleneffizienzen von (63 ± 12) % erreicht. Bei einer Extraktionsöffnung <strong>des</strong><br />
Ionisators von 0,2 mm wurde eine Ionenstrahlemittanz von ≤ 1,4 mm mrad erzielt. Aufgrund von Raumladungseffekten<br />
muß zur 89,90 Sr-Bestimmung in Umweltproben der Gesamtionenstrom auf ≈ 700 nA begrenzt<br />
werden, um eine Transmission <strong>des</strong> Strahls durch die gesamte RISIKO-Apparatur von (71 ± 6) % und eine<br />
Massenauflösung <strong>des</strong> Separators von Rp = 1360 ± 180 zu ermöglichen.<br />
Die Gesamteffizienz <strong>des</strong> RISIKO-Verfahrens konnte durch die höhere Ionisationseffizienz und einige apparative<br />
Detailverbesserungen auf ε ≈ 4 ·10 −6 gesteigert werden. Die Nachweisgrenze <strong>für</strong> 90 Sr in synthetischen<br />
Proben wurde dadurch auf ≤ 10 7 Atome 90 Sr in 10 17 Atomen stabilem Strontium bei einer Isotopenselektivität<br />
<strong>des</strong> Nachweisverfahrens von S ≥ 1,3 ·10 10 gesenkt. Unter Einsatz der Dubna-Ionenquelle wurde zum<br />
ersten Mal 89 Sr, <strong>des</strong>sen Nachweis aufgrund der Hyperfeinaufspaltung der Resonanzlinien erschwert ist, in<br />
einer synthetischen Probe bestimmt. In beiden verwendeten optischen Übergängen 5s4d 3 D2,3 → 5snf mit<br />
n = 23 bzw. 32 wurde <strong>für</strong> 89 Sr eine Nachweisgrenze ≤ 10 8 Atome bei einem Gehalt von 10 16 Atomen<br />
stabilem Strontium erreicht.<br />
Der statistische Fehler der 89,90 Sr-Bestimmung in synthetischen Proben liegt unterhalb von 14 % (3σ), der<br />
Fehler der Relativmessung beträgt +12,5 % / -14,1 %, wobei die Unsicherheit der relativen Detektorkalibration<br />
mit ± 10 % dominiert. Die Meßdauer beträgt ≤ 4 Stunden. Die 90 Sr-Bestimmung in einem 2. Satz<br />
von Luftfilterproben (siehe oben) ergab eine mittlere 90 Sr-Aktivität von 1,20 mBq/m 3 bei einem statistischen<br />
Fehler von ± 2,6 % (3σ) und einem Fehler der Relativmessung von +12,1 % / -13,5 %. Dieser Wert<br />
stimmt sehr gut mit dem Referenzwert von (1,180 ± 0,002) mBq/m 3 überein, der von der GSF radiometrisch<br />
in einer wesentlich größeren Teilprobe ermittelt wurde. Zusammen mit der chemischen Abtrennung<br />
kann die 89,90 Sr-Bestimmung in Umweltproben innerhalb eines Arbeitstages erfolgen. Die ursprünglichen<br />
Anforderungen an das Nachweisverfahren können somit als erfüllt angesehen und die RISIKO-Methode zur<br />
89,90 Sr-Bestimmung in Umweltproben angewandt werden.<br />
6.4.9 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Blaum, K., Geppert, C., Müller, P., Nörtershauser, W., Otten, E.W., Schmitt, A., Trautmann, N., Wendt,<br />
K., and Bushaw, B.A.: Properties and performance of a quadrupole mass filter used for resonance ionization<br />
mass spectrometry, Int. J. Mass Spectr. Ion Processes 181, 67 - 87 (1998)<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Geppert, C., Müller, P., Nörtershauser, W., Schmitt, A., Trautmann, N., and<br />
Wendt, K.: Diode-Laser-Based Resonance Ionization Mass Spectrometry of Gadolinium, AIP Conf. Proc.<br />
454, RIS 98, Manchester, 275 -278 (1998)<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Ott, U., Otten, E.W., Schmitt, A., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Diode-laser-based resonance ionization mass spectrometry of gadolinium, EPS Conf.<br />
Proc. 23 D, EGAS 99, Marseille, 150-151 (1999)<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Geppert, Ch., Müller, P., Nörtershauser, and Wendt, K.: Peak shape for a quadrupole<br />
mass spectrometer: comparison of computer simulation and experiment, Int. J. Mass Spectrom.,<br />
in print (Juli 2000)<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Diel, S., Geppert, Ch., Kuschnick, A., Müller, P., Nörtershauser, W., Schmitt,<br />
31
A., and Wendt, K.: Isotope shifts and hyperfine structure in the [Xe] 4f7 5d 6s2 9DJ r○ [Xe] 4f7 5d 6s 6p<br />
9FJ+1 transitions of gadolinium, Eur. Phys. J. D 11, 37-44 (2000)<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Otten, E.W., Trautmann, N., Wendt, K., and<br />
Wiche, B.: Ionen auf Abwegen - Optimierung eines Quadrupol-Massenspektrometers, Nr.: MS 4.4, DPG<br />
FV-Massenspektrometrie, Mainz 1997<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Otten, E.W., Trautmann, N., Wendt, K., and<br />
Wiche, B.: Ionen auf Abwegen - Optimierung eines Quadrupol-Massenspektrometers, Abstract No.: P 1,<br />
30. AGMS-Tagung, Konstanz 1997<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Otten, E.W., Trautmann, N., Wendt, K., and Wiche,<br />
B.: Isotopenselektive Ultraspurenanalyse mittels Diodenlaser-Resonanzionisations-Massenspektrometrie<br />
RIMS, Abstract: Laser/Laseranalytik 6D, InCom-Tagung, Düsseldorf 1997<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Geppert, Ch., Nörtershauser, W., Otten E.W., Schmitt, A., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Einsatz eines Diodenlaser-Quadrupol-Massenspektrometers zur selektiven und<br />
empfindlichen Elementspurenbestimmung, Abstract No.: V 25, 31. AGMS-Tagung, Cottbus 1998<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Geppert, C., Müller, P., Nörtershauser, W., Schmitt, A., Trautmann, N., and<br />
Wendt, K.: Diode laser resonance ionization mass spectrometry RIMS of Gadolinium, Abstract No.: P-2,<br />
9th RIS Symposium, Manchester 1998<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Ott, U., Otten, E.W., Schmitt, A., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Diode laser based resonance ionization mass spectrometry of gadolinium, Abstract<br />
No.: P 60, 14. ICP-MS-Tagung, Mainz 1999<br />
Blaum, K., Diel, S., Geppert, Ch., Müller, P., Nörtershauser, W., Schmitt, A., Trautmann, N., and<br />
Wendt, K.: Den Ionen auf der Spur - Quantitative Beschreibung der Transmissionspeaks im Quadrupol-<br />
Massenspektrometer, Nr.: MS 2.4, DPG FV-Massenspektrometrie, Heidelberg 1999<br />
Blaum, K., Diel, S., Geppert, Ch., Müller, P., Nörtershauser, W., Schmitt, A., Otten, E.W., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Den Ionen auf der Spur - Quantitative Beschreibung der Transmissionspeaks im<br />
Quadrupol-Massenspektrometer, Abstract No.: V 4, 32. DGMS-Tagung, Oldenburg 1999<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Müller, P., Nörtershauser, W., Ott, U., Otten, E.W., Schmitt, A., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Diode-laser-based resonance ionization mass spectrometry of gadolinium, Abstract<br />
No.: P 1-18, 31st EGAS Conference, Marseille 1999<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Diel, S., Geppert, Ch., Kuschnick, A., Müller, P., Nörtershauser, W., Trautmann,<br />
N., and Wendt, K.: Isotopenverhaltnismessungen mit der Resonanzionisations-Massenspektrometrie,<br />
Abstract No.: V 2, 33. DGMS-Tagung, Berlin 2000<br />
Blaum, K., Bushaw, B.A., Diel, S., Geppert, Ch., Kuschnick, A., Müller, P., Nörtershauser, W., Otten,<br />
E.W., Trautmann, N., and Wendt, K.: Isotopieverschiebung und Hyperfeinstruktur im autoionisierenden<br />
Spektrum von Gadolinium, Nr.: A 12.1, DPG FV-Atomphysik, Bonn 2000<br />
Bushaw, B.A., H.-J. Kluge, J. Lantzsch, R. Schwalbach, J. Stenner, H. Stevens, K. Wendt, K. Zimmer<br />
(1993): Hyperfine structure in 5s 4d 3D - 5snf transitions of 87 Sr. Z. Phys. D 28.<br />
Bushaw, B.A., H.-J. Kluge, J. Lantzsch, R. Schwalbach, M. Schwarz, J. Stenner, H. Stevens, K. Wendt, K.<br />
Zimmer (1995): Hyperfine structure of 87,89Sr 5s4d 3D - 5snf transitions in collinear fast beam RIMS. In:<br />
AIP Conference Proceedings 329; Seventh International Symposium on Resonance Ionization Spectroscopy<br />
and its Applications held in Bernkastel, Germany, 3 - 8 July 1994, eds.: H.-J.Kluge, J.E. Parks, K. Wendt;<br />
AIP Press, New York.<br />
Kugler, E., D. Fiander, B. Jonson, H. Haas, A. Przewloka, H.L. Ravn, D.J. Simon, K. Zimmer and the<br />
ISOLDE Collaboration (1992):The new CERN-ISOLDE on-line mass-separator facility at the PS-Booster.<br />
Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B70.<br />
32
Kunze, S., R. Hohmann, H.-J. Kluge, J. Lantzsch, L. Monz, J. Stenner, K. Stratmann, K. Wendt, K.<br />
Zimmer (1993): Lifetime measurements of highly excited Rydberg states of strontium I. Z. Phys. D 27.<br />
Lantzsch, J., B.A. Bushaw, G. Herrmann, H.-J. Kluge, L. Monz, S. Nieß, E.W. Otten, R. Schwalbach,<br />
M. Schwarz, J. Stenner, N. Trautmann, K. Walter, K. Wendt, K. Zimmer (1995): Spurenbestimmung der<br />
Radionuklide Strontium-90 und Strontium-89 in Umweltproben, I: Lasermassenspektrometrie. Angewandte<br />
Chemie 107, Nr.2.<br />
Lantzsch, J., B.A. Bushaw, B.A. Bystrov, G. Herrmann, H.-J. Kluge, S. Nieß, E.W. Otten, G. Passler,<br />
R. Schwalbach, M. Schwarz, J. Stenner, N. Trautmann, K. Wendt, Y.V. Yushkevich, K. Zimmer (1995):<br />
Trace determination of 89 Sr and 90 Sr in environmental samples by collinear Resonance Ionization Mass<br />
Spectroscopy. In: AIP Conference Proceedings 329; Seventh International Symposium on Resonance<br />
Ionization Spectroscopy and its Applications held in Bernkastel, Germany, 3 - 8 July 1994, eds.: H.-J.Kluge,<br />
J.E. Parks, K. Wendt; AIP Press, New York.<br />
Monz, L., R. Hohmann, H.-J. Kluge, S. Kunze, J. Lantzsch, J. Stenner, K. Stratmann, K. Wendt, K.<br />
Zimmer, G. Herrmann, N. Trautmann, K. Walter (1993): Fast, low-level detection of strontium-90 and<br />
strontium-89 in environmental samples by collinear resonance ionization spectroscopy. Spectrochim. Acta,<br />
Vol. 48B, No. 14.<br />
Monz, L., R. Hohmann, H.-J. Kluge, S. Kunze, J. Lantzsch, E.W. Otten, G. Passler, P. Senne, J. Stenner,<br />
K. Stratmann, K. Wendt, K. Zimmer, G. Herrmann, N. Trautmann, K. Walter (1992): Collinear Resonance<br />
Ionization Spectroscopy for the determination of strontium-90 and strontium-89 in environmental samples.<br />
In: Proceedings of the Sixth International Symposium on Resonance Ionization Spectro- scopy and its<br />
Applications held in Santa Fe, New Mexico, USA 24-29 May 1992, eds. C.M. Miller and J.E. Parks, IOP<br />
Conf. Ser. No. 128, Adam Hilger Press, Bristol.<br />
Nörtershauser, W., Blaum, K., and Bushaw, B.A.: Isotope shifts and hyperfine structure in the [Xe] 4f7<br />
5d 6s 6p 9F7 r○ 9D6SES transition of gadolinium, Phys. Rev. A. 62, XXX (2000)<br />
Stratmann, K., R. Hohmann, H.-J. Kluge, S. Kunze, J. Lantzsch, L. Monz, E.W. Otten, G. Passler, J.<br />
Stenner, K. Wendt, K. Zimmer (1994): High-resolution field ionizer for state-selective detection of Rydberg<br />
atoms in fast- beam laser spectroscopy. Rev. Sci. Instrum. Vol. 65, No. 6.<br />
Wendt, K., K. Christian, G. Haub, S. Köhler, H.-J. Kluge, L. Monz, E.W. Otten, G. Passler, P. Senne, J.<br />
Stenner, K. Zimmer, G. Herrmann, N. Trautmann, K. Walter (1990): Quantitative Detection of Strontium-<br />
90 and Strontium-89 in Environmental Samples by Laser Mass Spectrometry. In: Optoelectronics for<br />
Environmental Science, eds.: S. Martellucci and A.N. Chester, Plenum Press, New York.<br />
Wendt, K., K. Christian, G. Haub, S. Köhler, H.-J. Kluge, L. Monz, E.W. Otten, G. Passler, P. Senne,<br />
J. Stenner, K. Zimmer, G. Herrmann, N. Trautmann, K. Walter (1991): Collinear Resonance Ionization<br />
Spectroscopy for the Quantitative Detection of Strontium-90 and Strontium-89 in Environmental Samples.<br />
In: Proceedings of the Fifth International Symposium on Resonance Ionization Spectro- scopy and its<br />
Applications held at the Congress Centre Villa Poni, Varese, Italy 16 - 21 Sept. 1990, eds. J.E. Parks and<br />
N. Omenetto, IOP Conf. Ser. No. 114, Inst. Phys., Bristol.<br />
Wendt, K., G. Herrmann, R. Hohmann, H.-J. Kluge, S. Kunze, J. Lantzsch, L. Monz, E.W. Otten, G.<br />
Passler, J. Stenner, K. Stratmann, N. Trautmann, K. Walter, K. Zimmer (1992): Determination of term<br />
energy, hyperfine structure and life-time of strontium Rydberg levels by Resonance Ionization Spectroscopy<br />
in Collinear Geometry. In: Proceedings of the Sixth International Symposium on Resonance Ionization<br />
Spectro- scopy and its Applications held in Santa Fe, New Mexico, USA 24-29 May 1992, eds. C.M. Miller<br />
and J.E. Parks, IOP Conf. Ser. No. 128, Adam Hilger Press, Bristol.<br />
Wendt, K., Blaum, K., Bushaw, B.A., Grüning, C., Horn, R., Huber, G., Kratz, J.V., Kunz, P., Müller,<br />
P., Nörtershauser, W., Nunnemann, M., Passler, G., Schmitt, A., Trautmann, N., and Waldek, A.: Recent<br />
developments in and applications of resonance ionization mass spectrometry, Fresenius J. Anal. Chem.<br />
33
364, 471-477 (1999)<br />
Yushkevich, Y.V., K. Zimmer, G.J. Beyer, V.A. Bystrov, H.-J. Kluge, A.F. Novgorodov, E.W. Otten,<br />
N. Trautmann, K. Wendt (1994): Hocheffektive Oberflächenionisationsquelle zur Bestimmung von ultra<br />
Mikromengen radioaktiver Strontiumisotope. JINR Dubna, LJAP, Dubna, Rußland (in russischer Sprache)<br />
Zimmer, K., G. Beyer, B.A. Bystrov, H.-J. Kluge, A.F. Novgorodov, E.W. Otten, N. Trautmann, K. Wendt,<br />
Y.V. Yushkevich (1993): Development of an efficient ion source for trace detection of radioactive strontium<br />
isotopes in environmental samples. Proposal to the 8. JINR Scientific Coordination Council on low and<br />
intermediate energies, JINR, Dubna, Russia, April 22 -24.<br />
Zimmer, K., J. Stenner, H.-J. Kluge, J. Lantzsch, L. Monz, E.W. Otten, G. Passler, R. Schwalbach,<br />
M. Schwarz, H. Stevens, K. Wendt, G. Herrmann, S. Nieß, N. Trautmann, K. Walter, B.A. Bushaw<br />
(1994): Determination of 90 Sr in environmental samples with resonance ionization spectroscopy in collinear<br />
geometry. Appl. Phys. B29.<br />
34
7 Projekte am Fachbereich 19 (Chemie)<br />
7.1 Kernchemie<br />
Univ.-Prof. Dr. G. Herrmann, Dr. N. Trautmann und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Kernchemie)<br />
7.1.1 Ultraspurenanalyse von Aktinoiden mittels Laser-Massenspektrometrie<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Carsten Grüning<br />
Hauptbetreuer: Dr. N. Trautmann<br />
Ziel der ersten Phase der Promotion ist der Aufbau, Charakterisierung und Test eines neuartigen, Nd:YAG<br />
gepumpten, aus 3 Titan-Saphir Lasern bestehenden Systems, um zusammen mit einem Flugzeitmassenspektrometer<br />
Aktinoide mittels Resonanzionisations-Massenspektrometrie in Ultraspurenmengen nachzuweisen.<br />
Dieses Einsatzgebiet der Laser stellt spezifische Anforderungen an das System: es muss hochrepetierend<br />
und leistungsstark sein, eine Linienbreite von wenigen Gigahertz haben und seine Wellenlänge über einen<br />
großen Bereich präzise und reproduzierbar einstellbar sein.<br />
Ausgehend von Vorarbeiten in der Arbeitsgruppe sind Halterungen <strong>für</strong> die wellenlängenselektiven Elemente<br />
Etalon und Birefringent-Filter konstruiert worden. Über computergesteuerte Schrittmotoren lassen sich jetzt<br />
die Wellenlängen aller 3 Titan-Saphir Laser durch Verdrehen eines Birefringent-Filters in einem Bereich von<br />
730 - 900 nm exakt einstellen. Wichtig ist insbesondere die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Etalon<br />
Positionierung, die durch umfangreiche Messungen dokumentiert wurde. Der Fehler in der eingestellten<br />
Wellenlänge ist kleiner als die Auflösung <strong>des</strong> zur Wellenlängenmessung eingesetzten Wavemeters. Durch<br />
Verkippen <strong>des</strong> Etalons lässt sich der Laser um 250 GHz verstimmen bei einer Linienbreite von 5 GHz.<br />
Die Synchronisation der drei Titan-Saphir Laser wird durch eine Pockelszelle in jedem Laser realisiert. Sie<br />
arbeiten als schneller Güteschalter <strong>des</strong> Laserresonators. Die dazugehörende schnelle Hochspannungselektronik<br />
wurde aufgebaut. Das Gesamtsystem ist eingehend getestet worden. Mit der Pockelszelle lässt sich<br />
der Titan-Saphir Laserpuls relativ zum Pumppuls um mehrere Mikrosekunden verschieben, ohne dass die<br />
spektralen Eigenschaften <strong>des</strong> Lasers beeinflusst werden.<br />
Bei laufenden Messreihen zum Nachweis von Plutonium mit dem Kupferdampf- / Farbstoff-Lasersystem<br />
habe ich intensiv mitgearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem National Radiation Protection Board in England<br />
wird Plutonium in Urinporben zum Verständnis der Plutoniumausscheidung im menschlichen Körper<br />
nachgewiesen. Für die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt <strong>für</strong> Fischerei in Hamburg sind Meerwasserproben aus dem<br />
Nordatlantik auf ihren Plutoniumgehalt hin untersucht worden. Dabei habe ich mich in die Funktionsweise<br />
und Handhabung <strong>des</strong> Kupferdampf- / Farbstofflasersystems, <strong>des</strong> Flugzeitmassenspektrometers und der<br />
Messelektronik eingearbeitet, um sie auch bei Messungen mit dem Titan-Saphir Lasersystem einsetzen zu<br />
können. Weiterhin arbeite ich an Bestimmungen der Technetiumgehalte in Meerwasserproben <strong>für</strong> die International<br />
Atomic Energy Agency und die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt <strong>für</strong> Fischerei mit. Das Technetium wird<br />
dabei in einer Laserionenquelle resonant ionisiert und in einem doppelfokussierenden Massenspektrometer<br />
nachgewiesen.<br />
Mit dem Titan-Saphir Lasersystem und dem Flugzeitmassenspektrometer habe ich Effizienzmessungen der<br />
gesamten Apparatur durchgeführt. Dabei wurden Proben mit etwa 1 · 10 11 Atomen Plutonium 239 bzw.<br />
240 verwendet. Die abgedampften Atome wurden in einem dreistufigen Anregungs- und Ionisationsprozess<br />
ionisiert und im Massenspektrometer nachgewiesen. Es konnten jeweils 10 6 Ionen Plutonium nachgewiesen<br />
werden bei wenigen Untergrundereignissen. Das ergibt eine Effizienz <strong>des</strong> Gesamtsystems von typischer<br />
Weise 1 · 10 −5 und eine Nachweisgrenze von etwa 1 · 10 6 Atomen Plutonium.<br />
Zur isotopenselektiven Ultraspurenanalyse ist die genaue Kenntnis der Wellenlängen im verwendeten Anregungsschema<br />
<strong>für</strong> alle Isotope notwendig. Dazu sind die Isotopieverschiebungen der Plutoniumisotope 238<br />
35
is 244 bestimmt worden.<br />
Über die Arbeiten mit dem Titan-Saphir Lasersystem wurde auf 4 Konferenzen berichtet. Dies waren<br />
Vorträge auf den Frühjahrstagungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 1998 in Konstanz und 1999<br />
in Heidelberg und dem InCom’99 Symposium in Düsseldorf. Auf dem Symposium ” Resonance Ionisation<br />
Spectroscopy“ 1998 in Manchester wurde ein Poster vorgestellt. Auf der Messe ” Laser 99“ in München<br />
wurde ein Titan-Saphir Laser einem breiten Publikum präsentiert.<br />
7.1.2 Bestimmung der Ionisationsenergien von Curium und Plutonium<br />
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Stefan Köhler<br />
Hauptbetreuer: Dr. N. Trautmann<br />
Die Ionisationsenergie (IP) spielt als fundamentale Größe eines Elements in vielen physikalischen und chemischen<br />
Prozessen eine wichtige Rolle. Ihre präzise Bestimmung dient der Untersuchung systematischer<br />
Trends in den Bindungsenergien und unterstützt die Interpretation atomarer Spektren. Zudem kann die<br />
Ionisationsenergie als Test <strong>für</strong> Multi-Konfigurations-Dirac-Fock-Rechnungen dienen. Die präzisesten Bestimmungen<br />
der Ionisationsenergien wurden mittels Laserspektroskopie durchgeführt. So wurde die Ionisationsenergie<br />
<strong>des</strong> schwersten bisher untersuchten Elements, Plutonium, über die Konvergenzen von<br />
Rydbergserien ermittelt, wobei jedoch bis zu 2 g Plutonium eingesetzt werden mussten. Für die schwereren<br />
Aktiniden existieren nur Vorhersagen der Ionisationsenergien, die aus spektroskopischen Daten abgeleitet<br />
sind.<br />
Aufgrund der hohen Nachweiseffizienz der Resonanzionisations-Massenspektroskopie, die atomspektroskopische<br />
Untersuchungen auch bei sehr geringen Probenmengen (≤ 10 12 Atome) zulässt, ist es möglich, die<br />
Ionisationsenergie der schwereren Aktiniden zu bestimmen, welche nur in geringen Mengen zugänglich und<br />
handhabbar sind.<br />
Hierzu wird dem Coulombpotential <strong>des</strong> Atoms ein externes, statisches elektrisches Feld überlagert, so dass<br />
es nach dem klassischen Sattelpunktmodell zu einer Absenkung <strong>des</strong> Potentials in Richtung <strong>des</strong> elektrischen<br />
Fel<strong>des</strong> kommt. Die energetische Lage <strong>des</strong> entstehenden Sattelpunkts ist linear von der Wurzel der elektrischen<br />
Feldstärke abhängig. Alle Zustände, die nun energetisch über dem Sattelpunkt liegen, werden<br />
feldionisiert. Den Sattelpunkt bezeichnet man daher als Ionisationsschwelle im elektrischen Feld. Experimentell<br />
wird mit Hilfe eines Lasersystems, bestehende aus drei durchstimmbaren Farbstofflasern und zwei<br />
Kupferdampflasern, ein angeregter Zustand <strong>des</strong> Atoms in zwei Stufen durch Laserlicht resonant populiert.<br />
Das in einem vorgegebenen statischen elektrischen Feld befindliche Atom wird dann durch einen weiteren<br />
Laserstrahl ionisiert, <strong>des</strong>sen Frequenz durchgestimmt wird. Die erzeugten Ionen werden in einem Flugzeitspektrometer<br />
massenselektiv nachgewiesen. Die Lage der Ionisationsschwelle wird durch den spontanen<br />
Anstieg <strong>des</strong> Ionensignals bestimmt. Führt man diese Messung bei unterschiedlichen Feldstärken durch, so<br />
kann die Ionisatiosnenergie nach dem Sattelpunktmodell durch Extrapolation der Ionisationsschwelle auf<br />
die Feldstärke Null bestimmt werden.<br />
Auf diese Art und Weise wurde die Ionisationsenergie von 248 Cm über 15 Messpunkte mit insgesamt nur<br />
6 · 10 12 Atomen zu IP( 248 Cm) = 48324(2) cm −1 ≡ 5.9915(2) eV zum ersten Mal bestimmt. Die Ionisationsenergie<br />
von 239 Pu wurde zur Bestätigung der Methode erneut gemessen und zu IP( 239 Pu) = 48601(2)<br />
cm −1 ≡ 6.0258(2) eV erhalten, wobei 1·10 12 Atome (0.4 ng) verwendet wurden. Die Übereinstimmung mit<br />
dem durch Rydbergkonvergenzen ermittelten Literaturwert von IP( 239 Pu) = 48604(1) cm −1 ≡ 6.0262(2)<br />
eV ist hervorragend und bestätigt die hohe Präzision der verwendeten Methode. Die hohe Empfindlichkeit<br />
der Resonanzionisations-Massenspektroskopie wurde im Hinblick auf die Spurenanalyse von Curium<br />
exploriert, wobei eine Nachweisgrenze <strong>für</strong> Curium von 7 · 10 6 Atomen angegeben werden kann.<br />
36
7.1.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
R. Deißenberger, S. Köhler, F. Ames, K. Eberhardt, N. Erdmann, H. Funk, G. Herrmann, H.-J. Kluge, M.<br />
Nunnemann, G. Passler, J. Riegel, F. Scheerer, N. Trautmann, F.-J. Urban Erste Messung der Ionisationsenergie<br />
der Elemente Americium und Curium Angew. Chem. 107, 891 (1995)<br />
R. Deissenberger, S. Köhler, F. Ames, K. Eberhardt, N. Erdmann, H. Funk, G. Herrmann, H.-J. Kluge,<br />
M. Nunnemann, G. Passler, J. Riegel, F. Scheerer, N. Trautmann, F.-J. Urban First Determination of the<br />
Ionization Potential of Americium and Curium Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 34, 814 (1995)<br />
S. Köhler, F. Albus, R. Deißenberger, N. Erdmann, H. Funk, H.-U. Hasse, G. Herrmann, G. Huber, H.-J.<br />
Kluge, M. Nunnemann, G. Passler, P.M. Rao, J. Riegel, N. Trautmann, F.-J. Urban Determination of the<br />
First Ionization Potential of Actini<strong>des</strong> by Resonance Ionization Mass Spectroscopy in: Resonance Ionization<br />
Spectroscopy 1994, AIP Conference Proceedings 329 (H.-J. Kluge, J.E. Parks, K. Wendt eds.) p. 377,<br />
AIP Press, New York 1995<br />
S. Köhler, N. Erdmann, M. Nunnemann, G. Herrmann, G. Huber, J.V. Kratz, G. Passler, N. Trautmann Die<br />
experimentelle Bestimmung der Ionisationsenergien von Berkelium und Californium Angew. Chem. 108,<br />
3036 (1996)<br />
S. Koehler, N. Erdmann, M. Nunnemann, G. Herrmann, G. Huber, J.V. Kratz, G. Passler, N. Trautmann<br />
First Experimental Determination of the Ionization Potentials of Berkelium and Californium Angew. Chem.<br />
Int. Ed. Engl. 35, 2856 (1996)<br />
M. Nunnemann, K. Eberhardt, N. Erdmann, G. Herrmann, G. Huber, S. Köhler, J.V. Kratz, A. Nähler,<br />
G. Passler, N. Trautmann Determination of the First Ionization Potential of Berkelium and Californium<br />
by Resonance Ionization Mass Spectroscopy in: Resonance Ionization Spectroscopy 1996, AIP Conference<br />
Proceedings 388 (N. Winograd, J.E. Parks eds.) p. 267, AIP Press, New York 1997<br />
S. Köhler, R. Deißenberger, K. Eberhardt, N. Erdmann, G. Herrmann, G. Huber, J.V. Kratz, M. Nunnemann,<br />
G. Passler, P.M. Rao, J. Riegel, N. Trautmann, K. Wendt Determination of the First Ionization<br />
Potential of Actinide Elements by Resonance Ionization Mass Spectroscopy Spectrochimica Acta B52, 717<br />
(1997)<br />
N. Erdmann, M. Nunnemann, K. Eberhardt, G. Herrmann, G. Huber, S. Köhler, J.V. Kratz, G. Passler,<br />
J.R. Peterson, N. Trautmann, A. Waldek Determination of the First Ionization Potential of Nine Actinide<br />
Elements by Resonance Ionization Mass Spectroscopy (RIMS) J. Alloys and Compounds 271-273, 837<br />
(1998)<br />
7.2 Physikalische Chemie<br />
Univ.-Prof. Dr. W. Baumann und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> physikalische Chemie)<br />
7.2.1 Speziesanalytik quecksilberorganischer Verbindungen und deren Anwendung auf biotische<br />
und abiotische Matrizes<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. R. Fischer<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Baumann, Prof. Dr. M. Andreae<br />
In dieser Arbeit wurden der Gehalt und das Mobilitäts- sowie Akkumulationsverhalten von quecksilberorganischen<br />
Verbindungen in ausgewählten terrestrischen Umweltkompartimenten <strong>des</strong> ehemalige Quecksilber-<br />
Bergbaugebietes ” Stahlberg“ untersucht.<br />
Als speziesselektive Analysenmethode <strong>für</strong> die Identifizierung und Quantifizierung von Organo-Quecksilber-<br />
Spezies wurde ein ” Purge and Trap“-Quarzofen-Atomabsorptionsspektrometer-System entwickelt. Dieses<br />
37
Verfahren beruht auf dem Prinzip der in-situ Derivatisierung (Ethylierung) der Quecksilber-Spezies mit<br />
Natriumaethylborat. Die absolute Erfassungsgrenze <strong>für</strong> Methylquecksilber beträgt 4 pg. Die relative Nachweisgrenze<br />
liegt unter 1 ng Hg/(g Trockenmasse) <strong>für</strong> verschiedene Matrizes. Diese Methode stellt ein<br />
kostengünstiges, einfaches, schnelles und vor allem nachweisstarkes Analyseverfahren dar, das mit sehr<br />
guter Reproduzierbarkeit und Richtigkeit in diesem Spurenelementbereich arbeitet.<br />
Die Methylquecksilber-Gehalte von Humusmaterial liegen in einem Konzentrationsbereich zwischen<br />
0.008 und 0.9 µg Hg/(g Trockenmasse). Das Methylquecksilber ist vermutlich auf Mikroorganismen<br />
zurückzuführen, die anorganisches Quecksilber methylieren können (Biotransformation). Der<br />
Methylquecksilber-Anteil an der Gesamtquecksilber-Konzentration im Humusmaterial beträgt nur 0.02 -<br />
0.12 %.<br />
Die Methylquecksilber-Gehalte der Großpilze variierten zwischen 0.08 und 8.0 µg Hg/(g Trockenmasse).<br />
Der Anteil von Methylquecksilber am Gesamtquecksilber-Gehalt beträgt 1 - 19 %. Die Methylquecksilberund<br />
Gesamtquecksilber-Gehalte aus dem Gebiet ” Stahlberg“ können um mehr als drei Größenordnungen<br />
über den Gehalten von Pilzen aus unbelasteten Gebieten liegen.<br />
Methylquecksilber wird in den Fruchtkörpern von Großpilzen akkumuliert. Im Gegensatz dazu wurde keine<br />
Akkumulation von Gesamtquecksilber gegenüber der Bodenkonzentration festgestellt. Methylquecksilber<br />
wird jedoch nicht nur akkumuliert, sondern kann auch durch Pilze aus anorganischem Quecksilber gebildet<br />
werden. Durch ein mit zwei saprophytischen Pilzen durchgeführtes Laborexperiment konnte erstmals gezeigt<br />
werden, daß auch Großpilze anorganisches Quecksilber zu Methylquecksilber transformieren können. Es<br />
konnte eine lineare Abhängigkeit <strong>des</strong> produzierten Methylquecksilber gegenüber der Ausgangskonzentration<br />
an HgCl2 im Nährmedium nachgewiesen werden.<br />
Die Quecksilberaufnahme von höheren Pflanzen wurde anhand von Feldsalat untersucht. Die Methylquecksilber-Konzentration<br />
in Feldsalatblättern waren um mehr als drei Größenordnungen niedriger als die<br />
Gesamtquecksilber-Gehalte. Es wurde eine Aufnahme von Methylquecksilber (30 - 40 %) und Gesamtquecksilber<br />
(23 %) aus dem Wachstumssubstrat gemessen. Weder Methylquecksilber noch Gesamtquecksilber<br />
wurden jedoch in Feldsalatblättern akkumuliert.<br />
7.2.2 Entwicklung einer neuartigen, direkt potentiometrischen Immunoelektrode gegen Atrazin,<br />
die auf einem kompetitiven Format beruht<br />
Bearbeiterin: Dr. Heike Holthues<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Baumann<br />
Frau Holthues hat durch sehr sauberes und gründliches Arbeiten und wissenschaftliches Geschick wichtige<br />
Beiträge in unserer Gruppe zur Entwicklung von direkt potentiometrischen Immunoelektroden zur organischen<br />
Spurenanalytik gelegt. Solche Elektroden nutzen die Potentialänderung analytisch aus, die man<br />
beobachtet, wenn ein Antigen bzw. der nachzuweisende Analyt am auf der Elektrode immobiliserten Antikörper<br />
andockt. Durch ihre Arbeiten induziert werden wir in Zukunft eher einerseits inverse kompetitive<br />
Systeme untersuchen, in denen der Analyt selbst auf der Elektrode immobilisiert ist und der in Lösung<br />
nachzuweisende Analyt mit dem immobilisierten um die reaktiven Plätze der der Lösung zuzusetzenden<br />
Antikörper konkurriert. Andererseits werden wir verstärkt die indirekt potentimetrischen Methoden untersuchen,<br />
die beispielsweise pH-Elektroden als finalen Detektoren <strong>für</strong> die Reaktion Antikörper/Antigen(Analyt<br />
einsetzen.<br />
Frau Holthues´ lange Promotionszeit ist begründet dadurch, daß sie fast während der ganzen Dauer der<br />
Promotion eine volle Stelle zur Betreuung <strong>des</strong> arbeitsintensiven Medizinerpraktikums in Chemie hatte.<br />
38
7.2.3 Auswirkungen der organischen Fremdstoffbelastung eines eutrophen Sees in der Region<br />
dos Lagos/Brasilien auf die Kontamination <strong>des</strong> Grund- und Trinkwassers<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. Marcus Stumpf<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Baumann<br />
Herr Stumpf lieferte mit mehreren Aufenthalten am Departamento de Química Analítica der Universidade<br />
Federal Fluminense die Basis <strong>für</strong> eine weitere fruchtbare Kooperation der Gruppe Baumann mit diesem<br />
Departamento. So baute Herr Stumpf dort wesentliche Einrichtungen zur organischen Spurenanalytik auf,<br />
die heute noch gerne benutzt werden.<br />
Herr Stumpf war an einer Reihe von Publikationen beteiligt, die teilweise auch deutlich über das Promotionsthema<br />
hinausgingen.<br />
7.2.4 Qualifizierung und Quantifizierung von Fremdstoffen in Wasser und Fischen aus unterschiedlich<br />
belasteten Gewässern mittels Gaschromatographie / Massenspektroskopie<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. Thomas Ternes<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. W. Baumann<br />
Zur Bearbeitung <strong>des</strong> Themas wurde ein Analytiklabor aufgebaut. Danach konnten Methoden etabliert bzw.<br />
entwickelt werden, die einen Nachweis von polaren bis lipophilen Substanzen im Wasser und in den Fischen<br />
im Bereich von ng/kg ermöglichen.<br />
Für die Wasseranalytik stehen nunmehr <strong>für</strong> Triazine, Carbonsäureamide, Phenylharnstoffe, Aniline, Phenole,<br />
Phenoxycarbonsäuren, Cyclodien-Insektizide, HCH-Isomere, chlorierte Benzole, DDT und verwandte<br />
Verbindungen, polychlorierte Biphenyle und UV-Filtersubstanzen die Methoden <strong>für</strong> die GC/MS-Analytik<br />
zur Verfügung. Die zur Analyse der Fische entwickelten Methoden ermöglichen die simultane Erfassung<br />
der mittelpolaren Triazine und Carbonsäureamide mit den lipophilen Fremdstoffen in einer Aufbereitung,<br />
sowie die Bestimmung der Phenoxycarbonsäuren in einem weiteren Probenäquivalent. Gemündener Maar,<br />
Weinfelder Maar, Meerfelder Maar (Eifel), Neuhofener Altrhein und Hegbachsee (Oberrheinebene) wurden<br />
bezüglich der Belastung mit organischen Fremdstoffen im Sommer 1991 charakterisiert. Es wurden hierzu<br />
sowohl das Wasser als auch die Belastung von Fischen untersucht. Von jedem See wurden zwei Wasserproben<br />
gezogen, eine Mischprobe <strong>des</strong> Epilimnions an der tiefsten Stelle <strong>des</strong> Sees und eine ufernahe Probe.<br />
Die Untersuchung der Wasserproben, die zwischen dem 28.6.91 und dem 8.7.91 entnommen wurden,<br />
umfaßt die folgenden Fremdstoffe: Triazine (Atrazin,..), Phenole (DNOC,..), Phenoxycarbonsäuren (2,4-<br />
D,..), Aniline (3,4-DCA,..), substituierte Phenylharnstoffe (Diuron,..), chlorierte Benzole (Quintocen,..),<br />
Carbonsäureamide (Metolachlor,..), Cyclodien-Insektizide (Isodrin,..), polychlorierte Biphenyle (PCB’s),<br />
HCH-Isomere sowie DDT mit verwandten Verbindungen. In den fünf Seen konnten insgesamt dreizehn<br />
Substanzen nachgewiesen werden. Die Konzentrationen der einzelnen Substanzen bewegen sich zwischen<br />
1 und 157 ng/L.<br />
Der Hegbachsee ist in bezug auf die untersuchten Substanzen eindeutig der am stärksten belastete See.<br />
Im Epilimnion im Bereich der tiefsten Stelle <strong>des</strong> Sees sind in der Summe rund 520 ng/L an Herbiziden<br />
nachweisbar. Der Neuhofener Altrhein liegt mit 57 ng/L um den Faktor 10 darunter. Die drei Maare<br />
weisen mit 18 ng/L (Weinfelder Maar/Tiefste Stelle), 28 ng/L (Gemündener Maar/Schwimmstelle) und<br />
33 ng/L (Meerfelder Maar/Tiefste Stelle) die niedrigsten Werte auf. Da die Maare keine oberirdischen<br />
Zuläufe besitzen und zudem der Einsatz von Pestiziden in unmittelbarer Nähe verboten ist, ist ein Eintrag<br />
der Substanzen aus der Atmosphäre anzunehmen.<br />
In den Fischen der jeweiligen Seen können eine Vielzahl von lipophilen Substanzen bestimmt werden, die<br />
im Wasser nicht nachweisbar sind. In den Rotaugen (Rutilus rutilus) <strong>des</strong> Hegbachsees zum Beispiel befinden<br />
sich 312 ng Lindan pro Kilogramm Fischfilet, im Wasser dagegen liegt die Lindankonzentration<br />
39
unter der Nachweisgrenze von 1 ng/L. Der Fisch dient demnach <strong>für</strong> diese Substanz aufgrund eines großen<br />
Anreicherungsfaktors als Biomonitor. Von der Gruppe der Triazine und Carbonsäureamide können in den<br />
Rotaugen <strong>des</strong> Hegbachsees Atrazin und Metolachlor nachgewiesen werden. Atrazin weist im Fischfilet eine<br />
Konzentration von 346 ng/kg Filet auf, so daß gegenüber 57 ng/L im Wasser ein Anreicherungsfaktor<br />
von 6 resultiert. Die Phenoxycarbonsäuren Mecoprop, Dichlorprop, MCPA und 2,4-D sind ebenfalls nachweisbar.<br />
Ihre Konzentrationen bewegen sich zwischen 119 und 498 ng/kg Filet. (Die Methode erfaßt die<br />
Phenoxycarbonsäuren plus deren Metabolite). Die Anreicherungsfaktoren liegen zwischen 1,3 und 20,5.<br />
7.2.5 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Holthues, H., U. Pfeifer-Fukumura and W. Baumann (2000): Design and Synthesis of New Heterologous<br />
Atrazine Haptens and Their Differential Recognition in Enzyme-Immunoaasays. Eingereicht zu Anal. Chim.<br />
Acta<br />
Holthues, H., U. Pfeifer-Fukumura, I. Hartmann, W. Baumann (2000): Immunoassays and the heterology<br />
principle. In Vorbereitung.<br />
Pfeifer-Fukumura, U., I. Hartmann, H. Holthues and W. Baumann (1999): New Developments in Immunochemical<br />
Water Analysis Down to 30µl Sample Volume. Talanta, 48, 803 - 819<br />
Stumpf, M., T. Ternes, K. Haberer, P. Seel and W. Baumann (1996): Nachweis von Arzneimittelrückständen<br />
in Kläranlagen und Fließgewässern. Vom Wasser 86, 291-303<br />
Stumpf, M., T.A. Ternes, K. Haberer and W. Baumann (1996): Verbreitung von Pharmaka in deutschen<br />
Fließgewässern. 20. Achener Werkstattgespräch, Essen 1996, 2 - 8<br />
Stumpf, M., T. Ternes, K. Haberer and W. Baumann (1996): achweis von natürlichen und synthetischen<br />
Östrogenen in Kläranalagen und Fließgewässern. Vom Wasser 87, 251-261<br />
Stumpf, M., K. Haberer, S. V. Rodrigues and W. Baumann (1997): Organic Residues in the Lagoa de<br />
Juturnaíba (Região dos lagos, RJ, Brazil) and in drinking water. J. Brazil. Chem. Soc. 8, 509-514<br />
Stumpf, M., T.A. Ternes, K. Haberer, und Wolfram Baumann (1998): Isolierung von Ibuprofen-Metaboliten<br />
und deren Bedeutung als Kontaminanten der aquatischen Umwelt. Vom Wasser, 91, 291-303<br />
Stumpf, M., T.A. Ternes, R.-D. Wilken, S.V. Rodrigues, W. Baumann (1999): Polar drug residues in<br />
sewage and natural waters in the state of Rio de Janeiro. The Science of the Total Environment, 225, 135<br />
- 141<br />
Stumpf, M., T. Ternes, S. V. Rodrigues and W. Baumann (1997): Determinação de Residuos Farmaceúticos<br />
em Àguas Através de Cromatografia Gasosa - Espectrometria de Massas. Livro de Resumos do IX Encontro<br />
Nacional de Química Analítica. Campus USP São Carlos, 31. 8. - 3.9. 1997, page 4<br />
Stumpf, M., T. Ternes, K. Haberer, S. Rodrigues, and W. Baumann (1998): Comparative studies of<br />
Drug Contamination in Waste, River, and Tap-water Between Brazil and Germany. 28th Symposium of<br />
Environmental Analytical Chemistry (ISEAC), Genève, Switherland, 1. - 5. 3. 1998<br />
Stumpf, M., T. Ternes, S.V. Rodrigues, W. Baumann (1997): Determinação de residuos farmaceúticos em<br />
águas através de Cromatografia Gasosa - Espectrometria de massas. IX Encontro Nacional de Química<br />
Analítica, São Carl, 31. 8. - 3. 9. 1997<br />
40
8 Projekte am Fachbereich 21 (Biologie)<br />
8.1 Photosynthese, physiologische Ökologie, Streßphysiologie<br />
Univ.-Prof. Dr. A. Wild und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik)<br />
8.1.1 Ökophysiologische Untersuchungen <strong>des</strong> Photosyntheseapparates bei Fichte (Picea abies<br />
(L.) Karst) mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenz-Meßtechnik<br />
Bearbeiter: Dr. Bernhard Dietz<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Die Intention der vorliegenden Arbeit war einerseits die beschreibende Erfassung und differenzierende<br />
Beurteilung von Schadcharakteristika (diagnostischer Ausgangspunkt) und als weitere Konsequenz<br />
die Erörterung einer praktischen Applikation dieser Erkenntnisse <strong>für</strong> eine Bioindikation ” Neuartiger<br />
Waldschäden“.<br />
Mit Hilfe der nicht<strong>des</strong>truktiven Chlorophyllfluoreszenz-Meßtechnik wurden an äußerlich ungeschädigten,<br />
grünen Nadeln unterschiedlich stark geschädigter Freilandfichten in vivo-Untersuchungen <strong>des</strong> von der<br />
Schädigung besonders betroffenen Photosyntheseapparates vorgenommen.<br />
Die Fluoreszenzdaten weisen auf eine gesteigerte Sensitivität geschädigter Fichten gegenüber Lichtstress<br />
hin, welcher die Bildung toxischer Sauerstoffspezies verstärkt. Die Pflanze verfügt über eine gestaffelte,<br />
mehrstufige Defensive, die es ihr ermöglicht, die Entstehung bzw. die Akkumulation von reaktiven Sauerstoffspezies<br />
zu verhindern. Der erste Schritt hierbei ist das Abführen überschüssiger Anregungsenergie.<br />
Das erhöhte terminale nicht-photochemische Quenching (qN)t der geschädigten Fichten sowie weitere<br />
Fluoreszenzparameter lassen auf eine solche verstärkte Dissipation von überschüssiger Anregungsenergie<br />
schließen.<br />
Ein vielfach belegtes Indiz <strong>für</strong> Photoinhibition ist die Erniedrigung <strong>des</strong> Verhältnisses variabler zu maximaler<br />
Fluoreszenz - ein Maß <strong>für</strong> die Quantenausbeute <strong>des</strong> PS II. Die reversible Photoinhibition wird ebenfalls als<br />
Schutzinstrument gegenüber Lichtstress angesehen.<br />
Ein weiteres Indiz <strong>für</strong> eine gesteigerte Lichtsensitivität geschädigter Fichten ist die gegenüber den relativ<br />
ungeschädigten Bäumen verminderte Wiedererholung der variablen Fluoreszenz nach photoinhibitorischem<br />
Stress.<br />
Außerdem gibt es Hinweise auf eine Destabilisierung der lichtsammelnden Pigment-Protein-Komplexe<br />
geschädigter Fichten. Da<strong>für</strong> sprechen der niedrigere Kritische Punkt der Fo-Temperaturabhängigkeitskurve<br />
und die erhöhte initiale Grundfluoreszenz geschädigter Fichten. Einen weiteren Anhaltspunkt <strong>für</strong> eine<br />
Störung <strong>des</strong> Excitonentransfers liefern die Ergebnisse der Tieftemperaturspektren der Chlorophyllfluoreszenz.<br />
Fast alle Parameter, die eine gesteigerte Lichtsensitivität geschädigter Fichten signalisieren, zeigen einen<br />
ausgeprägten Jahresgang mit den deutlichsten Effekten in den Wintermonaten.<br />
Es wird diskutiert, daß diese Beobachtung auf den sogenannten ” Memory“-Effekt <strong>des</strong> Ozons zurückgeführt<br />
werden könnte. Die hohe Ozon-Immission bei gleichzeitig erhöhter Globalstrahlung im Sommer führt<br />
zu einer latenten Membranschädigung, die Wochen später in einer verminderten Frosthärtung bzw.<br />
Kälteresistenz resultiert. In der Folge kommt es zu einer stärkeren Anfälligkeit der geschädigten Fichten<br />
gegenüber Photooxidation und Photoinhibition. Wesentlich <strong>für</strong> das Auftreten von Photoinhibition<br />
ist nicht die Absoluthöhe der Lichtintensität, sondern das Ungleichgewicht zwischen der Absorption und<br />
dem ” Verbrauch“ von Lichtquanten in der Photosynthese. Deshalb können selbst die mäßigen winterlichen<br />
Lichtintensitäten in Verbindung mit niedrigen Temperaturen zu einer im Vergleich zum Sommer verstärkten<br />
41
Photoinhibition führen.<br />
Den phänotypisch sichtbaren Schäden bei Waldbäumen gehen physiologische Veränderungen voraus. Die<br />
Bioindikationsforschung versucht, geeignete Frühindikatoren, die noch vor visuellen Schadsymptomen auf<br />
der Ebene <strong>des</strong> Stresses eine latente Erkrankung bzw. Schädigung anzeigen, in einen quantifizierbaren,<br />
möglichst universellen physiologischen Schadindex (pSI) umzusetzen. Eine beginnende Erkrankung<br />
wird so frühzeitig erkannt und der weitere Schadensverlauf kann überwacht werden. Dies ermöglicht<br />
die rechtzeitige Einleitung und Kontrolle von Gegenmaßnahmen. Voraussetzung <strong>für</strong> die Eignung eines<br />
Parameters als physiologischer Frühindikator muß die praktikable, methodisch einfache, nicht zeitaufwendige,<br />
kostengünstige und ubiquitäre Anwendbarkeit sein. Kriterien, die von der hier vorgestellten<br />
Chlorophyllfluoreszenz-Meßtechnik erfüllt werden. Zahlreiche Fluoreszenzparameter weisen eine signifikante,<br />
lineare Korrelation mit dem Schädigungsgrad auf. Sie reagieren bereits auf der phänotypisch schwer<br />
erkennbaren Ebene der Stressreaktionen.<br />
8.1.2 Untersuchungen zum Stickstoff-Assimilationspotential bei Buche in Abhängigkeit von der<br />
Stickstoff-Zufuhr und bei Eiche unter der Einwirkung von Ozon, Kohlendioxid und Trockenstreß<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Christoph Engel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Hauptsächlicher Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit war das N-Assimilationspotential von<br />
Buche und Eiche. Dazu wurde die Aktivität der Enzyme Nitratreduktase (in vivo), Nitritreduktase und<br />
Glutaminsynthetase, letztere z.T. isoenzymspezifisch, bestimmt. Zusätzliche Meßparameter waren der<br />
Gehalt löslicher Proteine, die NO − 3 - und NH+ 4 -Aufnahmerate sowie der Gehalt an NH+ 4 .<br />
Zunächst wurde eine Charakterisierung der Meßgrößen vorgenommen. Dies diente zur Optimierung der<br />
Nachweisbedingungen und zur näheren Bestimmung der Aussagefähigkeit der Meßwerte. So konnte<br />
beim Eichenblatt die Abhängigkeit einer maximalen Glutaminsynthetaseaktivität (GSA) von einem SH-<br />
Gruppenschutz (DTE oder DTT), einem löslichen Phenolabsorbens (PVP) und einem effektiven Gewebsaufschluß<br />
(Microdismembrator) festgestellt werden. Die GSA-Ausbeute beträgt bei einmaliger Extraktion<br />
aus Buchenblatt und -wurzel und aus Eichenblatt min<strong>des</strong>tens 89 %. Die Nitritreduktaseaktivitäts-Ausbeute<br />
beträgt bei einmaliger Extraktion aus Eichenblatt ca. 85 %. Die GSA-Fraktionen, die mittels Ionenaustauschchromatographie<br />
mit einer Ausbeute von 85 - 116 % gewonnen werden konnten, unterscheiden<br />
sich bei Buchen- und Eichenblatt bezüglich der pH-Abhängigkeit. Bei der Eiche wurde auch der KM <strong>für</strong><br />
Glutamat bei beiden GSA-Fraktionen über Hanes-Diagramme ermittelt: Die Fraktionen scheinen sich auch<br />
hierin zu unterscheiden. Anhand dieser Eigenschaften wurde eine Zuordnung der GSA-Fraktionen zu den<br />
Isoformen GS1 und GS2 vorgenommen. In der Buchenwurzel kommt möglicherweise keine GS2 vor. Die in<br />
vivo-NRA <strong>des</strong> Eichenblattes unterliegt starken circadianen Schwankungen.<br />
Anhand eines Versuches mit isolierten Buchenblättern wurde ein Anstieg der in vivo-NRA mit zunehmender<br />
NO − 3 -Zufuhr gefunden. Dies spricht <strong>für</strong> die Fähigkeit <strong>des</strong> Buchenblattes zur Reduktion größerer NO− 3 -<br />
Mengen und gegen die Vorstellung, daß eine Dominanz der Wurzel bei der NO3–Reduktion bei vielen<br />
Gehölzarten durch die Unfähigkeit <strong>des</strong> Sprosses zu diesem Prozeß bedingt ist.<br />
Bei Buchensämlingen sollten die Auswirkungen der N-Qualität bezüglich <strong>des</strong> NO − 3 - bzw. NH+ 4<br />
die N-Aufnahmerate und das NH + 4 -Assimilationspotential festgestellt werden. Die Untersuchung <strong>des</strong> NH+ 4 -<br />
Assimilationspotentials anhand der GS-Aktivität, <strong>des</strong> Gehaltes löslicher Proteine und <strong>des</strong> NH + 4 -Gehaltes im<br />
-Anteils auf<br />
Stammgewebe sollte dabei die verfügbaren Literaturbefunde zu N-Aufnahmeraten und Wachstum ergänzen.<br />
Es konnte gezeigt werden, daß bei einem N-Angebot mit hohem NH + 4 -Anteil gegenüber reiner NO− 3 -Zufuhr<br />
neben der N-Aufnahmerate die GSA ansteigt, was mit einer Zunahme an löslichem Protein verbunden<br />
ist. Auch unter veränderten Kulturbedingungen bleibt der Anstieg der drei Parameter erhalten. Allerdings<br />
42
ändert sich bezüglich der GSA und <strong>des</strong> Proteingehaltes der Ort der deutlichsten Zunahme in der Pflanze.<br />
Die Abweichungen könnten mit einem veränderlichen relativen Beitrag von Wurzel und Sproß zur NH + 4 -<br />
Assimilation in Verbindung stehen. So ist der NH + 4 -Gehalt im Stamm bei der NH+ 4 -dominierten N-Zufuhr<br />
dann erhöht, wenn anhand der Kulturbedingungen eine eingeschränkte NH + 4 -Assimilation in der Wurzel<br />
angenommen werden kann.<br />
Für die Eiche sollten grundlegende Untersuchungen zum N-Assimilationspotential im Blatt unter der Einwirkung<br />
von O3, CO2 und Trockenstreß vorgenommen werden. Der in einem größeren als hier dargestellten<br />
Rahmen durchgeführte Versuch sollte eine zukünftig mögliche Umweltsituation simulieren; gleichzeitig wurden<br />
die Wirkungen aller möglichen Zweierkombinationen der drei Faktoren sowie die Einzelfaktoreinflüsse<br />
untersucht. Anhand bekannter, in Beziehung zur N-Assimilation stehender Stoffwechselbeeinflussungen<br />
durch diese Faktoren war am ehesten mit einem Rückgang der Meßparameter zu rechnen. Mittels Nachweis<br />
der Einzelaktivitäten der wahrscheinlichen GS-Isoenzyme - GS1 und GS2 - unter CO2-Einfluß sollte<br />
eine differenzielle Regulation dieser Isoenzyme aufgedeckt werden. Diese schien anhand von Literaturbefunden<br />
zur Funktion der beiden Formen möglich. Wie erwartet sinken NiR-Aktivität, GS-Aktivität und der<br />
Gehalt löslicher Proteine bezogen auf FG unter dem Einfluß vermehrter O3- und / oder CO2-Zufuhr ab.<br />
CO2 verursacht bezüglich der GS-Isoenzyme lediglich bei der GS2 einen Aktivitätsrückgang, während die<br />
GS1-Aktivität nicht signifikant beeinflußt wird. Dieser Befund steht im Einklang mit jenem von Ramazanov<br />
& Cardenas (1994) und unterstreicht die Bedeutung der GS2 bei der Reassimilation von photorespirato-<br />
rischem NH + 4<br />
. Der Trockenstreß wirkt sich lediglich auf die spezifische NiR-Aktivität negativ aus. Bei<br />
Doppelbegasung Mit O3 und CO2 wird keine Wechselwirkung bezüglich der Beeinflussung der Meßgrößen<br />
beobachtet. Die in vivo gemessene NR-Aktivität steigt bei den begasten Bäumen an und verhält sich damit<br />
gegensätzlich zu den anderen Meßparametem. Als Erklärung kommt eine Abhängigkeit der Aktivität vom<br />
Gewebsgehalt an glykolysierbaren Kohlehydraten in Betracht, welcher bei den begasten Pflanzen erhöht<br />
sein könnte.<br />
8.1.3 Die Douglasienerkrankung - eine manganinduzierte Nährstoffstörung? Untersuchungen<br />
unter besonderer Berücksichtigung <strong>des</strong> Eisenhaushaltes<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Andrea Kaus-Thiel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Ziel der Arbeit war es mittels diverser biochemischer und anatomischer Untersuchungen an Douglasien<br />
unterschiedlichen Schädigungsgra<strong>des</strong> die Hypothese <strong>des</strong> durch Manganüberschuß induzierten<br />
Nährstoffmangels, unter besonderer Berücksichtigung <strong>des</strong> Eisenhaushaltes, zu überprüfen und Indizien zur<br />
Verifizierung bzw. Falsifizierung zu erfassen und darzulegen.<br />
Das Probenmaterial umfaßte Douglasien eines Bestan<strong>des</strong>, der die charakteristischen Symptome der Erkrankung,<br />
in Form von Nadelverfärbungen, Kronenverlichtung, Harzfluß und Wuchsanomalien, aufweist. Als<br />
Vergleichskulturen wurden Douglasien eines ungeschädigten Bestan<strong>des</strong> und eines Standortes mit kalkbedingter<br />
Eisenmangelchlorose herangezogen. In Hydrokulturen angezogene Douglasiensämlinge, die unterschiedlichen<br />
Mangankonzentrationen in der Nährlösung ausgesetzt waren, dienten gleichfalls als Probenmaterial.<br />
Die beprobten Varianten <strong>des</strong> geschädigten Bestan<strong>des</strong> wiesen extrem hohe, im toxischen Bereich liegende<br />
Mangangehalte auf, wobei auch die Werte der okular ungeschädigten Variante dieses Bestan<strong>des</strong> deutlich<br />
über der Mangankonzentration der Referenzbäume lagen. Die natürliche Akkumulation <strong>des</strong> Mangans mit<br />
zunehmendem Nadelalter war in allen Varianten zu beobachten. Das Erntejahr 1996 wies im Vergleich<br />
zum Vorjahr eine leichte Abnahme der Manganspiegelwerte auf. Die Negativreferenz spielt hinsichtlich der<br />
Mangangehalte keine Rolle.<br />
Der Eisenhaushalt war im Zusammenhang mit manganinduzierten Nährstoffstörungen von besonderem<br />
43
Interesse, da die betroffenen Douglasien in ihren jüngsten Nadeln eine Symptomatik ähnlich einer auf<br />
Kalkstandorten zu beobachtende Eisenmangelchlorose aufwiesen. Im vorliegenden Fall schien die Aufnahme<br />
<strong>des</strong> Eisens nur marginal beeinträchtigt zu sein, Obwohl die okular schadfreien Bäume deutlich<br />
höhere Werte verzeichneten, lag der Gesamteisengehalt der symptomtragenden Douglasien auch nach<br />
dem Absinken der Werte im Erntejahr 1996 noch nicht im Mangelbereich. Mit Ausnahme <strong>des</strong> Magnesium,<br />
das in den geschädigten Varianten deutlich niedrigere Nadelspiegelwerte zeigte, welche jedoch im<br />
ausreichenden Versorgungsbereich lagen, wiesen die übrigen gemessenen Nährelemente keine auffälligen,<br />
schädigungsabhängigen Beeinträchtigungen auf<br />
Die okular schadfreien Douglasien zeigten im Vergleich zu den symptomtragenden Douglasien einen deutlich<br />
höheren Anteil an löslichem und, noch ausgeprägter, an dreiwertigern Eisen, während eine Differenzierung<br />
-Gehaltes in geschädigt und ungeschädigt nicht vorgenommen werden konnte.<br />
der Varianten anhand <strong>des</strong> Fe + 2<br />
Die Beeinträchtigung <strong>des</strong> Eisenhaushaltes äußert sich demnach nicht, wie bislang in der Literatur diskutiert,<br />
im Fe + 2 -Gehalt sondern in der Beeinflussung <strong>des</strong> Fe+ 3 -Gehaltes.<br />
Als weiteres Indiz <strong>für</strong> einen physiologischen Eisenmangel konnten die Ergebnisse der Chlorophyllanalyse<br />
bewertet werden. Da die Synthese <strong>des</strong> Chlorophylls stark eisenabhängig ist, lassen sich Unregelmäßigkeiten<br />
<strong>des</strong> Eisenhaushaltes im Chlorophyllgehalt nachweisen. Dabei war ein Absinken der Gehalte mit steigendem<br />
Schädigungsgrad zu beobachten.<br />
Die Ergebnisse einer Korrelationsanalyse von Chlorophyll-, Eisen- und Mangangehalt sprechen <strong>für</strong> einen<br />
induzierten physiologischen Eisenmangel im ersten Nadeljahrgang und direkte toxische Auswirkungen von<br />
extremen Mangankonzentrationen in den älteren Nadeljahrgängen.<br />
Da ca. 80 % <strong>des</strong> pflanzlichen Eisens in den Chloroplasten lokalisiert ist und sich ein Eisenmangel direkt in<br />
deren Struktur widerspiegelt, lag es nahe, die feinstrukturellen Verhältnisse der unterschiedlich geschädigten<br />
Douglasien vergleichend zu untersuchen und die Ergebnisse zur Detektierung eines physiologischen Eisenmangels<br />
heranzuziehen.<br />
In den symptomtragenden Douglasien ließ sich im Vergleich zur Referenzvariante ein erheblich reduziertes,<br />
stark aufgelockertes Thylakoidsystem nahezu ohne Granastapel erkennen. Die als ” Negativreferenz“<br />
ausgewählten Douglasien <strong>des</strong> Kalkstandortes zeigten vergleichbare Verhältnisse im Membransystem <strong>des</strong><br />
Chloroplasten.<br />
Sowohl Chlorophyllgehalt als auch der ultrastrukturelle Zustand der Chloroplasten lieferten aufgrund ihres<br />
hohen Eisenbedarfs sichere Hinweise zur Identifizierung eines, im vorliegenden Fall manganinduzierten,<br />
physiologischen Eisenmangels.<br />
8.1.4 Untersuchung <strong>des</strong> Stickstoff-Stoffwechsels an Fichten (Picea abies), Buchen (Fagus sylvatica)<br />
und Eichen (Quercus petraea) im Zusammenhang mit dem Auftreten Neuartiger<br />
Waldschäden<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Roman Kleiner<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
In Übereinstimmung haben viele Ergebnisse aus der Waldschadensforschung gezeigt, daß das Erscheinungsbild<br />
der neuartigen Waldschäden multikausalen Ursprungs ist (edaphische, klimatische und anthropogene<br />
Faktoren). Als eine <strong>für</strong> das Auftreten der Komplexkrankheit verantwortliche Hauptursache wird heute<br />
die anthropogen bedingte Luftverunreinigung angesehen. In der vorliegenden Arbeit steht die Schädigung<br />
durch überhöhte Stickstoffeinträge im Mittelpunkt der Überlegungen. Im Laufe der Evolution war Stickstoff<br />
ein begrenzender Wachstumsfaktor <strong>für</strong> Waldökosysteme, weshalb ein starker Selektionsdruck in Richtung<br />
Recycling und Einsparung herrschte.<br />
Ziel der vorliegenden Arbeit war es u. a., physiologisch-biochemische Testmethoden zu entwickeln, die es<br />
44
in Reihenuntersuchungen erlauben, Umstellungen im N-Stoffwechsel zu erfassen. Im methodischen Teil<br />
wurden Parameter und Bestimmungsmethoden gesucht, die diese veränderten Stoffwechselbedingungen<br />
sicher anzeigen (Nitratreduktase, Nitritreduktase, Glutaminsynthetase, Glutamatdehydrogenase, Protein-,<br />
Nitrat- und Ammoniumgehalt der Blattorgane). Desweiteren wurden geeignete Testmethoden jeweils so<br />
verändert, daß die Testbedingungen <strong>für</strong> die Bestimmung aus Nadel- und Blattextrakten (Buchen, Eichen<br />
und Fichten) optimal waren.<br />
Ein praktikabler GDH-Test, der <strong>für</strong> Reihenmessungen geeignet ist, konnte etabliert werden. Der Test wurde<br />
so verbessert, daß gleichzeitig 12 Extrakte mit je drei Wiederholungsmessungen untersucht werden konnten.<br />
Dies verkürzte die Meßzeit am Photometer von 10 Minuten <strong>für</strong> eine Messung (ein Extrakt; drei Replikate)<br />
auf 5 Minuten <strong>für</strong> 12 Extrakte (inklusive dreier Wiederholungsmessungen).<br />
Im zweiten Teil der Arbeit wurden Reihenuntersuchungen angestellt, wobei verschiedenen Projekten unterschiedliche<br />
Fragestellungen zugrunde lagen. Die Untersuchungen sollten dazu beitragen, gesicherte<br />
Erkenntnisse der biochemischen Schadanalyse, welche durch langjährige Erfahrung in Fichtenversuchen<br />
gesammelt wurden, auf Laubbäume zu übertragen. Weiter dienten die Untersuchungen dazu, weitgehend<br />
unerforschte stoffwechsel-physiologische Prozesse von Bäumen besser zu verstehen.<br />
Am Standort Freudenstadt (Picea abies) wurde ein Fichtenkollektiv mit Symptomen der montanen Vergilbung<br />
mit einem direkt benachbarten, gesunden verglichen. Der geschädigte Bestand zeigt die Tendenz zu<br />
geringerer GS-Aktivität. Auch der Gehalt löslicher Proteine ist reduziert. Zusammen mit anderen Untersuchungsparametern,<br />
die degenerative Prozesse aufzeigen, kann eine starke Reduktion <strong>des</strong> N-Metabolismus<br />
vermutet werden, der durch massive Schädigung bedingt ist.<br />
Auch beim Kompensationskalkungsversuch Leisel (Picea abies) eignet sich die GS-Aktivität als Indikator <strong>des</strong><br />
N-Metabolismus. Dieser zeigt sich sowohl von der Kalkung, als auch von der Schädigung beeinflußt. Die<br />
GS-Aktivität ist in beiden Fällen erhöht. Im Gegensatz zu Freudenstadt zeigen sich bei den geschädigten<br />
Fichten keine degenerativen Veränderungen; die gesteigerte GS-Aktivität wird hier als Indiz <strong>für</strong> intensivierte,<br />
stressbeantwortende Reaktionen gewertet. Der Proteingehalt zeigt klimatisch bedingte Unterschiede.<br />
Wie bei den Fichten in Leisel zeigt sich die Eichen-GS in Merzalben (Quercus petraea) von der Kalkungsmaßnahme<br />
beeinflußt. Die Steigerung der Enzymaktivität wird hier als Folge gesteigerter, durch die Kalkung<br />
verursachter, Nitratfreisetzung interpretiert. Die GDH kann als Indikator unspezifischer Streßeinwirkung<br />
angesehen werden. Die oxidative Desaminierung scheint dabei im Vordergrund zu stehen.<br />
Untersuchungen am Buchenwaldökosystem (Fagus sylvatica) in Zierenberg, welches sich in der Phase<br />
beginnender Humus<strong>des</strong>integration befindet, zeigen die Schwierigkeiten auf, die bei der visuellen Schadansprache<br />
von Laubbäumen auftreten. Der relative Blattverlust und der Fruktifikationsgrad scheinen nicht<br />
unbedingt mit der Vitalität der Buchen kongruent zu sein. Die GDH-Aktivität kann auch hier als Indikator<br />
einer Streßmanifestation herangezogen werden, die GS als Intensitätsanzeiger <strong>des</strong> N-Metabolismus. Die<br />
Ergebnisse in Abhängigkeit vom Nitratgehalt im Boden und vom Blattverlust lassen auf unterschiedliche<br />
Wasserversorgung auf den Teilstandorten schließen. Die GDH-Aktivität ist auf der vermutlich weniger<br />
gut stickstoffversorgten Teilfläche gesteigert, die GS reduziert. Noch scheint das überdurchschnittliche N-<br />
Angebot in Zierenberg, aufgrund der optimalen Bodenbedingungen, eine Vitalitätssteigerung zu bewirken.<br />
Ob sich diese über längere Sicht negativ auswirkt, kann nicht ausgeschlossen werden.<br />
8.1.5 Kausalanalyse und Bioindikation der Neuartigen Waldschäden anhand <strong>des</strong> Polyamin- sowie<br />
<strong>des</strong> <strong>des</strong> Phenolstatus am Beispiel von Picea abies (Fichte), Abies alba (Weißtanne) und<br />
Quercus petraea (Eiche): - Okulare Bonitur versus Bioindikation?<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Claudia Kurz<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Diese Arbeit befaßte sich mit einem Teilaspekt eines Forschungsprojektes, das in Zusammenarbeit mit dem<br />
45
Kernforschungszentrum Karlsruhe im Zeitraum zwischen 1993 und 1995 an zehn Fichten (Picea abies) und<br />
zwei Weißtannenstandorten (Abies alba) unterschiedlichsten Schädigungsgra<strong>des</strong> in Baden-Württemberg<br />
durchgeführt wurde. Im Rahmen der Arbeit sollte durch Analyse der Phenol- sowie Polyamingehalte untersucht<br />
werden, ob sich anhand dieser Aussagen über den Schädigungsgrad sowie über <strong>des</strong>sen Verlauf treffen<br />
lassen. Weiterhin sollte der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich Übereinstimmungen zwischen den<br />
durch die okulare Bonitur erhobenen Bewertungen und den Ergebnissen der Bioindikation ergeben.<br />
Die Messung der Phenole sowie Polyamine erfolgte mittels geeigneter HPLC-Verfahren und anschließender<br />
Detektion. Bei der Fichte wurden die phenolischen Komponenten Picein, U1, Catechin, Epicatechin, PHAP,<br />
PTG sowie die unbekannte Komponente U2, die später als Coniferin identifiziert werden konnte, untersucht.<br />
Bei der Tanne waren es die Komponenten Gallussäure, Catechin, sowie zwei weitere bisher noch unbekannte<br />
Substanzen TI und T2.<br />
Die bereits früher geäußerte Vermutung, daß es sich bei der Substanz U2 um ein Glykosid handelt, konnte<br />
durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Die Analyse der UV-Spektren in Verbindung mit dem<br />
Massen- sowie NMR-Spektrum ermöglichte es, diese Substanz mit ziemlicher Sicherheit als Coniferin zu<br />
identifizieren.<br />
Für die Substanzen Catechin sowie Picein konnte <strong>für</strong> die Baumart Fichte ein korrelativer Zusammenhang<br />
zwischen diesen Substanzen und dem mittels der okularen Bonitur ermittelten Schädigungsgrad nachgewiesen<br />
werden. Desweiteren ließ sich diese Korrelation zwischen dem Schädigungsgrad <strong>des</strong> Baumes und<br />
den Phenolgehalten in den nachfolgenden Jahren weiterverfolgen. Bei der Baumart Fichte zeigte sich<br />
ein ähnliches Verhalten <strong>für</strong> die Catechingehalte, die auch hier mit den Parametern Nadelverlust- beziehungsweise<br />
Nadelvergilbungsrate korrelierten. Auch hier ließ sich dieser Trend <strong>für</strong> die nachfolgenden Jahre<br />
bestätigen.<br />
In einem separaten Experiment sollte der Frage nachgegangen werden, ob die am Standort Baden-<br />
Württemberg mit zunehmender Höhenlage ansteigenden Catechingehalte auf eine Zunahme der UV-B-<br />
Strahlung zurückgeführt werden können. Zwar ließ sich kein signifikanter korrelativer Zusammenhang<br />
zwischen den Catechingehalten und dem Grad der UV-B-Strahlung nachweisen, allerdings zeigten die Ergebnisse<br />
einen Trend zwischen dem Grad der UV-B-Strahlung und den Catechinkonzentrationen, so daß<br />
unter Berücksichtigung der kurzen Versuchsdauer sowie der Witterungsbedingungen ein möglicher Zusammenhang<br />
gegeben ist. Dies läßt es möglich erscheinen, die am Standort Baden-Württemberg mit der<br />
Höhenlage zunehmenden Catechingehalte auf einen UV-Effekt zurückzuführen.<br />
Von den Polyaminen wurden die Komponenten Putrescin und Catechin <strong>für</strong> Tannen und Fichten ermittelt.<br />
Die Auswertung der Fichten- und Tannenproben erbrachte auch hier einen korrelativen Zusammenhang<br />
zwischen den Parametern Nadel- beziehungsweise Blattverlust und den Polyanungehalten. Dieser war <strong>für</strong><br />
das Spermidin nicht in allen Jahren signifikant.<br />
In einem ergänzenden Experiment wurden auch noch die Polyamingehalte von Eichen, die unter erhöhten<br />
CO2- sowie Ozonkonzentrationen angezogen wurden, untersucht. Bei den Eichen konnte noch zusätzlich<br />
das Tetraamin Spermin als weitere Polyaminkomponente nachgewiesen werden.<br />
Bei den Eichenproben führte eine alleinige Erhöhung der Ozonkonzentration zu keinen signifikanten Effekten.<br />
Erst eine Kombinationsbelastung mit erhöhten Ozonkonzentrationen und einer gleichzeitigen Belastung<br />
unter temporärem Trockenstreß hatte einen Anstieg der Putrescinkonzentrationen zur Folge.<br />
Abschließend läßt sich feststellen, daß <strong>für</strong> die Baumarten Picea abies und Abies alba die Eignung der<br />
Parameter Catechin, Picein, sowie Putrescin als Indikatoren im Rahmen der Bloindikation nachgewiesen<br />
werden konnte. Als weiteres Ergebnis der Untersuchungen konnte <strong>für</strong> die oben genannten Baumarten eine<br />
signifikante Korrelation zwischen den Parametern Nadelverlust beziehungsweise Nadelvergilbung und dem<br />
Gehalt der oben genannten bioindikatorischen Substanzen erwiesen werden.<br />
46
8.1.6 Untersuchungen zum Gehalt an Ascorbat, α-Tocopherol, Polyaminen und Mineralien in<br />
Fichtennadeln von 46 Freilandstandorten in der BRD. Bioindikation im Zusammenhang<br />
mit den ” Neuartigen Waldschäden“<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Ulrike Lauchert<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden in den Jahren 1991 und 1992 an 46 verschiedenen Fichtenstandorten<br />
in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Fichtennadeln <strong>des</strong><br />
zweiten Nadeljahrgangs geerntet und auf ihren Gehalt an den Antioxidantien Ascorbat und α-Tocopherol<br />
untersucht. Des weiteren wurde die Konzentration der Polyamine Putrescin, Spermidin und Spermin sowie<br />
die Gehalte an Mineralstoffen analysiert. Als Bezugsgrößen wurden das Frisch- zu Trockengewicht, der<br />
Chlorophyllgehalt und ein okularer Nadelindex ermittelt.<br />
Zur Bestimmung <strong>des</strong> α-Tocopherolgehaltes in Fichtennadeln wurde eine neue Methode mit methanolischer<br />
Extraktion und anschließender HPLC-Analyse mit fluorometrischer Detektion etabliert, die einfach und<br />
schnell durchzuführen ist und dennoch selektiv und sensitiv das α-Tocopherol erfaßt.<br />
Um diurnale Konzentrationsveränderungen zu belegen, wurden am Standort Freudenstadt Tagesgangmessungen<br />
von Ascorbat, α-Tocopherol und den Polyaminen im Paarvergleich an je einer geschädigten und<br />
einer ungeschädigten Fichte durchgeführt. Es konnte sowohl <strong>für</strong> die Vitamine C und E als auch <strong>für</strong> das<br />
Putrescin über den ganzen Tagesverlauf ein erhöhter Level der untersuchten Parameter im geschädigten<br />
Baum nachgewiesen werden.<br />
Die an den 46 Freilandstandorten gewonnenen Daten wurden ausführlich dargestellt und auf Zusammenhänge<br />
der einzelnen biochemischen Parameter untereinander und mit der Standortsituation untersucht<br />
und diskutiert.<br />
Es konnten signifikante positive Korrelationen der jeweiligen Nadelspiegelwerte zwischen den Mineralien<br />
Kalzium, Magnesium und Zink sowie zwischen den Elementen Eisen und Aluminium festgestellt werden.<br />
Des weiteren korreliert Magnesium negativ mit Ascorbat, und Kalium korreliert negativ mit dem Putrescingehalt.<br />
Die in der Literatur oft beschriebene Akkumulation von Putrescin in Pflanzen, die unter Kaliummangelbedingungen<br />
(im Boden bzw. in der Nährlösung) gedeihen, konnte hier erstmals anhand der<br />
Kaliumnadelspiegelwerte bei Fichten, die an unterschiedlichen Standorten wachsen, bestätigt werden. Und<br />
zwar zeigte sich, daß Fichten mit hoher Kaliumversorgung geringe Putrescinkonzentrationen aufweisen,<br />
während in den Nadeln mit hohen Putrescinwerten vergleichsweise wenig Kalium nachgewiesen werden<br />
konnte, ohne daß ein ausgesprochener Kaliummangel vorlag.<br />
Die Analysenergebnisse der einzelnen Standorte wurden anschließend multivariat mittels einer Faktoranalyse<br />
ausgewertet. Offenbar wird die Gesamtvarianz von mehreren Faktoren bestimmt, wobei die Parameter<br />
Ascorbat, α-Tocopherol und Putrescin jeweils unterschiedlichen Faktoren zugewiesen wurden, was da<strong>für</strong><br />
spricht, daß sie unterschiedlichen Einflüssen unterliegen. Die <strong>für</strong> die einzelnen Fichtenstandorte errechneten<br />
Faktorwerte wurden graphisch im zweidimensionalen Koordinatensystem dargestellt und bezüglich der zeitlichen<br />
Verschiebungen (1991 nach l992) betrachtet. Es zeigte sich, daß die Veränderungen zwischen den<br />
beiden Erntejahren in den verschiedenen Erntegebieten zum Teil unterschiedliche dominierende Richtungen<br />
aufweisen, was <strong>für</strong> einen unterschiedlichen Einfluß von Umweltfaktoren spricht.<br />
Die anschließende Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den biochemischen Parametern und der Luftschadstoffbelastung<br />
ergab trotz unvollständiger Immissionsdaten Hinweise auf ein gegensinniges Verhalten<br />
der untersuchten Antioxidantien: Der Ascorbatgehalt korreliert positiv mit dem Ozon und dem Stickstoffdioxid,<br />
während die α-Tocopherolmenge mit zunehmenden Konzentrationen dieser Schadgase absinkt.<br />
Umgekehrt zeigt Ascorbat eine negative Korrelation mit dem Schwefelgehalt der Nadeln, der die Schwefeldioxidbelastung<br />
gut repräsentiert, während das Vitamin E bei steigender Schwefeldioxidkonzentration<br />
(bzw. steigendem Schwefelgehalt der Nadeln) erhöht ist. Diese gegensätzliche Reaktion der Antioxidan-<br />
47
tien auf unterschiedliche Luftschadstoffe wird besonders deutlich, wenn der Quotient aus Ascorbat und<br />
α-Tocopherol gebildet wird. Somit ist die Bestimmung <strong>des</strong> Verhältnisses von Ascorbat zu α-Tocopherol in<br />
Fichtennadeln vielversprechend hinsichtlich einer Differentialdiagnose zwischen den genannten Schadgasen.<br />
Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die ermittelten Zusammenhänge zwischen Putrescin und Kalium,<br />
sowie zwischen den Antioxidantien und der Schadstoffbelastung in älteren Bäumen (> 60 Jahre) und an<br />
höhergelegenen Standorten (> 600 m ü.NN) besonders ausgeprägt sind.<br />
8.1.7 Planung und Aufbau computergesteuerter Expositionskammern zur Umweltsimulation <strong>für</strong><br />
Pflanzen<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Dieter Peuser<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Durch die anthropogen veränderte Zusammensetzung der Atmosphäre ist in den kommenden Jahrzehnten<br />
mit einer Klimaveränderung zu rechnen, die drastische Auswirkungen auf die Vitalität und Zusammensetzung<br />
von Ökosystemen haben wird. Insbesondere steigende Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre<br />
und ein möglicherweise verändertes Niederschlagsmuster sind dabei von Bedeutung. Vor dem Hintergrund,<br />
daß Langzeitstudien zur Erforschung der Akklimation von Pflanzen immer wichtiger werden, wurde am Institut<br />
<strong>für</strong> Allgemeine Botanik beschlossen, eine Expositionskammeranlage zur Umweltsimulation <strong>für</strong> Pflanzen<br />
zu entwickeln.<br />
Zur Durchführung <strong>des</strong> oben genannten Projektes waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die vor allem<br />
in der Planung <strong>des</strong> Aufbaus der Expositionskammern, der Auswahl, Beauftragung und Koordination der<br />
beteiligten Firmen sowie in der Beschaffung der notwendigen Geld- und Sachmittel lagen. Hinzu kamen<br />
die erforderliche Sanierung und der Umbau <strong>des</strong> Gewächshauses zur Aufnahme der Klimakammern. Parallel<br />
dazu erfolgte die Ausarbeitung eines Konzeptes zur computergestützten Regelung der Versuchsanlage und<br />
eine Erprobung einzelner Bauelemente an einem selbstkonstruierten Kammermodell im Maßstab 1 : 1. Bei<br />
den oben genannten Aufgaben und beim Aufbau der elektronischen Regelungsanlage erforderte der Umfang<br />
der Arbeiten eine intensive Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen und universitären Fachkräften.<br />
Neben der wissenschaftlichen Betreuung verlangte das Projekt eine Einarbeitung in die technischen Bereiche<br />
<strong>des</strong> Anlagenbaus.<br />
Die nach unseren Bedürfnissen von einem Ingenieurbüro entworfene Wasseraufbereitungsanlage ermöglicht<br />
nicht nur die Herstellung von Reinstwasser, sondern bietet auch die Möglichkeit der kontrollierten<br />
Nährstoffgabe über eine Dosiereinrichtung. Darüber hinaus dient sie im Regelkreis der computergesteuerten<br />
Bewässerung zur Erzeugung von definierten Bodensaugspannungen. Insgesamt besteht die Möglichkeit, Klimaelemente<br />
wie Temperatur und Luftfeuchte gezielt zu kontrollieren, wie dies beispielsweise <strong>für</strong> Tagesgänge<br />
erforderlich ist. Besondere Berücksichtigung fand das Belüftungs- und Luftverteilungssystem, mit dem<br />
in den Kammern <strong>für</strong> natürliche Windgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger homogener Verteilung der Luft<br />
und der von ihr getragenen Klimaelemente gesorgt werden kann. Eine völlige Neuentwicklung stellt das<br />
Beleuchtungssystem dar, <strong>des</strong>sen Abwärme über eine Warmluftabsauganlage entsorgt wird. Durch die besondere<br />
Konstruktion der Leuchtfelder und der reflektierenden Wirkung der Absaughauben war es erstmals<br />
möglich, mit Leuchtstofflampen Quantenflußdichten um 900 µE·m −1 ·s −1 (PAR) in Expositonskammern<br />
zu erreichen. Mit der geschützten Eigenentwicklung (Gebrauchsmusterschutz) <strong>des</strong> CO2-Analysators zur<br />
Regelung der CO2-Konzentration konnte eine funktionsfähige Alternative zu den sonst verwendeten, teuren<br />
Meßgeräten (IRGA bzw. URAS) geschaffen werden.<br />
Mit der computergestützten Regelung der Anlage in Verbindung mit der von uns konfigurierten Software<br />
DIA/DAGOO konnte die Kontrolle und Handhabung der Expositionskammern vereinfacht werden. Diese<br />
Regelung ermöglicht darüber hinaus, eingegebene lang- oder auch kurzfristige Klimaänderungen nachzufahren,<br />
sofern sie mit der zur Verfügung stehenden Kammertechnik realisierbar sind.<br />
48
8.1.8 Vergleichende Untersuchungen der Chlorophyllfluoreszenz bei Buchen (Fagus sylvatica),<br />
Eichen (Quercus petraea) und Fichten (Picea abies) in Zusammenhang mit den Neuartigen<br />
Waldschäden<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Ralph Scheuermann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Seit Mitte der 70er Jahre werden in Mitteleuropa ausgedehnte Waldschäden an Nadel- und Laubbäumen<br />
beobachtet. Vor etwa 10 Jahren wurde dann erstmalig in einer breiten Öffentlichkeit die Frage diskutiert,<br />
warum der Wald in seiner derzeitigen Form erkrankt ist und welche gesellschaftlichen, ökologischen<br />
und politischen Folgen daraus resultieren. Im Jahre 1991 gelten gemäß der bun<strong>des</strong>deutschen Waldschadenserhebung<br />
64 % aller Waldbäume als geschädigt. Es ist unumstritten, daß die Komplexkrankheit der<br />
neuartigen Waldschäden auf eine Vielfalt von anthropogenen, edaphischen und klimatischen Stressoren<br />
zurückzuführen ist. Hier sind ein eingeschränktes Nährstoffangebot, ein gestörtes Nährstoffgleichgewicht,<br />
klimatische Faktoren wie Trockenheit, Frostereignisse oder hohe Lichtintensitäten und insbesondere anthropogen<br />
verursachte Luftverunreinigungen aus Industrieanlagen, Verkehr, Haushalt und Landwirtschaft<br />
zu nennen. Ein einheitliches Schadbild ist bisher auch nicht zu beobachten. Eine Belastung mit Schadstoffen<br />
kann vor geraumer Zeit erfolgt sein, die phänotypische Erkrankung aber erst nach entsprechender<br />
Vorlaufzeit sichtbar werden. Somit wäre eine biochemische Frühdiagnose von Vorteil, um bedrohte Standorte<br />
rechtzeitig zu ermitteln und gegebenenfalls mit Meliorationsmaßnahmen einzugreifen. Um eine solche<br />
Bioindikation zu erreichen, müssen vielfältige Stoffwechselparameter und -wege nach einer Schädigung hin<br />
untersucht werden.<br />
Mit der biophysikalischen Methode der Fluoreszenzlichtuntersuchung sollte geklärt werden, inwieweit diese<br />
Methode geeignet ist, bei den untersuchten Waldbäumen eine Erkrankung anzuzeigen. Außerdem sollten<br />
Hinweise auf den Ort der Schädigung im untersuchten Organismus erhalten werden. Ein Hauptaugenmerk<br />
der vorliegenden Arbeit lag darin, die <strong>für</strong> Fichten bereits erfolgreich angewandte Methode noch zu verfeinern<br />
und gleichzeitig den Transfer zur Indikation von Laubbäumen zu vollziehen.<br />
So weisen die Ergebnisse von qN, Φe, Fv/Fm einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der okularen<br />
Schadeinteilung seitens der Forstbehörden und dem biochemischen Zustand der Fichten auf.<br />
Bei Fichten lassen sich, wie aufgrund der erhaltenen Ergebnisse gezeigt werden konnte, Schäden an der<br />
Thylakoidmembran detektieren, welche auf ein Zusammenspiel klimatischer und edaphischer Faktoren mit<br />
Luftschadstoffen zurückzuführen sind.<br />
Aufgrund dieser Befunde ist die Chlorophyllfluoreszenz geeignet, als Bioindikator bei Fichten mit dem<br />
Schadbild der montanen Vergilbung zu dienen. Bereits in einem frühen Stadium der Erkrankung, wo mit<br />
okularen Methoden noch kein Schadbild feststellbar ist, ist mit der biophysikalischen Methode der Chlorophyllfluoreszenz<br />
bereits eine Schädigung nachweisbar. So war am Standort Leisel nur bei den Ergebnissen<br />
der Chlorophyllfluoreszenz und dem Enzym PEPC eine Korrelation zur Schadstufe zu finden.<br />
Bei der Untersuchung von Laubbäumen liegt eine grundsätzlich andere Situation vor. Eine Klassifizierung<br />
in Schadklassen ist aufgrund <strong>des</strong> noch unbekannten Einflusses von endogenen Faktoren, wie z.B. der Fruktifikation,<br />
auf den visuellen Zustand eines Laubbaums, sehr schwierig und wird sehr kontrovers diskutiert.<br />
Die Auswirkung von anthropogenen, klimatischen und edaphischen Faktoren läßt sich daher nur sehr schwer<br />
nachweisen. Auch mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenz ist, wie bei den Laubbaumstandorten Zierenberg<br />
und Merzalben gezeigt werden konnte, keine Korrelation bezüglich der okularen Schadeinteilung zu finden.<br />
Lediglich die Jahresgänge von qN und Φe deuten, unabhängig von der morphologischen Eingruppierung,<br />
eine Anpassung an die gegebenen Umwelteinflüße an.<br />
Eine weitere Möglichkeit, weshalb eine Schädigung bei Laubbäumen schwierig zu detektieren sein könnte,<br />
liegt im Faktor Zeit. Die Expositionszeit eines Laubblattes mit Schadgasen und anderen Stressoren könnte<br />
möglicherweise zu kurz sein, um eindeutige Schadsymptome zu zeigen.<br />
49
8.1.9 Untersuchungen über die Ursachen <strong>des</strong> ” Eichensterbens“ an drei Stieleichenbeständen<br />
(Quercus robur L.) im Westerwald<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Andreas Simon<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Nach dem heutigen Kenntnisstand handelt es sich beim Eichensterben um eine multifaktoriell bedingte<br />
Krankheit, die nicht auf einen einzelnen Schadfaktor zurückzuführen ist. Als mögliche Schadfaktoren kommen<br />
klimatische, biotische, anthropogene und standortbedingte Einflüsse in Frage. Ziel der vorliegenden<br />
Arbeit war es, die Rolle der diskutierten Schadfaktoren bzw. deren Zusammenwirkung zu untersuchen.<br />
Dazu wurden drei Eichenbestände im Westerwald ausgewählt, in denen es in den letzten Jahren zu einem<br />
gehäuften Absterben von Eichen gekommen ist. In diesen Beständen wurden biochemische, bodenkundliche,<br />
dendrochronologische, mykologische md mikroskopische Untersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen<br />
erstreckten sich über einen Zeitraum von zwei Vegetationsperioden, die okularen Schadansprachen<br />
wurden drei Jahre durchgeführt.<br />
Aufgrund der Ergebnisse der okularen Schadansprachen läßt sich in den Beständen von 1994 bis 1996 eine<br />
gewisse Erholungstendenz erkennen. Der durchschnittliche Blattverlust lag 1996 in allen drei Beständen<br />
unter 30 %. Die okularen Schadansprachen weisen weiterhin auf ein gutes Regenerationsvermögen der<br />
Eichen hin, da fast alle Bäume den Insektenfraß im Frühjahr 1996 bis zum Sommer nahezu vollständig<br />
kompensieren konnten.<br />
Die dendrochronologischen Untersuchungen gaben keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung von klimatischen<br />
Faktoren an der Eichenerkrankung in den untersuchten Beständen. Dagegen zeigten die Jahrringanalysen<br />
bei den abgestorbenen Bäumen bereits Jahre vor dem Absterbezeitpunkt deutliche Zuwachseinbrüche im<br />
Dickenwachstum. Der Zeitpunkt, an dem die Zuwachseinbrüche begannen, war bei allen abgestorbenen<br />
Bäumen unterschiedlich, so daß ein gemeinsamer Auslöser der Zuwachsdepression nicht zu erkennen war.<br />
Daneben waren die stark geschädigten und zum Untersuchungszeitpunkt abgestorbenen Bäume nicht mehr<br />
in der Lage, die günstigen Wachstumsbedingungen zu Beginn der neunziger Jahre zu nutzen.<br />
Die Bodenanalysen zeigen, daß die Bestände nicht auf Risikostandorten stocken. In allen drei Beständen<br />
ist keine übermäßige Bodenversauerung zu erkennen, die Basensättigung liegt in allen drei Beständen fast<br />
immer über 10 %. Lediglich der Bestand 17b zeigt eine etwas stärkere Tendenz zur Versauerung mit einer<br />
Basensättigung teilweise unter 10 %. Auch eine Belastung <strong>des</strong> Bodens durch hohe Schwermetallgehalte<br />
konnte nicht festgestellt werden.<br />
Alle drei Bestände zeigen in beiden Untersuchungsjahren schwache bis mangelhafte Magnesiumversorgung.<br />
Eine Düngung im Jahr vor Beginn der Untersuchungen hat bis jetzt keine deutliche Wirkung gezeigt.<br />
Die schwache Magnesiumversorgung konnte bei allen Eichen, unabhängig von ihrem Schädigungsgrad,<br />
diagnostiziert werden. Bei allen anderen Elementen ist die Nährstoffversorgung als gut bis sehr gut zu<br />
bezeichnen. Bei den meisten Elementen waren die Gehalte in der Schadklasse C niedriger als bei den<br />
Eichen mit einem geringeren Blattverlust. Allerdings lagen auch die Elementgehalte in der Schadklasse C<br />
mit Ausnahme von Magnesium nie im Mangelbereich. Die niedrigeren Gehalte in der Schadklasse C scheinen<br />
eher Folge denn Ursache der Erkrankung zu sein. Die Stickstoffversorgung der Blätter ist als optimal zu<br />
bezeichnen. Es läßt sich keine Überversorgung oder Mangelsituation feststellen. Die im Zusammenhang<br />
mit dem Eichensterben oft erwähnten hohen Stickstoffgehalte spielen in den untersuchten Beständen keine<br />
Rolle.<br />
Die Mineralstoffanalysen der Rindenproben lassen keine Kontaminationen der Bäume mit Schadstoffen<br />
durch Deposition auf der Rinde erkennen.<br />
Die Analysen der Phenolgehalte zeigten keine klaren Unterschiede zwischen geschädigten und nicht<br />
geschädigten Bäumen. Allerdings zeigten die stark geschädigten Bäume in beiden Untersuchungsjahren<br />
die niedrigsten Phenolgehalte in der Borke. Eine stärkere Gefährdung der geschädigten Eichen durch einen<br />
50
geringeren Gehalt an Abwehrsubstanzen im Bast gegen biotische Faktoren war dagegen nicht zu erkennen.<br />
Die Chlorophyllgehalte waren in den stark geschädigten Bäumen in beiden Untersuchungsjahren niedriger<br />
als bei weniger stark geschädigten Bäumen. Allerdings war auch bei diesen Eichen keine Chlorophyllmangelsituation<br />
auszumachen. Die schwachen Magnesiumgehalte haben sich nicht negativ auf die Chlorophyllgehalte<br />
ausgewirkt.<br />
Ein starker Befall mit biotischen Schädlingen konnte, mit Ausnahme der blattfressenden Insekten im<br />
Frühjahr, nicht diagnostiziert werden. Genaue Aussagen zur Bedeutung von Agrilus biguttatus und Befall<br />
durch Armillaria-Arten sind nicht möglich, weil dazu zu wenige Bäume untersucht wurden. Die durchgeführten<br />
Untersuchungen deuten auf eine geringe Beteiligung von Hallimasch und eine deutlich stärkere<br />
Beteiligung von Agrilus am Absterbeprozeß hin. Die aus dem Holz isolierten Pilze scheinen sämtlich einen<br />
sekundären Charakter zu haben, d.h. sie dürften lediglich schadverstärkende Wirkung haben.<br />
In den untersuchten Beständen traten im Untersuchungszeitraum als Schadfaktoren Kahlfraß durch Insekten<br />
mit anschließendem Mehltaubefall, Magnesiummangel und Befall mit dem Eichenprachtkäfer Agrilus<br />
biguttatus auf Ein deutlicher Zusammenhang dieser Faktoren untereinander oder in Bezug auf den Gesundheitszustand<br />
der Eichen war jedoch nicht zu erkennen. Ein Einfluß klimatischer oder standortbedingter<br />
Faktoren erscheint unwahrscheinlich. Insgesamt lassen die Untersuchungen keine klaren Ursachen <strong>für</strong> die<br />
Erkrankung einiger Eichen in den untersuchten Beständen erkennen. Dies dürfte in erster Linie daran liegen,<br />
daß sich die Bestände zu Beginn der Untersuchungen bereits wieder in einer Phase der Erholung befanden.<br />
Während <strong>des</strong> Untersuchungszeitraums waren in den Beständen nur noch zwei Eichen abgestorben. Die<br />
Ergebnisse der Untersuchungen lassen darauf schließen, daß auch im nächsten Jahr nicht mit größeren<br />
Abgängen zu rechnen ist, zumal auch die stark geschädigten Eichen teilweise eine deutliche Erholungstendenz<br />
zeigen. Offensichtlich haben unsere Untersuchungen zu spät eingesetzt, um das ” Eichensterben“,<br />
welches in den Beständen besonders in den Jahren 1991-1993 auftrat, direkt an davon betroffenen Eichen<br />
zu beobachten.<br />
8.1.10 Vergleichende Untersuchung zum Photosyntheseapparat an Fichten und Eichen unterschiedlicher<br />
Freilandstandorte im Zusammenhang mit den Neuartigen Waldschäden<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Petra Strobel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
In dieser Dissertationsarbeit wurden im Hinblick auf die Neuartigen Waldschäden zweijährige Fichtennadeln<br />
sowie Eichenblätter von vier verschiedenen Waldstandorten unter jeweils verschiedener Fragestellung<br />
untersucht. Da als Hauptauslöser inzwischen verstärkt Luftschadstoffe, insbesondere hohe Ozonkonzentrationen,<br />
in Verbindung mit Mineralstoffmangel und/oder extremen klimatischen Belastungen diskutiert<br />
werden, wurden Standorte mit hohen Ozonbelastungen sowie Nährstoffmangel ausgewählt.<br />
Um das maximale Ausmaß einer Schadausprägung festzustellen, wurden vergleichende Untersuchungen<br />
an einem phänotypisch ungeschädigten Fichtenkollektiv mit einem benachbarten, phänotypisch stark<br />
geschädigten Fichtenkollektiv durchgeführt. Die Wirkung von Luftschadstoffen wurde an zu Versuchsbeginn<br />
phänotypisch ungeschädigten Fichten in einem Schadgasausschluß-experiment mit Hilfe von Open-Top-<br />
Kammern untersucht. Es sollte zudem dadurch festgestellt werden, ob es sich bei den Untersuchungsparametern<br />
um Frühindikatoren handelt. Vergleichende Untersuchungen zwischen phänotypisch ungeschädigten<br />
und geschädigten Fichten bzw. Eichen auf benachbarten ungekalkten und gekalkten Versuchsflächen sollten<br />
aufzeigen, ob sich Eichen bezüglich der Schadausbildung wie Fichten verhalten und ob eine Kalkung<br />
eine geeignete Maßnahme zur Verbesserung <strong>des</strong> Zustan<strong>des</strong> der Waldbestände darstellt.<br />
Zur Untersuchung der physiologisch-biochemischen Hintergründe der an den betrachteten Standorten auftretenden<br />
Schäden wurden neben dem Chlorophyllgehalt Komponenten der photosynthetischen Elektronentransportkette<br />
(QB-Protein, Cyt b-559, Cyt f, Cyt b-563, P700) quantitativ bestimmt.<br />
51
An Standorten mit dem Schadbild der montanen Vergilbung zeigten sich bereits früh typische Veränderungen<br />
an den Thylakoidmembranen, die zu einer allgemeinen Schädigung <strong>des</strong> Baumes führen können. Es konnte<br />
aufgezeigt werden, daß nicht nur ein deutlicher Chlorophyllabbau, sondern auch eine Reduzierung im<br />
Gehalt verschiedener Redoxkomponenten (QB-Protein, Cyt f) vorliegt. Diese Veränderung im Gehalt der<br />
Redoxkomponenten kann über das Ausmaß <strong>des</strong> Chlorophyllabbaus hinausgehen. Dadurch ändert sich die<br />
Stöchiometrie in den Thylakoidmembranen. Das QB-Protein reagiert bereits frühzeitig relativ stark auf<br />
Schädigung, während der Gehalt an P700 auch in deutlich geschädigten Fichten nur im gleichen Verhältnis<br />
wie das Chlorophyll reduziert wird. Damit stellt das Verhältnis von PS II : PS 1 (QB-Protein : P700)<br />
einen guten Schadindikator dar. An Messungen <strong>des</strong> QB-Proteins und <strong>des</strong> Cyt f-Gehaltes konnte weiterhin<br />
festgestellt werden, daß diese Komponenten bereits auf Streß bzw. beginnende Schädigung reagieren, so<br />
daß sie frühzeitig eine Schädigung der Thylakoidmembranen anzeigen.<br />
Ozon in Kombination mit Magnesiummangel konnte als wichtiger Verursacher der Neuartigen Waldschäden<br />
bestätigt werden. Die Bäume scheinen allerdings hinsichtlich <strong>des</strong> Auftretens von Schäden einen gewissen<br />
” Schwellenwert“ zu besitzen. Unterhalb <strong>des</strong> Schwellenwertes finden sich nur wenige Stress- bzw. Schadreaktionen,<br />
oberhalb <strong>des</strong> Schwellenwertes zeigen die Pflanzen Schädigungen auf breiter physiologischer Basis.<br />
Dies gilt auch <strong>für</strong> die gemessenen Redoxkomponenten in den Thylakoidmembranen. Es ist anzunehmen,<br />
daß die Höhe <strong>des</strong> Schwellenwertes genetisch fixiert ist.<br />
In der Schadausprägung reagieren Eichen bezüglich ihres Photosyntheseapparates in vergleichbarer Weise<br />
wie Fichten. Die Schädigung <strong>des</strong> Photosyntheseapparates erfolgt frühzeitig. Zusammen mit dem Chlorophyllabbau<br />
findet - wie bei Fichten - eine Reduktion der Photosynthesekomponenten statt, wobei die<br />
gemessenen Parameter unterschiedlich stark von der Schädigung betroffen werden.<br />
Die durchgeführte Dolomitkalkung scheint bei einer schlechten Mineralversorgung im Mangelbereich nicht<br />
nur eine stabilisierende, sondern auch eine regenerierende Wirkung auf den Photosyntheseapparat und<br />
damit auf den Vitalitätszustand der Bäume zu besitzen. Die Kalkungswirkung tritt bei älteren Bäumen<br />
jedoch verzögert erst nach einigen Jahren auf.<br />
8.1.11 Biochemische Schadinidkation der neuartigen Waldschäden bei Fichten<br />
Bearbeiterin: Dr. Sabine Tietz-Siemer<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Im Sommer 1991 wurden in Nordrhein-Westfalen 20 Fichtenbestände hinsichtlich ihrer Schädigung untersucht.<br />
Das Schadausmaß wurde dabei neinerseits mit den okularen Kriterien der Waldschadenserhebung<br />
(Nadelverlust und Nadelvergilbung) und andererseits mit biochemischen Parametern in den Nadeln ermittelt.<br />
Diese als Biomarker bezeichneten biochemischen Parameter ändern sich gleichsinnig mit dem<br />
Schädigungsgrad der Bäume und stellen ein Maß <strong>für</strong> die Schädigung dar. Eine Gegenüberstellung der beiden<br />
Schadansprachen sollte zeigen, inwiefern Biomarker eine sinnvolle und notwendige Ergänzung <strong>für</strong> eine<br />
differenziertere Beurteilung der neuartigen Waldschäden bei Fichten darstellen.<br />
In den Nadeln der 20 Fichtenbestände wurden eine Reihe von physiologisch-biochemischen Parametern<br />
als Biomarker untersucht, die sich in zahlreichen Freilanduntersuchungen als geeignet erwiesen, den<br />
Schädigungsgrad der Bäume wiederzugeben. Dazu gehören u.a. der Gesamt-Chlorophyllgehalt, der Gehalt<br />
der Redoxkomponente Cytochrom f der photosynthetischen Elektronentransportkette in den Chloroplasten<br />
und der Magnesiumgehalt sowie die PEPC-Aktivität und die Gehalte an Putrescin und Ascorbat.<br />
Diese Parameter wurden in den 2-jährigen Nadeln der beernteten Fichten untersucht und der Schadstufe<br />
der Bäume, die in der jährlich durchgeführten Waldschadenserhebung der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland<br />
ermittelt wurden, gegenübergestellt.<br />
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, daß besonders die PEPC-Aktivität der Nadeln einen geeigneten<br />
Indikator <strong>für</strong> die Schädigung bei Fichten darstellt. Dieses Ergebnis wurde durch die vorliegenden Untersu-<br />
52
chungen bestätigt. So konnte eine Zunahme der PEPC-Aktivität in den Fichtennadeln mit zunehmender<br />
Schadstufe gefunden werden. Die Korrelation beider Parameter war signifikant (r = 0.6, s = 0.007).<br />
Ähnliche Korrelationen fanden sich auch <strong>für</strong> andere Biomarker. So nahm der Chlorophyllgehalt der Nadeln<br />
mit zunehmender Schadstufe der Fichten ab. Ebenso waren <strong>für</strong> die Magnesiumkonzentrationen in den<br />
Nadeln abnehmende Werte bei zunehmender Schadstufe der Fichten zu beobachten.<br />
Die Ergebnisse zeigen nochmals, daß diese als Biomarker eingesetzten physiologisch-biomechanischen Parameter<br />
den Schädigungsgrad der untersuchten Fichtenbestände wiederspiegeln. Im Gegensatz zu den okularen<br />
Kriterien Nadelverlust und Vergilbung, die lediglich eine Klassifizierung der Schäden in 5 Schadstufen<br />
erlauben, ist mit Hilfe der Biomarker eine wesentlich differenziertere Beurteilung <strong>des</strong> Schädigungsgra<strong>des</strong> der<br />
Fichten möglich. Zudem kann eine beginnende, äußerlich noch nicht sichtbare Schädigung mittels Biomarker<br />
erfaßt werden, da sich Stoffwechselveränderungen vor der sichtbaren Schädigung zeigen. Es erscheint<br />
daher sinnvoll, neben den okularen Kriterien physiologisch-biochemische Parameter heranzuziehen, um eine<br />
differenziertere Beurteilung der Waldschäden gewähleisten zu können.<br />
8.1.12 Untersuchungen zum molekularen Mechanismus der Photosystem II-Photoinhibition an<br />
Spinat (Spinacia oleracea L.)<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Helmut Tripp<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Ziel der vorliegenden Arbeit war die nähere Untersuchung der molekularen Vorgänge innerhalb <strong>des</strong> Reaktionszentrums<br />
II während Photoinhibition. Die Versuche konzentrierten sich auf die im Photosystem<br />
II von höheren Pflanzen und Algen vermutete proteolytische Aktivität. In Übereinstimmung mit diverser<br />
gegenwärtiger Literatur wurde von einer proteolytischen Spaltung <strong>des</strong> D1-Proteins aus dem Photosystem<br />
II im Bereich der Plastochinon QB-Bindenische während Photoinhibition ausgegangen.<br />
Zur Detektion der vermuteten Spaltstelle wurden Antikörper gegen die entsprechende Proteinregion hergestellt.<br />
Hierzu erfolgte eine Amplifizierung <strong>des</strong> korrespondierenden Abschnittes <strong>des</strong> psbA-Gens mittels PCR.<br />
Das erhaltene Genfragment wurde daraufhin in einen Expressionsvektor einkloniert. Das D1-Fragment<br />
wurde als Fusionsprotein zusammen mit dem bakteriellen Maltose-Bindeprotein exprimiert. Mit diesem<br />
Fusionsprotein wurden vier Kaninchen immunisiert.<br />
Entgegen der ursprünglichen Hypothese konnte keine proteolytische Spaltung <strong>des</strong> Dl-Proteins aus dem Reaktionszentrum<br />
während photoinhibitorischer Belichtung von Spinat-Thytakoiden detektiert werden. Dieser<br />
Befund steht im Gegensatz zu häufig formulierten Modellen über den D1-turn-over, deckt sich allerdings<br />
mit einer Reihe von Publikationen, die einer nachgewiesenen proteolytischen Aktivität innerhalb <strong>des</strong> Photosystems<br />
II eine regulatorische Funktion, unter Spaltung eines anderen, als <strong>des</strong> Dl-Proteins, beimessen.<br />
Es wurde allerdings eine Markierung <strong>des</strong> D1-Proteins im Zuge von Photoinhibition festgestellt, die zu einer<br />
Verminderung der Mobilität <strong>des</strong> Proteins im elektrischen Feld führte. Diese Proteinmodifikation wird mit der<br />
vermehrten Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies unter Starklicht in Zusammenhang gebracht. Die<br />
radikalische Proteinschädigung kann als ein wesentlicher Faktor angesehen werden, der das Polypeptid <strong>für</strong><br />
einen Abbau markiert. Diese proteolytische Dl-Degradation benötigt, nach den vorliegenden Ergebnissen,<br />
zusätzlich zu den thylakoidinternen noch weitere Faktoren.<br />
Die nachgewiesene proteolytische Aktivität konnte den Serin-Proteasen zugeordnet werden. Zusätzlich<br />
konnte gezeigt werden, daß die proteolytische Aktivität der Thylakoide und Grana konstitutiv ist und durch<br />
Licht in ihrer Wirkungsstärke nicht beeinflußt wird.<br />
Während kein direkter Abbau <strong>des</strong> D1-Proteins durch die gefundene(n) Protease(n) gezeigt werden konnte,<br />
ergaben sich aber Hinweise auf eine indirekte Beteiligung dieser proteolytischen Funktion an der Dl-<br />
Degradation. Die Bestimmungen der Atrazin-Bin<strong>des</strong>tellen innerhalb <strong>des</strong> PS II ergaben, daß eine Hem-<br />
53
mung der Protease(n) in einer strukturerhaltenden Wirkung <strong>des</strong> D1-Bereiches, der den Elektronencarrier<br />
Plastochinon (QB) sowie zahlreiche Herbizide bindet, resultiert. Ebenso war der photosynthetische Elektronentransport<br />
über die QB-Bin<strong>des</strong>telle nach Proteasehemmung deutlich gesteigert. Der nachgewiesenen<br />
proteolytischen Aktivität wird infolge<strong>des</strong>sen eine Beteiligung an der Aufrechterhaltung der QB-Bin<strong>des</strong>tellen-<br />
Konformation zugeschrieben. Der eigentliche Dl-Abbau erfolgte nicht durch die membrangebundene(n)<br />
Protease(n). Es wird in Übereinstimmung mit neueren Modellen zur D1-Degradation, demzufolge davon<br />
ausgegangen, daß weitere, höchstwahrscheinlich kerncodierte, stromale Faktoren <strong>für</strong> den Dl-Abbau<br />
erforderlich sind.<br />
8.1.13 Ethylenmetabolismus in Waldbäumen: Untersuchungen zum Gehalt an 1-Aminocyclopropan-Carboxylsäure<br />
(ACC), N - Malonylaminocyclopropan - Carboxylsäure (MACC) und<br />
zur Ethylenproduktion in unterschiedlich geschädigten Fichten, Tannen und Eiche<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Werner Wilksch<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Das Phytohormon Ethylen ist im Stoffwechsel <strong>für</strong> eine Vielzahl von Regulationen verantwortlich. Daneben<br />
hat es maßgeblichen Anteil an der Reaktion einer Pflanze auf von außen wirkenden Streß. Deswegen wird<br />
Ethylen als ” Streßhormon“ bezeichnet.<br />
Schädigungen an Waldbäumen sind oft auf Streß zurückzuführen, dem die Bäume ausgesetzt sind. Vorhergehende<br />
Arbeiten zum ACC- und MACC-Gehalt haben gezeigt, daß diese Parameter geeignet sind, den<br />
Schädigungszustand von Bäumen zu beschreiben.<br />
Mit dieser Arbeit wurde nun der Versuch unternommen, auch das Ethylen selbst in die Betrachtungen<br />
mit einzubeziehen. Bislang war es technisch sehr schwer, Ethylenmessungen an voll entwickelten Bäumen<br />
durchzuführen. Es wurde eine einfache, praktisch durchführbare Methode entwickelt, mit der das von<br />
einzelnen Astabschnitten produzierte Ethylen in einem statischen System gesammelt werden kann. Bei<br />
allen Nachteilen einem kontinuierlich arbeitenden System gegenüber bietet die Methode den Vorteil, daß die<br />
Meßwerte ohne großen materiellen und zeitlichen Aufwand gewonnen werden können. Die durchgeführten<br />
Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit standen zum einen in Zusammenhang mit einem breit angelegten<br />
Projekt, das den Versuch unternahm, die biochemische Schadensindikation als ein eigenständiges System<br />
neben der traditionellen okularen Schadensansprache einzusetzen, um diese zu ergänzen. Zum anderen<br />
wurde mit den Jahresgangmessungen aller drei Parameter versucht herauszufinden, inwieweit jahreszeitlich<br />
bedingte Schwankungen der drei Stoffe auftreten. Gleichzeitig wurden damit einige nähere Einblicke in<br />
Regulationsmechanismen der Parameter untereinander gewonnen.<br />
Jahresgang: Alle drei Parameter weisen in den untersuchten drei geschädigten und drei ungeschädigten<br />
Bäumen deutlich ausgeprägte Jahresgänge auf. Die Ethylenproduktion hat jeweils in der Zeit zwischen<br />
August und Oktober in jedem Baum ein ausgeprägtes ” Herbstmaximum“. Wahrend der Wintermonate<br />
November bis März befindet sich die Ethylenproduktion in allen Bäumen ausnahmslos auf einem sehr<br />
niedrigen Niveau. Zu Beginn <strong>des</strong> Frühlings ist ein Anstieg der Produktion festzustellen. Der ACC-Gehalt<br />
sank den Winter hindurch kontinuierlich ab, stieg im Frühjahr an, erreichte je nach Baum zwischen April und<br />
August ein Maximum, um dann wieder abzusinken. Insgesamt gesehen schwankten alle Bäume bezüglich<br />
ihres ACC-Gehaltes mit Ausnahme eines Ausreißers in einem bestimmten Bereich. Dabei pendelten die<br />
Gehalte in allen Bäumen über den gesamten Bereich.<br />
Der MACC-Gehalt in den Nadeln der untersuchten Bäume war im Gegensatz zu den anderen Parametern<br />
im Winter am höchsten. Während <strong>des</strong> Herbstes hatte eine Aufstockung <strong>des</strong> Gehaltes stattgefunden. Zu<br />
Beginn <strong>des</strong> Frühjahres wurde der MACC-Pool - vermutlich innerhalb sehr kurzer Zeit - wieder verkleinert,<br />
was mit einem Anstieg der Ethylen-Produktion einher geht.<br />
Die Betrachtung der Verhältnisse der Meßwerte aller drei Parameter eröffnete die Einsicht, daß der ACC-<br />
54
Pool bezogen auf die Ethylenproduktion während <strong>des</strong> Winters wesentlich größer ist als im restlichen Jahr.<br />
Zu dieser Jahreszeit ist im Pool wesentlich mehr ACC vorhanden, als <strong>für</strong> die Bildung <strong>des</strong> Ethylens, das in<br />
einer Stunde produziert wird, benötigt wird. In der restlichen Zeit <strong>des</strong> Jahres ist der Pool stets kleiner als<br />
<strong>für</strong> die Ethylenproduktion notwendig. Dies wird derart gedeutet, daß während <strong>des</strong> Sommers ein starker<br />
Fluß durch den Pool stattfindet und während <strong>des</strong> Winters, wenn wenig Ethylen abgegeben werden soll,<br />
<strong>des</strong>sen Produktion auch über die ACC-Oxidase gedrosselt wird. Gleichzeitig wird ein größerer Teil <strong>des</strong><br />
ACC aus diesem Pool zu MACC metabolisiert. Die Größe <strong>des</strong> MACC-Pools scheint dabei stärker von der<br />
Größe <strong>des</strong> ACC-Pools abzuhängen als von der Stärke <strong>des</strong> Flusses durch diesen Pool und damit von der<br />
Ethylen-Produktion.<br />
Die hier aufgenommenen Jahresgänge, spiegeln offensichtlich keine streßinduzierten Schwankungen wider,<br />
sondern beruhen lediglich auf endogenen und exogenen Faktoren wie Beeinflussung durch andere Hormone<br />
oder Tageslänge und Temperatur. Somit ist davon auszugehen, daß diese ermittelten Tagesgänge - zumin<strong>des</strong>t<br />
<strong>für</strong> diesen Standort - eine allgemeingültige Tatsache darstellen. Um das Phänomen zu generalisieren<br />
ist es natürlich nötig, Tagesgänge an anderen Standorten zu untersuchen.<br />
Okulare und Biochemische Schadensansprache bei Fichten und Weißtannen. Die gewonnenen Ergebnisse<br />
zeigen, daß alle drei hier untersuchten Parameter in der Lage sind, biochemische Veränderungen im Stoffwechsel<br />
<strong>des</strong> Baumes anzuzeigen. Stark geschädigte Bäume lassen sich dabei sehr gut von ungeschädigten<br />
unterscheiden. Dies gilt auch (bedingt) bei einzelner Betrachtung aller drei untersuchten Parameter. Eine<br />
genauere Differenzierung hinsichtlich einer beginnenden Auslenkung <strong>des</strong> Stoffwechsels aufgrund eines<br />
einwirkenden Stressors läßt sich bei dieser zeitlichen Auflösung allerdings kaum treffen. Vor allem die<br />
Parameter ACC-Gehalt und Ethylen-Produktion sind geeignet, Veränderungen, die der Baum erfährt, innerhalb<br />
kürzester Zeit erkennen zu lassen, doch setzt dies auch die entsprechende zeitliche Auflösung bei<br />
der Beerntung voraus.<br />
8.1.14 Molekularbiologische Untersuchungen der Multigenfamilie der Glutamin-Synthetase aus<br />
Brassica napus<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Siegfried Wojtyna<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Wild<br />
Die Kulturpflanze Raps (Brassica napus) benötigt beim Anbau relativ hohe Düngemitteleinsätze um maximale<br />
Saaterträge zu erzielen. Dabei wird weniger als 50 % der eingesetzten Stickstoffmenge in den Samen<br />
wiedergewonnen.<br />
Ansatzpunkt <strong>für</strong> molekulargenetische Verbesserungen zur Stickstoffverwertungseffizienz ist das Schlüsselenzym<br />
der Stickstoffassimilation, die Glutamin-Synthetase. Der über die Bodenlösung aufgenommene Stickstoff<br />
wird durch die Glutamin-Synthetase in organische Verbindungen überführt, wobei vor allem die cytosolischen<br />
Isoformen der GS eine entscheidende Rolle spielen.<br />
Ziel dieser Promotion ist es, die Gene <strong>für</strong> min<strong>des</strong>tens zwei Paare der GS-Isoformen über eine Genbank in<br />
ihrer Sequenz aufzuschlüsseln und zu charakterisieren. Anhand dieser Ergebnisse ist es in Zukunft vielleicht<br />
möglich, den Stickstoffeinsatz auf dem Feld zu minimieren - bei gleichzeitiger Sicherung <strong>des</strong> Ernteertrages.<br />
Bereits abgeschlossene Arbeiten:<br />
• Erstellung einer Phagenbank<br />
• Screenen der Phagenbank mit spezifischen Ribosonden<br />
• Isolierung der GS-haltigen Klone<br />
• Subklonierung der GS-Fragmente in ein geeignetes Vektorsystem, als Voraussetzung einer sich anschließenden<br />
Sequenzierung der GS-Fragmente.<br />
55
• Sequenzierung zweier Gene, codierend <strong>für</strong> die plastidäre Isoform L1 (einschließlich Promotor- und<br />
Terminatorregion) und die cytosolische Isoform R2-1 (Promotorregion, 1. Exon und 1. Intron fehlen)<br />
• Erstellung einer Cosmidbank<br />
Da mannigfaltige Schwierigkeiten mit dem Phagensystem auftraten (Restriktionen, Amplifizierung der Phagen,<br />
Isolation der Phagen-DNA, Subklonierung, Stabilität der Phagen), wurde die Erstellung einer Cosmidbank<br />
vorgenommen. Da Cosmide doppelt so große DNA-Fragmente aufnehmen können, halbiert sich die<br />
Anzahl der Klone in der Bank. Die Komplexität der Bank reduziert sich und das darauffolgende Screenen<br />
der Klone vereinfacht sich. Zur Sequenzierung sind keine Subklonierungen notwendig, da direkt aus dem<br />
Cosmid heraus sequenziert werden kann. Des weiteren sind Cosmide ähnlich einfach in ihrer Handhabung<br />
wie Plasmide.<br />
Zukünftige Arbeiten:<br />
• Vollständige Sequenzierung und Charakterisierung der Gene <strong>für</strong> die plastidären Isoformen L1 und L2<br />
und <strong>für</strong> das cytosolische Pärchen R2-1 und R2-2.<br />
• Vergleiche untereinander und mit verwandten Arten wie Arabidopsis thaliana.<br />
8.1.15 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
BAUR, M., LAUCHERT, U., WILD, A.: Biochemical indicators for novel forest decline in spruce. Chemosphere<br />
36, 865-870 (1998).<br />
DIETZ, B., MOORS, I., FLAMMERSFELD, U., RÜHLE, W., WILD, A.: Investigation on the photosynthetic<br />
membranes of spruce needles in relation to the occurrence of novel forest decline. I. The photosynthetic<br />
electron transport. Z. Naturforsch. 43c (Biosciences 43), 581-588 (1988).<br />
KAUS, A., SCHMITT, V., SIMON, A., WILD, A.: Microscopical and mycological investigations on wood<br />
of pedunculate oak (Quercus robur L.) relative to the occurrence of oak decline. J. Plant Physiol. 148,<br />
302-308 (1996).<br />
KAUS, A., WILD, A.: Nutrient disturbance through manganese accumulation in Douglas fir. Chemosphere<br />
36, 961-964 (1998).<br />
KAUS, A., WILD, A.: Physiologische Aspekte der Erkrankung der Douglasie (Pseudotsuga menziesii var.<br />
viridis). Mitteilungen der Forstlichen Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz 41/97, 117-127 (1997).<br />
KURZ, C., SCHMIEDEN, U., STROBEL, P., WILD, A.: The combined effect of CO2, ozone, and drought<br />
on the radical scavenging system of young oak trees (Quercus petraea) - A phytotron study. Chemosphere<br />
36, 783-788 (1998)<br />
LAUCHERT, U., WILD, A.: Studies on the correlation of putrescine and potassium content on the needles<br />
of spruce trees. J. Plant. Physiol. 147, 267-269 (1995)<br />
OCHS, G., SCHOCK, G., TRISCHLER, M., KOSEMUND, K., WILD, A.: Complexity and expression of the<br />
glutamine synthetase multigene family in the amphidiploid crop Brassica napus. Plant Molecular Biology,<br />
39, 395-405 (1999).<br />
OCHS, G., SCHOCK, G., WILD, A.: Chloroplastic glutamine synthetase from Brassica napus. Plant<br />
Physiol. 103, 303-304 (1993).<br />
OCHS, G., SCHOCK, G., WILD, A.: Purification and characterization of glutamine synthetase isoenzymes<br />
from leaves and roots of Brassica napus (L.). J. Plant Physiol. 147, 1-8 (1995)<br />
PEUSER, D., WILD, A.: Umweltsimulation. Nachr. Chem. Tech. Lab. 44, 289-294 (1996).<br />
56
PEUSER, D., WILD, A.: Umweltsimulation mit dem PC. Verein der Forschungsingenieure 4, 23-31 (1996).<br />
PEUSER, D., LENZ, C:, WILD, A.: Umweltsimulation <strong>für</strong> Pflanzen in Klimakammern: eine kostengünstige<br />
Lösung mittels industrieller Standardsoftware und eines selbstentwickelten CO2-Analysators. Forschungsmagazin<br />
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Sonderausgabe aus Anlaß der Hannover Messe, S.<br />
34-42, März/April 1995.<br />
SCHMITT, V., SCHEUERMANN, R., WILD, A.: Auswirkungen einer Düngemaßnahme auf physiologische<br />
und biochemische Parameter unterschiedlich geschädigter Fichten an der Umweltkontrollstation Idar-<br />
Oberstein. In: Mitteilungen aus der Forstlichen Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz, Nr: 32, S. 90-105.<br />
Ministerium <strong>für</strong> Landwirtschat, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (1995) (ISSN 0931-9662).<br />
SCHMADEL-HAGEBÖLLING, H.E., ENGEL, C., SCHMITT, V., WILD, A.: The combined effects of CO2,<br />
ozone, and drought on Rubisco and nitrogen metabolism of young oak trees (Quercus petraea) - A phytotron<br />
study. Chemosphere 36, 789-794 (1998).<br />
SCHOCK, G., OCHS, G., WILD, A.: Glutamine synthetase from roots of Brassica napus. Nucleotide<br />
sequence of a cytosolic isoform. Plant Physiol. 105, 757-758 (1994).<br />
SCHULZ, H., WEIDNER, M., BAUR, M., LAUCHERT, U., SCHMITT, V., SCHROER, B., WILD, A.:<br />
Recognition of air pollution stress on Norway spruce (Picea abies L.) on the basis of multivariate analysis<br />
of biochemical parameters: a model field study. Angew. Bot. 70, 19-27 (1996).<br />
SIMON, A., WILD, A.: Auswirkungen verschiedener Futterpflanzen auf die Entwicklung von Schwammspinnerraupen.<br />
Mitteilungen aus der Forstlichen Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz, 45, 14-26 (1999).<br />
SIMON, A., WILD, A.: Mineral nutrients in leaves and bast of pedunculate oak (Quercus robur L.) at<br />
different states of defoliation. Chemosphere 36, 955-959 (1998).<br />
SIMON, A., WILD, A.: Untersuchungen zum Mineralstoff-, Phenol- und Chlorophyllgehalt in Blatt und<br />
Rinde von unterschiedlich stark geschädigten Stieleichen (Quercus robur). In: Wulf, A. und Kehr, R.:<br />
Eichensterben in Deutschland: Situation, Ursachenforschung und Bewertung. Mitteilungen aus der Biologischen<br />
Bun<strong>des</strong>anstalt <strong>für</strong> Land- und Forstwirtschaft BerlinDahlem, Heft 318, Seite 99-114. Parey Buchverlag,<br />
Berlin (1996). ISSN 0067-5849, ISBN 3-8263-3123-0.<br />
TIETZ, S., WILD, A.: Phosphoenolpyruvate carboxylase activity and malate content of spruce needles of<br />
healthy and damaged trees at three mountain sites. Biochem. Physiol. Pflanzen 187, 273-282 (1991).<br />
TIETZ, S., SCHNEIDER, S., GILL, J., WILD, A.: Die PEPC-Aktivität als biochemischer Indikator <strong>für</strong> den<br />
Schädigungsgrad bei Fichten. UWSF (Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung) - Z. Umweltchem.<br />
Ökotox. 3, 206-209 (1991).<br />
TIETZ, S., WILD, A.: Die PEPC-Aktivität als Schadindikator in Fichtennadeln. UWSF (Umweltwissenschaften<br />
und Schadstoff-Forschung) - Z. Umweltchem. Ökotox. 2, 197-198 (1990).<br />
TIETZ, S., WILD, A.: Investigations on the phosphoenolpyruvate carboxylase activity of spruce needles<br />
relative to the occurrence of novel forest decline. J. Plant Physiol. 137, 327-31 (1991).<br />
TRIPP, H., REILÄNDER, H., WILD, A.: A rapid method for amplification of plastome DNA-fragments<br />
from Spinacia oleracea by PCR. J. Plant Physiol. 142, 115-116 (1993).<br />
TRIPP, H., WIELAND, A., RICHTER, M., WILD, A.: Photoinhibition involves the shift of subunit D1<br />
to a higher molecular weight rather than protein cleavage in isolated spinach thylakoids. Plant Physiol.<br />
Biochem. special issue (lOth FESPP congress, Italy), 112-113 (1996).<br />
WILD, A., DIETZ, B., FLAMMERSFELD, U., MOORS, I.: Comparative investigations on the photosynthetic<br />
electron transport chain of spruce (Picea abies) with different degrees of damage in the,open air.<br />
In. Air Pollution and Ecosystems, pp. 754-759, P. Mathy (ed)., Proceedings symposium from 18th to<br />
22nd May 1987 in Grenoble. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Boston, Lancaster, Tokyo (ISBN<br />
57
90-277-2611-6) 1988.<br />
WILD, A., FLAMMERSFELD, U., DIETZ, B., MOORS, I., RÜHLE, W.: Investigation on the photosynthetic<br />
membranes of spruce needles in relation to the occurrence of novel forest decline. II. The content of QBprotein,<br />
cytochrome f, and P-700. Z. Naturforsch. 43c (Biosciences 43), 589-595 (1988).<br />
WILD, A., TIETZ, S.: Physiological and cytomorphological investigations of undamaged and damaged<br />
spruce in the Northern Black Forest. In: 7. Statuskolloquium <strong>des</strong> PEF vom 5.-7. März 1991 im Kernforschungszentrum<br />
Karlsruhe, KFK-PEF 80, pp. 93-107, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1991.<br />
WILD, A., TIETZ, S.: Untersuchung der Phosphoenolpyruvat-Carboxylase bei Fichten in Open-Top-<br />
Kammern. In: Oben Offene Experimentierkammern am Edelmannshof, 1. Bericht. KfK-PEF 76, S.<br />
163-172, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe 1991.<br />
WILD, A., TIETZ-SIEMER, S., FLAMMERSFELD, U.: Unter-suchungen über primäre latente Wirkungen<br />
von Automobilabgasen auf die Photosynthesemembranen und den Metabolismus von Pflanzen unter definierten<br />
Bedingungen in Expositionskammern. Forschungsbericht Bun<strong>des</strong>ministerium <strong>für</strong> Forschung und<br />
Technologie (BMFT), Förderkennzeichen 0339190 C. BMFT (1992).<br />
WILD, A., TIETZ-SIEMER, S.: Physiological and cytomorphological investigations of undamaged and<br />
damaged spruce trees in the northern Black Forest. In: 8. Statuskolloquium <strong>des</strong> PEF vom 17.-19. März<br />
1992 im Kernforschungszentrum Karlsruhe, KfK-PEF 94, 47-59 (1992).<br />
WILD, A., SCHMITT, V., TIETZ-SIEMER, S.: Biochemische Schadindikation der Neuartigen Waldschäden<br />
bei Fichten. PEPC-Kataster Nordrhein-Westfalen. Forschungsberichte zum. Forschungsprogramm <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen ” Luftverunreinigungen und Waldschäden“, Nr. 36, 1994 (ISSN 0934-5124).<br />
WILD, A., FLAMMERSFELD, U., TIETZ, S.: Untersuchung der Thylakoidmembran (P-700 und Cytochrom<br />
f) und der Phosphoenolpyruvat-Carboxylase bei Fichten in Open-Top-Kammern. In: 5. Statuskolloquium<br />
<strong>des</strong> PEF vom 7.-9. März 1989 im Kernforschungszentrum Karlsruhe, KfK-PEF 50, pp. 247-257,<br />
Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, 1989.<br />
WILD, A., FLAMMERSFELD, U., TIETZ, S.: Investigation of the thylakoid membrane (P-700 and cytochrome<br />
f) and the phosphoenolpyruvate-carboxylase of Norway spruce in open-top-chambers. In: 6.<br />
Statuskolloquium. <strong>des</strong> PEF vom 6.-8. März 1990 im Kernforschungszentrum. Karlsruhe, KFK-PEF 61,<br />
pp. 231-243, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, 1990.<br />
WILD, A., SCHMITT, V., EIS, U., STROBEL, P., WILKSCH, W., WOHLFAHRT, S.: Okulare und biochemische<br />
Schadensdiagnose bei Fichten und Weißtannen. Ein Vergleich beider Diagnoseverfahren an Dauerbeobachtungsflächen<br />
in Baden-Württemberg. Forschungszentrum Karlsruhe - Projekt ” Europäisches Forschungszentrum<br />
<strong>für</strong> Maßnahmen zur Luftreinhaltung“, FZKA-PEF 149, D-76021 Karlsruhe, FRG (1996).<br />
ISSN: 0948-535 X (Buch).<br />
WILD, A., STROBEL, P., FLAMMERSFELD, U.: Studies of components of the thylakoid membrane of<br />
undamaged and damaged spruce trees at different mountain sites. Z. Naturforsch. c (Biosciences) 48c,<br />
911-922 (1993).<br />
WILD, A., STROBEL, P., SIEMER, S., FLAMMERSFELD, U.: Studies on redox components of the thylakoid<br />
membrane and on the activities of phosphoenolpyruvate carboxylase and glutamate dehydrogenase of<br />
spruce in an open-top chamber experiment. In: Bittlingmaier, L.: Air pollutant exclusion experiment with<br />
spruce trees at Edelmannshof: Physiological and biochemical investigations, pp. 103-132. Forschungszentrum<br />
Karlsruhe, PEF-Projekt ” Europäisches Forschungszentrum <strong>für</strong> Maßnahmen zur Luftreinhaltung“,<br />
FZKA-PEF 164 (1997). ISSN 0948-535X.<br />
WILD, A., TIETZ-SIEMER, S., RICHTER, C., SCHMITT, V., STROBEL, P.: Physiologische, biochemische<br />
und cytomorphologische Untersuchugen an immissionsgeschädigten Fichten im Zusammenhang mit den<br />
neuartigen Waldschäden an einem Standort im Nordschwarzwald (Staatswald Freudenstadt). In: Bittling-<br />
58
maier, L., Reinhardt, W., Siefermann-Harms, D. (Herausgeber): Waldschäden im Schwarzwald. Ergebnisse<br />
einer interdisziplinären Freilandstudie zur montanen Vergilbung am Standort Freudenstadt/Schöllkopf, S.<br />
204-255. Ecomed, 86899 Landsberg (1995) (ISBN: 3-609-69470-X).<br />
WILKSCH, W., WOHLFAHRT, S., STROBEL, P., WILD, A.: Diagnosis of damage to Norway spruce (Picea<br />
abies) through ethylene and other biochemical criteria. In: Garab, G. (Ed.): Photosynthesis: Mechanisms<br />
and Effects, Vol. IV, pp. 2749-2752. Proc. XIth Intern. Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary),<br />
August 17-22, 1998. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London (1998).<br />
WILKSCH, W., SCHMITT, V., WILD, A. Ehtylene biosynthesis in conifers: investigations on the emission<br />
of ethylene and the content of ACC and MACC in Norway spruce (Picea abies) and silver fir (Abies alba).<br />
Chemosphere, 36, 883-888 (1998).<br />
YANG, C., WILKSCH, W., WILD, A.: 1-Aminocyclopropane-l-Carboxylase acid, its malonyl conjugate and<br />
1-Aminocyclopropane-1-carboxylase synthase activity in needles of damaged and undamaged Norway spruce<br />
trees. J. Plant Physiol. 143, 389-395 (1994).<br />
ZHU, H., WILD, A.: Changes in the content of chlorophyll and redox components of the thylakoid membrane<br />
during development and senescence of beech (Fagus sylvatica) leaves. Z. Naturforsch. 50 c, 69-76<br />
(1995).<br />
8.2 Analyse <strong>des</strong> Photosyntheseapparates und biochemische Charakterisierung phototropher<br />
Algen<br />
Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik)<br />
8.2.1 In-Vivo Chlorophyll a-fluoreszenz von einzelligen Algen zur quantitativen Erfassung von<br />
Herbiziden in Wasser<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Roswitha Conrad<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm<br />
Der Algenfluoreszenztest ist ein schnelles und kostengünstiges Biotestsystem, das auf der Basis der Chl<br />
a in-vivo Fluoreszenz einzelliger Algen <strong>für</strong> die summative Erfassung ökonomisch und ökologisch relevanter<br />
PSII-Herbizide konzipiert wurde. Eine hohe Selektivität <strong>für</strong> die PSII-spezifischen Schadstoffe wird<br />
gewährleistet durch das PAM Fluorometer, das aus dem Gesamtfluoreszenzsignal der Probe selektiv den<br />
Fluoreszenzanteil erfaßt, der durch die Bindung der PSII-Herbizide an die PSII-Reaktionszentren verursacht<br />
wird. Hohe Meßwertschwankungen, wie sie in biologischen Systemen üblicherweise auftreten, werden<br />
minimiert durch die gezielte Berücksichtigung physiologischer Prozesse und Parameter, die im intakten<br />
Testorganismus eine unspezifische Veränderung <strong>des</strong> herbizid-sensitiven Fluoreszensignals bewirken. Die<br />
einzelnen Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
• Als Testorganismus im Algenfluoreszenztest wurde die einzellige Grünalge Chlorella fusca verwendet.<br />
Maximale Sensitivität erhält man mit 14 Tage alten Zellsuspensionen, einem Chlorophyllgehalt von<br />
250 mg/l und einer Suspensionstemperatur von 14 ◦ C.<br />
• Die im Algenfluoreszenztest experimentell ermittelten Dosis-Response-Kurven <strong>für</strong> DCMU, Atrazin und<br />
Simazin konnten auf der Basis der Hill-Gleichung mathematisch formuliert werden. DCMU zeigte mit<br />
einer in-vivo Hemmkonstante (I50-Wert) von 0.9 µmM eine geringfügig höhere inhibitorische Aktivität<br />
als die Triazine mit I50-Werten von 2.2 M (Simazin) bzw. 3.3 µM (Atrazin). Die Nachweisgrenzen<br />
<strong>des</strong> Algenfluoreszenztests liegen entsprechend bei 48 µg/l <strong>für</strong> DCMU und bei 98 µg/l respektive 180<br />
µg/l <strong>für</strong> Atrazin und Simazin. Die Fehler schwanken im Meßbereich zwischen 10 % und 20 %.<br />
59
• Zum Nachweis von PSII-Herbiziden im Bereich der von der TrinkwV vorgegebenen Pestizid-Grenzwert<br />
von 100 ng/l bzw. 500 ng/l sind Voranreicherungen unerläßlich. Die Festphasenreaktion erwies sich<br />
als eine geeignete Methode zur effizienten Anreicherung von PSII-Herbiziden aus wässrigen Systemen.<br />
Für 0.25 nM und 2.5 nM Herbizidproben wurden Wiederfindungsraten von 70 - 116 % bestimmt,<br />
wobei maximale Anreicherungsfaktoren von 3333 erzielt werden konnten. Die Nachweisgrenzen <strong>des</strong><br />
Algenfluoreszenztests sinken dadurch auf Werte von 28.8 ng/l (DCMU), 58.8 ng/l (Simazin) und<br />
64.9 ng/l (Atrazin). Durch die Kopplung <strong>des</strong> Algenfluoreszenztests mit der Festphasenreaktion steigt<br />
der durchschnittliche Fehler im getesteten Konzentrationsbereich auf ca. 30 %.<br />
• In komplexen Freilandwässern unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung konnten durch die<br />
Verknüpfung Algenfluoreszenztests und Festphasenreaktion Kontaminationen mit PSII-spezifischen<br />
Schadstoffen im Bereich der Pestizid-Grenzwerte summativ erfaßt werden. Die Ergebnisse <strong>des</strong> Algenfluoreszenztests<br />
zeigen eine tendenzielle Übereinstimmung mit den entsprechenden Daten der<br />
chromatographischen Pestizidanalyse, so daß eine grobe qualitative Einordnung der untersuchten<br />
Proben in nicht oder gering belastete (
anorganischen Kohlenstoff bzw. dem C:N Verhältnis im Medium beeinflußt wird und eine entscheidende<br />
Rolle bei der DMSP Produktion durch marine Algen spielt.<br />
8.2.3 Die Wirkung von UV-B Strahlen auf die Produktivität der Planktonalge Phaeodactylum<br />
tricornutum im Vergleich zur Wirkung von starkem Weißlicht: Hemmeffekte auf den Phytosyntheseapparat<br />
Bearbeiterin: Dipl-Biol. Bettina Kaiser<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm<br />
Ziel dieser Arbeit war es, die Wirkungsmechanismen der UV-B-Strahlung anhand simultaner Sauerstoffund<br />
Fluoreszenzmessungen zu charakterisieren und die Interaktion von photosynthetisch aktiver Strahlung<br />
und <strong>des</strong> UV-Lichts zu erfassen. Dazu wurden Schwachlicht-Kulturen der Diatomee Phaeodactylum tricornutum<br />
verschiedenen Bestrahlungsprogrammen ausgesetzt, in denen unterschiedliche UV- und Weißlichtintensitäten<br />
kombiniert waren. Die Intensität von UV1 entsprach dabei einem 3 bis 15%igen Rückgang der<br />
stratosphärischen Ozonkonzentration, während UV2 einem 50 bis 70%igen Rückgang nahe kommt. Weiterhin<br />
sollte die Präadaption an Starklicht, sowie an Starklichtimpulse mit und ohne UV-Anteil hinsichtlich<br />
ihrer Auswirkungen auf den UV-B Effekt untersucht werden.<br />
Die alleinige UV-B Wirkung führt zu Störungen in der Excitonenübertragung von der Antenne zum Reaktionszentrum<br />
und einem Atmungsrückgang. In Kombination mit Starklicht scheint die UV-B Wirkung zum<br />
Teil anderen Mechanismen zu unterliegen, wobei möglicherweise die Entstehung toxischer Sauerstoffspezies<br />
gefördert wird. Im Rahmen der Starklichtanpassung einer Phaeodactylum-Kultur wird vermutlich die<br />
Konzentration der Sauerstoff-Scavenger-Systeme erhöht. Dies könnte die Ursache der verringerten UV-<br />
Sensitivität von Starklicht-Kulturen im Vergleich zu Schwachlicht-Kulturen darstellen. Starklichtimpulse<br />
während der Anzucht reichen aus, um die Entwicklung photoprotektiver Mechanismen zu fördern, obwohl<br />
keine ausgeprägte HL-Anpassung stattfindet. Werden die Starklichtimpulse zusammen mit einem geringen<br />
UV-Anteil appliziert, wird die Ausbildung photoprotektiver Mechanismen weder verhindert noch gefördert.<br />
Die Existenz spezieller, nur durch UV-Licht induzierbarer Schutzmechanismen vor UV-B Strahlung ist in<br />
Phaeodactylum tricornutum nicht feststellbar.<br />
Die Auswirkungen der zunehmenden UV-B Strahlung auf die Produktivität <strong>des</strong> Phytoplanktons werden<br />
möglicherweise unterschätzt, da eine UV-B bedingte Verzögerung <strong>des</strong> Recoverys, der Atmungsrückgang und<br />
die ausgeprägte UV-Empfindlichkeit von Schwachlicht-adaptierten Phytoplanktern nicht berücksichtigt werden.<br />
Dadurch wird auch die Aussagekraft von Klimamodellen relativiert, welche auf Daten zur Abschätzung<br />
der Produktivität zurückgreifen, die diese Effekte nicht berücksichtigen können.<br />
8.2.4 Physiologische Charakterisierung von Planktonalgen aus unterschiedlichen Expositionstiefen<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Martin Lohr<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm<br />
Zahlreiche Laboruntersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß der pflanzliche Organismus in der<br />
Lage ist, seinen Photosyntheseapparat an die herrschenden Lichtbedingungen anzupassen. In Gewässer<br />
steht die Aktivität <strong>des</strong> Phytoplankton in einem direkten Zusammenhang mit den Kreisläufen der Makround<br />
Mikroelemente. Für die Abschätzung der Umsätze der Stoffkreisläufe ist daher die Kenntnis der Photosyntheseleistung<br />
der Phytoplankter von entscheidender Bedeutung. Von besonderem Interesse ist dabei<br />
die Untersuchung der Reaktionen der Zellen auf ein überoptimales Lichtangebot (Photoinhibition). Aus Laboruntersuchungen<br />
ist bekannt, daß der Photosyntheseapparat bei einem Überangebot von Licht, zunächst<br />
Photosystem II inaktiviert, dann abbaut und parallel dazu bestimmte Carotinoide synthetisiert, die in der<br />
61
Lage sind, die absorbierte Lichtenergie in Wärme zu überführen. Diese physiologischen Regulationsmechanismen<br />
hängen jedoch vom Adaptationszustand der Zellen ab, der vom Licht selbst getriggert wird. Es ist<br />
daher interessant zu untersuchen, wie unter wechselnden Lichtbedingungen, diese Anpassungsmechanismen<br />
ausgeprägt werden.<br />
Herr Lohr hat dies in zwei verschiedenen experimentellen Zugängen realisiert. Er hat zum einen im Labor<br />
rhythmische Lichtdunkelwechsel bei einem veränderten Nährstoffangebot durchgeführt und die Reaktionen<br />
der Zellen unter diesen Bedingungen studiert. Er hat zweitens die Zellen in einem natürlichen Lichtklima<br />
ausgesetzt und dann solcherart angepaßte Zellen hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Lichtstress untersucht.<br />
Es zeigte sich bei den Laborexperimenten, daß rhythmische Photoinhibition im Langzeitexperiment (über<br />
mehrere Tage) die Produktivität kaum negativ beeinflußt, da die Zellen Resistenzmechanismen entwickeln,<br />
die zu einer schnellen Wiedererholung führen. Versuche, die Primärproduktion auf der Grundlage von Gaswechselmessungen<br />
zu quantifizieren, zeigen eine aussichtsreiche Perspektive. Produktionsabschätzungen<br />
allein auf der Grundlage von Fluoreszenzmessungen scheinen bestenfalls relativ aber keinesfalls absolut<br />
möglich zu sein. Die Ergebnisse der Laborexperimente sind in zwei Publikationen niedergelegt (Wilhelm et<br />
al. 1994, Wilhelm et al. 1995).<br />
8.2.5 Molekulare Analyse <strong>des</strong> Photosyntheseapparates von Phytoplanktonalgen unter freilandnahen<br />
Bedingungen<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Anna-Maria Müller<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm<br />
Zielsetzung der Untersuchung war es, die Adaptation <strong>des</strong> Photosyntheseapparates der Diatomee Phaeodactylum<br />
tricornutum an die natürlichen Licht- und Temperaturbedingungen im Freiland auf physiologischer<br />
und molekularer Ebene zu charakterisieren und die Reaktionen auf künstliche photoinhibitorische Belichtung<br />
zu testen. Vergleichend dazu sollte die Adaptation dieser Alge an die konstanten Licht- und Temperaturbedingungen<br />
im Labor untersucht werden. Dazu wurden im Labor vorkultivierte und physiologisch definierte<br />
Algenkulturen in drei verschiedene Systeme überführt. Zwei Ansätze verblieben im Labor und adaptierten<br />
jeweils an konstante HL- und LL-Bedingungen. In einem Ansatz befanden sich die Algen in Maarwasser,<br />
im anderen im Nährmedium der Algen. Der dritte Ansatz, in dem die Algen ebenfalls in Maarwasser<br />
überimpft waren, wurde in drei verschiedene Teile <strong>des</strong> Meerfelder Maars exponiert. Insgesamt wurden vier<br />
Freilandexpositionen unter verschiedenen Lichtklimata durchgeführt.<br />
Unter naturnahen Freilandbedingungen adaptierte Algen zeigten ausgeprägte Adaptationen an die gegebenen<br />
Lichtintensitäten. Drastische Unterschiede hinsichtlich der Adaptation ergaben sich zwischen ” rein“<br />
Starklicht-adaptierten und ” rein“ Schwachlicht-adaptierten Freilandalgen. An Starklichtbedingungen im<br />
Freiland adaptierte Algen zeichneten sich durch eine hohe Sensitivität gegenüber Starklichtbestrahlung<br />
aus. Schon nach kurzer inhibitorischer Belichtung senkten sie ihre Fluoreszenzemission und Sauerstoffproduktion<br />
bei 18.9 W/m 2 dramatisch. Nach Abklingen der Belichtung war dieser zustand innerhalb kurzer<br />
Zeit umkehrbar. Zum Zeitpunkt, an dem die fluoreszenzemission vollständig regeneriert war, hatte sich die<br />
Sauerstoffproduktion bei der genannten lichtintensität noch nicht vollkommen erholt. Fluoreszenzquenching<br />
und -recovery gingen in diesen Algen einher mit der Hin- und Rückumwandlung das Xanthophyllzykluspigmente<br />
Diadinoxanthin und Diatoxanthin. Algen, die an abgeschwächtere Lichtbedingungen adaptierten,<br />
reagierten hinsichtlich Fluoreszenzemission, Sauerstoffproduktion bei 18.9 W/m 2 und Umwandlung der<br />
Xanthophyllzykluspigmente weniger sensitiv. in Starklichtalgen fiel sowohl die Poolgröße der Xanthophyllzykluspigmente<br />
als auch deren Umwandlungsrate auf photoinhibitorische Belichtung sehr viel höher aus als<br />
in Schwachlichtalgen. Darüber hinaus verfügten Starklichtalgen über einen höheren α-Tocopherolgehalt als<br />
Schwachlichtalgen. Algen, die im Maarwasser im Labor gewachsen waren, bildeten auf inhibitorische Belichtung<br />
im HL nur geringfügig (1.2-fach) mehr Diatoxanthin als im LL. Unter vergleichbaren, aber schwankenden<br />
Lichtintensitäten im Freiland gewachsene Algen bildeten dagegen im HL 3.6-fach mehr Diatoxanthin<br />
62
als im LL. Dieser Befund spricht <strong>für</strong> einen Trainingseffekt <strong>des</strong> Photosyntheseapparates im Freiland, der vor<br />
allem auf die dort wechselnden Lichtbedingungen zurückgeführt werden muß. Algen, die im Nährmedium<br />
im Labor adaptierten, bildeten im HL auf inhibitorische Belichtung 2.2-fach mehr Diatoxanthin als im LL.<br />
Dies verdeutlicht, daß die Adaptation der Algen im Nährmedium im Vergleich zur Adaptation im Maarwasser<br />
die Bildung von Diatoxanthin auf photoinhibitorische Belichtung fördert. Die Ergebnisse zeigen, daß<br />
der Xanthophyllzyklus als Schutzmechanismus vor Photoinhibition im Freiland eine wichtige Rolle spielt.<br />
Sowohl die Poolgröße als auch die Schnelligkeit der Umwandlung der Pigmente (Wirksamkeit) sind unter<br />
Starklichtbedingungen erhöht. Ein deutlicher Verbrauch an α-Tocopherol auf inhibitorische Belichtung<br />
trat nur in denjenigen Fällen auf, die während ihrer Adaptation zunächst Starklichtintensitäten und dann<br />
Schwachlichtintensitäten ausgesetzt waren.<br />
Trotz der entwickelten und effizient arbeitenden Schutzsyteme, die - wie gezeigt werden konnte - Freilandalgen<br />
unter Starklichtintensitäten effektiv vor einem Photoschaden bewahren, erlitten reine Starklichtalgen<br />
gegenüber Algen, die unter gemäßigteren Lichtintensitäten wuchsen, einen geringfügigen Produktionsverlust.<br />
8.2.6 Untersuchung der Auswirkungen von UV-B und hoher Lichtstrahlung auf die Produktivität<br />
<strong>des</strong> Phytoplanktons<br />
Bearbeiterin: Dr. Anna-Maria Müller<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. C. Wilhelm<br />
Das Thema steht in engem Zusammenhang mit dem Kohlenstoffkreislauf der Erde, der auf dem Hintergrund<br />
der zukünftigen Klimaentwicklung besondere Relevanz besitzt. Aus bisherigen Ergebnissen ist bekannt, daß<br />
die Primärproduzenten ein erhebliches Anpassungspotential an wechselnde Lichtbedingungen haben, das<br />
im Freiland sogar stärker ausgeprägt ist als unter Laborbedingungen. Die molekularen Mechanismen, die<br />
von den Zellen benutzt werden, um schädliche Wirkungen durch überoptimales Licht oder UV-B Strahlung<br />
abzuwehren, sind vielfältig. In letzter Zeit wird in der Literatur der sogenannte Xantophyllzyklus diskutiert.<br />
So konnte an Laborkulturen gezeigt werden, daß bei Lichtüberschuß das Pigment Diadinoxanthin in Diatoxanthin<br />
umgewandelt wird und infolge dieser Konversion die absorbierte Lichtenergie als Wärmeenergie<br />
dissipiert werden kann. Unter diesen Bedingungen sinkt die Quantenausbeute der Photosynthese und das<br />
absorbierte Licht ist nicht oder nur sehr viel weniger effizient produktionswirksam. Es ist jedoch nicht klar,<br />
• in welchem quantitativen Verhältnis die Leistungsfähigkeit dieses Zyklus mit der Produktivität steht,<br />
• wie die Aktivität dieses Zyklus im Freiland durch Lichtstreß beeinflußt wird,<br />
• ob die Wirksamkeit der Wärmedissipation vom Verhältnis der beiden Pigmente oder von der absoluten<br />
Konzentration an Diatoxanthin abhängt.<br />
Sollte der zweite Fall zutreffen, so wäre die Diatoxanthinmenge ein sicherer Indikator <strong>für</strong> den Lichtstreßzustand<br />
der Zellen und <strong>für</strong> eine niedrige Quantenausbeute der Photosynthese. Diese Fragen können in einer<br />
Freilandexposition gezielt angegangen werden. Aufbauend auf den methodischen Verbesserungen und neuen<br />
Meßmöglichkeiten, die im Rahmen der Dissertation von Herrn Lohr etabliert wurden, wurde folgen<strong>des</strong><br />
Experiment durchgeführt:<br />
Im Labor vorkultivierte Kulturen wurden im Freiland in verschiedenen Tiefen <strong>für</strong> mehrere Tage exponiert bis<br />
sich die Zellzahl etwa verdoppelt hat. Nach dieser Zeit sind die Zellen an das Lichtklima adaptiert. Während<br />
der Exposition wurden Lichtintensität und Temperatur in-situ quasi-kontinuierlich gemessen. Von den Zellen<br />
wurden Produktion, Absorptionseigenschaften sowie die Photosynthesekapazität (mittels Fluoreszenz) und<br />
die Xantophyllzykluspigmente untersucht. Danach wurden die Zellen photoinhibitorischem Licht ausgesetzt<br />
und die Diatoxanthinsyntheseleistung der Kulturen aus den verschiedenen Expositionstiefen in der Zeit<br />
63
verfolgt. Der aus dem innerhalb von drei Monaten abgewickelten Experiment gewonnene Datensatz sowie<br />
die zuvor gewonnenen Ergebnisse wurden <strong>für</strong> eine Veröffentlichung aufbereitet.<br />
8.2.7 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Hilse, C., Wilhelm, C., Kesselmeier, J., Johnston, A.M. and Raven, J.A. (2000): DMSP production of the<br />
nanoalga Prymnesium parvum dependent on environmental factors and the photosynthetic activity of the<br />
cells. In preparation.<br />
Kesselmeier, J., Bartell, U., Blezinger, S., Conze, W., Gries, C., Hilse, C., Hofmann, R., Hofmann, U.,<br />
Hubert, A., Kuhn, U., Meixner, F., Merk, L., Nash, T.H. III, Protoschill-Krebs, G., Velmecke, F., Wilhelm,<br />
C., Andreae, M.O. (1997): Exchange of reduced sulfur compounds between the biosphere and the atmosphere.<br />
In: Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the Troposphere (P. Borrell, P.M.<br />
Borrell, T. Cvitas, K. Kelly and W. Seiler, eds.) Vol 4, Biosphere-Atmosphere Exchange of Pollutants and<br />
Trace Substances ( J. Slanina, ed.) pp 320-326, Springer Verlag, Heidelberg.<br />
Wilhelm, C., Bida, J., Domin,A., Hilse, C., Kaiser, B., Kesselmeier, J., Lohr, M. and Müller, A.M. (1997):<br />
Interaction between global climate change and the physiological responses of algae. Photosynthetica 33,<br />
491-503.<br />
8.3 Ökotoxikologie<br />
Univ.-Prof. Dr. R. Nagel und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Zoologie)<br />
8.3.1 Bioakkumulation und Metabolismus von γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (Lindan) und<br />
2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure (Dichlorprop) beim Regenwurm Lumbricus rubellus<br />
(Oligochaeta, Lunbricidea).<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Christine Füll<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Nagel<br />
Regenwürmer präsentieren einen quantitativ und qualitativ sehr bedeutenden Teil der Bodenfauna und<br />
sind in ihrem Lebensraum einer Vielzahl an Umweltchemikalien ausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit<br />
wurde ein geeignetes Testsystem zur Untersuchung der Bioakkumulation und <strong>des</strong> Metabolismus bei terrestrischen<br />
Organismen entwickelt. Die Regenwürmer der Art L. rubellus wurden dabei mit kontaminierter<br />
OECD-Erde exponiert. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe der Tracertechnik und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie<br />
durchgeführt.<br />
Bei den Versuchen zur Aufnahmekinetik von 14 C-Lindan und 14 C-Dichlorpop wurden jeweils zwei verschiedene<br />
Konzentrationen eingesetzt. Die 14 C-Aktivität im Boden blieb während der gesamten Versuchszeit<br />
konstant. Wird im Verlauf einer Aufnahmekinetik ein Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Elimination<br />
erreicht, so läßt sich aus dem Quotienten der Konzentrationen im Tier und der Umgebung ein sogenannter<br />
Biokonzentrationsfaktor (BCF) berechnen. Dieser ist bei Fischen in einem log Pow-Bereich von 0-6 linear<br />
mit der Lipophilie der Substanz korreliert. Ein Gleichgewichtszustand wurde weder im Falle von Lindan,<br />
noch von Dichlorpop erreicht. Es konnten daher nur Anreicherungsfaktoren (AF) ermittelt werden. Bezogen<br />
auf die jeweiligen Frischgewichte (FG) von Tier und Erde ergab sich ein AF <strong>für</strong> 14 C-Lindan von ca.<br />
6 (43 d). Die Ermittlung der AF kann aber nur unter Verwendung verschiedener Bezugsgrößen erfolgen.<br />
So ergeben sich beispielsweise bei Normierung auf Wurm-FG und Bodenwasser-Konzentration AF von bis<br />
zu 3000, die in ihrer Größenordnung durchaus vergleichbar sind mit AF (bzw. BCF) aquatischer Organismen.<br />
Bezogen auf FG/FG ergaben sich <strong>für</strong> 14 C-Dichlorpop ein AF von ca. 15 (56 d). Vergleicht man die<br />
jeweiligen AF bezogen auf Konzentrationen von FG/FG, so liegen die Werte <strong>für</strong> 14 C-Dichlorpop um ca.<br />
64
Faktor zwei über denen <strong>des</strong> lipophileren 14 C-Lindans; bei Bezug auf FG- und Bodenwasserkonzentration<br />
sind sie jedoch 20 - 30 mal niedriger. Lindan wird also, obgleich lipophiler, je nach Bezugssystem weniger<br />
stark angereichert. Untersuchungen zur Elimination ergaben, daß bei beiden Substanzen die zuvor aufgenommene<br />
14 C-Aktivität vollständig in den Würmern verblieb. Ein Fütterungsversuch mit 14 C-Dichlorpop<br />
zeigte, daß eine intestinale Aufnahme <strong>des</strong> Fremdstoffes stattfand, wenngleich ihr Anteil an der gesamten<br />
Bioakkumulation gering war.<br />
Mit Hilfe der Metabolismus-Untersuchungen konnte eine Differenzierung der in der OECD-Erde und den<br />
Regenwürmern gemessenen Radioaktivität in Ursubstanz und gebildete Metabolite erfolgen. Im Versuch<br />
mit Lindan konnten in der Erde zu keinem Zeitpunkt Metbolite nachgewiesen werden, während sich in den<br />
Wurmextrakten Metabolite fanden, die polarer als Lindan sind. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte eine AF<br />
<strong>für</strong> die Ursubstanz von Lindan von ca. 1,4 berechnet werden. Im Versuch mit Dichlorpop konnte in der<br />
Erde der Hauptmetabolit <strong>des</strong> Dichlorpops, 2,4-Dichlorphenol nachgewiesen werden. In den Regenwürmern<br />
war der prozentuale Anteil an Dichlorpop und 2,4-DCP vergleichsweise gering. Den Hauptanteil an der<br />
extrahierten 14 C-Aktivität stellte ein polarer Metabolit. Enzymatische und saure Hydrolysen der Wurmextrakte<br />
deuten darauf hin, daß es sich dabei um min<strong>des</strong>tens zwei verschiedene Konjugate handelt. Anhand<br />
dieser Ergebnisse wurde <strong>für</strong> die Ursubstanz Dichlorpop ein AF (14 d) von 0,4 berechnet.<br />
Insgesamt konnte gezeigt werden, daß Lumbricus rubellus sowohl das lipophile Lindan als auch das weniger<br />
lipophile Dichlorpop aufnehmen, anreichern und metabolisieren kann. Aufgrund der fehlenden Elimination<br />
von Ursubstanz und deren Metaboliten wird eine einmal erfolgte Belastung mehr oder weniger konserviert.<br />
Die entwickelte Methode ist als Testsystem <strong>für</strong> die Prüfung der Bioakkumulation von Umweltchemikalien<br />
bei Regenwürmern gut geeignet.<br />
8.3.2 Toxikokinetik von Umweltchemikalien mit unterschiedlichen Wirkmechanismen bei der Regenbogenforelle<br />
(Oncorhynchus mykiss)<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Renate Hryk<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Nagel<br />
Zum besseren Verständnis der Beziehungen zwischen Toxikokinetik und Toxikodynamik von Umweltchemikalien<br />
bei Fischen wurden Aufnahme, Verteilung, Anreicherung, Metabolismus und Elimination von<br />
drei Substanzen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen untersucht. Die Versuche zum Metabolismus<br />
der 14C-markierten Testsubstanzen erfolgten mit Hilfe der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Zum<br />
Nachweis der Ursubstanzen und der gebildeten Metabolite im Haltungswasser und in den Fischen wurden<br />
Extraktionsmethoden und Trennbedingungen erarbeitet, die eine quantitative und qualitative Erfassung<br />
ermöglichen.<br />
Für das polare Narkotikum 3,4-Dichloranilin betrug der Biokonzentrationsfaktor (BCF) 23. Die Biotransformation<br />
erfolgte überwiegend durch Konjugation in Form einer N-Acetylierung zu 3,4-Dichloracetanilid.<br />
Ferner wurde ein weiterer metabolit detektiert, <strong>des</strong>sen Identifizierung noch aussteht. Es liegen Anhaltspunkte<br />
vor, daß es sich um das Phase I-Produkt 3,4-Dichlorphenylhydroxylamin handelt. Bis auf die dreifache<br />
Anreicherung <strong>des</strong> 3,4-Dichloracetanilid im Gehirn der Fische traten keine Unterschiede in der Verteilung von<br />
Ursubstanz und Metaboliten auf. Die stärkste Akkumulation erfolgte in der Galle, der Leber und im Darm<br />
der Fische. 3,4-Dichloanilin und die gebildeten Metabolite wurden innerhalb von 48 h in unbelastetem<br />
Wasser nahezu vollständig ausgeschieden.<br />
2,4-Dinitrophenol, ein Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung, lag bei dem gegebenen pH-Wert <strong>des</strong><br />
Haltungswassers in dissoziierter Form vor. Daher wurde diese Substanz sehr langsam aufgenommen und der<br />
BCF betrug lediglich 0.9. Die überwiegende Akkumulation in der Galle deutet auf eine biliäre Elimination<br />
hin. Bedingt durch den hohen Ionisationsgrad fand keine Metabolisierung von 2,4-Dinitrophenol statt.<br />
Innerhalb von 48 h wurden 95 % der ursprünglich aufgenommenen Substanzmenge wieder ausge- schieden.<br />
65
Ein BCF von 32 wurde <strong>für</strong> den Acetylcholinesterase-Hemmer Methylparathion ermittelt. Oxidation, Dearylierung<br />
und Nitroreduktion sind die wichtigsten metabolischen Reaktionen. Der prozentuale Anteil <strong>des</strong><br />
Metaboliten Methylparaoxon war im Vergleich zu 4-Nitrophenol und p-Aminophenol wesentlich geringer.<br />
Die Unterschiede in der Lipophilie zwischen Methylparathion und den gebildeten Metaboliten wirkten sich<br />
entscheidend auf die Verteilung in den Fischen aus. Während im Filet über 80 % der Gesamtmenge als<br />
Ursubstanz vorlagen, betrug der Anteil im Verdauungstrakt nur noch etwa 10 %. Methylparathion und die<br />
gebildeten Metabolite wurden von den Fischen sehr schnell ausgeschieden (t 1/2 = 1.4 h).<br />
Die toxikokinetischen Parameter der untersuchten Testsubstanzen zeigten Unterschiede in der Aufnahme,<br />
Anreicherung, Verteilung, Metabolisierung und Elimination. Nach subletaler Applikation resultierten daraus<br />
unterschiedliche interne konzentrationen. Unter Berücksichtigung der kinetischen Prozesse wurden<br />
letale Körperdosen kalkuliert. Für 3,4-Dichloranilin und Methylparathion lagen die Werte bei 380 und 450<br />
µmol/kg. Die kalkulierten Letaldosen von Methylparaoxon, dem eigentlichen Hemmer der AChE und von<br />
dem Entkoppler 2,4-Dinitrophenol lagen um den Faktor 30 unter den Dosen von 3,4-Dichloranilin und Methylparathion,<br />
die als unspezifisch wirkende polare Narkotika eingestuft werden können. Die Kalkulation<br />
letaler Körperdosen unter Berücksichtigung der Toxikokinetik liefert Hinweise auf das Vorliegen spezifischer<br />
Wirkmechanismen und stellt ein gutes Maß <strong>für</strong> die Abschätzung der akuten Toxizität dar, die in der<br />
Reihenfolge Methylparaoxon < 2,4-Dinitrophenol < 3,4-Dichloranilin < Methylparathion abnimmt.<br />
8.3.3 Bioakkumulation und Verteilung von 3,4-Dichloranilin und α-Endosulfan im aquatischen<br />
Laborsystem: ein Vergleich zwischen Einzelspezies- und Mikrokosmos-Experimenten.<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Achim Schmitz<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Nagel<br />
Für die Bewertung der Anreicherung von Umweltchemikalien in aquatischen Organismen werden zur Zeit<br />
überwiegend Ergebnisse aus Untersuchungen mit Fischen herangezogen. Diese Vorgehensweise wirft die<br />
Frage nach der Übertragbarkeit der Daten auf andere Wasserorganismen, sowie auf komplexere Bedingungen<br />
im Freiland auf. Vor diesem Hintergrund wurden Einzelspezies- und Mikrokosmos-Experimente mit<br />
den Modellsubstanzen 3,4-Dichloranilin und α-Endosulfan durchgeführt. Die Verwendung der Tracertechnik<br />
machte Untersuchungen zum Metabolismus mittels Hochleistungsflüssigkeitschomatographie (HPLC)<br />
notwendig. Hierzu mußten Extraktionsmethoden und Trennsysteme <strong>für</strong> den Nachweis der Metabolite in<br />
Organismen und Haltungswasser entwickelt werden.<br />
Die toxikokinetischen Parameter zur Aufnahme, Metabolisierung, Anreicherung und Elimination von 3,4-<br />
Dichloranilin wurden an den aquatischen Invertebraten Daphnia magna, Asellus aquaticus, Planorbarius<br />
corneus, Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri und Lumbricus variegatus, sowie bei den submersen<br />
Makrophyten Ceratophyllum demersum und Elodea canadensis in Einzelspezies-Tests untersucht.<br />
Die Biokonzentrationsfaktoren (BCF) auf Basis der 14 C-Aktivität betrugen 113 (Ceratophyllum demersum),<br />
79 (E. canadensis), 29 (D. magna), 28 (A. aquaticus), 15 (P. corneus), 35 (T. tubifex), 30 (L. hoffmeisteri)<br />
und 800 (L. variegatus). Die, auf die Ursubstanz bezogenen BCF lagen erwartungsgemäß niedriger, als die<br />
auf die Gesamtradioaktivität basierenden Werte. Die Untersuchungen zur Elimination in fremdstofffreiem<br />
Wasser ergaben z.T. hohe Restradioaktivitäten in den Organismen. So konnten bei Versuchsende (264<br />
h) noch 72 % der zu Beginn der Elimination enthaltenen 14 C-Aktivität im Oliogochaeten L. variegatus<br />
nachgewiesen werden.<br />
Zur Untersuchung der Bioakkumulation unter komplexen, naturnahen Bedingungen wurde ein Aquarienmikrokosmos<br />
mit einem Gesamtvolumen von 40 Litern etabliert. Die Überprüfung der Stabilität in vier Parallelansätzen<br />
über einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten ergab eine hohe Übereinstimmung bezüglich<br />
der wasserchemischen Parameter, sowie der qualitativen Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften.<br />
Die aus der Literatur bekannten BCF von 3,4-DCA und α-Endosulfan bei Fischen unterscheiden sich zum<br />
66
Teil um Größenordnungen von den in der vorliegenden Arbeit ermittelten BCF <strong>für</strong> andere aquatische Organismen.<br />
Für beide Substanzen ist eine Übertragung der Daten weder von Fischen auf Invertebraten, noch<br />
von einer Invertebratenspezies auf die andere möglich. Insbesondere <strong>für</strong> das mittelpolare 3,4-DCA wird<br />
die Bioakkumulationsneigung in Invertebraten und Makrophyten bei Anwendung <strong>des</strong> üblichen Bewertungsschemas<br />
unterschätzt.<br />
Die im Rahmen der Arbeit etablierten Mikrokosmen bieten die Möglichkeit zur zeitgleichen Untersuchung<br />
von Bioakkumulationsvorgängen bei mehreren Tier- und Pflanzenspezies unter vergleichsweise naturnahen<br />
Bedingungen. Darüber hinaus liefern die Systeme Informationen zur Verteilung und zum Verbleib der<br />
Testsubstanzen.<br />
8.3.4 Qualifizierung und Quantifizierung von Fremdstoffen in Wasser und Fischen aus unterschiedlich<br />
belasteten Gewässern mittels Gaschromatographie / Massenspektroskopie<br />
Bearbeiter: Dr. Thomas Ternes. Dr. Michael Engel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Nagel<br />
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Folgeprojekt zur Dissertation von Herrn Ternes, das von Herrn<br />
Dr. Ternes begonnen und von Herrn Dr. Engel fortgesetzt und abgeschlossen wurde.<br />
Von den insgesamt 61 im Rahmen <strong>des</strong> Disserationsprojektes untersuchten Substanzen konnten lediglich die<br />
mittelpolaren Herbizide im Wasser nachgewiesen werden. Die Konzentrationen lagen <strong>für</strong> die 13 Herbizide<br />
zwischen 1 und 157 ng/l. Bildet man die Summe, so zeigt sich, daß der Hegbachsee mit 520 ng/l deutlich<br />
stärker belastet ist, als der Neuhofer Altrhein (57 ng/l) und die drei Maare (17 - 33 ng/l). Da in den Fischen<br />
eine Vielzahl von lipophilen Substanzen nachgewiesen werden konnte, deren Konzentrationen im Wasser<br />
unter der Nachweisgrenze lagen, können Fische <strong>für</strong> solche Chemikalien als Expositionsmonitor dienen.<br />
Von Schwermetallen und lipophilen Chemikalien ist jedoch bekannt, daß sie sich im Sediment von Gewässern<br />
anreichern können. Im Rahmen <strong>des</strong> Postdoktoranden-Projektes wurde <strong>des</strong>halb geprüft, ob dies auch <strong>für</strong><br />
mittelpolare Substanzen gilt. Hierzu wurden ” clean-up“-Methoden entwickelt, die eine Bestimmung der<br />
Triazine, Carbonsäureamide und Phenylharnstoff-Derivate im ppt-Bereich ermöglichen. Um diese niedrigen<br />
Nachweis- grenzen zu gewährleisten, müssen Anreicherungsfaktoren zwischen 1000 und 10000 vorliegen.<br />
Zur Detektion wurde ein Gaschromatograph mit massenselektivem Detektor verwendet.<br />
Mit den ausgearbeiteten Methoden wurde das Sediment <strong>des</strong> Mombacher Leitgrabens in Mainz untersucht.<br />
Nach Abschluß <strong>des</strong> Projektes sowie einer zeitgleich durchgeführten Diplomarbeit im Fachbereich Biologie,<br />
die sich mit der Belastung <strong>des</strong> Wassers und der Stichlinge aus diesem Graben befasste, liegen erstmals <strong>für</strong><br />
ein kleineres Fließgewässer diejenigen Informationen vor, die <strong>für</strong> eine Bewertung der Gesamtbelastung mit<br />
organischen Chemikalien notwendig sind.<br />
8.3.5 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Füll, C. und R. Nagel (1994): Bioaccumulation of Lindane (γ-HCH) and Dichlorprop (2,4-DP) by Earthworms<br />
(Lumbricus rubellus). Abstract book of the Third European Conference on Ecotoxicology (SE-<br />
COTOX), 1994, Zürich.<br />
Nagel, R. (1990): Ökotoxikologie- Eine junge Wissenschaft mit hohem Anspruch Biologie in unserer Zeit<br />
20 (6), 299-304<br />
Nagel, R. (1992): Ecotoxicology - an emerging Science. In: Braunbeck, Segner und Hanke (Edit.) Fish in<br />
ecotoxicology and ecophysiology, VCH Verlagsgesellschaft<br />
Oertel, D., Poethke, H.-J., Seitz, A., Schäfers. C. and R. Nagel (1991): Monte-Carlo-Simulation of the<br />
population dynamics of zebrafish in a complex experimental system. Verh. Ges. Ökologie, 20/2, 865-869<br />
67
Schäfers, C., D. Oertel und R. Nagel (1992): Effects of 3,4-Dichloroaniline on Fish Populations with<br />
differing strategies of reproduction. In: Braunbeck, Segner und Hanke (Edit.) Fish in ecotoxicology and<br />
ecophysiology, VCH Verlagsgesellschaft<br />
Schmitz, A. und R. Nagel (1995): Influence of 3,4-Dichloranilin on benthic invertebrats in indoor experimental<br />
streams. Ecotoxicol. Environ. Safety 30 (1), 63-71.<br />
8.4 Populationsbiologie<br />
Univ.-Prof. Dr. A. Seitz und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Zoologie)<br />
8.4.1 Entwicklung eines Schätzverfahrens <strong>für</strong> die effektive Populationsgröße einer räumlich strukturierten<br />
Population<br />
Bearbeiterin: Dr. Eva-Maria Griebeler<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
Die effektive Größe einer Population hat sowohl in der Populationsgenetik als auch in der Naturschutzbiologie<br />
eine zentrale Bedeutung, da der Verlust an genetischer Variabilität umgekehrt proportional zu<br />
ihrem Wert ist. Die effektive Größe einer Population wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt, z.B.<br />
der Fluktuation der Populationsgröße, von Unterschieden im Fortpflanzungserfolg einzelner Individuen, der<br />
Mutation oder von Genfluß. Von den in der Literatur existierenden Schätzverfahren werden aber immer nur<br />
einzelne Faktoren berücksichtigt. Zum Vergleich der Güte dieser Methoden im Kontext von natürlicheren<br />
Populationen wurde von mir ein stochastisches individuenbasiertes Simulationsmodell entwickelt. Es modelliert<br />
eine einfache monözische diploide Art mit nicht-überlappender Generationsfolge und stochastischem<br />
logistischem Wachstum in den Populationen. Die Simulation der zeitlichen Entwicklung einer Population<br />
ermöglicht die Berechnung der exakten effektiven Populationsgröße zu einem beliebigen Zeitpunkt, die ich<br />
dann mit den von den untersuchten Schätzverfahren berechneten Werten verglichen habe.<br />
Es zeigte sich, daß die in der Literatur existierenden Methoden relativ schlechte Schätzwerte der effektiven<br />
Populationsgröße liefern, falls die von ihnen angenommenen Voraussetzungen in einer Population verletzt<br />
sind. Neben diesen Schwierigkeiten bei der Schätzung der effektiven Populationsgröße, die aus der Nicht-<br />
Erfülltheit der von den jeweiligen Modellen angenommen Rahmenbedingungen resultieren, zeigte sich, daß<br />
auch rein statistische Faktoren einen sehr großen Einfluß auf die Güte der Schätzung von Verfahren, die<br />
auf genetischen Daten basieren, besitzen. So können verschiedene Genorte aufgrund von Zufallsprozessen<br />
(genetische Drift, Mutation etc.) unterschiedliche Schätzwerte liefern und es ist daher die Untersuchung<br />
einer Min<strong>des</strong>tanzahl Genorte erforderlich, um gute Schätzungen zu erhalten. Auch der Polymorphiegrad der<br />
Genorte, der durch die Wahl <strong>des</strong> molekularen Markers vorgegeben wird und die Stichprobengröße besitzen<br />
einen sehr starken Einfluß auf die Güte der Schätzwerte. Insgesamt definieren diese beiden Variablen<br />
den Wertebereich aller auf Heterozygotiewerten basierender Schätzer. Während Schätzer der eigenvalue<br />
und variance effective population size <strong>für</strong> die Praxis unrealistische Stichprobengrößen und Anzahlen von<br />
untersuchten Genorten <strong>für</strong> vergleichsweise gute Schätzungen benötigten, liefern die Schätzer der inbreeding<br />
effective size wesentlich bessere Ergebnisse unter realistischen Untersuchungsbedingungen (10 Genorte,<br />
25 Individuen). Nur dann, wenn alle Voraussetzungen der Schätzer tatsächlich erfüllt sind, dürfen die<br />
Schätzwerte aber quantitativ interpretiert werden. Ansonsten ist nur eine qualitative Interpretation sinnvoll.<br />
8.4.2 Modellierung strukturierter Insektenpopulationen. Ein vereinfachter Ansatz im Rahmen<br />
der standardisierten Populationsprognose<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Andreas Heidenreich<br />
68
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
In diesem Projekt wurde ein Simulationswerkzeug zur Gefährdungsanalyse von räumlich strukturierten Insektenpopulationen,<br />
SISP, entwickelt. Dieses Modell basiert auf der von Poethke et al. (1996) vorgeschlagenen<br />
Kombination der Formulierung <strong>des</strong> logistischen Wachstums nach Maynard Smith und Slatkin (1973)<br />
mit dem, den Inzidenzmodellen von Hanski (1994) zugrunde liegenden Migrationsmodell. Es wurde individuenbasiert<br />
umgesetzt, um auch demographische Stochastizität abzubilden. Da eine Praxisanwendung<br />
von SISP erzielt werden sollte, wurde das Simulationswerkzeug mit einem Datenbankhintergrund versehen,<br />
in den umfangreiches Recherchematerial zu den Modellparametern <strong>für</strong> verschiedene arten einfloß. Zudem<br />
wurde eine komfortable Benutzeroberfläche geschaffen, die auch internetfähig ist.<br />
Eine detaillierte Fehleruntersuchung <strong>des</strong> Simulationswerkzeugs umfaßte zunächst eine Prüfung der unterschiedlichen<br />
Funktionen anhand von Testfällen. Es konnte dadurch gezeigt werden, daß das Simulationsmodell<br />
in der Lage ist eine große Zahl unterschiedlicher Szenarien korrekt abzubilden.<br />
Die Untersuchung der Fehlerbereiche, die aus technisch bedingten Ungenauigkeiten und aus der Methodik<br />
der Parameterschätzung resultieren, zeigte allerdings, daß die Fehler <strong>für</strong> einen Praxiseinsatz deutlich zu groß<br />
sind. Damit konnte die Kritik von Ludwig (1999) an der Parametergewinnung aus Zeitreihen bestätigt<br />
werden. Ungünstigerweise zeigte eine Sensitivitätsanalyse <strong>des</strong> populationsgenetischen Modells, daß es<br />
Bereiche sehr hoher Sensitivität im Parameterraum gibt. Die dennoch durchgeführten Praxistests zeigten,<br />
daß das Simulationswerkzeug, abgesehen von den technischen Problemen, einsetzbar ist. Allerdings ist eine<br />
intensive Beratung der Anwender nötig. Als Fazit muß akzeptiert werden, daß das entwickelte Modell zwar<br />
einsetzbar ist, aber aufgrund der Unsicherheit der Modellparameter und der fehlenden Validierbarkeit noch<br />
nicht die erforderliche Sicherheit und Genauigkeit erbringen kann.<br />
8.4.3 Untersuchung von genetischen Austauschprozessen bei der Ausbreitung und Evolution von<br />
periodisch-sozialen und sozialen Spinnen der Familie Eresidae<br />
Bearbeiter: Dr. Jes Johannesen<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
Cooperative behaviour may evolve by enhancing the genetic identity of group members. Increased group<br />
identity is thought to be the basis for the ” subsocial route“ of social evolution in the spider family Eresidae.<br />
Two processes may promote the coalescence of individuals within populations or breeding groups, namely<br />
philopatry in stable environments and founder events in a stochastic environment. We show that both<br />
processes led to genetic differentiation within and among populations of the subsocial spider Stegodyphus<br />
lineatus. Spiders were investigated by means of allozyme electrophoresis for population genetic structure in<br />
three relatively stable patches and at three environmentally unstable sites. Within the former three sites,<br />
each population was substructured into groups found in different trees and showed evidence of philopatry<br />
and isolation by distance. In contrast, there was no indication of isolation by distance among all six<br />
investigated sites. We were able to discriminate tree groups consisting of sibs and non-sibs, respectively.<br />
Different gene coancestries within groups resulted in unequal sampling leading to high variance among<br />
single locus data, and confounded the within-population differentiation estimates. These results imply that<br />
sex-specific dispersal behaviour (random male mating-dispersal or female group founding) had different<br />
impacts on the population structure.<br />
8.4.4 Genetische Variabilität bei Bachforellen (Salmo trutta forma fario) in Rheinland - Pfalz<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Harald Kleisinger<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
In der Arbeit wurden Bachforellenpopulationen aus dem Hunsrück, dem Taunus, dem Westerwald, dem<br />
69
Spessart, dem Gebiet der in die Ostsee mündenden Warnow und als outgroup eine Zuchtpopulation mittels<br />
DNA-Fingerprinting mit der Oligonucleotidsonde (GATA)4 auf ihre genetische Variabilität untersucht.<br />
Die hierbei untersuchten Populationen zeigen sich genetisch stark strukturiert. Zwar lassen sich geografische<br />
Untereinheiten, die auch in der Clusteranalyse eng beisammen liegen, zusammenfassen, die Variabilität<br />
innerhalb der gepoolten Populationen ist aber immer noch sehr hoch.<br />
Die Verteilungsmuster der Fragmente in den untersuchten Gewässern weichen stark voneinander ab.<br />
Populations- oder wuchsgebietsspezifische Banden konnten nicht detektiert werden, obwohl innerhalb von<br />
Populationen Banden bei allen Tieren dieser Stichproben vorkamen.<br />
Die gewonnenen BSF-Werte zeigen in allen Populationen keine signifikante Abweichung von einer Normalverteilung.<br />
Abweichungen ergeben sich in der Lage der Mittelwerte, Mediane und der Varianz. Populationen<br />
in kleinen naturnahen Bächen erreichen durchschnittliche mittlere BSF-Werte von 0,5 und darüber. Genetische<br />
Isolation bedingt einen Anstieg der mittleren BSF-Werte auf 0,7.<br />
Die beobachteten Heterozygotiegrade erreichen im Vergleich mit Isoenzymen sehr hohe Werte zwischen 0,3<br />
und 0,9. Naturnahe Populationen zeigen geringere Werte, jedoch ist die gesamte genetische Variabilität<br />
groß genug, um Inzuchtdepression in den vom Genpool her limitierten Populationen entgegenzuwirken.<br />
Die genetischen Distanzen der Populationen zeigen ebenfalls eine deutliche Differenzierung der untersuchten<br />
Geboiete. Allein die Populationen aus dem Hunsrück zeigen keinen Unterschied in bezug auf die<br />
genetischen Distanzen. Korrelationen zwischen genetischer und geografischer Distanz konnten in keinem<br />
Fall beobachtete werden.<br />
Insgesamt zeigen sich die untersuchten Populationen sehr heterogen. Selbst innerhalb der Gewässersysteme<br />
besteht eine Unterteilung in distinkte Subpopulationenh. Die gewonnenen FST -Werte bestätigen dies.<br />
Auf Grund der FST -Werte berechnete effektive Migranten pro Generation zwischen den Populationen erreichen<br />
in keinem Fall Werte über 1, was eine weitergehende Fixierung der genetischen Unterschiede in den<br />
Populationen erwarten lässt.<br />
Die beobachtete Fraktionierung der Gesamtpopulation macht die Erhaltung einer möglichst grossen genetischen<br />
Vielfalt zu einem äusserst schwierigen Unterfangen. Besatzmaßnahmen können diese Vielfalt<br />
durch ihren eingeschränkten Genpool nicht erhalten. Schutz der Habitate, Rückbau von Querverbauungen<br />
und Schutz vor Überfischung scheinen effektive Mechanismen zu sein, um bedrohen Populationen zum<br />
Überleben zu verhelfen und die natürliche genetische Variabilität zu erhalten.<br />
8.4.5 Untersuchung historischen und rezenten Genaustauschs zwischen südostasiatischen Festlands-<br />
und Inselpopulationen ökologisch unterschiedlich angepaßter Froscharten<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Joachim Kosuch<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
In dieser Arbeit sollen mittels DNA-Sequenzierung die genetischen Austauschprozesse verschiedener<br />
Froscharten auf den Großen Sundainseln (Indonesien) und dem daran angrenzenden malayischen Festland<br />
untersucht werden. Auf der Basis der Allozymelektrophorese wurden bereits erste Hinweise auf<br />
unterschiedliche genetische Differenzierungsmuster gefunden (Kosuch et al. 1994: Genetische Differenzierungsmuster<br />
verschiedener Froscharten (Genus Rana s.l. auf den Großen Sundainseln (Java, Sumatra,<br />
Borneo.- Verh. Dtsch. Zool. Ges. 87:310), die auf zeitlich unterschiedliche Kolonisationsprozesse und<br />
Genflüsse zurückgeführt werden können. Diese ersten Ergebnisse sollen durch die in länger zurückliegende<br />
evolutive Zeiträume auflösende DNA-Sequenzierung zweier mitochondrialer Gene mit unterschiedlichen<br />
Evolutionsraten überprüft und/oder abgesichert werden. Zudem soll neben Vertretern der Gattung Rana<br />
(R. (limnonectes) limnocharis, R. (limnonectes) cancrivorus, R. (limnonectes) kuhlii, R. (limnonectes) blythii,<br />
R. erythraea) mit Polypedatus leucomystax (Rhacophoridae) eine andere, baumbewohnende Froschart<br />
70
in die Untersuchung einbezogen werden, da die meisten Rana-Arten eine obligat terrestrische Lebensweise<br />
besitzen, und somit in ihrem Dispersionsverhalten und damit auch in ihrem Differenzierungsmuster von<br />
baumbewohnenden Arten potentiell abweichen. Anhand von Genstammbäumen der mtDNA-Haplotypen<br />
wird in Verbindung mit den in dieser Region bekannten geographischen Veränderungen versucht, die molekulare<br />
Uhr zu eichen und damit die den genetischen Differenzierungsmustern zugrunde liegenden Prozesse zu<br />
identifizieren. Bezüglich der Gattung Rana wird die Untersuchung außerdem grundsätzliche Informationen<br />
zur Phylogenie liefern, insbesondere, da als potentielle ” Outgroups“ Rana-Arten aus Europa, Nordamerika,<br />
Afrika und Vorderasien einbezogen werden können. Ein weiterer interessanter Aspekt wird der Vergleich der<br />
DNA-Sequenzanalysen mit den bereits durchgeführten allozymelektrophoretischen Analysen sein, der eine<br />
Bewertung hinsichtlich ihrer Aussagekraft auf unterschiedlichen evolutiven Differenzierungsebenen zulassen<br />
sollte.<br />
8.4.6 Modellierung und Simulation der Wirkungen von Fremdstoffen in einem See<br />
Bearbeiter: Dr. Detlef Oertel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
Erster Arbeitsschwerpunkt war ein Vergleich zwischen den Ergebnissen <strong>des</strong> Simulationsprogramms SIM-<br />
PEL und gewonnen Freilanddaten zu physikalischen und biologischen Parametern von fünf verschiedenen<br />
Seen. Diese Daten waren im Rahmen <strong>des</strong> Forschungsvorhabens ” Auswirkungen von Fremdstoffen auf<br />
die Struktur und Dynamik von aquatischen Lebensgemeinschaften in Labor und Freiland“ von anderen<br />
Mitarbeitern <strong>des</strong> Projektes über mehrere Jahre gewonnen worden. Um einen Vergleich zwischen diesen<br />
Freilanddaten und den jetzigen Simulationen zu ermöglichen, wurden die Daten zusammengefaßt und in<br />
ein einheitliches, der elektronischen Datenverarbeitung zugängliches Format gebracht. Desweiteren wurden<br />
die aus den Zählungen von Zooplanktonorganismen gewonnen Abundanzdaten unter Berücksichtigung von<br />
Literaturwerten und neuen Untersuchungen aus dem genannten Projekt in Daten zur Dynamik der Biomassen<br />
verschiedener auqatischer Funktionsgruppen konvertiert. Das entsprechende Datenpaket (inklusive<br />
der angepassten Auswertungs- und Darstellungs-Software) konnte anderen Mitarbeitern <strong>für</strong> die weitere<br />
Anwendung bei anderen Fragestellungen zu Verfügung gestellt werden.<br />
Der Vergleich zwischen den so gewonnen Freilanddaten und den Simulationen zeigte gravierende Unterschiede<br />
auf. Zum Teil sind dies Effekte, <strong>für</strong> die die Ursache in Problemen während der Datenerhebung<br />
oder meteorologischen Besonderheiten während der Erhebung zu suchen sind. Daneben leiten sich aus dem<br />
Vergleich auch kritische Fragestellungen zu dem verwendeten Modell ab. Diese Fragestellungen lassen sich<br />
im wesentlichen in drei Bereiche aufspalten:<br />
1. Parameterprobleme: Der bisher verwendete Parametersatz war in manchen Annahmen von der Realität<br />
zu weit entfernt. Entsprechend wird inzwischen mit einem verbesserten Parametersatz gearbeitet.<br />
2. Modellstrukturprobleme: Die bisher verwendete Modellstruktur ist nicht in der Lage, einige im Freiland<br />
beobachtete Phänomene zu erklären (wie z.B. metastabile kopfständige Biomassenpyramiden).<br />
Hier werden Überlegungen zur einer Erweiterung <strong>des</strong> Modells (Bacterial-Loop, Schichten-Modell)<br />
angestellt. Dabei sind jedoch die Schwierigkeiten unter 3. zu beachten<br />
3. Probleme der ” Modellierungsphilosophie“: Die genaue Untersuchung <strong>des</strong> Verhaltens verschiedener<br />
Modelle zur Simulation auqatischer Systeme zeigte, daß aufgrund der vorhandenen nichtlinearen<br />
Modellgleichungen das Systemverhalten qualitativ empfindlich auf geringfügige Änderungen der verwendeten<br />
Parameter oder Modellgleichungen reagiert. Die unter Punkt 2 diskutierten Erweiterungen<br />
<strong>des</strong> Modells tragen tendenziell zur Verschärfung dieses Problems bei. Es werden daher grundsätzlich<br />
Veränderungen <strong>des</strong> Modellierungsansatzes (z.B. Modelle mit sich dynamisch optimierenden Funktionsgruppen)<br />
diskutiert.<br />
71
8.4.7 Genetische Populationsstruktur und Arealsystemanalyse <strong>des</strong> Silbergrünen Bläulings Polyommatus<br />
coridon und <strong>des</strong> Rundaugen-Mohrenfalters Erebia medusa<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Thomas Schmitt<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
Die populationsgenetischen Strukturen der Tagfalter P. coridon, P. icarus, E.medusa und M. jurtina wurden<br />
über einen großen Bereich ihrer europäischen Verbreitungsgebiete mittels Allozymelektrophorese untersucht.<br />
Zusätzlich wurden P. hispana, P. bellargus und verschiedenen Erebia spec. analysiert. Folgende Ergebnisse<br />
wurden erzielt:<br />
P. coridon besitzt zwei genetische Großgruppen, die vermutlich durch Differenzierung im adriatomediterranen<br />
(P. coridon apennina) und im pontomediterranen Bereich (Nominatform) entstanden sind.<br />
Die Kontaktzone zwischen beiden Taxa verläuft nordöstlich <strong>des</strong> Kyffhäuser, entlang der Ostgrenze<br />
Thüringens, dann folgend den Kämmen <strong>des</strong> Erzgebirges und <strong>des</strong> Bayerischen Wal<strong>des</strong> oder Böhmerwal<strong>des</strong>.<br />
Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet wird die Donau überschritten. In den Alpen verläuft die Grenzlinie<br />
etwa entlang der westlichen Wasserscheiden der nach Osten entwässernden Flußsysteme Drau und Save.<br />
Die genetische Verarmung der süddeutschen Populationen von P. coridon apennina wird als Auswirkung<br />
<strong>des</strong> Flaschenhalses bei der Durchwanderung der Burgundischen Pforte interpretiert.<br />
Die populationsgenetische Struktur von P. coridon apennina im westrheinischen Deutschland folgt keinem<br />
geographischen oder erkennbaren historischen Ordnungsprinzip. P. c. coridon zeigt kontinuierlichen Verlust<br />
der durchschnittlichen Allelzahl von Westungarn bis nach Brandenburg. Für dieses Taxon konnte isolation<br />
by distance nachgewiesen werden. P. bellargus besitzt drei genetische Großgruppen, die vermutlich das<br />
atlanto-, adriato- und pontomediterrane Refugium repräsentieren. P. icarus zeigt keine Auftrennung in<br />
genetische Gruppen, sondern bildet ein großes isolation by distance System über ganz Europa aus. Deshalb<br />
war diese Art während <strong>des</strong> Würm-Glazials wohl nicht in verschiedenen Refugien isoliert, sondern besiedelte<br />
ein nicht disjunktes europäisches Areal.<br />
Die untersuchten Populationen von E. medusa teilen sich auf vier genetische Großgruppen auf. Die genetisch<br />
reichhaltigste (Nominatform) in Tschechien, der Slowakei und Nordost-Ungarn leitet sich aus einem<br />
südosteuropäischen Refugium ab.<br />
Die Nominatform von E. medusa spaltet sich in zwei genetische Linien auf, die unterschiedliche postglaziale<br />
Immigrationslinien nördlich und südlich der Karpaten repräsentieren dürften. E. medusa brigobanna, die<br />
Frankreich und Deutschland besiedelt, differenzierte sich glazial in einem Rückzugsgebiet am Westalpenrand,<br />
das teilweise Südwestdeutschland erreicht haben könnte.<br />
Am Ostalpenrand differenzierte sich ein weiteres Taxon, das wahrscheinlich als E. medusa loricarum zu<br />
bezeichnen ist, und das im westlichen Ungarn nachgewiesen wurde.<br />
E. medusa hippomedusa ist ein rein südalpines Taxon, das sich vermutlich durch glaziale Isolation im<br />
Südalpenbereich herausbildete. Phänotypisch ähnlich erscheinende Individuen von Hochlagen der Gebirge<br />
(z.B. Feldberg im Schwarzwald) außerhalb der Südalpen, müssen den jeweiligen anderen Subspezies<br />
zugerechnet werden.<br />
M. jurtina weist im Untersuchungsgebiet zwei genetische Großgruppen auf. Dies ist wahrscheinlich auf<br />
zwei unterschiedliche Refugialgebiete zurück zu führen, ein atlantomediterranes (M. jurtina hispulla) und<br />
ein (adriato)-pontomediterranes (Nominatform). Die Nominatform konnte in Deutschland, Norditalien,<br />
der Slowakei und Ungarn nachgewiesen werden. M. jurtina hispulla besiedelt die Iberische Halbinsel und<br />
Frankreich.<br />
Weder <strong>für</strong> M. jurtina hispulla noch <strong>für</strong> die Nominatform konnten unterhalb der Subspeziesebene weitere<br />
Strukturierungen festgestellt werden, die geographische Gegebenheiten oder Auswirkungen der postglazialen<br />
Arealexpansion reflektieren würden. Für P. coridon, E. medusa und M. jurtina konnten zum Ende der<br />
72
jeweiligen Generationszeit unterschiedlich ausgeprägte Verschiebungen der genetischen Populationsstruktur<br />
festgestellt werden.<br />
Die untersuchten Taxa der Untergattung Meleageria scheinen anhand von Allozymuntersuchungen phylogenetisch<br />
jung zu sein und ihre Differenzierung weitgehend in der zweiten Hälfte <strong>des</strong> Pleistozän durchlaufen<br />
zu haben. Die Radiation der Mohrenfalter hingegen erscheint stammesgeschichtlich zum Teil erheblich<br />
älter, so daß der Beginn von Differenzierungsprozessen bis zum Anfang <strong>des</strong> Pleistozän und eventuell bis ins<br />
Pliozän vermutet werden.<br />
8.4.8 Austauschprozesse zwischen und genetische Struktur von Flußbarschpopulationen<br />
Bearbeiter: Dr. Andreas Wagner<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. A. Seitz<br />
Populationen <strong>des</strong> Flußbarschs (Perca fluviatilis L.) werden aufgrund mangelnder kommerzieller Nutzbarkeit<br />
nicht direkt durch Besatzmaßnahmen anthropogen in ihrer genetischen Struktur beeinflußt. Diese Art ist<br />
<strong>des</strong>halb geeignet, die natürlichen Austauschprozesse in und zwischen Populationen mit populationsgenetischen<br />
Methoden zu untersuchen. Die weite Verbreitung <strong>des</strong> Flußbarsches, der mit Ausnahme sehr schnell<br />
fließender Gewässer alle Gewässertypen, einschließlich der Brackwasserbereiche besiedelt, kennzeichnet ihn<br />
als eine euryöke Art. Flußbarsche sind in ganz Eurasien einschließlich der Britischen Inseln, jedoch ohne<br />
Spanien und Italien, vertreten.<br />
Frühere enzymelektrophoretische Studien am Flußbarsch haben diese Art, im Gegensatz zu der aufgrund<br />
seiner euryöken Verbreitung erwarteten hohen Polymorphie, als sehr monomorph mit geringen räumlichen<br />
Differenzierungen charakterisiert. Dies könnte zum Beispiel auf eine kurze Verbreitungsgeschichte mit<br />
einem europaweiten Austausch zwischen den Populationen zurückzuführen sein. Dies würde erklären,<br />
warum erstens generell nur eine geringe genetische Polymorphie zu beobachten ist und zweitens keine<br />
regionalen Muster erkennbar sind.<br />
Um diese Hypothese zu überprüfen wurden Barsche aus unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen<br />
Gewässertypen untersucht (Flußpopulationen aus Saar, Mosel und Spree und Seepopulationen aus dem<br />
oligotrophen Weinfelder und dem eutrophen Meerfelder Maar in der Eifel). Zudem wurde als Untersuchungsmethode<br />
nicht die Enzymelektrophorese, sondern das DNA-Fingerprinting gewählt, da damit sowohl<br />
technisch mehr Polymorphismen nachgewiesen werden können (ca. dreimal mehr auf der DNA-Ebene als<br />
bei Proteinen), aber auch ein höherer Grad an genetischem Polymorphismus erwartet werden kann, da<br />
durch das DNA-Fingerprinting nichtkodierende Regionen der DNA erreicht werden, die wahrscheinlich selektionsneutral<br />
sind.<br />
Alle fünf Populationen ließen sich aufgrund der Zahl gemeinsamer Banden im DNA-Fingerprint (Band-<br />
Sharing-Frequenzen, BSF) signifikant voneinander trennen. Die Fluß- und Seepopulationen unterschieden<br />
sich bezüglich der Häufigkeitsverteilung der Fragmentlängen. Insbesondere fehlten in den Seepopulationen<br />
kurze Fragmente (3,7 bis 4,2 kB). Die Populationen aus der Spree zeigten besonders in diesem Bereich<br />
ihr Maximum der Fragmenthäufigkeit. Diese Charakterisierung läßt den Schluß zu, daß die Habitatqualität<br />
(Fluß bzw. See) die genetische Struktur der Populationen stärker beeinflußt hat als die regionale Verbreitung.<br />
Eine Clusteranalyse der BSF-Werte läßt ähnliche, jedoch differenziertere Schlüsse zu. Es bestätigt<br />
sich, daß die beiden Seepopulationen genetisch am ähnlichsten sind und auf einem gemeinsamen Zweig<br />
<strong>des</strong> Phänogramms liegen. Es ist jedoch auch eine geographische Zuordnung der Populationen erkennbar:<br />
Saar- und Moselpopulationen sind deutlich (etwa in gleichem Maß wie die beiden Seepopulationen) von<br />
der Spreepopulation abgesetzt. Das aktuell beobachtbare Verteilungsmuster der genetischen Ähnlichkeiten<br />
kann demnach durch ein Zusammenwirken von min<strong>des</strong>tens zwei Prozessen verstanden werden: Habitateigenschaften<br />
(durch Selektion oder genetische Drift in den weitgehend isolierten Teilpopulationen) und<br />
eingeschränkter Genaustausch aufgrund der regionalen Verteilung.<br />
73
8.4.9 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Amler K., Heidnreich A., Kähler G., Poethke H.-J. und J. Samietz (1999): Die Standardisierte Populationsprognose<br />
(SPP): eine Anwendung der Zoologischen Datenbanken am Beispiel <strong>des</strong> NSG ”Leurtratal”(Thüringen).<br />
- In: Henle K., Amler K., Kaule G., Bahl A. und J. Settele (Hrsg.): Verinselung von<br />
Lebensräumen - Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis, Ulmer, Stuttgart.<br />
Gottschalk E., Griebeler E. M., Heidenreich A., Poethke H. J. und D. Schmeller (1999): Von der Biologie<br />
einer Art zur Ermittlung <strong>des</strong> Flächenbedarfs einer überlebensfähigen Population - das Beispiel der Westlichen<br />
Beißschrecke (Platycleis albopunctata). - NNA-Berichte 2/99: 41-45.<br />
Gottschalk E., Schmeller D. und A. Heidenreich (1999): PVA-Fallbeispiel 3: Analyse der Gefährdungsursachen<br />
von Tiergruppen mittlerer Mobilität am Beispiel der Westlichen Beißschrecke (Platycleis albopunctata).<br />
- In: Henle K., Amler K., Kaule G., Bahl A. und J. Settele (Hrsg.): Verinselung von Lebensräumen<br />
- Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis, Ulmer, Stuttgart.<br />
Griebeler, E.M. (1999): A comparison of different methods estimating the effective population size. Abstractband<br />
zur 4th European Conference on Mathematics Applied to Biology and Medicine, Amsterdam:<br />
208-209.<br />
Griebeler, E.M. (1999): Estimating the effective size of a single ideal population. Tagungsband zum<br />
Seventh congress of the European Society for Evolutionary Biology, Barcelona: II-128.<br />
Griebeler, E.M. und A. Seitz (eingereicht): A comparison of two methods estimating the effective size of<br />
a Wright-Fisher population. Heredity.<br />
Heidenreich A., Poethke H.-J. und A. Seitz (1997): Ableitung der minimalen langfristig überlebensfähigen<br />
Populationsgrößen (MVP) von Insekten aus längerfristigen Abundanzbeobachtungen. Verh. der DZG: 237.<br />
Heidenreich A., Poethke H.-J., Halwart M und A. Seitz (1997): Simulation der Populationsdynamik von<br />
Pomacea canaliculata (Prosobranchia) zur Bewertung von Managementmaßnahmen. - Verh. der Ges. <strong>für</strong><br />
Ökologie 27: 441-446.<br />
Heidenreich A. und K. Amler (1999): Ein vereinfachtes Prognoseverfahren <strong>für</strong> die Naturschutzpraxis - Die<br />
Standardisierte Populationsprognose (SPP). - NNA-Berichte 2: 3-12.<br />
Johannesen, J. and Y. Lubin (1999). Group founding and breeding structure in the subsocial spider<br />
Stegodyphus lineatus (Eresidae). Heredity 82: 677-686.<br />
Johannesen, J. and Y. Lubin (1999). Genetic analysis of breeding groups in the subsocial spider Stegodyphus<br />
lineatus (Eresidae). Zoology 102, Suppl. II (DZG 92.1): 29.<br />
Kosuch, J., M. Veith und A. Seitz (1994): Genetische Differenzierungsmuster verschiedener Froscharten<br />
(genus Rana s.l.) auf den Großen Sundainseln (Java, Sumatra, Borneo; Indonesien). Verh. Dtsche. Zool.<br />
Ges. 88.1:36<br />
Kosuch, J., A. Ohler und M. Veith (1997): Genetic and morphological variation in Limnonectes limnocharis<br />
(Gravenhorst, 18299 from the Great Sunda Islands (Sumatra, Java, Borneo). In: Rocek, Z. und Hart, S.:<br />
Abstracts of the Third World Congress of Herpetology 1997:249<br />
Kosuch, J., M. Vences und W. Böhme (1999): Mitochondrial DNA sequence data support the allocation<br />
of Greek mainland chameleons to Chameleo africanus. Amphibia-Reptilia 20: 355-448<br />
Malkmus, R., J. Kosuch und J. Kreutz (1999): Die Larve von Staurois tuberulinguis, Boulenger 1918. Eine<br />
neue centrolenidenähnliche Kaulquappe aus Borneo (Anura: Ranidae). Herpetozoa 12 (1/2):17-22<br />
Malkmus, R. und J. Kosuch (1999): Description of the tadpole of Leptolalax arayai (Matsui, 1997) (Amphibia:<br />
Anura: Megophryidae). Lacerta 57(5): 161-165<br />
Poethke H. J., Griebeler E. M. und Heidenreich (1998): Die Rolle populationsökologischer Modelle in der<br />
74
Langzeitforschung und als Prognoseinstrument im Naturschutz. - Schriftenreihe <strong>für</strong> Landschaftspflege und<br />
Naturschutz 58: 47-62.<br />
Schmitt, T. und A. Seitz (1999): Glacial differentiation and postglacial expansion of Polyommatus coridon<br />
(Lepidoptera: Lycaenidae). - Zoolology 102 Suppl. II: 35.<br />
Schmitt, T. und A. Seitz (1999): Analyse der genetischen Struktur und <strong>des</strong> Arealsystems mitteleuropäischer<br />
Populationen von Erebia medusa (Lepidoptera: Nymphalidae). - Verh. Ges. Ökologie 29: 381-387.<br />
Schmitt, T. und A. Seitz (2000): Phylogeography of European populations of Erebia medusa (Lepidoptera:<br />
Nymphalidae). - Zoolology 103 Suppl. III: 50.<br />
Schmitt, T. (accepted): Influence of the ice-age on the genetics and subspecific differentiation in butterflies.<br />
- EIS-Symposium in Millas, August/September 1999.<br />
Schmitt, T. (accepted): Glaziale Refugien und postglaziale Arealausweitung von Polyommatus coridon<br />
(Lepidoptera: Lycaenidae). - Verh. Westd. Entomol. Tag 1999.<br />
Schmitt, T., Varga, Z. und A. Seitz (accepted): Forests as dispersal barriers for Erebia medusa (Nymphalidae,<br />
Lepidoptera). - Basic Appl. Ecol.<br />
Settele J., Amler K., Heidenreich A., Hermann G. und H. Reck (1999): Naturwissenschaftliche Anforderungen<br />
und Grenzen der standardisierten Populationsprognose. - In: Henle K., Amler K., Kaule G., Bahl<br />
A. und J. Settele (Hrsg.): Verinselung von Lebensräumen - Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis,<br />
Ulmer, Stuttgart.<br />
Veith, M., J. Kosuch, R. Feldmann, H. Martens und A. Seitz (2000): A test for correct species declaration<br />
of frog legs imports from Indonesia into the European union. Biodiversity and Conservation 9:333-341<br />
Veith, M., J. Kosuch, A. Ohler und A. Dubois (in press): Systematics of Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,<br />
1829) (Amphibia: Anura: Ranidae). 2. Morphological and molecular variation in frogs from the<br />
Great Sunda Islands (Sumatra, Java, Borneo) with the definition of two species. Alytes<br />
Vences, M., J. Kosuch, S. Lötters, A. Widmer, K.-H. Jungfer, J. Köhler und M. Veith (2000): Phylogeny<br />
and classification of poison frogs (Amphibia: Dendrbatidae) based on mitochondrial 16S and 12S ribosomal<br />
DNA gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 15(1):34-40<br />
Vences, M., F. Glaw, J. Kosuch, I. Das und M. Veith (in press): Polyphyly of Tomopterna (Amphibia:<br />
Ranidae) and ecological biogeography of Malagasy relict amphibian groups. Mémoires de Biogeographie<br />
(Proceedings of the second int. Syposium ”Biogeographie de Madagascar”; W. Laurenco ed.)<br />
Vogel K. und A. Heidenreich (1999): Einsatz der Standardisierten Populationsprognose (SPP) in der regionalen<br />
Schutzgebietsplanung am Beispiel von Halbtrockenrasen an der Fränkischen Saale (Unterfranken /<br />
Bayern). - In: Henle K., Amler K., Kaule G., Bahl A. und J. Settele (Hrsg.): Verinselung von Lebensräumen<br />
- Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis, Ulmer, Stuttgart.<br />
Wagner A.R. (1995): Populationsgenetische Analyse von Flußbarschpopulationen mittels DNA-Fingerprinting.<br />
Verh. Ges. Ökologie 24: 169-174<br />
75
9 Projekte am Fachbereich 22 (Geowissenschaften)<br />
9.1 Ökologie und Planung<br />
Prof. Dr. V. Heidt, Univ.-Prof. Dr. M. Domrös und Mitarbeiter (Geographisches Institut)<br />
9.1.1 Ökosystemare Bewertung <strong>des</strong> Bodens - Integrierter Bodenschutz anhand systematisch<br />
entwickelter Bodenqualitätsziele - Ein Betrag zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Geogr. Sabine Heinig<br />
Hauptbetreuer: Prof. Dr. V. Heidt<br />
Im Auftrag <strong>des</strong> Amtes <strong>für</strong> Grünanlagen und Naherholung der Stadt Mainz wurde die Universität Mainz<br />
1993 mit der Bearbeitung der Stadtbiotopkartierung betraut. Die Arbeitsgruppe an der Universität Mainz<br />
setzt sich aus Fachleuten <strong>des</strong> Geographischen Institutes (Projektleitung und Ansprechpartner PD Dr. V.<br />
Heidt), <strong>des</strong> Institutes <strong>für</strong> Spezielle Botanik (Dr. W. Licht) und <strong>des</strong> Zoologischen Institutes (PD Dr. G.<br />
Eisenbeis) zusammen.<br />
Neben einer flächendeckenden Biotopkartierung nach dem Schlüssel zur Kartierung nach Vegetations- und<br />
Nutzungsformen werden gleichzeitig die abiotischen und ästhetisch / anthropogenen Faktoren <strong>des</strong> Stadtgebietes<br />
erfaßt.<br />
Das innovative an dem gewählten Ansatz, die Stadtbiotopkartierung von unterschiedlichen Fachdisziplinen<br />
durchführen zu lassen sowie nicht nur rein biotische Aspekte zu berücksichtigen, ist, daß über die<br />
Entwicklung einer ökosystemaren Zielkonzeption eine naturschutzfachliche Bewertung der natürlichen Ressourcen<br />
stattfindet. Neben der rein naturwissenschaftlichen Erfassung und Deskription und der naturschutzfachlichen<br />
Bewertung, werden über die Ermittlung von Belastungspotentialen und unterschiedlicher<br />
Wirkungsfaktoren (Vorbelastung und Wirkung von anthropogenen Beeinträchtigungen), Handlungsempfehlungen<br />
zum nachhaltigen Schutz der Umweltmedien im Mainzer Stadtgebiet erarbeitet. Im Rahmen der<br />
zu erfassenden Umweltmedien kommt dem Boden aufgrund seiner zentralen Stellung im Ökosystem sowie<br />
seiner Bedeutung als ” Integral“ der abiotischen, biotischen und ästhetisch/anthropogenen Funktionen eine<br />
zentrale Bedeutung zu. Er bestimmt die Biotopstruktur eines Raumes mit.<br />
Biotopkartierungen sind planerische Grundlagen <strong>für</strong> die Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele <strong>des</strong> Naturschutzes<br />
und damit auch <strong>des</strong> Bodenschutzes. Bislang fehlen geignete, anerkannte und handhabbare<br />
Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Böden. Die Erfassung und ökosystemar ausgerichtete Bewertung<br />
von Boden ist allerdings die Grundlage <strong>für</strong> einen ökologisch-naturräumlich orientierten Bodenschutz.<br />
Einem flächendeckend (z.B. bezogen auf ein Stadtgebiet) konzipierten, vorsorgenden Bodenschutz kommt<br />
demnach eine zentrale Bedeutung zu. Stadtbiotopkartierungen werden meist mit der Zielsetzung durchgeführt,<br />
eine möglichst große Biotopvielfalt in dem jeweiligen Stadtgebiet zu erhalten. Somit müssen<br />
gerade in der an Arten- und Strukturvielfalt naturgemäß reichen Stadt-Kulturlandschaft die Böden mit<br />
in die Überlegungen einbezogen werden. So erfolgt im Rahmen der Stadtbiotopkartierung die Erfassung<br />
der Bodengesellschaften, -typen, -spezifika, die Anwendung der entwickelten Bodenbewertungssystematik<br />
unter Berücksichtigung der<br />
• biotischen Faktoren (Verknüpfung der Vegetationsausprägung mit dem Ausgangs- substrat)<br />
• abiotischen Faktoren<br />
• anthropogenen Beeinflussung (Einwirkungsfaktoren und deren Auswirkungen), sowie die Zusammenstellung<br />
von Umweltqualitätszielen <strong>für</strong> definierte Raumein- heiten und die Bewertung <strong>des</strong> Naturraumpotentials<br />
<strong>des</strong> Bodens.<br />
76
Dieser Ansatz liefert einen wesentlichen Beitrag zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen.<br />
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie sollen die Auswirkungen von bestimmten Vorhaben (anthropogene<br />
Beeinflussungen) auf die Umweltmedien bewertet werden.<br />
Biotopkartierungen dienen als Datenbasis <strong>für</strong> die Durchführung von UVP und anderer kommunaler Planungen.<br />
Sie sind aber auch als methodisches Konzept zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung<br />
ökosystemarer Zusammenhänge sowie zur Klassifizierung spezifischer Belastungssituationen und x-faktoren<br />
in dem abgesteckten Untersuchungsraum (Stadt Mainz) zu verstehen.<br />
Bei diesem, im Rahmen der Stadtbiotopkartierung entwickelten Leitfaden mit ökosystemar ausgerichteten<br />
Bewertungsmaßstäben <strong>für</strong> sämtliche Umweltmedien und deren Wechselwirkungen sowie mit Beurteilungskriterien<br />
<strong>für</strong> die Einschätzung von Wirkungen und Austauschprozessen bedingt durch anthropogene<br />
Beeinträchtigungen (chemischer, physikalischer oder mechanischer Art) auf die Umwelt, kommt der Interdisziplinarität<br />
eine wesentliche Rolle zu.<br />
9.1.2 Eine neue Methode der Informationsverknüpfung zur Klassifizierung der Landnutzung auf<br />
der Grundlage hochauflösender Satellitenbilddaten am Beispiel von Landau und Umgebung<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Geogr. Wanxiao Sun<br />
Hauptbetreuer: Prof. Dr. V. Heidt<br />
Satellite image classification involves <strong>des</strong>igning and developing efficient image classifiers. With satellite<br />
image data and image analysis methods multiplying rapidly, selecting the right mix of data sources and<br />
data analysis approaches has become critical to the generation of quality land-use maps.<br />
In this study, a new postprocessing information fusion algorithm for the extraction and representation of<br />
land-use information based on high-resolution satellite imagery is presented. This approach can produce<br />
land-use maps with sharp interregional boundaries and homogeneous regions. The proposed approach is<br />
conducted in five steps.<br />
1. A GIS layer - ATKIS data - was used to generate two coarse homogeneous regions, i.e. urban and<br />
rural areas.<br />
2. A thematic (class) map was generated by use of a hybrid spectral classifier combining Gaussian<br />
Maximum Likelihood algorithm (GML) and ISODATA classifier.<br />
3. A probabilistic relaxation algorithm was performed on the thematic map, resulting in a smoothed<br />
thematic map.<br />
4. Edge detection and edge thinning techniques were used to generate a contour map with pixel-width<br />
interclass boundaries.<br />
5. The contour map was superimposed on the thematic map by use of a region-growing algorithm with<br />
the contour map and the smoothed thematic map as two constraints.<br />
For the operation of the proposed method, a software package is developed using programming language<br />
C. This software package comprises the GML algorithm, a probabilistic relaxation algorithm, TBL edge detector,<br />
an edge thresholding algorithm, a fast parallel thinning algorithm, and a region-growing information<br />
fusion algorithm. The county of Landau of the State Rheinland-Pfalz, Germany was selected as a test site.<br />
The high-resolution IRS-1C imagery was used as the principal input data.<br />
9.2 Altlasten<br />
Univ.-Prof. Dr. J. Preuß und Mitarbeiter (Geographisches Institut)<br />
77
9.2.1 Standortdifferenzierte Abschätzung von Versickerungsraten <strong>für</strong> Einzugsgebiete mittlerer<br />
Größe in Hessen als Beitrag zur Ermittlung von Stofffrachten aus dem Boden<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Geogr. Anna Mense-Stefan<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. J. Preuß<br />
Ziel der Untersuchung ist die Berechnung von Versickerungsraten bis zur Untergrenze <strong>des</strong> Wurzelraums<br />
<strong>für</strong> mittlere bis große Einzugsgebiete <strong>für</strong> das Bun<strong>des</strong>lan<strong>des</strong> Hessen, um die lokal verfügbare potentielle<br />
Lösungsmittelmenge abschätzen und flächenhaft darstellen zu können. Danach wird eine vergleichende<br />
Bewertung von Rüstungsaltstandorten vorgenommen.<br />
Grundlage der Berechnung sind standortdifferenzierte langfristige Wasserhaushaltsbilanzen. Der neue Ansatz<br />
liegt darin, die Versickerung auf der Grundlage eines konzeptionellen geoökologischen Modells <strong>für</strong> einen<br />
Raum mittlerer Größe (20.000 km 2 ) zu berechnen.<br />
Nach der Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen wurde ein konzeptionelles Modell entwickelt, mit<br />
dem die Versickerung an der Untergrenze <strong>des</strong> Wurzelraums berechnet wird. Die zur Charakterisierung <strong>des</strong><br />
standorttypischen Wasserhaushaltes erforderlichen Daten, die in die Modellierung eingehen, wurden von<br />
Hessischen Lan<strong>des</strong>ämtern sowie dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beschafft. Satelliten- und Luftbilder<br />
wurden von verschiedenen Stellen erworben. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden diese Daten so aufbereitet,<br />
dass sie in die flächenbezogene Berechnung der Versickerungsraten einbezogen werden können. Die<br />
Aufbereitung und Analyse der Daten umfasste dabei die folgenden Schritte.<br />
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Einfluss unterschiedlicher Oberflächenbedeckung auf den<br />
Versickerungsprozess. Aus diesem Grund wurde die Oberflächenbedeckung Hessens anhand digitaler<br />
Satellitenbild- und Luftbildauswertungen ermittelt. Als weitere wesentliche Datengrundlage wurde ein<br />
digitales Höhenmodell <strong>des</strong> Hessischen Lan<strong>des</strong>vermessungsamtes verwendet. Aus diesem wurden die Einzugsgebiete<br />
mittlerer Größe sowie Hangneigungs- und Expositionskarten abgeleitet. Diese Daten wurden<br />
in einem nächsten Schritt zu einer höhenabhängigen Regionalisierung der Klimadaten verwendet. Dabei<br />
handelt es sich um Daten zur Temperatur und relative Luftfeuchte um 14 Uhr (DIN 19685), die an allen<br />
Klimastationen <strong>des</strong> DWD gemessen werden. Sie wurden mit dem statistischen Verfahren multipler Regressionen<br />
zu Flächendaten aufbereitet und in die Berechnung der potentiellen Evapotranspiration nach<br />
dem Ansatz von HAUDE eingebracht. Bei Waldbeständen wurden zusätzlich die Interzeptionsraten <strong>für</strong><br />
Waldgebiete berechnet. Sie wurden anhand der Niederschlagsverteilung, die in Form von aufbereiteten<br />
Flächendaten <strong>des</strong> DWD vorliegt, und der Oberflächenbedeckung abgeschätzt.<br />
Das Hessische Lan<strong>des</strong>amt <strong>für</strong> Bodenforschung (HLfB) stellt <strong>für</strong> die Modellierung digitale Bodendaten Gesamthessens<br />
mit Angaben zu Bodenart, Lagerungsdichte, Humus- und Steingehalt sowie zur nutzbaren<br />
Feldkapazität im durchwurzelbaren Raum zur Verfügung. Alle diese Teilergebnisse und Datensätze werden<br />
in ein Geographisches Informationssystem eingebunden und untereinander über Verknüpfungsregeln in Beziehung<br />
gesetzt. Das Endergebnis ist eine digitale Karte der Versickerungsraten in Hessen. Diese soll bei<br />
der Bewertung von kontaminierten Standorten zur Beurteilung der relativen potentiellen Schadstofffracht<br />
herangezogen werden.<br />
9.3 Sedimentologie, Geochemie<br />
Univ.-Prof. Dr. R. Gaupp, Univ.-Prof. Dr. R. Oberhänsli und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften)<br />
9.3.1 Mobilität von Seltenen-Erd-Elementen (SEE) und deren Fixierung in Karbonatphasen<br />
Bearbeiter: Dr. Thomas Deutrich, Dipl.-Geol. Berndt Hartmann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. R. Gaupp<br />
78
Im Gegensatz zum magmatisch-pegmatisch-hydrothermalen Bildungsbereich sind die Lösungs-, Transportund<br />
Fixierungsmechanismen von SEE-Mineralen unter oberflächennahen Bedingungen (niedrige Temperaturen<br />
und Drucke) bislang kaum untersucht worden. Die Mobilität von SEE im sedimentären und diagenetischen<br />
Bereich wird bisher als relativ gering angesehen. Neueste Vorkommen rezenter, oberflächennah<br />
gebildeter SEE-Karbonate in Südost-Tunesien stellen derartig pauschale Aussagen allerdings in Frage. Die<br />
SEE, zu denen neben Scandium und Yttrium die Gruppe der Lanthaniden gehört, besitzen z.T. ähnliche<br />
Eigenschaften und Verbindungsformen wie die Actiniden, zu denen u.a. Uran und Thorium gehören. Deshalb<br />
könnten neue Erkenntnisse über ihre Mobilität im Bereich der Hydro- und Biosphäre von Bedeutung<br />
sein.<br />
Probenmaterial von SEE-mineralführenden Sandsteinen wurde durch die Erdgasindustrie zur Verfügung<br />
gestellt. An diesem Probenmaterial, das aus Tiefbohrungen <strong>des</strong> Norddeutschen Beckens stammt ( ” Rotliegend“-Material),<br />
wurden bereits erste Untersuchungen durchgeführt. In der Vorbereitungsphase <strong>des</strong><br />
Projektes (Postdoktorandenstipendium Deutrich) wurde Herr Hartmann in sedimentpetrographische und<br />
mineralchemische Untersuchungsverfahren eingeführt. Im einzelnen wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:<br />
• Bereitstellung von Literatur zur Rotliegend-Diagenese im Norddeutschen Becken<br />
• Betreuung am Licht- und Rasterelektronenmikroskop<br />
• Betreuung bei Probenpräparation <strong>für</strong> Röntgendiffraktometrie und Mikrosonde<br />
An Sandsteinproben wurde Herr Hartmann mit charakteristischen Diagenese-Typen <strong>des</strong> Rotliegenden vertraut<br />
gemacht. Dabei wurden sulphatische, karbonatische und silikatische Neubildungen, sowie Lösungs-,<br />
Verdrängungs- und Alterationserscheinungen vorgestellt. Für Diagenesevorgänge verantwortliche Prozesse<br />
wurden diskutiert und erste Versuche unternommen, paragenetische Abfolgen zu definieren. Weiterhin<br />
wurden Untersuchungen durchgeführt zur Sandstein-Granulometrie, der Beschaffenheit <strong>des</strong> Porenraumes<br />
sowie zum detritischen Mineralbestand, der im Fall von Vulkanitklasten und Schwermetallen Kationen (sehr<br />
wahrscheinlich auch SEE) <strong>für</strong> diagenetische Neubildungen bereitstellen kann. Um eine erste petrographische<br />
Datenbasis zu erhalten, wurde Herr Hartmann in die Methodik <strong>des</strong> point-count-Verfahrens eingeführt.<br />
Außerdem wurden erste Proben <strong>für</strong> weitergehende Untersuchungen mittels Röntgendiffraktometrie, Mirkosonde<br />
und Kathodenlumineszenz ausgewählt und teilweise bereits vorbereitet.<br />
Nach bisherigem Untersuchungsstand sind die Gehalte von SEE-Karbonaten (Bastnaesite bzw. bastnaesitreiche<br />
Mischkristalle) vermutlich sehr gering. Hierbei ist allerdings zu bedenken, daß mögliche SEEhaltige<br />
Karbonatphasen auf optischem Wege nicht zweifelsfrei zu identifizieren sind. Bislang wurden folgende<br />
Erscheinungsformen möglicherweise SEE-haltiger Karbonatphasen festgestellt:<br />
• homogen verteilte, zwickelfüllende, hoch lichtbrechende Aggregate von max. 200 mm Durchmesser<br />
(Volumenanteile am Gesamtgestein stets deutlich unter 1 %).<br />
• Anreicherungen von feinsten kristallen (ca. 10 - 20 mm Durchmesser), die in Verwachsung mit Quarz<br />
und Tonmineralpartikeln im intergranularen Porenraum auftreten (Volumenanteile im Bereich weniger<br />
%).<br />
• Außerdem treten Karbonatzemente mit Volumenanteilen bis über 15 % auf, die nach optischem Erscheinungsbild<br />
als calcitisch-dolomitische Karbonate anzusprechen sind und eventuell geringe Gehalte<br />
an SEE enthalten können.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Dissertationsprojektes wird ein rezentes Vorkommen authigener Seltener-Erd-Mineralien<br />
in karbonatischen Strandsanden Südost-Tunesiens mit dem Auftreten von neugebildeten SEE-Karbonaten<br />
in fossilen Sandsteinen <strong>des</strong> Perm aus Nordwest-Deutschland verglichen, mit dem Ziel die geochemischen<br />
79
Rahmenbedingungen bei Niedertemperatur-Mobilisierung und Transport von SEE und bei deren Fixierung<br />
in Karbonat-Mineralphasen im Bereich der Diagenese zu erfassen.<br />
Mineralchemische Untersuchungen zur Bestimmung möglicher Herkunftsmaterialien der SEE, hydrochemische<br />
Untersuchungen sowie eine detaillierte petrographische Studie zur paragenetischen Stellung der SEE-<br />
Karbonate liefern die Daten <strong>für</strong> die Erarbeitung eines Diagenese-Modells. Da die SEE zum Teil ähnliche<br />
Eigenschaften und Verbindungen wie die Actiniden aufweisen, könnten neue Ergebnisse über die Mobilität<br />
der SEE auch von Interesse <strong>für</strong> das Verhalten der Actiniden, beispielsweise bei der Endlagerung nuklearer<br />
Abfälle, im Bereich der Hydro- und Biosphäre sein. Projektziele sind:<br />
• Erfassung der geochemischen Rahmenbedingungen bei Mobilisierung und Transport von Seltenen-<br />
Erd-Elementen (SEE) und bei deren Fixierung in eigenständigen (Karbonat-) Mineralphasen im Wirkungsbereich<br />
von Oberflächenwässern in einem rezenten und fossilen Beispiel.<br />
• Petrographische Studie zur paragenetischen Stellung der Bastnaesite<br />
• Untersuchungen zur Bestimmung möglicher Herkunfts-Substanzen der SEE<br />
• Erarbeitung eines Modells zu Mobilisierung, Transport und Fällung der SEE; Vergleich der Rahmenbedingungen<br />
von fossilem und rezentem Fall<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Projektes wurden die folgenden Arbeiten durchgeführt:<br />
• Auswertung vorhandener Daten <strong>für</strong> die Auswahl geeigneter Beprobungsstandorte<br />
• Literaturrecherche und Auswertung<br />
• Beprobung der permischen Sandsteine anhand diverser Bohrungen und anschließende Aufbereitung<br />
<strong>für</strong> die Analytik<br />
• Übersichtsbeprobung <strong>des</strong> rezenten Fallbeispiels in SE-Tunesien, Entnahme von Gesteins- (Boden)<br />
und Wasserproben, Geländeuntersuchungen, Probenaufbereitung <strong>für</strong> die Analytik<br />
• Chemische Analyse der Wasserproben mittels AAS und ICP-MS<br />
• NAA, RFA beim rezenten Material abgeschlossen, am fossilen Material z.T. durchgeführt<br />
• Dünnschliff-Mikroskopie an beiden Probenserien<br />
• erste Analysen mit REM/EDAX, Beleg der Neubildung eines Ce, La-Karbonates in den permischen<br />
Sandsteinen<br />
• Beginn von Schwermineralaufbereitung und -analysen von beiden Probenserien<br />
• Abschluß der NAA am fossilen Material am Forschungsreaktor TRIGA Mark II der Universität Mainz<br />
• Fortführung von: Dünnschliff-Mikroskopie; RFA; XRD; REM/EDAX und Abschluß der Untersuchungen<br />
• Fortsetzung der Schwermineralanalytik<br />
• Mikrosondenananlysen an ausgewählten Proben beider Beispiele<br />
• Beschaffung und Analyse von ergänzendem Probenmaterial <strong>für</strong> das rezente Beispiel<br />
• SEE-Bestimmungen (NAA) an möglichen Herkunfts-Substanzen der Lanthaniden<br />
• KL-Spektrometrie an ausgewählten Proben an der Ruhr Universität Bochum<br />
• Aufbereitung und Auswertung der Analysendaten sowie Erarbeitung eines Modells zu Mobilisierung,<br />
Transport und Fällung der SEE<br />
80
9.4 Angewandte Geologie, Hydrogeologie<br />
Univ.-Prof. Dr. D. Schenk, Univ.-Prof. Dr. R. Oberhänsli und Mitarbeiter (Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften)<br />
9.4.1 Modellierung von Porenraumgeometrien und Transport in korngestützten porösen Medien<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Frieder Enzmann<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. D. Schenk<br />
Poröse Medien spielen in der Hydrosphäre eine wesentliche Rolle bei der Strömung und beim Transport<br />
von Stoffen. In diesem Raum finden komplexe Prozesse statt: Advektion, Konvektion, Diffusion, hydromechanische<br />
Dispersion, Sorption, Komplexierung, Ionenaustausch und Abbau. Die strömungsmechanischenund<br />
die Transportverhältnisse in porösen Medien werden direkt durch die Geometrie <strong>des</strong> Porenraumes<br />
selbst und durch die Eigenschaften der transportierten (oder strömenden) Medien bestimmt. In der Praxis<br />
wird eine Vielzahl von empirischen Modellen verwendet, die die Eigenschaften <strong>des</strong> porösen Mediums in<br />
repräsentativen Elementarvolumen wiedergeben. Die Ermittlung der in empirischen Modellen verwendeten<br />
Materialparameter (z.B. Porosität, Permeabilität, Dispersivität) erfolgt i.d.R. über Labor- oder Feldbestimmungsmethoden.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Computermodell PoreFlow entwickelt, welches die hydraulischen Eigenschaften<br />
eines korngestützten porösen Mediums aus der mikroskopischen Modellierung <strong>des</strong> Fluidflusses<br />
und Transportes ableitet. Das poröse Modellmedium wird durch ein dreidimensionales Kugelpackungsmodell,<br />
zusammengesetzt aus einer beliebigen Kornverteilung, dargestellt. Im Modellporenraum wird die<br />
Strömung eines Fluids basierend auf einer stationären Lösung der Navier-Stokes-Gleichung simuliert. Nach<br />
der Strömungssimulation kann eine Stofftransportmodellierung auf Basis einer instationären Lösung der<br />
advektiv-diffusiven Transportgleichung in einem nunmehr bestehenden Porenströmungsfeld erfolgen. Die<br />
Ableitung der Transportparameter erfolgt direkt aus den resultierenden Daten der Strömungs- und Transportsimulation<br />
(Vektoren der Bahngeschwindigkeiten, Bahnwege von Tracerpartikeln aus Monte-Carlo-<br />
Simulationen). Die Ergebnisse der Modellsimulationen an verschiedenen Modellmedien werden mit den<br />
Ergebnissen von Säulenversuchen (Durchströmungs- und Tracerversuche) verglichen. Bei den Modellsimulationen<br />
zeigt sich bei Variation der Kugelverteilungen eine deutliche Abhängigkeit der effektiven Transportparameter<br />
von den entstehenden Porenraumgeometrien (Erniedrigung der Durchlässigkeit und Erhöhung der<br />
Dispersivität bei Erhöhung <strong>des</strong> Ungleichförmigkeitsgra<strong>des</strong> einer Kugelverteilung). Die gleichen qualitativen<br />
Zusammenhänge sind bei den Experimentbefunden zu beobachten. Quantitativ sind die Modellsimulationen<br />
mit den Ergebnissen der Säulenversuche nicht direkt zu vergleichen, da im Modell nur wesentlich<br />
kleinere Systeme simuliert werden können.<br />
Ergebnisse: Die Modellierung/Generierung <strong>des</strong> Porenraumes und die Simulation von Strömung und Transport<br />
in diesem Raum ist möglich und führt zur Ableitung der effektiven Transportparameter. Allerdings<br />
sind die Ergebnisse dieser Modellsimulationen nur bedingt, aufgrund der unterschiedlichen Systemgrößen,<br />
mit Standardsäulenversuchen vergleichbar.<br />
9.4.2 Mobilisation von Schwermetallen aus Fahlerzen in Grundwässern im Bereich Rheinhessisches<br />
Hügelland als Folge anthropogen bedingten Nitrateintrages<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Harald Schmitt<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. D. Schenk<br />
Die chemischen Analysen der gelösten Inhaltsstoffe der Mischwässer im Raum Alzey aus den Brunnen und<br />
Quellen, sowie den Bachquellen im Untersuchungsgebiet zeigten, daß es sich bei den Wässern zur Hauptsache<br />
um hydrogenkarbonat- sulfat- chloridhaltige Erdalkali-Wässer handelt. Daneben liefern die Tiefbrunnen<br />
81
in Albig Alkali-Wässer, die überwiegend hydrogenkarbonathaltig sind. Mit Hilfe <strong>des</strong> Computerprogramms<br />
PHREEQC wurden die jeweiligen Mineralspeziationen berechnet, die sich aus den ermittelten Inhaltsstoffen<br />
der Grundwässer und den gegebenen pH- und Redoxbedingungen bei Anwendung der Gleichgewichtsthermodynamik<br />
ergeben. Mögliche Austauschvorgänge, denen einige der beprobten Wässer im Untergrund<br />
ausgesetzt sind, wurden aufgezeigt.<br />
Die Analysen zeigen außerdem, daß bei den oberflächennahen Wässern der Quellen und Bachquellen sowie<br />
der flachen Brunnen eine starke Beeinflussung durch gelöstes Nitrat gegeben ist. Dieses Nitrat wird<br />
wahrscheinlich durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung über eine mineralische Düngung in den<br />
Wasserkreislauf eingebracht, was noch durch eine in 1999 auszuwertende Isotopenuntersuchung zu klären<br />
ist. Durch die Nitratverlagerung ins Grundwasser ändern sich die dortigen Milieubedingungen. In den<br />
anoxischen Grundwässern werden die dort geogen vorhandenen Schwermetallsulfide bakteriell oxidiert. Der<br />
benötigte Sauerstoff da<strong>für</strong> wird durch die ablaufende Nitratreduktion frei. Die Isotopenbestimmung von<br />
Deuterium und Sauerstoff-18 belegte, daß die Wässer alle meteorischen Ursprungs sind. Zusammen mit den<br />
Verhältnissen von 2 H und 18 O, 34 S und 18 O aus dem im Wasser gelösten Sulfat und 15 N und 18 O aus dem<br />
im Wasser gelösten Nitrat sollen zukünftige Aussagen über Änderungen im Aquifermilieu getroffen werden.<br />
Zudem ist die Quelle <strong>des</strong> Sulfats und Nitrats in den Wässern, in Zusammenhang mit repräsentativen<br />
Isotopenanalysen im Raum Alzey anstehender Gesteine, feststellbar.<br />
Im Bereich <strong>des</strong> Alzey-Niersteiner Horstes wurden strukturgeologische und geophysikalische Untersuchungen<br />
zur Bestimmung der Fließwege durchgeführt. Der Luftbildbereich der Befliegungen 17/84 und 30/97 <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong>vermessungsamtes Rheinland-Pfalz auf der Topographischen Karte 1:25000 Blatt 6214 Alzey wurde<br />
näher untersucht und eine Linearkarte <strong>des</strong> Blattes Alzey (TK 25, 6214) erstellt.<br />
Aus den gemessenen FCKW-Konzentrationen ließen sich verschiedene Modellalter errechnen. Dabei wurden<br />
<strong>für</strong> die Wässer Heimersheim (B3), Bechenheim neu (B5), Offenheim P2 (B12) und Albig neu (B16) mittlere<br />
Verweilzeiten von mehr als 40 Jahren bestimmt. Die übrigen Verweilzeiten schwanken zwischen 26 und<br />
40 Jahren. Die Alter aus der F11- und der F12-Bestimmung zeigen dabei eine gute Übereinstimmung.<br />
Die F113-Alter können nur Aussagen über die letzten 20 Jahre liefern, da sie erst seit den 70er Jahren<br />
hergestellt werden. So zeigt F113 Verweilzeiten von mehr als 20 Jahren <strong>für</strong> die meisten Wässer an. Nur<br />
die Proben aus Esselborn (B4) und Bornheim alt (B7) liegen mit Altern von 17 bzw. 16 Jahren leicht<br />
darunter.<br />
Berücksichtigt man nun, daß es sich bei den Grundwässern um Mischwässer handelt, so ist es mit der<br />
FCKW-Methode möglich, mit den drei voneinander unabhängigen Stoffen F11, F12 und F113 den Jungwasseranteil<br />
zu bestimmen. Man geht von einer Mischung aus einer alten, FCKW-freien Komponente<br />
und einer rezenten bzw. nur wenige Jahre alten Komponente aus. Die Ergebnisse der Jungwasserberechnung<br />
weisen eine gute Übereinstimmung bei den einzelnen FCKW auf. Mit den gewonnenen Daten sollen<br />
Umsatzraten bei der Mobilisierung und dem Austausch von Schwermetallen in Wechselwirkung mit anthropogenen<br />
Stoffeinträgen (Aufzeigen von Regelkreisläufen) und die dabei auftretenden hydrogeologischen und<br />
hydrochemischen Rahmenbedingungen aufgezeigt und zukünftige Entwicklungen prognostiziert werden.<br />
9.4.3 Analyse möglicher Grundwasserkontaminationen durch ehemalige Rüstungsstandorte:<br />
Gefährdungsabschätzung mit GIS<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Geol. Simone Simon<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. D. Schenk<br />
Problemstellung und Zielsetzung: Im Verlauf der beiden Weltkriege sind im Bereich der Bun<strong>des</strong>republik<br />
Deutschland Rüstungsaltlasten aus Sprengstoff-, Kampfstoff- u. Munitionsbetrieben entstanden, deren<br />
kennzeichnen<strong>des</strong> Merkmal das Auftreten toxischer und ökotoxischer Stoffe ist. Insbesondere die Ausbreitung<br />
der Schadstoffe über den Transportweg der ungesättigten Bodenzone zum Grundwasser stellt eine zentrale<br />
82
Problematik dar, da hier das Schutzgut Trinkwasser gefährdet ist.<br />
Dabei handelt es sich hauptsächlich um Explosivstoffe mit stark polaren Eigenschaften auf Nitro-Basis,<br />
wie z.B. 2,4,6-Trinitrotoluol. Mit zunehmender Anzahl der Nitrosubstituenten nimmt die Reaktivität der<br />
Nitroaromaten ab, womit TNT durch die symmetrische Verteilung der Nitrogruppen biologisch besonders<br />
schwer abbaubar ist. Neben diesem Sachverhalt ergibt sich die Problematik der Bewertung aus dem großen<br />
Substanzspektrum, da schon allein die Produktion von TNT eine große Zahl toxischer Intermediär- oder<br />
Abbauprodukte nach sich zieht.<br />
Eine exakte Aussage oder Vorhersage zur großräumigen Grundwasserkontamination durch ehemalige<br />
Rüstungsbetriebe kann durch die Vielzahl der potentiell zu erwartenden Stoffe nicht getroffen werden,<br />
da dies eine genaue, jedoch auch sehr kostenintensive Recherche <strong>des</strong> jeweiligen Standorts voraussetzt. Ziel<br />
ist es, <strong>für</strong> eine großräumige Betrachtung einer Rüstungslandschaft mit intensiver militärtechnischer Nutzung,<br />
ein kostengünstiges, auf frei zugänglichen Daten basieren<strong>des</strong> und GIS-gestütztes Modellkonzept zu<br />
entwickeln, um <strong>für</strong> größere Rüstungsaltlasten eine erste Gefährdung prognostizieren zu können.<br />
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im rechtsrheinischen Großraum von Köln, zwischen Leverkusen im<br />
Norden und Troisdorf im Süden und umfaßt etwa eine Größe von 150 km 2 . Auf diesem Gebiet befinden<br />
sich eine Vielzahl unterschiedlicher ehemaliger Rüstungsstandorte, deren potentielles Gefährdungspotential<br />
basierend auf folgenden Schritten, abgeschätzt wird:<br />
• Intensive historische Recherche der Rüstungslandschaft mittels Luftbildern und -karten sowie in<br />
zugänglichen Archiven, zur Ermittlung der potentiellen Kontaminationsquellen, der chemischen Substanzen<br />
und dem chemischen Spektrum der Rüstungsstandorte<br />
• Erfassung der physikalisch-chemischen Stoffeigenschaften potentiell auftretender sprengstofftypischer<br />
Verbindungen (z.B. Sorptionskapazitäten, Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient), Einteilung<br />
in Gruppen ähnlicher Stoffeigenschaften<br />
• Erfassung physikalisch-chemischer Transportparameter der ungesättigten Zone basierend auf allgemein<br />
zugänglichen Daten (z.B. Corg, pH, KAK, FK)<br />
• Betrachtung der Auswirkungen von Landnutzung/Landnutzungsänderung und der historischen Landschaftsentwicklung<br />
auf Grundwasserneubildung, Sickerwasser und Fließgeschwindigkeit<br />
• Erfassung der Grundwasserverhältnisse (Fließwege, Fließgeschwindigkeit, Flurabstand etc.)<br />
• Gruppierung und Parametrisierung der erhobenen Daten und Einbindung dieser in ein Geographisches<br />
Informationssystem (GIS)<br />
Ausblick: Bisherige Verfahren zur Gefährdungsabschätzung beruhen auf statistischen Methoden, wobei die<br />
verschiedenen Stoff- und Standorteigenschaften nach bestimmten Bewertungskriterien klassifiziert und in<br />
Gefährdungsstufen eingeteilt werden. In dieser Arbeit wird ein empirischer Ansatz gewählt, in dem durch<br />
Betrachtung eines Worst-Case-Szenarios die Schadstoffgehalte im Sickerwasser in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen<br />
und Einbeziehung der Stoffeigenschaften abgeschätzt werden, beispielsweise in Anlehnung<br />
an die Korrelation nach Karickhoff et al. (1979), einer empirischen Korrelation zwischen Oktanol/Wasser-<br />
Verteilungskoeffizient Kow und dem auf den Gehalt <strong>des</strong> Bodens an organisch gebundenem Kohlenstoff<br />
normierten Sorptionskoeffizienten Koc.<br />
Neben empirischen Korrelationen werden <strong>für</strong> das Modell die Grundwasserverhältnisse erfaßt, indem die<br />
Fließgeschwindigkeit und -richtung <strong>für</strong> einzelne Stromfäden sowie die Sickerwassermenge über die Niederschlagsverteilung<br />
und die Art der Vegetation bestimmt wird.<br />
Durch die Kombination und Verschneidung dieser Daten in einem GIS können stufenweise Gebiete mit<br />
hohen bis niedrigen Gefährdungspotentialen lokalisiert werden, welche über das GIS auch mit externen<br />
83
Transport-/ bzw. Grundwasserströmungsmodellen gekoppelt werden können. Durch räumliche Analyse und<br />
Modellierung können damit z.B. Planungsgrundlagen geschaffen werden, welche die Entscheidungsfindung<br />
<strong>für</strong> Sanierung- oder Verbesserungsmaßnahmen unterstützen, oder Alternativszenarien mit unterschiedlichen<br />
Maßnahmen unter vorgegebenen Rahmenbedingungen berechnet werden.<br />
9.4.4 Sorption, Migration und Transportverhalten von Sprengstoffen (2,4,6-Trinitrotoluol und<br />
1,3 - Dinitrobenzol) in der ungesättigten Zone - Experimentelle Studien und Modelle<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Thomas Track<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. D. Schenk<br />
Für die vertikale Verlagerung in der ungesättigten Bodenzone ist neben dem Wassergehalt das Sorptionsverhalten<br />
der Schadstoffe an unterschiedlichen Bodenkonstituenten von Bedeutung, da es in bestimmten<br />
Fällen als Kd-Wert in den Retardierungsfaktor der Transportgleichung eingeht.<br />
Das Adsorptionsverhalten umweltrelevanter Stoffe an Böden und ihrer Komponenten, d.h. Sande, Tone,<br />
Huminstoffe etc., läßt sich durch Adsorptionsisothermen illustrieren. Diese Adsorptionsisotherme beschreiben<br />
eine Beziehung zwischen der adsorbierten Masse (Adsorbent) der Chemikalien pro Masseneinheit<br />
<strong>des</strong> Adsorbens und der Masse <strong>des</strong> Stoffes in der Lösung nach der Gleichgewichtseinstellung. Für<br />
die Untersuchungen zum Adsorptionsverhalten von Sprengstoffen wurden zehn verschiedene Modellstoffe,<br />
wie sie als häufige Bodenbestandteile auftreten (Sande und Tone z.T. mit Anteilen organischer Substanz)<br />
ausgewählt sowie über verschiedene Untersuchungsverfahren charakterisiert. Zur Quantifizierung <strong>des</strong><br />
spontanen Adsorptionsvermögens beider Sprengstoffe wurden mit den oben charakterisierten Adsorbentien<br />
Schüttelversuche durchgeführt.<br />
Für die verschiedenen Versuchsanordnungen wurden die Parameter der Langmuir- und Freundlich-<br />
Adsorptionsisothermen ermittelt. In Versuche an Sandsäulen gehen die Ergebnisse der Batchversuche<br />
als Grundlage <strong>für</strong> das Transportverhalten in der ungesättigte Bodenzone ein. Für die Tone wird das Mobilitätsverhalten<br />
in Diffussionsversuchen weiter untersucht. Anhand von Lösungsversuchen werden durch<br />
das Aufbringen verschiedener Modellniederschlagswässer die Lösungskinetik von TNT und DNB sowie ihre<br />
Eintragsmenge in die ungesättigte Bodenzone untersucht. Die Ergebnisse der Säulen- und Diffusionsversuchen<br />
werden in einer Computersimulation mit dem Programm COTAM modelliert. Als Eintragsgrößen <strong>für</strong><br />
die ungesättigte Bodenzone dienen dabei die Ergebnisse der Untersuchungen zum Freisetzungsverhalten.<br />
Die Modellierungsergebnisse sollen an Felduntersuchungen verifiziert werden.<br />
9.4.5 Bestimmung und chemische Modellierung der Sorptions-Mechanismen von TNT und DNB<br />
unter definierten Randbedingungen an unterschiedlichen Bodenmaterialien<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Domenik Wolff-Boenisch<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. D. Schenk<br />
Dieses Forschungsvorhaben dient dazu, den Kontaminationspfad der Sprengstoffe TNT und DNB von<br />
ihrem Eintrag in den Oberboden bis hin zur gesättigten Zone zu erfassen, d.h. Mobilitäten und Sorptionsmechanismen<br />
zu ermitteln, um Aussagen über ihr Gefährdungspotential als toxische Substanzen <strong>für</strong> das<br />
Grundwasser bzw. den Boden treffen zu können. TNT als ubiquitärer Sprengstoff in den Weltkriegen spielt<br />
eine eminente Rolle bei der Evaluierung von Rüstungsaltlasten aus dieser Zeit, während DNB zeitweise als<br />
TNT-Ersatz verwendet wurde; zudem entsteht es als Beiprodukt bei der TNT-Fabrikation.<br />
Versuchsdurchführung: Zehn ausgewählte und mineralogisch bestimmte Sande und Tone werden mit definierten<br />
wäßrigen Lösungen von TNT und DNB versetzt, geschüttelt, wieder separiert und die Konzentration<br />
<strong>des</strong> Sprengstoffes in der wäßrigen Phase mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie gemessen,<br />
um ihr Sorptionsvermögen zu determinieren. Daraus resultieren sog. Sorptionsisotherme, anhand derer<br />
84
man Affinitäten der Sprengstoffe <strong>für</strong> bestimmte Bodenkonstituenten erkennen kann, deren physikochemischen<br />
Ursachen in weitergehenden Versuchen, die sich mit der Art und Ausprägung der Bindung zwischen<br />
Ton/Sand und chemischer Substanz beschäftigen, genauer untersucht werden. Diese Wechselwirkungen<br />
können vielfältig sein und hängen ab a) von den Mineraleigenschaften <strong>des</strong> Adsorbens, z. B. Kationenaustauschkapazität,<br />
Quellfähigkeit, Oberflächendichte, b) von den Eigenschaften der ökorelevanten Substanz,<br />
z. B. Löslichkeit, Molekülmasse, -ladung, einzelnes Elektronenpaar, Polarität und c) von umgebenden<br />
Faktoren wie pH, Temperatur und Ionenstärke der Lösung. Als analytische Instrumente dienen hierzu<br />
Röntgendiffraktometer, Infrarotspektroskope und Magnetkernresonanzspektroskope. Die Verifikation der<br />
gewonnenen Daten und Prognosen über die Mobilität beider Chemikalien findet in Lysimeter (=Säulen)<br />
Versuchen statt.<br />
9.4.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
ENZMANN, F., HOFMANN, T., SCHENK., D. (2000): A new microskopic approach to determine transport<br />
parameters and surfaces in porous media. Groundwater 2000: International Conference on Groundwater<br />
Research, June 6-8, Copenhagen, Denmark.<br />
ENZMANN, F., HOFMANN, T., SCHENK., D. (2000): A new microscopic approach to determine transport<br />
parameters and surfaces in porous media. In: Rosbjerg et al. (Hrsg), Groundwater Research, S. 83-84,<br />
Balkema, Rotterdam.<br />
KNOKE, H., ENZMANN, F., THOMAS, L., HORSTMANN, B. PEKDEGER, A., SCHENK, D. (1997):<br />
XPS-FROCKI - Bedienungsanleitung und Referenzhandbuch.- 250 S., DGMK-Ber. 436-2; Hamburg.<br />
MAIER-HARTH, U. und SCHMITT, H. (1999): Hydrogeologische Beschreibung Blatt Alzey (6214).- in<br />
Erläuterungen zur geologischen Karte Blatt Alzey 6214, Geologisches Lan<strong>des</strong>amt Rheinland Pfalz, Mainz.<br />
PIRRUNG M., ENZMANN F., SCHMITT, H. (1995): Geologie in der Um-gebung der oberoligozänen<br />
Fossillagerstätte-Enspel (NW-Wester-wald) - erste Ergebnisse.- 1995, Cour. Forsch. Inst. Senkenberg,<br />
Frankfurt a. M..<br />
SCHMITT, H. und SCHENK, D. (1997): Zur Problematik der anthropogen induzierten geogenen Schwermetallbelastung<br />
in Grundwässern.- Mainzer naturwiss. Archiv, 35, 23-25; Mainz.<br />
SCHMITT, H., BOTT, W. und SCHENK, D. (1999): Mobilisation von Schwermetallen aus Fahlerzen im<br />
Bereich Rheinhessisches Hügelland als Folge anthropogen bedingten Nitrateintrages?.- in: F. Rosenberg<br />
und H.-G. Röhling (Hg): Arsen in der Geospäre, Schriftenreihe der DDG, Heft 6: 117-122; Hannover.<br />
SCHMITT, H. und SCHENK, D. (1999): Mobilisation von Schwermetallen aus Fahlerzen im Bereich<br />
Rheinhessisches Hügelland als Folge anthropogen bedingten Nitrateintrages?.- in: Joachim W. Härtling,<br />
Monika Huch und Jörg Matschullat (Hrsg): Umwelt 2000 - Geowissenschaften <strong>für</strong> die Gesellschaft: 22-25.<br />
September 1999 in Halle (Saale); Kurzfassungen der Vorträge und Poster [Gesellschaft <strong>für</strong> Umweltgeowissenschaften],<br />
Schriftenreihe der DDG, Heft 9, 121-122; Hannover.<br />
SIMON. S., HOFMANN, T., PREUSS, J., SCHENK, D. (2000): Analysis of groundwater contamination by<br />
former ammunition plants: large scale risk assessment with GIS. In: Rosbjerg et al. (Hrsg), Groundwater<br />
Research, S. 511-512 , Balkema, Rotterdam.<br />
SIMON, S., HOFMANN, T., SCHENK, D, PREUSS, J. (2000): Groundwater risk assessment of former ammunition<br />
plants. ConSoil 2000: 7th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, September<br />
18-22, Leipzig. (in prep.)<br />
SIMON, S., HOFMANN, T., SCHENK, D, PREUSS, J. (2000): Groundwater risk assessment of former<br />
ammunition plants. HydroGeoEvent 2000, Heidelberg. (in prep.)<br />
SIMON, S, HOFMANN, T., SCHENK, D, PREUSS, J. (2000): Analysis of groundwater contamination<br />
85
y former ammunition plants: large scale risk assessment with GIS. Groundwater 2000: International<br />
Conference on Groundwater Research, June 6-8, Copenhagen, Denmark.<br />
SIMON, S., HOFMANN, T., SCHENK, D, PREUSS, J. (2000): Groundwater risk assessment of former ammunition<br />
plants. ConSoil 2000: 7th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, September<br />
18-22, Leipzig.<br />
SIMON, S., HOFMANN, T., SCHENK, D, PREUSS, J. (2000): Groundwater risk assessment of former<br />
ammunition plants. HydroGeoEvent 2000, 29.09 - 04.10.2000, Heidelberg.<br />
9.5 Bindung und Mobilität ökotoxischer Metalle und Metalloide im Bereich von Lagerstätten<br />
und Halden in Rheinland-Pfalz<br />
Univ.-Prof. Dr. H. v. Platen, Univ.-Prof. Dr. R. Oberhänsli, Univ.-Prof. Dr. R. Gaupp und Mitarbeiter<br />
(Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften)<br />
9.5.1 Bindungsformen, Mobilität und Aufnahmeverhalten von Uran in Vererzungen, Böden und<br />
Pflanzen im Saar-Nahe-Gebiet, Rheinland-Pfalz<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Holger Appel<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H. von Platen<br />
Im Saar-Nahe-Becken entstanden im Zusammenhang mit vulkanischen Aktivitäten im Oberrotliegend und<br />
den begleitenden Alterationsprozessen hydrothermale Uranvererzungen.<br />
In der Lagerstätte am Bühlskopf bei Ellweiler tritt eine epi-mesothermale Uranvererzung in der Varietät<br />
” Nohfelden B“ im Nohfelder Rhyolithkomplex auf (U max.: 1380 ppm), am Großwald bei Dreiweiherhof<br />
existiert eine Vererzung vom Typ roll-front“ in Sand- und Tonsteinen <strong>des</strong> Unterrotliegend (U max.: 1150<br />
”<br />
ppm).<br />
Durch Verwitterung gelangen das Uran und die assoziierten Schwermetalle (Pb, Cu, Zn) in den Boden<br />
und stehen dort potentiell den Standortpflanzen zur Aufnahme zur Verfügung. Zur Abschätzung <strong>des</strong><br />
ökologischen Risikos wurden durch sequentielle Standardextraktionen Art und Anteil der leichter löslichen,<br />
” bioverfügbaren“ Uranspezies in den Gesteinen und Böden bestimmt. Dies sind:<br />
• wasserlösliche und kationenaustauschbare Urananteile,<br />
• karbonatisch gebundenes Uran,<br />
• an amorphe Fe-Oxid-Hybride gebundene Gehalte,<br />
• organisch fixierte Anteile.<br />
Ergänzend zu der Erfassung der geochemischen Bindungsformen und deren Mobilitäten wurde das biochemische<br />
Aufnahmeverhalten von Uran in Standortpflanzen und Nutzpflanzen eines Freilandversuchs bestimmt.<br />
In allen untersuchten Pflanzen fand eine Uranaufnahme statt. Die Konzentrationen in der Wurzel nehmen<br />
in der Regel mit steigenden Gesamtgehalten in den Böden zu. Die Quantifizierung der Uranaufnahme<br />
und der Mobilität <strong>des</strong> Urans in den Pflanzen erfolgt mit Transferfaktoren und Verteilungskoeffizienten. In<br />
Landpflanzen sind Transferfaktoren < 1 (0.05 - 0.8) die Regel. In Wassergräsern dagegen kommen in<br />
den Untersuchungsgebieten signifikante Uranakkumulationen mit Transferfaktoren zwischen 7 und 13 vor.<br />
Alle untersuchten Pflanzen besitzen eine markante Wurzel/Sproßbarriere <strong>für</strong> Uran, die Verteilungskoeffizienten<br />
variieren zwischen 0.01 und 0.5. In den pflanzlichen Organismen kommte es zu einer bevorzugten<br />
” Endablagerung“ <strong>des</strong> Urans in den wasserreichen Endgliedern (Blätter, Nadeln, Früchte). Aufgrund der<br />
86
vorgelegten geochemischen und biochemischen Analysedaten und relevante Analogiebeziehungen werden<br />
Richtwerte <strong>für</strong> geogene und anthropogene Uranbelastungen in Böden im Sinne der Hollandliste und der<br />
Klärschlammverordnung sowie ein Wert <strong>für</strong> den tolerierbaren Gesamtgehalt in Böden vorgeschlagen.<br />
9.5.2 Erfassung und Quantifizierung von Quecksilber-, Arsen- und Antimonverbindungen im<br />
Bereich Boden - Pflanze eines historischen Quecksilber-Bergbaugebietes im Nordpfälzer<br />
Bergland<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Geogr. Anke Neuhaus<br />
Hauptbetreuer: Univ.-Prof. Dr. H. von Platen<br />
Im Zusammenhang mit dem Oberrotliegend-Vulkanismus <strong>des</strong> Saar-Nahe-Beckens bildeten sich im Nordpfälzer<br />
Bergland oberflächennahe, hydrothermale bis epithermale Quecksilber-Arsen-Antimon-Barium-<br />
Vererzungen.<br />
Das mit Abstand häufigste Quecksilbererz ist Zinnober (HgS). Als Begleiter der Quecksilbermineralisation<br />
werden sulfidische Arsen- und Antimonminerale, Fahlerze sowie Baryt (BaSO4) beobachtet. Quecksilber,<br />
Arsen, Antimon und Barium gelten als hochtoxisch, die Toxizität hängt jedoch von der Verfügbarkeit der<br />
vorliegenden Verbindung ab. Sulfidische Quecksilber-, Arsen- und Antimonverbindungen sind schwerlöslich<br />
und können als relativ ungefährlich eingestuft werden. Durch verschiedene Prozesse kann jedoch deren<br />
Verfügbarkeit und das dadurch verursachte potentielle Risiko erhöht werden. Für die vorliegende Untersuchung<br />
wurden gärtnerisch, land- und forstwirtschaftlich genutzte Böden in und um das ehemalige<br />
Quecksilberbergbaugebiet Stahlberg beprobt und analysiert. Die gefundenen Gesamtgehalte überschreiten<br />
bisherige Richtwerte (Hollandliste, Kloke-Werte) deutlich bis extrem. Dabei muß berücksichtigt werden,<br />
daß diese Richtwerte nur <strong>für</strong> anthropogene Kontaminationen, die wegen ihrer Bindungsformen leichter<br />
verfügbar sind, anwendbar sind.<br />
Die Bindungsformen von Hg, As und Sb in den Vererzungs- und Haldenbereichen wurden mit Hilfe sequentieller<br />
Extraktionsanalyse und naturnaher Extraktion untersucht. Für die Abschätzung realistischer Werte<br />
wurden die Hg-, As- und Sb-gehalte in verfügbaren Nutzpflanzen bestimmt.<br />
Für Quecksilber besteht bei pH-Werten zwischen 4.1 und 7 ein linearer Zusammenhang zwischen dem<br />
extrahierbaren Hgextr und dem Gesamtquecksilber Hgges. Im Durchschnitt lassen sich 7.5 % und maximal<br />
12.5 % <strong>des</strong> Gesamtquecksilbers extrahieren. Der größte Teil von Hgextr ist relativ fest an die organische<br />
Substanz gebunden (K = 10 −21 ). Die naturnahen Extraktionsversuche ergaben, daß in Essigsäure maximal<br />
0.4 %, in EDTA ca. 20 % von Hgorg (bei linearer Korrelation zu Hgorg) gelöst werden.<br />
Arsen ist mit ca. 59 %, Antimon mit ca. 45 % in stärkerem Maße extrahierbar als Quecksilber, es besteht<br />
ein linearer Zusammenhang zu den jeweiligen Gesamtgehalten. Der größte Teil ist an Fe-Oxid-Hydroxide<br />
gebunden, außerdem treten Arsenate auf.<br />
Die gefundenen Quecksilbergehalte liegen bei den untersuchten Blattgemüsen (Mangold, Lauch), bei Petersilie<br />
und Weizen z. T. deutlich über den vom BGA festgestzten Richtwerten. Bei den beprobten Wurzel-,<br />
Sproß- und Fruchtgemüsen, Beerenobst und Kartoffeln und anderen Getreidearten wurden keine überhöhten<br />
Konzentrationen in den verzehrbaren Pflanzenteilen beobachtet. In Pflanzenversuchen konnte festgestellt<br />
werden, daß die Quecksilberkonzentration in Pflanzen von dem mit EDTA-extrahierbarem bzw. dem organisch<br />
gebundenen Quecksilber abhängig ist. Aus dem Verhältnis HgP flanze/Hgorg wurden Transferfaktoren<br />
bestimmt. Die so berechneten Transferfaktoren liegen mit wenigen Ausnahmen zwischen 0.001 und 0.006,<br />
höhere Werte mit einem Maximum zwischen 0.012 und 0.014 wurden <strong>für</strong> Weizen, Lauch, Petersilie und<br />
Erdbeeren gefunden.<br />
Die vom BGA festgesetzten Richtwerte <strong>für</strong> Arsen werden in den untersuchten Blattgemüsen (Mangold,<br />
Lauch), der Petersilie, Kohlrabi, Zucchini und Himbeere überschritten. Für den größten Teil der untersuchten<br />
Pflanzen liegen die Transferfaktoren unter 0.001, <strong>für</strong> einige Pflanzenarten (Erdbeerem Zucchini,<br />
87
Kohlrabi und Petersilie) ergeben sich Transferfaktoren zwischen 0.001 und 0.002, <strong>für</strong> die Blattgemüse Lauch<br />
und Mangold solche zwischen 0.002 und 0.003.<br />
Für Antimon existieren keine Richtwerte <strong>für</strong> Nutzpflanzen <strong>des</strong> BGA. Die Antimongehalte der Pflanzen sind<br />
niedriger als die Arsengehalte, die berechneten Transferfaktoren liegen in der gleichen Größenordnung. Aus<br />
den Pflanzenversuchen ergibt sich ein Zusammenhang zwischen den Antimongehalten der Pflanzen und<br />
dem mit EDTA bzw. HAc extrahierbaren Antimon.<br />
Aufgrund der Pflanzenuntersuchungen, der Extraktionsversuche und der gemessenen Gesamtgehalte in den<br />
Böden wurden realistische Richtwerte <strong>für</strong> die geogenen Belastungen vorgeschlagen.<br />
88
10 Projekte am Max-Planck-Institut <strong>für</strong> Chemie<br />
10.1 Biogeochemie<br />
Prof. Dr. M. Andreae, Dr. Günter Helas, Dr. J. Kesselmeier, Dr. F. X. Meixner und Mitarbeiter<br />
10.1.1 Messungen von Lachgas (N2O) und Methan (CH4) in europaeischen Nebenmeeren<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. Hermann Bange<br />
Hauptbetreuer: Prof. Dr. M. Andreae<br />
Zur räumlich und zeitlich hochaufgelösten Messung von gelösten und atmosphärischen Lachgas (N2O) und<br />
Methan (CH4) wurde ein kontinuierlich arbeiten<strong>des</strong> gaschromatographisches Analysesystem (GC-ECD/FID)<br />
aufgebaut. Zur Messung von N2O und CH4 in der ozeanischen Mischungschicht wurde ein Seewasser-<br />
Gas Equilibrator eingesetzt. Dieses System wurde während mehrerer Expeditionen in verschiendenen europäischen<br />
Nebenmeeren (Nordsee September 1991, September 1992; Ostsee Februar 1992, Juli-August<br />
1992, Gironde November 1992, östliches Mittelmeer Juli 1993) eingesetzt.<br />
Das wichtigste Ergebnis läßt sich wie folgt zusammenfassen: Es konnte erstmals gezeigt werden, dass N2Ound<br />
CH4-Emissionen aus Küstengebieten (kontinentaler Schelf und Aestuare) einen wesentlichen Beitrag<br />
zu den globalen ozeanischen Emissionen von N2O und CH4 leisten.<br />
10.1.2 Die Abgabe von organischen Säuren an die Atmosphäre durch Pflanzen verschiedener<br />
Entwicklungsstufen<br />
Bearbeiterin: Dipl.-Biol. Kirsten Bode<br />
Hauptbetreuer: Dr. J. Kesselmeier<br />
Im Rahmen der Dissertation sollte untersucht werden, ob die Vegetation als Quelle <strong>für</strong> Ameisen- und<br />
Essigsäure in der Atmosphäre angesehen werden kann. Um dabei Oxidationsvorgänge an pflanzlich emittierten<br />
Spurengasen während der Verweildauer in der Küvette auszuschließen, wurde diese Arbeiten unter<br />
Reinluft-Bedingungen durchgeführt. Dabei wurden verschiedene junge Baumspezies hinsichtlich ihres<br />
Austauschverhaltens und ihrer Saisonalität verglichen. Erste Feldmessungen an Fichtenzweigen mit einem<br />
halboffenem Küvettensystem ergaben aufgrund der im Freiland üblichen wechselhaften klimatischen<br />
und luftchemischen Bedingungen uneinheitliche Ergebnisse. Die daraufhin geforderte Standardisierung der<br />
Meßbedingungen, die einen Vergleich verschiedener Pflanzenarten ermöglichen sollte, machte die völlige<br />
Neukonstruktion eines Küvettensystems und den Aufbau einer Gasreinigungsanlage notwendig. Mit dem<br />
neuen System wurden unter einheitlichen Bedingungen in einem Klimaschrank zwei Fichten (Picea abies (L)<br />
Karst.), eine Buche (Fagus sylvatica L.) und eine Esche (Fraxinus excelsior L.) untersucht. Im Laufe von 3<br />
bis 7 Tagen wurden die oberirdischen Abschnitte der 3-5 Jahre alten Bäume mit gereinigter Luft begast und<br />
der Austausch von Ameisen- und Essigsäure gemessen. Gleichzeitig wurden die Nettophotosynthese- bzw.<br />
die Atmungsrate und die Transpiration bestimmt. Die gewonnenen Gaswechseldaten und Austauschraten<br />
<strong>für</strong> die beiden organischen Säuren waren mit denen von Feldversuchen vergleichbar. Bei allen untersuchten<br />
Pflanzen wurden hauptsächlich Emissionen und kaum Depositionen beobachtet. Während der Lichtphasen<br />
emittierten die Versuchspflanzen in höheren Raten als in den Dunkelphasen. Bei den meisten Experimenten<br />
waren Ameisensäureaustausch und Transpirationsrate korreliert. Für die Essigsäure waren diese<br />
Beziehungen weniger deutlich. Bei allen Versuchspflanzen waren die Verhältnisse zwischen Ameisensäureund<br />
Essigsäureabgabe korreliert. Im Zusammenhang mit der herbstlichen Stoffwechselumstellung nahmen<br />
die Freisetzungsraten der Esche bezogen auf die Blattfläche und den Gaswechsel zu. Bei der Buche waren<br />
im Herbst die Emissonsraten in Bezug auf Transpiration und Photosynthese erhöht. Desweiteren war eine<br />
89
auffällige Verschiebung <strong>des</strong> Ameisen- zu Essigsäureverhältnisses zugunsten der Essigsäure zu erkennen. Einer<br />
einfachen Abschätzung zufolge kann die Vegetation eine bedeutsame kontinentale Quelle <strong>für</strong> Ameisenund<br />
Essigsäure in der Atmosphäre darstellen. Danach würde eine globale Waldfläche von 48·10 6 km 2 jährlich<br />
114 Gmol Ameisen- und 52 Gmol Essigsäure freisetzen. Bei den weiter führenden Arbeiten im Anschluß<br />
an die Dissertation wurden umfangreiche Arbeiten zur Freisetzung von biogenen Kohlenwasserstoffen in<br />
Feldexperimenten durchgeführt. Alle Arbeiten schlossen die oxigenierten Verbindungen (organische Säuren<br />
und Carbonyle) ein. Die Ergebnisse weisen auf einen potentiell bedeutenden Beitrag der Vegetation zum<br />
Budget der oxigenierten (teiloxidierten) in der Atmosphäre hin.<br />
10.1.3 Modellierung der biogenen Emissionen von Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen<br />
aus Ökosystemen <strong>des</strong> Amazonasgebietes<br />
Bearbeiter: Bachelor of Agricultural Management Grant A. Kirkman<br />
Hauptbetreuer: Dr. F. X. Meixner<br />
Die photochemische Produktion von troposphärischem Ozon im Rahmen der Oxidation von Kohlenwasserstoffverbindungen<br />
(CO, CH4, VOC) durch Radikalverbindungen (OH·, RO2, etc.) ist entscheidend von<br />
der atmosphärischen Konzentration der Stickstoffoxide (NOX = NO + NO2) abhängig. Während in industrialisierten<br />
Ländern die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen die Hauptquelle <strong>des</strong> NOX darstellt,<br />
sind dies in den Ländern der dritten Welt die Verbrennung von Biomasse und die biogene Emission von<br />
Stickstoffmonoxid (NO) aus Böden.<br />
Im Rahmen der noch laufenden Doktorarbeit wurde zur Vorbereitung der geplanten Untersuchungen zur<br />
biogenen NO-Emission aus brasilianischen Ökosystemen (s.u.) zunächst ein einfacher Algorithmus entwickelt,<br />
um die jährliche biogene NO-Emission <strong>für</strong> das Staatsgebiet von Zimbabwe zu ermitteln. Den durch<br />
räumliche Extrapolation gewonnenen Ergebnissen lagen Laboruntersuchungen an Bodenproben zugrunde,<br />
welche 1994 durchgeführt wurden und die die NO-Emission <strong>für</strong> die drei wesentlichen Landnutzungsklassen<br />
Zimbabwes (miombo woodland, grassland, agricultural land) in Abhängigkeit der Bodentemperatur und -<br />
feuchte charakterisierten. Im Rahmen der Doktorarbeit wurden durch Modellierung lan<strong>des</strong>weite Datenfelder<br />
(a) der Bodentemperatur und -feuchte und (b) der landnutzungsspezifischen, mittleren monatlichen NO-<br />
Emission aus Böden erzeugt, welche durch den Beitrag derjenigen NO-Emission ergänzt werden konnten,<br />
der sich akut nach Starkniederschlägen ergibt (pulsing). Für das Staatsgebiet von Zimbabwe ergibt sich<br />
damit eine jährliche NO-Emission aus Böden von 33 Gg NO-N, wobei 63 % aus der Landnutzungsklasse<br />
miombo woodland stammen, welche 66 % der Gesamtfläche von Zimbabwe ausmacht. Die so gewonnenen<br />
Abschätzungen sind die ersten, die jemals <strong>für</strong> die Stickstoffbilanzierung eines afrikanischen Staates ermittelt<br />
wurden; die Ergebnisse wurden bereits zusammengefasst und zur Veröffentlichung (Global Biogeochemical<br />
Cycles) eingereicht.<br />
Im September/November 1999 wurde die NO-Emission aus Weide- und Regenwaldböden in Rondônia /<br />
Brasilien mit der Hilfe eines dynamischen Bodenkammersystem im Feldexperiment untersucht. Die mittlere<br />
biogene NO-Emission aus den Regenwaldböden (3.5 ng N m −2 s −1 ) erwies sich als zehnmal höher<br />
als die, welche über denjenigen Weideflächen beobachtet wurde, die vor 20 Jahren durch Brandrodung<br />
aus Regenwaldökosystemen entstanden waren. Die in einer parallelen Doktorarbeit im Labor ermittelten<br />
Abhängigkeiten der NO-Emission von Bodentemperatur, -feuchte, sowie dem Nährstoffgehalt der Böden<br />
wird im Rahmen der Doktorarbeit benutzt werden, um die NO-Emission <strong>für</strong> das Gebiet der westbrasilianischen<br />
Provinz Rondônia jahreszeitabhängig und flächendeckend zu ermitteln. Dazu wird derAlgorithmus<br />
verwendet, der bereits <strong>für</strong> die Bestimmung der lan<strong>des</strong>weiten biogenen NO-Emission Zimbabwes<br />
benutzt und der mittlerweile erheblich verbessert und an die brasilianischen Verhältnisse angepasst wurde.<br />
Darüberhinaus wurden geeignete Modellkomponenten implementiert, die der Untersuchung derjenigen<br />
Prozesse dienen, welche der NO-Emission zugrunde liegen (Nitrifikation, Denitrifikation, Mineralisierung,<br />
Dekomposition, etc.).<br />
90
10.1.4 Spurengasaustausch klimarelevanter reduzierter Schwefelverbindungen zwischen Biosphäre<br />
und Atmosphäre: COS Transfer der Flechten und anderer biotischer Kompartimente<br />
Bearbeiter: Dipl.-Biol. Uwe Kuhn<br />
Hauptbetreuer: Dr. J. Kesselmeier<br />
Die Arbeiten zur Dissertation über atmosphärisches Carbonylsulfid (COS) erfolgten in zwei Abschnitten.<br />
Zunächst wurde der Spurengasaustausch unter Feldbedingungen untersucht. Daran schloß sich dann eine<br />
methodische Arbeit zum Verständnis der pflanzenphysiologischen Vorgänge an. In den Feldversuchen unter<br />
natürlichen Bedingungen an einem Standort in Kalifornien wurden dynamische Einschlußkammern eingesetzt.<br />
Flechtenproben wurde in einer Meßkammer im Vergleich zu einer leeren Kammer gemessen. Die<br />
Arbeiten fanden im Mai/Juni (Trockenzeit) und im November/Dezember (Regenzeit) statt. Aufgezeichnet<br />
wurden physiologische Parameter (CO2 Austausch und Thallus Wasserstatus) sowie Umweltvariable (Temperatur,<br />
Strahlung, Luftfeuchte und atmosphärische COS Konzentrationen). Es stellte sich heraus, daß<br />
Flechten in der Lage sind, kontinuierlich COS aufzunehmen und zwar im Licht wie im Dunkeln. In erster<br />
Linie ist die Aufnahme abhängig vom Feuchtegehalt der Flechten. Zusätzlich zeigte sich eine Abhängigkeit<br />
von der Temperatur und vom atmosphärischen COS Mischungsverhältnis. Inaktivierung durch hohe Temperaturen<br />
wies auf einen enzymatischen Hintergrund hin. Licht und Photosynthese haben keinen direkten<br />
Einfluß auf die COS Aufnahme. Die Aufnahmeraten bewegten sich zwischen 0.015 und 0.071 pmol g −1 s −1<br />
(auf Trockengewichtsbasis). Umgerechnet auf die Thallusoberfläche zeigte sich die Senkenstärke der Flechten<br />
vergleichbar stark wie die höhere Vegetation. Im Vergleich zu den Flechtenmessungen wurden während<br />
der Feldmessungen in der Regenzeit sowohl der Boden, als auch höhere Vegetation untersucht. Damit war<br />
es möglich das Potential der <strong>für</strong> das betroffene Ökosystem wichtigen Komponenten abzuschätzen. Es zeigte<br />
sich, daß neben Flechten und höherer Vegetation, der Boden als die dominante Senke agierte. Mit der<br />
oben beschriebenen Technik wurden anschließend die Grundlagen <strong>des</strong> COS Austausches der Flechten unter<br />
Klimakammerbedigungen untersucht. Hier bestätigte sich der zentrale Einfluß <strong>des</strong> Thalluswassergehaltes<br />
auf die Physiologie und die Aufnahmevorgänge. Ein Wassergehalt von 30 % war das Minimum <strong>für</strong> die COS<br />
Aufnahme, deren Rate bis zum Wassergehalt von 200 % anstieg. Zusätzlich signifikant regulierend war das<br />
atmosphärische Mischungsverhältnis. Die Aufnahmerate zeigte eine lineare Abhängigkeit von ambienten<br />
COS Konzentrationen mit einem Kompensationspunkt im Bereich von 37 ppt. Das Temperaturoptimum<br />
von 25 ◦ C verwies auf den physiologischen Hintergrund der COS Aufnahme, was sich schließlich mit dem<br />
erfolgreichen Einsatz eines spezifischen Enzymhemmstoffes beweisen ließ. Zur Modellierung konnten alle<br />
Variablen in einen Algorithmus integriert werden, der die Feldergebnisse erfolgreich nachzeichnete und zur<br />
weiteren Modellierung eingesetzt werden kann.<br />
10.1.5 Herkunft und Massenbilanz von Blei in metallreichen Sediemnten<br />
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Bernhard Peucker-Ehrenbrink<br />
Hauptbetreuer: Prof. Dr. M. Andreae<br />
Seit langem ist bekannt, daß die Bleiisotopen-Zusammensetzung von Gesteinen, die aus Mantelschmelzen<br />
entstanden sind, schlecht mit denen <strong>des</strong> Strontiums und Neodyms korrelliert. Die globale Differentiation<br />
der (U, Th)-Pb-Verhältnisse im Kruste-Mantel-System muß <strong>des</strong>halb von der anderer Isotopensysteme abweichen.<br />
Seit den Untersuchungen von Unruh und Tatsumoto (1976), Chen et al. (1986) und Berrett et<br />
al. (1987, 1988) ist bekannt, daß Blei in metallreichen Sedimenten aus Tiefsee-sedimentkernen isotopisch<br />
eher auf Mantel- als auf Krustenherkunft hindeutet.<br />
In diesem projekt wurde die Möglichkeit untersucht, daß ein erheblicher Teil <strong>des</strong> Bleis aus der ozeanischen<br />
Kruste (Mantel) durch hydrothermale Alteration gelaugt und in marine Sedimente (Kruste) umgelagert<br />
wird. Diese Sediemente werden während der Subduktion der kontinentalen Kruste angegliedert oder verlieren<br />
einen großen Teil ihres Bleis im Zuge von Entwässerungs- und Schmelzprozessen während der Subdukti-<br />
91
on der ozeanischen Lithosphäre. Dieser Prozeß könnte zu einer Zunahme <strong>des</strong> U/Pb und Th/Pb im Mantel<br />
in geologische Zeiträume führen und die abweichende Fraktionierung im (U,Th)/Pb-system erklären.<br />
In der ersten Projektphase wurden 371 DSDP/ODP-Kerne aus dem Pazifik auf ihre Konzentration und<br />
Verteilung von metallreichen Sedimenten hin untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß metallreiche Sedimente<br />
vor allem im untersten Teil der Sedimentsäule weit verbreitet sind. Sie machen etwa 1,5 bis 2<br />
Volumenprozent der pazifischen Sedimente aus. Die Konzentration schwankt regional stark und kann bis<br />
zu 40 Volumenprozent der Gesamtsedimentmenge erreichen.<br />
Bleiisotopen-Untersuchungen an 38 Proben von 13 ausgewählten DSDP/ODP-Kernen <strong>des</strong> Ostpazifiks<br />
(52 ◦ N bis 63 ◦ S) zeigen, daß metallreiche Sedimente Mischungslinien zwischen radiogenen pelagischen<br />
Sedimenten (EM I) und ozeanischen basalten (MORB, HIMU) definieren. Die 206 Pb/ 204 Pb, 207 Pb/ 204 Pb<br />
und 208 Pb/ 204 Pb variieren zwischen 18,274 und 19,234, 15,504 und 15,685 sowie 37,894 uund 38,945. Die<br />
Anteile der beiden Mischungs-Endglieder können aus den Isotopenzusammensetzungen und Bleikonzentrationen<br />
berechnet werden. Die starke isotopische Variabilität normaler pelagischer Sedimente ist Ausdruck<br />
der kurzen Verweildauer <strong>des</strong> Bleis im Meerwasser und spiegelt regionale Einflüsse wider. Deshalb sollte den<br />
Berechnungen nicht, wie bisher üblich, ein Mittelwert (z.B. der Schwerpunkt <strong>des</strong> Manganknollen-Fel<strong>des</strong>)<br />
<strong>für</strong> pelagische Sedimente als rediogenes Endglied zu Grunde gelegt, sondern die radiogene Isotopenzusammensetzung<br />
<strong>des</strong> betreffenden kernes verwendet werden. Die Anteile <strong>des</strong> basaltischen (Mantel-) Endglie<strong>des</strong><br />
liegen in den untersuchten proben zwischen 0 und 90 Prozent.<br />
Vorläufige Abschätzungen über die Effizienz der hydrothermalen Laugung <strong>des</strong> Bleis aus der ozeanischen<br />
Kruste deuten auf einen Blei-Verlust von etwa einem Drittel hin. Unter der Annahme, daß die heutige<br />
Produktionsrate an Ozeankruste und die Laugungseffizienz <strong>für</strong> die gesamte Erdgeschichte als Minimalwerte<br />
angesehen werden können, kann die Bleiverarmung <strong>des</strong> Erdmantels abgeschätzt werden. Der obere Mantel<br />
(10 ng/g Pb) verliert danach etwa 6 % seines Bleis in 100 Millionen Jahren. Der ursprüngliche, primitive<br />
Erdmantel (175 ng/g Pb) hat seit der Entstehung der Erde min<strong>des</strong>tens 4,3 % <strong>des</strong> Bleis verloren. Mit dem<br />
untersuchten Prozeß lassen sich demnach min<strong>des</strong>tens ein Drittel <strong>des</strong> Blei-Überschusses, den die kontinentale<br />
Kruste im Vergleich zu mäßig inkompatiblen Elementen bei der Erdkrustenbildung wie Sr und den leichten<br />
Seltenen Erden hat, erklären.<br />
10.1.6 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Bange, H.W., U.H. Bartell, S. Rapsomanikis and M.O. Andreae (1994): Methane in the Baltic and North<br />
Seas and a reassessment of the marine emissions of methane, Global Biogeochem. Cycles, 8, 465-480.<br />
Bange, H.W., S. Rapsomanikis and M.O. Andreae (1996): The Aegean Sea as a source of atmospheric<br />
nitrous oxide and methane, Mar. Chem., 53 (1-2), 41-49.<br />
Bange, H.W., S. Rapsomanikis and M.O. Andreae (1996): Nitrous oxide in coastal waters, Global Biogeochem.<br />
Cycles, 10 (1), 197-207.<br />
Bode, K., Schebeske, G., Weller, D., Wolf, A. and Kesselmeier, J. (1996) Emission of short chained (C1/C2)<br />
organic acids and aldehy<strong>des</strong> in relation to physiological activities of Mediterranean tree and shrub species<br />
during the BEMA field campaigns in 1995. In:Coeur, C., Jacob, V., Foster, P., Torres, L., Kotzias, D.,<br />
Cieslik, S., Versino, B. (Eds.), Biogenic Emissions in the Mediterranean Area, BEMA-Project. Report on<br />
the 2nd BEMA measuring campaign Montpellier-France-June 1995. pp 65-75. EUR 16449 EN, Brussels.<br />
Bode, K., Helas, G., and Kesselmeier, J. (1997) Biogenic contribution to atmospheric organic acids. In:<br />
Biogenic volatile organic compounds in the atmosphere - Summary of present knowledge (Helas, G., Slanina,<br />
S., and Steinbrecher, R., eds.) pp 157-170, SPB Academic Publishers, Amsterdam, The Netherlands.<br />
Ciccioli, P., Fabozzi, C., Brancaleoni, E., Cecinato, A., Frattoni, M., Loreto F., Kesselmeier, J., Schäfer, L.,<br />
Bode, K., Torres, L. and Fugit, J.L. (1997) Use of the isoprene algorithm for predicting the monoterpene<br />
emission from the Mediterranean Holm oak Quercus ilex L.. Performances and limits of this approach.<br />
92
Journal of Geophys. Res. 102, D19, 23319-23328.<br />
Collins, C.D. Hofmann, U., Kuhn, U., Wolf, A. and Kesselmeier, J. (1997) The deposition and emission<br />
of sulphur compounds by crops. In: Sulphur metabolism in higher plants. Molecular, ecophysiological<br />
and nutritional aspects. (Cram, W.J., DeKok, L.J., Stulen, I, Brunold, C. and Rennenberg, H. eds.) pp<br />
281-284, Backhuys Publishers, Leiden.<br />
Collins, C.D. Hofmann, U., Kuhn, U., Wolf, A. and Kesselmeier, J. (1999) Fluxes of sulfur compounds from<br />
crops. In: Proceedings of EUROTRAC Symposium 1998, P.M. Borrell and P. Borrell (eds.) pp 163-166,<br />
WITPress, Southampton, UK. ISBN: 1-85312-742-6.<br />
Gries, C, Sanz, M.J., Romagni, J.G., Goldsmith, St., Kuhn, U., Kesselmeier, J., Nash III, Th. H. (1997)<br />
The uptake of gaseous sulphur dioxide in non-gelatinous lichens. New Phytologist 135, 595-602.<br />
Gries, C., Romagni, J.G., Nash III, Th.H., Kuhn, U. and Kesselmeier, J. (1997) The relation of H2S release<br />
to SO2 fumigation of lichens. New Phytologist 136, 703-711.<br />
Gut, A., Kirkman, G.A., Meixner, F.X., Andreae, M.O., Gatti, L.V. (2000), Fluxes of nitrogen oxi<strong>des</strong> and<br />
ozone from and to Amazonian primary forest and pasture soils during the dry-to-wet transition period,<br />
Newsletter European Geophysical Society, 74, 221.<br />
Helas, G., Andreae, M.O., Bliefernicht, M., Bode, K., Helligrath, S., Schäfer, L., Scheibe, B., Seyffer, E.,<br />
Velmecke, F., and Kesselmeier, J. (1992) Volatile organic acids and ammonia measurements in a spruce<br />
forest. EUROTRAC Annual Report 1991, Part BIATEX, pp 178-182.<br />
Kesselmeier, J., Bode, K., and Helas, G. (1993) Exchange of organic acids between trees and the atmosphere.<br />
EUROTRAC Annual Report 1992, Part 4 BIATEX, 151-153.<br />
Hilse, C., Wilhelm, C., Kesselmeier, J., Johnston, A.M. and Raven, J.A. (2000) DMSP production of the<br />
nanoalga Prymnesium parvum dependent on environmental factors and the photosynthetic activity of the<br />
cells. In preparation.<br />
Kesselmeier, J., Teusch, N. and Kuhn, U. (1999) Controlling variables for the uptake of atmospheric<br />
carbonyl sulfide (COS) by soil. Journal of Geophysical Research-Atmospheres. 104 (D9): 11577-11584.<br />
Kesselmeier, J., Bartell, U., Blezinger, S., Conze, W., Gries, C., Hilse, C., Hofmann, R., Hofmann, U.,<br />
Hubert, A., Kuhn, U., Meixner, F., Merk, L., Nash, T.H. III, Protoschill-Krebs, G., Velmecke, F., Wilhelm,<br />
C., Andreae, M.O. (1997) Exchange of reduced sulfur compounds between the biosphere and the atmosphere.<br />
In: Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the Troposphere (P. Borrell, P.M.<br />
Borrell, T. Cvitas, K. Kelly and W. Seiler, eds.) Vol 4, Biosphere-Atmosphere Exchange of Pollutants and<br />
Trace Substances ( J. Slanina, ed.) pp 320-326, Springer Verlag, Heidelberg.<br />
Kesselmeier, J., Bode, K., Gabriel, R., Schäfer, L., Beck, J., Rausch, Th., and Helas, G. (1994) Exchange<br />
of organic acids between the biosphere and the atmosphere: emissions by tree species and organic acid<br />
distribution between intra- and extracellular fluids. EURO-TRAC Annual Report 1993, Part 4 BIATEX,<br />
194-199.<br />
Kesselmeier, J. and Bode, K. (1997) Biological knowledge needed for the measurements and interpretation<br />
of exchange processes between plants and the atmosphere. In: Biogenic volatile organic compounds in the<br />
atmosphere - Summary of present knowledge (Helas, G., Slanina, S., and Steinbrecher, R., eds.) pp 9-25,<br />
SPB Academic Publishers, Amsterdam, The Netherlands.<br />
Kesselmeier, J., Bode, K., Schjoerring, J.K. and Conrad, R. (1997) Biological mechanisms involved in the<br />
exchange of trace gases. In: Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the Troposphere (P.<br />
Borrell, P.M. Borrell, T. Cvitas, K. Kelly and W. Seiler, eds.) Vol 4, Biosphere-Atmosphere Exchange of<br />
Pollutants and Trace Substances ( J. Slanina, ed.) pp 117-133, Springer Verlag, Heidelberg.<br />
Kesselmeier, J., Ammann, C., Beck, J., Bode, K., Gabriel, R., Hofmann, U., Helas, G., Kuhn, U., Meixner,<br />
F.X., Rausch, Th., Schäfer, L., Weller, D., Andreae. M.O. (1997) Exchange of short chained organic acids<br />
93
etween the biosphere and the atmosphere. In: Transport and Chemical Transformation of Pollutants in the<br />
Troposphere (P. Borrell, P.M. Borrell, T. Cvitas, K. Kelly and W. Seiler, eds.) Vol 4, Biosphere-Atmosphere<br />
Exchange of Pollutants and Trace Substances ( J. Slanina, ed.) pp 327-334, Springer Verlag, Heidelberg.<br />
Kesselmeier, J. Wilske, B., Muth, S., Bode, K., Wolf, A. (1999) Exchange of oxygenated volatile organic<br />
compounds between boreal lichens and the atmosphere. In: Biogenic VOC emissions and photochemistry<br />
in the boreal regions of Europe -? BIPHOREP (Tuomas Laurila and Virpi Lindfors, eds.) pp 57-71, Office<br />
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. ISBN 92-828-6990-3<br />
Kesselmeier, J. Bode, K., Hofmann, U., Müller, H., Schäfer, L. Wolf, A., Ciccioli, P., Brancaleoni, E.,<br />
Cecinato, A., Frattoni, M., Foster, P., Ferrari, C., Jacob, V., Fugit, J.L., Dutaur, L., Simon, V. and Torres,<br />
L. (1997) Emission of short chained organic acids, aldehy<strong>des</strong> and monoterpenes from Quercus ilex L. and<br />
Pinus pinea L. in relation to physiological activities, carbon budget and emission algorithms. Atmospheric<br />
Environment, 31(SI), 119-134.<br />
Kesselmeier, J., Bode, K., Gerlach, C. and Jork, E.-M. (1998) Exchange of atmospheric formic and acetic<br />
acid with trees and crop plants under controlled chamber and purified air conditions. Atmos. Environm.32<br />
(10), 1765-1775.<br />
Kesselmeier, J., Bode, K., Schäfer, L., Schebeske, G., Wolf, A., Brancaleoni, E., Cecinato, A., Ciccioli, P.,<br />
Frattoni, M., Dutaur, L., Fugit, J.L., Simon, V. and Torres, L. (1998) Simultaneous field measurements<br />
of terpene and isoprene emissions from two dominant Mediterranean oak species in relation to a North<br />
American species. Atmos. Environm. 32 (11), 1947-1953.<br />
Kirkman, G.A., Meixner, F.X., Schenk, D., Andreae, M.O. (2000), Upscaling of biogenic nitric oxide<br />
emissions from soils: An elementary approach to Zimbabwe, Newsletter European Geophysical Society, 74,<br />
133.<br />
Kirkman G.A., W. X. Yang, F. X. Meixner, Biogenic nitric oxide emissions upscaling: an approach to<br />
Zimbabwe, Global Biogeochemical Cycles, submitted, March 2000.<br />
Kuhn, U. and Kesselmeier, J. (1997) Lichens involved in the exchange of carbonyl sulfide between biosphere<br />
and the atmosphere. In: The Proceedings of EUROTRAC Symposium 1996 (P.M. BORRELL, P. Borrell, T.<br />
Cvitas, K. Kelly and W. Seiler, eds.), pp 189-196. Computational Mechanics Publications, Southampton.<br />
Kuhn, U., Wolf, A., Ammann, C., Meixner, F.X., Andreae, M.O. and Kesselmeier, J. (1999) Soil as a sink<br />
for atmospheric carbonyl sulfide in an open oak woodland ecosystem. Atmos. Environm. 33 (6), 995-1008.<br />
Kuhn, U., Gries, C., Nash III, T.H., and Kesselmeier, J. (2000) Field measurements on the exchange of<br />
carbonyl sulfide between lichens and the atmosphere. Atmos. Environ., in press.<br />
Kuhn, U. and Kesselmeier, J. (2000) Environmental parameters controlling the uptake of carbonyl sulfide<br />
by lichens. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, in press.<br />
Meixner, F.X., Gatti, L.V., Kirkman, G.A., Cordoba Leal, A.M., Moura, M.L., Oliveira dos Santos, E.,<br />
Andreae, M.O. (2000), Surface mixing ratios of NO, NOx, and ozone at an west Amazonian pasture site<br />
during the 1999 wet-to-dry and dry-to-wet-transition periods, Newsletter European Geophysical Society,<br />
74, 221.<br />
Meixner, F.X., Ammann, C., Andreae, M.O., Beck, J., Biesenthal, T., van Djik, S., Gut, A., Guyon, P.,<br />
Graham, B., Helas, G., v. Jouanne, J., Kesselmeier, J., Kirkman, G.A., Kormann, R., Kuhn, U., Mayol,<br />
O., Roberts, G., Rottenberger, S., Rummel, U., Schebeske, G., Scheibe, M., Welling, M., Wolf A., Artaxo,<br />
P., Gatti, L.V., Tavares, T.M., Gomes, B.M., Lyra, R., Moura, M.L., Esteves, J.L. (2000), Biosphereatmosphere<br />
exchange of nitrogen oxi<strong>des</strong>, volatile organic compounds, and aerosols on interlinking scales:<br />
an overview of LBA-EUSTACH 1999 measurements (Poster), Newsletter European Geophysical Society,<br />
74, 133.<br />
Neeb, P., Bode, K., Beck. J., Schäfer, L., Kesselmeier, J. and Moortgat, G.K. (1997) Influence of gas-phase<br />
94
oxidation on estimated emission rates of biogenic hydrocarbons. In: Proceedings of the 7th European<br />
Symposium on Physico-Chemical Behaviour of Atmospheric Pollutants: The oxidizing Capacity of the<br />
Troposphere, pp 295-299, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (EUR<br />
17482) ISBN 92-828-0158-6.<br />
Romagni J G., Gries C., Nash T H III., Kuhn U., Kesselmeier J . (1996) The release of H2S in response to<br />
SO2 fumigation of seven lichen species. American Journal of Botany 83 (6 SUPPL.). 19.<br />
Simon, V., Dutaur, L., Fugit, J.L., Torres, L., Kesselmeier, J., Bode, K., Schäfer, L., Wolf, A., Ciccioli, P.,<br />
Brancaleoni, E., Cecinato, A., Frattoni, M., and Loreto, F. (1997) Emission of terpenes and isoprene from<br />
the different oak species Quercus ilex L., Quercus pubescens L. and Quercus agrifolia L. In: Proceedings<br />
of the 7th European Symposium on Physico-Chemical Behaviour of Atmospheric Pollutants: The oxidizing<br />
Capacity of the Troposphere, pp 472-475, Office for Official Publications of the European Communities,<br />
Luxembourg (EUR 17482) ISBN 92-828-0158-6.<br />
Wilhelm, C., Bida, J., Domin,A., Hilse, C., Kaiser, B., Kesselmeier, J., Lohr, M. and Müller, A.M. (1997)<br />
Interaction between global climate change and the physiological responses of algae. Photosynthetica 33,<br />
491-503.<br />
Zaady, E., Kuhn, U., Wilske, B., Sandoval-Soto, L. and Kesselmeier, J. (2000) Patterns of CO2 exchange<br />
in biological crusts of successional age. Soil Biology and Biochemistry 32, 959-966.<br />
10.2 Luftchemie<br />
Prof. Dr. P. Crutzen und Mitarbeiter<br />
10.2.1 Messung und Interpretation von 13 C, 14 C, 17 O und 18 O Variationen in Atmosphärischem<br />
Kohlenmonoxid<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. Thomas Röckmann<br />
Hauptbetreuer: Prof. Dr. P. Crutzen<br />
Isotopenbestimmungen an atmosphärischen Spurengasen werden in zunehmendem Maße zur Untersuchung<br />
ihrer Quellen und Senken sowie zur Identifikation von chemischen Reaktionswegen eingesetzt. Im Falle von<br />
CO existieren vier seltene Isotope, 13 C, 14 C, 17 O und 18 O. Eine vollständige Analytik zur gleichzeitigen<br />
Bestimmung aller vier Isotopensignaturen wurde in dieser Arbeit entwickelt.<br />
Ausgeprägte saisonale Schwankungen der Isotopenzusammensetzung von CO wurden an Reinluftproben,<br />
die regelmäßig an unterschiedlichen Stationen genommen werden, beobachtet. Die Interpretation dieser<br />
Schwankungen ist nützlich <strong>für</strong> das Verständnis <strong>des</strong> globalen CO Zyklus. Insbesondere wurden zwei bisher<br />
unbekannte Phänomene identifiziert.<br />
Die unabhängige Bestimmung von δ 17 O und δ 18 O an atmosphärischem CO zeigt eine beträchtliche massenunabhängige<br />
Fraktionierung in den Sauerstoffisotopen. Mit Hilfe von Laborexperimenten wurden die<br />
Hauptquellen dieser neuentdeckten Isotopensignatur identifiziert. Von großer Bedeutung ist, daß in der<br />
Senkenreaktion von CO mit OH das verbleibende CO einen Überschuß an 17 O aufbaut. Weiterhin wird<br />
massenunabhängig fraktionierter Sauerstoff von O3 bei der Ozonolyse ungesättiger Kohlenwasserstoffe auf<br />
CO übertragen.<br />
Während Episoden troposphärischen Ozonabbaus im Arktischen Frühling werden erniedrigte Werte von<br />
δ 13 C(CO) gemeinsam mit erniedrigten Ozonmischungverhältnissen beobachtet. Dies wird durch die Produktion<br />
von stark 13 C abgereichertem CO in der Reaktion von Cl mit CH4 bei erhöhten Cl Mischungsverhältnissen<br />
verursacht. Die Auswertung der δ 13 C Abweichungen ermöglicht die Quantifizierung von Cl<br />
Mischungsverhältnissen während dieser Ozonabbauereignisse, und die Ergebnisse sind in Übereinstimmung<br />
95
mit unabhängigen Untersuchungen.<br />
10.2.2 Anomalien ozonchemisch relevanter Spurengase, Feldmessungen und Modellierung<br />
Bearbeiter: Dipl.-Chem. Andreas Waibel<br />
Hauptbetreuer: Prof. Fischer, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Es wurden flugzeuggetragene in situ Messungen von verschiedenen atmosphärischen Spurengasen im Rahmen<br />
<strong>des</strong> EUProjektes STREAMII an Bord einer Cessna Citation II in der oberen Troposphäre und unteren<br />
Stratosphäre durchgeführt.<br />
In einem ersten Feldexperiment mit Ausgangspunkt Amsterdam wurden im Juli 1994 über Europa in einem<br />
Höhenbereich von 9 – 12 km stark erhöhte Werte von Kohlenmonoxid (CO) gemessen. In der oberen<br />
Troposphäre konnten Werte bis zu 600 ppbv beobachtet werden. In der unteren Stratosphäre variierten<br />
die Konzentrationen zwischen typischen Hintergrundwerten von ≈ 40 ppbv und stark erhöhten Werten<br />
von ≈ 300 ppbv. Trajektorienberechnungen zeigen, daß die wahrscheinlichste Ursache da<strong>für</strong> boreale Feuer<br />
sind. Solche Feuer können aufgrund ihrer Energiefreisetzung Konvektionen verursachen, die bis in die obere<br />
Troposphäre und gelegentlich sogar bis in die untere Stratosphäre reichen. CO hat einen direkten Einfluß<br />
auf die Bildung und Zerstörung von Ozon. Störungen <strong>des</strong> Ozonhaushalts im Tropopausenbereich und der<br />
unteren Stratosphäre haben einen verstärkten Einfluß auf das Strahlungsgleichgewicht der Erde.<br />
In einem zweiten Feldexperiment mit Ausgangspunkt Kiruna wurden im Februar 1995 stark erhöhte Konzentrationen<br />
von reaktiven Stickstoffverbindungen (NOy) in der unteren arktischen Stratosphäre mit maximalen<br />
Werten von 9 ppbv beobachtet. Zur Erklärung dieser Beobachtung ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit<br />
ein Modell entwickelt worden, welches die Bildung und gravitationsbedingte Sedimentation von Eisteilchen<br />
sowie die daraus resultierende räumliche Umverteilung von Salpetersäure (HNO3) und Wasser (H2O) in<br />
der arktischen Stratosphäre auf der Basis von ECMWF Daten simuliert. Die Modellergebnisse zeigen – bei<br />
Berücksichtigung eines Coating Mechanismus <strong>für</strong> Eisteilchen aufgrund von Salpetersäuretrihydrat (NAT)<br />
– eine substantielle vertikale Umverteilung von NOy (Denitrifizierung und Nitrifizierung) der arktischen<br />
Stratosphäre im Winter 1994/95. Der Prozeß der Denitrifizierung wird als eine wesentliche Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> einen großskaligen Ozonabbau in der polaren Stratosphäre betrachtet.<br />
Der CONachweis erfolgte durch Absorptionsspektroskopie mit Hilfe von abstimmbaren Diodenlasern (TD-<br />
LAS). FÜr den NOyNachweis sind die reaktiven Stickstoffverbindungen in einem beheizten Goldkonverter<br />
unter Zugabe von CO zu Stickstoffoxid (NO) reduziert worden. NO wurde anschließend mit einem Chemilumineszensdetektor<br />
(CLD) nachgewiesen.<br />
10.2.3 Publikationen im Zusammenhang mit Projekten im Graduiertenkolleg<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., C. Köppel, T. Röckmann, D. Scharffe, M. Bräunlich and V. Gros, Absolute<br />
measurement of the abundance of atmospheric carbon monoxide J. Geophys. Res., in press, 2000.<br />
Rom, W., C.A.M. Brenninkmeijer, M. Bräunlich, R. Golser, M. Mandl, A. Kaiser, W. Kutschera, A. Priller,<br />
S. Puchegger, T. Röckmann, and P. Steier, A detailed 2-year record of atmospheric 14 CO in the temperate<br />
northern hemisphere, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B, 161, 780-785, 2000.<br />
Röckmann, T., J. Kaiser, J.N. Crowley, R. Borchers, W.A. Brand, and P.J. Crutzen, The isotopic enrichment<br />
of nitrous oxide (15N14NO, 14N15NO, 14N14N18O) in the stratosphere and in the laboratory, submitted<br />
to J. Geophys. Res., 2000.<br />
Johnston, J.C., T. Röckmann, and C.A.M. Brenninkmeijer, Laboratory and modeling studies of CO2 and<br />
O(1D) isotopic exchange, J. Geophys. Res., 105, 15213-15229, 2000.<br />
Röckmann, T., C.A.M. Brenninkmeijer, M. Wollenhaupt, J.N. Crowley, and P.J. Crutzen, Measurement of<br />
96
the isotopic fractionation of 15N14N16O, 14N15N16O and 14N14N18O in the UV photolysis of nitrous<br />
oxide, Geophys. Res. Lett., 27, 1399-1402, 2000.<br />
Kato, S., J. Kajii, H. Akimoto, M. Bräunlich, T. Röckmann, and C.A.M. Brenninkmeijer, Observed and<br />
modeled seasonal variation of 13 C, 18 O and 14 C of atmospheric CO at Happo, a remote site in Japan, and<br />
a comparison with other records, J. Geophys. Res., 105, 8891-8900, 2000.<br />
Kaiser, J., T. Röckmann, and C.A.M. Brenninkmeijer, Offline extraction and analysis of all N2O isotopomers<br />
in tropospheric air, in preparation, 2000.<br />
Röckmann, T., C.A.M. Brenninkmeijer, M. Hahn, and N.F. Elanksy, CO mixing and isotope ratios across<br />
Russia; Trans-Siberian Railroad Expedition TROIKA 3, April 1997, Chemosphere, 1, 219-231, 1999.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., and T. Röckmann, Mass spectrometry of the intramolecular nitrogen isotope<br />
distribution of environmental nitrous oxide using fragment-ion analysis, Rap. Comm. Mass Spectrom., 13,<br />
2028-2033, 1999.<br />
Kato, S., H. Akimoto, M. Bräunlich, T. Röckmann, and C.A.M. Brenninkmeijer, Measurements of stable<br />
carbon and oxygen isotopic composition of CO in automobile exhausts and ambient air from semi-urban<br />
Mainz, Germany, Geochem. J., 33, 73-77, 1999.<br />
Rom, W., C.A.M. Brenninkmeijer, W. Kutschera, A. Priller, S. Puchegger, C.B. Ramsey, T. Röckmann,<br />
and P. Steier, Methodological aspects of 14CO measurements with AMS, submitted to Nucl. Instr. Meth.<br />
Phys. Res. B, 1999.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., T. Röckmann, M. Bräunlich, P. Jöckel, and P. Bergamaschi, Review of Progress<br />
in Isotope Studies of Atmospheric Carbon Monoxide, Chemosphre: Global Change Science, 1, 33-52, 1999.<br />
Röckmann, T., C.A.M. Brenninkmeijer, P.J. Crutzen, and U. Platt, Short term variations in the 13 C/ 12 C<br />
ratio of CO as a measure of Cl activation during tropospheric ozone depletion events in the Arctic, J.<br />
Geophys. Res., 104, D1, 1691-1697, 1999.<br />
Kato, S., H. Akimoto, T. Röckmann, M. Bräunlich, and C.A.M. Brenninkmeijer, Stable isotopic compositions<br />
of carbon monoxide from biomass burning experiments, Atmosph. Environm., 33, 4357-4362,<br />
1999.<br />
Röckmann, T., and C.A.M. Brenninkmeijer, The error in conventionally reported 13 C/ 12 C ratios of atmospheric<br />
CO due to the presence of mass independent oxygen isotope enrichment, Geophys. Res. Lett., 25,<br />
3163-3166, 1998.<br />
Bergamaschi, P., C.A.M. Brenninkmeijer, M. Hahn, T. Röckmann, D.H. Scharffe, and P.J. Crutzen, Isotope<br />
analysis based source identification for atmospheric CH4 and CO across Russia using the Trans-Siberian<br />
railroad, J. Geophys. Res., 1998.<br />
Röckmann, T., C.A.M. Brenninkmeijer, G. Saueressig, P. Bergamaschi, J. Crowley, H. Fischer, and P.J.<br />
Crutzen, Mass independent fractionation of oxygen isotopes in atmospheric CO due to the reaction CO +<br />
OH, Science, 281, 544-546, 1998.<br />
Röckmann, T., Measurement and interpretation of 13 C, 14 C, 17 O and 18 O variations in atmospheric carbon<br />
monoxide, Ph.D. thesis, University of Heidelberg, Heidelberg, 1998.<br />
Röckmann, T., C.A.M. Brenninkmeijer, P. Neeb, and P.J. Crutzen, Ozonolysis of nonmethane hydrocarbons<br />
as a source of the observed mass independent oxygen isotope enrichment in tropospheric CO, J. Geophys.<br />
Res., 103, 1463-1470, 1998.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., and T. Röckmann, A rapid method for the preparation of O 2 from CO 2 for mass<br />
spectrometric analysis of 17O/16O ratios, Rap. Commun. Mass Spectrom., 12, 479-483, 1998.<br />
Crutzen, P.J., N.F. Elansky, M. Hahn, G.S. Golitsyn, C.A.M. Brenninkmeijer, D.H. Scharffe, I.B. Belikov,<br />
M. Maiss, P. Bergamaschi, T. Röckmann, A.M. Grisenko, and V.M. Sevostyanov, Trace gas measurements<br />
97
etween Moscow and Vladivostok using the Trans-Siberian railroad, J. Atmosph. Chem., 29, 179-194,<br />
1998.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., and T. Röckmann, Using isotope analysis to improve atmospheric CO budget<br />
calculations, in International Symposium on Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental<br />
Changes in the Hydrosphere and the Atmosphere, edited by P. Murphy, pp. 69-77, International<br />
Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 1998.<br />
Röckmann, T., and C.A.M. Brenninkmeijer, CO and CO 2 isotopic composition in Spitsbergen during the<br />
1995 ARCTOC campaign, Tellus, 49B, 455-465, 1997.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., and T. Röckmann, Principal factors determining the 18 O/ 16 O ratio of atmospheric<br />
CO as derived from observations in the southern hemispheric troposphere and lowermost stratosphere, J.<br />
Geophys. Res., 102, 25477-25485, 1997.<br />
Brenninkmeijer, C.A.M., and T. Röckmann, Russian doll type cryogenic traps: Improved <strong>des</strong>ign and isotope<br />
separation effects, Anal. Chem., 68 (17), 3050-3053, 1996.<br />
Dissly, R.W., J.B. Miller, P.P. Tans, T. Röckmann, J.W.C. White, and M. Trolier, A technique to measure<br />
the carbon isotopic ratio in atmospheric methane from small air samples, EOS Trans., abstracts, AGU fall<br />
meeting 1995, F68, 1995.<br />
Röckmann, T., Feasibility of measuring 13 C in atmospheric methane from small air samples using a cryofocused<br />
gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry technique, M.Sc. thesis, University of Colorado,<br />
Boulder, 1994.<br />
98
11 Statistische Angaben zu Kollegiaten / Stipendiaten<br />
In diesem Abschnitt werden Daten über den Studien- und Promotionsverlauf sowie zum beruflichen Werdegang<br />
nach Verlassen <strong>des</strong> GK zu allen Kollegiaten / Stipendiaten zusammengestellt.<br />
Albrecht, Jörg<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Sipendiat Juli 1994 - Juni 1995<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden feste Anstellung außerhalb der Universität<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, 1994<br />
Abgabe der Dissertation ./.<br />
Promotion ./.<br />
Alter bei Abschluß der Promotion ./.<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Bibliothekar<br />
Albus, Frank<br />
Arbeitsgruppe Prof. Kluge, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status D-Sipendiat Januar 1991 - März 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende, Promotion<br />
1. Hochschulabschluß Bonn, September 1989<br />
Abgabe der Dissertation 1994<br />
Promotion März 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 2. Symposium über ” Massenspektrometrische Verfahren<br />
der Elementspurenanalyse“, Regensburg, 1993;<br />
Frühjahrstagung der DPG, Berlin, 1993; Frühjahrstagung<br />
der DPG, Hamburg, 1994<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Ames, Friedhelm<br />
Arbeitsgruppe Prof. Kluge, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status PD-Sipendiat Januar 1991 - März 1992<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Mainz, 1990<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Verbleib am Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Appel, Holger<br />
Arbeitsgruppe Prof. von Platen, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Sipendiat Januar 1991 - Dezember 1992<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, 1990<br />
Abgabe der Dissertation 1993<br />
Promotion Mainz, August 1993<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 29<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Projektleiter in Umweltlabor<br />
99
Bange, Hermann<br />
Arbeitsgruppe Prof. Andreae, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß 1990<br />
Abgabe der Dissertation 1994<br />
Promotion März 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Blaum, Klaus<br />
Arbeitsgruppe Prof. Otten, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status D-Sipendiat Dezember 1997 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Oktober 1997<br />
Abgabe der Dissertation Juli 2000<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 28<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen DPG FV-Massenspektrometrie, Mainz 1997; 30. AGMS-<br />
Tagung, Konstanz 1997; InCom-Tagung, Düsseldorf<br />
1997; AGMS-Tagung, Cottbus 1998; 9th RIS Symposium,<br />
Manchester 1998; 14. ICP-MS-Tagung, Mainz<br />
1999; DPG FV-Massenspektrometrie, Heidelberg 1999;<br />
32. DGMS-Tagung, Oldenburg 1999; 31st EGAS Conference,<br />
Marseille 1999; 33. DGMS-Tagung, Berlin 2000;<br />
DPG FV-Atomphysik, Bonn 2000<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am CERN<br />
Blaum, Peter<br />
Arbeitsgruppe Prof. Hofmeister, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Sipendiat April 1998 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, März 1998<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 28<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ICAME (August 1999, Garmisch-Partenkirchen); Jahrestagung<br />
der Deutschen mineralogischen Gesellschaft<br />
(August 1999, Wien); ISIAME 2000, Virginia Beach<br />
(USA); Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft<br />
(September 2000, Heidelberg)<br />
Weitere Tätigkeit ./.<br />
100
Bode, Kirsten<br />
Arbeitsgruppe Dr. Kesselmeier, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status D-Sipendiat Februar 1991 - Juli 1993;<br />
März 1994 - Mai 1994, dazw. Kollegiatin<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Hamburg, April 1990<br />
Abgabe der Dissertation September 1994<br />
Promotion September 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Botaniker-Tagungen in Bayreuth (1992 und 1994);<br />
BIATEX-Workshop in Madrid (1995); BIATEX-Tagung<br />
in Garmisch-Partenkirchen (1995)<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am MPI, Redakteurin beim ZDF<br />
Brinkmann, Jutta<br />
Arbeitsgruppe Prof. Jaenicke, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status a) D-Sipendiat Januar 1991 - März 1994;<br />
b) PD-Stipendiatin Juni 1995 - April 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, August 1990<br />
Abgabe der Dissertation März 1995<br />
Promotion Mai 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen CLEOPATRA-Workshop (Oberpfaffenhofen, 1993);<br />
EURASAP-Workshop (Braunschweig, 1994); Praktische<br />
Oberflächenanalytik (Karlsruhe, 1994); European<br />
Aerosol Conference (Helsinki, 1995)<br />
Weitere Tätigkeit a) Fertigstellung der Dissertation;<br />
b) wissenschaftl. Mitarbeiterin KF Jülich<br />
Conrad, Roswitha<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiatin Januar 1991 - Februar 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Oktober 1990<br />
Abgabe der Dissertation Februar 1994<br />
Promotion März 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungskoordinatorin Pharma-Industrie<br />
Deutrich, Thomas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Gaupp, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status PD-Stipendiat April 1994 - Juni 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion 1993<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
101
Dietz, Bernhard<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status PD-Stipendiat November 1991 - Juni 1992<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion November 1991<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Engel, Christoph<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat November 1993 - September 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Mai 1993<br />
Abgabe der Dissertation Februar 1997<br />
Promotion März 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiter, Inst. <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Engel, Michael<br />
Arbeitsgruppe Prof. Nagel, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status PD-Stipendiat März 1994 - September 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Januar 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
Enzmann, Frieder<br />
Arbeitsgruppe Prof. Schenk, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiat April 1997 - März 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Dezember 1996<br />
Abgabe der Dissertation Juli 2000<br />
Promotion Oktober 2000<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Fischer, Ralf<br />
Arbeitsgruppe Prof. Baumann, Institut <strong>für</strong> Physikalische Chemie<br />
Status D-Stipendiat Februar 1991 - April 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1990<br />
Abgabe der Dissertation Oktober 1994<br />
Promotion Dezember 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
102
Füll, Christine<br />
Arbeitsgruppe Prof. Nagel, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiatin Dezember 1992 - August 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Oktober 1992<br />
Abgabe der Dissertation November 1996<br />
Promotion Dezember 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit wissenschaftl. Mitarbeiterin beim GDCh-<br />
Beratergremium <strong>für</strong> umweltrelevante Altstoffe (BUA)<br />
Griebeler, Eva-Maria<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status PD-Stipendiatin Juli 1998 - Juni 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Februar 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiterin am Inst. <strong>für</strong> Zoologie<br />
Gruber, Sabine<br />
Arbeitsgruppe Prof. Jaenicke, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiatin März 1996 - April 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Februar 1996<br />
Abgabe der Dissertation August 2000<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Grüning, Carsten<br />
Arbeitsgruppe Dr. Trautmann, Institut <strong>für</strong> Kernchemie<br />
Status D-Stipendiat Januar 1998 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Oktober 1997<br />
Abgabe der Dissertation September 2000<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen RIS-Konferenz in Manchester 1998<br />
Weitere Tätigkeit Abschluß der Promotion<br />
103
Hannemann, Anke<br />
Arbeitsgruppe Prof. Pruppacher, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiatin März 1991 - August 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Dezember 1990<br />
Abgabe der Dissertation August 1994<br />
Promotion September 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit wiss. Mitarbeiterin<br />
Hartmann, Berndt<br />
Arbeitsgruppe Prof. Gaupp, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiat April 1994 - März 1997<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende / Promotion<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Oktober 1993<br />
Abgabe der Dissertation März 1997<br />
Promotion Mai 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
Hasse, Hans-Ulrich<br />
Arbeitsgruppe Prof. Huber, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status D-Stipendiat April 1993 - April 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, April 1993<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion ./.<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 2. Symposium über ” Massenspektrometrische Verfahren<br />
der Elementspurenanalyse“, Regensburg, 1993;<br />
Frühjahrstagung der DPG, Berlin, 1993; Frühjahrstagung<br />
der DPG, Hamburg, 1994; 7th International Symposium<br />
on Resonance Ionization Spectroscopy, Bernkastel-Kues,<br />
1994; Frühjahrstagung der DPG, Innsbruck, 1995<br />
Weitere Tätigkeit Mitarbeiter Lan<strong>des</strong>bank RLP,<br />
Fertigstellung der Dissertation<br />
Heidenreich, Andreas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiat Januar 1997 - Dezember 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Dezember 1995<br />
Abgabe der Dissertation März 2000<br />
Promotion Mai 2000<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen GFÖ, Bonn, 1996;<br />
DZG, Mainz, 1997<br />
Weitere Tätigkeit Softwareentwickler<br />
104
Heinig, Sabine<br />
Arbeitsgruppe Prof. Heidt, Geographisches Institut<br />
Status a) D-Stipendiatin Juli 1993 - Juni 1996;<br />
b) PD-Stipendiatin Juli 1996 - Dezember 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Münster, Juni 1989<br />
Abgabe der Dissertation Dezember Mai 1996<br />
Promotion Juni 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Umweltbehörde der Stadt Mainz<br />
Hilse, Christine<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status Kollegiatin ohne Stipendium bis Juli 1995;<br />
D-Stipendiatin August 1995 - September 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Mai 1992<br />
Abgabe der Dissertation 1998<br />
Promotion 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc an MPI und Universität Dundee<br />
Hofmann, Stephan<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeiner Botanik<br />
Status D-Stipendiat April 1994 - Mai 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Dezember 1993<br />
Abgabe der Dissertation ./.<br />
Promotion ./.<br />
Alter bei Abschluß der Promotion ./.<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Holthues, Heike<br />
Arbeitsgruppe Prof. Baumann, Institut <strong>für</strong> Physikalische Chemie<br />
Status PD-Stipendiatin September 1998 - August 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Mainz, Juli 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 34<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit wiss. Mitarbeiterin am Anatomischen Institut der Universität<br />
Mainz<br />
105
Hryk, Renate<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeiner Botanik<br />
Status Kollegiatin bis März 1994, D-Stipendiatin April 1994 -<br />
September 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderunsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1990<br />
Abgabe der Dissertation September 1994<br />
Promotion Januar 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 34<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
Johannesen, Jes<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status PD-Stipendiat März 1997 - Februar 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Februar 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen DFG - Evolution von Sozialsystemen, November 1997,<br />
Bonn;<br />
DZG-Tagung Main 1997, Mainz<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Angestellter am Inst. <strong>für</strong> Zoologie<br />
Kaiser, Bettina<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeiner Botanik<br />
Status D-Stipendiatin Dezember 1994 - Dezember 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Dezember 1992<br />
Abgabe der Dissertation 1997<br />
Promotion 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit unbekannt<br />
Kandlbinder, Thomas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Zdunkowski, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiat August 1994 - Oktober 1997<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Heidelberg, März 1994<br />
Abgabe der Dissertation November 1997<br />
Promotion Januar 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiter AWI Potsdam<br />
106
Kaus-Thiel, Andrea<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiatin Juli 1995 - Juni 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, November 1994<br />
Abgabe der Dissertation Juli 1998<br />
Promotion September 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 17th International Meeting for Specialists in Air Pollution,<br />
Effects on Forest Ecosystems, Florence, Italy 14-19<br />
September, 1996<br />
Weitere Tätigkeit Mutter<br />
Kirkman, Grant A.<br />
Arbeitsgruppe Dr. Meixner, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status D-Stipendiat Juli 1998 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Pietermaritzburg (R.S.A.), 1988<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 5th International Aerosol Conference, Edinburgh, U.K.,<br />
1998; European Geophysical Society XXV General Assembly,<br />
Nizza, 2000; First Scientific Conference of the<br />
Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia,<br />
Belem, Pará, 2000; Forschungsaufenthalt: Grassland<br />
Research Station Marondera, Zimbabwe, 1998<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Kleiner, Roman<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat Januar 1991 - Dezember 1993<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Kaiserslautern, Dezember 1998<br />
Abgabe der Dissertation 1994<br />
Promotion Januar 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Kleisinger, Harald<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiat Oktober 1993 - September 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, November 1992<br />
Abgabe der Dissertation Mai 1998<br />
Promotion Juli 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 34<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen<br />
” Fischsymposium“, Oktober 1995, Pruchten<br />
Weitere Tätigkeit Projektkoordinator Bayer. Lan<strong>des</strong>amt <strong>für</strong> Umweltschutz<br />
107
Köhler, Stefan<br />
Arbeitsgruppe Dr. Trautmann, Institut <strong>für</strong> Kernchemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, März 1991<br />
Abgabe der Dissertation November 1995<br />
Promotion Dezember 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Softwareentwickler<br />
Kosuch, Joachim<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiat August 1995 - Juli 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, April 1994<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Population Genetics Group, 29th Annual Meeting, Bangor,<br />
Wales, 1996; Population Genetics Group, 30th Annual<br />
Meeting, Edinburgh, Schottland, 1997; Third World<br />
Congress of Herpetology, Prag, 1997; 8th OGM of the<br />
Societas Europaea Herpetologica, Chambery, Frankreich,<br />
1998; 9th OGM of the Societas Europaea Herpetologica,<br />
Heraklion, Griechenland, 1999; Vierwöchiger Forschungsaufenthalt<br />
in Nord-Borneo (Malaysia), 1994<br />
Weitere Tätigkeit Fortführung der Promotion<br />
Koutsenoguii, Pjotr<br />
Arbeitsgruppe Prof. Jaenicke, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Novosibirsk, 1990<br />
Abgabe der Dissertation November 1992<br />
Promotion Dezember 1992<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungsinstitut Belgien<br />
Kuhn, Uwe<br />
Arbeitsgruppe Dr. Kesselmeier, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1993<br />
Abgabe der Dissertation 1997<br />
Promotion 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am MPI<br />
108
Kurz, Claudia<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiatin Februar 1996 - Januar 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1995<br />
Abgabe der Dissertation März 1999<br />
Promotion Mai 1999<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 39<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 17th International Meeting for Specialists in Air Pollution,<br />
Effects on Forest Ecosystems, Florence, Italy 14-19<br />
September, 1996<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiterin Inst. <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Lantzsch, Jörg<br />
Arbeitsgruppe Prof. Otten, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status D-Stipendiat Januar 1994 - September 1995<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, 1992<br />
Abgabe der Dissertation Dezember 1995<br />
Promotion Februar 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit HiWi, dann GSI Darmstadt<br />
Larisch (geb. Strobel), Petra<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status Kollegiatin ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, 1989<br />
Abgabe der Dissertation November 1993<br />
Promotion Dezember 1993<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Mutter<br />
Lauchert-Massalha, Ulrike<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeiner Botanik<br />
Status Kollegiatin ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Januar 1991<br />
Abgabe der Dissertation September 1994<br />
Promotion November 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 29<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungsinstitut<br />
109
Li, Quian<br />
Arbeitsgruppe Prof. Zimmermann, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiatin Januar 1994 bis Februar 1997<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende, Abbruch der Promotion wegen Erkrankung<br />
1. Hochschulabschluß Mai 1990<br />
Abgabe der Dissertation ./.<br />
Promotion ./.<br />
Alter bei Abschluß der Promotion ./.<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Softwareentwicklerin<br />
Lohr, Martin<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat März 1994 - August 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Dezember 1992<br />
Abgabe der Dissertation August 2000<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungsaufenthalt USA<br />
Mense-Stefan, Anne<br />
Arbeitsgruppe Prof. Preuß, Geographisches Institut<br />
Status D-Stipendiatin Januar 1998 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Oktober 1997<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Müller, Anna-Maria<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wilhelm, Institut <strong>für</strong> Allgemeiner Botanik<br />
Status a) D-Stipendiatin April 1991 - März 1994;<br />
b) PD-Stipendiatin Juni 1995 - August 1995<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Januar 1991<br />
Abgabe der Dissertation Januar 1995<br />
Promotion März 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungstaetigkeit im Bereich <strong>des</strong> IOW<br />
110
Müller, Peter<br />
Arbeitsgruppe Prof. Otten, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status D-Stipendiat April 1997 - März 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, November 1996<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Neuhaus, Anke<br />
Arbeitsgruppe Prof. von Platen, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiatin März 1991 - Februar 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Promotion<br />
1. Hochschulabschluß Freiburg, November 1988<br />
Abgabe der Dissertation Februar 1994<br />
Promotion Februar 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 34<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen<br />
Weitere Tätigkeit Weidereingliederungsstipendium, Mannheim<br />
Oertel, Detlef<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status PD-Stipendiat März 1992 - Februar 1993<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion 1992<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiter am Inst. <strong>für</strong> Zoologie<br />
Peucker-Ehrenbrink, Bernhard<br />
Arbeitsgruppe Prof. Andreae, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Göttingen, Juni 1989<br />
Abgabe der Dissertation Juni 1994<br />
Promotion Oktober 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungsinstitut<br />
Peuser, Dieter<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat Oktober 1994 - Januar1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Promotion<br />
1. Hochschulabschluß Dezember 1993<br />
Abgabe der Dissertation Dezember 1995<br />
Promotion Januar 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
111
Ries, Roland<br />
Arbeitsgruppe Prof. Zdunkowski, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiat August 1991 - September 1993<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle, 1995 Abbruch der Dissertation<br />
1. Hochschulabschluß Juni 1991<br />
Abgabe der Dissertation ./.<br />
Promotion ./.<br />
Alter bei Abschluß der Promotion ./.<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Symposium Lahmeyer International, Berlin, 1994; VDI-<br />
Seminar ” Ausbreitung von Kfz-Emissionen“, Düsseldorf,<br />
1994; 3rd Workshop on ” Harmonisation within Atmospheric<br />
Dispersion Modelling for Regulatory Purposes“,<br />
Mol, Belgium, 1994; 21st NATO/CCMS International<br />
Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application,<br />
Baltimore, USA, 1995<br />
Weitere Tätigkeit Ingenieurbüro<br />
Röckmann, Thomas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Crutzen, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Boulder (USA), 1994<br />
Abgabe der Dissertation April 1998<br />
Promotion Heidelberg, April 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 28<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen EGS 1996 und 1998 (Den Haag); AGU 1997 (San Francisco);<br />
Arbeitsgemeinschaft Stabile Isotope 1999 (Braunschweig);<br />
International Conference on CO, 1998 (Seattle);<br />
Workshop for young scientists in atmospheric chemistry,<br />
1998 (Boulder) Internationale Konferenz über<br />
Isotopenmessungen in Wasser und Luft, 1997 (Wien)<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Scheuermann, Ralph<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status a) D-Stipendiat Januar 1991 - Dezmeber 1992;<br />
b) PD-Stipendiat Januar 1993 - Dezember 1993<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) Promotion b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Kaiserslautern, Juli 1989<br />
Abgabe der Dissertation November 1992<br />
Promotion Dezember 1992<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
112
Schmidt, Wieland<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat November 1998 - Januar 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß 1998<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Referendariat<br />
Schmitt, Harald<br />
Arbeitsgruppe Prof. Schenk, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiat Januar 1997 - Dezember 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1996<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Schmitt, Thomas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiat November 1996 - Oktober 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende, Promotion<br />
1. Hochschulabschluß Saarbrücken, Februar 1996<br />
Abgabe der Dissertation November 1999<br />
Promotion Dezember 1999<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen EIS-Symposium, Debrecen, 1997; DZG-<br />
Graduiertentreffen Evolutionsbiologie, Kiel, 1998;<br />
GFÖ-Tagung, Ulm, 1998; DZG-Graduiertentreffen<br />
Evolutionsbiologie, München, 1999;<br />
pulationsökologie von Tagfaltern“,<br />
Workshop Po-<br />
”<br />
Leipzig, 1999;<br />
DZG-Tagung, Innsbruck, 1999; EIS-Symposium, Millas,<br />
1999; GFÖ-Tagung, Bayreuth, 1999; Westdeutscher<br />
Entomologentag, Düsseldorf, 1999; Zoologisches Kolloquium<br />
der Universität Bochum, 1999; Workshop<br />
” Populationsbiologie von Tagfaltern“, Leipzig, 2000;<br />
European Congress of Lepidopteriology, Bialowieza,<br />
2000;<br />
Forschungsaufenthalte in Südportugal und Südfrankreich<br />
zum Probensammeln und zu ökologischen Studien, 1997,<br />
1998; Forschungsreisen in Deutschland, Frankreich,<br />
Weitere Tätigkeit<br />
Tschechien, Slowakei und Ungarn zum Sammeln der<br />
Proben von E. medusa und P. coridon, 1997, 1998<br />
Wiss. Angestellter am Inst. <strong>für</strong> Zoologie<br />
113
Schmitz, Achim<br />
Arbeitsgruppe Prof. Nagel, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status D-Stipendiat Januar 1991 - September 1992<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Januar 1991<br />
Abgabe der Dissertation Januar 1997<br />
Promotion Februar 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit wissenschaftl. Angestellter beim Frauenhofer-Institut <strong>für</strong><br />
Umweltchemie und Ökotoxikologie, Schmallenberg<br />
Schock, Gerald<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status PD-Stipendiat Januar 1996 - April 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Januar 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Seligmann, Christoph<br />
Arbeitsgruppe Prof. Zdunkowski, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiat Mai 1996 - April 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1995<br />
Abgabe der Dissertation April 1999<br />
Promotion Juni 1999<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 29<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen BEM XIX (Wessex, 1997)<br />
Weitere Tätigkeit Softwareentwickler<br />
Simon, Andreas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status a) D-Stipendiat November 1993 - Dezember 1996;<br />
b) PD-Stipendiat Juli 1998 - Juni 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1993<br />
Abgabe der Dissertation April 1997<br />
Promotion August 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 17th International Meeting for Specialists in Air Pollution,<br />
Effects on Forest Ecosystems, Florence, Italy 14-19<br />
September, 1996<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiter Inst. <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
114
Simon, Simone<br />
Arbeitsgruppe Prof. Schenk, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiatin Dezember 1998 - Mai 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf Drittmittelstelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1998<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Groundwater 2000: International Conference on Groundwater<br />
Research, Kopenhagen; ConSoil 2000: 7th International<br />
FZK/TNO Conference on Contaminated Soil,<br />
Leipzig; HydroGeoEvent 2000, Heidelberg.<br />
Weitere Tätigkeit Fortführung der Dissertation<br />
Stenner, Judith<br />
Arbeitsgruppe Prof. Kluge, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status Kollegiatin ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1990<br />
Abgabe der Dissertation November 1994<br />
Promotion Dezember 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Softwareentwicklerin<br />
Stumpf, Marcus<br />
Arbeitsgruppe Prof. Baumann, Institut <strong>für</strong> Physikalische Chemie<br />
Status D-Stipendiat Mai 1995 - Mai 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Darmstadt, Februar 1995<br />
Abgabe der Dissertation Mai 1998<br />
Promotion Juli 1998<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 29<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 2 Forschungsaufenthalte in Niteroi, BR, 1997; Tagung in<br />
Sao Carlos, BR, 1997<br />
Weitere Tätigkeit Firma Midas, ingelheim<br />
Sun, Wanxiao<br />
Arbeitsgruppe Prof. Heidt, Geographisches Institut<br />
Status D-Stipendiatin November 1996 - Oktober 1999<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Nanjing, 1986<br />
Abgabe der Dissertation November 1999<br />
Promotion Dezember 1999<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Postdoc am Geogr. Institut<br />
115
Ternes, Thomas<br />
Arbeitsgruppe a) Prof. Nagel, Institut <strong>für</strong> Zoologie;<br />
b) Prof. Baumann, Institut <strong>für</strong> Physikalische Chemie<br />
Status a) D-Stipendiat Januar 1991 - Dezember 1993;<br />
b) PD-Stipendiat Januar 1994 - März 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) Promotion; b) Wechsel auf feste Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Januar 1990<br />
Abgabe der Dissertation Dezember 1993<br />
Promotion Dezember 1993<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Forschungsinstitut im Umwelt- und Wasserbereich<br />
Tietz-Siemer, Sabine<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status PD-Stipendiatin Januar 1991 - Oktober 1991<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
Promotion Mainz, Dezember 1990<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 27<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Mutter<br />
Track, Thomas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Schenk, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status D-Stipendiat April 1994 - März 1997<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1993<br />
Abgabe der Dissertation August 1997<br />
Promotion November 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 30<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Tagung in Metz, F, 1996; Forschungsaufenthalt Schottland,<br />
1996; Tagung in Las Vegas, USA, 1997<br />
Weitere Tätigkeit wissensch. Mitarbeiter<br />
Tripp, Helmut<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat Mai 1993 - Oktober 1995<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, 1990<br />
Abgabe der Dissertation Oktober 1995<br />
Promotion Februar 1996<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 35<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
116
Uhlig, Eva-Maria<br />
Arbeitsgruppe Prof. Jaenicke, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status a) D-Stipendiatin September 1991 - November 1994;<br />
b) PD-Stipendiatin Juni 1995 - April 1996<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Leipzig, August 1991<br />
Abgabe der Dissertation November 1994<br />
Promotion Dezember 1994<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 27<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Vössing, Hermann<br />
Arbeitsgruppe Prof. Jaenicke, Institut <strong>für</strong> Physik der Atmosphäre<br />
Status D-Stipendiat Januar 1998 - Dezember 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Frankfurt, 1992<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen DPG-Frühjahrstagung 1998, Regensburg; EAC 1997,<br />
Hamburg<br />
Weitere Tätigkeit wissenschaftlicher Angesteller, Referendariat <strong>für</strong> das<br />
Lehramt an Gymnasien im Land Hessen<br />
Wagner, Andreas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Seitz, Institut <strong>für</strong> Zoologie<br />
Status PD-Stipendiat März 1993 - September 1994<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
Promotion Dezember 1992<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Industrie<br />
Waibel, Andreas<br />
Arbeitsgruppe Prof. Fischer, MPI <strong>für</strong> Chemie<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Heidelberg, 1993<br />
Abgabe der Dissertation 1997<br />
Promotion Heidelberg, Juli 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte /Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Systemprogrammierer<br />
117
Wilksch, Werner<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status a) D-Stipendium Januar 1994 - März 1997;<br />
b) PD-Stipendium Juni 1997 - Mai 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Mai 1993<br />
Abgabe der Dissertation April 1997<br />
Promotion Juni 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen 17th International Meeting for Specialists in Air Pollution,<br />
Effects on Forest Ecosystems, Florence, Italy 14-19<br />
September, 1996<br />
Weitere Tätigkeit Wiss. Mitarbeiter am Inst. <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Wojtyna, Siegfried<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiat Juli 1998 - September 2000<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß September 1997<br />
Abgabe der Dissertation noch ausstehend<br />
Promotion noch ausstehend<br />
Alter bei Abschluß der Promotion noch ausstehend<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Dechema Statusseminar 2000, Frankfurt/Main<br />
Weitere Tätigkeit Fertigstellung der Dissertation<br />
Wolff-Boenisch, Domenik<br />
Arbeitsgruppe Prof. Schenk, Institut <strong>für</strong> Geowissenschaften<br />
Status a) D-Stipendiat April 1994 - März 1997;<br />
b) PD-Stipendiat Juli 1997 - Juni 1998<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden a) und b) Förderungsende<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, September 1993<br />
Abgabe der Dissertation Mai 1997<br />
Promotion Juni 1997<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 31<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen Tagung in Metz, F, 1996; Forschungsaufenthalt Schottland,<br />
1996; Tagung in Las Vegas, USA, 1997<br />
Weitere Tätigkeit Ausland<br />
Zimmer, Klaus<br />
Arbeitsgruppe Prof. Otten, Institut <strong>für</strong> Physik<br />
Status Kollegiat ohne Stipendium<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1990<br />
Abgabe der Dissertation Februar 1995<br />
Promotion Mai 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 32<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit Software-Entwickler<br />
118
Zhu, Hua<br />
Arbeitsgruppe Prof. Wild, Institut <strong>für</strong> Allgemeine Botanik<br />
Status D-Stipendiatin Juli 1992 - November 1992<br />
Grund <strong>für</strong> Ausscheiden Wechsel auf andere Stelle<br />
1. Hochschulabschluß Mainz, Juli 1986<br />
Abgabe der Dissertation 1995<br />
Promotion August 1995<br />
Alter bei Abschluß der Promotion 33<br />
Auslandsaufenthalte / Tagungen ./.<br />
Weitere Tätigkeit selbständig<br />
119
12 Zusammenfassende Bewertung<br />
Die seitens der DFG vorgegebene Zielsetzung der <strong>Graduiertenkollegs</strong> konnte im Rahmen <strong>des</strong> GK ” Kreisläufe,<br />
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt“ teilweise realisiert werden.<br />
Als gelungen ist der Versuch anzusehen, durch interdisziplinär konzipierte zusätzliche Lehrveranstaltungen<br />
eine gegenüber einem ” normalen“ Promotionsstudium eine verbesserte Ausbildungsqualität zu erreichen.<br />
Die durchgeführten Ringvorlesungen und Praktika ermöglichten den Mitgliedern <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong><br />
Einblicke in die Arbeitsweisen von Fachrichtungen, die zwar wie die vergebenen Promotionsthemen dem<br />
Themenbereich Umweltkreisläufe zuzuordnen sind, die aber im Rahmen der eigenen Projektarbeit ansonsten<br />
nicht berührt worden wären.<br />
Ebenfalls positiv zu bewerten ist das Graduierten-Kolloquium, in dem die Stipendiaten und Kollegiaten<br />
regelmäßig den Fortschritt ihrer Arbeiten in halbstündigen Vorträgen dokumentieren konnten. Bei diesen<br />
Vorträgen entwickelten sich häufig ins Detail gehende Diskussionen, die sowohl zu einem vertieften<br />
Verständnis der vorgestellten Arbeiten führten, als auch in einigen Fällen wertvolle Anregungen zum Fortgang<br />
der Arbeiten liefern konnten.<br />
Als erschwerend hat sich in manchen Fällen die ausgeprägte Interdisziplinarität <strong>des</strong> <strong>Graduiertenkollegs</strong><br />
herausgestellt, da ” benachbarte“ Naturwissenschaften trotz vieler Überschneidungen in den Arbeitsgebieten<br />
unter Umständen unterschiedliche Sprachen sprechen. Auch gestaltete es sich mitunter schwierig, die<br />
beteiligten 4 Universitäts-Fachbereiche sowie das mit zwei Arbeitsgruppen beteiligte Max-Planck-Institut <strong>für</strong><br />
Chemie organisatorisch ” unter einen Hut“ zu bringen, Zeugnis hier<strong>für</strong> waren beispielsweise die alljährlichen<br />
Terminschwierigkeiten bei der Bearbeitung der Fragebögen.<br />
Ein wichtiges Ziel der <strong>Graduiertenkollegs</strong> ist die Straffung <strong>des</strong> Promotionsstudiums durch klar umrissene<br />
Dissertationsthemen, die in einer kalkulierbaren Zeitspanne zu bearbeiten sind. Ob nun eine Verkürzung<br />
der Bearbeitungszeiten <strong>für</strong> Dissertationen erreicht werden konnte, ist nicht abschließend feststellbar. Zum<br />
einen sind insgesamt 11 Dissertationsprojekte noch nicht abgeschlossen, die Abgabe der betroffenen Arbeiten<br />
ist in 10 Fällen <strong>für</strong> das letzte Quartal <strong>des</strong> Jahres zu erwarten. Zum anderen sind die reinen Zahlen<br />
über Förderungs- und Promotionsdauer nur eingeschränkt aussagefähig, da etliche Stipendiaten dem GK<br />
nur über kurze Zeiträume angehörten imd ihre Promotion z.T. außerhalb der Universität Mainz anderweitig<br />
finanziert fortgesetzt haben. Abgeschlossen wurden im Bewilligungszeitraum Oktober 1990 bis September<br />
2000 (inklusive 12-monatiger Auslauffinanzierung) 43 Dissertationen, die zumin<strong>des</strong>t zeitweise durch<br />
das GK finanziert wurden. Die mittlere Dauer der finanziellen Förderung betrug dabei 31 Monate, die<br />
mittlere Bearbeitungszeit bis zur Abgabe der Dissertation 41 Monate. Zumin<strong>des</strong>t <strong>für</strong> den Fachbereich Physik<br />
sowie <strong>für</strong> das Max-Planck-Institut <strong>für</strong> Chemie bedeutet dies eine Reduzierung der durchschnittlichen<br />
Promotionszeiten um einige Monate.<br />
120