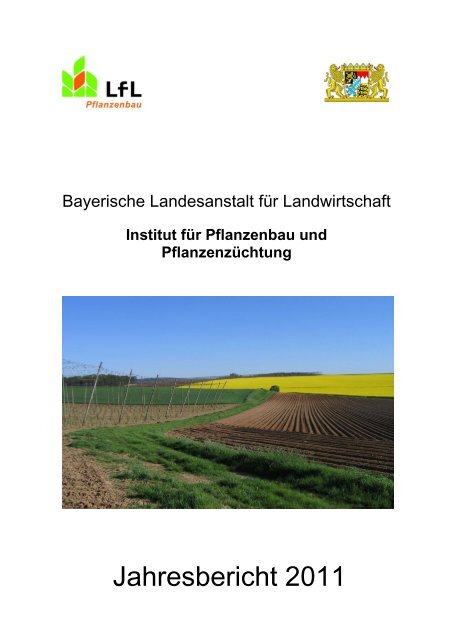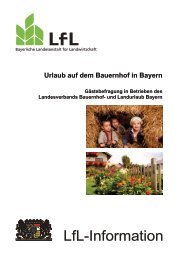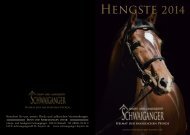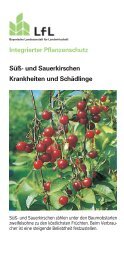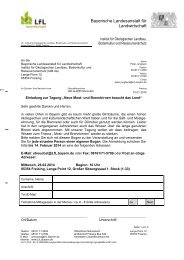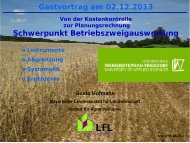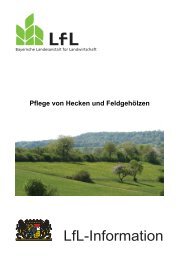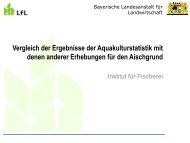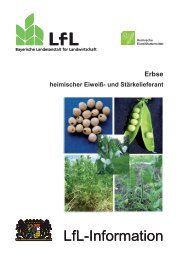Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bayerische</strong> <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong><br />
Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und<br />
Pflanzenzüchtung<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2011</strong>
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Bayerische</strong> <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> (LfL)<br />
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan<br />
Internet: www.LfL.bayern.de<br />
Redaktion: Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung<br />
Auflage: März 2012<br />
Am Gereuth 8, 85354 Freising -Weihenstephan<br />
E-Mail: Pflanzenbau@LfL.bayern.de<br />
Telefon: 08161 71-3637<br />
Druck: Abteilung Information und Wissensmanagement<br />
© LfL
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Alois Aigner Herbert Kupfer<br />
Peter Doleschel Anton Lutz<br />
Joachim Eder Martin Müller<br />
Peter Geiger Ulrike Nickl<br />
Lorenz Hartl Johann Portner<br />
Stephan Hartmann Andrea Schwarzfischer<br />
Markus Herz Günther Schweizer<br />
Heidi Heuberger Stefan Seefelder<br />
Klaus Kammhuber Elisabeth Seigner<br />
Adolf Kellermann Benno Voit<br />
Berta Killermann Florian Weihrauch
Inhalt<br />
Seite<br />
1 Organisation .........................................................................................................9<br />
1.1 <strong>Bayerische</strong> <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> (LfL) ..............................................9<br />
1.2 Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (IPZ) ..........................................10<br />
2 Ziele und Aufgaben ............................................................................................11<br />
2.1 Organisationsplan des Instituts <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung ..............13<br />
3 Projekte und Daueraufgaben ............................................................................14<br />
3.1 Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung ..............................................................14<br />
3.1.1 Gewebekulturtechniken (IPZ 1a) .........................................................................15<br />
3.1.2 Genomanalyse (IPZ 1b) .......................................................................................22<br />
3.1.3 Gentransfer und GVO-Sicherheitsforschung (IPZ 1c) .........................................29<br />
3.2 Getreide ................................................................................................................32<br />
3.2.1 Produktionssysteme und Pflanzenbau Getreide (IPZ 2a) .....................................33<br />
3.2.2 Züchtungsforschung Winter- und Sommergerste (IPZ 2b) ..................................37<br />
3.2.3 Züchtungsforschung Weizen und Hafer (IPZ 2c) ................................................44<br />
3.3 Hackfrüchte, Öl- und Eiweißpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen .....................48<br />
3.3.1 Pflanzenbausysteme, Züchtungsforschung und Beschaffenheitsprüfung<br />
bei Kartoffeln (IPZ 3a) .........................................................................................49<br />
3.3.2 Zuchtmethodik und Biotechnologie Kartoffeln (IPZ 3b) .....................................55<br />
3.3.3 Pflanzenbausysteme bei Öl- und Eiweißpflanzen und Zwischenfrüchten<br />
(IPZ 3c) ................................................................................................................61<br />
3.3.4 Pflanzenbausysteme bei Heil- und Gewürzpflanzen (IPZ 3d) .............................65<br />
3.4 Grünland, Futterpflanzen und Mais .....................................................................70<br />
3.4.1 Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung bei Silo- und Körnermais (IPZ 4a) ..............71<br />
3.4.2 Züchtungsforschung bei Futterpflanzen, Pflanzenbausystemen bei<br />
Grünland und Feldfutterbau (IPZ 4b) ...................................................................76<br />
3.5 Hopfen ..................................................................................................................79<br />
3.5.1 Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik (IPZ 5a) .....................................80<br />
3.5.2 Erarbeitung von integrierten Pflanzenschutzverfahren gegen den<br />
Luzernerüssler Otiorhynchus ligustici im Hopfenbau: Die Eiproduktion<br />
(IPZ 5b) ................................................................................................................86<br />
3.5.3 Züchtungsforschung Hopfen (IPZ 5c) ..................................................................90<br />
3.5.4 Hopfenqualität und -analytik (IPZ 5d) .................................................................96<br />
3.6 Hoheitsvollzug ...................................................................................................102<br />
3.6.1 Amtliche Saatenanerkennung (IPZ 6a) ..............................................................102<br />
3.6.2 Verkehrs- und Betriebskontrollen (IPZ 6b) .......................................................109
3.6.3 Beschaffenheitsprüfung Saatgut und Saatgutforschung (IPZ 6c und 6d) ..........112<br />
4 Ehrungen und ausgezeichnete Personen ........................................................118<br />
4.1 Dienstjubiläen .....................................................................................................118<br />
4.2 Auszeichnungen .................................................................................................118<br />
5 Veröffentlichungen und Fachinformationen .................................................119<br />
5.1 Veröffentlichungen .............................................................................................119<br />
5.1.1 Veröffentlichungen Praxisinformationen ...........................................................119<br />
5.1.2 Veröffentlichungen – Wissenschaftliche Beiträge .............................................122<br />
5.1.3 LfL-Schriften ......................................................................................................129<br />
5.1.4 Pressemitteilungen .............................................................................................129<br />
5.1.5 Fernsehen, Rundfunk .........................................................................................130<br />
5.1.6 Externe Zugriffe auf IPZ-Beiträge im Internet ..................................................130<br />
5.2 Tagungen, Vorträge, Vorlesungen, Führungen und Ausstellungen ...................131<br />
5.2.1 Tagungen ............................................................................................................131<br />
5.2.2 Gemeinsames Kolloquium der Pflanzenbauinstitute der LfL ............................140<br />
5.2.3 Vorträge ..............................................................................................................141<br />
5.2.4 Vorlesungen .......................................................................................................157<br />
5.2.5 Führungen, Exkursionen ....................................................................................158<br />
5.2.6 Ausstellungen .....................................................................................................167<br />
5.2.7 Aus- und Fortbildung .........................................................................................170<br />
5.3 Diplomarbeiten und Dissertationen ....................................................................173<br />
5.3.1 Diplomarbeiten ...................................................................................................173<br />
5.3.2 Abgeschlossene Dissertationen ..........................................................................174<br />
5.4 Mitgliedschaften und Mitarbeit in Arbeitsgruppen ............................................174<br />
5.5 Kooperationen ....................................................................................................178
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
das Jahr <strong>2011</strong> hat uns mit einem warmen und vor allem in Nordbayern<br />
sehr trockenen Frühjahr „verwöhnt“. Für die <strong>Landwirtschaft</strong><br />
bedeutete das Wachstumsverzögerungen, Trockenschäden<br />
und teilweise enttäuschende Erträge. Umso wichtiger war es, dass<br />
die Reaktion der vielfältig angebotenen Sorten in neutralen, wissenschaftlich<br />
exakten Feldversuchen regional in Bayern geprüft<br />
wurde. Das Feldversuchswesen ist <strong>für</strong> die <strong>Landwirtschaft</strong> die<br />
wichtigste Wissensquelle <strong>für</strong> den optimalen Einsatz von Sorten,<br />
Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Für unser Institut stehen natürlich<br />
die Sortenversuche im Fokus, die eine schnelle Umsetzung<br />
des Zuchtfortschritts in die Praxis garantieren. Ein Großteil der zahlreichen Klicks auf das<br />
IPZ-Internetangebot geht daher auf das Konto der Landessortenversuche.<br />
Für die bayerische <strong>Landwirtschaft</strong> mindestens genauso wichtig sind die IPZ-<br />
Züchtungsaktivitäten bei den Kulturen Gerste, Weizen, Hafer, Kartoffeln, Heilplanzen,<br />
Mais, Futtergräsern, Klee-Arten, Körnerleguminosen und Hopfen. Die Biodiversität bei<br />
Nutzpflanzen steht und fällt mit aktiven Zuchtprogrammen. Hier leistet unser Institut einen<br />
wichtigen Beitrag dazu, den regionalen Besonderheiten im Flächenland Bayern Rechnung<br />
zu tragen und die private Pflanzenzüchtung in Bayern zu unterstützen. Dabei werden viele<br />
Facetten abgedeckt, von der Erforschung alter Landsorten bei Mais bis hin zur Entwicklung<br />
modernster Selektionsverfahren mit frei konfigurierbaren DNA-Arrays. Die Stärke<br />
unserer Arbeit liegt ganz klar in der Kombination der intensiven Feldversuchsarbeit/Phänotypisierung<br />
mit dem Einsatz molekularer Diagnoseverfahren.<br />
Eine Herausforderung ist die züchterische Bearbeitung „aufgegebener“ Fruchtarten. Durch<br />
die bayerische Eiweißstrategie sind ertragreiche Körnerlegumiosen wieder gefragt. Schon<br />
in den 1950er Jahren war die Züchtung von Sojabohnen an der damaligen Landessaatzuchtanstalt<br />
aufgegeben worden, in jüngerer Zeit folgten – dem Personalabbau geschuldet<br />
– Ackerbohnen und Erbsen. Jetzt konnten wir mit einem kleinen Projekt wieder neu in die<br />
Ackerbohnenzüchtung einsteigen. Künftig soll durch nationale und internationale Kooperationen<br />
auch eine effektive Verbesserung der Sojabohne <strong>für</strong> bayerische Anbaubedingungen<br />
realisiert werden.<br />
Ein großer Erfolg im wichtigen Bereich Hoheitsvollzug war die Übertragung der Feldbestandsprüfungen<br />
im amtlichen Anerkennungsverfahren bei Getreide und Kartoffeln an das<br />
LKP. Das große Engagement der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei IPZ, bei<br />
den Fachzentren Pflanzenbau und beim LKP sorgte <strong>für</strong> einen reibungslosen Übergang und<br />
gute Resonanz.<br />
Dass die Arbeit von und bei IPZ im Jahr <strong>2011</strong> vielfältig, qualitativ hochwertig und<br />
manchmal auch etwas reichlich war, zeigen die nachfolgenden, ausgewählten Beiträge und<br />
Statistiken. Diese positive Bilanz war nur durch das große und ausdauernde Engagement<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsers Institutes und die gute Kooperation innerhalb<br />
außerhalb der LfL möglich. Da<strong>für</strong> möchte ich allen ganz herzlich danken!<br />
Freising, im März 2012<br />
Dr. Peter Doleschel<br />
Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
9 Organisation<br />
1 Organisation<br />
1.1 <strong>Bayerische</strong> <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> (LfL)<br />
Die Organisationsstruktur unterscheidet<br />
• eine strategische Ebene <strong>für</strong> die Leitung und Gesamtausrichtung der LfL,<br />
• eine operative Ebene, auf deren Basis zehn relativ unabhängige Institute praxisorientierte<br />
wissenschaftliche Erkenntnisse <strong>für</strong> Politik- und Praxisberatung sowie <strong>für</strong> den<br />
einschlägigen Hoheitsvollzug erarbeiten, unterstützt durch fünf zentrale Abteilungen<br />
(Servicebereich) und<br />
• eine Transformationsebene mit sieben regionalen Lehr-, Versuchs- und Fachzentren,<br />
die Aus- und Fortbildung sowie Versuchstätigkeiten wahrnehmen.<br />
Organisationsstruktur der LfL
10 Organisation<br />
1.2 Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (IPZ)<br />
Das Institut ist Informations-, Dokumentations- und Kompetenzzentrum <strong>für</strong> alle fachlichen<br />
Fragestellungen rund um Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung, Sortenwesen und Saatgut<br />
in Bayern. Es liefert fachliche Entscheidungsgrundlagen <strong>für</strong> die <strong>Bayerische</strong> Staatsregierung,<br />
erarbeitet aktuelle Fachinformationen <strong>für</strong> die staatliche Beratung, <strong>für</strong> Handel, Industrie,<br />
Züchter und Verarbeiter und vollzieht entsprechende pflanzenbauliche Hoheitsaufgaben.<br />
Eine Sonderstellung nimmt der IPZ-Arbeitsbereich Hopfen ein, wo am Standort<br />
Wolnzach/Hüll alle fachlichen Fragen rund um diese <strong>für</strong> Bayern besondere Kulturpflanze<br />
in einem international bedeutenden Fachzentrum gebündelt werden.
11 Ziele und Aufgaben<br />
2 Ziele und Aufgaben<br />
Übergeordnetes Ziel ist es, <strong>für</strong> den landwirtschaftlichen Pflanzenbau in Bayern bestmögliche<br />
fachliche Rahmenbedingungen zu gestalten. Die fast ausschließlich operative Tätigkeit<br />
des Instituts erstreckt sich auf angewandte Forschung, pflanzenbauliche Versuche,<br />
Beratung und hoheitliche Aufgaben. Dies bildet die Basis, um bei wichtigen landwirtschaftlichen<br />
Kulturpflanzen die Erzeugung hochwertiger und gesunder Nahrungs- und<br />
Futtermittel zu fördern. Mit den Mitteln der Pflanzenzüchtung und Biotechnologie werden<br />
die genetischen Ressourcen genutzt und die vorhandene Variabilität erhalten sowie die<br />
Resistenz- und Qualitätseigenschaften und die Nährstoffeffizienz verbessert. Die Entwicklung<br />
optimierter Produktionsverfahren sichert die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>. Leitbild ist der auf Nachhaltigkeit und Umweltschonung ausgerichtete integrierte<br />
Pflanzenbau.<br />
Forschung <strong>für</strong> Pflanzenbau und Politikberatung<br />
• Entwicklung optimierter Produktionsverfahren <strong>für</strong> Ackerbau und Grünland<br />
• Sortenberatung und regionale Sortenprüfung<br />
• Forschung zur Erzeugung hochwertiger Nahrungs- und Futtermittel<br />
• Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und bestmögliche Umweltschonung<br />
• Fachinformationen <strong>für</strong> Beratung, Züchter, Handel und Industrie<br />
Züchtungsforschung<br />
• Züchtungsforschung bei ausgewählten Kulturarten<br />
• Nutzung, Erhaltung und Weiterentwicklung genetischer Ressourcen<br />
• Anpassung an den Klimawandel durch besondere Selektionsmaßnahmen<br />
• Verbesserung der Resistenz- und Qualitätseigenschaften<br />
• Einsatz der Bio- und Gentechnologie als Werkzeug in der Züchtung<br />
• Fachinformationen <strong>für</strong> Züchter, Beratung, und Handel<br />
Hoheitsvollzug<br />
• Saatenanerkennung und Beschaffenheitsprüfung<br />
• Verkehrs- und Betriebskontrollen<br />
• Fachinformation <strong>für</strong> Beratung, Züchter, Handel und Industrie<br />
Zur Erfüllung der Aufgaben stehen dem Institut das bayernweite staatliche Versuchswesen,<br />
Monitoringprogramme, eigene Versuchsflächen, ein spezielles Rollhaus zur Anwendung<br />
von künstlichem Trockenstress im Freiland, moderne Labore, Klimakammern, Gewächshäuser,<br />
diverse Untersuchungseinrichtungen und langzeitentwickelte genetische<br />
Ressourcen zur Verfügung.
12 Ziele und Aufgaben<br />
Wiedereinkehr ins Gewächshaus: Vicia faba (Ackerbohne) <strong>für</strong> die Eiweißstrategie!
2.1 Organisationsplan des Instituts <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung<br />
A r b e i t s g r u p p e n<br />
a<br />
b<br />
c<br />
d<br />
Institutsleitung: LD Dr. Doleschel<br />
Stellvertretender Leiter: Ltd. LD Kupfer Stand Januar 2012<br />
IPZ 1<br />
Arbeitsbereich<br />
Biotechnologie der<br />
Pflanzenzüchtung<br />
Koordinator:<br />
Dr. Schweizer<br />
Gewebekulturtechniken<br />
Dr. Müller (komm.)<br />
Genomanalyse,<br />
Genquellen<br />
IPZ 2<br />
Arbeitsbereich<br />
Getreide<br />
Koordinator:<br />
Dr. Hartl<br />
Pflanzenbausysteme<br />
bei Getreide<br />
Nickl<br />
Züchtungsforschung<br />
Winter- und Sommer-<br />
gerste<br />
Dr. Schweizer Dr. Herz<br />
Gentransfer, GVO- Züchtungsforschung<br />
Sicherheitsforschung Weizen und Hafer<br />
Dr. Müller<br />
Bioinformatik<br />
N.N.<br />
Dr. Hartl<br />
Zuchtmethodik und<br />
Biotechnologie Getreide<br />
N.N.<br />
IPZ 3<br />
Arbeitsbereich<br />
Hackfrüchte, Öl- und<br />
Eiweißpflanzen, Heilu.<br />
Gewürzpflanzen<br />
Koordinator:<br />
Kellermann<br />
Pflanzenbausysteme,<br />
Züchtungsforschung<br />
und Beschaffenheitsprüfung<br />
bei Kartoffeln<br />
Kellermann<br />
Zuchtmethodik und<br />
Biotechnologie Kartoffeln<br />
Dr. Schwarzfischer<br />
Pflanzenbausysteme<br />
bei Zuckerrüben, Ölu.<br />
Eiweißpflanzen;<br />
Zwischenfruchtanbau,<br />
Fruchtfolgen<br />
Aigner<br />
Pflanzenbausysteme<br />
bei Heil- und Gewürzpflanzen<br />
Dr. Heuberger<br />
IPZ 4<br />
Arbeitsbereich<br />
Futterpflanzen,<br />
Mais, Grünland<br />
Koordinator:<br />
Dr. Eder<br />
Pflanzenbausysteme<br />
und Züchtungsforschung<br />
bei Körnerund<br />
Silomais<br />
Dr. Eder<br />
Züchtungsforschung<br />
bei Futterpflanzen,<br />
Pflanzenbausysteme<br />
bei Grünland und<br />
Feldfutterbau<br />
Dr. Hartmann<br />
Biomasse<br />
Hofmann<br />
IPZ 5<br />
Arbeitsbereich<br />
Hopfen<br />
Koordinator:<br />
Doleschel (komm.)<br />
Hopfenbau, Produktionstechnik<br />
Portner<br />
Pflanzenschutz im<br />
Hopfenbau<br />
Portner (komm.)<br />
Züchtungsforschung<br />
Hopfen<br />
Dr. Seigner<br />
Hopfenqualität und<br />
-analytik<br />
Dr. Kammhuber<br />
IPZ 6<br />
Arbeitsbereich<br />
Amtliche Saatenanerkennung,<br />
Verkehrskontrollen<br />
Koordinator:<br />
Kupfer<br />
Amtliche Saatenanerkennung<br />
Kupfer<br />
Verkehrs- und Betriebskontrollen<br />
Geiger<br />
Beschaffenheitsprüfung<br />
Saatgut<br />
Dr. Killermann<br />
Saatgutforschung<br />
und Proteinelektrophorese<br />
Dr. Killermann
14 Projekte und Daueraufgaben<br />
3 Projekte und Daueraufgaben<br />
3.1 Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung<br />
Die Biotechnologie ist ein wichtiger Bestandteil der Züchtungsforschung an der LfL. Die<br />
Kombination von Züchtungs- und Genpoolarbeit mit den aktuellen Methoden der Biotechnologie<br />
ermöglicht bislang nie gekannte Wege der Merkmalsaufklärung (genomweite<br />
Assoziationsstudien). Biotechnologie und genetische Diversität sind gerade unter dem Aspekt<br />
eines fortschreitenden Klimawandels Voraussetzung <strong>für</strong> eine nachhaltige Sicherung<br />
von Ernährung, Futter- und Rohstoffproduktion.<br />
Biotechnologische Methoden wie Protoplatenfusion und Embryorescue ermöglichen hierbei<br />
die direkte Nutzung der genetischen Diversität durch die Integration der Gene nahverwandter<br />
Wildarten. Auf diesem Wege können neue und bislang nicht adaptierte Resistenzgene<br />
<strong>für</strong> die Sortenentwicklung verfügbar gemacht werden. Mit der Meristemkultur,<br />
bei der nur kleinste Sprosskegel-Segmente im Reagenzglas aufgezogen werden, kann eine<br />
z.B. mit Viren befallene Mutterpflanze vom Pathogen befreit und <strong>für</strong> Vermehrung von gesundem<br />
Pflanzgut bereitgestellt werden. Für die Selektion der besten Zuchtlinien wird mit<br />
Hilfe der Genomanalyse direkt ins Erbgut geschaut. Diese Technologie ist mittlerweile so<br />
schlagkräftig geworden, dass sich die Vererbung vieler züchtungsrelevanter Gene hochparallel<br />
und sicher verfolgen lässt. „Molecular Breeding“ heißt das Stichwort – unter dem<br />
sich neue, umfassende Selektionsmöglichkeiten eröffnen. Eine Vielzahl ganzer Genome<br />
landwirtschaftlich genutzter Pflanzen werden derzeit mit Hilfe neuester<br />
Sequenziertechnologien binnen Wochen entschlüsselt und warten auf ihre komplexe Analyse.<br />
Selbst vielschichtige Fragestellungen, welche Gene unter welchem Klimaszenario<br />
oder Pathogenstress eine entscheidende Rolle im Verteidigungshaushalt der Pflanze eine<br />
Rolle spielen, werden durch sie gleichzeitig fassbar und bringen grundlegende Erkenntnisse<br />
und Informationen <strong>für</strong> die heutige Pflanzenzüchtung ein.<br />
Abb. 1: FH Studenten<br />
lernen im Praktikum<br />
Gewebekulturtechniken,<br />
die Herstellung von Kartierungspopulationen,<br />
die Bonitur von Krankheiten<br />
und die Anwendung<br />
molekularer Marker<br />
kennen.
15 Projekte und Daueraufgaben<br />
Am IPZ werden die kurz beschriebenen Techniken im Arbeitsbereich Biotechnologie <strong>für</strong><br />
eine Vielzahl von Projekten angewandt:<br />
• Umsetzung universitärer Forschungsergebnisse <strong>für</strong> die praktische Pflanzenzüchtung<br />
Bayerns<br />
• Nutzung und Fortentwicklung der Gewebekulturtechnik zur Erzeugung doppelt haploider<br />
Linien im Bereich des PreBreedings<br />
• Regeneration, in vitro Vermehrung, Reinerhaltung und Langzeitlagerung wichtiger<br />
Zuchtlinien<br />
• Herstellung und Erweiterung der genetischer Variabilität durch Protoplastenfusion und<br />
Embryorescue Technik<br />
• Kartierung und Sequenzierung essentieller Resistenz- und Qualitätsgene <strong>für</strong> die Entwicklung<br />
molekularer Selektionsmarker<br />
• Markergestützte Selektion / Molecular Breeding auf die Vererbung wichtiger Gene in<br />
vielfältigen Züchtungsprogrammen bei diversen Kulturarten<br />
• Umfassende Expressions- und Transkriptomanalysen zum Nachweis merkmalsbestimmender<br />
Kandidatengene bei Klima- und Umweltstress<br />
• Anwendung von Transformationstechniken zur Aufklärung von Qualitäts- und Resistenzmechanismen<br />
• Ausbildung und Informationstransfer (Abb. 1) <strong>für</strong> Schulen und Studenten<br />
3.1.1 Gewebekulturtechniken (IPZ 1a)<br />
Hauptaufgabe der Arbeitsgruppe ist die Entwicklung doppelhaploider Pflanzen (DHs) bei<br />
den Getreidearten Gerste und Weizen. Damit werden zum einen spezielle Zuchtprogramme<br />
unterstützt, zum anderen wird die Voraussetzung <strong>für</strong> die Entwicklung molekularer<br />
Marker geschaffen, <strong>für</strong> die Populationen doppelhaploider Linien zur Phänotypisierung benötigt<br />
werden. Als Methoden der DH-Entwicklung werden die Mikrosporen- und die<br />
Weizen x Maismethode angewandt. Daneben befasst sich die Arbeitsgruppe mit der Optimierung<br />
von Gewebekulturtechniken zur vegetativen in vitro-Vermehrung und Langzeitlagerung<br />
von Heil- und Gewürzpflanzen im Rahmen von Zuchtprogrammen. Durch diese<br />
Arbeiten konnten wertvolle Heilpflanzenarten <strong>für</strong> den Praxisanbau unter bayerischen Bedingungen<br />
optimiert werden. In einer aktuellen Kooperation mit der Arbeitsgruppe<br />
IPZ 3d, Heil- und Gewürzpflanzen, wird versucht DH-Linien verschiedener Baldriangenotypen<br />
über die Antherenkultur zu erstellen. Ein weiterer Aufgabenbereich beinhaltet mikroskopische<br />
und flowcytometrische Untersuchungen der in vitro erzeugten Pflanzen.<br />
Erzeugung doppelhaploider Gersten- und Weizenlinien<br />
Doppelhaploide Gerstenlinien werden in unserem Labor seit einigen Jahren ausschließlich<br />
über den androgenetischen Weg der Mikrosporenkultur erzeugt. Dabei werden die nach
16 Projekte und Daueraufgaben<br />
Meiose haploiden Mikrosporen in einem frühen Entwicklungsstadium isoliert und auf verschiedenen<br />
Nährmedien zunächst zur Embryoidbildung angeregt und anschließend im<br />
Licht zur haploiden, bzw. nach Spontanaufdopplung der Chromosomen, zur doppelhaploiden<br />
Gerstenpflanze regeneriert. Der wichtigste Schritt bei dieser Methode ist die der<br />
Mikrosporenisolierung nach vorgelagerter Stressinduktion der Mikrosporen. Diese ist<br />
notwendig <strong>für</strong> die Änderung des normalen gametophytischen Enwicklungsgangs der Mikrospore<br />
(zum reifen Pollen) in Richtung „sporophytische“ Embryogenese. Als Stressor<br />
wird bei uns eine mindestens dreiwöchige Kältebehandlung intakter Ähren eingesetzt.<br />
Für die DH-Entwicklung bei Weizen (ausschließlich Winterweizen) wird in unserem Labor<br />
seit 2004 eine gynogenetische Methode, die Weizen x Mais-Methode, angewandt. Bei<br />
dieser werden nach interspezifischer Kreuzung, indem nach Befruchtung das väterliche<br />
Mais-Genom während der ersten zygotischen Teilungen eliminiert wird, ebenfalls haploide<br />
Pflanzen erzeugt. Am Eliminationsprozess ist, wie man seit 2010 weiß, das Centromer-<br />
Protein CENH3 maßgeblich beteiligt. Da Weizen in nur sehr geringem Maße spontan<br />
„aufdoppelt“ muss der diploide Zustand mittels Colchizinierung hergestellt werden. Die<br />
Weizen x Mais-Methode erweist sich als sehr robust und effizient und erbringt über die<br />
Jahre nahezu Genotypen-unabhängige konstante Ergebnisse.<br />
Zielsetzung<br />
In der Saison 2010 - <strong>2011</strong> sollten <strong>für</strong> fünf bayerische Züchterfirmen sowie zwei IPZ-<br />
Züchtungsgruppen aus insgesamt 223 Kreuzungen doppelhaploide Linien erstellt werden.<br />
Die Kreuzungen verteilten sich auf 41 Sommergerste-, 118 Wintergerste- und 64 Winterweizen-Genotypen.<br />
Im abgeschlossenen Berichtszeitraum lagen noch nicht alle Ergebnisse<br />
vor, von den 118 Wintergerste-Genotypen waren 87 bearbeitet.<br />
Ergebnisse und Diskussion<br />
Wichtige Kenngrößen der Gersten- und Weizen-DH-Entwicklung sind in den Tabellen 1<br />
bis 3 dargestellt. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die Regenerationsraten der dihaploiden<br />
Sommergerste- und haploiden Winterweizen-Linien (vor Colchizinierung).<br />
Tab.1: Sommergerste Mikrosporenkultur 2010 - <strong>2011</strong> – Kenngrößen<br />
Kreuzungen Mikrosporen- MsI Isolierte vitale Regenerierte Grüne Pflanzen<br />
Isolierungen pro Kreuzung Mikrosporen grüne Pflanzen pro Kreuzung<br />
41 261 6,4 312422000 14945 365<br />
Regenerationsrate (n = 261 MsI)<br />
GP pro Ähre GP pro 100 Antheren GP pro 10000 Ms<br />
MW Maximum MW Maximum MW Maximum<br />
5,3 46,5 13,2 116 0,48 4,93<br />
MW: Mittelwert; GP: Grüne Pflanze; MsI: Mikrosporen-Isolierung;<br />
<strong>für</strong> 1 MsI wurden im Mittel 10,9 Ähren verwendet.
17 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 2: Wintergerste Mikrosporenkultur 2010 - <strong>2011</strong> *) – Kenngrößen<br />
Kreuzungen Mikrosporen- MsI Isolierte vitale Regenerierte Grüne Pflanzen<br />
Isolierungen pro Kreuzung Mikrosporen grüne Pflanzen pro Kreuzung<br />
87 300 3,7 333093628 74198 853<br />
Regenerationsrate (n = 300 MsI)<br />
GP pro Ähre GP pro 100 Antheren GP pro 10000 Ms<br />
MW Maximum MW Maximum MW Maximum<br />
24 320 60 800 2,3 88<br />
*) im Berichtszeitraum waren 87 von 118 Kreuzungen bearbeitet;<br />
MW: Mittelwert; GP: Grüne Pflanze; MsI: Mikrosporen Isolierung;<br />
<strong>für</strong> 1 MsI wurden im Mittel 10,6 Ähren verwendet.<br />
Tab. 3: Weizen x Mais Kreuzungen 2010 - <strong>2011</strong> – Kenngrößen<br />
Kreuzungen<br />
Eingesetzte<br />
Ähren<br />
Gebildete<br />
Embryonen<br />
Pflanzen aus<br />
Embryo-<br />
Rescue<br />
Pflanzen<br />
pro Ähre<br />
Reg.rate<br />
Pfl./Embryo<br />
Summe 64 3050 26581 19483<br />
MW 48 415 304 6,4 0,73<br />
Maximum 75 665 453 10,8 0,98<br />
Minimum 32 310 189 3,3 0,50
18 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 1: Regenerationsraten von 41 haploiden-Sommergerste-Genotypen<br />
Abb. 2: Regenerationsraten von 64 haploiden Weizen-Genotypen
19 Projekte und Daueraufgaben<br />
Mit den 41 Sommergerste-Genotypen wurden insgesamt 261 Mikrosporen-Isolierungen<br />
(MsI) durchgeführt, im Schnitt 6,4 pro Kreuzung. Dabei wurden 2.856 Ähren verarbeitet,<br />
im Mittel 10,9 pro Isolierung bzw. 69,7 Ähren pro Kreuzung und davon in der Summe etwa<br />
300 Millionen lebende Mikrosporen <strong>für</strong> die Regenerationen gewonnen. Daraus entwickelten<br />
sich 14.945 grüne DH-Pflanzen, durchschnittlich 365 SG-Pflanzen pro Kreuzung.<br />
Die Regenerationsraten schwankten sehr stark, abhängig vom Genotyp um den Mittelwert<br />
0,48 pro 10.000 Ms (siehe auch Abb.1). Das Maximum lag bei 4,93 GP/10.000 Ms bzw.<br />
bei 47 grünen Pflanzen pro Ähre. An die Züchter wurden insgesamt 12.285 Sommergersten-DH-Pflanzen<br />
abgegeben, im Mittel etwa 300 Pflanzen pro Kreuzung, 14-mal wurde<br />
dabei nicht die Grenze von 250 Individuen erreicht.<br />
Mit den vorläufig 87 bearbeiteten Wintergerste-Genotypen wurden 300 MsI durchgeführt,<br />
im Schnitt 3,7 pro Kreuzung. Dabei wurden 3.073 Ähren verarbeitet, im Mittel 35,3 pro<br />
Kreuzung. Aus den insgesamt isolierten 333 Millionen Mikrosporen konnten 74.198 grüne<br />
Pflanzen regeneriert werden, im Mittel 853 GP pro Kreuzung. Die Regenerationsraten<br />
schwankten, noch stärker als bei Sommergerste, um den Mittelwert 2,3 (<strong>für</strong> n=300), das<br />
Maximum lag bei 88 GP pro 10.000 Ms bzw. 320 grünen Pflanzen pro Ähre. Somit ist im<br />
Einzelfall ein Regenerationspotential von nahezu 1 Prozent erreicht (= 1 GP/100Ms).<br />
Für die immense unvorhersehbare Variabilität der Mikrosporen-Regeneration ist zum einen<br />
der Genotyp verantwortlich zum anderen aber, in beträchtlichem Umfang, der physiologische<br />
Zustand der Pflanze während des gesamten methodischen Prozesses. Es muss ein<br />
langfristiges Ziel sein, diesen Zustand besser verstehen zu lernen, um ihn im Hinblick auf<br />
eine Methodenoptimierung gezielt beeinflussen zu können.<br />
Mit der Weizen x Mais-Methode wurden 64 Winterweizen-Kreuzungen bearbeitet. Aus<br />
3.050 mit Maispollen bestäubten Weizenähren (MW=48 Ähren pro Kreuzung), die zuvor<br />
emaskuliert und nach Bestäubung Hormon-behandelt waren, konnten 26.581 haploide<br />
Embryonen gewonnen werden, woraus sich über Embryo-Rescue-Verfahren 19.483<br />
Pflanzen entwickelten, im Mittel waren das 304 haploide Weizenpflanzen pro Genotyp.<br />
Dies entspricht einer mittleren Regenerationsrate von 0,73 Pflanzen pro Embryo mit einem<br />
Maximum bei 0,98 und einem Minimum bei 0,5 Pflanzen/Embryo (siehe auch<br />
Abb. 2). Mit exakt der Hälfte der Genotypen wurden mehr als 300 haploide Pflanzen erzeugt.<br />
Bei 10 Genotypen lag die Ausbeute bei weniger als 250 Pflanzen.<br />
Projektleitung: Dr. M. Müller<br />
Projektbearbeiter: A. Baumann, E. Schultheiß, J. Beer, M. Oberloher, P. Starke,<br />
Ch. Schöffmann, B. Sperrer, M. Penger<br />
Laufzeit: Daueraufgabe und Projektbefristung (BPZ-DH-Projekt bis zum<br />
31.10.2012)
20 Projekte und Daueraufgaben<br />
Der Einfluss von 2-Hydroxynikotinsäure auf die Induktion der Mikrosporen-<br />
Embryogenese bei verschiedenen Weizen-Genotypen<br />
Zielsetzung<br />
Bei Sommer- und Wintergerste ist in unserem Labor seit einigen Jahren die Mikrosporenmethode<br />
ein etabliertes Verfahren zur DH-Entwicklung. Die Methode ist schnell und<br />
finanziell relativ günstig, allerdings anfälliger gegenüber Störfaktoren als es die im Vergleich<br />
teure Weizen x Maismethode ist, die bei Weizen eingesetzt wird. In einem Projekt<br />
(Bachelorarbeit) sollte die Mikrosporenmethode bei Weizen erstmals bei uns erprobt werden.<br />
Gleichzeitig sollte der Einfluss des chemischen Stress-„Inducers“ 2-<br />
Hydroxynikotinsäure (2-HNA) auf die Umprogrammierung unreifer Mikrosporen in Richtung<br />
Embryogenese untersucht werden.<br />
Methode<br />
Für die Versuche wurden zwei Winterweizensorten Atlantis und Petrus ausgewählt. Diese<br />
Sorten zeigten in früheren Versuchen eine gute Antherenkultur-Tauglichkeit. Das wesentliche<br />
Kriterium der Versuchsbedingungen war die <strong>für</strong> die Stressinduktion der<br />
Androgenese notwendige Kältevorbehandlung, die im Unterschied zur DH-Entwicklung<br />
bei Gerste mit wässrigen Lösungen ablief. Dabei wurden Weizenähren in steriles Wasser<br />
(4-5 °C bei Dunkelheit) mit und ohne 2-HNA gestellt. Für die Embryoidinduktion wurden<br />
zwei verschiedene Nährmedien getestet, auf die nicht näher eingegangen wird. Tab. 4 gibt<br />
die vier verschiedenen Versuchsvarianten wieder, die bis zu fünfmal wiederholt wurden.<br />
Tab. 4: DH-Entwicklung bei Winterweizen über Mikrosporenkultur - Versuchsvarianten<br />
a - d<br />
Variante<br />
a<br />
Variante<br />
b<br />
Variante<br />
c<br />
Variante<br />
d<br />
Ergebnis:<br />
Kältevorbehandlung Inducer-Zugabe Induktionsmedium<br />
21 Tage bei 4-5 °C 0 A<br />
21 Tage bei 4-5 °C 0 B<br />
21 Tage bei 4-5 °C<br />
21 Tage bei 4-5 °C<br />
21 Tage 50 mg<br />
2-HNA/l<br />
21 Tage 100 mg<br />
2-HNA/l<br />
In Tab. 5 sind die wichtigsten Daten erfasst, Abb. 3 zeigt grüne Weizenregenerate.<br />
Grundsätzlich ist es möglich aus Weizenmikrosporen haploide Pflanzen zu regenerieren.<br />
In einem Fall konnten 178 grüne Atlantis-Pflanzen regeneriert werden, was einer Regenerationsrate<br />
von 5,3 grünen Pflanzen pro 10.000 Mikrosporen entspricht. Damit ist ein Niveau<br />
erreicht das mit einem guten Ergebnis bei Gerste vergleichbar ist. Die genetischen<br />
Voraussetzungen sind also vorhanden. Der Unterschied zum Gerstensystem liegt in der<br />
fehlenden Reproduzierbarkeit. Lediglich in vier von 36 Versuchen wurden grüne Pflanzen<br />
regeneriert. Knapp 90 % der Versuche liefern entweder keine Pflanzen oder Albinos. Zum<br />
Vergleich – bei Gerste liegt dieser Wert bei etwa 15 %. Ob 2-HNA ein guter Embryoid-<br />
B<br />
B
21 Projekte und Daueraufgaben<br />
Inducer ist, lässt sich noch nicht statistisch absichern. Immerhin lassen sich Tendenzen erkennen:<br />
Bei drei der vier positiven Versuche war 2-HNA eingesetzt worden. Außerdem<br />
zeigt sich eine Tendenz der verstärkten Embryoidbildung mit 2-HNA. Insgesamt sind die<br />
Ergebnisse vielversprechend, so dass die Versuche wiederholt werden.<br />
Abb. 3: Grüne Weizenregenerate aus der Mikrosporenkultur<br />
Tab. 5: Ergebnisse 2-HNA Mikrosporenkulturversuch bei Weizen. MS: Mikrosporen; GP:<br />
Grüne Pflanzen; Genotyp 1: Atlantis; Genotyp 2: Petrus; 1-5 Wiederholungen der vier<br />
Varianten a - d<br />
Variante<br />
a-d<br />
Minus<br />
HNA<br />
Anzahl<br />
lebender<br />
Mikro-<br />
sporen/<br />
Regene-<br />
rierte<br />
GP/<br />
Ähre<br />
GP/<br />
10000<br />
Wdh.<br />
Genotyp<br />
1-5<br />
MS Ähre<br />
Embryoide<br />
Pflanzen<br />
GP<br />
Ms<br />
1a 1 106250 21250 0 0 0 0 0<br />
1a 2 75000 18750 0 0 0 0 0<br />
2a 1 43750 10937 0 0 0 0 0<br />
2a 2 31250 6250 27 17 0 0 0<br />
3a 1 25000 5000 0 0 0 0 0<br />
3a 2 112500 18750 12 2 0 0 0<br />
4a 1 18750 3750 68 34 0 0 0<br />
4a 2 112500 18750 0 0 0 0 0<br />
5a 1 406250 81250 0 0 0 0 0<br />
5a 2 193750 32292 0 0 0 0 0<br />
1b 1 125000 25000 156 83 0 0 0<br />
1b 2 43750 8750 0 0 0 0 0<br />
2b 1 18750 3125 0 0 0 0 0<br />
2b 2 68750 11458 60 26 0 0 0<br />
3b 1 50000 7143 45 7 0 0 0<br />
3b 2 100000 13500 60 16 0 0 0<br />
4b 1 318750 53125 21 7 0 0 0<br />
4b 2 200000 40000 900 341 16 3,2 0,8
22 Projekte und Daueraufgaben<br />
Plus<br />
HNA<br />
, ,<br />
1c 1 87500 17500 48 24 0 0 0<br />
1c 2 56250 9375 72 52 0 0 0<br />
2c 1 5000 855 0 0 0 0 0<br />
2c 2 62500 8928 144 99 1 0,14 0,2<br />
3c 1 62500 12500 564 101 8 1,6 1,3<br />
3c 2 143750 28750 282 129 0 0 0<br />
4c 1 12500 2500 3 0 0 0 0<br />
4c 2 12500 3125 144 44 0 0 0<br />
1d 1 75000 15000 0 0 0 0 0<br />
1d 2 62500 10417 0 0 0 0 0<br />
2d 1 31250 6250 6 0 0 0 0<br />
2d 2 50000 10000 33 18 0 0 0<br />
3d 1 56250 11250 0 0 0 0 0<br />
3d 2 56250 14063 27 6 0 0 0<br />
4d 1 281250 56250 900 323 178 29,7 5,3<br />
4d 2 162500 32500 0 0 0 0 0<br />
5d 1 375000 62500 135 45 0 0 0<br />
5d 2 143750 23958 0 0 0 0 0<br />
Projektleitung: Dr. M. Müller<br />
Projektbearbeiter: A. Baumann, K. Aigner, E. Schultheiß, J. Beer, M. Oberloher, P.<br />
Starke, Ch. Schöffmann, B. Sperrer, M. Penger<br />
Kooperation: TUM Lehrstuhl Pflanzenzüchtung: Dr. M. Schmolke (Betreuer der<br />
Bachelorarbeit seitens der TUM)<br />
Laufzeit: Bachelorarbeit von August bis November <strong>2011</strong><br />
3.1.2 Genomanalyse (IPZ 1b)<br />
In der Pflanzenzüchtung werden große Nachkommenschaften mit DNA-basierten Analyseverfahren<br />
auf wichtige Züchtungsziele vorselektiert. Diese Technik wird als Smart- oder<br />
Molecular Breeding bezeichnet. Voraussetzung hier<strong>für</strong> ist eine enge Kopplung des Selektionsmarkers<br />
mit dem Zielgen, sowie dessen genetischen Einfluss auf das Zuchtziel. Diese<br />
Typisierung kann inzwischen einfach und kostengünstig durchgeführt werden. Sie ist aber<br />
immer noch das Ergebnis langjähriger Analysen ganzer Genome an vielen Genorten<br />
gleichzeitig. Über aufwändige Assoziationsstudien können dann ausgewählte Genorte mit<br />
züchtungsrelevanten Merkmalen in Verbindung gebracht und zur Selektion eingesetzt<br />
werden. Der entscheidende Vorteil der DNA-Analyse liegt in ihrer Ungebundenheit zum<br />
Entwicklungsstadium der Pflanze und in ihrer Unabhängigkeit vom Versuchsaufbau.
23 Projekte und Daueraufgaben<br />
Allen Marker-Techniken ist<br />
gemein, dass die Genomanalyse<br />
am Erbmaterial der<br />
Pflanze und damit direkt an<br />
der DNA ansetzt. Hierbei<br />
dockt der DNA-Marker nur<br />
an einer ganz spezifischen<br />
Stelle, entsprechend seines<br />
genetischen Codes, auf dem<br />
Chromosom an und kann so<br />
zur Analyse und Detektion<br />
eines bekannten Gens eingesetzt<br />
werden. Die Erkundung<br />
der genetischen Information,<br />
welche Zuchtlinien nun welche<br />
Gene tragen und welche<br />
Form des Gens (Haplotyp)<br />
die Züchtungsforschung<br />
weiterbringt, ist das Ziel<br />
aufwändiger Forschungsarbeiten.<br />
Abb. 1: Von der DNA zum Selektionsmarker: Ausgehend<br />
vom genetischen Code der Pflanze können DNA-Sequenzen<br />
die in unmittelbarer Nähe zum gesuchten Gen liegen als<br />
Selektionshilfe in der Züchtung eingesetzt werden.<br />
Die Genom- oder DNA-Analyse wird deshalb an der LfL als präzise und vertrauenswürdige<br />
Selektionsmethode quer über Forschungsthemen und Arbeitsgruppen hinweg<br />
eingesetzt. Sie liefert exakte Ergebnisse zum Einkreuzen spezifischer Allele<br />
merkmalstragender Kreuzungseltern, gibt Auskunft zu genetischen Ähnlichkeiten im<br />
Zuchtmaterial und beschreibt die genetische Diversität im Zuchtgarten.<br />
Derzeit bei Weizen bearbeitete Themen sind u. a.: Auswuchs, Kornhärte, Trockenstress,<br />
Backqualität (Speicherproteine, Auswuchs, a-Amylase, Proteingehalt) Fusariumresistenz<br />
(Kartierung, Markerentwicklung und Expressionsanalyse) und Rostkrankheiten.<br />
Bei Gerste standen Klimawandel (Trockenstress), Brauqualität, Ramularia- und<br />
Rhynchosporium secalis-Resistenz, Gelbmosaik-Virosen, Zeiligkeit und Vernalisationsgene<br />
in Kombination mit markergestützten Rückkreuzungsprogrammen im Vordergrund.<br />
Im Forschungsschwerpunkt „Klima/Trockenstress“ konnte eine vergleichende Solexa-<br />
Sequenzierung des Transkriptoms von drei Genotypen aus zwei unabhängigen Klimakammern<br />
in Kooperation mit dem MaxPlanck Institut in Golm/Potsdam (AG Prof. Usadel,<br />
Dr. Marc Lohse) durchgeführt werden. Bei Mais wurden umfangreiche Stammbaumanalysen<br />
zur weiteren Charakterisierung einer umfassenden Landsortensammlung umgesetzt.<br />
Die Ausbildung zum agrartechnischen Assistenten/ATA (Agrarbildungszentrum<br />
Landsberg) gehörte <strong>2011</strong> genauso zur Arbeit, wie die Betreuung von Praktikanten, Bachelor-<br />
und Masterstudenten. Durch Vorlesung an der FH, einem Praktikum<br />
(Pyrosequencing) <strong>für</strong> die TUM und Teilnahme an Seminaren konnte die gute Zusammenarbeit<br />
mit den Universitäten des Campus Weihenstephan untermauert werden.
24 Projekte und Daueraufgaben<br />
GABI-Plant-KBBE II Projekt: „ExpResBar“ – Nutzbarmachung genetischer<br />
Variabilität <strong>für</strong> die Resistenz gegenüber bedeutsamer Pathogenen bei Gerste –<br />
Teilprojekt C:<br />
Entwicklung diagnostischer Marker und physikalische Kartierung des Rrs1-<br />
Resistenzlocus gegen die Blattfleckenkrankheit<br />
Abb. 2a: Gerste nach der<br />
Inokulation mit R. secalis<br />
Pilzsporen<br />
Abb. 2b: Pilzmycel von<br />
Rhynchosporium secalis<br />
Abb. 2c: Gerstenblatt mit<br />
deutlichen<br />
Befallssymptomen, 21 Tage<br />
nach der Inokulation<br />
Zielsetzung<br />
Das Forschungsprogramm „ExpResBar“ hat es sich zum Ziel gesetzt neue Resistenzen<br />
gegen die wichtigen Gerstenkrankheiten Mehltau, Blattfleckenkrankheit, Rost, Ramularia<br />
und Gerstengelbverzwergung (BYDV) zu finden. Der Pilz Rhynchosporium secalis ist der<br />
Auslöser der Blattfleckenkrankheit und je nach Witterung eine der wichtigsten Blattkrankheiten<br />
im Gerstenanbau. Die Erkrankung führt aufgrund vielortiger Blattschädigungen<br />
durch Austrocknen und Absterben des Blattes zu Ertragsreduktion und schlechter<br />
Kornqualität. Bei Gerste liegen mehrere, an unterschiedlichen Genorten vererbte Resistenzgene<br />
vor. Einige davon konnten von der Arbeitsgruppe bereits identifiziert werden.<br />
Das Hauptresistenzgen (Rrs1) der spanischen Landsorten SBCC145 und SBCC154 wurde<br />
von uns auf Chromosom 3H nahe des Zentromers lokalisiert. Ziel des Projektes ist es, den<br />
Resistenzlocus „Rrs1“ in hoher Auflösung zu kartieren und entsprechend diagnostische<br />
Marker <strong>für</strong> die markergestützte Selektion des Rrs1-Genes zu entwickeln. Mithilfe der neu<br />
entwickelten Marker kann das Gen über einen Molecular breeding-Ansatz sicher im<br />
Zuchtmaterial selektiert und im Züchtungsprogramm integriert werden.<br />
Methode<br />
Das Resistenzgen Rrs1 wurde von uns in den spanischen Landrassen SBCC145 und<br />
SBCC154 identifiziert und auf Chromosom 3H kartiert. Alle verfügbaren DNA-Marker in<br />
diesem Bereich wurden auf Polymorphie zwischen den Kreuzungseltern getestet und <strong>für</strong><br />
eine Kartierung eingesetzt. Zur weiteren Feinkartierung wurde eine F2-Population mit<br />
über 10.000 Linien aus der Kreuzung der anfälligen Sorte Beatrix mit der resistenten
25 Projekte und Daueraufgaben<br />
Landrasse SBCC145 erzeugt. In diese F2-Pflanzen wird derzeit mittels Marker, die den<br />
Rrs1 Resistenzlocus flankieren, nach Rekombinanten Linien gesucht.<br />
Ergebnisse<br />
Es konnten bislang 33 polymorphe DNA-Marker identifiziert und kartiert und eine genetische<br />
Karte der Region um den Rrs1 Resistenzlokus erstellt werden (Abb. 3).<br />
Abb. 3: Genetische Karte des Chromosomenabschnittes,<br />
der den Resistenzlocus Rrs1 enthält<br />
Die identifizierten, flankierenden DNA-Marker werden derzeit verwendet um in der F2<br />
Population aus der Kreuzung der anfälligen Sorte Beatrix mit der resistenten Landrasse<br />
SBCC145 nach rekombinanten Linien zu suchen. Bislang konnten bereits 185 rekombinante<br />
F2-Pflanzen identifiziert werden. Die Untersuchung der fehlenden Pflanzen ist derzeit<br />
in Arbeit. Mit Hilfe der rekombinanten Pflanzen und weiteren 9.000 Markern des<br />
Illumina 9k Gersten-DNA-Chips kann die Region <strong>für</strong> den Rrs1-Resistenzlocus weiter eingeengt<br />
und der Pflanzenzüchtung als sichere Selektionshilfe zur Verfügung gestellt werden.<br />
Aufgrund mehrerer vermuteter Resistenzloci bzw. unterschiedlicher Rrs1-Allele am<br />
Zentromer von Chr. 3 ist dieser Bereich von außerordentlichem Interesse <strong>für</strong> Forschung<br />
und Züchtung. Durch die Integration natürlicher Resistenzen aus spanischen Landsorten<br />
führt das Projekt zudem zu einer Erweiterung des genutzten Gerstengenpools.<br />
Projektleitung: Dr. G. Schweizer<br />
Projektbearbeitung: Dr. B. Büttner, K. Hofmann, A. Barth, A. Jestadt<br />
Laufzeit: 2007 - 2010<br />
Kooperation: IPZ 2b, MPI-MP/Golm, IPK, JKI, CSIC, SCRI
26 Projekte und Daueraufgaben<br />
Klimatoleranz bei Gerste – von der Induktion zur Genfunktion“<br />
– ein Smart Breeding Ansatz zur Selektion auf Trockentoleranz<br />
Abb. 4: Klimakammerversuch: „Trockentoleranz bei Gerste“ am Helmholtz-Zentrum<br />
München. Links: Anzucht der Gersten in Röhren. Mitte: Messung des Blatt-<br />
Chlorophyllgehaltes. Rechts: Unterschiedliche Reaktionen auf Trockenstress<br />
Zielsetzung<br />
Das Weltklima hat sich in den vergangenen 30 Jahren deutlich und in immer schnelleren<br />
Schritten erwärmt. Bereits 2006 wurde in einer Dokumentation die Temperaturzunahme<br />
mit 0,2 °C pro Dekade beschrieben (PNAS Bd.103, S.14288, 2006). Ernstzunehmende<br />
Klimasimulationen beschreiben, dass sich die Schwankungen durchschnittlicher Sommertemperaturen<br />
deutlich ändern werden. Nicht nur in Bayern haben wir es mit einer Zunahme<br />
von Extremereignissen zu tun, d. h. mit stark schwankender Wasserverfügbarkeit und<br />
drastischen Temperatursprüngen. Die Wetterereignisse sind hierbei regional sehr verschieden<br />
und wirken sich negativ auf die Produktion landwirtschaftlicher Lebensmittel<br />
und Rohstoffe und somit direkt auf die <strong>Landwirtschaft</strong> und verarbeitende Industrie aus.<br />
Die Züchtung auf stresstolerante Pflanzen stellt die Züchtungsforschung wegen deren<br />
enormen Komplexität vor eine große Aufgabe. Die Reaktionsbreite der Pflanze gegenüber<br />
abiotischem Stress ist von einer Vielfalt an Genen und Stoffwechselwegen geprägt. Sie<br />
haben im Laufe der Evolution vielfältige Reaktionswege entwickelt und können beispielsweise<br />
ihren Stoffwechsel auf Wasserknappheit umstellen und auch noch das letztverfügbare<br />
Regenwasser optimal nutzen. Es gibt somit genetisch bedingte Unterschiede<br />
zwischen Trockenstress-toleranteren und sensitiveren Genotypen, die im vorliegenden<br />
Forschungsprojekt herausgearbeitet und gezielt über Züchtungsansätze genutzt werden<br />
sollen.<br />
Material und Methoden<br />
Die Sommergersten Barke (Referenzsorte), LfL24727 (Resistenz gegenüber nichtparasitärer<br />
Blattverbräunung und Ramularia) und Mut6519 (argentinische Braugerste, Trockenstresstolerant)<br />
wurden in vier Klimakammern des Helmholtz-Zentrums mehrfach geprüft.
27 Projekte und Daueraufgaben<br />
Zu Beginn der Blüte wurde die Bewässerung der einen Hälfte der Pflanzen <strong>für</strong> zwölf Tage<br />
unterbrochen, während die zweite Hälfte (Kontrolle) normal bewässert wurde. Von beiden<br />
Gruppen wurden vor, während und nach der Trockenstressperiode zu jeweils zehn Zeitpunkten<br />
Blattproben genommen und RNA <strong>für</strong> die Expressionsanalyse extrahiert. Vier<br />
ausgewählte Zeitpunkte während und nach der Trockenstressphase wurden umfangreichen<br />
unterschiedlichen Expressionsanalysen unterzogen. Unter Einsatz der 44k Barley Agilent<br />
Microarray Analyse, sowie der 454 Roche- und der Illumina-Solexa-Sequenzierung konnten<br />
pro Genotyp und Zeitpunkt über 36.000 spezifische Genfragmente gefunden werden.<br />
War vor Jahren die Situation der Züchtungsforschung auf mehr als zehn Gene gleichzeitig<br />
selektieren zu können noch ziemlich aussichtlos, so gibt es heute die Möglichkeit der „gesamt-genomischen<br />
Selektion“. Diese neuen Marker-Technologien generieren in kürzester<br />
Zeit umfangreiche, genetische Informationen mit denen hochkomplexe, molekulare<br />
Schaltstrukturen wie z. B. <strong>für</strong> Trockentoleranz erfasst und gezielten Züchtungsprogrammen<br />
zugänglich gemacht werden können.<br />
Ergebnisse<br />
Den Kooperationspartnern vom MaxPlanck-Institut in Golm ist es gelungen, aus den<br />
durch „Hochdurchsatz-Sequenzierung“ gewonnenen Daten ein genotypspezifisches<br />
Gerstentranskriptom (= Gesamtheit aller aktiven Gene/pro Zeitpunkt, Versuchsvariante<br />
und Pflanze) zusammenzubauen. Dieses besteht aus 36.000 Genfragmenten und bildet das<br />
Grundgerüst <strong>für</strong> unsere Analysen: „Welche Pflanze reagiert zu welchem Zeitpunkt mit<br />
welchen Genen auf die jeweilige Trockenstress-Situation?“ Darüber hinaus können wir<br />
die Genkopien eines jeden Gens zum jeweiligen Zeitpunkt zählen und dessen Expressionslevel<br />
bestimmen. Selbst die Unterschiede in der Gensequenz dieser 36.000 Genfragmente<br />
zwischen den drei untersuchten Gerstengenotypen können durch bioinformatische Vergleiche<br />
sicher erkannt werden.<br />
Abb. 5: Skizze zur Beziehung zwischen Kohlenhydrat-liefernden (Blatt) und Kohlenhydratspeichernden<br />
(Ähre) Pflanzenteilen während der Trockenstress-Phase
28 Projekte und Daueraufgaben<br />
Im Folgenden wird ein Ergebnis zum ertragsrelevanten Kohlenhydrat-Stoffwechsel herausgegriffen.<br />
Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel wird, wie wir gefunden haben, u. a. durch<br />
ein unter Trockenstress induziertes Enzym, einer „Invertase“, stark beeinflusst.<br />
Während der Photosynthese liefern die Blätter den Zucker aus der Photosynthese über die<br />
Leitbündel an die Speicherorgane (Körner). Die aktive Transportform ist die Saccharose,<br />
die ins Phloem (Leitbahnen) durch spezielle Transportproteine eingeladen wird. An den<br />
Speicherorganen wird die Saccharose aus dem Phloem entladen und durch Invertasen <strong>für</strong><br />
die Stärkebildung in den Körnern wieder in Glucose gespalten.<br />
Unter Wassermangel schließen die Pflanzen ihre Spaltöffnungen, mit der Folge, dass weniger<br />
CO2 im Blatt aufgenommen werden kann. Dadurch wird zwangsläufig weniger CO2<br />
in Zucker umgewandelt und die Photosyntheseleistung nimmt ab. Der Pflanze steht weniger<br />
Energie zur Verfügung und weniger Saccharose wird an die Speicherorgane geliefert,<br />
Ertragsgrößen wie das TKG gehen zurück. Die Blätter benötigen jetzt zunehmend eigene<br />
Energie, wodurch selbige Invertasen nun auch in den Blättern vermehrt gebildet werden<br />
(Abb. 5). Die Folge ist, dass jetzt zwar weniger Kohlenhydrate an die Ähre geliefert werden,<br />
im Gegenzug bleiben da<strong>für</strong> aber die Blätter länger intakt und können bei besserem<br />
Wasserangebot nun schneller wieder ihre volle Funktion aufnehmen (Abb. 6: Rückgang<br />
der Invertasen bei Wiederbewässerung).<br />
relative Expression (log2)<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
-6<br />
Genexpression einer "Blatt-Invertase"<br />
6 Tage trocken 10 Tage trocken 1 Tag bewässert<br />
Barke<br />
LfL24727<br />
Mut6519<br />
Abb. 6: qPCR Ergebnisse zur Analyse der Genexpression einer „Blatt-Invertase“ zu den<br />
Zeitpunkten 6 und 10 Tage Trockenstress, sowie am ersten Tag nach Wiederbewässerung.<br />
Es wurden drei unterschiedliche Gerstengenotypen analysiert. Es konnte gezeigt werden,<br />
dass die Aktivität der Invertase bei Wiederbewässerung umgehend wieder eingestellt wurde.<br />
Die untersuchten Gerstengenotypen reagierten hierbei unterschiedlich schnell.<br />
Umfangreiche Haplotypen-Analysen, das sind DNA-Sequenzanalysen der dargestellten<br />
Invertasen in einem umfangreichen Gersten-Panel, zeigen eine erstaunlich große genetische<br />
Diversität in der Vielfalt dieses Enzyms an. Diese Diversität dürfte noch von großer<br />
züchterischer Relevanz sein (Abb. 7).
29 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 7: Haplotypenanalyse und Clusterbildung nach der Sequenzierung der Invertase<br />
HvB064 bei 15 unterschiedlichen Gerstensorten (der Name ist in der Sequenzbezeichung<br />
enthalten)<br />
In weiterführenden Arbeiten werden diese Invertasen-Haplotypen kartiert und in Kooperation<br />
mit IPZ 2b/Gerste in Assoziationsstudien im Rain-Out-Shelter-Versuch auf ihre<br />
Funktion hin validiert.<br />
Projektleitung: Dr. G. Schweizer<br />
Projektbearbeitung: Dr. M. Diethelm, M. Möller, S. Wüllner<br />
Laufzeit: 2008 - <strong>2011</strong>; StMELF-Projekt<br />
Kooperation: IPZ 2b, MPI-MP Golm (Prof. B. Usadel), Helmholtz-Zentrum<br />
München<br />
3.1.3 Gentransfer und GVO-Sicherheitsforschung (IPZ 1c)<br />
Die Arbeitsgruppe befasst sich zum einen mit der Analyse von Genen bei grasartigen<br />
Nutzpflanzen, deren Expression <strong>für</strong> die <strong>Landwirtschaft</strong> in Zukunft von Bedeutung sein<br />
kann, zum anderen mit Themen der Grünen Gentechnik und GVO-Sicherheitsforschung.<br />
Arbeitsschwerpunkte sind:<br />
• Funktionsanalyse von in Gerste überführter Gene der Aminosäure-Biosynthese<br />
• Entwicklung von Techniken zur Beeinflussung von Genen während der Mikrosporenentwicklung<br />
bei Gräsern<br />
• Fachliche Stellungnahmen und Beratung zum Thema Grüne Gentechnik und GVO-<br />
Sicherheit
30 Projekte und Daueraufgaben<br />
Optimierung von DH-Technologien in der Gräserzüchtung zur Entwicklung<br />
leistungsfähiger Gräsersorten<br />
Zielsetzung<br />
Das übergeordnete Ziel des seit 01.11.2009 laufenden Projektes ist es in Kooperation mit<br />
dem Projektpartner (Karl-Franzens-Universität Graz) über die Kenntnis physiologischer<br />
Parameter des Kohlenhydrat (KH)-Stoffwechsels in Mikrosporen Ansatzpunkte <strong>für</strong> eine<br />
Induktion der Androgenese (Regeneration aus männlichen Keimzellen) bei Lolium<br />
perenne L. zu finden und eine Regeneration aus Zellabkömmlingen der Mikrosporen bis<br />
hin zur Entwicklung grüner doppelhaploider Pflanzen (DHs) zu ermöglichen. Dies könnte<br />
durch Beeinflussung des KH-Stoffwechsels vor oder während der in vitro-Kultur geschehen.<br />
Bisher ist bekannt, dass über einen Stressreiz (Kälte, Wärme, ABA, Nährstoffverarmung,<br />
chemische Inducer (2-Hydroxy-Nicotinsäure) verschiedene Kohlenhydrate und<br />
Analoga) die Fähigkeit zur Embryogenese erlangt werden kann. Als DH-Entwicklungs-<br />
Methoden werden die Antherenkultur- und die Mikrosporenkultur-Methode verglichen.<br />
Zunächst sollte eine Ms-Isolationsmethode entwickelt werden und in einer Bestandsaufnahme<br />
von verschiedenen Lolium-Sorten Gesamt- und Lebend-Mikrosporenzahlen über<br />
geeignete Vital-Färbungen bestimmt werden.<br />
Methode<br />
Im zweiten Projektjahr wurde die Bestimmung (drei Wiederholungen) der Gesamt- und<br />
Lebend-Mikrosporenzahlen nach Isolation <strong>für</strong> die bisher untersuchten Sorten Ivana,<br />
Lipresso, Abersilo, Rebecca, Barata, Bree, Respect, Niata, Kabota, Orleans und Tove<br />
(tetraploid, 4n) von Lolium perenne (L.p., diploid, 2n) vervollständigt. Ebenso wurden<br />
diese Parameter bei den zu Vergleichszwecken neu ins Programm genommenen acht Sorten<br />
von Lolium multiflorum (2n) (Andrea, Alisca, Licherry, Licollos, Litop, Suxyll, Diplomat,<br />
LMW05/220) analysiert. Um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen wurde neben<br />
„Ähre“ auch „Ährchen“ als Bezugsgröße gewählt.<br />
Von den verschiedenen Lolium-Genotypen wurden sowohl Antheren- als auch Mikrosporenkulturen<br />
angelegt und auf bis zu sechs verschiedenen Medien die Kallus- bzw.<br />
Embryoid-Induktion und Regeneration getestet.<br />
Ergebnisse und Diskussion<br />
Die isolierten lebenden Mikrosporen (Ms) schwanken beim diploiden deutschen Weidelgras<br />
über alle Genotypen hinweg im Mittel zwischen 100.000 und 200.000 Ms pro Ähre,<br />
bzw. zwischen 5.000 und 10.000 Ms pro Ährchen. Die Werte <strong>für</strong> L. multiflorum liegen<br />
etwas höher (zwischen 200.000 und 300.000 Ms pro Ähre, bzw. zwischen 10.000 und<br />
13.000 Ms pro Ährchen. Dieser Unterschied zwischen den Grasarten ist offenbar unabhängig<br />
von den gewählten Bezugsgrößen. Aus der Reihe der L.p. Genotypen fällt Tove,<br />
hier werden die höchsten Ms-Zahlen erzielt, damit ähnelt Tove den L. m. Genotypen.<br />
Möglicherweise begünstigt die Tetraploidie die Anzahl gebildeter Mikrosporen (Abb. 1).
31 Projekte und Daueraufgaben<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Lolium multiflorum und Lolium perenne<br />
lebende Mikrosporen / Ähre<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
Abb. 1: Lebendzahlen isolierter Mikrosporen pro Ähre und Ährchen verschiedener Lolium<br />
perenne und multiflorum Sorten<br />
Bei der DH-Entwicklung kann folgendes Zwischenergebnis festgehalten werden: Über<br />
Mikrosporenkulturen erfolgte eine Kallus/Embryoid-Induktion und Regeneration zu Albino-Sprossen<br />
bei den Lolium perenne Sorten Tove, Ivana und Abersilo auf zwei von vier<br />
Kultur-Medien, wohingegen noch keine Regeneration bei den getesteten Lolium<br />
multiflorum Sorten zu beobachten war. Über Antherenkulturen konnte eine gute Regeneration,<br />
allerdings überwiegend zu Albinos, bei den Lolium perenne Sorten Lipresso, Barata<br />
und Niata verzeichnet werden. Alle Sorten zeigen Kallus-Induktion, Barata konnte in einem<br />
Fall zu grünen Pflanzen regeneriert werden (Abb. 2). Lolium multiflorum zeigte bei<br />
drei Sorten, Licollos, Licherry und Andrea gutes Regenerationspotential. Licherry-<br />
Antheren konnten kürzlich zu grünen Pflanzen entwickelt werden.<br />
Für das dritte Projektjahr werden keine weiteren Genotypen ins Programm mit aufgenommen.<br />
Statt dessen wird auf einige wenige Sorten reduziert und diese auf gut funktionierenden<br />
Medien in Kombination mit zwei chemischen Invertase-Inhibitoren (Acarbiose<br />
und Miglitol) in verschiedenen Stressvarianten (Temperatur, Stressdauer) geprüft.<br />
5.000<br />
0<br />
Lolium multiflorum und Lolium perenne<br />
lebende Mikrosporen / Ährchen
32 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 2: Regeneration grüner Pflanzen aus der Antherenkultur<br />
Projektleitung: Dr. M. Müller, Dr. St. Hartmann (IPZ 4b)<br />
Projektbearbeitung: St. Gellan und S. Sigl<br />
Projektkooperation: Karl-Franzens-Universität Graz ( Prof. Dr. Th. Roitsch), Saazucht<br />
Steinach (Dr. B. Saal), AG IPZ 4b, AG IPZ 1a<br />
Laufzeit: November 2009 - Oktober 2012<br />
Förderung: GFP-Forschungsvorhaben F 62/09 LR<br />
3.2 Getreide<br />
Den größten Einfluss auf den Ertragsfortschritt hatte<br />
im Getreidebereich die Züchtung. Neben verbesserten<br />
Resistenzeigenschaften gegen die wichtigsten<br />
Blattkrankheiten, Virosen oder auch den Umweltstress<br />
ist die Steigerung der Verarbeitungsqualität<br />
wesentliches Zuchtziel. Den pflanzenzüchterisch errungenen<br />
Fortschritt bringt die regionale Sortenprüfung<br />
unverzüglich in die Praxis. Akzente werden auf<br />
folgende Bereiche gelegt:<br />
• Förderung und Nutzung der genetischen Diversifikation,<br />
Anlage und Weiterentwicklung eines<br />
"bayerischen Genpools"<br />
• Getreideanbausysteme zur Förderung der Qualität<br />
der Nahrungs- und Futtermittel
33 Projekte und Daueraufgaben<br />
• Integrierter Getreidebau, Produktionstechnik und Sortenfragen<br />
• Züchtungsforschung und Biotechnologie bei Getreide zur Förderung von Ertragsleistung,<br />
Krankheitsresistenz, Brau-, Futter- und Verarbeitungsqualität<br />
• Erhaltung und Verbesserung der genetischen Ressourcen bei Getreide.<br />
3.2.1 Produktionssysteme und Pflanzenbau Getreide (IPZ 2a)<br />
Ziel der Tätigkeit ist die Förderung der Erzeugung von Qualitätsgetreide in Bayern durch<br />
markt- und verwertungsgerechte Sortenwahl und angepasste Produktionstechnik. Hierzu<br />
bildet die laufende Prüfung von Sorteninnovationen einen wichtigen Aufgabenschwerpunkt.<br />
Die Sortenprüfung auf Anbaueignung und Qualitätsleistung unter bayerischen<br />
Standortverhältnissen erfolgt dazu bei allen wichtigen Getreidearten. Alle Versuche<br />
sind in enger Kooperation mit der Arbeitsgruppe ‘Versuchswesen, Biometrie’ und den<br />
Fachzentren Pflanzenbau an den Ämtern <strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten geplant.<br />
Die Versuchsdurchführung erfolgt überwiegend durch die regionalen Versuchsteams.<br />
Aus den in Feldversuchen, Kornuntersuchungen und im Qualitätslabor ermittelten Daten<br />
werden fruchtartenbezogene Versuchsberichte erstellt, die jährlich im Internet publiziert<br />
werden (www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/) und der Information von Beratung, Schulen,<br />
Hochschulen und der Wirtschaftskreise dienen.<br />
Für die Beratung bayerischer Landwirte werden zu den Themen Sortenwahl, Anbausysteme<br />
und Bestandesführung fachliche Unterlagen sowie Beiträge in der Fachpresse und im<br />
Internet/Intranet erstellt. Vorträge bei wissenschaftlichen und fachlichen Veranstaltungen<br />
und die Mitarbeit bei der Aus- und Weiterbildung von Kollegen gehören ebenso zu den<br />
Aufgaben.<br />
Untersuchungen zur Winterfestigkeit von Getreide<br />
Zielsetzung<br />
Größere Schäden durch Auswinterung treten immer wieder auf. In Bayern konnten massivere<br />
Auswinterungsverluste bei Wintergetreide zuletzt 2002/03 beobachtet werden. In den<br />
letzten Jahren wurde an die Winterhärte jedoch keine hohen Ansprüche gestellt und das<br />
Wintergetreide überstand die kalte Jahreszeit zumeist ohne Probleme. Aufgrund der geringen<br />
Auswinterungsschäden in der Vergangenheit konnte vom Bundessortenamt, das zuständig<br />
<strong>für</strong> die Beschreibung der Eigenschaften bei allen wichtigen landwirtschaftlichen<br />
Kulturen ist, die Winterhärte der verschiedenen Getreidesorten häufig nicht beurteilt werden.<br />
Von den in Deutschland zugelassenen Winterweizen-, Wintergersten- und<br />
Triticalesorten weisen derzeit lediglich rund 1 /3 davon Noten in diesem Merkmal auf. Von<br />
den meisten Sorten ist somit nichts über ihre Winterfestigkeit bekannt.<br />
Um zu verhindern, dass aus Unwissenheit stark auswinterungsgefährdete Sorten in den<br />
Anbau gelangen, werden seit mehreren Jahren von der LfL in Zusammenarbeit mit den
34 Projekte und Daueraufgaben<br />
Länderdienststellen in Thüringen und Sachsen sowie dem Züchterhaus Limagrain Winterhärteversuche<br />
durchgeführt.<br />
Material und Methoden<br />
Weihenstephaner Kastenanlage<br />
Holzkästen in einer Größe von etwa 300 cm Länge, 75 cm Breite und 20 cm Höhe werden<br />
mit aufbereiteter Ackererde jedes Jahr<br />
neu befüllt. Damit kalte Luft von allen<br />
Seiten an die Pflanzen dringen kann,<br />
stehen die Kästen auf einem Gestell 60<br />
cm über dem Boden. Um zu verhindern,<br />
dass das Getreide durch eine Schneedecke<br />
geschützt wird, müssen die Kästen<br />
bei Schneefall mit Foliendächern abgedeckt<br />
werden. So wird sichergestellt,<br />
dass die Pflanzen niedrigen Temperaturen<br />
und Wechselfrösten ohne Schutz<br />
ausgesetzt sind.<br />
Weihenstephaner Kastenanlage<br />
Jede Sorte wird in zwei 30 cm langen<br />
Reihen mit jeweils 14 gebeizten Körnern<br />
in drei Wiederholungen gesät. Der Aussaatzeitpunkt ist fruchtartenspezifisch. Angestrebt<br />
ist eine mehrmalige optische Bonitur der Auswinterungsschäden. Das Einstufungsschema<br />
umfasst die Notenstufen eins (fehlende oder sehr geringe Auswinterungsneigung)<br />
bis neun (sehr starke Auswinterungsneigung).<br />
Die Kastenanlage wurde an vier Orten (Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen) angelegt.<br />
Aus den Jahren 2009 bis <strong>2011</strong> liegen bei Winterweizen 12, bei Triticale neun und<br />
bei Wintergerste sechs auswertbare Versuche vor.<br />
Ergebnisse<br />
Artenvergleich<br />
In Abbildung 1 sind die Winterhärtebonituren von Triticale, Winterweizen und Wintergerste<br />
an verschiedenen Standorten dargestellt. In einigen Versuchen wurde zusätzlich die<br />
Winterhafersorte Fleuron mit angebaut (nicht dargestellt). Sie war zumeist auswinterungsgefährdeter<br />
als die anderen geprüften Winterungen. Wie aus der Praxis bekannt, nahm<br />
auch bei dem Versuch die Winterhärte in der Reihenfolge Triticale, Winterweizen, Wintergerste,<br />
Winterhafer ab.
35 Projekte und Daueraufgaben<br />
++ Winterhärte --<br />
Winterhärtebonitur (Noten 1-9)<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Dornburg<br />
2009<br />
Dornburg<br />
2010<br />
Nossen<br />
2010<br />
Dornburg<br />
<strong>2011</strong><br />
Nossen<br />
<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
<strong>2011</strong><br />
Triticale<br />
W-Weizen<br />
W-Gerste<br />
Abb. 1: Winterhärteprüfung mit der Weihenstephaner Kastenmethode bei Triticale<br />
(N = 11-12 Sorten), Winterweizen (N = 37-52) und Wintergerste (N = 26-34).<br />
Note 1: fehlende oder sehr geringe Auswinterungsneigung, Note 9: sehr starke Auswinterungsneigung<br />
Sortenvergleich<br />
Wie in Abbildung 2 a-c zu sehen ist, traten Sortenunterschiede bei den untersuchten Winterungen<br />
auf.<br />
++ Winterhärte --<br />
Abb. 2a<br />
Winterhärtebonitur (Noten 1-9)<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Winterweizen<br />
Julius<br />
Toras<br />
Famulus<br />
MV Lucilla<br />
Arktis<br />
Florian<br />
Türkis<br />
Matrix<br />
Sailor<br />
Pamier<br />
Akteur<br />
Event<br />
Genius<br />
Linus<br />
Cubus<br />
Adler<br />
Kredo<br />
Orcas<br />
JB Asano<br />
Chevalier<br />
Kerubino<br />
Manager<br />
Edgar<br />
Meister<br />
Hermann<br />
Tabasco<br />
Potenzial<br />
Hystar<br />
Mittel<br />
Impression<br />
Premio<br />
KWS Eras.<br />
Lear
36 Projekte und Daueraufgaben<br />
++ Winterhärte --<br />
Winterhärtebonitur (Noten 1-9)<br />
Abb. 2b<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Wintergerste<br />
Highlight<br />
Fridericus<br />
Semper<br />
Sebrau<br />
Lomerit<br />
Kathleen<br />
Hobbit<br />
Metaxa<br />
■ 6-zeilige Sorten<br />
■ 2-zeilige Sorten<br />
Abb. 2a-c: Winterhärteprüfung mit der Weihenstephaner Kastenmethode bei Winterweizen<br />
(N = 12 Umwelten), Wintergerste (N = 6) und Triticale (N = 9); 2009 - <strong>2011</strong>; Berechnung<br />
mit LSMEANS<br />
Bei Winterweizen konnten die größten Sortenunterschiede beobachtet werden (Abb. 2a).<br />
Über alle Versuchsorte hinweg zeigten sich die Sorten Julius, Toras, Famulus, MV Lucilla<br />
und Arktis als gut winterhart. Lear, KWS Erasmus und Premio hingegen waren am stärksten<br />
auswinterungsgefährdet. Die in Bayern verbreiteten Sorten Akteur und Cubus wiesen<br />
eine überdurchschnittliche, JB Asano eine leicht unterdurchschnittliche und Impression<br />
eine vergleichsweise geringe Winterhärte auf.<br />
Die Sortenunterschiede waren bei Wintergerste weniger stark ausgeprägt (Abb. 2b). Auffällig<br />
ist, dass die mehrzeiligen Sorten im Mittel eine bessere Winterhärte aufwiesen als<br />
die Zweizeiligen. Ergebnisse aus Thüringen sowie vom Bundessortenamt bestätigen dies.<br />
Bei Triticale zeigten sich die Sorten Sequenz, Grenado und SW Talentro an allen untersuchten<br />
Orten als überdurchschnittlich winterhart (Abb. 2c). Massimo hingegen gehörte<br />
stets zu den Sorten, die am ehesten auswinterten.<br />
Projektleitung: U. Nickl<br />
Projektbearbeitung: S. Schmidt, L. Huber, A. Wiesinger<br />
Zzoom<br />
Campanile<br />
Souleyka<br />
Wintmalt<br />
Anisette<br />
Pelican<br />
Malwinta<br />
Sandra<br />
Canberra<br />
Famosa<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Triticale<br />
Sequenz<br />
Abb. 2c<br />
Grenado<br />
SWTalentro<br />
Tulus<br />
Agostino<br />
Benetto<br />
Cosinus<br />
Cando<br />
Tarzan<br />
Massimo
37 Projekte und Daueraufgaben<br />
3.2.2 Züchtungsforschung Winter- und Sommergerste (IPZ 2b)<br />
Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der züchterischen<br />
Bearbeitung von mehrzeiliger und zweizeiliger Wintergerste<br />
und Sommergerste. Als Zuchtziele stehen im<br />
Vordergrund die Verbesserung von Ertrag, Resistenz<br />
gegenüber biotischen- und abiotischen Schadfaktoren<br />
und insbesondere die Brauqualität der Gerste. Die Nutzung<br />
und Erhaltung eines Genpools bestehend aus<br />
Zuchtmaterial und Gerstensorten, die optimal an regionale<br />
bayerische Anbauverhältnisse angepasst sind, stellt<br />
dabei die Basis der züchterischen Tätigkeit dar. Neben<br />
der klassischen Züchtungsarbeit rückt jedoch zunehmend<br />
die Nutzung von neuem Genmaterial und die<br />
Anwendung neuer effizienter Zuchtmethoden in den<br />
Mittelpunkt der Züchtungsforschung. Die Einkreuzung<br />
exotischer Gene in bayerisches Zuchtmaterial stellt einen<br />
Schwerpunkt dieser sog. Prebreeding-Arbeiten dar,<br />
genauso wie die Untersuchung der Auswirkungen solcher<br />
exotischer Gene auf die Qualität und die agronomi-<br />
Abb. 1: Exotische Gersten im<br />
Zuchtgarten<br />
schen Merkmale der Gerste. Hierzu wird entweder über gezielte Rückkreuzungen oder<br />
über die Nutzung von Doppelhaploiden definiertes Pflanzenmaterial erstellt, welches in<br />
Feldversuchen exakt analysiert werden kann. Das adaptierte Pflanzenmaterial mit interessanten<br />
Merkmalskombinationen wird zur weiteren Bearbeitung an die bayerischen Pflanzenzüchter<br />
abgegeben.<br />
Das wichtigste Hilfsmittel <strong>für</strong> die spezifische Selektion auf solche neuen Gene sind molekulargenetische<br />
Marker. In enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Genomanalyse<br />
werden markergestützte Züchtungsprogramme <strong>für</strong> Resistenzen und Qualität bearbeitet.<br />
Hierzu zählen die Resistenz gegenüber dem Gerstengelbmosaikvirus, den Pilzkrankheiten<br />
Rhynchosporium secalis, Mehltau und Fusarium sowie der durch Globalstrahlung induzierten<br />
nicht parasitären Blattverbräunung. Auch <strong>für</strong> die Selektion auf spezifische Gene,<br />
die Einfluss auf die Malzqualität haben, kommen Marker zum Einsatz. Die gezielte Einkreuzung<br />
und Selektion auf die hitzestabile ß-Amylase und reduzierte Lipoxigenase-<br />
Aktivität sind hier<strong>für</strong> prominente Beispiele. Mit der Untersuchung von neuen Sorten auf<br />
ihre Neigung zum Aufplatzen der Körner stellt die Arbeitsgruppe Züchtern, Erzeugern<br />
und Verarbeitern wichtige Informationen über die Qualität der Sommergerste zur Verfügung.<br />
Die ständige Änderung von Anforderungen der Verbraucher einerseits und Umweltbedingungen<br />
andererseits machen die fortlaufende Anpassung des Zuchtmaterials notwendig.<br />
Daher werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Genomanalyse laufend neue<br />
Marker entwickelt, die dazu beitragen, die genetische Basis <strong>für</strong> eine entsprechende Verbesserung<br />
des Genpools zu nutzen und in höchst effizienter Weise gezielt auf diese Gene<br />
zu selektieren. Die Arbeitsgruppe Züchtungsforschung Winter- und Sommergerste generiert<br />
hierzu das Pflanzenmaterial, das zur Entwicklung von Selektionsmarkern notwendig<br />
ist. Die Erstellung von Kartierungspopulationen zur Identifizierung von Genen und Entwicklung<br />
von Markern wird in Zukunft eine noch wichtigere Rolle in der Züchtungsforschung<br />
bei Gerste spielen als bisher.
38 Projekte und Daueraufgaben<br />
Unverzichtbar <strong>für</strong> die Einschätzung der genetischen Variabilität dieser Experimentalkreuzungen<br />
und des Zuchtmaterials ist die Beobachtung dieses Pflanzenmaterials im Feld.<br />
Durch die Anlage von Exaktversuchen und deren statistische Auswertung können auch<br />
komplex vererbte Merkmale erfasst und molekulargenetisch bearbeitet werden. Reproduzierbare<br />
Ergebnisse werden durch gezielte Anlage von Versuchen mit künstlicher Infektion<br />
z. B. mit Rhynchosporium secalis und Fusarium Arten gewährleistet. Gewächshaustests<br />
zur Überprüfung der Resistenz des Zuchtmaterials und von Sorten gegenüber Mehltau-<br />
und Rhynchosporium tragen zur Entwicklung von Sortenprototypen mit verbesserten Eigenschaften<br />
bei.<br />
Durch die enge Verzahnung von pflanzenbaulicher Praxis, Versuchswesen, Züchtung und<br />
Biotechnologie ist im Bereich Gerstenzüchtung eine schnelle Reaktion auf veränderte Anbaubedingungen<br />
und aktuelle Fragestellungen der Praxis möglich. Umgekehrt können auf<br />
diese Weise neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit minimaler Zeitverzögerung in die<br />
Anwendung umgesetzt werden.<br />
Untersuchungen zur genetischen Variabilität von Parametern im Zusammenhang<br />
mit Trockenstressresistenz bei Gerste<br />
Zielsetzung<br />
Der Klimawandel stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung <strong>für</strong> Qualität und Ertrag der<br />
Gerste dar. Die Sommer werden zunehmen wärmer und niederschlagsärmer. Einen Vorgeschmack<br />
lieferte der heiße Sommer 2003. Der von der Versicherungswirtschaft geschätzte<br />
durchschnittliche Wertverlust durch diese Dürreperiode liegt in Deutschland bei rund 200<br />
Millionen Euro. Die beste Lösung zum Schutz der Nutzpflanzen gegenüber Trockenstress<br />
ist der Anbau von Sorten, welche Trockenstresstolerant sind und längere Zeit mit eingeschränkter<br />
Wasserversorgung zurechtkommen.<br />
Ziel der Arbeit soll es sein, Methoden zur Selektion auf Trockenstressresistenz zu finden.<br />
Der dazu notwendige Trockenstress wurde auf zwei unterschiedlichen Wegen erzeugt:<br />
zum einen in einem Rain-Out-Shelter, zum anderen chemisch induziert durch Kaliumiodid.<br />
Hierbei kann der Versuch auf dem freien Feld angebaut werden. Zum Vergleich wurden<br />
die Sorten auch an anderen Standorten mit unterschiedlichen Bodeneigenschaften angebaut.<br />
Weiter wird mit genetischen Markern nach Unterschieden auf dem Genom der einzelnen<br />
Sorten gesucht. Dazu wird eine Assoziationsstudie mit allen erfassten Daten durchgeführt,<br />
um eventuelle Genorte, die im Zusammenhang mit Trockenstress stehen zu identifizieren.
39 Projekte und Daueraufgaben<br />
Methode<br />
Versuchsaufbau Rain-Out-Shelter (ROS)<br />
Abb. 2: Rain-Out-Shelter am<br />
Moyacker in Freising<br />
Das Rain-Out-Shelter ist ein Foliengewächshaus, das mobil auf Schienen gebaut wurde<br />
(Abb. 2). So ist es möglich, Trockenstress unter natürlichen Bedingungen reproduzierbar<br />
zu erzeugen. Als Standort des Hauses wurde ein Flurstück mit sehr gutem Boden und hoher<br />
Wasserspeicherfähigkeit ausgewählt. Das Haus fährt sensorgesteuert bei Regen über<br />
den Bestand und schützt diesen vor Niederschlägen.<br />
<strong>2011</strong> wurden 78 Sommergerstensorten unterschiedlicher Herkunft angebaut. Teilweise<br />
stammen die Sorten aus Ländern mit sehr trockenem und heißem Klima, andere stammen<br />
von bayerischen Züchtern. Ergänzend wurden einige alte deutsche Sorten und derzeit zugelassene<br />
Hochleistungssorten ausgewählt.<br />
Während der Vegetationsperiode wurden verschiedene sensorische und thermische Messverfahren<br />
(SPAD-Meter, Oberflächentemperaturmessung) und wichtige agronomische Parameter<br />
(Ährenschieben, Lager, Reife) erfasst. Die Oberflächentemperatur der Bestände<br />
wurde mit einer Wärmebildkamera aufgenommen (Abb. 3).<br />
Nach der Ernte wurden ertragsrelevante Daten und Qualitätsparameter ermittelt.<br />
Versuchsaufbau chemical dessication<br />
Abb. 3: Aufnahme des Rain-Out-Shelters<br />
mit einer Wärmebildkamera<br />
In einem zweiten Versuch wurden die Sorten mit einer 5%igen Kaliumiodidlösung besprüht.<br />
Diese führt dazu, dass die Pflanzen ihre Stomata schließen und kein Wasser mehr<br />
transpirieren. Weiter führt die Behandlung zu Salzschäden und Nekrosen an den behandelten<br />
Pflanzenteilen. Dabei wird das Chlorophyll in den behandelten Organen abgebaut,<br />
wodurch keine Photosynthese mehr betrieben werden kann. Behandelt wurde an drei Terminen<br />
(07.06., 10.06. und 14.06) unmittelbar nach dem Ährenschieben der jeweiligen Sorte.
40 Projekte und Daueraufgaben<br />
Ergebnisse<br />
Messung des Bodenfeuchtegehalts<br />
Regelmäßige Bodenfeuchtemessungen wurden mittels Tensiometern in 20, 40, 60, 80 und<br />
100 cm Tiefe durchgeführt (Abb. 4).<br />
Abb. 4: Ergebnisse der Tensiometermessungen aus dem Rain-Out-Shelter in 60 cm Tiefe<br />
Zur besseren Übersicht wurde nur der Wert in 60 cm Tiefe dargestellt. Ab einem Wert von<br />
-300m bar ist keine ausreichende Wasserversorgung mehr gewährleistet. Es ist zu sehen,<br />
dass die Pflanzen im Rain-Out-Shelter bereits ab Mitte Mai nicht mehr ausreichend mit<br />
Wasser versorgt wurden. Anfang Juni sinken die Werte weiter, bis gegen Ende Juni die<br />
Messgrenze der Tensiometer erreicht ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde der zuletzt gemessene<br />
Wert eingegeben. In der Kontrolle unter natürlichen Bedingungen ist deutlich zu sehen,<br />
dass die Pflanzen mit Ausnahme einer kurzen Trockenperiode in der zweiten Maihälfte<br />
immer ausreichend mit Wasser versorgt waren. Deutlich zu sehen ist der Unterschied zwischen<br />
den Pflanzen im Rain-Out-Shelter und der Kontrolle auf den Abb. 5A (ROS) und<br />
5B (Kontrolle). Der Bestand in der Kontrolle ist wesentlich dichter und die Pflanzen sind<br />
noch deutlich grüner. Abb. 5C zeigt ergänzend die gleiche Sorte am 10.06.<strong>2011</strong> im chemisch<br />
behandelten Versuch. Die Behandlung erfolgte am 10.06.<strong>2011</strong>. Auch dieser Bestand<br />
ist dünner als der in der Kontrolle und die Blätter und Grannen weisen fortgeschrittene<br />
Chlorosen und Nekrosen auf.
41 Projekte und Daueraufgaben<br />
A B<br />
C<br />
Abb. 5: Die Sorte Barke am 30.06.<strong>2011</strong>. A im Rain-Out-Shelter, B in der Kotrolle,<br />
C chemisch behandelt<br />
Messung des Chlorophyllgehaltes mit SPAD<br />
Mit einem SPAD-Meter (Minolta SPAD 502) wurden an allen Standorten Messungen<br />
durchgeführt (Abb. 6). Das Gerät gibt einen dimensionslosen Wert wieder, von dem aus<br />
auf den Chlorophyllgehalt der Pflanze rückgeschlossen werden kann.<br />
SPAD-Wert<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Die Abbildung bestätigt die visuellen Eindrücke auf den Abbildungen 5A, B und C. Bei<br />
allen Sorten treten in der Kontrolle die höchsten Werte auf. Zwischen den einzelnen Sorten<br />
ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Bei den Sorten Abessinische, Arg. Mutante<br />
6519 und Hindukusch sind die SPAD-Werte im ROS erheblich niedriger. Andere Sorten<br />
wie Aphrodite, Calcule und IPZ 24727 dagegen zeigen nur wenig niedrigere Werte als in<br />
der Kontrolle. Bei der chemischen Behandlung weisen alle Sorten sehr viel niedrigere<br />
Werte auf, als in der Kontrolle. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten sind<br />
nicht so ausgeprägt, wie im Rain-Out-Shelter. Die Tendenz des SPAD Wertes als Reaktion<br />
auf den Trockenstress ist aber bei den meisten Sorten ähnlich. Scheinbar reagieren je-<br />
ROS<br />
Kontrolle Gereuth<br />
Abb. 6: SPAD Werte ausgewählter Sorten am 24.06.<strong>2011</strong>. Im Vergleich sind Rain-Out-<br />
Shelter, Kontrolle und der chemisch behandelte Versuch zu sehen<br />
ChD
42 Projekte und Daueraufgaben<br />
doch einige Sorten (wie die IPZ 24727) sehr sensibel auf das Kaliumiodid. Dies muss<br />
noch genauer untersucht werden.<br />
Erste Ergebnisse agronomischer Merkmale<br />
In Abb. 7 sind die Ertragsergebnisse, sowie der Proteingehalt und das Tausendkorngewicht<br />
der jeweiligen Sorte aufgetragen. Zwischen den Sorten sind signifikante Unterschiede<br />
bezüglich des Ertrages und des Rohproteingehaltes und des Tausendkorngewichtes<br />
zu erkennen.<br />
Abb. 7: Ergebnisse der Ertragsbestimmungen, sowie Proteingehalt und Tausenkorngewicht<br />
im Rain-Out-Shelter (ROS), der nicht gestressten Kontrolle (MA) und dem chemisch<br />
gestressten Versuch (ChD)
43 Projekte und Daueraufgaben<br />
Der geringe Ertrag bei den chemisch behandelten Pflanzen spiegelt sich in den sehr hohen<br />
Proteingehalten (bis zu 17 %) der Körner wieder, da es den Pflanzen durch die Behandlung<br />
nicht mehr möglich war, Stärke im Korn zu speichern. Anders in der Kontrolle: die<br />
Proteingehalte liegen bei hohen Erträgen ebenfalls sehr hoch. Dies lässt sich durch eine<br />
optimale Stickstoffaufnahme während der Vegetation erklären. Im Rollhaus liegen die<br />
Proteingehalte weit unter denen von Kontrolle und chemischem Versuch. Dies ist auf den<br />
Trockenstress der Pflanzen zurückzuführen. Bei allen drei Parametern sind signifikante<br />
Sortenunterschiede zu erkennen (Abb. 7).<br />
Assoziationsstudie<br />
Eine genomweite Assoziationsstudie mit SNP-Markern soll Informationen über den genetischen<br />
Hintergrund der Stressresistenz liefern. Hierzu wurde das Gerstengenom mit 8-10<br />
SNP-Markern pro Chromosom abgedeckt. Diese werden im Labor mittels eines<br />
Pyrosequencers über alle 78 Sorten detektiert (Abb. 8).<br />
200<br />
100<br />
Scarlett<br />
T/T<br />
E S G A C T C<br />
5<br />
G A T G<br />
Abb. 8: Pyrogramm zweier Genotypen Sortiment mit dem Marker GBS102<br />
200<br />
100<br />
Adonis<br />
E S G A C T C<br />
5<br />
G A T G<br />
Die Sorte Scarlett weist an dem gleichen Genort ihres Genoms ein Thymin, statt eines<br />
Cytosins auf. Ob dieser Polymorphismus trockenstressrelevant ist muss in weiteren Untersuchungen<br />
überprüft werden.<br />
Neben den eigenen Untersuchungen wurden die Sorten in einem Hochdurchsatzverfahren<br />
mit 9.000 Markern zugleich getestet. Die Daten liegen vor, und können nach Erfassung aller<br />
phänotypischer Daten aus dem Jahr <strong>2011</strong> verrechnet werden.<br />
Literatur:<br />
Ferrio J.P., Bertran E., Nachit M., Royo C., Araus J.L. (2001) Near infrared<br />
reflectance spectroscopy as a potential surrogate method for the analysis of δ 13 C in<br />
mature kernels of durum wheat. Aust. J. Agric. Res., 52, 809-816<br />
Olivares-Villegas J.J., Reynolds M.P., McDonald G.K. (2007) Drought-adaptive<br />
attributes in the Seri/Babax hexaploid wheat population. Functional Plant Biology, 34,<br />
189-203<br />
Passioura J. (2004): Increasing Crop Productivity When Water is Scare - From Breeding<br />
to Field Management; www.regional.org.au/au/cs.<br />
Reagan K.L., Whan B.R., Turner N.C. (1993) Evaluation of chemical desiccation as a<br />
selection technique for drought resistance in a dryland wheat breeding program. Aust.<br />
Agric. Res. 44, 1683-91<br />
C/C
44 Projekte und Daueraufgaben<br />
Schuster, Weinfurtner, Narziss (1976) Die Bierbrauerei, Die Technologie der<br />
Malzbereitung. Ferdinand Enke Verlag Stuttgard, 6. Auflage, S. 8<br />
Projektleitung: Dr. M. Herz<br />
Projektbearbeitung: G. Reichenberger<br />
Laufzeit: 2008 - <strong>2011</strong><br />
Förderung: <strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> und<br />
Forsten (Bay. StMELF)<br />
3.2.3 Züchtungsforschung Weizen und Hafer (IPZ 2c)<br />
Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die angewandte Züchtungsforschung bei Weizen und Hafer<br />
mit den Schwerpunkten Qualität, Resistenz, Ertragssicherheit und Gesamtleistung <strong>für</strong> alle<br />
wesentlichen Erzeugungsrichtungen. Hierzu gehören beispielsweise Sammlung, Evaluierung,<br />
Neukombination und Erhalt genetischer Ressourcen. Unter Einsatz moderner Selektionsmethoden<br />
wird in Kooperation mit den bayerischen Pflanzenzüchtern Zuchtmaterial<br />
mit kombinierten Resistenzen und guter Qualität entwickelt. Breiten Raum nimmt die Erarbeitung<br />
effizienter Methoden <strong>für</strong> die Sortenbeurteilung und die Selektion in der Züchtung<br />
ein. Daneben werden Resistenz- und Qualitätsprüfungsmethoden zur Erhöhung der<br />
Selektionssicherheit erarbeitet und überprüft. Die Qualitätsbeurteilung wird in enger Kooperation<br />
mit dem Sachgebiet „Rohstoffqualität pflanzlicher Produkte“ durchgeführt. In<br />
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Genomanalyse“ sind die molekulargenetische<br />
Charakterisierung züchterisch wertvoller Eigenschaften und deren Validierung <strong>für</strong> den<br />
Einsatz in der praktischen Züchtung von grundlegender Bedeutung. Forschungsprojekte<br />
zur Genetik der Backqualität, der Auswuchsresistenz und der Trockenstresstoleranz bilden<br />
zurzeit neben der klassischen Züchtungsarbeit die Schwerpunkte.
45 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 1: “Rain-Out-Shelter” in Freising zur Prüfung auf Trockenstresstoleranz unter kontrollierten<br />
Bedingungen. Nur bei Regen fährt das Dach über die Prüfparzellen und verhindert<br />
damit unkontrollierten Niederschlag.<br />
Einfluss von Trockenstress auf die Bestandestemperatur und den Ertrag bei<br />
Weizen (Triticum aestivum)<br />
Einleitung<br />
Aufgrund der globalen Erwärmung ist laut Bundesumweltamt die Durchschnittstemperatur<br />
im letzten Jahrhundert um 0,74 °C angestiegen. Klimaforscher prognostizieren auch in<br />
Deutschland milde, feuchte Winter und trockene, heiße Sommer. Um die Erträge in der<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> stabil zu halten, ist es notwendig bestehende Sorten an die veränderten<br />
Umweltbedingungen anzupassen.<br />
Unter Trockenstress schließen die Pflanzen ihre Stomata, um Transpirationsverluste zu<br />
vermeiden. Durch die verminderte Transpirationskühlung steigt die Temperatur auf der<br />
Blattoberfläche an. In dieser Arbeit soll mittels einer Wärmebildkamera die Auswirkung<br />
von Trockenstress auf die Bestandestemperatur und den Ertrag bei Weizen untersucht<br />
werden.
46 Projekte und Daueraufgaben<br />
Material und Methoden<br />
In einem Rollgewächshaus (Rain-Out-Shelter, Abb. 1) wurden 10 Winterweizen-Sorten<br />
(1,1 m²/Parzelle) in dreifacher Wiederholung angebaut. Die 10 Sorten wurden unter<br />
Stress- und unter kontrolliert bewässerten Bedingungen geprüft. Ab Beginn der Hauptwachstumsphase<br />
wurde der Regen von den Versuchspflanzen abgehalten, um Trockenstress<br />
zu simulieren. Die Trockenstressvariante wurde mit 10 bis 30 mm an drei Düngungsterminen<br />
bewässert. Somit lag die Beregnungsmenge in der Stressvariante bei<br />
115 mm und in der Kontrolle bei 255 mm, gerechnet vom 1. Januar bis zur Ernte, die Ende<br />
Juli stattfand. Mittels Tensiometern wurde die Wasserversorgung des Bodens ständig<br />
überwacht. Bei der Bodenart handelt es sich um schluffigen Lehm bzw. mittelschluffigen<br />
Ton in den tieferen Schichten, mit einer nutzbaren Feldkapazität von 194 mm bis 100 cm<br />
Bodentiefe.<br />
Eine Prüfung unter natürlichen Bedingungen fand an den eher feuchteren Standorten in<br />
Roggenstein und Oberhummel statt. Sandige und damit schneller zu Trockenheit neigende<br />
Böden haben die Standorte Triesdorf, Baumannshof und Straßmoos. Die Parzellengrößen<br />
lagen zwischen 7,5 und 12,3 m². Trockenstress gab es an den sandigen Standorten 2010 in<br />
der Kornfüllungsphase und <strong>2011</strong> während des Schossens.<br />
Neben dem Sortenversuch wurde auch eine doppelhaploide Nachkommenschaft der Kreuzung<br />
Chevalier/Impression (2010: 152 Linien, drei Orte, zwei Wiederholungen; <strong>2011</strong>: 15<br />
Linien, fünf Orte, drei Wiederholungen) an oben genannten Orten geprüft.<br />
Um den Stress der Pflanzen zu charakterisieren, wurde die Bestandestemperatur mit einer<br />
hochauflösenden Wärmebildkamera gemessen. Bei den digitalen Aufnahmen im Rollgewächshaus<br />
wurde jede Pflanzenreihe mit Hilfe des Auswertungsprogrammes markiert, um<br />
den durchscheinenden Boden nicht in den Temperaturmittelwert mit einzubeziehen, der<br />
über die markierte Fläche ermittelt wurde. An allen Standorten wurde der Ertrag bestimmt.<br />
Ergebnisse<br />
Es konnte gezeigt werden, dass unter sonst identischen Bedingungen, die gestressten<br />
Pflanzen eine um ca. 2 °C signifikant höhere Bestandestemperatur als die kontrolliert bewässerten<br />
Pflanzen aufwiesen. Die Aufnahmen der Wärmebildkamera sind in Abb. 2 anhand<br />
der Sorte ‚Kerubino‘ dargestellt.<br />
Abb. 2: Wärmebildkamera-Aufnahme der Sorte ‚Kerubino‘ im Rain-Out-Shelter.<br />
Unter Trockenstress mit 27,2 °C (Links); Kontrolle mit 23,9 °C (Rechts)
47 Projekte und Daueraufgaben<br />
Im Sortenversuch war keine Korrelation zwischen Bestandestemperatur und Kornertrag<br />
möglich. An den Standorten Triesdorf und Baumannshof gab es in der biparentalen Population<br />
mit 152 Prüfgliedern und zwei Wiederholungen eine signifikante Korrelation zwischen<br />
der Bestandestemperatur und dem Kornertrag (Abb. 3). Je niedriger die Bestandestemperatur,<br />
desto höher war der Kornertrag. Am Standort Roggenstein war aufgrund der<br />
regelmäßigen Niederschläge kein Trockenstress zu verzeichnen. Eine Korrelation zwischen<br />
Bestandestemperatur und Kornertrag wurde an dieser Umwelt nicht beobachtet.<br />
Abb. 3: Korrelation von Ertrag und Bestandestemperatur in der Population<br />
Im Rain-Out-Shelter betrug der durchschnittliche Ertragsverlust durch Trockenstress 32 %<br />
bzw. 29 dt/ha. Den geringsten Ertragsverlust und den höchsten Ertrag unter Trockenstress<br />
erzielte die Sorte Inspiration (siehe Tabelle 1). Eine gute Trockentoleranz der beiden Hybridsorten<br />
‚Hybred‘ und ‚Hystar‘ konnte hier nicht bestätigt werden.<br />
Tab. 1: Rangfolge und Ertrag der Sorten im Rain-Out-Shelter, Mittelwerte aus 2010 und<br />
<strong>2011</strong><br />
Ertrag<br />
dt/ha<br />
Akratos<br />
Akteur Cheva-<br />
lier<br />
Cubus Hybred Hystar Impres-<br />
ion<br />
Inspira-<br />
tion<br />
JB<br />
Asano<br />
Keru-<br />
bino<br />
Kontrolle 1 96 8 86 9 81 5 92 4 93 3 95 10 79 7 89 6 89 2 96<br />
Stress 2 66 8 55 10 53 3 66 4 64 5 64 9 54 1 67 7 56 6 63<br />
Ertragsverlust<br />
7 31 6 30 4 27 3 26 5 29 8 31 2 26 1 22 9 33 10 33<br />
Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Erträge des Sortenversuches unter natürlichen<br />
Standortbedingungen. Die beiden Versuchsorte Roggenstein und Oberhummel, die eine<br />
weitgehend regelmäßige Wasserversorgung aufwiesen, sind als Mittelwert unter Kontrolle<br />
zusammengefasst. Die Weizenbestände an den Orten Baumannshof, Straßmoos und<br />
Triesdorf wiesen bei geringer nutzbarer Feldkapazität in beiden Jahren Trockenstresssymptome<br />
auf. Bei diesen Versuchen erzielte die Hybridweizensorte ‚Hystar‘ die<br />
höchsten Erträge. Die zweite Hybridsorte im Sortiment war unter Trockenstress ähnlich<br />
gut. Im Vergleich zu den Liniensorten konnten sie allerdings nur einen geringen Mehrertrag<br />
realisieren.
48 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 2: Rangfolge und Ertrag der Sorten an fünf Standorten, Mittelwerte aus 2010 und<br />
<strong>2011</strong><br />
Ertrag<br />
dt/ha<br />
Kontrolle<br />
Stress<br />
5 Orte<br />
Akra- Akteur Cheva- Cubus Hybred Hystar ImpresInspira- JB Kerutosliersiontion<br />
Asano bino<br />
2 98 9 91 8 92 7 92 4 98 1 101 10 91 5 97 3 98 6 94<br />
8 53 10 49 4 54 3 55 2 56 1 56 7 54 5 54 6 54 9 53<br />
5 70 10 65 8 68 6 69 2 72 1 73 9 68 4 70 3 70 7 68<br />
Ausblick<br />
In der Population Chevalier x Impression soll eine QTL-Kartierung <strong>für</strong> Ertrag, Qualität<br />
und die physiologische Merkmale durchgeführt werden. Allgemeines Ziel dieser Arbeit ist<br />
die Etablierung geeigneter Kriterien zur Selektion von Weizenlinien unter Trockenstress.<br />
Projektleitung: Dr. L. Hartl<br />
Projektbearbeitung: R. Friedlhuber<br />
Laufzeit: 12/2008 - 04/2012<br />
Förderung: <strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> und<br />
Forsten<br />
3.3 Hackfrüchte, Öl- und Eiweißpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen<br />
Die Bedeutung der Kartoffel hat sich vom Futtermittel und Grundnahrungsmittel zum<br />
Gemüse, weiter zu Verarbeitungsprodukten und zum technischen Rohstoff gewandelt. So<br />
bestimmen Verarbeitungseigenschaften <strong>für</strong> Fertigprodukte und die Stärkegehalte ihren<br />
Wert. Zunehmende Bedeutung gewinnt die Resistenzzüchtung vor allem gegen Krautfäule,<br />
als zentrales Problem im<br />
ökologischen Landbau, und gegen<br />
Nematoden.<br />
Viele pharmazeutische Unternehmen<br />
bauen neben den Importen<br />
auf die heimische Erzeugung<br />
von Heil- und Gewürzpflanzen.<br />
Eine Ausweitung<br />
könnte sich durch den Anbau<br />
von Pflanzen, die in der Traditionellen<br />
Chinesischen Medizin<br />
zunehmend Anwendung finden,<br />
ergeben. Dies eröffnet Marktnischen<br />
<strong>für</strong> die heimische <strong>Landwirtschaft</strong>.<br />
Öl- und Eiweißpflanzen lockern getreidereiche Fruchtfolgen auf und sind Quelle <strong>für</strong> gesunde<br />
Speiseöle, umweltfreundliche technische Öle und vor allem Grundlage <strong>für</strong> die heimische<br />
Eiweißproduktion.
49 Projekte und Daueraufgaben<br />
Der Arbeitsbereich umfasst:<br />
• Anbausysteme bei Kartoffeln, Öl- und Eiweißpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen<br />
• Integrierter Pflanzenbau, Produktionstechnik und Sortenfragen<br />
• Biotechnologie und Züchtungsforschung bei Kartoffeln<br />
und ausgewählten Heil- und Gewürzpflanzen<br />
• Beschaffenheitsprüfung bei Pflanzkartoffeln (Virustestung)<br />
• Erarbeitung von Kulturanleitungen und praxisnahe Nutzung<br />
der genetischen Diversifikation bei Heil- und Gewürzpflanzen<br />
• Erhaltung und Verbesserung der genetischen Ressourcen<br />
bei Kartoffeln, Heil- und Gewürzpflanzen<br />
3.3.1 Pflanzenbausysteme, Züchtungsforschung und Beschaffenheitsprüfung<br />
bei Kartoffeln (IPZ 3a)<br />
Die wirtschaftliche Bedeutung des Kartoffelanbaus liegt weit höher, als es der Blick auf<br />
Anbaustatistiken vermuten lässt. Vielfältige Verwertungsmöglichkeiten und die besonderen<br />
Qualitätsanforderungen, insbesondere auch beim Pflanzgut, erfordern umfangreiche<br />
Anstrengungen in Forschung und Beratung. Diese spiegeln sich in den Tätigkeitsfeldern<br />
der Arbeitsgruppe IPZ 3a wider. Um Antworten auf Fragen der spezialisierten Betriebe<br />
geben zu können, werden Sortenversuche, produktionstechnische Versuche (Tropfbewässerung,<br />
optimale N-Düngung, Legetechnik, Einsatz der elektronischen Knolle) durchgeführt<br />
und Beratungsunterlagen erstellt. Im Bereich Züchtungsforschung wird Zuchtmaterial<br />
<strong>für</strong> die bayerischen Züchter entwickelt. Für grundlegende Fragen werden Züchtungsexperimente<br />
durchgeführt und Populationen aufgebaut. In der Beschaffenheitsprüfung erfolgt<br />
die Virustestung <strong>für</strong> die Pflanzgutanerkennung und von Privatproben. Diese Aufgaben<br />
können nur in enger Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Abteilungen der LfL<br />
bewältigt werden.
50 Projekte und Daueraufgaben<br />
Virusbefall bei Anerkennungs- und Privatproben<br />
Abb. 1: Bei Pflanzgut der Kategorie Z und Privatproben erfolgt in der Regel der Virusnachweis<br />
mittels ELISA am Kartoffelkeim. Links: Pressen der Keime; Mitte: Übertragen<br />
des Keimpresssaftes auf ELISA-Platten; rechts: Ausschnitt einer ELISA-Platte mit positiven<br />
(Gelbfärbung) und negativen Reaktionen<br />
Zielsetzung<br />
Viruserkrankungen führen bei Kartoffeln zu erheblichen Ertrags- und Qualitätseinbußen.<br />
Daher muss auf Basis der Pflanzgutverkehrsverordnung Kartoffelpflanzgut auf Virusbefall<br />
untersucht werden. Die Ergebnisse bilden <strong>für</strong> die amtliche Pflanzgutanerkennung die<br />
Grundlage <strong>für</strong> die Festlegung der Pflanzgutkategorie. Daneben werden auch Partien, die<br />
Landwirte <strong>für</strong> den Eigennachbau vorsehen, als sogenannte Privatproben untersucht. Diese<br />
Ergebnisse dienen als zentrale Entscheidungshilfe <strong>für</strong> die Anbauwürdigkeit des Eigennachbaus.<br />
Darüber hinaus lassen sich aus den Daten wichtige Aussagen <strong>für</strong> die Pflanzenbauberatung<br />
hinsichtlich der Virusanfälligkeit von Sorten im Praxisanbau ableiten.<br />
Methode<br />
Für die Bestimmung des Virusbefalls an Kartoffeln wird zunächst die Keimruhe mit Hilfe<br />
der Begasung mit Rindite gebrochen. Vorstufen- und Basispflanzgut werden nach einer<br />
rund zweiwöchigen Keimphase, im Dunkeln bei ca. 22 °C und hoher Luftfeuchte, vier<br />
Wochen als Augenstecklinge im Glashaus gezogen. Der Virusbesatz wird mittels ELISA<br />
(Enzyme-linked Immunosorbent Assay) an Blattmaterial und visueller Bonitur der Pflanzen<br />
bestimmt. Bei Z-Pflanzgut und Privatproben schließt sich nach der Keimruhebrechung<br />
eine mindestens vierwöchige Keimphase an. Anschließend erfolgt der ELISA-Test an<br />
Dunkelkeimen. Im Bedarfsfall schließt sich Anzucht von Augenstecklingen und eine visuelle<br />
Einstufung der Virussymptome an, womit insgesamt erheblich Arbeits- und Glashauskapazität<br />
eingespart werden kann. Nur bei Sorten, die keine sichere Virusuntersuchung<br />
am Keim mittels ELISA zulassen, wird auch bei Z-Proben das<br />
Augenstecklingsverfahren gewählt. Die Festlegung der zu untersuchenden Virusarten erfolgt<br />
in jährlicher Abstimmung mit der Pflanzgutwirtschaft. Z-Pflanzgut wird entsprechend<br />
des Testplans getrennt auf Kartoffelvirus Y (PVY), Kartoffelblattrollvirus (PLRV)<br />
und oder auf Kartoffelvirus M (PVM) untersucht. Privatproben werden mit einem Mischserum<br />
kombiniert auf PLRV und PVY geprüft. Ab 2009 wurde bei besonders anfälligen<br />
Sorten zusätzlich der PVM-Befall ermittelt. Pro Jahr werden 1.400 - 1.800 Anerkennungsproben<br />
der Kategorie Z und rund 1.400 Privatproben untersucht. Damit die Ergebnisse<br />
aus beiden Probenarten verglichen werden können, wurden die Werte der Anerken-
51 Projekte und Daueraufgaben<br />
nung dem Untersuchungsschema der Privatproben rechnerisch angepasst. Resultate zur<br />
Befallsausprägung von PVY am Augensteckling, die <strong>für</strong> bestimmte Sorten anstelle der serologischen<br />
Untersuchung vorlagen, wurden in die Ja/Nein-Aussage der ELISA-Werte<br />
umgerechnet.<br />
Befall in %<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
0,0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Jahr<br />
Abb. 2: Mittelwerte des PLRV- und PVY-Befalls von Privatproben und zur Anerkennung<br />
vorgestellten (Z, beantragt) und letztendlich anerkanntem Pflanzgut der Kategorie Z<br />
(Z, anerkannt)<br />
Ergebnisse<br />
Privatproben weisen in den einzelnen Jahren einen mehr als doppelt so hohen Virusbefall<br />
wie die bei der Anerkennungsstelle beantragten Partien der Kategorie Z (Z, beantragt) auf.<br />
Gegenüber anerkannten Z-Partien (Z, anerkannt) und damit marktfähiger Ware sind bei<br />
Privatproben sogar drei- bis sechsfach höhere Viruswerte festzustellen. Dabei kann an<br />
Privatproben und in abgeschwächter Form an beantragten Z-Proben der jährlich unterschiedliche<br />
Virusdruck in der Praxis abgelesen werden. Infolge der Aberkennung von Partien,<br />
die nicht der Norm von Z-Pflanzgut (maximal 8 % schwere Viren) entsprechen, weist<br />
anerkanntes Z-Pflanzgut über die Jahre stets niedrige Befallswerte auf. Daran wird die<br />
qualitätssichernde Wirkung der Pflanzgutanerkennung deutlich. Beim Eigennachbau liegt<br />
der Selektionsgrad in der Hand des einzelnen Landwirtes. Als Entscheidungshilfe erhält er<br />
mit der Ergebnismitteilung <strong>für</strong> die eingesandte Privatprobe von uns eine an den Anerkennungsnormen<br />
angelehnte Beratungsaussage, ob von einem Nachbau abzuraten ist.<br />
Projektleitung: A. Kellermann<br />
Projektbearbeitung: S. Marchetti<br />
Laufzeit: Daueraufgabe<br />
Privatproben Z, beantragt Z, anerkannt
52 Projekte und Daueraufgaben<br />
Einfluss der Unterfußdüngung auf die Biomasseentwicklung, Wurzelverteilung<br />
und Qualität von Kartoffeln<br />
Abb. 1: Wurzellängenverteilung an einer Profilwand bei der Sorte Agria im August bei<br />
breitwürfig (2 Dämme links) und unterfuß (2 Dämme rechts) ausgebrachter Düngung in Form<br />
von NPK (15/15/15). Ein Punkt stellt 5 mm Wurzellänge dar. Ein Strich gibt 5mm Wurzellänge<br />
in Regenwurmröhren wider. Angeschnittene Knollen wurden in ihrer Größe dargestellt.<br />
Zielsetzung und Methode<br />
Ziel des Projektes war es, den Einfluss der Unterfußdüngung auf die Biomasseentwicklung,<br />
N-Aufnahme, Wurzelverteilung und Qualität von Kartoffeln zu quantifizierten. Zu<br />
diesem Zweck wurde ein praxisnaher Versuch mit der Sorte Agria angelegt. Es erfolgte<br />
der Vergleich von breitwürfiger Ausbringung und Einmischung des Düngers in den<br />
Damm mit einer bandförmigen Ablage 10 cm unterhalb der Saatknolle. Ermittelt wurden<br />
dabei Grünfärbung (mittels YARA N-Tester), Biomasseaufwuchs, Stickstoffgehalte (nach<br />
DUMAS) und die Wurzelverteilung (Wurzellängenmessung an einer Profilwand) an mehreren<br />
Terminen. Neben der Ertragsfeststellung wurden auch Knollenqualität<br />
(Qualitätsbonitur nach CKA II durch Fachpersonal des LKP) sowie Speise- und Veredelungseigenschaften<br />
überprüft.<br />
Ergebnisse<br />
Für die Bestimmung der Wurzellängenverteilung hat sich die Methode der Profilwand-<br />
Grabungen als gut geeignet erwiesen. Damit konnte die Lage des Düngerbandes deutlich<br />
gemacht werden, da sich dort die Wurzelbildung konzentrierte. Bei der breitwürfigen<br />
Ausbringung lag eine gleichmäßige Wurzelverteilung vor (Abb. 1). Zwischen den beiden<br />
Varianten konnten keine signifikanten Ertragsunterschiede festgestellt werden. Knollen,<br />
die bei breitflächiger Düngerausbringung erwuchsen, zeigten jedoch einen höheren Stärkegehalt.<br />
Durch platzierte Düngung ließ sich der Anteil übergroßer Knollen reduzieren<br />
und die Anteile mittlerer Sortierung erhöhen. Damit einhergehend konnte auch die Anzahl<br />
an hohlherzigen Knollen verringert werden. In der Speisewertprüfung wurde ein leichter<br />
Nachteil im Geschmack, ein geringere Mehligkeit und eine erniedrigte Kochdunkelung<br />
festgestellt. Trotz der Unterschiede war aber bei keiner Variante die Speiseeignung in Frage<br />
gestellt. Die Veredelungsprüfung (Pommes frites) ergab keine nennenswerten Unterschiede<br />
zwischen den Varianten.
53 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 2: Links: Hohlherzige Knollen unterschiedlicher Mängelausprägung (1 Punkt: kleiner<br />
1 cm, unverfärbt; 4 Punkte: größer 1 cm; verfärbt). Rechts: Gewichtsanteile der einzelnen<br />
Knollenfraktionen<br />
Projektleitung: A. Kellermann; Prof. Dr. T. Ebertseder<br />
Projektbearbeitung: B. Fichtner<br />
Laufzeit: <strong>2011</strong><br />
Kooperation: HSWT, Firma Heiss Legetechnik
54 Projekte und Daueraufgaben<br />
Agronomische, phänotypische und genotypische Charakterisierung der Kartoffelsorte<br />
Schwarzblaue aus dem Frankenwald<br />
Abb. 1: Blüte, Lichtkeim und Knollen der Sorte Schwarzblaue aus dem Frankenwald<br />
Zielsetzung und Methode<br />
Bei der „Schwarzblauen aus dem Frankenwald“ (SBF) handelt es sich um eine alte Kartoffelsorte,<br />
die nur noch im nördlichen Oberfranken vereinzelt angebaut wird. Die Anstrengungen<br />
einzelner Landwirte und der Organisation Slow Food zum Erhalt der Sorte im<br />
praktischen Anbau außerhalb von Genbanken unterstützte die LfL in Zusammenarbeit mit<br />
dem Wissenschaftszentrum Straubing mit einer Masterarbeit. Ziel war es, die Sorte nach<br />
der UPOV-Richtlinie zu beschreiben, agronomische Merkmale zu erfassen, Stärke- und<br />
Proteingehalt inklusive Aminosäure-Zusammensetzung zu analysieren und die Verwandtschaftsverhältnisse<br />
zu Sorten mit ähnlichen Knolleneigenschaften festzustellen.<br />
Damit sollte die Anmeldung als Erhaltungssorte beim Bundessortenamt vorbereitet werden.<br />
Dem Wunsch, dass die Sorte einen größeren Bekanntheitsgrad und in der Folge eine<br />
erhöhte Nachfrage auf regionalen Märkten erfährt, wurde mit einem Presse- und einem<br />
Fernsehtermin Rechnung getragen.<br />
Ergebnisse<br />
Die Sorte wurde nach den UPOV-Richtlinien <strong>für</strong> die Durchführung der Prüfung auf<br />
Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit beschrieben. Die Beschreibung entspricht<br />
der bei Putsche 1810 beschriebenen Sorte.<br />
Das Ausgangspflanzgut zeigte 100 % Virusbefall, oft auch Mischinfektionen der Virusarten<br />
Blattroll-, Y- und M-Virus der Kartoffel. Entsprechende Auswirkungen auf den Ertrag<br />
waren zu erwarten. Am Standort Freising zeigte die Herkunft „Gebelein“ der SBF einen<br />
Ertrag von relativ 52 % im Vergleich zu Agria. Die Herkunft „Hornfeck“ schnitt mit relativ<br />
42 % noch schwächer ab. Am Standort Carlgrün erreichte die Herkunft „Gebelein“<br />
55 % des Ertrages von Agria. Der relativ hohe Stärkegehalt von 18 bis 24 % je nach Prüfstandort<br />
und Herkunft macht die SBF über die Ernährung hinaus interessant <strong>für</strong> eine stoffliche<br />
Nutzung. Außerdem konnte im hitze-koagulierbaren Proteinanteil ein überdurchschnittlich<br />
hoher Gehalt an essenziellen Aminosäuren nachgewiesen werden. Die Proteingehalte<br />
i. d. TM liegen im Vergleich zu anderen Kartoffelsorten etwas über dem Durchschnitt.<br />
Die molekulare Untersuchung ergab, dass die Herkünfte der SBF bis zu einem<br />
gewissen Grad als eine Sorte gesehen werden können. Geringe Abweichungen sind aber<br />
vorhanden. Das untersuchte Exemplar der Sorte „Südtiroler 1“ konnte aufgrund einer ho-
55 Projekte und Daueraufgaben<br />
hen Übereinstimmung der bei der AFLP-Analyse erzielten Daten der Gruppe SBF zugeordnet<br />
werden. Phänotypische Übereinstimmung der Knollen sowie ein übereinstimmendes<br />
Proteinbandenmuster bestätigten dieses Ergebnis.<br />
Abb. 2: Darstellung des Verwandtschaftsgrades als Hamming-Abstand zwischen den untersuchten<br />
Sorten und Herkünfte der Schwarzblauen aus dem Frankenwald (SBF) durch<br />
SplitsTree4 unter Verwendung der Methode Split Decomposition (verändert)<br />
Projektleitung: A. Kellermann; Prof. Dr. V. Sieber; Dr. A. Schwarzfischer, IPZ 3b<br />
Kooperation: G. Lang, Slow Food; Dr. K. Dehmer, IPK;<br />
Projektbearbeitung: Robert Bauer<br />
Laufzeit: <strong>2011</strong><br />
3.3.2 Zuchtmethodik und Biotechnologie Kartoffeln (IPZ 3b)<br />
Verschiedene biotechnologische Methoden wie Zell- und Gewebekultur sowie molekulargenetische<br />
Analyseverfahren werden bei uns im Dienste der Kartoffelzüchtung eingesetzt.<br />
Basierend auf Gewebekulturtechniken erfolgen die Erhaltungszüchtung (in vitro-<br />
Etablierung, Erhaltung und Vermehrung) und Gesundmachung (Meristemkultur) von Kartoffelsorten<br />
und wertvollen Zuchtstämmen. Gesunde in vitro-Pflanzen dienen als Ausgangsmaterial<br />
<strong>für</strong> die Pflanzgutvermehrung bayerischer Sorten und auch von Erhaltungs-
56 Projekte und Daueraufgaben<br />
sorten, beispielsweise den „Bamberger Hörnchen“ (Abb. 1). Diese über 150 Jahre alte<br />
Landsorte wurde dank unserer Vorleistungen zur Virusbefreiung im Dezember <strong>2011</strong> als<br />
Erhaltungssorte vom Bundessortenamt zugelassen. Für die „Schwarzblauen aus dem<br />
Frankenwald“ erfolgte nun die Etablierung gesunder in vitro-Pflanzen um eine entsprechende<br />
Registrierung vorzubereiten.<br />
Für die Neuzüchtung von Basiszuchtmateriel mit multipler Widerstandsfähigkeit gegen<br />
Kartoffelkrankheiten und Schaderreger werden spezielle dihaploide Zuchtstämme eingesetzt.<br />
Aus den Blättern von in vitro-Kulturen dieser Pflanzen werden einzelne Zellen<br />
(Protoplasten) isoliert und verschmolzen. Ziel dieser Protoplastenfusion ist die gezielte<br />
Kombination verschiedener Resistenzeigenschaften. Im Berichtszeitraum ist es uns beispielsweise<br />
gelungen, einige Speisekartoffelstämme auf diesem Wege zu gewinnen, die<br />
resistent gegen das Kartoffelvirus Y (PVY) und gegen Kartoffelnematoden (Globodera<br />
pallida Pa3, G. rostochiensis Ro1-5) sind. Bislang gibt es in Deutschland nur eine Sorte<br />
mit Pa3 Resistenz. Speisesorten mit entsprechenden Resistenzkombinationen sind bisher<br />
nicht beschrieben und werden <strong>für</strong> Befallsgebiete dringend nachgefragt, insbesondere auch<br />
in Bayern (Donaumoos).<br />
Alle Versuche zur Entwicklung transgener Kartoffeln wurden im Berichtszeitraum eingestellt.<br />
Unter Einsatz molekulargenetischer Selektionsmethoden (PCR-, RFLP-, AFLP-<br />
Analysen, DNA-Klonierung) werden molekulare Marker <strong>für</strong> wichtige Resistenzen entwickelt,<br />
Fusionshybride identifiziert, Sämlingspflanzen, Zuchtstämme sowie Populationen<br />
genau charakterisiert und hinsichtlich wertvoller Resistenzen selektiert. Ziel ist auch hier<br />
die Kombination möglichst vieler Resistenzeigenschaften, insbesondere bei Speisestämmen<br />
aus Spezialkreuzungen. Die identifizierten Zielpflanzen werden im Gewächshaus zur<br />
Knollenproduktion angebaut. In den Folgejahren werden sie im Freiland im Vergleich zu<br />
konventionellem Zuchtmaterial angebaut und bewertet. Alle Arbeiten erfolgen in enger<br />
Zusammenarbeit und Verflechtung mit der klassischen Kartoffelzüchtung.<br />
Abb. 1: Bamberger Hörnchen
57 Projekte und Daueraufgaben<br />
QTL-Kartierung der Kartoffelkrebsresistenz<br />
Zielsetzung<br />
Kartoffelkrebs wird durch den Pilz Synchytrium endobioticum hervorgerufen. Durch die<br />
Ausbildung von hitze- und kälteresistente Dauerformen ist der Pilz in der Lage bis zu 40<br />
Jahre im Boden zu überleben. Um einer Verschleppung des Erregers aus verseuchten Gebieten<br />
vorzubeugen, wird der Befall mit Kartoffelkrebs als Quarantänekrankheit eingestuft.<br />
Für die Entwicklung krebsresistenter Sorten ist die Entwicklung vereinfachter Testverfahren<br />
zum Nachweis der Resistenz dringend erforderlich, da der bisherige Biotest<br />
nach der von Glynne (1925) und Lemmerzahl (1930) entwickelten Methode extrem aufwendig,<br />
unsicher, teuer und somit in frühen Zuchtstadien nicht umsetzbar ist. Sorten mit<br />
breiter Resistenz gegen den Kartoffelkrebs sind auch weiterhin trotz großer Nachfrage<br />
Mangelware. In der Bundessortenliste von <strong>2011</strong> sind unter den über 200 Sorten gerade<br />
einmal 3 Speisesorten mit Krebsvollresistenz (Pathotyp P1, 2, 6, 18) registriert. Unser Ziel<br />
ist deshalb die Entwicklung eines vereinfachten molekulargenetischen Testverfahrens, das<br />
eine sichere Selektion bereits im Sämlingsstadium erlauben würde. Dank eines Forschungsprojektes<br />
des Bundesministeriums <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong>, Ernährung und Verbraucherschutz<br />
(BMELV) und der Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen <strong>Landwirtschaft</strong><br />
(GFP) konnten nun über eine QTL-Kartierung detaillierte Informationen zur<br />
Vererbung der Krebsresistenz als wesentliche Grundlage <strong>für</strong> eine markergestützte Selektion<br />
erhalten werden.<br />
Methode<br />
Für unser Projekt standen drei Populationen, d. h. Kreuzungsnachkommenschaften, der<br />
Sorten Panda und Ulme zur Verfügung. Beide Sorten sind jeweils resistent gegen alle bekannten<br />
Krebspathotypen (P1, 2, 6, 8, 10, 18). Fünf Jahre lang wurden fast 800 Genotypen<br />
dieser Populationen in vitro und zum Teil auch im Feld erhalten. Jährlich wurden über 500<br />
Genotypen einer Krebsresistenzprüfung unterzogen. Die Untersuchungen erfolgten nach<br />
Glynne und Lemmerzahl in Räumlichkeiten der AG Dr. Büttner (IPS) mit Hilfe von Kartoffelaugen,<br />
die in stark feuchtem Milieu mit Krebswucherung bedeckt und kultiviert<br />
wurden. Die verschiedenen Krebspathotypen müssen jeweils getrennt voneinander untersucht<br />
werden. Wir erweiterten dabei unsere Untersuchungen von ursprünglich Pathotyp 1,<br />
2 und 6 auf Pathotyp 18, da dieser an Bedeutung gewonnen hat. Zudem zeigen Sorten mit<br />
einer Resistenz gegen P18 auch meist eine Resistenz gegenüber den anderen Pathotypen.<br />
Die Ausgangswucherungen wurden uns dankenswerterweise von IPS zur Verfügung gestellt.<br />
Nach 3-4 Wochen zeigten sich bei anfälligen Vergleichssorten und Proben deutliche neue<br />
Wucherungen an den Augenstecklingen (Abb. 2).
58 Projekte und Daueraufgaben<br />
Entscheidend <strong>für</strong> die erfolgreiche Entwicklung von genetischen Markern sind gute<br />
Boniturdaten <strong>für</strong> die zu untersuchende Eigenschaft. Die Ergebnisse müssen sicher und<br />
eindeutig sein. Um die Masse an Proben bewältigen zu können, beschränkten wir anfangs<br />
den Prüfungsumfang auf fünf Wiederholungen, d. h. fünf Augen pro Zuchtstamm und<br />
Pathotyp. Über 7.500 Augenstecklinge wurden mit dieser Methode jährlich bonitiert.<br />
Doch trotz des großen Probenumfangs war diese Vorgehensweise noch zu unsicher. Der<br />
Biotest ist generell so fehlerbehaftet, dass 20 Wiederholungen empfohlen werden müssen.<br />
Auch die ursprüngliche Bonitur in die beiden Klassen „resistent“ und „anfällig“ musste<br />
angepasst werden und erfolgte im Weiteren auf einer Skala von 1 (frühe Abwehrnekrosen)<br />
bis 5 (starke Infektion). Abb. 2 zeigt die Befallsklassifizierung <strong>für</strong> einen resistenten Genotyp<br />
mit den Boniturnoten 1 und 2, sowie <strong>für</strong> einen anfälligen Genotyp mit Boniturnoten<br />
von 3 bis 5 nach Inokulation mit Pathotyp 18.<br />
Abb. 2: Ergebnis der Krebsresistenzprüfung auf Pathotyp 18 <strong>für</strong> einen resistenten (links)<br />
und einen anfälligen Genotypen (rechts)<br />
Die untersuchten Populationen wurden parallel mit Hilfe von AFLP- und Mikrosatelliten-<br />
Analysen molekulargenetisch charakterisiert. Verschiedene statistische Verfahren<br />
(Einzelmarkerregressionen, multiple Regressionen, QTL-Kartierungsanalysen) lieferten<br />
anschließend Genomregionen, die mit der Krebsresistenz gekoppelt waren.<br />
Ergebnisse<br />
Es ist uns gelungen, zuverlässig Genomregionen zu identifizieren, die mit der Kartoffelkrebsresistenz<br />
in Verbindung stehen (Abb. 3).
59 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 3: Schematische Darstellung der zwölf Kartoffelchromosomen. Genomregionen, die<br />
signifikant mit der Krebsresistenz gegenüber den Pathotypen (P) 1, 2, 6 und 18 gekoppelt<br />
waren, sind graphisch hervorgehoben. In Klammern ist jeweils vermerkt, ob die entsprechende<br />
Genomregionen in der Population Saturna x Panda (SxP) oder in der Population<br />
Ulme x 2899/9B (1538) identifiziert wurde.<br />
Die QTL-Kartierung lieferte wichtige Erkenntnisse über die Vererbung der Resistenz gegenüber<br />
den Pathotypen 1, 2, 6, und 18. Die Resistenz gegenüber P 1 war in den hier untersuchten<br />
Populationen hauptsächlich durch den Sen1-Locus auf Chromosom XI (Hehl et<br />
al., 1999) bedingt. Die Präsenz von Sen1 führt zu einer beachtlichen Befallsreduktion von<br />
bis zu 65 %. Die Resistenzen gegenüber den Pathotypen 2, 6 und 18 werden oftmals durch<br />
ähnliche Genombereiche vermittelt, die jeweils einen kleineren bis mittleren Anteil an der<br />
phänotypischen Varianz erklärten. Genotypen, in denen mehrere positive Allele in Kombination<br />
vorlagen, zeigten ein deutlich höheres Resistenzniveau als solche, die keine oder<br />
wenige positive Allele trugen. Exemplarisch ist dies <strong>für</strong> Pathotyp 18 in der Population<br />
Saturna x Panda gezeigt (Abb. 4).
60 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 4. Boxplot-Verteilungen der Boniturmittelwerte <strong>für</strong> Pathotyp 18 klassifiziert nach der<br />
Anzahl an kombinierten positiven Allelen. Die Mittelwerte <strong>für</strong> die Klassen 0 (kein positives<br />
Allel) bis 4 (4 positive Allele) sind jeweils unter den entsprechenden Boxplots angegeben.<br />
Je niedriger der Boniturwert, desto niedriger der Befall. Die Daten basieren auf den Mittelwerten<br />
von jeweils 10-20 inokulierten Augen pro Genotyp und Rasse aus den Jahren<br />
2009/10 und 2010/11. Berücksichtigt wurden alle signifikanten (P < 0,01) Marker aus der<br />
Einzelmarkerregression, die in einer schrittweisen multiplen Regression signifikant blieben<br />
(P < 0,05). Durchgezogene Linien: Median; +: Mittelwerte, 50 % der Datenpunkte<br />
liegen innerhalb der grauen Boxen.<br />
Die Resistenz von Panda und Ulme bezüglich der Pathotypen 2, 6 und 18 beruhte größtenteils<br />
auf unterschiedlichen Genomregionen mit Ausnahme von Chromosom I, auf dem in<br />
beiden Populationen signifikante Marker-Merkmals-Assoziationen gefunden werden<br />
konnten. In der Population Saturna x Panda wurden außerdem auf den Chromosomen VI,<br />
VII, VIII und X Marker/QTL <strong>für</strong> die Pathotypen 2, 6 und/oder 18 identifiziert, während in<br />
der Ulme-Population neben Chromosom I auch Marker auf den Chromosomen III und IX<br />
einen Beitrag zur Resistenz leisteten (Abb. 3). Interessanterweise konnten in einer parallel<br />
laufenden Studie von Ballvora et al. (<strong>2011</strong>) ebenfalls Marker auf den Chromosomen I und<br />
IX gefunden werden, die mit der Resistenz gegenüber den Pathotypen 2, 6 und 18 (Chromosom<br />
I) bzw. Pathotyp 18 (Chromosom IX) gekoppelt waren. Ob es sich tatsächlich um<br />
die gleichen Resistenzorte handelt wie bei Ulme müssen weitere Untersuchungen zeigen.<br />
Aufgrund der Komplexität des Merkmals und der Abhängigkeit der Resistenz vom<br />
Resistenzdonor sowie dem genetischen Hintergrund bleibt die Entwicklung von diagnostischen<br />
Markern, die direkt <strong>für</strong> die markergestützte Selektion einsetzbar sind, schwierig.<br />
Die Übertragbarkeit der Marker aus QTL-Regionen in andere Populationen oder auf andere<br />
Sorten ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt möglich, da je nach genetischem Hinter-
61 Projekte und Daueraufgaben<br />
grund und beteiligten Kreuzungseltern andere Genombereiche in die Krebsresistenz involviert<br />
sind. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass <strong>für</strong> ein gutes Resistenzniveau mehrere<br />
positive Allele kombiniert vorliegen müssen. Nichtsdestotrotz bilden unsere Ergebnisse<br />
eine entscheidende Grundlage <strong>für</strong> weitere Forschungsarbeiten zur Krebsresistenz und<br />
werden im Rahmen neuer Analyse-Verfahren mittelfristig auch in die praktische Züchtung<br />
einfließen.<br />
Projektleitung: Dr. A. Schwarzfischer<br />
Projektbearbeitung: Dr. J. Groth, Dr. Y.S. Song<br />
Laufzeit: 2008 - 2012<br />
Förderung: Bundesministeriums <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong>, Ernährung und Verbraucherschutz<br />
, Bundesanstalt <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> und Ernährung<br />
(BLE), Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen <strong>Landwirtschaft</strong><br />
(GFP). Vorarbeiten über <strong>Bayerische</strong>n Staatsministeriums<br />
<strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten (2006 - 2008)<br />
3.3.3 Pflanzenbausysteme bei Öl- und Eiweißpflanzen und Zwischenfrüchten<br />
(IPZ 3c)<br />
Obwohl der Winterrapsanbau in Bayern in den letzten zwei Jahren um 25 Prozent eingeschränkt<br />
wurde, liegt der Hauptarbeitsschwerpunkt der Arbeitsgruppe IPZ 3c nach wie vor<br />
in der Sortenberatung und Optimierung der Produktionstechnik bei Winterraps. Als<br />
Grundlage <strong>für</strong> die Sortenberatung wurden dazu neben der Wertprüfung in Frankendorf,<br />
am Standort Oberhummel ein Landessortenversuch und der kombinierte BSV/EU2 Versuch<br />
angelegt. Aus den Versuchs- und Praxiserträgen der letzten Jahre kann die Erfahrung<br />
abgeleitet werden, dass die Vorwinterentwicklung des Winterrapses den Ertrag maßgeblich<br />
beeinflusst. In Abstimmung mit den Kollegen der 2.1 P der Ämter <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong><br />
wurde im Herbst 2010 ein neuer produktionstechnischer Versuch zur optimalen Vorwinterentwicklung<br />
mit unterschiedlicher Saatzeit, N-Düngung und Wachstumsreglereinsatz<br />
neu angelegt und <strong>2011</strong> erstmals beerntet.<br />
Die Auswertung und fachliche Beurteilung der Sortenversuche zu den übrigen Ölsaaten<br />
sowie bei allen Hülsenfrüchten ist eine weitere Daueraufgabe. Die Abstimmung und gemeinsame<br />
Durchführung von Sortenversuchen bei den Körnerleguminosen auf konventionellen<br />
Flächen und Ökoflächen wurde fortgeführt. An den Versuchsstellen Viehhausen<br />
und Hohenkammer hat die Versuchsmannschaft von IPZ 3c in <strong>2011</strong> insgesamt 28 Versuchsvorhaben<br />
zu Fragen des ökologischen Landbaus <strong>für</strong> IAB 3b angelegt und betreut. Da<br />
speziell die Fruchtfolgeversuche sehr arbeitsaufwändig sind, beansprucht diese Versuchstätigkeit<br />
mittlerweile den größten Teil der Arbeitskapazität von IPZ 3c.<br />
<strong>Bayerische</strong> Eiweißinitiative hat neuen Arbeitsschwerpunkt zur Folge<br />
In bundesweiten Gremien und Verbänden wurde in der jüngsten Vergangenheit kontinuierlich<br />
auf den gravierenden Rückgang des Körnerleguminosenanbaues in Deutschland<br />
hingewiesen und die hohe Importabhängigkeit von Eiweißfuttermitteln beklagt. Auch in
62 Projekte und Daueraufgaben<br />
Bayern nimmt der Anbau von Eiweißpflanzen im Jahr <strong>2011</strong> mit gut 19.000 ha nicht einmal<br />
1 Prozent der bayerischen Ackerfläche ein; siehe Grafik 1.<br />
F l ä c h e in 1000 ha<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Ackerfläche in Bayern <strong>2011</strong>: 2 069 Mio ha<br />
Leguminosen : 19 089 ha = 0,9 % der AF<br />
Körnererbsen<br />
12 051 ha<br />
Ackerbohnen<br />
3 678 ha<br />
Sojabohnen<br />
3 002 ha<br />
0<br />
1990 1992 94 96 98 2000 02 04 06 08 2010 2012<br />
Abb. 1: Anbau von Eiweißpflanzen in Bayern seit 1990<br />
Während der Erbsenanbau in den letzten 15 Jahren zwischen 12 und 14.000 ha pendelte,<br />
ging die Ackerbohnenfläche bis auf 2.000 ha zurück, und hat erst in den letzten zwei Jahren<br />
durch das KuLaP Programm wieder einen leicht Anstieg erfahren. Die tragende Säule<br />
des Ackerbohnenanbaus ist mittlerweile der Ökolandbau. 70 Prozent der bayerischen<br />
Ackerbohnen standen in den letzten 5 Jahren auf Ökoflächen. Erst in den letzten zwei Jahren<br />
hat der Sojabohnenanbau in Bayern die 1.000 ha Schwelle überschritten, und ist damit<br />
aus dem Nischendasein herausgetreten.<br />
Die bayerische Staatsregierung hat im Rahmen von „Aufbruch Bayern“ mit dem Aktionsprogramm<br />
Heimische Eiweißfuttermittel ebenfalls auf diese Situation reagiert, und <strong>für</strong> die<br />
Jahre <strong>2011</strong> und 2012 zwei Millionen Fördermittel <strong>für</strong> insgesamt 10 Forschungsprojekte an<br />
der LfL bereitgestellt. Neben diesen konkreten Projekten soll generell eine Ausdehnung<br />
des Anbaus heimischer Eiweißpflanzen gefördert werden, und kurzfristig der Anbau von<br />
Sojabohnen auf 5.000 ha in Bayern verdoppelt werden. Im Vegetationsjahr 2010 wurden<br />
daher an drei Standorten in Bayern Sortenversuche mit Sojabohnen neu aufgenommen.<br />
Zum Frühjahrsanbau <strong>2011</strong> hat sich die Höhere Landbauschule in Rotthalmünster an dieser<br />
Sortenprüfung beteiligt, womit auch im niederbayerischen Anbaugebiet zukünftig eine<br />
Aussage zu besonders geeigneten Sorten möglich sein wird.<br />
Parallel zur Sortenfrage werden auch Fragen zur optimalen Produktionstechnik unter bayerischen<br />
Anbaubedingungen aktuell. Mit Auslaufen des arbeitsintensiven Versuchsvorhabens<br />
Biogasfruchtfolgen nach vier Jahren wurden die freiwerdenden Kapazitäten in IPZ 3c<br />
<strong>2011</strong> in vier produktionstechnische Versuche zu Sojabohnen „umgewidmet“.
63 Projekte und Daueraufgaben<br />
Am Standort Oberhummel bei Freising, an dem im Vorjahr der Sortenversuch wieder aufgenommen<br />
wurde, standen in acht der letzten zehn Jahre alle drei Leguminosenarten auf<br />
dem gleichen Schlag neben einander, womit ein direkter Leistungsvergleich möglich ist;<br />
siehe Tabelle 1. Mit einem Rohproteinertrag von 14,4 dt/ha lagen die Sojabohnen zwischen<br />
der führenden Ackerbohne mit 16,8 dt/ha und den Erbsen mit knapp 13,1 dt/ha.<br />
Auch wenn es sich hier um Parzellenerträge handelt, erzielten die Ackerbohnen und Erbsen<br />
im zehnjährigen Mittel mit 63 bzw. 65 dt/ha respektable Erträge, die den schwachen<br />
Praxiserträgen der amtlichen Erntestatistik von rund 35 dt/ha deutlich widersprechen. Neben<br />
den guten Standortbedingungen (Ackerzahl zwischen 70 und 80 Punkten) sind eine<br />
weite Fruchtfolge und das gesunde Versuchssaatgut verantwortlich <strong>für</strong> diese respektablen<br />
Erträge, die dem Leguminosenanbau eine höhere Wirtschaftlichkeit geben würden als die<br />
statistisch veröffentlichten Praxiserträge. Die große Spannweite der Erträge zeigt allerdings<br />
auch an diesem Standort die hohe Abhängigkeit der Leguminosenerträge von der<br />
Jahreswitterung auf.<br />
Tab. 1: Erträge der einzelnen Leguminosenarten am Standort Oberhummel<br />
Ackerbohnen Körnererbsen Sojabohnen<br />
Jahr Ertrag Roh- RP-Ertrag Ertrag Roh- RP-Ertrag Ertrag Roh-<br />
RP-<br />
Ertrag<br />
dt/ha protein % dt/ha dt/ha protein % dt/ha dt/ha protein % dt/ha<br />
2002 65,6 32,0 18,1 65,2 23,5 13,2 43,5 43,8 17,3<br />
2003 49,7 32,0 13,7 67,7 22,9 13,3 39,0 39,7 14,1<br />
2004 84,6 29,4 21,4 65,5 21,8 12,3 32,9 40,7 12,2<br />
2005 79,1 31,7 21,6 69,5 24,8 14,8 32,5 45,4 13,4<br />
2006 50,1 33,1 14,3 67,4 23,3 13,5 39,3 41,6 14,9<br />
2007 58,0 29,3 14,6 69,9 21,8 13,1 37,2 44,0 14,9<br />
2008 73,8 30,3 19,2 59,8 23,6 12,1<br />
2009 53,1 30,3 13,8 53,1 23,3 10,6<br />
2010 52,0 28,7 12,8 61,1 24,0 12,6 45,6 43,9 18,2<br />
<strong>2011</strong> 70,2 30,1 18,2 74,0 24,1 15,3 28,9 42,1 10,5<br />
10 Jahre 63,6 30,7 16,8 65,3 23,3 13,1 37,4 42,7 14,4<br />
Zusätzlich zum Sortenversuch wurden im Frühjahr <strong>2011</strong> am Standort Oberhummel auf einem<br />
gleichen Schlag ein Herbizidversuch <strong>für</strong> IPS, sowie als Vorversuche <strong>für</strong> eventuell<br />
Bayern weite Versuche ein Impfversuch, ein Saatzeiten sowie ein Saattechnik- und Saatstärkenversuch<br />
angelegt.
64 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 2: Einfluss der Saatgutimpfung bzw. N-Düngung auf den Ertrag am Standort Oberhummel<br />
<strong>2011</strong><br />
Impfung N-Düngung Kornertrag<br />
Roh- Pflanzen- Lager<br />
des dt/ha<br />
protein- länge bei Ernte<br />
Saatgutes kg/ha absolut relativ 1) gehalt % cm Bonitur<br />
ohne ohne 24,3 = 100 % B 43,2 86 3,8<br />
trotzdem<br />
Knöllchenansatz<br />
ohne 50 früh 23,2 95 BC 42,8 88 3,8<br />
ohne 50 spät 23,9 98 B 43,0 89 4,5<br />
ohne 80 früh 21,8 90 C 42,4 87 4,3<br />
ohne 80 spät 22,6 93 BC 42,9 84 4,8<br />
Hi Stick ohne 24,0 99 B 43,2 87 4,0<br />
Hi Stick 50 früh 23,0 95 BC 43,2 86 3,8<br />
fix und fertig ohne 26,7 110 A 43,4 91 3,5<br />
1) Mittelwertvergleich mittels SNK; P = 5%<br />
Letztmals standen vor sechs Jahren auf diesem Schlag die Leguminosen. Auf der Teilfläche<br />
des Impfversuches standen nach dem damaligen Plan keine Sojabohnen. Dennoch war<br />
zu Blühbeginn auch in den nicht geimpften Varianten des Versuches ein voller Knöllchenansatz<br />
sichtbar und eine Teilfrage des Versuches damit hinfällig. Anscheinend wurden<br />
über die mehrjährige Bodenbearbeitung die spezifischen „Sojabakterien“ in die Versuchsfläche<br />
„verschleppt“. Dennoch wurden die N-Düngungsvarianten weitergeführt, und<br />
erwartungsgemäß haben die N-Gaben dann keinerlei Wirkung gezeigt. Der signifikante<br />
Mehrertrag der fix und fertig geimpften Variante muss wohl damit erklärt werden, dass<br />
hier eine andere Saatgutcharge zum Anbau kam.<br />
Tab. 3: Erträge und agronomische Merkmale am Standort Oberhummel <strong>2011</strong><br />
Roh- Frost- B l ü h- Pflanzen- Lager<br />
Saat- Ertrag<br />
protein- schäden beginn ende länge bei<br />
termin dt/ha relativ 1) gehalt % Bonitur Juni Juli cm Ernte<br />
31.3. 37,7 = 100 % A 45,0 2,7 9. 15. 80 2,4<br />
11.4. 39,3 104 A 45,4 1,4 12. 18. 87 2,2<br />
26.4. 35,4 94 B 45,4 1,0 19. 23. 87 2,0<br />
6.5. 32,5 86 C 45,6 1,0 25. 27. 85 2,8<br />
Saatstärke abzügl.<br />
Kö/qm dt/ha relativ 1) Saatgut % cm Bonitur<br />
50 32,2 = 100 % A = 100 % 43,6 97 3,6<br />
70 32,1 100 A 95 43,9 98 4,5<br />
90 31,0 96 A 87 44,1 98 5,2<br />
1) Mittelwertvergleich mittels SNK; P = 5%
65 Projekte und Daueraufgaben<br />
Aus diesem ersten Versuchsjahr können vorerst folgende Feststellungen gezogen werden:<br />
• Im Jahr <strong>2011</strong> war eine frühzeitige Saat Mitte April angebracht, da zu diesem Termin<br />
optimale Aussaatbedingungen vorlagen. Je höher die Bodentemperaturen waren, desto<br />
zügiger liefen die Sojabohnen auf. Spätfröste Anfang Mai bis minus 4°C wurden ohne<br />
Schäden überstanden. Die Aussaat Ende April Anfang Mai hatte unter den günstigen<br />
Auflaufbedingungen dieses Jahres, statistisch abgesichert, geringere Erträge zur Folge.<br />
• Eine Bodenimpfung mit speziellen Rhizobien (Bradyrhizobium japonicum) bei erstmaligen<br />
Anbau ist unerlässlich, da sonst Ertragsausfälle von rund 25 Prozent drohen.<br />
• Bei ausreichender Rhizobienbildung an den Wurzeln hat eine zusätzliche N-Düngung<br />
keinerlei Effekt gezeigt. Im Gegenteil, bei günstigen Vegetationsbedingungen wird der<br />
Lagerdruck erhöht und die Erträge, sowie die Druschfähigkeit leiden darunter.<br />
• Obwohl nach Berücksichtigung der Saatgutkosten 50 Körner/qm Aussaatstärke wirtschaftlich<br />
optimal waren, sollte aus Sicherheitsgründen (schwierigere Auflaufbedingungen<br />
und mögliche Verluste durch Wildverbiss) vorerst an einer Saatstärke von 70<br />
Körnern festgehalten werden.<br />
Leitung: LD A. Aigner<br />
technische Leitung: LT G. Salzeder<br />
Projektdauer: <strong>2011</strong> - 2013<br />
3.3.4 Pflanzenbausysteme bei Heil- und Gewürzpflanzen (IPZ 3d)<br />
In Deutschland werden etwa 110 Arten der anspruchsvollen und empfindlichen Heil- und<br />
Gewürzpflanzen in sehr unterschiedlichen Betriebsstrukturen und Flächengrößen feldmäßig<br />
kultiviert. In einer Marktanalyse hat sich der Anbau von „Pflanzen mit besonderen Inhaltsstoffen“<br />
als bedeutender und zukunftsträchtiger Bereich der nachwachsenden Rohstoffe<br />
und damit als förderwürdig erwiesen. Zusätzliche öffentliche Mittel können aber<br />
nur dann effizient eingesetzt werden, wenn in entsprechenden Forschungsinstitutionen,<br />
z. B. <strong>Landesanstalt</strong>en, überhaupt zumindest kleine, kontinuierlich arbeitende Forschungskapazitäten<br />
als „Kristallisationskerne“ vorhanden sind. Dies ist bei der AG „Heil- und<br />
Gewürzpflanzen“ der LfL seit vielen Jahren mit immer wieder neuen Schwerpunkten der<br />
Fall. Derzeit konzentrieren sich die Aufgaben auf:<br />
• Züchtung einer Baldriansorte mit grober Wurzelstruktur und guten Inhaltsstoffgehalten<br />
<strong>für</strong> die einfachere und damit kostengünstigere Rodung und Reinigung der Wurzelballen.<br />
• Entwicklung von Anbauverfahren <strong>für</strong> Heilpflanzen, die in der Traditionellen Chinesischen<br />
Medizin (TCM) verwendet werden.<br />
• Züchterische Verbesserung ausgewählter Chinesischer Heilpflanzen <strong>für</strong> höhere Erträge<br />
und Produktqualität.<br />
• Transfer in die Praxis: Beratung der Landwirte, die Chinesische Heilpflanzen produzieren,<br />
und Aufklärung der Marktteilnehmer (Handel, Apotheken, Ärzte) über die<br />
Chancen der TCM-Kräuter aus heimischer Produktion.
66 Projekte und Daueraufgaben<br />
• Erhaltung von umfangreichen Kollektionen von Minze, Zitronenmelisse, Baldrian und<br />
Knoblauch.<br />
Abb. 1: Polycross von Leonurus japonicus (im Vordergrund) und Artemisia scoparia (im<br />
Hintergrund) am Isolationsstandort zur Erzeugung der ersten Generation der synthetischen<br />
Sorte (Syn1)<br />
Züchtung von grobwurzeligem Baldrian zur Erhöhung der Rentabilität und<br />
der Rohstoffqualität - Eigenschaften verfügbarer Baldriansorten und Potenzial<br />
<strong>für</strong> die Züchtung<br />
Zielsetzung<br />
Das Baldrian-Züchtungsprogramm ist Teil des Verbundvorhabens „Verbesserung der internationalen<br />
Wettbewerbsposition des deutschen Arzneipflanzenanbaus am Beispiel der<br />
züchterischen und anbautechnologischen Optimierung von Kamille, Baldrian und Zitronenmelisse“.<br />
Das Teilprojekt Züchtung von Baldrian, Valeriana officinalis L., hat das<br />
Ziel, durch Auslese und Kreuzungszüchtung eine Baldriansorte mit gröberen und weniger<br />
verzweigten Wurzelballen mit hohem Ertrag und gutem Inhaltsstoffgehalt zu entwickeln.<br />
Da <strong>für</strong> Baldrian nur selten Sortenversuche angelegt und publiziert werden, musste das verfügbare<br />
Ausgangsmaterial zunächst gesichtet und anschließend aus den besten Sorten/Herkünften<br />
die Elitepflanzen <strong>für</strong> die Zuchtlinienentwicklung selektiert werden. Diese<br />
Versuche entsprechen zwar nicht den üblichen Sortenversuchen, dennoch ergeben sich daraus<br />
<strong>für</strong> die Praxis Anhaltspunkte über die Leistung der derzeit verfügbaren Sorten. Diese<br />
sollen hier vorgestellt werden.
67 Projekte und Daueraufgaben<br />
Baldrian (Valeriana officinalis L.) gehört zu den wenigen Arzneipflanzen, von denen es<br />
eine größere Anzahl von Sorten gibt, wovon nur zwei einen Sortenschutz besitzen. Alle<br />
anderen Sorten sind keinem Sortenschutz unterworfen, so dass diese an verschiedenen<br />
Stellen vermehrt bzw. vertrieben werden und so nach mehreren Vermehrungsgenerationen<br />
die Eigenschaften der verschiedenen Herkunftspopulationen divergieren können.<br />
Methode<br />
Im Jahr 2009 wurden auf der Versuchsstation Baumannshof der LfL (Lkr. Pfaffenhofen)<br />
44 Herkünfte der verfügbaren Sorten (z. T. mehrere Herkünfte je Sorte) im Vergleich mit<br />
weiteren 47 Herkünften in einfacher Wiederholung gesichtet. Die auf Grund ihrer grober<br />
strukturierten Wurzeln (d. h. sehr dicke Adventivwurzeln, wenig feine und entfernt vom<br />
Rhizom ansetzende Seitenwurzeln, kleine Rhizome, u. a.) <strong>für</strong> das Züchtungsprogramm<br />
aussichtsreichsten 10 Herkünfte wurden 2010 und <strong>2011</strong> auf den Versuchsstationen Baumannshof<br />
und Groß-Gerau (Kooperation: Justus Liebig Universität Gießen, Prof.<br />
Honermeier) mit drei Wiederholungen einer Leistungsprüfung unterzogen. Alle Versuche<br />
wurden nach Jungpflanzenanzucht im Gewächshaus Anfang bis Mitte April gepflanzt<br />
(50 cm x 30 cm) und im Herbst desselben Jahres Mitte Oktober bis Anfang November geerntet.<br />
Der Gehalt der Valerensäuren und des Ätherischen Öls in der Droge wurden von<br />
Fa. Phytolab, Vestenbergsgreuth, nach den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs untersucht.<br />
Ergebnisse<br />
Der Wurzeldrogenertrag des Screenings 2009 lag bei 41,2 dt/ha, wobei einzelne Herkünfte<br />
von Polka, Marau und Erfurter Breitblättriger sowie die nur mit einer Herkunft geprüfte<br />
Lubelski über dem Durchschnitt lagen. Zwischen den Herkünften der Sorte Anthos und<br />
Polka wurden große Ertragsunterschiede sichtbar. In der Leistungsprüfung 2010 - <strong>2011</strong><br />
brachte Lubelski die dicksten Wurzeln und die höchsten Wurzeldrogenerträge hervor,<br />
Trazalyt und eine Herkunft von Polka lagen ebenfalls über dem Durchschnitt von<br />
49,3 dt/ha.<br />
Beim Gehalt an Valerensäuren und Ätherischem Öl in der Wurzeldroge waren 2009 ebenfalls<br />
große Unterschiede zwischen den einzelnen Herkünften einer Sorte zu verzeichnen.<br />
Das Versuchsmittel <strong>für</strong> den Gehalt an Valerensäuren lag bei 0,26 % und <strong>für</strong> den<br />
Ätherischölgehalt bei 0,65 %. Überragend waren bei beiden Inhaltsstoffen die als BLBP<br />
19 bekannte Herkunft von Polka und die von einem Wildstandort stammende BLBP 20.<br />
Diese bilden sehr feine Wurzeln aus. Überdurchschnittliche Valerensäuregehalte wiesen<br />
außerdem einzelne Herkünfte von Anthos, Anton, Polka und Trazalyt auf. Beim Ätherischen<br />
Öl tendierten Anthosherkünfte, Schipka, Stamm PHASA und eine Trazalytherkunft<br />
zu höheren Gehalten. In der Leistungsprüfung bestätigten sich die überdurchschnittlichen<br />
Inhaltsstoffgehalte der BLBP 19 (vgl. Abb. 2). Mit etwas Abstand wiesen außerdem Anton,<br />
Stamm PHASA und Ukraine hohe Valerensäuregehalte auf. Einzelne Chargen von<br />
Trazalyt und der Wildherkunft sowie des grobwurzeligen Lubelski lagen unter dem vom<br />
Europäischen Arzneibuch geforderten Mindestgehalt von 0,17 % Valerensäuren. Hohe<br />
Ölgehalte wiesen neben der BLBP 19 auch eine Anthosherkunft und Stamm PHASA auf.<br />
Unterdurchschnittlich blieben dagegen die Wildherkunft und je eine Herkunft von Polka,<br />
Anthos und Trazalyt.
68 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 2: Valerensäure- und Ätherischölgehalt (%) in der Wurzeldroge der<br />
Baldrianherkünfte im Mittel über zwei Standorte (Baumannshof, Groß-Gerau) und zwei<br />
Versuchsjahre (2010, <strong>2011</strong>); gestrichelte Linie: Mindestgehalt nach Europäischem Arzneibuch<br />
Die Variabilität des Ertrags und der Inhaltsstoffgehalte zwischen den verschiedenen Herkünften<br />
einer Sorte macht eine verlässliche Sortenwahl allein auf Grund des Sortennamens<br />
schwierig. Eine Herkunft oder Sorte, die sowohl eine zufriedenstellend grobe Wurzelstruktur<br />
als auch zuverlässig ausreichende Inhaltsstoffgehalte aufweist, konnte nicht gefunden<br />
werden. Dies rechtfertigt die Züchtung zur Realisierung der gewünschten Merkmalskombination.<br />
Im Zuge der Leistungsprüfung wurden über 20 Einzelpflanzen selektiert,<br />
die beide Merkmalkomplexe in sich vereinen. Daraus werden in den kommenden<br />
Jahren Inzuchtlinien und neue Populationen <strong>für</strong> eine leichter zu rodende und zu reinigende<br />
Sorte mit zuverlässigen Wirkstoffgehalten entwickelt.<br />
Projektleitung: Dr. H. Heuberger<br />
Projektbearbeitung: Dr. H. Heuberger, B. Steinhauer, L. Schmidmeier<br />
Laufzeit: 2008 - 2012<br />
Förderung: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR, Agrarprodukte Ludwigshof<br />
Ranis, agrimed Hessen Trebur, Bionorica Neumarkt, Erzeugerring<br />
Heil- und Gewürzpflanzen München, Kneipp-Werke Bad<br />
Wörishofen, Martin Bauer Vestenbergsgreuth, Pfizer Berlin, Salus<br />
Haus Bruckmühl, Walter Schoenenberger Magstadt, Dr. Willmar<br />
Schwabe Karlsruhe, Verein zur Förderung des Heil- und Gewürzpflanzenanbaus<br />
in Bayern München
69 Projekte und Daueraufgaben<br />
Züchtung von grobwurzeligem Baldrian – Verwandtschaftsverhältnisse und<br />
Cytotypen der Herkünfte<br />
Zielstellung<br />
Der Arznei-Baldrian Valeriana officinalis L. sensu lato (s.l.) tritt in di-, tetra- und<br />
oktoploiden Formen über weite Teile Europas verbreitet auf. Um geeignete, möglichst entfernt<br />
verwandte Herkünfte zur Entwicklung einer Sorte zu selektieren wurden die verwandtschaftlichen<br />
Beziehungen eines großen Sortiments von Baldrianherkünften mit Hilfe<br />
von DNA- und karyologischen Analysen untersucht.<br />
Methode<br />
Die Ploidiestufe von 122 Baldrianherkünften (BLBP-Nr.) wurde an angefärbten Quetschpräparaten<br />
von jungen Fiederblättchen von je fünf Einzelpflanzen mit einem Durchfluss-<br />
Cytometer bestimmt. Die Untersuchung der genetischen Diversität von 112 Herkünften erfolgte<br />
an je sechs Individuen je Herkunft über eine AFLP (amplified fragment length<br />
polymorphism)-Analyse mit dem Enzymsystem EcoRI/MseI. Aus acht<br />
Primerkombinationen resultierten zunächst 86 gut auswertbare polymorphe Fragmente, in<br />
einer späteren Untersuchung konnten weitere 13 polymorphe Fragmente ausgewertet werden.<br />
Die Identitätsüberprüfung wurde von Prof. G. Heubl, Ludwig-Maximilians-<br />
Universität München, Institut <strong>für</strong> Systematische Botanik vorgenommen. Dazu wurde von<br />
einzelnen Herkünften die DNA-Sequenz der nukleären ITS-Region analysiert und mit verfügbaren<br />
Sequenzen der NCBI-GenBank <strong>für</strong> V. officinalis verglichen.<br />
Ergebnisse<br />
Von den 122 Baldrianherkünften waren 13 diploid, 88 tetraploid, 2 gemischt di- und<br />
tetraploid, 1 gemischt tetra- und oktoploid, 1 hexaploid und 17 oktoploid. Alle als Sorten<br />
bezogenen Herkünfte erwiesen sich als tetraploid.<br />
Abb. 3: Gruppierung von di-, tetra- und oktoploiden Baldrian-Herkünften auf der Basis<br />
einer zweidimensionalen Hauptkomponentenanalyse von 99 AFLP-Markern (BLBP 108,<br />
112-115: nur 38 Marker). N=6 je Herkunft
70 Projekte und Daueraufgaben<br />
Basierend auf den AFLP-Markern ergaben sich drei Verwandtschaftsgruppen, die weitgehend<br />
den drei Cytotypen entsprechen (vgl. Abb. 3). Jeder Cytotyp wies dabei einzelne<br />
charakteristische Fragmente auf. Innerhalb eines Cytotyps waren sich die Herkünfte deutlich<br />
ähnlicher. Eine Differenzierung der Herkünfte war jedoch bei Betrachtung einzelner<br />
Herkünfte möglich, z.B. die 14 tetraploiden Herkünfte, die <strong>für</strong> das Zuchtprogramm in Frage<br />
kommen. Die ITS-Sequenz von Valeriana officinalis L. aus der NCBI-GenBank<br />
stimmte mit Sequenzen der drei untersuchten diploiden Herkünfte überein. Die Sequenzen<br />
der acht tetra- und neun oktoploiden Herkünfte bzw. Individuen wiesen mehrere Punktmutationen<br />
auf und wichen von der NCBI-Sequenz ab. Morphologisch sind die tetra- und<br />
oktoploiden Herkünfte aber ohne Zweifel V. officinalis L. s.l. zuzuordnen.<br />
Projektleitung: Dr. H. Heuberger<br />
Projektbearbeitung: Dr. H. Heuberger, Dr. M. Müller, C. Püschel, E. Schultheiß,<br />
Dr. St. Seefelder, B. Steinhauer<br />
Laufzeit: 2008 - 2012<br />
Förderung: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR, Agrarprodukte Ludwigshof<br />
Ranis, agrimed Hessen Trebur, Bionorica Neumarkt, Erzeugerring<br />
Heil- und Gewürzpflanzen München, Kneipp-Werke Bad<br />
Wörishofen, Martin Bauer Vestenbergsgreuth, Pfizer Berlin, Salus<br />
Haus Bruckmühl, Walter Schoenenberger Magstadt, Dr. Willmar<br />
Schwabe Karlsruhe, Verein zur Förderung des Heil- und Gewürzpflanzenanbaus<br />
in Bayern München<br />
3.4 Grünland, Futterpflanzen und Mais<br />
Der größte Teil des landwirtschaftlichen Einkommens wird in der Veredelung erwirtschaftet.<br />
Eine leistungsgerechte Fütterung setzt qualitativ hochwertiges Futter aus Grünland und<br />
Feldfutterbau voraus.<br />
Besondere Bedeutung hat die Ausdauer der wichtigsten Grassorten, diese bestimmt die regionale<br />
Leistungsfähigkeit von Grünlandflächen.<br />
In den Ackerbaulagen wird die größte energetische Flächenleistung mit dem Silomais erzielt,<br />
der sowohl in der Ertragsleistung als auch in der Restpflanzenverdaulichkeit und<br />
Stärkequalität laufend verbessert wird.<br />
Das Institut widmet sich deshalb vermehrt folgenden<br />
Fragestellungen:<br />
• Anbausysteme bei Mais <strong>für</strong> alle Nutzungsarten<br />
• Integrierter Pflanzenbau, Produktionstechnik und Sortenfragen<br />
bei Feldfutterbau und Nachsaaten auf Dauergrünland<br />
(Artenzusammensetzung, Ausdauer, Qualität,<br />
Inhaltsstoffe)<br />
• Anbausysteme <strong>für</strong> Futterpflanzen<br />
• Entwicklung adaptierter Sorten- und Artenmischungen<br />
<strong>für</strong> Feldfutterbau und Grünland<br />
• Forschung zur Förderung des Grassamenanbaues
71 Projekte und Daueraufgaben<br />
• Züchtungsforschung und Biotechnologie bei Mais<br />
• Züchtungsforschung und Biotechnologie bei Gräser- und Kleearten.<br />
3.4.1 Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung bei Silo- und Körnermais (IPZ 4a)<br />
Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsgruppe IPZ 4a ist die angewandte Forschung zum Pflanzenbau<br />
und zur Pflanzenzüchtung bei Silo- und Körnermais, vor allem im Hinblick auf die<br />
Erarbeitung von Beratungsempfehlungen zur umweltgerechten Produktion und der Weiterentwicklung<br />
des bayerischen Genpools bei Mais. Entscheidendes Fundament hier<strong>für</strong><br />
sind die Exaktversuche des staatlichen Versuchswesens in Bayern in Zusammenarbeit mit<br />
den AELF und der Abteilung Versuchsbetriebe der LfL sowie mit Züchtungsunternehmen<br />
innerhalb und außerhalb Bayerns. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Evalierung von<br />
Alternativen zum Mais <strong>für</strong> die Biogasproduktion.<br />
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit von IPZ 4a war in <strong>2011</strong> wiederum die Entwicklung<br />
des umfangreichen Sortenprüfwesens <strong>für</strong> Mais in Bayern. In Anbetracht der Sortenvielfalt<br />
und der umfangreichen Werbemaßnahmen der Saatgutwirtschaft wird eine neutrale<br />
Empfehlung von Seiten der LfL und der AELF von der landwirtschaftlichen Praxis sehr<br />
geschätzt und die Ergebnisse der Sortenversuche in Verantwortung von IPZ 4a wurden in<br />
ganz Bayern mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und <strong>für</strong> die Anbauplanung in<br />
den Betrieben genutzt. Insgesamt wurden in Bayern 28 Landessortenversuche mit<br />
Silomais, elf mit Energiemais und 23 mit Körnermais angelegt und zusammen mit den<br />
AELF betreut, ausgewertet und die Ergebnisse in Fachzeitschriften und über das Internet<br />
publiziert. Die Prüfung von Maissorten zur Biogasproduktion nimmt ebenfalls einen großen<br />
Raum ein. Neu aufgenommen wurden Versuche zur Spätsaateignung von Sorten in<br />
Biogasfruchtfolgen und Sortenprüfungen <strong>für</strong> Grenzlagen des Maisanbaus in Nordostbayern<br />
(Oberfranken, Oberpfalz, <strong>Bayerische</strong>r Wald).<br />
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Untersuchungen zur Produktionstechnik <strong>für</strong> die Biogas-Substratproduktion,<br />
wobei derzeit Sortenversuche und die Fruchtfolgegestaltung unter<br />
Einsatz von Getreideganzpflanzensilage und Zweikulturnutzungssystemen im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Im Bereich Pflanzenzüchtung wurde ein 2008 begonnenes Projekt zur Evaluierung von<br />
Genbankmaterial historischer Maissorten aus Bayern weitergeführt und aktuelles Material<br />
in Zusammenarbeit mit Züchtungsunternehmen aus Bayern, Österreich und der Schweiz<br />
geprüft.
72 Projekte und Daueraufgaben<br />
Projekt: Bewertung von Körnermaissorten auf Resistenz gegenüber<br />
Kolbenfusarium - Mykotoxingehalte (DON) von Maissorten<br />
Abb. 1: Befall mit Fusarium graminearum kann bei anfälligen Körnermaissorten<br />
zu einer erheblichen Mykotoxinbelasung führen<br />
Der Befall mit Mykotoxin bildenden phytophathogenen Pilzen spielt - ähnlich wie bei anderen<br />
Getreidearten - auch bei Körnermais eine große Rolle. Auf den Kolben und Körnern<br />
können unter ungünstigen Bedingungen eine ganze Reihe von Erregern meist aus der Gattung<br />
Fusarium identifiziert werden. Viele dieser Pilze bilden Mykotoxine als toxische<br />
Stoffwechselprodukte.<br />
Für die Sortenberatung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> und der Ämter<br />
<strong>für</strong> Ernährung <strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten soll zukünftig der Belastung an Mykotoxinen<br />
auch bei Körnermais ein wichtiges Entscheidungskriterium sein. Seit mehreren Jahren<br />
wird das Druschgut von neuen Körnermaissorten in den Landessortenversuchen deshalb<br />
auf Mykotoxine untersucht. Als „Leitmykotoxin“ wurde wegen seines häufigen Vorkommens<br />
DON (Deoxynivalenol), welches vor allem bei Befall mit Fusarium graminearum<br />
gebildet wird. Dieser Erreger wird auch oft auf anderen Getreidearten gefunden und das<br />
Toxin vor allem bei Weizen oftmals in hohen Konzentrationen festgestellt. In dem Projekt<br />
ist vorgesehen, von allen in den Versuchen geprüften Körnermaissorten die Gehalte an<br />
DON im Erntegut zu bestimmen. Die Ergebnisse sollen statistisch verrechnet auch <strong>für</strong> die<br />
Sortenempfehlung der Ämter <strong>für</strong> Ernährung <strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten zur Verfügung<br />
stehen. Sorten, die zu hohen Toxingehalten neigen, sind als <strong>für</strong> den Körnermaisanbau ungeeignet<br />
einzustufen.<br />
Die EU hat <strong>für</strong> Mykotoxine in Getreide Höchstwerte festgesetzt, die nicht überschritten<br />
werden dürfen. Der EU-Grenzwert <strong>für</strong> DON bei Handelsware von Körnermais liegt bei<br />
1,75 mg/kg. Für die Fütterung gibt es Empfehlungen und Richtwerte, die je nach Tierart<br />
unterschiedlich sind. Der Richtwert, der in Schweinemastrationen nicht überschritten werden<br />
sollte ist 1,0 mg/kg.
73 Projekte und Daueraufgaben<br />
Die Grafik zeigt als Beispiel die DON-Gehalte in den Landessortenversuchen mittelfrühes<br />
Sortiment <strong>2011</strong>. Sie werden jedes Jahr an jeweils drei der Körnermais-Versuchsorte in<br />
Bayern in dreifacher Wiederholung mittels ELISA-Test bestimmt. Die Ergebnisse werden<br />
auch über mehrere Jahre ausgewertet und fließen zudem in eine deutschlandweite Zusammenstellung<br />
ein. Die mehrjährigen Mittelwerte der Sorten sind in den grafischen Darstellungen<br />
über die drei Standorte/Jahr mit 90 % Konfidenzintervallen dargestellt. In die<br />
Auswertung fließen sämtliche <strong>für</strong> eine Sorte vorhandenen Ergebnisse der vergangenen<br />
Jahre ein.<br />
Abb. 2: Mehrjährige Mittelwerte der DON-Gehalte von Körnermaissorten (frühes Sortiment)<br />
in Bezug zur gesetzlich festgelegten Höchstgrenze (Auswertung mit 90 %<br />
Konfidenzintervall)<br />
Weitere Untersuchungen zur Analyse und überregionalen Erfassung geoepidmiologischer<br />
Ausbreitungsmuster von Fusarium-Pilzen und zur Entwicklung von Strategien zur Reduktion<br />
der Mykotoxinbelastung bei Körnermais in Bayern werden in den kommenden Jahren<br />
zusammen mit dem Institut <strong>für</strong> Pflanzenschutz der LfL und dem Institut <strong>für</strong> Phytopathologie<br />
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt.<br />
Projektleitung: Dr. J. Eder<br />
Projektbearbeitung: W. Widenbauer<br />
Laufzeit: unbefristet
74 Projekte und Daueraufgaben<br />
Projekt: Arten- und Sortenversuch mit Wintergetreide zur GPS-Nutzung <strong>für</strong><br />
die Biogasproduktion<br />
In einem Arten- und Sortenversuch mit den Wintergetreidearten Grünroggen, Gerste,<br />
Roggen, Triticale und Weizen wurde dreijährig (2009 - <strong>2011</strong>) die Trockenmasseleistung<br />
und Trockensubstanzgehalte zur praxisüblichen GPS-Reife (BBCH 75) an zwei Standorten<br />
in Oberbayern untersucht.<br />
Ziel war das Ertragspotential der verschiedenen Getreidearten und -sorten bei GPS-<br />
Nutzung genauer zu bestimmen sowie eine agronomische Kenngröße zu identifizieren, die<br />
eine Schlussfolgerung auf die Eignung als Biomasselieferant zulässt (z. B. Kornertrag,<br />
Pflanzenlänge). Hier<strong>für</strong> wurden alle Sorten zur Kornreife gedroschen und weitere Ertragsparameter<br />
ermittelt.<br />
Ergebnisse<br />
Aus den dreijährigen Ergebnissen ist abzuleiten, dass langstrohige Triticale-Sorten das<br />
höchste Ertragspotential bei GPS-Nutzung haben. Ausgenommen sind Standorte mit hohem<br />
Trockenheitsrisiko, hier schneiden Hybridroggen-Sorten besser ab. Triticale hat einen<br />
späten Erntezeitpunkt, so dass der Nachbau einer Zweitfrucht nicht mehr sinnvoll scheint.<br />
Die Gerste hat das niedrigste Ertragspotential, bietet sich aber aufgrund des frühen Erntezeitpunktes<br />
dort an wo nachfolgend eine Zweitfurcht angebaut werden soll. Der Anbau<br />
von Grünschnittroggen ist als Winterzwischenfrucht zu sehen und ermöglicht einen anschließenden<br />
ertragreichen Hauptfruchtanbau. Die Mindererträge im Vergleich zu den Getreidearten<br />
mit längeren Standzeiten werden ausgeglichen und der Flächenertrag kann dadurch<br />
erhöht werden. Weizen hingegen scheint durch die lange Standzeit und geringen Erträge<br />
wenig geeignet <strong>für</strong> die Verwertung als GPS.<br />
Bei allen Arten kommt es zu Sortenunterschieden. Eine Optimierung des Trockenmasseertrages<br />
ist somit über die Sortenwahl möglich.<br />
Positive lineare Zusammenhänge zwischen Pflanzenlänge und Trockenmasseertrag wurden<br />
mit einem hohen Bestimmtheitsmaß insbesondere bei Triticale und Grünroggen beobachtet.<br />
Bei der Sortenwahl von Triticale und Grünroggen ist somit auf langstrohige Sorten<br />
zu achten. Für Weizen und mehrzeilige Gerste ist das Bestimmtheitsmaß <strong>für</strong> die positive<br />
lineare Korrelation zwischen Kornertrag und Trockenmasseertrag am größten. Für einen<br />
hohen GPS-Ertrag sollten beim Anbau von Weizen und mehrzeiliger Gerste daher<br />
Sorten mit hohem Kornertrag gewählt werden. Auch bei Roggen sollten aus diesem Grund<br />
kornbetonte Sorten bevorzugt werden.
75 Projekte und Daueraufgaben<br />
TM-Ertrag dt/ha<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
Triticale<br />
R² = 0,91<br />
60<br />
40<br />
Winterweizen<br />
Winterroggen<br />
Wintergerste_mehrzeilig<br />
R² = 0,47<br />
R² = 0,22<br />
R² = 0,01<br />
20 Wintergerste_zweizeilig R² = 0,33<br />
0<br />
Grünroggen<br />
R² = 0,96<br />
0 50 100<br />
Pflanzenlänge cm<br />
150 200<br />
Abb. 1: Zusammenhang zwischen Trockenmasseertrag (TM) und Pflanzenlänge bzw.<br />
Kornertrag <strong>für</strong> die Getreidearten (Sortenmittelwerte aus drei Jahren, zwei Standorten)<br />
Projektleitung: Dr. J. Eder<br />
Projektbearbeitung: C. Riedel, D. Hofmann, M. Landsmann, Dr. E. Sticksel<br />
Laufzeit: 2008 - 2012<br />
Projekt: Energie aus Wildpflanzen - Ringversuch in Bayern<br />
Das IPZ und sieben LfL-Versuchsbetriebe beteiligen sich ab Frühjahr <strong>2011</strong> mit Feldversuchen<br />
am bayernweiten Praxistest der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> Weinbau und Gartenbau<br />
(LWG), in dem eine mehrjährige auf die Biogasproduktion ausgerichtete Wildpflanzenmischung<br />
im Vergleich zu Biogasmais untersucht wird. Weiterer Standort ist das<br />
Technologie- und Förderzentrum (TFZ) in Straubing.<br />
Hier<strong>für</strong> wird eine speziell <strong>für</strong> Biogas<br />
entwickelte Wildpflanzenmischung<br />
aus 24 einjährigen, zweijährigen<br />
und ausdauernden Arten<br />
in Parzellenversuchen angebaut.<br />
Durch die einjährigen Arten wie<br />
Sonnenblumen und Malven kann<br />
bereits im 1. Jahr ein erntewürdiger<br />
Biomasseaufwuchs erreicht<br />
werden (Abb.). Die zwei- und<br />
mehrjährigen Arten etablieren sich<br />
zunächst im Unterwuchs und sind<br />
ab dem zweiten Standjahr ertragsbildend.<br />
Die Wildpflanzenansaat wird in<br />
drei aufeinanderfolgenden Jahren<br />
wiederholt und über eine Standzeit<br />
von fünf Jahren untersucht. Die<br />
parallele Anlage von Maisparzellen<br />
ermöglicht den direkten Vergleich<br />
zu Biogasmais. Der<br />
Schwerpunkt der Untersuchungen<br />
TM-Ertrag dt/ha<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Triticale<br />
Winterweizen<br />
Winterroggen<br />
R² = 0,57<br />
R² = 0,95<br />
R² = 0,66<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Wintergerste_mehrzeilig<br />
Wintergerste_zweizeilig<br />
R² = 0,82<br />
R² = 0,68<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Kornertrag dt/ha (TS86%)<br />
Abb.2: Wildpflanzen (1. Standjahr) neben Mais Ende<br />
Juli (2 Wochen vor der Ernte)
76 Projekte und Daueraufgaben<br />
liegt in der Ertragsermittlung im Verlauf mehrerer Standjahre um abschließend eine Aussage<br />
über die Wirtschaftlichkeit von Wildpflanzenmischungen als Biogassubstrat treffen<br />
zu können.<br />
Zur Optimierung der Produktionstechnik sind weitere Versuche in Zusammenarbeit mit<br />
der LWG <strong>für</strong> 2012 geplant.<br />
Projektleitung: Dr. J. Eder<br />
Projektbearbeitung: C. Riedel<br />
Laufzeit: <strong>2011</strong> - 2013<br />
3.4.2 Züchtungsforschung bei Futterpflanzen, Pflanzenbausystemen bei<br />
Grünland und Feldfutterbau (IPZ 4b)<br />
Arbeitsschwerpunkt ist die angewandte Züchtungsforschung bei Futterpflanzen (Gräser,<br />
Klee und Luzerne). Es werden ausgewählte, <strong>für</strong> Bayern wichtige Arten bearbeitet. Die<br />
Weiterentwicklung des bayerischen Genpools und des hiervon abgeleiteten besonders angepassten<br />
Genmaterials stellt bei den Einzelarten eine Querschnittsaufgabe dar. Ziel ist es,<br />
<strong>für</strong> die speziellen regionalen Bedürfnisse der bayerischen <strong>Landwirtschaft</strong> besonders angepasstes<br />
Material zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit den bayerischen<br />
Pflanzenzüchtern. Herausragende Merkmale sind hierbei „Ausdauer“ und Resistenz<br />
gegen Krankheitserreger und Klimastress. Daneben wird in der Arbeitsgruppe ständig an<br />
der Entwicklung und Anpassung von Resistenz- und Qualitätsprüfungsmethoden gearbeitet,<br />
um die Selektionssicherheit zu erhöhen (Infektionen im Gewächshaus und in vitro,<br />
Kältetests) sowie an Zuchttechniken, Zuchtgangdesign und -methodik <strong>für</strong> die Futterpflanzenzüchtung.<br />
Im Bereich des Pflanzenbaues liegen die Kernaufgaben der Arbeitsgruppe zum einen bei<br />
der Optimierung der Pflanzenbausysteme und der Produktionstechnik bei Futterpflanzen<br />
und Grünland sowie Zwischenfrüchten zur Futternutzung. Arbeitsschwerpunkte sind hier<br />
die Neuansaat und Nachsaat auf Grünland und integrierte Ansätze zur Bekämpfung und<br />
Eindämmung von minderwertigen Arten in Grünland und Feldfutterbau. Zum anderen<br />
leistet sie einen Beitrag zur Bereitstellung von besonders geeignetem Saatgut <strong>für</strong> die bayerische<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> durch Prüfung von Sorten und Mischungen <strong>für</strong> Grünland, Feldfutterbau<br />
und Zwischenfrucht und der darauf aufbauenden, stetigen Aktualisierung und Optimierung<br />
der offiziellen Sorten- und Mischungsempfehlungen. Vor dem Hintergrund der<br />
Energiewende und der Eiweißinitiative in Bayern gewinnen diese Aufgaben besondere<br />
Bedeutung.<br />
Die gewonnenen Ergebnisse dienen der Erstellung von Beratungsunterlagen, der Entwicklung<br />
von Qualitätsstandards in Absprache mit der Saatgutwirtschaft, deren Einführung und<br />
kontrollierende Begleitung in Form der staatliche empfohlenen Mischungen.
77 Projekte und Daueraufgaben<br />
Ermittlung regionalspezifischer Ertrags- und Qualitätsdaten von Alternativen<br />
zu Mais im Futterbau - Feldversuche zu Futtergräsern und deren Gemengen,<br />
Hirsen sowie Getreide-Ganzpflanzensilage<br />
Zielsetzung<br />
Der Landkreis Passau befindet sich im Einwanderungsgebiet des Westlichen Maiswurzelbohrers<br />
(Diabrotica virgifera virgifera), einem Quarantäneschädling, der bislang neben<br />
ertraglichen Schäden an Mais besonders ökonomische Schäden und Eingrenzungsmaßnahmen<br />
der betroffenen Betriebe nach sich zieht. Daher sind mögliche ertragreiche Alternativen<br />
zu Mais in dieser Region besonders von Interesse, da Mais, der seinen Einsatz in<br />
der Tierfütterung und mit zunehmender Tendenz als Energiepflanze <strong>für</strong> Biogasanlagen<br />
findet, dort sehr oft in engen Fruchtfolgen angebaut wird.<br />
Da aus dieser Region nicht genügend Daten zur Ertragsleistung und den Qualitätsparametern<br />
von alternativen Futterpflanzen zu Mais vorliegen, wurden in diesem Projekt Kulturen<br />
wie Futtergräser im Rein- und Gemengeanbau, Kleegrasmischungen, Sudangräser/Hirsen<br />
und Getreide-Ganzpflanzensilage (GPS) getestet. Es lagen vor allem <strong>für</strong> die<br />
Sudangräser und Hirsen aus dieser Region weder genügend Daten vor noch konnten bislang<br />
exakte Anbauempfehlungen abgeleitet und regionalspezifische Berechnungen zur<br />
Wirtschaftlichkeit dazu durchgeführt werden.<br />
In dreijährigen Feldversuchen wurden die möglichen Alternativen zu Mais in direktem<br />
Vergleichsanbau an drei Standorten geprüft. Für den Getreide-GPS-Versuch sind zwei<br />
Versuchsjahre ausreichend, da hier bereits aus laufenden Versuchen auf Datenmaterial zurückgegriffen<br />
werden kann.<br />
Methode<br />
Der Versuch wurde 2009 im Befallsgebiet des Westlichen Maiswurzelbohrers an den drei<br />
Standorten Rotthalmünster, Kirchham und Egglfing in Niederbayern angelegt. Diese liegen<br />
im Landkreis Passau im Bodenklimaraum (116 „Gäu, Donau- und Inntal“). Sie wurden<br />
so ausgewählt, dass sich ihre Böden geologisch unterscheiden und damit die Variation<br />
im Befallsgebiet hinreichend abdecken.<br />
Im Versuch wurden folgende Kulturen verglichen:<br />
• 15 Kleegrasmischungen, die z. T. in zwei Schnitt-Intensitäten geprüft werden: Intensität<br />
„intensiv“ (bis 5 Schnitte/a) und „extensiv“ (bis 4 Schnitte/a)<br />
• 3 Silomaissorten mit unterschiedlichen Reifegruppen (ES Bombastic, S 240; Torres,<br />
S 25; PR 39 F 58, S 260)
78 Projekte und Daueraufgaben<br />
• 6 Sudangräser- und Hirsesorten (Mithril, Sucrosorghum 506, Energiemischung 2,<br />
Sorghum spezial, Branco, Inka)<br />
• 3 Getreidearten mit je zwei Sorten (Winterroggen Balistic und Visello, Winterweizen<br />
Akratos und Inspiration, Wintertriticale Benetto und Trisol)<br />
Ergebnisse<br />
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Aufgang der Leguminosen entwickelten sich<br />
die Kleegräser im Anlagejahr 2009 an allen Standorten sehr gut. Der Ertrag der Neuansaat<br />
unter die Deckfrucht Hafer erreichte bis zum Jahresende die angestrebten 70 % vom Vollertrag<br />
(Abbildung 1). Im ersten Hauptnutzungsjahr 2010 konnte ein erwartet hoher Trockenmasseertrag<br />
(TM) erreicht werden. Im zweiten und letzten Hauptnutzungsjahr war<br />
das Wasserhaltevermögen der Böden der ausschlaggebende Faktor <strong>für</strong> guten Ertrag. Die<br />
ausgeprägte Frühjahrstrockenheit <strong>2011</strong> wirkte sich daher besonders in Kirchham negativ<br />
auf den Ertrag aus. Die überjährigen Mischungen wurden im Frühjahr <strong>2011</strong> neu angesät<br />
und gerieten während des Auflaufens in die trockene Phase. Daraus resultierte bis Jahresende<br />
ein Schnitt weniger als bei den etablierten mehrjährigen Mischungen, was sich<br />
ertraglich negativ auswirkte. Auffallend war die starke Differenzierung des<br />
Leguminosenanteils an den drei Standorten: Die Spanne reichte von dreijährig gleichbleibenden<br />
Mischungen in Rotthalmünster, über einen sinkenden Anteil auf den mineralischen<br />
Böden von Kirchham bis hin zum völligen Verschwinden der Leguminosen aus den Mischungen<br />
in Egglfing schon zum Ende des ersten Jahres.<br />
Die geprüften Silomaissorten erzielten über die drei Versuchsjahre die höchsten Erträge.<br />
Diese reichten von 212 TM dt/ha bis 244 TM dt/ha. Auch 2010 und <strong>2011</strong> konnten, trotz<br />
sehr ungünstiger Witterung, überdurchschnittliche Erträge geerntet werden. Es zeigte sich<br />
zudem eine geringe Varianz in den Silomais-Erträgen über die einzelnen Sorten und Standorte.<br />
Im Mittel waren die Trockenmasseerträge der geprüften Sudangräser und Hirsen 2009 bis<br />
<strong>2011</strong> um 25 % - 50 % niedriger als die von Silomais. Die Erträge zeigten eine starke<br />
Streuung sowohl innerhalb der Sorten als auch an den einzelnen Standorten. Im Schnitt erreichten<br />
die Sudangräser Trockensubstanzgehalte (TS-Gehalt) von unter 25 %, zu niedrige<br />
TS-Gehalte, um silierfähig zu sein. Eine einzige Sortenmischung erzielte einen TS-Gehalt<br />
von 29 % in 2010 an zwei Standorten.<br />
Bedingt durch die kalte Witterung im Winter und Frühjahr 2010 entwickelten sich die Getreidearten<br />
der GPS sehr unterschiedlich. Der Winterroggen reagierte mit verzögertem<br />
Wachstum auf die Kälte, ging 2010 sehr frühzeitig ins Lager und musste einen Monat vor<br />
den anderen Getreidearten geerntet werden und erreichte nur einen TM-Ertrag von ca. einem<br />
Drittel der anderen Arten. Winterweizen und -triticale entwickelten sich sehr zufriedenstellend<br />
und erbrachten durchschnittliche TM-Erträge. <strong>2011</strong> gab es <strong>für</strong> die GPS-Kultur<br />
trotz des kalten und langen Winters 2010/<strong>2011</strong> und der enormen Frühjahrstrockenheit keine<br />
Ausfälle, die Erträge von allen drei Arten waren erfreulich hoch.<br />
Die Daten zur Futterqualität lagen bis zum Erscheinen des Berichtes noch nicht vollständig<br />
vor.<br />
Zusammenfassung<br />
Die mehrjährigen Kleegräser erreichten über den geprüften Zeitraum einen hohen TM-<br />
Ertrag, wobei der Kleeanteil standortbedingt über die Jahre sank bzw. gänzlich ver-
79 Projekte und Daueraufgaben<br />
schwand. Der Ertrag der überjährigen Mischungen konnte im dritten Jahr nicht überzeugen,<br />
da die Ansaat genau in die Frühjahrstrockenheit <strong>2011</strong> fiel. Die GPS-Varianten Winterweizen<br />
und -triticale zeigten besonders <strong>2011</strong> hohe Erträge. Nur der Winterroggen hatte<br />
witterungsbedingte Wachstumsdefizite und Lager im Versuchsjahr 2010 und lag ertragsmäßig<br />
um zwei Drittel niedriger als die anderen Getreidearten. Die Sudangräser und Hirsen<br />
wiesen 25 % - 50 % weniger TM-Ertrag auf als die Silomaissorten, schwankten sehr<br />
stark von ihren Einzelerträgen und erreichten keine silierfähigen Trockensubstanzgehalte.<br />
Mit Abstand am ertragsstärksten waren die Silomaisvarianten, die auch relativ konstante<br />
Erträge über die drei Versuchsjahre lieferten.<br />
RotthalmünsterParabraunerde,<br />
Ackerzahl 68<br />
Kirchham<br />
Braunerde,<br />
Ackerzahl 36<br />
Egglfing<br />
Aueboden,<br />
Ackerzahl 59<br />
TM dt/ha<br />
TM dt/ha<br />
TM dt/ha<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Silomais Sudangr. Kleegras<br />
5 S<br />
Abb. 1: Darstellung der Trockenmasseerträge (TM-Erträge) aller geprüften Kulturen über<br />
die drei Versuchsstandorte und -jahre<br />
Projektleiter: Dr. St. Hartmann<br />
Projektbearbeiter: A. Wosnitza<br />
Laufzeit: Januar 2009 - Mai 2012<br />
2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Kleegras<br />
4 S<br />
Silomais<br />
Sudangräser/Hirsen<br />
3.5 Hopfen<br />
Die Hallertau ist das größte geschlossene Hopfenanbaugebiet der Welt. Die Hopfenpflanzer<br />
sind auf Dauer international nur konkurrenzfähig, wenn sie stets über die neuesten<br />
pflanzenbaulichen Erkenntnisse und über gesunde, aromareiche bzw. α-säurenreiche<br />
Sorten verfügen.<br />
Auf dem Hopfensektor werden daher vordringlich folgende Fragestellungen verfolgt:<br />
• Integrierter Pflanzenbau, Produktionstechnik und Sortenfragen<br />
2009 kein Anbau von Getreide - GPS<br />
Kleegras GPS-WR GPS-TRI GPS-WW<br />
überj<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Silomais Sudangr. Kleegras<br />
5 S<br />
Kleegras<br />
4 S<br />
Kleegras GPS-WR GPS-TRI GPS-WW<br />
überj<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Kleegras („intensiv“ = 5 Schnitte)<br />
Kleegras („extensiv“ = 4 Schnitte)<br />
überjähriges Kleegras, „intensiv „<br />
50<br />
0<br />
Silomais Sudangr. Kleegras<br />
5 S<br />
Kleegras<br />
4 S<br />
GPS, WR<br />
GPS, WTRI<br />
GPS, WW<br />
Kleegras GPS-WR GPS-TRI GPS-WW<br />
überj
80 Projekte und Daueraufgaben<br />
• Züchtungsforschung einschließlich biotechnologischer<br />
und gentechnischer Methoden zur<br />
Verbesserung der Resistenz- und Qualitätseigenschaften<br />
• Erhaltung und Erweiterung der genetischen<br />
Ressourcen<br />
• Herkunfts- und sortenspezifische Analyse der<br />
brauqualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe<br />
• Pflanzenschutz im Hopfen, auch im Ökohopfenbau<br />
• Entwicklung neuer Produktionssysteme wie beispielsweise die Niedriggerüstanlage<br />
• produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung.<br />
3.5.1 Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik (IPZ 5a)<br />
Aufgaben der Arbeitsgruppe sind die angewandte praxisorientierte Forschung auf dem<br />
Gebiet der Produktionstechnik des Hopfenanbaus, die Erarbeitung von Beratungsunterlagen<br />
und Warndiensthinweisen, die Beratung und Fortbildung von Hopfenpflanzern in<br />
Spezialfragen, die Zusammenarbeit mit Hopfenorganisationen und im Rahmen der Verbundberatung<br />
die Schulung und fachliche Betreuung des Verbundpartners Hopfenring.<br />
Arbeitsschwerpunkte sind:<br />
• Neue Anbauverfahren und -techniken im Hopfenbau<br />
• Bewässerung von Hopfen<br />
• Optimierte Düngung und Spurenelementversorgung<br />
• Verbesserung integrierter Pflanzenschutzsysteme<br />
• Pflanzenschutz-Applikationstechnik<br />
• Optimierung der Trocknung und Konditionierung zur Qualitätserhaltung<br />
• Leistungssteigerung und Energieeinsparung bei der Hopfentrocknung<br />
• Dokumentationssysteme und betriebswirtschaftliche Auswertungen<br />
• Produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung in Spezialfragen<br />
Sortenreaktion auf Reduzierung der Gerüsthöhe (6 m)<br />
Ziel:<br />
Aufgrund verheerender Sturmereignisse in den letzten Jahren, die in der Hallertau zum<br />
Einsturz von Hopfengerüstanlagen vor der Ernte geführt haben, soll untersucht werden, ob<br />
die Höhe der Gerüstanlagen bei gleichbleibenden Erträgen auf 6 m reduziert werden kann.
81 Projekte und Daueraufgaben<br />
Nach ersten Berechnungen würden sich dadurch die statischen Belastungen der<br />
Hallertauer Gerüstanlage um ca. 15 - 20 % verringern und sich die Standfestigkeit bei extremen<br />
Windgeschwindigkeiten stark verbessern.<br />
Zudem könnten die Gerüstkosten durch die Verwendung von kürzeren und schwächeren<br />
Mittelmasten verringert werden, ohne dabei die Statik negativ zu beeinflussen. Desweiteren<br />
ergäben sich Vorteile beim Pflanzenschutz, da durch die Nähe zur Zielfläche der Gipfelbereich<br />
besser mit Pflanzenschutzmitteln benetzt und Abdrift werden könnte.<br />
In dem Projekt wurde in mehreren Praxisgärten (Ertragsanlagen verschiedener Hopfensorten)<br />
das 7 m hohe Hopfengerüst im Bereich der Versuchsparzellen auf 6 m reduziert. Ziel<br />
war es, die Reaktion verschiedener Sorten hinsichtlich Pflanzenentwicklung, Krankheits-<br />
und Schädlingsbefall, Ertrag und Qualität bei niedrigerer Gerüsthöhe zu untersuchen. Bei<br />
den Aromasorten wurden die Versuche mit den Sorten Perle und Hallertauer Tradition, bei<br />
den Bittersorten mit Hallertauer Magnum, Hallertauer Taurus und Herkules durchgeführt.<br />
Methode:<br />
Geeignete Praxisgärten verschiedener Sorten wurden in vier gleich große Parzellen eingeteilt,<br />
wobei eine Parzelle zehn Säulenabstände lang und einen Säulenabstand breit war. In<br />
zwei Parzellen wurde die Gerüsthöhe durch ein zusätzlich eingezogenes Drahtnetz von 7<br />
auf 6 m reduziert. Die zwei Säulen breite „6 m Anlage“ befand sich somit direkt neben der<br />
„7 m Anlage“.<br />
Je Parzelle wurden je zwei Wiederholungen als zu beerntende Versuchsglieder zufällig<br />
angeordnet. Ein Versuchsglied bestand aus 20 aufeinanderfolgenden Reben. In Absprache<br />
mit den Landwirten wurden die Versuchsflächen betriebsüblich bewirtschaftet.<br />
7 m<br />
6 m<br />
Abb. 1 + 2: 7 m Gerüstanlage durch zusätzliches Drahtnetz auf 6 m reduziert
82 Projekte und Daueraufgaben<br />
Von den beernteten Versuchsgliedern wurde der Ertrag, der Alphasäurengehalt und der<br />
Wassergehalt der grünen Dolden gemessen. Zusätzlich wurde bei den Bittersorten der Alphaertrag<br />
in kg je ha errechnet. Im ersten Versuchsjahr wurde von jeder Parzelle ein Doldenmuster<br />
genommen und jeweils 500 Dolden einzeln auf Doldenausbildung und Krankheitsbefall<br />
untersucht.<br />
Da in 2009 aufgrund eines Hagelschlags vier der sechs Versuchsstandorte zerstört wurden,<br />
wurde das Projekt um ein Jahr verlängert.<br />
Ergebnisse:<br />
Bei den Aromasorten Hallertauer Tradition und Perle und bei den Hochalphasorten<br />
Hallertauer Magnum und Taurus konnte auf keinem Standort ein signifikanter Unterschied<br />
im Ertrag zwischen den Gerüsthöhen festgestellt werden, auch wenn die höhere Gerüstform<br />
tendenziell höhere Erträge aufwies. Eine Ausnahme bildete die Hochalphasorte Herkules,<br />
die deutliche Mehrerträge in der 7 m Anlage hatte.<br />
Ertrag (kg/ha)<br />
3600<br />
3200<br />
2800<br />
2400<br />
2000<br />
1600<br />
1200<br />
800<br />
400<br />
0<br />
Tradition Perle Magnum Taurus Herkules<br />
Gerüst 6m Gerüst 7m<br />
Abb. 3: Einfluss der Gerüsthöhe auf den Ertrag verschiedener Hopfensorten<br />
Ertrag (kg/ha) mit Standardabweichung der Aromasorten Hallertauer Tradition und Perle<br />
(jew. n = 12) sowie der Bittersorten Hallertauer Magnum (n = 12), Hallertauer Taurus<br />
und Herkules (jew. n = 16) im Vergleich bei 6 m und 7 m Gerüstaufbau. Signifikante Unterschiede<br />
der Erträge wurden intraspezifisch mittels mehrfaktorieller Varianzanalysen<br />
getestet und gekennzeichnet (p < 0,05 *, p < 0,01 ** und p < 0,001***)<br />
Beim Alphasäurengehalt konnte lediglich bei der Sorte Taurus ein signifikanter Anstieg<br />
bei der niedrigeren Gerüsthöhe gemessen werden, wobei der Alphasäurenertrag pro ha<br />
wieder gleich war. Der höhere Ertrag bei Herkules brachte bei gleichem Alphagehalt auch<br />
einen höheren Alphaertrag pro ha.<br />
***
83 Projekte und Daueraufgaben<br />
Alphasäureertrag (kg/ha)<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
*<br />
Tradition Perle Magnum Taurus Herkules<br />
Gerüst 6m Gerüst 7m Alphasäuregehalt<br />
Abb. 4: Einfluss der Gerüsthöhe auf den Alphasäurengehalt und -ertrag verschiedener<br />
Hopfensorten<br />
Alphasäuregehalt (%) und Alphasäurenertrag (kg/ha) der Aromasorten Hallertauer Tradition<br />
und Perle (jew. n =12) sowie der Bittersorten Hallertauer Magnum (n = 12),<br />
Hallertauer Taurus und Herkules (jew. n = 16) im Vergleich bei 6 m und 7 m Gerüstaufbau.<br />
Signifikante Unterschiede der Erträge wurden intraspezifisch mittels mehrfaktorieller<br />
Varianzanalysen getestet und gekennzeichnet (p < 0,05 *, p < 0,01 ** und p < 0,001***)<br />
Durch die Reduzierung der Gerüsthöhe konnte im Durchschnitt der Versuchsjahre bei allen<br />
Sorten (außer Perle) ein signifikant höherer Wassergehalt des Grünhopfens gemessen<br />
werden. Dies deutet darauf hin, dass der optimale Erntezeitpunkt bei niedrigerer Gerüsthöhe<br />
später erreicht wird. Bei den Doldenbonituren waren keine Unterschiede in der Größe<br />
und hinsichtlich des Krankheitsbefalls festzustellen.<br />
Eine allgemeine Empfehlung <strong>für</strong> die Praxis zur Reduzierung der Gerüsthöhe aus statischen<br />
Gründen lässt sich aus den Versuchen noch nicht ableiten, da je Sorte nur ein Standort geprüft<br />
wurde. Dies sollte bei der Anlage neuer Gerüste in sturmgefährdeten Lagen berücksichtigt<br />
werden.<br />
Projektleitung: J. Portner<br />
Bearbeitung: S. Fuß<br />
Laufzeit: 2008 - <strong>2011</strong><br />
Finanzierung: Erzeugergemeinschaft Hopfen HVG e.G.<br />
*<br />
***<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Alphasäuregehalt (%)
84 Projekte und Daueraufgaben<br />
Pflanzenschutzmitteleinsparung durch Sensortechnik bei Reihenbehandlungen<br />
im Hopfen<br />
Zielsetzung:<br />
Vor und nach dem Ausputzen und Anleiten des Hopfens (BBCH 11 - 19) werden Pflanzenschutzmittel<br />
in Reihenbehandlungen mit 1-3 Düsen pro Seite auf die Hopfentriebe appliziert,<br />
um Peronospora-Primärinfektionen oder Schädlinge wie z. B. den Erdfloh und<br />
Liebstöckelrüssler zu bekämpfen. Die Wasseraufwandmenge beträgt bei Reihenbehandlung<br />
300 - 400 l/ha. Aufgrund des weiten Stockabstandes (1,4 - 1,6 m) und der geringen<br />
Bodenbedeckung der ausgetriebenen bzw. angeleiteten Triebe gelangen bei der durchgehenden<br />
Bandbehandlung ca. 80 - 90 % der Spritzbrühe auf den Boden. Durch ein Abschalten<br />
des Spritzfächers zwischen den Hopfenstöcken könnten bei gleicher Wirkung Pflanzenschutzmittel<br />
eingespart und die Umwelt geschont werden.<br />
Methodik:<br />
Zur Ermittlung des Einsparpotentials wurde ein Pflanzenschutzgerät zur sensorgesteuerten<br />
Gießbehandlung umgebaut, indem die Düseneinheit zur Gießbehandlung durch 2-3 Flachstrahldüsen<br />
zum Spritzen ausgetauscht wurde. Bei vertikaler Anordnung der Düsen (Einsatz<br />
nach dem Aufleiten) kann der angeleitete Hopfen bis zu einer Höhe von 1,5 m behandelt<br />
werden.<br />
Der optische Sensor erkennt während der Vorfahrt den Aufleitdraht oder die Hopfenrebe<br />
und öffnet über pneumatische Ventile die Düsen. In Abhängigkeit von der Vorfahrtgeschwindigkeit<br />
kann die Verzögerung und die Öffnungsdauer am Steuergerät eingestellt<br />
werden.<br />
In zwei Versuchsreihen wurde im Zuchtgarten des Hopfenforschungszentrums Hüll am<br />
19.04.<strong>2011</strong> (vor dem Ausputzen und Anleiten) und am 02.05.<strong>2011</strong> (nach dem Ausputzen<br />
und Anleiten) im Vergleich der durchgehenden Bandbehandlung mit der sensorgesteuerten<br />
Abschaltung die Einsparungsrate an PSM ermittelt.<br />
Abb. 1 + 2: Stand der Technik in der Praxis zur durchgängigen Reihenbehandlung
85 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 3 + 4: Sensorgesteuerte Applikationstechnik zum 1. Anwendungszeitpunkt<br />
(19.04.<strong>2011</strong>) bis 40 cm Wuchshöhe<br />
Abb. 5 - 7: Sensorgesteuerte Applikationstechnik zum 2. Anwendungszeitpunkt<br />
(02.05.<strong>2011</strong>) bis 1,5 m Wuchshöhe<br />
Ergebnisse:<br />
Im ersten Versuch am 19.04.<strong>2011</strong> wurden die gekreiselten Hopfenstöcke mit einer Trieblänge<br />
von 5 - 40 cm in Bandbehandlung mit zwei Flachstrahldüsen je Seite besprüht. Im<br />
Vergleich zur durchgängigen Reihenbehandlung brachte die Abschaltung zwischen den<br />
Stöcken mit Hilfe des Sensors eine Einsparung an Spritzbrühe und somit Pflanzenschutzmittel<br />
in Höhe von 61,7 %.<br />
Zum 2. Anwendungstermin nach dem Ausputzen und Anleiten betrug die Wuchshöhe<br />
schon ca. 1,5 m. Darum wurden drei Flachstrahldüsen an einem vertikalen Gestänge angeordnet<br />
und zwischen den Aufleitungen mittels Sensor abgeschaltet. Die Einsparung an<br />
Spritzbrühe und Pflanzenschutzmittel betrug hier 55,2 %.<br />
Es war kein optischer Unterschied bei der Blattbenetzung zwischen Bandbehandlung und<br />
sensorgesteuerter Applikationstechnik festzustellen. Ein Wirkungsversuch wurde nicht<br />
durchgeführt.<br />
Projektleitung: J. Portner<br />
Bearbeitung: S. Fuß, S. Pauli<br />
Kooperation: Reith Landtechnik GmbH & Co. KG
86 Projekte und Daueraufgaben<br />
3.5.2 Erarbeitung von integrierten Pflanzenschutzverfahren gegen den Luzernerüssler<br />
Otiorhynchus ligustici im Hopfenbau: Die Eiproduktion<br />
(IPZ 5b)<br />
Zielsetzung<br />
Dieses Projekt ist eingebettet in das „Verbundvorhaben Bodenschädlinge“, in dem sich<br />
weitere fünf Institutionen mit integrierten und alternativen Bekämpfungsmöglichkeiten<br />
von Bodenschädlingen, mit den Schwerpunkten Bodenrüsselkäfer und Drahtwürmer, beschäftigten.<br />
Hierbei wurden dreijährige Freilandversuche in der Hallertau angelegt, in denen<br />
die Wirksamkeit von entomopathogenen Nematoden (EPN) und Pilzen (EPP) getestet<br />
wurden. Aufgrund des geringen Befalls mit Rüsselkäferlarven und indifferenter Abundanz<br />
von adulten Käfern konnten hier keine Aussagen bezüglich der Wirksamkeit getroffen<br />
werden. Flankierend zur Absicherung der Wirksamkeit von EPN und EPP war ein Biotest<br />
nach GLAZER & LEWIS (2000) angedacht, welcher jedoch ebenfalls aufgrund des geringen<br />
Befalls mit L2- bzw. L3-Larven an Fangpflanzen im Freiland (Rotklee) nicht durchgeführt<br />
werden konnte. Aus diesem Grund wurde mit der Methode nach VAN TOL & GWYNN<br />
(2004) gearbeitet. Hierbei wurde eine Käferzucht zur Gewinnung von Eiern aufgebaut, um<br />
<strong>für</strong> einen definierten Ausgangsbefall <strong>für</strong> Topfversuche zu sorgen. 2010 wurde die Anzahl<br />
abgelegter Eier/Individuum von Käfern, welche mit Rotklee gefüttert worden waren, mit<br />
denen von Käfern mit Luzerne als Futterpflanze verglichen. <strong>2011</strong> wurde der Vergleich mit<br />
Rotklee und Hopfen durchgeführt.<br />
Methode<br />
Für die Eierproduktion wurden jeweils Anfang April Käfer aus Hopfenanlagen der Hallertau<br />
gesammelt und in acht Haltungsgefäßen, mit Populationsdichten von jeweils<br />
5 Individuen/Gefäß, aufgeteilt. Vier Gefäße wurden mit Rotklee als Futterpflanze bestückt<br />
und vier Gefäße mit Luzerne (2010) bzw. Hopfen (<strong>2011</strong>). Die relative Luftfeuchtigkeit in<br />
den Gefäßen betrug 85 %, um ein Austrocknen der abgelegten Eier zu vermeiden. Die<br />
Futterpflanzen wurden wöchentlich erneuert und dabei die Eier abgesammelt und gezählt.<br />
Ergebnisse und Diskussion<br />
Die Eiablage begann jeweils Anfang April und endete bei den Varianten Klee und Luzerne<br />
Mitte Juli, wobei sich die Hauptablagezeit von Ende April bis Mitte Juni erstreckte. Bei<br />
der Variante Hopfen wurde eine verzettelte Eiablage auf hohem Niveau mit Spitzen Ende<br />
Mai und Mitte Juli beobachtet. Das Ende der Eiablage zog sich bis in den September. Zusätzlich<br />
zeigte sich bei der Hopfenvariante eine verzögerte Mortalität nach Ende der Eiablage,<br />
wohingegen bei den Klee- und Luzernevarianten die Sterberate nach beendeter Eiablage<br />
sehr stark anstieg. Die durchschnittlich abgelegten Eier lagen 2010 bei Rotklee als<br />
Futterpflanze bei 421 Eier/Individuum und bei Luzerne bei 291 Eier/Individuum. Folglich<br />
kam es bei O. ligustici, welche mit Luzerne gefüttert worden waren, zu einer reduzierten<br />
Eiablage (df = 1; F = 9,9492; P = 0,0197). <strong>2011</strong> wurde eine durchschnittliche Anzahl abgelegter<br />
Eier bei der Rotkleevariante von 1001 Eier/Individuum beobachtet, wohingegen<br />
die Käfer mit Hopfen als Futterpflanze 1.467 Eier je adultem Tier legten. Die Fütterung<br />
mit Hopfen brachte somit nicht nur eine verzettelte Eiablage und Mortalität, sondern auch<br />
eine Steigerung der Eiproduktivität der einzelnen Individuen (df = 1; F = 30,7153; P =<br />
0,0014). Die Wahl der Futterpflanze hatte folglich einen signifikanten Einfluss auf die Eiablage<br />
von O. ligustici. Die Reduktion bei Luzerne gegenüber Rotklee als Futterpflanze in<br />
2010 kann auf die spezifische Zusammensetzung der Pflanzenmasse beider Leguminosen-
87 Projekte und Daueraufgaben<br />
Arten beruhen. Die Zunahme der Anzahl abgelegter Eier bei der Hopfenvariante gegenüber<br />
der Rotkleevariante in <strong>2011</strong> kann an dem fortschreitenden Übergang des Rotklees<br />
zum generativen Wachstum gelegen haben, wohingegen der Hopfen stets im vegetativen<br />
Wachstum beerntet wurde. 2012 werden etwaige Einflussfaktoren in den Versuch mit aufgenommen.<br />
Abb. 1: Säulen stellen die Anzahl abgelegter Eier/Individuum * Tag von O. ligustici mit<br />
Rotklee bzw. Luzerne als Futterpflanzen in Haltungsgefäßen in 2010 dar<br />
Abb. 2: Säulen stellen die Anzahl abgelegter Eier/Individuum * Tag von O. ligustici an<br />
Rotklee bzw. Hopfen als Futterpflanze in Haltungsgefäßen in <strong>2011</strong> dar
88 Projekte und Daueraufgaben<br />
Projektleitung: Dr. F. Weihrauch, J. Schwarz (seit 01.04.11), B. Engelhard (bis<br />
31.03.11)<br />
Projektbearbeitung: J. Schwarz, U. Lachermeier (bis 31.03.10)<br />
Laufzeit: 2008 - 2012<br />
Schnellkäfer-Monitoring in Hopfengärten der Hallertau mit<br />
Pheromonfallen<br />
Zielsetzung<br />
Bei den allgemein als 'Drahtwürmer' bezeichneten Bodenschädlingen handelt es sich um<br />
die Larven von Schnellkäfern (Elateridae). Drahtwürmer haben in den letzten Jahren in<br />
stetig zunehmendem Maße Schäden am Hopfen verursacht, insbesondere bei Jungpflanzen.<br />
So wurde 2010 und <strong>2011</strong> auch das Insektizid 'Actara' (Wirkstoff Thiamethoxam) mit<br />
zeitlich befristeten Notgenehmigungen nach § 11 PflSchG im Frühjahr zur Drahtwurm-<br />
Bekämpfung im Hopfen eingesetzt. Allerdings ist das Wissen um die tatsächliche Biologie<br />
dieser Schädlinge bislang sehr begrenzt und bezieht sich z. B. hinsichtlich der Entwicklungsdauer<br />
der Larven hauptsächlich auf mehrere Jahrzehnte alte Studien des Saatschnellkäfers<br />
Agriotes lineatus. Andere Arten, wie der rezent in Deutschland eingewanderte und<br />
sich derzeit ausbreitende Agriotes sordidus, besitzen jedoch deutlich kürzere Entwicklungszeiten.<br />
Das müsste bei sinnvollen Bekämpfungsmaßnahmen natürlich Berücksichtigung<br />
finden. Das tatsächliche, aktuelle Artenspektrum der Schnellkäfer im Hopfen war bis<br />
dato jedoch unbekannt.<br />
Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde im Rahmen eines mehrjährigen, bundesweiten Verbundprojektes<br />
im Jahr 2010 auch in der Hallertau erstmals mit dem Monitoring von<br />
Schnellkäfern begonnen.<br />
Methoden<br />
Es wurden jedes Jahr zwei möglichst unterschiedliche<br />
Standorte <strong>für</strong> die Erhebung ausgewählt. Im ersten<br />
Jahr 2010 sollten die Hopfengärten hinsichtlich ihrer<br />
Höhenlage möglichst an beiden Enden des Spektrums<br />
in der Hallertau liegen, um auch kleinklimatische<br />
Einflüsse von Beginn an mit zu erfassen. Ein<br />
Standort (Oberulrain, Lkr. Kelheim, Bodenart lehmiger<br />
Sand) lag auf der Niederterrasse des Donautales<br />
auf 370 m ü.NN, der zweite (Rudertshausen, Lkr.<br />
Freising, Bodenart sandig-schluffiger Lehm) im Tertiären<br />
Hügelland auf 510 - 520 m ü.NN. Im zweiten<br />
Jahr <strong>2011</strong> wurde ein Öko-Hopfengarten (Ursbach,<br />
Lkr. Kelheim, 430 m ü.NN, Bodenart sandiger<br />
Lehm) und ein konventioneller Garten am Rand des<br />
Ilmtales (Eichelberg, Lkr. Pfaffenhofen, 395 m ü.NN,<br />
Bodenart Sand) verglichen. An jedem Standort wurden<br />
fünf Pheromonfallen, die jeweils mit unterschiedlichen,<br />
mehr oder weniger artspezifischen Lockstof-<br />
Abb. 1: Pheromonfalle zum<br />
Fang von Schnellkäfern
89 Projekte und Daueraufgaben<br />
fen bestückt wurden, im Abstand von etwa 50 m am Rand des Hopfengartens aufgestellt<br />
(Abb. 1). Die Fallen wurden ab Mitte bzw. Ende April im wöchentlichen Rhythmus bis<br />
Ende Juli jeden Freitag geleert (2010: 16 Leerungen; <strong>2011</strong>: 14 Leerungen). Die<br />
Pheromondispenser in den Fallen wurden jeweils nach fünf Wochen erneuert. Die Bestimmung<br />
der gefangenen Käfer erfolgte mit Standardliteratur (Freude, Harde & Lohse<br />
Bd. 6, 1979; Bd. 13, 1992).<br />
Ergebnisse<br />
Insgesamt wurden 2010 in den zehn Fallen in 16 Wochen 565 Schnellkäfer-Imagines<br />
(13 Arten) gefangen und identifiziert (Oberulrain: 347 Käfer, Rudertshausen: 218 Käfer).<br />
Im Folgejahr <strong>2011</strong> wurden in 14 Wochen 207 Käfer (elf Arten) gefangen (Eichelberg: 123<br />
Käfer, Urbach: 84 Käfer). Der Gesamtfang beider Jahre verteilte sich auf insgesamt 15 Arten,<br />
von denen die sechs Agriotes-Arten als landwirtschaftliche Schädlinge mit unterschiedlichem<br />
Schadpotential gelten (Tab. 1). Dominante Arten waren in zwei Fällen der<br />
Saatschnellkäfer A. lineatus und in den anderen beiden Fällen der Düstere Humusschnellkäfer<br />
A. obscurus. Der Garten-Humusschnellkäfer A. sputator trat als dritte regelmäßig<br />
vorkommende Art an jedem Standort mäßig häufig auf (Tab. 1). Diese drei Arten waren in<br />
den Fallen von Ende April bis Mitte Juli auch regelmäßig zu finden. Der ebenfalls stark<br />
schädigende Rauchige Schnellkäfer A. ustulatus wurde auch an allen Standorten registriert,<br />
allerdings nur im Hochsommer mit wenigen Individuen.<br />
Tab. 1: Relatives Auftreten von Schnellkäfer-Arten (Elateridae) in Pheromonfallen in<br />
Hopfengärten der Hallertau in den Jahren 2010 und <strong>2011</strong>. Die dominanten Arten jedes<br />
Standortes sind farbig hinterlegt.<br />
Oberulrain Rudertshausen Ursbach Eichelberg<br />
2010 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Art deutscher Name Schädling? (n=347) (n=218) (n=84) (n=123)<br />
Adrastus pallens Zwergschnellkäfer 0,6 % 1,2 %<br />
Agriotes acuminatus ! 6,9 % 3,6 % 9,8 %<br />
Agriotes gallicus ! 1,2 % 3,7 % 1,2 % 3,3 %<br />
Agriotes lineatus Saatschnellkäfer !!! 55,0 % 12,4 % 13,1 % 62,6 %<br />
Agriotes obscurus Düsterer Humusschnellkäfer !!! 21,9 % 60,1 % 54,8 % 6,5 %<br />
Agriotes sputator Garten-Humusschnellkäfer !! 18,4 % 11,5 % 19,0 % 9,4 %<br />
Agriotes ustulatus Rauchiger Schnellkäfer !!! 0,6 % 4,6 % 3,6 % 4,1 %<br />
Agrypnus murina Mausgrauer Schnellkäfer 0,6 % 4,1 %<br />
Athous subfuscus Bräunlicher Schnellkäfer 0,5 % 1,2 %<br />
Athous vittatus Gebänderter Schnellkäfer ! 1,2 %<br />
Cidnopus aeruginosus 0,6 %<br />
Dalopius marginatus Gestreifter Forstschnellkäfer 0,8 %<br />
Ectinus aterrimus Wald-Humusschnellkäfer 0,2 %<br />
Hemicrepidius hirtus Rauhaariger Schnellkäfer 1,2 %<br />
Limonius aeneoniger 0,5 %<br />
Insgesamt war der Fang in den Fallen unerwartet artenreich, wobei mit A. lineatus und<br />
A. obscurus die 'gängigen' Schnellkäfer-Arten meist auch die dominanten waren. Als erfreulich<br />
ist zu werten, dass der thermophile A. sordidus, der als gefährlicher Schädling<br />
sich in Mitteleuropa derzeit aus Süden entlang der großen Ströme (z. B. Oberrhein) ausbreitet,<br />
die Hallertau offensichtlich noch nicht erreicht hat. Auch das nur geringe, zeitlich<br />
eng begrenzte Auftreten von A. ustulatus ist als positiv zu werten. Es muss allerdings berücksichtigt<br />
werden, dass die Fänge von Imagines in den Pheromonfallen nur einen Hin-
90 Projekte und Daueraufgaben<br />
weis darauf geben, welche Arten tatsächlich als Drahtwürmer im Hopfen schädlich auftreten,<br />
da die flugfähigen Käfer genauso gut von anderen Flächen im Umgriff der Hopfengärten<br />
stammen können.<br />
Projektleitung: Dr. F. Weihrauch<br />
Projektbearbeitung: Dr. F. Weihrauch, J. Schwarz<br />
Laufzeit: 2010 - 2012<br />
Kooperation: JKI, DPG (AK Getreideschädlinge) und Syngenta Agro GmbH<br />
3.5.3 Züchtungsforschung Hopfen (IPZ 5c)<br />
Mit der Entwicklung neuer Hopfensorten versucht die Hopfenzüchtung in Hüll, immer am<br />
Puls der Zeit zu sein. Züchterisch bearbeitet wird in Hüll die gesamte Bandbreite von feinsten<br />
Aromahopfen bis zu Super-Hochalphasorten. Dabei stellt die Verbesserung der Resistenzen<br />
gegenüber den wichtigsten Krankheiten und Schädlingen die Basis <strong>für</strong> die Selektion<br />
neuer Sämlinge dar. Künftige Sorten sollen bei gesteigerter Leistungsfähigkeit und bester<br />
Qualität von den deutschen Hopfenpflanzern noch umweltschonender und kostengünstiger<br />
produziert werden können. Die klassische Züchtung wird seit Jahren durch biotechnologische<br />
Methoden unterstützt. Beispielsweise gelingt es nur über die Meristemkultur,<br />
virusfreies Pflanzmaterial zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren werden molekulare<br />
Techniken eingesetzt, um das Erbmaterial des Hopfens selbst wie auch von Hopfenpathogenen<br />
zu identifizieren.<br />
Neuer Trend in der Hopfenzüchtung – Hopfen mit blumigen, zitrusartigen<br />
und fruchtigen Aromanoten<br />
Zielsetzung<br />
Bis vor Kurzem folgten alle Züchtungsprogramme der Zielsetzung, Aromasorten mit feinem<br />
klassischem Aromaprofil zu züchten bzw. Hochertrags-Alphasorten zu entwickeln,
91 Projekte und Daueraufgaben<br />
wobei die Sorten beider Kategorien sowohl Pflanzer als auch Brauer voll zufriedenstellten.<br />
Erst US Craft-Brewer entdeckten neuartige Hopfen-Aroma- und Geschmacksnoten<br />
<strong>für</strong> sich und diese Ideen wurden auch von anderen kreativen Brauern aus aller Welt aufgegriffen.<br />
Deshalb wurde 2006 mit einer neuen Zuchtrichtung begonnen, um Hopfensorten<br />
anbieten zu können, die den Bieren vielfältige florale, fruchtige und zitrusartige Aroma-<br />
und Geschmackseindrücke verleihen.<br />
Material und Methoden<br />
Bis <strong>2011</strong> wurden 33 Kreuzungen mit diesem Zuchtziel durchgeführt. Alle Sämlinge wurden<br />
auf Krankheitsresistenz, Wüchsigkeit, Stockgesundheit und Geschlecht vorselektiert.<br />
Nur Zuchtstämme, die angenehme, fruchtige oder blumige Aromanuancen besaßen, wurden<br />
geerntet. Das Aroma von trockenen Hopfendolden wurde organoleptisch bestimmt<br />
und auch chemisch analysiert. Bittersubstanzen wurden mit der HPLC-Methode nach EBC<br />
7.7 bestimmt. Die ätherischen Ölkomponenten wurden als Wasserdampfdestillat mit dem<br />
Gaschromatographen nach den EBC-Methoden 7.10 und 7.12 analysiert und quantifiziert.<br />
Routinemäßig wurde allerdings die Headspace GC-Technik eingesetzt.<br />
Ergebnisse<br />
Von den 33 durchgeführten Kreuzungen beruhen die meisten auf der US Sorte Cascade,<br />
die spezielle Aromacharakteristika von ihren nordamerikanischen Vorfahren zeigen, kombiniert<br />
mit Hüller Zuchtmaterial, das <strong>für</strong> feine Aromaqualität europäischen Ursprungs<br />
steht und verbesserte Krankheitsresistenz sowie gesteigerte agronomische Leistungsfähigkeit<br />
mitbringt. 2.208 vorselektierte weibliche Stämme aus diesem Zuchtprogramm werden<br />
als Einzelpflanzen in Hüll drei Jahre lang angebaut und bonitiert. Die erfolgversprechendsten<br />
Stämme werden in Wiederholung an zwei verschiedenen Standorten angebaut,<br />
um ihre Anbaueignung zu prüfen. Mehrere Zuchtstämme, die diesem neuen Aroma- und<br />
Geschmackstrend entsprachen, wurden geerntet und chemisch analysiert, wobei Cascade<br />
mit seinem fruchtig-zitrusartigem Aroma als Vergleichssorte dient. Erste Brauversuche<br />
mit acht neuen Hüller Zuchtstämmen sind sehr vielversprechend. In den Bieren entfalteten<br />
sich einzigartige Aromen, die an Mandarine, Melone, Grapefruit und Aprikose erinnern,<br />
es wurden auch blumige Duftnoten festgestellt.<br />
Zum ersten Mal hat die Hüller Züchtung Hopfen mit verschiedensten fruchtigen,<br />
zitrusartigen und auch blumigen Aroma- und Geschmacksstoffen hervorgebracht, die von<br />
kreativen Brauern auf der ganzen Welt nachgefragt werden. Zwei Zuchtstämme wurden<br />
bereits beim Europäischen Sortenamt zur Registrierung als Sorte angemeldet.<br />
Leitung: A. Lutz, Dr. E. Seigner<br />
Bearbeitung: A. Lutz, J. Kneidl, Team von IPZ 5c<br />
Kooperation: Dr. K. Kammhuber, Team von IPZ 5d; Anheuser-Busch InBev,<br />
W. Lossignol; BayWa, Dr. D. Kaltner; Bitburger Braugruppe,<br />
Dr. S. Hanke; Brauerei Schönram, E. Toft; Brauerei Veltins,<br />
W. Bauer; Hopfenveredlung St. Johann, A. Gahr; Hopfenverwertungsgenossenschaft<br />
HVG; Hopsteiner; J. Barth & Sohn; New Glarus<br />
Brewing Company, D. Carey; Städt. Berufsschule <strong>für</strong> das Braugewerbe,<br />
München, D. Stegbauer; The Boston Beer Company,<br />
D. Grinnell; Urban Chestnut Brewing Company, F. Kuplent
92 Projekte und Daueraufgaben<br />
Charakterisierung der Interaktion Hopfen-Hopfenmehltau auf Zellebene und<br />
Funktionsanalyse von an der Abwehr beteiligten Genen<br />
Ziel<br />
Ziel dieses Forschungsprojektes war es, auf Zellebene mit dem Licht- und Fluoreszenzmikroskop<br />
Abwehrreaktionen in verschiedenen Wildhopfen zu charakterisieren. Dadurch<br />
sollten neue Resistenzträger <strong>für</strong> die Mehltauresistenzzüchtung gefunden werden.<br />
Ein anderer Teil dieser Arbeit unterstützte mit einem molekularbiologischen Ansatz die<br />
Resistenzzüchtung. Ein sog. transienter Transformationsassay wurde bei Hopfen erarbeitet,<br />
mit dem es möglich ist, Gene, die an Abwehrreaktionen gegenüber Hopfenmehltau beteiligt<br />
sind, funktionell zu analysieren.<br />
A<br />
B<br />
Abb. 1: Bilder aus einzelnen<br />
Arbeitsschritten des Projektes.<br />
A), Inokulierte Blätter <strong>für</strong> mikroskopische<br />
Untersuchungen.<br />
C D<br />
B), Zwei Haustorien (Pfeile) des<br />
Mehltaupilzes in einer transformierten<br />
Haarzelle, Blaufärbung<br />
durch das GUS-Reportersystem.<br />
C), Zelltod (Pfeil) als<br />
Abwehrreaktion gegen den<br />
Mehltaupilz. D), Sporulation<br />
des Mehltaupilzes aufgrund der<br />
Infektion einer einzelnen Haarzelle.<br />
Pfeil: Haustorium in<br />
Haarzelle. Maßstab: A: 1 cm;<br />
B ,C ,D: 25 µm<br />
Methoden<br />
Aus dem Hüller Zuchtprogramm wurden acht Wildhopfen, zwei Zuchtstämme und zwei<br />
Sorten, die alle als mehltauresistent eingestuft werden, sowie Northern Brewer als anfällige<br />
Kontrollsorte mit Echtem Mehltau inokuliert (vgl. Abb. 1 A). Die Infektion wurde zu<br />
verschiedenen Zeitpunkten (24 h, 48 h und 7 d) nach der Inokulation abgestoppt und Pilzstrukturen<br />
sowie Abwehrreaktionen auf Zellebene durch histochemische Färbungen sichtbar<br />
gemacht. Anschließend wurden ca. 30.170 Interaktionen zwischen einzelnen<br />
Epidermiszellen und dem Mehltaupilz unter einem Fluoreszenzmikroskop untersucht. Da<br />
sich herausstellte, dass der Mehltaupilz auch Haarzellen kolonisiert und diese ein anderes<br />
Resistenzverhalten im Vergleich zu normalen Epidermiszellen aufweisen, wurde ergänzend<br />
auch das Resistenzverhalten dieser Haarzellen untersucht.<br />
Um einen transienten Transformationsassay <strong>für</strong> Hopfen zu etablieren, wurde zunächst ein<br />
Protokoll <strong>für</strong> die Transformation von Epidermiszellen mit der Particle Gun erarbeitet.<br />
Haarzellen erwiesen sich <strong>für</strong> den transienten Assay im Vergleich zu Epidermiszellen als<br />
geeigneter, da eine Mindestanzahl an Interaktionen zwischen transformierten<br />
Epidermiszellen und dem Mehltaupilz erforderlich ist und diese mit Haarzellen besser erreicht<br />
werden kann. Außerdem wurde eine Vermehrung des echten Mehltaupilzes auf lebenden<br />
Pflanzen in Klimakammern etabliert, da angenommen wurde, dass mit dieser Me-
93 Projekte und Daueraufgaben<br />
thode im Vergleich zu der Mehltauvermehrung in der Petrischale vitalere Sporen erhalten<br />
werden können. Um den transienten Transformationsassay mit dem Ziel der funktionalen<br />
Analyse von an der Mehltauresistenz beteiligten Genen zu validieren, wurde ein Hopfen<br />
Mlo-Gen ausgewählt. Von anderen Fruchtarten ist bekannt, dass es sich bei Mlo-Genen<br />
um Anfälligkeitsgene handelt und dass ein Funktionsverlust eines oder mehrerer dieser<br />
Gene zu einer erhöhten Resistenz dieser Pflanzen führt (Bai et al., 2008; Panstruga, 2005;<br />
Consonni et al., 2006; Pavan et al., <strong>2011</strong>). Zunächst wurde die Aktivität dieses Hopfen<br />
Mlo-Gens nach Mehltaubefall in einer anfälligen und einer resistenten Sorte untersucht,<br />
um nähere Informationen über dieses Gen zu erhalten. Anschließend wurde ein „Knockdown“-Konstrukt<br />
<strong>für</strong> die funktionale Analyse dieses Gens durch die transiente Transformation<br />
von Haarzellen über Mikropartikelbeschuss hergestellt.<br />
Ergebnisse<br />
Bei den mikroskopischen Untersuchungen der <strong>für</strong> die Mehltauresistenz verantwortlichen<br />
Anwehrreaktionen zeigte sich, dass bei allen zwölf Genotypen die Resistenz auf einem<br />
Zelltod der angegriffenen Zellen beruht (Abb. 1 C). Bei elf Genotypen war dieser Zelltod<br />
bereits 24 h nach der Inokulation nachweisbar. Bei einem Genotyp beruhte die Resistenz<br />
auf einem Zelltod zu einem späteren Zeitpunkt. Zellwandverstärkungen, die ein Eindringen<br />
des Pilzes behindern, spielen bei allen untersuchten Genotypen eine geringere Rolle.<br />
Haarzellen waren in allen untersuchten Genotypen anfällig, auf zehn Genotypen konnten<br />
unter dem Mikroskop einzelne sporulierende Kolonien mit einer anfälligen Haarzelle in<br />
der Mitte gefunden werden (Abb. 1 D). Da allerdings der Flächenanteil der Haarzellen an<br />
der Blattoberfläche gering ist, scheint sich diese Beobachtung nicht auf die Ausprägung<br />
des Resistenzphänotyps auszuwirken.<br />
Zur transienten Transformation von Epidermiszellen bei Hopfen durch Mikropartikelbeschuss<br />
wurden ein Protokoll erarbeitet, wozu folgende Punkte/Aspekte untersucht bzw.<br />
optimiert worden waren: Bestimmung des optimalen Beschleunigungsdruckes <strong>für</strong> den<br />
Mikropartikelbeschuss und Vergleich der Zellgrößen verschiedener epidermaler Zelltypen<br />
sowie die Optimierung der Mehltauerhaltung und -vermehrung. Genexpressionsstudien<br />
eines Hopfen Mlo-Gens in einer anfälligen und einer resistenten Sorte deuteten auf vermehrte<br />
Aktivität dieses Gens nach Mehltaubefall und somit auf eine Funktion dieses Gens<br />
in der Interaktion Hopfen-Hopfenmehltau hin. Abschließend wurde der transiente Transformationsassay<br />
durch die funktionale Charakterisierung dieses Mlo-Gens validiert. Hierbei<br />
zeigten die Knockdown-Experimente in der anfälligen Sorte Northern Brewer, dass<br />
Zellen, in welchen ein transienter Knockdown dieses Anfälligkeitsgens erfolgt war, weniger<br />
Haustorien enthielten als die Kontrolle. Durch das Ausschalten des Gens wurden die<br />
Zellen also weniger anfällig. Abb. 1 C zeigt beispielhaft <strong>für</strong> die mikroskopische Auswertung<br />
des transienten Assays eine Interaktion einer transformierten Haarzelle mit dem<br />
Mehltaupilz. Die transformierte Haarzelle enthält zwei Haustorien.<br />
Publikationen zu diesen Arbeiten sind in Vorbereitung.<br />
Projektleitung: Dr. E. Seigner<br />
Projektbearbeitung: K. Oberhollenzer, A. Lutz, B. Forster<br />
Kooperation: Prof. Dr. R. Hückelhoven, Dr. R. Eichmann, TU München, Wissenschaftszentrum<br />
Weihenstephan, Lehrstuhl <strong>für</strong> Phytopathologie;<br />
Dr. F. Felsenstein, EpiLogic GmbH, Agrarbiol. Forschung & Beratung,<br />
Freising
94 Projekte und Daueraufgaben<br />
Finanzierung: Erzeugergemeinschaft Hopfen HVG e.G.<br />
Laufzeit: April 2008 - Dezember <strong>2011</strong><br />
Literatur<br />
Bai Y, Pavan S, Zheng Z, Zappel NF, Reinstädler A, Lotti C, De Giovanni C, Ricciardi L,<br />
Lindhout P, Visser R, Theres K, Panstruga R (2008): Naturally occurring broad-spectrum<br />
powdery mildew resistance in a Central American tomato accession is caused by loss of<br />
Mlo function. Molecular Plant-Microbe Interactions, 21: 30-39<br />
Consonni C, Humphry ME, Hartmann HA, Livaja M, Durner J, Westphal L, Vogel J,<br />
Lipka V, Kemmerling B, Schulze-Lefert P, Somerville SC, Panstruga R (2006): Conserved<br />
requirement for a plant host cell protein in powdery mildew pathogenesis. Nature<br />
Genetics, 38: 716-720<br />
Panstruga R (2005): Serpentine plant MLO proteins as entry portals for powdery mildew<br />
fungi. Biochemical Society Transactions, 33: 389-392<br />
Pavan S, Schiavulli A, Appiano M, Marcotrigiano AR, Cillo F, Visser RGF, Bai Y, Lotti<br />
C, Ricciardi L (<strong>2011</strong>) Pea powdery mildew er1 resistance is associated to loss-of-function<br />
mutations at a MLO homologous locus. Theoretical and Applied Genetics, 123: 1425-1431<br />
Untersuchungen zu Verticillium-Infektionen in der Hallertau<br />
Zielsetzung<br />
Nachdem seit dem verstärkten Auftreten der Hopfenwelke in der Hallertau sowohl molekulargenetisch<br />
als auch über künstliche Infektionstests das Vorkommen sowohl milder als<br />
auch letaler Rassen nachgewiesen werden konnte, ist es nun die Aufgabe, den<br />
Verticillium-Pilz und seine Rasse möglichst schnell in einem in-planta-Test zu bestimmen,<br />
um ackerbaulich geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine weiterer, wenngleich sehr<br />
schwieriger Bereich, ist der Nachweis von Verticillium in Bodenproben. Dies ist <strong>für</strong> die<br />
Landwirte immens wichtig, um speziell bei Neuanlagen von Hopfengärten dem Risiko einer<br />
Verticillium-Infektion begegnen zu können: Nachdem es bis heute <strong>für</strong> dieses Bodenpathogen<br />
keine chemischen Bekämpfungsmöglichkeiten gibt, sollen Bioantagonisten (biologische<br />
„Gegenspieler“); die als Maßnahme gegen den Welkepilz in anderen Kulturen wie<br />
z. B. Erdbeeren in Versuchen ihre präventive Wirksamkeit erfolgreich beweisen konnten,<br />
nun auch bei Hopfen getestet werden.<br />
Methoden<br />
Aufgrund der Tatsache, dass <strong>für</strong> die Etablierung eines in-planta-Laborschnelltests die<br />
Homogenisierung der sehr holzigen Rebenteile von Hopfenpflanzen eine Grundvoraussetzung<br />
darstellt und dies mit der in der Genomanalyse routinemäßig verwendeten Kugelmühle<br />
nicht möglich ist, wurde <strong>für</strong> diesen Arbeitsschritt ein Homogenisator beschafft. Im<br />
Gegensatz zu Kugelmühlen mit zweidimensionalen Bewegungen wird bei diesem<br />
Homogenisator das Pflanzenmaterial mit speziellen Kugeln in einer dreidimensionalen<br />
Bewegung unter hoher Frequenz (bis zu 6 m/s) aufgeschlossen. Bevor verschiedenste<br />
kommerzielle DNA-Isolationskits auf ihre Eignung zu dieser Fragestellung getestet wurden,<br />
mussten zunächst unterschiedlichste Aufschlussparameter wie Material der Kugeln,
95 Projekte und Daueraufgaben<br />
Form und Größe der Kugeln und optimale Schwingfrequenz des Gerätes getestet werden.<br />
Zur Etablierung einer multiplex real-time PCR wurden ausgehend von bereits publizierten<br />
und <strong>für</strong> die qualitative PCR bereits etablierten spezifischen Genomsequenzen <strong>für</strong><br />
Verticillium albo-atrum- (V. a.a.) und Verticillium dahliae (V.d.) Primer und Real-Time-<br />
Sonden <strong>für</strong> die jeweilige Verticillium-Art entwickelt.<br />
Um erstmalig eine Basis zu bekommen, Bodenproben molekular auf Verticillium hin zu<br />
untersuchen, wurde Erde mit Verticillium-albo-atrum-Pilzmycelien oder Pilz-DNA versehen<br />
und in eine PCR eingesetzt.<br />
Bei der Suche nach geeigneten Mikroorganismen <strong>für</strong> die biologische Kontrolle des<br />
Verticillium-Pilzpathogens wurden fünf Bakterienstämme ausgewählt. Sie gehören den<br />
Gattungen Bacillus, Burkholderia, Pseudomonas, Serratia und Stenotrophomonas an.<br />
Aufgrund des verstärkten Verticillium-Befalls der Sorte Hallertauer Tradition wurde diese<br />
zur Testung verwendet. Wurzeln junger Hopfenfechser wurden hierzu in spontan mutierte<br />
Rifampicin-resistente Bakteriensuspensionen eingetaucht, eingetopft und nach 4 Wochen<br />
wieder von Erde befreit. Sowohl Endosphäre als auch Rhizosphäre der Wurzeln wurden<br />
auf ihre Bakterienbesiedelung hin untersucht. Die Kolonienzahl der Antagonisten pro<br />
Gramm Wurzel wurde auf Standard Bakterienmedien mit Rifampicin ermittelt.<br />
Ergebnis<br />
In einem ersten Vorlauf konnte anhand von 150 Proben der in-planta Verticillium-<br />
Schnelltest, d. h. der Nachweis des Pilzes direkt aus der Hopfenrebe ohne vorhergehende<br />
Pilzanzucht und DNA-Isolation, erfolgreich angewandt werden. Die neue Technik konnte<br />
dadurch verifizierte werden, weil diese Hopfenproben schon letztes Jahr unter Nutzung<br />
der herkömmlichen langwierigen Methodik auf Verticillium albo atrum untersucht worden<br />
waren. Damals wurde der Pilz zuerst Inkultur gebracht, in Flüssigmedium vermehrt und<br />
nachfolgend erst die DNA des Pilzes nach der herkömmlich verwendeten Isolationsmethode<br />
extrahiert. Selbst in fünf bislang als phänotypisch gesund geführten Rebenproben<br />
konnte über diesen Schnelltest erstmalig Verticillium dahliae nachgewiesen werden. In<br />
Abb. 1 ist die Real-Time-Amplifikation von in-planta V.a.a.-DNA (A) im Vergleich zu<br />
DNA von kultivierten<br />
B<br />
V.a.a. Referenzisolaten (B)<br />
dargestellt. In ersten realtime<br />
PCR-Reaktionen mit<br />
künstlichen DNA-Mi-<br />
A<br />
schungen aus Verticillium<br />
albo-atrum und Verticilliumdahliae-Referenzen<br />
konnten die <strong>für</strong> V.a.a<br />
und V.d. entwickelten<br />
Primer und Real-Time-<br />
Sonden erfolgreich getestet<br />
werden.<br />
Abb. 1: Direkter Nachweis von Verticillium albo-atrum in<br />
Hopfenreben mittels Real-Time PCR A=Pilz aus Rebe,<br />
B=Referenzisolate; RFU=relative fluorescence units
96 Projekte und Daueraufgaben<br />
In bislang zwei Versuchsreihen mit je zwölf Topfpflanzen/Bakterium der Sorte<br />
Hallertauer Tradition wurden alle Bakterienstämme zunächst auf ihre Fähigkeit der Besiedelung<br />
der Hopfenwurzeln (Endosphäre und Rhizosphäre) untersucht. Dies ist die Grundvoraussetzung<br />
zur Überprüfung ihrer antagonistischen Wirkung auf das Pathogen. Alle<br />
Gattungen konnten sich bislang erfolgreich an Hopfen ansiedeln.<br />
Ausblick<br />
Zu einer statistischen Absicherung des Verticillium-Schnelltestes ist in der kommenden<br />
Hopfensaison eine umfassendere Untersuchungsreihe geplant. Des Weiteren ist geplant,<br />
Erde von Verticillium-verseuchten Hopfengärten mit Indikatorpflanzen auf das Vorkommen<br />
des Pilzpathogens hin zu untersuchen. Die Entwicklung von spezifischen Primern zur<br />
Differenzierung von milden und letalen Verticillium-Isolaten basierend auf den bereits detektierten<br />
AFLPs erweist sich schwieriger als erwartet und wird weiter forciert.<br />
Projektleitung: Dr. S. Seefelder<br />
Projektbearbeitung: K. Drofenigg, C. Püschel, S. Petosic, E. Niedermeier<br />
Kooperation: Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, University<br />
Lubliana, Karl-Franzens-Universität Graz<br />
Förderung: Erzeugergemeinschaft Hopfen HVG e. G.,<br />
Wissenschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft e. V.<br />
Laufzeit: 2008 - 2013<br />
3.5.4 Hopfenqualität und -analytik (IPZ 5d)<br />
Die Arbeitsgruppe IPZ 5d führt im Arbeitsbereich IPZ 5 Hopfen alle analytischen Untersuchungen<br />
durch, die zur Unterstützung von Versuchsfragen der anderen Arbeitsgruppen,<br />
insbesondere der Hopfenzüchtung, benötigt werden. Der Hopfen hat drei Gruppen von<br />
wertgebenden Inhaltsstoffen. Dies sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung die Bitterstoffe,<br />
die ätherischen Öle und die Polyphenole. Die Bitterstoffe bestehen aus den α- und<br />
ß-Säuren, wobei der α -Säurengehalt als das primäre wirtschaftliche Qualitätsmerkmal des<br />
Hopfens gilt, da er ein Maß <strong>für</strong> das Bitterpotential darstellt. Die α-Säuren geben dem Bier<br />
die typische Hopfenbittere, sorgen <strong>für</strong> dessen biologische Stabilität und auch <strong>für</strong> eine gute<br />
Schaumstabilität. Die ß-Säuren sind wegen ihrer antimikrobiellen Eigenschaften <strong>für</strong> alternative<br />
Anwendungen des Hopfens interessant, z. B. als Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie.<br />
In der Zuckerindustrie und auch bei der Ethanolherstellung werden ß-<br />
Säuren bereits erfolgreich eingesetzt, um Formalin zu ersetzen.<br />
Die ätherischen Öle sind <strong>für</strong> den Geruch und das Aroma verantwortlich. Insbesondere in<br />
der Craft Brewers Szene erlangen sie immer mehr Bedeutung, da die Craft Brewers Hopfen<br />
mit besonderen und teilweise hopfenuntypischen Aromen wünschen. Diese werden<br />
unter dem Begriff „Flavor Hops“ zusammengefasst.<br />
Wegen der beruhigenden Wirkung der ätherischen Öle werden aus Hopfen in Kombination<br />
mit Baldrian pharmazeutische Präparate hergestellt.<br />
Über die positiven Wirkungen von Polyphenolen <strong>für</strong> die Gesundheit gibt es eine Vielzahl<br />
von Veröffentlichungen, da Polyphenole antioxidative Fähigkeiten besitzen und freie Radikale<br />
einfangen können. Hopfen ist eine sehr polyphenolreiche Pflanze. Insbesondere
97 Projekte und Daueraufgaben<br />
Xanthohumol erlangte in den letzten Jahren wegen seines großen antikanzerogenen Potentials<br />
viel öffentliche Aufmerksamkeit, wobei aber nach neuesten Studien dessen Bioverfügbarkeit<br />
im menschlichen Organismus nicht besonders gut ist. Die Substanz 8-<br />
Prenylnaringenin, die im Hopfen in Spuren vorkommt, gilt als eines der stärksten<br />
Phytoöstrogene und verleiht dem Hopfen eine leicht östrogene Aktivität. Dies war bereits<br />
seit Jahrhunderten bekannt, doch die da<strong>für</strong> verantwortliche Substanz wurde erst vor zehn<br />
Jahren entdeckt.<br />
Momentan gibt es <strong>für</strong> die Brauereien ein großes Überangebot an Hopfen, deshalb wäre es<br />
sehr wichtig, alternative Anwendungen zu erschließen. Weitere Einsatzmöglichkeiten von<br />
Hopfen sind in der Lebensmittelindustrie sowie in den Bereichen Medizin und Wellness<br />
zu finden.<br />
Analytische Charakterisierung des Aromaprofils von „Flavor Hops“<br />
Einführung und Zielsetzung:<br />
Bisher werden Hopfen in Bittersorten und Aromasorten eingeteilt. Bittersorten haben einen<br />
hohen Gehalt an alpha-Säuren und Aromasorten zeichnen sich durch ein feines Aroma<br />
aus. In der Craft Brewers Szene hat sich in den letzten Jahren jedoch auch ein neuer Begriff<br />
zur Charakterisierung von Hopfensorten herauskristallisiert, die sogenannten „Flavor<br />
Hops“. Unter diesen versteht man Hopfen, die sich in ihren Aromaprofilen deutlich von<br />
konventionellen Hopfen unterscheiden. Sie weisen zum Teil exotische und hopfenuntypische<br />
Aromen auf, die meistens in fruchtige und zitrusartige Noten gehen. Auch können<br />
„Flavor Hops“ durchaus einen hohen alpha-Säurengehalt haben. Geübte Parfumeure können<br />
Hopfenaromen sehr detailliert beschreiben. Eine Einteilung in sieben Aromabeschreibungen<br />
ist jedoch <strong>für</strong> die Charakterisierung von Hopfensorten gut geeignet. Die<br />
Tabelle 1 zeigt die Aromaprofile und die da<strong>für</strong> verantwortlichen chemischen Substanzen.<br />
Es können sicher noch einige Substanzen hinzugefügt und ergänzt werden.
98 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 1: Beschreibung des Hopfenaromas und die dazugehörenden Aromakomponenten<br />
fruchtig blumig zitrusartig Kräuter/Gemüse<br />
Isobutyl.-isobutyrat Linalool Limonen α-Pinen<br />
Isoamyl-acetat 2-Decanon Citronellol ß-Phellandren (*)<br />
2-Methylbutyl-isobutyrat 2-Undecanon Citral (*) ß-Pinen<br />
2-Methylbutyl-2-<br />
Tridecanon p-Cymen (*) ß-Selinen<br />
Oenanthsäuremethylester Pentadecanon Citronellal (*) α-Selinen<br />
Methyl-6-Methylheptanoat Geraniol Cadinen<br />
2-Nonanon Farnesol (*) Selinadien<br />
4-Decensäuremethylester Nerol (*)<br />
4,8-<br />
Geranyl-acetat (*)<br />
Gewürze/Holz Gras,Heu Off-Flavor<br />
Myrcen Hexanal (*) Dimethylsulfid<br />
α-Copaen (*)<br />
ß-Caryophyllen<br />
Humulen<br />
Caryophyllenoxid<br />
Eudesmol (*)<br />
(*) wird noch zur Analytik hinzugefügt<br />
Methode:<br />
In Hüll wird als Routineanalytik <strong>für</strong> die Züchtung die Headspace Gaschromatographie<br />
eingesetzt. Diese Methode ermöglicht qualitative, aber keine quantitativen Auswertungen.<br />
Die einzelnen Komponenten werden relativ zu ß-Caryophyllen (=100) angegeben. Für<br />
quantitative Bestimmungen des Gesamtölgehalts (ml/100 g Hopfen) wird die Wasserdampfdestillation<br />
nach EBC 7.10 angewandt. Zur quantitativen Auswertung einzelner Ölkomponenten<br />
wird das Wasserdampfdestillat gaschromatographisch gemäß EBC 7.12 analysiert.<br />
Die Mengenangaben erfolgen entweder in % des Gesamtöls oder in mg/100 g<br />
Hopfen.<br />
Ergebnisse<br />
Wenn man die Ölkomponenten, analysiert mit Headspace Gaschromatographie, nach der<br />
Tabelle 1 zusammenstellt, kann man einzelne Hopfensorten hinsichtlich ihrer Aromaausprägung<br />
sehr gut vergleichen. Die Abbildung 1 zeigt einige Hopfensorten im Vergleich<br />
zu Zuchtstämmen.
99 Projekte und Daueraufgaben<br />
Abb. 1: Aromaprofile von Hopfensorten und Zuchtstämmen<br />
Die analytischen Ergebnisse entsprechen der sensorischen Bewertung. Der Zuchtstamm<br />
2007/019/008 ist der mit Abstand am intensivsten riechende.<br />
Schlussfolgerung<br />
Die Aromaanalytik ist eine wichtige Ergänzung zur Sensorik, die doch mehr subjektiv ist.<br />
Wie das Aroma in das Bier übergeht, hängt von vielen Faktoren ab. Je später der Hopfen<br />
zum Würzekochen hinzugefügt wird, desto mehr Aroma gelangt auch in das Bier. Am<br />
meisten Hopfenaroma kann man jedoch durch Hopfenstopfen (dry hopping) in das Bier<br />
bekommen. Dieses Verfahren wird vor allem von den Craft Brewern angewandt. Die<br />
Verwendung von „Flavor Hops“ ist ein geeignetes Mittel, um Biere zu differenzieren.<br />
Man ist jetzt gerade dabei, ein Sortenbewusstsein zu entwickeln und die Individualität des<br />
Hopfens zu entdecken.<br />
Projektleitung: Dr. K. Kammhuber<br />
Projektbearbeitung: S. Weihrauch<br />
Laufzeit: Daueraufgabe<br />
Kooperation Arbeitsgruppe Züchtungsforschung Hopfen IPZ 5c
100 Projekte und Daueraufgaben<br />
Differenzierung des Welthopfensortiments mit Hilfe der niedermolekularen<br />
Polyphenole-Ergebnisse <strong>2011</strong><br />
Einführung und Zielsetzung<br />
Neben der Zusammensetzung der Bitterstoffe und ätherischen Öle bieten die niedermolekularen<br />
Polyphenole eine dritte Möglichkeit, um Sorten zu differenzieren. In diesem Projekt<br />
sollte erforscht werden, ob mit Hilfe der Zusammensetzung der niedermolekularen<br />
Polyphenole Sorten differenziert und ob eventuell Sorten in Gruppen zusammengefasst<br />
werden können. Das Projekt wird vom <strong>Bayerische</strong>n Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung,<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten mit 20.000,- € gefördert.<br />
Methode<br />
Zuerst wurden geeignete Methoden zur Probenvorbereitung und HPLC-Trennung ausgearbeitet.<br />
Mit diesen Methoden wurde das ganze in Hüll verfügbare Welthopfensortiment<br />
der Erntejahre 2009 und 2010 analysiert. Einzelne Substanzen wurden mit Hilfe von Referenzsubstanzen<br />
identifiziert. An der TUM wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Coelhan<br />
auch Strukturaufklärungen mit einem Massenspektrometer durchgeführt.<br />
Ergebnisse<br />
Es hat sich herausgestellt, dass vor allem die Zusammensetzung der Quercetin- und<br />
Kämpferolglykoside sortenspezifisch ist. Das Erntejahr 2010 bestätigte die Ergebnisse der<br />
Ernte 2009. Die Abbildung 2 zeigt als Beispiel vier Chromatogramme der Sorten Opal,<br />
Hersbrucker Spät, Herkules und Zeus.<br />
Abb. 2: HPLC-Chromatogramme der Quercetin- und Kämpferolglykoside von den Sorten<br />
Opal, Hersbrucker Spät, Herkules und Zeus
101 Projekte und Daueraufgaben<br />
Diese ausgewählten Sorten zeigen ganz eindeutige Unterschiede. Andere Sorten wie die<br />
alten Landsorten sind jedoch in ihrer Flavonoidzusammensetzung sehr ähnlich. Die Abbildung<br />
3 zeigt die chemischen Strukturen, der mit Hilfe von Referenzsubstanzen und<br />
massenspektroskopischen Untersuchungen identifizierten Substanzen.<br />
Abb. 3: Identifizierte Flavonoide<br />
Die Substanz 1 leitet sich von der Verbindung Multifidolglukosid ab, das seinen Namen<br />
nach der tropischen Pflanze „Jatropha multifida“ hat. Dieser Inhaltsstoff hat entzündungshemmende<br />
Eigenschaften und ist deshalb pharmakologisch interessant. Sorten mit hohen<br />
Gehalten an Substanz 1 sind zum Beispiel Hall. Tradition oder Perle.<br />
Eine Auswertung der Daten mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse hat gezeigt, dass<br />
keine Gruppenbildung möglich ist.<br />
Schlussfolgerung<br />
Die Analytik der Quercetin- und Kämpferolglykoside ist ein zusätzliches Hilfsmittel, um<br />
Sorten zu differenzieren. Einige Sorten sind sehr gut unterscheidbar. Die alten Landsorten<br />
sind jedoch ziemlich ähnlich. In dieser Arbeit wurde zum ersten Mal das gesamte Welthopfensortiment<br />
hinsichtlich der Zusammensetzung der niedermolekularen Polyphenole<br />
systematisch untersucht.
102 Projekte und Daueraufgaben<br />
Projektleitung: Dr. K. Kammhuber<br />
Projektbearbeitung: Dr. K. Kammhuber, B. Sperr, E. Neuhof-Buckl, B. Wyschkon<br />
Laufzeit: 2010 - <strong>2011</strong><br />
Kooperation Dr. M. Coelhan, Lehrstuhl <strong>für</strong> chemisch technische Analyse,<br />
TUM, Weihenstephan<br />
3.6 Hoheitsvollzug<br />
3.6.1 Amtliche Saatenanerkennung (IPZ 6a)<br />
Zielsetzung<br />
Zentrale Aufgabe der Saatenanerkennung ist die Sicherstellung der Marktversorgung mit<br />
qualitativ hochwertigem Saat- und Pflanzgut. Ausgehend von der Tatsache, dass leistungsfähiges<br />
Saatgut das wichtigste Betriebsmittel <strong>für</strong> die Erzeugung pflanzlicher Produkte ist,<br />
genießt die Saatgutproduktion eine sehr hohe Wertschätzung in allen Ländern. Das deutsche<br />
Saatgutrecht basiert auf den detaillierten Vorschriften des europäischen Saatgutrechtes.<br />
Im Laufe der Zeit und durch die Erweiterung der EU auf nunmehr 27 Mitgliedsstaaten<br />
wurde dieses Recht mehrfach geändert und erweitert. Derzeit läuft auf europäischer Ebene<br />
ein Prozess der Neugestaltung des Saatgutrechtes. In der Diskussion wird deutlich, dass in<br />
einigen Staaten unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der notwendigen staatlichen<br />
Maßnahmen bestehen. Die Bundesregierung hat sich mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung<br />
der Zertifizierung von Saatgut weitgehend allein positioniert. Die Mehrzahl der<br />
Mitgliedsstaaten fordert eine Modifizierung der bisherigen Regelungen unter Beibehaltung<br />
der staatlichen Aufsicht und Zertifizierung.<br />
Die Absichten der EU-Kommission gehen derzeit in die Richtung, dass das reformierte<br />
Saatgutrecht zwar als eigenständiger Rechtsbereich erhalten bleiben soll, dass aber die<br />
Durchführung und die Überwachung im Rahmen der EU-Verordnung 882/2004 erfolgen<br />
soll. Nach dieser Verordnung werden bisher die Bereiche Vieh und Fleisch, Lebensmittel,<br />
Tiergesundheit und Tierschutz überwacht. Die Haltung der Kommission wird unter anderem<br />
durch die Bundesregierung unterstützt. Viele Fachleute, darunter die mittelständischen<br />
Züchter und die bayerische Saatgutwirtschaft be<strong>für</strong>chten einen Verlust von Fachkompetenz<br />
bei einer gleichzeitigen Zunahme von Bürokratie.<br />
Im Rahmen von Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren müssen nationale, risikobasierte<br />
Kontrollpläne erstellt werden. Jährlich sind Berichte über die durchgeführten Kontrollmaßnahmen<br />
an die Kommission zu senden. Die Kommission ihrerseits wird mit eigenen<br />
Kontrollteams in den Mitgliedsstaaten darüber wachen, ob die zuständigen Behörden zuverlässig<br />
arbeiten.<br />
Die Infragestellung der Notwendigkeit amtlicher Maßnahmen im Rahmen der Saatenanerkennung<br />
hat zu vielen, teilweise auch heftigen Diskussionen geführt. In Deutschland und<br />
speziell in Bayern fordert die große Mehrheit der Wirtschaftsbeteiligten, das amtliche Verfahren<br />
der Saatenanerkennung insgesamt zu erhalten. Die Saatgutwirtschaft bei uns empfindet<br />
es weniger als bürokratische Belastung, sondern vielmehr als ein ausgefeiltes<br />
Dienstleistungsverfahren. Wünsche bestehen von Seiten der Saatgutwirtschaft an einer<br />
stärkeren Einbindung privater Elemente in das Anerkennungsverfahren.
103 Projekte und Daueraufgaben<br />
<strong>2011</strong> wurde die Feldbestandsprüfung bei Zertifiziertem Saatgut von Getreide und bei Zertifiziertem<br />
Pflanzgut von Kartoffeln in Bayern auf das LKP übertragen. Die Übernahme<br />
und die Durchführung erfolgte unter der fachlichen Aufsicht der LfL unter Mithilfe der<br />
SG 2.1 P (Fachzentren <strong>für</strong> Pflanzenbau). Die Feldbestandsprüfung bei den hochwertigen<br />
Kategorien Vorstufe und Basis sowie bei den übrigen Fruchtarten (Futterpflanzen und Leguminosen)<br />
wurde <strong>2011</strong> wie bisher amtlich durch die LfL und die SG 2.1 P durchgeführt.<br />
Im Rahmen der Übertragung auf Mitarbeiter des LKP waren in diesem und sind in den<br />
folgenden Jahren umfangreiche Schulungsmaßnahmen notwendig.<br />
2012 ist beabsichtigt, auch die Feldbestandsprüfung bei großkörnigen Leguminosen auf<br />
das LKP zu übertragen.<br />
Methode<br />
Die Durchführung der Anerkennungsverfahren in Bayern obliegt der Arbeitsgruppe IPZ<br />
6a der LfL. Für die Eröffnung des Anerkennungsverfahrens ist ein Antrag an die Anerkennungsstelle<br />
notwendig. Die Anmeldungen werden von Züchtern oder den vertraglich<br />
beauftragten Betrieben des Handels (VO-Firmen) durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt<br />
aus Rationalisierungsgründen fast ausschließlich auf elektronischem Wege. Auch die Zustellung<br />
der Anerkennungsbescheide erfolgt zunehmend mittels E-Mail.<br />
Unterstützt wird die Arbeit von IPZ durch Beauftragte an den Ämtern <strong>für</strong> Ernährung,<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten mit Sonderfunktionen, jetzt Fachzentren <strong>für</strong> Pflanzenbau. Eine<br />
wichtige Funktion ist die Organisation und Durchführung der Feldbesichtigungen. Darüber<br />
hinaus werden Vermehrer und Saatgutfirmen beraten und angemessen überwacht. Die<br />
Probenahme, Verschließung und Kennzeichnung von Saatgut werden unter Aufsicht der<br />
Amtlichen Saatenanerkennung durch das LKP durchgeführt. Die Aufgaben und die Einzelheiten<br />
<strong>für</strong> diese Tätigkeiten werden jährlich im sogenannten Plombierungsausschuss<br />
festgelegt. In diesem Ausschuss sind die <strong>Landesanstalt</strong>, das LKP sowie Vertreter der<br />
Züchter und des Saatguthandels vertreten.<br />
Ergebnisse<br />
Die angemeldete Vermehrungsfläche <strong>für</strong> Getreide erhöhte sich in Deutschland von<br />
116.821 ha auf 122.599 ha in <strong>2011</strong>. In Bayern war eine Flächenmehrung bei Getreide von<br />
12.196 ha auf 12.936 ha zu verzeichnen. Dies bedeutet einen Anstieg der Vermehrungsflächen<br />
um 6 %.
104 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 1: Zur Saatgutanerkennung angemeldete Flächen in Bayern<br />
2010<br />
Bayern<br />
<strong>2011</strong><br />
Bayern<br />
Veränderungen<br />
<strong>2011</strong> zu 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
Bund<br />
Anteil<br />
Bayern<br />
Fruchtart<br />
ha ha % ha %<br />
Winterweichweizen 4.729 5.177 9,5 56.129 9,2<br />
Wintergerste 2.670 2.562 -4,0 22.686 11,3<br />
Wintertriticale 1.100 1.193 8,5 9.949 12,0<br />
Winterroggen 643 760 18,3 11.125 6,8<br />
Winterspelzweizen 216 261 21,0 1.129 23,1<br />
Sommergerste 1.872 2.071 10,7 9.780 21,2<br />
Hafer 669 585 -12,6 3.728 15,7<br />
Hartweizen 45 19 -58,1 830 2,3<br />
Sommerweichweizen 214 254 18,7 2.245 11,3<br />
Sommerroggen 0 0 - 343 0,0<br />
Sommertriticale 27 38 42,2 673 5,6<br />
Mais 11 16 41,0 3.982 0,4<br />
Getreide gesamt: 12.196 12.936 6,1 122.599 10,6<br />
Gräser 897 799 -10,9 26.362 3,0<br />
Leguminosen 2.087 1.823 -12,6 11.428 16,0<br />
Öl- und Faserpflanzen 133 74 -44,4 7.517 1,0<br />
Sonst. Futterpflanzen 59 26 -55,9 469 5,5<br />
Saatgut gesamt: 15.372 15.658 1,9 168.375 9,3<br />
Kartoffeln gesamt: 2.489 2.447 -1,7 16.605 14,7<br />
In Tabelle 1 sind die in Bayern zur Saatenanerkennung angemeldeten Flächen der Jahre<br />
2010 und <strong>2011</strong> sowie die Bundesflächen aus dem Jahr <strong>2011</strong> enthalten.<br />
Die bayerischen Vermehrungsflächen bei Saatgut insgesamt sind seit Jahren rückläufig.<br />
Im Erntejahr <strong>2011</strong> stiegen sie jedoch um 1,9 % gegenüber 2010. So beträgt die Vermehrungsfläche<br />
bei Saatgut 15.658 ha. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg bei den bedeutenden<br />
Getreidearten zurückzuführen.<br />
Ein stetiger Rückgang ist weiterhin nur bei Wintergerste (- 108 ha) und Hafer (- 84 ha)<br />
ausgeprägt. Aufgrund knapper Saatgutbestände wurden vor allem die Vermehrungsflächen<br />
von Winterweichweizen (+ 448 ha), Sommergerste (+ 199 ha), Winterroggen (+ 117 ha)<br />
und Wintertriticale (+ 93 ha) ausgedehnt. Ebenfalls wurden mehr Spelzweizen und Sommerformen<br />
von Weizen und Triticale vermehrt.<br />
Die Vermehrungsfläche bei Gräsern fiel um circa 10,9 %, besonders stark beim Deutschen<br />
Weidelgras. Auch die der Leguminosen reduzierte sich in dieser Größenordnung. Der<br />
Rückgang bei den Futtererbsenflächen war hier augenfällig. Die Frühsommertrockenheit<br />
führte regional zu Ertragseinbußen. Die Öl- und Faserpflanzen und die Sonstigen Futterpflanzen<br />
sind flächenmäßig nicht maßgeblich.<br />
Die durchschnittliche Vermehrungsfläche je Vorhaben bewegt sich seit Jahren bei rd.<br />
6 ha.
105 Projekte und Daueraufgaben<br />
Bei der Vermehrung von Pflanzkartoffeln nahm die Vermehrungsfläche geringfügig um<br />
42 ha ab. Der Ertrag nahm um ca. 5 % zu und liegt <strong>2011</strong> bei 370 dt/ha. Der Ertrag in der<br />
<strong>für</strong> Pflanzkartoffeln vorwiegend in Frage kommenden Sortierbreite von 35 bis 55 mm lag<br />
mit 55 % gegenüber 71 % im vergangenen Jahr sehr niedrig.<br />
Die erzeugte Menge in dieser Fraktion liegt bei 50.700 t gegenüber 62.000 t im Jahr 2010.<br />
Der Anteil der Übergrößen (>55 mm) war mit 43 % sehr hoch. Dies ist darauf zurückzuführen,<br />
dass die lange Trockenheit im Frühjahr und Frühsommer vielerorts zu einem geringen<br />
Knollenansatz führte. Durch den einsetzenden Regen entwickelten sich die wenigen<br />
Knollen kräftig, während ein <strong>für</strong> die Ernte nötiger Stärkegehalt erst spät erreicht wurde.<br />
Erfreulich waren die in ganz Bayern optimalen trockenen Erntebedingungen im Herbst<br />
<strong>für</strong> die Rodung der mittelfrühen und späteren Sorten.<br />
Der hohe durchschnittliche Flächenertrag von 370 dt/ha führte trotz Reduzierung der Anbaufläche<br />
zu einer Erhöhung der Gesamterntemenge bei Pflanzkartoffeln von 84.000 t im<br />
Jahr 2010 auf heuer 92.000 t, wobei ein erheblicher Anteil Übergrößen enthalten sind.<br />
Die Anerkennungsquote bei Pflanzkartoffeln liegt mit ca. 92 % im durchschnittlichen Bereich.<br />
Aus den nördlichen und östlichen Bundesländern wird von hohen Anerkennungsquoten<br />
berichtet, während der Süden voraussichtlich nur durchschnittliche Werte erreicht.<br />
Allerdings stellt sich die Problematik mit großfallender Ware bis auf wenige Ausnahmen<br />
in der ganzen Bundesrepublik, so dass es bei einzelnen Sorten in der Normalsortierung zu<br />
Engpässen kommen kann.<br />
In einem Betrieb trat Bakterielle Ringfäule auf. Hier war Z2-Pflanzgut befallen. Alle anderen<br />
Partien des Betriebs einschließlich der Konsumpartien waren frei.<br />
Abb. 1: Entwicklung der Anzahl der Vermehrungsbetriebe in Bayern und der durchschnittlichen<br />
Vermehrungsfläche je Betrieb bei Saatgetreide Anzahl der Vermehrer <strong>2011</strong>:<br />
685; Getreidevermehrungsfläche je Betrieb 18,9 ha
106 Projekte und Daueraufgaben<br />
Der langjährige Rückgang der Vermehrungsfläche hat auch auf die Strukturentwicklung<br />
Einfluss. So halbierte sich bei Getreide die Anzahl der aktiven Vermehrer innerhalb der<br />
letzten 15 Jahre. <strong>2011</strong> sank die Anzahl der Vermehrungsbetriebe noch einmal von 721 auf<br />
685. Die durchschnittliche Vermehrungsfläche je Betrieb erhöhte sich dementsprechend<br />
auf 18,9 ha.<br />
Anfang des Jahres erfolgt schwerpunktmäßig die Anerkennung von Sommergetreide <strong>für</strong><br />
die Frühjahrsbestellung. Durch den starken Rückgang der Vermehrungsfläche bei Sommergerste<br />
zur Ernte 2010 nahm die anerkannte Saatgutmenge bei Sommergetreide insgesamt<br />
um 31 % auf 129.339 dt ab. Die schwierigen Witterungsbedingungen 2010 mit einer<br />
langen Trockenphase im Juli und langanhaltenden Niederschlägen im August waren <strong>für</strong><br />
mindere Keimfähigkeiten verantwortlich. Dies war der Hauptgrund <strong>für</strong> die höhere Ablehnungsquote<br />
von knapp 10 %.<br />
Tab. 2: Anerkennung von Sommergetreide aus der Ernte 2010 (Stand: 01.04.<strong>2011</strong>)<br />
Anmeldung Saatgutuntersuchung und -anerkennung*<br />
anerkannt<br />
Fruchtart Bund Bayern abgelehnt<br />
Vorstufen-<br />
Zertifiziertes<br />
und Basis-<br />
insgesamt<br />
Saatgut<br />
saatgut<br />
ha ha dt dt dt dt<br />
Sommergerste 8.935 1.872 8.757 13.026 75.725 88.751<br />
Sommerhafer 3.751 669 3.647 6.009 24.298 30.307<br />
Mais 3.782 11 44 44<br />
Sommerroggen 259 0<br />
Sommertriticale 438 27 290 410 140 550<br />
Sommerhartweizen 1.014 45 505 495 495<br />
Sommerweichweizen 1.990 214 815 1.860 7.332 9.192<br />
Sommergetreide<br />
gesamt:<br />
20.169 2.838 14.014 21.349 107.990 129.339<br />
Angemeldete Vermehrungsfläche bei Sommergetreide im Bundesgebiet: 20.169 ha; Anteil Bayerns: 14,1 %<br />
*Nicht enthalten sind Saatguterträge von Vermehrungsvorhaben, die zwar in Bayern anerkannt wurden,<br />
deren Aufwuchs aber von Flächen aus anderen Bundesländern stammt.<br />
Bei Wintergetreide nahm zur Ernte <strong>2011</strong> die anerkannte Saatgutmenge aus bayerischem<br />
Aufwuchs um rund 17 % zu. Neben dem Zuwachs an Vermehrungsfläche waren die im<br />
Vergleich zu 2010 besseren Erntebedingungen ausschlaggebend <strong>für</strong> die höhere Saatgutausbeute.<br />
Die gute Kornausbildung und hohe Tausendkorngewichte ließen regional sehr<br />
gute Saatguterträge einfahren. Mindererträge durch Hagelschaden im nördlichen Oberbayern<br />
und die gebietsweise teils geringe Bestandesdichte aufgrund langanhaltender Frühjahrstrockenheit<br />
konnten dadurch ausgeglichen werden. Die zur Untersuchung eingereichten<br />
Proben waren von guter Qualität, so dass die Aberkennungsquote bei nur 6,3 % lag.<br />
Lediglich Triticale musste im größeren Umfang wegen Besatz mit anderen Arten aberkannt<br />
werden.
107 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 3: Anerkennung von Wintergetreide aus der Ernte <strong>2011</strong> (Stand: 01.11.<strong>2011</strong>)<br />
Anmeldung Saatgutuntersuchung und -anerkennung*<br />
anerkannt<br />
Fruchtart Bund Bayern abgelehnt<br />
VorstufenundBasissaatgut<br />
Zertifiziertes<br />
Saatgut<br />
insgesamt<br />
ha ha dt dt dt dt<br />
Wintergerste 22.686 2.562 8.807 17.903 97.940 115.843<br />
Winterroggen 11.125 760 1.172 32.759 32.759<br />
Wintertriticale 9.949 1.193 7.972 1.880 54.403 56.283<br />
Winterspelzweizen 1.129 261 166 10 7.121 7.131<br />
Winterweichweizen 56.129 5.177 18.476 49.561 281.508 331.069<br />
Wintergetreide<br />
gesamt:<br />
101.190 9.953 36.593 69.354 473.731 543.085<br />
Angemeldete Vermehrungsfläche bei Wintergetreide im Bundesgebiet: 101.190 ha; Anteil Bayerns: 9,8 %<br />
*Nicht enthalten sind Saatguterträge von Vermehrungsvorhaben, die zwar in Bayern anerkannt wurden, deren<br />
Aufwuchs aber von Flächen aus anderen Bundesländern stammt.<br />
Die Anerkennung von Saatgut nach § 12 Abs. 1b, SaatgutV (Nicht obligatorische Beschaffenheitsprüfung<br />
– kurz: NOB) konnte sich in Bayern etablieren. Insgesamt wurden<br />
nach diesem System 49.475 dt anerkannt. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem<br />
Vorjahr (43.835 dt). Die Flächenmehrung und die guten Saatguterträge spiegelten sich<br />
hier wider.<br />
Tab. 4: Nicht obligatorische Beschaffenheitsprüfung (NOB) nach § 12 (1b) SaatgutV<br />
(Ernte <strong>2011</strong>)<br />
Fruchtart<br />
dt gesamt abgelehnt anerkannt dt %<br />
Sommergerste 9.570 37 5 32 8.120 85<br />
Sommerhartweizen 530 2 2 0 0<br />
Sommerweichweizen 700 3 3 700 100<br />
Wintergerste 875 4 4 875 100<br />
Wintertriticale 2.330 9 8 1 300 13<br />
Winterweichweizen 43.680 169 16 153 39.480 90<br />
Getreide gesamt: 57.685 224 31 193 49.475 86<br />
* Stand 02.01.2012<br />
Vorgestellte Menge nach § 12 (1b) SaatgutV*<br />
Partien<br />
anerkannte Menge<br />
nach § 12 (1b)*
108 Projekte und Daueraufgaben<br />
In Bayern gibt es derzeit vier Aufbereitungsbetriebe, welche an diesem Verfahren teilnehmen.<br />
Der große Vorteil des NOB-Verfahrens liegt vor allem darin, dass nicht die gesamte<br />
Menge des angelieferten Saatgutes vor der Anerkennung dem teuren und zeitaufwändigen<br />
Aufbereitungsverfahren unterzogen werden muss. So muss nur derjenige Teil<br />
endgültig aufbereitet werden, der, je nach Nachfrage, auch auf dem Markt verkauft werden<br />
kann. In der Tabelle 4 sind die Ergebnisse aus dem NOB-Verfahren in Bayern dargestellt.<br />
Die Mischungsanträge nahmen in der Zahl und der beantragten Menge erheblich zu. Dies<br />
ist auch auf den erhöhten Zwischenfruchtanbau <strong>für</strong> Zwecke der Biogasgewinnung zurückzuführen.<br />
Auch der technische Bereich (keine landwirtschaftliche Nutzung), z.B. Rasen<br />
oder Böschungsansaaten, weitete sich aus.<br />
Tab. 5: Umfang der Saatgutmischungen <strong>2011</strong> in Bayern<br />
Projektleitung: H. Kupfer<br />
Projektbearbeitung: G. Bauch, E.-M. Eisenschink, L. Linseisen<br />
Menge<br />
dt<br />
<strong>2011</strong><br />
Anzahl der<br />
Anträge<br />
<strong>für</strong> Futterzwecke<br />
- Ackerfutterbau 18.770 488<br />
davon bayer. Qualitätssaatgutmischungen (2002) (78)<br />
- Dauergrünland 16.480 537<br />
davon bayer. Qualitätssaatgutmischungen (2.601) (96)<br />
Getreide<br />
- Mahlweizen 915 4<br />
- Roggenmischungen 15.951 21<br />
- Wintertriticale/Winterroggen 3.547 21<br />
Technischer Bereich (Rasen und Sonstiges) 32.034 885<br />
Mischungen insgesamt: 87.697 1.956
109 Projekte und Daueraufgaben<br />
3.6.2 Verkehrs- und Betriebskontrollen (IPZ 6b)<br />
Zielsetzung<br />
Die Arbeitsgruppe Verkehrs- und Betriebskontrollen IPZ 6b ist beauftragt, die Einhaltung<br />
von Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Saat- und Pflanzgut der<br />
landwirtschaftlichen Arten (seit dem 1. August 2003 auch von Gemüsearten) nach dem<br />
Saatgutrecht, von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln<br />
nach dem Düngemittelrecht sowie von Pflanzenschutzmitteln, Pflanzenstärkungsmitteln<br />
und Zusatzstoffen nach dem Pflanzenschutzrecht zu überwachen.<br />
Die zu überwachenden Vorschriften dienen überwiegend dem Umwelt- und Anwenderschutz<br />
und verfolgen sehr hoch angesiedelte Ziele:<br />
• die Förderung der Saatgutqualität, den Schutz des Verbrauchers, die Ordnung des<br />
Saatgutverkehrs, die Sicherung des Saatgutes vor Verfälschung, die Förderung der Erzeugung<br />
und der Qualität von Saat- und Erntegut im Bereich des Saatgutrechts;<br />
• die Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens, den Schutz der Gesundheit von Menschen<br />
und Tieren und den Schutz des Naturhaushaltes, die Förderung des Wachstums von<br />
Nutzpflanzen, die Erhöhung ihres Ertrages und die Verbesserung ihrer Qualität, die<br />
Ordnung des Verkehrs mit Düngemitteln und den Schutz des Anwenders im Bereich<br />
des Düngemittelrechts;<br />
• den Schutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen und nichtparasitären<br />
Beeinträchtigungen, die Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung<br />
von Pflanzenschutzmitteln <strong>für</strong> die Gesundheit von Mensch und Tier und <strong>für</strong> den Naturhaushalt<br />
entstehen können, die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen im Bereich<br />
des Pflanzenschutzrechts.<br />
Aufgaben<br />
Innerhalb Bayerns koordiniert die Arbeitsgruppe die Kontrolltätigkeit der Beauftragten,<br />
die an den Ämtern <strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> und Forsten (AELF) mit Fachzentrum<br />
Pflanzenbau (FZ 3.1) angesiedelt sind. In den Aufgabenbereich fallen u.a. die Bearbeitung<br />
der Protokolle über die durchgeführten Kontrollen der Beauftragten, die Veranlassung der<br />
Laboruntersuchungen der Proben, die im Rahmen der Kontrollen von Saatgut, Düngemitteln<br />
und Pflanzenschutzmitteln gezogen wurden, sowie die weiteren Veranlassungen bei<br />
festgestellten Verstößen. Auf Bundesebene hält IPZ 6b Kontakt mit den Kontrollbehörden<br />
der anderen Bundesländer um eine einheitliche Vorgehensweise bei den Kontrollen zu<br />
gewährleisten.
110 Projekte und Daueraufgaben<br />
Tab. 1: Probeziehung im Rahmen der Saatgut- (SVK) und Düngemittelverkehrskontrolle<br />
(DVK) und zahlenmäßige Vorgaben <strong>für</strong> die Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle (PVK)<br />
im Jahre <strong>2011</strong><br />
AELF<br />
DVK-<br />
Proben<br />
Pflanzkartoffeln<br />
-Virus-<br />
SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST<br />
A 95 97 24 25 95 105 15 15 85 86<br />
AN 65 65 10 10 65 65 9 10 44 47<br />
BT 55 54 7 7 55 53 9 6 45 59<br />
DEG 95 95 19 18 95 94 11 14 74 75<br />
R 85 85 16 16 85 88 10 10 60 49<br />
RO 50 54 8 8 50 72 7 9 79 85<br />
WÜ 75 75 6 6 75 79 13 9 56 63<br />
BY 520 525 90 90 520 556 74 73 443 464<br />
+5 +36 -1 +21<br />
Ausgewählte Ergebnisse der Tab. 1:<br />
SVK-<br />
Proben<br />
(ldw. Arten)<br />
SVK-<br />
Proben<br />
Gemüse<br />
PVK<br />
Handelsbetriebe<br />
Düngemittelverkehrskontrolle (DVK-Proben)<br />
Im Rahmen der DVK wurden 525 Düngemittel beprobt und im Düngemittellabor der LfL<br />
(AQU 1) analysiert. Aufgrund der Ergebnisse mussten 78 Düngemittel beanstandet werden<br />
(Beanstandungsquote: 14,7 %). Insgesamt wurden 64 verschiedene Düngemitteltypen<br />
untersucht. Diese waren nach deutschem Recht (DüMV: 39 Typen) oder nach EU-Recht<br />
(VO (EU) 2003/2003: 25 Typen) Inverkehr gebracht worden. Am häufigsten war der<br />
Düngemitteltyp „NPK-Dünger (EG-Düngemittel)“ mit 90 Kontrollen, gefolgt von den<br />
Typen „Kalkammonsalpeter“ (59 Kontrollen) und „NP-Dünger (EG-Düngemittel)“ (43<br />
Kontrollen) beprobt worden.<br />
Die höchsten Beanstandungsquoten (bei mehr als zwei Kontrollen/Düngertyp) waren bei<br />
den Düngemitteltypen „PK-Dünger“ (drei Beanstandungen bei vier Kontrollen), „Organisch-mineralische<br />
NPK-Dünger“ (14 Beanstandungen bei 28 Kontrollen) und „Ammoniumnitrat“<br />
(fünf Beanstandungen bei elf Kontrollen).<br />
Im Rahmen der DVK wurden die verschiedensten Düngemittel überprüft. Neben mineralischen,<br />
organischen und organisch-mineralischen Düngemittel wurden auch flüssige Düngemittel,<br />
Spurennährstoffdünger, Blumendünger u. a. in die Verkehrskontrollen mit einbezogen.<br />
Die Auswahl der überprüften Düngemitteltypen berücksichtigt neben dem Aspekt<br />
„Bisher festgestellte Verstöße“ auch die „Marktbedeutung“, „Verfügbarkeit im Handel“<br />
und „Sonstige Auffälligkeiten“.<br />
Dabei wurden im Rahmen der Kontrollen neben der stofflichen Zusammensetzung der<br />
beprobten Düngemittel auch bei 3.129 Düngemitteln die Kennzeichnungen überprüft (acht<br />
Beanstandungen).
111 Projekte und Daueraufgaben<br />
Pflanzkartoffeln – Virus –<br />
Bei den Kontrollen von Pflanzkartoffeln wurden bei insgesamt 90 Partien die Zahl von<br />
637 Merkmalen überprüft. Sieben Partien mussten wegen Mängeln bei Beschaffenheit und<br />
Virusbesatz beanstandet werden.<br />
Saatgutverkehrskontrolle (SVK-Proben landwirtschaftliche Arten und Gemüse)<br />
Bei der Saatgutverkehrskontrolle wird der Saatguthandel, sowohl landwirtschaftlicher Arten<br />
(556 Proben), als auch Gemüsesaatgut (73 Proben), überwacht. Im Rahmen der Kontrollen<br />
wurden insg. 3.489 Merkmale überprüft. Die Beanstandungen beziehen sich vor allem<br />
auf Keimfähigkeit, Besatz und Reinheit, aber auch auf die Kennzeichnung.<br />
Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle (PVK Handelsbetriebe)<br />
Durch die Beauftragten wurden im Rahmen der Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle<br />
464 Handelsbetriebe überprüft. Hierbei sind 19.690 Pflanzenschutzmittel (PSM) einer<br />
Sichtprüfung unterzogen worden. Bei 118 Mitteln kam es zu einer Beanstandung, hauptsächlich<br />
weil das PSM zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht zugelassen war oder die Kennzeichnung<br />
nicht in deutscher Sprache war. Außerdem wurden 309 Pflanzenstärkungsmittel<br />
(ohne Beanstandung) und 119 Zusatzstoffe (2 Beanstandungen) überprüft.<br />
Gleichzeitig wurden, soweit möglich, die Einhaltung der Anzeigepflicht (§21a PflSchG,<br />
23 Verstöße), das Verbot der Selbstbedienung (§22 Abs. 1 PflSchG, 22 Verstöße), das<br />
Gebot der Unterrichtung des Erwerbers (§22 Abs. 2 PflSchG, 1 Verstoß), sowie die Sachkunde<br />
des Abgebers (§22 Abs. 3 PflSchG, 11 Verstöße) überprüft. In 4 Fällen musste dem<br />
überprüften Betrieb das Feilhalten und die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln untersagt<br />
werden. (Hinweis: Die hier zitierte Rechtsgrundlage wurde mit Erlass des Gesetzes zur<br />
Neuordnung des Pflanzenschutzrechtes am 6. Februar 2012 außer Kraft gesetzt.)<br />
Neben den klassischen Landhandelsbetrieben wurden auch Verbraucher- und Heimwerker-Märkte<br />
(117), Gärtnereien und Blumengeschäfte (69), sowie Apotheken (49) überprüft.<br />
Zunehmend gewinnt auch der Pflanzenschutzmittelhandel im Internet an Bedeutung. Aufgrund<br />
einer Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzmittelverkehrskontrolle<br />
der Länder (AG PVK) recherchieren beauftragte Kollegen im Bundesgebiet nach einschlägigen<br />
Angeboten. Bei festgestellten Verstößen werden die Angebote auf den Internet-Plattformen<br />
gelöscht und der Vorgang der jeweils zuständigen Länderstelle zur weiteren<br />
Veranlassung abgegeben.<br />
Insgesamt wurden 19 Pflanzenschutzmittel (15 Plan- und 4 Anlasskontrollen) zur Überprüfung<br />
der stofflichen Qualität an das Bundesamt <strong>für</strong> Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(BVL) übersandt. Zwei Pflanzenschutzmittel mussten aufgrund dieser Laboruntersuchung<br />
beanstandet werden.<br />
Ämterstruktur<br />
Vom „Konzept der Weiterentwicklung der <strong>Landwirtschaft</strong>sverwaltung in Bayern“ waren<br />
die Beauftragten <strong>für</strong> die Verkehrs- und Betriebskontrollen an den Ämtern mit Sachgebiet<br />
2.1P ebenso betroffen, wie alle anderen Kollegen an den Ämtern. Diese sind jetzt den neu<br />
errichteten Fachzentren <strong>für</strong> Pflanzenbau (FZ 3.1) zugeordnet. Die mit der Umsetzung des<br />
Konzeptes verbundenen Personalveränderungen gehen über die normale Fluktuation weit
112 Projekte und Daueraufgaben<br />
hinaus und stellen vor dem Hintergrund dieser Spezialaufgabe <strong>für</strong> alle Seiten eine große<br />
Herausforderung dar.<br />
Projektleiter: H. Geiger (bis 30.04.<strong>2011</strong>), Peter Geiger (ab 01.05.<strong>2011</strong>)<br />
Projektbearbeiter: H. Geiger, P. Geiger (ab 01.04.<strong>2011</strong>), J. Schwarzfischer<br />
3.6.3 Beschaffenheitsprüfung Saatgut und Saatgutforschung (IPZ 6c und<br />
6d)<br />
Saatgut ist <strong>für</strong> die <strong>Landwirtschaft</strong> ein sehr wichtiges Betriebsmittel. Beim Kauf von Zertifiziertem<br />
Saatgut erwarten die Landwirte gut gereinigte Ware sowie einen hohen Feldaufgang.<br />
Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens wird in den Arbeitsgruppen IPZ 6c und<br />
IPZ 6d die Beschaffenheitsprüfung <strong>für</strong> landwirtschaftliches Saatgut nach dem Saatgutverkehrsgesetz<br />
durchgeführt. Neben den Saatgutproben <strong>für</strong> das Anerkennungsverfahren und<br />
den Saatgutexport werden auch Proben <strong>für</strong> die Saatgutverkehrskontrolle (SVK), die amtliche<br />
Pflanzenbeschau, das Privatlabor Kiel zur amtlichen Nachkontrolle, Versuche (aktuelle<br />
Fragen aus der Praxis, Arbeitsgruppen der LfL, Fachhochschule, Wissenschaftszentrum<br />
Weihenstephan, Forschungsprojekte) und <strong>für</strong> Dritte (Züchter, Aufbereiter, Handel, Landwirte<br />
und Ökoverbände) untersucht. SVK-Proben wurden stichprobenweise zum Nachweis<br />
von genetisch veränderten Organismen (GVO) an das Gentechniklabor des <strong>Bayerische</strong>n<br />
Landesamtes <strong>für</strong> Gesundheit, Lebensmittelsicherung (LGL) in Oberschleißheim<br />
weitergeleitet.<br />
<strong>2011</strong> wurden an 9.513 Saatgutproben über 35.000 Einzeluntersuchungen durchgeführt.<br />
Mit fast 400 verschiedenen Fruchtarten ist das untersuchte Artenspektrum vielfältig und<br />
anspruchsvoll. Im Rahmen der Qualitätssicherung hat das Saatgutlabor an drei internationalen<br />
(ISTA) und zwei nationalen (VDLUFA) Ringuntersuchungen mit sehr gutem Erfolg<br />
teilgenommen. In den Ringversuchen wurden bei den Fruchtarten Sonnenblumen (Helianthus<br />
annuus), Weizen (Triticum aestivum), Rotklee (Trifolium pratense), Wiesenrispe<br />
(Poa pratenis) und Basilikum (Ocimum basilicum) je nach Fragestellung die Technische<br />
Reinheit, der Fremdbesatz, die Keimfähigkeit, die Lebensfähigkeit, der Feuchtigkeitsgehalt,<br />
die Tausendkornmasse, die Echtheit und die Gesundheit bestimmt.<br />
Das Privatlabor der KWS Lochow führt im Rahmen der nicht amtlichen Beschaffenheitsprüfung<br />
die Untersuchungen an den eigenen Vermehrungen von Getreide und Futtererbsen<br />
durch. Zusammen mit der Anerkennungsstelle Niedersachsen prüfte das Saatgutlabor<br />
Freising drei Mitarbeiterinnen aus dem KWS Lochow Labor, ob Sie über ausreichende<br />
Kenntnisse in der Reinheits-, Besatz- und Keimfähigkeitsuntersuchung verfügen. Auf dem<br />
Gebiet der Reinheitsuntersuchung war eine Nachschulung erforderlich, die im Saatgutlabor<br />
Freising durchgeführt wurde.
113 Projekte und Daueraufgaben<br />
Sojabohnenanbau und Vermehrung in Bayern<br />
Zielsetzung<br />
Die Sojabohne ist eine Kurztagspflanze mit hohen Wärmeansprüchen und gedeiht daher<br />
am besten in warmen Körnermaisanbaulagen. Ähnlich wie beim Mais wurden bei der Sojabohne<br />
züchterische Fortschritte hinsichtlich einer früheren Abreife erzielt. Damit ist ein<br />
Vermehrungsanbau in günstigen Lagen Bayerns möglich. Die Vermehrung von Soja ist in<br />
Bayern Neuland und bedarf wissenschaftlicher Begleitung.<br />
Methode<br />
Die Keimfähigkeit im Labor wird unter optimalen Bedingungen im sterilen Quarzsand bei<br />
25 °C festgestellt. Im Praxisanbau auf dem Feld liegen nur selten Optimalbedingungen<br />
vor. Kalte oder nasskalte Witterung nach der Saat und während der Keimung stellen hohe<br />
Anforderungen an das Saatgut. Deshalb stellt sich die Frage, ob <strong>für</strong> die Berechnung der<br />
Aussaatstärke die Keimfähigkeit die richtige Bezugsgröße ist, oder ob nicht der Triebkraft-<br />
bzw. Kalttestwert herangezogen werden soll In den internationalen Vorschriften der<br />
ISTA zur Prüfung von Saatgut gibt es derzeit keine Untersuchungsmethode <strong>für</strong> die Triebkraftprüfung<br />
von Sojabohnen. Daher wird die Triebkraftmethode von Mais übernommen.<br />
Dazu werden die Proben in Ackererde eine Woche bei 10 °C in den Klimaschrank gestellt.<br />
Anschließend eine Woche bei 25 °C in die Klimakammer gebracht. Alternativ soll dazu<br />
eine Triebkraftprüfung bei 10 °C konstanter Temperatur mit getestet werden. Während der<br />
kühlen Phase haben Pilze und Mikroorganismen die Möglichkeit, insbesondere aus dem<br />
Boden, die Keimung zu beeinträchtigen. Die Folge sind meist anomale Keimlinge oder tote<br />
Samen. Nach bisherigen Beobachtungen scheint die Sojabohne nicht besonders pilzanfällig<br />
während der Keimung zu sein. Anhand der Ergebnisse des Feldaufganges soll entschieden<br />
werden, welche Methode den Wert liefert, der dem Feldaufgang am nächsten ist.<br />
Nach der Ermittlung des Feldaufganges werden die Parzellen weiterhin beobachtet. Jede<br />
Parzelle wird gedroschen und der Ertrag ermittelt. Anhand der Ertragsdaten kann entschieden<br />
werden, wie niedrig der Triebkraftwert sein darf um noch einen akzeptablen<br />
Feldaufgang und Ertrag erwarten zu können.<br />
Anhand der Ertragsergebnisse von unterschiedlichen Saatgutqualitäten (hohe, mittlere und<br />
niedrige Keimfähigkeit) lassen sich Rückschlüsse ziehen über den Einfluss von Triebkraft<br />
und Feldaufgang (Abb. 1).<br />
Abb. 1: Feldaufgang bei (1) niedriger, (2) mittlerer und (3) hoher Keimfähigkeit
114 Projekte und Daueraufgaben<br />
Für den Sojabohnenanbau ist die Abreife ein wesentlich begrenzender Faktor. Wir erwarten<br />
deshalb mit Spannung die Qualität des geernteten Sojabohnensaatgutes. Insbesondere<br />
im Hinblick auf die Kriterien Keimfähigkeit und Triebkraft. Aus diesem Grund werden<br />
zwei unterschiedliche Sorten angebaut. Die frühreife Sorte Merlin und die etwas spätere<br />
Sorte Cordoba. Die Versuchsstandorte wurden nach der Abreife ausgewählt.<br />
Rotthalmünster als klimatisch sehr günstiger Standort hat die besten Voraussetzungen <strong>für</strong><br />
eine gute Abreife. Dagegen gilt der zweite Standort in Oberhummel bei Freising als klimatisch<br />
durchschnittlich.<br />
Mehrjährige Ergebnisse zur Strategie gegen Zwergsteinbrand und Steinbrand<br />
im ökologischen Landbau<br />
Zielsetzung<br />
Zwergsteinbrand und Steinbrand sind derzeit die beiden ge<strong>für</strong>chtetsten Krankheiten im<br />
ökologischen Weizenanbau. Wenn Befall vorliegt ist die Ware meist unbrauchbar, egal ob<br />
es sich um Saat-, Konsum- oder Futterware handelt. Weizen ist eine wichtige Verkaufsfrucht<br />
im ökologischen Landbau, deshalb ist ein Stoßen der Ware <strong>für</strong> die Landwirte mit<br />
großen finanziellen Verlusten verbunden.<br />
Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes wurde untersucht, welchen Einfluss<br />
unterschiedliche Schwellenwerte der Brandsporen am Saatgut auf den Befall am Erntegut<br />
haben. Des weiteren wurde erstmals das Brandsporenpotential im Boden untersucht und<br />
dessen Einfluss auf das Befallsgeschehen betrachtet.<br />
Für die Praxis stellt sich die Frage, ob Schwellenwerte am Saatgut ausreichend sind oder<br />
ob künftig das Sporenpotential im Boden beim Weizen- und Dinkelanbau stärker berücksichtigt<br />
werden muss. Bei Steinbrand liegt der Schwellenwert <strong>für</strong> Saatgut in Bayern bei 20<br />
Sporen/Korn, während <strong>für</strong> Zwergsteinbrand noch kein Schwellenwert existiert. Da der<br />
Boden bisher weltweit noch nie untersucht wurde gibt es auch keine Schwellenwerte.<br />
Material und Methoden<br />
Die Versuche wurden auf Öko-Praxisflächen durchgeführt, die bereits ein Brandsporenpotenzial<br />
im Boden aufwiesen. Die Zwergsteinbrandversuche wurden an drei und die Steinbrandversuche<br />
an vier Standorten über ganz Deutschland verteilt angelegt. Die<br />
mehrfaktorielle Anlage der Feldversuche (Saatzeit, Sorte, Infektionsstufe) erfolgte als randomisierte<br />
Streifenanlage, mit einer Parzellengröße von 10-13 m². Mit einer anfälligen<br />
Winterweizen- und Dinkelsorte “A“ sowie einer weniger anfälligen Sorte “B“ bzw. “E“<br />
wurden die Versuche mit unterschiedlichen Infektionsstufen (Kontrolle, 20 und 100 Sporen/Korn)<br />
und vier Wiederholungen durchgeführt. Da die Zwergsteinbrandinfektion nahezu<br />
ausschließlich über das Sporenpotenzial des Bodens erfolgt, wurde zusätzlich eine Variante<br />
mit künstlicher Bodeninfektion (0,5 g Sporen/m²) angelegt. Bei Steinbrand findet<br />
die Infektion während der Keimung des Getreides statt, deshalb wurde der Einfluss der<br />
Saatzeit auf den Befall zusätzlich mit einer Früh- und Spätsaat untersucht.
115 Projekte und Daueraufgaben<br />
Ergebnisse<br />
Zwergsteinbrand<br />
Die Hauptinfektion bei Zwergsteinbrand findet über den Boden während der Bestockung<br />
statt, d. h. im Zeitraum November bis März. Die optimale Keimtemperatur <strong>für</strong> die Brandsporen<br />
liegt bei 0-5 °C. Diese Idealbedingungen herrschten im Herbst 2008 auf dem<br />
Standort in Baden-Württemberg vor. Im November fiel Schnee auf nicht gefrorenen Boden<br />
und die Schneedecke blieb bis März liegen. Zusammen mit dem Licht unter der<br />
Schneedecke waren optimale Bedingungen <strong>für</strong> die Keimung der Brandsporen und den Befall<br />
der jungen Weizenpflanzen gegeben. Mit über 11.500 Sporen/Korn am Erntegut war<br />
dies der höchste Befall in den drei Jahren an einem Standort (Tab. 1).<br />
Tab. 1: Besatz mit Zwergsteinbrand am Erntegut auf dem Standort Baden-Württemberg,<br />
sowie das Sporenpotenzial im Boden nach der Saat und nach der Ernte (2009)<br />
Behandlung<br />
Sporen/Korn<br />
Sporen in 10 g Boden<br />
am Erntegut nach der Saat nach der Ernte<br />
Kontrolle 8.300 152 7.112<br />
Bodeninfektion 11.571 80 29.376<br />
20 Sporen/Korn 2.391 87 7.676<br />
100 Sporen/Korn 1.966 29 4.374<br />
Erwartungsgemäß hatte die Variante Bodeninfektion den höchsten Befall. Dies konnte<br />
auch auf den anderen Standorten und in anderen Versuchsjahren beobachtet werden. Zwischen<br />
den beiden Saatgutinfektionsstufen 20 und 100 Sporen/Korn zeigte sich in keinem<br />
Jahr und auf keinem Standort ein signifikanter Befallsunterschied am Erntegut. In den anderen<br />
Jahren und Versuchsstandorten waren keine Befallsbedingungen gegeben. Entweder<br />
war der Boden gefroren oder es war ein schneeloser Winter wie 2008. Trotzdem trat in jedem<br />
Jahr und auf jedem Standort ein leichter Befall auf, der jedoch schwer wahrzunehmen<br />
ist. Der Befall am Erntegut (Tab. 2) war sehr gering, so dass die Verwertung der Ware<br />
nicht beeinträchtigt wurde.<br />
Tab. 2: Durchschnittlicher Besatz mit Zwergsteinbrand am Erntegut auf dem Standort<br />
Bayern, sowie das Sporenpotenzial im Boden nach der Saat und nach der Ernte (2008 -<br />
2010)<br />
Behandlung<br />
Sporen/Korn<br />
Sporen in 10 g Boden<br />
am Erntegut nach der Saat nach der Ernte<br />
Kontrolle 61 93 128<br />
Bodeninfektion 2.837 608 2.678<br />
20 Sporen/Korn 87 79 526<br />
100 Sporen/Korn 260 89 257
116 Projekte und Daueraufgaben<br />
Die Zunahme des Brandsporenpotenzials im Boden war daher überraschend. Damit wurde<br />
deutlich, dass beim Mähdrusch mehr Brandsporen wieder auf das Feld gelangten, als im<br />
Erntegut festgestellt wurden. Lag vor der Aussaat das Sporenpotenzial im Boden bei unter<br />
100 Sporen in 10 g Boden, so war das Potenzial nach der Ernte jeweils deutlich über 100<br />
Sporen in 10 g Boden. In einem Jahr mit starkem Befall wie 2009 in Baden-Württemberg<br />
hat das Sporenpotenzial im Boden von ca. 100 Sporen auf bis zu 29.000 Sporen in 10 g<br />
Boden zugenommen. Dieses enorme Infektionspotenzial im Boden, das bei Zwergsteinbrand<br />
mehr als 10 Jahre infektionsfähig bleibt, wird von der Praxis nicht wahrgenommen<br />
und <strong>für</strong> den nachfolgenden Weizenanbau im Rahmen der Fruchtfolge völlig außer Acht<br />
gelassen. Die schnelle bzw. langsame Zunahme des Sporenpotenzials im Boden muss, je<br />
nach Befallssituation, dringend unterbunden werden. Dazu ist es notwendig, dass nur geprüftes<br />
Saatgut ausgesät wird, um das Sporenpotenzial im Boden gering zu halten. Aus<br />
diesem Grund kann der Schwellenwert von Steinbrand am Saatgut mit 20 Sporen/Korn<br />
auch <strong>für</strong> Zwergsteinbrand übernommen werden.<br />
In den Versuchen haben sich zwischen der anfälligen Sorte “A“ und der weniger anfälligen<br />
Sorte “B“ keine signifikanten Unterschiede in der Befallshöhe am Erntegut gezeigt.<br />
Da im Projekt nur zwei Sorten bearbeitet werden konnten und zudem die Beschreibende<br />
Sortenliste keine Auskunft über die Brandanfälligkeit der Sorten gibt, wurde im letzten<br />
Jahr ein Sortenanfälligkeitsversuch durchgeführt. Von den 21 Sorten, die auf zwei Standorten<br />
zum Anbau kamen, war keine Sorte völlig befallsfrei. Es zeigten sich aber sehr<br />
deutliche Unterschiede in der Anfälligkeit der Sorten. Wenn sich die Ergebnisse im nächsten<br />
Jahr bestätigen, besteht mit der entsprechenden Sortenwahl ein gutes Regulativ den<br />
Befall am Erntegut und das Sporenpotential im Boden gering zu halten. Zwischen Weizen<br />
und Dinkel zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Anfälligkeit.<br />
Steinbrand<br />
Die Steinbrandinfektion findet während der Keimung des Winterweizens statt. Das Temperaturoptimum<br />
<strong>für</strong> die Infektion liegt zwischen 5-10 °C. Den signifikant höchsten Befall<br />
am Erntegut hatte die Variante 100 Sporen/Korn. Das heißt, die Infektionshöhe des ausgesäten<br />
Saatgutes hat einen direkten Einfluss auf die Befallshöhe am Erntegut. Anhand der<br />
Kontrollvariante wurde bestätigt, dass bei Steinbrand eine Infektion auch über den Boden<br />
erfolgt.<br />
Die Frühsaat Anfang Oktober zeigte auf allen Standorten einen signifikant höheren Befall<br />
als die Spätsaat Ende Oktober. Bei der Spätsaat lagen die Bodentemperaturen unter der Infektionstemperatur<br />
<strong>für</strong> Steinbrand, d. h. der Saatzeitpunkt hat bei Steinbrand einen großen<br />
Einfluss auf das Befallsgeschehen. Der häufig von den Praktikern be<strong>für</strong>chtete geringere<br />
Ertrag mit der Spätsaat, konnte nicht bestätigt werden. Ganz erheblich beeinflusst wird die<br />
Befallshöhe am Erntegut von der angebauten Sorte. So war der Befall bei der anfälligen<br />
Sorte “A“ mit 2.690 Sporen/Korn im Vergleich mit der weniger anfälligen Sorte “E“ mit<br />
87 Sporen/Korn deutlich höher. Auch bei Steinbrand wurden Sortenanfälligkeitsversuche<br />
durchgeführt. Die anfälligste Sorte wies einen Befall von knapp 20.000 Sporen/Korn auf.<br />
Die weniger anfälligen Sorten hatten nur ca. 50 Sporen/Korn. Bei diesen Sorten handelt es<br />
sich fast ausschließlich um neuere Sorten aus ökologischer Züchtung. Von allen Möglichkeiten<br />
über die der Landwirt zur Befallsreduzierung verfügt, hat er mit der Sortenwahl das<br />
wirksamste Instrument in der Hand.<br />
Neben Saatzeitpunkt und Sorte wird der Befall mit Steinbrand auch vom Witterungsverlauf<br />
nach der Saat entscheidend beeinflusst. Eine trockene Witterung nach der Saat führt
117 Projekte und Daueraufgaben<br />
zu einer verzögerten Keimung. Das bietet den Steinbrandsporen eine lange Infektionszeit.<br />
So fiel im Herbst 2008 auf dem Standort in Bayern nach der Saat zwei Wochen kein Regen.<br />
Tab. 3: Besatz mit Steinbrand am Erntegut auf den Standorten Bayern und Sachsen, sowie<br />
das Sporenpotenzial im Boden nach der Saat und nach der Ernte (2008)<br />
Sporen/Korn<br />
Behandlung am Erntegut<br />
Bayern Sachsen Bayern Sachsen Bayern Sachsen<br />
Kontrolle 13.739 314 22 1.281 209 841<br />
20 Sporen/Korn 14.760 526 72 1.209 188 1.044<br />
100 Sporen/Korn 21.442 299 51 1.807 127 461<br />
Dies führte zu einem sehr hohen Befall am Erntegut der zwischen 14.000 und 21.000 Sporen/Korn<br />
lag (Tab. 3). Infolge des starken Befalls am Erntegut nahm das Sporenpotenzial<br />
im Boden nach der Ernte deutlich zu. Ein hohes Sporenpotenzial im Boden zur Saat bedeutet<br />
nicht automatisch einen hohen Befall im Erntegut, wie das Beispiel am Standort in<br />
Sachsen zeigt. Zur Saat wurden mehr als 1.000 Sporen in 10 g Boden festgestellt. Aufgrund<br />
des günstigen Witterungsverlaufs lief der Weizen sehr zügig auf und wuchs dem<br />
Steinbrand davon. Im Erntegut wurde eine Belastung von ca. 300 Sporen/Korn festgestellt.<br />
Trotz des Befalls am Erntegut nahm das Sporenpotenzial im Boden deutlich ab. Erklären<br />
lässt sich die Abnahme damit, dass auf dem Schlag im Erntejahr 2006 ein hoher<br />
Befall auftrat. Da die Lebensfähigkeit der Brandsporen 3-5 Jahre beträgt, nimmt die Zahl<br />
der Brandsporen von Jahr zu Jahr ab.<br />
Projektleitung: Dr. B. Killermann, B. Voit<br />
Projektbearbeitung: M. Dressler, IPZ 6d<br />
Laufzeit: 2007 - <strong>2011</strong><br />
Sporen in 10 g Boden<br />
nach der Saat nach der Ernte
118 Ehrungen und ausgezeichnete Personen<br />
4 Ehrungen und ausgezeichnete Personen<br />
4.1 Dienstjubiläen<br />
Anni Peckl , IPZ 6c, 25-jähriges Dienstjubiläum, 01.08.<strong>2011</strong><br />
Rita Gottwald, IPZ 6a, 25-jähriges Dienstjubiläum, 01.08.<strong>2011</strong><br />
Kleidofer Gerda, IPZ 3d, 25-jähriges Dienstjubiläum, 07.04.<strong>2011</strong><br />
Schultheiß Elke, IPZ 1a, 25-jähriges Dienstjubiläum, 01.10.<strong>2011</strong><br />
Hagn Elisabeth, IPZ 3c, 25-jähriges Dienstjubiläum, 01.10.<strong>2011</strong><br />
Baumann Alfred, IPZ1a, 40-jähriges Dienstjubiläum, 01.12.<strong>2011</strong><br />
4.2 Auszeichnungen<br />
Bernhard Engelhard, IPZ 5b, Hopfenorden zweiter Stufe „Offizier“ durch das Internationale<br />
Hopfenbaubüro IHB<br />
Erich Niedermeier, IPZ 5a, Verleihung des IHB-Hopfenordens im Rahmen der Sommersitzung<br />
des Verbandes deutscher Hopfenpflanzer e.V. in Spalt
119 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.1 Veröffentlichungen<br />
5.1.1 Veröffentlichungen Praxisinformationen<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Mehr Rohfett bringt mehr Bares. DLG Agrarmagazin Juli <strong>2011</strong>, 38-40.<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Neue Blütezeit <strong>für</strong> Leguminosen? BLW 6, 26-27.<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Schweres Jahr <strong>für</strong> den Raps. BLW 32, 24-26.<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Sonnenblume – Frankenblume. BLW 8, 44.<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Viel Zucker oder hoher Rübenertrag. BLW 2, 23-26.<br />
Aigner, A. (<strong>2011</strong>): Wird Soja bei uns sicher reif? BLW 7, 24-25.<br />
Bachl-Staudinger, M. und Hartmann, St. (<strong>2011</strong>): Produktionstechnische Hinweise Feldfutterbau, Themenmodul<br />
im Bereich des Internetangebotes der IPZ/LfL,<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/gruenland/42895/index.php<br />
Dollinger, L., Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Saatguterzeugung von Gräsern, Klee, Luzerne Situation Deutschland,<br />
Europa und Welt (Teil 2), SuB, 1-2/11, III-7 - III-11<br />
Eder J., Widenbauer W., Ziegltrum A. (<strong>2011</strong>): Leistungssprung bei Silomais – Landessortenversuche: Silomaiserträge<br />
erreichen wieder ein Rekordniveau. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt 51, 43-<br />
47<br />
Eder J., Widenbauer W., Ziegltrum A. (<strong>2011</strong>): Top-Erträge in ganz Bayern – Das Jahr <strong>2011</strong> war ideal <strong>für</strong><br />
den Körnermais. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt 52, 30-33<br />
Eder J., Widenbauer W. (<strong>2011</strong>): Was ist vom Mais <strong>2011</strong> zu erwarten – LfL hilft mit Prognosemodell <strong>für</strong> die<br />
Maisernte. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt 34, 35<br />
Eder J., Widenbauer W., Ziegltrum A. (<strong>2011</strong>): 300er Sorten passen nicht, Landessortenversuche Energiemais:<br />
Die besten Sorten <strong>für</strong> Bayern. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt 5, 44-46.<br />
Gültlinger, T.; Leiminger, J.; Hausladen, H.; Ebertseder, T. (<strong>2011</strong>): Einfluss fungizider Wirkstoffe auf den<br />
Schaderreger Alternaria spp. Kartoffelbau 01-02/<strong>2011</strong> Seite 48-52<br />
Gültlinger, T.; Leiminger, J.; Hausladen, H.; Ebertseder, T. (<strong>2011</strong>): Einfluss fungizider Wirkstoffe auf den<br />
Schaderreger Alternaria spp. Sonderdruck Kartoffelbau 01-02/<strong>2011</strong><br />
Hartl, L., (<strong>2011</strong>): Aktuelle Informationen zu den Brotgetreidesorten in Bayern. Mühle + Mischfutter 5, 153<br />
– 156.<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Winterschäden beheben Grünlandpflege wird zur Daueraufgabe BLW, 201, 10, 37-<br />
38<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Das Grünland richtig pflegen, Allgäuer Bauernblatt, 79, 11, 20-23<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Sortenbewusstsein bei Gräsern lohnt!, top agrar, 04, 100-101<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Die frühe Saat macht das Rennen, BLW, 201, 16, 41-43<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Gräser <strong>für</strong> jeden Zweck, dlz-spezial Sortenführer, Ausgabe 11/12, 45-47<br />
Hartmann, St., Kalzendorf, Ch., Jänicke, H., (<strong>2011</strong>): Ansaatmischung: Augen auf beim Saatgutkauf, top agrar,<br />
07, 76-78<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): <strong>Bayerische</strong>r Pflanzenbauspiegel (2010), Grünland und Futterbau, Erntepressefahrt<br />
des Staatsministeriums<br />
Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Rostbefall im Grünland, Allgäuer Bauernblatt, 36, 79, 22-23
120 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Hartmann, St., Diepolder, M. Lichti F. (<strong>2011</strong>): Grünland als Biogassubstrat; Faltblatt im Rahmen des Biogasforums<br />
Bayern, http://www.biogas-forum-bayern.de/Presse/Grunland_als_Biogassubstrat.pdf<br />
Hartmann, St. <strong>Bayerische</strong> Qualitätssaatgutmischungen <strong>für</strong> Grünland und Feldfutterbau, ergänze und erweiterte<br />
Auflage 2012, Faltblatt des <strong>Bayerische</strong>n Feldsaaten Erzeugerverbandes (6. S.)<br />
Hartmann S., Hofmann, D., Lichti F., Gehring, K. (<strong>2011</strong>): Weidelgras-Untersaaten in Wintergetreide zur<br />
GPS-Nutzung <strong>für</strong> die Biogasproduktion, Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und landwirtschaftliches<br />
Bauwesen in Bayern e.V.. http://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Weidelgras-<br />
Untersaaten_in_Wintergetreide_mit_Kurzsteckbrief.pdf. 12 S<br />
Herz, M. (<strong>2011</strong>): Braugerste mit Wintervorteil – Wintergerstensorten erfüllen Brauqualität/Saatentscheidung<br />
im Sommer. BLW 32, 30.<br />
Heuberger, H. (<strong>2011</strong>): Forschungs- und Versuchsprojekt der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong><br />
(LfL) zum Feldanbau und zur Züchtung von Heil- und Gewürzpflanzen im Jahr <strong>2011</strong>. Zeitschr. f. Arznei-<br />
und Gewürzpflanzen 16 (2), 84.<br />
Heuberger, H. (<strong>2011</strong>): Forschungs- und Versuchsprojekte in Bayern <strong>2011</strong>. Gemüse 47 (3), 53.<br />
Heuberger, H. (<strong>2011</strong>): Nun auch Fructus Xanthii, Cang’erzi, aus heimischem Anbau verfügbar! Chin. Med.<br />
26 (1), 48.<br />
Hofmann D., Sticksel E. (<strong>2011</strong>): Gegenüber Mais tun sich alle schwer – Biogas: Substratproduktion mit Getreide<br />
– GPS und Zweitfrüchten. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt 15, 38-40<br />
Jacob, I., Hartmann, St., (<strong>2011</strong>): Rotklee in Gefahr, bioland, 07, 10-11<br />
Kammhuber, K. (<strong>2011</strong>): Ergebnisse von Kontroll- und Nachuntersuchungen <strong>für</strong> Alphaverträge der Ernte<br />
2010, Hopfen-Rundschau, Nummer 8, August <strong>2011</strong>, 217-218<br />
Killermann, B., Voit, B. (<strong>2011</strong>) Die schwarze Gefahr – Zwergsteinbrand und Steinbrand kehren zurück.<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt BW agrar. Organ des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg,<br />
178. Jahrgang, Heft 34, 12-13.<br />
Killermann, B., Voit, B. (<strong>2011</strong>) Stinkende Weizenkörner – Schon vergessene Krankheiten kommen zurück.<br />
<strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt, Heft 33, 36 - 37.<br />
Killermann, B., Voit, B. (<strong>2011</strong>) Zwei fast überwundene Krankheiten kehren zurück. Der Newsletter des<br />
Gemeinschaftfonds Saatgetreide, 04/<strong>2011</strong>.<br />
Leiminger, J., Hausladen, H. (<strong>2011</strong>) Gezielte vorbeugende Maßnahmen reduzieren den Alternaria Befall.<br />
Kartoffelbau 06/<strong>2011</strong>, Seite 20-24<br />
Leiminger, J., Hausladen, H. (<strong>2011</strong>) Kartoffeln vor Alternaria schützen, BLW 26, Seite 26-27<br />
Leiminger, J., (<strong>2011</strong>) Dürrflecken kosten Ertrag, russische Ausgabe der Neuen <strong>Landwirtschaft</strong>, HCX<br />
2/<strong>2011</strong>, Seite 46-49<br />
Lutz, A., Kammhuber, K., Hainzlmaier, M., Kneidl., J., Petzina, C., Wyschkon, B. (<strong>2011</strong>): Bonitierung und<br />
Ergebnisse <strong>für</strong> die Deutsche Hopfenausstellung <strong>2011</strong>. Hopfenrundschau 62 (11), 316-319.<br />
Müller, M. Gruber, H. (<strong>2011</strong>): Gelangt Bt-Protein aus gentechnisch verändertem Mais über das Ausbringen<br />
von Gülle auf landwirtschaftliche Flächen? http://www.biosicherheit.de/projekte/1332.bt-proteingentechnisch-mais-guelle-boden.html,<br />
25.07.<strong>2011</strong><br />
Müller, M. Gruber, H. (<strong>2011</strong>): Verbleib oder Abbau von Bt-Protein im landwirtschaftlichen Kreislauf?<br />
http://www.biosicherheit.de/forschung/mais/1338.verbleib-abbau-bt-protein-landwirtschaftlichenkreislauf.html,<br />
23.08.<strong>2011</strong><br />
Müller, M. Gruber, H. (<strong>2011</strong>): Was passiert mit dem Bt-Protein aus gentechnisch verändertem Mais im Boden?<br />
(Langzeitbeobachtung) http://www.biosicherheit.de/projekte/1324.protein-gentechnisch-maisboden-langzeitbeobachtung.html,<br />
25.07.<strong>2011</strong><br />
Nickl, U. (<strong>2011</strong>): Sortenwahl bei Winterweizen. Nach Mais ist die Fusariumresistenz ein entscheidendes<br />
Sortenkriterium. LOP 08, 21 – 24.
121 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Nickl, U., Hartl, L. (<strong>2011</strong>): Hohe Winterweizenerträge überraschten. Vielfach waren aber auch große Schäden<br />
durch die Frühjahrstrockenheit zu verzeichnen. BLW 36, 36 – 41.<br />
Nickl, U., Herz, M., Huber, L. (<strong>2011</strong>): Bayern braucht mehr Braugerste. Landessortenversuch Sommergerste:<br />
Bewährte Sorten auch weiterhin top. BLW 49; 33-35.<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger A. (<strong>2011</strong>): Die Sorten haben viel mehr drauf. Landessortenversuche Hafer:<br />
Die Praktiker verschenken viel Ertrag. BLW 50; 46-47.<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger A. (<strong>2011</strong>): Lückenfüller weil 20 % fehlen. Landessortenversuch Sommerweizen:<br />
E-Sorten bringen fast so viel Ertrag wie die A-Sorten. BLW 48; 44<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Dünne Bestände und dicke Körner. Triticale litt unter der Frühjahrstrockenheit.<br />
BLW 35, 48 -50.<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Geht die Rechnung doch noch auf? Winterroggen: Schwache Erträge,<br />
aber gute Kornqualität und Fallzahlen. BLW 35, 46 – 47.<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Wenige, aber große Körner. LSV Wintergerste: Langsame<br />
Abreife rettet noch so manchen Bestand. BLW 33, 30 – 35.<br />
Niedermeier, E. (<strong>2011</strong>): Pflanzenstandsbericht. Hopfen Rundschau 62 (5), 138.<br />
Niedermeier, E. (<strong>2011</strong>): Pflanzenstandsbericht. Hopfen Rundschau 62 (6), 160.<br />
Niedermeier, E. (<strong>2011</strong>): Pflanzenstandsbericht. Hopfen Rundschau 62 (7), 187.<br />
Niedermeier, E. (<strong>2011</strong>): Pflanzenstandsbericht. Hopfen Rundschau 62 (8), 218.<br />
Niedermeier, E. (<strong>2011</strong>): Pflanzenstandsbericht. Hopfen Rundschau 62 (9), 259.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Aktuelle Hopfenbauhinweise. Hopfenbau-Ringfax Nr. 2; 4; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16;<br />
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 52; 53;<br />
54; 56; 57<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Aktuelles zum Pflanzenschutz und Termine. Hopfenring-Information v. 28.07.<strong>2011</strong>, 1-2.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Fortbildungsveranstaltungen; KuLaP-Förderung; Flächenzu- und -abgänge melden. Hopfenring-Information<br />
v. 04.11.<strong>2011</strong>, 1-2.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Gezielte Stickstoffdüngung des Hopfens nach DSN (Nmin). Hopfen Rundschau 62 (3),<br />
81-82.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Kostenfreie Rücknahme von Pflanzenschutz-Verpackungen PAMIRA <strong>2011</strong>. Hopfen<br />
Rundschau 62 (8), 198.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Nährstoffvergleich bis 31. März erstellen! Hopfen Rundschau 62 (3), 78.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Nmin-Untersuchung in Hopfen und anderen Ackerkulturen; Hopfen Rundschau 62 (3),<br />
81.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Peronosporabekämpfung. Hopfen Rundschau 62 (6), 162.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Rebenhäcksel bald möglichst ausbringen! Hopfen. Rundschau 62 (8), 212.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Zwischenfruchteinsaat im Hopfen <strong>für</strong> KuLaP-Betriebe spätestens am 30. Juni! Hopfen<br />
Rundschau 62 (5), 142.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Zwischenfruchteinsaat im Hopfen <strong>für</strong> KuLaP-Betriebe spätestens bis 30. Juni vornehmen!<br />
Hopfen Rundschau 62 (6), 161.<br />
Portner, J. (<strong>2011</strong>): Hopfentechnologie aus der Hallertau beispiellos – Hop Technology from the Hallertau<br />
peerless. Hopfenrundschau – International Edition of the German Hop Growers Magazine <strong>2011</strong>/2012,<br />
52-56.<br />
Portner, J., Brummer, A. (<strong>2011</strong>): Nmin-Untersuchung <strong>2011</strong>. Hopfen Rundschau 62 (5), 125-126.<br />
Portner, J., Dr. Kammhuber, K. (<strong>2011</strong>): Fachkritik zur Moosburger Hopfenschau <strong>2011</strong>. Hopfen Rundschau<br />
62 (10), 282-286.
122 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Hop stunt viroid-Monitoring. Hopfenrundschau 62 (5), 125.<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Welthopfensortenliste des Internationalen Hopfenbaubüros 2010. Hopfenrundschau 62<br />
(1),12-20.<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Bericht zur Tagung der Wissenschaftlichen Kommission des IHB in Lublin, Polen.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/hopfen/10585/sc_<strong>2011</strong>_kurzbericht.pdf<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Report on the meeting of the Scientific Commission of the I.H.G.C. in Poland.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/hopfen/10585/sc_<strong>2011</strong>_report_english.pdf<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Hopfenforscher der LfL zum Wissensaustausch in Polen. Hopfenrundschau 62 (7), 184-<br />
185.<br />
Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Hopfenforscher zum Wissensaustausch in Polen – Hop Researchers meet in Poland for<br />
Information Exchange. Hopfenrundschau – International Edition of the German Hop Growers Magazine<br />
<strong>2011</strong>/2012, 46-47.<br />
Voit, B. und Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Steinbrand und Zwergsteinbrand – was tun? Bioland Fachmagazin <strong>für</strong><br />
den ökologischen Landbau, Seite 7-8.<br />
Voit, B., Büttner, P., Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Gute Gelegenheit zum Saatgutwechsel – Saatgutproben zeigen<br />
trotz schwieriger Witterung eine gute Keimfähigkeit. <strong>Bayerische</strong>s <strong>Landwirtschaft</strong>liches Wochenblatt,<br />
Heft 36, 42.<br />
5.1.2 Veröffentlichungen – Wissenschaftliche Beiträge<br />
Aigner, A, Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Winterraps.<br />
http://www.versuchsberichte.de<br />
Aigner, A., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Ackerbohnen und<br />
Erbsen. http://www.versuchsberichte.de<br />
Aigner, A., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Sonnenblumen.<br />
http://www.versuchsberichte.de<br />
Aigner, A., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Sojabohnen 2010<br />
http://www.versuchsberichte.de<br />
Aschenbach, B., Mohler, V., Schweizer, G., Eisenschink, EM., Zamani-Noor, N., v. Tiedemann, A., Ruge-<br />
Wehling, B., Herz, M. (<strong>2011</strong>): A biotechnology-based breeding strategy to improve resistance against<br />
Ramularia collo cygni in barley. Proceedings of the 9th PlantGEM, Istanbul 04.-07.05.<strong>2011</strong><br />
Diethelm, M., Rhiel, M., Wagner,C., Mikolajewski, S., Groth, J., Hartl, L., Friedt, W. und Schweizer,G.<br />
(<strong>2011</strong>) Gene expression analysis of four WIR1-like genes in floret tissues of European winter wheat after<br />
challenge with G. zeae. Euphytica, DOI 10.1007/s10681-011-0498-7.<br />
Dressler, M., Sedlmeier, M., Voit, B., Büttner, P., Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Schwellenwerte und weitere Entscheidungshilfen<br />
bei Befall mit Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) und Steinbrand (Tilletia caries).<br />
Beiträge zur 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 16.-18. März <strong>2011</strong>, Gießen, Band 1, 270-<br />
273. ISBN 978-3-89574-777-9<br />
Dressler, M., Voit, B., Büttner, P., Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Mehrjährige Ergebnisse zur Strategie gegen<br />
Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) und Steinbrand (Tilletia caries) im Ökologischen Getreidebau.<br />
VDLUFA Schriftenreihe Band 67/<strong>2011</strong>, ISBN 978-3-941273-12-2, 460-467.
123 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Drofenigg, K., Zachow, C., Berg, G., Radišek, S., Seigner, E., Seefelder, S. (<strong>2011</strong>): Development of a rapid<br />
molecular in-planta test for the detection of Verticillium pathotypes in hops and strategies for prevention<br />
of wilt. Proceedings of the Scientific Commission, International Hop Growers` Convention, Poland,<br />
ISSN 1814-2192, 98-100.<br />
Engelhard, B., Weihrauch, F. (<strong>2011</strong>): Nachhaltige Optimierung der Bekämpfung von Blattläusen (Phorodon<br />
humuli) im Hopfen (Humulus lupulus) durch Bekämpfungsschwellen und Züchtung Blattlaus-toleranter<br />
Hopfensorten. Abschlussbericht des Forschungsprojektes im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung<br />
Umwelt, Osnabrück. 46 pp.<br />
Ettle, T., J. Eder, M. Landsmann, A. Obermayer (<strong>2011</strong>): Untersuchungen zu Ertragsleistung und<br />
Verdaulichkeiten von Hirsesilagen. Tagungsband 10. BOKU-Symposium Tierernährung, 220-224<br />
Friedlhuber, R., Schmidhalter, U., Hartl, L. (<strong>2011</strong>): Einfluss von Trockenstress auf die Bestandestemperatur<br />
und den Ertrag bei Weizen (Triticum aestivum L.). Tagungsband der 61. Jahrestagung der Vereinigung<br />
der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 23.-25. November 2010, Raumberg-Gumpenstein.<br />
ISBN: 978-3-902559-53-1, S. 155-157.<br />
Groth, J., Tamburic-Ilincic, L., Schaafsma, A., Brule-Babel, A. and Hartl, L. (<strong>2011</strong>): FHB Resistance of<br />
Winter Wheat from Canada and Europe Estimated across Multi-environments after Inoculation with Two<br />
Deoxynivalenol Producing Fusarium Species. Cereal Research Communications <strong>2011</strong>, 39, 189 – 199.<br />
Groth, J., Song, Y.S., Kellermann, A., Schwarzfischer, A. (<strong>2011</strong>): Molecular characterization of resistance to<br />
potato wart in tetraploid potato populations. Abstracts 18th Triennial Conference oft he European Association<br />
for potato research, 80.<br />
Gruber, H., Paul, V., Meyer H.H.D., Müller, M. (<strong>2011</strong>): Determination of insecticidal Cry1Ab protein in<br />
soil collected in the final growing seasons of a nine-year field trial of Bt-maize MON810. Transgenic<br />
Research, DOI 10.1007/s11248-011-9509-7<br />
Gruber, H., Paul, V., Guertler, P., Spiekers, H., Tichopad, A., Meyer, H.H.D., Müller, M. (<strong>2011</strong>): Fate of<br />
Cry1Ab Protein in Agricultural Systems under Slurry Management of Cows Fed Genetically Modified<br />
Maize (Zea mays L.) MON810: A Quantitative Assessment. J. Agric. Food Chem., 59 (13), pp 7135–<br />
7144, DOI 0.1021/jf200854n<br />
Hartl L, Mohler V, Henkelmann G (<strong>2011</strong>) Backqualität und Ertrag im deutschen Winterweizen. I. Historische<br />
Entwicklung. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs 2010, BAL Gumpenstein, Österreich, pp 25–28<br />
Hartl, L., Henkelmann, G.. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Winterweizen,<br />
Backqualität Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Hartl, L., Nickl, U., Gastl, A., Faltermaier, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Winterweizen, Brauqualität Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Hartl, L., Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern,<br />
Landessortenversuch Sommerweizen, Qualitäts- und Kornphysikalische Untersuchungen Ernte 2010.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Risser, P., Ebmeyer, E., Korzun, V., Hartl, L., and Miedaner, T. (<strong>2011</strong>). Quantitative trait loci for adultplant<br />
resistance to Mycosphaerella graminicola in two winter wheat populations. Phytopathology<br />
101:1209-1216.
124 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Schilly, A., Risser, P., Ebmeyer, E., Hartl, L., Reif, J., Würschum, T., Miedaner, T., (<strong>2011</strong>): Stability of<br />
Adult-plant Resistance to Septoria tritici blotch in 24 EuropeanWinter Wheat Varieties Across Nine<br />
Field Environments. Journal of Phythophatology, 159, 411 – 416, DOI. 10.1111/j. 1439-<br />
0434.2010.01783.x.<br />
Hartmann, St., Hochberg, H., Riehl, G., Wurth, W. (<strong>2011</strong>): Measuring the loss of dry matter yield effected<br />
by Rough-stalked meadow-grass (Poa trivialis), Grassland Farming and Land Management Systems in<br />
Mountainous Regions, EGF Grassland Science in Europe, Volume 16, 241-243<br />
Schubiger, F. X., Baert, J., Ball, T., Cagas, B., Czembor, E., Feuerstein, U., Gay, A., Hartmann, St.,<br />
Jakesova, H., Klima, M., Krautzer, B., Leenheer, H., Persson, C., Pietraszek, W., Poinsard, L., Posselt,<br />
U.K., Quitte, Y., Romani, M., Russi, L., Schulze, S., Tardin M. C., Van Nes M., Willner, E., Wolters, L.<br />
and Boller, B. (<strong>2011</strong>): The EUCARPIA multi-site rust evaluation – results 2010, Proceedings of the 29th<br />
meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section <strong>2011</strong>, Dublin in press<br />
Herz, M., Aschenbach, B., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Ertrag und Qualität der bayerischen Sommerbraugerste<br />
<strong>2011</strong>. Brauwelt 51/<strong>2011</strong><br />
Herz, M., Huber, L. (<strong>2011</strong>): Neigung der Sommergerste zum Aufspringen der Körner im Labortest 2010.<br />
Braugerstenjahrbuch <strong>2011</strong>,Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Qualitätsgerstenbaues<br />
im Bundesgebiet e. V., Oskar von Miller Ring 1, 80333 München<br />
Herz, M., Krumnacker, K., Mikolajewski, S. Schweizer, G. (<strong>2011</strong>): Association of differentially expressed<br />
genes during micomalting to QTL for malt quality in spring barley. Proceedings 33rd Congress European<br />
Brewery Convention.<br />
Herz, M., Nickl, U., Huber, L., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Ertragsleistung, Korn- und Malzqualität der 2zeiligen<br />
Wintergerste 2009. Braugerstenjahrbuch <strong>2011</strong>,Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft zur<br />
Förderung des Qualitätsgerstenbaues im Bundesgebiet e. V., Oskar von Miller Ring 1, 80333 München<br />
Herz, M., Nickl, U., Huber, L., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Ertragsleistung, Korn- und Malzqualität der 6zeiligen<br />
Wintergerste 2009. Braugerstenjahrbuch <strong>2011</strong>,Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft zur<br />
Förderung des Qualitätsgerstenbaues im Bundesgebiet e. V., Oskar von Miller Ring 1, 80333 München<br />
Herz, M., Nickl, U., Huber, L., Henkelmann, G., (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Gerste, Brauqualität und Kornphysikalische Untersuchungen, Ernte 2010.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Herz, M., Nickl, U., Huber, L., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Sommergerste, Brauqualität und Kornphysikalische Untersuchungen Ernte 2010.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Heuberger, H., Behrendt, A., Reh, K., Wiebrecht, A., Sievers, H., Seidenberger, R. (<strong>2011</strong>): Zubereitungen<br />
aus Heilpflanzen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) Chancen und Herausforderungen aus<br />
Sicht der Akteure bei Entwicklung, Registrierung und Anwendung. Workshop. Kurzfassungen der Vorträge<br />
und Poster, 6. Fachtagung Arznei- und Gewürzpflanzen, Berlin, 19.-22.09.<strong>2011</strong>, 221-222.<br />
Heuberger, H., Heubl, G., Müller, M., Seefelder, S., Seidenberger, R. (<strong>2011</strong>): Verwandtschaftsverhältnisse<br />
und Ploidiestufen ausgewählter Herkünfte und Wildformen des Arznei-Baldrians (Valeriana officinalis<br />
L. s.l.). Kurzfassungen der Vorträge und Poster, 6. Fachtagung Arznei- und Gewürzpflanzen, Berlin, 19.-<br />
22.09.<strong>2011</strong>, 90-92.<br />
Honermeier, B., Heuberger, H., Doernfeld, P. (<strong>2011</strong>): Untersuchungen zur Wirkung von Phytohormonen auf<br />
die Blühinduktion von Baldrian(Valeriana officinalis L.) Posterpräsentation. Kurzfassungen der Vorträge<br />
und Poster, 6. Fachtagung Arznei- und Gewürzpflanzen, Berlin, 19.-22.09.<strong>2011</strong>, 103-105.
125 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Kammhuber, K. (<strong>2011</strong>): Differentiation of the world hop collection by means of the low molecular polyphenols.<br />
Proceedings of the Scientific Commission, International Hop Growers` Convention, Poland, ISSN<br />
1814-2192, 61-64.<br />
Killermann, B., Voit, B. (<strong>2011</strong>) Es geht ums Ganze: Forschen im Dialog von Wissenschaft und Praxis. Saatgut-Qualitätssicherung<br />
bei Getreide. 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 15.-18. März<br />
<strong>2011</strong>, Gießen. Tagungsband zu den Dialog-Workshops, 14-21.<br />
Killermann, B., Diethelm, M., Jestadt, A., Schweizer, G., Voit, B. (<strong>2011</strong>): Unterscheidung von zwei- und<br />
mehrzeiliger Gerste mittels Pyrosequenzierung von Punktmutationen. VDLUFA Schriftenreihe Band<br />
67/<strong>2011</strong>, ISBN 978-3-941273-12-2, 454-459.<br />
Killermann, B. Voit, B. (<strong>2011</strong>) Einfluss von Keimfähigkeit und Triebkraft auf den Feldaufgang und Ertrag<br />
bei Sojabohnen. Tagungsband der 62. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs (im Druck).<br />
Leiminger, J.; Hausladen, H. (<strong>2011</strong>): Wirkung verschiedener Fungizide auf den Befall der Dürrfleckenkrankheit<br />
(Alternaria spp.) sowie auf den Ertrag der Kartoffel. Gesunde Pflanzen 2/<strong>2011</strong><br />
Leiminger, J.; Hausladen, H. (<strong>2011</strong>): Early blight control in potatoes using disease orientated threshold values.<br />
Plant Disease, http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-05-11-0431<br />
Lutz, A., Kneidl, J., Seefelder, S., Kammhuber, K., and Seigner, E. (<strong>2011</strong>): Trends in hop breeding – new<br />
aroma and bitter qualities at the Hop Research Center Huell. Proceedings of the Scientific Commission,<br />
International Hop Growers` Convention, Poland, ISSN 1814-2192, 14.<br />
Mohler V, Schweizer G, Hartl L (<strong>2011</strong>) Backqualität und Ertrag im deutschen Winterweizen. II. Marker-<br />
Merkmalsassoziation. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs 2010, BAL Gumpenstein, Österreich, pp 29–31<br />
Mohler V, Zeller FJ, Hsam SLK (<strong>2011</strong>) Molecular mapping of powdery mildew resistance gene Eg-3 in cultivated<br />
oat (Avena sativa L. cv. Rollo). J Appl Genet DOI: 10.1007/s13353-011-0077-6<br />
Rauwolf U, Greiner S, Mráček J, Braun M, Golczyk H, Mohler V, Herrmann RG, Meurer J (<strong>2011</strong>) Uncoupling<br />
of sexual reproduction from homologous recombination in Oenothera species. Heredity 107:87-94<br />
Schmolke, M., Mohler, V., Hartl, L., Zeller, F., J., Hsam, S., (<strong>2011</strong>): A new powdery mildew resistance allele<br />
at the Pm4 wheat locus transferred from einkorn (Triticum monococcum). Molecular Breeding, <strong>2011</strong>,<br />
28, DOI 10.10077s11032-011-9561-2.<br />
Müller, M., Ibrahim, A.S. (<strong>2011</strong>): D-Hordein Promoter Driven dapA and lysC Genes Lead to Higher Levels<br />
of Total Nitrogen in Stably Transformed Mature Barley Endosperm Independent of the Nitrogen Nutritional<br />
Regime. Abstract, In: Plant Transformation Technologies II, p. 45, Wien 19.-22.02.<strong>2011</strong><br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Winterweizen, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Hartl, L., Huber, L., Wiesinger, A., Schmidt, M., Rieder, J. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern,<br />
Landessortenversuch Winterweizen, DON-Gehalte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Winterweizen,<br />
Kornphysikalische Untersuchungen Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Winterweizen,<br />
Ertragsstruktur Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Sommerweizen, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/
126 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Sommerweizen,<br />
Ertragsstruktur Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
zweizeilige Wintergerste, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
sechszeilige Wintergerste, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Herz, M., Huber, L., (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Gerste, Ertragsstrukturdaten<br />
Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Sommergerste, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Herz, M., Huber, L., (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch Sommergerste,<br />
Ertragsstruktur Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Winterroggen, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch<br />
Winterroggen, Backqualität, Mutterkornuntersuchungen und Kornphysikalische Untersuchungen<br />
Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch Winterroggen,<br />
Ertragsstruktur Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern, Landessortenversuch<br />
Triticale, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch Triticale,<br />
Kornphysikalische Untersuchungen und Rohproteingehalt Ernte 2010.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch Triticale,<br />
Ertragsstruktur Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/.<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch<br />
Spelzweizen, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Sticksel, E., Schmidt, M. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch<br />
Hafer, Ernte <strong>2011</strong>. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A., Henkelmann, G. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch<br />
Hafer, Qualitäts- und Kornphysikalische Untersuchungen Ernte 2010.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Nickl, U., Huber, L., Wiesinger, A. (<strong>2011</strong>): Versuchsergebnisse aus Bayern. Landessortenversuch Hafer, Ertragsstruktur<br />
Ernte 2010. http://www.lfl.bayern.de/ipz/getreide/<br />
Oberhollenzer, K., Seigner, E., Lutz, A., Eichmann, R., Hückelhoven, R. (<strong>2011</strong>): Resistance mechanisms of<br />
different hop genotypes to hop powdery mildew. Proceedings of the Scientific Commission, International<br />
Hop Growers` Convention, Poland, ISSN 1814-2192, 21-24.
127 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Reichenberger, G., Schön, CC:, Herz, M. (<strong>2011</strong>): Genetic variability of spring barley concerning resistance<br />
to drought stress simulated in the scale of a breeder’s nursery. Proceedings of the Final Conference of the<br />
European Union Founded Project AGRISAFE in cooperation with EUCARPIA "Climate change - challenge<br />
for training of applied plant scientists, Budapest 21-23. March <strong>2011</strong><br />
Gschwendtner, S., Esperschütz, J., Buegger, F., Reichmann, M�, Müller, M., Munch, J.C., Schloter, M.<br />
(<strong>2011</strong>): Effects of genetically modified starch metabolism in potato plants on photosynthate fluxes into<br />
the rhizosphere and on microbial degraders of root exudates. FEMS Microbiology Ecology, 76, 3, 564 –<br />
575, DOI: 10.1111/j.1574-941.<strong>2011</strong>.01073.x<br />
Rinder, R., Heuberger, H., Heubl, G., Seidenberger, R. (<strong>2011</strong>): Chinesisches Süßholz (Glycyrrhiza<br />
uralensis/inflata/glabra) als Arznei- und Rohstoffpflanze – eine botanische Charakterisierung.<br />
Posterpräsentation. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, 6. Fachtagung Arznei- und Gewürzpflanzen,<br />
Berlin, 19.-22.09.<strong>2011</strong>, 114-116.<br />
Schwarz, J., Engelhard, B., Lachermaier, U., Weihrauch, F. (<strong>2011</strong>): Efficacy of entomopathogenic nematodes<br />
and fungi on larvae of Alfalfa snout weevil Otiorhynchus ligustici in semi-field trials in hops.<br />
DgaaE-Nachrichten 25 (2): 70<br />
Schwarz, J., Engelhard, B., Lachermaier, U., Weihrauch, F. (<strong>2011</strong>): Efficacy of entomopathogenic nematodes<br />
and fungi on larvae of alfalfa snout weevil Otiorhynchus ligustici in semi-field trials in hops. In:<br />
Herz, A., Ehlers, R.-U. (eds), Report on the 29th Annual Meeting of the Working Group "Beneficial Arthropods<br />
and Entomopathogenic Nematodes": 80-81. Journal of Plant Diseases and Protection 118 (2):<br />
80-85<br />
Schwarzfischer, A., Behn-Günter, A., Enders, R., Groth, J., Reichmann, E., Reichmann, M., Scheur, M.,<br />
Song, Y.S. (<strong>2011</strong>): 20 years with protoplast fusion in potato breeding – results and perspectives. Abstracts<br />
18th Triennial Conference oft he European Association for potato research, 80.<br />
Lindner K., Behn A., Schwarzfischer A., Song YS (<strong>2011</strong>): Extreme Y-Resistenz im aktuellen deutschen<br />
Sortensortiment. Journal <strong>für</strong> Kulturpflanzen 63, 97-103<br />
Draba V., Ordon F., Schweizer G. and Klaus Pillen (<strong>2011</strong>) The barley nested association mapping (NAM)<br />
population HEB-25: development and phenotyping. Abtract: IZN-Jahrestagung in Halle.<br />
Förster J., ExpResBar und Schweizer, G. (<strong>2011</strong>) Better barley –ExpResBar a multidisciplinary partnership<br />
between academia und industrie, is looking to harness new resistance to barley pathogenes. International<br />
Innovation EuroFocus <strong>2011</strong> Issue 5, 106-108.<br />
Hanemann A., SharmaS., Marzin S., Schweizer G. und M. Röder (<strong>2011</strong>) Pectin esterase inhibitor gene: A<br />
candidate for the resistance gene Rrs2 against Rhynchosporium secalis in barley. Abstract Collaborative<br />
Research Center SFB648, Tagung: Molecular mechanisms of information processing in plants, 19-<br />
22.05.<strong>2011</strong> in Halle.<br />
Marzin S., Hanemann A., SharmaS., Schweizer, G. und M. Röder (<strong>2011</strong>) Pectin esterase inhibitor gene: A<br />
candidate for the resistance gene Rrs2 against Rhynchosporium secalis in barley. Abstract IPK-<br />
Institutstagung, Okt <strong>2011</strong>.<br />
Meiners, J. Debener,T., Schweizer, G. und Traud Winkelmann (<strong>2011</strong>): Analysis of the taxonomic subdivision<br />
within the genus Helleborus by nuclear DNA content and genome-wide DNA markers. Scientia<br />
Horticulturae 128 (<strong>2011</strong>) 38–47.<br />
Silvar C, Casas AM, Igartua E, Ponce-Molina LJ, Gracia MP, Schweizer G, Herz M, Flath K, Waugh R,<br />
Kopahnke D, Ordon F. (<strong>2011</strong>) Resistance to powdery mildew in Spanish barley landraces is controlled<br />
by different sets of quantitative trait loci. Theor Appl Genet. <strong>2011</strong> Oct;123(6):1019-28. Epub <strong>2011</strong> Jul 8.
128 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Ordon, F. Perovic, D. Silvar, C., Hofmann K. Schweizer G. Casas A. Igartua E, Molina JL. Marian C.<br />
Moralejo, Roccaro M., Usadel B, Pellicer J, Bagge M, Korzun V und Förster J.(<strong>2011</strong>) Exploiting genetic<br />
variation for resistance to important pathogens in barley (ExpResBar). Abstract: GABI-Statusseminar.<br />
Seefelder, S., Drofenigg, K., Seigner, E., Niedermeier, E., Berg, G., Javornik, B., Radisek, S. (<strong>2011</strong>): Investigations<br />
about occurrence and characterization of different strains of hop wilt (Verticillium ssp.) to develop<br />
a control strategy against this pathogen. Proceedings 33rd Congress European Brewery Convention.<br />
Seefelder, S.,Drofenigg, K., Seigner, E., Niedermeier, E., Berg, G., Javornik, B., Radišek, S. (<strong>2011</strong>):<br />
Studies of Verticillium wilt in hops. Proceedings of the Scientific Commission, International<br />
Hop Growers` Convention, Poland, ISSN 1814-2192, 97.<br />
Seidenberger, R., Heuberger, H. (<strong>2011</strong>) Erste züchterische Bearbeitung und Qualitätsbeurteilung ausgewählter<br />
chinesischer Heilpflanzen, die <strong>für</strong> einen Anbau in Deutschland geeignet sind. Schlussbericht des Forschungsvorhabens,<br />
FKZ 22019707, 76 S.<br />
Strumpf, T., Engelhard, B., Weihrauch, F., Riepert, F., Steindl, A. (<strong>2011</strong>): Erhebung von Kupfergesamtgehalten<br />
in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Böden. Teil 2: Gesamtgehalte in Böden deutscher<br />
Hopfenanbaugebiete. Journal <strong>für</strong> Kulturpflanzen 63 (5): 144-155<br />
Voit, B., Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Warum sind Steinbrand und Zwergsteinbrand derzeit nicht nur im ökologischen<br />
Getreidebau ein Problem? Tagungsband der 62. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter<br />
und Saatgutkaufleute Österreichs (im Druck).<br />
Voit, B., Dressler, M., Killermann, B. (<strong>2011</strong>) Mehrjährige Ergebnisse zur Strategie gegen Zwergsteinbrand<br />
und Steinbrand im ökologischen Landbau. VDLUFA – Mitteilungen 02/<strong>2011</strong><br />
Voit, B., Killermann, B. (<strong>2011</strong>): Der Handel mit Wildpflanzensaatgut auf Basis der EU-Richtlinie.<br />
VDLUFA Schriftenreihe Band 67/<strong>2011</strong>, ISBN 978-3-941273-12-2, 424-428.<br />
Weihrauch, F. (<strong>2011</strong>): The significance of Brown and Green Lacewings as aphid predators in the special<br />
crop hops (Neuroptera: Hemerobiidae, Chrysopidae). Abstracts, DgaaE-Entomologentagung vom 21.-<br />
24. März <strong>2011</strong> in Berlin: 196<br />
Weihrauch, F., Schwarz, J. (<strong>2011</strong>): Monitoring of click beetles with the use of pheromone traps in hop yards<br />
of the Hallertau. In: Ehlers, R.-U., N. Crickmore, J. Enkerli, I. Glazer, M. Kirchmair, M. Lopez-Ferber,<br />
S. Neuhauser, H. Strasser, C. Tkaczuk & M. Traugott (eds), Insect Pathogens and Entomopathogenic<br />
Nematodes. Biological Control in IPM Systems. IOBC wprs Bulletin 66: 548<br />
Weihrauch, F., Schwarz, J., Sterler, A. (<strong>2011</strong>): Downy mildew control in organic hops: How much copper is<br />
actually needed? Proceedings of the Scientific Commission of the International Hop Growers´ Convention,<br />
Lublin, Polen, 19-23 June <strong>2011</strong>: 76-79
129 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.1.3 LfL-Schriften<br />
Name Arbeits-<br />
gruppe<br />
Schweizer, G., Diethelm,<br />
M., Halaweh, B., Reichenberger,<br />
G., Herz, M.<br />
Engelhard, B., Kammhuber,<br />
K., Lutz, A., Lachermeier,<br />
U., Bergmaier, M.<br />
Engelhard, B., Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
Engelhard, B., Portner, J.,<br />
Seigner, E., Lutz, A.,<br />
Schwarz, J., Seefelder, S.,<br />
Kammhuber, K.,<br />
Weihrauch, F.<br />
IPZ 1b<br />
IPZ 2b<br />
LfL-Schriften Titel<br />
LfL-Schriftenreihe: Klimaänderung<br />
in Bayern<br />
Klimatoleranz bei Gerste – ein<br />
biotechnologischer Ansatz zur Ertragssicherung<br />
S. 17-36.<br />
IPZ 5 LfL-Schriftenreihe Blattentwicklung und Ertragsaufbau<br />
wichtiger Hopfensorten<br />
IPZ 5 LfL-Information Hopfen <strong>für</strong> alle Biere der Welt<br />
IPZ 5 LfL-Information <strong>Jahresbericht</strong> 2010 – Sonderkultur<br />
Hopfen<br />
Portner, J. IPZ 5a „Grünes Heft“ Hopfen <strong>2011</strong><br />
5.1.4 Pressemitteilungen<br />
Autor(en), Arbeitsgruppe Titel<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b Nachruf Dr. Reichmann<br />
Seigner, E., IPZ 5c Hopfenforscher der LfL zum Wissensaustausch in Polen<br />
Kellermann, A., IPZ 3a 4. Kartoffeltag der LfL in Dürrenmungenau<br />
Herz, M., IPZ 2b Projektstart Öko-Braugerste<br />
Müller, M., IPZ 1a Pflanzenflüsterer Alfred Baumann feiert 40-jähriges Dienstjubiläum
130 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.1.5 Fernsehen, Rundfunk<br />
Name /AG Sendetag Thema Titel der Sendung Sender<br />
Münsterer, J.<br />
IPZ 5a<br />
Geiger, P.<br />
IPZ 6b<br />
Hartmann, St.<br />
IPZ 4b<br />
Doleschel, P.<br />
IPZ-L<br />
Lutz, A.<br />
IPZ 5c<br />
Doleschel, P.<br />
IPZ-L<br />
Portner, J.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5a/c<br />
Bauer, R.<br />
IPZ 3a/b<br />
Kellermann, A.<br />
IPZ 3a<br />
10.05.11 Auswirkungen der aktuellen<br />
Trockenheit auf Hopfen<br />
17.05.11 Illegaler Pflanzenschutzmittelhandel<br />
20.05.<strong>2011</strong> „Nicht alle Gräser eignen<br />
sich“ (Teilbeitrag zu: „Gras<br />
statt Soja – wie es funktionieren<br />
kann“<br />
25.05.11 Aktuelle Trockenheit – Konsequenzen<br />
<strong>für</strong> die <strong>Landwirtschaft</strong><br />
IN TV<br />
Plusminus ARD<br />
Unser Land Bayer.<br />
Fernsehen<br />
Bayern 1 Am Morgen Bayer.<br />
Rundfunk,<br />
Bayern1<br />
29.05.11 Hopfenzüchtung Imagefilm „Hallertauer<br />
Hopfen“<br />
17.06.11 Niederschläge und Aussichten<br />
in der <strong>Landwirtschaft</strong><br />
01.08.11 Angewandte Forschung am<br />
Beispiel des Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
23.09.11 Schwarzblaue aus dem Frankenwald<br />
Rapunzel,<br />
Abensberg<br />
Bayern 1 Am Morgen Bayer.<br />
Rundfunk,<br />
Bayern1<br />
Bayernmagazin Bayer.<br />
Rundfunk,<br />
Bayern1<br />
Unser Land Bayer.<br />
Fernsehen<br />
21.11.11 Lila Kartoffeln radioMikro Bayer.<br />
Rundfunk,<br />
Bayern2<br />
5.1.6 Externe Zugriffe auf IPZ-Beiträge im Internet<br />
Durchschnittlich 174.000 Zugriffe pro Monat
131 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2 Tagungen, Vorträge, Vorlesungen, Führungen und Ausstellungen<br />
5.2.1 Tagungen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L;<br />
Hartl, L.,<br />
IPZ 2c<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L;<br />
Müller, M.,<br />
IPZ 1a<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
11.01.<strong>2011</strong>-<br />
13.01.1201<br />
München<br />
23.02.<strong>2011</strong>-<br />
24.02.<strong>2011</strong><br />
Soest<br />
02.03.<strong>2011</strong><br />
Frankfurt<br />
04.03.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
17.03.<strong>2011</strong><br />
Regensburg<br />
25.03.<strong>2011</strong><br />
Berlin<br />
29.03.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
01.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
13.-14.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
16.06.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
29.06.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
04.07.<strong>2011</strong><br />
München<br />
07.07.<strong>2011</strong><br />
Kinding<br />
08.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
11.07.<strong>2011</strong><br />
Allershausen<br />
19.07.<strong>2011</strong><br />
Langlau<br />
DLG Wintertagung Mitglieder, Politik, Berater;<br />
250 TN<br />
Fachveranstaltung <strong>Landwirtschaft</strong><br />
2025<br />
Workshop zur Beurteilung von<br />
Züchtungstechniken <strong>für</strong> den ökologischen<br />
Landbau<br />
LfL-Tagung „Pachtkampf ums<br />
Maisfeld“<br />
Verband <strong>Bayerische</strong>r Pflanzenzüchter,<br />
Mitgliederversammlung<br />
150 TN<br />
Wissenschaftler, Züchter,<br />
Verbandsverteter; 60 TN<br />
Landwirte, Wissenschaftler, Berater,<br />
Politik; 200 TN<br />
Mitglieder, Gäste; 30 TN<br />
Strategiegespräch FNR/GFP BMELV, Wissenschaftler,<br />
Züchter, Verbandsvertreter; 35<br />
TN<br />
GfH Mitgliederversammlung Mitglieder, Verbandsvertreter,<br />
Beirat, Wissenschaftler, Gäste;<br />
150 TN<br />
Besprechung Klimadatenbank LfL-Arbeitgruppe; 10 TN<br />
Arbeitsbesprechung Futterpflanzen<br />
der GFP<br />
AG-Mitglieder, LfL-Vertreter,<br />
Gäste; ca. 35 TN<br />
Testgremium Pflanzkartoffel Verbandsvertreter, Züchter,<br />
Vertr. 2.1P der ÄELF<br />
VDM-Getreidefachtagung Mitglieder des Verbandes deutscher<br />
Mühlen, Wissenschaftler,<br />
Gäste; ca. 40 TN<br />
Rundgespräch der <strong>Bayerische</strong>n<br />
Akademie der Wissenschaften<br />
Thema: Pflanzenzüchtung und<br />
Genetik<br />
Wissenschaftler, Verwaltung,<br />
Politik, 65 TN<br />
LKP Ausschuss Mitglieder, Gäste; 20 TN<br />
Hochschultag Wissenschaftstag<br />
Weihenstephan<br />
Erntepressefahrt des BBV mit<br />
Minister<br />
Wissenschaftler, Studenten,<br />
Gäste; ca. 200 TN<br />
Politiker, Landwirte, Vertreter<br />
der Fachverwaltung; 85 TN<br />
HVG e.G. Beiratssitzung Mitglieder, Fachbetreuer, Gäste;<br />
40 TN
132 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L<br />
Doleschel, P.,<br />
IPZ-L,<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kollegium hD<br />
von IPZ<br />
Kollegium hD<br />
von IPZ<br />
Müller, M.,<br />
IPZ 1a<br />
Hartl, L.,<br />
IPZ 2c<br />
Hartl, L., Doleschel,<br />
P.,<br />
IPZ 2c, IPZ-L<br />
Kellermann, A.,<br />
IPZ 3a<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
25.08.<strong>2011</strong><br />
Niederlauterbach<br />
01.09.<strong>2011</strong><br />
Raum Hallertau<br />
20.-21.09.<strong>2011</strong><br />
Bad Kreuznach<br />
23.09.<strong>2011</strong><br />
Metten<br />
18.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
19.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
25.10.<strong>2011</strong><br />
Grub<br />
16.11.<strong>2011</strong><br />
Herrsching<br />
18.11.<strong>2011</strong><br />
Weichering<br />
08.12.<strong>2011</strong><br />
München<br />
10.05.<strong>2011</strong><br />
Kinding<br />
22.-23.03.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
26.-27.07.<strong>2011</strong><br />
Oberfranken<br />
Niederlauterbacher Hopfentag Hopfenpflanzer, Berater, Firmenvertreter;<br />
100 TN<br />
Hopfenrundfahrt und Pflanzenschutztagung<br />
Fachbeiratssitzung und 10jähriges<br />
Bestehen ISIP<br />
Politik, Fachverwaltung, Verbandsvertreter,<br />
Hopfenpflanzer;<br />
ca. 200 TN<br />
Mitglieder, Gäste; ca. 45 TN<br />
40 Jahre Erzeugerring Politik, Fachverwaltung, Mitglieder,<br />
Verbandsvertreter; ca.<br />
200 TN<br />
Symposium Pflanzen- und Gewässerschutz<br />
Wissenschaftler, Berater; ca.<br />
100 TN<br />
LfL Jahrestagung Politik, Wissenschaftler, Berater,<br />
Landwirte; ca. 150 TN<br />
Landtechnische Jahrestagung Politik, Wissenschaftler, Fachverwaltung,<br />
Landwirte; ca. 200<br />
TN<br />
Woche der Erzeugergemeinschaften<br />
– Fachabteilung Kartoffeln<br />
BBV, Mitglieder der EZGen,<br />
Berater, Wirtschaft; ca. 60 TN<br />
LKP Ausschuss Mitglieder, Gäste; ca. 25 TN<br />
<strong>Bayerische</strong>r Braugerstentag Politik, Verbände, Berater,<br />
Wirtschaft, Erzeuger; ca. 120<br />
TN<br />
SGV Beiratssitzung Mitglieder, Gäste; ca. 25 TN<br />
Winterarbeitsbesprechung 2.1 P<br />
und höherer Dienst IPZ<br />
Sommerarbeitsbesprechung IPZ<br />
mit dem hD der SG 2.1P<br />
21.07.<strong>2011</strong> Organisation und Durchführung<br />
der Tagung Münchner Pflanzenforscher<br />
(MüPf)<br />
14.12.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
04.-05.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
29.-30.06.<strong>2011</strong><br />
Magdeburg und<br />
Braunschweig<br />
Mitarbeiter hD der SG 2.1 P der<br />
ÄELF u. hD des IPZ, TN 52<br />
Höherer Dienst IPZ mit dem hD<br />
der SG 2.1 P der ÄELF, TN 34<br />
Münchner und Freisinger Pflanzenforscher,<br />
75 TN<br />
BPZ Arbeitsgruppe BPZ Mitglieder,<br />
ca. 15 TN<br />
Abschlusstagung Projekt<br />
QualityNet und Projekttreffen<br />
Robust Wheat<br />
Sommertagung Arbeitsgebiet<br />
Kartoffeln der GPZ,<br />
Projektpartner, Wissenschaftler,<br />
Gäste;<br />
Ca. 40 TN<br />
Mitglieder der GPZ-AG Kartoffeln,<br />
25 Teilnehmer
133 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Kellermann, A.,<br />
IPZ 3a<br />
Kellermann, A.,<br />
IPZ 3a; Doleschel,<br />
P., IPZ-L<br />
Kellermann, A.,<br />
Marchetti, S.,<br />
IPZ 3a<br />
Schwarzfischer,<br />
A., IPZ 3b<br />
Schwarzfischer,<br />
A., Kellermann,<br />
A., IPZ 3b, IPZ 3a<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Aigner, A.,<br />
IPZ 3c<br />
Heuberger, H.,<br />
IPZ 3d; Deutscher<br />
Fachausschuss <strong>für</strong><br />
Arznei-, Gewürz-<br />
und<br />
Aromapflanzen<br />
Rinder, R.,<br />
Heuberger, H.,<br />
IPZ 3d<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
16.-17.11.<strong>2011</strong><br />
Göttingen<br />
21.07.<strong>2011</strong><br />
Dürrenmungenau<br />
16.06.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Kartoffelzüchtung<br />
und Pflanzguterzeugung<br />
Mitglieder der GPZ-<br />
Arbeitsgemeinschaft Kartoffelzüchtung<br />
und Pflanzguterzeugung<br />
4. Kartoffeltag der LfL Landwirte, Berater, Firmenvertreter,<br />
120 TN<br />
Testgremium Pflanzkartoffeln Vertreter der Saatkartoffelverbände,<br />
VO-Firmen, Vertreter<br />
der SG 2.1 P der ÄELF, 25<br />
Teilnehmer<br />
21.07.<strong>2011</strong> Organisation und Durchführung<br />
der Tagung Münchner Pflanzenforscher<br />
(MüPf)<br />
24.-29.07.<strong>2011</strong><br />
Oulu, Finnland<br />
03.-04.02.<strong>2011</strong><br />
Berlin<br />
10.03.<strong>2011</strong><br />
Dornburg/<br />
Camburg<br />
15.03.<strong>2011</strong><br />
Berlin<br />
20.-21.06.<strong>2011</strong><br />
Leipzig<br />
09.08.<strong>2011</strong><br />
Kassel<br />
28.11.<strong>2011</strong><br />
Beilngries<br />
06.12.<strong>2011</strong><br />
Plattling<br />
14.12.<strong>2011</strong><br />
Frankfurt/Main<br />
21.09.<strong>2011</strong><br />
Berlin<br />
21.06.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Münchner und Freisinger Pflanzenforscher,<br />
75 TN<br />
3-Jahrestagung der EAPR Mitglieder, Gäste; ca. 350 TN<br />
Sitzung der Sektion „Ölpflanzen“<br />
der UFOP Fachkommission<br />
Treffen der Länder „Kleine und<br />
mittlere Kulturen“<br />
Thüringer <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Landwirtschaft</strong><br />
Sitzung des UFOP Fachausschusses<br />
Sortenprüfwesen<br />
Sitzung des Ackerbauausschuss<br />
der DLG<br />
Sitzung der Sortenkommission<br />
UFOP RAW<br />
Arbeitsbesprechung der Leiter<br />
der Fachzentren Pflanzenbau<br />
und Agrarökologie<br />
Sitzung des Fachbeirates der<br />
ARGE Regensburg<br />
Projektbegleitende Arbeitsgruppe<br />
BÖLN.-Sojaprojekt<br />
Workshop zu Zubereitungen aus<br />
Heilpflanzen der Traditionellen<br />
Chinesischen Medizin (TCM) -<br />
Chancen und Herausforderungen<br />
aus Sicht der Akteure bei Entwicklung,<br />
Registrierung und<br />
Anwendung<br />
UFOP, TN 35<br />
AG-Mitglieder; 11 TN<br />
Mitglieder, 10 TN<br />
Mitglieder, TN 28<br />
Mitglieder, TN 7<br />
Koordinierungsgruppe Pflanzenbau,<br />
TN 24<br />
Mitglieder des Fachbeirates,<br />
TN 13<br />
ca. 30 TN<br />
Wissenschaftler,<br />
Phytopharmazeutische Industrie,<br />
Berater, 40 TN<br />
Essential Oils Workshop Pacific Aromatherapy Institute,<br />
Leiter von Aromatherapiezentren,<br />
17 TN
134 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Probst, M.,<br />
Warthun, U.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
11.01.<strong>2011</strong><br />
München<br />
12.01.<strong>2011</strong><br />
München<br />
18.01.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
19.01.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
24.01.<strong>2011</strong><br />
Deggendorf<br />
31.01.<strong>2011</strong><br />
München<br />
01.02.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
21.02.<strong>2011</strong><br />
Großumstadt<br />
22.-23.02.<strong>2011</strong><br />
Großumstadt<br />
15.03.<strong>2011</strong><br />
Hannover<br />
17.03.<strong>2011</strong><br />
Würzburg<br />
21.03.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Sitzung DLG-Hauptausschuss Mitglieder des DLG-<br />
Hauptausschusses<br />
Sitzung DLG-Ausschuss „Grünland“<br />
Gedankenaustausch über pflanzenbauliche<br />
und pflanzenzüchterische<br />
Fragen zur Methionin-<br />
respektive Eiweißlücke (speziell<br />
ökologische Geflügel- und<br />
Schweinehaltung)<br />
9. Sitzung der Arbeitsgruppe I<br />
„Substrat“ des Biogas Forum<br />
Bayern<br />
Projektbesprechung zu „Grundfutteroffensive<br />
BayerWald“<br />
Arbeitsschwerpunkt „Eiweißstrategie“<br />
Arbeitsschwerpunkt „Grünlandbewirtschaftung“<br />
Sitzungen des DLG Ausschusses<br />
"Versuchswesen in der Pflanzenproduktion"<br />
Mitglieder des DLG-<br />
Ausschusses „Grünland“<br />
Vertreter LfL, Öko-Verbände,<br />
Saatzucht Steinach und LLA<br />
Triesdorf<br />
Mitglieder der Arbeitsgruppe<br />
Kooperationspartner LfL und<br />
SG 2.1P AELF DEG<br />
Mitglieder des Arbeitsschwerpunktes<br />
Mitglieder des Arbeitsschwerpunktes<br />
Mitglieder des Ausschusses und<br />
Gäste<br />
Sitzung DLG-Planungsausschuss Mitglieder des Ausschusses<br />
Sitzung Arbeitsgruppe NOFUG Mitglieder der Arbeitsgruppe<br />
Arbeitsbesprechung der Ländergruppe<br />
„Mitte-Süd“<br />
Absprache zu länderübergreifenden<br />
LSV’s Futterpflanzen<br />
10. Sitzung der Arbeitsgruppe I<br />
„Substrat“ des Biogas Forum<br />
Bayern<br />
22.-23.03.<strong>2011</strong> Arbeitsbesprechung IPZ mit den<br />
Sachgebieten 2.1 P der ÄELF<br />
04.04.<strong>2011</strong><br />
München<br />
13.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
13.-14.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Arbeitsschwerpunkt „Eiweißstrategie“<br />
Projektbesprechung mit IPK<br />
„Genet. Drift“<br />
Sommerarbeitsbesprechung der<br />
Arbeitsgruppe Futterpflanzen<br />
der GFP gemeinsam mit der<br />
GPZ Arbeitsgruppe „Futterpflanzen<br />
Gräser“<br />
Länderreferenten der teilnehmenden<br />
Länder<br />
Mitglieder der Arbeitsgruppe<br />
IPZ AG-Leiter, hD und gD SG<br />
2.1P<br />
Mitglieder des Arbeitsschwerpunktes<br />
IPZ, IPK<br />
Zuchtleiter Firmen, Mitglieder<br />
der Fachgruppe
135 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Jacob, I.,<br />
IPZ 4b<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Jacob, I.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
15.04.<strong>2011</strong><br />
Oberweißbach<br />
04.05.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
09.-10.06.<strong>2011</strong><br />
Potsdam-<br />
Bornim<br />
12.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
19.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
21.07.<strong>2011</strong><br />
Kassel<br />
Züchtergespräch Vertreter Züchterhäuser<br />
Vertreter <strong>Landesanstalt</strong>en und<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>skammern<br />
Arbeitskreis Leguminosen- und<br />
Futterpflanzenzüchtung <strong>für</strong> den<br />
ökologischen Landbau<br />
Mitglieder des Arbeitskreises<br />
Projektbesprechung „GNUT“ Mitglieder des Projektverbundes<br />
11. Sitzung der Arbeitsgruppe I<br />
„Substrat“ des Biogas Forum<br />
Bayern<br />
Ausschusssitzung des Feldsaatenerzeugerverbandes:Sortenempfehlung<br />
Qualitätsmarke<br />
2. Abstimmungsrunde des Arbeitsfeldes<br />
„Nutzungskonzept<br />
<strong>für</strong> das Grünland“<br />
26.-27.07.<strong>2011</strong> Sommerarbeitsbesprechung des<br />
IPZ mit SG 2.1 P der ÄELF<br />
28.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
03.08.<strong>2011</strong><br />
Göttingen<br />
23.08.<strong>2011</strong><br />
Kempten<br />
22.09.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
28.09.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
20.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
26.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
07.11.<strong>2011</strong><br />
Bonn<br />
07.11.<strong>2011</strong><br />
Bonn<br />
Arbeitskreis Krankheiten und<br />
Schädlinge im ökologischen<br />
Landbau<br />
Projektvorbesprechung<br />
„Klimawandel Lolium“<br />
Versuche am Spitalhof Stand<br />
und Perspektive<br />
4. Internes Projekttreffen der<br />
LfL zu Diabrotica<br />
12. Sitzung der Arbeitsgruppe I<br />
„Substrat“ des Biogas Forum<br />
Bayern<br />
Arbeitsschwerpunkt „Grünlandbewirtschaftung<br />
8. Sitzung des Arbeitskreises Biogas<br />
Forum Bayern<br />
Projektbesprechung mit IPK<br />
„Genet. Drift“<br />
Arbeitssitzung DLG-<br />
Ausschusses „Gräser, Klee und<br />
Zwischenfrüchte (Planung 2012:<br />
Versuche und Sommertagung)<br />
Mitglieder der Arbeitsgruppe<br />
Firmenvertreter<br />
Ländervertreter Fachbehörden<br />
hD IPZ, SG 2.1 ÄELF und<br />
Verstreter StMELF<br />
Mitglieder des Arbeitskreises<br />
IPZ, JKI, IPK, EGB, NPZ<br />
Vertreter LfL, Energie F-10 und<br />
MdL Müller<br />
Projektpartner LfL<br />
Mitglieder der Arbeitsgruppe<br />
Mitglieder des Arbeitsschwerpunktes<br />
Mitglieder des Arbeitskreises<br />
IPZ, IPK, Saatzucht Steinach<br />
Mitglieder der Fachgruppe
136 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Lunenberg, T.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Wosnitza, A.,<br />
IPZ 4b<br />
Hartmann, St.,<br />
IPZ 4b<br />
Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
08.11.<strong>2011</strong><br />
Bonn<br />
08.11.<strong>2011</strong><br />
Bonn<br />
09.11.<strong>2011</strong><br />
Bonn<br />
22.-24.11.<strong>2011</strong><br />
Raumberg-<br />
Gumpenstein<br />
01.12.<strong>2011</strong><br />
Triesdorf<br />
01.12.<strong>2011</strong><br />
Triesdorf<br />
05.12.<strong>2011</strong><br />
Triesdorf<br />
07.12.<strong>2011</strong><br />
Hesselberg<br />
12.12.<strong>2011</strong><br />
Kinding<br />
13.12.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
13.-14.12.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
14.12.<strong>2011</strong><br />
München<br />
17.01.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
18.01.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
01.02.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
08.02.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
52. Fachtagung des DLG-<br />
Ausschusses „Gräser, Klee und<br />
Zwischenfrüchte gemeinsam mit<br />
der GPZ Arbeitsgruppe „Futterpflanzen,<br />
Gräser“<br />
Projektvorbesprechung<br />
„Klimawandel Lolium“<br />
Sitzung der Abteilung Futterpflanzen<br />
der GFP<br />
62. Tagung der Vereinigung der<br />
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs<br />
Gespräch zur Koordination der<br />
Zusammenarbeit von LfL und<br />
LLA<br />
Gespräch zur Koordination der<br />
Zusammenarbeit von LfL und<br />
LLA und SG 3.1 der AELF<br />
Wintersitzung des Pflanzenbauzirkels<br />
Zuchtleiter, Firmenvertreter,<br />
Mitglieder der Fachgruppe<br />
IPZ, JKI, IPK, EGB, NPZ<br />
Mitglieder der Abteilung Futterpflanzen<br />
Vereinigung der Pflanzenzüchter<br />
und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs mit<br />
HBLFA Raumberg-<br />
Gumpenstein<br />
Vertreter LfL und LLA<br />
Vertreter LfL, LLA<br />
und SG 3.1 der AELF WÜ, AN<br />
und BY<br />
Mitglieder des Pflanzenbauzirkels<br />
Grünlandseminar Grünlandberater der ER und<br />
Mitarbeiter der Grünguttrocknungen<br />
Ausschusssitzung des Landesverbandes<br />
der Feldsaatenerzeuger<br />
in Bayern e.V.<br />
Arbeitsbesprechung Versuchsplanung<br />
Frühjahrsanbau<br />
3. Diabrotica-Tagung des Projektverbundes<br />
Vorstand<br />
AG LfL und gD und hD SG 2.1<br />
P ÄELF<br />
Projektpartner Bund/Länder<br />
Biogas Jour fixe AG-L LfL und TFZ mit laufenden<br />
Projekten zum Thema Biogas<br />
gefördert durch das<br />
StMELF<br />
Seminar: Neueste Erkenntnisse<br />
zur Hopfentrocknung<br />
Seminar: Optimale Konditionierung<br />
von Hopfen<br />
Hinweise zur Optimierung der<br />
Konditionierung<br />
34 Hopfenpflanzer<br />
22 Hopfenpflanzer<br />
18 Hopfenpflanzer<br />
Workshop Bandtrockner 10 Hopfenpflanzer
137 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Portner, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Portner, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Schätzl, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Seigner, E.,<br />
IPZ 5c<br />
Kammhuber, K.,<br />
IPZ 5d<br />
Lutz, A., IPZ 5c,<br />
Kammhuber, K.,<br />
IPZ 5d<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a;<br />
Voit, B., IPZ 6c/d<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
10.02.<strong>2011</strong><br />
Wolnzach<br />
15.03.<strong>2011</strong><br />
Hüll<br />
13.09.<strong>2011</strong><br />
Moosburg<br />
12.05.<strong>2011</strong>-<br />
10.08.<strong>2011</strong><br />
8 Termine; Hüll,<br />
Wolnzach,<br />
Rohrbach,<br />
Geisenfeld<br />
19.-23.06.<strong>2011</strong><br />
Lublin, Polen<br />
08. -09.12.<strong>2011</strong><br />
Hüll<br />
05.10.<strong>2011</strong><br />
Hüll<br />
15.11.<strong>2011</strong><br />
München<br />
23.11.<strong>2011</strong><br />
Hannover<br />
24.11.<strong>2011</strong><br />
Hannover<br />
19.01.<strong>2011</strong><br />
Kassel<br />
25.02.<strong>2011</strong><br />
Weichering<br />
02.03.<strong>2011</strong><br />
Erdweg/<br />
Petersberg<br />
06.-07.06.<strong>2011</strong><br />
Nossen<br />
08.06.<strong>2011</strong><br />
Kinding<br />
06.07.<strong>2011</strong><br />
Langenbach<br />
Workshop Bewässerungssteuerung<br />
12 Hopfenpflanzer<br />
Besprechung „Grünes Heft“ Kollegen aus Hopfenforschungseinrichtungen<br />
in D<br />
Hopfenbonitierung <strong>für</strong> die<br />
Moosburger Hopfenschau<br />
Erfahrungsaustausch und Schulungen<br />
Tagung der Wissenschaftlichen<br />
Kommission des Internationalen<br />
Hopfenbaubüros<br />
Besprechung Arbeitsgruppe <strong>für</strong><br />
Hopfenanalytik<br />
Hopfenbonitur <strong>für</strong> VLB-<br />
Ausstellung Berlin<br />
20 Mitglieder der Bonitierungskommission<br />
Ringbetreuer und Ringfachberater<br />
Hopfen-Wissenschaftler (52 aus<br />
13 Nationen)<br />
Laborleiter der Hopfenverarbeitungswerke,<br />
VLB, TUM Weihenstephan,<br />
12 TN<br />
Hopfenexperten der Brauwirtschaft,<br />
-wissenschaft, des Hopfenhandels,<br />
des<br />
Hopfenpflanzerverbandes; Hopfenberatung;<br />
F. Rothmeier,<br />
stellvertr. Landrat Pfaffenhofen<br />
(21 TN)<br />
KG Hoheitsvollzug LfL-Mitarbeiter, 15 TN<br />
EDV-Datenaustausch<br />
Besprechung bei der UNIKA –<br />
Arbeitskreis Pflanzkartoffel<br />
Projekttreffen, Arbeitsgruppe<br />
SAPRO/KAPRO EDV in der<br />
Saatenanerkennung<br />
Arbeitskreis - Leiter von den<br />
Anerkennungsstellen od. Stellvertreter<br />
Mitglieder der Fachkommission,<br />
32 TN<br />
Arbeitskreis – Leiter von den<br />
Anerkennungsstellen, TN 20<br />
LKP-Ausschusssitzung LKP-Ausschussmitglieder<br />
Workshop - Aufgabenbeschreibung<br />
der künftigen Abt. L2 und<br />
L3 der ÄELF mit Vortrag<br />
Tagung der Arbeitsgemeinschaft<br />
der Anerkennungsstellen<br />
Mitarbeiter der ÄELF, FÜAK,<br />
StMELF u. <strong>Landesanstalt</strong><br />
Leiter der Anerkennungsstellen<br />
in Deutschland, TN 20<br />
SKV-Ausschusssitzung Ausschussmitglieder<br />
Plombierungsausschuss <strong>für</strong> Saat-<br />
und Pflanzgut<br />
Züchter, Vermehrer, LKP, IPZ,<br />
TN 15
138 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
Eisenschink, E.-<br />
M., Linseisen, L.,<br />
IPZ 6a,<br />
Voit, B., IPZ 6c<br />
Kupfer, H.,<br />
Bauch, G.,<br />
Eisenschink, E.-<br />
M., Linseisen, L.,<br />
IPZ 6a;<br />
Voit, B., IPZ 6c<br />
Kupfer, H.,<br />
Eisenschink, E.-<br />
M., IPZ 6a<br />
Kupfer, H.,<br />
Eisenschink, E.-<br />
M., IPZ 6a<br />
Geiger, H.,<br />
IPZ 6b<br />
Geiger, H.,<br />
IPZ 6b<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
12.09.<strong>2011</strong><br />
Kassel<br />
21.-22.09.<strong>2011</strong><br />
Fulda<br />
29.-30.03.<strong>2011</strong><br />
Gülzow<br />
16.06.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
07.-09.11.<strong>2011</strong><br />
Wünsdorf/<br />
Zossen<br />
16.-17.11.<strong>2011</strong><br />
Göttingen<br />
08.12.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
24.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
28.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
22.03.<strong>2011</strong><br />
Kassel<br />
01.12.<strong>2011</strong><br />
Barbing<br />
15.-16.02.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
12.-14.04.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Vortragsveranstaltung - Evaluierung<br />
Sorten- und Saatgutrecht<br />
Vortragsveranstaltung - Wirtschaftliche<br />
Fachtagung <strong>für</strong> Futterpflanzen<br />
und Zwischenfruchtsaatgut<br />
Leiter der AG der Anerkennungsstellen,<br />
8 TN<br />
Züchter, VO-Firmen, Behördenvertreter,<br />
ca. 100 TN<br />
Arbeitsgruppe Virustestung Leiter von Anerkennungsstellen<br />
und Teststationen <strong>für</strong> Pflanzkartoffeln<br />
Testgremium Pflanzkartoffel Verbandsvertreter, Züchter,<br />
Vertr. 2.1 P der ÄELF<br />
89. Sitzung der AG Anerkennungsstellen<br />
<strong>für</strong> landw. Saat-<br />
und Pflanzgut<br />
Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Kartoffelzüchtung<br />
und Pflanzguterzeugung<br />
Leiter der Anerkennungsstellen<br />
in Deutschland, TN 20<br />
Mitglieder der GPZ-<br />
Arbeitsgemeinschaft Kartoffelzüchtung<br />
und Pflanzguterzeugung<br />
Winterarbeitsbesprechung IPS FZ der ÄELF, StMELF,<br />
50 TN<br />
Dienstbesprechung der Amtlichen<br />
Saatenanerkennung mit<br />
dem gD der FZ der ÄELF und<br />
dem LKP<br />
Dienstbesprechung Amtliche<br />
Saatenanerkennung mit dem gD<br />
der ÄELF<br />
Beratung über die Entwicklung<br />
eines neuen EDV-Programmes<br />
<strong>für</strong> die Saatenanerkennung<br />
gD FZ Fachzentrum Pflanzenbau<br />
der ÄELF, LKP-Vertreter u.<br />
Erzeugerringe,<br />
TN 25<br />
gD der ÄELF, SG 2.1 P, TN 20<br />
Arbeitskreis – Leiter von den<br />
Anerkennungsstellen, TN 20<br />
SGV-Jahreshauptversammlung Mitglieder des Landesverbandes<br />
<strong>Bayerische</strong>r Saatgetreideerzeuger-Vereinigungen<br />
e.V.<br />
Besprechung mit den Beauftragten<br />
der Betriebs- und Verkehrskontrolle,<br />
sowie der Anwendungskontrolle<br />
PS<br />
Tagung der Arbeitsgemeinschaft<br />
Pflanzenschutzmittelkontrolle<br />
Beauftragte der Ämter,<br />
25 Teilnehmer<br />
Vertreter der Pflanzenschutzkontrolldienste<br />
der Länder und<br />
des BVL, 27 Teilnehmer
139 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Veranstaltet<br />
durch bzw.<br />
beteiligt:<br />
Geiger, P.,<br />
IPZ 6b<br />
Killermann B.,<br />
Voit B., Dressler,<br />
M., IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
Voit, B., Dressler,<br />
M., IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
Voit, B.,<br />
Dressler, M.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B.,<br />
Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Datum /Ort Thema Teilnehmer, Anzahl<br />
25.10.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
26.01.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
09.03.<strong>2011</strong><br />
Lambrecht/Pfalz<br />
15.-18.03.<strong>2011</strong><br />
Giessen<br />
05.-07.04.<strong>2011</strong><br />
Prag<br />
13.-16.06.<strong>2011</strong><br />
Zürich<br />
13.-15.09.<strong>2011</strong><br />
Speyer<br />
22.-23.11.<strong>2011</strong><br />
Gumpenstein<br />
03.05.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
20.07.<strong>2011</strong><br />
Freising<br />
Besprechung mit den Beauftragten<br />
der Betriebs- und Verkehrskontrolle,<br />
sowie der Anwendungskontrolle<br />
PS<br />
Projektbesprechung, Zwergsteinbrand,<br />
Steinbrand<br />
Beauftragte der Ämter,<br />
TN 24<br />
Projektpartner und Öko-<br />
Verbände<br />
TN 17<br />
VDLUFA-Workshop Erweiteter VDLUFA-Vorstand<br />
TN 18<br />
Wissenschaftstagung Öko-<br />
Landbau<br />
Frühjahrsarbeitstagung der FG<br />
Saatgut im VDLUFA<br />
Berater, Wissenschaftler,<br />
Landwirte<br />
TN 170<br />
Saatgutanalysten, Züchter und<br />
Wissenschaftler<br />
TN 52<br />
ISTA Annual Meeting Saatgutanalysten, Wissenschaftler,<br />
Stimmberechtigte; TN 210<br />
VDLUFA-Kongress Wissenschaftler, Berater, Firmen,<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>liche<br />
Untersuchungsanstalten;<br />
TN 420<br />
62. Pflanzenzüchtertagung der<br />
Vereinigung der Pflanzenzüchter<br />
und Saatgutkaufleute Österreichs<br />
AK Krankheiten und Schädlinge<br />
im Ökologischen Landbau<br />
Wissenschaftler, Berater,<br />
Landwirte, Firmen, Landw.<br />
Untersuchungsanstalten;<br />
TN 130<br />
Öko-Verbände, LfL-Mitarbeiter<br />
(IPS, IAB, IPZ)<br />
ISTA-Probenehmerschulung Probenehmer, LKP, IPZ<br />
TN 15
140 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2.2 Gemeinsames Kolloquium der Pflanzenbauinstitute der LfL<br />
Thema/Titel Ort,<br />
Datum<br />
„Auswuchs und Fallzahlstabilität bei Weizen“,<br />
Dr. Lorenz Hartl, (IPZ 2c), Dr. Volker Mohler, (IPZ 2c)<br />
„Radolan – Erhebung von Starkniederschlägen mit Hilfe von Radardaten“,<br />
Elmar Weigl, Deutscher Wetterdienst<br />
„Ergebnisse zur Tropfbewässerung im Kartoffelbau“,<br />
Dr. Martin Müller, (ILT 1a)<br />
„Feldmaikäfer – Comeback eines vermeintlich Ausgestorbenen“,<br />
Dr. Ullrich Benker, (IPS 2d)<br />
„20 Jahre Protoplastenfusion bei Kartoffeln – Erfahrungen und Perspektiven“,<br />
Dr. Andrea Schwarzfischer, (IPZ 3b)<br />
„Ausbringung und Verwertung von Biogas-Gärrest“,<br />
Fabian Lichti, (IAB 2a)<br />
„Neuerungen bei der Ausbringung von Gülle“,<br />
Dr. Stefan Neser, (ILT 2b)<br />
„Optimierte integrierte Produktion oder Bioanbau – Wo liegt die Zukunft<br />
<strong>für</strong> den Gemüsebau?“<br />
Bernhard Leuprecht, (IPS 3e)<br />
Aktionsprogramm Heimische Eiweißfuttermittel<br />
• „Überblick und Stand der Umsetzung“,<br />
Josef Groß, ILB<br />
• „Abschätzung der Proteinpotentiale“,<br />
Dr. Robert Schätzl, ILB<br />
• „Unkrautkontrolle in Leguminosen“,<br />
Klaus Gehring, IPS<br />
„Integrierte Kontrollstrategien gegen die Späte Rübenfäule (Rhizoctonia<br />
solani) der Zuckerrrübe – Untersuchungen zu Erreger-Nachweis und Quantifizierung<br />
in Feldböden“,<br />
Dr. Jan Nechwatal, IPS<br />
Freising,<br />
11.01.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
18.01.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
01.02.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
15.02.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
01.03.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
15.03.<strong>2011</strong><br />
Freising,<br />
29.03.<strong>2011</strong><br />
Teilnehmerzahl<br />
ca. 40<br />
ca. 40<br />
ca. 45<br />
ca. 40<br />
ca. 40<br />
ca. 40<br />
ca. 45<br />
22.11.<strong>2011</strong> ca. 45<br />
06.12.<strong>2011</strong> ca. 45
141 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2.3 Vorträge<br />
(AG-Arbeitsgruppe)<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 1a Müller, M. Gentechnik in der <strong>Landwirtschaft</strong><br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnik in der Diskussion<br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnik – eine Technologie<br />
in der Sackgasse?<br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnik in der <strong>Landwirtschaft</strong><br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnik – Fachliche<br />
Grundlagen<br />
IPZ 1a Müller, M. Optimierung von DH-Technologien<br />
in der Gräserzüchtung zur<br />
Entwicklung leistungsfähiger<br />
Gräsersorten<br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnologie - Herausforderung<br />
und Antwort - Stand<br />
der Wissenschaft<br />
IPZ 1a Müller, M. Entwicklungen in der Grünen<br />
Gentechnik<br />
BBV Zukunftskonferenz<br />
Marktfrucht-<br />
Fachtagung, ErzeugerringPflanzenbau<br />
Südbayern,<br />
AELF Augsburg<br />
Lions Club Freising<br />
VLF-Oberbayern<br />
Bezirkshauptausschusssitzung<br />
Akademie <strong>für</strong> Politische<br />
Bildung<br />
GFP-Wintertagung,<br />
Abt. Futterpflanzen<br />
ArGe Naherholung<br />
„Mittleres<br />
Labertal“ -<br />
Labertaler Gespräch<br />
VLF-Ingolstadt-<br />
Eichstädt<br />
IPZ 1a Müller, M. Grüne Gentechnik <strong>Bayerische</strong> Meisterschule<br />
<strong>für</strong> Gemüsebau/Herr<br />
Schmitt<br />
IPZ 1a Müller, M. Entwicklungen in der Grünen<br />
Gentechnik<br />
IPZ 1b Diethelm, M. Identifizierung und Kartierung<br />
differentiell exprimierter Gene<br />
nach Fusarium graminearum Inokulation<br />
in Winterweizen<br />
IPZ 1b Halaweh, B. „Phenomics, Transkriptomics<br />
und Genomics – ein integrierter<br />
Ansatz zur Effizienzsteigerung<br />
in der Selektion trockenstresstoleranter<br />
Gerste“<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Genomanalyse in der Züchtungsforschung<br />
VLF-Ingolstadt-<br />
Eichstädt<br />
GPZ-Tagung; Von-<br />
Rümker Vorträge<br />
BLE/GFP Projekttagung<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
24.01.11,<br />
Ev. Bildungszentrum<br />
Hesselberg<br />
14.02.11,<br />
Laimering<br />
17.02.11,<br />
WZW-Freising<br />
21.03.11,<br />
Aschheim<br />
20.10.11,<br />
Tutzing<br />
09.11.11,<br />
Bonn<br />
16.11.11,<br />
Holztraubach-<br />
Pfaffenberg<br />
17.11.11,<br />
Nassenfels<br />
21.11.11,<br />
LfL Freising<br />
29.11.11,<br />
Großmehring-<br />
Theißing<br />
29.03.11,<br />
Quedlinburg<br />
05.04.11,<br />
Bonn<br />
Referendare 13.04.11,<br />
Freising<br />
35<br />
100<br />
40<br />
40<br />
35<br />
40<br />
50<br />
15<br />
15<br />
100<br />
8
142 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 1b Diethelm, M. Identifizierung und Kartierung<br />
differentiell exprimierter Gene<br />
nach Fusarium graminearum Inokulation<br />
in Winterweizen<br />
IPZ 1b Hofmann, K. Exploiting genetic variation for<br />
resistance to important pathogens<br />
in barley – Development of<br />
diagnostic markers and physical<br />
mapping for Rrs1 resistance locus<br />
against scald.<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Genomanalyse in der Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Diethelm, M. Klimatoleranz bei Gerste –von<br />
der Induktion zur Genfunktion“Ein<br />
„Smart Breeding“ -<br />
Ansatz zur Selektion auf Trockentoleranz<br />
und UV-<br />
Strahlungsresistenz<br />
IPZ 1b Halaweh, B. „Phenomics, Transkriptomics<br />
und Genomics – ein integrierter<br />
Ansatz zur Effizienzsteigerung<br />
in der Selektion trockenstresstoleranter<br />
Gerste“<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Genomanalyse in der Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Diethelm, M. Transcriptome analysis of barley<br />
exposed to climate stress; sowie<br />
3 Poster<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Biotechnologie in der <strong>Landwirtschaft</strong><br />
und Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Klimatoleranz bei Gerste – ein<br />
biotechnologischer Ansatz zur<br />
Ertragssicherung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. Genomanalyse und Gentechnik<br />
in der Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Diethelm, M. Genexpressionsanalysen bei<br />
Weizen nach Inokulation mit<br />
Fusarium graminearum<br />
AS-Fusarium 13.04.11,<br />
Freising<br />
ExpResBar-<br />
Meeting<br />
Amt <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong><br />
Rosenheim<br />
AS - Klima mit<br />
StMELF<br />
TUM Züchterseminar,<br />
Prof. C.C.<br />
Schön<br />
Camerloher Gymnasium<br />
KL. 11<br />
MüPf-Tagung<br />
(Münchner Pflanzenforscher<br />
FH-Freising Fakultät<br />
Biotechnologie<br />
und Bioinformatik;<br />
PLV- PraxisbegleitendeLehrveranstaltung<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
14.04.11,<br />
Quedlinburg<br />
25.05.11,<br />
Freising<br />
31.05.11,<br />
Freising<br />
06.07.11,<br />
Freising<br />
19.07.11,<br />
Freising<br />
21.07.11,<br />
Freising<br />
30.09.11,<br />
FH-Freising<br />
LFL-Jahrestagung 19.10.11,<br />
Freising<br />
<strong>Bayerische</strong> Meisterschule<br />
<strong>für</strong> Gemüsebau/Herr<br />
Schmitt<br />
GPZ-<br />
Pflanzenzüchter/Pflanzenschutz-<br />
Tagung<br />
21.11.11,<br />
Freising<br />
06.12.11,<br />
Fulda<br />
50<br />
150
143 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 2a Nickl, U. Differenzierung der Winterweizensorten<br />
bezüglich der<br />
Mykotoxinakkumulation<br />
Abschlusstagung<br />
des Verbundprojektes<br />
QualityNet,<br />
Abteilung Getreide<br />
der GFP<br />
IPZ 2a Nickl, U. Pflanzenbauliche Versuche Referendarausbildung<br />
IPZ 2a Nickl, U. Ergebnisse der Fusariumversuche<br />
von Winterweizen und<br />
Triticale<br />
Sitzung des Arbeitsschwerpunktes<br />
„Mykotoxine“<br />
IPZ 2a Nickl, U. Neue Sorten bei Roggen Getreidefachtagung<br />
mit Verband dt.<br />
Mühlen<br />
IPZ 2b Herz, M. Kornanomalien der neu zugelassenen<br />
Sorten<br />
IPZ 2b Herz, M. Aktuelle Ergebnisse aus der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 2b Herz, M.,<br />
Aschenbach,<br />
B. Ruge-<br />
Wehling, B.<br />
'Gesunde Gerste'<br />
Eine biotechnologiegestützte<br />
Züchtungsstrategie zur Erhöhung<br />
der Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Ramularia-Blattflecken<br />
IPZ 2b Herz, M. Aktuelle Ergebnisse des<br />
“Neuen Berliner Programms“<br />
Ernte 2010<br />
IPZ 2b Herz, M. Association of differentially expressed<br />
genes during<br />
micromalting to QTL for malt<br />
quality in spring barley<br />
IPZ 2b Cais, R. Vorstellung des Wintergersten-<br />
Zuchtmaterials im Zuchtgarten<br />
IPZ 2b Herz, M. Ausblick und Prognose über Ertrag<br />
und Qualität der Sommergerste<br />
in Bayern<br />
IPZ 2b Herz, M. Ausblick und Prognose über Ertrag<br />
und Qualität der Sommergerste<br />
in Bayern<br />
IPZ 2b Cais, R. Vorstellung des Sommergersten-<br />
Zuchtmaterials im Zuchtgarten<br />
IPZ 2b Herz, M. Ausblick und Prognose über Ertrag<br />
und Qualität der Sommergerste<br />
in Bayern<br />
Sitzung des Sortengremiums<br />
des<br />
neuen Berliner<br />
Programms<br />
8. Rohstoffseminar<br />
Weihenstephan<br />
GFP Sommertagung<br />
Getreide<br />
Frühjahrsarbeitsbesprechung<br />
des IPZ<br />
mit den 2.1P<br />
33. Congress European<br />
Brewery<br />
Convention<br />
BPZ-SommertagungWintergerste <br />
Braugerstenrundfahrt<br />
des Braugerstenvereins <br />
Braugerstenrundfahrt<br />
Unterfranken<br />
BPZ-Sommertagung,<br />
AG Sommergerste <br />
Braugerstenrundfahrt<br />
Oberfranken<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
04.04.11,<br />
Freising<br />
13.04. 11,<br />
Freising<br />
13.04.11,<br />
Freising<br />
29.06.11,<br />
Freising<br />
06.02.11,<br />
Berlin<br />
14.02.11,<br />
Freising<br />
07.05.11,<br />
Stuttgart<br />
Hohenheim<br />
22.05.11<br />
25.05.11,<br />
Glasgow<br />
29.06.11,<br />
Niedertraubling<br />
05.07.11<br />
12.07.11<br />
13.07.11,<br />
Rinkam<br />
22.07.11<br />
25<br />
22<br />
15<br />
55
144 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 2b Herz, M. Versuche zur Beurteilung besonderer<br />
Eigenschaften von<br />
Hybridwintergerste<br />
IPZ 2b Herz, M. Mehrländerprojekt<br />
„Düngestrategien zu Winterbraugerste“ <br />
Sommerarbeitsbesprechung<br />
des IPZ<br />
mit den AELF SG<br />
2.1P<br />
Sommerarbeitsbesprechung<br />
des IPZ<br />
mit den 2.1P<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
27.07.11<br />
27.07.11<br />
IPZ 2b Herz, M. Fachkritik Braugerste Herbstschau 16.09.11,<br />
Moosburg<br />
IPZ 2b Herz, M. Braugerstensorten in Fokus 47. MälzereitechnischeArbeitstagung<br />
IPZ 2b Herz, M. Entwicklung von Erzeugung und<br />
Qualität der Braugerste in Bayern<br />
IPZ 2b Cais, R. Vorstellung der Ergebnisse des<br />
Sommergersten-Zuchtmaterials<br />
IPZ 2c Mohler, V. Late-maturity α-Amylase –<br />
Ein genetischer Defekt führt zu<br />
niedrigen Fallzahlen<br />
IPZ 2c Mohler, V. Assoziations- und QTL-<br />
Kartierung von Backqualitätseigenschaften<br />
IPZ 2c Mohler, V. Bestimmung der Pm3e-<br />
Mehltauresistenz in der Winterweizensorte<br />
Cortez<br />
XIII. <strong>Bayerische</strong>r<br />
Braugerstentag<br />
BPZ-Sitzung,<br />
Sommergerste<br />
Sitzung des Getreideausschusses<br />
der<br />
ArbeitsgemeinschaftGetreideforschung<br />
e.V.<br />
Abschlusstagung<br />
des Verbundprojektes<br />
QualityNet,<br />
Abteilung Getreide<br />
der GFP<br />
Abschlusstagung<br />
des Verbundprojektes<br />
QualityNet,<br />
Abteilung Getreide<br />
der GFP<br />
IPZ 2c Hartl, L. Neue Sorten bei Weizen Getreidefachtagung<br />
mit Verband dt.<br />
Mühlen<br />
IPZ 2c Hartl, L. Molekulargenetische Ergebnisse<br />
der Züchtungsforschung zur<br />
Bewertung der Backqualität bei<br />
Weizen<br />
IPZ 2c Hartl, L. Pflanzenbauexaktversuche – Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> den Fortschritt<br />
4. Wissenschaftliches<br />
Symposium<br />
des Verbandes<br />
Deutscher Mühlen,<br />
e. V.<br />
Saatgetreideerzeugervereinigung<br />
Oberpfalz, Erzeugerring<br />
f. landw.<br />
pflanzliche Qualitätsprodukte<br />
Oberpfalz<br />
26.10.11,<br />
Planegg<br />
08.12.11,<br />
München<br />
14.12.11,<br />
Freising<br />
15.03.11,<br />
Detmold<br />
04.04.11,<br />
Freising<br />
04.04.11,<br />
Freising<br />
29.06.11,<br />
Freising<br />
14.10.11,<br />
Würzburg<br />
11.11.11,<br />
Mariaort<br />
20<br />
25<br />
25<br />
55<br />
40<br />
30
145 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 2c Mohler, V. Genetische Analyse des Merkmals<br />
Fallzahl in europäischen<br />
Winterweizen<br />
IPZ 2c Hartl, L. Nutzung des Qualitätsfortschritts<br />
bei Winterweizen<br />
IPZ 2c Mohler, V. Einfluss des Kornhärtelocus<br />
Pin-D1 auf Backqualitätsmerkmale<br />
bei Winterweizen<br />
IPZ 3a<br />
IPZ 3b<br />
Kellermann,<br />
A., Groth, J.,<br />
Song, Y.,<br />
Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3a Kellermann,<br />
A.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
Beitrag zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit<br />
von Kartoffelpopulationen<br />
gegen Kartoffelkrebs<br />
durch Einsatz effizienter<br />
Testverfahren, hier am Beispiel<br />
markergestützter PCR-<br />
Analysen<br />
Vermehrungen: Probleme in der<br />
Anerkennung 2010,<br />
Neue Sorten: Problemlöser mit<br />
Zukunft<br />
Wie kann die Pflanzgutqualität<br />
bei der Kartoffel verbessert werden?<br />
Bedeutung des Kartoffel M-<br />
Virus, Pflanzgutqualität, latenter<br />
Krautfäulebefall und<br />
Schwarzbeinigkeitsbefall<br />
Erhebung zu Rhizoctonia,<br />
Stand der Auswertung<br />
„Blue Lamp“ – Breite Anwendung<br />
möglich?<br />
Das Berufsfeld aus der Sicht eines<br />
Mitarbeiters an der LfL<br />
62. Pflanzenzüchtertagung<br />
der Vereinigung<br />
der Pflanzenzüchter<br />
und<br />
Saatgutkaufleute<br />
Österreichs<br />
Initiative Grundwasserschutz<br />
durch<br />
Ökolandbau, L2.1P<br />
Arbeitskreis Weizen<br />
der BPZ<br />
GFP-Wintertagung<br />
Abt. Kartoffeln<br />
Erzeugerringe<br />
Südbayern<br />
Erzeugerringe<br />
Oberpfalz<br />
Frühjahrsdienstbesprechung<br />
der LfL<br />
mit L 2.1 P<br />
Frühjahrsdienstbesprechung<br />
der LfL<br />
mit L 2.1 P<br />
GFP-<br />
Sommertagung<br />
Abt. Futterpflanzen<br />
Praktikantenamt<br />
Weihenstephan<br />
Sortenberatung Kartoffeln Fachzentren Pflanzenbau<br />
der ÄLF<br />
20 Jahre Protoplastenfusion -<br />
Erfahrungen und Perspektiven<br />
IPZ 3b Leiminger, J. Schwellenorientierte Bekämpfungsstrategien<br />
gegen Alternaria<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
23.11.11,<br />
Raumberg-<br />
Gumpenstein,<br />
Österreich<br />
07.12.11,<br />
Estenfeld<br />
14.12.11,<br />
Freising<br />
09.11.11,<br />
Bonn<br />
24.02.11,<br />
Moosinnig<br />
11.03.11,<br />
Moosinnig<br />
22.03.11,<br />
Moosinnig<br />
22.03.11,<br />
Moosinnig<br />
13.04.11,<br />
Freising<br />
09.05.11,<br />
Freising<br />
02.12.11,<br />
Freising<br />
LfL Kolloquium 01.03.11,<br />
Freising<br />
DPG Arbeitskreis<br />
Integrierter PflanzenschutzProjektgruppe<br />
Kartoffel<br />
02.03.-<br />
03.03.11,<br />
Braunschweig<br />
100<br />
120<br />
15<br />
30<br />
100<br />
70<br />
20<br />
20<br />
40<br />
70<br />
40<br />
50
146 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
Healthy food production and<br />
maintenance of biodiversity with<br />
modern plant breeding strategies<br />
Forum Life Science<br />
- Bayern<br />
Innovativ<br />
Biotechnologie Kartoffel Referendarausbildung<br />
Vorstellung des<br />
Krautfäuleprojektes<br />
20 years with protoplast fusion<br />
in potato breeding<br />
IPZ 3b Leiminger, J. Disease orientated threshold<br />
values as tool for effective early<br />
blight control<br />
IPZ 3b Leiminger, J. Sensitivity of German Alternaria<br />
solani isolates against QoI fungicides<br />
IPZ 3c Aigner, A. Sojabohnen – Anbau und Fütterung<br />
IPZ 3c Aigner, A. Ergebnisse und Erfahrungen aus<br />
den bayer. Sojaversuchen<br />
IPZ 3c Aigner, A. Sortenberatung Winterraps<br />
RAW<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
23.03.11,<br />
Garching<br />
14.04.11,<br />
Freising<br />
BLE 13.07.11,<br />
Bonn<br />
3-Jahrestagung der<br />
EAPR<br />
Euroblight workshop,<br />
A potato late<br />
blight network for<br />
Europe<br />
Euroblight workshop,<br />
A potato late<br />
blight network for<br />
Europe<br />
24.07.-<br />
29.07.11,<br />
Oulu, Finnland<br />
09.10.-<br />
12.10.11,<br />
St. Petersburg,<br />
Russland<br />
09.10.-<br />
12.10.11,<br />
St. Petersburg,<br />
Russland<br />
VLF Wasserburg 10.02.11,<br />
Eiselfing<br />
Öko-Sojafeldtag<br />
von Naturland<br />
25.06.11,<br />
Kissing<br />
SG 2.1 P der ÄLF 26.07.11,<br />
Hirschaid<br />
IPZ 3c Aigner, A. Sojaanbau eine Alternative VLF Ebersberg 07.11.11,<br />
Grafing<br />
IPZ 3c Aigner, A. Aktuelle Informationen zum<br />
Anbau von Körnerleguminosen<br />
IPZ 3c Aigner, A. Aktuelle Informationen zum<br />
Anbau von Körnerleguminosen<br />
IPZ 3c Aigner, A. Sortenabstimmung Leguminosen<br />
in ökologischen Landbau<br />
FÜAK Lehrgang 17.11.11,<br />
Hesselberg,<br />
Gerolfingen<br />
FÜAK Lehrgang 22.11.11,<br />
Regenstauf<br />
Verbände des ökologischenLandbaus<br />
IPZ 3c Aigner, A. Sortenberatung Leguminosen Fachzentren Pflanzenbau<br />
der ÄLF<br />
IPZ 3c Aigner, A. Versuchserfahrungen Sojaanbau<br />
in Bayern <strong>2011</strong><br />
IPZ 3d Heuberger, H. Züchterische Verbesserung von<br />
Baldrian: Ertrag, Wurzelmorphologie,<br />
Valerensäuren im<br />
Zuchtmaterial, Veränderung des<br />
Ploidiestatus<br />
Treffen der projektbegleitenden<br />
AG „Ausweitung<br />
des Sojaanbaus in<br />
Deutschland“<br />
Experten-AG<br />
Züchtung,<br />
„KAMEL“-<br />
DemonstrationsvorhabenArzneipflanzen<br />
01.12.11,<br />
Freising<br />
02.12.11,<br />
Freising<br />
14.12.11,<br />
Frankfurt/Main<br />
23.02.11,<br />
Bernburg<br />
100<br />
8<br />
20<br />
100<br />
95<br />
95<br />
35<br />
80<br />
35<br />
35<br />
24<br />
23<br />
25<br />
12<br />
15
147 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 3d Heuberger, H. Züchterische Verbesserung von<br />
Baldrian<br />
IPZ 3d Heuberger, H. Verwandtschaftsverhältnisse<br />
und Ploidiestufen ausgewählter<br />
Herkünfte und Wildformen des<br />
Arznei-Baldrians<br />
IPZ 3d Seidenberger,<br />
R.<br />
Zubereitungen aus Heilpflanzen<br />
der Traditionellen Chinesischen<br />
Medizin (TCM) - Sicherung definierter<br />
Rohware durch dokumentierten<br />
Anbau<br />
IPZ 3d Heuberger, H. Aktueller Stand des Anbaus<br />
Chinesischer Heilkräuter in<br />
Bayern<br />
IPZ 3d Heuberger, H. Zeitschrift <strong>für</strong> Arznei- und Gewürzpflanzen<br />
– Wissens- und<br />
Informationsplattform <strong>für</strong> die<br />
Branche<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide Ganzpflanzensilage<br />
sowie mögliche Fruchtfolgegestaltung<br />
IPZ 4a Darnhofer, B. Optimierung des Maisanbaus<br />
zur Biogasproduktion<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Der Einsatz von Getreide Ganzpflanzensilage<br />
<strong>für</strong> die Biogasproduktion<br />
mit möglicher<br />
Fruchtfolgegestaltung<br />
IPZ 4a Darnhofer, B. Mais <strong>für</strong> die Biogaserzeugung -<br />
Ansätze zur Optimierung des<br />
Anbaus<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide Ganzpflanzensilage<br />
sowie mögliche Fruchtfolgegestaltung<br />
IPZ 4a Darnhofer, B. Optimierung des Maisanbaus<br />
zur Biogasproduktion<br />
Wissenschaftlicher<br />
Beirats zum Demonstrationsvorha<br />
ben „KAMEL“<br />
6. Fachtagung Arznei-<br />
und Gewürzpflanzen<br />
6. Fachtagung Arznei-<br />
und Gewürzpflanzen<br />
Wissenschaftlicher<br />
Kongress der SMS<br />
„Chinesische Medizin<br />
im klinischen<br />
Alltag – Grundlagen,<br />
Anwendung<br />
und Wissenschaft“<br />
Sitzung der FAH-<br />
Arbeitsgruppe<br />
„Arzneipflanzenbau“<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Süddeutsche Biogas<br />
- Fachtagung<br />
Süddeutsche Biogas<br />
– Fachtagung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
28.06.11,<br />
Artern<br />
21.09.11,<br />
Berlin<br />
21.09.11,<br />
Berlin<br />
01.10.11,<br />
Tutzing<br />
08.12.11,<br />
Bonn<br />
18.01.11,<br />
Landshut<br />
18.01.11,<br />
Landshut<br />
26.01.11,<br />
Westerheim<br />
26.01.11,<br />
Westerheim<br />
01.02.11,<br />
Bayreuth<br />
01.02.11,<br />
Bayreuth<br />
30<br />
20<br />
150<br />
20<br />
20<br />
200<br />
200<br />
20<br />
20
148 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 4a Eder, J. Parameter <strong>für</strong> die Biogas-<br />
Sortenempfehlung<br />
der LfL und der AELF in Bayern<br />
IPZ 4a Eder, J. Maisanbau <strong>für</strong> Biogas unter<br />
oberfränkischen Anbaubedingungen<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide-Ganzpflanzensilage/<br />
Zweitfrüchte <strong>für</strong> die Biogasproduktion<br />
Ergebnisse aus Bayern<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide Ganzpflanzensilage<br />
sowie mögliche Fruchtfolgegestaltung<br />
IPZ 4a Darnhofer, B. Optimierung des Maisanbaus<br />
zur Biogasproduktion<br />
IPZ 4a Eder, J. Ergebnisse der<br />
Fusariumuntersuchungen bei<br />
Körnermais<br />
IPZ 4a Riedel, C. Ringversuch Energie aus Wildpflanzen<br />
– erste Erfahrungen<br />
und Ergebnisse<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide Ganzpflanzensilage<br />
sowie Zweit- und Zwischenfrüchte<br />
IPZ 4a Eder, B. Optimierung des Maisanbaus<br />
zur Biogasproduktion<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Optimierung von Biogasfruchtfolgen<br />
IPZ 4a Hofmann, D. Getreide Ganzpflanzensilage<br />
sowie Zweit- und Zwischenfrüchte<br />
IPZ 4a Eder, B. Optimierung des Maisanbaus<br />
zur Biogasproduktion<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Mäuse, Rispe & Co – Aktuelles<br />
zur Grünlandpflege<br />
Syngenta Beraterseminar<br />
Biogas<br />
Oberfränkisches<br />
Biogas Fortbildungsseminar<br />
Biogas Expertenseminar<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Sitzung des Arbeitsschwerpunktes<br />
„Mykotoxine“<br />
Biogasstammtisch<br />
Maschinenring<br />
ND-SOB, AELF<br />
Pfaffenhofen<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Projektstatusseminar<br />
Biogas im<br />
StMELF<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Biogas Schulung:<br />
Modul Substratproduktion<br />
und –<br />
bereitstellung<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
03.02.11,<br />
Ingolstadt<br />
08.02.11,<br />
Kloster Banz<br />
03.03.11,<br />
Ingolstadt<br />
14.03.11,<br />
Landsberg<br />
14.03.11,<br />
Landsberg<br />
13.04.11,<br />
Freising<br />
25.11.11,<br />
Mitterscheyern<br />
06.12.11,<br />
Landsberg<br />
06.12.11,<br />
Landsberg<br />
14.12.11,<br />
München<br />
22.12.11,<br />
Bayreuth<br />
22.12.11,<br />
Bayreuth<br />
AELF Nördlingen 14.01.11<br />
180<br />
15<br />
15<br />
15<br />
15<br />
15<br />
15<br />
15<br />
20<br />
20
149 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Luzerne- und Kleegrasanbau -<br />
Erzeugung von heimischen Eiweiß<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Grünlandverbesserung und -<br />
erneuerung<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Luzerne- und Kleegrasanbau -<br />
Erzeugung von heimischen Eiweiß<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Aktuelle Entwicklungen bei der<br />
Prüfung und Empfehlung <strong>für</strong><br />
Gräser und kleinkörnige Leguminosen<br />
in Bayern<br />
AELF Fürstenfeldbruck<br />
Jungzüchter AELF<br />
Passau<br />
AELF Schwandorf,<br />
LKV Leistungsoberprüfer<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
03.02.11<br />
28.02.11<br />
01.03.11<br />
IPZ / SG 3.1 23.03.11<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Nachsaat, Übersaat, Sortenwahl AELF Augsburg 24.03.11<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Grünlanderträge und -bestände<br />
verbessern<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Aktuelle Entwicklungen beim<br />
Empfehlungssystem <strong>für</strong> Gräser<br />
und kleinkörnige Leguminosen<br />
in Bayern<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Top Grünland – mit Nach- und<br />
Übersaat die Leistung und Qualität<br />
steigern<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Grünlandverbesserung und -<br />
erneuerung<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Intensives Grünland professionell<br />
führen<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Seenreinhaltung und Grünlandverbesserung<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Erste Ergebnisse von<br />
Weidelgrasuntersaaten bei Roggen<br />
und Triticale<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Sortenwahl bei Gräsern und<br />
kleinkörnigen Leguminosen und<br />
Hinweise zum Einsatz von Saatgutmischungen<br />
IPZ 4b Hartmann, St. Geeignete Gräser-Sortenprofile<br />
<strong>für</strong> intensives Grünland<br />
IPZ 4b Jacob, I. Selektion und Entwicklung<br />
anthracnoseresistenter Rotkleesorten<br />
IPZ 4b Jacob, I. Anthracnose bei Rotklee – Progress<br />
Report<br />
AELF Schweinfurt 01.04.11<br />
SFG 15.04.11<br />
HLS Almesbach<br />
und AELF Weiden<br />
AELF Kempten<br />
und AELF Kaufbeuren<br />
03.05.11<br />
17.05.11<br />
AELF Rosenheim 05.07.11<br />
AELF Traunstein /<br />
Interreg<br />
AELF Pfaffenhofen<br />
Biogasstammtisch<br />
FÜAK Schulung<br />
Grünlandberater<br />
der ER und Mitarbeiter<br />
der Grünguttrocknungen<br />
14.09.11<br />
25.11.11<br />
07.12.11<br />
AELF Mindelheim 02. 03 11<br />
3. AGROSNET<br />
Doktorandentag,<br />
Univ. Halle<br />
Forschungsanstalt<br />
ART, Molekulare<br />
Ökologie/CH<br />
17.01.11<br />
29.11.11
150 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 4b Lunenberg, T. Beispiel zur genetischen Variabilität<br />
bei diploiden Artkreuzungen<br />
zwischen Deutschem Weidelgras<br />
(Lolium perenne) und<br />
Wiesenschwingel (Festuca<br />
pransis)<br />
IPZ 4b Wosnitza, A. Alternativen zu Mais im Futterbau<br />
IPZ 4b Lunenberg, T. Bewertung von Kreuzungen<br />
zwischen Deutschem Weidelgras<br />
und Wiesenschwingel<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Optimierung der Hopfentrocknung<br />
durch das richtige Verhältnis<br />
der Trocknungsparameter<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Hopfentrocknung: Dimensionierung,<br />
Optimierung, Automatisierung<br />
IPZ 5a Portner, J. Kosten der Hopfentrocknung in<br />
Abhängigkeit von Trocknungsleistung<br />
und Technisierungsgrad<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Optimierung der Hopfentrocknung<br />
durch das richtige Verhältnis<br />
der Trocknungsparameter<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelles zur Produktionstechnik<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Strategien zur Bekämpfung der<br />
Peronospora Primärinfektion<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelles zur Produktionstechnik<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Strategien zur Bekämpfung der<br />
Peronospora Primärinfektion<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Auswertungsversammlung Hopfenschlagkartei<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
Hopfen: Düngung mit Haupt-<br />
und Spurennährstoffen<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Auswertungsversammlung Hopfenschlagkartei<br />
IPZ 5a Münsterer, J. Auswertungsversammlung Hopfenschlagkartei<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelles zur Produktionstechnik<br />
Vereinigung der<br />
Pflanzenzüchter<br />
und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs<br />
mit HBLFA<br />
Raumberg-<br />
Gumpenstein<br />
3. Diabrotica-<br />
Tagung im Rahmen<br />
des Forschungsverbundes<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
23.11.11<br />
14.12.11<br />
LAZBW Aulendorf 16.12.11<br />
Hopfenpflanzerverband<br />
Tettnang<br />
Hopfenbautagung<br />
AELF Abensberg<br />
25.01.11,<br />
Tettnang<br />
26.01.11,<br />
Elsendorf<br />
AELF LA u. AB 26.01.11,<br />
Elsendorf<br />
Hopfenring 11.01.-07.02.11,<br />
9 Orte<br />
BayWa 08.02.11,<br />
Mainburg<br />
BayWa 08.02.11,<br />
Mainburg<br />
Beiselen GmbH 21.02.11,<br />
Mainburg<br />
Beiselen GmbH 21.02.11,<br />
Mainburg<br />
AK Hopfen 22.02.11,<br />
Haunsbach<br />
Fa. Barth 22.02.11,<br />
Mainburg<br />
IGN 23.02.11, Niederlauterbach<br />
AK Schlagkartei 24.02.11,<br />
Wolnzach<br />
LfL u. ÄELF 23.02. -<br />
04.03.11,<br />
9 Orte<br />
80<br />
100<br />
420<br />
20<br />
20<br />
25<br />
25<br />
18<br />
13<br />
40<br />
8<br />
555
151 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Strategien zur Bekämpfung der<br />
Peronospora Primärinfektion<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Strategien zur Bekämpfung der<br />
Peronospora Primärinfektion<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
Hopfen: Aktueller Pflanzenschutz<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelle Zulassungssituation<br />
von Pflanzenschutzmittels im<br />
Hopfens<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
LfL u. AELF 23.02 –<br />
04.03.11,<br />
9 Orte<br />
GFH Techn.- wiss.<br />
Arbeitsausschuss<br />
Hopfenpflanzer-<br />
Gruppe<br />
DHWV u. HVH/<br />
Landhandel, Bay-<br />
Wa und PS-<br />
Industrie<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
29.03.11,<br />
Wolnzach<br />
11.04.11,<br />
Wolnzach<br />
27.05.11,<br />
Mainburg<br />
Aktueller Pflanzenschutz IGN 01.06.11, Niederlauterbach<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Prognoseschulung, Aktuelles<br />
zum Pflanzenschutz<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
LfL u. AELF Roth 01.06.11,<br />
Spalt<br />
Maßnahmen nach Hagelschlag HVH 20.06.11,<br />
Koppenwall<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelles zum Pflanzenschutz AELF Roth 15.07.11,<br />
Spalt<br />
IPZ 5a Portner, J. Ordnungsgemäßer Zwischenfruchtanbau<br />
im Hopfen unter<br />
dem Aspekt Erosionsschutz<br />
IPZ 5a Portner, J. Ordnungsgemäßer Zwischenfruchtanbau<br />
im Hopfen unter<br />
dem Aspekt Erosionsschutz<br />
IPZ 5a Portner, J. Aktuelle Pflanzenschutzprobleme<br />
und mögliche Lösungen im<br />
Hopfenbau<br />
LfL 03.08.11,<br />
Niederlauterbach<br />
LfL 04.08.11,<br />
Aiglsbach und<br />
Niederlauterbach<br />
HVH 01.09.11,<br />
Bad Gögging<br />
IPZ 5a Portner, J. Fachkritik Hopfen <strong>2011</strong> Stadt Moosburg 15.09.11,<br />
Moosburg<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
Welke: Stand der Forschung und<br />
Wege der Bekämpfung<br />
IPZ 5a Schätzl, J. Jahresrückblick, Beratungssaison<br />
<strong>2011</strong><br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
IPZ 5a Niedermeier,<br />
E.<br />
Welke: Stand der Forschung und<br />
Wege der Bekämpfung; Strategien<br />
zu Virus<br />
Alte und neue Versuchsergebnisse<br />
zur Düngung und dessen<br />
Einfluss auf den Welkebefall<br />
Hopfenpflanzerver-<br />
band Elbe-Saale<br />
Hopfenpflanzer,<br />
Behörden, Organisationen<br />
Hopfenring u. LfL/<br />
Ringbetreuer u.<br />
Fachberater<br />
HR/ ISO-zertifizierte<br />
Betr.<br />
Arbeitskreis Unternehmensführung<br />
Hopfen<br />
30.11.11,<br />
Grimma /<br />
Höfgen<br />
05.12.11,<br />
Wolnzach<br />
08.12.11,<br />
Aiglsbach<br />
15.12.11,<br />
Haunsbach<br />
555<br />
30<br />
11<br />
25<br />
23<br />
69<br />
70<br />
40<br />
40<br />
75<br />
60<br />
150<br />
56<br />
75<br />
9
152 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Ökologischer Hopfenbau in<br />
Deutschland und der Welt:<br />
Einführung und Bedeutung<br />
IPZ 5b Schwarz, J. Erste Ergebnisse zum BLE-<br />
Projekt "Reduzierung oder Ersatz<br />
kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel<br />
im ökologischen<br />
Hopfenbau"<br />
IPZ 5b Schwarz, J. Aktuelle Versuchsergebnisse<br />
zum Einsatz von Sprüh-<br />
Molkenpulver zur Bekämpfung<br />
der Gemeinen Spinnmilbe<br />
Tetranychus urticae im ökologischen<br />
Hopfenbau<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Ökologischer Hopfenbau in<br />
Deutschland und der Welt:<br />
Einführung und Bedeutung<br />
IPZ 5b Schwarz, J. Entwicklung von Blatt- und<br />
Doldenfläche von Hopfen über<br />
die Vegetationsperiode<br />
IPZ 5b Engelhard, B. Nichts ist beständiger als der<br />
Wandel - ein Rückblick auf 16<br />
Jahre Hopfenforschung und 11<br />
Wünsche an die Hopfenpflanzer<br />
IPZ 5b Schwarz, J. Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln<br />
im Hopfen<br />
<strong>2011</strong><br />
IPZ 5b Engelhard, B. Überprüfung einer Bodenanwendung<br />
von Actara im Hopfenanbau<br />
auf mögliche schädliche<br />
Auswirkungen auf Bienen<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. The significance of Brown and<br />
Green Lacewings as aphid predators<br />
in the special crop hops<br />
(Neuroptera: Hemerobiidae,<br />
Chrysopidae)<br />
IPZ 5b Engelhard, B. Verhalten der Bienen im Hopfengarten<br />
und Auswirkung auf<br />
den Einsatz von Insektiziden<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Überblick zur weltweiten Produktion<br />
von Öko-Hopfen<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Marktanalyse Biohopfen –<br />
Deutschland, Europa, Welt<br />
Ring junger<br />
Hopfenpflanzer,<br />
Winterversammlung<br />
Hopfenbau-Tag des<br />
Bioland-<br />
Arbeitskreises<br />
Hopfen<br />
Hopfenbau-Tag des<br />
Bioland-<br />
Arbeitskreises<br />
Hopfen<br />
Hopfenbau-Tag des<br />
Bioland-<br />
Arbeitskreises<br />
Hopfen<br />
DLR Neustadt a. d.<br />
Weinstraße<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
25.01.11,<br />
Niederlauterbach<br />
02.02.11,<br />
Berching-<br />
Plankstetten<br />
02.02.11,<br />
Berching-<br />
Plankstetten<br />
02.02.11,<br />
Berching-<br />
Plankstetten<br />
17.02.11,<br />
Neustadt a. d.<br />
Weinstraße<br />
LfL u. ÄELF 23.02. –<br />
04.03.11,<br />
9 Orte<br />
LfL u. ÄELF 23.02. –<br />
04.03.11,<br />
9 Orte<br />
Imkerverband<br />
Niederbayern<br />
Entomologentagung<br />
der Deutschen<br />
Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> allgemeine und<br />
angewandte Entomologie<br />
TWA, Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Hopfenforschung<br />
e.V.<br />
TWA, Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Hopfenforschung<br />
e.V.<br />
LfL-Arbeitskreis<br />
'Märkte <strong>für</strong> Ökolebensmittel'<br />
22.03.11,<br />
Elsendorf<br />
24.03.11,<br />
Berlin<br />
29.03.11,<br />
Wolnzach<br />
29.03.11,<br />
Wolnzach<br />
13.04.11,<br />
München<br />
65<br />
22<br />
22<br />
22<br />
10<br />
555<br />
555<br />
55<br />
20<br />
30<br />
30<br />
11
153 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Downy mildew control in organic<br />
hops: How much copper is actually<br />
needed?<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Überblick über Arbeitsschwerpunkte<br />
am Hopfenforschungszentrum<br />
Hüll – Pflanzenschutz<br />
IPZ 5b Schwarz, J. Erarbeitung von integrierten<br />
Pflanzenschutzverfahren gegen<br />
den Luzernerüssler im Hopfen –<br />
5. Koordinationstreffen<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Die Arthropodenfauna von Hopfendolden<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Neuropteren<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. Kupferreduktion im Hopfen -<br />
Ergebnisse eines BLE-Projekts<br />
sowie Saisonrückblick und Status<br />
der Kupfer-Strategie im Bereich<br />
Hopfen<br />
IPZ 5c Seefelder, S. Investigations about the occurrence<br />
of Verticillium in some<br />
Regions oft he Hallertau<br />
IPZ 5c Drofenigg, K. Development of methods for the<br />
molecular detection of Verticillium<br />
pathotypes in hops and<br />
strategies for containment and<br />
prevention of wilt<br />
IPZ 5c Seefelder, S. Investigations about occurrence<br />
and characterization of different<br />
strains of hop wilt (Verticillium<br />
ssp.) to develop a control strategy<br />
against this pathogen<br />
IPZ 5c Oberhollenzer,<br />
K.<br />
Resistance mechanisms of different<br />
hop genotypes to hop<br />
powdery mildew<br />
IPZ 5c Drofenigg, K. Development of a rapid molecular<br />
in-planta test for the detection<br />
of Verticillium pathotypes<br />
in hop and strategies to prevent<br />
wilt<br />
IPZ 5c Seigner, E. Administrative meeting of the<br />
Scientific Commission<br />
International Hop<br />
Growers´ Convention,<br />
Scientific<br />
Commission<br />
Besuch der<br />
Tsingtao Brewery,<br />
China mit Barth &<br />
Sohn<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
21.06.11,<br />
Lublin (Polen)<br />
11.11.11,<br />
Hüll<br />
JKI 16.11.11,<br />
Braunschweig<br />
30. Jahrestagung<br />
des Arbeitskreises<br />
„Nutzarthropoden“<br />
der DPG und der<br />
DGaaE<br />
Fachgespräch<br />
"Kupfer im Pflanzenschutz"<br />
von JKI<br />
und BÖLW<br />
48th Hop Seminar<br />
in Slovenia with internationalparticipation <br />
Doktorandenseminar,<br />
Prof. Hückelhoven,<br />
TUM<br />
33. Congress European<br />
Brewery<br />
Convention<br />
Tagung der Wissenschaftl.Kommission<br />
(WK) des<br />
Internat. Hopfenbaubüros<br />
(IHB)<br />
Tagung der WK<br />
des IHB<br />
Tagung der WK<br />
des IHB<br />
30.11.11,<br />
Geisenheim<br />
01.12.11,<br />
Berlin-Dahlem<br />
04.02.11,<br />
Portoroz<br />
11.04.11,<br />
Freising<br />
24.05.11,<br />
Glasgow<br />
21.06.11,<br />
Lublin, Polen<br />
22.06.11,<br />
Lublin, Polen<br />
22.06.11,<br />
Lublin, Polen<br />
53<br />
8<br />
20<br />
55<br />
90<br />
120<br />
25<br />
52<br />
52<br />
52
154 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 5c Oberhollenzer,<br />
K.<br />
Development of a transient<br />
transformation assay and functional<br />
analysis of a hop MLOgene<br />
in powdery mildew resistance<br />
IPZ 5c Lutz, A. Neue Trends in der Hopfenzüchtung<br />
IPZ 5c Seigner, E. Aktuelle Zielsetzungen der Hopfenzüchtung<br />
IPZ 5c Lutz, A. Hopfensorten und Bonitur von<br />
Qualitätsmerkmalen<br />
IPZ 5c Seigner, E. Überblick über Arbeitsschwerpunkte<br />
am Hopfenforschungszentrum<br />
Hüll – Züchtung, chem.<br />
Analyse und Hopfenbau<br />
IPZ 5c Lutz, A. Flavour Hops – Neue Hopfensorten<br />
<strong>für</strong> den Biermarkt<br />
IPZ 5d Kammhuber,<br />
K.<br />
IPZ 5d Kammhuber,<br />
K.<br />
IPZ 5d Kammhuber,<br />
K.<br />
Differenzierung des Welthopfensortiments<br />
mit Hilfe der niedermolekularen<br />
Polyphenole<br />
Differentiation of the world hop<br />
collection by means of the low<br />
molecular polyphenols<br />
Niedermolekulare Polyphenole<br />
zur Differenzierung des Welthopfensortiments<br />
IPZ 6a Kupfer, H. Aufgabenbeschreibung der künftigen<br />
Abt. L2 und L3 der ÄELF<br />
IPZ 6a Bauch, G. Untersuchungen zur Übertragung<br />
des Erregers Dickeya spp.<br />
IPZ 6a Kupfer, H. Saatgutrecht der Europäischen<br />
Union<br />
IPZ 6a Kupfer, H. Evaluierung Sorten- und Saatgutrecht <br />
Doktorandenseminar,<br />
Prof. Hückelhoven,<br />
TUM<br />
Informationsreihe<br />
<strong>für</strong> Handel und<br />
Verbände im Hopfen<br />
Informationsreihe<br />
<strong>für</strong> Handel und<br />
Verbände im Hopfen <br />
Alt-WeihenstephanerBrauerbund<br />
Besuch der<br />
Tsingtao Brewery,<br />
China mit Barth &<br />
Sohn<br />
17. Arbeitszirkel<br />
<strong>für</strong> ISO-Betriebe<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
25.07.11,<br />
Freising<br />
17.10.11,<br />
19.10.11,<br />
20.10.11,<br />
24.10.11,<br />
Hüll<br />
19.10.11,<br />
20.10.11,<br />
24.10.11,<br />
Hüll<br />
07.11.11,<br />
Freising<br />
11.11.11,<br />
Hüll<br />
08.12.11,<br />
Aiglsbach<br />
GfH-TWA 29.03.<strong>2011</strong>,<br />
Wolnzach<br />
Tagung der WK<br />
des IHB<br />
Informationsreihe<br />
<strong>für</strong> Handel und<br />
Verbände im Hopfen<br />
21.06.11,<br />
Lublin, Polen<br />
17.10.11,<br />
19.10.11,<br />
20.10.11,<br />
24.10.11,<br />
Hüll<br />
StMELF 02.03.11,<br />
Petersberg/<br />
Erdweg<br />
Julius Kühn-<br />
Institut/ BundesarbeitskreisBakterielleQuarantänekrankheiten<br />
IPZ<br />
Referendare<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
der Anerkennungsstellen<br />
16.03.11,<br />
Berlin<br />
13.04.11,<br />
Freising<br />
12.09.11,<br />
Kassel<br />
23<br />
85<br />
85<br />
35<br />
8<br />
30<br />
30<br />
52<br />
85
155 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ 6a Kupfer, H. Harmonisierung des EU-Rechts:<br />
Entwicklungen bei der Pflanzgutanerkennung<br />
IPZ 6a Bauch, G. Epidemiologische Untersuchungen<br />
zu Schwarzbeinigkeit bei<br />
Pflanzkartoffeln in Bayern<br />
IPZ 6a Kupfer, H. Überlegungen zur Zukunft der<br />
Saatgutanerkennung in Deutschland<br />
IPZ 6a Bauch, G. Schwarzbeinigkeit – Ein Problem<br />
im Kartoffelbau<br />
IPZ 6a Bauch, G. Vorstellung des Anerkennungsverfahrens<br />
Kartoffeln<br />
IPZ 6b Geiger, P. Illegaler Handel mit Pflanzenschutzmitteln;<br />
Ergebnisse und<br />
Konsequenzen<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
Voit, B. Erarbeitung von Schwellenwerten<br />
zur wirksamen Bekämpfung<br />
von Steinbrand (Tilletia caries)<br />
und Zwergsteinbrand (Tilletia<br />
controversa)<br />
Dressler, M. Schwellenwerte und weitere Entscheidungshilfen<br />
bei Befall mit<br />
Zwergsteinbrand (Tilletia controversa)<br />
und Steinbrand (Tilletia<br />
caries)<br />
Killermann, B. Activity report of the Variety<br />
Committee<br />
Voit, B. ISTA-Probenehmerschulung<br />
alle Regierungsbezirke<br />
Killermann, B. Zwergsteinbrand – Steinbrand<br />
zwei „alte Bekannte“ kehren zurück<br />
Voit, B. Zwergsteinbrand – Steinbrand<br />
zwei „alte Bekannte“ kehren zurück<br />
Voit, B. Saatgutqualität Wintergetreide<br />
<strong>2011</strong><br />
Killermann, B. Unterscheidung von zwei- und<br />
mehrzeiliger Gerste mittels<br />
Pyrosequenzierung von Punktmutationen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Pflanzenzüchtung<br />
e.V.<br />
Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Pflanzenzüchtung<br />
e.V.<br />
Bundesverband<br />
Deutscher Pflanzenzüchter,<br />
Abt.<br />
Futterpflanzen<br />
Stärkekartoffelerzeuger-<br />
Vereinigung<br />
Ein- und Verkaufsgenossenschaft<br />
Schrobenhausen<br />
Sommerarbeitsbesprechung<br />
IPZ mit<br />
dem hD der SG<br />
2.1P<br />
11. WissenschaftstagungÖkologischer<br />
Landbau<br />
11. WissenschaftstagungÖkologischer<br />
Landbau<br />
ISTA Annual<br />
Meeting<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
17.09.11,<br />
Göttingen<br />
17.09.11,<br />
Göttingen<br />
22.09.11,<br />
Fulda<br />
02.11.11,<br />
Regensburg<br />
11.11.11,<br />
Freising<br />
27.07.11,<br />
Hirschaid<br />
17.03.11,<br />
Gießen<br />
18.03.11,<br />
Gießen<br />
14.06.11,<br />
Zürich<br />
LKP München 20.07.11,<br />
Freising<br />
Sommerarbeitsbesprechung<br />
IPZ<br />
mit dem hD der SG<br />
2.1 P<br />
Arbeitsbesprechung<br />
gD mit den<br />
Ämtern<br />
Öko-Landbau Sortenwesen,Herbstanbau;<br />
VDLUFA-<br />
Kongress<br />
27.07.11,<br />
Hirschaid<br />
28.07.11,<br />
Freising<br />
24.08.11,<br />
Freising<br />
15.09.11,<br />
Speyer<br />
35<br />
20<br />
35<br />
210<br />
18<br />
35<br />
15<br />
45
156 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
Voit, B. Bekämpfung von Zwergsteinbrand<br />
und Steinbrand im Ökolandbau<br />
und konventionellen<br />
Landbau<br />
Voit, B. Warum sind Steinbrand und<br />
Zwergsteinbrand derzeit nicht<br />
nur im ökologischen Getreidebau<br />
ein Problem?<br />
Voit, B. Zwergsteinbrand im Weizenbestand<br />
und seine Biologie<br />
Voit, B. Der Handel mit Wildpflanzensaatgut<br />
auf Basis der EU-<br />
Richtlinie<br />
Killermann, B. • Besteht zwischen Keimfähigkeit<br />
und Fallzahl ein Zusammenhang?<br />
• Ergebnisse der Beschaffenheitsprüfung<br />
bei Ackerbohnen<br />
und Futtererbsen 2010<br />
IPZ 6d Dressler, M. Mehrjährige Ergebnisse zur<br />
Strategie gegen Zwergsteinbrand<br />
(Tilletia controversa) und Steinbrand<br />
(Tilletia caries) im Ökologischen<br />
Getreidebau<br />
Herbstarbeitungsbesprechung<br />
IPS<br />
62. Pflanzenzüchtertagung<br />
der Vereinigung<br />
der Pflanzenzüchter<br />
und<br />
Saatgutkaufleute<br />
Österreichs<br />
Ökolandbau-<br />
Feldtag <strong>2011</strong><br />
VDLUFA-<br />
Kongress<br />
Winterarbeitsbesprechung<br />
IPZ mit<br />
dem hD der<br />
SG 2.1 P<br />
VDLUFA-<br />
Kongress<br />
IPZ-L Doleschel, P. Biotechnology at the IPZ 13. Münchener<br />
Pflanzenforschertreffen<br />
IPZ-L Doleschel, P. Versuchs- und Forschungstätigkeit<br />
am Hopfenforschungszentrum<br />
in Hüll im Jahre 2010<br />
IPZ-L Doleschel, P. Vorstellung des Instituts <strong>für</strong><br />
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung <br />
GfH-Mitgliederversammlung <br />
Referendarausbildung<br />
IPZ-L Doleschel, P. Vorstellung der LfL AG Pflanzenschutzmittelkontrolle<br />
IPZ-L Doleschel, P. Begrüßung und Einführung IPZ Referendarausbildung<br />
IPZ-L Doleschel, P. Begrüßung und Aktuelles Getreidefachtagung<br />
mit Verband dt.<br />
Mühlen<br />
IPZ-L Doleschel, P. Eröffnung des 4. Kartoffeltages LfL/AELF<br />
Ansbach<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
06.10.11,<br />
Freising<br />
23.11.11,<br />
Gumpenstein<br />
01.07.11,<br />
Viehhausen<br />
15.09.11,<br />
Speyer<br />
22.03.11,<br />
Freising<br />
15.09.11,<br />
Speyer<br />
21.07.011,<br />
Freising<br />
29.03.11,<br />
Wolnzach<br />
06.04.11,<br />
Freising<br />
12.04.11,<br />
Freising<br />
13.04.11,<br />
Freising<br />
29.06.11,<br />
Weihenstephan<br />
21.07.11,<br />
Dürrenmungenau<br />
30<br />
100<br />
100<br />
45<br />
28<br />
45<br />
50<br />
150<br />
22<br />
30<br />
6<br />
55<br />
100
157 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name Thema/Titel Veranstalter/<br />
Besucher<br />
IPZ-L Doleschel, P. Neues aus der Hopfenforschung Niederlauterbacher<br />
Hopfentag<br />
IPZ-L Doleschel, P. Überblick über das IPZ Besuch der Ein-<br />
und Verkaufsgenossenschaft<br />
Schrobenhausen<br />
IPZ-L Doleschel, P. Sortenschutz bei Hopfen Jahresgespräch der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Hopfenforschung<br />
5.2.4 Vorlesungen<br />
Name Lehreinrichtung Thema<br />
Schweizer, G. Hochschule Weihenstephan Triesdorf, Fachbereich<br />
Land- und Ernährungswirtschaft<br />
Schweizer, G. Hochschule Weihenstephan Triesdorf, Fakultät<br />
Gartenbau und Lebensmitteltechnologie<br />
Mohler, V. Technische Universität München, Fakultät Wissenschaftszentrum<br />
Weihenstephan<br />
Mohler, V. Technische Universität München, Fakultät Wissenschaftszentrum<br />
Weihenstephan<br />
Killermann, B. Hochschule Weihenstephan Triesdorf, Fachbereich<br />
Land- und Ernährungswirtschaft<br />
Datum /Ort Teilneh<br />
mer<br />
25.08.11,<br />
Niederlauterbach<br />
11.11.11,<br />
Freising<br />
22.11.11,<br />
Hüll<br />
62<br />
55<br />
20<br />
Biotechnologie in der Pflanzenzüchtung<br />
(WS)<br />
Gartenbauliche Pflanzenzüchtung und<br />
Grundlagen der Pflanzenbiotechnologie<br />
(SS)<br />
Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion<br />
(SS)<br />
Landnutzung in den Tropen und Subtropen<br />
(WS)<br />
Saatguterzeugung/Saatgutunter- suchung<br />
(SS)<br />
Hartmann, St. TUM WZW Ökologische Futterbau (SS) [1,5 SWS]<br />
Eder, J. Hochschule Weihenstephan Triesdorf, Fachbereich<br />
Land- und Ernährungswirtschaft, Technische<br />
Universität München, Wissenschaftszentrum<br />
Weihenstephan. Masterstudiengang Agrarmanagement<br />
Modul Ackerfutterbau<br />
SS=Sommersemester, WS =Wintersemester<br />
Silomais: Anbau, Sorten, Qualität,<br />
Versuchswesen
158 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2.5 Führungen, Exkursionen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 1a Baumann, A. 17.03.11 Gewebekulturen Schülerin 1<br />
IPZ 1a Baumann, A. 24.03.11 Gewebekulturen FH Studenten, Fachrichtung<br />
<strong>Landwirtschaft</strong><br />
IPZ 1a Baumann, A. 06.04.11 Gewebekulturen Master Studentin TUM 1<br />
IPZ 1a Baumann, A. 21.06.11 Gewebekulturen Cooperativa - Agraria aus<br />
Guava Puava, Brasilien<br />
IPZ 1ac Müller, M. 08.02.11 Gewebekulturtechniken TUM; Student 1<br />
IPZ 1ac Müller, M. 09.03.11 Doppelhaploide und Gentechnik<br />
Herr Schüssler (StMELF)<br />
mit Delegation aus Südafrika<br />
IPZ 1ac Müller, M. 14.04.11 Gewebekulturtechniken Referendare 3<br />
IPZ 1ac Müller, M.,<br />
Baumann, A.<br />
14.04.11 Gewebekulturtechniken GFP-Mitglieder,<br />
2 Führungen<br />
IPZ 1ac Müller, M. 23.05.11 Doppelhaploide V. Mohler mit Studenten 5<br />
IPZ 1ac Müller, M. 08.06.11 Doppelhaploide Fr. Stabentheiner mit Studenten<br />
der Uni Graz<br />
IPZ 1ac Müller, M. 06.07.11 Gewebekulturtechniken Franziska Rank, Studentin 1<br />
IPZ 1ac Müller, M. 21.11.11 Gentechnik <strong>Bayerische</strong> Meisterschule <strong>für</strong><br />
Gemüsebau/Herr Schmitt<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 08.02.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 09.02.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 14.04.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 25.04.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 25.05.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 19.07.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 21.11.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 1b Schweizer, G. 22.11.11 Genomanalyse in der<br />
Züchtungsforschung<br />
IPZ 2b Herz, M. 17.05.11 Züchtungsforschung<br />
Braugerste<br />
FH-Biotechnologie; Leitg<br />
Prof. Bartke<br />
2<br />
1<br />
6<br />
30<br />
15<br />
15<br />
Fr. Heineke; Uni Graz 1<br />
Referendare 15<br />
GFP, Leitung CorNet-<br />
Programm<br />
Amt <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong><br />
Rosenheim; Hauswirtschaft<br />
Camerloher Gymnasium<br />
Kl. 11<br />
<strong>Bayerische</strong> Meisterschule <strong>für</strong><br />
Gemüsebau/Herr Schmitt<br />
TUM; LS Genetik, Prof.<br />
Gierl, Prof Torres<br />
MA des <strong>Landwirtschaft</strong>sministeriums<br />
und Universität<br />
Namibia, Fa. Durst Malz und<br />
SyngentaSeeds<br />
3<br />
4<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
8
159 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
IPZ 2b Reichenberger,<br />
G., Herz, M.,<br />
Doleschel, P.<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
31.05.11 Rollgewächshaus, Trockenstress<br />
bei Getreide<br />
IPZ 2b Herz, M. 29.06.11 Züchtungsforschung<br />
Braugerste<br />
IPZ 2c Friedlhuber, R. 31.05.11 Rollgewächshaus, Trockenstress<br />
bei Getreide<br />
IPZ 2c Mohler, V. 08.06.11 Prebreeding in der Weizenzüchtung<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.,<br />
Reichmann, M.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
23.03.11 Healthy food production<br />
and maintenance of biodiversity<br />
with modern<br />
plant breeding strategies<br />
Mitarbeiter StMELF 20<br />
Haus der Senioren, Ottobrunn<br />
22<br />
Mitarbeiter StMELF 20<br />
Studenten Uni Graz 20<br />
Internationale Delegation mit<br />
Bayern Innovativ im Rahmen<br />
des Forum Life Science<br />
14.04.11 Biotechnologie Kartoffel Referendare 15<br />
IPZ 3b Heringlehner, J. 25.05.11 Gentechnik Amt Rosenheim<br />
Hauswirtschaftsschüler<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3b Schwarzfischer,<br />
A.<br />
IPZ 3c Aigner, A.,<br />
Salzeder, G.<br />
8.06.11 Biotechnologie Kartoffel Studenten Uni Graz 20<br />
21.07.11 Organisation und Durchführung<br />
der Tagung<br />
Münchner Pflanzenforscher<br />
(MüPf)<br />
Münchner und Freisinger<br />
Pflanzenforscher<br />
06.04.11 Besichtigung WP Raps BSA. 1<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 18.04.11 Rapsbesichtigung UFOP, Frau Oschwald 1<br />
IPZ 3c Aigner, A. 20.04.11 Besichtigung LSV-RAW Syngenta, DSV, Limagrain, 7<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 20.04.11 Besichtigung ökologischer<br />
Versuche<br />
10<br />
25<br />
20<br />
IAB 3b 6<br />
IPZ 3c Aigner, A. 04.05.11 Besichtigung LSV RAW SW Seed 2<br />
IPZ 3c Aigner, A. 10.05.11 Besichtigung LSV RAW KWS 1<br />
IPZ 3c Aigner, A. 16.05.11 Führung durch den Arbeitsbereich<br />
IPZ 3c<br />
IPZ 3c Aigner, A.,<br />
Salzeder, G.<br />
26.05.11 Besichtigung RAW Versuche<br />
IPZ 3c Aigner, A. 06.06.11 Führung zu. Versuchswesen<br />
und Produktionstechnik<br />
RAW<br />
IPZ 3c Aigner, A. 07.06.11 Führung zu den Sojaversuchen<br />
Zürich, Reckenholz 2<br />
BSA 1<br />
Lehrstuhl <strong>für</strong> Pflanzenbau<br />
und Pflanzenzüchtung TU<br />
Weihenstephan<br />
Arbeitskreis Marktfruchtbau<br />
Unterfranken<br />
IPZ 3c Aigner, A. 24.06.11 Führung LSV RAW Firma Pioneer 2<br />
9<br />
20
160 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 28.06.11 Führung ökologischer<br />
Versuche<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 01.07.11 Feldtag Ökologischer<br />
Landbau, Viehhausen<br />
IPZ 3c Salzeder, G.,<br />
Aigner, A.<br />
IPZ 3c Aigner, A.,<br />
Salzeder, G.<br />
IPZ 3c Aigner, A.,<br />
Salzeder, G.<br />
IAB 3b 5<br />
Landwirte, Ökoberater 120<br />
04.07.11 Rapsbesichtigungen SFG, Herr Roether 2<br />
06.07.11 Führung mit dem Präsidenten<br />
Sojaversuche<br />
Oberhummel<br />
14.07.11 Führung zu den Sojaversuchen<br />
Diverse Führungspersonen 5<br />
Bioland 18<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 17.08.11 Sojaversuchsbesichtigung Landwirte Soja,<br />
Fürstenfeldbrucker-Land<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 30.08.11 Führung Sojaversuche Saatbau Linz 6<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 14.09.11 Besichtigung Zwischenfrüchte<br />
IPZ 3c Aigner, A. 26.09.11 Erläuterung Versuchsanlage<br />
Winterraps, Oberhummel<br />
IPZ 3c Salzeder, G. 14.11.11 Besichtigung Ökoversuche<br />
IPZ 3d Seidenberger, R. 28.04.11 Züchtung und Anbau chinesischer<br />
Heilpflanzen<br />
IPZ 3d Heuberger, H. 20.06.11 Anbau- und Züchtungsversuche,<br />
Sortimente von<br />
Heil- und Gewürzpflanzen<br />
IPZ 3d Heuberger, H. 28.07.11 Versuchskonzepte <strong>für</strong><br />
Kulturen mit Wurzelnutzung<br />
IPZ 3d Heuberger, H. 22.08.11 Angewandte Forschung<br />
bei Heil- und Gewürzpflanzen<br />
sowie Transfer<br />
in die Praxis<br />
IPZ 3d,<br />
AVB<br />
Heuberger, H.,<br />
Schmidmeier, L.<br />
13.09.11 Versuchsmanagement<br />
und Versuchstechnik<br />
Arznei- und Gewürzpflanzen<br />
IPZ 4b Jacob, I. 09.03.11 Anthracnoseresistenztest<br />
bei Rotklee<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 24.03.11 Begehung der Nachsaatflächen<br />
in Biberbach<br />
BSA, Herr Wienecke 1<br />
Herr Sanbu, Tibet 1<br />
IAB 3b 6<br />
Delegation aus China 9<br />
Ökoplant e.V. Förderverein<br />
ökologischer Arznei- und<br />
Gewürzpflanzenanbau<br />
Vertreter des <strong>Landwirtschaft</strong>skollegs<br />
Oulu, Lappland<br />
L. Tabrizi, Universität Teheran,<br />
M. Lorenz, Berater<br />
Vitaplant AG, Uttwil,<br />
Schweiz<br />
8<br />
30<br />
NPZ-Lemke 2<br />
AELF Augsburg 40<br />
4<br />
2<br />
4
161 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 4b Probst, M. 12.04.11 Führung durch die Landessortenversuche<br />
und<br />
Wertprüfungen <strong>für</strong> Futterpflanzen<br />
an der Versuchsstation<br />
der LfL<br />
Osterseeon<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 14.04.11 Führung durch den<br />
Zuchtgarten <strong>für</strong> Futterpflanzen<br />
der LfL<br />
IPZ 4b Seibel, F. (Univ.<br />
der Bundeswehr<br />
München)<br />
Hartmann, St.<br />
14.04.11 Vorführung einer UAV-<br />
Plattform als Prototyp einer<br />
automatisierten luftgestützten<br />
Bonitur im<br />
landwirtschaftlichen Versuchswesen<br />
mittels optischer<br />
Sensoren<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 12.05.11 Vorstellen von Sorten-<br />
und Mischungsversuchen<br />
am Standort Pfrentsch mit<br />
Übungen<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 16.05.11 Vorstellen der Versuche<br />
von Deutschem Weidelgras<br />
zur besonderen Eignung<br />
in Bayern (Buchen<br />
a. Auerberg)<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 17.05.11 Vorstellen der Versuche<br />
von Deutschem Weidelgras<br />
zur besonderen Eignung<br />
in Bayern (Buchen<br />
a. Auerberg)<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 25.05.11 Vorführung NIRS-Online<br />
Osterseeon<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 05.06.11 Vorstellen von Landessortenversuchen<br />
bei Gräsern<br />
am Standort<br />
Osterseeon mit Übungen<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 06.07.11 Vorstellen ausgewählter<br />
Sortenversuche<br />
IPZ 4b Seibel, F. (Univ.<br />
der Bundeswehr<br />
München),<br />
Hartmann, St.<br />
13.07.11 Vorstellen einer Vorführung<br />
einer UAV-<br />
Plattform als Prototyp einer<br />
automatisierten luftgestützten<br />
Bonitur im<br />
landwirtschaftlichen Versuchswesen<br />
mittels optischer<br />
Sensoren<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 28.07.11 Führung durch den<br />
Zuchtgarten <strong>für</strong> Futterpflanzen<br />
der LfL<br />
NPZ-Lemke 2<br />
GFP Abteilung Futterpflanzen<br />
GFP Abteilung Futterpflanzen<br />
HLS Almesbach und <strong>Landwirtschaft</strong>sschulen<br />
Weiden<br />
und Praktiker<br />
20<br />
50<br />
32<br />
LKP Mitarbeiter & Praktiker 80<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>sschulen<br />
Kempten und Mindelheim<br />
Teilnehmer aus LfL/SN und<br />
TLL/TH<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>sschulen Rosenheim,<br />
Wasserburg und<br />
Traunstein<br />
AELF Deggendorf<br />
(39. Grünlandtag Steinach)<br />
LVFZ Spitalhof/Kempten<br />
(25. Grünlandtag Spitalhof)<br />
Arbeitskreis Leguminosen<br />
und Futterpflanzenzüchtung<br />
<strong>für</strong> den ökologischen Landbau<br />
35<br />
17<br />
60<br />
ca.<br />
200<br />
ca.<br />
240<br />
8
162 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 4b Hartmann, St. 14.09.11 Führung durch Meisterarbeit<br />
zur Grünlandverbesserung<br />
und Flächen<br />
einer Praxisvorführung<br />
IPZ 5 Kammhuber, K.,<br />
Lutz, A.<br />
IPZ 5 Engelhard, B.,<br />
Kammhuber, K.,<br />
Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5 Seigner, E.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ 5 Seigner, E.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ 5 Lutz, A.,<br />
Kammhuber, K.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5 Seigner, E.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ 5 Lutz, A.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ 5 Seigner, E.,<br />
Lutz, A.,<br />
Kammhuber, K.,<br />
Weihrauch, F.<br />
IPZ 5 Seigner, E.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ-L,<br />
IPZ 5<br />
Doleschel, P.,<br />
Kammhuber, K.,<br />
Seigner, E.,<br />
Weihrauch, F.<br />
25.01.11 Hopfenzüchtung und<br />
Analytik<br />
Teilnehmer einer Interreg-<br />
Veranstaltung zur Seenreinhaltung<br />
Staatliche Fachoberschule,<br />
Landshut;<br />
01.03.11 Hop Research AB-InBev Management<br />
Team<br />
27.05.11 Hopfenforschung Österr. Schweinezuchtverband<br />
20.07.11 Hopfenforschung Studenten der Brau- und Getränketechnologie,<br />
WZW<br />
11.08.11 Hop Research at Huell –<br />
New trends for Craft<br />
Brewers<br />
23.09.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
27.09.11 Hopfenzüchtung; Hopfenanalytik<br />
und Qualität<br />
20.10.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
11.11.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
31.08.11 Hop Research at the Bavarian<br />
State Research<br />
Center for Agriculture<br />
IPZ 5a Schätzl, J. 12.05.11 Aktuelles zum Pflanzenschutz<br />
und zum Hopfenputzen,<br />
Flurbegehung<br />
IPZ 5a Portner, J. 19.05.11 Versuchsführung „Hopfenputzen<br />
– Alternativen<br />
zu Lotus“<br />
IPZ 5a Niedermeier, E. 24.06.11 Hopfen-Flurbegehung;<br />
Aktuelle Pflanzenschutzsituation<br />
und Strategien<br />
IPZ 5a Fuß, S. 27.06.11 Aktuelle Situation bei<br />
Krankheiten und Schädlingen,Hopfenputzversuch<br />
IPZ 5a Münsterer, J. 27.07.11 Bewässerungsversuche<br />
im Hopfen<br />
Stan Hieronymus, Braujournalist,<br />
USA<br />
Kirin und Mitsubishi,<br />
Dr. Pichlmaier, HVG<br />
Braustudenten Polar,<br />
Venezuela<br />
Sapporo Brewery, Japan;<br />
HVG<br />
Tsingtao Brewery, China;<br />
Barth<br />
Managementteam von Kirin<br />
und Mitsubishi;<br />
Dr. Pichlmaier, HVG<br />
Hopfenpflanzer Siegelbezirk<br />
Au<br />
Vertreter von BayWa und<br />
Landhandel, Hopfenpflanzer<br />
Hopfenpflanzer BBV-<br />
Ortsverband Stadt Geisenfeld<br />
in Unterpindhart<br />
93<br />
45<br />
7<br />
30<br />
33<br />
1<br />
8<br />
5<br />
6<br />
8<br />
8<br />
16<br />
60<br />
38<br />
IGN Hopfenpflanzer 25<br />
Ringbetreuer 12
163 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 5a Schätzl, J. 27.07.11 Flurbegehung: Aktuelle<br />
Pflanzenbau- und Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
im<br />
Hagelgebiet<br />
IPZ 5a Münsterer, J.,<br />
Fuß, S.,<br />
Portner, J.<br />
IPZ 5a Münsterer, J.,<br />
Fuß, S.<br />
IPZ 5a Münsterer, J.,<br />
Fuß, S.,<br />
Portner, J.<br />
03.08.11 Bewässerungsversuche,<br />
Sensortechnik im PS<br />
Erosionsschutz<br />
03.08.11 Bewässerungsversuche<br />
Sensortechnik im PS<br />
04.08.11 Bewässerungsversuche,<br />
Sensortechnik im PS<br />
Erosionsschutz<br />
IPZ 5a Münsterer, J. 10.08.11 Bewässerungsversuche<br />
im Hopfen<br />
IPZ 5a Niedermeier, E. 10.08.11 Flurbegehung: Aktuelle<br />
Pflanzenbau- und Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
IPZ 5a Niedermeier, E. 11.08.11 Bestandsbeurteilung und<br />
Maßnahmen gegen Welke<br />
IPZ 5a Münsterer, J. 12.08.11 Bewässerungsversuche<br />
im Hopfen<br />
IPZ 5a Fuß, S. 29.08.11 Flurbegehung: aktuelle<br />
Pflanzenbau- und Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
und Ernteempfehlungen<br />
im Hagelgebiet<br />
IPZ 5a Portner, J. 01.09.11 Hopfenrundfahrt<br />
(Busführung)<br />
Hopfenpflanzer Abens, Au,<br />
Osseltshausen<br />
17<br />
Ring junger Hopfenpflanzer 40<br />
VlF FS 18<br />
VlF LA und VlF KEH 75<br />
Workshop Bewässerung Firma<br />
Barth & Sohn<br />
20<br />
Hopfenpflanzer Wolnzach 16<br />
Fa. Barth, mit Vertragslandwirten<br />
der Boston Brewery<br />
Hopfenpflanzer mit LfL -<br />
Bewässerungsversuchen<br />
Hopfenpflanzer Hagelgebiet<br />
Mainburg<br />
Gäste des Verbands deutscher<br />
Hopfenpflanzer<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. 03.02.11 Öko-Hopfenbau University of Wisconsin,<br />
USA<br />
IPZ 5b Schwarz, J.;<br />
Weihrauch, F.<br />
25.08.11 Versuchswesen im Pflanzenschutz;<br />
Öko-Hopfenbau;<br />
Niedriggerüstanlage<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. 13.09.11 Öko-Hopfenbau;<br />
Pflanzenschutz<br />
Hopfenbaugenossenschaft<br />
Mühlviertel, AT<br />
57<br />
13<br />
35<br />
50<br />
Hopfenwirtschaftsverband 2<br />
IPZ 5b Weihrauch, F. 26.09.11 Öko-Hopfenbau Hopfenpflanzer, Kanada 1<br />
IPZ 5c Seigner, E. 09.03.11 Hop research at the Bavarian<br />
State Research<br />
Center for Agriculture<br />
IPZ 5c Lutz, A. 06.06.11 Zuchtstämme <strong>für</strong> Sudversuche<br />
Western Cape Delegation,<br />
Südafrika, und StMELF<br />
Veltins 2<br />
IPZ 5c Lutz, A. 09.06.11 Hopfenforschung Hüll <strong>Landwirtschaft</strong>l. Berufsschule<br />
Pfaffenhofen Amberger<br />
3<br />
2<br />
6<br />
13
164 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
IPZ 5c Seigner, E. 01.07.11 Hopfenforschung Vertreter der landwirtschaftl.<br />
Verwaltung, Korea<br />
IPZ 5c Lutz, A. 21.07.11 Hopfenzüchtung – Neue<br />
Zielsetzungen<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
28.07.11 Low trellis system –<br />
breeding efforts<br />
25<br />
Barth, Nürnberg 2<br />
US Dwarf Hop Assoc.,<br />
L. Roy, G. Morford<br />
IPZ 5c Lutz, A. 29.07.11 Hopfenforschung in Hüll <strong>Landwirtschaft</strong>sschule PAF,<br />
Sommersemester<br />
IPZ 5c Lutz, A. 08.08.11 Neue Aromanoten in der<br />
Hopfenzüchtung<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
10.08.11 Tettnanger Kreuzungsprogramm,<br />
Biogeneseversuche <strong>2011</strong><br />
H.P. Drexler, Scheider-<br />
Weisse, O. Weingarten,<br />
Hopfenpflanzerverband<br />
Tettnanger<br />
Hopfenpflanzerverband<br />
IPZ 5c Lutz, A. 18.08.11 Hopfenforschung Berufsschule <strong>für</strong> Brauwesen,<br />
München<br />
IPZ 5c Lutz, A. 18.08.11 Stand der Hopfenzüchtung,<br />
Hopfenreife, Ernteempfehlungen<br />
<strong>2011</strong><br />
IPZ 5c Seigner, E. 19.08.11 Hopfenforschungszentrum<br />
Hüll<br />
IPZ 5c Seigner, E.,<br />
Kammhuber, K.<br />
IPZ 5c Lutz, A. 25.08.11 Neue Hopfen-<br />
Zuchtstämme<br />
Infoveranstaltung des Hopfenringes<br />
<strong>für</strong> die ISO-<br />
Betriebe<br />
Besucher anlässlich der<br />
Hallertauer Hopfenwochen<br />
24.08.11 Hop Research Hop Products Australia,<br />
Barth<br />
2<br />
15<br />
2<br />
4<br />
2<br />
25<br />
15<br />
Veltins und Hopfenpflanzer 2<br />
IPZ 5c Lutz, A. 26.08.11 Sorten und Zuchtstämme Riegele Brauerei, Augsburg 5<br />
IPZ 5c Lutz, A. 02.09.11 Hopfen Züchtungsprogramm<br />
Barth, Versuchsbrauerei St.<br />
Johann<br />
IPZ 5c Lutz, A. 06.09.11 Hüll aroma hops Ron Barchet, Eric Toft 2<br />
IPZ 5c Lutz, A. 07.09.11 Hüller Hopfensorten und<br />
neue Zuchtstämme<br />
IPZ 5c Seigner, E. 19.09.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
BayWa, Dr. Kaltner 1<br />
AB-InBev – 4 Gruppen<br />
(USA, Skandinavien, Griechenland,<br />
Asia Pacific) Dr.<br />
Buholzer<br />
IPZ 5c Lutz, A. 20.09.11 Hüll breeding program Val Peacock, Dan Carey,<br />
Hopfen- und Brauexperten,<br />
USA<br />
IPZ 5c Lutz, A. 20.09.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
IPZ 5c Seigner, E. 25.09.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
IPZ 5c Seigner, E. 27.09.11 Biotechnologie und Genomanalyse<br />
bei Hopfen<br />
Sumitomo Japan,<br />
Dr. Pichlmaier, HVG<br />
AB-InBev – (USA,Türkei)<br />
Dr. Buholzer<br />
Braustudenten Polar, Venezuela<br />
2<br />
5<br />
98<br />
2<br />
4<br />
21<br />
5
165 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
29.09.11 Neue Hüller<br />
Aromahopfen<br />
05.10.11 Huell Hop Breeding, Historic<br />
wild hops, New<br />
Huell Aroma Hops<br />
IPZ 5c Lutz, A. 06.10.11 Neue Hüller<br />
Aromahopfen<br />
IPZ 5c Lutz, A. 13.10.11 Hop Research Center<br />
Hüll<br />
IPZ 5c Lutz, A. 13.10.11 Hop Research Center<br />
Hüll, new breeding lines<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
IPZ 5c Lutz, A.,<br />
Seigner, E.<br />
14.10.11 New breeding lines of the<br />
Hop Research Center<br />
Hüll<br />
17.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
19.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
19.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
20.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
21.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
24.10.11 Neue Zuchtstämme des<br />
Hopfenforschungszentrums<br />
Hüll<br />
IPZ 5c Lutz, A. 26.10.11 Hop Research Center<br />
Hüll, new breeding lines<br />
IPZ 5c Seigner, E. 07.11.11 Hop Research Center<br />
Hüll, breeding and plant<br />
protection<br />
Eric Toft, Schönram 1<br />
Mr. Lossignol, Dr. Buholzer,<br />
AB-InBev<br />
St. Weingart, Barth<br />
Brock Wagner, Saint Arnold<br />
Brewing Company, USA,<br />
HVG<br />
David Grinnell, Boston<br />
Brewery, Dr. Schönberger,<br />
Barth<br />
Advisory Board der GfH,<br />
Vorstand der GfH<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
11<br />
Hopsteiner 6<br />
Hallertauer<br />
Hopfenpflanzerverband<br />
Hopfenverwertungsgen.<br />
HVG; Lupex<br />
13<br />
10<br />
Hopfenpflanzer der GfH 40<br />
IPZ 5, GfH 11<br />
Barth 9<br />
Chris Dows, Botanix, UK 1<br />
Ann George und US-<br />
Pflanzer, O. Weingarten<br />
IPZ 5c Lutz, A. 09.11.11 Hop Breeding D. Gamache, USA 1<br />
IPZ-L,<br />
IPZ 5c<br />
Doleschel, P.,<br />
Seefelder, S.,<br />
Seigner, E.<br />
03.03.11 Hop Research – Genome<br />
analysis and Biotechnology<br />
IPZ 6a Kupfer, H. 24.02.11 Führung von KErn-<br />
Mitarbeitern durch die<br />
neuen Arbeitsräume, Am<br />
Gereuth 4<br />
AB-InBev Management<br />
Team<br />
KErn-Mitarbeiter 10<br />
8<br />
2
166 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
AG Name<br />
IPZ 6c/d Killermann, B.,<br />
Voit B.<br />
Datum Thema/Titel Gastinstitution TZ<br />
21.01.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung, Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit, B. 13.04.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung, Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Killermann, B.,<br />
Voit, B.<br />
IPZ 6c/d Killermann, B.,<br />
Voit, B.<br />
12.05.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
27.05.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit., B. 27.06.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit, B. 01.08.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Killermann, B.,<br />
Mosch, S.<br />
IPZ 6c/d Voit, B.,<br />
Killermann, B.<br />
22.08.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
02.09.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit, B. 09.11.11 Saatgutuntersuchung;<br />
Schwerpunkt:<br />
Probenahme<br />
IPZ 6c/d Voit, B. 21.11.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit, B.,<br />
Killermann, B.<br />
08.12.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
IPZ 6c/d Voit, B. 13.12.11 Saatgutuntersuchung,<br />
Saatgutforschung,<br />
Proteinelektrophorese<br />
TUM und WZW Studenten<br />
Dr. Michael Schmolke<br />
Pflanzenbau-Referendare 6<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>sstudenten<br />
Hochschule Weihenstephan-<br />
Triesdorf<br />
Frau Witte, KWS-Lochow<br />
mit Kolleginnen<br />
Michael Schmolke, WZW<br />
mit 8 Studenten<br />
Dr. Süß mit 4 Teilnehmer 5<br />
Frau Dr. Tabrizi, Iran<br />
Herr Dr. Lorenz<br />
Dr. Huss, Institut <strong>für</strong> Biologische<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>,<br />
HBLFA Raumberg –<br />
Gumpenstein (Österreich)<br />
Dr. Moreth mit Kolleginnen 5<br />
Staatl. Fachschule <strong>für</strong> Agrarwirtschaft,<br />
Fachrichtung<br />
Gartenbau, Fachgebiet Gemüsebau;<br />
Andreas Schmidt<br />
Herr Knon mit Mitarbeiter/innen<br />
10<br />
120<br />
4<br />
9<br />
2<br />
1<br />
15<br />
18<br />
HJ Reents mit Studenten 11
167 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2.6 Ausstellungen<br />
Name der<br />
Ausstellung<br />
International Conference<br />
Plant TransformationTechnologies<br />
II<br />
GABI-<br />
Statusseminar <strong>2011</strong><br />
GFP-<br />
Sommertagung<br />
9. PlantGEM<br />
Istanbul<br />
9. PlantGEM<br />
Istanbul<br />
Collaborative Research<br />
Center<br />
SFB648, Tagung:<br />
Molecular mechanisms<br />
of information<br />
processing<br />
in plants<br />
Final Conference of<br />
the European Union<br />
Founded Project<br />
AGRISAFE in<br />
cooperation with<br />
EUCARPIA"Clima<br />
te change - challenge<br />
for training of<br />
applied plant scientists"<br />
Final Conference of<br />
the European Union<br />
Founded Project<br />
AGRISAFE in<br />
cooperation with<br />
EUCARPIA"Clima<br />
te change - challenge<br />
for training of<br />
applied plant scientists"<br />
Ausstellungsobjekte/<br />
-projekte bzw. Themen /Poster<br />
D-Hordein Promoter Driven dapA and<br />
lysC Genes Lead to Higher Levels of<br />
Total Nitrogen in Stably Transformed<br />
Mature Barley Endosperm Independent<br />
of the Nitrogen Nutritional Regime<br />
Exploiting genetic variation for resistance<br />
to important pathogens in barley<br />
(ExpResBar). Abstract: GABI-<br />
Statusseminar.<br />
Optimierung von DH-Technologien in<br />
der Gräserzüchtung zur Entwicklung<br />
leistungsfähiger Gräsersorten<br />
- Identification and mapping of differentially<br />
expressed genes in European<br />
winter wheat after inoculation with<br />
Fusarium graminearum.<br />
- Haplotyping and marker development<br />
of barley genes involved in<br />
terminal drought stress<br />
A biotechnology-based breeding strategy<br />
to improve resistance against<br />
Ramularia collo cygni in barley<br />
Pectin esterase inhibitor gene: A candidate<br />
for the resistance gene Rrs2<br />
against Rhynchosporium secalis in barley.<br />
Genetic variability of spring barley<br />
concerning resistance to drought stress<br />
simulated in the scale of a breeder’s<br />
nursery Gabriela Reichenberger 1 ,<br />
Chris-Carolin Schön 2 , Markus Herz 1<br />
Effects of drought stress on canopy<br />
temperature and grain yield of wheat.<br />
R. Friedlhuber, U. Schmidhalter,<br />
L. Hartl<br />
Veranstalter Ausstelldauer<br />
VIPCA 19.-<br />
22.02.<strong>2011</strong><br />
Berlin<br />
BMBF 15.-<br />
16.03.<strong>2011</strong><br />
GFP und IPZ 4b 13.-<br />
14.04.<strong>2011</strong><br />
PGEM 04.-<br />
07.05.<strong>2011</strong><br />
PGEM 04.-<br />
07.05.<strong>2011</strong><br />
SFB648 19.-<br />
22.05.<strong>2011</strong><br />
in Halle<br />
EUCARPIA 21.-<br />
23.05.<strong>2011</strong><br />
Budapest<br />
EUCARPIA 21.-<br />
23.05.<strong>2011</strong><br />
Budapest<br />
AG<br />
IPZ 1c<br />
IPZ 1b<br />
IPZ1ac<br />
IPZ 1b<br />
IPZ 2b<br />
Röder<br />
&<br />
IPZ 1b<br />
IPZ 2b<br />
IPZ 2c
168 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name der<br />
Ausstellung<br />
7. Plant Science<br />
Student Conference<br />
(PSSC)<br />
13th European<br />
Meeting of the<br />
IOBC/WPRS<br />
Working Group<br />
IHGC Scientific<br />
Commission,<br />
Lublin, Polen<br />
BayWa Agrartage<br />
in Gründl<br />
Internationale<br />
Grünlandtage<br />
(IGLT) <strong>2011</strong><br />
25. Grünlandtag<br />
Spitalhof<br />
25. Grünlandtag<br />
Spitalhof<br />
25. Grünlandtag<br />
Spitalhof<br />
EAPR-Tagung,<br />
Oulu, Finnland<br />
14th Symposium<br />
on Insect-Plant Interactions<br />
Ausstellungsobjekte/<br />
-projekte bzw. Themen /Poster<br />
Elucidation of the genetic diversity in<br />
populations of perennial ryegrass and<br />
development of selection methods for<br />
the trait „persistence“<br />
Monitoring of click beetles with the<br />
use of pheromone traps in hop yards of<br />
the Hallertau<br />
- Sensor controlled single plant treatment<br />
in the pesticide application<br />
(Poster)<br />
- Pesticide reduction through sensor<br />
implementation (Poster)<br />
- Device for automated attachment of<br />
the supporting wires in hop-growing<br />
(Poster)<br />
- Studies of Verticillium wilt in hops<br />
- Trends in hop breeding – new aroma<br />
and bitter qualities at the Hop Research<br />
Center Huell<br />
Zwergsteinbrand – ein alter Bekannter<br />
kehrt zurück<br />
Datenerhebung in der Zukunft<br />
Mesure du rendement, visions d’avenir<br />
Sensor- und Plattformmanagement<br />
im high-throughput Phenotyping –<br />
Aussgangssituation & Versuchsbeschreibung<br />
Sensor- und Plattformmanagement<br />
im high-throughput Phenotyping – Systemanforderungen<br />
& Projektpartner<br />
Sensor- und Plattformmanagement<br />
im high-throughput Phenotyping –<br />
Flugsteuerung & Regelkreise<br />
Molecular characterization of resistance<br />
to potato wart<br />
The use of metabolomics in insect resistance<br />
studies<br />
Veranstalter Ausstelldauer<br />
Leibniz Institute of<br />
Plant Biochemistry<br />
(IPB)<br />
Universität<br />
Innsbruck, AT<br />
International Hop<br />
Grower Convention,<br />
Scientific Commission<br />
BayWa AG München<br />
DLR Eifel<br />
(Deutschland/Rheinland-<br />
Pfalz), Lycée<br />
Technique Agricole<br />
(Luxemburg) und<br />
Agra-Ost/Glea (Belgien;Deutschsprachige<br />
Gemeinschaft,<br />
Wallonische Region)<br />
LVFZ Spitalhof/Kempten<br />
LVFZ Spitalhof/Kempten<br />
LVFZ Spitalhof/Kempten<br />
14.-<br />
17.06.<strong>2011</strong><br />
19.-<br />
23.06.<strong>2011</strong><br />
19.-<br />
23.06.<strong>2011</strong><br />
28.-<br />
29.06.<strong>2011</strong><br />
01.-<br />
03.07.<strong>2011</strong><br />
AG<br />
IPZ 4b<br />
IPZ 5b<br />
IPZ 5a<br />
IPZ 5c<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IPZ 4b<br />
13.07.<strong>2011</strong> IPZ 4b<br />
13.07.<strong>2011</strong> IPZ 4b<br />
13.07.<strong>2011</strong> IPZ 4b<br />
EAPR 24.-<br />
29.07.<strong>2011</strong><br />
Universität<br />
Wageningen, NL<br />
13.-<br />
18.08.<strong>2011</strong><br />
IPZ 3b<br />
IPZ 5b
169 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name der<br />
Ausstellung<br />
Botanikertagung<br />
<strong>2011</strong><br />
6. Fachtagung Arznei-<br />
und Gewürzpflanzen<br />
Berlin<br />
Kongress „Biogas<br />
in der <strong>Landwirtschaft</strong><br />
– Stand und<br />
Perspektiven“<br />
Bauernmarktmeile<br />
<strong>2011</strong><br />
München<br />
Ausstellungsobjekte/<br />
-projekte bzw. Themen /Poster<br />
The trait ”persistence“ in perennial<br />
ryegrass – Analysis of allele compositions<br />
and development of selection<br />
methods<br />
- Chinesisches Süßholz (Glycyrrhiza<br />
uralensis/inflata/glabra) als Arznei-<br />
und Rohstoffpflanze – eine botanische<br />
Charakterisierung<br />
- Wirkung von Phytohormonen auf<br />
die Blühinduktion von Baldrian<br />
- Arten- und Sortenwahl bei Wintergetreide<br />
zur GPS-Nutzung<br />
- Weidelgras - Untersaat mit Getreide<br />
- GPS <strong>für</strong> die Biogasproduktion<br />
Sortiment aus bekannten und speziellen<br />
Kartoffelsorten (28 Sortenmuster)<br />
IPK-Institutstagung Pectin esterase inhibitor gene: A candidate<br />
for the resistance gene Rrs2<br />
against Rhynchosporium secalis in barley.<br />
Poster und Abstract IPK-<br />
Institutstagung, Okt <strong>2011</strong><br />
HopFA im Rahmen<br />
des Gallimarktes<br />
Mainburg<br />
HopFA im Rahmen<br />
des Gallimarktes<br />
Mainburg<br />
3. Symposium<br />
Energiepflanzen<br />
Berlin<br />
Agritechnica<br />
62. Tagung der<br />
Vereinigung der<br />
Pflanzenzüchter<br />
und Saatgutkaufleute<br />
Österreichs<br />
IZN-Jahrestagung<br />
in Halle <strong>2011</strong><br />
<strong>Bayerische</strong>r Braugerstentag<br />
Gerät zur vollautomatischen Drahtaufhängung<br />
im Hopfenbau (Poster)<br />
- Trocknung von Hopfen (Poster)<br />
- Erforderliche Messpunkte <strong>für</strong> die<br />
Trocknungsoptimierung (Poster)<br />
- Integriertes Energiesparkonzept<br />
(Poster)<br />
- Arten- und Sortenwahl bei Wintergetreide<br />
zur GPS-Nutzung<br />
- Weidelgras - Untersaat mit Getreide<br />
- GPS <strong>für</strong> die Biogasproduktion<br />
Tropfbewässerung bei Kartoffeln,<br />
Standdienst<br />
Einfluss der Keimfähigkeit auf den<br />
Feldaufgang bei Sojabohnen (Glycine<br />
max.)<br />
The barley nested association mapping<br />
(NAM) population HEB-25: development<br />
and phenotyping.<br />
Veranstalter Ausstelldauer<br />
Deutsche Botanische<br />
Gesellschaft<br />
(DBG)<br />
Deutscher Fachausschuss<br />
<strong>für</strong> Arznei-,<br />
Gewürz- und<br />
Aromapflanzen;<br />
Humboldt-<br />
Universität Berlin<br />
18.-<br />
23.09.<strong>2011</strong><br />
19.-<br />
21.09.<strong>2011</strong><br />
FNR/KTBL 20.-<br />
21.09.<strong>2011</strong><br />
Göttingen<br />
Bayer. Bauernverband,<br />
StMELF<br />
AG<br />
IPZ 4b<br />
IPZ 3d<br />
IPZ 4a<br />
25.09.<strong>2011</strong> IPZ 3a<br />
IPK 10.<strong>2011</strong> Röder<br />
& IPZ<br />
1b<br />
Stand der Fa. Soller 08.-<br />
10.10.<strong>2011</strong><br />
Stand der Fa. ATEF 08.-<br />
10.10.<strong>2011</strong><br />
FNR 02.-<br />
03.11.<strong>2011</strong><br />
DLG<br />
Vereinigung der<br />
Pflanzenzüchter und<br />
Saatgutkaufleute<br />
13.-<br />
15.11.<strong>2011</strong><br />
22.-<br />
24.11.<strong>2011</strong><br />
Raumberg/<br />
Gumpenstein<br />
IPZ 5a<br />
u. ILT<br />
IPZ 5a<br />
IPZ 4a<br />
IPZ 3a<br />
bei<br />
ILT 1a<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
IZN 02.12.<strong>2011</strong> Pillen<br />
& IPZ<br />
1b<br />
Sommer- und Wintergerste 15 Poster Braugerstenverein 08.12.<strong>2011</strong><br />
München<br />
IPZ 2b
170 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.2.7 Aus- und Fortbildung<br />
Name,<br />
Arbeitsgruppe<br />
Thema Teilnehmer<br />
Aigner, A., IPZ 3c Produktionstechnik Öl- und Eiweißpflanzen 6 Referendare<br />
Bauch, G., IPZ 6a Schulung und Einweisung der Feldbesichtiger<br />
<strong>für</strong> Pflanzkartoffeln in Freising<br />
Bauch, G., Kupfer, H.,<br />
IPZ 6a<br />
Hoheitsvollzug im Pflanzenbau – Anerkennung<br />
von Saat- und Pflanzgut<br />
Eisenschink, E.-M., IPZ 6a Feldbesichtigerschulung <strong>für</strong> Getreide in<br />
Würzburg<br />
Eisenschink, E.-M., IPZ 6a Feldbesichtigerschulung <strong>für</strong> Getreide in<br />
Rotthalmünster<br />
Eisenschink, E.-M., IPZ 6a Feldbesichtigerschulung <strong>für</strong> Getreide in<br />
Günzburg<br />
Feldbesichtiger <strong>für</strong> Pflanzkartoffeln<br />
6 Referendare – Fachrichtung<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> – Schwerpunkt<br />
Pflanzenproduktion<br />
Feldbesichtiger aus Ober-,<br />
Mittel- und Unterfranken<br />
Feldbesichtiger aus Niederbayern<br />
und Oberpfalz<br />
Feldbesichtiger aus Oberbayern<br />
und Schwaben<br />
Hartmann, St., IPZ 4b Regionale Sortenwahl Schüler HLS Almesbach &<br />
LWS Schule Weiden<br />
Hartmann, St., IPZ 4b Richtige Sortenwahl <strong>für</strong> das Dauergrünland LWS Schule Kempten &<br />
LWS Kaufbeuren<br />
Hartmann, St., IPZ 4b Grünlandseminar an der LfL ER-Berater „Grünland“<br />
Hartmann, St., IPZ 4b Richtige Sortenwahl <strong>für</strong> Feldfutter und Dauergrünland<br />
Hartmann, St., IPZ 4b Welche Chancen <strong>für</strong> eine effiziente und<br />
nachhaltige Produktion bieten Sortenprofile<br />
und regionale Sortenempfehlungen <strong>für</strong><br />
Grünland und Feldfutterbau?<br />
Kellermann, A., IPZ 3a Klassische Züchtung und Pflanzenbau bei<br />
Kartoffeln<br />
Kellermann, A., Marchetti,<br />
S., IPZ 3a<br />
Kellermann, A., Marchetti,<br />
S., IPZ 3a<br />
Killermann, B., Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B., Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Killermann, B., Voit, B.,<br />
IPZ 6c/d<br />
Virussymptome im Feld,<br />
Feldbesichtigerschulung bei Kartoffeln<br />
Bestimmung von Viruserkrankungen der<br />
Kartoffel im Feld<br />
Schüler LWS Rosenheim,<br />
LWS Weilheim, LWS<br />
Traunstein<br />
Referendare<br />
6 Referendare – Fachrichtung<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> – Schwerpunkt<br />
Pflanzenproduktion<br />
Feldbesichtiger <strong>für</strong> Pflanzkartoffeln<br />
25 Studenten, TUM, Dr.<br />
Hans Hausladen<br />
Technische Reinheit bei Getreide Frau Witte, KWS-Lochow<br />
mit 3 Kolleginnen<br />
Saatgutuntersuchung, Saatgutforschung und<br />
Proteinelektrophorese<br />
Saatgutuntersuchung, Saatgutforschung und<br />
Proteinelektrophorese<br />
ATA-Ausbildung<br />
Ulla Fischle<br />
Bettina Greis<br />
Stefanie Reitmeier<br />
Praktikant Lukas Prey<br />
Leiminger, J., IPZ 3b Diagnose von Krankheiten an Kartoffeln 60 Studierende im 4. Sem.,<br />
FH-Weihenstephan, Prof. T.<br />
Ebertseder
171 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name,<br />
Arbeitsgruppe<br />
Thema Teilnehmer<br />
Lutz, A., IPZ 5c Unterstützung Seminararbeit „Der Weg einer<br />
Hopfensorte von der Auslese bis zum<br />
Brauer“<br />
Lutz, A., Weihrauch, F.,<br />
Portner, J., IPZ 5<br />
Müller, M., Baumann, A.,<br />
IPZ 1a<br />
Müller, M., Baumann, A.,<br />
IPZ 1a<br />
A. Senftl, Schyren Gymnasium<br />
Pfaffenhofen<br />
Hopfenproduktion, Ernte, Sämlingspflege A.Th. Lutz, Hagl<br />
Betreuung Bachelorarbeit TUM Klara Aigner<br />
Betreuung Diplomarbeit Hochschule Weihenstephan<br />
Bettina Göttl<br />
Müller, M., IPZ 1c Referendarausbildung- Gentechnik Referendare<br />
Müller, M., IPZ 1c Gewebekulturen, DH-Entwicklung 5 Studenten<br />
Müller, M., IPZ 1c ATA Prüfung in Landsberg 30 Studenten<br />
Müller, M., IPZ 1a, ATA-Ausbildung:<br />
Entwicklung von Doppelhaploiden<br />
Ulla Fischle, Bettina Geiss<br />
Stefanie Reitmeier; Tobias<br />
Wildermann<br />
Portner, J., IPZ 5a Peronospora 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a E. Mehltau u. Verticillium-Welke 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a Minderschädlinge und Hopfenblattlaus 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a Gemeine Spinnmilbe 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a Bewässerung 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a Hopfentrocknung 17 Studierende des 1. und 3.<br />
Sem. der LS Pfaffenhofen<br />
Portner, J., IPZ 5a Betreuung und Bewertung von Arbeitsprojekten<br />
im Hopfenbau im Rahmen der Meisterprüfung<br />
2 Meisteranwärter<br />
Portner, J., IPZ 5a BiLa-Kurs Hopfenbau (4 Abende) 33 Hopfenpflanzer(innen) im<br />
Nebenerwerb<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Prüfungsvorbereitung, Sachkundeschulung 40 Hopfenbäuerinnen vom<br />
Lkr. FS, KEH, PAF<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Sachkundeprüfung <strong>für</strong> die Anwendung von<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
32 Hopfenbäuerinnen vom<br />
Lkr. FS, KEH, PAF<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Informationsveranstaltung <strong>für</strong> Berufsschüler 12 Berufsschüler PAF<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Krankheiten und Schädlinge, aktueller<br />
Pflanzenschutz, Warndienst in Hüll<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Abschlussprüfung (Hopfenbau) im Ausbildungsberuf<br />
Landwirt in Thalhausen<br />
15 Studierende des 2. Sem.<br />
der LS Pfaffenhofen<br />
Prüflinge vom Lkr. FS, PAF<br />
Schätzl, J., IPZ 5a Nachprüfung (Hopfenbau) in Anning Prüflinge vom Lkrs. FS
172 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name,<br />
Arbeitsgruppe<br />
Schätzl, J., Münsterer, J.,<br />
IPZ 5a<br />
Thema Teilnehmer<br />
Abschlussprüfung (Hopfenbau) im Ausbildungsberuf<br />
Landwirt in Jauchshofen<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b ATA-Ausbildung:<br />
Entwicklung von Doppelhaploiden<br />
Prüflinge vom Lkr. KEH; LA<br />
Ulla Fischle, Bettina Geiss,<br />
Stefanie Reitmeier<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b BTA-Ausbildung (Straubing) Andreas Berger<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b Hochschulpraktikum Armin Wiese<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b Schulpraktikum Laura Müller<br />
Schwarzfischer, A., IPZ 3b Biotechnologie-Gentechnik Kartoffeln 6 Referendare – Fachrichtung<br />
<strong>Landwirtschaft</strong> – Schwerpunkt<br />
Pflanzenproduktion<br />
Schweizer, G., Barth, A.,<br />
Wüllner, S., Jestadt, A.,<br />
Greim, P., IPZ 1b<br />
Schweizer, G., Jestadt, A.,<br />
IPZ 1b<br />
Schweizer; G., IPZ 1b Methylierungsstudien mit dem<br />
Pyrosequencer<br />
ATA-Ausbildung Tobias Wildermann<br />
Pyrosequencing in der Genomanalyse Praktikum <strong>für</strong> Sudenten der<br />
TUM, LS Prof. Gierl, Prof.<br />
Torres<br />
Schweizer; G., IPZ 1b Markergestütze Selektion in der Pflanzenzüchtung<br />
Seefelder, S., IPZ 5c Chemie-Laboranten-Ausbildung Tim Nerbas<br />
TUM Physiologie LS-Prof.<br />
Meyer und Fürst<br />
Praktikum <strong>für</strong> HSWT-<br />
Gartenbau; Prof. Hausser<br />
Seefelder, S., IPZ 5c Chemie-Laboranten-Ausbildung Barbara Eichinger<br />
Seefelder, S., IPZ 5c Betriebspraktikum Maximilian Stang<br />
Seigner, E., IPZ 5c Unterstützung Seminararbeit “Transgener<br />
Hopfen – Chancen und Risiken <strong>für</strong> die Zukunft“<br />
Voit, B., IPZ 6c/d Prüfung der Laboranten bei KWS-Lochow<br />
GmbH, Bergen<br />
Voit, B., IPZ 6c/d Technische Reinheit und Echtheit bei Gräsern<br />
Voit, B., IPZ 6c/d Saatgutuntersuchung, Saatgutforschung und<br />
Proteinelektrophorese<br />
K. Jakobi, Schyren Gymnasium<br />
Pfaffenhofen<br />
3 Laborantinnen<br />
Herr Knon, Saatzucht<br />
Steinach GmbH mit<br />
17 Mitarbeiter/innen<br />
6 Referendare
173 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.3 Diplomarbeiten und Dissertationen<br />
5.3.1 Diplomarbeiten<br />
AG Name<br />
IPZ 1a<br />
IPZ<br />
1a/3d<br />
Thema/Titel<br />
Diplomarbeit<br />
Klara Aigner Der Einfluss von 2-Hydroxynicotinsäure<br />
auf die Induktion der Mikrosporen-<br />
Embryogenese bei verschiedenen Weizen-Genotypen<br />
(Bachelorarbeit)<br />
Bettina Göttl Valeriana officinalis und seine Erzeugung<br />
haploider Pflanzen durch Antheren-<br />
und Mikrosporenkultur – <strong>2011</strong><br />
IPZ 3a Anita Oberneder Einflüsse der Kartoffelaufbereitung auf<br />
die Lichtergrünung unter den Bedingungen<br />
des Lebensmittelseinzelhandels<br />
IPZ<br />
3a/b<br />
Robert Bauer Agronomische, phänotypische und genotypische<br />
Charakterisierung der Kartoffelsorte<br />
Schwarzblaue aus dem Frankenwald<br />
IPZ 3b Juliane Böhm Untersuchungen zum Nachweis und zur<br />
Charakterisierung von bodenbürtigen<br />
Streptomyceten als Erreger des Kartoffelschorfs<br />
(Bachelorarbeit)<br />
IPZ 3d Christine Bauer Die Arzneipflanzen des Demonstrationssortiments<br />
des Instituts <strong>für</strong> Pflanzenbau<br />
und Pflanzenzüchtung (IPZ) in Freising<br />
IPZ 4b Michael Bachl-<br />
Staudinger<br />
IPZ 6a<br />
IPZ<br />
6c/d<br />
Aufbau eines medienoptimierten Fachinformationsangebotes<br />
zum Thema Feldfutterbau<br />
im Bereich des Internetauftrittes<br />
des Institutes <strong>für</strong> Pflanzenbau und<br />
Pflanzenzüchtung der LfL<br />
Gerda Bauch Epidemiologische Untersuchungen zur<br />
Verbreitung der bakteriellen Schwarzbeinigkeit<br />
und Welke an Pflanzkartoffeln<br />
in Bayern<br />
Constanze<br />
Hennig<br />
Etablierung der isoelektrischen Fokussierung<br />
(IEF) in der Saatgutuntersuchung<br />
zur Nachprüfung der Echtheit von<br />
Art und Sorte<br />
Zeitraum Betreuer an der<br />
LfL,<br />
Zusammenarbeit<br />
Aug. 11 –<br />
Nov 11<br />
Nov. 10 –<br />
Mai 11<br />
Jan. 11 –<br />
Sept. 11<br />
Mrz. 11 –<br />
Nov. 11<br />
Feb. 11 –<br />
April 11<br />
April 10 –<br />
Nov. 11<br />
Feb. 11 –<br />
Okt. 11<br />
Dez. 10 –<br />
Juni 11<br />
Okt. 10 –<br />
Mai 11<br />
M. Müller,<br />
Dr. M. Schmolke,<br />
TUM<br />
M. Müller, H. Heuberger,<br />
Prof. Dr.<br />
Henning, HSWT<br />
Weihenstephan<br />
A. Kellermann,<br />
Prof. Dr. Ebertseder,<br />
HSWT Weihenstephan<br />
A. Kellermann,<br />
Prof. Dr. Sieber,<br />
TUM, WZ Straubing<br />
J. Leiminger,<br />
Prof. Vögele, Universität<br />
Hohenheim<br />
H. Heuberger, Prof.<br />
Mag. Dr. Kopp,<br />
Univ. Wien<br />
Dr. St. Hartmann,<br />
Prof. Dr. Schnyder,<br />
TUM Weihenstephan<br />
H. Kupfer, Prof. Dr.<br />
Hückelhoven,<br />
Dr. Hausladen, TUM<br />
B. Killermann,<br />
Prof. Dr. Ebertseder,<br />
HSWT Weihenstephan
174 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.3.2 Abgeschlossene Dissertationen<br />
AG Name Thema/Titel<br />
Dissertation<br />
IPZ 1c<br />
Gruber Helga Surveillance of Cry1Ab protein and cry1Ab<br />
DNA in liquid manure, soil and agricultural<br />
crops under Bt-maize cropping and slurry<br />
management of cows fed Bt-maize (MON810)<br />
5.4 Mitgliedschaften und Mitarbeit in Arbeitsgruppen<br />
Name Mitgliedschaften<br />
Zeitraum Betreuer LfL,<br />
Zusammenarbeit<br />
2007 - <strong>2011</strong> Müller, M.,<br />
Prof. Dr. Meyer,<br />
H. H. D. , TUM,<br />
Lehrstuhl <strong>für</strong><br />
Physiologie<br />
Aigner, A. • Mitglied der Fachkommission „Produktmanagement Öl- und Eiweißpflanzen -<br />
Sektion Raps - der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen e.V.<br />
(UFOP)“<br />
• Mitglied der Sortenkommission Raps der UFOP<br />
• Mitglied im UFOP-SFG-Fachausschuss (Arbeitsgruppe Sortenprüfwesen)<br />
• Mitglied im Beirat der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Zuckerrübenanbaus<br />
in Südbayern<br />
• Mitglied in der Koordinierungsgruppe <strong>für</strong> die Arbeit der Abteilungen L 2 der<br />
ÄLF<br />
• Mitglied im DLG-Ausschuss <strong>für</strong> Ackerbau<br />
Darnhofer, B. • Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ)<br />
Doleschel, P. • Vorsitzender des Testgremiums <strong>für</strong> Pflanzkartoffeln in Bayern<br />
• Mitglied des Ausschusses im Landeskuratorium <strong>für</strong> pflanzliche Erzeugung in<br />
Bayern e. V. (LKP)<br />
• Fachbetreuer des Rings <strong>Bayerische</strong>r Pflanzenzüchter im LKP<br />
• Mitglied des Beirates der <strong>Bayerische</strong>n Pflanzenzuchtgesellschaft<br />
• Mitglied bei der Deutschen Landwirt. Gesellschaft (DLG)<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft<br />
(GIL)<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Hopfenforschung<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenbauwissenschaften<br />
• Mitglied des Ausschusses Kartoffelgesundheitsdienst Bayern e.V.<br />
Eder, J. • Mitglied im DLG-Ausschuss <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung und Saatgut<br />
• Mitglied in der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenbauwissenschaften e.V.<br />
• Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Koordinierung bei Grünland –<br />
und Futterbauversuchen beim Verband der <strong>Landwirtschaft</strong>skammern (VLK)<br />
• Mitglied in der Arbeitsgruppe Sortenwesen beim Deutschen Maiskomitee<br />
(DMK)<br />
• Leiter der Arbeitsgruppe Substratproduktion im Biogasforum Bayern<br />
Engelhard, B. • Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission im Internationalen Hopfenbaubüro<br />
(IHB; bis Juni 2009)<br />
• Mitglied der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft<br />
Fuß, S. • Mitglied im Prüfungsausschuss <strong>für</strong> den Ausbildungsberuf Landwirt am Fortbildungsamt<br />
Landshut
175 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name Mitgliedschaften<br />
Geiger, H. • Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Düngemittelverkehrskontrollen der Länder<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Saatgutverkehrskontrollen der Länder<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungs- und Nachkontrollstellen<br />
<strong>für</strong> Standardsaatgut der Länder<br />
• Mitglied der Pflanzenschutzmittelkontrollen der Länder<br />
Geiger, P. • Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Düngemittelverkehrskontrollen der Länder<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Saatgutverkehrskontrollen der Länder<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungs- und Nachkontrollstellen<br />
<strong>für</strong> Standardsaatgut der Länder<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutzmittelkontrolle der Länder<br />
Hartl, L. • Mitglied der Koordinierungsgruppe EVAII der GFP<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e.V.<br />
• Mitglied des vom BML berufenen Gremiums zur Qualitätseinstufung der deutschen<br />
Weizensorten<br />
• Mitglied des Getreideausschusses der Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Getreideforschung<br />
• Fachbetreuer der BPZ-Arbeitsgruppen Weizen und Hafer<br />
• Mitglied der EUCARPIA<br />
• Beisitzer im Widerspruchsausschuss 1 (Getreide) des Bundessortenamtes<br />
Hartmann, S. • Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Futterpflanzen, Gräser“ der Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ)<br />
• Stellv. Vorsitzender des DLG-Ausschusses <strong>für</strong> Gräser, Klee und Zwischenfrüchte<br />
• Stellv. Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Versuchstätigkeit im Grassamenbau<br />
e.V.<br />
• Mitglied der UAG „Grünland und Kulturlandschaft“ in der AG „Pflanzenbau“<br />
im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung über die Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen<br />
<strong>Landesanstalt</strong>en<br />
• Fachbetreuer des Feldsaatenerzeugerringes Bayern e.V.<br />
• Fachbetreuer der BPZ - Arbeitsgruppe Futterpflanzen<br />
• Mitglied im Arbeitskreis „Koordinierung von Grünland und Futterbauversuchen“<br />
des Verbandes der <strong>Landwirtschaft</strong>kammern<br />
• Mitglied der EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section<br />
• Mitglied der AG Futterpflanzen der GFP<br />
• Mitglied bei der Deutschen Landwirt. Gesellschaft (DLG)<br />
• Mitglied des DLG-Ausschusses „Versuchswesen im Pflanzenbau“<br />
• Mitglied der DLG-Planungsgruppe „Pflanzenproduktion, nachhaltige <strong>Landwirtschaft</strong>“<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenbauwissenschaften e. V.<br />
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau der Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Pflanzenbauwissenschaften e.V. (AGGF)<br />
• Mitglied der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)<br />
• Mitglied der österreichischen Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Grünland und Futterbau<br />
• Mitglied im Deutschen Grünlandverband e.V.<br />
Herz, M. • Mitglied des Arbeitkreises Sortenempfehlung des Vereins zur Förderung des<br />
bayerischen Qualitätsgerstenanbaus e.V.<br />
• Mitglied GPZ Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e.V.<br />
• Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Braugerstengemeinschaft<br />
• Fachbetreuer der BPZ-Arbeitsgruppen Winter- und Sommergerste
176 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name Mitgliedschaften<br />
Heuberger, H. • Mitglied der AG Arznei- und Gewürzpflanzen der GFP<br />
• Mitglied der International Society of Horticultural Science (ISHS)<br />
• Beiratsmitglied im Erzeugerring „Heil- und Gewürzpflanzen e.V.“<br />
• Beiratsmitglied im Verein zur Förderung des „Heil- und Gewürzpflanzenanbaues<br />
in Bayern“<br />
• Mitglied im „Ausschuss <strong>für</strong> Pharmazeutische Biologie“ der „Deutschen Arzneibuch-Kommission“<br />
• Mitglied des Deutschen Fachausschusses <strong>für</strong> Arznei-, Gewürz- und<br />
Aromapflanzen<br />
• Mitglied in der Schriftleitung und Mitherausgeber der „Zeitschrift <strong>für</strong> Arznei-<br />
und Gewürzpflanzen“<br />
• Mitglied in der Arbeitsgruppe „Arzneipflanzenanbau“ der Forschungsvereinigung<br />
der Arzneimittelhersteller e.V. (FAH)<br />
• Mitglied des Wissenschaftlichen FAH-Forschungsbeirates „Verbesserung der<br />
internationalen Wettbewerbsposition des deutschen Arznei- und Gewürzpflanzenanbaus“<br />
• Mitglied in der Arbeitsgruppe „Koordinierung Arznei- und Gewürzpflanzen<br />
nach Konstanzer Abkommen“<br />
Kammhuber, K. • Mitglied des Analysen-Komitees der European Brewery Convention (Hopfen-<br />
Sub-Komitee)<br />
• Mitglied der Arbeitsgruppe <strong>für</strong> Hopfenanalytik (AHA)<br />
Kellermann, A. • Mitglied der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e.V.<br />
• Mitglied des Ausschusses Kartoffelgesundheitsdienst Bayern e.V.<br />
• Mitglied des Ausschusses <strong>für</strong> Kartoffelzüchtung und Pflanzguterzeugung der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung<br />
• Mitglied des Ausschusses <strong>für</strong> Kartoffelforschung in der Arbeitsgruppe Kartoffelforschung<br />
e.V.<br />
• Mitglied des Testgremiums <strong>für</strong> Pflanzkartoffeln in Bayern<br />
• Fachbetreuer der BPZ - Arbeitsgruppe Kartoffeln<br />
• Fachbetreuer der Fachgruppe Qualitätskartoffel im LKP<br />
Killermann, B. • Mitglied der Internationalen Vereinigung <strong>für</strong> Saatgutprüfung (ISTA) – Vorsitzende<br />
des Technischen Komitees <strong>für</strong> Arten- und Sortenprüfung, Mitglied im<br />
Technischen Komitee <strong>für</strong> das ISTA-Methodenbuch<br />
• Vorsitzende der Fachgruppe Saatgut im VDLUFA mit Stimmrecht <strong>für</strong> die Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
• Mitglied der Deutschen Elektrophoresegesellschaft<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ)<br />
• Mitglied beim Ausschuss <strong>für</strong> die Plombierung von Saat- und Pflanzgut beim<br />
Landeskuratorium <strong>für</strong> pflanzliche Erzeugung (LKP)<br />
Kupfer, H. • Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen in Deutschland<br />
• Beauftragter des Bundesrates <strong>für</strong> den „Ständigen Ausschuss <strong>für</strong> das landwirtschaftliche,<br />
gartenbauliche und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen“ bei der<br />
EG-Kommission in Brüssel<br />
• Mitglied in der Arbeitsgruppe „EDV-Datenaustausch“ zwischen BDP und<br />
Anerkennungsstellen „Kooperation in der Saatgutwirtschaft“<br />
• Leiter der Arbeitsgruppe „Virustestung bei Pflanzkartoffeln“<br />
• Mitglied beim Ausschuss <strong>für</strong> die Plombierung von Saat- und Pflanzgut beim<br />
Landeskuratorium <strong>für</strong> pflanzliche Erzeugung (LKP)<br />
• Mitglied im Ausschuss der Landesvereinigung der Saatkartoffelerzeuger und<br />
Mitglied im Beirat des Landesverbandes der Saatgetreideerzeuger<br />
• Mitglied in der Fachkommission Pflanzkartoffeln der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft<br />
(UNIKA)
177 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Name Mitgliedschaften<br />
Leiminger, J. • Mitglied der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)<br />
• Mitglied der „Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e. V.“ (GPZ)<br />
• Mitglied im DPG-Arbeitskreis Integrierter Pflanzenschutz – Projektgruppe Kartoffel<br />
• Mitglied im „potato late blight network for Europe”<br />
Müller, M. • Mitglied der AG „Anbaubegleitendes Monitoring des JKI“<br />
• Mitglied des Informationskreises Biotechnologie und Gentechnik des BDP<br />
• Mitglied des Prüfungsausschuss <strong>für</strong> die ATA-Ausbildung am Agrarbildungszent<br />
rum Landsberg im Auftrag des StMELF<br />
• Mitglied des Gutachtergremiums der EU Kommission im 7.Rahmenprogramm<br />
der EU-Forschungsförderung<br />
Münsterer, J. • Mitglied im Prüfungsausschuss <strong>für</strong> den Ausbildungsberuf Landwirt am Fortbildungsamt<br />
Landshut<br />
• Mitglied des Bewertungsausschusses <strong>für</strong> Investitionen im Hopfenbau im Rahmen<br />
des EIF am AELF Landshut<br />
Portner, J. • Mitglied des Fachbeirates Geräte-Anerkennungsverfahren <strong>für</strong> die Bewertung<br />
von Pflanzenschutzgeräten und der Fachreferenten <strong>für</strong> Anwendungstechnik beim<br />
JKI<br />
• Mitglied (Stellvertreter) des Meisterprüfungsausschusses Niederbayern und<br />
Oberbayern-Ost und Mitglied des Meisterprüfungsausschusses Oberbayern-<br />
West <strong>für</strong> den Ausbildungsberuf Landwirt<br />
Reichmann, M. • Mitglied der American Association for the Advancement of Science (AAAS)<br />
Schätzl, J. • Mitglied im Prüfungsausschuss <strong>für</strong> den Ausbildungsberuf Landwirt am Fortbildungsamt<br />
Landshut<br />
• Mitglied im Prüfungsausschuss <strong>für</strong> den Ausbildungsberuf Landwirt am Fortbildungsamt<br />
Region Erding und Freising<br />
Schwarzfischer, A. • Mitglied der European Association for Potato Research<br />
• Mitglied der AG „Anbaubegleitendes Monitoring des JKI“<br />
• Mitglied der „Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e. V.“<br />
Schweizer, G. • Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Genetik e. V.<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e. V.<br />
• Mitglied der EUCARPIA<br />
Seefelder, S. • Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Hopfenforschung e. V.<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e. V.<br />
• Mitglied der KG-Öffentlichkeitsarbeit der LfL<br />
Seigner, E. • Vorsitzende und Sekretärin der Wissenschaftlichen Kommission des Internationalen<br />
Hopfenbaubüros<br />
• Mitglied des Editorial Board von „Hop Bulletin“, Institute of Hop Research and<br />
Brewing, Zalec, Slovenia<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung e. V.<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Hopfenforschung e.V.<br />
Weihrauch, F. • Mitglied der Arbeitsgemeinschaft <strong>Bayerische</strong>r Entomologen e.V.<br />
• Arbeitskreis Neuropteren der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> allgemeine und angewandte<br />
Entomologie (DgaaE) – Führung der Bibliographie<br />
• Mitglied der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Orthopterologie e. V.<br />
• Schriftleitender Vorstand der Gesellschaft deutschspachiger Odonatologen e. V.<br />
• Mitglied der Gesellschaft <strong>für</strong> Tropenökologie e. V.<br />
• Mitglied der Münchner Entomologischen Gesellschaft e.V.<br />
• Mitglied der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg e.V<br />
• Mitglied der Worldwide Dragonfly Association<br />
• Mitglied der Rote-Liste-Arbeitsgruppen der Heuschrecken und Libellen Bayerns<br />
des <strong>Bayerische</strong>n Landesamtes <strong>für</strong> Umweltschutz
178 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
5.5 Kooperationen<br />
Aeskulap, Steinach: Dr. Eickmeyer (IPZ 3d)<br />
agrotop GmbH, Obertraubling: S. Graef (IPZ 5a)<br />
AlzChem AG, Trostberg, A. Franzl (IPZ 5a)<br />
Anheuser-Busch-InBev, München (IPZ 5)<br />
ATEF Euringer & Friedl GmbH, Oberhartheim, C. Euringer u. M. Friedl (IPZ 5a)<br />
BASF, Limburger Hof, Anett Kühn, Martina Dahlbender (IPZ 5b)<br />
Bauplanungs- und Ing.-Büro Breitner, Wolnzach, S. Maier (IPZ 5a)<br />
Bayer Crop Science, Langenfeld, J. Geithel (IPZ 5b)<br />
Bay. Landesamt <strong>für</strong> Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Oberschleißheim: Dr. U. Busch (IPZ 6a,<br />
IPZ 6b, IPZ 6c)<br />
Bay. <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> Wein- und Gartenbau, Veitshöchheim: Dr. Klemisch, Frau Schneider, Dr. Degenbeck,<br />
Dr. Vollrath, Herr Kuhn, Frau Werner (IPZ 4a, IPZ 6a, IPZ 6c)<br />
Bay. Pflanzenzuchtgesellschaft eG, München: Dr. A. Augsburger (IPZ 1a, 1b; 2b,2 c; 3a, 3b; 4a, 4b; 6c)<br />
Bay. Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung, <strong>Landwirtschaft</strong> u. Forsten<br />
Belchim, Isernhagen, H. Schöler, Herr Bauer, Herr Rieger (IPZ 5b)<br />
Bioland Erzeugerring Bayern e.V., N. Drescher (IPZ 5b), Markus Wiggert (IPZ 6c/d)<br />
Bioplant, Ebstorf: Dr. Tacke (IPZ 3a, IPZ 3b)<br />
BLE (Bundesanstalt <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> und Ernährung)<br />
Böhm Nordkartoffel, Ebstorf: Dr. Hofferbert (IPZ 3a, IPZ 3b)<br />
BON TERRA Weiland GmbH, Nideggen, U. Prinz (IPZ 5a)<br />
Braugerstengemeinschaft - <strong>Bayerische</strong>r Brauerbund (IPZ 2b)<br />
Centro International de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT), Mexico<br />
Cerveceria y Malteria Quilmes, Argentinien, H. Savio, A. Aguinaga (IPZ 2b)<br />
Cooperativa Agraria Agroindustrial, Entre Rios Brasilien<br />
CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Aula Dei Experimental Station, Avda Montañana<br />
1005 50059-Zaragoza, Spain, Dr. Ernesto Igartua, Dr. Ana Casas (IPZ1b)<br />
Curculio-Institut e.V., Hannover (IPZ 5b)<br />
Department Biologie I, Bereich Biodiversitätsforschung der Ludwig-Maximilians Universität München,<br />
Prof. Heubl (IPZ 3d)<br />
DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt (IPZ 5a, 5b)<br />
Delley Samen und Pflanzen AG, Delley, Schweiz, Herr R. Jaquiéry (IPZ 4a)<br />
Deutsche Forschungsanstalt <strong>für</strong> Lebensmittelchemie, Garching, Dr. H. Wieser (IPZ 2c)<br />
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V., H.-J. Cooberg, Josef Grauvogl, Dr. R. Kugel (IPZ 5)<br />
Deutsches Maiskomitee, Bonn: Dr. H. Messner, J. Rath (IPZ 4a; 6c)<br />
Deutscher Wetterdienst, Freising-Weihenstephan, K.-D. Buchwald (IPZ 5a)<br />
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, Braugerstenberatung, Mainz, F. Hoffmann (IPZ 2a, 2b)<br />
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Eifel, Bitburg, Gruppe Grünland, R. Fisch (IPZ 4b)<br />
DLF Trifolium (DLF) Store Heddinge Dänemark M. Greve Petersen (IPZ 4b)<br />
Dow Agro Sciences, München, Dr. H. Brüggemann (IPZ 5b)<br />
ECOZEPT GbR, Freising, E. Wissinger (IPZ 5a)<br />
Energie- und Automatisierungstechnik, Königsfeld, E. Bichler (IPZ 5a)<br />
EpiGene und EpiLogic GmbH, Agrarbiol. Forschung und Beratung, Freising, Dr. F.G. Felsenstein (IPZ 5c)<br />
Erzeugerringe <strong>für</strong> Qualitätskartoffeln Niederbayern e.V., G. Kärtner<br />
Erzeugerringe <strong>für</strong> Qualitätskartoffeln Oberpfalz e.V., H. Hofstetter<br />
Erzeugerring <strong>für</strong> Grassamenerzeugung in Bayern e.V., H. Kammermeier (IPZ 4b)<br />
Erzeugergemeinschaft Hopfen HVG e.G. , Wolnzach (IPZ 5)<br />
Erzeugergemeinschaften Hopfen HVG e.G., Spalt, (IPZ 5)<br />
Euro Grass Breeding (EGB), Lippstadt, Dr. U. Feuerstein, L. Wolters (IPZ 4b)
179 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), S. Zanetti, S. Vogelgsang (IPZ 6c/d),<br />
Dr. B. Boller, Dr. R. Kölliker, Dr. F.X. Schubiger (IPZ 4b)<br />
Forschungsanstalt <strong>für</strong> Gartenbau an der Fachhochschule Weihenstephan (FGW), Institut <strong>für</strong> Pflanzenschutz,<br />
Freising, Prof. W. Gerlach (IPZ 4b)<br />
Forschungsvereinigung der Arzneimittel-Hersteller e.V. (FAH), Bonn-Bad Godesberg: Dr. Grohs, Dr.<br />
Steinhoff (IPZ 3d)<br />
Fraunhofer-Institut <strong>für</strong> Umweltchemie und Ökotoxikologie, Abt. Molekulare Biotechnologie,<br />
Schmallenberg, Dr. Prüfer<br />
Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Straubing Alburg, Herr Feldmeier (IPZ 4a)<br />
Fuß Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG, Sckölen, J. Fuß (IPZ 5a)<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> die Dokumentation von Erfahrungsmaterial der chinesischen Arzneitherapie (DECA),<br />
Reitmehring: Dr. Friedl (IPZ 3d)<br />
GfH, Gesellschaft <strong>für</strong> Hopfenforschung, Hüll (IPZ 5)<br />
GFP, Gesellschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e.V., Bonn<br />
GFS, Gemeinschaftsfonds Saatgetreide, Bonn (IPZ 6c)<br />
Graminor AS, Bjørke forsøksgård, , Norwegen, Dr. P. Marum (IPZ 4b)<br />
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Damme<br />
GST-electronik, Großmehring, G. Sterler<br />
Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft (HHV), Mainburg (IPZ 5)<br />
Hans Binder Maschinenbau GmbH, Marzling: Dr. M. Gatterer (IPZ 3d)<br />
Hans Wanner GmbH, Wangen im Allgäu, H. J. Wanner (IPZ 5a)<br />
Haus im Moos, Kleinhohenried, Herr Sorg, Dr. Wechselberger, Herr Freimann<br />
HBLFA Raumberg – Gumpenstein, Institut <strong>für</strong> Biologische <strong>Landwirtschaft</strong>, Versuchsstation Lambach:<br />
Dr. Huss (IPZ 6c)<br />
Heiß Technik, Pförring, A. Heiß<br />
Helmholtz Zentrum München - Neuherberg, Institute <strong>für</strong><br />
- Bodenökologie,<br />
- Pflanzenpathologie,<br />
- Bodenökologie,<br />
- Strahlenschutz.<br />
Hessisches Dienstleistungszentrum <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong>, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) – Eichhof,<br />
Bad Hersfeld, Dr. R. Neff (IPZ 4b)<br />
Hochschule <strong>für</strong> Technik und Wirtschaft Dresden, Fachgebiet Ökologischer Landbau: Prof. K. Schmidtke<br />
(IPZ 6c)<br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf:<br />
- Fakultät <strong>für</strong> Biotechnologie und Bioinformatik: Prof. Schödel<br />
- Fakultät <strong>für</strong> Land- und Ernährungswirtschaft: Prof. Bauer, Prof. Ebertseder, Prof. Grundler, Prof. Roeb<br />
(IPZ 1b, 3a, 4a, 5, 6c)<br />
- Fakultät <strong>für</strong> Gartenbau und Lebensmitteltechnologie: Prof. Gerlach, Prof. Hauser, Prof. Henning,<br />
Dr. M. Beck (IPZ 1a, 1b, 3d, 5a)<br />
Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V., Wolnzach (IPZ 5)<br />
Hopfenring Hallertau, Wolnzach (IPZ 5)<br />
Hopsteiner, Mainburg, Dr. M. Biendl (IPZ 5)<br />
Ingenieur-Büro <strong>für</strong> angewandte Messtechnik, Erding, Dr. J. Rottmeier (IPZ 5a)<br />
Institut <strong>für</strong> Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben und Außenstelle Poel<br />
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Rennes, Frankreich<br />
Institute of Plant Genetics, Poznan, Polen, Prof J. Chelkowski<br />
Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences (AS) CR, Dr. D. Kopecký (IPZ 4b)<br />
Instituto National de Investigacion Agropecuaria (INIA), La Estanzuela, Uruguay, Dr. S. German<br />
InterSaatzucht GmbH & Co. KG, Hohenkammer<br />
Interuniversitäres Forschungsinstitut <strong>für</strong> Agrarbiotechnologie (IFA) Tulln, Tulln, Österreich,<br />
Dr. H. Bürstmayr, H. Biestrich<br />
IPK Gatersleben, Abteilung Cythogenetik und Genomanalyse, Prof. Dr. I. Schubert (IPZ 1b)
180 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
ISTA, International Seed Testing Association, Zürich: (IPZ 6c)<br />
Jelitto Staudensamen GmbH, Schwarmstedt: Herr Uebelhart (IPZ 3d)<br />
Joh. Barth & Sohn GmbH & Co. KG, Nürnberg, S. Barth, H. Meier (IPZ 5b)<br />
John Innes Centre, Norwich, UK, P. Nicholson<br />
Julius Kühn Institut (JKI) <strong>für</strong><br />
- <strong>für</strong> Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst, Braunschweig: Dr. M. Hommes (IPZ 5b, 5c)<br />
- <strong>für</strong> die Sicherheit biotechnologischer Verfahren bei Pflanzen, Quedlinburg: Prof. Dr. J. Schiemann<br />
(IPZ 1c)<br />
- <strong>für</strong> Resistenzforschung und Stresstoleranz, Quedlinburg, Prof. Dr. F. Ordon (IPZ ,2c)<br />
- <strong>für</strong> Epidemiologie und Pathogendiagnostik, Quedlinburg, Dr. F. Rabenstein; Dr. U. Kastirr (IPZ1b, 3d,<br />
4b, 6c)<br />
- <strong>für</strong> Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Braunschweig: Dr. Kerstin Lindner (IPZ 3a, b)<br />
- <strong>für</strong> ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz Prof. Dr. H. Schulz (IPZ 3d)<br />
- <strong>für</strong> landwirtschaftliche Kulturen, Groß Lüsewitz, Dr. U. Darsow, Dr. B. Ruge- Wehling (IPZ 1b)<br />
- <strong>für</strong> biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt, Dr. E. Koch (IPZ 5b)<br />
- <strong>für</strong> Strategien und Folgenabschätzung, Kleinmachnow, Prof. Dr. B. Freier, Dr. S. Kühne, Dr. M. Wick<br />
(IPZ 5b)<br />
- Versuchsfelder, Berlin-Dahlem, Dr. T. Strumpf (IPZ 5b)<br />
Justus-Liebig-Universität, Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I, Giessen, Prof. Dr. Honermeier<br />
(IPZ 3d) u. Prof. Dr. Friedt (IPZ1b)<br />
Kali + Salz, Kassel, Dr. G. Rühlicke (IPZ 5a)<br />
Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich:<br />
- Institut <strong>für</strong> Pharmazeutische Wissenschaften: Prof. Dr. Bauer (IPZ 3d)<br />
- Institut <strong>für</strong> Pflanzenwissenschaften, Pflanzenphysiologie, systemat. Botanik: T. Roitsch (IPZ 4b),<br />
- Institut <strong>für</strong> angewandte Biotechnologie: Prof. G. Berg (IPZ 5c)<br />
Kräuter Mix GmbH, Abtswind: Dr. Torres Londono, Friedmann (IPZ 3d)<br />
KWS-Lochow, Bergen-Wohlde: Dr. E. Ebmeyer, Dr. V. Korzun, E. Roßa, A. Witte (IPZ 1b, 6c)<br />
KWS Saat AG Einbeck: Dr. M. Ouzunova, Dr. B. Kessel (IPZ 4a)<br />
Labor Veritas, Zürich, Dr. Anderegg (IPZ 5d)<br />
Laborgemeinschaft DSV – I.G.S., Thüle, M. Koch<br />
Landesamt <strong>für</strong> Umweltschutz, Augsburg, Dr. Zeitler, Dr. Görlich<br />
<strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> und Gartenbau, Magdeburg, E. Bergmann<br />
Landeskuratorium <strong>für</strong> pflanzliche Erzeugung e.V. in Bayern (IPZ)<br />
Landessaatzuchtanstalt Hohenheim, Hohenheim, Dr. T. Miedaner, Dr. Posselt<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>liches Technologiezentrum Augustenberg,<br />
- Referat Saatgutuntersuchung (IPZ 6c)<br />
- Außenstelle Hopfen, Tettnang: Dr. W. Moosherr, Dr. M. Glas (IPZ 5a)<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>liches Zentrum des Kantons St. Gallen, Salez, Herr Oppliger<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>skammer Schleswig-Holstein: H. Brogmus (IPZ 6c)<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>skammer Niedersachsen, Hannover, Dr. M. Benke, Dr. C. Rieckmann (IPZ 4a, 4b)<br />
<strong>Landwirtschaft</strong>skammer Rheinland, Kleve, Dr. C. Berendonk (IPZ 4b)<br />
Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein (A), Institut <strong>für</strong> Pflanzenbau und Kulturlandschaft,Vegetationsmanagement<br />
im Alpenraum, Dr. B. Krautzer (IPZ 4b)<br />
LMU, Department <strong>für</strong> Statistik, München, PD Dr. C. Heumann (IPZ 5)<br />
Luft, Mess- und Regeltechnik, Fellbach, U. Kronmüller<br />
LVVG Baden Württemberg, Aulendorf, Dr. H.-J. Nussbaum, Herr W. Wurth (IPZ 4b)<br />
Martin Bauer Group, Vestenbergsgreuth: Dr. Hannig (IPZ 3d)<br />
Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Köln, Mario Roccaro (IPZ1b)<br />
Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology; Potsdam-Golm, Prof. Björn Usedal, Dr. Marc Loose<br />
(IPZ1b)<br />
Max-Planck-Institut Köln, Dr. Gebhardt, Prof. Rohde, Prof. Steinbiss (IPZ 3a, b)
181 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
Mitterer KG Maschinenbau, Terlan (Italien), A. Mitterer (IPZ 5a)<br />
MMM Tech Support, Berlin, Dr. T. Mosler (IPZ 5a)<br />
MIPS Neuherberg, Dr. S. Rudd<br />
NATECO2, Wolnzach, H. Schmidt (IPZ 5)<br />
Naturland Erzeugerring Bayern e.V.: W. Zwingel (IPZ 6c)<br />
New Zealand Institute for Crop and Food Research Limited, New Zealand, Prof. Pickering<br />
Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ), Poel, W. Luesink, Dr. B. Ingwersen (IPZ 4b)<br />
Österreichische Agentur <strong>für</strong> Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES): M. Weinhappl, A.<br />
Österreichische Agentur <strong>für</strong> Gesundheit und Ernährungssicherheit: Allgemeiner Austausch,<br />
spezieller Pflanzenbau, Wien, Herr D.I. Oberforster<br />
Pajbjergfonden, Odder, Dr. A. Schiemann<br />
Pfeiffer, Mailach: T. Pfeiffer (IPZ 3d)<br />
PHARMAPLANT Arznei- und Gewürzpflanzen Forschungs- und Saatzucht GmbH, Artern:<br />
B. Mikus-Plescher, Dr. Plescher (IPZ 3d)<br />
PhytoLab GmbH & Co. KG, Vestenbergsgreuth: Dr. Schmücker (IPZ 3d)<br />
Planta Angewandte Pflanzengenetik und Biotechnologie GmbH, Einbeck<br />
Planta Research International B.V., Wageningen, NL, Dr. R. van Tol (IPZ 5b, 5c)<br />
Ratzenböck, Ch. Leonhard (IPZ 6c); Institut <strong>für</strong> Sortenwesen, D.I. Oberforster (IPZ 2c)<br />
Reith Landtechnik GmbH & Co. KG, Wolnzach, S. Pauli (IPZ 5a)<br />
Research Institute of Crop Production, Prag-Ruzyne<br />
Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn, Institut <strong>für</strong> Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz,<br />
INRES; Prof. Leon, Dr. Schumann (IPZ1b)<br />
Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn, Institut <strong>für</strong> Molekulare Physiologie und Biotechnologie<br />
der Pflanzen, IMBIO; Prof. Bartels (IPZ 1b)<br />
Saatbau Linz, OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H.<br />
Saaten-Union Biotec GmbH, Leopoldshoehe, Dr. Jens Weyen, Jutta Förster (IPZ 1b)<br />
Saatzucht Gleisdorf GmbH, Gleisdorf, Österreich<br />
Saatzucht Steinach, Steinach, (IPZ1c, IPZ 4b)<br />
SaKa Zuchtstation Windeby, Dr. Strahwald, Dr. Lübeck (IPZ 3b)<br />
Sächsisches Landesamt <strong>für</strong> Umwelt, <strong>Landwirtschaft</strong> und Geologie, Christgrün, Dr. G. Riehl (IPZ 4b)<br />
Scottish Crop Research Institute, Dundee, Dr. Bradshaw<br />
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing, Dr. S. Radisek, Dr. A. Cerenak, Dr. M. Rak Cizej,<br />
M. Zupancic (IPZ 5)<br />
Small Grain Centre, Südafrika, T. Bredenkamp<br />
Societas Medicinae Sinensis (SMS), München: Dr. Hummelsberger, Dr. Nögel (IPZ 3d)<br />
Soller GmbH, Geisenfeld, H. Soller (IPZ 5a)<br />
Spiess-Urania, Hamburg, Dr. Braunwarth (IPZ 5b)<br />
Stähler, Stade, Dr. H. Götzke (IPZ 5b)<br />
Stauden Panitz, Rottenburg, Herr Panitz (IPZ 3d)<br />
Syngenta Crop Protection AG, Basel (CH), R. Wohlhauser (IPZ 5a und b)<br />
Syngenta Agro GmbH, Maintal, H.-H. Petersen (IPZ 5b)<br />
Sächsisches Landesamt <strong>für</strong> Umwelt, <strong>Landwirtschaft</strong> und Geologie, Christgrün, Dr. Riehl<br />
Spanish National Research Council, Ministry of Education and Science, Dr. Ernesto Igartua, Dr. Ana Casas<br />
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg, Referat Pflanzenschutz, Dr. C. Schmidt (IPZ 5b)<br />
Svalöf Weibull AB, Svalöv, Schweden, Dr. A. Olesen (IPZ 4b)<br />
Swiss Federal Agricultural Research Station, Changins, Schweiz, Dr. F. Mascher-Frutschi<br />
Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW):<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> ökologischen Landbau: Prof. Hülsbergen, Dr. Reents, Dr. F.X. Maidl (IPZ 3a), H. Schmid<br />
(IPZ 3a), M. Kainz (IPZ 3a)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung, Freising, Prof. Dr. C.C. Schön (IPZ 1b, 4a)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Grünlandlehre Prof. H. Schnyder (IPZ 4b)
182 Veröffentlichungen und Fachinformationen<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Chemie Biogener Rohstoffe, Prof. Dr. V. Sieber (IPZ 3a)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Ökologischen Landbau: Prof. Hülsbergen, Dr. H.J. Reents, J.P. Baresel, Dr. F.X.<br />
Maidl, H. Schmid, M. Kainz (IPZ 3a)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Pflanzenzüchtung: Prof. C.C. Schön, Dr. E. Bauer (IPZ 1b, 4a)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Genetik: Prof. Gierl<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Pflanzenernährung: Dr. S. v. Tucher (IPZ 3d)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Phytopathologie: Prof. Dr. R. Hückelhoven, Dr. H. Hausladen (IPZ 1b, 3a, 3b, 5c, 6c)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Tierhygiene, Freising, Prof. Dr. Dr. J. Bauer<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Tierökologie, Dr. A. Gruppe (IPZ 5b)<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Vegetationsökologie, Freising, Dr. Albrecht<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Technische Mikrobiologie, Freising, Prof. Vogel<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Technologie der Brauerei I, Freising, Prof. Becker, Dr. M. Gastl, (IPZ 2b, 5c, 5d)<br />
- Lehrstuhl Allgemeine Lebensmitteltechnologie, Freising, Prof. Engel<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Landtechnik, Freising, Dr. Rothmund<br />
- Lehrstuhl <strong>für</strong> Zellbiologie, Prof. Hock<br />
- Fachgebiet <strong>für</strong> Wildbiologie und Wildtiermanagement, Freising, Prof. Rottmann, B. Lutz<br />
- Versuchsstation Viehhausen, Herrn Stefan Kimmelmann (IPZ 6c)<br />
Technische Universität München, Zentralinstitut <strong>für</strong> Ernährungs- und Lebensmittelforschung (ZIEL),<br />
- Abteilung Physiologie, Prof. Meyer (IPZ 1b)<br />
Thüringer <strong>Landesanstalt</strong> <strong>für</strong> <strong>Landwirtschaft</strong> (TLL), Dornburg<br />
TrifolioM, Lahnau: J. Bahlo (IPZ 3d)<br />
Universität der Bundeswehr München, Fakultät <strong>für</strong> Luft- & Raumfahrttechnik, Institut <strong>für</strong> Flugsysteme,<br />
Prof. P. Stütz (IPZ 4b)<br />
Universität Ljubljana, Biotechn. Fakultät, Slovenien, Prof. Dr. Branka Javornik (IPZ 5c)<br />
Universität Rostock, Institut <strong>für</strong> Landnutzung, Phytomedizin, PD Dr. C. Struck (IPZ 4b)<br />
Universität Tübingen, Dr. Schilde-Rentschler, Prof. Hemleben<br />
Universität Wageningen, Laboratory of Plant Physiology, A. Undas, H.J. Bouwmeester (IPZ 5b, 5c)<br />
Universität Wien, Department Pharmakognosie, Wien: V. Klatte-Asselmeyer, Dr. C. Dobes (IPZ 3d)<br />
Universität Zürich, Institut <strong>für</strong> Pflanzenbiologie, Molekulare Pflanzenphysiologie, Dr. A. Böhm<br />
VDLUFA, Verband Deutscher <strong>Landwirtschaft</strong>licher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Bonn<br />
VDLUFA Qualitätssicherung NIRS GmbH, Kassel, Dr. P. Tillmann (IPZ 4b)<br />
Verband der <strong>Landwirtschaft</strong>skammern, Berlin<br />
Verband Deutscher Hopfenpflanzer, Wolnzach, (IPZ 5)<br />
Versuchsbrauerei St. Johann, A. Gahr (IPZ 5)<br />
Vertis AG; Dr. habil. Fritz Tümmler; Gründerzentrum Freising-Weihenstephan<br />
Washington State University, USA, Dr. K. Eastwell (IPZ 5c, IPS 2c)<br />
Wye Hops Ltd., China Farm Office, Harbledown, Canterbury, England, Dr. P. Darby (IPZ 5b, 5c)