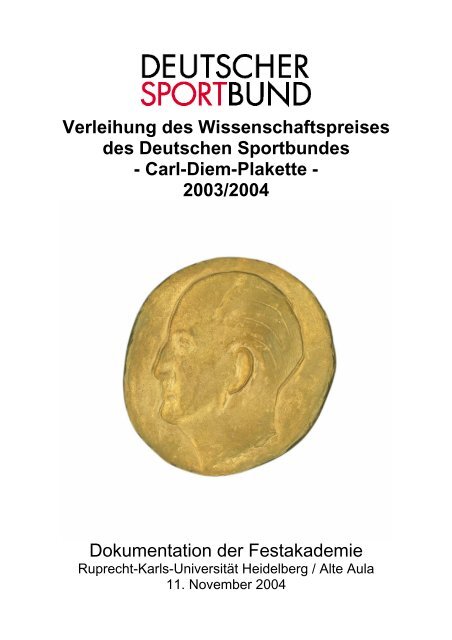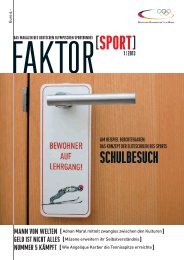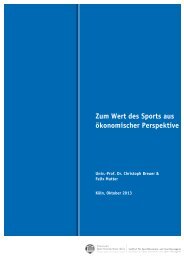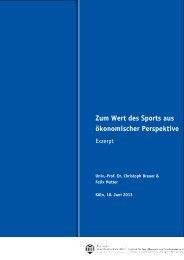Carl-Diem-Plakette - Der Deutsche Olympische Sportbund
Carl-Diem-Plakette - Der Deutsche Olympische Sportbund
Carl-Diem-Plakette - Der Deutsche Olympische Sportbund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verleihung des Wissenschaftspreises<br />
des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es<br />
- <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> -<br />
2003/2004<br />
Dokumentation der Festakademie<br />
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / Alte Aula<br />
11. November 2004
1. Ausschreibung ......................................................................................................<br />
2. Einladung...............................................................................................................<br />
3. Grußworte und Festreden<br />
Inhalt<br />
- Prof. Dr. Raban von der Malsburg ............................................................ 5<br />
- Manfred von Richthofen ............................................................................ 7<br />
- Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Hommelhof ........................................................... 10<br />
- Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe ......................…........................................ 14<br />
4. Erwiderung des Preisträgers<br />
- Prof. Dr. Oliver Höner ...................................…......................................... 23<br />
5. Biographien der Preisträger ..................................................................................<br />
6. Presse ...................................................................................................................<br />
7. Kuratorium zur Verleihung der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong> <strong>Plakette</strong> ............................................... 34<br />
8. Bilder .....................................................................................................................<br />
9. Alle Preisträger seit 1953 ......................................................................................<br />
10. Alte Aula ...............................................................................................................<br />
Kontakt<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Sportbund</strong><br />
Stabsstelle „Grundsatzfragen,<br />
Wissenschaft und Gesellschaft“<br />
Christian Siegel<br />
Postfach<br />
60525 Frankfurt am Main<br />
Tel.: 069/6700-360<br />
Fax.: 069/6700-1-360<br />
E-Mail: siegel@dsb.de<br />
www.dsb.de<br />
Seite:<br />
3<br />
4<br />
29<br />
31<br />
35<br />
39<br />
33<br />
2
Wettbewerb um den Wissenschaftspreis<br />
des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es -<br />
<strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> 2003 / 2004<br />
Ausschreibung<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> verleiht alle zwei Jahre für eine hervorragende<br />
sportwissenschaftliche Arbeit in deutscher Sprache die <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong>. Diese wird in den<br />
Sektionen Naturwissenschaft/Medizin und Geistes-/Sozialwissenschaften vergeben. <strong>Der</strong><br />
Wettbewerb dient vor allem der Förderung des sportwissenschaftlichen Nachwuchses.<br />
1. Wichtige Kriterien für die Beurteilung der eingereichten Arbeiten sind ihr<br />
wissenschaftlicher Charakter, die neuen Erkenntnisse der vorgelegten Untersuchung<br />
sowie ihre Originalität und Aktualität.<br />
2. Mit der Verleihung des Ersten Preises und der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> ist eine Geldsumme<br />
bis zu einer Höhe von € 2.500,- sowie ein Druckkostenzuschuss verbunden. Neben dem<br />
Ersten Preis können auch Zweite Preise vergeben und lobende Anerkennungen<br />
ausgesprochen werden, die ebenfalls mit Geldpreisen dotiert sind. Die<br />
Gesamtpreissumme beträgt bis zu € 15.000,-.<br />
3. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden in einer Festakademie geehrt, die gegen<br />
Ende des zweiten Wettbewerbsjahres stattfinden wird.<br />
4. Die für die Teilnahme am Wettbewerb bestimmten Arbeiten sind in sechsfacher<br />
Ausfertigung an den <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>, Stabsstelle „Grundsatzfragen, Wissenschaft<br />
und Gesellschaft“, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main, zu senden.<br />
Einsendeschluss ist der 31. März 2004 (Poststempel).<br />
5. Den eingereichten Arbeiten sind folgende Angaben beizufügen:<br />
a) Name, Anschrift und kurzgefasster Lebenslauf der Verfasserin oder des Verfassers;<br />
c) eine eidesstattliche Erklärung, dass die Arbeiten selbständig angefertigt wurden und<br />
dass die Bewerbung den Bedingungen der Ausschreibung gerecht wird;<br />
d) eine vollständige Zusammenstellung der benutzten Hilfsmittel und die Versicherung,<br />
dass keine anderen Hilfsmittel benutzt wurden (soweit diese Angaben nicht bereits in<br />
der Arbeit selbst enthalten sind);<br />
e) eine Erklärung, ob, wo und in welcher Fassung die Arbeit bereits Gegenstand eines<br />
Wettbewerbs war oder ist.<br />
6. Die Arbeiten dürfen bis zum Abschluss des Wettbewerbs (mit der Festakademie) in der<br />
eingereichten Form noch nicht veröffentlicht sein.<br />
7. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb übertragen die Bewerber und Bewerberinnen dem<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong> das Recht, eine mit der <strong>Plakette</strong> oder einem anderen Preis<br />
ausgezeichnete Arbeit in der „Wissenschaftlichen Schriftenreihe des <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Sportbund</strong>es“ zu veröffentlichen. Das Buchmanuskript ist bis zum 31. März 2005<br />
abzuschließen.<br />
Frankfurt am Main, im September 2003<br />
KURATORIUM FÜR DIE VERLEIHUNG<br />
DER CARL-DIEM-PLAKETTE<br />
gez. Professor Dr. Ommo Grupe, Vorsitzender<br />
3
Verleihung des Wissenschaftspreises des<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es - <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
Donnerstag, 11. November 2004<br />
Alte Universität Heidelberg,<br />
Grabengasse 1, Alte Aula<br />
Programm<br />
18.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer sowie der Gäste<br />
Festakademie<br />
18.30 Uhr Kammerchor des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums<br />
Heidelberg<br />
Musikalischer Auftakt<br />
anschließend Empfang<br />
Mitwirkende:<br />
Kammerchor und Solisten des<br />
Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums Heidelberg<br />
Leitung: OSR Werner Glöggler<br />
Grußwort<br />
Prof. Dr. Raban von der Malsburg,<br />
1. Bürgermeister der Stadt Heidelberg<br />
Begrüßung<br />
Manfred von Richthofen, Präsident des<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es<br />
Festrede<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Hommelhoff,<br />
Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg<br />
Kammerchor des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums<br />
Heidelberg<br />
Musikalisches Zwischenspiel<br />
Bekanntgabe und Würdigung der Preisträger<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe<br />
Vorsitzender des Kuratoriums für die Verleihung<br />
der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
Erwiderung des Trägers der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
Prof. Dr. Oliver Höner<br />
Solisten des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums,<br />
Heidelberg<br />
Musikalischer Ausklang<br />
4
Prof. Dr. Raban von der Malsburg<br />
Erster Bürgermeister der Stadt Heidelberg<br />
Sehr geehrter Herr Präsident von Richthofen,<br />
seien Sie herzlich gegrüßt in Heidelberg.<br />
Grußworte<br />
Es ist eine hohe Ehre für uns, dass der Wissenschaftspreis des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es, die<br />
<strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong>, hier in Heidelberg vergeben wird und das von der größten Organisation,<br />
die es in Deutschland gibt. Mit rund 27 Mio. Mitgliedschaften in 87.000 Vereinen, die<br />
allesamt von Ihnen seit nunmehr 10 Jahren repräsentiert werden. Wir wünschen Ihnen Glück<br />
und Segen zu diesem sehr beachtlichen Jubiläum. Ich glaube, nur Willi Daume hat Sie darin<br />
noch etwas übertroffen. Wir wünschen Ihnen auch viel Erfolg bei Ihren Bestrebungen, die<br />
Führungsorganisationen des deutschen Sports effizienter zu gestalten und<br />
zusammenzuführen. Viel Erfolg bei den Gesprächen, die in diesen Tagen anstehen.<br />
Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Verleihung in Heidelberg und ich<br />
denke dass ist nicht nur eine Anerkennung für unser Sportinstitut, welches hier durch Prof.<br />
Dr. Klaus Roth vertreten ist, sondern auch für die gesamte Ruprecht-Karls-Universität. Lieber<br />
Rektor Hommelhoff, es ist wirklich immer wieder eine Freude, hier sitzen zu dürfen. Ich habe<br />
schon viele Reden in der Alten Aula hören dürfen und habe sie alle sehr gut<br />
durchgestanden.<br />
<strong>Der</strong> Mensch ist ein äußerst komplexes System, meine Damen und Herren. Körper und Geist<br />
des Menschen sind wenig erforscht und man staunt immer wieder, wie sehr wir von<br />
Überraschungen abhängen, gerade bei sportlichen Höchstleistungen. Die Schwimmer haben<br />
in Athen unsere hochgesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllen können, die Segler noch viel<br />
weniger. Auf der anderen Seite, haben die Hockey-Damen bravourös gesiegt. Auch wir<br />
Heidelberger freuen uns darüber. Heidelberg ist eine Hockeystadt, die viele aufstrebende<br />
Talente des Hockeysports, z.B. den jungen Manfred von Richthofen, hier erleben durfte. Er<br />
hat soeben verraten, dass nicht nur die Hockeyspiele, sondern auch die Nachfeiern sehr<br />
beeindruckend gewesen sind. Ich kann das bestätigen, als kürzlich der HC Heidelberg die<br />
Meisterschaft feiern konnte und aufsteigen durfte. Hier habe ich abends die jungen Sportler<br />
bei ihrer Feier aufgesucht und Ihnen gratuliert.<br />
Zurück zum Sport. Es ist doch immer wieder überraschend, dass einerseits große<br />
Athletinnen und Athleten im entscheidenden Augenblick das Zittern bekommen und<br />
versagen, andererseits aber diese unglaublichen Leistungen, wie die der Hockey-Damen-<br />
Mannschaft in Athen, erbracht werden. Dies zu verstehen und zu steuern ist Aufgabe der<br />
Sportwissenschaft. In der Presse habe ich gelesen, dass die prämierte Arbeit von Oliver<br />
Höner den Titel „Entscheidungshandeln im Sportspiel Fußball – eine Analyse im Lichte der<br />
Rubikontheorie im Sportspiel Fußball“ trägt. Lieber Herr Prof. Höner, man sollte<br />
wahrscheinlich schon vom Titel her ausschließen, dass es sich hierbei möglicherweise um<br />
Entscheidungsstrategien bei Personalentscheidungen des <strong>Deutsche</strong>n Fußball-Bundes<br />
handelt. Dies ist wohl sicher nicht der Fall.<br />
Wir sind auch stolz, meine Damen und Herren, dass wir zusammengekommen sind, weil es<br />
eine gute Zusammenarbeit im Bereich des Sportes hier in Heidelberg gibt. Klaus Roth hat<br />
eine wunderbar Ballschule ins Leben gerufen, die ähnliches durchführt, wie das heute in<br />
Karlsruhe ausgezeichnete „Karlsruher Netzwerk“.<br />
5
Herr Bürgermeister Denecken aus Karlsruhe, seien Sie hier bei uns herzlich willkommen,<br />
und herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen sport- und sozialpolitischen Leistung. Wir<br />
werden ähnlich Gutes leisten - wenn auch ohne EU-Förderung – dafür aber vielleicht mit<br />
ähnlich guten Ergebnissen.<br />
Die Zusammenarbeit mit dem Badischen <strong>Sportbund</strong>, mit Heinz Janalik und mit Gerd Schäfer,<br />
hier prominent vertreten, verläuft großartig. Ich glaube, wir können sagen, dass wir uns<br />
bemühen, den Sport zu pflegen. Wir kennen seine hohe Bedeutung, nicht nur für das<br />
Sozialleben, sondern auch einfach für die Lebensfreude, die damit verbunden ist. 39<br />
Sporthallen, zwei sind erst kürzlich gebaut worden, sie sind alle „gut in Schuss“. Ich habe mit<br />
großem Entsetzen gelesen, dass 40% der Sporthallen in Westdeutschland und 70% der<br />
Sporthallen in Ostdeutschland in einem stark renovierungsbedürftigen Zustand sind.<br />
Dem <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong> nochmals ein herzliches Dankeschön, dass Sie hierher<br />
gekommen sind, um die <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> zu verleihen. Dies ist vielleicht auch ein<br />
bisschen Anerkennung für die Leistungen von Universität, Sportkreis und Stadt auf dem<br />
sportlichen Gebiet in Heidelberg.<br />
Auch den Preisträgerinnen und Preisträgern herzliche Glückwünsche. Solch eine große<br />
Anerkennung geht immer ein ganz gehöriges Maß an Arbeit voraus. Ich wünsche Ihnen,<br />
dass Sie diesen Preis, den Sie heute hier erhalten, als Bestätigung Ihrer Arbeit sehen und<br />
Sie weiter zu Höhenflügen im Sport und Sportwissenschaft anspornen wird.<br />
Ihnen allen noch einmal herzlich Willkommen in Heidelberg und viel Freude bei dieser<br />
wunderbaren Feier.<br />
6
Manfred von Richthofen<br />
Präsident des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es<br />
Sehr geehrter Herr Bürgermeister von der Malsburg,<br />
sehr geehrte Magnifizenz, Herr Professor Hommelhoff,<br />
sehr geehrte Damen und Herren Professoren,<br />
meine Damen und Herren.<br />
Grußworte<br />
Zur Verleihung des Wissenschaftspreises des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es, der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<br />
<strong>Plakette</strong>, begrüße ich Sie alle ganz herzlich.<br />
Ich danke Herrn Bürgermeister von der Malsburg für sein Grußwort und dem Rektor der<br />
Ruprecht-Karls-Universität, Herrn Professor Hommelhoff, für die Gastfreundschaft in dieser<br />
schönen Aula.<br />
Mein herzlicher Gruß gilt ebenso den vormaligen und insbesondere den aktuellen<br />
Preisträgerinnen und Preisträgern sowie den Mitgliedern des Kuratoriums unter Vorsitz von<br />
Professor Grupe.<br />
Ich begrüße ferner die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsorganisationen<br />
des DSB, des regionalen Sports und der Wissenschaft.<br />
Ein besonderer Gruß gilt Herrn Professor Röhrs, langjähriges Mitglied im wissenschaftlichen<br />
Beirat des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es und engagierter HSV-Anhänger.<br />
Mein herzlicher Willkommensgruß gilt nicht zuletzt Herrn <strong>Carl</strong>-Jürgen <strong>Diem</strong>, dem Sohn von<br />
<strong>Carl</strong> und Liselott <strong>Diem</strong>.<br />
Während die letzte Preisverleihung in Bonn vor zwei Jahren im Rahmen des DSB-<br />
Bundestages erfolgte, sind wir heute in einer Universität zusammengetroffen. Ich meine, mit<br />
diesen beiden Veranstaltungsorten sind die wichtigen Partner bereits angesprochen: Sport<br />
und Wissenschaft.<br />
Die Sportentwicklung kann auf die Unterstützung durch die Wissenschaft nicht verzichten,<br />
heute genauso wenig wie vor 50 Jahren, als der Wissenschaftswettbewerb des DSB<br />
begründet wurde. <strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> hatte sich entsprechend dieser Überzeugung<br />
schon in seiner Gründungssatzung von 1950 auf die Wissenschaftsförderung festgelegt. Um<br />
dieses Ziel zu erreichen, gründete er wissenschaftliche Gremien und initiierte zahlreiche<br />
wissenschaftspolitische und schulsportpolitische Aktivitäten.<br />
Die konstruktive Partnerschaft über Jahrzehnte hat dem Sport zweifellos einen erheblichen<br />
Bedeutungszuwachs gebracht. Er integriert weit mehr Menschen als andere gesellschaftliche<br />
Organisationen und rekrutiert die weitaus meisten Ehrenamtlichen. Er sichert in hohem<br />
Maße die Tragfähigkeit des sozialen Netzes und trägt zur Bildung sozialen Kapitals bei.<br />
Sport und Bewegung sind Aktivposten der Gesundheitspolitik, gewinnen als Wirtschaftsfaktor<br />
an Bedeutung und beflügeln gesellschaftliche Entwicklungsprozesse auf vielfältige Weise.<br />
Dieses überaus breite Leistungsspektrum des Sports versteht sich jedoch nicht von selbst.<br />
Angebotsprofile und organisatorische Voraussetzungen der Sportvereine und -verbände<br />
müssen weiterentwickelt und neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst<br />
werden. Und da wir in gesellschaftspolitisch dynamischen Zeiten leben, hat der Sport es mit<br />
einem turbulenten Umfeld zu tun, das uns in einem immer schnelleren Takt vor neue<br />
Herausforderungen stellt. Es ist daher heute notwendiger denn je, wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse zur Grundlage der Sportentwicklung und unseres Handelns zu machen.<br />
7
<strong>Der</strong> Sport und seine Vereine und Verbände bedürfen der Beratung und Unterstützung, aber<br />
auch der kritischen Begleitung durch die Wissenschaft und insbesondere durch die<br />
Sportwissenschaft.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> tritt daher auch und gerade in Zeiten enger werdender öffentlicher<br />
Finanz-Spielräume nachdrücklich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der<br />
sportwissenschaftlichen Forschung und Lehre an den deutschen Hochschulen ein. Ich hoffe<br />
auf einen baldigen Abschluss der Arbeiten an einer Fortschreibung des Memorandums zur<br />
Förderung der Sportwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Diese aktualisierte gemeinsame Plattform von Sport und Wissenschaft ist notwendig, um uns<br />
zeitgemäß positionieren zu können.<br />
Ich freue mich, Herr Professor Hommelhoff, dass wir an Ihrer sport- und sportwissenschaftsfreundlichen<br />
Hochschule zu Gast sein dürfen. Mein Dank gilt Ihnen und Ihrem<br />
sportwissenschaftlichen Institut für die zahlreichen Beiträge und Kooperationsprojekte, z.B.<br />
im Spitzensport. Das hatte nicht zuletzt Auswirkungen bis zu den <strong>Olympische</strong>n Spielen, wie<br />
die Athener Medaillengewinnerinnen, die zu Ihren Studierenden zählen, unter Beweis stellen.<br />
Die erfreuliche Initiative zur Einrichtung und Förderung von möglichst vielen<br />
„Partnerhochschulen des Spitzensports“ lässt für die Zukunft auch bundesweit neue Impulse<br />
erwarten.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> setzt sich ebenso für die Weiterentwicklung der mit ihm<br />
verbundenen wissenschaftlichen oder wissenschaftsnahen Einrichtungen ein. Ich nenne an<br />
dieser Stelle das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin, das<br />
Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig sowie die beiden in Köln<br />
ansässigen Akademien des DSB, die Trainerakademie und die Führungs-Akademie.<br />
Und schließlich plädieren wir - und zwar ganz nachdrücklich - für den Erhalt des<br />
Bundesinstituts für Sportwissenschaft. Dessen angemessene finanzielle Ausstattung zur<br />
Forschungsförderung und eine möglichst weitgehende inhaltliche und organisatorische<br />
Unabhängigkeit sind unverzichtbar für praxisnahe Ergebnisse in der Sportlandschaft.<br />
Auch der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> selbst engagiert sich an der Schnittstelle von<br />
Sportentwicklung und Wissenschaft mit besonderem Nachdruck. Ich darf vier Beispiele<br />
nennen:<br />
<strong>Der</strong> Schulsport ist ein Kernanliegen des DSB seit seiner Gründung 1950. Wie steht es um<br />
den Schulsport in unserem Land? Welche flächendeckenden Daten und Erkenntnisse haben<br />
wir, und was können wir daraus für Orientierungen, Analysen und Forderungen ableiten?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragen hat der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> im Verbund mit Partnern eine<br />
entsprechende „Untersuchung zur aktuellen Situation des Schulsports in Deutschland“ in<br />
Auftrag gegeben. Eine wissenschaftlich vergleichbare Bestandsaufnahme hat es bisher noch<br />
nicht gegeben.<br />
Wir erhoffen uns davon nicht nur Bewegung in der Schulsportdebatte, sondern wir erwarten<br />
auch Erkenntnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität des Schulsports. Erste<br />
Ergebnisse werden noch in diesem Jahr vorgelegt; der Abschlussbericht ist für den Sommer<br />
2005 vorgesehen.<br />
Ich nenne ein zweites Beispiel: Vor wenigen Wochen ist vom <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>, dem<br />
Bundesinstitut für Sportwissenschaft und den Landessportbünden ein<br />
„Sportentwicklungsbericht“ in Auftrag gegeben worden.<br />
Dieser Bericht löst nicht nur die vormaligen Finanz- und Strukturanalysen ab, sondern soll<br />
vielmehr Gegenwartsanalysen mit vorausschauenden Elementen verbinden und dem<br />
gemeinwohlorientierten Sport als wirkungsvolles Steuerungsinstrument dienen.<br />
Künftig haben wir also einen Gesamtbericht zur Lage und Entwicklung des Sports in<br />
Deutschland.<br />
8
Beispiel Nr. 3: Zur gesellschaftspolitischen Beratung sozusagen konnten wir vor wenigen<br />
Wochen einen „Wissenschaftlichen Gesprächskreis“ begründen, der dem DSB-Präsidium<br />
unmittelbar zugeordnet ist. Er soll in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche<br />
Themenstellungen aufarbeiten und bewerten.<br />
Schließlich darf ich als viertes Beispiel ein sportgeschichtliches Projekt nennen: Die<br />
Biographie <strong>Carl</strong> <strong>Diem</strong>s weckt bis auf den heutigen Tag Emotionen und polarisiert die<br />
Sportexperten und solche, die sich dafür halten. Wer war <strong>Carl</strong> <strong>Diem</strong>? Bis heute gibt es keine<br />
umfassende, wissenschaftlich fundierte und auf Quellen gestützte sowie theoretisch<br />
begründete Biographie <strong>Diem</strong>s. Denn wer sie schreiben wollte, „muss die deutsche<br />
Sportgeschichte des 20. Jahrhunderts schreiben“, so die Aussage eines Sporthistorikers.<br />
Dennoch – oder gerade deshalb: <strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> hat eine solche Biographie in<br />
Auftrag gegeben. Die Arbeit wird am 1.1.2005 beginnen. Ich bin den Partnern dieses<br />
Projektes, der <strong>Deutsche</strong>n Sporthochschule Köln und der Krupp-Stiftung, für ihr finanzielles<br />
Engagement dankbar. Ich persönlich glaube, dass wir uns nicht nur auf eine biographische<br />
Aufarbeitung des <strong>Diem</strong>’schen Lebenswerks und der Sportgeschichte freuen können, sondern<br />
wohl auch auf einen Beitrag des Sports zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte<br />
Deutschlands - die Wissenschaftsgeschichte in der angemessenen Form eingeschlossen.<br />
Mit der <strong>Diem</strong>-Biographie sind wir über den Namensgeber zum Wissenschaftspreis des<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es zurückgekehrt. Wir können heute auf ein halbes Jahrhundert<br />
Wissenschaftswettbewerb des DSB zurückblicken. Die Preisträgerinnen und Preisträger<br />
bürgen für wissenschaftliche Qualität und das hohe Niveau unseres Wettbewerbs. Dieser<br />
war immer auch Ausdruck der Wissenschaftsförderung des DSB, der seit 1953, dem ersten<br />
Wettbewerbsjahr, nahezu 250.000 Euro in diese Förderung investiert hat.<br />
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der DSB an dieser Form der Förderung und<br />
damit am Wettbewerb um den Wissenschaftspreis auch zukünftig festhalten wird.<br />
Ich danke den Mitgliedern des Gutachter-Kuratoriums für ihre Tätigkeit. Die herzlichsten<br />
Glückwünsche zum Schluss: Ich übermittele sie dem Träger der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
2003/2004 sowie den übrigen Preisträgerinnen und Preisträgern im Namen des Präsidiums<br />
des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es. Bleiben Sie der Wissenschaft und dem Sport verbunden. Alles<br />
Gute für Ihren künftigen Berufs- und Lebensweg.<br />
9
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Hommelhoff<br />
Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg<br />
Festansprache<br />
Erlauben Sie mir, zunächst einige Worte über das Gebäude und vor allem über die Alte Aula<br />
zu verlieren. Das Gebäude, in dem sie sich befinden, die alte Universität, wurde 1728<br />
abgeschlossen und ist in seiner äußeren Gestalt unverändert bis auf den heutigen Tag. Nur<br />
im Inneren hat sich manches getan. <strong>Der</strong> Festsaal, in dem wir heute zusammengekommen<br />
sind, wurde 1886 zum 500. Jubiläum der Universität Heidelberg so umgebaut, wie Sie ihn<br />
heute bewundern können. Anstelle der bis dahin diesen Saal prägenden<br />
Barockausgestaltung wurde eine vollständige Holzaustäfelung im Stil der Italienischen<br />
Renaissance eingefügt. . Wenn Sie die Paneelen von der Wand oder von der Decke nehmen<br />
würden, würden sie die barocke Ausgestaltung noch finden, die nicht beseitigt worden ist.<br />
Hinzuweisen ist auch noch auf eine Farbkombination, die Sie in dieser Gegend wohl nicht<br />
erwarten, nämlich die weiß-blauen bayerischen Rauten. Das hat seinen Sinn, denn das<br />
Bayerische Königshaus ist aus der Kurpfalz gekommen und wir Heidelberger bedauern bis<br />
heute, dass mit dem Umzug nach München der Inhalt der alten Pinakothek ebenfalls<br />
abgezogen wurde, um die Kultur in Bayern wesentlich abzustützen.<br />
Ich möchte mich im Folgenden auf ein Stichwort konzentrieren, mit dem die Universität<br />
Heidelberg in diesen Tagen und Monaten immer wieder in der Öffentlichkeit hervorgetreten<br />
ist, nämlich auf das Stichwort „Elite“ und d.h. auf unsere Bemühungen um den Status einer<br />
Elite-Universität. Wir steuern den Status einer Elite-Universität unter zwei Leitsternen an: 1.<br />
unter dem Leitstern des Wettbewerbs und 2. unter dem der Internationalität. Dabei sind wir<br />
uns natürlich darüber im Klaren darüber, dass dies eine sehr ambitionierte Zielsetzung ist,<br />
denn im internationalen Ranking liegt Heidelberg unter den deutschen Universitäten zwar<br />
ziemlich weit vorne, aber international eher im Mittelfeld. Wir müssten also gewaltige<br />
Anstrengungen unternehmen, um in Europa und weltweit in die Spitzengruppe vorzustoßen.<br />
Was aber ist unter universitärer Elite zu verstehen? Erlauben Sie mir, dies mit drei<br />
Stichworten anzudeuten: Ich verstehe unter universitärer Elite eine Leistungselite, eine<br />
Funktionselite und eine Wertelite und möchte sie deutlich von der Machtelite abgrenzen.<br />
Lassen sie mich Ihnen nur einige Felder universitärer Elite aus der Sicht Heidelbergs<br />
skizzieren: Eliteforschung, Elitenachwuchsförderung und Elitestudien. Die Eliteforschung in<br />
Heidelberg hat Ihre Schwerpunkte in der Medizin und in den Biowissenschaften, in der<br />
Mathematik, in der Physik und in der Chemie, in den Rechtswissenschaften sowie in einer<br />
Reihe sogenannter kleiner Fächer: wie z.B. alte Geschichte oder Ägyptologie. Das<br />
Besondere an dieser Universität – und das ist auch ein Fundament dessen, was sie so weit<br />
nach vorne getragen hat – ist die inneruniversitäre, interdisziplinäre Verknüpfung und<br />
Vernetzung der Teildisziplinen. Zwei Zentren bringen dies besonders schön zum Ausdruck:<br />
Zum einen das Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) und zum anderen das Institut für<br />
Wissenschaftliches Rechnen (IWR). In diesen beiden Einheiten arbeiten Spitzenforscher aus<br />
verschiedenen Disziplinen und Fakultäten zusammen, um hier Hervorragendes zu leisten.<br />
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der geisteswissenschaftliche<br />
Sonderforschungsbereich „Ritualdynamik“, der zahlreiche kleine Fächer umfasst,<br />
einschließlich der Theologie, der Soziologie und der Geschichte, und damit lebendiger<br />
Ausdruck des umfassenden Universitätsgedankens ist. Ich hoffe, diese Vernetzung macht<br />
auch unsere kleinen Fächer gegenüber ressourcengierigen Finanz- und sonstigen Ministern<br />
unangreifbarer.<br />
10
Die Vernetzung der Universität Heidelberg ist auch gekennzeichnet durch Kontakte zu den<br />
außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Region, insbesondere zu den Max-Planck-<br />
Instituten, zum <strong>Deutsche</strong>n Krebsforschungs-Zentrum (DKFZ) und zum Europäischen<br />
Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL). Mit dem <strong>Deutsche</strong>n Krebsforschungs-Zentrum<br />
verbindet die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum eine enge und lang<br />
andauernde Beziehung. Sie wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ihren sinnfälligen<br />
Ausdruck in einem nationalen Großprojekt, dem Nationalen Tumorzentrum, finden. Die<br />
Vernetzungen in der Region sind für uns zwar eine bare Selbstverständlichkeit, aber<br />
vielleicht gerade deshalb als Heidelberger Besonderheit erwähnenswert. Wir arbeiten<br />
intensiv mit den Fachhochschulen zusammen. Hervorzuheben sind hier die Kooperationen<br />
im Bereich der Medizintechnik mit der Fachhochschule Mannheim und auf dem Gebiet der<br />
Medizininformatik mit der Fachhochschule Heilbronn.<br />
Bei der Elite-Nachwuchsförderung legt die Universität Heidelberg einen besonderen<br />
Schwerpunkt auf die Promotionsphase. Wir liegen sowohl absolut als auch relativ mit der<br />
Zahl unserer Promotionen an der Spitze in der Bundesrepublik. Eine weitere Besonderheit:<br />
Wir haben das erste und einzige Graduiertenkolleg in der ganzen Bundesrepublik mit einer<br />
Fachhochschule, nämlich der in Mannheim. Wir sind momentan dabei, unsere<br />
Promotionsprogramme unter dem Dach einer Graduiertenakademie zusammenfassen, um<br />
insbesondere die gemeinsamen Anstrengungen zur Vermittlung sogenannter „Softskills“ für<br />
die Doktoranden zu verbessern, die Verwaltungsabläufe zu optimieren und auf der Ebene<br />
der Doktoranden den interdisziplinären Austausch zu befördern. Ein weiteres<br />
herausragendes Anliegen der Universität Heidelberg ist es, die Karrierewege nach der<br />
Promotion, das Nebeneinander der Habilitation und der Juniorprofessur, sicherzustellen.<br />
Schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war es die erklärte Politik der<br />
Universität, beide Wege dem Nachwuchs zur Verfügung zu stellen und da wir jetzt mit dem<br />
Juniorprofessor endlich in festes Gelände kommen, werden auch in Heidelberg die ersten<br />
Juniorprofessuren eingerichtet werden können. In dieses System werden wir auch die<br />
Position der Arbeitsgruppenleiter einbeziehen, die ja insbesondere im Zusammenhang mit<br />
den außeruniversitären Forschungseinrichtungen große Bedeutung haben.<br />
Auf die Elitestudien möchte ich mit wenigen Stichworten eingehen. Dass diese Elitestudien<br />
besonders auf die Forschung ausgerichtet sind, versteht sich für eine der führenden<br />
deutschen Forschungsuniversitäten von selbst. Unser besonderes Ziel muss es sein, die<br />
sogenannte Betreuungsrelation nachdrücklich zu verbessern. Wir sehen vor dem<br />
Hintergrund rückläufiger Staatsfinanzen dabei keinen anderen Weg, als die Studienbeiträge,<br />
von denen wir erwarten, dass sie im Jahre 2005 wohl möglich werden, dazu zu benutzen,<br />
um die Bedingungen für die Studierenden erlebbar zu verbessern.<br />
Erlauben Sie mir, den Elitegedanken in Richtung Sportwissenschaften weiterzuführen.<br />
Wenn ich mich diesem Thema widme, geht es nicht darum, die Leistungen Heidelberger<br />
Olympioniken nachzuzeichnen, sondern es geht zunächst einmal darum, was die<br />
Sportwissenschaften im Zusammengang mit den Lehramtsstudiengängen leisten und<br />
welchen Beitrag sie zum Elitegedanken liefern. Ich glaube, die Sportwissenschaften können<br />
Wesentliches für die Grundlegung des Elitegedankens erbringen, denn die<br />
Leistungsbereitschaft und die Leistungsfreude junger Menschen lässt sich nirgendwo so gut<br />
stimulieren und unterstützen, wie im Sport und durch den Sport. Ebenso sind die für eine<br />
Wertelite unverzichtbaren Fähigkeiten wie Teamfähigkeit und Kameradschaft auch mit den<br />
Schwächeren im Sport und im Spiel besonders gut zu erlernen. Ich erkläre klar an dieser<br />
Stelle, dass ich das nicht bei meinen Sportlehrer gelernt habe. Wahrscheinlich weil ich so<br />
unendlich unsportlich war, musste ich diese wichtigen Fähigkeiten erst am Kessel eines<br />
Minensuchers mit den Heizern aus dem Ruhrgebiet lernen – da habe ich es aber auch richtig<br />
gelernt. Ich wäre froh gewesen, wenn ich das vorher durch meinen Sportlehrer gelernt hätte.<br />
11
Beim Thema „Sport und Doping“ ist das interdisziplinäre Zusammenwirken in einer<br />
Universität wie der Ruperto Carola in vielfältiger Weise angesprochen. Es geht von den<br />
Sportwissenschaften über die Medizin bis zu den Geistes-, Kultur- und<br />
Rechtswissenschaften. <strong>Der</strong> Zusammenhang mit der Elite ist ganz einfach: Denn bei Doping<br />
ist klar aufzuzeigen, wo dem Willen zu Spitzenleistungen Grenzen gezogen werden müssen<br />
, damit der Wille zur Exzellenz nicht in Unrecht umschlägt. Die Sportwissenschaften im<br />
universitären Umfeld Heidelbergs sind gekennzeichnet durch eine Vielzahl universitärer<br />
Vernetzungen in Lehre und Forschung.<br />
Die Sportwissenschaften sind mit den Erziehungswissenschaften und mit der Medizin<br />
verknüpft und ich hoffe sehr, das die Sportwissenschaften auch einen wesentlichen Beitrag<br />
leisten können, wenn es darum geht, in Heidelberg die Altenforschung noch stärker zu<br />
etablieren. Ich glaube, Sportwissenschaft kann auch in diesem Bereich helfen, das<br />
Gesamtphänomen des Alterns und die soziale Begleitung dieses Prozesses wissenschaftlich<br />
besser zu erschließen.<br />
Erlauben Sie mir, einen kurzen Hinweis auf eine Begegnung, die ich in einem Bereich hatte,<br />
von der ich nie gedacht hatte, dass er für den Sport von Bedeutung ist. Bei den<br />
Mathematikern, in dem schon erwähnten Institut für wissenschaftliches Rechnen, begegnete<br />
mir eine Flugzeugingenieurin, die an einem Projekt zur mathematischen Simulation von<br />
Bewegungsabläufen saß. Dies war ein wunderbares Thema für die Mathematikerin in<br />
Verbindung mit der Medizin und auch mit den Sportwissenschaften. Denn was sie sich<br />
vorgenommen hatte, war eine nachdrückliche Verbesserung der Prothetik. Und ich könnte<br />
mir vorstellen, das so etwas ein besonders interessantes Feld ist, um unser Institut für<br />
wissenschaftliches Rechnen in eine Aufgabe hineinzustellen, die dann Ergebnisse bringt für<br />
den Vorteil des Einzelnen.<br />
Spitzensport und Wissenschaft in Heidelberg: Wir sind seit 2001 Partnerhochschule des<br />
Spitzensports mit konkreten Aufgaben und Erfolgen. Die Namen der Olympiasiegerinnen, die<br />
dafür stehen, sind die Damen Dahlmann, Haase und Rinne. Die Beiträge der Universität<br />
hierfür ist die Bereitstellung persönlicher Methoden und die Flexibilisierung der Studien- und<br />
Prüfungspläne. Frau Dahlmann hat beim Neujahrsempfang der Stadt Heidelberg einen sehr<br />
beeindruckenden Bericht über ihr Leben als Studentin und Spitzensportlerin abgegeben. Es<br />
war für die Universität eine besondere Freude, die Anerkennung zu erfahren, die Frau<br />
Dahlmann unseren Bemühungen geschenkt hat und deshalb haben wir uns natürlich von<br />
Herzen über den Erfolg von Frau Dahlmann in Athen gefreut.<br />
Heidelberg gilt selbstverständlich als Elitehochschule für den Leistungssport und seiner<br />
Athletinnen und Athleten. Ich habe mit besonderer Freude gelesen, dass das Institut für<br />
Sportwissenschaft auch ein Betreuungsprogramm für behinderte Athletinnen und Athleten<br />
aufgenommen hat. Und Ihnen, Herr Präsident von Richthofen, rufe ich natürlich bei dieser<br />
Gelegenheit zu: Heidelberg wird sich um das DSB-Gütesiegel Elitehochschule des<br />
Spitzensports selbstverständlich bewerben und ich bin sicher, Herr Roth wird das erfolgreich<br />
tun.<br />
Erlauben Sie mir zum Schluss eine ketzerische Frage: „Braucht die Universität Heidelberg<br />
eine eigene Sportmannschaft nach amerikanischem Vorbild?“ Wenn man sieht, wie sich<br />
amerikanische Hochschulen in ihren Broschüren präsentieren, dann fällt einem darin die<br />
zentrale Bedeutung des Sports auf. In Amerika hat der Sport an den Universitäten eine<br />
herausragende Position. Sollte man das übertragen? Wenn man die Vorteile auflistet,<br />
allemal, denn erstens können so Sportler zugelassen werden, auch wenn sie für das Fach<br />
nicht unbedingt die Voraussetzungen erbringen. Es gibt einen breiten Zugangsweg und dies<br />
ist nicht uninteressant. Zweitens würde die Breitenwirkung der Universität durch<br />
Sportmannschaften enorm gesteigert werden, was nicht nur für die Politik von Vorteil ist,<br />
sondern vor allem auch für uns und unsere Sponsoren. Die Nachteile fallen in die<br />
Zuständigkeit unseres 1. Bürgermeisters von der Malsburg: Wir müssten im Neuenheimer<br />
Feld ein mindestens 50.000 Plätze umfassendes Stadion errichten.<br />
12
Die Vorteile sind klar und es stellt sich die Frage, „warum hat eigentlich Heidelberg noch<br />
keine Universitäts-Mannschaft?“ – Ja, aber wir haben eine! Nämlich den USC. Die Frage<br />
muss daher präzisiert lauten, „warum hat der USC bis heute nicht jene Wirkungen entfaltet,<br />
die wir bei den amerikanischen Universitäten finden“? Und dafür hat ein/e Doktorand/in der<br />
Universität Heidelberg im Rahmen einer Dissertation mit dem Titel „Baseball als heiliges<br />
Symbol“ eine Antwort gefunden. Seine/Ihre Antwort kann ich Ihnen kurz zusammenfassen:<br />
<strong>Der</strong> USC Heidelberg hat deshalb nicht die Bedeutung amerikanischer Collageteams, weil die<br />
Universitätsangehörigen in Heidelberg nicht Sport als Religionsersatz auffassen. Über diese<br />
These wäre jetzt eigentlich in diesen heiligen Hallen ein Streitgespräch fällig, wenn nicht gar<br />
ein Symposium. Aber damit wären wir viel zu weit weg vom eigentlichen Anlass, nämlich von<br />
der Verleihung des Wissenschaftspreises des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es. Deshalb heiße ich<br />
Sie alle an der Universität Heidelberg willkommen, gratuliere den Preisträgern von Herzen<br />
und räume jetzt das Podium, damit wir zu dem kommen, was wirklich hier geschehen muss,<br />
zur Preisverleihung.<br />
13
Bekanntgabe und Würdigung der Preisträger<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe<br />
Vorsitzender des Kuratoriums für die Verleihung der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
Würdigung<br />
1.<br />
Den Preisträgerinnen und Preisträgern in diesem Wissenschaftswettbewerb des <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Sportbund</strong>es gehört dieser Akademie-Abend. Sie sind der Anlass, weshalb wir in dieser<br />
wunderschönen Aula der alten Universität in Heidelberg zusammengekommen sind. Sie<br />
wollen wir ehren. Und sie zeigen uns, dass dieser Wettbewerb - nach nun über fünfzig<br />
Jahren, in denen er durchgeführt wird - höchst lebendig ist. Mit ihren vom Kuratorium zur<br />
Preisverleihung ausgewählten Arbeiten leisten sie wichtige Beiträge zur Vermehrung<br />
unseres Wissens über den Sport. <strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> will das mit dieser Akademie<br />
auch öffentlich würdigen.<br />
In der Geschichte dieses Wettbewerbs spiegelt sich ein Stück weit auch die Entwicklung des<br />
Faches "Sportwissenschaft". Als der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> diesen Wettbewerb 1952 zum<br />
siebzigsten Geburtstag von <strong>Carl</strong> <strong>Diem</strong> stiftete, waren die, die wir heute ehren wollen, noch<br />
gar nicht auf dieser Welt. Und auch das Fachgebiet der Sportwissenschaft, in dem sie sich<br />
jetzt mit ihren Arbeiten für einen Preis qualifizieren konnten, gab es noch gar nicht.<br />
Bestenfalls gab es eine Idee von einer wissenschaftlichen Disziplin, die sich - irgendwie - mit<br />
Fragen des Sports, der Leibesübungen, der Leibeserziehung befassen sollte. Einen<br />
anerkannten Namen dafür hatte man auch noch nicht. Nur den Wunsch nach Beachtung<br />
durch die Wissenschaften. <strong>Der</strong> war aber nicht neu, den gab es seit 1913. Neu war, dass der<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> ihn bereits in seiner Gründungssatzung von 1950 verankerte. Das war<br />
mutig in einer Zeit, in der sich der Sport in Deutschland, und nicht nur der Sport, wie Willi<br />
Daume schrieb, materiell und moralisch am Nullpunkt befand; manche meinten sogar, es sei<br />
anmaßend - der Sport habe sich schließlich ohne besondere Not der nationalsozialistischen<br />
Diktatur angedient. Den Nachweis seiner "Wissenschaftswürdigkeit" sei er ohnehin schuldig<br />
geblieben.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> sah das anders, und <strong>Diem</strong> auch. Er hatte sich, obwohl selbst kein<br />
gelernter Wissenschaftler, eher ein großer Autodidakt, bemüht, zusammen mit Eduard<br />
Spranger, wenigstens an einer Universität, am liebsten in Berlin, Interesse an einem solchen<br />
Fach zu wecken, sogar gleich nach 1945, allerdings vergeblich. Er hatte auch eine vage<br />
Vorstellung davon, wo es in der akademischen Welt angesiedelt sein sollte, nämlich<br />
irgendwo zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften/Medizin. Von allen<br />
sollte es das Beste übernehmen, dachte er sich in seiner Unbekümmertheit -<br />
Komplexwissenschaft nennen wir das heute, wenn auch nicht viele wissen, wie diese mit<br />
ihren unterschiedlichen Paradigmen funktionieren soll.<br />
<strong>Diem</strong> stellte sich dieses Fach vor allem als pädagogisch vor, denn die, die es ausbildete,<br />
sollten - damals jedenfalls - tüchtige Sportlehrerinnen und Sportlehrer werden, in und<br />
außerhalb der Schule, das ist heute etwas anders, und außer Pädagogik brauchten sie dazu<br />
noch psychologische, historische und medizinische Grundkenntnisse. Das blieb sogar,<br />
nachdem es dann, etwa zwei Jahrzehnte nach Begründung dieses Wettbewerbs, an vielen<br />
Universitäten eingerichtet wurde, noch für eine Weile so.<br />
An den Arbeiten unserer Preisträger und Preisträgerinnen sehen wir, dass nach nun fünf<br />
Jahrzehnten die Wissenschaftswelt des Sports sehr viel bunter geworden ist. Bunt ist eine<br />
freundliche Umschreibung. Auch was die Sportwissenschaft betrifft: Ihre<br />
Ausdifferenzierungslust ist heiß entflammt; die traditionellen geisteswissenschaftlichen<br />
Disziplinen, die sie ursprünglich prägten, bleiben dabei allerdings auch bei ihr auf der<br />
Strecke.<br />
14
Gerade deren Fürsprache jedoch hatte die neue Disziplin, als ihre akademische Zukunft<br />
noch unklar war, das Entré in die Universität zu verdanken, einigen Althistorikern,<br />
Altphilologen, auch Pädagogen, natürlich nie allen, Psychologen und Philosophen, nicht<br />
zuletzt einigen großen Medizinern; unter den Naturwissenschaftlern gab es leidenschaftliche<br />
Fans, aber die äußerten sich als Naturwissenschaftler in dieser Frage weniger.<br />
Natürlich wäre auch eine solche Fürsprache folgenlos geblieben, hätte es nicht zunehmend<br />
eine immer stärkere öffentliche Nachfrage nach wissenschaftlich fundiertem Wissen über<br />
den Sport gegeben, zuerst meistens aus dem <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>, aus dessen anfänglich<br />
eher bescheidenem Wunsch dann auch bald deutlich formulierte Forderungen nach<br />
Einrichtung von sportwissenschaftlichen Professuren wurden, vorsichtigerweise, um tunlichst<br />
das Wort Sport zu vermeiden, "Theorie der Leibeserziehung" genannt. Aber auch diese<br />
Forderungen wären vermutlich ungehört geblieben, wäre nicht im Vorfeld der <strong>Olympische</strong>n<br />
Spiele 1972 in München und im Zusammenhang mit den Ost-West-Konflikten vor allem der<br />
Leistungssport politisch als wirksames Instrument entdeckt worden; damit nahm dann auch<br />
der politische Druck zu, und die politischen Entscheidungsgremien, also die Parteien und die<br />
Landtage, waren auf einmal in der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur auch nicht<br />
mehr so kleinlich.<br />
<strong>Diem</strong> hat dies alles nicht mehr erlebt, nicht einmal, dass seine Hochschule in Köln einen<br />
wissenschaftlichen Status bekam und hernach eine beneidenswerte Menge an Professuren.<br />
Zeit seines Lebens oder zumindest in den Nachkriegsjahren hatte er wohl alle seine<br />
Hoffnungen darauf gesetzt, dass es in der Bundesrepublik auch einmal Kultusminister vom<br />
Format Wilhelm von Humboldts im neunzehnten Jahrhundert und <strong>Carl</strong> Heinrich Beckers gut<br />
hundert Jahre später, beide reformfreudige preußische Kultusminister, geben würde, die von<br />
sich aus Wert und Bedeutung der Leibesübungen für Erziehung, Gesundheit und<br />
Zusammenleben der Menschen erkannten. Da es Preußen nicht mehr gab, wäre ihm wohl<br />
auch ein badischer Kultusminister recht gewesen.<br />
Im Anfang war dieser Wettbewerb weniger auf den Nachwuchs ausgerichtet: Wie sollte er<br />
das auch, wenn es das Fach, für den man den Nachwuchs hätte fördern wollen, noch nicht<br />
gab, und für die, die Nachwuchs hätten sein können, war eine berufliche Perspektive an der<br />
Universität nicht einmal in der Ferne zu erkennen, höchstens als Lehrkraft im<br />
Hochschulsport. So diente er zunächst vor allem dazu, Arbeiten auszuzeichnen oder solche<br />
anzuregen, die sich irgendwie, natürlich auf möglichst anspruchsvolle Weise, mit Fragen des<br />
Sports befassten. Um unter den eingereichten Arbeiten die besten Arbeiten herauszufinden,<br />
berief man ein Kuratorium, in dem damals große Namen vertreten waren, unser Kuratorium<br />
kann heute damit leider nicht mehr dienen (dafür mit einer Auswahl hervorragender<br />
Preisarbeiten), wie zum Beispiel Professor Erich Burck, Latinist und international hoch<br />
renommierter Ovid-Forscher in Kiel, der weltweit angesehene Philosoph und Soziologe<br />
Helmut Plessner, nach der Rückkehr aus der Emigration in Göttingen, der hochangesehene<br />
Mediziner Hans-Erhard Bock, der - hundertjährig - Anfang dieses Jahres starb, Bock und<br />
Burck auch noch gelernte Turnlehrer, und alle drei Universitätsrektoren - heute würden<br />
Universitätsrektoren, voll verwickelt in die existenziellen Fragen der Universität, wohl kaum<br />
noch Zeit für so was finden -, der eine in Kiel, die anderen in Göttingen und Marburg, zwei<br />
Universitäten, die damals, als es noch keine Hochschulrankings gab, zu den besten<br />
gehörten, die es in Deutschland gab - außer Heidelberg natürlich als allerbeste. Es ehrt<br />
deshalb die Akademie, dass sie an dieser so traditionsreichen und doch auch so modernen<br />
Universität stattfinden kann, die zudem auch noch so zahlreiche Preisträger und<br />
Preisträgerinnen in den letzten Jahrzehnten gestellt hat. Auch der Münchener Psychologe<br />
Philipp Lersch gehörte zu den Kuratoriumsmitgliedern. Ein wenig akademischen Glanz<br />
wünschte sich der DSB mit der Wahl eines solchen Kuratoriums natürlich auch, und diese<br />
großen Persönlichkeiten waren auch bereit, ihn zu liefern.<br />
15
Sie zu gewinnen, die es ja nicht nötig hatten, sich das Modewort "Elite" anzuheften, sie<br />
waren das einfach, und mit ihrer Hilfe der Sportwissenschaft die verschlossenen Eingänge<br />
zu den Universitäten und zur Wissenschaft wenigstens ein Stück weit zu öffnen - die<br />
Universitäten hatten in guter deutscher Kulturtradition zu der Zeit mit dem Sport als einer<br />
wissenschaftlichen Disziplin nur wenig, eigentlich gar nichts im Sinn, die Universität Münster<br />
wollte sogar den ohnehin randständigen Hochschulsport aus der Universität ausgliedern, die<br />
Universität zu Köln wandte sich gegen eine "Fakultas für Bauchwelle", das hatte sie in den<br />
zwanziger Jahren auch schon getan, und ein nicht einmal unbekannter Professor einer nicht<br />
unbekannten liberalen und offenen Universität, gab Willi Daume, der ihn zu einem<br />
Festvortrag einlud, einen Korb mit der Begründung, er wolle sich doch nicht mit dem Sport<br />
kompromittieren, das würde heute wohl keiner mehr mit einem solchen Argument tun - dass<br />
dieses Gremium in einer solchen Besetzung berufen werden konnte, war das Verdienst des<br />
weltläufigen und humanistisch hochgebildeten DSB-Gründungsvorsitzenden Willi Daume.<br />
<strong>Der</strong> erste Preisträger 1953 war übrigens der Mediziner Prof. Herbert Reindell.<br />
Die mit der Entscheidung des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es eingeleitete und durch diesen<br />
Wettbewerb unterstützte Entwicklung führte dann letztendlich zu einer eigenen Fachdisziplin,<br />
die im Anfang meistens noch "Theorie der Leibeserziehung" genannt wurde, ab den<br />
siebziger Jahren dann "Sportwissenschaft", manchmal auch "Sportwissenschaften" -<br />
worüber überflüssige Glaubenskriege geführt wurden, in der Akademikersprache verkleidet<br />
als wissenschaftstheoretischer Diskurs, - und heute spricht man an einigen Universitäten von<br />
Bewegungswissenschaften, weil man offenbar glaubt, mit der Trennung vom Wort Sport<br />
wäre man etwas Besonderes. Angesichts einer solchen Verleugnung der eigenen Herkunft<br />
aus dem Sport wäre ein kleiner Glaubenskrieg eher angebracht.<br />
Wenn man historisch genauer hinsieht, muss man sagen, dass der DSB mit seiner<br />
seinerzeitigen Entscheidung nicht nur Mut und Weitsicht bewiesen, sondern auch dazu<br />
beigetragen hat, eine für die Sportwissenschaft und für die Sportmedizin erfolgreiche<br />
Entwicklung einzuleiten, auch wenn diese im Anfang ziemlich langsam, im Schneckentempo<br />
sozusagen, verlaufen ist, nicht zuletzt deshalb, weil qualifizierte Nachwuchskräfte für neue<br />
Professuren nur in geringem Maße zur Verfügung standen. Möglicherweise gäbe es uns als<br />
Fach ohne diese Initiative auch noch gar nicht, jedenfalls nicht in dieser Form, mit dieser<br />
Ausstattung und auf diesem Niveau. Zwar haben sich unsere Universitäten bei der<br />
Ausdifferenzierung ihrer Fächer in der Regel als recht einfallsreich und erfinderisch<br />
erwiesen, diese ist ja in gewissem Sinne in ihrer Entwicklungslogik auch vorgezeichnet.<br />
Sport hatten sie aber nicht auf ihrer Agenda. Es gibt kaum eine, vermutlich keine, in der die<br />
neue Disziplin wirklich aus dem Fleisch von Mutterwissenschaften herausgeschnitten worden<br />
wäre, die Filetstücke waren sowieso längst verteilt. Deshalb mussten externe Nachfrage,<br />
öffentlicher Druck, Wachstum des Sports zu einem gesellschaftlichen Phänomen, ein<br />
"Kulturgut" wird er heute sogar genannt, und Initiativen seines Dachverbandes und<br />
schließlich politischer Wille von Landtagen - also außeruniversitäre Faktoren -<br />
zusammenkommen, um Universitäten zu veranlassen und es ihnen zu ermöglichen, sich<br />
jene Infrastruktur zu schaffen, die für den Aufbau einer neuen wissenschaftlichen Disziplin<br />
unerlässlich ist. Zu diesem Zweck eigene Stellen umzuwidmen, also beispielsweise C4-<br />
(frühere H4-)Stellen für evangelische oder katholische Theologie in Sportwissenschaft, hätte<br />
vermutlich kein Rektor überstanden. Damals!<br />
Die Sportwissenschaft teilt damit das Schicksal anderer inzwischen etablierter<br />
Fachdisziplinen, die besondere Lebens-, Kultur- und Gesellschaftsbereiche zum Thema<br />
haben wie die Verkehrswissenschaft, die Milchwissenschaft, die Ernährungswissenschaft,<br />
die Bierwissenschaft, die Sexualwissenschaft sowie die etwas vornehmeren wie<br />
Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft oder Kulturwissenschaft oder auch Musik- und<br />
Kunstwissenschaft, alles wichtige und auf die Lebenspraxis der Menschen bezogene<br />
Disziplinen mit schönen Doppelnamen, mit deren Einrichtung die Universität auf externe<br />
Nachfrage, Ausbildungsbedarf und öffentlichen Druck reagiert.<br />
16
Das ist nicht schlimm, meistens sogar gut, beeinträchtigt auch nicht die Reputation dieser<br />
Fächer, die regelt sich sowieso anders, sondern zeigt uns nur, wie stark äußere Einflüsse<br />
das Binnenleben unserer Universitäten beeinflussen. An dem für unsere Gesellschaft<br />
offensichtlich so wichtig gewordenen Sport wollte am Ende kaum noch eine Universität in<br />
Deutschland vorbeigehen.<br />
In der Sportwissenschaft spiegelt sich diese Entwicklung beispielhaft wider, besonders ab<br />
den siebziger Jahren, als nicht nur vermehrt sportwissenschaftliche Universitätsprofessuren<br />
eingerichtet wurden, sondern auch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft von der<br />
Bundesregierung in Köln, der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> ein "Zentralkomitee" für die Forschung<br />
auf dem Gebiet des Sports mit einer sportpädagogischen und einer naturwissenschaftlichmedizinischen<br />
Sektion bildete, es allenthalben (sport-)wissenschaftliche und<br />
sportmedizinische Beiräte gab, eine eigene internationale sportwissenschaftliche Zeitschrift<br />
erschien und der erste große internationale sportwissenschaftliche Kongress als Teil der<br />
<strong>Olympische</strong>n Spiele 1972 in München organisiert wurde, und in Zusammenhang damit<br />
entwickelte sich auch noch eine umfangreiche sportwissenschaftliche und sportmedizinische<br />
Literaturproduktion, dies nicht immer zur Freude der Studierenden, die möglichst viel davon<br />
lesen sollten, inzwischen meistens in Gestalt von Kopien. Für die Qualität der Arbeit, die<br />
dabei geleistet wurde, kann der DSB allerdings nicht verantwortlich gemacht werden. Diese<br />
Verantwortung tragen die in diesen Bereichen, vor allem die in den universitären<br />
Sporteinrichtungen tätigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und da es so etwas<br />
gibt wie eine Institutionenethik auch diese Einrichtungen.<br />
Mit diesem Wettbewerb bekundete der DSB sein Interesse an der Einrichtung einer<br />
anspruchsvollen Sportwissenschaft, und das tut er heute wieder; ein Spötter sagte<br />
seinerzeit, er habe sich nur mit einem gekauften Doktorhut schmücken wollen. Von dieser<br />
Wissenschaft und ihren Ergebnissen erhoffte er sich natürlich auch eigenen Nutzen. Ich<br />
glaube, dass diese Hoffnung des DSB sich erfüllt hat. Mit der endgültigen "Etablierung"<br />
dieser Disziplin, die heute ziemlich erwachsen ist, wenn auch manchmal mit - meistens<br />
sympathischen - Anflügen von Pubertät, konnte auch die Zielrichtung dieses Wettbewerbs<br />
auf konsequente Nachwuchsförderung umgestellt werden. Denn vor allem diese, das weiß<br />
auch der DSB, sichert die sportwissenschaftliche Zukunft.<br />
Aber es zeigen sich auch mancherlei Schwierigkeiten, vor denen das Fach steht und die<br />
unseren Gutachtern und Gutachterinnen ihre Aufgaben nicht leicht machen. Dies hat mit der<br />
schnellen - fast zu schnellen - Ausdifferenzierung dieses ja im Grunde und im Vergleich zu<br />
anderen Fächern noch jungen Faches zu tun; diese macht es zunehmend unübersichtlich.<br />
Zum Glück hat sich diese Frage bei diesem Wettbewerb nur theoretisch gestellt. Aber<br />
generell wird eine Antwort immer dringlicher. Ist alles schon Sportwissenschaft, was sich als<br />
Sportwissenschaft und in deren Umfeld "wissenschaftlich" mit Sport befasst? Was ist der<br />
gemeinsame Kern der Sportwissenschaft, worauf kann sie ihre Identität begründen und<br />
womit ihr Selbstverständnis, was sind ihre originären Themen? Da der leidenschaftliche<br />
Drang zur Differenzierung auch die Sportwissenschaft überkommen hat, ungezügelt wie<br />
meistens bei Leidenschaften, finden sich neben den traditionellen sportwissenschaftlichen<br />
Disziplinen inzwischen viele neue: zum Beispiel Sportökonomie, Sportrecht, Sporttechnik,<br />
Sportinformatik, Sportbiomechanik, also immer mehr Wissen in immer mehr (und kleineren)<br />
Parzellen, die jedoch die Neigung haben, sich in eigenen Organisationsstrukturen zu<br />
stabilisieren, dabei die ohnehin in der Sportwissenschaft wirksamen zentrifugalen Nestflucht-<br />
Tendenzen noch verstärkend. Nicht dass das dabei produzierte Wissen nicht nützlich oder<br />
unwichtig wäre. Nur: für den Beobachter, Nutzer oder Abnehmer dieses Wissens ist das<br />
alles verwirrend. Die behauptete Einheit der Sportwissenschaft erweist sich als Illusion, eine<br />
"Schimäre" nennt sie Gunnar Drexel ziemlich respektlos, da sie ihre Paradigmen nicht<br />
zusammenkriege. Trotzdem: Auch wenn "Einheit" eine Fiktion sein sollte (besser Option!),<br />
man benötigt sie aus wissenschaftssystematischen und -organisatorischen (und -politischen)<br />
Gründen. Aber sie fällt dem Fach nicht zu, sondern jeder und jede der in ihr Tätigen muss<br />
sich um sie bemühen.<br />
17
Zum Sport möchten inzwischen aber auch noch andere Wissenschaften etwas sagen,<br />
jedenfalls, wenn sie die Mittel dafür erhalten. Nur: Wenn die Verkehrswissenschaft uns<br />
darüber belehrt, dass die Ausbreitung des Sports auch mit der Entwicklung der<br />
Nachrichtensysteme und des Verkehrswesens zusammenhängt und die Medienwissenschaft<br />
Auskunft über Hör- und Sehgewohnheiten der Nutzer oder über die Abhängigkeit der<br />
Sportartenentwicklung von deren Medienpräsenz liefert oder der Sinologe uns darüber<br />
informiert, dass die Vorläufer des Fußballspiels nicht mehr im England Shakespeares<br />
gesucht werden müssen, sondern im alten China, einer Einsicht, die die FIFA gleich zur<br />
Wahrheit erklärt hat - zur Freude der Chinesen -, obwohl Professor Vogel, dem wir diese<br />
Erkenntnis verdanken und der lange schwankte, ob er Profifußballer in der Schweizer<br />
Nationalliga werden sollte oder lieber Sinologie studieren, vorsorglich darauf hinwies, dass<br />
das Spielen einer Art Ball mit dem Fuß noch kein Fußball ist, dann stellt sich doch schnell die<br />
Frage, ob solche Arbeiten in dem Sinne sportwissenschaftlich sind, dass sie dem Fach<br />
Sportwissenschaft zugerechnet werden können, auch wenn sie für den Sport nützlich sind,<br />
wie ja gegenwärtig an manchen ökonomischen, soziologischen und pharmakologischen<br />
Erkenntnissen zu sehen ist.<br />
Warum ist das wichtig und nicht nur anekdotisch? Ein Grund liegt darin, dass sportbezogene<br />
Erkenntnisse anderer wissenschaftlicher Disziplinen interessant, oft auch spannend und<br />
wichtig für den Sport sind, und von ihrer Art gibt es zunehmend mehr. Aber es sind<br />
letztendlich keine sportwissenschaftlichen. Die Sportwissenschaft kann sie sich nicht selbst<br />
gutschreiben. Sie muss sich um ein eigenes Selbstverständnis, um ihre spezifischen<br />
Methoden, ihre authentischen Inhalte kümmern. Das ist nicht immer leicht, setzt ein hohes<br />
Maß an Selbstreflexivität, ein differenziertes Methodenbewusstsein und ein fundiertes<br />
Problemverständnis und die Respektierung von Fachgrenzen voraus. Man muss als<br />
Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerin wissen, worüber man redet und - mit<br />
Wittgenstein - wo man besser schweigt.<br />
2.<br />
Unsere diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen haben in ihren Arbeiten diese Maxime<br />
befolgt haben, jeder und jede hat mit den von ihnen bearbeiteten Themen originäre und<br />
originelle sportwissenschaftliche und sportmedizinische Erkenntnisse gewonnen,<br />
unprätentiös und ohne weltverbesserische Ambitionen. Sie tragen mit ihren Arbeiten zum<br />
Fortschritt der Sportwissenschaft und zur Vermehrung unserer Erkenntnisse über den Sport<br />
bei, und sie haben damit das, was der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> mit diesem Wettbewerb<br />
erreichen wollte, auf großartige Weise eingelöst. Den DSB-Präsidenten kann das<br />
Wettbewerbsergebnis in der Überzeugung bestärken, mit diesem Wettbewerb das<br />
sportwissenschaftlich und sportpolitisch Richtige getan zu haben und - wir hoffen - auch<br />
weiterhin zu tun. Auch in diesem Wettbewerb konnten Arbeiten ausgezeichnet werden, die<br />
nicht nur - das ist selbstverständlich - die Kriterien Qualität, Neuigkeitswert, Kreativität,<br />
Nachwuchsförderung erfüllten, sondern immer auch das des praktischen Nutzens für den<br />
Sport.<br />
Die wirklich preiswürdigsten Arbeiten unter den eingereichten zu finden, ist für die Mitglieder<br />
des Kuratoriums angesichts ihrer breiten thematischen Streuung nicht leicht gewesen, aber<br />
auch keine lästige Pflichtaufgabe, sondern eine interessante, manchmal spannende und<br />
immer lohnende Tätigkeit. Es ist dabei erfreulich zu sehen, wie über die Jahre das Niveau<br />
des Wettbewerbs in seiner Breite gestiegen ist und welch ein eindrucksvolles Bild von<br />
Sportwissenschaft und Sportmedizin er uns heute liefert, bei dem die, deren Auszeichnung<br />
ich nun zu begründen habe, sozusagen Glanzpunkte sind, von denen fünf hell leuchten und<br />
einer noch ein wenig heller. Mit diesem besonders hell leuchtenden Glanzpunkt - soweit<br />
Männer überhaupt Glanzpunkte sein können, woran man begründete Zweifel haben kann -<br />
fange ich an und stütze mich dabei auf die vom Kuratorium gebilligten Gutachten.<br />
18
<strong>Der</strong>, der uns diesen liefert, hat Sportwissenschaft und Mathematik studiert, schaut weit über<br />
sein engeres Fachgebiet hinaus und bearbeitet ein Thema am Beispiel einer Sportart, die er<br />
auch praktisch beherrscht: Fußball, das er in seiner Jugend und Juniorenzeit auf hohem<br />
Niveau spielte und jetzt noch in der Verbandsliga, dazu besitzt er die DFB-Trainerlizenz, das<br />
ist eine etwas unerwartete Kombination von Fähigkeiten, die jedoch eine glänzende<br />
Voraussetzung für seine Arbeit waren. Seit dem letzten Semester ist Oliver Höner<br />
Juniorprofessor in Mainz. In der Würdigung heißt es:<br />
Die letzte Fußballeuropameisterschaft hat es in vielfältiger Weise auch dem Laien vor Augen<br />
geführt: Neben den balltechnischen Fertigkeiten werden viele Auseinandersetzungen um<br />
den Ball gleichsam durch die Art und Weise"vorentschieden", wie der ballführende Spieler<br />
sein Handlungsziel (denkend) anvisiert oder ohne viel oder überhaupt nicht zu denken<br />
unmittelbar verfolgt. Oliver Höner versucht dieses Entscheidungsproblem im Sportspiel aus<br />
handlungspsychologischer Sicht so zu analysieren, dass er sowohl dem Problem<br />
situationsangemessenen Handelns als auch wissenschaftstheoretischen Ansprüchen<br />
gerecht wird; dies konkretisiert er dann in einem eigenen empirischen Untersuchungsteil.<br />
Die theoretische Grundlage seiner Arbeit bildet das von Heckhausen und dann Gollwitzer<br />
entwickelte kognitiv-handlungstheoretische Konzept, die so genannte "Rubikontheorie".<br />
Diese allgemeinpsychologische Handlungstheorie verknüpft Höner mit dem<br />
sportpsychologischen Phasenmodell von Nitsch. Auf diese Weise wird eine Differenzierung<br />
der spieltaktischen Situation in sogenannte prädezionale, präaktionale, aktionale und<br />
postaktionale Phasen erreicht.<br />
Zur Konkretisierung dieser Theoriekonstruktion aus empirischer Sicht, greift Oliver Höner auf<br />
die Eye-Tracking-Methode zurück, bei der Augenbewegungen durch eine besondere<br />
Videotechnik in Beziehung gesetzt werden zu willenspsychologischen Annahmen der<br />
Rubikontheorie. Ihm gelingt es auf diese Weise, Entscheidungsprozesse in<br />
Sportspielsituationen empirisch genauer zu erfassen. Unter Bezugnahme auf die<br />
Wissenschaftstheorie von Stegmüller und deren Übertragung von Westermann auf die<br />
Psychologie sowie die daraus abgeleitete Forschungskombinatorik Herrmanns fügt er<br />
schließlich seine einzelnen Theoriebausteine in einem inter- und intradisziplinären Konzept<br />
auf - höherer - metatheoretischer Ebene zusammen und integriert die einzelnen<br />
theoriegeleiteten Elemente einschließlich der Laborsituation in ein komplexes<br />
Theoriekonzept zur Erfassung der taktischen Entscheidungshandlungen im Sportspiel.<br />
Mit seiner Arbeit hat Oliver Höner einen beeindruckenden Beitrag zur empirisch basierten<br />
Systematisierung von Entscheidungsprozessen in Sportspielsituationen geleistet. Dabei ist<br />
besonders die Breite des Forschungsansatzes als auch die Konsequenz seiner<br />
Argumentation hervorzuheben. Es gelingt ihm auf großartige Weise, ein schwieriges und<br />
komplexes Thema auf theoretisch anspruchsvolle und kompetente Art und Weise zu<br />
bearbeiten. Wir gratulieren Oliver Höner ganz herzlich zu dieser hervorragenden Arbeit.<br />
Wir kommen zu unseren fünf hell leuchtenden Glanzpunkten - dem Alphabet nach zuerst zu<br />
Ingrid Bähr und ihrer Arbeit: Erleben "Frauen" sportbezogene Bewegung anders als<br />
"Männer"?<br />
Die Frage, ob und inwiefern Bewegungshandeln tatsächlich vom Geschlecht beeinflusst und<br />
geprägt ist, wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Zwar hat sich der traditionelle Sport,<br />
der sich vor allem auf Männer und männliche Jugendliche konzentrierte, inzwischen über alle<br />
Sozialschichten, Altersgruppen und beide Geschlechter ausgebreitet. Aber selbst wenn<br />
selbstbewusste Frauen längst in die bisherigen Männlichkeitsdomänen eingedrungen sind,<br />
immer noch - so wird behauptet - stehe das Weiche und Beziehungsorientierte der Frauen<br />
gegen das Harte und Konkurrenzorientierte der Männer. Gilt dies wirklich für alle Sportarten?<br />
Ingrid Bähr hat daran Zweifel.<br />
19
Um dies zu klären, wählte sie für ihre Arbeit eine sozusagen "geschlechtsneutrale" Sportart<br />
mit komplexen motorischen Anforderungen aus: Sportklettern. Dazu entwirft sie einen<br />
beeindruckenden theoretischen Rahmen, wobei die Interdisziplinarität ihrer Fragestellung<br />
eine Kombination verschiedener theoretischer Ansätze und methodischer Vorgehensweisen<br />
notwendig machte. Eines der wichtigsten Resultate ihrer Arbeit ist tatsächlich das Fehlen von<br />
Geschlechterunterschieden in zentralen Kategorien des Bewegungshandelns. Auf<br />
Widersprüche zwischen den in der Literatur vertretenen Thesen und ihren eigenen Befunden<br />
geht Ingrid Bähr in einer ausführlichen Diskussion ein. Ist dieses Ergebnis mit der Struktur<br />
der Sportart, der Auswahl der Stichprobe oder dem Potential der Sportart zum "undoing<br />
gender", wie es im Sprachgebrauch der "Frauenforschung" heißt, zu erklären? Die Antwort<br />
auf diese Frage muss sie offen lassen. Ihrer Ansicht nach sind dazu weitere Forschungen<br />
erforderlich. Auf die Ergebnisse sind wir neugierig.<br />
Ingrid Bähr fügt mit ihrer Arbeit der bislang nur geringen Zahl empirischer und<br />
interdisziplinärer Untersuchungen zum "doing gender" eine eindrucksvolle Untersuchung<br />
hinzu, die sich konkret auf das Bewegungshandeln bezieht und neue und auch<br />
überraschende Einsichten liefert. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer schönen Arbeit, Frau<br />
Bähr.<br />
Thomas Hilberg befasst sich in seiner sportmedizinischen Arbeit mit dem Thema "Sportliche<br />
Belastung und Hämostase". Sogenannte thromboembolische Zwischenfälle im Sport werden<br />
auf intravasale Aktivierungen des Gerinnungssystems durch intensive Beanspruchungen<br />
zurückgeführt. Grundlegende Erkenntnisse zu Zusammenhängen zwischen Quantitäten von<br />
akuten körperlichen Belastungen und Änderungen des komplexen Hämostasesystems<br />
wurden bislang aber nicht vorgelegt. Thomas Hilberg untersuchte deshalb systematisch an<br />
95 gesunden Männern und an 16 insulinpflichtigen Diabetikern, jeweils Nichtraucher und im<br />
Alter von 20-30 Jahren, die Wirkungen von definierten, 15 Sekunden bis zu zwei Stunden<br />
dauernden, maximalen und submaximalen, ansteigenden und kontinuierlichen Fahrrad- und<br />
Laufbandergometerbelastungen auf wesentliche Kenngrößen der Hämostase. Vor und bis<br />
zwei Stunden nach Arbeit wurden Thrombozytenzahl und -funktion, klassische<br />
Thrombinbildungsmarker, Thrombinpotential sowie die Fibrinolyse mit von Thomas Hilberg<br />
zum Teil verbesserten und auch neuen Methoden überprüft. Als wesentliches Ergebnis<br />
konnte er herausarbeiten, dass auch intensivste sportliche Belastungen bis zu zwei Stunden<br />
bei gefäßgesunden Personen wie auch jungen Diabetikern kein hyperkoagulatives Risiko<br />
beinhalten, da das hämostasiologische Gleichgewicht bereits kurz nach Beginn einer<br />
Belastung und mit deren Dauer zunehmend zu Gunsten der Fibrinolyse verschoben wird.<br />
Das ist für die ärztliche Praxis, die Sportmedizin und den praktischen Sport ein<br />
gleichermaßen wichtiges Ergebnis, und wir gratulieren Thomas Hilberg herzlich zu seiner<br />
beeindruckenden Arbeit.<br />
Die von Andrea Horn eingereichte Arbeit befasst sich mit dem Thema: Diagnostik der<br />
Herzfrequenzvariabilität in der Sportmedizin - Rahmenbedingungen und methodische<br />
Grundlagen: <strong>Der</strong> diagnostische Stellenwert der Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist in der<br />
Sportmedizin umstritten, da u.a. wichtige methodische Probleme nicht geklärt und<br />
grundlegende physiologische Fragen noch offen sind. Beiden Bereichen ging Andrea Horn<br />
systematisch in sieben empirischen Einzelstudien mit zum Teil höchst originellen Methoden<br />
nach. Mit Hilfe von mathematischen Modellversuchen, in denen sie physiologisch<br />
bedeutsame Sinusschwingungen summierte, erarbeitete sie Kriterien und Parameter für eine<br />
möglichst wenig aufwändige Analysemethode mit möglichst hohem Informationsgehalt für<br />
quantitative und qualitative Interpretationen. Anhand empfehlenswerter Parameter wurden<br />
sowohl Reliabilität und Objektivität der Analytik auf Untersucherebene als auch die<br />
Reliabilität der HRV-Befunde als sehr gut bis gut beurteilt.<br />
20
Zur physiologischen Variationsbreite der HRV hat Andrea Horn an mehr als 200 Probanden<br />
beiderlei Geschlechts herausgearbeitet, dass (1.) Ruheherzfrequenz und Lebensalter dabei<br />
als Hauptdeterminanten zu gelten haben, (2.) intensive körperliche Belastungen zu<br />
biphasischen Auslenkungen der HRV mit einer Gesamtdauer bis zu fünf Tagen führen und<br />
(3.) Umgebungsbedingungen (Lärm, Licht) sowie individuelle Bedingungen (Schlafstörungen,<br />
banale Infekte, Alkohol) als unter Umständen gravierenden Störfaktoren der Diagnostik<br />
anzusehen sind.<br />
Andrea Horn gelang es, einen für die Sportmedizin wichtigen, basalen und vor allem auch<br />
praktikablen Untersuchungsstandard zu definieren und verlässliche Interpretationsrichtlinien<br />
aufzustellen. Wir gratulieren ihr, die jetzt am Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Bonn<br />
arbeitet, zu ihrer gelungenen Arbeit.<br />
Thomas Schack beschäftigt sich in seiner Arbeit "Zur kognitiven Architektur von<br />
Bewegungshandlungen" mit einem Themenkomplex, der zu den traditionellen und zentralen<br />
Problemgegenständen sportwissenschaftlicher Forschung gehört. Seine Arbeit ist in<br />
vierfacher Hinsicht beeindruckend und auch richtungsweisend. Erstens leitet Thomas<br />
Schack aus traditionellen Zugängen bzw. aus klassischen wissens- und bewegungsbasierten<br />
Ansätzen ein eigenes Rahmenmodell ab, in dem die wechselseitige Überlappung von<br />
Repräsentations- und Ausführungsfunktionen ausdrücklich berücksichtigt wird. Auf seiner<br />
Grundlage werden - zweitens - innovative Forschungsperspektiven aufgezeigt. Sie betreffen<br />
u.a. die Dimensionierung mentaler Bewegungsrepräsentationen im Langzeitgedächtnis, die<br />
sogenannten Chunking-Prozesse im Kurzzeitgedächtnis sowie den Zusammenhang der<br />
bewegungsbasierten Vorgänge mit den Repräsentationsstrukturen. Zu diesen<br />
Fragestellungen präsentiert Thomas Schack sieben Experimente und zwei Reanalysen. Die<br />
eingesetzten Erhebungsverfahren hat er - und dies ist seine dritte besondere Leistung - zum<br />
Teil selbst konzipiert. Besonders die, wie sie genannt wird, "Strukturdimensionale Analyse"<br />
mentaler Repräsentationen - von Schack zur SDA-M weiterentwickelt - wird sicherlich die<br />
Forschungsmethodik auch außerhalb der Sportwissenschaft beeinflussen. Und viertens ist<br />
hervorzuheben, dass die grundlagenwissenschaftlichen Argumentationen und empirischen<br />
Entscheidungen in seiner Arbeit immer wieder mit konkreten, auch für den Leistungssport<br />
bedeutsamen Bewegungsproblemen in Verbindung gebracht werden. Schacks Ergebnisse<br />
stützen wesentliche Annahmen des Rahmenmodells und versprechen zudem klare<br />
Übertragungsmöglichkeiten in die Praxis, vor allem in die Bereiche des motorischen Lernens<br />
und des mentalen Trainings.<br />
Thomas Schack hat sich mit seiner "Architektur" als ein guter Baumeister erwiesen, der<br />
Planung und Aufbau eines sportwissenschaftlichen Forschungsgebäudes eindrucksvoll<br />
beherrscht. Wir gratulieren ihm zu seiner hervorragenden Leistung.<br />
Und schließlich hat sich das Kuratorium noch von einer Arbeit überzeugen lassen, die sich<br />
einem Thema zuwendet, dessen Bearbeitung man zunächst nicht gerade in der<br />
Sportwissenschaft vermutet. Wie wir wissen, ist, dass Kinder schreiben lernen, eine der<br />
ersten großen Aufgaben der Schule. Wie komplex und voraussetzungsreich Lernfähigkeit<br />
indes ist, erfährt man in der Arbeit von Andrea Stachelhaus mit dem Titel "Auswirkungen<br />
wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die Graphomotorik von<br />
Schulanfängern". Es geht dabei um die Frage, ob eine psychomotorische Förderung den<br />
Prozess des Schreiben-Lernens, genauer: die Entwicklung der Schreibmotorik, voranbringen<br />
kann. Für die pädagogische Praxis ist das eine ungewöhnliche Fragestellung; sie geht immer<br />
noch wie selbstverständlich von der Annahme aus, dass Kinder das Schreiben lernen, indem<br />
sie schreiben. Im Zentrum der Arbeit von Frau Stachelhaus steht eine sorgfältig geplante<br />
quasi-experimentelle Untersuchung mit 284 Kindern im frühen Schulalter. Die Ergebnisse<br />
sind bemerkenswert.<br />
21
In der psychomotorischen Experimentalgruppe zeigt sich eine im Vergleich mit den<br />
Kontrollgruppen, die lehrplangemäßen Sportunterricht bzw. eine entsprechende Förderung<br />
erhielten, bedeutsame Verbesserung der Schreibmotorik, die plausibel auf das Treatment<br />
zurückgeführt werden kann und auch nach sechs Monaten noch zu erkennen ist. Dabei<br />
betrifft diese Verbesserung nur Parameter der Genauigkeit, nicht der Geschwindigkeit des<br />
Schreibens. Überraschenderweise und im Widerspruch zu bisherigen Annahmen der<br />
einschlägigen Forschung ließ sich jedoch nicht zeigen, dass die Effektivität der Förderung<br />
vom psychomotorischen Ausgangsniveau und von der Intelligenz abhängt. Die<br />
ausgezeichnete Arbeit von Andrea Stachelhaus lässt sich auch als eindeutige Empfehlung<br />
zur Ausweitung von Bewegungsangeboten in der Schuleingangsstufe lesen. Wir gratulieren<br />
ihr herzlich.<br />
Wir haben in diesem Wettbewerb hervorragende Arbeiten prämieren und in vollem Konsens<br />
den ersten Preis, der mit der von dem Essener Künstler Jean Sprenger geschaffenen <strong>Carl</strong><br />
<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> und einen Druckkostenzuschuss verbunden ist sowie fünf zweite Preise, zu<br />
denen jeweils auch eine Urkunde und ein Scheck gehören, für exzellente Dissertationen und<br />
Habilitationen vergeben können. Wir freuen uns mit den Preisträgerinnen und Preisträgern<br />
und wünschen ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute.<br />
22
Erwiderung des Trägers der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> 2003/2004<br />
Prof. Dr. Oliver Höner<br />
Sehr geehrter Erster Bürgermeister Herr Prof. Dr. von der Malsburg,<br />
sehr geehrte Magnifizenz Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Hommelhoff,<br />
sehr geehrter DSB-Präsident Herr von Richthofen,<br />
sehr geehrtes Kuratorium unter dem<br />
Vorsitz von Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Grupe,<br />
sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Erwiderung<br />
was sollten die Inhalte einer Erwiderungsrede nach solch einer Würdigung sein? Ich denke,<br />
es sind vor allem zwei Inhalte, die man zu Recht erwarten darf: Zum einen erwartet das<br />
Publikum inhaltliche Informationen darüber, wofür überhaupt ausgezeichnet wurde. Zum<br />
Anderen habe ich in diesem feierlichen Rahmen aber auch das persönliche Bedürfnis,<br />
Menschen meinen Dank auszusprechen, die mich bei der Realisierung meiner Arbeit in ganz<br />
erheblichem Maße unterstützt haben.<br />
Ich werde versuchen, die beiden Erwartungen Information und Dank so miteinander zu<br />
verweben, dass zentrale inhaltliche Aspekte meiner Arbeit und die jeweiligen<br />
Unterstützungsleistungen deutlich werden. Dabei möchte ich meinen Vortrag mit der<br />
Alltagserkenntnis „Denken lähmt, und Handeln macht gewissenlos!“ betiteln und diese<br />
Erkenntnis auf drei Handlungsbereiche beziehen; zunächst das Handeln im Alltag, dann das<br />
Handeln im Sportspiel sowie abschließend das Handeln in der Sportwissenschaft.<br />
Handeln im Alltag<br />
Jeder von uns kennt aus seinem persönlichen Alltag diese Phänomene: Wir nehmen uns<br />
etwas vor, fassen z.B. die Absicht zukünftig mehr Sport zu treiben, ein gutes Buch zu lesen<br />
oder auch einen guten Freund zu besuchen, lassen uns aber durch andere Anreize unseres<br />
Alltags immer wieder ablenken und kommen so gar nicht dazu, unsere beabsichtigten<br />
Handlungen durchzuführen. Es kommt also zu einer Unterbrechung unseres<br />
Handlungsvollzugs.<br />
Auf der anderen Seite kennen wir aber auch Situationen – und dies erkennen wir häufig<br />
leider erst im Nachhinein -, bei denen wir unsere Handlungen so sehr gegenüber<br />
konkurrierenden Informationen abschirmen, dass wir angetrieben von unserem starken<br />
Willen unser Handeln ganz „gewissenlos“ durchführen. Heckhausen (1987) hat auf dieses<br />
Phänomen im Zusammenhang mit der Wiederentdeckung der Willenspsychologie Mitte der<br />
80er hingewiesen: „Wollen heißt entschlossen sein. […] Wir sehen nicht mehr recht hin, wir<br />
hören nicht mehr recht zu, wenn es unser Wollen schwächen könnte.“<br />
In der aktuellen Volitions- und Kognitionspsychologie wird dies von mir eben nur kurz<br />
skizzierte Problem der Steuerung alltäglicher Handlungen als Abschirmungs-<br />
Unterbrechungs-Dilemma bezeichnet. Es wird damit die prinzipielle Unvereinbarkeit zweier<br />
zentraler Anforderungen im Handlungsgeschehen beschrieben: Einerseits gilt es gefasste<br />
Absichten abzuschirmen, um sie wirklich in die Tat umzusetzen.<br />
Andererseits muss in dynamischen Umwelten diese Abschirmung der Zielrealisierung immer<br />
wieder unterbrochen werden, um nach besseren Alternativen Ausschau halten zu können.<br />
Während damit die Vorteile und unbedingten Notwendigkeiten der Abschirmung und<br />
Unterbrechung in der Handlungssteuerung beschrieben sind, werden mit der hier<br />
aufgegriffenen Erkenntnis „Denken lähmt, und Handeln macht gewissenlos!“ die ganz<br />
offensichtlichen Nachteile beschrieben.<br />
23
Diese Nachteile erschienen mir für meine Person besonders bedeutsam in meiner Art<br />
Fußball zu spielen zu sein – und ich komme damit zum Hauptteil meiner inhaltlichen<br />
Ausführungen zum Handeln im Sportspiel Fußball.<br />
Handeln im Sportspiel<br />
Nach Kenntnis des Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemmas wurde mir in meiner eigenen<br />
Praxis des Fußballspielens deutlich, dass ich mich während des Spiels oft in diesem<br />
Dilemma befand und auch von seinen negativen Auswirkungen betroffen war: In<br />
aussichtsreichen Positionen ließ ich mir den Ball noch abnehmen, da ich von zu vielen<br />
Denkprozessen über mögliche Handlungsalternativen wie dem Torschuss oder das Abspiel<br />
zum Mitspieler wie gelähmt war. In anderen Situationen war es so, dass ich mich sehr<br />
frühzeitig für eine Handlung entschieden habe – z.B. zum eigenen Dribbling mit<br />
anschließendem Torschuss – und dabei erst im Nachhinein merkte, dass in der Phase<br />
meiner Torschussvorbereitung sich die Situation geändert hatte und andere Mitspieler<br />
plötzlich besser standen.<br />
Aufbauend auf diesen eher deprimierenden Erfahrungen aus der eigenen Praxis ergab eine<br />
Analyse von Spielen der Fußball-WM, dass ganz nicht nur ich in meinem amateurhaften<br />
Fußballspielen mit dem Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemma zu kämpfen hatte, sondern<br />
ganz offensichtlich auch für Spieler auf Weltklasseniveau gilt: „Denken lähmt, und Handeln<br />
macht gewissenlos!“<br />
Dabei sind die aus dem Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemma resultierenden Phänomene<br />
des „lähmenden Denkens“ und des „gewissenlosen Handelns“ auf Weltklasseniveau sicher<br />
nicht mit technischen oder konditionellen Mängeln zu erklären. Sie sind vielmehr als<br />
individualtaktische Fehler im Entscheidungshandeln zu kennzeichnen, denen kognitive<br />
Prozesse wie die der Informationsaufnahme und -verarbeitung zu Grunde liegen. Diesen<br />
kognitiven Prozessen ist eine hohe Bedeutung für die Spielfähigkeit beizumessen, die<br />
zukünftig im Spitzensport – bei technisch und konditionell bestens ausgebildeten Spielern –<br />
sogar noch zunehmen dürfte. Die Relevanz dieses Praxisproblems war Motivation genug,<br />
um dieses Dilemma einer sportwissenschaftlichen Betrachtung zu unterziehen, die sich hier<br />
zunächst auf einer theoretischen und dann einer untersuchungsmethodischen Ebene<br />
vollzieht, um dann auf ausgewählte Ergebnisse und Perspektiven für die Praxis eingehen zu<br />
können.<br />
Theoretische Ebene<br />
Die theoretische Ebene wird durch die Betrachtung des Abschirmungs-Unterbrechungs-<br />
Dilemmas mit der Brille der Rubikontheorie Heckhausens gebildet. Diese Theorie unterteilt<br />
ein Handlungsgeschehen in vier Phasen, die als abwägende, planende, aktionale und<br />
bewertende Phase bezeichnet werden. Für eine Sportspielhandlung wie der<br />
Angriffsinitiierung eines Mittelfeldspielers bedeutet dies, dass der Spieler zunächst abwägt,<br />
welche Handlungsabsicht er bildet. Mögliche Handlungsabsichten wären hier z.B. das<br />
Anspiel eines Mitspielers oder das eigene Dribbling mit Torabschluss. Danach muss der<br />
Spieler sich in einer planenden Phase konkret festlegen, wie er seine Handlungsabsicht<br />
durchführen möchte.<br />
Er bildet hierzu z.B. Vorsätze wie „Wenn der Verteidiger mir entgegenkommt, dann schieße<br />
ich auf das Tor!“. In der dritten, der aktionalen Phase führt der Spieler die motorische Aktion<br />
durch und analysiert danach in der bewertenden Phase seine soeben vollzogenen Prozesse<br />
der Zielauswahl und -realisierung.<br />
Für das Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemma besonders bedeutsam sind die ersten<br />
beiden Handlungsphasen und die sich darin abspielenden kognitive Prozesse des Abwägens<br />
und Planens. Zur Unterscheidung dieser kognitiven Prozesse wurde von Gollwitzer das<br />
Konzept der kognitiven Orientierungen ausgearbeitet.<br />
24
Es besagt u.a., dass Menschen in einer abwägenden Handlungsphase eine weit gefasste<br />
Informationsaufnahmebereitschaft aufweisen, während sie in einer planenden Phase eine<br />
auf die Zielrealisierung fokussierte Informationsaufnahmebereitschaft besitzen. <strong>Der</strong><br />
Übergang zwischen diesen beiden kognitiven Orientierungen im Handlungsverlauf soll sehr<br />
abrupt geschehen und wurde von Heckhausen (1987) mit der Metapher der Rubikon-<br />
Überquerung belegt. Mit einem viel zitierten Ausspruch beschreibt er diese kognitive Zäsur<br />
sehr anschaulich: „Von abwägenden Moderatoren des Wählens werden wir im<br />
Handumdrehen zu einseitigen Partisanen unseres Wollens”.<br />
Das abrupte Umschalten von einer weiten auf eine fokussierte<br />
Informationsaufnahmebereitschaft in den beiden Phasen vor der motorischen Aktion bildete<br />
die zentrale empirische Hypothese meiner Arbeit, für die ich nun die methodische<br />
Herangehensweise erläutern möchte.<br />
Methodische Ebene<br />
Da sich kognitive Prozesse wie die Informationsaufnahmebereitschaft als interne Prozesse<br />
nicht direkt erheben lassen, werden zur ihrer empirischen Untersuchung Methoden benötigt,<br />
die sie indirekt erfahrbar werden lassen. Aufgrund der Bedeutung der (häufig unbewussten)<br />
Prozesse visueller Informationsaufnahme im Sportspiel wurde die Methode der<br />
Blickregistrierung („Eye-Tracking“) gewählt.<br />
Die Anwendung dieser Methode basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Den<br />
Versuchspersonen wird eine Aufgabe gestellt. Während die Versuchspersonen diese<br />
Aufgabe bearbeiten werden die Blickbewegungen aufgezeichnet und daraus Rückschlüsse<br />
auf kognitive Prozesse wie die Weite der Informationsaufnahmebereitschaft gezogen.<br />
Aufbauend auf diesem Grundprinzip besteht die zentrale Anforderung an einen<br />
gegenstandsadäquaten Einsatzes der Blickregistrierung im Sport in der Entwicklung<br />
möglichst realitätsnaher Aufgabenstellungen. Hierzu wurde ein Test mit simulierten<br />
Entscheidungshandlungen konzipiert, bei dem die Versuchspersonen mit offensiven 3:3-<br />
Situationen aus der Perspektive eines Ball besitzenden Spielers konfrontiert wurden. Die<br />
Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, sich so schnell und so gut wie möglich zu<br />
entscheiden und über Fußpads mitzuteilen, ob sie als Ball besitzender Spieler den rechten<br />
oder linken Flügelspieler anspielen würden. Zudem sollten sie verbal angeben, ob sie den<br />
Pass in den Fuß oder in den Lauf des Angreifers spielen würden.<br />
Bevor ich nun zu den Ergebnissen der hier nur ausschnitthaft skizzierten theoretischen und<br />
methodischen Herangehensweise komme, möchte ich betonen, dass ich bei der<br />
Durchführung der Untersuchung von mehreren Personen und Institutionen unterstützt wurde.<br />
Zu allererst möchte ich mich beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft und seinem Direktor<br />
Herrn Dr. Büch bedanken - und zwar zum einen für die Förderung dieses<br />
Forschungsprojekts und zum anderen für Ihr Einverständnis meiner Teilnahme an dem <strong>Carl</strong>-<br />
<strong>Diem</strong>-Wettbewerb.<br />
Ein weiterer Dank gilt der AG Neuroinformatik der Universität Bielefeld unter der Leitung von<br />
Leibniz-Preisträger Prof. Dr. Helge Ritter und seinem Mitarbeiter Dr. Hendrik Koesling, deren<br />
Eye-Tracking-System und persönlichen Erfahrungsschatz ich bei der technischen<br />
Realisierung des Laborexperiments nutzen durfte. Ein ganz herzlicher Dank gilt ebenfalls<br />
den DFB-Trainern Jörg Daniel und Paul Schomann, die mit ihrer Hilfsbereitschaft eine<br />
optimale Organisation der Untersuchungsdurchführung mit insgesamt 65 DFB-<br />
Jugendnationalspielern ermöglichten.<br />
25
Ergebnisse<br />
Die Ergebnisauswertung der Untersuchung zeigte, dass das Blickverhalten der<br />
Jugendnationalspieler während der simulierten Entscheidungshandlungen zunächst durch<br />
zahlreiche große Blicksprünge zwischen den verschiedenen Handlungsalternativen<br />
gekennzeichnet ist. Zum Zeitpunkt des Tastendrucks und damit der Entscheidung für das<br />
Anspiel zum linken oder rechten Flügelspieler fokussierten dann die Spieler ihr<br />
Blickverhalten. Die visuelle Informationsaufnahmebereitschaft wird also zunächst weit<br />
ausgerichtet und mit dem Übergang in die planende Phase des Entscheidungsprozesses<br />
eingeengt. Auf der kognitiven Prozessebene finden damit die rubikontheoretischen<br />
Aussagen zur Informationsaufnahmebereitschaft im Verlauf des Entscheidungshandelns im<br />
Fußball Bestätigung.<br />
<strong>Der</strong> Einsatz der Methode der Blickregistrierung ermöglicht noch eine zusätzliche Aussage,<br />
die über die Grundlagenstudien der Psychologie zur Rubikontheorie hinausgeht. In den<br />
Grundlagenstudien wird zwar sehr überzeugend der Unterschied der kognitiven<br />
Orientierungen abwägender und planender Versuchspersonen gezeigt, allerdings wird nicht<br />
der Prozess des Umschaltens zwischen diesen Orientierungen betrachtet. Die hier mit der<br />
Blickregistrierung ermöglichte prozesshafte Betrachtung der<br />
Informationsaufnahmebereitschaft verdeutlicht, dass es wirklich zu einer rapiden – und nicht<br />
zu einer allmählichen – Einengung der Weite der Informationsaufnahmebereitschaft kommt.<br />
Mit den aufgezeigten Ergebnissen liefert das Konzept der kognitiven Orientierungen eine<br />
Möglichkeit der theoretischen Beschreibung des „Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemmas“<br />
in Entscheidungshandlungen im Fußball. Dabei sollte jedoch nicht von einer disjunkten<br />
Trennung zwischen zwei Handlungsphasen ausgegangen werden, in denen ausschließlich<br />
abgewogen bzw. geplant wird. Es ist vielmehr eine „phasenspezifische Optimierung“<br />
anzustreben, in der über eine unterschiedliche Gewichtung der abwägenden und planenden<br />
Aktivitäten die jeweiligen Erfordernisse in den Handlungsphasen erfüllt werden. Danach<br />
werden in der ersten Phase der Entscheidungsfindung vermehrt abwägende Aktivitäten<br />
eingesetzt, ohne planende auszuschließen. Entsprechend werden in der zweiten Phase der<br />
Planung vermehrt planende Aktivitäten durchgeführt, ohne gänzlich auf abwägende<br />
Aktivitäten zu verzichten.<br />
Konsequenzen für die Praxis<br />
Für den in der Praxis tätigen Trainer kann die Betrachtung des Entscheidungshandelns im<br />
Lichte der Rubikontheorie und das daraus resultierende Hintergrundwissen eine neue<br />
Sichtweise darstellen, die ihm das „Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemma“ deutlicher vor<br />
Augen führt. So fokussieren viele Spieler nach einer Absichtsbildung „Torschuss“ im Sinne<br />
der Rubikontheorie durchaus funktional in der planenden Phase die<br />
Informationsaufnahmebereitschaft auf realisierende Aspekte. Allerdings führt diese<br />
Abschirmung häufig so weit, dass abwägende Aktivitäten vollständig vernachlässigt werden.<br />
Die Spieler besitzen dadurch nicht mehr das Mindestmaß an Offenheit bezüglich der<br />
Informationsaufnahme, um sich noch rechtzeitig für bessere Alternativen entscheiden zu<br />
können.<br />
Eine solche Betrachtung des Entscheidungshandelns im Fußball kann für den Trainer zu<br />
einer Neubewertung individualtaktischer Handlungsfehler führen: So mag ein Trainer einen<br />
unsinnigen Torschuss eines Spielers als eine Handlung einstufen, bei der der Spieler den<br />
Torschuss vor allem aus Eigensinn auswählt, um möglicherweise übergeordnete persönliche<br />
Ziele wie den Gewinn der „Torjägerkrone“ zu realisieren. Ein anderer Trainer mag auf Basis<br />
der Rubikontheorie den Handlungsfehler des Spielers nicht als eine Handlung aus<br />
Eigensinn, sondern als misslungene Lösung des „Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemmas“<br />
im Entscheidungshandeln deuten.<br />
26
<strong>Der</strong> Besitz eines solchen Hintergrundwissens beeinflusst die anstehenden<br />
Trainingsmaßnahmen zur Behebung von Entscheidungsfehlern. Während der eine Trainer in<br />
Einzelgesprächen die eigensinnigen Zielsetzungen seines Spielers mannschaftsdienlicher<br />
gestalten möchte, versucht der andere Trainer, dem Spieler bei der Lösung des<br />
Optimierungsproblems der Handlungskontrolle zu helfen. Hierzu könnte er Trainingsformen<br />
mit komplexen Spielformen forcieren, in denen die Spieler in umfangreichen situativen<br />
Kontexten Entscheidungshandlungen zu bewältigen haben. Die Spieler werden dadurch<br />
immer wieder mit dem Umschalten zwischen den kognitiven Orientierungen konfrontiert und<br />
können dabei (langfristig) lernen, den Umgang mit dem Abschirmungs-Unterbrechungs-<br />
Dilemma zu optimieren.<br />
Handeln in der Sportwissenschaft<br />
Meine Damen und Herren, zum Abschluss meines Vortrags möchte ich in der gebotenen<br />
Kürze noch auf den dritten Anwendungsbereich der Erkenntnis „Denken lähmt, und<br />
Handeln macht gewissenlos!“ zu sprechen kommen. Ich meine, dass auch wir in der<br />
Sportwissenschaft in unserem wissenschaftlichen Handeln immer wieder mit dem<br />
Abschirmungs-Unterbrechungs-Dilemma konfrontiert werden, und zwar insbesondere bei der<br />
wissenschaftstheoretischen Reflektion unseres Fachgebiets. Auch in einer<br />
anwendungsorientierten Sportwissenschaft wird es immer wieder notwendig sein, unseren<br />
„normalen“ Forschungsprozess zu unterbrechen und kritisch zu reflektieren. Natürlich führt<br />
diese Auseinandersetzung mit letztlich wissenschaftstheoretischen Fragen hinsichtlich des<br />
konkreten Forschungsprozesses auch immer wieder zu lähmenden Denken. Hier in der Alten<br />
Aula habe ich bereits zahlreiche Kolleginnen und Kollegen entdecken können, die mir aus<br />
ihrer umfassenden Erfahrung mit der wissenschaftstheoretischen Reflexion ihrer Arbeit<br />
sicherlich beipflichten können, wie zeitaufwendig und zuweilen auch verunsichernd solche<br />
kritischen Reflexionen sein können.<br />
In meiner Arbeit habe ich versucht, auf Basis der strukturalistischen Wissenschaftstheorie<br />
Stegmüllers einen Mittelweg zwischen Abschirmung und Unterbrechung zu finden. Er soll<br />
einerseits erlauben, sehr wohl bestimmte kritische Reflektionen der angewendeten Theorie<br />
durchzuführen, aber auf der anderen Seite auch konkretes Forschungshandeln und die<br />
empirische Anwendung unterstützen. Dabei bietet die strukturalistische Sichtweise<br />
Möglichkeiten, die gerade für die angewandte, integrative Sportwissenschaft zu fordernde<br />
Verknüpfung von Erkenntnissen aus unterschiedlichen Disziplinen zu reflektieren. Dabei<br />
danke ich dem Psychologen und Rektor von der Universität Greifswald Herrn Prof. Dr.<br />
Rainer Westermann für Ratschläge bei der strukturalistischen Rekonstruktion des<br />
theoretischen Teils und für die Begutachtung der Arbeit.<br />
Abseits solch doch sehr wissenschaftstheoretisch orientierter Versuche der Reflektion<br />
wissenschaftlichen Handelns bietet der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> mit dem <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Wettbewerb<br />
und der heutigen Festveranstaltung eine ganz konkrete Gelegenheit zur Reflektion und - wie<br />
ich meine auch zu Recht – zur Würdigung der Sportwissenschaft.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Wettbewerb führt mit seiner Philosophie, die Wissenschaft und den Sport<br />
zusammenzubringen, auch immer wieder zur Besinnung, wofür die Sportwissenschaft<br />
ursprünglich gegründet wurde, nämlich für den Sport. Dies kann man als Wissenschaftler im<br />
Rahmen des universitären Treibens leicht aus dem Blick verlieren, da sich die universitären<br />
Anforderungen im Anblick der disziplinspezifischen Standards der so genannten<br />
Mutterwissenschaften damit manchmal nur schwer vereinbaren lassen.<br />
Die Sportwissenschaft ist m.E. weiterhin darin gut beraten, einen Mittelweg zu gehen und<br />
neben der Erfüllung wissenschaftlicher Standards den Bezug zur Praxis als ihr zentrales<br />
Markenzeichen anzusehen. <strong>Der</strong> <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Wettbewerb des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es<br />
verkörpert genau dieses Markenzeichen und wird deshalb zu Recht als der bedeutendste<br />
Wissenschaftspreis der Sportwissenschaft angesehen.<br />
27
Dieses Prestige hat sich der Wettbewerb in seiner nun über 50-jährigen Geschichte<br />
erworben und das große allgemeine Interesse an der heutigen Festakademie – wie mir Herr<br />
Klages mitteilte, stellen wir heute einen neuen Besucherrekord auf – sind als deutliches Indiz<br />
dafür zu sehen, dass der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Preis auch zukünftig seine Dominanz beibehalten wird.<br />
Er bildet damit weiterhin einen wichtigen Motor für die integrative Ausrichtung der<br />
Sportwissenschaft als Ganzes und ihrer Partnerschaft zur Praxis.<br />
Ich möchte mich deshalb beim Präsidenten des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>s Herrn Manfred von<br />
Richthofen ganz herzlich für die Ausrichtung dieses für das Ideal der Sportwissenschaft so<br />
wichtigen Preises bedanken. Des Weiteren gilt mein ganz besonderer Dank den Mitgliedern<br />
des Kuratoriums und ihrem Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe. Sie tragen<br />
sicherlich allein schon durch ihre herausragende personale Expertise zur Qualität des<br />
Wettbewerbs bei. Sie haben allerdings - angesichts der Teilnehmerzahlen und der zu<br />
erstellenden Gutachten - sicherlich auch so manche Arbeitsstunde für das Gelingen des<br />
diesjährigen <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Wettbewerbs investieren müssen. Herzlichen Dank dafür!<br />
Meine Damen und Herren, diejenigen von Ihnen, die meine wissenschaftliche Herkunft<br />
kennen, werden sich jetzt nach so vielen Inhalten und Dankesworten sicherlich fragen, „Hat<br />
er nicht noch eine wichtige Person vergessen?“ – Ich habe den Dank an meinen Doktorvater<br />
bewusst ans Ende meines Vortrags gestellt. Dies hat zum Einen rethorische Gründe, um<br />
diesen Dank besonders hervorzuheben. Zum Anderen ist die Platzierung in meiner<br />
Erwiderungsrede inhaltlich begründet, da es wohl nur wenige Personen in der<br />
Sportwissenschaft gibt, die sich so schwer einem einzelnen Themengebiet zuordnen lassen.<br />
Entsprechend war es mir nicht möglich, meinen Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus<br />
Willimczik einem der drei Anwendungsgebiete zuzuordnen. Lieber Klaus, ich möchte bei Dir<br />
für Deine Unterstützungsleistung in all den drei genannten Bereichen, also dem Handeln im<br />
Alltag, Sportspiel und in der Sportwissenschaft ganz, ganz herzlich bedanken. Gerade auch<br />
durch die Arbeit in der dvs-Kommission wissenschaftlicher Nachwuchs wird mir immer<br />
wieder bewusst, wie bedeutsam der Einfluss der akademischen Eltern für den Erfolg des<br />
wissenschaftlichen Nachwuchses ist.<br />
Meine Damen und Herren, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf<br />
einen geselligen Abend hier in dem schönen Ambiente der Alten Aula der Universität<br />
Heidelberg!<br />
28
Preisträgerinnen und Preisträger<br />
Biografien<br />
Prof. Dr. Oliver Höner<br />
Entscheidungshandeln im Sportspiel Fußball – Eine Analyse im Lichte der<br />
Rubikontheorie<br />
Prof. Dr. Oliver Höner (geb. 1972) studierte an der Universität Bielefeld Mathematik,<br />
Sportwissenschaft und Erziehungswissenschaft. Von 1998 bis 2004 Wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter im Arbeitsbereich "Bewegung und Motorik" in Bielefeld und Promotion (2003)<br />
zum Thema „Entscheidungshandeln im Sportspiel Fußball“. In der Sportpraxis Spieler und<br />
Trainer mit DFB-A-Lizenz in der Verbands- und Oberliga Westfalen.<br />
Seit April 2004 Professor als Juniorprofessor in der Abteilung Sportpädagogik/-psychologie<br />
des Fachbereichs Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Neben handlungs- und<br />
kognitionspsychologischen Analysen von Sportspielhandlungen liegen weitere<br />
Forschungsschwerpunkte in motivations- und volitionspsychologischen Fragestellungen der<br />
Förderung regelmäßiger sportlicher Aktivität von leistungsgeminderten Menschen, der<br />
Entwicklung auditiver Sportspielformen für Menschen mit Sehschädigung sowie<br />
wissenschaftstheoretischen Problemen der Theorienbildung und -prüfung.<br />
Dr. Ingrid Bähr<br />
Erleben „Frauen“ sportbezogene Bewegung anders als „Männer“?<br />
Dr. Ingrid Bähr (geb. 1968) hat an der Universität Bremen Sportwissenschaft,<br />
Kunstpädagogik sowie Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften studiert und 1996 ihr<br />
Studium abgeschlossen. Es folgten Lehraufträge an der Universität Bremen im Studiengang<br />
Sportwissenschaften, ab 1998 als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit dem Schwerpunkt<br />
der fachdidaktischen Ausbildung im Turnen sowie in verschiedenen Bewegungskünsten und<br />
Natursportarten. Von 1998 bis 2001 Mitarbeit im Sprecherrat der Kommission<br />
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“ der <strong>Deutsche</strong>n Vereinigung für Sportwissenschaft, in<br />
diesem Rahmen u.a. Ausrichtung des 10. dvs-Nachwuchsworkshops (2000). Zwischen 1999<br />
und 2004 Dissertationsschrift mit dem Titel: „Erleben ‚Frauen’ Sport anders als ‚Männer’? Zur<br />
Geschlechtstypik des Bewegungshandelns am Beispiel des Sportkletterns“. 2003 gewann<br />
sie mit einer Präsentation dieser Arbeit auf dem 16. Hochschultag der <strong>Deutsche</strong>n<br />
Vereinigung für Sportwissenschaft den „dvs-Nachwuchspreis“. Seit 2001 Beschäftigung am<br />
Institut für Sportwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt,<br />
Lehrtätigkeit und Mitarbeit an einem Forschungsprojekt zum „Kooperativen Lernen im<br />
Sportunterricht“.<br />
PD Dr. med. Dr. phil. Thomas Hilberg<br />
Sportliche Belastung und Hämostase<br />
PD Dr. med. Dr. phil. Thomas Hilberg, geb 1960, studierte Sportwissenschaft an der<br />
<strong>Deutsche</strong>n Sporthochschule Köln (Abschluss Diplom-Sportlehrer) und Humanmedizin an der<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen (Abschluss drittes Staatsexamen). Mitarbeit an<br />
experimentellen Untersuchungen im Rahmen der Promotion zum Dr. med. am Max Planck<br />
Institut für Gerinnungsforschung in Gießen. Ab 1992 klinische Ausbildung an der Klinik für<br />
Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie Regensburg. 1995 Wechsel als Assistenzarzt<br />
an die Klinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der TU München. Hier erfolgten<br />
experimentellen Untersuchungen für die Promotion zum Dr. phil. Seit 1999<br />
wissenschaftlicher Angestellter bzw. Assistent und ab November 2004 als Oberassistent am<br />
Lehrstuhl für Sportmedizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2004 Erteilung der Venia<br />
legendi für das Fach Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportmedizin an der FSU<br />
Jena in Verbindung mit dem Titel Privatdozent.<br />
29
Dr. Andrea Horn<br />
Diagnostik der Herzfrequenzvariabilität in der Sportmedizin – Rahmenbedingungen<br />
und methodische Grundlagen<br />
Dr. Andrea Horn, geb. 1971, studierte Sportwissenschaft mit anschließendem Zusatzstudium<br />
„Prävention und Rehabilitation durch Sport“ an der Ruhr-Universität Bochum. Zwischen 1998<br />
bis 2003 wissenschaftliche Hilfskraft und Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sportmedizin der<br />
Ruhr-Universität (Prof. Dr. Hermann Heck und PD Dr. Henry Schulz).<br />
Durchführung leistungsphysiologischer Untersuchungen zum Inline-Skaten und Walking.<br />
Tätigkeitsschwerpunkt war die sportmedizinische Bedeutung der autonomen<br />
Herzfrequenzregulation (Herzfrequenzvariabilität, HRV) im Kontext von körperlicher Aktivität.<br />
Hieraus entwickelte sich die Promotion zum Thema „Diagnostik der Herzfrequenzvariabilität<br />
in der Sportmedizin - Rahmenbedingungen und methodische Grundlagen“. Seit Januar 2004<br />
Mitarbeiterin beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Bonn. Dort Leitung des<br />
Fachgebiets Behindertensport und Unterstützung des Fachgebiets Medizin in<br />
leistungsphysiologisch orientierten Fragen.<br />
PD Dr. Thomas Schack<br />
Zur kognitiven Architektur von Bewegungshandlungen – modelltheoretischer Zugang<br />
und experimentelle Untersuchungen<br />
PD Dr. Thomas Schack, geb. 1962, Trainerabschluss in Leichtathletik (1984) und<br />
Gewichtheben (1985). Diplom-Sportlehrer (1990) an der PH Zwickau. Diplom-Psychologe<br />
(1999) Universität Leipzig. 1988-1991 Studium der Philosophie in Leipzig (Universität) und<br />
München (Philosophische Hochschule). Promotionsstudent (Landesstipendium) 1990-1992,<br />
Stipendium des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft für Experimentelle<br />
Psychologie 1992-1994. 1994-1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter TU Chemnitz. 1996<br />
Promotion an der TU Chemnitz (Themenbereich: Angst und Wille im Sport), 1996-2002<br />
wissenschaftlicher Assistent <strong>Deutsche</strong> Sporthochschule Köln. Habilitation 2002. Ab 10/2002<br />
Hochschuldozent DSHS Köln und seit 2004 Vertretung der C4-Professur Sportmotorik/<br />
Sportbiomechanik Universität Halle. Preise: 1996 Bernstein-Preis, 1997 Karl-Hofmann-<br />
Publikationspreis, 1998 Kurt-Meinel-Sonderpreis, 2002 TOYOTA-Wissenschaftspreis.<br />
Forschungsaufenthalte u.a. in Japan, Hong Kong und USA. Wettkampfterfahrung in<br />
Leichtathletik, Motorsport, Wintersport, Ultramarathon.<br />
Dr. Andrea Stachelhaus<br />
Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die<br />
Graphomotorik von Schulanfängern<br />
Dr. Andrea Stachelhaus, geb. 1977, Studium der Sportwissenschaft, Mathematik und<br />
Deutsch in Münster. Auslandsaufenthalt in Australien. Graduiertenföderung des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen und Promotion am Fachbereich Sportwissenschaft/Psychologie bei<br />
Prof. Dr. Bernd Strauß in Münster (2002-2004). Präsentation der Zwischenergebnisse auf<br />
der asp-Tagung 2002 und Gewinn des Posterpreises bei der asp-Tagung 2003.<br />
Seit Februar 2004 Referendariat.<br />
30
DSB-Presse<br />
Presse<br />
Festakademie für den Wettbewerb um den Wissenschaftspreis des<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es - <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> 2003/2004<br />
<strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-Wettbewerb 2003/2004 mit exzellenten<br />
Arbeiten<br />
(DSB PRESSE) Prof. Dr. Oliver Höner (Universität Mainz) hat den alle zwei Jahre<br />
vergebenen Wissenschaftspreis des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es (DSB) – <strong>Carl</strong> <strong>Diem</strong> <strong>Plakette</strong><br />
2003/04 gewonnen. Dieser ist mit einer Preissumme in Höhe von 3.000 Euro dotiert.<br />
Von insgesamt 19 hochwertigen Bewerbungen waren sechs Habilitationen, zwölf<br />
Dissertationen und eine Diplomarbeit. Das Preis-Kuratorium unter Vorsitz von Prof. Dr. Dr.<br />
Ommo Grupe entschied die Rangfolge der 19 Arbeiten aus den Sektionen Geistes-<br />
/Sozialwissenschaften sowie Naturwissenschaft/Medizin.<br />
Die herausragende Arbeit des Sportwissenschaftlers Höner trägt den Titel:<br />
„Entscheidungshandeln im Sportspiel Fußball – Eine Analyse im Lichte der Rubikontheorie“.<br />
Diese Arbeit wird nun in der Wissenschaftlichen Schriftenreihe des DSB (Band 34)<br />
veröffentlicht.<br />
Das Kuratorium hat weiterhin fünf Zweite Preise vergeben. Die zweiten Preisträgerinnen und<br />
Preisträger sind: Privatdozenten Dr. med. Dr. phil. Thomas Hilberg (Jena) und Dr. Thomas<br />
Schack (Köln) sowie Dr. Ingrid Bähr (Frankfurt am Main), Dr. Andrea Horn (Bochum) und Dr.<br />
Andrea Stachelhaus (Münster). Die Zweiten Preise sind mit jeweils 2.000 Euro ausgestattet.<br />
Lobende Anerkennungen wurden in diesem Jahr nicht vergeben.<br />
Die 24. Verleihung des Wissenschaftspreises des DSB findet im Rahmen einer<br />
Festakademie am Donnerstag, den 11. November 2004 in der Alten Aula der Ruprecht-<br />
Karls-Universität in Heidelberg statt. <strong>Der</strong> DSB-Präsident Manfred von Richthofen wird die<br />
Preise übergeben.<br />
13. November 2004 / Frankfurt Allgemeine Zeitung<br />
31
13. November 2004 / Rhein-Neckar-Zeitung<br />
<strong>Der</strong> Sport braucht die Wissenschaft<br />
Deshalb verleiht der <strong>Deutsche</strong> <strong>Sportbund</strong> Preise<br />
an besonders profilierte Forscher<br />
Sie erhielten Preise des <strong>Deutsche</strong>n <strong>Sportbund</strong>es:<br />
Dr. Thomas Hilberg, Dr. Andrea Stachelhaus, Dr. Andrea Horn, Prof. Dr. Oliver Höner, Dr. Ingrid Bähr und Dr. Thomas<br />
Schack (vorne von links nach rechts).<br />
Geehrt wurden sie vom Rektor der Heidelberger Universität, Peter Hommelhoff, dem Präsidenten des <strong>Sportbund</strong>es,<br />
Manfred von Richthofen, Heidelbergs Erstem Bürgermeister, Raban von der Malsburg, und Prof. Klaus Roth vom<br />
Heidelberger Sportinstitut.<br />
<strong>Der</strong> Kammerchor des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums sang "Ich habe mein Herz in<br />
Heidelberg verloren." 250 Zuschauer in der Alten Aula der Universität Heidelberg<br />
applaudierten, darunter auch Manfred von Richthofen, Präsident des <strong>Deutsche</strong>n Sport-<br />
Bundes (DSB).<br />
Für seine Institution gilt diese Aussage wohl besonders. Denn obwohl in diesem Jahr kein<br />
Heidelberger unter den Preisträgern dabei war, entschied sich der DSB seine <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<br />
<strong>Plakette</strong> für Sportwissenschaft heuer in Heidelberg zu verleihen. Hauptpreisträger war der<br />
Mainzer Professor Dr. Oliver Höner. <strong>Der</strong> Juniorprofessor in der Abteilung Sportpädagogik<br />
und Sportpsychologie bekam den Preis, der alle zwei Jahre an wechselnden Orten<br />
stattfindet, für seine Forschungen zum Thema "Entscheidungen im Sportspiel Fußball – Eine<br />
Analyse im Lichte der Rubikontheorie."<br />
"<strong>Der</strong> Sport ist ein Aktivposten der Gesundheit", sagte von Richthofen in seiner Rede, "und<br />
auch eine wirtschaftliche Größe." Da sei es auch nötig, den Sport wissenschaftlich zu<br />
begleiten. "<strong>Der</strong> Sport kann ohne die Sportwissenschaft nicht auskommen. Die konstruktive<br />
Partnerschaft hat dem Sport viel Anerkennung gebracht", sagte der DSB-Präsident.<br />
32
Dies scheint der DSB, der mittlerweile 27 Millionen Mitglieder zählt, da jedes Mitglied eines<br />
Sportvereins automatisch im DSB-Computer gespeichert wird, schon früh erkannt zu haben.<br />
Schon 1950 entschieden sich die Funktionäre für eine zweijährige Verleihung einer<br />
derartigen Medaille für Sportwissenschaftler, die neue Erkenntnisse liefern. Auch zahlreiche<br />
Heidelberger waren über die Jahre immer wieder dabei.<br />
Anno 2004 gingen die Preise gewissermaßen an die Konkurrenz. Neben Höner wurden<br />
außerdem Ingrid Bähr (Thema: Erleben "Frauen" sportbezogene Bewegung anders als<br />
"Männer"?), Thomas Hilberg (Sportliche Belastung und Hämostase), Andreas Horn<br />
(Diagnostik der Herzfrequenzvariabilität in der Sportmedizin – Rahmenbedingungen und<br />
methodische Grundlagen), Thomas Schack (Zur kognitiven Architektur von<br />
Bewegungshandlungen – modelltheoretischer Zugang und experimentelle Untersuchungen)<br />
sowie Andrea Stachelhaus (Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter<br />
Förderung auf die Graphomotorik von Schulanfängern).<br />
Die Themen sind für Laien freilich komplex. Vielleicht entschied sich deshalb Universitäts-<br />
Rektor Peter Hommelhoff in seiner fast halbstündigen Festansprache dazu, die Gemälde der<br />
Alten Aula zu beschreiben und Heidelbergs Weg zur Elite-Uni zu zeichnen, anstatt auf die<br />
Themen der Prämierten einzugehen. Das überließ er den Leuten vom Fach. Den Bezug der<br />
Universität Heidelberg zum Sport stellte Hommelhoff dann aber doch unmissverständlich<br />
klar. "Seit 2001 ist die Ruprecht-Karls-Universität Partnerschule des Spitzensports", sagte<br />
der Rektor.<br />
Mit den Hockey-Spielerinnen Fanny Rinne und Mandy Haase studieren derzeit zwei aktuelle<br />
Olympiasiegerinnen in Heidelberg, dazu kommt mit Petra Dallmann eine Bronzemedaillen-<br />
Gewinnerin aus Athen (4x200-Meter-Freistil-Staffel im Schwimmen).<br />
Und auch wenn diesmal Heidelberg keine <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> bekam, die sportlichen<br />
Triumphe der Athletinnen bei den <strong>Olympische</strong>n Spielen dürften für die Außendarstellung<br />
sowieso wertvoller sein.<br />
33
Das Kuratorium zur Verleihung der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong><br />
Vorsitzender des Kuratoriums<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe<br />
Eberhard-Karls-Universität Tübingen<br />
Mitglieder des Kuratoriums<br />
Prof. Dr. Achim Conzelmann<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel<br />
Prof. Dr. Eike Emrich<br />
Johann Wolfgang Goethe-Universität<br />
Frankfurt am Main<br />
Prof. Dr. Elk Franke<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Prof. Dr. Ulrich Göhner<br />
Eberhard-Karls-Universität Tübingen<br />
Prof. Dr. Dieter Jeschke<br />
Technische Universität München<br />
Prof. Dr. Wilfried Kindermann<br />
Universität des Saarlandes<br />
Prof. Dr. Dietrich Kurz<br />
Universität Bielefeld<br />
Prof. Dr. Dr. Gertrud Pfister<br />
Universität Kopenhagen<br />
Prof. Dr. Klaus Roth<br />
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg<br />
Andreas Klages<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Sportbund</strong> (Geschäftsführung)<br />
Kuratorium<br />
34
Bilder<br />
35
Mit der <strong>Carl</strong>-<strong>Diem</strong>-<strong>Plakette</strong> und dem 1. Preis<br />
ausgezeichnete Wissenschaftler<br />
1953 Prof. Dr. Herbert Reindell<br />
Sport und Kreislauf<br />
1955 Prof. Dr. Otto Neumann<br />
Sport und Persönlichkeit<br />
1957/58 Dr. Hugo Wagner<br />
Humanismus – Militarismus - Leibeserziehung<br />
Prof. Dr. Josef Nöcker<br />
Die Bedeutung des Mineralstoffwechsels für Leistungsfähigkeit und Training des Muskels<br />
1959/60 Prof. Dr. Dr. h.c. Wildor Hollmann<br />
Höchst- und Dauerleistungsfähigkeit des Sportlers unter besonderer Berücksichtigung<br />
des kardiopulmonalen Systems<br />
1961/62 Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Lenk<br />
Wertsetzung und Wertverwirklichung der neuzeitlichen <strong>Olympische</strong>n Bewegung<br />
1963/64 Prof. Dr. Joseph Keul<br />
Über den Stoffwechsel des menschlichen Herz- und Skelettmuskels<br />
1965/66 Prof. Dr. Hermann Altrock<br />
Für langjähriges hervorragendes Wirken für die Sportwissenschaft<br />
1967/68 Prof. Dr. Dr. h.c. Ommo Grupe<br />
Die Leiblichkeit des Menschen und die Aufgaben der Leibeserziehung<br />
1973/74 Prof. Dr. Wolfgang Groher<br />
Spondylolyse und Spondylolisthesis als erworbener Spätzustand nach ständig einwirkenden<br />
Mykrotraumen bei Sportlern<br />
1975/76 Prof. Dr. Wilfried Kindermann<br />
Metabolische Azidose – ihre Bedeutung unter physiologischen und pathologischen Bedingungen<br />
Prof. Dr. Hartmut Gabler<br />
Aggressive Handlungen im Sport.<br />
1977/78 Prof. Dr. Ulrich Göhner<br />
Funktionale Bewegungsanalyse. Ein Bezugssystem zur Analyse sportlicher Bewegungen unter<br />
pädagogischen Aspekten<br />
Prof. Dr. Heinz Liesen<br />
Metabolische Adaptationen an akute und chronische Ausdauerbeanspruchungen<br />
1979/80 Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Burck<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Erhard Bock<br />
Beide für langjähriges hervorragendes Wirken zur Entwicklung der Sportwissenschaft<br />
1981/82 Prof. Dr. Hans-Joachim Appell<br />
Anabolika und muskuläre Systeme<br />
Prof. Dr. Klaus Bös/Prof. Dr. Heinz Mechling<br />
Dimensionen sportmotorischer Leistungen<br />
1983/84 Prof. Dr. Dieter Hackfort<br />
Theorie und Diagnostik sportbezogener Ängstlichkeit<br />
1985/86 Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Mester<br />
Zur sportartspezifischen Diagnostik im Bereich der Sinnesorgane unter besonderer Berücksichtigung<br />
des visuellen Systems<br />
1987/88 Prof. Dr. Jürgen Baur<br />
Körper- und Bewegungskarrieren<br />
Prof. Dr. Hermann Heck<br />
Laktat in der Leistungsdiagnostik<br />
1989/90 PD Dr. Günther Strobel<br />
Stoffwechsel und körperliche Belastung<br />
Prof. Dr. Hans Joachim Teichler<br />
Internationale Sportpolitik im Dritten Reich<br />
1991/92 Prof. Dr. Wolfgang Schlicht<br />
Sport und seelische Gesundheit<br />
Dr. Thomas Schmalz<br />
Biomechanische Modellierung menschlicher Bewegung<br />
1993/94 Prof. Dr. Eckart Balz<br />
Gesundheitserziehung im Schulsport<br />
PD Dr. Ernst-Joachim Hossner<br />
Module der Motorik<br />
1995/96 Prof. Dr. Achim Conzelmann<br />
Entwicklung konditioneller Fähigkeiten im Erwachsenenalter<br />
1997/98 Prof. Dr. Holger Gabriel<br />
Sport und Immunsystem<br />
1999/00 PD Dr. Kai Röcker<br />
Eine neue Betrachtungsweise der zeitlichen Abläufe im Energiestoffwechsel mittels Anwendung eines<br />
weiterentwickelten 13 C-Dilutionsverfahrens<br />
PD Dr. Rainer Wollny<br />
<strong>Der</strong> Einfluss altersbezogener Personenmerkmale auf die Plastizität motorischer<br />
Fertigkeitsoptimierungen<br />
2001/02 PD Dr. Ernst-Joachim Hossner<br />
Bewegende Ereignisse – ein Versuch über die menschliche Motorik<br />
2003/04 Prof. Dr. Oliver Höner<br />
Entscheidungshandeln im Sportspiel Fußball<br />
39
Alte Aula<br />
Anlässlich des Universitätsjubiläums von 1886 wurde das Innere der alten Aula dem Stil des<br />
Historismus entsprechend umgestaltet. In der Mitte der abgebildeten Stirnwand befindet sich<br />
seitdem eine Büste Großherzog Friedrichs von Baden, die von Friedrich Moest angefertigt<br />
wurde. Links von der Büste befindet sich ein Portrait von Kurfürst Ruprecht I., dem<br />
Begründer der Universität Heidelberg, während rechts von der Büste ein Portrait des<br />
Markgrafen Karl Friedrich von Baden zu sehen ist, der die Universität, nach dem Anschluss<br />
Heidelbergs an Baden, großzügig förderte. Nach beiden Persönlichkeiten wird die Universität<br />
Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität (oder lateinisch Ruperto-Carola) genannt. Das obere<br />
Bild stellt den Einzug der Pallas Athene, der Göttin der Weisheit, in Heidelberg dar, womit<br />
auf die Gründung der Universität unter Ruprecht I. angespielt wird. Die Bedeutung, die die<br />
Universität Heidelberg als nach Prag und Wien älteste deutsche Universitätsgründungen für<br />
Deutschland hat, wird durch die schwarz-weiß-rote Fahne des <strong>Deutsche</strong>n Reiches<br />
unterstrichen, die der Pallas Athene vorausgetragen wird.<br />
40