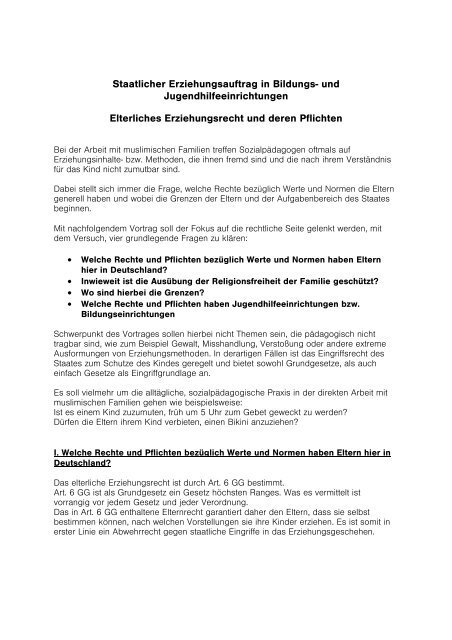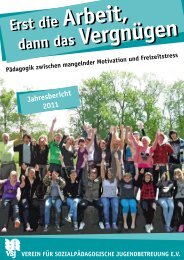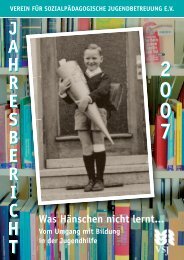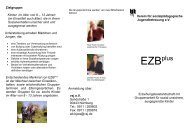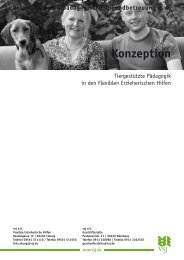Elterliches Erziehungsrecht und deren Pflichten - Irene Blank
Elterliches Erziehungsrecht und deren Pflichten - Irene Blank
Elterliches Erziehungsrecht und deren Pflichten - Irene Blank
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Staatlicher Erziehungsauftrag in Bildungs- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfeeinrichtungen<br />
<strong>Elterliches</strong> <strong>Erziehungsrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>deren</strong> <strong>Pflichten</strong><br />
Bei der Arbeit mit muslimischen Familien treffen Sozialpädagogen oftmals auf<br />
Erziehungsinhalte- bzw. Methoden, die ihnen fremd sind <strong>und</strong> die nach ihrem Verständnis<br />
für das Kind nicht zumutbar sind.<br />
Dabei stellt sich immer die Frage, welche Rechte bezüglich Werte <strong>und</strong> Normen die Eltern<br />
generell haben <strong>und</strong> wobei die Grenzen der Eltern <strong>und</strong> der Aufgabenbereich des Staates<br />
beginnen.<br />
Mit nachfolgendem Vortrag soll der Fokus auf die rechtliche Seite gelenkt werden, mit<br />
dem Versuch, vier gr<strong>und</strong>legende Fragen zu klären:<br />
• Welche Rechte <strong>und</strong> <strong>Pflichten</strong> bezüglich Werte <strong>und</strong> Normen haben Eltern<br />
hier in Deutschland?<br />
• Inwieweit ist die Ausübung der Religionsfreiheit der Familie geschützt?<br />
• Wo sind hierbei die Grenzen?<br />
• Welche Rechte <strong>und</strong> <strong>Pflichten</strong> haben Jugendhilfeeinrichtungen bzw.<br />
Bildungseinrichtungen<br />
Schwerpunkt des Vortrages sollen hierbei nicht Themen sein, die pädagogisch nicht<br />
tragbar sind, wie zum Beispiel Gewalt, Misshandlung, Verstoßung oder andere extreme<br />
Ausformungen von Erziehungsmethoden. In derartigen Fällen ist das Eingriffsrecht des<br />
Staates zum Schutze des Kindes geregelt <strong>und</strong> bietet sowohl Gr<strong>und</strong>gesetze, als auch<br />
einfach Gesetze als Eingriffgr<strong>und</strong>lage an.<br />
Es soll vielmehr um die alltägliche, sozialpädagogische Praxis in der direkten Arbeit mit<br />
muslimischen Familien gehen wie beispielsweise:<br />
Ist es einem Kind zuzumuten, früh um 5 Uhr zum Gebet geweckt zu werden?<br />
Dürfen die Eltern ihrem Kind verbieten, einen Bikini anzuziehen?<br />
I. Welche Rechte <strong>und</strong> <strong>Pflichten</strong> bezüglich Werte <strong>und</strong> Normen haben Eltern hier in<br />
Deutschland?<br />
Das elterliche <strong>Erziehungsrecht</strong> ist durch Art. 6 GG bestimmt.<br />
Art. 6 GG ist als Gr<strong>und</strong>gesetz ein Gesetz höchsten Ranges. Was es vermittelt ist<br />
vorrangig vor jedem Gesetz <strong>und</strong> jeder Verordnung.<br />
Das in Art. 6 GG enthaltene Elternrecht garantiert daher den Eltern, dass sie selbst<br />
bestimmen können, nach welchen Vorstellungen sie ihre Kinder erziehen. Es ist somit in<br />
erster Linie ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe in das Erziehungsgeschehen.
Inhaltlich bestimmt Art 6 GG folgendes:<br />
(1) Ehe <strong>und</strong> Familie stehen unter dem beson<strong>deren</strong> Schutz der staatlichen<br />
Ordnung<br />
Absatz 1 enthält den allgemeinen Schutz der Familie als geschlossener <strong>und</strong><br />
eigenständiger Lebensbereich.<br />
(2) Pflege <strong>und</strong> Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern <strong>und</strong><br />
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Ober ihrer Betätigung wacht die<br />
staatliche Gemeinschaft.<br />
Absatz 2 bestimmt die Beziehung zwischen Eltern <strong>und</strong> Kindern in der Familie <strong>und</strong> legt<br />
außerdem Aufgaben <strong>und</strong> Grenzen staatlicher Stellen bei der Kindererziehung fest.<br />
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die<br />
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus an<strong>deren</strong><br />
Gründen zu verwahrlosen drohen.<br />
Absatz 3 enthält das Eingriffsrechts des Staats in den Fällen der Vernachlässigung.<br />
Diese Extremfälle sind klar geregelt <strong>und</strong> sollen nicht Ziel der nachfolgenden<br />
Ausführungen werden.<br />
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG:<br />
Pflege <strong>und</strong> Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern <strong>und</strong> die zuvörderst<br />
ihnen obliegende Pflicht.<br />
Satz 1 enthält eine Institutsgarantie, welche die Kindererziehung in der Familie unter<br />
verfassungsrechtlichen Schutz stellt.<br />
Dies bedeutet, dass Eltern bei ihren Erzielungszielen frei sind <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich nicht<br />
durch staatlich verordnete Erziehungsziele oder -mittel eingeschränkt werden dürfen.<br />
Sie sind frei, ihre Kinder im Sinne ihrer eigenen Weltanschauung <strong>und</strong> Religion, sowie ihrer<br />
eigenen Moral zu erziehen.<br />
Unter diese Institutionsgarantie fallen hierbei im Zusammenhang mit der Kindererziehung<br />
die Bestimmung des Erziehungsziels <strong>und</strong> der Erziehungsmittel. Letztere müssen<br />
angemessen sein. Was hierbei unter angemessen zu verstehen ist, wird im<br />
Nachfolgenden bei der Frage nach den Grenzen des <strong>Erziehungsrecht</strong>s diskutieren<br />
werden.<br />
Träger des Elternrechts sind ausschließlich die Eltern.<br />
Ihnen allein obliegt die Aufgabe der Pflege <strong>und</strong> Erziehung. Daneben hat als Erzieher nur<br />
die Schule Platz. Sie hat ebenfalls einen gr<strong>und</strong>rechtlich verankerten Erziehungsauftrag<br />
durch Art. 7 GG.<br />
Alle sonstigen Miterzieher können nur mittelbar, auf dem Umweg über die Eltern mit<br />
<strong>deren</strong> Zustimmung zur Wirksamkeit gelangen. Dies gilt insbesondere für die Jugendhilfe.<br />
In keinem Fall dürfen Erziehung <strong>und</strong> Versorgung auf andere Kinder, speziell auf die<br />
älteren Brüder übertragen werden. Auch wenn dies eine häufig vorzufindende Praxis in<br />
an<strong>deren</strong> Kulturen ist, so ist dies nicht von dem Elternrecht gedeckt.
Das Elternrecht lässt sich in drei Bereiche gliedern:<br />
1. Erziehungsfunktion der Eltern<br />
2. Einwirkungsrecht<br />
3. Wahrnehmungsrecht<br />
1. Erziehungsfunktion der Eltern<br />
Die einfachgesetzlich konkretisierte Elternverantwortung bezieht sich auf „Pflege“ als<br />
Sorge um Ernährung, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Vermögen, sowie auf „Erziehung“ als Vermittlung<br />
von Wissen <strong>und</strong> als wertbezogene Einwirkung durch Erstreckung auf die Weltanschauung<br />
2. Einwirkungsrecht<br />
Das Elternrecht gibt den Eltern das Recht gegenüber dem Kind zur Einwirkung ohne<br />
staatliche Störung. Es hat in diesem Bereich durchaus auch Züge eines Herrschaftsrechts<br />
3. Wahrnehmungsrecht<br />
Es gewährt den Eltern das Recht für das Kind zu handeln (z.B. Vorgehen gegen staatliche<br />
Bestrafung in der Schule).<br />
Es ist manifestiert eine treuhänderische Stellung der Eltern.<br />
Erst wenn die Eltern versagen oder ausfallen kommt die staatliche „Erziehungsreserve“<br />
ins Spiel.<br />
II. Inwieweit ist die Ausübung der Religionsfreiheit der Familie geschützt?<br />
Das Gr<strong>und</strong>recht aus Art. 4 I <strong>und</strong> II GG (Glaubens- Gewissens- <strong>und</strong> Bekenntnisfreiheit,<br />
sowie die Freiheit in der Religionsausübung) schließt das Recht der Eltern ein, ihrem Kind<br />
die von ihnen für richtig gehaltene, religiöse oder weltanschauliche Erziehung zu<br />
vermitteln. Ihnen sind in diesem Zusammenhang keine inhaltlichen, festliegenden,<br />
kindlichen Rechtspositionen bei der Vermittlung von religiösen Anschauungen<br />
vorgegeben.<br />
Auch hierbei handelt es sich zunächst um ein Gr<strong>und</strong>gesetz <strong>und</strong> damit um ein Gesetz<br />
höchsten Ranges.<br />
III. Wo sind hierbei die Grenzen?<br />
Es stellt sich die Frage, ob das Elternrecht <strong>und</strong> das Recht der Religionsfreiheit grenzenlos<br />
<strong>und</strong> damit unantastbar gegen jeden staatlichen Eingriff sind oder ob es Grenzen gibt, <strong>und</strong><br />
wenn ja, wo diese zu ziehen sind<br />
Sofern der Gesetzgeber ein Eingriffsrecht in das Elternrecht erlaubt, so hat dabei das<br />
Kindeswohl die Leitlinie zu sein — allerdings nicht im Sinne staatlich veranlasster<br />
Kindeswohloptimierung, sondern nur im Sinne Hintanhaltung von Gefährdungen.<br />
Es geht damit nicht um eine Optimierung von Erziehung sondern um eine Verhinderung<br />
von Kindeswohlgefährdung.
Es stellt sich daher in erster Linie die Frage, wann durch Überschreitung der elterlichen<br />
Erziehungsfreiheit eine Kindeswohlgefährdung gegeben ist? Wann sind Erziehungsmittel<br />
nicht mehr angemessen?<br />
Die Notwenigkeit konkreter Grenzen ist unbestritten. Problematisch ist hierbei jedoch,<br />
dass das Gr<strong>und</strong>gesetz den Eltern eben gerade keine Erziehungsziele oder<br />
Erziehungsmethoden vorgibt. Als Faustregel gilt in der Rechtsprechung:<br />
Erziehungsziele müssen im abendländischen Raum diskutierbar sein.<br />
Ferner gibt die Rechtsprechung als formales Erziehungsziel die Heranbildung zur<br />
mündigen <strong>und</strong> selbstentscheidungsfähigen Persönlichkeit vor.<br />
Was heiß nun „angemessen sein“. Wann wird die Heranbildung zur mündigen <strong>und</strong><br />
selbstentscheidungsfähigen Persönlichkeit durch die Vorgabe von beispielsweise<br />
Bekleidungsvorschriften verhindert. Ist es noch angemessen, dass ein Kind mit 14 Jahren<br />
immer um 18 Uhr zu Hause sein muss?<br />
Ist hierin schon eine Kindeswohlgefährdung zusehen, die ein Einschreiten des Staates<br />
erlaubt?<br />
Art. 6 Abs. 2 GG etabliert zwar das staatliche Wächteramt für den Fall von Elternrechts —<br />
Grenz — Überschreitungen, benennt aber nicht selbst Grenzen. Es gibt lediglich vor, dass<br />
sich die Erziehung in gemeinschaftsverträglichen Grenzen bewegen muss.<br />
Daraus kann man zumindest die Erziehung zur Rechtstreue ableiten. Ferner liegt die<br />
Grenze bei Misshandlung <strong>und</strong> Verhungern.<br />
Die oben genannten Beispiele fallen jedoch nicht hierunter. Damit ist in solchen Fällen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich das elterliche <strong>Erziehungsrecht</strong> voranging <strong>und</strong> absolut gegen staatliche<br />
Eingriffe.<br />
- Kindergr<strong>und</strong>rechte als Grenze?<br />
Es gibt keine speziellen Gr<strong>und</strong>rechte für Kinder.<br />
Das Kindeswohl, das die entscheidende Leitlinie in jeder gerichtlichen Entscheidung ist,<br />
ist in der Verfassung nicht ausdrücklich genannt. Dennoch hat es einen wesentlichen<br />
Einfluss — in seinem Licht muss der Inhalt des Elternrechts interpretiert werden. Dies<br />
resultiert aus dem ausdrücklich in Art. 6 Abs. 2 GG genannten Pflichtgehalt („zuvörderst<br />
ihnen obliegende Pflicht“).<br />
Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Elternrechts gilt somit in erster Linie zum<br />
Schutz des Kindes.<br />
Darüber hinaus kann das Kind selbst auch Träger von Gr<strong>und</strong>rechten sein, beispielsweise<br />
dem Recht auf Leben <strong>und</strong> Unversehrtheit, Art. 1 <strong>und</strong> 2 GG.<br />
Diese Gr<strong>und</strong>rechte geben ihm jedoch in erster Linie, wie alle an<strong>deren</strong> Gr<strong>und</strong>rechte auch,<br />
Schutz gegenüber staatlichen Eingriffen, nicht aber gegenüber den Eltern.<br />
Sie erlangen jedoch Bedeutung in der Eltern — Kind — Beziehung im Rahmen des<br />
elterlichen <strong>Erziehungsrecht</strong>s <strong>und</strong> im Rahmen der elterlichen Wahrnehmungsbefugnis<br />
(=Personen- <strong>und</strong> Vermögenssorge).<br />
Neben dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dem Recht auf Leben <strong>und</strong> Unversehrtheit,<br />
Art 1 <strong>und</strong> 2 des Gr<strong>und</strong>gesetzes hat das Kind auch ab einem bestimmten Zeitpunkt das<br />
Recht auf Religions- <strong>und</strong> Entfaltungsfreiheit.
1. Religions- <strong>und</strong> Entfaltungsfreiheit<br />
Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahrs ist das Kind religionsunmündig. In dieser Zeit<br />
weist die Religionsfreiheit für das Kind noch keinen bestimmten Inhalt aus. Dies bedeutet,<br />
dass kein staatlicher Schutz für das Kind möglich ist, wenn Elternrecht <strong>und</strong> Kindes —<br />
Rechtsgut kollidieren. Den Eltern sind, wie bereits ausgeführt, in diesem Zusammenhang<br />
keine inhaltlichen, festliegenden kindlichen Rechtspositionen bei der Vermittlung von<br />
religiösen Anschauungen vorgegeben. Es kann daher auch kein Eingriff in solche, nicht<br />
existente Rechtspositionen geben („Herrschaftsrecht“).<br />
Dies bedeutet gr<strong>und</strong>sätzlich, dass Eltern das Recht haben, ihren neunjährigen Kindern die<br />
fünfmaligen Gebete ausführen zu lassen.<br />
Eine Grenze ist hier nur dann zu ziehen, wenn das elterliche Einwirkungs- <strong>und</strong><br />
Wahrnehmungsverhalten die Grenze der „Pluralen Spannbreite“ überschreitet <strong>und</strong> den in<br />
unserem Kulturkreis festgelegten Bereich des objektiv „ Kindeswohlwidrigen“ erreicht.<br />
Wo dieser genau beginnt ist nicht festgelegt. Auch hier gibt es nur Richtlinien:<br />
Bei massiven Zurückbleiben der körperlichen, geistigen <strong>und</strong> seelischen Entwicklung<br />
hinter der Norm ist eine Gefährdung des Kindeswohl zu sehen, die die Aufrechterhaltung<br />
der Familiengemeinschaft als nicht mehr verantwortbar erscheinen ließe. In diesem Fall<br />
muss der Staat in Ausübung seines Wächteramtes eingreifen.<br />
In Einzelfällen ist hier sogar eine Herausnahme des Kindes aus der Familie angemessen.<br />
Innerhalb diese Rahmens (der „Pluralen Spannbreite“) sind die Eltern frei.<br />
Auch wenn demnach die Kinder Einschränkungen im Alltag erleben müssen, ihnen<br />
versagt wird, Schweinefleisch zu essen, Bikinis anzuziehen oder sie die fünfmaligen<br />
Gebete sprechen müssen <strong>und</strong> auch wenn es einem als Fachkraft betroffen macht <strong>und</strong><br />
einem die Kinder leid tun. Solange hierdurch nicht wirklich schädliche Auswirkungen auf<br />
den körperlichen, seelischen <strong>und</strong> geistigen Zustand der Kinder hervorgerufen werden, ist<br />
kein Einschreiten des Staates möglich.<br />
Mit zunehmendem Alter des Kindes, also mit dem Wechsel von der absoluten zur<br />
relativen Unmündigkeit, kommt dem kindlichen Persönlichkeitsrecht, welches dem<br />
Kindeswillen entspricht, immer mehr Bedeutung zu.<br />
Mit Vollendung des 12. Lebensjahres ist bereits gemäß § 5 S. 2 des Gesetzes über die<br />
religiöse Kindererziehung ein Wechsel des religiösen Bekenntnisses gegen den Willen<br />
des Kindes nicht mehr möglich.<br />
Mit Vollendung des 14. Lebensjahres erreicht das Kind den Eintritt in die<br />
Religionsmündigkeit. Ab diesem Zeitpunkt kann das Kind selbst sein religiöses<br />
Bekenntnis bestimmen.<br />
Das heißt, ab diesem Zeitpunkt darf ein Kind den Vorgaben seiner Eltern hinsichtlich<br />
Glaubensbekenntnisses <strong>und</strong> Religionsausübung widersprechen <strong>und</strong> sich auch<br />
gegebenenfalls mit Hilfe des staatlichen Wächteramtes dagegen wehren.<br />
Im Einklang mit den Eltern ist dies bereits vor Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs<br />
möglich. Das Kind kann bereits vorher zusammen mit den Eltern Gebrauch von seiner<br />
Religionsfreiheit machen.<br />
<strong>Elterliches</strong> <strong>Erziehungsrecht</strong> in Religionsfragen endet nicht durch den Eintritt des Kindes in<br />
die Religionsmündigkeit, es tritt jedoch hinter dem Recht des Kindes auf Religionsfreiheit<br />
mit zunehmendem Alter zurück. Es erlischt mit Eintritt der Volljährigkeit.
2. Das staatliche Wächteramt<br />
Dem Elternrecht sind daher durchaus Grenzen gesetzt. Art 6 Abs. 2 Satz 2 GG besagt:<br />
„Ober ihrer Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“ <strong>und</strong> weist damit dem Staat<br />
die Rolle des Wächteramtes zu. Seine Aufgabe besteht darin, die Einhaltung dieser<br />
Grenzen <strong>und</strong> die Erfüllung der Elternpflichten zu überprüfen.<br />
Richtlinie ist hier wieder das Wohl des Kindes.<br />
Dabei muss der Staat jedoch bei allen Maßnahmen, die er ergreift, das Elternrecht soweit<br />
wie möglich respektieren <strong>und</strong> immer das mildeste zur Verfügung stehende Mittel<br />
einsetzen.<br />
Ausschlaggebend für jedes staatliche Eingreifen ist die Gefährdung des Kindeswohls.<br />
Ein Eingreifen im Interesse eines „Erziehungsoptimismus“ gestattet Art. 6 Abs. 2 Satz 2<br />
i.V.m. Abs. 3 GG nicht.<br />
Ziel des staatlichen Wächteramtes ist die Verhütung von Verletzung des Kindeswohls.<br />
Es geht nicht darum, eine bessere oder optimierte Erziehung für das Kind zu<br />
gewährleisten, sondern darum, das Kind vor Schaden zu bewahren!<br />
IV. Welche Rechte <strong>und</strong> <strong>Pflichten</strong> haben Jugendhilfeeinrichtungen bzw.<br />
Bildungseinrichtungen<br />
1. Schule <strong>und</strong> staatliche Bildungseinrichtungen<br />
Der Unterschied zwischen Jugendhilfe <strong>und</strong> Schule liegt im Wesentlichen darin, dass die<br />
Schule als staatliche Bildungseinrichtungen neben den Eltern ebenfalls ein gleichrangiger<br />
Erziehungsträger ist, dessen Erziehungsauftrag durch Art. 7 GG geschützt ist. Im<br />
Ausgangspunkt stehen also elterliches <strong>Erziehungsrecht</strong> <strong>und</strong> schulisches <strong>Erziehungsrecht</strong><br />
gleichgeordnet nebeneinander.<br />
Dagegen kommt den Jugendämtern <strong>und</strong> öffentlichen Jugendhilfen lediglich eine<br />
dienende, instrumentale Funktion zu. Sie haben hierbei gr<strong>und</strong>sätzlich die Verpflichtung zur<br />
Bereitstellung von Hilfsangeboten durch Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit,<br />
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer ect.<br />
Sie haben jedoch keinen eigenständigen Erziehungsauftrag, weder durch Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
noch durch einfaches Gesetz.<br />
I.<br />
Inhalte des staatlichen Erziehungsauftrages gemäß Art. 7 GG sind eigene<br />
Erziehungsziele:<br />
Das Recht auf die Festlegung von Unterrichtszielen, das Recht, die<br />
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes umfassend zu fördern, sowie das Recht <strong>und</strong> die<br />
Pflicht, Voraussetzungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Minderheiten zu schaffen.<br />
Bei der Festlegung der Erziehungsziele geht man von der christlichen<br />
Gemeinschaftsschule als Regeltyp aus. Erziehungsinhalte sind in erster Linie die<br />
Erziehung zur Beachtung der Verfassungsprinzipien <strong>und</strong> der Rechtsordnung, die<br />
Erziehung zu allgemein anerkannten Wertvorstellungen, die Erziehung zum Bürgertum,<br />
sowie die Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott.<br />
Begrenzt wird der staatliche Erziehungsauftrag vor allem durch das Gebot der Neutralität<br />
<strong>und</strong> die Religionsfreiheit Art 4 GG.
Durch die Gleichrangigkeit von Elternrecht (Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG) <strong>und</strong> staatlichen<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsauftrag (Art 7 Abs. 1 GG) sind Konfliktsituationen im schulischen<br />
Bereich vorprogrammiert.<br />
Die häufigsten Konfliktsituationen treten auf bei Fragen hinsichtlich:<br />
- Tragen von Kopftüchern <strong>und</strong> an<strong>deren</strong> religiösen Kleiderstücken<br />
- Befreiungswunsch vom Sport- bzw. Schwimmunterricht<br />
- Teilnahme an der schulischen Sexualerziehung<br />
- Befreiungswunsch von der Klassenfahrt<br />
- Beurlaubung auf Gr<strong>und</strong> religiöser Feiertage<br />
Bei der Kollidierung zweier gr<strong>und</strong>rechtlich geschützten Interessen muss ein<br />
Ausgleich der widerstrebenden, gr<strong>und</strong>sätzlich gleichrangigen Verfassungsgüter unter<br />
Berücksichtigung des Toleranzgebots geschaffen werden.<br />
Die kollidierenden Gr<strong>und</strong>rechte müssen mit dem Ziel der Optimierung <strong>und</strong> unter<br />
Beachtung des Gr<strong>und</strong>satzes der Verhältnismäßigkeit zu einem angemessenen Ausgleich<br />
gebracht werden.<br />
Es erfordert eine Abwägung der widerstreitenden Belange <strong>und</strong> verbietet es, einem davon<br />
generell Vorrang einzuräumen.<br />
Beispiel:<br />
Befreiungswunsch vom Sport- bzw. Schwimmunterricht aus religiösen Gründen:<br />
Der Sport- <strong>und</strong> Schwimmunterricht ist Teil des Bildungsauftrages des Staates <strong>und</strong><br />
staatlichen Erziehungsauftrag, Art 7 GG:<br />
Erziehungsziele sind die Vermittlung vom sportlichen Fähigkeiten, sozialem Verhalten,<br />
Gefahrenbewusstsein <strong>und</strong> Einschätzung der körperlichen Leistung.<br />
Das Elternrecht, Art 6 GG, <strong>und</strong> die Freiheit, die Kinder hinsichtlich ihre eigenen<br />
Weltanschauung <strong>und</strong> Religion zu erziehen, Art 4 GG, erlauben den Eltern gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
jedoch, die Teilnahme am Schwimm- <strong>und</strong> Sportunterricht zu verbieten.<br />
Um einen Ausgleich zu schaffen müssen hier beide Gr<strong>und</strong>rechte gegeneinander<br />
abgewogen werden. Es muss unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen<br />
Rechtsgüter <strong>und</strong> dem Toleranzgebot eine Lösungsmöglichkeit geschaffen werden, die<br />
beide Gr<strong>und</strong>recht nebeneinander zulässt.<br />
Als Orientierungsmaßstab dient hier auch wieder das Kindeswohl.<br />
Lösung:<br />
Gr<strong>und</strong>schule:<br />
Bei jüngeren Kindern hat das Erlernen sportlicher <strong>und</strong> sozialer Gr<strong>und</strong>fertigkeiten,<br />
Erfahrung von Abgrenzung <strong>und</strong> Distanz zum an<strong>deren</strong> Geschlecht, sowie von<br />
Gemeinschaftlichkeit <strong>und</strong> Nähe Vorrang.<br />
Die Glaubensfreiheit der Kinder, sowie elterliches <strong>Erziehungsrecht</strong> treten gegenüber<br />
diesen Bildungszielen zurück. Es besteht kein Anspruch auf getrennte Unterrichte oder<br />
Befreiung von Sport- <strong>und</strong> Schwimmunterricht aus religiösen Gründen.<br />
Eintritt der Pubertät (ab 5. Jahrgangstufe)<br />
Die Schulen sind angehalten, durch entsprechende Organisation Befreiungen zu<br />
vermeiden, beispielsweise durch getrennten Unterricht von Jungen <strong>und</strong> Mädchen.<br />
Im Einzelfall bleibt der Anspruch auf Befreiung gegeben, wenn Lösungsmöglichkeiten<br />
organisatorisch nicht möglich sind <strong>und</strong> wenn dadurch bei Schülern muslimischen
Glaubens im Hinblick auf die von ihnen als verbindlich angesehenen, religiösen<br />
Bekleidungsvorschriften objektiv nachvollziehbare Gewissenskonflikte glaubhaft dargelegt<br />
werden.<br />
In diesem Fall geht die Religionsfreiheit der Kinder in Zusammenwirkung mit dem<br />
elterlichen <strong>Erziehungsrecht</strong> vor.<br />
Sie überwiegen in der Abwägung gegenüber dem staatlichen Bildungs- <strong>und</strong><br />
Erziehungsauftrag, da aus der unterschiedlichen Entwicklung von Jungen <strong>und</strong> Mädchen<br />
ab der Pubertät eine besondere Schutzwürdigkeit von Glaubensgr<strong>und</strong>sätzen wächst.<br />
2. Rechte <strong>und</strong> <strong>Pflichten</strong> der Jugendhilfeeinrichtungen:<br />
Wie bereits ausgeführt, kommt den Jugendämtern <strong>und</strong> öffentlichen Jugendhilfen lediglich<br />
eine dienende, instrumentale Funktion zu. Sie sind neben den Eltern als gr<strong>und</strong>gesetzlich<br />
geschütztem Erziehungsberechtigen als ergänzende Hilfe des Staates bei der Erziehung<br />
zu sehen.<br />
Die Hilfe wird zwar in erster Linie den Eltern gewährt, die angebotene Hilfe muss sich<br />
hierbei an den Interessen der Kinder / Jugendlichen orientieren. Sie sind an den<br />
betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.<br />
Das gilt insbesondere auch für die Art <strong>und</strong> Ausgestaltung der geeigneten Hilfe.<br />
Ausschlaggebend ist, dass die Hilfe für den individuellen, erzieherischen Bedarf geeignet<br />
<strong>und</strong> notwendig ist.<br />
Die Verpflichtung resultiert aus den Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfegesetzen des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> den<br />
jeweiligen Ausführungsgesetzen der Länder.<br />
Das in Art. 6 GG Abs. 2 Satz 1 GG manifestierte Elternrecht ist als Gesetz mit dem<br />
höchsten Rang in der Rechtsordnung vorrangig vor jedem einfachen Gesetz. Dennoch ist<br />
es kein rechtsfreier oder willkürlicher Raum.<br />
Interpretationskriterium des Elternrechts ist das Kindeswohl.<br />
Es bietet daher unter bestimmten Umständen dem Jugendamt ein Recht zum Eingriff:<br />
Die Jugendämter <strong>und</strong> öffentlichen Erziehungshilfen sind Träger des staatlichen<br />
Wächteramtes. Sie haben hierbei zwar keine eigene Eingriffsbefugnis, ihnen obliegt<br />
jedoch als „Augen des staatlichen Wächteramtes „ eine Meldepflicht.<br />
Fazit:<br />
Das elterliche <strong>Erziehungsrecht</strong> ist verfassungsrechtlich geschützt <strong>und</strong> daher gegenüber<br />
den einfachen Gesetzen, <strong>und</strong> damit auch gegenüber den Gesetzen zum Schutze der<br />
Kinder, vorrangig. Dennoch ist es kein absolutes Herrschaftsrecht.<br />
Es muss wie jedes andere Gr<strong>und</strong>recht in diesem Zusammenhang immer am Kindeswohl<br />
interpretiert werden. Sofern erzieherische Maßnahme der Eltern in die Rechte der Kinder<br />
eingreifen <strong>und</strong> das Kindeswohl durch diesen Eingriff gefährdet ist, eröffnet sich<br />
zwangsläufig die Eingriffsmöglichkeit des Staates in Funktion seines Wächteramtes.<br />
Mit zunehmendem Alter des Kindes erlangen auch seine eigenen Rechte zunehmend<br />
gegenüber dem Elternrecht an Bedeutung.<br />
Maßnahmen, die gegenüber einem fünfjährigen Kind noch von dem elterlichen<br />
<strong>Erziehungsrecht</strong> geschützt sind, können gegenüber einem Teenager durchaus<br />
beispielsweise zur unangemessenen Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit <strong>und</strong> damit<br />
zur Beeinträchtigung des Kindeswohls führen.
Sofern es sich nicht um klare Fälle des körperlichen Missbrauchs oder der<br />
Vernachlässigung handelt, ist die Abgrenzung, wann die Ausübung des elterlichen<br />
<strong>Erziehungsrecht</strong>s zu einer Kindeswohlverletzung führt, oft sehr wage.<br />
Es sind Einzelfallentscheidungen, bei denen die individuelle Situation in der Familie, die<br />
Reife des Kindes <strong>und</strong> die Art der Einschränkung im Einzelnen im Hinblick auf das<br />
elterliche <strong>Erziehungsrecht</strong> <strong>und</strong> das Kindeswohl geprüft werden müssen. Jeder Fall ist<br />
anders <strong>und</strong> muss neu entschieden werden.<br />
<strong>Irene</strong> <strong>Blank</strong><br />
Rechtsanwältin <strong>und</strong> Fachanwältin für Familienrecht