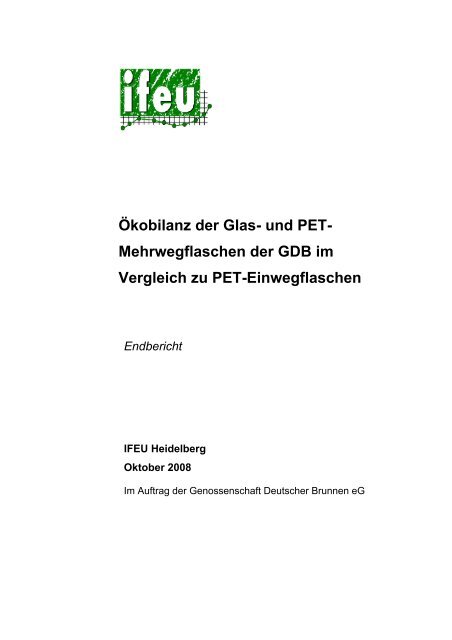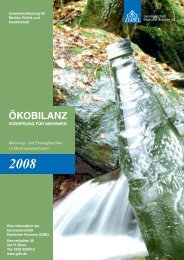Ökobilanz der Glas- und PET - Genossenschaft Deutscher Brunnen ...
Ökobilanz der Glas- und PET - Genossenschaft Deutscher Brunnen ...
Ökobilanz der Glas- und PET - Genossenschaft Deutscher Brunnen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ökobilanz <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflaschen <strong>der</strong> GDB im<br />
Vergleich zu <strong>PET</strong>-Einwegflaschen<br />
Endbericht<br />
IFEU Heidelberg<br />
Oktober 2008<br />
Im Auftrag <strong>der</strong> <strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong> eG
Ökobilanz <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflaschen <strong>der</strong> GDB im<br />
Vergleich zu <strong>PET</strong>-Einwegflaschen<br />
Im Auftrag <strong>der</strong> <strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong> eG<br />
Autoren:<br />
Benedikt Kauertz<br />
Frank Wellenreuther<br />
Stefanie Busch<br />
Martina Krüger<br />
Andreas Detzel<br />
IFEU Heidelberg, 23. Oktober 2008<br />
IFEU - Institut für Energie- <strong>und</strong> Umweltforschung Heidelberg GmbH<br />
Wilckensstraße 3, 69120 Heidelberg,<br />
Tel. 06221-47670, Fax: 06221-476719<br />
e-mail: andreas.detzel@ifeu.de
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 I<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 ZIEL UND RAHMEN DER STUDIE........................................................................... 3<br />
1.1 HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG ........................................................................ 3<br />
1.2 ORGANISATION DER STUDIE ................................................................................. 4<br />
1.3 CRITICAL REVIEW-VERFAHREN............................................................................. 4<br />
1.4 ANWENDUNG UND ZIELGRUPPEN DER STUDIE ....................................................... 5<br />
1.5 BETRACHTETE PRODUKTSYSTEME........................................................................ 5<br />
1.6 FUNKTIONELLE EINHEIT........................................................................................ 6<br />
1.7 LEBENSWEG UND SYSTEMGRENZEN ..................................................................... 6<br />
1.8 DATENERHEBUNG UND DATENQUALITÄT ............................................................... 8<br />
1.8.1 Zeitlicher Bezug .......................................................................................... 9<br />
1.8.2 Geographischer Bezug ............................................................................... 9<br />
1.8.3 Technologischer Bezug............................................................................... 9<br />
1.9 ALLOKATION ........................................................................................................ 9<br />
1.9.1 Allokation auf Prozessebene..................................................................... 10<br />
1.9.2 Allokation auf Systemebene...................................................................... 11<br />
1.10 VORGEHEN BEI WIRKUNGSABSCHÄTZUNG UND AUSWERTUNG ............................. 16<br />
1.10.1 Wirkungskategorien <strong>und</strong> -indikatoren........................................................ 16<br />
1.10.2 Optionale Elemente................................................................................... 17<br />
2 MARKTÜBERSICHT............................................................................................... 19<br />
3 UNTERSUCHTE VERPACKUNGSSYSTEME UND SZENARIEN......................... 23<br />
3.1 VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN ........................................................................ 23<br />
3.2 END-OF-LIFE QUOTEN........................................................................................ 25<br />
3.2.1 Erfassungsquoten <strong>der</strong> Mehrwegsysteme.................................................. 25<br />
3.2.2 Erfassungsquoten <strong>und</strong> Stoffflüsse <strong>der</strong> Stoffkreislaufflaschen................... 25<br />
3.2.3 Erfassungsquoten <strong>und</strong> Sortierung gebrauchter <strong>PET</strong>-Einwegflaschen ...... 25<br />
3.3 STOFFFLUSSBILDER ........................................................................................... 26<br />
3.4 UMFASSTE SZENARIEN....................................................................................... 29<br />
3.4.1 Basisszenarien.......................................................................................... 29<br />
3.4.2 Szenarien zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen............................ 31<br />
4 AUSGEWÄHLTE DATEN ZUR SACHBILANZ ...................................................... 33<br />
4.1 KUNSTSTOFFHERSTELLUNG................................................................................ 33<br />
4.1.1 Datensatz PP ............................................................................................ 33<br />
4.1.2 Datensatz LDPE........................................................................................ 33<br />
4.1.3 Datensatz HDPE ....................................................................................... 33<br />
4.1.4 Datensatz <strong>PET</strong> .......................................................................................... 34<br />
4.2 HERSTELLUNG VON GLAS UND GLASFLASCHEN................................................... 34<br />
4.3 HERSTELLUNG VON <strong>PET</strong>-FLASCHEN................................................................... 35<br />
4.4 VERPACKUNGSKOMPONENTEN AUS ALUMINIUM................................................... 35<br />
4.4.1 Herstellung von Aluminiumbarren <strong>und</strong> -bän<strong>der</strong>n....................................... 35<br />
Endbericht Oktober 2008
II Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
4.4.2 Herstellung von Aluminium-Anrollverschlüssen........................................ 36<br />
4.5 HERSTELLUNG VON WELLPAPPE UND WELLPAP<strong>PET</strong>RAYS .................................... 37<br />
4.6 ABFÜLLDATEN.................................................................................................... 37<br />
4.7 ANNAHMEN ZUR GETRÄNKEDISTRIBUTION........................................................... 37<br />
4.8 VERWERTUNG GEBRAUCHTER PACKSTOFFE ....................................................... 40<br />
4.8.1 <strong>PET</strong>-Flaschenaufbereitung zu <strong>PET</strong>-Flakes (open loop) ........................... 40<br />
4.8.2 Bottle-to-Bottle-Recycling (closed-loop) [<strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen] ...... 41<br />
Solid State Polycondensation (SSP) ................................................................... 41<br />
URRC-Verfahren ................................................................................................. 42<br />
4.9 HINTERGRUNDDATEN ......................................................................................... 42<br />
4.9.1 LKW-Transporte........................................................................................ 42<br />
4.9.2 Strombereitstellung ................................................................................... 43<br />
5 ERGEBNISSE DER WIRKUNGSABSCHÄTZUNG................................................ 45<br />
5.1 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGSGRUPPE A [OFG]......................................... 50<br />
5.2 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGSGRUPPE A [MFG]......................................... 55<br />
5.3 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGSGRUPPE B: VERÄNDERTE<br />
DISTRIBUTIONSBEDINGUNGEN............................................................................... 60<br />
6 SENSITIVITÄTSANALYSE..................................................................................... 65<br />
6.1 VARIATION DER ERFASSUNGSQUOTE FÜR <strong>PET</strong> EINWEGFLASCHEN ...................... 65<br />
6.2 VARIATION DES VERWENDETEN <strong>PET</strong>-DATENSATZES ........................................... 70<br />
6.3 VARIATION BEZÜGLICH DER ALLOKATIONSFAKTOREN IM SYSTEM ......................... 75<br />
7 NORMIERUNG ....................................................................................................... 80<br />
7.1 ERGEBNISSE DER NORMIERUNG......................................................................... 85<br />
7.2 GÜLTIGKEIT DER NORMIERUNGSERGEBNISSE ..................................................... 85<br />
8 AUSWERTUNG ...................................................................................................... 86<br />
8.1 VOLLSTÄNDIGKEIT, KONSISTENZ UND DATENQUALITÄT........................................ 86<br />
8.2 SIGNIFIKANZ DER UNTERSCHIEDE....................................................................... 87<br />
8.3 ÜBERGREIFENDE INTERPRETATION..................................................................... 88<br />
8.3.1 Vorgehen .................................................................................................. 88<br />
8.3.2 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]... 88<br />
8.3.3 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut] ...... 90<br />
8.3.4 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mit Füllgut] ...... 92<br />
8.3.4.1 Bewertung <strong>der</strong> Basisszenarien.............................................................. 92<br />
8.3.4.2 Bewertung unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Sensitivitätsanalysen............... 94<br />
8.4 CARBON FOOTPRINTS DER UNTERSUCHTEN VERPACKUNGEN.............................. 98<br />
8.5 EINSCHRÄNKUNGEN......................................................................................... 100<br />
8.5.1 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> Verpackungsspezifikationen.............. 100<br />
8.5.2 Einschränkungen durch die Auswahl <strong>der</strong> Marktsegmente...................... 100<br />
8.5.3 Einschränkungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen ......................... 100<br />
8.5.4 Einschränkungen durch die Wahl <strong>der</strong> Bewertungsmethode ................... 100<br />
8.5.5 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> län<strong>der</strong>spezifischen Gültigkeit <strong>der</strong><br />
Ergebnisse .............................................................................................. 100<br />
8.5.6 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> Distributionsdaten.............................. 101<br />
8.5.7 Einschränkung hinsichtlich <strong>der</strong> Verwertung gebrauchter Getränkeverpackungen<br />
im Ausland....................................................................... 101<br />
8.5.8 Einschränkungen bezüglich <strong>der</strong> verwendeten Daten.............................. 101<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 III<br />
9 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN.......................................... 103<br />
10 LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................. 105<br />
ANHANG I. ERLÄUTERUNG DER WIRKUNGSKATEGORIEN ................................. 108<br />
ANHANG II. DATEN ZU DEN POOL-UMLAUFZAHLEN DER GDB <strong>PET</strong>-<br />
MEHRWEGFLASCHEN ............................................................................................... 117<br />
ANHANG III. SCHLUSSBERICHT ZUR KRITISCHEN PRÜFUNG............................. 118<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 1<br />
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS<br />
AzV Abfall zur Verwertung<br />
AzB Abfall zur Beseitigung<br />
APME Association of Plastic Manufacturers in Europe<br />
CO2<br />
Kohlendioxid<br />
CSD Carbonated Soft Drinks (kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke)<br />
EDW Einwohnerdurchschnittswert<br />
EW Einweg<br />
GDB <strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong><br />
GFGH Getränkefachgroßhandel<br />
GS Gutschrift<br />
HDPE High Density Polyethylene (Polyethylen hoher Dichte)<br />
LDPE Low Density Polyethylene (Polyethylen geringer Dichte)<br />
MKS Mischkunststoffe<br />
NOx Stickoxide<br />
MW Mehrweg<br />
MVA Müllverbrennungsanlage<br />
MSWI Municipal Solid Waste Incineration (Müllverbrennung)<br />
PE Polyethylen<br />
<strong>PET</strong> Polyethylenterephthalat<br />
PP Polypropylen<br />
POCP Photooxidantienbildungspotential<br />
R-<strong>PET</strong> <strong>PET</strong>-Rezyklat<br />
ROE Rohöl-Ressourcen-Äquivalenzwert<br />
SBM Stretch Blow Molding (Streckblas-Verfahren)<br />
UBA-ll/1 Phase 1 <strong>der</strong> 2. Ökobilanz des UBA zu Getränkeverpackungen<br />
UBA-ll/2 Phase 2 <strong>der</strong> 2. Ökobilanz des UBA zu Getränkeverpackungen<br />
UBA-ll Phase 1 <strong>und</strong> Phase 2 <strong>der</strong> 2. Ökobilanz des UBA zu Getränkeverpackungen<br />
VOC flüchtige Organische Verbindungen<br />
Endbericht Oktober 2008
2 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 3<br />
1 Ziel <strong>und</strong> Rahmen <strong>der</strong> Studie<br />
1.1 Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Zielsetzung<br />
Im Zeitraum 1997 bis 2002 wurde eine umfangreiche Ökobilanz des deutschen Umweltb<strong>und</strong>esamts<br />
zu Getränkeverpackungen für Wässer, Säfte, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke<br />
<strong>und</strong> Wein durchgeführt:<br />
� UBA Getränkeökobilanz II, Teil 1 (Auftraggeber UBA; veröffentlicht in 2000)<br />
� UBA Getränkeökobilanz II, Teil 2 (Auftraggeber UBA; veröffentlicht in 2002)<br />
Die Ökobilanzergebnisse <strong>und</strong> die darauf basierende Auswertung des deutschen Umweltb<strong>und</strong>esamts<br />
sind maßgeblich in die Ausgestaltung <strong>der</strong> Verpackungsverordnung (VerpackV) eingeflossen.<br />
So wurde mit <strong>der</strong> 2. Novelle <strong>der</strong> VerpackV das Konzept <strong>der</strong> „ökologisch vorteilhaften“<br />
Getränkeverpackungen eingeführt. In <strong>der</strong> VerpackV sind <strong>der</strong>zeit <strong>der</strong> Getränkekarton, <strong>der</strong><br />
Standbodenbeutel <strong>und</strong> <strong>der</strong> PE-Schlauchbeutel unter dieser Rubrik (§ 3 (4) VerpackV) aufgeführt.<br />
Die Entscheidung über die Einstufung einer Getränkeverpackung als ökologisch vorteilhaft<br />
wird durch das B<strong>und</strong>esumweltministerium vorgenommen, wobei die Getränkeökobilanzen<br />
des deutschen Umweltb<strong>und</strong>esamtes im bisherigen Verfahren eine wichtige Informationsbasis<br />
darstellten. Bislang wurde dabei die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche als „Benchmark“ herangezogen.<br />
Nur solche Einwegverpackungen, die gesamtökologisch mit dem jeweils relevanten <strong>Glas</strong>-<br />
MW-System mindestens gleichwertig sind, erfüllen die Voraussetzung <strong>der</strong> ökologischen Vorteilhaftigkeit.<br />
Mit <strong>der</strong> 4. Novelle <strong>der</strong> VerpackV wurde die bis dahin rechtlich bindende Mehrwegquote von<br />
72% aufgegeben. An ihre Stelle trat die abfallwirtschaftliche Zielsetzung, dass „<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong><br />
in Mehrweggetränkeverpackungen sowie in ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen<br />
(MöVE) abgefüllten Getränke durch diese Verordnung gestärkt werden [soll]<br />
mit dem Ziel, einen Anteil von mindestens 80 von Hun<strong>der</strong>t zu erreichen.“<br />
Die Gesamtmehrwegquote <strong>der</strong> von <strong>der</strong> VerpackV erfassten Getränkebereiche lag im Jahr<br />
2006 bei ca. 50% [UBA 2008]. Im Bereich <strong>der</strong> Wässer liegt sie knapp über diesem Wert, im<br />
Bereich <strong>der</strong> Erfrischungsgetränke darunter (siehe auch Kapitel 2). Die B<strong>und</strong>esregierung ist<br />
allerdings gemäß §1, Abs. 2 VerpackV aufgerufen, die abfallwirtschaftlichen Auswirkungen<br />
<strong>der</strong> Regelungen <strong>der</strong> VerpackV spätestens bis zum 1. Januar 2010 zu prüfen. Die mögliche<br />
Verfehlung <strong>der</strong> Zielerreichung <strong>der</strong> genannten 80% Quote könnte erneut zu Fragen hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> aktuellen ökologischen Bewertung von Getränkeverpackungen führen.<br />
In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrfach ökobilanzielle Positionsbestimmungen<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegsysteme vorgenommen. Der Datenbestand für die <strong>PET</strong>-Einwegsysteme<br />
wurde dabei durch gezielte Erhebungen aktualisiert. Die <strong>Glas</strong>-MW-Flasche wurde in diesen<br />
Ökobilanzen wegen ihres „Benchmark-Charakters“ häufig einbezogen. Die Studien zeigten,<br />
dass sich auch die ökobilanziellen Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-MW-Flasche aufgr<strong>und</strong> aktualisierter<br />
Hintergr<strong>und</strong>daten (Stromnetz, LKW-Flotte, LKW-Emissionen) im Vergleich zur UBA-Studie<br />
verän<strong>der</strong>t haben.<br />
Da diese Studien jedoch nur sehr eingeschränkt öffentlich verfügbar sind, hat die GDB bislang<br />
keinen Zugriff auf die dort gewonnenen Erkenntnisse. Durch die Beauftragung einer eigenen<br />
Ökobilanzstudie soll <strong>der</strong> Kenntnisstand um den aktuellen ökologischen Status Quo<br />
von Mehrwegflaschen <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflaschen verbessert werden.<br />
Endbericht Oktober 2008
4 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Der Auftraggeber möchte die direkte Vergleichbarkeit mit den UBA Ökobilanzen [UBA 2000,<br />
UBA 2002] soweit wie möglich sicherstellen. Dies betrifft einerseits methodische Fragen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e die seitens des UBA angewendete Auswertestrategie <strong>und</strong> dem damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Ansatz <strong>der</strong> ökologischen Prioritätenbildung. An<strong>der</strong>erseits soll auch <strong>der</strong> in den UBA-<br />
Studien verwendete Datenpool möglichst konsistent fortgeschrieben werden.<br />
Im Einzelnen verfolgt die Studie folgende Ziele:<br />
A Vergleich <strong>der</strong> 0,7 L GDB-Mehrweg-<strong>Glas</strong>flasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> 1,0 L GDB-<strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
mit <strong>PET</strong>-Einwegflaschen im Status Quo 2007 unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Randbedingungen<br />
<strong>der</strong> UBA-Ökobilanzen.<br />
Zweck: Aktualisierung des Verpackungsvergleichs in direkter Fortschreibung <strong>der</strong> UBA-<br />
Getränkeökobilanz unter Verwendung aktualisierter Daten.<br />
B Vergleich <strong>der</strong> 0,7 L GDB-Mehrweg-<strong>Glas</strong>flasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> 1,0 L GDB-<strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
mit <strong>PET</strong>-Einwegflaschen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bereich <strong>der</strong><br />
Getränkedistributionslogistik.<br />
Zweck: Vergleich eher regionaler (tendenziell bei Mehrwegsystemen stärker ausgeprägt)<br />
mit eher zentralisierten Distributionsstrukturen (tendenziell stärker ausgeprägt bei Einwegsystemen).<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird daher zunächst im ersten Schritt auf die Methodik zurückgegriffen,<br />
die in den UBA-Getränkeökobilanzen [UBA 2000], [UBA 2002] entwickelt wurde. Im<br />
Folgeschritt wird <strong>der</strong> UBA-Ansatz auf die Fragestellung unter Punkt B angepasst.<br />
Es ist zusätzlich <strong>der</strong> Wunsch des Auftraggebers, die so genannten „Carbon Footprints“ (d.h.<br />
die Summe <strong>der</strong> Treibhausgasemissionen ausgedrückt als CO2-Äquivalente pro funktioneller<br />
Einheit) <strong>der</strong> betrachteten Verpackungssysteme geson<strong>der</strong>t gegenüber zu stellen.<br />
Die vorliegende Studie soll die Anfor<strong>der</strong>ungen einer ISO-konformen Ökobilanz nach [ISO<br />
14040 <strong>und</strong> 14044 (2006)], einschließlich einer kritischen Begutachtung, erfüllen.<br />
1.2 Organisation <strong>der</strong> Studie<br />
Die Studie wurde von <strong>der</strong> <strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong> e.G. (kurz GDB) mit Sitz in<br />
Bonn beauftragt. Der GDB als Einkaufsgenossenschaft <strong>und</strong> zentrale Dienstleistungsorganisation<br />
obliegt die rechtliche Trägerschaft <strong>der</strong> Mehrwegpools <strong>der</strong> deutschen Mineralbrunnen.<br />
Das Projekt wird vom Institut für Energie <strong>und</strong> Umweltforschung GmbH (IFEU) in Heidelberg<br />
durchgeführt. Projektbearbeiter auf Seiten des IFEU sind Andreas Detzel, Benedikt Kauertz,<br />
Frank Wellenreuther, Martina Krüger <strong>und</strong> Stefanie Busch.<br />
1.3 Critical Review-Verfahren<br />
Die Studie wird einem Critical Review nach [ISO 14040 <strong>und</strong> 14044 (2006)] unterzogen. Die<br />
Gutachter sind:<br />
� Prof. Dr. Walter Klöpffer (Vorsitzen<strong>der</strong>),<br />
Editor-in-Chief, Int. Journal of life Cycle Assessment, LCA CONSULT & REVIEW, Am<br />
Dachsberg 56E, D-60435 Frankfurt/M<br />
� Hans- Jürgen Garvens,<br />
LCA Consultant and Review, Wolfgang-Heinz-Str. 54, 13125 Berlin<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 5<br />
� Dr. Volker Lange,<br />
Ressortleiter Verpackungs- <strong>und</strong> Handelslogistik/ Auto ID <strong>und</strong> RFID- Systeme am<br />
Fraunhofer Institut für Materialfluss <strong>und</strong> Logistik, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4,<br />
44227 Dortm<strong>und</strong><br />
1.4 Anwendung <strong>und</strong> Zielgruppen <strong>der</strong> Studie<br />
Die Studie richtet sich in erster Linie an den Auftraggeber <strong>und</strong> die von ihm vertretenen Mitgliedsbetriebe.<br />
Die Erkenntnisse aus <strong>der</strong> vorliegenden Studie sollen zudem einen sachorientierten<br />
Dialog über die ökologische Bewertung <strong>der</strong> untersuchten Getränkeverpackungen<br />
ausgehend von einer aktuellen Datengr<strong>und</strong>lage för<strong>der</strong>n. Zielgruppen sind daher sowohl die<br />
interessierten Öffentlichkeit auch die politischen Entscheidungsträger auf Landes- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esebene.<br />
Da die B<strong>und</strong>esebene zudem in den legislativen Kontext <strong>der</strong> Europäischen Union eingeb<strong>und</strong>en<br />
ist, müssen die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie auch im europäischen Zusammenhang Bestand<br />
haben. Daher soll die vorliegende Ökobilanz so gestaltet sein, dass <strong>der</strong> direkte Bezug zur<br />
UBA-Getränkeökobilanz ggf. auch für die politischen Entscheidungsgremien <strong>der</strong> Europäischen<br />
Union erkennbar wird. Die verwendeten Sachbilanz-Daten sollen daher auch für die<br />
europäischen Entscheidungsgremien nachvollziehbar sein.<br />
1.5 Betrachtete Produktsysteme<br />
Die GDB Mitgliedsfirmen füllen fast ausschließlich kohlensäurehaltige Wässer <strong>und</strong> Erfrischungsgetränke<br />
ab. Bezogen auf das Abfüllvolumen sind die 0,7 L Mehrweg-<strong>Glas</strong>flasche<br />
sowie die 1,0 L Mehrweg-<strong>PET</strong>-Flasche als Hauptgebinde anzusehen. Beide Gebinde sind<br />
gemäß <strong>der</strong> Nomenklatur <strong>der</strong> [UBA-Ökobilanz] als Gebinde zur Vorratshaltung eingestuft.<br />
Unter <strong>PET</strong>-Einwegflaschen werden hier ganz allgemein nach Gebrauch nicht wie<strong>der</strong> befüllte<br />
Getränkeverpackungen aus <strong>PET</strong> verstanden. Im Einzelnen kann man aber zwischen den<br />
Stoffkreislaufsystemen <strong>und</strong> den eigentlichen <strong>PET</strong>-Einwegsystemen unterscheiden.<br />
� Stoffkreislaufsysteme: hier gelangen bepfandete <strong>PET</strong>-Einweg-Getränkeflaschen eingestellt<br />
in Kästen nach Gebrauch wie<strong>der</strong> zum Abfüller <strong>und</strong> von dort in die Verwertung.<br />
Die betrachteten Systeme beruhen auf den Gr<strong>und</strong>lagen des durch <strong>PET</strong>CYCLE<br />
organisierten Stoffkreislaufsystems. Als Synonym wird häufig auch <strong>der</strong> Begriff „Zweiwegsystem“<br />
verwendet. Im Text werden diese Systeme als „SK-Systeme“ (SK steht<br />
für Stoffkreislauf) bezeichnet.<br />
� <strong>PET</strong>-Einwegsysteme mit Pfand nach Maßgabe <strong>der</strong> Verpackungsverordnung: hier<br />
werden bepfandete <strong>PET</strong>-Getränkeflaschen unterschiedlicher Herkunft nach<br />
Gebrauch im Rahmen eines b<strong>und</strong>esweit einheitlichen Rücknahmesystems erfasst<br />
<strong>und</strong> von dort an die Verwerter weitergegeben.<br />
Die jeweiligen Hauptgebinde <strong>der</strong> beiden Systemtypen im Bereich <strong>der</strong> Vorratshaltung sind die<br />
1,0 L <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf-Flasche sowie die 1,5 L <strong>PET</strong>-Einweg Flasche (s.a. Kapitel 2).<br />
Endbericht Oktober 2008
6 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Nachfolgend sind die in <strong>der</strong> vorliegenden Studie untersuchten Verpackungssysteme zusammengestellt:<br />
1. 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (GDB <strong>Glas</strong>-MW 0,7 L)<br />
2. 1,0 L <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf-Flasche (<strong>PET</strong>-SK 1,0 L)<br />
3. 1,5 L <strong>PET</strong>-Einweg Flasche (<strong>PET</strong>-EW 1,5 L)<br />
4. 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche (GDB <strong>PET</strong>-MW 1,0 L)<br />
1.6 Funktionelle Einheit<br />
Als funktionelle Einheit wird analog zu den vorausgegangenen UBA-Ökobilanzen<br />
[UBA 2000], [UBA 2002] die Bereitstellung von 1000 L Füllgut im Handel (d.h. am Verkaufs-<br />
ort) definiert.<br />
Zum Referenzfluss eines Produktsystems gehört die eigentliche Getränkeverpackung, also<br />
<strong>Glas</strong>- bzw. <strong>PET</strong>-Flasche, die Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse sowie die Transportverpackungen<br />
(Kästen für Mehrweg- <strong>und</strong> Stoffkreislaufgebinde, Wellpappe-Trays <strong>und</strong> Schrumpffolie für<br />
Einweggebinde, Paletten), die zum Befüllen <strong>und</strong> zur Auslieferung von 1000 L Füllgut erfor<strong>der</strong>lich<br />
sind.<br />
1.7 Lebensweg <strong>und</strong> Systemgrenzen<br />
Die Ökobilanz betrachtet die potentiellen ökologischen Auswirkungen <strong>der</strong> Verpackungskomponenten<br />
„von <strong>der</strong> Wiege bis zur Bahre“, d.h. von <strong>der</strong> Extraktion <strong>der</strong> Rohstoffe über <strong>der</strong>en<br />
Verarbeitung zu Packstoffen <strong>und</strong> Verpackungen, inklusive <strong>der</strong> Transportprozesse bis hin zur<br />
Entsorgung.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie werden daher explizit folgende Stufen <strong>der</strong> Produktlinie berücksichtigt,<br />
wobei immer vom bestimmungsgemäßen Betrieb <strong>der</strong> Anlagen ausgegangen wird:<br />
• Herstellung, Recycling <strong>und</strong> Entsorgung <strong>der</strong> Getränkeverpackung<br />
• Herstellung, Recycling <strong>und</strong> Entsorgung <strong>der</strong> Transportverpackungen wie Kästen, Wellpappe-Trays,<br />
Folien sowie Holzpaletten<br />
• Herstellung <strong>und</strong> Entsorgung von Betriebs- <strong>und</strong> Hilfsstoffen, soweit sie nicht unter das Abschneidekriterium<br />
(s.u.) fallen<br />
• Das Abfüllen des Getränks<br />
• Die Distribution vom Abfüller zum Verkaufsort („Point of Sale“)<br />
• Die Redistribution des Leergutes vom Verkaufsort (Point of Sale) zum Abfüller (Mehrweg<br />
<strong>und</strong> Stoffkreislauf) bzw. zum Recycling (Einweg)<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 7<br />
Nicht berücksichtigt werden:<br />
• Herstellung <strong>und</strong> Entsorgung <strong>der</strong> Infrastruktur (Maschinen, Aggregate, Transportmittel)<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong>en Unterhalt<br />
• Herstellung des jeweiligen Füllguts<br />
• Umweltwirkungen, die sich aus Aktivitäten des Verbrauchers ergeben (Transportfahrten<br />
zum Handel, Kühlprozesse)<br />
• Umweltwirkungen, die sich aus Kühlprozessen ergeben<br />
• Umweltwirkungen durch Getränkeverlust als Folge von beschädigten Verpackungen<br />
• Umweltwirkungen durch Unfälle<br />
• Getränkeverluste an unterschiedlichen Stellen <strong>der</strong> Prozesskette (Getränkeverluste können<br />
zum Beispiel beim Abfüllprozess, während Transport <strong>und</strong> Lagerung o<strong>der</strong> beim Konsumenten<br />
auftreten. Es stehen im Rahmen dieser Studie keine belastbaren Daten zu Getränkeverlusten<br />
zu Verfügung.<br />
• Umweltauswirkungen die sich durch den Export von Sek<strong>und</strong>ärmaterialien über den in<br />
Kapitel 1.8.2 definierten geographischen Bezug <strong>der</strong> Studie hinaus ergeben (z.B. Umweltauswirkungen<br />
in China durch Verarbeitung gebrauchter <strong>PET</strong>-Einwegflaschen). Demnach<br />
werden in <strong>der</strong> vorliegenden Studie die Annahmen zur Verwertung so bilanziert, als würde<br />
sie in Europa stattfinden. Der Mengenstrom <strong>der</strong> gebrauchten Getränkeverpackungen<br />
verbleibt somit modellierungstechnisch in den Grenzen des geographischen Bezugs <strong>der</strong><br />
Studie.<br />
Die „Lebenswege“ <strong>der</strong> Produktsysteme mit den verschiedenen Stufen von <strong>der</strong> Rohstoffgewinnung<br />
bis zur Abfallentsorgung werden als Prozessketten mit bestimmten Prozess-<br />
Spezifikationen abgebildet. Ein Produktsystem wird erst durch Systemparameter im Lebensweg,<br />
z.B. Distributionsentfernungen o<strong>der</strong> Recyclingquoten, eindeutig bestimmt. Diese sind<br />
ergebnisrelevant für das Produktsystem <strong>und</strong> müssen bei Vergleichen stets mit berücksichtigt<br />
werden. Die Produktsysteme beschreiben also das gesamte Produktions-, Konsumtions- <strong>und</strong><br />
Entsorgungssystem des Produktes innerhalb <strong>der</strong> Systemgrenzen des Lebensweges.<br />
Das Ziel ist es, Inputmaterialien in Produktsystemen zu berücksichtigen, wenn sie im jeweiligen<br />
Teilprozess des Lebensweges mehr als 1 % <strong>der</strong> Masse des Outputs in dem Prozess<br />
umfassen. Gleichzeitig sollte aber die Summe <strong>der</strong> vernachlässigten Stoffmengen bei einem<br />
Prozess nicht mehr als 5% des Outputs betragen.<br />
Alle Energieflüsse werden vollständig berücksichtigt. Das Abschneidekriterium wird ebenfalls<br />
nicht auf umweltintensive aber nicht massenrelevanter Prozesse angewendet. Das heißt,<br />
Stoffflüsse die bekannte toxische Substanzen enthalten werden auch dann nicht vernachlässigt,<br />
wenn sie weniger als 1% <strong>der</strong> Masse darstellen. Die Einschätzung <strong>der</strong> Umweltrelevanz<br />
<strong>der</strong> Materialströme basiert auf Expertenmeinung.<br />
Gemäß <strong>der</strong> UBA-Methode schließen die Systemgrenzen nur die auf das Verpackungsmaterial<br />
zurückgehenden Umweltbelastungen ein. Diese Vorgehensweise ist dann möglich, wenn<br />
– wie in <strong>der</strong> UBA-Studie – die Transportentfernungen <strong>der</strong> Einweg- <strong>und</strong> Mehrwegsysteme als<br />
gleich angesehen werden. In <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A dieser Studie ist dies entsprechend<br />
umgesetzt.<br />
In dem Untersuchungsbereich zur Untersuchungsgruppe B (vgl. Kapitel 3.4) sind jedoch die<br />
Aufwendungen des Füllguttransports zum Verkaufsort berücksichtigt. Diese methodische<br />
Endbericht Oktober 2008
8 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Än<strong>der</strong>ung steht im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Annahme, dass sich in den vergangenen Jahren<br />
unterschiedliche Distributionsentfernungen für Einweg- bzw. Mehrwegsysteme eingestellt<br />
haben (siehe Kapitel 4.7). Letzteres bedingt die Berücksichtigung des Füllguttransports aus<br />
Symmetriegründen.<br />
Insgesamt umfasst <strong>der</strong> Bilanzraum auch die Sammlung <strong>und</strong> Aufbereitung gebrauchter Verpackung.<br />
Für die dabei entstehenden Sek<strong>und</strong>ärmaterialien <strong>und</strong> Nutzenergie aus <strong>der</strong> thermischen<br />
Abfallverwertung erfolgen Gutschriften (vgl. Kap. 1.9.2). Die jeweiligen Systemgrenzen<br />
<strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme sind in vereinfachter Form in den Stoffflussbil<strong>der</strong>n<br />
im Kapitel 3.3 ersichtlich.<br />
Die beschriebenen Festlegungen zu Lebensweg <strong>und</strong> Systemgrenzen stehen, ergänzt um die<br />
Allokation im Bereich des open-Loop Recyclings (vgl. Kap. 1.9.2) sowie <strong>der</strong> Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Aufwendungen für den Transport des Füllguts zum Verkaufsort (vgl. Kapitel 3.4), in Einklang<br />
mit dem Vorgehen in den UBA-Ökobilanzen [UBA 2000], [UBA 2002].<br />
1.8 Datenerhebung <strong>und</strong> Datenqualität<br />
Durch die Anlehnung an die UBA-Methodik ergeben sich Anfor<strong>der</strong>ungen, was die zu berücksichtigenden<br />
Datenkategorien angeht. Gr<strong>und</strong>sätzlich müssen hier all jene Input- <strong>und</strong> Outputflüsse<br />
<strong>der</strong> Produktsysteme erfasst werden, die einen relevanten Beitrag zu den in den<br />
UBA Ökobilanzen betrachteten ökologischen Wirkungskategorien leisten.<br />
Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für die allgemeinen Datensätze <strong>der</strong> Energiebereitstellung, Transporte,<br />
Entsorgung <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stoffherstellung. An<strong>der</strong>erseits wird auch bei in dieser Studie neu hinzugekommenen<br />
bzw. überarbeiteten Prozessdatensätzen auf eine vergleichbare Datenqualität<br />
<strong>und</strong> Datensymmetrie geachtet.<br />
An die in dieser Studie neu erhobenen Daten wird die Anfor<strong>der</strong>ung gestellt, möglichst vollständig,<br />
konsistent <strong>und</strong> nachvollziehbar zu sein. Diese Aspekte sollen sowohl bei <strong>der</strong> Datenerhebung<br />
<strong>und</strong> Prozessmodellierung sowie <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> Daten <strong>und</strong> Ergebnisse berücksichtigt<br />
werden. Im Rahmen dieser Studie wurden alle Daten aktualisiert, im Bereich <strong>der</strong><br />
Verpackungszusammensetzung <strong>und</strong> – gewichte sowie die Abfüll- <strong>und</strong> Distributionsprozesse<br />
wurde eine vollständige Neuerhebung durchgeführt.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich erfolgt eine Plausibilitätskontrolle aller empirischen Daten. Sie werden mit Literaturdaten<br />
<strong>und</strong> dem IFEU intern vorliegenden Daten abgeglichen.<br />
Eine Schwierigkeit ist die Beurteilung <strong>der</strong> Genauigkeit von Datensätzen, da die Prozessdaten<br />
meist nicht mit Streu- bzw. Fehlerbreiten o<strong>der</strong> Standardabweichungen verfügbar sind. Die<br />
Beurteilung basiert damit im Wesentlichen auf qualitativem Expertenwissen. Zur deskriptiven<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Daten sollen daher verfügbare Informationen wie etwa <strong>der</strong> Durchschnitt einer<br />
verwendeten Technologie, das Bezugsjahr usw. herangezogen werden. Man erhält damit vor<br />
allem Auskunft zur Repräsentativität <strong>der</strong> Daten.<br />
Eine ausführlichere Beschreibung <strong>der</strong> in dieser Studie speziell bearbeiteten bzw. beson<strong>der</strong>s<br />
relevanten Daten <strong>und</strong> Datensätze befindet sich im Kapitel 3 (Verpackungsspezifikationen)<br />
<strong>und</strong> Kapitel 4 (insbeson<strong>der</strong>e Prozessdatensatz Abfüllung <strong>und</strong> Daten zur Distributionsstruktur).<br />
Darüber hinaus gibt es Anfor<strong>der</strong>ungen an den zeitbezogenen, geographischen <strong>und</strong> technologischen<br />
Erfassungsbereich, die nachfolgend aufgeführt sind.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 9<br />
1.8.1 Zeitlicher Bezug<br />
Für den Verpackungsvergleich sollen die Verpackungen herangezogen werden, die im Bezugszeitraum<br />
2006/2007 auf dem deutschen Markt waren. Die verwendeten Gewichte <strong>und</strong><br />
die Materialzusammensetzung <strong>der</strong> untersuchten Verpackungen soll dies angemessen wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Für Prozessdaten gilt ein Bezugszeitraum zwischen den Jahren 2002 <strong>und</strong> 2005. Das heißt,<br />
es wird angestrebt, dass die Gültigkeit <strong>der</strong> verwendeten Daten auf den genannten Zeitraum<br />
zutrifft bzw. möglichst nahe an diesen Zeitpunkt heranreicht.<br />
1.8.2 Geographischer Bezug<br />
Der geographische Rahmen dieser Studie ist die Verpackungsherstellung, Distribution <strong>und</strong><br />
Verpackungsentsorgung in Deutschland.<br />
Einige <strong>der</strong> in den betrachteten Verpackungssystemen verwendeten Rohmaterialien werden<br />
auf einem europaweiten Markt produziert, gehandelt <strong>und</strong> von dort auch durch die deutsche<br />
Industrie bezogen. Für solche Materialien werden europäische Durchschnittsdaten verwendet.<br />
Beispiele dafür sind insbeson<strong>der</strong>e die Rohstoffe Aluminiumbarren- bzw. Aluminiumband<br />
<strong>und</strong> Kunststoffe (Polyolefine, <strong>PET</strong>).<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Herstellung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einweg- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>–Mehrwegflaschen sowie <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflaschen sowie hinsichtlich <strong>der</strong> Befüllung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Distribution werden die Prozessdaten<br />
so modelliert, als wären die entsprechenden Prozesse ausschließlich in Deutschland<br />
angesiedelt (z.B: Für die Verpackungsherstellung wird ein deutscher Strommix angesetzt).<br />
Der in <strong>der</strong> Realität zu einem gewissen Maß stattfindende Getränkeimport <strong>und</strong> -export wird<br />
nicht berücksichtigt.<br />
1.8.3 Technologischer Bezug<br />
Die verwendeten Daten sollen nach Möglichkeit einen mittleren Stand <strong>der</strong> Prozesstechnik<br />
wi<strong>der</strong>spiegeln. Bei den in dieser Studie erhobenen Daten sollen entwe<strong>der</strong> entsprechende<br />
Mittelwerte gebildet werden o<strong>der</strong>, wenn dies nicht möglich ist, eine qualitative Einschätzung<br />
zum abgebildeten Standard vorgenommen werden.<br />
1.9 Allokation<br />
Die Modellierung <strong>der</strong> betrachteten Produktsysteme erfor<strong>der</strong>t an verschiedenen Stellen die<br />
Anwendung so genannter Allokationsregeln (Zuordnungsregeln). Dabei sind zwei systematische<br />
Ebenen zu unterscheiden: Eine Allokation kann auf <strong>der</strong> Ebene einzelner Prozesse innerhalb<br />
des untersuchten Produktsystems o<strong>der</strong> zwischen dem untersuchten Produktsystem<br />
<strong>und</strong> vor- bzw. nachgelagerten Produktsystemen erfor<strong>der</strong>lich sein.<br />
Im Fall <strong>der</strong> prozessbezogenen Allokationen werden Multi-Input- <strong>und</strong> Multi-Output-Prozesse<br />
unterschieden. Die Frage <strong>der</strong> systembezogenen Allokation stellt sich dann, wenn ein Produktsystem<br />
neben dem eigentlichen, über die funktionelle Einheit abgebildeten Nutzen, weitere<br />
Zusatznutzen erbringt. Dies ist <strong>der</strong> Fall, wenn das untersuchte Produktsystem Energie-<br />
<strong>und</strong> Materialflüsse für an<strong>der</strong>e Produktsysteme bereitstellt o<strong>der</strong> Abfälle verwertet. Bei systembezogenen<br />
Allokationsvorgängen im Kontext eines open-loop Recyclings werden gemäß<br />
ISO 14044, § 4.3.4.3.1 die gleichen Allokationsprinzipien wie bei <strong>der</strong> prozessbezogenen Allokation<br />
angewandt.<br />
Endbericht Oktober 2008
10 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
1.9.1 Allokation auf Prozessebene<br />
Multi-Output-Prozesse<br />
Diese Form <strong>der</strong> Allokation ist erfor<strong>der</strong>lich, wenn in einem Prozess Kuppelprodukte entstehen,<br />
von denen jedoch nur eines im betrachteten Produktsystem verwendet wird. Ein viel zitiertes<br />
Beispiel ist die Chloralkalielektrolyse mit den Kuppelprodukten Natriumhydroxid, Chlorgas<br />
<strong>und</strong> Wasserstoff. Natriumhydroxid wird etwa beim Recycling von <strong>PET</strong>-Flaschen eingesetzt.<br />
Würde das Kuppelprodukt Natriumhydroxid die ganze Last <strong>der</strong> Herstellung tragen, würde<br />
auch das <strong>PET</strong>-Flaschensystem entsprechend stark belastet werden. Die Umweltlasten <strong>der</strong><br />
Elektrolyse müssen also in „fairer“ Weise zwischen den Kuppelprodukten aufgeteilt werden,<br />
damit auch die Produktsysteme, in denen Chlorgas bzw. Wasserstoff eingesetzt wird, entsprechende<br />
Anteile <strong>der</strong> Umweltlast tragen.<br />
Bei von den Verfassern <strong>der</strong> Studie selbst erstellten Datensätzen erfolgt die Allokation <strong>der</strong><br />
Outputs aus Kuppelprozessen in <strong>der</strong> Regel über die Masse (z.B. für Raffinerieprodukte wie<br />
schweres Heizöl). Bei einigen <strong>der</strong> Literatur entnommenen Datensätzen wird auch <strong>der</strong> Heizwert<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Marktwert als Allokationskriterium verwendet (z.B. <strong>der</strong> Heizwert bei PlasticsEurope<br />
Daten für Kunststoffe). Die jeweiligen Allokationskriterien werden, soweit sie für einzelne<br />
Datensätze von beson<strong>der</strong>er Bedeutung sind, in <strong>der</strong> Datenbeschreibung dokumentiert. Bei<br />
Literaturdaten wird in <strong>der</strong> Regel nur auf die entsprechende Quelle verwiesen.<br />
Multi-Input-Prozesse<br />
Multi-Input-Prozesse finden sich insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Entsorgung. Entsprechende<br />
Prozesse werden daher so modelliert, dass die durch die Entsorgung <strong>der</strong> gebrauchten Packstoffe<br />
anteilig verursachten Stoff- <strong>und</strong> Energieflüsse diesen möglichst kausal zugeordnet<br />
werden können. Die Modellierung <strong>der</strong> Beseitigung von zu Abfall gewordenen Packstoffen in<br />
einer Müllverbrennungsanlage ist das typische Beispiel einer Multi-Input-Zuordnung. Für die<br />
Ökobilanz selbst sind dabei diejenigen In- <strong>und</strong> Outputs von Belang, die ursächlich auf die<br />
Verbrennung <strong>der</strong> Packstoffe zurückgeführt werden können. Entsprechend <strong>der</strong> einleitenden<br />
Ausführungen zur prozessbezogenen Allokation werden hier vor allem physikalische Beziehungen<br />
zwischen Input <strong>und</strong> Output verwendet 1 .<br />
1 für eine detaillierte Beschreibung <strong>der</strong> Zuordnung von Input/Output am Beispiel <strong>der</strong> Abfallverbrennung siehe [UBA 2000], S. 82<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 11<br />
Transportprozesse zur Distribution<br />
Bei <strong>der</strong> Modellierung <strong>der</strong> Distribution gefüllter Verpackungen wurden bei den UBA-Studien<br />
[UBA 2000], [UBA 2002] die Umweltlasten zwischen Verpackung <strong>und</strong> Füllgut unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Auslastung des Transportfahrzeugs alloziert. Das genaue Vorgehen ist in [U-<br />
BA 2000] dokumentiert.<br />
In den Szenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A (vgl. Kapitel 3.4.1), wurde diese Vorgehensweise<br />
ebenfalls gewählt, um eine methodische Vergleichbarkeit mit den UBA-Ökobilanz-<br />
Ergebnissen sicherzustellen.<br />
In <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B wird <strong>der</strong> Transport des Füllguts mitbetrachtet. Daher entfällt<br />
hier die Notwendigkeit <strong>der</strong> Allokation.<br />
1.9.2 Allokation auf Systemebene<br />
Die Notwendigkeit einer systembezogenen Allokation stellt sich, wenn das ursprünglich betrachtete<br />
Produkt, also beispielsweise die <strong>PET</strong>-Einweg-Flasche, nach dem Gebrauch einen<br />
Zusatznutzen erbringt, <strong>der</strong> über den in <strong>der</strong> funktionellen Einheit abgebildeten Nutzen hinaus<br />
geht. So wird bei <strong>der</strong> Aufbereitung gebrauchter <strong>PET</strong>-Flaschen <strong>PET</strong>-Rezyklat gewonnen, welches<br />
für an<strong>der</strong>e Produktsysteme bereitgestellt wird, beispielsweise für die Herstellung von<br />
<strong>PET</strong>-Fasern für Bekleidung. Da das Sek<strong>und</strong>ärmaterial in einem an<strong>der</strong>en als dem ursprünglichen<br />
Produktsystem verwendet wird, spricht man von open-loop Recycling (offener Kreislauf).<br />
In dieser Studie erfolgt die Allokation von systembedingten Kuppelprodukten nach <strong>der</strong><br />
„50:50“-Methode, die auch als Standardverfahren in [UBA 2002] angewendet wurde. Dabei<br />
wird <strong>der</strong> Nutzen für Sek<strong>und</strong>ärmaterialien im Verhältnis 50:50, also paritätisch, zwischen dem<br />
abgebenden <strong>und</strong> dem aufnehmenden System aufgeteilt. Im Fall einer werkstofflichen Verwertung<br />
von <strong>PET</strong>-Flaschen besteht <strong>der</strong> Nutzen im Ersatz von primärem <strong>PET</strong> aus Erdöl. Dem<br />
<strong>PET</strong>-Einwegsystem wird dieser Nutzen bilanztechnisch in Form einer Gutschrift angerechnet.<br />
Die Höhe <strong>der</strong> Gutschrift beträgt dabei 50% des Massenanteils <strong>der</strong> durch den Einsatz<br />
von <strong>PET</strong>-Rezyklat substituierten Primär-<strong>PET</strong>-Herstellung.<br />
Die Festlegung von Allokationsfaktoren, beson<strong>der</strong>s im Fall einer Systemallokation, lässt sich<br />
nicht alleine mit wissenschaftlichen Erwägungen begründen, son<strong>der</strong>n stellt eine Konvention<br />
dar, in die auch Werthaltungen einfließen. Zur Beurteilung <strong>der</strong> Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> gewählten<br />
Standardverfahrens wird in Sensitivitätsszenarien a) eine 0% Allokation, d.h. ohne Berücksichtigung<br />
von Sek<strong>und</strong>ärnutzen, sowie b) eine 100:0-Allokation angewendet. Im letzteren<br />
Fall werden Gutschriften für Sek<strong>und</strong>ärmaterialien vollständig dem abgebenden System<br />
zugeordnet.<br />
In Abhängigkeit vom Allokationsverfahren sind bestimmte Lenkungswirkungen zu erwarten.<br />
So wird bei <strong>der</strong> 50:50-Methode sowohl den abgebenden als auch aufnehmenden Systemen<br />
<strong>der</strong> gleiche ökobilanzielle Anreiz zu verstärktem Recycling gegeben. Bei <strong>der</strong> 100%-Methode<br />
liegt <strong>der</strong> Nutzen aus <strong>der</strong> Abfallverwertung fast ausschließlich beim abgebenden System.<br />
Entsprechend ergeben sich Anreize zu verstärktem Recycling auch beson<strong>der</strong>s auf Seiten <strong>der</strong><br />
abgebenden Systeme.<br />
Die Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Allokationsverfahren wurde im Kap. 6.3 anhand <strong>der</strong><br />
Untersuchungsgruppe B geprüft.<br />
Endbericht Oktober 2008
12 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird <strong>der</strong> ursprüngliche UBA-Ansatz jedoch dahin gehend modifiziert,<br />
dass nunmehr auch <strong>der</strong> Bereich „Entsorgung“ im Lebenszyklus 2 (LZ 2) des Sek<strong>und</strong>ärprodukts<br />
in <strong>der</strong> Allokationsmethode berücksichtigt wird. Zur besseren Nachvollziehbarkeit<br />
wird dies anhand <strong>der</strong> Abbildungen 1-1 bis 1-5 kurz skizziert.<br />
Generelle Anmerkungen bzgl. <strong>der</strong> Abbildungen 1-1 bis 1-5<br />
Die folgenden Abbildungen 1-1 bis 1-5 dienen dem generellen Verständnis <strong>der</strong> Allokationsprozesse<br />
<strong>und</strong> stellen eine Vereinfachung des tatsächlichen Sachverhaltes dar. Die Abbildungen<br />
dienen dazu:<br />
� den Unterschied zwischen <strong>der</strong> 0% Allokation, <strong>der</strong> 50% Allokation <strong>und</strong> <strong>der</strong> 100% Allokation<br />
zu verdeutlichen <strong>und</strong><br />
� darzustellen, welche Prozesse <strong>der</strong> Allokation unterliegen 2 :<br />
o Primärmaterialproduktion<br />
o Recycling-/ Verwertungsprozess<br />
o Restabfallbehandlung/ Beseitigung (hier MVA)<br />
Über die hier gezeigten Vereinfachungen hinaus bilden jedoch die zugr<strong>und</strong>e liegenden Systemmodelle<br />
eine tatsächliche <strong>und</strong> realistische Situation ab. So sind zum Beispiel im verwendeten<br />
Berechnungsmodell die realen Recyclingströme <strong>und</strong> die reale Recyclingeffizienz modelliert.<br />
Zudem werden in Abhängigkeit des substituierten Materials verschiedene Substitutionsfaktoren<br />
angesetzt.<br />
Aus Gründen <strong>der</strong> Vereinfachung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Übersichtlichkeit sind folgende Aspekte nicht explizit<br />
in den Abbildungen 1-1 bis 1-5 dokumentiert:<br />
� Materialverluste in den Systemen A <strong>und</strong> B. Für die dargestellten werden die Materialverluste<br />
(z.B. Produktionsabfall o<strong>der</strong> Feinabrieb beim <strong>PET</strong>-Recycling) <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Verwertung<br />
<strong>und</strong>/ o<strong>der</strong> Beseitigung bilanziert.<br />
� Nicht alle Materialströme gehen geschlossen in System B. Konsequenterweise werden<br />
nur die Aufwendungen <strong>der</strong> tatsächlich recycelten Stoffströme einer Allokation unterzogen.<br />
� Materialströme die direkt einer Beseitigung zu geführt werden unterliegen nicht <strong>der</strong><br />
Allokation. Diese sind in den Abbildungen nicht dargestellt<br />
� In den Abbildungen wird aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Vereinfachung nur <strong>der</strong> Substitutionsfaktor 1<br />
verwendet. In <strong>der</strong> Tat kann das Modell aber auch Substitutionsfaktoren kleiner 1 für<br />
die Berechnung anwenden, wenn diese vorkommen.<br />
� Ebenfalls nicht dargestellt ist die Tatsache, dass auch ein komplett an<strong>der</strong>es Material<br />
substituiert werden kann (z.B. Holz statt Plastik).<br />
� Die Restabfallbehandlung in System B ist ausschließlich als Beseitigung in <strong>der</strong> MVA<br />
dargestellt. Tatsächlich wäre aber auch ein Splitt zwischen MVA <strong>und</strong> Deponie möglich.<br />
2 vgl. ISO 14044 (2006) §4.3.4.3.2: "reuse and recycling ... may imply that the inputs and outputs associated with unit processes<br />
for final disposal of products are to be shared by more than one product system"<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 13<br />
Nicht gekoppelte Systeme<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
Produkt A<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-A)<br />
MVA<br />
(MVA-A)<br />
System A:<br />
MP-A + Pr-A + MVA-A<br />
Abbildung 1-1: Schema für nicht gekoppelte Systeme<br />
Gekoppelte Systeme (Systemraumerweiterung)<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
Produkt A<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-A)<br />
MVA<br />
(MVA-A)<br />
System A:<br />
MP-A + Pr-A<br />
Recycling<br />
Recycling<br />
(Rec)<br />
(Rec)<br />
Lastschrift System A + B:<br />
MP-A + Pr-A + Pr-B + MVA-B<br />
vermiedene Lastschrift:<br />
MVA-A + MP-B<br />
zusätzlicher Prozess:<br />
+ Rec<br />
Abbildung 1-2: Schema für gekoppelte Systeme<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-B)<br />
Produkt B<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-B)<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B:<br />
MP-B + Pr-B+ MVA-B<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-B)<br />
Produkt B<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-B)<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B:<br />
Pr-B+ MVA-B
14 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Allokation: 50% Ansatz<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
Produkt A<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-A)<br />
MVA<br />
(MVA-A)<br />
System A:<br />
0.5*MP-A + Pr-A+ 0.5*Rec-A<br />
+ 0.5*MVA-B<br />
System A<br />
+50% +50%<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
+50% +50%<br />
Recycling<br />
(Rec-A)<br />
+50% +50%<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B<br />
Abbildung 1-3: Schema für gekoppelte Systeme 50% Allokation<br />
Modellierung: Allokation; inkl. Entsorgung im 2. Lebenszyklus („System B“)<br />
Allokation: 100% Ansatz<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
Produkt A<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-A)<br />
MVA<br />
(MVA-A)<br />
System A:<br />
Pr-A+ Rec-A + MVA-B<br />
System A<br />
+0% +100%<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
+100% +0%<br />
Recycling<br />
(Rec-A)<br />
+100% +0%<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B<br />
Abbildung 1-4: Schema für gekoppelte Systeme 100% Allokation<br />
Modellierung: Allokation; inkl. Entsorgung im 2. Lebenszyklus („System B“)<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-B)<br />
Produkt B<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-B)<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B:<br />
0.5*MP-A+0.5*Rec-A + Pr-B +<br />
0.5*MVA-B<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-B)<br />
Produkt B<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-B)<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B:<br />
MP-A + Pr-B
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 15<br />
Allokation: 0% Ansatz<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
Produkt A<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-A)<br />
MVA<br />
(MVA-A)<br />
System A:<br />
MP-A + Pr-A<br />
System A<br />
+100% +0%<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-A)<br />
+0% +100%<br />
Recycling<br />
(Rec-A)<br />
+0% +100%<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B<br />
Abbildung 1-5: Schema für gekoppelte Systeme 0% Allokation<br />
Modellierung: Allokation; inkl. Entsorgung im 2. Lebenszyklus („System B“)<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Material<br />
Produktion<br />
(MP-B)<br />
Produkt B<br />
Produktion &<br />
Gebrauch<br />
(Pr-B)<br />
MVA<br />
(MVA-B)<br />
System B:<br />
Rec-A + Pr-B + MVA-B<br />
Wie in Abb. 1-1 dargestellt geht man zunächst von zwei jeweils voneinan<strong>der</strong> unabhängigen<br />
Systemen A <strong>und</strong> B aus. Jedes System hat für sich Materialherstellung, Produktion des Produktes<br />
<strong>und</strong> Beseitigung zu tragen. Der in System A aus Abfall gewinnbare Wertstoff wird<br />
hierbei in <strong>der</strong> Bilanzierung nicht weiter berücksichtigt.<br />
Wird <strong>der</strong> Wertstoff aus System A jedoch in System B wie<strong>der</strong>verwertet, wie in Abb. 1-2 dargestellt,<br />
so entfällt die Herstellung <strong>der</strong> entsprechenden Menge Primärmaterial („MP-B“) in System<br />
B, allerdings muss zusätzlich die Aufbereitung des Wertstoffs im Zuge des Recyclings<br />
(Rec-A) erfolgen.<br />
Durch das Recycling entfällt ebenfalls die Beseitigung von Produkt A im System A. Eine Beseitigung<br />
des aus Produkt A zurück gewonnenen Materials wird jedoch in System B fällig (es<br />
wird hierbei vorausgesetzt, dass nach <strong>der</strong> Nutzung in System B kein weiterer Nutzungszyklus<br />
erfolgt). Zur konsistenten Betrachtung des Stoffstroms wäre also auch die Beseitigung<br />
des Materials im zweiten Lebenszyklus in die Allokation einzubeziehen.<br />
In den UBA-Ökobilanzen geschah dies aus Aufwandsgründen nicht. Es galt das so genannte<br />
“one-step-forward/one-step-back” Prinzip. Dieses Prinzip meint, dass immer nur ein Schritt<br />
weiter bilanziert wird. Dies betrifft die Substitution von Primärmaterial durch Sek<strong>und</strong>ärmaterial.<br />
In <strong>der</strong> Ökobilanz wird dies in Form einer Gutschrift anrechnet. Der weitere Lebensweg<br />
wird jedoch nicht berücksichtigt. Damit kann <strong>der</strong> Aufwand zur Modellierung <strong>der</strong> Allokation<br />
deutlich limitiert werden.<br />
Enthält <strong>der</strong> Vergleich von Produkten implizit einen Vergleich von Materialien aus nachwachsenden<br />
<strong>und</strong> fossilen Rohstoffen kann dieser Ansatz unter Umständen zu kurz greifen <strong>und</strong> zu<br />
Asymmetrien, beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Kohlenstoff-Bilanz, führen.<br />
Daher wurde die Allokationsvorschrift um die Abfallverbrennung im zweiten Lebenszyklus<br />
(LZ 2) ergänzt. Das entsprechende Vorgehen <strong>und</strong> die Rechenvorschrift sind in <strong>der</strong> Abb. 1-3<br />
bis 1-5 schematisch dargestellt.
16 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
1.10 Vorgehen bei Wirkungsabschätzung <strong>und</strong> Auswertung<br />
1.10.1 Wirkungskategorien <strong>und</strong> -indikatoren<br />
Die Wirkungsabschätzung in <strong>der</strong> vorliegenden Studie erfolgt anhand <strong>der</strong> nachfolgend aufgelisteten<br />
Wirkungskategorien:<br />
A) Ressourcenbezogene Kategorien<br />
• fossiler Ressourcenverbrauch<br />
• Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche<br />
• Naturraumbeanspruchung Forstfläche<br />
B) Emissionsbezogene Kategorien<br />
• Klimawandel<br />
• Sommersmog (POCP)<br />
• Versauerung<br />
• Terrestrische Eutrophierung<br />
• Aquatische Eutrophierung<br />
Mit <strong>der</strong> Aufspaltung <strong>der</strong> Wirkungskategorie Eutrophierung in eine getrennte Betrachtung <strong>der</strong><br />
aquatischen <strong>und</strong> terrestrischen Eutrophierung wird den in beiden Bereichen unterschiedlichen<br />
Wirkungsmechanismen Rechnung getragen.<br />
Die für die betrachteten Kategorien angewendeten Wirkungsmechanismen sind (mit Ausnahme<br />
<strong>der</strong> Naturraumbeanspruchung) wissenschaftlich begründet <strong>und</strong> mit Bezug aus den<br />
Sachbilanzdaten üblicherweise auch gut umsetzbar. Dies bestätigt auch ihre weit verbreitete<br />
Verwendung in nationalen <strong>und</strong> internationalen Ökobilanzen. Es kann hier also durchaus von<br />
einer allgemeinen Akzeptanz dieser Wirkungskategorien gesprochen werden 3 . Sie können<br />
als in <strong>der</strong> ökobilanziellen Praxis standardmäßig verwendete Umweltwirkungskategorien betrachtet<br />
werden.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> Naturraumbeanspruchung findet man in <strong>der</strong> Ökobilanzpraxis<br />
unterschiedliche Ansätze <strong>und</strong> Vorgehensweisen. Die wissenschaftliche Diskussion bewegt<br />
sich unter an<strong>der</strong>em um die Frage, wie eine festgestellte Flächennutzung ökologisch zu bewerten<br />
ist.<br />
An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen, dass die Wirkungsabschätzung ein Analyseinstrument<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Ökobilanz darstellt. Die Ergebnisse basieren teilweise auf Modellannahmen<br />
<strong>und</strong> bisherigen Kenntnissen über bestimmte Wirkungszusammenhänge <strong>und</strong><br />
sind im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Es handelt sich keinesfalls um Voraussagen<br />
z.B. über konkrete Wirkungen, Schwellenwertüberschreitungen o<strong>der</strong> Gefahren, die durch die<br />
untersuchten Produktsysteme verursacht werden.<br />
3 In <strong>der</strong> ökobilanziellen Praxis ist es kaum möglich, eine vollständige Einschätzung aller Umweltthemen vorzunehmen. In <strong>der</strong><br />
vorliegenden Studie findet allein schon durch die Vorauswahl einzelner Umweltthemen eine diesbezügliche Einschränkung<br />
statt. Die wünschenswerte breite Betrachtung möglichst vieler Umweltthemen scheitert häufig an <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Qualität <strong>der</strong> verfügbaren Sachbilanzdaten <strong>und</strong> <strong>der</strong> ebenso unterschiedlichen wissenschaftlichen Akzeptanz <strong>der</strong> einzelnen<br />
Wirkmodelle.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 17<br />
Die genannten Wirkungskategorien werden im Anhang 1 ausführlich beschrieben. Mit <strong>der</strong><br />
Zuordnung <strong>der</strong> für die einzelnen Wirkungskategorien relevanten Indikatoren in Tabelle 1-1<br />
soll jedoch vorab schon <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen den Sachbilanzdaten <strong>und</strong> den im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung ermittelten Wirkungspotentialen sowie den als Messgröße<br />
verwendeten Wirkungsindikatoren verdeutlicht werden.<br />
Tabelle 1-1: Zuordnung <strong>der</strong> im Projekt erhobenen Sachbilanzparameter (zur Erläuterung <strong>der</strong> Wirkungskategorien<br />
siehe auch Anhang 1)<br />
Wirkungskategorie Sachbilanzparameter<br />
fossiler Ressourcenverbrauch<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Einheit des Wirkungsindikators<br />
Rohöl, Rohgas, Braunkohle, Steinkohle kg Rohöläquivalente<br />
Klimawandel CO 2 fossil, CH 4, CH 4 regenerativ, N 2O, C 2F 6,<br />
C 2F 2H 4, CF 4, CCl 4<br />
Sommersmog (POCP)<br />
~ Ozonbildung (bodennah)<br />
NMVOC, VOC, Benzol, CH 4, C-ges., Acetylen,<br />
Ethanol, Formaldehyd, Hexan, Toluol, Xylol, Aldehyde<br />
unspez.<br />
kg CO2 -Äquivalente<br />
kg Ethen-Äquivalente<br />
Versauerung NO x, SO 2, H 2S, HCl, HF, NH 3, TRS kg SO 2 -Äquivalente<br />
Eutrophierung (terrestrisch) NO x, NH 3 kg PO 4 3- -Äquivalente<br />
Eutrophierung (aquatisch) P-ges., CSB, N-ges., NH 4 + , NO3 - , NO2 - , N unspez . kg PO4 3- -Äquivalente<br />
Naturraumbeanspruchung Flächenkategorie I-VII m 2 * a<br />
1.10.2 Optionale Elemente<br />
Nach ISO 14044 (§ 4.4.3) kann die Auswertung drei optionale Elemente enthalten:<br />
1. Normierung<br />
2. Ordnung<br />
3. Gewichtung<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird lediglich die Normierung durchgeführt. Aus Aufwandsgründen<br />
kann dies im gegebenen Projektrahmen nur exemplarisch erfolgen.<br />
Bei <strong>der</strong> hier durchgeführten Normierung werden die wirkungsbezogenen, aggregierten Umweltbelastungen<br />
über ihren „spezifischen Beitrag“ in Form von so genannten Einwohnerdurchschnittswerten<br />
dargestellt (vgl. Kapitel 7). Diese geben an, welchen mittleren Beitrag<br />
ein Einwohner in einem gegebenen geographischen Bezugsraum pro Jahr an den jeweiligen<br />
Wirkungskategorien hat. Damit können Informationen zur Relevanz einzelner Kategorien<br />
gewonnen werden.<br />
Das Element „Ordnung“ wird in dieser Studie nicht eigens umgesetzt. Alternativ wird auf die<br />
in den Getränkeökobilanzen des Umweltb<strong>und</strong>esamts erfolgte Einstufung <strong>der</strong> Wirkungskategorien<br />
Bezug genommen, um eine Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Studie<br />
mit den Ergebnissen <strong>der</strong> Getränkeökobilanzen des Umweltb<strong>und</strong>esamtes zu ermöglichen.<br />
Tabelle 1-2: Einstufung <strong>der</strong> ökologischen Priorität in <strong>der</strong> Getränkeökobilanz des Umweltb<strong>und</strong>esamtes<br />
[UBA 2000]
18 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Wirkungskategorie Ökologische Priorität (UBA 2000)<br />
Klimawandel sehr große ökologische Priorität<br />
Fossile Ressourcenbeanspruchung große ökologische Priorität<br />
Eutrophierung (terrestrisch) große ökologische Priorität<br />
Versauerung große ökologische Priorität<br />
Sommersmog (~ bodennahe Ozonbildung) große ökologische Priorität<br />
Eutrophierung (aquatisch) mittlere ökologische Priorität<br />
Naturraumbeanspruchung<br />
-> Versiegelte Fläche<br />
Naturraumbeanspruchung<br />
-> Forstfläche<br />
mittlere ökologische Priorität<br />
mittlere ökologische Priorität<br />
Das vom Umweltb<strong>und</strong>esamt entwickelte Verfahren zur Ordnung beruht auf drei Kriterien. Die<br />
ersten beiden Kriterien sind die ökologische Gefährdung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Abstand zum Zielwert (Distance-to-Target).<br />
Die entsprechende Einstufung <strong>der</strong> Wirkungskategorien ist in<br />
[UBA 1999] beschrieben. Die Einstufungen <strong>der</strong> ökologischen Gefährdung <strong>und</strong> des Abstandes<br />
zum Zielwert können sich heute möglicherweise an<strong>der</strong>s darstellen. Um die Vergleichbarkeit<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Studie mit den Ergebnissen <strong>der</strong> Getränkeökobilanzen<br />
des Umweltb<strong>und</strong>esamtes zu erhalten, werden die vom UBA getroffenen Einstufungen in die<br />
entsprechenden Wirkungskategorien beibehalten.<br />
Das dritte Kriterium sind die Ergebnisse <strong>der</strong> Normierung. Sind die ersten beiden Kriterien<br />
unabhängig vom Kontext einer individuellen Ökobilanzstudie, so kann sich die Prioritätenbildung<br />
je nach Normierungsergebnis unterscheiden. Damit ist auch die ökologische Prioritätenbildung<br />
Kontext abhängig. Aufgr<strong>und</strong> vergleichbarer Normierungsergebnisse (s. Kapitel 6-<br />
2) ist es jedoch gerechtfertigt die Prioritätenbildung nach Tabelle 1-2 auch in <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Studie anzuwenden.<br />
Die Einstufung <strong>der</strong> Wirkungskategorie „Naturraumbeanspruchung“ durch das Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
zur Bewertung in Ökobilanzen [UBA 1999] beruht teilweise auf Zielvorgaben zur<br />
Schutzguterhaltung, die durch den deutschen Kontext geprägt sind.<br />
Der noch in <strong>der</strong> UBA Studie verwendete Indikator Naturraumbeanspruchung Deponiefläche<br />
ist im Kontext dieser Studie unter dem Indikator „versiegelte Fläche“ subsumiert. Ziel des Indikators<br />
Naturraumbeanspruchung Deponiefläche war es, die Flächenversiegelung durch<br />
Abfalldeponierungen zu bewerten. Dieser Aspekt wird in <strong>der</strong> vorliegenden Studie zwar weiterhin<br />
betrachtet jedoch verliert <strong>der</strong> Flächenverbrauch durch die Deponierung von Abfällen in<br />
Deutschland seit Erlass <strong>der</strong> Ablagerungsverordnung vom 1. Juni 2005, wonach die Deponierung<br />
unbehandelter Haushaltsabfälle nicht mehr zulässig ist, zunehmend an Bedeutung. Daher<br />
wurde diese Wirkkategorie um die Betrachtung <strong>der</strong> beanspruchten versiegelten Verkehrsfläche<br />
ergänzt, welche sich aus dem LKW-Spezifischen Flächenbedarf <strong>und</strong> <strong>der</strong> bilanzierten<br />
Gesamt-Fahrleistung errechnet.<br />
Eine „Gewichtung“ ist für vergleichende, <strong>der</strong> Öffentlichkeit zugängliche Ökobilanzen gemäß<br />
ISO 14040ff nicht zulässig <strong>und</strong> verbietet sich daher für die vorliegende Ökobilanz.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 19<br />
2 Marktübersicht<br />
Im folgenden Kapitel werden einige Marktdaten dargestellt. Sie beruhen überwiegend auf Informationen<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM) <strong>und</strong> <strong>der</strong> GfK<br />
Gruppe (GfK). Aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher Betrachtungswinkel <strong>der</strong> Quellen sind die dargestellten<br />
Daten nicht immer uneingeschränkt direkt miteinan<strong>der</strong> vergleichbar.<br />
Mit <strong>der</strong> Marktbetrachtung soll ein Verständnis für die aktuellen Entwicklungen im Themenkreis<br />
Mehrweg- <strong>und</strong> Einweggetränkeverpackungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Vertriebslogistik<br />
gewonnen werden.<br />
Abbildung 2-1 zeigt den Gesamtverbrauch alkoholfreier Getränke in den bepfandeten Getränkesegmenten<br />
in Deutschland im Jahr 2006 für die Marktsegmente Vorratshaltung <strong>und</strong><br />
Sofortverzehr. Die höchsten Abfüllmengen verzeichnen Mineralwasser <strong>und</strong> CSD, sie stellen<br />
damit gemeinsam ca. 83% <strong>der</strong> Gesamtabfüllmenge dar <strong>und</strong> bilden zugleich den zentralen<br />
Geschäftsbereich <strong>der</strong> GDB-Mitgliedsbetriebe.<br />
Mio. Mrd. Liter<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Mineralwasser<br />
Getränkeverbrauch 2006<br />
Limonaden,<br />
Bittergetränke<br />
Grafik: IFEU, Quelle: GVM in UBA 15/08<br />
Fruchtsaftgetränke<br />
Abbildung 2-1: Getränkeverbrauch im Marktsegment Vorratshaltung <strong>und</strong> Sofortverzehr in<br />
Deutschland 2006<br />
Eine Übersicht über die Entwicklung <strong>der</strong> Mehrweganteile in den Jahren 2000 bis 2006 zeigt<br />
Abbildung 2-2. Die Mehrweg-Quote sank bei Mineralwasser von 81,0% im Jahr 2000 auf<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Eistee Sportgetränke<br />
Sonstige<br />
alkoholfreie<br />
Getränke
20 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
52,6% im Jahr 2006. Im Bereich CSD sank <strong>der</strong> Mehrweganteil etwas weniger stark von<br />
67,0% auf 47,5%.<br />
Quelle: GVM in UBA 15/08<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Mehrweganteile 2000 - 2006<br />
Abbildung 2-2: Entwicklung <strong>der</strong> Mehrweganteile 2000 - 2006<br />
Ein Rückgang <strong>der</strong> Mehrweg-Quote bedeutet im Umkehrschluss eine relative Zunahme <strong>der</strong><br />
Einwegsysteme. Deren Relevanz in den Füllgutbereichen Mineralwasser <strong>und</strong> CSD wird in<br />
Abbildung 2-3 für das Jahr 2007 ersichtlich.<br />
Gemäß <strong>der</strong> Angaben <strong>der</strong> GfK ist das bedeutendste Verpackungssystem in beiden betrachteten<br />
Getränkesegmenten demnach die <strong>PET</strong>-EW-Flasche mit deutlich mehr als 50% Anteil an<br />
<strong>der</strong> Gesamtabfüllmenge. Für das Füllgut Wasser liegt <strong>der</strong> Anteil bei 54,5% (im Vorjahr 47,2%<br />
<strong>und</strong> für die CSD bei 61,5% (im Vorjahr 52,5% ).<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke spielt neben <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-EW-Flasche<br />
vor allem die <strong>PET</strong>-MW-Flasche eine größere Rolle. Die <strong>Glas</strong>-MW-Flasche erreicht einen Anteil<br />
von knapp unter 10%.<br />
Im Mineralwassersegment ist die <strong>Glas</strong>-MW-Flasche das zweitstärkste Verpackungssystem<br />
nach <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-EW-Flasche <strong>und</strong> vor <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-MW-Flasche. In diesem Bereich sind auch nennenswerte<br />
Anteile <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche zu verzeichnen, sie erreicht einen Anteil an<br />
<strong>der</strong> Gesamtabfüllmenge von 7,2%. Die restlichen Verpackungen, vorwiegend Getränkedosen<br />
<strong>und</strong> Getränkekartons, spielen in beiden betrachteten Getränkesegmenten nahezu keine<br />
Rolle.<br />
Bei Betrachtung des <strong>PET</strong>-Mehrwegsystems muss zwischen zwei gr<strong>und</strong>legend verschiedenen<br />
Bereichen unterschieden werden. Der erste Bereich umfasst die in dieser Studie unter-<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 21<br />
suchten <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen des GDB Mehrwegpools. Den an<strong>der</strong>en Bereich bilden die<br />
vielen verschiedenen am Markt erhältlichen <strong>PET</strong>-Mehrweg-Individualgebinde, z.B. von Coca-<br />
Cola, Adelholzener o<strong>der</strong> Gerolsteiner.<br />
Der Anteil <strong>der</strong> GDB Poolflaschen an den <strong>PET</strong>-Mehrwegsystemen bei Mineralwässern <strong>und</strong><br />
kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken liegt <strong>der</strong>zeit nach brancheninternen Schätzungen<br />
bei ca. 50% Prozent. Dies begründet sich in dem hohen Anteil an <strong>PET</strong>-Mehrweg-<br />
Individualgebinden im Bereich <strong>der</strong> Erfrischungsgetränke. Betrachtet man nur die Mineralbrunnen<br />
erreicht die GDB 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche einen Anteil von 70%.<br />
Die in <strong>der</strong> vorliegenden Studie betrachtete <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche gehört zum Bereich <strong>der</strong><br />
GDB-Poolflaschen. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie sind nicht ohne weiteres auf die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg-Individualgebinde übertragbar.<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
27,0%<br />
1,8%<br />
61,5%<br />
Grafik: IFEU, Quelle: GfK<br />
Verpackungsstruktur für Kohlensäurehaltige<br />
Erfrischungsgetränke <strong>und</strong> Wasser 2007<br />
9,3%<br />
15,2%<br />
7,2%<br />
54,7%<br />
22,6%<br />
0,4% 0,3%<br />
Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke Wasser<br />
Abbildung 2-3: Verpackungsstruktur für Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke <strong>und</strong> Wasser<br />
2007<br />
Parallel zu <strong>der</strong> geschil<strong>der</strong>ten Gebindeentwicklung fand eine Verschiebung <strong>der</strong> Anteile <strong>der</strong><br />
Vertriebsschienen statt. Dies ist in Abbildung 2-4 ersichtlich, die die Vertriebsschienenentwicklung<br />
für Süßgetränke <strong>und</strong> Wasser in den Jahren 2003 <strong>und</strong> 2007 zeigt.<br />
Die in dieser Studie betrachteten Kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke stellen ca. 64%<br />
<strong>der</strong> Süßgetränke dar (siehe Abb. 1-1). Der Anteil <strong>der</strong> Discounter am Vertrieb hat sich im Bereich<br />
<strong>der</strong> Süßgetränke fast, im Bereich <strong>der</strong> Wässer mehr als verdoppelt. Die Verbraucher-<br />
<strong>und</strong> Getränkeabholmärkte büßten r<strong>und</strong> ein Drittel bis zur Hälfte ihrer Anteile ein.<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
<strong>PET</strong> MW<br />
<strong>PET</strong> Rücklaufflasche im Kasten<br />
<strong>PET</strong> EW inkl. Rücklaufflasche einzel<br />
<strong>Glas</strong> MW<br />
Restl. Verpackungen
22 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Vertriebsschienenentwicklung für Süßgetränke <strong>und</strong> Wasser<br />
9,5% 10,6% 9,9% 10,9%<br />
41,8%<br />
27,1%<br />
Süßgetränke Wasser<br />
2003 2007 2003<br />
2007<br />
26,9%<br />
50,8%<br />
37,2%<br />
22,7%<br />
21,6% 48,4%<br />
26,1%<br />
18,0%<br />
14,6%<br />
3,6%<br />
8,9%<br />
2,8% 5,2% 3,4%<br />
Grafik: IFEU, Quelle: GfK 2007<br />
Abbildung 2-4: Vertriebsschienenentwicklung für Süßgetränke <strong>und</strong> Wasser<br />
Beide Entwicklungen stehen in einem Zusammenhang, da <strong>PET</strong>-EW-Flaschen überwiegend<br />
von Lebensmitteldiscountern vertrieben werden, die in <strong>der</strong> Regel keine Getränke in Mehrwegsystemen<br />
anbieten. Der Vertrieb von Mehrwegsystemen wie<strong>der</strong>um ist traditionell <strong>der</strong><br />
Schwerpunkt des klassischen Lebensmittelhandels <strong>und</strong> <strong>der</strong> Getränkeabholmärkte.<br />
Diese Beobachtungen würden die These unterstützen, dass <strong>der</strong> Trend zu einem höheren<br />
Einweg-Anteil in <strong>der</strong> Verpackungsstruktur ursächlich mit <strong>der</strong> Produktpolitik <strong>der</strong> Discounter<br />
zusammenhängen könnte. So werden die Discounter in Deutschland von nur fünf Großabfüllern<br />
mit insgesamt 16 Standorten beliefert. Damit sind entsprechend große Distributionsentfernungen<br />
verb<strong>und</strong>en, zu <strong>der</strong>en Bedienung man sich zugunsten <strong>der</strong> Einwegverpackungen<br />
entschieden hat.<br />
Im Gegensatz dazu hat die GDB allein 168 Mitgliedsbetriebe mit einer entsprechend hohen<br />
Zahl von über das B<strong>und</strong>esgebiet gestreuten 181 Abfüllstandorten für Mehrwegflaschen. Angesichts<br />
<strong>der</strong> <strong>Brunnen</strong>struktur sind kürzere Distributionsentfernungen als bei den Einwegvertriebsschienen<br />
zu erwarten.<br />
Der beschriebene Sachverhalt war Anlass, im Rahmen dieser Ökobilanzstudie neue Daten<br />
zur Distributionslogistik <strong>der</strong> GDB Mehrwegsysteme zu erheben <strong>und</strong> analog eine entsprechende<br />
quantitative Einschätzung <strong>der</strong> Einweglogistik vorzunehmen. Die diesbezüglichen<br />
Ausführungen finden sich im Kapitel 4.7.<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Traditioneller<br />
Lebensmitteleinzelhandel<br />
Verbrauchermärkte<br />
Discounter<br />
Getränkeabholmärkte<br />
restl. Einkaufsstätten (inkl.<br />
Heimdienst)
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 23<br />
3 Untersuchte Verpackungssysteme <strong>und</strong> Szenarien<br />
3.1 Verpackungsspezifikationen<br />
Der Bilanzierung <strong>der</strong> in <strong>der</strong> vorliegenden Studie untersuchten Verpackungssysteme liegen<br />
die in Tabelle 3-1 zusammengestellten Verpackungsdefinitionen, Palettenschemata sowie<br />
Rücklaufquoten bzw. Umlaufzahlen zugr<strong>und</strong>e. Die Spezifikationen <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einweg- <strong>und</strong><br />
Mehrwegsysteme sowie des <strong>Glas</strong>-Mehrwegsystems wurden <strong>der</strong> Zielstellung entsprechend<br />
geprüft <strong>und</strong> bei Bedarf aktualisiert.<br />
Die Spezifikationen <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-MW <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-MW Systeme beruhen auf Angaben seitens <strong>der</strong><br />
GDB [GDB 2008]. Die Verpackungsspezifikationen <strong>der</strong> <strong>PET</strong> Stoffkreislaufflasche beruhen<br />
auf Angaben <strong>der</strong> <strong>PET</strong>CYCLE AG [<strong>PET</strong>CYCLE 2008] 4 .<br />
Das Gewicht <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche wurde anhand <strong>der</strong> im IFEU verfügbaren Informationen<br />
<strong>und</strong> Testkäufen bei Discountern abgeleitet. Anhand des IFEU Datenpools zeigt sich über den<br />
Zeitraum 2003 bis 2007 für die 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflaschen eine Bandbreite des Flaschengewichts<br />
zw. 33,7 g <strong>und</strong> 36,5 g. Auf Basis dieser Zahlen <strong>und</strong> in Verbindung mit den Messwerten<br />
aus den Testkäufen wurde das mittlere Flaschengewicht mit 35,5 g angesetzt.<br />
Für die bilanzierte <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche wurde ein <strong>PET</strong>-Rezyklateinsatz von 50%<br />
zugr<strong>und</strong>e gelegt, dies entspricht dem Anteil <strong>der</strong> durch den Mengenstromnachweis <strong>der</strong> Petcycle<br />
E.A.G. belegt werden kann, die <strong>PET</strong>-Einwegflasche sowie die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
wurden jeweils mit 100% Primär-<strong>PET</strong> bilanziert.<br />
Die Umlaufzahl des <strong>Glas</strong>-Mehrwegsystems wird in <strong>der</strong> vorliegenden Studie aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> aktualisierten<br />
Angaben <strong>der</strong> GDB zur Sortierquote mit 40 Umläufen angenommen. Die Umlaufzahl<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen beträgt 15 Umläufe, was durch die Daten <strong>der</strong> GDB zu den<br />
Pool-Umlaufzahlen bestätigt wird (vgl. Anhang II).<br />
Die Umlaufzahl <strong>der</strong> Kästen <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche wird mit 100<br />
Umläufen angesetzt. Dieser Wert entspricht den Berechnungen <strong>der</strong> GDB <strong>und</strong> <strong>PET</strong>CYCLE.<br />
Die Umlaufzahl <strong>der</strong> Kästen <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche liegt mit ermittelten 150 Umläufen<br />
deutlich höher, was in <strong>der</strong> stabileren Bauweise <strong>der</strong> Kästen begründet liegt.<br />
Das <strong>Glas</strong>mehrwegsystem wird zur Verladung auf eigene, nur für den Getränketransport bestimmten<br />
Paletten (GDB-Palette) verladen, während die an<strong>der</strong>en Systeme auf den so genannten<br />
Euro-Paletten distribuiert werden. Die Umlaufzahlen <strong>der</strong> schwereren GDB-Paletten<br />
liegen deutlich über den <strong>der</strong> Euro-Paletten, da diese, aufgr<strong>und</strong> ihrer vielfältigen Einsatzbereiche<br />
einem höheren Verschleiß unterliegen.<br />
4 Das gewählte Flaschengewicht entspricht dem Mittelwert über den drei Monats-Zeitraum vom 01.02.2008 bis einschließlich<br />
30.04.2008<br />
Endbericht Oktober 2008
24 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 3-1: Spezifikationen Verpackungssysteme im Marktsegment Vorratshaltung<br />
Bestandteile<br />
<strong>Glas</strong>-MW-<br />
Flasche<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
Flasche<br />
<strong>PET</strong>-EW-<br />
Flasche<br />
<strong>PET</strong>-MW-<br />
Flasche<br />
Wasser Wasser Wasser Wasser<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,0 L<br />
Primärverpackung [g] 593,2 34,4 38,6 65,8<br />
Flasche <strong>PET</strong>/<strong>Glas</strong> [g] 590 30,5 35,5 62<br />
Verschlüsse (HDPE) [g] 3,2 (40%) 2,4 2,4 3,2<br />
Verschlüsse (Alu) [g] 1,5 (60%) - - -<br />
Etikett (Papier) [g] 1 1,5 1,5 (5%) -<br />
Etikett (PP) [g] - - 0,6 (95%) 0,6<br />
Umverpackung<br />
Kasten (HDPE) [g] 1.400 1.850 1.550<br />
Schrumpffolie (LDPE) [g] - - 26 g -<br />
Zwischenlagen (Graukarton, pro Lage) - - 475 -<br />
Transportverpackung<br />
Palette [g] 30.000 24.000 24.000 24.000<br />
(<strong>Brunnen</strong>) (Euro) (Euro) (Euro)<br />
Stretch-Folie pro Palette (LDPE) [g] 18 18 450 18<br />
Palettenschema<br />
Flaschen pro Kasten/Schrumpfpack 12 12 6 12<br />
Kasten/Schrumpfpack pro Lage 12 8 19 8<br />
Lagen pro Palette 4 5 4 5<br />
Flaschen pro Palette 576 480 456 480<br />
Liter pro Palette 403 480 684 480<br />
Rücklauf<br />
MW-Flaschen/ SK-Flaschen/EW-<br />
Pfandflaschen/<br />
Umlaufzahlen<br />
99% 97% 90% (95%) 99%<br />
Flaschen 40 1 1 15<br />
Kasten 150 100 - 100<br />
Palette 50 25 25 25<br />
LKW-Auslastung am Beispiel eines 40t LKW<br />
Anzahl Flaschen pro LKW-Ladung 16.704 16.320 14.592 16.320<br />
Transportiertes Füllgut pro LKW-Ladung<br />
[L]<br />
11.693 16.320 21.888 16.320
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 25<br />
3.2 End-of-Life Quoten<br />
Durch die Erfassungs- bzw. Rücklaufquote wird festgelegt, welcher Anteil <strong>der</strong> Verpackungen<br />
vom Verbraucher in das System zurückgegeben wird <strong>und</strong> welcher Anteil <strong>der</strong> Verpackungen<br />
entsorgt wird, wobei die Frage ob Verwertung o<strong>der</strong> Beseitigung im Kapitel 3.2.3 genauer<br />
thematisiert wird.<br />
3.2.1 Erfassungsquoten <strong>der</strong> Mehrwegsysteme<br />
Bei den hier untersuchten Mehrwegsystemen im Bereich <strong>der</strong> Vorratshaltung (Kastenverkauf)<br />
lag die Verlustquote <strong>der</strong> Flaschen in den Jahren 2006/07 bei maximal 1%, was einer Erfassungsquote<br />
von 99% entspricht. Diese Zahlen lassen sich anhand <strong>der</strong> GDB-internen Daten<br />
zur Poolentwicklung <strong>der</strong> letzten Jahre nachvollziehen.<br />
3.2.2 Erfassungsquoten <strong>und</strong> Stoffflüsse <strong>der</strong> Stoffkreislaufflaschen<br />
Nach Information von Petcycle [Petcycle 2007] werden bei den <strong>PET</strong>-SK Flaschen <strong>der</strong>zeit<br />
Rücklaufquoten von 97% über das eigene Mehrweg-Kastensystem erreicht. Diese <strong>PET</strong>-<br />
Flaschenfraktion stellt über bottle-to-bottle Recyclingverfahren das <strong>PET</strong>-Rezyklat für den Sek<strong>und</strong>ärmaterialeinsatz<br />
von 50% innerhalb des Stoffkreislaufsystems (closed-loop recycling).<br />
Dies ist auch durch den Mengenstromnachweis belegt.<br />
In <strong>der</strong> modellierungstechnischen Umsetzung des SK-Systems verlässt die über den Rezyklateinsatz<br />
von 50% hinausgehende Rezyklatmenge das Stoffkreislauf-System <strong>und</strong> wird dementsprechend<br />
als open-loop Recycling angenommen.<br />
3.2.3 Erfassungsquoten <strong>und</strong> Sortierung gebrauchter <strong>PET</strong>-Einwegflaschen<br />
<strong>PET</strong>-Einwegflaschen im untersuchten Füllgutbereich werden über das DPG-Pfandsystem erfasst.<br />
Mengenstromnachweise für das Pfandsystem sind jedoch <strong>der</strong>zeit nicht verfügbar, daher<br />
wurde für die vorliegende Ökobilanz eine Erfassungsquote von 90% angenommen. Diese<br />
Annahme ist orientiert an den IFEU intern vorliegenden Expertenschätzungen<br />
[WMW 2005]. Seitens des BMU wird dieser Wert als an <strong>der</strong> Untergrenze liegend angesehen,<br />
während die tatsächliche Rücklaufquote durchaus bei 93% liegen könnte. Nach Angaben<br />
des BMU gibt es auch Quellen, nach denen eine Spannweite bis zu 95% angegeben wird.<br />
Um die Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> hier bestehenden Datenunsicherheit einschätzen zu können,<br />
wird in <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz eine Sensitivitätsanalyse mit einer Erfassungsquote von<br />
95% <strong>der</strong> gebrauchten <strong>PET</strong>-Einwegflaschen durchgeführt.<br />
Tabelle 3-2: Erfassungsquoten <strong>der</strong> untersuchten Getränkeverpackungssysteme<br />
Erfassungsquoten <strong>Glas</strong>-MW- <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW- <strong>PET</strong>-MW-<br />
Flasche Flasche Flasche Flasche<br />
Basisfall 99% 97% 90% 99%<br />
Sensitivitätsanalyse 95%<br />
Für die Verpackungen, die nicht von den in Tabelle 3-2 aufgeführten Quoten erfasst sind,<br />
wird eine Beseitigung in <strong>der</strong> Müllverbrennungsanlage angenommen.<br />
Endbericht Oktober 2008
26 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
<strong>Glas</strong> Mehrweg 0,7 Liter<br />
Abfüller Verbraucher<br />
100%<br />
<strong>PET</strong>-Stoffkreislauf 1,0 Liter<br />
Abfüller<br />
Abbildung 3-1: End-of-Life-Settings <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme<br />
3.3 Stoffflussbil<strong>der</strong><br />
GDB Mehrwegpool<br />
97%<br />
100%<br />
<strong>PET</strong>-Einweg 1,5 Liter<br />
99%<br />
Verbraucher<br />
gebrauchte Flaschen vom Abfüller zum Verwerter<br />
90% (95%)<br />
DPG Pfandpool<br />
Abfüller Verbraucher<br />
100%<br />
Die folgenden Abbildung 3-2 bis Abbildung 3-5 zeigen die relevanten Stoffflüsse <strong>der</strong> vier untersuchten<br />
Verpackungssysteme, basierend auf den in den Kapiteln 3.1 <strong>und</strong> 3.2 genannten<br />
Festlegungen.<br />
1%<br />
3%<br />
10% (5%)<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Beseitigung<br />
(MVA)<br />
Beseitigung<br />
(MVA)<br />
Verwertung<br />
Flaschen <strong>PET</strong> zur Flaschenproduktion<br />
(50% Rezyklatanteil in den <strong>PET</strong>-SK Flaschen) Closed Loop Recycling<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg 1,0 Liter<br />
GDB Mehrwegpool<br />
99%<br />
Abfüller Verbraucher<br />
100%<br />
1%<br />
Verwertung<br />
Beseitigung<br />
(MVA)<br />
Beseitigung<br />
(MVA)<br />
Asche <strong>und</strong> Schlacken<br />
Energie<br />
Asche <strong>und</strong> Schlacken<br />
Sek. Produkte<br />
Sek. Produkte<br />
Energie<br />
Asche <strong>und</strong> Schlacken<br />
Energie<br />
Asche <strong>und</strong> Schlacken
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 27<br />
Fläche, CO 2<br />
Mineralische<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Mineralische<br />
Ressourcen<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Verpackungssystem: <strong>Glas</strong>-MW Flasche 0,7 L<br />
Funktionelle Einheit: 1000 L Füllgut<br />
Papieretikett<br />
<strong>Glas</strong>flasche<br />
HDPE<br />
Aluminiumband<br />
Altglas: 13,2 kg<br />
1,8 kg<br />
1,3 kg<br />
1,4 kg<br />
21,1 kg<br />
Verschlussherstellung<br />
Holzpalette<br />
LDPE- Folie<br />
3,2 kg<br />
Mehrwegkasten<br />
1,5 kg<br />
0,04 kg<br />
1,1 kg<br />
Abbildung 3-2: Fließbild <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche<br />
Fläche, CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Papieretikett<br />
<strong>PET</strong><br />
1,5 kg<br />
15,4 kg Preformherstellung<br />
30,5 kg<br />
2,4 kg<br />
Abfüllung<br />
1,5 kg<br />
2,0 kg<br />
0,04 kg<br />
Abbildung 3-3: Fließbild <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche<br />
Flasche: 843 kg<br />
Verschluss: 3,1 kg<br />
Papieretikett: 1,4 kg<br />
LDPE-Folie: 0,04 kg<br />
Palette: 74 kg<br />
Kasten 167 kg<br />
Flasche: 834 kg<br />
Verschluss: 2,8 kg<br />
Papieretikett: 1,4 kg<br />
Kasten: 167 kg<br />
Paletten: 74 kg<br />
<strong>Glas</strong> (AzV): 13,7 kg<br />
Verschluss (AzV): 2,7 kg<br />
Papier (AzV): 1,3 kg<br />
HDPE (AzV): 1,1 kg<br />
Holz (AzV): 1,4 kg<br />
Verpackungssystem: <strong>PET</strong>-SK Flasche 1,0 L<br />
Funktionelle Einheit: 1000 L Füllgut<br />
<strong>PET</strong><br />
HDPE<br />
<strong>PET</strong><br />
15,4 kg<br />
Verschlussherstellung<br />
Mehrwegkasten<br />
Holzpalette<br />
LDPE- Folie<br />
<strong>PET</strong>- Recyclat<br />
Flaschenherstellung<br />
<strong>und</strong><br />
Abfüllung<br />
2,4 kg<br />
Flasche: 30,5 kg<br />
Verschluss: 2,4 kg<br />
LDPE-Folie: 0,04 kg<br />
Palette: 50 kg<br />
Papieretikett: 1,5 kg<br />
Kasten: 154 kg<br />
Flasche: 29,5 kg<br />
Verschluss: 2,2 kg<br />
Papieretikett: 1,5 kg<br />
Palette: 50 kg<br />
Kasten: 154 kg<br />
<strong>PET</strong> 15,4 kg<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Handel/<br />
Verbraucher<br />
Handel/<br />
Verbraucher<br />
Flasche (AzV): 11,4 kg<br />
Verschluss (AzV): 0,8 kg<br />
Etikett (AzV): 0,6 kg<br />
Palette (AzV): 1,9 kg<br />
HDPE (AzV): 1,5 kg<br />
Flasche (AzV): 17,8 kg<br />
Verschluss (AzV): 1,3 kg<br />
Etikett (AzV): 0,9 kg<br />
Flasche (AzB): 8,4 kg<br />
Verschluss (AzB): 0,3 kg<br />
Papieretikett (AzB): 0,01 kg<br />
Beseitigung<br />
Verwertung<br />
Systemgrenze<br />
Flasche (AzB): 0,9 kg<br />
Verschluss (AzB): 0,2 kg<br />
Beseitigung<br />
Verwertung<br />
Recovery<br />
Bottle-to-Bottle<br />
Recycling<br />
Systemgrenze<br />
Gutschrift<br />
Elektrische Energie<br />
Wärmeenergie<br />
PE (LDPE)<br />
Holz<br />
Sek<strong>und</strong>är-Fasern<br />
HDPE Granulat<br />
Aluminium- Barren<br />
Gutschrift<br />
Elektrische Energie<br />
Wärmeenergie<br />
<strong>PET</strong> Flakes<br />
PE (LDPE)<br />
Holz<br />
HDPE Granulat<br />
Zement Klinker
28 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Verpackungssystem: <strong>PET</strong>-EW Flasche 1,5 L<br />
0,4 kg<br />
0,05 kg<br />
23,9 kg Preformherstellung<br />
23,7 kg<br />
1,6 kg<br />
Abbildung 3-4: Fließbild <strong>PET</strong>-Einwegflasche<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Fläche,<br />
CO 2<br />
Fossile<br />
Ressourcen<br />
Funktionelle Einheit: 1000 L Füllgut<br />
Kunststoffetikett<br />
Papieretikett<br />
<strong>PET</strong><br />
HDPE<br />
0,6 kg<br />
Verschluss- 1,6 kg<br />
herstellung<br />
Wellpappe<br />
Holzpalette<br />
LDPE- Folie<br />
4,1 kg<br />
Preform- <strong>und</strong><br />
Flaschenherstellung<br />
4,1 kg<br />
3,2 kg<br />
Abbildung 3-5: Fließbild <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
Flaschenherstellung<br />
<strong>und</strong><br />
Abfüllung<br />
2,1 kg<br />
1,4 kg<br />
3,5 kg<br />
1,3 kg<br />
2,0 kg<br />
Abfüllung<br />
0,04 kg<br />
Flasche: 23,7 kg<br />
Verschluss: 1,6 kg<br />
Wellpappe: 2,1 kg<br />
LDPE- Folie: 3,5 kg<br />
Palette: 35,1 kg<br />
Etikett: 0,4 kg<br />
Papier/Pappe (AzV): 1,6 kg<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Flasche (AzB): 2,4 kg<br />
Verschluss (AzB): 0,3 kg<br />
Etikett (AzB): 0,04 kg<br />
LDPE- Folie (AzB): 0,4 kg<br />
Papier (AzB): 0,4 kg<br />
Handel/<br />
Verbraucher<br />
Palette: 35,1 kg<br />
Flasche (AzV): 21,3 kg<br />
Verschluss (AzV): 1,3 kg<br />
Etikett (AzV): 0,4 kg<br />
LDPE-Folie (AzV):3,2 kg<br />
Papier (AzV): 1,9 kg<br />
Palette (AzV): 1,3 kg<br />
Produktionsabfall (AzV): 0,02 kg<br />
Verpackungssystem: <strong>PET</strong>-MW Flasche 1,0 L<br />
Funktionelle Einheit: 1000 L Füllgut<br />
Kunststoffetikett<br />
<strong>PET</strong><br />
HDPE für<br />
Verschluss<br />
Verschlussherstellung<br />
3,2 kg<br />
Mehrwegkasten<br />
Holzpalette<br />
LDPE- Folie<br />
Flasche: 62 kg<br />
Verschluss: 3,2 kg<br />
Etikett: 0,6 kg<br />
LDPE-Folie: 0,04 kg<br />
Palette: 50 kg<br />
Kasten: 129 kg<br />
Flasche: 61,4 kg<br />
Verschluss: 2,9 kg<br />
Etikett: 0,6 kg<br />
Kasten: 129 kg<br />
Paletten: 50 kg<br />
Beseitigung<br />
Verwertung<br />
Recovery<br />
Systemgrenze<br />
Flasche (AzB): 0,6 kg<br />
Verschluss (AzB): 0,3 kg<br />
Handel/<br />
Verbraucher<br />
Produktionsabfälle<br />
Flaschenherstellung (AzV): 2,8 kg<br />
Verschluss (AzV): 2,8 kg<br />
HDPE (AzV): 1,2 kg<br />
Paletten (AzV): 1,9 kg<br />
Beseitigung<br />
Verwertung<br />
Recovery<br />
Systemgrenze<br />
Gutschrift<br />
Elektrische Energie<br />
Wärmeenergie<br />
<strong>PET</strong> Flakes<br />
PE<br />
Holz<br />
Sek<strong>und</strong>är-Fasern<br />
HDPE Granulat<br />
Zement Klinker<br />
Gutschrift<br />
Elektrische Energie<br />
Wärmeenergie<br />
<strong>PET</strong> Flakes<br />
PE (LDPE)<br />
Holz<br />
HDPE Granulat<br />
Zement Klinker
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 29<br />
3.4 Umfasste Szenarien<br />
3.4.1 Basisszenarien<br />
Für jedes <strong>der</strong> untersuchten Produktsysteme wurden Basisszenarien bilanziert, mit dem die<br />
jeweilige Situation im definierten Bezugsraum möglichst repräsentativ abgebildet werden<br />
sollte. Diese Basisszenarien werden durch die in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 beschriebenen<br />
Festlegungen definiert. Tabelle 3-3 bietet eine Übersicht über die Basisszenarien.<br />
Die Szenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut] sind eine Fortschreibung <strong>der</strong> UBA<br />
Studien aus den Jahren 2000 <strong>und</strong> 2002 [UBA 2002] <strong>und</strong> ermöglichen die Vergleichbarkeit<br />
<strong>der</strong> neuen Ergebnisse mit denen älterer Studien.<br />
Seit den UBA-Ökobilanzen hat sich die Distributionsstruktur <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme<br />
verän<strong>der</strong>t. In den Szenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B werden die Auswirkungen<br />
dieser neuen, verän<strong>der</strong>ten Distributionsstrukturen untersucht. Im Gegensatz zu den Annahmen<br />
<strong>der</strong> UBA Ökobilanz stellt sich im Rahmen dieser Untersuchung ein gr<strong>und</strong>legen<strong>der</strong> Unterschied<br />
zwischen den Distributionsstrukturen <strong>der</strong> Einweg- <strong>und</strong> Mehrwegsysteme dar. Aufgr<strong>und</strong><br />
dieses Unterschiedes ist eine Betrachtung <strong>der</strong> Verpackungen ohne Füllgut nicht mehr<br />
möglich. Daher sind die Szenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B mit Füllgut bilanziert. Um<br />
dennoch eine Vergleichbarkeit <strong>der</strong> neuen Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen<br />
früherer Studien, insbeson<strong>der</strong>e den UBA Studien herstellen zu können werden als Untersuchungsgruppe<br />
A [ohne Füllgut] die vier Verpackungssysteme mit den gleichen Szenario-<br />
Settings auch mit Füllgut berechnet (Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut]).<br />
Endbericht Oktober 2008
30 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 3-3: Basisszenarien <strong>der</strong> untersuchten Getränkeverpackungssysteme<br />
Basisszenarien<br />
Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]<br />
700 mL <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (Perlglasflasche); Umlaufzahl 40<br />
Flaschengewicht 590 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche; 50% Rezyklateinsatz, Rücklauf 97%<br />
Flaschengewicht 30,5 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 90%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche; Umlaufzahl 15<br />
Flaschengewicht 62 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000<br />
Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut]<br />
700 mL <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (Perlglasflasche); Umlaufzahl 40<br />
Flaschengewicht 590 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000,<br />
=> mit Füllgut<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche; 50% Rezyklateinsatz, Rücklauf 97%<br />
Flaschengewicht 30,5 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000,<br />
=>mit Füllgut<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 90%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000,<br />
=> mit Füllgut<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche; Umlaufzahl 15<br />
Flaschengewicht 62 g, Abfüllung Stand 2006/07, Distribution nach UBA 2000,<br />
=> mit Füllgut<br />
Untersuchungsgruppe B – aktualisierte Distribution<br />
700 mL <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (Perlglasflasche); Umlaufzahl 40<br />
Flaschengewicht 590 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> aktualisierte GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche; 50% Rezyklateinsatz, Rücklauf 97%<br />
Flaschengewicht 30,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Anwendung <strong>der</strong> aktualisierten GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 90%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Distribution entsprechend <strong>der</strong> Abfüllerumfrage im Kontext <strong>der</strong> Petcore Ökobilanz,<br />
=> mit Füllgut<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche; Umlaufzahl 15<br />
Flaschengewicht 62 g, Abfüllung Stand 2006/07;<br />
=> aktualisierte GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 31<br />
3.4.2 Szenarien zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen<br />
Sensitivitätsanalysen dienen dazu, die Ergebnisrelevanz von Datensätzen <strong>und</strong> Systemannahmen<br />
in den Basisszenarien zu überprüfen. Aus Sicht <strong>der</strong> Auftragnehmer ist dabei die Analyse<br />
<strong>der</strong> nachfolgend aufgelisteten Aspekte erfor<strong>der</strong>lich. Die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> durchgeführten Varianten werden im Kapitel 6 näher erläutert. Die Kurzbeschreibung<br />
zum Szenarienüberblick in diesem Kapitel dient <strong>der</strong> Orientierung des Lesers.<br />
• Aspekt Rücklaufquote <strong>PET</strong>-EW<br />
Die Sensitivitätsanalyse Aspekt Rücklaufquote <strong>PET</strong>-EW untersucht den Einfluss <strong>der</strong> auf<br />
95% erhöhten Sammel- bzw. Erfassungsquote für <strong>PET</strong>-Einwegflaschen auf das Gesamtergebnis.<br />
Dieses Szenario ergibt sich, wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, aus <strong>der</strong> Notwendigkeit<br />
heraus, dass belegbare Aussagen zur realen Rücklaufquote <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche <strong>der</strong>zeit nicht vorhanden sind. Aus <strong>der</strong> verfügbaren Literatur <strong>und</strong> Expertenmeinungen<br />
lässt sich jedoch eine Bandbreite <strong>der</strong> Quote zw. 90% <strong>und</strong> 95% ableiten.<br />
Daher wird das Basisszenario für <strong>PET</strong>-Einwegflaschen durch eine Sensitivitätsanalyse<br />
ergänzt, die das obere Ende <strong>der</strong> Rücklaufquoten-Bandbreite abdeckt. Die Ergebnisse<br />
werden in Kapitel 6.1 dargestellt.<br />
• Aspekt alternativer <strong>PET</strong>-Datensatz<br />
In den Basisszenarien <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird das von PlasticsEurope veröffentlichte<br />
Ecoprofil für die <strong>PET</strong>-Herstellung verwendet. In <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse wird <strong>der</strong> Einfluss<br />
<strong>der</strong> Verwendung eines alternativen <strong>PET</strong>-Datensatzes auf die Ergebnisse <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung<br />
<strong>der</strong> Studie untersucht. Als alternativer Datensatz wird <strong>der</strong> im Rahmen<br />
einer Ökobilanz im Auftrag von <strong>PET</strong>CORE erarbeitete <strong>PET</strong>-Datensatz verwendet. Die<br />
Ergebnisse werden in Kapitel 6.2 dargestellt.<br />
• Aspekt unterschiedliche Allokationsfaktoren<br />
Wie bereits in Kapitel 1.9 erwähnt wird durch die Sensitivitätsanalysen die Ergebnisrelevanz<br />
des Allokationsfaktors untersucht. Die Ergebnisse werden in Kapitel 6.3 dargestellt.<br />
Endbericht Oktober 2008
32 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 3-4: Szenarien zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen<br />
Sensitivitätsanalysen (Än<strong>der</strong>ungen sind FETTGEDRUCKT)<br />
Aspekt Rücklaufquote <strong>PET</strong>-EW<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 95%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Distribution entsprechend <strong>der</strong> Abfüllerumfrage im Kontext <strong>der</strong> Petcore Ökobilanz,<br />
=> mit Füllgut<br />
Aspekt alternativer <strong>PET</strong>-Datensatz<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche; 50% Rezyklateinsatz, Rücklauf 97%<br />
Flaschengewicht 30,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Anwendung <strong>der</strong> aktualisierten GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Datensatz <strong>PET</strong>CORE<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 90%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Distribution entsprechend <strong>der</strong> Abfüllerumfrage im Kontext <strong>der</strong> Petcore Ökobilanz,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Datensatz <strong>PET</strong>CORE<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche; Umlaufzahl 15<br />
Flaschengewicht 62 g, Abfüllung Stand 2006/07;<br />
=> aktualisierte GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Datensatz <strong>PET</strong>CORE<br />
Aspekt unterschiedliche Allokationsfaktoren<br />
700 mL <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (Perlglasflasche); Umlaufzahl 40<br />
Flaschengewicht 590 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> aktualisierte GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Allokation 0% / Allokation 100%<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche; 50% Rezyklateinsatz, Rücklauf 97%<br />
Flaschengewicht 30,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Anwendung <strong>der</strong> aktualisierten GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Allokation 0% / Allokation 100%<br />
1500 mL <strong>PET</strong>-Einwegflasche; 0% Rezyklateinsatz, Monolayer, Erfassungsquote 90%<br />
Flaschengewicht 35,5 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> Distribution entsprechend <strong>der</strong> Abfüllerumfrage im Kontext <strong>der</strong> Petcore Ökobilanz,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Allokation 0% / Allokation 100%<br />
1000 mL <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche; Umlaufzahl 15<br />
Flaschengewicht 62 g, Abfüllung Stand 2006/07,<br />
=> aktualisierte GDB-MW Distribution,<br />
=> mit Füllgut<br />
=> Allokation 0% / Allokation 100%<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 33<br />
4 Ausgewählte Daten zur Sachbilanz<br />
Im folgenden Kapitel 4 werden kurz die verwendeten Inventardaten <strong>und</strong> Prozessschritte beschrieben,<br />
die für die Modellierung verwendet wurden.<br />
4.1 Kunststoffherstellung<br />
4.1.1 Datensatz PP<br />
Polypropylen entsteht durch die katalytische Polymerisation von Propen zu langkettigem Polypropylen.<br />
Die beiden wichtigen Verfahren sind die Nie<strong>der</strong>druck-Fällungs- <strong>und</strong> die Gasphasen-Polymerisation.<br />
In einem abschließenden Schritt wird das Polymerpulver im Extru<strong>der</strong> zu<br />
Granulat verarbeitet.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz wurde das von PlasticsEurope (ehemals APME) veröffentlichte<br />
Ecoprofile für PP verwendet [PlasticsEurope 2005a]. Der Datensatz umfasst die Produktion<br />
von PP-Granulat ab <strong>der</strong> Entnahme <strong>der</strong> Rohstoffe aus <strong>der</strong> natürlichen Lagerstätte inkl. <strong>der</strong><br />
damit verb<strong>und</strong>enen Prozesse. Die Daten beziehen sich auf einen Zeitraum um 1999. Sie<br />
wurden in insgesamt 29 Polymerisationsanlagen erhoben. Die betrachteten Anlagen umfassen<br />
eine Jahresproduktion von 5.690.000 Tonnen. Die europäische Gesamtproduktion lag<br />
1999 bei 7.395.000 Tonnen. Der PlasticsEurope Datensatz repräsentiert 76,9% <strong>der</strong> westeuropäischen<br />
PP-Produktion.<br />
4.1.2 Datensatz LDPE<br />
Polyethylen geringer Dichte (LDPE) wird in einem Hochdruckprozess hergestellt <strong>und</strong> enthält<br />
eine hohe Anzahl an langen Seitenketten. In <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz wurde das von<br />
PlasticsEurope veröffentlichte Ecoprofile für LDPE verwendet [PlasticsEurope 2005b].<br />
Der Datensatz umfasst die Produktion von LDPE-Granulat ab <strong>der</strong> Entnahme <strong>der</strong> Rohstoffe<br />
aus <strong>der</strong> natürlichen Lagerstätte inkl. <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Prozesse. Die Daten beziehen<br />
sich auf einen Zeitraum um 1999. Sie wurden in insgesamt 27 Polymerisationsanlagen erhoben.<br />
Die betrachteten Anlagen umfassen eine Jahresproduktion von 4.480.000 Tonnen. Die<br />
europäische Gesamtproduktion lag 1999 bei ca. 4.790.000 Tonnen. Der PlasticsEurope Datensatz<br />
repräsentiert somit 93,5% <strong>der</strong> westeuropäischen LDPE-Produktion.<br />
4.1.3 Datensatz HDPE<br />
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) wird in verschiedenen Nie<strong>der</strong>druckverfahren hergestellt<br />
<strong>und</strong> enthält weniger Seitenketten als das LDPE. In <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz wurde das<br />
von PlasticsEurope veröffentlichte Ecoprofile für HDPE verwendet [PlasticsEurope 2005c].<br />
Der Datensatz umfasst die Produktion von HDPE-Granulat ab <strong>der</strong> Entnahme <strong>der</strong> Rohstoffe<br />
aus <strong>der</strong> natürlichen Lagerstätte inkl. <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Prozesse. Die Daten beziehen<br />
sich auf einen Zeitraum um 1999. Sie wurden in insgesamt 24 Polymerisationsanlagen erhoben.<br />
Die betrachteten Anlagen umfassen eine Jahresproduktion von 3.870.000 Tonnen. Die<br />
europäische Gesamtproduktion lag 1999 bei ca. 4.310.000 Tonnen. Der PlasticsEurope Datensatz<br />
repräsentiert 89,7% <strong>der</strong> westeuropäischen HDPE-Produktion.<br />
Endbericht Oktober 2008
34 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
4.1.4 Datensatz <strong>PET</strong><br />
Gereinigte Terephthalsäure (Purified Terephthalic Acid, PTA) <strong>und</strong> Ethylenglykol sind die<br />
Ausgangsstoffe für die folgende Veresterung zum bis-(2-Hydroxyethyl)-Terephthalat (BHET).<br />
Dieses formale Monomer wird durch den nachfolgenden Polykondensationsschritt zu Polyethylenterephthalat<br />
(<strong>PET</strong>) polykondensiert.<br />
Die vorliegende Studie verwendet in den Basisiszenarien das von PlasticsEurope veröffentlichten<br />
Ecoprofile für die <strong>PET</strong>-Herstellung [PlasticsEurope 2005 d]. Dieser Datensatz umfasst<br />
die Produktion von <strong>PET</strong> ab <strong>der</strong> Entnahme <strong>der</strong> Rohstoffe bis zum fertigen Polymer inklusive<br />
aller damit verb<strong>und</strong>enen Prozesse. Die Daten beziehen sich auf einen Zeitraum um 1999.<br />
Sie wurden in insgesamt 10 Polymerisationsanlagen erhoben. Die betrachteten Anlagen umfassen<br />
eine Jahresproduktion von 933.000 Tonnen. Die europäische Gesamtproduktion lag<br />
1999 bei ca. 1.560.000 Tonnen. Der PlasticsEurope Datensatz repräsentiert 59,8% <strong>der</strong><br />
westeuropäischen <strong>PET</strong>-Produktion.<br />
Der Datensatz ist in hoch aggregierter Form via Internet-Download erhältlich. Die Prüfung<br />
<strong>der</strong> Daten erfolgte intern bei PlasticsEurope.<br />
In einer Sensitivitätsanalyse wird ein alternativer <strong>PET</strong>-Datensatz verwendet. Dieser <strong>PET</strong>-<br />
Datensatz wurde im Rahmen einer Ökobilanz im Auftrag von <strong>PET</strong>CORE 5 erarbeitet [I-<br />
FEU 2004b]. Die Daten zur Terephthalsäure-Produktion basieren auf Werten europäischer<br />
Anlagen, die von Prof. Rieckmann (FH Köln) erhoben <strong>und</strong> von IFEU entsprechend den Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an eine ISO-konforme Ökobilanz aufgearbeitet <strong>und</strong> eingesetzt wurden.<br />
Der Datensatz zur <strong>PET</strong>-Produktion in Flaschenqualität basiert auf einer Produktionskapazität<br />
von fünf europäischen Anlagen <strong>und</strong> wurde von Prof. Rieckmann (FH Köln) zusammengestellt.<br />
Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 2002/2003. Es werden ca. 36% <strong>der</strong> europäischen<br />
<strong>PET</strong>-Produktion durch den <strong>PET</strong>-Datensatz abgedeckt.<br />
Der Petcore Datensatz ist auf Nachfrage <strong>und</strong> gegen Gebühr ebenfalls in aggregierter Form<br />
erhältlich. Die Daten wurden im Rahmen einer kritischen Begutachtung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>CORE-<br />
Studie von externen Experten geprüft.<br />
4.2 Herstellung von <strong>Glas</strong> <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>flaschen<br />
Die verwendeten Daten für die Herstellung von Hohlglas entsprechen dem Datensatz <strong>der</strong> im<br />
Rahmen von UBA-lI/1 [UBA 2000] erhoben <strong>und</strong> dokumentiert wurde. Der von <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>industrie<br />
zur Verwendung in <strong>der</strong> UBA-Studie bereitgestellte Datensatz gab einen repräsentativen<br />
Querschnitt <strong>der</strong> eingesetzten Technologien <strong>und</strong> Energieträger wie<strong>der</strong> 6 . Der Energieverbrauch<br />
<strong>und</strong> die Emissionen <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>herstellung werden durch die Zusammensetzung des<br />
mineralischen Rohstoffgemenges <strong>und</strong> vor allem durch die Wannentechnologie sowie die in<br />
<strong>der</strong> Direktbefeuerung verwendeten fossilen Energieträger bestimmt.<br />
Bei <strong>der</strong> Fachvereinigung Behälterglas e.V. (FVB) wurden im Februar 2003 aktuelle Daten<br />
nachgefragt. Dabei wurde bestätigt, dass die in <strong>der</strong> UBA II/1-Ökobilanz verwendeten Daten<br />
für die Behälterglasherstellung noch dem aktuellen Stand entsprechen. Der Innovationszyklus<br />
ist in <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>industrie relativ langsam, da <strong>der</strong> Invest für <strong>Glas</strong>schmelzwannen sehr hoch<br />
liegt.<br />
5 <strong>PET</strong> Containers Recycling Europe<br />
6 Siehe [UBA 2000], S. 57<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 35<br />
Der Eigen- <strong>und</strong> Fremdscherbenanteil bei <strong>der</strong> Herstellung von Weißglas liegt wie auch in<br />
[UBA 2000] dargestellt bei ca. 65%.<br />
4.3 Herstellung von <strong>PET</strong>-Flaschen<br />
Die Produktion von <strong>PET</strong>-Flaschen erfolgt in <strong>der</strong> Regel zweistufig, d.h. es werden aus dem<br />
getrockneten <strong>PET</strong>-Granulat zunächst so genannte. Preforms hergestellt <strong>und</strong> diese in einem<br />
zweiten Schritt (Flaschenblasen) zu Flaschen weiterverarbeitet. Im Falle von <strong>PET</strong>-Einweg<br />
<strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen findet das Flaschenblasen direkt beim Abfüller statt, während<br />
im Falle von <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen die fertigen Flaschen beim Abfüller angeliefert werden.<br />
Der Energieverbrauch für den Spritzguß von Preforms ist stark vom Preformgewicht abhängig.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wurde auf aktuelle Daten zur Preformherstellung zurückgegriffen,<br />
die dem IFEU-Institut intern aus verschiedenen Projekten vorliegen.<br />
Der Energieverbrauch für das Flaschenblasen (SBM) wird unter an<strong>der</strong>em stark vom Flaschenvolumen<br />
bestimmt. Ebenso wie im Falle <strong>der</strong> Preformherstellung wird in <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Studie auf dem IFEU-Institut vorliegende interne Daten zurückgegriffen.<br />
Zur Wahrung <strong>der</strong> Vertraulichkeit <strong>der</strong> Daten muss auf die Dokumentation <strong>der</strong> Rechenwerte<br />
zum Strom- <strong>und</strong> Materialverbrauch im vorliegenden Bericht verzichtet werden.<br />
Die Daten werden seitens IFEU als näherungsweise repräsentativ eingeschätzt. Dies kann<br />
jedoch aufgr<strong>und</strong> des relativ kleinen Stichprobenumfangs <strong>der</strong>zeit nicht belastbar dargestellt<br />
werden.<br />
4.4 Verpackungskomponenten aus Aluminium<br />
Innerhalb <strong>der</strong> betrachteten Verpackungssysteme wird Aluminium als Aluminiumband (Stärkebereich:<br />
20µ - 200µ) zur Herstellung von Anrollverschlüssen eingesetzt.<br />
Die Gr<strong>und</strong>lage für die verwendeten Ökobilanzdaten bilden die in den Jahren 2000 bzw. 2005<br />
veröffentlichten Ökoprofile <strong>der</strong> European Aluminium Association (EAA), Brüssel [EAA 2000],<br />
EAA 2005]. Diese Datensätze sind insgesamt über mehrere Prozessstufen hinweg aggregiert.<br />
Tabelle 4-1: Verwendete Aluminiumdatensätze [EAA 2000] [AA 2005]<br />
Material<br />
Datum <strong>der</strong><br />
Veröffentlichung<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Bezugszeitraum Umfasste Anlagen<br />
Primäraluminium 2005 2002 k.A.<br />
Aluminiumbän<strong>der</strong> 2000 1998 k.A.<br />
4.4.1 Herstellung von Aluminiumbarren <strong>und</strong> -bän<strong>der</strong>n<br />
Der Datensatz zum Primäraluminium beschreibt die Herstellung von Aluminium ausgehend<br />
von <strong>der</strong> Bauxitgewinnung über die Tonerdeherstellung bis zum fertigen Aluminiumbarren<br />
einschließlich <strong>der</strong> Anodenherstellung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Elektrolyse. Der Datensatz beruht auf Erhebungen<br />
des europäischen Aluminiumverbandes (EAA) im Jahre 1998. Dabei wurde eine Repräsentativität<br />
von 98% bezogen auf die europäische Primäraluminiumherstellung erreicht.<br />
Der Datensatz wurde vom europäischen Aluminiumverband im Jahre 2005 einem Update mit
36 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
aktualisierten Prozessdaten (erhoben im Jahr 2002) unterzogen. Dieser aktualisierte Datensatz<br />
wird in <strong>der</strong> vorliegenden Studie verwendet.<br />
Der Datensatz für Aluminiumband beruht auf Datenerhebungen des europäischen Aluminiumverbandes<br />
(EAA) im Jahre 1998 für die Herstellung von Halbzeug aus Aluminium. Dabei<br />
wurde je nach Produktgruppe eine Repräsentativität von 20% – 70% erreicht.<br />
Die Datensätze wurden von <strong>der</strong> EAA in aggregierter Form veröffentlicht. Lediglich <strong>der</strong> Anteil<br />
<strong>der</strong> Stromerzeugung kann aus den Datensätzen separiert werden. Zum Zwecke <strong>der</strong> Datensymmetrie<br />
wurden daher die Aluminiumdatensätze mit aktualisierten Datensätzen für Netzstrom<br />
kombiniert.<br />
4.4.2 Herstellung von Aluminium-Anrollverschlüssen<br />
Der Datensatz zur Herstellung des Aluminium-Anrollverschlusses 28 mm entstammt <strong>der</strong> Datensammlung<br />
einer im Dezember 1996 veröffentlichten Ökobilanz des Öko-Instituts e.V.<br />
Freiburg. 7 Der Datensatz wurde im Jahre 1992 vom Verband Metallverpackungen e.V. Düsseldorf<br />
in <strong>der</strong> Arbeitsgruppe Ökobilanzen für Metallverpackungen erstellt. 8 Nach internen<br />
Rückfragen des Verbandes bei den deutschen Verschlussherstellern hatten die Daten auch<br />
1998 noch ihre Gültigkeit. 9 Die fehlenden Daten zu den produktionsbedingten Abfallmengen<br />
wurden vom größten deutschen Hersteller (Crown Ben<strong>der</strong> GmbH, Frankenthal) im Oktober<br />
1998 ergänzt. 10 Der Prozessdatensatz wurde mit einem aktuellen Netzstromdatensatz kombiniert.<br />
7 Öko-Institut e. V. (Hrsg.), Gensch, C.O: Vergleich von Weinflaschenverschlüssen unter ökologischen Gesichtspunkten.<br />
Naturkorkenverschluß versus Aluminiumdrehverschluß. Im Auftrag des Deutschen Korkverbands. Abschlußbericht. Freiburg,<br />
1996<br />
8 Hexel, G.: Ökobilanz Aluminiumanrollverschluß 28 mm Durchmesser mit EL-Dichtung. Braunschweig, 1992<br />
9 Schreiben Verband Metallverpackungen e.V., Düsseldorf vom 21. 9. 1998<br />
10 Telefax <strong>der</strong> Crown Ben<strong>der</strong> GmbH, Frankenthal vom 27. 10. 1998<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 37<br />
4.5 Herstellung von Wellpappe <strong>und</strong> Wellpappetrays<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz wurden die von <strong>der</strong> FEFCO 11 im Jahr 2003 veröffentlichten<br />
Datensätze zur Herstellung von Wellpappe-Rohpapieren <strong>und</strong> Wellpappe-Verpackungen verwendet<br />
[FEFCO 2003].<br />
Tabelle 4-2: Verwendete Datensätze zur Wellpappeherstellung [FEFCO 2003]<br />
Karton-Material<br />
Datum <strong>der</strong><br />
Veröffentlichung<br />
Bezugszeitraum Repräsentativität Umfasste Staaten<br />
Kraftliner 2003 2002 >70% A, Fi, Fr, P, Sk, Se<br />
Testliner 2003 2002<br />
Wellenstoff 2003 2002<br />
Wellpappe<br />
<strong>und</strong> Trays<br />
2003<br />
2002<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
52%<br />
20%<br />
(111 Werke)<br />
A, B, Dk, Fr, D, It,<br />
NL, Es, CH, UK<br />
A, B, Cz, Dk, Fi, Fr, D, Hu,<br />
It, NL, Es, No, Se, CH, UK<br />
Im Einzelnen wurde auf die Datensätze zur Herstellung von „Kraftliner“ (überwiegend aus<br />
Primärfasern), “Testliner“ <strong>und</strong> „Wellenstoff“ (beide aus Altpapier) sowie <strong>der</strong> Wellpappeverpackung<br />
zurückgegriffen. Die Datensätze stellen gewichtete Mittelwerte <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Datenerhebung<br />
<strong>der</strong> FEFCO erfassten europäischen Standorte dar. Sie beziehen sich auf die Produktion<br />
im Jahr 2002.<br />
Bei Wellpappen wird häufig aus Gründen <strong>der</strong> Stabilität ein Anteil von Frischfasern eingesetzt.<br />
Im europäischen Mittel liegt nach [FEFCO 2003] dieser Anteil bei 24%. Mangels spezifischerer<br />
Daten wurde dieser Split auch in <strong>der</strong> vorliegenden Studie angesetzt.<br />
4.6 Abfülldaten<br />
Für die vorliegende Ökobilanz wurden für die verschiedenen Verpackungstypen Abfülldaten<br />
von 10 Abfüllstandorten verschiedener GDB-Mitgliedsbetriebe erhoben <strong>und</strong> zur Plausibilitätsprüfung<br />
mit den Daten älterer Studien sowie den Angaben zweier Hersteller von Abfülllinien<br />
verglichen. Daten zur Abfüllung wurden beispielsweise im Petcore Bericht von 2004<br />
ausführlich dokumentiert. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Vertraulichkeit <strong>der</strong> aktuell erhobenen Daten ist dies<br />
im Rahmen dieser Studie nicht möglich. Im Vergleich zu älteren Verbrauchsdaten wurde <strong>der</strong><br />
Bedarf an Dampf vor allem beim Abfüllprozess von <strong>Glas</strong>-MW-Flaschen gesenkt, was mit einer<br />
Optimierung bereits bestehen<strong>der</strong> Anlagen zu begründen ist. Im Bereich aller Verpackungssysteme<br />
hat sich dagegen <strong>der</strong> Verbrauch von elektrischer Energie leicht erhöht. Dies<br />
ist mit einem fortschreitenden Automatisierungsgrad <strong>der</strong> Abfülllinien zu erklären.<br />
4.7 Annahmen zur Getränkedistribution<br />
Für die „Ökobilanz für Getränkeverpackungen“ des UBA [2000] wurde eine ausführliche Distributionsanalyse<br />
durchgeführt, die für die Jahre 1996/1997 repräsentativ ist. Die erhaltenen<br />
Daten wurden in ein Modell überführt, das eine Distribution über drei Schienen abbildet: Direkttransport,<br />
Transport über den Getränkefachgroßhandel <strong>und</strong> Distribution über Zentralläger<br />
des Handels. Es war aber auf Basis <strong>der</strong> Distributionsanalyse nicht möglich, unterschiedliche<br />
11 FEFCO: Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé, Brussels.
38 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Entfernungen zwischen einzelnen Einweg- <strong>und</strong> Mehrwegsystemen kausal zu begründen.<br />
Daher wurden Ein- <strong>und</strong> Mehrwegverpackungen mit den gleichen Entfernungen aber unterschiedlichen<br />
Anteilen in den Distributionssträngen modelliert.<br />
Tabelle 4-3 zeigt die Transportentfernungen <strong>und</strong> den LKW-Fuhrpark <strong>der</strong> verschiedenen Verpackungssysteme<br />
für Mineralwasser im Bereich Vorratskauf, wie sie <strong>der</strong> UBA-Ökobilanz<br />
zugr<strong>und</strong>e lagen. Die Transportstrecken zwischen Abfüllern <strong>und</strong> „Point of Sale“ (POS) belaufen<br />
sich damit, Hin- <strong>und</strong> Rückfahrt zusammen genommen, auf knapp 372 km für die Mehrwegsysteme<br />
<strong>und</strong> auf ca. 432 km für die Einwegsysteme. Dieses Distributionsmodell nach<br />
UBA findet in Untersuchungsgruppe A [oFG] <strong>und</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG] Anwendung.<br />
Tabelle 4-3: Transportparameter für die Distribution von Mineralwasser in <strong>der</strong> UBA-Ökobilanz<br />
Vom Abfüller<br />
Distributionswege<br />
2. Distributionsstufe<br />
Distribution von Mineralwasser in Deutschland 2004<br />
Verteilung (%) Distanz (km)<br />
Mehr-<br />
weg<br />
Einweg<br />
Mehrweg Einweg<br />
voll leer voll leer<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
LKW-Größen (Vol.-% Getränkemenge differenziert<br />
nach zulässigem Gesamtgewicht)<br />
> 32 t 26-32 t 20-26 t 14-20 t < 14 t<br />
Direktvertrieb 30% 15% 110 110 110 90 66 3 27 4 0<br />
zum "GFGH"" 62% 25% 170 170 170 140 88 2 9 1 0<br />
zum Zentrallager 8% 57% 210 210 210 170 94 2 4 0 0<br />
vom "GFGH" zum POS 62% 28% 50 30 50 30 35 1 35 25 4<br />
vom Zentrallager zum POS 8% 57% 90 60 90 60 77 5 17 1 0<br />
Mittelwert Gesamtdistanz 193 179 244 188<br />
Seit dem Zeitpunkt <strong>der</strong> UBA-Distributionsanalyse hat es deutliche Verän<strong>der</strong>ungen auf dem<br />
Getränke- <strong>und</strong> Verpackungsmarkt in Deutschland gegeben. Weiterhin haben Expertengespräche<br />
im Rahmen von an<strong>der</strong>en Studien des IFEU Hinweise für verpackungsbedingte Unterschiede<br />
in <strong>der</strong> Transportlogistik geliefert, die in <strong>der</strong> oben genannten Distributionsanalyse<br />
(noch) nicht berücksichtigt wurden.<br />
Um diesen verän<strong>der</strong>ten Bedingungen Rechnung zu tragen, wurden im Rahmen dieser Studie<br />
neue Distributionsdaten im Bereich <strong>der</strong> MW-Flaschen erhoben. Dazu wurden Mitgliedsbetriebe<br />
<strong>der</strong> GDB unterschiedlicher Größe befragt. Die jährlichen Abfüllmengen dieser Mineralbrunnen<br />
<strong>und</strong> Abfüllbetriebe reichen von weniger als 50 Millionen Liter bis über 700 Millionen<br />
Liter. Da die ermittelten Daten für die <strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrweg Distribution keine<br />
statistisch belastbaren Unterschiede aufweisen, werden diese Systeme hinsichtlich <strong>der</strong> Distribution<br />
gemeinsam betrachtet.<br />
Tabelle 4-4 zeigt die Transportentfernungen <strong>und</strong> den LKW-Fuhrpark <strong>der</strong> Mehrwegsysteme<br />
für Mineralwasser <strong>und</strong> kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke (CSD) im Bereich Vorratskauf.<br />
Die Transportstrecken zwischen Abfüllern <strong>und</strong> „Point of Sale“ (POS) belaufen sich damit,<br />
Hin- <strong>und</strong> Rückfahrt zusammen genommen, auf knapp 260 km. Bezüglich <strong>der</strong> Verteilung<br />
<strong>der</strong> zum Transport von Getränkefachgroßhändlern beziehungsweise Zentrallägern zum<br />
„Point of Sale“ genutzten LKW-Größen konnten keine Neuerhebungen durchgeführt werden,<br />
weshalb im Bereich <strong>der</strong> 2. Distributionsstufe die Daten <strong>der</strong> „Ökobilanz für Getränkeverpackungen“<br />
des UBA [2000] herangezogen wurden.
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 39<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Distribution wurde die <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche wie die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
bilanziert, da sie den gr<strong>und</strong>sätzlich gleichen logistischen Abläufen <strong>und</strong> Strukturen wie die<br />
<strong>PET</strong>-Mehrwegflasche unterliegt.<br />
Die Datenerhebung bei den GDB-Mitgliedsfirmen umfasste auch die Distribution von <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflaschen. Diese stellen bei den befragten Mitgliedsbetrieben <strong>der</strong> GDB jedoch eher ein<br />
Randsegment dar. Für die 1. Distributionsstufe <strong>der</strong> Distribution <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-EW-Flasche wurde<br />
daher auf eine frühere Datenerhebung zurückgegriffen [Petcore 2004] die bereits die verän<strong>der</strong>ten<br />
Distributionsbedingungen bezüglich <strong>PET</strong>-EW durch Discounterlieferanten berücksichtigt.<br />
Die entsprechenden Daten sind in Tabelle 4-5 dargestellt. Die durchschnittliche Transportentfernung<br />
für Hin- <strong>und</strong> Rückfahrt liegt hier mit über 480 km deutlich über denen, die für<br />
die Mehrwegflaschen <strong>der</strong> GDB ermittelt wurden.<br />
Die erhobenen <strong>PET</strong>-EW Distributionsentfernungen <strong>der</strong> aktuellen GDB-Befragung liegen in<br />
ähnlichen Bereichen wie diejenigen <strong>der</strong> Umfrage im Kontext <strong>der</strong> <strong>PET</strong>CORE-Studie <strong>und</strong> stützen<br />
daher die Annahme, dass <strong>PET</strong>-Einweg über große Strecken distribuiert wird. Bezüglich<br />
<strong>der</strong> Transportdistanzen <strong>der</strong> Fahrten von Zentrallägern zum POS (2. Distributionsstufe) werden<br />
die Daten <strong>der</strong> MW Distribution verwendet.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-EW Flaschen findet vor <strong>der</strong> Rückfahrt zu den Zentrallägern eine Reduktion<br />
des Flaschenvolumens durch Kompaktierung statt. Da nach Expertenschätzung ungefähr<br />
die Hälfte <strong>der</strong> Ver- <strong>und</strong> Entsorgung <strong>der</strong> Märkte durch Speditionsverkehr übernommen<br />
wird, kann aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Volumenreduktion auf Rückfahrten von weniger Fahrten beziehungsweise<br />
zum Zwecke <strong>der</strong> Modellierung von einer kürzeren Rückfahrtentfernung ausgegangen<br />
werden.<br />
Dieses Distributionsmodell aus Daten <strong>der</strong> aktualisierten GDB-Befragung <strong>und</strong> <strong>PET</strong>CORE Daten<br />
findet in Untersuchungsgruppe B Verwendung.<br />
Tabelle 4-4: Transportparameter für die Distribution von Mineralwasser <strong>und</strong> CSD in Mehrwegsystemen<br />
nach GDB-Befragung (aktualisierte GDB-MW Distribution)<br />
Distribution von Mineralwasser <strong>und</strong> CSD in: <strong>Glas</strong>-Mehrweg 0,7 L <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrweg 1,0 L (Quelle GDB-Befragung; 2008)<br />
Vom Abfüller<br />
Split <strong>der</strong> Distribution<br />
2. Distributionsstufe<br />
Split (%)<br />
Mehrweg<br />
Distanz<br />
(km)<br />
Mehrweg<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Fuhrparkzusammensetzung<br />
voll leer > 32 t 26-32 t 20-26 t 14 - 20 t > 14 t<br />
Direktvertrieb 38,0% 78 78 98,6% 0,4% 0,8% 0,3% 0,0%<br />
zum "GFGH"" 50,4% 111 111 96,4% 1,2% 1,9% 0,3% 0,2%<br />
zum Zentrallager 11,5% 128 128 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
vom "GFGH" zum POS 50,4% 44 44 86,5% 13,5% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
vom Zentrallager zum POS 11,5% 60 60 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
Mittelwert Gesamtdistanz 129 129
40 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 4-5: Transportparameter für die Distribution von Mineralwasser <strong>und</strong> CSD in Einwegsystemen<br />
nach Abfüllerumfrage im Kontext <strong>der</strong> Petcore Ökobilanz 2004 <strong>und</strong> aktualisierter GDB-MW Distribution<br />
Distribution von Mineralwasser <strong>und</strong> CSD in: <strong>PET</strong>-Einweg 1,5 L (Quelle <strong>PET</strong>CORE 2004; GDB-Befragung; 2008)<br />
Vom Abfüller<br />
Split <strong>der</strong> Distribution<br />
2. Distributionsstufe<br />
Split (%)<br />
Einweg<br />
Distanz<br />
(km)<br />
Einweg<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Fuhrparkzusammensetzung<br />
voll leer > 32 t 26-32 t 20-26 t 14 - 20 t > 14 t<br />
Direktvertrieb 0,0%<br />
zum "GFGH"" 0,0%<br />
zum Zentrallager 100,0% 245 125 95,9% 1,1% 2,7% 0,3% 0,0%<br />
vom "GFGH" zum POS 0,0%<br />
vom Zentrallager zum POS 100,0% 60 52 77,0% 5,0% 17,0% 1,0% 0,0%<br />
Mittelwert Gesamtdistanz 305 177<br />
Die für die meisten Strecken bedeutendste LKW-Größe > 32 t steht zu 60% stellvertretend<br />
für Sattelzüge <strong>und</strong> zu 40% für Lastkraftwagen mit Hänger.<br />
Die Annahme größerer Einweg-Transportdistanzen wird dadurch gestützt, dass die Discounter<br />
deutschlandweit von nur 16 Abfüllstandorten mit Einwegflaschen beliefert werden. Demgegenüber<br />
stehen 181 Mehrweg-Abfüller <strong>der</strong> GDB, die von einer noch höheren Anzahl Abfüllstandorte<br />
aus distribuieren.<br />
Wie groß die Unterschiede <strong>der</strong> jeweiligen Transportdistanzen tatsächlich sind, ist nicht endgültig<br />
zu belegen. Die in dieser Studie getroffenen Annahmen werden aber von den Auftragnehmern<br />
als plausibel einschätzt.<br />
4.8 Verwertung gebrauchter Packstoffe<br />
4.8.1 <strong>PET</strong>-Flaschenaufbereitung zu <strong>PET</strong>-Flakes (open loop)<br />
Die <strong>PET</strong>-Flaschenfraktion aus Sortierungen wie auch aus den getrennten Sammlungen wird<br />
einer Flaschenaufbereitung zugeführt, die saubere <strong>PET</strong>-Flakes als Produkt liefern. Die Aufwendungen<br />
<strong>und</strong> die Effizienz <strong>der</strong> Aufbereitung hängen dabei wesentlich von <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong><br />
Ausgangsware, <strong>der</strong> Zielqualität <strong>der</strong> Flakes <strong>und</strong> <strong>der</strong> eingesetzten Technologie ab.<br />
Die in Deutschland <strong>der</strong>zeit eingesetzten Aufbereitungsanlagen für <strong>PET</strong>-Flaschen unterscheiden<br />
sich zwar im Alter <strong>und</strong> in den Detailverfahren, dennoch weisen die meisten Anlagen folgende<br />
Verfahrensschritte auf:<br />
• Ballenöffnung <strong>und</strong> Vereinzelung <strong>der</strong> Flaschen<br />
(Manche Recycler schalten einen Warmwaschprozess für die Flaschen dazwischen,<br />
um Etiketten <strong>und</strong> Verunreinigungen bereits zu entfernen)<br />
• Manuelle o<strong>der</strong> automatische Sortierung (Entfernung von Störstoffen <strong>und</strong> Metallen)<br />
• Zerkleinerung <strong>der</strong> Flaschen zu Flakes<br />
• Dichtetrennung (Separierung v.a. von PE, PP <strong>und</strong> EVA)<br />
• Waschprozess (meist warm mit NaOH)<br />
• Mechanische <strong>und</strong> thermische Trocknung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Flakes
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 41<br />
(In einigen Anlagen erfolgt eine automatische Nachsortierung, die PVC-<br />
•<br />
Kontaminationen <strong>und</strong> farbiges <strong>PET</strong> entfernen)<br />
Abfüllung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Flakes<br />
Die in dieser Studie verwendeten Prozessdaten wurden im Rahmen <strong>der</strong> Studie im Auftrag<br />
von <strong>PET</strong>CORE [IFEU 2004b] erarbeitet <strong>und</strong> validiert. Sie bilden 3 Recyclinganlagen mit einer<br />
Gesamtkapazität von 53.000 Jahrestonnen ab.<br />
4.8.2 Bottle-to-Bottle-Recycling (closed-loop) [<strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen]<br />
In Europa existieren verschiedene Verfahren, mit denen aus <strong>PET</strong>-Flakes (bzw. aus alten<br />
<strong>PET</strong>-Flaschen) Recycling-<strong>PET</strong> (R-<strong>PET</strong>) hergestellt werden kann, welches den hohen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an die Lebensmitteltauglichkeit genügt 12 , um daraus wie<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Flaschen zu produzieren.<br />
Im Rahmen dieser Studie wurden modelltechnisch folgende Verfahren berücksichtigt:<br />
• Solid State Polycondensation (SSP) mit vorgeschalteter Regranulierung<br />
• URRC (HybridUn<strong>PET</strong>)<br />
Generell wurden Daten zu den einzelnen Verfahren über die Anlagen-Kapazitäten gewichtet.<br />
Die Datensätze können aber aus Vertraulichkeitsgründen nicht dargestellt werden.<br />
Solid State Polycondensation (SSP)<br />
Der SSP-Prozess ist <strong>der</strong>zeit das gängige Verfahren zur Herstellung von R-<strong>PET</strong> für das Bottle-to-Bottle<br />
Recycling. Der eigentlichen Nachkondensation muss zunächst eine Regranulierung<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Flakes vorgeschaltet werden. Dazu werden die getrockneten Flakes in einen<br />
Entgasungsextru<strong>der</strong> gegeben <strong>und</strong> zu <strong>PET</strong>-Strängen bei ungefähr 270-280°C verpresst.<br />
Gleichzeitig werden leichtflüchtige Verbindungen ausgegast <strong>und</strong> Feststoff-Verunreinigungen<br />
über einen feinporigen Filter aus dem flüssigen <strong>PET</strong> abgeschieden. Die Stränge werden anschließend<br />
auf Granulat-Größe geschnitten.<br />
In dem Polykondensations-Prozess wird das <strong>PET</strong>-Regranulat über einen längeren Zeitraum<br />
auf einer Temperatur von ca. 210-220°C gehalten. Ziel dieses Prozesses ist eine Verlängerung<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Ketten <strong>und</strong> ein Erhöhung <strong>der</strong> Viskosität, so dass das R-<strong>PET</strong> für die Preform-<br />
Herstellung wie<strong>der</strong> eingesetzt werden kann.<br />
Leichtflüchtige Verunreinigungen werden in <strong>der</strong> SSP – soweit sie nicht bereits im Regranulierschritt<br />
ausgegast worden sind – durch die lange Temperatureinwirkung <strong>und</strong> einem leichten<br />
Vakuum aus dem Material herausgezogen. Meistens werden kontinuierliche analytische<br />
Messungen zur Überwachung <strong>der</strong> Reinheit des Materials angeschlossen.<br />
Es existieren für dieses Verfahren in Europa einige Recyclinganlagen, die über mehrere Jahre<br />
bereits ein Bottle-to-Bottle Recycling praktizieren. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die<br />
Möglichkeit einer hohen gezielten Viskositäts(IV)-Steigerung <strong>und</strong> die Homogenität des Endprodukts.<br />
Nachteilig stellt sich <strong>der</strong> relativ hohe Energieverbrauch dieses Recyclingprozesses<br />
dar. In <strong>der</strong> neuen Anlage von Amcor in Beaune, kommt aber ein kontinuierliches Verfahren<br />
anstatt des üblichen Batch-Prozesses zum Einsatz, wodurch <strong>der</strong> Energiebedarf erheblich reduziert<br />
werden kann.<br />
12 Challenge-Test gemäß Fraunhofer Institut, Freising, Deutschland<br />
Endbericht Oktober 2008
42 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Es liegen aktuelle Zahlen aus den Jahren 2002/2003 für zwei SSP-Anlagen mit Batchprozess<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Datensatz für die kontinuierlich arbeitende Anlage von Amcor in Beaune vor.<br />
URRC-Verfahren<br />
Das URRC-Verfahren, das auch HybridUn<strong>PET</strong>-Verfahren genannt wird, unterscheidet sich<br />
gegenüber den Alternativverfahren durch das Ausgangsmaterial. Hierbei werden <strong>PET</strong>-<br />
Flaschen direkt eingesetzt <strong>und</strong> zunächst in Schneidmühlen zu einer einheitlichen Korngröße<br />
gemahlen. Anschließend trennen Windsichter die Etiketten aus Papier o<strong>der</strong> Kunststoff ab,<br />
mit Klebstoff behaftete Etiketten werden in einer Intensivwäsche gelöst.<br />
Nach <strong>der</strong> folgenden Trennung <strong>der</strong> polyolefinischen Verschlussdeckel beginnt die Veredelung<br />
des <strong>PET</strong>-Rezyklats für den Einsatz in <strong>der</strong> Lebensmittelindustrie: In einer Mischschnecke wird<br />
das <strong>PET</strong>-Mahlgut mit Natronlauge benetzt. Hierdurch löst sich die Oberfläche des Materials<br />
(durch Verseifung <strong>und</strong> Entfernung <strong>der</strong> entstehenden Monomere) ab, <strong>und</strong> anhaftende Verunreinigungen<br />
werden entfernt. Um einen größtmöglichen Reinigungsgrad zu erreichen, folgen<br />
abschließend noch weitere Prozessschritte, bevor das Material zur mechanischen Trocknung<br />
gelangt.<br />
Für die URRC-Anlage <strong>der</strong> Cleanaway in Rostock, liegen Verbrauchsdaten aus 2002 vor, die<br />
in dieser Studie Berücksichtigung fanden.<br />
4.9 Hintergr<strong>und</strong>daten<br />
Die in <strong>der</strong> UBA-Ökobilanz für die Bilanzierung <strong>der</strong> Bereitstellung von Netzstrom <strong>und</strong> LKW-<br />
Transporten verwendeten Daten (Emissionsfaktoren, Energiemix) bezogen sich auf den<br />
Stand etwa Mitte <strong>der</strong> 1990er Jahre. Mittlerweile wurden aufgr<strong>und</strong> von gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> EU (LKW-EURO-Normen, EU-Verordnung zu Großfeuerungsanlagen)<br />
erhebliche technische Verän<strong>der</strong>ungen implementiert.<br />
Die entsprechenden Daten wurden vom IFEU-Institut auf den durchschnittlichen Stand des<br />
Zeitraums 2005-2006 aktualisiert.<br />
4.9.1 LKW-Transporte<br />
Für den Gütertransport auf <strong>der</strong> Straße wurde die <strong>der</strong>zeit auf den Straßen eingesetzte (dieselbetriebene)<br />
LKW-Flotte modelliert.<br />
Der Datensatz beruht auf Standardemissionsdaten, die für das Umweltb<strong>und</strong>esamt Berlin,<br />
Umweltb<strong>und</strong>esamt Wien <strong>und</strong> das B<strong>und</strong>esamt für Umweltschutz (BUWAL), Bern in dem<br />
„Handbuch für Emissionsfaktoren“ [INFRAS 2004] zusammengestellt, validiert, fortgeschrieben<br />
<strong>und</strong> ausgewertet wurden. Alle Faktoren berücksichtigen die entsprechenden Zusammensetzungen<br />
des Kfz-Bestandes <strong>und</strong> ggf. Fahrleistungsanteile in Deutschland. Das „Handbuch“<br />
ist eine Datenbankanwendung <strong>und</strong> liefert als Ergebnis den fahrleistungsbezogenen<br />
Kraftstoffverbrauch <strong>und</strong> die Emissionen differenziert nach LKW-Klassen, Straßenkategorien<br />
<strong>und</strong> in geson<strong>der</strong>ten Berechnungen auch nach Auslastungsgraden.<br />
Um die gebräuchlichsten LKW-Typen abbilden zu können, wurden die sechs in <strong>der</strong> folgenden<br />
Tabelle 4-5 dargestellten Größenklassen gebildet (Hinweis: Innerhalb <strong>der</strong> Größenklasse<br />
> 32t werden LKWs mit Anhänger <strong>und</strong> Sattelzug getrennt betrachtet).<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 43<br />
Tabelle 4-5: LKW-Fahrzeugklassen mit den zugehörigen zulässigen Gesamtgewichten <strong>und</strong> maximalen<br />
Nutzlasten<br />
Klasse<br />
Zulässiges Gesamt-Gewicht.<br />
Maximale Nutzlast<br />
1 LKW 7,5 t 3,4 t<br />
2 Solo LKW 14 – 20 t 8 t<br />
3 Solo LKW über 20 t 15 t<br />
4 Solo LKW bis 32 t 18 t<br />
5 LKW mit Hänger/Sattelzug über 32 t 25 t<br />
Der Auslastungsgrad – das Verhältnis von tatsächlicher Zuladung zu maximaler Nutzlast –<br />
beeinflusst die spezifischen Transportaufwendungen wesentlich <strong>und</strong> wurde in dem Modell<br />
berücksichtigt. Der Dieselverbrauch teilt sich in den lastunabhängigen Teil Bleer, den <strong>der</strong> leere<br />
LKW bereits benötigt, <strong>und</strong> den zuladungsabhängigen Verbrauch Blast, <strong>der</strong> linear mit dem<br />
Transportgutgewicht <strong>und</strong> dem Auslastungsgrad zunimmt, auf (Abbildung 4-1). Da Bleer auf<br />
das gesamte Transportgut aufgeteilt wird, nehmen die spezifische Verbräuche bzw. Emissionen<br />
(bezogen auf das Transportgewicht) mit zunehmendem Auslastungsgrad ab.<br />
Abbildung 4-1: Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit vom Auslastungsgrad<br />
Auf Basis <strong>der</strong> oben genannten Parameter LKW-Klasse, Straßenkategorie <strong>und</strong> Auslastungsgrad<br />
wurden <strong>der</strong> Kraftstoffeinsatz <strong>und</strong> die Emissionen in Abhängigkeit von Transportgewicht<br />
<strong>und</strong> -entfernung bestimmt. Der in dieser Studie verwendete Datensatz bezieht sich auf das<br />
Jahr 2005.<br />
4.9.2 Strombereitstellung<br />
0<br />
Kraftstoffverbrauch<br />
B leer<br />
Auslastungsgrad<br />
Blast<br />
Die Strombereitstellung für Prozesse, die innerhalb des deutschen Bezugsraums angesiedelt<br />
sind, wurde mit dem deutschen Mix an Energieträgern bilanziert. Vorprodukte, <strong>der</strong>en Herstellung<br />
auch im Ausland erfolgt, wurden mit dem entsprechenden regionalen Energieträger-Mix<br />
berechnet, sofern das Aggregationsniveau <strong>der</strong> jeweiligen Datensätze eine separate Modellierung<br />
<strong>der</strong> Strombereitstellung ermöglichte.<br />
Das Vorgehen bei <strong>der</strong> Modellierung <strong>der</strong> Strombereitstellung erfolgt - unabhängig von <strong>der</strong> regionalen<br />
Zuordnung – nach dem gleichen Prinzip. Der Mix an Energieträgern im deutschen<br />
Netzstrom wurde gemäß <strong>der</strong> Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung<br />
(DIW) auf den Stand 2006 aktualisiert (siehe Tabelle 4-6).<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
1
44 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 4-6: Kraftwerkssplit im Modell Netzstrom Deutschland 2006<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Deutschland 2006<br />
Energieträger Anteile [%]<br />
Steinkohle 20,9%<br />
Braunkohle 23,4%<br />
Mineralöl 1,1%<br />
Naturgase 13,5%<br />
Kernenergie 26,6%<br />
Wasser (ohne Pumpspeicher) 3,6%<br />
Windkraft 5,1%<br />
Sonstige 5,8%<br />
Quelle [DIW 2007]: DIW-Wochenberichte, Nr. 8/2007<br />
Die Modellierung <strong>der</strong> Kraftwerke erfolgte auf <strong>der</strong> Basis von Messwerten, die dem IFEU von<br />
Betreibern deutscher Kraftwerke zur Verfügung gestellt wurden. Diese Daten wurden mit Hilfe<br />
von Literaturangaben, beson<strong>der</strong>s [GEMIS 2001], [Ecoinvent 2003], ergänzt.
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 45<br />
5 Ergebnisse <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung<br />
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme dargestellt.<br />
Die Darstellung <strong>und</strong> Diskussion <strong>der</strong> Ergebnisse stützt sich im Wesentlichen auf die Wirkkategorien,<br />
die in <strong>der</strong> Ökobilanz für Getränkeverpackungen des Umweltb<strong>und</strong>esamt Verwendung<br />
fanden, mit <strong>der</strong> Ausnahme, das <strong>der</strong> Indikator Naturraumbeanspruchung Deponie im<br />
vorliegenden Bericht zum Indikator Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche erweitert<br />
wurde. Die betrachteten Wirkkategorien sind im Einzelnen:<br />
• Klimawandel<br />
• Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
• Sommersmog (POCP) 13<br />
• Versauerung<br />
• Terrestrische Eutrophierung<br />
• Aquatische Eutrophierung<br />
• Naturraumbeanspruchung<br />
In Tabelle 5-1 sind diejenigen Sachbilanzgrößen, die Eingang in die graphisch ausgewertete<br />
Wirkungsabschätzung finden, samt <strong>der</strong> resultierenden Indikatorergebnisse aufgelistet. In nebeneinan<strong>der</strong><br />
stehenden Spalten sind jeweils zuerst die Daten für das eigentliche System <strong>und</strong><br />
dann die Netto-Werte unter Einberechnung <strong>der</strong> Gutschriften aufgeführt.<br />
Tabelle 5-1 Sachbilanz- <strong>und</strong> Wirkungsabschätzungsgrößen <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme<br />
in <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B pro funktionelle Einheit<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
Sachbilanzergebnis<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
System Netto System Netto System Netto System Netto<br />
Braunkohle kg 9,74E+00 8,91E+00 2,21E+01 1,89E+01 1,44E+01 9,53E+00 8,26E+00 7,79E+00<br />
Rohgas kg 1,15E+01 1,08E+01 1,53E+01 1,07E+01 2,11E+01 1,23E+01 8,17E+00 8,09E+00<br />
Rohöl kg 1,27E+01 1,19E+01 2,08E+01 1,61E+01 3,13E+01 2,19E+01 1,30E+01 1,30E+01<br />
Steinkohle kg 4,34E+00 3,93E+00 1,30E+01 1,02E+01 1,31E+01 8,23E+00 4,79E+00 4,60E+00<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Braunkohle kg ROE 3,98E-01 3,65E-01 9,04E-01 7,75E-01 5,91E-01 3,90E-01 3,38E-01 3,19E-01<br />
Rohgas kg ROE 7,13E+00 6,70E+00 9,47E+00 6,63E+00 1,31E+01 7,63E+00 5,07E+00 5,02E+00<br />
Rohöl kg ROE 1,27E+01 1,19E+01 2,08E+01 1,61E+01 3,13E+01 2,19E+01 1,30E+01 1,30E+01<br />
Steinkohle kg ROE 8,00E-01 7,25E-01 2,40E+00 1,89E+00 2,43E+00 1,53E+00 8,82E-01 8,47E-01<br />
Indikatorergebnis kg ROE 2,10E+01 1,97E+01 3,36E+01 2,54E+01 4,74E+01 3,15E+01 1,93E+01 1,92E+01<br />
Klimawandel<br />
Sachbilanzergebnis<br />
CF4 kg 3,29E-05 3,21E-05 6,18E-09 5,49E-09 2,82E-09 1,76E-09 1,27E-09 1,19E-09<br />
CH4 kg 1,60E-01 1,45E-01 4,22E-01 3,05E-01 5,94E-01 3,66E-01 1,87E-01 1,85E-01<br />
CH4, regenerativ kg 8,89E-06 7,75E-06 3,99E-03 3,98E-03 8,63E-05 8,16E-05 8,08E-06 7,61E-06<br />
CO2 fossil+CO2 land use change kg 8,29E+01 7,90E+01 1,43E+02 1,17E+02 1,74E+02 1,29E+02 6,44E+01 6,33E+01<br />
Halon1301 kg 1,05E-11 9,59E-12 2,16E-11 1,81E-11 1,61E-11 1,07E-11 9,52E-12 8,98E-12<br />
N2O kg 2,41E-03 2,33E-03 2,19E-03 1,61E-03 1,76E-03 8,88E-04 1,06E-03 1,01E-03<br />
13 POCP: Photochemical Ozone Creation Potential<br />
Endbericht Oktober 2008
46 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
System Netto System Netto System Netto System Netto<br />
CF4 kg CO2 2,43E-01 2,37E-01 4,57E-05 4,06E-05 2,09E-05 1,30E-05 9,41E-06 8,78E-06<br />
CH4 kg CO2 4,43E+00 4,03E+00 1,17E+01 8,47E+00 1,65E+01 1,02E+01 5,20E+00 5,14E+00<br />
CH4, regenerativ kg CO2 2,47E-04 2,15E-04 1,11E-01 1,11E-01 2,39E-03 2,27E-03 2,24E-04 2,11E-04<br />
CO2 fossil kg CO2 8,29E+01 7,90E+01 1,43E+02 1,17E+02 1,74E+02 1,29E+02 6,44E+01 6,33E+01<br />
Halon1301 kg CO2 7,48E-08 6,85E-08 1,54E-07 1,29E-07 1,15E-07 7,64E-08 6,80E-08 6,41E-08<br />
N2O kg CO2 7,20E-01 6,94E-01 6,52E-01 4,79E-01 5,26E-01 2,65E-01 3,17E-01 3,02E-01<br />
Treibhauspotential ( GWP 100) kg CO2 8,84E+01 8,40E+01 1,55E+02 1,26E+02 1,91E+02 1,39E+02 7,00E+01 6,87E+01<br />
GWP. abzgl. CO2 in Biomasse kg CO2 8,84E+01 8,40E+01 1,55E+02 1,26E+02 1,91E+02 1,39E+02 7,00E+01 6,87E+01<br />
Indikatorergebnis kg CO2 8,84E+01 8,40E+01 1,55E+02 1,26E+02 1,91E+02 1,39E+02 7,00E+01 6,87E+01<br />
Sommersmog (POCP)<br />
Sachbilanzergebnis<br />
Benzol (inkl Ethylbenzol) kg 2,51E-04 2,47E-04 2,42E-04 2,15E-04 2,87E-04 2,43E-04 1,71E-04 1,69E-04<br />
Ethanol + Butanol kg 1,08E-08 9,92E-09 2,51E-08 2,18E-08 1,67E-08 1,14E-08 9,20E-09 8,66E-09<br />
Ethylen kg 3,43E-06 2,42E-06 3,03E-05 2,18E-05 4,73E-05 3,07E-05 1,36E-05 1,36E-05<br />
Formaldehyd kg 1,09E-03 1,08E-03 8,99E-04 8,74E-04 9,66E-04 9,26E-04 7,07E-04 7,02E-04<br />
Methan kg 1,60E-01 1,45E-01 4,26E-01 3,09E-01 5,94E-01 3,66E-01 1,87E-01 1,85E-01<br />
Hexan kg 3,18E-06 2,91E-06 7,38E-06 6,39E-06 4,89E-06 3,34E-06 2,70E-06 2,54E-06<br />
Toluol kg 9,57E-08 9,33E-08 1,97E-05 1,33E-05 3,06E-05 1,92E-05 5,35E-06 5,35E-06<br />
Xylol kg 1,30E-07 1,26E-07 1,28E-05 8,67E-06 1,99E-05 1,25E-05 3,48E-06 3,48E-06<br />
NOx kg 3,55E-01 3,49E-01 3,74E-01 3,24E-01 4,85E-01 3,94E-01 2,40E-01 2,38E-01<br />
NMVOC aus Dieselemis. kg 1,56E-02 1,56E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,25E-02 1,24E-02 9,53E-03 9,53E-03<br />
NMVOC unspez. kg 9,31E-03 8,91E-03 2,39E-02 1,64E-02 3,53E-02 2,15E-02 7,86E-03 7,75E-03<br />
VOC unspez. kg 1,06E-02 7,98E-03 1,42E-01 9,91E-02 2,27E-01 1,44E-01 5,01E-02 5,01E-02<br />
NMVOC (Kohlenwasserstoffe) kg 1,89E-03 1,79E-03 5,78E-03 3,98E-03 8,92E-03 5,66E-03 1,97E-03 1,97E-03<br />
VOC (Kohlenwasserstoffe) kg 9,11E-03 9,07E-03 3,13E-03 3,12E-03 2,61E-04 2,38E-04 2,14E-03 2,12E-03<br />
Aldehyde unspez. kg 9,52E-07 9,52E-07 6,48E-10 3,65E-10 6,16E-08 3,48E-08 6,48E-10 3,65E-10<br />
Butan kg 4,46E-08 4,08E-08 9,18E-08 7,70E-08 6,87E-08 4,55E-08 4,05E-08 3,82E-08<br />
Ethan kg 6,84E-07 6,25E-07 1,41E-06 1,18E-06 1,05E-06 6,98E-07 6,21E-07 5,86E-07<br />
Heptan kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00<br />
Propen + Propan kg 2,54E-06 1,80E-06 2,24E-05 1,61E-05 3,51E-05 2,27E-05 1,01E-05 1,01E-05<br />
Styrol kg 1,58E-13 1,49E-13 5,15E-09 3,48E-09 8,00E-09 5,02E-09 1,40E-09 1,40E-09<br />
Dichlorethen kg 5,43E-12 5,12E-12 1,32E-11 8,88E-12 8,73E-11 5,06E-11 7,10E-12 6,79E-12<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Benzol + Ethylbenzol + Chlorbe kg Ethen 5,52E-05 5,43E-05 5,31E-05 4,73E-05 6,32E-05 5,35E-05 3,76E-05 3,73E-05<br />
Ethanol + Butanol kg Ethen 4,33E-09 3,96E-09 1,00E-08 8,69E-09 6,65E-09 4,54E-09 3,67E-09 3,45E-09<br />
Ethylen kg Ethen 3,43E-06 2,42E-06 3,03E-05 2,18E-05 4,73E-05 3,07E-05 1,36E-05 1,36E-05<br />
Formaldehyd kg Ethen 5,66E-04 5,61E-04 4,68E-04 4,55E-04 5,02E-04 4,81E-04 3,68E-04 3,65E-04<br />
Methan kg Ethen 9,57E-04 8,72E-04 2,56E-03 1,86E-03 3,56E-03 2,20E-03 1,12E-03 1,11E-03<br />
Hexan kg Ethen 1,53E-06 1,40E-06 3,56E-06 3,08E-06 2,36E-06 1,61E-06 1,30E-06 1,22E-06<br />
Toluol kg Ethen 6,10E-08 5,94E-08 1,26E-05 8,48E-06 1,95E-05 1,22E-05 3,41E-06 3,41E-06<br />
Xylol kg Ethen 1,43E-07 1,39E-07 1,41E-05 9,54E-06 2,18E-05 1,37E-05 3,83E-06 3,83E-06<br />
NMVOC aus Dieselemis. kg Ethen 1,09E-02 1,09E-02 7,02E-03 7,02E-03 8,72E-03 8,70E-03 6,67E-03 6,67E-03<br />
NMVOC unspez. kg Ethen 1,12E-02 1,07E-02 2,97E-02 2,04E-02 4,42E-02 2,72E-02 9,83E-03 9,72E-03<br />
VOC unspez. kg Ethen 7,44E-03 6,43E-03 5,46E-02 3,85E-02 8,56E-02 5,44E-02 1,97E-02 1,97E-02<br />
Aldehyde unspez. kg Ethen 4,22E-07 4,22E-07 2,87E-10 1,62E-10 2,73E-08 1,54E-08 2,87E-10 1,62E-10<br />
Butan kg Ethen 1,57E-08 1,44E-08 3,23E-08 2,71E-08 2,42E-08 1,60E-08 1,43E-08 1,35E-08<br />
Ethan kg Ethen 8,41E-08 7,69E-08 1,73E-07 1,45E-07 1,29E-07 8,58E-08 7,64E-08 7,20E-08<br />
Propen + Propan kg Ethen 2,87E-06 2,03E-06 2,52E-05 1,81E-05 3,93E-05 2,55E-05 1,13E-05 1,13E-05<br />
Styrol kg Ethen 2,25E-14 2,12E-14 7,31E-10 4,94E-10 1,14E-09 7,12E-10 1,98E-10 1,98E-10<br />
Dichlorethen kg Ethen 2,28E-12 2,15E-12 5,56E-12 3,73E-12 3,67E-11 2,12E-11 2,98E-12 2,85E-12<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 47<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
System Netto System Netto System Netto System Netto<br />
Ethylenglykol kg Ethen 0,00E+00 0,00E+00 3,23E-06 3,23E-06 0,00E+00 0,00E+00 1,74E-28 1,74E-28<br />
Indikatorergebnis (POCP) kg Ethen 3,11E-02 2,95E-02 9,45E-02 6,84E-02 1,43E-01 9,31E-02 3,78E-02 3,76E-02<br />
Versauerung<br />
Sachbilanzergebnis<br />
Chlorwasserstoff kg 1,68E-03 1,56E-03 4,65E-03 3,19E-03 5,60E-03 3,05E-03 1,69E-03 1,63E-03<br />
Fluorwasserstoff inkl HCN kg 3,27E-04 3,17E-04 2,83E-04 2,12E-04 3,00E-04 1,81E-04 9,15E-05 8,76E-05<br />
Schwefeloxide (als SO2) kg 8,93E-02 8,34E-02 2,35E-01 1,71E-01 3,24E-01 2,05E-01 9,18E-02 9,03E-02<br />
Stickoxide (NOx als NO2) kg 3,55E-01 3,49E-01 3,74E-01 3,24E-01 4,85E-01 3,94E-01 2,40E-01 2,38E-01<br />
Ammoniak kg 6,24E-04 6,04E-04 1,16E-03 1,09E-03 1,40E-03 1,29E-03 3,74E-04 3,64E-04<br />
Salpetersäure (HNO3) kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00<br />
Schwefelsäure kg 7,22E-14 7,10E-14 4,41E-13 2,99E-13 7,06E-13 4,48E-13 1,27E-13 1,27E-13<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Chlorwasserstoff kg SO2 1,48E-03 1,38E-03 4,10E-03 2,80E-03 4,92E-03 2,68E-03 1,49E-03 1,44E-03<br />
Fluorwasserstoff inkl. HCN kg SO2 5,24E-04 5,07E-04 4,53E-04 3,40E-04 4,80E-04 2,89E-04 1,46E-04 1,40E-04<br />
Schwefeloxide (als SO2) kg SO2 8,93E-02 8,34E-02 2,35E-01 1,71E-01 3,24E-01 2,05E-01 9,18E-02 9,03E-02<br />
NOx als NO2 kg SO2 2,49E-01 2,44E-01 2,62E-01 2,27E-01 3,39E-01 2,76E-01 1,68E-01 1,66E-01<br />
Ammoniak kg SO2 1,17E-03 1,14E-03 2,18E-03 2,05E-03 2,63E-03 2,43E-03 7,03E-04 6,84E-04<br />
Salpetersäure kg SO2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00<br />
Schwefelsäure kg SO2 4,69E-14 4,61E-14 2,86E-13 1,94E-13 4,59E-13 2,91E-13 8,23E-14 8,23E-14<br />
Indikatorergebnis kg SO2 3,41E-01 3,30E-01 5,03E-01 4,03E-01 6,71E-01 4,86E-01 2,62E-01 2,59E-01<br />
Eutrophierung<br />
Sachbilanzergebnis<br />
Ammoniak (L) + N2O (L) kg 6,24E-04 6,04E-04 1,16E-03 1,09E-03 1,40E-03 1,29E-03 3,74E-04 3,64E-04<br />
NOx als NO2 (L) kg 3,55E-01 3,49E-01 3,74E-01 3,24E-01 4,85E-01 3,94E-01 2,40E-01 2,38E-01<br />
CSB (W) kg 5,45E-02 4,85E-02 6,62E-02 6,02E-02 4,81E-02 3,58E-02 2,85E-02 2,57E-02<br />
Nitrat (Gr<strong>und</strong>wasser) 85% OF-<br />
GW<br />
kg 1,37E-03 1,37E-03 1,48E-03 1,46E-03 3,33E-03 3,29E-03 4,07E-04 4,06E-04<br />
Ammonium (W) kg 1,40E-04 1,34E-04 1,50E-04 1,23E-04 1,49E-04 9,95E-05 6,27E-05 6,04E-05<br />
N-Verbindungen, unspez. (W) kg 3,14E-06 2,45E-06 3,52E-05 2,47E-05 5,71E-05 3,63E-05 1,24E-05 1,24E-05<br />
N-Verbindungen als N (W) kg 1,87E-03 1,76E-03 5,48E-04 5,47E-04 4,08E-04 3,84E-04 1,12E-03 1,07E-03<br />
Phosphat (W) kg 4,85E-08 4,44E-08 1,12E-07 9,74E-08 7,45E-08 5,10E-08 4,12E-08 3,87E-08<br />
P als P2O5 (W) kg 5,21E-06 5,21E-06 0,00E+00 0,00E+00 2,60E-09 2,60E-09 0,00E+00 0,00E+00<br />
P-Verbindungen als P (W) kg 8,78E-05 7,49E-05 5,24E-05 5,18E-05 7,00E-05 6,56E-05 3,48E-04 3,42E-04<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Ammoniak (L) + N2O (L) kg PO4 2,16E-04 2,09E-04 4,01E-04 3,76E-04 4,85E-04 4,48E-04 1,29E-04 1,26E-04<br />
NOx als NO2 (L) kg PO4 4,62E-02 4,53E-02 4,86E-02 4,21E-02 6,30E-02 5,12E-02 3,12E-02 3,09E-02<br />
CSB (W) kg PO4 1,20E-03 1,07E-03 1,46E-03 1,32E-03 1,06E-03 7,88E-04 6,27E-04 5,64E-04<br />
Nitrat (W) kg PO4 1,30E-04 1,30E-04 1,40E-04 1,39E-04 3,16E-04 3,13E-04 3,86E-05 3,86E-05<br />
Ammonium (W) kg PO4 4,58E-05 4,39E-05 4,91E-05 4,04E-05 4,86E-05 3,25E-05 2,05E-05 1,98E-05<br />
N-Verbindungen unspez. (W) kg PO4 1,32E-06 1,03E-06 1,48E-05 1,04E-05 2,40E-05 1,52E-05 5,22E-06 5,22E-06<br />
N-Verbindungen als N (W) kg PO4 7,84E-04 7,38E-04 2,30E-04 2,30E-04 1,71E-04 1,61E-04 4,72E-04 4,50E-04<br />
Phosphat (W) kg PO4 4,85E-08 4,44E-08 1,12E-07 9,74E-08 7,45E-08 5,10E-08 4,12E-08 3,87E-08<br />
P als P2O5 (W) kg PO4 6,97E-06 6,97E-06 0,00E+00 0,00E+00 3,48E-09 3,48E-09 0,00E+00 0,00E+00<br />
P-Verbindungen als P (W) kg PO4 2,69E-04 2,29E-04 1,60E-04 1,59E-04 2,14E-04 2,01E-04 1,06E-03 1,05E-03<br />
Indikatorergebnisse:<br />
Eutrophierung (terrestrisch) kg PO4 4,64E-02 4,56E-02 4,90E-02 4,25E-02 6,35E-02 5,17E-02 3,13E-02 3,10E-02<br />
Eutrophierung (aquatisch) kg PO4 2,44E-03 2,22E-03 2,05E-03 1,90E-03 1,83E-03 1,51E-03 2,23E-03 2,12E-03<br />
Naturraumbedarf: versiegelte<br />
Fläche<br />
Endbericht Oktober 2008
Sachbilanzergebnis<br />
48 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
System Netto System Netto System Netto System Netto<br />
Flächenbedarf Kl. 7 m 2 pro Jahr 1,04E-03 9,81E-04 1,65E-03 1,43E-03 1,10E-03 7,53E-04 6,14E-04 5,79E-04<br />
Verkehrsfläche m 2 pro Jahr 8,29E+08 8,28E+08 5,91E+08 5,90E+08 6,95E+08 6,93E+08 5,49E+08 5,48E+08<br />
Flächenbedarf Kl. 7 (inkl. Verkehrsfläche)<br />
m 2 pro Jahr 8,29E+08 8,28E+08 5,91E+08 5,90E+08 6,95E+08 6,93E+08 5,49E+08 5,48E+08<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Flächenbedarf Kl. 7 m 2 pro Jahr 1,04E-03 9,81E-04 1,65E-03 1,43E-03 1,10E-03 7,53E-04 6,14E-04 5,79E-04<br />
Verkehrsfläche m 2 pro Jahr 8,29E+08 8,28E+08 5,91E+08 5,90E+08 6,95E+08 6,93E+08 5,49E+08 5,48E+08<br />
Flächenbedarf Kl. 7 (inkl. Verkehrsfläche)<br />
m 2 pro Jahr 8,29E+08 8,28E+08 5,91E+08 5,90E+08 6,95E+08 6,93E+08 5,49E+08 5,48E+08<br />
Indikatorergebnis m 2 pro Jahr 8,29E+08 8,28E+08 5,91E+08 5,90E+08 6,95E+08 6,93E+08 5,49E+08 5,48E+08<br />
Naturraumbedarf: Forst<br />
Sachbilanzergebnis<br />
Flächenbedarf KL. 2 m 2 pro Jahr 1,37E-01 9,09E-02 1,49E-01 9,86E-02 1,69E-01 1,28E-01 1,09E-01 5,68E-02<br />
Flächenbedarf KL. 3 m 2 pro Jahr 1,40E+00 9,52E-01 1,48E+00 1,01E+00 1,67E+00 1,27E+00 1,03E+00 5,36E-01<br />
Flächenbedarf KL. 4 m 2 pro Jahr 1,66E+00 1,17E+00 1,09E+00 8,48E-01 2,44E+00 2,19E+00 5,19E-01 1,47E-01<br />
Flächenbedarf KL. 5 m 2 pro Jahr 4,38E-01 3,24E-01 3,34E-01 2,70E-01 4,53E-01 3,81E-01 1,43E-01 5,67E-02<br />
Wirkungsindikatorergebnis<br />
Fläche 2 m 2 pro Jahr 1,37E-01 9,09E-02 1,49E-01 9,86E-02 1,69E-01 1,28E-01 1,09E-01 5,68E-02<br />
Fläche 3 m 2 pro Jahr 1,40E+00 9,52E-01 1,48E+00 1,01E+00 1,67E+00 1,27E+00 1,03E+00 5,36E-01<br />
Fläche 4 m 2 pro Jahr 1,66E+00 1,17E+00 1,09E+00 8,48E-01 2,44E+00 2,19E+00 5,19E-01 1,47E-01<br />
Fläche 5 m 2 pro Jahr 4,38E-01 3,24E-01 3,34E-01 2,70E-01 4,53E-01 3,81E-01 1,43E-01 5,67E-02<br />
Indikatorergebnis m 2 pro Jahr 3,63E+00 2,54E+00 3,05E+00 2,22E+00 4,73E+00 3,97E+00 1,80E+00 7,97E-01<br />
Für die graphische Darstellung <strong>der</strong> Indikatorergebnisse wird die Gesamtumweltwirkung <strong>der</strong><br />
untersuchten Verpackungssysteme in die nachfolgend aufgeführten Prozessgruppen (Sektoren)<br />
unterteilt. Die in den Grafiken verwendeten Kurzbezeichnungen <strong>der</strong> Sektoren werden<br />
hervorgehoben aufgeführt.<br />
• Herstellung von <strong>Glas</strong> <strong>und</strong> Flaschenherstellung <strong>Glas</strong>flaschen<br />
<strong>Glas</strong>flasche<br />
• Herstellung von Kunststoffgranulat zur Produktion von Flaschen-Preforms (<strong>PET</strong>)<br />
Kunststoff Flasche<br />
• Herstellung von <strong>PET</strong>-Preforms <strong>und</strong> Flaschenblasen (SBM)<br />
Herstellung Flasche<br />
• Materialbereitstellung <strong>und</strong> Herstellung <strong>der</strong> Flaschenetiketten aus Papier bzw. PP-<br />
Folie <strong>und</strong> Verschlussherstellung für Flaschen (HDPE, Alu)<br />
Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
• Herstellung <strong>der</strong> Materialien für Sek<strong>und</strong>är- <strong>und</strong> Tertiärverpackungen: Kästen, Wellpappe-Trays,<br />
Paletten, Folie<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
• Abfüllung <strong>und</strong> Verpackung von Flaschen; bei Mehrwegsystemen ist hier auch die<br />
Flaschen- <strong>und</strong> Kastenwäsche enthalten; bei Stoffkreislaufsystemen nur die Kastenwäsche<br />
Abfüllung<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 49<br />
• Distribution <strong>der</strong> Verkaufseinheiten vom Abfüllbetrieb zum „Point of Sale“ <strong>und</strong> Redistribution<br />
von Mehrweg- <strong>und</strong> Stoffkreislaufflaschen zum Abfüller<br />
Distribution<br />
• Sammlung, Aufbereitung, Verwertung <strong>und</strong> Entsorgung von gebrauchten <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflaschen, nicht in das System zurückgegebener Mehrwegflaschen, Produktionsabfällen<br />
<strong>und</strong> an<strong>der</strong>em Verpackungsmaterial<br />
Recycling & Entsorgung<br />
• Nutzenergie aus Abfallverbrennung <strong>und</strong> thermischer Verwertung<br />
Gutschrift Energie<br />
• Recycelte Materialien<br />
Gutschrift Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
In <strong>der</strong> ersten (gestaffelten) Säule <strong>der</strong> Ergebnisgrafiken werden die Aufwendungen des jeweiligen<br />
Systems (ohne Gutschriften) dargestellt. Die Beträge <strong>der</strong> Gutschriften werden als negative<br />
Balkenabschnitte abgebildet. Dabei handelt es sich um Materialströme bzw. Energieflüsse,<br />
die im open-loop die Systemgrenze überschreiten <strong>und</strong> für an<strong>der</strong>e Produktsysteme bereit<br />
stehen. Im Falle <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen ist dies beispielsweiße <strong>PET</strong>-Rezyklat, welches<br />
über die innerhalb des Systems wie<strong>der</strong> eingesetzte Menge (closed-loop) hinausgeht.<br />
Die Gutschrift erfolgt für die Substitution primärer Rohstoffe bzw. die vermiedenen Emissionen.<br />
Das Nettoergebnis ergibt sich aus System minus Gutschrift. Der entsprechende Balken ist<br />
grau dargestellt, auf eine sektorale Unterglie<strong>der</strong>ung wird hierbei verzichtet. Der Vergleich unterschiedlicher<br />
Verpackungssysteme erfolgt auf Basis <strong>der</strong> Nettoergebnisse.<br />
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die funktionelle Einheit: Bereitstellung von 1000 L Getränk<br />
im Handel.<br />
Im Anschluss an die Balkendiagramme finden sich jeweils Tabellen, in denen die relativen<br />
Unterschiede des <strong>PET</strong>-SK-Systems, des <strong>PET</strong>-EW-Systems sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-MW-Flasche im<br />
Vergleich zum <strong>Glas</strong>-MW-System dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt in Form von positiven<br />
bzw. negativen Prozentwerten. Zusätzlich werden die relativen Unterschiede des<br />
<strong>PET</strong>-SK-Systems <strong>und</strong> des <strong>PET</strong>-EW-Systems in Vergleich zum <strong>PET</strong>-MW-System in gleicher<br />
Form dargestellt.<br />
Endbericht Oktober 2008
50 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
5.1 Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [oFG]<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Verpackungssysteme für Wässer <strong>und</strong> kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke<br />
in den Basisszenarien sind in Abbildung 5-1 <strong>und</strong> Abbildung 5-2 dargestellt.<br />
Untersucht wurden <strong>Glas</strong>-Mehrwegsysteme mit 0,7 L Füllvolumen, <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen<br />
<strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegsysteme mit 1,0 L sowie <strong>PET</strong>-Einwegflaschen mit 1,5 L Füllvolumen.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Aus dem Systemvergleich <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche mit <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche geht hervor, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche in drei <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch <strong>und</strong> Sommersmog<br />
(POCP) – Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche zeigt.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Versauerung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen vier Kategorien – Terrestrische Eutrophierung, Aquatische Eutrophierung sowie<br />
Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Nachteile im Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in vier <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP) <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Versauerung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen drei Kategorien – Terrestrische <strong>und</strong> Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-MW (1,0 L)<br />
Gegenüber <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche nur in einer<br />
<strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien Vorteile, nämlich im Indikator Sommersmog (POCP).<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Aquatische Eutrophierung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen sechs untersuchten Kategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Versauerung, Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung versiegelte<br />
Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt das <strong>PET</strong>-Mehrwegssystem Vorteile gegenüber <strong>der</strong><br />
<strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 51<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Der Systemvergleich zwischen <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche zeigt Vorteile für das Mehrwegssystem in sieben <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien - Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), Versauerung,<br />
Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche<br />
<strong>und</strong> Forstfläche.<br />
Ein Nachteil <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche besteht hinsichtlich<br />
des Indikators Aquatische Eutrophierung.<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
Forstfläche.<br />
In den übrigen zwei Kategorien –Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
52 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
g Ethen-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe A [oFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
81,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Sommersmog (POCP)<br />
28,3<br />
Klimawandel<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
64,9<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
85,2<br />
Abbildung 5-1: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]<br />
60,3<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
34,1<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
kg Rohöl-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg SO 2 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
-0,3<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
18,9<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 LL<br />
0,32<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
22,8<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Versauerung<br />
0,34<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
24,9<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 LL<br />
0,34<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
16,5<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,20<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 53<br />
cm²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe A [oFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
43,1<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Naturraum: versiegelte Fläche<br />
760<br />
32,6<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
354<br />
27,7<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
137<br />
Abbildung 5-2: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]<br />
21,2<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
303<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
m²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
-0,5<br />
-1<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
2,22<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
2,54<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,90<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Naturraum: Forstfäche<br />
2,22<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
1,51<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
3,97<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
2,12<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,80<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
54 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-2 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
<strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
(<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative<br />
Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen<br />
bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-2: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [oFG] zw.<br />
<strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -44% -45% 35%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -20% -32% 14%<br />
Sommersmog (POCP) -129% -201% -20%<br />
Versauerung -9% -9% 57%<br />
Terrestrische Eutrophierung 32% 55% 103%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 115% 454% 151%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-3 zeigt äquivalent zur Tabelle 5-2 eine vergleichende Übersicht<br />
zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten Nettoergebnisse<br />
von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative Werte höhere, also<br />
schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen bedeuten<br />
niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-3: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [oFG] zw.<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -95% -96%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -38% -51%<br />
Sommersmog (POCP) -90% -150%<br />
Versauerung -72% -71%<br />
Terrestrische Eutrophierung -54% -31%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -17% 121%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 55<br />
5.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG]<br />
Die Abbildungen 5-3 <strong>und</strong> 5-4 zeigen die Ergebnisse <strong>der</strong> Verpackungssysteme für Wässer<br />
<strong>und</strong> kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A, jedoch mit Füllgut.<br />
Untersucht wurden ebenfalls <strong>Glas</strong>-Mehrwegsysteme mit 0,7 L Füllvolumen, <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflaschen <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegsysteme mit 1,0 L sowie <strong>PET</strong>-Einwegflaschen mit<br />
1,5 L Füllvolumen.<br />
Wie erwartet stiegen alle Werte relativ zu <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A ohne Füllgut an, wobei<br />
die stärksten Auswirkungen bei <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-EW-Flasche zu beobachten sind. Ursache hierfür<br />
ist das relativ geringe Flaschengewicht <strong>und</strong> die größere Flasche im Verhältnis zu den an<strong>der</strong>en<br />
untersuchten Verpackungsarten. Dadurch fällt die Massenzunahme durch das Füllgut<br />
relativ stark ins Gewicht, hauptsächlich im Bereich <strong>der</strong> Distribution.<br />
Die Ausrichtung <strong>der</strong> jeweiligen Netto-Werte relativ zueinan<strong>der</strong> bleibt mehrheitlich wie in <strong>der</strong><br />
Untersuchungsgruppe A [oFG]. Es entsteht eine generelle Zunahme <strong>der</strong> Umweltlasten.<br />
Nachfolgend werden nochmals die bereits für A [oFG] beschriebenen Ergebnisse aufgeführt.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Aus dem Systemvergleich <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche mit <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche geht hervor, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche in drei <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch <strong>und</strong> Sommersmog<br />
(POCP) – Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche zeigt.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Versauerung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen vier Kategorien – Terrestrische Eutrophierung, Aquatische Eutrophierung sowie<br />
Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Nachteile im Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in fünf <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
In den übrigen drei Kategorien – Terrestrische <strong>und</strong> Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-MW (1,0 L)<br />
Gegenüber <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche nur in einer<br />
<strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien Vorteile, nämlich im Indikator Sommersmog (POCP).<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Aquatische Eutrophierung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen sechs untersuchten Kategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Versauerung, Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung versiegelte<br />
Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt das <strong>PET</strong>-Mehrwegssystem Vorteile gegenüber <strong>der</strong><br />
<strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
56 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Der Systemvergleich zwischen <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche zeigt Vorteile für das Mehrwegssystem in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien - Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), Versauerung,<br />
<strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche zeigen nahezu<br />
identische Werte.<br />
Ein Nachteil <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche besteht hinsichtlich<br />
des Indikators Aquatische Eutrophierung.<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
Forstfläche.<br />
In den übrigen zwei Kategorien –Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 57<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
g Ethen-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe A [mFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
98,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Sommersmog (POCP)<br />
35,1<br />
Klimawandel<br />
134<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
71,7<br />
138<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
92,9<br />
76,9<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
41,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 5-3: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut] bezogen auf die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut<br />
kg Rohöl-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg SO 2 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
-0,3<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
24,1<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
0,43<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
28,0<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Versauerung<br />
0,46<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
31,0<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
0,48<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
21,7<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,32<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
58 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
cm²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
-200<br />
Untersuchungsgruppe A [mFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
62,3<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 0,7 L<br />
Naturraum: versiegelte Fläche<br />
1.279<br />
52,2<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
872<br />
50,2<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
698<br />
40,8<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
821<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 5-4: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut] bezogen auf die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut<br />
m²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
2,22<br />
-0,5<br />
-1<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
2,54<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,90<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Naturraum: Forstfäche<br />
2,22<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
1,51<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
3,97<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
2,12<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,80<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 59<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-4 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
<strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
(<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative<br />
Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen<br />
bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-4: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG] zw.<br />
<strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -37% -40% 28%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -16% -29% 11%<br />
Sommersmog (POCP) -104% -164% -17%<br />
Versauerung -7% -11% 36%<br />
Terrestrische Eutrophierung 19% 24% 53%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 47% 83% 56%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-5 zeigt äquivalent zur Tabelle 5-4 eine vergleichende Übersicht<br />
zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten Nettoergebnisse<br />
von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative Werte höhere, also<br />
schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen bedeuten<br />
niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-5: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG] zw.<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -75% -79%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -43%<br />
Sommersmog (POCP) -75% -127%<br />
Versauerung -45% -51%<br />
Terrestrische Eutrophierung -28% -23%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -6% 18%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
60 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
5.3 Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B: Verän<strong>der</strong>te<br />
Distributionsbedingungen<br />
In den Abbildungen 5-5 <strong>und</strong> 5-6 sind die Ergebnisse <strong>der</strong> Verpackungssysteme für Wässer<br />
<strong>und</strong> kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in den Variantenszenarien B (verän<strong>der</strong>te Distributionsbedingungen)<br />
dargestellt.<br />
Untersucht wurden <strong>Glas</strong>-Mehrwegsysteme mit 0,7 L Füllvolumen, <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflaschen<br />
<strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegsysteme mit 1,0 L sowie <strong>PET</strong>-Einwegflaschen mit 1,5 L Füllvolumen.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Aus dem Systemvergleich <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche mit <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche geht hervor, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche in vier <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP) <strong>und</strong><br />
Versauerung – Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche zeigt.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Terrestrische Eutrophierung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen drei Kategorien –Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile im Vergleich<br />
mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
Forstfläche.<br />
In den übrigen zwei Kategorien –Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-MW (1,0 L)<br />
Gegenüber <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche nur in einer<br />
<strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien Vorteile, nämlich im Indikator Sommersmog (POCP).<br />
Die Nettoergebnisse <strong>der</strong> Indikatoren Fossiler Ressourcenverbrauch <strong>und</strong> Aquatische<br />
Eutrophierung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen fünf untersuchten Kategorien – Klimawandel, Versauerung, Terrestrische<br />
Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt<br />
das <strong>PET</strong>-Mehrwegssystem Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 61<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Der Systemvergleich zwischen <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche zeigt Vorteile für das Mehrwegssystem in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien - Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), Versauerung,<br />
<strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche zeigen nahezu<br />
identische Werte.<br />
Ein Nachteil <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche besteht hinsichtlich<br />
des Indikators Aquatische Eutrophierung.<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in sieben <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche.<br />
Im betrachteten Indikator Aquatische Eutrophierung zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Nachteile<br />
gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
62 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
g Ethen-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe B [mFG] Basis: Distributionsmodell 07/08<br />
84,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
29,5<br />
Klimawandel<br />
126<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Sommersmog (POCP)<br />
68,4<br />
139<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 1,5 LL<br />
93,1<br />
68,7<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
37,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 5-5: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B (mit Füllgut <strong>und</strong> verän<strong>der</strong>ten<br />
Distributionsbedingungen) bezogen auf die Verpackung <strong>und</strong> Distribution von<br />
1000 L Füllgut<br />
kg Rohöl-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg SO 2 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
-0,3<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
19,7<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
0,33<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
25,4<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Versauerung<br />
0,40<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
31,5<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
0,49<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
19,2<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,26<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 63<br />
cm²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe B [mFG] Basis: Distributionsmodell 07/08<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
45,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Naturraum: versiegelte Fläche<br />
838<br />
42,5<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
605<br />
51,7<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
701<br />
31,0<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
554<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 5-6: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B (mit Füllgut <strong>und</strong> verän<strong>der</strong>ten<br />
Distributionsbedingungen) bezogen auf die Verpackung <strong>und</strong> Distribution von<br />
1000 L Füllgut<br />
m²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
-0,5<br />
-1<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
2,22<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
2,54<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,90<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 LL<br />
Naturraum: Forstfäche<br />
2,22<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
1,51<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 1,5 LL<br />
3,97<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
2,12<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 1,0 LL<br />
0,80<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
64 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-6 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
<strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
(<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative<br />
Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen<br />
bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-6: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -50% -66% 22%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -60% 3%<br />
Sommersmog (POCP) -132% -215% -27%<br />
Versauerung -22% -47% 28%<br />
Terrestrische Eutrophierung 7% -13% 47%%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 20% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgende Tabelle 5-7 zeigt äquivalent zur Tabelle 5-6 eine vergleichende Übersicht<br />
zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten Nettoergebnisse<br />
von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative Werte höhere, also<br />
schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen bedeuten<br />
niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 5-7: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -83% -103%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -33% -64%<br />
Sommersmog (POCP) -82% -148%<br />
Versauerung -56% -88%<br />
Terrestrische Eutrophierung -37% -66%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 65<br />
6 Sensitivitätsanalyse<br />
Zur Überprüfung <strong>der</strong> Ergebnisrelevanz von Systemannahmen in den Basisszenarien wurden<br />
drei Sensitivitätsanalysen durchgeführt.<br />
Durch die Sensitivitätsanalyse Aspekt Rücklaufquote <strong>PET</strong>-EW wird <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> auf 95%<br />
erhöhten Sammel- bzw. Erfassungsquote für <strong>PET</strong>-Einwegflaschen auf das Gesamtergebnis<br />
untersucht, da belegbare Aussagen zur realen Rücklaufquote <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche <strong>der</strong>zeit<br />
nicht vorhanden sind. Somit ist die von Experten- <strong>und</strong> Literaturangaben abgeleitete Bandbreite<br />
von 90 % bis 95 % abgedeckt.<br />
Die Sensitivitätsanalyse bzgl. <strong>der</strong> Variation des <strong>PET</strong>-Datensatzes dient <strong>der</strong> Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Ergebnisrelevanz des verwendeten <strong>PET</strong>-Datensatzes.<br />
Durch die Sensitivitätsanalyse Aspekt 0% Allokation/ Aspekt 100% Allokation wird die Ergebnisrelevanz<br />
des Allokationsfaktors untersucht.<br />
6.1 Variation <strong>der</strong> Erfassungsquote für <strong>PET</strong> Einwegflaschen<br />
Die Abbildungen 6-1 <strong>und</strong> 6-2 zeigen die Ergebnisse <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse zur alternativen<br />
Erfassungsquote für <strong>PET</strong>-Einwegflaschen von 95%. Die Gründe die zur Implementierung <strong>der</strong><br />
Sensitivitätsanalyse geführt haben sowie die Annahmen die für die Untersuchung getroffen<br />
wurden sind in den vorangehenden Kapiteln bereits erläutert worden.<br />
Die Ergebnisse sind, zumindest was die Indikatorenergebnisse <strong>der</strong> Mehrwegsysteme <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche angeht äquivalent zu den Ergebnissen <strong>der</strong> Basisszenarien <strong>der</strong><br />
Untersuchungsgruppe B. Daher werden im vorliegenden Kapitel nunmehr die Unterschiede<br />
zwischen <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche <strong>der</strong> Basisszenarien <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche mit <strong>der</strong><br />
95 %igen Rücklaufquote in Relation zur <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche, die in <strong>der</strong> Studie als Benchmark<br />
dient, herausgearbeitet.<br />
<strong>PET</strong>-EW (1,5 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L) EQ 95 %<br />
Bedingt durch die um 5% erhöhte Erfassungsquote zeigt die in <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse untersuchte<br />
<strong>PET</strong>-Einwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche <strong>der</strong> Basisszenarien im<br />
Durchschnitt bei fast allen Indikatoren außer <strong>der</strong> Naturraumbeanspruchung um 1 % bis 3 %<br />
niedrigere Nettowerte. Für eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> gr<strong>und</strong>legenden Aussagen <strong>der</strong> Indikatorenergebnisse<br />
sind die Än<strong>der</strong>ungen jedoch zu gering.<br />
Im Einzelnen zeigt die <strong>PET</strong>-Einwegflasche EQ 95 % niedrigere Werte in den Indikatoren Klimawandel,<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP) <strong>und</strong> Versauerung. Die<br />
Werte <strong>der</strong> übrigen Indikatoren, terrestrische <strong>und</strong> aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche sind gleich, bzw. annähernd gleich.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L) EQ 95 %<br />
Wie im Basisfall zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche EQ 95% in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler<br />
Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung<br />
<strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
In den übrigen zwei Kategorien –Aquatische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche EQ 95%.<br />
Endbericht Oktober 2008
66 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L) EQ 95 %<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche EQ 95% zeigt die 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
Vorteile in sieben <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Terrestrische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche.<br />
Im betrachteten Indikator Aquatische Eutrophierung zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche Nachteile<br />
gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche EQ 95%.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 67<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
g Ethen-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
84,0<br />
29,5<br />
Untersuchungsgruppe B: Sensitivität EQ <strong>PET</strong>-EW<br />
Klimawandel<br />
126<br />
139<br />
Sommersmog (POCP)<br />
68,4<br />
93,1<br />
136<br />
90,6<br />
68,7<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L<br />
37,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L 1,0 L<br />
Sens. 95%<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 6-1: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B bezogen auf die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut mit zusätzlicher Auszeichnung einer<br />
Erfassungsquote (EQ) von 95%<br />
kg Rohöl-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg SO 2 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
-0,3<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
19,7<br />
0,33<br />
25,4<br />
Versauerung<br />
0,40<br />
31,5<br />
0,49<br />
30,8<br />
0,48<br />
19,2<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L<br />
0,26<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L<br />
1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L
68 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
cm²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe B: Sensitivität EQ <strong>PET</strong>-EW<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
45,6<br />
Naturraum: versiegelte Fläche<br />
838<br />
42,5<br />
605<br />
51,7<br />
701<br />
51,1<br />
702<br />
31,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L<br />
554<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L 1,0 L<br />
Sens. 95%<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 6-2: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B bezogen auf die Verpackung <strong>und</strong><br />
Distribution von 1000 L Füllgut mit zusätzlicher Auszeichnung einer Erfassungsquote<br />
(EQ) von 95%<br />
m²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
2,22<br />
2,54<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
1,90<br />
Naturraum: Forstfäche<br />
2,22<br />
1,51<br />
3,97<br />
1,50<br />
3,98<br />
2,12<br />
-0,5<br />
-1<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L<br />
0,80<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 69<br />
Die nachfolgende Tabelle 6-1 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
<strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
(<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative<br />
Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen<br />
bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 6-1: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität<br />
EQ <strong>PET</strong>-EW zw. <strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg, <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Sens. 95% sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
<strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -50% -66% -62% 22%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -60% -57% 3%<br />
Sommersmog (POCP) -132% -215% -207% -27%<br />
Versauerung -22% -47% -45% 28%<br />
Terrestrische Eutrophierung 7% -13% -12% 47%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 48% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 20% 19% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% -57% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgende Tabelle 6-2 zeigt äquivalent zur Tabelle 6-1 eine vergleichende Übersicht<br />
zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten Nettoergebnisse<br />
von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative Werte höhere, also<br />
schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen bedeuten<br />
niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 6-2: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität<br />
EQ <strong>PET</strong>-EW zw. <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf. <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-<br />
Einweg Sens. 95%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Sens. 95%<br />
Klimawandel -83% -103% -98%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -33% -64% -61%<br />
Sommersmog (POCP) -82% -148% -141%<br />
Versauerung -56% -88% -85%<br />
Terrestrische Eutrophierung -37% -66% -65%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41% 42%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -27% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398% -399%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
70 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
6.2 Variation des verwendeten <strong>PET</strong>-Datensatzes<br />
In den Abbildungen 6-3 <strong>und</strong> 6-4 sind die Ergebnisse <strong>der</strong> Verpackungssysteme für Wässer<br />
<strong>und</strong> kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in den Variantenszenarien B unter Verwendung<br />
des alternativen Petcore Datensatzes dargestellt. Die Gründe die zur Implementierung<br />
<strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse geführt haben sowie die Annahmen die für die Untersuchung getroffen<br />
wurden sind in den vorangehenden Kapiteln bereits erläutert worden.<br />
Der Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse zwischen den Basisszenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
B <strong>und</strong> <strong>der</strong> hier betrachteten Sensitivität macht deutlich, dass die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Flaschen, die mit dem Petcore-Datensatz bilanziert wurden deutlich bessere Ergebnisse in<br />
den Indikatoren Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung aufweisen.<br />
Geringfügig besser als im Basisszenario fallen die Ergebnisse des Indikators Klimawandel<br />
aus.<br />
Deutlich schlechter hingegen sind die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Flaschen die mit dem Petcore-<br />
Datensatz bilanziert wurden im Indikator Aquatische Eutrophierung. Hier sind die Nettoergebnisse<br />
teils drei Mal so hoch wie im Basisfall. Geringfügige Verschlechterungen gegenüber<br />
den Basisszenarien ergeben sich auch für den Indikator Fossiler Ressourcenverbrauch.<br />
Im direktem Systemvergleich ergibt sich somit folgendes Bild:<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Aus dem Systemvergleich <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche mit <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche geht hervor, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche in drei <strong>der</strong> acht betrachteten<br />
Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch <strong>und</strong> Aquatische<br />
Eutrophierung – Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche zeigt.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Versauerung sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen vier Kategorien – Sommersmog (POCP) Terrestrische Eutrophierung sowie<br />
Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche <strong>und</strong> Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Nachteile im Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Vergleich mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche Vorteile<br />
in sechs <strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien – Klimawandel, Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung, Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
Forstfläche.<br />
Die Nettoergebnisse des Indikators Terrestrische Eutrophierung sind nahezu identisch.<br />
In <strong>der</strong> verbleibenden Kategorie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
<strong>Glas</strong>-MW (0,7 L) versus <strong>PET</strong>-MW (1,0 L)<br />
Gegenüber <strong>der</strong> 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt die 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche nur in einer<br />
<strong>der</strong> acht betrachteten Wirkkategorien Vorteile, nämlich im Indikator Aquatische Eutrophierung.<br />
Die Nettoergebnisse <strong>der</strong> Indikatoren Fossiler Ressourcenverbrauch sind nahezu identisch.<br />
In den übrigen sechs untersuchten Kategorien – Klimawandel, Sommersmog (POCP), Versauerung,<br />
Terrestrische Eutrophierung sowie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 71<br />
<strong>und</strong> Forstfläche - zeigt das <strong>PET</strong>-Mehrwegssystem Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche.<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-SK (1,0 L)<br />
Die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt in sieben <strong>der</strong> acht Wirkkategorien niedrigere Werte als die<br />
<strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche, dabei sind die relativen Unterschiede zwischen beiden Systemen<br />
sind in den Indikatoren – Klimawandel <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung Forstfläche - am größten.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Kategorie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche zeigt sich, dass die<br />
Nettoergebnisse <strong>der</strong> Systeme nahezu identisch sind.<br />
<strong>PET</strong>-MW (1,0 L) versus <strong>PET</strong>-EW (1,5 L)<br />
Im Systemvergleich gegen die <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche in allen<br />
acht Indikatoren deutlich niedrigere Werte.<br />
Endbericht Oktober 2008
72 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
g Ethen-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe B Sensitivität Petcore Datensatz<br />
84,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
29,5<br />
Klimawandel<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Sommersmog (POCP)<br />
26,4<br />
128<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
32,6<br />
65,5<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
20,8<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 6-3: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B bezogen auf die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut unter Verwendung des Petcore-<br />
Datensatzes für die <strong>PET</strong>-Herstellung<br />
kg Rohöl-Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg SO 2 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
19,7<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
0,33<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
25,6<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Versauerung<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 1,0 L<br />
0,30<br />
31,8<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
0,34<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 1,5 L<br />
19,3<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
0,22<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 73<br />
cm²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
Untersuchungsgruppe B Sensitivität Petcore Datensatz<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
45,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Naturraum: versiegelte Fläche<br />
838<br />
37,8<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
608<br />
45,0<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
706<br />
29,2<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
555<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
1,0 L<br />
1,5 L<br />
1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
Abbildung 6-4: Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B bezogen auf die Verpackung <strong>und</strong><br />
Distribution von 1000 L Füllgut unter Verwendung des Petcore-Datensatzes für die<br />
<strong>PET</strong>-Herstellung<br />
m²/Jahr pro 1000L Füllgut<br />
g PO 4 -Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
2,22<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
2,54<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
3,89<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Naturraum: Forstfäche<br />
2,23<br />
<strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
4,38<br />
<strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
3,97<br />
<strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
2,92<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 LL<br />
0,80<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
74 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Die nachfolgende Tabelle 6-3 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
<strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
(<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative<br />
Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen<br />
bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 6-3: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität<br />
alternativer <strong>PET</strong>-Datensatz zw. <strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg,<br />
<strong>PET</strong>-Einweg Sens. 95% sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator<br />
<strong>PET</strong>-SK 1,0 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Basis. Sens.<br />
Klimawandel -50% -40% -66% -52% 22% 28%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -30% -60% -62% 3% 2%<br />
Sommersmog (POCP) -132% 12% -215% -10% -27% 42%<br />
Versauerung -22% 9% -47% -4% 28% 50%<br />
Terrestrische Eutrophierung 7% 20% -13% 1% 47%% 56%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% -76% 47% -98% 4% -32%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 38% 20% 19% 51% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% 14% -56% -57% 218% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgende Tabelle 6-4 zeigt äquivalent zur Tabelle 6-3 eine vergleichende Übersicht<br />
zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten Nettoergebnisse<br />
von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten negative Werte höhere, also<br />
schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive Werte hingegen bedeuten<br />
niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Tabelle 6-4: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität<br />
alternativer <strong>PET</strong>-Datensatz zw. <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf. <strong>PET</strong>-Einweg<br />
sowie <strong>PET</strong>-Einweg Sens. 95%<br />
Indikator<br />
<strong>PET</strong>-SK 1,0 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Basis Sens.<br />
Klimawandel -83% -80% -103% -95%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -33% -33% -64% -65%<br />
Sommersmog (POCP) -82% -27% -148% -57%<br />
Versauerung -56% -39% -88% -57%<br />
Terrestrische Eutrophierung -37% -30% -66% -54%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% -33% 41% -50%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -9% -27% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -179% -398% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 75<br />
6.3 Variation bezüglich <strong>der</strong> Allokationsfaktoren im System<br />
Die Abbildungen 6-5 <strong>und</strong> 6-6 zeigen die Ergebnisse <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse mit 0%, 50%<br />
<strong>und</strong> 100% Allokation. Der Einfluss <strong>der</strong> Variation <strong>der</strong> Allokationsfaktoren auf die verschiedenen<br />
Indikatoren ist sehr unterschiedlich.<br />
Die stärksten Auswirkungen durch die Variation <strong>der</strong> Allokation zeigen sich bei den Indikatorergebnissen<br />
bezüglich Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), Versauerung<br />
<strong>und</strong> bei <strong>der</strong> Naturraumbeanspruchung Forstfläche.<br />
Auf die Indikatorergebnisse <strong>der</strong> Kategorien Klimawandel <strong>und</strong> Naturraum: Versiegelte Fläche<br />
hat die Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Allokation fast keine Auswirkungen, da diese Indikatoren nur in sehr<br />
geringem Maße durch die Verwertung beeinflusst werden. Bei <strong>der</strong> aquatischen <strong>und</strong> terrestrischen<br />
Eutrophierung sind die Auswirkungen aus den gleichen Gründen nur gering.<br />
Die Auswirkungen <strong>der</strong> Allokationsän<strong>der</strong>ung zeigen bei fast allen Indikatoren die gleiche Tendenz,<br />
das heißt eine Verringerung <strong>der</strong> Werte mit zunehmen<strong>der</strong> Allokation. Eine Ausnahme<br />
hiervon ist die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche, die bei den Indikatoren Klimawandel, Versauerung <strong>und</strong><br />
Terrestrische Eutrophierung eine leicht beziehungsweise kaum wahrnehmbare gegenläufige<br />
Reaktion zeigt. Ursache hierfür ist die geringe Relevanz <strong>der</strong> Sek<strong>und</strong>ärmaterialgutschriften für<br />
das Nettoergebnis <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen. Im Vergleich zur Sek<strong>und</strong>ärmaterialgutschrift<br />
erhalten Aufwendungen im Bereich <strong>der</strong> Verwertung (z.B. Transportaufwendungen) eine größere<br />
Bedeutung, da sie bei höheren Allokationsfaktoren stärker steigen als die Gutschriften.<br />
Damit geht eine Erhöhung <strong>der</strong> Nettoergebnisse einher.<br />
Bei den Mehrwegflaschen sind die Än<strong>der</strong>ungen deutlich geringer als bei <strong>der</strong> Einweg- <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Stoffkreislaufflasche. Bei <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche sind sie am deutlichsten ausgeprägt, vor<br />
allem bei den Indikatoren Fossiler Ressourcenverbrauch, Sommersmog (POCP), aquatische<br />
Eutrophierung, <strong>und</strong> Versauerung. Ursache für den starken Einfluss <strong>der</strong> Allokationen auf die<br />
<strong>PET</strong>-Einwegflasche ist die hohe Gutschrift für den Ersatz von Primär-<strong>PET</strong> durch <strong>PET</strong>-<br />
Rezyklat aus den gebrauchten Flaschen.<br />
Eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ergebnisausrichtung ist vor allem beim Indikator Fossile Ressourcen<br />
zu erkennen. Die verän<strong>der</strong>ten Allokationen zeigen hier auf die <strong>Glas</strong>- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche kaum Auswirkungen. Die <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche, vor allem aber die <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche erfahren durch die Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Allokationen von 0% auf 100% eine sehr<br />
starke Verringerung <strong>der</strong> Werte, die bei 100% Allokation sogar in einem besseren Ergebnis<br />
als die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche mündet.<br />
Ursache hierfür ist, dass bei <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche bei einer Allokation von 100% eine hohe<br />
Gutschrift für die Verwertung erfolgt, die bei den Mehrwegflaschen natürlich nicht o<strong>der</strong> nur<br />
zu einem viel geringerem Anteil erfolgt.<br />
Die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt bei allen Allokationsfaktoren <strong>und</strong> allen Indikatoren, abgesehen<br />
von <strong>der</strong> Aquatischen Eutrophierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> bereits erwähnten Ergebnisverschiebung<br />
bei <strong>der</strong> Kategorie Fossiler Ressourcenverbrauch unter Annahme <strong>der</strong> 100% Allokation die<br />
besten Werten.<br />
Endbericht Oktober 2008
76 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
kg CO2 - Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
g Ethen- Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Untersuchungsgruppe B Sensitivitätsanalyse Allokation<br />
Klimawandel<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
Sommersmog (POCP)<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
Abbildung 6-5: Balkengrafik Allokation 0%/50%/100%<br />
kg Rohöl- Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
5<br />
0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 0,7 L<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Versauerung<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 1,0 L<br />
Allokationsfaktor 0% Allokationsfaktor 50% Allokationsfaktor 100%<br />
kg SO2 - Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 1,5 LL<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 77<br />
g PO4 - Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
cm 2 /a pro 1000 L Füllgut<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Untersuchungsgruppe B Sensitivitätsanalyse Allokation<br />
Terrestrische Eutrophierung<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
Naturraum: Versiegelte Fläche<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
Abbildung 6-6: Balkengrafik Allokation 0%/50%/100%<br />
Die nachfolgenden Tabellen 6-5 <strong>und</strong> 6-6 zeigen vergleichende Übersichten zwischen <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> den untersuchten Konkurrenzverpackungssystemen. Die Prozentwerte repräsentieren<br />
die rechnerische Differenz zwischen dem konkurrierendem System <strong>und</strong> <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg (<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L). Die Prozentwerte beziehen sich auf die in den Grafiken dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten<br />
negative Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-Mehrweg. Positive<br />
Werte hingegen bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg.<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Aquatische Eutrophierung<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Allokationsfaktor 0% Allokationsfaktor 50% Allokationsfaktor 100%<br />
g PO4 - Äquivalente pro 1000 L Füllgut<br />
m 2 /year per 1000 L beverage<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Naturraum: Forst<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
78 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 6-5: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg - Allokationsfaktor 0%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -58% -83% 28%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -57% -124% 8%<br />
Sommersmog (POCP) -202% -357% -22%<br />
Versauerung -44% -91% 30%<br />
Terrestrische Eutrophierung -1% -29% 49%<br />
Aquatische Eutrophierung 19% 34% 9%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 20% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 20% -30% 102%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Tabelle 6-6: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg - Allokationsfaktor 100%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -42% -48% 17%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch 2% 13% -3%<br />
Sommersmog (POCP) -54% -60% -33%<br />
Versauerung 1% -2% 25%<br />
Terrestrische Eutrophierung 17% 3% 45%<br />
Aquatische Eutrophierung 13% 66% -1%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 38% 19% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 2% -123% 14537%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Die nachfolgenden Tabellen 6-7 <strong>und</strong> 6-8 zeigen äquivalent zu den Tabellen 6-5 <strong>und</strong> 6-6 eine<br />
vergleichende Übersicht zwischen <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche sowie<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche. Die Prozentwerte beziehen sich auf die, in den Grafiken grau dargestellten<br />
Nettoergebnisse von <strong>PET</strong>-Mehrweg. Nach dieser Berechnungsmethode bedeuten<br />
negative Werte höhere, also schlechtere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-Mehrweg. Positive<br />
Werte hingegen bedeuten niedrigere, demnach bessere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 79<br />
Tabelle 6-7: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Einweg - Allokationsfaktor 0%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -103% -135%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -70% -142%<br />
Sommersmog (POCP) -148% -275%<br />
Versauerung -87% -149%<br />
Terrestrische Eutrophierung -50% -92%<br />
Aquatische Eutrophierung 9% 22%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -26%<br />
Naturraum: Forstfläche -69%% -162%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Tabelle 6-8: numerischer Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw.<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Einweg - Allokationsfaktor 100%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -65% -73%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch 5% 17%<br />
Sommersmog (POCP) -16% -20%<br />
Versauerung -24% -27%<br />
Terrestrische Eutrophierung -23% -41%<br />
Aquatische Eutrophierung 15% 68%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -10% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -14285% -32476%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Die hier gezeigten Werte sind rein mathematischer Natur, ohne Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
Endbericht Oktober 2008
80 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
7 Normierung<br />
In diesem Kapitel werden als ergänzende Darstellung alle Ergebnisse in normiertem Format,<br />
d.h. als Einwohnerdurchschnittswerte, dargestellt. Ein solcher Normierungsschritt erlaubt die<br />
Einschätzung <strong>der</strong> relativen Bedeutung einzelner Indikatoren <strong>und</strong> bietet zudem die Möglichkeit,<br />
Indikatorergebnisse in <strong>der</strong>selben Einheit, den Einwohnerwerten, auszudrücken.<br />
Ziel <strong>der</strong> Normierung ist es die im vorliegenden Bericht verwendete UBA-Priorisierung <strong>der</strong><br />
verwendeten Wirkkategorien kritisch zu überprüfen <strong>und</strong> ggf. ihre <strong>der</strong>zeitige Gültigkeit zu bestätigen<br />
bzw. zu negieren.<br />
Die Normierung bezeichnet die Berechnung <strong>der</strong> Größenordnung <strong>der</strong> Indikatorergebnisse im<br />
Verhältnis zu einem Referenzwert. Der Beitrag <strong>der</strong> durch das untersuchte Produktsystem<br />
verursachten Umweltwirkungen kann damit z.B. auf bereits existierende Umweltbelastungen<br />
bezogen werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, ein besseres Verständnis für die relative Bedeutung<br />
<strong>der</strong> ermittelten Indikatorergebnisse zu bekommen.<br />
In <strong>der</strong> hier anhand ausgewählter Beispiele durchgeführten Normierung wird die Umweltlast<br />
Deutschlands als Referenzwert herangezogen. Man berechnet dazu, wie groß z.B. das<br />
Treibhauspotential ist, das durch die <strong>der</strong>zeitigen Emissionen in Deutschland innerhalb eines<br />
Referenzjahres verursacht wird. Das berechnete Treibhauspotential wird durch die Anzahl<br />
<strong>der</strong> Einwohner Deutschlands dividiert <strong>und</strong> man erhält so das Treibhauspotential, das im Mittel<br />
durch einen Einwohner Deutschlands verursacht wird. Dieser Wert entspricht also einem<br />
Einwohnerdurchschnittswert (EDW).<br />
Zu diesem Wert setzt man in einem nachfolgenden Schritt das Treibhauspotential einer bestimmten<br />
Untersuchungsoption ins Verhältnis <strong>und</strong> erhält somit den spezifischen Beitrag <strong>der</strong><br />
gewählten Option, ausgedrückt als eine bestimmte Anzahl von EDW. Diese sind also nichts<br />
an<strong>der</strong>es als eine Bezugsgröße, um die verschiedenen Indikatorergebnisse in vergleichbare<br />
Einheiten zu überführen <strong>und</strong> die Relevanz des Beitrags einer Untersuchungsoption zu den<br />
betrachteten Umweltwirkungen zu veranschaulichen.<br />
In Tabelle 7-1 sind die als Bezug herangezogenen Gesamtbelastungswerte Deutschlands<br />
<strong>und</strong> die auf einen Einwohner skalierte Menge – entspricht einem EDW - aufgeführt.<br />
In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse, die sich zunächst auf die in <strong>der</strong> Zieldefinition<br />
gewählte funktionelle Einheit beziehen, auf den Gesamtverbrauch <strong>der</strong> betrachteten Getränke<br />
in Deutschland skaliert. Dabei wurde ein Verbrauch von Wässern <strong>und</strong> kohlensäurehaltigen<br />
Erfrischungsgetränken im Marktsegment Vorratshaltung von 14,98 Mrd. L/Jahr in Deutschland<br />
zugr<strong>und</strong>e gelegt.<br />
Am Ende des beschriebenen Rechengangs liegen die spezifischen Beiträge <strong>der</strong> verschiedenen<br />
untersuchten Optionen bezüglich <strong>der</strong> jeweiligen Umweltindikatoren vor. Für die Darstellung<br />
von EDW werden die Ergebnisse <strong>der</strong> ausgewählten Indikatoren nicht-sektoral abgebildet,<br />
da es bei dieser Darstellungsform eher auf den Gesamtbeitrag hinsichtlich <strong>der</strong> betrachteten<br />
Umweltwirkungskategorien ankommt (s. Abb. 7-1, 7-2 <strong>und</strong> 7-3).<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 81<br />
Tabelle 7-1: Daten zur Ermittlung des spezifischen Beitrags (EDW)<br />
EDW = Einwohnerdurchschnittswert Deutschland<br />
Fracht pro Jahr EDW<br />
Einwohner<br />
Einwohner<br />
Ressourcen<br />
82 348 999 a)<br />
Braunkohle 1 573 000 e) TJ 19 102 MJ<br />
Erdgas 3 300 000 e) TJ 40 074 MJ<br />
Rohöl 5 164 000 e) TJ 62 709 MJ<br />
Steinkohle 1 876 000 e) TJ 22 781 MJ<br />
Fläche, gesamt 349 223 c) km 2<br />
4 200 m 2<br />
Emissionen (Luft)<br />
Ammoniak 619 480 d) t 7,52 kg<br />
Arsen 33 f) t 0,0004 kg<br />
Benzol 42 900 h) t 0,52 kg<br />
Benzo(a)pyren 13,76 g) t 0,0002 kg<br />
Chlorwasserstoff kg<br />
Fluorwasserstoff 124 000 i) t 1,50 kg<br />
Kohlendioxid, fossil 872 943 011 d) t 10 601 kg<br />
Kohlenmonoxid 4 034 502 d) t 48,99 kg<br />
Methan 662 675 d) t 8,05 kg<br />
Methan regenerativ 1 605 518 d) t 19,50 kg<br />
NMVOC 1 253 290 d) t 15,22 kg<br />
Stickoxid (als NO2) 1 443 097 d) t 17,52 kg<br />
Schwefeldioxid 560 074 d) t 6,8 kg<br />
Staub (PM10)<br />
Emissionen (Wasser)<br />
193 468 d) t 2,35 kg<br />
Phosphor 33 164 b) t 0,40 kg<br />
Stickstoff<br />
Aggregierte Werte<br />
687 960 b) t 8,35 kg<br />
Rohöläquivalente 185 985 788 t COE-Eq 2 259 kg<br />
Klimawandel 995 396 551 t CO2-Eq 12 088 kg<br />
Versauerung 2 933 148 t SO2-Eq 35,62 kg<br />
Eutrophierung (terr.) 462 319 t PO4-Eq 5,61 kg<br />
Eutrophierung (aqu.) 390 425 t PO4-Eq 5,61 kg<br />
Sommersmog (POCP) 1 266 899 t Eth-Eq 15,38 kg<br />
Fläche 349 223 km 2 4200 m 2<br />
a) Stat. B<strong>und</strong>esamt 2004, Stand 31.12.2003<br />
b) Umweltb<strong>und</strong>esamt, UBA-Texte 82/03, Quantifizierung <strong>der</strong> Nährstoffeinträge <strong>der</strong> Flussgebiete Deutschlands<br />
auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage eines harmonisierten Vorgehens (Zahlen für 2000)<br />
c) StBA FS 3 R 5.1, erschienen am 20. Dez. 2005: Flächennutzung in D 2004. Eckzahlen über die Bodenfläche<br />
zum 31.12.2004 nach Art <strong>der</strong> tatsächlichen Nutzung in D (Ergebnis Flächenerhebung 2004)<br />
d) Umweltb<strong>und</strong>esamt (Hrsg.) - Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer<br />
Emissionen 1990-2005. Dessau, April 2007<br />
e) DIW Berlin: Wochenbericht Nr. 8/2007 (Energiedaten D 2006) (Tabelle 1)<br />
f) Daten zur Umwelt 1996 für das Jahr 1995<br />
g) Ifeu-Studie “POP in Deutschland”, Bezugsjahr 1994<br />
h) Enquete Stoff- <strong>und</strong> Materialströme 1993, S.146<br />
i) Daten zur Umwelt 92/93 für das Jahr 1991<br />
Für die Normierung des Wirkungsindikators Naturraumbeanspruchung wurde die Gesamtfläche<br />
Deutschlands herangezogen. Das entspricht dem Vorgehen bei den an<strong>der</strong>en Wirkungskategorien,<br />
wo auch jeweils die deutschen Gesamtwerte die Referenz bilden.<br />
Einschränkend muss bemerkt werden, dass im Falle des aquatischen Eutrophierungspotentials<br />
durch das Fehlen <strong>der</strong> EDW-Bezugsgröße für CSB die Einwohnerdurchschnittswerte zu<br />
hoch berechnet sind. Von dem ausgewiesenen Eutrophierungspotential z.B. für die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche (1,0 L) mit 2,9 g PO4-Äquivalenten pro 1000 L Füllgut werden 1,35 g durch<br />
den CSB-Anteil verursacht, welches knapp 50% darstellt. Somit wäre insgesamt bei Vernachlässigung<br />
des CSB-Wertes auch ein um etwa 50% niedrigeres aquatisches Eutrophierungspotential<br />
in <strong>der</strong> EDW-Darstellung zu erwarten. Diese Datenlücke hinsichtlich <strong>der</strong> Bezugsgröße<br />
wird in <strong>der</strong> späteren Auswertung <strong>der</strong> EDW-Ergebnisse berücksichtigt.<br />
Endbericht Oktober 2008
82 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Betrachtet man die in <strong>der</strong> vorliegenden Studie untersuchten Indikatoren, dann zeigen Fossiler<br />
Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung die<br />
größten Beiträge mit tendenziell höheren Werten beim Fossilen Ressourcenverbrauch.<br />
1000 Einwohnerwerte (Deutschland)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Untersuchungsgruppe A [oFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
Fossiler<br />
Ressourcenverbauch<br />
Klimaw andel Sommersmog (POCP) Versauerung Terrestrische<br />
Eutrophierung<br />
Abbildung 7-1: Einwohnerwerte Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut] für die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Aquatische<br />
Euthrophierung<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>_EW 1,5 L <strong>PET</strong>_MW 1,0 L<br />
Naturrraum: Forst Naturraum: versiegelte<br />
Fläche
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 83<br />
1000 Einwohnerwerte (Deutschland)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Untersuchungsgruppe A [mFG]: Distributionsmodell 96/97<br />
Fossiler<br />
Ressourcenverbauch<br />
Klimaw andel Sommersmog (POCP) Versauerung Terrestrische<br />
Eutrophierung<br />
Abbildung 7-2: Einwohnerwerte Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut] für die Verpackung<br />
<strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Aquatische<br />
Euthrophierung<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>_EW 1,5 L <strong>PET</strong>_MW 1,0 L<br />
Naturrraum: Forst Naturraum: versiegelte<br />
Fläche
84 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
1000 Einwohnerwerte (Deutschland)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Untersuchungsgruppe B [mFG] Basis: Distributionsmodell 07/08<br />
Fossiler<br />
Ressourcenverbauch<br />
Klimaw andel Sommersmog (POCP) Versauerung Terrestrische<br />
Eutrophierung<br />
Abbildung 7-3: Einwohnerwerte Untersuchungsgruppe B für die Verpackung <strong>und</strong> Distribution<br />
von 1000 L Füllgut<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Aquatische<br />
Euthrophierung<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>_EW 1,5 L <strong>PET</strong>_MW 1,0 L<br />
Naturrraum: Forst Naturraum: versiegelte<br />
Fläche
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 85<br />
7.1 Ergebnisse <strong>der</strong> Normierung<br />
Die normierten Indikatorergebnisse für die ausgewählten Szenarien in den Abbildungen 7-1<br />
bis 7-3 zeigen, welche Wirkungskategorien relativ höhere bzw. niedrigere spezifische Beiträge<br />
zu den Gesamtwerten beitragen. An<strong>der</strong>s ausgedrückt: in den Wirkungskategorien mit den<br />
höchsten spezifischen Beiträgen könnte eine Reduktion <strong>der</strong> Umweltlasten <strong>der</strong> betrachteten<br />
Verpackungssysteme beson<strong>der</strong>s wirkungsvoll zur Umweltverbesserung beitragen.<br />
Die höchsten normierten Indikatorergebnisse bei den relevanten Indikatoren weisen in allen<br />
drei Szenarien die Wirkungskategorien Fossiler Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Versauerung<br />
<strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung auf. Die Werte für den Indikator Sommersmog<br />
(POCP) sind vornehmlich für die <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> die <strong>PET</strong>-Einwegflasche von<br />
Relevanz, die spezifischen Beiträge <strong>der</strong> Kategorien Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
Forstfläche sind erheblich geringer als die <strong>der</strong> bereits oben erwähnten<br />
Kategorien. Bzgl. <strong>der</strong> Wirkkategorie Naturraumbeanspruchung versiegelte Fläche ergeben<br />
sich keine relevanten Beiträge.<br />
Wie die in EDW gemessenen Unterschiede zwischen den Szenarien zu lesen sind, soll am<br />
Beispiel Klimawandel in Abb. 7-3 verdeutlicht werden. Im Bezug Deutschland erreicht die<br />
<strong>PET</strong>-Mehrwegflasche 85334 EDW <strong>und</strong> die <strong>PET</strong>-Einwegflasche 172826 EDW. Geht man nun<br />
davon aus, dass die gesamte in Deutschland in einem Jahr konsumierte Menge an Wässern<br />
<strong>und</strong> kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken alternativ in 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen<br />
o<strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflaschen abgefüllt werden würde, so würden sich bei <strong>der</strong> Alternative<br />
<strong>PET</strong>-Mehrwegflasche potenziell soviel Treibhausgase einsparen lassen, wie sie statistisch<br />
von 77095 Einwohnern jährlich verursacht werden.<br />
7.2 Gültigkeit <strong>der</strong> Normierungsergebnisse<br />
Ziel <strong>der</strong> im Rahmen dieser Studie durchgeführten Normierung ist es, die in den UBA-<br />
Getränkeökobilanzen vorgenommene Einstufung <strong>der</strong> ökologischen Bedeutung <strong>der</strong> einzelnen<br />
Wirkkategorien zu überprüfen. Die Priorisierung erfolgt seitens des UBAs aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Kriterien<br />
ökologische Gefährdung <strong>und</strong> Abstand zum Zielwert (distance to target) sowie dem spezifischen<br />
Beitrag (dem Ergebnis <strong>der</strong> Normierung).<br />
Während die Einstufung <strong>der</strong> ersten beiden Kriterien unabhängig vom Kontext einer Ökobilanz<br />
ihre Gültigkeit bewahrt, wird <strong>der</strong> spezifische Beitrag jeweils durch die Normierung neu<br />
bestimmt. Somit ist die ökologische Prioritätenbildung immer vom Ergebnis <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Ökobilanz abhängig.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> in <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz durchgeführten Normierung verhalten sich<br />
äquivalent zu den Normierungsergebnissen <strong>der</strong> UBA-Getränkeökobilanzen. Die spezifischen<br />
Einwohnerwerte unterscheiden sich in den absoluten Werten zwar von denen <strong>der</strong> UBA-<br />
Ökobilanz, das Verhältnis zwischen den Wirkkategorien bleibt jedoch weitestgehend gleich.<br />
Insofern erscheint es gerechtfertigt, aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> ähnlichen Normierungsergebnisse die Einstufung<br />
<strong>der</strong> ökologischen Priorität die in den Getränkeökobilanzen des UBAs abgeleitet wurde<br />
auch in <strong>der</strong> vorliegenden Studie zu verwenden. Die Einstufung <strong>der</strong> ökologischen Priorität<br />
ist bereits in Kapitel 1.10.2 dargestellt.<br />
Auf eine eigene Herleitung <strong>der</strong> ökologischen Priorität <strong>der</strong> einzelnen Wirkkategorien kann daher<br />
im Kontext dieser Ökobilanz verzichtet werden.<br />
Endbericht Oktober 2008
86 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
8 Auswertung<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Zielsetzung <strong>der</strong> Untersuchung <strong>und</strong> den in den Kap. 5 bis Kap. 7 vorgestellten<br />
Ergebnissen, sollen im vorliegenden Kap. 8 Auswertungen vorgenommen werden,<br />
die schließlich in Kap. 9 in Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen münden.<br />
Dabei sollen alle wesentlichen Festlegungen <strong>und</strong> Annahmen berücksichtigt werden, ebenso<br />
wie die Qualität <strong>und</strong> Unsicherheit von Daten <strong>und</strong> Informationen sowie die Auswahl <strong>und</strong> Methoden<br />
<strong>der</strong> Wirkungsabschätzung.<br />
8.1 Vollständigkeit, Konsistenz <strong>und</strong> Datenqualität<br />
Die für die Auswertung <strong>der</strong> in dieser Studie untersuchten Verpackungssysteme relevanten<br />
Informationen <strong>und</strong> Daten lagen vor. Ergebnisrelevante Fehlstellen sind nach Einschätzung<br />
<strong>der</strong> Auftragnehmer nicht zu verzeichnen.<br />
Bei <strong>der</strong> Modellierung <strong>der</strong> vier Verpackungsarten wurde jeweils <strong>der</strong> gesamte Lebenszyklus<br />
betrachtet.<br />
Eine gewisse Einschränkung <strong>der</strong> Datenrepräsentativität besteht hinsichtlich <strong>der</strong> Erfassungs-<br />
<strong>und</strong> Sammelquote <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflaschen. Für die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche, die <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche gab es diesbezüglich von den Organisationen<br />
GDB <strong>und</strong> <strong>PET</strong>CYCLE nachvollziehbare Informationen. Für die <strong>PET</strong>-Einweg-Flasche<br />
lagen Experteneinschätzungen vor. Die Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> hier als realistisch eingeschätzten<br />
Bandbreite für die Erfassungsquote <strong>der</strong> bepfandeten <strong>PET</strong>-Einwegflaschen wurde<br />
über eine vorgenommene Sensitivitätsanalyse geprüft.<br />
Für die Modellierung <strong>der</strong> Herstellung <strong>der</strong> Primärverpackungsmaterialien PP, LDPE, HDPE<br />
<strong>und</strong> <strong>PET</strong> wurden die Ecoprofile 2005 <strong>der</strong> PlasticsEurope (ehemals APME) verwendet. Für<br />
die Herstellung des <strong>PET</strong> ist ein alternativer Datensatz verfügbar, <strong>der</strong> im Auftrag einer von<br />
<strong>PET</strong>CORE angefertigten Ökobilanz [IFEU 2004b] erarbeitet wurde. Da die Entscheidung für<br />
einen <strong>der</strong> beiden verfügbaren <strong>PET</strong>-Datensätze eine gewisse Subjektivität birgt, wurde zur<br />
Überprüfung <strong>der</strong> Ergebnisrelevanz dieser Auswahl eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt.<br />
Die Güte <strong>der</strong> Daten <strong>und</strong> Annahmen zur Getränkedistribution ist in <strong>der</strong> vorliegenden Studie<br />
von beson<strong>der</strong>er Relevanz. Das Distributionsmodell 2006/07 <strong>der</strong> GDB Mehrwegflaschen (<strong>und</strong><br />
implizit das <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche) kann aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> eigens durchgeführten aktuellen<br />
Datenerhebung als belastbar eingestuft werden.<br />
Im Unterschied dazu beruht das Distributionsmodell 2006/07 <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche auf einer<br />
Kombination von Datenerhebungen im Zeitraum 2003/2004 <strong>und</strong> aktuellen Experteneinschätzungen<br />
<strong>und</strong> Plausibilitätsüberlegungen. In dieser Hinsicht ist die in beiden Modellen unterlegte<br />
Datenqualität <strong>und</strong> –symmetrie nicht vollständig gleichwertig.<br />
Die Distributionsmodelle wurden daher im Projektkreis (beson<strong>der</strong>s zwischen Auftragnehmer<br />
<strong>und</strong> kritischen Gutachtern) intensiv diskutiert. Das Distributionsmodell 2006/07 <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche wurde von allen Beteiligten als realistisch eingestuft. Eine vertiefende statistische<br />
Absicherung <strong>der</strong> Daten (z.B. über eine umfängliche Distributionsanalyse) wäre angesichts<br />
<strong>der</strong> Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> getroffenen Festlegungen dennoch zu empfehlen.<br />
Allokationsregeln, Systemgrenzen <strong>und</strong> die Berechnungen zur Wirkungsabschätzung wurden<br />
einheitlich bei allen untersuchten Verpackungssystemen <strong>und</strong> den darauf beruhenden Szenarien<br />
in gleicher Weise angewendet. Die Ergebnisrelevanz <strong>der</strong> als UBA-Standard angewand-<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 87<br />
ten 50-50 Allokation wurde mittels Sensitivitätsanalysen für den gesamten Bereich von 0 %<br />
bis 100 % Allokation symmetrisch über die 4 Untersuchungssysteme geprüft.<br />
Insgesamt werden die Datenqualität <strong>und</strong> die Datensymmetrie dieser Ökobilanz aus Sicht<br />
des Auftragnehmers als gut <strong>und</strong> <strong>der</strong> Zielstellung <strong>der</strong> Studie angemessen eingestuft.<br />
8.2 Signifikanz <strong>der</strong> Unterschiede<br />
Nach ISO 14040/14044 können in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Zieldefinition <strong>und</strong> dem Untersuchungsrahmen<br />
Informationen <strong>und</strong> Verfahren notwendig werden, die eine Ableitung von signifikanten<br />
Ergebnissen zulassen. Dies trifft zu, wenn, wie im vorliegenden Fall, ökobilanzielle<br />
Ergebnisse möglicherweise in marktstrategische o<strong>der</strong> politische Entscheidungen einfließen.<br />
Da jedoch eine Signifikanzprüfung anhand einer Fehlerrechnung mit Fehlerfortpflanzung im<br />
streng mathematischen Sinne aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Datenstruktur in Ökobilanzen kritisch gesehen<br />
wird, sollen nachfolgende Hinweise eine Orientierung darüber geben, wann Unterschiede<br />
zwischen den Systemen als relevant anzusehen sind.<br />
Die Auftragnehmer vertreten die Auffassung, dass die verwendeten Daten <strong>und</strong> Annahmen in<br />
den ergebnisrelevanten Bereichen für die betrachteten Verpackungssysteme zutreffend <strong>und</strong><br />
in ihrem Grad an Aktualität über die Verpackungssysteme hinweg weitgehend symmetrisch<br />
sind. Die darauf beruhenden Ergebnisse können daher als belastbar angesehen werden.<br />
Unsicherheiten bezüglich <strong>der</strong> Genauigkeit <strong>und</strong> Repräsentativität <strong>der</strong> Daten sind, wie vorher<br />
ausgeführt, dennoch in einem gewissen Maße unvermeidlich. Infolgedessen sind geringe<br />
Unterschiede <strong>der</strong> Indikatorwerte im Vergleich <strong>der</strong> Verpackungssysteme weniger signifikant<br />
als große Unterschiede.<br />
Auch wenn diskrete Angaben für Signifikanzschwellen in Ökobilanzuntersuchungen wegen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlicher Bedenken nicht belastbar hergeleitet werden können, wurde, um eine Überinterpretation<br />
kleiner Unterschiede zu vermeiden, <strong>der</strong> Systemvergleich von <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflaschen <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Verpackungen behelfsweise unter Anwendung einer Signifikanzschwelle<br />
geprüft.<br />
Das IFEU verwendet bei <strong>der</strong> Analyse von Verpackungssystemen i.d.R. einen Schwellenwert<br />
von 10 %. Es handelt sich dabei um einen pragmatischen <strong>und</strong> in <strong>der</strong> ökobilanziellen Praxis<br />
durchaus gängigen Ansatz, den die Autoren <strong>der</strong> Studie für ökobilanzielle Vergleiche von solchen<br />
Szenarien als zulässig erachten, <strong>der</strong>en Systemgrenze jeweils nur ein einzelnes <strong>und</strong><br />
vergleichsweise wenig komplexes Produktsystem umfasst.<br />
Endbericht Oktober 2008
88 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
8.3 Übergreifende Interpretation<br />
8.3.1 Vorgehen<br />
Bereits die in Kapitel 5 gezeigten Ergebnisse lassen erkennen, dass in keiner <strong>der</strong> Untersuchungsgruppen<br />
die Indikatorergebnisse bei allen Wirkungskategorien nur in eine Richtung,<br />
d.h. zugunsten des einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Systems, weisen. Weitere Bewertungshilfen sind<br />
somit erfor<strong>der</strong>lich.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wird zu diesem Zweck die UBA-Prioritätenbildung <strong>der</strong> Wirkungskategorien<br />
(s. Tabelle 1-2) herangezogen, d.h. die absoluten <strong>und</strong> relativen Unterschiede <strong>der</strong><br />
Indikatorergebnisse werden unter Berücksichtigung <strong>der</strong> ökologischen Priorität gemäß <strong>der</strong><br />
UBA Getränkeökobilanzen betrachtet.<br />
Kapitel 5 zeigt die Ergebnisse <strong>der</strong> drei Untersuchungsgruppen in Form von Sektoralgrafiken<br />
<strong>und</strong> Prozentwerttabellen. Diese Prozentwerttabellen werden im folgenden Kapitel erneut<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> mit einem farblichen Muster ergänzt, welches in diesem Kapitel <strong>der</strong> Interpretation<br />
dient. Die farblichen Unterschiede geben dabei die absoluten Unterschiede zwischen<br />
den Systemen <strong>und</strong> dem Referenzsystem (in diesem Fall <strong>Glas</strong>-Mehrweg) an. „Grün“<br />
bedeutet niedrigere, „rot“ höhere Indikatorergebnisse des <strong>Glas</strong>-Mehrwegsystems im Systemvergleich.<br />
Grau bedeutet, dass <strong>der</strong> prozentuale Unterschied unterhalb <strong>der</strong> in Kapitel 8.2 gewählten<br />
Signifikanzschwelle liegt.<br />
Die Prozentwerte <strong>der</strong> Tabelle geben Auskunft über die relativen Unterschiede zwischen den<br />
Systemen. So ist es zwar möglich, dass das farbliche Muster <strong>der</strong> Tabelle erhalten bleibt, <strong>der</strong><br />
Unterschied zwischen den Nettoergebnisse <strong>der</strong> untersuchten Systeme sich jedoch verän<strong>der</strong>t.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Tabellen geben daher nicht nur Auskunft über die Ausrichtung <strong>der</strong><br />
Ergebnisse son<strong>der</strong>n zeigen weiterhin auch die quantitative Ausprägung <strong>der</strong> relativen Unterschiede.<br />
Im Folgenden werden die Ergebnisse <strong>der</strong> einzelnen Untersuchungsgruppen jeweils in getrennten<br />
Unterkapiteln betrachtet, wobei aber Querbezüge zwischen den Untergruppen hergestellt<br />
werden. Die Auswertung erfolgt entlang <strong>der</strong> bereits angesprochenen ökologischen<br />
Prioritätenbildung. Es wird jeweils die Positionierung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche getrennt beleuchtet.<br />
In <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut] wird, durch einen Vergleich <strong>der</strong> Werte für <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg die Verbindung zu den Ergebnissen <strong>der</strong> zurückliegenden UBA Studien (UBA 2000)<br />
hergestellt. Die Interpretation <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B wird durch Einbeziehung<br />
<strong>der</strong> Sensitivitätsanalysen vertieft.<br />
8.3.2 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]<br />
Vergleich <strong>Glas</strong>-Mehrweg gemäß UBA 2000 mit <strong>der</strong> aktuellen Studie:<br />
Die Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut] bildet die <strong>der</strong>zeitige Situation <strong>der</strong> untersuchten<br />
Verpackungen bei weitgehen<strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> methodischen Rahmenbedingungen <strong>der</strong><br />
UBA Studien aus den Jahren 2000 <strong>und</strong> 2002 ab. Zu Vergleichszwecken werden die aktuellen<br />
Netto-Ergebnisse <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong> Mehrwegflasche den Ergebnissen aus [UBA 2000] gegenüber<br />
gestellt.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 89<br />
Das Vergleichsergebnis ist in Tabelle 8-1 ersichtlich <strong>und</strong> zeigt durchgängig eine Vermin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Indikatorwerte.<br />
Tabelle 8-1 Vergleich <strong>der</strong> Nettowerte <strong>der</strong> UBA 2000-Studie mit den Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
A [oFG]<br />
UBA-2000 aktuelle Studie<br />
Indikator Einheit*<br />
<strong>Glas</strong>-MW 0,7 L Entwicklung<br />
<strong>Glas</strong>-MW-0,7l Untersuchungsgruppe<br />
A [oFG]<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch kg Rohöl-Äquiv. 21,2 18,9 -10,8% ↓<br />
Klimawandel kg CO2-Äquiv. 84,2 81,6 -3,1% ↓<br />
Versauerung kg SO2-Äquiv. 0,45 0,32 -28,9% ↓<br />
Terrestrische Eutrophierung g PO4-Äquiv. 59,1 43,1 -27,1% ↓<br />
Aquatische Eutrophierung g PO4-Äquiv. 2,53 2,22 -12,3% ↓<br />
*Werte pro 1000L Füllgut<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-2):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche, nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Nachteile gegenüber den untersuchten <strong>PET</strong>-Flaschen.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt, sowie<br />
Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Tabelle 8-2: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [oFG] zw. <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -44% -45% 35%<br />
Fossiler Ressourcen-<br />
-20% -32% 14%<br />
verbrauch<br />
Sommersmog (POCP) -129% -201% -20%<br />
Versauerung -9% -9% 57%<br />
Terrestrische Eutrophierung 32% 55% 103%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 115% 454% 151%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Endbericht Oktober 2008
90 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-3):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche durchgängig Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
in <strong>der</strong> Summe mehr Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt.<br />
Tabelle 8-3: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [oFG] zw. <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -95% -96%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -38% -51<br />
Sommersmog (POCP) -90% -150%<br />
Versauerung -72% -71%<br />
Terrestrische Eutrophierung -54% -31%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -17% 121%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Insgesamt zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche unter den Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
A [oFG] das ökologisch günstigste Umweltwirkungsprofil.<br />
8.3.3 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut]<br />
Die Untersuchungsgruppen A [ohne Füllgut] <strong>und</strong> A [mit Füllgut] unterscheiden sich, wie<br />
schon in <strong>der</strong> Namensgebung ersichtlich, lediglich durch die zusätzliche Bilanzierung des<br />
Füllguttransports. Da dabei in allen Verpackungssystemen <strong>der</strong>selbe Betrag an Umweltlast<br />
hinzukommt, bleiben die absoluten Unterschiede zwischen den Ergebnissen gleich. Die relativen<br />
Unterschiede än<strong>der</strong>n sich jedoch. Beson<strong>der</strong>s deutlich wird dies in <strong>der</strong> durch die Distribution<br />
stärker beeinflusste Wirkungskategorie terrestrische Eutrophierung.<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-4):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche, nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 91<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Nachteile gegenüber den untersuchten <strong>PET</strong>-Flaschen.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt, sowie<br />
Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Tabelle 8-4: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG] zw. <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -37% -40% 28%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -16% -29% 11%<br />
Sommersmog (POCP) -104% -164% -17%<br />
Versauerung -7% -11% 36%<br />
Terrestrische Eutrophierung 19% 24% 53%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 47% 83% 56%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-5):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche durchgängig Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
in <strong>der</strong> Summe mehr Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt.<br />
Endbericht Oktober 2008
92 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Tabelle 8-5: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe A [mFG] zw. <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -75% -79%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -43%<br />
Sommersmog (POCP) -75% -127%<br />
Versauerung -45% -51%<br />
Terrestrische Eutrophierung -28% -23%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -6% 18%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Weiterhin zeigt die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche auch unter den Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
A [mFG] das ökologisch günstigste Umweltwirkungsprofil.<br />
8.3.4 Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mit Füllgut]<br />
8.3.4.1 Bewertung <strong>der</strong> Basisszenarien<br />
In <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B wurde <strong>der</strong> Einfluss eines aktualisierten Distributionsmodells<br />
auf die Umweltauswirkungen <strong>der</strong> vier Getränkeverpackungen untersucht. Dabei gab es, im<br />
Gegensatz zu den Annahmen, die den Untersuchungsgruppen A zu Gr<strong>und</strong>e liegen, unterschiedliche<br />
Modelle <strong>der</strong> Mehrweg- <strong>und</strong> <strong>der</strong> Einweg-Distribution.<br />
Dieser Unterschied hat Auswirkungen auf die Ergebnisse <strong>der</strong> MW- <strong>und</strong> EW-Systeme, die<br />
sich in Verän<strong>der</strong>ungen im Muster des Ergebnisvergleichs mit <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-MW-Flasche nie<strong>der</strong>schlagen.<br />
Im Einzelnen stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar.<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-6):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche, nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche, nicht jedoch gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Nachteile gegenüber den untersuchten <strong>PET</strong>-Flaschen.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt, sowie<br />
Nachteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 93<br />
Tabelle 8-6: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw. <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Klimawandel -50% -66% 22%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -60% 3%<br />
Sommersmog (POCP) -132% -215% -27%<br />
Versauerung -22% -47% 28%<br />
Terrestrische Eutrophierung 7% -13% 47%%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% 47% 4%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 20% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% -56% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Betrachtung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen im Systemvergleich (vgl. Tabelle 8-7):<br />
In <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung – Klimawandel - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung – Fossiler Ressourcenverbrauch,<br />
Sommersmog (POCP), Versauerung <strong>und</strong> Terrestrische Eutrophierung - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche durchgängig Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
In den Kategorien mit mittlerer ökologischer Bedeutung – Aquatische Eutrophierung <strong>und</strong> Naturraumbeanspruchung<br />
versiegelte Fläche sowie Forstfläche - zeigt die <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche in <strong>der</strong> Summe mehr Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche insgesamt ökologische<br />
Vorteile gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigt.<br />
Tabelle 8-7: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw. <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Klimawandel -83% -103%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -33% -64%<br />
Sommersmog (POCP) -82% -148%<br />
Versauerung -56% -88%<br />
Terrestrische Eutrophierung -37% -66%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% 41%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Die Position <strong>der</strong> betrachteten Systeme bleibt gegenüber den Erkenntnissen aus den Untersuchungsgruppe<br />
A [mFG] <strong>und</strong> A [oFG] im Prinzip unverän<strong>der</strong>t. Auch unter den Rahmenbedingungen<br />
<strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B gilt, dass die <strong>PET</strong>-MW-Flasche das ökologisch günstigste<br />
Umweltwirkungsprofil aufweist.<br />
Endbericht Oktober 2008
94 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
8.3.4.2 Bewertung unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Sensitivitätsanalysen<br />
Variation <strong>der</strong> Erfassungsquote für <strong>PET</strong> Einwegflaschen:<br />
Die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erfassungsquote für gebrauchte <strong>PET</strong>-Einwegflaschen von 90% im Basisszenario<br />
auf 95% in <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse hat keinen Einfluss auf die Ausrichtung <strong>der</strong><br />
Ergebnisse im Vergleich zur <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche (vgl. Tabelle 8-8).<br />
Tabelle 8-8: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw. <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Einweg EQ 95%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-EW 1,5 L Basis <strong>PET</strong>-EW 1,5 L Sens. 95%<br />
Klimawandel -66% -62%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -60% -57%<br />
Sommersmog (POCP) -215% -207%<br />
Versauerung -47% -45%<br />
Terrestrische Eutrophierung -13% -12%<br />
Aquatische Eutrophierung 47% 48%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 20% 19%<br />
Naturraum: Forstfläche -56% -57%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Auch im Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche ergeben sich durch die Erhöhung <strong>der</strong> Erfassungsquote<br />
keine Än<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Ausrichtung <strong>der</strong> Ergebnisse (vgl. Tabelle 8-9).<br />
Tabelle 8-9: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] zw. <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-Einweg EQ 95%<br />
Indikator <strong>PET</strong>-EW 1,5 L Basis <strong>PET</strong>-EW 1,5 L Sens. 95%<br />
Klimawandel -103% -98%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -64% -61%<br />
Sommersmog (POCP) -148% -141%<br />
Versauerung -88% -85%<br />
Terrestrische Eutrophierung -66% -65%<br />
Aquatische Eutrophierung 41% 42%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -27% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -398% -399%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Verwendung eines alternativen <strong>PET</strong>-Datensatzes<br />
Bei Verwendung des alternativen Petcore Datensatzes zur <strong>PET</strong>-Herstellung ergeben sich<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Muster <strong>der</strong> Vergleichsergebnisse zwischen <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong><br />
den <strong>PET</strong>-Einwegflaschen.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e für den Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche wirkt sich dies auf die Gesamtbewertung<br />
aus. Zunächst zeigt sich in <strong>der</strong> Kategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung<br />
weiterhin ein Vorteil für die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche. In den Kategorien mit großer ökologischer<br />
Bedeutung steht jedoch dem Vorteil beim fossilen Ressourcenverbrauch (Unterschied:<br />
30%) ein Nachteil bei <strong>der</strong> terrestrischen Eutrophierung <strong>und</strong> beim Sommersmog (Unterschied:<br />
20% bzw. 12%) gegenüber. Ähnlich das Bild bei den Kategorien mit mittlerer ökologischer<br />
Bedeutung. Hier steht dem Vorteil bei <strong>der</strong> aquatischen Eutrophierung (Unterschied:<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 95<br />
76%) ein Nachteil bei Naturraum (versiegelte Fläche) <strong>und</strong> Naturraum (Forstfläche) gegenüber<br />
(Unterschied: 38% bzw. 14%) gegenüber.<br />
Insgesamt lässt sich dann für keines <strong>der</strong> beiden Systeme ein eindeutiger ökologischer Vorteil<br />
bzw. Nachteil ableiten (vgl. Tabelle 8-10).<br />
Tabelle 8-10: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität alternativer<br />
<strong>PET</strong>-Datensatz zw. <strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie <strong>PET</strong>-<br />
Mehrweg<br />
Indikator<br />
<strong>PET</strong>-SK 1,0 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
Basis. Sens.<br />
Klimawandel -50% -40% -66% -52% 22% 28%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -29% -30% -60% -62% 3% 2%<br />
Sommersmog (POCP) -132% 12% -215% -10% -27% 42%<br />
Versauerung -22% 9% -47% -4% 28% 50%<br />
Terrestrische Eutrophierung 7% 20% -13% 1% 47%% 56%<br />
Aquatische Eutrophierung 17% -76% 47% -98% 4% -32%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche 39% 38% 20% 19% 51% 51%<br />
Naturraum: Forstfläche 14% 14% -56% -57% 218% 218%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Für den Vergleich <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche mit den <strong>PET</strong>-Einwegflaschensystemen ergibt<br />
sich durch die Verwendung des alternativen <strong>PET</strong>-Datensatzes keine prinzipielle Neubewertung<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse (vgl. Tabelle 8-11).<br />
Tabelle 8-11: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität alternativer<br />
<strong>PET</strong>-Datensatz zw. <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator<br />
<strong>PET</strong>-SK 1,0 L<br />
Basis Sens.<br />
<strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
Basis Sens.<br />
Klimawandel -83% -80% -103% -95%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -33% -33% -64% -65%<br />
Sommersmog (POCP) -82% -27% -148% -57%<br />
Versauerung -56% -39% -88% -57%<br />
Terrestrische Eutrophierung -37% -30% -66% -54%<br />
Aquatische Eutrophierung 12% -33% 41% -50%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -9% -27% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -179% -179% -398% -398%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Die Aussage, dass die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche von allen untersuchten Systemen das ökologisch<br />
günstigste Wirkungsprofil aufzeigt, wird durch die durchgeführte Sensitivitätsanalyse<br />
bestätigt.<br />
Variation <strong>der</strong> Allokationsfaktoren im System<br />
Die Sensitivitätsanalyse <strong>der</strong> Allokationsfaktoren zeigt, dass sich je nach verwendetem Allokationsfaktor<br />
die Vergleichsergebnisse stark verän<strong>der</strong>t darstellen. Die Verän<strong>der</strong>ung findet<br />
dabei wesentlich im Umweltwirkungsprofil des <strong>PET</strong>-EW-Systems bzw. in abgeschwächtem<br />
Ausmaß im <strong>PET</strong>-SK-System statt. Bei Anwendung <strong>der</strong> 100% Allokation ergibt sich ein deut-<br />
Endbericht Oktober 2008
96 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
lich günstigeres Umweltwirkungsprofil, während es bei Anwendung <strong>der</strong> 0% Allokation deutlich<br />
ungünstiger als im Basisszenario wird.<br />
Dies liegt an <strong>der</strong> ausgeprägten allokationsbedingten Zunahme bzw. Abnahme <strong>der</strong> Recyclinggutschriften.<br />
Die Mehrwegsysteme sind davon systembedingt weit weniger betroffen <strong>und</strong><br />
zeigen damit Umweltwirkungsprofile die nur sehr begrenzt auf die gewählte Allokationsmethode<br />
reagieren.<br />
Bei Anwendung des Allokationsfaktors 0% ergeben sich im Vergleich <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-<br />
Mehrwegflasche mit den untersuchten <strong>PET</strong>-Systemen keine Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> schon<br />
aus den Basisszenarien bekannten Ergebnissausrichtung.<br />
An<strong>der</strong>s stellt sich die Situation bei Annahme eines Allokationsfaktors von 100% dar. Unverän<strong>der</strong>t<br />
bleibt <strong>der</strong> Vorteil <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche in <strong>der</strong> Wirkkategorie mit sehr großer ökologischer Bedeutung.<br />
Bei den Kategorien mit großer ökologischer Bedeutung steht jeweils <strong>der</strong> Vorteil bei einer Kategorie<br />
dem Nachteil bei einer an<strong>der</strong>en Kategorie gegenüber. Bei den Kategorien mit mittlerer<br />
ökologischer Bedeutung steht jeweils <strong>der</strong> Vorteil bei einer Kategorie dem Nachteil bei<br />
zwei an<strong>der</strong>en Kategorien gegenüber.<br />
Insgesamt kann dies noch als Vorteil <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche bewertet werden. Die Systemergebnisse<br />
liegen dabei deutlich näher beieinan<strong>der</strong> als bei <strong>der</strong> Anwendung des Allokationsfaktors von<br />
50% (vgl. Tabelle 8-12).<br />
Tabelle 8-12: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität Variation <strong>der</strong><br />
Allokationsfaktoren zw. <strong>Glas</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf, <strong>PET</strong>-Einweg sowie<br />
<strong>PET</strong>-Mehrweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L <strong>PET</strong>-MW 1,0 L<br />
0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%<br />
Klimawandel -58% -50% -42% -83% -66% -48% 28% 22% 17%<br />
Fossiler Ressourcen-<br />
-57% -29% 2% -124% -60% 13% 8% 3% -3%<br />
verbrauch<br />
Sommersmog (POCP) -202% -132% -54% -357% -215% -60% -22% -27% -33%<br />
Versauerung -44% -22% 1% -91% -47% -2% 30% 28% 25%<br />
Terrestrische Eutrophierung -1% 7% 17% -29% -13% 3% 49% 47%% 45%<br />
Aquatische Eutrophierung 19% 17% 13% 34% 47% 66% 9% 4% -1%<br />
Naturraum: versiegelte Flä-<br />
39% 39% 38% 20% 20% 19% 51% 51% 51%<br />
che<br />
Naturraum: Forstfläche 20% 14% 2% -30% -56% -123% 102% 218% 14537%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>Glas</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche zeigt im Vergleich mit <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche bei allen verwendeten Allokationsfaktoren (0%/ 50%/ 100%) insgesamt Vorteile<br />
gegenüber den Vergleichssystemen (vgl. Tabelle 8-13).<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 97<br />
Tabelle 8-13: Vergleich <strong>der</strong> Nettoergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B Sensitivität Variation <strong>der</strong><br />
Allokationsfaktoren zw. <strong>PET</strong>-Mehrweg <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf sowie <strong>PET</strong>-Einweg<br />
Indikator <strong>PET</strong>-SK 1,0 L <strong>PET</strong>-EW 1,5 L<br />
0% 50% 100% 0% 50% 100%<br />
Klimawandel -103% -83% -65% -135% -103% -73%<br />
Fossiler Ressourcenverbrauch -70% -33% 5% -142% -64% 17%<br />
Sommersmog (POCP) -148% -82% -16% -275% -148% -20%<br />
Versauerung -87% -56% -24% -149% -88% -27%<br />
Terrestrische Eutrophierung -50% -37% -23% -92% -66% -41%<br />
Aquatische Eutrophierung 9% 12% 15% 22% 41% 68%<br />
Naturraum: versiegelte Fläche -9% -9% -10% -26% -27% -27%<br />
Naturraum: Forstfläche -69%% -179% -14285% -162% -398% -32476%<br />
Positive Werte: niedrigere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Negative Werte: höhere Indikatorergebnisse als <strong>PET</strong> Mehrweg<br />
Anmerkung: Darstellung unter Anwendung einer Signifikanzschwelle von 10%<br />
Die Aussage, dass die <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche von allen untersuchten Systemen das ökologisch<br />
günstigste Wirkungsprofil aufzeigt, bestätigt sich auch unter <strong>der</strong> Annahme verschiedener,<br />
konträr zueinan<strong>der</strong> stehen<strong>der</strong> Allokationsfaktoren.<br />
Endbericht Oktober 2008
98 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
8.4 Carbon Footprints <strong>der</strong> untersuchten Verpackungen<br />
Der bereits in den UBA-Ökobilanzen mit sehr großer ökologischer Bedeutung bewertete Indikator<br />
Klimawandel hat durch die in den letzten Jahren verstärkt geführte Klimadebatte weiter<br />
an Gewicht gewonnen. Die Reduktion des Ausstoßes klimarelevanter Gase ist eines <strong>der</strong><br />
großen Ziele <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Umweltpolitik, nicht nur in Deutschland, son<strong>der</strong>n auch auf internationaler<br />
Ebene. Hier hat <strong>der</strong> Begriff Carbon-Footprint Eingang in die Diskussion gef<strong>und</strong>en<br />
Dieser ersetzt keine Ökobilanz son<strong>der</strong>n stellt nur ein Teilergebnis dar. Es handelt sich dabei<br />
um das Indikatorergebnis <strong>der</strong> Wirkungskategorie „Klimaän<strong>der</strong>ung“ o<strong>der</strong> „Klimawandel“ in<br />
CO2- Äquivalenten pro funktionelle Einheit. Da zu den Klima-relevanten Gasen auch solche<br />
gehören, die keinen Kohlenstoff enthalten (N2O, SF6), werden diese anteilig in CO2- Äquivalente<br />
umgerechnet. Die hier gezeigten Carbon Footprints entsprechen nicht <strong>der</strong> ISO-<br />
Nomenklatur für Ökobilanzen <strong>und</strong> können daher nicht im Sinne <strong>der</strong> ISO 14040ff verwendet<br />
werden.<br />
Abbildung 8-1 zeigt die Ergebnisse des Indikators Klimawandel in den drei untersuchten Basisszenarien<br />
sowie <strong>der</strong> Sensitivitätsanalyse hinsichtlich des verwendeten <strong>PET</strong>-Datensatzes.<br />
Bei <strong>der</strong> Betrachtung des Indikators Klimawandel zeigen sich deutliche Vorteile <strong>der</strong> Mehrwegsysteme<br />
gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong> dem <strong>PET</strong>-Einwegsystem in allen Untersuchungsgruppen.<br />
So verursacht die Bereitstellung von 1000 L Getränk im Handel unter<br />
den Annahmen <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe B [mFG] 40% weniger CO2-Äquivalente wenn es<br />
statt in <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-Einwegflasche in 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflaschen verpackt wird. Bei Verwendung<br />
<strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche statt <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche lassen sich sogar über 50<br />
% <strong>der</strong> emittierten CO2-Äquivalente einsparen.<br />
Bei einem Gesamtgetränkeverbrauch von Wasser <strong>und</strong> kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken<br />
von ca. 15 Mrd. Litern pro Jahr ließen sich unter den Annahmen <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
B [mFG] durch Verwendung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche statt <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche<br />
ca. 0,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen, bei Verwendung <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflasche statt <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche sogar annähernd 1,1 Mio. Tonnen CO2-<br />
Äquivalente pro Jahr.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 99<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
UG A [oFG]<br />
81,6<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
84,0<br />
Klimawandel<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
Klimawandel<br />
126<br />
139<br />
60,3<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
68,7<br />
<strong>Glas</strong>-MW <strong>PET</strong>-SK <strong>PET</strong>-EW <strong>PET</strong>-MW<br />
0,7 L 1,0 L 1,5 L 1,0 L<br />
Recycling + Entsorgung<br />
Distribution<br />
Abfüllung<br />
60<br />
Sek./Tert. Verpackung<br />
40 Etiketten <strong>und</strong> Verschlüsse<br />
20 Herstellung Flasche<br />
0 Kunststoff Flasche<br />
-20 <strong>Glas</strong>flasche<br />
GUTSCHRIFT Sek<strong>und</strong>ärmaterial<br />
GUTSCHRIFT Energie<br />
Nettoergebnis<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
Abbildung 8-1: Ergebnisse des Indikators Klimawandel <strong>der</strong> drei Untersuchungsgruppe <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Sensitivität bzgl. des verwendeten <strong>PET</strong>-Datensatzes bezogen auf die<br />
Verpackung <strong>und</strong> Distribution von 1000 L Füllgut.<br />
kg CO 2 Äquivalente pro 1000L Füllgut<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
-50<br />
-100<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
-50<br />
-100<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
0<br />
0<br />
UG A [mFG]<br />
98,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
84,0<br />
<strong>Glas</strong>-MW<br />
0,7 L<br />
Klimawandel<br />
134<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
Klimawandel<br />
118<br />
<strong>PET</strong>-SK<br />
1,0 L<br />
138<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
UG B [mFG] UG B Sens. alt. <strong>PET</strong>-Datensatz<br />
128<br />
<strong>PET</strong>-EW<br />
1,5 L<br />
76,9<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L<br />
65,5<br />
<strong>PET</strong>-MW<br />
1,0 L
100 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
8.5 Einschränkungen<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Basisszenarien <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme <strong>und</strong> <strong>der</strong> darauf<br />
basierenden Systemvergleiche sind nach Auffassung <strong>der</strong> Auftragnehmer innerhalb <strong>der</strong> definierten<br />
Randbedingungen belastbar. Bei Abweichung von diesen Randbedingungen sollten<br />
bei <strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Studie die nachfolgend erläuterten Einschränkungen<br />
berücksichtigt werden.<br />
8.5.1 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> Verpackungsspezifikationen<br />
Die Gestaltung von Verpackungen befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie gelten für die verwendeten Verpackungsspezifikationen <strong>der</strong> betrachteten<br />
MW- <strong>und</strong> SK-Flaschen sowie <strong>PET</strong>-EW-Flasche im Bezugszeitraum 2006/07. Eine<br />
Übertragung auf einzelne <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> abweichende Flaschentypen daher ist nicht ohne weiteres<br />
möglich.<br />
8.5.2 Einschränkungen durch die Auswahl <strong>der</strong> Marktsegmente<br />
Die Auswahl <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme war orientiert an <strong>der</strong>en Marktbedeutung<br />
(siehe Kap. 2). Die Ergebnisse dieser Studie zum Vergleich von <strong>Glas</strong>-MW-Flaschen <strong>und</strong><br />
<strong>PET</strong>-Flaschen gelten nur für die untersuchten Marktsegmente. Eine Übertragung von Ergebnissen<br />
auf an<strong>der</strong>e Füllgüter o<strong>der</strong> Verpackungsgrößen ist aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> komplexen Zusammenhänge<br />
nicht ohne weiteres möglich.<br />
Ebenso gelten die vorliegenden Ergebnisse nur für die Mehrwegsysteme <strong>der</strong> <strong>Genossenschaft</strong><br />
deutscher <strong>Brunnen</strong>. Auf an<strong>der</strong>e Mehrwegsysteme (zum Beispiel Individualgebinde im<br />
untersuchten Füllgutbereich) sind die Ergebnisse nicht übertragbar.<br />
8.5.3 Einschränkungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen<br />
Die Aussagen <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz gelten nur für den betrachteten Bezugszeitraum.<br />
Fragen zum zukünftigen ökobilanziellen Abschneiden <strong>der</strong> untersuchten Verpackungen waren<br />
nicht Gegenstand <strong>der</strong> Studie.<br />
8.5.4 Einschränkungen durch die Wahl <strong>der</strong> Bewertungsmethode<br />
Die in <strong>der</strong> vorliegenden Studie angewandte Indikatorenauswahl erfolgte im Konsens mit den<br />
kritischen Gutachtern. Die durchgeführte Auswertung ist stark an die Vorgehensweise gemäß<br />
<strong>der</strong> vom UBA veröffentlichten Bewertungsmethode für Ökobilanzen [UBA 1999] angelehnt.<br />
Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Anwendung an<strong>der</strong>er Bewertungsansätze<br />
zu einer an<strong>der</strong>en Einschätzung des Systemvergleichs führen könnte.<br />
8.5.5 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> län<strong>der</strong>spezifischen Gültigkeit <strong>der</strong><br />
Ergebnisse<br />
Die Ergebnisse dieser Studie gelten für die Situation in Deutschland. Es ist nicht ohne weiteres<br />
möglich den vorliegenden Bericht zum Vergleich von Verpackungssystemen unter abweichenden<br />
geographischen Rahmenbedingungen zu verwenden.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 101<br />
8.5.6 Einschränkungen hinsichtlich <strong>der</strong> Distributionsdaten<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie finden zwei unterschiedliche Distributionsmodelle Anwendung.<br />
Die Untersuchungsgruppen A (oFG) <strong>und</strong> A (mFG) verwenden ein älteres Distributionsmodell<br />
wie es schon in <strong>der</strong> UBA Ökobilanz aus dem Jahr 2000 verwendet wurde. Für die Untersuchungsgruppe<br />
B Basis (Distributionsmodell 07/08) wird ein für diese Studie neu entwickeltes<br />
Distributionsmodell verwendet, in dem die Mehrwegsysteme deutlich kürzere Transportdistanzen<br />
aufweisen als die <strong>PET</strong>-Einwegflasche, was dazu führt, dass die Mehrwegsysteme<br />
verbesserte Gesamtergebnisse gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche zeigen. Aussagen zu den<br />
Ergebnissen <strong>der</strong> Studie sind damit insofern eingeschränkt, als sie immer nur mit Bezug auf<br />
eine bestimmte definierte Distributionslogistik zulässig sind.<br />
Die Ergebnisse auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> hier angenommenen Distribution sind nicht unmittelbar auf<br />
einzelne Standorte anwendbar, da diese eine spezifische „Standortlogistik“ aufweisen.<br />
8.5.7 Einschränkung hinsichtlich <strong>der</strong> Verwertung gebrauchter Getränkeverpackungen<br />
im Ausland<br />
Die vorliegende Studie berücksichtigt ausschließlich die Verwertung gebrauchter Getränkeverpackungen<br />
innerhalb Deutschlands. Die Umweltauswirkungen, die sich durch den Export<br />
gebrauchter <strong>PET</strong>-Einwegflaschen bspw. nach China <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Verwertung dort ergeben,<br />
bleiben in den Ergebnissen dieser Studie unberücksichtigt. Der Mengenstrom <strong>der</strong> gebrauchten<br />
Getränkeverpackungen verbleibt modellierungstechnisch somit in den Grenzen des geographischen<br />
Bezugs <strong>der</strong> Studie.<br />
8.5.8 Einschränkungen bezüglich <strong>der</strong> verwendeten Daten<br />
Die vorgestellten Ergebnisse gelten unter Verwendung <strong>der</strong> in Kapitel 4 beschriebenen Datensätze.<br />
Sofern für einzelne Prozesse an<strong>der</strong>e Datengr<strong>und</strong>lagen herangezogen werden,<br />
könnte dies Einfluss auf die Vergleichsergebnisse <strong>der</strong> untersuchten Verpackungssysteme<br />
haben.<br />
Im Kontext <strong>der</strong> vorliegenden Studie betrifft dieser Aspekt vor allem die Herstellung von primärem<br />
<strong>PET</strong>-Granulat. Bei Verwendung des Datensatzes <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> Petcore-<br />
Ökobilanz erarbeitet wurde, würde sich das Umweltprofil <strong>der</strong> untersuchten <strong>PET</strong>-Flaschen<br />
gegenüber den hier erarbeiteten Ergebnissen verbessern. So zeigt <strong>der</strong> in dieser Studie verwendete<br />
PlasticsEurope Datensatz beim Treibhauseffekt 20 %, bei Sommersmog 80 % <strong>und</strong><br />
bei Versauerung <strong>und</strong> Terrestrischer Eutrophierung 100 % höhere Werte. Dies hätte entsprechende<br />
Auswirkungen auf die Gesamtergebnisse <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislauf- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>- Einwegsysteme,<br />
da die <strong>PET</strong> Herstellung die größten Beiträge zum Umweltwirkungsprofil <strong>der</strong> <strong>PET</strong><br />
Flasche liefert. Daher sind die Ergebnisse dieser Studie mit Studien, bei denen <strong>der</strong> <strong>PET</strong> Datensatz<br />
von Petcore zur Anwendung kommt nur eingeschränkt vergleichbar.<br />
Während des Bearbeitungszeitraums <strong>der</strong> Studie wurden neue Aluminium-Daten (EAA 2008)<br />
für das Bezugsjahr 2005 veröffentlicht. Diese unterscheiden sich nicht sehr von den früheren,<br />
hier verwendeten Daten, stetige, langsame Verbesserungen kennzeichnen die Entwicklung.<br />
14 Die geringen Verän<strong>der</strong>ungen sind auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> geringen Beiträge aus <strong>der</strong> Alumini-<br />
14<br />
Klöpffer, W.: Critical Review Report. In: Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. Life Cycle Inventory<br />
data for aluminium production and transformation processes in Europe. European Aluminium Association (EAA),<br />
Brussels, April 2008, 12pp<br />
Endbericht Oktober 2008
102 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
umherstellung für die Gesamtergebnisse <strong>der</strong> Wirkkategorien nicht ergebnisrelevant <strong>und</strong> können<br />
daher vernachlässigt werden.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 103<br />
9 Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen<br />
Ziel <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz ist ein Vergleich <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche <strong>der</strong> GDB mit ausgewählten <strong>PET</strong>-Einwegflaschen. Dazu wird weitgehend<br />
auf die Methodik zurückgegriffen, die in den Getränkeökobilanzen des UBA [UBA<br />
2000, UBA 2002] bereits Verwendung fand.<br />
Um einerseits eine Vergleichbarkeit mit älteren Ökobilanzen zu erhalten <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits<br />
neue Entwicklungen im Bereich <strong>der</strong> Distribution zu berücksichtigen werden drei Untersuchungsgruppen<br />
gebildet.<br />
- Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]; durchgeführt unter den Randbedingungen<br />
nach UBA<br />
- Untersuchungsgruppe A [mit Füllgut]; dient zur Vergleichbarkeit mit <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe<br />
B Basis<br />
- Untersuchungsgruppe B Basis; mit Füllgut <strong>und</strong> aktualisiertem Distributionsmodell<br />
2006/07<br />
Eine Einschätzung <strong>der</strong> unterschiedlichen Verpackungstypen bezüglich ihrer Umweltwirkung<br />
in den jeweiligen Untersuchungsgruppen anhand <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> einzelnen Wirkungskategorien<br />
ist nicht ohne weiteres möglich, da kein Verpackungssystem in allen Kategorien<br />
besser o<strong>der</strong> schlechter als konkurrierende Systeme abschneidet.<br />
Als Bewertungshilfe wird daher die Prioritätenbildung <strong>der</strong> Wirkungskategorien gemäß [UBA<br />
2000] herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass diese auch bei Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Normierungsergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Studie insgesamt weiterhin Bestand hat.<br />
Die vergleichende ökologische Bewertung <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche mit <strong>der</strong> 1,5 L <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflasche zeigt Vorteile für die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflache in allen untersuchten Szenarien<br />
einschließlich <strong>der</strong> durchgeführten Sensitivitätsanalysen.<br />
Die vergleichende ökologische Bewertung <strong>der</strong> 0,7 L <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche <strong>der</strong> GDB mit <strong>der</strong><br />
1,0 L <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche ergibt eine Vorteilhaftigkeit <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche in den<br />
Untersuchungsszenarien <strong>der</strong> Untersuchungsgruppen A (mit <strong>und</strong> ohne Füllgut) <strong>und</strong> B. Diese<br />
Aussage gilt mit Bezug auf den <strong>PET</strong> Datensatz <strong>der</strong> europäischen Kunststoffindustrie<br />
(PlasticsEurope) <strong>und</strong> ist daher immer im Kontext des zugr<strong>und</strong>e gelegten <strong>PET</strong> Datensatzes<br />
zu bewerten.<br />
Das ökologisch insgesamt günstigste Verpackungssystem ist die 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche<br />
<strong>der</strong> GDB. Sie zeigt unter allen untersuchten Verpackungssystemen deutlich <strong>und</strong> durchgängig<br />
das ökologische Umweltwirkungsprofil mit den niedrigsten potentiellen Umweltwirkungen.<br />
Der Trend <strong>der</strong> vergangenen Jahre zur <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche – sie hat bezogen auf das im<br />
Rahmen <strong>der</strong> GDB abgefüllte Volumen an Wässern <strong>und</strong> CO2-haltigen Erfrischungsgetränken<br />
mittlerweile nahezu die Bedeutung <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche erreicht – ist aus ökologischer<br />
Sicht als deutlich positiv zu werten <strong>und</strong> sollte daher seitens <strong>der</strong> GDB-Mitgliedsfirmen fortgesetzt<br />
werden.<br />
Die <strong>Glas</strong>-Mehrwegflasche ist <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche ökologisch insgesamt unterlegen, ist<br />
aber als Baustein einer regionalen Vertriebsstrategie einer stark zentralisierten <strong>und</strong> über<br />
Endbericht Oktober 2008
104 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
deutlich längere Distributionskänale verlaufenden Vermarktung von Einwegflaschen überlegen.<br />
Vermarktungskonzepte von Getränken in <strong>Glas</strong>-Mehrwegflaschen sollten weiterhin auf<br />
eine starke Regionaliserung ausgelegt werden.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Ökobilanz sollten auch <strong>der</strong> interessierten Öffentlichkeit zur<br />
Verfügung gestellt werden, wobei auf die Relevanz kurzer Vertriebswege <strong>und</strong> funktionieren<strong>der</strong><br />
Flaschenpools hingewiesen werden sollte.<br />
Die in <strong>der</strong> Studie getroffenen Einschätzungen zur Einweg-Distribution weisen darauf hin,<br />
dass in den vergangenen Jahren mit <strong>der</strong> zunehmenden Verwendung von <strong>PET</strong>-<br />
Einwegflaschen – beson<strong>der</strong>s im Discounthandel – eine Erweiterung <strong>der</strong> Distributionsradien<br />
stattgef<strong>und</strong>en hat. Da die damit verb<strong>und</strong>enen Umweltlasten insgesamt höher sind als die einer<br />
regionalen Mehrwegdistribution sollte auch seitens <strong>der</strong> Politik über Anreizinstrumente zur<br />
Stärkung des regionalen Vertriebs <strong>und</strong> Einkaufs von Wässern <strong>und</strong> karbonisierten Erfrischungsgetränken<br />
nachgedacht werden.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die positive Ökobilanz <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflasche sollte in den politischen Entscheidungsprozessen<br />
eine angemessene Berücksichtigung finden. Sie vereint die Vorteile<br />
<strong>der</strong> Mehrfachnutzung (Umlaufzahl 15) <strong>und</strong> des leichten Gewichts <strong>und</strong> ist unter ökologischen<br />
Gesichtpunkten das vorteilhafteste System.<br />
Der in den durchgeführten Ökobilanzen als Wirkungskategorie betrachtete Klimawandel hat<br />
durch die Klimadebatte <strong>der</strong> vergangenen Jahre in <strong>der</strong> Öffentlichkeit an Gewicht gewonnen.<br />
Die Reduktion des Ausstoßes klimarelevanter Gase ist eines <strong>der</strong> großen Ziele <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen<br />
Umweltpolitik, nicht nur in Deutschland, son<strong>der</strong>n auch auf internationaler Ebene. Der<br />
zunehmende Bezug zu Produkten wird dabei über die Aktivitäten um den „Carbon Footprint“<br />
deutlich. Die Quantifizierung des Carbon Footprints in CO2-Äquivalenten unterscheidet sich<br />
nicht von dem in Ökobilanzen gebräuchlichen „Global Warming Potential (GWP)“.<br />
Bei <strong>der</strong> Betrachtung des Indikators Klimawandel zeigen sich in <strong>der</strong> vorliegenden Studie<br />
durchgängig Vorteile <strong>der</strong> Mehrwegsysteme gegenüber <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche <strong>und</strong><br />
dem <strong>PET</strong>-Einwegsystem. Damit könnte die Verwendung von Mehrwegflaschen unter <strong>der</strong><br />
Voraussetzung ausreichend hoher Umlaufzahlen <strong>und</strong> regionalen Konsums einen nennenswerten<br />
Beitrag zum Klimaschutz leisten.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 105<br />
10 Literaturverzeichnis<br />
[1] VerpackV: Verordnung über die Vermeidung <strong>und</strong> Verwertung von Verpackungsabfällen.<br />
August 1998.<br />
[BGR 2004] B<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe: Reserven, Ressourcen<br />
<strong>und</strong> Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2004 - Kurzstudie. Hannover, 2004.<br />
[DEGUSSA 2005] Buchholz, S.: BioPerspectives 2005, Vortrag auf dem BREW-Symposium,<br />
Wiesbaden Mai 2005.<br />
[DIN EN ISO 14040] International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental<br />
management - Life cycle assessment: Principles and framework. Prinzipien <strong>und</strong> allgemeine<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen. ISO EN 14040 (1997).<br />
[DIN EN ISO 14041] International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental<br />
management - Life cycle assessment: Goal and scope definition and inventory analysis.<br />
Festlegung des Ziels <strong>und</strong> des Untersuchungsrahmens sowie Sachbilanz. ISO EN<br />
14041 (1998).<br />
[DIN EN ISO 14042] International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental<br />
management - Life cycle assessment: Life cycle impact assessment. Wirkungsabschätzung.<br />
ISO EN 14042 (2000).<br />
[DIN EN ISO 14043] International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental<br />
management - Life cycle assessment: Interpretation. Auswertung. ISO EN 14043<br />
(2000).<br />
[DIW 2007]: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW-Wochenberichte, Nr. 8/2007<br />
74. Jahrgang/21. Februar 2007, Berlin<br />
[EAA 2000] European Aluminium Association: Ecological Profile Report for the European<br />
Aluminium Industry. Brussels, 2000.<br />
[EAA 2006] European Aluminium Association: Update of Ecological Profile Report for the<br />
European Aluminium Industry. Brussels, 2006. Bezugsquelle http://www.eaa.net<br />
[Ecoinvent 2003] ecoinvent Centre 2003, ecoinvent data v1.01, Swiss Centre for Life Cycle<br />
Inventories, Dübendorf, 2003. Download unter www.ecoinvent.ch<br />
[EurObserv’ER] http://www.observ-er.org/observ-er/stat_baro/observ/baro164.pdf<br />
[FEFCO 2003] European Database for Corrugated Board Live Cycle Studies. Brüssel, 2003.<br />
[Hartwig 2006] Hartwig, K.: Barrier technologies for <strong>PET</strong> bottles. In: <strong>PET</strong>planet insi<strong>der</strong> Vol. 7,<br />
No. 04/06, S. 20-23.<br />
[GEMIS 1997] Hessisches Ministerium für Wirtschaft <strong>und</strong> Technik (Hrsg.): Fritsche, U. et al.<br />
Gesamtemissionsmodell integrierter Systeme(GEMIS), Version 3.0, Wiesbaden, 1997.<br />
[GEMIS 2001] Fritsche, U. et al.: Gesamt-Emissions-Modell integrierter Systeme, Darmstadt/Kassel,<br />
Version 4.1: http://www.oeko.de/service/gemis/deutsch/index.htm.<br />
Endbericht Oktober 2008
106 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
[HASLER 2004] Hasler, A.: Die Auswirkungen des Ökostromgesetzes auf den heimischen<br />
Biomasserohstoffmarkt. Diplomarbeit an <strong>der</strong> Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich,<br />
2004.<br />
[IFEU 2004a] Detzel, A., Ostermayer, A., Böß, A., Gromke, U. (IFEU): Ökobilanz Getränkekarton<br />
für Saft – Bezugsjahr 2002. Im Auftrag des Fachverband Kartonverpackungen,<br />
Wiesbaden, 2004. Unveröffentlicht.<br />
[IFEU 2004b]: Detzel, A. et al. (IFEU): Ökobilanz <strong>PET</strong>-Einwegverpackungen <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>äre<br />
Verwertungsprodukte. Im Auftrag von <strong>PET</strong>CORE, Brüssel. IFEU-Heidelberg, August<br />
2004.<br />
[INFRAS 2004] INFRAS: „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs Version<br />
2.1“, im Auftrag des Umweltb<strong>und</strong>esamts (UBA), Berlin <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esamts für Umwelt,<br />
Wald <strong>und</strong> Landwirtschaft (BUWAL), Bern, 2004.<br />
[IVV 1999]: Heyde, M. <strong>und</strong> Kremer, M.: Recycling and Recovery of Plastics from Packagings<br />
in Domestic Waste (Appendix 1, S. 5). LCA Documents, ecomed publishers, Landsberg,<br />
1999.<br />
[ISO 14040]: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework<br />
(ISO 14040:2006); German and English version EN ISO 14040:2006<br />
[ISO 14044]: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines<br />
(ISO 14044:2006); German and English version EN ISO 14044:2006<br />
[MAIER 2004] Maier, J.: Biomasse - nie war sie so wertvoll wie heute. In: Forum Umwelt <strong>und</strong><br />
Entwicklung (2004): R<strong>und</strong>brief 4/2004 - Chancen <strong>und</strong> Risiken <strong>der</strong> Bioenergie. Bonn.<br />
38 S.<br />
[Petcycle 2007] Ökobilanzielle Berechnung zur <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche (Sachstand 2007)<br />
Heidelberg, April 2007, Unveröffentlicht<br />
[Petcycle 2008] Ökobilanzielle Optimierungsanalyse zur <strong>PET</strong>-Stoffkreislaufflasche Heidelberg,<br />
April 2008, Unveröffentlicht<br />
[PlasticsEurope 2004]: Für eine nachhaltige Zukunft, Factsheet, PlasticsEurope, Brüssel,<br />
2004. www.plasticseurope.org<br />
[PlasticsEurope 2005a]: Boustead, I.: Eco-profiles of the European Plastics Industry – Polypropylene<br />
(PP), data last calculated March 2005, report prepared for PlasticsEurope,<br />
Brussels, 2005. (Zugriff im August 2005 auf www.lca.plasticseurope.org)<br />
[PlasticsEurope 2005b]: Boustead, I.: Eco-profiles of the European Plastics Industry – Polyethylene<br />
(LDPE), data last calculated March 2005, report prepared for PlasticsEurope,<br />
Brussels, 2005. (Zugriff im August 2005 auf www.lca.plasticseurope.org)<br />
[PlasticsEurope 2005c]: Boustead, I.: Eco-profiles of the European Plastics Industry – Polyethylene<br />
(HDPE), data last calculated March 2005, report prepared for PlasticsEurope,<br />
Brussels, 2005. (Zugriff im August 2005 auf www.lca.plasticseurope.org)<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 107<br />
[PlasticsEurope 2005d]: Boustead, I.: Eco-profiles of the European Plastics Industry –<br />
Polyetylenterephthalat (<strong>PET</strong>), data last calculated March 2005, report prepared for<br />
PlasticsEurope, Brussels, 2005. (download August 2005 von:<br />
http://www.lca.plasticseurope.org/index.htm)<br />
[Schmidt 1998]: Schmidt, M. et al.: Evaluierung gängiger Datenmodelle zur Ermittlung verkehrlicher<br />
Umweltbelastung. In: Umweltinformatik 98. Marburg.<br />
[UBA 1999] Umweltb<strong>und</strong>esamt: Bewertung in Ökobilanzen. UBA-Texte 92/99, Berlin, 1999.<br />
[UBA 2000] Umweltb<strong>und</strong>esamt, Berlin (Hrsg.): Ökobilanz für Getränkeverpackungen II,<br />
Hauptteil. UBA-Texte 37/00, Berlin, 2000.<br />
[UBA 2000a] Umweltb<strong>und</strong>esamt (Hrsg.): Ökobilanzen für graphische Papiere. UBA-Texte<br />
22/00, Berlin, 2000.<br />
[UBA 2000b] Umweltb<strong>und</strong>esamt (Hrsg.): Ökologische Bilanzierung von Altölverwertungswegen.<br />
UBA-Texte 20/00, Berlin, 2000.<br />
[UBA 2001] Umweltb<strong>und</strong>esamt (Hrsg.): Gr<strong>und</strong>lagen für eine ökologisch <strong>und</strong> ökonomisch<br />
sinnvolle Verwertung von Verkaufsverpackungen; Berlin, 2001.<br />
[UBA 2002] Umweltb<strong>und</strong>esamt, Berlin (Hrsg.): Ökobilanz für Getränkeverpackungen II/2.<br />
UBA-Texte 51/02, Berlin, 2002.<br />
[UBA 2008]: Umweltb<strong>und</strong>esamt: Verbrauch von Getränken in Einweg- <strong>und</strong> Mehrweg Verpackungen,<br />
Berichtsjahr 2006; UBA-Texte 15/08; Dessau-Roßlau, 2008<br />
[VDEW 2004] Verband <strong>der</strong> Elektrizitätswirtschaft: Energiepolitik <strong>und</strong> Stromwirtschaft für das<br />
Jahr 2003, Berlin 2004.<br />
Endbericht Oktober 2008
108 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Anhang I. Erläuterung <strong>der</strong> Wirkungskategorien<br />
Die in dieser Studie umfassten Wirkungsindikatoren werden im Folgenden geglie<strong>der</strong>t nach<br />
Wirkungskategorien vorgestellt <strong>und</strong> die entsprechenden Charakterisierungsfaktoren beziffert.<br />
Der jeweilige Ursprung <strong>der</strong> Methode wird referenziert. Die Rechenvorschrift zur Berechnung<br />
des Indikatorergebnisses befindet sich am Ende jedes Unterkapitels <strong>der</strong> einzelnen Wirkungskategorien.<br />
A 1. Klimawandel<br />
Diese, früher auch Treibhauseffekt genannte Wirkungskategorie steht für die negative Umweltwirkung<br />
<strong>der</strong> anthropogen bedingten Erwärmung <strong>der</strong> Erdatmosphäre <strong>und</strong> ist in entsprechenden<br />
Referenzen bereits eingehend beschrieben worden [IPCC 1995, IPCC 2001]. Der<br />
bisher in Ökobilanzen meist angewandte Indikator ist das Strahlungspotential (radiative forcing)<br />
[CML 1992, Klöpffer 1995] <strong>und</strong> wird in CO2-Äquivalenten angegeben. Die Charakterisierungsmethode<br />
gilt als allgemein anerkannt.<br />
Mit dem Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) besteht zudem ein internationales<br />
Fachgremium, das sowohl Methode als auch die entsprechenden Kennzahlen für jede klimawirksame<br />
Substanz errechnet <strong>und</strong> fortschreibt. Die vom IPCC fortgeschriebenen Berichte<br />
sind als wissenschaftliche Gr<strong>und</strong>lage zur Instrumentalisierung des Treibhauseffektes in ihrer<br />
jeweils neuesten Fassung heranzuziehen.<br />
In den stofflich genutzten Pflanzen ist Kohlenstoff aus <strong>der</strong> Atmosphäre geb<strong>und</strong>en, <strong>der</strong> im<br />
Laufe <strong>der</strong> Zeit, sei es bei Verrottung o<strong>der</strong> Verbrennung, wie<strong>der</strong> freigesetzt wird. Diese CO2-<br />
Emissionen werden per Konvention des IPCC nicht dem Treibhauseffekt zugerechnet, da<br />
hierbei genau soviel CO2 freigesetzt wird, wie zuvor <strong>der</strong> Atmosphäre beim Wachstum <strong>der</strong><br />
Pflanze entzogen wurde. Die zeitweilige Bindung von CO2 in <strong>der</strong> Pflanze bzw. dem daraus<br />
produzierten Stoff ist in <strong>der</strong> Regel auf maximal einige Jahrzehnte beschränkt <strong>und</strong> erfor<strong>der</strong>t<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> langen Integrationszeiträume beim Treibhauseffekt keine Berücksichtigung.<br />
Selbstverständlich werden die CO2-Emissionen, die während <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Produktion<br />
etwa beim Maschineneinsatz o<strong>der</strong> für die Produktion von Düngemitteln durch den<br />
Einsatz fossiler Energieträger entstehen, auf den Lebensweg angerechnet.<br />
Bei <strong>der</strong> Berechnung von CO2-Äquivalenten wird die Verweilzeit <strong>der</strong> Gase in <strong>der</strong> Troposphäre<br />
berücksichtigt, daher stellt sich die Frage, welcher Zeitraum <strong>der</strong> Klimamodellrechnung für die<br />
Zwecke <strong>der</strong> Produkt-Ökobilanz verwendet werden soll. Es existieren Modellierungen für 20,<br />
50 <strong>und</strong> 100 Jahre. Die Modellrechnungen für 20 Jahre beruhen auf <strong>der</strong> sichersten Prognosebasis.<br />
Das Umweltb<strong>und</strong>esamt empfiehlt die Modellierung auf <strong>der</strong> 100-Jahresbasis, da sie<br />
am ehesten die langfristigen Auswirkungen des Treibhauseffektes wi<strong>der</strong>spiegelt. Sie wurde<br />
in diesem Projekt verwendet.<br />
Nachfolgend werden die in den Berechnungen des Treibhauspotentials angetroffenen Substanzen<br />
mit ihren CO2-Äquivalenzwerten - ausgedrückt als „Global Warming Potential (GWP)<br />
- aufgelistet:<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 109<br />
Treibhausgas CO2-Äquivalente (GWPi)<br />
Kohlendioxid (CO 2) 1<br />
Methan (CH 4) 25,75<br />
Methan (CH 4), regenerativ 25<br />
Distickstoffmonoxid (N 2O) 298<br />
Tetrachlormethan 1.400<br />
Tetrafluormethan 7.390<br />
Hexafluorethan 12.200<br />
Quelle: [IPCC 2007]<br />
Tabelle A1-1: Treibhauspotential <strong>der</strong> im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Stoffe<br />
Der Beitrag zum Treibhauseffekt wird durch Summenbildung aus dem Produkt <strong>der</strong> emittierten<br />
Mengen <strong>der</strong> einzelnen treibhausrelevanten Schadstoffe (mi) <strong>und</strong> dem jeweiligen GWP<br />
(GWPi) nach folgen<strong>der</strong> Formel berechnet:<br />
GWP = ∑ ( mi× GWPi)<br />
A 2. Photooxidantienbildung (Photosmog o<strong>der</strong> Sommersmog)<br />
i<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> komplexen Reaktionsvorgänge bei <strong>der</strong> Bildung von bodennahem Ozon (Photosmog<br />
o<strong>der</strong> Sommersmog) ist die Modellierung <strong>der</strong> Zusammenhänge zwischen Emissionen<br />
ungesättigter Kohlenwasserstoffe <strong>und</strong> Stickoxiden äußerst schwierig. Die bisher in Wirkungsabschätzungen<br />
verwendeten Ozonbildungspotentiale (Photochemical Ozone Creation<br />
Potential - POCP) [CML 1992], ausgedrückt in Ethenäquivalenten, sind in Fachkreisen umstritten,<br />
da sie zum einen auf <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung bestehen<strong>der</strong> Ozonkonzentrationen aufbauen <strong>und</strong><br />
zum an<strong>der</strong>en für regional weiträumige Ausbreitungsrechnungen entwickelt wurden. Sie basieren<br />
auf dem Ozonbildungspotential <strong>der</strong> Kohlenwasserstoffe <strong>und</strong> blenden den Beitrag <strong>der</strong><br />
Stickoxide an den Bildungsreaktionen vollkommen aus.<br />
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens des UBA [UBA 1998] wurde versucht ein verbessertes<br />
Berechnungsmodell zu entwickeln. Dabei war zunächst beabsichtigt, die relevanten<br />
Bildungsreaktionen für Photooxidantien vor dem Hintergr<strong>und</strong> real existieren<strong>der</strong> Konzentrationen<br />
<strong>und</strong> Mischungsverhältnisse unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Stickoxide für eine solche Modellbildung<br />
heranzuziehen. Die Atmosphäre über einer gegebenen Fläche - z.B. Deutschlands<br />
- wäre als ein Ein-Box-Modell angenommen <strong>und</strong> mit den zusätzlichen ozonbildenden<br />
Agenzien neu berechnet worden. Dieser Ansatz erwies sich jedoch orientiert an <strong>der</strong> schlechten<br />
Datenlage <strong>der</strong> ozonbildenden Substanzen im Rahmen einer Sachbilanz als zu aufwendig<br />
im Vergleich zu seinem möglichen Nutzen.<br />
Um dennoch die Stickoxide in die Modellierung <strong>der</strong> Photooxidantienbildung mit einbeziehen<br />
zu können, wurde von [Stern 1997] eine lineare Berücksichtigung <strong>der</strong> Stickoxide vorgeschlagen.<br />
Dies bedeutet, dass aufbauend auf das POCP-Modell in Ethenäquivalenten jeweils die<br />
pro System emittierten Stickoxide zu dem berechneten POCP-Wert multipliziert werden. Es<br />
ergibt sich daraus ein neuer Indikator – das Nitrogen Corrected Photochemical Ozone Creation<br />
Potential – NCPOCP, das eine lineare Berücksichtigung <strong>der</strong> Stickoxide ermöglicht. Das<br />
Endbericht Oktober 2008
110 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Modell wurde bisher vor allem im deutschen Kontext angewendet <strong>und</strong> es muss noch diskutiert<br />
werden, mit welcher wissenschaftlichen Belastbarkeit <strong>der</strong> gewählte lineare Ansatz die<br />
Wechselwirkung zwischen NOx <strong>und</strong> den in Tabelle A1-2 genannten Schadgasen hinsichtlich<br />
des Ozonbildungspotentials abzubilden vermag.<br />
Nachfolgend sind die Gase mit ihren photochemischen Ozonbildungspotentialen (POCP)<br />
aufgelistet, die im Rahmen dieser Ökobilanz erhoben werden konnten.<br />
Schadgas POCPi<br />
Ethen 1<br />
Methan 0,006<br />
Formaldehyd 0,52<br />
Benzol<br />
Kohlenwasserstoffe<br />
0,22<br />
· NMVOC aus Dieselemissionen<br />
0,7<br />
· NMVOC (Durchschnitt)<br />
1<br />
VOC (Durchschnitt)<br />
0,377<br />
Quellen: [Jenkin+Hayman 1999, Derwent et al. 1998] in [CML Dec 2007]<br />
Tabelle A1-2: Ozonbildungspotential <strong>der</strong> im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Stoffe<br />
Dabei wurden nur Einzelsubstanzen mit einem definierten Äquivalenzwert zu Ethen berücksichtigt.<br />
Für die stofflich nicht präzise spezifizierten Kohlenwasserstoffe, die in Literaturdatensätzen<br />
häufig angegeben werden, wird ein aus CML [1992] entnommener mittlerer Äquivalenzwert<br />
verwendet.<br />
Das POCP wurde nach folgen<strong>der</strong> Formel ermittelt:<br />
POCP = ∑ ( mi<br />
∗ POCPi)<br />
i<br />
A 3. Eutrophierung <strong>und</strong> Sauerstoffzehrung<br />
Die Eutrophierung steht für eine Nährstoffzufuhr im Übermaß, sowohl für Gewässer als auch<br />
für Böden. Da zwei unterschiedliche Umweltmedien auf sehr unterschiedliche Weise betroffen<br />
sind, soll auch eine Unterteilung in Gewässer-Eutrophierung <strong>und</strong> Boden-Eutrophierung<br />
vorgenommen werden. Dabei wird vereinfachend davon ausgegangen, dass alle luftseitig<br />
emittierten Nährstoffe eine Überdüngung des Bodens darstellen <strong>und</strong> alle wasserseitig emittierten<br />
Nährstoffe zur Überdüngung <strong>der</strong> Gewässer. Da <strong>der</strong> Nährstoffeintrag in die Gewässer<br />
über Luftemissionen im Vergleich zum Nährstoffeintrag über Abwässer gering ist, stellt diese<br />
Annahme keinen nennenswerten Fehler dar.<br />
Die Eutrophierung eines Gewässers führt sek<strong>und</strong>är zu einer Sauerstoffzehrung. Ein übermäßiges<br />
Auftreten sauerstoffzehren<strong>der</strong> Prozesse kann zu Sauerstoffmangelsituationen im<br />
Gewässer führen. Ein Maß für die mögliche Belastung des Sauerstoffhaushalts im Gewässer<br />
stellen <strong>der</strong> Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) <strong>und</strong> <strong>der</strong> Chemische Sauerstoffbedarf<br />
16 Der CSB ist (abhängig vom Abbaugrad) höher als <strong>der</strong> BSB5, weshalb <strong>der</strong> Äquivalenzfaktor als relativ unsicher einzu-<br />
schätzen ist <strong>und</strong> tendenziell zu hoch liegt.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 111<br />
(CSB) dar. Da <strong>der</strong> Biochemische Sauerstoffbedarf nur mit Hilfe einer Reaktionszeit definiert<br />
ist <strong>und</strong> <strong>der</strong> Chemische Sauerstoffbedarf quasi das gesamte zur Verfügung stehende Potential<br />
zur Sauerstoffzehrung umfasst, wird <strong>der</strong> CSB als konservative Abschätzung 16 in die Parameterliste<br />
<strong>der</strong> Eutrophierung aufgenommen.<br />
Zur Berechnung <strong>der</strong> unerwünschten Nährstoffzufuhr wird <strong>der</strong> Indikator Eutrophierungspotential<br />
gewählt <strong>und</strong> dieser Indikator in <strong>der</strong> Maßeinheit Phosphatäquivalente [CML 1992,<br />
Klöpffer 1995] angegeben. Nachfolgend sind die im Rahmen dieses Projektes vorkommenden<br />
verschiedenen Schadstoffe bzw. Nährstoffe mit ihrem jeweiligen Charakterisierungsfaktor<br />
aufgeführt:<br />
3—<br />
Schadstoff PO4 Äquivalente (NPi)<br />
Eutrophierungspotential (Boden)<br />
Stickoxide (NO x als NO 2) 0,13<br />
Ammoniak (NH 3) 0,35<br />
Eutrophierungspotential (Wasser)<br />
Gesamtphosphor 3,06<br />
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 0,022<br />
Ammonium (NH 4 + ) 0,327<br />
Nitrat (NO 3 2- ) 0,128<br />
Quelle: [Heijungs et al 1992] in [CML Dez. 2007]<br />
Tabelle A1-3: Eutrophierungspotential <strong>der</strong> im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Stoffe<br />
Für die Nährstoffzufuhr in den Boden <strong>und</strong> in Gewässer getrennt wird <strong>der</strong> Beitrag zum Eutrophierungspotential<br />
durch Summenbildung aus dem Produkt <strong>der</strong> emittierten Menge <strong>der</strong> einzelnen<br />
Schadstoffe <strong>und</strong> dem jeweiligen NP berechnet.<br />
Es gilt für die Eutrophierung des Bodens:<br />
NP = ∑ ( mi× NPi)<br />
Es gilt für die Eutrophierung <strong>der</strong> Gewässer:<br />
A 4. Versauerung<br />
i<br />
NP = ∑ ( mi× NPi)<br />
i<br />
Eine Versauerung kann sowohl bei terrestrischen als auch bei aquatischen Systeme eintreten.<br />
Verantwortlich sind die Emissionen säurebilden<strong>der</strong> Substanzen.<br />
Der in [CML 1992, Klöpffer 1995] beschriebene ausgewählte Wirkungsindikator Säurebildungspotential<br />
wird als adäquat dafür angesehen. Damit sind insbeson<strong>der</strong>e keine spezifischen<br />
Eigenschaften <strong>der</strong> belasteten Land- <strong>und</strong> Gewässersysteme vonnöten. Die Abschätzung<br />
des Säurebildungspotentials erfolgt üblicherweise in <strong>der</strong> Maßeinheit <strong>der</strong> SO2-<br />
Äquivalente. Nachfolgend sind die in dieser Studie erfassten Schadstoffe mit ihren Versauerungspotentialen,<br />
engl. „Acidification Potential (AP)“, in Form von SO2-Äquivalenten aufgelistet:<br />
Endbericht Oktober 2008
112 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Schadstoff SO2-Äquivalente (APi)<br />
Schwefeldioxid (SO 2) 1<br />
Stickoxide (NO x) 0,7<br />
Chlorwasserstoff (HCl) 0,88<br />
Schwefelwasserstoff (H 2S) 1,88<br />
Fluorwasserstoff (HF) 1,6<br />
Ammoniak 1,88<br />
Quelle: [Hauschild <strong>und</strong> Wenzel 1998] in [CML Dez. 2007]<br />
Tabelle A1-4: Versauerungspotential <strong>der</strong> im Rahmen dieses Projekts erhobenen Stoffe<br />
Der Beitrag zum Versauerungspotential wird durch Summenbildung aus dem Produkt <strong>der</strong><br />
emittierten Menge <strong>der</strong> einzelnen Schadstoffe <strong>und</strong> dem jeweiligen AP nach folgen<strong>der</strong> Formel<br />
berechnet:<br />
A 5. Ressourcenbeanspruchung<br />
AP = ∑ ( mi× APi)<br />
i<br />
Der Verbrauch von Ressourcen wird als Beeinträchtigung <strong>der</strong> Lebensgr<strong>und</strong>lagen des Menschen<br />
angesehen. In allen Überlegungen zu einer dauerhaft umweltgerechten Wirtschaftsweise<br />
spielt die Schonung <strong>der</strong> Ressourcen eine wichtige Rolle. Der Begriff Ressourcen wird<br />
dabei manchmal beschränkt auf erschöpfliche mineralische o<strong>der</strong> fossile Ressourcen angewendet<br />
o<strong>der</strong> sehr weit interpretiert, indem z.B. genetische Vielfalt, landwirtschaftliche Flächen,<br />
etc. darin eingeschlossen werden.<br />
Für eine Bewertung <strong>der</strong> Ressourcenbeanspruchung innerhalb <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung<br />
wird üblicherweise die „Knappheit“ <strong>der</strong> Ressource als Kriterium herangezogen. Zur Bestimmung<br />
<strong>der</strong> Knappheit einer Ressource werden, bezogen auf eine bestimmte geographische<br />
Einheit, die Faktoren Verbrauch, eventuelle Neubildung <strong>und</strong> Reserven in Beziehung gesetzt.<br />
Als Ergebnis erhält man einen Verknappungsfaktor, <strong>der</strong> dann mit den in <strong>der</strong> Sachbilanz erhobenen<br />
Ressourcendaten verrechnet <strong>und</strong> in einen Gesamtparameter für die Ressourcenbeanspruchung<br />
aggregiert werden kann.<br />
Trotz einer vermeintlich guten methodischen Zugänglichkeit zu <strong>der</strong> Umweltbelastung "Ressourcenbeanspruchung"<br />
werden zukünftig noch einige gr<strong>und</strong>sätzliche Aspekte zu klären<br />
sein. Dies betrifft insbeson<strong>der</strong>e die sinnvolle Einteilung <strong>der</strong> Ressourcenarten <strong>und</strong> die Definition<br />
von Knappheit. Erst dann sind nachvollziehbare <strong>und</strong> akzeptierte Messvorschriften <strong>und</strong><br />
Bewertungsgr<strong>und</strong>lagen möglich.<br />
Die Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Abgrenzung <strong>der</strong> Ressourcenarten ergeben sich z.B. dadurch,<br />
dass Materialien auch Energieträger sein können <strong>und</strong> umgekehrt, dass biotische Ressourcen<br />
unter Umständen nicht erneuerbar sind, dass Wasser ein erneuerbares Material <strong>und</strong> ein erneuerbarer<br />
Energieträger sein kann, usw. Dazu kommen Probleme aus <strong>der</strong> Sachbilanz: Ist<br />
<strong>der</strong> Anbau einer biotischen Ressource ein Teil des Systems, so ist nicht das biologische Material<br />
ein Input in das System, son<strong>der</strong>n die Fläche, auf <strong>der</strong> es erzeugt wird. Damit ist Fläche<br />
die Ressource, die in <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung <strong>und</strong> Bewertung zu betrachten ist <strong>und</strong> nicht<br />
die biotische Ressource selbst.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wird von drei Ressourcenkategorien ausgegangen:<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 113<br />
• Ressource Energie<br />
• Materialressourcen<br />
• Ressource Naturraum<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> in dieser Studie getroffenen Auswahl an vorrangig betrachteten Wirkungskategorien<br />
werden im Folgenden nur die beiden Ressourcenkategorien Energie <strong>und</strong> Flächennutzung/Naturraumbeanspruchung<br />
erläutert.<br />
A 5.1. Energieressourcen<br />
Verschiedene Energierohstoffe, wie z.B. Erdöl o<strong>der</strong> auch Holz, haben die Eigenschaften,<br />
sowohl stofflich (sog. feedstock) als auch energetisch verwendbar zu sein. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> vielfältigen<br />
Umwandlungsprozesse innerhalb eines Lebenswegs sind dabei die Abgrenzungen<br />
nicht leicht zu setzen.<br />
Diese Eigenschaften <strong>der</strong> Energierohstoffe haben bisher zu dem Vorschlag geführt, die Energieträger<br />
als Material darzustellen. Damit wurde es jedoch schwer, nichtmaterielle Energieträger<br />
wie Windkraft, Wasserkraft, Gezeitenkraft, Photovoltaik, etc. in ein Konzept mit einzubeziehen.<br />
Umgekehrt stellen an<strong>der</strong>e Arbeiten sowohl stofflich als auch energetisch einsetzbare<br />
Materialien durch <strong>der</strong>en Energieinhalt dar. Daraus folgt unweigerlich das Problem, dass<br />
diese Materialien mit nicht-energetischen Materialien nicht in Beziehung gesetzt werden<br />
können. Beispielsweise kann bei einer Substitution von <strong>Glas</strong> durch Kunststoff die eingesetzte<br />
Masse nicht mit <strong>der</strong> Energiemenge verglichen werden. Anstelle des Bezugs auf den Energieinhalt<br />
des Kunststoffes ist eine Rückübersetzung in eine gewichtsbezogene Darstellung erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Energievorräte auf <strong>der</strong> Erde sind - soweit sie einer menschlichen Nutzung zugänglich sind -<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich als endlich anzusehen. Das gilt vor allem für die erschöpflichen Energieträger<br />
wie fossile Brennstoffe aber auch für Uran als Gr<strong>und</strong>material <strong>der</strong> Kernenergienutzung. Daher<br />
sind insbeson<strong>der</strong>e die fossilen Energieträger <strong>und</strong> Uran zur Betrachtung im Rahmen <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung<br />
von Bedeutung. Darüber hinaus ist auch die Information über die Gesamtenergiemenge<br />
17 eines betrachteten Systems wichtig, da sie die gr<strong>und</strong>sätzliche energetische<br />
Effizienz dieses Systems beschreibt, inklusive an<strong>der</strong>er Energieformen wie Sonnenenergie<br />
<strong>und</strong> Erdwärme.<br />
Die Aggregation <strong>der</strong> Ressource Energie erfolgt in dieser Studie auf zwei Arten: Zum einen<br />
wird das Konzept einer primärenergetischen Bewertung des Energieaufwandes umgesetzt,<br />
zum an<strong>der</strong>en eine Bewertung <strong>der</strong> Endlichkeit <strong>der</strong> Primärenergieträger vorgenommen.<br />
Als Kategoriebezeichnung für die primärenergetische Bewertung wird <strong>der</strong> Begriff des KEA<br />
(Kumulierter Energieaufwand) verwendet. Er ist eine Sachbilanzgröße <strong>und</strong> drückt die Summe<br />
<strong>der</strong> Energieinhalte aller bis an die Systemgrenzen zurückverfolgten Primärenergieträger<br />
aus. Unter <strong>der</strong> Bezeichnung KEA fossil werden nur die so bilanzierten fossilen Primärenergieträger<br />
aufsummiert. Als KEA nuklear wird <strong>der</strong> Verbrauch an Uran bilanziert. Die Berechnung<br />
des KEA nuklear erfolgt aus Beaufschlagung des in den Untersuchungssystemen verbrauchten<br />
Atomstroms mit einem Wirkungsgrad von 33 %. Daneben wird auch <strong>der</strong> KEA<br />
Wasserkraft, <strong>der</strong> KEA regenerativ <strong>und</strong> <strong>der</strong> KEA Sonstige sowie <strong>der</strong> aus allen KEA-Werten<br />
17 Der Gesamtenergieverbrauch <strong>der</strong> untersuchten Systeme wird in <strong>der</strong> Sachbilanzgröße KEA als die Summe des Energieinhalts<br />
<strong>der</strong> Primärenergieträger dargestellt <strong>und</strong> als KEA gesamt in dieser Studie berücksichtigt.<br />
Endbericht Oktober 2008
114 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
gebildete KEA-Summenwert in den Sachbilanzergebnissen erfasst. Der KEA Wasserkraft<br />
wird auf <strong>der</strong> Basis eines Wirkungsgrads von 85% ermittelt.<br />
Nach <strong>der</strong> Methode des UBA dient die statische Reichweite <strong>der</strong> Energieträger als Indikator für<br />
die Knappheit fossiler Brennstoffe 18 . Die statische Reichweite wird dabei aus Daten zu den<br />
vorhandenen Weltreserven <strong>und</strong> des aktuellen Verbrauchs <strong>der</strong> jeweiligen Ressource abgeleitet.<br />
Die Knappheiten werden auf Rohöl-Äquivalente (ROE) umgerechnet [UBA 1995]. Die<br />
nachfolgende Tabelle gibt die Umrechnungsfaktoren zur Berechnung <strong>der</strong> Rohöläquivalente<br />
wie<strong>der</strong>.<br />
INPUT Statische<br />
Reichweite<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Energieinhalt<br />
fossil<br />
Rohöl-Äquivalenzfaktor<br />
(ROEi)<br />
Rohstoffe in d. Lagerstätte (RiL) [a] in kJ/kg in kg Rohöl-Äq./kg<br />
Braunkohle 200 8.303 0,0409<br />
Erdgas 60 37.718 0,6205<br />
Rohöl 42 42.622 1<br />
Steinkohle 160 29.809 0,1836<br />
Quelle: [UBA 1995]<br />
Tabelle A1-5: Energieinhalte <strong>und</strong> Rohöläquivalente <strong>der</strong> im Rahmen dieses Projekts erhobenen Stoffe<br />
Es gilt für die Berechnung des Rohöl-Äquivalenzfaktors:<br />
ROE = ∑ ( mi<br />
× ROEi)<br />
i<br />
A 5.2. Flächennutzungen bzw. Naturraumbeanspruchung<br />
Fläche kann im Zusammenhang <strong>der</strong> wirkungsorientierten Bewertung als eine endliche Ressource<br />
verstanden werden. Doch ist es nicht hilfreich, Fläche nur als eine zur freien Verfügung<br />
stehende Menge zu verstehen. Fläche steht in direktem Bezug zu einem ökologisch<br />
bewertbaren Zustand dieser Fläche.<br />
Wird <strong>der</strong> ökologische Bestand einer Fläche berücksichtigt, so sind darunter alle flächenbezogenen<br />
Umweltbelastungen zu verstehen, wie z.B. die Verringerung <strong>der</strong> biologischen Diversität,<br />
Lan<strong>der</strong>osion, Beeinträchtigung <strong>der</strong> Landschaft usw. Es erscheint angebracht, mit dem<br />
Begriff "Naturraum" alle darin enthaltenen natürlichen Zusammenhänge zu verstehen <strong>und</strong> zu<br />
beschreiben – im Gegensatz zum Begriff <strong>der</strong> Fläche.<br />
Zu diesem Zweck wurde im Rahmen <strong>der</strong> UBA Ökobilanz für graphische Papiere [UBA 1998]<br />
eine Methode zur Wirkungsabschätzung weiterentwickelt, die auf <strong>der</strong> Beschreibung des „Natürlichkeitsgrades“<br />
(Hemerobiestufen) von Naturräumen [Klöpffer, Renner 1995] aufbaut <strong>und</strong><br />
zunächst speziell für Waldökosysteme spezifiziert wurde. Entscheiden<strong>der</strong> Punkt <strong>der</strong> Methode<br />
ist die Beschreibung <strong>der</strong> Flächenqualitäten in sieben Qualitätsklassen mit abnehmendem<br />
Natürlichkeitsgrad, wobei alle Landflächen in dieses Qualtitätsraster einordenbar sein müs-<br />
18 Die Verlässlichkeit <strong>der</strong> statischen Reichweite als Knappheitsindikator wird durch die Unsicherheiten zum Stand <strong>der</strong> bekannten<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlich erschließbaren Ressourcenvorräte beeinträchtigt.
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 115<br />
sen. Waldflächen können den ersten fünf Natürlichkeitsklassen zugeordnet werden. Klasse l<br />
entspricht dabei „unberührter Natur“, für die über lange Zeit keinerlei Nutzung erfolgen darf.<br />
Die vier folgenden Klassen gelten <strong>der</strong> forstlichen Nutzung von naturnaher bis naturferner<br />
Waldnutzung. Die Natürlichkeitsklassen lll, lV, V <strong>und</strong> Vl umfassen die landwirtschaftliche<br />
Nutzung <strong>und</strong> überschneiden sich damit in drei Klassen (lll, lV <strong>und</strong> V) mit <strong>der</strong> forstlichen Nutzung.<br />
Die Natürlichkeitsklasse Vll entspricht versiegelten o<strong>der</strong> sehr lange Zeit degradierten<br />
Flächen, wie z.B. Deponien.<br />
Die Methode ist in [UBA 1999] ausführlich beschrieben. Dort wird auch darauf hingewiesen,<br />
dass die Methodenentwicklung <strong>der</strong>zeit noch nicht abgeschlossen ist. Insbeson<strong>der</strong>e fehlt eine<br />
über die Forstnutzung hinausgehende durchgängige Einteilung aller Ökobilanz relevanten<br />
Naturraumnutzungen in die angesprochenen Natürlichkeitsklassen. Dies liegt unter an<strong>der</strong>em<br />
auch daran, dass die verfügbaren Datensätze in aller Regel nicht die benötigten Informationen<br />
mitführen <strong>und</strong> zudem für Naturraumnutzungen außerhalb <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
die Indikatoren zur Klassenbildung erst noch entwickelt werden müssen.<br />
A 7. Quellenverzeichnis<br />
[BUWAL 250]: B<strong>und</strong>esamt für Umwelt, Wald <strong>und</strong> Landschaft: Ökoinventare für Verpackungen;<br />
Schriftenreihe Umwelt 250/II; Bern, 1998<br />
[CML 1992]: Environmental life cycle assessment of products, Guide and backgro<strong>und</strong>s, Center<br />
of Environmental Science (CML), Netherlands Organisation for Applied Scientific<br />
Research (TNO), Fuels and Raw Materials Bureau (B&G), Leiden, 1992<br />
[CML et al. 2002]: Guinée, J.B. (Ed.) - Centre of Environmental Science - Leiden University<br />
(CML), de Bruijn, H., van Duin, R., Huijbregts, M., Lindeijer, E., Roorda, A., van <strong>der</strong><br />
Ven, B., Weidema. B.: Handbook on Life Cycle Assessment. Operational Guide to the<br />
ISO Standards. Eco-Efficiency in Industry and Science Vol. 7. Kluwer Academic Publishers,<br />
Netherlands 2002.<br />
[CML 2007] CML-IA database that contains characterisation factors for life cycle impact assessment<br />
(LCIA) for all baseline characterisation methods mentioned in [CML 2002].<br />
The version that was available at time of calculations of this project: “Last update April<br />
2004”.<br />
[IFEU 1997]: (Description carcinogenic risk)<br />
[IPCC 1995]: IPCC (Publisher): Intergovernmental panel on the climatic change. Climatic<br />
Change, Report to the United Nations 1996, New York (USA) 1995<br />
[IPCC 2001]: IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001: Synthesis Report,<br />
29.09.2001; http://www.ipcc.ch/pub/SYR-text.pdf<br />
[IPCC 2007]: IPCC Fourth Assessment Report – Contribution of Working Group I: Technical<br />
Summary 2007; 31.03.2008<br />
Endbericht Oktober 2008
116 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
[IRIS 2006] Environmental Protection Agency (US-EPA): Environmental and Risk Assessment<br />
Software, Washington D.C., 1996<br />
[Heijungs et al 1992]: Heijungs, R., J. Guinée, G. Huppes, R.M. Lankreijer, H.A. Udo de<br />
Haes, A. Wegener Sleeswijk, A.M.M. Ansems, P.G. Eggels, R. van Duin, H.P. de<br />
Goede, 1992: Environmental Life Cycle Assessment of products. Guide and Backgro<strong>und</strong>s.<br />
Centre of Environmental Sciense (CML), Leiden University, Leiden.<br />
[Heldstab 2003] Heldstab, J. et al.: Modelling of PM10 and PM2.5 ambient concentrations in<br />
Switzerland 2000 and 2010. Environmental Documentation No.169. Swiss Agency for<br />
the Environment, Forests and Landscape SAEFL. Bern, Switzerland, 2003.<br />
[Jenkin + Hayman 1999]: Jenkin, M.E. & G.D. Hayman, 1999: Photochemical ozone creation<br />
potentials for oxygenated volatile organic compo<strong>und</strong>s: sensitivity to variations in kinetic<br />
and mechanistic parameters. Atmospheric Environment 33: 1775-1293.<br />
[Klöpffer 1995]: Methodik <strong>der</strong> Wirkungsbilanz im Rahmen von Produkt-Ökobilanzen unter Berücksichtigung<br />
nicht o<strong>der</strong> nur schwer quantifizierbarer Umwelt-Kategorien, UBA-Texte<br />
23/95, Berlin, 1995<br />
[Leeuw 2002]: Leeuw, F.D.: A set of emission indicators for long-range transbo<strong>und</strong>ary air pollution,<br />
Bilthoven 2002<br />
[Stern 1997]: (NCPOCP method description)<br />
[UBA 1995]: Umweltb<strong>und</strong>esamt (Publisher): Ökobilanz für Getränkeverpackungen. Datengr<strong>und</strong>lagen.<br />
Berlin, 1995. (UBA-Texte 52/95)<br />
[UBA 1998]: Umweltb<strong>und</strong>esamt Berlin (Publisher): Ökobilanz Graphischer Papiere. Berlin,<br />
1998<br />
[UBA 1999] Umweltb<strong>und</strong>esamt: Bewertung in Ökobilanzen. UBA-Texte 92/99, Berlin, 1999.<br />
Endbericht Oktober 2008
IFEU-Heidelberg Ökobilanz GDB 2008 117<br />
Anhang II. Daten zu den Pool-Umlaufzahlen <strong>der</strong> GDB <strong>PET</strong>-<br />
Mehrwegflaschen<br />
Altersverteilung <strong>und</strong> Umlaufzahlen <strong>der</strong> GDB 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen im Marktsegment<br />
Mineralwasser:<br />
20%<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
Altersverteilung <strong>und</strong> Umlaufzahlen <strong>der</strong> GDB 1,0 L <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen im Marktsegment<br />
kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke:<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
Durchschnittliche<br />
Pool-Umlaufzahl: 15<br />
38 35 31 26 20 15 10 5 Umlaufzahl<br />
Durchschnittliche<br />
Pool-Umlaufzahl: 14<br />
42 39 35 31 28 25 21 17 13 9 6 3<br />
Quelle: GDB, Bonn, 2008<br />
Endbericht Oktober 2008<br />
Umlaufzahl
118 Ökobilanz GDB 2008 IFEU-Heidelberg<br />
Anhang III. Schlussbericht zur kritischen Prüfung<br />
Endbericht Oktober 2008
CR Report.doc<br />
Ökobilanz <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen <strong>der</strong><br />
GDB im Vergleich zu <strong>PET</strong>-Einwegflaschen<br />
Schlussbericht<br />
zur kritischen Prüfung<br />
von<br />
Walter Klöpffer<br />
Frankfurt am Main<br />
Hans-Jürgen Garvens<br />
Berlin<br />
<strong>und</strong><br />
Volker Lange<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
an die<br />
<strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong> eG<br />
Oktober 2008<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 1 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
1 Einleitung<br />
Die zu prüfende Ökobilanz (LCA) wurde vom Institut für Energie- <strong>und</strong> Umwelt-.<br />
Forschung Heidelberg (IFEU, "Ersteller") im Rahmen des Projekts<br />
Ökobilanz <strong>der</strong> <strong>Glas</strong>- <strong>und</strong> <strong>PET</strong>-Mehrwegflaschen <strong>der</strong> GDB<br />
im Vergleich zu <strong>PET</strong>-Einwegflaschen<br />
für die <strong>Genossenschaft</strong> <strong>Deutscher</strong> <strong>Brunnen</strong> e.G. („Auftraggeber“) durchgeführt.<br />
Die Ökobilanz wurde in Übereinstimmung mit <strong>der</strong> für das Umweltb<strong>und</strong>esamt Berlin<br />
entwickelten Methodik <strong>der</strong> Ökobilanzierung für Getränkeverpackungen durchgeführt.<br />
Diese bereits für eine Reihe von Ökobilanzen zur Bewertung von<br />
Getränkeverpackungen unter Umweltaspekten eingesetzte Methode [1,2] basiert auf<br />
den internationalen Normen ISO EN 14040 <strong>und</strong> 14044 (2006), die gleichzeitig als<br />
nationale Normen (u.a. DIN) <strong>der</strong> CEN-Mitgliedstaaten gültig sind. Die genannte<br />
Ökobilanz beruft sich auf diese Normen <strong>und</strong> musste daher, da vergleichende<br />
Aussagen getroffen werden, die <strong>der</strong> Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden<br />
sollen, einer kritischen Prüfung unterzogen werden.<br />
Der hier vorliegende Schlussbericht zur kritischen Prüfung ist Bestandteil des<br />
Schlussberichts des Erstellers an den Auftraggeber. Ersteller <strong>und</strong> Auftraggeber<br />
haben nach <strong>der</strong> Norm ISO EN 14040/44 das Recht, schriftliche Kommentare zur<br />
kritischen Prüfung abzugeben, die dann ebenfalls Bestandteil des Berichts sind.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 2 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
2 Veranlassung <strong>und</strong> Ablauf des kritischen Gutachtens<br />
Ökobilanzen nach ISO 14040/44, welche vergleichende Aussagen enthalten, die <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, müssen einem kritischen<br />
Gutachten nach ISO 14040 § 7.3.3 (Panelmethode) unterzogen werden.<br />
Vergleichende Aussagen im Sinne <strong>der</strong> Norm sind von <strong>der</strong> Art: "Produkt A ist unter<br />
Umweltgesichtspunkten vorteilhafter als o<strong>der</strong> gleich gut wie Produkt B".<br />
Im vorliegenden Fall macht die geplante Verwendung <strong>der</strong> Studie im politischen<br />
Entscheidungsprozess in <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland (ggf. auch ohne formelle<br />
Publikation) sehr hohe Qualitätsansprüche in Bezug auf Daten, Methodik,<br />
Auswertung <strong>und</strong> Darstellung <strong>der</strong> Ergebnisse erfor<strong>der</strong>lich. Außerdem werden vom<br />
deutschen Umweltb<strong>und</strong>esamt <strong>und</strong> vom B<strong>und</strong>esministerium für Umwelt, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Reaktorsicherheit in Absprache mit den Industrieverbänden ausschließlich<br />
solche Ökobilanzen anerkannt, die nach den genannten internationalen Normen<br />
durchgeführt <strong>und</strong> kritisch begutachtet wurden. Die nach § 7.3.3 optional vorgesehene<br />
Zuziehung betroffener Kreise in dem begleitenden Panel war in dieser kritischen<br />
Prüfung nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist auf die enge methodische<br />
Anlehnung <strong>der</strong> Studie an "Getränkeverpackungen II/Phase 1 <strong>und</strong> 2" (für UBA) [1,2]<br />
zu verweisen; in diesen Studien waren die betroffenen Kreise in Form eines<br />
begleitenden Gremiums an <strong>der</strong> fachlichen Ausgestaltung <strong>der</strong> Studie beteiligt.<br />
Die Beauftragung zur Durchführung des kritischen Gutachtens auf <strong>der</strong> Basis des<br />
Angebots erfolgte zu einem Zeitpunkt (Frühjahr 2008), als auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage einer<br />
vorläufigen Studie die Hauptphase <strong>der</strong> Projektarbeit begann. Die kritische Prüfung ist<br />
daher als eine begleitende einzustufen. Da die internationale Norm offen lässt, ob<br />
das kritische Gutachten begleitend o<strong>der</strong> a posteriori durchgeführt wird, sind beide<br />
Ausführungsformen in Übereinstimmung mit <strong>der</strong> Norm. Zur Erstellung des<br />
Gutachtens lag ein ausgereifter Entwurf des Schlussberichts vor, nachdem bereits<br />
vorläufige Entwürfe zur Kommentierung vorgelegt worden waren <strong>und</strong> auch ein<br />
gemeinsames Meeting mit Auftraggeber <strong>und</strong> Ersteller (Heidelberg, 14. 05. 2008,<br />
Protokoll) <strong>und</strong> eine Telefonkonferenz stattgef<strong>und</strong>en hatte.<br />
Das vorliegende Gutachten beruht auf Konsens unter den drei Gutachtern. Es wurde<br />
vorab als Entwurf an Auftraggeber <strong>und</strong> Ersteller zur Kommentierung verschickt.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 3 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
3 Normen <strong>und</strong> Prüfkriterien<br />
Der Prüfung wurden die internationalen Normen ISO EN 14040 (2006) <strong>und</strong> 14044<br />
(2006) zu Gr<strong>und</strong>e gelegt. Diese Normen lösten die ältere Serie 14040 (1997), 14041<br />
(1998), 14042 (2000) <strong>und</strong> 14043 (2000) ab, ohne dass es zu gravierenden<br />
inhaltlichen Än<strong>der</strong>ungen gekommen wäre. Geprüft wurde nach den in <strong>der</strong> LCA-<br />
Rahmennorm 14040 vorgegebenen Kriterien, ob<br />
• "die bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Ökobilanz angewendeten Methoden mit dieser<br />
Internationalen Norm übereinstimmen;<br />
• die bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Ökobilanz angewendeten Methoden<br />
wissenschaftlich begründet sind <strong>und</strong> dem Stand <strong>der</strong> Ökobilanz-Technik<br />
entsprechen;<br />
• die verwendeten Daten in Bezug auf das Ziel <strong>der</strong> Studie hinreichend <strong>und</strong><br />
zweckmäßig sind;<br />
• die Auswertungen die erkannten Einschränkungen <strong>und</strong> das Ziel <strong>der</strong><br />
Ökobilanz berücksichtigen;<br />
• <strong>der</strong> Bericht transparent <strong>und</strong> in sich stimmig ist".<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 4 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4 Ergebnisse <strong>der</strong> kritischen Prüfung<br />
4.1 Allgemeiner Eindruck<br />
Die Ökobilanz-Studie macht einen positiven Eindruck auf die Gutachter.<br />
Sie ist auch ein Resultat intensiver Konsultationen während <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong><br />
Studie, die sich auch in kritischen Phasen bewährte. Diese Erfahrung kann auch als<br />
starker Hinweis für die Überlegenheit <strong>der</strong> begleitenden kritischen Prüfung über die<br />
Prüfung a posteriori gewertet werden [3].<br />
Inhaltlich schließt sich die Ökobilanz an die „UBA-Methodik“ an, wobei die Datenlage<br />
wo möglich aktualisiert wurde <strong>und</strong> Än<strong>der</strong>ungen in die Sachbilanz aufgenommen<br />
wurden, die letztlich auf verän<strong>der</strong>tes Käuferverhalten zurückzuführen sind (Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Logistik vor allem auf dem Einwegsektor durch eine starke Verschiebung<br />
zugunsten <strong>der</strong> Discounter). Die Aktualisierung <strong>der</strong> in früheren Jahren erstellten<br />
Ökobilanzen zu Verpackungssystemen von Getränken ist jedoch keineswegs trivial,<br />
da wesentliche methodische Än<strong>der</strong>ungen mit zu berücksichtigen sind, ebenso wie<br />
Aspekte, die aufgr<strong>und</strong> von Marktän<strong>der</strong>ungen aktuell geworden sind. Darüber hinaus<br />
sind Daten von berücksichtigten Teilprozessen anzupassen gewesen.<br />
Die vorliegende Studie enthält deshalb eine mit den Altdaten vergleichbare<br />
Aktualisierung sowie aktuell notwendige Anpassungen, dies aber sinnvoller weise<br />
nicht gleichzeitig.<br />
Einerseits wird ein Teil <strong>der</strong> Ergebnisse entsprechend <strong>der</strong> bisher erstellten<br />
Ökobilanzen dargestellt (Untersuchungsgruppe A [ohne Füllgut]), die somit einen<br />
wenigstens eingeschränkten Vergleich zu früheren Ergebnissen ermöglichen,<br />
an<strong>der</strong>erseits wird die aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> verän<strong>der</strong>ten Marktdaten von <strong>Glas</strong> zu Einweg<br />
notwendige Betrachtung <strong>der</strong> unterschiedlichen, verpackungsspezifischen<br />
Transportentfernungen in einem eigenständigen Teil (Untersuchungsgruppen A [mit<br />
Füllgut] <strong>und</strong> B) <strong>der</strong> vorliegenden Bilanz durchgeführt. Dieser Teil lässt sich aus<br />
methodischen Gründen nicht mit den Bilanzdaten <strong>der</strong> zuvor erstellten Bilanzen<br />
vergleichen, wie aus einem Vergleich von den an sich auf gleichen Daten<br />
beruhenden Szenarien A [ohne Füllgut] <strong>und</strong> A [mit Füllgut] klar hervorgeht.<br />
Die Kritikpunkte <strong>der</strong> Gutachter wurden vom Ersteller vollinhaltlich aufgenommen <strong>und</strong><br />
bei <strong>der</strong> jeweils nächsten Fassung berücksichtigt.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 5 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4.2 Übereinstimmung mit <strong>der</strong> Norm<br />
Es wurde bereits erwähnt, dass die mit dem UBA <strong>und</strong> mit den beteiligten Kreisen<br />
abgestimmte Methodik, die auch bei <strong>der</strong> begutachteten Studie angewendet wurde,<br />
mit den internationalen Normen ISO EN 14040 bis 14043 (jetzt 14040 <strong>und</strong> 14044,<br />
2006) übereinstimmt. Dies wurde bereits in mehreren kritischen Gutachten<br />
festgestellt <strong>und</strong> braucht hier nicht begründet zu werden.<br />
Die Allokation wurde in dieser Studie nicht entsprechend <strong>der</strong> Abbildungen 1-3 bis 1-5<br />
durchgeführt. Diese zeigen einen vereinfachten Ansatz. Die Berechnungen <strong>und</strong><br />
Modelle wurden durch einen <strong>der</strong> Gutachter auch unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Allokationsverfahren geprüft. Keine <strong>der</strong> Allokationen nutzte die Vereinfachungen, die<br />
den Abbildungen 1-3 bis 1-5 zugr<strong>und</strong>e liegen. Die Materialproduktion B wurde in <strong>der</strong><br />
Allokation jeweils unter Berücksichtigung des Allokationsfaktors <strong>und</strong> - soweit sinnvoll<br />
- eines Substitutionsfaktors als Gutschrift verwendet, wie es Stand <strong>der</strong> Technik in<br />
Ökobilanzen ist.<br />
Im Laufe dieser kritischen Prüfung wurde die „Festlegung des Ziels <strong>und</strong> des<br />
Untersuchungsrahmens („Goal & Scope“) wesentlich verän<strong>der</strong>t. Dies ist zwar durch<br />
die internationale Norm gedeckt („iteratives Vorgehen bei <strong>der</strong> Ökobilanz“), führte<br />
aber zu einigen Diskussionen hinsichtlich <strong>der</strong> Tragweite <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> wie<br />
sich diese im Endbericht auswirken. Wesentliche Än<strong>der</strong>ungen in den Ergebnissen<br />
durch die Än<strong>der</strong>ung von Goal & Scope konnten bei einigen Wirkungskategorien (v.a.<br />
bei <strong>der</strong> aquatischen Toxizität) festgestellt werden. Die Gutachter anerkennen jedoch<br />
das übergeordnete Ziel <strong>der</strong> Studie, nämlich die Vergleichbarkeit mit den früheren<br />
UBA-Studien <strong>und</strong> bescheinigen <strong>der</strong> Studie, dass "die bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong><br />
Ökobilanz angewendeten Methoden mit dieser Internationalen Norm<br />
übereinstimmen".<br />
Die zusätzliche Angabe eines in <strong>der</strong> Norm nicht vorgesehenen sog. „Carbon<br />
footprint“ [4] tut diesem Urteil insofern keinen Abbruch, als dies nur eine an<strong>der</strong>e<br />
Bezeichnung für das Global Warming Potential (GWP) darstellt, das in dieser Studie<br />
normgerecht erhoben wurde. Gegen Geist <strong>und</strong> Wortlaut <strong>der</strong> Normen würde es nur<br />
dann verstoßen, wenn diese Größe (wie immer man sie nennen mag) als alleiniges<br />
Resultat <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung zu Vergleichszwecken verwendet würde.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 6 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4.3 Wissenschaftliche Begründung <strong>der</strong> Methodik <strong>und</strong> Stand <strong>der</strong> Technik<br />
Für die vorliegende Studie wurde keine von Gr<strong>und</strong> auf neue Methodik entwickelt,<br />
son<strong>der</strong>n die Methodik <strong>der</strong> "Ökobilanzen Getränkeverpackungen II, Phase 1 <strong>und</strong> 2"<br />
(Prognos, ifeu <strong>und</strong> UBA [1,2]) adaptiert. Eine Aktualisierung dieser Methodik, vor<br />
allem im Bereich <strong>der</strong> Wirkungsabschätzung, wurde aus Gründen <strong>der</strong> Vergleichbarkeit<br />
mit den älteren Studien nicht durchgeführt.<br />
Wir möchten die Gelegenheit nutzen <strong>und</strong> an dieser Stelle dem Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> deutschen „LCA community“ zu empfehlen, eine Aktualisierung <strong>der</strong> Methodik<br />
<strong>der</strong> UBA-Ökobilanzen [1,2] anzugehen. Seitens <strong>der</strong> kritischen Gutachter wird hier<br />
dringen<strong>der</strong> Handlungsbedarf gesehen. Dabei wäre Hilfe von Seiten <strong>der</strong> interessierten<br />
Industriesparten wünschenswert. Internationale Aktivitäten laufen im Rahmen <strong>der</strong><br />
SETAC, <strong>der</strong> UNEP/STEC Life Cycle Initiative <strong>und</strong> in diversen EU-Gremien.<br />
An verschiedenen Stellen des vorliegenden Berichtes werden Än<strong>der</strong>ungen<br />
gegenüber den Methoden <strong>der</strong> vorangegangenen UBA-Ökobilanzen dargestellt. Diese<br />
Än<strong>der</strong>ungen sind aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> kritischen Gutachter unbedingt nötig.<br />
Die UBA-Methode schließt inzwischen den Verwertungsschritt im abschließenden<br />
Lebenszyklus mit in die Allokation ein. UBA hat auf Nachfrage gegenüber den<br />
Autoren <strong>der</strong> Studie bestätigt, das <strong>der</strong> abschließende Beseitigungsschritt<br />
entsprechend dem jeweiligen Allokationsfaktor zu berücksichtigen ist, <strong>und</strong> ebenso,<br />
dass die 50%-Allokation weiterhin Basisszenario aller LCA sein sollte, die sich auf<br />
die UBA-Methode berufen, so wie es in dieser Studie <strong>der</strong> Fall ist.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> übernommenen Methodik <strong>und</strong> vor allem in Bezug auf die Sachbilanz<br />
muss den Autoren eine hervorragende strukturelle Arbeit bescheinigt werden, die wie<br />
auch in vergleichbaren Studien aus diesem Hause, mit Hilfe von Umberto ®<br />
durchgeführt wurde. Diese systemanalytische Seite wurde seitens <strong>der</strong> Gutachter<br />
beson<strong>der</strong>s gründlich geprüft. Ein systemanalytischer Mangel, <strong>der</strong> aber auf dem<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 7 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
Fehlen geeigneter Daten <strong>und</strong> geeigneter Expertenschätzungen beruht, ist das<br />
Weglassen <strong>der</strong> Exporte von Sek<strong>und</strong>ärmaterial (v.a. <strong>PET</strong> bei <strong>der</strong> <strong>PET</strong>-Einwegflasche)<br />
außerhalb Europas, z.B. nach China. Es ist in Abstimmung mit den Gutachtern die<br />
vollständige Verwertung innerhalb Europas modelliert worden, was einerseits<br />
sicherlich nur eingeschränkt stimmt, an<strong>der</strong>erseits die daraus resultierende mögliche<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ergebnisse aber zumindest nicht als ergebnisrelevant eingestuft<br />
wurde.<br />
Im Zusammenhang mit den Sachbilanzdaten in Bezug auf die Transporte ist<br />
festzuhalten, dass es nach wie vor keine aktuelle flächendeckende Erhebung gibt.<br />
Hier wurden mit Sachverstand, <strong>der</strong> auch durch die Zusammensetzung des<br />
Gutachterpanels unterstrichen wurde, die bestmöglichen Ergebnisse bzw.<br />
Schätzungen zu den mittleren Entfernungen eingebracht. Dadurch kann dieser<br />
ergebnisrelevante Teil <strong>der</strong> Daten als bestmögliche Erhebung zum gegebenen<br />
Zeitpunkt angesehen werden.<br />
Die Normalisierung wurde mit Hilfe von Einwohnergleichwerten durchgeführt. Die<br />
Normalisierung von einzelnen Naturraumklassen mit Referenz auf die Gesamtfläche<br />
Europas ist umstritten. Es gibt gute Gründe, die Naturraumklassen nur auf die<br />
jeweilig referenzierte Fläche zu beziehen – Naturraum versiegelte Fläche auf die<br />
gesamte versiegelte Fläche bzw. Naturraum Forst auf die Gesamtfläche Forst.<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> sehr kleinen Beiträge <strong>der</strong> betrachteten Systeme zu den genannten<br />
Werten, auch bei Berücksichtigung <strong>der</strong> spezifischen Referenzen, sind die daraus<br />
abzuleitenden Än<strong>der</strong>ungen für die Interpretation <strong>der</strong> Ergebnisse nicht relevant.<br />
Insgesamt können die bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Studie verwendeten Methoden als<br />
"wissenschaftlich begründet" <strong>und</strong> dem in Deutschland für Getränkeverpackungen<br />
gültigen "Stand <strong>der</strong> Technik entsprechend" eingestuft werden.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 8 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4.4 Daten<br />
Bei den Daten, die neben <strong>der</strong> Methodik für die Qualität <strong>der</strong> Sachbilanz entscheidend<br />
sind, konnte bei dieser Studie auf einen reichen F<strong>und</strong>us von Daten <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
aus den "Ökobilanzen für Getränkeverpackungen" [1,2] zurückgegriffen werden.<br />
Zusätzlich wurden aktualisierte Datensätze für Transport <strong>und</strong> Logistik, sowie für<br />
Energiebereitstellung verwendet (siehe Abschnitt 4.3). Auch an<strong>der</strong>e Datensätze<br />
beruhen auf Neu-Erhebungen durch den Auftraggeber (z.B. zur Umlaufzahl <strong>der</strong><br />
Mehrwegflaschen) <strong>und</strong> ergeben in <strong>der</strong> Summe eine gute Datenbasis für die<br />
Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>daten.<br />
Für die <strong>PET</strong>-Sachbilanzen wurde in den Gr<strong>und</strong>szenarien dieser Studie <strong>der</strong> Plastics<br />
Europe (früher APME) Datensatz [5] verwendet. Dieser weicht erheblich von <strong>der</strong><br />
Neuerhebung im Rahmen <strong>der</strong> Petcore-Studie [6] ab. Um diesen Diskrepanzen<br />
Rechnung zu tragen, wurde <strong>der</strong> Petcore-Datensatz in einer Sensitivitätsanalyse mit<br />
dem Datensatz von Plastics Europe verglichen. Aus den Ergebnissen lassen sich<br />
wesentliche Unterschiede zwischen den verfügbaren, aktuellen Datengr<strong>und</strong>lagen<br />
ableiten. Werden die Wirkungskategorien mit den höchsten Normierungsergebnissen<br />
betrachtet (fossiler Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Versauerung <strong>und</strong><br />
terrestrische Eutrophierung sowie mit etwas geringerem Anteil Sommersmog) dann<br />
werden im Vergleich mit <strong>Glas</strong>-MW in einigen dieser Kategorien signifikante<br />
Ergebnisän<strong>der</strong>ungen deutlich.<br />
Das Gesamtergebnis <strong>der</strong> Studie wird dadurch allerdings nicht in Frage gestellt.<br />
Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass "die verwendeten Daten in<br />
Bezug auf das Ziel <strong>der</strong> Studie hinreichend <strong>und</strong> zweckmäßig sind".<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 9 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4.5 Berücksichtigung <strong>der</strong> Einschränkungen in <strong>der</strong> Auswertung<br />
Die Kapitel 5 <strong>und</strong> 6 zeigen die großen Einflüsse aus getroffenen Annahmen<br />
(Allokation, verwendeter <strong>PET</strong>-Datensatz). Diese Annahmen sind eindeutig<br />
ergebnisrelevant. Während bei <strong>der</strong> Allokation eine eindeutige Vorgabe <strong>der</strong> UBA-<br />
Methodik für Getränkeökobilanzen vorliegt (50/50), kann nicht entschieden werden,<br />
welcher <strong>PET</strong>-Datensatz <strong>der</strong> Realität näher kommt. Der in den Basisszenarien<br />
verwendete Plastics Europe Datensatz [5] besitzt eine höhere Repräsentativität, ist in<br />
großen Bereichen aber nicht hinreichend transparent.<br />
Der Datensatz von Petcore [6] hat eine geringere Repräsentativität, ist dagegen<br />
vollständig transparent <strong>und</strong> durch kritische Gutachter <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Experten<br />
unabhängig geprüft.<br />
Deshalb richtet sich unsere Empfehlung an die Kunststoffindustrie. Diese sei<br />
eingeladen, die Unklarheiten über den <strong>PET</strong>-Datensatz in transparenter Weise durch<br />
die Erstellung eines allgemein anerkannten Profils zu beenden.<br />
Das in <strong>der</strong> Komponente Auswertung bevorzugte Instrument ist die erprobte<br />
Sensitivitätsanalyse, die in dieser Studie in vielfältiger Weise eingesetzt wurde. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> kommt die Beurteilung zu dem Schluss, dass "die Auswertungen die<br />
erkannten Einschränkungen <strong>und</strong> das Ziel <strong>der</strong> Ökobilanz berücksichtigen" <strong>und</strong> damit<br />
<strong>der</strong> Norm entsprechen.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 10 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
4.6 Transparenz<br />
Die von <strong>der</strong> ISO-Norm 14040 vorgegebene Struktur ist im Bericht zu erkennen. Die<br />
ausführlichen Vorschriften von ISO 14044 zur Komponente Auswertung<br />
(einschließlich Berichterstattung) wurden <strong>der</strong> guten Lesbarkeit halber nicht voll<br />
nachvollzogen. Die Darstellung <strong>der</strong> Ergebnisse erfolgte in verständlicher Form <strong>und</strong><br />
bereitete bei <strong>der</strong> Begutachtung keine Schwierigkeiten. Die graphische Darstellung<br />
von Resultaten ist von hoher Qualität. Die in <strong>der</strong> Sachbilanz verwendeten Datensätze<br />
wurden beschrieben <strong>und</strong> ihre Herkunft angegeben, aber nicht abgedruckt. Den<br />
Gutachtern wurde aber Einblick in die Daten gewährt. Damit kann auch die<br />
Transparenz <strong>der</strong> Studie positiv beurteilt werden.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 11 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
5 Fazit<br />
Insgesamt kann festgestellt werden, dass diese Studie nach den internationalen<br />
Normen ISO 14040 <strong>und</strong> 14044 (2006) durchgeführt wurde, <strong>und</strong> daher eine<br />
verlässliche Gr<strong>und</strong>lage für die Beurteilung <strong>der</strong> ökologischen Wirkungen <strong>der</strong><br />
verschiedenen Verpackungssysteme darstellt.<br />
Die angewandten Methoden sind wissenschaftlich begründet <strong>und</strong> entsprechen dem<br />
in Deutschland für Getränkeverpackungen gültigen Stand <strong>der</strong> Technik.<br />
Die verwendeten Daten sind in Bezug auf das Ziel <strong>der</strong> Studie hinreichend <strong>und</strong><br />
zweckmäßig.<br />
Die Auswertungen berücksichtigen die erkannten Einschränkungen <strong>und</strong> das Ziel <strong>der</strong><br />
Ökobilanz <strong>und</strong> entsprechen damit <strong>der</strong> Norm.<br />
Der Bericht ist transparent <strong>und</strong> in sich stimmig.<br />
Dem Auftraggeber sei empfohlen, den Bericht zu veröffentlichen (z.B. auf einer<br />
Webseite) <strong>und</strong> ggf. eine Kurzfassung in einem Fachjournal. Mittelfristig wird<br />
empfohlen, die in dieser Studie erzielten Ergebnisse zum Ausgangspunkt für weitere<br />
Verbesserungen des Systems Getränke-Mehrwegverpackung zu machen. Dazu<br />
besteht unter den deutschen Konsumenten prinzipiell ein positives Klima.<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 12 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
Literatur:<br />
[1] Plinke, E.; Schonert, M.; Meckel, H.; Detzel, A.; Giegrich, J.; Fehrenbach, H.;<br />
Ostermayer, A.; Schorb, A.; Heinisch, J.; Luxenhofer, K.; Schmitz, S.: Ökobilanz für<br />
Getränkeverpackungen II, Zwischenbericht (Phase 1) zum Forschungsvorhaben FKZ<br />
296 92 504 des Umweltb<strong>und</strong>esamtes Berlin – Hauptteil (ISSN 0722-186X): UBA<br />
Texte 37/00, Berlin September 2000<br />
[2] Schonert, M.; Metz, G.; Detzel, A.; Giegrich, J.; Ostermayer, A.; Schorb, A.;<br />
Schmitz, S.: Ökobilanz für Getränkeverpackungen II, Phase 2. Forschungs-bericht<br />
103 50 504 UBA-FB 000363 des Umweltb<strong>und</strong>esamtes Berlin (ISSN 0722-186X):<br />
UBA Texte 51/02, Berlin Oktober 2002<br />
[3] Klöpffer, W.: The Critical Review Process According to ISO 14040-43: An<br />
Analysis of the Standards and Experiences Gained in their Application. Int. J. Life<br />
Cycle Assess. 10 (2) 98-102 (2005)<br />
[4] SETAC Europe LCA Steering Committee: Standardisation Efforts to Measure<br />
Greenhouse Gases and “Carbon Footprinting” for Products. Int J Life Cycle Assess<br />
13 (2) 87-88 (2008)<br />
[5] Boustead, I.: Ecoprofiles of the European Plastics Industry –<br />
Polyethylenterephthalate (<strong>PET</strong>). Report prepared for Plastics Europe, Brussels 2005<br />
[6] Detzel, A. et al. (IFEU): Ökobilanz <strong>PET</strong>-Einwegverpackungen <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>äre<br />
Verwertungsprodukte. Im Auftrag von Petcore, Brüssel 2004<br />
Frankfurt am Main, am 22.10.2008<br />
Prof. Dr. Walter Klöpffer<br />
für den Gutachterkreis<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 13 von 14
Ökobilanz GDB 2008 – Kritische Prüfung<br />
Adressen <strong>der</strong> Gutachter:<br />
Prof. Dr. Walter Klöpffer<br />
Editor-in-chief, Int. Journal of<br />
Life Cycle Assessment<br />
LCA CONSULT & REVIEW<br />
Am Dachsberg 56E<br />
D-60435 Frankfurt/M<br />
Tel.: (+49 (0)69) 54 80 19 35<br />
E-Mail: walter.kloepffer@t-online.de<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Hans-Jürgen Garvens<br />
LCA Consultant and Review<br />
Wolfgang-Heinz-Str. 54<br />
D-13125 Berlin<br />
Tel.: (+49 (0)176) 83 00 31 89<br />
E-Mail: h.garvens@lca-cr.de<br />
Dr. Volker Lange<br />
Ressortleiter Verpackungs- <strong>und</strong><br />
Handelslogistik/ Auto ID <strong>und</strong> RFID- Systeme<br />
Fraunhofer Institut für Materialfluss <strong>und</strong> Logistik (IML)<br />
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4<br />
D-44227 Dortm<strong>und</strong><br />
Tel.: (+49 (0)231) 9 74 32 64<br />
E-Mail: volker.lange@iml.fraunhofer.de<br />
Kritische Prüfung durch Walter Klöpffer, Hans-Jürgen Garvens <strong>und</strong> Volker Lange S. 14 von 14