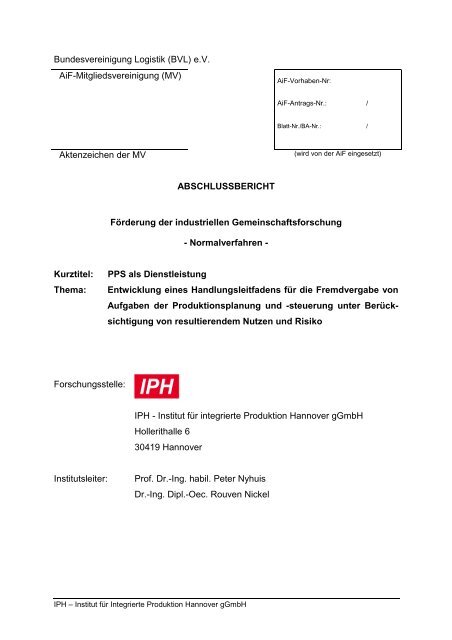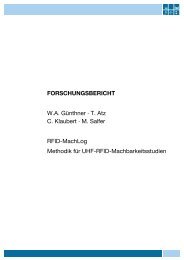Strategie - Die BVL
Strategie - Die BVL
Strategie - Die BVL
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bundesvereinigung Logistik (<strong>BVL</strong>) e.V.<br />
AiF-Mitgliedsvereinigung (MV)<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
AiF-Vorhaben-Nr:<br />
AiF-Antrags-Nr.: /<br />
Blatt-Nr./BA-Nr.: /<br />
Aktenzeichen der MV (wird von der AiF eingesetzt)<br />
ABSCHLUSSBERICHT<br />
Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
Kurztitel: PPS als <strong>Die</strong>nstleistung<br />
- Normalverfahren -<br />
Thema: Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die Fremdvergabe von<br />
Forschungsstelle:<br />
Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung unter Berück-<br />
sichtigung von resultierendem Nutzen und Risiko<br />
IPH - Institut für integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Hollerithalle 6<br />
30419 Hannover<br />
Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Nyhuis<br />
Dr.-Ing. Dipl.-Oec. Rouven Nickel
Inhaltsverzeichnis<br />
Kurzfassung.............................................................................................................. 1<br />
1 Forschungsthema ............................................................................................. 2<br />
2 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung............. 2<br />
2.1 Anlass für den Forschungsantrag................................................................. 2<br />
3 Angestrebte Teilziele......................................................................................... 6<br />
3.1 Forschungsziel ............................................................................................. 6<br />
4 Darstellung der erzielten Ergebnisse .............................................................. 7<br />
4.1 AP 1: Unternehmensanalyse, Erfassung der Anwenderanforderung ........... 7<br />
4.2 AP 2: Konzeption eines Modells zur Identifikation und Beschreibung<br />
relevanter PPS-Aufgaben ................................................................ 12<br />
4.3 AP 3: Entwicklung einer Methode zur Ableitung von<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen ............................................ 19<br />
4.4 AP 4: Erstellung einer Methode zur quantitativen Bewertung des<br />
prognostizierbaren Nutzens ............................................................. 30<br />
4.5 AP 5: Entwicklung einer Methode zur Chancen und Risiken basierten<br />
Bewertung und Auswahl von <strong>Die</strong>nstleistungspaketen...................... 38<br />
4.6 AP 6: Konzeption einer Vorgehensweise und Checkliste zur Bewertung und<br />
Auswahl von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern...................................................... 47<br />
4.7 AP 7: Erstellung von Referenzprozessen für die Zusammenarbeit zwischen<br />
KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleistern ........................................................... 56<br />
4.8 AP 8: Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung des<br />
Handlungsleitfadens......................................................................... 61<br />
5 Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für KMU ..................... 69<br />
5.1 Voraussichtliche Nutzung der angestrebten Forschungsergebnisse.......... 69<br />
5.2 Möglicher Beitrag zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit<br />
der KMU..................................................................................................... 69<br />
6 Umsetzung der Forschungsergebnisse ........................................................ 70<br />
6.1 Innovativer Beitrag der angestrebten Forschungsergebnisse .................... 71<br />
6.2 Projektbegleitender Ausschuss .................................................................. 71<br />
6.3 Diplom- und Studienarbeiten...................................................................... 72<br />
7 Durchzuführende Forschungsstelle .............................................................. 73<br />
Literaturverzeichnis ................................................................................................ IV<br />
Quellenverzeichnis................................................................................................ VIII<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
II
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................... IX<br />
Tabellenverzeichnis ................................................................................................ XI<br />
Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................... XI<br />
Anhang .................................................................................................................... XII<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
III
Kurzfassung<br />
Im Rahmen des Forschungsprojektes „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“ wurde das Ziel, die<br />
Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die Fremdvergabe von Aufgaben der Pro-<br />
duktionsplanung und -steuerung (PPS), erreicht. Kleine und mittelständische Unter-<br />
nehmen (KMU) werden mit Hilfe des Handlungsleitfadens bei der Bewertung und<br />
Entscheidung, ob und welche der Aufgaben ihrer PPS fremd vergeben werden kön-<br />
nen, unterstützt. <strong>Die</strong> entwickelte Methode stellt z. B. durch die Nutzung entwickelter<br />
Checklisten sicher, dass Unternehmen PPS-Aufgaben identifizieren und die dazu<br />
gehörenden Chancen und Risiken einer Fremdvergabe erkennen können.<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister können mit der entwickelten Vorgehensweise zur Fremdvergabe<br />
geeignete PPS-Aufgaben auswählen und bewerten.<br />
Das Forschungsvorhaben wurde von der Bundesvereinigung Logistik (<strong>BVL</strong>) e.V. be-<br />
treut und über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto<br />
von Guericke“ e. V. (AiF) (AiF-Nr. 15556 N/1) aus Mitteln des Bundesministeriums für<br />
Wirtschaft und Technologie (BMWi) für die Projektlaufzeit vom 01.03.2008 bis<br />
31.10.2009 gefördert. <strong>Die</strong> Forschungsstelle bedankt sich für die Förderung und Un-<br />
terstützung.<br />
Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.<br />
Summary<br />
Logistics is a significant key factor for the small and medium-sized production com-<br />
panies to compete. Nowadays small and medium-sized companies have a lack of<br />
experience in terms of outsourcing tasks of their production planning and control sys-<br />
tem. For this purpose companies need assistance to establish a method which sup-<br />
ports the determination of opportunities and threads of outsourcing selected tasks.<br />
Another goal of this method is to develop a partnership with a service lead logistics<br />
provider who is capable of planning, optimizing and controlling the outsourced ser-<br />
vices. The method will be applicable to any level of the production in small and me-<br />
dium-sized companies to identify, evaluate and realize outsourcing potential.<br />
The goal of the research project has been achieved.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
1
1 Forschungsthema<br />
Ziel des Forschungsprojektes „PPS <strong>Die</strong>nstleistung“ war die Entwicklung eines Hand-<br />
lungsleitfadens für die Vergabe von PPS-Aufgaben an <strong>Die</strong>nstleister. Der Handlungs-<br />
leitfaden soll KMU bei der Bewertung und Entscheidung unterstützen, ob und welche<br />
der PPS-Aufgaben fremd vergeben werden können. Hierzu wurde eine Methode<br />
entwickelt, die eine Entscheidung bezüglich der Fremdvergabe von<br />
PPS-Aufgaben anhand zu erwartender Nutzen und Risiken ermöglicht. Darüber hin-<br />
aus wurden Vorgehensweisen zur Bewertung und Auswahl geeigneter<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister sowie zur Realisierung der Fremdvergabe erarbeitet. Das Ziel des<br />
Forschungsprojektes wurde erreicht.<br />
2 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstel-<br />
lung<br />
2.1 Anlass für den Forschungsantrag<br />
Wettbewerbsfähigkeit durch leistungsfähige PPS<br />
<strong>Die</strong> Logistik gilt als Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit von produzierenden<br />
Unternehmen. Zur Erzielung und dauerhafter Sicherung der Wettbewerbsvorteile ist<br />
die ständige Verbesserung von Produktionsprozessen eine Voraussetzung. Hierzu<br />
gehört, Differenzierungsmerkmale schneller auszubauen als Konkurrenten den be-<br />
stehenden Stand aufholen können. Neben technischen und technologischen Innova-<br />
tionen bieten in KMU insbesondere organisatorische und logistische Prozesse signi-<br />
fikante Potenziale für Kosteneinsparungen und somit für eine Stärkung der Wettbe-<br />
werbsfähigkeit [Nyh03].<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Nach Untersuchungen der <strong>BVL</strong> sind die meisten Unternehmen primär mit der Aus-<br />
nutzung der Potenziale im Bereich von Bestands- und Transportkonzepten in Liefer-<br />
ketten beschäftigt [Bvl05]. Durch Veränderungen in der Umschlag- und Transportlo-<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
2
gistik werden die Lieferung von Zukaufteilen und die Distribution von Fertigerzeug-<br />
nissen verbessert. Das Potenzial wird aber in absehbarer Zeit ausgeschöpft sein.<br />
Daher stellt die Produktion zukünftig den Mittelpunkt der Rationalisierungsbemühun-<br />
gen dar. Von allen denkbaren Logistikprojekten wird ebenfalls nach Untersuchungen<br />
der <strong>BVL</strong> der Optimierung der PPS sowie der Verlagerung von<br />
PPS-Aufgaben an <strong>Die</strong>nstleister die am stärksten wachsende Bedeutung durch füh-<br />
rende Wirtschaftsunternehmen beigemessen [Bvl05]. <strong>Die</strong> Wirtschaft hat bereits das<br />
Potenzial zur Fremdvergabe von PPS-Aufgaben erkannt, aber bisher fehlte ein prak-<br />
tikabler Handlungsleitfaden zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforde-<br />
rung.<br />
Zahlreiche Unternehmen sehen aufgrund des tiefgehenden Einblicks des<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleisters in unternehmensinternen Abläufe Risiken in einer Fremdvergabe<br />
von PPS-Aufgaben. Daher ist eine Abwägung von Nutzen und Risiken der Fremd-<br />
vergabe von PPS-Aufgaben erforderlich.<br />
Entwicklung der Fremdvergaben von Logistikdienstleistungen<br />
Eine aktuelle Studie der <strong>BVL</strong> zeigt, dass der Trend zur Vergabe der Logistikleistun-<br />
gen ununterbrochen anhält [Bvl05]. 87 % der befragten Industrieunternehmen geben<br />
an, die logistischen Aufgaben (z. B. Transport, Umschlag) an <strong>Die</strong>nstleister zu über-<br />
geben [Bvl05]. Dabei handelt es sich vorwiegend um sogenannte logistische Primär-<br />
leistungen, die operative Standardaufgaben mit einer geringen Komplexität im Ge-<br />
gensatz zu PPS-Aufgaben darstellen. Abbildung 1 zeigt, dass die Vergabe von<br />
PPS-Aufgaben an <strong>Die</strong>nstleister mit einem Anteil von 3-5 % erst am Anfang einer<br />
Entwicklung steht.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
3
Grad Grad der der Fremdvergabe<br />
Fremdvergabe<br />
Produktionssteuerung<br />
Beschaffungs- und und Lieferantenmanagement<br />
Lieferantenmanagement<br />
Innovationsgenerierung<br />
Netzwerkgestaltung<br />
Bestands- und und Materialdisposition<br />
Materialdisposition<br />
Transport / Umschlag / Lagerung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
0% Anteil der befragten Unternehmen 100%<br />
3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
3<br />
vollständig<br />
vollst ä ndig<br />
5<br />
11<br />
16<br />
18<br />
21<br />
31<br />
teilweise nicht<br />
Abbildung 1: Fremdvergabe von Logistikdienstleistungen durch die Industrie [Bvl05]<br />
PPS-Aufgaben zählen zu den sogenannten logistischen Sekundäraufgaben, die stra-<br />
tegisch-planerische, taktische und informationstechnologische Leistungen beinhal-<br />
ten. Dem <strong>Die</strong>nstleistungsanteil dieser Sekundäraufgaben wird bis zum Jahre 2010<br />
durch die meisten befragten Unternehmen eine positive Entwicklung beigemessen<br />
[Bvl05].<br />
<strong>Die</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsbranche misst dem Aufbau einer eigenen Kompetenz der PPS<br />
eine hohe Bedeutung zu. Unter Einbeziehung der in diesem Gebiet ebenfalls erfor-<br />
derlichen IT-Kompetenz wird nur noch die Weiterbildung der Mitarbeiter höher be-<br />
wertet als die Planungs-, Steuerungs- und IT-Kompetenz. Abbildung 2 zeigt die ent-<br />
sprechenden Ergebnisse der <strong>BVL</strong>-Befragung [Bvl05].<br />
Bedeutung als Erfolgsstrategie für Logistik-<strong>Die</strong>nstleister eher niedrig<br />
Weiterbildung der Mitarbeiter<br />
Aufbau IT-Kompetenz<br />
Aufbau Planungskompetenz<br />
Aufbau Steuerungskompetenz<br />
Aufbau Kooperationen<br />
Erweiterung eigenes Standortnetz<br />
Erweiterung eigene Transportkapazitäten<br />
56<br />
eher hoch sehr hoch<br />
Abbildung 2: Erfolgsstrategien für Logistikdienstleister [Bvl05]<br />
4
Umsetzungsprobleme bei PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Im Rahmen der Umsetzung einer <strong>Die</strong>nstleistungsvergabe werden Unternehmen vor<br />
eine Anzahl zu bewältigender Herausforderungen gestellt. <strong>Die</strong>se betreffen Fragestel-<br />
lungen bezüglich <strong>Die</strong>nstleistungsbeziehungen sowie spezifische Fragestellungen<br />
über die Fremdvergabe von PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen. Grundsätzliche Fragestellungen<br />
werden aufgeworfen, die bei allen Arten von <strong>Die</strong>nstleistungen existieren und betref-<br />
fen u. a. die Produktentwicklung der <strong>Die</strong>nstleistung und den laufenden Betrieb<br />
[Spa05]. Speziell KMU sind kaum vertraut mit der Gestaltung von Ausschreibungsun-<br />
terlagen für <strong>Die</strong>nstleistungen. Beispielsweise fehlen die erforderlichen Prozessbe-<br />
schreibungen und Definitionen der Schnittstellen sowie geeignete Bewertungskrite-<br />
rien und -methoden für die angebotenen <strong>Die</strong>nstleistungspakete. <strong>Die</strong> Fremdvergabe<br />
scheitert „weder an der mangelnden Vergabebereitschaft der Industrie, noch an der<br />
Übernahmebereitschaft der Logistikdienstleister. Entscheidend ist die enge Abstim-<br />
mung und gemeinsame Entwicklung zusätzlicher Leistungspakete“ [Bvl05].<br />
<strong>Die</strong> Probleme verschärfen sich, wenn es speziell um die Vergabe von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen geht, denn eine eindeutige Zuordnung der Verantwortung des<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleisters für die Produktion ist häufig schwierig. Daher sind die Risiken ei-<br />
ner <strong>Die</strong>nsleistungskooperation im Bereich der PPS höher als in anderen abgrenzba-<br />
ren Aufgabenfeldern [Pil04]. Entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich<br />
einer Bewertung von logistischen Veränderungen und deren Auswirkungen in Liefer-<br />
ketten werden erst seit kurzem im Bereich des Risikomanagements erforscht. Sub-<br />
jektiv empfundene Hemmschwellen bei der Abgabe der Steuerungshoheit für den<br />
Produktionsprozess sind nicht zu vernachlässigen, da diese oft als Kernkompetenz<br />
empfunden wird [Bri04].<br />
Zusammenfassung<br />
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ist es sehr wichtig, signifikante Potenziale<br />
für Kosteneinsparungen von PPS-Aufgaben zu erkennen und zu nutzen. Da den<br />
KMU aus Wissens- und Aufwandsgründen eine Beurteilung der Fremdvergabe von<br />
PPS-Aufgaben oft schwer fällt, ist auf diesem Gebiet eine generelle Zurückhaltung<br />
erkennbar. Notwendig erschien KMU eine Hilfestellung in Form eines Handlungsleit-<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
5
fadens zur Verfügung zu stellen, der eine systematische Vorgehensweise zur Identi-<br />
fizierung der Risiken und des möglichen wirtschaftlichen Nutzens bei Fremdvergabe<br />
von PPS-Aufgaben beinhaltet.<br />
3 Angestrebte Teilziele<br />
3.1 Forschungsziel<br />
Das Ziel des Forschungsprojektes war eine aufwandsarme, in KMU nutzbare, ganz-<br />
heitliche Methode zur Unterstützung der Integration von <strong>Die</strong>nstleistern in<br />
PPS-Aufgaben in Form einer Fremdvergabe, damit sich KMU auf ihre Kernkompe-<br />
tenzen konzentrieren und ihre Logistikleistung verbessern können.<br />
Der Handlungsleitfaden ertüchtigt Unternehmen, ihre PPS mit geringem Aufwand<br />
daraufhin zu untersuchen, ob und für welche PPS-Aufgaben das Einbinden eines<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleisters zweckmäßig ist. Wird ein Potenzial zur Fremdvergabe von<br />
PPS-Aufgaben erkannt, gibt der Handlungsleitfaden darüber hinaus eine Hilfestel-<br />
lung bei der Auswahl eines geeigneten PPS-<strong>Die</strong>nstleisters und der Abstimmung der<br />
operativen Zusammenarbeit.<br />
Das Ergebnis ist in produzierenden KMU unabhängig von der Art der vorhandenen<br />
PPS einsetzbar, ohne dass an der zugrunde liegenden Methodik Änderungen vorge-<br />
nommen werden müssen. Als Ergebnis kann der Anwender die Verbesserungspo-<br />
tenziale durch eine Fremdvergabe von PPS-Aufgaben an einen PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
erkennen, bewerten und realisieren unter Berücksichtigung von resultierendem Nut-<br />
zen und Risiko. <strong>Die</strong> Projektergebnisse dienen dazu, eine hohe logistische Prozess-<br />
fähigkeit und Prozesssicherheit in KMU zu gewährleisten.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
6
4 Darstellung der erzielten Ergebnisse<br />
In den folgenden Unterpunkten werden die einzelnen Ergebnisse in Arbeitspaketen<br />
(AP) detailliert vorgestellt.<br />
4.1 AP 1: Unternehmensanalyse, Erfassung der Anwenderanforderung<br />
Das Arbeitspaket eins hatte die Aufgabe, das vorhandene Erfahrungswissen bzgl.<br />
Fremdvergaben von Logistikdienstleistungen und insbesondere bzgl.<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen mit den Unternehmen des PA zu ermitteln, zu analysieren und<br />
zu dokumentieren. Darüber hinaus wurde thematisiert, in welcher Form die Unter-<br />
nehmen und mögliche PPS-<strong>Die</strong>nstleister allgemeine Chancen und Risiken von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen einschätzen.<br />
Dokumentiertes Erfahrungswissen der projektbeteiligten Unternehmen zum<br />
Thema PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen sowie Chancen- und Risikobewertung der KMU<br />
Mithilfe eines strukturierten Fragebogens (siehe Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3) hin-<br />
sichtlich Fremdvergaben von Logistikdienstleistungen und PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen er-<br />
folgte die Dokumentation des vorhandenen Erfahrungswissens der sechs befragten<br />
KMU (siehe Anhang 4, Anhang 5, Anhang 6, Anhang 7, Anhang 8, Anhang 9). Der<br />
Fragebogen wurde in klassische Logistikleistungen (z. B. Verpacken, Transport, La-<br />
gerhaltung) sowie potenzielle PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen (z. B. Produktionsprogrammpla-<br />
nung, Lagerwesen) unterteilt (vgl. Abbildung 3) [Sch09] [Muc98].<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
7
Logistikdienstleistungen<br />
(Tatsäschliche<br />
Fremdvergabe)<br />
PPS-<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
(Bereitschaft zur<br />
Fremdvergabe)<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Verpacken<br />
Transport<br />
Versand von Gütern<br />
Lagerhaltung<br />
Kommissionierung<br />
Umlagerung<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
Eigenfertigungsplanung und<br />
-steuerung<br />
Fremdbezugsplanung und<br />
-steuerung<br />
Auftragskoordination<br />
Lagerwesen<br />
PPS-Controlling<br />
KMU 1<br />
Sehr gut Gut Neutral Eher nicht<br />
Abbildung 3: Bereitschaft von KMU mit der Fremdvergabe von PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
<strong>Die</strong> sechs befragten KMU schätzten ihre Bereitschaft zur Fremdvergabe von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen zum Teil unterschiedlich ein. <strong>Die</strong> Einzelentscheidungen der<br />
KMU wurden basierend der gewählten Wertigkeit sehr gut, gut, neutral, eher nicht zu<br />
einer unterschiedlichen Prioritätenreihenfolge zusammengefasst. Beispielsweise<br />
konnten sich alle sechs befragten KMU eine Fremdvergabe ihres Lagerwesens vor-<br />
stellen, weil dieser Bereich für produzierende KMU selten eine Kernkompetenz dar-<br />
stellt. Dagegen tendierten vier von sechs befragten KMU zu keiner Fremdvergabe<br />
ihrer Produktionsprogrammplanung, weil dies für KMU eine der Kernkompetenzen im<br />
Unternehmen darstellt und KMU viele ihrer internen Informationen (z. B. Stückzahlen<br />
bei der Absatzplanung) preisgeben müssten. <strong>Die</strong> klassischen Logistikleistungen sind<br />
kein primärer Bestandteil des Forschungsprojektes und wurden bei der Prioritäten-<br />
reihenfolge nicht eingehender betrachtet.<br />
Zur Beschreibung von PPS-Aufgaben wurde das Aachener PPS-Modell verwendet,<br />
da die PPS-Aufgaben in Kern- und Querschnittsaufgaben eingeteilt und somit eine<br />
Strukturierung der PPS-Aufgaben ermöglicht werden kann [Sch06]. <strong>Die</strong> Auswertung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
-<br />
+ +<br />
+ +<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
o<br />
o<br />
+ +<br />
+<br />
+ +<br />
o<br />
KMU 2<br />
+ +<br />
+ +<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
+ +<br />
-<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
o<br />
Unternehmen<br />
KMU 3<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
o<br />
o<br />
o<br />
+<br />
+<br />
++<br />
-<br />
KMU 4<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
o<br />
o<br />
-<br />
+ +<br />
+<br />
+ +<br />
o<br />
KMU 5<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
o<br />
-<br />
+ +<br />
-<br />
+ +<br />
o<br />
KMU 6<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
+ +<br />
-<br />
o<br />
-<br />
+ +<br />
+<br />
+ +<br />
o<br />
Prioritätenreihenfolge<br />
6<br />
4<br />
6<br />
2<br />
3<br />
1<br />
5<br />
8
des Fragebogens zur Bereitschaft der KMU bezüglich der Fremdvergabe von<br />
PPS-Aufgaben ist in Abbildung 4 dargestellt.<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
und<br />
-steuerung<br />
Kernaufgaben<br />
Fremdbezugsplanung und -steuerung<br />
Auftragskoordination<br />
Sehr gut Gut Neutral Eher nicht<br />
Abbildung 4: Auswertung des Fragebogens<br />
Lagerwesen<br />
PPS -Controlling<br />
Querschnittsaufgaben<br />
<strong>Die</strong> Bereitschaft zur Fremdvergabe von Kernaufgaben (z. B. Produktionsprogramm-<br />
planung, Eigenfertigungsplanung und -steuerung) ist geringer als bei den Quer-<br />
schnittsaufgaben (z. B. Auftragskoordination, Lagerwesen). Ein möglicher Grund da-<br />
für ist, dass die Erfahrungswerte der befragten KMU im Bereich der Fremdvergabe<br />
von Kernaufgaben minimal sind.<br />
<strong>Die</strong> möglichen Chancen und Risiken der PPS-<strong>Die</strong>nstleister orientieren sich an den<br />
Chancen und Risiken, die bei der Bewertung klassischer Logistikdienstleistungen<br />
herangezogen werden, da für die Fremdvergabe von PPS-Aufgaben keine umfang-<br />
reichen Kenntnisse über spezielle Chancen und Risiken in der Literatur existieren.<br />
<strong>Die</strong> Aufgliederung des Fragebogens im Bereich der klassischen Logistikleistungen<br />
wird in Abbildung 5 veranschaulicht.<br />
9
Logistikdienst-<br />
Leistungen<br />
(Tatsäschliche<br />
Fremdvergabe)<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Transport<br />
Verpacken<br />
Versand von Gütern<br />
Lagerhaltung<br />
Kommissionierung<br />
Umlagerung<br />
KMU 1<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
Abbildung 5: Fremdvergabe Chancen und Risiken im Bereich der Logistikleistung „Transport“<br />
<strong>Die</strong> Auswertung der Fragebögen hat ergeben, dass für den Bereich der klassischen<br />
Logistikleistungen die Chancen gegenüber den Risiken qualitativ höher bewertet<br />
wurden. Ein Grund dafür ist das bereits vorhandene Erfahrungswissen der KMU bei<br />
der Fremdvergabe von klassischen <strong>Die</strong>nstleistungen aus dem Bereich Logistik.<br />
Das Erfahrungswissen der Chancen und Risiken der Logistikdienstleistungen wurden<br />
auf das fehlende Erfahrungswissen der Chancen und Risiken bei der Fremdvergabe<br />
von PPS-Aufgaben (z. B. Produktionsprogrammplanung) übertragen und in<br />
Abbildung 6 zusammengefasst.<br />
ja<br />
ja<br />
KMU 2<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
ja<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
Details<br />
KMU 3<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Details<br />
ja<br />
KMU 4<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
KMU 5<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
Details Chance Risiko<br />
Kostenersparnisse x<br />
Leistungssteigerung x<br />
KMU 6<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Welche Chancen oder Risiken sind<br />
vorhanden?<br />
In den Bereichen: Personalkosten,<br />
Transportmittelkosten (Transporter,<br />
Wartungen, Sprit, Versicherungen…)<br />
In den Bereichen: Termintreue,<br />
Transportkapazität..<br />
Koordinationsaufwand x Geringer Koordinationsaufwand<br />
Potenzielle <strong>Die</strong>nstleister x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Kosten x<br />
Erfolgsaussichten x<br />
Versand<br />
Verpacken<br />
Transport<br />
Mehrere Potenzielle <strong>Die</strong>nstleister am Markt<br />
vorhanden<br />
x Zuverlässigkeit, Preis, Standort, Qualität<br />
Vergabe verursacht Kosten (Entgelt der<br />
Gegenleistung)<br />
<strong>Die</strong> Gegenüberstellung der aus der<br />
Fremdvergabe resultierenden Kosten und<br />
Nutzen liefert einen deutlichen Vorteil im<br />
Bereich Transportleistung und führt zu<br />
Erfolgsaussichten für die Zukunft<br />
Unerwarteter Aufwand Bis Dato nicht vorgekommen<br />
Anmerkungen <strong>Die</strong> Risiken in diesem Bereich sind minimal.<br />
un<br />
Erg<br />
en<br />
ebn<br />
ür<br />
sze<br />
ch<br />
und<br />
Le<br />
gra<br />
erg<br />
Ein en<br />
rkt bn<br />
ise<br />
en<br />
mit<br />
Sze<br />
en<br />
ven<br />
er<br />
und<br />
ten<br />
ten<br />
die<br />
ft<br />
10
PPS-<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
(Bereitschaft zur<br />
Fremdvergabe)<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
und -steuerung<br />
Auftragskoordination<br />
Lagerwesen<br />
PPS-Controlling<br />
Abbildung 6: Chancen und Risiken im Bereich Produktionsprogrammplanung<br />
<strong>Die</strong> Auswertung des Fragebogens bei PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen bzgl. der Chancen und<br />
Risiken bei einer möglichen Fremdvergabe von PPS-Aufgaben hat gezeigt, dass die<br />
KMU die Risiken, im Gegensatz zu den klassischen Logistikleistungen, höher bewer-<br />
ten. <strong>Die</strong> KMU beurteilen beispielsweise die PPS-Aufgaben (z. B. Produktionspro-<br />
grammplanung) mit den PPS-Unteraufgaben (z. B. Absatzplanung, Bestandspla-<br />
nung, Primärbedarfsplanung, Ressourcengrobplanung) als Kernkompetenz mit hoher<br />
strategischer Bedeutung für die Unternehmen.<br />
Zusammenfassung<br />
Insgesamt ist das Erfahrungswissen der befragten sechs KMU im Bereich der<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen geringer als im Bereich der klassischen Logistikleistungen.<br />
KMU sind gegenwärtig vereinzelt in der Lage, Fremdvergabepotenzial der<br />
PPS-Aufgaben zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten. Aufgrund des ge-<br />
ringen Erfahrungswissens des PA bzgl. der Fremdvergabe von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen wurde abweichend von dem Forschungsantrag kein Pflichten-<br />
heft erstellt.<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
Fremdbezugsplanung und<br />
-steuerung<br />
nein<br />
eher ja<br />
eher nein<br />
ja<br />
ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
Details<br />
nein<br />
eher nein<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
eher ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
eher ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
generell ja<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Details<br />
eher nein<br />
eher ja<br />
eher nein<br />
ja<br />
Kostenersparnisse<br />
Leistungssteigerung<br />
Koordinationsaufwand<br />
eher nein<br />
eher ja<br />
eher nein<br />
ja<br />
nein<br />
ja<br />
eher nein<br />
ja<br />
ja<br />
Chance Risiko<br />
Potenzielle <strong>Die</strong>nstleister x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Kosten x<br />
Erfolgsaussichten x<br />
Unerwarteter Aufwand<br />
Anmerkungen<br />
Details<br />
x<br />
x<br />
x<br />
nein<br />
ja<br />
eher nein<br />
ja<br />
nein<br />
Welche Chancen oder Risiken sind<br />
vorhanden?<br />
Es werden kaum Kostenersparnisse erwartet<br />
In den Bereichen: Ressourcengrobplanung<br />
Bestandsplanung<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
generell ja<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
Hoher Koordinationsaufwand<br />
Kaum potenzielle <strong>Die</strong>nstleister am Markt<br />
vorhanden<br />
x Zuverlässigkeit, Preis, Reaktionsfähigkeit<br />
Vergabe und Kontrolle verursachen hohe<br />
Kosten.<br />
Da keine Erfahrungen auf diesem Gebiet<br />
vorliegen, werden die Erfolgsaussichten<br />
eher als schlecht bewertet.<br />
Der Aufwand kann nicht abgeschätzt werden<br />
<strong>Die</strong> Chancen in diesem Bereich sind minimal<br />
un<br />
Erg<br />
en<br />
ebn<br />
ür<br />
sze<br />
ch<br />
und<br />
Le<br />
gra<br />
erg<br />
Ein en<br />
rkt bn<br />
ise<br />
en<br />
mit<br />
Sze<br />
en<br />
ven<br />
er<br />
und<br />
ten<br />
ten<br />
de<br />
ft<br />
11
4.2 AP 2: Konzeption eines Modells zur Identifikation und Beschreibung re-<br />
levanter PPS-Aufgaben<br />
In diesem Arbeitspaket wird ein Modell entwickelt, anhand dessen sich die im Unter-<br />
nehmen etablierten und zukünftig einzuführenden PPS-Aufgaben identifizieren und<br />
beschreiben lassen. Hierzu wurden die durch das Aachener PPS-Modell definierten<br />
PPS-Aufgaben um Unteraufgaben ergänzt (siehe Anhang 10). Durch die Erstellung<br />
von Aufnahmebögen können die KMU ihre unternehmensspezifischen Aufgaben<br />
(z. B. Sonderkonditionen, Zahlungsbedingungen) an das Aachener PPS-Modell an-<br />
passen. <strong>Die</strong> Informationen, basierend aus den Aufnahmebögen, dienen als Daten-<br />
grundlage für die Überführung in die Beschreibungssystematik nach Supply Chain<br />
Operations Reference (SCOR). Ziel der Beschreibungssystematik nach SCOR ist<br />
u. a. die Beschreibung der Prozesse von PPS-Aufgaben und deren<br />
PPS-Unteraufgaben.<br />
Klassifikationen der PPS-Aufgaben<br />
<strong>Die</strong> Klassifikation der PPS-Aufgaben in PPS-Unteraufgaben lässt sich für die Kern-<br />
aufgaben (z. B. Produktionsprogrammplanung, Produktionsbedarfsplanung) mit den<br />
PPS-Unteraufgaben (z. B. Absatzplanung, Bestandsplanung, Bruttosekundärbe-<br />
darfsplanung, Nettosekundärbedarfsplanung) der Abbildung 7 entnehmen.<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
Absatzplanung<br />
Bestandsplanung<br />
Primärbedarfsplanung<br />
Ressourcengrobplanung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
Bruttosekundärbedarfsermittlung<br />
Nettosekundärbedarfsermittlung<br />
Beschaffungsartzuordnung<br />
Abbildung 7: Unteraufgaben des Aachener PPS-Modells [Sch06]<br />
<strong>Die</strong>se Klassifikation stellt die Grundlage für die zu entwickelten Aufnahmebögen dar<br />
und unterstützt KMU, die im Unternehmen anfallenden PPS-Aufgaben (z. B. Absatz-<br />
planung) eindeutig zu erfassen.<br />
...<br />
12
Aufnahmebögen für die PPS-Aufgaben<br />
Für KMU wurden Aufnahmebögen entwickelt, um eine Analysegrundlage zur Identifi-<br />
kation und Beschreibung relevanter PPS-Aufgaben zu schaffen. <strong>Die</strong> entwickelten<br />
Aufnahmebögen (siehe Anhang 11, Anhang 12, Anhang 13, Anhang 14) behandeln<br />
die Kern- und Querschnittsaufgaben der PPS mit den zugehörigen<br />
PPS-Unteraufgaben und werden um die Kategorien „Aufgaben des Unternehmens“<br />
(z. B. Anfrage an Lieferanten), „Betroffene Abteilungen/Personen“ (z. B. Einkauf) und<br />
die Eintragung der „Stammdaten“ und „Bewegungsdaten“ erweitert. Für KMU dient<br />
dies zur Dokumentation der PPS-Aufgaben. In Abbildung 8 ist ein Auszug der Auf-<br />
nahmebögen dargestellt.<br />
Produktionsprogrammplanung Aufgaben Ihres Unternehmens Betroffene Abteilungen/Personen Stammdaten Bewegungsdaten<br />
Absatzplanung X<br />
Bestandsplanung X<br />
Produktionsbedarfsplanung Primärbedarfsplanung<br />
Ressourcengrobplanung<br />
Bruttosekundärbedarfsermittlung<br />
Nettosekundärbedarfsermittlung<br />
Beschaffungsartzuordnung<br />
Fremdbezugsplanung und -steuerung<br />
Durchlaufterminierung<br />
Bestellrechnung<br />
Angebotseinholung/ -bewertung<br />
Aufgaben Ihres Unternehmens Betroffene Abteilungen/Personen Stammdaten Bewegungsdaten<br />
Bestandsmanagement X<br />
Beschaffungsart Einkauf X<br />
X<br />
Verwendungszweck Produktion X<br />
Aufgaben Ihres Unternehmens Betroffene Abteilungen/Personen Stammdaten Bewegungsdaten<br />
Informationsaufbereitung<br />
Anfrage an Lieferanten<br />
Angebotsbewertung<br />
Einkauf<br />
Einkauf<br />
X<br />
X<br />
Sonderkonditionen X<br />
Informationsaufbereitung<br />
Liefervereinbarungen X<br />
Maßnahmenableitung<br />
Zahlungsbedingungen X<br />
...<br />
Lieferantenauswahl<br />
Bestellfreigabe<br />
Bestellüberwachung<br />
Abbildung 8: Aufnahmebögen der PPS-Aufgaben<br />
Zwei Vorgehensweisen zur Identifikation der PPS-Aufgaben sind vorhanden:<br />
1. Der Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Untersuchung auf der untersten Ebene<br />
des hierarchisch gegliederten Unternehmens beginnt.<br />
2. Der Top-Down-Ansatz, bei dem die Untersuchung auf der obersten Ebene des<br />
hierarchisch gegliederten Unternehmens beginnt [Fra04].<br />
Für das vorliegende Forschungsprojekt wurde der Bottom-Up-Ansatz verwendet,<br />
damit nicht zu Beginn der Unternehmensanalyse PPS-Aufgaben für die Fremdverga-<br />
be ausgeschlossen werden. <strong>Die</strong> Untersuchung der PPS-Aufgaben schließt von der<br />
kleinst möglichen Einheit auf die nächst größere. Der Abbildung 9 ist der Bottum-Up-<br />
Ansatz grafisch zu entnehmen.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
13
100%<br />
80%<br />
Eigenleistungsanteil<br />
Prozesstyp<br />
Prozesskategorie<br />
Prozesselement<br />
Kategorie 1 Kategorie 2<br />
Leistungs-/ Geschäftsprozess<br />
….<br />
….<br />
0% 20% <strong>Die</strong>nstleistungstiefe<br />
100%<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Kategorie n<br />
Element 1 Element 2<br />
Element n<br />
Aufgabe 1<br />
Aufgabe n<br />
Abbildung 9: Bottom-Up-Ansatz<br />
Der Bottom-Up-Ansatz als Vorgehensweise zur Beschreibung und Identifikation rele-<br />
vanter PPS-Aufgaben für die Fremdvergabe wurde gewählt, um die zu der PPS-<br />
Aufgabe dazugehörenden PPS-Unteraufgaben nicht voreilig auszuschließen.<br />
Theoretische Grundlagen des SCOR Modells<br />
Das SCOR Modell stellt einen möglichen Ansatz dar, um die Lieferkette einer Orga-<br />
nisation zu definieren [Brp97]. Das SCOR Modell ist hierarchisch aufgebaut und in<br />
vier Level gegliedert. Level eins beschränkt sich auf die Verwendung der fünf Pro-<br />
zesstypen Plan, Source, Make, Deliver und Return sowie der Beschreibung des Um-<br />
fangs der zu betrachteten Lieferkette, der beteiligten Unternehmen sowie der Ver-<br />
knüpfung der Prozesse. Level zwei gliedert die fünf Prozesstypen in Prozesskatego-<br />
rien nach der Auftragsart (z. B. Fertigung auf Lager, Auftragsbezogene Fertigung,<br />
Kundenspezifische Fertigung). <strong>Die</strong> Hauptaufgabe von Level zwei ist die Detaillierung<br />
der Gesamtkonfiguration und die Verknüpfung der Teilprozessketten, um u. a. dop-<br />
pelt wahrgenommene Einkaufsfunktionen zu identifizieren. Level drei verfeinert die<br />
Prozesskategorien durch Prozesselemente. Zu jedem Prozesselement sind Ein- und<br />
Ausgangsinformationen (Inputs, Outputs) angegeben. Immer nur eine Prozesskate-<br />
gorie wird auf diesem Level betrachtet. Level vier stellt die branchen- und unterneh-<br />
mensspezifischen Prozesselemente dar. Unternehmen passen individuell ihre Pro-<br />
zesse an die Unternehmensstruktur an. Jedes der Level des SCOR Modells verfolgt<br />
Bottom-up-Ansatz<br />
14
eine unterschiedliche Zielsetzung, stellt aber eine Detaillierung der vorangegangenen<br />
dar [Knu05].<br />
In Abbildung 10 ist das Levelkonzept des SCOR Modells dargestellt.<br />
Level 1<br />
Level 2<br />
Level 3<br />
Level 4<br />
Prozesstyp<br />
Plan<br />
Source Make Deliver<br />
Return<br />
Return<br />
Prozesskategorie<br />
Prozesstyp Prozesskategorie<br />
Prozesstyp<br />
Prozesselement<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Aufgabe<br />
Aufgabe 1<br />
Aufgabe 2<br />
Aufgabe n<br />
Abbildung 10: Levelkonzept des SCOR Modells, eigene Darstellung in Anlehnung an [Scc03]<br />
<strong>Die</strong> fünf Prozesstypen sind nach Prozesskategorien, Prozesselementen und Aufga-<br />
ben im SCOR Modell strukturiert (vgl. Abbildung 10). <strong>Die</strong>se Struktur wird durch eine<br />
Nomenklatur aus Tabelle 1 unterstützt.<br />
Tabelle 1: Nomenklatur der Beschreibungssystematik [Scc03]<br />
Prozesstyp P (Plan), S (Source), M (Make), D (Deliver), R (Return)<br />
Prozesskategorie Prozesstyp + fortlaufende Nummer , z. B.: M1, ....., Mn<br />
Prozesselement Bildet die Unterklasse zur zugehörigen Prozesskategorie,<br />
z. B.: M1.1<br />
Aufgabe Bildet die Unterklasse zum zugehörigen Prozesselement,<br />
z. B.: M1.1.1<br />
Beschreibungssystematik nach SCOR<br />
Eine Beschreibungssystematik dient im Allgemeinen der planmäßigen Darstellung<br />
von Klassen oder abstrakten Konzepten, die bestimmten Ordnungsprinzipien bzw.<br />
15
Systemen zum Zweck der Informationsweitergabe folgen [Dwd09]. Ein solches Sys-<br />
tem stellt das SCOR Modell dar.<br />
Der Anlass für die Überführung der PPS-Aufgaben in das SCOR Modell ist, dass ei-<br />
ne unternehmensspezifische Erweiterung des SCOR Modells möglich ist. Des Weite-<br />
ren werden Inputs und Outputs sowie interne Schnittstellen und Abhängigkeiten von<br />
PPS-Aufgaben dargestellt. Ein weiterer Vorteil liegt in den vorgegebenen Fertigungs-<br />
strategien (z. B. Fertigung auf Lager, Auftragsbezogene Fertigung) für die Prozess-<br />
kategorien und Prozesselemente. Enabler-Prozesse (Infrastrukturprozesse), die ei-<br />
nen reibungslosen und effizienten Ablauf ermöglichen und unabhängig von den Pro-<br />
zesstypen ausgeführt werden, lassen sich eindeutig darstellen [Knu05].<br />
In Abbildung 11 ist ein Auszug der Beschreibungssystematik nach SCOR am Bei-<br />
spiel der Auftragsbezogenen Fertigung bis zum Level drei mit den zugehörigen In-<br />
puts und Outputs dargestellt.<br />
Level 1<br />
Level 2<br />
Level 3<br />
Source Make<br />
Input<br />
P3.4<br />
Produktionsplan<br />
M2.2,..., M2.6<br />
Informationsweitergabe<br />
EM.5<br />
Betriebsmittel u. Anlagen<br />
Plan<br />
M2.1<br />
Fertigungsplanung<br />
Output<br />
Fertigungsplan<br />
P3.2, S1.1, S2.1, S3.3,<br />
D1.3, D1.8, D4.2<br />
M1<br />
Fertigung<br />
auf Lager<br />
Input<br />
S1.4, S2.4, S3.6<br />
Bestandsplan SOLL<br />
EM.6<br />
Transportinformationen<br />
EM.4<br />
Material Handlingsanweisungen<br />
M2.2<br />
Fertigungsversorgung<br />
Output<br />
Bestandsplan IST<br />
Bestandplan IST<br />
P3.2<br />
P3.2<br />
Prozesskategorien<br />
M2<br />
Auftragsbezogene<br />
Fertigung<br />
M2.3<br />
Fertigung u.<br />
Prüfung<br />
Prozesstyp<br />
Plan<br />
Prozesselemente<br />
P = Plan S = Source M = Make D = Deliver E = Enable<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
M3<br />
Kundenspezifische<br />
Fertigung<br />
Input<br />
P3.4<br />
Produktionsplan<br />
P4.4<br />
Lieferplan<br />
M2.4<br />
Verpacken<br />
der Ware<br />
Output<br />
Informationsrückgabe<br />
Informationsrückgabe<br />
M2.1<br />
M2.1<br />
Deliver<br />
M2.5<br />
Lagerung<br />
der Ware<br />
M2.6<br />
Lieferfreigabe<br />
Output<br />
Informationsrückgabe<br />
M2.1<br />
Produktfreigabe D2.8<br />
Abbildung 11: Beschreibungssystematik nach SCOR am Beispiel der Auftragsbezogenen Fer-<br />
tigung [Scc03]<br />
16
<strong>Die</strong> Nutzung der Beschreibungssystematik ist abhängig von der Fertigungsstrategie<br />
eines Unternehmens. Verfolgt ein Unternehmen eine Auftragsbezogene Fertigung<br />
(vgl. Abbildung 12) bedeutet das, dass die Produkte kundenindividuell nach konkre-<br />
ten Vorgaben und nach Erhalt eines Auftrages gefertigt werden. Damit sind der PPS<br />
die Arbeitspläne zur Fertigung vorgegeben und der Start sowie das Ende des Ferti-<br />
gungsauftrages durch den Kundenauftrag vorgegeben. <strong>Die</strong> Auftragsbezogene Ferti-<br />
gung ist i.d.R. als Einzel- oder Kleinserienfertigung organisiert [Gwl03].<br />
Wird dagegen die Fertigung auf Lager verfolgt, so wird die Ware ohne konkreten Auf-<br />
trag produziert und eingelagert, damit diese bei einer Kundenbestellung sofort ver-<br />
fügbar ist. <strong>Die</strong> mengenmäßige und zeitliche Verteilung der Produktion erfolgt in der<br />
Regel aufgrund von vorgegebenen Bedarfsprognosen [Log09]. Bei der Fertigung auf<br />
Lager sind vorgegebene Arbeitspläne nicht vorhanden, weil auf Prognosen zurück-<br />
gegriffen wird.<br />
Für jede Fertigungsstrategie wurden die PPS-Aufgaben der KMU aus den Aufnah-<br />
mebögen in das Level vier der Beschreibungssystematik nach SCOR übertragen, um<br />
den Einfluss der Prozessaufgaben (z. B. Feinterminplanung) auf die Prozesselemen-<br />
te (z. B. Fertigungsplanung) und die Prozesskategorien (z. B. Auftragsbezogene Fer-<br />
tigung) zu verdeutlichen (vgl. Abbildung 12).<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
17
Level 1<br />
Level 2<br />
Source Make<br />
M1<br />
Fertigung<br />
auf Lager<br />
Prozesskategorien<br />
M2<br />
Auftragsbezogene<br />
Fertigung<br />
Level 3 Prozesselemente<br />
M2.1<br />
M2.2<br />
M2.3<br />
M2.4<br />
Level 4<br />
Fertigungsplanung<br />
Feinterminplanung<br />
Kapazitätsbedarf<br />
Reparatur<br />
Wartung<br />
Fertigungsversorgung<br />
Materialbedarf<br />
Fertigung u.<br />
Prüfung<br />
Prozessaufgaben<br />
Vormontage<br />
P = Plan S = Source M = Make D = Deliver E = Enable<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
M3<br />
Kundenspezifische<br />
Fertigung<br />
Verpacken<br />
der Ware<br />
Verpackungsvorschriften<br />
Personalbedarf Endmontage Material<br />
Nachschub<br />
Handlingsanweisungen<br />
Sichtprüfung<br />
M2.5<br />
Deliver<br />
Lagerung<br />
der Ware<br />
Lagerort<br />
Lagerungsvorschriften<br />
Transport<br />
Abbildung 12: Beispiel: Beschreibungssystematik nach SCOR mit Aufgaben<br />
Zusammenfassung<br />
M2.6<br />
Lieferfreigabe<br />
Fertigungsgrad<br />
Terminplanung<br />
Qualitätskontrolle<br />
<strong>Die</strong> relevanten PPS-Aufgaben für eine mögliche Fremdvergabe eines Unternehmens<br />
wurden in Aufnahmebögen dokumentiert und können um unternehmensspezifische<br />
Aufgaben ergänzt werden. <strong>Die</strong> Abhängigkeiten der Prozesskategorien (z. B. Ferti-<br />
gung auf Lager, Auftragsbezogene Fertigung) können mit den Prozesselementen<br />
(z. B. Fertigungsplanung, Fertigungsversorgung) und Auswirkungen auf unterneh-<br />
mensspezifischen Aufgaben nach SCOR beschrieben werden.<br />
18
4.3 AP 3: Entwicklung einer Methode zur Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungsauf-<br />
gaben und -paketen<br />
Das Arbeitspaket drei beinhaltet die Entwicklung einer Methode zur Ableitung von<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und –paketen. <strong>Die</strong> Methode dient den KMU als Hilfsmittel,<br />
um die anfallenden PPS-Aufgaben im Unternehmen zu <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
-paketen zusammenzufassen.<br />
Definitionen<br />
<strong>Die</strong> sechs Begrifflichkeiten (<strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe, <strong>Die</strong>nstleistungspaket, <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungstiefe, Kriterien, Gruppierungskriterien und Kriterienkatalog) wurden für die ein-<br />
deutige Zuordnung wie folgt definiert:<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe ist eine Aufgabe aus dem Unternehmensablauf, die sich zur<br />
Fremdvergabe eignet.<br />
<strong>Die</strong>nstleitungspaket umfasst mehrere <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und ist der überge-<br />
ordnete Begriff für <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe.<br />
<strong>Die</strong>nstleistungstiefe beschreibt den prozentualen Anteil der Aufgaben, die das Unter-<br />
nehmen selbst übernimmt [Hal05]. Der Abbildung 9 ist eine grafische Darstellung der<br />
spezifischen Unternehmensaufgaben in Anlehnung an die Beschreibungssystematik<br />
nach SCOR zu entnehmen: ein prozentualer Anteil der <strong>Die</strong>nstleistungstiefe von 20%<br />
lässt den Rückschluss zu, dass der Eigenfertigungsanteil des Unternehmens bei<br />
80% liegt. Zudem ist die Beziehung zwischen <strong>Die</strong>nstleistungstiefe und Eigenferti-<br />
gungsanteil des Unternehmens abgebildet.<br />
Kriterien sind im Allgemeinen unterscheidende Merkmale bzw. Kennzeichen, die zur<br />
Entscheidungsfindung über eine Fremdvergabe dienen. Ein Kriterium kann ein<br />
Merkmal eines Material- oder Informationsflusses eines Unternehmens sein [Arn08]<br />
[Fwd90].<br />
Gruppierungskriterien sind untergeordnete Merkmale von Kriterien, die Aufschluss<br />
über die Eignung bzw. Nichteignung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
-paketen geben.<br />
In einem Kriterienkatalog werden die wichtigsten Kriterien, die der Material- und In-<br />
formationsfluss mit sich bringt, zusammengefasst.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
19
Vorgehensweise zur Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen<br />
Für die Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und –paketen wurde folgendes Vor-<br />
gehen entwickelt:<br />
� Übertrag der Unternehmensaufgaben in die Beschreibungssystematik nach<br />
SCOR<br />
� Ermittlung von Kriterien zur Fremdvergabe<br />
� Bestimmung von Gruppierungskriterien<br />
� Auswahl eines Startkriteriums zur Analyse<br />
� Untersuchung der Analyseergebnisse und Bildung von potenziellen <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungsaufgaben und -paketen<br />
Folgende zwei Übertragungsvarianten der PPS-Aufgaben, PPS-Unteraufgaben und<br />
unternehmensspezifische Aufgaben in das SCOR-Modell stehen zur Auswahl:<br />
1. Auswahl von unternehmensspezifischen Aufgaben, die aus den erstellten<br />
Aufnahmebögen stammen (z. B. Anfrage an Lieferanten). Hierbei werden dem<br />
Unternehmen die PPS-Aufgaben im Level vier der Beschreibungssystematik<br />
nach SCOR vollständig vorgegeben. Das Unternehmen kann entscheiden,<br />
welche unternehmensspezifischen Aufgaben der Aufnahmebögen im eigenen<br />
Unternehmen anwendbar sind. <strong>Die</strong>se Vorgehensweise eignet sich besonders<br />
für mittlere und große Unternehmen, weil ein geringer Aufwand verbunden ist,<br />
der Ablauf standardisiert wird und sich so Fehler (z. B. Übersehen von PPS-<br />
Aufgaben) reduzieren lassen. Zudem ergibt sich bei großen Unternehmen ein<br />
Zeitvorteil, da sie eine Vielzahl an unternehmensspezifischen Aufgaben be-<br />
wältigen müssen. Ein Nachteil kann dadurch entstehen, dass die unterneh-<br />
mensspezifischen Aufgaben nicht in dem notwendigen Detaillierungsgrad be-<br />
trachtet werden können.<br />
2. Selbsteintragen der PPS-Aufgaben in das SCOR Modell. Das Unternehmen<br />
bekommt bis zum Level drei des SCOR Modells eine „Vorgabe“. In das Level<br />
vier des SCOR Modells werden die unternehmensspezifischen Aufgaben<br />
selbständig eingetragen. <strong>Die</strong>se Variante eignet sich u. a. für KMU mit einer<br />
begrenzten Anzahl an unternehmensspezifischen Aufgaben bzw. Prozessen.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
20
<strong>Die</strong> sich aus dieser Methode ergebenen Vorteile sind die vollständige Analyse<br />
der eigenen Unternehmensstruktur sowie die unternehmensspezifische An-<br />
passungsfähigkeit. Nachteile, die entstehen können, sind der hohe Analyse-<br />
aufwand, fehlende Standardisierung der Prozesse und Fehler durch Nichtauf-<br />
nahme von unternehmensspezifischen Aufgaben.<br />
Ermittlung von Kriterien zur Fremdvergabe<br />
Um <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete ableiten zu können, wird das Unternehmen<br />
in Materialfluss, Informationsfluss, Zeit und Wertefluss gegliedert. <strong>Die</strong>s bildet die so-<br />
genannte Flussaufteilung des Unternehmens. Den Flussbereichen werden im Fol-<br />
genden relevante Kriterien zugeordnet. Aus dem Bereich Materialfluss ergeben sich<br />
die Hauptkriterien „Schnittstelle“ und „Komplexität“. Aus dem Bereich Informations-<br />
fluss wird der „Datentyp“ betrachtet sowie der komplette Zeitfluss aus dem Bereich<br />
„Zeit“. Der Wertefluss wird bei der Erstellung der Methode zur quantitativen Bewer-<br />
tung des prognostizierbaren Nutzens in Arbeitspaket vier betrachtet.<br />
Nach der Übertragung der Unternehmensaufgaben in die Beschreibungssystematik<br />
nach SCOR werden die vier Kriterien „Zeit“, „Schnittstelle“, „Komplexität“ und „Daten-<br />
typ“ aus der Unternehmensstruktur ermittelt, anhand derer im weiteren Verlauf<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete gebildet werden können.<br />
<strong>Die</strong> Abbildung 13 zeigt eine grafische Darstellung der Flussaufteilung des Unterneh-<br />
mens mit den Hauptkriterien.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
21
Materialfluss<br />
Schnittstelle z.B.: intern, extern, …<br />
Zeit<br />
Zeit<br />
Zeit<br />
Zeit<br />
Zeit<br />
Zeit<br />
z.B.:<br />
Einordnung in den<br />
Einordnung in den<br />
Unternehmensablauf<br />
Unternehmensablauf<br />
Informationsfluss<br />
z.B.:<br />
- Qualifikation der Mitarbeiter<br />
- Anzahl der Mitarbeiter<br />
- …<br />
z.B.:<br />
Komplexität<br />
Eintrittshäufigkeit der<br />
Eintrittshäufigkeit der<br />
Aufgabe<br />
Aufgabe<br />
Datentyp<br />
- Stammdaten<br />
- Bewegungsdaten<br />
- IT Infrastruktur<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Zeit Schnittstellen<br />
Zeit Schnittstellen<br />
Zeitbedarf Zeit der Aufgabe Schnittstelle<br />
Interne Schnittstellen<br />
Zeitbedarf der Aufgabe Interne Schnittstellen<br />
Zeitbedarf Einordnung der Aufgabe in den Interne Abhängigkeiten Schnittstellen von<br />
Einordnung Unternehmensablauf in den Abhängigkeiten Aufgaben / Abteilungen von<br />
Einordnung Unternehmensablauf in den Abhängigkeiten Aufgaben / Abteilungen von<br />
Eintrittshäufigkeit<br />
Unternehmensablauf<br />
Eintrittshäufigkeit<br />
Aufgaben Externe / Abteilungen Schnittstellen<br />
der Aufgabe<br />
Externe Schnittstellen<br />
Eintrittshäufigkeit der Aufgabe<br />
Externe Schnittstellen<br />
der Aufgabe …<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
Komplexität<br />
Komplexität<br />
Komplexität Qualifikation der<br />
Qualifikation Mitarbeiter der<br />
Qualifikation Mitarbeiter der<br />
Anzahl Mitarbeiter der Mitarbeiter<br />
…<br />
Datentypen<br />
Datentypen<br />
Datentyp Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
Bewegungsdaten<br />
Anzahl der Mitarbeiter Bewegungsdaten<br />
Anzahl Anzahl der Mitarbeiter der abhängigen Bewegungsdaten<br />
Anzahl der<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Anzahl der Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben …<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
Abbildung 13: Unternehmensstruktur nach Materialfluss, Informationsfluss und Zeit mit zuge-<br />
hörigen Kriterien<br />
<strong>Die</strong> Zuordnung von Kriterien soll Aufschluss geben, ob Ähnlichkeiten zwischen PPS-<br />
Aufgaben bestehen, die aussagekräftig genug sind, um <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zu<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaketen zusammenzufassen. Der Kriterienkatalog besteht aus<br />
Hauptkriterien (z. B. Zeit, Schnittstelle) und Unterkriterien (z. B. Zeitbedarf der Auf-<br />
gabe, interne/externe Schnittstelle). <strong>Die</strong> Abbildung 14 zeigt Auszüge des Kriterienka-<br />
taloges nach „Zeit“, „Schnittstelle“, „Komplexität“ und „Datentyp“.<br />
Zeit Schnittstellen<br />
Zeit Schnittstellen<br />
Zeit Schnittstelle<br />
Zeitbedarf der Aufgabe Interne Schnittstellen<br />
Zeitbedarf der Aufgabe Interne Schnittstellen<br />
Zeitbedarf Einordnung der Aufgabe in den Interne Abhängigkeiten Schnittstellen von<br />
Einordnung Unternehmensablauf in den Abhängigkeiten Aufgaben / Abteilungen von<br />
Einordnung Unternehmensablauf in den Abhängigkeiten Aufgaben / Abteilungen von<br />
Eintrittshäufigkeit<br />
Unternehmensablauf<br />
Eintrittshäufigkeit<br />
Aufgaben Externe / Abteilungen Schnittstellen<br />
der Aufgabe<br />
Externe Schnittstellen<br />
Eintrittshäufigkeit der Aufgabe<br />
Externe Schnittstellen<br />
der Aufgabe …<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
Komplexität<br />
Komplexität<br />
Komplexität Qualifikation der<br />
Datentypen<br />
Datentypen<br />
Datentyp<br />
Qualifikation Mitarbeiter der<br />
Qualifikation Mitarbeiter der<br />
Mitarbeiter Anzahl der Mitarbeiter<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
Bewegungsdaten<br />
Anzahl der Mitarbeiter Bewegungsdaten<br />
Anzahl Anzahl der Mitarbeiter der abhängigen Bewegungsdaten<br />
Anzahl der<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Anzahl der Aufgaben abhängigen<br />
IT Infrastruktur<br />
Aufgaben …<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
Kriterienkatalog<br />
Abbildung 14: Kriterienkatalog nach Zeit, Schnittstelle, Komplexität und Datentyp<br />
22
<strong>Die</strong> vier Hauptkriterien können in weitere Unterkriterien aufgegliedert werden, wie im<br />
Folgenden dargestellt:<br />
� Zeit<br />
� Zeitbedarf der PPS-Aufgabe<br />
Ist die Durchführungszeit bezogen auf einen bestimmten Zeithorizont<br />
� Einordnung in den Unternehmensablauf<br />
Bezieht sich auf die zeitliche Einordnung der PPS-Aufgabe in das Un-<br />
ternehmen (z. B. nach oder vor welchem Prozesselement sich die<br />
PPS-Aufgabe befindet) und die Struktur ist durch das SCOR Modell<br />
vorgegeben<br />
� Eintrittshäufigkeit der PPS-Aufgabe<br />
Beschreibt wie oft und wie regelmäßig eine PPS-Aufgabe ausgeführt<br />
wird<br />
� Schnittstelle<br />
� Komplexität<br />
� Interne Schnittstelle<br />
Ist der interne Teil des Unternehmens, in dem der Übergang von ei-<br />
ner Kommunikationsebene in eine andere erfolgt (z. B. Abteilungen)<br />
und die Struktur ist durch das SCOR Modell vorgegeben (Inputs, Out-<br />
puts) [Haa06]<br />
� Abhängigkeit von PPS-Aufgaben<br />
<strong>Die</strong> abhängigen Schnittstellen beschreiben den Zusammenhang zwi-<br />
schen den PPS-Aufgaben im Unternehmen und die Struktur ist durch<br />
das SCOR Modell vorgegeben (Inputs, Outputs)<br />
� Externe Schnittstelle<br />
Ist der externe Teil des Unternehmens, in dem der Übergang von ei-<br />
ner Kommunikationsebene in eine andere erfolgt (z. B. zum Lieferan-<br />
ten) [Haa06]<br />
� Qualifikation der Mitarbeiter<br />
Ist das Anforderungsprofil der PPS-Aufgabe<br />
� Anzahl der Mitarbeiter<br />
Ist die physikalische Zahl der Mitarbeiter<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
23
� Datentyp<br />
� Anzahl der abhängigen PPS-Aufgaben<br />
Ist die physikalische Zahl der abhängigen PPS-Aufgaben<br />
� Stammdaten<br />
Sind Daten mit einer zeitlich unbegrenzten Lebensdauer [Sch06]<br />
� Bewegungsdaten<br />
Sind Daten mit einer zeitlich begrenzten Lebensdauer [Sch06]<br />
� IT Infrastruktur<br />
Bildet die Grundlage des technischen Informationsaustausches (z. B.<br />
Soft- und Hardware)<br />
Bestimmung von Gruppierungskriterien<br />
Um Aufschluss über die Bildung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen zu ge-<br />
ben, müssen sogenannte Gruppierungskriterien aus dem allgemeinen Kriterienkata-<br />
log gefiltert werden, die der Tabelle 2 zu entnehmen sind.<br />
Einordnung in den Unternehmensablauf<br />
Eintrittshäufigkeit der Aufgabe<br />
Interne Schnittstellen<br />
Abhängigkeiten von Aufgaben<br />
Externe Schnittstellen<br />
Qualifikation der Mitarbeiter<br />
Stammdaten<br />
IT Infrastruktur<br />
Zeitbedarf der Aufgabe<br />
Anzahl der Mitarbeiter<br />
Anzahl der abhängigen Aufgaben<br />
Bewegungsdaten<br />
Tabelle 2: Auswahl von Gruppierungskriterien<br />
Für die Gruppierung geeignet<br />
Für die Gruppierung ungeeignet<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Grund für eine mögliche<br />
Zusammenfassung<br />
Aufgaben aus gleichen Elementen oder Kategorien des<br />
Unternehmensablaufes<br />
Aufgaben die eine gleiche Durchführungshäufigkeit<br />
(regelmäßig, unregelmäßig) besitzen sind für die<br />
Zusammenfassung von Aufgaben ein wichtiger Indikator<br />
Zeitliche, logische Verkettung von Aufgaben, die direkte<br />
Schnittstellen besitzen<br />
Aufgaben die Abhängigkeiten zueinander aufweisen<br />
Zeitliche, logische Verkettung von Aufgaben, die indirekte<br />
Schnittstellen haben<br />
Bei gleicher oder naheliegender Qualifikationsanforderung<br />
Bei Nutzung der gleichen Stammdaten, können diese<br />
aufgrund der mangelnden Dynamik zusammengefasst<br />
werden<br />
Wenn zwei oder mehr Aufgaben auf die gleiche<br />
Infrastruktur zugreifen, können diese zusammengefasst<br />
werden<br />
Grund für die mangelnde<br />
Aussagekraft<br />
Eine reine Zeitangabe ist kein Indiz anhand dessen zwei<br />
Aufgaben gruppiert werden können<br />
<strong>Die</strong> Physikalische Zahl allein ist kein Indikator<br />
z.B. 12 Mitarbeiter der Aufgabe 1 und<br />
12 Mitarbeiter der Aufgabe 2<br />
<strong>Die</strong> Physikalische Zahl allein ist kein Indikator<br />
Aufgrund der hohen Dynamik der Daten ist eine<br />
Gruppierung sehr schwer<br />
24
<strong>Die</strong> Wahl der Gruppierungskriterien für die Analyse sowie die Relevanz der Kriterien<br />
wird nach der Priorität von unternehmensspezifischen Arbeitsprozessen festgelegt.<br />
Auswahl eines Startkriteriums zur Analyse<br />
Zu Beginn der Untersuchung der PPS-Aufgaben muss ein Gruppierungskriterium als<br />
Startpunkt für den Beginn der Untersuchung aus Tabelle 2 der Rubrik „für die Grup-<br />
pierung geeignet“ gewählt werden. Hierbei handelt es sich um das SK. Welches der<br />
vorgegebenen Gruppierungskriterien als SK gewählt wird, obliegt dem Unternehmen.<br />
Aussagekraft der Gruppierungskriterien mit Empfehlung einer Reihenfolge<br />
<strong>Die</strong> Gewichtung der Kriterien sollte je nach Fertigungsstrategie vom Unternehmen<br />
spezifisch angepasst werden, weil jedes KMU innerhalb der Prozesse verschiedene<br />
Schwerpunkte setzt. Dabei haben die Kriterien Zeit, Komplexität und Datentyp bei<br />
einer Auftragsbezogenen Fertigung eine größere Gewichtung als bei einer Fertigung<br />
auf Lager. Gründe sind eine zeitkritische Fertigung (z. B. kaum Puffer in Beschaf-<br />
fungs-, Durchlaufs- und Transportzeiten) und komplexere Betrachtungen bezogen<br />
auf die Qualifikation der Mitarbeiter (z. B. schnellere Anpassung an Änderungen im<br />
Fertigungsablauf). <strong>Die</strong> Reaktionszeit des Unternehmens nimmt von der Kundenspe-<br />
zifischen Fertigung zur Fertigung auf Lager kontinuierlich ab [Knu05].<br />
Damit lässt sich für ein Unternehmen mit einer Auftragsbezogenen Fertigung eine<br />
Empfehlung für die Reihenfolge der zu untersuchenden PPS-Aufgaben respektive<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaketen festlegen, die in Abbildung 15 dargestellt ist.<br />
Startkriterium Qualifikation<br />
Hauptkriterium<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Zeit<br />
Hauptkriterium Datentyp<br />
Hauptkriterium Schnittstelle<br />
Abbildung 15: Reihenfolgeempfehlung der zu untersuchenden Aufgaben bei Auftragsbezoge-<br />
ner Fertigung<br />
25
Mit steigender Anzahl der übereinstimmenden Kriterien kann das potenzielle <strong>Die</strong>nst-<br />
leistungspaket bestätigt oder widerlegt werden. <strong>Die</strong> im Forschungsantrag geforderte<br />
Mindestanzahl an Kriterien konnte bisher nicht allgemeingültig bestätigt werden.<br />
Um eine Empfehlung der Reihenfolge für die Kriterien vorzugeben, sollen die Krite-<br />
rien mit der größten Relevanz für das Unternehmen am Anfang der Analyse unter-<br />
sucht werden, so dass nach jedem untersuchten Hauptkriterium ein Ausschluss für<br />
die Gruppierung der zu vergleichenden PPS-Aufgaben stattfinden kann. Eine Emp-<br />
fehlung der Reihenfolge der zu untersuchenden Kriterien (z. B. Qualifikation, Zeit,<br />
Datentyp) ist der Abbildung 15 zu entnehmen.<br />
Beispiel: Bildung von Anforderungsprofilen für das Unterkriterium „Qualifikati-<br />
on“<br />
Das gewählte Unterkriterium „Qualifikation“ stammt aus dem Hauptkriterium „Kom-<br />
plexität“. Alle PPS-Unteraufgaben des Unternehmens (z. B. Bestandsplanung) wer-<br />
den auf dieses Unterkriterium untersucht und gruppenweise zu einem Anforderungs-<br />
profil zusammengefasst (vgl. Abbildung 16). <strong>Die</strong> PPS-Unteraufgaben, die das „An-<br />
forderungsprofil 1“ aufweisen, bilden eine Gruppe und die PPS-Unteraufgaben, die<br />
das „Anforderungsprofil 2“ aufweisen eine weitere Gruppe. <strong>Die</strong> PPS-Unteraufgaben,<br />
die Übereinstimmungen (z. B. im Anforderungsprofil) aufweisen, können zu poten-<br />
ziellen <strong>Die</strong>nstleistungspaketen zusammengefasst werden, solange kein weiteres<br />
Haupt- oder Unterkriterium einen Ausschluss der Gruppierung erfordert.<br />
Mitarbeiter Techniker:<br />
Techniker:<br />
- Wartung<br />
- Wartung<br />
�� Gering - Reparatur<br />
- Reparatur<br />
z. B.: - …<br />
- …<br />
Anforderungsprofil 1<br />
Stichprobenkontrolle,<br />
Buchung Wareneingang<br />
und -ausgang<br />
Qualifikation<br />
Spezialist Techniker:<br />
Techniker:<br />
- Wartung<br />
- Wartung<br />
�� Mittel - Reparatur<br />
- Reparatur<br />
z. B.: - …<br />
- …<br />
Anforderungsprofil 2<br />
Korrekturbuchung,<br />
Disposition von Aufträgen,<br />
Kommunikation, Analysen<br />
von Fertigungsaufträgen,<br />
CAD-Zeichnungen<br />
Management Techniker:<br />
Techniker:<br />
- Wartung<br />
- Wartung<br />
�� Hoch - Reparatur<br />
- Reparatur<br />
z. B.: - …<br />
- …<br />
Anforderungsprofil 3<br />
Berichtswesen nutzen,<br />
<strong>Strategie</strong> festlegen<br />
gering hoch<br />
Abbildung 16: Bildung von Anforderungsprofilen für das Unterkriterium „Qualifikation“<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
26
Für das Unterkriterium „Qualifikation“ wird eine Richtungsabhängigkeit anhand der<br />
Bildung von Anforderungsprofilen aufgezeigt. <strong>Die</strong> Richtungsabhängigkeit der<br />
PPS-Unteraufgaben beschreibt die Verlagerung von einem geringen Anforderungs-<br />
profil (z. B. Buchung im Wareneingangsbereich) zu einem hohen Anforderungsprofil<br />
(z. B. Disposition von Aufträgen). Ein Mitarbeiter, der an PPS-Unteraufgaben in dem<br />
Anforderungsprofil 1 arbeitet, könnte auch PPS-Unteraufgaben mit dem Anforde-<br />
rungsprofil 2 übernehmen. Jedoch wird ein Mitarbeiter bei Ausübung der PPS-<br />
Unteraufgaben des Anforderungsprofils 2 aus Lohnkostengesichtspunkten nicht für<br />
Tätigkeiten innerhalb der PPS-Unteraufgaben mit dem Anforderungsprofil 1 einge-<br />
setzt. <strong>Die</strong>se Richtungsabhängigkeit der PPS-Unteraufgaben bewirkt eine Aufwands-<br />
reduzierung für das Unternehmen, da die Anzahl der möglichen Kombinationen der<br />
Zusammenfassung von PPS-Unteraufgaben eingeschränkt werden.<br />
Untersuchung der Analyseergebnisse und Bildung von potenziellen <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungsaufgaben und -paketen<br />
Im folgenden Beispiel wird die Bildung von potenziellen <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zu<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaketen der unternehmensspezifischen Aufgaben „Wartung und Re-<br />
paratur“ erläutert.<br />
In diesem Beispiel wird das Unterkriterium „Qualifikation“ als SK für die unterneh-<br />
mensspezifische Aufgabe „Wartung“ (vgl. Abbildung 17) aus den Gruppierungskrite-<br />
rien gewählt.<br />
Anzahl der<br />
Mitarbeiter<br />
Anzahl der<br />
abhängigen<br />
Aufgaben<br />
Komplexität<br />
Qualifikation<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
…<br />
Reparatur<br />
Umrüsten<br />
Wartung<br />
Zeit Schnittstelle<br />
480 min<br />
M3.1<br />
1x monatlich,<br />
regelmäßig<br />
…<br />
Komplexität<br />
Mitarbeiter mit<br />
Anforderung x<br />
2 Mitarbeiter<br />
5 abhängige Aufgaben<br />
…<br />
Interne Schnittstellen<br />
Abteilung: Produktion<br />
Aufg.: M3.1, M3.2<br />
Keine ext. Schnittstellen<br />
…<br />
Datentyp<br />
Maschinenstammdaten<br />
Bewegungsdaten liegen<br />
vor<br />
System xy<br />
Abbildung 17: Gruppierungskriterien der unternehmensspezifischen Aufgabe „Wartung“ des<br />
SK „Qualifikation“<br />
…<br />
27
Exemplarisch wird die Analyse der unternehmensspezifischen Aufgaben „Wartung<br />
und Reparatur“ für die Hauptkriterien (z. B. Zeit, Schnittstelle) in der Tabelle 3 aufge-<br />
führt. Je mehr Übereinstimmungen innerhalb der Hauptkriterien gefunden werden,<br />
desto größer ist das Potenzial, <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zu einem <strong>Die</strong>nstleistungspa-<br />
ket zusammenzufassen.<br />
Datentyp Komplexität Schnittstelle Zeit<br />
Tabelle 3: Vergleich der Gruppierungskriterien bei „Wartung und Reparatur“<br />
Zeitbedarf der Aufgabe<br />
Einordnung in den Unternehmensablauf<br />
Eintrittshäufigkeit der Aufgabe<br />
Interne Schnittstellen<br />
Abhängigkeiten von Aufgaben / Abteilungen<br />
Externe Schnittstellen<br />
Qualifikation der Mitarbeiter<br />
Anzahl der Mitarbeiter<br />
Anzahl der abhängigen Aufgaben<br />
Stammdaten<br />
Bewegungsdaten<br />
IT-Infrastruktur<br />
Kriterien<br />
Nicht entscheidungsrelevant<br />
Entscheidungsrelevant<br />
Gleich<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Wartung<br />
480 min<br />
M3.2<br />
1x monatlich,<br />
regelmäßig<br />
ja<br />
Abteilung: Prod., Einkauf<br />
Aufg.: M3.1, M3.2<br />
keine<br />
Anforderung x<br />
2<br />
5<br />
Maschinenstammdaten<br />
liegen vor<br />
System xy<br />
Unterschiedlich<br />
Reparatur<br />
60 min<br />
M3.2<br />
1x monatlich,<br />
unregelmäßig<br />
ja<br />
Abteilung: Prod., Einkauf<br />
Aufg.: M3.1, M3.2<br />
keine<br />
Anforderung x<br />
2<br />
4<br />
Maschinenstammdaten<br />
liegen vor<br />
System xy<br />
Der Vergleich ergibt, dass die unternehmensspezifischen Aufgaben „Wartung und<br />
Reparatur“ bei fünf von sechs Gruppierungskriterien Übereinstimmungen aufweisen:<br />
� Gleicher Unternehmensablauf<br />
� Ungleiche Eintrittshäufigkeit<br />
� Gleiche Abhängigkeiten<br />
� Gleiche Qualifikation<br />
� Gleiche Stammdaten<br />
� Gleiche IT-Infrastruktur<br />
Ein potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket kann somit gebildet werden (vgl. Abbildung<br />
18).<br />
28
�� M2.1<br />
�� Produktion<br />
M2.1, M2.2<br />
�� Techniker<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung Reparatur<br />
�� Maschinenstammdaten<br />
�� System xy<br />
�� regelmäßig<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
�� M2.1<br />
�� Produktion, Einkauf<br />
M2.1, M2..2<br />
�� Techniker<br />
�� Maschinenstammdaten<br />
�� System xy<br />
�� unregelmäßig<br />
Abbildung 18: Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket der Aufgaben „Wartung und Reparatur“<br />
Zusammenfassung<br />
Da ein Großteil der KMU das Potenzial zur Fremdvergabe von PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
nicht eigenständig identifizieren, analysieren, zusammenfassen und bewerten kön-<br />
nen, wurde eine systematische Vorgehensweise zur Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungs-<br />
aufgaben und -paketen anhand von Gruppierungskriterien entwickelt.<br />
29
4.4 AP 4: Erstellung einer Methode zur quantitativen Bewertung des prog-<br />
nostizierbaren Nutzens<br />
In Arbeitspaket vier wird eine Methode vorgestellt, die den KMU zur Bewertung des<br />
potenziellen Nutzens der <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete dient. <strong>Die</strong> Grundlage<br />
bilden die <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete, die in Arbeitspaket drei (Entwicklung<br />
einer Methode zur Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen) ermittelt<br />
wurden. Dabei werden Kennzahlen zur quantitativen Bewertung des prognostizierba-<br />
ren Nutzens ermittelt und anhand von Kosten untersucht.<br />
KMU müssen bei der Fremdvergabe für PPS-Systeme sowohl einmalige Kosten in<br />
Form von Schulungen, Hardware (z. B. Rechner) und Software (z. B. Datenbanken)<br />
als auch laufende Kosten (z. B. für das Personal) aufbringen [Tud09].<br />
Ermittlung von quantifizierbaren Kennzahlen<br />
Zunächst werden Kennzahlen (z. B. Durchlaufzeit, Bearbeitungszeit) ermittelt, mit<br />
denen sich <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete quantifizieren lassen. Eine Eintei-<br />
lung in Kataloge nach den Bereichen (z. B. Qualität, Leistung) dient dazu, die Kenn-<br />
zahlen zu strukturieren und eine aufwandsarme Anwendung für die KMU zu ermögli-<br />
chen. In Abbildung 19 sind die Kataloge nach Bereichen mit Kennzahlen grafisch<br />
dargestellt.<br />
Bestände Systemkosten<br />
Systemkosten<br />
Mehrbestand Lagerkosten<br />
Lagerkosten<br />
Mindestbestand<br />
Transportkosten<br />
Transportkosten<br />
Reichweite Handlingskosten<br />
Handlingskosten<br />
Lagerbestand<br />
Verpackungskosten<br />
Verpackungskosten<br />
sonstige … Kosten<br />
sonstige Kosten<br />
… …<br />
…<br />
…<br />
Qualität Systemkosten<br />
Systemkosten<br />
Kompatibilität Lagerkosten<br />
Lagerkosten<br />
Geschwindigkeit<br />
Transportkosten<br />
Transportkosten<br />
Flexibilität Handlingskosten<br />
Handlingskosten<br />
Verpackungskosten<br />
Fehlteile<br />
Verpackungskosten<br />
Fehlerquote sonstige Kosten<br />
sonstige Kosten<br />
Störanfälligkeit …<br />
…<br />
…<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Leistung Systemkosten<br />
Systemkosten<br />
Durchlaufzeit Lagerkosten<br />
Lagerkosten<br />
Bearbeitungszeit<br />
Transportkosten<br />
Transportkosten<br />
Datenaufbereitungsz.<br />
Handlingskosten<br />
Handlingskosten<br />
Handlingsaufwand<br />
Verpackungskosten<br />
Verpackungskosten<br />
Prozessleistung<br />
sonstige Kosten<br />
sonstige Kosten<br />
Kapazitätsauslastung …<br />
…<br />
…<br />
Abbildung 19: Kataloge nach Bereichen mit Kennzahlen<br />
Mit den Katalogen lassen sich Nutzen und Kosten beschreiben: nach der Einteilung<br />
der Kennzahlen in Kataloge werden unternehmensindividuell aus den ermittelten<br />
30
Kennzahlen diejenigen ausgewählt, die die betrachtete <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe oder<br />
-paket näher beschreiben. Nur die monetär bewertbaren Kennzahlen werden in Be-<br />
tracht gezogen. Kennzahlen, die sich mit hohem Aufwand auf Kosten umrechnen<br />
lassen (z. B. Qualität), wurden nicht betrachtet. <strong>Die</strong> Umrechnung der Kennzahlen in<br />
Kosten dient der Bewertung und der Analyse des Nutzens der einzelnen <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungsaufgaben und -pakete. Werden Kennzahlen miteinander verglichen, muss ein<br />
Bewertungsmaßstab (z. B. Nutzwertanalyse) eingeführt werden, der die Vergleich-<br />
barkeit der Kennzahlen gewährleistet [Sta05].<br />
Der Bereich Leistung aus dem Katalog sollte in jedem Wirtschaftsvergleich beschrie-<br />
ben werden, um eine fundierte Entscheidungsunterstützung zu erlangen. Dabei wird<br />
zwischen quantifizierbaren und nicht quantifizierbaren Nutzen unterschieden<br />
[Spa05]. Aus Abbildung 20 wird deutlich, dass der quantifizierbare Nutzen monetär<br />
bewertet werden kann. <strong>Die</strong>ser Teil wird in diesem Arbeitspaket näher betrachtet.<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Kosten Nutzen<br />
Einmalige Kosten Laufende Kosten<br />
Monetär bewertbarer<br />
Nutzen<br />
Abbildung 20: Struktur von Wirtschaftlichkeitsvergleichen [Sta05]<br />
Bei der Quantifizierung des Nutzens von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen an-<br />
hand geeigneter Kennzahlen ergibt sich ein objektives und auf Basis von Kosten<br />
vergleichbares Ergebnis. Zu berücksichtigen ist, dass die gewählten Kennzahlen nur<br />
eine <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe in einem <strong>Die</strong>nstleistungspaket beschreiben.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Quantifizierbarer<br />
Nutzen<br />
Nicht<br />
quantifizierbarer<br />
Nutzen<br />
Nicht<br />
Monetär bewertbarer<br />
Nutzen<br />
31
Kosten<br />
Qualität Systemkosten<br />
Systemkosten<br />
Kompatibilität Lagerkosten<br />
Kosten Lagerkosten Kosten<br />
Geschwindigkeit<br />
Transportkosten n<br />
Bestände Systemkosten Transportkosten Leistung Systemkosten<br />
Systemkosten Flexibilität Handlingskosten Systemkosten<br />
Mehrbestand Lagerkosten Handlingskosten Durchlaufzeit Lagerkosten<br />
Lagerkosten Verpackungskosten<br />
Fehlteile Lagerkosten<br />
Mindestbestand<br />
Transportkosten Verpackungskosten Bearbeitungszeit<br />
Transportkosten<br />
Transportkosten Fehlerquote sonstige Kosten Transportkosten<br />
Reichweite Handlingskosten sonstige Kosten Datenaufbereitungsz.<br />
Handlingskosten<br />
Handlingskosten Störanfälligkeit … Handlingskosten<br />
Lagerbestand<br />
Verpackungskosten … Handlingsaufwand<br />
Verpackungskosten<br />
Verpackungskosten … Verpackungskosten<br />
sonstige … Kosten<br />
Prozessleistung<br />
sonstige Kosten<br />
sonstige Kosten<br />
sonstige Kosten<br />
… …<br />
Kapazitätsauslastung …<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
Zuweisung der Größen<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Aufgabe 3<br />
Aufgabe 2<br />
Aufgabe 1<br />
� Merkmal 1<br />
� Merkmal � Merkmal 1 2<br />
� Merkmal � Merkmal 2 3<br />
� Merkmal x<br />
� Merkmal � Merkmal y 3<br />
� Merkmal z<br />
Abbildung 21: Zuweisung der Kennzahlen zu dem ausgewählten <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Am Beispiel des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ sollen die zur Be-<br />
schreibung des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes ausgewählten Kennzahlen aufgezeigt wer-<br />
den. <strong>Die</strong> Kennzahlen zur quantitativen Bewertung der <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben „War-<br />
tung“ und „Reparatur“ sind innerhalb des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes gleich. Als Kenn-<br />
zahlen zur Beschreibung des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ die-<br />
nen die Bearbeitungszeit, Datenaufbereitungszeit, Fehlerquote und der Materialein-<br />
satz. <strong>Die</strong>se Kennzahlen wurden vom PA ausgewählt, weil sie das <strong>Die</strong>nstleistungspa-<br />
ket „Wartung und Reparatur“ eindeutig quantifizieren. Kennzahlen wie Geschwindig-<br />
keit und Flexibilität wurden ausgeschlossen, weil diese nicht aufwandsarm in finan-<br />
zielle Mittel umgerechnet werden können.<br />
Bestimmung der Kosten<br />
Kosten sind zeitraumbezogene Größen, die den Verzehr von Gütern und <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungen zur Erstellung der betrieblichen Leistung darstellt. Leistungen sind zeitraum-<br />
bezogene Größen, die den Wert aller erbrachten Güter und <strong>Die</strong>nstleistungen im<br />
Rahmen der betrieblichen Tätigkeit aufweisen [Zel08]. In der Kostenrechnung, die<br />
u. a. zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit dient, werden Kosten (z. B. Bestandskosten,<br />
Personalkosten, Handlingskosten) erfasst. Wichtige Zielgrößen werden anhand von<br />
Kennzahlen angegeben, die zur Überwachung von Kosten und Leistungen im Unter-<br />
nehmen dienen. Für KMU sind Kosten (z. B. für Personal und Betriebsmittel) mittel-<br />
32
fristig fixe Bestandteile. Bei einer Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungspaketen an den<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister fallen Kosten lediglich in Form eines abhängigen Entgelts an, die<br />
den variablen Kosten zurechenbar sind [Muc98] [Her05].<br />
Einmalige Kosten<br />
Einmalige Kosten fallen innerhalb der Vertragslaufzeit einmalig an und sie entstehen<br />
bei der Abwicklung des Fremdvergabeprojektes an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister. Einmalige<br />
Kosten, die bei der Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben anfallen, sind<br />
Transaktionskosten, die sich wiederum in folgende Kosten gliedern:<br />
� Transformationskosten resultieren aus der physischen Umstrukturierung der<br />
KMU aufgrund der Verlagerung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben (z. B. „Wartung<br />
und Reparatur“) an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister.<br />
� Optimierungskosten, die zur Standardisierung der Prozesse dienen, bilden ei-<br />
nen Großteil der Transformationskosten ab.<br />
� Anbahnungskosten entstehen bei der Suche nach potenziellen<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern sowie beim Einholen von Informationen (z. B. Preise oder<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsqualität) der PPS-<strong>Die</strong>nstleister.<br />
� Vereinbarungskosten fallen bei Vertragsverhandlungen zwischen KMU und<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister an.<br />
� Kontrollkosten sind Kosten, die im Laufe der Geschäftsbeziehung zwischen<br />
KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister entstehen und sie überprüfen, ob die Leistungs-<br />
vereinbarungen eingehalten werden.<br />
� Anpassungskosten entstehen bei Veränderungen des Vertrages<br />
(z. B. Änderung der Auftragslage und/oder der wirtschaftlichen Lage zwischen<br />
KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister).<br />
Um die Transaktionskosten möglichst gering zu halten, sollten standardisierte, wenig<br />
komplexe und geringe strategische <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zur Fremdvergabe ein-<br />
bezogen werden [Hor96] [Her05] [Keu08].<br />
Am Beispiel des in Abbildung 22 dargestellten <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und<br />
Reparatur“ ergeben sich bei einer Fremdvergabe einmalige Kosten in Höhe von<br />
3.640 Euro. <strong>Die</strong> einmaligen Kosten (z. B. Schulungskosten) müssen sich innerhalb<br />
der Vertragslaufzeit amortisieren (investierte Finanzmittel müssen innerhalb der Ver-<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
33
tragslaufzeit über die Rückflüsse, z. B. Einsparungen in den laufenden Kosten, zu-<br />
rückgewonnen werden), um einen potenziellen Nutzen für die Fremdvergabe des<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ zu erzielen.<br />
<strong>Die</strong> Berechnung der Amortisationsdauer erfolgt folgendermaßen:<br />
Rückgewinn ungszeit(<br />
Amortisationsdauer)<br />
=<br />
Schulungskosten der eigenen Mitarbeiter<br />
Transaktionskosten<br />
Kosten für <strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Kosten für Vertragsverhandlungen<br />
Kosten für Backsourcing / Vertragsverlängerung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Investitionsbetrag<br />
Rückfluss<br />
[Pro08]<br />
Einmalige Kosten<br />
220 €<br />
1200 €<br />
850 €<br />
650 €<br />
720 €<br />
3640 €<br />
Abbildung 22: beispielhafte Darstellung der einmaligen Kosten bei Fremdvergabe des <strong>Die</strong>nst-<br />
Laufende Kosten<br />
leistungspaketes "Wartung und Reparatur"<br />
Laufende Kosten fallen bei Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungspaketen in regelmäßi-<br />
gen Zeitabständen an und müssen regelmäßig an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister gezahlt<br />
werden [Hor96]. Den KMU fällt eine prognostizierte unternehmensinterne Kostenauf-<br />
stellung aufgrund von Erfassungsproblemen schwer (z. B. bei einer Mehrfachnutzung<br />
nach der betrieblichen Einteilung für unterschiedliche Prozesse). PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
stellen die Leistungen, die sie für KMU erbringen, entsprechend eines Vertrages in<br />
Rechnung. Damit wird dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister eine exakte Zuordnung und Planbar-<br />
keit der Kosten ermöglicht [Her05]. Um die prognostizierbaren Kosten eines <strong>Die</strong>nst-<br />
leistungspaketes zu ermitteln, können bei potenziellen PPS-<strong>Die</strong>nstleistern Angebote<br />
eingeholt werden.<br />
Im <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Reparatur“ lassen sich für die zugeordneten<br />
Kennzahlen die zugehörigen Zahlenwerte durch die Umrechnung in laufende Kosten<br />
erfassen. Dazu werden Bruttokosten herangezogen, weil diese einen Aufschluss ü-<br />
ber die gesamten Ausgaben für eine <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe geben. Für das <strong>Die</strong>nst-<br />
leistungspaket „Wartung und Reparatur“ werden für beide <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben<br />
34
„Wartung“ und „Reparatur“ die Personalkostenbestandteile ermittelt, die im Unter-<br />
nehmen entstehen. <strong>Die</strong> Abbildung 23 zeigt, dass die Bearbeitungszeit für die „War-<br />
tung“ 480 Minuten beträgt. <strong>Die</strong>ser Wert wird über den Personalkostensatz umge-<br />
rechnet, der im Fallbeispiel bei 43,66 Euro je Stunde liegt. <strong>Die</strong> Umrechnung der Zei-<br />
ten in Kosten resultiert aus der Umrechnung des Bruttolohns der beteiligten Mitarbei-<br />
ter auf die Bearbeitungszeit. Insgesamt betragen die monatlichen Kosten der Bear-<br />
beitungszeit für „Wartung“ 349,28 Euro. <strong>Die</strong> Gesamtkosten setzen sich aus der Addi-<br />
tion der noch verbleibenden Kosten (z. B. für Datenaufbereitungszeit, Fehlerquote)<br />
zusammen. Im Fallbeispiel betragen die Gesamtkosten für „Wartung“ 423,67 Euro.<br />
Um die Personalgesamtkosten des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“<br />
aufzuzeigen, werden die Kostenanteile, die für die „Reparatur“ anfallen, mit denen<br />
der „Wartung“ addiert. So ergeben sich Personalgesamtkosten in Höhe von 592,48<br />
Euro, die innerbetrieblich im KMU anfallen. Abbildung 23 stellt zudem die prognosti-<br />
zierten, monatlich anfallenden Personalkosten bei einer Fremdvergabe von „Wartung<br />
und Reparatur“ dar. <strong>Die</strong> Personalgesamtkosten betragen bei einer Fremdvergabe<br />
375,11 Euro und fallen eindeutig geringer aus als bei Eigenerstellung.<br />
Wartung Reparatur<br />
Kosten im eigenen Betrieb<br />
Bearbeitungszeit 480 min 349,28 € 60 min 43,66 €<br />
Datenaufbereitungszeit 25 min 18,19 € 15 min 10,95 €<br />
Fehlerquote 5% 12,20 € 2% 02,00 €<br />
Materialeinsatz Werkzeug,<br />
sonst. Material<br />
43,00 € Werkzeug,<br />
Ersatzteile<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
112,20 €<br />
Gesamtkosten 423,67 € 168,81 €<br />
Prognostizierte Kosten bei Fremdvergabe<br />
Bearbeitungszeit 450 min 215,55 € 60 min 28,74 €<br />
Datenaufbereitungszeit 13 min 06,29 € 12 min 05,75 €<br />
Fehlerquote 3% 02,00 € 1% 00,78 €<br />
Materialeinsatz Werkzeug, IT,<br />
sonst. Material<br />
25,00 € Werkzeug, IT<br />
Ersatzteile<br />
91,00 €<br />
Gesamtkosten 248,84 € 126,27 €<br />
Personalkostensatz je Stunde vor Fremdvergabe: 43,66 €<br />
Personalkostensatz je Stunde nach Fremdvergabe: 28,74 €<br />
592,48 €<br />
375,11 €<br />
Abbildung 23: Aufstellung der monatlichen Personalkosten bei Eigenerstellung und Fremdbe-<br />
zug des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“<br />
35
Kostenveränderungen in abhängigen Aufgaben<br />
<strong>Die</strong> unternehmensspezifischen Aufgaben „Wartung und Reparatur“ werden im Fol-<br />
genden als Prozessaufgaben in Anlehnung an die Nomenklatur des SCOR Modells<br />
bezeichnet. <strong>Die</strong> Prozessaufgaben „Wartung und Reparatur“ der Prozesskategorie<br />
„Auftragsbezogene Fertigung“ bewirken Kostenveränderungen auf das Prozessele-<br />
ment (z. B. Fertigungsplanung). Prozessaufgaben können ebenfalls noch Kostenver-<br />
änderungen in weiteren Prozesselementen (z. B. Fertigungsversorgung) bewirken,<br />
die entsprechend berücksichtigt werden müssen. In Abbildung 24 sind die Kosten-<br />
veränderungen der Prozesselemente in der Prozesskategorie „Auftragsbezogene<br />
Fertigung“ grafisch dargestellt.<br />
M2.1<br />
Fertigungsplanung<br />
Prozessaufgaben<br />
M2.2<br />
Fertigungsversorgung<br />
M2.3<br />
Fertigung<br />
u. Prüfung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
M2.4<br />
Verpacken<br />
der Ware<br />
M2.5<br />
Lagerung<br />
der Ware<br />
+ 300 € 0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
- 250 €<br />
Reparatur<br />
Wartung<br />
- 500 € 0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
M2.6<br />
Liefer-<br />
freigabe<br />
+ 250 €<br />
Abbildung 24: Kostenveränderung in den Prozesselementen und Prozessaufgaben<br />
Ableitung des potenziellen Nutzens<br />
Nachdem die Kosten für das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Reparatur“ ermittelt<br />
wurden, lässt sich daraus ein potenzieller Nutzen ableiten (vgl. Abbildung 25). <strong>Die</strong><br />
gesamte Vertragslaufzeit sollte in Betracht gezogen werden. Haben sich die Kosten<br />
innerhalb der Vertragslaufzeit amortisiert, ist ein Einsparpotenzial vorhanden. Falls<br />
keine Amortisation innerhalb der Vertragslaufzeit vorhanden ist, gibt es keinen mone-<br />
tären Nutzen [Röh07].<br />
0 €<br />
36
Vertragsbeginn<br />
Amortisationsdauer<br />
kein monetärer Nutzen<br />
kein monetärer Nutzen<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Einsparung<br />
potenzieller Nutzen<br />
potenzieller Nutzen<br />
Abbildung 25: Ableitung des potenziellen Nutzens<br />
Vertragsende<br />
Bei der Fremdvergabe des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ entste-<br />
hen (vgl. Abbildung 22) einmalige Kosten in Höhe von 3.640 Euro, die den Investiti-<br />
onsbetrag darstellen. Das Einsparpotenzial ergibt sich aus der Differenz der Kosten<br />
vor und nach der Fremdvergabe und zusätzlich der Veränderung der Kosten in ab-<br />
hängigen Prozessaufgaben. Das monatliche Einsparpotenzial beträgt bei der Fremd-<br />
vergabe 417,37 Euro. Daraus ergibt sich eine Amortisationsdauer von 8,7 Monaten.<br />
Bei einer Vertragslänge von 36 Monaten liegt das gesamte Einsparpotenzial bei<br />
11.394 Euro. Ergebnis der Analyse ist, dass das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und<br />
Reparatur“ für eine Fremdvergabe potenziell geeignet ist.<br />
Zusammenfassung<br />
Wichtig für KMU ist die Schaffung von Transparenz über Kosten im eigenen Unter-<br />
nehmen, um die Kosten potenzieller Angebote für eine Fremdvergabe an<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern mit den Kosten bei Eigenerstellung vergleichen zu können. Mithil-<br />
fe dieses Vergleichs gelingt die kritische Hinterfragung, ob durch eine Fremdvergabe<br />
ein langfristiger Kostenvorteil entsteht [Net03].<br />
Eine Methode zur quantitativen Bewertung des prognostizierbaren Nutzens wurde<br />
erstellt.<br />
37
4.5 AP 5: Entwicklung einer Methode zur Chancen und Risiken basierten<br />
Bewertung und Auswahl von <strong>Die</strong>nstleistungspaketen<br />
Im Rahmen des Arbeitspaketes fünf werden Chancen und Risiken der Fremdvergabe<br />
von PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen ermittelt und zusammengefasst. Anschließend wird mit<br />
Hilfe einer Chancen- und Risikoanalyse sowie einer Nutzwertanalyse eine Bewertung<br />
vorgenommen. <strong>Die</strong> Ergebnisse dieser Bewertung werden in ein Chancen-Risiken-<br />
Portfolio übertragen und dienen dem Vergleich von potenziellen <strong>Die</strong>nstleistungsauf-<br />
gaben oder -paketen als Entscheidungsgrundlage.<br />
Für eine Entscheidung über Eigenerstellung oder Fremdbezug einer Logistikleistung,<br />
sind die potenziellen Chancen und Risiken der Fremdvergabe im Hinblick auf die<br />
spezifische Entscheidungssituation des jeweiligen Unternehmens zu bewerten und<br />
gegeneinander abzuwägen [Vah07]. <strong>Die</strong> Entscheidung über eine Fremdvergabe<br />
kann die Prozessorganisation verändern. Durch die Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungsaufgaben oder -paketen werden Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Ergebnisqua-<br />
lität und Kosten beeinflusst. Unternehmen, die über eine Fremdvergabe von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen nachdenken, müssen sich mit Chancen und Risiken der<br />
Fremdvergabe auseinandersetzen, um die Fremdvergabepotenziale der zu vergebe-<br />
nen Leistungen zu erkennen.<br />
Allgemeine Chancen und Risiken der Fremdvergabe<br />
Zunächst folgt eine Begriffserklärung für „Risiko“ und „Chance“ sowie „Vorteil“ und<br />
„Nachteil“. Anschließend werden die allgemeinen Chancen und Risiken der Fremd-<br />
vergabe dargelegt sowie deren Überführung auf die PPS-Aufgaben.<br />
Ein Risiko ist eine nach Häufigkeit und Auswirkung bewertete Bedrohung eines ziel-<br />
orientierten Systems. Das Risiko betrachtet dabei stets die negative, unerwünschte<br />
und ungeplante Abweichung von Systemzielen und deren Folgen. Dem Risiko steht<br />
meist eine Chance gegenüber, welches ein positives Ergebnis in Aussicht stellt<br />
[Kön09].<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
38
Unter Vorteil und Nachteil sind im Rahmen der Problemlösungsstrategie die positive<br />
bzw. negative Folge einer Lösung bzw. die Lösung des Problems selbst zu verste-<br />
hen. [Fwd90]<br />
Nach KNOLMAYER sind die möglichen Vor- und Nachteile einer Fremdvergabe in ei-<br />
nem Katalog mit Kategoriegruppen „<strong>Strategie</strong>“, „Leistung“, „Kosten“, „Personal“ und<br />
„Finanzen“ zusammengestellt. In Abbildung 26 sind exemplarisch die Vor- und<br />
Nachteile in der Kategoriegruppe „<strong>Strategie</strong>“ dargestellt.<br />
<strong>Strategie</strong><br />
Vorteile:<br />
- Konzentration auf das Kerngeschäft<br />
- Kooperationen in strategischen Allianzen<br />
statt vertikaler Hierarchien<br />
- Beschleunigte Umsetzung von<br />
Reengineering-Erkenntnissen<br />
- Auf neuestem Technik-Stand<br />
befindliche,innovative IT-Lösungen<br />
- Standardisierung der eingesetzten ITSysteme<br />
- Verbesserte Führbarkeit des IT-Bereiches<br />
- Reduktion des Risikos der Erfüllung von IT-Aufgaben<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Nachteile:<br />
- Wettbewerbsrelevanz bestimmter IT-Aufgaben<br />
- Entstehen irreversibler Abhängigkeiten<br />
- Störung zusammengehöriger Prozesse Vertraulichkeit<br />
von Geschäftsprozessen und -daten<br />
- Risiken aus der Zusammenarbeit<br />
- Starke Machtposition des Outsourcing-<br />
<strong>Die</strong>nstleisters bei Realisierung von<br />
- Individuallösungen durch Wissensmonopole<br />
- Unterschiedliche Unternehmenskulturen<br />
- Probleme gegen Ende der Vertragslaufzeit<br />
Abbildung 26: Vor- und Nachteile der Fremdvergabe in der Kategorie „<strong>Strategie</strong>“ [Kno00]<br />
<strong>Die</strong> Kategoriegruppen werden miteinander verglichen, um daraus allgemeine Krite-<br />
rien (z. B. Kerngeschäft, Personal) abzuleiten.<br />
Chancen und Risiken bei Fremdvergabe klassischer Logistikleistungen<br />
Da bisher wenige PPS-Aufgaben an PPS-<strong>Die</strong>nstleister fremd vergeben werden, sind<br />
bisher in der Literatur keine Ausführungen der jeweiligen Chancen und Risiken einer<br />
Fremdvergabe dokumentiert. Für klassische Logistikleistungen sind Chancen und<br />
Risiken einer Fremdvergabe bekannt, die im Folgenden die Grundlage für eine mög-<br />
liche Übertragung auf Chancen und Risiken bei der Fremdvergabe von PPS-<br />
Aufgaben bilden. Dazu wurden die Chancen und Risiken einer klassischen Logistik-<br />
leistung sowie Vorteile und Nachteile für die Umstellung von einer Vorratsbeschaf-<br />
fung auf ein Konsignationskonzept erfasst. Hierbei wurde untersucht, welchen Ein-<br />
fluss die Umstellung der Beschaffungskonzepte (z. B. Vorratsbeschaffung, Konsigna-<br />
39
tionskonzept) auf die Chancen und Risiken des Zulieferers und des Herstellers (sie-<br />
he Anhang 17, Anhang 18) hat (vgl. Abbildung 27).<br />
Vorratsbeschaffung Konsignationskonzept<br />
Hersteller Zulieferer<br />
Vorteil<br />
Nachteil<br />
Vorteil<br />
Nachteil<br />
Koordination bei der Bereitstellung<br />
z.B. durch Bedienung mehrerer Kunden<br />
Verantwortung bei Engpässen<br />
Vertraglich zugesicherte Versorgungssicherheit<br />
Abgabe der Ressourcenkontrolle<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Chance<br />
Optimierung der<br />
Versorgungsstrategie<br />
Anpassungsfähigkeit<br />
aufgrund erhöhter<br />
Sicherheitsbestände<br />
Chance<br />
Optimale<br />
Versorgungssicherheit<br />
Optimierung der<br />
Versorgungsstrategie<br />
Risiko<br />
Versorgungsengpässe<br />
durch Fehlplanung<br />
Vertragsstrafen<br />
Risiko<br />
Nicht Erfüllung des<br />
Vertrages<br />
Abbildung 27: Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken bei Logistikleistungen am Bei-<br />
spiel der Umstellung der Beschaffungskonzepte<br />
Als Ergebnis wurden Kriterien wie „Versorgungssicherheit“, „Abhängigkeit“, „Kernge-<br />
schäft“, „Personal“ und „IT“ mit dem PA als Gruppenkriterien abgeleitet. Bei der Ana-<br />
lyse der Vor- und Nachteile und deren Zusammenfassung zu einem Kriterienkatalog<br />
wurde festgestellt, dass u. a. ein Vorteil nicht nur eine Chance (z. B. Optimierung der<br />
Versorgungsstrategie) sondern auch ein Risiko (z. B. Versorgungsengpässe durch<br />
Fehlplanung) darstellen kann.<br />
Überführung der Chancen und Risiken der klassischen Logistikleistungen auf<br />
PPS-Aufgaben<br />
<strong>Die</strong> Chancen und Risiken für PPS-Aufgaben wurden einerseits aus den Kriterien der<br />
Chancen und Risiken der klassischen Logistikleistungen und andererseits aus den<br />
allgemeinen Chancen und Risiken, die aus der Literatur zu entnehmen sind (siehe<br />
Anhang 19, Anhang 20), abgeleitet (vgl. Abbildung 28). Da nicht alle Kriterien der<br />
Chancen und Risiken der klassischen Logistikleistungen für PPS-Aufgaben relevant<br />
sind (z. B. Reduzierung der Anzahl der Lieferanten), werden diese Kriterien ausge-<br />
schlossen. <strong>Die</strong> Chancen und Risiken der PPS-Aufgaben setzen sich zu 70% aus den<br />
Kriterien der Chancen und Risiken der klassischen Logistikleistungen zusammen und<br />
30% der Kriterien wurden aus der Literatur ergänzt (vgl. Abbildung 28).<br />
VS<br />
VS<br />
40
Chancen und Risiken<br />
Kriterien aus dem Bereich<br />
Logistikdienstleistung:<br />
Beispiel Beschaffungsprozess<br />
� Kosten<br />
� Versorgungssicherheit � IT<br />
Kriterien aus dem Bereich<br />
Allgemeine Chancen u. Risiken der<br />
Fremdvergabe:<br />
� Qualität<br />
� Produktion<br />
� Kerngeschäft<br />
� Räumliche Distanz<br />
� Innovationsfähigkeit<br />
70%<br />
30%<br />
PPS-Aufgaben<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
<strong>Strategie</strong><br />
Risiko der Zusammenarbeit<br />
Konzentration auf das Kerngeschäft<br />
Qualitätssteigerung<br />
...<br />
Know-how<br />
Leistung<br />
Verfügbarkeit von Kapazitäten<br />
Koordinationsbedarf<br />
...<br />
Transaktionskosten<br />
Kosten<br />
Kostenreduktion im laufenden Betrieb<br />
Auswirkung auf den Jahresabschluss<br />
...<br />
Personal<br />
Rechtliche Bedingungen<br />
Motivation der Mitarbeiter<br />
Qualifikation der Mitarbeiter<br />
...<br />
Abbildung 28: Überführung der Chancen und Risiken auf PPS-Aufgaben<br />
Insgesamt sind Chancen und Risiken für PPS-Aufgaben in die Kriterien „<strong>Strategie</strong>“,<br />
„Leistung“, „Kosten“ und „Personal“ unterteilt. Zu dem Kriterium „<strong>Strategie</strong>“ für die<br />
Fremdvergabe von PPS-Aufgaben gehören u. a. die „Konzentration auf die Kern-<br />
kompetenzen“, „Innovationsfähigkeit“ und „Qualitätssteigerung“. Anhand der ermittel-<br />
ten Chancen und Risiken für PPS-Aufgaben erfolgt die Bewertung der Fremdvergabe<br />
von <strong>Die</strong>nstleistungspaketen.<br />
Bewertung von Chancen und Risiken der Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungs-<br />
paketen<br />
Ziel der Chancen- und Risikobewertung ist die Quantifizierung der Chancen und Ri-<br />
siken [Web99].<br />
<strong>Die</strong> Chancen- und Risikobewertung bezieht sich auf die Umwelt des Unternehmens.<br />
Dabei werden langfristige Planziele hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit einge-<br />
schätzt [Het07]. Bei der Chancen- und Risikobewertung werden die Chancen und<br />
Risiken von PPS-Aufgaben aus dem zuvor ermittelten Kriterienkatalog verwendet.<br />
Für die Gewichtung von Chancen und Risiken werden drei qualitative Bewertungs-<br />
stufen („hoch“, „mittel“, „gering“) eingeführt. Jede Bewertungsstufe entspricht einer<br />
Zahl, die für die Quantifizierung der Veränderungen im Unternehmen bei Fremdver-<br />
gabe dient. Durch die Quantifizierung wird eine Vergleichbarkeit der <strong>Die</strong>nstleistungs-<br />
aufgaben und -pakete geschaffen. <strong>Die</strong> Gesamtsummen der Chancen und Risiken<br />
41
dienen im weiteren Verlauf der Positionierung im Portfolio (siehe Anhang 21). Der<br />
Bewertungsbogen aus Abbildung 29 bietet den KMU eine Vorlage zur Quantifizie-<br />
rung der Chancen und Risiken der zu vergebenen <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
–paketen.<br />
Nutzwertanalyse<br />
Transaktionskosten<br />
Kostenreduktion im laufenden<br />
Betrieb<br />
Kostentransparenz<br />
Konkurs des <strong>Die</strong>nstleisters<br />
Auswirkung auf den<br />
Jahresabschluss<br />
Auswirkung auf die Zahlungslegung<br />
<strong>Strategie</strong><br />
Leistung<br />
Kosten<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe o- paket 1 ... n<br />
+6<br />
6<br />
Chance<br />
Chance<br />
+4<br />
+2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
+2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
Risiko<br />
Risiko<br />
+4<br />
14 12<br />
24 18<br />
+6<br />
Hoch Mittel Gering Gering Mittel Hoch<br />
Hoch<br />
Abbildung 29: Bewertungsbogen der Chancen und Risiken<br />
Ziel dieser Nutzwertanalyse ist das Erkennen des Nutzens von <strong>Die</strong>nstleistungsauf-<br />
gaben und -paketen bei der Fremdvergabe. <strong>Die</strong> Nutzwertanalyse ist ein formalisier-<br />
tes Verfahren zur Entscheidungsfindung für eine Auswahl von Handlungsalternativen<br />
unter Berücksichtigung eines mehrdimensionalen Zielsystems [Dit96].<br />
<strong>Die</strong> Nutzwertanalyse besteht in der subjektiven Beurteilung und damit verbunden<br />
existiert die Gefahr von Fehlurteilen. Um diese Gefahrenquelle zu reduzieren, wer-<br />
den bei der Nutzwertanalyse mehrere Personen zur Beurteilung befragt. <strong>Die</strong> Auswahl<br />
und Gewichtung der Kriterien, die in Anspruch genommen werden, geschieht anhand<br />
eines frei wählbaren Gewichtungsfaktors. Je höher ein Gewichtungsfaktor, desto be-<br />
deutsamer ist das Kriterium. <strong>Die</strong> Gewichtung der Gruppen erfolgt in diesem For-<br />
schungsprojekt mit Hilfe der Zuweisung von Punkten (vgl. Tabelle 4).<br />
2<br />
6<br />
6<br />
6<br />
42
Tabelle 4: Gewichtung der Kriterien der Nutzwertanalyse<br />
Kriterien Gewichtung in Punkten<br />
Gruppenkriterien 100<br />
Teilkriterien 100<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben<br />
u. -pakete<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
0-10<br />
Anschließend werden die Teilkriterien (z. B. Konzentration auf das Kerngeschäft)<br />
ebenfalls über Punktezuweisung gewichtet. <strong>Die</strong>se Zuweisung erfolgt innerhalb der<br />
Gruppenkriterien. Abhängig von der/dem zu prüfenden <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe oder<br />
-paket wird eine Gewichtung für die <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe oder -paket anhand ei-<br />
ner Punkteskala von 0 bis 10 Punkte vorgenommen. Erreicht ein Kriterium 0 Punkte,<br />
werden die gewünschten Anforderungen nicht erreicht. Eine Punktezahl von 10 be-<br />
deutet maximale Zielerreichung.<br />
Für jede Kriteriengruppe wird die Zwischensumme ermittelt, die zeigt, welche der<br />
Kriteriengruppen den größten Nutzwert hat (vgl. Tabelle 5), (siehe Anhang 22).<br />
43
IT Personal Kosten<br />
Leistung<br />
<strong>Strategie</strong><br />
Konzentration auf das Kerngeschäft<br />
Verantwortungsübergabe<br />
Qualität<br />
Komplexität<br />
Serviceorientierung<br />
Räumlich Distanzen<br />
Zwischensumme:<br />
Know-how<br />
Verfügbarkeit von Kapazitäten<br />
Firmenimage<br />
Abhängigkeit vom <strong>Die</strong>nstleister<br />
Innovationsfähigkeit<br />
Koordination<br />
Versorgungssicherheit<br />
Zwischensumme:<br />
Transaktionskosten<br />
Kostenreduktion im laufenden Betrieb<br />
Kostentransparenz<br />
Konkurs des <strong>Die</strong>nstleisters<br />
Auswirkung auf den Jahresabschluss<br />
Auswirkung auf die Zahlungslegung<br />
Zwischensumme:<br />
Rechtliche Bedingungen<br />
Motivation der Mitarbeiter<br />
Mitarbeiterführung<br />
Qualifikation der Mitarbeiter<br />
Zwischensumme:<br />
Datensicherheit<br />
Standadisierung durch einheitliche IT<br />
Anpassungsfähigkeit der IT Infrastruktur<br />
Zwischensumme:<br />
Nutzwert (Σ) :<br />
Kriterium<br />
Chancen-Risiken-Portfolio<br />
Tabelle 5: Nutzwertanalyse<br />
Ø Gruppengewichtung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Ø Teilkriteriengewichtung<br />
<strong>Die</strong>nstleistungs-aufgabe<br />
oder -paket<br />
Punkte Nutzwert<br />
Ein Chancen-Risiken-Portfolio zeigt das Verhältnis von Chancen und Risiken bezüg-<br />
lich eines Entscheidungsobjektes auf. Relevante Entscheidungskriterien, die bei der<br />
Entscheidung für die Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen un-<br />
terstützen, können grafisch dargestellt werden [Bua02].<br />
Untersuchungsrichtung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben oder -paketen<br />
Auf Grundlage des ermittelten potenziellen Nutzens werden <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben<br />
und -pakete auf eine mögliche Untersuchungsrichtung analysiert. <strong>Die</strong>se Untersu-<br />
chungsrichtung der <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -pakete beginnt mit dem größten<br />
und endet mit dem kleinsten potenziellen Nutzen (vgl. Abbildung 30).<br />
44
Vertragsbeginn<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung Reparatur<br />
� M3.2<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbe iter mit Anfo rderung x<br />
� Maschi nenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßi g<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung Reparatur<br />
� M3.2<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbe iter mit Anfo rderung x<br />
� Maschi nenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßi g<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung Reparatur<br />
kein monetärer Nutzen<br />
kein monetärer Nutzen<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
� M3.2<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbe iter mit Anfo rderung x<br />
� Maschi nenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßi g<br />
� M3.2<br />
Wartung Reparatur<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßig<br />
� M3.2<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
Wartung Reparatur<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
Untersuchungsrichtung<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßig<br />
� M3.2<br />
� Produktion<br />
M3.1, M3.2<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung Reparatur<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� regelmäßig<br />
potenzieller Nutzen<br />
potenzieller Nutzen<br />
� M3.2<br />
� Produktion, Einkauf<br />
M3.1, M3.2<br />
� Mitarbeiter mit Anforderung x<br />
� Maschinenstammdaten<br />
� System xy<br />
� unregelmäßig<br />
Vertragsende<br />
Abbildung 30: Untersuchungsrichtung des potenziellen Nutzens bei <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben<br />
und -paketen<br />
Mögliche Bezugsgrößen innerhalb des Portfolios<br />
<strong>Die</strong> Bezugsgröße ist der Maßstab der Leistung einer am Produkterstellungsprozess<br />
beteiligten Kostenstelle [Kil07]. Zu den möglichen Bezugsgrößen innerhalb des Port-<br />
folios zählen u. a.:<br />
- Nutzwert aus der Nutzwertanalyse<br />
- Einsparpotenzial aus der Analyse der Kosten<br />
- Amortisationsdauer<br />
- Anzahl von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben in einem <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
- Einmalige Kosten bei der Fremdvergabe<br />
- Umsatz<br />
Methode auf Basis von Chancen und Risiken für <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
–paketen<br />
Das Chancen-Risiken-Portfolio wird zweidimensional dargestellt. Auf der Abszisse<br />
wird das „Risiko“ und auf der Ordinate die „Chance“ aufgetragen (vgl. Abbildung 31).<br />
<strong>Die</strong> Skalierung sowie die Positionierung der <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe oder -paketes<br />
erfolgt aus der Bewertung der Chancen und Risiken. Um Entscheidungen aus dem<br />
Chancen-Risiken-Portfolio treffen zu können, muss das KMU die Wichtigkeit der Be-<br />
zugsgrößen (z. B. Nutzwert aus der Nutzwertanalyse, Amortisationsdauer) vorab<br />
festlegen.<br />
45
Chance<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Hoch<br />
3<br />
Gering<br />
�� Hohe Chance u.<br />
geringes Risiko<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
�� Geringe Chance<br />
u. geringes Risiko<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
1<br />
Potenz. <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe<br />
4<br />
�� Hohe Chance u.<br />
hohes Risiko<br />
Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
�� Hohes Risiko u.<br />
geringe Chance<br />
Potenz. <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe<br />
2<br />
Hoch<br />
50 100 150<br />
Abbildung 31: Chancen-Risiken-Portfolio<br />
Potenz. <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe<br />
Risiko<br />
Das Portfolio besteht aus einer vier Felder-Matrix. <strong>Die</strong>se Aufteilung ist notwendig, um<br />
die gewünschte <strong>Strategie</strong> im Hinblick auf Chancen und Risiken bei Fremdvergabe<br />
von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen abzuleiten (vgl. Abbildung 31). <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tungspakete, die sich im ersten Quadranten befinden, werden für die Fremdvergabe<br />
empfohlen, weil der Chance ein geringes Risiko gegenübersteht. <strong>Die</strong> unterschiedli-<br />
chen Größen der potenziellen <strong>Die</strong>nstleistungspakete spiegeln das mögliche Einspar-<br />
potenzial aus der Analyse der Kosten sowie den Nutzwert aus der Nutzwertanalyse<br />
wieder. <strong>Die</strong>nstleistungspakete, die sich im ersten Quadranten befinden sind im Ge-<br />
gensatz zu <strong>Die</strong>nstleistungspaketen aus dem vierten Quadranten verhältnismäßig<br />
groß dargestellt, weil diese ein großes Einsparpotenzial und einen hohen Nutzwert<br />
aufweisen und sich damit zur Fremdvergabe eignen.<br />
Zusammenfassung<br />
Bei der Entscheidung über die Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
-paketen ist es notwendig, Chancen und Risiken anhand von unternehmensspezifi-<br />
schen Kriterien zu quantifizieren. Um den bei der Fremdvergabe entstehenden Nut-<br />
zen zu ermitteln, wird die Nutzwertanalyse herangezogen und der ermittelte Nutzwert<br />
sowie die Werte aus der Chancen- und Risikobewertung in das Portfolio übertragen.<br />
Somit dient das Portfolio als visualisierte Entscheidungsgrundlage zur Fremdvergabe<br />
von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben oder -paketen.<br />
46
4.6 AP 6: Konzeption einer Vorgehensweise und Checkliste zur Bewertung<br />
und Auswahl von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern<br />
In Arbeitspaket sechs wird eine Vorgehensweise zur Auswahl potenzieller<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister für die Fremdvergabe erstellt. Dafür werden Ausschreibungsvorla-<br />
gen entworfen, die dem potenziellen PPS-<strong>Die</strong>nstleister einen Überblick über dessen<br />
Leistungsumfang geben sollen. Zur Bewertung der PPS-<strong>Die</strong>nstleister erfolgt die Ü-<br />
bertragung der gewonnenen Erkenntnisse in eine Checkliste.<br />
Ausschreibungsvorlagen<br />
Ausschreibungsvorlagen dienen der Bereitstellung von Informationen (z. B. der Leis-<br />
tungsbeschreibung) für PPS-<strong>Die</strong>nstleister, damit PPS-<strong>Die</strong>nstleister eindeutige Ange-<br />
bote für die geforderte Leistung anfertigen können. Des Weiteren unterstützen Aus-<br />
schreibungsvorlagen bei der Verhandlung und Gestaltung des<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungsvertrages, denn die Ausschreibung ist für die erfolgreiche<br />
Fremdvergabe von Bedeutung. Zunächst folgt eine Begriffserklärung für „Ausschrei-<br />
bung“ und anschließend werden Ausschreibungsverfahren erläutert sowie eine Emp-<br />
fehlung für das Forschungsprojekt „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“ gegeben.<br />
Unter dem Begriff Ausschreibung wird ein formales Dokument verstanden, „welches<br />
von Anbietern den Nachweis einfordert, dass sie ihre Anforderungen erfüllen können“<br />
[Ber05].<br />
Zwei Arten von Ausschreibungsverfahren sind existent, - die klassischen und die e-<br />
lektronisch neu hinzugekommenen -, die ausführlich behandelt werden, denn Verga-<br />
beverhandlungen beruhen auf einer sorgfältigen und professionellen Vorbereitung<br />
[Dau05].<br />
Klassische Ausschreibungen sind häufig geprägt von persönlichen Kontakten. <strong>Die</strong><br />
handelnden Personen sind in der Regel bekannt sowie die Anzahl der Teilnehmer<br />
begrenzt. <strong>Die</strong> Ausschreibung kann mehrere Gesprächsrunden durchlaufen. <strong>Die</strong><br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister, die in die engere Auswahl gelangen, haben die Möglichkeit zur<br />
Selbstpräsentation des angestrebten Vorgehens [Bme08]. Zu den klassischen Aus-<br />
schreibungen gehören u. a. das Lastenheft, das Pflichtenheft, ein Request for Infor-<br />
mation, ein Request for Quotation und ein Request for Proposal.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
47
Das Lastenheft beinhaltet Anforderungen an die Lieferungs- und Leistungsumfänge<br />
eines PPS-<strong>Die</strong>nstleisters, wobei die Leistungskriterien messbar und quantifizierbar<br />
sein müssen (z. B. Stückzahlen, Kosten, Investitionsanforderungen, Qualität) [Lin05]<br />
[Reg06].<br />
Das Pflichtenheft gestaltet der PPS-<strong>Die</strong>nstleister, indem die Umsetzung aller Rand-<br />
bedingungen (z. B. die Gewährleistung zur Sicherstellung der Qualität und äußeren<br />
Einflüssen, die Einhaltung der Gesetzgebung für die Entwicklung der<br />
PPS-Aufgaben) dokumentiert werden [Lin05].<br />
Ein Request for Information (RFI) oder auch erste Informationsanfrage genannt, dient<br />
der Vorauswahl von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern, indem Erkundigungen über das Unterneh-<br />
men, Produkte, <strong>Die</strong>nstleistungen, Referenzen oder Standorte des Anbieters in Erfah-<br />
rung gebracht werden. <strong>Die</strong> Einholung der Auskünfte ist mit wenig Aufwand verbun-<br />
den, weil keine konkreten Daten (z. B. Kosten) abverlangt werden. Daher hat das<br />
RFI unverbindlichen Charakter [Wit09].<br />
Ein Request for Quotation (RFQ) oder auch Angebotsanfrage genannt, verlangt aus-<br />
führlichere und strukturiertere Angebote als das RFI (z. B. unverbindliche Preisemp-<br />
fehlungen). Das RFQ dient als vorab durchzuführende Ausschreibung, um eine wei-<br />
tere Selektion der PPS-<strong>Die</strong>nstleister durchzuführen [Wit09].<br />
Im Request for Proposal (RFP) oder auch als Aufforderung zur Angebotsabgabe be-<br />
zeichnet, werden relevante Daten in Form von Kostenangaben eingefordert. <strong>Die</strong>ses<br />
Ausschreibungsverfahren stellt die umfassendste aller „Requests“ dar [Wit09].<br />
Für das Forschungsprojekt „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“ hat sich der PA für die Anwen-<br />
dung eines Lasten- und Pflichtenheftes aufgrund der geringen Erfahrung mit RFI,<br />
RFQ und RFP entschieden. <strong>Die</strong> Forderungen der Lieferungen und Leistungen sind<br />
dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister eindeutig zu vermitteln. Durch die persönliche Kontaktauf-<br />
nahme zwischen KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister werden Fragen individueller beantwor-<br />
tet und die Chance auf ein detailliertes, aussagekräftiges Angebot erhöht. <strong>Die</strong> Prä-<br />
sentation des Fremdvergabekonzeptes der PPS-<strong>Die</strong>nstleister vor den KMU ermög-<br />
licht offene Fragen zu klären sowie die Kompetenzen hinsichtlich Know-how zu ü-<br />
berprüfen. Der PPS-<strong>Die</strong>nstleister bringt dem KMU Interesse für das Ausschreibungs-<br />
projekt entgegen und kann zu einem verbesserten Umsetzungskonzept der Fremd-<br />
vergabe von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen führen.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
48
Bei den modernen Ausschreibungen besteht kein persönlicher Kontakt von KMU und<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern. <strong>Die</strong> handelnden Personen sind oft anonym. <strong>Die</strong> Teilnehmerzahl<br />
kann unbegrenzt ausgeweitet werden und die PPS-<strong>Die</strong>nstleister haben keine Mög-<br />
lichkeit auf eine Präsentation des angestrebten Vorgehens vor den KMU [Bme08].<br />
Zu den modernen Ausschreibungen zählen u. a. Auktionen.<br />
<strong>Die</strong> Anwendung von Auktionen im Beschaffungsmanagement ist ein junges Phäno-<br />
men [Bme08]. Heutzutage vergeben Unternehmen etwa 25 Prozent des Beschaf-<br />
fungsvolumens über Auktionen [Bme08]. Dabei handelt es sich um eine besondere<br />
Gestaltung der Preisermittlung, bei der am Ende das KMU, der PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
und der Preis zur Fremdvergabe der <strong>Die</strong>nstleistungspakete feststehen. Somit ist das<br />
Ergebnis für die Teilnehmer bindend. Auktionen werden vorwiegend von einer Per-<br />
son (meist KMU) vorbereitet und durchgeführt und mindestens zwei potenzielle<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister sind daran beteiligt. <strong>Die</strong> Abwicklung startet mit einem Anfangsge-<br />
bot, dass die PPS-<strong>Die</strong>nstleister schrittweise unterbieten können und am Ende erhält<br />
der PPS-<strong>Die</strong>nstleister mit dem niedrigsten Gebot den Zuschlag [Bme08].<br />
Für das Forschungsprojekt „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“ verschaffen Auktionen eine<br />
schnelle und effiziente Übersicht der teilnehmenden PPS-<strong>Die</strong>nstleister und deren<br />
Preisstrukturen. Für die Realisierung der Fremdvergabe ist es nötig, auf eine Menge<br />
von Informationen zurückzugreifen und bedarf daher einen intensiven Austausch<br />
zwischen dem KMU und dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister. Auktionen lassen keine Interaktio-<br />
nen zwischen den Beteiligten zu, somit ist die Auktion nicht weiter zu betrachten.<br />
Checkliste zur Bewertung der PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
Eine Checkliste ist ein Hilfsmittel, welches die Beurteilung von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern<br />
der vom Unternehmen vordefinierten spezifischen Kriterien (z. B. Standorte, Kapazi-<br />
täten) ermöglicht. Diverse Kategorien (z. B. Referenzen des PPS-<strong>Die</strong>nstleisters, Ver-<br />
tragsbestandteile, Preis- und Kostenkalkulationen, Prozessbeschreibungen, Einbin-<br />
dung von Kennzahlen, IT-Schnittstellen) können anhand einer Skala von Punkten<br />
(eins bis fünf, wobei fünf die höchste zu vergebene Punktzahl darstellt) gewichtet<br />
werden [Ber05] [Bme08].<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
49
Phasen der <strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
<strong>Die</strong> Phasen zur Auswahl der <strong>Die</strong>nstleister sind in Abbildung 32 dargestellt. <strong>Die</strong> fol-<br />
genden Erläuterungen beziehen sich auf das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und<br />
Reparatur“.<br />
Vorauswahl<br />
Ausschreibungsbearbeitung<br />
Angebotsauswertung<br />
Konzeptpräsentation<br />
Vergabe<br />
Geheimhaltungserklärung<br />
Fragebogen<br />
Projektvorstellung<br />
Phasen der <strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Festlegung der K.O.-Kriterien<br />
Grobe Durchsicht der Angebote<br />
Fachliche Klärung<br />
Bewertung (Nutzwertanalyse)<br />
Angebotspräsentation<br />
Bewertung durch alle Projektbeteiligten<br />
Kombination aus Angebotsauswertung<br />
Referenzbesuche<br />
Preisverhandlung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Bieterliste (max. 10 <strong>Die</strong>nstleister)<br />
Intensive Bewertung von x Angeboten<br />
„Top 3“<br />
Vergabeempfehlung<br />
Optimaler Logistikdienstleister<br />
Abbildung 32: Phasen der <strong>Die</strong>nstleisterauswahl [Dau05]<br />
In der Phase der Vorauswahl erfolgt das Selektieren von geeigneten<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern, die das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Reparatur“ anbieten.<br />
Recherchen über das Internet (z. B. räumliche Anbindung des PPS-<strong>Die</strong>nstleisters,<br />
Informationssuche bei Verbänden bzgl. des Bekanntheitsgrades) erleichtern die Su-<br />
che nach potenziellen PPS-<strong>Die</strong>nstleistern. Ebenso kann die Nutzwertanalyse zur<br />
Eingrenzung der PPS-<strong>Die</strong>nstleister beitragen, indem Kriterien (z. B. Referenzen)<br />
festgelegt werden. Aufgrund des bevorstehenden Aufwandes in Form von Rückfra-<br />
gen und der Minimierung des Bearbeitungsprozesses sollten nicht mehr als zehn<br />
potenzielle PPS-<strong>Die</strong>nstleister angefragt werden [Dau05].<br />
50
<strong>Die</strong> Phase der Ausschreibungsbearbeitung befasst sich mit der inhaltlichen Gestal-<br />
tung des Vertrages. Abzuarbeitende Punkte sind dabei folgende:<br />
1) Ziel und Gegenstand der Ausschreibung, damit der PPS-<strong>Die</strong>nstleister überprü-<br />
fen kann, ob die Kapazitäten, Prozesse oder Know-how für die Übernahme<br />
des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ vorhanden sind. Da-<br />
durch fällt der PPS-<strong>Die</strong>nstleister die Entscheidung, ob eine Teilnahme an ei-<br />
ner Fremdvergabe für ihn interessant ist<br />
2) Darstellung von Materialfluss und Mengengerüst (z. B. Stammdaten, Bewe-<br />
gungsdaten) für die Quantifizierbarkeit der Leistung als Basis für die Preiskal-<br />
kulation<br />
3) Beschreibung von Leistungen, die sich durch Größen (z. B. Bearbeitungszeit,<br />
Fehlerquote, Materialeinsatz) in dem <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Re-<br />
paratur“ eindeutig quantifizieren und in Kosten umrechen lassen<br />
4) Datenverwaltungs- und Steuerungskonzept als Vorlage zur Systemauslegung<br />
von Hard- und Software für den PPS-<strong>Die</strong>nstleister, in dem Daten gespeichert<br />
und verwaltet werden<br />
5) Vertragliche Rahmenbedingungen, um die rechtlichen und wirtschaftlichen<br />
Konsequenzen innerhalb der Vertragslaufzeit einzugrenzen. Darunter fallen<br />
Fragen, wer das Risiko bei Kostenveränderungen von regelmäßigen Kosten<br />
(z. B. Instandhaltungskosten) bei „Wartung und Reparatur“ trägt oder welche<br />
Auswirkungen für den PPS-<strong>Die</strong>nstleister im Fall eines rechnerisch fehlerhaften<br />
Angebotes resultieren<br />
6) Vorgabe der Kalkulationsschemas und Preisblätter, die zur Vereinheitlichung<br />
der Preisangaben und Bezugsgrößen (z. B. regelmäßig anfallende Kosten für<br />
das Personal) dienen, um die Angebote transparent zu gestalten<br />
7) Organisation der Ausschreibung unterstützt die Kommunikation zwischen dem<br />
KMU und dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister, indem u. a. Vorgehensweisen, Abgabefris-<br />
ten, Ansprechpartner der betreffenden Abteilungen geklärt werden [Kra05]<br />
[Dau06]<br />
In der Phase der Angebotsauswertung werden geeignete von ungeeigneten<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern differenziert, indem nach qualitativen Aspekten (z. B. Erfahrun-<br />
gen, räumliche Nähe, Kompetenz) gefiltert wird. <strong>Die</strong> jeweiligen Angebotsleistungen<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
51
(z. B. strukturierte Preisblätter) werden transparent und vergleichbar gestaltet. Weite-<br />
re Kriterien (z. B. Kapazitäten, Qualitätsanforderungen, eingesetzte Kennzahlen,<br />
Schnittstellen) können einzeln anhand einer Nutzwertanalyse gewichtet und bewertet<br />
werden. <strong>Die</strong>s ermöglicht einen weiteren Ausschluss von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern [Dau05].<br />
<strong>Die</strong> zu betrachtenden Schnittstellen wurden in Abstimmung mit dem PA bereits in der<br />
Nutzwertanalyse in Kapitel fünf berücksichtigt.<br />
<strong>Die</strong> begrenzte Anzahl der in Frage kommenden PPS-<strong>Die</strong>nstleister haben in der Pha-<br />
se der Konzeptpräsentation die Möglichkeit, ihr Konzept dem KMU persönlich zu<br />
präsentieren. Das Konzept durchläuft eine fachliche und kompetente Wertung hin-<br />
sichtlich der Nachvollziehbarkeit von Prozessen, Verhandlung von Preisen und Kon-<br />
ditionen [Dau05].<br />
Bei der Vergabephase wird die Entscheidung für einen PPS-<strong>Die</strong>nstleister getroffen,<br />
mit dem in Zukunft zusammen gearbeitet werden soll. Formale Aspekte (z. B. die<br />
Vertragsgestaltung) sind individuell zu vervollständigen und exakt zwischen KMU<br />
und PPS-<strong>Die</strong>nstleister zu kommunizieren [Dau05].<br />
Verfahren der <strong>Die</strong>nstleisterbewertung und -auswahl<br />
In Abbildung 33 wird eine Übersicht über eine Vielzahl von Methoden zur Bewertung<br />
und Auswahl von PPS-<strong>Die</strong>nstleistern dargestellt. Dabei wird zwischen quantitativen<br />
und qualitativen Verfahren unterschieden. Bei quantitativen Methoden existieren<br />
konkrete Zahlenwerte, so dass die Resultate bewertbar sind. Qualitative Verfahren<br />
beruhen auf erhobenen Informationen, die sich unabhängig von ihrer Quantifizierbar-<br />
keit erfassen lassen (z. B. Referenzkriterien) [Suc06].<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
52
Quantitative Verfahren Qualitative Verfahren<br />
Preis-Entscheidungsanalyse Numerische Verfahren<br />
Kosten-Entscheidungsanalyse<br />
Cost-Ratio-Method<br />
Total Cost Supplier Selection Model<br />
Kostenvergleichsverfahren<br />
Optimierungsverfahren<br />
Lineare Programmierung<br />
Goal-Programming-Ansätze<br />
Kennzahlenverfahren<br />
Bilanzanalyse<br />
Verfahren der Lieferantenbewertung und -auswahl<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Notensysteme<br />
Punktbewertungsverfahren<br />
Matrix-Approach<br />
Nutzwertanalyse<br />
Verbale Verfahren<br />
Checklistenverfahren<br />
Portfolio-Analyse<br />
Lieferantentypologien<br />
Profilanalyse<br />
Graphische Verfahren<br />
Lieferanten-Gap-Analyse<br />
Abbildung 33: Verfahren der Lieferantenbewertung und -auswahl [Suc06]<br />
Des Weiteren sollte eine Klassifikation in strategische Bewertungen (z. B. Kostenpo-<br />
sitionen, Einhaltung von Zielpreisen, Qualitätsmanagementsystemen) und operativen<br />
Kriterien (z. B. Liefertreue, Lieferfähigkeit) vorgenommen werden, um lang- und kurz-<br />
fristig den Zielerreichungsgrad überprüfen zu können. Nach dieser Einteilung wird<br />
eine Gesamtbewertung vorgenommen, die es ermöglicht, das Fehlerrisiko zu verrin-<br />
gern [Sto00].<br />
Im Folgenden werden einige Beispiele zum inhaltlichen Aufbau einzelner Kategorien<br />
für das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Reparatur“ gegeben.<br />
<strong>Die</strong> Einteilung in die Vertragsbestandteile beschäftigt sich mit Aspekten zur Ver-<br />
tragsgestaltung. Art und Umfang der <strong>Die</strong>nstleistung, Zuständigkeits- und Verantwor-<br />
tungsbereiche, Flexibilität im Zeitverlauf, Preisbindung, Preisanpassung, Kündi-<br />
gungsfristen uvm. sind abzuwägen und einzuschätzen. <strong>Die</strong> Geheimhaltung wichtiger<br />
Informationen (z. B. Datenschutz) ist ein weiterer Bestandteil. <strong>Die</strong> Vertragslaufzeit ist<br />
eine wichtige Konstante: abzuwägen ist die Entscheidung, ob kurze oder lange Lauf-<br />
53
zeiten für das <strong>Die</strong>nstleistungspaket „Wartung und Reparatur“ erfolgversprechend<br />
sind [Hol05].<br />
Abbildung 34 stellt eine Checkliste für das Kriterium Auswahl des geeigneten PPS-<br />
<strong>Die</strong>nstleisters dar. <strong>Die</strong> KMU beurteilen anhand einer Skala die Wichtigkeit wesentli-<br />
cher Kriterien.<br />
Bestehende Geschäftsbeziehungen<br />
Referenzen<br />
Fragen zum PPS-<strong>Die</strong>nstleister (Kriterium „Auswahl des Partners“)<br />
Wie beurteilen Sie die Bedeutsamkeit der folgenden Kriterien bei der Wahl eines PPS-<strong>Die</strong>nstleisters?<br />
1= gar nicht 2= in geringem Umfang 3= in mittlerem Umfang 4= in hohem Umfang 5= in sehr hohem Umfang<br />
Name, Größe, Standort des PPS-<strong>Die</strong>nstleisters<br />
Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft<br />
Vertrauen in den PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
Flexibilitätsanpassung im Zeitverlauf<br />
Fachkenntnisse, Know-how<br />
zusätzliche Kriterien: ________________________<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Bedeutsamkeit der jeweiligen Kriterien<br />
1 2 3 4 5<br />
Abbildung 34: Fragenkatalog an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister [Hol05]<br />
Vereinbarungen im Bereich Kapazität befassen sich beispielsweise mit folgenden<br />
Fragestellungen an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister:<br />
(1) Sind ausreichend Kapazitäten beim PPS-<strong>Die</strong>nstleister vorhan-<br />
den?<br />
(2) Gibt es einen Projektstrukturplan mit Ressourcenplan?<br />
(3) Ist ein Notfallplan und/oder Notfallstrategie vorhanden?<br />
(4) Wurden eventuelle Maßnahmen in der Vergangenheit als Prob-<br />
lemlösung eingeleitet?<br />
54
Zusammenfassung<br />
Eine sorgfältige Ermittlung nach potenziellen PPS-<strong>Die</strong>nstleistern ist empfehlenswert,<br />
damit der Koordinationsaufwand nicht zu hoch ausfällt. <strong>Die</strong> Ausschreibungsvorlagen<br />
sollten präzise formuliert sein, damit sowohl die potenziellen PPS-<strong>Die</strong>nstleister als<br />
auch die KMU den gleichen Informationsstand über das Fremdvergabeprojekt haben<br />
und es nicht zu Missverständnissen kommt. Für die PPS-<strong>Die</strong>nstleister ist es unab-<br />
dingbar, ein für das KMU individuelles Angebot zu erstellen, um in die Phase der<br />
Vorauswahl aufgenommen zu werden. Neben der fachlichen Kompetenz der<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister muss die Kommunikationsfähigkeit und/oder Kommunikationsbe-<br />
reitschaft zwischen KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister in hohem Maß vorhanden sein, um<br />
eventuell auftretende Herausforderungen hinsichtlich der <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben<br />
und -paketen zeitnah zu lösen. <strong>Die</strong> Dokumentation unter Verwendung der erstellten<br />
Checklisten bieten KMU die Möglichkeit strukturiert und aufwandsarm ihre<br />
PPS-Aufgaben für eine Fremdvergabe an PPS-<strong>Die</strong>nstleister zu bewerten.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
55
4.7 AP 7: Erstellung von Referenzprozessen für die Zusammenarbeit zwi-<br />
schen KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleistern<br />
Um die Umsetzung der Entscheidung des PPS-<strong>Die</strong>nstleisters realisieren zu können,<br />
wird in Arbeitspaket sieben ein Referenzprozess sowohl für die „Einführungsphase“<br />
als auch für den „Laufenden Betrieb“ einer <strong>Die</strong>nstleisterkooperation erstellt.<br />
Referenzprozesse für die „Einführungsphase“ einer <strong>Die</strong>nstleisterkooperation<br />
Referenzmodelle von Prozessen dienen als Analyse- und Optimierungsinstrument.<br />
<strong>Die</strong> Schwachstellen können analysiert und die Prozesse optimiert werden, da die<br />
Transparenz der Identifizierung von Prozessen und Strukturen erhöht wird. Durch die<br />
Bereitstellung einer einheitlichen Basis eignen sich Referenzmodelle als Kommunika-<br />
tions- und Orientierungshilfe und können somit als ein Hilfsmittel zur Standardisie-<br />
rung durch Festlegung von Anforderungen fungieren. Um all diese Vorteile nutzen zu<br />
können, sollte ein Referenzmodell einen allgemeingültigen Charakter aufweisen<br />
[Sch09].<br />
Das Referenzmodell muss eine Reihe von Anforderung erfüllen, um die genannten<br />
Eigenschaften gewährleisten zu können. <strong>Die</strong> Struktur des Referenzprozesses sollte<br />
widerspruchfrei aufgebaut sein.<br />
In Abbildung 35 ist der Referenzprozess für die Einführungsphase des Fremdverga-<br />
beprozesses dargestellt.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
56
Output<br />
Hersteller<br />
Fachkräfte<br />
bereitstellen<br />
Input Input<br />
Projektteam<br />
bilden<br />
Fachkräfte<br />
bereitstellen<br />
Was, wie<br />
und wann<br />
Umsetzungskonzept<br />
- Was, wie<br />
und wann<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
Risiken der<br />
Umstellung<br />
ermitteln<br />
Notfallplan<br />
erstellen<br />
Gegenmaßnahmen<br />
ermitteln<br />
Schnittstellen<br />
vorbereiten<br />
Übernahme IT<br />
Infrastruktur<br />
ggf. Personal<br />
Integration<br />
IT-Infrastruktur<br />
ggf. Personal<br />
Erforderliche<br />
Stammdaten<br />
vorbereiten<br />
Datenübergabe<br />
planen<br />
Eingehende<br />
mit eigenen<br />
anpassen<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Auftrag<br />
veranlassen<br />
Testlauf<br />
durchführen<br />
Auftrag<br />
bearbeiten<br />
Prozessfehler<br />
melden<br />
Prozessanpassung<br />
Prozessfehler<br />
beheben<br />
Personal<br />
bereitstellen<br />
Anwender<br />
schulen<br />
Personal<br />
bereitstellen<br />
Abbildung 35: Referenzprozess "Einführungsphase" [Hod06]<br />
Controlling<br />
Referenzprozess<br />
Projektteam<br />
auflösen<br />
Controlling<br />
Bei einem Fremdvergabeprojekt ist die Überführung die aufwändigste und kritischste<br />
Phase. Daher sollte diese Phase, um mögliche Probleme frühzeitig erkennen zu<br />
können, genau durchdacht und beschrieben werden. Nicht rechtzeitig erkannte Prob-<br />
leme können das Projekt erschweren oder es zum Scheitern bringen. Durch gut defi-<br />
nierte Referenzmodelle kann erfahrungsgemäß Zeit und Geld eingespart sowie die<br />
Qualität gesichert werden [Hod06].<br />
Jeder Schritt der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und PPS-<strong>Die</strong>nstleister sowie<br />
jede darin enthaltene Tätigkeit wird im Modell wie folgt dargestellt:<br />
� Bildung eines Projektteams<br />
� Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes<br />
� Erstellung eines Notfallplans<br />
� Übernahme der IT-Struktur ggf. Personalübernahme<br />
� Planung der Datenübergabe<br />
� Testlauf starten<br />
� Prozessanpassung<br />
� Schulung der Anwender<br />
� Auflösung des Projektteams<br />
57
Zu Beginn des Projektes sollte eine kompetente Projektorganisation sowohl vom<br />
Hersteller als auch vom PPS-<strong>Die</strong>nstleister aufgebaut werden. Somit werden eine<br />
funktionale Kommunikation und ein funktionaler Informationsfluss gewährleistet. Dar-<br />
über hinaus ist es relevant, dass die Verantwortung der jeweiligen Funktionen und<br />
Aufgaben auf die ausgewählten Personen übertragen und dokumentiert werden<br />
[Hor96].<br />
Nach der Bildung des Projektteams müssen die Projektmitarbeiter ein Umsetzungs-<br />
konzept entwickeln, das die anfallenden Fragen zum Projekt erklärt. Dabei werden<br />
relevante Themen bearbeitet, die im Rahmen der Umsetzung realisiert werden<br />
[Sch09]. Relevante Thematiken sind u. a. Personalübernahme, Abnahmekriterien,<br />
Risiken und Art der Kommunikation. Nachdem der Inhalt des Umsetzungskonzepts<br />
klar definiert worden ist, werden Teilaufgaben (z. B. die Erstellung eines Notfallplans,<br />
die Implementierung von Anwendungssoftware) auf einzelne Projektgruppen verteilt<br />
(vgl. Abbildung 36).<br />
Projektteam 1<br />
Hardware<br />
Mitarbeiter<br />
Unternehmen<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Projektlenkungsausschuß<br />
Unternehmen <strong>Die</strong>nstleister<br />
Geschäfts,-<br />
Betriebs,- oder Geschäftsleitung<br />
Bereichsleitung<br />
Gesamtprojektleitung<br />
Projektmanagement<br />
Gesamtprojektleitung<br />
Unternehmen <strong>Die</strong>nstleister<br />
Projektleiter Projektleiter<br />
Leiter der<br />
Projektteams<br />
Projektteam 2<br />
Software A, B und C<br />
Mitarbeiter<br />
Unternehmen<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Leiter der<br />
Projektteams<br />
Projektteam 3<br />
Mitarbeiterüberleitung<br />
Mitarbeiter<br />
Unternehmen<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Projektteam 4<br />
Prozessanpassung<br />
Mitarbeiter<br />
Unternehmen<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Abbildung 36: Organigramm der Projektorganisation [Hor96]<br />
Eine „Überwachungsinstanz“ wie das Controlling überwacht und dokumentiert die<br />
erarbeiteten Ergebnisse. Sobald die fremd zu vergebenen PPS-<strong>Die</strong>nstleistung vom<br />
58
PPS-<strong>Die</strong>nstleister ausgeführt wird, kann mit der Auflösung des Teams aus der Ein-<br />
führungsphase begonnen werden. Vorher sollte ein Testlauf gestartet werden, um<br />
mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen [Hod06].<br />
Feinterminplanung der Prozessschritte<br />
Jeder Prozessschritt wird in einer logischen und terminlichen Abfolge in einem hohen<br />
Detaillierungsgrad geplant. Dabei ist es wichtig, die Struktur der Feinterminplanung<br />
mit Abstimmung aller Projektbeteiligten festzulegen. Für die Durchführung der Fein-<br />
terminplanung ist der Projektleiter verantwortlich. Einzelne Feinterminplanungsaktivi-<br />
täten (z. B. die Planung der Termine, Planung der Durchlaufzeiten) erfolgen durch<br />
den Projektleiter.<br />
„Einführungsphase“ Feinterminplanung<br />
Ein Projektteam aus KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister wird zusammengestellt. <strong>Die</strong> Ge-<br />
samtprojektleitung, die aus der Geschäftsleitung des PPS-<strong>Die</strong>nstleisters und dem<br />
Produktionsleiter des KMU besteht, legt fest, welche Fachkräfte in dem Projekt mit<br />
aufgenommen werden. Dabei wird das Was, Wie und Wann ausführlich beschrieben,<br />
z. B. die Erstellung eines Feinterminplanungsschemas sowie die Festlegung des<br />
„Kritischen Pfades“ (Prozess mit den längsten Durchlaufzeiten) durch eine Rück-<br />
wärtsterminierung. <strong>Die</strong> Diskussion über die Übernahme der IT bzw. des Personals<br />
sowie über die Erstellung eines Notfallplans findet jeweils in gebildeten Projektteams<br />
statt. Sobald die Planung abgeschlossen ist, wird das Projektteam aufgelöst und die<br />
Informationen an das Controlling weitergegeben.<br />
Referenzprozesse für den „Laufenden Betrieb“ einer <strong>Die</strong>nstleisterkooperation<br />
Bei dem Vergleich der Referenzprozesse „Laufender Betrieb“ und „Einführungspha-<br />
se“ ist festzustellen, dass sich die Referenzprozesse insbesondere in den Aktivitäten<br />
unterscheiden. In der „Einführungsphase“ handelt es sich überwiegend um Aktivitä-<br />
ten hinsichtlich der Diskussion und Definition des Rahmenvertrages sowie eines Ser-<br />
vice Level Agreements, der auf dem Rahmenvertrag basiert. Dagegen geht es in<br />
dem „Laufenden Betrieb“ um Controlling, Reporting und Anpassung (vgl. Abbildung<br />
37). <strong>Die</strong> in der „Einführungsphase“ erarbeiteten Ergebnisse müssen in der „Betriebs-<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
59
phase“ gefestigt und ständig optimiert werden [Hod06]. Dabei muss sich der Prozess<br />
einem permanenten Leistungscheck unterziehen, wobei die Kennzahlen fortlaufend<br />
vom Controlling auf interne und externe Anforderungen überprüft werden. Das Cont-<br />
rolling findet sowohl bei dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister als auch bei KMU statt.<br />
Output<br />
Input<br />
Hersteller<br />
Datenübergabe<br />
Auftrag<br />
PPS<br />
Datenerfassung Datenverarbeitung<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
Auftrag<br />
realisierbar?<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
ja<br />
Nein Notfallplan<br />
<strong>Die</strong>nstleistung<br />
Auftrag umsetzen<br />
- Information - Ressource<br />
- Verzweigung - Tätigkeit<br />
Zusammenfassung<br />
PPS<br />
Referenzprozess<br />
<strong>Die</strong>nstleistung<br />
übernehmen<br />
PPS<br />
Auftrag nicht<br />
realisierbar<br />
Notfallplan<br />
- QS = Qualitätssicherung<br />
Abbildung 37: Referenzprozess „Laufender Betrieb“ [Hod06]<br />
Um den Erfolg der Umsetzung von Referenzprozessen zu erhöhen, sind Risiken zu<br />
minimieren sowie Schwächen rechtzeitig zu erkennen. Daher ist auf die genaue Er-<br />
stellung des Referenzprozesses mit Hilfe eines geeigneten Projektteams zu achten.<br />
Nur wenn die genauen Arbeitsschritte bei der zu vergebenen <strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe<br />
bekannt sind, können die dafür notwendigen Fachkräfte in das Projektteam einge-<br />
bunden werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die anfallenden Tätigkeiten genau<br />
zu definieren. <strong>Die</strong> Referenzprozesse für die „Einführungsphase“ und für den „Lau-<br />
fenden Betrieb“ einer <strong>Die</strong>nstleisterkooperation wurden erstellt.<br />
QS<br />
Controlling<br />
60
4.8 AP 8: Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung des Handlungsleit-<br />
fadens<br />
In Arbeitspaket acht wird anhand eines webbasierten dynamischen Handlungsleitfa-<br />
dens eine Zusammenfassung der in den Arbeitspaketen eins bis sieben gesammel-<br />
ten und für einen Praxiseinsatz erforderlichen Informationen gegeben. Der Hand-<br />
lungsleitfaden stellt ein Hilfsmittel für KMU dar, um eine aufwandsarme, leichte und<br />
praxisnahe Anwendbarkeit der Methode zur Bewertung und Entscheidung, ob und<br />
welche der PPS-Aufgaben zur Fremdvergabe geeignet sind, zu ermöglichen. Das<br />
Ergebnis zielt auf einen einheitlichen, in jedem KMU einsetzbaren Handlungsleitfa-<br />
den, der Potenziale der Fremdvergabe von PPS-Aufgaben an einen PPS-<br />
<strong>Die</strong>nstleister Verbesserungspotenziale unter Berücksichtigung von resultierendem<br />
Nutzen und Risiko erkennt, bewertet und realisiert.<br />
Handlungsleitfaden für KMU zur Fremdvergabe von PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
<strong>Die</strong> Anwendung des webbasierten dynamischen Handlungsleitfadens gestaltet sich<br />
wie folgt: Der Nutzer hat die Option zwischen drei Bereichen „Unternehmen“,<br />
„<strong>Die</strong>nstleister„ und „<strong>Die</strong>nstleister/Unternehmen“, zu wählen. <strong>Die</strong> Kategorie „Unter-<br />
nehmen“ beschreibt alle PPS-Aufgaben (z. B. Produktionsprogrammplanung, Pro-<br />
duktionsbedarfsplanung, Eigenfertigungsplanung und –steuerung) und alle PPS-<br />
Unteraufgaben in Anlehnung an das Aachener PPS-Modell. Gleichzeitig sind mögli-<br />
che Chancen und Risiken der Fremdvergabe unternehmensintern abzuwägen. <strong>Die</strong><br />
Einteilung „<strong>Die</strong>nstleister“ gibt einen Überblick der Unternehmensaufgaben nach dem<br />
SCOR Modell. <strong>Die</strong> Fertigungsstrategie ist vom Unternehmen spezifisch anzupassen.<br />
Anhand der Kriterien „Zeit“, „Schnittstelle“, „Komplexität“ und „Datentyp“ wird über-<br />
prüft, inwieweit sich <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zur Fremdvergabe eignen. Unter Be-<br />
achtung der Eignung bzw. Nichteignung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben für die Zu-<br />
sammenfassung zu einem potenziellen <strong>Die</strong>nstleistungspaket erfolgt die Bewertung<br />
anhand potenziellen Nutzens sowie dem Aufdecken möglicher Chancen und Risiken.<br />
<strong>Die</strong> Kategorie „<strong>Die</strong>nstleister/Unternehmen“ befasst sich mit dem Prozess zur Aus-<br />
wahl und Bewertung eines für das KMU geeigneten PPS-<strong>Die</strong>nstleisters.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
61
Klassifizierung der PPS-Aufgaben in der Kategorie „Unternehmen“<br />
In der Kategorie „Unternehmen“ sind die Kern- und Querschnittsaufgaben in Anleh-<br />
nung an das Aachener PPS-Modell dargestellt. Um die Klassifizierung der<br />
PPS-Aufgaben zu vereinfachen, sind entsprechende Erläuterungen über eine Hilfe-<br />
funktion zu den Klassen beigefügt. Des Weiteren lassen sich die PPS-Aufgaben mit-<br />
hilfe zweier Button „Bewerten“ und „Bearbeiten“ bearbeiten (vgl. Abbildung 38).<br />
Abbildung 38: Ansicht der PPS-Aufgaben in der Kategorie „Unternehmen"<br />
<strong>Die</strong> Bewertung der PPS-Aufgaben erfolgt über einen individuell gestaltbaren Chan-<br />
cen- und Risikenkatalog. Mit Hilfe des Buttons „Bearbeiten“ werden<br />
PPS-Unteraufgaben über eine Hilfefunktion detailliert beschrieben und dienen damit<br />
der eindeutigen Zuordnung in den jeweiligen Unternehmensbereich bzw. Abteilung.<br />
<strong>Die</strong> Abbildung 39 verdeutlicht den Prozess. Ebenfalls lassen sich beispielsweise<br />
Stammdaten zu Lieferanten (z. B. betroffene Abteilung, Adresse, Ansprechpartner,<br />
Zahlungs- und Lieferbedingungen) über den Button „Pflegen“ erfassen. Eine Anpas-<br />
sung bzw. Erweiterung des Chancen- und Risikenkataloges, der<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
62
PPS-Unteraufgaben und der Stammdaten ist durch den Anwender individuell mög-<br />
lich.<br />
Abbildung 39: Ansicht der PPS-Unteraufgaben, deren Einordnung in betroffene Abteilung und<br />
Pflege der Stammdaten<br />
Bewertung der PPS-Aufgaben in der Kategorie „<strong>Die</strong>nstleister“<br />
Nachdem die PPS-Aufgaben detailliert beschrieben und allgemein auf Chancen und<br />
Risiken bewertet sowie die Stammdaten erfasst worden sind, kann über die Katego-<br />
rie „<strong>Die</strong>nstleister“ auf die Auswahlliste der einzelnen PPS-Aufgaben zugegriffen wer-<br />
den. Das Unternehmen kann aus der Auswahlliste, die individuell erweitert werden<br />
kann, PPS-Aufgaben auswählen, um diese auf mögliche Fremdvergabe zu überprü-<br />
fen. Nach der Auswahl der PPS-Aufgaben (z. B. Feintermin-, Wartungs- oder Repa-<br />
raturplanung) werden diese über den Link „Details“ anhand von Kriterien wie „Zeit“<br />
oder „Schnittstellen“ bearbeitet. <strong>Die</strong> Bearbeitung wird (vgl. Abbildung 40) über den<br />
Button „Vergleich“ auf einer möglichen „Verschmelzung“ der <strong>Die</strong>nstleistungsaufga-<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
63
en zu einem <strong>Die</strong>nstleistungspaket bewertet. Durch die Zusammenfassung der<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben zu einem <strong>Die</strong>nstleistungspaket werden die Schnittstellen<br />
verringert und möglicherweise die Kosten minimiert.<br />
Abbildung 40: Ausschnitt des Vergleichs der PPS-Aufgaben<br />
Vor einer endgültigen Entscheidung über die Fremdvergabe von <strong>Die</strong>nstleisteraufga-<br />
ben oder -paketen müssen Fragen bezüglich des Nutzwertes, des Einsparpotenzials,<br />
der Amortisationsdauer sowie der Chancen und Risiken bei einer Fremdvergabe be-<br />
antwortet und abgewogen werden. <strong>Die</strong> Abbildung 41 verdeutlicht die einzelnen Be-<br />
wertungskriterien (z. B. Nutzwert, Einsparpotenzial, Amortisationsdauer) für eine<br />
Fremdvergabe von PPS-Aufgaben.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
64
Abbildung 41: Ansicht der Bewertung von PPS-Aufgaben<br />
Um den Nutzwert der <strong>Die</strong>nstleisteraufgaben oder -paketen bei einer Fremdvergabe<br />
zu ermitteln, erfolgt die Bewertung der Kriterien. <strong>Die</strong> Bewertung gelangt über den<br />
Button „Durchführen“. In Bezug auf die Kategoriegruppen <strong>Strategie</strong>, Leistung, Kos-<br />
ten, Personal und IT wird der Nutzwert durch die Bewertung der Hauptkriterien Quali-<br />
tät und Komplexität von den jeweiligen Personen (z. B. Geschäftsführer, Abteilungs-<br />
leiter) ermittelt. Aus der Summe der einzelnen Bewertungen ergibt sich der Nutzwert<br />
(vgl. Abbildung 42).<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
65
Eingabefeld<br />
Abbildung 42: Ausschnitt der Nutzwertanalyse<br />
<strong>Die</strong> Vorgehensweise zur Ermittlung des Einsparpotenzials wird am Beispiel „War-<br />
tung“ näher erläutert. <strong>Die</strong> Abbildung 43 verdeutlicht, dass vorab die Personalkosten-<br />
bestandteile sowohl im eigenen Betrieb als auch beim PPS-<strong>Die</strong>nstleister ermittelt<br />
werden müssen. <strong>Die</strong> Differenz der Kosten ergibt das mögliche Einsparpotenzial.<br />
Nach der Berechnung des Einsparpotenzials folgt die Ermittlung der Amortisations-<br />
dauer. Gemäß der Auswahl des Buttons „Durchführen“ aus der Spalte „Amortisati-<br />
onsdauer“ müssen sowohl die einmaligen Kosten als auch das Einsparpotenzial ein-<br />
getragen werden. Mithilfe der Formel zur Amortisation wird die Amortisationsdauer<br />
berechnet. Anschließend erfolgt die Bewertung der Chancen und Risiken der ausge-<br />
wählten <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
66
Abbildung 43: Ansicht des monatlichen Einsparpotenzials<br />
Auswahl und Bewertung von PPS-<strong>Die</strong>nstleister sowie Erstellung des Referenz-<br />
prozesses in der Kategorie „<strong>Die</strong>nstleister/Unternehmen“<br />
<strong>Die</strong> Kategorie „<strong>Die</strong>nstleister/Unternehmen“ stellt die Auswahl und Bewertung geeig-<br />
neter PPS-<strong>Die</strong>nstleister dar, die sich anhand einer Checkliste mittels vordefinierten<br />
spezifischen Kriterien (z. B. Kapazität, Standort, Referenzen, Preise) eingrenzen las-<br />
sen (vgl. Abbildung 44). Zudem werden wichtige Prozessschritte bearbeitet, die für<br />
die Erstellung eines Referenzprozesses dienen. Einzelne Prozessschritte (z. B. die<br />
Bildung eines Projektteams, das Umsetzungskonzept, die Erstellung eines Notfall-<br />
plans, die Durchführung eines Testlaufs) werden über eine Hilfefunktion beschrieben<br />
und sind beliebig durch den Anwender erweiterbar. <strong>Die</strong> Zuständigkeit für die ver-<br />
schiedenen Prozessschritte ist nach KMU und PPS-<strong>Die</strong>nstleister aufgezeigt.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
67
Abbildung 44: Checkliste zur Auswahl und Bewertung von PPS-<strong>Die</strong>nstleister<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
68
5 Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für KMU<br />
5.1 Voraussichtliche Nutzung der angestrebten Forschungsergebnisse<br />
Der Nutzen der erzielten Projektergebnisse wird von der Industrie hoch eingeschätzt,<br />
weil produzierende Unternehmen in Deutschland einem enormen Kosten- und Wett-<br />
bewerbsdruck ausgesetzt sind und der Handlungsleitfaden diesen Unternehmen so-<br />
wohl Möglichkeiten zu Kostensenkungen im Bereich der PPS als auch zur Verbesse-<br />
rung von Logistikleistungen aufzeigt. In jedem produzierendem KMU ist das Ergebnis<br />
unabhängig von der Art der vorhandenen PPS einsetzbar, ohne das an der zugrunde<br />
liegenden Methodik Änderungen vorgenommen werden müssen.<br />
5.2 Möglicher Beitrag zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähig-<br />
keit der KMU<br />
Aus traditioneller Sicht wurden bisher nur kernferne Bereiche des Unternehmens<br />
ausgelagert. Um weitere Wettbewerbsvorteile schaffen zu können, ist es notwendig<br />
auch kernnahe Bereiche auszulagern und somit vom Wissen und Potenzial des<br />
<strong>Die</strong>nstleisters zu profitieren. Durch die Nutzung der entwickelten Methode werden<br />
Unternehmen in die Lage versetzt, PPS-Aufgaben zu identifizieren und wenn möglich<br />
zu einem <strong>Die</strong>nstleistungspaket zusammenzufassen, auf den möglichen Nutzen sowie<br />
Chancen und Risiken zu überprüfen.<br />
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass zunehmend auch KMU dem harten<br />
Wettbewerb der Konkurrenz aus Niedriglohnländern standhalten müssen. Um nach-<br />
haltig dem starken Preisdruck und der steigenden Qualitätsanforderung standhalten<br />
zu können, sind diese gezwungen, innovative Ideen umzusetzen. Durch die in die-<br />
sem Forschungsprojekt entwickelte Methode und den Handlungsleitfaden können<br />
KMU Chancen und Nutzen der Fremdvergabe schneller erkennen und Risiken mini-<br />
mieren sowie Vorteile in Bezug auf <strong>Strategie</strong>, Kosten, Qualität sichern.<br />
<strong>Die</strong> eigenverantwortliche Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung bestehender<br />
PPS-Aufgaben durch einen PPS-<strong>Die</strong>nstleister ist nur deshalb möglich, weil der<br />
<strong>Die</strong>nstleister auch den zukünftigen, reibungslosen Routineablauf verantwortet. Der<br />
Nutzen einer Einführung durch den <strong>Die</strong>nstleister liegt in der Vermeidung von Perso-<br />
nalengpässen und eines aufgrund der größeren Erfahrung und Routine der<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
69
PPS-<strong>Die</strong>nstleister stabileren Umstellungsprozesses. Um sicherzustellen, dass die<br />
Kooperation mit einem PPS-<strong>Die</strong>nstleister zufrieden stellend und entsprechend der<br />
gesteckten Ziele verläuft, werden den KMU Vorgehensweisen zur Verfügung gestellt,<br />
mit denen sich die Eignung potenzieller <strong>Die</strong>nstleister beurteilen lässt. <strong>Die</strong> notwendi-<br />
gen Abstimmungen mit dem PPS-<strong>Die</strong>nstleister sind vorzunehmen um eine prozess-<br />
sichere Einführungsphase der Kooperation sowie einen reibungslosen späteren lau-<br />
fenden Betrieb zu ermöglichen. Als Ergebnis kann der Anwender die durch eine Ver-<br />
lagerung von PPS-Aufgaben auf einen <strong>Die</strong>nstleister erschließbare Verbesserungspo-<br />
tenziale erkennen, bewerten und realisieren. Neben dem quantitativ prognostizierba-<br />
ren wirtschaftlichen Netto-Nutzen werden die zu erwartenden Chancen und Risiken<br />
deutlich.<br />
6 Umsetzung der Forschungsergebnisse<br />
<strong>Die</strong> Forschungsergebnisse werden Gegenstand von produktionsorganisatorischen<br />
und technischen Vorlesungen an Hochschulen sein, um das Potenzial von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen aufzuzeigen. Durch das Institut für Integrierte Produktion Han-<br />
nover gGmbH (IPH) wird die Verbreitung der Forschungsergebnisse in Forschung<br />
und Lehre sichergestellt.<br />
Durch die Einbindung von Industrieunternehmen in das Projekt „PPS als <strong>Die</strong>nstleis-<br />
tung“ wurde die Überprüfung der Maßnahmen hinsichtlich der technischen und orga-<br />
nisatorischen Realisierbarkeit sichergestellt und die praktische Umsetzbarkeit und<br />
Akzeptanz der Projektergebnisse signifikant erhöht. <strong>Die</strong> beteiligten Industrieunter-<br />
nehmen haben eine Vielzahl von Kunden-Lieferanten-Beziehungen, so dass Multipli-<br />
kationseffekte zu externen Geschäftspartnern zu erwarten sind.<br />
Unternehmenszweck des IPH ist die anwendungsorientierte Forschung und Entwick-<br />
lung sowie der Technologietransfer auf dem Gebiet der innovativen Produktionstech-<br />
nik. Seit Jahren führt das Institut regelmäßig Seminare für KMU durch, um die neues-<br />
ten Forschungsergebnisse in die Industrie zu transferieren. Im Kontext des beantrag-<br />
ten Vorhabens waren vor allem die Schwerpunkte Produktionslogistik und<br />
-management sowie Supply Chain Management (SCM) von besonderem Interesse.<br />
Zur Durchführung des Forschungsvorhabens wurde ein projektbegleitender Aus-<br />
schuss (PA) (vgl. Tabelle 6) gebildet, in dem sich die Projektpartner über die ge-<br />
sammelten Erfahrungen sowie die Projektergebnisse austauschten und das weitere<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
70
Vorgehen im Projekt detaillieren konnten. Der Arbeitsfortschritt sowie die Zwischen-<br />
und Endergebnisse wurden regelmäßig diskutiert, bewertet und im Rahmen von Ein-<br />
zelterminen bei Unternehmensbesuchen und Treffen des PA mit den Praxisanforde-<br />
rungen abgestimmt. Workshops und Arbeitstreffen dienten zur zielorientierten, unter-<br />
nehmensübergreifenden Bearbeitung bestimmter Projektinhalte. <strong>Die</strong> Zusammenar-<br />
beit mit den Unternehmen sicherte die Praxistauglichkeit der Ergebnisse. Der Kennt-<br />
nistransfer zwischen den Forschungsstellen und den Unternehmen waren damit ge-<br />
währleistet. Projektbegleitend wurde eine Projektpräsentation im Internet unter<br />
http://www.pps-dienstleistung.de aufgebaut. <strong>Die</strong> Internetpräsenz stellt den elektroni-<br />
schen Handlungsleitfaden unter http://www.webantenne.com/iph/ bereit.<br />
6.1 Innovativer Beitrag der angestrebten Forschungsergebnisse<br />
Mithilfe des Handlungsleitfadens für das Forschungsprojekt „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“<br />
wird KMU eine systematische Vorgehensweise zur Identifikation und Analyse mögli-<br />
cher Fremdvergaben von PPS-Aufgaben an einen PPS-<strong>Die</strong>nstleister und zu deren<br />
Realisierung vorgegeben. Sämtliche PPS-Aufgaben eines Unternehmens können<br />
hinsichtlich der Fremdvergabeeignung erstmalig mittels der Methoden beurteilt wer-<br />
den. <strong>Die</strong> Vorgehensweise ist unabhängig vom betrachteten Unternehmen und von<br />
der vorhandenen PPS einsetzbar. Das Projektergebnis ermöglicht KMU, die für eine<br />
Fremdvergabe geeigneten Bestandteile der PPS strukturiert zu identifizieren und zu<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaketen zusammenzufassen. Eine weitere Innovation besteht darin,<br />
Chancen und Risiken der Fremdvergabe von möglichen <strong>Die</strong>nstleistungspaketen be-<br />
werten zu lassen. Zudem geben in dem Forschungsprojekt entwickelte Methoden<br />
(z. B. Checklisten) Hilfestellung bei der Bewertung und Auswahl von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistern. Erstmalig werden KMU dahingehend unterstützt, dass der Pro-<br />
zess der operativen Fremdvergabe durch zur Verfügung gestellter Referenzprozesse<br />
prozesssicher durchgeführt werden kann.<br />
6.2 Projektbegleitender Ausschuss<br />
Zur Durchführung des Forschungsvorhabens wurde ein PA gebildet, in dem sich die<br />
Projektpartner über die gesammelten Erfahrungen sowie die Projektergebnisse aus-<br />
tauschen und das weitere Vorgehen im Projekt detaillieren können. Der Tabelle 6<br />
sind die Mitglieder des PA zu entnehmen:<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
71
Tabelle 6: Mitglieder des PA<br />
Unternehmen Branche Produkte KMU<br />
Friedrich Höltje Maschinenbau Fertigungsteile nach Kunden- x<br />
Zahnradfabrik<br />
zeichnung, Bearbeitung von<br />
GmbH<br />
eingesandten Verzahnungsteilen<br />
Visality Consulting<br />
GmbH<br />
Beratung Logistik-Beratung x<br />
Pleyma GmbH Beratung Logistik-Beratung x<br />
Hoppecke Batterien<br />
GmbH &<br />
Co. KG<br />
ZPF therm Maschinenbau<br />
GmbH<br />
Wohlenberg<br />
Buchbindesysteme<br />
GmbH<br />
GTT-Gesellschaft<br />
für Technologie<br />
Transfer mbH<br />
Energiebranche Batterien, integrierte Ladetechnologie,<br />
Systemlösungen<br />
Sondermaschinenbau <br />
Sondermaschinenbau<br />
6.3 Diplom- und Studienarbeiten<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Industrieöfen für die Aluminium<br />
verarbeitende Industrie<br />
Zusammentragmaschinen, Klebebinder,<br />
Dreischneider,<br />
Buchblockanleger, Kühlstrecken,<br />
Buchstapler<br />
Beratung Logistik-Beratung x<br />
Innerhalb des Forschungsprojektes „PPS als <strong>Die</strong>nstleistung“ wurden zwei Diplomar-<br />
beiten und zwei Studienarbeiten vergeben:<br />
Igor Spitzer schreibt seine Diplomarbeit zu dem Thema „Bewertung der Chancen und<br />
Risiken des Outsourcings der Produktionsplanung und -steuerung und die Konzepti-<br />
on einer Vorgehensweise für PPS-<strong>Die</strong>nstleisterauswahl“. <strong>Die</strong> Diplomarbeit wird an<br />
der Fachhochschule Hannover im Studiengang Betriebswirtschaft im Februar 2010<br />
eingereicht.<br />
Yehiba Ballout verfasst seine Diplomarbeit zu dem Thema „Vorgehensweise zur<br />
quantitativen Bewertung des prognostizierbaren Nutzen für das Outsourcing von<br />
PPS-Aufgaben“. <strong>Die</strong> Diplomarbeit wird an der Fachhochschule Hannover im Stu-<br />
diengang Wirtschaftsingenieurwesen im März 2010 eingereicht.<br />
Wiebke Bohlen hat mit ihrer Studienarbeit „Konzeption eines Modells zur Identifikati-<br />
on und Beschreibung relevanter Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung<br />
und Entwicklung einer Methode zur Ableitung von <strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und<br />
x<br />
x<br />
72
-paketen“ zur Wissensbasis beigetragen. <strong>Die</strong> Studienarbeit wurde an der Fachhoch-<br />
schule Braunschweig/Wolfenbüttel im Studiengang Betriebswirtschaftslehre im Sep-<br />
tember 2009 eingereicht.<br />
<strong>Die</strong> Studienarbeit von Sascha Sachse trägt den Titel „Erstellung einer Methode zur<br />
quantitativen Bewertung des prognostizierten Nutzens“ und wurde an der techni-<br />
schen Hochschule Wildau im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im August<br />
2009 eingereicht.<br />
7 Durchzuführende Forschungsstelle<br />
Das IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH ist eine gemeinnützige<br />
Forschungseinrichtung, die eng mit der Universität Hannover kooperiert. <strong>Die</strong> Gesell-<br />
schafter des IPH, Prof. Nyhuis, Prof. Behrens und Prof. Overmeyer, sind gleicher-<br />
maßen Inhaber produktionstechnischer Lehrstühle an der Universität Hannover. <strong>Die</strong><br />
Gliederung des IPH in die drei Abteilungen „Logistik“, „Prozesstechnik“, und „Pro-<br />
zessautomatisierung“ spiegelt die Ausrichtung dieser Lehrstühle wider. Das IPH<br />
widmet sich unter anderem anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung. Das<br />
Institut wurde 1988 mit Unterstützung des niedersächsischen Wirtschaftsministeri-<br />
ums gegründet und ist besonders der technologischen Förderung mittelständischer<br />
Industriebetriebe verpflichtet. Der Technologietransfer von der Universität in die In-<br />
dustrie erfolgt dabei hauptsächlich über gemeinsam mit der Industrie durchgeführte,<br />
öffentlich geförderte Verbundforschungsprojekte sowie über Fortbildungsseminare<br />
und Arbeitskreise für spezielle Zielgruppen aus Industrie und Handel. Darüber hinaus<br />
stellt das IPH laufend in einer Vielzahl ausschließlich industriefinanzierter Beratungs-<br />
projekte seine Praxisorientierung und Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis [Iph09].<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
73
Leiter der Forschungsstelle<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gemeinnützige GmbH<br />
Anschrift: Hollerithallee 6<br />
30419 Hannover<br />
Tel.: +49 (0511) 279 76 – 0<br />
Fax: +49 (0511) 279 76 – 888<br />
www.iph-hannover.de<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Nyhuis<br />
Geschäftsführender Gesellschafter des IPH – Institut für Integrierte Produktion Han-<br />
nover gemeinnützige GmbH, Hollerithallee 6, 30419 Hannover, Tel.: 0511/27976-119<br />
Dr.-Ing. Dipl.-Oec. Rouven Nickel<br />
Geschäftsführer des IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gemeinnützige<br />
GmbH, Hollerithallee 6, 30419 Hannover, Tel.: 0511/27976-119<br />
Projektleiter<br />
Dipl.-Wirtschaftsing. Dipl.-Ing. (FH) Jens-Michael Potthast<br />
Projektingenieur der Abteilung Logistik des IPH<br />
Hannover, 11.02.2010<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. Dipl.-Oec.<br />
Peter Nyhuis Rouven Nickel<br />
Geschäftsführender Gesellschafter Koordinierender Geschäftsführer<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
74
Literaturverzeichnis<br />
[Alp05] Alpar, P.: Unternehmensorientierte Wirtschaftsinformatik - Eine Einfüh-<br />
rung in die <strong>Strategie</strong> und Realisierung erfolgreicher IuK-Systeme. Vie-<br />
weg Verlag 1998.<br />
[Arn08] Arnold, D.: Handbuch Logistik, 3., neu bearb. Auflage, Springer Verlag,<br />
Berlin 2008.<br />
[Bme08] Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik (Hrsg.): Best<br />
Practice in Einkauf und Logistik, 2., völlig neue und erweiterte Auflage,<br />
Gabler Verlag, Wiesbaden 2008.<br />
[Ber05] Bertheau, N.: <strong>Die</strong> besten Checklisten für Manager,<br />
in: Handelsblatt Management Bibliothek, Campus Verlag GmbH, Band<br />
11 (2005), S. 24-25.<br />
[Bua02] Burger, A.; Buchhart, A.: Risiko-Controlling, Oldenbourg Wissen-<br />
schaftsverlag GmbH, München, Wien 2002.<br />
[Bri04] Brindley, C.: Supply Chain Risk, Ashgate Publishing Limited, Hamp-<br />
shire 2004.<br />
[Brp97] Bolstorf, P.; Rosenbaum, R.-G.; Poluha, Rolf, G.: Spitzenleistungen im<br />
Supply Chain Management - Ein Praxishandbuch zur Optimierung mit<br />
Scor, Springer Verlag 2007.<br />
[Bvl05] Bundesvereinigung Logistik e.V. (Hrsg.): Trends und <strong>Strategie</strong>n in der<br />
Logistik – Ein Blick auf die Agenda des Logistik-Managements 2010,<br />
Deutscher Verkehrsverlag, Bobingen 2005.<br />
[Dau06] Dauppert-Müller, B.; Stoll, M.: Mit Ausschreibungen gewinnen, Verlag<br />
Heinrich Vogel, München 2006.<br />
[Dau05] Dauppert-Müller, B.: Logistik-Outsourcing - Ausgabe, Vergabe,<br />
Controlling, Verlag Heinrich Vogel, München 2005.<br />
[Dit96] <strong>Die</strong>trich, A.: Planung und Entscheidung. Modelle - Ziele - Methoden. Mit<br />
Fallstudien und Lösungen, 4. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
IV
[Fra04] Franken, M.: Produktionsplanung und –steuerung in strategischen Net-<br />
zen – Ein logistikorientierter Koordinationsansatz, GWV Fachverlage<br />
GmbH, Wiesbaden 2004.<br />
[Fwd90] Fremdwörter Duden Band 5, Dudenverlag, Mannheim, Wien, Zürich<br />
1990.<br />
[Gwl03] Alisch, K.; Winter, E.: Gabler Wirtschaftslexikon, 16. Auflage, Gabler<br />
Verlag 2004.<br />
[Haa06] Haase, K.: Koordination von Marketing und Vertrieb - Determinanten,<br />
Gestaltungsdimensionen und Erfolgsauswirkungen, Springer Verlag,<br />
Wiesbaden 2006.<br />
[Hal05] Haller, S.: <strong>Die</strong>nstleistungsmanagement - Grundlagen, Konzepte, In-<br />
strumente, 3. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2005.<br />
[Her05] Hermes, H.-J.: Outsourcing - Chancen und Risiken, Erfolgsfaktoren,<br />
rechtssichere Umsetzung, Rudolf Haufe Verlag & Co. KG, München<br />
2005.<br />
[Het07] Hesse, J.; Neu, M.; Theuner, G.: Marketing - Grundlagen, 2. Auflage,<br />
Berliner Wissenschaftsverlag GmbH, Berlin 2007.<br />
[Hod06] Hodel, M.; Berger, A.; Risi, P.: Outsourcing Realisieren - Vorgehen für<br />
IT und Geschäftsprozesse zur nachhaltigen Steigerung des Unterneh-<br />
menserfolgs, 2. Auflage, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006.<br />
[Hol05] Hollekamp, M.: Strategisches Outsourcing von Geschäftsprozessen,<br />
Rainer Hampp Verlag, München, Mering 2005.<br />
[Hor96] Horchler, H.: Outsourcing - Eine Analyse der Nutzung und ein Hand-<br />
buch der Umsetzung, Datakontext-Fachverlag GmbH, Köln 1996.<br />
[Iph09] IPH - Institut für Integrierte Produktion gGmbH, Jahresbericht 2008, IPH<br />
2009.<br />
[Keu08] Keuper, F.; Oecking, C. (Hrsg.): Corporate Shared Services – Bereit-<br />
stellung von <strong>Die</strong>nstleistungen im Konzern, 2. Auflage, Gabler Verlag,<br />
Wiesbaden 2008.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
V
[Kil07] Kilger, W.: Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrech-<br />
nung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.<br />
[Knu05] Knut, A.: Planung und Betrieb von Logistiknetzwerken - Unterneh-<br />
mensübergreifendes Supply Chain Management, 2. Auflage, Springer<br />
Verlag, Berlin, Heidelberg 2005.<br />
[Kön09] Königs, H.-P.: IT-Risiko-Management mit System. Von den Grundlagen<br />
bis zur Realisierung - Ein praxisorientierter Leitfaden, Vieweg+Teubner<br />
Verlag, Wiesbaden 2009.<br />
[Kra05] Kranke, A.: Da muss jeder durch. In: Logistik inside, Verlag Heinrich<br />
Vogel GmbH, Oktober 2005, H. 10, S. 44-46.<br />
[Lin05] Linß, G.: Qualitätsmanagement für Ingenieure, 2. Auflage, Carl Hanser<br />
Verlag, München, Wien 2005.<br />
[Luc04] Luczak, H.; Weber, J.; Wiendahl, H.-P.: Logistik-Benchmarking - Praxis-<br />
leitfaden mit LogiBEST, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg, New York 2004.<br />
[Net03] Nettesheim, C.; Grebe, M.; Kottmann, D.: Business Process Outsour-<br />
cing – aber richtig! In: Information Management & Consulting, 18. Bd.<br />
(2003), H. 3, S. 24-30.<br />
[Nyh03] Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P.: Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werk-<br />
zeuge und Anwendungen. 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin 2003.<br />
[Pil04] Pill, T.: Controllinginstrumente für die Materialwirtschaft, Books on De-<br />
mand GmbH 2004.<br />
[Pro08] Prokein, O.: IT-Risikomanagement - Identifikation, Quantifizierung und<br />
wirtschaftliche Steuerung. GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008.<br />
[Reg06] Regius, B.: Qualität in der Produktentwicklung - Vom Kundenwunsch<br />
bis zum fehlerfreien Produkt, Carl Hanser Verlag, München, Wien 2006.<br />
[Röh07] Röhrich, M.: Grundlage der Investitionsrechnung – Eine Darstellung<br />
anhand einer Fallstudie, Wissenschaftsverlag GmbH, München 2007.<br />
[Scc03] Supply Chain Council 2003.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
VI
[Sch06] Schuh, G.: Produktionsplanung und -steuerung - Grundlagen, Gestal-<br />
tung und Konzepte. 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg,<br />
New York, 2006.<br />
[Sch09] Schulte, C.: Logistik – Wege zur Optimierung der Supply Chain, 5. Auf-<br />
lage, Vahlen Verlag, München 2009.<br />
[Spa05] Spath, D.; Schlegel, T.: Entwicklung innovativer <strong>Die</strong>nstleistungen, IRB-<br />
Verlag, Stuttgart 2005.<br />
[Sto00] Stocker, S.; Radtke, P.: Supply Chain Quality, Carl Hanser Verlag 2000.<br />
[Suc06] Sucky, E.: Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung, 2006,<br />
S. 139, 140.<br />
[Vah07] Vahrenkamp, R.: Logistik - Management und <strong>Strategie</strong>n, 6. Auflage,<br />
Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2007.<br />
[Web99] Weber, J.; Weißenberger, B.-E.; Liekweg, A.: Risk Tracking and Repor-<br />
ting, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 1999.<br />
[Wie03] Wiendahl, H.-P.; Nofen, D.; Klußmann, J.-H.; Löllmann, F.: Regelkreis-<br />
basierte Wandlungsprozesse - Wandlungsfähigkeit auf Basis modularer<br />
Fabrikstrukturen. In: wt Werkstattstechnik online (2003), Band 93, H. 4,<br />
S. 238-243.<br />
[Wie05] Wiendahl, H.-P.; Nofen, D.; Klußmann, J.-H.; Breitenbach, F.: Planung<br />
modularer Fabriken - Vorgehen und Beispiele aus der Praxis, Hanser<br />
Verlag, München 2005.<br />
[Wil04] Wildemann, H.: Leitfaden zur Optimierung der Leistungstiefe in Ent-<br />
wicklung, Produktion und Logistik, 9. Auflage, München 2004.<br />
[Zel08] Zell, M.: Kosten- und Performance Management – Grundlagen-<br />
Instrumente-Fallstudie, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
VII
Quellenverzeichnis<br />
[Dwd09] Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20 Jh.,<br />
http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Systematik, 26.08.2009.<br />
[Log09] Logistik Lexikon, http://www.logistik-lexikon.de/ccMiid941.html,<br />
26.08.2009.<br />
[Tud09] Technische Universität Dresden, http://pps.elcms.de/content/e62,<br />
21.11.2009.<br />
[Wit09] Witherton, Peter G., http:www.wirtschaftslexikon24.net/, 13.11.2009.<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
VIII
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Fremdvergabe von Logistikdienstleistungen durch die Industrie ......... 4<br />
Abbildung 2: Erfolgsstrategien für Logistikdienstleister [Bvl05]................................. 4<br />
Abbildung 3: Bereitschaft von KMU mit der Fremdvergabe von<br />
PPS-<strong>Die</strong>nstleistungen.......................................................................... 8<br />
Abbildung 4: Auswertung des Fragebogens............................................................. 9<br />
Abbildung 5: Fremdvergabe Chancen und Risiken im Bereich der<br />
Logistikleistung „Transport“................................................................ 10<br />
Abbildung 6: Chancen und Risiken im Bereich Produktionsprogrammplanung...... 11<br />
Abbildung 7: Unteraufgaben des Aachener PPS-Modells ...................................... 12<br />
Abbildung 8: Aufnahmebögen der PPS-Aufgaben.................................................. 13<br />
Abbildung 9: Bottom-Up-Ansatz ............................................................................. 14<br />
Abbildung 10: Levelkonzept des SCOR Modells ...................................................... 15<br />
Abbildung 11: Beschreibungssystematik nach SCOR am Beispiel der<br />
Auftragsbezogenen Fertigung............................................................ 16<br />
Abbildung 12: Beispiel: Beschreibungssystematik nach SCOR mit Aufgaben ......... 18<br />
Abbildung 13: Unternehmensstruktur nach Materialfluss, Informationsfluss und Zeit<br />
mit zugehörigen Kriterien................................................................... 22<br />
Abbildung 14: Kriterienkatalog nach Zeit, Schnittstelle, Komplexität und Datentyp.. 22<br />
Abbildung 15: Reihenfolgeempfehlung der zu untersuchenden Aufgaben bei<br />
Auftragsbezogener Fertigung ............................................................ 25<br />
Abbildung 16: Bildung von Anforderungsprofilen für das<br />
Unterkriterium „Qualifikation“ ............................................................. 26<br />
Abbildung 17: Gruppierungskriterien der unternehmensspezifischen Aufgabe<br />
„Wartung“ des SK „Qualifikation“ ....................................................... 27<br />
Abbildung 18: Potenzielles <strong>Die</strong>nstleistungspaket der Aufgaben „Wartung und<br />
Reparatur“.......................................................................................... 29<br />
Abbildung 19: Kataloge nach Bereichen mit Kennzahlen ......................................... 30<br />
Abbildung 20: Struktur von Wirtschaftlichkeitsvergleichen........................................ 31<br />
Abbildung 21: Zuweisung der Kennzahlen zu dem ausgewählten<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaket.......................................................................... 32<br />
Abbildung 22: Darstellung der einmaligen Kosten bei Fremdvergabe<br />
des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes "Wartung und Reparatur" ...................... 34<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
IX
Abbildung 23: Aufstellung der monatlichen Personalkosten bei Eigenerstellung und<br />
Fremdbezug des <strong>Die</strong>nstleistungspaketes „Wartung und Reparatur“ . 35<br />
Abbildung 24: Kostenveränderung in den Prozesselementen und<br />
Prozessaufgaben............................................................................... 36<br />
Abbildung 25: Ableitung des potenziellen Nutzens................................................... 37<br />
Abbildung 26: Vor- und Nachteile der Fremdvergabe in der Kategorie „<strong>Strategie</strong>“... 39<br />
Abbildung 27: Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken bei Logistikleistungen<br />
am Beispiel der Umstellung der Beschaffungskonzepte.................... 40<br />
Abbildung 28: Überführung der Chancen und Risiken auf PPS-Aufgaben ............... 41<br />
Abbildung 29: Bewertungsbogen der Chancen und Risiken..................................... 42<br />
Abbildung 30: Untersuchungsrichtung des potenziellen Nutzens bei<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgaben und -paketen.............................................. 45<br />
Abbildung 31: Chancen-Risiken-Portfolio ................................................................. 46<br />
Abbildung 32: Phasen der <strong>Die</strong>nstleisterauswahl....................................................... 50<br />
Abbildung 33: Verfahren der Lieferantenbewertung und -auswahl........................... 53<br />
Abbildung 34: Fragenkatalog an den PPS-<strong>Die</strong>nstleister........................................... 54<br />
Abbildung 35: Referenzprozess "Einführungsphase" ............................................... 57<br />
Abbildung 36: Organigramm der Projektorganisation .............................................. 58<br />
Abbildung 37: Referenzprozess „Laufender Betrieb“................................................ 60<br />
Abbildung 38: Ansicht der PPS-Aufgaben in der Kategorie „Unternehmen"............. 62<br />
Abbildung 39: Ansicht der PPS-Unteraufgaben, deren Einordnung in betroffene<br />
Abteilung und Pflege der Stammdaten .............................................. 63<br />
Abbildung 40: Ausschnitt des Vergleichs der PPS-Aufgaben................................... 64<br />
Abbildung 41: Ansicht der Bewertung von PPS-Aufgaben ....................................... 65<br />
Abbildung 42: Ausschnitt der Nutzwertanalyse......................................................... 66<br />
Abbildung 43: Ansicht des monatlichen Einsparpotenzials....................................... 67<br />
Abbildung 44: Checkliste zur Auswahl und Bewertung von PPS-<strong>Die</strong>nstleister......... 68<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
X
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Nomenklatur der Beschreibungssystematik............................................. 15<br />
Tabelle 2: Auswahl von Gruppierungskriterien ......................................................... 24<br />
Tabelle 3: Vergleich der Gruppierungskriterien bei „Wartung und Reparatur“.......... 28<br />
Tabelle 4: Gewichtung der Kriterien der Nutzwertanalyse........................................ 43<br />
Tabelle 5: Nutzwertanalyse ...................................................................................... 44<br />
Tabelle 6: Mitglieder des PA..................................................................................... 72<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen<br />
AP Arbeitspaket<br />
BMWi Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie<br />
<strong>BVL</strong> Bundesvereinigung Logistik e.V.<br />
E-Manufacturing Elektronische Produktionsplanung und -steuerung<br />
IPH Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
KMU Kleine und mittelständische Unternehmen<br />
PA Projektbegleitenden Ausschuss<br />
PPS Produktionsplanung und -steuerung<br />
SCM Supply Chain Management<br />
SCOR Supply Chain Operations Reference<br />
SK Startkriterium<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XI
Anhang<br />
Anhang 1: Fragebogen anhand der PPS-<strong>Die</strong>nstleistung Lagerwesen<br />
Lagerverwaltung<br />
1 Wie ist die Lagerstruktur aufgebaut?<br />
Untergeordnete Struktur (Lagerplätze je Lagerort)<br />
Lagerorte eines Betriebs<br />
Einzelplätze<br />
Blockplätze<br />
Gesonderte Angabe von Gang, Anfahrpunkt und Ebene<br />
Verwaltung mehrerer Lagerstandorte<br />
2 Welche Unterstützung bietet das System bei mehreren Lagerstandorten?<br />
Abbildung eigenbetriebener Außenläger<br />
Abbildung fremdbetriebener Außenläger<br />
Externes Versandlager<br />
Mehrstufige Distributionsstruktur<br />
3 Welche Lagertypen unterstützt das System?<br />
Wareneingangslager<br />
Offenes Wareneingangslager<br />
Automatisches Lager<br />
Zolllager<br />
Restmengen-/Anbruchlager<br />
Kommissionierlager<br />
Kunden-Konsignationslager<br />
Lieferanten-Konsignationslager<br />
Sperrlager<br />
Transitlager<br />
Gefahrgutlager<br />
Kühllager<br />
Tanklager<br />
Wärmekammer<br />
4 Welche Arten der Lagerortinformationen sind möglich?<br />
Besondere Lagerbedingungen (z.B. klimatisiertes Lager)<br />
Zulässige/geeignete Lademittel (z.B. Europalettenlager)<br />
Max. zulässige Lagerungsdichte (z.B. Gefahrstofflager)<br />
5 Welche Arten der Lagerplatzinformationen sind möglich?<br />
Lagervolumen als Vielfaches von Lademitteleinheiten (z.B. 10 Europaletten)<br />
Fachhöhe<br />
Exakte Geometrie (Breite, Tiefe, Höhe)<br />
Max. zulässiges Gewicht<br />
Sperrkennzeichen<br />
6 Welche Möglichkeiten der Lagerplatzverwaltung (Material-Lager-<br />
Zuordnung) werden angeboten?<br />
Chaotische Lagerung<br />
Festplätze für Materialgruppen/-klassen definierbar<br />
Kombination von Festplatzsystem und chaotischer Lagerung möglich<br />
7 Welche Lagerungsarten können je Lagerplatz definiert werden?<br />
Artikelreine Lagerung<br />
Artikelgemischte Lagerung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
(Lagerverwaltung)<br />
Outsourcing Potential<br />
Satus quo Chancen Risiken Bemerkung<br />
XII
Anhang 2: Fragebogen der PPS-<strong>Die</strong>nstleistung Lagerwesen (Lagerbewegung)<br />
Lagerbewegung<br />
8 Nach welchen Kriterien kann die automatische Vorgabe von<br />
Einlagerungsplätzen durch das System erfolgen?<br />
Manuelle Vorgabe bzw. Korrektur des vorgeschlagenen Einlagerplatzes<br />
möglich<br />
Nach ABC-Kriterien<br />
Nach Materialgruppe/-klasse<br />
Nach erforderlichen Lagerbedingungen (z.B. Kühllagerung)<br />
Nach Gewicht<br />
Nach Geometrie<br />
Nach Menge (Materialmenge bzw. Chargenmenge)<br />
Unter Berücksichtigung von Zusammenlagerungsverboten<br />
9 Welche Formen der Einlagerung sind im System möglich?<br />
Einlagerung auf freien Lagerplatz<br />
Zulagerung auf bereits teilbelegten Lagerplatz<br />
Splittung der Einlagerungsmenge auf mehrere Lagerorte und -plätze<br />
10 Welche Umbuchungen können abgewickelt werden?<br />
Von einem Lagerplatz auf einen anderen<br />
Von einer Materialnummer auf eine andere<br />
Zusammenführung artikelreiner Chargen (Chargenverschmelzung)<br />
Umlagerungsvorschläge zur Optimierung der Lagerplatznutzung<br />
Lagerumbuchung zu externem Lager mit Ausgabe eines Lieferscheins<br />
Lagerumbuchung zu externem Lager mit Ausgabe einer Proformarechnung<br />
Erstellung eines Transport-/Speditionsauftrags<br />
11 Nach welchen Kriterien kann die automatische Vorgabe von<br />
Entnahmeplätzen durch das System erfolgen?<br />
FIFO<br />
LIFO<br />
Menge<br />
Minimaler Restlagerzeit (MHD-gesteuert)<br />
12 Welche Arten der Bereitstellveranlassung werden unterstützt?<br />
Manuelle Bereitstellveranlassung<br />
Fertigungsauftragsbezogene Bereitstellveranlassung<br />
Fertigungsarbeitsgangbezogene Bereitstellveranlassung<br />
Automatische Bereitstellveranlassung mit Auftrags- bzw.Arbeitsgangfreigabe<br />
Automatische Bereitstellveranlassung mit festem Vorlauf zum Fertigungsbeginn<br />
13 Welche Verfahren der Bereitstellung werden unterstützt?<br />
Einfache Bereitstellung für den Auftrag bzw. Arbeitsgang<br />
Mehrfache Bereitstellung für einen Arbeitsgang<br />
Bereitstellung abgezählter bzw. kommissionierter Ware<br />
Ganzgebindebereitstellung<br />
14 Wie lassen sich Bereitstellübersichten darstellen?<br />
Lagerortbezogene Bereitstellübersicht<br />
Kapazitäts(gruppen)bezogene Bereitstellübersicht<br />
Fehlteilliste für Bereitstellungen (ggf. mit Hinweis auf kurzfristige<br />
Anlieferung)<br />
15 Welche Informationen können im Lagerbewegungsprotokoll<br />
angezeigt werden?<br />
Materialnummer<br />
Menge der Bewegung<br />
Wert der Ware<br />
Datum des Zu- und Abgangs<br />
Lagerbewegungstyp<br />
Kunden-/Fertigungsauftragsbezug<br />
Quell- und Ziellagerort<br />
Lager-/Versandeinheit<br />
Charge<br />
Gebinde<br />
Seriennummer<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Outsourcing Potential<br />
Satus quo Chancen Risiken Bemerkung<br />
XIII
Anhang 3: Fragebogen der PPS-<strong>Die</strong>nstleistung Lagerwesen (Inventur)<br />
Inventur<br />
16 Welche Methoden der Inventur werden angeboten?<br />
Permanente Inventur<br />
Stichtagsinventur<br />
Vor-/Nachverlagerung der Stichtagsinventur möglich<br />
Stichprobeninventur<br />
Inventur bei minimalem Bestand (Bsp.: Nulldurchgang)<br />
Generelle Buchungssperre während der Inventur notwendig<br />
17 Welche Funktionalitäten werden bezüglich des Inventurablaufes<br />
geboten?<br />
Inventur nach Lagerbereichen<br />
Inventur nach Materialnummernbereichen<br />
Chargenbezogene Inventur<br />
Inventur angearbeiteter Teile (Werkstattinventur)<br />
Nichtberücksichtigung inaktiver Teile oder verbrauchter Einmalteile<br />
Angaben zum Warenzustand bei Inventur möglich<br />
Inventur von Materialien mit besonderen Mengendimensionen (z.B. Länge,<br />
Fläche)<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Outsourcing Potential<br />
Satus quo Chancen Risiken Bemerkung<br />
XIV
Details<br />
Anhang 4: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 1<br />
Transport Versand Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
Symbol Bedeutung<br />
0 keine<br />
+ gering<br />
++ mittel<br />
+++ hoch<br />
++++ sehr hoch<br />
x keine Angaben<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
ungeeignet: zu sehr<br />
unternehmensstrategisch<br />
orientiert<br />
nur reine Rechenaufgaben:<br />
Bruttobedarfsermittlung,<br />
Durchlaufteminierung<br />
XV<br />
Eigenfertigungs-planung<br />
und -steuerung<br />
eher ungeeignet: Aufgabe ist<br />
Herzstück des Unternehmens<br />
Kostenersparnisse ++ ++++ ++ ++ x<br />
Leistungssteigerung + ++ 0 ++ x<br />
Fragen und Koordinationsaufwand + 0 ++ ++ x<br />
Besonderheiten Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
x<br />
Risiken 0 0 ++ ++ x<br />
Kosten + + + + x<br />
Erfolgsaussichten + +++ 0 ++ x<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 ++ + x<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Anmerkungen<br />
Details<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
Bestellrechnung,<br />
Angebotsmanagement,<br />
Bestellüberwachung<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Lagerbewegung<br />
Informationsaufbereitung<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
Informationsbewertung<br />
Chargenverwaltung<br />
Konfiguration<br />
Lagerkontrolle Inventur<br />
Kostenersparnisse +++ ++ +++ ++++<br />
Leistungssteigerung ++ ++ +++ +++<br />
Koordinationsaufwand + + ++ ++<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Risiken + 0 + +<br />
Kosten ++ + ++ ++<br />
Erfolgsaussichten ++ +++ +++ +++<br />
Unerwarteter Aufwand ++<br />
Professionalität steigt (one<br />
Voice to the supplyer)<br />
0 0 +<br />
Anmerkungen<br />
management der externen<br />
Leistungen<br />
keine Bestellfreigabe<br />
keine Reihenfolgeplanung
Details<br />
Anhang 5: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 2<br />
Verpacken Transport Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
ungeeignet: zu sehr nur reine Rechenaufgaben:<br />
unternehmensstrategisch Bruttobedarfsermittlung,<br />
orientiert<br />
Durchlaufteminierung<br />
XVI<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
und -steuerung<br />
eher ungeeignet: Aufgabe ist<br />
Herzstück des Unternehmens<br />
Kostenersparnisse ++ +++ ++ ++ x<br />
Leistungssteigerung + + 0 ++ x<br />
Fragen und Koordinationsaufwand 0 + ++ ++ x<br />
Besonderheiten Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
x<br />
Risiken 0 0 ++ ++ x<br />
Kosten + + + + x<br />
Erfolgsaussichten + ++ 0 ++ x<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 ++ + x<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Anmerkungen<br />
Details<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
Bestellrechnung,<br />
Bestellüberwachung<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Auftragsklärung<br />
Lagerbewegung<br />
Bestandsteuerung<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
Chargenverwaltung<br />
Lagerkontrolle<br />
Informationsbewertung<br />
Konfiguration<br />
Kostenersparnisse ++++ +++ ++++ +++<br />
Leistungssteigerung +++ ++ +++ ++<br />
Koordinationsaufwand ++ + ++ +<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Risiken + 0 + +<br />
Kosten ++ + ++ ++<br />
Erfolgsaussichten +++ +++ +++ ++<br />
Unerwarteter Aufwand +<br />
Professionalität steigt (one<br />
Voice to the supplyer)<br />
+ + ++<br />
Anmerkungen<br />
management der externen<br />
Leistungen<br />
keine Bestellfreigabe<br />
keine Reihenfolgeplanung<br />
Symbol Bedeutung<br />
0 keine<br />
+ gering<br />
++ mittel<br />
+++ hoch<br />
++++ sehr hoch<br />
x keine Angaben
Details<br />
Anhang 6: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 3<br />
Verpacken Transport Versand Lagerhaltung Kommissionierung Umlagerung<br />
Kostenersparnisse ++ ++++ ++ ++ ++ ++<br />
Leistungssteigerung ++ ++ + + ++ +<br />
Fragen und Koordinationsaufwand 0 + 0 + + 0<br />
Besonderheiten Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise,<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl Standorte<br />
Standorte<br />
Risiken 0 0 + 0 0 0<br />
Kosten ++ + + ++ ++ +<br />
Erfolgsaussichten ++ +++ + + + +<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 0 + + +<br />
Anmerkungen<br />
Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
und -steuerung<br />
Symbol Bedeutung<br />
0 keine<br />
+ gering<br />
++ mittel<br />
+++ hoch<br />
++++ sehr hoch<br />
x keine Angaben<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
XVII<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Details<br />
ungeeignet: zu sehr<br />
unternehmensstrategisch<br />
orientiert<br />
nur reine Rechenaufgaben:<br />
eher ungeeignet: Aufgabe ist<br />
Bruttobedarfsermittlung,<br />
Herzstück des Unternehmens<br />
Durchlaufteminierung<br />
Bestellrechnung,<br />
Angebotsmanagement,<br />
Bestellüberwachung<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Auftragsklärung<br />
Lagerbewegung<br />
Lagerplatzverwaltung Informationsaufbereitung<br />
Chargenverwaltung Informationsbewertung<br />
Lagerkontrolle Konfiguration<br />
Inventur<br />
Kostenersparnisse ++ ++ x ++++ ++ ++++ ++<br />
Leistungssteigerung 0 ++ x +++ ++ +++ ++<br />
Koordinationsaufwand<br />
Fragen und Besonderheiten<br />
++ ++ x ++ + ++ +<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
x<br />
Risiken ++ ++ x + 0 + 0<br />
Kosten + + x ++ + ++ +<br />
Erfolgsaussichten 0 ++ x +++ +++ +++ +++<br />
Unerwarteter Aufwand ++ + x +<br />
Professionalität steigt (one<br />
Voice to the supplyer)<br />
0 + 0<br />
Anmerkungen<br />
management der externen<br />
Leistungen<br />
keine Bestellfreigabe<br />
keine Reihenfolgeplanung
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Details<br />
Anhang 7: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 4<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Verpacken Transport Versand Lagerhaltung<br />
Kostenersparnisse + ++ ++ ++++<br />
Leistungssteigerung + + + +++<br />
Koordinationsaufwand 0 + 0 0<br />
Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Standorte<br />
Risiken 0 0 0 0<br />
Kosten + + + +++<br />
Erfolgsaussichten + + + +<br />
Unerwarteter Aufwand + 0 0 +<br />
Anmerkungen<br />
Details<br />
XVIII<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Kommissionierung Umlagerung Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
ungeeignet: zu sehr<br />
unternehmensstrategisch<br />
orientiert<br />
nur reine Rechenaufgaben:<br />
Bruttobedarfsermittlung,<br />
Durchlaufteminierung<br />
Kostenersparnisse + + ++ ++<br />
Leistungssteigerung 0 0 0 ++<br />
Koordinationsaufwand + + ++ ++<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise,<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Standorte<br />
Standorte<br />
Risiken 0 0 ++ ++<br />
Kosten + + + +<br />
Erfolgsaussichten + + 0 ++<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 ++ +<br />
Details<br />
Anmerkungen<br />
Eigenfertigungsplanung<br />
und -steuerung<br />
eher ungeeignet: Aufgabe ist<br />
Herzstück des Unternehmens<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
Bestellrechnung,<br />
Angebotsmanagement,<br />
Lieferantenauswahl<br />
Bestellüberwachung<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Lagerbewegung<br />
Bestandsteuerung<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
Chargenverwaltung<br />
Lagerkontrolle<br />
Informationsaufbereitung<br />
Informationsbewertung<br />
Konfiguration<br />
Kostenersparnisse x ++++ ++<br />
Inventur<br />
++++ +++<br />
Leistungssteigerung x +++ ++ +++ +++<br />
Koordinationsaufwand x ++ + ++ +<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
x<br />
Risiken x + 0 + +<br />
Kosten x ++ + ++ +<br />
Erfolgsaussichten x +++ +++ +++ ++<br />
Unerwarteter Aufwand x ++<br />
Professionalität steigt (one<br />
Voice to the supplyer)<br />
0 + 0<br />
Anmerkungen<br />
management der externen<br />
Leistungen<br />
keine Bestellfreigabe<br />
keine Reihenfolgeplanung
Details<br />
Anhang 8: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 5<br />
Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
nur reine<br />
ungeeignet: zu sehr<br />
Rechenaufgaben:<br />
unternehmensstrategisc<br />
Bruttobedarfsermittlung,<br />
h orientiert<br />
Durchlaufteminierung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Eigenfertigungspla<br />
nung und -<br />
steuerung<br />
eher ungeeignet:<br />
Aufgabe ist Herzstück<br />
des Unternehmens<br />
XIX<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
Bestellrechnung,<br />
Angebotsmanagement,<br />
Bestellüberwachung<br />
Kostenersparnisse ++ ++ x ++++<br />
Leistungssteigerung 0 ++ x +++<br />
Fragen und Koordinationsaufwand ++ ++ x ++<br />
Besonderheiten Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
x<br />
Risiken ++ ++ x +<br />
Kosten + + x ++<br />
Erfolgsaussichten 0 ++ x +++<br />
Unerwarteter Aufwand ++ + x +<br />
Professionalität steigt (one<br />
Voice to the supplyer)<br />
Anmerkungen<br />
management der externen<br />
Leistungen<br />
keine Bestellfreigabe<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Details<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Auftragsklärung<br />
Lagerbewegung<br />
Bestandsteuerung<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
Chargenverwaltung<br />
Lagerkontrolle Inventur<br />
Informationsaufbereitung<br />
Informationsbewertung<br />
Konfiguration<br />
Kostenersparnisse ++ +++ ++<br />
Leistungssteigerung ++ ++ ++<br />
Koordinationsaufwand + + +<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Risiken 0 + 0<br />
Kosten + ++ +<br />
Erfolgsaussichten +++ ++ +++<br />
Unerwarteter Aufwand 0 ++ 0<br />
Anmerkungen<br />
Symbol Bedeutung<br />
0 keine<br />
+ gering<br />
++ mittel<br />
+++ hoch<br />
++++ sehr hoch<br />
x keine Angaben
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Fragen und<br />
Besonderheiten<br />
Details<br />
Anhang 9: Vorhandenes Erfahrungswissen bei KMU 6<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Verpacken Transport Versand Lagerhaltung<br />
Kostenersparnisse + ++ ++ +++<br />
Leistungssteigerung + + + ++<br />
Koordinationsaufwand 0 + + 0<br />
Potentielle<br />
<strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Standorte<br />
Standorte<br />
Risiken 0 0 0 0<br />
Kosten + + + +<br />
Erfolgsaussichten + ++ ++ ++<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 0 0<br />
Anmerkungen<br />
Details<br />
Zuverlässigkeit, Preise,<br />
Standorte<br />
Kommissionierung Umlagerung Pr.Prog.Planung Pr.Bed.Planung<br />
ungeeignet: zu sehr<br />
unternehmensstrategisch<br />
orientiert<br />
XX<br />
nur reine Rechenaufgaben:<br />
Bruttobedarfsermittlung,<br />
Durchlaufteminierung<br />
Kostenersparnisse + + ++ ++<br />
Leistungssteigerung + + 0 ++<br />
Koordinationsaufwand 0 0 ++ ++<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister<br />
Kriterien zur<br />
Zuverlässigkeit, Preise, Zuverlässigkeit, Preise,<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
Standorte<br />
Standorte<br />
Risiken 0 0 ++ ++<br />
Kosten + + + +<br />
Erfolgsaussichten + + 0 ++<br />
Unerwarteter Aufwand 0 0 ++ +<br />
Details<br />
Anmerkungen<br />
Eigenfertigungs-planung<br />
und -steuerung<br />
eher ungeeignet: Aufgabe ist<br />
Herzstück des Unternehmens<br />
Fremdbezugsplanung<br />
und -steuerung<br />
Bestellrechnung,<br />
Angebotsmanagement,<br />
Bestellüberwachung<br />
Auftragskoordination Lagerwesen PPS-Controlling<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Auftragsklärung<br />
Lagerbewegung<br />
Bestandsteuerung<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
Chargenverwaltung<br />
Informationsaufbereitung<br />
Informationsbewertung<br />
Konfiguration<br />
Kostenersparnisse x ++++ +++<br />
Lagerkontrolle<br />
++++ +++<br />
Leistungssteigerung x +++ + ++++ +++<br />
Koordinationsaufwand x ++ + ++ +<br />
Potentielle <strong>Die</strong>nstleister x<br />
Kriterien zur<br />
<strong>Die</strong>nstleisterauswahl<br />
x<br />
Risiken x + 0 0 +<br />
Kosten x ++ + ++ +<br />
Erfolgsaussichten x +++ +++ +++ ++<br />
Unerwarteter Aufwand x +<br />
Professionalität steigt (one<br />
0 + 0<br />
Anmerkungen<br />
Voice to the supplyer)<br />
management der externen<br />
Leistungen
Anhang 10: Klassifikation der PPS-Aufgaben<br />
Kernaufgaben Klassifizierung Querschnitssaufgaben Klassifizierung<br />
Angebotsbearbeitung, Auftragsgrobterminierung,<br />
Ressourcengrobplanung (auftragbezogen), Auftragsführung<br />
Absatzplanung, Bestandsplanung,<br />
Primärbedarfsplanung, Ressourcengrobplanung Auftragskoordination<br />
Produktionsprogrammplanung<br />
Lagerbewegungsführung Bestandssteuerung<br />
Lagerort- und Lagerplatzverwaltung Chargenverwaltung<br />
Lagerkontrolle<br />
Lagerwesen<br />
Bruttosekundärbedarfsermittlung,<br />
Nettosekundärbedarfsermittlung,<br />
Beschaffungsartzuordnung,<br />
Durchlaufterminierung,<br />
Kapazitätsbedarfermittlung,<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Informationsaufbereitung Informationsbewertung<br />
Informationsaufbereitung<br />
PPS-Controlling<br />
Losgrößenrechnung Feinterminierung<br />
Ressourcenfeinplanung Reihenfolgeplanung<br />
Verfügbarkeitsprüfung Auftragsfreigabe<br />
Auftragsüberwachung Ressourcenüberwachung<br />
Eigenfertigungspla<br />
nung und -<br />
steuerung<br />
Kern- und<br />
Querschnittsaufgabe<br />
Daten erfassen Verarbeiten Aktualisieren Speichern<br />
Schützen Verwalten archivieren Ausgeben<br />
Datenverwaltung<br />
Bestellrechnung Angebotseinholung/ -bewertung<br />
Lieferantenauswahl Bestellfreigabe<br />
Bestellüberwachung<br />
Fremdbezugsplanu<br />
ng und -steuerung<br />
XXI
Anhang 11: Aufnahmebogen der Produktionsprogrammplanung und Produkti-<br />
Klassifikation anhand des Aachener PPS Modell<br />
onsbedarfsplanung<br />
Produktionsprogrammplanung Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Stammdaten<br />
XXII<br />
Bewegungsdaten<br />
Absatzplanung<br />
Anzahl der festen Kundenaufträge<br />
Auftragsbestand ermitteln<br />
Art<br />
Menge<br />
Termin<br />
Absatzprognose erstellen<br />
Bestandsplanung X<br />
Festlegung der Bevorratungsebene<br />
Geforderte Lieferzeit<br />
Durchlaufzeit<br />
Wiederbeschaffungszeit<br />
Festlegung der Sicherheitsbestände<br />
Festlegung der Lagerreichweite<br />
Bedrafsermitllung<br />
Stochastisch, Determenistisch, Heuristisch<br />
Festlegung der Dispositionsparameter<br />
Primärbedarfsplanung<br />
Vorläufiger Produktionsplan<br />
Zu produzierender Bedarf an Endprodukten<br />
Verkaufsfähige Baugruppen<br />
Standartkomponenten<br />
Ersatzteile<br />
Ressourcengrobplanung<br />
Produktionsbedarfsplanung<br />
Grobterminplanung<br />
Vor- o. Rückwertsterminierung<br />
Zeitdauer einzel Vorgänge<br />
Kapazitätsdeckungsrechnung<br />
Kapazitätsangebot<br />
Kapazitätsbedarf<br />
Materialdeckungsrechnung<br />
Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Betroffene<br />
Stamm-<br />
Abteilungen/<br />
daten<br />
Personen<br />
Bewegungsdaten<br />
Bruttosekundärbedarfsermittlung<br />
Bedarfsartenermittlung<br />
Primär-, Sekundär- u. Tertärbedarf<br />
Einteilung der Sekundärbedarfe<br />
ABC-/XYZ Analyse<br />
X<br />
Nettosekundärbedarfsermittlung<br />
Beschaffungsartzuordnung<br />
Ermittlung der zu beschaffenden Sekundärbedarfe<br />
Bruttosekundärbedarfsermittlung<br />
Lagerbestände<br />
Reservierungen<br />
Sicherheitsbestand etc.<br />
X<br />
Durchlaufterminierung<br />
Kapazitätsbedarfsermitllung<br />
Kapazitätsabstimmung<br />
Festlegung der Fertigungstermine<br />
Vorwärtsterminierung<br />
Rückwertsterminierung<br />
Netzplan
Anhang 12: Aufnahmebogen der Fremdbezugsplanung und -steuerung sowie<br />
Eigenfertigungsplanung und -steuerung<br />
Fremdbezugsplanung und -steuerung Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Bestellrechnung<br />
Angebotseinholung/ -bewertung<br />
Lieferantenauswahl<br />
Bestellfreigabe<br />
Bestellüberwachung<br />
Ermittlung optimale Bestellmenge<br />
Bestelltermin ermitllung<br />
Zusammenfassen der Einkaufsaufträge<br />
nach Bedarfen<br />
Bestellmengenermittlung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Stammdaten<br />
XXIII<br />
Bewegungsdaten<br />
Anfrage an Lieferanten Einkauf X<br />
Angebotsbewertung Einkauf X<br />
Sonderkonditionen X<br />
Liefervereinbarungen X<br />
Zahlungsbedingungen X<br />
Datenhinterlegung für Haupt- u. Nebenlieferanten<br />
Kritärien zur Lieferantenauswahl festlegen<br />
Qualität<br />
Liefertermintreue<br />
Preis / Sonderkonditionen<br />
Informatiosnaustausch mit Bestllrechnung<br />
Eigenfertigungsplanung und -steuerung Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Losgrößenrechnung<br />
Feinterminierung<br />
Ressourcenfeinplanung<br />
Reihenfolgenplanung<br />
Verfügbarkeitsprüfung<br />
Auftragsfreigabe<br />
Auftragsüberwachung<br />
Ressourcenüberwachung<br />
Kapazitätsplanung auf Maschinenebene<br />
Maschienenbelegungsplan<br />
Zeitliche abfolge der Arbeitsgänge<br />
Betriebsmittelzuordnung zum Arbeitsgang<br />
Ermittlung der Beginn- und Endtermine<br />
der Arbeitsgänge<br />
Festlegung der Warteschlangen-<br />
abarbeitungsmethode<br />
Prioritätsregeln<br />
KOZ-Regel<br />
LOZ-Regel<br />
GRB-Regel<br />
Rüstzeitminimierung<br />
Belegerstellung<br />
Arbeitszuteilung<br />
Soll-Ist_Vergleich von Menge und Termin<br />
Auftragsbezogene Kennzahlenüberwachung<br />
Kapazitätsbelegung<br />
Informationsweitergabe an Auftragskoodination<br />
Materialüberwachung<br />
Materialflußkontrolle<br />
Bestandsentwicklung<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Stammdaten<br />
Bewegungsdaten
Anhang 13: Aufnahmebogen der Auftragskoordination und Lagerwesen<br />
Auftragskoordination Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Angebotsbearbeitung<br />
Auftragsklärung<br />
Auftragsgrobterminierung<br />
Ressourcengrobplanung (auftragsbezogen)<br />
Auftragsausführung<br />
Kundenanfrage entgegennehmen<br />
Kundenspezifisches Angebot erstellen<br />
Auftragsbeginn<br />
Auslastungssituation der Fertigung<br />
Kundenbewertung<br />
Stammkunde o. Neukunde<br />
Konstruktion<br />
Arbeitsplanung<br />
Teilefertigung u. Montage<br />
Lagerwesen Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Lagerbewegungsführung<br />
Bestandssteurerung<br />
Lagerort- u. Lagerplatzverwaltung<br />
Chargenverwaltung<br />
Lagerkontolle<br />
Inventur<br />
Erfassung aller Veränderungen der Lagerung<br />
Wareneingangslager<br />
Wareneingänge<br />
Warenumschlag<br />
Weiterleitung der Ware an andere Läger<br />
Warenausgangslager<br />
Zwischenlager<br />
Erfassung Lagerzu- u. abgänge<br />
Vornahme von artikelbezogenen Reservierungen<br />
Informationsaustausch Produktionsbedarfsplanung<br />
Zuordnung zu geeignetem Lagerplatz<br />
Erfassung sämtlicher Daten<br />
Barcode / Transponder<br />
Lagerort<br />
Festlegung der Lagerplatzstrategie<br />
FIFO<br />
HIFO<br />
LIFO<br />
Nachweis über eingeflossene Lieferungen in<br />
Erzeugnisse<br />
Reklamationsverfolgung<br />
Zuordnung Teilebestand zu Charge<br />
Verfallsdatum<br />
Wareneingangsdatum<br />
Lagerbestand pro Lagerort<br />
Auswertung der Rationalisierungspotenziale<br />
Materialbestandslisten<br />
Umschlagshäufigkeit<br />
Reichweitenermittlung<br />
Festlegung der Inventurmethode<br />
Permanente Inventur<br />
Stichtagsinventur<br />
Stichprobeninventur<br />
Sequenzailtest<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
XXIV<br />
Bewegungsdaten<br />
Bewegungsdaten
Anhang 14: Aufnahmebogen des PPS-Controllings und Datenverwaltung<br />
PPS-Controlling Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Informationsaufbereitung<br />
Informationsbewertung<br />
Konfiguration<br />
Beschaffung von PPS-Daten<br />
Ermitteln von Einflussgrößen<br />
Bildung von Informatiosnstrukturen<br />
Anhand der Zeilvorgaben<br />
Initalkonfiguration (statisch)<br />
Anpassungskonfiguration (dynamisch)<br />
Datenverwaltung Aufgaben Ihres Unternehmens<br />
Datenverwaltung (Stamm- u. Bewegungsdaten)<br />
Teileverwaltung<br />
Stücklistenverwaltung<br />
Arbeitsplanverwaltung<br />
Produktionsmittelverwaltung<br />
Plandatenverwaltung<br />
Auftragsverwaltung<br />
Kundenverwaltung<br />
Lieferantenverwaltung<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Betroffene<br />
Abteilungen/<br />
Personen<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten<br />
XXV<br />
Bewegungsdaten<br />
Bewegungsdaten
DIREKTE KOSTEN<br />
Hardware<br />
Anhang 15: Auflistung der direkten Kosten<br />
Klassische Softwarenutzung ASP-Modell<br />
Hohe Client-Rechnerkosten Geringe Client-Rechnerkosten<br />
Hohe Serverkosten Sehr geringe Serverkosten<br />
Hohe Ersatzteilkosten Sehr geringe Ersatzteilkosten<br />
Kosten für Upgrades Sehr geringe Upgrade-Kosten<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XXVI<br />
Kosten für Betriebsstoffe Sehr geringe Betriebsstoff-Kosten<br />
Bewertung: - - - Bewertung: +++<br />
Software<br />
Hohe Lizenzkosten für<br />
Betriebssystemsoftware,<br />
Anwendungssoftware,<br />
Datenbanksysteme und für<br />
sonstige Software<br />
Im ASP-Mietpreis (SLA) enthalten:<br />
Bewertung: - - - Lizenzkosten für Betriebssystem,<br />
Anwendungssoftware, Datenbanksysteme und für<br />
sonstige Software<br />
Bewertung: +++<br />
IT-Support und Hohe Peronalkosten für:<br />
Installation, Konfiguration und<br />
Management der IT-<br />
Komponenten,<br />
Im ASP-Mietpreis (SLA) enthalten:<br />
-Administration Datensicherung und<br />
Installation, Konfiguration und Management der IT-<br />
Archivierung,<br />
Komponenten,<br />
Systemwartung und<br />
Systempflege,<br />
Datensicherung und Archivierung,<br />
und<br />
Problemlösungsmanagement<br />
Systemwartung und Systempflege,<br />
Hohe Kosten für Nutzer-<br />
Administration<br />
Problemlösungsmanagement<br />
Bewertung: - - - Nutzer-Administration<br />
Bewertung: +++<br />
IT-Management Hohe Personalkosten für: Im ASP-Mietpreis (SLA) enthalten:<br />
Nutzerverwaltung &<br />
Nutzerverwaltung & –management,<br />
–management,<br />
Schutzeinrichtungen für Netzwerk, Datenbank,<br />
Schutzeinrichtungen für<br />
Netzwerk, Datenbank, Hard- &<br />
Software<br />
Hard- & Software<br />
IT-Verwaltung<br />
IT-Schulung<br />
Hohe Such- und<br />
Informationskosten<br />
Hohe Such- und Informationskosten<br />
Bewertung: - - - Bewertung: 000<br />
Hohe Personalkosten für: Aufgrund des reduzierten Verwaltungsaufwandes<br />
geringe Kosten für :<br />
Führung IT-Manager & IT-<br />
Mitarbeiter, IT-Budgetierung<br />
und –Controlling,<br />
IT-Beschaffung &<br />
Lieferantenmanagement<br />
Bewertung: - - - Bewertung: 000<br />
Hohe Schulungskosten für IT-<br />
Manager, Mitarbeiter der IT-<br />
Abteilung und Endanwender<br />
Führung IT-Manager & IT-Mitarbeiter, IT-<br />
Budgetierung und –Controlling,<br />
IT-Beschaffung & Lieferantenmanagement<br />
Geringe Schulungskosten für IT-Manager und<br />
Mitarbeiter der IT-Abteilung<br />
Bewertung: - - - Hohe Schulungskosten für Endanwender<br />
Bewertung: 000
INDIREKTE KOSTEN<br />
Ausfallzeit der IT<br />
Endanwender<br />
Unterstützung<br />
Anhang 16: Auflistung der indirekten Kosten<br />
Klassische Softwarenutzung ASP-Modell<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XXVII<br />
Fehlende Funktionalität der<br />
Anwendungssoftware:<br />
Fehlende Funktionalität der Anwendungssoftware:<br />
messbar / intransparent Gut messbar<br />
Nicht Verfügbarkeit<br />
Nicht-Verfügbarkeit (Netzausfall, Fehler auf dem<br />
(Netzausfall, Fehler auf dem<br />
Server):<br />
Server):<br />
messbar / intransparent Gut messbar<br />
Bewertung: - - - Bewertung: +++<br />
Entwicklungsunterstützung<br />
(Softwareentwicklung):<br />
Entwicklungsunterstützung (Softwareentwicklung):<br />
Schwer messbar / intransparent Gut messbar<br />
IT-Schulung (z.B.<br />
Informationsbeschaffung im<br />
Internet):<br />
Schwer messbar / intransparent<br />
Bewertung: - - -<br />
IT-Schulung (z.B. Informationsbeschaffung
Anhang 17: Beschaffungskonzept Zulieferer<br />
Vorratsbeschaffung-----------------------------------------------------> Konsignationskonzept<br />
Zulieferer<br />
Kriterium Richtung Vorteil Nachteil Chance Risiko<br />
Anzahl von Lieferanten Abnehmend "Monopolstellung" Preisbestimmung Keine Kapazitätsverlagerung möglich<br />
Bei Überlastung keine<br />
Ausweichmöglichkeit Keine Konkurenz Vertragsstrafen<br />
Vertrauensbasis zum Hersteller Hohe Inovationsfähigkeit Abhängigkeit vom Hersteller<br />
Preisgestaltungmöglichkeit (Ware) Abnehmend Vorratsbeschaffung möglich Mengenrabatt Erhöhte Lagerkosten<br />
Keine Abnahme der bevorrateten Ware Finanzieller Verlust<br />
Größeres<br />
Disposition und Bestellabwicklung Übernahme der Herstellerprozesse<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsspektrum Fehlentscheidungen<br />
Wertsteigerung des eigenen<br />
Erhöhte Qualifikation von Mitarbeitern Unternehmens Mangel an qualifizierten Mitarbeitern<br />
Rechnung / Zahlung Sammelgutschriftsanzeige Weniger Verwaltungsaufwand Bei Zahlungsausfall, großer Verlust<br />
Vorfinanzierung Abnahmegarantie Anfallende Zinsen<br />
Kosten (Kapitalbindungs-, Lager-,<br />
Optimierung der<br />
Rüst-,Transportkosten) Erhöhter Freiheitsgrad<br />
Kostenverursacher Fehlerhafte Kalkulation<br />
Kostenverlagerung vom Hersteller Eigene Kostenkontrolle z.B.: Erhöhte Kapitalbildungskosten<br />
Optimierung der<br />
Versorgungssicherheit Koordination bei der Bereitstellung<br />
Versorgungsstrategie Versorgungsengpässe durch Fehlplanung<br />
Anpassungsfähigkeit aufgrund<br />
Verantwortung bei Engpässen<br />
erhöhter Sicherheitsbestände Vertragsstrafen<br />
Abhängigkeit Auftragssicherheit Gesicherter Umsatz Erhöhte Verwantwortung gegenüber dem Hersteller<br />
Bei großer Konkurenz einseitige<br />
Abhängigkeit Substitution<br />
Kerngeschäft Konzentration auf Kerngeschäft Spezialist werden Betriebsblindheit<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XXVIII<br />
Umwandlung von seltenen<br />
Komplexität Standardisierung von Prozessen<br />
Prozessen in Routineprozessen Fehlerrisiko bei Umwandlung der Prozesse<br />
Hohe Komplexität der übertragenden Anpassung der<br />
Aufgaben<br />
Anforderungsprofile Nicht erkennen von fehlerhaften prozessen<br />
Optimierung von Routen- und<br />
Koordination Bessere Planung von Routen- und Zeitfenstern<br />
Zeitfenstern Verantwortlichkeit bei Fehlplanung<br />
Bindung der Hersteller an den<br />
Erhöhter Koordinationsaufwand<br />
Zulieferer Keine ausreichenden Ressourcen (Kapital, Personal)<br />
Personal Motivation durch Auftragssicherheit Leistungssteigerung Überlastung durch höhere Komplexität der Aufgaben<br />
Übernahme des Personals vom<br />
Mangel an qualifizierten Mitarbeitern Hersteller Mangelnde Motivation der übernommenden Mitarbeiter<br />
Bestandsauswirkungen Eigene Bestandskalkulation Optimale Lagerausnutzung Durch Falschkakulation, Versorgungssicherheit gefährdet<br />
Zusatzleistungen durch Abnahme der<br />
Losgrößen<br />
Schnelle und einheitliche<br />
IT<br />
Einheitliche IT Infrastruktur<br />
Übermittlung von Daten Hohe Investitionskosten<br />
Verbesserung der<br />
Erhöhter Aufwand durch einheitliche Kommunikation durch<br />
Kennzeichnung<br />
Standardisierte Kennzeichnung Fehleranfälligkeit in der Umstellungsphase
Vorratsbeschaffung-----------------------------------------------------> Konsignationskonzept<br />
Hersteller<br />
Kriterium Richtung Vorteil Nachteil Chance Risiko<br />
Anzahl von Lieferanten Abnehmend Schaffung einer WIN - WIN Situation Gesteigerte Zuverlässigkeit Abhängigkeit<br />
Substituierbarkeit einzelner Lieferanten Keine Ausweichmöglichkeit bei Auslastungsschwankungen<br />
Anhang 18: Beschaffungskonzept Hersteller<br />
Preisgestaltungmöglichkeit (Ware) Abnehmend Festpreis Keine Preisschwankungen Bei sinkendem Preis, keine Anpassung<br />
Guter Preis von meinem<br />
Keine Ausnutzung von Mengenrabatten Zulieferer Kaum Einsparpotenzial im Einkauf<br />
Konzentration auf<br />
Disposition und Bestellabwicklung Schlankerer Beschaffungsprozess<br />
Kernkompetenz Kontrollverlust<br />
Verstärken der Beziehung zum<br />
Kontaktverlust zu anderen Lieferanten Zulieferer Erschwerte suche nach alternativen Lieferanten<br />
Kann mit dem Geld länger<br />
Rechnung / Zahlung Sammelgutschrifts-anzeige<br />
arbeiten Verfügbarkeit Liquidität<br />
Erhöhter Prüfaufwand Fehlerbehebung<br />
Kosten (Kapitalbindungs-, Lager-,<br />
z.B.: Geringere<br />
Rüst-,Transportkosten) Abgabe der Kosten an Zulieferer<br />
Kapitalbindungskosten Fehlende Kostentransparenz<br />
Erhöhter Festpreis < eigene<br />
Erhöhung des Festpreises<br />
Kapitalbindungskosten Erhöhter Festpreis > eigene Kapitalbindungskosten<br />
Versorgungssicherheit Vertraglich zugesicherte Versorungssicherheit Optimale Versorgungssicherheit Nicht Erfüllung des Vertrages<br />
Optimierung der<br />
Abgabe der Ressourcenkontrolle Versorgungsstrategie Versorgungsengpässe durch Fehlplanung des Zulieferers<br />
Reibungslose<br />
Nicht Erfüllung des Vertrages kann zu Produktionsstillstand<br />
Abhängigkeit Versorgungssicherheit<br />
Produktionsversorgung führen<br />
Geschäftsaufgabe des Zulieferers Neuorientierung am Markt Erhöhter finanzieller Aufwand<br />
Kerngeschäft Konzentration auf Kerngeschäft Spezialist werden Betriebsblindheit<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Komplexität Geringerer Inventuraufwand Zeitersparnis Fehlerrisiko bei der Inventurdurchführung<br />
Sinkende Komplexität Geringe Prozessanforderung Verlust von Know-how<br />
Koordination Weniger Koordinationsaufwand Konzentration auf Kerngeschäft Verlust von Know-how<br />
Nicht festgelegte Verantwortlichkeiten bei<br />
neuen Schnittstellen Keine Verantwortungsübernahme<br />
Personal Reorganisation der internen Ressourcen Einsparpotenzial Verlust von Know-how<br />
Sinkende Motivation der eigenen<br />
Mitarbeiter Reduzierung der Leistung<br />
Bestandsauswirkungen Entnahmeregelung<br />
Erhöhung des Sicherheitsbestandes<br />
Schnelle und einheitliche<br />
Übermittlung von Daten Umstellungskosten<br />
Datensicherheit Weitergabe von internen Daten<br />
IT Verminderung der Schnittstellen<br />
XXIX
Anhang 19: Chancen und Risiken der Überführung von Chancen und Risiken<br />
Kriterium PPS<br />
Aufgaben<br />
Kriterium<br />
Logistikdienstleistung<br />
der PPS<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Chance Risiko<br />
IT IT<br />
Schnelle und einheitliche Übermittlung von<br />
Daten<br />
Hohe Investitionskosten<br />
Verbesserung der Kommunikation durch<br />
Standardisierte Kennzeichnung<br />
Fehleranfälligkeit in der Umstellungsphase<br />
Kosten (Kapitalbindungs-,<br />
Schnelle und einheitliche Übermittlung von<br />
Daten<br />
Umstellungskosten<br />
Weitergabe von internen Daten<br />
Kosten<br />
Lager-, Rüst-<br />
,Transportkosten)<br />
Optimierung der Kostenverursacher Fehlerhafte Kalkulation<br />
Eigene Kostenkontrolle z.B.: Erhöhte Kapitalbildungskosten<br />
z.B.: Geringere Kapitalbindungskosten Fehlende Kostentransparenz<br />
Erhöhter Festpreis < eigene<br />
Erhöhter Festpreis > eigene<br />
Kapitalbindungskosten<br />
Kapitalbindungskosten<br />
Leistung Abhängigkeit Gesicherter Umsatz<br />
Erhöhte Verwantwortung gegenüber dem<br />
Hersteller<br />
Neuorientierung am Markt Erhöhter finanzieller Aufwand<br />
Leistung Koordination Optimierung von Routen- und Zeitfenstern Verantwortlichkeit bei Fehlplanung<br />
Bindung der Hersteller an den Zulieferer<br />
XXX<br />
Keine ausreichenden Ressourcen (Kapital,<br />
Personal)<br />
Substitution<br />
Personal Personal Wertsteigerung des eigenen Unternehmens Mangel an qualifizierten Mitarbeitern<br />
Leistungssteigerung<br />
Überlastung durch höhere Komplexität der<br />
Aufgaben<br />
Übernahme des Personals vom Hersteller<br />
Mangelnde Motivation der übernommenden<br />
Mitarbeiter<br />
Einsparpotenzial Verlust von Know-how<br />
Reduzierung der Leistung<br />
Produktion Versorgungssicherheit<br />
Anpassungsfähigkeit aufgrund erhöhter<br />
Sicherheitsbestände<br />
Vertragsstrafen<br />
Verstärken der Beziehung zum Zulieferer<br />
Erschwerte suche nach alternativen<br />
Lieferanten<br />
Optimale Versorgungssicherheit Nicht Erfüllung des Vertrages<br />
Optimierung der Versorgungsstrategie<br />
Versorgungsengpässe durch Fehlplanung<br />
des Zulieferers<br />
Reibungslose Produktionsversorgung<br />
Nicht Erfüllung des Vertrages kann zu<br />
Produktionsstillstand führen<br />
<strong>Strategie</strong> Kerngeschäft Spezialist werden Betriebsblindheit<br />
Konzentration auf Kerngeschäft Verlust von Know-how<br />
Keine Verantwortungsübernahme<br />
Spezialist werden Betriebsblindheit<br />
<strong>Strategie</strong> Komplexität<br />
Umwandlung von seltenen Prozessen in<br />
Routineprozessen<br />
Fehlerrisiko bei Umwandlung der Prozesse<br />
Anpassung der Anforderungsprofile Nicht erkennen von fehlerhaften prozessen<br />
Zeitersparnis Fehlerrisiko bei der Inventurdurchführung<br />
Geringe Prozessanforderung Verlust von Know-how
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XXXI<br />
Anhang 20: Vor- und Nachteile der Überführung von Chancen und Risiken der<br />
PPS unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken<br />
Risiko Chance<br />
Vorteile Nachteile Bemerkung +2 +1 0 +1 +2<br />
1 Fertigungskosten x Optimierung der Fertigungskostenbeim Lieferanten x<br />
2 Anzahl von Lieferanten x Substituierbarkeit einzelner Lieferanten x<br />
3 Preisgestaltung x Zeit- und mengenflexible Preisgestaltung x<br />
4 Disposition und Bestellabwicklung x Disposition und Bestellabwicklung x<br />
5 Rechnung / Zahlung x Sammelgutschriftsanzeige x<br />
6 Retourabwicklung x Retourabwicklung vom Lieferanten / DL x<br />
7 Lagerbewirtschaftungkosten x Senkung der Lagerbewirtschaftungskosten x<br />
8 Kapitalbindungskosten x Senkung der Kapitalbindungskosten x<br />
9 Lagerkosten x Reduzierung der Lagerkosten x<br />
10 Versorgungssicherheit x Hoche Versorgungssicherheit x<br />
11 Abwicklungskosten x Beim Lieferanten / DL x<br />
12 Transportkosten x Senkung der Transportkosten x<br />
13 Abhängigkeit vom Lieferanten x Hohe Abhängigkeit vom Lieferanten x<br />
14 Kerngeschäft x Konzentration auf das Kerngeschäft x<br />
15 Komplexität x Komplexitätsreduktion x<br />
16 Ermittlung von fehlerhafte Prozessen x Fehlerhafte Prozesse bleiben im Verborgenen x<br />
17 Sicherheitsbestand x Erhöhung des Sicherheitsbestandes x<br />
18 Transparenz im Lager x Reduktion der Transparenz x<br />
19 Koordination x Erhöhter Koordinationsbedarf x<br />
20 Motivation der Mitarbeiter x Sinkende Motivation der eigenen Mitarbeiter x<br />
21 Bestandsauswirkungen x Minimierung des eigenen Bestandes x<br />
Summe<br />
10 17
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
XXXII<br />
Anhang 21: Bewertungsbogen von Chancen und Risiken des <strong>Die</strong>nstleistungs-<br />
DL-Paket: Wartung u. Reparatur<br />
Chance<br />
Risiko<br />
+6 +4 +2 +2 +4 +6<br />
Kriterien Hoch Mittel Gering Gering Mittel Hoch<br />
paketes “Wartung und Reparatur”<br />
Zuverlässigkeit 6<br />
Konzentration auf die Kernkompetenzen 6 2<br />
Qualität 4 2<br />
Komplexität 6 2<br />
Serviceorientierung 2 4<br />
Räumlich Distanzen 4<br />
Zwischensumme:<br />
24 14<br />
Know-how 6<br />
Verfügbarkeit von Kapazitäten 6<br />
Image des Unternehmens 4<br />
Abhängigkeit vom <strong>Die</strong>nstleister 4<br />
Innovationsfähigkeit 6<br />
Koordinationsbedarf 2<br />
Versorgungssicherheit 6 2<br />
Zwischensumme:<br />
28 8<br />
Transaktionskosten 4<br />
Kosten im laufenden Betrieb 6<br />
Kostentransparenz 4 2<br />
Konkurs des <strong>Die</strong>nstleisters 2 6<br />
Auswirkung auf den Jahresabschluss 2 2<br />
Auswirkung auf die Zahlungslegung 2 2<br />
Zwischensumme:<br />
16<br />
16<br />
Rechtliche Bedingungen 2 2<br />
Motivation der Mitarbeiter 4 4<br />
Mitarbeiterführung 2 2<br />
Qualifikation der Mitarbeiter 6<br />
Zwischensumme:<br />
8 14<br />
Datensicherheit 6<br />
Standardesierung durch einheitliche IT 6<br />
Anpassungsfähigkeit der IT Infrastruktur 2 2<br />
Zwischensumme:<br />
14 2<br />
Summe<br />
90<br />
54<br />
IT Personal<br />
Kosten<br />
Leistung <strong>Strategie</strong>
<strong>Die</strong>nstleistungsaufgabe<br />
Feinterminplanung<br />
<strong>Die</strong>nstleistungspaket<br />
Wartung u. Reparatur<br />
Ø Teilkriteriengewichtung<br />
Teilkriteriengewichtung<br />
Abteilungsleiter<br />
Teilkriteriengewichtung<br />
Geschäftsführer<br />
Ø Gruppengewichtung<br />
Gruppengewicht<br />
Abteilungsleiter<br />
Gruppengewicht<br />
Geschäftsführer<br />
Kriterium<br />
Punkte Nutzwert Punkte Nutzwert<br />
<strong>Strategie</strong> 25 19 22 100 100 100<br />
Konzentration auf das Kerngeschäft 25 25 25 10 5500 10 5500<br />
Verantwortungsübergabe 20 15 17,5 10 3850 10 3850<br />
Qualität 24 20 22 6 2904 0<br />
Komplexität 20 20 20 10 4400 8 3520<br />
Serviceorientierung 7 10 8,5 2 374 2 374<br />
Räumlich Distanzen 4 10 7 8 1232 2 308<br />
Leistung 18 29 23,5 100 100 100<br />
Anhang 22: Nutzwertanalyse<br />
Know-how 5 10 7,5 8 1410 4 705<br />
Verfügbarkeit von Kapazitäten 30 15 22,5 10 5287,5 2 1057,5<br />
Firmenimage 30 5 17,5 6 2467,5 2 822,5<br />
Abhängigkeit vom <strong>Die</strong>nstleister 10 15 12,5 2 587,5 2 587,5<br />
Innovationsfähigkeit 10 25 17,5 6 2467,5 4 1645<br />
Koordination 10 15 12,5 6 1762,5 2 587,5<br />
Versorgungssicherheit 5 15 10 10 2350 2 470<br />
IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH<br />
Kosten 35 16 25,5 100 100 100<br />
Transaktionskosten 23 10 16,5 0 0 0 0<br />
Kostenreduktion im laufenden Betrieb 23 35 29 6 4437 6 4437<br />
Kostentransparenz 23 10 16,5 8 3366 10 4207,5<br />
Konkurs des <strong>Die</strong>nstleisters 0 25 12,5 0 0 0 0<br />
Auswirkung auf den Jahresabschluss 23 10 16,5 2 841,5 0 0<br />
Auswirkung auf die Zahlungslegung 8 10 9 2 459 0 0<br />
Personal 9 14 11,5 100 100 100<br />
Rechtliche Bedingungen 60 10 35 2 805 2 805<br />
Motivation der Mitarbeiter 10 20 15 2 345 0 0<br />
Mitarbeiterführung 10 35 22,5 2 517,5 0 0<br />
Qualifikation der Mitarbeiter 20 35 27,5 8 2530 10 3162,5<br />
IT 13 22 17,5 100 100 100<br />
Datensicherheit 50 50 50 2 1750 2 1750<br />
Standadisierung durch einheitliche IT 20 25 22,5 6 2362,5 4 1575<br />
Anpassungsfähigkeit der IT Infrastruktur 30 25 27,5 2 962,5 2 962,5<br />
Nutzwert: 52968,5 36326,5<br />
XXXIII<br />
100 100 100 500 500 500<br />
0 0