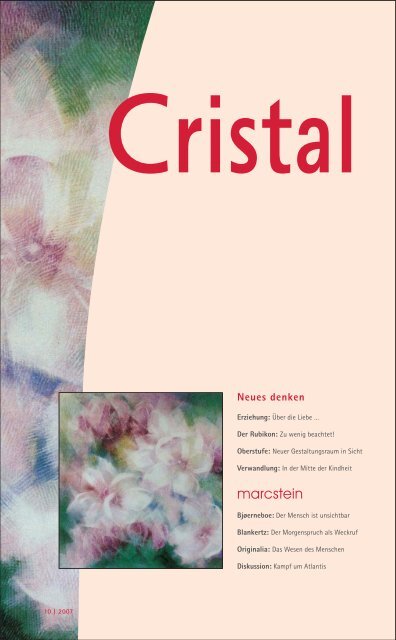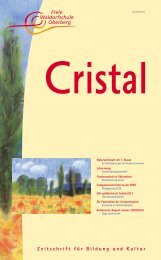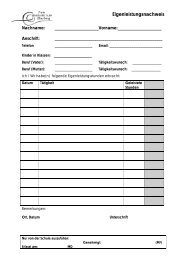RS-Reisen Rainer Söhnchen - Freie Waldorfschule Oberberg
RS-Reisen Rainer Söhnchen - Freie Waldorfschule Oberberg
RS-Reisen Rainer Söhnchen - Freie Waldorfschule Oberberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 | 2007<br />
Cristal<br />
Neues denken<br />
Erziehung: Über die Liebe …<br />
Der Rubikon: Zu wenig beachtet!<br />
Oberstufe: Neuer Gestaltungsraum in Sicht<br />
Verwandlung: In der Mitte der Kindheit<br />
marcstein<br />
Bjøerneboe: Der Mensch ist unsichtbar<br />
Blankertz: Der Morgenspruch als Weckruf<br />
Originalia: Das Wesen des Menschen<br />
Diskussion: Kampf um Atlantis
Inhalt<br />
Editorial<br />
Der Verwandlungsprozess in der Mitte der Kindheit 2<br />
Ute Indiestel<br />
Zu wenig beachtet: der Rubikon! 6<br />
Peter Schamberger<br />
Die Entwicklung des Kindes 11<br />
Ulrike Nolte<br />
Impressum 18<br />
Über die Liebe in der Erziehung 19<br />
Annette Renschler<br />
Biografiearbeit – Schauspiel – Handwerkspraktikum 24<br />
Annette Renschler<br />
Neuer Gestaltungsraum in Sicht 26<br />
Jochen Fritsch<br />
Titelbild und Bund: Aquarell von Karo Bergmann<br />
marcstein<br />
Der Mensch ist unsichtbar m1<br />
Von Jens Ingvald Bjøerneboe<br />
»Werdet endlich wach!« m4<br />
Von Rüdiger Blankertz<br />
»Da haben Sie auch was für die Pause« m7<br />
Von Inger Hermann<br />
Kampf um Atlantis. Ein Weckruf. m8<br />
Von Jens Göken<br />
Das Wesen des Menschen m12<br />
Von Rudolf Steiner<br />
Denkanregungen m15
Editorial<br />
Fragen öffnen Welten<br />
seit fast sechs Jahren geben wir Ihnen in Cristal<br />
einen Einblick in das Schulleben der <strong>Freie</strong>n <strong>Waldorfschule</strong><br />
<strong>Oberberg</strong>. Nicht nur pädagogische, auch<br />
ökologische, kulturelle und spirituelle Fragen sprachen<br />
eine breite Öffentlichkeit an und haben sie<br />
und uns bewegt.<br />
Unser Anliegen, mit Menschen in- und außerhalb<br />
der Waldorfkommunität Kontakt aufzunehmen und<br />
miteinander ins Gespräch zu kommen, ist gelungen.<br />
Unser Jubiläumsheft – Cristal No. 10 – informiert<br />
Sie über die einzelnen Jahrgangsstufen unserer<br />
Schule. Ein näherer Blick auf diese Beiträge lohnt<br />
sich: Wer die Waldorfpädagogik schon ein wenig<br />
kennengelernt hat, wird dort in die Tiefe gehende<br />
Hinweise finden, worauf es ihr ankommt: Jedes Kind<br />
steht entsprechend seinem Alter an einer ganz<br />
bestimmten Stufe seiner inneren Entwicklung. Das<br />
Besondere der Waldorfpädagogik besteht ja gerade<br />
darin, dass sie ihre pädagogischen Impulse genau<br />
dort ansetzt, die Kinder dort abholt, wo sie innerlich<br />
gerade stehen. Ihrem menschenkundlich interessierten<br />
Blick können sich an diesen Fragen Welten<br />
öffnen.<br />
Die staatlich anerkannten Abschlüsse bis hin zum<br />
Abitur werden jährlich an der <strong>Freie</strong>n <strong>Waldorfschule</strong><br />
<strong>Oberberg</strong> erworben. Obwohl die Waldorfschüler –<br />
nicht nur an unserer <strong>Waldorfschule</strong> – immer wieder<br />
durch hervorragende Leistungen auffallen, möchte<br />
ich eines nicht verschweigen: Manch staatliche Vorgabe<br />
zwingt uns in letzter Zeit zu einem erheblichen<br />
Spagat, da sie bedenkenswerte menschenkundliche<br />
Gesichtspunkte (siehe oben) weder kennt<br />
noch beachtet.<br />
Die Kernfrage: Wer sich für Menschenkunde interessiert,<br />
stößt bald auf eine Kernfrage. Entscheidendes<br />
hängt von dieser Frage ab, nicht zuletzt das<br />
Motiv pädagogischen Handelns: Wer und was ist<br />
eigentlich der Mensch? Der Marcstein stellt in dieser<br />
Ausgabe in und zwischen den Zeilen immer wieder<br />
diese Frage: Wer und was ist eigentlich der Mensch?<br />
Unsichtbar sei er, meint der norwegische Waldorflehrer<br />
Jens Bjøerneboe. Wie ist das vorzustellen: unsichtbar?<br />
Alles Gute beim Nachdenken! (Statt einer<br />
Reißleine, ein Literaturtipp: R. Steiner: Theosophie.<br />
GA9)<br />
Die <strong>Freie</strong> <strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong> ist eine öffentliche<br />
Schule in privater Trägerschaft. Sie ist offen für<br />
Menschen aller Nationalitäten und Glaubensbekenntnisse.<br />
Die Qualität unserer Pädagogik wird<br />
durch Selbstverwaltung und Mitfinanzierung der<br />
Schule aus der Initiative und Tatkraft von Eltern,<br />
Lehrern und Menschen des Umkreises ermöglicht.<br />
Haben Sie Fragen zu unserer Schule? Möchten<br />
auch Sie Ihr Kind zum Schuljahr 2008/09 bei uns<br />
anmelden? Wir freuen uns auf ein persönliches<br />
Gespräch mit Ihnen und informieren Sie gerne<br />
ausführlich.<br />
Mit herzlichen Grüßen<br />
Ihre<br />
Cristal 10 | 2007 1
Mittelstufe<br />
Der Verwandlungsprozess in der Mitte der Kindheit<br />
Von Ute Indiestel<br />
Die Mitte der Kindheit: Die Mittelstufe heißt<br />
nicht nur so, weil sie zwischen der Unter- und Oberstufe<br />
liegt: Die Kinder durchleben von der 5. bis 8.<br />
Klasse die Mitte der Kindheit und der gesamten<br />
Schulzeit. Sie stehen inmitten eines großen Verwandlungsprozesses<br />
von der an die Umgebung<br />
hingegebenen Kindheit zur aus dem eigenen<br />
Innenleben heraus weltergreifenden Jugend- und<br />
Erwachsenenzeit.<br />
2<br />
5. Klasse<br />
Harmonischer Körperbau<br />
Pflanzenkunde<br />
Deutschland – Landschaftskunde<br />
Komplexe Satzteile / Plus Fut. II<br />
Komplexe Bruchrechnungsaufgaben<br />
Römisch / Griechische Geschichte<br />
Olympische Spiele<br />
6. Klasse<br />
Glieder wachsen<br />
Wie finden mich die Anderen?<br />
Wachsende Weltdistanz<br />
Verwirrendes Gefühlsleben<br />
Gesteinskunde<br />
Sternenkunde<br />
Physik<br />
Konjunktiv – Rede<br />
Dreisatz / Potenz / Wert<br />
Chemie<br />
Ist der Schritt in der Unterstufe gelungen, dass die<br />
Kinder aus Liebe zum Lehrer in die bildhaft, seelischmoralischen<br />
Unterrichtsinhalte eintauchen konnten,<br />
so gilt es in der Mittelstufe, die Hingabe der<br />
Kinder von der liebevollen Autorität zum konkreten,<br />
eigenen Interesse und zum Anschluss der jungen<br />
Menschen an die Welt zu entwickeln.<br />
Das Wesen der Kinder im Kleinkindalter und auch<br />
noch in den ersten Jahren der Schulzeit ist in die<br />
Cristal 10 | 2007
7. Klasse Algebra<br />
Entdecker, Renaissance Ernährungslehre<br />
Perspektive 7. Klassgespräche<br />
Selbstgewähltes Referatsthema Waldpraktikum<br />
Schreibstil Reformation<br />
Umgebung ausgegossen, die Welt wird wesenhaft<br />
und ungetrennt erlebt. In der Mitte der Kindheit<br />
vollzieht sich ein Einstülpungs- oder Schnittpunkt<br />
der Kindheitslemniskate, (siehe Zeichnung) von dem<br />
aus es nun möglich wird, menschlich seelischen<br />
Innenraum zu entwickeln. Das heißt: die Qualität<br />
des empfindungsreichen Seelenraumes zu erleben,<br />
auszubilden und zu differenzieren. Von da aus kann<br />
in der Oberstufe die eigene gedankliche Urteils-<br />
8. Klasse<br />
Französische Revolution<br />
Nationalsozialismus<br />
Biographien<br />
Sexualkunde<br />
Selbstbehauptungstraining<br />
Klassenspiel<br />
Handwerkspraktikum<br />
bildung entwickelt werden, aus der heraus der<br />
erwachsene Mensch selbstbestimmt und eigeninitiativ<br />
die Welt ergreifen kann.<br />
Der rote Faden in der 5. Klasse: In der 5. Klasse<br />
leben die Kinder die letzte Phase, ja geradezu die<br />
Blüte der sich in Harmonie befindenden Kindheit<br />
aus. Ihr ganzer Körperbau ist auf zauberhafte Weise<br />
harmonisch und sie haben im besten Falle ein freu-<br />
Cristal 10 | 2007 3
dig offenes Interesse an einander und an ihrer<br />
Umgebung.<br />
Im Waldorflehrplan steht nun die Pflanzenkunde,<br />
die, anders als die Tierkunde in der 4. Klasse, in der<br />
die Kinder intensiv in die seelischen Qualitäten der<br />
Tierwelt eintauchen, schon einen eher ästhetischen<br />
und genaueren Beobachtungsprozess braucht. Es<br />
gilt Wachstumsformen und -gesetzmäßigkeiten zu<br />
entdecken und zu verstehen. In der Erdkunde wird<br />
der Schritt aus der Heimat- zur Länderkunde<br />
Deutschlands gemacht.<br />
Im Deutschunterricht werden nun die schon recht<br />
komplexen Satzteile wichtig und das bewusste<br />
Zeitenverständnis im Deutschunterricht erweitert<br />
sich in die fernere Vergangenheit und Zukunft.<br />
Die in der 4. Klasse begonnene Bruchrechnung<br />
wird komplizierter und abstrakter.<br />
Die Welt wird immer mehr zum Gegenüber. Nicht<br />
umsonst wechselt die Perspektive des Morgenspruches<br />
der Unterstufenklassen von der Freude an<br />
der Sonne: »Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den<br />
Tag« zu einer eher betrachtenden Perspektive des<br />
5. Klass- und Mittelstufenspruches: »Ich schaue in<br />
die Welt, in der die Sonne leuchtet«.<br />
Aber auch bei dieser, in den kommenden Jahren<br />
immer größer werdenden, betrachtenden Distanz<br />
bleibt der Rückbezug auf den Menschen und seine<br />
Spiegelung in der Welt und im Kosmos, der rote<br />
Faden in den naturwissenschaftlichen Epochen der<br />
Mittelstufe.<br />
In der 6. Klasse die Welt neu verstehen: Erste<br />
Anzeichen der Pubertät werden deutlich, die Glieder<br />
wachsen, eine leichte Schwere, seelische Empfindlichkeit<br />
und Unausgeglichenheit schleicht sich ein.<br />
»Wie empfinden mich die anderen? Wie finde ich die<br />
anderen?« wird zur wichtigen Frage. Wie die Kehrseite<br />
der Medaille der wachsenden Distanz zur Welt,<br />
gebiert die Seele nun ein reges und für die Kinder<br />
meist verwirrendes Empfindungsleben, in dem es<br />
sich zurecht zu finden gilt.<br />
Das Gefühl, weiterhin in der Welt eingebettet zu<br />
sein, braucht nun eine andere, neue Art von Nahrung<br />
oder Aufmerksamkeit: Die Gesteinskunde lässt die Kinder<br />
die Wandelbarkeit, aber auch die Festigkeit der<br />
Erde verstehen. Die Sternenkunde gibt ihnen einen<br />
Zusammenhang zum Kosmos. Die erste Physikepoche<br />
lässt sie präzises Beobachten und Beschreiben, aber<br />
auch das Begreifen der äußerlichen Zusammenhänge<br />
der physischen Welt erlernen. In Deutsch erleben sie<br />
im Konjunktiv die Welt der Fiktion und der Möglichkeiten.<br />
Der Dreisatz und das Prozentrechnen schließen<br />
sie konkret an die Geld- und Wirtschaftwelt an.<br />
Die Welt wird immer verstehbarer und konkreter.<br />
In der 7. Klasse Weltinteresse entdecken und<br />
entwickeln: Schlüsselbegriffe sind das Entdeckerund<br />
Renaissancezeitalter. Die Welt entdecken- und<br />
ergreifen: Eigenständiger und reflektierter Interesse<br />
entwickeln. Wichtige Lernschritte: Erste Stellungnahmen<br />
zu selbst gewählten Themen abgeben,<br />
4<br />
Schreibstile und Textformen differenzieren und in<br />
der Mathematik sich in die Gesetze der Algebra hineinzudenken<br />
und sie damit handhaben zu können.<br />
Erste chemische und eigenkörperliche Prozesse<br />
verstehen: Ernährungslehre, Chemie.<br />
Im Waldpraktikum erleben die jungen Menschen<br />
mit allen Sinnen und ihrer Hände Arbeit den Lebensraum<br />
Wald und sich selbst als darin aktiv eingreifend,<br />
als Handlungsfähige zu verstehen.<br />
In den Siebtklassgesprächen reflektieren die Kinder<br />
sich zum ersten Mal in ihrem eigenen Lernverhalten,<br />
entdecken sich geradezu selbst. »Wer bin ich<br />
eigentlich? Wie arbeite ich? Was will ich erreichen,<br />
entwickeln? Was kann mir Hilfe sein?«<br />
Innenraum – Eigenerlebnis – Aufwachen: erste<br />
Schritte zum Erleben und Ergreifen der eigen Biographie.<br />
Die Höhepunkte der 8. Klasse: Die Pubertät ist in<br />
vollem Gange. Die Jungen schießen in die Höhe, die<br />
Gliedmaßen werden lang und schlaksig, seelisch<br />
ziehen sie sich meist innerlich immer weiter zurück,<br />
werden empfindlicher, aber äußerlich oft immer<br />
lauter und »großspuriger«. Die Mädchen entwickeln<br />
ausgeprägte weibliche Formen, werden immer stärker<br />
und offensiver, aber auch feinfühliger im sozialen<br />
Umgang. Die 8. Klasse bietet drei Höhepunkte<br />
und zentrale Epochen:<br />
1. Die Biographiearbeit: Die Jugendlichen beschäftigen<br />
sich lange und intensiv mit dem Lebensbogen<br />
eines von ihnen gewählten Menschen. Den Fragen<br />
nach dem eigenen Lebensweg gibt diese Arbeit Raum,<br />
Spiegelungsfläche, Vorbild, Miterleben und Wachstumsmöglichkeit.<br />
Einen Lebensweg zu begleiten, mitzuempfinden<br />
und dann auch zu reflektieren kann eine<br />
persönliche Hilfe sein, das eigene Erleben zu schärfen<br />
und zu ordnen. Die öffentliche Vorstellung eigener<br />
Arbeitsergebnisse wird geübt.<br />
2. Das Klassenspiel: Theaterspielen heißt, sich für<br />
das Wesen eines Anderen (seiner Rolle) zur Verfügung<br />
zu stellen, sich einzufühlen in die Seele und<br />
Befindlichkeit einer anderen Person. Zum einen ist<br />
das ein enormes soziales Übfeld, zugleich auch die<br />
Chance, sich selbst in völlig neuen Aspekten zu entdecken<br />
und auszuprobieren.<br />
3. Das Handwerkspraktikum: Die Jugendlichen<br />
erleben die Arbeitswelt der Erwachsenen und werden<br />
darin tätig. »Was ist mit meiner Hände Arbeit<br />
erreich- und gestaltbar?« Erstmals nicht im Schonraum<br />
Schule, sondern im realen Wirtschaftsleben.<br />
Eine wichtige und elementare Erfahrung der Welt<br />
und der eigenen Persönlichkeit.<br />
Ute Indiestel<br />
Klassenlehrerin im zweiten<br />
Durchgang, führt die 7. Klasse<br />
(Ringelblumen), eine der<br />
Balkonklassen der <strong>Freie</strong>n<br />
<strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong>.<br />
Cristal 10 | 2007
3. und 4. Klasse<br />
Zu wenig beachtet: der Rubikon!<br />
Von Peter Schamberger<br />
Eine Grenze ziehen<br />
Schüler beim Abschreiten des Ackers im Freilichtmuseum zum Begrenzen der Parzellen für die verschiedenen Getreidearten.<br />
Worauf kommt es im 3. Schuljahr an? Mit den<br />
befeuernden Worten dieses Liedes ist es in wunderbarer<br />
Weise zum Ausdruck gebracht: Freudig zupacken<br />
und lernen – um immer erdentüchtiger zu<br />
werden.<br />
Schon gegen Ende des 2. Schuljahres haben wir im<br />
Gelände des Freilichtmuseums in Lindlar ein Stück<br />
Ackerfläche umgepflügt und geeggt, um dann Weizen,<br />
Roggen und Hafer aussäen zu können. Welche<br />
Freude war es im Herbst, eine reiche Ernte einzufahren,<br />
zu dreschen, zu mahlen, um schließlich<br />
aus dem gewonnenen Mehl ein wohlschmeckendes<br />
Brot backen zu können.<br />
6<br />
Die Bezeichnung Rubikon geht auf eine Anregung Rudolf Steiners zurück. Um die zentrale Bedeutung<br />
des damit verbundenen Entwicklungsschrittes um das 9. Lebensjahr zum Ausdruck zu bringen,<br />
verglich er diesen mit Cäsars mutiger und weitreichender Entscheidung, das norditalienische<br />
Flüsschen Rubikon zu überschreiten, um gegen Rom zu ziehen. Ein unumkehrbarer Prozess setzt<br />
ein, dessen Auswirkungen für die weitere Persönlichkeitsentwicklung erst in Ansätzen erforscht sind<br />
(Siehe hierzu: Hermann Koepke: Das neunte Lebensjahr).<br />
Fangt an!<br />
Fangt euer Handwerk fröhlich an!<br />
Dann wird ´s gar bald sein wohlgetan!<br />
Doch durften die Kinder auch von anderen Handwerkern<br />
lernen: Wir haben einen Schreiner, einen<br />
Schuster, einen Instrumentenbauer, einen Töpfer<br />
und einen Schmied besucht. Eine Jägerin und ein<br />
Zimmermann kamen sogar zu uns ins Klassenzimmer,<br />
um Kostproben ihrer vielfältigen Arbeit zu<br />
geben. Bei unserer einwöchigen Wollwerkstatt, beim<br />
Flechten eines kleinen Korbes oder zum Backen von<br />
Brötchen für unsere Patenklasse durften die Kinder<br />
dann selbst intensiv tätig werden.<br />
Im Rahmen der Hausbau-Epoche werden wir mit<br />
Elternunterstützung sogar noch ein Fachwerkhäuschen<br />
für unsere Schul-Bienen bauen. In Team-<br />
Cristal 10 | 2007
arbeit werden daneben noch viele kleine Wohnanlagen<br />
aus Naturmaterialien entstehen, welche die<br />
Kinder selbst gesammelt und bearbeitet haben.<br />
Zwar werden die konkreten Angebote und Aufgaben<br />
in jeder 3. Klasse individuell verschieden sein<br />
– zumal sich die Elternschaft mit ihren Fähigkeiten<br />
und Kontakten einbringen kann. Nur das Ziel ist für<br />
diese Klassenstufe das Gleiche: Den Kindern<br />
Schaffensfreude und Gestaltungskraft im konkreten<br />
Lebensalltag zum Erlebnis zu bringen.<br />
Inmitten des Rubikon: Wie wichtig solche Erfahrungen<br />
gerade in diesem Entwicklungsabschnitt um<br />
das 9. Lebensjahr herum sind, kann jeder bestätigen,<br />
der sein Kind genauer beobachtet. Nach einer Phase<br />
der inneren Unsicherheit – die einerseits zu einem<br />
Rückzug bis hin zum manches Mal unerklärlichem<br />
Weinen, andererseits aber zu trotzigem Selbstbehaupten<br />
führen kann – setzt ein völlig neues seelisches<br />
Verhältnis zur Umwelt ein. Eine andere Art von<br />
Fragen taucht nun auf – die eben gerade durch die<br />
praxisbezogenen Epochen des Landbaus, des Kennenlernens<br />
von Handwerken und des Hausbaus eine<br />
Antwort finden.<br />
Auch der Erzählstoff im 3. Schuljahr kommt dieser<br />
andersgearteten Seelenhaltung entgegen. Die<br />
Kinder hören jetzt in Anlehnung an das Alte Testament,<br />
wie die Welt und die Erde erschaffen worden<br />
sind – und wie es der Menschheit nach und nach gelang,<br />
die Erde zu bebauen und fruchtbar zu machen.<br />
Und sie erleben mit tiefer Ergriffenheit, wie das<br />
Scheitern zum Mensch-Sein dazugehört, wie es<br />
Konsequenzen mit sich bringt – und, dass es sich<br />
lohnt, immer wieder neu anzufangen.<br />
Die damit einhergehende Veränderung des Lernverhaltens<br />
bekommt nun natürlich genauso im<br />
Rahmen der Deutsch- und Mathematik-Epochen<br />
Nahrung. Jetzt kann die erste Sprachlehre sowie das<br />
umfangreiche Gebiet des Sachrechnens wirklich<br />
ergriffen werden.<br />
Im 4. Schuljahr setzt sich diese Entwicklung in<br />
verstärktem Maße fort. Die Schilderung der germanischen<br />
Götter- und Heldensagen im Erzählteil am<br />
Ende des jeweiligen Hauptunterrichtes wird nun<br />
zum inneren Begleiter. Sie impulsiert die Kinder, ihre<br />
Mut- und Willenskräfte noch gezielter einzusetzen.<br />
Dies ist beispielsweise notwendig, wenn es bei der<br />
Einführung des Bruchrechnens gilt, bei der Vielzahl<br />
von ungleichnamigen Bruchstücken nicht die Übersicht<br />
zu verlieren.<br />
Dem neuen Erleben der Umwelt kommt jetzt die<br />
erste Menschen- und Tierkundeepoche entgegen.<br />
Das von jedem Kind zu haltende erste kleine Referat<br />
ist eine der vielen kleinen Mutproben, die es in<br />
diesem Schuljahr zu meistern gilt. Die erste Heimatkunde-Epoche<br />
hilft demgegenüber, seinen eigenen<br />
Standpunkt im konkreten Lebensumfeld zu festigen.<br />
Auch das Anfertigen einfacher Landkarten trägt<br />
dazu bei.<br />
Im Spann<br />
Gemeinsam erleben die Kinder die Kraft der »Zugpferde«, die<br />
die Egge durch den Acker zieht.<br />
Cristal 10 | 2007 7
Ein sichtbarer und ein unsichtbarer Erfolg<br />
Ein ganzer Anhänger voll Getreide! Die Arbeit hat sich gelohnt!<br />
Da sich in diesem Lebensalter um das 9. und 10.<br />
Lebensjahr das gesunde Eins-zu-vier-Verhältnis von<br />
Atem und Pulsschlag herausbilden soll, kommt allem<br />
rhythmischen Tun eine wesentliche Bedeutung zu.<br />
Tagtäglich werden darum Lieder gesungen, Gedichte<br />
rezitiert oder es wird mit den Flöten musiziert.<br />
Auch wenn in dieser Zeit noch nicht der große<br />
Wachstumsschub der Pubertätszeit einsetzt, darf<br />
nicht unberücksichtigt bleiben, dass für die Bildung<br />
des eigenen Leibes genügend Kräfte zur Verfügung<br />
stehen müssen. Zu frühes und zu einseitiges Ansprechen<br />
des Intellektes würde demgegenüber die<br />
Gesundheitskräfte schwächen.<br />
Weiterhin kommt daher auch im Rahmen des<br />
Hauptunterrichtes dem künstlerischen Üben eine<br />
entscheidende Bedeutung zu. Im Verlaufe der Formenzeichnen-Epoche<br />
werden jetzt zum Beispiel<br />
Flechtbandformen geübt, die durch das fortwäh-<br />
Harmonie oder Lebensgefahr<br />
Es klappt nur, wenn der Rhythmus stimmt: Fünf Kinder schwingen Ihren Rhythmus beim Dreschen aufeinander ein.<br />
Cristal 10 | 2007 9
Ein Vergnügen mit Vorfreude<br />
In der Backstube beim Formen der Brötchen<br />
10<br />
rend wechselnde Oben-unten-Kreuzen die Aufmerksamkeit<br />
in besonderem Maße herausfordern.<br />
Doch findet der künstlerische Grundduktus genauso<br />
in einer sorgfältigen und schönen Gestaltung der<br />
Hefte zu den Epochen einen sprechenden Ausdruck.<br />
Die Bezeichnung Hauptunterricht will keineswegs<br />
darauf hinweisen, dass die daneben stattfindenden<br />
Fachunterrichte Nebensache wären. Im Gegenteil:<br />
Haupt- und Fachunterrichte ergänzen sich harmonisch.<br />
Beim Handarbeiten, Turnen, eurythmischen<br />
Bewegen, beim Erlernen der Fremdsprachen und<br />
sogar im Religionsunterricht wird das Thema der<br />
jeweiligen Klassenstufe aufgegriffen, um es für die<br />
Kinder wirklich ganzheitlich vertiefen zu können.<br />
Peter Schamberger<br />
ist Klassenlehrer der 3. Klasse<br />
(Bienen), seit acht Jahren<br />
in der Schulleitung, verantwortlich<br />
für die Säule »Pädagogische<br />
Entwicklung und<br />
Organisation der Unter- und<br />
Mittelstufe« an der FWO.<br />
Cristal 10 | 2007
1. und 2. Klasse<br />
Die Entwicklung des Kindes<br />
Von Ulrike Nolte<br />
Mit Kopf und Hand<br />
Handarbeiten der ersten Klasse in gemütlicher Runde.<br />
Aufgeschreckt durch die PISA-Studie wurden in<br />
den letzten Jahren bildungspolitische Entscheidungen<br />
forciert, die den gewohnten Organisationsrahmen<br />
schulischer Bildung aufbrechen. Statt sich an<br />
den laut Studie erfolgreichen Systemen zu orientieren<br />
(wie z. B. Finnland), gelten hierzulande Früheinschulung,<br />
zentrale Abschlüsse und Schulzeitverkürzung<br />
als Heilsbringer.<br />
Diesem herrschenden Glauben muss auch die<br />
Waldorfpädagogik begegnen, wenn sie weiterhin als<br />
Ersatzschule anerkannt bleiben will. Da sich aber<br />
Waldorfpädagogik nicht an wechselnden gesellschaftlichen<br />
Normen, sondern an der Entwicklung<br />
des Kindes orientiert – die sich der Anpassung an<br />
Gesetzesvorgaben verweigert! – steht die Waldorfschulbewegung<br />
nun vor der Aufgabe, in der Verantwortung<br />
für das Kind und dem Respekt vor seiner Individualität<br />
nach Wegen zu suchen den zu erwartenden<br />
Schaden zu begrenzen und ihr Ziel der ganzheitlichen<br />
Förderung aller Begabungen und Fähigkeiten<br />
des Kindes weiter zu verfolgen.<br />
Sicherlich können die Kinder der heutigen Zeit,<br />
wie von der Politik gefordert, schon früher auf intellektuelle<br />
Herausforderungen reagieren – sie sind<br />
ja (zum Glück!) erstaunlich anpassungsfähig. Je-<br />
doch: Die Ausbildung des Willens, die physisch-motorische<br />
Entwicklung und die seelisch-soziale Reifung<br />
werden darunter zu leiden haben.<br />
Wie häufig treffen wir auf die hellwachen Kinder,<br />
die zwar bereits in der ersten Klasse halbwissenschaftliche<br />
Erklärungen geben können, aber nicht in<br />
der Lage sind, über einen gewissen Zeitraum hinweg<br />
still zu sitzen, anderen zuzuhören und Arbeiten mit<br />
einer bestimmten Ausdauer zum Ende zu bringen<br />
und sorgfältig zu gestalten. Zu den glücklichen Kindern<br />
einer Klasse gehören diese Kinder oft nicht,<br />
deshalb liegt hier ganz deutlich unsere Verantwortung.<br />
Die Entwicklung des Kindes: Die Entwicklung des<br />
Kindes gilt in der Waldorfpädagogik als Maßstab<br />
und Orientierungshilfe methodischer und didaktischer<br />
Entscheidungen. Die Menschenkunde Rudolf<br />
Steiners dient dabei als Grundlage. Entwicklung findet<br />
das ganze Leben über statt, doch wird das Fundament<br />
in Kindheit und Jugend gelegt: das Fundament<br />
für Gesundheit und Leistungsstärke – oder<br />
aber auch für Krankheit und Schwäche in Folge<br />
eines Ernährungsmangels in physischer sowie seelisch-geistiger<br />
Hinsicht.<br />
Cristal 10 | 2007 11
Mit der Hilfe einer guten Ordnung<br />
English Tea Time in Class 2<br />
Entwicklung ist kein linearer Prozess, der beliebig<br />
beschleunigt werden kann, sondern eine Abfolge<br />
bestimmter eigenständiger Entwicklungsphasen.<br />
Jede Verfrühung bedingt eine Schwächung der<br />
Konstitution, das physikalische Energieerhaltungsgesetz<br />
lässt sich auch auf den Menschen übertra-<br />
Nach konzentrierter Arbeit müde geworden?<br />
Dann könnten aus Arbeitstischen Turnbänke werden …<br />
12<br />
gen: Fordere ich zu früh Kräfte für intellektuelle<br />
Leistungen, werden physisch-physiologische und<br />
seelisch-geistige Reifungsprozesse eingeschränkt.<br />
So kann zu frühe und einseitige intellektuelle Förderung<br />
im Physischen zu späterer höherer Infektionsanfälligkeit<br />
und damit häufigeren Erkrankungen<br />
führen und eine seelische und soziale Vernachlässigung<br />
eine emotionale Deprivation bedeuten, was<br />
zu gefährlichen Entwicklungen führen kann, wie<br />
Bindungsverlust oder die Entwicklung von krimineller<br />
Energie bei relativ hoher Intelligenz. Hinweise<br />
darauf geben die in letzter Zeit häufiger auftauchenden<br />
Presseberichte über zunehmende Gewalt<br />
an Schulen.<br />
Rudolf Steiner beschreibt die Entwicklung des<br />
Kindes in Jahrsiebten. Werden in den ersten Jahren<br />
die physischen Grundlagen durch die Lebenskräfte<br />
des Kindes ausgebildet und mit ihnen die Basalsinne,<br />
wie Tast-, Lebens-, Eigenbewegungssinn sowie<br />
das Gleichgewicht, liegt der Schwerpunkt nach der<br />
Schulreife auf der emotional-seelischen Entwicklung,<br />
dazu gehören die sogenannten Natursinne:<br />
Riechen, Schmecken, Sehen und der Wärmesinn.<br />
Nach der Pubertät folgt die Ausbildung des Denkens<br />
auf der Grundlage der vorherigen Entwicklungsschritte:<br />
Über die Ruhe führt die Ausbildung des<br />
Gleichgewichtssinnes zum Hören; der Eigenbewe-<br />
Cristal 10 | 2007
gungssinn schenkt die Freiheit zum gedanklichen<br />
Ergreifen des Wortes und der Sprache; der Lebenssinn<br />
zeigt sich im Wohlbefinden, der Tastsinn bildet<br />
die erste Brücke vom Ich zur Welt und das Gottgefühl<br />
wird im Ichwahrnehmungssinn tätig und wach.<br />
Fazit: Gerade in der Sinnesentwicklung wird deutlich,<br />
wie die ersten Lebensjahre die Ausgestaltung<br />
der menschlichen Individualität für sein späteres<br />
Leben bestimmen.<br />
Die ersten beiden Schuljahre: Unter diesen Voraussetzungen<br />
ergeben sich für die Waldorfpädagogik<br />
methodische und didaktische Konsequenzen.<br />
Natürlich sollen (und wollen!) die Kinder die eher intellektuellen<br />
Kulturtechniken Schreiben und Lesen<br />
sowie das Rechnen lernen, aber mit einer Methode,<br />
die ihrem Entwicklungsstand entspricht. Kinder<br />
kommen aus der geistigen Welt und wollen sich auf<br />
der Erde verwurzeln, sie er- und begreifen, sich mit<br />
ihr verbunden fühlen (Kohärenzgefühl).<br />
Alles, was sie lernen, muss durchschaubar, handhabbar<br />
und sinnvoll sein, über das Gefühl wird eine<br />
innere Verbindung zwischen Lernstoff (Welt) und<br />
den Kindern hergestellt. Bildung findet über Bilder<br />
statt, Begreifen über das Ergreifen, insbesondere das<br />
Ergriffensein und in der frühen Kindheit primär über<br />
das Greifen an sich. In diesem Zusammenhang wird<br />
ebenso deutlich, dass sich das Ergreifen der Welt<br />
konzentrisch in wachsenden Kreisen vom Kinde aus<br />
vollziehen muss und über seine Sinne tastend und<br />
fühlend fortschreitet bis hin zur abstrahierenden<br />
Vorstellung.<br />
Findet im ersten Jahrsiebt durch eine geeignete<br />
Umgebung über den Bewegungsdrang und die offene<br />
nachahmende Lernfreude des Kindes Selbstbildung<br />
statt, so bedeutet der Übergang ins Schulalter<br />
eine Änderung des Lernverhaltens: Von der Selbstbildung<br />
zur Bildung, vom lokalen Gedächtnis zur<br />
gesteuerten Erinnerung, von spontaner Anregung<br />
zu zielgerichtetem Verhalten, von einer Außenorientierung<br />
zu einer innengerichteten Reflexionsfähigkeit.<br />
Im Sozialen bedeutet die erste Klasse zum ersten<br />
Male eine große altershomogene Gruppe, in der<br />
jedes Kind seinen Platz finden muss. Von Gewohnheiten<br />
führt der Lernprozess zur bewussten Akzeptanz<br />
von Regeln im Miteinander.<br />
Dieser komplexe Entwicklungsschritt in die Schulreife<br />
verläuft nur dann glücklich, wenn die physisch-physiologischen<br />
Grundlagen mit Hilfe der Lebenskräfte<br />
des Kindes geschaffen wurden. Schon<br />
heute, also im Grunde vor dem nun beginnenden<br />
Prozess der immer früher geforderten Einschulung,<br />
bringen aber viele Kinder diese Voraussetzungen<br />
nicht mit. Das bedeutet schon jetzt für die ersten<br />
Schuljahre Gelegenheit zur Nachreifung und Förderung<br />
der Sinnesentwicklung als notwendiger Bestandteil<br />
der Didaktik. Im emotional-seelischen<br />
Bereich muss die Bindungsfähigkeit im Vordergrund<br />
stehen; Ergebnisse der Hirnforschung machen deutlich,<br />
dass nachhaltiges Lernen über ein emotional<br />
positives Verhältnis zum Lehrer und zu den Dingen<br />
gefördert wird.<br />
In den <strong>Waldorfschule</strong>n wird von Beginn an durch<br />
die 8-jährige Klassenlehrerzeit, in der Vertrautheit,<br />
Bindung und somit Sicherheit wachsen können, diesem<br />
Anspruch an persönliche Bindung Rechnung<br />
getragen, die Beziehung zu den Dingen wird über<br />
den künstlerischen Schwerpunkt in der Didaktik<br />
(»Die Welt ist schön«) und nicht zuletzt über den<br />
religiösen Aspekt hergestellt: Die Welt und natürlich<br />
auch sich selbst als Gottes Schöpfung zu begreifen<br />
lassen im Kinde Ruhe, Geborgenheit, Orientierung<br />
und Dankbarkeit wachsen.<br />
Die Praxis des Waldorfunterrichts: Doch wie<br />
sieht der Waldorfunterricht in den ersten beiden<br />
Klassen nun konkret aus? Drei sich abwechselnde<br />
Epochen prägen zunächst den Hauptunterricht: das<br />
Formenzeichnen, das Schreiben und das Rechnen,<br />
wobei die etwa vierwöchigen Epochen, in denen<br />
täglich ein Thema weitergeübt wird, rhythmisch<br />
immer wieder ergriffen werden und ein tiefes Eintauchen<br />
in die Inhalte ermöglichen.<br />
Das Formenzeichnen greift genau die Kräfte auf,<br />
die bisher körperbildend in der Physis des Kindes<br />
gewirkt haben und gleichzeitig die ganze Welt beschreiben,<br />
in dem es die Gerade und die gebogene<br />
Linie als Wesenheiten vermittelt. Wie aber können<br />
solche Abstraktionen Gefühle ansprechen, wie zuvor<br />
gefordert wurde? Schon die Frage „Worauf möchtest<br />
Du lieber sitzen?“ führt bei zwei spitz zusammengeführten<br />
Geraden oder einer nach oben gewölbten<br />
Gebogenen zu innerem Empfinden!<br />
Das Schreiben ist zunächst ebenso abstrakt-intellektuell,<br />
ist doch jeder Buchstabe eine von Menschen<br />
festgelegte abstrakte Form für einen Laut.<br />
Auch hier kann die Bildhaftigkeit vermitteln: Nach<br />
einer die Gefühlswelt des Kindes ansprechenden Geschichte<br />
wird am nächsten Tag ein Bild gemalt, aus<br />
dem dann später der Buchstabe in seiner abstrakten<br />
Form gelöst wird – Sinnhaftigkeit gekoppelt an gefühltes<br />
Erleben in den Bildern der Erzählung vermittelt<br />
den Lernprozess. Dem Rechnen dagegen liegt<br />
eine göttliche Ordnung zugrunde, erkennbar an den<br />
Naturgesetzen der Schöpfung. Dabei wird metho-<br />
Cristal 10 | 2007 13
disch vom Ganzen aus gegliedert, ein Gott, eine<br />
Sonne, eine Erde, ein Mensch – doch zwei Hände,<br />
zwei Augen usw. Das Zählen wird rhythmisiert,<br />
Strukturen entstehen und lassen in Verbindung mit<br />
Bewegung Ordnungen aufleuchten.<br />
Rhythmus findet sich im ganzen Unterricht,<br />
gemäß der Entwicklungsfolge Gehen – Sprechen –<br />
Denken beginnt der Unterricht mit viel Bewegung<br />
und führt über das Singen von Liedern und dem<br />
Sprechen von Gedichten zum Thema der Epoche.<br />
Gerade im Bewegungsteil werden die notwendigen<br />
Nachreifungen in der sensorisch-motorischen Entwicklung<br />
der Kinder gefördert, dabei können mit<br />
den in unserer Schule für die beiden ersten Schuljahre<br />
eingerichteten sogenannten »Bewegten Klassenzimmern«,<br />
in denen an Stelle von Stühlen und Tischen<br />
Bänke und Sitzkissen zu finden sind, insbesondere<br />
für die Förderung des Eigenbewegungssinns<br />
und des Gleichgewichtsgefühles optimale Bedingungen<br />
erreicht werden. Schnell sind die Bänke zum<br />
Kreis gestellt und bieten in der Mitte viel Freiraum,<br />
dann wieder dienen sie umgedreht als Balancier-<br />
Balken (Bild) und quer hintereinander gestellt als<br />
Hindernisse. Für den Epochenteil werden sie mit<br />
Sitzkissen wieder zum Tisch. Gleiches gilt für das gemeinsame<br />
Frühstück im Klassenzimmer, sogar eine<br />
14<br />
lange Tafel für eine »English-teatime« ist schnell<br />
gestellt (Bild). Je nach Gruppengröße werden sie zu<br />
kleineren oder größeren Kreisen zusammengestellt,<br />
um als Sitzbänke ein gemütlichen Beisammensein<br />
während der Handarbeit zu ermöglichen (Bild).<br />
Ein weiterer Schritt unserer Schule in Richtung<br />
einer Zukunftsbewältigung, wenn man hier wieder<br />
die Problematik Früheinschulung einbezieht, war die<br />
Einrichtung des »Bochumer Modells«, einer an der<br />
Bochumer <strong>Waldorfschule</strong> 1998 entwickelten Tagesstruktur,<br />
die dem Anspruch nach persönlichem Beziehungsaufbau<br />
Rechnung trägt und daher den Kindern<br />
in den ersten beiden Schuljahren Verlässlichkeit,<br />
Geborgenheit und Hülle bietet.<br />
Nach diesem Modell verbleibt der Klassenlehrer<br />
von 8 bis 12 Uhr bei seiner Klasse und begleitet so<br />
auch den von Fachlehrern erteilten Unterricht, den<br />
er selbst in der Regel nicht übernimmt (Russisch,<br />
Englisch, Eurythmie, Handarbeit, Religion oder Turnen).<br />
So ist er in der Organisation des Tages frei und<br />
kann z.B. den abschließenden Erzählteil ans Ende<br />
des Schultages legen – der Schultag als rhythmischstrukturierter<br />
erweiterter Hauptunterricht, was den<br />
Bedürfnissen der heutigen Kinder sehr entgegen<br />
kommt. Als Ansprechpartner bleibt er in der Nähe<br />
der Kinder und kann auch einmal als Nichtunter-<br />
Cristal 10 | 2007
Achtsam erkunden<br />
Balancieren auf umgedrehten Arbeitstischen erfrischt.<br />
richtender die Klasse wahrnehmen – ein nicht zu<br />
unterschätzender Vorteil.<br />
Sind das »Bewegte Klassenzimmer« und das Bochumer<br />
Modell verbindende Elemente des ersten<br />
und zweiten Schuljahres, werden die Unterschiede<br />
– begründet in der Entwicklung der Kinder – besonders<br />
im Erzählstoff deutlich. Tauchen die Erstklässler<br />
noch wohlig träumend tief in die Märchenwelt<br />
ein, wo mit Hilfe von alten Wahrbildern trotz<br />
aller vermeintlichen Grausamkeiten die Zuversicht<br />
in den Sieg des Guten gedeihen kann, wird der<br />
wache Blick der gewachsenen Zweitklässler auf die<br />
Fabeln gelenkt. In den Bildern der Fabeln werden<br />
menschliche Eigenschaften an den Einseitigkeiten<br />
der geschilderten tierischen Verhaltensweisen verdeutlicht<br />
und mit Humor zur Kenntnis genommen –<br />
der Blick der Zweitklässler ist schärfer geworden.<br />
Ausgleichend werden dazu die Legenden der großen<br />
Heiligen erzählt, das sieghafte Gute des Märchens<br />
wird im Menschen spürbar und rückt dem individuell<br />
wacheren Bewusstsein des Zweitklässlers näher.<br />
Zusammenfassung und Ausblick: Trotz der bis<br />
hierher aufgezeigten Wege, den von außen gegebenen<br />
Anforderungen angemessen zu begegnen ohne<br />
die eigenen Zielsetzungen aufzugeben, bleiben<br />
angesichts der auf uns zukommenden jüngeren und<br />
in der Regel unreiferen Kinder auch für unsere<br />
<strong>Waldorfschule</strong> große Aufgaben zu bewältigen, um<br />
diesen Spagat zwischen früher Einschulung, verkürzter<br />
Schulzeit, zentralen und rein intellektuell-<br />
orientierten Abschlüssen und den tatsächlichen<br />
Entwicklungsschritten der Kinder zu meistern. Hilfreich<br />
sein wird uns das Vertrauen in den entwicklungsgemäßen<br />
Waldorflehrplan, das Bochumer<br />
Modell und das bewegte Klassenzimmer zur Förderung<br />
von Nachreifung und Aufbau von Bindung.<br />
Ein kleiner Schritt auf diesem Wege kann die feste<br />
Einrichtung einer Waldschulepoche zu Beginn des<br />
ersten Schuljahres sein, die in den letzten beiden<br />
Jahren mit viel Elternhilfe gelingen konnte. Sie schuf<br />
einen gleitenden Übergang vom Kindergarten in die<br />
Schule.<br />
Gegenüber unpädagogischen staatlichen Vorgaben,<br />
die eine geisteswissenschaftliche Menschenkunde<br />
des kleinen Kindes nicht anerkennen, ist uns<br />
das Vertrauen in die sich entfaltenden Kräfte der<br />
Kinder, die für die Welt der Zukunft geboren wurden,<br />
Trost und Ansporn zugleich bei der Lösung aller<br />
Probleme. Lernen lässt sich nur durch Wahrnehmen,<br />
und da die Kinder unserer Zeit voraus sind, werden<br />
wir an ihnen und mit ihnen den richtigen Weg<br />
finden.<br />
Ulrike Nolte<br />
Klassenlehrerin der 2. Klasse,<br />
im Schuljahr 2006/07 hat sie<br />
das Anti-Bullying Konzept nach<br />
Dan Olweus an der FWO<br />
eingeführt.<br />
Cristal 10 | 2007 15
16<br />
H. Ochsenbrücher GmbH<br />
Ihr Spezialist für:<br />
Linienbusse · Schulbusse · Gruppen- und<br />
Studienreisen<br />
H. Ochsenbrücher GmbH<br />
Seifen 1<br />
51597 Morsbach<br />
Tel. 0 22 94 / 244<br />
Fax. 0 22 94 / 87 58<br />
info@ochsenbruecher.de<br />
Cristal 10 | 2007
Cristal 10 | 2007 17
18<br />
Cristal erscheint Mitte des Jahres als unabhängige<br />
Zeitschrift für Bildung und Kultur.<br />
Herausgeber: <strong>Freie</strong> <strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong> e.V.<br />
Verantwortlich:<br />
Brigitte Wurster (V.i.S.d.P.). Jeder Beitrag gibt die<br />
Meinung des Autors wieder; eine Übereinstimmung<br />
mit der Meinung der Redaktion kann aus seiner<br />
Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.<br />
Anzeigen:<br />
Petra Ley p.ley@tiscali.de<br />
wurster@schulzeitschrift.org<br />
Redaktion:<br />
Susanne Starke, Brigitte Wurster<br />
Photos:<br />
Ulrike Nolte, Peter Schamberger, Rolf Schönstein,<br />
Schularchiv<br />
Verteiler:<br />
Susanne Starke starke@schulzeitschrift.org<br />
Verlag:<br />
MARCSTEIN-GmbH, Veldnerweg 19, 74523 Schwäbisch<br />
Hall, T. 0791-9 78 09 71. Verantwortlich für<br />
Auswahl, Titel und sinnwahrende Kürzung der<br />
MARCSTEIN-Beiträge (Pagninierung mit vorangestelltem<br />
»m«). Inhalt verantwortet der Autor.<br />
info@marcstein.de<br />
Impressum<br />
Satz und Druck:<br />
Siller Print Factory www.siller-print.de<br />
Auflage:<br />
6.000<br />
Vertrieb:<br />
Kostenlose Verteilung im <strong>Oberberg</strong>ischen Kreis, Gemeindegebiet<br />
Much und Neunkirchen-Seelscheid<br />
Anzeigen- und Redaktionsschluss<br />
Cristal No. 11: 30. März 2008<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
<strong>Freie</strong> <strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong> e.V.<br />
Redaktion Cristal<br />
Kirchhellstraße 32<br />
51645 Gummersbach<br />
T. 02261-968612<br />
F. 02261-968676<br />
wurster@schulzeitschrift.org<br />
Gedruckt auf Luxo Samtoffset, ausgezeichnet mit<br />
dem umfassenden Nordischen Umweltzeichen<br />
»Swan Label«.<br />
Cristal 10 | 2007
Pädagogik<br />
Über die Liebe in der Erziehung<br />
Von Annette Renschler<br />
„Ach Gott, warum muss dein Kind denn zur <strong>Waldorfschule</strong>,<br />
ist etwas nicht in Ordnung mit dem?“<br />
Diese Frage hörte ich, als ich einer Bekannten stolz<br />
erzählte, dass mein Sohn den begehrten Platz in der<br />
<strong>Waldorfschule</strong> bekommen hatte.<br />
Eine Nachbarin erklärte den Freunden meines Sohnes:<br />
„Da müssen alle die Kinder hin, die kein Fernsehen<br />
gucken dürfen.“ Damit begann ein immer wieder<br />
auftauchender Rechtfertigungsdruck, stets musste<br />
ich auf Anfragen erklären, dass meine Kinder ganz<br />
normal, die <strong>Waldorfschule</strong> keine Schule für Lernbehinderte<br />
und ich auch keine Sonderschullehrerin sei.<br />
Selbst unsere Schüler werden mit diesen Fragen konfrontiert,<br />
so erklärte mir eine Schülerin nach dem<br />
Achtklassspiel, wir hätten in diesem Jahr ja eigentlich<br />
nichts gelernt. Sie hatte sich mit den Nachbarskindern<br />
verglichen, die ein Gymnasium besuchen.<br />
Wir alle kennen diese Vorurteile, eines aber haben<br />
sie alle gemeinsam: Sie gründen auf Unwissen, diese<br />
Menschen verstehen nicht, was Waldorfpädagogik<br />
eigentlich will. Und wie kann man das auch mal<br />
eben knapp und prägnant auf einen Nenner bringen?<br />
Während meiner Ausbildung zur Waldorflehrerin<br />
habe ich mich schließlich gefragt, wie man denn das<br />
Anliegen der Waldorfpädagogik in eine kurze Form<br />
fassen könnte. Meine Kurzform lautete schließlich:<br />
»Die Waldorfpädagogik erzieht die Menschen zur<br />
Liebefähigkeit.«<br />
Was dies eigentlich bedeutet und wie man dieses<br />
Ziel ansteuern kann, möchte ich im Folgenden erläutern.<br />
Vor allem aber möchte ich anregen, sich<br />
mit dem Begriff der Liebe auseinanderzusetzen.<br />
Der Begriff »Liebe«: Wohl kein Wort wird in der<br />
Literatur und in der Musik so oft benutzt wie dieses.<br />
Entsprechend sind wir alle der Meinung zu wissen,<br />
was damit gemeint ist. Ist das wirklich so?<br />
Beim Stöbern in Lexika und Duden kann man denkwürdige<br />
Entdeckungen machen, ebenso beim Lesen<br />
christlicher und altphilologischer Texte und in philosophischen<br />
Abhandlungen von Plato, Spinoza usw.<br />
Jeder kennt auch den sehr fragwürdigen Satz von<br />
Sigmund Freud, dass »Liebe gehemmte Sexualität sei«.<br />
Man kann leicht den Eindruck gewinnen, dass es wohl<br />
„Es gibt nur drei Erziehungsmittel: Angst, Ehrgeiz und Liebe.<br />
Wir verzichten auf die beiden ersten.“<br />
Rudolf Steiner<br />
mehrere Begriffe von Liebe gibt. Sie lässt sich nicht<br />
wirklich definieren und somit auf einen Punkt bringen.<br />
So geht man von der triebhaften Liebe aus, die<br />
durch den sexuellen Trieb und der Sehnsucht nach<br />
harmonischer Einheit zwischen männlichem und<br />
weiblichem Prinzip bestimmt wird, bis hin zu Begriffen<br />
wie Hingabe, Opferwille, Selbstaufgabe in<br />
der Mystik usw. Viele Philosophen und Theologen<br />
haben sich intensiv mit diesem Begriff beschäftigt.<br />
Das Christentum, das unsere Kultur begründet und<br />
bestimmt, hat schließlich Gott selbst in seinem Sohn<br />
Christus als die personifizierte Liebe bezeichnet.<br />
Hat man einige Definitionen und Beschreibungen<br />
gefunden, stößt man auf das, was Liebe will. So fordert<br />
Liebe angeblich immer Gegenliebe, sie will stets<br />
eine Vereinigung gegensätzlicher Prinzipien, sie ist<br />
laut Plato Grundlage jeder Erkenntnis usw.<br />
Ich möchte gerne einladen, sich einmal in den<br />
alten und auch neueren Texten umzuschauen, die<br />
Liebe ist ein sehr spannender Begriff. Nach all dem<br />
Stöbern und Nachlesen hat sich für mich eine Gemeinsamkeit<br />
herauskristallisiert, die ich nun zu umschreiben<br />
versuche.<br />
Liebe ist nach all dem kein süßliches Gefühl, kein<br />
lächelndes Harmoniebedürfnis sondern ein tiefes<br />
Bedürfnis – ja sogar Begehren – nach Erkenntnis<br />
und Verbindung, das in jedem Menschen wohnt.<br />
Damit hat die Liebe einen grundlegenden Gestus,<br />
nämlich den Gestus des »Sich-Öffnens« für etwas<br />
oder jemanden. Diese Öffnung geht der Liebe immer<br />
voraus, sie ist Bedingung für jede Form von Liebe.<br />
Sympathie und Antipathie: In der allgemeinen<br />
Menschenkunde finden wir eine spannende Umschreibung<br />
Rudolf Steiners für jede Form von Beziehung.<br />
So prägt er die Begriffe Sympathie und Antipathie<br />
von der Ethymologie ausgehend als notwendiges<br />
Gegensatzpaar für jede zwischenmenschliche<br />
Begegnung. Dabei umschreibt Pathos im Griechischen<br />
das Gefühl, also das, was vom Seelischen ausgeht.<br />
Sym- ist eine Vorsilbe, die ursprünglich zusammen<br />
bedeutet. Anti ist immer das, was gegenüber,<br />
entgegengesetzt steht.<br />
So bedeutet Sympathie eigentlich das, was wir<br />
heute Empathie nennen, nämlich das Mitfühlen-<br />
Cristal 10 | 2007 19
20<br />
Cristal 10 | 2007
Zusammenfühlen mit dem Gegenüber. Rudolf Steiner<br />
fasst es noch enger, er spricht hier davon, dass<br />
wir in den andern hineinträumen, ja sogar hineinschlafen,<br />
was ausdrücken möchte, dass es ein halbbewusstes<br />
oder sogar unbewusstes Innewohnen in<br />
der Seelenwelt des Gegenübers ist.<br />
Antipathie bedeutet demnach, dass wir aus dem<br />
Gefühl aussteigen, uns also von außen das Gegenüber<br />
betrachten, man könnte sagen rein sachlich. In<br />
dem Moment, in dem ich eine Position gegenüber<br />
habe und etwas von außen betrachte, bin ich erst<br />
zur bewussten Erkenntnis fähig, kann es als Ganzes<br />
sehen. Also im Gegensatz zur Sympathie bin ich hier<br />
weder träumend noch schlafend sondern hellwach,<br />
ganz im Bewusstsein.<br />
Nun beschreibt Rudolf Steiner das Gegenspiel von<br />
Antipathie und Sympathie wie ein Oszillieren. Die<br />
Momente von sympathischem Hineinträumen und<br />
antipathischem Gegenüberstellen müssen stetig in<br />
einem schnellen Rhythmus zwischen uns und dem<br />
Gegenüber wechseln, nur so werden wir dem anderen<br />
– und auch uns – gerecht.<br />
Verglichen mit dem oben gefundenen Liebebegriff<br />
finden wir außer dem Gestus des Öffnens auch den<br />
Gestus des Verschließens. Dies gilt aber nur für den<br />
seelischen Gestus, denn während ich die antipathische<br />
Geste habe, öffne ich alle geistigen Sinne, die<br />
zur Erkenntnis notwendig sind. Und so kommt man<br />
hier wieder zum Liebebegriff, denn wie schon Platon<br />
sagte, ist die Liebe Grundlage für jede Erkenntnis.<br />
Pädagogik und Liebe: Auch hier möchte ich erst<br />
einmal auf den Begriff eingehen. Päd- als Vorsilbe<br />
kommt aus dem Griechischen und bezeichnet das<br />
Kind, den Knaben. agein ist ein griechisches Verb,<br />
das mit unserem begleiten, führen zu übersetzen<br />
ist. Pädagogen sind also Menschen, die ein Kind<br />
führen und begleiten. Demnach sind auch alle Eltern<br />
und anderen Erwachsenen, die sich mit Kindern beschäftigen<br />
eigentlich Pädagogen. Dies ist von daher<br />
wichtig, da uns bewusst sein sollte, dass jede Begegnung<br />
mit einem Kind eine pädagogische Bedeutung<br />
hat. Dies kann uns helfen, uns der Verantwortung<br />
bewusst zu sein, die wir in diesen Begegnungen<br />
haben, wir führen nämlich diese Kinder in ihr<br />
Leben. Überhaupt ist für mein Verständnis die Liebe<br />
immer an Verantwortung gekoppelt. In der liebevollen<br />
Begegnung zu anderen Menschen entsteht<br />
schon aus dem heraus, was Liebe will sofort ein Gefühl<br />
der Verantwortung für das Wohlergehen und<br />
die Bedürfnisse des Gegenüber. Dabei bedeutet<br />
Wohlergehen in unserer Pädagogik vor allem Entwicklung<br />
und damit Erkenntnis dessen, was in dem<br />
Menschen entwickelt werden möchte. Das hat<br />
nichts mit dem Lustprinzip zu tun und dem oft falschen<br />
Verständnis zu tun, dass die Kinder sich immer<br />
wohlfühlen müssen. Nein, es geht darum, ihren entwicklungsbedingten<br />
Bedürfnissen gerecht zu werden<br />
und das kann auch mal unangenehm sein.<br />
Die Waldorfpädagogik will Kinder zu Weltenbürgern<br />
machen, anders ausgedrückt: zu lebensfähi-<br />
gen Menschen in unserer sehr komplexen Gesellschaft.<br />
Und in unserem Erwachsenenleben erleben<br />
wir viele Schwierigkeiten, die wir bewältigen müssen.<br />
Um aber mit solchen Situationen umgehen zu<br />
können, müssen wir vorher ein Übfeld haben und<br />
das findet sich in der Kindheit. Hier wird im Spiel<br />
geübt, Frustrationen auszuhalten, Grenzen zu erkennen<br />
und zu achten und Regeln einzuhalten. Im<br />
Unterricht in einer Klasse wird geübt, wie man sich<br />
Inhalte aneignet, wie man am besten lernt, werden<br />
unendlich viele Erfahrungen im Seelischen und Sozialen<br />
gemacht.<br />
Hier hilft vielleicht das Bild einer Traube,<br />
die nur gut wachsen und reiche Frucht<br />
tragen kann, wenn sie an ihrer Rebe<br />
festgebunden ist, die ihr einen klaren<br />
Halt gibt.<br />
Wildwuchs schwächt: Konflikte und Umgang mit<br />
Kritik übt man am besten schon im Kindesalter in<br />
der Familie, ebenso erüben die Kinder ihre Wirkung<br />
im Sozialen schon im Kindergarten. Und bekommen<br />
sie hier keine Grenzen und klaren Rückmeldungen,<br />
können sie auch nicht zu Erkenntnissen und Erfahrungen<br />
kommen: Sie erleben sich nicht, sie spüren<br />
sich und ihre Grenzen nicht und schon gar nicht die<br />
der anderen. Daher ist es uns wichtig, den Kindern<br />
klare Regeln und Formen zu geben, nur innerhalb<br />
der festgesetzten Grenzen können sie sich nämlich<br />
frei entwickeln. So ist Strenge auch eine Form von<br />
Liebe, nämlich eine formgebende, die den Kindern<br />
Halt und dadurch Schutz vor Fehlentwicklung gibt.<br />
Hier hilft vielleicht das Bild einer Traube, die nur gut<br />
wachsen und reiche Frucht tragen kann, wenn sie an<br />
ihrer Rebe festgebunden ist, die ihr einen klaren<br />
Halt gibt. In Griechenland sieht man oft Reben wild<br />
und ungezügelt auf dem Boden wachsen, sie ergehen<br />
sich im Wildwuchs, sind aber schwächer und<br />
tragen weniger und oft saure Frucht.<br />
Künstlerisch erziehen: Wie nun können wir Kinder<br />
liebevoll zu liebefähigen Menschen erziehen?<br />
Auch hier hilft uns die Menschenkunde. Rudolf Steiner<br />
beschreibt ein gutes Erziehen stets als ein künstlerisches<br />
Erziehen.<br />
Dies wird häufig missverstanden. So meinen viele,<br />
ein künstlerischer Unterricht habe viel mit Malen<br />
und Basteln zu tun. Ein Lehrer, der mit den Kindern<br />
viele Bildchen malt, muss deswegen noch lange<br />
nicht künstlerisch unterrichten. Wieder hilft uns die<br />
Auseinandersetzung mit dem Begriff. Der heutige<br />
Kunstbegriff ist schwer zu fassen, auch er ist eigentlich<br />
nicht mehr auf einen Punkt zu bringen. Beuys<br />
prägte den Satz: »Jeder Mensch ist ein Künstler«.<br />
Damit drückt er aus, was Kunst heute sein sollte, individueller<br />
Ausdruck einer individuellen Wahrnehmung.<br />
Was bedeutet das für die Pädagogik Rudolf<br />
Steiners? Vereinfacht könnte man sagen: Ein künst-<br />
Cristal 10 | 2007 21
lerischer Unterricht entsteht aus einer Wahrnehmung,<br />
die ihren pädagogischen Ausdruck findet.<br />
Dabei nimmt der Pädagoge zum einen die Unterrichtsinhalte<br />
wahr. Dazu muss er sich für diese Inhalte<br />
öffnen, also eine Liebe für die Sache entwickeln<br />
können, sich in die Gesetze und Regeln, in die<br />
Geschichte und die Sprache einfühlen. Gleichzeitig<br />
muss er aber auch Antipathie entwickeln, sonst<br />
würde er sich in den Inhalten verzetteln und den<br />
Blick für das Ganze verlieren.<br />
Dann nimmt der Lehrer die Klasse wahr, er entwickelt<br />
ein tiefes Gefühl für das, was da lebt. Dabei ist<br />
außerordentlich wichtig, dass Sympathie und Antipathie<br />
im Gleichklang sind. So lebt er empathisch<br />
mit jedem Kind mit und hat so ein unbewusstes<br />
oder halbbewusstes Gefühl für die Bedürfnisse aller<br />
Kinder in der Klasse, man könnte sagen ein Bauchgefühl.<br />
Dies muss er antipathisch betrachten können,<br />
also ins Bewusstsein heben. Daraus erwächst<br />
dann die pädagogische Umsetzung, die Tat. So kann<br />
es für eine Klasse durchaus mal ein Jahr früher<br />
schon dran sein, sich mit der Sternenkunde zu beschäftigen,<br />
eine andere Klasse sollte vielleicht erst<br />
ein Jahr später ihr Sozialtraining machen. Dieses individuelle<br />
Einfühlen und Erspüren des Klassenbedürfnisses<br />
ist die Grundlage für jeden Unterricht,<br />
der die Kinder und Jugendlichen auch erreichen will.<br />
Dies gilt natürlich auch für jede individuelle Kinderbetrachtung<br />
und die Begegnungen mit den einzelnen<br />
Individuen. So kann es gut sein, ein Kind sehr<br />
streng und scharf auf seine Grenzen aufmerksam zu<br />
machen, für ein anderes Kind reicht ein humorvolles<br />
Augenzwinkern und ein nettes Anekdötchen.<br />
Manche Kinder brauchen viel Lob und Anerkennung,<br />
um überhaupt zu bemerken, dass auch sie<br />
Lernerfolge haben können, manche brauchen klare<br />
und sachliche Rückmeldungen, wieder andere<br />
wachsen an der Kritik. Jedes Kind möchte individuell<br />
betrachtet und adäquat begleitet werden, das ist<br />
für mich liebevolle und eben künstlerische Pädagogik.<br />
Ein guter Pädagoge, ob Lehrer oder Elternteil,<br />
muss demnach liebefähig im obigen Sinne sein, um<br />
dem Kind gerecht zu werden.<br />
22<br />
Zur Liebefähigkeit erziehen: Schon durch die<br />
Inhalte unserer Pädagogik ist eigentlich veranlagt,<br />
den Kindern die Liebe zur Sache und schließlich<br />
auch zu sich und den anderen zu vermitteln. So erleben<br />
die Kleinsten in der liebevollen und bewussten<br />
Begegnung mit der Natur, mit ausgesuchten Materialien,<br />
im Umgang mit ihren Sinnen eine tiefe Beziehung<br />
zu der Welt und ihren geistigen immateriellen<br />
Wahrheiten. Beziehung zu Gott heißt<br />
Religion, also, eine religiöse Zuwendung, ein sich<br />
Öffnen: Liebe zur Welt.<br />
Rudolf Steiner nennt diese Haltung auch die Haltung<br />
der Demut. Dies setzt sich altersgemäß fort. Die<br />
Kinder erleben in den Märchen unbewusst eine Auseinandersetzung<br />
mit den Werten und der Moral, sie<br />
erfahren im Rechnen die naturgegebenen Rhythmen<br />
und Gesetze, sie erleben andere Religionen und<br />
fühlen sich in Geschichte tief in andere Zeiten hinein.<br />
So entsteht Ehrfurcht. Dies geht bei uns immer<br />
über den ganzen Menschen, nicht nur Begriffe lernen<br />
sondern mit allen Sinnen erfahren ist hier die<br />
Devise. In den kleinen und schließlich großen Schauspielen<br />
fühlen sie sich in andere Rollen hinein, auch<br />
hier ein Sich-Öffnen und Verbinden mit anderen<br />
Menschen, praktizierte Liebefähigkeit. Dies kann<br />
man über unseren ganzen Lehrplan entwickeln, was<br />
hier zu weit führen würde.<br />
Deutlich ist aber bei all dem, was ich hier angeführt<br />
habe, dass beides zusammen, nämlich die so<br />
verstandene Liebefähigkeit der Pädagogen – auch<br />
und vor allem die der Eltern – und die Auswahl der<br />
Dinge, die ich den Kindern und Jugendlichen nahe<br />
bringe, im guten Zusammenklang sein müssen, um<br />
die Kinder zu liebefähigen Menschen erziehen zu<br />
können.<br />
Annette Renschler<br />
Klassenlehrerin der 8. Klasse,<br />
übernimmt im Schuljahr<br />
2007/08 die 1. Klasse der <strong>Freie</strong>n<br />
<strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong>,<br />
Mutter von vier Kindern und<br />
Entwicklungsbegleiterin.<br />
Cristal 10 | 2007
Zur Pädagogik der 8. Klasse<br />
Biografiearbeit – Schauspiel – Handwerkspraktikum<br />
Von Annette Renschler<br />
Am Ende der 8. Klasse verabschieden sich die<br />
Schüler und Schülerinnen von der Klassenlehrerzeit.<br />
Mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer<br />
schließen Sie dann ein letztes – an unserer Schule<br />
sehr ereignisreiches – Schuljahr ab.<br />
Wie schon in der 7. Klasse wird das Verhalten und<br />
Denken der Schüler stark von der Pubertät geprägt.<br />
Allerdings kann man nun davon ausgehen, dass sich<br />
alle Kinder in dieser Entwicklungsphase befinden<br />
und manche sogar schon darüber hinaus gewachsen<br />
sind. So fällt uns der veränderte Körperbau auf,<br />
die Jugendlichen sind deutlich größer geworden,<br />
die Gesichtszüge markanter, die sekundären<br />
Geschlechtsmerkmale sind deutlich ausgeprägt,<br />
mancher zarte Bart sprießt, die Jungen haben kräftigere<br />
und tiefere Stimmen. Es gibt Liebesbeziehungen<br />
und so manche damit verbundenen Konflikte<br />
und Intrigen. Insgesamt aber wirken die Achtklässler<br />
etwas ruhiger als in der 7. Klasse, so, als hätten<br />
sie sich in ihre oft verwirrenden Gefühlswelten ein<br />
wenig eingelebt.<br />
Elisabeth Haas<br />
Gestalttherapeutin<br />
Beratung – Coaching – Supervision<br />
Einzel – Paare – Team – Organisationen<br />
In der Gestalt-Arbeit unterstütze und begleite ich<br />
Sie, kleine Schritte der Veränderung zu wagen<br />
und Mutkräfte zu entwickeln, die Dinge zu verändern,<br />
die Ihnen wichtig sind.<br />
Lernen sich selbst mehr wertzuschätzen und zu<br />
erfahren, wer Mann/Frau eigentlich ist.<br />
Unnötige Selbsteinschränkung wird bewusst und<br />
alte Abhängigkeiten werden losgelassen.<br />
Unerledigtes wird vollendet und<br />
Wiederholungszwänge werden aufgelöst.<br />
Terminabsprache per E-mail oder tel. Vereinbarung.<br />
Keine Kassen<br />
Hauptstr. 41 · 53804 Much<br />
Tel. 02245/610278, /2263<br />
Info@Elisabeth-Haas.de<br />
www.Elisabeth-Haas.de<br />
24<br />
Die Waldorfpädagogik setzt in dieses Schuljahr<br />
viele Inhalte, die sich mit den Gefühls- und Gedankenwelten<br />
anderer Menschen auseinandersetzen.<br />
So beschäftigt man sich mit den großen deutschen<br />
Dichtern Schiller und Goethe. In der Geschichte erleben<br />
sie passenderweise die Zeit des Absolutismus<br />
mit dem Aufbegehren der Aufklärung über die unruhigen<br />
und prägenden Revolutionen und Veränderungen<br />
der politischen Strukturen bis hin zur Zeit<br />
des Nationalsozialismus. In der Mathematik beschäftigen<br />
sie sich mit immer stärker abstrahierenden<br />
Inhalten in der Algebra und komplizierten<br />
dreidimensionalen platonischen Körpern in der Geometrie<br />
usw. Auch hier sehen wir, dass der Lehrplan<br />
die Jugendlichen genau da anspricht, wo sie sich<br />
entwicklungsphysiologisch befinden. An der <strong>Oberberg</strong>er<br />
Schule gibt es außerdem einige Projekte, die<br />
den Kindern außergewöhnliche Lernerfahrungen bescheren.<br />
So beginnt das 8. Schuljahr mit der Biografiearbeit.<br />
Hier müssen die jungen Menschen sich intensiv<br />
mit einer Biografie auseinandersetzen und in<br />
einem öffentlichen Vortrag ihre Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse schildern und sich mit diesem Menschen<br />
künstlerisch auseinandersetzen. Diese Vorträge<br />
eröffnen den Zuhörern oft sehr sensible und<br />
tiefe Einblicke in das Denken und Fühlen der Vortragenden,<br />
sie gehören zu den Perlen in unserem<br />
Schulgeschehen.<br />
Das nächste große Projekt ist dann das Schauspiel,<br />
das traditionsgemäß in der 8. Klasse stattfindet. Hier<br />
müssen die Jugendlichen sich nicht nur in einen<br />
anderen Menschen hineindenken und -fühlen, sondern<br />
sich bis ins Physische mit diesem Menschen<br />
verbinden. Sie müssen die Sprache, Gestik, den Gang<br />
und die Mimik übernehmen und verbinden sich so<br />
inniglichst mit ihrer Rolle. Es gehört einiges pädagogisches<br />
Geschick und Sensibilität dazu, den<br />
Jugendlichen zu der passenden Rolle zu verhelfen.<br />
Manche Rollen sind so angelegt, dass sie Eigenschaften<br />
des Schülers verstärken oder persiflieren,<br />
manche Rollen sind dem Charakter der Jugendlichen<br />
gänzlich fremd, entgegengesetzt. Beides hat seine<br />
Berechtigung, es verhilft den Jugendlichen zu einer<br />
Erweiterung ihres seelischen Horizontes und zur<br />
seelischen Stärkung und Selbsterkenntnis. Je nach<br />
Reife, Charakter und Entwicklungsstand können<br />
manche der Jugendlichen leicht und souverän in<br />
jede Rolle schlüpfen und ihr Ausdruck verleihen,<br />
andere haben es schon schwer, auch nur eine winzige<br />
Geste zu entwickeln und zu zeigen. Aber immer<br />
ist das Schaupiel in der 8. Klasse eine Höchstleistung<br />
für jeden Einzelnen, die zu erbringen ist. Dass dafür<br />
Cristal 10 | 2007
eine ganze Epoche normalen Unterrichts ausfällt,<br />
ist den hier zu erreichenden Lernerfahrungen gegenüber<br />
nachrangig.<br />
Am Ende des Schuljahres gehen unsere Achtklässler<br />
noch in ein dreiwöchiges Handwerkspraktikum,<br />
wo sie mit Herz und Hand in das Arbeitsleben<br />
der Handwerker schlüpfen dürfen. Um sie dafür zu<br />
stärken gibt es an unserer Schule vorher ein geschlechtsgetrenntes<br />
Sozialtraining, das die Jugendlichen<br />
selbstbewusster und sicherer im Umgang mit<br />
sich selbst und anderen machen möchte.<br />
Als letztes und wohl lustvollstes Projekt gibt es<br />
traditionsgemäß eine Klassenfahrt, in der die Klasse<br />
zum letzten Mal mit ihrem Klassenlehrer auf <strong>Reisen</strong><br />
geht. Insgesamt ist die 8. Klasse die Zeit des Abschieds.<br />
Nicht nur von der seit acht Jahren gewohnten<br />
Unterrichtsstruktur wird sich verabschiedet,<br />
sondern auch von dem Menschen, der die<br />
Kinder – im Idealfall – acht Jahre durch ihr Schulleben<br />
begleitet hat. Es ist wichtig, dass die Kinder<br />
sich hier endgültig abnabeln können.<br />
So wie sie sich von ihren Eltern immer mehr distanzieren,<br />
um das Leben selbst zu ergreifen, müssen<br />
sie sich von dem dritten Erzieher in ihrem Leben<br />
trennen. Dies ist manches Mal nicht einfach. So<br />
kann es sein, dass der Klassenlehrer zum völlig<br />
uncoolen Menschen erklärt wird, der längst überfällig<br />
ist. Jede andere Lehrperson ist besser, alles,<br />
was er/sie sagt ist eigentlich unmöglich, lautes Ge-<br />
motze bei jeder Ansage, ständiges Gemecker über<br />
den völlig öden Unterricht sind mögliche Erscheinungen<br />
dieser anstehenden Trennung. Dies ist für<br />
die Lehrer und oft auch für die Eltern eine recht<br />
schwierige Zeit, in der Gelassenheit und Humor und<br />
eben die Erkenntnis in den Sinn dieser Geschehnisse<br />
angesagt sind. Nur, wenn die Schüler und Schülerinnen<br />
sich von ihrem Klassenlehrer trennen können,<br />
sind sie frei für die völlig neuen und spannenden<br />
Erfahrungen, die in der Oberstufe auf sie zukommen<br />
werden.<br />
Cristal 10 | 2007 25
Pädagogik der Oberstufe<br />
Neuer Gestaltungsraum in Sicht<br />
Von Jochen Fritsch<br />
Eine zusammenfassende Darstellung der jetzigen<br />
Oberstufe zu schreiben, bedeutet, etwas Gewachsenes<br />
zu beschreiben, das an entscheidenden Stellen<br />
in Bewegung, Formung und Umbau, ist.<br />
Das Zentralabitur, das 2008 zum ersten Mal an<br />
unserer Schule abgenommen werden wird und die<br />
zentralen Prüfungen für die Fachoberschulreife, die<br />
der jetzigen Klasse 9 in Klasse 11 2009 ins Haus<br />
stehen, fordern viel von uns. Mir persönlich drängt<br />
sich angesichts der Aufgabe immer wieder das Bild<br />
eines Zuges auf, der in voller Fahrt – und mit kostbarer<br />
Fracht an Bord – umgebaut werden muss,<br />
ohne dass genau zu erkennen ist, welchen Anforderungen<br />
er in Zukunft genügen muss und wohin der<br />
Weg geht, denn nur in Teilen ist das vor ihm liegende<br />
Streckennetz erkennbar und immer wieder geht<br />
es durch Tunnel, in denen die Sicht schwindet und<br />
der Lärm zunimmt, die Überraschung auf der anderen<br />
Seite mit Spannung zu erwarten ist. Nicht nur<br />
wir selbst als Zugbegleiter und Zugführer arbeiten<br />
an der Streckenführung und dem Zug, sondern auch<br />
Beamte in Düsseldorf und Berlin.<br />
Dennoch: Die Aufgabe wird angepackt und die<br />
Chance ergriffen, das Bestehende und Bewährte zu<br />
betrachten und neben das Befürchtete und Erhoffte<br />
zu stellen. Möge dieser Schritt bei den wenigen<br />
aber entscheidend wichtigen Weichenstellungen<br />
helfen, die wir selbst vornehmen können.<br />
Im Folgenden stelle ich die Klassen 9 bis 13 vor und<br />
zeige auf, was in den letzten Jahren an unserer Schule<br />
gewachsen ist, zugleich mit einem Blick auf sich<br />
ankündigende Änderungen. Um diese zu verstehen,<br />
finden Sie vorangestellt die zu erwartenden Konsequenzen<br />
aus den Schulrechtsänderungen in NRW.<br />
Abschließend Ausblicke und Visionen, sollen Fragen<br />
gestellt und Hoffungen formuliert werden, denn<br />
Vieles ist zurzeit noch nicht absehbar.<br />
Zentralabitur und FOR: Mit den Schulrechtsänderungen<br />
des Jahres 2006, die als Folge des PISA-<br />
Schocks und beschwert durch einen Regierungswechsel<br />
in NRW zustande kamen, wurde schnell<br />
deutlich, dass auch die WaldorfschülerInnen in<br />
Nordrhein-Westfalen über kurz oder lang das<br />
Zentralabitur und die zentralen Prüfungen für die<br />
Fachoberschulreife (Realschulabschluss – FOR)<br />
ablegen müssen. Das bedeutet, dass unsere Abiturienten<br />
ab 2008 mit allen anderen SchülerInnen in<br />
NRW die genau gleichen schriftlichen Prüfungen in<br />
den entsprechenden Fächern zur gleichen Zeit<br />
machen müssen.<br />
Unsere FOR-SchülerInnen werden ab 2009 in den<br />
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch (oder<br />
26<br />
vielleicht einer anderen Fremdsprache) zeitgleich<br />
und parallel zu den Realschulen in NRW die schriftlichen<br />
Prüfungen ablegen.<br />
Zwei Arbeitsgruppen und Eigner arbeiten an unserer<br />
Schule von verschiedenen Seiten kommend an<br />
der Aufgabe, unsere Oberstufe und den Unterricht so<br />
umzubauen und zu verändern, dass unsere SchülerInnen<br />
diese Hürden nehmen können und wir als<br />
Schule unsere Gestalt nicht verlieren.<br />
In der Gruppe Umgestaltung Oberstufe (Eigner<br />
Jochen Fritsch) arbeiten fünf OberstufenkollegInnen<br />
seit Januar 2005 daran, die Strukturen und<br />
Unterrichte vor allem in Klasse 12 so zu verändern,<br />
dass Leistungskurse und Grundkurse für die AbiturschülerInnen<br />
möglich sind und diese zugleich die<br />
(zur Zeit noch notwendigen) dreizehn Unterrichtsfächer<br />
haben, damit sie den FOR-Abschluss machen<br />
können (z.Z. in Klasse 12). Zugleich wollen und müssen<br />
wir für die FOR-SchülerInnen ein differenziertes<br />
und attraktives Programm erarbeiten, das sie noch<br />
besser als bisher auf die Arbeits- und Berufswelt<br />
nach der Schule vorbereitet.<br />
Ein zweite Gruppe, die sich um die Eignerin<br />
Lorraine Welnick scharen wird, soll aus der Mittelstufe<br />
kommend, die Fragen der Individualisierung<br />
und Differenzierung von Unterrichten betrachten<br />
und einen für die SchülerInnen und Eltern verlässlichen<br />
und transparenten Weg erarbeiten, wie die<br />
individuelle Beratung der SchülerInnen und die differenzierte<br />
Zusammensetzungen von Lerngruppen in<br />
den Oberstufenklassen ablaufen sollen.<br />
Die erste Gruppe arbeitet unter hohem Zeitdruck<br />
sehr strukturell aber nicht ohne pädagogische Erfahrung<br />
und Verantwortung – die zweite Gruppe ist<br />
deutlich pädagogischer ausgerichtet und braucht<br />
einen langen Atem. Gemeinsam ist beiden, dass sich<br />
zum einen die Anforderungen von außen immer<br />
wieder verändern können und dass zum anderen<br />
auch intern viele heikle Themen und Fragen angepackt<br />
werden müssen.<br />
Soweit zunächst die von außen an uns gestellten<br />
Forderungen und unser Umgang damit. Was das im<br />
Einzelnen bedeutet, wird bei den Klassenstufen, soweit<br />
es absehbar ist, angeführt und erläutert.<br />
Einstieg in die Oberstufe in Klasse 9: Nach dem<br />
Ende der Klassenlehrerzeit, die an der <strong>Waldorfschule</strong><br />
idealtypisch von Klasse 1 bis 8 reicht, kommen die<br />
SchülerInnen an der FWS <strong>Oberberg</strong> in die Oberstufe.<br />
Vieles von dem, was sie bisher gewohnt waren, ändert<br />
sich nun. Viele Lehrerinnen und Lehrer, die vor<br />
den SchülerInnen stehen, sind diesen neu, aber auch<br />
der ganze Duktus des Unterrichtens ist ein anderer.<br />
Cristal 10 | 2007
Die KlassenlehrerInnen, die bislang nahezu alle<br />
Epochen unterrichtet haben und damit zunehmend<br />
eine Reihe von Fächern als (gewollt und positiv zu<br />
bewertender) Nichtspezialisten bewältigten, werden<br />
abgelöst von FachlehrerInnen, die ihre studierten<br />
Unterrichtsfächer als Fachleute unterrichten<br />
und die in der Regel alle drei Wochen mit der neuen<br />
Hauptunterrichtsepoche wechseln. Neben diesem<br />
neuen Kollegium, mit dem sich die SchülerInnen<br />
auseinanderzusetzen haben, bleibt den SchülerInnen<br />
aber an vielen Stellen des Unterrichtes (z.B.<br />
möglicherweise in den Fremdsprachen, den Künsten,<br />
in Sport- und Handwerksunterrichten) ein erfahrenes<br />
Kollegium erhalten, das in Unter-, Mittel- und<br />
Oberstufe gleichermaßen zu Hause ist und den abrupten<br />
Wechsel in die Oberstufe abfedert.<br />
Betreut werden die Klassen von KlassenbetreuerInnen,<br />
die oft zu zweit arbeiten und dabei, wenn<br />
möglich, die männliche und weibliche Komponente<br />
in die Betreuung einbringen.<br />
Aus pädagogischer Sicht und unter menschenkundlichen<br />
Aspekten ist für die 9. Klasse der Begriff<br />
der Kausalität besonders wichtig. Mit Blick auf die<br />
Pubertät sprechen wir an der <strong>Waldorfschule</strong> gerne<br />
auch von der Geburt des intellektuellen Denkens, die<br />
schrittweise vonstatten geht. Zunächst geht es um<br />
das Erkennen von Notwendigkeiten, das Ursache-<br />
Wirkungs-Prinzip wird erfahrbar gemacht.<br />
Das heißt noch lange nicht, dass solche Verhältnisse<br />
und gesetzmäßigen Zusammenhänge von den<br />
Jugendlichen auch im eigenen Handeln oder gar in<br />
Fragen der sozialen Verantwortung erkannt und gegriffen<br />
werden.<br />
Hinzu kommt, dass das Verhältnis zwischen der<br />
Entwicklung von Jungen und Mädchen immer noch<br />
weit auseinander klafft, der Schritt vom Gefühlszum<br />
Verstandesurteil individuell noch sehr unterschiedlich<br />
genommen werden kann.<br />
Das Urteilen selbst ist für die jungen Menschen aber<br />
von entscheidender Bedeutung und kann in Abänderung<br />
eines Descartes-Wortes vielleicht mit einem »Ich<br />
urteile, also bin ich« beschrieben werden. Urteilen<br />
heißt hier, sich abzugrenzen und die eigene Identität<br />
zu bestimmen. Das muss geübt und gelernt werden<br />
und findet oft auf Feldern statt, die wir Erwachsenen<br />
in ihrer Bedeutung völlig anders einschätzen.<br />
Die Unterrichtsmethoden und die Rhythmik des<br />
Unterrichtens nimmt gerade auf dieses Urteilen-<br />
Lernen Rücksicht. Wie auch schon in den Jahren<br />
zuvor, wird das zu frühe Urteilen vermieden. Neunte<br />
Klassen sind deshalb auch pädagogisch eine Herausforderung.<br />
Die von den SchülerInnen mit Spannung<br />
erwarteten und zum Teil ersehnten Änderungen<br />
werden entsprechend motiviert angenommen, aber<br />
binnen eines halben Jahres auch gerne kritisch und<br />
zum Teil vehement hinterfragt. Hier ist dann der<br />
Fachlehrer als Kompetenz und Pädagoge gefragt,<br />
Klassenbetreuer müssen wach und aufmerksam sein<br />
und bisweilen zwischen Klasse, KollegIn und Elternschaft<br />
vermitteln.
Der Fächerkanon der 9. Klasse ist breit. Neben den<br />
– im Staatsschulwesen gerne als Kernfächer bezeichneten<br />
– Fächern Mathematik, Deutsch und<br />
Englisch finden sich die Natur- und Gesellschaftswissenschaften<br />
Biologie, Physik, Chemie, Geographie,<br />
Geschichte und Politik, die zweite Fremdsprache<br />
Russisch, die Künste mit Musik, Eurythmie und<br />
der Bildenden Kunst (Malen, Zeichnen und Plastizieren),<br />
das Handwerk mit Schreinern und Handarbeit,<br />
die Religion und die Arbeit im Gartenbau. Zu all<br />
dem kommt das Landwirtschaftspraktikum, das<br />
nach dem Waldpraktikum in Klasse 7, dem Handwerkspraktikum<br />
in Klasse 8 eine gewisse Verbindung<br />
zur Mittelstufe darstellt. Das Feldmesspraktikum<br />
in Klasse 10 und das Sozial- und Dienstleistungspraktikum<br />
in Klasse 11 komplettiert die Reihe<br />
der Praktika.<br />
Konsolidierung in Klasse 10: Die Schülerinnen<br />
und Schüler sind jetzt in der Oberstufe angekommen.<br />
Weitere Schritte zur Eigenaktivität, zum Sich-<br />
Finden des jungen Menschen sollen erfolgen. Die<br />
jungen Leute werden von den Lehrern ab hier in der<br />
Regel mit dem distanzierteren „Sie“ angesprochen.<br />
Die Naturwissenschaften, aber auch beispielweise<br />
die Methoden im Deutschunterricht an Literatur<br />
heranzugehen, sollen helfen, die Klarheit im Denken<br />
und zunehmende Urteilsfähigkeit zu befördern.<br />
Deutlich spürt der Lehrer am Ende der Klasse 10,<br />
dass sich die Jugendlichen immer besser aus dem<br />
Belieben von Sympathie und Antipathie herauslösen<br />
Hier steht in den kommenden Jahren nach<br />
Überzeugung einer Vielzahl von Lehrern auch<br />
an unserer Schule ein Paradigmenwechsel an,<br />
der aber nicht einfach verordnet werden kann,<br />
sondern der mit Eltern und vor allem den<br />
Schülern zusammen entwickelt werden muss.<br />
können. Oft beruhigen sich hier zuvor noch wilde<br />
Klassen. Der Epochenunterricht bietet den Klassen<br />
und den LehrerInnen immer wieder neue Gelegenheiten,<br />
den Umgang miteinander zu verändern.<br />
Besonderheiten sind an unserer Schule zwei mögliche<br />
<strong>Reisen</strong>: die Sprachreise, die in den vergangenen<br />
Jahren in den russischen Sprachraum ging (vorzugsweise<br />
St. Petersburg oder Jalta/Ukraine) und<br />
das Feldmesspraktikum, für das sich neben heimischen<br />
Gefilden, auch Inseln in der Nordsee anbieten<br />
oder Landschaften in Bayern gewählt wurden.<br />
Die oft hinterfragte Favorisierung des russischen<br />
Sprachraumes für eine solche Reise erklärt sich<br />
leicht, wenn man den Blick auf die andere Fremdsprache<br />
Englisch richtet. Das Englische lebt in so<br />
hohen Maße in unserem Kulturraum (z.B. in alltäglich<br />
wahrnehmbarer Musik oder auch in Fachsprachen<br />
bei Entwicklungen in Wissenschaft und Technik),<br />
dass man von einer Allgegenwart des Englischen<br />
in unserem und mehr noch dem Alltag unserer<br />
Kinder sprechen kann. Hinzu kommt, dass das<br />
28<br />
Englische als germanische Sprache dem Deutschen<br />
verwandt ist.<br />
Dem gegenüber findet das Russische in unserer<br />
westeuropäischen Welt nahezu keinen Raum. Bedenkt<br />
man, dass mit dem Kyrillischen eine eigene<br />
Schrift erlernt werden muss, kann man es einsehen:<br />
Eine solche Sprache in ihrem eigenen Kulturraum zu<br />
erfahren, Menschen und Mentalitäten zu erleben,<br />
die in dieser Sprache einen wesentlichen Teil ihrer<br />
geistigen Heimat haben, ist dringend notwendig.<br />
Dennoch: Das Konzept der Sprachreisen wird immer<br />
wieder diskutiert und bearbeitet, auch, weil <strong>Reisen</strong><br />
teuer und Unterrichtszeiten knapp sind.<br />
Zusätzlich zum normalen Deutschunterricht<br />
kommt in Klasse 10 die sogenannte Poetikepoche,<br />
sie ist Teil einer kunst- und kulturhistorischen<br />
Epochenreihe in der Oberstufe und fasst die Lyrik der<br />
deutschen Literatur vom 11. Jahrhundert bis in die<br />
Gegenwart ins Auge. In der Ausgestaltung an unserer<br />
Schule kreieren die Schüler gerne und viel selbstverfasste<br />
Lyrik.<br />
Zu dieser Epoche kommt in der Klasse 9 die Kunstgeschichte<br />
hinzu – die Musikgeschichte und eine<br />
Geschichte der Architektur sind noch denkbar. Die<br />
Ausgestaltung dieser Reihe ist bis auf die beiden<br />
Säulen der Poetik und der Kunstgeschichte für unsere<br />
Schule noch offen.<br />
Oberstufe oder Sekundarstufe II: Ein wenig kompliziert<br />
wird es vom Schulrecht her, wenn unsere<br />
Schüler in die 11. Klasse kommen. Juristisch sind<br />
die SchülerInnen dann nämlich in der Sekundarstufe<br />
II, dass heißt, dass sie das Schulgelände verlassen<br />
dürfen, früher durften Sie zudem auf dem<br />
Schulgelände an besonders dafür vorgesehenen<br />
Orten rauchen. Dies ist seit dem Schuljahr 2006/07<br />
verboten und die wenigen Raucher, die wir noch<br />
haben, verlassen hierfür das Schulgelände.<br />
Von den Abschlüssen und der Refinanzierung (der<br />
Unterrichtskosten durch das Land NRW) her gehören<br />
unsere Elftklässler aber noch in die Sekundarstufe<br />
I, weil sie erst am Ende der Klasse 11 die Fachoberschulreife<br />
(ab 2009) ablegen werden.<br />
Vom Pädagogischen her haben es die Lehrer mit<br />
zunehmend selbstständig werdenden jungen Menschen<br />
zu tun. Die nun 17 und 18 Jahre alten Schülerinnen<br />
und Schüler durchschauen zunehmend die<br />
sie umgebende Welt und auch die sie umgebenden<br />
Menschen, inklusive ihrer Lehrer. Ihre Kritikfähigkeit<br />
– nicht zwingend ihre Selbstkritikfähigkeit – wächst<br />
mit der Urteilsgrundlage und es ist von Seiten der<br />
Pädagogen dringend geboten, den SchülerInnen mit<br />
Respekt und Achtung auch nach außen hin zu begegnen.<br />
Dieser Respekt vor dem jungen Menschen<br />
ist natürlich bereits in der ersten Klasse der <strong>Waldorfschule</strong><br />
Grundprinzip pädagogischen Handelns,<br />
jetzt wird er aber auch nach außen sichtbar notwendig<br />
als soziale Form.<br />
Hier sollte der Lehrer noch viel mehr als zuvor<br />
zum Berater werden. Die Unterrichtsformen, die in<br />
Unter- und Mittelstufe noch lehrerzentriert sind,<br />
Cristal 10 | 2007
sollten schülerzentrierter werden. Gruppenarbeiten<br />
und selbstverantwortetes Lernen werden wichtiger.<br />
Hier steht in den kommenden Jahren nach Überzeugung<br />
einer Vielzahl von Lehrern auch an unserer<br />
Schule ein Paradigmenwechsel an, der aber nicht<br />
einfach verordnet werden kann, sondern der mit Eltern<br />
und vor allem den Schülern zusammen entwickelt<br />
werden muss.<br />
Der Fächerkanon wird in der Klasse 11 ein wenig<br />
schmaler. Das Fach Gartenbau ist mit dem Ende der<br />
Klasse 10 beendet, auch wenn es in gewisser Weise<br />
mit dem Ökologiepraktikum in Klasse 11 unter veränderten<br />
Vorzeichen fortgesetzt wird und auch die<br />
Handarbeit wird weniger.<br />
Das Sozial- und Dienstleistungspraktikum führt<br />
die SchülerInnen erstmals nach dem Handwerkspraktikum<br />
in Klasse 8 wieder in die Arbeitswelt des<br />
freien Arbeitsmarktes, auch wenn man feststellen<br />
kann, dass für Schüler unserer Schule der Beruf des<br />
Landwirts nicht nur eine abstrakte oder romantische<br />
Größe darstellt.<br />
Mit dem Sozial- und Dienstleistungspraktikum<br />
sammeln unsere Schüler Erfahrungen in Berufsfeldern,<br />
die ihnen bis dahin fremd waren. Da erfahrungsgemäß<br />
eine Reihe unserer Schüler in Sozialberufe<br />
gehen (z.B. Krankenpflege, Sonderpädagogik,<br />
Kindergärten) sind die Praktika als berufsorientierend<br />
unverzichtbar. Sie werden begleitet und betreut<br />
von den Klassenkollegen, Sie werden aufgearbeitet<br />
in Berichtsheften und sollen in Zukunft Teil<br />
der Abschlussportfolios unserer Schüler werden.<br />
Durch die oben angedeuteten Umgestaltungen in<br />
unserer Oberstufe, die das Zentralabitur zunächst<br />
einmal nötig macht, hat sich die Klasse 11 in den<br />
vergangenen zwei Jahren verändert. Das Theaterprojekt,<br />
das früher Zwölftklassspiel hieß, ist ans<br />
Ende der Klasse 11 gerutscht und an dieser Stelle in<br />
den letzten Jahren auch mit Erfolg über die Bühne<br />
gegangen. Die Jahresprojektarbeiten sind in 2006<br />
und 2007 leicht verkürzt, vom Abschlusstermin her<br />
um fast ein halbes Jahr nach vorne verlegt worden.<br />
Die Abschlusspräsentationen finden in diesem Jahr<br />
zum zweiten Mal vor den Herbstferien statt und bestimmen<br />
deshalb nicht die Abläufe in der Klasse 12<br />
bis in den Frühling hinein.<br />
Vor allem aber müssen in den 11. Klassen die Differenzierungsvorgänge<br />
mit Blick auf die Abiturkurse<br />
entschieden werden. Am Ende der Klasse 11 muss<br />
feststehen, wer in der zwölften den Weg zum Abitur<br />
gehen soll und wer den FOR- und Berufsvorbereitungsweg<br />
vor sich hat.<br />
Zurzeit können wir für unsere Schule noch nicht<br />
mit Gewissheit sagen, wie sich diese Differenzierungsprozesse<br />
gestalten werden und wie offen und<br />
durchlässig die unterschiedlichen Schienen in Zukunft<br />
sein werden. Zentralabitur bedeutet ja, dass je<br />
Fach eine ganze Reihe obligatorischer Themen und<br />
Inhalte im Unterricht gelehrt und bearbeitet werden<br />
müssen, auf die die SchülerInnen auch formal ein<br />
Anrecht haben. Hier stellen sich für uns als Schule<br />
eine Frage und eine Aufgabe.<br />
30<br />
Der Umbruch der 12. Klasse: Die gravierendsten<br />
Veränderungen hat es in den letzten beiden Jahren<br />
in der Klasse 12 gegeben. Bis vor zwei Jahren war<br />
unsere zwölfte die klassische Abschlussklasse, in der<br />
die Hauptunterrichtsepochen die Fächer und Fachinhalte<br />
abrundeten und in denen mit den drei<br />
großen Säulen Theaterprojekt, Künstlerischer Abschluss<br />
und Jahresprojektarbeit, neben den staatlich<br />
sanktionierten Schulabschlüssen auch der Waldorfabschluss<br />
gemacht wurde. Auch wenn hierüber<br />
mehrfach berichtet wurde, will ich kurz darstellen,<br />
was in den vergangenen zwei Jahren geschah, wie<br />
der jetzige Stand ist und wie vielleicht die Zukunft<br />
aussehen könnte.<br />
Konzentration auf das Notwendige: Gleich<br />
nach Bekanntwerden der Absichten und Pläne der<br />
damals noch SPD-geführten Landesregierung<br />
2004/05 ging die oben skizzierte Eignerschaft und<br />
die Arbeitsgruppe Umgestaltung Oberstufe an die<br />
Arbeit. Seit Februar 2005 arbeiten wir wöchentlich<br />
zu festgelegten Zeiten, mit Tagesordnungen und<br />
Protokollen und haben viel geschafft in den zurückliegenden<br />
Jahren, auch wenn die Gedanken<br />
und Pläne zu Beginn der Arbeit visionärer und idealistischer<br />
waren. Der Wunsch nach veränderten<br />
Zeitstrukturen, dem Aufbrechen des 45-Minuten-<br />
Taktes und veränderten Unterrichtsformen und<br />
-räumen war zu Beginn groß. Schnell aber wurde<br />
klar, dass angesichts der geringen Zeit von 2–3<br />
Schuljahren und der Komplexität der Aufgabe,<br />
realisierbare Pläne für 15 Klassen, 480 Schüler,<br />
35 Kollegen in etwa 30 Unterrichtsräumen zu entwerfen,<br />
eine Konzentration auf das unbedingt Notwendige<br />
angesagt war.<br />
Mit Beginn der Klasse 12 2006/07 mussten die<br />
Leistungs- und Grundkurse der vier schriftlichen<br />
Abiturfächer einsetzen. Um den Unterricht zu konzentrieren,<br />
damit die Nicht-Abiturfächer nicht völlig<br />
an den Rand (oder darüber hinaus) gedrängt würden,<br />
führten wir einen zweiten Epochenstreifen für<br />
die Klassen 11–13 ein, in dem vor allem die vier<br />
schriftlichen Abiturfächer in 8-stündigen 4-Wochen-Epochen<br />
gegeben werden. So konnten wir die<br />
bis dahin üblichen Einzel-Übstunden aufgeben.<br />
Die Zeitstruktur des Schuljahresverlaufes der Klassen<br />
11 und 12 wurde verändert. Das Theaterprojekt<br />
(s.o.) wurde ans Ende der Klasse 11 gelegt und die<br />
Jahresprojektarbeit von der Präsentation, also dem<br />
Abschluss her, um vier bis fünf Monate nach vorne<br />
verschoben, damit sie Anfang Klasse 12 abgeschlossen<br />
werden kann.<br />
Der Künstlerische Abschluss in seinem Verlauf und<br />
Gewicht wurde neu bedacht und strukturiert: Die<br />
SchülerInnen legen in diesem Jahr den Abschluss in<br />
Musik oder in Eurythmie ab und auch im Bereich der<br />
Bildenden Kunst müssen die Schüler eine Auswahl<br />
treffen.<br />
In zeitaufwändiger Kleinarbeit gelang es uns, dies<br />
in die Stundentafel einzuarbeiten und später im<br />
Stundenplan umzusetzen.<br />
Cristal 10 | 2007
Evaluierung der Änderungen: Im laufenden Schuljahr<br />
2006/07 werden diese ersten Schritte rückblickend<br />
evaluiert und ggf. modifiziert. Im Blick auf<br />
das Theaterprojekt, die Jahresprojektarbeit und den<br />
zweiten Epochenstreifen ist das bereits geschehen:<br />
Der zweite Epochenstreifen wird von Schüler-<br />
Innen und KollegInnen als ruhig und konzentrierend<br />
beschrieben. Die Stillarbeits- und Übphasen begrenzen<br />
die Hausaufgabenbelastung. Die Schüler<br />
haben weniger Fächer pro Tag, auf die sie sich vorbereiten,<br />
einstellen und konzentrieren müssen. Die<br />
Vorbereitung der KollegInnen ist kontinuierlicher, es<br />
gibt weniger Einarbeitungsreibungen zu überwinden.<br />
Auch Nachteile wurden sichtbar: Wenn durch<br />
Doppelepochen ein Kollege mit einem oder zwei<br />
Fächern beide Epochen einer Klasse zugleich vertritt<br />
(= 20 Stunden pro Woche) sind die Nerven der<br />
Klassen und KollegInnen doch sehr belastet. Krankheiten<br />
und Ausfälle solcher KollegInnen sind nicht<br />
kompensierbar. Diesen Nachteilen kann man zum<br />
Teil in der Stundenplanung begegnen und sie berücksichtigen!<br />
Für das Theaterprojekt und die Jahresprojektarbeit<br />
ergab sich zunächst, dass die Zeitstruktur zumindest<br />
für die kommende Zwölfte, die jetzige Elfte, beibehalten<br />
wird. Der Künstlerische Abschluss mit seinen<br />
beiden Teilen kann erst am Ende des Schuljahres<br />
überprüft werden.<br />
Planungen für das Schuljahr 2007/08: Die<br />
Hauptunterrichte und Zweitepochen der Klasse 12<br />
werden in den Abiturfächern weitgehend differenziert.<br />
Voraussichtlich werden wir 7 von 13 HU-Epochen<br />
in eine Abitur- und eine FOR-Gruppe aufteilen.<br />
Hierin steckt vor allem für die FOR-Gruppe eine<br />
große Chance, weil diese SchülerInnen nicht mehr<br />
den auch in der Vergangenheit doch immer wieder<br />
in die Hauptunterrichte der Klasse 12 hineinragenden<br />
Abituranforderungen genügen müssen, sondern<br />
im Gegenteil ein für diese SchülerInnen zugeschnittener<br />
Unterricht angeboten werden kann. Hier<br />
werden z.Z. eine Reihe von Unterrichten und Kursen<br />
geprüft und Konzepte erarbeitet.<br />
Dies wären neben den notwendigen Unterrichtsfächern<br />
beispielsweise: PC – Unterricht, Berufsorientierte<br />
Pädagogik, KunstWerk-Epochen, Berufspraktika<br />
(zur Orientierung oder Berufsvorbereitung),<br />
Anlage eines Abschlussportfolios (in Zukunft in Klasse<br />
9 einsetzend), Bewerbungen und Bewerbungstrainings,<br />
Politik und Medienkunde, Wirtschaftslehre/Recht,<br />
Technisches Zeichnen und Elektro- u.<br />
Haustechnik/Physik.<br />
Der zweite Epochenstreifen soll auf die Klasse 10<br />
ausgedehnt werden, damit auch hier die ruhigere,<br />
rhythmischere und konzentriertere Arbeit in den<br />
Fächern möglich wird.<br />
Erfreuliche Aussichten: Für die Schuljahre ab<br />
2008/09 sieht die Lage völlig anders aus. Interessante<br />
Möglichkeiten und Chancen eröffnen sich uns,<br />
weil die SchülerInnen ab 2009 in der Klasse 11 die<br />
FOR-Prüfungen ablegen werden, aber alle Schüler<br />
der 12. Klasse refinanziert werden.<br />
Ab 2009 werden in der 12. Klasse der <strong>Waldorfschule</strong>n<br />
gemeinsam Schüler sitzen, die entweder<br />
das Abitur machen oder sich auf die weitere berufliche<br />
Ausbildung vorbereiten wollen. Allen gemeinsam<br />
ist, dass sie (hoffentlich) am Ende der 11. Klasse<br />
den FOR-Abschluss gemacht haben und nun in der<br />
Klasse 12, wie bisher den Waldorfabschluss machen<br />
können. Dadurch, dass sie alle den FOR-Abschluss<br />
schon gemacht haben und vom Land, unabhängig<br />
von ihren weiteren Plänen, refinanziert werden,<br />
kann der Waldorfabschluss, der bis jetzt eine eher<br />
untergeordnete Rolle spielte, weil er mit den FOR-<br />
Abschlüssen zusammenfiel und der Abiturvorbereitung<br />
eher im Wege stand, ein neues Gewicht und<br />
endlich eine eigene, sichtbare Gestalt bekommen.<br />
Es entsteht plötzlich ein Gestaltungsraum, weil<br />
die SchülerInnen nicht mehr alle bindenden 13<br />
Unterrichtsfächer des FOR-Abschlusses haben müssen.<br />
Die Abiturgruppe muss nur acht Fächer belegen,<br />
die aber nicht so intensiv gefahren werden müssen,<br />
wie in der Klasse 13 nach jetzigem Muster.<br />
Es ist also denkbar, dass Teile der jetzt in die Elften<br />
verlagerten Aktivität (Theater, Künstlerischer<br />
Abschluss, Jahresprojektarbeit) wieder in die Klasse<br />
12 gelegt werden können und der Waldorfabschluss<br />
eine darüber hinaus gehende Ausgestaltung und Bedeutung<br />
erfährt.<br />
Soweit der Blick auf unsere Oberstufe, wie sie sich<br />
im laufenden und kommenden Schuljahr präsentiert.<br />
Der Blick ist bei aller Komplexität sehr knapp<br />
ausgefallen. Vieles hätten die einzelnen Fächer und<br />
die Fachbereiche noch beizutragen. Bis in die Klassen<br />
12 und 13 hinein bleiben unsere Ansprüche pädagogisch-menschenbildende,<br />
in deren Dienst die<br />
Fächer und die Inhalte stehen.<br />
Ein jeder Fachkollege hätte andere Aspekte betont,<br />
interessante Perspektiven gewählt und letztlich<br />
liegt hierin etwas Entscheidendes und Wertvolles:<br />
Im Miteinander der Arbeit und Entwicklung von so<br />
unterschiedlichen Menschen, die ein gemeinsames<br />
Ziel und Wollen haben, entstehen immer wieder Beratungs-<br />
und Entscheidungsprozesse von großer<br />
Qualität. Dieser Blick auf unsere Oberstufe ist nicht<br />
nur ein Blick auf zwei Jahre Reform und Umbau,<br />
sondern auch ein Blick auf 10 Jahre Entwicklung unserer<br />
Oberstufe und viele Jahrzehnte Entwicklung<br />
der <strong>Waldorfschule</strong>n in Deutschland.<br />
Jochen Fritsch<br />
Oberstufenlehrer, betreut die<br />
11. Klasse, verantwortlich für<br />
den Prozess »Umgestaltung der<br />
Oberstufe« an der FWO.<br />
Cristal 10 | 2007 31
32<br />
Wilhelm Heuel GmbH<br />
Olper Straße 106 · 51702 Bergneustadt<br />
Telefon: (0 22 61) 94 78 0<br />
Telefax: (0 22 61) 94 78 15<br />
E-mail: info@heuel-reisen.de<br />
Internet: www.heuel-reisen.de<br />
<strong>RS</strong>-<strong>Reisen</strong> <strong>Rainer</strong> <strong>Söhnchen</strong><br />
Hohefuhrweg 3<br />
51647 Gummersbach (Berghausen)<br />
Telefon: (0 22 66) 70 37<br />
Telefax: (0 22 66) 81 31<br />
Omnibushalle: Peisel, Gelpestraße 55<br />
Cristal 10 | 2007
<strong>Freie</strong> <strong>Waldorfschule</strong> <strong>Oberberg</strong> e.V. Kirchhellstraße 32 51645 Gummersbach<br />
Tel. 0 22 61 / 96 86-0 Fax 0 22 61 / 96 86-76 info@fws-oberberg.de