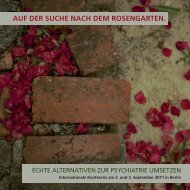„ Betroffenheit als Impuls für die Weiterentwicklung ... - weglaufhaus.de
„ Betroffenheit als Impuls für die Weiterentwicklung ... - weglaufhaus.de
„ Betroffenheit als Impuls für die Weiterentwicklung ... - weglaufhaus.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit zur Erlangung <strong>de</strong>s Gra<strong>de</strong>s einer Diplom- Sozialarbeiterin<br />
an <strong>de</strong>r Fachhochschule <strong>für</strong> Sozialarbeit und Sozialpädagogik<br />
<strong>„</strong>Alice Salomon“<br />
Titel:<br />
<strong>„</strong> <strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> <strong>Impuls</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Weiterentwicklung</strong> <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
Eine Analyse am Beispiel ausgewählter Berliner Projekte“<br />
Eingereicht im Sommersemester 2006<br />
Am 01.06.2006<br />
Von<br />
Ramona Schnekenburger, Matr.-Nr.: 031 446<br />
&<br />
Regina Nicolai, Matr.-Nr.: 031 469<br />
Projektseminar: <strong>„</strong>Rekonstruktion von Lebenswelten durch Soziale Netzwerkarbeit“<br />
Erstgutachter: Johannes Stoverink<br />
Zweitgutachter: Jürgen Nowak
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
1. Eigener Bezug zum Thema ..............................................................................................1<br />
1.1 Regina (2).................................................................................................................1<br />
1.2 Ramona (1) ..............................................................................................................3<br />
2. Das Thema <strong>de</strong>r Arbeit ......................................................................................................5<br />
3. Der Aufbau <strong>de</strong>r Arbeit......................................................................................................6<br />
Teil I: Der Betroffenenkontrollierte Ansatz (2)<br />
1. Die betroffenenkontrollierten Projekte............................................................................8<br />
2. Historische Grundlagen <strong>de</strong>s Ansatzes .............................................................................9<br />
3. Theoretische Grundlagen <strong>de</strong>s Ansatzes...........................................................................9<br />
3.1 Gewaltbegriff.........................................................................................................10<br />
3.2 Freiwilligkeit .........................................................................................................11<br />
3.3 Menschenbild ........................................................................................................12<br />
3.4 Krisenbegriff..........................................................................................................12<br />
3.5 Parteilichkeit .........................................................................................................13<br />
3.6 Selbsthilfe ..............................................................................................................14<br />
3.7 Umgang mit Hierarchien......................................................................................14<br />
3.8 Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen ............................................................................15<br />
3.9 Einstellung von Betroffenen.................................................................................15<br />
Teil II: Die Projekte Weglaufhaus und Wildwasser<br />
1. Das Weglaufhaus <strong>„</strong>Villa Stöckle“ .................................................................................18<br />
1.1 Projektvorstellung ................................................................................................18<br />
1.2 Geschichte ............................................................................................................22<br />
1.3 Die Antipsychiatrie ...............................................................................................27<br />
1.4 Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> im Weglaufhaus ............................................29<br />
1.5 Wie wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatzes vom Weglaufhaus umgesetzt? ..............................................................31<br />
2. Wildwasser - Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch<br />
an Mädchen e. V. (2) ......................................................................................................36
2.1 Projektvorstellung .................................................................................................36<br />
2.1.1 Körperarbeit im Rahmen <strong>de</strong>r Wildwasser – Frauenselbsthilfe .................42<br />
2.1.2 Konkrete Angebote zur Körperarbeit bzw. kreative<br />
Arbeitsmetho<strong>de</strong>n und Beratung .................................................................43<br />
2.1.3 Beispielhafte Kurzdarstellung zweier angewandter Metho<strong>de</strong>n ................43<br />
2.2 Geschichte ............................................................................................................45<br />
2.3 Spezielle Grundsätze von Wildwasser .................................................................48<br />
2.4 Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> bei Wildwasser ...............................................50<br />
2.5 Wie wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatzes von <strong>de</strong>r Wildwasser-Frauenselbsthilfe umgesetzt? .............................51<br />
Teil III: Die Befragung <strong>de</strong>r Nutzer und Nutzerinnen<br />
1. Rahmenbedingungen <strong>de</strong>r Befragung ............................................................................54<br />
1.1 Ziel <strong>de</strong>r Befragung................................................................................................54<br />
1.2 Das <strong>„</strong>Forschungsteam“ ........................................................................................55<br />
1.3 Die Auswahl <strong>de</strong>r Interviewpartnerinnen..............................................................55<br />
1.4 Die Form <strong>de</strong>r Befragung ......................................................................................56<br />
1.5 Die Fragen.............................................................................................................57<br />
1.6 Kategorienbildung.................................................................................................58<br />
1.7 Form <strong>de</strong>r Darstellung ...........................................................................................58<br />
2. Qualitative und quantitative Auswertung ausgewählter Daten....................................58<br />
2.1 Stichprobenbeschreibung .....................................................................................58<br />
2.2 Kategorien<strong>de</strong>finition: Unterstellte Kategorien.....................................................59<br />
2.2.1 Vorbildfunktion (2)..................................................................................60<br />
2.2.2 Authentizität (1) .......................................................................................61<br />
2.2.3 Positives Krisenverständnis (2) ...............................................................62<br />
2.2.4 Schaffung alternativer Strukturen (1)....................................................64<br />
2.2.5 Reflexion bestimmter Themen (1)...........................................................65<br />
2.3 Kategorien<strong>de</strong>finition: Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien...............................................65<br />
2.3.1 Empathie (1) ............................................................................................65<br />
2.3.2 Akzeptanz (1)............................................................................................67<br />
2.3.3 Kontakt (1) ...............................................................................................68<br />
2.3.4 Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation (2) ..................................68<br />
2.3.5 Verbun<strong>de</strong>nheit (1)....................................................................................68
2.3.6 Distanz (1)................................................................................................69<br />
2.3.7 Hierarchie (2) ..........................................................................................70<br />
2.3.8 Vertrauenswürdigkeit (2) ........................................................................71<br />
2.3.9 Unkenntlichkeit (1)..................................................................................72<br />
2.3.10 Ebenbürtigkeit (1)....................................................................................72<br />
2.3.11 Perspektivwechsel (2) ..............................................................................73<br />
2.3.12 Selbsthilfe (2)............................................................................................73<br />
2.3.13 Verän<strong>de</strong>rtes Krisenverständnis (2)..........................................................75<br />
2.3.14 Umgang mit Krisen (2)............................................................................75<br />
2.3.15 Lebensumstän<strong>de</strong> (2).................................................................................75<br />
2.4 Auswertung <strong>de</strong>r Einzelfragen...............................................................................75<br />
2.4.1 Zu Frage 1...............................................................................................75<br />
2.4.2 Zu Frage 2...............................................................................................76<br />
2.4.3 Zu Frage 3...............................................................................................78<br />
2.4.4 Zu Frage 4...............................................................................................80<br />
2.4.5 Zu Frage 5...............................................................................................81<br />
2.4.6 Zu Frage 6...............................................................................................81<br />
2.4.7 Zu Frage 7...............................................................................................83<br />
2.4.8 Zu Frage 8...............................................................................................88<br />
2.5 Gesamtauswertung................................................................................................90<br />
2.5.1 Tabellarische Übersicht <strong>de</strong>r Kategorien ................................................90<br />
2.5.2 Diskussion und kritische Einschätzung <strong>de</strong>r Ergebnisse .......................90<br />
2.5.2.1 Personelle Ebene (2)..................................................................92<br />
2.5.2.2 Strukturelle Ebene (1) ...............................................................97<br />
Teil IV: Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Soziale Arbeit (1)<br />
1. Die Klient – Helferbeziehung in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit..................................................100<br />
2. Das Wachstums- und das Hierarchiemo<strong>de</strong>ll nach Virginia Satir..............................101<br />
3. Die Selbsthilfe, <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierte Ansatz, und<br />
<strong>die</strong> Profession <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ..............................................................................102<br />
4. Betroffenenkompetenzen und professionelle Schlüsselkompetenzen<br />
in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ...................................................................................................108<br />
5. Experten aus <strong>Betroffenheit</strong> ..........................................................................................111
Fazit ................................................................................................................. 113<br />
Literaturangaben ...................................................................................................................114<br />
Internetseiten..........................................................................................................................117<br />
Abbildungsverzeichnis ...........................................................................................................118<br />
Anhang.............................................................................................................1-21<br />
Erklärungen
Einleitung<br />
1. Eigener Bezug zum Thema<br />
1.1 Regina<br />
Was es alles gibt<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> schlagen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> rennen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> zün<strong>de</strong>ln<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> brennen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> wegsehn<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> hinsehn<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> mahnen:<br />
Wer hinsieht, muss auch hingehn<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> wissen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> fragen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> warnen:<br />
Wer fragt, wird selbst geschlagen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> re<strong>de</strong>n<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> schweigen<br />
Da gibt es <strong>die</strong>, <strong>die</strong> han<strong>de</strong>ln:<br />
Was wir sind, wird sich zeigen.<br />
(Gernhardt 2000, 151)<br />
Als ich mich heute fragte, wann ich <strong>de</strong>r <strong>„</strong><strong>Betroffenheit</strong>“ das erste Mal begegnet bin,<br />
setzte ein längerer Denkprozess ein. Waren es <strong>die</strong> Männer und Frauen 1 aus <strong>de</strong>n<br />
Krüppel-Gruppen? Einer von ihnen hatte das ehemalige NSDAP-Mitglied und <strong>de</strong>n<br />
damaligen Bun<strong>de</strong>spräsi<strong>de</strong>nten Karl Carstens Anfang <strong>de</strong>r achtziger Jahren mit einer<br />
Krücke tätlich angegriffen. Das Bild, dass durch <strong>die</strong> Me<strong>die</strong>n ging, blieb lebendig. Aber<br />
nein, Betroffene waren das nicht. Sie waren <strong>die</strong> Krüppel. Für mich war es bis dahin nur<br />
ein Schimpfwort, aber sie nannten sich frech selbst so. Wur<strong>de</strong>n sie sonst nicht<br />
Behin<strong>de</strong>rte genannt? <strong>„</strong>Die <strong>Betroffenheit</strong>“ hat bis zur Jahrtausendwen<strong>de</strong> keine<br />
ein<strong>de</strong>utigen Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen. Im Laufe <strong>de</strong>r Jahre fühlte ich<br />
1 Wir haben uns da<strong>für</strong> entschie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r gesamten Arbeit zwischen <strong>de</strong>r männlichen und weiblichen Form<br />
frei zu wechseln. Manchmal wer<strong>de</strong>n auch bei<strong>de</strong> genannt. Wenn es um Wildwasser geht, wird <strong>die</strong><br />
weibliche Form benutzt, da real nur Frauen bei Wildwasser arbeiten und auch <strong>die</strong> Nutzerinnen<br />
ausschließlich Frauen sind. Bei<strong>de</strong> Geschlechter wur<strong>de</strong>n somit gleichermaßen gewürdigt.<br />
1
mich manches Mal betroffen, manches machte mich betroffen, an<strong>de</strong>res betraf mich o<strong>de</strong>r<br />
auch nicht. Meine Familie war dam<strong>als</strong> betroffenen von <strong>de</strong>n Auswirkungen eines<br />
Unwetters. Wenn ich selbst betroffen war, dann war an<strong>de</strong>ren etwas zugestoßen und ich<br />
fühlte mit ihnen. Ansonsten hatte ich eine Geschichte und auch Erfahrungen. Ich bin in<br />
meiner Kindheit und Jugend von einem männlichen Verwandten sexuell missbraucht<br />
wor<strong>de</strong>n und doch hatte ich mich nie Betroffene genannt.<br />
Heute wür<strong>de</strong> ich sagen, dass ein gewichtiger Grund, warum ich das Studium <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit aufnahm und <strong>Betroffenheit</strong> zum Thema meiner Diplomarbeit machte,<br />
meine eigene <strong>Betroffenheit</strong> ist. Ich bin eine Betroffene von sexualisierter Gewalt in <strong>de</strong>r<br />
Kindheit.<br />
Durch mein Praktikum im Weglaufhaus erfuhr ich von <strong>de</strong>r Kooperation mit Tauwetter<br />
und Wildwasser. Vom Betroffenenkontrollierten Ansatz war <strong>die</strong> Re<strong>de</strong> und eine<br />
gemeinsame Broschüre in Arbeit. Ich wollte wissen, was hinter <strong>de</strong>n mir so frem<strong>de</strong>n<br />
Begrifflichkeiten steckte, <strong>de</strong>nn zu <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> gesellten sich an<strong>de</strong>re wie z.B.<br />
<strong>die</strong> Ermächtigung. Die Frage, ob im Zusammenwirken aller Faktoren eine neue Qualität<br />
entsteht, interessierte mich brennend.<br />
Vor Jahren, im Rahmen einer tiefenpsychologischen Gesprächstherapie, hatte ich selbst<br />
mit <strong>de</strong>r professionellen Distanziertheit zu kämpfen. Die Schwierigkeit ein<br />
Vertrauensverhältnis aufzubauen, speiste sich aus vielen Quellen. Eine Frage in <strong>die</strong>sem<br />
Zusammenhang war <strong>für</strong> mich, ob <strong>die</strong> Therapeutin überhaupt versteht, wovon ich<br />
spreche. Kann sie mich so annehmen wie ich bin? Eigene Erfahrungen <strong>de</strong>r Therapeutin<br />
hätten mir in <strong>de</strong>r damaligen Zeit Sicherheit gegeben. Der Inhalt <strong>die</strong>ser Erfahrung war<br />
dabei nicht von Interesse, <strong>die</strong> Bestätigung <strong>de</strong>r Tatsache an sich hätte mir gereicht. Sie<br />
antwortete selbstverständlich mit <strong>de</strong>r Gegenfrage, warum das jetzt <strong>für</strong> mich wichtig sei.<br />
Die Frage, ob nur <strong>die</strong> helfen können, <strong>die</strong> selbst bestimmte Bewältigungsprozesse<br />
durchlebt haben, stand im Raum. Während ich anfangs <strong>die</strong>se Frage ein<strong>de</strong>utig mit ja<br />
beantwortet habe, hielt ich es später <strong>für</strong> möglich, dass auch <strong>„</strong>nur“ Professionelle helfen<br />
können. Natürlich habe ich nie erfahren, ob <strong>die</strong> Therapeutin eigene Erfahrungen hatte,<br />
aber am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Therapieprozesses war <strong>die</strong>se Frage nicht mehr relevant. So o<strong>de</strong>r so,<br />
sie hatte mir geholfen.<br />
Diesen Themenkomplex, mit <strong>de</strong>m inzwischen erworbenen eigenen professionellen<br />
Blick, genauer zu untersuchen, reizte mich. Zumal ich mein zweites Praktikum bei<br />
Wildwasser machte und dort wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Aspekten <strong>de</strong>s<br />
Betroffenenkontrollierten Ansatz in Berührung kam.<br />
2
Seit Beginn <strong>de</strong>s Studiums verband mich mit Ramona ein lebhafter Austausch und <strong>die</strong><br />
gemeinsamen Erfahrungen in großen und kleinen stu<strong>de</strong>ntischen Projekten. Unsere<br />
Fragen an <strong>die</strong> Betroffenenkontrollierten Projekte unterschie<strong>de</strong>n sich, jedoch nicht <strong>die</strong><br />
Lust, nach Antworten zu suchen. Für mich war das eine gute Basis, um gemeinsam eine<br />
Diplomarbeit zu schreiben.<br />
1.2 Ramona<br />
Mein Interesse <strong>für</strong> das Thema <strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> Ressource resultiert aus <strong>de</strong>n<br />
Erfahrungen, <strong>die</strong> ich im Laufe meines Praktikums im Weglaufhaus sammelte.<br />
Es beeindruckte mich, wie natürlich <strong>de</strong>r Umgang <strong>de</strong>r Mitarbeiter mit <strong>de</strong>n Bewohnern<br />
war. Es herrschte ein lockeres, ehrliches und offenes Klima, sowohl <strong>die</strong> Mitarbeiter <strong>als</strong><br />
auch <strong>die</strong> Bewohnerinnen <strong>de</strong>s Weglaufhauses waren sehr authentisch. Die<br />
antipsychiatrische Grundhaltung war mir zunächst wichtiger <strong>als</strong> <strong>die</strong> <strong>Betroffenheit</strong> <strong>de</strong>r<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dies war <strong>de</strong>r Grund, dass ich überhaupt auf das<br />
Weglaufhaus aufmerksam wur<strong>de</strong>.<br />
Ich arbeitete dam<strong>als</strong> im Rahmen meines freiwilligen sozialen Jahres auf einer<br />
geschlossenen psychiatrischen Station bei Freiburg im Breisgau. Die Zeit dort war <strong>für</strong><br />
mich und mein weiteres Leben entschei<strong>de</strong>nd. Ich hatte viele neue Eindrücke gesammelt<br />
und langsam begann meine Vorstellung von einer beruflichen Laufbahn im sozialen<br />
Bereich Konturen anzunehmen.<br />
Der Hauptgrund waren <strong>die</strong> Patienten. Sie inspirierten mich täglich neu. Durch ihre Art<br />
und Weise zu leben und zu lei<strong>de</strong>n und durch <strong>die</strong> Erfahrung <strong>de</strong>r Krisenbegleitung<br />
erweiterte sich sozusagen meine Vorstellung vom Leben an sich. Es mag sich sehr groß<br />
anhören, was ich hier sage. Und das war es auch. Ich bekam durch <strong>die</strong><br />
Grenzüberschreitungen, <strong>die</strong> ich gemeinsam mit <strong>de</strong>n Menschen in <strong>de</strong>r Psychiatrie<br />
erlebte, eine Vorstellung davon, wie relativ <strong>die</strong> sogenannte <strong>„</strong>Normalität“ ist. An<br />
Krankheit habe ich dabei nicht gedacht.<br />
Wie mit <strong>de</strong>n Patienten teilweise umgegangen wur<strong>de</strong>, und dass <strong>die</strong> Krisen, <strong>die</strong> sie<br />
erlebten, durch <strong>die</strong> Krankheitslehre jegliche persönliche Färbung verloren, ließ mich<br />
nach<strong>de</strong>nken.<br />
Es schien mir, <strong>als</strong> wür<strong>de</strong> <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r Psychiatrie verordnete Behandlung nur wenigen<br />
Patienten dabei helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.<br />
An meine persönlichen Grenzen stieß ich immer dann, wenn es darum ging, Regeln zu<br />
vertreten, <strong>die</strong> mir selbst nicht einleuchteten, welche <strong>die</strong> Institution aber vorschrieb.<br />
3
Außer<strong>de</strong>m fand ich schwierig zu akzeptieren, dass mehr über <strong>als</strong> mit <strong>de</strong>n Patienten<br />
gesprochen wur<strong>de</strong>. Die professionelle Distanz, <strong>die</strong> auf <strong>de</strong>r Station zwischen Patienten<br />
und Pflegepersonal herrschte, wur<strong>de</strong> nahezu <strong>als</strong> Muss bezeichnet. Diese Art <strong>de</strong>r<br />
Begegnung entsprach nicht meiner persönlichen und somit fühlte ich mich nie ganz bei<br />
mir.<br />
Es war mir nach meinem freiwilligen sozialen Jahr klar, dass es Alternativen zur<br />
psychiatrischen Behandlung geben sollte und dass sie bisher kaum existierten.<br />
Ich verfolgte das Ziel, während meines Studiums an <strong>de</strong>r ASFH-Berlin nach Alternativen<br />
zu suchen. Ich informierte mich bezüglich bestehen<strong>de</strong>r Möglichkeiten und arbeitete<br />
dann in meinem Stu<strong>die</strong>npraktikum <strong>für</strong> ein halbes Jahr im Weglaufhaus. Wie bereits<br />
erwähnt war bei <strong>de</strong>r Arbeit dort wirklich alles an<strong>de</strong>rs. Es gab so gut wie keine Struktur,<br />
<strong>die</strong> Selbstbestimmung <strong>de</strong>r Bewohner <strong>de</strong>s Weglaufhauses wur<strong>de</strong> <strong>als</strong> einer <strong>de</strong>r wichtigsten<br />
Grundsätze vertreten und <strong>die</strong> eigene Psychiatriebetroffenheit <strong>de</strong>r Mitarbeiter wur<strong>de</strong> <strong>als</strong><br />
Qualifikation gesehen.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r Psychiatriebetroffenheit fiel mir im Praktikum auf, dass ich keinen<br />
konkreten Unterschied in <strong>de</strong>r Qualität <strong>de</strong>r Arbeit feststellen konnte. Zumin<strong>de</strong>st war es<br />
kein genereller Unterschied, son<strong>de</strong>rn ein sehr persönlicher. Es gab betroffene und nicht<br />
betroffene Mitarbeiter, <strong>die</strong> mich sehr beeindruckten. Ich <strong>de</strong>nke, <strong>die</strong> beson<strong>de</strong>re<br />
Stimmung, <strong>die</strong> im Weglaufhaus herrschte, lag auch an <strong>de</strong>r Art und Weise, wie je<strong>de</strong>r<br />
Einzelne <strong>de</strong>r Mitarbeiter <strong>als</strong> Person anwesend war. Es wur<strong>de</strong> ein hohes Maß an<br />
Akzeptanz vertreten, das <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Menschen <strong>die</strong> Freiheit lässt, sich zu<br />
entfalten, ob nun Mitarbeiter o<strong>de</strong>r Bewohner.<br />
Ich wollte mich in <strong>die</strong>sem Kontext schließlich näher mit <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten<br />
Projekten auseinan<strong>de</strong>rsetzen. Diese stehen <strong>für</strong> mich <strong>als</strong> Plädoyer <strong>für</strong> eine <strong>„</strong>persönlich“<br />
geleistete Sozialarbeit, <strong>die</strong> sich durch eine beson<strong>de</strong>re Qualität auszeichnet.<br />
Regina lernte ich schon zu Beginn meines Studiums kennen. Uns verband neben einer<br />
von meiner Seite sehr schnell vorhan<strong>de</strong>nen Sympathie <strong>die</strong> Praktikumserfahrung im<br />
Weglaufhaus. Wir tauschten unsere Erfahrungen <strong>die</strong>sbezüglich rege aus und<br />
entwickelten dabei einige Fragen. Zunächst blieb es bei <strong>de</strong>n Fragen. Als mich Regina<br />
dann eines Tages fragte, ob ich schon ein Thema <strong>für</strong> meine Diplomarbeit wüsste und ob<br />
ich nicht Lust auf eine Gruppenarbeit hätte, zögerte ich nicht lange und sagte <strong>„</strong>ja“. Der<br />
große Altersunterschied und <strong>die</strong> unterschiedlichen Lebenserfahrungen sowie <strong>die</strong><br />
gemeinsame Erfahrung mit <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projekten schienen mir eine<br />
fruchtbare Grundlage zur <strong>„</strong>Wissenserweiterung“ zu sein.<br />
4
2. Das Thema <strong>de</strong>r Arbeit<br />
Oft herrschte große Konfusion, wenn wir Freun<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Kommilitoninnen das Thema<br />
unserer Diplomarbeit nannten. <strong>„</strong><strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> <strong>Impuls</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Weiterentwicklung</strong> <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit“ blieb <strong>für</strong> viele unverständlich. Es wur<strong>de</strong> an Mitgefühl und Empathie<br />
gedacht. Erst nach <strong>de</strong>r Nennung <strong>de</strong>s Untertitels <strong>„</strong>Eine Analyse am Beispiel<br />
ausgewählter Berliner Projekte“ und <strong>de</strong>m Bezug zu <strong>de</strong>n Projekten Weglaufhaus und<br />
Wildwasser erweiterte sich das Verständnis und <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> gewann<br />
Kontur.<br />
Die Soziale Arbeit bringt <strong>Betroffenheit</strong> vor allem mit <strong>de</strong>n Klienten in Verbindung.<br />
Diesen Begriff auf <strong>die</strong> Helfer zu übertragen, liegt <strong>de</strong>r Profession bis heute fern. Die<br />
eigene Lebenserfahrung offen in <strong>die</strong> Arbeit einzubeziehen ist ein Tabu. Im Studium<br />
tauchten eigene Erfahrungen nur am Ran<strong>de</strong> auf. Es ging dabei hauptsächlich um ihre<br />
Reflexion und nicht darum, sie <strong>als</strong> Ressource <strong>für</strong> <strong>die</strong> weitere Arbeit nutzbar zu machen.<br />
Die Frage ob, und wenn ja wie, <strong>Betroffenheit</strong> in <strong>de</strong>r sozialen Arbeit zur Ressource<br />
wer<strong>de</strong>n kann, stellte sich <strong>für</strong> uns.<br />
Die aktuelle sozialpolitische Situation ist geprägt von Ressourcenknappheit im Sozialen<br />
Bereich, wie sie sich in <strong>de</strong>n Kürzungen <strong>de</strong>r Mittel, <strong>de</strong>r Schließung verschie<strong>de</strong>nster<br />
Einrichtungen und nicht zuletzt in <strong>de</strong>n sich verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen nach Hartz IV ausdrückt. Daraus resultiert eine verstärkte<br />
Ressourcenorientierung, <strong>die</strong> sich in <strong>de</strong>r Suche nach bisher nicht beachteten Ressourcen<br />
<strong>de</strong>r Klienten <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ausdrückt.<br />
Wenn <strong>die</strong> Profession bei sich selbst nach Ressourcen sucht, wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong>se vorrangig in<br />
<strong>de</strong>r Steigerung <strong>de</strong>r Effizienz und Effektivität gesehen. Der Markt, <strong>de</strong>r Wettbewerb und<br />
das Management <strong>de</strong>s Sozialen sind neben <strong>de</strong>r Professionalisierung <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
<strong>die</strong> Schlagworte <strong>de</strong>r Stun<strong>de</strong>. Diese Ten<strong>de</strong>nzen bleiben nicht ohne Einfluss. Die Kluft<br />
zwischen Sozialmanagern und personenzentrierten Helfern wird immer größer. Die<br />
Soziale Arbeit wird zunehmend zur unpersönlichen Dienstleitung, <strong>die</strong> sich an<br />
ökonomischen Vorgaben ausrichtet.<br />
Diese Entwicklung entspricht <strong>de</strong>m Mainstream, ist aber keine zwangsläufige. In <strong>de</strong>r<br />
Arbeit <strong>de</strong>r Projekte Weglaufhaus und Wildwasser wird <strong>de</strong>utlich, dass auch innerhalb<br />
eines ökonomisierten Systems eine Gegenbewegung möglich ist. Der<br />
5
Betroffenenkontrollierte Ansatz kann <strong>als</strong> Teil <strong>die</strong>ser Gegenbewegung aufgefasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Er ist zum Hauptgegenstand unserer Untersuchung gewor<strong>de</strong>n.<br />
Ein Teil <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Entwicklungen von heute ist <strong>die</strong> <strong>„</strong>För<strong>de</strong>rung und<br />
For<strong>de</strong>rung“ von Eigenverantwortung <strong>de</strong>s Bürgers, womit oft <strong>die</strong> Individualisierung <strong>de</strong>r<br />
Lebensrisiken gemeint ist. Das heißt, dass <strong>die</strong> soziale Verantwortung, <strong>die</strong> bisher in <strong>de</strong>n<br />
Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Staates lag, <strong>de</strong>m Bürger zurückgegeben wird. Wenn aber nicht<br />
Individualisierung, son<strong>de</strong>rn tatsächlich Eigenverantwortung gemeint ist, erfor<strong>de</strong>rt <strong>die</strong>s<br />
auch eine Kultur <strong>de</strong>r Eigenverantwortung. Sie kann nicht verordnet wer<strong>de</strong>n. Sie muss<br />
statt<strong>de</strong>ssen wachsen. Wir wür<strong>de</strong>n in <strong>die</strong>sem Zusammenhang von einer Kultur <strong>de</strong>r<br />
Beteiligung sprechen, welche auch <strong>die</strong> Soziale Arbeit <strong>als</strong> ein berufliches Ziel formuliert.<br />
Allerdings scheint <strong>die</strong>ses Ziel unter <strong>de</strong>n vielen an<strong>de</strong>ren zu verschwin<strong>de</strong>n.<br />
Wo wer<strong>de</strong>n heute Nutzerinnen und Nutzer real beteiligt?<br />
Wir haben in unseren Praktika festgestellt, dass sowohl im Weglaufhaus <strong>als</strong> auch bei<br />
Wildwasser Nutzer und Nutzerinnen tatsächlich beteiligt wer<strong>de</strong>n. Sie können selbst in<br />
krisenhaften Situationen Einfluss nehmen und bestimmen auch, welche Hilfe <strong>für</strong> sie <strong>die</strong><br />
richtige ist.<br />
Deshalb interessierte uns, wie <strong>die</strong> Nutzer und Nutzerinnen das Unterstützungsangebot<br />
<strong>de</strong>s Weglaufhauses o<strong>de</strong>r von Wildwasser reflektiert haben. Wir wollten, dass ihre<br />
Erfahrungen und Ansichten in unserer Arbeit präsent sind.<br />
3. Der Aufbau <strong>de</strong>r Arbeit<br />
Teil I <strong>die</strong>ser Arbeit stellt <strong>de</strong>n Betroffenenkontrollierten Ansatz vor. Dabei wer<strong>de</strong>n<br />
einführend <strong>die</strong> dazugehörigen Projekte aufgeführt und kurz beschrieben. Danach folgt<br />
eine Skizze <strong>de</strong>r Geschichte und Entwicklung <strong>de</strong>s Ansatzes. Die theoretischen<br />
Grundlagen bil<strong>de</strong>n im Anschluss <strong>die</strong> genaue Ausführung <strong>de</strong>s gedanklichen Überbaus,<br />
welcher <strong>die</strong> drei Projekte unter <strong>de</strong>m Dach <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
vereint.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n Teil II wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>n Projekte Wildwasser und Weglaufhaus genauer<br />
untersucht. Wir haben uns dabei auf <strong>die</strong>se bei<strong>de</strong>n beschränkt, weil wir erstens in <strong>de</strong>n<br />
Projekten durch unsere Stu<strong>die</strong>npraktika auf eigene Erfahrungen zurückgreifen konnten<br />
und sich zweitens <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>n Projekte in Größe, Inhalt und Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> einen<br />
Vergleich gut eignen.<br />
6
Teil III bil<strong>de</strong>t das Herzstück <strong>die</strong>ser Arbeit. Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um einen empirischen<br />
Teil. Hier kommen <strong>die</strong> Nutzerinnen bzw. ehemaligen Nutzer <strong>de</strong>r Projekte selbst zu<br />
Wort. Wir haben uns in <strong>de</strong>r Auswertung bemüht, Interpretationen zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
In Teil IV <strong>die</strong>ser Arbeit wird <strong>die</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Sozialen Arbeit untersucht.<br />
7
Teil I: Der Betroffenenkontrollierte Ansatz<br />
1. Die betroffenenkontrollierten Projekte<br />
�������������������<br />
���������������<br />
����������<br />
���������������<br />
Abb.1: Logos <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte<br />
Der Betroffenenkontrollierte Ansatz wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Berliner Projekten Tauwetter e.V. -<br />
Anlaufstelle <strong>für</strong> Männer, <strong>die</strong> <strong>als</strong> Jungen sexuell missbraucht wur<strong>de</strong>n, Wildwasser e.V. -<br />
Frauenselbsthilfe und Beratung <strong>für</strong> Frauen, <strong>die</strong> <strong>als</strong> Mädchen sexuelle Gewalt erlebt<br />
haben und Weglaufhaus Villa Stöckle - Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt<br />
e.V. entwickelt und ist Deutschlandweit einzigartig.<br />
Kennzeichnend <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Ansatz ist <strong>die</strong> konzeptionell festgeschriebene Einstellung von<br />
betroffenen Mitarbeitern. Bei Tauwetter und Wildwasser sind 100% <strong>de</strong>r Frauen und<br />
Männer von sexueller Gewalt in <strong>de</strong>r Kindheit, im Weglaufhaus min<strong>de</strong>stens 50% von<br />
psychiatrischer Gewalt betroffen. Auch <strong>die</strong> Menschen, an <strong>die</strong> sich <strong>die</strong> Angebote <strong>de</strong>r<br />
Einrichtungen richten, haben in ihrem Leben sexuelle Gewalt in <strong>de</strong>r Kindheit o<strong>de</strong>r psychiatrische<br />
Gewalt erlebt. Eine wachsen<strong>de</strong> Anzahl <strong>de</strong>r Nutzerinnen und Nutzer von<br />
Wildwasser o<strong>de</strong>r Tauwetter haben Erfahrungen mit psychiatrischer Gewalt. Ein hoher<br />
Anteil <strong>de</strong>r Nutzer und Nutzerinnen <strong>de</strong>s Weglaufhauses ist auch Opfer sexualisierter<br />
Gewalt gewesen.<br />
Die drei Projekte <strong>de</strong>finieren Gewalt <strong>als</strong> <strong>„</strong>eine auf Machtstrukturen basieren<strong>de</strong> Handlung,<br />
<strong>die</strong> einen Menschen auf ein Objekt reduziert“ (Tauwetter u.a. 2004, 2). Die Projekte<br />
legen beson<strong>de</strong>ren Wert darauf, das Thema Gewalt bzw. Gewalterfahrung im gesamtgesellschaftlichen<br />
Kontext zu betrachten. Oft sind <strong>die</strong> von <strong>de</strong>n Me<strong>die</strong>n und <strong>de</strong>r<br />
Fachöffentlichkeit konstruierten Bil<strong>de</strong>r über Gewaltbetroffene mit ein Grund <strong>für</strong> eine<br />
gesellschaftliche Stigmatisierung und schaffen so zusätzliche Probleme <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Menschen.<br />
Die Erfahrung von Stigmatisierung und Isolation sind häufig ein Teil <strong>de</strong>r Probleme,<br />
<strong>die</strong> von <strong>de</strong>n Nutzerinnen und Nutzern <strong>de</strong>r Projekte bewältigt wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
8
2. Historische Grundlagen <strong>de</strong>s Ansatzes<br />
Alle drei Projekte haben ihre Wurzeln in <strong>de</strong>n emanzipatorischen Ansätzen <strong>de</strong>r sozialen<br />
Bewegungen <strong>de</strong>r 70er und 80er Jahre <strong>de</strong>s vergangenen Jahrhun<strong>de</strong>rts, wie <strong>de</strong>r Frauen-,<br />
Antipsychiatrie- und Selbsthilfebewegung. Trotz inhaltlicher und struktureller Unterschie<strong>de</strong><br />
hatten sie eines gemeinsam <strong>„</strong>nämlich ihre Ausrichtung gegen <strong>die</strong> Normen,<br />
Strukturen, Zwänge und Regeln <strong>de</strong>s bürgerlichen Establishments“ (Günther u.a. 1999,<br />
23). Ein wichtiger Ansatz <strong>de</strong>r Bewegungen war es daher, dass jeweils persönlich Erlebte<br />
in einen gesamtgesellschaftlichen und politischen Kontext zu stellen.<br />
Der Zusammenhang zwischen <strong>de</strong>n Herrschaftsstrukturen <strong>als</strong> Auslöser <strong>de</strong>r erlebten Gewalt<br />
und <strong>de</strong>n diskriminieren<strong>de</strong>n und stigmatisieren<strong>de</strong>n gesellschaftlichen Dynamiken,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> jeweilige gesellschaftliche Gruppe auch weiter ausgrenzen, wur<strong>de</strong> hergestellt.<br />
Die drei Projekte wur<strong>de</strong>n von gewaltbetroffenen Menschen gegrün<strong>de</strong>t, <strong>die</strong> das bisherige<br />
Hilfeangebot entwe<strong>de</strong>r vollständig ablehnten o<strong>de</strong>r wichtige Teile darin vermissten. Da<br />
<strong>de</strong>r Gewaltbegriff nicht starr, son<strong>de</strong>rn gesellschaftlichen Prozessen unterworfen ist und<br />
sich mit ihnen verän<strong>de</strong>rt, ging es auch darum, dass das Erlebte überhaupt <strong>als</strong> Gewalterfahrung<br />
anerkannt wur<strong>de</strong> (vgl. Hagemann-White u.a. 1997, 27ff.). Aus <strong>die</strong>sem Eigenbedarf<br />
entstand <strong>die</strong> Notwendigkeit, sich mit an<strong>de</strong>ren zusammenzuschließen, um <strong>die</strong> eigenen<br />
Anliegen selbst zu organisieren. Ein emanzipatorisches Selbstverständnis und das<br />
Streben nach Selbstbestimmung war und ist <strong>die</strong> wichtigste Arbeitsgrundlage. Dabei ist<br />
<strong>die</strong> persönliche Verän<strong>de</strong>rung und <strong>Weiterentwicklung</strong> von <strong>de</strong>r gesellschaftlichen nicht zu<br />
trennen und soll es auch gar nicht sein. Sie bedingen sich gegenseitig und alle drei Projekte<br />
verstehen ihre Arbeit explizit <strong>als</strong> sozialarbeiterisch bzw. psychosozial und politisch<br />
(vgl. Tauwetter u.a., 2004, 2f.).<br />
3. Theoretische Grundlagen <strong>de</strong>s Ansatzes<br />
Neben zahlreichen konzeptionellen Unterschie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r drei Projekte hat<br />
sich <strong>de</strong>nnoch unabhängig voneinan<strong>de</strong>r eine gemeinsame professionelle Haltung entwickelt.<br />
Einzelne Aspekte <strong>de</strong>s Ansatzes fin<strong>de</strong>n sich auch in <strong>de</strong>r Arbeit an<strong>de</strong>rer, nicht betroffenenkontrollierter<br />
Einrichtungen und Projekte wie<strong>de</strong>r, jedoch beinhaltet eben das Zu-<br />
9
sammenspiel aller im Weiteren beschriebenen Standards 1 , Haltungen und Herange-<br />
hensweisen <strong>die</strong> Qualität <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes. Nachfolgend wer<strong>de</strong>n<br />
<strong>die</strong>se Merkmale aufgeführt und im Weiteren beschrieben.<br />
o Gewaltbegriff<br />
o Freiwilligkeit<br />
o Menschenbild<br />
o Krisenbegriff<br />
o Parteilichkeit<br />
o Selbsthilfe<br />
3.1 Gewaltbegriff<br />
o Umgang mit Hierarchien<br />
o Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen<br />
o Einstellung von Betroffenen<br />
(vgl. Hävernick 2005, Anhang 7ff.)<br />
<strong>„</strong>Gewalt ist eine auf Machtstrukturen basieren<strong>de</strong> Handlung, <strong>die</strong> einen Menschen auf ein<br />
Objekt reduziert“ ( Tauwetter u.a. 2004, 2).<br />
Entschei<strong>de</strong>nd im Rahmen <strong>die</strong>ser Definition ist <strong>die</strong> Auffassung, dass auch heute noch <strong>die</strong><br />
Definitionsmacht über das Geschehen bei <strong>de</strong>n Tätern und Täterinnen bzw. <strong>de</strong>n jeweils<br />
Ausführen<strong>de</strong>n liegt.<br />
Sowohl in <strong>de</strong>r Gewaltsituation völlig ausgeliefert zu sein, <strong>als</strong> auch im Weiteren nicht<br />
selbstbestimmt über das Geschehene sprechen, es <strong>de</strong>finieren zu können, führt zu Gefühlen<br />
<strong>de</strong>r Ohnmacht und Hilflosigkeit.<br />
Diese Erfahrung von Ohnmacht und Hilflosigkeit ist <strong>de</strong>r zerstörerische Kern <strong>de</strong>r Gewalt.<br />
Sie ist kein persönliches Stigma, son<strong>de</strong>rn erlebtes Unrecht (vgl. Hävernick 2005,<br />
Anhang 7).<br />
In <strong>de</strong>m Kontext <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r drei Projekte geht es nicht vorrangig, aber durchaus<br />
auch, um Gewalt im <strong>„</strong>körperlichen Sinne“. Auf <strong>die</strong>ser Grundlage sind sexuelle Gewalt-<br />
1 <strong>„</strong>Ein Qualitätsstandard umfasst ein Ziel und <strong>die</strong> Maßnahme(n), um <strong>die</strong>ses Ziel zu erreichen. Dabei sind<br />
Ziele konkrete Zustän<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Ereignisse, <strong>die</strong> durch Han<strong>de</strong>ln von Personen o<strong>de</strong>r Personengruppen erreicht<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. Ziele entstehen (...) vor <strong>de</strong>m Hintergrund von Werten (Nicolai u.a. 2004, 11)“.<br />
10
erfahrung und psychiatrische Gewalt sehr ähnlich. Der Gewaltbegriff in <strong>die</strong>sem Ver-<br />
ständnis kann letztlich auf alle Erscheinungsformen ausgeweitet wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r alltäglichen<br />
Arbeit <strong>de</strong>r Projekte, in <strong>de</strong>r konkreten Begegnung mit <strong>de</strong>n Hilfesuchen<strong>de</strong>n gilt natürlich<br />
auch, dass je<strong>de</strong> Erfahrung von Gewalt individuell und, vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s<br />
persönlichen Erlebens, niem<strong>als</strong> gleichzusetzen ist.<br />
<strong>„</strong>Im Mittelpunkt je<strong>de</strong>r Arbeit mit Opfern von Gewalt steht <strong>die</strong> Wie<strong>de</strong>rerlangung <strong>de</strong>s<br />
Subjektstatus und <strong>die</strong> Entwicklung <strong>de</strong>r eigenen Handlungsfähigkeit. Das Definieren<br />
<strong>de</strong>s Erlebten <strong>als</strong> Gewalterfahrung ist <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raneignung <strong>de</strong>s Subjektstatus“<br />
(Tauwetter u.a. 2004, 2).<br />
3.2 Freiwilligkeit<br />
Die Projekte arbeiten nicht im Auftrag Dritter, wie sie Betreuer, Therapeuten o<strong>de</strong>r auch<br />
Angehörige darstellen, son<strong>de</strong>rn machen <strong>de</strong>n Nutzern und Nutzerinnen Angebote.<br />
<strong>„</strong>Alle drei Projekte arbeiten nach <strong>de</strong>m Prinzip <strong>de</strong>r Freiwilligkeit. Je<strong>de</strong> Nutzerin / je<strong>de</strong>r<br />
Nutzer entschei<strong>de</strong>t selber, ob sie o<strong>de</strong>r er das gemachte Angebot wahrnehmen<br />
will“ ( Tauwetter 2004, 3).<br />
Die Mitarbeiter in <strong>de</strong>n Projekten suchen aktiv <strong>de</strong>n Kontakt mit <strong>de</strong>n potentiellen Nutzern.<br />
In <strong>de</strong>r Realität kommt es durchaus vor, dass <strong>de</strong>r erste Kontakt über Dritte erfolgt. Eine<br />
Nutzung <strong>de</strong>r jeweiligen Angebote kann aber nur nach direktem Kontakt zwischen Hilfesuchen<strong>de</strong>n<br />
und Mitarbeitern stattfin<strong>de</strong>n.<br />
Je<strong>de</strong> Nutzerin und je<strong>de</strong>r Nutzer ist vom ersten Moment aktives Subjekt in <strong>die</strong>sem Prozess<br />
und entschei<strong>de</strong>t selbst.<br />
Diese Entscheidung <strong>für</strong> o<strong>de</strong>r gegen <strong>die</strong> Nutzung <strong>de</strong>r Hilfsangebote fin<strong>de</strong>t unter Umstän<strong>de</strong>n<br />
nicht nur einmal statt, son<strong>de</strong>rn muss immer wie<strong>de</strong>r neu getroffen wer<strong>de</strong>n. Die Nutzerinnen<br />
und Nutzer wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Mitarbeitern aktiv in <strong>die</strong>sem Prozess unterstützt.<br />
Viele Angebote <strong>de</strong>r Sozialhilfe scheitern auch <strong>de</strong>shalb, weil sie <strong>„</strong>am grünen Tisch“ ohne<br />
Rücksprache mit <strong>de</strong>nen, um <strong>die</strong> es eigentlich geht, geplant wur<strong>de</strong>n. Hier können <strong>die</strong><br />
Angebote auf Grundlage <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes eine Alternative darstellen.<br />
In <strong>de</strong>r konkreten Arbeit <strong>de</strong>r Projekte gibt es natürlich festgelegte Rahmenbedingungen<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Hilfsangebote. So dauert ein Beratungsgespräch eine Stun<strong>de</strong>, <strong>die</strong> Selbsthilfegruppe<br />
trifft sich einmal in <strong>de</strong>r Woche o<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Hausversammlung fin<strong>de</strong>t zweimal wöchentlich<br />
statt, es wer<strong>de</strong>n aber mit <strong>de</strong>n Nutzerinnen und Nutzern immer auch <strong>die</strong> individuellen<br />
Bedürfnisse abgeklärt und nach Möglichkeit berücksichtigt. Wichtig ist, dass es<br />
keine verordneten Pläne, vorgegebenen Vorgehensweisen und keine Anweisungen gibt.<br />
11
Die Klienten bleiben eigenverantwortlich. Sie wissen selbst am besten über ihre konkre-<br />
te Situation Bescheid und was sie in <strong>die</strong>ser Situation benötigen.<br />
Wer sich <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzung <strong>de</strong>s Angebots entschei<strong>de</strong>t, wird im Rahmen <strong>de</strong>r formalen und<br />
personellen Möglichkeiten <strong>de</strong>r Projekte akzeptiert.<br />
3.3 Menschenbild<br />
Es gibt nach <strong>die</strong>sem Verständnis keine verschie<strong>de</strong>nen Wertigkeiten von Menschen.<br />
Männer und Frauen, <strong>die</strong> in einem <strong>de</strong>r Projekte um Hilfe bitten, wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong> selbstbe-<br />
stimmte, sich verän<strong>de</strong>rn wollen<strong>de</strong> Menschen betrachtet und haben somit <strong>de</strong>n vollen<br />
Gestaltungsspielraum <strong>für</strong> <strong>de</strong>n jeweiligen Umgang mit <strong>de</strong>r Situation.<br />
<strong>„</strong>Je<strong>de</strong>r Mensch bringt erheblich mehr an Lebenserfahrungen mit <strong>als</strong> <strong>die</strong> erlebte<br />
Gewalt. Alle verfügen grundsätzlich über <strong>die</strong> notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten,<br />
sich zu verän<strong>de</strong>rn“ (Tauwetter u.a. 2004, 2 ).<br />
Wichtig im Rahmen <strong>die</strong>ses Menschenbil<strong>de</strong>s ist auch <strong>die</strong> Vermeidung von Diagnosen<br />
und Zuschreibungen. Aus <strong>die</strong>sem Blickwinkel übernimmt je<strong>de</strong>s Verhalten, und sei es<br />
noch so ungewöhnlich, im Leben <strong>de</strong>s jeweiligen Menschen eine Funktion und ist immer<br />
auch ein kreativer Lösungsversuch einer konfliktreichen Situation.<br />
<strong>„</strong>Die Spaltung in Hilfesuchen<strong>de</strong> und Helfen<strong>de</strong> ist <strong>für</strong> uns eine situative, keine grundsätzliche“(Tauwetter<br />
u.a. 2004, 2). Das heißt, je<strong>de</strong>r heute Hilfesuchen<strong>de</strong> kann morgen<br />
schon in einem an<strong>de</strong>ren Kontext <strong>de</strong>r Berater <strong>de</strong>r Mitarbeiter sein. So kann z.B. eine heute<br />
bei Wildwasser Ratsuchen<strong>de</strong> morgen <strong>als</strong> Rechtsanwältin Beraterin einer Mitarbeiterin<br />
sein.<br />
Auch in <strong>de</strong>r alltäglichen Arbeit kommt <strong>die</strong>se Haltung zum Tragen, <strong>de</strong>nn in <strong>de</strong>n Projekten<br />
ist es möglich (siehe auch 3.8 Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen), dass ehemalige Nutzerinnen<br />
zu Mitarbeiterinnen und somit zu Kolleginnen wer<strong>de</strong>n.<br />
3.4 Krisenbegriff<br />
Krisen sind integraler Bestandteil je<strong>de</strong>n Lebens und wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Projekten <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatzes auch so reflektiert. <strong>„</strong>Sie sind normaler Bestandteil <strong>de</strong>s<br />
Lebens und stellen eine Chance zu konstruktiven Verän<strong>de</strong>rungen dar“ (Hävernick 2005,<br />
Anhang 8).<br />
Auch von <strong>de</strong>r Norm abweichen<strong>de</strong> Verhaltensweisen wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong> aktive Lösungsversuche<br />
und in <strong>de</strong>r jeweiligen Situation auch <strong>als</strong> das Bestmögliche anerkannt. Diagnosen spielen<br />
12
keine Rolle. Ungewöhnliche, abweichen<strong>de</strong> Verhaltensweisen wer<strong>de</strong>n nicht <strong>als</strong> Krank-<br />
heiten eingestuft.<br />
In einem Vortrag über <strong>die</strong> Sprache <strong>de</strong>r Erfahrung und <strong>de</strong>n Umgang mit psychiatrischen<br />
Diagnosen in <strong>de</strong>r Beratungsarbeit stellt Jasna Russo fest, dass<br />
<strong>„</strong>Diagnosen nicht in <strong>de</strong>r Lage sind, über <strong>die</strong> Erfahrung zu sprechen, und genauso<br />
kann <strong>die</strong> Erfahrung einer Person in Diagnosen nicht zur Sprache kommen. Eine<br />
Möglichkeit <strong>de</strong>r Sprache <strong>de</strong>r Erfahrung bleibt aus Diagnosen strukturell ausgeschlossen“<br />
(Russo 2003, Anhang 13).<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis ihrer Erfahrungen sprechen und entschei<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Nutzer und bleiben auch<br />
in <strong>de</strong>r krisenhaften Situation verantwortlich <strong>für</strong> sich selbst.<br />
Eine ebenso entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>r Krise spielt <strong>für</strong> <strong>die</strong> Projekte <strong>de</strong>r<br />
gesellschaftliche und politische Hintergrund. Er wird <strong>als</strong> Auslöser und Verstärker gesehen,<br />
<strong>de</strong>nn neben <strong>de</strong>n individuellen Anteilen sind es immer auch gesellschaftliche und<br />
soziale Faktoren, <strong>die</strong> zu einer Krise führen (vgl. Tauwetter u.a. 2004, 2).<br />
So geht es in <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r Projekte darum, sich <strong>de</strong>r vielen Faktoren, <strong>die</strong> in einer Krisensituation<br />
zusammen spielen, bewusst zu wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Menschen nicht unabhängig<br />
von seiner Lebenssituation zu sehen.<br />
3.5 Parteilichkeit<br />
Parteilichkeit im Rahmen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes wird von <strong>de</strong>n Projekten<br />
<strong>als</strong> Arbeitshaltung verstan<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> unter Einbeziehung aller relevanten gesellschaftlichen,<br />
politischen und wirtschaftlichen Hintergrün<strong>de</strong> versucht, <strong>die</strong> jeweils individuellen<br />
Probleme <strong>de</strong>r Nutzer und Nutzerinnen zu verstehen. Deren Gewalterfahrungen berühren<br />
häufig alle angesprochenen Ebenen. Aus <strong>die</strong>sem Verständnis folgt auch eine aktive<br />
Positionierung <strong>de</strong>r Mitarbeiter gegen herrschen<strong>de</strong> Machtstrukturen und Diskriminierungsmechanismen.<br />
In <strong>die</strong>sem Kontext arbeiten <strong>die</strong> Mitarbeiter <strong>de</strong>r Projekte parteilich<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzerinnen, nicht nur in <strong>de</strong>n Projekten selbst, son<strong>de</strong>rn auch in fachlichen Gremien<br />
und an<strong>de</strong>ren gesellschaftlichen Strukturen.<br />
Es gibt keine <strong>„</strong>Neutralität und Unabhängigkeit von <strong>de</strong>r eigenen gesellschaftlichen Her-<br />
kunft, ethischer und ethnischer Zugehörigkeit, vom eigenen Geschlecht, von Alter und<br />
persönlicher Geschichte“ (Tauwetter u.a. 2004, 3). Entschei<strong>de</strong>nd <strong>für</strong> <strong>die</strong> parteiliche<br />
Arbeit <strong>de</strong>r drei Projekte ist es, dass in <strong>de</strong>m kontinuierlichen Prozess <strong>de</strong>r alltäglichen<br />
Arbeit auch <strong>die</strong> Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Zusammenhänge beleuchtet, dis-<br />
13
kutiert und einbezogen wer<strong>de</strong>n. <strong>„</strong>Parteiliche Arbeit ist immer ein Prozess und beinhal-<br />
tet ein differenziertes Verständnis <strong>de</strong>r Komplexität von Lebenszusammenhängen“<br />
(Tauwetter u.a. 2004, 3).<br />
3.9 Selbsthilfe<br />
Alle drei Projekte sind aus <strong>de</strong>r Selbsthilfebewegung entstan<strong>de</strong>n. Wildwasser und Tau-<br />
wetter waren in ihren Anfängen Selbsthilfegruppen. Diese gemeinsame Grundlage<br />
spielt auch heute noch in <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r Projekte eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle.<br />
In projektabhängigen, unterschiedlichen Kontexten wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Nutzern und Nutzerin-<br />
nen Möglichkeiten eröffnet, sich mit an<strong>de</strong>ren Nutzern auszutauschen. Im Kontakt mit<br />
an<strong>de</strong>ren, <strong>die</strong> ähnliches erlebt haben, fin<strong>de</strong>n sie eigene Worte und Definitionen <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
erlebte Gewalt und <strong>de</strong>ren Folgen.<br />
<strong>„</strong>Im Rahmen von Selbsthilfe sprechen <strong>die</strong> Betroffenen selber, es wird nicht über sie ge-<br />
sprochen“ (Tauwetter u.a. 2004, 4). Die Selbsthilfe ist ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Faktor, um<br />
<strong>de</strong>n Nutzerinnen und Nutzern <strong>de</strong>n Raum zu öffnen, sich selbst <strong>de</strong>n Subjektstatus wie-<br />
<strong>de</strong>ranzueignen (siehe auch 3.1. Gewaltbegriff). Zu<strong>de</strong>m soll im Kontakt mit an<strong>de</strong>ren Be-<br />
troffenen erfahrbar wer<strong>de</strong>n, dass Gewalt kein individuelles Schicksal ist: <strong>„</strong>Durch <strong>de</strong>n<br />
Austausch zwischen Betroffenen wird <strong>die</strong> Isolation been<strong>de</strong>t und <strong>die</strong> gesellschaftliche<br />
Dimension <strong>de</strong>r erlebten Gewalt greifbar.“(Hävernick 2005, Anhang 9)<br />
Auch <strong>die</strong> Erfahrung, dass sich an<strong>de</strong>re Menschen, <strong>die</strong> eine ähnliche Erfahrung gemacht<br />
haben, solidarisch verhalten, auf Seiten <strong>de</strong>r jeweiligen Nutzer und Nutzerinnen stehen,<br />
wird <strong>als</strong> ein wichtiger Faktor wahrgenommen. <strong>„</strong>Sie tauschen sich aus, unterstützen und<br />
solidarisieren sich“ (Hävernick 2005, Anhang 9).<br />
3.7 Umgang mit Hierarchien<br />
In <strong>de</strong>n Projekten und ihrer Arbeit gibt es Hierarchien, <strong>die</strong> u.a. aus <strong>de</strong>m Verhältnis von<br />
Ratsuchen<strong>de</strong>m zu Berater, <strong>de</strong>r Position <strong>als</strong> angestellte Mitarbeiter o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Hausrecht<br />
resultieren. Aus <strong>de</strong>n realen Arbeits- und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ergibt<br />
sich, dass trotz hierarchiekritischer Haltung in <strong>de</strong>n Projekten keine Hierarchiefreiheit<br />
herzustellen ist.<br />
Die drei Projekte verbin<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Betroffenenkontrollierten Ansatz <strong>de</strong>n Anspruch,<br />
einen Raum zu schaffen, in <strong>de</strong>m vorhan<strong>de</strong>ne Hierarchien flach gehalten und <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Nutzerinnen und Nutzer transparent gemacht wer<strong>de</strong>n. Im Rahmen <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Möglichkeiten können <strong>die</strong> Nutzer aktiv Einfluss nehmen. <strong>„</strong>Vorhan<strong>de</strong>ne Hierarchien<br />
14
wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n NutzerInnen transparent gemacht, es wer<strong>de</strong>n ihnen weitestgehen<strong>de</strong> Ein-<br />
flussmöglichkeiten eingeräumt“ (Tauwetter u.a. 2004, 4).<br />
Der Umgang mit Hierarchien wird <strong>als</strong> permanenter Prozess begriffen, <strong>de</strong>r einer andau-<br />
ern<strong>de</strong>n Diskussion, Auseinan<strong>de</strong>rsetzung und Reflektion bedarf (vgl. ebd., 4).<br />
3.9 Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen<br />
Ein wichtiger Faktor zur Umsetzung <strong>de</strong>r formulierten Ansprüche ist <strong>für</strong> <strong>die</strong> Projekte <strong>die</strong><br />
Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen. Es wird Nutzern und Nutzerinnen prinzipiell ermöglicht<br />
zu einem späteren Zeitpunkt, an <strong>de</strong>m sie das Projekt o<strong>de</strong>r spezielle festgelegte Angebote<br />
2 selbst nicht mehr nutzen, Mitarbeiter o<strong>de</strong>r Mitarbeiterin wer<strong>de</strong>n zu können.<br />
<strong>„</strong>Für NutzerInnen bzw. ehemalige NutzerInnen <strong>de</strong>r Projekte besteht <strong>die</strong> Möglichkeit,<br />
irgendwann selbst in <strong>de</strong>m jeweiligen Projekt mitzuarbeiten und damit zukünftige MitarbeiterInnen<br />
o<strong>de</strong>r KollegInnen zu wer<strong>de</strong>n“ (Tauwetter u.a. 2004, 4).<br />
Nach Auffassung <strong>de</strong>r Projekte wirkt <strong>die</strong> Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen vor allem in<br />
zwei Richtungen. Zum einen wirkt sie in Richtung einer Aufhebung von Machtverhältnissen<br />
und Hierarchien, da <strong>die</strong> Ratsuchen<strong>de</strong>n tatsächlich Mitarbeiter wer<strong>de</strong>n können.<br />
Zum an<strong>de</strong>ren bestimmt <strong>die</strong>se Möglichkeit explizit <strong>die</strong> Arbeitshaltung in Beratung und<br />
Begleitung. Den Mitarbeitern ist zu je<strong>de</strong>m Zeitpunkt bewusst, dass <strong>die</strong> jeweiligen Nutzer<br />
potentielle Kollegen sind.<br />
<strong>„</strong>Diese grundsätzliche Option <strong>de</strong>r formalen Gleichberechtigung ist Ausdruck einer<br />
Haltung, <strong>die</strong> getragen ist von <strong>de</strong>r perspektivischen Möglichkeit <strong>de</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
Machtverhältnisse. Diese Haltung ist grundlegend <strong>für</strong> je<strong>de</strong> Begegnung zwischen<br />
NutzerInnen und MitarbeiterInnen und oft auch zwischen <strong>de</strong>n NutzerInnen selbst“<br />
(ebd., 4).<br />
3.9 Einstellung von Betroffenen<br />
Die konzeptionell festgeschriebene, gleichberechtigte Einstellung von Betroffenen ist<br />
elementarer Bestandteil <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes.<br />
Der Hintergrund <strong>die</strong>ser Festlegung ist keineswegs <strong>die</strong> Vorstellung selbstbetroffene Mit-<br />
arbeiter und Mitarbeiterinnen könnten per se bessere Arbeit machen o<strong>de</strong>r seien grund-<br />
sätzlich empathischer. Ausgangspunkt ist vielmehr <strong>de</strong>r gesellschaftliche, meist stigmatisieren<strong>de</strong><br />
Blick auf Gewaltbetroffene.<br />
2 So kann bei Wildwasser eine Nutzerin <strong>de</strong>s Beratungsangebots nicht gleichzeitig Mitarbeiterin wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Teilnahme an einer (nicht-angeleiteten) Selbsthilfegruppe schließt jedoch nicht von <strong>de</strong>r Mitarbeit aus.<br />
15
<strong>„</strong>Beson<strong>de</strong>rs durch Me<strong>die</strong>n und Fachöffentlichkeit gibt es (scheinbar) allgemeingültige<br />
Vorstellungen von Frauen und Männern, <strong>die</strong> sexuelle Gewalt <strong>als</strong> Kin<strong>de</strong>r<br />
und/o<strong>de</strong>r psychiatrische Gewalt erfahren haben. Durch <strong>die</strong>se konstruierten Bil<strong>de</strong>r<br />
wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Betroffenen stigmatisiert und isoliert“ (Tauwetter u.a. 2004, 4).<br />
Die Einstellung von Betroffenen hebt <strong>die</strong> Stigmatisierung auf und wirkt <strong>de</strong>n klischee-<br />
haften Bil<strong>de</strong>rn aktiv entgegen. Von Gewalt betroffene Menschen wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong> kompetente<br />
und professionelle Mitarbeiterinnen anerkannt.<br />
Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, das Gewaltbetroffenheit <strong>für</strong> eine Einstellung<br />
ausreichend ist. Es ist ein Kriterium unter vielen. Ein Teil <strong>de</strong>r Einstellungskriterien fin<strong>de</strong>n<br />
sich in <strong>de</strong>r formalen Qualifikation, <strong>die</strong> meisten jedoch im Bereich <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Fähigkeiten zu Reflektion und Auseinan<strong>de</strong>rsetzung.<br />
Die gefor<strong>de</strong>rten formalen Qualifikationen sind abhängig von <strong>de</strong>n Vorgaben <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Geldgeber und nicht Teil <strong>de</strong>r konzeptionellen Anfor<strong>de</strong>rungen. Im Weglaufhaus wird<br />
<strong>die</strong> Ausbildung zum Sozialarbeiter vorausgesetzt, das heißt <strong>Betroffenheit</strong> muss mit einer<br />
professionellen Qualifikation kombiniert sein. In <strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe von Wildwasser<br />
kann nach Absprache mit <strong>de</strong>n Zuwendungsgebern von einer formalen Qualifikation<br />
abgesehen wer<strong>de</strong>n, wenn <strong>die</strong> betreffen<strong>de</strong> Mitarbeiterin über langjährige und profun<strong>de</strong><br />
Kenntnisse <strong>de</strong>s Themenbereichs verfügt.<br />
Als Qualifikation im Sinne <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes 3 wird <strong>die</strong> Bereitschaft<br />
und Kompetenz über das eigene Erleben zu kommunizieren gesehen. Ebenso <strong>die</strong><br />
Fähigkeit <strong>die</strong> eigene Gewalterfahrung aktiv <strong>als</strong> Ressource zu nutzen, um so Hemmschwellen<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzerinnen und Nutzer herabzusetzen und Zuschreibungen in Frage<br />
zu stellen. Auch sollten verschie<strong>de</strong>ne Perspektiven eingenommen wer<strong>de</strong>n können und<br />
<strong>die</strong> Offenheit, sich in <strong>de</strong>n eigenen Vorstellungen und Werten irritieren zu lassen, sollte<br />
vorhan<strong>de</strong>n sein.<br />
<strong>„</strong>MitarbeiterInnen in betroffenkontrollierten Projekten bewegen sich in einem<br />
Spannungsfeld zwischen <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>r Gleichstellung von MitarbeiterInnen und<br />
NutzerInnen und <strong>de</strong>r Rolle <strong>als</strong> professionell Helfen<strong>de</strong>. Dies ist eine hohe Anfor<strong>de</strong>rung,<br />
<strong>die</strong> we<strong>de</strong>r durch eigene Gewalterfahrungen noch durch Berufsausbildungen<br />
alleine gewährleistet wer<strong>de</strong>n kann“<br />
(ebd., 8).<br />
3 Wenn im Weiteren <strong>als</strong>o von betroffenen Mitarbeitern gesprochen wird, ist damit nicht gemeint, dass<br />
<strong>die</strong>se unqualifiziert sind, son<strong>de</strong>rn lediglich, dass sie eventuell nicht über verlangte formale Qualifikationen<br />
verfügen. Sie haben jedoch immer eigene Gewalterfahrungen und sind bereit <strong>die</strong>se im oben genannten<br />
Sinne zu nutzen.<br />
16
Für <strong>die</strong> Öffentlichkeit und beson<strong>de</strong>rs auch <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzer und Nutzerinnen <strong>de</strong>r Projekte<br />
braucht es leben<strong>de</strong> Vorbil<strong>de</strong>r, dass trotz Gewalterfahrung ein selbstbestimmtes Leben<br />
möglich ist. Die Kompetenz von Betroffenen soll und ist integraler Bestandteil <strong>de</strong>r Projekte.<br />
“Zur Beendigung <strong>de</strong>r persönlichen und gesellschaftlichen Isolation ist es absolut<br />
notwendig, dass Mann und Frau in <strong>de</strong>n Projekten auf an<strong>de</strong>re Menschen treffen<br />
können, <strong>die</strong> ebenfalls persönliche Erfahrungen mit <strong>de</strong>m jeweiligen Thema haben.<br />
Für viele NutzerInnen ist es ganz entschei<strong>de</strong>nd zu wissen, dass sie in <strong>de</strong>n Projekten<br />
Menschen begegnen, <strong>die</strong> ähnliches erlebt haben. Die MitarbeiterInnen erfüllen eine<br />
Vorbildfunktion in Bezug darauf, dass es trotz <strong>de</strong>r Gewalterfahrungen möglich ist,<br />
ein Selbstbestimmtes Leben zu führen“ (ebd., 4).<br />
17
Teil II: Die Berliner Projekte Weglaufhaus und Wildwasser<br />
1. Das Weglaufhaus <strong>„</strong>Villa Stöckle“<br />
Weglaufhaus "Villa Stöckle" Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V.<br />
Postfach 280 427<br />
13444 Berlin<br />
Tel.: 030 – 406 32 146<br />
Fax.: 030 – 406 32 147<br />
E-mail: <strong>weglaufhaus</strong>@web.<strong>de</strong><br />
Homepage: www.<strong>weglaufhaus</strong>.<strong>de</strong><br />
1.1 Projektvorstellung<br />
<strong>„</strong>Verrückte sind nicht krank, son<strong>de</strong>rn<br />
auf einem <strong>für</strong> an<strong>de</strong>re schwer<br />
verständlichen Weg, auf <strong>de</strong>r Suche<br />
nach ihrem Platz in <strong>de</strong>r Welt. Da<strong>für</strong><br />
brauchen sie keine Psychopharmaka,<br />
<strong>die</strong> ihr Gehirn lahmlegen, und keine<br />
Therapie, <strong>die</strong> ihnen einre<strong>de</strong>t, sie seien<br />
behin<strong>de</strong>rt. Statt <strong>de</strong>ssen brauchen sie<br />
Verständnis, Ermutigung, Zeit und Ruhe.“ 1<br />
Abb.2: das Weglaufhaus Villa <strong>„</strong>Stöckle“<br />
Das Weglaufhaus <strong>„</strong> Villa Stöckle“ ist eine Kriseneinrichtung 2 , <strong>die</strong> auf <strong>de</strong>r Grundlage<br />
<strong>de</strong>r §§ 67ff SGB XII "Hilfe zur Überwindung beson<strong>de</strong>rer sozialer Schwierigkeiten" in<br />
Verbindung mit § 75 SGB XII "Hilfe in Einrichtungen" arbeitet. Es bietet bis zu 13<br />
Wohnungslosen o<strong>de</strong>r akut von Wohnungslosigkeit bedrohten Psychiatrie-Betroffenen 3<br />
einen intensiv betreuten Schutz- und Wohnraum. Das Weglaufhaus ist somit Teil <strong>de</strong>r<br />
Berliner Wohnungslosenhilfe.<br />
Der Trägerverein ist <strong>de</strong>r Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V.. Er ist seit<br />
1993 Mitglied <strong>de</strong>s Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverban<strong>de</strong>s (dpw).<br />
Das Weglaufhaus ist eine am nördlichen Stadtrand von Berlin gelegene zweistöckige<br />
Altbauvilla, <strong>die</strong> mehrere Ein- und Zweibettzimmer, Gemeinschaftsräume und einen<br />
1 http://www.<strong>weglaufhaus</strong>-leipzig.<strong>de</strong>/main.htm<br />
2 2000 wur<strong>de</strong> in Berlin <strong>de</strong>r Leistungstyp Kriseneinrichtung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Wohnungslosenhilfe geschaffen. Dieser<br />
zeichnet sich durch eine <strong>„</strong>rund-um-<strong>die</strong>-Uhr-Betreuung“ aus und gehört <strong>de</strong>shalb zu <strong>de</strong>n teuersten Einrichtungen<br />
in <strong>die</strong>sem Bereich<br />
3 “Als Psychiatrie-betroffen gelten Menschen, <strong>die</strong> in psychiatrischen Anstalten behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r<br />
früher behan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n” (Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e. V., 2001).<br />
18
großen Garten hat. Die zweite Etage <strong>de</strong>s Hauses ist <strong>de</strong>n Frauen vorbehalten, um <strong>die</strong>sen<br />
einen beson<strong>de</strong>ren Schutzraum anbieten zu können.<br />
Bis zu einem halben Jahr kann <strong>de</strong>r Aufenthalt im Weglaufhaus dauern. In <strong>de</strong>r Regel<br />
dauert er 2-3 Monate, in einigen Fällen war es bereits möglich, <strong>die</strong>sen Zeitraum auf bis<br />
zu einem Jahr auszuweiten.<br />
Eltern o<strong>de</strong>r Elternteile, <strong>die</strong> mit ihren Kin<strong>de</strong>rn im Weglaufhaus um Aufnahme bitten,<br />
können nicht aufgenommen wer<strong>de</strong>n. Dies gilt ebenfalls <strong>für</strong> alle Menschen, <strong>die</strong> durch ein<br />
Strafgericht im Maßregelvollzug o<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>r StPO in einer psychiatrischen Anstalt<br />
untergebracht sind. Auch <strong>die</strong> Unterbringung nach PsychKG o<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m Betreuungsrecht<br />
ist ein Ausschlusskriterium <strong>für</strong> <strong>die</strong> Aufnahme im Weglaufhaus, es sei <strong>de</strong>nn <strong>die</strong><br />
Unterbringung wird aufgehoben o<strong>de</strong>r vorläufig ausgesetzt (vgl. Verein zum Schutz vor<br />
psychiatrischer Gewalt e.V. 2001, 16 f.).<br />
Das Weglaufhaus ist ein antipsychiatrisches Projekt und bezieht explizit Stellung gegen<br />
das psychiatrische System und <strong>de</strong>ssen Behandlungsformen.<br />
Der Schwerpunkt in <strong>de</strong>r Arbeit wird darauf gelegt, <strong>„</strong>(…) <strong>die</strong> Wahrnehmung, Entwick-<br />
lung und Stärkung <strong>de</strong>r Selbstbestimmung psychiatrie- betroffener Menschen(…)“ (Verein<br />
zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt 2001, 18) zu ermöglichen und zu unterstützen.<br />
Die Betreuung ist <strong>de</strong>shalb bewusst nicht therapeutisch angelegt.<br />
Die Bewohner 4 im Weglaufhaus wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong>o nicht behan<strong>de</strong>lt, son<strong>de</strong>rn bei ihren Vorhaben<br />
und in ihrer Krise von <strong>de</strong>n Mitarbeitern begleitet und unterstützt. Die Ursachen <strong>für</strong><br />
eine Krise im Leben eines Menschen besteht aus vielen Faktoren. Sie sind persönlicher,<br />
sozialer und gesellschaftlicher Natur. So ist es abhängig vom zeitlichen, gesellschaftlichen<br />
und kulturellen Rahmen, wie akzeptiert und getragen Krisen durchlebt wer<strong>de</strong>n<br />
können und auch in welcher Ausprägung sie sich ereignen. Eine Krise ist zunächst ein<br />
Zustand, in <strong>de</strong>m man oft alleine <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Lebens nicht mehr gewachsen<br />
ist und da<strong>für</strong> Hilfe benötigt. Im Weglaufhaus wird <strong>die</strong>se Hilfe angeboten. Wichtig dabei<br />
ist, dass <strong>de</strong>r Mensch sich in <strong>de</strong>r Krise getragen und sicher fühlt. Wie <strong>die</strong>se Begleitung<br />
genau aussieht, ist so unterschiedlich wie <strong>die</strong> Personen selbst. Dasselbe gilt <strong>für</strong> <strong>die</strong> Krise<br />
an sich.<br />
Die Bewohner <strong>de</strong>s Weglaufhauses sind häufig mit <strong>de</strong>m psychiatrischen Krankheitsbegriff<br />
konfrontiert. Es wird dabei von psychischer Erkrankung gesprochen. Die Ursache<br />
<strong>de</strong>r Krankheit hängt laut <strong>die</strong>ser Definition hauptsächlich mit biologische Faktoren (Ver-<br />
4 So wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Nutzer <strong>de</strong>s Weglaufhauses genannt. Dieser Begriff ist im Gegensatz zu Klient o<strong>de</strong>r Patient<br />
frei von <strong>de</strong>r Zuschreibung spezifischer werten<strong>de</strong>r Eigenschaften, <strong>die</strong> oft ein Machtgefälle implizieren.<br />
19
erbung, Stoffwechselstörung von Gehirnbotenstoffen) kombiniert mit lebensgeschichtli-<br />
che Bedingungen zusammen.<br />
Bei <strong>de</strong>r psychiatrischen Behandlung steht <strong>die</strong> Therapie durch Psychopharmaka im Vor-<br />
<strong>de</strong>rgrund; manchmal wird begleitend <strong>die</strong> Bewältigung von Alltagsanfor<strong>de</strong>rungen und<br />
<strong>de</strong>r Umgang mit <strong>de</strong>r Erkrankung psychotherapeutisch unterstützt.<br />
Bezeichnend <strong>für</strong> eine solche Art <strong>de</strong>s Umgangs mit einer Krise ist <strong>die</strong> Fixierung <strong>de</strong>r Ur-<br />
sachen auf <strong>de</strong>r persönlichen Ebene. Der Mensch ist persönlich da<strong>für</strong> <strong>die</strong> Ursache, dass<br />
er <strong>„</strong>psychisch krank“ wird. Die soziale sowie <strong>die</strong> gesellschaftliche Mitverantwortung<br />
bleiben dabei unberücksichtigt. Gleichzeitig wird <strong>die</strong> Person durch <strong>die</strong> Diagnosevergabe<br />
Angehörige einer Gruppe von Menschen mit <strong>de</strong>r selben Diagnose, wird dabei <strong>als</strong>o <strong>als</strong><br />
Person unsichtbar. Die eigene Krise wird <strong>de</strong>rart abstrahiert, dass man sich <strong>die</strong> Behandlung<br />
betreffend an <strong>de</strong>n Fachmann wen<strong>de</strong>t.<br />
Ich gehe hier kurz auf <strong>de</strong>n Krisenbegriff <strong>de</strong>r Psychiatrie ein, weil eben in Abgrenzung<br />
zu <strong>die</strong>sem das Weglaufhaus eine enorm befreien<strong>de</strong> Wirkung auf viele Bewohnerinnen<br />
und Bewohner hat. Sie sind und bleiben <strong>die</strong>jenigen, <strong>die</strong> mit ihrer Lebenssituation umgehen<br />
müssen. Außer<strong>de</strong>m geht es bei einer Krise um nichts abstraktes, son<strong>de</strong>rn um das<br />
Leben selbst und <strong>die</strong> Auseinan<strong>de</strong>rsetzung damit. Es geht im Weglaufhaus um <strong>de</strong>n konkreten<br />
Umgang mit <strong>de</strong>r Situation und dabei zunächst darum, <strong>de</strong>n Bewohnern zu ermöglichen,<br />
eine gewisse Grundstabilität zu erreichen. Danach liegt <strong>de</strong>r Fokus darauf, <strong>die</strong><br />
Bewältigung <strong>de</strong>s Alltags in <strong>de</strong>r Einrichtung und gleichzeitig <strong>die</strong> Basis <strong>für</strong> ein Leben<br />
außerhalb <strong>die</strong>ser zu organisieren. Zu <strong>de</strong>n alltagspraktischen Verrichtungen im Haus gehören<br />
Küchen<strong>die</strong>nste, Putz<strong>die</strong>nste und das Erledigen <strong>de</strong>r Einkäufe. Diese wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
zweimal pro Woche stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Hausversammlung organisiert. Zusätzlich ist hier<br />
<strong>de</strong>r Raum, um im Zusammenleben auftreten<strong>de</strong> Konflikte und sonstige Probleme zu besprechen.<br />
Die Vorbereitungen auf das Leben nach <strong>de</strong>m Aufenthalt im Weglaufhaus bestehen<br />
hauptsächlich darin, in <strong>de</strong>r Krise meist vernachlässigte Aktivitäten wie Arztbesuche,<br />
Behör<strong>de</strong>ngänge, Schul<strong>de</strong>nregulierung, Wohnungssuche und Ähnliches in Angriff zu<br />
nehmen. Die Entscheidung über <strong>die</strong> individuelle Gestaltung <strong>de</strong>s Aufenthaltes liegt<br />
grundsätzlich bei je<strong>de</strong>m selbst, es gibt allerdings auch Pflichten (Hausversammlung,<br />
Putz<strong>die</strong>nste, Verzicht auf Drogen), <strong>die</strong> bei Aufnahme im Weglaufhaus unterschrieben<br />
und damit akzeptiert wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
Da das Angebot <strong>de</strong>s Weglaufhauses sich alternativ zum psychiatrischen System versteht,<br />
wird auch <strong>die</strong> Vergabe von Psychopharmaka abgelehnt. Nimmt ein Bewohner<br />
20
<strong>die</strong>se, wird seine Entscheidung respektiert, falls er möchte, wird er beim Absetzen <strong>de</strong>r<br />
Medikamente unterstützt. Diesbezüglich bietet das Weglaufhaus <strong>als</strong> eines von wenigen<br />
Projekten in Deutschland umfassen<strong>de</strong> und kritische Aufklärung und Beratung über <strong>die</strong><br />
Wirkung von Psychopharmaka und eine direkte Unterstützung beim Absetzen an.<br />
Auch <strong>de</strong>r medizinische Begriff <strong>de</strong>r Diagnose fin<strong>de</strong>t keine Verwertung. Er bietet <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Mitarbeiter <strong>de</strong>s Weglaufhauses keine Arbeitsgrundlage. Mit <strong>de</strong>r Diagnose wer<strong>de</strong>n lediglich<br />
bestimmte Symptome zusammengefasst. Ihre Hauptaufgabe ist es, <strong>die</strong> Menschen zu<br />
sortieren und zu prognostizieren, <strong>die</strong> realen sozialen Bedingungen bleiben dabei unberücksichtigt.<br />
Die Möglichkeiten zu klassifizieren sind dabei sehr groß.<br />
<strong>„</strong>Trotz so viel Platz, ist <strong>de</strong>r Platz <strong>für</strong> individuelle Unterschie<strong>de</strong>, aufgrund <strong>de</strong>rer ein<br />
ähnliches psychologisches Phänomen unterschiedliche Be<strong>de</strong>utungen und auch einen<br />
unterschiedlichen Sinn <strong>für</strong> verschie<strong>de</strong>ne Personen haben kann, nicht vorhan<strong>de</strong>n.<br />
Alle an<strong>de</strong>ren Unterschie<strong>de</strong> verschwin<strong>de</strong>n auch, wie kulturelle, ökonomische<br />
Bedingungen, Unterschie<strong>de</strong> <strong>de</strong>r politischen Systeme, in <strong>de</strong>nen <strong>die</strong> Person lebt, Altersunterschie<strong>de</strong>,<br />
usw.“<br />
Ebenso fin<strong>de</strong>t eine Distanzierung von <strong>de</strong>r konkret erlebten Erfahrung statt. Die Diagno-<br />
se ist, <strong>de</strong>n direkten Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation betreffend, nicht nützlich. Die Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r Bewohner und ihr bisheriger, sehr individueller Umgang mit schwierigen<br />
Situationen sind entschei<strong>de</strong>nd da<strong>für</strong>, wie in <strong>de</strong>r Gegenwart und in Zukunft bestimmte<br />
Probleme gelöst wer<strong>de</strong>n und somit wichtig in <strong>de</strong>r Krisenbegleitung. Die Definition <strong>de</strong>s<br />
Problems und auch <strong>de</strong>r Problemlösung stammt dabei vom Bewohner selbst und nicht,<br />
wie im Falle <strong>de</strong>r Diagnosevergabe, von einem Fachmann.<br />
Kerstin Kempker beschreibt ihre eigene Erfahrung mit Diagnosen wie folgt:<br />
<strong>„</strong>Die Diagnose ist das Machtmittel <strong>de</strong>r Psychiatrie. Mit ihr än<strong>de</strong>rt sich schlagartig<br />
alles. Sie ist das Vergehen, <strong>für</strong> das mir meine Freiheiten entzogen wer<strong>de</strong>n, <strong>für</strong>sorglich<br />
und vorsorglich und nur zu meinem besten natürlich, <strong>für</strong> das ich eingesperrt,<br />
zwangsbehan<strong>de</strong>lt und geschockt wer<strong>de</strong>. Ohne Diagnose dürfte das keine mit mir<br />
tun. Das wäre Freiheitsberaubung, Körperverletzung und versuchter Totschlag. Mit<br />
<strong>de</strong>r Diagnose Schizophrenie o<strong>de</strong>r endogene Depression ist es ärztliche Heilkunst“<br />
( Kempker 1997, 69).<br />
Diese Meinung wird vom Team <strong>de</strong>s Weglaufhauses geteilt und entspricht <strong>de</strong>r antipsy-<br />
chiatrischen Grundhaltung <strong>de</strong>r Mitarbeiter. Diese ist neben <strong>de</strong>r eigenen Psychiatrie-<br />
<strong>Betroffenheit</strong> Teil <strong>de</strong>r internen Qualifikationskriterien <strong>für</strong> <strong>die</strong> Einstellung <strong>de</strong>r Mitarbeiter.<br />
Ebenso müssen <strong>die</strong> Mitarbeiter Sozialarbeiter sein. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong><br />
<strong>als</strong> Qualifikation <strong>de</strong>r Mitarbeiter wird unter 1.4 weiter ausgeführt.<br />
21
1.2. Geschichte<br />
Direktes Vorbild <strong>de</strong>s Weglaufhauses waren <strong>die</strong> holländischen Wegloophuizen. Als Re-<br />
aktion auf Menschenrechtsverletzungen in <strong>de</strong>r Psychiatrie (Zwangsbehandlung mit Psy-<br />
chopharmaka, Elektroschocks, Isolierzellen und an<strong>de</strong>res) wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong>se von <strong>de</strong>r psychi-<br />
atriekritischen und antipsychiatrischen Gekken-Bewegung 5 zusammen mit Nichtbetrof-<br />
fenen in <strong>de</strong>n 1970er Jahren gegrün<strong>de</strong>t. Sie setzten an einer Stelle an, wo Menschen be-<br />
reits in <strong>de</strong>r Psychiatrie waren und <strong>die</strong> psychiatrische Behandlung aufgrund ihrer<br />
schlechten Erfahrung ablehnten.<br />
Die Zustän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n psychiatrischen <strong>„</strong>Großanstalten“ waren dam<strong>als</strong> grauenerregend.<br />
Die <strong>„</strong>Verrückten“ lebten in <strong>de</strong>n Krankenhäusern oft mehrere Jahre und wur<strong>de</strong>n mehr<br />
verwahrt <strong>als</strong> behan<strong>de</strong>lt. Die wenigen angewandten Behandlungskonzepte waren sehr<br />
unwissenschaftlich, und eher <strong>als</strong> ein Versuch zu verstehen <strong>de</strong>r Ratlosigkeit zu entkom-<br />
men, mit <strong>de</strong>r sich <strong>die</strong> Mitarbeiter <strong>de</strong>r damaligen psychiatrischen Krankenhäuser kon-<br />
frontiert sahen.<br />
Abb.3: Ausschnitt aus <strong>de</strong>r Psychiatrie Enquete 1975, 64 6<br />
Darauf reagieren<strong>de</strong> theoretische Überlegungen von psychiatrischer und philosophischer<br />
Seite 7 , sowie <strong>die</strong> praktischen Umsetzungen <strong>de</strong>r <strong>„</strong>antipsychiatrischen I<strong>de</strong>e“ fin<strong>de</strong>n seit<br />
5 Psychiatriebetroffenen-Bewegung<br />
22
<strong>de</strong>n sechziger Jahren bereits in England (Kingsley Hall, R.D. Laing, D. Cooper, 1965 -<br />
1970), in Kalifornien (Soteria ,L. Mosher, 1973 - 1985) und in Italien (Psychiatrie-<br />
Reform; F. Basaglia, 1978) statt.<br />
Die Erkenntnisse <strong>die</strong>ser Psychiatriekritik flossen zusätzlich in <strong>die</strong> I<strong>de</strong>e und schließlich<br />
in <strong>die</strong> Umsetzung <strong>de</strong>s Berliner Weglaufhauses mit ein.<br />
Abb.4: v.li. Kingsley Hall und das Soteria Haus<br />
Auch in Deutschland organisierten sich bereits En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1960er Jahre Psychiatrie-<br />
Betroffene zeitgleich mit vielen an<strong>de</strong>ren emanzipatorischen Bewegungen 8 .<br />
Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre war in Berlin unter an<strong>de</strong>rem <strong>die</strong> Hausbesetzerszene sehr aktiv.<br />
Hier fan<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Psychiatrie-Betroffenen erneut Anknüpfungspunkte.<br />
So grün<strong>de</strong>te sich 1980 <strong>die</strong> Irren-Offensive. Diese besteht bis heute und versteht sich von<br />
Anfang an <strong>als</strong> eine Betroffenorganisation, <strong>die</strong> Selbsthilfe, Öffentlichkeitsarbeit und poli-<br />
tische Aktionen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Rechte von Psychiatrie-Betroffenen organisiert und Aufklärung<br />
über <strong>die</strong> Schädigungen durch Psychopharmaka betreibt. Außer<strong>de</strong>m unterstützen und<br />
beraten sie Betroffene in persönlichen sowie politischen Belangen (vgl.<br />
http://www.<strong>weglaufhaus</strong>.<strong>de</strong>/history.html).<br />
6 http://www.dgppn.<strong>de</strong>/enquete/enquete.htm<br />
7 Durch Michel Foucault (Philosoph und Psychologe) und Gilles Deleuze ( Philosoph)<br />
8 Frauenbewegung, Frie<strong>de</strong>nsbewegung, Stu<strong>de</strong>ntenbewegung usw.<br />
23
1982 bil<strong>de</strong>te sich aus Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Irren-Offensive und <strong>de</strong>s Beschwer<strong>de</strong>zentrums 9 <strong>die</strong><br />
Weglaufhausgruppe, <strong>die</strong> sich zur Aufgabe machte ein Haus nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländischen<br />
Wegloophuizen aufzubauen ( vgl. Stöckle 1983b, 25).<br />
Menschen, <strong>die</strong> sich in einer akuten Krisensituation befan<strong>de</strong>n, jedoch nicht psychiatrisch<br />
behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n wollten, hatten dam<strong>als</strong> keinen Zugang zu kompetenter Hilfe.<br />
Die bereits in <strong>de</strong>n 1970er Jahren entstan<strong>de</strong>nen Selbsthilfegruppen waren <strong>für</strong> viele Menschen,<br />
<strong>die</strong> nach einer nicht-psychiatrischen Alternative suchten, eine Möglichkeit ihr<br />
Leben und ihre Krisen in Begleitung einer <strong>die</strong>ser Gruppen zu meistern. Dies galt jedoch<br />
häufig nur <strong>für</strong> <strong>„</strong>kleinere“ Krisen, <strong>de</strong>nn eine kontinuierliche Begleitung, <strong>die</strong> gegebenenfalls<br />
notwendig war, konnte dort nicht gewährleistet wer<strong>de</strong>n. Es wur<strong>de</strong> dam<strong>als</strong> <strong>de</strong>utlich,<br />
dass reine Selbsthilfekonzepte nicht ausreichten, um <strong>die</strong>se Krisen aufzufangen. Es bestand<br />
<strong>als</strong>o eine Versorgungslücke, <strong>die</strong> es zu füllen galt.<br />
Das Weglaufhaus sollte <strong>de</strong>shalb ein Haus sein, in <strong>de</strong>m verrückte Zustän<strong>de</strong> ausgelebt<br />
wer<strong>de</strong>n durften. Die Bewohner sollten während ihres Aufenthaltes keinem psychiatrische<br />
Behandlungszwang unterliegen. Es sollte auch ein Platz sein, <strong>de</strong>r <strong>als</strong> Kontakt und-<br />
Kommunikationsstelle <strong>die</strong>nt.<br />
Die genauere Ausgestaltung <strong>die</strong>ses <strong>„</strong>Hauses“ und <strong>die</strong> Entwicklung eines durchsetzbaren<br />
Konzeptes war eine schwierige Aufgabe. Diesbezüglich gab es bereits 1983 sehr unterschiedliche<br />
Vorstellungen (vgl. Kempker 1998, 31). Der wohl größte Unterschied lag<br />
darin, dass <strong>die</strong> Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Irren-Offensive eine staatliche Finanzierung, sowie <strong>die</strong><br />
Einbeziehung von Nicht-Betroffenen ablehnten, während ein an<strong>de</strong>rer Teil <strong>die</strong>s <strong>für</strong> erstrebenswert<br />
hielt. Diese Differenzen konnten nicht ausgeräumt wer<strong>de</strong>n und so kam es<br />
zu einer Spaltung <strong>de</strong>r Weglaufhausgruppe. Man könnte auch sagen zur Trennung von<br />
<strong>de</strong>r Irren-Offensive (vgl. Günther/Rohrmann 1999,75 ff).<br />
Als Folge darauf grün<strong>de</strong>te sich 1989 <strong>de</strong>r Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt<br />
e.V., welcher sich von Anfang an aus betroffenen und nicht betroffenen Mitglie<strong>de</strong>rn<br />
zusammensetzte. Dieser wur<strong>de</strong> später zum Trägerverein <strong>de</strong>s Weglaufhauses <strong>„</strong>Villa<br />
Stöckle“.<br />
Die vielfältigen Aktivitäten seiner Mitglie<strong>de</strong>r führten mit dazu, dass 1989 <strong>die</strong> Alternative<br />
Liste (AL) in <strong>de</strong>n rot-grünen Koalitionsvereinbarungen <strong>für</strong> das Land Berlin <strong>die</strong> I<strong>de</strong>e<br />
eines Weglaufhauses <strong>als</strong> politisches Ziel verankerte.<br />
Nach ersten ergebnislosen För<strong>de</strong>ranträgen wur<strong>de</strong> 1990 von privater Hand eine Million<br />
DM in Aussicht gestellt.<br />
9 Vorwiegend nicht-betroffene Psychologiestu<strong>de</strong>nten<br />
24
Noch im selben Jahr wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. in<br />
das Vereinsregister eingetragen und eine Villa am Stadtrand von Berlin gekauft.<br />
Durch Kontakte einzelner Vereinsaktiver wur<strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>r <strong>für</strong> ein international be-<br />
setztes, beraten<strong>de</strong>s Gremium gewonnen, <strong>die</strong> mit ihrem Namen <strong>für</strong> <strong>die</strong> I<strong>de</strong>e eines Weg-<br />
laufhauses einstan<strong>de</strong>n.<br />
Ein Beirat wur<strong>de</strong> gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ssen Mitglie<strong>de</strong>r in Berlin wohnten und <strong>de</strong>r in beson<strong>de</strong>rs<br />
schwierigen Situationen Hilfestellung bot.<br />
1990 gab <strong>die</strong> dam<strong>als</strong> verantwortliche SPD-Senatorin Ingrid Stahmer vor <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong>s-<br />
parlament eine politische Willenserklärung <strong>für</strong> ein Weglaufhaus ab, wodurch eine Pau-<br />
schalfinanzierung möglich erschien.<br />
Im Haushaltsentwurf <strong>de</strong>r Berliner Senatsverwaltung <strong>für</strong> Gesundheit wur<strong>de</strong> ein entspre-<br />
chen<strong>de</strong>r Antrag aufgenommen. Das Geld blieb jedoch gesperrt, da kurz vor <strong>de</strong>r ent-<br />
schei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Haushaltssitzung im Herbst 1990 <strong>die</strong> rot-grüne Koalition auseinan<strong>de</strong>r-<br />
brach.<br />
1991 erfolgte <strong>de</strong>r politische Machtwechsel. Eine Koalition aus CDU und SPD regierte<br />
nun <strong>die</strong> Stadt und bekun<strong>de</strong>te keinerlei Interesse mehr an <strong>de</strong>m Projekt.<br />
Nun wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Versuch unternommen, das Projekt mit Stiftungsmitteln und Spen<strong>de</strong>n<br />
frei zu finanzieren. Gedacht wur<strong>de</strong> an monatliche Einzelspen<strong>de</strong>n von Privatleuten, <strong>die</strong><br />
<strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Betrieb tragen sollten.<br />
Ein Darlehen vom Netzwerk Selbsthilfe e.V. ermöglichte das breit gestreute Versen<strong>de</strong>n<br />
eines Aufrufes an <strong>die</strong> potentiellen <strong>„</strong>Paten“. Ein Jahr später unterstützte ein För<strong>de</strong>rkreis<br />
von über 150 Personen <strong>die</strong> Vereinsarbeit mit monatlich knapp 5000 DM. Das war nicht<br />
genug Geld, um das Projekt zu betreiben, aber <strong>die</strong> Aufbauarbeit konnte beginnen.<br />
1992 erkannte das Finanzamt <strong>für</strong> Körperschaften <strong>die</strong> Gemeinnützigkeit <strong>de</strong>s Vereins an.<br />
Steigen<strong>de</strong> Akzeptanz in <strong>de</strong>r Fachöffentlichkeit wur<strong>de</strong> durch <strong>die</strong> Vorstellung <strong>de</strong>s Konzeptes<br />
in Publikationen und auf Tagungen erreicht.<br />
Eine Einzelspen<strong>de</strong> über 10.000 DM von <strong>de</strong>r Berliner Gesellschaft <strong>für</strong> Soziale Psychiatrie<br />
e.V. ging ein.<br />
Im Frühjahr 1992 entstan<strong>de</strong>n aus Gesprächen mit <strong>de</strong>r Berliner Gesellschaft <strong>für</strong> Soziale<br />
Psychiatrie, <strong>de</strong>m Paritätischen Wohlfahrtsverband und <strong>de</strong>r Berliner Ärztekammer neue<br />
I<strong>de</strong>en <strong>für</strong> <strong>die</strong> Finanzierung <strong>de</strong>s Weglaufhauses. Als Alternative zur pauschalen Zuwendungsfinanzierung<br />
wur<strong>de</strong> eine Tagessatzfinanzierung, wie sie <strong>für</strong> eine therapeutische<br />
Wohngemeinschaft o<strong>de</strong>r ein Heim angewen<strong>de</strong>t wird, in Erwägung gezogen.<br />
25
Eine bald wie<strong>de</strong>r fallen gelassene I<strong>de</strong>e bestand darin, <strong>die</strong> Krankenkassen in eine Mischfinanzierung<br />
einer <strong>„</strong>ausgelagerten häuslichen Pflege“ (§37 Sozialgesetzbuch V) o<strong>de</strong>r<br />
einer Rehabilitationseinrichtung zusammen mit <strong>de</strong>n Sozialhilfeträgern einzubin<strong>de</strong>n.<br />
Schließlich konzentrierten sich <strong>die</strong> Überlegungen auf eine Kostensatzfinanzierung nach<br />
§39 BSHG (<strong>„</strong>Wie<strong>de</strong>reinglie<strong>de</strong>rung von Behin<strong>de</strong>rten“) o<strong>de</strong>r §72 (<strong>„</strong>Hilfe in beson<strong>de</strong>ren<br />
sozialen Schwierigkeiten“).<br />
Die Finanzierung sollte jetzt nicht mehr über <strong>die</strong> Einrichtung, son<strong>de</strong>rn über <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Hilfesuchen<strong>de</strong>n erfolgen, <strong>de</strong>r einen im Bun<strong>de</strong>ssozialhilfegesetz geregelten Anspruch<br />
auf staatliche Unterstützung hat.<br />
Für <strong>de</strong>n Bezug auf §39 BSHG sprach, dass er in therapeutischen Wohngemeinschaften<br />
o<strong>de</strong>r Wohnheimen bereits Anwendung fand und dass <strong>de</strong>r relativ hohe Tagessatz eine<br />
ausreichen<strong>de</strong> Finanzierung bieten könnte. Als problematisch wur<strong>de</strong> <strong>die</strong> Zielgruppen<strong>de</strong>finition<br />
und das notwendige Begutachtungsverfahren angesehen. Auch hätte eine solche<br />
Einrichtung von <strong>de</strong>r Gesundheitsverwaltung konzessioniert wer<strong>de</strong>n müssen. Dies wur<strong>de</strong><br />
<strong>als</strong> unrealistisch eingeschätzt.<br />
Eine Finanzierung über <strong>de</strong>n §72 BSHG erschien praktikabeler. Da etliche Psychiatriebetroffene<br />
im Zuge längerer Klinikaufenthalte ihre Wohnung verlieren und wenn sie aus<br />
<strong>de</strong>r Psychiatrie <strong>„</strong>weglaufen“ erst einmal obdachlos sind, wür<strong>de</strong> sich <strong>die</strong>ser Paragraph<br />
da<strong>für</strong> eignen, einen großen Teil <strong>de</strong>r so genannten <strong>„</strong>Zielgruppe“ <strong>de</strong>r Psychiatriebetroffenen<br />
zu erreichen. Er regelt insbeson<strong>de</strong>re <strong>die</strong> Hilfen <strong>für</strong> Wohnungslose und Haftentlassene.<br />
Demnach haben sie Anspruch auf einen Wohnheimplatz, <strong>de</strong>ssen Kosten vom Sozialamt<br />
übernommen wer<strong>de</strong>n. Ein Wohnheim kann auch ein Weglaufhaus sein. Die Planer<br />
<strong>de</strong>s Weglaufhauses mussten sich dabei allerdings fragen, ob <strong>die</strong> konzeptionelle Beschränkung<br />
auf obdachlose Psychiatriebetroffene verantwortbar war und ob auf <strong>die</strong>se<br />
Weise genügend Mitarbeiter eingestellt wer<strong>de</strong>n konnten, um <strong>de</strong>n tatsächlichen Hilfebedarf<br />
zu <strong>de</strong>cken.<br />
Im Sommer 1992 kam es noch einmal zu Son<strong>die</strong>rungsgesprächen mit Mitarbeitern verschie<strong>de</strong>ner<br />
sozialpsychiatrischer Dienste und <strong>de</strong>m Koordinator <strong>de</strong>r Karl-Bonhoeffer-<br />
Nervenklinik. Doch auch jetzt war <strong>die</strong> Gesundheitsverwaltung nicht davon zu überzeugen,<br />
das Weglaufhaus aus <strong>de</strong>m Topf <strong>für</strong> das psychiatrische Netz zu finanzieren. Das<br />
Projekt galt <strong>als</strong> abgeschmettert. Ein Teil <strong>de</strong>r Fachöffentlichkeit war jedoch an einem<br />
Weglaufhaus interessiert, empfand <strong>de</strong>n Umgang <strong>de</strong>r Verwaltung mit <strong>de</strong>m Projekt <strong>als</strong><br />
unfair und bezog nun öffentlich Stellung.<br />
26
Nach<strong>de</strong>m <strong>die</strong> Weglaufhausgruppe <strong>als</strong>o 1987 ihren ersten Finanzierungsantrag an <strong>de</strong>n<br />
Berliner Senat stellte, sollte es wie bereits beschrieben noch fast zehn Jahre dauern, bis<br />
Neujahr 1996 <strong>de</strong>r Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. <strong>als</strong> Träger <strong>die</strong> erste<br />
öffentlich finanzierte, antipsychiatrische Zufluchtsstätte <strong>für</strong> Psychiatrie-Betroffene<br />
eröffnen konnte (vgl. Kempker 1998, 40ff.).<br />
2004 erhielt das Projekt <strong>de</strong>n "Ingeborg-Drewitz-Preis" 10 <strong>de</strong>r Humanistischen Union.<br />
Am 1.1.2006 feierte das Weglaufhaus 10-jähriges Bestehen. Seit Projektbeginn 1996<br />
lebten mehr <strong>als</strong> 700 Bewohner in <strong>de</strong>r Villa <strong>„</strong>Stöckle“.<br />
Das antipsychiatrische Angebot <strong>de</strong>s Weglaufhauses wird in Berlin durch Support- Ein-<br />
zelfallhilfe, Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener<br />
(BOPP&P) 11 , <strong>die</strong> Irren-Offensive 12 und Für alle Fälle e.V. 13 . ergänzt.<br />
Deutschlandweit haben sich in <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>die</strong> Weglaufhausinitiative Ruhrgebiet<br />
e.V. und <strong>die</strong> Weglaufhausinitiative Leipzig gegrün<strong>de</strong>t. Außer<strong>de</strong>m ist in Saarbrücken ein<br />
Weglaufhaus in Planung. Als bestehen<strong>de</strong>s Weglaufhaus ist <strong>die</strong> Villa <strong>„</strong>Stöckle“ allerdings<br />
<strong>de</strong>rzeit in Deutschland das einzige.<br />
1.3. Die Antipsychiatrie<br />
Abb. 5: v.li.o.: G. Deleuze, Basaglia, D.Cooper T. Szasz, M. Foucault, R.D. Laing, L. Mosher<br />
10 <strong>„</strong>Den Ingeborg-Drewitz-Preis vergibt <strong>die</strong> Bürger- und Menschenrechtsorganisation Humanistische<br />
Union in unregelmäßigen Abstän<strong>de</strong>n an Menschen, <strong>die</strong> sich in beson<strong>de</strong>rer Weise <strong>für</strong> <strong>die</strong> Menschenwür<strong>de</strong><br />
engagiert haben.“ (http://www.hu-bb.<strong>de</strong>/themen/ingeborg-drewitz-preis/in<strong>de</strong>x.html)<br />
11 Weitere Informationen dazu auf <strong>de</strong>r Homepage: http://www.bpe-online.<strong>de</strong>/bopp.htm<br />
12 Weitere Informationen dazu auf <strong>de</strong>r Homepage: http://www.psychiatrie-erfahrene.<strong>de</strong>/<br />
13 Weitere Informationen dazu auf <strong>de</strong>r Homepage: http://www.faelle.org/<br />
27
Grundlage <strong>de</strong>s Weglaufhaus und eigentlicher Ursprung ist <strong>die</strong> antipsychiatrische<br />
Grundhaltung. Diese ist sehr wichtig <strong>für</strong> das Gesamtangebot und häufig <strong>für</strong> Nutzer ein<br />
Kriterium bei <strong>de</strong>r Auswahl <strong>de</strong>r Einrichtung. Das Weglaufhaus – Konzept basiert einer-<br />
seits auf <strong>de</strong>n theoretischen Ansätzen <strong>de</strong>r Antipsychiatrie <strong>de</strong>r 1960er bis 1980er Jahre<br />
und an<strong>de</strong>rerseits auf neueren Positionen und Erfahrungen <strong>de</strong>r Psychiatrie-Betroffenenund<br />
Selbsthilfebewegung.<br />
Theoretisch befassten sich Thomas Szasz, Ronald D. Laing, F. Basaglia, L. Mosher und<br />
David Cooper mit <strong>de</strong>m Thema Psychiatrie/Antipsychiatrie. Sie lehnten vor allem <strong>die</strong><br />
Anerkennung <strong>de</strong>r Schizophrenie <strong>als</strong> Erkrankung ab (vgl. Cooper, 1971). Einen ähnlichen<br />
Ansatz vertrat auch <strong>de</strong>r französische Philosoph Michel Foucault (vgl. Foucault,<br />
2005). Da Schizophrenie zu jener Zeit in <strong>de</strong>n USA häufiger bei Angehörigen sozial benachteiligter<br />
Gesellschaftsgruppen, insbeson<strong>de</strong>re bei Schwarzen diagnostiziert wur<strong>de</strong>,<br />
fragte man sich, ob <strong>die</strong> psychiatrische Diagnose nicht möglicherweise <strong>als</strong> Mittel <strong>de</strong>r<br />
gesellschaftlichen Stigmatisierung 14 benutzt wur<strong>de</strong> (vgl. www.wikipedia.org/Antipsychiatrie).<br />
Anhänger <strong>de</strong>r Antipsychiatrie glaubten <strong>de</strong>shalb, <strong>die</strong> Psychiatrie sei dazu da, <strong>de</strong>n <strong>„</strong>Mächtigen“<br />
ihre Herrschaft und ihr Einkommen zu sichern. Die Antipsychiatrie stellte <strong>als</strong>o<br />
<strong>die</strong> Existenz geistiger Krankheiten in Frage und lehnte dabei <strong>die</strong> Definition psychischer<br />
Störungen <strong>als</strong> Erkrankung ab und betrachtete es <strong>als</strong> ein gesellschaftliches Phänomen,<br />
das von außen herbeigeführt wur<strong>de</strong>.<br />
Unabhängig davon, ob man nun psychiatrische Diagnosen sozial erklärt o<strong>de</strong>r nicht,<br />
kann man davon ausgehen, dass es im Falle psychischer Störungen wesentlich schwieriger<br />
ist, eine treffen<strong>de</strong> Diagnose zu stellen <strong>als</strong> bei körperlichen Erkrankungen. Die Gefahr<br />
einer f<strong>als</strong>chen Behandlung ist <strong>de</strong>mentsprechend größer.<br />
Heute kann <strong>die</strong> Antipsychiatrie nicht mehr <strong>als</strong> eine einheitlichen Bewegung gesehen<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Gemeinsamkeit besteht oft nur noch in <strong>de</strong>r Kritik <strong>de</strong>r <strong>„</strong>ursprünglichen“<br />
Psychiatrie. Ansonsten gibt es verschie<strong>de</strong>ne Ausprägungen kritischer Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>r Psychiatrie. Einerseits wer<strong>de</strong>n bestimmte Behandlungsformen und -<br />
maßnahmen in Frage gestellt und abgelehnt, an<strong>de</strong>rerseits besteht <strong>die</strong> Kritik in einer gesamtgesellschaftlichen,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> psychische Erkrankung in ihrer Existenz an sich ablehnt<br />
und <strong>die</strong>se <strong>als</strong> Symptom einer fehlerhaften Gesellschaft beschreibt.<br />
Antipsychiatrie be<strong>de</strong>utet <strong>für</strong> das Weglaufhaus, wie bereits in <strong>de</strong>r Projektvorstellung erwähnt,<br />
dass <strong>de</strong>r Schwerpunkt auf <strong>de</strong>r Selbstbestimmung von psychiatriebetroffenen<br />
28
Menschen liegt. Der Bewohner entschei<strong>de</strong>t und bestimmt <strong>de</strong>shalb selbst darüber, wie<br />
<strong>die</strong> Hilfe, <strong>die</strong> er im Weglaufhaus erfährt, aussieht.<br />
Die Bewohner wer<strong>de</strong>n in ihrer Selbstbestimmung ernst genommen und gelten nicht <strong>als</strong><br />
krank.<br />
<strong>„</strong>Eine <strong>de</strong>r zentralen antipsychiatrischen Positionen besteht in <strong>de</strong>r Überzeugung,<br />
dass es psychische Krankheit mit kategorisierbaren Ursachen, Verläufen und Prognosen<br />
nicht gibt und dass <strong>die</strong> Diagnostizierung einer solchen "Krankheit" zusätzliche<br />
Probleme erzeugt, statt bei <strong>de</strong>r Lösung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n zu helfen“ (Verein zum<br />
Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. 2001, 6).<br />
Die Vergabe von Diagnosen sowie <strong>de</strong>r Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt tra-<br />
gen zum ohnehin schon vorhan<strong>de</strong>nen Stigmatisierungsprozess bei. Die Krisenintervention<br />
setzt direkt bei <strong>de</strong>r speziellen Situation <strong>de</strong>s einzelnen Bewohners an und stellt sich<br />
individuell auf <strong>de</strong>ssen Hilfebedarf ein. Diese Art <strong>de</strong>r Arbeit ist nur möglich, wenn man<br />
<strong>de</strong>m Einzelnen unvoreingenommen begegnet. Das wie<strong>de</strong>rum wird ermöglicht durch <strong>die</strong><br />
Annahme <strong>de</strong>s krisenhaften Zustan<strong>de</strong>s <strong>als</strong> eine <strong>„</strong>normale“, wenn auch oft heftige Möglichkeit,<br />
sich einen Weg aus <strong>de</strong>r problembesetzten Lebenssituation zu bahnen.<br />
Zentral wird <strong>die</strong> Vergabe von Neuroleptika und an<strong>de</strong>ren Psychopharmaka sowie <strong>die</strong><br />
Anwendung von Elektroschocks kritisiert, insbeson<strong>de</strong>re wenn <strong>die</strong>se <strong>„</strong>Behandlung“ gegen<br />
<strong>de</strong>n ausdrücklichen Willen <strong>de</strong>r Betroffenen geschieht. Aus <strong>die</strong>ser Kritik ergibt sich<br />
im Weglaufhaus allerdings kein direkter Handlungsplan zur Ausgestaltung eines alternativen<br />
Ortes zur Bewältigung sozialer und psychischer Krisen. Die immer fortwähren<strong>de</strong><br />
Freiheit in <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Weglaufhauses ist bewusster Teil <strong>de</strong>s Konzeptes, da<br />
nur so <strong>die</strong> Mitarbeiter gemeinsam mit <strong>de</strong>n Bewohnern <strong>„</strong>(...) <strong>die</strong> Praxis einer antipsychi-<br />
atrischen Institution überhaupt erst hervorbringen, entwickeln und immer wie<strong>de</strong>r revi<strong>die</strong>ren“(<br />
Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. 2001, 7) können. Eine Institution,<br />
<strong>die</strong> vom strukturellen Aufbau <strong>de</strong>r Psychiatrie ähnelt, ihren theoretischen Bezugsrahmen<br />
allerdings mit an<strong>de</strong>ren Inhalten füllt, kann keine wirkliche Alternative bieten.<br />
1.4. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> im Weglaufhaus<br />
Es sollte ein gemischtes, bezahltes Team sein, welches im Weglaufhaus zusammenarbeitet.<br />
Die Fähigkeiten <strong>de</strong>r Betroffenen, <strong>die</strong> aus <strong>de</strong>r Selbsthilfe kamen, sollten durch <strong>die</strong><br />
<strong>de</strong>r Nichtbetroffenen ergänzt wer<strong>de</strong>n. Tina Stöckle, Mitbegrün<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>r Hausgruppe<br />
14 <strong>„</strong>Soziale Deklassierung, Isolation o<strong>de</strong>r sogar allgemeine Verachtung auf Grund eines physischen,<br />
psychischen o<strong>de</strong>r sozialen Merkm<strong>als</strong>, durch das sich <strong>die</strong> Person von allen übrigen Mitglie<strong>de</strong>rn einer<br />
Gruppe negativ unterschei<strong>de</strong>t“ (vgl. Hillmann 1994, 843).<br />
29
sagte 1983 dazu, dass <strong>die</strong> Mitarbeiter egal ob betroffen o<strong>de</strong>r nicht betroffen, eine be-<br />
stimmte Fähigkeit besitzen sollten, um im Weglaufhaus arbeiten zu können:<br />
<strong>„</strong>Die wesentliche Vorraussetzung da<strong>für</strong> ist, dass <strong>die</strong> Menschen Verständnis <strong>für</strong> ihre<br />
eigenen Probleme und eben <strong>für</strong> <strong>die</strong> Probleme <strong>de</strong>r Ver-rückten besitzen, dass sie da<br />
sein können, ohne <strong>de</strong>n Anspruch, <strong>de</strong>m Hilfesuchen<strong>de</strong>n etwas aufzuzwingen o<strong>de</strong>r<br />
aufzudrängen“ (Stöckle 1983 b, 31).<br />
Im Weglaufhaus arbeiten heute min<strong>de</strong>stens 50% selbstbetroffene Mitarbeiter. Das heißt,<br />
dass <strong>die</strong> Hälfte auf je<strong>de</strong>n Fall Psychiatrieerfahrung und damit psychiatrische Gewalter-<br />
fahrung in ihrem Leben gemacht haben. Diese Quotierung besteht seit <strong>de</strong>r Gründung<br />
<strong>de</strong>s Vereins zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt, <strong>de</strong>r sich ebenfalls aus betroffenen<br />
und nicht betroffenen Mitglie<strong>de</strong>rn zusammensetzt.<br />
Die eigene <strong>Betroffenheit</strong> stellt in <strong>die</strong>sem Zusammenhang eine zentrale interne Qualifikation<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Tätigkeit im Weglaufhaus dar. Dabei ist es wichtig, dass <strong>die</strong> erlebte Erfahrung<br />
ständig reflektiert wird. Diese Verarbeitung <strong>de</strong>r eigenen Geschichte und das<br />
Wissen darum, wie sich <strong>„</strong>Krise“ anfühlt bzw. bewältigt wer<strong>de</strong>n kann, kann dazu führen,<br />
im Weglaufhaus eine beson<strong>de</strong>re Art von <strong>„</strong>Verständnis <strong>für</strong> Verrücktheit“ zu fin<strong>de</strong>n. Das<br />
gilt allerdings auch <strong>für</strong> Menschen ohne Psychiatrie-, jedoch mit Krisenerfahrung. Hierbei<br />
kommt es nicht darauf an, welche Profession jemand hat. Das Verständnis resultiert<br />
aus <strong>de</strong>r eigenen Erfahrung und kann somit nicht erlernt wer<strong>de</strong>n (vgl. Verein zum Schutz<br />
vor psychiatrischer Gewalt e. V. 2001,7).<br />
Dazu gibt es Forschungsergebnisse über das Soteria-Projekt, <strong>die</strong> belegen, dass Menschen<br />
ohne psychiatrische Ausbildung sogar besser unterstützend tätig sein können <strong>als</strong><br />
<strong>die</strong> sogenannten professionellen Helfer. Dies bezieht sich auf <strong>die</strong> Unterstützung von<br />
Menschen in extremen psychischen Situationen. Sie sind dabei in <strong>de</strong>r Lage <strong>de</strong>n Menschen<br />
in seinem beson<strong>de</strong>ren sozialen Kontext wahrzunehmen und ihn dabei nicht <strong>als</strong><br />
<strong>„</strong>psychisch Kranken“ zu betrachten und können <strong>de</strong>shalb direkter, spontaner und flexibler<br />
auf <strong>die</strong> Situation reagieren (vgl. Mosher u.a. 1985, 105-122).<br />
Um in <strong>de</strong>r Außendarstellung klar zu sein und keine Hierarchie zwischen <strong>de</strong>n Mitarbeitern<br />
zu entwickeln, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Psychiatrieerfahrenen über <strong>de</strong>n <strong>„</strong>einfachen“ Professionellen<br />
stellt, hat sich <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Verein“ und somit auch das Weglaufhaus dazu entschlossen <strong>die</strong> <strong>Betroffenheit</strong><br />
nach außen zu anonymisieren.<br />
<strong>„</strong>Das be<strong>de</strong>utet <strong>für</strong> <strong>die</strong> Betroffenen, dass sie sich nicht direkt auf ihre persönlichen<br />
Psychiatrie-Erfahrungen berufen können, son<strong>de</strong>rn nur auf <strong>die</strong> verschie<strong>de</strong>nen Psychiatrie-Erfahrungen,<br />
<strong>die</strong> in <strong>de</strong>r Gruppe <strong>als</strong> ganzer präsent sind, auch auf <strong>die</strong> Gefahr<br />
hin, dass ihre Kompetenz – vielleicht gera<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Betroffenen –<br />
30
angezweifelt wird. Und das be<strong>de</strong>utet <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nichtbetroffenen, dass sie gezielt offen<br />
lassen müssen, ob sie nun selber in <strong>de</strong>r Psychiatrie waren o<strong>de</strong>r nicht – auch auf <strong>die</strong><br />
Gefahr hin, dass man sie <strong>für</strong> (ehemalige) Verrückte hält und dass sie nicht beschreiben<br />
können, wie sie ganz persönlich zu ihrer antipsychiatrischen Haltung gefun<strong>de</strong>n<br />
haben“ (von Trotha in Kempker 1998, 132).<br />
Intern ist bekannt, wer psychiatriebetroffen ist und wer nicht.<br />
Man kann <strong>als</strong>o zusammenfassend sagen, dass alle Mitarbeiter krisenerfahren, min<strong>de</strong>stens<br />
50% <strong>de</strong>r Mitarbeiter psychiatriebetroffen sind. Die antipsychiatrische Haltung, <strong>die</strong><br />
durch direkte o<strong>de</strong>r indirekte schlechte Erfahrungen mit <strong>de</strong>r Psychiatrie begrün<strong>de</strong>t ist, ist<br />
ebenfalls wichtig da<strong>für</strong>, <strong>de</strong>n Bewohnern <strong>de</strong>s Weglaufhauses das Gefühl geben zu können,<br />
sich in einem <strong>„</strong>psychiatriefreien“ Raum zu befin<strong>de</strong>n.<br />
Die existieren<strong>de</strong> Quote hat Einfluss auf <strong>die</strong> Arbeit im Weglaufhaus. Den Bewohnern ist<br />
bei <strong>de</strong>r Aufnahme nicht transparent, wer von <strong>de</strong>n Mitarbeitern betroffen ist und wer<br />
nicht. Erst durch <strong>die</strong> Nachfrage im Gespräch wird es offen. Diese Tatsache muss we<strong>de</strong>r<br />
schlechte noch gute Folgen haben, kann aber ein Grund da<strong>für</strong> sein, dass <strong>die</strong> <strong>Betroffenheit</strong><br />
<strong>de</strong>r Mitarbeiter im Weglaufhaus nicht so sehr wahrgenommen wird (siehe Befragung).<br />
Es spricht auch da<strong>für</strong>, dass es im Grun<strong>de</strong> darauf ankommt, wie <strong>die</strong> Haltung <strong>de</strong>r Einzelnen<br />
und ihre persönliche Offenheit und Akzeptanz verrückten Zustän<strong>de</strong>n gegenüber ist.<br />
1.5 Wie wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
vom Weglaufhaus umgesetzt?<br />
• Gewaltbegriff<br />
Die Bewohner <strong>de</strong>s Weglaufhauses wer<strong>de</strong>n dort <strong>als</strong> eigenmächtige, <strong>für</strong> sich selbst verantwortliche<br />
Menschen gesehen. Sie sind <strong>die</strong>jenigen, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Hilfeprozess steuern<br />
und gestalten. Der hier gewahrte Subjektstatus <strong>de</strong>s Bewohners wird von <strong>de</strong>n Mitarbeitern<br />
auch im Kontakt mit an<strong>de</strong>ren Institutionen unterstützt.<br />
Es wird offen über Gewalterfahrung gesprochen. Dies fin<strong>de</strong>t entwe<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Gruppe<br />
o<strong>de</strong>r in Einzelgesprächen statt. Sowohl zwischen <strong>de</strong>n Bewohnern <strong>als</strong> auch mit <strong>de</strong>n<br />
Mitarbeitern wer<strong>de</strong>n Themen wie Gewalt in <strong>de</strong>r Psychiatrie o<strong>de</strong>r häusliche Gewalt<br />
angesprochen und gegebenenfalls reflektiert.<br />
• Freiwilligkeit<br />
Die Aufnahme in das Weglaufhaus erfolgt ausnahmslos freiwillig. Es gibt oft Situationen,<br />
in <strong>de</strong>nen Angehörige o<strong>de</strong>r Sozialarbeiter aus an<strong>de</strong>ren Einrichtungen anrufen<br />
und nachfragen, ob ein Sohn, eine Tochter, ein Vater, Onkel o<strong>de</strong>r zum Beispiel ein<br />
31
Klient aufgenommen wer<strong>de</strong>n kann. In <strong>die</strong>sen Fällen wird von <strong>de</strong>n Mitarbeitern dar-<br />
auf verwiesen, dass ein Vorgespräch sowie eine eventuelle Aufnahme ausschließlich<br />
mit <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>n es selbst betrifft, vereinbart und besprochen wer<strong>de</strong>n kann. Das schließt<br />
nicht aus, dass allgemeine Informationen an <strong>die</strong>se Personen weitergegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Annahme <strong>de</strong>s Beratungsangebotes und <strong>de</strong>r Krisenintervention ist ebenfalls frei-<br />
willig. Im Weglaufhaus ist nahezu keine Struktur vorgegeben. Die Mahlzeiten, <strong>de</strong>r<br />
Tagesrhythmus sowie an<strong>de</strong>re Aktivitäten wer<strong>de</strong>n individuell von je<strong>de</strong>m Bewohner<br />
selbst gestaltet. Bis auf <strong>die</strong> zweimal pro Woche stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Hausversammlung und<br />
das Putzen am Wochenen<strong>de</strong> sind alle Aktivitäten freiwillig. Man kann sogar sagen,<br />
dass durch <strong>die</strong> generelle Zustimmung <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Hausordnung“ zu Beginn <strong>de</strong>s Aufenthaltes<br />
frei entschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n kann, ob man sich auf <strong>die</strong>se Pflichten einlässt o<strong>de</strong>r nicht.<br />
Teil <strong>de</strong>r Aufnahmevereinbarung ist <strong>die</strong> Mitwirkung gegenüber <strong>de</strong>n Leistungsträgern.<br />
• Menschenbild<br />
Das Menschenbild ist <strong>die</strong> Grundhaltung hinter <strong>de</strong>n Handlungen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Art und<br />
Weise, wie <strong>die</strong> Mitarbeiter ihre Arbeit und ihr Leben gestalten.<br />
Im Weglaufhaus herrscht <strong>die</strong>sbezüglich ein großer Respekt vor <strong>de</strong>r Vielseitigkeit <strong>de</strong>s<br />
Menschen. Grundsätzlich strebt je<strong>de</strong>r Mensch nach Entwicklung und Verwirklichung<br />
seiner selbst. Die Lebensentwürfe dazu sind sehr unterschiedlich.<br />
Diese individuelle Umgehensweise mit <strong>de</strong>m Leben und auch <strong>de</strong>n Problemen ist <strong>de</strong>n<br />
Mitarbeitern bewusst. Deshalb unterstützen sie <strong>die</strong> Bewohner und geben <strong>de</strong>ren eigenen<br />
I<strong>de</strong>en Raum, anstatt sich selbst reproduzieren zu wollen.<br />
Ich <strong>de</strong>nke etwas beson<strong>de</strong>res an <strong>die</strong>sem Menschenbild ist, dass <strong>die</strong> Norm, <strong>die</strong> ansonsten<br />
maßgeblich <strong>für</strong> <strong>die</strong> Lebensgestaltung vieler Menschen ist, hier kaum existiert. Es<br />
wird respektiert, dass je<strong>de</strong>r Bewohner seine eigene Norm entwickelt. Der gesellschaftlich<br />
existieren<strong>de</strong> Anpassungsdruck wird im Weglaufhaus sehr gering gehalten.<br />
Eine Ausgrenzung aufgrund ungewöhnlicher Verhaltensweisen ist selten. Trotz<strong>de</strong>m<br />
kommt es vor, dass genau <strong>die</strong>se Anpassungsansprüche im Raum stehen. Oft wer<strong>de</strong>n<br />
sie von Seiten <strong>de</strong>r Bewohnerinnen gefor<strong>de</strong>rt, <strong>die</strong> sich zum Beispiel von Verhaltensweisen<br />
an<strong>de</strong>rer Bewohner bedroht fühlen. In <strong>die</strong>sen Situationen ist es sehr wichtig,<br />
zwischen <strong>de</strong>m Schutz <strong>de</strong>s einen und <strong>de</strong>r Freiheit <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren ein ausgewogenes<br />
Verhältnis anzustreben.<br />
32
• Krisenbegriff<br />
Der vom betroffenenkontrollierten Ansatz vertretene Krisenbegriff stößt im Weg-<br />
laufhaus an bestimmte Grenzen in <strong>de</strong>r Umsetzung. Diese begrün<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r Art<br />
und Weise, wie extrem verrückte Situationen gelöst bzw. nicht gelöst wer<strong>de</strong>n können.<br />
Die Krisenbegleitung ist flexibel handhabbar und wird von je<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>rs gestaltet.<br />
Dies gilt sowohl <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bewohner wie auch <strong>für</strong> <strong>die</strong> Mitarbeiter. Dieser Umgang<br />
birgt <strong>die</strong> Gefahr, dass keine <strong>„</strong>klare Linie“ vorhan<strong>de</strong>n ist, an <strong>de</strong>r sich <strong>de</strong>r Bewohner<br />
orientieren könnte. In <strong>de</strong>r ohnehin oft sehr unsicheren Krisensituation könnte<br />
<strong>die</strong>se jedoch häufig gebraucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Es kommt vor, dass Bewohner das Weglaufhaus verlassen und in <strong>die</strong> Psychiatrie gehen,<br />
weil sie <strong>de</strong>nken, dort könne man ihnen evtl. besser helfen. Dass <strong>de</strong>rselbe Bewohner<br />
noch vor einigen Tagen gesagt hat, dass er nie wie<strong>de</strong>r in <strong>die</strong> Psychiatrie<br />
möchte, weil es dort so schrecklich war, <strong>de</strong>utet an, wie schwierig manche Situationen<br />
einzuschätzen sind. Die Entscheidung, wo und wie sich <strong>de</strong>rjenige helfen lassen<br />
will, liegt natürlich auch in <strong>die</strong>ser Situation beim Bewohner selbst. Es bleibt allerdings<br />
ein fa<strong>de</strong>r Nachgeschmack, wenn jemand aus <strong>de</strong>m Weglaufhaus in <strong>die</strong> Psychiatrie<br />
geht, wo <strong>de</strong>r Weg doch ursprünglich an<strong>de</strong>rsherum gedacht war.<br />
Das Krisenbegleitungskonzept ist <strong>als</strong>o nicht <strong>für</strong> je<strong>de</strong>s Bedürfnis geeignet. In beson<strong>de</strong>rs<br />
<strong>„</strong>haltlosen“ Situationen ist es unter Umstän<strong>de</strong>n schwer <strong>für</strong> <strong>die</strong> Mitarbeiter, <strong>die</strong><br />
Begleitung leisten zu können.<br />
Für viele an<strong>de</strong>re ist das Weglaufhaus <strong>de</strong>r Platz, wo sie zunächst zur Ruhe kommen<br />
können, um neue Kräfte zu sammeln und danach anfangen können, sich neu zu ordnen<br />
und zu organisieren. Ich habe von einigen Bewohnern gehört, dass sie im Weglaufhaus<br />
seit langem das erste Mal wie<strong>de</strong>r zu sich kommen konnten.<br />
• Parteilichkeit<br />
Die Mitarbeiter stehen auf <strong>de</strong>r Seite <strong>de</strong>r Bewohner, wenn es darum geht ihre Rechte<br />
zu vertreten, ihren Freiraum zu sichern, unabhängig zu bleiben und gesellschaftliche<br />
Verän<strong>de</strong>rungen zu bewirken.<br />
Dies geschieht auf <strong>de</strong>r persönlichen Ebene direkt im Weglaufhaus, in<strong>de</strong>m zum Beispiel<br />
Begleitungen zu Behör<strong>de</strong>n stattfin<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen häufig <strong>für</strong> <strong>die</strong> Rechte <strong>de</strong>r Bewohnerinnen<br />
gekämpft wer<strong>de</strong>n muss.<br />
Ebenso wird auf einer übergeordneten Ebene <strong>für</strong> <strong>die</strong> Öffentlichkeit <strong>de</strong>r Anliegen <strong>de</strong>r<br />
Psychiatriebetroffenen gesorgt. Dies geschieht in Form von Gremienarbeit. Ein-<br />
33
drücklich schil<strong>de</strong>rt dazu Iris Hölling ihre Zeit <strong>als</strong> Mitarbeiterin im Weglaufhaus, <strong>als</strong><br />
sie <strong>als</strong> Delegierte <strong>de</strong>s <strong>„</strong>Hauses“ in zahlreichen Gremien <strong>de</strong>s sozialpsychiatrischen<br />
Versorgungssystems saß. Sie fühlte sich im <strong>„</strong>Fein<strong>de</strong>sland“ und befand sich in stän-<br />
digem Wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>n Meinungen, <strong>die</strong> dort geäußert wur<strong>de</strong>n. Trotz<strong>de</strong>m hat ihre<br />
Präsenz <strong>de</strong>n dort Anwesen<strong>de</strong>n gezeigt, dass es noch an<strong>de</strong>re Möglichkeiten gibt, Men-<br />
schen in Problemsituationen zu begegnen und <strong>die</strong>se aufzufangen.<br />
Außer<strong>de</strong>m wird durch <strong>die</strong> Anwesenheit <strong>de</strong>r Weglaufhaus - Mitarbeiter in <strong>de</strong>n ver-<br />
schie<strong>de</strong>nen Gremien <strong>die</strong> Stimme <strong>de</strong>r Betroffenen laut. Diese Aufgabe übernehmen<br />
sowohl betroffene <strong>als</strong> auch nicht betroffene Mitarbeiter. Es geht in <strong>die</strong>sem Fall nicht<br />
nur darum sich selbst und <strong>die</strong> Einrichtung, son<strong>de</strong>rn vor allem <strong>die</strong> Nutzerinnen und<br />
Nutzer zu vertreten.<br />
• Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen<br />
Es besteht <strong>die</strong> Möglichkeit im Weglaufhaus <strong>als</strong> ehemaliger Nutzer zum Mitarbeiter<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Tatsächlich kam <strong>die</strong>ser Fall noch nicht vor.<br />
Die Bewohner <strong>de</strong>s Weglaufhauses haben das Recht an <strong>de</strong>n Teamsitzungen sowie <strong>de</strong>n<br />
hausinternen Übergaben <strong>de</strong>r Mitarbeiter teilzunehmen. Dies gilt allerdings nur <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Zeiten, in <strong>de</strong>nen es um ihre Belange geht. Dieses Angebot wird ab und zu in Anspruch<br />
genommen.<br />
• Selbsthilfe<br />
Das Weglaufhaus hat seine Wurzeln in <strong>de</strong>r Selbsthilfebewegung. Diese sind heute<br />
noch <strong>de</strong>utlich erkennbar. Das Haus selbst bietet viele Möglichkeiten <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bewohner,<br />
sich mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren zusammen zu schließen und sich gegenseitig in <strong>de</strong>r Krisenzeit<br />
zu unterstützen. Es kommt auch gelegentlich vor, dass mehrere Bewohner nach<br />
<strong>de</strong>m Aufenthalt gemeinsam in eine Wohnung ziehen o<strong>de</strong>r ansonsten befreun<strong>de</strong>t bleiben.<br />
Vom Weglaufhaus aus wer<strong>de</strong>n einige Bewohnerinnen in Selbsthilfegruppen vermittelt.<br />
• Umgang mit Hierarchien<br />
Das Weglaufhaus ist ein hierarchiearmer Raum. Die Entscheidungen wer<strong>de</strong>n horizontal<br />
und nicht vertikal getroffen.<br />
Natürlich gibt es ein gewisses Gefälle zwischen Mitarbeiter und Bewohner, da <strong>die</strong><br />
Mitarbeiter <strong>die</strong> Regeln <strong>de</strong>s Hauses aushan<strong>de</strong>ln und aufstellen und <strong>die</strong> Bewohner <strong>die</strong>se<br />
akzeptieren bzw. nach ihnen han<strong>de</strong>ln müssen. Die tatsächlichen Pflichten bestehen<br />
34
jedoch aus wenigen Punkten und <strong>die</strong> Infragestellung und Diskussion <strong>die</strong>ser ist je<strong>de</strong>r-<br />
zeit möglich. Die Bewohner können ihre Anliegen auf <strong>de</strong>r wöchentlich stattfin<strong>de</strong>n-<br />
<strong>de</strong>n Teamsitzung einbringen.<br />
• Einstellung von Betroffenen<br />
Tatsächlich arbeiten im Weglaufhaus knapp 50% fest angestellte betroffene Mitar-<br />
beiter. Sie haben alle <strong>die</strong> berufliche Qualifikation <strong>de</strong>s Sozialarbeiters.<br />
Viele <strong>de</strong>r Honorarkräfte sind betroffen.<br />
Wenn <strong>die</strong> Bewohner nicht im Gespräch fragen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rs erfahren, dass <strong>de</strong>r jewei-<br />
lige Mitarbeiter selbst in <strong>de</strong>r Psychiatrie war, besteht <strong>die</strong> Möglichkeit, dass es <strong>de</strong>n<br />
gesamten Aufenthalt über unkenntlich <strong>für</strong> sie bleibt.<br />
35
2. Wildwasser -<br />
Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e. V.<br />
�������������������<br />
���������������<br />
����������<br />
���������������<br />
Abb.6:Logo Wildwasser<br />
Wildwasser e.V.<br />
Verein und Geschäftsführung<br />
und Verwaltung<br />
Wriezener Strasse 10/11, 13359 Berlin<br />
Tel.: 030 – 48 22 82 32<br />
E-Mail: geschaeftsfuehrung@wildwasser-berlin.<strong>de</strong><br />
Homepage: www.wildwasser-berlin.<strong>de</strong><br />
2.1 Projektvorstellung<br />
Der Träger <strong>de</strong>s Projektes Wildwasser ist <strong>die</strong> Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen<br />
Missbrauch an Mädchen e.V..<br />
Der Verein hat sich in <strong>de</strong>n 23 Jahren seines Bestehens kontinuierlich entwickelt und<br />
seine Strukturen <strong>de</strong>n Entwicklungen angepasst.<br />
In <strong>de</strong>n ersten Jahren prägten <strong>die</strong> unbezahlten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen <strong>de</strong>r<br />
Selbsthilfe das Vereinsleben. Sie waren gleichzeitig Vereinsfrauen, stellten <strong>de</strong>n Vorstand<br />
und organisierten und erledigten auch <strong>die</strong> Verwaltungs- und Beratungsarbeit. Später<br />
war ein Koordinationsrat <strong>als</strong> geschäftsführen<strong>de</strong>s Gremium tätig. Nach langen Diskussionen<br />
wur<strong>de</strong> im Jahr 2001 <strong>die</strong> Entscheidung getroffen, <strong>die</strong> Strukturen grundlegend<br />
zu verän<strong>de</strong>rn.<br />
Die Anpassung <strong>de</strong>r Strukturen ist eine Entwicklung, <strong>die</strong> in vielen an<strong>de</strong>ren, aus <strong>de</strong>r<br />
Selbsthilfe und Selbstverwaltung kommen<strong>de</strong>n Betrieben und Zusammenhängen schon<br />
viel früher einsetzte. Da En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r achtziger Jahre <strong>die</strong> Selbsthilfeför<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>n Sozialetats<br />
<strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r zum festen Bestandteil gewor<strong>de</strong>n ist, waren alle in <strong>die</strong>sen Prozess<br />
involvierten Gruppen vor <strong>die</strong> Frage gestellt, wie sie es mit steuerlich absetzbaren<br />
Spen<strong>de</strong>ngel<strong>de</strong>rn und <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Staatsknete“ halten sollen. Einerseits wur<strong>de</strong> <strong>die</strong>ses Geld gebraucht,<br />
an<strong>de</strong>rerseits nahmen <strong>die</strong> Geldgeber so auf Struktur und Arbeitsweise Einfluss.<br />
36
Karl-Heinz Roth warnte schon 1980 vor <strong>de</strong>m Aufkommen einer neuen Führungsschicht<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Institutionalisierung <strong>de</strong>r Selbsthilfe und damit vor einer Rückkehr von<br />
Werten und Strukturen, gegen <strong>die</strong> man sich im eigenen Aufbruch gewandt hatte (vgl.<br />
Günther 1999, 25f.).<br />
Bei Wildwasser wur<strong>de</strong> <strong>die</strong>se Diskussion 2001 been<strong>de</strong>t und in <strong>de</strong>r Folge eine externe<br />
Geschäftsführerin eingestellt, <strong>die</strong> im Jahr 2002 ihre Arbeit aufnahm. Heute ist <strong>de</strong>r Verein<br />
<strong>„</strong>eine Art Dach“ <strong>für</strong> <strong>die</strong> verschie<strong>de</strong>nen Arbeits- und Projektbereiche (vgl. Wildwasser<br />
2003, 7).<br />
Die Mitfrauenversammlung ist, dam<strong>als</strong> wie heute, oberstes Organ <strong>de</strong>s Vereins. Neben<br />
vielen <strong>de</strong>r bei Wildwasser angestellten Frauen, arbeiten hier auch interessierte Frauen<br />
aus <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Projekten und Ämtern mit. Konzeptionelle Grundsätze und <strong>die</strong><br />
Zielsetzung <strong>de</strong>s Vereins wer<strong>de</strong>n hier entwickelt.<br />
Die Mitfrauenversammlung wählt <strong>de</strong>n Vorstand. Der Vorstand wählt <strong>die</strong> Geschäftführerin<br />
und arbeitet vertrauensvoll mit ihr zusammen.<br />
Die Team<strong>de</strong>legierten (TDT) stehen <strong>de</strong>r Geschäftsführung <strong>als</strong> beraten<strong>de</strong>s Gremium zur<br />
Seite und Verfügung. Je<strong>de</strong>s Team schickt eine Vertreterin zum Team<strong>de</strong>legiertentreffen.<br />
Alle zwei Wochen treffen sie sich und tauschen sich über neue Vorhaben, Verän<strong>de</strong>rungen,<br />
<strong>Weiterentwicklung</strong>en, Arbeitsweisen und Öffentlichkeitsarbeit aus. Auch wer<strong>de</strong>n<br />
hier <strong>die</strong> Aktivitäten <strong>de</strong>r einzelnen Bereiche koordiniert. Die Delegierten tragen <strong>die</strong> Diskussion<br />
und Ergebnisse zurück in <strong>die</strong> Teams. Das TDT wirkt <strong>als</strong>o in verschie<strong>de</strong>ne Richtungen.<br />
Zum einen verbin<strong>de</strong>t es <strong>die</strong> Geschäftsführung mit <strong>de</strong>n einzelnen Teams, aber<br />
auch <strong>die</strong> Teams mit <strong>de</strong>r Geschäftsführung und <strong>die</strong> verschie<strong>de</strong>nen Teams bleiben, vermittelt<br />
über ihre Delegierte, untereinan<strong>de</strong>r in Kontakt.<br />
Ein weiteres wichtiges Gremium ist das Plenum. Es ist ein Forum <strong>für</strong> themenzentrierte<br />
Diskussionen. Da hier auch interessierte Frauen aus an<strong>de</strong>ren Projekten und Bereichen<br />
teilnehmen können, wird dort oftm<strong>als</strong> <strong>de</strong>r eigene Horizont erweitert.<br />
Zu <strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>r Geschäftführung gehört <strong>die</strong> Außenvertretung sowie <strong>die</strong> Gremienund<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Einzelne festangestellte Vertreterinnen aus <strong>de</strong>n Teams unterstützen<br />
<strong>die</strong> Geschäftsführung in <strong>die</strong>sen Aufgaben und vertreten sie gegebenenfalls.<br />
Regionale und überregionale Vernetzungen und Kooperationen gehören zur täglichen<br />
Arbeit.<br />
37
Regional ist Wildwasser vernetzt mit:<br />
- AG § 78 KJHG Kreuzberg-Frie<strong>de</strong>richshain<br />
- U AG Krisen- und Not<strong>die</strong>nste Kreuzberg-Frie<strong>de</strong>richshain<br />
- AG <strong>de</strong>r Kriseneinrichtungen <strong>de</strong>r Senatsverwaltung <strong>für</strong> Bildung, Jugend und<br />
Sport<br />
- AK Frauenhan<strong>de</strong>l<br />
- AK Zwangsverheiratung<br />
- U AG <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sarbeitsgemeinschaft (LAG) §78 geschlechtsspezifische Mädchen-<br />
und Jungenarbeit<br />
- U AG <strong>de</strong>r LAG §78 Not- und Krisen<strong>die</strong>nste<br />
- AG §78 Mitte<br />
- U AG Beratungsstellen <strong>de</strong>r AG §78 Mitte<br />
- Kleine Fachrun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Projekte gegen sexuellen Missbrauch<br />
- Berliner Fachrun<strong>de</strong> gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Aktuelles<br />
Fachwissen – Vernetzung – Öffentlichkeit, arbeitet mit Unterstützung <strong>de</strong>r<br />
Senatsverwaltung <strong>für</strong> Bildung, Jugend und Sport<br />
- AG Opferschutz <strong>de</strong>r Fachrun<strong>de</strong><br />
- Berliner Frauen Netzwerk, Mitarbeit im Sprecherinnenrat<br />
- Frauenprojekteplenum <strong>de</strong>s Bezirksamtes Kreuzberg-Frie<strong>de</strong>richshain<br />
- Datenschutz AG<br />
- Fachgespräche über Maßnahmen zum Schutz (geistig) behin<strong>de</strong>rter Mädchen und<br />
jungen Frauen vor sexuellen Übergriffen in und außerhalb <strong>de</strong>r Familie bei <strong>de</strong>r<br />
Senatsverwaltung <strong>für</strong> Wirtschaft, Arbeit und Frauen<br />
- AG sexueller Missbrauch Bezirk Mitte<br />
- Fachgespräche zum Thema Beratung im Internet beim Lan<strong>de</strong>sjugendamt<br />
- BIG, Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt, Vorstandstätigkeit<br />
- Sputnik, Trägerverbund <strong>de</strong>r überregionalen, spezialisierten Kin<strong>de</strong>r- und Jugendhilfe<br />
in Berlin<br />
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPW) AK erzieherische Hilfen;<br />
Fachgruppe Jugendhilfe; Fachgruppe Familie, Frauen, Mädchen; Qualitätsgemeinschaft<br />
- DPW U AG Standardüberprüfung<br />
- Berliner Rechtshilfefonds<br />
- Tauwetter und Weglaufhaus im Rahmen <strong>de</strong>s Betroffenkontrollierten Ansatzes<br />
Überregional ist Wildwasser vernetzt mit:<br />
- Mädchen und Frauen (BAG)<br />
- Deutsche Gesellschaft gegen Kin<strong>de</strong>smissbrauch und –vernachlässigung<br />
(DGgKV)<br />
- Bun<strong>de</strong>sarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen sexuelle Gewalt an<br />
Bun<strong>de</strong>sverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.<br />
Wildwasser besteht heute aus fünf verschie<strong>de</strong>nen Einrichtungen:<br />
• Frauenselbsthilfe und Beratung<br />
Friesenstraße 6, 10965 Berlin<br />
Tel.: 030 – 69 39 192<br />
E-Mail: selbsthilfe@wildwasser-berlin.<strong>de</strong><br />
38
- Beratungen fin<strong>de</strong>n von Montags bis Freitags und nach Vereinbarung statt, es<br />
han<strong>de</strong>lt sich dabei um <strong>„</strong>face to face“-, Telefon- und Online-Beratungen<br />
- Offene und angeleitete Gruppen wer<strong>de</strong>n angeboten<br />
- etwa alle drei Monate wird eine neue Selbsthilfegruppe gegrün<strong>de</strong>t, zwei Mitar-<br />
beiterinnen geben beim ersten und dritten Treffen Erfahrungen weiter, bei späterem<br />
Bedarf sind Interventionen o<strong>de</strong>r auch ein spezieller Input möglich, einmal<br />
jährlich fin<strong>de</strong>t ein Forum aller existieren<strong>de</strong>n Selbsthilfegruppen statt, es <strong>die</strong>nt<br />
<strong>de</strong>m Austausch von Erfahrungen und Wünschen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Zukunft<br />
- wird durch Zuwendungen <strong>de</strong>r Senatsverwaltung <strong>für</strong> berufliche Bildung, Arbeit<br />
und Frauen finanziert, im Jahr 2002 waren das 139.080,- € (vgl. Wildwasser<br />
2003, 18)<br />
- das Team besteht aus drei festangestellten Frauen, <strong>die</strong> auf Teilzeitbasis arbeiten<br />
und zwei Teilzeit-Honorarkräften<br />
• Frauenla<strong>de</strong>n und Info-Café<br />
Friesenstraße 6, 10965 Berlin<br />
Tel.: 030 – 69 23 35 96<br />
E-Mail: selbsthilfeww@web.<strong>de</strong><br />
- <strong>de</strong>r La<strong>de</strong>n wird täglich von Selbsthilfegruppen genutzt<br />
- einmal in <strong>de</strong>r Woche, Dienstags <strong>für</strong> 2,5 Stun<strong>de</strong>n, fin<strong>de</strong>t ein offenes Treffen statt,<br />
zwei sogenannte La<strong>de</strong>nfrauen stehen <strong>als</strong> Ansprechpartnerin <strong>für</strong> <strong>die</strong> Besucherinnen<br />
zur Verfügung<br />
- Öffentlichkeitsarbeit wird organisiert<br />
- wird durch ehrenamtliche Arbeit getragen und durch Spen<strong>de</strong>n finanziert<br />
- das Team hat sechs feste Mitarbeiterinnen, davon ist eine Kontaktfrau <strong>de</strong>s Beratungsteams;<br />
auch Bewerberinnen nehmen gleichberechtigt am Team teil, zur<br />
Zeit sind es drei<br />
• FrauenNachtCafé<br />
Friesenstraße 6, 10965 Berlin<br />
Tel.: 030 – 61 62 09 70<br />
E-Mail: wiwa-frauenla<strong>de</strong>n-berlin@web.<strong>de</strong><br />
39
- einmal wöchentlich, von Samstag 18.00 bis Sonntagmorgen um 8.00 Uhr, sowie<br />
in Nächten, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Feiertagen vorangehen fin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>n Räumen <strong>de</strong>s Frauenla-<br />
<strong>de</strong>ns das FrauenNachtCafé statt<br />
- <strong>die</strong> nächtliche Krisenanlaufstelle richtet sich an alle Frauen, <strong>die</strong> sich in einer<br />
Krisensituation befin<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r das Kontakt- und Gesprächsangebot nutzen möchten<br />
- das zweijährige Mo<strong>de</strong>llprojekt wird durch <strong>die</strong> finanzielle Unterstützung <strong>de</strong>r Stiftung<br />
Deutsches Hilfswerk-ARD Fernsehlotterie <strong>„</strong>Ein Platz an <strong>de</strong>r Sonne“ geför<strong>de</strong>rt,<br />
20.000 € fehlen zur Kosten<strong>de</strong>ckung und müssen selbst aufgebracht wer<strong>de</strong>n<br />
- das eigenständige Team besteht aus vier Frauen, zwei von ihnen sind auf festen<br />
Teilzeitstellen, <strong>die</strong> an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n arbeiten auf <strong>de</strong>r Basis von Minijobs<br />
- alle drei Monate fin<strong>de</strong>t ein Gesamtteam statt, es nehmen alle Mitarbeiterinnen<br />
<strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe und Beratung, <strong>de</strong>s La<strong>de</strong>ns, <strong>de</strong>s FrauenNachtCafés und <strong>die</strong><br />
Geschäftführerin teil<br />
• Beratungsstelle <strong>für</strong> Mädchen und unterstützen<strong>de</strong> Personen<br />
Dircksenstraße 47, 10178 Berlin<br />
Tel.: 030 – 282 44 27<br />
E-Mail: dircksen@wildwasser-berlin.<strong>de</strong><br />
• Beratungsstelle <strong>für</strong> Mädchen und unterstützen<strong>de</strong> Personen<br />
Wriezener Strasse 10/11, 13359 Berlin<br />
Tel.: 030 – 48 62 82 34/35<br />
E-Mail: wriezener@wildwasser-berlin.<strong>de</strong><br />
- persönliche, telefonische, aufsuchen<strong>de</strong> und Online-Beratungen fin<strong>de</strong>n Montags<br />
bis Freitags bzw. nach Vereinbarung statt<br />
- beraten wer<strong>de</strong>n Mädchen und junge Frauen, <strong>die</strong> sexuelle Gewalt erlebt haben<br />
o<strong>de</strong>r sich davon bedroht fühlen, Mütter und an<strong>de</strong>re unterstützen<strong>de</strong> Personen sowie<br />
professionelle Helferinnen und Helfer<br />
- Gruppenangebote <strong>für</strong> Mädchen und Mütter wer<strong>de</strong>n gemacht<br />
- Begleitung bei Strafprozessen<br />
- in bei<strong>de</strong>n Teams arbeiten jeweils vier festangestellte Frauen, <strong>die</strong> auf Teilzeitbasis<br />
arbeiten<br />
- bei<strong>de</strong> Projekte wer<strong>de</strong>n durch Zuwendungen <strong>de</strong>s Senats <strong>für</strong> Schule, Jugend und<br />
Sport finanziert, im Jahr 2002 waren das 451.990,- € (vgl. Wildwasser 2003, 18)<br />
40
• Mädchennot<strong>die</strong>nst- Anlaufstelle und Krisenwohnung<br />
Obentrautstraße 53, 10963 Berlin<br />
Tel.: 030 – 21 00 39 90<br />
E-Mail: maedchennot<strong>die</strong>nst@wildwasser-<strong>de</strong><br />
- ist täglich Rund-um-<strong>die</strong>-Uhr geöffnet<br />
- übernimmt im Auftrag <strong>de</strong>r Berliner Jugendämter <strong>die</strong> Aufgabe <strong>de</strong>r Inobhutnahme<br />
von Mädchen gem. § 42 SGB VIII in Verbindung mit § 76 SGB VIII auf <strong>de</strong>r<br />
Grundlage <strong>de</strong>r Leistungsbeschreibung <strong>„</strong>Sozialpädagogische Krisenintervention /<br />
Inobhutnahme“<br />
- ist ein niedrigschwelliges Angebot <strong>für</strong> Mädchen in Krisensituationen<br />
- angeboten wird Beratung in <strong>de</strong>r da<strong>für</strong> vorgesehenen Anlaufstelle und kurzfristige<br />
Unterkunft in <strong>de</strong>r Krisenwohnung <strong>für</strong> bis zu 6 Wochen<br />
- das Unterbringungsangebot besteht aus <strong>de</strong>n Leistungsbausteinen<br />
■ Unterkunftsgewährung und pädagogische Betreuung<br />
■ Problemklärung und Ursachenanalyse mit Jugendlichen<br />
■ Ganzheitliche Problemklärung mit allen Beteiligten<br />
■ Perspektivklärung und Vorbereitung <strong>de</strong>r Entscheidung<br />
- außer<strong>de</strong>m gewährleistet <strong>de</strong>r Mädchennot<strong>die</strong>nst im Rahmen von ergänzen<strong>de</strong>n<br />
Leistungen <strong>die</strong> Rund-um-<strong>die</strong>-Uhr-Aufnahme, kurzzeitige Akutversorgung bzw.<br />
Soforthilfe und psychologische Leistungen<br />
- das Team besteht aus elf Frauen, davon sind sieben pädagogische Mitarbeiterinnen,<br />
zwei gehören zum Wirtschaftspersonal, eine ist psychologische Mitarbeiterin<br />
und eine ist mit Leitungs- und Koordinationsaufgaben betraut.<br />
Alle oben geschil<strong>de</strong>rten Angebote richten sich an <strong>als</strong>o Mädchen und erwachsenen Frauen,<br />
<strong>die</strong> <strong>als</strong> Mädchen o<strong>de</strong>r Jugendliche sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren bzw. sind,<br />
sowie an Angehörige, unterstützen<strong>de</strong> Personen und Professionelle.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n wird auf spezielle Angebote <strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe eingegangen, da <strong>die</strong>s<br />
<strong>de</strong>r Bereich von Wildwasser ist, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m Betroffenenkontrollierten Ansatz arbeitet.<br />
Dies ist auch <strong>de</strong>r Teil von Wildwasser, auf <strong>de</strong>n sich <strong>de</strong>r empirische Teil <strong>die</strong>ser Arbeit<br />
bezieht.<br />
Bei Wildwasser arbeiten ausschließlich Frauen, <strong>die</strong> sich <strong>für</strong> Mädchen und Frauen engagieren,<br />
<strong>die</strong> sexualisierte Gewalt erlebt haben.<br />
41
In <strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe und Beratung und <strong>de</strong>m Frauenla<strong>de</strong>n haben alle Mitarbeiterin-<br />
nen eigene sexuelle Gewalterfahrungen.<br />
2.1.1 Körperarbeit im Rahmen <strong>de</strong>r Wildwasser – Frauenselbsthilfe<br />
Die Wildwasser-Frauenselbsthilfe bietet in regelmäßigen Abstän<strong>de</strong>n Körperarbeit <strong>für</strong><br />
ihre Nutzerinnen an. Die im Betroffenenkontrollierten Ansatz vertretenen Grundhaltun-<br />
gen <strong>de</strong>finieren auch <strong>de</strong>n Rahmen <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Angebote zur Körperarbeit und Bewegung.<br />
Die Anleiterinnen <strong>de</strong>r Angebote verstehen sich in erster Linie <strong>als</strong> "Raumöffnerinnen".<br />
Das heißt, sie bieten konkrete Übungen an, jedoch bestimmt je<strong>de</strong> Frau <strong>für</strong> sich selbst,<br />
was und wie weit sie mitmacht. Natürlich ist <strong>die</strong>se Klarheit über <strong>die</strong> eigenen Grenzen<br />
<strong>de</strong>r "I<strong>de</strong>alfall". Die Gruppenzusammenhänge sind <strong>als</strong>o immer auch Lernfeld, <strong>die</strong> eigenen<br />
Grenzen zu fin<strong>de</strong>n, sie zu setzen o<strong>de</strong>r auch mal zu überschreiten.<br />
Eine <strong>de</strong>r Hauptmotivationen Körper- und Kreativangebote zu machen, liegt in <strong>de</strong>r eigenen<br />
Freu<strong>de</strong> an <strong>die</strong>ser Art <strong>de</strong>r Arbeit. Es wur<strong>de</strong> <strong>die</strong> Erfahrung gemacht, dass und wie<br />
<strong>die</strong>se kreativen Ebenen <strong>die</strong> persönliche <strong>Weiterentwicklung</strong> för<strong>de</strong>rn. Neue Lebenswelten<br />
können sich öffnen und dadurch neue Wahlmöglichkeiten im Verhalten ermöglichen.<br />
Bewegung kann auch <strong>de</strong>n Zugang zu <strong>de</strong>n eigenen Ressourcen erleichtern. Ein weiteres<br />
Ziel ist es, <strong>die</strong> vielseitigen Arbeitsmetho<strong>de</strong>n an <strong>die</strong> Nutzerinnen weiterzugeben, so dass<br />
sie <strong>die</strong>se auch selbstständig <strong>für</strong> sich o<strong>de</strong>r in einer Gruppe anwen<strong>de</strong>n können.<br />
Viele Frauen <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Angebote nutzen, haben <strong>die</strong> Erfahrung gemacht, dass es <strong>für</strong> sie<br />
im Vereinssport o<strong>de</strong>r in Kursen, wie sie von <strong>de</strong>n Volkshochschulen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Verbän<strong>de</strong>n<br />
angeboten wer<strong>de</strong>n, äußerst schwierig ist, <strong>die</strong> eigenen Grenzen zu fin<strong>de</strong>n. Die<br />
dortigen Anleiterinnen reagieren irritiert, wenn Übungen nicht, o<strong>de</strong>r nicht wie vorgegeben,<br />
ausgeführt wer<strong>de</strong>n. Für einen Teil <strong>de</strong>r Nutzerinnen stan<strong>de</strong>n bisher Ängste vor genau<br />
<strong>die</strong>sem Druck so sehr im Vor<strong>de</strong>rgrund, dass sie <strong>die</strong>se Angebote vermie<strong>de</strong>n haben.<br />
Wichtiger Inhalt <strong>de</strong>s Wildwasserangebots ist es, dass Frauen in <strong>de</strong>n Workshops o<strong>de</strong>r<br />
angeleiteten Gruppen <strong>die</strong> Übungen sich selbst entsprechend ausführen können. Es gibt<br />
kein vorgegebenes Schema. Je<strong>de</strong> Bewegungsart und -weise hat ihre Berechtigung. Körperarbeit<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Selbsthilfe wird stark nachgefragt und angenommen.<br />
42
2.1.2 Konkrete Angebote zur Körperarbeit bzw. kreative Arbeitsmetho<strong>de</strong>n und Be-<br />
ratung<br />
Workshops: Selbsthilfegruppen, <strong>die</strong> schon über einen Zeitraum zusammenarbeiten und<br />
sich <strong>als</strong> Gruppe bereits konstituiert haben, wer<strong>de</strong>n Workshops angeboten. Ausgerichtet<br />
auf <strong>die</strong> Bedürfnisse <strong>de</strong>r jeweiligen Gruppe, leiten min<strong>de</strong>stens zwei Mitarbeiterinnen<br />
über 3–5 Aben<strong>de</strong> <strong>die</strong> Gruppe an. In <strong>die</strong>sem Rahmen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Frauen verschie<strong>de</strong>nste<br />
Körperarbeitsmetho<strong>de</strong>n und kreative Ansätze vorgestellt. Den Gruppenteilnehmerinnen<br />
wird auch <strong>die</strong> selbstständige Anwendung und Umsetzung im Gruppengeschehen vermittelt.<br />
Themenfrühstück: Einmal monatlich wer<strong>de</strong>n offene Themenfrühstücke <strong>für</strong> alle Nutzerinnen<br />
angeboten. Es können <strong>als</strong>o Frauen, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n Frauenla<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Beratung o<strong>de</strong>r<br />
ein an<strong>de</strong>res offenes Angebot nutzen, hinzu kommen. <strong>„</strong>In Kontakt mit mir und an<strong>de</strong>ren“<br />
o<strong>de</strong>r <strong>„</strong>Abschied und Neubeginn“ sind nur zwei beispielhafte Themen, unter <strong>de</strong>nen <strong>die</strong><br />
Treffen stattfin<strong>de</strong>n. Interessierte Frauen sind immer willkommen.<br />
Feste Gruppen: Einmal im Jahr wird eine feste Gruppe mit thematischen Schwerpunkten<br />
angeleitet. Es können zehn bis zwölf Frauen teilnehmen. Die Teilnahme ist verbindlich<br />
und erstreckt sich über zehn bis fünfzehn Termine. Es können 10- 12 Frauen teilnehmen.<br />
Themen in <strong>de</strong>r Vergangenheit waren <strong>„</strong>Meine Herkunftsfamilie“, <strong>„</strong>Die eigene<br />
Sexualität“ o<strong>de</strong>r <strong>„</strong>Körperreise zu mir selbst“.<br />
Beratungsarbeit: Nutzerinnen können das Angebot <strong>de</strong>r Beratung, je nach Notwendigkeit,<br />
bis zu 10 Mal nutzen. Auch im Rahmen <strong>die</strong>ser Beratungsreihen wird bei Bedarf<br />
Körperwahrnehmung, Körperübungen und auch Malen angeboten.<br />
2.1.3 Beispielhafte Kurzdarstellung zweier angewandter Metho<strong>de</strong>n<br />
Blitzlichtrun<strong>de</strong>n sind ein fester Bestandteil <strong>de</strong>r Gruppenstruktur.<br />
Anfangsblitzlicht: Diese Run<strong>de</strong> bietet je<strong>de</strong>r Frau <strong>die</strong> Möglichkeit ein momentanes<br />
Stimmungs- und Zustandsbild von sich selbst zu verbalisieren. Je<strong>de</strong> Frau sollte sich so<br />
kurz und knapp wie möglich bzw. nötig halten. Es gibt <strong>die</strong> Möglichkeit, <strong>die</strong>se Run<strong>de</strong>n<br />
durch einen festgelegten Zeitrahmen zu regulieren. Ebenfalls wird keine Frau bzw. <strong>die</strong><br />
gesamte Run<strong>de</strong> durch nachfragen o<strong>de</strong>r Einwän<strong>de</strong> von Seiten <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Gruppenteilnehmerinnen<br />
unterbrochen.<br />
43
Body Mind Centering (BMC):<br />
BMC ist eine sanfte Körperarbeit, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n freien Bewegungsfluss för<strong>de</strong>rt. Wie in kaum<br />
einer an<strong>de</strong>ren Körperarbeit, wird im BMC <strong>de</strong>r erfahrungsbetonte Aspekt und das Zu-<br />
sammenspiel von physischer, seelischer und geistiger Wahrnehmung erforscht. Mit Hilfe<br />
von angeleiteten Bewegungsreisen wird aktiv <strong>die</strong> Bewusstheit in <strong>de</strong>n eigenen Körper<br />
vertieft. Dies geschieht durch <strong>die</strong> Visualisierung <strong>de</strong>r einzelnen Körpersysteme. Dabei<br />
verfeinern sich spürbar <strong>die</strong> Erlebnisfähigkeit und <strong>die</strong> Wahrnehmung <strong>für</strong> sich selbst <strong>als</strong><br />
körperliches Wesen und <strong>für</strong> an<strong>de</strong>re. Es gibt in <strong>de</strong>r Arbeit zwei Hauptaspekte. Der erste<br />
ist <strong>die</strong> Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>r Bewegungsentwicklung eines je<strong>de</strong>n Menschen.<br />
Kleinkin<strong>de</strong>r durchlaufen bestimmte Bewegungsmuster. Diese können durch angeleitete<br />
Übungen verfestigt, verfeinert o<strong>de</strong>r gar neu erfahren wer<strong>de</strong>n. Dadurch können mögliche<br />
Lücken im Bewegungsprozess geschlossen, sowie körperliche und emotionale Blocka<strong>de</strong>n<br />
gelöst wer<strong>de</strong>n. Der zweite Aspekt ist das Kennenlernen <strong>de</strong>r einzelnen Körpersysteme<br />
(wie z.B. das Knochengerüst, <strong>die</strong> Muskeln, Organe, Flüssigkeiten, usw.) und somit<br />
<strong>de</strong>s eigenen Körpers. Dadurch kann <strong>die</strong> Vielfalt <strong>de</strong>r Bewegungen erlebbar gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n, neue Bewegungen erlernt und eigene Ressourcen ent<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n. Auch bieten<br />
<strong>die</strong> einzelnen Körpersysteme Quellen <strong>für</strong> Verhaltensverän<strong>de</strong>rungen. So stehen zum Beispiel<br />
<strong>die</strong> Organe <strong>für</strong> <strong>die</strong> Tiefe <strong>de</strong>r Emotionen, das Erleben unseres Inneren, unsere Art<br />
Eindrücke aufzunehmen und zu verarbeiten. Die Visualisierung und dadurch das körperliche<br />
Erleben <strong>de</strong>s Knochengerüsts, lassen uns seine Stützfunktion erleben, wie auch<br />
Winkel und Hebelmöglichkeiten erkun<strong>de</strong>n. Die Energie <strong>de</strong>s Skeletts wird auch <strong>als</strong><br />
Klarheit und Geradlinigkeit erlebt. Durch aktive Kombination, beispielsweise mit <strong>de</strong>m<br />
Nervensystem, können so <strong>die</strong> Klarheit <strong>de</strong>s Verstan<strong>de</strong>s bzw. <strong>de</strong>r Gedanken erfahrbar<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. Beweglichkeit, Rhythmik und Flexibilität sind <strong>die</strong> Erlebniswelten <strong>de</strong>r<br />
Flüssigkeiten. In <strong>de</strong>r konkreten Arbeit wer<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem Anatomieanschauungen<br />
benutzt, um sich ein Bild <strong>de</strong>r inneren Strukturen zu machen, mit angeleiteten inneren<br />
Reisen können <strong>die</strong>se direkt erfahrbar gemacht wer<strong>de</strong>n (vgl.<br />
www.bodymindcentering.com).<br />
Neurolinguistisches-Programmieren (NLP):<br />
Alle Erfahrungen wer<strong>de</strong>n durch <strong>die</strong> fünf Sinne aufgenommen und von <strong>de</strong>n Nervenzellen<br />
an das Gehirn weitergeleitet. Alles Verhalten leitet sich aus neurologischen Prozessen<br />
ab.<br />
<strong>„</strong>Neuro“ steht in <strong>die</strong>sem Zusammenhang <strong>für</strong> <strong>die</strong> sensorische Wahrnehmung.<br />
44
<strong>„</strong>Linguistik“ steht da<strong>für</strong>, dass das Gehirn versucht, <strong>die</strong>se Erfahrungen zu erfassen, in<br />
Sprachmuster zu ko<strong>die</strong>ren und zu speichern. Wir benutzen Sprache um Erfahrungen,<br />
Gedanken und Verhalten zu organisieren, zu strukturieren und um mit an<strong>de</strong>rn zu<br />
kommunizieren.<br />
<strong>„</strong>Programmieren“ steht <strong>für</strong> <strong>die</strong> Möglichkeit, in <strong>die</strong> Auswahl, Entwicklung und <strong>die</strong> Speicherung<br />
von Denk- und Verhaltensgewohnheiten, <strong>die</strong> u.a. zu inneren Einstellungen und<br />
praktischen Han<strong>de</strong>ln führen, verän<strong>de</strong>rnd einzugreifen.<br />
NLP eine sehr lebendige, sehr kreative, sich beständig weiterentwickeln<strong>de</strong> Sichtweise<br />
und Methodik, um Menschen und ihre Kommunikation in <strong>de</strong>r Erreichung <strong>de</strong>s jeweils<br />
Gewünschten zu unterstützen.<br />
Für <strong>die</strong> konkrete Arbeit ist <strong>de</strong>r Zusammenhang zwischen physischen Abläufen und <strong>de</strong>r<br />
Kraft zur Imagination sehr wichtig. Gedanken und Emotionen können sich durch <strong>die</strong><br />
Bewegung <strong>de</strong>s Körpers verän<strong>de</strong>rn. Zielzustän<strong>de</strong> können <strong>„</strong>vorgestellt“ wer<strong>de</strong>n. So wird<br />
wahrnehmbar, was in <strong>de</strong>r Wunsch- o<strong>de</strong>r Zielsituation gefühlt, was gesehen o<strong>de</strong>r was<br />
gehört wird. Der Körper und <strong>die</strong> Psyche reagieren auf <strong>die</strong>se lebhaft Vorstellung ganz<br />
genau so, <strong>als</strong> ob wir <strong>die</strong> Situation real erleben (vgl. Krusche, 2005).<br />
Weitere Metho<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Anwendung fin<strong>de</strong>n, sind zum Beispiel das <strong>„</strong>Authentic Movement“<br />
und <strong>„</strong>Fantasiereisen“ o<strong>de</strong>r Malen.<br />
Abschlußblitzlicht:<br />
Diese Run<strong>de</strong> <strong>die</strong>nt dazu, ein abschließen<strong>de</strong>s Stimmungsbild zu äußern, ohne weiter darüber<br />
zu diskutieren.<br />
2.2. Geschichte<br />
Die Gründung <strong>de</strong>r ersten Selbsthilfegruppe gegen sexuellen Missbrauch in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik<br />
Deutschland fand in Berlin statt. Sie ist <strong>de</strong>r Initiative zweier Frauen zu verdanken.<br />
Bei<strong>de</strong> kamen von einem Auslandsaufenthalt in Großbritannien bzw. <strong>de</strong>n Vereinigten<br />
Staaten von Amerika mit <strong>de</strong>r Erfahrung zurück, <strong>„</strong>dass es dort Selbsthilfegruppen<br />
gibt, in <strong>de</strong>nen Frauen über ihre in <strong>de</strong>r Kindheit erlebten sexuellen Gewalterfahrungen<br />
sprechen können“ (Wildwasser e.V. (Hg.) 1993, 9).<br />
Es war eine befreien<strong>de</strong> Erfahrung, erlebten sie doch dort, dass sie <strong>die</strong> sexuelle Gewalterfahrung<br />
mit vielen an<strong>de</strong>ren Frauen und Mädchen teilen und nicht allein damit sind.<br />
<strong>„</strong>Es war auch und vor allem das Erleben <strong>de</strong>r Freiheit <strong>die</strong>ser Frauen, <strong>die</strong> über <strong>für</strong><br />
mich bis dahin Unaussprechliches sprachen. Es war das aufmerksame Zuhören, ihr<br />
Wissen um <strong>die</strong> eigene Geschichte, ihr offensichtlicher Mut und ihre Fähigkeit, ihr<br />
Leben in <strong>die</strong> Hand zu nehmen“ (Mebes 2003, Anhang 19).<br />
45
In <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland hatte zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt noch keine Frau <strong>die</strong> eige-<br />
ne Stimme öffentlich zum Thema <strong>de</strong>s sexuellen Missbrauchs erhoben. Den Begriff <strong>de</strong>s<br />
sexuellen Missbrauchs gab es noch nicht, wenn überhaupt, wur<strong>de</strong> hierzulan<strong>de</strong> über Inzest<br />
gesprochen. Gesellschaftlich wur<strong>de</strong> das Thema ignoriert und <strong>die</strong> Betroffenen weitgehend<br />
allein gelassen.<br />
So waren <strong>die</strong> Handlungen, <strong>die</strong> darauf zielten <strong>die</strong>se Situation zu verän<strong>de</strong>rn, eine Pionierleistung,<br />
von <strong>de</strong>r Birgit Rommelsbacher anlässlich <strong>de</strong>s zehnjährigen Bestehens von<br />
Wildwasser sagt :<br />
<strong>„</strong>Denn ich <strong>de</strong>nke, nur <strong>die</strong>ses persönliche Bekennen gab <strong>de</strong>m Anliegen das Gewicht<br />
von Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit, das in <strong>de</strong>r Lage war, <strong>die</strong> gewaltigen<br />
Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> zu brechen, (.....) und <strong>die</strong> ganze Gesellschaft anzuklagen“<br />
(Wildwasser e.V. (Hg.) 1993, 13).<br />
Auf <strong>de</strong>m Kongress zum zwanzigjährigen Bestehen von Wildwasser reflektiert Marion<br />
Mebes <strong>die</strong> Situation <strong>de</strong>r damaligen Zeit wie folgt: <strong>„</strong>Wir wollten einfach so sehr, dass<br />
unser Leben an<strong>de</strong>rs wird. Daraus zogen wir unseren Mut. Und da<strong>für</strong> waren wir bereit,<br />
Risiken einzugehen“ (Mebes, 2003, Anhang 20).<br />
Sie und Anne Voss wollten <strong>die</strong> <strong>für</strong> sich und an<strong>de</strong>re ent<strong>de</strong>ckte Möglichkeit hier ebenso<br />
Wirklichkeit wer<strong>de</strong>n lassen. Sie suchten und fan<strong>de</strong>n sich über Handzettel, <strong>die</strong> Marion<br />
Mebes in Buchlä<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Universität aufgehängt hatte. Das erste Treffen <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
fand im Winter 1982 in <strong>de</strong>r Potsdamer Strasse statt, schnell kamen an<strong>de</strong>re Frauen hinzu.<br />
Zu nennen wären hier Ingrid Lohstöter und Barbara Kavemann, <strong>die</strong> zu <strong>die</strong>ser Zeit eine<br />
Stu<strong>die</strong> im Rahmen <strong>de</strong>s Jugendhilfeberichtes <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bun<strong>de</strong>sregierung erstellten.<br />
Diese noch kleine Selbsthilfegruppe organisierte dann <strong>die</strong> erste öffentliche Veranstaltung<br />
zu <strong>die</strong>sem Thema. Das war im Mai <strong>de</strong>s folgen<strong>de</strong>n Jahres. Veranstaltungsort war<br />
<strong>de</strong>r Mehringhof und fast hun<strong>de</strong>rt Frauen fan<strong>de</strong>n sich ein.<br />
<strong>„</strong>Der innere Aufruhr ist mir heute wie eh und je ganz präsent: Angst, Hoffnung und<br />
sehr <strong>de</strong>utlich das Gefühl � es gibt keinen an<strong>de</strong>ren Weg. Wenn sich etwas än<strong>de</strong>rn<br />
soll, dann müssen wir an <strong>die</strong> Öffentlichkeit, müssen weiter gehen <strong>als</strong> bisher.<br />
Wir berichteten über unserer Erlebnissen, unsere Gruppe und was wir sie <strong>für</strong> uns<br />
be<strong>de</strong>utet. Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter ihrerseits berichteten von <strong>de</strong>n<br />
Ergebnissen ihrer Befragung, von Interviews und was sie in mühseliger Kleinarbeit<br />
an Information und Wissen zusammen getragen hatten.<br />
Als hätten sie nur darauf gewartet, endlich einen Rahmen zu haben, in <strong>de</strong>m sie<br />
selbst sprechen können.<br />
Denn das taten sie im Anschluss an unsere Vorträge.<br />
Sie stan<strong>de</strong>n auf mitten in <strong>die</strong>sem Saal voller Frauen und sagten: <strong>„</strong>Ich auch....“...<br />
und sicher erlebten sie <strong>de</strong>n gleichen inneren Aufruhr wie wir.<br />
Und das Gefühl <strong>de</strong>s Aufbruchs. Auch das ein bestimmen<strong>de</strong>s Gefühl zu <strong>die</strong>ser Zeit<br />
( Mebes, 2003, Anhang 20).<br />
46
Dieses Ereignis beschleunigte <strong>die</strong> Entwicklung. Noch im selben Monat wur<strong>de</strong> eine so-<br />
genannte Berufsgruppe gegrün<strong>de</strong>t. Hier fan<strong>de</strong>n sich Frauen zusammen, <strong>die</strong> durch ihre<br />
berufliche Tätigkeit in Kontakt mit Opfern sexueller Gewalt gekommen waren. Sie alle<br />
tauschten sich aus. Es wur<strong>de</strong> endlich über das bisher Unaussprechbare gesprochen.<br />
Heute kann festgestellt wer<strong>de</strong>n, dass sich in <strong>de</strong>r Gründung von Wildwasser e.V.<br />
<strong>„</strong>sowohl inhaltlich-konzeptionell wie auch personell zwei herausragen<strong>de</strong> Entwicklungen<br />
in <strong>de</strong>r BRD: <strong>die</strong> in <strong>de</strong>n siebziger Jahren entstan<strong>de</strong>ne Frauenbewegung, mit<br />
ihrem Einsatz <strong>für</strong> <strong>die</strong> Rechte <strong>de</strong>r Frauen, und das Auftreten von Frauen, <strong>die</strong> in ihrer<br />
Kindheit von sexualisierter Gewalt betroffen waren, mit ihren persönlichen Erfahrungen<br />
in <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Öffentlichkeit“ (Wildwasser, 2003, 9) trafen.<br />
Als Rahmen <strong>für</strong> <strong>die</strong> zukünftigen Aktivitäten wur<strong>de</strong> ein eingetragener Verein <strong>als</strong> geeig-<br />
net empfun<strong>de</strong>n und das Projekt erhielt <strong>de</strong>n Namen Wildwasser.<br />
Die folgen<strong>de</strong>n Überlegungen entschie<strong>de</strong>n <strong>die</strong>se Namenswahl.<br />
<strong>„</strong>Wasser <strong>als</strong> kräftiges Element, das seinen Weg bahnt – unter und über <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>.<br />
Wasser, das ruhig fließend Landschaften verän<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r wild schäumend<br />
Hin<strong>de</strong>rnisse überwin<strong>de</strong>t.<br />
Wasser <strong>als</strong> schillern<strong>de</strong> Inspiration.<br />
Wasser, das langsam tropfend selbst härteste Steine aushöhlt.<br />
Wasser, das <strong>die</strong> Schroffheit von Felsen in sanfte Rundungen verwan<strong>de</strong>ln kann.<br />
Wasser, das nährt und trägt“ (Mebes, 2003, Anhang 21).<br />
Im Oktober 1983 wird Wildwasser in das Vereinsregister eingetragen.<br />
Im August <strong>de</strong>s folgen<strong>de</strong>n Jahres wird <strong>de</strong>r Dokumentarfilm <strong>„</strong>Das schreckliche Geheim-<br />
nis <strong>„</strong> im WDR 1 und in <strong>de</strong>r ARD 2 ausgestrahlt.<br />
Die Wildwasser-Frauenselbsthilfe bezieht im Juni 1985 neue Räume in <strong>de</strong>r Holsteini-<br />
schen Strasse in Berlin Wilmersdorf und <strong>die</strong> Frauen eröffnen ihr neues Domizil mit ei-<br />
nen <strong>„</strong>Tag <strong>de</strong>r offenen Tür“. Schon Mitte <strong>de</strong>s gleichen Monats wird <strong>die</strong> Gemeinnützig-<br />
keit <strong>de</strong>s Vereins anerkannt.<br />
Die Aktivitäten <strong>die</strong>ser anfänglichen Phase waren davon bestimmt, sich mit an<strong>de</strong>ren be-<br />
troffenen und interessierten Frauen zusammen zu fin<strong>de</strong>n und Öffentlichkeit <strong>für</strong> das<br />
Thema herzustellen. Auch in Köln, Bremen, Hamburg und an<strong>de</strong>ren Städten griffen<br />
Frauen zur Selbsthilfe. Sie nannten sich <strong>„</strong>Zartbitter“, <strong>„</strong>Schattenriß“ und <strong>„</strong>Dolle Deerns“<br />
und brachten <strong>die</strong> sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen ins öffentliche Bewusstsein.<br />
1 Abkürzung <strong>für</strong> West Deutscher Rundfunk<br />
2 Arbeitsgemeinschaft <strong>de</strong>r öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland<br />
47
<strong>„</strong>Die Erkenntnis, dass es sich um alltägliche Erlebnisse von Kin<strong>de</strong>rn je<strong>de</strong>r Alterstufe<br />
und aus je<strong>de</strong>r sozialen Schicht han<strong>de</strong>lt, rief zunächst allgemeinen Unglauben,<br />
dann Ratlosigkeit und Bestürzung hervor“ (En<strong>de</strong>rs, Köln, 1995, 14).<br />
Im Oktober 1985 fand eine von Wildwasser-Berlin organisierte, bun<strong>de</strong>sweite Fachta-<br />
gung zum Thema <strong>„</strong>Sexueller Missbrauch, Strategien zur Befreiung“ in Berlin statt und<br />
eine Wildwasser-Selbsthilfegruppe trat einige Tage später im ZDF 3 in <strong>de</strong>r Reihe <strong>„</strong>Re-<br />
portage am Montag“ zum Thema Inzest auf.<br />
In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n zwei Jahren wer<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>r öffentlichen Einflussnahme vor allem<br />
praktische Hilfeleistungen organisiert und in Angriff genommen.<br />
Im Oktober 1987 wird <strong>die</strong> erste Wildwasser - Mädchenberatungstelle in Berlin Kreuz-<br />
berg eröffnet, <strong>die</strong> im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Mo<strong>de</strong>llphase wissenschaftlich<br />
begleitet wird. Finanziert wur<strong>de</strong> das Projekt vom Bun<strong>de</strong>sministerium <strong>für</strong> Frauen und<br />
Jugend.<br />
Eine Mädchenzufluchtswohnung kommt im September <strong>de</strong>s folgen<strong>de</strong>n Jahres dazu.<br />
Im März 1990 nehmen Frauen aus Selbsthilfegruppen im Frauenla<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Friesenstraße<br />
ihre Tätigkeit auf.<br />
Im April 1991 wird in Berlin Mitte eine zweite Mädchenberatungsstelle eröffnet. Die<br />
Mitarbeiterinnen <strong>de</strong>s Teams kommen alle aus <strong>de</strong>r ehemaligen Deutschen Demokratischen<br />
Republik.<br />
Von Mitte 1994 bis 1998 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Dircksenstrasse auch Frauen beraten.<br />
Im Februar 2001 schließt <strong>die</strong> Zufluchtswohnung <strong>für</strong> Mädchen und im März <strong>de</strong>s gleichen<br />
Jahres wird <strong>de</strong>r Mädchennot<strong>die</strong>nst eröffnet, <strong>de</strong>r heute noch besteht.<br />
Im Februar 2006 wur<strong>de</strong> das FrauenNachtCafé <strong>als</strong> nächtliche Krisenanlaufstelle eröffnet.<br />
2.3 Spezielle Grundsätze von Wildwasser<br />
Wildwasser arbeitet auf <strong>de</strong>r Grundlage eines feministischen Konzepts.<br />
Feminismus ist eine Bezeichnung <strong>„</strong><strong>für</strong> <strong>die</strong> Theorie und Lehre <strong>de</strong>r Frauenbewegung <strong>als</strong><br />
auch <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bewegung selbst“ (Brockhaus 7 1988, 188). Im engeren Sinne ist es <strong>die</strong><br />
Bezeichnung <strong>für</strong> <strong>die</strong> vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r amerikanischen Bürgerrechts- und westeuropäischen<br />
Stu<strong>de</strong>ntenbewegung En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r sechziger Jahre entstan<strong>de</strong>nen Neuen Frauenbewegung.<br />
Als <strong>de</strong>ren allgemeinstes Ziel wird <strong>„</strong><strong>die</strong> Abschaffung <strong>de</strong>r Frauenunterdrü-<br />
3 Zweites Deutsches Fernsehen<br />
48
ckung und eine von weibl. Einfluß geprägte, grundlegen<strong>de</strong> Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s gesellschaftl.<br />
Normen- und Wertesystems“ (ebd.) verstan<strong>de</strong>n.<br />
Wildwasser versteht unter Feminismus eine politische Haltung, <strong>die</strong> sich gegen strukturelle<br />
Gewalt und je<strong>de</strong> Form von Diskriminierung wen<strong>de</strong>t.<br />
Nach wie vor ist unsere Gesellschaft von patriarchalen Strukturen bestimmt. Verschie<strong>de</strong>ne<br />
Reformen haben zu Verbesserungen geführt, jedoch <strong>die</strong> geschlechtsspezifische<br />
Rollenverteilung und <strong>die</strong> dazugehören<strong>de</strong>n Machtverhältnisse nicht grundsätzlich verän<strong>de</strong>rt.<br />
Konstituieren<strong>de</strong>r Bestandteil unser Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems ist<br />
<strong>die</strong> strukturelle Diskriminierung von Frauen und Mädchen. Die Gleichberechtigung ist<br />
zwar gesetzlich verankert, aber von <strong>de</strong>r Umsetzung <strong>die</strong>ses Gleichheitsgrundsatzes ist<br />
unsere Gesellschaft nach wie vor weit entfernt.<br />
Feministische Arbeit fin<strong>de</strong>t auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Wissens über <strong>die</strong> konkreten Machtstrukturen<br />
in <strong>de</strong>r Gesellschaft und ihrer Auswirkungen auf <strong>die</strong> Lebensbedingungen <strong>de</strong>rer, <strong>die</strong> in<br />
<strong>die</strong>ser Hierarchie unten stehen, statt. Sie be<strong>de</strong>utet Einsatz <strong>für</strong> <strong>die</strong> Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
Machtstrukturen im Sinne einer gleichberechtigten Lebensweise <strong>de</strong>r Geschlechter.<br />
Eine feministische Haltung zeigt sich in <strong>de</strong>r persönlichen und fachlichen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>r Lebenssituation von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft. Der<br />
Fokus wird beson<strong>de</strong>rs auf <strong>de</strong>n Zusammenhang zwischen struktureller und spezifischer<br />
sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen gelegt.<br />
<strong>„</strong>Das politische Engagement von Wildwasser richtet sich darauf, sexualisierte Gewalt<br />
aus <strong>de</strong>m Stigma eines schrecklichen, <strong>„</strong>nur“ individuellen Schicks<strong>als</strong> herauszuholen,<br />
<strong>de</strong>ren gesellschaftliche Ursachen durch <strong>die</strong> ungleichen Machtverhältnisse<br />
aufzu<strong>de</strong>cken und sich <strong>für</strong> ihre Überwindung einzusetzen“ (Wildwasser 2003, 10).<br />
Feministische Arbeit be<strong>de</strong>utet somit auch Arbeit <strong>für</strong> Menschenrechte und Menschenwür<strong>de</strong>.<br />
Das Unterstützungsangebot ist parteilich, da es <strong>die</strong> Selbstbestimmung von Mädchen und<br />
Frauen in <strong>de</strong>n Mittelpunkt rückt und sich gegen <strong>die</strong> gesellschaftliche Toleranz von Gewalt<br />
stellt. Eine parteiliche Haltung beinhaltet auch das Wissen,<br />
<strong>„</strong>dass Neutralität und Unabhängigkeit von <strong>de</strong>r eigenen Klasse, ethischer Grundhaltung<br />
und ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter und persönlicher Geschichte<br />
nicht möglich sind und <strong>die</strong>se in <strong>de</strong>r Beratungs- und Betreuungsarbeit reflektiert<br />
wer<strong>de</strong>n müssen“ (Wildwasser 2003, 11).<br />
Parteiliches Arbeiten be<strong>de</strong>utet in <strong>de</strong>r Praxis, mit <strong>de</strong>n Betroffenen gemeinsam Perspektiven<br />
<strong>für</strong> ein eigenverantwortliches Han<strong>de</strong>ln in problematischen Strukturen zu entwickeln.<br />
Ziel und Tempo <strong>die</strong>ses Prozesses wird von <strong>de</strong>r hilfesuchen<strong>de</strong>n Frau bestimmt.<br />
49
Um Menschen verschie<strong>de</strong>ner Kulturen anzusprechen, und ihren kulturellen Kontext zu<br />
berücksichtigen, wer<strong>de</strong>n gezielt Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergrün<strong>de</strong>n<br />
eingestellt und <strong>die</strong> interkulturelle Kompetenz aller Mitarbeiterinnen geför<strong>de</strong>rt.<br />
Im Beratungs- und Betreuungsprozess be<strong>de</strong>utet <strong>die</strong>s, spezifische, kulturell bedingte<br />
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.<br />
Die Mädchen und Frauen wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong> Expertinnen ihrer Lebenssituation wahrgenommen,<br />
<strong>die</strong> ihr Leben aktiv gestalten können und damit auch dazu beitragen, strukturelle<br />
Gewalt zu durchschauen und zu verän<strong>de</strong>rn. Ihnen wird ein Schutzraum geboten, in <strong>de</strong>m<br />
ihnen mit Wertschätzung und Empathie begegnet wird und ihre Ressourcen zur Verän<strong>de</strong>rung<br />
wahrgenommen und respektiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Ziel <strong>de</strong>r Arbeit in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit ist letztlich <strong>die</strong> gesellschaftliche Ächtung von sexualisierter<br />
Gewalt und eine Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Umgangs mit <strong>die</strong>ser Gewalt.<br />
In <strong>de</strong>r Präventionsarbeit geht es um <strong>die</strong> Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung<br />
von Mädchen und Frauen, <strong>die</strong> sexualisierte Gewalt unter Umstän<strong>de</strong>n verhin<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r<br />
möglichst frühzeitig unterbrechen können.<br />
Zu<strong>de</strong>m wird Rollenstereotypen entgegen gewirkt, <strong>die</strong> Gewaltstrukturen perpetuieren.<br />
Das Ziel ist ein gleichberechtigtes, gewaltfreies Miteinan<strong>de</strong>r.<br />
2.4 Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> bei Wildwasser<br />
Wildwasser ist heute eine verzweigte Institution mit fünf verschie<strong>de</strong>nen Einrichtungen.<br />
Ein Hauptarbeitsfeld ist <strong>de</strong>r Mädchenbereich, mit <strong>de</strong>n zwei Mädchenberatungsstellen<br />
und <strong>de</strong>m Mädchennot<strong>die</strong>nst. Für <strong>die</strong> Arbeit in <strong>die</strong>sem Bereich wer<strong>de</strong>n sowohl von <strong>de</strong>n<br />
Zuwendungsgebern <strong>als</strong> auch von Wildwasser, vertreten durch <strong>die</strong> Geschäftsführung,<br />
unterschiedliche Qualifikationen verlangt. Dazu gehört <strong>die</strong> Ausbildung zur Erzieherin,<br />
Sozial-Pädagogin, Diplom-Pädagogin, Sozialarbeiterin und zur Psychologin. Zwar wird<br />
in allen Vorstellungsgesprächen <strong>die</strong> Motivation <strong>de</strong>r Bewerberinnen erfragt, so auch eine<br />
eventuelle <strong>Betroffenheit</strong>, aber sie ist in <strong>die</strong>sem Bereich kein Einstellungskriterium. Eher<br />
ist <strong>die</strong> Bereitschaft, sich <strong>„</strong>durch Fortbildungen und Teilnahme an Fachtagungen bezüg-<br />
lich <strong>de</strong>r neuesten Entwicklungen und professionellen Standards auf <strong>de</strong>m Laufen<strong>de</strong>n“<br />
(Wildwasser 2003, 23) zu halten, relevant. In <strong>die</strong>sem Arbeitsbereich wer<strong>de</strong>n Mädchen<br />
und junge Frauen beraten und begleitet, <strong>die</strong> we<strong>de</strong>r juristisch noch von ihrer altersgemäßen<br />
Entwicklung <strong>für</strong> sich selbst verantwortlich sind. Es han<strong>de</strong>lt sich um Kin<strong>de</strong>r, Jugendliche<br />
und junge Frauen.<br />
50
In <strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe ist <strong>die</strong> eigene <strong>Betroffenheit</strong> ein Einstellungskriterium. Da hier<br />
ausschließlich erwachsene Frauen beraten wer<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> <strong>für</strong> sich selbst verantwortlich<br />
sind, ist <strong>die</strong> Selbsthilfe ein möglicher Weg. Diese unterschiedlichen Arbeitsfel<strong>de</strong>r brin-<br />
gen auch unterschiedliche Arbeitshaltungen hervor. So arbeitet <strong>de</strong>r Mädchennot<strong>die</strong>nst<br />
mit Diagnosen, wie zum Beispiel <strong>de</strong>m Posttraumatischen Belastungssyndrom, während<br />
Diagnosen von <strong>de</strong>r Frauenselbsthilfe abgelehnt wer<strong>de</strong>n. Diese differenzierte Herange-<br />
hensweise wird durch <strong>die</strong> unterschiedliche Persönlichkeits- und Reifeentwicklung von<br />
Mädchen und Frauen begrün<strong>de</strong>t.<br />
Die internen Fachteams, Plena und an<strong>de</strong>re Weiterbildungsmaßnahmen sind <strong>de</strong>r Ort, an<br />
<strong>de</strong>m <strong>die</strong>se Unterschiedlichkeit thematisiert und diskutiert wer<strong>de</strong>n.<br />
2.5 Wie wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
von <strong>de</strong>r Wildwasser-Frauenselbsthilfe umgesetzt?<br />
• Gewaltbegriff<br />
In <strong>de</strong>r Beratungs- und Gruppenarbeit <strong>de</strong>r Selbsthilfe wird <strong>de</strong>n Nutzerinnen vom<br />
ersten Moment an <strong>de</strong>r Raum eröffnet, ihre Gewalterfahrung selbst zu <strong>de</strong>finieren,<br />
neue Erfahrungen zu machen und eigene Ziele zu bestimmen. Sie sind das Subjekt<br />
<strong>die</strong>ses Prozesses.<br />
Das be<strong>de</strong>utet im Beratungszusammenhang, dass durch offene Fragen sowie eine<br />
wertschätzen<strong>de</strong> und einfühlen<strong>de</strong> Haltung <strong>die</strong> Selbst<strong>de</strong>finition und -findung <strong>de</strong>r<br />
Nutzerinnen unterstützt wird. Die Ziele <strong>de</strong>r Beratung wer<strong>de</strong>n von ihnen selbstbestimmt<br />
und <strong>de</strong>ren mögliche Umsetzung mit <strong>de</strong>r Beraterin ausgehan<strong>de</strong>lt.<br />
Gruppenarbeit fin<strong>de</strong>t auf unterschiedlichen Ebenen statt. In <strong>de</strong>r offenen Gruppenarbeit,<br />
wie es zum Beispiel das monatlich stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Themenfrühstück ist,<br />
wird darauf geachtet, dass je<strong>de</strong> Frau, <strong>die</strong> das wünscht, zu Wort kommen kann<br />
und eigene Erfahrungen an<strong>de</strong>ren Frauen nicht <strong>als</strong> allgemeingültig übergestülpt<br />
wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r angeleiteten Gruppenarbeit wer<strong>de</strong>n Erwartungen <strong>für</strong> sich selbst<br />
und an an<strong>de</strong>re, Ängste in bezug auf das Gruppengeschehen besprochen, sowie<br />
<strong>die</strong> Arbeitsstrukturen <strong>de</strong>r Gruppe diskutiert und ausgehan<strong>de</strong>lt. Über <strong>de</strong>n Zusammenhang<br />
von individueller Gewalterfahrung und struktureller Gewalt wird<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Möglich- und Notwendigkeiten gesprochen.<br />
• Freiwilligkeit<br />
Die freiwillige Entscheidung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzung <strong>de</strong>r Angebote ist in allen Arbeitsbereichen<br />
<strong>de</strong>r Selbsthilfe Voraussetzung. Aushandlungsprozesse stehen im Vor-<br />
51
<strong>de</strong>rgrund. Die Verantwortung bleibt bei <strong>de</strong>n Nutzerinnen bzw. wird ihnen, wenn<br />
nötig, zurückgegeben.<br />
• Menschenbild<br />
Die in <strong>de</strong>r Selbsthilfe arbeiten<strong>de</strong>n Frauen kommen aus unterschiedlichen kulturellen<br />
Zusammenhängen, sind verschie<strong>de</strong>nen Alters, verfügen über vielfältigste<br />
Lebenserfahrungen, haben soziale Berufe o<strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>r Selbsthilfe professionalisiert.<br />
Zwei von ihnen sind von ehemaligen Nutzerinnen zu Mitarbeiterinnen<br />
gewor<strong>de</strong>n. Diese Unterschiedlichkeit wird respektiert und ist gleichzeitig ein<br />
reichhaltiges Reservoir von Erfahrungen. Hierin drückt sich das Menschenbild<br />
aus und es wird <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzerinnen in <strong>de</strong>n Begegnungen erfahrbar.<br />
• Krisenbegriff<br />
Da <strong>die</strong> Nutzerinnen nicht auf ihre Gewalterfahrungen reduziert wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn<br />
an Stärken und Ressourcen angeknüpft wird und wer<strong>de</strong>n kann, sind Defizite<br />
nicht mehr, <strong>als</strong> ein Teil <strong>de</strong>s Lebens. Es wird nicht mit Diagnosen gearbeitet.<br />
Statt<strong>de</strong>ssen wird versucht, an <strong>de</strong>n eigenen Erfahrungen anzuknüpfen.<br />
• Parteilichkeit<br />
Das Team arbeitet in verschie<strong>de</strong>nen Zusammenhängen wie <strong>de</strong>m Frauennetzwerk<br />
und <strong>de</strong>r Berliner Fachrun<strong>de</strong> gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen<br />
mit. Mit Tauwetter und <strong>de</strong>m Weglaufhaus besteht eine Kooperation im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes. Auf öffentlichen Veranstaltungen<br />
wird gegen sexualisierte Gewalt Position bezogen. In <strong>die</strong> Beratung und <strong>die</strong><br />
Gruppenarbeit wer<strong>de</strong>n gesellschaftliche Zusammenhänge mit einbezogen.<br />
• Selbsthilfe<br />
Der Selbsthilfeansatz ist in allen Arbeitsbereichen gegenwärtig. Die Verantwortung<br />
bleibt bei <strong>de</strong>n Nutzerinnen.<br />
• Umgang mit Hierarchien<br />
Dadurch, dass alle Mitarbeiterinnen <strong>de</strong>r Selbsthilfe sowohl beraten <strong>als</strong> auch in<br />
<strong>de</strong>r Gruppenarbeit tätig sind, gestalten sich <strong>die</strong> Verhältnisse hierarchiearm. Das<br />
monatliche Themenfrühstück wird von <strong>de</strong>n Mitarbeiterinnen lediglich vorbereitet<br />
und mo<strong>de</strong>riert, in <strong>de</strong>r Diskussion sind sie aber <strong>als</strong> Betroffene Teil <strong>de</strong>r Diskussion.<br />
Da <strong>die</strong> Beraterinnen auch im Frauenla<strong>de</strong>n mitarbeiten, sind sie auch hier<br />
<strong>als</strong> Betroffene präsent. Alle Nutzerinnen <strong>de</strong>r Beratung wissen, dass <strong>die</strong> Beraterinnen<br />
eigene Erfahrungen mit sexueller Gewalt haben und können, ebenso wie<br />
52
<strong>die</strong> Beraterinnen selbst, an <strong>die</strong>se Erfahrungen anknüpfen. Das Situative <strong>de</strong>r aktuellen<br />
Situation wird erfahrbar.<br />
• Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen<br />
Viele ehemalige Nutzerinnen sind heute Mitarbeiterinnen von Wildwasser. Lediglich<br />
<strong>die</strong> Inanspruchnahme <strong>de</strong>r Beratung schließt eine Nutzerin von <strong>de</strong>r Möglichkeit<br />
<strong>de</strong>r Mitarbeit aus, nicht jedoch <strong>die</strong> Mitarbeit in einer Selbsthilfegruppe.<br />
Ein Praktikum ist das Erprobungsfeld, in <strong>de</strong>m bei<strong>de</strong> Seiten feststellen können,<br />
ob eine Zusammenarbeit möglich ist.<br />
• Einstellung von Betroffenen<br />
Da <strong>de</strong>r Einstellung von Betroffenen oftm<strong>als</strong> Praktika vorausgehen, gibt es <strong>die</strong><br />
Möglichkeit, in <strong>die</strong>sem Rahmen <strong>die</strong> eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zur<br />
Geltung zu bringen und <strong>die</strong> Team-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten<br />
auszuprobieren und zu entwickeln. Nach <strong>die</strong>ser, unterschiedlich langen, Vorlaufphase<br />
wird dann über eine Einstellung entschie<strong>de</strong>n. Bewerberinnen mit zusätzlichen<br />
Qualifikationen im Sozialen Bereich durchlaufen ein reguläres Vorstellungsverfahren,<br />
dass sich von an<strong>de</strong>ren Bereichen nicht unterschei<strong>de</strong>t. Eine<br />
Probezeit schließt sich an.<br />
53
Teil III: Die Befragung <strong>de</strong>r Nutzer und Nutzerinnen<br />
1. Rahmenbedingungen <strong>de</strong>r Befragung<br />
1.1 Ziel <strong>de</strong>r Befragung<br />
<strong>„</strong>(…) <strong>die</strong>ses Forschungsprojekt hat (…) aufgezeigt, dass (…) Forschung auch ein<br />
Prozess ist, in <strong>de</strong>ssen Verlauf man lernt, wie und was man lernen soll. Dieser Prozess<br />
zeigt uns, welche Dinge zu lernen und zu verstehen relevant ist, wie man <strong>die</strong>ses<br />
Wissen und Verstehen erwirbt und wie man aufgrund <strong>die</strong>ses Wissens und Verstehens<br />
zu han<strong>de</strong>ln hat, um weiter zu lernen, was man <strong>als</strong> nächstes lernen soll(…)“<br />
(Friedlan<strong>de</strong>r 1972, 40f.).<br />
Hier fin<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Nutzerinnen <strong>de</strong>r bereits oben beschriebenen und Grundlage unserer Ar-<br />
beit bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Projekte Raum, sich zu äußern und aus ihrer Perspektive <strong>de</strong>n Stellenwert<br />
<strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> <strong>de</strong>r Mitarbeiter, ebenso wie <strong>die</strong> Rolle <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten<br />
Projekte im Gesamthilfesystem zu reflektieren.<br />
Der betroffenenkontrollierte Ansatz existiert nur in <strong>de</strong>n Berliner Projekten Tauwetter,<br />
Wildwasser und Weglaufhaus. Diese Form <strong>de</strong>r Arbeit von betroffenen Mitarbeitern<br />
kann <strong>als</strong>o nur hier reflektiert wer<strong>de</strong>n. Es gibt kaum veröffentlichte <strong>de</strong>utsche Stu<strong>die</strong>n, <strong>die</strong><br />
sich mit <strong>die</strong>sem Thema befassen.<br />
Unserer Fragestellung am nächsten kommt <strong>die</strong> Forschungsarbeit <strong>„</strong>Stellung nehmen“<br />
von Jasna Russo und Thomas Fink (vgl. Russo u.a. 2003). Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um<br />
eine Stu<strong>die</strong>, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Betroffenen selbst in <strong>de</strong>n Mittelpunkt rückt und an <strong>de</strong>r Forschung<br />
aktiv beteiligt. Unter an<strong>de</strong>rem wird zur Be<strong>de</strong>utung von Betroffenen in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
festgestellt:<br />
<strong>„</strong> Die meisten Stu<strong>die</strong>nteilnehmerInnen waren <strong>de</strong>r Meinung, dass eigene Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r MitarbeiterInnen mit Wohnungslosigkeit, Psychiatrie o<strong>de</strong>r Drogen/Alkohol<br />
eine wichtige Grundlage sind, um einen guten Zugang zu <strong>de</strong>n Betroffenen herzustellen.<br />
Für manche war <strong>die</strong>s eine Voraussetzung <strong>für</strong> ein glaubhaftes Gegenüber. Sie<br />
wünschen sich, dass verstärkt MitarbeiterInnen mit eigenen Erfahrungen in <strong>de</strong>n<br />
Einrichtungen arbeiten sollten“(Russo u.a. 2003, 74ff.).<br />
Die Stu<strong>die</strong>n von Carkhuff (1968), Karlsruher (1974) und Durlak (1979) zum Thema<br />
Laienkompetenz im psychosozialen Bereich können Anhaltspunkte liefern, sind aber<br />
nicht übertragbar, da <strong>de</strong>r Aspekt <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> keine Berücksichtigung fin<strong>de</strong>t (vgl.<br />
Müller-Kohlenberg, 1996, 13ff.).<br />
Die Meinung <strong>de</strong>r Nutzerinnen <strong>de</strong>r Projekte ist <strong>de</strong>shalb umso wichtiger. Weiterhin be<strong>de</strong>utend<br />
ist, dass sie a) <strong>als</strong> Experten ihrer eigenen Erfahrungen zu betrachten sind und b)<br />
ihre Zufrie<strong>de</strong>nheit Indikator <strong>für</strong> <strong>die</strong> Qualität <strong>de</strong>r angebotene Hilfeleistungen ist.<br />
54
Unsere Hypothese, dass <strong>Betroffenheit</strong> in und <strong>für</strong> <strong>die</strong> Soziale Arbeit eine Ressource dar-<br />
stellt, liegt <strong>de</strong>r Befragung zugrun<strong>de</strong>. Die verschie<strong>de</strong>nen Aspekte <strong>die</strong>ser Ressource tau-<br />
chen in <strong>de</strong>n einzelnen Fragen auf und sollen durch <strong>die</strong> konkrete Erfahrung <strong>de</strong>r Nutze-<br />
rinnen auf ihren Realitätsgehalt überprüft wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Ziel ist es, <strong>die</strong> Nutzerinnen, <strong>die</strong> Erfahrungen mit <strong>de</strong>n zu analysieren<strong>de</strong>n Projekten<br />
und häufig auch mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems gemacht haben, sowie in<br />
direkten Kontakt mit <strong>de</strong>n dortigen Mitarbeitern gekommen sind, beschreiben zu lassen,<br />
was <strong>für</strong> sie von Be<strong>de</strong>utung war, was sie an Erkenntnissen gewonnen haben und wie sie<br />
<strong>die</strong>se bewerten.<br />
Es wur<strong>de</strong>n jeweils fünf Nutzerinnen und Nutzer von Wildwasser und vom Weglaufhaus<br />
befragt. Ursprünglich wollten wir jeweils sechs Personen befragen. 1<br />
Maßgeblich da<strong>für</strong> war <strong>die</strong> tatsächliche Nutzung <strong>de</strong>r Projekte. Im Weglaufhaus fin<strong>de</strong>n<br />
maximal 13 Bewohner Aufnahme, <strong>die</strong> offenen Angebote von Wildwasser wer<strong>de</strong>n<br />
durchschnittlich von 12 Frauen genutzt.<br />
Um <strong>de</strong>n Vergleich zu ermöglichen reduzierten wir <strong>die</strong> Befragung auf fünf Interviews je<br />
Einrichtung. Somit ist <strong>de</strong>r Proporz weiterhin gewahrt und es können relevante Aussagen<br />
getroffen wer<strong>de</strong>n.<br />
1.2 Das <strong>„</strong>Forschungsteam“<br />
Die Interviews wur<strong>de</strong>n von uns durchgeführt. Im Weglaufhaus arbeiteten wir bei<strong>de</strong> im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Stu<strong>die</strong>npraktikums, bei<br />
Wildwasser ausschließlich Regina Nicolai.<br />
Dies hatte zur Folge, dass bei<strong>de</strong>n <strong>die</strong> zu<br />
befragen<strong>de</strong>n Personen bereits bekannt waren.<br />
Eine von uns hat eigene Erfahrung mit<br />
sexueller Gewalt. Keine von uns hat<br />
Psychiatrieerfahrung.<br />
Abb.: Ramona und Regina<br />
1.3 Die Auswahl <strong>de</strong>r Interviewpartnerinnen<br />
Die Interviewten sind alle entwe<strong>de</strong>r frühere o<strong>de</strong>r aktuelle Nutzerinnen <strong>de</strong>r Projekte<br />
Wildwasser und Weglaufhaus.<br />
1<br />
Kurzfristig hat uns ein Interviewpartner zum Weglaufhaus abgesagt und es war uns nicht möglich in <strong>de</strong>r<br />
gegebenen Zeit einen an<strong>de</strong>ren zu fin<strong>de</strong>n.<br />
55
Bei <strong>de</strong>n befragten Frauen von Wildwasser han<strong>de</strong>lt es sich um aktuelle Nutzerinnen <strong>de</strong>s<br />
Frauenla<strong>de</strong>ns, bei <strong>de</strong>n Männern und Frauen, <strong>die</strong> zum Weglaufhaus befragt wur<strong>de</strong>n, aus-<br />
schließlich um ehemalige Nutzer.<br />
Der Wildwasser-Frauenla<strong>de</strong>n ist eine Einrichtung, <strong>die</strong> von <strong>de</strong>n meisten dort existieren-<br />
<strong>de</strong>n Selbsthilfegruppen zum Thema sexuelle Gewalt einmal wöchentlich <strong>für</strong> mehrere<br />
Stun<strong>de</strong>n genutzt wird. Ebenso fin<strong>de</strong>t einmal wöchentlich ein offenes Treffen statt, sowie<br />
einmal im Monat ein Themenfrühstück, an <strong>de</strong>m interessierte Frauen teilnehmen können.<br />
Es wur<strong>de</strong>n Frauen befragt, <strong>die</strong> eines o<strong>de</strong>r mehrere <strong>die</strong>ser Angebote nutzen. Sie befin<strong>de</strong>n<br />
sich in unterschiedlichen Phasen <strong>de</strong>r Aufarbeitung ihrer sexuellen Gewalterfahrung, <strong>de</strong>r<br />
Kontakt zu Wildwasser ist in ihren Alltag integriert.<br />
Die Interviewpartnerinnen wur<strong>de</strong>n per Aushang gesucht, und mussten selbst Verbindung<br />
aufnehmen. Diesen Weg haben wir gewählt, um <strong>de</strong>n Frauen eine freie Entscheidung<br />
zu ermöglichen. Wir gingen davon aus, dass sich so nur Frauen mel<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>n,<br />
<strong>die</strong> sich <strong>de</strong>r Beantwortung <strong>de</strong>r Fragen gewachsen fühlen.<br />
Da eine von uns ehrenamtlich im Frauenla<strong>de</strong>n arbeitet, übernahm <strong>die</strong> an<strong>de</strong>re Kontakt<br />
und Interviewführung, um eine mögliche Beeinflussung <strong>de</strong>r Interviewpartnerinnen<br />
durch Rollenvermischung zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
Beim Weglaufhaus han<strong>de</strong>lt es sich um eine stationäre Kriseneinrichtung, in <strong>de</strong>r Erwachsene<br />
in akuten Krisen rund um <strong>die</strong> Uhr begleitet wer<strong>de</strong>n. Die Verbindung von Krise und<br />
<strong>de</strong>m permanenten Aufenthalt in <strong>de</strong>r Einrichtung lassen eine Reflektion schwer zu. Deshalb<br />
haben wir uns entschlossen, ehemalige Bewohner <strong>de</strong>s Weglaufhauses zu befragen<br />
und <strong>de</strong>n Schwerpunkt auf solche gelegt, <strong>de</strong>ren Aufenthalt nicht länger <strong>als</strong> ein Jahr zurück<br />
lag.<br />
Dadurch, dass durch <strong>die</strong> Praktika weiterhin Kontakte zu ehemaligen Bewohnern bestan<strong>de</strong>n,<br />
konnten <strong>die</strong>se angesprochen wer<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m feierte das Weglaufhaus zehnjähriges<br />
Bestehen mit einer großen Party, auf <strong>de</strong>r wir einen Ehemaligen ansprechen<br />
konnten. Es hat sich auch gezeigt, dass existieren<strong>de</strong> Vertrauensverhältnisse <strong>die</strong> Entscheidung,<br />
unseren Fragebogen zu beantworten, begünstigten.<br />
Wir haben Wert darauf gelegt, sowohl Frauen <strong>als</strong> auch Männer in einem ausgewogenen<br />
Verhältnis zu interviewen, um geschlechtsspezifischen Sichtweisen Raum zu geben.<br />
1.4 Die Form <strong>de</strong>r Befragung<br />
Die Befragung fand mittels Fragebogen statt, <strong>de</strong>r zum größten Teil in face-to-face Interviews<br />
abgefragt wur<strong>de</strong>, um zu vermei<strong>de</strong>n, dass Fragen nicht verstan<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>shalb<br />
nicht beantwortet wer<strong>de</strong>n können.<br />
56
Wir haben <strong>de</strong>n Befragten <strong>die</strong> Möglichkeit eröffnet, <strong>de</strong>n Fragebogen selbst auszufüllen.<br />
Dies wur<strong>de</strong> von Einzelnen genutzt. Hintergrund <strong>die</strong>ses Angebots war <strong>die</strong> Annahme,<br />
dass <strong>die</strong> Aufzeichnung <strong>de</strong>s Gesagten durch <strong>die</strong> Interviewerinnen bereits sprachliche<br />
Verän<strong>de</strong>rungen beinhaltet.<br />
Die Befragung fand wahlweise in <strong>de</strong>r eigenen Wohnung <strong>de</strong>r Befragten o<strong>de</strong>r an einem<br />
neutralen Ort statt. Die Wahl wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Interviewpartnerinnen getroffen. So sahen<br />
wir <strong>die</strong> Ungestörtheit und Vertrautheit am besten gewahrt. Die Interviewtermine wur<strong>de</strong>n<br />
flexibel gestaltet und gemeinsam bestimmt. Die Interviews zu Wildwasser dauerten cir-<br />
ca. eineinhalb, <strong>die</strong> zum Weglaufhaus circa zweieinhalb Stun<strong>de</strong>n. Innerhalb <strong>die</strong>ser Zeit<br />
wur<strong>de</strong>n von uns auch Begriffs<strong>de</strong>finitionen gegeben, sowie Unklarheiten, <strong>die</strong> Fragen<br />
betreffend, ausgeräumt.<br />
1.5 Die Fragen<br />
Der Fragebogen beginnt mit einem kurzen Text, in <strong>de</strong>m Sinn und Zweck <strong>de</strong>r Befragung<br />
erläutert und <strong>die</strong> Interviewerinnen vorgestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Der teilstandardisierte Bogen setzt sich aus acht Fragen zusammen, von <strong>de</strong>nen zwei<br />
offen, vier teilweise offen und zwei geschlossen gestellt sind. Den Abschluss bil<strong>de</strong>n<br />
zusätzlich zwei Fragen zur Person.<br />
Der Fragebogen wur<strong>de</strong> je nach Projekt leicht verän<strong>de</strong>rt, ist jedoch inhaltlich i<strong>de</strong>ntisch.<br />
Bei <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung ging es um <strong>die</strong> Ansprache, <strong>die</strong> sich bei Wildwasser ausschließlich<br />
an Frauen richtet, beim Weglaufhaus auf Interviewpartner bei<strong>de</strong>r Geschlechter, sowie in<br />
Frage eins und sechs <strong>die</strong> jeweilige Bezeichnung <strong>de</strong>s Projekts. Bei<strong>de</strong> Fragebögen befin<strong>de</strong>n<br />
sich im Anhang auf <strong>de</strong>n Seiten 2-6.<br />
Die Fragen wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Forschungsinteresse entwickelt. So soll aus Nutzerinnenperspektive<br />
eventuelle Unterschie<strong>de</strong> zwischen betroffenen und nicht betroffenen Mitarbeitern<br />
und <strong>de</strong>r Qualität ihrer Arbeit erfragt wer<strong>de</strong>n. Ebenso geht es darum, <strong>die</strong> subjektive<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Projekte im Vergleich mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems<br />
zu beleuchten.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s vorgegebenen Rahmens einer Diplomarbeit und <strong>de</strong>r dadurch beschränkten<br />
Möglichkeiten haben wir uns <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Form <strong>de</strong>r Befragung entschie<strong>de</strong>n. Deshalb bil<strong>de</strong>ten<br />
<strong>die</strong> von uns extrahierten Merkmale <strong>de</strong>r Ressource <strong>Betroffenheit</strong> <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r Fragen.<br />
Durch <strong>die</strong> Offenheit <strong>de</strong>r Fragen blieb jedoch Raum, individuell Position zu beziehen.<br />
57
1.6 Kategorienbildung<br />
Wir haben uns <strong>für</strong> das Auswertungsverfahren <strong>de</strong>r Kategorienbildung entschie<strong>de</strong>n.<br />
Grundlage da<strong>für</strong> waren <strong>die</strong> ausgefüllten Fragebögen. Unterstellte Kategorien (siehe 2.2)<br />
lagen <strong>de</strong>n Fragen zu Grun<strong>de</strong>, neue Kategorien ergaben sich aus <strong>de</strong>n einzelnen Antworten<br />
(vgl. Steinert u.a. 2000, 138). Die Auswertungskategorien wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong>o an das Material<br />
herangetragen, daran überprüft und gegebenenfalls modifiziert.<br />
Ähnliche Inhalte wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Kategorien zugeordnet. Damit sollen keine<br />
allgemeingültigen abstrakten Aussagen getroffen, son<strong>de</strong>rn <strong>die</strong> einzelnen Angaben<br />
zusammengefasst wer<strong>de</strong>n. Somit wer<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Kategorien nicht theoretisch, son<strong>de</strong>rn empirisch<br />
hergeleitet. Die Transparenz bei <strong>de</strong>r Herleitung <strong>de</strong>r Kategorien ist somit gegeben.<br />
<strong>„</strong>Diese Transparenz ist ein wesentliches Kriterium <strong>für</strong> <strong>die</strong> wissenschaftliche Ausgewiesenheit<br />
und Objektivität einer qualitativen Untersuchung, da darüber <strong>de</strong>r Erkenntnisweg<br />
<strong>für</strong> an<strong>de</strong>re nachvollziehbar wird“ (Schmidt-Grunert 1999, 50).<br />
1.7 Form <strong>de</strong>r Darstellung<br />
Wir haben <strong>die</strong> Antworten wortwörtlich übernommen, und <strong>die</strong>se in Tabellenform geordnet.<br />
Die Tabellen beziehen sich jeweils auf eine Frage bzw. Teilfrage. Eine Teilauswertung<br />
fin<strong>de</strong>t am En<strong>de</strong> je<strong>de</strong>r Frage statt. Den Abschluss bil<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Diskussion und kritische<br />
Einschätzung <strong>de</strong>r Ergebnisse insgesamt.<br />
2. Qualitative und quantitative Auswertung ausgewählter Daten<br />
2.1 Stichprobenbeschreibung<br />
Bei <strong>de</strong>n Befragten han<strong>de</strong>lt es sich um fünf aktuelle Nutzerinnen <strong>de</strong>s Wildwasser-<br />
Frauenla<strong>de</strong>ns. Zum Weglaufhaus wur<strong>de</strong>n ebenfalls fünf Personen befragt, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Einrichtung<br />
innerhalb <strong>de</strong>r letzten 12 Monate nutzten. Hier han<strong>de</strong>lt es sich um drei weibliche<br />
und zwei männliche Befragte, da <strong>die</strong>se Einrichtung sowohl von Männern <strong>als</strong> auch<br />
Frauen genutzt wird.<br />
Das Alter aller Befragten liegt zwischen 28 – 39 Jahren. Vorgegeben waren vier Altersgruppen<br />
– von 18-27, von 28-39, von 40-55 und über 55. Das genaue Alter bzw. Durchschnittsalter<br />
wur<strong>de</strong> nicht ermittelt, um <strong>die</strong> Anonymität zu sichern.<br />
58
2.2 Kategorien<strong>de</strong>finition: Unterstellte Kategorien<br />
Ausgehend von unserer Hypothese, dass <strong>Betroffenheit</strong> eine Ressource <strong>für</strong> <strong>die</strong> und in <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit ist, haben wir gefragt was <strong>die</strong>se Ressource ausmacht? Der Klärung <strong>die</strong>-<br />
ser Frage galt auch unser Forschungsinteresse. Die folgen<strong>de</strong>n Annahmen haben sich aus<br />
<strong>de</strong>n theoretischen Ausführungen zum Betroffenenkontrollierten Ansatz und unseren<br />
praktischen Erfahrungen in <strong>de</strong>n Projekten ergeben:<br />
– Sie können Vorbild da<strong>für</strong> sein, dass es möglich ist sich aus Gewaltverhältnissen zu<br />
lösen und dass <strong>die</strong> Gewalterfahrung in ein selbstbestimmtes Leben integriert wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Eigentlich ist das we<strong>de</strong>r Kompetenz noch Ressource, son<strong>de</strong>rn eher eine Funktion<br />
und Rolle, <strong>die</strong> Jeman<strong>de</strong>n zugesprochen wird.<br />
– Authentizität, in <strong>de</strong>r Frage, dass Krisen bewältigt und eine lebensbejahen<strong>de</strong> Haltung<br />
gewonnen wer<strong>de</strong>n kann.<br />
– Positives Krisenverständnis, das darin besteht, dass Krisen eine legitime Möglichkeit<br />
sind, auf unerträgliche Lebensumstän<strong>de</strong> zu reagieren. Somit ist ein krisenhafter Prozess<br />
auch <strong>als</strong> Chance zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Situation zu sehen. Krise ist keine Krankheit<br />
und kann nicht behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n.<br />
– Eine umfassen<strong>de</strong> Reflexion von Gewaltstrukturen. Das be<strong>de</strong>utet einerseits ein ständiges<br />
Bemühen um alternative Strukturen und Verhältnisse, sowie an<strong>de</strong>rerseits das Ringen<br />
um gesellschaftliche Verän<strong>de</strong>rung. Alternative Verhältnisse und Strukturen<br />
be<strong>de</strong>utet in <strong>die</strong>sem Zusammenhang, dass versucht wird <strong>die</strong> Gewalterfahrung aufzuheben,<br />
in <strong>de</strong>m hierachiearme, gewaltfreie, selbstbestimmte und transparente Räume<br />
geschaffen und zur Verfügung gestellt wer<strong>de</strong>n und an<strong>de</strong>re Betroffene <strong>als</strong> Subjekte ihrer<br />
Geschichte, ihres Lebens wahrgenommen wer<strong>de</strong>n. Das Ringen um gesellschaftliche<br />
Verän<strong>de</strong>rung fin<strong>de</strong>t vor allem in <strong>de</strong>r Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit statt.<br />
Aber auch in <strong>de</strong>r Organisation von und Teilnahme an Protesten und Demonstrationen.<br />
– Das Wissen, das aus eigenen, unmittelbaren Erfahrungen gewonnen wird ist umfassen<strong>de</strong>r,<br />
<strong>als</strong> erlerntes. Es verbin<strong>de</strong>t, im Gegensatz zur rein theoretischen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit Gewalterfahrungen, <strong>die</strong> sinnliche mit <strong>de</strong>r rationalen Ebene. Die daraus<br />
erwachsenen Handlungsmöglichkeiten sind vielfältiger.<br />
In <strong>de</strong>r Auswertung <strong>de</strong>r Interviews haben wir überprüft ob <strong>die</strong>se Merkmale <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzer<br />
und Nutzerinnen ebenfalls von Be<strong>de</strong>utung waren. Diese haben wir unterstellte Kategorien<br />
genannt.<br />
59
2.2.1 Vorbildfunktion<br />
Der Brockhaus <strong>de</strong>finiert <strong>de</strong>n Begriff Vorbild <strong>als</strong> eine Bezeichnung <strong>„</strong>(...) <strong>für</strong> konkret<br />
leben<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r geschichtl. Personen, <strong>die</strong> <strong>als</strong> Leitbild <strong>für</strong> <strong>die</strong> eigene Entwicklung und Le-<br />
bensgestaltung aufgefasst wer<strong>de</strong>n“ (Brockhaus 23 1994, 446).<br />
In <strong>de</strong>n ersten Lebensjahren eines Kin<strong>de</strong>s sind <strong>die</strong> Bezugspersonen grundlegend prägend<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Entwicklung <strong>de</strong>r späteren Einstellungen. Im Jugendalter fin<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Wahl <strong>de</strong>s<br />
Vorbil<strong>de</strong>s, im Gegensatz zur Kindheit, bewusst statt. Idole wie Sportler und Stars wer-<br />
<strong>de</strong>n im Erwachsenenalter zunehmend durch <strong>„</strong>geistig, ethisch, religiös o<strong>de</strong>r politisch<br />
hervorragen<strong>de</strong>(n) Persönlichkeiten o<strong>de</strong>r <strong>für</strong> <strong>die</strong> eigene Entwicklung wichtige(n) Personen<br />
<strong>de</strong>s eigenen Umfelds“ (ebd., 446) ersetzt.<br />
Die antiautoritäre Bewegung <strong>de</strong>r 70er Jahre sowie Richtungen <strong>de</strong>r Erziehungstheorie<br />
drängten bewusst dargebotene Vorbil<strong>de</strong>r zurück. Ziel <strong>die</strong>ser Bestrebungen war <strong>die</strong> Entwicklung<br />
von autonomen und kritisch-mündigen Persönlichkeiten.<br />
Die Wahl von Vorbil<strong>de</strong>rn geschieht heute weitgehend frei.<br />
<strong>„</strong>Laut aktueller Jugendstu<strong>die</strong>n (z.B. Zinnecker et al.: Null Zoff und Voll Busy.) haben<br />
<strong>de</strong>rzeit knappe 60 % <strong>de</strong>r Jugendlichen in Deutschland ein Vorbild. Bei <strong>de</strong>r<br />
Mehrheit <strong>de</strong>r Vorbil<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>lt es um Prominente und Stars aus <strong>de</strong>n Me<strong>die</strong>n:<br />
Sportler, Sänger, Schauspieler. Mutter und Vater belegen aber immer noch <strong>de</strong>n ersten<br />
bzw. zweiten Platz in <strong>de</strong>r Hitliste <strong>de</strong>r Vorbil<strong>de</strong>r“<br />
(http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Vorbild).<br />
Sie können prägend <strong>für</strong> das eigene Verhalten sein und sind <strong>„</strong>von hoher Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> sittl. Ausbildung <strong>de</strong>r Persönlichkeit“ (ebd., 446).<br />
In <strong>de</strong>n von uns untersuchten Zusammenhängen können betroffene Mitarbeiter zum<br />
Vorbild <strong>für</strong> <strong>die</strong> Möglichkeit wer<strong>de</strong>n, traumatischen Erfahrungen in das eigene Leben zu<br />
integrieren bzw. krisenhaften Situationen zu überwin<strong>de</strong>n. Diese Rolle wird ihnen von<br />
<strong>de</strong>n Nutzern zugeschrieben. In <strong>de</strong>r Broschüre <strong>„</strong>Betrifft: Professionalität“ wird <strong>die</strong> daraus<br />
erwachsene Funktion wie folgt beschrieben:<br />
<strong>„</strong>Die MitarbeiterInnen erfüllen eine gewisse Vorbildfunktion in bezug darauf, dass<br />
es trotz <strong>de</strong>r Gewalterfahrung möglich sein kann, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“<br />
(Tauwetter u.a. 2004, 4)<br />
Wir sehen <strong>de</strong>n Begriff Vorbildfunktion problematisch und unterschiedlich. Die eine<br />
sieht sich aufgrund ihrer Tätigkeit <strong>als</strong> betroffene Mitarbeiterin bei Wildwasser in <strong>de</strong>r<br />
Rolle <strong>de</strong>s Vorbil<strong>de</strong>s, <strong>die</strong> an<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Rolle einer Person, <strong>die</strong> sich potentiell an Vorbil-<br />
<strong>de</strong>rn orientiert.<br />
Während <strong>die</strong> eine das Vorbild eher <strong>als</strong> eine positive Möglichkeit <strong>de</strong>r Anlehnung und<br />
damit verbun<strong>de</strong>ne Hoffnung <strong>für</strong> <strong>die</strong> eigene Lebensgestaltung verstand, sah <strong>die</strong> an<strong>de</strong>re<br />
60
darin nur eine begrenzte Orientierungsmöglichkeit, da je<strong>de</strong>r seinen eigenen Weg entwi-<br />
ckeln muss und im Vorbildsein sah sie eher eine Last und Bür<strong>de</strong>. Wir haben uns ent-<br />
schlossen, <strong>die</strong> Vorbildfunktion in unsere vorgegebenen Kategorien aufzunehmen. Da<br />
Vorbil<strong>de</strong>r in allen gesellschaftlichen Bereichen existieren, wollten wir wissen, in welchem<br />
Maße <strong>die</strong>s auf das Weglaufhaus und Wildwasser zutrifft.<br />
2.2.2 Authentizität<br />
<strong>„</strong>Authentizität <strong>die</strong>, -, Echtheit, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit“<br />
( Brockhaus 2 1987, 401).<br />
Wenn <strong>die</strong> Eigenschaft Authentizität einer Person zugeordnet wird, heißt das, dass <strong>die</strong>se<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>„</strong>real, urwüchsig, unverbogen, ungekünstelt“ ist bzw. wahrgenommen wird.<br />
Es muss sich <strong>als</strong>o nicht unbedingt um eine tatsächliche Eigenschaft <strong>de</strong>r Person han<strong>de</strong>ln.<br />
Sie kann <strong>de</strong>r Person auch von an<strong>de</strong>ren Menschen zugeschrieben wer<strong>de</strong>n<br />
(vgl. http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Authentizität).<br />
Authentisches Han<strong>de</strong>ln ist relativ zur eigenen Wahrnehmung, sowie Werturteilen, <strong>die</strong><br />
<strong>als</strong> richtig erachtet wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>ren Interpretation zu sehen.<br />
Ein <strong>de</strong>r Authentizität sehr ähnlicher Begriff fin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Integrität wie<strong>de</strong>r. Wir haben<br />
uns da<strong>für</strong> entschie<strong>de</strong>n <strong>die</strong>se bei<strong>de</strong>n Begriffe in einer Kategorie zusammen zu fassen.<br />
Unter Integrität (lat.) wer<strong>de</strong>n vom Brockhaus <strong>als</strong> bildungssprachliche Übersetzung <strong>die</strong><br />
Begriffe Unbescholtenheit und Unbestechlichkeit genannt (vgl. Brockhaus 10 1989,<br />
555).<br />
Dagegen wird bei Wikipedia genauer ausgeführt, dass es sich bei <strong>de</strong>r Integrität um<br />
eine ethische For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s philosophischen Humanismus han<strong>de</strong>lt. Ziel ist es,<br />
eine <strong>„</strong>Übereinstimmung zwischen i<strong>de</strong>alistischen Werten und <strong>de</strong>r tatsächlichen Lebenspraxis,<br />
nicht in je<strong>de</strong>m kleinen Detail, aber im Ganzen“ zu erreichen (vgl.<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Integrität).<br />
Der eigentliche Unterschied <strong>die</strong>ser bei<strong>de</strong>n Begriffe liegt <strong>als</strong>o im Inhalt <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Echtheit“.<br />
Dieser ist bei <strong>de</strong>r Authentizität völlig frei, es geht aus Sicht <strong>de</strong>s <strong>„</strong>Authentischen“ lediglich<br />
darum, sich selbst zum Ausdruck zu bringen ohne dabei fremdmotiviert zu sein.<br />
Integrität hingegen ist an <strong>de</strong>finierte Werte geknüpft, nämlich <strong>die</strong> <strong>de</strong>s Humanismus, es<br />
geht darum <strong>die</strong>se I<strong>de</strong>ale, natürlich auch in einer <strong>de</strong>r Person eigenen Art und Weise, zu<br />
vertreten und vor allem ebenso danach zu leben. Die Integrität geht <strong>als</strong>o weiter <strong>als</strong> <strong>die</strong><br />
Authentizität.<br />
Im Kontext <strong>de</strong>r Befragung und allgemein <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte war uns<br />
Authentizität sehr wichtig, da es eines <strong>de</strong>r Hauptmerkmale vom Weglaufhaus und von<br />
61
Wildwasser ist, <strong>als</strong> Mitarbeiter seine eigene Lebensgeschichte in <strong>die</strong> Arbeit mit einzubeziehen.<br />
Das heißt konkret nicht einem bestimmten Bild <strong>de</strong>s <strong>„</strong>perfekten Helfers“ entsprechen<br />
zu wollen son<strong>de</strong>rn <strong>„</strong>echt“, mit <strong>de</strong>n Stärken und Schwächen <strong>die</strong> sie haben, anwesend<br />
zu sein. Wir unterstellten somit <strong>de</strong>r Befragung, dass <strong>die</strong>se Kategorie von Be<strong>de</strong>utung<br />
sein wür<strong>de</strong>.<br />
2.2.3 Positives Krisenverständnis<br />
Bevor ein <strong>„</strong>positives Krisenverständnis“ <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n kann, müssen wir uns <strong>de</strong>r Krise<br />
<strong>als</strong> solcher wen<strong>de</strong>n.<br />
Der Begriff Krise ist auf das griechischen <strong>„</strong>krisis“ zurückzuführen. Es be<strong>de</strong>utet <strong>„</strong>Entscheidung“<br />
o<strong>de</strong>r auch <strong>„</strong>entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Wendung“. Im allgemeinen ist damit eine schwierige,<br />
gefährlich Lage gemeint, eine Zeit in <strong>de</strong>r es um eine Entscheidung geht (vgl.<br />
Brockhaus 12 1990, 517).<br />
Im medizinischen Sinne meint Krisis ein <strong>„</strong>anfallartiges Auftreten von Krankheitserscheinungen<br />
mit beson<strong>de</strong>rer Heftigkeit“, ein plötzlicher Fieberanfall <strong>als</strong> kritischer Wen<strong>de</strong>punkt<br />
einer Krankheit ist hier ein Beispiel. Auch bezeichnet Krisis <strong>de</strong>n Wen<strong>de</strong>punkt<br />
innerhalb eines Krankheitsverlaufs. Die Situation verbessert o<strong>de</strong>r verschlechtert sich<br />
schlagartig (ebd., 517).<br />
Die Psychologie im allgemeinen <strong>de</strong>finiert <strong>die</strong> Krise, <strong>als</strong> <strong>„</strong>entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Abschnitt eines<br />
durch innere und /o<strong>de</strong>r äußere, ausnahmehafte Belastungen gekennzeichneten psycholog.<br />
Entwicklungsprozesses o<strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>rer Lebenssituationen, <strong>die</strong> <strong>für</strong> das weitere Persönlichkeitsschicksal<br />
bestimmend ist (...)“ (ebd., 517).<br />
Differenzierter entwickeln <strong>die</strong> Mediziner um Riecher-Rössler <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Krise. Sie<br />
stellten fest, dass in <strong>de</strong>n letzten dreißig Jahren viele Autoren versucht haben <strong>die</strong> Krise<br />
zu <strong>de</strong>finieren. Die meisten Definitionen haben vier Punkte gemeinsam:<br />
1. steht <strong>die</strong> Krise im Zusammenhang mit einem Ereignis, welches emotional von<br />
Be<strong>de</strong>utung ist o<strong>de</strong>r aber mit Lebensumstän<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> sich verän<strong>de</strong>rn.<br />
2. han<strong>de</strong>lt es sich um einen akuten Zustand.<br />
3. wird <strong>die</strong>ser vom Betroffenen <strong>als</strong> bedrohlich und überwältigend wahrgenommen.<br />
4. sind <strong>die</strong> aktuellen Bewältigungsmöglichkeiten überfor<strong>de</strong>rt.<br />
Mit Caplan (1964) und Cullberg (1978) <strong>de</strong>finieren sie Krise <strong>als</strong><br />
<strong>„</strong><strong>de</strong>n Verlust <strong>de</strong>s seelischen Gleichgewichts, <strong>de</strong>n ein Mensch verspürt, wenn er mit<br />
Ereignissen und Lebensumstän<strong>de</strong>n konfrontiert wird, <strong>die</strong> er im Augenblick nicht<br />
bewältigen kann, weil sie von <strong>de</strong>r Art und vom Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen<br />
erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wich-<br />
62
tiger Lebensziele o<strong>de</strong>r zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfor<strong>de</strong>rn“ (Riecher-Rössler,<br />
2004, 19).<br />
Dieser Krisenbegriff geht nicht auf <strong>die</strong> psychiatrische Diagnostik zurück und beschreibt<br />
auch keine Krankheit. <strong>„</strong>Eine Krise und <strong>die</strong> mit ihr verbun<strong>de</strong>ne emotionale Reaktion ist<br />
ein emotionaler Ausnahmezustand, <strong>de</strong>n prinzipiell je<strong>de</strong>r entwickeln kann“ (ebd., 20).<br />
Der Krisenbegriff <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierten Projekte trifft sich mit <strong>de</strong>r oben entwickelten<br />
Definition und erweitert sie um <strong>de</strong>n gesellschaftlichen Aspekt.<br />
<strong>„</strong>Krisen sind Bestandteil <strong>de</strong>s Lebens und nicht Ausdruck einer Krankheit. Sie stellen<br />
immer eine Chance zu konstruktiven Verän<strong>de</strong>rung dar. Neben individuellen Faktoren<br />
fin<strong>de</strong>n sich immer auch gesellschaftliche und soziale Hintergrün<strong>de</strong>, <strong>die</strong> zu einer<br />
Krise führen“( Tauwetter u.a. 2004, 2).<br />
Es ist Habermas, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Krisenbegriff an <strong>die</strong> Erfahrung <strong>de</strong>r Akteure bin<strong>de</strong>t, dass ge-<br />
sellschaftlicher Wan<strong>de</strong>l ihre soziale I<strong>de</strong>ntität bedroht. Normative Strukturen sind<br />
Grundlage <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Konsens, auf sie bezieht sich soziale I<strong>de</strong>ntität. <strong>„</strong>Kri-<br />
senzustän<strong>de</strong> haben <strong>die</strong> Form einer Desintegration <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Institutionen“<br />
(Habermas 1973, 12). Da Institutionen soziale mit personalen Strukturen verknüpfen,<br />
rücken Krisen I<strong>de</strong>ntitätsprobleme <strong>de</strong>r Individuen und <strong>de</strong>r Gesellschaft in <strong>de</strong>n Blick. Jedoch<br />
nicht je<strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l ist Auslöser einer Krise und allein das Sprechen von einer<br />
<strong>„</strong>Krise“ artikuliert noch keine Krisenerfahrung. In <strong>die</strong>sem Zusammenhang kann nur von<br />
I<strong>de</strong>ntitätskrisen gesprochen wer<strong>de</strong>n, wenn sie auf gesellschaftliche Steuerungsprobleme<br />
verweisen, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>m Spannungsfeld von System- und Sozialintegration wurzeln.<br />
<strong>„</strong>Der Begriff <strong>de</strong>r Systemintegration beschreibt ein Gesellschaftssystem unter <strong>de</strong>m<br />
Gesichtspunkt, seine Funktionsbereiche angesichts einer komplexen Umwelt zu erhalten;<br />
unter <strong>de</strong>r Perspektive von Sozialintegration erscheint <strong>die</strong> Gesellschaft <strong>als</strong><br />
Lebenswelt symbolisch interagieren<strong>de</strong>r Subjekte. Die Herausfor<strong>de</strong>rung an einen sozialwissenschaftlichen<br />
Krisenbegriff besteht in <strong>de</strong>r Verknüpfung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n ebenso<br />
sehr ausschließen<strong>de</strong>n wie gegenseitig voraussetzen<strong>de</strong>n Dimensionen“ (Kreft/Mielenz<br />
2005, 556).<br />
Wir teilen <strong>die</strong> psychologische Definition <strong>de</strong>r Krise von Caplan, Cullberg und Riecher-<br />
Rössler. Sie reflektiert beson<strong>de</strong>rs <strong>die</strong> individuelle Ebene.<br />
Ein psycho-sozialer Krisenbegriff, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n psychologischen um <strong>die</strong> gesellschaftliche<br />
Dimension erweitert, kommt <strong>de</strong>n von uns beobachteten realen Problemlagen am nächsten.<br />
Der gesellschaftliche Aspekt wird dann notwendig, wenn es um <strong>die</strong> Herleitung <strong>de</strong>r<br />
Ursachen <strong>de</strong>r Krise und <strong>de</strong>n Umgang mit <strong>die</strong>ser geht.<br />
Wie oben entwickelt, ist je<strong>de</strong> Krise ein Wen<strong>de</strong>punkt, nach <strong>de</strong>m eine Verschlechterung<br />
o<strong>de</strong>r Verbesserung eintreten kann.<br />
63
Ein positives Krisenverständnis verweist auf <strong>die</strong> konstruktive Seite <strong>die</strong>ses Prozesses und<br />
<strong>die</strong> Möglichkeiten, <strong>die</strong> in je<strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung liegen. Das heißt, wenn eine bejahen<strong>de</strong><br />
Haltung zur eigenen Krise gefun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n kann, erhöhen sich <strong>die</strong> Chancen auf neue<br />
Handlungsmöglichkeiten. Es beinhaltet auch, dass <strong>die</strong> Verantwortung <strong>für</strong> sich selbst<br />
nicht durch krisenhafte Zustän<strong>de</strong> aufgehoben ist.<br />
2.2.4 Schaffung alternativer Strukturen<br />
Will man <strong>die</strong> <strong>„</strong>Schaffung einer alternativen Struktur“ <strong>de</strong>finieren, müssen zunächst <strong>die</strong><br />
Einzelbegriffe alternativ bzw. Alternative und Struktur erklärt wer<strong>de</strong>n. Laut Meyers<br />
Lexikon ist unter einer Alternative <strong>die</strong> Wahl und/o<strong>de</strong>r Entscheidung zwischen min<strong>de</strong>s-<br />
tens zwei Möglichkeiten zu verstehen (Meyers Lexikon 1994, 34).<br />
Als Struktur wird ganz allgemein ein aus verschie<strong>de</strong>nen Teilen bestehen<strong>de</strong>s Ganzes<br />
verstan<strong>de</strong>n. Die einzelnen Funktionen erschließen sich nur aus <strong>de</strong>r Gesamtheit <strong>de</strong>s Systems.<br />
Hillmann beschreibt ganz ähnlich, dass es sich bei einer Struktur um ein <strong>„</strong>relativ<br />
stabiles, bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegen<strong>de</strong>s Gefüge“ (Hillmann 1994, 846)<br />
han<strong>de</strong>lt.<br />
<strong>„</strong>In <strong>de</strong>r Soziol. bezeichnet S. das Gefüge <strong>de</strong>r Erwartungen, Normen, Positionen,<br />
Rollen, Gruppen, Organisationen, Instutitionen, Schichten o<strong>de</strong>r Klassen, aus <strong>de</strong>ren<br />
Vorschriften, Rechten, Verpflichtungen, Zugehörigkeiten u. Mitgliedschaften<br />
sich Regelmässigkeiten u. Funktionszus.hänge, aber auch Konflikte, Störungen<br />
u. Wan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r sozialen Beziehungen ergeben (…)“ (Hillmann 1994, 846).<br />
Wir verstehen <strong>die</strong> Schaffung von alternativen Strukturen zunächst ebenfalls <strong>als</strong> <strong>die</strong><br />
Schaffung <strong>de</strong>r Möglichkeit, sich zwischen verschie<strong>de</strong>nen <strong>„</strong>Systemen“ entschei<strong>de</strong>n zu<br />
können. Nun geht es im Fall <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte darum, einem dominanten,<br />
bestehen<strong>de</strong>n Hilfesystem etwas entgegenzusetzen und dazu alternativ zu sein.<br />
Das be<strong>de</strong>utet, dass <strong>de</strong>r Inhalt <strong>de</strong>r Alternativstruktur sich entschei<strong>de</strong>nd von <strong>de</strong>m Inhalt<br />
<strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n Struktur unterschei<strong>de</strong>n sollte. Unserer Meinung nach unterschei<strong>de</strong>n<br />
sich <strong>die</strong> Projekte in folgen<strong>de</strong>n Punkten<br />
• basis<strong>de</strong>mokratische Grundstruktur<br />
• Selbstbestimmung <strong>de</strong>s Klienten<br />
• Parteilichkeit<br />
• Feminismus (Wildwasser)<br />
• Antipsychiatrische Grundhaltung (Weglaufhaus)<br />
• Selbsthilfe<br />
• <strong>die</strong> psychische Krise wird nicht <strong>als</strong> Krankheit gesehen<br />
• Selbst<strong>de</strong>finition <strong>de</strong>r Betroffenen (Wildwasser)<br />
• Positives Krisenverständnis<br />
• Akzeptanz von abweichen<strong>de</strong>m Verhalten<br />
• <strong>Betroffenheit</strong> gilt <strong>als</strong> Ressource<br />
64
vom <strong>„</strong>üblichen“ Hilfesystem. Einige <strong>die</strong>ser Punkte fin<strong>de</strong>n auch in an<strong>de</strong>ren Einrichtungen<br />
Anwendung.<br />
2.2.5 Reflexion bestimmter Themen<br />
Wenn in <strong>de</strong>r Sozialwissenschaft mit Reflexion <strong>die</strong> <strong>„</strong>bes. krit. Überprüfung <strong>de</strong>r Theorie-<br />
ansätze u. Problem<strong>de</strong>finitionen sowie ihre Rückbeziehung auf beteiligte soziale Interessenlagen<br />
u. Erfahrungsinhalte“ (Hillmann 1994, 726) gemeint ist, so möchten wir hier<br />
Reflexion lediglich <strong>als</strong> prüfen<strong>de</strong>s und vergleichen<strong>de</strong>s Nach<strong>de</strong>nken verstan<strong>de</strong>n wissen<br />
(vgl. Meyers Lexikon 1994, 710).<br />
Da <strong>die</strong> Nutzer <strong>de</strong>r von uns untersuchten Einrichtungen Gewalterfahrungen nicht nur<br />
verarbeiten, son<strong>de</strong>rn ihr zukünftiges Leben auch frei von Gewalt gestalten wollen ist <strong>die</strong><br />
Reflexion gewaltrelevanter Themen eine Notwendigkeit.<br />
Die Begriffe, <strong>die</strong> wir an <strong>die</strong>sem Punkt <strong>de</strong>r Befragung auf <strong>die</strong> Reflexion innerhalb <strong>de</strong>r<br />
Projekte überprüft haben, sind <strong>de</strong>n theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatzes entnommen. Dabei han<strong>de</strong>lt es sich um Gewalterfahrung, Gewaltstrukturen,<br />
Hierarchien und <strong>de</strong>n Gesundheitsbegriff.<br />
Diese Kategorie war <strong>als</strong>o grundlegend <strong>für</strong> <strong>die</strong> Frage 5 und ihre Teilfragen und hat sich<br />
nicht aus <strong>de</strong>n Antworten ergeben.<br />
2.3 Kategorien<strong>de</strong>finition: sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien<br />
Hierbei han<strong>de</strong>lt es sich um Kategorien, <strong>die</strong> wir aus <strong>de</strong>n jeweiligen Antworten abgeleitet<br />
haben.<br />
2.3.1 Empathie<br />
Wörtlich übersetzt kommt <strong>de</strong>m Begriff Empathie <strong>die</strong> Einfühlung am nächsten. Er leitet<br />
sich aus <strong>de</strong>m spätgriechischen Empàtheia (Lei<strong>de</strong>nschaft) ab (vgl. Brockhaus 6 1988,<br />
352 ).<br />
Der Begriff ist ein<strong>de</strong>utig verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Kommunikation und <strong>de</strong>r Beziehung zwischen<br />
<strong>de</strong>n Menschen. Das Wörterbuch <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit beschreibt in Bezug auf <strong>die</strong><br />
<strong>„</strong>Helfen<strong>de</strong> Beziehung“ folgen<strong>de</strong>s:<br />
<strong>„</strong>Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um ein Einfühlen, ein sich hineinversetzen in <strong>die</strong> Gefühls-<br />
und Gedankenwelt einer Hilfe suchen<strong>de</strong>n Person (….) und in weiterer Folge um <strong>de</strong>n<br />
Versuch, <strong>de</strong>ren Erleben und Verhaltensweisen zu verstehen (… ) Zusammen mit <strong>de</strong>n<br />
Prinzipien <strong>de</strong>r Echtheit (Authentizität) und <strong>de</strong>r unbedingten Wertschätzung stellt eine<br />
solche Grundhaltung nach Rogers <strong>die</strong> notwendigen und hinreichen<strong>de</strong>n Bedingungen<br />
<strong>für</strong> Persönlichkeitsentwicklung und hilfreiche Prozesse dar“<br />
(Deutscher Verein <strong>für</strong> öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) 2002, 260).<br />
65
Ebenfalls wird Empathie <strong>als</strong> Grundbegriff <strong>de</strong>r psychologischen Ästhetik 2 verwen<strong>de</strong>t.<br />
Dort beschreibt <strong>de</strong>r Begriff <strong>die</strong> ästhetische Wirkung, <strong>die</strong> aufgrund <strong>de</strong>s im Anschauen<br />
eines Objekts (Mensch, Tier, Pflanze, Sache) in begriffenen Fühlens und <strong>„</strong>Ergriffen-<br />
seins“ <strong>de</strong>n Betrachter eigene Gefühle und Strebungen auf das Objekt übertragen lässt<br />
(vgl. Brockhaus 6 1988, 167).<br />
Aus soziologischer Sicht wird Empathie im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r heutigen Gesell-<br />
schaft immer be<strong>de</strong>utungsvoller, weil <strong>die</strong> Vielzahl <strong>de</strong>r Interaktionsbeziehungen zwischen<br />
einer Vielzahl von Personen aus verschie<strong>de</strong>nen Bereichen <strong>de</strong>s Lebens zur Regel wer<strong>de</strong>n.<br />
Laut Hillmann setzt Empathie charakterliche Dynamik, psychische Mobilität, Einfühlungsvermögen<br />
und ein <strong>„</strong>Sich-Hineinversetzenkönnen“ in <strong>die</strong> Situation an<strong>de</strong>rer voraus.<br />
Er bezeichnet im Gegensatz zu <strong>de</strong>n bisher genannten Definitionen <strong>die</strong> Fähigkeit zur<br />
Empathie etwas absoluter. Es gehe bei Empathie um eine <strong>„</strong>starke“, engagierte Teilnahme,<br />
und <strong>die</strong> bruchlose, aufgeschlossene Übernahme neuer sozialer Rollen und darum,<br />
frem<strong>de</strong> Wertvorstellungen kompromisshaft in sich aufnehmen zu können (vgl. Hillmann<br />
1994,179).<br />
Die Kombination aus <strong>die</strong>sen Definitionen spiegelt wi<strong>de</strong>r was wir unter Empathie verstehen.<br />
Es geht uns einerseits darum, <strong>die</strong> klassische Empathie zu erfragen und festzuhalten,<br />
an<strong>de</strong>rerseits han<strong>de</strong>lt es sich im Fall <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte um eine<br />
Empathie, <strong>die</strong> sich möglicherweise um <strong>die</strong> Ebene <strong>de</strong>r Sinne erweitert. Wenn ein Mensch<br />
eine Situation o<strong>de</strong>r eine ähnliche Situation, wie <strong>die</strong>, <strong>die</strong> ihm gera<strong>de</strong> erzählt wird, selbst<br />
erlebt hat, erweitert sich das Einfühlen um <strong>die</strong> eigene Erfahrung. Dieses Einfühlen fin<strong>de</strong>t<br />
so nicht weiter auf <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Vorstellungsebene“ statt, son<strong>de</strong>rn reicht in <strong>die</strong> <strong>„</strong>Erlebnisebene“<br />
hinein. Ob <strong>die</strong>se Erweiterung nun zu besserem o<strong>de</strong>r zu schlechterem Verstehen<br />
führt, sei dahingestellt. Zunächst geht es um <strong>de</strong>n eventuellen Unterschied. Was dann zur<br />
Kompetenz wer<strong>de</strong>n kann, liegt entschei<strong>de</strong>nd daran, wie <strong>die</strong>se Erfahrungsebene reflektiert<br />
wur<strong>de</strong> und inwiefern ein bewusstes <strong>„</strong>Einfließenlassen“ <strong>die</strong>ser Fähigkeit möglich ist.<br />
Es soll hier keine Hierarchie zwischen betroffener und nicht betroffener Empathie aufgebaut<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
2<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jhdts. wur<strong>de</strong> seitens <strong>de</strong>r Psychologie durch Gustav Th. Fechner <strong>die</strong> <strong>„</strong>psychologische Ästhetik“<br />
in Abgrenzung zur allgemeinen wissenschaftlichen Disziplin <strong>de</strong>r Ästhetik eingeführt. Diese Form<br />
<strong>de</strong>r Betrachtung setzte <strong>de</strong>n Fokus auf <strong>die</strong> <strong>„</strong>Wissenschaft <strong>de</strong>r Sinnlichen Erfahrung“, welche zuvor auf<br />
<strong>de</strong>n Geltungsbereich <strong>de</strong>s Schönen und <strong>de</strong>r Kunst verengt wur<strong>de</strong>. Sie stellt eine Ausweitung <strong>de</strong>s Begriffs<br />
<strong>„</strong>Ästhetik“ dar.<br />
(vgl.: www.sbg.ac.at/psy/lehre/allesch/psaest02.doc)<br />
66
2.3.2 Akzeptanz<br />
Das Etymologische Wörterbuch <strong>de</strong>s Deutschen beschreibt, dass <strong>„</strong>akzeptieren“ auch mit<br />
<strong>de</strong>n Verben annehmen, anerkennen, zulassen und einwilligen zu beschreiben wäre. Das<br />
Wort selbst lässt sich aus <strong>de</strong>m lateinischen <strong>„</strong>acceptare“ ableiten. <strong>„</strong>Akzeptanz“ wird <strong>als</strong>o<br />
<strong>als</strong> <strong>„</strong>Bereitschaft, etwas zu akzeptieren“ <strong>de</strong>finiert. Sie beruht auf Freiwilligkeit, beinhaltet<br />
aber im Gegensatz zu <strong>de</strong>m passiven Begriff Toleranz eine aktive Seite.<br />
Akzeptanz ist von <strong>de</strong>n drei folgen<strong>de</strong>n Perspektiven aus zu sehen: Akzeptanzsubjekt,<br />
Akzeptanzobjekt und Akzeptanzkontext. Das Akzeptanzobjekt kann man sich aneignen.<br />
Dies kann sich ebenso auf Dinge wie auch auf Eigenschaften beziehen (vgl.<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Akzeptanz).<br />
Es kann sich sogar laut Lucke <strong>„</strong>auf prinzipiell alle gesellschaftlichen Observationen und<br />
kulturellen Entäußerungen beziehen, darunter auch politische Maßnahmen“ (Lucke<br />
1995, 89). Subjektbezogen be<strong>de</strong>utet Akzeptanz, dass eine Person von einer an<strong>de</strong>ren akzeptiert<br />
wird, sie ist <strong>als</strong>o an Personen gebun<strong>de</strong>n. Der soziale Kontext, welcher sowohl<br />
Akzeptanzobjekt <strong>als</strong> auch Akzeptanzsubjekt beeinflusst, ist <strong>de</strong>r Akzeptanzkontext und<br />
wird aus <strong>de</strong>n maßgeblichen Bezugsgruppen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Zielgruppen beeinflussen, gebil<strong>de</strong>t<br />
(vgl. ebd.).<br />
Im Brockhaus wird neben <strong>de</strong>r grundsätzlich bejahen<strong>de</strong>n, positiven Haltung etwas o<strong>de</strong>r<br />
jeman<strong>de</strong>m gegenüber, auch <strong>die</strong> darauf folgen<strong>de</strong> Handlung benannt, jedoch nicht näher<br />
beschrieben (Brockhaus 1 1986, 299).<br />
Wir verwen<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Kategorie Akzeptanz stark auf das Subjekt bezogen. Es geht darum,<br />
dass eine Person von einer an<strong>de</strong>ren Person o<strong>de</strong>r Institution angenommen und akzeptiert<br />
wird. Die Akzeptanz beinhaltet vorallem abweichen<strong>de</strong>s Verhalten, welches im eigentlichen<br />
gesellschaftlichen Kontext (Akzeptanzkontext) oft zu Stigmatisierung und in <strong>de</strong>r<br />
Folge zu Ausschluss führt. Wer<strong>de</strong>n Menschen mit einem Stigma belegt, machen sie<br />
ähnliche Lebenserfahrungen<br />
<strong>„</strong>hinsichtlich ihrer Misere (und haben) ähnliche Verän<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r Selbstauffassung –<br />
einen ähnlichen ‚moralischen Wer<strong>de</strong>gang’,(…) <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>s ist, Ursache und Wirkung <strong>de</strong>r<br />
Gebun<strong>de</strong>nheit an eine ähnliche Sequenz persönlicher Anpassungen“ (Goffman 1963,<br />
45).<br />
Die Annahme <strong>de</strong>s Einzelnen ist vorallem <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Angenommenen von beson<strong>de</strong>rer Be<strong>de</strong>utung,<br />
da <strong>die</strong>ser sich so frei entfalten kann. Nahezu immer basiert <strong>die</strong> Akzeptanz auf<br />
Gegenseitigkeit. Die Handlung, <strong>die</strong> <strong>de</strong>r akzeptieren<strong>de</strong>n Grun<strong>de</strong>instellung folgt ist geprägt<br />
von Offenheit und Interesse von bei<strong>de</strong>n Seiten.<br />
67
2.3.3 Kontakt<br />
Kontakt kommt vom lateinischen <strong>„</strong>contingere“ und wird mit berühren übersetzt. Allgemein<br />
wird von einer Verbindung, Beziehung o<strong>de</strong>r Berührung gesprochen. Psychologisch<br />
betrachtet han<strong>de</strong>lt es sich bei einem Kontakt um eine <strong>„</strong>direkte (positive) Interakti-<br />
on zw. zwei und mehreren Personen. (Einem) Grundphänomen <strong>de</strong>r Verständigung und<br />
unerläßl. Bestandteil einer normalen Individualentwicklung. (...)“(Brockhaus 12 1990,<br />
304).<br />
Im Wörterbuch <strong>de</strong>r Soziologie wird vom sogenannten Sozialen Kontakt gesprochen.<br />
Diese Beziehung zwischen zwei Parteien, kann sich auf Einzelpersonen, Gruppen und<br />
auch auf Organisationen beziehen. Die Anzahl <strong>de</strong>r Kontakte, <strong>die</strong> ein solches System hat,<br />
bezeichnet <strong>die</strong> <strong>„</strong>Dichte eines sozialen Beziehungsfel<strong>de</strong>s“(Hillmann 1994, 441).<br />
Bezogen auf <strong>die</strong> hier verwen<strong>de</strong>te Kategorie Kontakt, geht es eigentlich um <strong>de</strong>n helfen<strong>de</strong>n<br />
Kontakt, <strong>die</strong> helfen<strong>de</strong> Beziehung. Dieser fin<strong>de</strong>t oft zwischen zwei Personen,<br />
manchmal aber auch zwischen mehreren statt. Bezeichnend <strong>für</strong> <strong>de</strong>n helfen<strong>de</strong>n Kontakt<br />
ist <strong>die</strong> Tatsache, dass eine Person o<strong>de</strong>r Personengruppe mit einem Anliegen <strong>de</strong>n Kontakt<br />
zu einer Hilfe anbieten<strong>de</strong>n Person sucht. Der Hilfesuchen<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich dabei in einer<br />
Problemlage, <strong>de</strong>r Hilfegeben<strong>de</strong> in seiner professionellen Rolle.<br />
Kontakt wird hier neutral verwen<strong>de</strong>t und bezieht sich auf <strong>die</strong> Perspektive <strong>de</strong>r Befragten.<br />
Die Wertung wird <strong>de</strong>n jeweiligen Aussagen entnommen.<br />
Eine berufliche Erfahrung ist, dass <strong>für</strong> viele Hilfesuchen<strong>de</strong> <strong>die</strong> eigene, oben benannte<br />
<strong>„</strong>Dichte eines sozialen Beziehungsfel<strong>de</strong>s“ sehr gering ist. Für manche stellt <strong>de</strong>r Kontakt<br />
zum Helfer sogar <strong>de</strong>n einzigen sozialen Kontakt überhaupt dar. Dementsprechend wichtig<br />
ist <strong>die</strong>ser <strong>für</strong> <strong>die</strong> Person.<br />
2.3.4 Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s oben entwickelten Krisenbegriffs verstehen wir unter verän<strong>de</strong>rtem<br />
Umgang, dass <strong>die</strong> Betroffenen ihre bisherigen Reaktionen überdachten und neue Möglichkeiten<br />
im Umgang mit krisenhaften Zustän<strong>de</strong>n gewonnen haben, dass sich ihr Handlungsspektrum<br />
erweitert hat.<br />
2.3.5 Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
<strong>„</strong>Verbun<strong>de</strong>nheit be<strong>de</strong>utet mehr <strong>als</strong> nur Verbindung. Während Verbindung <strong>als</strong> eine<br />
gegebene, materielle, aus einer Situation zwangsläufig entstan<strong>de</strong>ne Beziehung zwischen<br />
Menschen und <strong>de</strong>r Mitwelt angesehen wer<strong>de</strong>n kann, stellt Verbun<strong>de</strong>nheit eine<br />
akzeptierte, ein bewußt gewähltes o<strong>de</strong>r angestrebtes geistiges und gefühlsmäßiges<br />
Wahrnehmen einer Verbindung dar. Der Begriff <strong>de</strong>r Verbun<strong>de</strong>nheit kann auch <strong>die</strong><br />
Stellung <strong>de</strong>s menschlichen Individuums <strong>als</strong> Teil <strong>de</strong>s Organismus <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
68
eziehungsweise <strong>de</strong>r Menschheit <strong>de</strong>utlicher wer<strong>de</strong>n lassen und so einem Zerfall <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft entgegenwirken“ (Kuhr 2000, 120f.).<br />
Der Ausdruck Verbun<strong>de</strong>nheit be<strong>de</strong>utet in <strong>de</strong>r Psychologie <strong>de</strong>r Kommunikation Vertrauen<br />
und Zugehörigkeit zu einer Person o<strong>de</strong>r einer Gruppe von Personen. Sie stellt laut<br />
Schulz von Thun neben <strong>de</strong>m Empfin<strong>de</strong>n von Selbstwert, einem bestimmten Grad an<br />
Freiheit und <strong>de</strong>m Liebesbedürfnis (passiv und aktiv), eines <strong>de</strong>r vier seelischen Grundbedürfnisse<br />
dar (vgl. www.<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Verbun<strong>de</strong>nheit).<br />
Die Verbun<strong>de</strong>nheit ist somit <strong>als</strong> Grundlage und Bedingung <strong>de</strong>s seelischen Gleichgewichts<br />
anzusehen.<br />
Bedingt durch <strong>die</strong> Tatsache, dass im Weglaufhaus und bei Wildwasser betroffene Mitarbeiter<br />
arbeiten, <strong>die</strong> ähnliche Erfahrungen wie <strong>die</strong> Nutzer gemacht haben, besteht <strong>die</strong><br />
Möglichkeit sich verbun<strong>de</strong>n zu fühlen.<br />
2.3.6 Distanz<br />
Distanz kommt <strong>als</strong> Begriff vom lateinischen <strong>„</strong>distare“ , welches wörtlich <strong>„</strong>auseinan<strong>de</strong>r<br />
stehen“ be<strong>de</strong>utet ( Brockhaus 5 1988, 550).<br />
Der Begriff wird unter verschie<strong>de</strong>nen Gesichtspunkten betrachtet. Bei <strong>de</strong>r räumlichen,<br />
<strong>als</strong>o physischen Distanz ist <strong>die</strong> reale Entfernung von Personen o<strong>de</strong>r Gruppen im Sozialen<br />
Raum gemeint, bei <strong>de</strong>r sozialen Distanz geht es um <strong>de</strong>n <strong>„</strong>(…)Zustand einer durch<br />
Vorstellungen o<strong>de</strong>r äußere Situationen <strong>de</strong>s Gegeneinan<strong>de</strong>r gehemmten Annäherung“<br />
(Hillmann, 1994, 157), welche nicht ausschließt, dass physische Nähe vorhan<strong>de</strong>n ist. Im<br />
allgemeinen hängt Distanz immer von <strong>de</strong>n Wertvorstellungen, Einstellungen, Vorurteilen,<br />
Symphatie- u. Antipathiegefühlen <strong>de</strong>r Person selbst ab.<br />
Friedrich Nietzsche beschreibt in seinem <strong>„</strong>Pathos <strong>de</strong>r Distanz“ <strong>die</strong> Zweiteilung <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft in <strong>die</strong> <strong>„</strong>herrschen<strong>de</strong> Art“ und das <strong>„</strong>Unten“. <strong>„</strong>Im ‚Pathos <strong>de</strong>r D.’ liege<br />
zugleich <strong>de</strong>r Ursprung <strong>de</strong>s Gegensatzes ‚gut’ u. ‚schlecht’“ (Hillmann 1994, 157).<br />
Bezogen auf das Verhältnis Individuum und Gesellschaft wird <strong>die</strong>se Distanz heute<br />
durch <strong>die</strong> zunehmen<strong>de</strong> Individualisierungsten<strong>de</strong>nz immer subjektbezogener. Es wird<br />
dabei von Rollendistanz gesprochen.<br />
Distanz zu halten ist ein relativ natürlicher Vorgang und bezeichnet <strong>de</strong>n unbewusst eingehaltenen<br />
Abstand zu Menschen bzw. Dingen, <strong>die</strong> einem fremd sind. Wenn <strong>die</strong>ser Abstand<br />
von einer an<strong>de</strong>ren Person übertreten wird, ist das meist unangenehm. Wird <strong>de</strong>r<br />
Abstand zu weit überschritten, reagiert das Gegenüber entwe<strong>de</strong>r mit Angriff o<strong>de</strong>r<br />
Flucht. Dieser Abstand ist von Person zu Person unterschiedlich und ist ebenfalls von<br />
kulturellen sowie schichtbedingten Faktoren abhängig (vgl. Brockhaus 5 1988, 550).<br />
69
Alfred Bellebaum beschreibt <strong>die</strong> soziale Distanz <strong>als</strong> einen beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>n Randgruppen<br />
zugehörigen Zustand. Charakteristisch <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Randgruppen ist <strong>die</strong> Abweichung von<br />
<strong>de</strong>r gesellschaftlich anerkannten Norm, welche dazu führt, dass sie zum <strong>„</strong>Objekt sozia-<br />
ler Kontrolle wer<strong>de</strong>n und zusammen mit Stigmatisierung offene o<strong>de</strong>r versteckte Diskriminierung<br />
erfahren“ (Bellebaum 2002, 223).<br />
Die hier beschriebene soziale Kontrolle und Stigmatisierung aufgrund <strong>de</strong>r Randständigkeit<br />
bestimmter Personen ist auch <strong>für</strong> uns von beson<strong>de</strong>rer Wichtigkeit. Bei <strong>de</strong>n Nutzern<br />
<strong>de</strong>s Weglaufhauses und <strong>de</strong>n Nutzerinnen von Wildwasser han<strong>de</strong>lt es sich oft um Menschen,<br />
<strong>die</strong> aufgrund <strong>de</strong>r eigenen Lebensgeschichte verurteilt und zum Außenseiter gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Auswirkung auf das soziale Umfeld ist in bestimmten Fällen gravierend.<br />
Sie führt mitunter zu weitgehen<strong>de</strong>r Isolation von <strong>de</strong>r Umwelt.<br />
Distanz tauchte <strong>als</strong> Kategorie in <strong>de</strong>r Auswertung auf, <strong>als</strong> es um <strong>die</strong> Erfahrung <strong>de</strong>r Befragten<br />
mit professionellen Helfern ging. Wir gehen <strong>als</strong>o davon aus, dass es eine <strong>„</strong>professionelle“<br />
Distanz gibt, <strong>die</strong> eine Auswirkung auf <strong>de</strong>n Hilfeprozess haben kann. Diese<br />
kann sowohl positiv <strong>als</strong> auch negativ ausfallen.<br />
Die <strong>„</strong>professionelle“ Distanz wird im Laufe <strong>de</strong>r Professionalisierung <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
<strong>als</strong> eine <strong>de</strong>r großen Errungenschaften in <strong>die</strong>sem Prozess begriffen.<br />
Gera<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projekten ist auch <strong>die</strong>s immer eine <strong>de</strong>r <strong>„</strong>großen“<br />
Fragen, <strong>die</strong> von Außenstehen<strong>de</strong>n gestellt wird: <strong>„</strong>Ist es möglich mit einer Lebensgeschichte,<br />
<strong>die</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Klienten ähnelt, genügend Distanz zu halten?“ Die Antwort ist <strong>„</strong>ja“<br />
und <strong>„</strong>nein“ zugleich. Die individuelle Distanz gestaltet sich mit je<strong>de</strong>r neuen <strong>„</strong>Klient-<br />
Helfer“- Beziehung neu, und <strong>für</strong> je<strong>de</strong>n ist etwas an<strong>de</strong>res richtig, gut o<strong>de</strong>r gewollt.<br />
2.3.7 Hierarchie<br />
<strong>„</strong>Hierarchie [gr.], aus <strong>de</strong>m religiösen Sprachgebrauch übernommene Bez. <strong>für</strong> ein<br />
Herrschaftssystem von vertikal u. horizontal fest gefügten u. nach Über- und Unterordnung<br />
geglie<strong>de</strong>rten Rängen“ (Meyers Lexikon 1994, 374).<br />
Soziologisch gesehen ist <strong>die</strong> Hierarchie <strong>die</strong> i<strong>de</strong>ale Organisationsstruktur zur Durchsetzung<br />
eines <strong>„</strong>Obersten Willens“. Die darin enthaltenen Entscheidungsbefugnisse, Kommunikationswege<br />
und Zuständigkeiten wer<strong>de</strong>n von oben nach unten verordnet und sind<br />
institutionalisiert. Innerhalb <strong>die</strong>ses Systems sind alle, bis auf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sich an <strong>de</strong>r Spitze<br />
befin<strong>de</strong>t und <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sich im untersten Glied <strong>de</strong>r Kette befin<strong>de</strong>t, gleichzeitig Untergebener<br />
und Vorgesetzter (vgl. Hillmann 1994, 332f.).<br />
<strong>„</strong>Horizontale gegenseitige Abhängigkeiten o<strong>de</strong>r soz. Aktivitäten gelten in <strong>de</strong>r H.,<br />
soweit sie nicht von vertikal übergeordneter Stelle ausdrücklich vorgesehen u. kontrolliert<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>als</strong> regelwidrig“( Hillmann 1994, 332f.).<br />
70
Mit <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rung nach Demokratisierung und im Zusammenhang mit<br />
<strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r heutigen Gesellschaft sind hierarchische Strukturen nicht mehr <strong>de</strong>n<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen entsprechend. Sie eignen sich eher <strong>für</strong> langanhalten<strong>de</strong>, gleichbleiben<strong>de</strong><br />
Aufgaben und sind nicht kurzfristig und flexibel zu verän<strong>de</strong>rn. Es wird somit eine <strong>„</strong>Abflachung<br />
<strong>de</strong>r Herrschaftspyrami<strong>de</strong>“ und ebenfalls <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Ausbau <strong>de</strong>r horizontalen Kommunikation“<br />
angestrebt ( vgl. Hillmann 1994, 332f.).<br />
Auf <strong>die</strong> einzelne Person bezogen för<strong>de</strong>rn hierarchische Strukturen in allen Lebensbereichen<br />
<strong>die</strong> Entwicklung von einerseits autoritären Persönlichkeit und hemmen an<strong>de</strong>rerseits<br />
<strong>die</strong> Entfaltung <strong>de</strong>r selbstbestimmten Einzelpersönlichkeit ( vgl. Brockhaus 10<br />
1989, 64).<br />
Genau hier setzt unsere Betrachtungsweise <strong>de</strong>r Kategorie Hierarchie an. Die heutige<br />
Gesellschaft basiert auf hierarchischen Strukturen. Die Abflachung <strong>de</strong>r Hierarchien und<br />
<strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r horizontalen Kommunikation verän<strong>de</strong>rt <strong>die</strong>sen Charakter nicht. Ein wesentliches<br />
Merkmal <strong>de</strong>r Strukturen ist <strong>die</strong> ungleiche Behandlung <strong>de</strong>r Personen.<br />
<strong>„</strong>Solche gesellschaftlichen Machtverhältnisse können sich an Geschlecht, sozialer<br />
Herkunft, Kultur o<strong>de</strong>r ethnischer Zugehörigkeit festmachen. Sie beinhalten meist<br />
einen unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen. Sie drücken sich zum Beispiel in<br />
einseitiger Zuschreibung von Kompetenz, in aka<strong>de</strong>mischen Titeln o<strong>de</strong>r unterschiedlicher<br />
Bezahlung aus. Solche Ungleichbehandlungen können auch entstehen aufgrund<br />
von Zuschreibungen und Stigmatisierungen im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen“<br />
(Hävernick 2005, Anhang 9).<br />
Hierarchiearme Räume, wie in <strong>de</strong>n Betroffenenkontrollierten Projekten, sind in unserer<br />
Gesellschaft <strong>die</strong> Ausnahme. Sie sind <strong>de</strong>r Rahmen, in <strong>de</strong>m sich Selbstbestimmung entfal-<br />
ten kann. Die bestehen<strong>de</strong>n Hierarchien wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r ständigen Reflexion unterworfen, um<br />
sie transparent zu machen und <strong>de</strong>n Nutzern so weitestgehen<strong>de</strong> Einflussmöglichkeiten zu<br />
geben. Die Strukturen sind durchlässig. Dies be<strong>de</strong>utet, dass es möglich ist, dass <strong>die</strong> Nut-<br />
zer von heute <strong>die</strong> Mitarbeiter von morgen wer<strong>de</strong>n.<br />
2.3.8 Vertrauenswürdigkeit<br />
In <strong>de</strong>r Systemtheorie wird davon ausgegangen, dass Vertrauen maßgeblich <strong>für</strong> soziales<br />
Han<strong>de</strong>ln ist. Der Mensch muss aus <strong>de</strong>r komplexen Umwelt selektieren, um eine gewisse<br />
Sicherheit zu erlangen, <strong>die</strong> wie<strong>de</strong>rum <strong>für</strong> psychische Entlastung sorgt. Das Vertrauen ist<br />
eines <strong>die</strong>ser Selektionsinstrumente. Durch <strong>die</strong>ses <strong>„</strong>wer<strong>de</strong>n interne soziale Systemordnungen<br />
gegenüber einer komplexen sozialen Umwelt (…) stabilisiert“( Hillmann 1994,<br />
907).<br />
71
Der Ursprung je<strong>de</strong>r nahen Beziehung ist Vertrauen. Es ist gekennzeichnet durch emoti-<br />
onale Sicherheit und <strong>die</strong> Fähigkeit, sich einem an<strong>de</strong>ren Menschen gegenüber zu öffnen.<br />
<strong>„</strong>V. geht <strong>als</strong> ursprüngl. Haltung von <strong>de</strong>r Verlässlichkeit <strong>de</strong>r Umstän<strong>de</strong> und an<strong>de</strong>rer<br />
Menschen und von <strong>de</strong>ren guten Absichten aus. Erst ein enttäuschtes V., etwa durch<br />
Missbrauch <strong>de</strong>s V. durch an<strong>de</strong>re führt zu Misstrauen, d.h. zur Zurückhaltung und<br />
skept. Verschlossenheit bis hin zu einem manchmal neurot. Unterstellen schädigen<strong>de</strong>r<br />
Motive von seiten an<strong>de</strong>rer Menschen o<strong>de</strong>r zu einer entsprechend mißtrauischen<br />
Allgemeinhaltung gegenüber <strong>de</strong>r Umwelt“( Brockhaus 23 1994, 282).<br />
In Krisenzeiten ist das <strong>de</strong>r Person eigene Vertrauen maßgeblich daran beteiligt, neue<br />
Hoffnung entwickeln zu können und steigert <strong>die</strong> Empfänglichkeit <strong>für</strong> neue Erfahrungen.<br />
Die erste große Vertrauenserfahrung wird bereits in <strong>de</strong>r Mutter-Kind-Beziehung in <strong>de</strong>n<br />
ersten Lebensjahren gemacht. Diese ist <strong>die</strong> Basis da<strong>für</strong>, inwiefern sich später im Kin<strong>de</strong>s-,<br />
Jugend- und Erwachsenenalter Vertrauen zu an<strong>de</strong>ren Menschen fassen lässt.“ Eine<br />
Verletzung <strong>de</strong>s V. in <strong>die</strong>ser frühen Perio<strong>de</strong> kann sich daher folgenschwer auswirken“<br />
(Brockhaus 23 1994, 282).<br />
Diesen Zusammenhang sehen wir auch. Nach unser Erfahrung haben <strong>die</strong> meisten Menschen,<br />
<strong>die</strong> sich an Wildwasser und ans Weglaufhaus wen<strong>de</strong>n, in ihrem Leben, viele davon<br />
auch im Kin<strong>de</strong>salter, Vertrauensmißbrauch erlebt. Für viele ist es <strong>de</strong>shalb schwierig<br />
zu frem<strong>de</strong>n Menschen Vertrauen aufzubauen.<br />
Wir sehen <strong>die</strong>ses Vertrauen <strong>als</strong> eine Grundlage <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit. Ein Ziel ist es <strong>die</strong>ses<br />
im Laufe <strong>de</strong>r Zeit mehr und mehr zu stärken.<br />
2.3.9 Unkenntlichkeit<br />
Unkenntlichkeit bezeichnet in <strong>die</strong>sem Zusammenhang, dass von einigen Befragten kein<br />
Unterschied zwischen <strong>de</strong>n betroffenen und nicht betroffenen Mitarbeitern und ihrer geleisteten<br />
Arbeit festgestellt wur<strong>de</strong>. Es wur<strong>de</strong> keine herausragen<strong>de</strong> Kompetenz <strong>de</strong>r betroffenen<br />
Mitarbeiter im Gegensatz zu <strong>de</strong>n nicht betroffenen festgestellt.<br />
2.3.10 Ebenbürtigkeit<br />
<strong>„</strong>Ebenbürtigkeit, in ständ. Ges. Gleichheit <strong>de</strong>r Rechtstellung wegen Gleichheit <strong>de</strong>s<br />
Geburtsstan<strong>de</strong>s. In Dtl. bis zur Abschaffung adl. Stan<strong>de</strong>svorrechte (1919) von<br />
rechtl. Be<strong>de</strong>utung“( Meyers Lexikon 1994, 215).<br />
Ebenbürtigkeit heißt <strong>für</strong> uns, dass keine o<strong>de</strong>r nur eine geringfügige hierarchische Struk-<br />
tur zwischen <strong>de</strong>n Nutzern und Mitarbeitern vorhan<strong>de</strong>n ist. Sie beschreibt eine Begegnung<br />
auf gleicher Augenhöhe, in <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>r mit seinen Fähigkeiten und Belangen ernst<br />
genommen und akzeptiert wird. Dies ist eine Vorraussetzung, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Durchsetzung <strong>de</strong>r<br />
Persönlichkeitsrechte eines je<strong>de</strong>n bedingt.<br />
72
2.3.11 Perspektivwechsel<br />
Bildungssprachlich wird <strong>de</strong>r Begriff Perspektive <strong>für</strong> einen Blickwinkel, eine Betrach-<br />
tungsweise o<strong>de</strong>r Betrachtungsmöglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus benutzt.<br />
Es kann ebenfalls <strong>„</strong>Aussicht, Erwartung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Zukunft“ (Brockhaus 16 1991,<br />
706) damit gemeint sein. In <strong>de</strong>r Systemischen Theorie ist <strong>de</strong>r Perspektivwechsel eine<br />
wichtige Größe (vgl. Schlippe u.a. 2003).<br />
Wir sprechen hier von einem Perspektivwechsel, was be<strong>de</strong>utet, dass sich eine <strong>„</strong>alte“<br />
Sichtweise durch eine neue erweitert. Für <strong>de</strong>n Moment be<strong>de</strong>utet das, dass gedanklich<br />
ein neuer Standpunkt eingenommen wird. Dies kann zu neuen Einsichten und dadurch<br />
eventuell zu neuen Handlungsmöglichkeiten führen.<br />
2.3.12 Selbsthilfe<br />
Ursprünglich ist Selbsthilfe ein Rechtsbegriff. Im am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts entstan<strong>de</strong>nen<br />
Deutschen Wörterbuch <strong>de</strong>r Gebrü<strong>de</strong>r Grimm wird <strong>„</strong>SELBSTHILFE,-HÜLFE,<br />
f. hilfe, <strong>die</strong> man sich selbst leistet, beson<strong>de</strong>rs eigenmächtige hilfe mit umgehung o<strong>de</strong>r im<br />
wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>r obrigkeit“ (http://germazope.uni-trier.<strong>de</strong>) <strong>de</strong>finiert.<br />
Bis heute ist in einem geordneten Staatswesen Selbsthilfe nicht gestattet. Und so ist in<br />
Nachschlagewerken <strong>die</strong> Selbsthilfe <strong>als</strong> <strong>„</strong>eigenmächt. Durchsetzung o<strong>de</strong>r Sicherung ei-<br />
nes Anspruchs; nur erlaubt, wenn obrigkeitl. Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen u. ohne<br />
sie <strong>de</strong>r Anspruch gefähr<strong>de</strong>t ist“ (Meyers Lexikon 1994, 787) zu fin<strong>de</strong>n. Und im Brockhaus<br />
ist <strong>de</strong>r Hinweis, dass Selbsthilfe <strong>„</strong>da <strong>de</strong>r Rechtsschutz grundsätzlich Sache <strong>de</strong>r<br />
Behör<strong>de</strong>n und Gerichte ist, grundsätzlich unzulässig“ (Brockhaus 20 1993, 93) ist.<br />
Mögliche Ausnahmen sind in § 229 <strong>de</strong>s BGB geregelt.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 60er Jahre machten sich in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland verstärkte Partizipationsbegehren<br />
<strong>de</strong>r Bürger bemerkbar, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r Gründung von Selbsthilfegruppen zu<br />
verschie<strong>de</strong>nsten Themen ihren Ausdruck fan<strong>de</strong>n.<br />
So vielfältig wie <strong>die</strong> Selbsthilfebewegung selbst sind auch <strong>die</strong> Definitionen, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r<br />
sozialwissenschaftlichen Literatur zu fin<strong>de</strong>n sind.<br />
Die Selbsthilfebewegung, zusammengeschlossen im Fachverband Deutsche Arbeitsgemeinschaft<br />
Selbsthilfegruppen e.V., hat sich folgen<strong>de</strong>rmaßen <strong>de</strong>finiert:<br />
<strong>„</strong>Selbsthilfegruppen sind freiwillige, meist lose Zusammenschlüsse von Menschen,<br />
<strong>de</strong>ren Aktivitäten sich auf <strong>die</strong> gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, psychischen<br />
o<strong>de</strong>r sozialen Problemen richten, von <strong>de</strong>nen sie - entwe<strong>de</strong>r selber o<strong>de</strong>r durch<br />
Angehörige - betroffen sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen Gewinn erwirtschaften.<br />
Ihr Ziel ist eine Verän<strong>de</strong>rung ihrer persönlichen Lebensumstän<strong>de</strong> und häufig<br />
auch ein hineinwirken in ihr soziales und politisches Umfeld. In <strong>de</strong>r regelmäßigen,<br />
oft wöchentlichen Gruppenarbeit betonen sie Authentizität, Gleichberechtigung, ge-<br />
73
meinsames Gespräch und gegenseitige Hilfe. Die Gruppe ist dabei ein Mittel, <strong>die</strong><br />
äußere (soziale, gesellschaftliche) und <strong>die</strong> innere Isolation aufzuheben. Die Ziele von<br />
Selbsthilfegruppen richten sich vor allem auf ihre Mitglie<strong>de</strong>r und nicht auf Außenstehen<strong>de</strong>;<br />
darin unterschei<strong>de</strong>n sie sich von an<strong>de</strong>ren Formen <strong>de</strong>s Bürgerengagements.<br />
Selbsthilfegruppen wer<strong>de</strong>n nicht von professionellen Helfern geleitet; manche ziehen<br />
jedoch gelegentlich Experten zu bestimmten Fragestellungen hinzu“ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft<br />
Selbsthilfegruppen 1987, 5).<br />
Im wissenschaftlichen Diskurs wur<strong>de</strong> von verschie<strong>de</strong>nen Autoren versucht, aus <strong>de</strong>r<br />
Kenntnis konkreter Selbsthilfegruppen heraus, bestimmte allgemeine Merkmale herauszufiltern.<br />
Nach Gross lässt sich Selbsthilfe<br />
<strong>„</strong>in Abhebung von <strong>de</strong>n (...) Merkmalen sozialer Fremdhilfe (...) <strong>als</strong> nicht-entgeltlich,<br />
nicht-professionell, nicht-verrechtlicht bestimmen. Die Hilfe geschieht auf Grundlage<br />
gemeinsamer <strong>Betroffenheit</strong>, gemeinsamen Lei<strong>de</strong>ns, gemeinsamer Erfahrungen.<br />
Getragen wird sie von mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r spontan entstehen<strong>de</strong>n, auf unmittelbarer,<br />
gegenseitiger Kenntnis beruhen<strong>de</strong>r Kleingruppen, auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r Freiwilligkeit.<br />
Lebensfähig sind <strong>die</strong>se Gruppen nicht über Zwangssteuern und Zwangsbeiträge,<br />
son<strong>de</strong>rn über gegenseitige Hilfe“ (zitiert nach Günter/Rohrmann 1999, 18).<br />
Runge und Villmar haben im <strong>„</strong>Handbuch Selbsthilfe“ versucht, <strong>die</strong>se unter <strong>die</strong> Katego-<br />
rien Autonomie, Selbstgestaltung bzw. Sozialengagement, Solidarität, <strong>Betroffenheit</strong>,<br />
Graswurzelrevolution, Basis<strong>de</strong>mokratie, Kooperationsbereitschaft und Subsidiarität<br />
bzw. Dezentralisierung zu fassen ( vgl. Runge u.a. 1988, 50f).<br />
Müller schlägt vor, Selbsthilfe <strong>als</strong> <strong>de</strong>n Versuch zu verstehen, <strong>die</strong> drei Entwicklungslinien<br />
persönliches Schicksal, nachbarschaftliches Han<strong>de</strong>ln in <strong>de</strong>r Kleingruppe und politische<br />
Aktion zu verbin<strong>de</strong>n. O<strong>de</strong>r wie er es sagt: <strong>„</strong><strong>die</strong>se drei zusammengehören<strong>de</strong>n<br />
Segmente unseres öffentlichen Lebens im alltäglichen Han<strong>de</strong>ln zusammenzubin<strong>de</strong>n,<br />
kennzeichnet alle noch so disparat erscheinen<strong>de</strong>n Beispiele von SelbstHilfe“ (Müller<br />
1993, 10).<br />
Diese eher weite Definition lässt Spielraum <strong>für</strong> Beson<strong>de</strong>rheiten und Abweichungen spezieller<br />
Gruppierungen. Müller bleibt aber nicht bei <strong>die</strong>ser eher formale Definition stehen,<br />
son<strong>de</strong>rn bestimmt Selbsthilfe-Initiativen analytisch zusammenfassend<br />
<strong>„</strong><strong>als</strong> eine Erscheinungsform <strong>de</strong>r Vergesellschaftung allgemein gewor<strong>de</strong>ner Reproduktionsrisiken<br />
im Kapitalismus, bei welcher <strong>die</strong> Betroffenen längst <strong>de</strong>legierte Kompetenzen<br />
zurückzufor<strong>de</strong>rn beginnen und <strong>die</strong> Frage nach <strong>de</strong>r realen Verfügungsgewalt<br />
in Staat und Gesellschaft stellen“ (ebd., 22).<br />
Wenn wir im Zusammenhang <strong>de</strong>r Befragung von Selbsthilfe sprechen, beziehen wir uns<br />
nicht auf <strong>die</strong> Gesamtstruktur <strong>de</strong>s Weglaufhauses o<strong>de</strong>r Wildwasser. Bei<strong>de</strong> Einrichtungen<br />
haben ihre Wurzeln in <strong>de</strong>r Selbsthilfebewegung und wesentliche Elemente <strong>de</strong>r Selbsthilfe<br />
sind auch heute noch in <strong>de</strong>r Struktur verankert. Im Weglaufhaus fin<strong>de</strong>n sich <strong>die</strong>se<br />
im alltäglichen Zusammenleben <strong>de</strong>r Bewohner, bei Wildwasser im Frauenla<strong>de</strong>n und in<br />
74
<strong>de</strong>r Unterstützung von Selbsthilfegruppengründungen wie<strong>de</strong>r. In bei<strong>de</strong>n Einrichtungen<br />
wird das Selbsthilfepotential bewusst geför<strong>de</strong>rt.<br />
2.3.13 Verän<strong>de</strong>rtes Krisenverständnis<br />
Diese Kategorie geht von <strong>de</strong>r Erfahrung aus, dass viele Menschen eine Krise <strong>als</strong> Desas-<br />
ter, Nie<strong>de</strong>rlage und Katastrophe erleben. Mit verän<strong>de</strong>rtem Krisenverständnis meinen wir<br />
einen Blick auf <strong>die</strong> Krise, <strong>die</strong> auch <strong>die</strong> möglichen Chancen einbezieht, sowie <strong>de</strong>r Tatsache<br />
Rechnung trägt, dass je<strong>de</strong>r Mensch von einer Krise betroffen sein kann.<br />
2.3.14 Umgang mit Krisen<br />
Je<strong>de</strong>r Mensch verfügt über Reaktionsmöglichkeiten, <strong>die</strong> sich aus <strong>de</strong>r spezifischen Sozialisation<br />
<strong>de</strong>s Einzelnen und <strong>de</strong>n Erfahrungen <strong>de</strong>s bisherigen Lebens speisen. Durch Kontakt<br />
und Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit an<strong>de</strong>ren Betroffenen o<strong>de</strong>r durch <strong>die</strong> Nutzung von an<strong>de</strong>ren<br />
Hilfeangeboten wie z.B. Beratung/Therapie kann reflektiert wer<strong>de</strong>n, wie in kritische<br />
Situationen gehan<strong>de</strong>lt wird. Dies kann <strong>die</strong> Basis <strong>für</strong> neue Handlungsmöglichkeiten sein.<br />
2.3.15 Lebensumstän<strong>de</strong><br />
Wir verstehen unter Lebensumstän<strong>de</strong>n <strong>die</strong> jeweiligen speziellen Bedingungen, in <strong>de</strong>nen<br />
<strong>de</strong>r einzelne Mensch sein Leben entwickelt und gestaltet. Diese Umstän<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n nicht<br />
nur durch <strong>die</strong> Gegenwart <strong>de</strong>terminiert, son<strong>de</strong>rn ebenso durch <strong>die</strong> Vergangenheit.<br />
2.4 Auswertung <strong>de</strong>r Einzelfragen<br />
Die Auswertung fin<strong>de</strong>t in drei Schritten statt. Der erste Schritt bezieht sich auf <strong>die</strong> Gesamtheit<br />
<strong>de</strong>r Befragten und soll einen Gesamteindruck vermitteln. Um eventuelle Unterschie<strong>de</strong><br />
zwischen <strong>de</strong>n Projekten berücksichtigen zu können, wer<strong>de</strong>n im zweiten Schritt<br />
<strong>die</strong> Antworten <strong>de</strong>r Befragten zu Wildwasser und im dritten Schritt <strong>die</strong> zum Weglaufhaus<br />
ausgewertet. Die konkreten Fragen haben wir jeweils vor <strong>die</strong> Auswertung gestellt.<br />
2.4.1 Wusstest Du, dass es sich beim Weglaufhaus um ein Projekt han<strong>de</strong>lt, in <strong>de</strong>m<br />
MitarbeiterInnen selbst psychiatrische Gewalt erfahren haben?/ Wusstest Du<br />
dass es sich bei Wildwasser Selbsthilfe und Beratung um ein Projekt han<strong>de</strong>lt,<br />
in <strong>de</strong>m <strong>die</strong> Mitarbeiterinnen selbst sexuelle Gewalt erfahren haben?<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
ja 5 3 2<br />
nein 5 2 3<br />
75
Wenn ja, war es einer <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong> <strong>die</strong>se Einrichtung zu nutzen?<br />
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
ja 4 2 2<br />
nein 1 1 -<br />
Mit <strong>de</strong>r Eingangsfragestellung wollten wir <strong>de</strong>n öffentlichen Bekanntheitsgrad <strong>de</strong>s<br />
Betroffenenkontrollierten Ansatzes erfragen. Wir gingen davon aus, dass es selten aus-<br />
schließlich einen Grund <strong>für</strong> <strong>die</strong> Wahl eines Hilfeangebotes gibt. Dass jedoch je<strong>de</strong> be-<br />
wusste Entscheidung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzung mit einer eigenen Vorstellung von <strong>de</strong>r möglichen<br />
Qualität, <strong>die</strong> durch <strong>die</strong> Zusammenarbeit mit betroffenen Mitarbeitern entstehen kann,<br />
verbun<strong>de</strong>n ist. Diese Überlegungen spiegelt unsere Fragestellung wi<strong>de</strong>r.<br />
Die Hälfte <strong>de</strong>r Befragten waren über <strong>die</strong> Beschäftigung von Betroffenen in <strong>de</strong>n Projekten<br />
informiert und <strong>für</strong> 80 % von ihnen war <strong>die</strong>s ein Entscheidungskriterium <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzung<br />
<strong>de</strong>r Einrichtung. Das heißt <strong>für</strong> uns, dass <strong>de</strong>r Aspekt <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> nur mittelmäßig<br />
bekannt ist. Die Hälfte <strong>de</strong>r Befragten lernten <strong>die</strong>sen erst durch <strong>de</strong>n Aufenthalt in<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Kontakt mit <strong>de</strong>r Einrichtung kennen. Dies gilt <strong>für</strong> das Weglaufhaus und Wildwasser<br />
nahezu gleichermaßen.<br />
2.4.2 Was zeichnet <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiterinnen Deiner Meinung nach aus?<br />
− Unterstellte Kategorie: Authentizität, Vorbildfunktion<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Akzeptanz, Empathie, Vertrauenswürdigkeit, Unkenntlichkeit,<br />
Ebenbürtigkeit<br />
Akzeptanz Empathie Authentizität<br />
<strong>„</strong>Gelassenerer Umgang mit <strong>„</strong>verrückten“<br />
Zustän<strong>de</strong>n“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Sehr entgegenkommend“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Unaufdringliches/<br />
unzudringlicheres Mitge-<br />
fühl“(WLH)<br />
<strong>„</strong> Das sie vielleicht verstehen,<br />
schneller verstehen, warum es<br />
grad scheiße ist!“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Hilfsbereitschaft“ (WLH) An<strong>de</strong>re Reflexionsebene <strong>als</strong><br />
<strong>„</strong>Professionelle“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Sie sind nicht überfor<strong>de</strong>rt mit <strong>„</strong>Mehr Einfühlungsvermögen“<br />
krassen Situationen“ (WiWa) (Wiwa)<br />
<strong>„</strong>Mitarbeiterinnen bringen auch<br />
ihre Erfahrung ein und sind nicht<br />
<strong>„</strong>neutral“ “(WiWa)<br />
<strong>„</strong> Sie agieren aus einer Tiefe<br />
heraus, <strong>die</strong> sie selbst<br />
durchschritten haben“(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Beratung aus eigener Erfahrung<br />
heraus“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Transparenz <strong>de</strong>r eigenen <strong>Betroffenheit</strong><br />
und damit <strong>de</strong>r eigenen<br />
Persönlichkeit“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Empathie“(WiWa) <strong>„</strong>Integrität“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Helfen in je<strong>de</strong>r Lebensla- <strong>„</strong>Einfühlungsvermögen“ (Wi- <strong>„</strong>Mehr Engagement <strong>für</strong> das<br />
ge“(WiWa)<br />
Wa)<br />
Thema“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Immer Zeit, immer ansprechbar“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Verständnisvoll“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Für alle und je<strong>de</strong>n da“(WiWa) <strong>„</strong>Verständnis“(WiWa)<br />
76
Vertrauenswürdigkeit Unkenntlichkeit Ebenbürtigkeit<br />
<strong>„</strong>Gibt eventuell schneller Vertrauen<br />
und Kontakt zu Bewoh-<br />
nern“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Mehr Vertrauensvorschuss<br />
meinerseits“(WiWa)<br />
Vorbildfunktion<br />
<strong>„</strong>Das sie es auch geschafft haben“<br />
(WLH)<br />
Auswertung:<br />
<strong>„</strong>Ich habe zwischen Betroffen<br />
und nicht Betroffen keinen Un-<br />
terschied festgestellt.“(WLH)<br />
<strong>„</strong>Speziell <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiter<br />
sind mir nicht aufgefallen,<br />
alle waren verständnisvoller und<br />
mitfühlen<strong>de</strong>r <strong>als</strong> in <strong>de</strong>r Psychiatrie.“<br />
(WLH)<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Empathie: 8 3 5<br />
Akzeptanz: 7 3 4<br />
Authentizität: 6 - 6<br />
Unkenntlichkeit: 2 2 -<br />
Vertrauenswürdigkeit: 2 1 1<br />
Ebenbürtigkeit: 2 1 1<br />
Vorbildfunktion: 1 1 -<br />
<strong>„</strong>Das Gefühl, dass keiner über<br />
einem steht“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Es gibt eine Ebene von gleich<br />
zu gleich“ (WiWa)<br />
Hier fragten wir nach <strong>de</strong>n betroffenen Mitarbeitern. Dabei ging es darum herauszufin-<br />
<strong>de</strong>n, worin <strong>die</strong> Qualität <strong>de</strong>r Arbeit <strong>die</strong>ser Mitarbeiter besteht. Wir haben zwar <strong>die</strong> Kategorien<br />
Vorbildfunktion, Authentizität, positives Krisenverständnis und <strong>die</strong> kritische<br />
Reflexion bestimmter Themen unterstellt, sie jedoch nicht vorgegeben. Damit je<strong>de</strong>r Aspekt<br />
Würdigung fin<strong>de</strong>n konnte, haben wir <strong>die</strong>se Frage offen gestellt.<br />
Gezeigt hat sich, dass <strong>die</strong> Kategorien positives Krisenverständnis und <strong>die</strong> kritische Reflexion<br />
bestimmter Themen nicht bestätigt wur<strong>de</strong>n. Ursache da<strong>für</strong> könnte sein, dass<br />
bei<strong>de</strong> eher strukturelle Merkmale sind. Als neue Kategorien kamen hinzu: Akzeptanz,<br />
Empathie, Vertrauenswürdigkeit , Unkenntlichkeit und Ebenbürtigkeit.<br />
Die häufige Nennung von Empathie und Akzeptanz lässt darauf schließen, dass <strong>die</strong>se<br />
Fähigkeiten am charakteristischsten sind. Zwischen Weglaufhaus und Wildwasser gab<br />
es keinen signifikanten Unterschied.<br />
Authentizität wur<strong>de</strong> dagegen nur von <strong>de</strong>n Wildwassernutzerinnen genannt und ist<br />
gleichzeitig <strong>die</strong> häufigste Einzelnennung.<br />
Die Aspekte Vertrauenswürdigkeit und Ebenbürtigkeit wur<strong>de</strong>n gleichermaßen genannt.<br />
Die Vorbildfunktion steht mit einer Einzelnennung eher im Hintergrund.<br />
Im Weglaufhaus war <strong>de</strong>r Unterschied zwischen betroffenen und nicht betroffenen Mitarbeitern<br />
<strong>für</strong> zwei Befragte unkenntlich.<br />
77
2.4.3 Hat sich durch <strong>de</strong>n Kontakt zu <strong>de</strong>m Projekt Deine Sicht auf Krisen verän<strong>de</strong>rt?<br />
Wenn ja, wie?<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
ja 7 3 4<br />
nein 3 2 1<br />
− Unterstellte Kategorie: positives Krisenverständnis<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation, Verän<strong>de</strong>rtes<br />
Krisenverständnis<br />
Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit <strong>de</strong>r Positives Krisenverständnis Verän<strong>de</strong>rtes Krisenverständ-<br />
Krisensituation<br />
nis<br />
<strong>„</strong>Ich gehe mit meiner Krise ohne <strong>„</strong>Krise <strong>als</strong> <strong>„</strong>Ausprobieren“ neuer <strong>„</strong>Vom biologischen zum psy-<br />
Alkohol zurecht, in <strong>de</strong>m ich einen Handlungsweisen- und neuer cho-sozialen Ansatz.“(WLH)<br />
Gesprächspartner fin<strong>de</strong>“(WLH) Realitätsorientierung“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Durch <strong>die</strong> Erfahrungen mit <strong>de</strong>n <strong>„</strong>Dass sie dazu gehören und<br />
an<strong>de</strong>ren Bewohnern <strong>de</strong>s WLH`s,<br />
z.B. wenn jemand psychotisch<br />
drauf war, klingeln bei mir<br />
schneller <strong>die</strong> Alarmglocken. Meine<br />
Wahrnehmung hat sich verän<strong>de</strong>rt.<br />
Ich kann besser auf mich<br />
achten.“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Auch zur stärkeren Ich-<br />
Bezogenheit (warum erlebe ich<br />
meine Krise auf <strong>die</strong>se<br />
Art).“(WLH)<br />
<strong>„</strong>Ich akzeptiere und respektiere<br />
<strong>die</strong> vermeintlichen Macken von<br />
mir und an<strong>de</strong>ren ohne sie <strong>als</strong><br />
persönlichen Angriff zu sehen,<br />
o<strong>de</strong>r meine Mitmenschen darüber<br />
abzuwerten.“(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Erfahrungen zu teilen“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Aufgeschlossener“(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Ich bin wesentlich selbstbewusster<br />
im Umgang mit meinen Mitmenschen.<br />
Ich kann viel offener<br />
und liebevoller mit an<strong>de</strong>ren umgehen,<br />
da ich meine Grenzen gut<br />
zu setzen und zu schützen gelernt<br />
habe.“(WiWa)<br />
überlebbar sind“ (WiWa)<br />
78
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation<br />
7 3 4<br />
Positives Krisenverständnis 2 1 1<br />
Verän<strong>de</strong>rtes Krisenverständnis 1 1 -<br />
Wir haben nach <strong>de</strong>r individuellen Sicht auf <strong>die</strong> Krise gefragt. Schon bei <strong>de</strong>r Befragung<br />
haben wir gemerkt, dass es sich dabei um einen sehr abstrakten Begriff han<strong>de</strong>lt, <strong>de</strong>r<br />
häufig <strong>de</strong>r Erklärung bedurfte.<br />
Für sieben von zehn hat sich <strong>die</strong> Sicht auf ihre Krise durch <strong>de</strong>n Kontakt mit <strong>de</strong>n Projek-<br />
ten verän<strong>de</strong>rt. Beim Weglaufhaus traf es auf 60% und bei Wildwasser sogar auf 80% <strong>de</strong>r<br />
Befragten zu.<br />
Die Antworten zur näheren Beschreibung <strong>die</strong>ser Verän<strong>de</strong>rung waren mehrheitlich sehr<br />
persönlich. Es gab aber auch allgemeine Aussagen zur Krise. Deshalb benötigten wir<br />
drei Kategorien, <strong>die</strong> zunächst ähnlich erscheinen. Der verän<strong>de</strong>rte Umgang mit <strong>de</strong>r Krisensituation<br />
reflektiert <strong>die</strong> persönliche Ebene. Das positive Krisenverständnis beinhaltet<br />
eine bestimmte Vorstellung von Krisen und grenzt sich gegen <strong>„</strong> <strong>die</strong> Krise <strong>als</strong> Nie<strong>de</strong>rlage“<br />
ab. Dagegen ist das verän<strong>de</strong>rte Krisenverständnis neutral und beschreibt hauptsächlich<br />
einen Prozess.<br />
In <strong>de</strong>n Antworten zeigt sich <strong>de</strong>utlich, dass <strong>die</strong> persönliche Entwicklung im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
steht. Für <strong>die</strong> Mehrzahl geht es <strong>als</strong>o nicht um einen abstrakten Krisenbegriff, son<strong>de</strong>rn<br />
um reale Verän<strong>de</strong>rungen im Umgang mit <strong>de</strong>r eigenen Krise. Dieser wird wie<strong>de</strong>rum sehr<br />
unterschiedlich beschrieben. Man kann <strong>als</strong>o sagen: Je<strong>de</strong>r erlebt seine eigene Krise und<br />
muss aus seiner eigenen Geschichte heraus individuell Ansätze zur Bewältigung entwickeln.<br />
Das kann nur <strong>de</strong>rjenige selbst.<br />
An <strong>de</strong>r Vielfältigkeit <strong>de</strong>r Antworten zeigt sich auch, dass <strong>die</strong> Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Verän<strong>de</strong>rung bei <strong>de</strong>n Nutzern geblieben ist.<br />
79
2.4.4 Wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Projekten über <strong>die</strong> folgen<strong>de</strong>n Themen gesprochen?<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Gewalterfahrung ja 8 4 4<br />
nein 2 1 1<br />
Gewaltstrukturen ja 5 2 3<br />
nein 5 3 2<br />
Hierarchien ja 6 3 3<br />
nein 4 2 2<br />
Gesundheitsbegriff ja 6 3 3<br />
nein 4 2 2<br />
An<strong>de</strong>re ja 10 5 5<br />
Wenn ja, welche?<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Umgang mit Krisen, Lebensumstän<strong>de</strong>, Einzelnen-<br />
nungen<br />
Umgang mit Krisen Lebensumstän<strong>de</strong> Einzelnennungen<br />
<strong>„</strong>Suchtdruck“ (WLH) <strong>„</strong>Lebensziele und Umstän<strong>de</strong>“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Weiß ich nicht mehr“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Ängste“ (WiWa) <strong>„</strong>Elternhaus“ (WiWa) <strong>„</strong>Gott und <strong>die</strong> Welt“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Aktuelle Krisensituationen und <strong>„</strong>Beziehungen“ (WiWa) <strong>„</strong>Hygiene <strong>de</strong>s Hauses, was aber<br />
mögliche Bewältigungsstrategien“<br />
auch sofort danach egal war“<br />
(WiWa)<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Therapie“ (WiWa) <strong>„</strong>Lebenserfahrung“ (WiWa)<br />
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Umgang mit Krisen 4 1 3<br />
Lebensumstän<strong>de</strong> 4 - 4<br />
Einzelnennung 3 3 -<br />
Die in <strong>die</strong>ser Frage zu Grun<strong>de</strong> gelegten Begriffe Gewalterfahrung, Gewaltstruktur, Hie-<br />
rarchie und Gesundheitsbegriff sind <strong>de</strong>m theoretischen Konzept <strong>de</strong>s Betroffenenkontrol-<br />
lierten Ansatzes entliehen. Wir wollten herausfin<strong>de</strong>n, ob über <strong>die</strong>se Themen tatsächlich<br />
von und mit <strong>de</strong>n Nutzern <strong>de</strong>r Projekte gesprochen wur<strong>de</strong>. Die Antworten haben ergeben,<br />
dass <strong>die</strong>s in bei<strong>de</strong>n Einrichtungen gleichermaßen <strong>de</strong>r Fall war. Eine mögliche Erklärung<br />
warum Gewaltstruktur, Hierarchie und Gesundheitsbegriff von annähernd <strong>de</strong>r<br />
80
Hälfte <strong>de</strong>r Befragten nicht behan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>, kann im Abstraktionsgehalt <strong>de</strong>r Begriff-<br />
lichkeiten liegen. Auffällig war, dass acht von zehn Befragten über Gewalterfahrungen,<br />
<strong>die</strong> immer auch persönlich sind, im Projekt gesprochen haben. Die selbst genannten<br />
Themen <strong>de</strong>s offenen Teils haben ebenfalls einen unmittelbaren Bezug zum Leben und<br />
<strong>de</strong>n persönlichen Erfahrungen <strong>de</strong>r Befragten. Daraus schlussfolgern wir, dass haupt-<br />
sächlich Inhalte besprochen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> das eigene Leben erkennbar<br />
sind. Fehlt <strong>die</strong>ser Bezug o<strong>de</strong>r wird er nicht hergestellt, geht man das Risiko ein, einen<br />
relevanten Teil <strong>de</strong>r Nutzer nicht zu erreichen.<br />
2.4.5 Hast Du Erfahrungen mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems 1 gemacht?<br />
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
ja 9 5 4<br />
nein 1 - 1<br />
Erst durch Erfahrungen mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems kann ein Vergleich<br />
mit <strong>de</strong>n Projekten stattfin<strong>de</strong>n.<br />
Bis auf eine Ausnahme haben alle Befragten <strong>die</strong>se Erfahrungen gemacht.<br />
2.4.6 Stellt Wildwasser/das Weglaufhaus <strong>für</strong> Dich eine Alternative zum restlichen<br />
Hilfesystem dar?<br />
Wenn ja, warum?<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Ja 10 5 5<br />
− Unterstellte Kategorien: Schaffung von alternativen Strukturen, Positives Krisenverständnis<br />
Schaffung von alternativen Positives Krisenverständnis Einzelnennung<br />
1 Mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems sind soziale Einrichtungen gemeint, das heißt <strong>„</strong> Räume,<br />
Wohnungen und Gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Betriebe, in <strong>de</strong>nen regelmäßig eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt wird“<br />
(Goffman, 1995, 5), <strong>als</strong>o professionelle Hilfe angeboten wird. Dazu gehören auch <strong>die</strong> nicht an Räume<br />
gebun<strong>de</strong>nen Hilfeformen wie z.B. Streetwork o<strong>de</strong>r Betreutes-Einzel-Wohnen (BEW). (vgl. Deutscher<br />
Verein <strong>für</strong> öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.), 2002, 249)<br />
81
Strukturen<br />
<strong>„</strong>Weil ich dort freier leben und<br />
mich ausleben konnte. Für mich<br />
war es <strong>die</strong> Hilfe, <strong>die</strong> ich annehmen<br />
konnte, meine Ziele erreichen<br />
konnte, ohne vorher rausgeschmissen<br />
zu wer<strong>de</strong>n, weil ich<br />
nicht <strong>de</strong>m Regelkatalog entspre-<br />
che“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Das Aufnahmegespräch war<br />
positiv “ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Ebenso war gut selbst etwas tun<br />
zu müssen, wie kochen, einkaufen,<br />
putzen und <strong>die</strong><br />
Hausversammlung“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>In <strong>de</strong>r Organisation <strong>de</strong>s Hauses<br />
einen großen Unterschied zu an<strong>de</strong>ren<br />
Einrichtungen, man kann raus<br />
und rein, sich frei bewegen, spre-<br />
chen o<strong>de</strong>r nicht.“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Weg <strong>de</strong>s geringsten Zwangs“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Ich bin nur <strong>als</strong> Mensch in <strong>de</strong>r<br />
Krise gesehen wor<strong>de</strong>n, ohne dass<br />
<strong>die</strong> Sucht im Vor<strong>de</strong>rgrund stand<br />
und ohne <strong>als</strong> psychisch krank<br />
gesehen zu wer<strong>de</strong>n.“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Kreativer Umgang mit <strong>de</strong>m<br />
Leben an sich“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Persönlicheres Eingehen, kein<br />
Abfertigen, kein <strong>„</strong>in-eine-Bahndrängen“<br />
“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Aus <strong>de</strong>r eigenen <strong>Betroffenheit</strong><br />
<strong>de</strong>r Mitarbeiterinnen heraus<br />
macht <strong>für</strong> mich einen riesen Unterschied“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Bei WiWa weiß frau wovon sie<br />
spricht, es gibt keine Wertung,<br />
je<strong>de</strong> darf sein wie sie ist, das<br />
bestärkt sehr in eigenem TUN<br />
und SEIN“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Weil dort klar wird, dass <strong>die</strong><br />
Probleme <strong>„</strong>normal“ sind (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Auf einen eingehen“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Klares Angebot -<br />
(Selbsthilfegruppe)“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Selbsthilfeansatz wichtig“ (Wi-<br />
Wa)<br />
<strong>„</strong>Gesellschaftskritischer, verän- <strong>„</strong>Persönlicher, intensiver, <strong>„</strong>ein<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>r<br />
Ansatz fin<strong>de</strong> ich beson<strong>de</strong>rs<br />
und wesentlich“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Das damit verbun<strong>de</strong>ne Menschenbild<br />
fin<strong>de</strong> ich politisch wichtig“<br />
(WiWa)<br />
fach schön“ (WiWa)<br />
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Schaffung von alternativen Strukturen<br />
9 5 4<br />
Positives Krisenverständnis 8 2 6<br />
Einzelnennung 3 3 -<br />
<strong>„</strong>Prinzipiell ja. Aber, da wir viele<br />
sind bis heute, brauchten wir in<br />
<strong>die</strong>ser Zeit eigentlich geschlossene<br />
Türen, da wir <strong>de</strong>n Schutz vor<br />
uns und <strong>de</strong>r Sekte/Kult brauchten.<br />
Kein rein und raus!“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Psychiatrische Betreuer sind<br />
nicht so hilfsbereit“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Die Küche und wie es dort<br />
aussah hat <strong>für</strong> mich positive<br />
Erinnerungen hervorgerufen“<br />
(WLH)<br />
Mit <strong>de</strong>m Begriff Alternative wollten wir <strong>die</strong> Aufmerksamkeit <strong>de</strong>r Interviewten auf <strong>die</strong><br />
strukturellen Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>s Weglaufhauses und von Wildwasser lenken. Diese<br />
Form <strong>de</strong>r Fragestellung birgt <strong>die</strong> Gefahr, dass <strong>die</strong> Antworten zu absolut ausfallen, da<br />
nur mit Ja o<strong>de</strong>r Nein geantwortet wer<strong>de</strong>n konnte. Deshalb ergänzten wir <strong>die</strong> Frage um<br />
einen offenen Teil, <strong>de</strong>r <strong>die</strong> genauere Erläuterung <strong>de</strong>r Beson<strong>de</strong>rheiten erfragte und damit<br />
beschreibt, was unter <strong>de</strong>m Begriff Alternative von <strong>de</strong>n Einzelnen verstan<strong>de</strong>n wird.<br />
Alle Befragten waren, ohne lange überlegen zu müssen sicher, dass es sich bei <strong>de</strong>n Projekten<br />
um eine Alternative zum restlichen Hilfesystem han<strong>de</strong>lt.<br />
82
Die <strong>de</strong>r Frage unterstellten Kategorien Schaffung von alternativen Strukturen und das<br />
positives Krisenverständnis haben sich bestätigt. Letztere wur<strong>de</strong> mehrheitlich von <strong>de</strong>n<br />
Wildwassernutzerinnen reflektiert. Es ergaben sich keine weiteren Kategorien.<br />
2.4.7 Wie ist Deine Erfahrung mit<br />
• Teilfrage I : Professionellen Helfern wie Sozialarbeitern o<strong>de</strong>r Psychologen ?<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Kontakt, Graduelle Bewertung, Distanz, Hierarchie<br />
Graduelle Bewertung Distanz Hierarchie<br />
<strong>„</strong>Sozialarbeitern, da wür<strong>de</strong> ich <strong>die</strong><br />
fünf geben, Psychologen gebe ich<br />
eine drei“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>So unterschiedlich, wie <strong>die</strong><br />
Personen selbst, je<strong>de</strong> fachliche<br />
Sozialisation hat ihre Vor- und<br />
Nachteile“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Ich habe EINE sehr gute Psychotherapeutin<br />
kennen gelernt.“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Gut, abgegrenzter, emotionsloser,<br />
entfernter von <strong>de</strong>r Geschichte“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Manchmal etwas <strong>„</strong>Im-Regenstehen-gelassen“<br />
gefühlt“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Gefühl <strong>de</strong>r Isolation, keine Erlebnisschnittmenge,<br />
kein wirkliches<br />
Verständnis“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Überwiegend gut“ (WiWa) <strong>„</strong>Eigentlich nicht so gut, Probleme<br />
wer<strong>de</strong>n nicht intensiviert,<br />
mehr Verallgemeinerung, weniger<br />
personenbezogen“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Von gut über krass bis hin zu<br />
hilfreich und wichtig. An<strong>de</strong>re<br />
Beratungsstellen auch wichtig<br />
und manchmal nicht so gut“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Nicht ergiebig“ (WiWa)<br />
Kontakt<br />
<strong>„</strong>Schlecht, ihre Hilfe hat nicht<br />
dazu geführt, dass es mir besser<br />
ging o<strong>de</strong>r ich besser mit meinen<br />
Krisen umgehen konnte“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Gefahr, dass Professionelle Dinge<br />
auf Klienten projizieren.“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Kognitiv konnte niemand helfen“<br />
(WiWa)<br />
Auswertung:<br />
<strong>„</strong>Meistens durfte man nicht sagen<br />
was man <strong>de</strong>nkt, weil einem oft<br />
ein Strick daraus gedreht wur<strong>de</strong>.<br />
Deshalb wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Professionellen<br />
eher Mittel zum Zweck.“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Eigentlich gut, aber es gibt immer<br />
<strong>die</strong>ses Hierarchiegefälle, man<br />
ist selbst <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Problemfall“ (Wi-<br />
Wa)<br />
Da <strong>die</strong> Helfer selbst eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle im Hilfeprozess spielen, steht hier <strong>die</strong><br />
Erfahrung <strong>de</strong>r Befragten mit <strong>de</strong>n im Hilfesystem Arbeiten<strong>de</strong>n im Vor<strong>de</strong>rgrund. Wäh-<br />
rend <strong>de</strong>r Interviews stellte sich heraus, dass viele <strong>de</strong>r Befragten, insbeson<strong>de</strong>re <strong>die</strong> Nut-<br />
zer <strong>de</strong>s Weglaufhauses, nicht wussten, was mit selbst betroffenen Helfern und mit Hel-<br />
fern, <strong>die</strong> Profession und eigene Erfahrung verbin<strong>de</strong>n, gemeint ist. Es könnte daran gele-<br />
83
gen haben, dass wir zu <strong>de</strong>n letzten bei<strong>de</strong>n Teilfragen keine Hinweise auf <strong>de</strong>n Bezugs-<br />
rahmen gegeben haben, in <strong>de</strong>n <strong>die</strong>se eingeordnet wer<strong>de</strong>n konnten. Das wur<strong>de</strong> von uns in<br />
<strong>de</strong>n Interviews nachgeholt. Wir gaben folgen<strong>de</strong> Erklärung: betroffene Helfer fin<strong>de</strong>t man<br />
z.B. im Selbsthilfekontext; betroffene Helfer mit Zusatzqualifikation im sozialen Bereich<br />
arbeiten z.B. im Weglaufhaus und bei Wildwasser. Je<strong>de</strong> <strong>de</strong>r drei Teilfragen wur<strong>de</strong><br />
von uns offen gestellt, um <strong>de</strong>n tatsächlichen Erfahrungen <strong>de</strong>r Nutzer so nahe wie möglich<br />
zu kommen.<br />
Wir haben <strong>für</strong> alle drei Teilfragen <strong>die</strong> Kategorie Graduelle Bewertung eingeführt, da es<br />
Antworten gab, <strong>die</strong> eine Wertung vorgenommen haben ohne <strong>die</strong>se inhaltlich zu begrün<strong>de</strong>n.<br />
Die Antworten fassten wir unter <strong>de</strong>n Adjektiven positiv, negativ und neutral zusammen.<br />
Unter neutral verstehen wir, dass positive und negative Erfahrungen gleichermaßen<br />
gemacht wur<strong>de</strong>n.<br />
Zu Teilfrage I: Professionelle Helfer<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
6 3 3<br />
Graduelle Bewertung<br />
+ 0 - + 0 - + 0 -<br />
2 2 2 1 1 1 1 1 1<br />
Distanz 4 1 3<br />
Kontakt 3 1 2<br />
Hierarchie 2 1 1<br />
Als Kategorien in Bezug auf <strong>die</strong> professionellen Helfer ergaben sich: Distanz, Kontakt,<br />
Hierarchie und Graduelle Bewertung. Von sechs graduellen Nennungen waren je ein<br />
drittel positiv, negativ und neutral, was heißt, dass sich bei <strong>die</strong>ser Kategorie <strong>die</strong> positiven<br />
und negativen Erfahrungen <strong>die</strong> Waage halten. Auch gibt es hier keinen Unterschied<br />
zwischen <strong>de</strong>n Weglaufhaus- und Wildwassernutzerinnen.<br />
Die professionelle Distanz wur<strong>de</strong> sowohl positiv <strong>als</strong> auch negativ beschrieben. Bei <strong>de</strong>r<br />
positiven Erfahrung han<strong>de</strong>lte es sich um eine Einzelnennung. Bezeichnend ist, dass was<br />
einerseits geschätzt, von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren <strong>als</strong> störend empfun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>. Alle Nennungen,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> Distanz <strong>als</strong> kontraproduktiv empfan<strong>de</strong>n, kamen von Wildwassernutzerinnen.<br />
In Bezug auf <strong>de</strong>n Kontakt gab es ausschließlich negative Äußerungen. Sie reichten von<br />
wenig hilfreich bis zu einer potentiellen Gefahr.<br />
Das Hierarchiegefälle ist <strong>die</strong> am wenigsten genannte Kategorie. Die wahrgenommene<br />
Ungleichheit führt bei <strong>de</strong>n Nutzern dazu, sich in eine Schubla<strong>de</strong> gesteckt zu fühlen und<br />
zu einem taktischen Verhalten <strong>de</strong>n Helfern gegenüber.<br />
Zwei Drittel von 15 gegebenen Antworten bewerten <strong>die</strong> Erfahrung mit professionellen<br />
Helfern negativ, 70% davon kommen von Wildwassernutzerinnen.<br />
84
• Teilfrage II: Selbst betroffenen Helfern?<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Kontakt, Empathie, Graduelle Bewertung,<br />
Akzeptanz<br />
Kontakt Graduelle Bewertung Empathie<br />
<strong>„</strong>Ich hatte besseren Kontakt“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Geht so, oft braucht man/frau<br />
nicht so viel zu erzählen wie’s<br />
grad geht, da <strong>die</strong> Psychos selbst<br />
Erfahrung haben. Manchmal ist es<br />
aber auch ober krass , da <strong>die</strong> betroffenen<br />
Helfer selbst nicht mit<br />
ihrer Geschichte klarkommen. Oft<br />
Grenzüberschreitung “ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Ich konnte sagen was ich <strong>de</strong>nke,<br />
ohne das mir ein Strick daraus<br />
gedreht wur<strong>de</strong>. Aber nicht nur bei<br />
<strong>de</strong>n betroffenen MA war es so,<br />
son<strong>de</strong>rn bei allen.“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Hören zu, intensiver Austausch“<br />
(WiWa)<br />
Akzeptanz<br />
<strong>„</strong>Vielleicht stärker reflektierend<br />
im Sinne einer subjektiven Krisenerfahrung“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Erweiternd, das Gefühl man ist<br />
ok, so wie man ist erhält mehr<br />
Raum“ (WiWa)<br />
Zu Teilfrage II: Selbst betroffene Helfer<br />
<strong>„</strong>Ebenfalls sehr individuell“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Auch gemischt : von sehr gut<br />
über kann ich <strong>de</strong>nen vertrauen,<br />
bis, das fand ich jetzt aber blöd“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Gute Erfahrung, weil solche<br />
Leute in meiner Lage rein verset-<br />
zen können“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Verständnisvoll, helfen durch<br />
selbstgemachte Erfahrung“ (Wi-<br />
Wa)<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
2 1 1<br />
Graduelle Bewertung<br />
+ 0 - + 0 - + 0 -<br />
- 2 - - 1 - - 1 -<br />
Kontakt 4 3 1<br />
Empathie 2 1 1<br />
Akzeptanz 2 1 1<br />
Die meisten Antworten bezogen sich auf <strong>de</strong>n Kontakt. Von vier Nennungen kamen drei<br />
von Weglaufhaus- und eine von Wildwassernutzerinnen. Jeweils eine Nennung war<br />
ein<strong>de</strong>utig positiv. Eine war positiv, bezog sich aber nicht ausschließlich auf <strong>die</strong> selbst<br />
betroffenen Helfer, bei <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren hoben sich positive und negative Erfahrungen auf.<br />
85
Die vorgenommenen Graduellen Bewertungen bezogen sich auf <strong>die</strong> einzelnen Helfer<br />
und waren in ihrer Gesamtaussage neutral.<br />
Die Fähigkeit zur Empathie wur<strong>de</strong> in bei<strong>de</strong>n Antworten mit <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> in Verbindung<br />
gebracht und <strong>als</strong> hilfreich empfun<strong>de</strong>n.<br />
Akzeptanz wur<strong>de</strong> von Nutzern bei<strong>de</strong> Projekte gleichermaßen genannt. Die Möglichkeit,<br />
dass <strong>die</strong> eigene Krisenerfahrung eventuell eine individuellere Sicht auf <strong>die</strong> Krisen an<strong>de</strong>rer<br />
ergibt wur<strong>de</strong> von einem zum Weglaufhaus Befragten gesehen. Die Erfahrung <strong>de</strong>r<br />
Wildwassernutzerin war, sich selbst durch <strong>die</strong> Akzeptanz <strong>de</strong>r Mitarbeiterinnen besser<br />
annehmen zu können.<br />
70 % von zehn Antworten waren positiv, 30% neutral. Es gab keine negative Bewertung.<br />
Dies bezieht sich auf bei<strong>de</strong> Projekte gleichermaßen.<br />
• Teilfrage III: O<strong>de</strong>r mit Helfern, <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>s kombinieren, das heißt selbst betroffen<br />
sind und eine zusätzliche Qualifikation im Sozialen Bereich besitzen?<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Graduelle Bewertung, Empathie, Kontakt,<br />
Akzeptanz<br />
Graduelle Bewertung Kontakt Empathie<br />
<strong>„</strong>Ziemlich gut, wenn <strong>die</strong> HelferInnen<br />
ihre Geschichte bearbeitet<br />
haben und mit bei<strong>de</strong>n Beinen<br />
im Leben stehen“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Müssen sich stärker mit <strong>de</strong>m<br />
Gegensatz zwischen Professionalität<br />
und Intuition auseinan<strong>de</strong>rsetzen<br />
sind schnell intellek-<br />
tualisierend“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Gute Erfahrung“ (WLH) <strong>„</strong>Es gibt schnelleres Vertrauen“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Keine Ahnung was da jetzt<br />
an<strong>de</strong>rs sein soll, bei WiWa auch<br />
so und viele Psychologinnen<br />
und an<strong>de</strong>re sind auch betroffen“<br />
(<strong>„</strong>Auch gemischt : von sehr gut<br />
über kann ich <strong>de</strong>nen vertrauen,<br />
bis, das fand ich jetzt aber<br />
blöd“) (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Sicher das Optim<strong>als</strong>te, aber<br />
nicht nötig. Studium allein<br />
macht nicht Grad <strong>de</strong>r Qualität<br />
an Lebenshilfe“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Gut“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Das ist natürlich ziemlich klasse“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Kein Unterschied zu Betroffenen“<br />
(<strong>„</strong>Hören zu, intensiver<br />
Austausch“) (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Macht keinen Unterschied zum<br />
Betroffenen allgemein“ (<strong>„</strong>Gute<br />
Erfahrung, weil solche Leute sich<br />
in meiner Lage rein versetzen<br />
können“ ) (WLH)<br />
<strong>„</strong>Kein Unterschied zu Betroffenen“<br />
(<strong>„</strong>Verständnisvoll, helfen<br />
durch selbstgemachte Erfahrung“)<br />
(WiWa)<br />
86
Akzeptanz Einzelnennung<br />
<strong>„</strong>Positive Psychiatrieerfahrungen<br />
sind auf Vorbehalte gestoßen,<br />
bei allen Mitarbeitern.“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Die Öffentlichkeit <strong>de</strong>s Ansatzes<br />
ist wichtig und wie damit<br />
Politik gemacht wird ,und das<br />
Setting <strong>de</strong>r Einrichtung <strong>de</strong>r<br />
Hintergrund“ (WiWa)<br />
Zu Teilfrage III: Kombination aus eigener <strong>Betroffenheit</strong> und Profession<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
6 2 4<br />
Graduelle Bewertung<br />
+ 0 - + 0 - + 0 -<br />
5 1 - 2 - - 3 1 -<br />
Kontakt 3 2 1<br />
Empathie 2 1 1<br />
Akzeptanz 1 1 -<br />
Einzelnennung 1 - 1<br />
In vier von 13 Antworten wur<strong>de</strong> festgestellt, dass keine Unterschie<strong>de</strong> zu ausschließlich<br />
betroffenen Helfern ausgemacht wer<strong>de</strong>n konnten. Wir haben uns dagegen entschie<strong>de</strong>n,<br />
<strong>die</strong>se Antworten unter <strong>de</strong>r möglichen Kategorie <strong>„</strong>kein Unterschied zu betroffenen Helfern“<br />
aufzuführen, da sonst <strong>de</strong>r in Teilfrage II beschriebene Inhalt unberücksichtigt<br />
geblieben und eine Zuordnung nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Antworten sind<br />
<strong>de</strong>shalb in Klammern aufgeführt. Die Kategorien wur<strong>de</strong>n übernommen.<br />
Die Tatsache, dass <strong>für</strong> vier Nutzer <strong>die</strong> zusätzliche Ausbildung im Sozialen Bereich keinen<br />
nennenswerten Unterschied zu <strong>de</strong>n betroffenen Helfern allgemein ausmacht, wer<strong>de</strong>n<br />
wir in <strong>de</strong>r Gesamtauswertung interpretieren.<br />
Graduell wur<strong>de</strong> <strong>die</strong>ser Personenkreis positiv bewertet. Von sechs Nennungen war eine<br />
neutral.<br />
Zwei von drei Antworten beschreiben <strong>de</strong>n Kontakt <strong>als</strong> nah. Die dritte Nennung problematisiert<br />
<strong>de</strong>n <strong>„</strong>Gegensatz“ zwischen <strong>„</strong>Intuition“ und <strong>„</strong>Professionalität“ . Dieser Gegensatz<br />
wird <strong>als</strong> Ursache <strong>für</strong> eine verstärkte Intellektualisierung im Kontakt gesehen.<br />
Bei<strong>de</strong> Nennungen zur Empathie sind auf <strong>die</strong> Antworten zu Teilfrage II zurückzuführen,<br />
<strong>de</strong>shalb verzichten wir an <strong>die</strong>ser Stelle auf <strong>die</strong> Auswertung.<br />
Die Kategorien Kontakt und Empathie wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Befragten bei<strong>de</strong>r Projekte nahezu<br />
gleichermaßen genannt.<br />
Ein Weglaufhausnutzer stellte mangeln<strong>de</strong> Akzeptanz in Bezug auf positive Erfahrungen<br />
mit <strong>de</strong>r Psychiatrie fest.<br />
Die Einzelnennung stammt von einer Wildwassernutzerin. Sie weist auf <strong>de</strong>n strukturellen<br />
sowie <strong>de</strong>n politischen Zusammenhang, in <strong>de</strong>m sich <strong>die</strong> verschie<strong>de</strong>nen Helfer bewe-<br />
87
gen, hin. Auf <strong>die</strong>sen, von uns nicht ausreichend berücksichtigten Aspekt, gehen wir in<br />
<strong>de</strong>r Gesamtauswertung genauer ein.<br />
Neun von zwölf Antworten bewerteten <strong>die</strong> Erfahrung mit Helfern, <strong>die</strong> ihre eigene Be-<br />
troffenheit mit einer Ausbildung im Sozialen Bereich kombinieren, <strong>als</strong> positiv. Für zwei<br />
war sie negativ und <strong>für</strong> eine Befragte neutral. Die Negativnennungen stammen aus-<br />
schließlich von Weglaufhausnutzern.<br />
2.4.8 Hat <strong>de</strong>r Austausch von Erfahrungen mit betroffenen Mitarbeiterinnen eine<br />
Rolle <strong>für</strong> Dich gespielt?<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
ja 7 3 4<br />
nein 3 2 1<br />
Teilfrage I: Wenn ja wieso?<br />
− Unterstellte Kategorie: Vorbildfunktion,<br />
− Sich ergeben<strong>de</strong> Kategorien: Verbun<strong>de</strong>nheit, Empathie, Perspektivwechsel<br />
Verbun<strong>de</strong>nheit Perspektivwechsel Vorbildfunktion<br />
<strong>„</strong>Wegen <strong>de</strong>r ähnlichen Erfahrung.“<br />
(WLH)<br />
<strong>„</strong>Es gab einen Mitarbeiter <strong>de</strong>r<br />
seine Erfahrungen mit mir geteilt<br />
hat. Dadurch konnte ich auch<br />
schlechte Erinnerungen rauskra-<br />
men.“ (WLH)<br />
<strong>„</strong>Weil WiWa-Frauen absolut<br />
klasse sind s.o..WiWa so dankbar,<br />
dass ich mich selbst einbringe.<br />
Ohne WiWa dächte ich evtl. noch<br />
immer verzwickter Fall u. einzigartig<br />
(grins).“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>An<strong>de</strong>re Erfahrungen zu hören<br />
hat mir gezeigt, dass es verschie<strong>de</strong>ne<br />
Möglichkeiten gibt od. dass<br />
es an<strong>de</strong>ren ähnlich ging wie mir<br />
und dass das ok ist.“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong>Man ist plötzlich nicht mehr<br />
allein, kein Außerirdischer mehr,<br />
alle eigenen Probleme spiegeln<br />
sich plötzlich.“ (WiWa)<br />
Empathie<br />
<strong>„</strong>Verstehen besser durch <strong>Betroffenheit</strong>,<br />
können sich in meine<br />
Lage versetzen. Immer nett und<br />
freundlich.“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong> Weil sie meine eigenen Bewertungsmuster<br />
meiner Lebenssituation<br />
verän<strong>de</strong>rt hat.“ (WiWa)<br />
<strong>„</strong> Austausch von Bewältigungsstrategien,<br />
Ent<strong>de</strong>ckung von Stärken.“<br />
(WiWa)<br />
<strong>„</strong>Im WLH gesehen, dass <strong>„</strong>Verrückte“<br />
es <strong>„</strong>geschafft“ haben <strong>als</strong><br />
Sozialarbeiter dort zu arbeiten.<br />
Hoffnung <strong>für</strong> das eigene Leben“<br />
(WLH)<br />
88
Teilfrage II: Wenn nein, wieso?<br />
Selbsthilfe<br />
<strong>„</strong>Weil ich überhaupt nur mit ganz<br />
intimen Freun<strong>de</strong>n über meine Erfahrung<br />
re<strong>de</strong>“ (WLH)<br />
<strong>„</strong> Ich bin schnell in eine SHG und<br />
habe mich dort ausgetauscht.“<br />
(WiWa)<br />
Auswertung:<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Verbun<strong>de</strong>nheit 5 2 3<br />
Perspektivwechsel 2 - 2<br />
Empathie 1 - 1<br />
Vorbildfunktion 1 1 -<br />
Für 70 % <strong>de</strong>r Befragten hat <strong>de</strong>r Austausch von Erfahrungen mit <strong>de</strong>n betroffenen Mitar-<br />
beitern eine Rolle gespielt. Weglaufhaus und Wildwasser unterschei<strong>de</strong>n sich insofern,<br />
dass es bei Wildwasser nur <strong>für</strong> eine <strong>de</strong>r fünf Befragten keine Rolle gespielt hat, während<br />
es im Weglaufhaus <strong>für</strong> zwei von drei ebenso war.<br />
Die nähere Ausführung <strong>die</strong>ses Austausches und <strong>die</strong> jeweilige Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Einzelnen<br />
fin<strong>de</strong>t mittels <strong>de</strong>r Beantwortung <strong>de</strong>r offenen Teilfragen statt.<br />
Zu Teilfrage I:<br />
Die meisten Antworten konnten unter <strong>de</strong>r Kategorie Verbun<strong>de</strong>nheit zusammengefasst<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese setzt sich zusammen aus <strong>de</strong>r Erlebnisschnittmenge und <strong>de</strong>r daraus folgen<strong>de</strong>n<br />
Erkenntnis, dass man in seiner speziellen Lage nicht alleine ist. Dieser Aspekt<br />
wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Nutzern bei<strong>de</strong>r Projekte nahezu gleichermaßen benannt.<br />
Ausschließlich von Wildwassernutzerinnen wur<strong>de</strong>, <strong>als</strong> Folge <strong>de</strong>s Austausches von Erfahrungen,<br />
ein Perspektivwechsel genannt. Die bisherige Zwangsläufigkeit <strong>de</strong>r eigenen<br />
Handlungen konnte durch <strong>die</strong> Einbeziehung an<strong>de</strong>rer Sichtweisen in Frage gestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Kategorien Empathie und Vorbildfunktion waren von untergeordneter Be<strong>de</strong>utung.<br />
Sie wur<strong>de</strong>n jeweils nur einmal genannt. Die Nennung zu Empathie kam von einer<br />
Wildwasser-, <strong>die</strong> zur Vorbildfunktion von einer Weglaufhausnutzerin.<br />
Zu Teilfrage II:<br />
Es war uns ebenfalls wichtig zu erfragen, warum <strong>de</strong>r Austausch <strong>für</strong> Einzelne keine Rolle<br />
gespielt hat. Drei <strong>de</strong>r Befragten waren <strong>die</strong>ser Meinung, zwei erläuterten sie in Teilfrage<br />
II. Bei<strong>de</strong> wählten <strong>de</strong>n Weg <strong>de</strong>r Selbsthilfe. Der ehemalige Bewohner <strong>de</strong>s Weg-<br />
89
laufhauses fand <strong>die</strong>se im Freun<strong>de</strong>skreis, <strong>die</strong> Wildwassernutzerin wählte eine Selbsthil-<br />
fegruppe.<br />
2.5 Gesamtauswertung<br />
2.5.1 Tabellarische Übersicht <strong>de</strong>r Kategorien<br />
Wir haben hier <strong>die</strong> Kategorien in ihrer Gesamtheit dargestellt und sie nach Häufigkeit<br />
<strong>de</strong>r Nennung aufgeführt. Da <strong>die</strong> Nennungen in unterschiedlichen Zusammenhängen<br />
gegeben wur<strong>de</strong>n, ist <strong>die</strong> Aussagekraft nur bedingt <strong>für</strong> eine Gesamtauswertung nutzbar.<br />
Trotz<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n gewisse Ten<strong>de</strong>nzen sichtbar.<br />
Die häufige Nennung von Empathie, Akzeptanz, <strong>de</strong>m positiven Krisenverständnis, Kon-<br />
takt und <strong>de</strong>r Schaffung alternativer Strukturen im Kontext <strong>Betroffenheit</strong> wird in <strong>de</strong>r<br />
Diskussion <strong>de</strong>r Ergebnisse Thema sein. Auch <strong>die</strong> Tatsache, dass <strong>die</strong> Kategorien Distanz<br />
und Hierarchiegefälle nur in Verbindung mit <strong>de</strong>n Erfahrungen mit professionellen Hel-<br />
fern zum Tragen kommen, ist auffällig und wird dort erläutert.<br />
Gesamt WLH WiWa<br />
Empathie 13 5 8<br />
Akzeptanz 10 5 5<br />
Positives Krisenverständnis 10 3 7<br />
Kontakt 10 6 4<br />
Schaffung alternativer<br />
Strukturen<br />
9 5 4<br />
Verän<strong>de</strong>rter Umgang mit<br />
7 3 4<br />
<strong>de</strong>r Krisensituation<br />
Authentizität 6 - 6<br />
Verbun<strong>de</strong>nheit 5 2 3<br />
Distanz 4 1 3<br />
Vertrauenswürdigkeit 2 1 1<br />
Unkenntlichkeit 2 2 -<br />
Ebenbürtigkeit 2 1 1<br />
Vorbildfunktion 2 2 -<br />
Hierarchiegefälle 2 1 1<br />
Perspektivwechsel 2 - 2<br />
Selbsthilfe 2 1 1<br />
Verän<strong>de</strong>rtes Krisenverständnis<br />
1 1 -<br />
Einzelnennungen 7 6 1<br />
2.5.2 Diskussion und kritische Einschätzung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n haben wir <strong>die</strong> personelle und <strong>die</strong> strukturelle Ebene unterschie<strong>de</strong>n. Auf<br />
<strong>de</strong>r personellen Ebene fin<strong>de</strong>n sich <strong>die</strong> individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten, <strong>die</strong><br />
je<strong>de</strong>r Mitarbeiter in seine Arbeit einbringt, wie<strong>de</strong>r. Auf <strong>de</strong>r strukturellen Ebene geht es<br />
um <strong>die</strong> Frage, inwieweit eine Institution bestimmten Inhalten Rahmen und Raum gibt.<br />
90
Tatsächlich sind <strong>die</strong>se Ebenen nicht voneinan<strong>de</strong>r zu trennen, son<strong>de</strong>rn bedingen sich<br />
wechselseitig. Ein betroffener Mitarbeiter kann sich seiner speziellen Fähigkeiten noch<br />
so bewusst und auch bereit sein <strong>die</strong>se einzusetzen, wenn es aber <strong>de</strong>m Leitbild seiner<br />
arbeitgeben<strong>de</strong>n Institution wi<strong>de</strong>rspricht, sind sie nicht bzw. nur sehr begrenzt einsetzbar.<br />
Am Beispiel <strong>de</strong>s Weglaufhauses lässt sich beschreiben, dass selbst wenn <strong>die</strong>se bei<strong>de</strong>n<br />
Aspekte zusammenpassen, <strong>de</strong>r gesetzliche Rahmen Einschränkungen <strong>de</strong>r Gestaltungsmöglichkeiten<br />
mit sich bringen kann. Der Zwang <strong>de</strong>r individuellen Antragstellung, <strong>die</strong><br />
Begründung <strong>de</strong>r Notwendigkeit <strong>de</strong>s Aufenthaltes und <strong>die</strong> Abhängigkeit von <strong>de</strong>r Kostenübernahme<br />
<strong>de</strong>r jeweils zuständigen Sozialhilfeträger, erschweren, <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Krisenintervention,<br />
gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r doch oft schwierigen Anfangsphase. Die Notwendigkeiten<br />
<strong>de</strong>r Ämter müssen gegenüber <strong>de</strong>n Klienten durchgesetzt wer<strong>de</strong>n und ein beachtlicher<br />
Teil <strong>de</strong>r Kräfte ist in <strong>die</strong>ser Zeit gebun<strong>de</strong>n. Die <strong>de</strong>m Hilfeprozess zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong><br />
Beziehung zum Klienten wird <strong>als</strong>o auf Kosten bürokratischer Tätigkeiten gekürzt,<br />
<strong>de</strong>r gesamte Hilfeprozess dadurch möglicherweise verlängert. Die <strong>„</strong>täglichen Arbeitsroutinen“<br />
wer<strong>de</strong>n durch <strong>die</strong>se Form <strong>de</strong>r bürokratischen Kontrolle <strong>de</strong>r geleisteten Arbeit<br />
<strong>„</strong>erschwert und marginalisiert“ (Olk 1986, 125).<br />
Diese dritte Ebene <strong>de</strong>s <strong>„</strong>öffentlichen Sozialträgers“ war nicht Gegenstand <strong>de</strong>r Befragung,<br />
ist aber eine nicht zu vernachlässigen<strong>de</strong> Größe. Da sich aber alle drei Ebenen<br />
wechselseitig bedingen und <strong>für</strong> unsere Arbeit relevant sind, beziehen wir sie an <strong>die</strong>ser<br />
Stelle in unsere Untersuchung ein.<br />
Die Projekte arbeiten bei<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
mit überprüfbaren Kriterien. Da jedoch <strong>de</strong>r strukturelle Rahmen unterschiedlich ist, ergeben<br />
sich hieraus signifikante Unterschie<strong>de</strong>. Einige Antworten bezogen sich auf <strong>die</strong>se<br />
Unterschie<strong>de</strong>. Deshalb fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Vergleich <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Projekte im zweiten, auf <strong>die</strong><br />
Struktur bezogenen Teil, Beachtung.<br />
Wenn wir uns in <strong>de</strong>r vorangegangen Auswertung genauestens an unseren Fragebogen,<br />
seine Reihenfolge und <strong>die</strong> jeweils gegebenen Antworten gehalten haben, so geht es uns<br />
im Weiteren darum, das Ergebnis <strong>de</strong>r Befragung zu diskutieren und kritisch einzuschätzen.<br />
Hier haben wir auch auf <strong>die</strong> Erfahrungen zurückgegriffen, <strong>die</strong> wir in <strong>de</strong>n jeweiligen<br />
Praktika gewonnen haben und ebenso auf unser, durch das Studium erworbenes, Wissen.<br />
Die Sichtweisen <strong>de</strong>r Befragten sind wesentlicher Teil <strong>die</strong>ser Diskussion und darum<br />
auch hier wie<strong>de</strong>rgegeben.<br />
91
2.5.2.1 Personelle Ebene<br />
Am Anfang stand <strong>für</strong> uns <strong>die</strong> Frage, ob <strong>die</strong> <strong>de</strong>n betroffenen Mitarbeitern zugeschriebenen<br />
Eigenschaften <strong>als</strong> spezielle Ressource zu verstehen sind, über <strong>die</strong> nur <strong>die</strong>se Mitarbeiter<br />
verfügen.<br />
Wenn wir jetzt von <strong>de</strong>r personeller Ebene sprechen, dann meinen wir damit <strong>die</strong> Fähigkeiten,<br />
Eigenschaften o<strong>de</strong>r Merkmale, <strong>die</strong> einzelnen Personen betreffen.<br />
Wir gehen davon aus, dass <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiter <strong>die</strong> hier beschrieben wur<strong>de</strong>n, <strong>die</strong><br />
Mitarbeiter <strong>de</strong>r Projekte Weglaufhaus und Wildwasser sind, da keiner <strong>de</strong>r Interviewten<br />
von vergleichbaren Erfahrungen mit Mitarbeitern an<strong>de</strong>rer Einrichtungen sprach. Dass<br />
eine Interviewte in Psychologinnen Betroffene erkannt hat, steht dazu nicht im Wi<strong>de</strong>rspruch.<br />
Viele <strong>die</strong>ser zugeschriebenen Eigenschaften speisen sich aus <strong>de</strong>n Erfahrungen<br />
mit eben <strong>die</strong>sen Mitarbeitern, aber sind auch immer in Abgrenzung zu an<strong>de</strong>ren Erfahrungsbereichen,<br />
wie mit <strong>de</strong>n Mitarbeitern <strong>de</strong>r Psychiatrie o<strong>de</strong>r mit Sozialarbeitern in<br />
an<strong>de</strong>ren Einrichtungen o<strong>de</strong>r auch Psychotherapeuten zu sehen. Tatsächlich haben 90 %<br />
<strong>de</strong>r Befragten Erfahrungen mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems und somit natürlich<br />
auch mit <strong>de</strong>n jeweiligen Mitarbeitern dort. Sie verfügen <strong>als</strong>o über eine reale Vergleichsbasis.<br />
Die Nutzer und Nutzerinnen <strong>de</strong>s Weglaufhauses haben vor allem Erfahrungen<br />
mit Mitarbeitern <strong>de</strong>s psychiatrischen Versorgungssystems, bei <strong>de</strong>n Nutzerinnen<br />
von Wildwasser han<strong>de</strong>lt es sich häufig um Erfahrungen mit Sozialarbeitern, Psychotherapeuten<br />
und -therapeutinnen. Die beschriebenen professionellen Mitarbeiter waren <strong>als</strong>o<br />
in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Einrichtungen und Zusammenhängen aktiv.<br />
Akzeptanz, Empathie, und Vertrauenswürdigkeit wur<strong>de</strong>n <strong>als</strong> wichtige Eigenschaften <strong>de</strong>r<br />
betroffenen Helfer genannt. Die Fähigkeit <strong>die</strong> Nutzer und Nutzerinnen zu akzeptieren,<br />
ihnen empathisch zu begegnen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sehen wir<br />
nicht nur bei <strong>die</strong>sen Helfern, son<strong>de</strong>rn ebenso bei <strong>de</strong>n professionellen. Sie sind Grundvoraussetzungen<br />
im Hilfeprozess und wer<strong>de</strong>n von vielen Gesprächsführungstheorien<br />
wie z.B. in <strong>de</strong>r Klientenzentrierten Gesprächstherapie von Rogers o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Systemischen<br />
Beratung beschrieben und wur<strong>de</strong>n von uns Stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit im<br />
Lehrfach <strong>„</strong>Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit“ und <strong>„</strong>Psychosoziale Beratung“ erlernt und<br />
eingeübt.<br />
Der Umstand, dass <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiter in <strong>de</strong>n Augen einiger Nutzer <strong>de</strong>s Vertrauens<br />
würdiger sind, dadurch möglicherweise schneller in Kontakt kommen können,<br />
unterschei<strong>de</strong>t sie von <strong>de</strong>n nicht betroffenen. <strong>„</strong>Mehr Vertrauensvorschuss meinerseits“<br />
o<strong>de</strong>r <strong>„</strong>Gibt eventuell schneller Vertrauen und Kontakt zu Bewohnern“ lassen <strong>die</strong>sen<br />
92
Schluss zu, aber das <strong>„</strong>eventuell“ <strong>de</strong>utet wie<strong>de</strong>r auf <strong>die</strong> Persönlichkeit <strong>de</strong>s einzelnen Mitarbeiters,<br />
<strong>de</strong>nn es kann auch an<strong>de</strong>rs sein.<br />
Betont wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r <strong>„</strong>gelassener(e) Umgang“ <strong>de</strong>r betroffenen Mitarbeiter <strong>„</strong>mit <strong>„</strong>verrückten“<br />
Zustän<strong>de</strong>n“ und daraufhin gewiesen, dass sie mit <strong>„</strong>krassen Situationen“ nicht<br />
überfor<strong>de</strong>rt sind. Auch hier wäre anzumerken, dass Professionelle mit einer reichhaltigen<br />
Berufserfahrung durchaus in <strong>de</strong>r Lage sein können, Gelassenheit in schwierigen<br />
Situationen zu entwickeln o<strong>de</strong>r durch <strong>die</strong>se nicht überfor<strong>de</strong>rt zu sein.<br />
Die Möglichkeit, <strong>„</strong>dass sie vielleicht verstehen, schneller verstehen, warum es gera<strong>de</strong><br />
scheisse ist!“ wird gesehen und, dass sie <strong>de</strong>shalb auf eine Situation an<strong>de</strong>rs <strong>als</strong> nicht betroffene<br />
Mitarbeiter reagieren können. Auch hier fin<strong>de</strong>n wir ein <strong>„</strong>vielleicht“ und es gibt<br />
auch Erfahrungen, <strong>die</strong> in eine an<strong>de</strong>re Richtung <strong>de</strong>uten.<br />
<strong>„</strong>Geht so, oft braucht man/frau nicht so viel zu erzählen wie’s grad geht, da <strong>die</strong><br />
Psychos selbst Erfahrung haben. Manchmal ist es aber auch ober krass , da <strong>die</strong> betroffenen<br />
Helfer selbst nicht mit ihrer Geschichte klarkommen. Oft Grenzüberschreitung<br />
“<br />
Diese Erfahrungen stellen nicht in Frage, was von einer Nutzerin wie folgt beschrieben<br />
wird: <strong>„</strong>Sie agieren aus einer Tiefe heraus, <strong>die</strong> sie selbst durchschritten haben“. Mit<br />
<strong>die</strong>ser Aussage korrespon<strong>die</strong>rt, dass betroffenen Helfern eine <strong>„</strong>an<strong>de</strong>re Reflexionsebene<br />
<strong>als</strong> <strong>„</strong>Professionelle(n)““ zugeschrieben wird.<br />
Wir meinen, das Wissen, dass aus eigenen, unmittelbaren Erfahrungen gewonnen wird,<br />
umfassen<strong>de</strong>r <strong>als</strong> erlerntes ist. Es verbin<strong>de</strong>t, im Gegensatz zur rein theoretischen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit Gewalterfahrungen, <strong>die</strong> sinnliche mit <strong>de</strong>r rationalen Ebene. Die daraus<br />
erwachsenen Handlungsmöglichkeiten sind vielfältiger. Wer erfahren hat, wie es<br />
sich anfühlt zum Objekt <strong>de</strong>gra<strong>die</strong>rt zu wer<strong>de</strong>n, wer nicht heimisch wer<strong>de</strong>n konnte in<br />
unserer <strong>„</strong>normalen“ Welt, wer weiss, wie Ausgrenzung und Stigmatisierung <strong>die</strong> Seele<br />
verdunkeln können und wer aber auch in <strong>de</strong>r Schwäche Stärke ent<strong>de</strong>cken konnte und<br />
Wege aus <strong>die</strong>sen Krisen gefun<strong>de</strong>n hat, <strong>de</strong>r verfügt über ein reichhaltiges Repertoire an<br />
Handlungsmöglichkeiten, wenn <strong>die</strong> Erlebnisse zu Erfahrungen gemacht wur<strong>de</strong>n (vgl.<br />
Günther 1999, 193). Die Vermittlung <strong>de</strong>r jeweiligen Erfahrungen und <strong>de</strong>r Austausch<br />
darüber macht es <strong>de</strong>n Nutzerinnen und Nutzern möglich, <strong>die</strong> eigenen Aktions- und Reaktionsmuster<br />
zu hinterfragen, an<strong>de</strong>re Sichtweisen einzubeziehen und in <strong>die</strong>sem Prozess<br />
neue Handlungsansätze zu gewinnen.<br />
Genau <strong>die</strong>se neu gewonnenen Möglichkeiten drücken sich aus, wenn gesagt wird, <strong>„</strong>Ich<br />
gehe mit meiner Krise ohne Alkohol zurecht, in <strong>de</strong>m ich einen Gesprächspartner fin<strong>de</strong>“<br />
o<strong>de</strong>r <strong>„</strong>An<strong>de</strong>re Erfahrungen zu hören hat mir gezeigt, dass es verschie<strong>de</strong>ne Möglichkeiten<br />
gibt od. dass es an<strong>de</strong>ren ähnlich ging wie mir und, dass das ok ist.“ Hierher gehört<br />
93
auch, dass <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Austausch von Bewältigungsstrategien“ <strong>die</strong> <strong>„</strong>Ent<strong>de</strong>ckung von Stärken“<br />
möglich gemacht hat.<br />
Für <strong>die</strong> Bewältigung von Krisen und Traumata sind Ressourcen und eine Vielfalt von<br />
Handlungsmöglichkeiten von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung (vgl. Riecher-Rössler 2004,<br />
21). O<strong>de</strong>r wie Rüger u.a. formulieren:<br />
<strong>„</strong>Inzwischen steht es außer Zweifel, dass <strong>de</strong>r Ausgang einer Erkrankung o<strong>de</strong>r Lebenskrise<br />
oft weniger durch <strong>die</strong> Art und <strong>die</strong> objektive Schwere <strong>de</strong>s belasten<strong>de</strong>n Ereignisses<br />
selbst, son<strong>de</strong>rn weitaus mehr dadurch bestimmt wird, welche Bewältigungsmöglichkeiten<br />
einem Menschen in einer bestimmten Situation zur Verfügung<br />
stehen“(Rüger 1990, 9).<br />
Auch professionelle Helfer arbeiten ressourcenorientiert und unterstützen Nutzer bei <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung neuer Bewältigungsstrategien, aber sie können <strong>die</strong>se nicht austauschen. Sie<br />
sind nicht <strong>als</strong> Person kenntlich, was <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>die</strong> professionelle Distanz<br />
entspricht. Sie wird auch <strong>als</strong> <strong>„</strong>Gut, abgegrenzter, emotionsloser, entfernter von <strong>de</strong>r Geschichte“<br />
geschätzt. Aber <strong>de</strong>r Zusammenhang <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Transparenz <strong>de</strong>r eigenen <strong>Betroffenheit</strong><br />
und damit <strong>de</strong>r eigenen Persönlichkeit“, wie ihn eine Interviewte feststellt, bleibt<br />
relevant. Und so sind <strong>die</strong> Erfahrungen mit Professionellen <strong>„</strong>Eigentlich gut, aber es gibt<br />
immer <strong>die</strong>ses Hierarchiegefälle, man ist selbst <strong>de</strong>r ‚Problemfall’“ wie es eine an<strong>de</strong>re<br />
Nutzerin ausdrückt.<br />
Durch <strong>die</strong> Integration eigener Lebenserfahrungen in <strong>de</strong>n Hilfeprozess erfährt <strong>de</strong>r Nutzer<br />
seine aktuelle Lage <strong>als</strong> situativ. Die Beraterin von heute ist <strong>die</strong> Hilfesuchen<strong>de</strong> von gestern.<br />
Die Beziehung kann sich auf einer egalitären Basis entwickeln, sie kann ebenbürtig<br />
sein, o<strong>de</strong>r um wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n Worten einer Nutzerin zu sprechen: <strong>„</strong>Es gibt eine Ebene<br />
von gleich zu gleich“. Diese Möglichkeit hat nur <strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r <strong>die</strong> betroffene Helferin, <strong>die</strong><br />
sich immer wie<strong>de</strong>r bewusst entschei<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Klienten eigene Erfahrungen zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
Das be<strong>de</strong>utet im Umkehrschluss aber nicht, dass zwischen Mitarbeiterinnen und Nutzerinnen<br />
keine Hierarchie besteht. Schon <strong>die</strong> Tatsache, dass einer <strong>de</strong>r Hilfe bedarf und <strong>de</strong>r<br />
An<strong>de</strong>re sie gibt, begrün<strong>de</strong>t ein Machtgefälle und eine Hierarchie. Verhältnisse können<br />
trotz<strong>de</strong>m hierarchiearm gestaltet wer<strong>de</strong>n, z.B. in<strong>de</strong>m <strong>die</strong> beim Klienten vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Ressourcen sofort in <strong>de</strong>n Hilfeprozess einbezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
Nun könnte eingewandt wer<strong>de</strong>n, dass auch professionelle Helfer Lebenserfahrungen mit<br />
in <strong>de</strong>n Hilfeprozess einfließen lassen.<br />
Der Unterschied besteht unserer Meinung darin, dass es sich eben nicht um eine irgendwie<br />
geartete Erfahrung, son<strong>de</strong>rn um eine Gewalterfahrung mit oftm<strong>als</strong> traumati-<br />
94
schen Folgen, dass es sich um eine Erfahrung im Grenzbereich han<strong>de</strong>lt. Diese Erfah-<br />
rungen sind Teil <strong>de</strong>s weiteren Lebens <strong>de</strong>r Betroffenen. Die Gefahr, dass sich Ausgren-<br />
zung und Stigmatisierung, ausgelöst durch eine neuerliche Krise, wie<strong>de</strong>rholen könnten,<br />
ist nicht von <strong>de</strong>r Hand zu weisen. Diese Problematik spiegelt sich unserer Meinung<br />
nach auch in <strong>de</strong>r Entscheidung <strong>de</strong>s Weglaufhaus-Teams, <strong>die</strong> jeweilige <strong>Betroffenheit</strong><br />
ihrer Mitarbeiter in <strong>de</strong>r Außendarstellung nicht offen zu machen. Das Team von Wild-<br />
wasser hat <strong>die</strong>se Frage an<strong>de</strong>rs entschie<strong>de</strong>n. Alle Mitarbeiterinnen sind je<strong>de</strong>rzeit <strong>als</strong> Be-<br />
troffene zu erkennen. Sie geben <strong>die</strong>sen speziellen Erfahrungen Gewicht und positionie-<br />
ren sich.<br />
Vor <strong>die</strong>sem Hintergrund sehen wir auch <strong>die</strong> von vielen Wildwassernutzerinnen genann-<br />
te Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Authentizität <strong>de</strong>r Mitarbeiterinnen.<br />
<strong>„</strong>Mitarbeiterinnen bringen auch ihre Erfahrung ein und sind nicht <strong>„</strong>neutral“ wird ge-<br />
sagt und dass sie <strong>„</strong>Mehr Engagement <strong>für</strong> das Thema“ aufbringen.<br />
Ebenso stehen sie da<strong>für</strong>, dass Gewalterfahrungen in das weitere Leben integriert wer<strong>de</strong>n<br />
können.<br />
Dies kann potentiell alle betroffenen Mitarbeiter auch zu Vorbil<strong>de</strong>rn machen, aber <strong>die</strong>se<br />
Funktion war nur <strong>für</strong> einen Nutzer von Be<strong>de</strong>utung.<br />
Für vier von zehn Befragten war kein Unterschied zwischen betroffenen Helferinnen<br />
und solchen mit Zusatzqualifikationen feststellbar. Insgesamt hatte <strong>de</strong>r Betroffenenaspekt<br />
mehr Gewicht o<strong>de</strong>r wie es eine Befragte ausdrückt <strong>„</strong>Sicher das Optim<strong>als</strong>te, aber<br />
nicht nötig. Studium allein macht nicht Grad <strong>de</strong>r Qualität an Lebenshilfe“. Für einen<br />
an<strong>de</strong>ren Befragten ist sein Votum mit einer Einschränkung verbun<strong>de</strong>n: <strong>„</strong>Ziemlich gut,<br />
wenn <strong>die</strong> HelferInnen ihre Geschichte bearbeitet haben und mit bei<strong>de</strong>n Beinen im Leben<br />
stehen“. Auch wir meinen, dass <strong>die</strong> Bearbeitung <strong>de</strong>r eigenen Geschichte eine Voraussetzung<br />
ist, um an<strong>de</strong>ren Menschen zu helfen. Allerdings sind viele Sichtweisen möglich,<br />
wenn es darum geht zu bestimmen, was es heißt mit bei<strong>de</strong>n Beinen im Leben zu<br />
stehen. Als weiterer Aspekt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Gegensatz zwischen Professionalität und Intuition“<br />
genannt und <strong>als</strong> Folge gesehen, dass <strong>die</strong>se Mitarbeiter <strong>„</strong>schnell intellektualisierend“<br />
sind. Sicherlich ist <strong>die</strong>s ein Auseinan<strong>de</strong>rsetzungsfeld, dass <strong>die</strong> Professionalisierung<br />
mit sich bringt, jedoch ist Intellektualisierung keine zwangsläufige, son<strong>de</strong>rn nur<br />
eine mögliche Folge. <strong>Betroffenheit</strong> und Professionalität können auch eine sehr produktive<br />
Verbindung eingehen.<br />
Auffällig war in <strong>die</strong>sem Zusammenhang, dass <strong>die</strong> meisten ehemaligen Nutzer <strong>de</strong>s Weglaufhauses<br />
zwischen betroffenen und nichtbetroffenen Mitarbeitern nicht unterschei<strong>de</strong>n<br />
konnten. Auf <strong>die</strong>se fehlen<strong>de</strong> Unterscheidungsmöglichkeit sind wir erstmalig in <strong>de</strong>r In-<br />
95
terviewsituation gestoßen, aber auch in <strong>de</strong>n Interviews selbst ist <strong>die</strong>s festzustellen.<br />
<strong>„</strong>Speziell <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiter sind mir nicht aufgefallen, alle waren verständnisvoller<br />
und mitfühlen<strong>de</strong>r <strong>als</strong> in <strong>de</strong>r Psychiatrie“ und <strong>„</strong>Ich habe zwischen Betroffen und<br />
nicht Betroffen keinen Unterschied festgestellt“ wur<strong>de</strong> gesagt.<br />
Bedingt durch <strong>die</strong> Tatsache, dass nur 50% <strong>de</strong>r Weglaufhausmitarbeiter Betroffene sind,<br />
wird <strong>de</strong>r Unterschied unkenntlich und <strong>de</strong>r individuelle Kontakt zwischen Mitarbeiter<br />
und Nutzer entschei<strong>de</strong>t, ob <strong>die</strong> speziellen Ressourcen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> eigene <strong>Betroffenheit</strong> bietet,<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n können. Der Nutzer o<strong>de</strong>r <strong>die</strong> Nutzerin müssen ihre Beziehungsfähigkeit<br />
soweit stabilisiert haben, dass <strong>die</strong> Frage nach <strong>de</strong>r <strong>Betroffenheit</strong> <strong>de</strong>s jeweiligen<br />
Mitarbeiters möglich wird und <strong>die</strong> Mitarbeiter müssen in <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Situation<br />
darauf eingehen können. Es könnte eingewandt wer<strong>de</strong>n, dass <strong>die</strong>se Unterscheidungsfähigkeit<br />
nicht von Be<strong>de</strong>utung ist, da <strong>die</strong> Struktur <strong>de</strong>r Einrichtung <strong>die</strong> Bedürfnisse von<br />
Betroffenen reflektiert. Darauf könnten auch <strong>die</strong> überwiegend positiven Bewertungen<br />
<strong>de</strong>r ehemaligen Nutzer und Nutzerinnen <strong>de</strong>s Weglaufhauses hin<strong>de</strong>uten. Diese Bewertungen<br />
können aber ebenso <strong>de</strong>m Regime in <strong>de</strong>r Psychiatrie geschul<strong>de</strong>t sein, <strong>de</strong>nn dagegen<br />
heben sie sich ab.<br />
Wir meinen, dass ein offener und offensiver Umgang mit <strong>de</strong>r eigenen <strong>Betroffenheit</strong>,<br />
zumin<strong>de</strong>st innerhalb <strong>de</strong>r Einrichtung, <strong>die</strong>ses Potential klarer nutzen könnte.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, Empathie und Akzeptanz sind Ressourcen in <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit, <strong>die</strong> sowohl bei betroffenen wie auch bei nicht betroffenen Helfern zu<br />
fin<strong>de</strong>n sind.<br />
Ebenso sind bei<strong>de</strong> Gruppen von Mitarbeitern fähig, sich <strong>de</strong>s Vertrauens <strong>de</strong>r Nutzerinnen<br />
und Nutzer <strong>als</strong> würdig zu erweisen und in <strong>de</strong>r Lage, eine <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Hilfeprozess tragfähige<br />
Beziehung zu etablieren.<br />
Jedoch besteht zwischen <strong>de</strong>n professionellen Helfern und Helferinnen auf <strong>de</strong>r einen<br />
Seite und Nutzerinnen und Nutzern auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite immer ein Machtgefälle, dass<br />
sowohl personell <strong>als</strong> auch institutionell begrün<strong>de</strong>t ist.<br />
Begegnen sich Mitarbeiter und Nutzer <strong>„</strong>Von gleich zu gleich“, bauen sie eine ebenbürtige<br />
Beziehung auf und wer<strong>de</strong>n in <strong>die</strong>sem Ansatz institutionell unterstützt, ist erfahrene<br />
Ausgrenzung und Stigmatisierung nicht nur aufgehoben, son<strong>de</strong>rn <strong>die</strong> Selbstbestimmung<br />
<strong>de</strong>r Hilfesuchen<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> Weg und Ziel ist, erhält sofort Raum. Und auf <strong>die</strong>ser Basis<br />
können alle an<strong>de</strong>ren Ressourcen, <strong>die</strong> betroffenen Helfern im beson<strong>de</strong>rn Maße zugeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n, wie Empathie, Akzeptanz und das positive Krisenverständnis <strong>de</strong>n<br />
Prozess beschleunigen.<br />
96
2.5.2.2 Strukturelle Ebene<br />
Wie bereits erwähnt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass <strong>de</strong>r strukturelle Aspekt von Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
geleistete Arbeit in <strong>de</strong>n Projekten ist. Einerseits in Abgrenzung zu an<strong>de</strong>ren Projekten,<br />
an<strong>de</strong>rerseits in Bezug auf <strong>de</strong>n einzelnen Mitarbeiter und <strong>die</strong> einzelne Mitarbeiterin im<br />
Kontakt mit <strong>de</strong>n Nutzern und Nutzerinnen.<br />
Was <strong>die</strong> Abgrenzung <strong>de</strong>r Projekte Wildwasser und Weglaufhaus zu an<strong>de</strong>ren Einrichtun-<br />
gen <strong>de</strong>s Gesamthilfesystems bzw. <strong>die</strong> Öffentlichkeit <strong>de</strong>r Projekte angeht, wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n<br />
Befragten von einem beson<strong>de</strong>ren Menschenbild und dazu passen<strong>de</strong>m Krisenverständnis<br />
gesprochen. Ein Befragter sagte dazu: <strong>„</strong>Ich bin nur <strong>als</strong> Mensch in <strong>de</strong>r Krise gesehen<br />
wor<strong>de</strong>n, ohne dass <strong>die</strong> Sucht im Vor<strong>de</strong>rgrund stand und ohne <strong>als</strong> psychisch krank gesehen<br />
zu wer<strong>de</strong>n“. Der Ausdruck <strong>„</strong>nur <strong>als</strong> Mensch in <strong>de</strong>r Krise“ macht <strong>de</strong>utlich, wie<br />
wichtig es <strong>de</strong>m Befragten war, nicht in ein pathologisches Krankheitsbild eingeordnet<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Diese Ten<strong>de</strong>nz spiegeln auch Antworten, wie <strong>die</strong> einer an<strong>de</strong>ren Befragten,<br />
<strong>die</strong> <strong>„</strong>Krise <strong>als</strong> <strong>„</strong>Ausprobieren“ neuer Handlungsweisen- und neuer Realitätsorientierung“<br />
betrachtet, wi<strong>de</strong>r. Es ist in <strong>de</strong>n Projekten <strong>als</strong>o möglich, seine Krise individuell zu<br />
erleben. Wir sprechen dabei von einem positiven Krisenverständnis (siehe 2.2.3), das<br />
von <strong>de</strong>n Projekten strukturell vertreten wird und hier von <strong>de</strong>n Nutzerinnen und ehemaligen<br />
Nutzern erfahren und beschrieben wur<strong>de</strong>.<br />
Dieses Krisenverständnis in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit zu vermitteln schließt <strong>die</strong> politische Ebene<br />
mit ein. Dabei han<strong>de</strong>lt es sich um einen <strong>„</strong>Gesellschaftskritische(n), verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>(n)<br />
Ansatz“, <strong>de</strong>r sich gegen <strong>die</strong> herrschen<strong>de</strong> Meinung richtet und mit <strong>de</strong>m <strong>die</strong> Projekte Stellung<br />
beziehen. Dazu gehört zum Beispiel <strong>„</strong>ver-rückte Zustän<strong>de</strong>“ nicht <strong>als</strong> Krankheit zu<br />
sehen, son<strong>de</strong>rn <strong>als</strong> individuelle Reaktion auf eine schwierige Situation, <strong>die</strong> sich ebenfalls<br />
sehr individuell gestaltet und nur so gelöst wer<strong>de</strong>n kann.<br />
<strong>„</strong>Die Öffentlichkeit d(ies)es Ansatzes ist wichtig“, so eine Befragte und das <strong>„</strong>Setting <strong>de</strong>r<br />
Einrichtung(,) <strong>de</strong>r Hintergrund“ spielt eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle da<strong>für</strong>,“ wie damit Poli-<br />
tik gemacht wird“.<br />
Wir <strong>de</strong>nken, dass hierin eine große Funktion <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes und<br />
damit <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Projekte liegt. Durch <strong>die</strong> parteiliche Struktur und <strong>die</strong> dazugehören<strong>de</strong><br />
Öffentlichkeitsarbeit, <strong>die</strong> ganz klar Stellung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzer und sich selbst in <strong>de</strong>r Rolle<br />
<strong>de</strong>r <strong>„</strong>Betroffenen“ bezieht, kommt ein Vertrauen zustan<strong>de</strong>, welches <strong>die</strong> Menschen, <strong>die</strong><br />
sexuelle o<strong>de</strong>r psychiatrische Gewalt erfahren haben, stärkt (vgl. Hagemann-White u.a.<br />
97
1997, 208 ff.). Die Notwendigkeit, sich öffentlich mit Tabuthemen wie sexuellem Miss-<br />
brauch und psychischen Ausnahmezustän<strong>de</strong>n auseinan<strong>de</strong>rzusetzen und <strong>die</strong>sbezüglich<br />
Aufklärungsarbeit zu leisten, ist so lange gegeben, bis sich auf gesamtgesellschaftlicher<br />
Ebene eine an<strong>de</strong>re Sicht durchgesetzt hat.<br />
Die Antworten sprechen da<strong>für</strong>, dass ein Bewusstsein <strong>für</strong> <strong>die</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatzes bei <strong>de</strong>n Befragten vorhan<strong>de</strong>n ist.<br />
Die Möglichkeiten zur Selbsthilfe wird ebenfalls durch <strong>die</strong> Projekte gestärkt. So bietet<br />
das Weglaufhaus <strong>die</strong> Möglichkeit, während <strong>de</strong>s Aufenthaltes dort und auch darüber hinaus,<br />
Kontakte zu an<strong>de</strong>ren Psychiatriebetroffenen aufzubauen und sich damit gegenseitige<br />
Stütze und auch eventuell <strong>„</strong>Spiegel“ zu sein.<br />
<strong>„</strong>Durch <strong>die</strong> Erfahrungen mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Bewohnern <strong>de</strong>s WLH`s, z.B. wenn jemand<br />
psychotisch drauf war, klingeln bei mir schneller <strong>die</strong> Alarmglocken. Meine<br />
Wahrnehmung hat sich verän<strong>de</strong>rt. Ich kann besser auf mich achten.“<br />
sagt einer <strong>de</strong>r zum Weglaufhaus Befragten. Bei Wildwasser ist <strong>die</strong> Unterstützung zur<br />
Gründung einer Selbsthilfegruppe Teil <strong>de</strong>s <strong>„</strong>Klare(s)n Angebot(s)“. Der <strong>„</strong>Selbsthilfeansatz“<br />
wird <strong>als</strong> <strong>„</strong>wichtig“ erachtet.<br />
Diese strukturelle Ebene wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r stärken<strong>de</strong>n, akzeptieren<strong>de</strong>n Funktion jedoch<br />
auch <strong>als</strong> ausgrenzend beschrieben. Von einem Befragten wur<strong>de</strong> berichtet, dass <strong>„</strong>bei al-<br />
len Mitarbeitern“ <strong>„</strong>Positive Psychiatrieerfahrungen (sind) auf Vorbehalte gestoßen“<br />
sind. Diese Reaktion ist sicherlich auf das antipsychiatrische Konzept <strong>de</strong>s Weglaufhauses<br />
zurückzuführen. Auch wenn es unter <strong>de</strong>n einzelnen Mitarbeitern <strong>die</strong>sbezüglich einen<br />
unterschiedlichen Umgang gibt, wird eine relative Klarheit in punkto <strong>„</strong>antipsychiatrischer<br />
Grundhaltung“ von <strong>de</strong>n Mitarbeitern verlangt. Diese Entscheidung ist strukturell<br />
betrachtet wichtig, um <strong>die</strong> Abgrenzung zum psychiatrischen System <strong>de</strong>utlich zu machen,<br />
sorgt jedoch auf <strong>de</strong>r persönlichen Ebene zwischen Bewohner und Mitarbeiterin<br />
gelegentlich <strong>für</strong> Unverständnis. Was sich hier begegnet, ist einerseits <strong>die</strong> Erfahrung <strong>de</strong>r<br />
Nutzer mit <strong>de</strong>r Psychiatrie, <strong>die</strong> eben auch positiv sein kann, und <strong>die</strong> übergeordnete antipsychiatrische<br />
Haltung, <strong>die</strong> gegebenenfalls mit eigenen negativen Erfahrungen <strong>de</strong>s Mitarbeiters<br />
gepaart ist. Der Mitarbeiter steht hier in <strong>de</strong>m Dilemma sich zwischen eigener<br />
Erfahrung, Authentizität und Haltung und <strong>de</strong>r Wertschätzung und Akzeptanz <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>ren<br />
zu entschei<strong>de</strong>n.<br />
Die bei<strong>de</strong>n Projekte unterschei<strong>de</strong>n sich strukturell insofern, dass es sich bei Wildwasser<br />
um eine Einrichtung han<strong>de</strong>lt, <strong>die</strong> in Form von Beratung, Treffpunkt, Selbsthilfegruppen und<br />
an<strong>de</strong>ren Angeboten zusätzlich zum <strong>„</strong>normalen“ Alltag <strong>de</strong>r Nutzerinnen angelegt ist. Beim<br />
Weglaufhaus han<strong>de</strong>lt es sich um eine Kriseneinrichtung <strong>die</strong> <strong>„</strong>Rund-Um-Die-Uhr-Betreuung“<br />
98
anbietet. Wildwasser ist Einrichtungs-, das Weglaufhaus Tagessatzfinanziert. Wildwas-<br />
ser wird durch eine Geschäftsführung geleitet und vertreten und das Weglaufhaus ist ein<br />
selbstverwaltetes Projekt. Bei Wildwasser sind 100% <strong>de</strong>r Mitarbeiterinnen betroffen, im<br />
Weglaufhaus min<strong>de</strong>stens 50%. Diese strukturellen Unterschie<strong>de</strong> wirken sich auf <strong>die</strong><br />
Arbeit aus.<br />
Während <strong>die</strong> Art <strong>de</strong>r Finanzierung und <strong>die</strong> Form <strong>de</strong>r Verwaltung keine direkte Erwäh-<br />
nung fan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> <strong>die</strong> Mitarbeiterinnenstruktur sowie <strong>die</strong> Grundstruktur <strong>de</strong>s <strong>„</strong>ambu-<br />
lanten“ bzw. <strong>„</strong>stationären“ Angebotes näher ausgeführt.<br />
Bei Wildwasser war <strong>die</strong> Abgrenzung zwischen betroffenen und nicht betroffenen Mitar-<br />
beiterinnen innerhalb <strong>de</strong>r Einrichtung nicht von Belang, während es im Weglaufhaus<br />
Aussagen dazu gab. Diese bezogen sich allerdings weitgehend darauf, wie bereits oben<br />
erwähnt, dass kein wesentlicher Unterschied zwischen <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Mitarbeitern<br />
festgestellt wur<strong>de</strong>. Im <strong>die</strong>sem Zusammenhang wur<strong>de</strong> <strong>die</strong> Struktur <strong>de</strong>s Weglaufhauses <strong>als</strong><br />
sehr wichtig wahrgenommen. Gera<strong>de</strong> weil dort 50% nicht betroffene Mitarbeiter arbeiten<br />
und somit <strong>die</strong> Abgrenzung zu an<strong>de</strong>ren Projekten nicht so <strong>de</strong>utlich geschieht, wie bei<br />
Wildwasser, muss unserer Meinung nach <strong>die</strong>se Deutlichkeit von Seiten <strong>de</strong>r Struktur<br />
geleistet wer<strong>de</strong>n. Dass das Weglaufhaus <strong>als</strong> Alternative zum restlichen Hilfesystem<br />
wahrgenommen wur<strong>de</strong>, hatte unterschiedliche Grün<strong>de</strong>. Der <strong>„</strong>Weg <strong>de</strong>s geringsten<br />
Zwangs“ war einerseits Grund da<strong>für</strong>. Eine <strong>de</strong>r Befragten beschrieb <strong>die</strong>sen Aspekt folgen<strong>de</strong>rmaßen:<br />
<strong>„</strong>Weil ich dort freier leben und mich ausleben konnte. Für mich war es <strong>die</strong> Hilfe, <strong>die</strong><br />
ich annehmen konnte, meine Ziele erreichen konnte, ohne vorher rausgeschmissen zu<br />
wer<strong>de</strong>n, weil ich nicht <strong>de</strong>m Regelkatalog entspreche“.<br />
An<strong>de</strong>rerseits war es <strong>„</strong>gut, selbst etwas tun zu müssen, wie kochen, einkaufen, putzen und<br />
<strong>die</strong> Hausversammlung“. Diese bereits in <strong>de</strong>r Struktur verankerten Merkmale sind ebenso<br />
entschei<strong>de</strong>nd da<strong>für</strong>, wie hilfreich sich <strong>de</strong>r Kontakt zu einer Einrichtung <strong>für</strong> einen Hilfesu-<br />
chen<strong>de</strong>n gestaltet, wie <strong>die</strong> persönliche Begegnung mit <strong>de</strong>n Mitarbeitern <strong>de</strong>r Einrichtung.<br />
99
Teil IV: Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Soziale Arbeit<br />
1. Die Klient – Helferbeziehung in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
Wenn wir <strong>die</strong> Geschichte <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit betrachten, ist festzustellen, dass sich <strong>die</strong><br />
Existenz eines hierarchischen Verhältnisses zwischen Hilfesuchen<strong>de</strong>m und Hilfegeben-<br />
<strong>de</strong>m von <strong>de</strong>n Anfängen bis in <strong>die</strong> Gegenwart gehalten hat. Alle bis zu <strong>de</strong>n sechziger<br />
Jahren in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland entwickelten Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
sahen <strong>de</strong>n Hilfesuchen<strong>de</strong>n <strong>als</strong> Objekt, <strong>de</strong>m sie ihre Hilfe zuteil wer<strong>de</strong>n ließen. In <strong>de</strong>n<br />
achtziger Jahren tastete <strong>die</strong> Bürger- und Selbsthilfebewegung <strong>die</strong>ses Verhältnis an. Es<br />
fand eine Modifikation <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit statt, aber am grundsätzlichen<br />
Verhältnis zwischen Klientin und Helferin hat sich nichts entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s geän<strong>de</strong>rt.<br />
Noch heute bestehen <strong>die</strong> Elemente eines methodischen Ansatzes immer aus Anamnese<br />
und Diagnose, <strong>die</strong> durch <strong>de</strong>n Sozialarbeiter vergeben wer<strong>de</strong>n. Der Klient wird dabei<br />
zwar beteiligt, aber trotz<strong>de</strong>m liegt <strong>die</strong> Entscheidungs- und Deutungsmacht beim Sozialarbeiter.<br />
Die darauf folgen<strong>de</strong>n Therapie- und Handlungskonzepte wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Professionellen<br />
bestimmt. Das Subjekt <strong>die</strong>ses Prozesses ist <strong>als</strong>o <strong>de</strong>r Sozialarbeiter, <strong>de</strong>r über<br />
<strong>die</strong> zu geben<strong>de</strong> Hilfe entschei<strong>de</strong>t. Der Klient bleibt Objekt <strong>die</strong>ses Hilfeprozesses. Er<br />
wird in unterschiedlichen Formen beteiligt, aber <strong>die</strong> Entscheidungen wer<strong>de</strong>n nicht von<br />
ihm getroffen. Die Evaluation <strong>de</strong>s Erreichten ist ebenfalls Aufgabe <strong>de</strong>s Professionellen.<br />
Dieser steht seinerseits unter <strong>de</strong>r Kontrolle <strong>de</strong>s Auftraggebers <strong>„</strong>Staat“. Der Sozialarbeiter<br />
steht somit zwischen <strong>de</strong>n zwei Parteien. Einerseits soll er seinem Klienten aus einer<br />
schwierigen Situation helfen, an<strong>de</strong>rerseits soll er seinen staatlichen Auftrag verfolgen.<br />
In bestimmten Konstellationen wi<strong>de</strong>rsprechen sich <strong>die</strong>se Aufträge.<br />
Obwohl oft in <strong>de</strong>r Fachliteratur von Ressourcenorientierung <strong>die</strong> Re<strong>de</strong> ist, ist Hilfe ohne<br />
Defizitbeschreibung und <strong>die</strong> darauf folgen<strong>de</strong> Diagnosevergabe auch heute kaum zu erhalten.<br />
<strong>„</strong>Die meisten Professionellen haben eine <strong>de</strong>fizitorientierte Sichtweise. Zwar wer<strong>de</strong>n<br />
Schlagworte wie z.B. Ressourcenaktivierung, Vermeidung von Chronifizierung und<br />
Mo<strong>de</strong>worte wie ‚Empowerment’ und ‚Recovery’ immer öfter genannt, doch im Umgang<br />
mit KlientInnen hat sich dadurch wenig geän<strong>de</strong>rt, und <strong>die</strong> große Zahl <strong>de</strong>r Betroffenen,<br />
<strong>die</strong> vom Hilfesystem abhängig sind, spricht eine an<strong>de</strong>re Sprache.“ (Klafki<br />
2004, 7).<br />
100
2. Das Wachstums- und das Hierarchiemo<strong>de</strong>ll nach Virginia Satir<br />
In <strong>de</strong>n sechziger und siebziger Jahren beeinflusste Virginia Satir (1916-1988), <strong>die</strong> <strong>als</strong><br />
<strong>die</strong> Mutter <strong>de</strong>r Familientherapie bezeichnet wird, das systemische Denken und Han<strong>de</strong>ln<br />
nachhaltig. Ihre Wurzeln hatte sie in <strong>de</strong>r Humanistischen Psychologie.<br />
<strong>„</strong> Sie vertrat <strong>die</strong> Ansicht, dass unsere Welt auf einem hierarchischen Ursache-<br />
Wirkung-Denkmo<strong>de</strong>ll beruht, das linear, einengend, verurteilend und bestrafend ist<br />
und keinen Raum <strong>für</strong> persönliche Entwicklung zulässt“ (http://www.muenchnerfamilien-kolleg.<strong>de</strong>/vsg/vsg.html).<br />
Daraufhin entwickelte Virginia Satir das Wachstumsmo<strong>de</strong>ll, um damit <strong>die</strong> Einzigartig-<br />
keit eines je<strong>de</strong>n Menschen im Kontext darzustellen und zu würdigen. Sie stellte <strong>de</strong>m<br />
Wachstumsmo<strong>de</strong>ll das Hierarchiemo<strong>de</strong>ll gegenüber. Die Erkenntnisse, <strong>die</strong> in <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>n<br />
Mo<strong>de</strong>lle einflossen, resultierten einerseits aus <strong>de</strong>n gesellschaftlichen Bedingungen <strong>de</strong>r<br />
fünfziger Jahre in <strong>de</strong>n USA, wo Virginia Satir lebte und ihrer direkten Arbeit mit Fami-<br />
lien.<br />
Das Hierarchiemo<strong>de</strong>ll ist gekennzeichnet durch ein geschlossenes System mit disfunk-<br />
tionalen Strukturen und unoffenen Regeln. Letztere umfassen Verhaltensregeln, <strong>die</strong><br />
normativ festgelegt und an Rollen orientiert sind. Nach ihnen soll und muss gehan<strong>de</strong>lt<br />
wer<strong>de</strong>n. Dieses Mo<strong>de</strong>ll funktioniert durch unverrückbare Regeln hierarchisch. Der<br />
Selbstwert <strong>de</strong>r Person wird durch Anpassungsdruck in Frage gestellt. Es existieren ungleiche<br />
Machtverhältnisse und individuelle Wünsche wer<strong>de</strong>n ignoriert.<br />
Dagegen ist das Wachstumsmo<strong>de</strong>ll ein offenes System mit funktionalen Strukturen und<br />
offenen Regeln. Das be<strong>de</strong>utet, dass Vereinbarungen unter klaren Angaben getroffen<br />
wer<strong>de</strong>n. Verständnisfragen und Wünsche sind dabei erlaubt. Es beinhaltet einen hohen<br />
Selbstwert und Flexibilität in <strong>de</strong>n Wahlmöglichkeiten <strong>de</strong>r einzelnen Person. Der<br />
Mensch ist potentiell gut und fähig sich individuell zu entwickeln.<br />
Vier Bereiche wer<strong>de</strong>n in bei<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen einer genaueren Betrachtung unterzogen:<br />
1. Die Definition von Beziehungen<br />
2. Die Definition <strong>de</strong>s Menschen<br />
3. Die Definition von Ereignissen<br />
4. Die Sichtweise von Verän<strong>de</strong>rungen<br />
Im Hierarchie-Mo<strong>de</strong>ll wird <strong>die</strong> I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r Beziehung von außen über Rolle und Status<br />
<strong>de</strong>finiert und basiert auf Machtstrukturen. Der Mensch <strong>de</strong>finiert sich über ihm zugedachte<br />
Aufgaben und Rollen. Ereignisse wer<strong>de</strong>n linear vereinfacht gesehen und <strong>als</strong> richtig<br />
o<strong>de</strong>r f<strong>als</strong>ch, bzw. gut o<strong>de</strong>r böse bewertet. Es wird versucht <strong>de</strong>n Status quo zu erhalten,<br />
<strong>de</strong>nn Verän<strong>de</strong>rungen erscheinen <strong>als</strong> bedrohlich.<br />
101
Im Wachstums-Mo<strong>de</strong>ll wird I<strong>de</strong>ntität durch <strong>die</strong> Existenz <strong>de</strong>r Person im Einzelnen be-<br />
stimmt. Rollen und Status wer<strong>de</strong>n im Kontext <strong>de</strong>finiert. Je<strong>de</strong>r ist einzigartig und ohne<br />
Vor- o<strong>de</strong>r Nachrang. Die Ganzheit <strong>de</strong>s Menschen basiert auf <strong>de</strong>r Erkenntnis <strong>de</strong>s eigenen<br />
Wesens und <strong>de</strong>r Akzeptanz <strong>de</strong>r Unterschie<strong>de</strong> zu an<strong>de</strong>ren. Die Definitionen von Ereig-<br />
nissen sind variabel und vielfältig, im Kontext zu sehen und sind flexibel gestaltbar.<br />
Verän<strong>de</strong>rungen sind Möglichkeit und Chance.<br />
Es han<strong>de</strong>lt sich hierbei um Mo<strong>de</strong>lle, <strong>die</strong> nur Orientierungscharakter haben können und<br />
nicht stereotyp anwendbar sind. Jedoch eröffnen sie uns Erklärungsansätze menschli-<br />
chen Verhaltens und Erlebens. Sie können zur Veranschaulichung auf kleine Systeme,<br />
wie eine Familie, mittelgroße Systeme, wie eine soziale Einrichtung o<strong>de</strong>r große Systeme,<br />
wie Staaten, angewandt wer<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>lle können innerhalb eines Systems<br />
vorkommen. Es ist zum Beispiel möglich innerhalb eines Gesellschaftssystems das<br />
weitgehend <strong>de</strong>m Hierarchiemo<strong>de</strong>ll entspricht, Subsysteme zu fin<strong>de</strong>n, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Annahmen<br />
<strong>de</strong>s Wachstumsmo<strong>de</strong>lls beinhalten. Die bei<strong>de</strong>n Systeme beeinflussen einan<strong>de</strong>r dabei<br />
gegenseitig (vgl. Satir 1990). Die Gegenüberstellung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lle ist in <strong>die</strong>sem<br />
Zusammenhang interessant, weil es sich bei <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projekten, um<br />
Subsysteme in einem gegensätzlich organisierten Staatssystem han<strong>de</strong>lt. Die Projekte<br />
entsprechen dabei eher <strong>de</strong>m Wachstumsmo<strong>de</strong>ll, <strong>die</strong> BRD eher <strong>de</strong>m Hierarchiemo<strong>de</strong>ll.<br />
3. Die Selbsthilfe, <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierte Ansatz, und <strong>die</strong> Profession <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit<br />
In unserer Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m Betroffenenkontrollierten Ansatz und <strong>de</strong>n Projekten<br />
haben wir festgestellt, dass sich im Rahmen <strong>de</strong>r Selbsthilfebewegung eigene<br />
Werte und Ansätze entwickelt haben. Sie ähneln <strong>de</strong>n Merkmalen <strong>de</strong>s Wachstumsmo<strong>de</strong>lls<br />
und somit auch <strong>de</strong>n Werten <strong>de</strong>r systemischen Therapie, welche auf einem humanistischen<br />
Weltbild basiert. Das heißt <strong>als</strong>o, dass zwei in ihren Ursprüngen unterschiedliche<br />
<strong>„</strong>Bewegungen“ durch ihre Arbeit und <strong>die</strong> Umstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r damaligen Zeit zu<br />
ähnlichen Ergebnissen kamen. Die eine bestand aus Professionellen, <strong>die</strong> an<strong>de</strong>re aus Betroffenen.<br />
Bei<strong>de</strong> waren an <strong>de</strong>r freien Entfaltung <strong>de</strong>s Menschen interessiert.<br />
Die Projekte Tauwetter, Wildwasser und das Weglaufhaus haben ihre Ursprünge in <strong>de</strong>r<br />
Selbsthilfe und legen großen Wert darauf, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r Selbsthilfe entstan<strong>de</strong>nen<br />
Errungenschaften in ihrer Projektarbeit zu verwirklichen. Das Hierarchiemo<strong>de</strong>ll beschreibt<br />
<strong>die</strong> Struktur, gegen <strong>die</strong> sich <strong>die</strong> Projekte ein<strong>de</strong>utig im Wi<strong>de</strong>rspruch befin<strong>de</strong>n.<br />
102
Während <strong>die</strong> Humanistische Psychologie in <strong>de</strong>n USA bereits in <strong>de</strong>n sechziger Jahren<br />
Einfluss gewann, dauerte es in <strong>de</strong>r BRD bis in <strong>die</strong> späten sechziger bzw. achtziger Jah-<br />
re, bis <strong>die</strong>se Entwicklungen breitere Beachtung fan<strong>de</strong>n.<br />
Zunächst diskutierten <strong>die</strong> kritischen Psychologen und Sozialarbeiter im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
Stu<strong>de</strong>ntenbewegung <strong>die</strong> Annahmen, <strong>die</strong> <strong>de</strong>n oben im Wachstumsmo<strong>de</strong>ll beschriebenen<br />
sehr nahe kamen. Die For<strong>de</strong>rung, das hierarchische System aufzugeben und zu einem<br />
liberaleren, <strong>die</strong> Persönlichkeit <strong>de</strong>s Einzelnen achten<strong>de</strong>n zu fin<strong>de</strong>n, war dabei ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<br />
Punkt.<br />
Ebenfalls wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong> bestehen<strong>de</strong>n gesellschaftlichen Werte und Normen in Frage gestellt.<br />
Das Aufkommen <strong>de</strong>r zunehmend ökonomisierten Bürgergesellschaft wur<strong>de</strong> <strong>als</strong><br />
Ursache <strong>für</strong> <strong>die</strong> sozialen Probleme <strong>de</strong>r damaligen Zeit gesehen. Hierin liegt <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Unterschied zu Virginia Satirs Annahmen. Auch wenn <strong>die</strong> systemische Therapie<br />
das Umfeld <strong>de</strong>s Einzelnen mit einbezog, suchte sie doch auf einer persönlichen<br />
Ebene nach Lösungen. Die politische Dimension blieb dabei unberührt, während <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
emanzipatorischen Bewegungen <strong>de</strong>r siebziger Jahre <strong>de</strong>r Fokus genau darauf lag, <strong>die</strong><br />
gesellschaftliche Verantwortung zu for<strong>de</strong>rn.<br />
Der Sozialen Arbeit wur<strong>de</strong> vorgeworfen sie sei <strong>„</strong>ausführen<strong>de</strong>s Organ eines repressiven<br />
und ausbeuterischen Systems“ welches sich dazu verpflichtet, <strong>„</strong><strong>die</strong> herrschen<strong>de</strong>n ge-<br />
sellschaftlichen Normen auch gegen <strong>die</strong> Interessen <strong>de</strong>r Betroffenen durchzusetzen“<br />
(Heiner 2004, 27).<br />
Daraus entwickelte sich in <strong>de</strong>n achtziger Jahren <strong>die</strong> Selbsthilfebewegung. Der Konflikt<br />
mit <strong>de</strong>m hierarchisch orientierten und organisierten Hilfesystem war Grund da<strong>für</strong>, dass<br />
<strong>die</strong> Betroffenen sich selbst organisierten. Sie entwickelten dabei einen völlig eigenständigen<br />
Ansatz und <strong>de</strong>finierten eigene Werte und ihre eigenen Vorstellungen von Hilfe.<br />
Diese wur<strong>de</strong>n in Form von Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfegruppen und Ähnlichem<br />
in <strong>de</strong>r Praxis umgesetzt.<br />
Es gab dabei Überschneidungen <strong>de</strong>r Inhalte mit <strong>de</strong>n progressiven, kritischen Professionellen<br />
und <strong>de</strong>r Selbsthilfebewegung. Auch <strong>die</strong> Frauenbewegung und <strong>die</strong> Anti-<br />
Psychiatriebewegung waren gekennzeichnet durch ihre emanzipatorischen For<strong>de</strong>rungen.<br />
Die gemeinsamen Inhalte wur<strong>de</strong>n untereinan<strong>de</strong>r diskutiert.<br />
Trotz<strong>de</strong>m blieb <strong>die</strong> Selbsthilfebewegung zunächst unabhängig. Diese Unabhängigkeit<br />
von professioneller Hilfe war beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>r Bewegung von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<br />
Wichtigkeit. Es ging darum, sich selbst und an<strong>de</strong>ren Betroffenen zu helfen und<br />
eben nicht darum, professionelle Hilfe zu erhalten. <strong>„</strong>(…) Das Hilfesystem, das auf Aus-<br />
103
schluss <strong>de</strong>s Erfahrungswissens und auch auf einem strukturellen Ausschluss <strong>de</strong>r Betrof-<br />
fenen <strong>als</strong> Partner basiert“ (FaFür alle Fälle e.V. 2005, 14), wur<strong>de</strong> nicht <strong>als</strong> hilfreich<br />
empfun<strong>de</strong>n. Es galt sogar <strong>als</strong> hin<strong>de</strong>rlich bei <strong>de</strong>r Entwicklung von Selbsthilfekräften.<br />
<strong>„</strong>Ein neues Selbstverständnis entst(and)eht, das gekennzeichnet (war)ist durch <strong>die</strong> Übernahme<br />
und durch <strong>die</strong> For<strong>de</strong>rung nach mehr Selbstbestimmung“ (Moeller 1992,<br />
281).<br />
In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Zeit wur<strong>de</strong>n <strong>die</strong> unterschiedlichsten Mo<strong>de</strong>lle von Selbsthilfepraxis<br />
entworfen. So hat sich auch <strong>die</strong> Zusammenarbeit von Selbsthilfekräften mit professionellen<br />
Helfern etabliert. Es gibt heute eine Reihe von Selbsthilfeorganisationen 1 , <strong>die</strong><br />
von Professionellen gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, an<strong>de</strong>re wer<strong>de</strong>n von ihnen unterstützt und wie<strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>re 2 lehnen <strong>die</strong> Hilfe von Professionellen strikt ab.<br />
Die Arbeit <strong>de</strong>r Selbsthilfegruppen ist in <strong>de</strong>n achtziger Jahren <strong>als</strong> preiswerte Ergänzung<br />
zum professionellen Gesundheitssystem von <strong>de</strong>n Kostenträgern ent<strong>de</strong>ckt wor<strong>de</strong>n. Daher<br />
können Gesundheitliche Selbsthilfegruppen von <strong>de</strong>r gesetzlichen Krankenversicherung<br />
geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Grundlage ist <strong>de</strong>r § 20 Abs. 4 <strong>de</strong>s Sozialgesetzbuch V. Außer<strong>de</strong>m<br />
fin<strong>de</strong>t Unterstützung durch z.B. <strong>die</strong> Rentenversicherungen, aber auch <strong>die</strong> Kommunen<br />
und Län<strong>de</strong>r statt.<br />
Auch <strong>die</strong> Soziale Arbeit in ihrer Profession erkannte <strong>die</strong> Leistungen <strong>de</strong>r Selbsthilfe und<br />
<strong>die</strong> darin liegen<strong>de</strong>n Ressourcen an. Seit 1983 wur<strong>de</strong> Selbsthilfe erstm<strong>als</strong> in Berlin geför<strong>de</strong>rt.<br />
Die Selbsthilfeför<strong>de</strong>rung ist mittlerweile zum festen Bestandteil <strong>de</strong>r Sozialetats<br />
gewor<strong>de</strong>n ( vgl. Günther 1999, 25).<br />
In <strong>de</strong>r Arbeit mit behin<strong>de</strong>rten Menschen und <strong>de</strong>r Drogenhilfe wer<strong>de</strong>n immer mehr Betroffene<br />
eingesetzt. Die vorhan<strong>de</strong>ne Szenenähe und persönliche Nähe zu <strong>de</strong>n Problemen<br />
<strong>de</strong>r Klienten wird dabei von <strong>de</strong>n professionellen Helfern beson<strong>de</strong>rs geschätzt. Darin<br />
liegen Ressourcen, <strong>die</strong> in einer Ausbildung nicht erlernt wer<strong>de</strong>n können. Folglich sind<br />
sie <strong>für</strong> <strong>die</strong> Professionellen selbst schwer o<strong>de</strong>r gar nicht zu erlangen. Diese so genannten<br />
Laienhelfer wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong>o in bestimmten Bereichen <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit eingesetzt. Oft<br />
han<strong>de</strong>lte es sich dabei um ehrenamtliche o<strong>de</strong>r nur gering bezahlte Stellen. Die Qualität<br />
<strong>de</strong>r Arbeit <strong>die</strong>ser Laienhelfer wur<strong>de</strong> von Karlsruher, Carkhuff und Durlak in zahlrei-<br />
1<br />
<strong>„</strong>Selbsthilfeorganistionen' sind Zusammenschlüsse von Menschen mit chronischen Krankheiten und<br />
Behin<strong>de</strong>rungen. Sie sind meist auf Län<strong>de</strong>r- und/o<strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sebene <strong>als</strong> e.V. organisiert und ihrerseits<br />
wie<strong>de</strong>r Mitglied in einer Dachorganisation (auf Bun<strong>de</strong>sebene heißt <strong>die</strong>se "Bun<strong>de</strong>sarbeitgemeinschaft<br />
Selbsthilfe"). Auch <strong>de</strong>m Deutschen Paritätischen Wohlfahrstsverband (DPWV) sind viele Organisationen<br />
angeschlossen.“ (http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Selbsthilfeorganisation)<br />
2<br />
Etwa <strong>die</strong> Hälfte aller Selbsthilfegruppen sind freie, nicht organisierte Selbsthilfegruppen, ihre Mitglie<strong>de</strong>r<br />
sind ausschliesslich Betroffene.<br />
104
chen Stu<strong>die</strong>n belegt. Die Stu<strong>die</strong>n beziehen sich auf <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r personenzentrierten<br />
Hilfe (vgl. Kohlenberg u.a. 1994, 27).<br />
Das kennzeichnen<strong>de</strong> Element <strong>de</strong>r Selbsthilfe ist <strong>die</strong> eigene <strong>Betroffenheit</strong> aller Mitglie<strong>de</strong>r.<br />
Je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r Hilfe gibt, bekommt auch Hilfe.<br />
In Kombination mit Professionalität o<strong>de</strong>r in Verbindung mit einer Institution <strong>die</strong> Hilfe<br />
anbietet, ist <strong>die</strong> <strong>Betroffenheit</strong> eine <strong>„</strong>Eigenschaft“, <strong>die</strong> genutzt wird, um einen Hilfeprozess<br />
zu gestalten. Die Selbsthilfe ist <strong>die</strong> Basis geblieben, aber an<strong>de</strong>re professionelle<br />
Elemente kamen im Laufe <strong>de</strong>r Zeit dazu. Der Hilfeprozess basierte in <strong>die</strong>sem professionellen<br />
Kontext nicht länger auf Gegenseitigkeit.<br />
In <strong>de</strong>n Projekten <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes arbeiten sowohl professionelle<br />
Betroffene <strong>als</strong> auch Betroffene ohne eine Ausbildung zum Sozialarbeiter. Alle leisten<br />
dort professionelle Hilfe, da sie durch <strong>die</strong> Einbindung in <strong>de</strong>n Einrichtungen Anbieter<br />
professioneller Hilfe sind.<br />
Die Professionalität wird teilweise durch langjährige Berufserfahrung, langjährige eigene<br />
Krisenerfahrung und teilweise durch ein Studium begrün<strong>de</strong>t. Tatsächlich kommt es<br />
darauf an, ob sich <strong>die</strong> Hilfe <strong>de</strong>r Projekte <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzer und Nutzerinnen <strong>als</strong> hilfreich<br />
herausstellt.<br />
Der Betroffenenkontrollierte Ansatz beschreibt <strong>die</strong> Ressource <strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> ein Qualitätsmerkmal.<br />
Dass <strong>die</strong> Mitarbeiter selbst betroffen sind, ist nicht nur auf <strong>de</strong>r Beziehungsebene<br />
von Be<strong>de</strong>utung. Sämtliche Grundsätze wie sie in Teil I <strong>die</strong>ser Arbeit beschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n, stehen in Zusammenhang mit <strong>de</strong>n Grundsätzen <strong>de</strong>r Selbsthilfe und<br />
somit <strong>de</strong>n Betroffenen selbst. In <strong>de</strong>r Selbsthilfe liegen <strong>die</strong> Wurzeln betroffenenkontrollierter<br />
Arbeit.<br />
<strong>„</strong>Der Betroffenenkontrolle liegt häufig <strong>die</strong> Entscheidung zugrun<strong>de</strong>, <strong>die</strong> Ungewissheit<br />
<strong>de</strong>r Partnerschaft mit Professionellen nicht einzugehen und statt<strong>de</strong>ssen unter<br />
sich eher eigene Werte fin<strong>de</strong>n, festlegen und umsetzen zu können“( FaFür alle Fälle<br />
e.V. 2005, 14).<br />
In <strong>de</strong>r Selbsthilfe wird betroffenenkontrollierte Arbeit in ihrer konsequentesten Form<br />
betrieben. Kontrolle be<strong>de</strong>utet hier, dass <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Klient“ nicht nur beteiligt wird, son<strong>de</strong>rn<br />
selbst Gestalter <strong>de</strong>r Hilfe ist. Es könnte <strong>für</strong> <strong>de</strong>n psychosozialen Bereich be<strong>de</strong>uten, <strong>„</strong>dass<br />
Betroffene eigene Konzepte <strong>de</strong>r Hilfe erarbeiten und eine Finanzierung zur Umsetzung<br />
<strong>die</strong>ser Projekte erhalten“ (ebd.).<br />
Und wie sich am Beispiel <strong>de</strong>r systemischen Therapie herausgestellt hat, gibt es auch<br />
innerhalb <strong>de</strong>r professionellen Metho<strong>de</strong>n Strömungen <strong>die</strong> <strong>de</strong>m Betroffenenkontrollierten<br />
Ansatz in ihren Werten und Grundsätzen nahe kommen.<br />
105
Teile <strong>de</strong>r Systemischen Therapie <strong>die</strong>nen <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit und vor allem <strong>de</strong>n sozial<br />
Arbeiten<strong>de</strong>n ebenso <strong>als</strong> Handwerkszeug in <strong>de</strong>r Gesprächsführung wie auch <strong>als</strong> <strong>„</strong>philosophischer“<br />
Überbau in ihrem Beruf. Das humanistische Menschenbild entspricht <strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>s <strong>„</strong>zeitgemässen“ Sozialarbeiters. Der Mensch, <strong>de</strong>r im Wachstumsmo<strong>de</strong>ll beschrieben,<br />
wird, ist <strong>de</strong>shalb sowohl <strong>de</strong>r Klient, <strong>als</strong> auch <strong>de</strong>r Helfer. Nimmt man <strong>die</strong>sen theoretischen<br />
Ansatz ernst, muss <strong>die</strong> Frage gestellt wer<strong>de</strong>n, wie er in <strong>die</strong> Praxis zu übertragen<br />
ist.<br />
Wenn Menschen eine Helfer-Klienten- Beziehung eingehen, fin<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Begegnung auf<br />
einer <strong>„</strong>Augenhöhe“ 3 , statt. Das heißt, dass sie von bei<strong>de</strong>n Seiten gestaltet wird. Es<br />
herrscht eine hohe <strong>„</strong>Akzeptanz“ vor <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Person. Die Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Ausgestaltung <strong>de</strong>s Hilfeprozesses behält <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r <strong>die</strong> Hilfe sucht. Die Definitionsmacht<br />
<strong>de</strong>r Ereignisse und <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rungen liegt ebenfalls beim Hilfesuchen<strong>de</strong>n.<br />
Es existiert ein flexibles System, in <strong>de</strong>m <strong>die</strong> Wünsche <strong>de</strong>s Klienten berücksichtigt wer<strong>de</strong>n<br />
können. Verän<strong>de</strong>rungen wer<strong>de</strong>n <strong>als</strong> Chance betrachtet. Dieser Gedanke entspricht<br />
<strong>de</strong>r Definition <strong>de</strong>s <strong>„</strong>Positiven Krisenverständnisses“. Die Beteiligung <strong>de</strong>s Klienten wird<br />
dabei <strong>als</strong> grundlegend <strong>für</strong> <strong>die</strong> Ausgestaltung <strong>de</strong>s Hilfeprozesses erachtet.<br />
Diese Form <strong>de</strong>r Beteiligung wird ebenfalls in <strong>de</strong>r Fachliteratur diskutiert und <strong>für</strong> notwendig<br />
befun<strong>de</strong>n. So heißt es bei Merchel :<br />
<strong>„</strong>Adressatenbeteiligung“ erscheint <strong>als</strong> wesentliches Element fachlichen Selbstverständnisses.<br />
Sie kann allerdings nur gelingen, wenn <strong>die</strong> Institution <strong>die</strong> da<strong>für</strong> notwendigen<br />
Flexibilität <strong>de</strong>s Vorgehens zulässt“ (Merchel 1994, 333/334).<br />
Des weiteren stellen <strong>die</strong> sich verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n gesellschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
neue Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>die</strong> Soziale Arbeit.<br />
<strong>„</strong>Die unterschiedlichen Erwartungen, <strong>die</strong> an <strong>die</strong> Soziale Arbeit gestellt wer<strong>de</strong>n verän<strong>de</strong>rn<br />
sich vor <strong>de</strong>m Hintergrund nachweisbarer Individualisierungsten<strong>de</strong>nzen und<br />
zunehmen<strong>de</strong>r Vielfalt <strong>de</strong>r Lebensentwürfe. Es wird zunehmend schwieriger zu<br />
bestimmen auf welche <strong>„</strong>Normalzustän<strong>de</strong>“ hin sich Klienten verän<strong>de</strong>rn sollen“ (Gil<strong>de</strong>meister<br />
1993, 62).<br />
Eine Antwort auf <strong>die</strong>se Entwicklung könnte sein, dass <strong>die</strong> beschriebenen <strong>„</strong>Normalzu-<br />
stän<strong>de</strong>“ aus <strong>de</strong>r Deutungsmacht <strong>de</strong>s Professionellen zurück in <strong>die</strong> Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Hilfesu-<br />
chen<strong>de</strong>n gelegt wer<strong>de</strong>n. Damit wür<strong>de</strong>n sich auch <strong>die</strong> Ziele von einer fremdbestimmten<br />
Zielvorgabe <strong>de</strong>s Helfen<strong>de</strong>n zu einer Ziel<strong>de</strong>finition <strong>de</strong>s Hilfesuchen<strong>de</strong>n verän<strong>de</strong>rn.<br />
Die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte nach Beteiligung <strong>de</strong>r Klienten<br />
scheint <strong>als</strong>o mit <strong>de</strong>n gesellschaftlichen Verän<strong>de</strong>rungen und <strong>de</strong>n darauf folgen<strong>de</strong>n Ver-<br />
3 Die folgen<strong>de</strong>n in Anführungszeichen und kursiv aufgeführten Zitate sind <strong>de</strong>r Befragung <strong>de</strong>r Nutzer und<br />
<strong>de</strong>n theoretischen Grundsätzen <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes entnommen. Dies ist <strong>de</strong>r direkte<br />
Bezug zur Theorie und Praxis <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte.<br />
106
än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>die</strong> Soziale Arbeit konform zu gehen. Nimmt man<br />
<strong>die</strong>se For<strong>de</strong>rung ernst, wird schnell <strong>de</strong>utlich, dass es sich bei <strong>de</strong>r Umsetzung um einen<br />
Paradigmenwechsel han<strong>de</strong>ln wür<strong>de</strong>. Der Zwiespalt, in <strong>de</strong>m sich <strong>die</strong> Soziale Arbeit seit<br />
<strong>de</strong>r Etablierung <strong>die</strong>ses Berufsbil<strong>de</strong>s bis heute befin<strong>de</strong>t, spielt dabei eine große Rolle.<br />
<strong>„</strong>Soziale Arbeit wird <strong>als</strong> personenbezogene (…) Arbeit charakterisiert, <strong>die</strong> ohne <strong>die</strong><br />
Mitwirkung ihrer Klientel nicht erfolgreich geleistet wer<strong>de</strong>n kann. <strong>„</strong>Das Ziel <strong>de</strong>r<br />
Berufsvollzüge (ist) (…) <strong>die</strong> (Wie<strong>de</strong>r)herstellung <strong>de</strong>r Autonomie <strong>de</strong>r Lebenspraxis“<br />
<strong>de</strong>s Klienten. Hierbei <strong>„</strong> (…) ist <strong>die</strong> Wahrung <strong>de</strong>r Autonomie <strong>de</strong>r Lebenspraxis durch<br />
einen Eingriff in <strong>die</strong> Autonomie <strong>de</strong>r Lebensvollzüge (...) das Dilemma aller sozialer<br />
Dienstleistungsarbeit. “Die Probleme dürfen nicht stellvertretend <strong>für</strong> <strong>die</strong> Adressaten<br />
gelöst wer<strong>de</strong>n, weil <strong>die</strong>s ihre Autonomie einschränken wür<strong>de</strong>. Vielmehr muß es<br />
darum gehen, <strong>„</strong><strong>die</strong> lebenspraktischen Probleme von Klienten unter Rückgriff auf<br />
<strong>de</strong>n Kanon wissenschaftlichen Wissens (zu) erschließen. Gleichzeitig aber dürfen<br />
<strong>die</strong> individuellen Probleme <strong>de</strong>s Klienten nicht unter <strong>de</strong>m wissenschaftlichen Wissen<br />
subsumiert und damit <strong>als</strong> individuelle getilgt wer<strong>de</strong>n“(Gil<strong>de</strong>meister, 1992:213/14)“<br />
(Kähler 1999, 24).<br />
Theoretisch und praktisch könnte <strong>de</strong>r Einfluss von Beteiligung so weit gehen, dass man<br />
im En<strong>de</strong>ffekt von einer Beteiligung von Professionellen anstatt von <strong>de</strong>r Beteiligung von<br />
Nutzerinnen und Betroffenen spricht.<br />
Von <strong>die</strong>ser Ausprägung ist <strong>die</strong> Soziale Arbeit in Deutschland noch weit entfernt. Im<br />
Gegensatz zu <strong>de</strong>n skandinavischen Län<strong>de</strong>rn, <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und Großbritannien ist<br />
hier <strong>de</strong>r Dialog zwischen <strong>de</strong>n Betroffenen und <strong>de</strong>m Hilfesystem noch eher spärlich vertreten.<br />
Für alle Fälle e. V. beschreibt in <strong>de</strong>r Broschüre BlickWechsel drei Arten von Beteiligung,<br />
wie sie im Hilfesystem <strong>de</strong>r BRD angewandt wer<strong>de</strong>n. Die Aufteilung erfolgt in:<br />
• Konsultation<br />
• Partnerschaft<br />
• Kontrolle<br />
Die Konsultation ist <strong>die</strong> schwächste Form <strong>de</strong>r Beteiligung. Sie holt <strong>die</strong> Meinung <strong>de</strong>r<br />
Nutzerinnen und Nutzer zu bestimmten Themen ein und bittet sie <strong>die</strong>sbezüglich Vorschläge<br />
zu machen. Die Konsultation fin<strong>de</strong>t in unverän<strong>de</strong>rten Systemstrukturen statt.<br />
Bei <strong>de</strong>r Partnerschaft wird <strong>die</strong> Struktur geöffnet und <strong>die</strong> Betroffenen bekommen <strong>die</strong><br />
Möglichkeit, durch ihre Mitarbeit Einfluss auf <strong>die</strong> Frage <strong>de</strong>r Ausgestaltung psychosozialer<br />
Hilfe zu nehmen. Der Sachverstand <strong>de</strong>r Nutzer erhält somit direkte Gestaltungsmacht.<br />
Die Betroffenenkontrolle wur<strong>de</strong> in unserer Arbeit sehr genau dargestellt. Sie ist <strong>die</strong> am<br />
weitesten entwickelte Form <strong>de</strong>r Beteiligung. Sie ist im psychosozialen Bereich sehr sel-<br />
107
ten anzutreffen. Nicht zuletzt, weil sie <strong>de</strong>n weitgehend hierarchischen und expertendo-<br />
minierten Strukturen im Hilfesystem entgegen steht.<br />
FaFür alle Fälle e.V. sieht in <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projekten <strong>„</strong>(…) eine wichti-<br />
ge und unterstützenswerte Alternative im psychosozialen und psychiatrischen Bereich<br />
(FaFür alle Fälle e.V. 2005, 14)“ (vgl. ebd., 13-15).<br />
4. Betroffenenkompetenzen und professionelle Schlüsselkompetenzen in <strong>de</strong>r Sozialen<br />
Arbeit<br />
Es geht um <strong>die</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes <strong>für</strong> <strong>die</strong> Soziale Arbeit<br />
o<strong>de</strong>r wie <strong>de</strong>r Titel <strong>de</strong>r gesamten Arbeit sagt, um <strong>de</strong>n <strong>Impuls</strong>, <strong>de</strong>r durch <strong>die</strong> genutzte <strong>Betroffenheit</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Soziale Arbeit zur <strong>Weiterentwicklung</strong> <strong>de</strong>rselben führen könnte.<br />
Eine Bezugsgröße aus <strong>de</strong>r Vielzahl <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Fachöffentlichkeit <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
beschriebenen Kompetenzen und Charakteristika herauszufiltern, stellte ein ernst zu<br />
nehmen<strong>de</strong>s Problem dar. Es war uns nicht möglich, einen Überblick und damit <strong>de</strong>n tatsächlichen<br />
<strong>„</strong>Stand <strong>de</strong>r Dinge“ zu erlangen, insofern es <strong>die</strong>sen überhaupt gibt.<br />
Wir haben uns da<strong>für</strong> entschie<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Deutscher Berufsverband <strong>für</strong> Soziale Arbeit e.V.<br />
(DBSH) <strong>als</strong> Grundlage <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Einordnung <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes<br />
in <strong>die</strong> aktuelle Entwicklung <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit heranzuziehen.<br />
Der Berufsverband hat auf <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>smitglie<strong>de</strong>rversammlung einen Entwurf von<br />
<strong>„</strong>Schlüsselkompetenzen <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit“ beschlossen, welcher bis zum 30.Juni<br />
2006 auf breiter Basis diskutiert wer<strong>de</strong>n soll. Mit <strong>die</strong>sem Papier soll <strong>„</strong>ein verbindlicher<br />
Rahmen <strong>für</strong> Ausbildung, Beschäftigte und Träger entstehen, <strong>de</strong>r <strong>die</strong> Qualität und I<strong>de</strong>ntität<br />
Sozialer Arbeit festigt und verbessert“ (http://www.dbsh.<strong>de</strong>/html/schluessel.html).<br />
Wir beziehen uns im Folgen<strong>de</strong>n auf <strong>die</strong>sen Entwurf.<br />
Wie bereits beschrieben, ist <strong>die</strong> Beteiligung von Betroffenen im psychosozialen Bereich<br />
eines <strong>de</strong>r Strukturmerkmale <strong>de</strong>s Betroffenenkontrollierten Ansatzes. Die Selbstbestimmung<br />
<strong>de</strong>r Nutzer und Nutzerinnen hat in <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r Projekte oberste Priorität. Es<br />
gibt einige Bereiche in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit, in <strong>de</strong>nen ein Interesse an <strong>de</strong>r Beteiligung<br />
<strong>de</strong>r Klienten besteht. Von Betroffenenkontrolle kann jedoch in <strong>die</strong>sen nicht gesprochen<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Betroffenenkontrollierte Ansatz transportiert ein humanistisches Menschenbild,<br />
welches auch vom Berufsverband <strong>de</strong>r Sozialarbeiter in Kapitel VII - Berufsethische<br />
Kompetenz <strong>als</strong> grundlegend angesehen wird.<br />
108
Im Kapitel VIII: Sozialprofessionelle Beratung wird Folgen<strong>de</strong>s bemerkt:<br />
<strong>„</strong>Respekt vor <strong>de</strong>r Selbstverantwortung <strong>de</strong>r Menschen, vor <strong>de</strong>r Entscheidungsfreiheit<br />
und das grundsätzliche Vertrauen in <strong>die</strong> Fähigkeit <strong>de</strong>r Selbstbestimmung sind handlungsleitend<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Profession Soziale Arbeit.<br />
Menschen wollen Gemeinschaft und brauchen Solidarität. Solidarität ist nur möglich,<br />
dort wo Menschen in <strong>de</strong>r Lage sind autonom zu han<strong>de</strong>ln und ihre Interessen<br />
zum Wohle <strong>de</strong>r Gemeinschaft durchsetzen können. Menschen brauchen einen Sinn,<br />
sind fähig einen Sinn <strong>für</strong> ihr Leben zu fin<strong>de</strong>n“<br />
(http://www.dbsh.<strong>de</strong>/html/schluessel.html, Entwurf <strong>„</strong>Schlüsselkompetenzen <strong>de</strong>r Sozialen<br />
Arbeit“ 84).<br />
Auch hierbei han<strong>de</strong>lt es sich um Prämissen, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projek-<br />
ten Anwendung fin<strong>de</strong>n.<br />
In Bezug auf <strong>die</strong> Lebensweltorientierung wer<strong>de</strong>n u.a. Aussagen getroffen, <strong>die</strong> wenn<br />
man sich <strong>die</strong> tatsächliche helfen<strong>de</strong> Beziehung und <strong>die</strong> teilweise staatlich verordnete Hil-<br />
fe ansieht, lediglich <strong>für</strong> Teilbereiche <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit <strong>als</strong> Grundsätze verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
� <strong>„</strong>Alltagsorientierung be<strong>de</strong>utet, <strong>die</strong> Hilfe so zu organisieren, dass eine Hilfe im<br />
Bewältigen <strong>de</strong>s Alltags daraus wird, dass <strong>die</strong> <strong>„</strong>Hilfe zur Selbsthilfe“ im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
steht, wobei das Recht auf Eigensinnigkeit, auf Schrulligkeit betont wird.<br />
Eine vorschnelle Pathologisierung, Separierung und Einengung <strong>de</strong>s Blickwinkels<br />
soll vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
� Partizipation und Integration sind <strong>die</strong> entsprechen<strong>de</strong>n Ziele einer lebensweltorientierten<br />
Sozialen Arbeit. Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Dazugehören,<br />
Dabeisein, Eingebun<strong>de</strong>nsein in gegebene o<strong>de</strong>r neu zu grün<strong>de</strong>n<strong>de</strong> soziale Netze<br />
stehen gegen Ausgrenzung, Randständigkeit und Isolation.<br />
� Selbstbestimmung ist ein wesentliches Grundziel <strong>de</strong>r Profession Sozialer Arbeit“<br />
(ebd., 86).<br />
Die bisher erwähnten Werte sind in <strong>de</strong>n Projekten Weglaufhaus und Wildwasser hinge-<br />
gen strukturell verankert und wer<strong>de</strong>n durch <strong>die</strong> Beschäftigung von betroffenen Mitar-<br />
beitern getragen und garantiert. Sie resultieren in <strong>die</strong>sem Kontext aus <strong>de</strong>r eigenen, er-<br />
lebten Erfahrung und sind <strong>de</strong>shalb im Gegensatz zu erlernten, gewachsene Werte.<br />
Was aber ist mit <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Befragung <strong>de</strong>r Nutzer (Teil III) herausgestellten personellen<br />
Ressource <strong>Betroffenheit</strong>? Welche Be<strong>de</strong>utung liegt <strong>die</strong>ser inne?<br />
Die eigene <strong>Betroffenheit</strong> <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Projekten Wildwasser und Weglaufhaus Tätigen,<br />
stellt eine Beziehungskompetenz dar, o<strong>de</strong>r wie es vom Berufsverband <strong>de</strong>r Sozialarbeiter<br />
in Kapitel VI - Personale und kommunikative Kompetenz ausgedrückt wird:<br />
<strong>„</strong>Soziale Arbeit verstan<strong>de</strong>n <strong>als</strong> professionelles Han<strong>de</strong>ln ist immer auch menschliches<br />
Han<strong>de</strong>ln. Wie an<strong>de</strong>re helfen<strong>de</strong> Berufe auch bringt gera<strong>de</strong> <strong>die</strong> Sozialarbeiterin<br />
ihre ganze Person in <strong>de</strong>n Hilfeprozess mit ein. Die eigene Weltanschauung, eigene<br />
109
Sozialisationserfahrungen, eigene Bewältigungsmöglichkeiten und <strong>die</strong> eigene Lebenslage:<br />
das alles sind Faktoren, <strong>die</strong> in <strong>de</strong>n Hilfeprozess, d.h. <strong>als</strong>o in <strong>die</strong> menschliche<br />
Interaktion zwischen Helfen<strong>de</strong>m und Hilfesuchen<strong>de</strong>n, einfließen“ (ebd., 57).<br />
Dieser Einbezug <strong>de</strong>r gesamten Person <strong>de</strong>s Helfers, mit seinen Stärken und Schwächen<br />
ist <strong>für</strong> <strong>die</strong> Arbeit in <strong>de</strong>n Projekten von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung. Die Erfahrung mit <strong>de</strong>r<br />
eigenen <strong>Betroffenheit</strong> wird dort <strong>als</strong> Ressource genutzt und nicht, wie in vielen an<strong>de</strong>ren<br />
Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems aus Angst vor Stigmatisierung verschwiegen, o<strong>de</strong>r be-<br />
wusst zurückgehalten, um <strong>die</strong> professionelle Distanz 4 einzuhalten. Der Hilfeprozess<br />
wird durch <strong>die</strong> Transparenz <strong>de</strong>r eigenen Lebenserfahrung <strong>de</strong>r Mitarbeiter beeinflusst. Es<br />
kann dadurch eine <strong>„</strong>authentische“, <strong>„</strong>verbun<strong>de</strong>ne“, <strong>„</strong>vertrauensvolle“ und <strong>„</strong>gleichbe-<br />
rechtigte“ Beziehung entstehen.<br />
Insgesamt sind <strong>die</strong> erwähnten Quellen ein kleiner Teil <strong>de</strong>r im Entwurf<br />
<strong>„</strong>Schlüsselkompetenzen <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit“ beschriebenen Fertigkeiten, mit <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
<strong>„</strong>neue“ Sozialarbeiter ausgestattet sein sollte. In einem Großteil <strong>de</strong>s insgesamt 106<br />
Seiten langen Entwurfes stellt <strong>de</strong>r DBSH <strong>die</strong> Wichtigkeit von Expertenwissen, und <strong>de</strong>r<br />
Anwendung <strong>de</strong>s selben, heraus. Die Hilfe wird weiterhin von Professionellen<br />
vorgegeben. Am Objektstatus <strong>de</strong>s Klienten än<strong>de</strong>rt sich im wesentlichen nichts, <strong>die</strong><br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Beteiligung wird zwar ange<strong>de</strong>utet, aber nicht näher beschrieben.<br />
Der Anlass <strong>für</strong> <strong>die</strong> Erstellung <strong>die</strong>ses Entwurfs liegt in <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Annahme:<br />
<strong>„</strong>In <strong>de</strong>r gegenwärtigen sozialpolitischen Lage und damit auch <strong>de</strong>r Lage unserer<br />
Profession sollten wir uns klar darüber sein, dass <strong>die</strong> professionelle Qualität und<br />
<strong>de</strong>r Beruf <strong>de</strong>r Sozialarbeiterin bzw./<strong>de</strong>s Sozialarbeiters zur Disposition steht, nicht<br />
zuletzt auch, weil immer mehr Tätigkeiten, <strong>die</strong> originär Tätigkeiten von Fachkräften<br />
<strong>de</strong>r Profession Soziale Arbeit sind, von an<strong>de</strong>ren Professionen ausgeführt wer<strong>de</strong>n“<br />
(ebd. 9).<br />
Das be<strong>de</strong>utet, dass <strong>die</strong> vom Verband gefor<strong>de</strong>rten Kompetenzen vornehmlich mit erlern-<br />
tem Fachwissen zusammenhängen. Das Ziel dabei ist eine schärfere Profilierung <strong>de</strong>s<br />
Berufes zu erreichen(vgl. ebd. 8). Eine verstärkte Bürokratisierung ist dabei zu erwarten.<br />
Die Soziale Arbeit möchte von <strong>de</strong>r Semi-Profession zur anerkannten Profession<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese Anerkennung soll über Qualitätssicherung und verstärkte Metho<strong>de</strong>nbeschreibung<br />
sowie <strong>de</strong>m Nachweis von Fachwissen geschehen.<br />
Eine an<strong>de</strong>re Möglichkeit bietet unserer Meinung <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierte Ansatz <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Soziale Arbeit. Zunächst wür<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Profession das Betroffenenpotential geför<strong>de</strong>rt<br />
und damit eine bereits existieren<strong>de</strong> Ressource zugänglich gemacht. Dann wür<strong>de</strong> daran<br />
4<br />
Die professionelle Distanz ist eines <strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r Professionalisierung <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit. Der<br />
Helfer bringt dabei seine eigene Person und Erfahrung nicht in <strong>de</strong>n Hilfeprozess ein. Es wird in <strong>die</strong>sem<br />
Zusammenhang auch von Rollendistanz gesprochen.<br />
110
gearbeitet <strong>de</strong>n Klienten zu beteiligen, ihm seine Verantwortung zurück zu geben und<br />
ihn in <strong>de</strong>r Selbsthilfe zu unterstützen. Im Optimalfall macht sich <strong>de</strong>r Helfen<strong>de</strong> dabei<br />
überflüssig. Dies geschieht ganz nach <strong>de</strong>m Prinzip <strong>„</strong>Hilfe zur Selbsthilfe“. Anstatt sich<br />
<strong>als</strong> Sozialarbeiter unverzichtbar zu machen, in<strong>de</strong>m <strong>die</strong> Metho<strong>de</strong>n möglichst undurchsichtig<br />
und professionell gestaltet sind, wür<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Transparenz <strong>de</strong>n Klienten gegenüber<br />
gearbeitet. Ein offener, durchschaubarer Hilfeprozess wäre, und ist dabei das Ziel.<br />
5. Experten aus <strong>Betroffenheit</strong><br />
Auch Oskar Klemmert entwirft in seinem Text <strong>„</strong>Experte aus <strong>Betroffenheit</strong>“ eine Zukunftsvision,<br />
<strong>„</strong>(…) <strong>die</strong> aus <strong>de</strong>n inneren Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen und Spannungsverhältnissen<br />
ihrer zugehörigen professionellen Handlungsfel<strong>de</strong>r abgeleitet wird“ ( http://fjsev.<strong>de</strong>/archiv/freiwillig04/cont0019/artikel.htm).<br />
Diese beschreibt eine mögliche Zukunft,<br />
in <strong>de</strong>r <strong>die</strong> Klienten von heute <strong>als</strong> Sozialarbeiter von morgen arbeiten.<br />
Er stellt sich vor, dass im gesamten Sozial- und Gesundheitssektor <strong>„</strong>krisenerfahrene<br />
Menschen, <strong>die</strong> einmal straffällig, drogenabhängig, krebserkrankt, obdachlos, Opfer<br />
sexueller Gewalt, Langzeitarbeitslose u. s. w. waren“ arbeiten wür<strong>de</strong>n. Ihre berufliche<br />
Anerkennung wür<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m langjährigen ehrenamtliche Engagements <strong>für</strong> Gleichbetroffene<br />
und <strong>de</strong>r <strong>„</strong>tätigkeitsbegleiten<strong>de</strong>n Aus- o<strong>de</strong>r Weiterbildungsmaßnahme“ resultieren.<br />
Vor allem aber wären sie wegen ihrer Krisenerfahrung qualifiziert. Die Betroffenen<br />
wür<strong>de</strong>n auf tariflich bezahlten Planstellen (vgl. ebd.) arbeiten.<br />
<strong>„</strong>Als Eingeweihte verkörpern sie <strong>für</strong> <strong>die</strong> Hilfesuchen<strong>de</strong>n ein Vorbild, das authentische<br />
Krisenerfahrungen bewältigt hat und <strong>„</strong>querliegen<strong>de</strong>s" Insi<strong>de</strong>rwissen besitzt,<br />
das an keiner normalen Aus- und Weiterbildungstätte vermittelt wer<strong>de</strong>n kann“<br />
(ebd.).<br />
Auch <strong>die</strong> Ausbildung an <strong>de</strong>n Fachhochschulen wür<strong>de</strong> so organisiert, dass eine ehren-<br />
amtsbegleiten<strong>de</strong> Absolvierung möglich wür<strong>de</strong>. Die ausgebil<strong>de</strong>ten Betroffenen wür<strong>de</strong>n<br />
allerdings geringer entlohnt, <strong>als</strong> ihre <strong>„</strong>rein“ professionellen Kollegen.<br />
Von <strong>die</strong>ser Zukunftsvision entfernt uns noch einiges. Oskar Klemmert geht von einer<br />
groben <strong>„</strong>Schätzzahl von 200 000 5 <strong>„</strong>neuen Ehrenamtlichen", <strong>die</strong> im weitesten Sinne<br />
selbsthilfeunterstützen<strong>de</strong> Aufgaben wahrnehmen aus“( ebd.). Bei <strong>die</strong>sem Personenkreis<br />
kann von möglichen Kandidaten <strong>für</strong> <strong>de</strong>n avisierten <strong>„</strong>Experten aus <strong>Betroffenheit</strong>" ausge-<br />
gangen wer<strong>de</strong>n.<br />
5 <strong>„</strong>Nach Berechnungen <strong>de</strong>s Instituts <strong>für</strong> sozialwissenschaftliche Analysen (ISAB) existieren <strong>de</strong>rzeit nahezu<br />
70 000 Selbsthilfegruppen, <strong>de</strong>nen ca. 2,6 Millionen Menschen angehören - Ten<strong>de</strong>nz steigend. Geht man<br />
von einem Anteil von 5 bis 10 Prozent aus, <strong>die</strong> mit einer gewissen Regelmäßigkeit Aufgaben <strong>für</strong> Einzel-<br />
111
Laut Klemmert wür<strong>de</strong> sich <strong>die</strong> Arbeit <strong>de</strong>r <strong>„</strong>Experten aus <strong>Betroffenheit</strong>" von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Pro-<br />
fessionellen unterschei<strong>de</strong>n. Die betroffenen Helfer wür<strong>de</strong>n <strong>für</strong> <strong>die</strong> unmittelbar klientenbezogene<br />
Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsaufgaben eingesetzt, <strong>die</strong> Professionellen<br />
wären <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>„</strong>Hintergrundarbeit“ zuständig. Die Anerkennung <strong>als</strong> Professioneller<br />
wür<strong>de</strong> sich beim betroffenen Helfer auf <strong>die</strong> unmittelbar selbst erlebten Problembereiche<br />
beziehen (vgl. ebd.).<br />
Um eine solches Reform-Projekt in <strong>die</strong> Realität umzusetzen, bräuchte es allerdings <strong>die</strong><br />
Menschen, <strong>die</strong> sich da<strong>für</strong> einsetzen wür<strong>de</strong>n.<br />
<strong>„</strong>Es braucht eine nicht zu übersehen<strong>de</strong> und nicht zu überhören<strong>de</strong> Zahl von enga<br />
gierten Betroffenen, <strong>die</strong> <strong>für</strong> sich ganz persönlich glaubwürdig eine Professionalisie<br />
rungsperspektive entwickeln“(ebd.).<br />
Die Selbsthilfe ist <strong>de</strong>r Bereich, wo bisher <strong>die</strong> meisten Erfahrungen bezüglich Betroffe-<br />
nenkompetenz 6 im Hilfesystem gemacht wur<strong>de</strong>n. Deshalb <strong>die</strong>nt sie hier <strong>als</strong> Ausgangs-<br />
lage. Ebenfalls <strong>die</strong>nt sie <strong>de</strong>n betroffenenkontrollierten Projekten <strong>als</strong> Basis. Diese sind<br />
Beispiel da<strong>für</strong>, dass Projekte, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Kompetenz Betroffener nutzen eine erfolgreiche<br />
Arbeit machen können. Die Tatsache, dass Wildwasser bereits 20 Jahre und das<br />
Weglaufhaus 10 Jahre besteht, zeugt von Beständigkeit.<br />
Der Betroffenenkontrollierte Ansatz ist etwas neues in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Sozialen Ar-<br />
beit. Er sie<strong>de</strong>lt sich zwischen <strong>de</strong>r Selbsthilfe und <strong>de</strong>r professionellen Sozialen Arbeit an.<br />
Die Selbsthilfebewegung ist dam<strong>als</strong> in <strong>de</strong>n achtziger Jahren <strong>als</strong> Alternative zum Hilfe-<br />
system entstan<strong>de</strong>n. Die betroffenenkontrollierten Projekte rücken nun wie<strong>de</strong>r näher an<br />
<strong>die</strong> sich verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Profession heran.<br />
Die Kombination von <strong>Betroffenheit</strong> und Professionalität scheint geglückt zu sein und<br />
kann <strong>als</strong> <strong>Impuls</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Weiterentwicklung</strong> <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit gesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
personen, <strong>die</strong> Gruppe o<strong>de</strong>r Organisation wahrnehmen, ergibt sich eine grobe Schätzzahl von 200 000<br />
Helfern“ (ebd.).<br />
6 Wird hier verwen<strong>de</strong>t wie soziale Kompetenz, unter <strong>de</strong>r im pädagogischen Alltag <strong>die</strong> Fähigkeit verstan<strong>de</strong>n<br />
wird, sich sozial und tolerant auch gegenüber an<strong>de</strong>rs gearteten Menschen zu verhalten, <strong>„</strong>d.h. im Einzelnen<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren <strong>als</strong> gleichwertig und würdig zu achten, Empathievermögen <strong>für</strong> sich und an<strong>de</strong>re zu<br />
besitzen, Anteilnahme an <strong>de</strong>m Schicksal an<strong>de</strong>rer nehmen zu können, gegebenenfalls zu helfen“ (Deutscher<br />
Verein <strong>für</strong> öffentliche und private Fürsorge 2002, 566).<br />
112
Fazit<br />
Uns ist bewusst, dass es sich bei <strong>de</strong>n betroffenkontrollierten Projekten um eine kleine<br />
Min<strong>de</strong>rheit im Dschungel <strong>de</strong>s Hilfesystems han<strong>de</strong>lt. Trotz<strong>de</strong>m war es möglich, aus <strong>de</strong>r<br />
Praxis <strong>de</strong>r Projekte einen Ansatz zu entwickeln, <strong>de</strong>r <strong>die</strong> Merkmale eines methodischen<br />
Ansatzes enthält. Es bestehen allerdings wesentliche Unterschie<strong>de</strong> zu an<strong>de</strong>ren Metho<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Sozialen Arbeit. Der Mensch, <strong>de</strong>r bei ihnen Hilfe sucht, wird nicht zum Objekt<br />
gemacht. Das drückt sich unter an<strong>de</strong>rem darin aus, dass <strong>de</strong>r Krankheitsbegriff und <strong>die</strong><br />
Diagnose in ihrem Ansatz nicht vorkommt.<br />
Sie sehen <strong>die</strong> Ursachen <strong>für</strong> Gewalt, Krisen und Verrücktheiten nicht ausschließlich im<br />
Individuum, son<strong>de</strong>rn nehmen <strong>die</strong> gesellschaftliche Verantwortung ernst und entwickeln<br />
daraus Handlungspläne.<br />
In <strong>de</strong>r Fachöffentlichkeit fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierte Ansatz bisher nicht <strong>die</strong> Beachtung,<br />
<strong>die</strong> er unserer Meinung nach ver<strong>die</strong>nt.<br />
Diese Diplomarbeit soll dazu beitragen, Interesse an <strong>de</strong>r Arbeit und <strong>de</strong>m theoretischen<br />
Konzept von Tauwetter, Weglaufhaus und Wildwasser zu erwecken.<br />
113
Literaturangaben<br />
Bellebaum, Alfred In: Deutscher Verein <strong>für</strong> öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.):<br />
Fachlexikon <strong>de</strong>r sozialen Arbeit. Stuttgart, Köln, 2002<br />
Böllert, Karin / Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit auf <strong>de</strong>r Suche nach Zukunft.<br />
Bielefeld, 1989<br />
Brockhaus Enzyklopä<strong>die</strong>: in 24 Bd. - 19. völlig neubearb. Aufl., Mannheim, 1986- 1996<br />
Cooper, David : Psychiatrie und Antipsychiatrie. Frankfurt am Main, 1971<br />
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.(Hg.): Selbsthilfegruppen –<br />
Unterstützung - Ein Orientierungsrahmen. Gießen, 1987<br />
Deutscher Verein <strong>für</strong> öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon <strong>de</strong>r sozialen<br />
Arbeit. Stuttgart, Köln, 2002<br />
En<strong>de</strong>rs, Ursula (Hrsg.): Zart war ich, bitter war’s - Handbuch gegen sexuelle Gewalt an<br />
Mädchen und Jungen. Köln, 1995<br />
FAFür alle Fälle e.V.: BlickWechsel - Beteiligungen von Betroffenen in <strong>de</strong>r psychosozialen<br />
Arbeit. Berlin , 2005<br />
Foucault, Michel / Lagrange, Jacques (Hrsg.): Die Macht <strong>de</strong>r Psychiatrie - Vorlesung am<br />
College <strong>de</strong> France 1973-1974. Frankfurt a. M., 2005<br />
Friedlan<strong>de</strong>r,F : Die weiße und <strong>die</strong> schwarze Forschung. In: Gruppendynamik, 3/1972, Heft 1.<br />
Zitiert in: Heinze, Thomas: Qualitative Sozialforschung - Erfahrungen, Probleme und<br />
Perspektiven. Opla<strong>de</strong>n, 1987, 144<br />
Gernhard, Robert: Lichte Gedichte. Frankfurt am Main, 2000<br />
Gil<strong>de</strong>meister, R.: Soziologie <strong>de</strong>r Sozialarbeit. In :Korte, H. u.a.: Einführung in spezielle<br />
Soziologien 57-74. Opla<strong>de</strong>n, 1993<br />
Goffman, Erving: Stigma: über Techniken <strong>de</strong>r Bewältigung beschädigter I<strong>de</strong>ntität. 12. Aufl.,<br />
Frankfurt am Main, 1996<br />
Günther, Peter / Rohrmann, Eckhard (Hrsg.): Soziale Selbsthilfe-Alternative - Ergänzung<br />
o<strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> sozialer Arbeit? Hei<strong>de</strong>lberg, 1999<br />
Hagemann-White, Carol / Kavemann, Barbara / Ohl, Dagmar: Parteilichkeit und Solidarität -<br />
Praxiserfahrungen und Streitfragen zur Gewalt im Geschlechterverhältnis. Bielefeld, 1997<br />
Heiner, Maja: Professionalität in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit – Theoretische Konzepte, Mo<strong>de</strong>lle und<br />
empirische Perspektiven. Stuttgart, 2004<br />
Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch <strong>de</strong>r Soziologie. Stuttgart, 1994<br />
114
Kähler, H.D.: Beziehungen im Hilfesystem Sozialer Arbeit - Zum Umgang mit<br />
BerufskollegInnen und Angehörigen an<strong>de</strong>rer Berufe. Freiburg im Breisgau, 1999<br />
Kempker, Kerstin: Flucht in <strong>die</strong> Wirklichkeit - das Berliner Weglaufhaus. Berlin, 1998<br />
Kempker, Kerstin: Gewalt im Namen <strong>de</strong>r “psychischen Gesundheit” - kein En<strong>de</strong> in Sicht? Der<br />
aufgestörte Blick. Bielefeld, 1997<br />
Klafki, Hannelore: Vortrag beim Verein <strong>für</strong> Psychiatrie und seelische Gesundheit in Berlin<br />
e.V., Berlin, 2004. In FaFür alle Fälle e.V.: BlickWechsel – Beteiligung von Betroffenen in<br />
<strong>de</strong>r psychosozialen Arbeit. Berlin, 2005<br />
Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Weinheim und München,<br />
2005<br />
Krusche, Helmut: Der Frosch auf <strong>de</strong>r Butter : NLP - <strong>die</strong> Grundlagen <strong>de</strong>s Neuro-<br />
Linguistischen Programmierens, Berlin 2005<br />
Kuhr, Rudolf: Wachstum an Menschlichkeit, Humanismus <strong>als</strong> Grundlage - Ein Handbuch mit<br />
kurzen Texten und Zitaten. Angelika Lenz Verlag, 2000<br />
Lucke, Doris: Akzeptanz, Legitimität in <strong>de</strong>r "Abstimmungsgesellschaft". Opla<strong>de</strong>n, 1995<br />
Merchel, J.: Sozialverwaltung o<strong>de</strong>r Wohlfahrtsverband <strong>als</strong> ‚kun<strong>de</strong>norientiertes Unternehmen’:<br />
ein tragfähiges, zukunftorientiertes Leitbild? In: neue Praxis 25, Lahnstein, 1994, 325-340<br />
Meyers großes Handlexikon: 17. aktualisierte Aufl.. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1994<br />
Moeller, Michael Lukas: An<strong>de</strong>rs helfen – Selbsthilfegruppen und Fachleute arbeiten<br />
zusammen. Frankfurt am Main, 1992<br />
Mosher, Loren R. u.a. in Stierlin, H. / Wynne, L. C. / Wirsching, M. (Hg.): Psychotherapie und<br />
Sozialtherapie <strong>de</strong>r Schizophrenie - Ein internationaler Überblick. Berlin ,1985<br />
Nicolai, Eva-Maria / Derr, Regine: Qualitätsstandards <strong>für</strong> <strong>die</strong> Arbeit in <strong>de</strong>n feministischen<br />
Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen. Berlin, 2004<br />
Olk, Thomas: Abschied vom Experten - Sozialarbeit auf <strong>de</strong>m Weg zu einer alternativen<br />
Professionalität. Weinheim und München, 1986<br />
Prins, Sybille (Hg.): Vom Glück – Wege aus psychischen Krisen. Bonn, 2003<br />
Reyer, Jürgen: Kleine Geschichte <strong>de</strong>r Sozialpädagogik - Individuum und Gemeinschaft in <strong>de</strong>r<br />
Pädagogik <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne. Hohengehren, 2002<br />
Riecher-Rössler, Anita / Berger, Pascal / Yilmaz, Ali Tarik / Stieglitz, Rolf-Dieter(Hrsg.):<br />
Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention. Göttingen, 2004<br />
Rüger, Ulrich / Blomert, Albert Franz / Förster, Wolfgang: Coping - Theoretische Konzepte,<br />
Forschungsansätze, Messinstrumente zur Krankheitsbewältigung. Göttingen, 1990<br />
115
Russo, Jasna / Fink, Thomas: Stellung nehmen – Obdachlosigkeit und Psychiatrie aus <strong>de</strong>n<br />
Perspektiven <strong>de</strong>r Betroffenen. Berlin, 2003<br />
Satir, Virginia.: Kommunikation - Selbstwert - Konkurrenz. Pa<strong>de</strong>rborn, 1990<br />
Schaffer, Hanne: Empirische Sozialforschung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Soziale Arbeit – Eine Einführung.<br />
Freiburg im Breisgau, 2002<br />
Schlippe, Arist von / Schweitzer, Jochen: Lehrbuch <strong>de</strong>r systemischen Therapie und Beratung.<br />
Göttingen, 2003<br />
Schmidt-Grunert (Hrsg.): Sozialarbeitsforschung konkret – Problemzentrierte Interviews <strong>als</strong><br />
qualitative Erhebungsmetho<strong>de</strong>. Freiburg im Breisgau, 1999<br />
Steinert, E. / Thiele, G.: Sozialforschung <strong>für</strong> Studium und Praxis – Einführung in <strong>die</strong><br />
qualitativen und quantitativen Metho<strong>de</strong>n. Köln, 2000<br />
Stöckle, Tina: Kongress über alternative Psychiatrie. In: kleine Freiheit (Salzburg), 3.Jg.<br />
1983a, Nr. 10<br />
Stöckle, Tina: Das Ver-rücktenhaus - Ein Traum II. In: Irren-Offensive, Heft 2, 1983b<br />
Tauwetter / Weglaufhaus / Wildwasser: Betrifft: Professionalität. Broschüre. Berlin 2004<br />
Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V.: Weglaufhaus <strong>„</strong>Villa Stöckle“-<br />
Kriseneinrichtung <strong>für</strong> Psychiatrie-Betroffene. Konzeption. Druck: hinkelstein. Berlin, 2001<br />
Von Trotha; Thilo: Vorschlag <strong>für</strong> eine Übereinkunft, Manuskript. Berlin, 1994. In: Kempker,<br />
Kerstin: Flucht in <strong>die</strong> Wirklichkeit: das Berliner Weglaufhaus. Berlin, 1998<br />
Weh<strong>de</strong>, Uta: Das Weglaufhaus. Zufluchtsort <strong>für</strong> Psychiatrie-Betroffene - Erfahrungen,<br />
Konzeptionen, Probleme. Berlin, 1991<br />
Wildwasser (Hrsg.): Selbstdarstellung. Berlin, 2003<br />
116
Internetseiten<br />
http://www.bodymindcentering.com, 27.05.2006, 14.14Uhr<br />
http://www.dbsh.<strong>de</strong>/html/schluessel.html, 28.05.2006, 11.02 Uhr<br />
http://www.dgppn.<strong>de</strong>/enquete/enquete.htm, 08.05.2006, 20:29 Uhr<br />
http://fjs-ev.<strong>de</strong>/archiv/freiwillig04/cont0019/artikel.htm, 28.05.2006, 13.35 Uhr<br />
http://germazope.uni-trier.<strong>de</strong>/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GS25992,<br />
10.05.06, 11.11 Uhr<br />
http://www.hu-bb.<strong>de</strong>/themen/ingeborg-drewitz-preis/in<strong>de</strong>x.html, 27.03.06, 13.46 Uhr<br />
http://www.muenchner-familien-kolleg.<strong>de</strong>/vsg/vsg.html, 26.05.2006, 17.34 Uhr<br />
http://www.sbg.ac.at/psy/lehre/allesch/psaest02.doc, 05.05.2006, 19.15 Uhr<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Akzeptanz, 14.03.2006, 13.17 Uhr<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie, 09.05.2006, 15.43 Uhr<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Authentizit%C3%A4t, 14.03,2006, 11.17 Uhr<br />
http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Selbsthilfeorganisation, 28.05.2006, 10.11 Uhr<br />
http://www.<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Verbun<strong>de</strong>nheit, 05.05.2006, 15.30 Uhr<br />
http://www.<strong>weglaufhaus</strong>.<strong>de</strong>/history.html, 25.03.06, 16.29 Uhr<br />
http://www.<strong>weglaufhaus</strong>-leipzig.<strong>de</strong>/main.htm, 09.05.2006, 13.15Uhr<br />
117
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb.1: Logos <strong>de</strong>r betroffenenkontrollierten Projekte.................................................................8<br />
Abb.2: Das Weglaufhaus Villa <strong>„</strong>Stöckle“ .................................................................................18<br />
Abb.3: Ausschnitt aus <strong>de</strong>r Psychiatrie Enquete 1975, 64 .........................................................22<br />
Abb.4: v.li. Kingsley Hall und das Soteria Haus......................................................................23<br />
Abb.5: v.li.o.: G. Deleuze, Basaglia, D.Cooper T. Szasz, M. Foucault, R.D.Laing,<br />
L.Mosher ......................................................................................................................27<br />
Abb.6: Logo Wildwasser...........................................................................................................36<br />
Abb.7: Ramona und Regina......................................................................................................55<br />
118
Anhang
Anhang 1: Fragebögen<br />
1. Weglaufhausfragebogen<br />
Liebe Frauen und Männer,<br />
anlässlich unserer Diplomarbeit setzen wir uns mit <strong>„</strong><strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> <strong>Impuls</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Weiterentwicklung</strong><br />
<strong>de</strong>r Sozialen Arbeit. Eine Analyse am Beispiel ausgewählter Berliner Projekte“ auseinan<strong>de</strong>r.<br />
Das Weglaufhaus ist eines <strong>die</strong>ser Projekte, das wir ausgewählt haben, da hier <strong>die</strong> Hälfte <strong>de</strong>r<br />
MitarbeiterInnen Psychiatriebetroffene sind.<br />
Wir, das sind Ramona Schnekenburger und Regina Nicolai, Stu<strong>de</strong>ntinnen <strong>de</strong>r Sozialarbeit/<br />
Sozialpädagogik nun im 8. Semester an <strong>de</strong>r Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin-Hellersdorf.<br />
Den nachfolgen<strong>de</strong>n Fragebogen haben wir entwickelt, weil uns eure Meinung <strong>als</strong> NutzerInnen <strong>die</strong>ser<br />
Einrichtung wichtig ist.<br />
Alle Fragebögen bleiben anonym und wer<strong>de</strong>n nicht an Dritte weitergegeben.<br />
Wir bedanken uns herzlich <strong>für</strong> eure Unterstützung<br />
Ramona und Regina<br />
Der Fragebogen<br />
1. Wusstest Du, dass es sich beim <strong>„</strong>Weglaufhaus“ um ein Projekt han<strong>de</strong>lt, in <strong>de</strong>m MitarbeiterInnen<br />
selbst psychiatrische Gewalt erfahren haben?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja, war es einer <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong> <strong>die</strong>se Einrichtung zu nutzen?<br />
□ ja □ nein<br />
2. Was zeichnet <strong>die</strong> betroffenen MitarbeiterInnen Deiner Meinung nach aus?<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
3. Hat sich durch <strong>de</strong>n Kontakt zu <strong>de</strong>m Projekt Deine Sicht auf Krisen verän<strong>de</strong>rt?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja, wie?__________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
1
4. Wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Projekten über <strong>die</strong> folgen<strong>de</strong>n Themen gesprochen?<br />
Gewalterfahrung:□ ja □ nein<br />
Gewaltstrukturen: □ ja □ nein<br />
Hierarchien: □ ja □ nein<br />
Gesundheitsbegriff: □ ja □ nein<br />
An<strong>de</strong>re: □ ja □ nein<br />
Wenn ja, welche?_________________________________________________<br />
_______________________________________________________________<br />
5. Hast Du Erfahrungen mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems gemacht?<br />
□ ja □ nein<br />
6. Stellt das Weglaufhaus <strong>für</strong> Dich eine Alternative zum restlichen Hilfesystem dar?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja, warum?_______________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
7. Wie ist Deine Erfahrung mit<br />
o Professionellen Helfern wie Sozialarbeitern o<strong>de</strong>r Psychologen ?<br />
____________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
o Selbst betroffenen Helfern?<br />
____________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
o O<strong>de</strong>r mit Helfern, <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>s kombinieren, das heißt selbst betroffen sind und<br />
eine zusätzliche Qualifikation im Sozialen Bereich besitzen?<br />
____________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
8. Hat <strong>de</strong>r Austausch von Erfahrungen mit betroffenen Mitarbeiterinnen eine Rolle <strong>für</strong> Dich<br />
gespielt?<br />
□ ja □ nein<br />
2
Wenn ja wieso? __________________________________________________________<br />
__________________________________________________________<br />
__________________________________________________________<br />
Wenn nein, wieso? __________________________________________________________<br />
__________________________________________________________<br />
__________________________________________________________<br />
Persönliche Angaben<br />
Falls Du dazu bereit bist, wür<strong>de</strong>n wir uns über einige persönliche Angaben freuen:<br />
1. Wie alt bist Du?<br />
□ 18-27 □ 28-39 □ 40-55 □ über 55<br />
2. Geschlecht<br />
□ männlich □ weiblich<br />
2. Wildwasserfragebogen<br />
Liebe Frauen,<br />
anlässlich unserer Diplomarbeit setzen wir uns mit <strong>„</strong><strong>Betroffenheit</strong> <strong>als</strong> <strong>Impuls</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Weiterentwicklung</strong><br />
<strong>de</strong>r Sozialen Arbeit. Eine Analyse am Beispiel ausgewählter Berliner Projekte“ auseinan<strong>de</strong>r.<br />
Wildwasser e.V. ist eines <strong>die</strong>ser Projekte, das wir ausgewählt haben, da hier ausschließlich Frauen mit<br />
eigenen sexuellen Gewalterfahrungen tätig sind.<br />
Wir, das sind Ramona Schnekenburger und Regina Nicolai, Stu<strong>de</strong>ntinnen <strong>de</strong>r Sozialarbeit/<br />
Sozialpädagogik nun im 8. Semester an <strong>de</strong>r Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin-Hellersdorf.<br />
Den nachfolgen<strong>de</strong>n Fragebogen haben wir entwickelt, weil uns eure Meinung <strong>als</strong> Nutzerinnen <strong>die</strong>ser<br />
Einrichtung wichtig ist.<br />
Alle Fragebögen bleiben anonym und wer<strong>de</strong>n nicht an Dritte weitergegeben.<br />
Wir bedanken uns herzlich <strong>für</strong> Eure Unterstützung<br />
Ramona und Regina<br />
Der Fragebogen<br />
9. Wusstest Du dass es sich bei <strong>„</strong>Wildwasser Selbsthilfe und Beratung“ um ein Projekt han<strong>de</strong>lt, in<br />
<strong>de</strong>m <strong>die</strong> Mitarbeiterinnen selbst sexuelle Gewalt erfahren haben?<br />
□ ja □ nein<br />
3
Wenn ja, war es einer <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong> <strong>die</strong>se Einrichtung zu nutzen?<br />
□ ja □ nein<br />
10. Was zeichnet <strong>die</strong> betroffenen Mitarbeiterinnen Deiner Meinung nach aus?<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
11. Hat sich durch <strong>de</strong>n Kontakt zu <strong>de</strong>m Projekt Deine Sicht auf Krisen verän<strong>de</strong>rt?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja, wie?__________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
12. Wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Projekten über <strong>die</strong> folgen<strong>de</strong>n Themen gesprochen?<br />
Gewalterfahrung:□ ja □ nein<br />
Gewaltstrukturen: □ ja □ nein<br />
Hierarchien: □ ja □ nein<br />
Gesundheitsbegriff: □ ja □ nein<br />
An<strong>de</strong>re: □ ja □ nein<br />
Wenn ja, welche?_________________________________________________<br />
_______________________________________________________________<br />
13. Hast Du Erfahrungen mit an<strong>de</strong>ren Einrichtungen <strong>de</strong>s Hilfesystems gemacht?<br />
□ ja □ nein<br />
14. Stellt Wildwasser <strong>für</strong> Dich eine Alternative zum restlichen Hilfesystem dar?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja, warum?_______________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
15. Wie ist Deine Erfahrung mit<br />
o Professionellen Helfern wie z. B. Sozialarbeitern o<strong>de</strong>r Psychologen ?<br />
____________________________________________________________<br />
4
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
o Selbst betroffenen Helfern?<br />
____________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
o O<strong>de</strong>r mit Helfern, <strong>die</strong> bei<strong>de</strong>s kombinieren, das heißt selbst betroffen sind und<br />
eine zusätzliche Qualifikation im Sozialen Bereich besitzen?<br />
____________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________<br />
16. Hat <strong>de</strong>r Austausch von Erfahrungen mit betroffenen Mitarbeiterinnen eine Rolle <strong>für</strong> Dich<br />
gespielt?<br />
□ ja □ nein<br />
Wenn ja wieso?________________________________________________________<br />
_________________________________________________________<br />
_________________________________________________________<br />
Wenn nein, wieso?______________________________________________________<br />
_________________________________________________________<br />
_________________________________________________________<br />
Persönliche Angaben<br />
Falls Du dazu bereit bist, wür<strong>de</strong>n wir uns über einige persönliche Angaben freuen:<br />
3. Wie alt bist Du?<br />
□ 18-27 □ 28-39 □ 40-55 □ über 55<br />
4. Geschlecht<br />
□ männlich □ weiblich<br />
5
Anhang 2: Beitrag gehalten von Martina Hävernick auf <strong>de</strong>m Kongress Armut und<br />
Gesundheit, Berlin 2005<br />
<strong>„</strong><strong>Betroffenheit</strong> – nicht Manko, son<strong>de</strong>rn Qualifikation. Kriterien<br />
Betroffenenkontrollierter Praxis“<br />
Die Wildwasser Frauenselbsthilfe, das Weglaufhaus und Tauwetter wurzeln alle in <strong>de</strong>n<br />
emanzipatorischen Ansätzen <strong>de</strong>r sozialen Bewegungen <strong>de</strong>r 70er und 80er Jahre:<br />
Frauenbewegung, Antipsychiatriebewegung, Selbsthilfebewegung, ... Sie wur<strong>de</strong>n von<br />
Betroffenen gegrün<strong>de</strong>t, <strong>die</strong> mit <strong>de</strong>m bisherigen Hilfeangebot nicht zufrie<strong>de</strong>n waren.<br />
Menschen, <strong>de</strong>ren Verhalten nicht in <strong>die</strong> klassischen Bil<strong>de</strong>r von Hilfebedürftigkeit passt,<br />
z.B. weil sie ihren eigenen Kopf behalten wollen, machen oft schlechte Erfahrungen mit<br />
<strong>de</strong>m Hilfesystem. Die InitiatorInnen <strong>de</strong>r Projekte haben <strong>die</strong>s nicht <strong>als</strong> persönliches<br />
Versagen interpretiert, son<strong>de</strong>rn <strong>als</strong> Bestandteil einer grundsätzlich zu formulieren<strong>de</strong>n<br />
Kritik am bestehen<strong>de</strong>n Gesellschafts- und Hilfesystem erkannt. So entstand <strong>die</strong> I<strong>de</strong>e,<br />
sich mit an<strong>de</strong>ren Betroffenen zusammenzuschließen, um <strong>die</strong> eigenen Anliegen<br />
anzugehen und Hilfsangebote auf <strong>de</strong>r Basis eines emanzipatorischen<br />
Selbstverständnisses zu entwickeln.<br />
Heute verfügen <strong>die</strong> drei Projekte über eine mehr <strong>als</strong> 10 bzw. 20 jährige Praxis. Im Zuge<br />
<strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung um NutzerInnenbeteiligung und Qualitätssicherung in <strong>de</strong>r<br />
sozialen Arbeit entstand das Bedürfnis nach Austausch bei <strong>de</strong>m <strong>die</strong> Arbeit von<br />
Betroffenen nicht primär <strong>als</strong> Problem, son<strong>de</strong>rn <strong>als</strong> Qualitätsmerkmal verstan<strong>de</strong>n wird.<br />
Es war wohltuend festzustellen, dass unabhängig voneinan<strong>de</strong>r ähnliche Grundprinzipien<br />
in <strong>de</strong>r Arbeit von und mit Gewaltopfern entwickelt wur<strong>de</strong>n. In <strong>die</strong>sem Kontext wur<strong>de</strong><br />
2004 bis 2005 im Zeitraum von über einem Jahr <strong>de</strong>r Betroffenenkontrollierten Ansatz in<br />
Gestalt <strong>de</strong>r Broschüre <strong>„</strong>Betrifft: Professionalität“ formuliert. Die vorliegen<strong>de</strong><br />
Kurzfassung ist eine Aktualisierung und <strong>Weiterentwicklung</strong>.<br />
Der Gewaltbegriff:<br />
Gewalt ist eine auf Machtstrukturen basieren<strong>de</strong> Handlung, <strong>die</strong> einen Menschen auf ein<br />
Objekt reduziert. Als solches, <strong>als</strong> Objekt erlebt <strong>die</strong>ser Mensch dann Ohnmacht und<br />
Hilflosigkeit. Diese Erfahrung ist <strong>de</strong>r zerstörerische Kern von Gewalt und je<strong>de</strong>r<br />
Bearbeitungsprozess muss <strong>die</strong>s einbeziehen. Für uns folgt daraus, dass von Anfang an<br />
<strong>die</strong> Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit und <strong>die</strong> Vermeidung von neuen<br />
Situationen <strong>de</strong>s Ausgeliefertseins im Mittelpunkt stehen.<br />
Gewalt <strong>als</strong> Gewalt zu bezeichnen, <strong>die</strong> eigene Erfahrung <strong>als</strong> Gewalterfahrung zu<br />
<strong>de</strong>finieren, ist <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raneignung <strong>de</strong>s Subjektstatus. Gewalt ist kein<br />
persönliches Stigma, son<strong>de</strong>rn erlebtes Unrecht.<br />
Freiwilligkeit:<br />
Wenn Handlungsfähigkeit und Subjektstatus Ziel <strong>de</strong>s Bearbeitungsprozesses sind, ist<br />
Freiwilligkeit eine Grundvoraussetzung:<br />
Den NutzerInnen wird ein Angebot gemacht, sie entschei<strong>de</strong>n selber, ob und in welchem<br />
Umfang sie das Angebot wahrnehmen wollen. Es gibt kein therapeutisches Programm<br />
und keine Verordnungen.<br />
Aufträge von Dritten wer<strong>de</strong>n nicht entgegengenommen, da <strong>die</strong>s Betroffene erneut zu<br />
Objekten machen wür<strong>de</strong>.<br />
6
Dies heißt aber auch, dass <strong>die</strong> NutzerInnen eigenverantwortlich bleiben. Sie wissen<br />
selber am besten über ihre konkrete Situation Bescheid und können <strong>de</strong>shalb nur selber<br />
sagen, was Ihnen hilft und was nicht.<br />
Zugang:<br />
Freiwilligkeit bezüglich <strong>de</strong>s Zuganges heißt:<br />
Eingangsvoraussetzung sind nicht diagnostische Einstufungen, son<strong>de</strong>rn <strong>die</strong><br />
Einschätzung <strong>de</strong>r NutzerInnen, dass <strong>die</strong>ses Angebot <strong>für</strong> sie hilfreich ist. Wichtig ist <strong>die</strong><br />
Bereitschaft sich auf einen selbstbestimmten Verän<strong>de</strong>rungsprozess einzulassen.<br />
Wer sich <strong>für</strong> <strong>die</strong> Nutzung <strong>de</strong>s Angebots entschei<strong>de</strong>t, wird im Rahmen <strong>de</strong>r formalen und<br />
personellen Möglichkeiten <strong>de</strong>r Projekte akzeptiert.<br />
Menschenbild:<br />
Grundlegend <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Haltung ist ein Menschenbild, in <strong>de</strong>m:<br />
- Menschen nicht in Kategorien mit verschie<strong>de</strong>ner Wertigkeit einteilt wer<strong>de</strong>n,<br />
- <strong>die</strong> Aufteilung in Hilfesuchen<strong>de</strong> und Helfen<strong>de</strong> <strong>als</strong> situative und keine grundsätzliche<br />
begriffen wird,<br />
- je<strong>de</strong>r Mensch erheblich mehr an Lebenserfahrungen besitzt, <strong>als</strong> <strong>die</strong> erlebte Gewalt,<br />
- alle im Prinzip über <strong>die</strong> Fähigkeit verfügen sich zu verän<strong>de</strong>rn.<br />
Krisenbegriff:<br />
Krisen sind nicht Ausdruck einer Krankheit o<strong>de</strong>r eines Defizits. Krisen sind Ausdruck<br />
einer Überfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r eigenen Bewältigungsstrategien und <strong>de</strong>s sozialen Umfel<strong>de</strong>s.<br />
Sie sind normaler Bestandteil <strong>de</strong>s Lebens und stellen eine Chance zu konstruktiven<br />
Verän<strong>de</strong>rungen dar.<br />
Je<strong>de</strong>s Verhalten, auch ungewöhnliches, übernimmt im Leben <strong>de</strong>s jeweiligen Menschen<br />
eine Funktion und ist immer auch ein Lösungsversuch einer konfliktreichen Situation.<br />
Neben individuellen Faktoren fin<strong>de</strong>n sich immer auch gesellschaftliche und soziale<br />
Hintergrün<strong>de</strong>, <strong>die</strong> zu einer Krise führen.<br />
Ursachen <strong>für</strong> Krisen sind: Einschränkungen in <strong>de</strong>n Entfaltungsmöglichkeiten durch<br />
Zuschreibungen, Verweigerung <strong>de</strong>s Zugangs zu Ressourcen, Entzug <strong>de</strong>r<br />
Lebensgrundlagen…, <strong>als</strong> existenzbedrohend wahrgenommene Ereignisse.<br />
Parteilichkeit:<br />
Da Gewalt <strong>als</strong> eine konkrete Handlung in einer Struktur verstan<strong>de</strong>n wird, ist <strong>die</strong><br />
Positionierung auf Seiten <strong>de</strong>r Opfer selbstverständlich.<br />
Dieses Partei ergreifen heißt nicht <strong>die</strong> eigene Position aufzugeben, son<strong>de</strong>rn sich trotz<br />
Differenzen um größtmögliches Verständnis zu bemühen. Entschei<strong>de</strong>nd da<strong>für</strong> ist, <strong>die</strong><br />
konkreten Probleme und <strong>die</strong> erfahrene Gewalt im Kontext gesellschaftlicher Strukturen<br />
zu betrachten.<br />
Da es auch darin keine Neutralität und Unabhängigkeit von <strong>de</strong>r eigenen<br />
gesellschaftlichen Herkunft, ethischer und ethnischer Zugehörigkeit, vom eigenen<br />
Geschlecht, von Alter und persönlicher Geschichte gibt, müssen <strong>die</strong>se immer mit<br />
reflektiert wer<strong>de</strong>n.<br />
7
Selbsthilfe:<br />
Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>s Subjekt zu wer<strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utet, sich mit <strong>de</strong>n eigenen Erfahrungen<br />
auseinan<strong>de</strong>rzusetzen, sich das eigene Leben wie<strong>de</strong>r anzueignen, sich selber wie<strong>de</strong>r zu<br />
ermächtigen, selber <strong>für</strong> sich Verantwortung zu übernehmen – das ist Selbsthilfe:<br />
- Betroffene sprechen selber, es wird nicht über sie gesprochen.<br />
- Betroffene tauschen sich aus, unterstützen und solidarisieren sich.<br />
- Durch <strong>de</strong>n Austausch zwischen Betroffenen wird <strong>die</strong> Isolation been<strong>de</strong>t und <strong>die</strong><br />
gesellschaftliche Dimension <strong>de</strong>r erlebten Gewalt greifbar.<br />
Selbsthilfe beinhaltet <strong>de</strong>shalb auch, An<strong>de</strong>re z.B. <strong>die</strong> Gesellschaft in ihre Verantwortung<br />
zu nehmen.<br />
Umgang mit Hierarchien:<br />
Machtstrukturen und Hierarchien zu kritisieren heißt nicht, dass <strong>die</strong> Projekte<br />
hierarchiefreie Räume sind. Hierarchien zu leugnen heißt, sie unangreifbar zu machen.<br />
Solche gesellschaftlichen Machtverhältnisse können sich an Geschlecht, sozialer<br />
Herkunft, Kultur o<strong>de</strong>r ethnischer Zugehörigkeit festmachen. Sie beinhalten meist einen<br />
unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen. Sie drücken sich zum Beispiel in einseitiger<br />
Zuschreibung von Kompetenz, in aka<strong>de</strong>mischen Titeln o<strong>de</strong>r unterschiedlicher<br />
Bezahlung aus. Solche Ungleichbehandlungen können auch entstehen aufgrund von<br />
Zuschreibungen und Stigmatisierungen im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen.<br />
Und das reproduziert sich auch in <strong>de</strong>n einzelnen Projekten.<br />
Es ist <strong>de</strong>shalb notwendig <strong>de</strong>n Umgang mit <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong>n Hierarchien beständig zu<br />
reflektieren. Nur so ist es möglich, sie transparent zu machen. Dies soll auch <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen weitestgehen<strong>de</strong> Einflussmöglichkeiten eröffnen und <strong>die</strong> eigene<br />
<strong>Weiterentwicklung</strong> und <strong>die</strong> <strong>de</strong>s Projektes gewährleisten.<br />
Durchlässigkeit <strong>de</strong>r Strukturen:<br />
Auf <strong>die</strong>ser Grundlage ist es möglich, dass ehemalige NutzerInnen MitarbeiterInnen<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
Dies ist <strong>für</strong> <strong>die</strong> NutzerIn und <strong>die</strong> MitarbeiterIn <strong>die</strong> perspektivische Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
vorgefun<strong>de</strong>nen Machtverhältnisse. Es beeinflusst damit auch schon <strong>de</strong>n Kontakt in <strong>de</strong>r<br />
gegenwärtigen Situation, in<strong>de</strong>m es ermöglicht <strong>die</strong> eigene Rolle und<br />
Handlungsmöglichkeiten weitergehen<strong>de</strong>r zu reflektieren – es zwingt aber auch dazu.<br />
8
Beschäftigung von Betroffenen:<br />
Nicht je<strong>de</strong>r Betroffene vertritt automatisch einen betroffenenkontrollierten Ansatz.<br />
Der Ansatz ist Ergebnis eines Reflektions- und Abstraktionsprozesses bis dahin<br />
individualisierter persönlicher Erfahrungen von Betroffenen und stellt einen<br />
Sprung auf ein an<strong>de</strong>res, verallgemeinertes Niveau dar.<br />
Die konzeptionell festgeschriebene, gleichberechtigte Einstellung von Betroffenen<br />
ist <strong>de</strong>shalb elementarer Bestandteil <strong>de</strong>s betroffenenkontrollierten Ansatzes.<br />
Die mit <strong>de</strong>m Ansatz verbun<strong>de</strong>ne Haltung kann natürlich auch von Nicht-<br />
Betroffenen eingenommen wer<strong>de</strong>n. Für eine lebendige <strong>Weiterentwicklung</strong> <strong>de</strong>s<br />
Ansatzes ist aber <strong>de</strong>r gemeinsame Prozess von Betroffenen notwendig.<br />
Betroffene MitarbeiterInnen können Vorbil<strong>de</strong>r sein, dass trotz Gewalterfahrung<br />
ein selbstbestimmtes Leben ansatzweise möglich ist. So können stigmatisieren<strong>de</strong><br />
und isolieren<strong>de</strong> Bil<strong>de</strong>r von Gewaltopfern durchbrochen wer<strong>de</strong>n.<br />
Spezifische Anfor<strong>de</strong>rungen an MitarbeiterInnen:<br />
MitarbeiterInnen in betroffenenkontrollierten Projekten müssen<br />
- Die eigene Rolle, <strong>die</strong> Position bzgl. eigener <strong>Betroffenheit</strong> und <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>s<br />
eigenen Hilfeangebotes klar haben und transparent machen können.<br />
- Die eigenen Erfahrungen und ihren Umgang damit angemessen reflektieren,<br />
- Die Bereitschaft und Kompetenz haben, über das eigene Erleben zu<br />
kommunizieren,<br />
- Fähig sein, <strong>die</strong> eigenen (Gewalt-) Erfahrungen bzw. <strong>die</strong> Beschäftigung damit<br />
aktiv <strong>als</strong> Ressource zu nutzen und nicht <strong>als</strong> Makel zu betrachten, z.B. in<strong>de</strong>m sie<br />
eigene Erfahrungen bewusst einsetzen, um z.B. Hemmschwellen zu verringern<br />
o<strong>de</strong>r Zuschreibungen in Frage zu stellen.<br />
- Verschie<strong>de</strong>ne Perspektiven einnehmen können.<br />
Um NutzerInnen <strong>als</strong> kompetent und ExpertInnen <strong>für</strong> sich selber wahr zu nehmen,<br />
brauchen <strong>die</strong> MitarbeiterInnen<br />
- Die Offenheit, sich in <strong>de</strong>n eigenen Vorstellungen und Werten irritieren zu<br />
lassen,<br />
- Die Grundhaltung, sich lernend stetig weiter zu entwickeln.<br />
- Einen Umgang mit Stigmatisierungen, <strong>de</strong>r <strong>die</strong>se in ihren Funktionen auf<strong>de</strong>ckt,<br />
- Eine kritische Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.<br />
Diese Anfor<strong>de</strong>rungen gelten <strong>für</strong> alle MitarbeiterInnen unabhängig von ihren<br />
spezifischen Erfahrungen. Sie gehen über das in Berufsausbildungen Vermittelte<br />
hinaus, bzw. können unabhängig davon erworben wer<strong>de</strong>n. Sie können <strong>die</strong> darüber<br />
hinaus notwendigen Qualifikationen aber nicht ersetzen.<br />
Grenzen <strong>de</strong>s Angebots:<br />
Die formalen Zugangsvorausetzungen <strong>für</strong> NutzerInnen sind so gering wie<br />
möglich. Es hat sich aber gezeigt, dass unsere Grundhaltung bezüglich<br />
Freiwilligkeit, unsere Zugangsbedingungen, unser Verständnis von Parteilichkeit<br />
und Selbsthilfe, … dazu führt, dass NutzerInnen viel mitbringen bzw. entwickeln<br />
müssen, um unsere Angebote erfolgreich nutzen zu können. Grundlegend da<strong>für</strong> ist<br />
<strong>die</strong> Bereitschaft in Kontakt zu gehen, sich irritieren zu lassen, offen zu sein <strong>für</strong><br />
einen Prozess <strong>de</strong>s Hinterfragen, Neu- und Umorientierens.<br />
9
Die beteiligten Projekte:<br />
-Tauwetter e.V.<br />
Gneisenaustr. 2a<br />
2. Hof, Aufgang 3, 2 OG (Zugang über Fahrstuhl nach Absprache)<br />
10961 Berlin<br />
030 / 693 80 07<br />
www.tauwetter.<strong>de</strong><br />
mail@tauwetter.<strong>de</strong><br />
Telefonzeiten:<br />
Informations- und Beratungsstelle Do. 17.00 – 19.00 Uhr<br />
Selbsthilfebereich Di. 17.00 – 18.00 Uhr<br />
- Weglaufhaus <strong>„</strong>Villa Stöckle“<br />
Tel. 030/40632146<br />
Fax. 030/40632147<br />
Erreichbarkeit rund-um-<strong>die</strong>-Uhr<br />
Internet: www.<strong>weglaufhaus</strong>.<strong>de</strong><br />
Postfach 280427<br />
13444 Berlin<br />
Da sich das Weglaufhaus <strong>als</strong> Zufluchtsort versteht ist <strong>die</strong> Adresse nicht öffentlich<br />
zugänglich.<br />
- Wildwasser Frauenselbsthilfe und Beratung<br />
Friesenstraße 6, Dachgeschoss (Beratung auch ebenerdig möglich),<br />
10965 Berlin<br />
030/ 693 91 92<br />
selbsthilfe@wildwasser–berlin.<strong>de</strong><br />
www.wildwasser–berlin.<strong>de</strong><br />
Telefonzeiten:<br />
Dienstag 9–11 Uhr<br />
Mittwoch 16– 18 Uhr<br />
Donnerstag 13– 15 Uhr<br />
10
Anhang 4: Vortrag gehalten von Marion Mebes beim Wildwasser-Kongress:<br />
<strong>„</strong>Parteiliche Arbeit gegen sexuelle Gewalt – Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Zukunft“ , Berlin 2003<br />
Begrüßung<br />
Bevor Sie sich bei <strong>die</strong>sem Kongress an <strong>die</strong> Gegenwart und Zukunft <strong>de</strong>s Themas<br />
sexualisierte Gewalt machen, möchte ich Sie einla<strong>de</strong>n, mit mir ein Stück zurück<br />
zu gehen und <strong>die</strong> Anfänge zu betrachten.<br />
Ich wur<strong>de</strong> eingela<strong>de</strong>n <strong>als</strong> Mitbegrün<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>r ersten Selbsthilfegruppe von und <strong>für</strong><br />
Frauen nach sexuellem Missbrauch. Der Gruppe, in <strong>de</strong>r Wildwasser ihren<br />
Ursprung hat.<br />
Als solche bin ich sozusagen Ihr <strong>„</strong>wan<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>s Geschichtsbuch“.<br />
Die <strong>„</strong>Jüngeren“ unter Ihnen kennen vielleicht einen Teil <strong>de</strong>r Ursprünge überhaupt<br />
nicht und wüßten gerne mehr. Für Sie hoffe ich, dass ich Ihre Neugier ein wenig<br />
befriedigen kann.<br />
Die <strong>„</strong>Älteren“ mögen vielleicht daran <strong>de</strong>nken, wie sie sich – direkt o<strong>de</strong>r indirekt –<br />
mit <strong>de</strong>n Anfängen von Wildwasser verbun<strong>de</strong>n fühlen.<br />
Anfang <strong>de</strong>r 80er Jahre war es mein und unser ganz persönliches Erleben, das<br />
individuelle Gefühl <strong>de</strong>r Unfreiheit, das uns antrieb.<br />
Gesellschaftliche Verän<strong>de</strong>rungen und gesellschaftspolitische Einflussnahme<br />
waren uns nicht wirklich nah.<br />
Für uns waren wir selbst das Nahe liegen<strong>de</strong>.<br />
Dass alles an<strong>de</strong>re unabdingbar dazugehören wür<strong>de</strong>, wenn wir etwas erreichen<br />
wollten, ahnten wir dam<strong>als</strong> nicht.<br />
Sommer 1981<br />
Den Schock, dass ich – 27jährig – nachts schweißgeba<strong>de</strong>t erwache und starr im<br />
Bett liege, weil ER nach vielen Jahren erneut an meinem Bett steht, hatte ich<br />
gera<strong>de</strong> verdrängt.<br />
Erfolgreich, wie ich dachte.<br />
Ich war gera<strong>de</strong> seit ein paar Monaten in <strong>de</strong>n USA. Also weit weg.<br />
Außer<strong>de</strong>m: <strong>de</strong>r Mann war alt. Was sollte er mir jetzt schon noch tun<br />
können?<br />
Ich war erwachsen.<br />
Stell dich nicht so an!<br />
Das Verdrängen funktionierte aber wohl nicht mehr so gut. Das wur<strong>de</strong> mir<br />
schlagartig bei einem meiner Praxisbesuche bewusst.<br />
Ich arbeitete zu <strong>die</strong>ser Zeit <strong>als</strong> Sozialarbeiterin im Suchtbereich in <strong>de</strong>n USA und<br />
besuchte eine Nachsorgegruppe einer Suchteinrichtung ausschließlich <strong>für</strong> Frauen.<br />
(Einrichtungen <strong>die</strong>ser Art waren zu jener Zeit in Berlin lediglich in <strong>de</strong>n Köpfen<br />
einiger Frauen vorhan<strong>de</strong>n, gehörten zu <strong>de</strong>n Traumzielen.)<br />
Es han<strong>de</strong>lte sich bei <strong>die</strong>ser Gruppe um eine Themengruppe.<br />
17
Eigentlich war ich mit <strong>de</strong>r Leiterin <strong>de</strong>r Einrichtung verabre<strong>de</strong>t, <strong>die</strong> mich über<br />
Konzept, Aufbau, Inanspruchnahme, Finanzierung usw. informieren sollte.<br />
Die war aber krank.<br />
<strong>„</strong>Wenn du schon mal da bist“, meinte <strong>die</strong> Mitarbeiterin im Tages<strong>die</strong>nst, <strong>„</strong>kannst<br />
du dich ja mit in <strong>die</strong> Gruppe setzen. Da lernst du <strong>die</strong> praktische Seite unserer<br />
Arbeit gleich kennen.“<br />
<strong>„</strong>Ja klar,“ sagte ich ohne großes Nach<strong>de</strong>nken.<br />
Da saß ich dann in <strong>die</strong>ser Gruppe von Frauen. Es hat mich sozusagen <strong>„</strong>kalt<br />
erwischt“. Die Frauen trafen sich zum Schwerpunkt sexueller Missbrauch.<br />
Es war nicht nur <strong>die</strong> Erinnerung an sorgfältig vergrabene Puzzleteile meiner<br />
Kindheit.<br />
Nein. Es war auch und vor allem das Erleben <strong>de</strong>r Freiheit <strong>die</strong>ser Frauen, <strong>die</strong> über<br />
<strong>für</strong> mich bis dahin Unaussprechliches sprachen. Es war das aufmerksame<br />
Zuhören, ihr Wissen um <strong>die</strong> eigene Geschichte, ihr offensichtlicher Mut und ihre<br />
Fähigkeit, ihr Leben in <strong>die</strong> Hand zu nehmen.<br />
Ich war schockiert, zutiefst verunsichert – und neidisch.<br />
Die Freiheit, <strong>die</strong> ich dort unter <strong>die</strong>sen Frauen verspürte, wollte ich auch haben.<br />
Mit <strong>die</strong>sem Wunsch (sozusagen im Gepäck) kam ich im<br />
Sommer 1982<br />
nach Berlin zurück.<br />
Versuchen Sie sich vorzustellen – Sommer 1982<br />
Frauenbewegung – ja<br />
Frauenhäuser und Notrufe – ja<br />
Thema Kin<strong>de</strong>smisshandlung – ja<br />
Vergewaltigung von Frauen – ja<br />
Information über sexuellen Missbrauch – nein<br />
(Der Begriff existierte noch nicht einmal in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit – <strong>„</strong>Inzest“ war,<br />
wenn überhaupt davon gesprochen wur<strong>de</strong>, gebräuchlich)<br />
Verbreitung von Informationssystemen, Computer, Datenbanken – dürftig<br />
Zugang zum Internet – seltener <strong>als</strong> selten<br />
Schnelle Recherche-Möglichkeiten, Kontaktaufnahme über eMail, eine Website,<br />
auf <strong>de</strong>r über sexuelle Gewalt zu lesen war – das alles gab es nicht.<br />
Die Zeit bestand aus endlosen Telefonaten, zigmaligem Weiterreichen an Stellen,<br />
<strong>die</strong> schließlich doch kopfschüttelnd abwiesen: Nein, wir haben nichts Näheres.<br />
Nein, keine Therapeutischen Angebote. Nein, keine Gruppe. Nein.<br />
Es war <strong>als</strong>o <strong>die</strong> klassische Situation <strong>für</strong> das Entstehen von Selbsthilfe:<br />
Jemand hängt einen Zettel an einen Baum <strong>„</strong>Ich suche...“<br />
Jemand liest ihn und ruft an: <strong>„</strong>Ich habe gelesen und ich suche auch ...“<br />
Sie treffen sich.<br />
18
Ich hängte meinen Zettel in <strong>de</strong>n Frauenbuchla<strong>de</strong>n und in <strong>die</strong> Uni, wo in <strong>de</strong>n<br />
Semesterferien <strong>die</strong> Frauensommeruniversität stattfand. Wo so viele Frauen<br />
zusammen kamen, musste doch eine darunter sein, <strong>die</strong> ....<br />
Wahrscheinlich haben einige <strong>de</strong>n Zettel gelesen<br />
Inzest<br />
Suche an<strong>de</strong>re Frauen, <strong>die</strong> wie ich<br />
betroffen sind und darüber re<strong>de</strong>n wollen.<br />
Angerufen hat schließlich Anne Voss. Herbst 1982.<br />
Endlich waren wir zu zweit und es wur<strong>de</strong> einfacher.<br />
Sie hatte ähnliche Erfahrungen wie ich in London gemacht. Bei ihrer Arbeit in<br />
England hatte sie <strong>die</strong> Incest Survivors kennen gelernt.<br />
Wie ich wollte sie sich von <strong>de</strong>n Schatten <strong>de</strong>r Vergangenheit befreien.<br />
Wir wollten einfach so sehr, dass unser Leben an<strong>de</strong>rs wird. Daraus zogen wir<br />
unseren Mut. Und da<strong>für</strong> waren wir bereit, Risiken einzugehen.<br />
Die Entwicklung ging dann rasend schnell. An<strong>de</strong>re Frauen kamen dazu, wir<br />
wur<strong>de</strong>n eine richtige Gruppe.<br />
Wir lernten Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter kennen, <strong>die</strong> zu <strong>die</strong>ser Zeit<br />
eine Stu<strong>die</strong> im Rahmen <strong>de</strong>s Jugendhilfeberichtes <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bun<strong>de</strong>sregierung<br />
erstellten.<br />
Anfang 1983 entschlossen wir uns, an <strong>die</strong> Öffentlichkeit zu gehen. Wir lu<strong>de</strong>n ein<br />
zur ersten öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung in <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>srepublik zum Thema sexueller Missbrauch.<br />
Die Information verbreiteten wir über Mund-zu-Mund-Propaganda und<br />
Handzettel. Wir hatten keine Vorstellung, was passieren wür<strong>de</strong>.<br />
Was wir nicht erwartet hatten: Es kamen 80 bis 100 Frauen, von <strong>de</strong>nen wir mit<br />
offenen Ohren aufgenommen wur<strong>de</strong>n. Wir waren überwältigt.<br />
Der innere Aufruhr ist mir heute wie eh und je ganz präsent: Angst, Hoffnung und<br />
sehr <strong>de</strong>utlich das Gefühl � es gibt keinen an<strong>de</strong>ren Weg. Wenn sich etwas än<strong>de</strong>rn<br />
soll, dann müssen wir an <strong>die</strong> Öffentlichkeit, müssen weiter gehen <strong>als</strong> bisher.<br />
Wir berichteten über unserer Erlebnissen, unsere Gruppe und was wir sie <strong>für</strong> uns<br />
be<strong>de</strong>utet. Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter ihrerseits berichteten von <strong>de</strong>n<br />
Ergebnissen ihrer Befragung, von Interviews und was sie in mühseliger<br />
Kleinarbeit an Information und Wissen zusammen getragen hatten.<br />
Als hätten sie nur darauf gewartet, endlich einen Rahmen zu haben, in <strong>de</strong>m sie<br />
selbst sprechen können.<br />
Denn das taten sie im Anschluss an unsere Vorträge.<br />
Sie stan<strong>de</strong>n auf mitten in <strong>die</strong>sem Saal voller Frauen und sagten: <strong>„</strong>Ich auch....“<br />
... und sicher erlebten sie <strong>de</strong>n gleichen inneren Aufruhr wie wir.<br />
Und das Gefühl <strong>de</strong>s Aufbruchs. Auch das ein bestimmen<strong>de</strong>s Gefühl zu <strong>die</strong>ser Zeit.<br />
19
Dam<strong>als</strong> hatten wir Frauen <strong>als</strong> Opfer sexuellen Missbrauchs präsent. Dass auch<br />
Jungen betroffen sind, wussten wir noch nicht. Das lernten wir erst später dazu.<br />
Unsere Veranstaltung 1983 fand im Mehringhof statt.<br />
Und es ist fast so, <strong>als</strong> ob sich später ein Kreis geschlossen hat. Denn seit etlichen<br />
Jahren hat eine <strong>de</strong>r ersten Anlaufstellen <strong>für</strong> Jungen und Männer Tauwetter ihren<br />
Sitz im Mehringhof hier in Berlin.<br />
Kürzlich wur<strong>de</strong> ich bei einem Interview gefragt, ob ich dam<strong>als</strong> glücklich war. In<br />
<strong>die</strong>ser Begrifflichkeit hatte ich bis dahin über <strong>die</strong>se Zeit nicht nachgedacht.<br />
Entschlossen war ich, aus gewerkschaftlicher Vergangenheit politisch motiviert,<br />
kommunistischem und sozialistischem Denken verbun<strong>de</strong>n, hatte Blut gespen<strong>de</strong>t<br />
<strong>für</strong> Chile. Die Frage nach Glück hatte ich nicht gestellt.<br />
Aber nun, da sie gestellt war...?<br />
Ja. Es war eine glückliche Zeit.<br />
Welchen Sinn hätte es schließlich, all <strong>die</strong> Strapazen auf sich zu nehmen, wenn es<br />
nicht um’s Glück ginge.<br />
Dam<strong>als</strong> wie heute ist das Heraustreten aus <strong>de</strong>r Gefangenschaft, <strong>die</strong> durch <strong>die</strong><br />
Geheimhaltung erzeugt wird, ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Schritt.<br />
Wir än<strong>de</strong>rn damit <strong>die</strong> Richtung.<br />
Die Macht <strong>de</strong>s Täters verliert in <strong>de</strong>m Moment an Wirkung, in <strong>de</strong>m wir beginnen<br />
zu erzählen.<br />
Das ist es, woran Sie und wir täglich arbeiten:<br />
Daran, <strong>die</strong> Macht <strong>de</strong>r Täter (und <strong>die</strong> <strong>de</strong>r Täterinnen) zu verringern.<br />
Daran, <strong>die</strong> Opfer zu stärken, damit sie ihre Richtung än<strong>de</strong>rn können. Damit sie aus<br />
eigener Macht heraus, d.h. eigenmächtig entschei<strong>de</strong>n und han<strong>de</strong>ln und so <strong>de</strong>n<br />
Opferstatus hinter sich lassen können.<br />
Sommer 1983<br />
gaben wir <strong>de</strong>r Gruppe einen Rahmen und einen Namen.<br />
Wir grün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n ersten Verein und nannten ihn Wildwasser.<br />
Wildwasser wur<strong>de</strong> anfangs schon mal <strong>de</strong>m Kanusport zugeordnet.<br />
Unsere Gruppe hatte gedanklich mit an<strong>de</strong>ren Namen experimientiert –<br />
beispielsweise Wüstenblumen, <strong>die</strong> trotz Dürre wun<strong>de</strong>rbare Vielfalt entwickeln.<br />
Aber eine Woche später lan<strong>de</strong>ten wir wie<strong>de</strong>r bei Wildwasser.<br />
So blieb es dabei. Der Name entsprach einfach unseren I<strong>de</strong>en, Vorstellungen und<br />
Zielen:<br />
• Wasser <strong>als</strong> kräftiges Element, das seinen Weg bahnt – unter und über <strong>de</strong>r<br />
Er<strong>de</strong>.<br />
• Wasser, das ruhig fließend Landschaften verän<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r wild schäumend<br />
Hin<strong>de</strong>rnisse überwin<strong>de</strong>t.<br />
• Wasser <strong>als</strong> schillern<strong>de</strong> Inspiration.<br />
• Wasser, das langsam tropfend selbst härteste Steine aushöhlt.<br />
• Wasser, das <strong>die</strong> Schroffheit von Felsen in sanfte Rundungen verwan<strong>de</strong>ln kann.<br />
• Wasser, das nährt und trägt.<br />
20
Vielleicht unbewußt aber <strong>de</strong>nnoch bezeichnend haben wir keinen rein<br />
harmonischen Namen gewählt.<br />
So kraftstrotzend Wildwasser sein kann – es ist kein ruhiger See, in <strong>de</strong>n wir uns<br />
zurücklehnen können, wie in einen bequemen Sessel.<br />
Unser Thema ist und bleibt Wil<strong>de</strong>s Wasser, ein ständige Herausfor<strong>de</strong>rung.<br />
In <strong>die</strong>sem Sinn wünsche ich Ihnen allen eine ebenso anregen<strong>de</strong> wie aufregen<strong>de</strong><br />
<strong>„</strong>Fahrt“ während <strong>de</strong>r Kongresstage hier in Berlin und danach – wo immer Ihr Ort<br />
ist, an <strong>de</strong>m Sie sich mit <strong>de</strong>m Thema beschäftigen.<br />
Viel Glück.<br />
Marion Mebes<br />
Seit 1977 war ich mehr <strong>als</strong> 13 Jahre <strong>als</strong> Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin und<br />
Therapeutin tätig: mit Obdachlosen und Haftentlassenen, in <strong>de</strong>r Familienhilfe,<br />
Altenhilfe, Suchttherapie mit Kin<strong>de</strong>rn und Erwachsenen, Beratung <strong>für</strong> süchtige<br />
Frauen, Gruppen- und Einzelbetreuung von süchtigen und mit suchtmittelfreien<br />
Frauen sowie Selbsthilfe- und Beratungsbereich zum Thema sexualisierte Gewalt.<br />
Meine Arbeit in <strong>de</strong>n USA gab <strong>de</strong>n Anstoß, mich genauer mit sexualisierte Gewalt<br />
zu beschäftigen. Bei meiner Rückkehr nach Berlin suchte ich 1982 nach Frauen,<br />
<strong>die</strong> ebenfalls sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt hatten, <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Aufbau<br />
einer Selbsthilfegruppe. Aus <strong>die</strong>ser ersten Gruppe entstand 1983 Wildwasser.<br />
Wenige Jahre später habe ich <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sverein zur Prävention von sexuellem<br />
Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V. mitbegrün<strong>de</strong>t. Kurz darauf habe ich<br />
<strong>de</strong>n Fachhan<strong>de</strong>l Donna Vita ins Leben gerufen. Hier fließen sowohl meine<br />
Ausbildung <strong>als</strong> Kauffrau <strong>als</strong> auch <strong>die</strong> Erfahrungen aus <strong>de</strong>r pädagogischtherapeutischen<br />
Arbeit zusammen. Ich bin Autorin von Kin<strong>de</strong>rbüchern und<br />
Sachbüchern, habe didaktische Materialien <strong>für</strong> Mädchen, Jungen und Frauen<br />
entworfen und entwickle u.a. das Verlagsprogramm von mebes & noack.<br />
Für <strong>de</strong>n Dachverband Bun<strong>de</strong>sverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch<br />
an Mädchen und Jungen e.V. betreue <strong>die</strong> Zeitung prävention <strong>als</strong><br />
Schlußredakteurin.<br />
Ich lebe und arbeite in Köln.<br />
© 2003 Marion Mebes<br />
21
Erklärung<br />
Hiermit versichere ich, dass ich <strong>de</strong>n mit 2 gekennzeichneten Teil <strong>die</strong>ser Gruppenarbeit<br />
selbständig verfasst habe.<br />
Die nicht mit 1 o<strong>de</strong>r 2 gekennzeichneten Teile wur<strong>de</strong>n gemeinschaftlich bearbeitet und<br />
verfasst.<br />
Es wur<strong>de</strong>n keine an<strong>de</strong>ren <strong>als</strong> <strong>die</strong> angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt.<br />
Ich bin einverstan<strong>de</strong>n, dass unsere Diplomarbeit in <strong>de</strong>r Bibliothek bereitgestellt wird.<br />
Berlin, <strong>de</strong>n 01.06.2006<br />
_________________________________________<br />
Regina Nicolai
Erklärung<br />
Hiermit versichere ich, dass ich <strong>de</strong>n mit 1 gekennzeichneten Teil <strong>die</strong>ser Gruppenarbeit<br />
selbständig verfasst habe.<br />
Die nicht mit 1 o<strong>de</strong>r 2 gekennzeichneten Teile wur<strong>de</strong>n gemeinschaftlich bearbeitet und<br />
verfasst.<br />
Es wur<strong>de</strong>n keine an<strong>de</strong>ren <strong>als</strong> <strong>die</strong> angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt.<br />
Ich bin einverstan<strong>de</strong>n, dass unsere Diplomarbeit in <strong>de</strong>r Bibliothek bereitgestellt wird.<br />
Berlin, <strong>de</strong>n 01.06.2006<br />
_________________________________________<br />
Ramona Schnekenburger