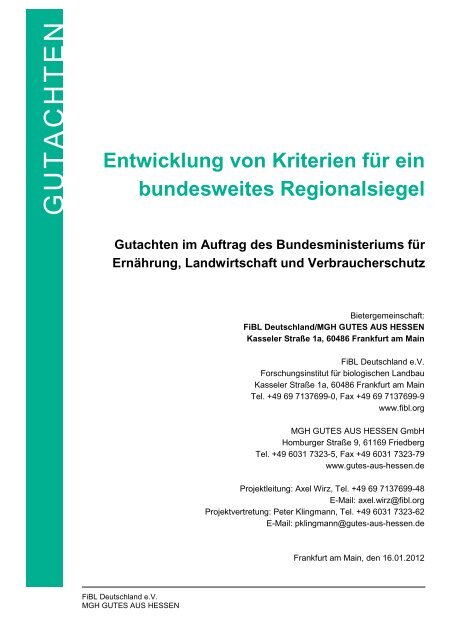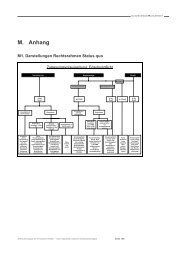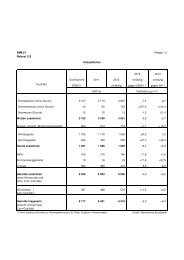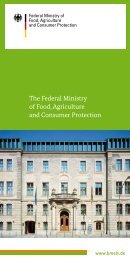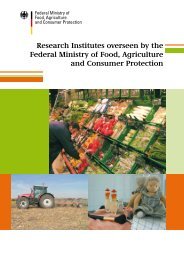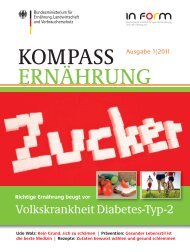Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV
Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV
Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GUTACHTEN<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong><br />
<strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums <strong>für</strong><br />
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
FiBL Deutschland e.V.<br />
MGH GUTES AUS HESSEN<br />
Bietergem<strong>ein</strong>schaft:<br />
FiBL Deutschland/MGH GUTES AUS HESSEN<br />
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main<br />
FiBL Deutschland e.V.<br />
Forschungsinstitut <strong>für</strong> biologischen Landbau<br />
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main<br />
Tel. +49 69 7137699-0, Fax +49 69 7137699-9<br />
www.fibl.org<br />
MGH GUTES AUS HESSEN GmbH<br />
Homburger Straße 9, 61169 Friedberg<br />
Tel. +49 6031 7323-5, Fax +49 6031 7323-79<br />
www.gutes-aus-hessen.de<br />
Projektleitung: Axel Wirz, Tel. +49 69 7137699-48<br />
E-Mail: axel.wirz@fibl.org<br />
Projektvertretung: Peter Klingmann, Tel. +49 6031 7323-62<br />
E-Mail: pklingmann@gutes-aus-hessen.de<br />
Frankfurt am Main, den 16.01.2012
Anbieter<br />
Projektpartner<br />
Unterstützer<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Aufgabenbeschreibung 7<br />
2 Übersicht über die regionalen Vermarktungswege und deren Kennzeichnung 7<br />
2.1 Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer 9<br />
2.2 Regionalsiegel/-marken des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels 13<br />
2.3 Regionalinitiativen und -marken 18<br />
2.4 Weitere regionale Kennzeichnungsansätze 21<br />
3 Erarbeitung und Darstellung der <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> Regionalität 22<br />
3.1 Regionsdefinitionen in Wissenschaft und Praxis 22<br />
3.1.1 Regionsdefinition in der Literatur 22<br />
3.1.2 Regionalität und regionale Lebensmittel 23<br />
3.1.3 Regionalbewussts<strong>ein</strong> und Heimat 23<br />
3.1.4 Regionsdefinitionen der Regionalinitiativen 24<br />
3.1.4.1 Regionalinitiativen 24<br />
3.1.4.2 Begriffsdefinitionen der Regionalinitiativen 25<br />
3.1.5 Überschneidungen und Transparenz 27<br />
3.2 Regionsdefinition im Hinblick auf Verbrauchererwartungen 27<br />
3.2.1 Konsummotivationen 27<br />
3.2.2 Kaufentscheidungsverhalten 29<br />
3.2.3 Verbraucherstudien zum Thema Regionalität 30<br />
4 Inhaltliche Definition unter Beachtung der Produktionstiefe 33<br />
4.1 Monoprodukte 34<br />
4.2 Zusammengesetzte Produkte 34<br />
4.2.1 Pflanzliche Produkte 35<br />
4.2.2 Tierische Produkte 36<br />
4.3 Wertschöpfungskette 38<br />
4.3.1 Landwirtschaft und deren Vorstufen 38<br />
4.4 Produktion- und naturbedingte Faktoren 41<br />
5 Einbindung weiterer Zusatzkriterien 43<br />
5.1 Bedeutung <strong>von</strong> Zusatzkriterien bei bestehenden Systemen 43<br />
5.1.1 Erwartungen der Verbraucher 43<br />
5.2 Auflistung verschiedener Zusatzkriterien 45<br />
5.2.1 Bio-Siegel 45<br />
5.2.2 Tierschutz 46<br />
5.2.3 Nachhaltigkeitskriterien 47<br />
5.2.4 Soziale <strong>Kriterien</strong>/Fair-Zertifizierung 49<br />
5.2.4.1 Beispiel: fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg 49<br />
5.2.4.2 Beispiel: Naturland Fair 51<br />
5.2.4.3 Beispiel: Die faire Milch 52<br />
5.2.5 Ohne Gentechnik 53<br />
6 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen Regionalsiegels 55<br />
6.1 Ausgangslage 55<br />
6.2 Rechtlicher Rahmen 56<br />
6.2.1 Obligatorische- und fakultative Herkunftskennzeichnung 56<br />
6.2.2 Nationale und gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Schutzsysteme 57<br />
6.2.3 Gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliches Schutzsystem 60<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 3
6.2.4 Staatliche Absatzförderung 62<br />
6.3 Zeichenvergabe 64<br />
6.3.1 Vorbemerkung 64<br />
6.3.2 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen Regionalsiegels 65<br />
6.3.3 Anwendungsbereich <strong>ein</strong>es Siegels 65<br />
6.3.4 Zeichenvergabe 66<br />
6.3.5 Kontrollen/Dokumentationen 69<br />
6.3.6 Verifizierung der Herkunftsaussagen 71<br />
7 Erfassung der Wünsche der Akteure 73<br />
8 Szenarienbildung 78<br />
8.1 Szenario „Anpassung/Koordination“ 79<br />
8.2 Szenario „Anerkennung“ 80<br />
8.3 Szenario „Regionalsiegel“ 82<br />
8.4 Szenario „Regionalfenster“ 83<br />
9 Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels 86<br />
9.1 Analyse des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte 86<br />
9.2 Absatzpotenziale nach ausgewählten Wirtschaftszweigen der Land- und<br />
Ernährungswirtschaft 89<br />
9.2.1 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Landwirtschaft 89<br />
9.2.1.1 Landwirtschaftliche Direktvermarktung 89<br />
9.2.1.2 Ökobetriebe 89<br />
9.2.1.3 Ackerbaubetriebe - Getreide 90<br />
9.2.1.4 Futterbaubetriebe/Tierhaltung 90<br />
9.2.2 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Ernährungsindustrie 91<br />
9.2.2.1 Fleischwirtschaft 91<br />
9.2.2.2 Mühlenwirtschaft 92<br />
9.2.3 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen des Ernährungshandwerks 93<br />
9.2.3.1 Fleischereien 93<br />
9.2.3.2 Bäckereien 95<br />
9.2.4 Absatzpotenziale beim Verbraucher 96<br />
9.3 Expertenbefragung: Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels 97<br />
9.3.1 Beurteilung der Szenarien 100<br />
9.4 Weitere Perspektiven 100<br />
10 Zusammenfassung 103<br />
11 Literatur 105<br />
12 Anhang 116<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 4
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Edeka Minden - die WEZette, 02.01.2012 16<br />
Abbildung 2: REWE-Dortmund, 02.01.2012 16<br />
Abbildung 3: Werbematerial <strong>von</strong> „Die Regionalen“ 16<br />
Abbildung 4: DLG-Medaillen 21<br />
Abbildung 5: Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“ 21<br />
Abbildung 6: Schematische Darstellung des Regionalisierungsprozesses und dessen<br />
Wirkung auf die Produktwahrnehmung 24<br />
Abbildung 7: Gebietskulissen ausgewählter Regionalinitiativen in Süddeutschland 26<br />
Abbildung 8: Theoretisches Konstrukt der möglichen Einflussfaktoren auf die individuelle<br />
Präferenz <strong>für</strong> regionale Lebensmittel (Henseleit et al. 2007, S. 8; nach<br />
Alvensleben 1999, 2001) 28<br />
Abbildung 9: Bandbreite <strong>von</strong> Regionsbezügen (Rutenberg 2011) 29<br />
Abbildung 10: Schematische Darstellung Wertschöpfungskette 39<br />
Abbildung 11: Wertschöpfungskette in der Schw<strong>ein</strong>emast 40<br />
Abbildung 12: Schematische Darstellung der milchwirtschaftlichen Unternehmensstruktur in<br />
Deutschland (nach Wolter, R<strong>ein</strong>hard, 2008. S. 19) 41<br />
Abbildung 13: Logo Biosiegel Rhön 45<br />
Abbildung 14: Logo Beter Leven 46<br />
Abbildung 15: Logo Aktion Tierwohl 47<br />
Abbildung 16: Logo Fairtrade International 49<br />
Abbildung 17: Logo fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg 49<br />
Abbildung 18: Logo Naturland Fair 51<br />
Abbildung 19: Die faire Milch 52<br />
Abbildung 20: Logo Ohne Gentechnik 53<br />
Abbildung 21: Internetseiten zur Rückverfolgbarkeit <strong>von</strong> Lebensmitteln 71<br />
Abbildung 22: Konzept Wasserzeichen 72<br />
Abbildung 23: Positionsebenen der Regionalakteure 75<br />
Abbildung 24: Darstellung der Umsetzungswege 78<br />
Abbildung 25: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>er Akkreditierung 82<br />
Abbildung 26: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>es Siegels 83<br />
Abbildung 27: Kontroll- und Vergabemodell des Regionalfensters 84<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 5
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Übersicht der befragten Schlüsselpersonen 7<br />
Tabelle 2: Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer 9<br />
Tabelle 3: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität 11<br />
Tabelle 4: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität 13<br />
Tabelle 5: Übersicht Werbung des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels mit Regionalität 15<br />
Tabelle 6: Anzahl der betrachteten Initiativen 18<br />
Tabelle 7: Übersicht Vielfalt der Regionalinitiativen 19<br />
Tabelle 8: Abgrenzung <strong>von</strong> Regionen 26<br />
Tabelle 9: Übersicht Verbraucherstudien zum Thema Regionalität 30<br />
Tabelle 10: Verbraucherstudien zum Thema Regionalität unter Beachtung der<br />
Produktionstiefe 33<br />
Tabelle 11: Beispiel Getreide: Weizenbrot 35<br />
Tabelle 12: Beispiel Obst: Erdbeerkonfitüre 36<br />
Tabelle 13: Beispiel Milch: Erdbeerjoghurt (Fruchtjoghurt) 37<br />
Tabelle 14: Beispiel Fleisch: Schinkenwurst 37<br />
Tabelle 15: Überblick Verbrauchererwartungen 43<br />
Tabelle 16: Übersicht Systemzulassungsstellen 68<br />
Tabelle 17: Übersicht Kontrollsystem 69<br />
Tabelle 18: Übersicht <strong>Kriterien</strong>modelle 77<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 6
1 Aufgabenbeschreibung<br />
Erstellung und Vorlage <strong>ein</strong>es Ergebnisberichtes mit Schlussfolgerung zur <strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> freiwilliges Regionalsiegel und der Umsetzung unter Berücksichtigung folgender<br />
Punkte:<br />
Tabellarischer Überblick über bestehende regionale Vermarktungswege und deren<br />
Kennzeichnung<br />
Darstellung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> Regionalität (Definition <strong>von</strong> Regionalität, Produktionstiefe,<br />
Rohstoffherkunft, weitere <strong>Kriterien</strong>, Rechtsrahmen)<br />
Realisierungsmodalitäten<br />
Potenzialanalyse<br />
Der Zuschlag <strong>für</strong> die Bietergem<strong>ein</strong>schaft erfolgte am 12.10.2011. Das erste Kick-off Meeting mit<br />
dem <strong>BMELV</strong> erfolgte am 03.11.2011 in Bonn. Ein erster Zwischenbericht wurde am 05.12.2011<br />
abgegeben. Die Abgabe des Sachberichtes ist <strong>für</strong> den 16.01.2012 festgelegt worden.<br />
2 Übersicht über die regionalen Vermarktungswege<br />
und deren Kennzeichnung<br />
Um <strong>ein</strong>e verlässliche Übersicht über die verschiedenen regionalen Vermarktungswege zu<br />
bekommen, wurden in den nachfolgenden Bundesländern Schlüsselpersonen ausgewählt und<br />
zu ihrem Wissensstand über die regionalen Vermarktungsaktivitäten und -organisationen sowie<br />
deren Adressen befragt. Die so gewonnenen Adressen wurden <strong>für</strong> die nachfolgenden<br />
Übersichten der regionalen Initiativen und Vermarktungswege benutzt.<br />
Tabelle 1: Übersicht der befragten Schlüsselpersonen<br />
Land Geschäftsstelle Ansprechpartner Telefon E-Mail<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsmarketing<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Bayern Bayerisches<br />
Staatsministerium <strong>für</strong><br />
Ernährung,<br />
Landwirtschaft und<br />
Forsten<br />
Brandenburg Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />
Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz<br />
Brandenburg<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Agrarmarketing<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern e.V.<br />
Katharina <strong>von</strong><br />
Plocki<br />
Ernst Süß<br />
Dr. Hartmut<br />
Kretschmer<br />
0711 6667061<br />
mbw@mbw-net.de<br />
089 2182-2320 Ernst.suess@stmelf.bayern.de<br />
03334 66-2724 Abt.GR@LUGV.Brandenburg.de<br />
Jarste Weuffen 0381 2523871 Info@MV-Ernaehrung.de<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 7
Niedersachsen<br />
Rh<strong>ein</strong>land-<br />
Pfalz<br />
Ökologischer Landbau,<br />
Förderung, BIO-<br />
Zeichen M-V<br />
Ministerium <strong>für</strong><br />
Landwirtschaft, Umwelt<br />
und Verbraucherschutz<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Marketinggesellschaft<br />
der niedersächsischen<br />
Land- und Ernährungswirtschaft<br />
e.V.<br />
Ministerium <strong>für</strong> Umwelt,<br />
Landwirtschaft,<br />
Ernährung, W<strong>ein</strong>bau<br />
und Forsten<br />
Rhön Dachmarke Rhön<br />
GmbH<br />
Saarland<br />
Ministerium <strong>für</strong><br />
Wirtschaft und<br />
Wissenschaft<br />
Sachsen Agrar-Marketing<br />
Sachsen e.V.<br />
Sachsen-<br />
Anhalt<br />
Schleswig-<br />
Holst<strong>ein</strong><br />
Thüringen<br />
Sächsisches<br />
Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />
Landwirtschaft und<br />
Geologie<br />
Sächsisches<br />
Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />
Landwirtschaft und<br />
Geologie<br />
Agrarmarketinggesellschaft<br />
Sachsen-<br />
Anhalt<br />
Netzwerk Zukunft<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Landwirtschaftskammer<br />
Schleswig-Holst<strong>ein</strong><br />
Agrar-Marketing<br />
Thüringen<br />
Dr. Hartmut<br />
Cziehso<br />
Dr. Kai-Uwe<br />
Kachel<br />
0381 4035-653<br />
0385 5886332<br />
hartmut.cziehso@lallf.mvnet.de<br />
kai-uwe.kachel@lu.mvregierung.de<br />
Jörg Helmsen 0511 34879-60 j.helmsen@mg-niedersachsen.de<br />
Jörg Wagner 06131 165256 Joerg.Wagner@mulewf.rlp.de<br />
Hannelore<br />
Rundell<br />
Dr. Arnold Ludes,<br />
D. Wehlen<br />
09774 9102-16<br />
bzw. -35<br />
0681 501-4166<br />
bzw. -4349<br />
Lutz Krüger 0351 3234657<br />
Catrina Kober<br />
(regionale<br />
Vermarktungsinitiativen)<br />
0351 2612-2404<br />
dmsekretariat@brrhoenbayern.de<br />
a.ludes@wirtschaft.saarland.de<br />
d.wehlen@wirtschaft.saarland.de<br />
ams@agrar-marketingsachsen.de<br />
Catrina.Kober@smul.sachsen.de<br />
Detlev Richter 0351 2612-2401 detlev.richter@smul.sachsen.de<br />
Dr. Thomas<br />
Lange bzw. Herr<br />
Zahn<br />
Anke Schulze-<br />
Fielitz<br />
Frau Sandra van<br />
Hoorn<br />
0391 7379010 thomas.lange@amg-sachsenanhalt.de<br />
0391 5433861 Agenda@kosa21.de<br />
04331 9453401 svanhoorn@lksh.de<br />
Dr. Norbert Stang 03641 683-136 agrarmarketing@tll.thueringen.de<br />
Alle Schlüsselpersonen wurden telefonisch und/oder per E-Mail bis zum 16.12.2011 kontaktiert<br />
und befragt. Auf Basis dieser Befragung sowie durch Rückkopplung durch die verschiedenen<br />
Partner der Bietergem<strong>ein</strong>schaft wurden die nachfolgenden Übersichten erstellt.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 8
2.1 Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer<br />
Für <strong>ein</strong>e Vergleichbarkeit wurden die verschiedenen Ländersiegel (konventionell wie bio) nach<br />
den nachfolgenden <strong>Kriterien</strong> betrachtet: Definition der Region, Anteil der Rohprodukte aus der<br />
Region bei zusammengesetzten Produkten, das Zertifizierungs- und Kontrollsystem sowie<br />
weitere verbindliche Standards.<br />
Tabelle 2: Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer<br />
Logo/Zeichen Siegel Definition der<br />
Region<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Anteil Rohprodukte aus<br />
der Region<br />
(zusammengesetzte<br />
Produkte)<br />
100 % der Hauptzutat<br />
(Ausnahmen<br />
produktbezogen)<br />
mind. 90 % der<br />
Hauptzutat<br />
Zertifizierung<br />
und Kontrolle<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
jährliche<br />
Kontrollen<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
jährliche<br />
Kontrollen,<br />
Stichproben<br />
Bayern 100 % der Hauptzutat 3-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
Bayern 80 % des Produkts 3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
Stichproben<br />
Biosphärenreservat<br />
Hessen, Bayern,<br />
Thüringen, 5 LKR<br />
100 % der Hauptzutat<br />
(Ausnahmen<br />
produktbezogen)<br />
Hessen 100 % der Hauptzutat<br />
(Ausnahmen<br />
produktbezogen)<br />
Hessen 100 % der Hauptzutat<br />
(Ausnahmen<br />
produktbezogen)<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
mind. 90 %<br />
Gewichtsanteil<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz 100 %<br />
(zurzeit nur Obst und<br />
Gemüse)<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
(nur<br />
Lizenznehmer)<br />
5-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
jährliche<br />
Zertifizierung<br />
5-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
jährliche<br />
Zertifizierung<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
(nur<br />
Lizenznehmer)<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
jährlich,<br />
Weitere<br />
verbindliche<br />
Standards<br />
integrierte<br />
Produktion<br />
ja, produktbezogen<br />
ja, produktbezogen<br />
ja, produktbezogen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 9<br />
k<strong>ein</strong>e<br />
ja, produktbezogen<br />
ja, produktbezogen<br />
ja, produktbezogen<br />
k<strong>ein</strong>e
Saarland 100 %<br />
(zurzeit nur Obst und<br />
Gemüse)<br />
Schleswig-Holst<strong>ein</strong> Molkereierzeugnisse:<br />
100 % der Hauptzutat,<br />
Fleischwaren:<br />
mindestens 60 %<br />
Erzeuger,<br />
Lizenznehmer und<br />
Zeichenträger:<br />
jährliche Kontrolle<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
Kontrolle<br />
mehrmals jährlich<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 10<br />
k<strong>ein</strong>e<br />
Thüringen ≥ 50,1 % der Hauptzutat jährliche Kontrolle k<strong>ein</strong>e<br />
ja, produktbezogen<br />
Die zurzeit verwendeten Länderzeichen (konventionell wie bio) unterscheiden sich im<br />
Wesentlichen durch den Anteil der Rohprodukte aus der Region bei zusammengesetzten<br />
Produkten sowie dem Zertifizierungs- und Kontrollsystem. So wird in Hessen vorgeschrieben,<br />
dass der Anteil der Rohstoffe bei zusammengesetzten Produkten <strong>für</strong> die Hauptzutat zu 100<br />
Prozent aus dem Bundesland kommen muss (produktbezogene Ausnahmen sind möglich). In<br />
Thüringen muss der Rohstoffanteil dagegen nur größer als 50,1 Prozent s<strong>ein</strong>. Bei den<br />
Zertifizierungs- und Kontrollsystemen reicht die Bandbreite <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em <strong>ein</strong>fachen Kontrollsystem<br />
über <strong>ein</strong> dreistufiges System bis zum fünfstufigen Kontrollsystem in Hessen.<br />
Zudem unterscheiden sich die Zeichen in der Anzahl der Lizenznehmer beziehungsweise ihrer<br />
Marktdurchdringung und Verbreitung. Da die jeweiligen Listungen in den verschiedenen<br />
Bundesländern jedoch nach unterschiedlichen Systematiken gehandhabt werden, kann hier<br />
k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitliche Darstellung erreicht werden. Festzuhalten bleibt, dass in den meisten Fällen<br />
je Bundesland, unabhängig <strong>von</strong> der Anzahl der Zeichennutzungs- oder Lizenzverträge, mehrere<br />
hundert Erzeuger (bzw. in Baden-Württemberg und Bayern jeweils mehrere tausend Erzeuger)<br />
in das Zeichensystem <strong>ein</strong>gebunden sind.<br />
Inaktivierte Zeichen (z. B. Sachsen: „Bewährte Qualität - neutral geprüft“) wurden bei der<br />
Aufstellung nicht berücksichtigt. Auch die Überlegungen beziehungsweise <strong>Entwicklung</strong>en in<br />
verschiedenen Bundesländern wie Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen oder Niedersachsen, die beide die<br />
Einführung <strong>ein</strong>es eigenen Länderzeichens in Erwägung ziehen, fließen noch nicht mit <strong>ein</strong>.<br />
Ebenso wurden die Überlegungen <strong>von</strong> Baden-Württemberg zur Erweiterung des QZ - Baden<br />
Württemberg mit dem Zusatz „Gentechnikfrei“ nicht berücksichtigt.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Kennzeichnung <strong>von</strong> Regionalität, besonders die Produktionstiefe und Zertifizierungs- und<br />
Kontrollsysteme betreffend, ist bei den Länderzeichen unterschiedlich. Einen vergleichbaren<br />
Standard haben bisher nur die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz und Saarland haben das Regelwerk aus Baden-Württemberg übernommen.
Eine zusätzliche Bedeutung auf Länder- bzw. EU-Ebene haben die drei EU-Kennzeichnungen<br />
<strong>für</strong> die Regionalität: geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), geschützte geografische Angabe<br />
(g.g.A.) und garantierte traditionelle Spezialität (g.t.S.) Die Vergabe dieser Kennzeichnung<br />
erfolgt über <strong>ein</strong> mehrstufiges Anerkennungsverfahren auf EU-Ebene.<br />
Tabelle 3: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität<br />
Kürzel Beschreibung<br />
g.U.<br />
g.g.A.<br />
Erzeugung, Verarbeitung und<br />
Herstellung <strong>ein</strong>es Produkts<br />
erfolgen in <strong>ein</strong>em bestimmten<br />
geografischen Gebiet nach <strong>ein</strong>em<br />
anerkannten und festgelegten<br />
Verfahren<br />
Ausreichend, wenn <strong>ein</strong>e der<br />
Herstellungsstufen (Erzeugung,<br />
Verarbeitung oder Herstellung) in<br />
<strong>ein</strong>em bestimmten<br />
Herkunftsgebiet erfolgt<br />
Produktgruppe<br />
Produkte in Deutschland<br />
Käse Allgäuer Bergkäse<br />
Allgäuer Emmentaler<br />
Altenburger Ziegenkäse<br />
Odenwälder Frühstückskäse<br />
Fleisch Diepholzer Moorschnucke<br />
Lüneburger Heidschnucke<br />
Wasser 24 Mineralwasser<br />
4 neue Anträge<br />
Käse Hessischer Handkäse<br />
Nieheimer Käse<br />
Fleisch Ammerländer<br />
Dielenrauchschinken/<br />
Ammerländer Katenschinken<br />
Obst und<br />
Gemüse<br />
Ammerländer Schinken/<br />
Ammerländer Knochenschinken<br />
Bayerisches Rindfleisch<br />
Göttinger Feldkieker<br />
Göttinger Stracke<br />
Greußener Salami<br />
Halberstädter Würstchen<br />
Hofer Rindfleischwurst<br />
Nürnberger Bratwürste/<br />
Nürnberger Rostbratwürste<br />
Schwäbische Maultaschen oder<br />
Schwäbische<br />
Suppenmaultaschen<br />
Schwäbisch-Hällisches<br />
Qualitätsschw<strong>ein</strong>efleisch<br />
Schwarzwälder Schinken<br />
Thüringer Leberwurst, Thüringer<br />
Rostbratwurst, Thüringer<br />
Rotwurst<br />
Bayerischer Kren<br />
Hopfen aus der Hallertau<br />
Lüneburger Heidekartoffeln<br />
Rh<strong>ein</strong>isches Apfelkraut<br />
Salate, Gurken, Feldsalat und<br />
Tomaten <strong>von</strong> der Insel Reichenau<br />
Schrobenhauser Spargel<br />
Spreewälder Gurken,<br />
Spreewälder Meerrettich<br />
Tettnager Hopfen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 11
g.t.S.<br />
Zusammenfassung<br />
K<strong>ein</strong>e geografische Herkunft,<br />
sondern nur <strong>ein</strong>e traditionelle<br />
Rezeptur oder <strong>ein</strong> traditionelles<br />
Herstellungsverfahren des<br />
Produkts<br />
Backwaren Aachener Printen<br />
Bremer Klaben<br />
Dresdner Stollen<br />
Lübecker Marzipan<br />
Meißner Fummel<br />
Nürnberger Lebkuchen<br />
Salzwedeler Baumkuchen<br />
Fisch Holst<strong>ein</strong>er Karpfen<br />
Bier 11 Biere<br />
Oberpfälzer Karpfen<br />
Schwarzwaldforelle<br />
Öl Lausitzer L<strong>ein</strong>öl<br />
W<strong>ein</strong> Hessischer Apfelw<strong>ein</strong><br />
18 neue Anträge<br />
k<strong>ein</strong>e Meldungen <strong>für</strong> Deutschland<br />
In Deutschland tragen sechs Lebensmittel und 24 Mineralwasser die EU-Kennzeichnung g.U.<br />
Im vergangenen Jahr wurden vier Neuanträge gestellt. Im Vergleich dazu hat all<strong>ein</strong> Italien 162<br />
Produkte in dieser Kategorie registriert oder zur Anmeldung angegeben.<br />
Im Bereich g.g.A. sind 49 Produkte registriert und 18 neu angemeldet worden. Italien hat 102<br />
Produkte mit diesem Zeichen registriert oder angemeldet.<br />
Das Antragsverfahren ist mit hohem zeitlichem und bürokratischem Aufwand versehen,<br />
sodass bisher wenige Organisationen/Antragsteller in Deutschland diesen Weg der Auslobung<br />
der Regionalität gegangen sind.<br />
Gleichzeitig gibt es <strong>ein</strong>e Diskussion um den Wert der g.g.A.-Kennzeichnung, da hier der<br />
Rohstoffbezug nicht berücksichtigt wird, was jedoch aus Verbrauchersicht gefordert wird.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 12
2.2 Regionalsiegel/-marken des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels<br />
Das Thema Regionalität wird beim Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel auf zwei unterschiedlichen Wegen<br />
angegangen. Auf der <strong>ein</strong>en Seite besitzen <strong>ein</strong>ige Handelsketten <strong>ein</strong>e eigene regionale<br />
Handelsmarke (Privat-Label). Diese regionalen Handelsmarken treten mit eigenem Logo und<br />
Verpackung auf und werden wie klassische Marken durch den Markeninhaber geführt. Es gibt<br />
k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitlichen Regeln beziehungsweise Qualitätsstandards, besonders was den<br />
Rohstoffbezug aus der Region angeht. In den meisten Fällen wird die Definition der Region<br />
gleichgesetzt mit der Vertriebsregion, was selten politisch-administrativen Grenzen oder<br />
geografischen Landschaftsräumen entspricht. Daher findet man bei den Markennamen der<br />
Handelsunternehmen eher Wortfelder mit ungenauer Regionsbeschreibung wie beispielsweise<br />
Heimat, Von Hier, Küstengold, Norden/Nordisch. Denn <strong>ein</strong>e klare Regionsabgrenzung über<br />
<strong>ein</strong>en Markennamen würde <strong>ein</strong>e Einschränkung des Vertriebsgebietes bedeuten.<br />
Bei der Marke „Unser Norden“ ist zum Beispiel nur der Verarbeitungsort ausschlaggebend, der<br />
Rohstoffbezug dagegen zweitrangig. Die EDEKA Südwest hat <strong>ein</strong> anderes Konzept: Bei der<br />
regionalen Handelsmarke „Unsere Heimat“ werden nur Rohwaren und Produkte verarbeitet, die<br />
den Qualitätsregeln der Länderzeichen Hessen, Baden-Württemberg, Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz oder<br />
Saarland entsprechen. Damit wird die EDEKA Südwest Marke „Unsere Heimat“ mit <strong>ein</strong>em<br />
externen Qualitäts- und Kontrollsystem zusätzlich aufgewertet, um <strong>ein</strong>e größere<br />
Glaubwürdigkeit zu erlangen.<br />
Bei der Edeka Nord Marke „Unsere Heimat“ wird auf die Qualitätsregeln der oben genannten<br />
Länderzeichen verzichtet, da in dem Vertriebsgebiet der EDEKA Nord k<strong>ein</strong>e vergleichbaren<br />
Länderzeichen vorhanden sind.<br />
Tabelle 4: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität<br />
Unternehmen Eigenmarke Logo Regionsdefinition + ggf.<br />
Qualitätskriterien<br />
Bünting Küstengold<br />
(famila)<br />
NaturWert<br />
regional (Combi)<br />
COOP Unser Norden<br />
(„Aus dem<br />
Norden <strong>für</strong> den<br />
Norden“)<br />
„der gesamte Nordwesten“<br />
alle Aufbereitungen und<br />
Veredelungen in der Region:<br />
SH, MV, NI, BB, gelegentlich<br />
Hamburg, Bremen und<br />
Berlin<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 13
EDEKA<br />
Nord<br />
EDEKA<br />
Rh<strong>ein</strong>-Ruhr<br />
EDEKA<br />
Südwest<br />
„Unsere Heimat –<br />
echt und gut“<br />
M<strong>ein</strong> Land<br />
„Unsere Heimat –<br />
echt und gut“<br />
Feneberg Von Hier<br />
LIDL „Ein gutes Stück<br />
Heimat –<br />
Ursprung ist<br />
Heimat“<br />
LIDL „Ein gutes Stück<br />
Heimat “ …<br />
garantiert aus<br />
Bayerischer<br />
Bauernmilch<br />
Netto Ein Herz <strong>für</strong><br />
Erzeuger<br />
„aus dem Absatzgebiet“:<br />
SH, HH, MV, nördliches NI<br />
„regional angebaut“<br />
(Obst und Gemüse)<br />
„aus der Region“: Länder<br />
BW, HE, RLP, SL, Rohstoffe<br />
müssen die <strong>Kriterien</strong> des<br />
entsprechenden<br />
Länderzeichens verbindlich<br />
erfüllen<br />
100 km um Kempten<br />
Biolinie<br />
„aus deutschen Regionen“<br />
Bayern, Nutzung „Geprüfte<br />
Qualität-Bayern“<br />
„deutsche Erzeuger“<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 14
Penny/REWE<br />
Zentral AG<br />
Echt Bayrisch<br />
Echt Nordisch<br />
real Bauernmilch<br />
k<strong>ein</strong>e Angabe<br />
Deutschland<br />
Viele Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandelsunternehmen werben mit dem Thema Regionalität<br />
ausschließlich am POS, mit Handzetteln oder Anzeigen und besitzen k<strong>ein</strong>e eigne regionale<br />
Handelsmarke. Dabei wird die Definition <strong>von</strong> Region auf das jeweilige Vertriebsgebiet des<br />
Händlers beschränkt, welches jedoch oft bundesländerübergreifend ist. Bei der<br />
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Direktvermarktern wird oft zusätzlich <strong>ein</strong><br />
Kilometerradius <strong>für</strong> die Regionalauslobung benutzt (z. B., maximal 30 Kilometer um den<br />
Marktstandort).<br />
Tabelle 5: Übersicht Werbung des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels mit Regionalität<br />
Unternehmen Werbebotschaft Regionsdefinition (ggf. Qualitätskriterien)<br />
EDEKA<br />
Minden-Hannover<br />
Bestes aus unserer Region max. 30 km Umkreis um den jeweiligen Markt;<br />
ab 30 km: „Bestes aus … [Benennung des<br />
Herstellungsortes]“<br />
REWE Dortmund NRW-Heimatprodukte REWE Erzeuger „vor Ort“<br />
REWE Aus unserer Region Erzeuger „vor Ort“<br />
tegut… Regionale Projekte, bevorzugt<br />
regionaler Einkauf und ausschließlich<br />
regionaler Vertrieb<br />
ca. 150 km um Fulda<br />
Kaufland Regionale Projekte, Naturschutz -<br />
Die Regionalen<br />
(Bio-Fachgroßhandel)<br />
Regional ist erste Wahl Erzeuger „vor Ort“<br />
Alnatura Aus der Region Erzeuger „vor Ort“<br />
Basic Aus der Region Erzeuger „vor Ort“<br />
Nachfolgend <strong>ein</strong>ige Beispiele <strong>für</strong> die Regionalwerbung des Einzelhandels.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 15
Abbildung 1: Edeka Minden - die WEZette, 02.01.2012<br />
Abbildung 2: REWE-Dortmund, 02.01.2012<br />
Abbildung 3: Werbematerial <strong>von</strong> „Die Regionalen“<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 16
Zusammenfassung<br />
Der Lebensmittelhandel geht das Thema Regionalität auf zwei Arten an: a) mit regionalen<br />
Handelsmarken, wobei der Regionenbegriff dem Vertriebsgebiet entspricht und an erster<br />
Stelle der Verarbeitungsort des Erzeugers/Herstellers steht und b) mit Werbung zum Thema<br />
Regionalität. Die Werbung zum Thema Regionalität kann dabei <strong>für</strong> den Verbraucher zu<br />
Verwirrung führen, da meistens nur der Standort des Verarbeitungsunternehmens ausgelobt<br />
wird, jedoch nicht die Herkunft des Rohstoffes oder die Qualität des regionalen<br />
Verarbeitungsprozesses.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 17
2.3 Regionalinitiativen und -marken<br />
Für die Erfassung der verschiedenen Regionalinitiativen wurden die durch die oben genannten<br />
Schlüsselpersonen gewonnen Adressen verwendet. Zusätzlich wurden verschiedene<br />
wissenschaftliche Studien, die der Bietergem<strong>ein</strong>schaft zur Verfügung standen, ausgewertet:<br />
zum Beispiel die Studie „Regionalsiegel in Deutschland, Dossier <strong>für</strong> das Jahr 2010“ (Familie<br />
Redlich) oder die Studie der Bayerischen Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft „Regionale<br />
Vermarktung, Projektbericht I, Strukturen und Tätigkeitsfelder, Stand Mai/Juni 2010“ Im<br />
Rahmen dieser bayerischen Studie wurden insgesamt 336 Regionalinitiativen aus ganz Bayern<br />
<strong>von</strong> lokaler bis überregionaler Marktbedeutung erfasst und ihre Ziele und Regeln in <strong>ein</strong>er<br />
gem<strong>ein</strong>samen Datenbank veröffentlicht, siehe auch www.lfl.bayern.de/iem/regionalvermarktung/<br />
38914/. Die in dieser Datenbank aufgeführten Initiativen konnten in der Kürze der Zeit <strong>für</strong> die<br />
geforderte Übersicht nicht alle berücksichtigt werden. Vergleichbare Studien, wie die aus<br />
Bayern, sind unseres Wissens <strong>für</strong> andere Bundesländer nicht durchgeführt worden. Die <strong>von</strong> uns<br />
erfassten und betrachteten Adressen <strong>von</strong> Regionalinitiativen und -marken betragen circa 220.<br />
Die betrachteten Initiativen und -marken wurden in <strong>ein</strong>e Übersichtstabelle mit den folgenden<br />
Rubriken <strong>ein</strong>gefügt: Bundesland, Marke, Gebietskulisse/Transparenz, Standards,<br />
Produktionstiefe, Vergabe/Kontrolle, Zusatzkriterien.<br />
Die nachfolgende Übersicht zeigt die betrachteten Initiativen in den verschiedenen<br />
Bundesländern. Eine ausführliche Auflistung aller Initiativen befindet sich im Anhang (siehe<br />
Anhang 12.1, Übersichtstabelle Regionalinitiativen).<br />
Tabelle 6: Anzahl der betrachteten Initiativen<br />
Bundesland betrachtete Initiativen<br />
Bayern 63<br />
Baden-Württemberg 39<br />
Brandenburg 2<br />
Brandenburg/Berlin 2<br />
Bremen 2<br />
Hamburg 2<br />
Hessen 10<br />
Mecklenburg-Vorpommern 5<br />
Niedersachsen 21<br />
Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen 8<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz 10<br />
Saarland 6<br />
Sachsen 7<br />
Sachsen-Anhalt 1<br />
Schleswig-Holst<strong>ein</strong> 5<br />
Thüringen 2<br />
Gesamt 185<br />
Dabei unterscheiden sich die <strong>ein</strong>zelnen Regionalinitiativen und -marken deutlich in der<br />
Definition der Region, der Produktionstiefe bei verarbeiteten Produkten, dem Kontroll- und<br />
Zertifizierungssystem und den Zusatzkriterien.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 18
So gibt es Regionsdefinitionen, die als Regionsgrenze Landkreise, Stadtgrenzen,<br />
Regierungsbezirke, Kilometerangaben oder Landschaftsräumen haben. Bei der Regulierung<br />
des Rohstoffbezuges reichen die <strong>Kriterien</strong>vorgaben <strong>von</strong> 10 über 50 Prozent (Spreewald) bis zu<br />
90 bis 100 Prozent Bezug (Soo Nahe) der Hauptrohware aus der Region. Bei dem<br />
Betrachtungspunkt Kontrollen/Zertifizierung findet man bei den betrachteten Regionalinitiativen<br />
die gesamte Bandbreite, <strong>von</strong> der Selbstkontrolle bis zum fünfstufigen Kontrollsystem. Ebenso<br />
findet man bei den Zusatzkriterien Vorgaben wie Fairness, Tierwohl, Umweltschutz bis zum<br />
dualen Modell (Kooperation <strong>von</strong> ideellem Ver<strong>ein</strong> und wirtschaftlichem Träger).<br />
Nachfolgend <strong>ein</strong>e exemplarische Übersicht der Vielfalt der verschiedenen Regionalinitiativen<br />
Tabelle 7: Übersicht Vielfalt der Regionalinitiativen<br />
Marke Regionsgrenze Produktionstiefe<br />
verarbeitete Produkte<br />
Landkreise, Städte<br />
Regierungsbezirke<br />
und angrenzende<br />
Landschaftsräume<br />
km-Radius<br />
Landkreise<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum,<br />
Landkreise<br />
Bundesland<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
Tierzukauf regional/<strong>von</strong><br />
anerkannten Zulieferern<br />
Kontrollen/<br />
Zertifizierung<br />
je nach<br />
Teilbereich<br />
intern/extern<br />
- 5-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
- eigener<br />
Standard und<br />
Kontrollen<br />
Rohstoffe nach Kapazität,<br />
Hauptwertschöpfung<br />
mind. 10 % der<br />
Verarbeitung/Vermarktung/<br />
Verbrauch<br />
produktspezifisch: 70 bis<br />
100 %<br />
mind. 70 % Gewichtsanteil,<br />
Verarbeitung in der Region<br />
mind. 50 %<br />
90 % der Rohwaren<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
Zeichenvergabe<br />
<strong>für</strong> 3 Jahre<br />
intern: jährliche<br />
Überprüfungen,<br />
terminiert vor<br />
Ort,<br />
Zertifizierung<br />
jährlich<br />
regelmäßige<br />
externe<br />
Kontrollen<br />
mind. 1x<br />
jährlich, extern<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem,<br />
intern/extern,<br />
Markennutzung<br />
<strong>für</strong> je 1 Jahr;<br />
g.g.A. Kontrollen<br />
3-stufiges<br />
Kontrollsystem<br />
Zusatzkriterien<br />
Duales Modell<br />
Duales Modell<br />
Duales Modell,<br />
Nachhaltigkeit,<br />
Fairness<br />
Artgerechte<br />
Tierhaltung<br />
Duales Modell,<br />
Naturschutz,<br />
Schulungen<br />
gentechnikfrei,<br />
Tierwohl<br />
Duales Modell,<br />
Fortbildungen,<br />
Arbeitsplätze<br />
Umweltschutz,<br />
gentechnikfrei,<br />
Tierwohl<br />
Anbauweise <br />
bio/konventionell <br />
bio/konventionell <br />
konventionell <br />
konventionell <br />
bio/konventionell <br />
bio/konventionell <br />
bio/konventionell <br />
konventionell <br />
bio/konventionell<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 19
Zusammenfassung<br />
Eine allumfassende Übersicht über die existierenden Regionalinitiativen und -marken in ganz<br />
Deutschland ist in der vorgegebenen Projektlaufzeit nicht möglich. Nach Auswertung der<br />
Literatur und nach Aussagen <strong>von</strong> Experten kann man da<strong>von</strong> ausgehen, dass zwischen 120<br />
und 150 Regionalinitiativen <strong>ein</strong>e regionale Marktbedeutung haben, die über dem lokalen<br />
Verkauf auf dem Wochen- oder Bauernmarkt liegt. Diese Initiativen haben k<strong>ein</strong>en<br />
gem<strong>ein</strong>samen oder vergleichbaren <strong>Kriterien</strong>katalog <strong>für</strong> die Auslobung <strong>von</strong> Regionalität. Die<br />
<strong>Kriterien</strong> bei der Regionenabgrenzung haben entweder r<strong>ein</strong> administrativen bzw.<br />
landschaftsräumlichen Charakter oder weisen Mischformen <strong>von</strong> administrativen und<br />
natürlichen Grenzen auf. Gebietskulissen können beispielsweise Kommunen, Landkreise,<br />
Bundesländer oder Naturlandschaftsräume s<strong>ein</strong>. Die <strong>Kriterien</strong> beim Rohstoffbezug reichen <strong>von</strong><br />
10 bis 100 Prozent aus der Region und beim verbindlichen Kontroll-/Zertifizierungssystem<br />
reicht die Bandbreite <strong>von</strong> der Selbstkontrolle bis zum fünfstufigen Kontrollsystem. Auch bei<br />
den Mitgliedern des Bundesverbandes der Regionalbewegung (BRB), welcher circa 55<br />
Mitglieder vertritt, die in der Regel <strong>ein</strong>e regionale Marktbedeutung haben, sind diese<br />
Spannbreiten in der <strong>Kriterien</strong>auswahl in den <strong>ein</strong>zelnen Statuten und Regelwerken vorhanden.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 20
2.4 Weitere regionale Kennzeichnungsansätze<br />
Bei verschiedenen Organisationen werden ebenfalls Überlegungen hinsichtlich <strong>ein</strong>er Regionalkennzeichnung<br />
angestellt. So wird beispielsweise bei der DLG (Deutsche Landwirtschafts-<br />
Gesellschaft e.V.) über dieses Thema nachgedacht. Heute schon ist <strong>ein</strong>e zusätzliche<br />
Auslobung des Herstellerortes bei der Prämierung mit den DLG-Medaillen möglich.<br />
Abbildung 4: DLG-Medaillen<br />
Die Agrikom GmbH, Tochtergesellschaft des Deutschen Bauernverbands, der<br />
Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Zentralverbands des<br />
Deutschen Handwerks, promotet zurzeit das alte Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen<br />
frisch auf den Tisch“. Markeninhaber ist die GAL (Gesellschaft <strong>für</strong> Absatzförderung der<br />
Deutschen Landwirtschaft e.V.). Das Zeichen wird vergeben, wenn die Produkte zumindest zu<br />
75 Prozent aus deutschen Rohstoffen bestehen.<br />
Abbildung 5: Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 21
3 Erarbeitung und Darstellung der <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong><br />
Regionalität<br />
Ausgangspunkt <strong>für</strong> die Erarbeitung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Regionalität ist <strong>ein</strong>e klare Beschreibung<br />
und Definition des Regionenbegriffs. Dabei wurde das Thema <strong>von</strong> zwei Seiten bearbeitet:<br />
a) aus Sicht der wissenschaftlichen Literatur, speziell der Geografie und<br />
b) aus Sicht des Verbrauchers.<br />
3.1 Regionsdefinitionen in Wissenschaft und Praxis<br />
3.1.1 Regionsdefinition in der Literatur<br />
Das Wortfeld Region wird b<strong>ein</strong>ahe inflationär gebraucht; in allen Bereichen <strong>von</strong> Wirtschaft über<br />
Handel hin zur Alltagssprache und Wissenschaft finden der Begriff der Region und s<strong>ein</strong>e<br />
Ableitungen Verwendung, was zu <strong>ein</strong>er großen Unschärfe der Begrifflichkeit führt (Hock 2005,<br />
S. 9). Der Begriff der Region kann sehr unterschiedlich definiert werden, wobei die jeweilige<br />
Definition <strong>von</strong> der Intention der Regionalisierung abhängt (Werlen 1997). In erster Linie geht es<br />
darum, <strong>ein</strong>en konkreten Raum, das heißt <strong>ein</strong>en dreidimensionalen Ausschnitt aus der<br />
Erdoberfläche, abzugrenzen. Eine Region wird als <strong>ein</strong>e gewissermaßen homogene Einheit<br />
wahrgenommen, die sich durch bestimmte Eigenschaften <strong>von</strong> den angrenzenden Gebieten<br />
unterscheidet. Im Folgenden <strong>ein</strong>e pragmatische Grob<strong>ein</strong>teilung:<br />
1. Im weitesten Sinne ist <strong>ein</strong>e Region <strong>ein</strong>e geografisch-räumliche Einheit mittlerer Größe, das<br />
heißt unterhalb der nationalen und oberhalb der kommunalen/lokalen Ebene: zum Beispiel<br />
<strong>ein</strong> Bundesland, Natur-/Landschaftsraum, Landkreis oder Ähnliches, das sich funktional<br />
oder strukturell nach außen abgrenzen lässt (vgl. Blotevogel et al. 1989, S. 70, Hock 2005,<br />
S. 13, Leser 2005).<br />
2. In der Landeskunde versteht man unter Region <strong>ein</strong> meist historisch und/oder administrativ<br />
bedingtes Territorium, das manchmal auch mehr oder weniger mit Naturräumen oder Teilen<br />
<strong>von</strong> diesen identisch s<strong>ein</strong> kann. Die Abgrenzung kann sowohl natur- als auch sozialwissenschaftlich<br />
abgeleitet s<strong>ein</strong> 1 . In Bezug auf Versorgungsstrukturen könnte <strong>ein</strong> Radius <strong>von</strong> 50<br />
bis 100 Kilometern gelten (vgl. Leser 2005 sowie Sauter und Meyer 2003, S. 25).<br />
3. In der Raumplanung sind Regionen die Planungs<strong>ein</strong>heit <strong>für</strong> die Regionalplanung.<br />
Dementsprechend geben Verwaltungsgrenzen die Gliederung vor. Eine Region wird in der<br />
Regel aus mehreren Landkreisen und eventuell kreisfreien Städten gebildet, wobei man sich<br />
heute bei der Einteilung zunehmend an Praxisbedürfnissen orientiert und sozioökonomischpolitische<br />
Handlungsprozesse stärker gewichtet (vgl. Leser 2005).<br />
4. Im Verständnis <strong>von</strong> Region als Handlungs- und Erfahrungsraum stehen „die handelnden<br />
Menschen im Vordergrund, ihr Handlungsfeld wird zur Bemessungsgrenze <strong>für</strong> die Region.<br />
Auf der lokalen Handlungsebene erfolgt <strong>ein</strong>e Orientierung meist an <strong>ein</strong>em selbst<br />
erarbeiteten Verständnis <strong>von</strong> Regionalität“ (Czech et al. 2002, S. 10, zit. nach Sauter und<br />
Meyer 2003, S. 25).<br />
1<br />
D.h. anhand naturräumlicher/landschaftlicher, politisch-administrativer, kulturell-historischer, demographischer<br />
oder wirtschaftlicher Gegebenheiten<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 22
Zusammenfassung<br />
Unter „Region“ versteht man <strong>ein</strong>en Teilraum Deutschlands, größenmäßig zwischen nationaler<br />
und lokaler Ebene, also zum Beispiel <strong>ein</strong> Bundesland, <strong>ein</strong> Natur-/Landschaftsraum oder <strong>ein</strong>e<br />
kl<strong>ein</strong>ere Raum<strong>ein</strong>heit mit kulturell-historischem Hintergrund, die vom Menschen je nach<br />
Intention oder Fragestellung anhand bestimmter Merkmale <strong>von</strong> anderen abgegrenzt wird.<br />
3.1.2 Regionalität und regionale Lebensmittel<br />
In Bezug auf Regionalvermarktung verbindet man mit Regionalität gem<strong>ein</strong>hin regionale<br />
Lebensmittel, das heißt „Erzeugnisse mit geografischer Herkunftsidentität“ und Produkte, deren<br />
Herkunft aus <strong>ein</strong>er bestimmten Region <strong>für</strong> den Konsumenten erkennbar ist. Die Herkunft <strong>ein</strong>es<br />
regionalen Produktes ist also transparent und wird dem Konsumenten kommuniziert. „Die<br />
meisten Konsumenten haben <strong>ein</strong> emotional-assoziatives Verständnis <strong>für</strong> den Begriff<br />
Regionalität.“ (Kaliwoda, 2007, S. 6, zit. nach Fahrner 2010, S. 5).<br />
„Als regionale Lebensmittel werden solche verstanden, deren Herkunft geografisch verortet und<br />
<strong>ein</strong>gegrenzt werden kann.“ (Sauter und Meyer 2003, S. 28). Sauter und Meyer regen an, die<br />
Produkte auch bezüglich ihrer Vermarktung zu unterscheiden: Das heißt aufzuzeigen, ob sich<br />
Herkunftsregion und Absatzregion entsprechen oder die Vermarktung auch überregional<br />
beziehungsweise im Falle regionaler Spezialitäten international geschieht.<br />
3.1.3 Regionalbewussts<strong>ein</strong> und Heimat<br />
Als Grundlage <strong>für</strong> Regionsdefinitionen dient zuweilen auch das jeweilige Regionalbewussts<strong>ein</strong><br />
oder die regionale Identität. Darunter versteht man das Zusammengehörigkeitsgefühl der<br />
Bevölkerung <strong>ein</strong>es bestimmten Teilraums über der lokalen Ebene innerhalb <strong>ein</strong>es Staates. Die<br />
Bevölkerung fühlt sich bewusst als Einwohner des betreffenden Raumes, den sie als ihre<br />
Heimat betrachtet. Regionalbewussts<strong>ein</strong> wurzelt häufig in <strong>ein</strong>er gem<strong>ein</strong>samen, <strong>von</strong> den<br />
anderen Landesteilen unterschiedlichen Geschichte, in gem<strong>ein</strong>samen Sitten und Gebräuchen,<br />
im Dialekt usw. und kann gezielt gefördert oder beworben werden. Dabei ist <strong>ein</strong>e erdräumliche<br />
Abgrenzbarkeit der Region/Raum<strong>ein</strong>heit zur Bildung <strong>von</strong> Identität <strong>von</strong> Vorteil (vgl. Leser 2005<br />
und Hock 2005, S. 13).<br />
Im Zusammenhang mit Regionalität darf auch der Verweis auf die „Heimat“ nicht fehlen. Heimat<br />
bedeutet ursprünglich Heimstätte, also Grundbesitz. Mittlerweile versteht man darunter <strong>ein</strong>e<br />
relativ eng, aber meist unscharf umgrenzte Umwelt, mit der der Einzelne durch Geburt, lange<br />
Wohndauer, Lebensumstände usw. emotional verbunden ist (vgl. Leser 2005). Heimat wird<br />
noch weniger als Region nach administrativen Grenzen definiert. Heimat ist das unmittelbare<br />
Lebensumfeld, das durch vertraute Normen und Konventionen Sicherheit bietet; <strong>ein</strong> Ankerpunkt<br />
innerhalb <strong>ein</strong>er sich immer schneller wandelnden Welt.<br />
Region wird <strong>von</strong> vielen Akteuren mit Heimat gleichgesetzt, entspricht also <strong>ein</strong>em biografisch<br />
definierten Raum. Zur geografischen Lokalisierbarkeit <strong>von</strong> Heimat darf der Aspekt <strong>von</strong> Heimat<br />
als Beziehungsgeflecht nicht vernachlässigt werden. Wichtig sind dabei Identifikation,<br />
Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Das Heimatgefühl kann als Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> soziales Engagement in der Region sowie <strong>für</strong> regionalen Konsum angesehen werden. Man<br />
kann vermuten, dass Region in gewisser Weise nur Heimat als Begrifflichkeit abgelöst hat,<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 23
denn auch in der Kommunikation wird versucht, die Inhalte <strong>von</strong> Heimat auf Region zu<br />
übertragen (Hock 2005, S. 212ff), was in der Regel positive Auswirkungen auf die<br />
Wahrnehmung <strong>von</strong> Produkten hat (vgl. Alvensleben 1999, 2001). Dies wird in der folgenden<br />
Abbildung schematisch dargestellt.<br />
Abbildung 6: Schematische Darstellung des Regionalisierungsprozesses und dessen Wirkung<br />
auf die Produktwahrnehmung<br />
Zusammenfassung<br />
Heimat als angeeigneter Raum hat sowohl räumliche als auch soziale Komponenten, die sich<br />
durch ihre Einmaligkeit in der Wahrnehmung des Menschen auszeichnen. Im Bezug auf<br />
Konsum wirkt sich die Verbindung <strong>von</strong> Heimat mit <strong>ein</strong>em Produkt in der Regel positiv auf<br />
dessen Wahrnehmung aus.<br />
3.1.4 Regionsdefinitionen der Regionalinitiativen<br />
Regionalinitiativen sind <strong>ein</strong>e der Hauptakteursgruppen im Themenfeld der Regionalität in Bezug<br />
auf die Vermarktung <strong>von</strong> Lebensmitteln. Im Folgenden wird daher aufgezeigt, wie<br />
Regionalinitiativen ihre jeweilige Region definieren.<br />
3.1.4.1 Regionalinitiativen<br />
Regionalinitiativen sind kl<strong>ein</strong>räumige Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebssysteme, deren<br />
Erzeugung und Produktion, Veredelung und Verbrauch in derselben abgegrenzten Region<br />
(Gebietskulisse) erfolgt, oder Dienstleister, die durch verschiedene Dienstleistungen die<br />
Wertschöpfung in der Region erhöhen (vgl. Bayerische Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft 2011,<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 24
S. 11). Nach Hock (2005, S. 18ff) 2 wollen alle Regionalinitiativen die <strong>Entwicklung</strong> ihrer<br />
jeweiligen Region fördern. Dies betrifft vor allem die nachhaltige Regionalentwicklung, inklusive<br />
Naturschutz und die (wirtschaftliche) Stärkung der ländlichen Strukturen. Prämisse ist es dabei,<br />
gemäß der Agenda 21-Grundsätze, durch lokales Handeln globalen Problemen zu begegnen 3<br />
(vgl. Hock 2005, S. 21, S. 189). Die Regionalbewegung geht auf unterschiedliche soziale<br />
Bewegungen zurück, wobei Regionalisierung als komplementäre <strong>Entwicklung</strong> zur<br />
Globalisierung zu verstehen ist.<br />
Das Voranschreiten der Globalisierung bringt wachsendes Unbehagen hervor. Es steigt die<br />
Sehnsucht nach Rückhalt in überschaubaren Lebenskreisen und „viele Menschen wollen das<br />
Gefühl haben, die Dinge überblicken zu können und nicht <strong>ein</strong>em anonymen Geschehen<br />
ausgeliefert zu s<strong>ein</strong>“ (Göppel 2000, S. 6). Die Auswirkungen der Globalisierung werden als<br />
Bedrohung empfunden, wenngleich die Vorstellungen <strong>von</strong> dem, was Globalisierung genau ist,<br />
aus<strong>ein</strong>andergehen und die damit verbundene marktwirtschaftlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung<br />
kaum infrage gestellt wird. Region ist in der Wahrnehmung der <strong>von</strong> Hock befragten<br />
Akteure k<strong>ein</strong> Globalisierungsgegenentwurf, sondern <strong>ein</strong> Rückzugsgebiet <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e <strong>von</strong> der<br />
Globalisierung überforderte Gesellschaft. Dabei würde aus der Feststellung „Jeder Mensch hat<br />
Wurzeln“ die Forderung „Jeder Mensch braucht Wurzeln“. Es ist die Region, so wird betont, die<br />
dieses „Wurzeln in <strong>ein</strong>er globalisierten Welt“ ermöglicht (Hock 2005, S. 196).<br />
Die Anzahl <strong>von</strong> Projekten und <strong>Entwicklung</strong>skonzepten mit Bezug zur regionalen Land- und<br />
Ernährungswirtschaft steigt kontinuierlich, wobei <strong>ein</strong>e vollständige Übersicht bislang offiziell<br />
nicht existiert. Die umfassendste Übersicht bietet <strong>ein</strong> Verzeichnis des Deutschen Verbandes <strong>für</strong><br />
Landschaftspflege e.V., worin Regionalinitiativen und -projekte aus dem gesamten<br />
Bundesgebiet gelistet sind (www.reginet.de). Nach der letzten Aktualisierung Ende 2007 waren<br />
darin über 500 Regionalinitiativen gelistet, 2001 waren circa 350 und 1996 erst circa 120<br />
gelistet. Dabei wurden klassische Direktvermarkter und etablierte kooperative<br />
Vermarktungsformen, wie zum Beispiel Bauernmärkte, nicht berücksichtigt. Ein Großteil der<br />
erfassten Projekte und Initiativen befasst sich mit der regionalen Vermarktung<br />
landwirtschaftlicher Produkte. 1996 stammten noch fast 40 Prozent der erfassten Initiativen aus<br />
dem Bundesland Bayern, seitdem nahm auch der Anteil <strong>von</strong> Initiativen aus den östlichen<br />
Bundesländern zu (vgl. Kullmann 2007).<br />
3.1.4.2 Begriffsdefinitionen der Regionalinitiativen<br />
Die Diskussion über genaue <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Definition <strong>von</strong> Regionen ersch<strong>ein</strong>t vielen<br />
Mitgliedern <strong>von</strong> Regionalinitiativen müßig und wird als Lähmung der eigentlichen Arbeit<br />
gesehen. Sie wird als wenig zielführend erachtet und birgt das Risiko, pragmatische<br />
Abgrenzungen als gegebene Raum<strong>ein</strong>heiten zu verstehen (vgl. Hock 2005). Klare<br />
Abgrenzungen sind darüber hinaus vor allem <strong>für</strong> Förderanträge sehr wichtig. Zudem stellt die<br />
Zweckmäßigkeit der Gebietskulisse <strong>ein</strong> wichtiges Erfolgskriterium <strong>ein</strong>er Regionalinitiative dar<br />
(Kullmann 2004, S. 6). Dementsprechend heterogen sind die vorliegenden Regions-<br />
2 Hock definiert nicht nach festgelegten <strong>Kriterien</strong>. Stattdessen nutzt sie die eigenen Aussagen der<br />
Regionalinitiativen, die sich als solche bezeichnen und bleibt damit vorurteilsfrei. Nach Radtke, 1992. S. 9, zit.<br />
nach HOCK 2005, S. 18) sind Initiativen der Regionalbewegung bzw. „alle kooperativen Aktivitäten […], die auf<br />
lokaler und regionaler Ebene kontinuierlich und institutionalisiert <strong>ein</strong>e verbesserte Zusammenarbeit und Nutzung<br />
vorhandener wirtschaftlicher, politischer, administrativer, wissenschaftlicher und anderer Potenziale und<br />
Ressourcen zum Ziel haben.“<br />
3 Dies ergibt sich auch aus der Entstehungsgeschichte vieler Regionalinitiativen in Folge der Rio-Nachhaltigkeits-<br />
konferenz 1992.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 25
abgrenzungen der Initiativen. „Gemessen daran, dass sämtliche Zielsetzungen und<br />
strategischen Orientierungen in der Regionalbewegung untrennbar vom Begriff der Region - vor<br />
allem als <strong>ein</strong>e normative Idee - geknüpft ist, […] wird der Frage, was eigentlich unter Region<br />
und Regionalität zu verstehen ist, jedoch erstaunlich selten nachgegangen“ (Hock 2005,<br />
S. 171).<br />
Hock (2005, S. 258) beobachtet, dass „die meisten Initiativen die Region als etwas objektiv<br />
Gegebenes und Unverrückbares ansehen“. Der Entstehungszusammenhang der Region sei<br />
sehr schnell vergessen und man rede <strong>von</strong> „der Region, als sei diese schon immer vorhanden“.<br />
Dies stelle insofern <strong>ein</strong> Problem dar, als die Regionsabgrenzung selbst Teil der Zielsetzungen<br />
der Initiativen würde, statt am Entwurf <strong>ein</strong>es Gegenmodells zu Leitbildern <strong>ein</strong>er globalisierten<br />
Welt zu arbeiten.<br />
Die gelisteten Regionalinitiativen grenzen ihre jeweilige Region in der Regel pragmatisch<br />
anhand folgender <strong>Kriterien</strong> ab: Administrative Grenzen, Landschaftsräume anhand natürlicher<br />
oder angelehnt an administrative Grenzen, oder Radius. Diese sind im Folgenden tabellarisch<br />
und grafisch dargestellt.<br />
Tabelle 8: Abgrenzung <strong>von</strong> Regionen<br />
Politisch-administrativ Natur-/Landschaftsraum Entfernung<br />
Regierungsbezirk<br />
(z. B. Genussregion Oberfranken)<br />
Einzelner Landkreis<br />
(z. B. Berchtesgadener Land)<br />
Mehrere Landkreise<br />
(z. B. Unser Land)<br />
natürliche Grenzen<br />
(z. B. Eifel, Dachmarke Rhön)<br />
Landkreisgrenzen in Anlehnung an<br />
Landschaftsraum<br />
(z. B. Schwäbische Alb)<br />
km-Radius um landschaftliche<br />
Besonderheit (z. B. Hesselberger: 30<br />
km um den Hesselberg)<br />
km vom Standort<br />
(z. B. Von Hier (Feneberg): 100 km<br />
um Kempten)<br />
Abbildung 7: Gebietskulissen ausgewählter Regionalinitiativen in Süddeutschland<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 26
Zusammenfassung<br />
Die Regionsdefinitionen <strong>von</strong> Regionalinitiativen spiegeln die vorangehend erläuterten<br />
Möglichkeiten, Regionen abzugrenzen, wider. Es handelt sich dabei um pragmatische<br />
Zuschnitte, je nach Intention zumeist unter Zuhilfenahme <strong>von</strong> bereits existenten<br />
Grenzziehungen natur-/landschaftsräumlicher oder politisch-administrativer Art. Alle sind<br />
kl<strong>ein</strong>er als das Bundesland, in dem sie liegen und größer als <strong>ein</strong>zelne Orte.<br />
3.1.5 Überschneidungen und Transparenz<br />
Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, Regionen abzugrenzen, ergeben sich zahlreiche<br />
Überschneidungen <strong>von</strong> Gebietskulissen, wie in Süddeutschland an den Beispielen<br />
Schwäbische Alb, ProNah, Unser Land und Von Hier (Feneberg) deutlich wird. In der<br />
Konsequenz werden manche Gebiete <strong>von</strong> mehr als zwei Regionalinitiativen gleichzeitig<br />
abgedeckt. Damit stehen nach Kullmann (2007, S. 3) die jeweiligen Marken zunehmend<br />
mit<strong>ein</strong>ander im Wettbewerb um Handelspartner und Kunden.<br />
Insofern sind <strong>ein</strong>erseits Forderungen nach <strong>ein</strong>heitlichen <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Definition <strong>von</strong><br />
Regionen im Rahmen der Regionalvermarktung verständlich. Andererseits ist dies aufgrund der<br />
Vielzahl der bestehenden und etablierten Initiativen sowie deren unterschiedlichen<br />
Entstehungsgeschichten und Marketingstrategien kaum umsetzbar, ohne die Autonomie der<br />
Initiativen zu beschneiden und ihrer Entstehungsgeschichte unrecht zu tun. Transparenz und<br />
leichte Einsehbarkeit der jeweiligen Regionsdefinition <strong>für</strong> die Kunden ist daher <strong>ein</strong>e Qualität,<br />
durch die sich Regionalinitiativen profilieren können.<br />
3.2 Regionsdefinition im Hinblick auf Verbrauchererwartungen<br />
3.2.1 Konsummotivationen<br />
Der Kauf regionaler Produkte befriedigt sowohl rationale als auch emotionale Bedürfnisse. Zum<br />
<strong>ein</strong>en weiß der Verbraucher, dass er zur wirtschaftlichen Stärkung des ländlichen<br />
Raumes/s<strong>ein</strong>er Region beiträgt und befriedigt damit s<strong>ein</strong> ökologisches Gewissen. Zum Anderen<br />
ist regionaler Konsum als Ausgleichstrend <strong>ein</strong>e Möglichkeit, das Bedürfnis nach Verankerung<br />
zu befriedigen, das durch globalisierungsbedingte Entwurzelung entsteht 4 . Die Unschärfe des<br />
Begriffes Region erlaubt s<strong>ein</strong>e Aufladung mit emotionalen Botschaften wie „Heimat“, „Hier“,<br />
„Gutes“ oder Ähnlichem. Dadurch gelingt es, sowohl rationale als auch emotionale Bedürfnisse<br />
zu befriedigen.<br />
Alvensleben (1999, 2001) unterteilt mögliche Einflussfaktoren auf die individuelle Präferenz <strong>für</strong><br />
regionale Lebensmittel in kognitive, normative und affektive Prozesse, wie folgende Abbildung<br />
visualisiert.<br />
4 Dazu passt auch das Motto der Regionalbewegung: „Wurzeln in <strong>ein</strong>er globalisierten Welt“<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 27
Abbildung 8: Theoretisches Konstrukt der möglichen Einflussfaktoren auf die individuelle<br />
Präferenz <strong>für</strong> regionale Lebensmittel (Henseleit et al. 2007, S. 8; nach Alvensleben<br />
1999, 2001)<br />
Nicht alle Lebensmittel werden gleich stark mit Regionalität assoziiert. So ist die Präferenz der<br />
Verbraucher bei solchen Lebensmitteln am stärksten ausgeprägt, bei denen die<br />
Kaufentscheidung hauptsächlich mit Frische sowie Vertrauen und Sicherheit zusammenhängt.<br />
Diese Lebensmittel sind Fleisch und Fleischwaren, Milch und Milchprodukte, Eier, Obst und<br />
Gemüse sowie Backwaren. Auch bei Mineralwassern existiert <strong>ein</strong> relativ starker Regionalbezug,<br />
teilweise bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken sowie bei Bier und W<strong>ein</strong>. Tendenziell nimmt<br />
mit zunehmendem Verarbeitungsgrad die Bedeutung des Kriteriums regionale Herkunft ab<br />
(Sauter und Meyer 2003, S. 29).<br />
Die Definition des jeweiligen Regionalitätsverständnisses ist sehr heterogen und hat <strong>ein</strong>e große<br />
Bandbreite, wie unter anderem die folgende Abbildung aus <strong>ein</strong>er Fokusgruppenerhebung der<br />
tegut… Gutberlet Stiftung <strong>von</strong> 2011 exemplarisch aufzeigt.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 28
Für Sie als Unternehmen würde ich sagen, ist die<br />
Region das gesamte Verbreitungs-Gebiet der tegut…<br />
Märkte plus 100 Kilometer Umkreis. Das ist die Region,<br />
wo Lebensmittel her kommen können, dann müsste man<br />
auch in Göttingen, Niedersachsen die gleichen Produkte<br />
haben wie in Weimar oder Franken.<br />
(Fulda)<br />
Regional ist Gotha (Gotha)<br />
Für mich ist die Region<br />
auch das Dreiländereck<br />
und die Rhön. (Wiesbaden)<br />
Abbildung 9: Bandbreite <strong>von</strong> Regionsbezügen (Rutenberg 2011)<br />
3.2.2 Kaufentscheidungsverhalten<br />
M<strong>ein</strong>e Region, das ist ganz klar, ist<br />
der Kreis Fulda, Main-Kinzig-Kreis<br />
schon nicht mehr, Vogelsberg erst<br />
recht nicht und Hersfeld oder<br />
Hünfeld sowieso nicht. (Fulda)<br />
Das Bundesland<br />
(Wiesbaden, Gotha)<br />
Für mich ist der <strong>ein</strong>zelne<br />
Landkreis die Region.<br />
(Wiesbaden)<br />
Verbraucher verhalten sich oft ambivalent, das heißt, ihre Kaufentscheidung entspricht nicht<br />
immer ihren eigentlichen Präferenzen beziehungsweise Überzeugungen. So stellen viele<br />
Studien <strong>ein</strong>en deutlichen Unterschied zwischen subjektiver Bedeutung regionaler Produkte und<br />
der tatsächlichen Kaufentscheidung fest. Dies ist auf die enorme Komplexität der Faktoren, die<br />
die Kaufentscheidung be<strong>ein</strong>flussen, zurückzuführen, <strong>von</strong> denen nicht zuletzt die<br />
Mehrpreisbereitschaft und damit die letztendliche Kaufentscheidung abhängen.<br />
Es besteht Einigkeit darüber, dass dem Wunsch nach Regionalität <strong>ein</strong>e jeweils individuelle<br />
Überzeugung zugrunde liegt. Wie weit die Erwartung „Es soll aus m<strong>ein</strong>er Region kommen“<br />
geht, darüber machen sich Verbraucher in aller Regel wenig Gedanken. Selten wird<br />
beispielsweise die Frage gestellt, ob <strong>ein</strong> regionales Schw<strong>ein</strong> auch mit regionalen Futtermitteln<br />
gefüttert wird oder woher Saatgut und Pflanzensetzlinge kommen. Fragt man Verbraucher<br />
jedoch genauer, erwarten sie mit großer Selbstverständlichkeit, dass sowohl landwirtschaftliche<br />
Vorstufen als auch die Verarbeitung regional sind.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 29
3.2.3 Verbraucherstudien zum Thema Regionalität<br />
Tabelle 9: Übersicht Verbraucherstudien zum Thema Regionalität<br />
Studie Jahr Inhaltszusammenfassung<br />
BVE/GfK:<br />
Consumers’<br />
Choice –<br />
Lebensmittelqualität<br />
im<br />
Verbraucherfokus<br />
DLG-Studie:<br />
Regionalität<br />
aus<br />
Verbrauchersicht<br />
(n=ca. 1.500)<br />
Fresenius<br />
Verbraucherstudie:Lebensmittelqualität<br />
und<br />
Verbrauchervertrauen<br />
bzw.<br />
Verbrauchermacht<br />
(n=je ca. 1.800)<br />
Nestlé Studie:<br />
So is(s)t<br />
Deutschland<br />
(n=4.203)<br />
2011 Für ca. 50 % stellt die Herkunft aus der Region <strong>ein</strong> wichtiges Qualitätskriterium dar.<br />
Ein Großteil der Befragten hält es <strong>für</strong> schwierig, die Qualität <strong>von</strong> Lebensmitteln richtig zu<br />
beurteilen und wünscht sich strengere Kontrollen.<br />
Das größte Vertrauen in Bezug auf Qualitätsaussagen wird Testberichten und<br />
Verbraucherschutzorganisationen entgegengebracht, gefolgt <strong>von</strong> Erzeugern, NGOs und<br />
Qualitätssiegeln.<br />
2011 Besonderheit der Studie: Unterscheidung nach innerdeutschen Regionen und drei<br />
sozialen Milieus.<br />
2011<br />
und<br />
2010<br />
Regionalität als langfristiger Trend, Stichwort: sehr bekannt.<br />
Regionalität <strong>für</strong> fast alle Befragten: „Produkte, die aus der eigenen Region kommen“.<br />
Ca. 50 % verstehen darunter den Großraum um die eigene Stadt, ca. 50 % das eigene<br />
Bundesland. Je weiter südlich und je höher das „soziale Milieu“ desto kl<strong>ein</strong>räumlicher<br />
wird definiert und desto stärker ist die Identifikation mit Liebe zur Region ausgeprägt.<br />
Regionalität betrifft vor allem Frischprodukte wie Obst/Gemüse, Eier,<br />
Fleisch/Wurstwaren und Milchprodukte. Zielgruppen <strong>für</strong> die Vermarktung finden sich<br />
eher in höheren Einkommensklassen. Die Sensibilität <strong>für</strong> die eigene Region korreliert oft<br />
mit dem Interesse an Produkten auch aus anderen Regionen.<br />
Siegel zur Zertifizierung regionaler Produkte wenig bekannt. Markenentscheidungen<br />
hauptsächlich emotional getroffen, wobei sich der Verbraucher auch auf Qualitätssiegel<br />
verlässt. Regionalität ist eher Produktthema, k<strong>ein</strong> ethisches Thema. Dies folgt aus der<br />
Kaufmotivation: Frische aus der eigenen Region; rationale Aspekte wie Transportwege<br />
oder Umweltschonung spielen dagegen <strong>ein</strong>e eher untergeordnete Rolle.<br />
Regionalität ist <strong>ein</strong> sehr emotionales Thema. Daher kann bei undifferenziertem<br />
Wissensstand der Verbraucher werblich leicht auf Allgem<strong>ein</strong>plätze, wie <strong>ein</strong> Verständnis<br />
<strong>von</strong> Deutschland als Region, zurückgegriffen werden. Dies stellt den Handel in die<br />
Verantwortung, die eigene Region zu definieren und authentisch zu kommunizieren.<br />
Verbraucher sind <strong>von</strong> Verpackungsangaben verunsichert. Angst vor allem vor<br />
Falschangaben bezüglich der Inhaltsstoffe, daher Bedürfnis nach Transparenz und<br />
Sicherheit in Form glaubwürdiger Orientierungshilfen.<br />
Mehrzahl der Verbraucher wünscht sich frische, qualitativ hochwertige und gleichzeitig<br />
günstige Produkte, wobei knapp die Hälfte beim Einkauf auf Produkte aus der Region<br />
achtet.<br />
Ost- und Süddeutsche achten überproportional stark darauf, dass gekaufte Lebensmittel<br />
aus der unmittelbaren Umgebung kommen.<br />
Für fast 60 % der Verbraucher hängt die Qualität der Lebensmittel <strong>von</strong> deren Herkunft<br />
ab.<br />
2011 37 % der Befragten kaufen regelmäßig, 44 % gelegentlich Produkte aus der Region;<br />
dabei ist <strong>ein</strong>e Diskrepanz zwischen subjektiver Bedeutung und Mehrpreisbereitschaft<br />
feststellbar.<br />
Unter regionalen Produkten verstehen Verbraucher: zu 51 % Produkte aus der näheren<br />
Umgebung, zu 23 % aus dem eigenen Landesteil, zu 25 % aus dem eigenen<br />
Bundesland, zu 5 % auch <strong>von</strong> weiter weg. In Ostdeutschland betrifft die<br />
Regionsdefinition unterproportional die nähere Umgebung, zugunsten des<br />
Bundeslandes (28 % bzw. 43 %).<br />
Vergleich der Konsummotivationen regional und bio: Beim Kauf <strong>von</strong> Bioprodukten folgt<br />
der Verbraucher eher <strong>ein</strong>em selbstbezogenen Motiv (z. B. Gesundheit). „Regional“ steht<br />
dagegen <strong>für</strong> nachhaltigkeits- und produktbezogene Themen wie Frische, Förderung der<br />
lokalen Wirtschaft, kurze Lieferwege und Wissen um die Herkunft der Produkte.<br />
Die Vielzahl an Qualitäts- und Gütesiegeln verwirrt Verbraucher zunehmend.<br />
Hinsichtlich deren Bekanntheit und Akzeptanz bestehen große Unterschiede.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 30
Otto Group<br />
Trendstudie<br />
Verbrauchervertrauen<br />
(n=1.000)<br />
SKOPOS:<br />
Studie zu<br />
Lebensmittelsiegeln<br />
(n= ca. 1.000)<br />
Dialego:<br />
Erhebung zum<br />
Konsum <strong>von</strong><br />
regionalen<br />
Produkten<br />
(n=1.000)<br />
Studie der<br />
Verbraucherzentrale<br />
„Die<br />
Ausweise,<br />
bitte!“<br />
(n=ca. 3.500)<br />
ZMP/CMA:<br />
Trendstudie<br />
Food<br />
ZMP-Studie:<br />
„Nahrungsmittel<br />
aus der Region<br />
- Regionale<br />
2011 Thema ethischer Konsum mit dem Fokus Verbrauchervertrauen.<br />
77 % der Befragten bringen Regionalität mit Konsumethik in Verbindung. Konsumenten<br />
suchen nach klaren Werten und verlässlicher Orientierung, Thema wird<br />
wissensintensiver, Reduktionskomplexität nötig, Bekanntheit <strong>von</strong> Marken gibt<br />
Sicherheit.<br />
Allgem<strong>ein</strong>e Verwirrung steigt, Interesse <strong>für</strong> nachhaltigen Konsum wird massentauglich.<br />
Großes Vertrauen in Testinstitute, Freunde und Verwandte, Bedeutung <strong>von</strong> NGOs<br />
nimmt zu, dagegen werden Politik, Werbung und Wirtschaft <strong>für</strong> unglaubwürdiger<br />
erachtet.<br />
Der Konsument ist k<strong>ein</strong> unmündiges und per se schützenswertes Wesen mehr, die<br />
Mehrzahl (vor allem in höheren Einkommensklassen) ist sich ihrer Macht bewusst und<br />
honoriert transparente Informationspolitik.<br />
2010 Wahrnehmung nicht bekannter Siegel zunächst skeptisch, wobei deren Glaubwürdigkeit<br />
eher nicht infrage gestellt wird. Fehlendes Vertrauen auf unzureichende Informationen<br />
bezüglich Prüfkriterien zurückführbar.<br />
Dilemma <strong>für</strong> den Hersteller: Verbraucher verlangen <strong>ein</strong>erseits mehr Transparenz und<br />
Detailinformationen, andererseits gibt <strong>ein</strong> Drittel s<strong>ein</strong>e Überforderung mit der Vielzahl an<br />
Zeichen und Aufdrucken an.<br />
2008 65 % kaufen bewusst und mit steigender Tendenz regionale Produkte (nicht weiter<br />
definiert) <strong>ein</strong>, verstärkt ab 30 und in Einkommensgruppen ab 1.250 Euro/Monat.<br />
2007<br />
Gründe gegen den Kauf regionaler Produkte sind Desinteresse, Aufwand und Kosten;<br />
Gründe da<strong>für</strong> sind vor allem die Unterstützung regionaler Betriebe, ausgereifte Produkte<br />
und Umweltschutz.<br />
Besonders Obst/Gemüse, Eier und Fleisch werden regional gekauft. Kaufstätten sind<br />
insbesondere der Supermarkt, Wochenmarkt und Direktvermarkter. Mehr als die Hälfte<br />
sind mit dem regionalen Angebot in der Umgebung zufrieden.<br />
Reges Verbraucherinteresse an Rohstoffherkunft, auch in zusammengesetzten<br />
Produkten. Aufklärung darüber ist lückenhaft und die fehlende gesetzliche Regelung<br />
wird bemängelt.<br />
Herkunftsangaben werden mehr zu Marketing- als zu Informationszwecken <strong>ein</strong>gesetzt.<br />
Daher Rahmenbedingungen <strong>für</strong> Transparenz gewünscht.<br />
85,4 % der Befragten wünschen die Kennzeichnung auf dem verpackten Produkt<br />
beziehungsweise auf <strong>ein</strong>em Schild bei loser Ware.<br />
Forderungen sind unter anderem die grundsätzliche Kennzeichnung <strong>von</strong><br />
Monoprodukten, der wichtigsten Zutaten in zusammengesetzten Lebensmitteln,<br />
Kennzeichnung <strong>von</strong> Produkten mit regionalem Bezug und Angabe der Kontaktdaten des<br />
Herstellers.<br />
2006 Regional Food sind Lebensmittel mit <strong>ein</strong>em „klar definierten räumlichen wie kulturellen<br />
Bezugspunkt <strong>für</strong> den Konsumenten“. Die Definition der Region ist vom jeweiligen<br />
situativen Kontext abhängig (aktueller Aufenthaltsort, Fragender, Fragestellung).<br />
Regionalität als langfristiger Konsumtrend der Rückbesinnung auf<br />
Bewährtes/Vertrautes; stark wachsendes Konsumentenbedürfnis nach regionaler<br />
Herkunft der Lebensmittel. Haupttreiber des Trends: durch Globalisierung entstehender<br />
Wunsch nach Überschaubarkeit sowie gesundheitliche Aspekte. Kommunikation<br />
verbindet durch Markenbildung Herkunft und Qualität.<br />
Bewussts<strong>ein</strong> <strong>für</strong> Produktherkunft nimmt zu. „Heimat“ als emotionaler Anker vermittelt<br />
durch räumliche Nähe das Gefühl <strong>von</strong> Sicherheit und Vertrauen. Geografische Herkunft<br />
wird mit Qualität und Authentizität gleichgesetzt, Herkunftsauslobung steht <strong>für</strong><br />
Vertrauenswürdigkeit, geschmackliche/gesundheitliche Vorteile und Lebensmittelsicherheit.<br />
Regionalität konstituiert sich aus geografischer und kultureller Zugehörigkeit und wirkt<br />
identitätsstiftend. Wichtig sind dahin gehend Gefühle <strong>von</strong> Heimat und Geborgenheit.<br />
2003 Der Verbraucher versteht unter „s<strong>ein</strong>er Region“: zu über 40 % s<strong>ein</strong> Bundesland, darauf<br />
folgen zu je etwa gleichen Anteilen Stadt, Kreis oder „naturräumliche Einheit“<br />
(Schwaben, Ruhrgebiet oder ähnliches). Knapp 9 % fühlen sich als Nord-, Süd-, Ost-,<br />
Westdeutsche.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 31
Spezialitäten<br />
(n=3.000)<br />
Zusammenfassung<br />
Regionalverständnis ist regional unterschiedlich: Verbraucher im Norden Deutschlands<br />
fühlen sich tendenziell eher als „Norddeutsche“, in den neuen Bundesländern verstärkte<br />
Identifikation über das Bundesland und vor allem in Bayern und Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen<br />
überproportional über kl<strong>ein</strong>ere Einheiten wie Naturräume.<br />
Ältere Menschen und solche, die ihre Region kl<strong>ein</strong>räumig definieren, identifizieren sich<br />
in der Regel auch stärker mit ihrer Region, was mit der Präferenz <strong>für</strong> den Kauf<br />
regionaler Lebensmittel korreliert.<br />
Besonders Frischware wie Eier, Fleisch- und Milchprodukte sowie Gemüse und Brot<br />
werden bevorzugt aus regionaler Herkunft gekauft, wobei vor allem in Süd- und<br />
Ostdeutschland auf die regionale Herkunft <strong>von</strong> Produkten geachtet wird.<br />
Verbraucher definieren die eigene Region größenmäßig unterhalb der nationalen/staatlichen<br />
und oberhalb der lokalen/kommunalen Ebene. Circa 40 Prozent nennen ihr Bundesland, circa<br />
50 Prozent <strong>ein</strong>e kl<strong>ein</strong>räumigere räumliche Einheit. Regionsdefinitionen und die Stärke der<br />
Identifikation mit der eigenen Region sind deutschlandweit un<strong>ein</strong>heitlich. Verwirrung durch<br />
unübersichtliche Kennzeichnungen wird bemängelt, Transparenz dagegen gewünscht und<br />
honoriert.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 32
4 Inhaltliche Definition unter Beachtung der<br />
Produktionstiefe<br />
Die Diskussion und Definition der inhaltlichen Vorgaben zur Regionalität hat größte Bedeutung<br />
und soll unter Beachtung <strong>ein</strong>er Vielzahl <strong>von</strong> Gesichtspunkten und deren Abwägung erfolgen. Im<br />
Folgenden werden daher die Themenfelder Monoprodukte, zusammengesetzte Produkte und<br />
Wertschöpfungsketten ausgewählt und gesondert betrachtet. Außerdem werden die Chancen<br />
und Risiken <strong>ein</strong>er Einbindung der Landwirtschaft, der landwirtschaftlichen Vorstufe, des<br />
nachgelagerten Bereichs sowie verschiedene Szenarien an Ausnahmeregelungen aufgezeigt.<br />
Die zentrale Fragestellung bei allen Betrachtungen ist, ob zur Gewährleistung <strong>ein</strong>er regionalen<br />
Auslobung der Hauptrohstoff ausschlaggebend ist oder ob weitere Zutaten berücksichtigt<br />
werden müssen und wie umfassend daher die Produktionstiefe ausgelobt werden soll.<br />
Zurzeit existieren k<strong>ein</strong>e bundesweiten aussagekräftigen Studien, die die M<strong>ein</strong>ung der<br />
Verbraucher in Bezug zur Produktionstiefe erfragen. Interpretiert man die Ergebnisse der drei<br />
nachfolgend aufgeführten Studien, so kann man die These aufstellen, dass <strong>ein</strong> großer Teil der<br />
Verbraucher <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em regionalen Produkt erwartet, dass die Rohstoffe in der Region erzeugt<br />
wurden und dass die Verarbeitung und die Vermarktung in der Region stattfinden.<br />
Tabelle 10: Verbraucherstudien zum Thema Regionalität unter Beachtung der Produktionstiefe<br />
Studie Jahr Stichprobe Ergebnisse<br />
DLG-Studie 2011 Online-Befragung;<br />
n=1.350<br />
Vzbv - Kennzeichnung <strong>von</strong><br />
regionalen Lebensmitteln/<br />
Forsa-Umfrage im Auftrag des<br />
<strong>BMELV</strong> zur biologischen Vielfalt,<br />
<strong>BMELV</strong> 2010<br />
Verbraucherumfrage des<br />
Saarländlich-Team<br />
97 % der Befragten verstehen unter<br />
Regionalität Produkte aus der Region<br />
(angebaut, produziert und verkauft)<br />
2010 k<strong>ein</strong>e Angabe Regionalität=Herstellung der Rohstoffe und<br />
Verarbeitung in der Region; zusätzliche<br />
Produktqualitäten: mehr Frische, ohne<br />
Gentechnik, Ökoqualität, artgerechte<br />
Tierhaltung<br />
2008 n=50 Herstellung in der genannten Region:<br />
80 %<br />
Herstellung der Zutaten in der Region:<br />
74 %<br />
Weiterverarbeitung und Herstellung des<br />
Endprodukts in der Region: 70 %<br />
Vermarktung in der Region: 56 %<br />
Eigenschaften regionaler Lebensmittel:<br />
nach besonderen <strong>Kriterien</strong> bezüglich<br />
Tierschutz und Pestizid<strong>ein</strong>satz hergestellt<br />
(80 %)<br />
gentechnikfrei (92 %)<br />
nach biologischen Richtlinien hergestellt<br />
(70 %)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 33
4.1 Monoprodukte<br />
Für die weitere Betrachtung werden die Produkte in zwei Kategorien aufgeteilt:<br />
Monoprodukte<br />
zusammengesetzte Produkte<br />
Eine <strong>ein</strong>heitliche Definition <strong>von</strong> Monoprodukten gibt es nicht. Laut Lebensmittelkennzeichnungsverordnung<br />
muss <strong>ein</strong>e mengenmäßige Zutatendeklaration in Gewichtsprozent erfolgen, kurz<br />
QUID (Quantitative Ingredients Declaration). Im Rahmen dieser Verordnung werden Monoprodukte<br />
als Produkte definiert, die aus <strong>ein</strong>er Zutat bestehen. Quasi-Monoprodukte sind solche,<br />
die zu 98 Prozent aus <strong>ein</strong>er Zutat bestehen. Für solche Produkte muss k<strong>ein</strong> Zutatenverzeichnis<br />
auf der Verpackung angegeben werden.<br />
Die Monoprodukte kann man wiederum in zwei Unterkategorien aufteilen:<br />
unverarbeitete Monoprodukte wie z. B. Obst und Gemüse etc.<br />
verarbeitete Monoprodukte wie z. B. H-Milch, Apfelsaft, Weizenbrot etc.<br />
Wie schwierig es ist, <strong>ein</strong>e regionale Wertschöpfungskette umzusetzen, muss man allerdings<br />
auch bei den Monoprodukten differenziert betrachten:<br />
Monoprodukte, die über <strong>ein</strong>en längeren Zeitraum lagerfähig sind, kann man durch <strong>ein</strong>e<br />
Chargenbildung und räumliche Trennung relativ <strong>ein</strong>fach als <strong>ein</strong> regionales Produkt darstellen.<br />
Verarbeitete Monoprodukte, die in <strong>ein</strong>em relativ kl<strong>ein</strong>en Zeitfenster erzeugt, erfasst, verarbeitet<br />
und verbraucht werden müssen - wie etwa Milch -, sind in der Umsetzung deutlich komplizierter.<br />
4.2 Zusammengesetzte Produkte<br />
Um die Rohstoffbasis darzustellen, werden exemplarisch vier verarbeitete Produkte, je zwei<br />
pflanzlicher und zwei tierischer Herkunft, tabellarisch dargestellt. Bei den jeweiligen Anteilen der<br />
Zutaten handelt es sich um ungefähre Zahlen, da verschiedene Verarbeitungsunternehmen<br />
individuelle Rezepturen haben. Die Wertschöpfungsketten werden in die Bereiche<br />
Landwirtschaft und verarbeitende Industrie aufgeteilt, wobei der jeweilige vor- und<br />
nachgelagerte Bereich sowie die Zulieferer in dem System nicht gesondert aufgeführt werden.<br />
Dies erfolgt im Abschnitt Wertschöpfungskette. Die regionale Verfügbarkeit wird mit Schulnoten<br />
<strong>von</strong> 1=sehr gut (Verfügbarkeit möglichst flächendeckend in der Region gegeben) bis<br />
6=ungenügend (Verfügbarkeit in der Region nicht gegeben) dargestellt.<br />
Zusammenfassung Monoprodukte und zusammengesetzte Produkte<br />
Da Monoprodukte quasi nur aus <strong>ein</strong>er Zutat bestehen, ist die Definition der Anteile der<br />
Rohstoffe, die in der Region erzeugt wurden, relativ <strong>ein</strong>fach. Eine Festlegung auf 100 Prozent<br />
Rohstoffe, die in der Region erzeugt wurden, ist bis auf wenige Ausnahmen umsetzbar.<br />
Zusammengesetzte Produkte können unter Umständen aus <strong>ein</strong>er Vielzahl <strong>von</strong> Zutaten<br />
bestehen. Analog der gängigen Praxis bestehender Regionalsysteme ist <strong>ein</strong> Bezug der<br />
Mindestanteile an Zutaten, die in der Region erzeugt wurden, zur Hauptzutat bzw. zur<br />
Gesamtmasse bzw. zu beiden Gesichtspunkten denkbar.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 34
Die Hauptzutat ist die Zutat (außer Wasser), die an erster Stelle vom Zutatenverzeichnis steht.<br />
Eine Ausnahme stellt hierbei die Zutat Wasser dar. Das wird am Beispiel Bier deutlich, da hier<br />
nach dem Wasser das Malz folgt, welches unter dem Gesichtspunkt der Regionalität die<br />
Hauptzutat ist. Bei <strong>ein</strong>em Bezug zur Gesamtmasse sollte man die prozentualen Anteile analog<br />
zum Zutatenverzeichnis, somit bezogen auf die Frischmasse, betrachten.<br />
Bei <strong>ein</strong>igen Regionalsystemen wird abweichend zum Bezugspunkt der mengenmäßigen<br />
Hauptzutat die wertmäßige Hauptzutat betrachtet. Dies hat aber folgende Nachteile:<br />
Bestimmung ist nur betriebsindividuell möglich und könnte sich je nach Preisentwicklung der<br />
Zutaten verändern.<br />
Für den Verbraucher ist diese Festlegung nicht nachvollziehbar, da er die Einkaufspreise der<br />
Hersteller nicht kennt.<br />
4.2.1 Pflanzliche Produkte<br />
Als verarbeitete Produkte pflanzlicher Herkunft werden Weizenbrot und Erdbeerkonfitüre<br />
herangezogen. Als Region wurde das Bundesland Baden-Württemberg ausgewählt.<br />
Weizenbrot<br />
Die folgende Tabelle gibt <strong>ein</strong>e Übersicht über die Zusammenstellung der Zutaten, der<br />
Wertschöpfungsketten und die regionalen Verfügbarkeiten <strong>für</strong> Weizenbrot. Für die Herstellung<br />
ist die Zugabe der Grundzutat Weizenmehl auf mindestens 90 Prozent vorgegeben.<br />
Grundsätzlich wäre es hier möglich, den Anteil an Weizen auf über 90 Prozent zu erhöhen, je<br />
nach Backrezeptur.<br />
Tabelle 11: Beispiel Getreide: Weizenbrot<br />
Zutat Anteil in<br />
Prozent<br />
Wertschöpfungsketten Regionale Verfügbarkeit<br />
(Notensystem 1-6)<br />
Weizenmehl mind. 90 Landwirtschaft (Weizen) 1<br />
Landhandel 3<br />
Mühle 3<br />
Wasser Wasserversorger 1<br />
Hefe Hefehersteller 5<br />
Salz Salzbergbau oder Salinen 5<br />
Quelle: MBW, 2011<br />
Der regionale Bezug der weiteren Zutaten, außer Wasser, wird schwer zu gewährleisten s<strong>ein</strong>,<br />
da sowohl Hefe als auch Salz nicht in allen denkbar möglichen Regionen (hier die Region<br />
Baden-Württemberg) verfügbar sind.<br />
Erdbeerkonfitüre<br />
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Zusammensetzung, Wertschöpfungsketten und<br />
regionale Verfügbarkeit <strong>für</strong> Erdbeerkonfitüre. Die Einfuhr <strong>von</strong> Erdbeeren lag mit knapp über<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 35
100.000 Tonnen 5 im vergangenen Jahr deutlich über den Ausfuhren (10.879 t 6 ). Die<br />
Eigenproduktion in Deutschland beläuft sich auf 150.500 Tonnen 7 .<br />
Daraus wird ersichtlich, dass <strong>ein</strong> Großteil der Erdbeeren <strong>für</strong> den Bereich Frische und<br />
Verarbeitung nicht aus Deutschland stammt. Ein regionaler Bezug wäre hier nur <strong>für</strong> kl<strong>ein</strong>ere<br />
Konfitürenhersteller möglich, welche in oder bei den Hauptanbaugebieten in Deutschland<br />
ansässig sind. Neben der mengenmäßigen Problematik ist es bei der Zusammensetzung <strong>von</strong><br />
Erdbeerkonfitüre schwierig, über den Fruchtanteil hinaus, der in der jeweiligen Rezeptur<br />
vorgesehen ist, regionale Rohstoffe zu beziehen.<br />
Die zweite Hauptzutat Zucker ist mit <strong>ein</strong>er Produktion <strong>von</strong> 3.951.000 Tonnen 8 in der Zeit <strong>von</strong><br />
August 2009 bis Oktober 2010 <strong>für</strong> die Verwendung in Marmeladen und Konserven (207.100 t 9 )<br />
in Deutschland zwar ausreichend verfügbar. Allerdings sind in der deutschen Zuckerindustrie<br />
2008 nur noch sechs Unternehmen tätig, wodurch der regionale Bezug, je nach Definition der<br />
Region, nur sehr selten möglich ist 10 . Gleichzeitig fehlen in vielen Regionen die entsprechenden<br />
Verarbeitungsstätten.<br />
Tabelle 12: Beispiel Obst: Erdbeerkonfitüre<br />
Zutat Anteil in<br />
Prozent<br />
Wertschöpfungsketten Regionale Verfügbarkeit<br />
(Notensystem 1-6)<br />
Früchte 54 Landwirtschaft 3<br />
Großhandel 3<br />
Verarbeitende Industrie 5<br />
Zucker aus Zuckerrüben 39 Anbau/Landwirtschaft 2<br />
Großhandel 2<br />
verarbeitende Industrie 5<br />
Pektin ca. 6 6<br />
Säuerungsmittel ca. 0,5 6<br />
Quelle: MBW, 2011<br />
4.2.2 Tierische Produkte<br />
Um die Rohstoffbasis tierischer Produkte darzustellen, wurden Erdbeerjoghurt und Schinkenwurst<br />
als verarbeitete Produkte herangezogen.<br />
Erdbeerjoghurt<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt <strong>ein</strong>en Überblick über Zutaten, Wertschöpfungsketten und<br />
regionale Verfügbarkeit <strong>von</strong> Erdbeerjoghurt. Insgesamt macht die Milchverwendung <strong>für</strong> Joghurt,<br />
Sauermilch und Kefirerzeugnisse mit 1,91 Prozent 11 der 2010 in Deutschland verfügbaren<br />
5<br />
Diagramm: Statistisches Bundesamt BLE422, Einfuhr <strong>von</strong> Erdbeeren nach Deutschland 2010<br />
6<br />
Statistisches Bundesamt, <strong>BMELV</strong>: Gesamtbericht Ausfuhr <strong>von</strong> Obst und Gemüse 2010<br />
7<br />
Diagramm: Statistisches Bundesamt, <strong>BMELV</strong> (123)<br />
8<br />
BLE: Zuckererzeugung, Zuckerabsatz, Zuckerbestände (Tabelle)<br />
9<br />
BLE: Zuckerabsatz der Zuckerfabriken und Handelsunternehmen (Tabelle)<br />
10<br />
Statistisches Bundesamt, <strong>BMELV</strong>: Unternehmenskonzentration im Produzierenden Ernährungsgewerbe (Tabelle)<br />
11<br />
BLE: Verwendung <strong>von</strong> Milch in den Molkereien nach Kalenderjahren (Tabelle)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 36
Menge nur <strong>ein</strong>en geringen Anteil aus. Bereits seit 2000 ist der Selbstversorgungsgrad <strong>für</strong><br />
Fruchtjoghurt dementsprechend hoch und unterschritt bis 2009 nie 110 Prozent 12 .<br />
Tabelle 13: Beispiel Milch: Erdbeerjoghurt (Fruchtjoghurt)<br />
Zutat Anteil in<br />
Prozent<br />
Wertschöpfungsketten Regionale Verfügbarkeit<br />
(Notensystem 1-6)<br />
Joghurt ca. 83 Landwirtschaft (Milch) 2<br />
Spedition/Erfassung 2<br />
Molkereiwirtschaft 2<br />
Fruchtzubereitung 12-20 Landwirtschaft (Obst) 3<br />
(Fruchtanteil muss mind.<br />
Großhandel 3<br />
6 % s<strong>ein</strong>)<br />
Verarbeitende Industrie 5<br />
Zucker ca. 12 Landwirtschaft (Zuckerrüben) 2<br />
Zuckerfabriken 5<br />
Stärke (Mais, Weizen oder ca. 2 Landwirtschaft 1<br />
Kartoffeln)<br />
Stärkeproduzenten 5<br />
Quelle: MBW, 2011<br />
Der Bezug <strong>von</strong> regionalen Rohstoffen kann, je nach Lage der Molkerei und deren<br />
Einzugsgebiet in der definierten Region, <strong>ein</strong>e Herausforderung <strong>für</strong> das Management der<br />
Warenströme s<strong>ein</strong>. Die Situation <strong>für</strong> die Fruchtzubereitung aus Erdbeeren stellt sich ähnlich dar<br />
wie <strong>für</strong> Erdbeerkonfitüre. Der Rohstoffbezug findet europaweit statt. Eine Erhöhung des Anteils<br />
an regionalem Joghurt ist schwierig, da der Anteil an Frucht in <strong>ein</strong>em Fruchtjoghurt mindestens<br />
6 Prozent betragen muss. Daher ergeben sich Zumischungen der Fruchtzubereitungen <strong>von</strong> 12<br />
bis 20 Prozent.<br />
Schinkenwurst<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt <strong>ein</strong>en Überblick über die Zutaten, Wertschöpfungsketten und<br />
regionale Verfügbarkeit <strong>für</strong> Schinkenwurst. Bei der Zusammensetzung dieses Produktes sind es<br />
zwei Hauptzutaten, die regional bezogen werden müssten. Von den weiteren Zutaten wären<br />
lediglich die Zwiebeln teilweise regional zu beziehen.<br />
All<strong>ein</strong>e bei <strong>ein</strong>er der beiden Hauptzutaten, dem Schw<strong>ein</strong>, ist die Verarbeitung in Deutschland<br />
sehr unterschiedlich angesiedelt. Während in Saarland und Hessen 2010 zusammen nur ca.<br />
556.000 Tiere inländischer Herkunft gewerblich geschlachtet wurden, waren es in<br />
Niedersachsen 16.115.576 Tiere 13 .<br />
Tabelle 14: Beispiel Fleisch: Schinkenwurst<br />
Zutat Anteil in<br />
Prozent<br />
Schw<strong>ein</strong>efleisch<br />
(Brät und Grob<strong>ein</strong>lage)<br />
ca. 42-47<br />
Wertschöpfungsketten Regionale Verfügbarkeit<br />
(Notensystem 1-6)<br />
Landwirtschaft (Schw<strong>ein</strong>) 2<br />
Viehhandel 2<br />
Verarbeitung (Fleisch und Wurst) 4<br />
12 <strong>BMELV</strong>, Statistisches Bundesamt, BLE: Versorgung mit Sauermilch-, Kefir- und Joghurterzeugnissen,<br />
Milcherzeugnissen sowie -getränken in Deutschland in den Jahren <strong>von</strong> 2000 bis 2009 (Tabelle)<br />
13 Statistisches Bundesamt: Geschlachtete Tiere, Schlachtmenge, Bundesländer (Tabelle)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 37
Rindfleisch ca. 42 Landwirtschaft (Rind) 2<br />
Viehhandel 2<br />
Verarbeitung (Fleisch und Wurst) 4<br />
Eis 10-20 Wasserversorger 1<br />
Zwiebel 1 Landwirtschaft 2<br />
Pfeffer und andere<br />
Gewürze oder<br />
Gewürzpräparate<br />
Großhandel/Lager 2<br />
2 Anbau/Landwirtschaft 5<br />
Großhandel 5<br />
verarbeitende Industrie 5<br />
Salz Salzbergbau oder Salinen 5<br />
Quelle: MBW, 2011<br />
4.3 Wertschöpfungskette<br />
Für zusammengesetzte Produkte und Monoprodukte darf da<strong>von</strong> ausgegangen werden, dass<br />
<strong>ein</strong>e tiefe Einbindung der Wertschöpfungskette die Glaubwürdigkeit regionaler Produkte<br />
steigert. Allerdings wächst damit die Gefahr, dass solche regionale Wertschöpfungsketten nicht<br />
umsetzbar sind. Im Folgenden werden zwei Teilbereiche näher betrachtet: zum <strong>ein</strong>en die Stufe<br />
der Landwirtschaft und deren Vorstufen, zum anderen die Verarbeitungs- und<br />
Vermarktungsstufen. Exemplarisch wird dies in der pflanzlichen Produktion anhand <strong>von</strong><br />
Weizenverarbeitung zu Brot und in der tierischen Produktion anhand <strong>von</strong> Milchverarbeitung zu<br />
Joghurt bzw. der Fleischproduktion dargestellt.<br />
4.3.1 Landwirtschaft und deren Vorstufen<br />
Bei der folgenden Betrachtung der Landwirtschaft und deren Vorstufen wird das<br />
Hauptaugenmerk auf die Betriebsmittel mit Wertschöpfungsketten gelegt, welche mengenmäßig<br />
den größten Anteil haben. Der Zukauf <strong>von</strong> Dienstleistungen, Maschinen oder Energie wird nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Obwohl im Jahr 2009/10 der Selbstversorgungsgrad bei Weizen 136 Prozent 14 betrug und die<br />
Verfügbarkeit deutschlandweit gegeben ist, liegen hier die Herausforderungen in der Struktur<br />
der Wertschöpfungskette, welche in Abbildung 10 schematisch dargestellt ist. Die wichtigsten<br />
<strong>ein</strong>gebrachten Betriebsmittel aus dem vorgelagerten Bereich sind Saatgut, Düngemittel und<br />
Pflanzenbehandlungs- sowie Schädlingsbekämpfungsmittel (PS-Mittel).<br />
Die Gesamtanbaufläche <strong>von</strong> Weizen (im Folgenden: Winterweizen und Sommerweizen ohne<br />
Hartweizen) betrug 2010 in Deutschland 32.211.000 Hektar 15 . Daran gemessen ist die<br />
Vermehrungsfläche <strong>für</strong> landwirtschaftliches Saatgut mit 50.923 Hektar 16 verhältnismäßig gering<br />
und liegt in der Hand weniger Unternehmen.<br />
14<br />
BLE, <strong>BMELV</strong>: Versorgung mit Hart- und Weichweizen zusammen (Tabelle)<br />
15<br />
<strong>BMELV</strong>: Getreideanbauflächen nach Getreidearten und Ländern (Tabelle)<br />
16<br />
Bundessortenamt, <strong>BMELV</strong>: Vermehrungsflächen <strong>von</strong> landwirtschaftlichem Saatgut (Tabelle)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 38
Ein Bezug <strong>von</strong> regional hergestellten Pflanzenschutz-Mitteln und mineralischem Dünger ist<br />
aufgrund des Konzentrationsprozesses der Herstellerfirmen in diesem Marktsegment in<br />
Deutschland nicht möglich.<br />
Hier besteht die Gefahr, dass k<strong>ein</strong>e Wertschöpfungsketten entstehen können. Gleiches gilt <strong>für</strong><br />
die Verwendung <strong>von</strong> mineralischen Düngern. Anders ist es, wenn tierische Düngemittel zum<br />
Einsatz kommen. Vieh haltende Betriebe können teilweise auf eigenen Dünger zurückgreifen<br />
oder <strong>ein</strong>e Kooperation mit Vieh haltenden Betrieben <strong>ein</strong>gehen. Hier kann in <strong>ein</strong>em regionalen<br />
System die Kreislaufwirtschaft und Zusammenarbeit gefördert werden, wobei insbesondere<br />
kl<strong>ein</strong>- und mittelständische Betriebe der Landwirtschaft <strong>ein</strong> All<strong>ein</strong>stellungsmerkmal<br />
herausarbeiten können.<br />
Abbildung 10: Schematische Darstellung Wertschöpfungskette<br />
Bei der Milchproduktion sind die Futtermittel der wichtigste Faktor. Die Nachzucht erfolgt häufig<br />
in <strong>ein</strong>em geschlossenen System, in dem bei künstlicher Befruchtung lediglich das Bullensperma<br />
<strong>von</strong> außen zugekauft wird. Grundsätzlich können Futtermittel innerbetrieblich erzeugt werden<br />
oder bei anderen landwirtschaftlichen Einheiten oder der Futtermittelindustrie zugekauft<br />
werden.<br />
Bei der Mischfuttermittelproduktion ergibt sich <strong>ein</strong>e vielschichtige Zusammensetzung<br />
verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse <strong>von</strong> Getreidearten, Mais, Futtererbsen,<br />
Ölsaaten u. a.. Gerade in den Mastbetrieben stellt die notwendige Eiweißversorgung in der<br />
Fütterung, welches hauptsächlich über Soja erfolgt und 30 bis 50 Prozent der Futterration<br />
ausmacht. Der bisherige Anbau <strong>von</strong> Soja in Deutschland beträgt ca. 3.000 Hektar und ist noch<br />
im Versuchsstadium. Eine regionale Versorgung mit Soja ist zurzeit nicht möglich.<br />
Außerdem ist die Anzahl der Futtermittelhersteller <strong>für</strong> Nutztiere mit 89 17 (2008) Unternehmen in<br />
Deutschland begrenzt. Andererseits wird durch die Einbeziehung der Futtermittel in <strong>ein</strong><br />
Regionalsystem die Kreislaufwirtschaft auf Betrieben gestärkt. Problematisch kann es in<br />
<strong>ein</strong>zelnen Regionen werden. In Deutschland gibt es beispielsweise <strong>ein</strong> starkes Ost-West-<br />
Gefälle. Beträgt die Herstellung <strong>von</strong> Mischfutter <strong>für</strong> Rinder und Kälber (Juli 2010 bis August<br />
2011) in den westlichen Bundesländern 5.929.000 Tonnen, waren es im Osten nur 615.000<br />
Tonnen 18 . Die monetär bemessene Vorleistung der Landwirtschaft beim Futtermittelkauf gibt <strong>für</strong><br />
die innerbetrieblich erzeugten Futtermittel in Deutschland über sechs Millionen Euro an. Ebenso<br />
<strong>für</strong> den Zukauf bei der Futtermittelindustrie. Es ist fraglich, ob die zugekauften Futtermittel ohne<br />
17 Statistisches Bundesamt, <strong>BMELV</strong>: Unternehmenskonzentration im Produzierenden Ernährungsgewerbe (Tabelle)<br />
18 BLE: Herstellung <strong>von</strong> Mischfutter (Tabelle)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 39
Weiteres durch <strong>ein</strong> regionales Angebot ersetzt werden können. Mit 66 Millionen Euro 19 ist der<br />
Anteil der bei anderen landwirtschaftlichen Betrieben zugekauften Futtermittel äußerst gering.<br />
Komplexer wird es bei der Betrachtung der Schw<strong>ein</strong>eproduktion bzw. bei der<br />
Fleischverarbeitung. Speziell in der Schw<strong>ein</strong>ehaltung hat sich der Trend zur arbeitsteiligen<br />
Produktion, also Aufteilung der <strong>ein</strong>zelnen Produktionsschritte auf <strong>ein</strong>e Reihe <strong>von</strong> Betrieben, in<br />
den letzten Jahren verstärkt. Wobei es natürlich immer noch den klassischen „geschlossenen<br />
Betrieb“ mit eigener Ferkelaufzucht und anschließender Mast gibt. Es existieren aber auch lose<br />
Betriebskooperationen, bei denen die Stufe der Jungsauenvermehrung, der Deckbetrieb der<br />
Zuchtsauen, der Wartebetrieb, der Abferkelbetrieb, der Babyferkelaufzuchtbetrieb und der<br />
Mastbetrieb jeweils als eigenständige landwirtschaftliche Betriebe geführt werden. In der Praxis<br />
existieren auch Lieferbeziehungen <strong>von</strong> Schw<strong>ein</strong>emastbetrieben zu Babyferkelaufzuchtbetrieben,<br />
die <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er Vielzahl <strong>von</strong> Ferkellieferanten bestückt werden. Des Weiteren muss<br />
beachtet werden, dass selbst kl<strong>ein</strong>ere familiengeführte Schw<strong>ein</strong>emastbetriebe in der Regel im<br />
„R<strong>ein</strong>-Raus-System“ wirtschaften und deshalb nicht kontinuierlich schlachtreife Schw<strong>ein</strong>e<br />
abgeben können, sodass unter Umständen der Schlachtbetrieb auf <strong>ein</strong>e Vielzahl <strong>von</strong><br />
Schw<strong>ein</strong>elieferanten zurückgreifen muss.<br />
Abbildung 11: Wertschöpfungskette in der Schw<strong>ein</strong>emast<br />
Verarbeitungs- und Vermarktungsstufe<br />
Bei der Herstellung <strong>von</strong> Brot aus Weizenmehl (siehe Abbildung 10) spielt insbesondere die<br />
Sicherung der Warenströme bei der Erfassung sowie in der Verarbeitungs- und<br />
Vermarktungsstufe <strong>ein</strong>e wichtige Rolle. Hier ist der Aufwand groß, um regionale Waren getrennt<br />
zu behandeln. Die zunehmende Unternehmenskonzentration verstärkt diesen Effekt.<br />
Besonders deutlich wird die Komplexität der möglichen Warenströme auch bei der Betrachtung<br />
der milchverarbeitenden Industrie in Abbildung 12. Je größer der Rohstoff<strong>ein</strong>satz und je<br />
vielfältiger die Wege der Rohstoffbeschaffung umso schwieriger wird es, <strong>ein</strong> regional<br />
19 <strong>BMELV</strong>: Vorleistungen <strong>für</strong> die Landwirtschaft (Tabelle)<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 40
nachvollziehbares Produkt herzustellen. Dabei werden in Deutschland mehr als zwei Drittel der<br />
verfügbaren Milchmenge durch 28 Unternehmen mit mehr als 300.000 Tonnen<br />
Milchverarbeitung im Jahr bearbeitet 20 .<br />
Abbildung 12: Schematische Darstellung der milchwirtschaftlichen Unternehmensstruktur in<br />
Deutschland (nach Wolter, R<strong>ein</strong>hard, 2008. S. 19)<br />
4.4 Produktion- und naturbedingte Faktoren<br />
Einfluss auf die <strong>Kriterien</strong>gestaltung haben neben der Betrachtung der Produktionstiefe und des<br />
Rohstoffanteils aus der Region auch produktions- und naturbedingte Faktoren.<br />
In der pflanzlichen Erzeugung, zum Beispiel <strong>von</strong> Weizen, können es vor allem naturbedingte<br />
Faktoren s<strong>ein</strong> wie Ernteausfälle oder Qualitätsverluste aufgrund <strong>von</strong> Trockenheit, Nässe, Kälte,<br />
Hagel, extremer Krankheitsdruck oder Schädlingsbefall.<br />
In der tierischen Erzeugung <strong>von</strong> beispielsweise Molkereiprodukten können naturbedingte<br />
Faktoren wie Tierkrankheiten und -seuchen oder alternierende Stallhaltungssysteme dazu<br />
führen, dass die Verfügbarkeit <strong>von</strong> regionalen Rohstoffen <strong>ein</strong>geschränkt ist oder Qualitäten<br />
nicht ausreichen und Ausnahmeregelungen geschaffen werden müssen.<br />
In der Weiterverarbeitung <strong>von</strong> tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen können Randlagen <strong>von</strong><br />
Betrieben und fehlende Lieferstrukturen oder fehlende Verarbeitungsunternehmen in der<br />
Wertschöpfungskette <strong>ein</strong> Hindernis s<strong>ein</strong>, welches nach Ausnahmeregelungen verlangt.<br />
20 Wolter, R<strong>ein</strong>hard, 2008. Die Unternehmensstruktur der Molkereiwirtschaft in Deutschland. Bonn:<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.). S. 18<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 41
Zusammenfassung Produktionstiefe<br />
Der Strukturwandel, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Lebensmittelverarbeitung, hat<br />
dazu beigetragen, dass die Anzahl der Betriebe deutlich abgenommen hat und in der Regel<br />
k<strong>ein</strong>e flächendeckende Verfügbarkeit mehr gegeben ist.<br />
Besonders in der Landwirtschaft haben sich die Betriebe zum Teil sehr stark spezialisiert und<br />
<strong>ein</strong>e arbeitsteilige Produktion aufgebaut. Dies muss bei der Betrachtung der Produktionstiefe<br />
sowohl auf der Stufe der Landwirtschaft als auch im Bereich der Verarbeitung beachtet<br />
werden. Die Einbindung aller Produktionsstufen bis hin zu den Vorstufen der Landwirtschaft ist<br />
theoretisch möglich, praktisch aber bei <strong>ein</strong>er Vielzahl <strong>von</strong> Produkten in kl<strong>ein</strong>räumigen<br />
Regionen nicht umsetzbar.<br />
Monoprodukte lassen sich, mit wenigen Ausnahmen, zu 100 Prozent aus regionalen<br />
Rohstoffen darstellen.<br />
Bei zusammengesetzten Produkten, die aus <strong>ein</strong>er Vielzahl an Zutaten bestehen, ist in der<br />
Regel <strong>ein</strong>es hundertprozentigen Rohstoffbezugs aus der Region nicht umsetzbar. Eine<br />
Definition der Mindestanteile aus der Region ist notwendig. Hierbei kann man Bezug nehmen<br />
zur Hauptzutat oder zu <strong>ein</strong>em prozentualen Anteil an der Gesamtmasse oder <strong>ein</strong>en Bezug<br />
sowohl zur Hauptzutat als auch zur Gesamtmasse.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 42
5 Einbindung weiterer Zusatzkriterien<br />
5.1 Bedeutung <strong>von</strong> Zusatzkriterien bei bestehenden Systemen<br />
Die geografischen Herkunftsangaben lassen sich in drei Kategorien <strong>ein</strong>teilen. Bei der <strong>ein</strong>fachen<br />
Herkunftsangabe steht all<strong>ein</strong>e nur die Herkunft im Vordergrund wie z. B. „made in Germany“.<br />
Bei der kombinierten Herkunftsangabe wird die Herkunftsangabe mit <strong>ein</strong>er Qualitätsaussage<br />
verbunden, wie dies z. B. bei den Länderzeichen „Geprüfte Qualität - HESSEN“ oder<br />
„Gesicherte Qualität - Baden-Württemberg“ der Fall ist. Bei der letzten Art der Herkunftsangabe,<br />
der sogenannten qualifizierten Herkunftsangabe, steht die Herkunft <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e bestimmte Qualität,<br />
wie es zum Beispiel bei den geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) wie etwa dem<br />
„Schwarzwälder Schinken“ der Fall ist (vgl. Becker 2002).<br />
Bei <strong>ein</strong>er Reihe <strong>von</strong> Regionalinitiativen bzw. Regionalsiegeln werden neben den Anforderungen<br />
zur Herkunft auch Vorgaben <strong>für</strong> weitergehende zusätzliche <strong>Kriterien</strong> gefordert.<br />
Bei den <strong>von</strong> der Europäischen Union (EU) notifizierten Qualitäts- und Herkunftszeichen der<br />
Länder werden in der Regel produktbezogene Qualitätsstandards vorgeschrieben, die über das<br />
gesetzlich vorgeschriebene Niveau hinausgehen. Dies ist vor allem in der Forderung der EU<br />
begründet, dass aus wettbewerbsrechtlichen Gründen k<strong>ein</strong>e r<strong>ein</strong>en Herkunftszeichen mit<br />
staatlichen Mitteln unterstützt werden dürfen. Hintergrund hierzu ist, dass <strong>ein</strong>e r<strong>ein</strong><br />
herkunftsbezogene Werbung <strong>für</strong> Lebensmittel den freien Warenverkehr innerhalb des<br />
europäischen Binnenmarktes stört.<br />
Bei den eher kl<strong>ein</strong>räumig orientierten Regionalinitiativen, bei denen <strong>ein</strong>e nachhaltige<br />
Regionalentwicklung und Umwelt- und Naturschutzanliegen im Fokus stehen, sind in der Regel<br />
auch <strong>ein</strong>e Reihe <strong>von</strong> zusätzlichen <strong>Kriterien</strong> im Regelwerk verankert.<br />
5.1.1 Erwartungen der Verbraucher<br />
Betrachtet man die Ergebnisse <strong>von</strong> Verbraucherbefragungen, so werden sehr häufig<br />
Argumente wie „Frische“ und „kurze Transportwege“ als Kaufargumente <strong>für</strong> regionale Produkte<br />
genannt. Aber auch viele weitere Gesichtspunkten erwartet der Verbraucher <strong>von</strong> Lebensmitteln<br />
aus der Region. Die folgende Auflistung gibt <strong>ein</strong>en kl<strong>ein</strong>en Überblick über die<br />
Verbrauchererwartungen:<br />
Tabelle 15: Überblick Verbrauchererwartungen<br />
Studie Jahr Stichprobe Ergebnisse<br />
Vzbv - Kennzeichnung <strong>von</strong><br />
regionalen Lebensmitteln /<br />
Forsa-Umfrage im Auftrag<br />
des <strong>BMELV</strong> zur<br />
biologischen Vielfalt,<br />
<strong>BMELV</strong> 2010<br />
2010 k<strong>ein</strong>e Angabe Regionalität = Herstellung der Rohstoffe und<br />
Verarbeitung; zusätzliche Produktqualitäten:<br />
mehr Frische, ohne Gentechnik, Ökoqualität,<br />
artgerechte Tierhaltung<br />
Stockebrand und Spiller 2009 n=261 Distanz zwischen Erzeugung/Herstellung und<br />
Einkaufsort; Assoziationen: kurze<br />
Transportwege und Frische; Verbindung <strong>von</strong><br />
ökologischem Landbau mit regionalen LM;<br />
Förderung der heimischen Wirtschaft<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 43
Banik und Simons 2008 n=632 Aspekte, die in Zusammenhang mit regionalen<br />
Lebensmitteln gebracht werden: Unterstützung<br />
der Landwirtschaft, Umweltschonung,<br />
Produktfrische<br />
Nur <strong>ein</strong> kl<strong>ein</strong>er Teil der Befragten gaben<br />
„weniger Skandale besser <strong>für</strong> die Gesundheit“<br />
und „artgerechte Tierhaltung“ als <strong>Kriterien</strong> an.<br />
Verbraucherumfrage des<br />
Saarländlich-Team<br />
2008 n=50 Regionaltypische Rezeptur: 44 %<br />
Herstellung in der genannten Region: 80 %<br />
Herstellung der Zutaten in der Region: 74 %<br />
Weiterverarbeitung und Herstellung des<br />
Endprodukts in der Region: 70 %<br />
Vermarktung in der Region: 56 %<br />
Eigenschaften regionaler Lebensmittel: nach<br />
besonderen <strong>Kriterien</strong> bezüglich Tierschutz und<br />
Pestizid<strong>ein</strong>satz hergestellt: 80 %<br />
Gentechnikfrei: 92 %<br />
nach biologischen Richtlinien hergestellt: 70 %<br />
Leitow 2005 n=440 Gründe <strong>für</strong> den Kauf regionaler Produkte:<br />
Geschmack (68,8 %) Frische (55,8 %)<br />
Profeta 2005 n=1.070<br />
Befragung <strong>von</strong><br />
„Rindfleischkäufern“<br />
Profeta 2005 n=994<br />
Befragung <strong>von</strong><br />
„Bierkäufern“<br />
Härlen, Simons und<br />
Vierboom<br />
2004 n=50; Einzelinterviews und<br />
Gruppendiskussionen<br />
Folgenden Aussagen stimmen die Befragten<br />
voll und ganz zu: Kauf regionaler Lebensmittel<br />
um die heimische Wirtschaft zu unterstützen<br />
(47,04 %); regionale Produkte sind meistens<br />
frischer (38,53 %); regionale Produkte sind<br />
umweltschonender (26,17 %); mehr Vertrauen<br />
zu regionalen Produkten (31,7 %)<br />
Folgenden Aussagen stimmen die Befragten<br />
voll und ganz zu: Kauf regionaler Lebensmittel<br />
um die heimische Wirtschaft zu unterstützen<br />
(34,25 %); regionale Produkte sind meistens<br />
frischer (28,79 %); regionale Produkte sind<br />
umweltschonender (17,85 %); mehr Vertrauen<br />
zu regionalen Produkten (20,33 %)<br />
Assoziation mit Regionalität: Frische und<br />
artgerechte Tierhaltung (kurze Transportwege);<br />
regionale Kennzeichnung als Qualitätsindikator<br />
ZMP 2002 n=3.000 Gründe <strong>für</strong> den Kauf <strong>von</strong> Produkten aus der<br />
eigenen Region: kürzere Transportwege,<br />
Unterstützung der heimischen Landwirtschaft,<br />
frischere Produkte, Spezialität der eigenen<br />
Region, besserer Geschmack, bessere<br />
Qualität, strenge gesetzliche Vorschriften,<br />
natürliche umweltschonende Produktion,<br />
gesündere Produkte<br />
Zusammenfassung<br />
Hauptargumente <strong>für</strong> den Kauf <strong>von</strong> regionalen Produkten beim Verbraucher sind die Frische<br />
der Produkte und die kurzen Transportwege. Die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft<br />
und das Argument, dass die Rohstoffe aus der Region kommen, sind weitere wichtige Punkte.<br />
Der Verbraucher verbindet mit regionalen Produkten oftmals Eigenschaften wie „natürlich<br />
produziert“ oder „geringe Schadstoffbelastung“.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 44
5.2 Auflistung verschiedener Zusatzkriterien<br />
5.2.1 Bio-Siegel<br />
Rechtliche Grundlage<br />
Rechtsgrundlage <strong>für</strong> das Bio-Siegel ist das deutsche Öko-Kennzeichengesetz und die Öko-<br />
Kennzeichnungsverordnung vom 10.12.2001. Die <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Vergabe nehmen Bezug auf<br />
die EG-Verordnung Nr. 834/2007 und deren Durchführungsvorschriften. Produkte und<br />
Erzeugnisse, die mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden, müssen diesen Vorschriften<br />
entsprechen. Die Verwendung schreibt <strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>malige Anzeigepflicht <strong>für</strong> jedes Produkt vor. Der<br />
Nachweis der Einhaltung der EG-Verordnung erfolgt über den Zertifizierungsnachweis.<br />
Inhaltliche Bedeutung<br />
Die Markensatzung des Bio-Siegels lässt es zu, dass zusätzlich zum Bio-Siegel <strong>ein</strong>e<br />
Herkunftsauslobung möglich ist. Einige Regionen, wie z. B. die Rhön, haben diese Möglichkeit<br />
genutzt und das Bio-Siegel mit <strong>ein</strong>er Herkunftsangabe versehen.<br />
Abbildung 13: Logo Biosiegel Rhön<br />
Durch die Nutzung des Bio-Siegels mit Herkunftsangabe hat man den Vorteil genutzt, dass das<br />
Bio-Siegel <strong>ein</strong>en Bekanntheitsgrad <strong>von</strong> knapp 90 Prozent (vgl. Buxel 2010) hat und man somit<br />
k<strong>ein</strong>e hohen werblichen Maßnahmen zur Bekanntmachung aufwenden musste. Durch das neue<br />
verpflichtende EU-Bio-Logo kann man allerdings da<strong>von</strong> ausgehen, dass das deutsche Bio-<br />
Siegel an Bedeutung verlieren wird und die Zeichennutzer sich über <strong>ein</strong>e neue<br />
Kommunikationsstrategie Gedanken machen müssen.<br />
Der Entstehungsweg war allerdings der, dass man ausgehend <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er Produktion nach den<br />
Richtlinien des ökologischen Landbau <strong>ein</strong>e zusätzliche Auslobung der Herkunft als <strong>ein</strong><br />
ergänzendes Kaufargument bewertet hat und nicht, dass <strong>ein</strong>e Regionalinitiative ausgehend <strong>von</strong><br />
dem „regionalen Gedanken“ entschieden hat, die gesamte Wertschöpfungskette auf Bio-<br />
Produktion umzustellen. Da Regionalität auch <strong>für</strong> „Natürlichkeit“ steht, braucht die Regionalität<br />
nicht zwingend die Ergänzung „Bio“ (vgl. Banik und Simons 2007).<br />
Eine Verbraucherbefragung in Bayern aus dem Jahr 2001 bestätigt, dass bei Bioprodukten die<br />
regionale Herkunft nicht das zentrale Kaufargument ist, aber als abgerundetes Argument, das<br />
die Öko-Kompetenz des Anbieters unterstreicht, angesehen wird (vgl. Schaer 2000).<br />
Die Bedeutung der Verknüpfung <strong>von</strong> „Bio“ und „Regional“ hat in den letzten Jahren deutlich<br />
zugenommen. Dies liegt sicherlich zum <strong>ein</strong>en in dem allgem<strong>ein</strong>en Trend zu regionalen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 45
Produkten und zum anderen an der gestiegenen Nachfrage und somit an dem gestiegenen<br />
Angebot <strong>von</strong> Biolebensmitteln mit der Konsequenz, dass vermehrt überregionale Strukturen<br />
sowohl in der Erzeugung als auch in der Verarbeitung entstanden sind. Die Bezeichnung<br />
„Regional“ hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und liegt beim<br />
Verbraucher laut DLG-Studie 2011 derzeit oftmals höher als „Bio“.<br />
Zusammenfassung<br />
Bioprodukte profitieren <strong>von</strong> der Herkunftsauslobung, Regionalprodukte brauchen nicht<br />
unbedingt „Bio“.<br />
5.2.2 Tierschutz<br />
Rechtliche Grundlage<br />
Neben den gesetzlichen Regelungen zur Tierhaltung im Allgem<strong>ein</strong>en existiert zurzeit k<strong>ein</strong><br />
staatliches Kennzeichnungssystem, welches freiwillige Bemühungen in Bezug auf den<br />
Tierschutz berücksichtigt, die über das gesetzliche Niveau hinausgehen.<br />
Der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz hat sich im März 2011 <strong>für</strong> die Einführung <strong>ein</strong>er staatlichen<br />
Tierschutzkennzeichnung ausgesprochen (Kurzstellungnahme zur Einführung <strong>ein</strong>es<br />
Tierschutzlabels in Deutschland, März 2011). Empfohlen wird <strong>ein</strong> mehrstufiges System, ähnlich<br />
dem Sternesystem der Hotelklassifizierung, bei dem Anreize <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e beständige<br />
Weiterentwicklung <strong>ein</strong>er tiergerechten Haltung gegeben werden. Dabei soll die gesamte<br />
Prozesskette <strong>von</strong> der Genetik über die Aufzucht bis hin zur Schlachtung <strong>ein</strong>gebunden werden.<br />
Aus Verbrauchersicht spielt das Thema „Tierwohl“ <strong>ein</strong>e immer größere Rolle und nimmt<br />
zunehmend Einfluss auf das Verbraucherverhalten (siehe auch Zwischenbericht zur Charta <strong>für</strong><br />
Landwirtschaft und Verbraucher - Thema Tierhaltung vom 01.07.2011 unter www.bmelv.de). In<br />
<strong>ein</strong>igen europäischen Ländern gibt es bereits verschiedene Ansätze: In Dänemark „Good<br />
farming practice“, in den Niederlanden „Beter leven“ und in Großbritannien „Animal welfare“.<br />
Abbildung 14: Logo Beter Leven<br />
Seit Januar 2011 bietet Westfleisch auf dem deutschen Markt mit der „Aktion Tierwohl“ <strong>ein</strong><br />
System <strong>für</strong> Handels- und Industriekunden an. <strong>Kriterien</strong> sind hier die Haltungsbedingungen im<br />
Stall, der Freilauf der Muttertiere in Gruppenhaltung, der tierärztliche Gesundheitsplan, die<br />
Wasserversorgung und Fütterung sowie Transportzeiten. Fleisch und Wurstwaren, bei deren<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 46
Produktion die vorgegebenen <strong>Kriterien</strong> <strong>ein</strong>gehalten wurden, können mit dem Label „Aktion<br />
Tierwohl“ gekennzeichnet werden.<br />
Abbildung 15: Logo Aktion Tierwohl<br />
Die „Initiativgruppe Tierwohl-Label“, zu der die Universität Göttingen und die Universität Kassel,<br />
der Deutsche Tierschutzbund und der Ver<strong>ein</strong> Neuland gehören, entwickelt zurzeit <strong>ein</strong><br />
Gütesiegel <strong>für</strong> Fleisch aus besonders tiergerechter Haltung, <strong>für</strong> welches Anfang 2012 erste<br />
verbindliche Standards veröffentlicht werden sollen. Schwerpunkt soll hierbei zum Beispiel <strong>für</strong><br />
die Mastschw<strong>ein</strong>ehaltung der Platzbedarf im Stall, der Verzicht auf das Kupieren der Schwänze<br />
sowie die Ferkelkastration ohne Betäubung und weitere Maßnahmen zur Reduzierung der<br />
Sterblichkeits- bzw. Verletzungsrate s<strong>ein</strong>.<br />
Da sich <strong>ein</strong>e Reihe <strong>von</strong> Initiativen mit dem Thema „Tierschutz“ beschäftigen, ist <strong>ein</strong> freiwilliger,<br />
<strong>von</strong> der Wirtschaft getragener, <strong>ein</strong>heitlicher <strong>Kriterien</strong>katalog derzeit nicht absehbar. Dies<br />
erschwert <strong>ein</strong>e Einbindung in <strong>ein</strong>e Regionalkennzeichnung.<br />
Zusammenfassung<br />
Aus Verbrauchersicht spielt das Thema „Tierschutz“ <strong>ein</strong>e Rolle. Eine Einbindung als<br />
Zusatzkriterium ist derzeit schwierig, da k<strong>ein</strong>e staatliche Regelung existiert.<br />
5.2.3 Nachhaltigkeitskriterien<br />
Der Ursprung der Definition der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Der Begriff selbst<br />
wird auf <strong>ein</strong>e Veröffentlichung <strong>von</strong> Hans Carl <strong>von</strong> Carlowitz aus dem Jahr 1713 zurückgeführt,<br />
in der <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er „nachhaltigen Nutzung“ der Wälder geschrieben wird (vgl. Wikipedia 2011).<br />
Eine <strong>ein</strong>heitliche Definition <strong>von</strong> Nachhaltigkeit existiert leider nicht. 1995 wurde <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e<br />
nachhaltige <strong>Entwicklung</strong> das Drei-Säulen-Modell entwickelt. Die drei Säulen Ökologie,<br />
Ökonomie und Soziale Ziele sollen gleichberechtigt und gleichwertig zu<strong>ein</strong>anderstehen.<br />
Rechtliche Grundlage<br />
Bisher existiert noch k<strong>ein</strong> Siegel, das alle <strong>Kriterien</strong> der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Es werden<br />
in der Regel immer nur Teilbereiche (<strong>ein</strong>e <strong>von</strong> drei Säulen) betrachtet.<br />
Für den Bereich der Ökologie bzw. Umwelt kommen zuerst die Zeichen und Systeme aus dem<br />
ökologischen Landbau infrage. Aber auch die „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung bzw.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 47
Regionalsiegel betrachten Teilaspekte der Nachhaltigkeit. Für den Bereich der sozialen Ziele<br />
kommen Systeme <strong>für</strong> „faire“ Produkte in Betracht, die in <strong>ein</strong>em späteren Abschnitt noch <strong>ein</strong>mal<br />
genauer erläutert werden.<br />
Inhaltliche Bedeutung<br />
Nachhaltigkeit im Allgem<strong>ein</strong>en<br />
Im Bereich des Lebensmittelmarketings wird der Begriff Nachhaltigkeit sehr vielfältig verwendet.<br />
Aber längst nicht alle Verbraucher können mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ etwas anfangen.<br />
Nach <strong>ein</strong>er Umfrage des Instituts <strong>für</strong> Demoskopie, Allensbach aus dem Jahr 2007 haben 33<br />
Prozent der Verbraucher den Begriff „Nachhaltigkeit“ noch nie gehört. 45 Prozent der Befragten<br />
haben den Begriff zwar schon <strong>ein</strong>mal gehört, können aber inhaltlich nichts mit dem Begriff<br />
anfangen. Die Verbraucher, die mit dem Begriff etwas verbinden können, haben allerdings<br />
unterschiedliche Vorstellungen da<strong>von</strong>, sodass als Ergebnis festzuhalten ist, dass die<br />
Verbraucher im Allgem<strong>ein</strong>en k<strong>ein</strong> klares Bild vom Begriff der Nachhaltigkeit haben (vgl. Nestlé<br />
Deutschland AG 2011).<br />
Klimaschutz/Product Carbon Footprint (PCF)<br />
Im Bereich des Klimaschutzes wird oft der Hinweis auf Klimalabels wie den Product Carbon<br />
Footprint (PCF) gegeben. Zurzeit existiert jedoch auch hier k<strong>ein</strong>e verbindliche<br />
Berechnungsgrundlage, die <strong>von</strong> der gesamten Wirtschaft anerkannt wird.<br />
Die Kennzeichnung <strong>von</strong> PCF-Angaben wird nur <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em Teil der Verbraucher verstanden.<br />
Dies war Ergebnis zweier Verbraucher-Befragungen aus den Jahren 2009 und 2010. Hiernach<br />
halten 56 Prozent bzw. 66 Prozent der Verbraucher <strong>ein</strong>e PCF-Angabe <strong>für</strong> sinnvoll, aber 35<br />
Prozent bzw. 54 Prozent zweifeln an der Umsetzbarkeit. Die Verbraucher sch<strong>ein</strong>en die<br />
Berechnung des PCF nicht zu verstehen. Daraus lässt sich schließen, dass <strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitliche<br />
Berechnung und klare Kommunikation erforderlich ist, damit das Konzept des PCF als<br />
Unterscheidungsmerkmal genutzt werden kann. (vgl. Schlich und Schlich 2010).<br />
Die Klimabilanzen <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln im Vergleich zu <strong>ein</strong>er überregionalen<br />
Produktion werden zurzeit vielfältig diskutiert. Bei gleichen Produktionsbedingungen <strong>von</strong><br />
regionalen und überregionalen Wertschöpfungsketten schneiden die regional erzeugten<br />
Lebensmittel aufgrund der kürzeren Transportwege bei der Klimabilanz deutlich besser ab.<br />
Gleiche Produktionsbedingungen sind allerdings in der Realität häufig nicht gegeben, sodass<br />
z. B. <strong>ein</strong> Brot, welches mit überregionalem Getreide in <strong>ein</strong>er modernen energieeffizienten<br />
Industriebäckerei produziert wurde, <strong>ein</strong>e bessere Klimabilanz aufweist als <strong>ein</strong> Brot, welches mit<br />
regionalem Getreide in <strong>ein</strong>er Kl<strong>ein</strong>bäckerei produziert wurde. Des Weiteren wirft dieses Thema<br />
natürlich die Diskussion <strong>von</strong> Produkten mit <strong>ein</strong>em hohen CO2-Verbrauch, wie etwa Fleisch, auf<br />
(vgl. R<strong>ein</strong>hardt, Gärtner, Münch und Häfele 2009).<br />
Zusammenfassung<br />
Nachhaltigkeit im Allgem<strong>ein</strong>en ist <strong>für</strong> den Verbraucher noch k<strong>ein</strong> klarer Begriff. Für<br />
„Klimalabels“ wie den PCF existieren bislang k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitlichen Berechnungsstandards und<br />
der Verbraucher kann inhaltlich noch nicht viel damit anfangen.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 48
5.2.4 Soziale <strong>Kriterien</strong>/Fair-Zertifizierung<br />
Soziale <strong>Kriterien</strong> in der Lebensmittelproduktion sind die dritte Säule der Nachhaltigkeit.<br />
Gegenüber dem Verbraucher wird dies in der Regel mit dem Begriff „fair“ versucht zu<br />
verdeutlichen. Seit vielen Jahren wird unter dem Fairtrade-Gütesiegel <strong>ein</strong> Angebot <strong>von</strong><br />
Produkten aus <strong>Entwicklung</strong>sländer bereitgestellt, das Erzeugerpreise oberhalb des<br />
Weltmarktpreises gewährleistet.<br />
Abbildung 16: Logo Fairtrade International<br />
Seit <strong>ein</strong>igen Jahren wird das System der „fairen Preise“ auch auf heimische Produkte<br />
übertragen. Dies begründet sich vor allem auf die sehr volatilen Rohstoffmärkte <strong>für</strong> Agrargüter,<br />
wo es in den letzten Jahren vorkam, dass die Erzeugerpreise die Produktionskosten bei Weitem<br />
nicht mehr gedeckt haben.<br />
Rechtliche Grundlage<br />
Eine rechtliche Grundlage zu sozialen <strong>Kriterien</strong> bzw. <strong>ein</strong>er Fair-Zertifizierung gibt es zurzeit<br />
nicht. Es existieren aber <strong>ein</strong>e Reihe <strong>von</strong> Aktivitäten, die sich selbst <strong>ein</strong>en Rahmen gesetzt<br />
haben.<br />
5.2.4.1 Beispiel: fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg<br />
Abbildung 17: Logo fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg<br />
Bio Berlin-Brandenburg Charta, Stand: 30.06.2010<br />
Die allgem<strong>ein</strong>en Ziele werden hier wie folgt definiert:<br />
Gem<strong>ein</strong>same Weiterentwicklung <strong>ein</strong>er sozialen und umweltverträglichen Biobranche in der<br />
Region Berlin-Brandenburg.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 49
Fairer Umgang aller Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette.<br />
Gem<strong>ein</strong>sames und gerechtes Wirtschaften zur Sicherung <strong>ein</strong>er nachhaltigen <strong>Entwicklung</strong>.<br />
Preis muss so s<strong>ein</strong>, dass er dem Erzeuger <strong>ein</strong>e angemessene Lebenshaltung ermöglicht.<br />
Die <strong>Kriterien</strong> lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
Verbindliche Abnahme- und Lieferverträge der Partner entlang der Wertschöpfungskette über<br />
<strong>ein</strong>en längerfristigen Zeitraum.<br />
<strong>Entwicklung</strong> und Umsetzung <strong>von</strong> gem<strong>ein</strong>samen Anbau-, Mengen- und Produktentwicklungsplänen<br />
<strong>für</strong> alle Beteiligten durch gem<strong>ein</strong>same Gesprächsrunden.<br />
Verbindliche Absprachen über zu zahlende Preise in gem<strong>ein</strong>samen Gesprächsrunden.<br />
Einvernehmliche Ver<strong>ein</strong>barung <strong>von</strong> angemessenen und produktspezifischen Zahlungszielen.<br />
Alle Teilnehmer erklären sich bereit, Vertragspartner oder andere Lizenznehmer der fair &<br />
regional-Charta in betrieblichen und wirtschaftlichen Notsituationen entsprechend eigener<br />
Möglichkeiten zu unterstützen.<br />
Soziale <strong>Kriterien</strong>: In den Betrieben dürfen nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse<br />
angeboten werden, regelmäßige Weiterbildung aller Mitarbeiter; Förderung der<br />
Übermittlung ökologischer Themen und Inhalte, gesellschaftliche/soziale Projekte entweder<br />
selber zu initiieren oder persönlich bzw. mit Spenden oder Sachleistungen zu unterstützen, <strong>für</strong><br />
die Wissens- und Erfahrungsvermittlung des ökologischen Gedankens geeignete Maßnahmen<br />
zu ergreifen.<br />
Umweltmanagement: Mitglieder sind verpflichtet, das Ziel <strong>ein</strong>es aktiven Umweltschutzes in<br />
ihrer Produktion und in ihren Betrieben zu verfolgen und Umweltaktivitäten ihres Betriebes zu<br />
veröffentlichen; Reduktion <strong>von</strong> Verpackungsmaterialien bzw. Verwendung umweltgerechter<br />
Verpackungsmaterialien, Unterstützung und Verwendung erneuerbarer Energien.<br />
Transparenz und Kommunikation: umfassende Kommunikation mit den Verbrauchern,<br />
Möglichkeit <strong>für</strong> Verbraucher die Arbeit und Produktion vor Ort kennenzulernen.<br />
Anforderungen an die Handelsstufen: Handel verpflichtet sich, die Produkte bei ausreichender<br />
Qualität und fairen marktüblichen Preisen zu listen und aktiv zu unterstützen. Unterstützung:<br />
hervorgehobene Platzierung und kommunikative Unterstützung.<br />
Herkunftsbestimmungen: Anbau <strong>von</strong> pflanzlichen Produkten zu 100 Prozent in der Region<br />
Berlin-Brandenburg, bis 20 Prozent der Hauptzutat <strong>ein</strong>es verarbeiteten Produktes können <strong>von</strong><br />
außerhalb stammen, wenn nicht in ausreichender Menge in der Region verfügbar,<br />
Verarbeitungsstätten <strong>für</strong> Veredelung müssen in der Region liegen, Tiere müssen spätestens<br />
ab dem Alter <strong>von</strong> sechs Wochen (<strong>ein</strong>er Woche bei Geflügel) in der Region gehalten werden.<br />
Bei Verarbeitungsprodukten müssen die jeweiligen Agrarrohprodukte in der Region erzeugt<br />
worden s<strong>ein</strong>, übrige Zutaten auch aus anderen Regionen, wenn sie den Anforderungen <strong>für</strong><br />
Bioware entsprechen.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 50
5.2.4.2 Beispiel: Naturland Fair<br />
Abbildung 18: Logo Naturland Fair<br />
Naturland Fair Richtlinien<br />
Ökologischer Anbau, sozialer Umgang im Mit<strong>ein</strong>ander und faire Handelsbeziehungen sind die<br />
entscheidenden drei Säulen der Nachhaltigkeit.<br />
Sozialer Umgang mit Menschen, die auf den Betrieben leben und arbeiten.<br />
Förderung der weltweiten ökologischen Erzeugung und gesellschaftliche Anerkennung des<br />
Ökolandbaus, dadurch Beitrag zum Schutz der Umwelt, zur nachhaltigen Nutzung der<br />
Ressourcen, zur Ernährungssicherung und zur Verbesserung der Lebensgrundlage der<br />
Menschen.<br />
Produkt kann als fair bezeichnet werden, sobald der Anteil der Rohstoffe aus fairen<br />
Handelsbeziehungen über 50 Prozent (Trockengewicht) im Produkt beträgt und die übrigen<br />
Rohstoffe nachweislich nicht in „Fair Qualität“ verfügbar sind.<br />
Ziel ist es, das ganze Unternehmen auf „Fair“ umzustellen.<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> Unternehmenszertifizierung: mindestens 70 Prozent der Produkte, welche<br />
den Hauptumsatz des Unternehmens ausmachen, nach den Richtlinien erzeugt, verarbeitet<br />
bzw. gehandelt und der Rest nicht in „Fair Qualität“ verfügbar.<br />
Soziale Verantwortung: sozialer Umgang mit Menschen, die auf den Betrieben leben und<br />
arbeiten.<br />
Verlässliche Handelsbeziehungen: langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit, dadurch<br />
mehr Planbarkeit , Sicherheit und Stabilität.<br />
Vorfinanzierung: Vorfinanzierung <strong>für</strong> die Ernten in „wirtschaftlich benachteiligten Regionen“.<br />
Faire Erzeugerpreise: Erhaltung der Existenzgrundlage der Erzeuger durch Abdeckung der in<br />
der Region üblichen Produktionskosten und angemessener Gewinn <strong>für</strong> Zukunftsinvestitionen.<br />
Partnerschaftliche Preisfindung: mindestens oberes Drittel der marktüblichen Durchschnittspreise<br />
(gleitender Drei-Jahres-Durchschnitt).<br />
Faire Mindestpreise: Existiert <strong>ein</strong> Mindestpreis der FLO, wird mindestens dieser gezahlt, liegt<br />
der Marktpreis höher, dann dieser.<br />
Faire Prämien: Prämien <strong>für</strong> Produkte aus wirtschaftlich benachteiligten Regionen, diese<br />
dienen ausschließlich der Finanzierung <strong>von</strong> Sozial-, Bildungs- , Gesundheits- und<br />
Umweltprojekten oder als zusätzliche Einnahme <strong>für</strong> Kl<strong>ein</strong>bauern.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 51
„Regionaler Rohstoffbezug: Lokale Produktion zur Ernährung der Bevölkerung und <strong>ein</strong>e<br />
regionale Vermarktung haben Vorrang.<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftliche Qualitätssicherung: Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden zwischen<br />
Abnehmer und Erzeuger(n) der landwirtschaftlichen Erzeugnisse partnerschaftlich auf<strong>ein</strong>ander<br />
abgestimmt.<br />
Gesellschaftliches Engagement: Überdurchschnittliches gesellschaftliches Engagement<br />
und/oder Förderung <strong>von</strong> Projekten, Engagement z. B. im praktischen Umweltschutz, bei<br />
gem<strong>ein</strong>nützigen Ver<strong>ein</strong>en und/oder unterstützen Umwelt-, Gesundheits- oder<br />
Bildungsprojekte, soziale Projekte oder kulturelle Initiativen und/oder fördern bzw. unterstützen<br />
bäuerliche Landwirtschaft; Bevorzugung <strong>von</strong> Waren <strong>von</strong> Kl<strong>ein</strong>bauern.<br />
Unternehmensstrategie und Transparenz: Die Unternehmen legen fest, wie die Richtlinien<br />
umgesetzt werden sollen, Beschäftigte, Mitglieder und Erzeuger sollen in Entscheidungsprozesse<br />
<strong>ein</strong>gebunden werden.<br />
5.2.4.3 Beispiel: Die faire Milch<br />
„Die faire Milch“ ist angetreten, den Milcherzeugern <strong>ein</strong>en auskömmlichen Milchpreis zu<br />
gewährleisten. Neben der Regionalität wird auch <strong>ein</strong>e gentechnikfreie Fütterung (entsprechend<br />
den Vorgaben des <strong>BMELV</strong> Logo „Ohne Gentechnik) umgesetzt.<br />
Abbildung 19: Die faire Milch<br />
Verbraucherschützer und die Wettbewerbszentrale kratzen am Image des vom Bundesverband<br />
Deutscher Milchviehalter BDM konzipierten Produkts. Sie sei weniger regional als behauptet<br />
und nicht „fair“ erzeugt.<br />
Die Wettbewerbszentrale hatte Klage gegen den Namen „Die faire Milch“ vor dem Landgericht<br />
Landshut <strong>ein</strong>gereicht. „Die faire Milch“ erwecke den Eindruck, sie sei die <strong>ein</strong>zige fair erzeugte<br />
Milch. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte Angaben, die Milch stamme „aus<br />
Ihrer Region“ und „die heimische Produktion spart unnötige Transportwege“, gerügt. Dies träfe<br />
nicht zu, so Verbraucherschützer Eckhard Benner, die Milch der MVS, die in Stuttgart verkauft<br />
wird, stamme nicht aus der Region, sondern <strong>von</strong> Höfen aus dem Allgäu, sagt Benner, zur<br />
Abfüllung werde sie zudem ins osthessische Schlüchtern transportiert.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 52
Das Landgericht Landshut hat mit Urteil vom 30.03.2011, Az. 1 HK O 1426/10 der<br />
Milchvermarktungsgesellschaft verboten, mit der Bezeichnung „Die faire Milch“ zu werben.<br />
Daneben darf auch die Aussage „kommt ausschließlich <strong>von</strong> Höfen aus Ihrem Bundesland“ nicht<br />
weiter verwendet werden (Börnecke 2010).<br />
Die MVS Milchvermarktungsgesellschaft ging in Berufung. Das Verfahren läuft zurzeit noch, bis<br />
zum Berufungsurteil muss nichts an der Auslobung der „fairen Milch“ geändert werden<br />
(Niedermaier 2011).<br />
Zusammenfassung<br />
Die Verbindung <strong>von</strong> Regionalität und <strong>ein</strong>em „fairen“ Preis <strong>für</strong> die Erzeuger, aber auch <strong>für</strong> die<br />
Verarbeitungsunternehmen, gewinnt an Bedeutung. Einen rechtlichen Rahmen gibt es nicht,<br />
aber <strong>ein</strong>e Reihe <strong>von</strong> privaten Initiativen. Am Beispiel der „fairen Milch“ wird deutlich, dass der<br />
Begriff „fair“ rechtliche Risiken birgt.<br />
5.2.5 Ohne Gentechnik<br />
Abbildung 20: Logo Ohne Gentechnik<br />
Rechtliche Grundlage<br />
Seit dem 18.04.2004 besteht in der gesamten EU <strong>ein</strong>e Kennzeichnungspflicht <strong>für</strong> alle<br />
Lebensmittel und Futtermittel, die gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten, aus ihnen<br />
hergestellt wurden oder aus ihnen bestehen. K<strong>ein</strong>e Kennzeichnungspflicht besteht hingegen <strong>für</strong><br />
Produkte <strong>von</strong> Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden.<br />
Um dem Wunsch der Verbraucher und Hersteller gerecht zu werden, <strong>ein</strong>e Auslobung mit dem<br />
Zusatz „Ohne Gentechnik“ zu ermöglichen, regelt seit dem 01.05.2008 <strong>ein</strong>e Vorschrift und<br />
damit verbunden <strong>ein</strong>e Nachweispflicht die Verwendung dieses <strong>ein</strong>heitlichen Zeichens. Die<br />
Maßstäbe <strong>für</strong> die Verwendung sind sehr eng gefasst und umfassen bei pflanzlichen<br />
Lebensmitteln:<br />
Bestandteile aus gentechnisch veränderten Pflanzen sind nicht erlaubt. Nachweisbare<br />
zufällige oder technisch unvermeidbare GVO-Beimischungen werden nicht toleriert.<br />
Lebensmittelzusatzstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Aromen oder Enzyme, die mit Hilfe <strong>von</strong><br />
gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden, dürfen in der Verarbeitung<br />
nicht verwendet werden.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 53
Für tierische Lebensmittel gilt zusätzlich:<br />
Bei der Fütterung der Tiere wurden k<strong>ein</strong>e als „genetisch veränderte“ (gv) gekennzeichneten<br />
Futtermittel verwendet. Eine Ausnahme <strong>von</strong> der Kennzeichnungspflicht besteht nur <strong>für</strong><br />
zufällige oder technisch unvermeidbare Verunr<strong>ein</strong>igungen unter 0,9 Prozent.<br />
Futtermittelzusatzstoffe, die <strong>von</strong> gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert<br />
werden, sind nur zulässig, wenn sie nicht als „gentechnisch verändert“ zu kennzeichnen sind.<br />
Es sind tierartspezifische Mindestfütterungszeiten vorgeschrieben, ab denen k<strong>ein</strong>e<br />
gentechnisch veränderten Futterpflanzen mehr verfüttert werden dürfen.<br />
Die Anwendung <strong>von</strong> Tierarzneimitteln oder Impfstoffen aus gentechnischer Herstellung ist<br />
zulässig.<br />
Die Nutzung des Zeichens kann jeder beantragen, der die Anforderungen des EG-Gentechnik-<br />
Durchführungsgesetzes (EGGentDurchfG) erfüllt und <strong>ein</strong>en Lizenzvertrag mit dem privaten<br />
Zeicheninhaber, dem VLOG - Ver<strong>ein</strong> Lebensmittel ohne Gentechnik, abschließt. Zurzeit gibt<br />
es ca. 100 Zeichennutzer.<br />
Inhaltliche Bedeutung<br />
Die Auslobung des Zeichens „Ohne Gentechnik“ kommt vor allen <strong>für</strong> tierische Lebensmittel<br />
infrage. Dies wird auch durch die derzeitigen Zeichennutzer deutlich. Bis auf wenige<br />
Ausnahmen tragen vor allem Eier, Milchprodukte und <strong>ein</strong>ige Fleischprodukte das „Ohne<br />
Gentechnik“-Logo. Eine kombinierte Auslobung der „Regionalität“ ist möglich und wird bereits<br />
praktiziert.<br />
Zusammenfassung Zusatzkriterien<br />
Aufgrund der Tatsache, dass es <strong>ein</strong>e gesetzliche Regelung und <strong>ein</strong> verbindliches Logo gibt, ist<br />
<strong>ein</strong>e kombinierte Auslobung im Zusammenhang mit der Regionalität möglich.<br />
Bei zwei der hier aufgezeigten Zusatzkriterien existieren gesetzliche Vorgaben, wie die EG-<br />
Öko-Verordnung und die „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung. Das erleichtert <strong>ein</strong>e inhaltliche<br />
Einbindung als zusätzliches Kriterium <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e „Regionalkennzeichnung“. Bei <strong>ein</strong>er Vielzahl <strong>von</strong><br />
weiteren Möglichkeiten existieren k<strong>ein</strong>e gesetzlichen Vorgaben, sondern privatwirtschaftliche<br />
Lösungen, die in der Regel k<strong>ein</strong>e bedeutende Marktdurchdringung haben. Für die Einbindung<br />
solcher <strong>Kriterien</strong> sollten verbindliche Vorgaben definiert werden, damit man nicht Gefahr läuft,<br />
an Glaubwürdigkeit zu verlieren.<br />
Da der Verbraucher mit regionalen Produkten sehr oft auch Eigenschaften wie „natürlich<br />
produziert“ oder „geringe Schadstoffbelastung“ verbindet, müsste man der Fragestellung<br />
nachgehen, inwieweit der Verbraucher bereit ist, <strong>für</strong> regionale Produkte mit weiteren<br />
zusätzlichen <strong>Kriterien</strong> mehr Geld auszugeben, denn jedes weitere Kriterium verursacht weitere<br />
Kosten, die letztendlich der Erzeuger zu tragen hat.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 54
6 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen<br />
Regionalsiegels<br />
6.1 Ausgangslage<br />
Unter <strong>ein</strong>em regionalen Lebensmittel versteht man zunächst jedes Lebensmittel, dessen<br />
Werbung oder dessen Art der Kennzeichnung, Aussagen zu dessen regionalen Herkunft tätigt<br />
und dadurch <strong>ein</strong>en Bezug zu <strong>ein</strong>em bestimmten Ort, <strong>ein</strong>er bestimmten Region, <strong>ein</strong>er Landschaft<br />
oder <strong>ein</strong>em Land herstellt. Bevor auf die rechtlichen Vorgaben zu den geografischen<br />
Herkunftsangaben <strong>ein</strong>gegangen wird, soll jedoch <strong>ein</strong>e erste Annäherung an den Begriff des<br />
regionalen Lebensmittels unter Berücksichtigung der Erwartungen der Marktbeteiligen an <strong>ein</strong>e<br />
solche Kennzeichnung erfolgen. Die Herausarbeitung der Interessenlage der verschiedenen<br />
Marktbeteiligten ist <strong>ein</strong>e notwendige Voraussetzung, um in Verbindung mit der Beschreibung<br />
der bestehenden rechtlichen Bestimmungen zu <strong>ein</strong>er Beschreibung derjenigen<br />
Rahmenbedingungen zu gelangen, unter denen die Einführung <strong>ein</strong>es bundesweiten freiwilligen<br />
Regionalsiegels erfolgen kann.<br />
Interesse der Marktbeteiligen an der regionalen Kennzeichnung<br />
Die Verbraucher haben <strong>ein</strong> berechtigtes Interesse an der Kennzeichnung <strong>von</strong> Lebensmitteln<br />
hinsichtlich ihrer regionalen Herkunft. Mit der geografischen Herkunftsangabe geht oftmals <strong>ein</strong>e<br />
bestimmte Verbrauchererwartung an <strong>ein</strong> so gekennzeichnetes Produkt <strong>ein</strong>her. Das dem<br />
Interesse des Verbrauchers zugrunde liegende Bedürfnis zu erfahren, woher <strong>ein</strong> Lebensmittel<br />
stammt, unterscheidet sich jedoch maßgeblich <strong>von</strong> der Intention der Zeichennutzer. Mit <strong>ein</strong>er<br />
bestimmten regionalen Herkunft symbiotisch verknüpft ist <strong>ein</strong>e bestimmte Erwartung des<br />
Nutzers (Verbraucher) an <strong>ein</strong> so gekennzeichnetes Lebensmittel. Dies kann <strong>ein</strong>erseits aus der<br />
besonderen Affinität des Einzelnen zu <strong>ein</strong>er bestimmten Region herrühren und/oder aus der<br />
Erwartungshaltung resultieren, dass mit <strong>ein</strong>er bestimmten regionalen Herkunft auch besondere<br />
Eigenschaften hinsichtlich der Güte oder der spezifischen Eigenschaften der so<br />
gekennzeichneten Produkte <strong>ein</strong>hergeht. Dies hat häufig s<strong>ein</strong>en Grund darin, dass die dem<br />
Lebensmittel zugeschriebenen charakteristischen Eigenschaften, der Gegend oder der in dieser<br />
Region gebräuchlichen Art und Weise der Herstellung, der kulinarischen Tradition oder der<br />
regionalen Rezeptur zugeschrieben werden. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang<br />
beim W<strong>ein</strong>, dessen Güte und Beschaffenheit erheblich <strong>von</strong> der Bodenbeschaffenheit sowie den<br />
örtlichen klimatischen Bedingungen abhängig ist (Haß 1980, S. 87). Das vorhandene Angebot<br />
kann durch die Regionalkennzeichnung <strong>für</strong> den Nutzer (Verbraucher) transparenter werden,<br />
weil ihm <strong>ein</strong> weiteres Entscheidungskriterium an die Hand gegeben wird, das ihm erlaubt, die<br />
teils unüberschaubare Angebotsvielfalt zu „individualisieren“ (vgl. Brethauer o. J.). Es ist ihm<br />
somit möglich, die Gattung des gewünschten Lebensmittels weiter - anhand der durch die<br />
regionale Aussage implizierten Eigenschaften - zu konkretisieren und somit <strong>ein</strong>e Auswahl zu<br />
treffen, die s<strong>ein</strong>en individuellen Präferenzen entspricht. Hierin, so Grube, „liegt der eigentliche<br />
Wert geografischer Herkunftsangaben, der häufig unterschätzt wird“ (Grube 2011, S. 1). Hiermit<br />
wird vor allem das Ziel verfolgt, dem Verbraucher die Zuordnung <strong>ein</strong>es Lebensmittels zu <strong>ein</strong>er<br />
bestimmten Region zu vermitteln. Für den Verbraucher ist die regionale Herkunft <strong>ein</strong>es<br />
Produkts vor allem <strong>ein</strong>e wichtige Information, weil sie auch <strong>ein</strong> wichtiges Kriterium <strong>für</strong> die<br />
Kaufentscheidung darstellt (Nestlé Deutschland AG 2011, S. 96).<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 55
Den Verwendern dient die Regionalkennzeichnung vorwiegend als Marketinginstrument im<br />
Rahmen der Absatzförderung (Kopp 2009, S. 19 f.). Bei den Verwendern handelt es sich nicht<br />
um <strong>ein</strong>e homogene Gruppe. Vielmehr sind zwei Gruppen auszumachen, deren Intentionen<br />
hinsichtlich der regionalen Kennzeichnung teils diametral entgegenstehen: Zum <strong>ein</strong>en sind hier<br />
die Lebensmittelindustrie und der Lebensmittelhandel, zum anderen die Direktvermarkter und<br />
Regionalinitiativen zu nennen. Während Erstere insbesondere <strong>ein</strong> Interesse daran haben,<br />
möglichst viele Produkte (insbesondere auch verarbeitete Lebensmittel) regional ausloben zu<br />
können, haben Letztere <strong>ein</strong> Interesse daran, den Anwendungsbereich der Regionalkennzeichnung<br />
(insbesondere im Hinblick auf die Produktionstiefe der Produkte) möglichst<br />
schmal zu halten. Die hier zum Ausdruck kommenden unterschiedlichen Auffassungen der<br />
Verwender regionaler Aussagen darüber, welche <strong>Kriterien</strong> der Regionalkennzeichnung<br />
zugrunde gelegt werden, gepaart mit dem großen Spielraum, den die nationalen- und<br />
europäischen Normierungen in diesem Bereich ermöglichen, birgt gleichsam die Gefahr der<br />
Irreführung des Verbrauchers, „insbesondere, wenn Marketing oder staatliche Absatzförderung<br />
<strong>ein</strong>e Korrelation zwischen der Herkunft und der besonderen Qualität <strong>ein</strong>es Produktes herstellen,<br />
dieser Zusammenhang aber tatsächlich nicht nachweisbar ist“ (Brethauer o. J.)<br />
Diese rudimentäre Darstellung der Interessen der Marktteilnehmer zeigt, dass sich die<br />
Interessen, die an <strong>ein</strong>e regionale Kennzeichnung gestellt werden in Teilbereichen decken,<br />
andererseits aber auch stark <strong>von</strong><strong>ein</strong>ander abweichen können.<br />
Dem Verwender <strong>ein</strong>er regionalen Kennzeichnung steht somit <strong>ein</strong> weiter Rahmen zur Verfügung,<br />
innerhalb dessen die Regionalkennzeichnung zulässig ist.<br />
Ziel dieser Darstellung soll es zunächst s<strong>ein</strong>, aufzuzeigen, welche Aussagen im Rahmen <strong>ein</strong>er<br />
Regionalkennzeichnung schützfähig sind und welche nicht. Dies bedarf zunächst der<br />
Darstellung der bestehenden Gesetzessystematik, um gewährleisten zu können, dass es nicht<br />
zu Überschneidungen kommt. Im Hinblick auf <strong>ein</strong>e privat- oder öffentlich-rechtliche<br />
Ausgestaltung <strong>ein</strong>es „bundesweiten und freiwilligen Regionalsiegels“ muss der Bereich der<br />
staatlichen Absatzförderung erörtert werden.<br />
Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass trotz der unterschiedlichen Interessen der<br />
beteiligten Marktakteure, allgem<strong>ein</strong> <strong>ein</strong> Bedürfnis nach Transparenz im Rahmen der<br />
Regionalkennzeichnung besteht.<br />
6.2 Rechtlicher Rahmen<br />
Die Herkunftskennzeichnung wird durch diverse nationale und europäische Normen reguliert<br />
und kann dabei obligatorisch oder fakultativ ausgestaltet s<strong>ein</strong>.<br />
6.2.1 Obligatorische- und fakultative Herkunftskennzeichnung<br />
Herkunftsangaben finden sich in zweierlei Gestalt: zum <strong>ein</strong>en die obligatorische und zum<br />
anderen die fakultative Herkunftskennzeichnung. Bei bestimmten Produkten ist <strong>ein</strong>e<br />
Herkunftskennzeichnung verpflichtend. So muss zum Beispiel bei Rindfleisch und bei Honig das<br />
Herkunftsland angegeben werden. Diese verpflichtenden Herkunftsangaben dienen jeweils<br />
<strong>ein</strong>em spezifischen Ziel, das <strong>ein</strong>e obligatorische Kennzeichnung rechtfertigt.<br />
So ist beispielsweise bei der Pflichtangabe des Herkunftslandes bei der Rindfleischetikettierung<br />
die Rückgewinnung des Verbrauchervertrauens in die Qualität <strong>von</strong> Rindfleisch Ziel dieser<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 56
Verpflichtung. Hierdurch soll <strong>für</strong> jedermann die Herkunft des Rindfleisches transparent gemacht<br />
werden. So verweist die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 in Erwägungsgrund vier auf<br />
Folgendes: „Um das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität <strong>von</strong> Rindfleisch zu erhalten und<br />
zu stärken und um Irreführungen der Verbraucher zu vermeiden, muss der Rahmen entwickelt<br />
werden, in dem die Verbraucher durch <strong>ein</strong>e angemessene und klare Etikettierung des<br />
Erzeugnisses informiert werden.“ Die Rindfleischetikettierungs-Richtlinie (RL 2000/13/EG)<br />
verweist in Erwägungsgrund sechs darauf, dass jede Regelung der Etikettierung <strong>von</strong><br />
Lebensmitteln vor allem der Unterrichtung und dem Schutz der Verbraucher dienen soll. In<br />
Erwägungsgrund acht heißt es: „Eine detaillierte Etikettierung, die Auskunft gibt über die<br />
genaue Art und die Merkmale des Erzeugnisses, ermöglicht es dem Verbraucher, sachkundig<br />
s<strong>ein</strong>e Wahl zu treffen, und ist insofern am zweckmäßigsten, als sie die geringsten<br />
Handelshemmnisse nach sich zieht.“ Die Vorgaben der Rindfleischetikettierungsrichtlinie<br />
wurden vom deutschen Gesetzgeber in das Rindfleischetikettierungsgesetz transformiert.<br />
Bei Honig ist ebenfalls die obligatorische Angabe des Herkunftslandes vorgeschrieben. So heißt<br />
es im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 2001/110/EG: „Im Anbetracht des engen<br />
Zusammenhangs zwischen der Qualität des Honigs und s<strong>ein</strong>er Herkunft ist unbedingt<br />
sicherzustellen, dass vollständige Informationen zu diesen Aspekten gegeben werden, damit<br />
der Verbraucher nicht über die Qualität des Erzeugnisses irregeführt wird. Damit den<br />
besonderen Interessen der Verbraucher bezüglich der geografischen Merkmale <strong>von</strong> Honig<br />
Rechnung getragen wird, und <strong>ein</strong>e vollständige Transparenz in dieser Hinsicht sichergestellt ist,<br />
ist es erforderlich, dass das Ursprungsland, in dem der Honig erzeugt wurde, auf dem Etikett<br />
angegeben wird.“<br />
Eine ebenso große Rolle, als Beispiel <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e obligatorische Angabe des Ursprungs der<br />
Erzeugung, spielt die EU-Verordnung 1182/2007 <strong>für</strong> den Obst- und Gemüsesektor.<br />
Durch die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung) werden<br />
möglicherweise weitere Herkunftskennzeichnungen <strong>von</strong> Lebensmitteln verpflichtend (vgl. Art.<br />
26).<br />
Neben den obligatorischen gibt es fakultative Herkunftskennzeichnungen, deren Verwendung<br />
freiwillig ist. Im Falle der fakultativen Herkunftskennzeichnung sind seitens des Verwenders<br />
indes die allgem<strong>ein</strong>en rechtlichen nationalen- und gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Vorgaben zu<br />
beachten.<br />
6.2.2 Nationale und gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Schutzsysteme<br />
Der Schutz der geografischen Herkunftsangaben wird durch verschiedene Normierungen auf<br />
nationaler und europäischer Ebene gewährleistet.<br />
Nationales Schutzsystem<br />
Der Schutz der geografischen Herkunftsangaben und Qualitätszeichen <strong>für</strong> Lebensmittel im<br />
deutschen Rechtssystem findet sich zum <strong>ein</strong>en im Gesetz über den Schutz <strong>von</strong> Marken und<br />
sonstigen Kennzeichen (MarkenG) sowie im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)<br />
sowie im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und<br />
Futtermittelgesetzbuch - LFGB). Darüber hinaus finden die europäischen Verordnungen, die<br />
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen <strong>für</strong> Agrarerzeugnisse und Lebensmittel<br />
in der Bundesrepublik Deutschland betreffen, unmittelbare Anwendung.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 57
Diese gesetzlichen Bestimmungen geben - neben den gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Normierungen<br />
- den Rahmen vor, innerhalb dessen <strong>ein</strong>e fakultative Herkunftskennzeichnung zulässig ist.<br />
Markengesetz<br />
Das MarkenG bietet <strong>ein</strong>en umfassenden Schutz <strong>für</strong> den Bereich der geografischen<br />
Herkunftsangaben im wettbewerbsrechtlichen Bereich. Geregelt ist dieser<br />
wettbewerbsrechtliche Schutz in den §§ 126 bis 129 MarkenG. Ergänzend hierzu treten die §§<br />
130 bis 136 MarkenG, die den Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen<br />
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 regeln (hierzu siehe unten).<br />
Durch die Regelung des Markengesetzes, die die geografischen Herkunftsangaben betreffen,<br />
wird vor allem der Schutz vor Irreführungen über die Herkunft <strong>ein</strong>er Ware oder Dienstleistung<br />
statuiert (Kopp 2009, S. 66).<br />
Das MarkenG unterscheidet dabei zwischen <strong>ein</strong>fachen und qualifizierten Herkunftsangaben. Bei<br />
<strong>ein</strong>fachen Herkunftsangaben gemäß § 127 Abs. 1 MarkenG handelt es sich um solche, die<br />
lediglich auf die Herkunft des Lebensmittels abstellen, mit dieser aber nicht <strong>ein</strong>e bestimmte<br />
Qualitätserwartung verknüpfen. Dies ist jedoch bei qualifizierten Herkunftsangaben der Fall<br />
(Kopp 2009, S. 68). So ist zum Beispiel der geografische Bezeichnungsschutz (g.g.A. und g.U.)<br />
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 <strong>ein</strong>e qualifizierte Herkunftsangabe. Der Europäische<br />
Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass nur qualifizierte<br />
Herkunftsangaben unter die Definition des Art. 2 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EWG) Nr.<br />
2081/92 (diese Verordnung wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 abgelöst) fallen.<br />
Dies hat zu Folge, dass <strong>ein</strong>fache Herkunftsangaben nicht unter das Gem<strong>ein</strong>schaftsrecht fallen<br />
und somit im Schutzsystem des nationalen Gesetzgebers verbleiben (EuGH, GRUR Int. 2001,<br />
S. 51 ff).<br />
Der Schutz der geografischen Herkunftsangaben durch das MarkenG ist <strong>ein</strong> unmittelbarer<br />
wettbewerbsrechtlicher Schutz (Knaak 1995, S. 103). Folglich wird hierdurch die Lauterkeit des<br />
Wettbewerbs geschützt. Die Verwendung (<strong>ein</strong>facher und qualifizierter) geografischer<br />
Herkunftsangaben richtet sich dabei nach den Vorgaben der §§ 126 ff. MarkenG. Unter <strong>ein</strong>er<br />
geografischen Herkunftsangabe versteht man dabei die Verwendung <strong>von</strong> Orten, Gegenden,<br />
Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr<br />
zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft <strong>von</strong> Waren oder Dienstleistungen benutzt<br />
werden. Was hierunter im Einzelnen zu verstehen ist, besagt das Gesetz nicht. Insoweit ist es<br />
<strong>ein</strong>e Einzelfallentscheidung, ob <strong>ein</strong>e bestimmte geografische Herkunftsangabe korrekt ist. Die<br />
Verwendung <strong>ein</strong>er geografischen Herkunftsangabe darf gemäß § 127 zudem nicht irreführend<br />
s<strong>ein</strong>. Das MarkenG stellt somit auf die Verwendung <strong>ein</strong>er Aussage zur geografischen Herkunft<br />
ab, ohne dabei Aussagen zu weiteren <strong>Kriterien</strong>, wie etwa der Produktionstiefe zu liefern.<br />
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)<br />
Nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG kann derjenige auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch<br />
genommen werden, der im geschäftlichen Verkehr zum Zwecke des Wettbewerbs über<br />
Ursprung oder Herkunft der Ware irreführende Angaben macht. In Bezug auf das MarkenG sind<br />
die Regelungen des UWG jedoch subsidiär (BGH Grur 1999, S. 252).<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 58
Irreführungsverbot, § 11 LFGB<br />
Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 LFGB ist es verboten, Lebensmittel unter irreführender Bezeichnung,<br />
Angabe oder Aufmachung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen oder <strong>für</strong> Lebensmittel<br />
allgem<strong>ein</strong> oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen Aussagen zu<br />
werben. In § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird diese sogenannte Generalklausel noch weiter<br />
konkretisiert. Hiernach liegt <strong>ein</strong>e Irreführung insbesondere dann vor, wenn „bei <strong>ein</strong>em<br />
Lebensmittel zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen,<br />
Darstellungen oder sonstige Aussagen über Eigenschaften, insbesondere über Art,<br />
Beschaffenheit, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprung, Herkunft oder Art der<br />
Herstellung oder Gewinnung verwendet werden“. Somit sind Herkunftsangaben grundsätzlich<br />
geeignet, den Verbraucher in die Irre zu führen.<br />
„Eine Irreführung liegt - genauso wie im Wettbewerbsrecht - vor, wenn bei den angesprochenen<br />
Verkehrskreisen aufgrund der Aufmachung <strong>ein</strong>es Lebensmittels oder der hier<strong>für</strong> geschalteten<br />
Werbung falsche Vorstellungen über die tatsächlichen Verhältnisse hervorgerufen werden.<br />
Dass es tatsächlich zu <strong>ein</strong>er Täuschung kommt, ist nicht erforderlich. Bereits die Möglichkeit<br />
<strong>ein</strong>er Täuschung reicht aus“ (Str<strong>ein</strong>z 2011, Rn. 428). Mit der Herkunftsangabe wird<br />
verbraucherseitig oftmals <strong>ein</strong>e besondere Qualität, zumindest aber <strong>ein</strong>e spezielle<br />
Wertschätzung verbunden, sodass nicht korrekte Herkunftsangaben irreführend s<strong>ein</strong> können<br />
(Rathke 2011, § 11 LFGB, Rn. 120). Das Irreführungsverbot (§ 11 LFGB) zielt auf den Schutz<br />
der Verbraucher vor Täuschungen ab, denen er vor und beim Erwerb <strong>von</strong> Lebensmitteln in<br />
mannigfacher Weise ausgesetzt s<strong>ein</strong> kann (Leible in Str<strong>ein</strong>z 2011, Rn. 424).<br />
Die Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung (Aussage) <strong>ein</strong>es Lebensmittels ist also dann<br />
irreführend, wenn die Ist- mit der Sollbeschaffenheit nicht über<strong>ein</strong>stimmt. Um jedoch bestimmen<br />
zu können, wann <strong>ein</strong>e solche Irreführung vorliegt, muss zunächst bestimmt werden, ob die<br />
angesprochenen Verkehrskreise durch diese Aussagen falsche Vorstellungen über die<br />
tatsächlichen Verhältnisse hervorgerufen werden können (Leible in Str<strong>ein</strong>z 2011, Rn. 428). Von<br />
maßgeblicher Bedeutung ist hier das zugrunde zu legende Verbraucherleitbild. Je nachdem,<br />
welche Anforderungen an den Verbraucher gestellt werden, desto unterschiedlicher fällt die<br />
Bewertung aus, wann im Einzelfall falsche Vorstellungen hervorgerufen werden können.<br />
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass § 11 LFGB auf der Richtlinie 2000/13/EG<br />
(Etikettierungsrichtlinie) beruht und somit das Verbraucherleitbild gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlich<br />
auszulegen ist. Der EuGH definierte in <strong>ein</strong>em Urteil den Verbraucher als „durchschnittlich<br />
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ (EuGH, ZLR 1998,<br />
S. 459).<br />
Dem flüchtigen Durchschnittsverbraucher, <strong>von</strong> dem das deutsche Recht bis dato ausging, ist<br />
hiermit <strong>ein</strong>e Absage erteilt worden. Dem Verbraucher wird nunmehr <strong>ein</strong>iges zugetraut. Er muss<br />
folglich nicht mehr vor sich selbst beschützt werden. Vielmehr wird ihm <strong>ein</strong>e hohe<br />
Beurteilungskompetenz attestiert. Durch geeignete Informationen auf der Etikettierung oder in<br />
der Werbung ist er in <strong>ein</strong>em gewissen Rahmen selbst in der Lage, zu beurteilen, ob die<br />
Angaben, Bezeichnungen oder Aufmachungen stimmig sind und ob die Ist- mit der<br />
Sollbeschaffenheit über<strong>ein</strong>stimmt.<br />
Zusammenfassung<br />
Das nationale Recht gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen die Verwendung geografischer<br />
Herkunftsangaben geregelt wird. Es zielt dabei vorwiegend auf den Schutz der Lauterkeit des<br />
Handelsverkehrs sowie auf den Schutz vor Irreführung bei der Verwendung <strong>von</strong><br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 59
Herkunftsaussagen ab. <strong>Kriterien</strong>, anhand derer sich bestimmen ließe, was <strong>ein</strong> Lebensmittel<br />
erfüllen muss, um als „regional“ zu gelten, werden nicht getätigt. Es bleibt bei den allgem<strong>ein</strong>en<br />
Vorgaben des § 126 MarkenG, die auf den Ort, die Gegend, das Gebiet oder das Land<br />
abstellen. Hiermit werden indes k<strong>ein</strong>e Vorgaben gemacht, ob zum Beispiel die Zutaten <strong>ein</strong>es<br />
Lebensmittels aus dem benannten geografischen Gebiet stammen müssen.<br />
6.2.3 Gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliches Schutzsystem<br />
Auch auf Gem<strong>ein</strong>schaftsebene finden sich Vorschriften, die dem Schutz der geografischen<br />
Herkunftsangabe dienen. Hier sind insbesondere die allgem<strong>ein</strong>e Verordnung (Verordnung (EG)<br />
Nr. 510/2006 - vormals Verordnung (EG) Nr. 2081/92) sowie die produktspezifischen<br />
Verordnungen (Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, Verordnung (EWG) Nr. 1576/88) <strong>für</strong> den<br />
Schutz geografischer Angaben in den Bereichen Lebensmittel, W<strong>ein</strong> und Spirituosen zu<br />
nennen.<br />
Von besonderer Bedeutung <strong>für</strong> die vorliegende Begutachtung ist die Verordnung (EG) Nr.<br />
510/2006 zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen <strong>für</strong><br />
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Hiernach sind „bestimmte geografische Namen<br />
bestimmten Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln vorbehalten“ (Kopp 2009, S. 106). Sie bildet<br />
dabei <strong>ein</strong> gem<strong>ein</strong>schaftsweites Schutzsystem <strong>für</strong> <strong>ein</strong>en Teilbereich der geografischen<br />
Herkunftsangaben. Es gibt zwei verschiedene Gem<strong>ein</strong>schaftszeichen, die die Verwendung<br />
geografischer Herkunftsangaben regeln:<br />
Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.): Die geschützte Ursprungsbezeichnung sagt aus,<br />
dass dieses Lebensmittel in <strong>ein</strong>em abgegrenzten geografischen Gebiet erzeugt und<br />
hergestellt wurde (z. B. Allgäuer Bergkäse, Parmaschinken, Mozarella di Bufala).<br />
Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) Voraussetzung zum Führen des g.g.A. Zeichens ist,<br />
dass das Lebensmittel in mindestens <strong>ein</strong>er s<strong>ein</strong>er Produktionsstufen in dem bezeichneten<br />
Herkunftsgebiet erzeugt, hergestellt oder verarbeitet wurde (z. B. Münchner Bier, Tiroler<br />
Speck, Schwarzwälder Schinken).<br />
„Das Schutzsystem reserviert die Verwendung <strong>von</strong> Ursprungsbezeichnungen und<br />
geografischen Angaben ausschließlich <strong>für</strong> solche Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die im<br />
definierten geografischen Gebiet unter bestimmten, <strong>von</strong> den Erzeugern im Eintragungsantrag<br />
beschriebenen Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Herstellungsbedingungen erzeugt und<br />
verarbeitet werden“ (Grube 2011, S. 10).<br />
Bei den geografischen Herkunftsangaben nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 handelt es<br />
sich um qualifizierte Herkunftsangaben. Denn die Qualität - und somit die besondere<br />
Schutzwürdigkeit - beruht hier auf der Annahme, dass die Qualität bestimmter<br />
Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel auf die Besonderheiten <strong>ein</strong>es genau abgegrenzten<br />
geografischen Gebietes zurückzuführen ist (vgl. hierzu den fünften Erwägungsgrund der<br />
Verordnung (EG) Nr. 510/2006).<br />
Die Eintragung <strong>ein</strong>es Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels in das entsprechende Register<br />
führt zu <strong>ein</strong>er „Sperrung“ dieses Namens <strong>für</strong> Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die die<br />
betreffende Spezifikation nicht erfüllen. Jedoch kann jeder Marktteilnehmer den <strong>ein</strong>getragenen<br />
Namen verwenden, sofern die <strong>von</strong> ihm vermarkteten Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel den<br />
betreffenden Spezifikationen entsprechen (vgl. Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006).<br />
Dies führt zu <strong>ein</strong>em umfassenden Schutz der <strong>ein</strong>getragenen Bezeichnungen. Der<br />
Kennzeichenschutz durch dieses System schließt somit <strong>ein</strong>e nationale Regelung aus.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 60
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 führt aus, was unter „Ursprungsbezeichnung“ und<br />
„geografischer Angabe“ zu verstehen ist:<br />
1. „Ursprungsangabe“ (bedeutet) den Namen <strong>ein</strong>er Gegend, <strong>ein</strong>es bestimmten Ortes oder in<br />
Ausnahmefällen <strong>ein</strong>es Landes, der zur Bezeichnung <strong>ein</strong>es Agrarerzeugnisses oder <strong>ein</strong>es<br />
Lebensmittels dient,<br />
das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort oder diesem Land stammt,<br />
das s<strong>ein</strong>e Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen<br />
Verhältnissen <strong>ein</strong>schließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und<br />
das in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erzeugt, verarbeitet oder hergestellt<br />
wurde;<br />
2. „geografische Angabe“ (bedeutet) den Namen <strong>ein</strong>er Gegend, <strong>ein</strong>es bestimmten Ortes oder<br />
in Ausnahmefällen <strong>ein</strong>es Landes, der zur Bezeichnung <strong>ein</strong>es Agrarerzeugnisses oder<br />
Lebensmittels dient,<br />
das aus dieser Gegend, diesem Ort oder diesem Land stammt und<br />
bei dem sich <strong>ein</strong>e bestimmte Qualität, das Ansehen oder <strong>ein</strong>e andere Eigenschaft aus<br />
diesem geografischen Ursprung ergibt und<br />
das in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erzeugt und/oder verarbeitet und/oder<br />
hergestellt wurde.<br />
Auch die gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Regelung weist k<strong>ein</strong>e dezidierten <strong>Kriterien</strong> auf; sie bleibt<br />
insoweit eher allgem<strong>ein</strong>.<br />
Erwähnung finden soll noch die „garantiert traditionelle Spezialität“ (g.t.S.) gemäß der<br />
Verordnung (EG) Nr. 509/2006. Hierbei handelt es sich nicht um <strong>ein</strong>e Herkunftsbezeichnung<br />
wie die „geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.) und die „geschützte Ursprungsbezeichnung“<br />
(g.U.) sondern um <strong>ein</strong>e Kennzeichnung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> traditionelles Agrarerzeugnis oder Lebensmittel,<br />
dessen besondere Merkmale <strong>von</strong> der Gem<strong>ein</strong>schaft durch Eintragung entsprechend dieser<br />
Verordnung anerkannt worden sind.<br />
Verhältnis des nationalen zum gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Schutz<br />
Das Verhältnis zum nationalen Schutzsystem ist weder in der Verordnung (EG) Nr. 510/2006<br />
noch in zweiseitigen Abkommen geregelt. Festhalten lässt sich hier, dass <strong>ein</strong>e geografische<br />
Bezeichnung, die nach der Verordnung registriert und geschützt ist, darüber hinaus nicht<br />
zusätzlich durch nationale Schutzsysteme geschützt wird. Das nationale Recht tritt in diesem<br />
Fall hinter das europäische Recht zurück (EuGH Grur Int. 1999, 443 Rn. 18; Grur Int. 2003, 543<br />
(545): Nach dem Grundsatz des Geltungsvorranges können Bestimmungen des<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsrechts durch nationales Recht nicht abgeändert oder aufgehoben werden. Im<br />
Kollisionsfall mit nationalem Recht geht das Gem<strong>ein</strong>schaftsrecht - dem Grundsatz des<br />
Anwendungsvorrangs folgend - diesem vor. Ist der Anwendungsbereich der Verordnung (EG)<br />
Nr. 510/2006 eröffnet, ist die Regelung abschließend; <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e nationale Sonderregelung bleibt<br />
dann k<strong>ein</strong> Raum mehr. Diesbezüglich hat der EuGH entschieden, dass <strong>ein</strong>fache<br />
Herkunftsangaben nicht unter das Gem<strong>ein</strong>schaftsrecht fallen und somit im nationalen<br />
Schutzsystem verbleiben (EuGH Grur Int. 2001, S. 51ff).<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 61
Zusammenfassung der Schutzsysteme<br />
Nach der Darstellung der nationalen- und gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Schutzsysteme bedarf es<br />
noch der Klärung der Frage, welche Rechtsgüter hierdurch geschützt werden sollen, um im<br />
Anschluss hieran die Frage beantworten zu können, ob und inwieweit <strong>ein</strong> freiwilliges<br />
<strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel sich in dieses Schutzsystem <strong>ein</strong>fügen lässt und ob hierdurch<br />
nicht sogar die verschiedenen Rechtsgüter noch besser geschützt werden können.<br />
Auf nationaler Ebene geht es vorwiegend um den Schutz vor Irreführung, ergänzt durch den<br />
Schutz der Lauterkeit des Handelsverkehrs sowohl <strong>für</strong> <strong>ein</strong>fache als auch <strong>für</strong> qualifizierte<br />
Herkunftsangaben. Das gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Schutzsystem zielt auf den Schutz<br />
<strong>ein</strong>getragener Bezeichnungen ab, behält aber s<strong>ein</strong>en Schutz den qualifizierten<br />
Herkunftsangaben beziehungsweise Ursprungsbezeichnungen vor (Kopp 2009, S. 126).<br />
Die nationalen als auch die gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Schutzsysteme gewähren primär <strong>ein</strong>en<br />
Schutz vor Irreführung und <strong>ein</strong>en wettbewerbsrechtlichen Schutz. Dabei geben sie nur<br />
begrenzte Vorgaben hinsichtlich der Frage, welche Anforderungen an <strong>ein</strong> Lebensmittel bei<br />
Angabe <strong>ein</strong>er geografischen Herkunftsangabe oder Ursprungsbezeichnung zu stellen sind.<br />
Insbesondere verbleibt <strong>für</strong> den Bereich der <strong>ein</strong>fachen geografischen Herkunftsangabe die<br />
Möglichkeit <strong>ein</strong>er nationalstaatlichen Regelung. Diese kann privat- oder aber auch öffentlichrechtlich<br />
ausgestaltet s<strong>ein</strong>. Für letzteren Bereich ist jedoch die Problematik der staatlichen<br />
Absatzförderung, insbesondere im Hinblick auf die Ver<strong>ein</strong>barkeit mit der<br />
Warenverkehrsfreiheit, zu beachten.<br />
6.2.4 Staatliche Absatzförderung<br />
Schließlich ist noch der Bereich der Auswirkungen der staatlichen Absatzförderung auf <strong>ein</strong><br />
<strong>bundesweites</strong> freiwilliges Regionalsiegel zu untersuchen. Dies insbesondere im Hinblick auf<br />
dessen privat- oder öffentlich-rechtliche Ausgestaltung.<br />
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen der herkunftsbezogenen<br />
Kennzeichnung <strong>ein</strong>es dem Staat zuzuordnenden Zeichens <strong>ein</strong>erseits und die<br />
Verwendung regionaler Aussagen durch private Institutionen. Label bzw. Siegel, die Aussagen<br />
zur geografischen Herkunft tätigen, unterliegen, sofern sie zweifelsfrei dem Staat zugeordnet<br />
werden und somit <strong>für</strong> die nationalen Produkte absatzfördernd wirken können, den Vorgaben<br />
des EU-Vertrages, insbesondere im Hinblick auf die Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 AEUV).<br />
Zeichen hingegen, die <strong>von</strong> Privatrechtssubjekten, die autark vom Staat tätig werden, verwendet<br />
werden, unterfallen nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der Vorschriften über die<br />
Warenverkehrsfreiheit.<br />
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte im Jahre 2002 in der Rechtssache „CMA-<br />
Gütezeichen“ (EuGH, NJW 2002, 3609), dass <strong>ein</strong> staatliches Qualitätszeichen, bei dem der<br />
Hinweis auf die Qualität mit der Herkunft aus <strong>ein</strong>em bestimmten Mitgliedstaat verbunden war,<br />
unver<strong>ein</strong>bar mit der Warenverkehrsfreiheit sei, die Gütezeichenwerbung „Markenqualität aus<br />
deutschen Landen“ sei <strong>ein</strong>e öffentliche Vermarktungshilfe und untersagte diese aufgrund<br />
fehlender spezifischer Qualitätsnormen. In der Folge wurden entsprechende Zeichen der<br />
deutschen Bundesländer diesem Urteil angepasst.<br />
In der Einleitung der Gem<strong>ein</strong>schaftsleitlinien <strong>für</strong> staatliche Beihilfen zur Werbung <strong>für</strong> in Anhang I<br />
des EG-Vertrages genannte Erzeugnisse und bestimmte nicht in Anhang I genannte<br />
Erzeugnisse (siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:252:<br />
0005:0014:DE:PDF, zuletzt abgerufen am 30.11.2011) wird festgestellt, dass sich in fast allen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 62
Mitgliedstaaten die öffentliche Hand an der Finanzierung und Förderung des Absatzes und der<br />
Werbung <strong>für</strong> die entsprechenden Produkte beteiligt. Diese sind dann zulässig, wenn sie<br />
bestimmte <strong>Kriterien</strong> erfüllen und <strong>von</strong> der Kommission be<strong>für</strong>wortet werden.<br />
Für die <strong>Entwicklung</strong> der <strong>Kriterien</strong> <strong>ein</strong>es freiwilligen nationalen Regionalsiegels bedeutet dies,<br />
dass <strong>ein</strong> staatliches Zeichen diesen Anforderungen genügen muss und auch das<br />
Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen muss. Dabei muss darauf geachtet werden,<br />
dass die Ausgestaltung des Zeichens mit der Warenverkehrsfreiheit im Einklang steht. Ein<br />
(privates) Zeichen, das zweifelsfrei dem Staat nicht zugeordnet werden kann, unterfällt<br />
hingegen nicht den Vorschriften über die Warenverkehrsfreiheit. Im Hinblick auf <strong>ein</strong><br />
<strong>bundesweites</strong> freiwilliges Regionalsiegel hat dies zur Folge, dass die privatrechtliche<br />
Ausgestaltung weniger Hürden zu überwinden hätte als <strong>ein</strong>e entsprechende öffentlich-rechtlich<br />
verankerte Ausgestaltung. Denn <strong>ein</strong> privatrechtlich organisiertes Siegel müsste nicht das<br />
Genehmigungsverfahren durch Institutionen der EU durchlaufen, da es <strong>von</strong> der Problematik der<br />
staatlichen Absatzförderung nicht betroffen ist.<br />
Zusammenfassung<br />
Die nationalen und die gem<strong>ein</strong>schaftsrechtlichen Schutzsysteme geben den Rahmen vor, die<br />
<strong>ein</strong> „<strong>bundesweites</strong> und freiwilliges Regionalsiegel“ zu beachten hat. Die Ausgestaltung ist in<br />
privater, aber auch in öffentlich-rechtlicher Form möglich. Im letzteren Fall hat der nationale<br />
Gesetzgeber jedoch die Vorgaben der Warenverkehrsfreiheit zu beachten.<br />
Rechtliche Vorgaben, die <strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitliche Herkunftsangabe vorschreiben, existieren nur in<br />
Teilbereichen. Zudem wird die Herkunftskennzeichnung - so sie denn überhaupt rechtlich<br />
normiert ist - sowohl durch das gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche als auch das nationalstaatliche Recht<br />
normiert. Was unter <strong>ein</strong>em regionalen Lebensmittel genau zu verstehen ist, ergibt sich dabei<br />
jedoch nicht explizit aus dem nationalen und europäischen Normengefüge. <strong>Kriterien</strong> anhand<br />
derer sich bestimmen lässt, wann <strong>ein</strong> Lebensmittel regional ist und wann nicht, sind nur <strong>für</strong><br />
bestimmte Bereiche (g.g.A., g.U.) festgelegt. Außerhalb dieses rechtlich geschützten<br />
Bereiches gelten indes die allgem<strong>ein</strong>en rechtlichen Vorgaben, zum Beispiel aus dem<br />
Lebensmittelrecht und dem Wettbewerbsrecht. Die Schutzsysteme zielen dabei primär auf den<br />
Schutz vor Irreführung, der Lauterkeit des Handelsverkehrs sowie auf <strong>ein</strong>en<br />
kennzeichenrechtlichen Schutz ab. Vor dem Hintergrund der divergierenden Interessen der<br />
Marktakteure sowie deren unterschiedliche Sichtweise, wie der Begriff der Region zu<br />
verstehen ist, kann <strong>ein</strong> „<strong>bundesweites</strong> und freiwilliges Regionalsiegel“ s<strong>ein</strong>en Beitrag dazu<br />
leisten, Transparenz zu schaffen. Dies kann in <strong>ein</strong>er Festlegung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> s<strong>ein</strong>, die den<br />
Begriff der Region genauer spezifizieren, aber auch in der transparenten Kommunikation<br />
dessen, was der Verwender unter dem Begriff der Region, den er verwendet, versteht.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 63
6.3 Zeichenvergabe<br />
6.3.1 Vorbemerkung<br />
Im folgenden Text werden die Begrifflichkeiten Kontrolle, Zertifizierung,<br />
Zulassung/Genehmigung sowie Akkreditierung verwendet. Nachfolgende Definitionen dienen<br />
der Klarstellung, was mit diesen Begrifflichkeiten im Rahmen des Gutachtens gem<strong>ein</strong>t ist.<br />
Kontrolle<br />
Überprüfung <strong>von</strong> Betrieben sowie ggf. Unterauftragnehmern und/oder Lieferanten. Die Kontrolle<br />
umfasst in der Regel auch Inspektionen in <strong>ein</strong>em definierten zeitlichen Rhythmus. Ergebnis der<br />
Kontrolle ist <strong>ein</strong> Bericht, in dem der Kontrolleur die während des Kontrollbesuches festgestellten<br />
Sachverhalte dokumentiert. Die Kontrolle wird in der Regel durch <strong>ein</strong>e Kontrollstelle<br />
durchgeführt.<br />
Zertifizierung (oder Konformitätsbewertung)<br />
Bewertung der Einhaltung bestimmter privater oder gesetzlicher Vorschriften durch <strong>ein</strong><br />
Unternehmen/<strong>ein</strong>en Betrieb. Die Zertifizierung erfolgt in der Regel auf Grundlage der im<br />
Kontrollbereich dokumentierten Sachverhalte. Das Unternehmen/der Betrieb erhält <strong>ein</strong><br />
Zertifikat, welches ihn berechtigt, <strong>ein</strong>e Marke oder <strong>ein</strong> Zeichen zu verwenden. Das Zertifikat<br />
kann sich auf <strong>ein</strong> Unternehmen/<strong>ein</strong>en Betrieb oder nur auf bestimmte Betriebsbereiche oder<br />
Produkte beziehen. Die Zertifizierung wird in der Regel vom Zeichen-/Markeninhaber<br />
(Zertifizierungsstelle) durchgeführt. Die Zertifizierungsstelle kann auch <strong>ein</strong>e andere Stelle mit<br />
der Zertifizierung beauftragen.<br />
Zulassung/Genehmigung<br />
Die Begriffe Zulassung und Genehmigung werden synonym verwendet. Eine<br />
Zulassung/Genehmigung ist im Falle <strong>ein</strong>er Kontroll- und/oder Zertifizierungsstelle <strong>ein</strong>e<br />
Bestätigung, dass die beantragende Stelle die Kompetenz besitzt, bestimmte Kontroll- und<br />
Zertifizierungsaufgaben durchzuführen und die Erlaubnis hat, diese Tätigkeit im Rahmen der<br />
definierten Systeme auszuüben.<br />
Im Falle <strong>von</strong> Lizenznehmern <strong>ein</strong>er Dachmarke bedeutet Zulassung/Genehmigung die<br />
Bestätigung, dass die beantragende Stelle über <strong>ein</strong> System verfügt, mit welchem sie<br />
sicherstellt, dass die Anforderungen der Dachmarke erfüllt werden. Mit der<br />
Zulassung/Genehmigung erhält die beantragende Stelle die Erlaubnis, die Dachmarke im<br />
Rahmen der Lizenzver<strong>ein</strong>barung zu verwenden und die Genehmigung ggf. an<br />
Unterlizenznehmer weiterzugeben.<br />
Akkreditierung<br />
Akkreditierung ist die Bestätigung durch <strong>ein</strong>e dritte Stelle, die formal darlegt, dass <strong>ein</strong>e<br />
Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz besitzt, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben<br />
durchzuführen. In Deutschland dürfen Akkreditierungen nur durch die Deutsche<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 64
Akkreditierungsstelle GmbH/DAkkS) durchgeführt werden. Für die Zulassung als<br />
Ökokontrollstelle ist <strong>ein</strong>e Akkreditierung gemäß EN 45011 Voraussetzung.<br />
6.3.2 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen Regionalsiegels<br />
Bestehende Verordnungen, wie z. B. die EG-Öko-Verordnung oder die „Ohne Gentechnik“-<br />
Kennzeichnungsverordnung, sind Regelsysteme, die als Beispiele da<strong>für</strong> herangezogen werden<br />
können, wie die Vergabe und die Absicherung der Nutzung <strong>ein</strong>es bundesweiten<br />
Regionalsiegels gestaltet werden könnten. Nachfolgend <strong>ein</strong> Überblick über die bestehenden<br />
Systeme.<br />
6.3.3 Anwendungsbereich <strong>ein</strong>es Siegels<br />
Der Geltungsbereich <strong>ein</strong>er Regionalmarke sollte sich am Geltungsbereich bestehender<br />
Regelwerke <strong>für</strong> Produkte orientieren, <strong>für</strong> die <strong>ein</strong>e Regionalkennzeichnung Relevanz haben<br />
könnte. Im Folgenden werden die Geltungsbereiche relevanter Regelwerke <strong>für</strong> die<br />
Zusatzkennzeichnung <strong>von</strong> Lebensmitteln sowie landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen<br />
aufgeführt.<br />
EG-Öko-Verordnung<br />
Der Geltungsbereich der EG-Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den ökologischen Landbau umfasst den<br />
folgenden Produktbereich:<br />
„Lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche<br />
Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind, Futtermittel, vegetatives<br />
Vermehrungsmaterial und Saatgut <strong>für</strong> den Anbau sowie <strong>für</strong> als Lebensmittel oder Futtermittel<br />
verwendete Hefen.“<br />
Ausgenommen sind Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere.<br />
Verordnung zum Schutz <strong>von</strong> geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen<br />
Die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vom 20.03.2006 zum Schutz <strong>von</strong> geografischen Angaben<br />
und Ursprungsbezeichnungen <strong>für</strong> Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gilt <strong>für</strong> folgende<br />
Produktbereiche:<br />
Lebensmittel <strong>ein</strong>schließlich Bier, Getränke auf der Grundlage <strong>von</strong> Pflanzenextrakten,<br />
Backwaren, f<strong>ein</strong>e Backwaren, Süßwaren oder Kl<strong>ein</strong>gebäck, natürliche Gummis und Harze,<br />
Senfpaste, Teigwaren.<br />
Agrarerzeugnisse <strong>ein</strong>schließlich Heu, ätherische Öle, Kork, Cochenille (Rohstoff tierischen<br />
Ursprungs), Blumen und Zierpflanzen, Wolle, Korbweide, Schwingflachs.<br />
Ohne-Gentechnik-Kennzeichnung<br />
Gemäß dem „EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz - EGGenTDurchfG“ gelten die<br />
Bestimmungen <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e „Ohne-Gentechnik“-Kennzeichnung <strong>für</strong> Lebensmittel. Gemäß der EU-<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 65
Basisverordnung zum Lebensmittelrecht „VERORDNUNG (EG) Nr. 178/2002“ sind Lebensmittel<br />
„alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder <strong>von</strong> denen nach vernünftigem<br />
Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder<br />
unverarbeitetem Zustand <strong>von</strong> Menschen aufgenommen werden (Artikel 2). […] Zu<br />
Lebensmitteln zählen auch Getränke, Kaugummi sowie alle Stoffe, <strong>ein</strong>schließlich Wasser, die<br />
dem Lebensmittel bei s<strong>ein</strong>er Herstellung oder Be- oder Verarbeitung absichtlich zugesetzt<br />
werden“. K<strong>ein</strong>e Lebensmittel hingegen sind Futtermittel, lebende Tiere, Pflanzen vor dem<br />
Ernten, Arzneimittel, kosmetische Mittel sowie Tabak und Betäubungsmittel.<br />
Fair-Zertifizierung<br />
Eine privatrechtliche Fair-Zertifizierung erfolgt auf Basis der Anerkennung des eigenen Regel-<br />
und <strong>Kriterien</strong>werkes durch die Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Bonn.<br />
Basis <strong>für</strong> die <strong>Entwicklung</strong> eigener Mindestkriterien sind die Grundsätze <strong>von</strong> FINE, der<br />
internationalen Dachorganisation des Fairen Handels. Die Zertifizierung wird durch die FLO-<br />
CERT GmbH durchgeführt. FLO-CERT hat sich nach ISO 65 als unabhängige Zertifizierungsorganisation<br />
akkreditieren lassen.<br />
Ein Beispiel ist die Fair-Zertifizierung <strong>von</strong> Naturland, sie kann <strong>für</strong> alle Naturland Produkte<br />
zusätzlich durchgeführt und vergeben werden. Neben den Produkten, die über den<br />
Geltungsbereich der EG-Öko-Verordnung geregelt sind, betrifft dies die folgenden<br />
Produktgruppen: Fisch und Meeresfrüchte (auch Wildfisch) sowie Wald, Holz und<br />
Holzverarbeitung.<br />
Zusammenfassung<br />
Der Geltungsbereich <strong>für</strong> <strong>ein</strong> Regionalsiegel kann relativ weit gefasst werden. Mit <strong>ein</strong>em wie<br />
folgt definierten Geltungsbereich „Agrarerzeugnisse inklusive lebender Tiere sowie Saat- und<br />
Pflanzgut sowie Lebens- und Futtermittel“ sind die in den vorgenannten Regelwerken<br />
angeführten Geltungsbereiche weitgehend abgedeckt. Ergänzt werden kann dieser bei Bedarf<br />
durch Produktgruppen wie Wild, Wildfisch, Wald/Holz und daraus hergestellte Produkte sowie<br />
durch aus Agrarerzeugnissen herstellte Produkte, die k<strong>ein</strong>e Lebensmittel sind (z. B. Textilien).<br />
6.3.4 Zeichenvergabe<br />
Es muss <strong>ein</strong>e Zeichenvergabestelle geschaffen werden, die die Einhaltung der definierten<br />
Vorgaben <strong>für</strong> die Verwendung <strong>ein</strong>er bundesweiten Dachmarke sicherstellt. Die<br />
Zeichenvergabestelle prüft, ob das vom Antragsteller definierte System und die damit<br />
verbundenen Aussagen mit den Anforderungen der „Dachmarke“ kompatibel und mit<br />
entsprechenden prüfbaren <strong>Kriterien</strong> gestützt sind.<br />
Nachfolgend sind <strong>ein</strong>ige Varianten bestehender Zeichenvergabestellen bzw.<br />
Systemzulassungsstellen aufgeführt:<br />
Bio-Siegel<br />
Die Nutzung des staatlichen Biosiegels muss vor der erstmaligen Verwendung bei der<br />
„Informationsstelle Bio-Siegel“ (angesiedelt bei der Bundesanstalt <strong>für</strong> Ernährung) angezeigt<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 66
werden. Voraussetzung ist <strong>ein</strong>e gültige Zertifizierung gemäß den EU-Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den<br />
ökologischen Landbau. Die Nutzung des Bio-Siegels ist kostenfrei.<br />
„Ohne Gentechnik“-Label<br />
Das <strong>BMELV</strong> ist Markeninhaber des <strong>ein</strong>heitlichen „Ohne Gentechnik“-Siegels. Der Verband<br />
Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) ist Lizenznehmer der Marke und all<strong>ein</strong>ig befugt,<br />
Unterlizenzen an interessierte Unternehmen zu verteilen. Jeder, der die Anforderungen des<br />
EGGenTDurchfG erfüllt und dem VLOG diesen Standard glaubhaft macht, kann <strong>ein</strong>e Lizenz zur<br />
Nutzung des <strong>ein</strong>heitlichen Siegels erhalten. Die Nutzung des Siegels ist kostenpflichtig. Das<br />
Lizenzentgelt richtet sich nach der Größe des Unternehmens und beginnt bei 100 Euro im Jahr.<br />
Im Gegensatz zu der österreichischen „Gentechnik-frei erzeugt“- bzw. „Ohne Gentechnik<br />
hergestellt“-Kennzeichnung ist <strong>für</strong> die „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung k<strong>ein</strong> Kontroll- und<br />
Zertifizierungsverfahren vorgeschrieben.<br />
Rindfleischetikettierung (fakultative Kennzeichnung)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Kennzeichnung <strong>von</strong> Rindfleisch über die gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Angaben hinaus (fakultative Kennzeichnung) ist die Genehmigung durch das<br />
Rindfleischetikettierungssystem der zuständigen Stelle der Bundesanstalt <strong>für</strong> Ernährung (BLE).<br />
Mit dem Antrag sind umfangreiche Unterlagen <strong>ein</strong>zureichen. Diese umfassen unter anderem<br />
<strong>ein</strong>e Beschreibung der Kennzeichnungsvorschriften, des Kontroll- und Zertifizierungsverfahrens,<br />
der Dokumentationspflichten, der Vorschriften zur Chargenbildung, -abgrenzung<br />
und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit. Weiterhin müssen die Kontrollstellen, die mit der<br />
Kontrolle des Systems beauftragt werden, durch die BLE anerkannt werden. Die Kontrollstellen<br />
müssen hierzu die Voraussetzungen des <strong>ein</strong>schlägigen Fachrechts und der DIN EN 45011<br />
erfüllen. Eine Akkreditierung der Kontrollstelle ist allerdings nicht erforderlich.<br />
„Geprüfte Qualität - HESSEN“<br />
Inhaber der Marke „Geprüfte Qualität - HESSEN“ ist die Marketinggesellschaft GUTES AUS<br />
HESSEN e.V. Für die Zeichenvergabe ist die „MGH GUTES AUS HESSEN GmbH“ (100<br />
Prozent Tochter des e.V.) zuständig. Für die Nutzung des Zeichens ist <strong>ein</strong>e Teilnahmeerklärung<br />
an die Zeichenvergabestelle zu senden und <strong>ein</strong>e zugelassene Kontrollstelle mit der Kontrolle zu<br />
beauftragen. Eine erste Nutzung des Zeichens ist erst nach erfolgter Erstkontrolle und<br />
Ausstellung <strong>ein</strong>es Zertifikates durch die beauftragte Kontrollstelle möglich.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 67
Tabelle 16: Übersicht Systemzulassungsstellen<br />
Siegel/System Bio-Siegel Ohne Gentechnik Rindfleischetikettierung<br />
Marke<br />
Markeninhaber Bundesministerium <strong>für</strong><br />
Ernährung,<br />
Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz<br />
Vergabestelle Staatlich durch<br />
Bundesbehörde<br />
Antragsverfahren<br />
Kontrolle und<br />
Zertifizierung<br />
Überwachung<br />
der Kontrolle<br />
Bundesministerium <strong>für</strong><br />
Ernährung,<br />
Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz<br />
Privatrechtlich durch<br />
Vergabestelle<br />
Lizenznehmer Verband<br />
Lebensmittel ohne<br />
Gentechnik e.V.<br />
(VLOG)<br />
Anzeige der Nutzung Plausibilitätsprüfung<br />
durch Vergabestelle<br />
auf Grundlage <strong>ein</strong>es<br />
Fragebogens<br />
Abgedeckt über EU-<br />
Rechtsvorschriften <strong>für</strong><br />
den ökologischen<br />
Landbau<br />
Abgedeckt über EU-<br />
Rechtsvorschriften <strong>für</strong><br />
den ökologischen<br />
Landbau<br />
K<strong>ein</strong> Kontroll- und<br />
Zertifizierungsverfahren<br />
K<strong>ein</strong>e Marke.<br />
Freiwillige Angaben<br />
zu z. B. regionaler<br />
Herkunft,<br />
Tierkategorien,<br />
besonderen<br />
Aufzuchtverfahren<br />
K<strong>ein</strong>e Marke<br />
vorhanden<br />
Staatlich durch<br />
Bundesanstalt <strong>für</strong><br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung (BLE)<br />
Zulassung des<br />
Systems auf<br />
Grundlage<br />
umfangreicher<br />
Unterlagen.<br />
Zusätzlich Zulassung<br />
der Kontrollstelle<br />
notwendig<br />
Verfahren ist<br />
Bestandteil der<br />
Antragstellung.<br />
Meldepflichten durch<br />
Systeminhaber und<br />
Kontrollstelle an die<br />
BLE<br />
„Geprüfte Qualität -<br />
HESSEN“<br />
Marketinggesellschaft<br />
GUTES AUS<br />
HESSEN e.V.<br />
Privatrechtlich durch<br />
MGH GUTES AUS<br />
HESSEN GmbH<br />
Teilnahmeerklärung<br />
und Beauftragung<br />
<strong>ein</strong>er zugelassenen<br />
Kontrollstelle<br />
Kontrolle durch<br />
zugelassene<br />
Kontrollstellen.<br />
Zulassung erfolgt<br />
durch das<br />
Regierungspräsidium<br />
Gießen<br />
Durch die BLE Durch das<br />
Regierungspräsidium<br />
Gießen<br />
Für die Nutzung <strong>ein</strong>er „Dach“-Marke bzw. die Teilnahme an <strong>ein</strong>em übergeordneten System sind<br />
folgende Maßnahmen relevant, um die Marke und die Markennutzer zu schützen:<br />
Zulassung und Registrierung <strong>von</strong> Organisationen (Lizenznehmer) und deren<br />
Etikettierungssystemen durch den Dach-Markeninhaber oder <strong>ein</strong>e <strong>von</strong> diesem beauftragte<br />
Organisation.<br />
Zusätzlich Registrierung aller Unterlizenznehmer der registrierten Organisationen.<br />
Verfahren zur Zulassung <strong>von</strong> Kontrollstellen.<br />
Definition des Kontrollverfahrens und der Mindestkontrollanforderungen zur Absicherung der<br />
Einhaltung der Regeln durch die Markennutzer/Systemteilnehmer.<br />
Mit diesen Instrumenten wird auch gegenüber dem Verbraucher sichergestellt, dass die mit der<br />
Marke/dem System kommunizierten Erklärungen zu Produkteigenschaften, Produktqualität und<br />
Qualitätssicherungsmaßnahmen <strong>ein</strong>gehalten werden. Eine Akkreditierung <strong>von</strong> Lizenznehmern<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 68
wäre sehr aufwendig und teuer und würde <strong>ein</strong>en erheblichen Hinderungsgrund <strong>für</strong> die Nutzung<br />
<strong>ein</strong>er Regionaldachmarke darstellen.<br />
6.3.5 Kontrollen/Dokumentationen<br />
Der Sonderbericht Nr. 11 2011 des Europäischen Rechnungshofs stellt fest, dass in zahlreichen<br />
Fällen geografische Angaben genutzt wurden, ohne dass die Produkte die Voraussetzungen<br />
hier<strong>für</strong> erfüllen. Weiterhin stellt er fest, dass im Zusammenhang mit der Umsetzung der<br />
Regelungen <strong>für</strong> geografische Angaben (geschützte geografische Angabe (g.g.A.)) die<br />
Ausgestaltung des Kontrollverfahrens unzureichend ist. Um die unzulässige Kennzeichnung in<br />
Zukunft zu vermeiden, fordert der Rechnungshof, Mindestanforderungen <strong>für</strong> die Kontrolle der<br />
Einhaltung <strong>von</strong> Produktbeschreibungen zu formulieren. Diese sollten zumindest die<br />
Kontrollhäufigkeit und Kontrollmethoden regeln sowie <strong>ein</strong>e Definition enthalten, welche<br />
Unternehmen sich dem Kontrollverfahren unterziehen müssen.<br />
Ebenso wie bei Bioprodukten basiert der Mehrwert <strong>von</strong> Produkten mit <strong>ein</strong>er Regionalkennzeichnung<br />
auf dem Vertrauen der Konsumenten in diese. Deshalb ist es unerlässlich, die<br />
Wahrhaftigkeit der Aussagen über <strong>ein</strong> funktionierendes Kontrollsystem zu gewährleisten. In<br />
folgender Tabelle sind beispielhaft die Kontrollsysteme <strong>für</strong> vier verschiedene Marken bzw.<br />
Etikettierungssystem aufgeführt.<br />
Tabelle 17: Übersicht Kontrollsystem<br />
Siegel/System EU-Bio-Logo und Bio-<br />
Siegel<br />
Marke<br />
Standards EU-Rechtsvorschriften<br />
<strong>für</strong> den ökologischen<br />
Landbau<br />
Zulassung<br />
Kontroll- und<br />
Zertifizierungsverfahren <br />
Kontrollverfahren<br />
Zulassung der Kontrollstelle<br />
durch Bundesanstalt<br />
<strong>für</strong> Landwirtschaft<br />
und Ernährung (BLE).<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Zulassung ist <strong>ein</strong>e<br />
Akkreditierung nach EN<br />
45011<br />
Mindestens jährlicher<br />
Kontrollbesuch beim<br />
Unternehmen.<br />
Zusätzlich in zehn<br />
Ohne Gentechnik Rindfleischetikettierung<br />
EG-Gentechnik-<br />
Durchführungsgesetz<br />
(EGGenTDurchfG)<br />
K<strong>ein</strong> Kontroll- und<br />
Zertifizierungsverfahren<br />
vorgeschrieben.<br />
Die Teilnahme an<br />
<strong>ein</strong>em freiwilligen<br />
Kontroll- und Zertifizierungsverfahren<br />
wird<br />
seitens des VLOG den<br />
Siegel-Nutzern jedoch<br />
angeraten.<br />
K<strong>ein</strong>e Marke.<br />
Freiwillige Angaben<br />
zu z. B. regionaler<br />
Herkunft,<br />
Tierkategorien,<br />
besonderen<br />
Aufzuchtverfahren<br />
VERORDNUNG (EG)<br />
Nr. 1760/2000 in<br />
Verbindung mit nationalemRindfleischetikettierungsgesetz<br />
und -verordnung<br />
Zulassung der<br />
Kontrollstelle durch<br />
Bundesanstalt <strong>für</strong><br />
Landwirtschaft und<br />
Ernährung (BLE).<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Zulassung ist die<br />
Erfüllung der<br />
Anforderungen der<br />
EN 45011. Eine<br />
Akkreditierung ist<br />
nicht vorgeschrieben.<br />
Mindestens jährlicher<br />
Kontrollbesuch beim<br />
Unternehmen.<br />
Zusätzlich in zehn<br />
„Geprüfte Qualität -<br />
HESSEN“<br />
Privater Standard mit<br />
Richtlinien <strong>für</strong> die<br />
Erzeugung,<br />
Verarbeitung und<br />
Vermarktung<br />
Zulassung der<br />
Kontrollstelle durch<br />
das<br />
Regierungspräsidium<br />
Gießen<br />
Mindestens jährlicher<br />
Kontrollbesuch beim<br />
Unternehmen.<br />
Zusätzlich in zehn<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 69
Zertifizierung/<br />
Konformitätsbewertung<br />
Überwachung<br />
der Kontrolle<br />
Prozent der<br />
Unternehmen<br />
Stichprobenkontrollen<br />
Prozent der<br />
Unternehmen<br />
Stichprobenkontrollen<br />
Prozent der<br />
Unternehmen<br />
Stichprobenkontrollen<br />
Durch Kontrollstelle Durch Kontrollstelle Durch Kontrollstelle im<br />
Auftrag der<br />
Zeichenvergabestelle<br />
Überwachung durch<br />
zuständige Länderbehörden.<br />
Umfangreiche<br />
Meldepflichten der Kontrollstellen<br />
an die Überwachungsbehörden<br />
Überwachung durch<br />
die BLE.<br />
Umfangreiche Meldepflichten<br />
der Kontrollstellen<br />
an die Überwachungsbehörden<br />
Überwachung durch<br />
Regierungspräsidium<br />
Gießen. Umfangreiche<br />
Meldepflichten<br />
der Kontrollstellen an<br />
die Überwachungsbehörden<br />
Bis auf die „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung verfügen alle Systeme über folgende Elemente:<br />
Zulassung der Kontrollstellen auf Basis <strong>ein</strong>es Anforderungskataloges<br />
Definition <strong>von</strong> Mindestkontrollanforderungen<br />
Überwachung der Kontrollstellen inklusive Meldeverfahren<br />
Zertifizierung<br />
Dieses Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und kann <strong>ein</strong>e gute Grundlage<br />
<strong>für</strong> die Ausgestaltung <strong>ein</strong>es Kontrollverfahrens <strong>ein</strong>er Regionaldachmarke s<strong>ein</strong>. Für die<br />
Durchführung <strong>von</strong> Kontrollen kann auf die bereits im Bereich <strong>von</strong> Bioprodukten oder der<br />
Rindfleischetikettierung tätigen Kontrollstellen verwiesen werden. Als Voraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Durchführung der Kontrolle in diesen Produktbereichen müssen die Kontrollstellen die<br />
Anforderungen der EN 45011 erfüllen. Bezüglich der Zertifizierung muss der Inhaber der<br />
Regionaldachmarke entscheiden, ob er diese Aufgabe selbst wahrnimmt oder wie im Falle der<br />
Marke „Geprüfte Qualität - HESSEN“, <strong>ein</strong>e dritte Stelle hiermit beauftragt.<br />
Unter dem Aspekt der Verwendung der Regionalkennzeichnung <strong>für</strong> Produkte, die bereits<br />
andere Siegel tragen (z. B. Bio-Siegel), sollten bereits durchgeführte Kontrollverfahren im<br />
Hinblick auf die Vermeidung <strong>ein</strong>er „Doppel-Kontrolle“ anerkannt und ggf. um <strong>für</strong> die<br />
Regionalkennzeichnung relevante Aspekte ergänzt werden.<br />
Im Rahmen <strong>ein</strong>es Gespräches mit Handelsvertretern wurde die Problematik <strong>von</strong><br />
Kl<strong>ein</strong>sterzeugern angesprochen. Kl<strong>ein</strong>sterzeuger sind insbesondere im Spezialitätenbereich<br />
(z. B. Wachteleier oder Honig) wichtige regionale Lieferanten. Aufgrund des häufig geringen<br />
Erzeugungsvolumens wären <strong>für</strong> solche Erzeuger die Kosten <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e eigenständige Anmeldung<br />
zu <strong>ein</strong>em Kontrollverfahren <strong>ein</strong> Hinderungsgrund zur Teilnahme an <strong>ein</strong>em solchen System. Eine<br />
Möglichkeit zur Lösung des Problems wäre die Einbindung der Kontrollen <strong>von</strong> Herstellern, die<br />
nur selbst erzeugte Ware in <strong>ein</strong> solches System liefern, in die Kontrolle des abnehmenden<br />
Betriebes.<br />
Zusammenfassung<br />
Für <strong>ein</strong>e <strong>für</strong> den Verbraucher transparente Regionalkennzeichnung ist das Vorhandens<strong>ein</strong><br />
<strong>ein</strong>es glaubwürdigen Kontroll- und Zertifizierungssystems notwendig. Das Kontroll- und<br />
Zertifizierungssystem sollte <strong>ein</strong> mehrstufiges System s<strong>ein</strong>, bestehend aus Eigenkontrolle,<br />
neutraler Kontrolle und der Kontrolle der Kontrolle. Die Mindestanforderungen sollten die<br />
Kontrolle der Einhaltung der Produktionsregeln, die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollmethode und<br />
die Kontrolltiefe entlang <strong>ein</strong>er Wertschöpfungskette b<strong>ein</strong>halten.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 70
6.3.6 Verifizierung der Herkunftsaussagen<br />
Kernaussage <strong>von</strong> Regionalsiegeln ist die Zusicherung der Herkunft der Rohwaren aus <strong>ein</strong>er<br />
bestimmten Region sowie der Herstellung der Produkte in <strong>ein</strong>er bestimmten Region. Um die<br />
Einhaltung der regionalen Rohwarenherkünfte und Verarbeitung zu dokumentieren sowie<br />
transparent und verifizierbar zu machen, bietet sich <strong>ein</strong>e lückenlose Rückverfolgbarkeit durch<br />
Dokumentation der Rohwarenherkünfte und der Produktionsprozesse entlang der<br />
Wertschöpfungskette an. Zwar gibt es <strong>ein</strong>e gesetzliche Vorgabe <strong>für</strong> die Rückverfolgbarkeit <strong>von</strong><br />
Produkten, sie b<strong>ein</strong>haltet jedoch k<strong>ein</strong>e Vorschriften <strong>für</strong> die praktische Umsetzung. Ein<br />
privatwirtschaftlicher Ansatz der Umsetzung ist die datenbankbasierte Rückverfolgbarkeit.<br />
Datenbanktechnische Rückverfolgbarkeit<br />
Mittels <strong>ein</strong>er internetbasierten Datenbank kann <strong>ein</strong>e Rückverfolgbarkeit der Produkte bis zum<br />
Erzeuger gewährleistet werden. Voraussetzung <strong>für</strong> dieses System ist die Kennzeichnung der<br />
Produkte mit <strong>ein</strong>em <strong>ein</strong>deutigen Code. Beispiele <strong>für</strong> solche Systeme sind die KAT-Datenbank<br />
<strong>für</strong> Eier (www.was-steht-auf-dem-ei.de/home/was-steht-auf-dem-ei/), die Rückverfolgbarkeitsdatenbank<br />
der Bio mit Gesicht GmbH (www.bio-mit-gesicht.de) und der fish & more GmbH<br />
(www.followfish.de).<br />
Abbildung 21: Internetseiten zur Rückverfolgbarkeit <strong>von</strong> Lebensmitteln<br />
Diese Systeme ermöglichen <strong>ein</strong>e Rückverfolgbarkeit im Beschwerde- oder Krisenfall <strong>für</strong> die<br />
betroffenen Unternehmer, beteiligte Kontrollstellen sowie die Markeninhaber und bieten<br />
gleichzeitig die Basis <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e Kundenkommunikationsplattform, die im Bereich <strong>von</strong> Produkten<br />
mit Regionalkennzeichnung unerlässlich ist.<br />
Analytische Herkunftsverifizierung<br />
Als <strong>ein</strong> neuer, ebenfalls privatwirtschaftlicher Ansatz zur Verifizierung der Herkunft, kann die<br />
Methode der Herkunftsanalyse angesehen werden. Die Verifizierung <strong>von</strong> regionalen Herkünften<br />
mittels Untersuchung des Verhältnisses <strong>von</strong> stabilen Isotopen („Wasserzeichen“) bietet <strong>ein</strong>e<br />
gute Möglichkeit, die Rohwarenherkünfte abzusichern. Inhalt <strong>ein</strong>es parallel laufenden Projektes<br />
in Unterfranken und Hessen ist die Prüfung der Praxistauglichkeit der Isotopenanalytik zur<br />
Verifizierung <strong>von</strong> Herkunftsangaben. Basierend auf den Ergebnissen des Projektes wird die<br />
Möglichkeit der Verwendung der Isotopenanalytik als ergänzende Maßnahme zur Absicherung<br />
der Rohstoffherkünfte <strong>für</strong> mit dem Regionalzeichen gelabelte Produkte erörtert.<br />
Die notwendige Basis da<strong>für</strong> ist der Aufbau <strong>ein</strong>er Datenbank, in der die unterschiedlichen<br />
Isotopenmuster landwirtschaftlicher Produkte aus den verschiedenen Regionen<br />
(deutschlandweit, später weltweit) als Referenzmuster hinterlegt werden. Die Datenbank steht<br />
mit ihrem öffentlichen Bereich allen Interessierten zur Verfügung. Gleichzeitig ist die<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 71
Hinterlegung <strong>von</strong> Referenzdaten in der Datenbank notwendiger Teil <strong>ein</strong>es ganzheitlichen<br />
Qualitätssicherungssystems entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette. In der<br />
Datenbank werden die regionalen Isotopenmuster des Wassers, welches in allen Lebensmitteln<br />
vorhanden ist, gesammelt. Als Regionen werden die naturräumlichen Gebiete, definiert nach<br />
der Aufteilung des Bundesamt <strong>für</strong> Naturschutz (1994), angenommen. Diese naturräumlichen<br />
Gebiete (<strong>für</strong> Deutschland 72) haben den Vorteil, dass sie durch abiotische und biotische<br />
Faktoren definiert sind und unabhängig <strong>von</strong> politischen Grenzen innerhalb Deutschlands<br />
bestimmt werden.<br />
Abbildung 22: Konzept Wasserzeichen<br />
Zukünftiger Anwendungsbereich der Referenzdatenbank kann zum Beispiel die Beantwortung<br />
der nachfolgenden Fragen s<strong>ein</strong>:<br />
Deklariertes Herkunftsland: Kommt der Spargel tatsächlich, wie deklariert, aus Deutschland<br />
oder könnte es sich auch um Ware aus Südeuropa handeln?<br />
Deklarierte Region: Stammt das Putenfleisch, wie deklariert, aus Norddeutschland?<br />
Deklarierter Erzeugerbetrieb: Wurden die Kartoffeln tatsächlich auf den Feldern des<br />
angegebenen Produzenten geerntet oder könnte es sich auch um zugekaufte Ware handeln?<br />
Im Falle <strong>ein</strong>es Lebensmittelskandals: Stammen die Eier tatsächlich aus <strong>ein</strong>er bestimmten<br />
Region oder <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em bestimmten Betrieb?<br />
Im Falle <strong>ein</strong>er öffentlich gewordenen Reklamation: Stammt dieses Produkt tatsächlich aus<br />
dem deklarierten Betrieb?<br />
Vergleichbare Systeme wurden schon <strong>für</strong> die Bereiche Spargel (vgl.<br />
www.lanuv.nrw.de/verbraucher/nahrungsmittel/obst_gemuese/isotopen.htm) und Holz<br />
(http://literatur.vti.bund.de/digbib_extern/dk039300.pdf) entwickelt.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 72
7 Erfassung der Wünsche der Akteure<br />
Um die verschiedenen Vorstellungen zu dem Thema <strong>Kriterien</strong>entwicklung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong><br />
Regionalsiegel zu erfassen, wurde mit den wichtigsten Vertretern der verschiedenen<br />
Akteursgruppen gesprochen. So gab es Gesprächsrunden mit dem Bundesverband der<br />
Regionalbewegung, dem BVL als Dachorganisation des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels, dem<br />
BÖLW als Dachorganisation der Biobranche und dem hessischen Verbraucherschutz. Durch<br />
die Mitglieder der Bietergem<strong>ein</strong>schaft waren auch die M<strong>ein</strong>ungen der meisten Länderzeichen-<br />
Träger vertreten. Zur Vervollständigung wurden die verschiedenen Stellungnahmen und<br />
Positionspapiere der verschiedenen Akteure mitberücksichtigt. Die Protokolle der Gespräche,<br />
Stellungnahmen und Positionspapiere sind im Anhang aufgeführt.<br />
Auf <strong>ein</strong>er Beiratssitzung wurden die verschiedenen Positionen der Akteure nochmals überprüft<br />
und, wo notwendig, korrigiert. Die Teilnehmerliste und das Protokoll der Beiratssitzung sind im<br />
Anhang aufgeführt (siehe Anhang 12.3, Protokoll Beiratssitzung vom 09.12.2011).<br />
Auf dieser Basis entstanden die nachfolgenden Positionsbeschreibungen der <strong>ein</strong>zelnen<br />
Akteursgruppen <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e <strong>Kriterien</strong>entwicklung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel.<br />
Verbraucherschützer<br />
Die Verbraucherschutzorganisation wünscht sich <strong>ein</strong>e klare gesetzliche Regelung des Themas<br />
Regionalität. Hierbei sollen die drei <strong>Kriterien</strong> Regionaldefinition, Rohstoffherkunft und<br />
Herstellungs-/Verarbeitungsort rechtlich geregelt werden. Als <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> den Rohstoffbezug<br />
sollen die Monoprodukte zu 100 Prozent aus der Region stammen und bei zusammengesetzten<br />
Produkten muss der Rohstoff zu 95 Prozent aus der definierten Region stammen. Die<br />
Verarbeitung muss ebenfalls in der Region stattfinden. Die Überprüfung der Einhaltung der<br />
Regeln soll durch <strong>ein</strong> unabhängiges Kontrollsystem mit staatlicher Überwachung erfolgen<br />
(siehe Anhang 12.11, Positionspapier VZ).<br />
Handel/BVL<br />
Die Vertreter des Handels wünschen sich <strong>ein</strong>e stärkere Ausschöpfung und Nutzung der<br />
bestehenden Regelungen, bis auf EU-Ebene. Dabei sind sie an der Beibehaltung bzw.<br />
Ausweitung der schon existierenden Regionalzeichen der Länder interessiert. Es wurde der<br />
Wunsch geäußert, dass alle Bundesländer vergleichbare Ländersiegel wie Hessen und Baden-<br />
Württemberg erhalten, damit diese wie bei EDEKA genutzt werden können. Unterstützt werden<br />
sollen die zukünftigen Regionalaktivitäten des Handels durch <strong>ein</strong>e freiwillige Umsetzung <strong>von</strong><br />
mehr Transparenz und <strong>ein</strong>er Informationskampagne zum Verbraucher. Zusätzliche Kontrollen<br />
im Rahmen der Regionalauslobung sind nicht gewünscht, die bisherigen Systeme seien<br />
ausreichend, die finanzielle Mehrbelastung <strong>von</strong> kl<strong>ein</strong>en Herstellern soll vermieden werden<br />
(siehe Anhang 12.9, Positionspapier BVL vom 10.01.2012).<br />
Länder<br />
Die Vertreter der Regionalzeichen der Länder wünschen sich <strong>ein</strong>e kompatible<br />
Regionaldefinition zu ihren eigenen Definitionen. Wichtig ist dabei die Einführung <strong>von</strong><br />
Mindestkriterien <strong>für</strong> den Rohstoffbezug und den Herstellungs-/Verarbeitungsort der regionalen<br />
Produkte sowie <strong>ein</strong> neutrales mehrstufiges Kontrollsystem. Aus Sicht der Länder wäre die<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 73
Erstellung <strong>ein</strong>es <strong>Kriterien</strong>kataloges mit bundesweit <strong>ein</strong>heitlichen Mindeststandards <strong>für</strong> die<br />
Verwendung <strong>von</strong> Regionalzeichen bzw. Qualitätszeichen wünschenswert (siehe Anhang 12.10,<br />
Protokoll AMK vom 28.10.2011).<br />
Biobranche<br />
Der BÖLW als Vertreter der Biobranche wünscht sich <strong>ein</strong>e klare Definition, was <strong>ein</strong> regionales<br />
Lebensmittel ist. Dies umfasst <strong>ein</strong>e regionale Eingrenzung sowie <strong>ein</strong>en Mindestanteil <strong>von</strong><br />
regionalem Rohstoff in der Rezeptur. Das Kontrollsystem sowie die Auslobung der Regionalität<br />
müssen aus Verbrauchersicht neutral und überprüfbar s<strong>ein</strong>. Aus Sicht der Bioverbände ist <strong>ein</strong><br />
weiteres staatliches Zeichen nicht gewünscht, ebenso bedarf es k<strong>ein</strong>er weiteren Aufladung<br />
durch zusätzliche <strong>Kriterien</strong> wie Tierwohl oder Nachhaltigkeit. Wünschenswert wäre die weitere<br />
Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe (siehe Anhang 12.12, E-Mail BÖLW vom<br />
16.12.2011).<br />
Lebensmittelhandwerk/Lebensmittelhersteller<br />
Die Vertreter des Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittelhersteller (BVE<br />
Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V., VdF Verband der Fleischwirtschaft<br />
e.V., BVEO Bundesver<strong>ein</strong>igung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. und VDM<br />
Verband Deutscher Mühlen e.V.) stehen <strong>ein</strong>em bundesweiten Regionalsiegel eher ambivalent<br />
gegenüber. So sollte die Wirtschaft, wenn überhaupt, Träger <strong>ein</strong>es Regionalzeichens s<strong>ein</strong>. Die<br />
Nutzung des Zeichens sollte freiwillig s<strong>ein</strong>. Die <strong>Kriterien</strong> sollen nicht zu eng gefasst werden. Es<br />
soll k<strong>ein</strong>e zu kl<strong>ein</strong>räumige Regionendefinition geben sowie k<strong>ein</strong>e prozentuale Festlegung des<br />
Rohstoffbezuges oder des Verarbeitungsortes. Ein <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel soll nicht<br />
durch weitere Zusatzkriterien wie Nachhaltigkeit oder Tierwohl aufgeladen werden. Für die<br />
Einführung <strong>ein</strong>es solchen Regionalsiegels sollte es <strong>ein</strong>e staatliche Förderung geben (siehe<br />
Ergebnis Expertenbefragung, Kapitel 9).<br />
Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (BRB)<br />
Der BRB, als Vertreter <strong>von</strong> marktbedeutenden Regionalinitiativen, wünscht sich <strong>ein</strong><br />
Regionalsiegel, welches in <strong>ein</strong>em ersten Schritt ausschließlich an Regionalinitiativen vergeben<br />
wird. Die Vergabekriterien sollen <strong>ein</strong>e schlüssige und sinnvolle Regionenabgrenzung besitzen,<br />
Monoprodukte kommen zu 100 Prozent aus der Region, bei zusammengesetzten Produkten<br />
sollen die Rohstoffe weitestgehend aus der Region stammen, bei der Verarbeitung sollen so<br />
viele Akteure wie möglich <strong>ein</strong>er Wertschöpfungskette aus der definierten Region stammen<br />
(Ausnahmen sind möglich). Die Vermarktung der Produkte soll überwiegend in der definierten<br />
Region stattfinden, um die Wertschöpfung in der Region zu behalten. Die Einhaltung der<br />
<strong>Kriterien</strong> soll durch interne und externe Kontrollen, als privatrechtliches Zertifizierungssystem,<br />
gewährleistet werden. Zusätzlich fordert der BRB auf EU-Ebene fakultative Qualitätsangaben<br />
<strong>für</strong> den Begriff „Region“ und „regional“, sodass missbräuchliche Verwendung der<br />
Begrifflichkeiten geahndet werden kann (siehe Anhang 12.5, Positionspapier BRB vom<br />
25.11.2011).<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 74
Abbildung 23: Positionsebenen der Regionalakteure<br />
Abschlussbericht<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 75
Zusammenfassung<br />
Die Wünsche und Forderungen der <strong>ein</strong>zelnen Akteure an die <strong>Kriterien</strong>entwicklung <strong>für</strong> <strong>ein</strong><br />
<strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel reichen <strong>von</strong> klaren staatlichen Regelungen über <strong>ein</strong><br />
privatrechtliches, freiwilliges System bis zur moderaten Anpassung des Status quo durch das<br />
<strong>BMELV</strong>. Auch bei der Beschreibung der verschiedenen <strong>Kriterien</strong> sind k<strong>ein</strong>e Gem<strong>ein</strong>samkeiten<br />
aufgetreten. Hier reichen die Vorstellung <strong>von</strong> 100 Prozent (Monoprodukte)/95 Prozent<br />
(zusammengesetzte Produkte) des Rohstoffbezugs aus der Region bis hin zu Formulierungen<br />
wie „weitestgehender Rohstoffbezug aus der Region“. Auch bei der Frage <strong>ein</strong>es Kontroll- und<br />
Zertifizierungssystems wird <strong>ein</strong>e Bandbreite <strong>von</strong> staatlicher Überwachung bis zur<br />
Selbstkontrolle gefordert.<br />
Die schon oben aufgeführte Vielfalt bei den verschiedenen Akteuren lässt sich am besten an<br />
<strong>ein</strong>er Übersicht der verschiedenen <strong>Kriterien</strong>modelle aufzeigen. Die nachfolgende Übersicht<br />
zeigt ver<strong>ein</strong>facht die Wünsche der Akteure auf, wie und welche <strong>Kriterien</strong> aus ihrer Sicht<br />
notwendig wären. Wobei jedes <strong>Kriterien</strong>modell schon <strong>ein</strong>er aktuellen Handlungsweise der<br />
verschiedenen Akteure entspricht.<br />
Modell 1 „Ganzheitliches Modell“ hat <strong>ein</strong>e kl<strong>ein</strong>räumige Regionendefinition (kl<strong>ein</strong>er als <strong>ein</strong><br />
Bundesland), bezieht die Vorstufe der Landwirtschaft mit <strong>ein</strong> und verlangt beim Rohstoffbezug<br />
<strong>ein</strong>e Verwendung <strong>von</strong> 95 bis 100 Prozent regionaler Rohstoffe. Sowohl die Verarbeitung als<br />
auch die Vermarktung muss in der Region stattfinden. Weitere Zusatzkriterien sind<br />
verpflichtend.<br />
Modell 2 „Wertschöpfung in der Region“ sieht <strong>ein</strong>e klare Regionendefinition vor, die kl<strong>ein</strong>er als<br />
die Bundesrepublik Deutschland ist (also Bundesland oder kl<strong>ein</strong>er) und integriert die Vorstufe<br />
ebenso mit in das System. Auch der Rohstoffbezug ist mit 95 bis 100 Prozent aus der Region<br />
geregelt, genauso wie die Verarbeitung in der Region zu erfolgen hat. Jedoch wird k<strong>ein</strong> Wert<br />
auf <strong>ein</strong>e ausschließliche Vermarktung in der Region und auf Zusatzkriterien gelegt.<br />
Modelle 3 und 4 „aus der Region <strong>für</strong> die Region“ beschreiben den Ansatz <strong>ein</strong>er klaren<br />
Regionenbegrenzung unterhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, jedoch ohne<br />
Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Vorstufe und <strong>ein</strong>er klaren Regelung der<br />
Produktionstiefe. Der Rohstoffbezug kann in <strong>ein</strong>er Bandbreite <strong>von</strong> 50 bis 95 Prozent aus der<br />
Region erfolgen. Verarbeitung in der Region ist gewünscht, jedoch nicht verbindlich. Alle<br />
weiteren Vorgaben sind offen.<br />
Modell 5 „Erzeugung in der Region“ verlangt nur <strong>ein</strong>en Rohstoffbezug zwischen 50 bis 95<br />
Prozent aus der Region.<br />
Modell 6 „Verarbeitung in der Region“ sieht nur die Verarbeitung in der Region vor, ohne den<br />
Rohstoffbezug zu regeln.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 76
Tabelle 18: Übersicht <strong>Kriterien</strong>modelle<br />
<strong>Kriterien</strong>modell Abgrenzung der<br />
Region<br />
1 Ganzheitliches<br />
Modell<br />
2 Wertschöpfung in<br />
der Region<br />
3 aus der Region <strong>für</strong><br />
die Region<br />
4 aus der Region <strong>für</strong><br />
die Region - flexibel<br />
5 Erzeugung in der<br />
Region<br />
6 Verarbeitung in der<br />
Region<br />
kl<strong>ein</strong>räumig,<br />
natürliche<br />
Grenzen, kl<strong>ein</strong>er<br />
als <strong>ein</strong><br />
Bundesland<br />
kl<strong>ein</strong>er<br />
Deutschland<br />
kl<strong>ein</strong>er<br />
Deutschland<br />
kl<strong>ein</strong>er<br />
Deutschland<br />
kl<strong>ein</strong>er<br />
Deutschland<br />
kl<strong>ein</strong>er<br />
Deutschland<br />
Vorstufen der<br />
Landwirtschaft<br />
Produktionstiefe<br />
Landwirtschaft<br />
(z. B. Geburt,<br />
Aufzucht, Mast)<br />
Anteil Rohstoffe Verarbeitung in<br />
Mono-<br />
der Region<br />
Zusammengesetzte<br />
produkte Produkte<br />
Gesamt/Hauptzutat<br />
Verbindliche<br />
Vermarktung<br />
in der Region<br />
Zusatzkriterien<br />
ja alles 100 % > 95 % / 100 % ja ja ja, z. B. „ohne<br />
Gentechnik“,<br />
Bio etc.<br />
ja alles 100 % > 95 % / 100 % ja n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong><br />
n<strong>ein</strong> überwiegend 100 % > 51 % / 100 % wenn möglich n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong><br />
n<strong>ein</strong> überwiegend > 90% > 51 % /100 % wenn möglich n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong><br />
n<strong>ein</strong> überwiegend > 90 % > 51 % / 100 % n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong><br />
n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong> n<strong>ein</strong> ja ja n<strong>ein</strong><br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 77
8 Szenarienbildung<br />
Als Ergebnis der gesamten Ist-Analyse wurden die vier nachfolgenden Szenarien als mögliche<br />
Umsetzungswege entwickelt. Diese Szenarien wurden mit den <strong>ein</strong>zelnen Akteuren abgestimmt<br />
und entsprechen in den wesentlichen Zügen den Vorstellungen der verschiedenen<br />
Akteursgruppen. Die Vorstellung der Verbraucherschutzorganisationen mit <strong>ein</strong>er<br />
staatlichen/gesetzlichen Regelung als weiteres Szenario wurde nicht weiter verfolgt, da das<br />
<strong>BMELV</strong> <strong>ein</strong>en staatlichen Weg ausgeschlossen hat.<br />
Die ersten Ansätze der Szenarien „Anerkennung“, „Regionalsiegel“ und „Regionalfenster“<br />
wurden dem <strong>BMELV</strong> am 05.12.2011 vorgestellt und ausführlich besprochen. Als Ergebnis<br />
wurde festgehalten (siehe Anhang 12.2, Protokoll <strong>BMELV</strong> vom 05.12.2011):<br />
Das Szenario „Regionalsiegel“ ersch<strong>ein</strong>t am <strong>ein</strong>fachsten zu kommunizieren. Eine Umsetzung<br />
durch die Wirtschaft ersch<strong>ein</strong>t jedoch nicht realistisch. Es wird dementsprechend nicht weiter<br />
verfolgt.<br />
Das Szenario „Regionalfenster“ ersch<strong>ein</strong>t als <strong>ein</strong>e attraktive Lösung und soll weiterentwickelt<br />
werden. Szenario „Anerkennung“ soll ebenso optional weiter ausgearbeitet werden.<br />
Durch die intensiven Gespräche mit dem Handel wurde das zusätzliche Szenario<br />
„Anpassung/Koordination“ mit aufgenommen.<br />
Abbildung 24: Darstellung der Umsetzungswege<br />
Die erarbeiteten Szenarien stellen <strong>ein</strong> Grundgerüst dar und sollten in <strong>ein</strong>em Praxistest auf die<br />
praktikable Umsetzung überprüft werden.<br />
Bei der Erarbeitung der notwendigen Mindestkriterien <strong>für</strong> die Regionalität, vor allem in den<br />
beiden zu vertiefenden Szenarien, wurde stets abgewogen, ob der Anspruch besteht, möglichst<br />
viele existierende Initiativen/Systeme <strong>ein</strong>zubinden oder ob die Vorgaben so streng gewählt<br />
werden, dass nur wenige Initiativen/Systeme das entsprechende Szenario nutzen können.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 78
Wählt man <strong>ein</strong>fach zu erfüllende <strong>Kriterien</strong>, können zwar sehr viele bereits bestehende Initiativen<br />
oder Handelsmarken daran teilnehmen. Doch Initiativen, die <strong>für</strong> sich in Anspruch nehmen,<br />
„hohe Standards“ zu erfüllen, werden <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalzeichen dann tendenziell eher<br />
nicht nutzen. Deshalb wurde es bei der <strong>Entwicklung</strong> der Mindestkriterien <strong>für</strong> die beiden<br />
Szenarien „Anerkennung“ und „Regionalfenster“ als sinnvoll erachtet, sich an bestehenden<br />
Systemen zu orientieren. Sie haben zum <strong>ein</strong>en <strong>ein</strong>e gewisse Marktbedeutung und zum anderen<br />
praxis- und verbrauchergerechte Standards entwickelt. Wie bereits zuvor beschrieben, erwartet<br />
der Verbraucher <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em regionalen Produkt, dass vor allem die Rohstoffe aus <strong>ein</strong>er<br />
definierten Region kommen und die Verarbeitung in der Region stattgefunden hat.<br />
Als notwendige Voraussetzung zur <strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> Mindestkriterien werden klare Definitionen<br />
zur Regionenabgrenzung, zur Produktionstiefe der Landwirtschaft, dem Anteil des<br />
Rohstoffbezuges aus der definierten Region und dem Standort der Verarbeitung angesehen.<br />
Auf Basis dieser Vorgaben sind die nachfolgenden Szenarien entwickelt worden.<br />
8.1 Szenario „Anpassung/Koordination“<br />
Das Szenario „Anpassung/Koordination“ geht vom Status quo der Ländersiegel in Hessen,<br />
Baden-Württemberg, Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz, Saarland und den regionalen Handelsmarken, die <strong>ein</strong>e<br />
Kooperation mit diesen Länderzeichen haben, aus.<br />
Dabei werden die schon bestehenden EU-notifizierten Kennzeichnungssysteme <strong>für</strong><br />
Qualitätsprodukte aus regionalen Herkünften genutzt, wie zum Beispiel die regionalen<br />
Länderzeichen der oben genannten Bundesländer. Diese EU-konformen Regelwerke sollen<br />
allen anderen Bundesländern aktiv zur freiwilligen Verwendung angeboten werden.<br />
Diese aktive Vorgehensweise soll durch die Moderation des <strong>BMELV</strong> beziehungsweise <strong>ein</strong>es<br />
Dienstleisters erfolgen, der den Ländern die Chancen regionaler Qualitäts- und<br />
Herkunftszeichen und der zukünftigen europäischen Qualitätspolitik aufzeigt (z. B. VO (EG)<br />
510/2006). Als Beispiel <strong>für</strong> diese Vorgehensweise wird die erfolgreiche Übernahme des<br />
notifizierten Herkunfts- und Qualitätsprogramms <strong>von</strong> Baden Württemberg in Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz<br />
angesehen. Während des Moderationsprozesses soll <strong>ein</strong>e Anpassung der bestehenden<br />
<strong>Kriterien</strong>kataloge an die Gegebenheiten des jeweiligen Bundeslandes erfolgen, wobei das<br />
Anpassungsziel die Mindestkriterien <strong>von</strong> Hessen und Baden-Württemberg s<strong>ein</strong> sollen.<br />
Der gewünschte Moderationsprozess soll <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er gem<strong>ein</strong>samen Kommunikationskampagne,<br />
getragen <strong>von</strong> Bund und Länder, begleitet werden, um Regionalinitiativen verschiedene<br />
Umsetzungsoptionen <strong>für</strong> regionale Ansätze aufzuzeigen, wie zum Beispiel die Individualisierung<br />
der Kennzeichnungssysteme auf ihre Region (siehe z. B. PLENUM-Gebiete). Optional können<br />
Zusatzkriterien, die über dem Herkunfts- und Qualitätsprogramm des entsprechenden<br />
Bundeslandes liegen, verwendet werden. Durch die bestehenden Regelwerke ergibt sich die<br />
Möglichkeit <strong>ein</strong>er EU-konformen öffentlichen Förderung, zum Beispiel durch <strong>ein</strong>en Landkreis<br />
oder <strong>ein</strong>en Naturpark.<br />
Aus Kostengründen werden die bereits vorhandenen Kontroll- und vor allem<br />
Akkreditierungssysteme genutzt, um <strong>ein</strong>e höhere Akzeptanz der potenziellen Verwender, wie<br />
etwa die Handelsunternehmen, zu gewinnen.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 79
8.2 Szenario „Anerkennung“<br />
Das Szenario „Anerkennung“ geht <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er klassischen Dachmarkenstrategie aus. Eine<br />
Dachmarke ist <strong>ein</strong>e übergeordnete Marke <strong>ein</strong>es Markensystems. Es hat den Vorteil <strong>ein</strong>es<br />
hohen Wiedererkennungswertes durch <strong>ein</strong>e hohe Reichweite. Das positive Image <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er<br />
Dachmarke kann auf die Einzelmarken übertragen werden. Die Dachmarke ist als ergänzendes<br />
Element zu bestehenden Systemen zu sehen. Zielgruppe <strong>für</strong> dieses Szenario sind<br />
schwerpunktmäßig bestehende Regionalinitiativen, aber auch die Qualitäts- und<br />
Herkunftszeichen der Bundesländer sowie Handels- und Herstellermarken.<br />
Das Szenario „Anerkennung“ beschreibt die notwendigen Rahmen- bzw. Mindestkriterien, die<br />
<strong>für</strong> die Vergabe des Dachzeichens an Regionalinitiativen/Markeninhaber notwendig sind. Dazu<br />
gehören auch die Vorgaben <strong>für</strong> <strong>ein</strong> erforderliches Zertifizierungssystem sowie <strong>ein</strong><br />
Anerkennungsrat, der die Einhaltung der <strong>Kriterien</strong> bei den verschiedenen Institutionen überprüft<br />
(Anerkennung/Akkreditierung). Die Mindestkriterien im Szenario „Anerkennung“ umfassen auch<br />
Definitionen zur Regionenabgrenzung, zur Produktionstiefe der Landwirtschaft, dem Anteil des<br />
Rohstoffbezuges aus der definierten Region und dem Standort der Verarbeitung.<br />
Mindestkriterien <strong>für</strong> die Vergabe <strong>ein</strong>es Dachzeichens sind:<br />
Abgrenzung der Region<br />
Die Region muss klar abgegrenzt und kl<strong>ein</strong>er als Deutschland s<strong>ein</strong>.<br />
Produktionstiefe Landwirtschaft<br />
Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Urproduktion muss in der angegebenen<br />
Region stattgefunden haben (Beispiel Schw<strong>ein</strong>efleisch: Die gesamte Schw<strong>ein</strong>emast muss in<br />
der Region erfolgen, die Geburt kann in <strong>ein</strong>er anderen Region erfolgen).<br />
Anteil Rohstoffe bei Monoprodukten<br />
100 Prozent der Hauptzutat muss aus der angegebenen Region kommen.<br />
Anteil Rohstoffe bei zusammengesetzten Produkten<br />
100 Prozent der Hauptzutat muss aus der angegebenen Region kommen. Macht die<br />
Hauptzutat weniger als 50 Prozent an der Gesamtmasse des Produktes aus, so müssen auch<br />
weitere Zutaten aus der angegebenen Region kommen, bis mindestens 50 Prozent der<br />
Gesamtmenge. Wasser gilt nicht als Hauptzutat und wird somit nicht beachtet (Beispiel Bier:<br />
Wasser an erster Stelle im Zutatenverzeichnis, die relevante Hauptzutat <strong>für</strong> die „Regionalität“<br />
ist jedoch Gerste/Malz).<br />
Verarbeitung<br />
Die Verarbeitung muss in der angegebenen Region stattfinden. Nur in Ausnahmefällen, wenn<br />
k<strong>ein</strong>e geeigneten Verarbeitungsstätten in der Region vorhanden sind, kann die Verarbeitung<br />
auch in angrenzenden Regionen stattfinden.<br />
Zusatzkriterien<br />
Zusatzkriterien wie die Vermarktung in der Region, Einbeziehung der Vorstufen der<br />
Landwirtschaft (z. B. Futtermittel) oder Auslobung „ohne Gentechnik“ bleiben <strong>für</strong> die Vergabe<br />
<strong>ein</strong>es Dachzeichens unberücksichtigt.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 80
Vorgaben <strong>für</strong> das Kontroll- und Zertifizierungssystem bei <strong>ein</strong>er Vergabe <strong>ein</strong>es<br />
Dachzeichens:<br />
Für die Vergabe des Dachzeichens an Regionalinitiativen oder Regionalmarkeninhaber müssen<br />
diese <strong>ein</strong> eigenes Kontroll- und Zertifizierungssystem haben, das dem klassischen dreistufigen<br />
Kontrollsystem entspricht.<br />
Ein klassisches dreistufiges Kontrollsystem besteht aus:<br />
Eigenkontrolle<br />
Neutrale Kontrolle<br />
Kontrolle der Kontrolle<br />
Die Eigenkontrolle muss <strong>ein</strong>e umfangreiche Dokumentation der Prozesse, <strong>ein</strong>e transparente<br />
Darstellung der Warenströme und definierte Kontrollpunkte aufweisen. Dies gilt nicht nur <strong>für</strong> den<br />
<strong>ein</strong>zelnen Erzeuger, sondern auch <strong>für</strong> die gesamte Wertschöpfungskette. Es muss klare<br />
Vorgaben <strong>für</strong> Umfang und Häufigkeit der Eigenkontrolle geben, inklusive der Kontrollhäufigkeit<br />
<strong>für</strong> alle Stufen der Wertschöpfungskette sowie Sanktionsvorgaben <strong>für</strong> die Teilnehmer.<br />
Regelmäßige Vor-Ort-Überprüfung durch neutrale Kontrollstellen mit anschließender<br />
Zertifizierung der Teilnehmer muss gegeben s<strong>ein</strong>. Die beauftragten neutralen Kontrollstellen<br />
müssen den Vorgaben der DIN EN 45011 entsprechen.<br />
Die Anerkennung der verschiedenen Kontrollsysteme bei den unterschiedlichen Teilnehmern,<br />
Regionalinitiativen oder Regionalmarkeninhabern beziehungsweise die Überprüfung der<br />
durchgeführten externen Kontrollen sowie die Arbeit der zertifizierenden Stellen müssen <strong>von</strong><br />
<strong>ein</strong>er dritten Stelle überprüft werden.<br />
Diese „dritte Stelle“ hat die Aufgabe, formal darzulegen, dass die Kontroll- und<br />
Zertifizierungsstellen die Kompetenz besitzen, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben<br />
durchzuführen. Die „dritte Stelle“ könnte <strong>ein</strong> selbst gewähltes Organ s<strong>ein</strong>, das die Anerkennung<br />
ausspricht, oder es erfolgt die Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS.<br />
Das selbst gewählte Organ (Anerkennungsrat), das sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der<br />
Regionalinitiativen, Herstellern/Erzeugern/Handwerk und Verbraucherschutzorganisationen<br />
zusammensetzt, übernimmt auch die Verwaltung beziehungsweise die Weiterentwicklung des<br />
Dachzeichens und ist gleichzeitig Dachmarkeninhaber.<br />
Lizenzvertrag<br />
Der Dachmarkeninhaber wird zur Absicherung der Dachmarke mit allen Teilnehmern <strong>ein</strong>en<br />
Lizenzvertrag über die Nutzung der Marke abschließen. Die Arbeit des Anerkennungsrates<br />
finanziert sich durch die anfallenden Lizenzgebühren.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 81
Abbildung 25: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>er Akkreditierung<br />
8.3 Szenario „Regionalsiegel“<br />
Das Szenario „Regionalsiegel“ geht <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er klassischen Siegelstrategie aus. Ein Siegel ist<br />
<strong>ein</strong>e Beglaubigung. Es wird beglaubigt, dass der Siegelnutzer <strong>ein</strong>e bestimmte Voraussetzung,<br />
wie die Einhaltung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> (z. B. Einhaltung der EG-Verordnung Nr. 834/2007 = Bio-<br />
Siegel), erfüllt hat. Die Vergabe des Siegels basiert auf der Vorlage <strong>ein</strong>es Zertifikats. Ein Siegel<br />
kann mit anderen Zeichen, Marken oder Siegeln verwendet werden, es kann aber auch all<strong>ein</strong>e<br />
stehen. Das Szenario „Regionalsiegel“ umfasst die notwendigen Vergabekriterien und die<br />
Vorgaben, die <strong>ein</strong> Kontroll- und Zertifizierungssystem erfüllen muss.<br />
Mindestkriterien <strong>für</strong> die Vergabe <strong>ein</strong>es Siegels<br />
Der Siegelnutzer muss nachweisen, dass er folgende Voraussetzungen erfüllt:<br />
klare Regionenbeschreibung<br />
<strong>ein</strong>en prozentualen Rohstoffbezug aus der definierten Region<br />
<strong>ein</strong>e Aussage zum Verarbeitungsort<br />
<strong>ein</strong> neutrales Kontroll- und Zertifizierungssystem<br />
Durch <strong>ein</strong> entsprechendes Zertifikat kann das Siegel vergeben werden.<br />
Vergabeverfahren<br />
Ein zu bildender Vergaberat, der auch gleichzeitig Siegelinhaber ist, vergibt über <strong>ein</strong>en Lizenz-<br />
und Nutzungsvertrag das Regionalsiegel. Der Vergaberat ist ebenso <strong>für</strong> die Weiterentwicklung<br />
und Kommunikation, inklusive der Einführung des Siegels verantwortlich. So kann er <strong>ein</strong>e<br />
Abstufung des Siegels vornehmen, indem er etwa unterschiedliche Stufen <strong>für</strong> den regionalen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 82
Rohstoffbezug festgelegt, wie zum Beispiel 50 Prozent, 70 Prozent und 90 Prozent regionaler<br />
Rohstoffbezug und dies durch <strong>ein</strong>e farbliche Differenzierung symbolisiert.<br />
Abbildung 26: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>es Siegels<br />
8.4 Szenario „Regionalfenster“<br />
Das Szenario „Regionalfenster“ verfolgt den Ansatz <strong>ein</strong>er Herkunftsdeklaration. Der Begriff<br />
Deklaration (lat. declaratio: Kundmachung, Offenbarung) im wirtschaftlichen Gebrauch ist <strong>ein</strong>e<br />
Inhalts- oder Wertangabe <strong>ein</strong>es Handelsgutes (z. B. Zutatenliste gemäß Lebensmittel-<br />
Kennzeichnungsverordnung).<br />
Das Szenario „Regionalfenster“ beschreibt die Vorgehensweise der Herkunftsdeklaration sowie<br />
die notwendigen Rahmen- beziehungsweise Mindestkriterien inklusive des Kontroll- und<br />
Zertifizierungssystems, die <strong>für</strong> die Nutzung des Regionalfensters notwendig sind.<br />
Vorgehensweise im Szenario Regionalfenster<br />
Das Regionalfenster ist nicht als zusätzliches Markenzeichen zu verstehen, sondern als<br />
konkretes Informationsfeld neben der Zutatenliste, in dem die Herkunft der Zutaten deklariert<br />
werden kann. Das Informationsfeld besteht aus drei Bereichen:<br />
dem Claim/der Aussage (z. B. „aus der Region“ oder „Woher kommen die Zutaten“);<br />
der Auslobung beziehungsweise dem Informationsfeld (z. B. die Herkunft der ersten drei<br />
Zutaten aus dem Zutatenverzeichnis, der Herstellungs-/Verarbeitungsort und/oder der<br />
Rohstoffbezug);<br />
dem Hinweis auf die neutrale Überprüfung der im Informationsfeld getätigten Auslobung.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 83
Vergaberahmen des Regionalfensters<br />
Für die Nutzung des Regionalfensters müssen die nachfolgenden Rahmenbedingungen erfüllt<br />
werden:<br />
Abgrenzung der Region und des Rohstoffbezuges:<br />
Die Region muss klar benannt werden und kl<strong>ein</strong>er als die Bundesrepublik Deutschland s<strong>ein</strong>.<br />
Die erste Hauptzutat muss aus dieser Region stammen. Beträgt die Hauptzutat weniger als 50<br />
Prozent des Gesamtgewichts, so müssen weitere Zutaten aus der Region stammen, bis die 50<br />
Prozent erreicht sind.<br />
Vorhandens<strong>ein</strong> <strong>ein</strong>es Qualitätssicherungssystems mit nachvollziehbarer Dokumentationspflicht<br />
beziehungsweise <strong>ein</strong>es neutralen Kontroll- und Zertifizierungssystems.<br />
Die Vergabe des Regionalfensters erfolgt nach Überprüfung der angemeldeten Auslobung im<br />
Informationsfeld. Die Überprüfung erfolgt auf Basis <strong>ein</strong>er neutralen jährlichen Prozesskontrolle,<br />
die beispielsweise durch <strong>ein</strong>en analytischen Herkunftsnachweis mit Hilfe stabiler Isotopen<br />
ergänzt werden kann.<br />
Für die Vergabe und die Beauftragung der neutralen Überprüfung wird <strong>ein</strong> Vergabever<strong>ein</strong><br />
gegründet, in dem das Stimmverhältnis der Mitglieder aus <strong>ein</strong>em Drittel Erzeuger/Verarbeiter,<br />
<strong>ein</strong>em Drittel Handel und <strong>ein</strong>em Drittel Verbrauchervertretern besteht.<br />
Der Vergabever<strong>ein</strong> ist auch Zeicheninhaber und zuständig <strong>für</strong> die Betreuung und<br />
Weiterentwicklung des Regionalfensters. Dazu gehört auch die notwendige Kommunikation zur<br />
Einführung des Regionalfensters.<br />
Abbildung 27: Kontroll- und Vergabemodell des Regionalfensters<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 84
Zusammenfassung<br />
Die vier aufgeführten Szenarien verfolgen grundsätzlich unterschiedliche Ansätze und spiegeln<br />
teilweise die Wünsche und Positionen der verschiedenen Akteure wider.<br />
Das Szenario „Anpassung/Koordination“ umschreibt <strong>ein</strong> gem<strong>ein</strong>schaftliches Vorgehen <strong>von</strong><br />
Bund und Länder mit dem Ziel, bestehende Regelwerke der Länder <strong>für</strong> alle Bundesländer<br />
<strong>ein</strong>zuführen bzw. anzupassen. Bei diesem Szenario besteht die Schwierigkeit, die politischen<br />
Wünsche der Akteure mit der politischen Wirklichkeit und den Möglichkeiten des <strong>BMELV</strong> in<br />
Einklang zu bekommen, besonders in Bezug auf die hoheitlichen Rechte zwischen den<br />
Ländern und des Bundes.<br />
Das Szenario „Anerkennung“ umschreibt <strong>ein</strong>e Dachmarkenstrategie, hinterlegt mit <strong>ein</strong>em<br />
Akkreditierungsmodell und definierten Mindestkriterien. Es dient zur zusätzlichen Anerkennung<br />
bereits bestehender Regionalinitiativen. Nicht geklärt ist hier die Frage der Einführungskosten,<br />
die <strong>ein</strong>e solche Dachmarkenstrategie benötigt, um beim Verbraucher überhaupt<br />
wahrgenommen zu werden.<br />
Das Szenario „Regionalsiegel“ umschreibt <strong>ein</strong>e Siegelstrategie mit <strong>ein</strong>em mehrstufigen<br />
Kontrollsystem. Dabei kann das Siegel eigenständig, losgelöst <strong>von</strong> bestehenden<br />
Regionalzeichen <strong>ein</strong>gesetzt werden. Die Vergabe kann durch <strong>ein</strong> Stufenmodell, z. B. Höhe des<br />
prozentualen Rohstoffbezuges, differenziert werden. Hier wurde ebenfalls die Frage der<br />
Einführungskosten nicht berücksichtigt, die <strong>für</strong> die Bekanntmachung <strong>ein</strong>es Siegels notwendig<br />
sind (siehe Einführungskosten Bio-Siegel). Da in <strong>ein</strong>em frühen Stadium dieses Szenario auf<br />
große Ablehnung stieß, wurde es nicht weiter verfolgt.<br />
Das Szenario „Regionalfenster“ umschreibt <strong>ein</strong>e Strategie der Herkunftsdeklaration mit<br />
Mindestkriterien sowie <strong>ein</strong>em mehrstufigen Kontrollsystem gekoppelt, z. B. mit <strong>ein</strong>em<br />
analytischen Herkunftsnachweis. Die Deklaration erfolgt über <strong>ein</strong> eigenständiges<br />
Informationsfeld, die darin getroffenen Aussagen werden neutral überprüft. Eine weitere<br />
Ausgestaltung kann erst mit den teilnehmenden Akteuren in der Praxis vorgenommen werden.<br />
Der Kostenaspekt der Einführung ersch<strong>ein</strong>t bei diesem Szenario deutlich niedriger zu liegen,<br />
da <strong>ein</strong> Deklarationsfenster selbsterklärend ist und daher <strong>ein</strong>en geringeren<br />
Kommunikationsaufwand bedarf.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 85
9 Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten<br />
Regionalsiegels<br />
Die Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels sollte zum <strong>ein</strong>en <strong>ein</strong>e Analyse<br />
des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte b<strong>ein</strong>halten, um die potenziellen Mengenströme<br />
(u. a. nach Warenbereichen und Vertriebsschienen geordnet) zu quantifizieren, die <strong>ein</strong>em<br />
bundesweiten Regionalsiegel zugrunde liegen können. Zum anderen gilt es, das Potenzial<br />
<strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels bei den Akteuren zu ermitteln. Hier sind eher<br />
grundsätzliche Beurteilungen und Einlassungen zu den Eckpunkten <strong>ein</strong>es solchen<br />
Regionalsiegels <strong>von</strong> den maßgeblichen Marktakteuren gefragt.<br />
Das Absatzpotenzial <strong>für</strong> Regionalprodukte kann aufgrund fehlender belastbarer<br />
Marktforschungsergebnisse - insbesondere auf der Anbieterseite - nur in Ansätzen quantifiziert<br />
werden. Die vorliegenden, auch in jüngster Zeit angestellten Verbraucherbefragungen,<br />
beleuchten ausschließlich die Nachfrageseite und sind unter anderem <strong>für</strong> die Abschätzung <strong>von</strong><br />
Trends hilfreich. Aus den Erfahrungen, die beispielsweise <strong>für</strong> die Abschätzungen der<br />
<strong>Entwicklung</strong> des Ökobereichs ab circa 1985 gemacht wurden - die <strong>Entwicklung</strong> wurde zum Teil<br />
auf Basis der jeweiligen Verbraucherbefragungen maßlos überschätzt -, sollte hier unbedingt<br />
die Anbieterseite integriert werden.<br />
Da eigenständige Marktforschungsarbeiten im Rahmen der Studie nicht vollzogen werden<br />
konnten, wurde <strong>ein</strong>e Auswertung der vorliegenden Fachliteratur und der vorliegenden<br />
Fachstatistiken vorgenommen. Auf Basis dieser Auswertungen wurden - exemplarisch <strong>für</strong><br />
<strong>ein</strong>ige wesentliche Warenbereiche und Vertriebsschienen des Lebensmittelbereichs -<br />
Hilfestellungen gegeben, die <strong>ein</strong>e Einschätzung des Angebotspotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte<br />
erleichtern können. Es bleibt <strong>ein</strong>er weiteren Beauftragung vorbehalten, belastbare Daten zur<br />
Quantifizierung des Absatzpotenzials zu erheben und auszuwerten.<br />
Im Nachgang der Analyse des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte wurde in <strong>ein</strong>em weiteren<br />
Schritt die Potenzialermittlung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalzeichen vorgenommen. Ohnehin<br />
setzt die Potenzialermittlung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> Zeichensystem <strong>ein</strong>e Grobfestlegung der Zeichenkriterien<br />
und deren Aufgabenbestimmung voraus. Eine solche Festlegung gab es jedoch erst zum Ende<br />
des Vorhabens in Form zweier möglicher Alternativen, sodass schlussendlich nur <strong>ein</strong>e sehr<br />
<strong>ein</strong>geschränkte Analyse vorgenommen werden konnte. Da wesentliche Akteursgruppen in der<br />
Anfangsphase schon <strong>ein</strong>gebunden waren, erfolgte die weitere Befragung zur Akzeptanz in<br />
Form <strong>von</strong> Expertengesprächen bei den Sparten- und Spitzenverbänden BVE, BVEO, VDF und<br />
VDM. Diese Expertengespräche auf Basis <strong>ein</strong>es Gesprächsleitfadens bilden die erfahrungs-<br />
und praxisbasierten Beurteilungen, Einlassungen und Relativierungen ab. Sie erlauben k<strong>ein</strong>e<br />
abschließende Beurteilung, stellen aber <strong>ein</strong>e Basis des vorhandenen Potenzials dar.<br />
9.1 Analyse des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte<br />
Aufgabe der Recherche zur Fachliteratur und der vorliegenden Statistiken ist die Identifizierung<br />
belastbarer Forschungsergebnisse zur Frage des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Produkte mit<br />
Regionalhintergrund und <strong>von</strong> Hinweisen auf das Potenzial <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 86
Eine Literaturauswertung 21 der ecco GmbH der Jahre 1994 bis 2007 hat ergeben, dass in dem<br />
genannten Zeitraum der zahlenmäßige Höhepunkt der Veröffentlichungen zu diesem Thema<br />
um die Jahrtausendwende liegt. Folgende Themen wurden im Kontext Regionalvermarktung<br />
bearbeitet:<br />
Management regionaler Vermarktungsansätze<br />
Kommunikationspolitische Themen<br />
Produkt- und Sortimentspolitiken<br />
Wertschöpfungsketten, distributionspolitische und logistische Fragestellungen<br />
Untersuchungen zu Preisbereitschaften <strong>für</strong> regionale Lebensmittel<br />
Untersuchungen zu „regionalen Energiebilanzen“<br />
Fragen zur Vernetzung/zur Bedeutung regionaler Kooperationen und Netzwerke<br />
Fragen zum „richtigen“ Zuschnitt der Region(en)<br />
Regionalität, Nachhaltigkeit und Kultur<br />
Zusammenfassend halten die Autoren fest: Es wurde „bereits <strong>ein</strong>iges bearbeitet - aber nicht<br />
immer mit der als notwendig ersch<strong>ein</strong>enden empirischen Fundierung“ 22 .<br />
Die Durchsicht der als relevant angesehenen Studien im Beobachtungszeitraum <strong>von</strong> 2006 bis<br />
heute und deren datenbankbasierte Zuordnung zu Warengruppen und Vertriebsschienen (siehe<br />
Anhang 12.13, Matrix Potenzialanalyse) hat hinsichtlich der Fragestellung nach dem Potenzial<br />
<strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel nur wenig Erhellendes und nahezu k<strong>ein</strong>e belastbaren<br />
Quantifizierungen zutage gefördert. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, handelt es sich um<br />
politisch intendierte Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> Politik und Praxis auf Grundlage <strong>ein</strong>es<br />
„gefühlten“ Bedarfes.<br />
Unterschiedliche Auffassungen gibt es in der Literatur insbesondere zur Frage, welche<br />
Eigenschaften regionale Produkte aufweisen, beziehungsweise wo<strong>für</strong> Regionalvermarktung<br />
steht oder stehen sollte. „Regionalität gibt dem Zeitgeist <strong>ein</strong> Zuhause, Regionalität ist <strong>ein</strong><br />
frisches Produkt mit kurzen Transportwegen, k<strong>ein</strong>esfalls aber <strong>ein</strong> ethisches Thema“, so die<br />
DLG-Studie 2011 23 . Ganz anders sehen das Autoren wie Wagenhofer 24 und Fahrner 25 , die<br />
stellvertretend <strong>für</strong> die Autoren erwähnt werden, die Regionalität und regionale Produkte als<br />
Alternativentwurf zur wachstumsbasierten internationalen Arbeitsteilung, Globalisierung<br />
genannt, sehen. Von Kulturkampf über solides Herkunftsmarketing bis hin zur „mogelnden“<br />
Handelsmarke: Regionalität steht heute <strong>für</strong> vieles und entwickelt sich dynamisch.<br />
Zur Ver<strong>ein</strong>fachung werden im Folgenden Produkte, deren regionale Herkunft als explizite<br />
Eigenschaft herausgestellt wird, als „regionale Produkte“ bezeichnet.<br />
21<br />
Ecco GmbH, 2008. Zum Stand der Forschung, Vortrag Verbraucherzentrale Bundesverband - Seminar V 812<br />
Regional erzeugte Lebensmittel: Trends, Definitionen, Qualität 19. Bis 21. Mai 2008 in Hannover.<br />
22<br />
ebda<br />
23<br />
DLG, 2011. Neue DLG-Studie: Regionalität aus Verbrauchersicht.<br />
24<br />
vgl. Wagenhofer, Gertraud, 2007. Globalisierung versus Regionalisierung: Lebensmittel zwischen<br />
Regionalisierung und Globalisierung. Innsbruck: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.<br />
25<br />
vgl. Fahrner, Andreas, 2010. Potentialanalyse <strong>für</strong> die b2b-Vermarktung regionaler Lebensmittel im Wechselland.<br />
Diplomarbeit. Wien: Universität Wien.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 87
Dimensionierung der Absatzpotenziale nach Vertriebsschienen<br />
Zur dimensionsgerechten Einordnung regionaler Produkte wird zunächst die Vielfalt an<br />
Lebensmitteln beschrieben. Dazu dient der Blick in die Logistik/Warenwirtschaft: Ein Großteil<br />
aller gehandelten Food-Artikel ist mit Barcodes aus dem GS1-System versehen. Für den<br />
deutschen Markt werden dort „zwischen 600.000 und 700.000“ 26 Food-Artikel gekennzeichnet.<br />
Von diesen werden beispielsweise durchschnittlich in/bei<br />
SB-Warenhäusern rd. 15.500<br />
Großen Supermärkten rd. 13.200<br />
Supermärkten rd. 7.900<br />
Discountern rd. 1.440<br />
Artikel vorgehalten, <strong>ein</strong> Indiz da<strong>für</strong>, dass die wesentlichen Akteure im Handelsbereich sich dem<br />
Thema regionale Herkunft unter dem Aspekt Nischenmarketing nähern müssen.<br />
Des Weiteren werden die Versorgungsalternativen (Bezugsquellen) privater Haushalte <strong>für</strong><br />
Lebensmittel aufgezeigt. Danach tragen die <strong>ein</strong>zelnen Bereiche 27 zur Versorgung wie folgt<br />
bei 28 :<br />
Hersteller, Landwirte, Winzer, Beziehungskäufe 2,6 %<br />
Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien 9,3 %<br />
C+C Großhandel 1,1 %<br />
Universal<strong>ein</strong>zelhandel 45,8 %<br />
Spezial<strong>ein</strong>zelhandel 14,3 %<br />
Versandhandel 0,2 %<br />
Verkaufswagen, Heimdienste, Wochenmärkte 2,2 %<br />
Gastronomie, Hotels, Kantinen, Imbiss 24,5 %<br />
Auch wenn regionale Produkte grundsätzlich über alle Absatzmittler vertrieben werden können,<br />
ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass insbesondere der stationäre Einzelhandel mit <strong>ein</strong>em Anteil <strong>von</strong><br />
rund 60 Prozent <strong>ein</strong> gewichtiges Wort mitredet, wenn es um die Ausgestaltung <strong>von</strong> und s<strong>ein</strong>e<br />
Anforderungen an regionale Lebensmittel geht. Verbraucher berichten, dass sie vor allem im<br />
Supermarkt und in den Medien etwas über das Thema Regionalität hören 29 .<br />
Es ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass der Absatz explizit als regional beworbener Produkte<br />
ursprünglich vor allem über die Schienen Landwirte, Winzer, Verkaufswagen, Wochenmärkte,<br />
Gastronomie erfolgte. Der Beitrag des LEH nimmt stetig zu, dazu tragen Handelsmarken,<br />
Regionalecken, der Naturkosthandel und die Neuentdeckung bereits <strong>ein</strong>geführter<br />
Regionalprodukte wie etwa im Segment Getränke bei.<br />
Die deutsche Ernährungsindustrie, die den inländisch erzeugten Anteil an der Vielzahl der<br />
Food-Produkte verantwortet, befasst sich, wenn überhaupt, im Bereich der Markenführung oder<br />
26<br />
Lorry, Burkhard, SA2 Worldsync GmbH. Telefonische Auskunft am 18.11.2011.<br />
27<br />
ohne Berücksichtigung der Selbstversorgung<br />
28<br />
Quelle: Dr. Lademann & Partner In: The Nielson Company (Germany) 2011 TOP-Firmen 2012.<br />
29<br />
Quelle: DLG, 2011. Neue DLG-Studie: Regionalität aus Verbrauchersicht.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 88
im Rahmen <strong>von</strong> Premiumstrategien <strong>für</strong> den heimischen Markt mit der regionalen Herkunft und<br />
deren Auslobung.<br />
Landwirtschaftliche Direktvermarkter und kl<strong>ein</strong>ere Getreidemühlen sind im Wesentlichen per se<br />
regional, auch wenn diese Eigenschaft nicht bei allen hervorgehoben wird. Dieses gilt, wenn<br />
auch nicht im selben Umfang, <strong>für</strong> das Ernährungshandwerk.<br />
9.2 Absatzpotenziale nach ausgewählten Wirtschaftszweigen der<br />
Land- und Ernährungswirtschaft<br />
9.2.1 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Landwirtschaft<br />
Für den Bereich Landwirtschaft werden nachfolgend exemplarisch die landwirtschaftliche<br />
Direktvermarktung, Ökobetriebe, Ackerbaubetriebe (Getreideerzeugung) und Futterbaubetriebe/Tierhaltungsbetriebe<br />
vor dem Hintergrund ihres Absatzpotenzials <strong>für</strong> Produkte mit<br />
regionalem Hintergrund analysiert und quantifiziert.<br />
9.2.1.1 Landwirtschaftliche Direktvermarktung<br />
Unter Berufung auf Recke und Wirthgen (2004a) und die ZMP (2002) geht Hasan 30 da<strong>von</strong> aus,<br />
dass in Deutschland circa 60.000 landwirtschaftliche Betriebe ihre Produkte ohne<br />
Zwischenhändler absetzen, darunter seien circa 14.500 professionelle Direktvermarkter (10.170<br />
ökologische und 4.325 konventionelle Betriebe). Dies entspräche etwa 3,68 Prozent aller<br />
landwirtschaftlichen Betriebe, wenn man <strong>ein</strong>e Gesamtzahl <strong>von</strong> ca. 380.000 Betrieben zugrunde<br />
legt. Geografisch verteilen sich die professionellen Direktvermarkter mit circa 12.842 Betrieben<br />
auf Westdeutschland und mit 1.653 Betrieben auf Ostdeutschland. Als Folge der Anzahl großer<br />
Betriebe gäbe es in <strong>ein</strong>igen Regionen Ostdeutschlands, wie zum Beispiel in Berlin, Sachsen<br />
und Thüringen <strong>ein</strong>e relativ starke <strong>Entwicklung</strong> in Richtung Direktvermarktung. Dagegen schätzt<br />
die Fördergem<strong>ein</strong>schaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“ die Zahl der direktvermarktenden<br />
Bauernhöfe „in Ermangelung offizieller Statistik auf 20.000 bis 30.000“ Betriebe 31 . Auch Recke<br />
und Wirthgen 32 können nur „grob schätzen“: Sie beziffern die Zahl der Betriebe, „bei denen die<br />
Direktvermarktung <strong>ein</strong>en bedeutenden Anteil“ habe auf circa 30.000, bei denen es sich<br />
„überwiegend um Vollerwerbsbetriebe“ handele 33 .<br />
Das theoretische Potenzial liegt bei 14.500 bis 30.000 Betrieben.<br />
9.2.1.2 Ökobetriebe<br />
„Im Jahr 2010 bewirtschaften in Deutschland 16.500 Betriebe 941.500 Hektar landwirtschaftlich<br />
genutzte Fläche nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Somit sind fast sechs<br />
30<br />
Hasan, Yousra, 2006. Einkaufsverhalten und Kundengruppen bei Direktvermarktern in Deutschland: Ergebnisse<br />
<strong>ein</strong>er empirischen Analyse. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen.<br />
31<br />
Quelle: www.<strong>ein</strong>kaufen-auf-dem-bauernhof.com/redid=261369<br />
32<br />
Quelle: www.gil.de/dokumente/berichte/DDD/R9_02-0040.pdf<br />
33<br />
vgl. www.gil.de/dokumente/berichte/DDD/R9_02-0040.pdf<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 89
Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe dem Ökolandbau zuzurechnen und praktizieren diesen<br />
auf sechs Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dabei gibt es zwischen den<br />
Bundesländern erhebliche Unterschiede. Prozentual gesehen liegt der Anteil der Ökobetriebe in<br />
Mecklenburg-Vorpommern (15 Prozent) und Brandenburg (12 Prozent) am höchsten. Im<br />
Verhältnis zu diesen agieren die Landwirte in Niedersachsen (3 Prozent), Schleswig-Holst<strong>ein</strong> (3<br />
Prozent) und Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen (4 Prozent) aus ökologischer Sicht eher zurückhaltend.<br />
Absolut gesehen wirtschaften sehr viele Ökobetriebe in Bayern (5.700), gefolgt <strong>von</strong> Baden-<br />
Württemberg (3.000), auch bedingt durch die hohe Gesamtzahl an Agrarbetrieben in diesen<br />
Bundesländern.“ 34<br />
Bei entsprechender Ausgestaltung des bundesweiten Regionalsiegels käme <strong>ein</strong> Großteil der<br />
Ökobetriebe als Vorlieferanten in <strong>ein</strong> Herkunftszeichen-System infrage.<br />
Das theoretische Potenzial liegt bei 16.500 Betrieben.<br />
9.2.1.3 Ackerbaubetriebe - Getreide<br />
Rund 25 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe sind auf den Marktfruchtanbau fokussiert 35 .<br />
Diese rund 75.000 Getreideerzeuger vermarkten im Wesentlichen an die Erfassungsstufe<br />
und/oder - in Gänze oder zu Teilen - direkt an Mühlen. Beide Gruppen kommen in der Funktion<br />
des Rohstofflieferanten als Systempartner <strong>für</strong> <strong>ein</strong> Regionalsiegel infrage. Voraussetzung ist<br />
da<strong>für</strong> <strong>ein</strong> entsprechendes Engagement der nachgelagerten Stufen <strong>für</strong> <strong>ein</strong>en vertikalen Verbund<br />
und dessen „<strong>ein</strong>ladende“ Ausgestaltung. Limitiert ist die derart absetzbare Menge und da<strong>für</strong><br />
benötigte Zahl der Marktfruchtbetriebe a) vom Anteil der <strong>für</strong> die Vermahlung zur menschlichen<br />
Ernährung angebauten Getreidesorten und b) vom regionalen Absatz der Mühlen an<br />
Regionalmarketing treibende Mehlabnehmer.<br />
Das theoretische Potenzial liegt bei 75.000 Betrieben.<br />
9.2.1.4 Futterbaubetriebe/Tierhaltung<br />
Von direktvermarktenden Betrieben abgesehen können landwirtschaftliche Erzeuger nur im<br />
Rahmen <strong>von</strong> vertikalen Verbünden die regionale Karte spielen. Diese setzen in der Regel <strong>ein</strong>e<br />
Zertifizierung voraus. Zur Abschätzung des Potenzials <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel im<br />
Bereich der Schlachttierproduktion werden hier die Angaben der QS-Organisation 36 verwendet.<br />
Danach sind (Stand 2011) insgesamt 59.084 Rinderhalter, 38.057 Schw<strong>ein</strong>ehalter und 3.865<br />
Geflügelhalter nach QS-<strong>Kriterien</strong> zertifiziert. Nach eigenen Angaben beträgt die<br />
Marktdurchdringung bei den Rinderhaltern rund 60 Prozent, bei den Schw<strong>ein</strong>ehaltern und den<br />
Geflügelhaltern je rund 95 Prozent. 100 Prozent der Schlacht- und Zerlegebetriebe (361), 27<br />
Prozent der Fleischverarbeitungsbetriebe (259) und 83 Prozent des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels<br />
(23.132) sind Systempartner der QS-Organisation. Ein nicht näher zu bezifferndes<br />
theoretisches Potenzial besteht <strong>für</strong> den Anteil an Schlachttieren, deren Folgeprodukte im Inland<br />
und insbesondere im regionalen Umkreis der jeweiligen Erzeuger-, Schlacht- und<br />
Verarbeitungsbetriebe vermarktet werden. Aufgrund der Anzahl und Größe der Schlachtstätten,<br />
deren räumlicher Verteilung und dem Vorhandens<strong>ein</strong> <strong>von</strong> Schlachttieren, dürfte das Potenzial<br />
34<br />
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Agrarstrukturen in Deutschland 2010 (24)<br />
35<br />
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Agrarstrukturen in Deutschland 2010 (18)<br />
36<br />
Verfügbar unter: www.q-s.de/mc_marktinformationen_fleisch.html<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 90
<strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel <strong>für</strong> Schlachttiererzeuger im Süden Deutschlands höher<br />
s<strong>ein</strong> als in den anderen Landesteilen.<br />
9.2.2 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Ernährungsindustrie<br />
Die Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie positioniert sich zum Thema<br />
Regionalität wie folgt 37 : „Lebensmittel aus der Region sind <strong>ein</strong> Trend, der sowohl beim<br />
Verbraucher als auch bei den Erzeugern immer beliebter wird. Gerade kl<strong>ein</strong>ere und<br />
mittelständische Erzeuger und Verarbeitungsunternehmen haben so die Chance, die Vorzüge<br />
ihrer Region mit dem Produkt und der Herstellung zu verknüpfen. Gleichzeitig entwickelt der<br />
Verbraucher <strong>ein</strong> tieferes Verständnis <strong>für</strong> Lebensmittel, ihre Herkunft und die<br />
Wertschöpfungsprozesse, was zu höherer Wertschätzung und Zahlungsbereitschaft führt. Der<br />
Markt <strong>für</strong> regionale Produkte wächst dynamisch.“ Aus gleicher Quelle weiter zum Thema<br />
Rohstoffbezug: „Zu den wichtigsten Rohstoffen zählen neben Fleisch und Milch, Getreide,<br />
Ölsaaten, Gemüse und Hackfrüchte wie Kartoffeln und Zuckerrüben. Rund drei Viertel der<br />
verarbeiteten Rohstoffe stammen aus Deutschland. Ein Viertel der Rohstoffe wird im Ausland<br />
<strong>ein</strong>gekauft, da sie in Deutschland nicht in ausreichenden Mengen vorhanden sind oder nicht<br />
angebaut werden können wie Kaffee und Kakao (…). Die Ernährungsindustrie erwirtschaftet<br />
28,7 Prozent ihres Umsatzes im Auslandsgeschäft“.<br />
Aus den genannten Zahlen ergibt sich <strong>ein</strong> erhebliches Potenzial <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong><br />
Regionalsiegel, das nach Festlegung des Zeichensystems näher untersucht werden kann.<br />
Für den Bereich Ernährungsindustrie werden nachfolgend exemplarisch die Fleischwirtschaft<br />
und die Mühlenwirtschaft vor dem Hintergrund ihres Absatzpotenzials <strong>für</strong> Produkte mit<br />
regionalem Hintergrund analysiert.<br />
9.2.2.1 Fleischwirtschaft<br />
„Die in der Landwirtschaft erzeugten und gehandelten Tiere werden geschlachtet und<br />
weiterverarbeitet und gelangen über mehrere Stufen zu den Verbrauchern. In Deutschland<br />
haben die Landwirte die Möglichkeit, ihre Tiere an den privaten oder genossenschaftlichen<br />
Viehhandel, an Erzeugergem<strong>ein</strong>schaften oder direkt an Schlachtunternehmen zu verkaufen.<br />
Außerdem kann der Landwirt als Direktvermarkter s<strong>ein</strong>e Fleisch- und Wurstwaren unmittelbar<br />
an den Verbraucher absetzen. Über Verbrauchermärkte, Discountgeschäfte, Fleischerfachgeschäfte,<br />
sonstige Lebensmittelgeschäfte <strong>ein</strong>schließlich Supermärkte, Wochenmärkte und<br />
Direktbezug gelangen die Fleisch- und Wurstwaren zu den Endverbrauchern. Daneben wird<br />
Fleisch auch in der Gastronomie und in Großverbraucher<strong>ein</strong>richtungen wie Mensen und<br />
Heimen verzehrt.“ 38<br />
Wie unter dem Bereich „Futterbaubetriebe/Tierhaltungsbetriebe“ erläutert, besteht auch hier <strong>ein</strong><br />
nicht näher zu bezifferndes theoretisches Potenzial an Fleisch und Wurstwaren, die im Inland<br />
und insbesondere im regionalen Umkreis der jeweiligen Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe<br />
vermarktet werden können.<br />
37<br />
BVE Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie Jahresbericht 2010_2011.<br />
38<br />
Gurrath, Peter, 2008. Fleischversorgung in Deutschland Ausgabe 2008. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 91
9.2.2.2 Mühlenwirtschaft<br />
„Heute gibt es in Deutschland rund 600 Mühlen, <strong>von</strong> denen 308 mit <strong>ein</strong>er Vermahlung <strong>von</strong><br />
mindestens 500 Tonnen im Jahr meldepflichtig sind. 61 große Mühlen mit <strong>ein</strong>er<br />
Jahresvermahlung <strong>von</strong> 25.000 Tonnen und mehr haben <strong>ein</strong>en Anteil an der<br />
Gesamtvermarktung <strong>von</strong> 84,9 Prozent. 272 Mühlen mit <strong>ein</strong>er Jahresvermahlung zwischen 500<br />
und 25.000 Tonnen besitzen <strong>ein</strong>en Marktanteil <strong>von</strong> 15,1 Prozent.“ 39 Die Verteilung der<br />
Mühlenbetriebe in Deutschland lässt sich als südlastig beschreiben und spiegelt die Strukturen<br />
in Land- und Ernährungswirtschaft wider. Von den kl<strong>ein</strong>en Mühlen (500 bis unter 5.000 Tonnen<br />
Jahresvermahlung) sind im Süden rund 60 Prozent, im Westen und Osten je rund 17 Prozent<br />
und nur etwa 4 Prozent im Norden. Bei den Mühlen mit <strong>ein</strong>er Jahresvermahlung <strong>von</strong> 5.000 bis<br />
unter 25.000 Tonnen sind 51 Prozent im Süden, 14,5 Prozent im Westen, 12,2 Prozent im<br />
Osten und 14 Prozent im Norden. Bei den 63 Mühlen mit <strong>ein</strong>er Jahresvermahlung <strong>von</strong> über<br />
25.000 Tonnen sind im Süden 38 Prozent, im Westen 25 Prozent, im Osten 17,4 Prozent und<br />
im Norden 15,8 Prozent. 40 Von Bedeutung <strong>für</strong> die Potenzialanalyse sind Angaben über die<br />
räumliche Ausgestaltung des Mehlabsatzes und des Rohstoffbezugs. Nach Schmidt et. al. 41<br />
setzten die Mühlen 2007 86 Prozent ihres Mehles im Umkreis bis zu 100 Kilometer ab, die 247<br />
kl<strong>ein</strong>eren Mühlen (bis unter 25.000 Tonnen Jahresvermahlung) sogar bis zu 96 Prozent in<br />
diesem Bereich. Durchschnittlich sind es bei ihnen 48 Kilometer bis zum Abnehmer. Das<br />
Bäckerhandwerk bezieht zu zwei Dritteln das Mehl <strong>von</strong> kl<strong>ein</strong>eren Mühlen und zu <strong>ein</strong>em Drittel<br />
<strong>von</strong> den größeren (über 25.000 Tonnen Jahresvermahlung) 42 . Die Ernährungsindustrie bezieht<br />
6,5 Prozent des Mehles der kl<strong>ein</strong>eren Mühlen und gut 32 Prozent des Mehles der größeren<br />
Mühlen. Wiederverkäufer bekommen 14,2 Prozent des Mehles der kl<strong>ein</strong>eren Mühlen und 11,8<br />
Prozent des Mehles der größeren Mühlen. Beim LEH sind die Zahlen 3,7 Prozent und 1,75<br />
Prozent. Die kl<strong>ein</strong>eren Mühlen beziehen ihr Getreide zu 60 Prozent <strong>von</strong> Landwirten/Erzeugergem<strong>ein</strong>schaften<br />
(EZG) und zu 30 Prozent vom regionalen Agrarhandel. Überregionaler und<br />
internationaler Handel tragen zu insgesamt 10 Prozent zum Gesamtbezug bei. Auch die<br />
größeren Mühlen versorgen sich überwiegend in der Region: Ihren Bezug tätigen sie zu rund 44<br />
Prozent beim regionalen Agrarhandel, zu etwa 36 Prozent <strong>von</strong> Landwirten/EZGen und zu 20<br />
Prozent <strong>von</strong> überregionalen/internationalen Anbietern. Bei den kl<strong>ein</strong>eren Mühlen besteht der<br />
Mehlabsatz zu 13,1 Prozent aus vorgefertigten Typen-Mehlmischungen, bei den größeren zu<br />
knapp 20 Prozent. Die kl<strong>ein</strong>eren Mühlen beliefern mit den Mischungen zu 22,7 Prozent die<br />
Ernährungsindustrie und zu 77,3 Prozent das Handwerk. Bei den größeren Mühlen ist das<br />
Verhältnis umgekehrt: 79,4 Prozent gehen an die Ernährungsindustrie, 20,6 Prozent an das<br />
Handwerk.<br />
Unter dem Titel „Absatzströme“ analysiert das <strong>BMELV</strong> 43 wie folgt: „In den Regionen Nord und<br />
Ost ist jeweils <strong>ein</strong> nahezu ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Absatz <strong>von</strong> Mehl aus<br />
Brotgetreide innerhalb und außerhalb des eigenen Bundeslandes festzustellen. In den<br />
39<br />
www.muehlen.org/wirtschaft.html<br />
40<br />
Quelle: Kunkel, Sabrina, Uwe Platz und R<strong>ein</strong>hard Wolter, 2011. Die Struktur der Mühlenwirtschaft in Deutschland.<br />
Wirtschaftsjahr 2009/10. Bonn: Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.).<br />
S. 38 (eigene Berechnungen).<br />
41<br />
Schmidt, Christian, Oliver Halk und Werner Detmering, 2008. Betriebsvergleich der deutschen Mühlenwirtschaft<br />
2007: Ergebnisbericht <strong>ein</strong>er Unternehmenserhebung. Hannover: Marketinggesellschaft der niedersächsischen<br />
Land- und Ernährungswirtschaft e.V.<br />
42<br />
eigene Schätzung<br />
43<br />
Kunkel, Sabrina, Uwe Platz und R<strong>ein</strong>hard Wolter, 2011. Die Struktur der Mühlenwirtschaft in Deutschland.<br />
Wirtschaftsjahr 2009/10. Bonn: Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.).<br />
S. 16 ff.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 92
Regionen West und Süd liegt das Verhältnis mit etwa drei zu <strong>ein</strong>s beim Absatz innerhalb des<br />
eigenen Bundeslandes. Dies lässt sich damit begründen, dass in Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen aufgrund<br />
der hohen Bevölkerungszahl <strong>ein</strong>e große Nachfrage nach Mehl besteht und daher entsprechend<br />
große Mengen im eigenen Bundesland abgesetzt werden können. Auch in der Region Süd, vor<br />
allem in Bayern, spielt der regionale Verkauf <strong>ein</strong>e große Rolle. Bei der Betrachtung nach<br />
Größenklassen fällt auf, dass der Absatz außerhalb des eigenen Bundeslandes mit<br />
zunehmender Größe kontinuierlich ansteigt. Die kl<strong>ein</strong>en Mühlen bis 5.000 Tonnen setzten etwa<br />
10,4 Prozent ihrer Vermahlungsmenge außerhalb des eigenen Bundeslandes ab. Große<br />
Mühlen ab 100.000 Tonnen etwa 43,1 Prozent. In der Region Nord weisen auch schon kl<strong>ein</strong>e<br />
Mühlen <strong>ein</strong>e hohe Absatzmenge außerhalb des eigenen Bundeslandes auf. In der Region West<br />
war der Absatz außerhalb des eigenen Bundeslandes bei Mühlen mit <strong>ein</strong>er Gesamtvermahlung<br />
über 100.000 Tonnen kl<strong>ein</strong>er als bei Mühlen zwischen 50.000 Tonnen bis unter 100.000<br />
Tonnen Jahresvermahlung. Im Süden beträgt der Anteil am Absatz außerhalb des eigenen<br />
Bundeslandes in der Größenklasse zwischen 50.000 Tonnen bis unter 100.000 Tonnen<br />
Gesamtvermahlung 7,6 Prozent. Bei <strong>ein</strong>er Gesamtvermahlung über 100.000 Tonnen beträgt<br />
der Absatz in andere Bundesländer 41,3 Prozent und ist damit höher als der Mittelwert aller<br />
Mühlen in Deutschland (35,2 Prozent). Die Region Ost hatte auch schon in der kl<strong>ein</strong>sten<br />
Größenklasse fast 20 Prozent des Absatzes außerhalb des eigenen Bundeslandes. In den<br />
folgenden Größenklassen steigt dieser Anteil an.“<br />
Theoretisch gibt es aufgrund der relativ kl<strong>ein</strong>räumigen Bezugs- und Absatzstruktur vor allem<br />
kl<strong>ein</strong>erer Mühlen bei entsprechender Ausgestaltung <strong>ein</strong> beachtliches Potenzial im<br />
Getreide/Mehl/Backwaren-Bereich <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel.<br />
9.2.3 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen des Ernährungshandwerks<br />
Für den Bereich des Ernährungshandwerks werden nachfolgend exemplarisch die<br />
Fleischereien und Bäckereien vor dem Hintergrund ihres Absatzpotenzials <strong>für</strong> Produkte mit<br />
regionalem Hintergrund analysiert.<br />
9.2.3.1 Fleischereien<br />
„Definition: Das Fleischereigewerbe (WZ 10.13) wird nach Systematik der Wirtschaftszweige<br />
des Statistischen Bundesamtes <strong>von</strong> 2008 dem Wirtschaftszweig 10.1 „Schlachten und<br />
Fleischverarbeitung“ zugeordnet. Daten: 15.770 Unternehmen mit circa 151.300 Mitarbeitern<br />
erzielen 2009 <strong>ein</strong>en Umsatz <strong>von</strong> 15,74 Milliarden Euro. Status: Die Branche hat im Jahr 2009<br />
nur geringe Umsatzverluste verzeichnet. Perspektiven: Steigendes Qualitätsbewussts<strong>ein</strong> sowie<br />
der Trend zu gesunden Produkten eröffnen der Branche neue Chancen. (Quelle: Deutscher<br />
Fleischer-Verband (DFV); Statistisches Bundesamt) 44<br />
„Die Mehrzahl der Fleischerfachbetriebe schlachtet heute nicht mehr selbst, sondern kauft vom<br />
Schlachthof oder <strong>von</strong> Zerlegebetrieben zu. Laut Verbandsstatistik (Deutscher Fleischer-<br />
Verband 2008) beträgt der Einkauf <strong>von</strong> Lebendvieh 5,7 bis 9,2 Prozent der Umsatzerlöse <strong>ein</strong>es<br />
Fleischerfachgeschäftes, der Einkauf <strong>von</strong> Teilstücken dagegen 19,1 bis 30,5 Prozent (...). Als<br />
44 Quelle: Gothaer: Der KMU-Branchen-Wegweiser Fleischverarbeitung Stand: 2011.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 93
„regional vermarktet“ könnte man die Hausschlachtungen, bei Rindern circa <strong>ein</strong> Prozent aller<br />
Schlachtungen, bezeichnen (…).“ 45<br />
Der Anteil selbstschlachtender Fleischereien ist rückläufig. Eine Ursache sind unter anderem<br />
die hygienerechtlichen Auflagen. Eine Untersuchung 46 hat gezeigt, „dass immer mehr neue<br />
lebensmittelrechtliche Auflagen dem Nahrungsmittelhandwerk zum Teil sehr hohe Kosten<br />
verursachen. Kl<strong>ein</strong>e Betriebe können diese Kosten nur auf <strong>ein</strong>e kl<strong>ein</strong>e Produktionsmenge<br />
umlegen, was die Produktpreise nach oben schnellen lässt. Das wiederum schränkt die<br />
Nachfrage <strong>ein</strong> und die Möglichkeit, durch Qualitätserzeugung und regionale Vermarktung Arbeit<br />
und Einkommen in den ländlichen Räumen zu halten.“<br />
Anmerkung: Gleiches gilt <strong>für</strong> die landwirtschaftlichen Direktvermarkter, die sich mit der<br />
Fleischvermarktung befassen.<br />
Da der die Groß- und Kl<strong>ein</strong>strukturen ver<strong>ein</strong>heitlichende Regulierungsdruck <strong>von</strong> der EU-Ebene<br />
anhalten dürfte, ist <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em weiteren Rückgang der Zahl kl<strong>ein</strong>erer Fleischereien auszugehen.<br />
Ob sich diese <strong>Entwicklung</strong> als nachteilig <strong>für</strong> die Vermarktung regionaler Produkte und das<br />
Potenzial <strong>ein</strong>es Regionalsiegels auswirkt, ist fraglich: Denn die bisher verbreitete Einschätzung,<br />
wonach die Selbstschlachtung Voraussetzung <strong>für</strong> die Vermarktung regionaler Produkte sei, ist<br />
in dieser Stringenz nicht mehr aufrechtzuerhalten.<br />
So sind es gerade die großen Schlachtunternehmen, die den Abnehmern ihrer Hälften und<br />
Teilstücke <strong>ein</strong>en Herkunftsnachweis - gewonnen aus den während der Prozessdokumentation<br />
angefallenen Daten - als Zusatzleistung anbieten könnten oder es schon tun: inzwischen, wie<br />
zum Beispiel beim f-trace-System 47 , auch mit internetbasierter Erzeugeridentifizierung. Wenn<br />
auch diese Art Herkunftsnachweis derzeit vor allem <strong>für</strong> regionale Handelsmarken genutzt wird,<br />
ist es auch <strong>für</strong> das Fleischerhandwerk <strong>ein</strong>e denkbare Option.<br />
Laut Auskunft 48 des Deutschen Fleischer-Verbandes rechnet man <strong>für</strong> das Jahr 2011 mit 15.200<br />
fleischerhandwerklichen Betrieben in Deutschland.<br />
Etwa 30 Prozent dieser Betriebe schlachten in eigener Schlachtstätte oder schlachten selbst in<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsschlachtstätten oder lokalen Schlachthöfen. Eine genaue Anzahl werde<br />
statistisch nicht erfasst. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen (selbstständige<br />
Franchisenehmer) sei die Herstellung <strong>von</strong> Wurstwaren und sonstigen Fleischerzeugnissen in<br />
den Betrieben obligatorisch. Sie sei das Wesensmerkmal des Fleischerhandwerks.<br />
Ein Teil der Betriebe verarbeite und vermarkte ausschließlich Fleisch aus eigener Schlachtung.<br />
Der weitaus größte Teil der Betriebe (circa 80 Prozent) kaufe regelmäßig oder in saisonalen<br />
Spitzenzeiten (z. B. Grillsaison) Teilstücke zu. Der Fleischzukauf könne sich auch auf<br />
bestimmte Fleischqualitäten konzentrieren (bestimmte Fleischrassen, Qualitätsfleischprogramme).<br />
Etwa 80 Prozent der Schlachtbetriebe kauften zur Ergänzung ihrer Sortimente Wurstwaren und<br />
sonstige Fleischerzeugnisse zu. Dies gelte zum Beispiel <strong>für</strong> herkunftsgeschützte Produkte wie<br />
Parmaschinken oder regionale Spezialitäten wie Schwarzwälder Schinken.<br />
45<br />
Kögl, Hans und Jana Tietze, 2010. Regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung <strong>von</strong> Lebensmitteln,<br />
Forschungsbericht. Uni Rostock. S. 163.<br />
46<br />
Fink-Keßler, Andrea et al., 2003. Mit Kanonen auf Spatzen geschossen - Rechtliche Hemmnisse <strong>ein</strong>er<br />
handwerklichen Fleischverarbeitung und -vermarktung <strong>von</strong> Landwirten und Metzgern. Teil 1. In: arbeitsergebnisse<br />
Heft 55. Zeitschrift der AG Land- und Regionalentwicklung. Kassel: Universitätsverlag.<br />
47<br />
www.f-trace.de/web<br />
48<br />
Hühne, Klaus, Deutscher Fleischer-Verband e.V., 2011. E-Mail-Befragung am 25.11.2011.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 94
Nur wenige hundert Betriebe kauften ausschließlich zu. Diese seien in der Regel selbstständige<br />
Franchisenehmer <strong>von</strong> handwerklichen Filialbetrieben.<br />
Die Selbstschlachtung wird vom Deutschen Fleischer-Verband zwar als zuträglich aber nicht als<br />
unabdingbar <strong>für</strong> die Anerkennung <strong>von</strong> Fleisch- und Wurstwaren als Regionalprodukte gesehen.<br />
Sowohl der Zukauf <strong>von</strong> Fleisch als auch der <strong>von</strong> Fleischerzeugnissen aus der Region sei<br />
möglich und meist üblich. Entscheidend sei die regionale Bezugsquelle.<br />
Auch die Herstellung <strong>von</strong> nachweisbar regionalen Produkten (<strong>von</strong> der Zucht bis zum<br />
Verbraucher) werde, selbst wenn der Rohstoff (Hälften und/oder Teilstücke) ausschließlich<br />
zugekauft würde, <strong>für</strong> praktikabel angesehen. Entscheidend sei auch hier die nachweisbar<br />
regionale Bezugsquelle.<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Vermarktung <strong>von</strong> Fleischerzeugnissen als Regionalprodukte ist jedoch<br />
das Vorhandens<strong>ein</strong> regionaler Fleischerzeuger, womit die räumliche Definition <strong>von</strong> Region<br />
entscheidenden Einfluss auf die Zahl der potenziellen Zeichennutzer bekommt.<br />
Theoretisches Potenzial: alle selbstschlachtenden und zukaufenden Fleischereien.<br />
9.2.3.2 Bäckereien<br />
Während die Zahl der Filialen gleich blieb (30.000) hat sich die Zahl der Bäckereien im Jahr<br />
2010 um 2,66 Prozent zum Vorjahr auf 14.594 verringert 49 . In ihrer Selbstdarstellung erwähnt<br />
die Branche zwar regionale Rohstoffherkünfte in Form des Weizen-/Mehlbezugs <strong>von</strong><br />
landwirtschaftlichen Erzeugergem<strong>ein</strong>schaften bei „vielen Bäckereien“, sch<strong>ein</strong>t dem „Megatrend“<br />
Regionalität aber k<strong>ein</strong>e größere Bedeutung zuzumessen. 50<br />
„Die Konzentration im Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel (LEH) fordert dem Bäckerhandwerk <strong>ein</strong>e<br />
fortwährende Neuorientierung in s<strong>ein</strong>en Vertriebsstrukturen ab. So findet sich heute in vielen<br />
Supermärkten <strong>ein</strong>e Verkaufsfiliale <strong>ein</strong>es Handwerksbäckers. LEH-eigene Pre-Bake-Stationen<br />
und die Discountbäckereien haben zu <strong>ein</strong>er weiteren Verschärfung des Wettbewerbes geführt.<br />
Aufgrund der niedrigen Bezugspreise tiefgekühlter Teiglinge, des schmalen Sortiments, der<br />
<strong>ein</strong>fachen Ausstattung und des Selbstbedienungskonzeptes können beide Vertriebsschienen<br />
Backwaren zu Discountpreisen anbieten.“ 51<br />
Vor dem Hintergrund des Wettbewerbs besteht die permanente Notwendigkeit, durch<br />
Angebotsprofilierung wenn schon nicht die Kosten, dann doch die Preisführerschaft zu<br />
erlangen. Da der Rohstoffbezug in Getreidebauregionen im Wesentlichen aus regionalen<br />
Herkünften erfolgt und bei entsprechender Dokumentation bis zum Getreideerzeuger<br />
nachzuweisen wäre, sind theoretisch alle dortigen Bäckereien potenzielle Nutzer <strong>ein</strong>es<br />
bundesweiten Regionalsiegels.<br />
Theoretisches Potenzial: alle Bäckereien in Regionen mit Mühlen und Getreidebau.<br />
49<br />
Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerk, 2011. Das deutsche Bäckerhandwerk: Daten und<br />
Fakten 2011. Berlin.<br />
50<br />
vgl. www.baeckerhandwerk.de/Trends.29.0.html<br />
51 vgl. www.baeckerhandwerk.de/Marktsituation.30.0.html<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 95
9.2.4 Absatzpotenziale beim Verbraucher<br />
Was die Konsumenten als eigentliche Zielgruppe <strong>für</strong> regionale Produkte betrifft, hat es in<br />
jüngster Zeit aufwendige Befragungen gegeben, die die regionale Herkunft als <strong>für</strong> die<br />
Verbraucher zunehmend wichtiger werdendes Kriterium bestimmen und dem Thema <strong>ein</strong>e<br />
längerfristige Aktualität zusprechen. Auch wenn der Preis bei Lebensmitteln nach wie vor das<br />
entscheidende Kaufkriterium ist, gewinnen andere Aspekte an Bedeutung.<br />
In Bezug auf die <strong>Kriterien</strong>, nach denen Verbraucher Lebensmittel auswählen, zeigt <strong>ein</strong>e Studie<br />
des SGS Institut Fresenius 52 : „Die Ansprüche sind hoch. Lebensmittel sollen möglichst frisch<br />
(86 Prozent) und qualitativ hochwertig (60 Prozent), gleichzeitig aber günstig (57 Prozent) s<strong>ein</strong>.<br />
Darüber hinaus belegt die Studie jetzt <strong>ein</strong> weiteres wichtiges Kaufkriterium: Regionalität. 47<br />
Prozent achten beim Einkauf auf Produkte aus der Region. Bio- oder Ökoprodukte haben mit 23<br />
Prozent deutlich weniger Priorität. Der Gesundheitsaspekt ist dennoch wichtig: 43 Prozent der<br />
Verbraucher möchten gentechnikfreie Lebensmittel, 40 Prozent achten auf Lebensmittel, die<br />
wenig Fett enthalten.<br />
20 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es weiterhin Unterschiede im Einkaufsverhalten<br />
zwischen den alten und neuen Bundesländern. Im Osten sind Lebensmittel aus der eigenen<br />
Region überdurchschnittlich attraktiv. 59 Prozent der Ostdeutschen achten beim<br />
Lebensmittelkauf darauf, dass die Produkte aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Nur <strong>für</strong><br />
44 Prozent der Westdeutschen spielt Regionalität dagegen <strong>ein</strong>e Rolle.<br />
Verbraucher in den neuen Bundesländern sind außerdem preisbewusster als ihre Nachbarn<br />
aus dem Westen: 68 Prozent geben an, vor allem auf den Preis zu achten, während es im<br />
Westen 54 Prozent sind.“<br />
Die DLG-Regionalstudie 2011 53 bezeichnet Regionalität als „Megatrend“ <strong>für</strong> Handel und<br />
Verbraucher, das erhebliches Wertschöpfungspotenzial <strong>für</strong> Händler und Industrie enthält. Bei<br />
den Verbrauchern sind es die gehobenen Milieus, die sich <strong>für</strong> regionale Produkte interessieren<br />
und bereit sind, da<strong>für</strong> mehr bezahlen. Die Studie betont, dass Regionalität <strong>für</strong> die Konsumenten<br />
ausschließlich <strong>ein</strong> Thema der Herkunft frischer Produkte ist und k<strong>ein</strong>es der Ethik.<br />
Das sieht die OTTOGroup anders: Ihre Verbraucherstudie 54 gliedert Regionalität <strong>ein</strong> in den<br />
Gesamtkomplex „ethischen Konsum“, der sich ausdifferenziert: „Ethischer Konsum wird<br />
differenzierter gesehen. So werden mittlerweile menschenwürdige Arbeitsbedingungen (92<br />
Prozent), soziale Verantwortung (85 Prozent), umweltfreundliche Herstellung (89 Prozent),<br />
fairer Handel (87 Prozent), Recycelbarkeit (83 Prozent) und Regionalität (77 Prozent) stärker<br />
mit Konsumethik in Verbindung gebracht als biologische Erzeugung (73 Prozent). Die<br />
Ausdifferenzierung des Ethikmarktes ist Beleg da<strong>für</strong>, dass das Thema nicht nur auf Produkte<br />
beschränkt ist, sondern zunehmend in andere Bereiche vordringt und an Alltagsrelevanz<br />
gewinnt.“<br />
Das Potenzial in der Verbraucherschaft <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel hängt<br />
offensichtlich entscheidend auch <strong>von</strong> dessen inhaltlicher Ausgestaltung ab. Ein Siegel, das die<br />
Bedürfnisse der Mehrheit der regional affinen Verbraucher weitestgehend berücksichtigen<br />
würde, träfe auf <strong>ein</strong> großes, hier nicht bezifferbares Potenzial in der Konsumentenschaft.<br />
52<br />
Quelle: Institut Fresenius, 2010. SGS Institut Fresenius Verbraucherstudie 2010: Lebensmittelqualität und<br />
Verbrauchervertrauen.<br />
53<br />
DLG, 2011. Neue DLG-Studie: Regionalität aus Verbrauchersicht.<br />
54<br />
Quelle: Otto GmbH & Co KG (Hrsg.), 2011. Verbrauchervertrauen. 3. Studie zum ethischen Konsum. Auf dem<br />
Weg zu <strong>ein</strong>er neuen Wertekultur.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 96
9.3 Expertenbefragung: Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten<br />
Regionalsiegels<br />
Nachdem erst im fortgeschrittenen Verlauf des Vorhabens Alternativszenarien <strong>für</strong><br />
Zeichensysteme und deren Aufgabenbestimmung festgelegt wurden, konnte auch erst auf<br />
dieser Basis die geplante Expertenbefragung durchgeführt werden.<br />
Die Expertenbefragungen wurden in schriftlicher Form vom Leiter des Instituts <strong>für</strong> Sicherheit<br />
und Qualität beim Fleisch (Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut <strong>für</strong> Ernährung und<br />
Lebensmittel) sowie vom Deutschen Fleischer Verband erhoben. Darüber hinaus wurden<br />
Expertenbefragungen auf Basis <strong>ein</strong>es Gesprächsleitfadens bei den jeweiligen Geschäftsführern<br />
der BVE Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V., dem VdF Verband der<br />
Fleischwirtschaft e.V., der BVEO Bundesver<strong>ein</strong>igung der Erzeugerorganisationen Obst und<br />
Gemüse e.V. und dem VDM Verband Deutscher Mühlen e.V. im Zeitraum bis zum 09.01.2012<br />
durchgeführt (siehe Anhang 12.14, Gesprächsleitfaden Expertenbefragung). Die geplante<br />
Befragung des Deutscher Brauer-Bundes konnte mangels <strong>ein</strong>es Gesprächspartners nicht<br />
durchgeführt werden.<br />
Auf die Eingangsfrage „Stellen Sie sich doch <strong>ein</strong>mal vor, die <strong>Kriterien</strong> da<strong>für</strong>, was als „Produkt<br />
aus regionaler Erzeugung“ gekennzeichnet werden kann, würden bundes<strong>ein</strong>heitlich festgelegt“<br />
wurde <strong>ein</strong> heterogenes Bild deutlich. Die BVE begrüßt - wohlgemerkt aus Verbrauchersicht -<br />
diesen Ansatz, während VDF und BVEO diesen Ansatz ablehnen, BVEO mit der Begründung,<br />
gerade <strong>ein</strong> eigenes <strong>bundesweites</strong> Logo mit den dazugehörigen Nutzungsbedingungen<br />
<strong>ein</strong>geführt zu haben. Der VDM kann sich mit der Aussage „weiß nicht“ nicht festlegen.<br />
Zusammenfassung<br />
Eine bundes<strong>ein</strong>heitliche Festlegung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> wird bei den unterschiedlichen<br />
Produktgruppen auf sehr unterschiedliche Befindlichkeiten stoßen.<br />
Die Frage „Unabhängig <strong>von</strong> Ihrer grundsätzlichen Auffassung zu <strong>ein</strong>em bundesweiten<br />
Regionalsiegel, gesetzt den Fall, <strong>ein</strong> solches Siegel würde entwickelt, wer sollte Ihres<br />
Erachtens Träger <strong>ein</strong>es solchen Zeichens s<strong>ein</strong>?“ wurde in drei Fällen mit „Einrichtung der<br />
Privatwirtschaft“ und in zwei Fällen mit „egal“ beantwortet, wobei diese Nennungen mit <strong>ein</strong>er<br />
eher ablehnenden Gesamtgrundhaltung zu <strong>ein</strong>em bundesweiten Regionalsiegel <strong>ein</strong>hergingen.<br />
Nur die Wissenschaft aus dem Bundesforschungsinstitut be<strong>für</strong>wortete, dass der Staat oder <strong>ein</strong>e<br />
staatliche Einrichtung diese Rolle übernehmen sollte.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Wirtschaft sieht die Trägerschaft <strong>ein</strong>es solchen Zeichens - wenn überhaupt - eher bei sich<br />
selbst angesiedelt.<br />
Auf die Frage „Sollte die Kennzeichnung mit <strong>ein</strong>em übergeordneten Regionalsiegel<br />
verpflichtend, freiwillig oder „fakultativ vorbehalten“ s<strong>ein</strong> (=Zeichennutzung freiwillig, wer es<br />
nutzt, ist aber an s<strong>ein</strong>e Vorgaben gebunden)?“ antworteten drei Experten mit „freiwillig“, zwei<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 97
mit „fakultativ vorbehalten“ und <strong>ein</strong>em Experten war es „egal“, da er <strong>ein</strong>e bundes<strong>ein</strong>heitliche<br />
Regelung ohnehin ablehnt.<br />
Zusammenfassung<br />
K<strong>ein</strong>er der Befragten be<strong>für</strong>wortet <strong>ein</strong>e verpflichtende Kennzeichnung mit <strong>ein</strong>em<br />
übergeordneten Regionalsiegel. Jedes Unternehmen sollte selbst ausloten, ob die<br />
Kennzeichnung <strong>für</strong> den jeweiligen Produktbereich <strong>ein</strong>en Nutzen stiftet.<br />
Die Auffassung zur Definition des Regionsbegriffes stellt sich ebenfalls sehr heterogen dar. Es<br />
werden - je nach Produkt - mehrheitlich naturräumliche Grenzen vor administrativen Grenzen<br />
als sinnvoll angesehen. K<strong>ein</strong>er der Experten sieht virtuell gegriffene Umkreise beziehungsweise<br />
räumlich begrenzte Vertriebsgebiete als sinnvolle <strong>Kriterien</strong> an, wie sie zum Beispiel der Handel<br />
verwendet (u. a. Edeka, tegut…).<br />
Zusammenfassung<br />
Die Festlegung des Regionsbegriffes wird bei den unterschiedlichen Produktgruppen und in<br />
unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Regelungen erfordern.<br />
Die Frage, ob <strong>ein</strong> Regionalsiegel nur <strong>für</strong> Monoprodukte, also zum Beispiel Kartoffeln, Eier, Obst<br />
oder nur <strong>für</strong> zusammengesetzte Produkte, zum Beispiel Wurst, Konserven, Konfitüren,<br />
Fertiggerichte oder beides vergeben werden sollte, wurde ebenfalls heterogen beantwortet: Drei<br />
Verbandsvertreter antworteten „nur <strong>für</strong> Monoprodukte“, drei Vertreter „<strong>für</strong> Monoprodukte und<br />
zusammengesetzte Produkte“.<br />
Zusammenfassung<br />
Monoprodukte werden grundsätzlich als geeignet <strong>ein</strong>gestuft. Es wird jedoch <strong>ein</strong>e<br />
nachvollziehbare und belastbare Regelung <strong>für</strong> zusammengesetzte Produkte erfolgen müssen.<br />
Die Frage „Sollten bei zusammengesetzten Produkten, die mit <strong>ein</strong>em Regionalsiegel<br />
gekennzeichnet werden, die Rohstoffe und Zutaten aus derselben Region stammen, in der der<br />
verarbeitende Betrieb liegt?“ musste nur <strong>von</strong> den drei dieser Regelung zustimmenden Experten<br />
beantwortet werden. Ein Verband antwortet „Ja, aber nur wenn regional verfügbar“, <strong>ein</strong> anderer<br />
Experte antwortete mit „n<strong>ein</strong>“. Der dritte Experte lehnte <strong>ein</strong>e pauschale Festlegung ab, da die<br />
Verkehrsauffassung seitens des Konsumenten und des Herstellers bereits auf Produktebene<br />
unterschiedlich ausgelegt werde. Es erfolgte in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die<br />
verpflichtende Bezeichnung des „Ursprungslandes“ und die namentliche und örtliche Nennung<br />
des „Erstabpackers/Erstverarbeiters“ (statt der Floskel: „abgepackt <strong>für</strong> …“) geeignete regionale<br />
Verbraucherinformationen darstellen könnten, wenn dieses bereits verpflichtend geregelt<br />
werden würde. Hier solle das <strong>BMELV</strong> s<strong>ein</strong>e Handlungsspielräume nutzen. Ebenso sei der Ort<br />
der Be- und Verarbeitung <strong>von</strong> Lebensmitteln zu berücksichtigen.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 98
Die darauf folgende Frage „Wenn Sie der Auffassung sind, die Ausgangsstoffe <strong>ein</strong>es<br />
zusammengesetzten Produktes müssten zu <strong>ein</strong>em bestimmten Anteil aus der gleichen Region<br />
wie das Endprodukt stammen, wie hoch sollte Ihres Erachtens dieser Anteil mindestens s<strong>ein</strong>?“<br />
wurde insofern folgerichtig und <strong>ein</strong>heitlich mit dem Votum: „hängt vom Produkt ab“ bewertet.<br />
Zusammenfassung<br />
Im Zuge der Umsetzung <strong>ein</strong>es bundes<strong>ein</strong>heitlichen Regionalsiegels bedarf es dringend<br />
<strong>ein</strong>vernehmlicher und produktspezifischer Regelungen bezüglich Rohstoffen, Zutaten sowie<br />
den Ortsangaben der abpackenden, be- und verarbeitenden Unternehmen.<br />
Eine große Einheitlichkeit bestand in der M<strong>ein</strong>ungsbildung, das Regionalsiegel nicht mit<br />
weiteren Anforderungen an die Erzeugung/Herstellung, etwa zur Qualität oder zum<br />
Herstellungsprozess, verbunden werden sollten, die über die gesetzlichen Bestimmungen<br />
hinausgehen. Einheitlich abgelehnt wurden etwa „umweltgerechte Erzeugung“ (Hinweis der<br />
Experten: es existiert <strong>ein</strong> Nachhaltigkeitssiegel), soziale Belange, ohne Einsatz <strong>von</strong> Gentechnik<br />
(Hinweis: es existiert <strong>ein</strong> Label „Ohne Gentechnik“) und/oder Klimaschutz als zusätzliche<br />
Standards <strong>für</strong> <strong>ein</strong> Regionalsiegel. Der Experte der Wissenschaft be<strong>für</strong>wortete <strong>ein</strong>en<br />
zusätzlichen Standard im Bereich Tierschutz, wobei die anderen Experten aus dem<br />
Fleischbereich darauf hinwiesen, dass auch im Bereich Tierschutzaspekte <strong>ein</strong> eigenes<br />
Tierschutzlabel als singuläre Kennzeichnungsmaßnahme im Markt vorhanden beziehungsweise<br />
in der <strong>Entwicklung</strong> sei. Für die meisten der genannten zusätzlichen Anforderungen gibt es also<br />
laut den geführten Expertengesprächen etablierte Kennzeichnungen im Markt - weitere<br />
Verengungen des Regionalbegriffs seien nicht zielführend, zu komplex, dem Verbraucher nicht<br />
vermittelbar und nicht produktübergreifend zum Regionalitätsbegriff kompatibel.<br />
Zusammenfassung<br />
Zusätzliche Standards über den regionalen Aspekt hinaus werden <strong>von</strong> den befragten Experten<br />
<strong>ein</strong>heitlich abgelehnt.<br />
Ob <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel die Vermarktungschancen <strong>für</strong> Produkte aus regionaler<br />
Erzeugung be<strong>ein</strong>flussen würde, wird unterschiedlich <strong>ein</strong>geschätzt. Der Experte aus der<br />
Wissenschaft antwortete, dass sich die Vermarktungschancen erhöhen würden. Ein weiterer<br />
Experte betonte, dass „Mindestkriterien“ als unterer Standard die Vermarktungschancen sogar<br />
hemmen könnten, weil die Glaubwürdigkeit insgesamt unter <strong>ein</strong>em Mindeststandard leiden<br />
würde.<br />
Vier Experten m<strong>ein</strong>en, dass die Be<strong>ein</strong>flussung der Vermarktungschancen ausschließlich <strong>von</strong><br />
der Ausgestaltung des Regionalsiegels, dessen <strong>Kriterien</strong> und den jeweiligen<br />
Rahmenbedingungen abhängt. Im Gespräch nannten die Experten unter anderem den<br />
Sachverhalt, dass Herkunftswissen grundsätzlich die Verbraucherakzeptanz erhöhen würde<br />
und dass Kommunikationsanstrengungen und die materielle Förderung als solche die<br />
Vermarktungschancen erhöhen könnten, wenn alles „richtig“ gemacht werde. Geäußert wurde<br />
in diesem Zusammenhang auch der Sachverhalt, dass ausgelobte Regionalität - wenn auch im<br />
Trend - nur in Ausnahmefällen <strong>ein</strong>en maßgeblichen Beitrag zum Umsatz- und/oder<br />
Gewinnwachstum erbringen würde. Die wirtschaftliche Beurteilung sogenannter „regionaler<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 99
Initiativen“ wird als dauerhaft kritisch <strong>ein</strong>geschätzt, wenn diese nicht auch dauerhaft durch<br />
öffentliche Mittel gefördert werden würden.<br />
Zusammenfassung<br />
Im Zuge der Umsetzung <strong>ein</strong>es bundes<strong>ein</strong>heitlichen Regionalsiegels bedarf es <strong>ein</strong>er sorgfältig<br />
durchdachten inhaltlichen, gestalterischen und fördertechnischen Ausgestaltung, die ohne<br />
(zusätzliche) Fördermittel als wirtschaftlich kritisch angesehen wird.<br />
9.3.1 Beurteilung der Szenarien<br />
In der letzten Frage des Expertengespräches wurden die zwei nachfolgenden Modelle<br />
„Anerkennung“ und „Regionalfenster“ vorgestellt:<br />
Auf die Frage: „Wenn Sie sich zwischen den Varianten entscheiden müssten, welche würden<br />
Sie wählen?“, antworteten die befragten Institutionen wie folgt:<br />
<strong>ein</strong>e Dachmarke mit vorgegebenen Regionalkriterien (k<strong>ein</strong>e Zustimmung);<br />
das Regionalfenster mit Auslobung der jeweils eigenen Regionalkriterien (zwei<br />
Zustimmungen);<br />
k<strong>ein</strong>e <strong>von</strong> beiden (zwei Zustimmungen);<br />
<strong>für</strong> <strong>ein</strong>e Entscheidung bedürfte es weiterer Informationen (k<strong>ein</strong>e Zustimmung);<br />
der Unterschied bleibt unklar (k<strong>ein</strong>e Zustimmung).<br />
Zusammenfassung<br />
Eine Dachmarke findet zum jetzigen Zeitpunkt bei k<strong>ein</strong>em der Experten <strong>ein</strong>e Zustimmung -<br />
eher das Regionalfenster als Form der „Kontrollbestätigung <strong>für</strong> die Erfüllung jeweils eigener<br />
Regionalkriterien“.<br />
Zusammenfassend wünschen sich die befragten Experten der genannten Verbände - falls es<br />
überhaupt zu <strong>ein</strong>em bundesweiten Regionalzeichen kommen sollte - <strong>ein</strong>e hohe Flexibilität bei<br />
der Ausgestaltung und Rücksichtnahme auf produktspezifische Belange. Bevorzugt werden<br />
unternehmens- und privatwirtschaftliche Entscheidungsprozesse vor staatlichen Regelungen.<br />
K<strong>ein</strong>esfalls sollte <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalzeichen mit weiteren <strong>Kriterien</strong> außerhalb des<br />
regionalen Kontextes in Verbindung gebracht oder gar überladen werden.<br />
9.4 Weitere Perspektiven<br />
Eine Ausweitung der Verwendungsbereiche <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel auf die<br />
Bereiche Non Food und Tourismus wurde aufgrund der schon oben aufgeführten Komplexität<br />
der <strong>Kriterien</strong>findung und der Kürze der Zeit nicht weiter vertieft. Einzige der Bereich der<br />
Gastronomie wurde aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung <strong>für</strong> die Regionalinitiativen<br />
vertiefend betrachtet.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 100
Gastronomie<br />
Die Ausweitung der Vergabe <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels auf den Gastronomiesektor<br />
sollte nicht losgelöst <strong>von</strong> der allgem<strong>ein</strong>en Diskussion betrachtet werden. Für viele kl<strong>ein</strong>e<br />
Regionalinitiativen ist der Absatzweg über die regionale Gastronomie <strong>ein</strong> wichtiges Standb<strong>ein</strong>,<br />
zum Beispiel die Regionalinitiativen Altmühltaler Lamm oder Ostalblamm, die das Lammfleisch<br />
über die regionale Gastronomie erfolgreich vermarkten.<br />
Gleichwohl liegt bei der Vermarktung im Gastronomiebereich die Erfahrung vor, dass sich<br />
Köche und Gastronomen mit <strong>ein</strong>em Kontroll- oder Anerkennungsverfahren schwer tun.<br />
Erfahrungen mit Kontrollverfahren liegen in der Gastronomie bereits durch die im Jahr 2004<br />
<strong>ein</strong>geführte Biozertifizierung vor. Danach unterliegen alle Betriebe der<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsverpflegung und Gastronomie <strong>ein</strong>em Kontrollverfahren, wenn sie Bioprodukte<br />
<strong>ein</strong>setzen und diese auf der Speisenkarte ausloben. Betriebe, die sich dem Kontrollverfahren<br />
stellen, haben die Auswahl, <strong>für</strong> <strong>ein</strong> komplettes Menü <strong>ein</strong>e Biozertifizierung zu beantragen,<br />
<strong>ein</strong>zelne Komponenten zertifizieren zu lassen oder <strong>ein</strong>en Austausch kompletter Produktgruppen<br />
(beispielsweise Rindfleisch ausschließlich aus ökologischer Tierhaltung zu beziehen)<br />
vorzunehmen. Die Kontrolle obliegt den Ökokontrollstellen. Nach <strong>ein</strong>er Studie aus dem Jahr<br />
2009 haben 1.500 Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung <strong>ein</strong> Biozertifikat (vgl. ÖGS 2005). Eine<br />
gesonderte Darstellung, wie viele Restaurants biozertifiziert sind, liegt nicht vor. Allerdings<br />
dürfte der Anteil derer, die kontinuierlich oder zeitweise Bioprodukte verwenden, weit höher<br />
liegen. Gemessen an der Anzahl <strong>von</strong> deutlich über 100.000 Betrieben des Gaststättengewerbes<br />
wird deutlich, dass nur <strong>ein</strong> geringer Teil der Gastronomen bereit ist, <strong>ein</strong> Kontrollverfahren zu<br />
durchlaufen. Die geringe Akzeptanz der Biozertifizierung, die auch innerhalb der<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsverpflegung zu beobachten ist, hat folgende Gründe:<br />
hoher administrativer Aufwand<br />
Skepsis gegenüber dem Nutzen <strong>ein</strong>es Biosiegels <strong>für</strong> den Gast<br />
anfallende Kosten <strong>für</strong> die Zertifizierung und jährliche Kontrolle<br />
Einschränkung in der Auswahl <strong>von</strong> Lebensmitteln<br />
Insbesondere der letzte Punkt ist in der gehobenen Gastronomie zu beobachten. Nach<br />
Angaben <strong>von</strong> gastgewerbe-magazin online sind Bioprodukte in der gehobenen Gastronomie<br />
etabliert (vgl. gastgewerbe-magazin 2011). Allerdings wird selten <strong>für</strong> Bio auf der Speisekarte<br />
geworben. Der Gastronom möchte in der Auswahl s<strong>ein</strong>er Lebensmittel nicht <strong>ein</strong>geschränkt<br />
werden. So würde die Biozertifizierung <strong>für</strong> die Verwendung <strong>von</strong> Biorindfleisch bedeuten, dass<br />
k<strong>ein</strong> konventionelles Rindfleisch <strong>ein</strong>gesetzt werden dürfte. Auch wenn dies in der Praxis nicht<br />
zwangsläufig der Fall ist, fühlt sich der Gastronom, der s<strong>ein</strong>en Einkauf nach der besten auf dem<br />
Markt verfügbaren Qualität ausrichtet, be<strong>ein</strong>trächtigt.<br />
Dies ist sicher auch <strong>ein</strong> Grund da<strong>für</strong>, warum innovative Konzepte wie das Bioland-<br />
Gastronomiekonzept schwierig auf dem Markt zu platzieren sind. Die allgem<strong>ein</strong>en Vorschriften<br />
zur Biozertifizierung und die zusätzlichen Verbandsvorschriften, um als Bioland-Gastro-Partner<br />
<strong>für</strong> s<strong>ein</strong>en Betrieb zu werben, b<strong>ein</strong>halten <strong>ein</strong>en Bioanteil, der wertmäßig mindestens 70 Prozent<br />
betragen muss. In Ausnahmefällen kann mit <strong>ein</strong>em geringeren Bioanteil begonnen werden. Im<br />
Bereich Betriebsrestaurant liegt der Bioanteil bei mindestens 20 Prozent. Ein Teil der<br />
Bioprodukte muss zudem Verbandsware s<strong>ein</strong>.<br />
Der Einsatz regionaler Produkte in der Gastronomie erfreut sich bei den Gästen steigender<br />
Beliebtheit und „kommt ungewöhnlich gut an“ (vgl. gastgewerbe-magazin 2011). Bei der<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 101
Einführung <strong>ein</strong>es Dachzeichens und <strong>ein</strong>es angeschlossenen Kontrollverfahrens kann aufgrund<br />
der Erfahrungen bei der Biozertifizierung mit ähnlichen Widerständen gerechnet werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e mögliche Akzeptanz ist gegeben, wenn<br />
k<strong>ein</strong>e Einschränkung in der Auswahl der Produkte besteht,<br />
<strong>ein</strong> Zeichen k<strong>ein</strong>e Vorschriften hinsichtlich des prozentualen Anteils regionaler Produkte<br />
enthält,<br />
mit dem Erwerb k<strong>ein</strong>e Kosten verbunden sind.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 102
10 Zusammenfassung<br />
Ziel des Gutachtens ist es, <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> bundesweit geltendes Regionalzeichen zu<br />
entwickeln, damit der Begriff Regionalität <strong>für</strong> den Verbraucher transparent und wahrhaftig<br />
definiert wird. Dazu sollte unter Beachtung bereits bestehender Siegel und Marken die<br />
Abgrenzung der Region, die Produktionstiefe und der Anteil an Rohstoffen aus der Region<br />
definiert und die optionale Einbindung <strong>von</strong> Zusatzkriterien erörtert werden. Des Weiteren sollten<br />
Realisierungsmodalitäten ausgearbeitet und <strong>ein</strong>e Potenzialanalyse durchgeführt werden.<br />
Für die Analyse wurden deutschlandweit zwölf Länderzeichen, 14 regionale Handelsmarken<br />
sowie sechs Regionalauslobungen des Handels und <strong>von</strong> 185 Regionalinitiativen erfasst. Nur<br />
bei den Länderzeichen Bayerns, Baden-Württembergs und Hessens liegen vergleichbare<br />
Standards bezüglich Regionsabgrenzung, Produktionstiefe und Kontrollsystem vor.<br />
Eine Definition des Begriffs „Region“ ist zwischen der nationalen und der lokalen Ebene<br />
angesiedelt, wobei Grenzziehungen landschaftsräumlich, administrativ oder nach Entfernung<br />
erfolgen. Das Verständnis <strong>von</strong> Region ist sowohl bei Regionalinitiativen als auch bei<br />
Verbrauchern sehr heterogen.<br />
Die Einbindung aller Produktionsstufen in kl<strong>ein</strong>räumigen Regionen ersch<strong>ein</strong>t zumeist nicht<br />
praktikabel, da nicht alle Produkte verfügbar sind. Ein vollständiger regionaler Rohstoffbezug<br />
kann oftmals nur bei Monoprodukten gewährleistet werden. Bei zusammengesetzten<br />
Produkten müssen Mindestanteile definiert werden, wobei Bezug auf die Hauptzutat oder<br />
<strong>ein</strong>en prozentualen Anteil an der Gesamtmasse des Produktes genommen werden kann.<br />
Die Einbindung <strong>von</strong> Zusatzkriterien wie z. B. Tierwohl oder Nachhaltigkeit macht es<br />
erforderlich, dass hier<strong>für</strong> zuerst <strong>ein</strong>heitliche Regelungen und/oder gesetzliche Vorgaben<br />
erarbeitet werden. Zusatzkriterien sollten nur fakultativ s<strong>ein</strong> und der Differenzierung <strong>von</strong><br />
Initiativen dienen.<br />
Bei der Realisierung <strong>ein</strong>er freiwilligen Regionalkennzeichnung geben nationale und<br />
gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Schutzsysteme den rechtlichen Rahmen vor.<br />
Die Überprüfung der <strong>Kriterien</strong><strong>ein</strong>haltung sollte mindestens über <strong>ein</strong> dreistufiges Kontroll-<br />
und Zertifizierungssystem erfolgen.<br />
Inhalt <strong>ein</strong>es <strong>Kriterien</strong>kataloges sind demnach: Regionendefinition kl<strong>ein</strong>er als Deutschland<br />
und größer als <strong>ein</strong>e Kommune, Rohstoffanteil aus der Region größer als 50 Prozent, k<strong>ein</strong>e<br />
verpflichtende Berücksichtigung aller Vorstufen in der Landwirtschaft, Verarbeitung in der<br />
Region und <strong>ein</strong> dreistufiges Kontroll- und Zertifizierungssystem.<br />
Die Forderungen der Akteursgruppen an die <strong>Kriterien</strong>entwicklung <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong><br />
Regionalsiegel reichen <strong>von</strong> <strong>ein</strong>er staatlichen Regelung über <strong>ein</strong> privatrechtliches, freiwilliges<br />
System bis zur Beibehaltung des Status quo.<br />
Es wurden, abgeleitet aus bestehenden Ansätzen und Vorstellungen der betroffenen Akteure,<br />
vier Szenarien entwickelt:<br />
1. Szenario „Anpassung/Koordination“ umschreibt <strong>ein</strong> gem<strong>ein</strong>schaftliches Vorgehen <strong>von</strong><br />
Bund und Ländern mit dem Ziel, bestehende Regelwerke der Länder <strong>für</strong> alle Bundesländer<br />
<strong>ein</strong>zuführen bzw. anzupassen.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 103
2. Szenario „Anerkennung“ umschreibt <strong>ein</strong>e Dachmarkenstrategie, hinterlegt mit <strong>ein</strong>em<br />
Akkreditierungsmodell und definierten Mindestkriterien. Es dient zur zusätzlichen<br />
Anerkennung bereits bestehender Regionalinitiativen.<br />
3. Szenario „Regionalsiegel“ umschreibt <strong>ein</strong>e Siegelstrategie mit <strong>ein</strong>em mehrstufigen<br />
Kontrollsystem. Dabei kann das Siegel eigenständig und losgelöst <strong>von</strong> bestehenden<br />
Regionalzeichen <strong>ein</strong>gesetzt werden. Die Vergabe kann durch <strong>ein</strong> Stufenmodell, z. B. Höhe<br />
des prozentualen Rohstoffbezuges, differenziert werden.<br />
4. Szenario „Regionalfenster“ umschreibt <strong>ein</strong>e Strategie der Herkunftsdeklaration, gekoppelt<br />
mit Mindestkriterien sowie <strong>ein</strong>em mehrstufigen Kontrollsystem, z. B. mit <strong>ein</strong>em analytischen<br />
Herkunftsnachweis. Die Deklaration erfolgt über <strong>ein</strong> eigenständiges Informationsfeld, die<br />
darin getroffenen Aussagen werden neutral überprüft.<br />
Eine Diskussion mit den Akteursgruppen ergab folgendes Bild:<br />
1. Das Szenario „Anpassung/Koordination“ wurde <strong>von</strong> Teilen des Handels und dem Land<br />
Baden-Württemberg bevorzugt.<br />
2. Das Szenario „Anerkennung“ wurde vor allem vom BRB im Sinne <strong>ein</strong>er all<strong>ein</strong>igen<br />
Anerkennung der Regionalinitiativen bevorzugt.<br />
3. Das Szenario „Regionalsiegel“ wurde <strong>von</strong> der Mehrheit der Akteure schon in <strong>ein</strong>em frühen<br />
Stadium, z. T. kategorisch, abgelehnt und daher auch nicht weiter verfolgt.<br />
4. Das Szenario „Regionalfenster“ wurde u. a. <strong>von</strong> Teilen des Handels, der Hersteller, der<br />
Verbände und der Wissenschaft als <strong>ein</strong> interessanter Ansatz gesehen, der weiter verfolgt<br />
werden sollte.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 104
11 Literatur<br />
Alvensleben, Reimar <strong>von</strong>, 1999. Verbraucherpräferenzen <strong>für</strong> regionale Produkte:<br />
Konsumtheoretische Grundlagen. Wissenschaftliche Arbeitstagung „Regionale<br />
Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft - Chancen, Probleme<br />
und Bewertung“ des Dachverbandes wissenschaftlicher Gesellschaften der Agrar--, Forst-,<br />
Ernährungs-, Veterinär- und Umweltforschung e.V. (25./26.11.1999). Bonn. Verfügbar unter:<br />
www.uni-kiel.de/agrarmarketing/Lehrstuhl/verbraucherregio.pdf.<br />
Alvensleben, Reimar <strong>von</strong>, 2001. Die Bedeutung <strong>von</strong> Herkunftsangaben im regionalen<br />
Marketing. Symposium „Vielfalt auf dem Markt“ veranstaltet vom Informationszentrum<br />
Genetische Ressourcen (IGR) der ZADI und dem Landesschafzuchtverband Niedersachsen<br />
e.V. am 5./6.11.2001 in Sulingen. Verfügbar unter: http://orgprints.org/1652/1/sulingen.pdf.<br />
Balling, R., 2008. EU-Schutz <strong>für</strong> Lebensmittel und Agrarerzeugnisse - die aktuelle <strong>Entwicklung</strong><br />
in Bayern. Vortrag-Charts.<br />
Banik, Ina und J. Simons, 2007. Regionalvermarktung und Bio-Produkte: Spannungsverhältnis<br />
oder sinnvolle Ergänzung? 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität<br />
Hohenheim. Verfügbar unter: http://orgprints.org/9548/1/9548_Banik_Vortrag.pdf.<br />
Bastian, Andrea, 1995. Der Heimat-Begriff: Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in<br />
verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache. Reihe Germanistische Linguistik<br />
159. Tübingen.<br />
Bayerische Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft (LfL), 2011. Projektbericht Bayern. München.<br />
Becker, Tilman, 2002. Bedeutung und Nutzung geschützter Herkunftszeichen: Gutachten im<br />
Auftrag des Deutschen Bundestages. Berlin: Büro <strong>für</strong> Technologieabschätzung im Deutschen<br />
Bundestag (TAB). Verfügbar unter: https://marktlehre.unihohenheim.de/fileadmin/<strong>ein</strong>richtungen/marktlehre/Forschung/Herkunftsangaben/Gutachten_H<br />
erkunftszeichen.pdf.<br />
Benner, Eckhard und Christopph Kliebisch, 2004. Regio-Marketing-Strategien im<br />
Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel. Hrsg. Universität Hohenheim (420). ISSN 1615-0473. Verfügbar<br />
unter: http://opus.ub.uni-hohenheim.de/volltexte/2005/81/pdf/haa-nr10.pdf.<br />
Besch, Michael. und Helmut Hausladen, 1999. Regionales Marketing im Agribusiness<br />
Erfolgspotentiale und Problemfelder dargestellt an lokalen Kooperationsprojekten des<br />
regionalen Agrarmarketings. In: Innovative Konzepte <strong>für</strong> das Marketing <strong>von</strong> Agrarprodukten<br />
und Nahrungsmitteln. Schriftenreihe Band 13. Frankfurt a.M.: Landwirtschaftliche Rentenbank.<br />
S. 7-23. Verfügbar unter:<br />
www.rentenbank.de/cms/dokumente/10011465_262637/56f7bcce/Rentenbank_Schriftenreihe<br />
_Band13_.pdf.<br />
Blotevogel, Hans H<strong>ein</strong>rich, 1996. Auf dem Weg zu <strong>ein</strong>er „Theorie der Regionalität“: Die Region<br />
als Forschungsobjekt der Geographie. In: Brunn, G. (Hrsg.): Region und Regionsbildung in<br />
Europa. Konzeptionen der Forschung und empirische Befunde. Schriftenreihe des Instituts <strong>für</strong><br />
europäische Regionalforschungen, Bd. 1. Baden-Baden, S. 44-68.<br />
Blotevogel, Hans H<strong>ein</strong>rich, Günter H<strong>ein</strong>ritz und Herbert Popp, 1989. „Regionalbewußts<strong>ein</strong>“:<br />
Zum Stand der Diskussion um <strong>ein</strong>en St<strong>ein</strong> des Anstoßes. In: Geographische Zeitschrift 77,<br />
S 65-88.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 105
<strong>BMELV</strong>, 2011. Regionale Bio-Siegel (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter: www.biosiegel.de/infos-fuer-verbraucher/regionale-bio-siegel/.<br />
<strong>BMELV</strong>, o .J. Hintergrundinformationen zur „Ohne-Gentechnik“- Kennzeichnung (abgerufen<br />
am 28.11.2011). Verfügbar unter:<br />
www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/<br />
OhneGentechnikKennzeichnungHG_Informationen.html.<br />
Börnecke, Stephan, 2010. Wie fair ist die faire Milch? Online Artikel der Frankfurter<br />
Rundschau vom 14.05.2010 (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter: www.fronline.de/wirtschaft/verbraucherschutz-wie-fair-ist-die-faire-milch-,1472780,4457928.html.<br />
Brethauer, Christian, o. J. Der Schutz geographischer Herkunftsangaben (abgerufen am<br />
09.01.2012). Verfügbar unter: www.markenrecht.justlaw.de/geographischeherkunftsangaben.htm.<br />
Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V., 2011. Consumers Choice<br />
2011. Charts.<br />
Buxel, Holger, 2010. Akzeptanz und Nutzung <strong>von</strong> Güte- und Qualitätssiegeln auf<br />
Lebensmitteln: Ergebnisse <strong>ein</strong>er empirischen Untersuchung. Studienbericht. Münster.<br />
Verfügbar unter: www.lebensmittelzeitung.net/studien/pdfs/202_.pdf.<br />
Demmeler, Martin, 2007. Ökologische und ökonomische Effizienzpotenziale <strong>ein</strong>er regionalen<br />
Lebensmittelbereitstellung: Analyse ausgewählter Szenarien. Dissertation. München:<br />
Technische Universität München. Verfügbar unter: http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=988152231&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=988152231.pdf.<br />
destatis, 2005. Betriebe mit Anbau <strong>von</strong> Gartenbauerzeugnissen nach Betriebsart. SJT-<br />
3080200-2005.<br />
destatis, 2007. Betriebe mit Zuchtsauenhaltung. SJT-3101600-2007.<br />
destatis, 2007. Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung. SJT-3100700-2007.<br />
destatis, 2007. Landwirtschaftliche Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung. SJT-<br />
3011050-2007.<br />
destatis, 2007. Milchverarbeitung der Molkereiunternehmen 1997 bis 2007. SJT-4070300-<br />
0000.<br />
destatis, 2007. Zahl der Molkereiunternehmen 2000 bis 2006. SJT-4070200-0000.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit Masthühnerhaltung. SJT-3102200-2007.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit Mastschw<strong>ein</strong>ehaltung nach Bestandsgrößenklassen. SJT-<br />
3101500-2007.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit Milchkuhhaltung nach Bestandsgrößenklassen. SJT-3101200-<br />
2007.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit Schafhaltung. SJT-3101800-2007.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit Verkaufsanbau <strong>von</strong> Baumobst. SJT-3081250-2007.<br />
destatis, 2008. Betriebe mit W<strong>ein</strong>bau nach Größenklassen der Rebfläche. SJT-3081750-0000.<br />
destatis, 2008. Güterverzeichnis <strong>für</strong> Produktionsstatistiken (GP 2009).<br />
destatis, 2008. Vom Erzeuger zum Verbraucher - Fleischversorgung in Deutschland, Studie.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 106
destatis, 2008. Wirtschaftszweige A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI,<br />
Liste.xls.<br />
destatis, 2009. Produktion ausgewählter Erzeugnisse . SJT-4101500-2009.<br />
destatis, 2009. Vertragsanbau wichtiger Gemüsearten. SJT-3080700-0000.<br />
destatis, 2010. Ackerland nach Hauptgruppen des Anbaus. SJT-3070500-0000.<br />
destatis, 2010. Anbau, Ertrag und Ernte <strong>von</strong> Freilandgemüse. SJT-3080500-0000.<br />
destatis, 2010. Anlandungen der Hochsee- und Küstenfischerei 01 bis 09. SJT-4060300-0000.<br />
destatis, 2010. Anlieferung <strong>von</strong> Schlachttieren 1991 bis 2009. SJT-4050300-0000.<br />
destatis, 2010. Anzahl der Mühlen und Vermahlung. SJT-4021800-2010.<br />
destatis, 2010. Die Struktur der Mühlenwirtschaft, SBB-0200000-2010, Studie.<br />
destatis, 2010. Einkaufsstätten privater Haushalte. SJT-4104250-2009.<br />
destatis, 2010. Erzeugung <strong>von</strong> Eiern 1991 bis 2009. SJT-3110600-0000.<br />
destatis, 2010. Erzeugung <strong>von</strong> Gemüse 02/03 bis 09/10. SJT-4040100-0000.<br />
destatis, 2010. Erzeugung <strong>von</strong> Kuhmilch 1991 bis 2009. SJT-3110400-0000.<br />
destatis, 2010. Getreideverbrauch <strong>für</strong> Nahrung, Industrie und Futter 01/02 bis 08/09. SJT-<br />
4021600-0000.<br />
destatis, 2010. Herstellung <strong>von</strong> Fischerzeugnissen 2003 bis 2009. SJT-4060800-0000.<br />
destatis, 2010. Inlands-, Auslandsumsatz und Exportquote Ernährungsgewerbe. SJT-<br />
4101000-2009.<br />
destatis, 2010. Klassifizierungssystem der EU <strong>für</strong> landwirtschaftliche Betriebe. SJT-3010210-<br />
2010.<br />
destatis, 2010. Kuhbestände unter Milchleistungskontrolle. SJT-3110200-0000.<br />
destatis, 2010. Ldw. Erzeugung in Getreide<strong>ein</strong>heiten 02/03 bis 08/09. SJT-3120400-0000.<br />
destatis, 2010. Legehennenhaltung nach Haltungsformen. SJT-3102000-0000.<br />
destatis, 2010. Schlachtungen und Fleischanfall nach Tierarten 1991 bis 2009. SJT-4050100-<br />
0000.<br />
destatis, 2010. Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf 01/02 bis 08/09. SJT-4010600-<br />
0000.<br />
destatis, 2010. Verbrauch <strong>von</strong> Nahrungsmitteln je Kopf 00/01 bis 08/09. SJT-4010500-0000.<br />
destatis, 2010. Verbrauch <strong>von</strong> Tiefkühlkost 2002 bis 2009. SJT-4010700-0000.<br />
destatis, 2010. Verkaufsstätten im Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel 1996 bis 2009. SJT-4104200-<br />
0000.<br />
destatis, 2010. Versorgung mit Eiern 1991 bis 2009. SJT-4071600-0000.<br />
destatis, 2010. Versorgung mit Kartoffeln. SJT-4022700-0000.<br />
destatis, 2010. Versorgung mit Ölen und Fetten.<br />
destatis, 2010. Versorgung mit Ölsaaten u. pflanzl. Ölen und Fetten 02 bis 09. SJT-4080200-<br />
0000.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 107
destatis, 2010. Zahl der Betriebe des Produzierenden Ernährungsgewerbes 05 bis 09. SJT-<br />
4100500-0000.<br />
destatis, 2010. Zahl der Haltungen/Betriebe mit Tieren. SJT-3100300-0000.<br />
destatis, 2011. Landwirtschaft auf <strong>ein</strong>en Blick, Studie, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden<br />
2011.<br />
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume, 2011. Lokale Aktionsgruppen in<br />
Niedersachsen, Regionale Vermarktungsinitiativen in Niedersachsen. Expertenbefragung.<br />
Deutscher Brauer-Bund e.V., 2010. Betriebene Braustätten nach Bundesländern. Verfügbar<br />
unter: www.brauerbund.de/download/Archiv/PDF/statistiken/Braustätten%20nach%20Bundesländern%201995-<br />
2010.pdf<br />
Dialego AG (Hrsg.), 2008. Regionale Produkte. Aachen<br />
Dialego AG, 2008. Regionale Produkte - Eine Befragung der Dialego AG. Charts.<br />
Die Wissenschaftlichen Beiräte des <strong>BMELV</strong>, 2011. Gem<strong>ein</strong>same Stellungnahme<br />
Politikstrategie FoodLabelling.<br />
Dierenbescherming, 2008. (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter:<br />
http://beterleven.dierenbescherming.nl/nieuws/1982.<br />
DLG, 2011. DLG-Lebensmitteltage 2011: „Regionalität ist <strong>ein</strong> langfristiger Trend“. Verfügbar<br />
unter: www.dlg.org/aktuelles_ernaehrung.html?detail/dlg.org/4/1/4496.<br />
DLG, 2011. Neue DLG-Studie: Regionalität aus Verbrauchersicht (abgerufen am 14.11.2011).<br />
Verfügbar unter: www.dlg.org/39.html?detail/dlg.org/4/1/4479.<br />
DLG, 2011. Regionalität aus Verbrauchersicht. Studie, Frankfurt a.M.<br />
Ecco GmbH, 2008. Zum Stand der Forschung, Verbraucherzentrale Bundesverband - Seminar<br />
V 812 19. bis 21.05.2008 in Hannover. Vortrag-Charts.<br />
Fahrner, Andreas, 2010. Potentialanalyse <strong>für</strong> die b2b-Vermarktung regionaler Lebensmittel im<br />
Wechselland. Diplomarbeit. Wien: Universität Wien. Verfügbar unter<br />
http://othes.univie.ac.at/10378/1/2010-06-21_0403271.pdf.<br />
Fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg, 2010. Fair-Regional-Charta Berlin-Brandenburg.<br />
Stand: 30.06.2010 (abgerufen am 28.11.2011).Verfügbar unter: www.fairregional.de/pdfs/fair_regional_charta.pdf<br />
Fairtrade Labelling Organizations International (2011). Homepage der Fairtrade Labelling<br />
Organizations International (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter: www.fairtrade.net.<br />
Familie Redlich, 2011. Regionalsiegel in Deutschland, Dossier <strong>für</strong> das Jahr 2010. Im Auftrag<br />
des <strong>BMELV</strong>.<br />
Fink-Keßler, Andrea et al., 2003. Mit Kanonen auf Spatzen geschossen - Rechtliche<br />
Hemmnisse <strong>ein</strong>er handwerklichen Fleischverarbeitung und -vermarktung <strong>von</strong> Landwirten und<br />
Metzgern. Teil 1. In: arbeitsergebnisse Heft 55. Zeitschrift der AG Land- und<br />
Regionalentwicklung. Kassel: Universitätsverlag.<br />
gastgewerbe-magazin, 2011. Trend setzt sich durch - Gastronomie setzt auf Regionalität<br />
(abgerufen am 30.12.2010). Verfügbar unter http://gastgewerbemagazin.de/gastgewerbe/trends/trend-setzt-sich-durch-gastronomie-setzt-auf-regionalitaet-<br />
6011.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 108
Gerschau, Monika, Nina Jack, Christine Neubert, Dr. Michael Berger und Monika Luger, 2002.<br />
Ansatzpunkte <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e regionale Nahrungsmittelversorgung. Verfügbar unter:<br />
www.imuaugsburg.de/themen/VfU/aktuelles/case/organisation/material/ko.<br />
Göppel, Josef, 2000. Die Farben der Zukunft - Wie regionales Wirtschaften erfolgreich wird. In:<br />
Deutscher Verband <strong>für</strong> Landespflege - DVL (Hg.): Grundlagen der Regionalvermarktung.<br />
DVK-Schriftenreihe: Landschaft als Lebensraum 5. S. 4-15). Verfügbar unter:<br />
www.goeppel.de/fileadmin/template/goeppel/user_upload/Texte/2000_farben_der_zukunft.pdf.<br />
Grube, 2011. Geographische Herkunftsangaben. In: U. Krell und K. Warzecha (Hrsg.),<br />
Praxishandbuch Lebensmittelkennzeichnung. 38. Ergänzungslieferung 2011. Hamburg: Behr‘s<br />
Verlag. ISBN 978-3-86022-930-9.<br />
Gurrath, Peter, 2008. Fleischversorgung in Deutschland Ausgabe 2008. Wiesbaden:<br />
Statistisches Bundesamt. Verfügbar unter:<br />
www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachver<br />
oeffentlichungen/LandForstwirtschaft/ViehbestandTierischeErzeugung/Fleischversorgung1023<br />
202089004,property=file.pdf<br />
Halk, Oliver und Werner Detmering, 2011. Stellenwert der regionalen Herkunft <strong>von</strong><br />
Lebensmitteln auf Märkten aus Verbrauchersicht - Kurzfassung der Ergebnisse <strong>ein</strong>er<br />
stichprobenartigen Erhebung auf Märkten in Hannover und Oldenburg im Vergleich.<br />
Hannover.<br />
Härlen, Ingo, Johannes Simons und Carl Vierboom, 2004. Die Informationsflut bewältigen:<br />
über den Umgang mit Informationen zu Lebensmitteln aus psychologischer Sicht. Heidelberg:<br />
Dr. Rainer Wild Stiftung. ISBN 978-3833405600.<br />
Hasan, Yousra, 2006. Einkaufsverhalten und Kundengruppen bei Direktvermarktern in<br />
Deutschland: Ergebnisse <strong>ein</strong>er empirischen Analyse. Göttingen: Georg-August-Universität<br />
Göttingen. Verfügbar unter www.unigoettingen.de/de/document/download/ac1ff3eca8a6f3e2a221b45fa319a7aa.pdf/Einkaufsverha<br />
lten....pdf.<br />
Haß, Peter, 1980. W<strong>ein</strong>bezeichnungs- und Warenzeichnungsrecht. In: GRUR. Gewerblicher<br />
Rechtsschutz und Urheberrecht. München: Verlag C.H. Beck.<br />
Hausladen, Iris, Nicole Porzig und Melanie Reichert. Nachhaltige Handels-und<br />
Logistikstrukturen <strong>für</strong> die Bereitstellung regionaler Produkte: Situation und Perspektiven, HHL-<br />
Arbeitspapier Nr. 93; ISSN 1864-4562 (Online-Version). Verfügbar unter<br />
www.hhl.de/fileadmin/texte/publikationen/arbeitspapiere/hhlap0093.pdf.<br />
Henseleit, Meike, Sabini Kubitzki, Daniel Schütz und Ramona Teuber, 2007.<br />
Verbraucherpräferenzen <strong>für</strong> regionale Lebensmittel: Eine repräsentative Untersuchung der<br />
Einflussfaktoren. Gießen: Justus-Liebig-Universität Gießen. Verfügbar unter: http://geb.unigiessen.de/geb/volltexte/2007/4760/pdf/Agraroekonomie-2007-83.pdf.<br />
Hock, Sonja, 2005. Engagement <strong>für</strong> die Region: Initiativen der Regionalbewegung in der<br />
Region Nürnberg: Ziele, Strategien und Kooperationsmöglichkeiten, Erlangen: Fränkische<br />
Geogr. Ges. ISBN 978-3-920405-92-6.<br />
Hollst<strong>ein</strong>, A., 1999. Mengenströme und Wertschöpfung im deutschen Getreidesektor.<br />
Verfügbar unter: www.uni-kiel.de/agrarmarketing/Gewisola99/Posterhollst<strong>ein</strong>.pdf.<br />
Horx, Matthias, 2005. Vertrauen und Authentizität. Interview in:<br />
SnaxxMagazin_3_2005_Zukunft, S. 20 ff.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 109
Hühne, Klaus, Deutscher Fleischer-Verband e.V., 2011. E-Mail-Befragung am 25.11.2011<br />
zum Thema Selbstschlachtung, Befragung durch MG-Niedersachsen e.V.<br />
IMK Institut <strong>für</strong> angewandte Marketing und Kommunikationsforschung GmbH and MDR-<br />
Werbung GmbH, 2011. West-Ost-Markenstudie 2011. Verfügbar unter: www.i-mk.de/cms/getfile.php5?9115.<br />
Institut Fresenius, 2010. SGS Institut Fresenius Verbraucherstudie 2010: Lebensmittelqualität<br />
und Verbrauchervertrauen. Zusammenfassung (abgerufen am 14.11.2011). Taunusst<strong>ein</strong>.<br />
Verfügbar unter: www.institut-fresenius.de/presse/newsarchiv/jeder_zweite_deutsche_fuerchtet_mogelpackung_bei_lebensmitteln_72240.shtml.<br />
Institut Fresenius, 2011. SGS Institut Fresenius Verbraucherstudie 2011. Lebensmittelqualität<br />
und Verbrauchermacht. Zusammenfassung. Taunusst<strong>ein</strong>/Hamburg. Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/studien/pdfs/293_.pdf.<br />
Janssen, Meike und Ulrich Hamm, 2010. Standards und Kennzeichen <strong>für</strong> Öko-Lebensmittel<br />
aus Verbrauchersicht: Empfehlungen <strong>für</strong> agrar-politische Entscheidungsträger. In:<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.). Berichte<br />
über Landwirtschaft Band 88 (1). Bonn. ISSN 0005-9080. S. 86-102. Verfügbar unter:<br />
www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Service/BerichteLandwirtschaft/2010_Heft1_Band88.p<br />
df;jsessionid=40A0036A601E9114813EEE9B4F3452DB.2_cid163?__blob=publicationFile.<br />
Knaak, Roland, 1995. Der Schutz geographischer Herkunftsangaben im neuen Markengesetz.<br />
In: GRUR. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. München: Verlag C.H. Beck.<br />
Kögl, Hans und Jana Tietze, 2010. Regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung <strong>von</strong><br />
Lebensmitteln, Forschungsbericht. Uni Rostock. ISBN 978-3-86009-086-2. Verfügbar unter:<br />
http://rosdok.uni-rostock.de/file/rosdok_derivate_000000004324/FB02_10.pdf.<br />
Kopp, Sören, 2009. Geografische Qualitätszeichen <strong>für</strong> Lebensmittel - Staatliche<br />
Absatzförderung und Warenverkehrsfreiheit. Bayreuth: Verlag P.C.O. ISBN 978-3941678064.<br />
Kuhnert, Heike, Gesine Behrens und Volker Beusmann, 2011. Bericht zum Projekt<br />
„Strukturdaten Hamburger Öko-Markt“. Verfügbar unter: www.uni-hamburg.de/fachbereiche<strong>ein</strong>richtungen/biogum/2011.html.<br />
Kuhnert, Heike, Gesine Behrens und Volker Beusmann, 2011. Kurzfassung der Studie<br />
„Strukturdaten Hamburger Öko-Markt“. ISBN: 978-3-937792-28-6. Verfügbar unter: www.unihamburg.de/fachbereiche-<strong>ein</strong>richtungen/biogum/2011.html.<br />
Kullmann, Armin und Claudia Leucht, 2011. Synergie oder Profilverlust? Potentiale und<br />
Probleme <strong>ein</strong>er gem<strong>ein</strong>samen Regionalvermarktung ökologischer und konventioneller<br />
Produkte. Verfügbar unter: www.orgprints.org/19286/.<br />
Kullmann, Armin, 2004. Regionalvermarktung - Mit professionell organisierten Projekten neue<br />
Marktpotenziale erschließen. In: ÖKOLOGIE&LANDBAU, 3/2004, Bad Dürkheim: Stiftung<br />
Ökologie & Landbau. S. 29-31. Verfügbar unter: www.ifls.de/uploads/media/SOEL-<br />
Artikel0704ak.pdf.<br />
Kullmann, Armin, 2004. Regionalvermarktung <strong>von</strong> Öko-Produkten: Erfolgsfaktoren, Stand und<br />
Potentiale. In: Kullmann, Armin (Hrsg.): Ökologischer Landbau und Nachhaltige<br />
Regionalentwicklung. Tagungsband zur Tagung des Instituts <strong>für</strong> Ländliche Strukturforschung<br />
vom 11.03.2004. Frankfurt am Main: Institut <strong>für</strong> Ländliche Strukturforschung. S. 109-129.<br />
Kullmann, Armin, 2007. Regionalvermarktung und Regionalentwicklung in Modellregionen -<br />
Synergien und Handlungsbedarf. In: Antoni-Komar, I., R. Pfriem, T. Raabe und A. Spiller<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 110
(Hrsg.): Ernährung, Kultur, Lebensqualität - Wege regionaler Nachhaltigkeit. Marburg:<br />
Metropolis.<br />
Kullmann, Armin, 2008, Erfolgsfaktoren <strong>für</strong> regionales Nachhaltigkeitsmarketing - „Regionale<br />
Lebensmittel und Gesundheit“, Vortrag an der Hochschule Neubrandenburg.<br />
Kunkel, Sabrina, Uwe Platz und R<strong>ein</strong>hard Wolter, 2011. Die Struktur der Mühlenwirtschaft in<br />
Deutschland. Wirtschaftsjahr 2009/10. Bonn: Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.). ISSN 0942-2501. Verfügbar unter:<br />
http://berichte.bmelv-statistik.de/SBB-0200000-2010.pdf.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2007. LZ-Studie: Potenzial <strong>für</strong> viele Sortimente (09.02.2007).<br />
Verfügbar unter: www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/LZ-Studie-<br />
Potenzial-fuer-viele-Sortimente_65490.html?id=65490&a=0.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2007. Regionalität: Qualitätsversprechen zählen (31.08.2007).<br />
Verfügbar unter: www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/Regionalitaet-<br />
Qualitaetsversprechen-zaehlen_64978.html?id=64978&a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2009. Landgard setzt auf deutsche Paprika (17.09.2009). Verfügbar<br />
unter: www.lebensmittelzeitung.net/news/top/protected/Landgard-Setzt-auf-deutsche-<br />
Paprika_75812.html?a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2009. Westfleisch stellt Regionalität heraus (27.08.2009). Verfügbar<br />
unter: www.lebensmittelzeitung.net/news/top/protected/Westfleisch-Stellt-Regionalitaet-<br />
heraus_75398.html?a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2010. K<strong>ein</strong>e Berührungsängste: Interview mit Vion Chef Dr. Uwe<br />
Tillmann (29.10.2010). Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/show.php?id=83433&page=1.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2010. Trend zu Markenprodukten (11.02.2010). Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/Interview-Trend-zu-<br />
Markenprodukten_78342.html?id=78342&a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2010. Upgrading <strong>für</strong> Bio (23.04.2010). Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/business/handel/trends/protected/Bio-im-<br />
Handel_1157_7001.html.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2010. Vitaminpatroitismus (21.05.2010). Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/Regionalitaet-<br />
Vitaminpatriotismus_80609.html?id=80609&a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2011. Bio und Local Food wären <strong>ein</strong> Dream-Team (11.02.2011).<br />
Verfügbar unter: www.lebensmittelzeitung.net/news/messenews/Futurefoodstudios-Bio-und-<br />
Local-Food- waeren-<strong>ein</strong>-Dream-Team_84927.html?a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2011. Hemme-Milch beliefert Edeka (21.01.2011). Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/news/markt/protected/Hemme-Milch-Beliefert-<br />
Edeka_84535.html?a=2.<br />
LebensmittelZeitung.net, 2011. Nach der Bio- rollt nun die Regio-Welle (21.04.2011).<br />
Verfügbar unter:<br />
www.lebensmittelzeitung.net/news/newsarchiv/protected/show.php?id=86416&page=1.<br />
Leitow, Detmar, 2005. Produktherkunft und Preis als Einflussfaktoren auf die<br />
Kaufentscheidung: Eine experimentelle und <strong>ein</strong>stellungstheoretisch basierte Untersuchung<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 111
des Konsumentenverhaltens bei regionalen Lebensmitteln. Dissertation. Berlin: Humboldt-<br />
Universität. Verfügbar unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/leitow-detmar-2005-04-<br />
18/PDF/Leitow.pdf.<br />
Leser, Hartmut (Hrsg.), 2005. Diercke Wörterbuch Allgem<strong>ein</strong>e Geographie. München,<br />
Braunschweig. ISBN 978-3423034227.<br />
Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e.V., 2008.<br />
Direktvermarkterbefragung 2008. Charts.<br />
Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e.V., 2006.<br />
Regionale Vermarktungsinitiativen in Niedersachsen. Ergebnisse <strong>ein</strong>er Expertenbefragung.<br />
MVS Milchvermarktungsgesellschaft mbH, 2009. Die faire Milch (abgerufen am 28.11.2011).<br />
Verfügbar unter: www.die-faire-milch.de.<br />
Naturland, 2011. Fair Zertifizierung (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter:<br />
www.naturland.de/fairzertifizierung.html.<br />
Nestlé Deutschland AG (Hrsg.), 2011. So is(s)t Deutschland. Ein Spiegel der Gesellschaft.<br />
Stuttgart: Matthaes. ISBN 978-3875150988.<br />
Nestlé Deutschland AG, 2009. Nestlé Studie 2009, Ernährung in Deutschland 2008.<br />
Kurzfassung.<br />
Niedermaier, Jakob, 2011). Stellungnahme MVS GmbH zum Urteil Wettbewerbszentrale / „Die<br />
faire Milch“ (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter: www.die-fairemilch.de/userfiles/file/Stellungnahme%20MVS_UWZnach%20Urteilsbegr%C3%BCndung_080<br />
411.pdf.<br />
ÖGS - Ökologischer Großküchen Service Rainer Roehl, Anja Erhart & Dr. Carola Strassner<br />
GbR (Hrsg.), 2005. Mit <strong>ein</strong>fachen Schritten zum Bio-Zertifikat: Ein Leitfaden <strong>für</strong> Großküchen<br />
und Gastronomie. Frankfurt am Main. Verfügbar unter:<br />
www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/grossverbraucher/Leitfaden_Bio<br />
Zertifizierung.pdf.<br />
Öko-Test, 2011. Der große Schwindel. In: Öko-Test 9/2011, S. 14 ff.<br />
Otto GmbH & Co KG (Hrsg.), 2011. Verbrauchervertrauen. 3. Studie zum ethischen Konsum.<br />
Auf dem Weg zu <strong>ein</strong>er neuen Wertekultur. Hamburg: Ottogroup. Verfügbar unter:<br />
www.ottogroup.com/media/docs/de/studien/Otto-Group-Trendstudie-2011-<br />
Verbauchervertrauen.pdf.<br />
Pohle, R. 2008. Anforderungen an regionale Lieferanten im Lebensmittelhandel. Vortrag<br />
gehalten am 02.04.2008 in Hannover.<br />
Pohle, R. 2008. Anforderungen des LEH an Lieferanten, Textsammlung zur Vorbereitung des<br />
Regionalworkshops.<br />
Profeta, Adriano, 2005. Die Bedeutung <strong>von</strong> geschützten Herkunftsangaben in der<br />
Produktmarkierung <strong>für</strong> Lebensmittel und Schlussfolgerungen <strong>für</strong> das Marketing: Eine Discrete-<br />
Choice-Analyse <strong>von</strong> Kennzeichnungsmöglichkeiten und deren Wahrnehmung aus<br />
Verbrauchersicht <strong>für</strong> die Produktkategorien Bier und Rindfleisch. Dissertation an der<br />
Technischen Universität München-Weihenstephan.<br />
Rathke, Kurt-Dietrich, 2011. In: Walter Zipfel und Kurt-Dietrich Rathke. Lebensmittelrecht, Rn.<br />
120, 144. Ergänzungslieferung 2011. München: Verlag C.H. Beck. ISBN 978-3-406-62536-7.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 112
R<strong>ein</strong>hardt, Guido, Sven Gärtner, Julia Münch und Sebastian Häfele, 2009. Ökologische<br />
Optimierung regional erzeugter Lebensmittel: Energie- und Klimabilanzen. Heidelberg: Ifeu -<br />
Institut <strong>für</strong> Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH. Verfügbar unter:<br />
www.ifeu.de/landwirtschaft/pdf/Langfassung_Lebensmittel_IFEU_2009.pdf.<br />
Rippin, Markus, 2008. Öko-Absatzpotenziale in NRW bis 2012. Studie. Münster: Westfälisch<br />
Lippischer Landschaftsverband e.V. (Hrsg.). Verfügbar unter:<br />
www.umwelt.nrw.de/ministerium/pdf/marktstudie_080930.pdf.<br />
Rutenberg, Jan, 2011. tegut… lokal. Ergebnis Fokusgruppen Fulda, Gotha & Wiesbaden.<br />
Sauter, Arnold und Rolf Meyer, 2003. Potenziale zum Ausbau der regionalen<br />
Nahrungsmittelversorgung: Endbericht zum TA-Projekt „<strong>Entwicklung</strong>stendenzen bei<br />
Nahrungsmittelangebot und -nachfrage und ihre Folgen“. TAB - Arbeitsbericht Nr. 88. Berlin:<br />
Büro <strong>für</strong> Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Verfügbar unter: www.tabbeim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab088.pdf.<br />
Schaer, Burkhard, 2000. Regionales Gem<strong>ein</strong>schaftsmarketing <strong>für</strong> Öko-Lebensmittel,<br />
dargestellt am Beispiel der Konzeption des Zeichens „Öko-Qualität, garantiert aus Bayern“.<br />
Dissertation an der TU München-Weihenstephan, Veröffentlichung in Vorbereitung.<br />
Schlich, Michaela und Elmar Schlich, 2010. Consumer response to the Product Carbon<br />
Footprint, Universität Koblenz-Landau und Justus Liebig Universität Gießen. Verfügbar unter:<br />
www.unigiessen.de/fbr09/pt/PT_Publikationen/Schlich_Michaela_Full_Paper_LCA_XI_Chicago_2011.<br />
pdf.<br />
Schmidt, Christian, Oliver Halk und Werner Detmering, 2008. Betriebsvergleich der deutschen<br />
Mühlenwirtschaft 2007: Ergebnisbericht <strong>ein</strong>er Unternehmenserhebung. Hannover:<br />
Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft e.V.<br />
Siemes, Johannes und Katja Kröll, 2008. Sortimente und Warengruppen im deutschen<br />
Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel. Köln: KMPG Deutsche Treuhand-Gesellschaft. Verfügbar unter:<br />
www.kpmg.de/docs/Sortimente_und_Warengruppen_im_deutschen_Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel<br />
_-_<strong>ein</strong>e_Bewertung_aus_Verbrauchersicht.pdf.<br />
Sindel, H<strong>ein</strong>er, 2009. Erzeugung und Vermarktung <strong>von</strong> landwirtschaftlichen<br />
Qualitätsprodukten, Vortrag am 14. und 15.07.2009 in der Kalkscheune Berlin.<br />
SKOPOS Institut <strong>für</strong> Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co. KG, 2010. SKOPOS-<br />
Studie zu Lebensmittelsiegeln: Regionale Herkunft ist wichtiger als Bio (abgerufen am<br />
15.11.2011). Verfügbar unter: www.skopos.de/de/newspresse/141-skopos-studie-zulebensmittelsiegeln-regionale-herkunft-ist-wichtiger-als-bio.html.<br />
Spiller, Achim und Birgit Schulze (Hrsg.), 2008. Zukunftsperspektiven der Fleischwirtschaft:<br />
Verbraucher, Märkte, Geschäftsbeziehungen. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. ISBN<br />
978-940344-13-7. Verfügbar unter http://goedoc.uni-goettingen.de/goescholar/bitstream/<br />
handle/goescholar/3201/fleischwirtschaft.pdf?sequence=1.<br />
Spiller, Achim und Nina Stockebrand, 2008. Bio-Vermarktung im Handel: Regional und<br />
authentisch! Vortrag am 29.09.2008 im Rahmen der Bio-Sonderschau in Düsseldorf.<br />
Statista, 2009. Umsatz mit Food im LEH nach Warengruppen 2009, Studie, Charts.<br />
Statista, 2011. Bioprodukte und Gründe <strong>für</strong> deren Einkauf, Studie, Charts.<br />
Statista, 2011. Einkaufsstätten bei Bioprodukten seit 2008. Studie, Charts.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 113
St<strong>ein</strong>heuer, Christina, 2011. Megatrend Regionalität. In: Lebensmittel Praxis. 3/2011. S. 16-<br />
17.<br />
Stiftung Warentest, 2011. Essen <strong>von</strong> hier - Regionale Lebensmittel. In: test, 4/2011. Berlin:<br />
Stiftung Warentest. ISSN 0040-3946. S. 24-27.<br />
Stockebrand, Nina und Achim Spiller, 2009. Verknüpfung regionaler Beschaffungskonzepte<br />
mit innovativen regionalen Marketingansätzen. Abschlussbericht BÖL und Umwelt der<br />
Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades <strong>ein</strong>es Doktors der<br />
Agrarwissenschaften (Dr. agr.) genehmigten Dissertation. Verfügbar unter:<br />
http://orgprints.org/16111/1/16111%2D06OE235%2Duni_goettingen%2Dspiller%2D2009%2D<br />
beschaffungskonzept_KEHK.pdf.<br />
Stoyke, Cord, 2011. Regionale Produkte - Imageträger der Region? Workshop „Regionale<br />
Vermarktung - <strong>Entwicklung</strong>sperspektiven in der niedersächsischen Küstenregion“<br />
Wilhelmshaven, 08.11.2011.<br />
Str<strong>ein</strong>z, Rudolf, 2011. Lebensmittelrechts-Handbuch. 32. Auflage. München: Verlag C.H.<br />
Beck. ISBN 978-3-406-41833-4.<br />
Thiedig, Frank, 2011. Nachhaltigkeit im LEH, Chancen in der Zusammenarbeit mit der<br />
Ernährungswirtschaft, Edeka Minden, Vortrag.<br />
Verbaucherzentrale des Saarlandes e.V., 2008. Kennen Sie regionale Lebensmittel?<br />
(abgerufen am 28.11.2011) Verfügbar unter:<br />
www.saarlaendlich.de/Regionalentwicklung/umfrage08.php.<br />
Verbraucherzentrale, 2007. Die Ausweise, bitte! Lebensmittel aus aller Welt. Kennzeichnung<br />
lückenhaft und missverständlich. Hamburg: Verbraucherzentrale. Verfügbar unter:<br />
www.vzbv.de/mediapics/bericht_umfrage_herkunft_<strong>von</strong>_lebensmitteln_23.07.2007_copy.pdf.<br />
Verbraucherzentrale, 2010. Positionspapier zur verbrauchergerechten Kennzeichnung <strong>von</strong><br />
regionalen Lebensmitteln (Stand 20.12.2010). Verfügbar unter: www.verbraucher.de/<br />
download/2010-12-20_Positionspapier%20VZen%20Regionalkennzeichnung.pdf.<br />
Wagenhofer, Gertraud, 2007. Globalisierung versus Regionalisierung: Lebensmittel zwischen<br />
Regionalisierung und Globalisierung. Innsbruck: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.<br />
Werlen, Benno, 1997. Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 2:<br />
Globalisierung, Region und Regionalisierung. Stuttgart. Erdkundliches Wissen, Band119.<br />
Westfleisch o. J. Aktion Tierwohl (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter: www.aktiontierwohl.de.<br />
Wikipedia, Artikel zum Begriff Nachhaltigkeit (abgerufen am 28.11.2011). Verfügbar unter:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit.<br />
Wolter, R<strong>ein</strong>hard, 2008. Die Unternehmensstruktur der Molkereiwirtschaft in Deutschland.<br />
Bonn: Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.). ISSN<br />
0944-9035. Verfügbar unter: http://berichte.bmelv-statistik.de/SBB-0010000-2006.pdf.<br />
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerk, 2011. Das deutsche Bäckerhandwerk: Daten<br />
und Fakten 2011. Berlin. Verfügbar unter:<br />
http://www.baeckerhandwerk.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Zahlen_Fakten_2011_DE.<br />
pdf.<br />
ZMP, 2003. Nahrungsmittel aus der Region - Regionale Spezialitäten. Zentrale Markt- und<br />
Preisberichtstelle <strong>für</strong> Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (ZMP) in<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 114
Zusammenarbeit mit der Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH.<br />
CMA. Bonn.<br />
ZMP, 2006. Trendstudie Food. Gesellschaftlicher Wandel und s<strong>ein</strong>e Wirkung auf den Food-<br />
Bereich. Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle <strong>für</strong> Erzeugnisse der Land-, Forst- und<br />
Ernährungswirtschaft (ZMP). Bonn.<br />
Zühlsdorf, Anke, 2011. Transparenzerhebung der regionalen Landesprogramme -<br />
Ergebnisbericht - 2. Fassung Juni 2011. Verbraucherzentralen im Rahmen der<br />
Gem<strong>ein</strong>schaftsaktion „Nachhaltige Ernährung“: Verbraucherzentralen Hessen (Federführung),<br />
Niedersachsen, Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen,Saarland und Schleswig-Holst<strong>ein</strong> (Hrsg.). Verfügbar<br />
unter: www.verbraucher.de/download/Abschlussbericht_L%C3%A4nder%20FINAL.pdf.<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 115
12 Anhang<br />
12.1 Übersichtstabelle Regionalinitiativen<br />
12.2 Protokoll <strong>BMELV</strong> vom 05.12.2011<br />
12.3 Protokoll Beiratssitzung vom 09.12.2011<br />
12.4 Gesprächsnotiz BRB vom 10.11.2011<br />
12.5 Positionspapier BRB vom 25.11.2011<br />
12.6 Schreiben BRB vom 16.12.2011<br />
12.7 Gesprächsnotiz BVL vom 18.11.2011<br />
12.8 Gesprächsnotiz BVL vom 15.12.2011<br />
12.9 Positionspapier BVL vom 10.01.2012<br />
12.10 Protokoll AMK vom 28.10.2011<br />
12.11 Positionspapier VZ<br />
12.12 E-Mail BÖLW vom 16.12.2011<br />
12.13 Matrix Potenzialanalyse<br />
12.14 Gesprächsleitfaden Expertenbefragung<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 116
12.1 Übersichtstabelle Regionalinitiativen<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
BB Spreewald<br />
BB<br />
Biosphärenreservat<br />
Schorfheide-<br />
Chorin<br />
Landschaftsraum<br />
(Landkreise,<br />
Gem<strong>ein</strong>denn)<br />
Landschaftsraum<br />
BE, BB VON HIER Bundes-länder<br />
BB BE<br />
BW<br />
fair®ional Bio<br />
Berlin<br />
Brandenburg Bundes-länder Ökologischer Landbau<br />
(Berlin-) Brandenburg<br />
Kaiserlich<br />
genießen<br />
Landschaftsraum<br />
4<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 1<br />
Zerzifikate DLG, QS, IFS, EUREPGAP, DEHOGA-<br />
Klassifizierungen, pro agro, Kontrollring des integrierten<br />
Anbaus <strong>von</strong> Obst und Gemüse im Land Brandenburg e.V,<br />
kontrolliert ökologische Produktion , integrierter<br />
Pflanzenbaus (Fördergem<strong>ein</strong>schaft Integrierter<br />
Pflanzenbau e.V.), Betriebliche Nachweiskarte<br />
Mindestanforderungen sind durch überprüfbare<br />
<strong>Kriterien</strong> definiert; Erzeuger: Umweltschonende<br />
Herstellung der Produkte, kurze Transportwege;<br />
Einzelhändler/Regionalläden bieten <strong>ein</strong> besonders<br />
breites Angebot an regionalen Produkten und<br />
Spezialiäten<br />
Erzeuger: QS, Pestizide im Pflanzenbau bedarf<br />
Empfehlung/Genehmigung d. Amtes <strong>für</strong><br />
Verbraucherschutz, Düngung auf kontrollierter Basis,<br />
Produkte erreichen <strong>ein</strong>e Qualitätszahl <strong>von</strong> mindestens<br />
4,5 Punkten auf der DLG 5-Punkte-Skala; Verarbeiter:<br />
hohe (handwerkliche) Qualität gesichert<br />
Erzeuger: extensive Landwirtschaft, k<strong>ein</strong>e<br />
Klärschlämme, QbA-<strong>Kriterien</strong> (W<strong>ein</strong>bau) und Düngung<br />
und Pflanzenschutz nach QZ BW (Landwirtschaft)<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Tierfutter und Aufzucht zu mind. 50% ;<br />
Anbauflächen dürfen in Ausnahmefällen<br />
in angrenzende Gemarkung reichen;<br />
Verarbeitete Produkte: Hauptrohstoffe<br />
zu mind. 50%, überregionaler Zukauf<br />
ergänzender Zutaten bei mangelndem<br />
regionalem Angebot (jährl.<br />
Überprüfung)<br />
neutrale Kontrolle durch zugelassene<br />
Prüfstelle (<strong>für</strong> g.g.A-Produkte) und<br />
externe Mitglieder des Fachbeirates<br />
der regionalen Dachmarke,<br />
Markeninhaber darf Zertifizierung<br />
kontrollieren; Zertifizierung:<br />
Eigenanmeldung, Probennahme,<br />
Erstprüfung; Markennutzung <strong>für</strong><br />
jeweils 1 Jahr<br />
Rohstoffe "überwiegend aus dem<br />
Biosphärenreservat und der<br />
umliegenden Region" Naturschutz<br />
Tiere: Vorprodukte/Futtermittel soweit<br />
als möglich aus der Region; Pflanzen:<br />
Unverarbeitet: 100%, Verarbeitet:<br />
Rohstoffe soweit wie technisch möglich,<br />
jedoch mindestens zu 70 %<br />
Gewichtsanteil, Verarbeitung in Region,<br />
außer mit stichhaltiger Begründung im<br />
Sinne der Nachhaltigkeit<br />
Meldeformular über Vertragsfläche,<br />
Aufzeichnungen über Waren-<br />
/Rohstoff<strong>ein</strong>gang und -ausgang, die<br />
mind. 1x jährl. kontrolliert werden<br />
durch anerkannte Institute, ggf.<br />
Probennahme<br />
z. T. Bio; Tierwohl;<br />
Gentechnikfrei<br />
Monoprodukte zu 100%,<br />
Zusammengesetzte Produkte: 80-100%<br />
der Hauptzutat; Tiere: ab Alter v. 6 Wo<br />
in der Region (Geflügel ab 1 Wo.) Evaluation durch internes Gremium Bio; Naturschutz<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
Besonderer Beitrag zu<br />
nachhaltiger <strong>Entwicklung</strong> der<br />
Region, zum Erhalt/zur<br />
Schaffung <strong>von</strong><br />
Arbeitsplätzen; soziale<br />
Anliegen<br />
Nachhaltige Wirtschafts- und<br />
Handelsbeziehungen,<br />
Soziales Engagement
BW<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Heimat- nichts<br />
schmeckt näher<br />
BW Gutes vom See<br />
BW<br />
PLENUM<br />
Schwäbische Alb<br />
BW Regiokiste<br />
BW Regionalwert AG<br />
Landschaftsraum<br />
+<br />
Landkreise<br />
Landschaftsraum<br />
+ km<br />
Landschaftsraum<br />
+<br />
Landkreise<br />
Landkreise +<br />
Gem<strong>ein</strong>den<br />
Landschaftsraum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 2<br />
Erzeuger: Betriebsanerkennung als Betrieb,<br />
angemessene Qualifikation und technische Ausstattung,<br />
Mithilfe <strong>ein</strong>e regionale Erzeuger-Verbraucher-<br />
Partnerschaft aufzubauen und <strong>Entwicklung</strong> des<br />
gem<strong>ein</strong>samen Qualitätssystems zu fördern; hohe<br />
Genussqualität der Produkte durch optimale Erzeugungs-<br />
und Verarbeitungsmethoden, regionaltypische<br />
Angebote, Nachhaltigkeitskriterien, k<strong>ein</strong><br />
Klärschlamm/Müllkompost<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
interne und unabhängige Kontrollen;<br />
systematische Aufzeichnungen analog<br />
<strong>Kriterien</strong> QZ BW, Meldeformular,<br />
unangekündigte Kontrollen durch<br />
Beauftragte der Trägerorganisation,<br />
Kontrollen jährlich<br />
umweltschonende oder ökologische Erzeugung;<br />
Richtlinien des Qualitätszeichen Baden-Württemberg<br />
(QZ) oder wirtschaften kontrolliert ökologisch (Bio-<br />
Zertifikat), Extensivflächenanteil <strong>von</strong> mind. 10 % Unabhängige Herkunftsüberprüfung<br />
Erzeuger: 10% Extensivfläche, unabhängiges<br />
Zertifizierungssystem (QZ BW, QS oder auch<br />
Beauftragung <strong>ein</strong>er externen Zertifizierungsstelle ohne<br />
Programmzugehörigkeit)<br />
Ökozertifizierung (oder Umstellung begonnen) u.<br />
Verbandszugehörigkeit, Erhaltung <strong>ein</strong>er vielfältigen<br />
Kulturlandschaft, aktiver Aufbau der Fruchtbarkeit des<br />
Bodens und der Nutztiere, Erhaltung und Erhöhung der<br />
Biodiversität<br />
ökologisches Saatgut, Produktionsmittel<br />
Saatgut, Zuchtmaterial, Energie und<br />
Dünger aus regionaler Herkunft Bio<br />
gentechnikfrei;<br />
PLENUM-<br />
Naturschutz-ziele<br />
artgerechte<br />
Tierhaltung, MEKA<br />
und LPR PLENUM<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz:<br />
PLENUM-Ziele<br />
Hauptaugenmerk<br />
im Handlungsfeld<br />
Naturschutz<br />
aktive Stärkung der<br />
regionalen Wirtschaft,<br />
Vorprodukte und<br />
Verarbeitung "weitest<br />
möglich" durch Partner,<br />
Nutzung vorhandener<br />
Handelsstrukturen<br />
Erzeugungs- =<br />
Vermarktungsregion;<br />
branchenübergreifende<br />
Kooperation <strong>von</strong> zur<br />
<strong>Entwicklung</strong> und Stärkung<br />
regionaler<br />
Wirtschaftskreisläufe<br />
Vernetzung unter Partnern;<br />
Ausbildungsplätze,<br />
Integration sozial<br />
schwächerer Menschen,<br />
mehr Facharbeitskräfte als<br />
Saisonarbeiter, gerechte<br />
Entlohnung
BW<br />
BW<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
PLENUM<br />
westlicher<br />
Bodensee<br />
Landschaftsraum<br />
Württemberger<br />
Lamm Bundesland<br />
BW echt Alb echt gut<br />
Landschaftsraum<br />
BW Naukorn Gem<strong>ein</strong>den<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 3<br />
Erzeuger: heimisches Futter, das aus Gras, Heu und<br />
Getreide besteht; Rasse: Merino-Landschafe;<br />
Verarbeiter: Württemberger Lämmer werden in <strong>ein</strong>em<br />
Alter <strong>von</strong> 4 bis 6 Monaten geschlachtet<br />
Die Herstellung/Verarbeitung erfolgt unter definierten<br />
Qualitäts-, Herstellungs- und Sozialkriterien;<br />
Teilnahmekriterien<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
mind: 90% der Bestandteile/Zutaten<br />
(Max: 10% dürfen <strong>von</strong> außerhalb<br />
bezogen werden); Großteil der<br />
Wertschöpfung in der Region<br />
Kontrolle <strong>ein</strong>mal jährlich durch <strong>ein</strong> in<br />
der Branche führendes/<br />
obligatorisches Prüfinstitut<br />
Chemischer Pflanzenschutz, nur, wenn biologische/<br />
mechanische Verfahren oder das Resistenzvermögen<br />
der Sorte nicht ausreichen, starke Ertrags<strong>ein</strong>bußen zu<br />
vermeiden.; Verarbeiter: Es wird Natursauerteig<br />
verwendet und mit langen Teigführungen gearbeitet Verarbeitung in der Region Qualitätszeichen Baden-Württemberg<br />
BW Linzgaukorn Gem<strong>ein</strong>den QZ Baden-Württemberg, Bioland Verarbeitung in der Region<br />
BW Onser Saft Gem<strong>ein</strong>den<br />
Erzeuger: nur ausgereiftes, ungespritztes Obst aus<br />
unserem Einzugsgebiet, d. h. strenge ökologische<br />
Richtlinien und entsprechende Kontrolle; ausschließlich<br />
Streuobstwiesen; Düngung mit Mineralischem Dünger<br />
untersagt; Verarbeiter: garantierte Abnahme; bezahlt<br />
aktuellen Tagespreis <strong>für</strong> Mostobst zzgl. Bonus <strong>von</strong> 3,50<br />
je dz<br />
Erzeuger, Verarbeiter und Vermarktung<br />
in der Region<br />
Kontrollen regelmäßig <strong>von</strong><br />
unabhängigen Kontrollstellen<br />
durchgeführt; Zertifizierung:<br />
Qualitätszeichen Baden-Württemberg;<br />
Bioland, Demeter<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
umweltschonende<br />
r Anbau<br />
neutrale externe Kontrollen;<br />
unangemeldete Kontrollen durch den<br />
Ver<strong>ein</strong> jederzeit möglich; zertifiziert<br />
nach: EG-ÖkoVO Bio; Naturschutz<br />
sozial-ökologische Werte<br />
(Beschäftigungsstruktur,<br />
Ausbildung, Integration <strong>von</strong><br />
schwächeren Menschen,<br />
Entlohnung, Qualität der<br />
Arbeitsplätze)
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
BW St<strong>ein</strong>kauz Gem<strong>ein</strong>den<br />
BW Schnee-wittchen Landkreise<br />
BW<br />
BW<br />
Naturpark Südschwarzwald<br />
echt<br />
Schwarzwald<br />
BW Ostalblamm<br />
BW<br />
BW<br />
Boef de<br />
Hohenlohe<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
unterschiedliche<br />
Grenzen<br />
Schwäbisch<br />
Hällisches<br />
Schw<strong>ein</strong>efleisch<br />
BESH Landkreise<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 4<br />
Erzeuger: BIO-Zertifizierung; Verarbeiter ist verpflichtet<br />
dem Erzeuger den doppelten Marktpreis, maximal<br />
jedoch 17,90 € pro Doppelzentner zu zahlen<br />
Erzeuger: Obst ausschließlich aus der Region; k<strong>ein</strong>e<br />
Mineralische Düngung; Vermarkter: regional<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
neutrale externe Kontrollen und<br />
unangemeldete Kontrollen durch den<br />
Ver<strong>ein</strong> jederzeit möglich Bio; Naturschutz<br />
Rückstandskontrollen <strong>von</strong> Saft- und<br />
Blattproben durch <strong>ein</strong> unabhängiges<br />
Labor; kontrolliert werden 20% der<br />
Bestände und 100% der Saftmenge<br />
jährlich Naturschutz<br />
Weidehaltung, zumindest während der<br />
Vegetationsperiode; strengen Regeln und Kontrollen,<br />
um die hohen Qualitätsstandards zu sichern; Verkauf<br />
durch die Bauern selbst als Direktvermarkter, oder<br />
regionale Metzgereibetriebe Tierwohl<br />
Erzeuger: traditionelle Hüteschafhaltung zur Pflege<br />
wertvoller Wacholderheiden; Vermarkter: Die regionale<br />
Spezialität wird in ausgesuchten Gasthäusern und<br />
Restaurants zubereitet und serviert<br />
Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter<br />
in der Region<br />
Mutterkuhhaltungsaufzucht, Weidegang während<br />
Vegetationsperiode, Verzicht auf Anbindhaltung,<br />
Auslauf, ohne Tiermehl, Verbot <strong>von</strong> Medikamenten/<br />
Leistungsförderern/kommerziellen Tiertransporten hofeigenes/regionales Futter Bio<br />
Verbot <strong>von</strong> Medikamenten/Wachstumsförderer/<br />
Tiermehl u.a.; Stroh<strong>ein</strong>streu, Gruppenhaltung und<br />
Tageslicht Schlachtung in Schwäbisch Hall<br />
Tierwohl;<br />
gentechnikfrei<br />
neutrale Kontrolle durch das<br />
Lebensmittelinstitut Lacon Offenburg<br />
(gesamte Erzeugung <strong>von</strong> der Zucht bis<br />
zur Schlachtung) Tierwohl
BW<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Förderver<strong>ein</strong><br />
Göppinger<br />
Apfelsaft Landkreise<br />
BW Junges Weiderind<br />
BW<br />
Landschaftsraum<br />
So schmeckt<br />
Sigmaringen Landkreise<br />
BW Landzunge Landkreis<br />
BW Albkorn<br />
BW<br />
BW<br />
Schwäbisches<br />
Donautal<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
Apfelsaft <strong>von</strong><br />
Reutlinger<br />
Streuobst-wiesen Landkreis<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 5<br />
Erzeuger: nur ungespritztes Obst <strong>von</strong> Obsthochstämmen<br />
aus Göppinger Streuobstwiesen, Max. zwei Tonnen pro<br />
Jahr<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Untersuchung auf Pestizidrückstände<br />
in Blattproben und Saft, Ermittlung<br />
Qualitätsmerkmale<br />
Erzeuger: Kühe werden nicht gemolken; <strong>von</strong> Mai bis<br />
Oktober Weidehaltung; Futtergrundlage überwiegend<br />
Grünfutter; Weniger als 4 Stunden Transportzeit<br />
zwischen Erzeugerbetrieb EG-Ökoverordnung Bio; Tierwohl<br />
Vermarkter: Mind. 3 Gerichte mit regionalen Zutaten<br />
auf der Karte; LandZunge-Plus: Diese Gasthöfe<br />
verwenden nur Rindfleisch aus der Region, sie kaufen<br />
überwiegend regional.<br />
detaillierte Erzeugerrichtlinien; Verarbeiter: k<strong>ein</strong>erlei<br />
Backmischungen oder vorgefertigte Tiefkühl-Teiglinge<br />
aus Industrieproduktion. Nur heimisches Qualitätsmehl<br />
<strong>von</strong> Albkorn<br />
Baumbestand muss überwiegend hochstämmige<br />
Bäume; jedes neue Grundstück wird vorher durch<br />
Kontrollinstitut LACON geprüft; nachhaltige<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke<br />
Erzueuger, Verarbeiter und Vermarkter<br />
in der Region<br />
Erzeugung und Verarbeitung in der<br />
Region<br />
jährlich <strong>ein</strong>e Besichtigung der<br />
Streuobstwiesen, Dokumentation<br />
nachhaltiger Pflege; zertifiziert nach<br />
EG-ÖkoVO Bio<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz:<br />
Randstreifen u.a.
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Apfelsaftinitiative<br />
Landkreis<br />
Böblingen Landkreis<br />
Naturpark<br />
Apfelsaft Obere<br />
Donau<br />
Landschaftsraum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 6<br />
deutlich höherer Preis <strong>für</strong> Ernte als sonst üblich (7,50<br />
Euro Aufpreis auf den jeweils aktuellen Tagespreis, pro<br />
100 kg angelieferter Äpfel). Pflege und Erhaltung <strong>von</strong><br />
Streuobstflächen, Nachpflanzen junger Bäume<br />
k<strong>ein</strong>e Pflanzenschutzmittel/mineralischer Dünger,<br />
regelmäßige Pflegeschnitte; Verarbeiter:<br />
naturbelassener Direktsaft Apfelsaft ohne Konzentrat,<br />
Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Erzeugung, Verarbeitung und<br />
Vermarktung in der Region<br />
Regelmäßige Kontrollen durch <strong>ein</strong><br />
Labor<br />
FÖG Förderver<strong>ein</strong><br />
regionaler<br />
Streuobstbau<br />
Bergstraße/Oden<br />
wald/Kraichgau<br />
e.V. Landkreise Erzeuger erhalten höhere Preise zertifiziert nach EG-ÖkoVO Bio<br />
FÖS Förderver<strong>ein</strong><br />
regionaler<br />
Streuobstbau<br />
Hohenlohe<br />
Franken e.V. Landkreis<br />
Streuobstinitative<br />
Stadt- und<br />
Landkreis<br />
Karlsruhe<br />
Landkreis +<br />
Stadt<br />
NABU Nellingen<br />
Ostfildern<br />
Apfelsaft Landkreise<br />
Förderver<strong>ein</strong><br />
Nürtinger<br />
Apfelsaft e.V. Landkreis<br />
Erzeuger: nur ungespritztes Obst <strong>von</strong> Hochstämmen; je<br />
nach Verkaufsergebnis <strong>ein</strong>en Aufpreis <strong>von</strong> 4 - 12 DM pro<br />
dz<br />
voll ausgereifte, ungespritzte Früchte <strong>von</strong> alt<br />
bewährten, aromatischen Hochstammsorten der<br />
Region; Düngung nur bedarfsorientiert;<br />
überdurchschnittlicher Preis; ohne Zuckerzusatz; k<strong>ein</strong><br />
Konzentrat<br />
Äpfel <strong>von</strong> Streuobstwiesen die vom NABU<br />
bewirtschaftet werden;<br />
Erzeuger: ökologischer Landbau; abgängige Obstbäume<br />
durch Hochstamm-Neupflanzungen ersetzen;<br />
Baumpflege gewährleisten; Verarbeiter: Aufpreis auf<br />
den Tagespreis<br />
regelmäßige Kontrollen (wie<br />
Begehungen/ Rückstandsanalyse)<br />
durch den Förderver<strong>ein</strong>
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
BW "ebbes guads" Landkreis<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
BW<br />
Förderver<strong>ein</strong><br />
Offenburger<br />
Streuobst<br />
Apfelsaft e.V. Landkreis<br />
Freundeskreis<br />
Eberstädter<br />
Streuobst-wiesen<br />
e.V. Landkreis<br />
Förderver<strong>ein</strong><br />
Geislinger<br />
Apfelsaft e.V. Landkreise<br />
Marktgem<strong>ein</strong>sch Landschafts-<br />
aft Kraichgaukorn raum<br />
Erzeugergem<strong>ein</strong>s<br />
chaft Hohenloher<br />
Höfe Landkreis<br />
Baden- Württem-berg<br />
BY UNSER LAND<br />
Landkreise +<br />
Städte<br />
39<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 7<br />
Erzeuger: verpflichtet sich nur vollreifes und<br />
unverdorbenes Obst aus dem Zollernalbkreis abzuliefern<br />
und die Obstbäume zu pflegen<br />
Erzeuger: Obst <strong>von</strong> Hochstamm-Obstbäumen,<br />
Vorschriften zu Bewirtschaftung/Düngung/Pflege;<br />
frisches, am Baum ausgereiftem Streuobst;<br />
Verarbeitung in lokalen Mostkeltereien<br />
Erzeuger: Bioland, Obstankaufspreis weit über dem<br />
Marktpreis, dadurch Anreize zur nachhaltigen<br />
Bewirtschaftung, vollreife Früchte später Apfelsorten<br />
k<strong>ein</strong>e Pflanzenschutzmittel/Wachstumsregulatoren;<br />
Vorgaben zu Beikrautregulierung/Düngung;<br />
ausschließlich hochwertige E-Sorten; Ökostreifen;<br />
Kennzeichnung der Anbauflächen zur Transparenz <strong>für</strong><br />
den Verbraucher<br />
Erzeuger: Angebaut werden alte Dinkel- und<br />
Weizensorten ohne jegliche Spritzmittel; größerer<br />
Abstand zwischen den <strong>ein</strong>zelnen Pflanzen<br />
Erzeuger und Verarbeiter: konventionelle Ldw. Nach<br />
Unser Land Richtlinien oder ökologische Ldw. nach<br />
Biosiegel<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Rinder: Bezug Kälber soweit verfügbar<br />
<strong>von</strong> Partnern; Ferkelzukauf aus der<br />
Region bzw. <strong>von</strong> anerkannten<br />
Zulieferern, lückenloser<br />
Herkunftsnachweis<br />
Kontrolle: stichprobenweise durch den<br />
Kreisobstbauverband<br />
stichprobenartige Kontrollen durch<br />
Grundstücksbegehungen, Frucht-,<br />
Blatt- und Saftproben durchgeführt<br />
<strong>von</strong> FOSA-Beauftragten<br />
Kontrollen auf allen Stufen durch<br />
<strong>ein</strong>en öffentlich bestellten<br />
Sachverständigen<br />
je nach Teilbereich intern bzw. extern<br />
(TGD), Kontrollen gemäß Programm<br />
"offene Stalltür", jeweils eigenes<br />
System je Produktgruppe<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei<br />
regionale Kreisläufe und<br />
Kooperation. Ziel:<br />
umweltverträgliche und<br />
nachhaltigen Landwirtschaft<br />
regionale, dezentrale<br />
Strukturen, regionale<br />
Wirtschaftskreisläufe sowie<br />
Vernetzung; gerechte Preise
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Genussregion<br />
Oberfranken<br />
Regierungsbezirk<br />
Regional-siegel<br />
Berchtes-gadener<br />
Land Landkreis<br />
Die<br />
Regionaltheke -<br />
<strong>von</strong> fränkischen<br />
Bauern<br />
Region Bamberg -<br />
weil´s mich<br />
überzeugt<br />
Regierungsbezir<br />
ke +<br />
Landschaftsräu<br />
me<br />
Landschaftsräume<br />
BY VON HIER km-Radius<br />
BY Juradistl Lamm Landkreise<br />
BY<br />
Tagwerk - Unsere<br />
Bio Nachbarn diffus<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 8<br />
Erzeuger: Vertrieb nicht im Hard Discount,<br />
Trennung/Kennzeichnung (nicht-)regionaler Ware,<br />
Umweltverträgliche Viehhaltung, Einsatz GQS (od.<br />
gleichwertiges System), Ldw. Betrieb im Sinne des ALG<br />
und Hofstelle, dazu<br />
Hofladen/Verkaufs<strong>ein</strong>richtung/Marktbeschickung,<br />
Produktion zu 100% im eigenen Betrieb,<br />
Legehennenhaltung aus Oberfranken: r<strong>ein</strong> pflanzliches<br />
Futter, Futterzukauf nur bei QS-zertifizierten Produktspezifisch zw. 50% und 100%<br />
Erzeuger: Getrennte Lagerung regionaler und nichtregionaler<br />
Produkte, Tierschutzrichtlinie, Haltung auf<br />
Stroh im Laufstall erwünscht, Fütterung überwiegend<br />
mit Muttermilch, Medikamente nur zu<br />
Therapiezwecken, Transporte max. 2h; Richtlinien zu<br />
Düngung, Verarbeitung + Deklaration<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Geburt, Aufzucht, Schlachtung in der<br />
Region, Erzeugung Grundfutter in der<br />
Region (mind. 75%); wesentliche<br />
Rohstoffe aus der Region, 75% d.<br />
Zutaten aus (Umkreis 100km<br />
getrennte Lagerung regionaler und nicht-regionaler<br />
Produkte unverarbeitete Monoprodukte zu 100%<br />
getrennte Lagerung und Kennzeichnung regionaler und<br />
nicht-regionaler Produkte, Einhaltung guter fachlicher<br />
Praxis; Richtlinien Deutsche Honigverordnung, k<strong>ein</strong>e<br />
Antibiotika<br />
80% d. Grund- und Rohstoffe (nach<br />
Verfügbarkeit; gesamte Mastdauer in<br />
der Region, Geburt soweit<br />
möglich/Schlachtung in der Region,<br />
Futtermittel soweit möglich<br />
Rind: artgerechte Mutterkuhhaltung, Weidegang,<br />
Futterkontrolle; Schw<strong>ein</strong>: artgerechte Haltung auf Stroh,<br />
Auslauf, Getreidefutter; Geflügel: artgerechte Haltung, Schw<strong>ein</strong>e-/Geflügel futter überwiegend<br />
Auslauf, Getreidefutter<br />
aus eigenem Anbau<br />
Grundfuttermittel zu best %satz aus der<br />
Region, Rest bis 100km<br />
Erzeuger: Mitgliedschaft in anerkanntem ökologischem<br />
Anbauverband, in erster Linie Bioland<br />
Überprüfung durch<br />
Bereisungskommission;<br />
Logoverwendung ab Verleihung <strong>für</strong><br />
max. 2 Jahre<br />
Zertifizierung: Vergabe <strong>für</strong> 1 Jahr<br />
(Urkunde) <strong>für</strong> <strong>ein</strong>zelne Produkte;<br />
Einhaltung der <strong>Kriterien</strong>, v.a. aber<br />
Erfüllung des Ver<strong>ein</strong>szwecks<br />
z.T. Bio;<br />
gentechnikfrei<br />
Zusatz-siegel-Bio;<br />
Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
5-stufig: Produktdatenblatt der<br />
Initiative; EU-Zulassung; jährliche GLK-<br />
Kontrolle; Externes<br />
Zertifizierungsinstitut - Jährlich gentechnikfrei<br />
intern od. extern; Zertifizierung:<br />
automatische Verlängerung immer <strong>für</strong><br />
1 Jahr<br />
Bio: Kombination<br />
der Siegel möglich;<br />
gentechnikfrei<br />
Vernetzung ; Inhabergeführt<br />
und/oder Arbeits- und<br />
Ausbildungsplätzen<br />
Vernetzung aller Akeure;<br />
Lehrstellen werden als<br />
Qualitätsmerkmal<br />
angerechnet<br />
Inhabergeführt und/oder<br />
Bereitstellung <strong>von</strong> Arbeits-<br />
und Ausbildungsplätzen<br />
Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei Ausbildungsplätze<br />
Bio; Naturschutz:<br />
Biodiversität<br />
Förderung regionaler<br />
Wirtschaftskreisläufe
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Nimm´s RegRo<br />
nal Landkreis<br />
Region aktiv<br />
Chiemgau Inn<br />
Salzach Planungsregion<br />
BY Freisinger Land Lankdreis<br />
BY<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 9<br />
Erzeuger: <strong>Kriterien</strong> zur Qualität, Transparenz,<br />
Regionalität, Umwelt-/Naturschutz;<br />
Nahrungsmittelsicherheit, Qualitätsorientierung,<br />
artgerechte Tierhaltung; Gastronomie: Bestimmter<br />
Anteil <strong>von</strong> regionalen Speisen und Getränken<br />
Anbau regional; Verarbeiter: Verarbeitung so weit wie<br />
möglich regional<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Anbau oder Erzeugung, Verarbeitung<br />
oder Veredelung, Wertschöpfung oder<br />
Veredelung in der Region Wertschöpfung in der Region<br />
Tiere in der Region geboren und<br />
aufgezogen, Futter in der Region<br />
erzeugt<br />
Selbstauskunft, Erstkontrolle durch<br />
Audit vor Ort, Prüfung <strong>von</strong><br />
Produktmustern >> Freigabe; Lfd.<br />
Überwachung nach Prüfplan<br />
Heimat auf´m<br />
Teller Landkreis unabhängige Kontrolle<br />
BY hesselberger km-Radius<br />
BY Regional-buffet Landkreise<br />
BY Pro Nah e.V. Lankdreis<br />
BY<br />
BY<br />
Ankauf Obst aus Region, andernfalls deklariert (so<br />
regional wie möglich); R<strong>ein</strong>e Streuobstbestände mit<br />
Mostsorten ohne chemischen Pflanzenschutz, K<strong>ein</strong>e<br />
Tafelobstplantagen in der Ankaufregion vorhanden;<br />
Verarbeiter: r<strong>ein</strong>e Direktsäfte ohne Zusätze<br />
Erzeuger: regionale Erzeugnisse mit nachvollziehbarer<br />
hoher Qualität<br />
Altmühltaler<br />
Lamm Landkreise Qualitätssicherungsprogramm Altmühltaler Lamm<br />
Chiemgauer<br />
Naturfleisch<br />
BY Unser-Inn-Land<br />
Landschaftsraum<br />
regional und fair Richtlinien (Biokreis)<br />
Landschaftsraum<br />
gentechnikfrei:<br />
Naturschutz<br />
z.T. Bio;<br />
Naturschutz<br />
Selbsterklärung zum Chemieverzicht,<br />
eigener hoher Qualitätsanspruch statt<br />
Biozertifikat, Qualitätssicherung durch<br />
Kommunikation und persönliche<br />
Bindungen Naturschutz<br />
neutrale Kommission überprüft<br />
Qualität<br />
ständige Überwachung der<br />
Qualitätsstandards durch QAL<br />
Name des Herstellers auf der Packung,<br />
externe Kontrollen Bio<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz<br />
regionale Wertschöpfung,<br />
Vernetzung<br />
Initiierung regionaler<br />
Wirtschaftskreisläufe;<br />
Nachhaltigkeit und Fairness<br />
harmonische<br />
Zusammenarbeit, Ausbau<br />
der Gruppe, Netzwerk mit<br />
Partnern<br />
Förderung regionaler<br />
Kreisläufe und regionaler<br />
Kooperationen
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Ökomodell<br />
Achental<br />
Wittelsbacher<br />
Land Landkreis<br />
Landkreis +<br />
Partner Alpenkonvention<br />
Bio-Ring-Allgäu<br />
e.V. Landkreise Ökologischer Landbau<br />
Regionalentwickl<br />
ung Obere Vils-<br />
Ehenbach div. Grenzen<br />
Rödelseer Markt -<br />
Lebensmittel und<br />
mehr<br />
Regierungsbezirke<br />
Lust auf unsere<br />
Natur -<br />
Landschafts-<br />
Hesselberg Lamm raum<br />
Frankenhöhe<br />
Lamm<br />
Bayerwald Jung-<br />
Rind<br />
Landschaftsraum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 10<br />
Erzeuger: QM-System in frei zu wählender Form<br />
erwünscht.<br />
beim Einkauf werden Lebensmittel aus FRANKEN<br />
bevorzugt<br />
Erzeuger: Schäfer besitzen naturschutzrelevante<br />
Weideflächen im Projektgebiet „Naturpark<br />
Frankenhöhe“; Schäfer betreiben Hüteschafhaltung<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Futtermittel soweit wie möglich aus der<br />
Region; Zukauf <strong>von</strong> Schlachtlämmern<br />
nur <strong>von</strong> Frankenhöhe-Lamm-Betrieben<br />
Erzeuger: Mutterkuhhaltung ; k<strong>ein</strong>e<br />
Wachstumsförderer; im Sommer Weidehaltung;<br />
Mitgliedschaft beim Programm<br />
Haltung auf Einstreu im Winter; Verarbeiter: kurze<br />
"Offene Stalltür" ist Pflicht.<br />
Anfahrtswege zum Schlachthof; tierschonende<br />
Unangemeldete Kontrollen sind<br />
streßfreie Schlachtung und hoher Hygienestandard ausschließlich <strong>ein</strong>heimische Futtermittel jederzeit möglich und zu gestatten<br />
Naturschutz,natur<br />
verträgliche<br />
Inwertsetzung der<br />
Natur <strong>für</strong> den<br />
Tourismus<br />
Sicherung der<br />
kl<strong>ein</strong>strukturierten<br />
Landwirtschaft<br />
stichprobenartig intern/durch<br />
Beauftragte; Zertifizierung: 1x jährlich,<br />
Bewertungsschema, ggf. mit externen<br />
Sachverständigen; Vergabekriterien gentechnikfrei;<br />
(Punkte)<br />
Naturschutz soziale Gesichtspunkte<br />
Bio; Tierwohl;<br />
Gentechnikfrei<br />
Naturschutz durch<br />
Beweidung<br />
Tierwohl;<br />
Gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz<br />
Netzwerke zwischen<br />
Produzenten und<br />
Verbrauchern; stabile<br />
Arbeitsplätze
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Schlaraffenburge<br />
r Apfelsaft Landkreise<br />
BY Ökokiste<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Kalchreuther<br />
Artenreiches<br />
Kirschgarten<br />
Land -<br />
Lebenswerte<br />
Abensberger<br />
Qualitätssprargel Stadt<br />
Aus der Rhön <strong>für</strong><br />
die Rhön<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundes-länder<br />
BY, TH, HE<br />
BY REGINA Gem<strong>ein</strong>den<br />
BY<br />
BY<br />
Schrobenhausener<br />
Spargel<br />
Landschaftsraum<br />
Specht<br />
Delikatessen Bundesland<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 11<br />
Bioland -Richtlinien; Für ihren Beitrag zum Naturschutz<br />
erhalten die Landwirte <strong>ein</strong>en höheren Preis <strong>für</strong> ihr<br />
Mostobst<br />
Verarbeiter 100% ökologisch produzierte Waren; kurze<br />
Transportwege, Verzicht auf Flugware,<br />
Mehrwegverpackungen und jahreszeitliche Angebote;<br />
best. Service-Leistungen, Auszeichnungen <strong>für</strong><br />
bausgeprägt regionales/Bioland/Demeterangebot<br />
Kirschen stammen <strong>von</strong> Hochstammbäumen oder hohen<br />
Halbstammbäumen<br />
Sortierrichtlinien, Bodenuntersuchung jährlich,<br />
Vorschriften zu Lagerung und Meldung, kontrollierten<br />
und integrierten Anbau<br />
Qualitätsnormen der EU und des<br />
Handelsklassengesetzes, ansonsten festgelegte<br />
<strong>Kriterien</strong>; Vorschriften zu Lagerung<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Einhaltung der <strong>Kriterien</strong> vom<br />
Landesbund <strong>für</strong> Vogelschutz und <strong>ein</strong>er<br />
unabhängigen Bio-Kontrollstelle<br />
geprüft Bio; Naturschutz<br />
Kontakt mit der<br />
Arbeitsloseninitiative<br />
"Global sozial" bzw.<br />
"Regional sozial"<br />
<strong>Kriterien</strong>, zusätzlich zu den Richtlinien<br />
der EG-Öko-Verordnung, durch<br />
staatlich anerkannte Prüfstellen<br />
jährlich geprüft Bio soziales Engagement<br />
Qualitätsordnung unangemeldet <strong>von</strong><br />
unabhängigen Kontrolleuren (z.B. LKP<br />
o. ä.) überprüft<br />
Zertifizierung mit Silberdisteln, da hier<br />
die Kontrolle gewährleistet ist<br />
Vergabe der Lizenz zur Nutzung des<br />
Zeichens durch Zeichenträger;<br />
unabhängige Kontrollen<br />
GQ Bayern; Erzeuger: kontrollierter Vertragsanbau;<br />
Freilandgurke aus kontrolliertem, vertraglich<br />
gesichertem, bayerischen Anbau; Verarbeiter: max. 24h<br />
zwischen Ernte und Verarbeitung 90% der Rohstoffe Geprüfte Qualität Bayern<br />
Bio,<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz:<br />
Erhaltung<br />
bedrohter Arten<br />
Gastronomie mit regionalen<br />
Produkten
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Legegem<strong>ein</strong>schaf<br />
t - Die Biohennen<br />
Echt Bayern. Vom<br />
Ammersee<br />
Landschaftsraum<br />
BY PEMA Randunschärfen<br />
BY<br />
BY<br />
100% Bayerischer<br />
Meerrettich Randunschärfen<br />
espargo -<br />
fränkische wege<br />
vom spargel zum<br />
w<strong>ein</strong><br />
Landschaftsraum<br />
BY Dillinger Land Landkreis<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Aus der Region -<br />
Bayerischer<br />
Untermain<br />
Spezialitäten<br />
zwischen Donau-<br />
Altmühl-Ilm<br />
EuRegio Salzburg-<br />
Berchtesgadener<br />
Land-Traunst<strong>ein</strong><br />
Rosenheimer<br />
Bauernherbst<br />
Schloß-brauerei<br />
Reuth<br />
Landschaftsraum<br />
Lankdreise +<br />
Stadt<br />
Landkreise +<br />
Städte<br />
Landschaftsraum<br />
+<br />
Landkreis<br />
Stadt,<br />
Teilregierungsbe<br />
zirk<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 12<br />
EG-Öko-Verordnung; Qualitätsmanagement und<br />
Herkunftssicherheit wie auch Partnerschaften auf Basis<br />
fester Lieferverträge und fairer Preise<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
In der Gastronomie/Verarbeitung:<br />
mind. 80 % der ldw. Bio-Rohstoffe im<br />
Umkreis <strong>von</strong> 200 km um die<br />
Produktionsstätte.; Vermarkter: 60 %<br />
jährlich Kontrolle durch staatlich Bio; Tierwohl;<br />
anerkannte Öko-Kontrollinstitute; Naturschutz:<br />
Nach erfolgreicher Zertifizierung durch Erhaltung<br />
den Biokreis<br />
bedrohter Arten<br />
Erzeuger: Richtlinien <strong>von</strong> Bioland; Verarbeiter:<br />
Verarbeitung <strong>von</strong> pflückfrischem Obst aus eigenem<br />
Anbau sowie <strong>von</strong> Bioland-Partnern aus der Umgebung mind. 80% Zutaten aus Bayern Bio; Naturschutz<br />
traditionelle Verarbeitung in alt<strong>ein</strong>gesessenen<br />
Betrieben erfolgt nach speziellen Rezepturen 100% g.g.A.<br />
zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung<br />
und IFS Bio; gentechnikfrei<br />
Zertifikat der ABCERT AG in Esslingen<br />
(zertifiziert nach EG-Öko-Verornung);<br />
g.g.A.<br />
sozialverträgliche<br />
Beschäftigungsverhältnisse,<br />
Stellen v.a. an Bewerber aus<br />
dem Umland
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
So schmecken die<br />
Berge<br />
Delikatessen aus<br />
dem oberen<br />
Werntal<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 13<br />
realistischer und praktikabler Anteil regional erzeugter<br />
Lebensmittel im Gesamtangebot/best. Mindestanzahl<br />
auf der Speisekarte, eigene Zubereitung, möglichst<br />
hoher Anteil an ökologischen Lebensmitteln<br />
BY Münchner Bier Stadt R<strong>ein</strong>heitsgebot g.g.A.<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Geopark Ries -<br />
Kulinarisch<br />
Die<br />
Regionalbewegun Regierungsbezir<br />
g - Mittelfranken k<br />
Schnells<br />
Kürbiskernproduk Regierungsbezir<br />
te<br />
ke<br />
Chamer<br />
Schmankerl<br />
Original Service Regional Landkreis<br />
(aus der<br />
Metropolregion<br />
Nürnberg) Metropolregion<br />
Einkaufen auf<br />
dem Bauernhof<br />
Vermarkter: Partner des Geopark Ries kulinarisch<br />
obligatorisch<br />
Primat der kurzen Wege; Gentechnikfreiheit;<br />
Qualitätsstandards müssen <strong>ein</strong>gehalten werden<br />
Handelsbetriebe und Betriebe mit gewerblicher<br />
Tierhaltung sind ausgeschlossen; Produkte aus eigener<br />
Erzeugung/mit Angabe des Erzeugernamens bei Zukauf;<br />
max. 20% des Sortiments außerlandwirtschaftlich<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Produkte i.d.R. <strong>von</strong> Produzenten aus der<br />
Region<br />
Rohstoffherkunft: 80% - soweit<br />
verfügbar; Herstellung zum<br />
überwiegenden Teil<br />
mindestens jährliche Kontrolle;<br />
Bioland zertifiziert Bio<br />
Naturschutz:<br />
schonender<br />
Umgang mit<br />
Ressourcen und<br />
Energie<br />
Tierwohl;<br />
gentechnikfrei regionale Kooperation<br />
Einhaltung QS kontrolliert durch die<br />
Partner der Regionalkampagne gentechnikfrei k<strong>ein</strong>e Dumpingpreise<br />
Lebensmittelhygiene: Betriebseigene<br />
Maßnahmen und Kontrollen<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz
BY<br />
BY<br />
BY<br />
BY<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Allgäuer<br />
Alpgenuss - Hier<br />
schmeckt's guat<br />
Landschaftsraum<br />
gesamter Warenbezug muss offengelegt werden<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 14<br />
ORO - Fruchtsaft<br />
Verarbeitung und Vermarktung des <strong>ein</strong>heimischen<br />
aus Rohrdorf<br />
dida -<br />
Hochwertige<br />
Lebensmittel aus<br />
Stadt<br />
Streuobstes zu Säften Aus der Region – <strong>für</strong> die Region<br />
der Region Stadt Vermarkter: Direktvermarkter<br />
Fränkische<br />
Obstbauern e.V.<br />
BY Frankentomate<br />
BY<br />
BY, TH,<br />
HE<br />
Regierungsbezirke<br />
Erzeuger: Verpflichtung Obst <strong>von</strong> hoher Qualität zu<br />
produzieren; Verkauf in Hofläden oder auf dem<br />
Wochenmarkt<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Regierungsbezie<br />
rke Anbau <strong>von</strong> Tomaten in der Region; im Gewächshaus gentechnikfrei<br />
Regensburger<br />
Land - Nimm's<br />
regional Stadt/Land-kreis Vermarktung regionaler Produkte in Regionaltheken<br />
Qualität des<br />
Biospärenreserva<br />
ts Die Rhön<br />
BY, TH,<br />
HE Biosiegel Rhön<br />
Bayern<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundes-länder<br />
BY, TH, HE<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundes-länder<br />
BY, TH, HE EG-Öko-Verordnung 100% (Ausnahmen produktbezogen)<br />
63<br />
<strong>ein</strong>mal jährlich; ergänzt durch<br />
Stichproben des<br />
Dachmarkenmanagements; zertifiziert<br />
nach EG-ÖkoVO Bio<br />
Netzwerk aus Erzeugern,<br />
Verarbeitern, Lieferanten<br />
und Dienstleistern<br />
Erzeugung und Vermarktung<br />
in der Region
HB<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 15<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Bremer Erzeuger-<br />
Verbraucher-<br />
Genossenschaft<br />
e.G Bio; gentechnikfrei<br />
HB Weserklasse<br />
HE LandMarkt<br />
HE<br />
HE<br />
HE<br />
HE<br />
HE<br />
Bremen<br />
Stadt,<br />
Landkreise<br />
2<br />
Nachhaltigkeitsprinzipien, weitere (plausible,<br />
glaubwürdige, überprüfbare) <strong>Kriterien</strong> jeweils mit<br />
Partnern entwickelt; Verarbeitung: fachgerechte<br />
Verarbeitung in der Region<br />
Monoprodukte: Haupt- und<br />
Vorprodukte aus Region, Ausnahmen<br />
bei Nicht-Verfügbarkeit; Verarbeitete<br />
Produkte: Hauptrohstoff zum<br />
überwiegenden Teil aus Region<br />
Betriebskontrolle, Stichprobenartige<br />
Flächenkontrolle (intern),<br />
später zusätzlich neutrales<br />
Institut<br />
Gutes aus<br />
Waldhessen Randunschärfen z.T. Bio<br />
Rhöner<br />
Weideochsen<br />
Aus der Rhön <strong>für</strong><br />
die Rhön<br />
Rhöner<br />
Apfelinitiative<br />
Rhöner<br />
Durchblick<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundesländer<br />
BY, TH, HE<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundesländer<br />
BY, TH, HE<br />
Anbau umweltschonend, ohne chemischen<br />
Pflanzenschutz, mit <strong>ein</strong>geschränkter Mineraldüngung ;<br />
k<strong>ein</strong> Mais/Importfuttermittel. Im Winter Fütterung mit<br />
Heu und Getreideschrot; Vermarktung: Kennzeichnung<br />
unter Angabe der Lieferanten<br />
Geburt Kälber in der Rhön, regionales<br />
Futter<br />
Verarbeitung <strong>von</strong> regional erzeugten Lebensmitteln in<br />
Gerichten Erzeugung, Verarbeitung in der Region Zertifizierung mit Silberdisteln<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundesl-änder<br />
BY, TH, HE Erzeugung, Verarbeitung in der Region<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundes-länder<br />
BY, TH, HE<br />
Regionalvermarktung hochwertiger Produkte aus<br />
heimischer Erzeugung in eigenen Hofläden und<br />
Regionalladen<br />
z.T. Bio;<br />
gentechnikfrei<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz:<br />
Erhaltung<br />
bedrohter Arten<br />
regionale Vermarktung<br />
möglichst unter Nutzung<br />
vorhandener Partner und<br />
Handelsstrukturen; soz.<br />
Nachhaltigkeit<br />
Aufbau und Sicherung <strong>ein</strong>er<br />
regionalen<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Erweiterung der Vernetzung,<br />
Stärkung der ländliche<br />
Strukturen; Erhalt der<br />
nebenerwerblichen<br />
Landwirtschaft<br />
Enge Zusammenarbeit mit<br />
Slow-Food und Rhönklub und<br />
ARGE Rhön
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
HE Meissner Lamm<br />
HE<br />
HE<br />
HE<br />
HH<br />
Branden-st<strong>ein</strong>er<br />
Bio-Apfelsaft<br />
Landschaftsraum<br />
Lamm-<br />
Spezialitäten vom Landschafts-<br />
Taunus<br />
raum<br />
Gutes vom<br />
Welterbe<br />
Mittelrh<strong>ein</strong><br />
"Aus der Region<br />
<strong>für</strong> die Region"<br />
HH nordisch frisch<br />
MV<br />
Hessen<br />
Hamburg<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 16<br />
Hüteschäfer; k<strong>ein</strong> Zufüttern <strong>von</strong> Getreide; Lämmer<br />
haben 6-8 Monate Zeit heranzuwachsen Erzeuger und Verarbeiter in der Region<br />
Randunschärfen<br />
EG-Öko-Verordnung<br />
Landschaftsraum<br />
Vermarktung im Regionalregal<br />
noch in<br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Randunschärfen<br />
Das Beste <strong>von</strong><br />
Rügen Naturraum<br />
10<br />
2<br />
Erzeuger: Bestimmte aufgelistete Produkte sind<br />
antragsfähig; Frische, Herstellernachweis, artgerechte<br />
und überwachte Tierhaltung, gesundheitliche<br />
Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe, Vermeidung <strong>von</strong><br />
langen Transportwegen<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Erzeugung, Verarbeitung und<br />
Vermarktung in der Region zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung Bio<br />
Erzeugung, Verarbeitung und<br />
Vermarktung in der Region zertifiziert nach EG-Ökoverordnung Bio<br />
Gastronomie: Waren<strong>ein</strong>satz zu mind.<br />
60% aus regionalem Anbau<br />
Herkunftszeichen in 2 Stufen: "Original<br />
Rügen Produkt": Erzeugung des<br />
wertbestimmenden Anteils; "Rügen<br />
Produkt": Rohstoffe nicht <strong>von</strong> Rügen da<br />
nicht/nicht in ausreichender Menge<br />
vauf Rügen erzeugt<br />
Antragstellung; Antragsprüfung durch<br />
Zertifizierungskommission; ggf.<br />
Vergabe des Herkunftszeichens <strong>für</strong> 3<br />
Jahre, dann erneute Antragstellung<br />
und Prüfung Tierwohl<br />
Hauptveredelungsstufe auf<br />
Rügen, geistig schöpferische<br />
Tätigkeit/<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>ein</strong>er Rügener Person/<strong>ein</strong>em<br />
Rügener Unternehmen
MV<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Biosphärenreserv<br />
at Schaalsee - Für<br />
Leib und Seele<br />
MV Gutswerk<br />
Landschaftsraum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 17<br />
Auslage <strong>von</strong> Informationen,Mindestkriterien bzgl.<br />
Ordnung, fachliche Praxis, Naturschutz; Erzeuger:<br />
Punktesystem: Mind. Zertifizierung nach QS-system/EU-<br />
Öko-Verordnung o.ä.; Verarbeiter: Herstellung <strong>von</strong><br />
mind. drei regionalen Produkten; Vermarkter: mind. 5<br />
regionale Einzelprodukten; Gastronomie: mind. 2 mit<br />
der Regionalmarke augezeichnete Speisen<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Flächen ganz oder mit wesentlichen<br />
Anteilen in der Region,<br />
Produktionsschritte/wesentliche<br />
Vorprodukte aus der Region/aus ökol.<br />
Landbau<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
MV Hanseland - AMV Bundesland z.T. Bio Vernetzung<br />
MV<br />
natürlich!<br />
Mecklenburgische<br />
Seenplatte<br />
Mecklenburg<br />
Vorpommern<br />
Landschaftsraum<br />
NI Hi-Land Landkreis<br />
5<br />
Erzeuger konventioneller Produkte: Ressourcenschutz,<br />
Kulturlandschaftserhalt, Umwelt-/Naturschutz u.a. oder<br />
mind. EU-Bio-Verordnung zertifiziert; Vermarkter: k<strong>ein</strong><br />
Gleichzeitiges Angebot ökologischer und<br />
konventioneller Hi-Land-Produkte; fair gehandelte<br />
Produkte nicht als Konkurrenz sondern Ergänzung zu<br />
Regionalprodukten<br />
Zur Sortimentsbereicherung ggf.<br />
Zulassung <strong>von</strong> Produkten aus<br />
Nachbarregionen<br />
Selbstverpflichtung und<br />
Stichprobenkontrollen <strong>von</strong> Hi-Land<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz:<br />
Artenvielfalt,<br />
Streuobstwiesen<br />
u.a. Maßnahmen<br />
regelmäßige<br />
Kooperationoder<br />
regelmäßiges<br />
unentgeltliches Engagement<br />
in der Region<br />
Aufbau lokaler/regionaler<br />
Wertschöpfungsketten und<br />
Wirtschaftskreisläufe incl.<br />
energetischer<br />
Gesamtversorgung (Landwirt<br />
als Energiewirt)<br />
Vernetzung mit Hochschule<br />
und Zentrum <strong>für</strong><br />
Lebensmitteltechnologie<br />
Unterstützung fairen<br />
Handels durch El-Puente-<br />
Laden
NI<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
BR Flusslandschaft<br />
Elbe<br />
Landschaftsraum<br />
NI mehr als moor Landkreis<br />
NI LandMarkt<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
Heimat Braucht<br />
Freun.de Bundesland<br />
Regionale<br />
Esskultur<br />
Landschaftsraum/Land-kreis<br />
Norder Fleisch -<br />
Die Gläserne<br />
Kette Landesteil<br />
NI Naturwert<br />
NI<br />
NI<br />
Randunschärfen<br />
Nienburger<br />
Spargel Landkreis<br />
Kräuterregion<br />
Wiesteniederung<br />
e. V. Gem<strong>ein</strong>den<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 18<br />
Kenntliche Ausweisung der Herkunft der regionalen<br />
Produkte sowie s<strong>ein</strong>er Bestandteile; Handel: mindestens Erzeuger: Mind. 10% der Produkte in<br />
10% der Verkaufsprodukte aus der BR-Region bezogen der BR verarbeitet/direkt vermarktet<br />
oder selbst hergestellt; Gastronomie: mindestens zwei und/oder verbraucht; mind. 20% der<br />
in der BR-Region erzeugte Lebensmittel im<br />
zusätzlichen Futtermittel aus der<br />
Speisenangebot, mindestens täglich <strong>ein</strong><br />
Region; Verarbeiter. Mind. 30% der<br />
"Biosphärengericht"<br />
hauptrohstoffe aus der BR<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
jährliche Kontrollen - Überprüfungen<br />
jährlich: terminierte Vor-Ort-<br />
Überprüfung durch BR und<br />
Vergaberat; Zertifizierung gilt <strong>für</strong> <strong>ein</strong><br />
Jahr<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
Sicherheit in allen Bereichen, Rückverfolgbarkeit bis<br />
zum Erzeuger; Verarbeiter: Herstellung <strong>von</strong> Fleisch- und<br />
Wurstwaren nach alter handwerklicher Tradition Futter vorwiegend selbsterzeugt Tierwohl<br />
Verweis auf bestehende Richtlinien (nicht <strong>ein</strong>sehbar).<br />
Kartoffeln: Vorgaben des Prüf- und Gütesiegels der<br />
Landwirtschaftskammer<br />
kontrollierte Anbau- und Pflegemaßnahmen sowie k<strong>ein</strong><br />
Einsatz <strong>von</strong> Bleichmitteln<br />
hauptsächlich hofeigenes Futter,<br />
Mineralfutter <strong>von</strong> Vertragspartnern<br />
regelmäßige Überprüfung durch<br />
unabhängige Partner wie z.B.<br />
Landwirtschaftskammer<br />
Niedersachsen<br />
Vergabe mind. zweier<br />
externer Leistungen an<br />
Unternehmen/Einrichtungen<br />
in der BR; Arbeitsplätze,<br />
soziale <strong>Kriterien</strong>,<br />
Kooperation<br />
regionale Kreisläufe;<br />
standortgerechte<br />
Erwerbsmöglichkeiten,<br />
soziokulturelle/soziale<br />
Einrichtungen
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
NI Ise-Land<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
NI<br />
km-<br />
Radius/Lankdrei<br />
s<br />
Der Niedersachsenteller<br />
Bundesland<br />
Hannover-sche<br />
Bauernmärkte Randunschärfen<br />
Ver<strong>ein</strong><br />
Bauernmarkt<br />
Hildesheim e.V. Randunschärfen<br />
Hoorn's Hof<br />
Wehnsen Randunschärfen<br />
Ver<strong>ein</strong> zur<br />
Erhaltung des<br />
"Harzer Roten<br />
Höhenviehs" e.V.<br />
Schäfereigesellsc<br />
haft Südharz<br />
Landschaftsraum<br />
Zweckverband<br />
Naturpark Solling- Landschafts-<br />
Vogler<br />
raum<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 19<br />
Erzeuger: k<strong>ein</strong>e Pflanzenschutzmittel (Futter), heimische<br />
Futtermittel, Medikamente nur zu Therapiezwekcken,<br />
Naturschutzregelungen, Bestimmungen zu Haltung,<br />
Fütterung und Maximalviehbestand<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Zukauf nur <strong>von</strong> Partnerbetrieben oder<br />
NEULAND-/ökologischer Tierhaltung,<br />
Rinder: 2/3 der Lebenszeit nach<br />
Erzeugerrichtlinien gehalten, Fütterung<br />
ausschließlich mit heimischen<br />
Futtermitteln<br />
Landschaftsraum<br />
AbCert<br />
Erzeuger: extensive Beweidung, Verzicht auf<br />
Mineraldünger/Pflanzenschutzmittel, Weidegang<br />
Führen und Abgabe <strong>ein</strong>er Schlagkartei,<br />
Nachweise führen, Kontrolle durch<br />
Naturschutzverband Aktion<br />
Fischotterschutz<br />
Tierwohl;<br />
Naturschutz<br />
Naturschutz:<br />
extensive<br />
Weidehaltung,<br />
Förderung seltener<br />
Rassen<br />
Bio; Tierwohl;<br />
Naturschutz:<br />
extensive<br />
Wanderhütehaltun<br />
g<br />
Naturschutz:<br />
extensive<br />
Weidehaltung,<br />
Förderung seltener<br />
Rassen
NI<br />
NI<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Ver<strong>ein</strong> zur<br />
Erhaltung des<br />
Bunten<br />
Bentheimer<br />
Schw<strong>ein</strong>es e.V.<br />
Diepholzer Moorschnucke<br />
NI, ST,<br />
TH Typisch Harz<br />
NW Bergisch Pur<br />
NW<br />
Landschaftsraum<br />
Landschaftsraum<br />
über<br />
Bundes-länder<br />
NI, ST, TH<br />
Landschaftsraum<br />
Kartoffelprinzessi<br />
n Landesteil<br />
NW Senne Original<br />
NW<br />
Niedersachsen<br />
Kulturland Kreis<br />
Höxter Landkreis<br />
21<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 20<br />
Erzeuger: Mitgliedschaft in anerkannten Organisationen<br />
<strong>für</strong> artgerechte Tierhaltung bzw. ökologischen Landbau<br />
Erzeugung: KULAP, Haltungsform/Besatzdichte und<br />
Futter definiert; Wildbret nicht aus Gatterhaltung,<br />
Obst: Fruchtqualität geregelt; Kartoffeln:<br />
Mindeststandard integrierter Pflanzenbau; ;<br />
Kennzeichung Pflicht<br />
Erzeuger: Ackerboden: mindestens zweijährige<br />
Ruhepause; Vorgaben zu Pflanzgutbezug, Düngung,<br />
Pflanzenschutz Ernte, Lagerung<br />
Landschaftsraum<br />
Richtlinien können auf der Seite angefordert werden<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Erzeugung soweit möglich, teils aber<br />
nur die Verarbeitung, k<strong>ein</strong>e Vorstufen<br />
ggf. entscheidet <strong>ein</strong>e<br />
Expertenkommission<br />
unverarbeitete Monoprodukte: 100%,<br />
Schlachtung und Verarbeitung im<br />
Bergischen Land, Produktspezifische -<br />
orgaben: mind. 70-80% eig. Futter,<br />
Milch <strong>für</strong> Käse zu 100%, Lebenszeit je<br />
nach Tier<br />
lückenlose Dokumentation und<br />
Kennzeichnung der Tiere,<br />
unregelmäßige Kontrollen (Neuland<br />
etc.); g.U.<br />
alle drei Jahre durch Kontrollgremium;<br />
Zertifizierung: Antrag mit Spezifikation<br />
direkt an Experten; Zulassung <strong>für</strong> drei<br />
Jahre, danach neuer Antrag<br />
regelmäßige Kontrolle <strong>von</strong><br />
unabhängigem Institut (je nach<br />
Produkt QS-System),<br />
Naturschutzmaßnahmen <strong>von</strong> den<br />
Biologischen Stationen überprüft<br />
Kontrollsiegel der<br />
Landwirtschaftskammer Nordrh<strong>ein</strong>-<br />
Westfalen<br />
z.T. Bio;<br />
Naturschutz<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
Naturschutz<br />
Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
Getreide- und Rapsanbau nach Gramicea-Richtlinien,<br />
o.a.(z.B. Demeter oder Bioland); Schafhalter: <strong>Kriterien</strong><br />
zu Haltung, Betreuung, Fütterung, Transport;<br />
Verarbeiter: Gastronomie: Mindestangebot und<br />
explizite Kennzeichnung Aufzucht, Verarbeitung, Produktion Tierwohl<br />
Aufbau <strong>ein</strong>es<br />
Vermarktungsprogrammes
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
NW MühlenGarten Landkreis<br />
NW Lippe Qualität Landkreis<br />
NW BIOlokal Randunschärfen<br />
NW<br />
RP<br />
Genuss aus dem<br />
Münsterland<br />
Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen<br />
Regionalmarke-<br />
Eifel<br />
Landkreise,<br />
Stadt, km-<br />
Radius<br />
Landschaftsraum<br />
8<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 21<br />
Obst/Gemüse/Getreide: Richtlinien <strong>für</strong> integrierten<br />
Pflanzenanbau, k<strong>ein</strong>e<br />
Herbizide/Klärsschlamm/Müllkompost,<br />
Fleisch/Eier/Milchprodukte: Q+S-Status oder EG-<br />
Ökoverordnung, Bestimmungen zu Haltung;<br />
Verarbeiter: 100% Direktsaft, K<strong>ein</strong>e künstlichen<br />
Aromen/Farbstoffe in Milchprodukten<br />
QS/Bioland; Erzeuger: k<strong>ein</strong>e Klärschlämme,<br />
Tierbestandsdichte nach MURL-Blatt; Fleisch: QS-<br />
Standards, Obst: CS; Verarbeiter: kürzestmöglicihe<br />
Wege, k<strong>ein</strong>e<br />
Pflanzenfette/Konservierungsstoffe/Fungizide<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Futtermittel <strong>von</strong> überwiegend eigenen<br />
Futterflächen bzw. mind. 60% aus der<br />
Region; Verarbeitung 100%<br />
betriebseigener Milch; Wild: Jagd in der<br />
Herkunftsregion; Begrenzung der<br />
Ferkelherkunft jährliche Rückstandskontrollen<br />
Geburt und Aufzucht, Bezug <strong>von</strong><br />
Mitgliedsbetrieben, mind. 60%<br />
Futtermittel eigen/<strong>von</strong><br />
Mitgliedsbetrieben; Fleisch: max. 10%<br />
Zukauf, Schlachtung ggf. in<br />
Nachbarkreisen; Pflanzensamen etc.<br />
soweit möglich; Hauptbestandteile aus<br />
der Region<br />
Nachweispflicht (System prüft sich<br />
selbst); gegenseitige Kontrollen der<br />
Betriebe als Fachleute/Konkurrenten;<br />
ggf. Betriebsprüfung durch den Ver<strong>ein</strong><br />
oder den unabhängigen Vorstand, im<br />
Zweifelsfall durch unabhängige<br />
Kommission<br />
Erzeuger: EU-Öko-Verordnung (oder auch<br />
Demeter/Bioland/Naturland) Bio<br />
Erzeuger: QS/EUREGAP/ Bio-Richtlinien, Ansässigkeit im<br />
Kern- und Pufferbereich (10 km um die Kernregion);<br />
Gastronomie: Ansässigkeit im Kernbereich, mind. 1<br />
münsterländische Spezialität im Angebot;<br />
Nachweispflicht nicht selbst erzeugten Waren<br />
Erzeuger: Getreide: Zertifizierung nach IFS (o.ä.); Ferkel:<br />
QS-Prüfsystem, Richtlinien zu Fütterung und Haltung;<br />
Rind: extensive Haltung, Medikamente nur zu<br />
Therapiezwecken; Eier: QS; Frischmilch: Kälber:<br />
Strohhaltung; Verarbeiter: Bäcker: Lage in Region, ggf.<br />
Biozertifizierung<br />
Wachstum/Aufzucht und Verarbeitung;<br />
Hauptbestandteile verarbeiteter<br />
Produkte zu 100% (Ausnahmen nach<br />
Absprache möglich) Schriftliche Ver<strong>ein</strong>barung z.T. Bio<br />
detaillierte Vorgaben zu Futterherkunft<br />
(zw. 50 und 100%), Bezug Jungtiere,<br />
Aufzuchtperiode in Region, Schlachtung<br />
in Region; Wild in Region gejagt,<br />
Backwaren: 100%,<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei<br />
Frischmilch: je Quartal: sensorische<br />
und analytische Prüfung durch<br />
unabhängiges Prüfinstitut, QM Milch;<br />
Zertifizierung: Wildmarke wird <strong>von</strong> der<br />
Produzenen-Prüfgem<strong>ein</strong>schaft z.T. Bio; Tierwohl;<br />
vergeben<br />
gentechnikfrei<br />
Vernetzung kl<strong>ein</strong>er und<br />
mittlerer Betriebe<br />
Gastronomen beziehen Ware<br />
aus der Region/<strong>von</strong><br />
Partnerbetrieben
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
RP SooNahe<br />
Landschaftsraum<br />
RP Heimat schmeckt Landkreis<br />
RP<br />
RP<br />
RP<br />
RP<br />
RP<br />
Regionalinitiative<br />
Mosel Landkreise<br />
Kräuterwind -<br />
Genussreich<br />
Westerwald Landkreise<br />
Rindfleisch aus<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz Bundesland<br />
Pfälzer<br />
Grumbeere Randunschärfen<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 22<br />
DLG-Qualitätskriterien: Mindestpunktanzahlen je<br />
Produktgruppe; Wild: Standards zur Haltung,<br />
Bestandsdichte, Fütterung etc.; DLG-Qualitätsprüfung<br />
mindestens Silber oder Prüfung durch den<br />
Markenvorstand, Eier: k<strong>ein</strong>e Käfighaltung, Mindestplatz,<br />
Enten+Gänse in Freilandhaltung<br />
Erzeuger: Vorgaben zu Prämierungsergebnissen,<br />
Qualifizierung, Servicequalität,<br />
Ver<strong>ein</strong>smitgliedschaft/Teilnahmen, Produktsortiment<br />
Vermarkter: Vermarktet werden Produkte, die sich<br />
durch den Dreiklang Regionalität, Qualität, Attrak-tivität<br />
auszeichnen<br />
Einhaltung der im Detail geltenden Programm-<br />
/Modulkriterien; Qualitätsvorgaben; vertragliche<br />
Einbindung; Betreuungsvertrag mit Hoftierarzt;<br />
umfassende Nachverfolgbarkeit<br />
Erzeuger: Anbau in der Region; Vermarkter: Verkauf<br />
durch Vertragspartner <strong>von</strong> Handel und<br />
Genossenschaften; Versand in das ganze Bundesgebiet<br />
und das Ausland<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Futter zu mindestens 51% aus eigener<br />
Erzeugung; Wild: mind. 12 Monate in<br />
Gebietskulisse; Geflügel ab 4 Wochen in<br />
Gebietskulisse; Gemüse: 100%;<br />
Verarbeitungsprodukte: 90% d.<br />
Rohwaren aus der Region<br />
Geburt in Deutschland, Haltung mind. 6<br />
Monate in RP/Saarland, überwiegend<br />
Hofeigenes Futter,<br />
Schlachtung/Zerlegung in RP od.<br />
angrenzendem Landkreis<br />
1. Eigenkontrolle + Dokumentation; 2.<br />
Systemkontrolle nach FUL/PAULa oder<br />
<strong>von</strong> Kommission (unter Führung des<br />
Markenvorstands), 3. Kontrolle der<br />
Kontrolle durch neutrale Prüfinstitute<br />
regelmäßige und unangemeldete<br />
Kontrollen; dreistufiges<br />
Kontrollsystem ("Eigenkontrolle",<br />
"neutrale Kontrolle" und "Kontrolle<br />
der Kontrolle")<br />
Bodenuntersuchungen,<br />
Rückstandsanalysen; Kontrolle durch<br />
Landwirtschaftlichen Beratungs- und<br />
Kontrollrings Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz<br />
e.V./Agrar-Control GmbH ; Qualität<br />
durch Kontrolleure der<br />
Landwirtschafts-kammer<br />
Rh<strong>ein</strong>land-<br />
Pfälzische Milch-<br />
& Käsestraße Bundesland z.t. Bio<br />
z.T. Bio; Tierwohl;<br />
gentechnikfrei;<br />
Naturschutz<br />
regionale Vernetzung und<br />
Kooperation
RP<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Wild aus<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz Bundesland<br />
RP streuobst.rlp Bundesland<br />
SH<br />
SH<br />
SH<br />
SH<br />
SH<br />
SL<br />
SL<br />
Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz<br />
10<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 23<br />
Wildbret ausschließlich aus dem eigenen Revier;<br />
Vermarkter: Jäger oder Forstamt<br />
F<strong>ein</strong>heimisch-<br />
Genuss aus<br />
Schleswig-<br />
Holst<strong>ein</strong> Bundesland Verarbeitung nach Regeln der Kochkunst<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Prozessqualitätprüfung intern geprüft;<br />
Aufnahme in Interessensgem<strong>ein</strong>schaft<br />
bei Verfolgung der Grundsätze und<br />
Gewinnung <strong>von</strong> drei Fürsprechern<br />
(Paten) aus dem Kreis der Mitglieder<br />
Käsestraße<br />
Schleswig-<br />
Holst<strong>ein</strong> e.V. Bundesland z.t. Bio<br />
Qualitätsrindfleis<br />
ch Schleswig-<br />
Holst<strong>ein</strong> Bundesland<br />
Stiftungsland –<br />
Geniesserland Bundesland<br />
Fleisch stammt ausschließlich <strong>von</strong> Rinderrassen aus der<br />
Region; Aufzucht und Verarbeitung in <strong>von</strong> der LC<br />
Landwirtschafts-Consulting zertifizierten Betrieben<br />
die Tiere sollen ganzjährig, möglichst ohne zusätzliches<br />
Futter draußen weiden und ihre Kälber dort all<strong>ein</strong> zur<br />
Welt bringen<br />
Holst<strong>ein</strong>er Katenschinken<br />
Bundesland Pökeln, Räuchern in Buchenholzrauch bei max. 25°C Verarbeitung in der Region<br />
Schleswig-Holst<strong>ein</strong><br />
Bliesgauregal/<br />
Bliesgaukiste<br />
Vom<br />
Saarlandwirt Bundesland<br />
5<br />
Zertifizierung durch LC<br />
Landwirtschafts-Consulting<br />
Landschaftsraum<br />
z.T. Bio<br />
Landwirtschaftskammer überwacht<br />
Einhaltung der Richtlinien und vergibt<br />
Betriebszertifikat<br />
Erhaltung v.<br />
Lebensräumen<br />
bedrohter Arten<br />
Netzwerkbildung;<br />
gegenseitige Unterstützung<br />
bei Suche nach besten<br />
Produkten aus der Region,<br />
Nachwuchsarbeit
SL<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
Vom<br />
SAARLANDwirt<br />
SL Saargaukiste<br />
SL<br />
SL<br />
SN<br />
SN<br />
SN<br />
SN<br />
SN<br />
Naturraum/Gem<br />
<strong>ein</strong>den<br />
Lokalwarenmarkt<br />
St. Wendeler<br />
Land Landkreis<br />
Saarländlich -<br />
endlich wird’s<br />
ländlich Bundesland<br />
Saarland<br />
Qualität-direkt<br />
vom Hof Bundesland<br />
Oberlausitz<br />
genießen<br />
Lankdreise +<br />
Stadt<br />
Dachmarke<br />
„Bestes aus der<br />
Dübener Heide“ Landkreise<br />
Erzeugerzusamm<br />
enschluss<br />
Muldental<br />
Erzeugerzusamm<br />
enschluss<br />
„Koberland w.V.“<br />
6<br />
Landschaftsraum,<br />
Landkreis<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 24<br />
Hochwertigkeit bei Erzeugung <strong>von</strong> Bränden und<br />
Konfitüren<br />
naturnaher Anbau und Zucht heimischer Sorten und<br />
Rassen<br />
umweltschonende Bewirtschaftung, Beiträge zur Pflege<br />
und Erhaltung <strong>ein</strong>er<br />
vielfältigen Kulturlandschaft<br />
Einhaltung <strong>von</strong> Qualitätsmerkmalen; Absatz an<br />
Endverbraucher über eigene Hofläden, andere<br />
Direktvermarkter, LEH sowie Märkte, Messen und<br />
regionale Veranstaltungen<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Rohstoffe "weitgehend" regional,<br />
Ausnahmen wenn Produkt hilfreiche<br />
Ergänzung darstellt/Rohstoffe regional<br />
nicht verfügbar sind und Rezeptur +<br />
Verarbeiter aus Region<br />
dreistufiges Kontrollsystem; neutrale<br />
Kontrollen nach DIN-Norm durch<br />
akkreditierte Institute<br />
unabhängige Qualitätsprüfungen, die<br />
über die gesetzlich<br />
geforderten Kontrollen hinausgehen<br />
Erzeuger: artgerechte Tierhaltung; Verarbeiter:<br />
Schlachtung auf Mitgliedsbetrieb und Verarbeitung <strong>von</strong><br />
Fleischerei Heyer Tierwohl<br />
regionales Netzwerk; Ziel ist<br />
die regionale Wertschöpfung<br />
Wertschöpfung in Region,<br />
Arbeitsplätze
SN<br />
SN<br />
ST<br />
TH<br />
TH<br />
Land Marke Regionsgrenze Erzeuger-, Verarbeiter- und Vermarkter-standards<br />
„Agrarp-rodukte<br />
Direktvermarktun<br />
g Oberes Landschafts-<br />
Vogtland GmbH“ raum, Landkreis<br />
Kartoffeln aus<br />
Sachsen Bundesland<br />
Sachsen<br />
Regionalmarke<br />
Mittelelbe<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Regionalmarke<br />
Thüringer Wald<br />
(noch im Aufbau)<br />
R<strong>ein</strong>städter<br />
Landmarkt -<br />
Regional ist erste<br />
Wahl<br />
Thüringen<br />
Deutschland<br />
Landschaftsraum<br />
Randunschärfen<br />
Randunschärfen<br />
2<br />
185<br />
7<br />
1<br />
Übersicht wirtschaftlich relevanter Regionalinitiativen in Deutschland 2011 Seite 25<br />
Verarbeiter: Schlachtung und Verarbeitung in der<br />
hofeigenen Fleischerei; Verkauf in eigenen Geschäften<br />
sowie über Märkte und Handel<br />
Produktionstiefe (Erzeuger,<br />
Verarbeiter) Kontrollsystem, Zertifizierung Zusatz-kriterien duales Modell<br />
Futter: 100% betriebseigen,<br />
Verarbeitung in Region<br />
Pflanzgut; Vorgaben des Programms „Umweltgerechte<br />
Landwirtschaft”; Vorgaben zu Ernte und Lagerung; Führen <strong>ein</strong>er Schlagkartei<br />
Geburt in Gebietskulisse, Mästung mit<br />
betriebseigenem Futter; Rohmilch zu<br />
100%; Pflanzen: Anbau und<br />
Verarbeitung in Region<br />
z.T. Bio, Tierwohl;<br />
gentechnikfrei
12.2 Protokoll <strong>BMELV</strong> vom 05.12.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Präsentation des Zwischenberichts – <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
am 05.12.2011 – 14:00 bis 17:00 im <strong>BMELV</strong>, Bonn<br />
Gesprächsnotiz<br />
Am Treffen haben teilgenommen:<br />
Dr. Hermann Schlöder<br />
(<strong>BMELV</strong>)<br />
Martina Schäfer<br />
(<strong>BMELV</strong>)<br />
Karola Röttges<br />
(MGH)<br />
A. Wirz<br />
(FiBL Deutschland e.V. )<br />
Protokoll: Monja Kuske<br />
Kerstin Hartmann<br />
(<strong>BMELV</strong>)<br />
Peter Klingmann<br />
(MGH)<br />
Dr. R. Hermanowski<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
1 Präsentation des Zwischenberichts<br />
Dr. Rainer Gießübel<br />
(<strong>BMELV</strong>)<br />
Wilfried Schäfer<br />
(MGH)<br />
M. Kuske<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
Die Ausarbeitung der Arbeitsschwerpunkte Analyse bzw. <strong>Entwicklung</strong> der Szenarien verläuft<br />
parallel. Ziel: bestmöglicher Kompromiss zwischen Verbrauchererwartung, und Praktikabilität.<br />
Es wurden drei Szenarien erarbeitet, - Anerkennung, Siegel, Regionalfenster - die im Anschluss<br />
an die Präsentation diskutiert werden.<br />
2 Diskussion der Präsentation<br />
2.1 Allgem<strong>ein</strong>es<br />
Die Präsentation b<strong>ein</strong>haltet <strong>ein</strong>e umfassende Darstellung auch der schwierigen Themen und<br />
Interessenskonflikte. Wie bereits im Gespräch am 02.11.2011 wurde betont, dass die<br />
Verwirklichung <strong>ein</strong>er gesetzlichen Regelung ausgeschlossen ist.<br />
2.2 Diskussion der Szenarien und Bewertungskriterien<br />
Die drei vorgestellten Szenarien wurden <strong>für</strong> vollständig erachtet. Weitere notwendige <strong>Kriterien</strong><br />
zur Bewertung fallen nicht unmittelbar auf, wobei die Tabelle mancher Erklärungen bedarf um<br />
Missverständnissen vorzubeugen. Das Kriterium „Aussicht auf Umsetzung durch die Wirtschaft“<br />
müsste differenziert werden – Umsetzung durch Discounter, LEH, etc.<br />
Das Szenario Siegel ersch<strong>ein</strong>t das am <strong>ein</strong>fachsten Kommunizierbare zu s<strong>ein</strong>. Eine Umsetzung<br />
durch die Wirtschaft ersch<strong>ein</strong>t jedoch nicht realistisch. Es wird dementsprechend nicht weiter<br />
verfolgt.<br />
Vor- und Nachteile des Anerkennungsszenarios:<br />
das Konzept <strong>ein</strong>es Dachs kann, in Abhängigkeit der <strong>Kriterien</strong>, manche Akteure ausschließen.<br />
die Kommunizierbarkeit ist nicht unproblematisch; Missverständnisse entstehen leicht.<br />
Missbrauch des Dachzeichens diskreditiert die anderen Teilnehmer<br />
die Entscheidung <strong>für</strong> wen das zu konzipierende Dach ist, ist <strong>ein</strong>e politische.<br />
Regionalsiegel: Vorstellung Zwischenbericht <strong>BMELV</strong><br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 1
Vor- und Nachteile des Regionalfensters:<br />
die Risiken und Problematiken dieses Konzepts sollten noch stärker als in der Präsentation<br />
ausgeleuchtet werden<br />
was darf es b<strong>ein</strong>halten, wer erstellt das Regelwerk und kommuniziert es?<br />
<strong>ein</strong> Deklarationsfenster bietet <strong>ein</strong>e Art methodischen Rahmen, der viel Flexibilität erlaubt<br />
Frage: Wie frei wählbar sollen Regionalbezüge s<strong>ein</strong> - <strong>Kriterien</strong>wahl, Schwellen,<br />
Nachprüfbarkeit<br />
das Konzept Regionalfenster liegt am nächsten an der Idee der<br />
Nahrungsmittelinfoverordnung.<br />
Fenster attraktiv, denn es ist <strong>ein</strong> Verbraucherwunsch, <strong>ein</strong>e Geschichte zum Produkt zu haben<br />
2.3 Ergebnis:<br />
Das Szenario „Regionalfenster“ ersch<strong>ein</strong>t als <strong>ein</strong>e attraktive Lösung und soll weiterentwickelt<br />
werden. Szenario „Anerkennung“ soll ebenso optional weiter ausgearbeitet werden.<br />
3 Weiteres Vorgehen<br />
Abgabe bzw. Präsentation des Konzeptes am 16.01.2012<br />
Regionalsiegel: Vorstellung Zwischenbericht <strong>BMELV</strong><br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2
12.3 Protokoll Beiratssitzung vom 09.12.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Am Treffen haben teilgenommen:<br />
Protokoll zur Beiratssitzung am 09.12.2011<br />
H<strong>ein</strong>er Sindel Bundesverband der Regionalbewegung e.V.<br />
Ilonka Sindel Bundesverband der Regionalbewegung e.V.<br />
Nicole Weik Bundesverband der Regionalbewegung e.V.<br />
Prof. Dr. Ulrich Hamm Uni Kassel<br />
Andreas Swoboda tegut…<br />
Dr. Frank Thiedig Edeka Minden<br />
Dr. Alexander Gerber BÖLW<br />
Bruno Krieglst<strong>ein</strong> Ministerium <strong>für</strong> ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-<br />
Württemberg<br />
Dr. Hermann Schlöder <strong>BMELV</strong><br />
Wilfried Schäfer Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN mbH<br />
Peter Klingmann Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN mbH<br />
Karola Röttges Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN mbH<br />
Monja Kuske FiBL Deutschland e.V.<br />
Axel Wirz FiBL Projekte GmbH<br />
Dr. Robert Hermanowski FiBL Deutschland e.V./ FiBL Projekte GmbH<br />
Protokoll: Karola Röttges, Moderation: Dr. Robert Hermanowski<br />
1. Begrüßung und Vorstellungsrunde<br />
• (Herr Schlöder ist entschuldigt, er kommt erst im Laufe der Diskussion verspätet zu dem Treffen)<br />
2. Bericht zum Stand der Dinge<br />
• Zu Beginn der Beiratssitzung wurde die Frage gestellt, was das Ziel des Treffens ist und wohin<br />
die Ergebnisse fließen. Beantwortet wurde die Frage mit der Aussage, dass die Ergebnisse der<br />
Diskussion in den Sachbericht mit <strong>ein</strong>gehen<br />
• Anschließend erfolgt die Vorstellung der wichtigsten Inhalte, der im <strong>BMELV</strong> vorgetragenen<br />
Präsentation<br />
o Aufgabenstellung<br />
o Erste Arbeitsschritte<br />
o Erfassung der Wünsche der verschiedenen Akteure<br />
� Hierbei wurde angemerkt, dass die AMK nicht wie angegeben am 18. sondern<br />
am 28.10.2011 stattfand<br />
� Der BRB findet s<strong>ein</strong>e Position nicht korrekt dargestellt. Weder die Verarbeitung<br />
noch die Vermarktung müssen in den Augen des BRB zu 100% in der Region<br />
stattfinden, da dies bei v.a. verarbeiteten Produkten nicht praktikabel ist. Auch<br />
will er k<strong>ein</strong>e staatliche Regelung des Regionalbegriffs, sondern <strong>ein</strong><br />
privatwirtschaftliches Zertifizierungssystem. Der BRB fordert jedoch auf EU-<br />
Ebene fakultative Qualitätsangaben <strong>für</strong> den Begriff „Region“ und „regional“,<br />
sodass missbräuchliche Verwendung der Begrifflichkeiten geahndet werden<br />
kann.<br />
� Auf die Frage, was genau unter dem Dualen Modell zu verstehen ist, antwortete<br />
der BRB, dass im Dualen Modell wirtschaftliche und ideelle Gruppen eng<br />
zusammenarbeiten.<br />
� Des Weiteren merkt der BRB an, dass die Regionalinitiativen sehr heterogen<br />
sind und unterschiedliche Arbeitsweisen haben.<br />
� Eine weitere Bemerkung bei der Darstellung der Wünsche der Akteure: <strong>ein</strong><br />
neutrales Kontrollsystem bei den Wünschen der Länder ist zu kurz gesprochen.<br />
Hierbei fehlt die Partizipation<br />
o <strong>Kriterien</strong>modelle der verschiedenen Akteure<br />
o Begriffserläuterungen (Siegel, Dachmarke und Deklaration)<br />
� An dieser Stelle wurde nachgefragt, ob das System der Dachmarke nicht mit<br />
dem TÜV vergleichbar sei, dass also jeder, der die <strong>Kriterien</strong> erfüllt, das Zeichen<br />
tragen darf. Als Antwort auf die Frage wird auf das Siegel verwiesen, da das<br />
Siegel ähnlich funktioniere wie das TÜV-Siegel<br />
� Angemerkt wurde auch die Transparenz des Regionalfensters: Transparenz sei<br />
bei diesem System nur gegeben, wenn nicht jeder r<strong>ein</strong>schreiben darf, was er will.<br />
Hier wird auf die zu <strong>ein</strong>em späteren Zeitpunkt stattfindende Diskussion<br />
verwiesen; die provokante Darstellung dient auch der Anregung der Diskussion<br />
� Weil es Unklarheiten bezüglich der Benennungen gibt, wird noch <strong>ein</strong>mal<br />
erläutert, dass „Anerkennung“ und „Dachmarke“ das gleich Szenario beschreiben<br />
o <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> das Szenario „Anerkennung“<br />
o <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> das Szenario „Regionalfenster“<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel 06.12.2011<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 1
3. Diskussion<br />
Nachdem die Präsentation beendet ist, wird die Diskussion der dargestellten Ergebnisse eröffnet. Dr. R.<br />
Hermanowski übernimmt die Rolle des Diskussionsleiters:<br />
• Anders als Vorgesehen wird aufgrund des engen Zeitrahmens mit allgem<strong>ein</strong>em Einverständnis<br />
auf die Blitzlichtrunde verzichtet<br />
• Stattdessen wird direkt mit der Diskussion gestartet<br />
• Aufgrund der bereits dargestellten Unstimmigkeiten mit den präsentierten „Wünschen der<br />
Akteure“ und der tatsächlichen Position der Akteure, <strong>ein</strong>igen sich die Teilnehmer darauf, diesen<br />
Inhalt der Folie so nicht mehr nach außen zu kommunizieren<br />
• Der BRB wird gebeten, nach der Sitzung mit den Arbeitsgruppen in Kontakt zu treten und die<br />
Position noch <strong>ein</strong>mal darzustellen<br />
• (Swoboda): die Wünsche des Handels seien in dieser Darstellung sehr allgem<strong>ein</strong> gehalten und<br />
somit akzeptabel<br />
• (Hamm) stellt die Frage, ob das Ziel <strong>ein</strong>e Moderation zwischen den verschiedenen Stakeholdern<br />
sei oder ob letztendlich mehr Transparenz <strong>für</strong> den Verbraucher das Ziel sei; daher sei die<br />
Diskussion wichtig <strong>für</strong> die Akteure, um den Verbraucherwunsch erfüllen zu können<br />
• (H. Sindel): der Prozess, <strong>ein</strong>er <strong>ein</strong>heitlichen Regionalkennzeichnung laufe schon sehr lange, die<br />
verschiedenen Akteure haben unterschiedliche Positionen und sogar die Länder seien sehr<br />
heterogen in der Ausgestaltung ihrer Länderzeichen; das Wort „Dachmarke“ sollte vermieden und<br />
eher als „Regionalvermarktungssiegel“ bezeichnet werden; dabei könne nur <strong>ein</strong> Weg<br />
vorgeschlagen werden, doch bei der Umsetzung seien Partner wichtig. Da<strong>für</strong> sei der momentan<br />
veranschlagte Zeitrahmen jedoch eigentlich zu gering<br />
• (Hamm): die bestehenden Regionalinitiativen haben den Wunsch der Verbraucher nach mehr<br />
Transparenz sowie nach <strong>ein</strong>heitlichen <strong>Kriterien</strong> nicht befriedigen können; Wichtig sei es die Frage<br />
zu klären, was das Ziel sei „wo wollen wir hin?“; dabei müsse man es <strong>für</strong> den Verbraucher so<br />
<strong>ein</strong>fach wie möglich machen<br />
• (Gerber): es gebe unterschiedliche Herangehensweisen bezüglich der Definition <strong>von</strong><br />
Regionalität; dabei wird die Frage bezüglich wissenschaftlicher Erkenntnisse gestellt.<br />
o Hierbei wird auf frühere Treffen und dargestellte Ergebnisse verwiesen<br />
• (H. Sindel): es gebe zwei Möglichkeiten, entweder könne man die Frage jetzt ausdiskutieren oder<br />
bei der Umsetzung; dabei s<strong>ein</strong> <strong>ein</strong> Ansatz auch, den Zeitraum der Diskussion zu verlängern<br />
• An dieser Stelle stellt der Moderator die Frage, ob noch <strong>ein</strong> weiteres Szenario bzw. Modell fehle,<br />
oder ob die hier dargestellten alle Möglichkeiten abdecken<br />
• (Swoboda): Die Frage, was genau unter dem Begriff Regionalität zu verstehen sei, sei sehr<br />
wichtig, jedoch könne man k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitliche Definition finden; zumal auch <strong>ein</strong>e Unterscheidung<br />
nach Produktgruppe denkbar sei, insgesamt führe dieses Thema zu <strong>ein</strong>er endlosen Diskussion;<br />
der Begriff Regionalität müsse gefüllt werden<br />
• (I. Sindel): die Unternehmen fehlen bei der Darstellung der Akteure; was verstehen die Hersteller<br />
bzw. das Handwerk unter Regionalität?<br />
• (Thiedig): der Begriff müsse definiert werden; <strong>ein</strong> freiwilliges Siegel würde k<strong>ein</strong>er verwenden<br />
wollen<br />
• Moderator: Zusammenfassung: es sei nicht notwendig tiefer zu gehen, doch die M<strong>ein</strong>ung <strong>von</strong><br />
Handwerk und Hersteller fehle in dieser Darstellung<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): mache es Sinn, Regionalbewegungen zu befragen, die nicht Mitglieder des BRB<br />
seien<br />
• (Wirz): <strong>ein</strong> Teil wurde bereits gefragt<br />
• Wiederum stellt der Moderator die Frage, ob noch etwas fehle, woraufhin sich k<strong>ein</strong>er der<br />
Teilnehmer meldet<br />
• Moderator: Da das Szenario „Siegel“ wenig Aussicht auf Akzeptanz habe, werde es nicht weiter<br />
verfolgt; dies sei auch der Auftrag aus dem <strong>BMELV</strong>; es stelle sich die Frage, ob die bisherige<br />
Vorgehensweise gut sei, oder ob <strong>ein</strong> Szenario fehle.<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): Beispiel Qualitätssiegel Österreich: sehr weit gefasst, <strong>von</strong> Tschechien bis kl<strong>ein</strong>e<br />
Region in Österreich; statt „Siegel“ sei es besser <strong>ein</strong> Qualitäts- und Herkunftszeichen zu<br />
verwenden, bei dem der Verbraucher selbst entscheiden kann, welche Region er bevorzuge<br />
• (Thiedig): Statt <strong>ein</strong> neues Zeichen mit neuen <strong>Kriterien</strong> zu entwickeln, sei es doch besser, bereits<br />
bestehende Zeichen zum Beispiel der Länder zu nutzen und darauf aufzubauen<br />
• (Gerber): Länderzeichen seien zu kompliziert und erfüllten nicht den Wunsch der Verbraucher;<br />
man müsse <strong>ein</strong>e Lösung suchen, die verschiedenen Aspekte unter <strong>ein</strong>en Hut zu bringen<br />
• (Thiedig): unter Umständen seien die Chancen und Möglichkeiten der Länderzeichen gar nicht<br />
allgem<strong>ein</strong> bekannt<br />
• Moderator: Fehle Szenario? (Frage wird allgem<strong>ein</strong> vern<strong>ein</strong>t) Dann sollten nun die <strong>ein</strong>zelnen<br />
Modelle diskutiert werden; dargestellt seien drei Modelle, wo<strong>von</strong> zwei die Extrema darstellen und<br />
das dritte in der Mitte liege<br />
• (Hamm): vorher müsse das Ziel klar s<strong>ein</strong>. Das Ziel sei der Verbraucherwunsch, dass das was<br />
außen auf der Verpackung stehe auch tatsächlich in dem Produkt drin sei.<br />
• (Schlöder): das Ziel sei es <strong>ein</strong> Zeichen zu entwickeln, das Transparenz <strong>für</strong> die Produkte<br />
garantiere, die „regional“ seien; Erst anschließend müsse die Definition geführt werden, was<br />
genau Regionalität bedeute; wichtig sei die Sicherstellung, dass alle Aussagen, die getroffen<br />
werden auch wahr seien<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel 06.12.2011<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2
• (Hamm): <strong>ein</strong> Bundesland sei nicht „regional“<br />
• (Thiedig): <strong>ein</strong>e Region könne auch <strong>ein</strong> Bundesland s<strong>ein</strong>; man sollte bestehende Systeme nutzen<br />
• Moderator: das Ziel sei die Transparenz <strong>für</strong> den Verbraucher und nicht den Begriff Regionalität<br />
zu definieren<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): es müsse Grenzen geben, wann <strong>ein</strong> Produkt regional ist und wann nicht<br />
• (I. Sindel): <strong>ein</strong>e gem<strong>ein</strong>same Zielsetzung sei schwierig zu finden, sei aber auch gar nicht<br />
notwendig; nicht nur die Transparenz, auch die Stärkung der regionalen Wirtschaft mit den<br />
kl<strong>ein</strong>en und mittelständischen Unternehmen sei wichtig<br />
• Moderator: nicht „Dachmarke“ sondern „Anerkennung“, weil bestehende Regionalinitiativen<br />
anerkannt werden<br />
• (Schlöder): man müsse <strong>ein</strong>en Rahmen schaffen, mit klaren <strong>Kriterien</strong>, wo man möglichst alle<br />
Akteure mitnehme und der Transparenz <strong>für</strong> den Verbraucher sicherstelle; dabei sei der letzte<br />
Schritt die Benennung, vorher müssten die Inhalte geklärt werden; jedes Szenario wecke<br />
bestimmt Erwartungen, daher müssten vorher die <strong>Kriterien</strong> festgelegt werden<br />
• Moderator: Zusammenfassung: drei Szenarien: Anerkennung, Herkunftsdeklaration und<br />
Vernetzung bestehender Systeme; Frage: Finden sich alle wieder? (k<strong>ein</strong> Widerspruch)<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): worin bestehe Mehrnutzen <strong>ein</strong>es weiteren Regionalzeichens <strong>für</strong> bestehende<br />
funktionierende Systeme?<br />
• Moderator: weiteres Vorgehen: Diskussion der drei Szenarien hinsichtlich der Vor- und Nachteile<br />
anschließend Klärung der Frage, ob jemand mitmache<br />
• (Thiedig): wichtig seien immer Nachvollziehbarkeit und Machbarkeit<br />
• Moderator: also Transparenz und Umsetzbarkeit<br />
• (Schlöder): den gesetzlichen Weg gebe es nicht; das <strong>BMELV</strong> erstelle lediglich den Rahmen <strong>für</strong><br />
jemanden, der ihn dann nutze<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): anhand des Beispiels Bio-Siegel könne man sehen, welches Ziel vorher festgelegt<br />
wurde und wie dieses umgesetzt wurde<br />
• Moderator: Zeitlicher Rahmen: drei Szenarien � 10 Minuten <strong>für</strong> jedes<br />
4. Diskussion der drei Szenarien<br />
4.1. Szenario 1 Koordination (bereits bestehende Systeme nutzen)<br />
• (Gerber): Problem: Regionalinitiativen seien raus; bei „Anerkennung“ hingegen könnten sich auch<br />
die Länderzeichen wiederfinden<br />
• (I. Sindel): k<strong>ein</strong>e Regionalinitiativen nutzen <strong>ein</strong> Länderzeichen<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): Widerspruch: in Baden-Württemberg gebe es Beispiele<br />
• (Schäfer): Landmarkt nutzt Länderzeichen <strong>von</strong> Hessen; zu Gerber: Länderzeichen könne <strong>von</strong><br />
Regionalinitiativen übernommen werden<br />
• (I. Sindel): Korrektur der Aussage: nicht k<strong>ein</strong>e, sondern sehr wenige<br />
Regionalvermarktungsinitiativen nutzen <strong>ein</strong> Länderzeichen. Die Länderzeichen sind nicht<br />
ausreichend <strong>für</strong> Regionalvermarktungsinitiativen. Oftmals werden die Länderzeichen zwar als<br />
Basis genutzt, jedoch satteln die Initiativen anschließend ihre <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> „Regionalität“<br />
zusätzlich auf.<br />
• (Hamm): Koordination der Länder sei unmöglich<br />
• (Thiedig): Widerspruch: <strong>ein</strong>ige Länder seien bereits zusammengeschlossen<br />
• (H. Sindel): <strong>ein</strong> Zeichen <strong>für</strong> jeden mache k<strong>ein</strong>en Sinn<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): das führe zu <strong>ein</strong>er Marktabschottung<br />
• Moderator: Zusammenfassung: Weiteres Zeichen nicht nötig<br />
• (Schlöder): Festlegung <strong>von</strong> Mindestkriterien mit <strong>ein</strong>em +<br />
• Moderator: die Arbeitsgruppe werde sich bezüglich Szenario 1 mit Thiedig + Krieglst<strong>ein</strong><br />
absprechen<br />
4.2 Szenario 2 Anerkennung<br />
• Klingmann fasst noch <strong>ein</strong>mal zusammen, was genau „Anerkennung“ bedeutet (siehe Folie)<br />
• (Hamm): Modell 1 und 2 scheiden aus, da aus Verbrauchersicht Region auch kl<strong>ein</strong>räumig s<strong>ein</strong><br />
könne; des Weiteren solle man auf k<strong>ein</strong>en Fall Zusatzkriterien in das Regionalzeichen <strong>ein</strong>fließen<br />
lassen, da dadurch zu viele Töpfe geöffnet würden; die Einbindung der Wertschöpfungskette<br />
müsse diskutiert werden<br />
• (Weik): es stelle sich die Frage, wie das System ablaufen solle, wer vergebe das Zeichen und<br />
wer bekomme es?<br />
• (Wirz): Hersteller, Handwerk etc. sind in der Darstellung rausgelassen, diese kämen auf die Stufe<br />
der Regionalinitiativen, müssten jedoch nicht Partner dieser s<strong>ein</strong><br />
• Moderator: könne auch der Handel die Dachmarke verwenden?<br />
• (Weik): wie seien da die genauen Vorstellungen?<br />
• (H. Sindel): das Risiko, direkt an den Handel zu gehen, sei sehr hoch<br />
• Moderator: Anerkennung ist hoch komplex; Beispiel: AGÖL; Frage: wer wird akkreditiert?<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel 06.12.2011<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 3
• (H. Sindel): <strong>ein</strong> r<strong>ein</strong>es Produktlabel sei riskant; <strong>ein</strong> Schutzmechanismus sei wichtig; <strong>ein</strong>e zentrale<br />
Kontrollstelle sei schwierig, besser sei es da, mit den Ländern zusammen zu arbeiten und auf die<br />
Regionen runterzubrechen; die ideelle Schiene sei wichtig<br />
• (Swoboda): der Kontrollaufwand sei immer gleich groß, egal welches Szenario man betrachte;<br />
<strong>ein</strong> kl<strong>ein</strong>er Hersteller müsse genauso geprüft werden wie <strong>ein</strong> großer; das Szenario Anerkennung<br />
sei unsympathisch, da die Kosten zu groß seien<br />
• (Weik):Es existieren bereits Regionalvermarktungsinitiativen mit guten <strong>Kriterien</strong>- und<br />
Kontrollsystemen, die auch externe Kontrollen b<strong>ein</strong>halten. ? Könne man diese nicht nutzen?;<br />
Kontrollstelle kontrolliere Regionalinitiative und die Regionalinitiative kontrolliere die Hersteller,<br />
dies sei in der Abbildung falsch dargestellt. Ziel ist, möglichst geringen Aufwand <strong>für</strong> den<br />
Produzenten entstehen zu lassen und k<strong>ein</strong>e Doppelarbeit zu leisten, vielmehr ist es nötig,<br />
Synergieeffekte aus bestehenden Systemen zu nutzen.<br />
• (Schlöder) Prozesskontrolle sei wichtig<br />
• (Swoboda): die Akteure hätten unterschiedliche Erwartungen<br />
• (Wirz): Rückfrage bei Weik, ob der Ansatz richtig erfasst wurden<br />
• (Weik): es gebe bereits anerkannte Kontrollstellen, man muss k<strong>ein</strong>e neuen schaffen. Bisher<br />
übernehmen die Kontrolle bei Initiativen oftmals externe Zertifizierungsinstitute, die z. B. auch die<br />
Bio-Kontrollen durchführen.<br />
• (Swoboda): die Kontrollstelle kontrolliere im Auftrag der Regionalinitiativen<br />
• Moderator: BRB als Pate <strong>für</strong> dieses Szenario � Abstimmung der Arbeitsgruppe mit BRB<br />
• Szenario 1: Abstimmung mit Krieglst<strong>ein</strong><br />
4.3. Szenario 3 Regionalfenster<br />
• Klingmann stellt noch <strong>ein</strong>mal das Regionalfenster vor (siehe Folie)<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): Bsp. Apfelkuchen � Wertgebender Bestandteil seien die Äpfel<br />
• (Wirz): nicht wertgebender Bestandteil sondern Hauptzutat werde betrachtet<br />
• (Hamm): Modell verlange mündigen Bürger � Entscheidung liege letztendlich bei ihm<br />
• (Schlöder): Frage ob der Verbraucher dadurch überfordert sei<br />
• (Swoboda)Ver<strong>ein</strong>fachung <strong>für</strong> Verbraucher mache es nicht besser; mehr und detailliertere<br />
Informationen seien sinnvoller; <strong>ein</strong> interessierter Verbraucher sei auch bereit zu lesen; <strong>ein</strong>e<br />
transparente Deklaration sei sinnvoll und <strong>ein</strong> menschengemäße Kommunikation; jedoch sei die<br />
Darstellung schwierig, eventuell ließe sich die Deklaration in <strong>ein</strong> Zutatenverzeichnis integrieren;<br />
das Problem bei der „Anerkennung“ sei, dass die Angaben eventuell im Widerspruch zu der<br />
Herkunftsdeklaration stehe<br />
• (Thiedig): <strong>ein</strong>e Möglichkeit sei auch die Informationen im Detail mithilfe des Handys o.ä. zu<br />
kommunizieren; <strong>Entwicklung</strong>en der Technik könnten genutzt/unterstützt werden<br />
• Moderator: Zusammenfassung: mit dem Begriff Regionalfenster seien bestimmte Erwartungen<br />
verbunden; besser sei <strong>ein</strong> „Wo-komm-ich-her-Fenster“<br />
• (Hamm): Verbraucher denken <strong>von</strong> sich aus nicht an Vorstufen (Futtermittel etc.) darauf<br />
angesprochen wollen sie jedoch auch die Vorstufen regional<br />
• (H. Sindel): der Job der Regionalinitiativen sei es, die Herkunft der Zutaten zu klären und das<br />
transparent zu kommunizieren.<br />
• (Hamm): Beispiel Milch: Verarbeitung oder wirkliche Herkunft entscheidend?<br />
• (Swoboda): Herkunft<br />
• Moderator: ist Modell klar? (k<strong>ein</strong> Widerspruch) Weiteres Vorgehen: kurze Pause, anschließend<br />
soll jeder angeben,. Welches Modell er bevorzugt<br />
•<br />
5. Schlussrunde<br />
• (Hamm): Fenster; „Koordination“ überhaupt nicht<br />
(Krieglst<strong>ein</strong>): Ein weiteres Regionalsiegel ist nicht erforderlich, da<br />
beispielsweise das Qualitätszeichen/Qualitätsprogramm BW (wie auch das by.<br />
GQ) alle drei Szenarien bedienen kann.<br />
•<br />
• (Thiedig): Definition <strong>von</strong> Regionalität sei schwierig; Modell 1<br />
• (Swoboda): Modell 3<br />
• (H. Sindel): Modell 2<br />
• (I. Sindel): Modell 2; 1. Schritt: Handwerk müsse <strong>ein</strong>gebunden werden<br />
• (Weik): Modell 2; es sei das <strong>ein</strong>zige praktikable Modell, da hier k<strong>ein</strong>e Verbrauchertäuschung<br />
vorliege<br />
• (Gerber): „Fenster“ am zukunftsweisenden<br />
• Achtung: Modell 2 entspricht Szenario 1 in der Präsentation!! (Szenario „Anerkennung“)<br />
6. weiteres Vorgehen<br />
• (Schlöder): der Zeitplan stehe fest, das weitere Arbeiten werde mit Spannung erwartet;<br />
Diskussion auf grüner Woche; Erprobung, Design<br />
• (Schlöder): DLG zeige Interesse an der Umsetzung des Zeichens<br />
• (Krieglst<strong>ein</strong>): Frage, ob ausgeschrieben werde<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel 06.12.2011<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 4
• (Schlöder): ja<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel 06.12.2011<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 5
12.4 Gesprächsnotiz BRB vom 10.11.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Zusammenfassung: Treffen Bundesverband der Regionalbewegung, MGH, FiBL<br />
zum Thema „Regionalsiegel“ am Do, 10.11.2011<br />
Am Treffen haben teilgenommen:<br />
Ilonka Sindel Bundesverband der Regionalbewegung<br />
Nicole Weik Bundesverband der Regionalbewegung<br />
H<strong>ein</strong>er Sindel Bundesverband der Regionalbewegung<br />
Peter Klingmann Marketinggesellschaft GUTES AUS HESSEN mbH<br />
Monja Kuske FiBL Deutschland e.V.<br />
Axel Wirz FiBL Projekte GmbH<br />
1. Vorstellungsrunde FiBL<br />
FiBL und MGH sind Bietergem<strong>ein</strong>schaft. Die MGH spricht <strong>für</strong> die Marketinggesellschaft Baden<br />
Württemberg, Marketinggesellschaft Niedersachsen sowie <strong>für</strong> Schleswig Holst<strong>ein</strong> und Bayern.<br />
Projektpartner sind weiter Tegut, Feneberg, Edeka Südwest, Bio mit Gesicht, BÖLW, Bioland,<br />
Demeter, und Naturland.<br />
Die Bietergem<strong>ein</strong>schaft wird mit allen Stakeholdern im Themenfeld Regionalität sprechen, vom<br />
Einzelhandel, den Fachhandel, handwerkliche Verarbeitungsbetriebe bis zu den Regionalinitiativen.<br />
Über alle Kontakte und Gesprächsergebnisse wird das Ministerium zeitnah informiert.<br />
2. Vorstellungen des Bundesverband der Regionalbewegung<br />
• Die Ausschreibung war deutlich umfangreicher als in der Zeit machbar ersch<strong>ein</strong>t.. Man fragt sich<br />
<strong>für</strong> wen die Ausschreibung erfolgt ist. Wie ist diese zustande gekommen? Kl<strong>ein</strong>er anfangen wäre<br />
sinnhaft gewesen. Ein gangbarer Weg ist gewünscht.<br />
• Hauptanliegen: Durch <strong>ein</strong> Siegel sollen die Regionalvermarktungsinitiativen unterstützt und<br />
motiviert werden, und damit kl<strong>ein</strong>ere und mittlere Unternehmen ebenso, wodurch der ländliche<br />
Raum insgesamt gestärkt wird.<br />
• Die zu schützenden/zu stärkenden Initiativen sind gerade auch deswegen schützenswert, weil sie<br />
<strong>ein</strong>e ideelle Komponente haben (z.B. Zusatzkriterien sozialer Art, „ohne Gentechnik,<br />
Nachhaltigkeit, etc.).<br />
• Ein Siegel soll dazu dienen den Verbraucher vor Mogelpackungen zu schützen, das Siegel<br />
sollte nicht <strong>für</strong> den LEH und die Ernährungsindustrie s<strong>ein</strong>.<br />
• Bedenken: Werden, wenn der Handel ins Konzept <strong>ein</strong>bezogen wird, die Interessen der<br />
Regionalinitiativen genügend berücksichtigt?<br />
• Regionalität ist der Trumpf, so dass die Großen mal die Kl<strong>ein</strong>en brauchen; Der Handel soll<br />
Produkte der Regionalinitiativen stützen, nicht die Eigenmarken des Handels.<br />
• Damit <strong>ein</strong> Regionalsiegel erfolgreich wird, müsste es mit Fördermitteln unterstützt werden.<br />
• Stichwort TÜV: Standards entwickeln, Initiativen zertifizieren, die dann wiederum die<br />
Produktzertifizierung leisten; sowohl externes als auch internes Kontrollsystem.<br />
• Wichtig: Es soll k<strong>ein</strong> Zeichen entstehen, das allen Tür und Tor öffnet und gegen das<br />
Hauptanliegen arbeitet.<br />
3. Vorgehensweise FiBL/MGH<br />
Wie in der Ausschreibung<br />
• Datenerhebung: Eigenrecherche und Experten. Schwerpunkt auf öffentlich zugänglichen<br />
Inhalten, da der Fokus auf der Verbrauchersicht liegt<br />
• <strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> 3-4 Szenarien<br />
• Absprache der Szenarien mit <strong>BMELV</strong> und Beirat Anfang Dezember<br />
• Weiterentwicklung der <strong>für</strong> das Ministerium gangbaren Vorschläge<br />
• Befragungen der Stakeholder bezüglich dieser Szenarien<br />
• Angefragt <strong>für</strong> den Beirat sind VZ Hessen (Herr König), BÖLW (Herr Gerber), Uni Kassel (Prof.<br />
Ulrich Hamm), Bundesverband der Regionalbewegung?, eventuell weitere Teilnehmer<br />
Treffen_Bundesverband_Regionalbewegung_111110<br />
FiBL Deutschland e.V., Postfach 90 01 63, 60441 Frankfurt am Main, www.fibl.org<br />
Seite 1
4. Vorschläge zur Einbeziehung des Bundesverbandes der Regionalbewegung<br />
• Mitgliedschaft im Beirat.<br />
• Befragung der Regionalinitiativen als Expertenm<strong>ein</strong>ung zu den entwickelnden Szenarien, gegen<br />
<strong>ein</strong>e finanzielle Aufwandsentschädigung<br />
• Erprobung der bevorzugten Regionalkennzeichnung durch <strong>ein</strong>en gem<strong>ein</strong>samen Antrag <strong>für</strong> <strong>ein</strong><br />
Modellvorhaben<br />
>> Der Bundesverband möchte nicht das „Feigenblättchen“ spielen und s<strong>ein</strong>er Linie treu bleiben.<br />
Eine Möglichkeit der Zusammenarbeit besteht aus Sicht des Bundesverband nur dann, wenn die<br />
weiterzuentwickelnden Szenarien auch im Sinne der Zielvorstellungen des Bundesverbandes<br />
sind. Fibl/MGH erhält zeitnah <strong>ein</strong>e Rückmeldung, ob der Vorstand des Bundesverbandes der<br />
Regionalbewegung <strong>ein</strong>er aktiven Mitarbeit bei dem Gutachten zustimmt<br />
>> Das ist auch im Sinne <strong>von</strong> FiBL/MGH. Geäußerte M<strong>ein</strong>ungen, auch abweichende M<strong>ein</strong>ungen,<br />
werden als Expertenm<strong>ein</strong>ung im Gutachten aufgenommen und weitergegeben, um <strong>ein</strong> möglichst<br />
vollständiges Bild an die Entscheidungsträger in der Politik zu übermitteln.<br />
Feuchtwangen, den 10.11.2011<br />
Ilonka Sindel Axel Wirz<br />
Treffen_Bundesverband_Regionalbewegung_111110<br />
FiBL Deutschland e.V., Postfach 90 01 63, 60441 Frankfurt am Main, www.fibl.org<br />
Seite 2
12.5 Positionspapier BRB vom 25.11.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Positionspapier Glaubwürdige Regionalvermarktung<br />
Regionale Wirtschaftskreisläufe<br />
als Basis <strong>ein</strong>es Regionalsiegels<br />
Positionierung des Bundesverbandes der Regionalbewegung als<br />
Interessenvertretung der Regionalinitiativen in Deutschland<br />
zum Thema „Regionalsiegel“<br />
Präambel<br />
Im Spannungsfeld der Globalisierung gewinnt Regionalität zunehmend an Bedeutung und<br />
prägt die gesellschaftliche Diskussion in Deutschland. Die Chancen zur <strong>Entwicklung</strong> des<br />
ländlichen Raumes durch Wertschöpfung in der Landwirtschaft und im Handwerk gilt es<br />
zu nutzen, um kl<strong>ein</strong>e und mittelständische Unternehmen als Stabilitätsfaktoren unserer<br />
Gesellschaft zu gewichten.<br />
Bundesweit wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Regionalvermarktungsinitiativen<br />
gegründet, die sich in ihren Regionen <strong>für</strong> die Vermarktung regionaler Produkte <strong>ein</strong>setzen.<br />
Die Gründung der Regionalvermarktungsinitiativen geht meist <strong>ein</strong>her mit dem<br />
Ziel, regionale Vermarktungsstrukturen zu erhalten und wiederzubeleben, die heimischen<br />
Erzeuger und Verarbeiter zu stärken und dem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher<br />
nach Qualität und gesicherter regionaler Herkunft der Produkte mit <strong>ein</strong>em glaubwürdigen<br />
Richtlinien- und Kontrollsystem zu entsprechen. Die Bekanntheit und die Erfolge der Regionalvermarktungsprojekte<br />
sind jedoch extrem unterschiedlich.<br />
Ausgangslage<br />
Auf gesetzlicher Ebene sind bisher k<strong>ein</strong>e <strong>Kriterien</strong> und Richtlinien vorhanden, durch welche<br />
genau definiert ist, in welchem Rahmen mit den Begriffen „Region“, „regional“ oder<br />
„regionales Produkt“ geworben werden darf. Die Folge da<strong>von</strong> ist <strong>ein</strong>, vor allem <strong>für</strong> den<br />
Verbraucher, undurchschaubarer Markt <strong>von</strong> ehrlichen, glaubwürdigen Regionalprodukten<br />
bis hin zu „Mogelpackungen“, die nur Regionalität suggerieren. Anders als bei Bio-<br />
Lebensmitteln, die durch die EG-Öko-Verordnung und das Öko-Kennzeichengesetz genau<br />
definiert sind, hat der Verbraucher k<strong>ein</strong>e Möglichkeit regionale Produkte, die nach bestimmten<br />
<strong>Kriterien</strong> produziert werden, optisch zu identifizieren. Auch gibt es kaum Möglichkeiten<br />
missbräuchliche Regionalwerbung zu ahnden.<br />
Der Bundesverband der Regionalbewegung hatte im Rahmen des vom Bundesministerium<br />
<strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (<strong>BMELV</strong>) geförderten Projektes<br />
„Regionale Allianzen“ Gelegenheit, in Expertenrunden zunächst die Sinnhaftigkeit <strong>ein</strong>es<br />
Regionalsiegels <strong>für</strong> Regionalvermarktungsinitiativen zu erörtern, um anschließend das<br />
Konzept <strong>ein</strong>es solchen zu entwickeln. In diesen Expertenrunden (Dezember 2009, Februar<br />
2010, Mai 2010) wurde unter Einbeziehung des <strong>BMELV</strong>, der Marketinggesellschaft Niedersachsen,<br />
der Verbraucherzentrale Bundesverband, vertreten durch die Verbraucherzentrale<br />
Hessen, Neuland e. V., Institut <strong>für</strong> ländliche Strukturforschung, B.A.U.M.-<br />
1
Positionspapier Glaubwürdige Regionalvermarktung<br />
Consult und Regionalvermarktungsinitiativen sowie unter Berücksichtigung <strong>von</strong> EU-<br />
Projekten, z.B. Regio Market (Interreg III B-Projekt), ausgelotet, wie die Glaubwürdigkeit<br />
regionaler Produktvermarktung erhöht werden kann. Weiterhin wurden die Ergebnisse<br />
des bundesweiten Treffens der Regionalvermarktungsinitiativen (Juni 2011) <strong>ein</strong>bezogen.<br />
Dabei wurde festgestellt, dass <strong>ein</strong> bundes<strong>ein</strong>heitliches produktspezifisches <strong>Kriterien</strong>- und<br />
Kontrollsystem <strong>für</strong> Regionalität (noch) nicht machbar und praktikabel ersch<strong>ein</strong>t. Zum<br />
<strong>ein</strong>en kann Regionalität nicht – wie z.B. beim Öko-Siegel – nach definierten Anbaukriterien<br />
erfolgen, zum anderen sind die Vielfalt und Strukturen der Regionen sowie deren<br />
Produkte enorm.<br />
Ziel<br />
Der Bundesverband der Regionalbewegung empfiehlt <strong>ein</strong> Regionalsiegel <strong>für</strong> Regionalvermarktungsinitiativen<br />
(Privatwirtschaftliches Zertifizierungssystem). Das heißt, die Vergabe<br />
des Siegels erfolgt an die Initiativen vor Ort und ist als <strong>ein</strong>e Art „Regionalitäts-TÜV“ zu<br />
verstehen. Die Initiativen können anschließend wiederum ihre Produkte damit kennzeichnen.<br />
Kontroll- und Sanktionsmechanismen im Rahmen <strong>ein</strong>es Zertifizierungssystems gilt<br />
es da<strong>für</strong> auszuarbeiten. So können regionale Produkte an Glaubwürdigkeit gewinnen sowie<br />
die Verbraucher und auch die zahlreichen ehrlich arbeitenden Regionalvermarktungsinitiativen<br />
geschützt werden. Ein Regionalsiegel muss sich <strong>von</strong> den bestehenden Qualitäts-<br />
und Länderzeichen unterscheiden und soll in k<strong>ein</strong>em Fall <strong>ein</strong>e Konkurrenz zu diesen<br />
darstellen.<br />
Weiterhin sind Ziele dieser Positivkennzeichnung<br />
� Verbrauchern den Konsum <strong>von</strong> in ihrer Regionalität geprüften, nachvollziehbaren<br />
und gesicherten Regionalprodukten zu erleichtern,<br />
� die Regionalvermarktungsinitiativen im Handel wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig<br />
zu machen,<br />
� die empfohlenen Mindeststandards <strong>für</strong> Regionalität <strong>ein</strong>zuführen,<br />
� die Gründung weiterer Regionalvermarktungsinitiativen im Bundesgebiet zu fördern.<br />
Zusätzlich kann aufbauend darauf die Etablierung <strong>von</strong> fakultativen Qualitätsangaben <strong>für</strong><br />
„regionales Produkt“ auf EU-Ebene dazu dienen, missbräuchliche Verwendung dieser Begrifflichkeiten<br />
<strong>von</strong> Seiten der Unternehmen und des Handels ahnden zu können, d.h. die<br />
Werbeversprechen können somit überprüfbar und bestrafbar gemacht werden.<br />
2
Positionspapier Glaubwürdige Regionalvermarktung<br />
<strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> glaubwürdiges Regionalvermarktungssystem<br />
1. Eigene, schlüssige Definition der Region<br />
� Die Regionalvermarktungsinitiative besitzt <strong>ein</strong>e schlüssige und sinnvolle Definition<br />
ihrer eigenen Region in Form <strong>ein</strong>er genau definierten Gebietskulisse<br />
2. Transparente Qualitäts- und Herkunftskriterien (Produktspezifisch <strong>für</strong> Erzeuger<br />
und Verarbeiter)<br />
� Nicht zusammengesetzte Produkte (Monoprodukte) stammen zu 100% aus der<br />
definierten Region*<br />
� Bei zusammengesetzten und verarbeiteten Produkten stammen die Zutaten aus<br />
der definierten Region*<br />
� Die Produkte werden in der Region verarbeitet und hergestellt. Möglichst viele Akteure<br />
der Wertschöpfungskette profitieren an der Wertschöpfung (=am zunehmenden<br />
Wert der <strong>ein</strong>zelnen Waren vom Rohstoff bis hin zum Endprodukt).*<br />
� Qualitätskriterien existieren <strong>für</strong> die <strong>ein</strong>zelnen Produktgruppen (über den gesetzlichen<br />
Standards)<br />
� Es werden überwiegend heimische Futtermittel <strong>ein</strong>gesetzt<br />
� Die Produkte werden ohne Gentechnik erzeugt und verarbeitet (nach EGGenT-<br />
DurchfG)<br />
3. Regionale Vermarktung und Wertschöpfung<br />
� Prinzip: Aus der Region – <strong>für</strong> die Region<br />
� Die Vermarktung der Produkte findet überwiegend in der definierten Region statt<br />
� Durch die Regionalvermarktungsinitiative ist sichergestellt, dass so viel Wertschöpfung<br />
wie möglich in der Region stattfindet<br />
� Der Sitz der produzierenden Unternehmen ist in der Region* � Zahlung der Gewerbesteuer<br />
in der Region<br />
4. Kontrolle der <strong>Kriterien</strong><br />
� Die Regionalvermarktungsinitiative muss <strong>ein</strong> transparentes <strong>Kriterien</strong>- und Kontrollsystem<br />
(KuK) besitzen<br />
� Die Kontrolle aller <strong>Kriterien</strong> wird durch interne und externe Kontrollen gewährleistet<br />
* Ausnahmen sind zu vermeiden. Falls Kompromisse <strong>ein</strong>gegangen werden müssen (Verfügbarkeit,<br />
geeignete Verarbeitungsbetriebe o.ä.), existiert <strong>ein</strong>e transparente stichhaltige Begründung im Sinne<br />
der Nachhaltigkeit.<br />
3
Positionspapier Glaubwürdige Regionalvermarktung<br />
5. Nachhaltigkeit durch ökologische, ökonomische und soziale <strong>Kriterien</strong><br />
Ökologische <strong>Kriterien</strong>:<br />
� Kurze Transportwege vom Erzeuger über den Verarbeiter/Handwerk zum Verbraucher<br />
� Klima- und umweltschonende Erzeugung und Verarbeitung<br />
� Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft und damit Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
� Die Produkte stammen<br />
� entweder aus konventioneller Landwirtschaft mit zusätzlichen Richtlinien<br />
über den gesetzlichen Standards<br />
� oder aus ökologischem Landbau („Bio-Produkte“)<br />
Ökonomische <strong>Kriterien</strong>:<br />
� Faire Erzeugerpreise<br />
� Faire Preise <strong>für</strong> die Verarbeitung<br />
� Faire Ladenpreise<br />
� Förderung und Erhalt <strong>von</strong> regionalen Wirtschaftskreisläufen durch Einbeziehung<br />
kl<strong>ein</strong>er und mittelständischer Unternehmen und damit Erhöhung der Wertschöpfung<br />
in der Region<br />
Soziale <strong>Kriterien</strong>:<br />
� Erhalt und Schaffung <strong>von</strong> Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Region<br />
� Förderung des bürgerschaftlichen Engagements<br />
� Erhalt der Lebensgrundlagen <strong>für</strong> Menschen, Tiere und Pflanze<br />
� Förderung des Gesundheitsgedankens durch qualitativ hochwertige Produkte<br />
6. Wirtschaften im „Dualen Modell“<br />
� Regionalvermarktungsinitiativen arbeiten im „Dualen Modell“<br />
Definition Duales Modell:<br />
Regionale Netzwerke <strong>von</strong> Erzeugern, Verarbeitern, Handwerkern, Händlern und Verbrauchern<br />
bilden strategische Allianzen und generieren regionale Wertschöpfung innerhalb<br />
regionaler Wirtschaftskreisläufe zum gegenseitigen Nutzen aller Beteiligten.<br />
Ideelle und wirtschaftliche Gruppierungen arbeiten in der Allianz eng zusammen, um<br />
die Öffentlichkeit <strong>für</strong> die Unterstützung <strong>ein</strong>er nachhaltigen Regionalentwicklung zu<br />
gewinnen. Die ideellen Gruppierungen sind Ausdruck <strong>ein</strong>es bürgerschaftlichen Engagements<br />
im Sinne des Zieles zur Erhaltung der Lebensgrundlagen in der jeweiligen<br />
Region.<br />
Bundesverband der Regionalbewegung e. V.<br />
25. November 2011<br />
4
12.6 Schreiben BRB vom 16.12.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Bundesverband der Regionalbewegung e. V.<br />
Geschäftsstelle . Museumstraße 1 . 91555 Feuchtwangen<br />
FiBL und MGH<br />
Herrn Axel Wirz<br />
Herrn Peter Klingmann<br />
Postfach 900163<br />
60441 Frankfurt am Main<br />
Feuchtwangen, 16. Dezember 2011<br />
BUNDESVERBAND DER<br />
REGIONALBEWEGUNG E. V.<br />
www.regionalbewegung.de<br />
Geschäftsstelle:<br />
Museumstraße 1<br />
91555 Feuchtwangen<br />
Tel. 09852-13 81<br />
Fax 09852-61 52 91<br />
E-Mail:<br />
info@regionalbewegung.de<br />
Angebot zur Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Regionalbewegung<br />
im Rahmen des Projektes „<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel“<br />
Sehr geehrter Herr Wirz, sehr geehrter Herr Klingmann,<br />
wir nehmen Bezug auf das Projekt „<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel“,<br />
zu dessen Durchführung Sie den Zuschlag vom Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz erhalten haben.<br />
Im Rahmen <strong>ein</strong>es ersten Treffens der Marketinggesellschaft Hessen (MGH), des Forschungsinstitutes<br />
Biologischer Landbau (FiBL) mit dem Bundesverband der Regionalbewegung<br />
(BRB) am 10. November 2011 in Feuchtwangen konnten wir zunächst die Position<br />
des BRB zu den Inhalten der Ausschreibung sowie die Zielsetzungen der Regionalbewegung<br />
darlegen. Weiterhin wurde der BRB über die Vorgehensweise im Projekt informiert.<br />
Anschließend wurden <strong>von</strong> Seiten der MGH und des FiBL Vorschläge zur Einbeziehung des<br />
BRB unterbreitet (siehe Protokoll vom 10.11.11). Der BRB hat sich dazu bereit erklärt, im<br />
Beirat mitzuarbeiten sowie <strong>ein</strong>e Befragung der Regionalinitiativen als Expertenm<strong>ein</strong>ung<br />
zu den entwickelten Szenarien, gegen <strong>ein</strong>e finanzielle Aufwandsentschädigung, durchzuführen.<br />
Im Rahmen der Beiratssitzung am 9. Dezember 2011 in Fulda wurden die mit dem<br />
<strong>BMELV</strong> ausgewählten Szenarien vorgestellt. Dabei konnte festgestellt werden, dass das<br />
Szenario 1 „Anerkennung“ am ehesten den Vorstellungen <strong>ein</strong>er Initiativenzertifizierung<br />
des BRB entspricht. Das Modell der Initiativenzertifizierung wurde vom BRB in Zusam-<br />
Bankverbindung: Sparkasse Ansbach – BLZ 76550000 – Konto 8057549<br />
VR Bank Dinkelsbühl - BLZ 765 910 00 – Konto 251909<br />
Steuernummer 203-108-20858 Seite 1/2
menarbeit mit den Regionalvermarktungsinitiativen in Deutschland entwickelt. Jedoch<br />
wurde klar, dass die Ausarbeitung (Schaubild) des FiBL und der MGH nicht schlüssig ist<br />
und <strong>ein</strong>er intensiven Überarbeitung bedarf. Weiterhin wurde die – aus Sicht des BRB <strong>für</strong><br />
<strong>ein</strong>e saubere Potenzialanalyse äußerst notwendige – Initiativenbefragung zu den Szenarien<br />
gestrichen.<br />
Im Anschluss an die Beiratssitzung wurden dem BRB <strong>von</strong> Seiten des FiBL und der MGH<br />
folgende Anliegen herangetragen: Zum <strong>ein</strong>en sollte die in der Präsentation dargestellte<br />
Positionierung des BRB inhaltlich modifiziert werden, zum anderen sollte das Szenario<br />
„Anerkennung“ konkretisiert sowie Möglichkeiten der <strong>Entwicklung</strong> des Modellvorhabens<br />
ausgelotet werden. Erster Punkt kann mit Hilfe des am 25. November 2011 beschlossenen<br />
Positionspapiers des BRB zur „Glaubwürdigen Regionalvermarktung“ korrigiert bzw.<br />
ergänzt werden.<br />
In Anbetracht der komplexen Aufgabenstellung des Gesamtprojektes, das vor dem Hintergrund<br />
der äußerst heterogenen Arbeitsweisen der Regionalvermarktungsinitiativen in<br />
Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt aus Sicht des BRB k<strong>ein</strong>e validen Entscheidungsgrundlagen<br />
im Hause des <strong>BMELV</strong> präsentieren kann, möchten wir folgendes Angebot unterbreiten:<br />
Der BRB ist grundsätzlich gerne bereit zu kooperieren und mit s<strong>ein</strong>em Wissen und s<strong>ein</strong>en<br />
Erfahrungen zur Seite zu stehen und entsprechende Zuarbeit zu leisten. Jedoch achtet<br />
der BRB auch darauf, was zeitlich mit den vorhandenen Ressourcen realisierbar und auf<br />
seriöse, fundierte Art und Weise machbar ist. Unter Berücksichtigung der äußerst knappen<br />
Restlaufzeit des Projektes sowie der personellen Ressourcen des BRB, möchten wir<br />
das FiBL und die MGH als Bietergem<strong>ein</strong>schaft bitten, gegenüber dem <strong>BMELV</strong> <strong>ein</strong> angemessenes<br />
Budget <strong>für</strong> den BRB als Unterauftragnehmer zu akquirieren. Die Vorstellungen<br />
liegen hier bei rund 18.000,- EUR. Darin enthalten wären sowohl die inhaltliche und optische<br />
Ausarbeitung des Szenarios 1 „Anerkennung“ sowie die Formulierung zur Umsetzung<br />
des Szenarios 1 im Rahmen <strong>ein</strong>es Modellvorhabens.<br />
Ausdrücklich möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass diese Zuarbeit sehr aufwändig<br />
und intensiv recherchierte Ergebnisse des BRB b<strong>ein</strong>haltet und der finanzielle Rahmen<br />
dem Anforderungsprofil <strong>ein</strong>er seriösen Arbeit entspricht.<br />
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in der restlichen Projektlaufzeit gem<strong>ein</strong>sam Anstrengungen<br />
unternehmen, die erfolgsversprechend und mit <strong>ein</strong>er hohen Akzeptanz der<br />
Partner in den Regionen im anschließenden Modellvorhaben umgesetzt werden können.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
H<strong>ein</strong>er Sindel<br />
1. Vorsitzender<br />
Bankverbindung: Sparkasse Ansbach – BLZ 76550000 – Konto 8057549<br />
VR Bank Dinkelsbühl - BLZ 765 910 00 – Konto 251909<br />
Steuernummer 203-108-20858 Seite 2/2
12.7 Gesprächsnotiz BVL vom 18.11.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Gesprächsnotiz<br />
Am Treffen haben teilgenommen:<br />
C. Mieles<br />
(BVL)<br />
K. Voß<br />
(EDEKA Zentrale, HH)<br />
J. Müller<br />
(REWE, BVL)<br />
P. Klingmann<br />
MGH<br />
R. Mäder<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
A. Wirz<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
1. Arbeitstreffen Regionalsiegel – BVL am 18.11.2011<br />
11:00 bis 14:30 im Ökohaus, Frankfurt a. M.<br />
S. Rauschen<br />
(Kaufland)<br />
D. Reimerdes<br />
(Coop e.G.)<br />
A. Swoboda<br />
(tegut…)<br />
F. Wörner<br />
(Bio mit Gesicht GmbH)<br />
M. Kuske<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
Moderation: Axel Wirz; Protokoll: Monja Kuske<br />
1 Begrüßung, Vorstellungsrunde<br />
1.1 Beweggründe des BVL<br />
F. Thiedig<br />
(EDEKA Minden)<br />
A. Weydringer<br />
(EDEKA NB-S-T)<br />
W.Schäfer<br />
MGH<br />
R. Hermanowski<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
H. Hansen<br />
(FiBL Projekte GmbH)<br />
Das Thema „Regionalsiegel“ tauchte im Rahmen des letzten Treffens zum Thema<br />
Qualitätspolitik auf. Es herrscht handelsseitig <strong>ein</strong> erheblicher Diskussionsbedarf. Der BVL bietet<br />
an, die Erfahrungen und Vorstellungen des Handels <strong>ein</strong>zubringen, um abzuklären, was in der<br />
Praxis aus Handelssicht als möglich ersch<strong>ein</strong>t.<br />
1.2 Vorstellung MGH und FiBL<br />
Marketing Gesellschaft Gutes aus Hessen mbH und FiBL Deutschland (Forschungsinstitut <strong>für</strong><br />
Biologischen Landbau). Die MGH spricht <strong>für</strong> die Marketinggesellschaft Baden Württemberg,<br />
Marketinggesellschaft Niedersachsen sowie <strong>für</strong> Schleswig Holst<strong>ein</strong> und Bayern. Projektpartner<br />
sind weiter Tegut, Feneberg, Edeka Südwest, Bio mit Gesicht, BÖLW, Bioland, Demeter und<br />
Naturland.<br />
Die Bietergem<strong>ein</strong>schaft wird mit allen Stakeholdern im Themenfeld Regionalität sprechen, d.h.<br />
Einzelhandel, Fachhandel, handwerkliche Verarbeitungsbetriebe, Regionalinitiativen. Alle<br />
Facetten der bestehenden Auslobungen werden erhoben: <strong>Kriterien</strong> der Regionalität aus Sicht<br />
der Verbraucher (Studien), Initiativen, Länderzeichen und Handelsmarken,. Daraus werden bis<br />
5. Dezember 3-4 Szenarien entwickelt, die die gesamte Bandbreite der verschiedenen<br />
Vorstellungen der Stakeholder widerspiegeln. Als Gutachter wird die Bietergem<strong>ein</strong>schaft<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 1
Präferenzen angeben, woraus nach Rücksprache mit dem Ministerium 1-2 Szenarien<br />
weiterentwickelt werden.<br />
Sondergutachten der wissenschaftlichen Beiräte des <strong>BMELV</strong> (Politstrategie Foodlabelling,<br />
September 2011). Das Gutachten hat laut <strong>BMELV</strong> k<strong>ein</strong>e Bindung <strong>für</strong> den laufenden Auftrag,<br />
daher <strong>für</strong> den Auftragsnehmer volle Denkfreiheit. Weder Verordnung noch Gesetz sind aus<br />
Sicht des Ministeriums geplant, daher der Wunsch die Kennzeichnung auch <strong>für</strong> die Wirtschaft<br />
attraktiv zu gestalten, bzw. Empfehlungen der Wirtschaft <strong>ein</strong>zuarbeiten.<br />
2 Vorgehensweise<br />
Die Analyse der Daten und die <strong>Entwicklung</strong> der Szenarien verlaufen parallel (Stichwort<br />
Tunnelbau). Ziel: bestmöglicher Kompromiss zwischen Verbrauchererwartung und<br />
Praktikabilität.<br />
2.1 Aktueller Stand<br />
Derzeit vorstellbare Szenarien:<br />
0. K<strong>ein</strong> Handlungsbedarf (ergänzt, aus der Diskussion erfolgt)<br />
1. Akkreditierung und ggf. Zertifizierung: Schaffung <strong>von</strong> Mindestkriterien, auf die sich die<br />
Unternehmen stützen können,<br />
2. Zeichen/Siegel mit <strong>ein</strong>heitlichen <strong>Kriterien</strong>: Träger erfüllt gewisse <strong>Kriterien</strong> – Siegel <strong>für</strong><br />
Regel<strong>ein</strong>haltung<br />
3. Herkunftsnachweis: z. B. über Zutatenverzeichnis . Vorne Werbung, hinten Informationen.<br />
4. Ausschöpfung bereits bestehender Möglichkeiten (ergänzt, aus der Diskussion erfolgt)<br />
2.2 Diskussion<br />
Zu 0.: K<strong>ein</strong> Handlungsbedarf (nichts tun)<br />
Zu 1.: Für <strong>ein</strong>zelne Handelsvertreter denkbar aber kompliziert und es müsste auf die Kosten<br />
geachtet werden, Festsetzung <strong>ein</strong>heitlicher <strong>Kriterien</strong> schwierig. Eine Kombination aus 1. und<br />
3. wäre <strong>für</strong> <strong>ein</strong>zelne Vertreter denkbar, Art Rahmen feststecken (Vergabekriterien).<br />
Zu 2.: Es besteht Einigkeit darüber, dass k<strong>ein</strong> weiteres Zeichen/Siegel gewünscht ist.<br />
Normativer Ansatz ist nicht das Ziel.<br />
Zu 3.: Über dieses Szenario wurde ohne konkrete Festlegung ausgiebig gesprochen. Es liefert<br />
sowohl Ansätze <strong>für</strong> mehr Transparenz / Authentizität als auch Seriosität, ersch<strong>ein</strong>t <strong>für</strong><br />
<strong>ein</strong>zelne Handelsvertreter umsetzbar und flexibel. Widersprüche (durch Koppelung mit<br />
Qualität) werden vermieden. Ermöglicht dem Verbraucher, s<strong>ein</strong>en Regionalitätsanspruch<br />
durch s<strong>ein</strong>e Kaufentscheidung frei zu leben.<br />
Zu 4.: Möglich, zudem könnte auch hier auf mehr Transparenz gesetzt werden. So könnten<br />
die vielen individuellen Systeme bestehen bleiben, würden sich jedoch um mehr Transparenz<br />
bemühen, so dass der mündige Verbraucher selbst entscheiden kann, ob er ihnen s<strong>ein</strong><br />
Vertrauen schenkt.<br />
Die nachfolgende Übersicht enthält Einzelaspekte aus der Gesamtdiskussion (2.2 – 0. – 4.):<br />
Vorbehalte Fürsprache<br />
Geringe Massenkompatibilität, mögliche Zielgruppe sind nicht alle Verbraucher, sondern<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2
Verbraucherüberforderung, geringe<br />
Mehrpreisbereitschaft<br />
Gefahr, die kl<strong>ein</strong>en Lieferanten/Produzenten zu<br />
verlieren (Kosten).<br />
Selbstbelastung durch Offenheit? („20% aus<br />
Polen…“)<br />
Worträume (z. B. Region, Heimat, <strong>von</strong> hier etc.)<br />
können nicht definiert werden, solche<br />
Regionalitätsaussagen müssen auch in Verbindung<br />
mit dem POS gesehen werden.<br />
Die Festlegung übergreifender <strong>Kriterien</strong> ersch<strong>ein</strong>t<br />
kaum geeignet, den vielen regionalen Initiativen und<br />
Projekten gerecht zu werden.<br />
Widersprüche zwischen werblichen Aussagen und<br />
Produktinformationen (vorne, hinten) möglich.<br />
Herkunft der Rohstoffe (z. B. Konfitüre) oder letzte<br />
Verarbeitung (z. B. Kaffeeröstung)<br />
ausschlaggebend? Dies kann nur produktspezifisch<br />
beantwortet werden. Einheitliche Vorgehensweise<br />
nicht möglich.<br />
Gibt es hier <strong>ein</strong>e klare Verbrauchererwartung?<br />
3 Weiteres Vorgehen<br />
Ein weiterer Termin wird ver<strong>ein</strong>bart, um nach der Vorstellung der Szenarien beim <strong>BMELV</strong> das<br />
weitere Vorgehen zu besprechen. Zeitspanne: Zwischen 06.12. und 15.12.<br />
Frankfurt, den 18.11.2011<br />
Axel Wirz<br />
diejenigen mit <strong>ein</strong>er Affinität <strong>für</strong> regionale Produkte.<br />
Für diese sollen Produkte attraktiv gehalten werden<br />
Die Kennzeichnung ist freiwillig und notwendig <strong>für</strong><br />
die Kommunikation; Spielregeln <strong>für</strong> Transparenz,<br />
Werte schaffen<br />
Unterscheidung Werbung – Deklaration: k<strong>ein</strong>e<br />
Einmischung ins Marketing (es geht weder um <strong>ein</strong><br />
Marketingprojekt noch um Verbraucherschutz) –<br />
Deklarationsfeld: Fakten<br />
Facettenreichtum/Individualität <strong>von</strong> Philosophien<br />
bleibt erhalten; evtl. Leitlinien <strong>für</strong> Werbung? (ggf.<br />
durch Marktlogik geregelt)<br />
Einbezug <strong>von</strong> Qualitätskriterien kaum durchführbar<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 3
12.8 Gesprächsnotiz BVL vom 15.12.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Gesprächsnotiz<br />
Am Treffen haben teilgenommen:<br />
C. Mieles<br />
(BVL)<br />
K. Voß<br />
(EDEKA Zentrale, HH)<br />
P. Klingmann<br />
MGH<br />
2. Arbeitstreffen Regionalsiegel – BVL am 15.12.2011<br />
15:30 bis 17:00 Uhr im Intercity Hotel, Göttingen<br />
S.Warth (telefonisch<br />
zugeschaltet) (Kaufland )<br />
D. Reimerdes<br />
(Coop e.G.)<br />
M. Kuske<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
Moderation: Axel Wirz; Protokoll: Monja Kuske<br />
1 Begrüßung<br />
2 Präsentation Zwischenbericht<br />
Dr. F. Thiedig<br />
(EDEKA Minden)<br />
J. Müller<br />
( BVL, REWE)<br />
A. Wirz<br />
(FiBL Deutschland e.V.)<br />
Vorlage <strong>für</strong> die heutige Präsentation war das Handout der Beiratssitzung vom 09.12.2011 sowie<br />
die gewünschten Änderungen (Beschreibung <strong>ein</strong>es Szenarios „Status Quo“ und Erfassung der<br />
Position des Handwerks und der Lebensmittelerzeugung), soweit möglich in der Kürze der Zeit.<br />
Eine gesetzliche Regelung ist ausgeschlossen, <strong>ein</strong> eigenständiges Siegel nicht gewünscht. Das<br />
Ministerium hat die Bietergem<strong>ein</strong>schaft mit der weiteren Ausarbeitung der Szenarien<br />
„Anerkennung“ und „Deklaration/Regionalfenster“ beauftragt.<br />
2.1 Szenarien<br />
0. „Status Quo“: Bessere Koordination und Ausschöpfung der bestehenden Möglichkeiten 1<br />
1. „Anerkennung“: Schaffung <strong>von</strong> Mindestkriterien, um bestehende Systeme zu akkreditieren<br />
2. „Siegel“: Träger erfüllen <strong>ein</strong>heitliche <strong>Kriterien</strong>, kann auch all<strong>ein</strong>e stehen<br />
3. „Regionalfenster“: Deklaration – Aussagen über die Herkunft – angelehnt an das<br />
Zutatenverzeichnis<br />
1<br />
Dieses Szenario wurde im <strong>BMELV</strong> nicht präsentiert, ist dem Ministerium seit der Beiratssitzung am<br />
09.12.2011 aber bekannt<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 1
2.2 Rückfragen/Ergänzungen bei den Charts<br />
Externe Kontrollen wurden beim 1. Arbeitstreffen (Vorstellung erster Ansätze) nicht besprochen,<br />
deren Notwendigkeit ergab sich seitdem in der Ausarbeitung der Szenarien.<br />
Auf Wunsch des BVL soll bei der Beschreibung der Position des Handels „Seriösität“ durch<br />
„Information zum Verbraucher“ ersetzt werden.<br />
Stabile Isotopenanalyse: Risiko, unhaltbare Versprechungen zu machen und damit <strong>für</strong> noch<br />
mehr Verwirrung zu sorgen >> FiBL und MGH stellen Möglichkeiten der Überprüfung dar.<br />
Bessere Formulierung wäre: „Prozesskontrolle, ggf. mit Unterstützung <strong>von</strong> „Wasserzeichen“<br />
(stabile Isotopenanalyse)“. Umsetzung müsste im Rahmen <strong>ein</strong>es Modellvorhabens geklärt<br />
werden.<br />
2.3 Diskussion<br />
<strong>Kriterien</strong> „Anerkennung Modell 1“ treffen bereits zu. Allerdings derzeit ohne Dach/Anerkennung.<br />
Unklarheit herrscht unter den Handelsvertretern über die Definition „Dachmarke“, sprich was<br />
sich letzten Endes genau dahinter verbergen soll.<br />
Handelsseitig besteht die Frage, ob zu den bestehenden handelsseitigen Kontrollverfahren<br />
noch zusätzliche externe Kontrollen notwendig sind. Es besteht die Be<strong>für</strong>chtung, dass doch<br />
wieder <strong>ein</strong> weiteres Zeichen kommt und dass der Mehraufwand durch weitere Kontrollen bzw.<br />
die Bürokratisierung des Systems kl<strong>ein</strong>e Verarbeiter schädigen und damit „Regionalität kaputt<br />
machen“ könnte. Hersteller seien zu wenig berücksichtigt, und auf deren Möglichkeiten, <strong>ein</strong><br />
System umzusetzen, sei der Handel in erster Linie angewiesen. Daher wurde angeregt,<br />
grundsätzlich auch noch <strong>ein</strong>mal auf politischer Ebene zu hinterfragen, ob das Szenario 0<br />
„Ausschöpfen bestehender Möglichkeiten“ (im Protokoll vom 18.11. Szenario 4) nicht <strong>ein</strong>e<br />
Alternative zu den anderen Szenarien mit erheblichen Kontroll- und Kostenaufwand wäre.<br />
Denkbar wäre auch <strong>ein</strong>e Transparenzinitiative anzustoßen, zu der sich ganze Branchen<br />
bekennen könnten. Das sei möglicherweise das Mittel der Wahl, effektiv und effizient mögliche<br />
Transparenzprobleme zu lösen.<br />
Wenn das System freiwillig ist, ist vor allem <strong>ein</strong>e breite Akzeptanz notwendig. Da<strong>für</strong> wäre vor<br />
allem die Nutzung bestehender Systeme (z. B. Länderzeichen) sinnvoll. Die Beschreibung<br />
dieses Szenarios wird mit Herrn Thiedig noch detaillierter ausgearbeitet.<br />
Für die Modelle “Anerkennung 2 + 3“ sieht der Handel k<strong>ein</strong>e große Akzeptanz auf der<br />
Handelsebene. Zum Ausdruck wurde gegeben, dass der Verarbeitungsort <strong>für</strong> die anwesenden<br />
Handelsunternehmen das wichtigste Kriterium ist und weniger die klare Auslobung der<br />
Rohstoffherkunft.<br />
Mit Blick auf das Regionalfenster wurde angemerkt, dass auch hier trotz der verhältnismäßig<br />
etwas geringer ersch<strong>ein</strong>enden Belastung kl<strong>ein</strong>er Hersteller in Bezug auf Kontrollaufgaben, die<br />
Ressourcen auf Lieferantenseite überschätzt werden könnten.<br />
3 Weiteres Vorgehen<br />
Bis 05.01.2012 Befragung verschiedener Vertreter der Hersteller/Industrie.<br />
16. 01.2012 Präsentation des Gutachtens im <strong>BMELV</strong> (Bonn).<br />
26.01.2011 Präsentation im Rahmen der Grünen Woche/Zukunftsforum ländliche <strong>Entwicklung</strong>.<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2
Frankfurt, den 15.12.2011<br />
Axel Wirz<br />
Regionalsiegel: Arbeitstreffen BVL<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 3
12.9 Positionspapier BVL vom 10.01.2012<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
12.10 Protokoll AMK vom 28.10.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
12.11 Positionspapier VZ<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
30. November 2010<br />
Verbrauchergerechte Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen<br />
Lebensmitteln<br />
Positionspapier des Verbraucherzentrale Bundesverbandes und der<br />
Verbraucherzentralen<br />
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – vzbv<br />
Markgrafenstr. 66<br />
10969 Berlin<br />
info@vzbv.de<br />
www.vzbv.de
vzbv Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln 30.11.2010<br />
Laut aktuellen Marktforschungsergebnissen bevorzugen Verbraucher zunehmend<br />
regionale Produkte (Dorandt 2005; Nestlé/Allensbach 2009). Nach der 2010<br />
veröffentlichten Befragung des Forsa-Institutes im Auftrag des Bundesministeriums <strong>für</strong><br />
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (<strong>BMELV</strong>) achten inzwischen 65<br />
Prozent beim Kauf ihrer Lebensmittel immer oder meistens auf die regionale Herkunft,<br />
wobei mit „regionaler Herkunft“ nicht nur der Ort oder die Region der Verarbeitung<br />
und/oder Herstellung gem<strong>ein</strong>t ist, sondern auch die Herkunft der Rohstoffe. Häufig<br />
besteht auch die Erwartung, dass regionale Erzeugnisse zusätzliche Produktqualitäten<br />
wie „mehr Frische“, „ohne Gentechnik“, „Ökoqualität“ oder „artgerechte Tierhaltung“<br />
gewährleisten sollen.<br />
Verbraucher werden derzeit in vielfältiger Weise mit regionalen Herkunfts- und<br />
Qualitätsangaben umworben und sollen <strong>für</strong> diese Produkte zudem häufig mehr<br />
bezahlen. Daher müssen Regionalangaben korrekt und wahr s<strong>ein</strong>. Sie sind derzeit<br />
jedoch rechtlich nur ungenügend geregelt, und es bestehen vielfältige Möglichkeiten<br />
der Verbrauchertäuschung. Die regionale Herkunft und beworbene Qualitäten sind<br />
sogenannte Vertrauenseigenschaften, deren Wahrheitsgehalt Verbraucher weder am<br />
Lebensmittel noch im Handel oder über andere Informationsquellen selbst überprüfen<br />
können.<br />
1. Regionalkennzeichnung kann irreführen<br />
In <strong>ein</strong>er Piloterhebung hatte die Verbraucherzentrale Hessen 2009 im Rh<strong>ein</strong>-Main-<br />
Gebiet verteilte Hauswurfsendungen und Zeitungsbeilagen im Hinblick auf<br />
Regionalwerbung gesichtet. Es wurden insgesamt 17 Flyer <strong>von</strong> sechs<br />
Handelsunternehmen 1 mit Werbung <strong>für</strong> insgesamt 318 angebliche Regionalprodukte<br />
herangezogen. In der Bewertung zeigten sich die Facetten der Irreführung, die sich<br />
auch auf andere Regionen übertragen lassen:<br />
� Bei 14 Flyern fehlte jeder räumliche und geographische Bezug. Für die<br />
Verbraucher wird in den meisten Fällen nicht klar, auf welche Region sich die<br />
Regionalwerbung bezieht.<br />
� Drei Werbeflyer (alle Rewe) warben mit ganzen Seiten „Obst und Gemüse aus<br />
Hessen“. Hierbei wurde <strong>ein</strong> räumlich begrenzter Regionalbezug hergestellt. Auf<br />
Nachfrage bei Rewe, stellte sich jedoch heraus, dass <strong>ein</strong> Teil der beworbenen<br />
Produkte in angrenzenden Bundesländern erzeugt wurde 2 . Das deutet auf <strong>ein</strong><br />
fehlendes unabhängiges Kontrollsystem <strong>für</strong> den Herkunftsnachweis bei Rewe hin.<br />
� Nur <strong>ein</strong> „regional“ beworbenes Produkt war mit <strong>ein</strong>em Herkunftssiegel, dem<br />
Länderzeichen „Geprüfte Qualität - Hessen“ gekennzeichnet, das die regionale<br />
Herkunft durch neutrale Prüfinstitute und Sachverständige regelt (siehe auch.<br />
Abschnitt 2 Länderzeichen).<br />
� 21 Produkte waren mit <strong>ein</strong>er Produktbezeichnung versehen, die <strong>ein</strong>en Orts- oder<br />
Regionalbezug nennt, unter anderem Selters Mineralwasser, Sylter Salatfrische,<br />
Wetterauer-Gold-Apfelw<strong>ein</strong>, Rhöner Fruchtw<strong>ein</strong>, Elsässer Flammkuchen, Pfälzer<br />
Saumagen. Bei diesen Bezeichnungen können Verbraucher meist nur vermuten,<br />
ob es sich um örtlich bezogene Herstellungs- oder Herkunftsangaben oder um<br />
besondere Zubereitungsverfahren beziehungsweise Rezepturen handelt.<br />
1 Es wurden Hauswurfsendungen und Zeitungsbeilagen der Handelsunternehmen Rewe, Real, toom,<br />
tegut, Edeka und Plus mit Outlets in Frankfurt und in den umgebenden Gem<strong>ein</strong>den vom Jan. 2009 bis<br />
Dez. 2009 ausgewertet.<br />
2 Persönliche Mitteilung der Rewe vom 23.7.2009<br />
2
vzbv Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln 30.11.2010<br />
� Weiterhin wurden Firmennamen und Markenbezeichnungen wie Weihenstephaner<br />
(Milch), Rhöngut (Schinken), Berchtesgadener Land (Milch) und Hochstädter<br />
(Apfelw<strong>ein</strong>) gefunden, die <strong>ein</strong>en Orts- oder Regionsbezug herstellen. Auch bei<br />
diesen Produkten liefert die Bezeichnung kaum <strong>ein</strong>e Orientierung, ob sie sich auf<br />
den Verarbeitungsort oder die Herkunft der Rohstoffe oder auf beides bezieht.<br />
Bis auf <strong>ein</strong>e Ausnahme konnte man bei 318 regional gekennzeichneten<br />
beziehungsweise. beworbenen Lebensmitteln nicht erkennen, ob die Lebensmittel<br />
oder. deren Zutaten aus der ausgelobten Region stammen oder ob beispielsweise nur<br />
die Verarbeitung regional erfolgte.<br />
2. Länderzeichen: Regionale Herkunfts- und Qualitätszeichen<br />
Einige Bundesländer haben eigene Länderzeichen als <strong>ein</strong>getragene Marken entwickelt,<br />
die besondere Anforderungen an Herkunft und Qualität der gekennzeichneten<br />
Lebensmittel stellen. Die Verbraucherzentralen gaben 2009 <strong>ein</strong>e<br />
Transparenzuntersuchung über diese öffentlich mitfinanzierten Landesprogramme in<br />
Auftrag. Die Ergebnisse zeigen, dass die regionale Herkunft dieser Produkte nicht<br />
durchgängig sichergestellt ist, als Qualitätszeichen sind sie wenig ambitioniert und die<br />
Vorschriften <strong>für</strong> die Zeichennutzung sind vage und wenig transparent. Beispielsweise<br />
sind die Vorgaben <strong>für</strong> verarbeitete Regionalprodukte sehr unterschiedlich. So verlangt<br />
„Geprüfte Qualität Thüringen“ nur <strong>ein</strong>en Anteil <strong>von</strong> 50,1 Prozent der Zutaten aus<br />
regionaler Herkunft, während Fleischerzeugnisse „Gesicherte Qualität Baden<br />
Württemberg“ zu 100 Prozent aus dem Bundesland stammen müssen (Zühlsdorf,<br />
Franz 2010). Zu bemängeln ist, dass die Anforderungen an die Produktqualität nur<br />
selten über die gesetzlichen Standards beziehungsweise Marktstandards hinausgehen.<br />
Auch die Kontrollen und Sanktionen der regionalen Herkunftsangaben der<br />
Länderzeichen sind sehr unterschiedlich geregelt. Den Anforderungen <strong>ein</strong>er<br />
unabhängigen Kontrolle werden sie häufig nicht gerecht. Eine Bewertung der<br />
Wirksamkeit der Kontrollsysteme ist kaum möglich und die Dokumentation der<br />
Kontrolle unübersichtlich und wenig transparent.<br />
Die Länderzeichen nutzen zudem meist die jeweiligen Landesfarben und –zeichen, um<br />
sich <strong>ein</strong>en amtlichen Charakter zu geben. Dadurch werden die<br />
Verbrauchererwartungen hinsichtlich Herkunft und Qualität noch zusätzlich erhöht.<br />
3. Abmahnungen und Gerichtsverfahren<br />
Marke „Mark Brandenburg“<br />
Ende 2007 wurde die Campina GmbH & Co. KG <strong>von</strong> der Verbraucherzentrale Berlin<br />
wegen irreführender Werbung abgemahnt. Das Unternehmen hatte unter der<br />
Bezeichnung „Mark Brandenburg“ in Berlin und den neuen Bundesländern Milch<br />
vertrieben. Diese stammte jedoch aus Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen und wurde in Köln<br />
abgefüllt. Die Campina GmbH & CO. KG verpflichtete sich außergerichtlich dazu, k<strong>ein</strong>e<br />
Molkereiprodukte mit der Bezeichnung „Mark Brandenburg“ zu verkaufen, wenn sie<br />
nicht aus der genannten Region stammen.<br />
Speisequark „frisch aus unserer Region“ und „Faire Milch“<br />
Edeka-Südwest bot unter s<strong>ein</strong>er Marke "Gut & Günstig" unter anderem in Stuttgart und<br />
Konstanz Speisequark mit dem Hinweis "Frisch aus unserer Region" an. Hersteller<br />
waren die Hochwald-Nahrungsmittelwerke in Saarbrücken (Saarland). Diese Werbung<br />
wurde <strong>von</strong> der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg abgemahnt. Das Landgericht<br />
3
vzbv Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln 30.11.2010<br />
Offenburg stellte mit der Entscheidung vom 26.März.2008 3 fest, dass es sich um <strong>ein</strong>e<br />
irreführende Werbung im Sinne des § 5 UWG handelt und verurteilte Edeka zur<br />
Unterlassung. Das Gericht stellte klar, dass bei der Definition <strong>von</strong> „Region“ die<br />
Auffassung der Verbraucher und nicht die der Unternehmen zugrunde zu legen ist. Es<br />
urteilte, dass die Bezeichnung "Frisch aus unserer Region" nicht vom Unternehmen auf<br />
dessen Absatzgebiet und damit auf den gesamten südwestdeutschen Raum bezogen<br />
werden darf. Zudem stellte das Gericht fest, dass das Produkt vor allem deshalb als<br />
"frisch" beworben werden darf, wenn es über kurze Wege transportiert wird.<br />
Auch die Werbung <strong>für</strong> die „Faire Milch“ der Milchverwertungsgesellschaft MVS wurde<br />
<strong>von</strong> der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg abgemahnt. Kritisiert wurde die<br />
Angabe, die Milch stamme „aus Ihrer“ Region“ und „die heimische Produktion spart<br />
unnötige Transportwege“. Eine solche Kennzeichnung und Bewerbung ist nicht<br />
zulässig, wenn diese Milch in Stuttgart angeboten wird, die Milch jedoch im Allgäu<br />
erzeugt und im hessischen Schlüchtern verarbeitet wurde. Das Unternehmen hat <strong>ein</strong>e<br />
Unterlassungserklärung abgegeben.<br />
Diese rechtlichen Aus<strong>ein</strong>andersetzungen machen deutlich, dass <strong>ein</strong>e gesetzlich<br />
verbindliche Definition <strong>für</strong> Regionalangaben notwendig ist.<br />
4. Bestehende EU-Regelungen zur Herkunftskennzeichnung<br />
Eine verpflichtende nationale Herkunftsangabe bei Lebensmitteln wird derzeit auf<br />
europäischer Ebene im Rahmen der Überarbeitung des allgem<strong>ein</strong>en<br />
Lebensmittelkennzeichnungsrechts (EG-Verordnungsvorschlag zur<br />
Lebensmittelinformation) diskutiert. In <strong>ein</strong>igen Bereichen wie beispielsweise bei<br />
Rindfleisch, Eiern und den meisten Obst- und Gemüsearten ist sie bisher schon<br />
obligatorisch.<br />
Bei der kl<strong>ein</strong>räumigeren, regionalen Herkunftskennzeichnung gibt es zurzeit erst<br />
wenige Regelungsansätze 4 .<br />
Die geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) setzt voraus, dass<br />
entsprechende Lebensmittel in <strong>ein</strong>em abgegrenzten geographischen<br />
Gebiet erzeugt, verarbeitet und hergestellt wurden. Die<br />
Verkehrsbezeichnung derart geschützter Produkte weist auf den<br />
Herkunftsort hin und bietet Verbraucher <strong>ein</strong>e sichere Orientierung.<br />
Beispiele <strong>für</strong> Produkte mit g. U. sind Allgäuer Emmentaler, Altenburger<br />
Ziegenkäse oder etwa Feta.<br />
Die geschützte geographische Angabe (g. g. A.) gewährleistet <strong>ein</strong>e<br />
Verbindung zwischen mindestens <strong>ein</strong>er der Produktionsstufen – der<br />
Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung - und dem Herkunftsgebiet.<br />
So findet zum Beispiel beim Schwarzwälder Schinken nur die<br />
Herstellung (Würzen, Pökeln, Räuchern) im Schwarzwald statt. Die<br />
Schw<strong>ein</strong>ehaltung und Schlachtung können dagegen in anderen<br />
Regionen stattfinden.<br />
Die garantiert traditionelle Spezialität (g. t. S.) bezieht sich nicht auf<br />
<strong>ein</strong>en geographischen Ursprung, sondern hebt die traditionelle<br />
3 LG Offenburg, Urteil vom 26.03.2008 – Az.: 5 O114/07 KfH<br />
4 EU-Verordnung Nr. 2081/92 und Nr. 510/2006 vom 31.3.2006<br />
4
vzbv Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln 30.11.2010<br />
Zusammensetzung des Produkts oder <strong>ein</strong> traditionelles Herstellungs-<br />
und/oder Verarbeitungsverfahren hervor.<br />
Es wird deutlich, dass nur die geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) den<br />
Verbrauchererwartungen gerecht wird und klar über die Herkunft in der gesamten Kette<br />
<strong>von</strong> der Erzeugung bis zum Endprodukt informiert. Die geschützte geographische<br />
Angabe (g. g. A.) birgt hingegen erheblichen Raum <strong>für</strong> Täuschungen (normative<br />
Irreführung).<br />
Das Siegel "garantiert traditionelle Spezialität" enthält als solches zwar k<strong>ein</strong>en<br />
Herkunftsbezug. Um <strong>ein</strong>e mögliche Täuschung über die Herkunft bei<br />
Verkehrsbezeichnungen mit Ortsbezug jedoch auszuschließen (zum Beispiel bei<br />
"Frankfurter Würstchen"), sollten derartige Fälle ebenfalls immer mit <strong>ein</strong>em <strong>ein</strong>deutigen<br />
Hinweis auf den Rezepturbezug ergänzt werden.<br />
5. Markenrecht<br />
Gemäß Markengesetz (MarkenG), § 126 ff, können Anbieter geographische<br />
Herkunftsangaben als Marke schützen lassen. Derartig geschützte Produkte können<br />
auch besondere Eigenschaften oder Qualitäten aufweisen, die dann vom Anbieter<br />
<strong>ein</strong>gehalten werden müssen. Im Gegensatz zum EU-Herkunftsschutz (g. U./g. g. A.)<br />
sind <strong>für</strong> <strong>ein</strong>getragene Marken k<strong>ein</strong>e verbindlichen Regeln vorgegeben, dass bestimmte<br />
Produktionsschritte in der genannten Region stattfinden müssen. Die Regelungen im<br />
Markenrecht dienen in erster Linie den Anbietern und sind zur Orientierung <strong>für</strong><br />
Verbraucher kaum praxistauglich, da diese gezwungen sind, sich zu jeder <strong>ein</strong>zelnen<br />
Marke aufwändig zu informieren. Außerdem bestehen im Markenrecht bisher lediglich<br />
Zulassungspflichten, aber k<strong>ein</strong>e Pflicht zur unabhängigen Kontrolle.<br />
6. Forderungen<br />
Für die Kennzeichnung und Werbung mit den Begriffen „Region“, „Nähe“ und „Heimat“<br />
im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen bedarf es <strong>ein</strong>es rechtlich<br />
verbindlichen Systems, damit die regionale Herkunft und besondere Qualitäten<br />
abgesichert und nachvollziehbar erkennbar werden. Nur so lassen sich Täuschung und<br />
Irreführung vermeiden und bewusste Kaufentscheidungen <strong>für</strong> regionale Lebensmittel<br />
treffen.<br />
� In der Kennzeichnung und Werbung (Flyer, Wurfsendungen, Internet etc.) zur<br />
regionalen Herkunft <strong>von</strong> Lebensmitteln muss zwingend die betreffende Region<br />
genannt werden, aus der die beworbenen Produkte stammen.<br />
� Aus der Kennzeichnung und Werbung muss <strong>ein</strong>deutig hervorgehen, auf welche<br />
Produktionsschritte sich die regionale Kennzeichnung und Bewerbung bezieht,<br />
beispielsweise nur auf die Verarbeitung, die Herstellung, die Rohstoffe oder ob<br />
nur die Rezeptur <strong>ein</strong>en Bezug zur genannten Region aufweist. Dasselbe gilt <strong>für</strong><br />
Marken mit regionalem oder Ortsbezug.<br />
� Anbieter, die regionale Lebensmittel kennzeichnen und/oder bewerben, müssen<br />
<strong>für</strong> die Herkunft <strong>ein</strong> unabhängiges Kontrollsystem nachweisen. Die<br />
Kontrollsysteme der Anbieter sind in <strong>ein</strong> staatliches Kontrollsystem <strong>ein</strong>zubinden<br />
– analog zum Öko-Kontrollsystem –, das unabhängig die Herkunftsangaben<br />
effektiv kontrolliert.<br />
� Monoprodukte müssen zu 100 Prozent und zusammengesetzte Lebensmittel<br />
mindestens zu 95 Prozent der Zutaten aus der genannten Region stammen. Ist<br />
5
vzbv Kennzeichnung <strong>von</strong> regionalen Lebensmitteln 30.11.2010<br />
der Prozentanteil geringer, muss die Kennzeichnung klar und <strong>ein</strong>deutig<br />
erkennen lassen, auf welche wertgebende Zutat des Lebensmittels sich die<br />
Regionalkennzeichnung bezieht (zum Beispiel Rh<strong>ein</strong>ischer Reibekuchen mit<br />
Kartoffeln aus dem Rh<strong>ein</strong>land). In diesem Sinne müssen auch die staatlichen<br />
Länderzeichen angepasst werden.<br />
� Beworbene Qualitäten der Regionalprodukte müssen deutlich über dem<br />
gesetzlichen Standard liegen, rechtlich definiert und kontrolliert werden. Bei<br />
Verstößen sind seitens des Gesetzgebers wirksame Sanktionen vorzusehen.<br />
Literatur<br />
� Antwort der Bundesregierung auf die Kl<strong>ein</strong>e Anfrage der Abgeordneten Ulrike Höfken, Sylvia Kotting-<br />
Uhl, Nicole Maisch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache<br />
16/13999 zur EU-Lebensmittelinformationsverordnung, Deutscher Bundestag Drucksache<br />
16/14073,16. Wahlperiode vom 23. 09. 2009<br />
� Benner, Eckhard; Profeta, Adriano; Wirsig, Alexander: „Die EU-Übergangsregelung zum<br />
Herkunftsschutz bei Agrarprodukten und Lebensmitteln aus dem Blickwinkel der Transaktions- und<br />
der Informationsökonomie“, Schriften der Ges. <strong>für</strong> Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des<br />
Landbaues e.V., Bd. 44, 2009: 423 - 434<br />
� Büro <strong>für</strong> Technikfolgenabschätzung des Dt. Bundestages: „Potentiale zum Ausbau der regionalen<br />
Nahrungsmittelversorgung“. Büro <strong>für</strong> Technikfolgenabschätzung des Dt. Bundestages, TAB<br />
Arbeitsbericht Nr. 88 (Zusammenfassung) Okt. 2003<br />
� Dorandt, Stefanie Dr.: „Analyse des Konsumenten- und Anbieterverhaltens am Beispiel <strong>von</strong><br />
regionalen Lebensmitteln“, Ernährungs-Umschau 52 (2005) S.418 ff<br />
� Ermann, Ulrich: „Regionalprodukte – Vernetzung und Grenzziehungen bei der Regionalisierung <strong>von</strong><br />
Nahrungsmitteln“, Franz St<strong>ein</strong>er Verlag 2005<br />
� Forsa-Umfrage im Auftrag des <strong>BMELV</strong> zur biologischen Vielfalt, <strong>BMELV</strong> 2010<br />
� <strong>Kriterien</strong> beim Lebensmittel<strong>ein</strong>kauf“; Nestle/Allensbach 2009, Eine repräsentative Studie mit<br />
Befragungen <strong>von</strong> Verbrauchern allgem<strong>ein</strong> und <strong>von</strong> bewussten Verbrauchern<br />
� Markengesetz (Gesetz über den Schutz <strong>von</strong> Marken und sonstigen Kennzeichen) vom 25.10.1994<br />
(BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156, 1996 I S. 682), in Kraft getreten am 01.11.1994, 01.01.1995 bzw.<br />
20.03.1996 zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2521) m. W.v. 01.10.2009<br />
� Piloterhebung „Regionalwerbung im Handel“ Verbraucherzentrale Hessen, Datenblatt Feb. 2010<br />
� Zühlsdorf, Anke Dr.; Franz, Annabell: „Ergebnisbericht über die Durchführung <strong>ein</strong>er<br />
Transparenzerhebung der regionalen Landesprogramme“ im Auftrag der Verbraucherzentralen;<br />
Frankfurt, Feb. 2010<br />
6
12.12 E-Mail BÖLW vom 16.12.2011<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Von: Gerber, Dr. Alexander [mailto:gerber@boelw.de]<br />
Gesendet: Freitag, 16. Dezember 2011 15:47<br />
An: Wirz Axel<br />
Betreff: Regionalsiegel: <strong>Kriterien</strong> aus Öko-Perspektive<br />
Hallo Axel,<br />
leider war es nicht möglich noch <strong>ein</strong>e Verbandsabfrage zu machen, deshalb aus m<strong>ein</strong>er Sicht, die auf<br />
Vorstandsbeschlüssen BÖLW und Einzelgesprächen beruht, folgende Rückmeldung:<br />
- Definition was <strong>ein</strong> regionales Lebensmittel ist (Regionale Eingrenzung (< als) und Tiefe<br />
(Mindestanteil regionaler Produkte in der Rezeptur))<br />
- Klar beschriebene Fakten, die nachgeprüft werden<br />
- K<strong>ein</strong> staatliches Zeichen<br />
- Transparenz <strong>von</strong> Inhalt und Überprüfungs-System <strong>für</strong> die Öffentlichkeit<br />
- K<strong>ein</strong>e zusätzlichen <strong>Kriterien</strong> wie Tierwohl oder Nachhaltigkeit<br />
- Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe<br />
Viele Grüße<br />
Alexander<br />
Dr. Alexander Gerber<br />
Geschäftsführer<br />
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft<br />
Marienstr. 19-20<br />
10117 Berlin<br />
Tel. 030.28482300<br />
Fax 030.28482309<br />
gerber@boelw.de<br />
www.boelw.de
12.13 Matrix Potenzialanalyse<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Potentialanalyse - Literaturrecherche MATRIX A Stand: 10.01.2012<br />
Zuordnung der<br />
untersuchten Literatur zu<br />
Warengruppe und<br />
Vertriebsschiene<br />
1 K<strong>ein</strong>e<br />
2 Handel allg.<br />
A B C D E F G H I J<br />
K<strong>ein</strong>e<br />
8, 7, 6, 51, 5, 48,<br />
47, 43, 42, 41, 40,<br />
4, 39, 38, 37, 36,<br />
35, 33, 1, 27, 25,<br />
24, 20, 3, 13, 12,<br />
11, 15<br />
2, 23, 55, 54, 53, 50,<br />
49, 45<br />
3 Direktvermarktung 28, 19, 26<br />
Backwaren /<br />
Getreide-<br />
produkte<br />
4 Bäckerei, Konditorei 19 9<br />
Bier / Getränke Eier<br />
Fleisch- und<br />
Fleischwaren<br />
18<br />
Obst und<br />
Gemüse<br />
Kartoffeln und K-<br />
Erzeugnisse<br />
Milch und Milch-<br />
produkte<br />
9 29, 21, 14, 10 21, 30, 34 21 21<br />
5 Fleischerei 19 14, 52<br />
6 Märkte, Verk.-wagen 19 22, 44 22, 44 22, 44 22, 44 22, 44 22, 44<br />
7 Naturkosthandel 19, 26, 32<br />
8 Gastronomie<br />
9 SB-Warenhäuser<br />
10 Gr. Supermarkt 16, 17, 31 22 22 22, 10 22 22 22, 46<br />
11 Verbrauchermarkt 16, 17 10<br />
12 Supermarkt 16, 17 22 22 22, 10 22 22 22, 46<br />
13 Kl. Supermarkt 16, 17,19, 26 10 46<br />
14 Tankstellenshop<br />
15 Discounter<br />
16 Drogeriemarkt<br />
17 Versandhandel<br />
18 Anderes<br />
Angaben in grün: MaFo repräsentativ<br />
Angaben in rot: MaFo nicht repr., Einschätzungen<br />
Zahlen entsprechen CODE in Literaturliste<br />
Zuordnung bis Code Nr. 55 in Literaturliste<br />
F:\50015 Marketing- und Organisationsberatung, Regionalmarketing\50015048 Ausschreibung <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel (jh, eia)\Potentialanalyse\Literatur\Auswertung u. Listen\Matrix_AMatrix_AZuordnung VW<br />
Pfl. Öle Zucker
12.14 Gesprächsleitfaden Expertenbefragung<br />
Abschlussbericht:<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />
FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH
Gesprächsleitfaden<br />
Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels<br />
Datum: ……………………………………….<br />
Gesprächspartner<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
spricht <strong>für</strong> (Verband, Einrichtung)<br />
………………………………………………………………………………………..<br />
[Vorstellung]<br />
Wir sind an der Erstellung <strong>ein</strong>er Studie des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur<br />
Regionalvermarktung <strong>von</strong> Lebensmitteln beteiligt.<br />
Ich würde Ihnen in diesem Zusammenhang gern <strong>ein</strong> paar Fragen stellen.<br />
Es sind nur zwölf Fragen und es dauert nicht mehr als gut zehn Minuten.<br />
Mit Ihrer Antwort nehmen Sie auf zukünftige Regelungen in diesem Bereich Einfluss.<br />
Wären Sie hierzu bereit?<br />
[Da nur telef. Befragung möglich, ist auf die folgenden Auswahlkategorien, die u.<br />
a. <strong>ein</strong>en Versand des Fragebogens im Vorfeld vorsahen, verzichtet worden.]
Einleitung<br />
Seit <strong>ein</strong>iger Zeit wird innerhalb der Agrar- und Lebensmittelbranche intensiv über<br />
die Vermarktung <strong>von</strong> Erzeugnissen und Produkten mit <strong>ein</strong>er besonderen regionalen<br />
Ausprägung gesprochen. Kontrovers diskutiert wird hierbei vor allem die Frage,<br />
welche Produkte als „Regionale Erzeugnisse“ ausgelobt und beworben werden<br />
können.<br />
Das Bundesministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat<br />
hierzu <strong>ein</strong>e Studie in Auftrag gegeben, die nähere Aufschlüsse über die „<strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel“ geben soll.<br />
Hintergrund ist der Gedanke, ob durch <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> „Regionalsiegel“ <strong>ein</strong>e Art<br />
Bestätigung <strong>für</strong> Produkte aus regionaler Erzeugung geschaffen werden soll und<br />
falls „ja“, was das Garantieversprechen <strong>ein</strong>es solchen Siegels s<strong>ein</strong> sollte.
1. Bitte ordnen Sie in folgendes Raster<br />
<strong>ein</strong>, <strong>für</strong> welche Branche Sie in<br />
welcher Funktion sprechen!<br />
Unternehmens-<br />
vertreter<br />
Interessen-<br />
vertretung/<br />
Beratung<br />
1. Landwirtschaft (inkl. Direktverm.) 1 2<br />
2. Fleischwirtschaft 1 2<br />
3. Milchwirtschaft 1 2<br />
4. Bäcker/Konditoren 1 2<br />
5. Endverbraucher 1 2<br />
6. Sonstige/s: 1 2<br />
2. Stellen Sie sich doch <strong>ein</strong>mal vor, die <strong>Kriterien</strong> da<strong>für</strong>, was als „Produkt aus<br />
regionaler Erzeugung“ gekennzeichnet werden kann, würden bundes<strong>ein</strong>heitlich<br />
festgelegt. Würden Sie das …<br />
1 begrüßen 2 ablehnen 3 weiß nicht<br />
3. Unabhängig <strong>von</strong> Ihrer grundsätzlichen Auffassung zu <strong>ein</strong>em bundesweiten<br />
Regionalsiegel, gesetzt den Fall, <strong>ein</strong> solches Siegel würde entwickelt, wer<br />
sollte Ihres Erachtens Träger <strong>ein</strong>es solchen Zeichens s<strong>ein</strong>?<br />
1 Staat, staatl. Einrichtung<br />
2 Einrichtung der Privatwirtschaft<br />
4. Sollte die Kennzeichnung mit <strong>ein</strong>em übergeordneten Regionalsiegel verpflichtend,<br />
freiwillig oder „fakultativ vorbehalten“ s<strong>ein</strong> (= Zeichennutzung<br />
freiwillig, wer es nutzt, ist aber an s<strong>ein</strong>e Vorgaben gebunden)?<br />
1 verpflichtend 2 freiwillig 3 „fakultativ<br />
vorbehalten“<br />
4 weiß nicht<br />
5. Kommen wir zu den <strong>Kriterien</strong> <strong>ein</strong>es möglichen Zeichens, das ja vorrangig<br />
die regionale Herkunft <strong>ein</strong>es Produktes garantieren soll. Wie soll nach Ihrer<br />
Auffassung die regionale Herkunft <strong>ein</strong>gegrenzt werden?<br />
1 administrative Abgrenzung und zwar wie folgt (bitte k<strong>ein</strong>e Mehrfachnennung):<br />
11 Deutschland 12 Bundesland 13 Regierungsbezirk<br />
14 Landkreis 15 Gem<strong>ein</strong>de<br />
2 Naturraum, z. B. Lüneburger Heide<br />
3 bestimmter Umkreis des Vertriebsgebietes um <strong>ein</strong>en Erzeugungs-<br />
/Herstellungsort<br />
4 Sonstige <strong>Kriterien</strong>:
6. Sollte <strong>ein</strong> Regionalsiegel nur <strong>für</strong> Monoprodukte, also z. B. Kartoffeln, Eier,<br />
Obst oder nur <strong>für</strong> zusammengesetzte Produkte, z. B. Wurst, Konserven,<br />
Konfitüren, Fertiggerichte oder Beides vergeben werden können?<br />
1 Nur <strong>für</strong> Monoprodukte [weiter mit Frage 9]<br />
2 Nur <strong>für</strong> zusammengesetzte Produkte [weiter mit Frage 7]<br />
3 Für beide Produktbereiche [weiter mit Frage 7]<br />
7. Sollten bei zusammengesetzten Produkten, die mit <strong>ein</strong>em Regionalsiegel<br />
gekennzeichnet werden, die Rohstoffe und Zutaten aus derselben Region<br />
stammen, in der der verarbeitende Betrieb liegt?<br />
1 Ja, unbedingt [weiter mit Frage 8]<br />
2 Ja, aber nur wenn regional verfügbar [weiter mit Frage 8]<br />
3 N<strong>ein</strong> [weiter mit Frage 9]<br />
8. Wenn Sie der Auffassung sind, die Ausgangsstoffe <strong>ein</strong>es zusammengesetzten<br />
Produktes müssten zu <strong>ein</strong>em bestimmten Anteil aus der gleichen Region<br />
wie das Endprodukt stammen, wie hoch sollte Ihres Erachtens dieser<br />
Anteil mindestens s<strong>ein</strong>?<br />
1 % 2 hängt vom Produkt ab 3 weiß nicht<br />
9. Von verschiedenen Seiten hört man, mit <strong>ein</strong>em Regionalsiegel müssten<br />
weitere Anforderungen an die Erzeugung/Herstellung, etwa zur Qualität<br />
oder zum Herstellungsprozess, verbunden werden, die über die gesetzlichen<br />
Bestimmungen hinaus gehen. Stimmen Sie dieser Auffassung zu?<br />
1 Ja [weiter mit Frage<br />
10]<br />
2 N<strong>ein</strong> [weiter mit Frage<br />
11]<br />
3 weiß nicht<br />
[weiter mit Frage 11]<br />
10.Wenn Sie der Auffassung sind, mit <strong>ein</strong>em Regionalsiegel müssten weitere,<br />
über gesetzlichen Standards liegende Anforderungen an die Erzeugung/<br />
Herstellung verbunden s<strong>ein</strong>, zu welchen Bereichen sollte <strong>ein</strong> Regionalsiegel<br />
nach Ihrer Auffassung auch Garantien/<strong>Kriterien</strong> bieten?<br />
1. umweltgerechte Erzeugung 1 Ja 2<br />
N<strong>ein</strong><br />
2. soziale Belange, etwa Erhalt oder<br />
Schaffung <strong>von</strong> Arbeitsplätzen in der<br />
Region<br />
3. Tierschutzaspekte (sofern Produkt mit<br />
Bestandteilen aus tier. Erzeugung)<br />
4. ohne Einsatz <strong>von</strong> Gentechnik<br />
erzeugt/ hergestellt<br />
1 Ja 2<br />
N<strong>ein</strong><br />
1 Ja 2<br />
N<strong>ein</strong><br />
1 Ja 2<br />
N<strong>ein</strong><br />
3 weiß nicht<br />
3 weiß nicht<br />
3 weiß nicht<br />
3 weiß nicht
5. Klimaschutz 1 Ja 2<br />
6. Sonstige:<br />
N<strong>ein</strong><br />
3 weiß nicht<br />
11.Glauben Sie <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel <strong>für</strong> Produkte aus regionaler<br />
Erzeugung o. ä. würde die Vermarktungschancen dieser Produkte be<strong>ein</strong>flussen<br />
und zwar …<br />
1 fördern 2 hemmen<br />
3 hängt <strong>von</strong> der Ausgestaltung,<br />
den Rahmenbedingungen ab<br />
4 weiß nicht
12. Aktuell werden vorrangig zwei Modelle <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalzeichens<br />
diskutiert, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte.<br />
• Das erste Modell sieht die Schaffung <strong>ein</strong>er Art „Dachmarke“ zur Anerken-<br />
nung regionaler Zeichen anhand <strong>von</strong> vorgegebenen Mindestkriterien vor.<br />
Regionale Zeichen, die bestimmte Vorgaben z. B. zur regionalen Abgrenzung,<br />
der regionalen Wertschöpfung und des Rohstoffbezugs im Rahmen<br />
<strong>ein</strong>es definierten Kontroll- und Zertifizierungsverfahrens erfüllen, könnten<br />
neben ihrer eigenen Marke <strong>ein</strong>e bundes<strong>ein</strong>heitliche Dachmarke i. S. <strong>ein</strong>er<br />
übergeordneten „Anerkennung“ nutzen.<br />
• Ein zweites Modell sieht im Wesentlichen vor, die unterschiedlichen Angaben<br />
der jeweiligen Anbieter ausschließlich zur regionalen Herkunft ihrer<br />
Produkte auf Basis <strong>von</strong> analytischen und Prozesskontrollen zu überprüfen<br />
und im Fall ihrer Erfüllung <strong>ein</strong>e Art Kontrollbestätigung in Form <strong>ein</strong>es Zeichens<br />
zu vergeben.<br />
Wenn Sie sich zwischen den Varianten entscheiden müssten, welche würden Sie<br />
wählen?<br />
( ) <strong>ein</strong>e Dachmarke mit vorgegebenen Regionalkriterien<br />
( ) <strong>ein</strong>e Kontrollbestätigung <strong>für</strong> die Erfüllung jeweils eigener Regionalkriterien<br />
( ) k<strong>ein</strong>e <strong>von</strong> beiden<br />
( ) <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e Entscheidung bedürfte es weiterer Informationen<br />
( ) der Unterschied bleibt unklar<br />
( ) Sonstiges ………………………………………………………………………………..<br />
Vielen Dank <strong>für</strong> Ihre Mithilfe und Auskunftsbereitschaft!