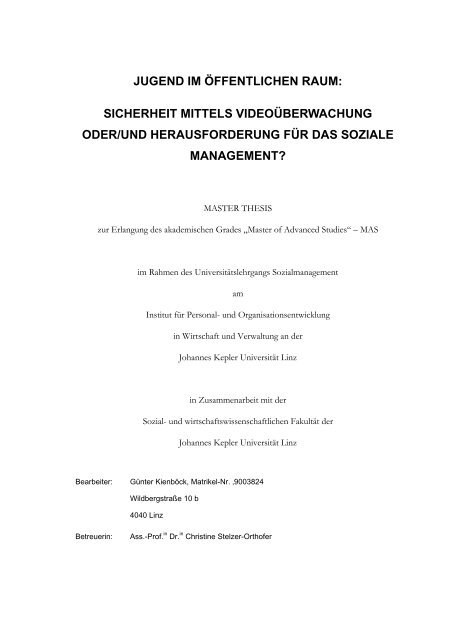jugend im öffentlichen raum: sicherheit mittels videoüberwachung
jugend im öffentlichen raum: sicherheit mittels videoüberwachung
jugend im öffentlichen raum: sicherheit mittels videoüberwachung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
JUGEND IM ÖFFENTLICHEN RAUM:<br />
SICHERHEIT MITTELS VIDEOÜBERWACHUNG<br />
ODER/UND HERAUSFORDERUNG FÜR DAS SOZIALE<br />
MANAGEMENT?<br />
MASTER THESIS<br />
zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Advanced Studies“ – MAS<br />
<strong>im</strong> Rahmen des Universitätslehrgangs Sozialmanagement<br />
am<br />
Institut für Personal- und Organisationsentwicklung<br />
in Wirtschaft und Verwaltung an der<br />
Johannes Kepler Universität Linz<br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der<br />
Johannes Kepler Universität Linz<br />
Bearbeiter: Günter Kienböck, Matrikel-Nr. ‚9003824<br />
Wildbergstraße 10 b<br />
4040 Linz<br />
Betreuerin: Ass.-Prof. in Dr. in Christine Stelzer-Orthofer
© Copyright Günter Kienböck 2008<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
II
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG<br />
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne<br />
fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt<br />
und die aus anderen Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe.<br />
Linz, Mai 2008 Günter Kienböck<br />
III
VORWORT<br />
Seit 1990 bin ich beruflich überwiegend der Jugendarbeit verbunden. Eigentlich wollte ich<br />
nach der Geburt meines ersten Sohnes Schluss mit meinem Engagement in diesem Bereich<br />
machen. Aus diesem Ent-Schluss wurde aber nichts: Die Herausforderung in Ansfelden (als<br />
Jugendkoordinator die örtliche Jugendarbeit mitzuentwickeln), lockte mich wieder in diese<br />
Arbeit hinein. Ähnlich ging es mir bei der Themenfindung zu dieser Arbeit: Meine Gedan-<br />
ken kreisten erst über Themen, die mit Jugend nicht zu tun haben. Gelandet bin ich aber<br />
dann doch wieder bei einem Thema, das Jugendliche mit einschließt. Entscheidend dafür<br />
war sicherlich ein Faktor, der mich in letzter Zeit zunehmend nachdenklich machte: Der<br />
feststellbare Trend, dass Jugendliche zunehmend als Problem wahrgenommen und disku-<br />
tiert werden. Dabei wird <strong>im</strong>mer häufiger das Potential der Jugend von Heute für die Her-<br />
ausforderungen von Morgen unter den Tisch gekehrt und stattdessen über Kontroll- und<br />
Sicherheitsmaßnahmen nachgedacht. War zu Zeiten meiner Jugend diese Art der Kontrolle<br />
weder technisch möglich noch diese Sichtweise (Jugend als omnipräsentes Problem) vor-<br />
stellbar, so drängte sich diese Sichtweise als Ansatzpunkt für diese Arbeit in den Vorder-<br />
grund: Fordert mich diese Art junge Menschen – also vor allem deren Defizite – zu sehen,<br />
doch laufend als Jugendarbeiter und auch als Vater von angehenden Jugendlichen heraus.<br />
Für die Möglichkeit, diese Arbeit zu schreiben und die Ausbildung Sozialmanagement zu<br />
absolvieren, gilt es zweierlei Dank auszusprechen: Einerseits dem IPO als Ausbildungsträ-<br />
ger und andererseits der Stadtgemeinde Ansfelden als Dienstgeber, der meinem Wunsch<br />
nach Weiterbildung in aller Offenheit gegenüberstand und dessen Umsetzung auch ermög-<br />
lichte.<br />
Mein Dank gilt insbesondere Frau Professorin Christine Stelzer-Orthofer, die sich die Be-<br />
gleitung dieser Arbeit aufbürdete und mir <strong>im</strong> Zuge der Mühen dieses Unterfangens wieder-<br />
holt ein „Silberstreif am Horizont“ war. Besonderer Dank gilt auch Frau Dr. in Brigitte<br />
Kepplinger, die sich trotz ihrer Gefragtheit Zeit für die eine oder andere angeregte Diskus-<br />
sion zu den bearbeiteten Themen genommen hat.<br />
IV
Herzlicher Dank gilt auch Gabi Meyer, die trotz allerschönstem Wochenend-Wetter dieser<br />
Arbeit die notwendigen Korrekturen angedeihen ließ.<br />
Weil ich - angeregt durch die Themenstellung - <strong>im</strong>mer wieder an meine eigene Jugend zu-<br />
rückdenken musste, kamen auch wiederholt meine Eltern ins Blickfeld. Aber nicht nur ge-<br />
sehen seien sie, sondern auch besonders gedankt sei ihnen: Danke für eure Mühen mit mir,<br />
danke für eure Begleitung und eure Liebe, die nicht einmal durch den blödesten Jugend-<br />
streich nachhaltig getrübt wurde. Wer hätte je gedacht, dass meine Jugendsünden einmal in<br />
einer Master Thesis enden?<br />
Aber nicht nur meine Jugend tat sich <strong>im</strong>mer wieder vor mir auf, sondern auch die Zukunft<br />
„meiner“ beiden Söhne. Ich hoffe, dass ihr Beide – Rafael und Marlin - eure Jugend (oder<br />
überhaupt eure Zukunft) so verbringen könnt, dass sie eines freien Menschen würdig ist. Es<br />
ist faszinierend und bewegend, bei eurem Weg durch das Leben mit dabei sein zu dürfen<br />
und euer Lachen (und manchmal – ja auch die gehören dazu - eure Tränen) mitzuerleben:<br />
Dafür meinen innigsten Dank. Dieser gilt auch meiner Lebensgefährtin Guggi: Vor allem<br />
für dein Da-Sein und für das, was uns verbindet. Nicht nur bei dieser Arbeit war deine Un-<br />
terstützung wesentlich. Deine aufmunternden Worte haben mir über die größten Krisen <strong>im</strong><br />
Zuge dieser (schließlich doch recht umfangreichen) Arbeit hinweggeholfen. Ihr Drei – und<br />
nicht der Dow Jones – seid das Wichtigste auf der Welt.<br />
Dank gilt auch noch Schwesternherz Doris, Kolleg/innen und besten Freund/innen, sowie<br />
jungen Menschen in Ansfelden und anderswo: Aber wie ich (auch) bei dieser Arbeit akzep-<br />
tieren musste, dass das Eine zwar das Andere ergibt, aber irgendwann doch einmal Schluss<br />
sein muss, so sei dieser nun hier gesetzt mit diesem.<br />
Günter Kienböck<br />
Linz, am 10. Mai 2008<br />
V
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1 Öffentlicher Raum.....................................................................................................................6<br />
1.1 Öffentliche Räume : Versuch einer Definition ..........................................................6<br />
1.2 Die Verdinglichung des Raumes als Grundproblem...............................................10<br />
1.3 Integriertes Verständnis von Raum............................................................................11<br />
1.3.1 Verhäuslichung von Funktionen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes 13<br />
1.3.2 Prägung durch Mobilitätsstrukturen 14<br />
1.3.3 Mediatisierung städtischer Öffentlichkeit 16<br />
1.3.4 Verinselung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes 17<br />
1.3.5 Spiegelung der sozialen Polarisierung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum 18<br />
1.3.6 Diffusion und Verflüssigung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes 21<br />
1.3.7 Wandel der <strong>öffentlichen</strong> Räume durch die Individualisierung 22<br />
1.3.8 Informalisierung öffentlicher Verhaltensstandards 24<br />
1.4 Vom Nutzen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes .....................................................................24<br />
1.5 Jugend <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum .....................................................................................27<br />
1.5.1 Eine Geringschätzung 27<br />
1.5.2 Die Wichtigkeit von öffentlichem (Frei)Raum für die Jugend 28<br />
1.5.3 Jugendliches Freizeitverhalten in der Stadt:<br />
Eine konfliktbeladene Situation 28<br />
1.5.4 Planerische Konsequenzen für eine <strong>jugend</strong>freundliche Gestaltung 31<br />
2 Die Jugend................................................................................................................................34<br />
2.1 Jugend: Versuch einer Definition...............................................................................34<br />
2.1.1 Die eine Jugend gibt es nicht 35<br />
2.1.2 Selbstbild der jungen Österreicher/innen 36<br />
2.2 Pubertät und Adoleszenz.............................................................................................36<br />
2.2.1 Die Pubertät 36<br />
2.2.2 Adoleszenz 37<br />
2.2.3 Herausforderungen in diesem Lebensabschnitt 38<br />
2.3 Jugend <strong>im</strong> „posttraditionellen Materialismus“..........................................................42<br />
2.3.1 Werte der Jugend 43<br />
2.3.2 Jugend unter Stress 44<br />
2.4 Freundschaften und Cliquen.......................................................................................45<br />
VI
2.4.1 Cliquen 46<br />
2.4.2 Cliquen und Konflikte 51<br />
2.5 Jungen.............................................................................................................................53<br />
2.5.1 Ursachen der Schwierigkeiten ein Junge zu sein 53<br />
2.5.2 Jungen: Opfer und Täter zugleich 55<br />
2.5.3 Ausprägungen der Rollenmuster bei Jungen 57<br />
2.6 Jugend und Gewalt .......................................................................................................58<br />
2.7 Jugendkr<strong>im</strong>inalität.........................................................................................................62<br />
2.7.1 Begriffsdefinition Jugendkr<strong>im</strong>inalität 62<br />
2.7.2 Zur Begrifflichkeit der Jugenddelinquenz 63<br />
2.7.3 Kr<strong>im</strong>inalität gilt als „normales“ Jugendphänomen 63<br />
2.7.4 Typische Delikte der Jugendkr<strong>im</strong>inalität 65<br />
2.7.5 Gründe für die Jugendkr<strong>im</strong>inalität 66<br />
2.7.6 Jugendliche Intensivtäter 66<br />
2.7.7 Jugendkr<strong>im</strong>inalität in Österreich 68<br />
2.7.8 Einschränkungen der Aussagekraft der<br />
polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalitätsstatistiken 69<br />
2.7.9 Gerichtliche Statistik und deren Aussagekraft zur Jugendkr<strong>im</strong>inalität 72<br />
2.7.10 Die Notwendigkeit einer (nicht vorhandenen) Dunkelfeldforschung 73<br />
2.8 Vandalismus...................................................................................................................75<br />
2.8.1 Vandalismus boomt in den Medien 75<br />
2.8.2 Vandalismus in Österreich nach Zahlen 76<br />
2.8.3 Jugendliche sind herausragende Tätergruppe 76<br />
2.8.4 Der Sinn hinter dem scheinbar sinnlosen Zerstören 77<br />
3 Videoüberwachung..................................................................................................................82<br />
3.1 Begriffsbest<strong>im</strong>mungen .................................................................................................82<br />
3.1.1 Videoüberwachung 82<br />
3.1.2 CCTV 83<br />
3.2 Nachweise der Wirkung der Videoüberwachung.....................................................83<br />
3.3 Die Effizienz der Videoüberwachung <strong>im</strong> Hinblick auf eine<br />
kr<strong>im</strong>inalpräventive Wirkung.....................................................................................84<br />
3.3.1 Grundsätzliches zur Qualität der Studien 84<br />
3.3.2 Interne Bewertungen 86<br />
3.3.3 Beispiel einer internen Evaluation: Regensburg 87<br />
VII
3.3.4 Beispiel interne Evaluation Bielefeld 90<br />
3.3.5 Interne Evaluation: Beispiel Bremen 94<br />
3.3.6 Wissenschaftliche Untersuchungen 97<br />
3.3.7 Wissenschaftliche Untersuchung: Beispiel Brandenburg 98<br />
3.3.8 Wissenschaftliche Untersuchung:: Beispiel Berlin 104<br />
3.3.9 Metaevaluationen 108<br />
3.3.10 Die Meta-Evaluation von Welsh und Farrington 109<br />
3.3.11 Die große Studie von Gill & Spriggs 110<br />
3.4 Effekte der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl...................................114<br />
3.4.1 Menschliche Sicherheit 114<br />
3.4.2 Das Sicherheitsgefühl 115<br />
3.4.3 Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht 115<br />
3.4.4 Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht 118<br />
3.4.5 Auswirkung der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl 119<br />
3.5 Wer wird überwacht?..................................................................................................127<br />
3.5.1 Problem 1: Die Überwachung des Raumes 127<br />
3.5.2 Problem 2: Überforderung durch die Datenflut 128<br />
3.5.3 Problem 3: Die Straf-Täter sehen die Überwachung gelassen 129<br />
3.5.4 Wer wird überwacht? 130<br />
3.6 Ursachen der Videoüberwachung ............................................................................132<br />
3.6.1 Der gesellschaftliche Wandel 133<br />
3.6.2 Die Kommerzialisierung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes 140<br />
3.6.3 Die Rolle bzw. die Veränderung des geltenden Rechtes 142<br />
3.7 Auswirkungen der Videoüberwachung ...................................................................145<br />
3.7.1 Änderung des Anzeigenverhaltens 145<br />
3.7.2 Verlust von Kommunikation und Nähe der Exekutive 146<br />
3.7.3 Unerwünschte Beeinflussung des Verhaltens <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum 147<br />
3.7.4 Ausgrenzung 148<br />
3.7.5 Veränderung des Sozialverhaltens 149<br />
3.7.6 Stadt als unsicherer (und geteilter) Ort 151<br />
3.8 Situation in Österreich ...............................................................................................153<br />
3.8.1 Rechtliche Situation 153<br />
3.8.2 Ausmaß der Videoüberwachung 156<br />
3.8.3 Wirkungsevaluationen in Österreich 157<br />
VIII
3.9 Fazit der Videoüberwachung ....................................................................................164<br />
4 Lösungsansätze ......................................................................................................................166<br />
4.1 Herausforderungen in der real existierenden Gegenwärtigkeit der Situation ....168<br />
4.1.1 Jugendliche <strong>im</strong> Raum, der als nicht ihnen zugedacht gesehen wird 168<br />
4.1.2 Wahrnehmung der Jugendlichen als eine Ansammlung von Defiziten 170<br />
4.1.3 Jugendliche ohne Macht <strong>im</strong> Beteiligungs(sand)spielkasten 172<br />
4.2 Das Konzept der Raumaneignung als Basis einer Lösungssuche........................174<br />
4.3 Grundsätzliche Projektvoraussetzungen .................................................................178<br />
4.4 Gemeinwesenarbeit und sozialräumliche Jugendarbeit als ideale Ergänzung....178<br />
4.5 Wesentliche Aspekte der sozialräumlichen Jugendarbeit......................................180<br />
4.5.1 Gestaltung des Ortes der Jugendarbeit als<br />
Aneignungs- und Bildungs<strong>raum</strong> 180<br />
4.5.2 Positive Sicht öffentlicher Räume gegenüber der<br />
„gefährlichen Straße“ 181<br />
4.5.3 Revitalisierung öffentlicher Räume als <strong>jugend</strong>politisches Mandat 182<br />
4.5.4 Kooperation und Vernetzung 182<br />
4.6 Sozialräumliche Konzeptentwicklung als Projekt..................................................183<br />
4.6.1 Klärung von Zielen 184<br />
4.6.2 Der Sozial<strong>raum</strong> bildet die Ausgangslage 184<br />
4.6.3 Planen und Entscheiden 188<br />
4.7 Ergebnisse und Wirkungen sozialräumlicher Konzeptentwicklungsprozesse<br />
– Ein Ausblick.........................................................................................................190<br />
Literaturverzeichnis.......................................................................................................................193<br />
IX
I. THEMENAUFRISS<br />
In der <strong>öffentlichen</strong> Wahrnehmung - und damit einhergehend in der politischen Debatte –<br />
hat in den letzten Jahren ein offenkundiger Paradigmenwandel stattgefunden: Öffentlicher<br />
Raum und Jugendliche (eine wichtige Nutzer/innengruppe) werden zunehmend unter einem<br />
defizitären, problematisierenden und kr<strong>im</strong>inalisierenden Blickwinkel wahrgenommen<br />
und diskutiert. Der Wunsch nach Sicherheit best<strong>im</strong>mt die Debatte - die sozialpolitische Debatte<br />
rückt dabei in den Hintergrund. Insbesondere das Thema „Jugend und Vandalismus“<br />
rückt dabei in den Mittelpunkt. Als oft einzige Möglichkeit die Sicherheit auf <strong>öffentlichen</strong><br />
Plätzen in den Griff zu bekommen und präventiv gegen Störungen der <strong>öffentlichen</strong> Ordnung<br />
vorzugehen, wird Videoüberwachung gesehen bzw. umgesetzt.<br />
Als Jugendkoordinator bin ich mit dem Thema Jugendliche <strong>im</strong> öffentlichem Raum laufend<br />
konfrontiert. Dabei scheinen sich zwei Wirklichkeiten unversöhnlich gegenüber zu stehen,<br />
die an zwei Beispielen exemplarisch dargestellt seien:<br />
� Im August 2007 veröffentlichte der Gemeindebund eine Umfrage unter den österreichischen<br />
Bürgermeistern. Ergebnis: 58 % der Gemeinden bezeichnen Vandalismus<br />
als aktuelles Thema, 73 % der Bürgermeister meinen, dass Videoüberwachung<br />
das Sicherheitsempfinden in der Gemeinde heben würde.<br />
� Im Herbst 2006 wurde die Ansfeldner Jugendstudie (Auftraggeber: Jugendbüro<br />
Ansfelden, Durchführung: Universität Linz, Institut für Soziologie, Lernprojekt unter<br />
der Leitung von Fr. Dr. Marlies Tschemer) fertiggestellt. Dabei kristallisierte sich<br />
in der freien Nennung „Was wäre die wichtigste Verbesserung“ neben der Frage der<br />
interkulturellen Integration vor allem der Bereich öffentliche Plätze heraus. Dabei<br />
zeichnet sich klar ein grundsätzlich positiver Zugang zum Handlungsfeld „Jugend<br />
und öffentliche Plätze“ ab: Vor allem Verbesserungen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
wurden hier eingefordert.<br />
Obwohl man – zumindest in der Wahrnehmung und <strong>im</strong> Bedarf an <strong>öffentlichen</strong> Räumen –<br />
1
von zwei Wirklichkeiten sprechen kann, ist die Realität der Entwicklung eine Eindeutige:<br />
Das Paradigma der Sicherheit <strong>mittels</strong> Kontrolle und Überwachung ist die herrschende<br />
Handlungsoption, um die <strong>öffentlichen</strong> Plätze „wieder in den Griff zu bekommen“. Die<br />
Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum hat ihren Siegeszug angetreten und setzt diesen<br />
unbeirrt fort bzw. wird zunehmend intensiviert<br />
In Österreich gibt es wenig Widerspruch und Reflexion in dieser (sozial)politischen und <strong>öffentlichen</strong><br />
Debatte. Zu klar scheint der Trend der Jugend hin zum gewalttätigen und kr<strong>im</strong>inellen<br />
Verhalten. Zu eindeutig scheinen die positiven Wirkungen von der Überwachung der<br />
<strong>öffentlichen</strong> Plätze auf der Hand zu liegen. Widerspruch gibt es in diesem Diskussionsfeld<br />
in Österreich nur in beschränktem Maße – und hier vor allem von Seiten der Datenschützer/innen.<br />
Abseits von den Bedenken von Datenschützer/innen stellt sich für die Jugendarbeit eine<br />
Fülle von Fragen:<br />
� Entwickeln sich die Sichtweisen und Realitäten der wahrgenommenen <strong>öffentlichen</strong><br />
und politischen Debatte und den Bedürfnissen einer der wichtigsten Nutzer/innengruppe<br />
entscheidend auseinander?<br />
� Kommen Jugendliche und ihre Interessen, ihre Notwendigkeiten zu einer gedeihlichen<br />
Entwicklung <strong>im</strong> gesellschaftlichen Rahmen unter die Räder? Oder anders gefragt:<br />
Sind junge Menschen die ersten Opfer einer Veränderung eines neues Paradigmas<br />
der Sicherheit hin zu Repression und Kontrolle, die nach und nach die gesamte<br />
Gesellschaft erreichen wird? Drängt dieser Paradigmenwechsel nicht gerade<br />
den sozialen Sektor zunehmend in die Rolle des „Verwalters von Auffälligkeiten<br />
und Defiziten“ die <strong>im</strong> Zuge dieses Wechsels entstehen?<br />
� Ist die Jugend – und mir ihr die Jugendarbeit als Teil des sozialen Sektors – der zunehmenden<br />
Kr<strong>im</strong>inalisierung in der Debatte ausgeliefert, von Stadtplanung und -<br />
Nutzung zunehmend ausgeschlossen und der stückweisen Entziehung eines der<br />
wichtigsten Entwicklungsfelder - den <strong>öffentlichen</strong> Räumen - hilflos ausgesetzt?<br />
2
In dieser Master Thesis soll aufgezeigt werden, wie wichtig die Debatte um den <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum für die Jugend, die Gesellschaft und den sozialen Sektor ist. Für Träger/innen der<br />
Jugendarbeit, Beschäftigte und insbesondere Führungskräfte <strong>im</strong> Bereich der Jugendarbeit<br />
wird es zunehmend unerlässlich, sich verstärkt in diese Debatte der <strong>öffentlichen</strong> Plätze und<br />
deren künftige Gestaltung sowie Handhabung einzubringen, um diesen wesentlichen Lebens-<br />
und Entwicklungsbereich von (jungen) Menschen nicht den (erwachsenen) Stadtplaner/innen<br />
und Sicherheitsfachleuten alleine zu überlassen.<br />
Als Jugendkoordinator, der mit dieser Master Thesis den Lehrgang „Sozialmanagement“<br />
abschließen will, lautet daher die zentrale Frage: Ist Kontrolle und Überwachung auf <strong>öffentlichen</strong><br />
Plätzen der Weisheit letzter Schluss, oder gibt es konkrete Impulse aus dem Sozialmanagement,<br />
um Gestaltungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die nicht auf reines Sicherheitsdenken<br />
fixiert sind, sondern „soziales Management“ der verschiedenen Interessen in <strong>öffentlichen</strong><br />
Räumen ermöglichen?<br />
3
2. AUFBAU DER ARBEIT UND METHODE<br />
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Jugend und öffentliche Räume. Besonderes Augenmerk<br />
wird dabei der vorherrschenden Debatte dieser beiden „Phänomene“ gewidmet: Während<br />
beide tatsächlich eine wichtige Ressource für das gesellschaftliche Gedeihen spielen<br />
(könnten), werden beide vielfach unter dem Aspekt der (nicht mehr gewährleisteten) Sicherheit<br />
diskutiert und abgehandelt. Diese Master Thesis soll dazu beitragen, den Blick wieder<br />
verstärkt auf die Chancen und Potentiale – sowohl die der Jugend als auch die der <strong>öffentlichen</strong><br />
Räume – zu lenken.<br />
Im ersten Abschnitt wird daher der öffentliche Raum definiert und diskutiert. Dabei werden<br />
Raumtheorien andiskutiert, die bei einem offensiven, sozial geprägten Andenken von<br />
Raumfragen behilflich sein können. Insbesondere werden in diesem Abschnitt die speziellen<br />
Bedürfnisse von Jugendlichen an öffentliche Räume erörtert und der Frage nachgegangen,<br />
warum der öffentliche Raum ein derart umstrittener zwischen Jugend- und Erwachsenenwelt<br />
ist.<br />
Daran anknüpfend steht <strong>im</strong> zweiten Abschnitt die Jugend von heute <strong>im</strong> Fokus. Besonderes<br />
Augenmerk liegt dabei auf den Aspekten, die derzeit wesentlich die <strong>öffentlichen</strong> Debatte<br />
prägen: Das aggressive Verhalten, die Jugendkr<strong>im</strong>inalität und der <strong>jugend</strong>liche Vandalismus.<br />
Das dritte Kapitel widmet sich ganz der Sicherheit. Speziell die Sicherheit, die man sich von<br />
Kontrolle und Überwachung – insbesondere der Videoüberwachung - erwartet, wird hier<br />
durchleuchtet. Aufgrund von den drei Parametern der Effizienz der Videoüberwachung<br />
bezüglich Kr<strong>im</strong>inalitätsprävention, Sicherheitsempfinden und den tatsächlich überwachten<br />
Personen wird aufgrund vorliegender Studien die Wirkung von Videoüberwachung untersucht.<br />
Auch der Frage nach den tieferen Ursachen des Siegeszuges der Videoüberwachung<br />
wird hier nachgegangen. Schließlich werden hier auch unerwünschte „Nebenwirkungen“<br />
der Kameraüberwachung diskutiert. Grundsätzliches soll die Frage geprüft werden, ob die<br />
Videoüberwachung ein taugliches Mittel <strong>im</strong> Management von <strong>öffentlichen</strong> Plätzen ist.<br />
4
III. LÖSUNGSANSÄTZE<br />
Unabhängig davon, ob sich die Videoüberwachung <strong>im</strong> Zuge der Analyse als wirksames oder<br />
wirkungsloses Mittel <strong>im</strong> Management der <strong>öffentlichen</strong> Räume darstellt, eine Feststellung<br />
steht <strong>im</strong> (<strong>öffentlichen</strong>) Raum: Der <strong>im</strong>mens wichtige Bereich „Öffentliche Plätze und Gesellschaft“<br />
– der Fokus auf Jugendliche – sollte <strong>im</strong> sozialen Sektor eine wichtigere Rolle<br />
spielen und verdient mehr Aufmerksamkeit.<br />
Sozialmanagement kann sich eines reichen Fundus an Methoden bedienen. In der Verknüpfung<br />
von „Wissen was Sache ist“ (Inhalt) und „Wissen wie etwas zu tun ist“ (Sozialmanagementmethoden)<br />
verbirgt sich möglicherweise ein Schlüssel zum Öffnen der Problem-<br />
Büchse (oder Schatzkiste) „Jugend <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum“.<br />
Daher versucht diese Thesis <strong>im</strong> abschließenden Abschnitt – anknüpfend an bisherige Erfahrungen<br />
– mit Methoden des Projektmanagements ein Modell zu entwickeln, das für Gemeinden<br />
eine Handreichung darstellen kann, den <strong>öffentlichen</strong> Raum – je nach Ergebnis dieser<br />
Arbeit begleitend oder alternativ zur Kontrolle und Überwachung – sozial zu denken<br />
und sozial zu managen.<br />
5
1 ÖFFENTLICHER RAUM<br />
Jede/r nutzt ihn, jede/r nutzt ihn anders, jede/r versteht darunter etwas anderes: Kaum et-<br />
was ist so allgegenwärtig, vielgenutzt und trotzdem (aufgrund der Selbstverständlichkeit des<br />
Da-Seins) so wenig reflektiert wie der öffentliche Raum. Jede/r versteht darunter etwas an-<br />
deres: Die Straße, den örtlichen Hauptplatz, oder den Bereich des Lieblingscafés, der <strong>im</strong><br />
Freien liegt und an schönen Tagen zum Verweilen einlädt. Auch die (private) Einkaufspas-<br />
sage oder der städtische Park kommen für diese Assoziation in Frage. Fakt ist: Die rechtli-<br />
che (Eigentums)Situation spielt in der Regel für die Wahrnehmung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
keine Rolle. Grundsätzlich wird das als öffentlich wahrgenommen, wo sich (mehrere) Men-<br />
schen treffen und ihrer (Freizeit)Beschäftigung nachgehen. Nachdem es viele Varianten der<br />
Nutzung und des Erlebens des <strong>öffentlichen</strong> Raumes gibt, ist auch - abseits der juristischen<br />
(die in der Praxis kaum eine Rolle spielt) - die wissenschaftliche Definition eine schwierige.<br />
1.1 Öffentliche Räume : Versuch einer Definition<br />
Oliver Frey lehnt sich mit seiner Definition an Nissen (Nissen 1998: 170) an und unterscheidet<br />
drei verschiedene Typen von <strong>öffentlichen</strong> Räumen: 1<br />
• „öffentliche Freiräume“ (Grünflächen, Parks, Spielplätze, der Straßen<strong>raum</strong>)<br />
• „Öffentlich zugängliche verhäuslichte Räume“ (Kaufhäuser, U-Bahnhöhe etc.)<br />
• „Institutionalisierte öffentliche Räume“ (Sportanlagen, Vereine, Ballet- und Musikschulen, Schul-<br />
räume, Kirchenräume etc.)<br />
Für ihn wird der (urbane) öffentliche Raum über die dort stattfindende Nutzung definiert.<br />
Dabei spielen die allgemeinen Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten die entscheidende Rol-<br />
le: Alle Räume, die prinzipiell öffentlich aufgesucht und genutzt werden können, sind dem-<br />
1 Quelle: Frey, Oliver: Urbane öffentliche Räume als Aneignungsräume. Lernorte eines konkreten Urbanismus?.<br />
In: Deinet, Ulrich/Reutlinger, Christian (Hrsg.): "Aneignung" als Bildungskonzept der Sozialpädagogik,<br />
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, S 223<br />
6
nach als öffentliche Räume zu verstehen. 2<br />
Schubert geht mit seiner „typologischen Unterscheidung“ auf der Grundlage einer integrier-<br />
ten Theorie des <strong>öffentlichen</strong> Raumes (vgl. Kapitel Integriertes Verständnis von Raum) einen<br />
Schritt weiter und entwickelte „zwölf Settings gelebter öffentlicher Räume“, die die soziale<br />
Produktion urbaner öffentlicher Räume repräsentieren. 3<br />
Tabelle 1: Typologie gelebter öffentlicher Stadträume nach Schubert 4<br />
2<br />
vgl. Frey (2004), S 223<br />
3<br />
vgl. Schubert, Herbert: Städtischer Raum und Verhalten - Zu einer integrierten Theorie des <strong>öffentlichen</strong> Raumes.<br />
Leske+Budrich, Opladen 2000, S 56<br />
4<br />
Quelle: Schubert (2000), S 60<br />
7
1) Diese speziellen „Räume für Öffentlichkeiten“ wurden in den vergangenen Jahr-<br />
zehnten unter verteilungspolitischen Raumvorstellungen geschaffen. Schubert weist<br />
darauf hin, dass die Infrastruktureinrichtungen „sozialräumliche Funktionen der Integrati-<br />
on in Wohngebieten“ 5 übernehmen. Dabei handelt es sich vor allem um Räume <strong>im</strong> öf-<br />
fentlichen Eigentum, die gewisse Zugangsberichtigungen - wie z.B. Eintritt – ver-<br />
langen.<br />
2) Diese auffälligen Orte sind markante Zeichen der tieferen Wurzeln der urbanen<br />
Kultur, die damit sichtbar gemacht und bewahrt werden können. Sie erfordern eine<br />
besondere planerische Behutsamkeit.<br />
3) Im Wohnumfeld entsteht Öffentlichkeit in der Nähe des Wohnbereiches, die an die<br />
privaten Räume unmittelbar angrenzt. „Dieses Grundmuster markiert den Übergang von<br />
privaten Lebensräumen zu halb<strong>öffentlichen</strong>, d.h. eingeschränkt genutzten sowie zu öffentlich ver-<br />
trauten Außenräumen in der Nähe der Wohnungen.“ 6 Dabei handelt es sich sowohl um<br />
Privatgrundstücke als auch um öffentlich gewidmete Flächen.<br />
4) Diese Übergangsbereiche sind in der Regel nur aus der Privatsphäre her zugänglich,<br />
liegen aber <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Wahrnehmungsbereich.<br />
5) Verkehrsflächen und –rändern spielen erst in jüngerer Geschichte eine wichtige Rol-<br />
le <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum. „Sie repräsentieren – meistens als Straßen – Flächen für die Raumüberwindung<br />
mit technischen Fahrzeugen.“ 7<br />
6) Bei diesen „Innenräumen von <strong>öffentlichen</strong> Verkehrsmitteln“ hebt Schubert die Pat-<br />
terns der Sitzordnung hervor, die meist seriell und parallel organisiert ist. Damit<br />
wird das Kontaktrisiko unter Fremden zunehmend min<strong>im</strong>iert.<br />
7) Diese „konsumorientierten Erlebnissorte“ verfügen über eine große Anziehungs-<br />
kraft. Obwohl sie oftmals in privatem Eigentum sind, suggerieren sie urbane Öf-<br />
fentlichkeit. „Sie konstituieren Öffentlichkeit über die Bedingungen des Tausches in Handel so-<br />
5<br />
Quelle: Schubert (2000), S 56<br />
6<br />
Quelle: Schubert (2000), S 56 ff<br />
7<br />
Quelle: Schubert (2000), S 57<br />
8
wie Dienstleistung und sind von einer Tendenz gekennzeichnet, durch die Gestaltung attraktiver<br />
Räume, das Umfeld für die Tauschbeziehungen sowohl für die Kunden als auch für die Geschäftsleute<br />
zu opt<strong>im</strong>ieren.“ 8<br />
8) An diesen Orten kann die Ausführung von privaten Tätigkeiten von Fremden beo-<br />
bachtet werden. Häufig sind diese Räume in privatem Eigentum, aber auch Einrich-<br />
tungen durch öffentliche Träger und Nischen an Verkehrswegen sind damit ge-<br />
meint.<br />
9) Die Mitte von Siedlungen wird durch archetypische Raumvorstellungen besonders<br />
hervorgehoben. „Diese Orte werden nicht nur als ‚Herz’ und als historische Ke<strong>im</strong>zelle von<br />
Städten und Siedlungen inszeniert, sondern auch aktiv so gelebt.“ 9<br />
10) Dieser „vergessene“ Raumtyp befindet sich zwar meist in privater Hand, ist aber<br />
vor allem durch Jugendliche und Kinder (als Spielfläche oder Treffpunkt) angeeig-<br />
net worden.<br />
11) Diese neuere Raumvorstellung sieht unter einer netzwerkorientierten Perspektive<br />
den „Austausch, der unter Menschen außerhalb ihrer Privatsphäre stattfindet, als konstitutiv für<br />
Öffentlichkeit“ 10 an. Da hier der räumliche Kontext keine Rolle spielt, müssen diese<br />
Austauschsorte nicht lokal verankert sein: „Ihre Orte erweitern das gewohnte Spektrum von<br />
Vorstelllungen öffentlicher Außenräume um sozial konstituierte Kommunikationsräume wie Ver-<br />
einräume und Treffpunkte, die von den traditionellen Orten urbaner Öffentlichkeit – wie zum Bei-<br />
spiel zentrale Stadtplätze, öffentliche Infrastruktureinrichtungen, Konsumfeld und Wohnnahbereiche<br />
– relativ unabhängig sind.“ 11<br />
12) Diese Raumvorstellung ist eine nicht physikalische, schafft aber <strong>mittels</strong> lokalem Be-<br />
zug und Kommunikationsmöglichkeit Öffentlichkeit.<br />
Diese weitgefasste Definition von Schubert dokumentiert sichtbar, wie ein neues Verständ-<br />
8<br />
Quelle: Schubert (2000), S 57<br />
9<br />
Quelle: Schubert (2000), S 58<br />
10<br />
Quelle: Schubert (2000), S 58<br />
11<br />
Quelle: Schubert (2000), S 58<br />
9
nis von Raum weit über die naturwissenschaftliche Sichtweise hinausgeht.<br />
1.2 Die Verdinglichung des Raumes als Grundproblem<br />
Der Planung und den Planungswissenschaften liegt bei der Sichtweise auf den <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum in der Regel ein naturwissenschaftliches Raumverständnis zu Grunde. Ausgehend aus<br />
der Antike (Raum als Schachtel) und angelehnt an Newton wird mit dem „absoluten Raum“<br />
ein klassisches Bild der Physik fortgeschrieben, das den Raum und die körperlichen Objekte<br />
darin entkoppelt. In diesem Raumbild ist der funktionale Kontext der gesellschaftlich-<br />
sozialen Inhalte völlig ausgeblendet. Der Raum scheint dabei völlig unabhängig zu sein von<br />
den Menschen, die diesen organisieren und in ihm leben. Albert Einstein hat bereits 1954<br />
darauf hingewiesen, dass die Vorstellung eines leeren Raumes (des „Container“-Raums), der<br />
unabhängig von den Körpern existiert, selbst für die Naturwissenschaften unbrauchbar<br />
ist. 12 Nichts desto trotz hat sich in den Planungswissenschaften der relationale Ansatz (in<br />
dem Raum und Materie eine Einheit bilden) noch nicht sehr verbreiten können. Weil die<br />
Aufgaben der Planung und Gestaltung auf der Grundlage der euklidischen Geometrie gelöst<br />
werden, hat sich das klassisch physikalische Raumverständnis in der Praxis und in der<br />
Wahrnehmung nachhaltig gefestigt. „In den Disziplinen Städtebau, Architektur und Raumplanung<br />
herrscht zumeist die Vorstellung von ‚objektiven’ Räumen, die vermessbar und abgrenzbar sind. Dabei wird<br />
der öffentliche Raum auf ein neutrales Gefäß reduziert, das materielle, körperliche Objekte in sich auf-<br />
n<strong>im</strong>mt.“ 13<br />
Die soziale Raumnutzung wird vom physikalischen Raumverständnis abgespalten und als<br />
eigener Typ den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften zugeführt. 14 Die klassisch-<br />
physikalisch orientierten Planungszugänge orientieren sich am Modell einer „Stadtbildpla-<br />
12 Quelle: Löw, Martina: Einstein, Techno und der Raum. Überlegungen zu einem neuen Raumverständnis in<br />
den Sozialwissenschaften. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der<br />
Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche<br />
Literatur, Berlin 2007, S 9 ff<br />
13 Quelle: Frey (2004), S 219 ff<br />
14 vgl. Schubert (2000), S 11 ff<br />
10
nung“, die sich gerade dadurch verselbstständigt und zersplittert: „Relativ isoliert voneinander<br />
schaffen die Professionen der Architekten und Stadtplaner öffentliche Räume nach dem Paradigma der<br />
Rahmung durch Bebauung; die Professionen der Frei<strong>raum</strong>planer gestalten die dabei zwischen den privaten<br />
Grundstücken entstehenden Flächen nach dem Paradigma des <strong>öffentlichen</strong> Frei<strong>raum</strong>s und wieder andere<br />
konzipieren die verbindenden Verkehrsflächen. Dies führt <strong>im</strong> Wettbewerb, wer die schönsten <strong>öffentlichen</strong><br />
Räume schafft, zu einer eklektischen Design-Orientierung.“ 15 Da es aber keinen verbindlichen bzw.<br />
verständlichen Kodex für die gestalterischen Maßnahmen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes gibt,<br />
entstehe eine große Un<strong>sicherheit</strong> und Unübersichtlichkeit: „Der Besitznahme öffentlicher Räume<br />
durch den Autoverkehr, der unkoordinierten Best<strong>im</strong>mung des Stadtbildes durch die Wirtschaftskraft der<br />
Bauherren oder auch der Schicht der Reklamezeichen, die den <strong>öffentlichen</strong> Raum in zentralen Bereichen der<br />
Städte geradezu überwuchert, wird eine stadtzerstörende Wirkung zugeschrieben.“ 16<br />
Die Verdinglich des Raumes und seine Sicht als „Container“ birgt auch – <strong>im</strong> speziellen<br />
Blick auf junge Menschen - Gefahren in sich, wie Christian Reutlinger herausarbeitet: „Da-<br />
durch drohen die biographischen Bewältigungsformen und die sozialemotionalen Bildungsaufgaben der Le-<br />
bensphase Jugend, also die Lebensbereiche von Jugendlichen, die nicht nach der systemrationalen Logik funk-<br />
tionieren, in der Unsichtbarkeit zu versinken. Deshalb muss vor jeder Verdinglichung des Sozial<strong>raum</strong>s<br />
gewarnt werden.“ 17<br />
1.3 Integriertes Verständnis von Raum<br />
Baulich-gestalterische Raumbildungen sind alleine nicht in der Lage, Öffentlichkeit zu er-<br />
zeugen, sondern können diese nur aufnehmen. Öffentlichkeit ist grundsätzlich ein gesell-<br />
schaftliches Phänomen, das von sozialen Entwicklungen best<strong>im</strong>mt wird. Um dieses erwei-<br />
terte Raumverständnis beschreiben zu können, wurde aufbauend auf Henri Lefebvre das<br />
15 Quelle: Schubert (2000), S 22<br />
16<br />
Quelle: Schubert (2000), S 21<br />
17<br />
Quelle: Reutlinger, Christian: Sozialpädagogische Räume - sozialräumliche Pädagogik. Chancen und Grenzen<br />
der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in<br />
der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für<br />
wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 23<br />
11
„Paradigma der sozialen Produktion urbaner Räume“ abgeleitet. Es konzentriert sich dar-<br />
auf, dass Raummuster vom System der sozialen und gesellschaftlichen Organisation ge-<br />
schaffen wurden. Raum, Zeitgeschichte und Lebensformen sind in dieser integrierten Theo-<br />
rie ineinander verflochten. Unser Verständnis von Raum, das durch Wahrnehmung, Vor-<br />
stellung und durch Lebensvollzug <strong>im</strong> Sinne gelebter Räumlichkeit generiert wird, repräsen-<br />
tiert dabei die Entwicklung der wissenschaftlichen Raum-Erkenntnis <strong>im</strong> historischen Pro-<br />
zess: 18<br />
1. Der wahrgenommene Raum bezieht sich auf materiell–physikalische Räumlichkeit. Im<br />
Alltag orientiert sich die Wahrnehmung an den Routinen der Raumnutzung.<br />
2. Der vorgestellte Raum entspricht einem objektivierten Denkprinzip. Denn eine konkrete<br />
Räumlichkeit muss auf eine formale Raumvorstellung reduziert werden, wenn eine plange-<br />
leitete Gestaltung natürlicher und gebauter Umwelten beabsichtigt ist.<br />
3. Die gelebte Räumlichkeit bezieht sich auf die komplexe Gesamtsituation. Wie eine pasto-<br />
se Kruste überlagern sozial erzeugte Symbole den physikalischen Raum und verfestigen<br />
sich zur gelebten Räumlichkeit.<br />
Der öffentliche Raum spiegelt damit die Entwicklung der Gesellschaft und der Individuen<br />
und darf daher auch nicht zur Sache verdinglicht werden. Der Raum ist auch nicht als Ge-<br />
genstand abseits der historischen Entwicklung zu behandeln, sondern es gilt, ihn vielmehr<br />
„als sozialräumlichen Prozess aufzufassen, in dem sich Raum- und Sozialfiguren korrespondierend wan-<br />
deln.“ 19<br />
Frey weist darauf hin, dass die Nutzer/innen , die sozialen Akteur/innen in den Räumen,<br />
durch inkorporierte soziale Strukturen mit sozialen Erfahrungen und einer verinnerlichten<br />
Geschichte gekennzeichnet sind: „Aus der Wechselbeziehung zwischen den objektivierten sozialen<br />
Strukturen der Materie und den sie nutzenden Akteuren entsteht ihrerseits wiederum inkorporierte Ge-<br />
18 Quelle: Schubert (2000), S 102<br />
19 Quelle: Schubert (2000), S 36<br />
12
schichte. Die <strong>öffentlichen</strong> Räume sind Ergebnis einer gesellschaftlichen Produktion in einem langfristigen<br />
historischen Entwicklungsprozess.“ 20<br />
Die wesentlichen Linien in diesem sozialräumlichen Prozess nach Schubert sind folglich<br />
dargestellt, um die Entwicklung und die Situation des <strong>öffentlichen</strong> Raumes verständlich zu<br />
skizzieren.<br />
1.3.1 Verhäuslichung von Funktionen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
Durch die großen technischen Errungenschaften (Elektrifizierung, Motorisierung und damit<br />
einhergehend neue Standards des Komforts wie Beheizung, Innenbeleuchtung, Abfallent-<br />
sorgung etc.) erlebte die Verhäuslichung <strong>im</strong> 18. Jahrhundert einen wesentlichen Schub. Vie-<br />
le Tätigkeiten, die vorher <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum ausgeführt wurden, wurden somit in die<br />
Innenräume verlagert. Diese Verhäuslichung ist als ein langanhaltender Trend während des<br />
Zivilisationsprozesses zu verstehen, der 3 markante Veränderungen bewirkt(e):<br />
1. Die Straßenöffentlichkeit verlagerte sich in gemeinschaftliche Höfe und privates<br />
Wohnen<br />
2. Lokale Märkte auf städtischen Plätzen verlagerten sich in öffentliche Bereiche<br />
der Markzentren und zum großflächigen Einzelhandel<br />
3. Soziale Treffpunkte auf Stadtplätzen wanderten in soziokulturelle Einrichtungen<br />
(Vereinshe<strong>im</strong>e, Kultureinrichtungen, Gaststätten). 21<br />
„Dieser Prozess gipfelt in einer Entlokalisierung sozialer Lebenszusammenhänge, die einerseits in einer<br />
Virtualisierung des Öffentlichen und andererseits in der Tendenz der Globalisierung und Weltsystembildung<br />
Ausdruck findet.“ 22<br />
Durch diesen Prozess der Verhäuslichung wurde die Bedeutung von privaten und über-<br />
dachten Räumen erhöht. Damit wurde einerseits der öffentliche Raum in Innenräume trans-<br />
20<br />
Quelle: Frey, (2004), S 221<br />
21<br />
vgl. Schubert (2000), S 38<br />
22<br />
Quelle: Schubert (2000), S 39<br />
13
feriert, andererseits wurden diese Innenräume als öffentliche Räume inszeniert. Diese in-<br />
szenierten (und privaten Räume) wie beispielsweise Einkaufszentren oder Parkhäuser ver-<br />
decken mit dem suggerierten <strong>öffentlichen</strong> Raum den privaten Charakter dieser Räume und<br />
die dahinter liegenden wirtschaftlichen Interessen. 23 Mit einer fatalen Wirkung auf den tat-<br />
sächlich <strong>öffentlichen</strong> Raum: „In den Köpfen der Bevölkerung setzt sich dieses Bild des sicheren und<br />
sauberen Raumes, des anständigen Benehmens der Passanten und des Ausschlusses von Personen mit abwei-<br />
chendem Verhalten als Idealtyp des Öffentlichen fest. Akzeptanz als öffentliche Räume finden nur urbane<br />
Bereiche, die die gesellschaftlichen Widersprüche ausgrenzen bzw. überdecken. Dabei wird kaum wahrge-<br />
nommen, dass es gerade die Rahmenbedingungen des Privateigentums sind, die solche klaren Ordnungsstruk-<br />
turen erlauben. Die <strong>öffentlichen</strong> Räume sind demgegenüber Spiegel der Stadtgesellschaft; ihre Nutzung lässt<br />
sich nicht in derselben Weise regulieren.“ 24<br />
Aber auch eine Ausdehnung von privaten Aktivitäten in den <strong>öffentlichen</strong> Raum hinein ist<br />
zu beobachten: Beispiele dafür sind Werbetafeln in Fußgängerzonen oder Sitzgelegenheiten<br />
der Gastronomie. „Dort dominieren dann auch private Umfangsformen und inszenierte Sicherheiten und<br />
Ordnungen; <strong>im</strong> weitestgehenden Fall kommt es zu einer Gleichsetzung öffentlicher Räume und dem Ein-<br />
kaufsbereich.“ 25 Es können allerdings auch positive Auswirkungen von diesen Privatisierungs-<br />
tendenzen ausgehen: diese Initiativen können beispielsweise Denkanstöße für den <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum bewirken und neue Qualitätsstandards kreieren. 26<br />
1.3.2 Prägung durch Mobilitätsstrukturen<br />
Durch die zunehmende Mobilität wurde auch die Öffentlichkeit zunehmend verleugnet,<br />
was dazu führte, dass die konsequente Trennung der Funktionen <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum be-<br />
gann. „Die wohl empfindlichste Einschränkung eines ungestörten Aufenthaltes in verschiedenen <strong>öffentlichen</strong><br />
Räumen der Stadt ist der in dem letzten halben Jahrhundert rapide gestiegene motorisierte Individualver-<br />
23<br />
vgl. Schubert (2000), S 39<br />
24<br />
Quelle: Schubert (2000), S 40<br />
25<br />
Quelle: Herlyn, Ulfert/Seggern, Hille/Heinzelmann, Claudia/Karow, Daniela: Jugendliche in <strong>öffentlichen</strong> Räumen<br />
der Stadt. Leske+Budrich, Opladen 2003, S 19<br />
26<br />
vgl. Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 19<br />
14
kehr.“ 27<br />
Durch die Konzentration auf die Planung des Straßenverkehrs wurden die Gebäude entlang<br />
der Straßen nur mehr als Fassade wahrgenommen und die Schnittpunkte privater Interessen<br />
hin zum <strong>öffentlichen</strong> Raum hin nicht beachtet. Der Aufenthalt auf der Straße ist durch die<br />
moderne Fortbewegungstechnik gehemmt, der öffentliche Raum verliert seine unabhängige<br />
Erfahrungsqualität. Eine neue Form der Isolation entsteht, weil die Menschen in ihren<br />
Fortbewegungsmitteln eingeschlossen sind und dem Raum kaum mehr als diesen Zweck<br />
der Fortbewegung zuschreiben. Folglich wird die Straße nicht mehr als öffentlicher Raum,<br />
sondern pr<strong>im</strong>är dem Verkehrssystem zugerechnet. Fußgänger treten auf diesen Straßen<br />
nicht mehr als Akteure auf, die den <strong>öffentlichen</strong> Raum konstituieren, sondern sind vielmehr<br />
in das Verkehrssystem inkludiert. Sie können aufgrund des langsamen Tempos zwar noch<br />
Kommunikationsangebote nutzen, die Kommunikationsfunktion ist allerdings min<strong>im</strong>al ge-<br />
worden. 28<br />
Dies hat auch Auswirkungen auf das konkrete Leben in der Öffentlichkeit: „Je mehr die Öf-<br />
fentlichkeit in den Städten von einer hohen räumlichen Mobilität gekennzeichnet ist, desto mehr wird das<br />
Schweigen zu einem Schutzwall individueller Privatheit. Es formte sich als persönliches Recht heraus, nicht<br />
von Fremden angesprochen zu werden und auch selbst die anderen zu ignorieren, um nicht deren Privatsphä-<br />
re zu verletzen. Im Gegensatz zu vorangegangenen Jahrhunderten wird die Begegnung <strong>im</strong> urbanen öffentli-<br />
chen Raum nicht mehr von Konventionen der Höflichkeit bei anonymer Kontaktaufnahme geprägt, sondern<br />
von weitgehender Ignoranz, als ob Menschen, die sich <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum begegnen, allein dort wären,<br />
bzw. der jeweilig andere nicht existent wäre.“ 29<br />
In der räumlichen Umsetzung findet man diese Prägung beispielsweise an der Sitzordnung<br />
in <strong>öffentlichen</strong> Verkehrsmitteln wieder (Parallelisierung des Blickes und serielle Anord-<br />
nung).<br />
27 Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 17<br />
28 vgl. Schubert (2000), S 40 ff<br />
29 Quelle: Schubert (2000), S 41<br />
15
1.3.3 Mediatisierung städtischer Öffentlichkeit<br />
Prozesse wie z.B. die Globalisierung haben das Interesse vom Lokalen hin zur Öffentlich-<br />
keit der überlokalen Massenmedien verschoben. Das ursprünglich lokale Politikgeschehen<br />
(das sich sozusagen vor den eigenen Augen abspielte) wurde durch die Herstellung einer<br />
politischen Öffentlichkeit durch die modernen Massenmedien übernommen und der Erfah-<br />
rungs<strong>raum</strong> damit entscheidend ausgeweitet . „Unter diesem erweiterten Bezugshorizont ist die Integ-<br />
ration in die Stadtöffentlichkeit vom einzelnen Individuum kaum noch zu leisten. Durch die Entwicklung<br />
der Massenmedien hat der öffentliche Raum der Stadt seine politischen Funktionen weitgehend an den privaten<br />
Raum verloren.“ 30<br />
Interessen, die auf der Straße artikuliert werden, zeigen sich daher als politisch schwach. Die<br />
Massenmedien haben die Aufgaben der Öffentlichkeit übernommen. Durch die neuen In-<br />
formations- und Kommunikationstechnologien verlagerten sich zunehmend Funktionen<br />
aus dem <strong>öffentlichen</strong> Raum hin in den privaten Bereich (Fernsehen als Information, Inter-<br />
net-Chatten als Kommunikation). Ein Aspekt dabei ist auch die Verlagerung der privaten<br />
Sphäre hin zu den Umlandgemeinden. „Da Privatheit nicht mehr in der Wechselbeziehung zur Öf-<br />
fentlichkeit gewonnen werde, verlieren die urbanen <strong>öffentlichen</strong> Räume nach der politischen nun auch die lo-<br />
kale Funktion. Räumliche Nähe ist kein vorrangiges Kriterium mehr für die Wahl von Wohn- und Arbeits-<br />
oder auch Infrastrukturstandorten.“ 31<br />
Während in diesem Prozess die Menschen verstärkt in private Räume hineingehen, verlas-<br />
sen die Medien diese Privatsphäre und drängen in den <strong>öffentlichen</strong> Raum, um diesen als<br />
Ort der Massenkommunikation zu nutzen (beispielsweise Großbildschirme in U-<br />
Bahnstationen und auf zentralen Plätzen.) Dadurch fördern sie eine weitere Anonymisie-<br />
rung des <strong>öffentlichen</strong> Lebens, weil dadurch Begegnungen zwischen den Menschen vermie-<br />
den werden können.<br />
30 Quelle: Schubert (2000), S 42<br />
31 Quelle: Schubert (2000), S 43<br />
16
1.3.4 Verinselung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
Den gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen folgt die soziale und räumliche Fragmen-<br />
tierung. Voneinander relativ isolierte Erfahrungs- und Milieuräume führen zu einer Verinse-<br />
lung der Stadt. Schubert bezeichnet den dahinter liegenden Kontext als „Mikro-Makro-<br />
Paradox“. So kann man zwar <strong>mittels</strong> Internet weltweit kommunizieren, hat allerdings auf-<br />
grund fehlender Nah<strong>raum</strong>-Kontakte keine Bindungen <strong>im</strong> Wohnumfeld. „Bei dieser isolierten<br />
Massenkommunikation unter Bedingungen einer ‚t<strong>im</strong>e-space-compression’ entstehen Paradoxien wie ‚getrennte<br />
Nähe’ oder ‚abwesende Anwesenheit’.“ 32<br />
Diese Prozesse gehen an die Substanz der <strong>öffentlichen</strong> Räume: „Sennett hebt hervor, dass die<br />
Fragmentierung der Stadt das Wesensmerkmal des <strong>öffentlichen</strong> Raums auflöst: Die Überlagerung mehrerer<br />
Funktionen auf einer Fläche, die auch Nutzungsmischung genannt wird und Grundlage für einen komple-<br />
xen Erfahrungs<strong>raum</strong> ist, wurde vom Prinzip der Funktionstrennung beseitigt (1983, 375). Die wachsen-<br />
den Nutzungskonkurrenzen in der Stadt drängen <strong>öffentlichen</strong> Nutzungen weiter in den Privatbereich zu-<br />
rück. Bei knapper werdenden Flächenressourcen verringern die verkehrlichen und die wirtschaftlichtechnischen<br />
Nutzungen die Nutzbarkeit von <strong>im</strong>mer mehr Bereichen als öffentliche Räume.“ 33<br />
Dieser Prozess ist besonders bei Kindern (Stichwort: organisierte Kindheit) und Jugendli-<br />
chen nachvollziehbar: Die Verdrängung von jungen Menschen aus den <strong>öffentlichen</strong> Räu-<br />
men hin zu eigens geschaffenen - verinselten – Angeboten (Spielplätze, Jugendeinrichtun-<br />
gen, Sportverein ....) ist überall beobachtbar, eine „Straßenkindheit“ ist heute kaum mehr<br />
wo auszumachen: „Die Kinder agieren <strong>im</strong>mer mehr als kleine Erwachsene, die mit ihren Eltern ‚Situa-<br />
tionsdefinitionen aushandeln’ und Zeitpläne koordinieren. Zugleich werden sie zu selbstständigen Nutzern<br />
der städtischen Infrastruktur.“ 34<br />
Die (isolierte) Entwicklung der Innenstädte sieht Schubert ebenfalls als Ausdruck dieser<br />
Fragmentierung <strong>im</strong> Zuge der städtisch-räumlichen Funktionstrennung: Während sich cirka<br />
zu Ende des 19. Jahrhunderts diese Bereiche zunehmend in Geschäfts- und Kulturbereiche<br />
32 Quelle: Schubert (2000), S 44<br />
33 Quelle: Schubert (2000), S 45<br />
34 Quelle: Schubert (2000), S 45<br />
17
verwandelten, wurde die Wohnfunktion zunehmend verdrängt.<br />
1.3.5 Spiegelung der sozialen Polarisierung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum<br />
Die Tendenz der Verinselung spiegelt auch die soziale Entmischung wider, die eine wach-<br />
sende Spannung zwischen den Polen von Armut und Reichtum zur Folge hat. „Durch die<br />
zunehmende Verräumlichung sozialer Ungleichheit entschwindet dem <strong>öffentlichen</strong> Raum das entscheidende<br />
Kriterium der sozialen Mischung. Es entsteht eine ‚Stadt der Ausgegrenzten als kaum vernetzte Inseln ortsgebundener<br />
Armut’.“ 35<br />
Durch die tendenzielle Abnahme von ausgleichenden mittleren Wohlfahrtslagen, spitzt sich<br />
der soziale Kontrast zu. Durch Armut und Wohlstand werden die Städte räumlich polarisiert.<br />
Die Spaltung der Stadt zeigt sich anhand dreier D<strong>im</strong>ensionen: 36<br />
1. Die ökonomische Ungleichheit nach Einkommen, Eigentum und Position auf<br />
dem Arbeitsmarkt<br />
2. Soziale Unterschiede nach Bildung, Gesundheit, sozialer Teilhabe und Position<br />
auf dem Wohnungsmarkt<br />
3. Kulturelle Unterschiede nach ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Verhaltens-<br />
formen und normativen Orientierungen<br />
Das Konzept der residentiellen Segregation – die ungleiche Verteilung der Wohnstandorte<br />
sozialer Gruppen in der Stadt bzw. ihren Teilen, steht <strong>im</strong> Mittelpunkt aller stadtsoziologischen<br />
Ansätze. 37<br />
35 Quelle: Frey (2004), S 231<br />
36<br />
vgl. Schubert (2000), S 46<br />
37<br />
vgl. Dangschat, Jens S./Frey, Oliver: Stadt- und Regionalsoziologie. In: Kessl, Fabian/Reutlinger, Christian/Maurer,<br />
Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.): Handbuch Sozial<strong>raum</strong>. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden<br />
2005, S 155<br />
18
Diese Segregation des öffentliches Raumes hat sowohl Nach-, als auch Vorteile, wie Hartmut<br />
Häußermann und Walter Siebel (2002) argumentieren: 38<br />
Als Nachteile werden genannt:<br />
• Ökonomische Nachteile durch schlechteres Angebot, kaum informelle Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
in haushaltsbezogenen Dienstleistungen und geringe Instandsetzung und Modernisierung <strong>im</strong> Stadt-<br />
teil<br />
• Politische Nachteile durch negative Etikettierung und Stigmatisierung<br />
• Soziale Nachteile, da keine für den Aufstieg hilfreichen Kontakte <strong>im</strong> Viertel geschlossen werden<br />
können, Vorurteile durch fehlende Berührungspunkte zwischen Klassen und Gruppen.<br />
Aber auch Vorteile entstehen durch die Segregation:<br />
• Ökonomische Vorteile durch Wohngelegenheiten und Verdienstmöglichkeiten in Gemeinschaften<br />
von Zugewanderten<br />
• Politische Vorteile durch gemeinsame Interessensbildung- und Verständigungsprozesse<br />
• Soziale Vorteile durch Gefühle von Vertrautheit, Netzwerke und eine ethnische Infrastruktur<br />
In der aktuellen Stadtforschung wird zwischen einer hilfreichen, freiwilligen Segregation<br />
und einer erzwungenen Segregation unterschieden. Diese nachvollziehbare Gegenüberstel-<br />
lung macht allerdings analytisch und sozialpolitisch-praktisch wenig Sinn, da zwischen bei-<br />
den Formen funktionale Bezüge stehen, „denn die ‚erzwungene’ Segregation ist auch das Ergebnis<br />
‚freiwilligen’ Wegzuges der Mittelschichten aus ehemals sozial gemischten Gebieten.“ 39<br />
In der Raumsoziologie gelten die traditionellen Konzepte von Klassen und Schichten zur<br />
Analyse sozialer Ungleichheiten seit den 1980er Jahren überholt. Da sich der Zusammen-<br />
hang zwischen Bildungsstatus, beruflicher Position und Einkommen <strong>im</strong>mer stärker lockerte,<br />
wird heute in neuen soziokulturellen D<strong>im</strong>ensionen sozialer Ungleichheit gedacht und von<br />
38<br />
Quelle: Löw, Martina/Steets, Silke/ Stoetzer, Sergej: Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie, Verlag Barbara<br />
Budrich, Opladen & Farmington Hills 2008, S 42<br />
39<br />
Quelle: Dangschat/Frey (2005), S 156<br />
19
sozialen Lagen, sozialen Milieus und Lebensstilen ausgegangen. 40<br />
Diese Lebensstile finden sich auch in verräumlichter Form wieder: „Die <strong>öffentlichen</strong> Räume der<br />
gespaltenen Stadt bilden diese sozialen Disparitäten auch visuell ab. Der Stadtt<strong>raum</strong> stellt dabei nicht mehr<br />
nur Flächen für Infrastruktur, Wohngebiete und Verkehrsanlagen zur Verfügung, sondern fungiert ver-<br />
mehrt als Träger von stilspezifischen Bedeutungen. Die semiotische Umrüstung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes mit<br />
Symbolen, Zeichen und Design prägt entsprechende Images eines sozialen Status unter den Stadtquartieren.<br />
Der öffentliche Stadt<strong>raum</strong> wird zum Darstellungsmedium lokaler Konstellationen: so ist <strong>im</strong> urbanen öffent-<br />
lichen Raum sofort zu erkennen, ob man sich beispielsweise in einem Quartier des Tätowierungsmilieus oder<br />
des aufstiegsorientierten neuen Bürgertums befindet.“ 41<br />
Diese zeichenhafte Markierung von Stadträumen – die dadurch ein entsprechendes Image<br />
erhalten 42 - weist darauf hin, dass es keine klare Ordnung der Sozialstruktur gibt. Ein klares<br />
Oben und Unten der Schichten ist einer Unübersichtlichkeit von Lebensstilen und sozialen<br />
Milieus gewichen. Ein gemeinsames Milieu entwickelt sich aufgrund von Ähnlichkeiten in<br />
Lebensvollzügen, Verhaltensmustern und Einstellungen (Geschmack, Vorlieben, Bildung,<br />
soziale Herkunft) und kultureller Kompetenz. Entlang dieser Unterschiedlichkeiten von Le-<br />
bensstilen und Milieus erfährt die Stadt eine zusätzliche Selektivität: Bei jüngeren und Milie-<br />
us mit hohem Kulturkapital erfährt der öffentliche Raum verbreitet symbolische Auf- und<br />
Umwertungen, bei hohen und niedrigen Statusgruppen wird der öffentliche Raum eher ne-<br />
gativ assoziiert (Gefahr, Anonymität, Unkontrollierbarkeit ...). Gruppen mit einer positiven<br />
Bewertung des <strong>öffentlichen</strong> Raums nutzen diesen als Bühne (öffentliche Präsenz, „Herum-<br />
lungern“, Graffitis ...). Weil sich die Nutzer/innen stilspezifisch pluralisierter öffentlicher<br />
Räume nicht als Repräsentanten verschiedener Lebensstile, sondern als Fremde begegnen,<br />
entstehen Un<strong>sicherheit</strong>en. 43<br />
„Jedes Milieu bzw. jeder Lebensstil hat seinen eigenen Regelkanon entwickelt, der Außenseitern fremd ist.<br />
Die Fremdheit wird durch abweichende Körper- und Modezeichen sowie eigenartige Verhaltenskonventionen<br />
40 vgl. Dangschat /Frey (2005), S 157<br />
41<br />
Quelle: Schubert (2000), S 46<br />
42<br />
vgl. Frey (2004), S 222<br />
43<br />
vgl. Schubert (2000), S 46 ff<br />
20
nachdrücklich unterstrichen. Was für die Insider der eigenen Subkultur als Erkennungssymbol fungiert,<br />
wirkt zwischen den kulturell unterschiedlichen urbanen Lebensformen ab- und ausgrenzend. Die gegenseitige<br />
Ignoranz bei der Begegnung kann in rationaler Begründung als ‚Toleranz’ ausgegeben werden (vgl. Walzer<br />
1998,66), ist affektiv häufig aber angstbeladen. Denn die Regeln der Benutzung öffentlicher Räume treten<br />
über nonverbale Kommunikation in Widerspruch zueinander (vgl. Watzlawick et al. 1969), wobei die Negation<br />
der eigenen Regeln durch andere bedrohlich wirkt.“ 44<br />
1.3.6 Diffusion und Verflüssigung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
Durch die Entwicklung von Verkehr und (technisch unterstützter) Kommunikation hat sich<br />
die Orientierung vom <strong>öffentlichen</strong> Raum wegverlagert und damit die subjektive Raum-<br />
wahrnehmung als flüchtig und unstet beeinflusst. Der subjektive Aktions- und Orientie-<br />
rungs<strong>raum</strong> reicht weit über die eigene Stadt hinaus, es wird zwischen globalen und regiona-<br />
len Orten „geswitcht“. Der Fokus liegt nicht mehr <strong>im</strong> unmittelbaren Umfeld, die Abhän-<br />
gigkeiten und Interaktionen finden nicht mehr innerhalb eines „prinzipiell koordinierten<br />
Raumes“ statt. Die Aufgabe dieser prinzipiellen Koordination des Raumes hat den Verlust<br />
eines festen Raumschemas von gegliederten Orten zur Folge. Nach Manuel Castell entwi-<br />
ckelt sich dadurch eine neue Raumlogik, die mit der Begrifflichkeit „Space of Flows“ beschrieben<br />
wird. 45<br />
Dieser Raum der Ströme, der nach Castell aus drei Schichten besteht, ersetzt sozusagen den<br />
Raum der Orte: 46<br />
1. Kreislauf der elektronischen Innovation: Die neue Technologie bildet die materielle<br />
Grundlage des fließenden Raumes. In den erzeugten Netzwerken existieren Räume<br />
nicht mehr per se, sondern werden über Ströme definiert. Die realen Plätze ver-<br />
schwinden zwar nicht, werden aber vom Netzwerk absorbiert.<br />
44 Quelle: Schubert (2000), S 47 ff<br />
45 vgl. Schubert (2000), S 48 ff<br />
46 vgl. Schubert (2000), S 49<br />
21
2. Netzwerk von Knoten und Schnittpunkten: Entscheider-Eliten spannen das Netz-<br />
werk der Weltwirtschaft über die „Global Cities“. Dahinter staffeln sich die nachge-<br />
ordneten Ökonomien (nationale, regionale) und sind über „ihre Knotenpunkte mit der<br />
globalen Ökonomie nach der Logik der Kommunikationstechnologien flexibel verbunden“. 47<br />
3. Globale Organisation der Entscheider-Eliten: Die Eliten sind in ihren Vernetzungen<br />
und Beziehungen kosmopolitisch ausgerichtet. „Während die Bevölkerung ortsbezogen<br />
bleibt, konstituiert sich der Macht<strong>raum</strong> der Eliten global.“ 48<br />
Räumlich ist die Ausdehnung der etablierten Netzwerke an der internationalen Vereinheitli-<br />
chung von Lebensstilen und Symbolen erkennbar: Hotels oder VIP-Lounges an Flughäfen<br />
unterscheiden sich kaum mehr. Im Gegensatz dazu bleiben die Netzwerke der marginalen<br />
Schichten lokal ausgerichtet.<br />
„Der urbane öffentliche Raum löst sich somit als konkreter Sozial<strong>raum</strong> in eine Koexistenz verschiedener<br />
sozialer, kultureller und ökonomischer Logiken innerhalb derselben räumlichen Struktur auf (...) Er ist<br />
(...) nicht mehr eine grundlegende Existenzbedingung, sondern wegweisender Orientierungs<strong>raum</strong>. Dies ist der<br />
Grund, warum die Debatte um den <strong>öffentlichen</strong> Raum in der Stadt zum großen Teil auf Designfragen seiner<br />
konsumgerechten Gestaltung reduziert wird.“ 49<br />
1.3.7 Wandel der <strong>öffentlichen</strong> Räume durch die Individualisierung<br />
Heute bewegen sich nicht mehr geschlossene Massen durch den <strong>öffentlichen</strong> Raum, sondern<br />
„Mengen von Individuen, die ihre Wege individuell verrichten und <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum kreuzen“. 50<br />
Traditionelle Regeln lösen sich auf, int<strong>im</strong>ere Kontaktformen (Selbstenthüllungen wie z.b.<br />
sportliche Betätigung, lautes Reden oder auch int<strong>im</strong>ere Einblicke durch lockere Kleidung)<br />
47 Quelle: Schubert (2000), S 49<br />
48 Quelle: ebd.<br />
49 Quelle: Schubert (2000), S 50<br />
50 Quelle: ebd.<br />
22
gewinnen die Oberhand. Verhaltenskonventionen, die eine gewisse Distanz zu sich selbst<br />
herstellen, wurden damit aufgekündigt. „Der Widerspruch, der auf öffentliche Räume ausstrahlt, ist<br />
das Bestreben der Menschen <strong>im</strong> 20. Jahrhundert, emotionale Offenheit und psychologische Authentizität<br />
voreinander zu entwickeln, sich dabei aber gegenseitig dennoch zu kontrollieren.“ 51<br />
Das narzisstische Streben der einzelnen Individuen schreibt sich auch in die Gestaltung des<br />
<strong>öffentlichen</strong> Raumes ein. Schubert nennt folgende Kennzeichen: 52<br />
• Prestigefördernde Oberflächengestaltung<br />
• Erlangung von Bewunderung und Anerkennung<br />
• Heraushebung gegenüber angrenzenden Räumen<br />
• Betonung von emotionalen Erlebnisqualitäten<br />
• Offenheit für alle sozialen Gruppen<br />
Aber auch das individuelle Scheitern – also die negativen Seiten des Narzissmus – sind <strong>im</strong><br />
Raum erkennbar: 53<br />
• Verlust sozialer Bindungen durch die Bevölkerung<br />
• Missraten von Gestaltungszielen zu perfektionistischen Überlegenheitsgesten<br />
• Heftige Schwankungen des Selbstwertes zwischen Festivalisierung und Marginalisierung<br />
• Starke Abwehrreaktionen gegen soziale Randgruppen<br />
• Überschätzung der sozialen Integrationsqualitäten<br />
Durch die Selbstpräsenz in den <strong>öffentlichen</strong> Räumen (Sport, Erlebnisorientierung ...) ge-<br />
winnen die Menschen zurück, was sich durch die gesellschaftliche Modernisierung ver-<br />
flüchtigt hat: „Es sind Situationen, in denen sich die Individuen stark fühlen und das Gefühl verschaffen,<br />
Ursache und Wirkung des Handelns selbst in der Hand zu haben. In einer Zeit schwindender Gewissheiten<br />
wird das Selbst über solche Praktiken der Selbstdarstellung gestützt und braucht für diese Verhaltensschab-<br />
51<br />
Quelle: Schubert (2000), S 51<br />
52<br />
Quelle: Schubert (2000), S 53<br />
53 Quelle: ebd.<br />
23
lonen urbane öffentliche Räume, in deren Nischen sich die Selbste individuell verwirklichen können.“ 54<br />
1.3.8 Informalisierung öffentlicher Verhaltensstandards<br />
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich bestehende Verhaltens- und Klei-<br />
dungsstandards in <strong>öffentlichen</strong> Räumen informalisiert. „Im <strong>öffentlichen</strong> Raum der Städte bedeutet<br />
Informalisierung eine Erweiterung der Toleranzgrenzen bestehender Normen und führt dabei zu deren Auf-<br />
lockerung.“ 55<br />
Was früher verboten war, ist heute akzeptiert und erlaubt. Als Ursachen dafür nennt Schu-<br />
bert eine Lockerung der Normen und ein Nachlassen der Selbststeuerung, aber auch die<br />
verringerten Machtungleichgewichte in den Staatsgesellschaften nach dem zweiten Welt-<br />
krieg. „Der geringere Machtdruck von außen und die größere individuelle Entscheidungsfreiheit führen zu<br />
komplexeren Anforderungsregeln der Selbstkontrolle; dies erschwert es, das Ideal der Selbststeuerung hinrei-<br />
chend umzusetzen. Die Folge ist ein fragiles, unbeständiges Anforderungsniveau der Selbststeuerung; zum<br />
Beispiel resultieren daraus bei Kindern ungleichmäßige und instabile Selbstkontroll-Strukturen.“ 56<br />
1.4 Vom Nutzen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
Besonders in den Städten ist öffentlicher Raum – und damit Öffentlichkeit - eine unabding-<br />
bare Voraussetzung für die Entfaltung einer urbanen Lebensweise, da Urbanisierung als ei-<br />
ne fortschreitende Polarisierung des gesellschaftlichen Lebens in eine öffentliche und priva-<br />
te Sphäre gelesen werden kann. Eine Störung dieser Wechselbeziehung bleibt für eine Entfaltung<br />
von Urbanität nicht ohne Folgen. 57<br />
„Öffentlichkeit stellt den Lebensnerv der verstädterten bürgerlichen Gesellschaf dar, insofern, als die freie<br />
54 Quelle: Schubert (2000), S 53<br />
55 Quelle: Schubert (2000), S 54<br />
56 Quelle: Schubert (2000), S 55<br />
57 vgl. Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 15<br />
24
Zugänglichkeit zu Informationen eine notwendige Voraussetzung für die Demokratie darstellt.“ 58<br />
Für die Einwohner/innen wie auch für Fremde erschließt sich die Stadt von den öffentli-<br />
chen Räumen her. Damit dient dieser Raum nicht nur der Orientierung, sondern hat einen<br />
besonderen Stellenwert für die Identifikation. 59<br />
Öffentlicher Raum bedeutet: „Orte zu haben für den Austausch von Waren und Gütern aller Art,<br />
aber auch von Information und Kommunikation; Orte zu haben für Repräsentation und Darstellung der<br />
verschiedenen sozialen Gruppen, aber auch der Individuen, um die Komplexität der Lebenswelten und ihrer<br />
Lebensformen anschaulich zu machen; Orte zu haben, an denen kulturelle und soziale Widersprüche deutlich<br />
werden und zur Sprache kommen können’ (Schäfers 2001a, 189).“ 60<br />
Bihler betont die (nach wie vor) wichtige Funktion des <strong>öffentlichen</strong> Raumes als zivilgesell-<br />
schaftlichen Aktions<strong>raum</strong>es (als Raum für Demonstrationen, Versammlungen, Informati-<br />
onsstände, Unterschriftensammlungen …) , der vor allem für die Herstellung lokaler (poli-<br />
tischer) Öffentlichkeit nach wie vor von zentraler Bedeutung ist. Gerade durch die allge-<br />
meine Zugänglichkeit – <strong>im</strong> Gegensatz zu technischen Formen (Internet), die noch nicht für<br />
alle Menschen zugänglich sind – und die symbolische Kraft von (besonderen) Plätzen ist<br />
der öffentliche Raum für die Gesellschaft notwendig und wichtig. 61 Er weist auch auf die<br />
wichtige Funktion des <strong>öffentlichen</strong> Raumes als Erlebnisort hin: „Öffentlicher Raum wird weiter-<br />
hin als Erlebnisgerüst und Zeichen der Identität dienen. Er ist wichtiger denn je für die Lesbarkeit der<br />
Städte.“ 62 Dabei spielen auch Veranstaltungen <strong>im</strong> Stadt<strong>raum</strong> eine wichtige Rolle. Öffentli-<br />
cher Raum spielt auch eine wichtige Rolle als Identitäts<strong>raum</strong> für die Menschen der jeweiligen<br />
Stadt. 63<br />
Dummreicher und Kolb darauf hin, dass erst die Benützung der Stadt (mit ihren Einrich-<br />
58 Quelle: vgl. Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 15<br />
59 vgl. ebd.<br />
60 Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 16<br />
61<br />
vgl. Bihler, Michael A.: Stadt, Zivilgesellschaft und öffentlicher Raum. Reihe Region - Nation – Europa. Lit<br />
Verlag, Münster - Hamburg – London 2004, S 53 ff<br />
62<br />
Quelle: Bihler (2004), S 56<br />
63 vgl. Bihler (2004), S 57<br />
25
tungen, Angeboten bis hin zur Stadtmöblage) Identifikation mit dem Ort verschafft. „Erst<br />
die persönliche Verwendung von öffentlichem Raum wie Parks und Straßen (...) lassen de-<br />
ren Wert erkennen und schaffen persönliche Nähe zum Ort. Das soziale Handeln und Tun,<br />
wie einkaufen, spielen etc. schafft diese Art von persönlicher Nähe, die eine Beziehung mit<br />
einem Stadtviertel aufkommen lässt.“ 64<br />
Die Wichtigkeit öffentlicher Räume für Kinder und Jugendliche wird von Deinet als we-<br />
sentliches Element von Bildung beschrieben: „Kinder und Jugendliche lernen und bilden sich nicht<br />
nur in Institutionen der Schule, sondern insbesondere auch in ihren jeweiligen Lebenswelten, Nahräumen,<br />
Dörfern, Stadtteilen, vor allem auch <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum. Diese Bereiche sind die Orte des informellen<br />
Lernens, das die intentionalen Bildungsprozesse wesentlich mitprägt. Die Entwicklung sozialer Kompetenz<br />
in wechselnden Gruppen oder <strong>im</strong> Umgang mit fremden Menschen in neuen Situationen, die Erweiterung des<br />
Handlungs<strong>raum</strong>es und damit der Verhaltensrepertoires prägen auch die Fähigkeit für den Erwerb von<br />
Sprachkenntnissen und Bildungsabschlüssen.“ 65<br />
Auch Oliver Frey unterstreicht die Wichtigkeit öffentlicher Räume für Kinder und Jugendli-<br />
che: „In urbanen <strong>öffentlichen</strong> Räumen findet ein sozialer Lernprozess statt, was Toleranz und Umgang mit<br />
fremden Lebenssituationen fördert. Die Individuen lernen, Raum zu ergreifen, sich <strong>im</strong> Raum zu positionie-<br />
ren, sich Raum anzueignen. Fremdheit und Unterschiedlichkeit können <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum reflexiv ver-<br />
arbeitet werden. Gerade Kinder und Jugendliche können in <strong>öffentlichen</strong> Räumen Selbstständigkeit erlernen,<br />
da sie mit Gleichaltrigen eigenständig und kreativ Kontakte aufbauen können. Für sie besteht die Chance,<br />
sich aus der Enge einer privaten Familiensituation zur Gesellschaft hin zu öffnen. Toleranz, Umgang mit<br />
Fremdheit, Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, Kennenlernen von ungleichzeitigen Geschwindigkeiten,<br />
Rücksichtnahme auf Schwächere sind Lernchancen <strong>im</strong> urbanen <strong>öffentlichen</strong> Raum.“ 66<br />
64<br />
Quelle: Dummreicher, Heidi/Kolb, Bettina: Sieben Thesen zur Qualität der Stadt. Öffentlicher Raum als Erlebens<strong>raum</strong>.<br />
Universität Wien, Wien 2000, S 6<br />
http://www.univie.ac.at/OEGS-Kongress-2000/On-line-Publikation/kolb.pdf<br />
65<br />
Quelle: Deinet (2007), S 51<br />
66 Quelle: Frey (2004), S 228<br />
26
1.5 Jugend <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum<br />
1.5.1 Eine Geringschätzung<br />
Bei der (wie vorher aufgezeigten notwendigen) interdisziplinären wissenschaftlichen Bear-<br />
beitung des Themas ist ein doppeltes Defizit zu orten: einerseits tut sich in den Sozialwis-<br />
senschaften eine Forschungslücke auf, die sich in der Jugendsoziologie <strong>im</strong> fehlenden<br />
Raumbezug zeigt, und in der Stadt- und Regionalsoziologie, die sich dem Thema Jugend<br />
und den dahinter liegenden Bedürfnissen kaum widmet. Ebenso wird in der Stadt- und<br />
Frei<strong>raum</strong>planung fortwährend auf die Situation und Bedürfnisse der jungendlichen Nut-<br />
zer/innen vergessen. Offensichtlich hat heute noch die provozierende These ihre Gültig-<br />
keit, „dass ‚die Nichtberücksichtigung der Interessen von Jugendlichen der eigentliche Skandal des modernen<br />
Städtebaus’ sei“. 67<br />
Die Gründe dieser Geringschätzung sind zu suchen „in der generellen Vernachlässigung der räum-<br />
lichen D<strong>im</strong>ension bei der Analyse sozialer Prozesse, in dem eigenartigen sozialräumlichen Probierverhalten<br />
von Jugendlichen zwischen dem Schutz- und Schon<strong>raum</strong> der Kinder und dem in der Regel von den Erwach-<br />
senen gewählten Wohnstandort und in der damit verbundenen Schwierigkeit, den Jugendlichen angesichts<br />
ihrer <strong>raum</strong>greifenden Aktivitäten konkrete Räume zuzuweisen.“ 68<br />
Geringschätzung schlägt den Jugendlichen in den <strong>öffentlichen</strong> Räumen auch durch die<br />
Wahrnehmung von Erwachsenen gegenüber: „Mit Jugendlichen in <strong>öffentlichen</strong> städtischen Räumen<br />
wird meist eine überzeichnete Vorstellung von provokanten und lauten jungen Leuten verbunden. Sie gelten<br />
als die Hauptverursacher von Vandalismus, sie lungern herum und erscheinen vielen Erwachsenen als be-<br />
drohlich.“ 69 Und dies obwohl „Die Analyse des alltäglichen Verhaltens der Jugendlichen, ihrer Aktivi-<br />
täten und Ausdrucksformen (...) ein weitaus unspektakuläres Bild“ 70 zeigt.<br />
Im realen Raum spiegelt sich diese Geringschätzung der Jugendlichen wider: „Durchweg wird<br />
Jugendlichen, vermittelt durch die gebaute Umwelt der untersuchten <strong>öffentlichen</strong> städtischen Räume, eine<br />
67 Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 13<br />
68 Quelle: ebd.<br />
69 Quelle: Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 241<br />
70 Quelle: ebd.<br />
27
mangelnde Wertschätzung entgegengebracht. Sie waren oftmals nicht als eigene Nutzergruppe vorgesehen und<br />
teilweise – was auffällige Verhaltensformen betrifft – gar nicht erwünscht. Spezifische räumliche Gestaltun-<br />
gen für Jugendliche, wie Holzunterstände, sind eher klägliche Versuche, auch für diese Altergruppe etwas<br />
anzubieten, was gleichzeitig nicht auf andere Nutzergruppen störend wirkt. Erwünscht können sich Jugend-<br />
liche in urbanen Räumen allenfalls kurzfristig als Konsumenten fühlen. Die Jugendlichen und insbesondere<br />
Jugendszenen oftmals zugedachte Rolle als belebender Faktor findet kaum eine Resonanz in der Gestaltung<br />
und Anlage der Räume, und den Jugendlichen wird von Seiten der Erwachsenen eher pauschale Skepsis<br />
entgegengebracht.“ 71<br />
1.5.2 Die Wichtigkeit von öffentlichem (Frei)Raum für die Jugend<br />
Die Wichtigkeit des Raumes für <strong>jugend</strong>liche Nutzer/innen sei hier nicht mehr <strong>im</strong> Detail<br />
argumentiert, da diese bereits <strong>im</strong> Kapitel „1.4. Vom Nutzen des Öffentlichen Raumes“ dar-<br />
gestellt wurde. Auch in der Ansfeldner Jugendstudie 2006 wurden von den befragten Ju-<br />
gendlichen die <strong>öffentlichen</strong> Flächen (vor allem Spielflächen, Sportflächen, Hauptplatz) in<br />
freier Nennung als die wesentlichste Herausforderung und den dringensten Handlungsbe-<br />
darf für eine <strong>jugend</strong>freundliche Gemeinde genannt. Insgesamt wurden Verbesserungen <strong>im</strong><br />
<strong>öffentlichen</strong> Raum 108 Mal in freier Nennung als wichtigste Verbesserungsmaßnahme ge-<br />
nannt. Abgeschlagen mit 39 Nennungen spielte die (in Ansfelden als heißes Thema wahrge-<br />
nommene) Frage der Integration die zweitwesentlichste Rolle 72 (angemerkt sei hierbei, dass<br />
diese beiden Fragen <strong>im</strong>mer wieder miteinander korrespondieren).<br />
1.5.3 Jugendliches Freizeitverhalten in der Stadt: Eine konfliktbeladene Situation<br />
Jugendliche verbringen ihre Freizeit <strong>im</strong> städtischen Umfeld vor allem mit Aktivitäten von<br />
71<br />
Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 244<br />
72<br />
vgl. Tschemer, Marlies: Ansfeldner Jugendstudie, Erstauswertung der Rohdaten, Johannes Kepler Universität,<br />
Linz 2006, <strong>im</strong> Besitz des Verfassers. Freie Nennungen auf die Frage: „Was wäre für dich die wichtigste Verbesserung?“,<br />
eigene Auswertung des Verfassers aufgrund der festgehaltenen freien Nennungen.<br />
28
Geselligkeit, Konsum und Sport. „Wir gehen davon aus, dass die verbreitete Suche nach Geselligkeit<br />
die Jugendlichen häufig auch in die <strong>öffentlichen</strong> Orte der Stadt führt und dort sich nicht selten mit Konsumaktivitäten<br />
verbindet.“ 73<br />
Das bringt folglich Konflikte mit der Erwachsenenwelt mit sich, weil sich die Prioritäten<br />
der sich in die Öffentlichkeit hinein orientierten Jugendlichen (Ausgehen) und die bevor-<br />
zugte Orientierung der Erwachsenen auf das Private (Wohnen) hin, diametral entgegen ste-<br />
hen. „Die meisten Jugendlichen (ca. 90 Prozent) bekennen sich dazu, in der Freizeit rumzuhängen, ein<br />
Ausdruck, mit dem Jugendliche nicht selten ihre Befindlichkeit in ihrer freien Zeit charakterisieren.“ 74<br />
Grundsätzlich ist das Freizeitbudget der Jugendlichen für den Aufenthalt <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum ohnehin stark eingeschränkt: neben der persönlichen Belastung 75 sind hier vor allem<br />
die komfortablen Möglichkeiten in den eigenen vier Wänden (Medien) und die vermehrte<br />
überregionale Freizeitbeschäftigung zu nennen. 76 Nichts desto trotz üben „die stärker erlebnis-<br />
orientierten Räume der inneren Stadt heute in besonderem Maße einen Reiz für Jugendliche aus, weil sie sich<br />
hier gegenüber anderen Personen, meist Erwachsenen, ‚in Szene setzen’ und profilieren können.“ 77<br />
Repräsentation und Selbstdarstellung, aber auch die Möglichkeit der Kommunikation und<br />
Interaktion sind wesentliche Funktionen des <strong>öffentlichen</strong> Raumes und für die Sozialisation<br />
der Jugendlichen von entscheidender Bedeutung. Bei dieser „Erprobung“ der Außenwir-<br />
kung von <strong>jugend</strong>lichem Handeln bilden sich <strong>im</strong>mer wieder Konflikte mit der Erwachse-<br />
nenwelt: „Vor allem handelt es sich hier um eine Auseinandersetzung mit der häufig Jugendlichen gegen-<br />
über verständnislosen Welt der Erwachsenen, in die Jugendliche letztlich integriert werden sollen. Auf dem<br />
Weg dahin finden jedoch mannigfache Abgrenzungen statt, um die eigene Identität zu stärken, was nicht<br />
selten zu latenten bzw. manifesten Konflikten führt.“ 78<br />
Ein weiter Grund für die Konflikte ist in den (oft szenetypischen) Deutungsmustern und<br />
73<br />
Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 26<br />
74<br />
Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 26<br />
75<br />
vgl. Kapitel: 2.3.2. Jugend unter Druck<br />
76<br />
vgl. Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), S 27<br />
77<br />
Quelle: Ulfert/Seggern/Heinzelmann, Karow (2003), (2003), S 27<br />
78 Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 30<br />
29
Symbolen zu finden. „Dies ist besonders öffentlichkeitswirksam, wenn es sich um deutlich abweichendes<br />
Verhalten handelt, das nicht nur andere Personen(gruppen) provoziert, sondern auch ihnen gegenüber Ge-<br />
waltbereitschaft signalisiert. Auch wenn sich Gewaltpotentiale nur bei einem geringen Prozentsatz von Ju-<br />
gendlichen finden, so ziehen sie doch in besonderer Weise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf<br />
sich.“ 79<br />
Weil Jugendliche <strong>im</strong>mer wieder unkonventionelle Möglichkeiten für ihren Aufenthalt su-<br />
chen – und <strong>im</strong> Falle des Nicht-Findens solcher Angebote die konventionellen Angebote<br />
nach ihren Bedürfnisse nutzen, entstehen ebenfalls <strong>im</strong>mer wieder Konflikte. Beispiele dafür<br />
sind zum Beispiel eine alternative Nutzung der Parkbank (es wird nicht auf der Sitzfläche,<br />
sondern auf der Lehne gesessen) oder – wie <strong>im</strong>mer wieder beobachtbar – der Rückgriff auf<br />
nicht altersadäquate Flächen wie z.B. Kinderspielplätze. 80<br />
Die Form des <strong>jugend</strong>spezifischen Aufenthaltes verstehen Breitfuß und Klausberger als eine<br />
Art Angebot an die Erwachsenen zur Auseinandersetzung, die vor allem in Siedlungsräu-<br />
men gut für eine Klärung genutzt werden kann. „Wo dieses Angebot durch Erwachsene wahrge-<br />
nommen wird, und die Auseinandersetzung von Verständnis geprägt ist, die Jugendlichen also nicht nur in<br />
die Rolle von ‚vernünftigen Erwachsenen’ gedrängt werden, ist eine Kl<strong>im</strong>averbesserung durchaus zu erzielen.<br />
Die Einhaltung der in der Siedlung geltenden Regeln, wie z.B. die Nachtruhe, ist durch persönliche Gesprä-<br />
che eher zu erzielen als durch rigide Sanktionen. Voraussetzungen für den Erfolg solcher Maßnahmen sind<br />
keine allzu große Anonymität in der Siedlung und ein vernünftiges Gesprächskl<strong>im</strong>a. Ein <strong>jugend</strong>freundli-<br />
ches Kl<strong>im</strong>a kann durch ein vernünftiges Frei<strong>raum</strong>konzept ebenso begünstigt werden, wie durch Handlungs-<br />
weisen der Verwaltung einer Wohnanlage und die Haltung der Bewohner gegenüber den Jugendlichen. Wenn<br />
die laute Minderheit eine <strong>jugend</strong>feindliche St<strong>im</strong>mung in der Siedlung schafft und diese durch Handlungen der<br />
Verwaltung noch verstärkt wird, ist häufig ein Abwandern der Jugendlichen auf andere Flächen oder eine<br />
Protesthaltung in Form von Zerstörung oder konfliktprovozierender Handlungen die Folge.“ 81<br />
Der Konflikt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen <strong>im</strong> Wohnumfeld beginnt oftmals<br />
79 Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow. (2003), S 31<br />
80 vgl. Breitfuß, Günter/Klausberger, Werner: Das Wohnumfeld. Qualitätskriterien für Siedlungsfreiräume. Eigenverlag<br />
Breitfuß-Klausberger OEG, Linz – Vöcklabruck 1999, S 67<br />
81 Quelle: Breitfuß/Klausberger (1999), S 67<br />
30
ereits mit der Planung: „Gibt es keinen Platz, der den Jugendlichen schon bei der Entstehung der<br />
Wohnanlage gewidmet wird, ist die Verdrängung von einem Aufenthaltsort auf den nächsten die Konse-<br />
quenz.“ 82<br />
Aber nicht nur die oftmals fehlgeschlagene Planung und Gestaltung des Raumes ist als Ur-<br />
sprung des Konfliktes zu nennen. Sehr oft steht eine generell <strong>jugend</strong>feindliche Grundhal-<br />
tung <strong>im</strong> Zentrum der Konflikte: „Das Ausmaß der Beschwerden über Jugendliche scheint angesichts<br />
beobachtbarer Realität übertrieben und ist wohl eher auf ein negatives Jugendlichenbild – der Jugendliche als<br />
(potentieller) Randalierer, als Gewalttäter – zurückzuführen und damit auf eine generell <strong>jugend</strong>feindliche<br />
Einstellung. Das heiße aber auch, dass alle planerischen Lösungsansätze zur Verbesserung der Frei<strong>raum</strong>situation<br />
allein nur sehr bedingt zu einer Konfliktlösung beitragen können.“ 83<br />
Die Ansfeldner Jugendstudie 2006 zeigte auf, dass aus Sicht der Jugendlichen die Nutzung<br />
der <strong>öffentlichen</strong> Flächen grundsätzlich konfliktbeladen ist. Grundsätzlich waren die Werte,<br />
ein Problem auf den jeweiligen Orten zu haben, höhere, als diese Orte konfliktfrei zu be-<br />
schreiben (mit Ausnahme zweier kleineren, relativ szenehomogen genutzter Skaterflächen<br />
und der privat betriebenen Lokale). In der Regel waren aber die Konflikte mit anderen Ju-<br />
gendlichen präsenter als jene mit anderen Bevölkerungsgruppen. Allerdings ist gerade der<br />
Kontakt mit Anrainer/innen der <strong>öffentlichen</strong> Flächen oftmals durch Konflikte gekenn-<br />
zeichnet: So geben <strong>im</strong>merhin 18,5 % der Befragten an, von Anrainer/innen ermahnt zu<br />
werden, 17 % wissen zu berichten, dass sie besch<strong>im</strong>pft werden. Fast 36 % geben an, dass<br />
sich Anrainer/innen sehr oft oder oft bei der Gemeinde oder der Polizei über deren Verhalten<br />
beschweren würden. 84<br />
1.5.4 Planerische Konsequenzen für eine <strong>jugend</strong>freundliche Gestaltung<br />
Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow haben aus ihrer Untersuchung von <strong>öffentlichen</strong><br />
82<br />
Quelle: Breitfuß/Klausberger (1999), S 69<br />
83<br />
Quelle: Gohde-Ahrens, Rixa: Jugendliche <strong>im</strong> städtischen Frei<strong>raum</strong> und ihre Berücksichtigung in der räumlichen<br />
Planung. Ermittlung von Frei<strong>raum</strong>ansprüchen Jugendlicher <strong>im</strong> Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg.<br />
Schriftenreihe des Fachbereiches Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover,<br />
Hannover 1998, S 24<br />
84<br />
vgl. Tschemer (2006)<br />
31
Räumen für die Jugend vier Konsequenzen gezogen 85 :<br />
1. Den einzelnen Räumen fehlt weitestgehend eine auf Typ und Örtlichkeit bezogene<br />
Planung <strong>im</strong> Interesse der Jugendlichen, obwohl dies möglich und erforderlich ist<br />
2. Die „streifende“ Benutzung von Freiräumen (beispielsweise <strong>im</strong> Zuge von Erkun-<br />
dungen) ist evident. Die Erreichbarkeit von Orten <strong>mittels</strong> Fuß-Fahrrad-<br />
Fahrbeziehungen ist <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Nahverkehr <strong>im</strong>mens wichtig, auch Haltestellen<br />
sind oftmals wichtige Treffpunkte. Eine sinnvolle vernetzte Einordnung von öffent-<br />
lichen Freiräumen ist für Jugendliche von <strong>im</strong>menser Bedeutung.<br />
3. Dass Jugendliche gerne unter sich wollen, darf nicht als Alibi für die Verdrängung<br />
auf spezielle oder an den Rand platzierte Räume dienen. Es muss auch möglich sein,<br />
dass sich Jugendliche in die Erwachsenenwelt hinbegeben können und braucht da-<br />
für auch entsprechende Orte.<br />
4. „Ein D<strong>im</strong>ensionssprung erfolgt oft bei den <strong>jugend</strong>spezifischen Eventorten für Parties, für Musik-<br />
veranstaltungen, große Sportereignisse, Open-Air Festivals, für das Unter-Sich-Sein in großen<br />
Mengen feiern.“ 86 Dies sind <strong>im</strong>mer wieder die ungenutzten, oder anders genutzten<br />
Orte (Brachen, Kiesteiche, alte Fabriken ....), die sich durch eine gewisse Offenheit<br />
der <strong>raum</strong>bezogenen Nutzung und einer ästhetischen Interpretationsfähigkeit aus-<br />
zeichnen. Hier weist sich gerade die kommerzielle Nutzung als sehr erfinderisch und<br />
ist anregend für Nicht-Kommerzielles.<br />
Zusammenfassend halten die Autor/innen fest: „Das heißt als planerische Konsequenz, dass dem<br />
<strong>öffentlichen</strong> Raum in Ganzen und den von uns untersuchten Typen darin, bezogen auf die Bedürfnisse von<br />
Jugendlichen, eine große Sorgfalt und Beachtung zukommen muss. Dies steht <strong>im</strong> krassen Gegensatz zu dem<br />
tatsächlichen räumlich-gestalterischen und organisatorischen Bemühen um Jugendliche, das oft darauf ausge-<br />
richtet ist, sie aus den <strong>öffentlichen</strong> Räumen fernzuhalten bzw. sie dort nur dann willkommen zu heißen,<br />
wenn sie als Konsumenten oder mit den gleichen Verhaltensweisen wie Erwachsene auftreten.“ 87<br />
85<br />
vgl. Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 247 ff<br />
86<br />
Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 248<br />
87<br />
Quelle: Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow (2003), S 248<br />
32
Detaillierter auf konkrete Möglichkeiten der Planung von Jugendfreundlichkeit geht diese<br />
Arbeit nicht ein, da grundsätzlich der Gedanke eines prozesshaften Vorgehens (gemeinsa-<br />
men mit Jugendlichen) verfolgt wird und nicht möglichst konkrete Planungsanleitungen für<br />
konkrete Vorhaben. 88<br />
88 Exemplarisch zu konkreten Schritten sei verwiesen auf die Überlegungen von Herlyn/Seggern/Heinzelmann/Karow<br />
(2003), Kapitel: Raumspezifische Szenarien, S 249 ff<br />
33
2 DIE JUGEND<br />
Wie schon <strong>im</strong> Kapitel „1.5. Jugend <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum“ dargelegt, gibt es gerade <strong>im</strong> öf-<br />
fentlichen Raum Konflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Das deutet bereits<br />
darauf hin, dass Jugendliche „anders sind“. Dieser Abschnitt widmet sich diesem „Anders-<br />
Sein“: Jugendliche stehen vor ganz anderen Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen<br />
als Erwachsene. Gerade die Pubertät bzw. die Adoleszenz sind ein besonderer Lebensab-<br />
schnitt, der ganz eigenen Dynamiken folgt. Wenn man über Jugendliche denkt oder redet,<br />
sollte man sich der Besonderheiten dieses Lebensabschnittes bewusst sein: Deshalb ist die-<br />
ser Lebensabschnitt folglich auch genauer beschrieben. Gegenwärtig – und in besonderem<br />
Maße <strong>im</strong> Kontext „öffentlicher Raum“ – beherrschen vor allem negative Wahrnehmungen<br />
und Zuschreibungen – Stichwörter: Kr<strong>im</strong>inalität, Gewalt und Vandalismus – das Bild der<br />
Jugend. Auch diesen Aspekten wird in diesem Abschnitt genauere Aufmerksamkeit gewid-<br />
met. Grundsätzlich versucht diese Arbeit, Phänomene wie Gewalt oder Kr<strong>im</strong>inalität verste-<br />
hend zu beschreiben, da dieses Verstehen die Grundvoraussetzung für Lösungsansätze dar-<br />
stellt. Keineswegs soll Gewalt oder Kr<strong>im</strong>inalität – weil dieser Vorwurf steht bei einem ver-<br />
stehenden Ansatz schnell <strong>im</strong> Raum – verharmlost oder gar geleugnet werden.<br />
2.1 Jugend: Versuch einer Definition<br />
Wenn man junge Menschen in ihrer Gesamtheit unter „Jugend“ zusammenfassen will, stößt<br />
man dabei außerhalb der juristischen Definition sehr schnell an Unübersichtlichkeiten. Zu<br />
unterschiedlich sind die Phänomene und Verhaltensweise der Jugendlichen, um sie als Ge-<br />
samtheit definieren zu können. Schon be<strong>im</strong> einzelnen Jugendlichen sind die Phänomene für<br />
diese Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter vielfältig und stark differierend, bei<br />
der Gesamtheit wird das Bild noch vielschichtiger: Die Pluralisierung der Jugendkulturen,<br />
Jugendliche einerseits mit heftigen pubertären Krisen und anderseits Jugendliche, die relativ<br />
harmonisch durch diese bewegte Zeit kommen, und eine <strong>im</strong>mer unklarere Zeit des Erwach-<br />
senswerdens (es gibt kein einheitlich best<strong>im</strong>mbares Ende der Jugendphase, dieser Lebens-<br />
34
abschnitt kann von 18 Jahren bis über 30 Jahren reichen) prägen eine starke Uneinheitlich-<br />
keit dieser gesellschaftlichen Gruppe.<br />
Genau so unterschiedlich wie die Jugendlichen selbst, sind auch die Haltungen der Erwach-<br />
senen ihnen gegenüber: „Sie schwanken zwischen Angst vor Jugendlichen und Hoffnungen auf ihre<br />
Kraft, zwischen der Sorge um ihre Reife und dem Neid auf ihre libidinöse Energie, zwischen der Skepsis, ob<br />
Jugendliche überhaupt noch beziehungs- und bindungsfähig sind und einer Glorifizierung der Jugendkulturen<br />
und deren Anstiftung zu neuer Gemeinschaftlichkeit.“ 89<br />
Die Spannung zwischen den Generationen hat sich verändert, sie ist aber weiterhin wirk-<br />
sam. Sie zeigt – wie es Schröder formuliert - „wie Jugendliche nach Autonomie streben und wie die<br />
Erwachsenen um ihre Macht ringen.“ 90<br />
2.1.1 Die eine Jugend gibt es nicht<br />
„Die Jugendphase verläuft heute vielschichtig und mehrd<strong>im</strong>ensional. Auch hinsichtlich des Zeitfaktors sind<br />
Veränderungen feststellbar: Noch in den 1950er und 60er Jahren war die Jugendphase viel einheitlicher.<br />
Damals dauerte die „Übergangsphase Jugend“ von der Kindheit in die Erwachsenenwelt zwischen sechs und<br />
acht Jahren. Heute sind 30–jährige Jugendliche keine Seltenheit, wenn man als Grundlage der Definition<br />
von „erwachsen“ materielle und auf andere Ressourcen bezogene Selbständigkeit (eigenes Einkommen, eigene<br />
Wohnung, eigene Familie usw.) ann<strong>im</strong>mt. Die Jugendphase ist so zu einem quantitativ aber zugleich auch<br />
qualitativ viel bedeutsameren Lebensabschnitt <strong>im</strong> Leben eines Menschen geworden.“ 91<br />
Heute wird auch von einer „Entstrukturierung“ der Jugend gesprochen: Es gibt keinen sta-<br />
bilen Fahrplan durch diese Phase und viele Elemente der Jugendlichkeit wurden von Er-<br />
wachsenen und auch von Kindern übernommen. Manche sprechen auch von einer „De-<br />
89 Quelle: Schröder, Ach<strong>im</strong>: Jugendliche. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene<br />
Kinder- und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 89 - 97, S 89 ff<br />
90 Quelle: Schröder (2005), S 90<br />
91 Quelle: Liebentritt, Sabine: Erwachsen werden heute - ein harter Job, In: Nichts passt. Fachreader zur Gewaltprävention<br />
in der Arbeit mit Jugendlichen. EfEU, Friedensbüro Salzburg, koje, Wien – Salzburg - Bregenz<br />
2002, S 7<br />
http://www.efeu.or.at/seiten/download/fachreader.pdf<br />
35
funktionalisierung“ der Jugendphase: Die Jugend hätte sozusagen ihre Funktion verloren,<br />
weil die gestellten Aufgaben an diesen Lebensabschnitt auch in einer anderen Lebensphase<br />
bewältigt werden können. 92<br />
2.1.2 Selbstbild der jungen Österreicher/innen<br />
Im „4. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich“ 93 wurde 2003 unter anderem auch das<br />
Selbstbild der jungen Menschen in Österreich zwischen 14 und 30 Jahren untersucht: „90 %<br />
der 14- bis 15-Jährigen und <strong>im</strong>merhin noch 70 % der 16- bis 17-Jährigen, jedoch nur mehr 42 % der 18-<br />
bis 19-Jährigen bezeichnen sich selbst als „Jugendliche“. Bereits jede/R zweite 18- bis 19-Jährige versteht<br />
sich hingegen als „jungeR Erwachsener“. (...) Die Jungerwachsenenphase dauert dann bis etwa zum 25.<br />
Lebensjahr an.“ 94<br />
Im Alter von 18 bis 19 Jahre fühlen sich 7 % als Erwachsene, 65 % der 26- bis 27-Jährigen<br />
fühlen sich als richtig erwachsen. Bei den 28- bis 30-Jährigen bezeichnen sich 80 % als Erwachsene,<br />
die anderen 20 % fühlen sich als „junge Erwachsene“. 95<br />
2.2 Pubertät und Adoleszenz<br />
Die Phase der Jugend ist vor allem geprägt durch die mannigfachen Lebensumbrüche der<br />
Pubertät und Adoleszenz. Diese beiden - entgegen der oft vorherrschenden Meinung han-<br />
delt es sich nicht um das selbe - Phänomene stellt Jugendliche vor viele Fragen und Heraus-<br />
forderungen und erklärt doch Krisen, in denen sich Jugendliche oftmals befinden.<br />
2.2.1 Die Pubertät<br />
Die Pubertät beschreibt die körperlichen Veränderungen, die junge Menschen zwischen 9<br />
92<br />
vgl. Schröder (2005), S 90<br />
93<br />
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz: 4. Bericht zur Lage der Jugend in<br />
Österreich. Teil A: Jugendradar 2003. Wien, 2003<br />
94<br />
Quelle: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 5<br />
95 vgl. ebd.<br />
36
und 13 Jahren (die einen früher, die anderen später) erfassen. Vor allem die Entwicklung<br />
der pr<strong>im</strong>ären und sekundären Geschlechtsmerkmale und das Erreichen der Geschlechtsrei-<br />
fe stehen hier <strong>im</strong> Zentrum. Pickel tauchen auf und plötzliche Wachstumsschübe verändern<br />
den Körper rasant. Dadurch resultierende „Ungelenke Bewegungen und ein Sichhässlichfühlen füh-<br />
ren zu Verunsicherungen und Scham. Pubertierende versuchen sich phasenweise zu verstecken, sie möchten<br />
manchmal <strong>im</strong> Boden versinken.“ 96<br />
Es wird zwischen Vorpubertät und eigentlicher Pubertät (Hochpubertät) unterschieden.<br />
Vorpubertät ist die „Zeitspanne zwischen dem ersten Erscheinen der sekundären Geschlechtsmerkmale<br />
und dem ersten Funktionieren der Geschlechtsorgane (Erstmenstruation und Erstpollution, also dem ersten<br />
Samenerguss).“ 97 Unter Pubertät versteht man die Zeitspanne zwischen diesem ersten Funk-<br />
tionieren der Geschlechtsorgane und dem Zeitpunkt, an dem die bisexuellen Tendenzen<br />
nachzulassen beginnen. Somit ist die Pubertät auch nach oben hin nicht genau begrenzt und<br />
liegt ungefähr am Ende des 16., Anfang des 17. Lebensjahres. 98<br />
2.2.2 Adoleszenz<br />
Die Adoleszenz betont vor allem den kulturellen Einfluss. Damit bezeichnet wird jene Zeit<br />
„die junge Menschen brauchen, um sich mit der durch den pubertären Umbruch ausgelösten Situation psy-<br />
chisch zu arrangieren, um den neuen Körper „bewohnen“ zu lernen und um sich ihren jeweiligen Platz in der<br />
Gesellschaft zu suchen.“ 99<br />
Die Adoleszenz ist in drei Zeitphasen einteilbar: 100<br />
� Die frühe Adoleszenz: Die Zeit der Pubertät – also die Zeit von zwischen 9 und 13<br />
Jahren bis hin zu zwischen 14 und 16 Jahren<br />
96 Quelle: Schröder (2005), S 91<br />
97<br />
Quelle: Klosinski, Gunther: Pubertät heute. Lebenssituationen – Konflikte – Herausforderungen. Kösel-<br />
Verlag, München 2004, S 19<br />
98<br />
vgl. Klosinski (2004), ebd.<br />
99 Quelle: Schröder (2005), S 91<br />
100 vgl. Schröder (2005), S 91 ff<br />
37
� Die mittlere Adoleszenz: Die Zeit, in der man sich in sozialen Beziehungen außer-<br />
halb des Elternhauses erprobt und teilweise die ökonomische Selbstständigkeit er-<br />
wirbt bzw. sich darauf vorbereitet und die vom Ende der Pubertät bis zu 18/19 Jah-<br />
ren reicht.<br />
� Die späte Adoleszenz, die daran anschließend hin zu 25 bis 30 Jahren reicht und in<br />
der man zu den jungen Erwachsenen zählt.<br />
Geprägt ist der Verlauf der Adoleszenz durch die kulturellen Angebote, die eine Gesell-<br />
schaft zur Verarbeitung des Umbruches in der Pubertät zur Verfügung stellt. Früher gab es<br />
in der Regel Initiationsriten, um mit den körperlichen und psychischen Wallungen in einem<br />
klaren Rahmen besser umgehen zu können. Die Adoleszenz war aufgrund dessen auf Tage<br />
oder wenige Wochen begrenzt. Heute ist die Adoleszenz offener und länger geworden. In<br />
unserer Kultur gibt es solche allgemeinverbindlichen Rituale nicht mehr. Zwar bilden sich<br />
speziell in Jugendkulturen <strong>im</strong>mer wieder rituelle Elemente heraus – aber diese zeigen eher<br />
die vielfältigen Möglichkeiten des Weges auf und sind nicht obligatorisch. 101<br />
2.2.3 Herausforderungen in diesem Lebensabschnitt<br />
Das Jugendalter stellt andere Anforderungen an die Selbstständigkeit als an das Kind-Sein.<br />
Hier entwickeln sich Aufgaben und Herausforderungen für Jugendliche, die große Span-<br />
nungen darstellen (zwischen Altem und Neuen, zwischen Bindung und Autonomie ...) und<br />
das Individuum in Adoleszenzkrisen der unterschiedlichsten Form bringen, die nicht gera-<br />
delinig oder einfach zu lösen sind.<br />
Schröder fasst die wesentlichen Grundaufgaben dieser Entwicklung in 4 Bereiche zusam-<br />
men 102 :<br />
A) Ablösung von der Familie und Hinwendung zu den Peers: Der Abschied von<br />
der Kindheit und die Ablösung von der Familie sind zu vollziehen. Diese Ablösung<br />
101 vgl. Schröder (2005), S 92<br />
102 vgl. Schröder (2005), S 92 ff<br />
38
ist ein stetes Hin und Her, eine Distanzierung von den Eltern ist mit einer Wieder-<br />
hinwendung verbunden. Ganz löst sich niemand von der Familie ab. Eine Entwick-<br />
lung der Eigenständigkeit ist aber zu vollziehen. Eine Distanz zu den Eltern ist<br />
schon alleine aufgrund des Inzesttabus von Nöten. Durch die hormonelle und sexu-<br />
elle Reifung werden die Jugendlichen förmlich aus den Familien hinausgetrieben.<br />
Welchen Weg der junge Mensch einschlägt und welche Gegensätze sich zu den El-<br />
tern auftun, „lässt sich in einer Gesellschaft, in der der Übergang in das Erwachsenenalter nicht<br />
mehr eindeutigen Ritualen unterworfen ist, weder allgemein gültig sagen, noch von den Eltern steu-<br />
ern.“ 103 Eine vergleichbare emotionale Funktion anstatt der Familie übern<strong>im</strong>mt in<br />
dieser Phase in der Regel die Gleichaltrigengruppe. Diese Peergroups 104 sind heute<br />
zu einem zentralen Sozialisationsfaktor geworden. In ihr fühlen sich die Jugendli-<br />
chen am ehesten aufgenommen, verstanden und ernst genommen.<br />
B) Liebesfähigkeit und Sexualität – Unterschied zwischen Wissen und Fühlen:<br />
Trotz aller Aufklärung ist das Sexuelle auch heute noch ein emotionales Gehe<strong>im</strong>nis,<br />
das jede/r für sich auf eigene Weise erobern und entdecken muss. Die biologische<br />
Fähigkeit, Leben zu erzeugen, kann ihre Wirkung erst entfalten, wenn int<strong>im</strong>e Bezie-<br />
hungen eingegangen werden. Int<strong>im</strong>ität erhält durch die Möglichkeiten der genitalen<br />
Sexualität neue Möglichkeiten. Es gilt dabei, Liebeserfahrungen aus der Kindheit<br />
mit den neuen sexuellen Möglichkeiten zu verbinden.<br />
C) Arbeitsfähigkeit – Chancen zu einer eigenständigen Lebensführung: Weil es<br />
in der kapitalistischen Gesellschaft dazugehört, seine Arbeitskraft auf dem Markt<br />
verkaufen – um eigenständig das Leben führen – zu können, gilt es, die dafür not-<br />
wendigen Fähigkeiten zu erwerben. Um den Erwachsenenstatus erreichen zu kön-<br />
nen, gilt es daher, Kompetenzen, Bildungsabschlüsse und Persönlichkeit auf markt-<br />
adäquate Weise zu entwickeln. Adoleszente Jugendliche reagieren auf vielfältige<br />
Weise: Teilweise mit vielfältigen Aktivitäten (Praktika, frühzeitige Arbeitsverhältnis-<br />
103 Quelle: Schröder, (2005), S 93<br />
104 vgl. Kapitel 2.4: Freundschaften und Cliquen<br />
39
se), teilweise mit Resignation oder Aggression und teilweise – gerade unter den ver-<br />
schärften Bedingungen von Arbeitslosigkeit und Sozialabbau mit dem Greifen nach<br />
anderen Mitteln, um sich „über Tauschgeschäfte in marginalisierten Milieus über Wasser (zu)<br />
halten“ 105 .<br />
D) Umgang mit Widersprüchen <strong>im</strong> Selbst: Die vielfältigen Spannungen und Krisen<br />
des Jugendalters erledigen sich nicht von selbst. Wesentlich kommt es für Jugendli-<br />
che darauf an, ob sie auf Personen und Strukturen treffen, die ein Gegenüber und<br />
die Möglichkeit zur Reibung bieten und trotzdem nicht ablehnend oder abwertend<br />
dabei reagieren. Die zwiespältigen Gefühle, denen Jugendliche durchaus verzweifelt<br />
und scheinbar unentrinnbar gegenüber stehen, motivieren diese oft für (<strong>jugend</strong>kul-<br />
turelle) Szenen und Meinungen, die deutlich polarisieren und ein schwarz-weiß<br />
Schema ausdrücken. „Hier spiegeln sich <strong>im</strong> Außen die Erfahrungen aus dem Innen. Dieser<br />
Umweg über teils extreme Polarisierungen ist ein Privileg der Jugend.“ 106 Die Überwindung<br />
dieser Schärfe muss den Jugendlichen gelingen, die gegensätzlichen Erfahrungen <strong>im</strong><br />
Selbst gilt es zu akzeptieren, zu versöhnen und zu integrieren.<br />
105 Quelle: Schröder (2005), S 94<br />
106 Quelle: ebd.<br />
40
Klosinski zählt für diesen Lebensabschnitt sechs wesentlich zu lösende Aufgabenbe-<br />
reich auf:<br />
• Eine mehr oder weniger vollständige „äußere“ Trennung vom Elternhaus sowie eine „in-<br />
nere“ Unabhängigkeit<br />
• Eine psychosexuelle Identität<br />
• Die Fähigkeit tragende Bindungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (sowohl sexuel-<br />
le Bindungen als auch Freundschaften)<br />
• Die Entwicklung eines persönlichen Wert- und Moralsystems<br />
• Die Bereitwilligkeit zur Arbeit und das Hineinfinden in eine entsprechende Tätigkeit<br />
• Eine Rückkehr zu bzw. eine Wiederbegegnung mit den Eltern (wobei hier von jeder<br />
107 Quelle: Klosinski (2004), S 26<br />
Seite partnerschaftliches Anerkennen Voraussetzung für diese neue Beziehung<br />
ist) 107<br />
41
2.3 Jugend <strong>im</strong> „posttraditionellen Materialismus“<br />
Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmaier erklärt die aktuellen <strong>jugend</strong>lichen Denk- und<br />
Handlungsweisen der Jugendlichen vor dem Hintergrund des „posttraditionellen Materia-<br />
lismus“, der für ein Lebensprinzip steht, „das ein hohes Sicherheitsbedürfnis und große Affinität zu<br />
materiellen Dingen (Einkommen, Konsum, Karriere, Erlebnis) mit dem weitgehenden Fehlen von ideologi-<br />
schen und institutionellen Bindungen vereint. Diese Art von Materialismus ist ein quasi moralisch völlig<br />
unkontrollierter, von den meisten Wertebindungen befreiter Pragmatismus, der pr<strong>im</strong>är am individuellen Ei-<br />
geninteresse, am Eigennutzen des handelnden Subjekts ausgerichtet ist. Im Kern regiert hier das „Cui Bo-<br />
no“, das heißt ausschließlich die Frage nach dem persönlichen Nutzen leitet das Handeln der postmodernen<br />
Pragmatiker. 108 “<br />
Ein Aufwachsen unter diesem Paradigma bedeutet, das gesuchte Glück trotz aller Bemü-<br />
hungen nicht finden zu können. Heinzelmaier beschreibt diesen vorherrschenden Typus als<br />
einen Menschen, der grundsätzlich melancholisch, phasenweise auch tieftraurig, das Defizi-<br />
täre dieser Lebensart in der Regel nicht offen ausspricht, jedoch beständig empfindet. Der<br />
Preis für das materialistische Vergnügen sind Stress und <strong>im</strong>menser Leistungsdruck. Es ge-<br />
linge nicht, dieses gesellschaftlich-ökonomische Muster zu durchbrechen, weil nicht mehr<br />
gelernt wurde, in einem größeren als dem individuellen „Cui Bono“ zu denken und zu han-<br />
deln.<br />
Jugendliche lernen in diesem gesellschaflichten Kontext vor allem dreierlei: 109<br />
„Erstens: Nütze deine Jugend, um dich für den Konkurrenzkampf in der Leistungsgesellschaft „hochzurüs-<br />
ten“.<br />
Zweitens: Es geht dir umso besser <strong>im</strong> Leben, je mehr materielle Güter du konsumieren und je mehr intensive<br />
Erlebnisse du dadurch haben kannst.<br />
Und drittens: Werte sind eine persönliche Angelegenheit, jeder hat seine eigenen, jeder hat andere.“<br />
108 Quelle: Heinzelmaier, Bernhard: Jugend unter Druck: Das Leben der Jugend in der Leistungsgesellschaft und<br />
die Krise der Partizipation in der Ära des posttraditionellen Materialismus. E-Papier, Wien 2007, S 6<br />
109 Quelle: Heinzelmaier (2007), S 3<br />
42
2.3.1 Werte der Jugend<br />
Heinzelmaier weist darauf hin, dass die Werte der Jugend für den Komplex „Hochrüstung für<br />
den Konkurrenzkampf des Arbeitslebens“ stehen, da unter den „Top 10“ der T<strong>im</strong>escout Welle 12<br />
drei Aussagen rund um Ausbildung und Karriere zu finden sind.<br />
Tabelle 2: Werte der Jugend <strong>im</strong> Jahr 2007 110<br />
So finden die Werte „Eine gute Ausbildung“ mit knapp mehr als 70 %, „ein sicherer Job“<br />
mit knapp über 60 % und „Karriere“ mit fast 50 % prominente Plätze in diesem Ranking.<br />
Auch „genügend Geld“ findet mit mehr als 40 % doch breite Werte-Zust<strong>im</strong>mung. Demge-<br />
genüber stehen „klassische Werte“ wie „Der Glaube an Gott“, mit knapp über 10 %, „Vor-<br />
bilder“ mit 10 % und „Engagement in der Politik“ mit knapp 5 % Zust<strong>im</strong>mung weit abge-<br />
schlagen in der Zust<strong>im</strong>mung. Hier zeigt sich doch eine breite Desillusionierung, was mögli-<br />
che wertbildende Instanzen betrifft. Weil für Jugendliche – wie auch für das Gros der Er-<br />
wachsenen – zusätzlich das Pr<strong>im</strong>at der Wirtschaft stark <strong>im</strong> Vordergrund sehen, bzw. die<br />
Wirtschaft als das machtvollere System wahrgenommen wird, schlussfolgert Heinzelmaier:<br />
110 Quelle: Heinzelmaier (2007), S 4<br />
43
„Ein großer Teil der heutigen Jugendlichen sieht sein Leben kaum mehr mit dem großen gesellschaftlichen<br />
Ganzen verbunden. Sie können Institutionen, Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften etc. in<br />
keinen Zusammenhang mit ihren persönlichen Bedürfnissen und Interessen bringen, weil sie meinen, dass die<br />
Durchsetzung dieser Bedürfnisse und Interessen lediglich von ihnen selbst und den sie unterstützenden unmit-<br />
telbaren Bezugspersonen abhängt. Den Jugendlichen wurde ein Individualismus „ansozialisiert“, der zur<br />
Ausblendung des großen Systemzusammenhangs geführt hat und der sie ihr Heil pr<strong>im</strong>är in emotional hoch<br />
aufgeladenen Bezügen zu Familienmitgliedern und den engsten Freunden suchen lässt.“ 111<br />
2.3.2 Jugend unter Stress<br />
Heinzelmaier ortet das sich „Unter Druck Fühlen“ als eine „Grundbefindlichkeit des jungen Men-<br />
schen in unserer Zeit.“ 112 . Das Schl<strong>im</strong>me dabei: Je jünger die Jugendlichen sind, desto stärker<br />
fühlen sie sich unter Druck.<br />
Tabelle 3: Stresserfahrungen bei Jugendlichen 2007 113<br />
Während knapp über 60 % der jungen Menschen zwischen 11 und 29 Jahren über wach-<br />
111 Quelle: Heinzelmaier (2007), S 14<br />
112 Quelle: Heinzelmaier (2007), S 6<br />
113 Quelle: Heinzelmaier (2007), S 8<br />
44
senden Druck klagen, trifft dies auf fast 70 % der 11- bis 14-Jährigen zu. Arbeit und Schule<br />
machen aufgrund des regierenden Leistungsdrucks einem Drittel der 11- bis 29-Jährigen<br />
keinen Spaß mehr und über 45 % bei den 11- bis 14-Jährigen. Die Wichtigkeit der eigenen<br />
Leistung wird von vielen vor der Wichtigkeit der eigenen Person bei der Wahrnehmung<br />
durch die Umgebung gesehen.<br />
2.4 Freundschaften und Cliquen<br />
Ein typisches „Jugendphänomen“ sind Freundschaften und Cliquen. Besonders <strong>im</strong> öffentli-<br />
chen Raum fallen diese Cliquen auf und sorgen <strong>im</strong>mer wieder für Unmut, manchmal auch<br />
Angst – vor allem bei erwachsenen bzw. älteren Personen. Cliquen sind auch oft der „Ur-<br />
sprungsherd“ für unüberlegte Aktionen Jugendlicher. Dabei stellt die Clique einen wesentli-<br />
chen Sozialisations<strong>raum</strong> für Jugendliche dar. Kurz gesagt: Jung sein ohne Zugehörigkeit zu<br />
einem Freundeskreis ist für die meisten Jugendlichen undenkbar. Um Jugendliche und de-<br />
ren Verhalten verstehen zu können, ist ein genauerer Blick auf die Rolle und Dynamiken<br />
der Clique unabdingbar.<br />
„Sobald Kinder in ihrer eigenen Vorstellung aufhören, Kind zu sein, und beginnen sich als Jugendliche zu<br />
fühlen (<strong>im</strong> Regelfalls passiert das irgendwann zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr), beginnt der Prozess<br />
des Selbständigwerdens bzw. die schrittweise Abnabelung von den Eltern.“ 114<br />
Die Eltern spielen zwar noch – bedingt durch eine starke emotionale Bindung eine wichtige<br />
Rolle – aber in vielen Dingen des Alltags verliert die Herkunftsfamilie an Bedeutung und<br />
<strong>im</strong>mer mehr Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung kommen aus den Freundeskreisen.<br />
„Alltägliche Probleme werden <strong>im</strong> Jugendalter kaum mehr <strong>im</strong> Gespräch mit den Eltern gelöst, sondern viel-<br />
mehr <strong>im</strong> Umfeld der Gleichaltrigen zum Thema gemacht. Da die FreundInnen nicht nur Interessen, sondern<br />
auch altersspezifische Erfahrungen und Probleme teilen, stellen FreundInnen für Jugendliche wichtige Ge-<br />
sprächsparterInnen dar. Konkret heißt das: Jugendliche holen sich bei ihren FreundInnen Rat, wenn es zu-<br />
hause, in der Schule oder auch in der Beziehung Probleme gibt. Sie vertrauen auf das Urteil ihrer Freun-<br />
114 Quelle: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 7<br />
45
dInnen, weil sie glauben, dass ihre FreundInnen das, was sie selbst gerade erleben, nachvollziehen kön-<br />
nen.“ 115<br />
Die Bedeutung der Freund/innen ist bei den Jugendlichen stark gestiegen. Die Jugend-<br />
Wertestudie 2000 zeigte einen Bedeutungsanstieg von Freund/innen <strong>im</strong> Alterssegment der<br />
16- bis 24-Jährigen einen Anstieg von 1990 auf 2000 von 53 % auf 72 % (Freund/innen als<br />
wichtiger Lebensbereich) an. 116 Diese Zahlen zeigten sich 2003 stabil: „72 % der 14- bis 19-<br />
Jährigen bezeichnen FreundInnen als persönlich sehr wichtigen und weitere 25 % als ziemlich wichtigen Le-<br />
bensbereich. Gute FreundInnen zu haben, nennen 3 von 4 Jugendlichen <strong>im</strong> Alter von 14 bis 19 Jahren als<br />
ein persönlich sehr wichtiges Lebensziel.“ 117<br />
Wie die Daten des „4. Bericht zur Lage der Jugend“ belegen, spielen gleichgeschlechtlichte<br />
Freundschaften aber über alle Altergruppen hinweg eine größere Rolle als gegengeschlecht-<br />
liche Freundschaften. 118 Dies ist vor allem bei Burschen der Fall: in der Altersgruppe der<br />
14- bis 19-Jährigen geben diese zu 89 % an, einen oder mehrere gute Freunde zu haben und<br />
diesen zu vertrauen, während sie nur zu 22 % Freundinnen ins Treffen führen. Bei Mäd-<br />
chen in dieser Altersgruppe geben drei Viertel (76 %) an, eine oder mehrere gute<br />
Freund/innen zu haben, allerdings haben fast die Hälfte (46 %) auch sehr gute Freunde. 119<br />
2.4.1 Cliquen<br />
Cliquen – auch als Peer-Groups, also als Gruppe Gleichaltriger bezeichnet – gab es wohl<br />
schon <strong>im</strong>mer. Relativ neu ist allerdings der zentrale Einfluss auf die Sozialisation junger<br />
Menschen, der vor allem durch die „systematische, altersbegründete Ausgrenzung längst biologisch<br />
herangereifter Menschen aus der Erwachsenengesellschaft“ 120 begründet wurde, die in dieser Form<br />
115 Quelle: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 7 ff<br />
116 vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 8<br />
117 Quelle: ebd.<br />
118 vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 8<br />
119 vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 9 ff<br />
120 Quelle: Krafeld, Franz Josef: Jungen und Mädchen in Cliquen. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt<br />
(Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesba-<br />
46
seit den Anfängen 1900 bekannt ist.<br />
Noch in den 50iger Jahren des vorigen Jahrhunderts galten Cliquen als bestenfalls ergän-<br />
zendes Sozialisationsfeld neben weit wichtigeren Feldern wie Familie, Arbeit, Nachbar-<br />
schaft, Milieu, etc. Durch die fortschreitende Auflösung der sozialen Milieus und die zu-<br />
nehmende Individualisierung verloren die gewohnten sozialen Bezugssysteme wesentlich an<br />
Bedeutung zugunsten der selbstgeschaffenen Zusammenhänge von Gleichaltrigen. Einen<br />
zusätzlichen Schub erhielt diese Entwicklung durch die zunehmende Brüchigkeit von Kon-<br />
zepten der Normalbiografie in den letzten 30 Jahren durch wachsende (soziale) Unsicher-<br />
heiten. 121<br />
34 % aller Jugendlichen sind laut dem österreichischen Jugendradar 2003 in einem festen<br />
Freundeskreis bzw. in einer Clique integriert. Mit zunehmendem Alter sinkt die Cliquenori-<br />
entierung zugunsten von loseren Freundschaften. Etwa ein Viertel der Befragten geht zum<br />
Cliquenprinzip (quer durch alle Altersschichten) auf Distanz und fühlt sich weder einem<br />
festen noch einem losen Freundeskreis zugehörig. In den Cliquen sind sowohl Jugendliche<br />
mit Paarbeziehungen, als auch jene ohne – zu annähernd gleichen Prozentsätzen vertreten.<br />
Generell lässt sich feststellen, dass die Cliquen – wieder quer durch die Altergruppen – nicht<br />
strikt altershomogen sind, sondern eher Gruppen, in denen gemeinsame Interessen und All-<br />
tagserfahrungen unter annähernd Gleichaltrigen identitätsstiftend sind. Jugendliche, die in<br />
eine Clique eingebunden sind, fühlen sich vor allem ihrer „Stamm-Clique“ verbunden: 68 %<br />
der 14- bis 19-Jährigen, die sich als Mitglied einer Clique ausgeben, sind nur in einer einzi-<br />
gen Clique, 17 % sind in zwei, 9 % sind in drei Cliquen und nur 5 % sind in vier oder mehr<br />
Cliquen integriert. Jene, die Teil einer Clique sind, haben durchaus intensiven Kontakt zu<br />
dieser: 63 % der 14- bis 19-jährigen Cliquenmitglieder treffen sich mehrmals pro Woche<br />
und weitere 29 % mindestens einmal pro Woche. Mit zunehmenden Alter (bei den über 19-<br />
Jährigen) steigt die Zugehörigkeit zu mehreren Cliquen und die Intensität der Cliquenkontakte<br />
lässt nach. 122<br />
den 2005, S 71<br />
121 vgl. Krafeld (2005), S 71 ff<br />
122 vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2003), S 15 ff<br />
47
Die Ansfeldner Jugendstudie des Jahres 2006 kommt zu einem ähnlichen Befund. Die jun-<br />
gen Menschen zwischen 12 und 21 Jahren geben an, hauptsächlich mit denselben Leuten<br />
die Freizeit zu verbringen (36,5 % trifft voll zu/48,2 % trifft eher zu). Hier kennt man als<br />
Jugendlicher zwar noch die meisten Jugendlichen aus der Nachbarschaft (46,7 % trifft voll<br />
zu, 24,6 % trifft eher zu), trifft sich aber nicht unbedingt mit diesen. Die Feststellung: „Ich<br />
treffe mich oft mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft“ trifft lediglich für 22,6 % voll zu,<br />
für 19,1 % trifft dies eher zu. Demgegenüber spielen die ähnlichen Interessen eine wesentli-<br />
chere Rolle: 68,9 % der Befragten geben an, gemeinsame Hobbys zu haben.<br />
Der „typische Freundeskreis“ stellt sich in Ansfelden wie folgt dar: 92,5 % der Befragten<br />
geben an, eher stark zusammen zu halten, die Clique besteht zu 61,9 % aus mehr als 5<br />
Freund/innen und trifft sich zu 44,9 % mehr als 3 Mal in der Woche (Gegenfeststellung:<br />
„Wir treffen uns bis 3 Mal die Woche“). Die Cliquen sind überwiegend geschlechtlich ge-<br />
mischt (68,1 %), auch eine Mischung be<strong>im</strong> Alter ist feststellbar (55,4 % geben an unter-<br />
schiedlichen Alters zu sein) und man bleibt zu 41 % gern unter sich. Größtenteils sind die<br />
Cliquen sehr regional orientiert – 57, 4 % der Jugendlichen einer Clique rekrutieren sich aus<br />
einem Bereich, der binnen 10 Minuten erreichbar ist. 123<br />
Krafeld weist darauf hin, dass für die Altergruppe der 13 bis 15-Jährigen vor allem ge-<br />
schlechtshomogene Cliquen typisch - über dieses Alter hinaus aber gemischte Gruppen üb-<br />
lich - sind. Größere und relativ offene Cliquen sind hauptsächlich in unteren sozialen<br />
Schichten zu finden. Ausnahme bilden hier die reinen Mädchencliquen: Diese sind in jeder<br />
Schicht gerade so groß, dass sie sich in einer privaten Wohnung treffen können (beste<br />
Freundinnen). Vergleichbar kleine Cliquen sind am ehesten noch in bildungsorientierten<br />
Mittelschichten zu finden. Diese sind speziell auf intensive Beschäftigung mit best<strong>im</strong>mten<br />
Hobbys und Aktivitäten konzentriert. Sonst sind Jungendcliquen und gemischte Cliquen<br />
meist wesentlich größer. 124<br />
In den gemischten Cliquen gibt es in der Regel eine Fortschreibung der typischen Ge-<br />
123 vgl. Tschemer (2006)<br />
124 vgl. Krafeld (2005), S 72 ff<br />
48
schlechterrollen: „In den Cliquen selbst reproduzieren sich vielmehr in ganz hohem Masse diejenigen ge-<br />
schlechtstypischen Verhaltensmuster, die in dieser Gesellschaft, bzw. genauer, in den jeweiligen Milieus vor-<br />
herrschend oder als selbstverständlich gelten. Manches spricht sogar dafür, dass sie dort teilweise eher ver-<br />
stärkt als abgebaut werden.“ 125 Mädchen ist es durch die Cliquen zwar gelungen einen zusätzli-<br />
chen Frei<strong>raum</strong> für sich zu gewinnen, andererseits sind sie aber durchaus auf die Jungen an-<br />
gewiesen: Sie werden mitgenommen und haben dadurch Zugang zu erlebnisintensiven All-<br />
tagserfahrungen, die ihnen vormals oft untersagt bleiben. Aber sie haben dadurch auch oft<br />
hinzunehmen, was in der Clique läuft bzw. passiert und sind teils eher zum Mitlaufen, teils<br />
eher zum Zuschauen und teils ganz vom Geschehen ausgeschlossen. 126<br />
Aber auch für Jungen sind Cliquen nicht nur paradiesisch: Weil sie nicht gelernt haben, mit<br />
ihren Ängsten und Un<strong>sicherheit</strong>en umzugehen, ist schon das Gefühl der Angst ein Versa-<br />
gen vor der Mann-Norm. Da Jungen darüber in der Regel nicht ins Gespräch kommen,<br />
denkt jeder, er sei der einzige, der so empfindet und so versucht jeder seine Gefühle vor<br />
jedem zu verbergen. Mit best<strong>im</strong>mten Strategien wandeln sie diese Un<strong>sicherheit</strong>en in For-<br />
men um, die unter Männern anerkannt sind (Herumbalgen, auf die Schulter hauen). Mit ih-<br />
rer Inszenierung der Männlichkeit (oder maßloser Überlegenheit) bis hin zur Gewalttätigkeit<br />
erreichen Jungen, dass niemand ihre Schwächen und ihr Leiden erkennt, teilweise auch so<br />
weit, dass sie diese selbst nicht mehr bemerken können. 127<br />
In diesen Cliquen spiegeln sich einerseits gesellschaftliche Entwicklungen und Vorstellun-<br />
gen wider, andererseits zeigt sich <strong>im</strong>mer wieder auch eine <strong>jugend</strong>liche Eigenständigkeit und<br />
auch Widerständigkeit und ein eigensinniger Weg gegen den Zugriff von Erwachsenenwel-<br />
ten. Mittlerweile sind Cliquen <strong>im</strong>mer häufiger „für Jugendliche ein – wenn nicht gar der zentrale –<br />
Ort, an dem überhaupt noch soziale Einbindung besteht und wo sich Identitätsbildung und Persönlichkeits-<br />
entwicklung auf den personalen Austausch mit anderen stützen kann.(...) Cliquen stellen letztlich <strong>im</strong>mer<br />
wieder einen Versuch dar, sich in einer Welt, in der Zukunft zunehmend ungewiss ist, selbstorganisiert und<br />
125 Quelle: Krafeld (2005), S 73<br />
126 vgl. Krafeld (2005) S 73<br />
127<br />
vgl. Müller, Mathias:, Jungenleben – Männerwelten. In: Männer gegen Männergewalt (Hrsg.): Handbuch der<br />
Gewaltberatung, OLE-Verlag, Hamburg 2002, S 89 ff<br />
49
selbstbest<strong>im</strong>mt mit Altersgleichen Gegenwart anzueignen, und damit ein Stück Lebensbewältigung konkret<br />
anzugehen.“ 128<br />
Vor allem Jugendliche, die sich darüber beklagen, dass ihnen nie jemand zugehört habe oder<br />
die sich über mangelndes Interesse ihnen gegenüber beklagen, finden sich <strong>im</strong>mer häufiger in<br />
gerade auffälligen Cliquen. 129<br />
Die Suche nach Sicherheit gewinnt in einer Zeit, die generell von Un<strong>sicherheit</strong>en geprägt ist,<br />
zunehmend in diesen Cliquen an Bedeutung. Dadurch wird der pubertätstypische Prozess,<br />
der vor allem durch die Frage: „Wie werde ich eine richtige Frau?/Wie werde ich ein richti-<br />
ger Mann?“ geprägt ist, angeheizt und lässt Jugendliche in Cliquenzusammenhängen beson-<br />
ders rigide zu Mustern greifen, die sie als Ausweis von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit be-<br />
greifen. Aus der Clique heraus werden <strong>im</strong>mer wieder Versuche gestartet, sich in der wach-<br />
senden Geschlechterrolle zu probieren, sich zu beweisen und sich in die Begegnung mit<br />
dem anderen Geschlecht einzuüben. 130<br />
In vielfältiger Hinsicht sind diese Cliquen für die Jugendlichen für ihre Identitäts- und Per-<br />
sönlichkeitsentwicklung zentral. Auch für die Ablösung vom Elternbaus spielt die Clique<br />
eine wesentliche Rolle. „Die Peer-Gruppe lässt das Gefühl des Common Sense entstehen, mit dem man<br />
sich identifizieren muss, um dazuzugehören. Ein Wechselspiel aus Kompetenzen des Einzelnen und Akzep-<br />
tiertwerden durch die Mitglieder der Gruppe bewirkt mit die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls:<br />
Damit kann die Gleichaltrigengruppe als ein entwicklungsförderliches Übungsfeld angesehen werden, das<br />
notwendig ist, um sich von den Beziehungen zu den pr<strong>im</strong>ären Bezugspersonen, d.h. von Vater und Mutter,<br />
zu lösen.“ 131<br />
Für diese Loslösungsbewegung gilt <strong>im</strong> Übrigen: „Je größer die Abhängigkeit vom Elternhaus in<br />
Form von innerer Bindung ist oder war, desto größer und heftiger wird die Absetzbewegung der Jugendlichen<br />
vollzogen.“ 132<br />
128<br />
Quelle: Krafeld (2005), S 72<br />
129<br />
vgl. ebd.<br />
130<br />
vgl. Krafeld (2005), S 73<br />
131<br />
Quelle: Klosinksi (2004), S 33<br />
132<br />
Quelle: Klosinski (2004), S 33<br />
50
2.4.2 Cliquen und Konflikte<br />
Zusätzlich gehört es für die Cliquen und deren Entfaltung substantiell dazu, dass sie sich in<br />
ihrer Umwelt – und das auch durchaus sehr konflikthaft (weil diese Plätze eigentlich nicht<br />
für sie gedacht sind) - Territorien aneignen. 133<br />
Jugendliche lassen sich in diesen Cliquen auch zu Handlungen hinreißen, die sie alleine nicht<br />
machen würden. Der Jugendstrafverteidiger Zieger hält dazu fest: „Gruppen entfalten (...) eine<br />
Gruppendynamik, die die jungen Gruppenmitglieder zu Handlungen verleitet, die sie als Einzelne nie bege-<br />
hen würden, die persönlichkeitsfremd erscheinen, die in ihrer Spontaneität, oft auch in ihrer Brutalität die<br />
einzelnen Teilnehmer später selbst erschrecken. Der Gruppeneinfluss führt zu gruppenkonformen Verhalten,<br />
zu einer motivationalen Gleichschaltung, verstärkt vorhandene Tendenzen, verleitet zu Aktionismus, ent-<br />
hemmt die Mitglieder, die – ohne sich dies bewusst zu machen – ihre Verantwortlichkeit an die übergeordnete<br />
Instanz der Gruppe abtreten.“ 134<br />
Klosinski sieht die Hinwendung der Jugendlichen zur Clique begleitet durch eine Verlage-<br />
rung der wachsenden intrafamilialen Gewalt (die vom Jugendlichen ausgeht) nach außen<br />
hin. Geborgenheitsgefühle in der Familie verwandeln sich in Ängste, kleingehalten oder<br />
„vergewaltigt“ zu werden. Familientraditionen werden oft als Zwänge wahrgenommen. Die<br />
Eltern werden entwertet, Idole überhöht und Jugendliche unterwerfen sich den Regeln der<br />
Gruppe. „Stellen sich Eltern in den Weg, kommt es zum Kampf, zur Adoleszentenkrise mit reaktiver<br />
intrafamilialer Gewalt auf beiden Seiten. Die Bedeutung der Peer-Gruppe für aggressives und abweisendes<br />
Verhalten wird in ihrer Bedeutung häufig unterschätzt: Körperlich akzelerierte (also fortgeschritten entwi-<br />
ckelte) Kinder und Jugendliche, die den Risikopfad der Frühentwicklung beschreiten, sich stark <strong>im</strong> Ablö-<br />
sungs- und Autoritätskonflikt mit den Eltern befinden uns sich einer Clique anschließen, unterliegen umso<br />
mehr der Gruppendynamik, je weniger Einfluss die Eltern noch auf sie ausüben. Gewalttätige Jugendliche<br />
sind überdurchschnittlich häufig in Jugend-Cliquen, in denen ein hohes Maß an Gewaltakzeptanz be-<br />
133 vgl. Krafeld (2005), S 74<br />
134 Quelle: Zieger, Matthias: Verteidigung in Jugendstrafsachen. 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2002, S<br />
9<br />
51
steht. 135 “<br />
Klosinski weist in diesem Zusammenhang auf vier Gesetze der Gruppendynamik hin, wie<br />
sie Battegay (1986) formulierte: 136<br />
• Konvergenz der Meinungen und Verhaltensweisen: Abweichende Meinungen und Haltun-<br />
gen werden auf ein Mittelmaß zusammengedrückt, prinzipiell wird alles Fremdartige<br />
aus der Gruppe ausgeschlossen bzw. abgewehrt<br />
• Rang- und Hackordnung: Die Aggression innerhalb der Gruppe wird an eine Ordnung<br />
gebunden, die „Alpha-Mitglieder“ werden definiert, die anderen ordnen sich unter<br />
• Gemeinsamer Gegner: Dient zur gemeinsamen Definition, der Außenfeind gegenüber<br />
dem man zusammensteht<br />
• Das verstärkende Prinzip: Je größer der Faktor der Angst ist (egal ob durch Bedrohung<br />
von Innen oder Außen), desto ungehemmter muss die innere Psychodynamik wir-<br />
ken. „Unter dem Druck der Angst wird die Gruppe den Kampf gegen die gemeinsame Gefahr,<br />
gegen den Außenfeind, aufnehmen und dadurch vom inneren Konflikt ablenken.“ 137 Der innere<br />
Konflikt bzw. das aggressive Potential wird über diesen Mechanismus nach außen<br />
hin abgeleitet.<br />
Allerdings schränkt der deutsche Sicherheitsbericht 2006 die Gefahr einer Kr<strong>im</strong>inalisierung<br />
durch Cliquenzugehörigkeit ein: „Der geringste Teil solcher Gleichaltrigengruppen ist von Gewalt und<br />
Delinquenz gekennzeichnet. So fand eine aktuelle deutsche Studie, dass Gewalt und Delinquenz „prekäre“<br />
Cliquen kennzeichnete, in denen sich etwa 10 % der Jugendlichen befinden. Zumeist handelte es sich bei<br />
ihnen um stark vorbelastete Jugendliche. Deren Hintergrund wird durch familiäre Konflikte und eine be-<br />
lastete Beziehung zu den Eltern, eine geringe Bildung, negative Erfahrungen in der Schule, schlechte Zu-<br />
kunftsoptionen und vielfältige Ausschlusserlebnisse gekennzeichnet. Andere Cliquenarten wären für sie gar<br />
135 Quelle: Klosinski (2004), S 35<br />
136 vgl. Klosinski (2004), S 35 ff<br />
137 Quelle: Klosinski (2004), 36<br />
52
nicht zugänglich. Diese Form des Zusammenschlusses mit Gleichaltrigen ist insoweit durch Alternativlosigkeit<br />
gekennzeichnet.“ 138<br />
2.5 Jungen<br />
Wenn man sich über öffentliche Räume – vor allem unter dem Sicherheitsaspekt – Gedan-<br />
ken macht, rücken naturgemäß vor allem männliche Jugendliche in den Mittelpunkt des In-<br />
teresses. Genauso wie sich aber die Lebenswelten der Jugendlichen pluralisiert haben, so<br />
gibt es eine Vielfalt männlicher Lebensentwürfe und verschiedenster Typen von Burschen.<br />
Diese Lebensentwürfe sind aber in der Regel nicht frei wählbar: Sie hängen von den eigenen<br />
sozialen Lebensressourcen - den Zugängen zu Bildung, Finanzen, Anregungsmilieus und<br />
Personen - sowie von kommunikativen Kompetenzen ab. 139<br />
2.5.1 Ursachen der Schwierigkeiten ein Junge zu sein<br />
Die Situation von Männern und Jungen hat sich während der letzten Jahrzehnte massiv ver-<br />
ändert: Einerseits riefen die Erfolge der emanzipatorischen Frauenbewegung - die männli-<br />
che Dominanzen in Frage stellten bzw. einstürzen ließen - eine große Un<strong>sicherheit</strong> bei brei-<br />
ten Teilen der männlichen Bevölkerung hervor (und tun das nach wie vor). Andererseits<br />
haben die modernen gesellschaftlichen Entwicklungen den „klassischen Mann“ in vielen<br />
Bereichen in Frage gestellt: Potentielle Arbeitslosigkeit, die Auflösung he<strong>im</strong>atspendender<br />
Milieus, die geringere Bedeutung der Muskelkraft, Angebote androgyner Konsummuster<br />
kratzen als Beispiele dieser Entwicklung am klassischen Rollenverständnis des Mannes. Oft<br />
haben Burschen noch ein gängiges Verhaltensrepertoire mitbekommen, das in mancher<br />
138<br />
Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht.<br />
Berlin 2006, S 359<br />
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2006/2__Periodischer__Sich<br />
erheitsbericht/2__Periodischer__Sicherheitsbericht__Langfassung__de,templateId=raw,property=publicationFile.<br />
pdf/2_Periodischer_Sicherheitsbericht_Langfassung_de.pdf<br />
139<br />
vgl. Sielert, Uwe: Jungen. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und<br />
Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 65<br />
53
Hinsicht heute nicht mehr ausreicht, um den neuen Herausforderungen unserer Zeit adä-<br />
quat zu begegnen. Tief verankerte geschlechtsspezifische Verhaltenstendenzen stehen einer<br />
wirksamen Bewältigung der neuen Situation <strong>im</strong> Wege und können zu einer Reihe problema-<br />
tischer Ergebnisse <strong>im</strong> Alltag führen: Kontaktprobleme mit Mädchen, Konkurrenzdruck,<br />
Selbstzweifel, psychosomatische Beschwerden, gewaltsame Konfliktaustragung sind nur<br />
eine paar Beispiele dieser negativen Auswirkungen. 140<br />
Eine besondere Schwierigkeit von männlichen Jugendlichen liegt darin, dass sie die meiste<br />
Zeit ihrer Kindheit mit Frauen verbringen, von denen sie versorgt und behütet werden.<br />
Obwohl Kinder spätestens mit Vollendung des 2. Lebensjahres über das Wissen verfügen,<br />
dass es unterschiedliche Geschlechter gibt, haben sie sowohl <strong>im</strong> häuslichen Umfeld, <strong>im</strong><br />
Kindergarten als auch in der Schule kaum Zugang zu männlichen Bezugspersonen. Jungen<br />
wissen zwar, dass sie ein anderes Geschlecht als ihre Mutter haben, können diesen Unter-<br />
schied aber inhaltlich nicht füllen. Männer treten den Jungen nicht als emotional spürbares<br />
Gegenüber bei der Suche der eigenen Geschlechtsidentität gegenüber, sondern beschränken<br />
sich vor allem auf drei – typisch männliche – Funktionen: 141<br />
• Auf eine strafende Sanktionsinstanz<br />
• Auf die Organisation von spektakulären Ereignissen (Sonntagsausflüge)<br />
• Auf die Förderung von Aktion und Aggression (Herumtoben)<br />
Die Gefühle von Niedergeschlagenheit, Trauer, Kleinheit und Bedürftigkeit werden durch<br />
Männer kaum an Burschen vermittelt. Dem Jungen fehlt damit ein Vorbild, an dem er sich<br />
„ganzheitlich“ orientieren kann. Folglich gibt es Irritationen, die mit Hilfe einer Umweg-<br />
Definition von Männlichkeit versucht werden zu bewältigen: Männlichkeit wird zum bloßen<br />
Gegenteil von Weiblichkeit. „Erlebt er dann bei einer Frau zum Beispiel, dass sie Angst hat, wird für<br />
ihn Ängstlichkeit zum Synonym für Weiblichkeit. Verhalten, das dem erlebten Vorbild der Mutter zu<br />
nahe kommt, wird bedrohlich, denn ein Junge, der sich wie eine Frau verhält, entspricht nicht der Norm<br />
eines „richtigen Jungen“. Statt also die Mutter nachzuahmen, macht er vielleicht genau das Gegenteil von<br />
140<br />
vgl. Sielert (2005), S 66<br />
141<br />
vgl. Müller (2002), S 84<br />
54
dem, was er bei ihr erfährt, selbst wenn er ihr Verhalten positiv bewertet.“ 142<br />
2.5.2 Jungen: Opfer und Täter zugleich<br />
Burkhard Oelemann beschreibt Jungen in seinem gleichnamigen Dossier als „Cool, aber ein-<br />
sam ...“. 143 Jungen stellen (auch in der Kr<strong>im</strong>inalität) den überwiegenden Großteil der Täter<br />
und der Opfer. Aufgrund der Abwesenheit von Männern in deren Sozialisation versuchen<br />
sich Jungen be<strong>im</strong> Zusammentreffen gegenseitig davon zu überzeugen, dass sie der vorherr-<br />
schenden Mann-Norm entsprechen. Je größer dabei die jeweilige Un<strong>sicherheit</strong> ist, desto<br />
deutlicher wird versucht, dieses Manko vor sich und den anderen zu verbergen: „Da aber<br />
jeder Mensch Situationen von Angst erlebt, trifft bei heranwachsenden Männern eine Gruppe von ‚Versa-<br />
gern’ aufeinander Und jeder Einzelne ist bemüht, das vor sich und den anderen zu verbergen. Zugleich<br />
denkt jeder Einzelne, er sei selbst der einzige ‚Versager’. Der Wunsch nach Kompensation hält Einzug.<br />
Gewalt und andere Auffälligkeiten wie Mutproben dienen dann der Leugnung von eigenen Gefühlen der<br />
Unzulänglichkeit und des Mangels. Jungen wachsen orientierungslos in einem Raum ohne Grenzen auf.<br />
Schwäche gilt als schwächlich. Weich als weichlich. Diese Leitsätze müssen ein differenziertes und lebbares<br />
Vorbild ersetzen“. 144<br />
Das Streben nach diesen Leitsätzen und alten Rollenmustern bezahlen Jungen mit einem<br />
durchaus hohen Preis:<br />
„So sind in Deutschland 54 % aller Gymnasiasten Mädchen, aber 56 % aller Hauptschüler und 64 %<br />
aller Sonderschüler Jungen; von allen Mädchen macht jedes vierte Abitur, von den Jungen jeder fünfte;<br />
knapp 50 % mehr Jungen als Mädchen bleiben in der Schule sitzen, wiederum 50 % mehr Jungen als<br />
Mädchen bleiben ohne Schulabschluss. ... Sie leiden öfter unter Sprach-, Lese und Rechtschreibschwäche,<br />
zeigen mehr Verhaltensauffälligkeiten, sind doppelt so häufig Bettnässer wie Mädchen, stottern viermal so<br />
oft und siebenmal häufiger wird bei ihnen das „Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom“ (ADS) diagnostiziert.<br />
142<br />
Quelle: Müller (2002), S 85<br />
143<br />
Quelle: Oelemann, Burkhard: "Cool, aber einsam ... Wie Jungen ihr Leben erleben. Forum Intervention,<br />
o.O. 2003,<br />
http://www.eduhi.at/dl/Cool_aber_einsam.pdf<br />
144<br />
Quelle: Olemann (2003), S 6<br />
55
Das hat zur Folge, dass viele Jungen bereits von Allgemein- oder Kinderärzten medikamentös ruhig gestellt<br />
werden, weil sie unter ihrer Orientierungslosigkeit leiden und den widersprüchlichen Anforderungen durch die<br />
Geschlechterrolle nicht gerecht werden können. Die erlebte Alltagserfahrung für die überwiegende Mehrzahl<br />
von Jungen einerseits und Männern andererseits st<strong>im</strong>mt demnach in einer Hinsicht häufig überein: Nicht<br />
Über- sondern Unterlegenheit ist für sie eine gängige Erfahrung.“ 145<br />
Für Männer generell stellt sich die Situation nach Oelemann nicht wesentlich besser dar: 146<br />
� Sie Leben rund 7 Jahre kürzer als Frauen<br />
� Sie sind häufiger krank<br />
� Sie begehen 3 bis 4 Mal häufiger Suizid<br />
� Sie bilden das Gros bei körperlicher Gewalt auf Opfer- und Täterseite (ca. 90 %<br />
sind Täter, ca. 2/3 sind Opfer)<br />
� Sie stellen 96 % der Gefängnisinsassen<br />
� Sie stellen 95 % der tödlichen Arbeitsunfälle<br />
� Sie sind häufiger alkohol- und drogenabhängig<br />
� Sie bilden 70 % der Obdachlosen<br />
Männliche Jugendliche selbst, wünschen sich in überwiegender Mehrheit „normal“ zu sein:<br />
Also ein bisschen von allem, aber halt nicht übertrieben. „Manchmal gelingt das auch, oft bleibt es<br />
ein Wunschbild, weil der stumme Zwang der ideologischen Männlichkeit stärker ist.“ 147 Andererseits<br />
steht die in Mode gekommene Abwertung alles Männlichen vielen Jungen dabei <strong>im</strong> Weg,<br />
ein gelingendes Verhältnis zu ihren starken Seiten zu entwickeln und in die Balance zu<br />
kommen.<br />
145<br />
Quelle: Oelemann, Burkhard: Vater Morgana oder: "Neue" Väterlichkeit, die ungestillte Sehnsucht. Gewaltberatung<br />
Hamburg, Hamburg 2002, S 6<br />
http://www.gewaltberatung-hamburg.org/mgm2007/<strong>im</strong>ages/stories/pdf/_vatermorgana.pdf<br />
146<br />
vgl. Oelemann (2002), S 3<br />
147 Quelle: Sielert (2005), S 66<br />
56
2.5.3 Ausprägungen der Rollenmuster bei Jungen<br />
Trotz mancher Variationen sind die beschriebenen Verhaltensmuster noch in der Erziehung<br />
von Burschen geltende Rollenmuster. Nicht jeder zeigt auf jede D<strong>im</strong>ension die klassische<br />
männliche Ausprägung, aber es kommt auch niemand an diesen Prinzipien gänzlich vorbei.<br />
Sielert beschreibt 4 grobe Ausprägungen, die heute feststellbar sind: 148<br />
• Jene, die noch keine „Programmstörung“ wahrgenommen haben. Sie verharren in<br />
den alten Mustern. Die weiblichen Bezugspersonen verhalten sich komplementär<br />
zur patriarchalischen Männerrolle. Kleine Irritationen werden verdrängt, ignoriert, geleugnet.<br />
• Jene, die äußerlich pazifisieren: Sie passen sich durch ein androgynes Outfit und<br />
„weichere“ Verhaltensweisen auf die modernen Verhältnisse ein, <strong>im</strong> Kern reagieren<br />
sie (vor allem in Stresssituationen) aber noch traditionell männlich.<br />
• Jene, die sich auf klassische Männerrollen und entsprechende männerbündlerische<br />
Cliquen zurückziehen: Sie verhärten und lösen auftretende Konflikte gewaltsam-<br />
• Die meisten aber „pendeln auf der Suche nach einer eigenen männlichen Identität zwischen ver-<br />
schiedenen Jungenbildern hin und her, identifizieren sich probeweise und basteln sich auf den erfolgreichen<br />
Erfahrungen ihren eigenen Weg.“ 149<br />
148 vgl. Sielert (2005), S 68<br />
149 Quelle: Sielert (2005), S 68<br />
57
2.6 Jugend und Gewalt<br />
Die alarmierend wachsende Gewaltbereitschaft und -ausübung der Jugendlichen steht <strong>im</strong><br />
Mittelpunkt der <strong>öffentlichen</strong> und medialen Diskurse. Auf Ursachen und Entstehung der<br />
Gewalt kann in dieser Arbeit angesichts des dafür notwendigen umfangreichen Rahmens<br />
nicht eingegangen werden, sind doch eine Vielzahl von persönlichen, sozialen und struktu-<br />
rellen Faktoren dafür ins Treffen zu führen. Allerdings gilt es einen grundsätzlichen Blick<br />
hinter die angeregte Gewaltdiskussion zu richten, da es doch Belege dafür gibt, dass das<br />
Ausmaß und die Entwicklung nicht dermaßen besorgniserregend sind wie oft dargestellt<br />
wird.<br />
Eine grundsätzliche niedrige Gewaltbereitschaft konstatiert die Studie zu „Jugend und Ge-<br />
walt“ des Österreichischen Instituts für Jugendforschung aus dem Jahre 2006. 150 So lehnen<br />
beispielsweise über 90 % der Befragten (500 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, Öster-<br />
reichweit und repräsentativ) Gewalt als Mittel der Konfliktlösung ab.<br />
Tabelle 4 : Zust<strong>im</strong>mungen zu Aussagen über Gewalt 151<br />
150<br />
Österreichisches Institut für Jugendforschung: Jugend und Gewalt: Gewalt innerhalb und außerhalb der Schule.<br />
Wien 2006<br />
http://www.oeij.at/site/article_list.siteswift?so=all&do=all&c=download&d=article%3A186%3A1<br />
151<br />
Quelle: Österreichisches Institut für Jugendforschung (2006), S 4<br />
58
Wie diese Grafik veranschaulicht, spielen in der Selbsteinschätzung der Jugendlichen die<br />
Konfliktlösung ohne Gewalt und auch das „Aus dem Weg gehen“ von Gewaltsituationen<br />
die größte Rolle. Sich durch Gewalt Respekt zu verschaffen, spielt mit 3 % eine sehr unter-<br />
geordnete Rolle.<br />
Auch <strong>im</strong> Vergleich mit der Jugend-Wertestudie des Forschungsinstitutes aus dem Jahre<br />
2000 ergibt sich bei gleichen Fragestellungen ein durchaus positiver Befund: „Vergleicht man<br />
die Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen der Jugend-Wertestudie 2000 nach der Zust<strong>im</strong>mung zu Aussagen<br />
über Gewalt mit den Ergebnissen der aktuellen Befragung, zeigt sich, dass 7 Jahre später um 17 % mehr<br />
Jugendliche der Ansicht sind, dass jeder Konflikt auch gewaltfrei lösbar ist. 1999 st<strong>im</strong>mte jeder 2. Jugendli-<br />
che der Aussage „Hin und wieder kann es schon zu einer Schlägerei kommen“ zu, 2006 sind nur 29 %<br />
der Jugendlichen dieser Ansicht. 25 % der 15- bis 20-Jährigen waren 1999 bereit, wichtige Sachen durch<br />
Einsatz von Gewalt durchzusetzen, jetzt sind dies um 12 % weniger Befragte. Der Vergleich der beiden<br />
Erhebungen zeigt deutlich, dass das Gewaltpotenzial der Jugendlichen gesunken ist.“ 152<br />
Gewalt zeigt sich in dieser Studie (auch diese Studie konstatiert gravierende Geschlechter-<br />
unterschiede, Mädchen sind wesentlich weniger gewaltbereit) abhängig vom Bildungsniveau<br />
(je gebildeter, desto weniger Gewaltbereitschaft) und sinkt mit steigendem Alter. 153<br />
Persönliche Gewalterfahrungen sind breit gestreut: 77 % der Befragten waren bereits Opfer<br />
von Gewalt. Das Gros bildet dabei allerdings die verbale Gewalt: 47 % wurden bereits an-<br />
geschrieen, 44 % wurden verspottet oder bloßgestellt. Insgesamt wurden 63 % der Jugend-<br />
lichen verbal attackiert, körperlich erlitten 52 % der Jugendlichen Gewalterfahrungen. Diese<br />
körperliche Gewalterfahrung spielt sich in der Arbeit bei 2 % der Befragten in der Arbeit<br />
ab, bei 15 % in der Schule, bei 18 % in der Familie und bei 28 % woanders. Beispielsweise<br />
hat jede/r dritte Jugendliche bereits Ohrfeigen kassiert, allerdings haben 49 % diese Schläge<br />
Zuhause bekommen. 154<br />
Das Gros der körperlichen Gewalt außerhalb des Themenkomplexes Familie/Arbeit/ Schu-<br />
152 Quelle: Österreichisches Institut für Jugendforschung (2006), S 5<br />
153 vgl. Österreichisches Institut für Jugendforschung (2006), S 5 ff<br />
154 vgl. Österreichisches Institut für Jugendforschung (2006), S 7 ff<br />
59
le bilden – wie in der unten folgenden Tabelle dargestellt - Verwicklungen in Schlägerein<br />
und das Bekommen einer Ohrfeige. Die Jungen sind öfters in Gewalthandlungen involviert<br />
als Mädchen, wobei Mädchen häufiger Opfer bei sexuellen Belästigungen sind.<br />
Tabelle 5: Körperliche Gewalt 155<br />
Als Gewalttäter traten 66 % der Befragten hervor. Dabei wendeten 61 % der Jugendlichen<br />
verbale Gewalt an und 30 % gaben an, bereits körperliche Gewalt ausgeübt zu haben.<br />
Bei der körperlichen Gewaltausübung spielten wieder die Ohrfeigen eine wesentliche Rolle:<br />
22 % der Jugendlichen hatten schon jemanden eine ausgeteilt. 14 % hatten sich an einer<br />
Schlägerei beteiligt, 2 % hatten jemanden mit Gewalt schon etwas weggenommen, 2 % hat-<br />
ten jemanden so verprügelt, dass es auch später noch sichtbar war und 0 % gaben an, je-<br />
manden sexuell belästigt zu haben. Grundsätzlich wenden Burschen um 16 % mehr körper-<br />
liche Gewalt an als Mädchen, von denen insgesamt 22 % einmal körperliche Gewalt ange-<br />
wandt hatten.<br />
Aber nicht nur die Studie des ÖJF zeigt ein weniger dramatisches Ansteigen der Jugendge-<br />
155 Quelle: Österreichisches Institut für Jugendforschung (2006), S 12<br />
60
walt als die öffentliche Debatte vermuten lässt. Auch Befunde aus Deutschland zeigen ein<br />
ähnliches Bild.<br />
In einer Studie aus Greifswald in Deutschland, die die Jahre 1998 – 2002 und 2006 umfasst,<br />
kommen die Autoren zum Resümee: „Im Bereich der Opfererfahrungen durch Gewalt (...) ergibt sich<br />
für den Referenzzeit<strong>raum</strong> eine relativ stabile Entwicklung in den Jahresprävalenzraten (bezogen auf den<br />
rückwärtigen Einjahreszeit<strong>raum</strong>) mit einer mittleren Opferrate von 16,7 % (1997: 17,1 %, 2001:<br />
15,7 %, 2005: 16,8 %). ... Hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Gewaltdelikte ergeben sich ten-<br />
denziell für die schweren Gewaltvikt<strong>im</strong>isierungen rückläufige Raten. ... Eine Ausnahme ergibt sich bei den<br />
einfachen Körperverletzungsdelikten. Hier ist 2005 ein Anstieg in den Jahresprävalenzraten gegenüber<br />
1997 um 16,3 % festzustellen (von 9,8 % auf 11,4 %). Allerdings zeigen die Analysen des Anzeigever-<br />
haltens und der physischen sowie materiellen Opferfolgen, dass sich <strong>im</strong> Bereich der minderschweren Gewalt-<br />
vikt<strong>im</strong>isierungen eine veränderte Sensibilisierung in der Bewertung der erlebten Vikt<strong>im</strong>isierungen und deren<br />
Folgen vollzogen hat, die sich in entsprechend höheren Prävalenzraten bei bagatellhaften einfachen Körperver-<br />
letzungen niederschlägt. ... Insgesamt ergeben die Analysen (auch <strong>im</strong> interregionalen Trendvergleich mit an-<br />
deren Studien) ein vergleichsweise niedriges und konstantes Niveau der Gewaltopferraten unter den Greifs-<br />
walder Jugendlichen. ... Im Bereich der Gewaltdelinquenz zusammengenommen zeigen sich ... für den Refe-<br />
renzzeit<strong>raum</strong> relativ konstante Verhältnisse (Anmerkung: auf hohem Niveau). ... Dementsprechend ist<br />
auch eine relativ stabile Entwicklung <strong>im</strong> Bereich der gewaltaffinen Einstellungen und Bewertungen feststell-<br />
bar.“ 156<br />
Auch <strong>im</strong> zweiten periodischen Sicherheitsbericht der deutschen Ministerien für Inneres und<br />
Justiz 2006 ist <strong>im</strong> Kapitel „Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer zusammengefasst:<br />
„Anhaltspunkte für eine Brutalisierung junger Menschen sind ebenfalls weder den Justizdaten noch den Er-<br />
kenntnissen aus Dunkelfeldstudien oder den Meldungen an die Unfallversicherer zu entnehmen. Es zeigt<br />
sich vielmehr <strong>im</strong> Gegenteil, dass in zunehmenden Maße auch weniger schwerwiegende Delikte, die nur gerin-<br />
156 Quelle: Dünkel, Frieder/Gebauer, Dirk/Geng, Bernd: Gewalterfahrungen, gesellschaftliche Orientierungen<br />
und Risikofaktoren von Jugendlichen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 1998 - 2002 – 2006.<br />
Erste zentrale Ergebnisse einer Langzeitstudie zur Lebenssituation und Delinquenz von Jugendlichen in der<br />
Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald 2007, S 116 ff<br />
http://www.rsf.unigreifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/duenkel/Schuelerbefragung_HGW_1998_2002_2006.pdf<br />
61
ge Schäden und keine gravierenderen Verletzungen zur Folge hatten, zur Kenntnis der Polizei gelangen.“ 157<br />
2.7 Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
2.7.1 Begriffsdefinition Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
Unter Jugendkr<strong>im</strong>inalität <strong>im</strong> engeren (strafrechtlichen) Sinne ist jedes strafbare Verhalten<br />
Strafmündiger zu verstehen, die dem Jugendstrafrecht unterstehen. Kinder unterliegen bis<br />
zur Vollendung des 14. Lebensjahres keinerlei Strafrecht, können daher strafrechtlich nicht<br />
zur Verantwortung gezogen werden. 158 Dem Jugendstrafrecht bzw. der Jugendgerichtsbar-<br />
keit (JGG) unterstehen Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Mit der Absenkung des zivilrecht-<br />
lichen Volljährigkeitsalters 2001 von 19 auf 18 Jahre – die in der Folge auch <strong>im</strong> Strafgesetz<br />
schlagend wurde – wurde der Begriff „Junge Erwachsene“ in das Strafrecht eingeführt.<br />
Darunter fallen Personen, die zwar schon das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Le-<br />
bensjahr vollendet haben. Für diese Altergruppe gelten zwar prozessuale Erleichterungen,<br />
die <strong>im</strong> Jugendgerichtsgesetz geregelt sind, allerdings nicht mehr die Strafbest<strong>im</strong>mungen des<br />
JGG. Hier unterliegen sie grundsätzlich dem Strafgesetz, jedoch gibt es Sonderbest<strong>im</strong>mun-<br />
gen, die in manchen Bereichen erleichternd wirken (Herabsetzung bzw. Entfall von Unter-<br />
grenzen von Strafandrohungen etc.) 159 . „Grund für die Einführung von Sonderbest<strong>im</strong>mungen für<br />
diese zweite Altersgruppe war vor allem, dass neuere entwicklungspsychologische Forschungen kontinuierlich<br />
fortschreitende Veränderungen des Reifungsprozesses ergeben haben, die eine auf diese Besonderheiten der<br />
Adoleszenz abgestellte besondere strafrechtliche Bedachtnahme sinnvoll erscheinen lassen.“ 160<br />
157 Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 354<br />
158 Das bedeutet aber nicht, dass das Handeln von Kindern ohne Konsequenzen bleiben muss. Bei gravierendem<br />
Fehlverhalten schaltet sich das Jugendamt ein. Die Palette der Konsequenzen kann von Erziehungsberatung<br />
der Eltern bis hin zur Abnahme des Kindes und Unterbringung bei einer Pflegefamilie bzw. in einem<br />
He<strong>im</strong> reichen.<br />
159 Vgl. Bundesministerium für Inneres (2008a): Sicherheitsbericht 2006. Kr<strong>im</strong>inalität 2006. Vorbeugung, Aufklärung<br />
und Strafrechtspflege. Bericht über die innere Sicherheit in Österreich. Wien 2008, S 415,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/<strong>im</strong>fname_100251.pdf<br />
bzw. Friis, Roland: Das Wichtigste zum Jugendstrafrecht. Wien o.J.,<br />
http://www.strafverteidiger-friis.at/DAS-WICHTIGSTE-ZUM-JUGENDSTRAFRECHT/DAS-<br />
WICHTIGSTE-ZUM-JUGENDSTRAFRECHT.pdf<br />
160 Quelle: Jesionek, Udo: Reaktionen auf entwicklungsbedingte Straffälligkeit junger Menschen. In: Cizek, Bri-<br />
62
2.7.2 Zur Begrifflichkeit der Jugenddelinquenz<br />
Von der Jugendkr<strong>im</strong>inalität begrifflich abzugrenzen ist die Jugenddelinquenz: Dieser kr<strong>im</strong>i-<br />
nologisch - soziologische Begriff ist weiter gefasst als die strafrechtliche Definition: „In An-<br />
lehnung an den angelsächsischen Begriff "juvenile delinquency" ist unter "Jugenddelinquenz" Mehreres zu<br />
verstehen: In personeller Hinsicht meint man damit diejenigen Personen, die in einer Zwischenphase zwischen<br />
Kind- und Erwachsenheit stehen und sich in ihrem Sozialisationsprozess befinden. Diese Phase kann bis<br />
weit in das dritte Lebensjahrzehnt hinein reichen. Gegenständlich werden vom Begriff der "Jugenddelin-<br />
quenz" nicht nur Verstöße gegen materielles Strafrecht, sondern auch sonstige abweichende Verhaltensweisen<br />
erfasst, die symptomatisch für dissoziale Verhaltensweisen sein können, etwa Schuleschwänzen, Bandenzu-<br />
gehörigkeit oder Alkoholmissbrauch. Schließlich soll durch die Verwendung des Begriffes "Delinquenz" eine<br />
Abgrenzung von strafrechtlichen Termini ermöglicht werden, denn diese Begriffe orientieren sich pr<strong>im</strong>är an<br />
den Vorstellungen der Erwachsenenwelt. Den motivationalen und sonstigen Besonderheiten des Verhaltens<br />
junger Menschen werden sie nicht gerecht. Endlich sollen stigmatisierende Wirkungen, wie sie die Verwen-<br />
dung von Begriffen wie "Schuld", "Straftat", "Verbrechen" oder "Kr<strong>im</strong>inalität" ausgehen, vermieden wer-<br />
den.“ 161<br />
2.7.3 Kr<strong>im</strong>inalität gilt als „normales“ Jugendphänomen<br />
Typisch für die Jugendkr<strong>im</strong>inalität– da ist sich die Fachliteratur durchwegs einig – ist, dass<br />
sie „ubiquitär“ (allgegenwärtig, also in allen gesellschaftlichen Gruppen unabhängig von<br />
Schichtzugehörigkeit oder Nationalität vertreten) und „normal“ (als ein Ausdruck der<br />
schwierigen Phase von Pubertät und Adoleszenz) ist. Jugenddelinquenz ist darüber hinaus<br />
„episodenhaft“ bzw. „passager“, das heißt sie „erledigt“ sich – egal ob entdeckt und sank-<br />
tioniert oder unentdeckt – in der Regel von selbst.<br />
gitte/Schipfer, Karl (Hrsg.): Zwischen Identität und Provokation. Das Spannungsfeld Jugendliche - Erwachsenwerden<br />
– Familie. Dokumentation des Symposiums Familie in Wissenschaft und Praxis. 20. – 22. November<br />
2002, Strobl am Wolfgangsee. ÖIF Materialien Heft 19, Wien 2004, S 35<br />
161 Quelle: Schulz, Felix: Jugendkr<strong>im</strong>inalität. o.O. o.J.,<br />
http://www.kr<strong>im</strong>lex.de/artikel.php?BUCHSTABE=J&KL_ID=93<br />
63
„Die statistischen Zahlen erweisen einen rasanten Anstieg der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung vom 14. bis zum<br />
21./22. Lebensjahr und danach ein deutliches, kontinuierliches Absinken mit zunehmendem Lebensalter.<br />
Bei jungen Männern steigt die Kurve der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr<br />
von Null (Strafunmündigkeit) auf knapp 8 % an, und senkt sich dann auf 3 % bis zum 50. Lebensjahr.<br />
Junge Frauen haben zwar insgesamt eine deutlich geringere Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung aufzuweisen, aber auch<br />
dort steigt die Kurve zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr von Null auf etwa 2 %, um dann bis zum<br />
50. Lebensjahr auf 1 % zurückzugehen.“ 162<br />
„Es wird kaum einen jungen Menschen geben, der nicht zumindest zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr<br />
eine ganze Reihe strafbarer Handlungen, mitunter auch Handlungen, die formal schwerer strafbar sind,<br />
begangen hat. Wir wissen aus der Dunkelfeldforschung, dass mehr als 90 % dieser strafbaren Handlungen<br />
nie zur Kenntnis der Behörden kommen, das heißt, nicht verfolgt werden. Trotzdem wird aus den meisten<br />
jungen Menschen ein erwachsener rechtstreuer Bürger.“ 163<br />
„Die „normale“ Jugendkr<strong>im</strong>inalität <strong>im</strong> Sinne einer seltenen, kurzfristigen Auffälligkeit <strong>im</strong> Bereich der Ba-<br />
gatell- und Kleinkr<strong>im</strong>inalität ist zwar allgemein verbreitet (ubiquitär), aber vorübergehend (episodenhaft).<br />
Sie wird nur zu einem ganz geringen Teil den Instanzen der formellen Sozialkontrolle überhaupt bekannt<br />
(Nichtregistrierung), und ihre „Täter“ hören zumeist von selbst wieder damit auf, Straftaten zu begehen,<br />
ohne dass eine förmliche Reaktion durch Polizei oder Justiz erfolgt wäre (Spontanbewährung). Jugendkr<strong>im</strong>i-<br />
nalität als altersspezifisches und alterstypisches Phänomen ist eher selten ein Hinweis auf (erhebliche) Erzie-<br />
hungs- oder sonstige Defizite, sondern hat viel mit den Reifungsprozessen zu tun, die <strong>im</strong> Jugendalter bewältigt<br />
werden müssen ...“ 164<br />
Wie an diesen drei zitierten Stellen zu erkennen ist, sind sich Vertreter aus Gerichtsbarkeit,<br />
Polizei und Rechtsvertretung grundsätzlich darin einig, dass Jugendkr<strong>im</strong>inalität grundsätz-<br />
lich ein „normales“ Phänomen ist.<br />
Aber auch die mangelnde „Professionalität“ führt zu der hohen Rate der Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
162 Quelle: Zieger (2002), S 3<br />
163 Quelle: Jesionek (2004), S 35<br />
164<br />
Quelle: Wiebke, Steffen: Junge Intensivtäter -kr<strong>im</strong>inologische Befunde. Bayrisches Landeskr<strong>im</strong>inalamt,<br />
München 2003, S 9 ff<br />
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/kr<strong>im</strong>i/DVJJ/Aufsaetze/Steffen2003.pdf<br />
64
<strong>im</strong> Vergleich zur Gesamtkr<strong>im</strong>inalität: „Das Ausmass, mit dem junge Menschen höher als Erwachsene<br />
mit Kr<strong>im</strong>inalität belastet sind, ist zu einem Teil das Ergebnis der systematischen Unterrepräsentierung von<br />
Erwachsenen infolge der geringeren Sichtbarkeit und Kontrollierbarkeit und grösseren Professionalität der<br />
von diesen verübten Delikte, zum anderen eine Folge der leichteren Überführbarkeit von jungen Men-<br />
schen.“ 165<br />
2.7.4 Typische Delikte der Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
Typische Jugenddelikte sind vor allem einfacher Diebstahl (insbesondere Ladendiebstahl),<br />
schwerer Diebstahl (Automaten und KFZ), einfache und schwere (insbesondere gemein-<br />
schaftliche) Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Schwarzfahren und Verkehrsdelikte<br />
(Fahren ohne Führerschein). In den letzten Jahren kommen noch verstärkt Sachbeschädi-<br />
gung und das „Abziehen“ (Wegnehmen von meist Statusgegenständen durch Drohungen)<br />
dazu. 166<br />
Grundsätzlich ist die Jugendkr<strong>im</strong>inalität eine „leichtere“ als die der Erwachsenen: „Relativiert<br />
wird diese Höherbelastung von jungen Menschen dadurch, dass es sich überwiegend um leichte Kr<strong>im</strong>inalität<br />
handelt, die zumeist weniger schwer ist als die Kr<strong>im</strong>inalität von Erwachsenen. Sowohl nach der Polizeilichen<br />
Kr<strong>im</strong>inalstatistik als auch nach der Strafverfolgungsstatistik dominieren bei Jugendkr<strong>im</strong>inalität die Eigen-<br />
tums- und Vermögensdelikte, darunter namentlich der Ladendiebstahl, ausweislich der Strafverfolgungssta-<br />
tistik auch die Verkehrsdelikte. Das Deliktsspektrum erweitert sich erst mit zunehmendem Alter. Bei<br />
Straftaten, die typischerweise von Erwachsenen begangen werden, sind in der Regel weit höhere Schäden zu<br />
verzeichnen als bei den typischerweise von jungen Menschen verübten Eigentums- und Vermögensdelik-<br />
ten.“ 167<br />
165 Quelle: Heinz, Wolfgang: Jugendkr<strong>im</strong>inalität in Deutschland. Kr<strong>im</strong>inalstatistische und kr<strong>im</strong>inologische Befunde.<br />
Aktualisierte Ausgabe Juli 2003. Universität Konstanz, Konstanz 2003, S 85<br />
http://www.uni-konstanz.de/rtf/kik/Jugendkr<strong>im</strong>inalitaet-2003-7-e.pdf<br />
166 vgl. Zieger (2002), S 5<br />
167 Quelle: Heinz (2003), S 85<br />
65
2.7.5 Gründe für die Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
Die Gründe, die für Jugendkr<strong>im</strong>inalität ausschlaggebend sind, sind natürlich vielfältig und<br />
können <strong>im</strong> Rahmen dieser Arbeit nicht ausschöpfend behandelt werden. Neben den bisher<br />
beschriebenen Faktoren in den vorhergehenden Kapiteln kann man mit Zieger zusammen-<br />
fassend festhalten: „Welchen Verlauf die Probleme und Konflikte nehmen, in denen sich die Gruppe der<br />
14- bis 21-jährigen befindet, hängt weitgehend von Sozialisation, Familienverhältnissen (gab es genug Zärt-<br />
lichkeit, Zuwendung und Zeit für die Kinder?), Wohn-, Arbeits- und sonstigen Lebensbedingungen, Erfolg<br />
oder Misserfolg bei der Ausbildung und der Frage ab, ob es gelingt, die Freizeit aktiv, selbstbest<strong>im</strong>mt und<br />
konstruktiv zu gestalten. (...) Junge Menschen können die mit dem Anstieg sozialer Gegensätze zunehmen-<br />
de Diskrepanz zwischen den subjektiven Ansprüchen (von teurer Markenkleidung bis hin zu gehobener<br />
Ausbildung) und den fehlenden Möglichkeiten, diese durchzusetzen (fehlende Geldmittel, keine abgeschlossene<br />
Schuldbildung) schwer ertragen. 168<br />
Besonders gefährdet erscheinen Jugendliche, die es mit folgenden Belastungen zu tun ha-<br />
ben: „unvollständige Familien, Ablehnung durch den neuen Lebensgefährten eines Elternteils; „Pendeler-<br />
ziehung“ mit inkonsistentem Erziehungsverhalten der wechselnden Erziehungspersonen (Mutter – Groß-<br />
mutter – Onkel – verschiedene He<strong>im</strong>e – Trebegängerzeiten – zwischendurch wieder kurzfristige Aufenthalte<br />
bei den Eltern), Gewalt in der Familie, eigene Gewalterfahrungen als Opfer; Suchtprobleme in der Familie,<br />
eigene Suchtprobleme“. 169<br />
2.7.6 Jugendliche Intensivtäter<br />
Von der „normalen“ Jugendkr<strong>im</strong>inalität abzugrenzen, ist allerdings eine kleine Gruppe von<br />
Jugendlichen, die sogenannten „Intensivtäter“. Diese begehen wiederholt und auch schwere<br />
Straftaten. Die genaue Größe dieser Gruppe ist schwer zu schätzen, da sie nur aufgrund des<br />
Hellfeldes 170 hochgerechnet werden kann. Zieger schätzt diese Gruppe der jungen „Inten-<br />
sivtäter“ auf etwa 5 % der Gesamt-Jugendlichen, die allerdings rund 30 % der gesamten Ju-<br />
168 Quelle: Zieger (2002), S 8<br />
169 Quelle: ebd.<br />
170 Die Basis für diese Schätzungen bilden die registrierten Straftaten<br />
66
gendkr<strong>im</strong>inalität – insbesondere der Gewalttaten - ausmachen. 171<br />
Die Kr<strong>im</strong>inologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei (KFG) hat auf der Basis<br />
polizeilicher Registrierungen Daten zur Mehrfachauffälligkeit von jungen Tatverdächtigen<br />
vorgelegt, die ein ähnliches Bild zeichnen. Dabei wurden knapp über 900 Jugendliche, die<br />
<strong>im</strong> Alter von 14 oder 15 Jahren polizeilich registriert wurden über 5 Jahre <strong>im</strong> Bezug auf ihre<br />
kr<strong>im</strong>inelle Auffälligkeit beobachtet. Für ein Drittel dieser Jugendlichen war der Polizeikon-<br />
takt ein „einmaliger Ausrutscher, ein weiteres Drittel wurde mit zwei bis vier Straftaten re-<br />
gistriert und ein letztes Drittel mit fünf und mehr Straftaten. „Von diesem zuletzt genannten<br />
Drittel wurden 83 % aller der Kohorte zur Last gelegten Delikte verübt, allein von den weniger als 10 %<br />
der Tatverdächtigen mit 20 und mehr Straftaten 52 % der Gesamtdelinquenz.“ 172<br />
Zieger geht von folgender Faustregel aus, die aufgrund praktischer Erfahrung gewonnen<br />
wurde: „Wer mehr als fünfmal auffällig wurde, kann zu dieser Gruppe gerechnet werden. Das bedeutet<br />
aber umgekehrt: Bei bis zu vier Registrierungen darf man von den Grundsätzen der Normalität und Episodenhaftigkeit<br />
des Straffälligwerdens ausgehen.“ 173<br />
Leider gibt es bis heute nicht gelungen, aussagekräftige Kriterien zu finden, die eine frühe<br />
Entscheidung zulassen, wer zu der Problemgruppe der Intensivtäter gehört oder nicht.<br />
Darüber hinaus gibt es eine allgemeine Ratlosigkeit, wie mit dieser Gruppe richtig umzuge-<br />
hen wäre. Auch eine Inkonsistenz <strong>im</strong> Setzen der Sanktionen (erzieherische und unterstüt-<br />
zende Maßnahmen einerseits und Anwendung des Strafrechtes) prägen den Umgang mit<br />
dieser Problemgruppe. 174<br />
Da es sich diese Arbeit aber ohnehin nicht zum Ziel gesetzt hat, den Bereich der Intensivtä-<br />
ter auszuleuchten, geht es um die grundsätzliche – also tendenziell um die „normale“ - Ju-<br />
gendkr<strong>im</strong>inalität.<br />
171 vgl. Zieger (2002), S 4<br />
172 Quelle: Steffen (2003), S 5<br />
173 Quelle: Zieger (2002), S 5<br />
174 vgl. Zieger (2002), S 18<br />
67
2.7.7 Jugendkr<strong>im</strong>inalität in Österreich<br />
Fakt ist: Laut den polizeilichen Statistiken ist in Österreich die Jugendkr<strong>im</strong>inalität (auch) in<br />
den letzten Jahren <strong>im</strong> Steigen begriffen. Fakt ist aber auch, dass die Zahl der gerichtlichen<br />
Verurteilungen in den letzten Jahren gesunken ist. Beide Quellen haben aber – wissen-<br />
schaftlich betrachtet – ihre Schwächen und geben letztendlich nicht stichhaltig Aussage ü-<br />
ber die tatsächliche Entwicklung der Jugendkr<strong>im</strong>inalität.<br />
Tabelle 6: Ermittelte Jugendliche Tatverdächtige in Österreich 175<br />
Wie an dieser Statistik erkennbar ist, ist die Zahl der Jugendlichen Tatverdächtigen seit dem<br />
Jahr 2001 <strong>im</strong> Steigen begriffen. Auch 2007 setzte sich dieser Trend fort: Insgesamt wurden<br />
33.068 tatverdächtige Jugendliche ermittelt. 176<br />
Das Steigen zieht sich beinahe nahtlos durch alle ausgewiesenen Deliktsbereiche, lediglich<br />
bei Verbrechen gegen Leib und Leben kam es <strong>im</strong> Vergleich zum Vorjahr zu einem Sinken,<br />
wobei sich der Trend auf gleichem Niveau vorhergehender Jahre einzupendeln scheint.<br />
Zahlen vor 2002 sind in diesem Bereich kaum heranzuziehen, da mit 31.12.2001 das Zäh-<br />
lungsverfahren umgestellt wurde: Wurde bis dahin die Zahl der verdächtigen Personen re-<br />
gistriert, wird seit Anfang 2002 die Zahl der verübten Delikte festgehalten. Das bedeutet,<br />
175 Quelle: Bundesministerium für Inneres, (2008a), Sicherheitsbericht 2006, S 191<br />
176 Quelle: Bundesministerium für Inneres (2008c): Kr<strong>im</strong>inalstatistik des BM.I für das Jahr 2007, Wien 2008,<br />
http://www.bmi.gv.at/downloadarea/kr<strong>im</strong>stat/2007/Jahresstatistik_2007.pdf<br />
68
dass die Taten eines Mehrfachstraftäters auch als mehrfache Täter registriert werden. 177<br />
2.7.8 Einschränkungen der Aussagekraft der polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalitätsstatistiken<br />
Leider geben diese Zahlen aber kein unmittelbares Bild der Entwicklung der Jugendkr<strong>im</strong>ina-<br />
lität wieder. Der Sicherheitsbericht schränkt die empirischen Aussagekraft der Zahlen selbst<br />
ein. Folgende Faktoren können die Kr<strong>im</strong>inalitätsstatistik beeinflussen bzw. verzerren: 178<br />
1) Eine geänderte Aktivität der Sicherheitsbehörden<br />
2) Eine geänderte Anzeigenneigung der Bevölkerung<br />
3) Eine tatsächliche Änderung der Anzahl der begangenen Strafhandlungen<br />
Heinz nennt zu diesen 3 Einschränkungen noch 2 weitere 179 :<br />
� Die Gesetzgebung oder Rechtssprechung selbst<br />
� Die Erfassungsgrundsätze für die Statistiken oder das Registrierverhalten<br />
Wissenschaftlich wird die Aussagekraft der polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalstatistik vielfach hinter-<br />
fragt. Vor allem eine gesteigerte Anzeigenbereitschaft wird dabei ins Treffen geführt:<br />
„Es wird geschätzt, dass etwa 50 % der heutigen Ermittlungsverfahren gegen junge Menschen Vorwürfe<br />
betreffen, die früher meist durch Eltern, Schule, Ausbildungsstelle oder der Nachbarschaft informell (Erzie-<br />
hungsmaßnahme der Eltern, Schadenausgleich) und somit rein erzieherisch beigelegt wurde. In der heutigen,<br />
eher anonymen Gesellschaft überwiegt die verpolizeilichte Sozialkontrolle. Hinzu kommt in der jetzigen<br />
weitgehend „versicherten“ Gesellschaft die Notwendigkeit, durch eine Strafanzeige die Voraussetzung für<br />
eine rasche Schadensregulierung durch die Versicherung zu schaffen.“ 180<br />
„Aus Dunkelfeldstudien gibt es Hinweise darauf, dass sich die Anzeigebereitschaft insbesondere gegenüber<br />
177 vgl. Bundesministerium für Inneres (2008a), S 15<br />
178 vgl. Bundesministerium für Inneres (2008a), S 17<br />
179 vgl. Heinz (2003), S 84<br />
180 Quelle: Zieger (2002), S 6<br />
69
<strong>jugend</strong>typischen Verhaltensweisen erhöht hat. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sei es, dass alterstypisches<br />
Verhalten („Schulhofraufereien“) nicht mehr als solches toleriert, sondern bei der Polizei angezeigt wird, sei<br />
es, dass vermehrt unbeteiligte Dritte verbale und körperliche Streitigkeiten zwischen Jugendlichen oder auch<br />
anderes potenziell strafrechtlich relevantes Verhalten der Polizei mitteilen (erleichtert nicht zuletzt durch die<br />
weite Verbreitung von Mobiltelefonen), sei es, dass die gerade in den letzten Jahren erheblich zugenommenen<br />
Bemühungen um die Kinder und Jugendkr<strong>im</strong>inalitätsprävention auch zu veränderten Einstellungen gegen-<br />
über potenziell delinquentem Verhalten von Kindern und Jugendlichen <strong>im</strong> Sinne einer gestiegenen Aufmerksamkeit,<br />
Sensibilität und dann auch Anzeigebereitschaft geführt haben.“ 181<br />
Die Polizeiliche Kr<strong>im</strong>inalstatistik (PKS) mehr als Instrument der Messung der Sozialkon-<br />
trolle denn als Messinstrument für die Entwicklung der Kr<strong>im</strong>inalität sieht Wolfgang Heinz<br />
die Aussagekraft der Statistik:<br />
„Fast alle Sachverhalte, die in der Polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalstatistik - und damit in allen weiteren, auf dem<br />
polizeilichen Arbeitsergebnis aufbauenden Statistiken - als "registrierte" Fälle ausgewiesen werden, werden<br />
der Polizei durch Anzeigen bekannt. Insofern zeigt registrierte Kr<strong>im</strong>inalität vor allem, in welchem Bereich<br />
informelle Sozialkontrolle als inadäquat und ineffektiv empfunden wird, wodurch sich Opfer, Informant und<br />
Anzeigeerstatter beschwert fühlen und was sie (nicht unbedingt strafrechtlich) verfolgt wissen wollen. Deshalb<br />
beschränkt sich auch ‚Kr<strong>im</strong>inalität’ nach ‚Begriff, Erscheinung, Wissen und kr<strong>im</strong>inalpolitischen Problemen<br />
... weitgehend auf die amtlich bekannt gewordenen Rechtsbrüche’. Folglich spiegelt registrierte Kr<strong>im</strong>inalität<br />
<strong>im</strong> Wesentlichen die unterschiedliche Intensität und Struktur der Sozialkontrolle wider.“ 182<br />
Er führt aus, dass die Anzeigenraten von unterschiedlichen Faktoren abhängen: Sie<br />
schwanken nach Delikttypus, weisen regionale Divergenzen auf, hängen ab von Täter-<br />
Opfer-Konstellationen, von Versicherungsbedingungen und der subjektiv eingeschätzten<br />
Schadenshöhe. 183<br />
Auch die deutsche Polizei warnt vor einer Überbewertung der Polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalitäts-<br />
181 Quelle: Wiebke, Steffen: Jugendkr<strong>im</strong>inalität und ihre Verhinderung zwischen Wahrnehmung und empirischen<br />
Befunden. Gutachten zum 12. Deutscher Präventionstag am 18. und 19. Juni 2007 in Wiesbaden. o.O.<br />
2007, S 187<br />
http://www.praeventionstag.de/html/GetDokumentation.cms?XID=227<br />
182 Quelle: Heinz (2003), S 15<br />
183 vgl. Heinz (2003), S 16 ff<br />
70
statistik, die sich <strong>im</strong> Hellfeld bewegt: „Wie zahlreiche Studien der letzten Jahre belegen, ist insbeson-<br />
dere <strong>im</strong> Jugendbereich das Dunkelfeld der polizeilich nicht nur Kenntnis gebrachten Straftaten und –täter<br />
enorm hoch. Insoweit können schon geringfügige Veränderungen der Relationen von Hell- und Dunkelfeld<br />
infolge vermehrter Mitteilungen an die Polizei zu gravierenden Zunahmen der <strong>im</strong> Hellfeld von Polizei und<br />
Justiz registrierten jungen Menschen führen, ohne dass dem eine tatsächliche Zunahe oder Änderungen des<br />
normabweichenden Verhaltens von Jugendlichen oder Kindern zugrunde liegen.“ 184<br />
184 Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 356<br />
71
2.7.9 Gerichtliche Statistik und deren Aussagekraft zur Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
Ein zweiter Zugang, der das Ausmaß der Jugendkr<strong>im</strong>inalität erhellen könnte, sind die Zah-<br />
len der gerichtlichen Verurteilungen. Diese stellen sich in Österreich wie folgt dar:<br />
Tabelle 7: Verurteilte Jugendliche in Österreich 185<br />
Wie aus dieser Aufstellung ersichtlich ist, ist die Zahl der <strong>jugend</strong>lichen Verurteilungen ins-<br />
gesamt <strong>im</strong> Sinken begriffen. Wie der Sicherheitsbericht festhält, sind die Verurteilungen seit<br />
Beginn der 1990er Jahre generell rückläufig und bewegen sich signifikant unter der Band-<br />
breite der Zahlen seit 1990 (3.815 Verurteilungen <strong>im</strong> Jahr 1992 und 3.178 Verurteilungen <strong>im</strong><br />
Jahr 2003). Allerdings stellen diese Zahlen aufgrund zweier Einschränkungen keinen empi-<br />
rischen Befund der Jugendkr<strong>im</strong>inalität dar: Erstens wurde die obere Altergrenze für Jugend-<br />
185 Quelle: Bundesministerium für Inneres (2008a), S 412 ff<br />
72
liche <strong>im</strong> Jahr 2008 von 19 auf 18 Jahre gesenkt, zweitens wurden <strong>im</strong> Jugendstrafrecht in die-<br />
ser Zeit alternative Erleidungsformen wie z.B. die Diversion entwickelt und gesetzlich fest-<br />
geschrieben.<br />
2.7.10 Die Notwendigkeit einer (nicht vorhandenen) Dunkelfeldforschung<br />
Um einen tatsächlichen Einblick in die Entwicklung der Jugendkr<strong>im</strong>inalität zu erhalten,<br />
bräuchte es eine Dunkelfeld-Forschung (Täterinterviews, Befragungen, teilnehmende Beo-<br />
bachtung etc.). Diese Dunkelfeld-Forschung gibt es in Österreich aber bis dato nicht. 186 .<br />
Im Sicherheitsbericht 2006 der Bundesregierung wird dieses Fehlen der Forschung vor al-<br />
lem mit der budgetären Situation und der ungewissen Zuständigkeit (ob denn solche Forschungen<br />
zu den pr<strong>im</strong>ären Aufgaben der Sicherheitsverwaltung gehöre) begründet. 187<br />
In Deutschland findet diese Dunkelfeldforschung (zumindest in einem gewissen Rahmen)<br />
statt und ermöglicht damit einen klareren Blick auf die Jugendkr<strong>im</strong>inalität bzw. deren Ent-<br />
wicklung. Dabei zeigt sich wiederholt, dass zwar die Daten <strong>im</strong> Hellfeld (Polizeiliche Kr<strong>im</strong>i-<br />
nalstatistik) auch in Deutschland steigen, die dahinterliegende Entwicklung sich jedoch in<br />
der Regel nicht so dramatisch entwickelt.<br />
So schreibt Boers über die bundesdeutsche Situation 2006 zusammenfassend: „Während die<br />
Gewaltkr<strong>im</strong>inalität Jugendlicher <strong>im</strong> Hellfeld in best<strong>im</strong>mten Bereichen weiterhin ansteigt, ist die Entwick-<br />
lung <strong>im</strong> Dunkelfeld jedenfalls seit Ende der neunziger Jahre tendenziell rückläufig. Nach aktuellen Befun-<br />
den aus der in Münster und Duisburg durchgeführten Panelstudie „Jugendkr<strong>im</strong>inalität in der modernen<br />
Stadt“ zur Verbreitung und zum Altersverlauf der Jugenddelinquenz <strong>im</strong> Dunkelfeld ist auch in diesen<br />
Städten eher ein leichter Rückgang der selbstberichteten Delinquenz zu beobachten.“ 188<br />
186 vgl. Fuchs, Walter: Zwischen Deskription und Dekonstruktion: Empirische Forschung zur Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
in Österreich von 1968 bis 2005. Eine Literaturstudie. irks working paper no 5, Wien 2007, S 34<br />
http://www.irks.at/downloads/05_irks-fuchs.pdf<br />
187 vgl. Bundesministerium für Inneres (2008a), S 17<br />
188 Quelle: Boers, Klaus/Walburg, Christian/Reinecke, Jost: Jugendkr<strong>im</strong>inalität - Keine Zunahme <strong>im</strong> Dunkelfeld,<br />
kaum Unterschiede zwischen Einhe<strong>im</strong>ischen und Migranten. Befunde aus Duisburger und Münsteraner<br />
Längsschnittstudien. o.O. 2006, S 22<br />
http://www.dasroteteam.de/docs/JugKr<strong>im</strong>Migr2.pdf<br />
73
Auch Wiebke kommt in seinem Gutachten zu einem ähnlichen Schluss: „Die empirischen Be-<br />
funde widersprechen der Wahrnehmung einer <strong>im</strong>mer häufigeren, <strong>im</strong>mer jüngeren und <strong>im</strong>mer schl<strong>im</strong>meren<br />
Jugendkr<strong>im</strong>inalität, sie stützen sie zumindest nicht.“ 189 . Er weist darauf hin, dass die Entwicklung<br />
<strong>im</strong> Dunkelfeld nur zu einem Teil in die Richtung der registrierten Kr<strong>im</strong>inalität geht, und<br />
insbesondere bei Gewalthandlungen eher eine rückläufige Tendenz <strong>im</strong> Dunkelfeld feststell-<br />
bar sei und die Anzeigebereitschaft für den registrierten Anstieg verantwortlich zeichne.<br />
Allerdings gibt es auch in Deutschland Grenzen der empirischen Sicherheit, wie Heinz fest-<br />
hält: „Das in den Kr<strong>im</strong>inalstatistiken erfasste sog. "Hellfeld" der Kr<strong>im</strong>inalität ist nur ein kleiner und ü-<br />
berdies nicht repräsentativer Ausschnitt der Gesamtkr<strong>im</strong>inalität, von der ein erheblicher Teil <strong>im</strong> "Dunkel-<br />
feld" verbleibt. Das Dunkelfeld selbst ist nach Umfang und Struktur auch durch die neueren Methoden der<br />
Dunkelfeldforschung, insbesondere durch Täter- oder Opferbefragungen, nur für Teilbereiche und auch für<br />
diese nur begrenzt aufhellbar.“ 190 Er weist darauf hin, dass sich an Anlehnung an US-<br />
amerikanischen Forschungsergebnissen zeigt, dass sich Hellfeld und Dunkelfeld selbst über<br />
einen längeren Zeit<strong>raum</strong> sogar gegengleich entwickeln können und „die Crux einer jeden Aus-<br />
sage zur Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung ist, dass unklar ist, ob die statistischen Zahlen die Entwicklung der<br />
"Kr<strong>im</strong>inalitätswirklichkeit" widerspiegeln oder ob sie lediglich das Ergebnis einer Verschiebung der Grenze<br />
zwischen Hell- und Dunkelfeld sind.“ 191<br />
189 Quelle: Wiebke (2007), S 191<br />
190 Quelle: Heinz (2003), S 83<br />
191 Quelle: ebd.<br />
74
2.8 Vandalismus<br />
Im August 2007 ließ der Österreichische Gemeindebund mit der Presseaussendung „Van-<br />
dalismus n<strong>im</strong>mt stark zu“ zu einer Online-Studie, bei der Bürgermeister aus 197 mitmach-<br />
ten aufhorchen: „Der Vandalismus n<strong>im</strong>mt in den Gemeinden stark zu. Das wurde durch eine Umfrage<br />
von kommunalnet.at bei Österreichs Gemeinden bestätigt. 58 % der Gemeinden geben an, dass Vandalis-<br />
mus ein aktuelles Thema ist. Rund 58 % dieser Gemeinden sehen sich zudem nicht ausreichend vor vanda-<br />
listischen Übergriffen geschützt. 73 % meinen, dass Videoüberwachung das Sicherheitsempfinden in der<br />
Gemeinde heben würde.“ 192<br />
Betroffen seien vor allem Gemeinden zwischen 1.000 und 4.000 Einwohnern (besonders<br />
Gemeinden zwischen 1000 und 1999 Einwohnern stechen dabei hervor), der Schaden für<br />
Kommunen durch Vandalismus wird durch den Gemeindebund auf 20 Millionen Euro<br />
jährlich hochgerechnet.<br />
2.8.1 Vandalismus boomt in den Medien<br />
In den Medien ist die zunehmende Sachbeschädigung generell ein boomendes Thema: Die<br />
Archivsuche bei zwei ausgewählten Tageszeitungen (Oberösterreichische Nachrichten und<br />
Kurier) zum Schlagwort Vandalismus deutet in diese Richtung: Während die OÖN <strong>im</strong> Jahr<br />
2000 32 Treffer zu diesem Schlagwort anführt, steigt diese Zahl über die Jahre hinweg kon-<br />
tinuierlich auf 80 <strong>im</strong> Jahr 2005 und springt <strong>im</strong> Jahr 2006 auf 133 Einträge und weiter auf<br />
138 <strong>im</strong> Jahr 2007. Be<strong>im</strong> Kurier bietet sich ein ähnliches Bild: War Vandalismus 2000 noch<br />
in 42 Beiträgen ein Thema, so wird hier <strong>im</strong> Jahr 2005 erstmals die 100er Marke gebrochen,<br />
sinkt 2006 wieder auf 91 Einträge und steigt 2007 auf 134 Einträge.<br />
192 Quelle: Österreichischer Gemeindebund: Vandalismus n<strong>im</strong>mt stark zu. Presseaussendung, Wien 10.08. 2007,<br />
http://www.gemeindebund.at/news.php?id=432<br />
75
2.8.2 Vandalismus in Österreich nach Zahlen<br />
Das Bild eines über die Jahre hin stark wachsenden Deliktes spiegelt der Sicherheitsbericht<br />
2006 in diesem Umfang nicht wieder: Während die eher leichte Sachbeschädigung nach §<br />
125 STGB über die Jahre hinweg kontinuierlich – aber nicht sprunghaft – von knapp<br />
65.000 Delikten <strong>im</strong> Jahr 2001 auf 66.931 Delikte <strong>im</strong> Jahr 2006 (Vorjahr 65.428) 193 ansteigt,<br />
sinkt die schwere Sachbeschädigung nach § 126 STGB von knapp 6.100 Delikten <strong>im</strong> Jahr<br />
2001 auf 4.556 Delikte <strong>im</strong> Jahr 2006. 194 .(Vorjahr: 4.709)<br />
2.8.3 Jugendliche sind herausragende Tätergruppe<br />
Unzweifelhaft sind Jugendliche dabei eine herausragende Tätergruppe: Von <strong>im</strong> Jahr 2006<br />
13.573 (Vorjahr 13.611) ermittelten Tatverdächtigen nach § 125 STGB sind 3.590 Personen<br />
(Vorjahr 3.212) zwischen 14 und 18 Jahre alt, von den nach § 126 STGB insgesamt 1.562<br />
Ermittelten (Vorjahr 1.532) <strong>im</strong>merhin 630 Personen (Vorjahr 499) dieser Altergruppe zuge-<br />
hörig. 195<br />
Den Befund, dass Jugendliche die wesentliche Tätergruppe bilden, bestätigt die Deutsche<br />
Polizei: „Der Anteil der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen ins diesem Deliktsbereich ist überpropor-<br />
tional hoch. Während der Anteil der Kinder an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen bei 5,5 % liegt, be-<br />
trägt er bei der Sachbeschädigung 9,9 %. In der Altersgruppe der Jugendlichen liegt der Anteil an den Tatverdächtigen<br />
insgesamt bei 12,2 %, bei der Sachbeschädigung jedoch bei 26,7 %. 196<br />
193<br />
Alle Vorjahreszahlen beziehen sich auf 2005. Quelle: Bundesministerium für Inneres: Kr<strong>im</strong>inalitätsbericht. Statistik<br />
und Analyse 2005. Wien 2006,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00005/<strong>im</strong>fname_070806.pdf<br />
194<br />
Quelle: Bundesministerium für Inneres (2008b): Kr<strong>im</strong>inalitätsbericht Statistik und Analyse 2006. Wien 2008, S<br />
101<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/<strong>im</strong>fname_100252.pdf<br />
195<br />
Quelle: Bundesministerium für Inneres (2008b), S 12<br />
196 Quelle: Polizeiliche Kr<strong>im</strong>inalprävention der Länder und des Bundes: Hauptsache kaputt?, Stuttgart o.J.,<br />
http://www.polizei-beratung.de/vorbeugung/<strong>jugend</strong>kr<strong>im</strong>inalitaet/taeter_von_vandalismus/fakten/<br />
76
2.8.4 Der Sinn hinter dem scheinbar sinnlosen Zerstören<br />
Für viele scheint Vandalismus die „sinnloseste“ Form der Kr<strong>im</strong>inalität zu sein, da dabei le-<br />
diglich die Zerstörung <strong>im</strong> Vordergrund steht. Doch gerade bei dieser scheinbaren „Sinnlo-<br />
sigkeit“ ist ein Blick auf die (möglichen) Motive der Täter für ein Verstehen hilfreich. Wulf<br />
Dessin weist fragend darauf hin, ob nicht „gerade dieser „Sachbeschädigungwunsch“ eine Ersatzbe-<br />
friedung für an sich gesellschaftlich durchaus respektable Bedürfnisse“ 197 ist.<br />
� Häufig spielen be<strong>im</strong> vandalistischen Verhalten Frustrationsmotive eine wichtige<br />
Rolle (Wut, Rache, Langeweile, Selbsthass). Der Vandalismus dient als Ventil für<br />
angestaute Aggressionen, die sich mal gegen Personen, mal gegen gewisse Bevölke-<br />
rungsgruppen, mal gegen Dinge richten kann. Dabei kann - muss aber nicht - zwi-<br />
schen der Frustrationsursache und dem Gegenstand der Zerstörung kein unmittel-<br />
barer Zusammenhang bestehen.<br />
� Ebenso spielen Anerkennungsmotive eine Rolle. Dazu gehören beispielsweise (van-<br />
dalistische) Mutproben für die Regelung der Gruppenhierarchie.<br />
� Vandalismus kann einfach Spaß und Lust bedeuten und ein intensiver sinnlich-<br />
ästhetischer Reiz sein. Tessin verweist dabei auf den Aufsatz von Allen und Green-<br />
burger (aesthetic theory of vandalism, 1978), in dem die Autoren auf die moderne<br />
Kunst verweisen, wo die Dinge ebenfalls nicht in ihrer „heilen“ Schönheit darge-<br />
stellt werden, sondern in Kaputtheit und Zerrissenheit. Ferner verweisen sie auf die<br />
hollywoodsche Faszination der Katastrophenfilme und die sinnliche Faszination die<br />
beispielsweise Autounglücke und Brände auf uns ausüben. Vandalismus ist also<br />
sinnliche Erregung pur.<br />
� Darüber hinaus hat der Nervenkitzel der Zerstörung mit Entfaltungsmotiven zu<br />
tun. Diese (teilweise pubertären) Motive haben zu tun mit Exper<strong>im</strong>entierfreude,<br />
Neugier, mit Ausprobieren, mit Machterprobung, Grenzüberschreitung, mit Frei-<br />
197 Tessin Wulf: , Frei<strong>raum</strong> und Verhalten. Soziologische Aspekte der Nutzung und Planung städtischer Freiräume.<br />
Eine Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, S 64<br />
77
heitsdrang (ich lasse mich nicht durch einen spießigen Verhaltenskodex gängeln) und künstlerischen-kreativen<br />
Bedürfnissen (Graffitis) zu tun. 198<br />
Tessin schlussfolgert daraus: „Am vandalistischen Verhalten der meist ja männlichen Jugendlichen<br />
sind also nicht die ihm zugrundeliegenden Bedürfnisse problematisch oder gar „falsch“ als vielmehr die aus<br />
ihnen (z.T. aus Mangel an Alternativen) abgeleiteten Verhaltenswünsche. Vandalismusbekämpfung hieße<br />
also, den betroffenen Jugendlichen, alternative Möglichkeiten zu bieten, ihre Frustration abzubauen, Anerkennung<br />
zu finden, sich auszuprobieren.“ 199<br />
Auch Hill weist darauf hin, dass Vandalismus als <strong>jugend</strong>licher Gestaltungswille zu interpre-<br />
tieren sei: „So muss Vandalismus – entsprechend einigen Forschungsergebnissen der angelsächsischen<br />
Vandalismusforschung – auch als eine Form <strong>jugend</strong>lichen Gestaltungswillens interpretiert werden: Es ver-<br />
ändert sich etwas durch die umgestürzte Parkbank, durch die ‚enthauptete‘ Laterne, durch die Reihe abge-<br />
rissener Papierkörbe am Busbahnhof. Vandalismus ist quasi die negative Form von Gestaltungsäußerun-<br />
gen, die keine andere Alternative findet. Er ist zugleich ein stummes Zeichen von Protest und eine anonyme<br />
Demonstration situativer Macht über die Verhältnisse: wenn kein Erwachsener die Missetäter erwischt,<br />
sichert das eine rud<strong>im</strong>entäre Form von Erfolgserlebnis aus einer insgesamt destruktiven Aktion.“ 200<br />
Georg Franck sieht Vandalismus als Reaktion der ungerechten Verteilung von Möglichkei-<br />
ten innerhalb der Stadt und als Zeichen der Schaffung von Identität, in Konkurrenz zum<br />
Markt, der sich der Werbung bedient: „Die Wut der Werber ist in der Sache nämlich nicht so ver-<br />
schieden vom Vandalismus der Sprayer. Die einen betreiben legal und professionell, was die anderen <strong>im</strong> Un-<br />
tergrund treiben. Hier wie dort geht es um den Aufbau und um die Durchsetzung von Identität. Die Wer-<br />
ber bauen die Identität von Marken auf und setzen die Prominenz von Waren durch. Die Sprayer bauen an<br />
ihrer eigenen Identität und machen ihre Codes durch die Effizienz der Störung prominent. Wie die Dichte<br />
der Werbung die obere Hälfe des sozialen Gefälles markiert, markiert die Dichte der Graffiti die unte-<br />
198 vgl. Tessin (2004), S 64 ff<br />
199 Quelle: Tessin (2004), S 65 ff<br />
200<br />
Quelle: Hill, Burkhard: "Musik-Machen" in Gleichaltrigengruppen als sozialpädagogisches Angebot. Siegen<br />
o.J.,<br />
http://www.musiktherapie.uni-siegen.de/forum/<strong>jugend</strong>liche/vortraege/31hill.pdf<br />
78
e.“ 201<br />
Er führt weiter aus: „Die Vandalen machen kaputt, was ihnen sagt, dass sie nicht mithalten können.<br />
Die Neigung zur Rache an den Verhältnissen wächst mit der Ungleichheit, mit der die Kaufkraft verteilt<br />
wird. In einer Umgebung, die einen auf Schritt und Tritt daran erinnert, dass man ist, was man sich leisten<br />
kann, entsteht ein ideales Reizkl<strong>im</strong>a. Der Reiz kann auch als Aufforderung verstanden werden, sich zu<br />
nehmen, was einem niemand gibt. Armut und Werbung reizen zu Übergriffen entlang der Besitzgren-<br />
zen.“ 202<br />
Als – zumindest temporäre Flucht aus der Ohnmacht sieht Handler den Vandalismus: „Ge-<br />
walt gegen Personen und Vandalismus gegen Eigentum ist eine psychologische Reaktion, um ein negatives<br />
Lebensgefühl in Erregung zu verwandeln und Lust daraus zu gewinnen, dass man ein soziales Tabu ver-<br />
letzt. Die tiefer liegende Motivation von einem Delikt wie Vandalismus ist also, eine Bestätigung dafür zu<br />
erhalten, dass auch machtlose Personen, die normalerweise von mächtigen Institutionen und Personen kon-<br />
trolliert werden, von Zeit zu Zeit aus ihrer Ohnmacht entfliehen, rebellieren und ihre Umwelt - zumindest<br />
teilweise - kontrollieren können.“ 203<br />
Eine plausible Leseart des Vandalismus ergibt sich aus dem Ansatz der Aneignungstheorie.<br />
Dabei wird davon ausgegangen, dass junge Menschen sich ihre Umwelt aneignen müssen in<br />
Form einer Gestaltung bzw. Veränderung dieser. In einer vorgefertigten Umwelt ist eine<br />
(neue) Gestaltung des Raumes aber kaum mehr möglich: „Um in einer solchen Welt trotzdem<br />
handlungsfähig zu sein, müssen die Kinder und Jugendlichen in Spannung mit der Arbeitsgesellschaft resp.<br />
mit der entfremdeten Umwelt treten. Die Zerstörung von städtischen Einrichtungsgegenständen bzw. Van-<br />
dalismus (...) sind Beispiele für den Aufbau der beschriebenen Spannung. Würde sich eine Gruppe von Ju-<br />
gendlichen an den für sie vorgesehenen, für diesen Zweck geplanten Orten treffen, so könnte sie nichts Eige-<br />
nes tun, die räumliche Welt ist schon fertig gestaltet. Um dennoch etwas zu verändern, <strong>im</strong> Sinne von ‚sich zu<br />
eigen machen’, selbst etwas zu bewirken, zerstören oder verändern sie etwas aus der fertigen, vorgefundenen<br />
201 Quelle: Franck, Georg: Werben und Überwachen. Zur Transformation des städtischen Raums. In: Hempel,<br />
Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 148<br />
202 Quelle: Frank (2005), S 148 ff<br />
203<br />
Quelle: Handler, Veronika: Ursachen des Vandalismus – psychologisch betrachtet. In: Gendarmerie aktiv,<br />
Wien 2004<br />
http://www.gendarmerie-aktiv.at/zeitung/200404_vandalismus.html<br />
79
Welt. Sie geben damit den Gegenständen eine neue, eigene Funktion, es ist von nun an ‚ihre’ räumliche<br />
Welt (ihre Sitzbank), die z.B. zum Zentrum ‚ihres Treffpunktes’ wird. Durch diese Abweichungen von der<br />
Norm treten sie in eine Spannung mit den Erwachsenen, mit den Ordnungshütern.“ 204<br />
Aus dem Sichtwinkel der (anders kaum mehr möglichen) Aneignung erklärt auch Godhe-<br />
Ahrens den Vandalismus: „Jugendliche setzen den restriktiven städtischen Umweltbedingungen und der<br />
Enteignung von Räumen eigene Aneignungsaktivitäten entgegen (vermutlich eher ein männlicher Teil von<br />
ihnen), z.B. in der Umnutzung und Veränderung von Gegenständen: Zäune knacken, über Mauern klet-<br />
tern, auf verbotenen Flächen Fußball spielen u. ä.; Graffiti an Hauswänden ist auch ein symbolischer Akt<br />
der Raumaneigung. Jugendliche suchen sich ‚neue’ Räume, sie entwickeln ‚neue’ Bewegungs- und Aneig-<br />
nungsformen.<br />
Vandalismus und best<strong>im</strong>mte Formen der Jugendkr<strong>im</strong>inalität sind auch eine Antwort auf der Suche nach<br />
dem ‚Kick’ der Gefühle, nach Risiko und persönlichen Grenzerlebnissen (‚Thrilling’); dies betrifft aber ent-<br />
gegen medienverzerrten Darstellungen <strong>im</strong>mer nur einen kleineren Teil v.a. von männlichen Jugendlichen.<br />
Hier spielen sicher auch die baulich-räumlichen Beschaffenheiten der Wohnumwelten eine Rolle: Leere, Lan-<br />
geweile, Anregungsarmut, Nutzungsverbote etc., also ein Verlust sinnlicher Erfahrungsmöglichkeiten und<br />
damit auch von Selbsterfahrung können zerstörerisches Verhalten begünstigen.“ 205<br />
Vandalismus sollte aber auch als durchaus ernstzunehmende Botschaft der Jugendlichen<br />
ihre Unzufriedenheit betreffend gelesen werden: „Wenn für Jugendliche kein geeigneter Frei<strong>raum</strong><br />
geschaffen wird, entweder weil seit der Erstausstattung der Freiflächen für Kleinkinder die Ausstattung nicht<br />
ergänzt wurde, oder weil die Jugendlichen in der Siedlung als Störfaktor wahrgenommen werden, kann es als<br />
Zeichen für die unbefriedigende Situation zu destruktiven Aktionen, wie der Zerstörung der Möblierungen<br />
kommen, deren Nutzung ihnen nicht zugebilligt wird.“ 206<br />
Wie an diesen Erklärungsmodellen für Vandalismus erkennbar ist, gibt es konkrete Gründe<br />
und Motivationen für vandalistische Aktionen, die nicht unbedingt mit „sinnloser“ Zerstö-<br />
rungswut zu erklären sind. N<strong>im</strong>mt man die Tat und Täter (in selteneren Fällen Täterinnen)<br />
204 Quelle: Reutlinger (2007), S 32 ff<br />
205 Quelle: Godhe-Ahrens (1998), S 24<br />
206 Quelle: Breitfuß/Klausberger (1999) S 73<br />
80
ernst, kann man durchaus Botschaften aus diesen Taten herauslesen, die natürlich auch<br />
Handlungsansätze für den Kampf gegen Vandalismus bilden können.<br />
81
3 VIDEOÜBERWACHUNG<br />
Wenn heute über Sicherheit (und speziell über die Sicherheit an <strong>öffentlichen</strong> Plätzen) disku-<br />
tiert wird, kommt man am Thema Videoüberwachung nicht vorbei. Von Befürwortern der<br />
Videoüberwachung wird diese sehr schnell als DIE Lösung bei Problemen oder Störungen<br />
auf <strong>öffentlichen</strong> Plätzen ins Spiel gebracht. Auf der anderen Seite fürchten Gegner dieser<br />
Art von Überwachung den „gläsernen Menschen.“ Videoüberwachung ist längst nicht<br />
mehr der modernste technische Zugang <strong>im</strong> Sektor der Sicherheitstechnik: Durch die sicht-<br />
bare Präsenz und durch die Symbolik, die die „elektronischen Augen“ umgibt, ist sie jedoch<br />
ein Ankerpunkt in der Diskussion über Sicherheit heute. Mit der Videoüberwachung ver-<br />
bunden ist eine umfangreiche Diskussion über Privatheit und Bürger/innenrechte: Diese<br />
umfangreichen Aspekte können jedoch aufgrund ihrer eigenen Komplexität <strong>im</strong> Zuge dieser<br />
Arbeit nicht abgehandelt, sondern bestenfalls gestreift werden.<br />
3.1 Begriffsbest<strong>im</strong>mungen<br />
3.1.1 Videoüberwachung<br />
„Unter „Videoüberwachung“ wird die Beobachtung, d.h. die systematische und längerdauernde visuelle und<br />
allenfalls auch akustische Kontrolle einer Örtlichkeit mit Hilfe von Videokameras verstanden. Sie liefert<br />
jedenfalls Bilddaten, allenfalls zusätzlich auch akustische Daten.“ 207<br />
Eine (insbesondere juristische) Abgrenzung erfolgt zu den sogenannten „Web-Cam“-<br />
Anwendungen. Diese Videokamera-Technik verfolgt keinen Kontrollzweck, sondern soll<br />
nur Bilder von Örtlichkeiten (z.B. für Internet-Anwendungen) zur Verfügung stellen.<br />
Videoüberwachung kommt in der Praxis entweder als „real t<strong>im</strong>e monitoring“ (RTM) oder<br />
mit Aufzeichnung der kameraerfassten Daten vor. Be<strong>im</strong> RTM wird in Echtzeit der oder die<br />
207<br />
Quelle: Datenschutzkommission: Datenschutzbericht 2005 - 2007, Wien 2007, S 64<br />
http://www.dsk.gv.at/Datenschutzbericht2007.pdf<br />
82
Bildschirm(e) beobachtet, während bei der Aufzeichnung die Daten gespeichert werden. 208<br />
3.1.2 CCTV<br />
Der Begriff CCTV - Closed Circuit Television – ist der in Großbritannien geläufige Termi-<br />
nus technicus für Videoüberwachung. Auch in der deutschsprachigen Fachliteratur wird<br />
dieser Begriff <strong>im</strong>mer wieder verwendet. Beschrieben wird damit der geschlossene Schalt-<br />
kreis aus Kamera und Monitor. Durch die (einfache) Ergänzung mit einem Videogerät kann<br />
eine entscheidende Wirkungserweiterung erfolgen: Die Bildsequenzen können aufgezeichnet<br />
und gespeichert werden. 209<br />
3.2 Nachweise der Wirkung der Videoüberwachung<br />
In der Diskussion um die Einführung oder den Ausbau der Videoüberwachung werden<br />
<strong>im</strong>mer wieder „Studien“ 210 für den Beleg der Wirkung der Videoüberwachung herangezo-<br />
gen. Während Befürworter/innen der Videoüberwachung von beachtlichen Erfolgen der<br />
Videoüberwachung anhand dieser „Studien“ zu berichten wissen, weisen Gegner/innen auf<br />
mangelhafte Effekte bzw. sogar auf negative Entwicklungen nach der Installierung von Vi-<br />
deoüberwachungssystemen hin. Aufgrund von drei wesentlichen Parametern in der Diskus-<br />
sion (Effektivität, Sicherheitsgefühl und „Zielgruppe“) werden folglich ausgewählte Unter-<br />
suchungen zur Wirksamkeit der Videoüberwachung diskutiert. Unter dem Strich bleibt je-<br />
doch die Frage der Effektivität der Videoüberwachung – zumindest in der sachlichen Dis-<br />
kussion – der entscheidende Parameter in der Pro- und Contra-Abwägung. Deshalb wird<br />
der Wirkungs-Fragestellung in diesem Abschnitt der meiste Raum eingeräumt. Weil es spe-<br />
ziell rund um die Evaluationen in Deutschland durchaus hitzige Debatten und damit ver-<br />
208<br />
vgl. Datenschutzkommission (2007), S 64<br />
209<br />
vgl. Hempel, Leon/Metelmann, Jörg: Bild – Raum – Kontrolle. Videoüberwachung als Zeichen gesellschaftlichen<br />
Wandels. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt<br />
am Main 2005, S 10<br />
210<br />
Wie sich <strong>im</strong> Laufe dieses Kapitels zeigen wird, ist der Begriff Studie nicht wirklich zutreffend und wird<br />
hier daher unter Anführungszeichen gesetzt.<br />
83
unden wichtige Weichenstellungen gab, kommt diese Arbeit nicht umhin, diese Debatten<br />
mit aufzunehmen. Insbesondere zeigt sich an diesen „Begleitgeräuschen“ auch sehr gut die<br />
dahinter steckende Intention der Auftraggeber mancher „Studie“.<br />
3.3 Die Effizienz der Videoüberwachung <strong>im</strong> Hinblick auf eine kr<strong>im</strong>inalpräventive<br />
Wirkung<br />
Meist soll die Videoüberwachung konkrete (unerwünschte) Zustände bekämpfen: Die Kri-<br />
minalität allgemein soll bekämpft werden, Taschendiebstähle sollen verhindert bzw. die Tä-<br />
ter aufgrund der Videoaufzeichnungen ausgeforscht werden, Vandalismus soll zurückge-<br />
drängt werden, etc. Um mögliche Bedenken gegen eine geplante Videoüberwachung zu zer-<br />
streuen, wird daher oft auf Untersuchungen verwiesen, die der CCTV große Erfolge in der<br />
Bekämpfung der unerwünschten Zustände in ausgewählten Modellregionen bescheinigen.<br />
3.3.1 Grundsätzliches zur Qualität der Studien<br />
Um ein realistisches Bild der Effektivität von Videoüberwachung zu erhalten, gilt es auch,<br />
die Qualität vorhandener Untersuchungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Leider genü-<br />
gen nur wenige Evaluationen den Kriterien, die eine unabhängige Wissenschaft an diese<br />
stellt. 211 Im „Mutterland der Videoüberwachung“ – Großbritannien – wurden die meisten<br />
frühen Studien, die einen positiven Effekt der Kr<strong>im</strong>inalprävention <strong>mittels</strong> CCTV bescheini-<br />
gen, selbst vom „Ausschuss für Naturwissenschaften und Technologie“ des britischen O-<br />
berhauses mit der Feststellung „data to support conclusions on the benefits of CCTV surveillance are<br />
weak“ 212 in Frage gestellt. Die englischen Wissenschafter Gill und Spriggs stellen in ihrer<br />
umfangreichen Studie 2005 fest, dass vor allem die Frage, wie Videoüberwachung funktio-<br />
211<br />
Vgl. Töpfer, Eric: Videoüberwachung - Eine Risikotechnologie zwischen Sicherheitsversprechen und Kontrolldystopien.<br />
In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag<br />
Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 35<br />
212<br />
Quelle: House of Lords: Fifth Report. Digital Images as Evidence. Committee on Science and Technology,<br />
London 1998<br />
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/064v/st0506.htm#a24<br />
84
niert und nicht wie sie wirkt, untersucht wurde. 213<br />
Für das Gros der Studien in Deutschland stellt der Berliner Politikwissenschaftler Eric Töp-<br />
fer ein ähnlich schlechtes Zeugnis aus: „.Auch in Deutschland waren es die Polizei oder die Innen-<br />
ministerien selbst, die ihren Überwachungsanlage nach methodisch fragwürdigen Zahlenspielen einen zumin-<br />
dest relativen Erfolg attestierten.“. 214 Ähnlich hart urteilt der Berliner Politik- und Literaturwis-<br />
senschaftlicher Leon Hempel über viele Untersuchungen: „Die Aussagekraft dieser pseudowis-<br />
senschaftlichen Evaluationen lässt sich in der Regel anzweifeln, ihre Bedeutung für die öffentliche und politi-<br />
sche Meinungsbildung jedoch nicht. Sie stützen Ad-hoc-Gesetzgebungen, also überstürzte und meist auf ei-<br />
nen äußerlichen Symbolgehalt reduzierte gesetzgeberische Reaktionen auf Themen unter dem Einfluss von<br />
Medien und <strong>öffentlichen</strong> Diskussionen, wie sie in Zeiten allgemeiner Verunsicherung aufgrund realer Bedrohungen<br />
in <strong>im</strong>mer kühnerer Selbstgefälligkeit der Politik heute zahlreich zu beobachten sind.“ 215<br />
In Österreich 216 best<strong>im</strong>mt vor allem die (mediale) Veröffentlichung von Erfolgszahlen<br />
durch die jeweiligen Betreiber eine Rolle. Widerspruch dagegen gibt es vor allem von Seiten<br />
von Datenschützer/innen. Eine breitere Diskussion über die Einführung von Videoüber-<br />
wachung findet in Österreich <strong>im</strong> Vergleich zu Deutschland generell nicht statt. Dies spiegelt<br />
sich sowohl in der Wissenschaft (kaum österreichische Veröffentlichungen zum Thema,<br />
keine mir bekannte umfangreichere Studie 217 ), <strong>im</strong> (Nicht)Vorhandensein von kritischen In-<br />
ternetinhalten 218 , sowie in der kaum geführten (kritischen) medialen und <strong>öffentlichen</strong> De-<br />
batte wider.<br />
213 vgl. Gill, Martin/Spriggs, Angela: Assessing the <strong>im</strong>pact of CCTV. Home Office Research Study 292. Home<br />
Office Research, Development and Statistics Directorate, London 2005, S 2<br />
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf<br />
214 Quelle: Töfper (2007), S 36<br />
215 Quelle: Hempel, Leon: Zur Evaluation von Videoüberwachung. In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies.<br />
Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 123<br />
216 siehe Kapitel 3.8. Situation in Österreich<br />
217 Eine telefonische Anfrage betreffend wissenschaftlicher Evaluation von Videoüberwachung in Österreich<br />
bei der Arge Daten am 22.02.08 bestätigte, dass solcherlei in Österreich nicht vorhanden ist<br />
218 Die Site der Arge Daten (www.argedaten.at) sei hier explizit ausgenommen. Im Gegensatz zu den zahlreichen<br />
privaten Internetseiten in Deutschland, die sich mit Videoüberwachung oder Datenschutz beschäftigen,<br />
wird man in Österreich jedoch kaum fündig.<br />
85
3.3.2 Interne Bewertungen<br />
Oftmals werden in der Debatte zur Effektivität der Wirkung von Videoüberwachung inter-<br />
ne Evaluationen durch die Betreiber vorgelegt bzw. angeführt. Dabei steht wiederholt nicht<br />
die wissenschaftliche Annäherung an die Wirklichkeit, sondern das Agieren aus einem be-<br />
st<strong>im</strong>mten Interesse heraus <strong>im</strong> Mittelpunkt. Nichts desto trotz spielen diese internen Bewer-<br />
tungen be<strong>im</strong> Ausbau der Videoüberwachung eine entscheidende Rolle. Gerade deshalb soll-<br />
te man in einer fundierten Meinungsbildung diesen Auswertungen bzw. Interpretationen<br />
besonderes Augenmerk widmen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt sind diese Bewertun-<br />
gen zumindest hinterfragbar. Wie Hempel in seiner Analyse zur Evaluation der Videoüber-<br />
wachung anmerkt, weisen diese Bewertungen eine Fülle von Mängeln auf: Sie sind ad hoc<br />
durchgeführt, verfügen häufig über pauschalierende Darstellungen von Ergebnissen, die<br />
Methodik wird in Praxisberichten oft weder transparent noch nachprüfbar dargestellt, die<br />
Art und Weise der Datenerhebung bleibt unbenannt, die Skalierung der Ergebnisse in Dia-<br />
grammen ist manipulierend und die „statistische Alchemie“ basiert oft auf ohnehin umstrit-<br />
tenen Kr<strong>im</strong>inalstatistiken. Darüber hinaus werden Ergebnisse in Prozentwerten angegeben,<br />
ohne auf ein Verhältnis dieser Zahlen zur Gesamtheit der untersuchten Fälle hinzuweisen.<br />
219<br />
219 Vgl. Hempel (2007), S 122<br />
86
3.3.3 Beispiel einer internen Evaluation: Regensburg<br />
Als „In einem besonderen Maße aufschlussreich für die Betrachtung und Problematisierung von internen<br />
Evaluationen“ 220 führt Hempel das Videoüberwachungs-Pilotprojekt in Regensburg an. Ins-<br />
besondere deshalb, weil die Ergebnisse eine Entscheidungsgrundlage für die Änderung des<br />
bayrischen Polizeiaufgabengesetztes vom 1. September 2001 bildeten. Seither sind ständige<br />
Bildaufzeichnungen an kr<strong>im</strong>inalitätsbelasteten <strong>öffentlichen</strong> Plätzen und Straßen erlaubt. 221<br />
Begründet wurde dieses Pilotprojekt mit der <strong>im</strong> bayrischen Durchschnitt hohen Straßen-<br />
kr<strong>im</strong>inalität und dem Anstieg der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht in best<strong>im</strong>mten Innenstadtbereichen,<br />
die durch die Studie „Räumliche Verteilung und Untersuchung von Angst-Räumen in Re-<br />
gensburg“ 1995 von Heike Seiler konstatiert, sowie durch eine Bürgerbefragung <strong>im</strong> Jahr<br />
1999 durch das geographische Institut der Technischen Universität München und dem<br />
Zentralen Psychologischen Dienst der Bayrischen Polizei vertieft wurden. 222<br />
Hempel bezieht sich in seinen Ausführungen zur Evaluation der Videoüberwachung am<br />
Beispiel Regensburg auf die Antrittsvorlesung des Rechtswissenschafters Henning Ernst<br />
Müller an der Universität Regensburg am 2. Februar 2001 und fasst dessen wesentliche Kritikpunkte<br />
wie folgt zusammen: 223<br />
� Mangels Personal und mangels technischer Ausstattung war eine Überwachung nur<br />
eingeschränkt möglich<br />
� Die überwiegende Anzahl der Kamerastandorte war nicht identisch mit den „Angst-<br />
räumen“, die Seiler in ihrer Diplomarbeit festgestellt hatte (u.a. bedingt durch den<br />
Rückgriff auf ein bestehendes Verkehrsüberwachungssystem) 224<br />
220 Quelle: Hempel (2007), S 123<br />
221<br />
vgl. Polizei Bayern: Videoüberwachung in Regensburg. Presseaussendung, Regensburg 10.01.2008<br />
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/regensburg/schuetzenvorbeugen/kr<strong>im</strong>inalitaet/index.html/3133<br />
1<br />
222<br />
vgl. Polizei Bayern: Polizeidirektion Regensburg: Videoüberwachung in Regensburg. Regensburg o.J., S 1<br />
http://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/3/1/video_berwachung_regensburg.pdf<br />
223<br />
vgl. Hempel (2007), S 124<br />
224<br />
vgl. Müller, Henning Ernst: Zur Kr<strong>im</strong>inologie der Videoüberwachung. Humanistische Union, Berlin 2003<br />
http://www.humanistische-union.de/themen/innere_<strong>sicherheit</strong>/<strong>sicherheit</strong>_vor_freiheit/mueller/<br />
87
� Bereits seit Beginn der 1990er Jahre – und nicht erst mit Durchführung der Video-<br />
überwachung war die Straßenkr<strong>im</strong>inalität in Regensburg rückläufig<br />
� Die Darstellung der Ergebnisse sei wenig aussagekräftig, da die Delikte nicht diffe-<br />
renziert wurden und auch insgesamt ein falscher Eindruck vom Kr<strong>im</strong>inalitätsge-<br />
schehen in Regensburg erweckt würde<br />
Auch die Regensburger Polizei veröffentlichte in ihrem Bericht durchaus bescheidene Er-<br />
folge. Im Vergleichszeit<strong>raum</strong> vom 1. Juni 1997 bis 31. Mai 2001 stellte sie zwar einen gene-<br />
rellen Rückgang der Delikte von 183 auf 158 fest, hält aber auch fest, dass „Der große Fahn-<br />
dungserfolg – d.h. Aufzeichnung einer konkreten Straftat auf Videoband“ 225 der Regensburger Polizei<br />
versagt blieb. Die Straßenkr<strong>im</strong>inalität – deren Bekämpfung ein großes Ziel war – ist <strong>im</strong> Jahr<br />
2000 <strong>im</strong> Vergleich zum Vorjahr um gerade 2 % zurückgegangen. Darüber hinaus kam es<br />
<strong>im</strong>mer wieder zu Straftaten, die von der Polizei mangels Ressourcen nicht beobachtet wer-<br />
den konnten. Das „Punkerunwesen“ in der Innenstadt wurde in den Jahren 2000 und 2001<br />
fast auf Null reduziert. Allerdings werden dafür auch verstärkte generelle Kontrollmaßnahmen<br />
verantwortlich gemacht. 226<br />
Nichtsdestotrotz fällt das Resümee der Regensburger Polizei durchwegs positiv aus: „Die<br />
Videoüberwachung an Brennpunkten öffentlich zugänglicher Straßen und Plätze ist eine sinnvolle Maß-<br />
nahme, potentielle Straftäter abzuschrecken, nachhaltig das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und<br />
gegebenenfalls auch Tatverdächtige zu ermitteln.“ 227<br />
Hempel schlussfolgert in seinen Ausführungen gänzlich anders: „Zieht man den finanziellen<br />
Rahmen und den damit eng verbundenen technischen Aufwand des Regensburger Projekts in Betracht und<br />
studiert den Bericht über den Erfolg der Maßnahme, so muss dieser Schluss aufgrund der Begründung, Pla-<br />
nung und Durchführung, also aufgrund der insgesamt bestehenden methodischen Dürftigkeit des Pilotpro-<br />
225 Quelle: Polizei Bayern (o.J.), S 3<br />
226 vgl. ebd.<br />
227 Quelle: Polizei Bayern (o.J.), S 4<br />
88
jekts, als Frömmigkeitsbekundung der Polizei gegenüber dem Innenminister bezeichnet werden.“ 228<br />
Anschließend an das Pilotprojekt werden seit 1. September 2001 drei Örtlichkeiten mit 4<br />
Kameras überwacht und die Bilder für eine nachträgliche Recherche für 30 Tage gespei-<br />
chert.<br />
Im Bericht der Polizei stellt sich die Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung an diesen 3 Örtlichkeiten wie<br />
folgt dar:<br />
Tabelle 8: Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung an videoüberwachten Orten in Regensburg 229<br />
Wie an der Tabelle zu erkennen ist, steigt die Gesamtkr<strong>im</strong>inalität trotz Videoüberwachung<br />
kontinuierlich an.<br />
Zusammenfassend hält der Bericht fest, dass diese Steigerung der Deliktzahlen die übliche<br />
Wellenbewegung, die sich mit den Erfahrungen anderer videoüberwachter Örtlichkeiten<br />
deckt, abbildet. Abschließend wird festgestellt: „Spektakuläre polizeiliche Erfolge <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
mit der Videoüberwachung konnten bisher <strong>im</strong>mer noch nicht verzeichnet werden.“ 230<br />
228 Quelle: Hempel (2007), S 123<br />
229 Quelle: Polizei Bayern (o.J.), S 6<br />
230 Quelle: ebd.<br />
89
3.3.4 Beispiel interne Evaluation Bielefeld<br />
Ein interessantes Beispiel für die (umstrittene) Qualität von Untersuchungen über die Wir-<br />
kungen von Videoüberwachungen – und für deren Auswirkungen – ist das Fallbeispiel des<br />
Ravensberger Parks in Bielefeld. Erstens handelt es sich dabei um das erste Videoüberwa-<br />
chungs-Pilotprojekt in Nordrhein-Westfallen (und wurde daher ausgiebig in Medien und<br />
Fachkreisen diskutiert), zweitens spiegelt es die methodischen Mängel der Evaluation wieder<br />
und drittens wurde aufgrund dieser Ergebnisse das Polizeigesetz verschärft. 231<br />
Seitens des Innenministers von Nordrhein-Westfalen gab es am 21.9.2000 grünes Licht für<br />
das Pilotprojekt: In dem <strong>öffentlichen</strong> Bielefelder Park sollten die Eingänge durch vier Ka-<br />
meras überwacht werden. 232 Davor hatte die Polizei den Park als Kr<strong>im</strong>inalitätsbrennpunkt<br />
identifiziert: Eine Vermengung der örtlichen Drogenszene mit Punkern, Obdachlosen und<br />
Trinkern wurde konstatiert. Folglich wurden vom 23. Februar 2001 bis 31. März 2002 vier<br />
Videokameras eingesetzt. 233<br />
Die Landeskoalition hatte <strong>im</strong> Vorfeld beschlossen, dass eine wissenschaftliche Bewertung<br />
dieser Maßnahme durch Klaus Boers (Institut für Kr<strong>im</strong>inalwissenschaften/Universität<br />
Münster) erfolgen sollte, und dieser einen Bericht bis 31. Oktober 2001 für das Innenminis-<br />
terium erstellen sollte. In diesem Bericht hielt Boers fest, dass u.a. wegen der Undurchführ-<br />
barkeit eines Pre-Tests zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Be-<br />
gleitung in Bielefeld sehr begrenzt sind. 234 Darüber hinaus stellte er ein „insgesamt geringes und<br />
für eine empirische Evaluation von Interventionseffekten ein zu geringes Kr<strong>im</strong>inalitätsvorkommen“ 235 fest.<br />
231<br />
Vgl. Glatzner, Florian: Die Staatliche Videoüberwachung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes als Instrument der Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung.<br />
Magisterarbeit, Münster 2006, S 30<br />
www.foebud.org/video/magisterarbeit-florian-glatzner.pdf<br />
232 Vgl. Veil, Katja: Raumkontrolle. Videokontrolle und Planung für den <strong>öffentlichen</strong> Raum, Diplomarbeit <strong>im</strong><br />
Rahmen des Studiums der Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin, Berlin 2001, S<br />
11<br />
http://de.geocities.com/veilkatja/<br />
233<br />
Vgl. Kubera, Thomas: Videoschutz Bielefeld, Gütersloh o.J.<br />
http://www.thomas-kubera.de/videoschutz.htm<br />
234<br />
Vgl. Möller, Claudia: Videoschutz <strong>im</strong> Ravensberger Park - Projektarbeit zur Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum, o.O. o.J.<br />
http://www.thomas-kubera.de/auszuege01.htm#M%F6ller<br />
235<br />
Quelle: Boers, Klaus: Möglichkeiten einer empirischen Begleitforschung der polizeilichen Videoüberwa-<br />
90
Nachdem Boers folglich diesen Auftrag nicht annahm, wurde die Evaluation von zehn Stu-<br />
denten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Abteilung Bielefeld unter der Leitung<br />
von Prof. Dr. Hans-Jörg Bücking und Thomas Kubera übernommen. 236<br />
Kubera ist aber nicht nur Leiter der Evaluation, sondern gleichzeitig auch Leiter der Polizeiinspektion<br />
Ost be<strong>im</strong> Polizeipräsidium Bielefeld und Leiter des Videoschutz-Projekts. 237<br />
Wenig überraschend ist daher das Fazit von Kubera: „Die Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum ist sicher kein Allheilmittel, sehr wohl aber eine interessante technische Ergänzung polizeilicher Ar-<br />
beit. Gerade in einer Zeit knapper Mittel kann sie die ressourcenschonendere und intelligentere Alternative<br />
sein, Kr<strong>im</strong>inalitätsbrennpunkten wirkungsvoll zu begegnen. Auch wenn die Überwachung zur Aufklärung<br />
von konkreten Straftaten offensichtlich weniger geeignet ist, zeigt sie doch Wirkung <strong>im</strong> Verhalten potentieller<br />
Zielgruppen und <strong>im</strong> Sicherheitsgefühl des Bürgers. Überwachte Gebiete können wieder regulär genutzt und<br />
sozial belebt werden.“ 238<br />
Dabei beruft sich Kubera auf sinkende Straftaten in Beobachtungszeit<strong>raum</strong> 1999 bis 2001,<br />
die insgesamt um 28,8 % zurück gegangen seien. Bei Drogendelikten von erheblicher Bedeutung<br />
konstatiert er sogar einen Rückgang von 100 %. 239<br />
Seine Studentin Claudia Möller stellt in der Projektarbeit „Videoschutz <strong>im</strong> Ravensberger<br />
Park“ <strong>im</strong> Kapitel „Eine historische Betrachtung des Videoschutzes in der Stadt Bielefeld<br />
unter Berücksichtigung erster Erfahrungen“ fest, dass es alleine <strong>im</strong> Jahr 1999 fünf Großein-<br />
sätze der Polizei gab, bei denen die Zahl von Zugehörigen der Drogenszene von 70 Perso-<br />
nen von Mai 1999 auf 10 Personen <strong>im</strong> September 1999 reduziert wurden und führt weiter<br />
aus: „Trotz der Videoüberwachung 2001 nahm in diesem Jahr die Kr<strong>im</strong>inalität <strong>im</strong> Vergleich zu 2000<br />
wieder zu. Bereits in nur neun Monaten diesen Jahres liegt hier schon eine Anzahl von 69 Straftaten vor.<br />
chung <strong>im</strong> Ravensberger und Roachdale Park in Bielefeld. Kr<strong>im</strong>inologisches Gutachten. Westfälische Wilhelms-Universität,<br />
Münster 2001, S 24<br />
http://www.befreite-dokumente.de/eingereichte-akten/44-1-1800-1/<br />
236 vgl. Glatzner (2006), S 34<br />
237 vgl. Glatzner, S 36<br />
238 Quelle: Kubera (o.J.)<br />
239 vgl. ebd.<br />
91
Sieben dieser Delikte fallen hier lediglich in die Statistik, da sich das Ordnungsamt <strong>im</strong> Ravensberger Park<br />
befindet (Betrug z. N. von Sozialversicherungen). Die Anzahl der BTM 240 -Delikte reduzierte sich auf 10,<br />
davon war nur eine <strong>im</strong> Zusammenhang mit harten Drogen. (...) Im Jahr 2000 gab es <strong>im</strong> Park nur noch<br />
sieben Straftaten von erheblicher Bedeutung. Von Januar bis September 2001 gab es neun Straftaten dieser<br />
Art. (...).“ Sie schlussfolgert: „Inwieweit durch die Videoüberwachung eine Verdrängung der Drogenab-<br />
hängigen oder der anderen Randgruppen in andere Bereiche vorliegt, müsste durch eine Milieustudie ermittelt<br />
werden, ansonsten ist dazu <strong>im</strong> Moment keine andere konkrete Aussage zu treffen.“ 241<br />
Dem von Kubera konstatierten dramatischen Rückgang relativiert Haiko Lietz mit der Veröffentlichung<br />
der polizeilichen Statistik als „einerseits richtig und falsch“ 242<br />
Tabelle 9: Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung <strong>im</strong> videoüberwachten Park/Bielefeld 243<br />
Dabei ist erkennbar, dass zwar <strong>im</strong> von Kubera angewandten Vergleichszeit<strong>raum</strong> 1999 bis<br />
2001 die Zahlen wesentlich sanken, jedoch <strong>im</strong> Vergleichszeit<strong>raum</strong> 2000 und 2001 gestiegen<br />
sind. Während sich Kubera alleinig auf einen Placebo Effekt – ausgelöst durch die öffentli-<br />
che Debatte der Videoüberwachung stützt, führt der Bielefelder Verein zur Förderung des<br />
240<br />
In Deutschland fallen diese Delikte unter das Betäubungsmittelgesetz, in Österreich als Suchtgiftgesetz<br />
bezeichnet<br />
241<br />
Quelle: Möller (o.J.)<br />
242 Quelle: Lietz, Haiko: Videoüberwachung: Sicherheit oder Scheinlösung. In: Telepolis, München 06.07.2004<br />
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/17/17813/1.html<br />
243 Quelle: Lietz (2004) – Daten der Polizei Bielefeld<br />
92
<strong>öffentlichen</strong> bewegten und unbewegten Datenverkehrs 244 andere Gründe an: Der Park sei<br />
zur damaligen Expo geschönt worden und darüber hinaus hätte die nahe Drogenanlaufstelle<br />
ihr Angebot für Suchtkranke verbessert. 245 Auch Glatzner zeigt diese Mängel in der Bewer-<br />
tung der Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung aufgrund der Videoüberwachung auf: „Obwohl beispielswei-<br />
se am Anfang des Abschlussberichtes auf die durchgeführten kr<strong>im</strong>inalitäts-entschärfenden Maßnahmen, wie<br />
das Schneiden der Hecken oder das Verbessern der Beleuchtung hingewiesen wurde, wird die Kr<strong>im</strong>inalitätsreduktion<br />
<strong>im</strong> Folgenden nur der Videoüberwachung zugeschrieben.“ 246<br />
Am 31. März 2002 wurde das Projekt abgebrochen, da aufgrund des Rückganges der Kri-<br />
minalitätsbelastung die Rechtsgrundlagen des (alten) Polizeigesetzes NRW nicht mehr ge-<br />
währleistet waren. Im April 2004 wurde die Videoüberwachung wieder in Betrieb genom-<br />
men, da die neue Fassung des Polizeigesetzes NRW die notwendigen Grundlagen dafür ge-<br />
schaffen hatte. 247 In der Zwischenzeit wurde am 25. Juli 2003 der Paragraf 15 a des Poli-<br />
zeigesetzes dahingehend geändert, dass nicht mehr "Straftaten von erheblicher Bedeutung"<br />
am zu überwachenden Ort vorhanden sein müssen, sondern dass ein "Kr<strong>im</strong>inalitätsbrenn-<br />
punkt", an dem "wiederholt Straftaten begangen wurden" vorliegt und "Tatsachen die An-<br />
nahme rechtfertigen, dass an diesem Ort weitere Straftaten begangen werden." 248 Der<br />
Grund für diese Verschärfung: „Das Kabinett berief sich dabei auf die Ergebnisse des Pilotprojekts<br />
der Bielefelder Polizei zur Videoüberwachung. In einer Pressemitteilung vom 17. Juli 2002 hat das Innen-<br />
ministerium mitgeteilt: Der Erfolg ließ sich in Zahlen messen: Schon nach einem Jahr war in Bielefeld die<br />
Zahl der erfassten Straftaten von erheblicher Bedeutung um mehr als die Hälfte gesunken.“ 249<br />
244 Homepage: http://www.foebud.org/<br />
245 Vgl. Lietz (2004)<br />
246 Quelle: Glatzner (2006), S 36<br />
247 Vgl. Glatzner, (2006), S 33<br />
248 vgl. Lietz (2004)<br />
249 Quelle: Lietz (2004)<br />
93
3.3.5 Interne Evaluation: Beispiel Bremen<br />
Es gibt aber auch interne Evaluationen, die sich der Komplexität der Kr<strong>im</strong>inalität differen-<br />
zierter nähern und ein besseres Bild über die Effektivität der Videoüberwachung ermögli-<br />
chen. Ein solches Beispiel bildet der Bericht des Bremer Senators für Inneres und Sport<br />
„Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum als Teil der Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung – Erfahrungsbericht“<br />
vom 12. Dezember 2005. 250<br />
Am 4. Oktober 2002 wurde am Bremer Bahnhofsvorplatz eine sogenannte Dome-Kamera<br />
(360 Grad drehbar, ausgestattet mit Zoom-Objektiv und fernsteuerbar) auf einem Mast der<br />
Bremer Straßenbahn AG installiert. Gründe dafür waren, dass dieser Platz aufgrund einer<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätsanalyse sich als Raum mit der höchsten Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung in Bremen her-<br />
ausgestellt hatte und <strong>im</strong> Rahmen einer Bürgerbefragung durch die Polizei als „Angst<strong>raum</strong>“<br />
ausgewiesen wurde. 251<br />
Die Videoüberwachung wurde hauptsächlich zur Bekämpfung der Straßenkr<strong>im</strong>inalität<br />
(Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Verstoße gegen das Betäugungsmittelgesetz) einge-<br />
setzt. Zur Darstellung der Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung wurden aufgrund der Kleinräumigkeit<br />
des Gebietes die Zahlen des Informationssystem-Anzeigen (ISA) der Polizei herangezogen,<br />
das lokalspezifische Anzeigen registriert und nicht die Daten der Polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalsta-<br />
tistik. Des weiteren wird zum Vergleich der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung eine einjährige Phase vor<br />
der Inbetriebnahme der Kamera dokumentiert. Darüber hinaus werden die Deliktarten dif-<br />
ferenziert dargestellt. Damit werden in der Folge unzulässige Pauschalierungen vermieden<br />
und nachvollziehbare Schlüsse auf einzelne Deliktarten ermöglicht. 252<br />
Dieser Erfahrungsbericht berichtet von einem teils drastischen Rückgehen der Kr<strong>im</strong>inalität<br />
– und differenziert nach Deliktgruppen.<br />
250 Bremische Bürgerschaft: Bericht des Senators für Inneres und Sport "Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum als Teil der Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung - Erfahrungsbericht". Mitteilung des Senats vom 12. Dezember<br />
2005. Drucksache 16/867. Bremen 2005<br />
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksachen/143/2894_1.pdf<br />
251 vgl. Bremische Bürgschaft (2005), S 3<br />
252 vgl. Hempel (2007), S 125 ff<br />
94
Abbildung 10: Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung am videoüberwachten Platz/Bremen 253<br />
Der Bericht -<br />
Wie in der Tabelle ersichtlich ist, sind vor allem Raubdelikte und auch gefährliche Körper-<br />
verletzungen zurückgegangen, während die Zahl der leichten Körperverletzungen leicht ge-<br />
stiegen ist.<br />
Folgend stellt der Bericht dar, dass der erhebliche Rückgang bei den Fahrraddienststählen<br />
wohl in der Demontage der Fahrradbügel auf dem Bahnhofsvorplatz zurückzuführen sei<br />
„und damit <strong>im</strong> Wesentlichen auf eine Veränderung der dortigen Tatgelegenheitsstrukturen zurückzuführen<br />
ist.“ 254 Darüber hinaus werden andere bauliche Maßnahmen, die zur Attraktivierung des<br />
Raumes geführt haben, erwähnt.<br />
Bei Straftaten <strong>im</strong> Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz wurde ein Verdrän-<br />
gungseffekt konstatiert, worauf man an den wiederholt wechselnden Ausweichorten jeweils<br />
mit zusätzlicher Polizeipräsenz reagierte. Während ein Rückgang der gefährlichen und<br />
schweren Körperverletzung <strong>im</strong> überwachten Bereich zu verzeichnen war, stagnierten die<br />
Zahlen der einfachen und fahrlässigen Körperverletzung. Im Bericht wird das darauf zu-<br />
rückgeführt, dass diese „häufig aufgrund von Streitigkeiten unter Angehörigen sozialer Randgruppen,<br />
die sich regelmäßig auf dem Bahnhofsvorplatz aufhalten, begangen werden“ und schlussfolgert daraus<br />
253 Quelle: Bremische Bürgerschaft (2005), S 4<br />
254 Quelle: ebd.<br />
95
„Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die präventiven Möglichkeiten der offenen Videoüberwachung<br />
begrenzt sein können, wenn es sich bei den Straftaten um Spontan-, Beziehungs- oder <strong>im</strong> Rausch begangene<br />
Delikte handelt, die von den Tätern meistens unvermittelt und irrational begangen werden. Sie sind sich der<br />
Existenz der Kamera in dem Moment nicht bewusst und stellen deshalb ihre Tatbegehung nicht darauf ab.“<br />
255<br />
Schlussendlich führt der Bericht aus, dass Videoüberwachung ein Element einer umfassen-<br />
den Sicherheitsstrategie sein kann, aber kein Allheilmittelmittel darstellt. Sie könne weder<br />
die polizeiliche Präsenz, noch allgemeine notwendige Attraktivitätssteigerungen des Raumes<br />
ersetzen. Außerdem sind die „Einsätze verschiedener Organisationseinheiten zu strukturieren und an-<br />
dere Behörden, Organisationen, private Einrichtungen und die Anrainer des Bahnhofvorplatzes für ein<br />
konzentriertes Vorgehen zu gewinnen“. 256<br />
255 Quelle: Bremische Bürgschaft, (2005), S 5<br />
256 Quelle: Bremische Bürgschaft (2005), S 7<br />
96
3.3.6 Wissenschaftliche Untersuchungen<br />
Für eine qualifizierte Meinungsbildung gilt es aber vor allem wissenschaftliche Untersu-<br />
chungen heranzuziehen. Diese gibt es zwar äußerst selten – es gibt sie aber doch. Im deut-<br />
sprachigen Raum habe ich <strong>im</strong> Zuge der Recherchen zwei wissenschaftlich fundierte Unter-<br />
suchungen gefunden, die in dieser Arbeit folglich auch dargestellt werden.<br />
Von amerikanischen und britischen Kr<strong>im</strong>inologen wurde mit der Maryland Scientific Me-<br />
thod Scale (MSMS) eine Richtlinie für kr<strong>im</strong>inalpräventive Untersuchungen erstellt, mit der<br />
externe Einflussgrößen besser kontrolliert werden können. Diese fünfstufige Skala be-<br />
schreibt die Qualitätskriterien einer qualifizierten und aussagekräftigen Untersuchung:<br />
1. Zusammenhang zwischen Maßnahme und einer Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung zu einem<br />
Zeitpunkt<br />
2. Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung bevor und nachdem die Maßnahme eingeführt wurde, aber oh-<br />
ne vergleichbare Kontrollgruppe<br />
3. Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung bevor und nachdem die Maßnahme eingeführt wurde, ein-<br />
schließlich einer Exper<strong>im</strong>ental- und einer vergleichbaren Kontrollgruppe<br />
4. Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsbelastung mit diversen Exper<strong>im</strong>ental- und Kontrollgruppen<br />
5. Zufallsmessungen mit diversen Exper<strong>im</strong>ental- und Kontrolleinheiten 257<br />
Die Stufe vier stellt dabei ein methodisches Mindestmaß dar.<br />
257 Quelle: Hempel (2007), S 127 ff<br />
97
3.3.7 Wissenschaftliche Untersuchung: Beispiel Brandenburg<br />
Erstmals wurde in Deutschland <strong>im</strong> Zuge der Einführung von Videoüberwachung in Bran-<br />
denburg eine wissenschaftliche Begleitung durchgeführt. Durch Professor Dr. Manfred<br />
Bornewasser von der Universität Greifswald wurde ein Gutachten zur kr<strong>im</strong>inologisch-<br />
soziologischen Bewertung erstellt. Parallel dazu führte der Greifswalder Professor Dr. Classen<br />
eine juristische Bewertung durch. 258<br />
Nach der entsprechenden Gesetzesänderung war es der Polizei gestattet worden, öffentlich<br />
zugängliche Straßen und Plätze <strong>mittels</strong> Kamera zu überwachen. Im November und Dezem-<br />
ber 2001 wurde mit der Überwachung in Brandenburg an vier Standorten begonnen:<br />
• Bahnhofvorplatz Potsdam (sechs Kameras)<br />
• Bahnhofvorplatz Erkner (zwei Kameras)<br />
• Bahnhofsvorplatz Bernau (zwei Kameras)<br />
• Außenbereich einer Großdiskothek in Rathenow (drei Kameras).<br />
Bei Bernau, Erkner und Potsdam handelt es sich um stark frequentierte Pendlerbahnhöfe<br />
an der Berliner Peripherie. 259<br />
Der Brandenburger Innenminister Jörg Schönböhm fasste in einer Presseaussendung die<br />
Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Evaluation markant zusammen: „Die Videoüberwachung<br />
ist eine wirksame polizeitaktische Maßnahme zur Bekämpfung der Kr<strong>im</strong>inalität an Kr<strong>im</strong>inalitätsbrenn-<br />
punkten sowie ein wirksames Einsatzmittel zur vorbeugenden Bekämpfung der Kr<strong>im</strong>inalität.“ 260 und<br />
sprach sich daher für eine Fortsetzung der Videoüberwachung aus.<br />
Die Zahlen sprechen auf den erste Blick für sich: Während in Brandenburg die Fallzahlen<br />
um lediglich 6,5 % zurückgegangen waren, sank die Gesamtkr<strong>im</strong>inalität vor den Potsdamer<br />
258 vgl. Land Brandenburg (2006a): Schönböhm: Videoüberwachung hat sich in Brandenburg bewährt. Presseaussendung<br />
des Ministerium des Innern Brandenburg, Potsdam 26.01.06,<br />
http://www.lds-bb.de/sixcms/detail.php?id=245916<br />
259 Vgl. Püschel, Hannes: Einführung und Etablierung der Videoüberwachung in Brandenburg, Köln 2007,<br />
http://www.linksnet.de/artikel.php?id=3322<br />
260 Quelle: Land Brandenburg (2006a)<br />
98
Kameras um ca. 30 %, jene in Rathenow um 60 % und jene in Erkner um gar zirka 60 %.<br />
Nur Bernau scherte aus diesem Überwachungserfolg aus: Nach einem schlagartigen Sinken<br />
unmittelbar nach Einführung der Überwachung stiegen die Gesamtzahlen zwischen 2001<br />
und 2004 um 30 %. Darüber hinaus wurden keine Verdrängungseffekte festgestellt, son-<br />
dern <strong>im</strong> Gegenteil: In angrenzenden Gebieten fiel die Kr<strong>im</strong>inalität durch einen „positiven<br />
Ausstrahlungseffekt“ sogar noch stärker als in den überwachten Gebieten. 261<br />
Ein erster Blick in die Statistik hellt diese Zahlen schon etwas auf:<br />
Tabelle 11 : Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung an Kamerastandorten/Brandenburg 262<br />
• die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Greifswald Prof. Dr. Bornewasser<br />
Wie man an dieser Statistik unschwer erkennen kann, gehen vor allem die Diebstahlsdelikte<br />
261 vgl. Landtag Brandenburg: Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 788 des Abgeordneten<br />
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, Drucksache 4/2057, Potsdam 2005<br />
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w4/drs/ab_2000/2057.pdf<br />
262 Quelle: Landtag Brandenburg (2005), S 3<br />
99
dramatisch zurück., während die anderen Deliktsarten teilweise stagnieren, teilweise auch<br />
steigen.<br />
In seiner umfangreichen wissenschaftlichen Evaluation bezeichnet Bornewasser die Ergebnisse<br />
der Videoüberwachung als „ermutigend“, schränkt aber gleichzeitig ein: 263<br />
• Dass die Videoüberwachung zwar an zwei von vier Standorten (Erkner, Rathenow)<br />
zu deutlichen und dauerhaften Reduktionen des Fallaufkommens führt, sich jedoch<br />
in den beiden anderen Standorten bereits wieder Rückläufe gegenüber den anfänglichen<br />
Erfolgen zeigen<br />
• Dass die Befunde andeuten, dass die Diebstahlsdelikte deutlich und dauerhaft zurückgehen,<br />
andere Deliktarten (z.B. Körperverletzungsdelikte) jedoch kaum einer<br />
dauerhaften Reduktion unterworfen sind<br />
• Dass sich die Frage stellt, ob die sehr auffälligen Ausstrahlungseffekte z.B. in Potsdam<br />
auch auf andere Ursachen bzw. Nutzung dieser Räume zurückgehen<br />
Bezüglich der steigenden Kr<strong>im</strong>inalitätszahl trotz Überwachung in Bernau (von 97 Delikten<br />
2001 auf 131 Delikte <strong>im</strong> Jahr 2004) konstatiert er einen Gewöhnungseffekt: „Dieser anfängli-<br />
che Abschreckungseffekt – in ihm schlagen sich vermutlich die Neuartigkeit der Maßnahme, eine umfassen-<br />
de Öffentlichkeitsarbeit und ein angemessenes Personalkonzept nieder - wird daraufhin von einem Gewöh-<br />
nungseffekt (parallel mit einer veränderten Personalstruktur und der Erledigung der Arbeit in Zugleichfunktion)<br />
überlagert und die erwarteten Reduktionen gehen wieder zurück.“ 264<br />
Während es (temporäre) deliktspezifische Verringerungen bei Fahrraddiebstählen und<br />
Sachbeschädigungen <strong>im</strong> überwachten Gebiet zu verzeichnen gibt – und die positiven Aus-<br />
strahlungseffekte sogar <strong>im</strong> Gebiet der Innenstadt zu einer Kr<strong>im</strong>inalitätsreduktion führen 265 ,<br />
kommen Fahrraddiebstähle <strong>im</strong> direkt angrenzenden Gebiet seltener, und Sachbeschädigung<br />
263 vgl. Bornewasser, Manfred: Evaluation der polizeilichen Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze<br />
<strong>im</strong> Land Brandenburg – Endbericht. Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald 2005. In: Landtag Brandenburg:<br />
Bericht der Landesregierung an den Landtag über die polizeiliche Videoüberwachung öffentlich zugänglicher<br />
Straßen und Plätze zu präventiven Zwecken <strong>im</strong> Land Brandenburg. Drucksache 4/2347. Potsdam<br />
2006, S 2<br />
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w4/drs/ab%5F2300/2347.pdfhttp://www.parldok.branden<br />
burg.de/parladoku/w4/drs/ab%5F2300/2347.pdf<br />
264 Quelle: Bornewasser (2005), 23 ff<br />
265 vgl. Bornewasser (2005), S 25<br />
100
häufiger vor. 266<br />
In Erker verändert sich vor der Kamera das Straftatenspektrum: Während der Diebstahl<br />
von 60 % der begangenen Strafteten 2001 auf 47 % <strong>im</strong> Jahr 2004 sinkt, steigen die Sachbe-<br />
schädigungen in diesem Zeit<strong>raum</strong> von rund 10 % auf 17 % an. 267 Insgesamt sinken aber<br />
beide Deliktbereich <strong>im</strong> videoüberwachten Bereich, <strong>im</strong> direkt angrenzenden Bereich kommt<br />
Fahrraddiebstahl relativ seltener, Sachbeschädigung aber wiederum häufiger vor. 268 Roh-<br />
heitsdelikte (Körperverletzung) reduzieren sich nicht.<br />
In Potsdam sinken die Diebstähle sowohl <strong>im</strong> überwachten, wie auch angrenzenden Bereich<br />
bis 2003 deutlich , <strong>im</strong> videoüberwachten Bereich steigen diese - <strong>im</strong> Gegensatz zum angren-<br />
zenden - wieder ab 2004. Die Rohheitsdelikte sinken <strong>im</strong> angrenzenden Bereich bis 2004, <strong>im</strong><br />
videoüberwachten lässt sich kein Trend erkennen. Auffällig in Potsdam: Der Deliktbereich<br />
Fahrraddiebstahl sinkt trotz Videoüberwachung nicht und könnte durch örtliche Gegebenheiten<br />
begründet sein. 269<br />
Für Rathenow konstatiert Bornewasser, dass die Überwachungsmaßnahme an der kritischen<br />
Disco zu erheblichen Rückgängen der Fallzahlen führt. Allerdings dürfte hier ein Verdrän-<br />
gungseffekt hineinspielen, weil eine nahe gelegene Tankstelle, als auch eine andere Disco<br />
teilweise zum Rückzugsgebiet von rechtsextremen Jugendlichen mutierten: „Diese Verdrän-<br />
gung ist zwar nicht unbedingt gewollt, sie lässt sich allerdings auch nicht ganz vermeiden, da sich durch die<br />
Videoüberwachung die Einstellungen nicht ändern lassen.“ 270 Darüber hinaus führt er aus, dass die<br />
Reduktionen in Rathenow nicht eindeutig durch die Videoüberwachung ursächlich erklärt<br />
werden können und kritisch auf die sehr geringen Fallzahlen <strong>im</strong> überwachten Bereich hin-<br />
zuweisen ist.<br />
Grundsätzlich weist Bornewasser in seiner Untersuchung darauf hin, dass die Videoüberwa-<br />
266 vgl. Bornewasser (2005), S 29<br />
267 vgl. Bornewasser (2005), S 32<br />
268 vgl. Bornewasser (2005), S 41<br />
269 vgl. Bornewasser (2005), S 50<br />
270 Quelle: Bornewasser (2005), S 59<br />
101
chung deutliche Rückgänge <strong>im</strong> Deliktbereich Diebstahl bewirkt. Spontane Körperverlet-<br />
zungen sind von der Überwachung nicht tangiert. Problematisch bewertet er den „Gewöh-<br />
nungseffekt“, gegen den man nur mit ständiger Öffentlichkeitsarbeit, mehr Technik, wirk-<br />
samen und schnellen Zugriffen und schlussendlich mit mehr und gut motiviertem Personal<br />
ansteuern könne.<br />
Am 26.09.2006 wurde eine Novelle zum Polizeigesetz <strong>im</strong> Brandenburg beschlossen, dass<br />
vor allem auf die Bereiche Videoüberwachung, Wohn<strong>raum</strong>überwachung, Eingriffe in die<br />
Telekommunikation und die anlassbezogene Kennzeichenfahndung abzielt. Damit sollte die<br />
bis Jahresende befristete Videoüberwachung öffentlicher Plätze und Straßen zu einer dau-<br />
erhaften Einrichtung werden. Die Videoüberwachung soll zwar nicht ausgeweitet werden,<br />
aber eine Daueraufzeichnung bis 48 Stunden soll ermöglicht werden. 271<br />
Insgesamt konnten in Brandburg <strong>im</strong> Zeit<strong>raum</strong> 2001 bis 31.08.2005 128 Täter durch die Vi-<br />
deoüberwachung nach Tatbegehung gestellt werden. Die jährlichen Sachkosten (Mietkosten<br />
der Videotechnik und Datenübertragung - ohne Personalkosten) belaufen sich auf ca. €<br />
260.000. 272 Wie viele von Gestellten tatsächlich als Täter verurteilt wurden und wie oft Ma-<br />
terial, das durch die Videoüberwachung gewonnen wurde, zu dieser Verurteilung beitrug,<br />
wurde statistisch leider nicht erfasst. 273<br />
Mit Ende des Jahres 2007 wurde die Überwachungsanlage in Rathenow abgebaut. Für Jörg<br />
Barthel, dem Leiter des Polizeischutzbereiches Havelland war die Überwachung ein Erfolg.<br />
Bei diesem Pilotprojekt sei es darum gegangen. zu testen, für welche Deliktsbereiche die<br />
Videoüberwachung das passende Instrument sei. Nach fünf Jahren Test sei klar, dass die<br />
erwartete präventive Wirkung nicht so groß sei, wie man erwartet habe. Die Zahl der Delik-<br />
te <strong>im</strong> überwachten Bereich sei zwar zurückgegangen, allerdings sei dies nicht unbedingt auf<br />
die Kameras zurückzuführen, vielmehr habe sich das Kr<strong>im</strong>inalitätsgeschehen in den Jahren<br />
271<br />
vgl. Land Land Brandenburg (2006b): Kabinett beschließt Änderung des Polizeigesetzes. Presseaussendung<br />
der Staatskanzlei, Potsdam 26.09.2006<br />
http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.370364.de<br />
272<br />
vgl. Landtag Brandenburg (2005)<br />
273 vgl. Püschel (2007)<br />
102
verändert. Die abschreckende Wirkung der Kameras bei „Affekt“-Straftaten gehe gegen<br />
Null. Darüber hinaus sei die Videoüberwachung zu teuer und Polizisten in Fleisch und Blut<br />
hätten eine größere abschreckende Wirkung als Kameras. 274<br />
Auch die Videoüberwachung am Bahnhofsvorplatz in Bernau wurde Ende 2007 eingestellt.<br />
Ausschlaggebend dafür war die Einschätzung durch den Schutzbereich Barn<strong>im</strong>, dass es sich<br />
um keinen Kr<strong>im</strong>inalitätsschwerpunkt mehr handelt. Laut Innenministerium seien die Straf-<br />
taten von 2001 bis 2006 um 27 % gesunken, die örtliche Polizei registrierte diese Verbesse-<br />
rung allerdings erst 2004. Der Rückgang der Delikte sei dort aber nicht auf die Videoüber-<br />
wachung zurückzuführen, sondern auf die gesamte Polizeiarbeit, führte der örtliche Polizeidirektor<br />
aus. 275<br />
274<br />
vgl. Kniebeler, Markus: Nach sechs Jahren endet die polizeiliche Videoüberwachung in Rathenow. In: Märkische<br />
Allgemeine, Potsdam 13.11.2007,<br />
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11064175/61759/#http://www.maerkischeallgemeine.de<br />
/cms/beitrag/11064175/61759/%23<br />
275<br />
vgl. Weilbacher, Jan C.: Die Kameras werden wieder abgeschaltet. Märkische Oberzeitung, Frankfurt (Oder)<br />
03.08.2007<br />
http://www.moz.de/index.php/Moz/Article/category/Bernau/id/195489<br />
103
3.3.8 Wissenschaftliche Untersuchung:: Beispiel Berlin<br />
Dass hinter der Installierung von Videoüberwachungssystemen nicht zwingend wissen-<br />
schaftlich-sachliche Überlegungen und Analysen stehen, lässt sich gut am Beispiel – und der<br />
damit verbundenen intensive Debatte - der Berliner Verkehrsbetriebe zeigen.<br />
Seit dem Jahr 2000 erfolgen videobasierende Aufzeichnungen auf Bahnhöfen der Berliner<br />
Verkehrsbetriebe (BVG). 276 Am 31. März 2006 führten die BVG auf den Bahnhöfen der U-<br />
Bahnlinien U2, U6 und U 8 Videolangzeitarchivierung als Pilotprojekt für die Dauer von 12<br />
Monaten ein. Zusätzlich erfolgen Aufzeichnungen in Verbindung mit Notrufsäulen auf<br />
Bahnhöfen und teilweise auf einzelnen Linien in Zügen. Außerdem erfolgt eine sporadische<br />
Video-Live-Beobachtung durch die Leitstelle. 277 . Der Unterausschuss für Datenschutz des<br />
Berliner Abgeordnetenhauses hatte dem Versuch <strong>im</strong> Vorfeld unter der Maßgabe zuge-<br />
st<strong>im</strong>mt, dass die Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet und die Verhältnismäßigkeit des<br />
Kameraeinsatzes geprüft werden. Im Anschluss an diese Einigung am 19. Juli 2005 zeigte<br />
sich BVG-Vorstand Necker sehr zufrieden: „Wir können auf ausgewählten Linien dann rund um<br />
die Uhr aufzeichnen und erhöhen damit auch deutlich das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäs-<br />
te.“ 278<br />
In der Folge wurde das Institut „D: 4 BaSE/Büro für angewandte Statistik“ mit der Durch-<br />
führung der Studie betraut und von Dr. Leon Hempel und Dipl.Chem. Christian Alisch<br />
durchgeführt, wobei Daten vom 3. März 2006 bis zum 16. Oktober 2006 ausgewertet wur-<br />
den. 279<br />
276 vgl. Hempel, Leon/Alisch Christian: Evaluation der 24-Stunden Videoaufzeichnung in U-Bahnstationen der<br />
Berliner Verkehrsbetriebe(BVG); Zwischenbericht. D:4 BaSE/Büro für angewandte Statistik und Evaluation,<br />
Berlin 2006, S 3<br />
http://berlin.humanistische-union.de/fileadmin/hu_upload/berlin/2007/04_Evaluationsbericht.pdf<br />
277 vgl. Hempel/Alish (2006), S 7<br />
278<br />
Quelle: Berliner Verkehrsbetriebe: Pilotversuch auf ausgewählten U-Bahnlinien. Berliner Datenschützer und<br />
BVG einigen sich auf Videoaufzeichnung. Presseaussendung vom 19. Juli 2005,<br />
http://www.bvg.de/index.php/de/Bvg/Detail/folder/301/rewindaction/Index/archive/1/id/276/name/Pi<br />
lotversuch+auf+ausgew%26auml%3Bhlten+U-Bahnlinien<br />
279<br />
vgl. Laninger, Tanja: Videokameras in U-Bahn bringen keine Sicherheit. In: Berliner Morgenpost, Berlin<br />
16.10.2007,<br />
http://www.morgenpost.de/desk/1268075.html<br />
104
Anfang 2007 wurde bekannt, dass die BVG den Auftrag zur wissenschaftlichen Begleitfor-<br />
schung des Pilotprojektes einseitig aufgekündigt hatte. Stattdessen sollte eine Umfrage unter<br />
den Fahrgästen zur Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Videoüberwachung durchgeführt<br />
werden. Zu den Gründen der Kündigung wollten sich die BVG nicht äußern. Bekannt war<br />
allerdings auch, dass Hempel und Alish einen Zwischenbericht abgeliefert hatten. Damit<br />
waren natürlich Spekulationen über das Ergebnis verbunden. In einem internen Schreiben<br />
verkündete der BVG-Vorstandsvorsitzende Thomas Necker diesen Schritt in einem inter-<br />
nen Schreiben damit, „dass eine Verbesserung der objektiven Sicherheit für unsere Fahrgäste bei derzeit<br />
festzustellenden steigenden Kr<strong>im</strong>inalitätszahlen <strong>im</strong> Bereich des ÖPNV in Berlin mit dieser Art der Evalu-<br />
ation nicht nachgewiesen werden kann.“ 280 Die BVG entschied sich, nach Ablauf des Pilotprojek-<br />
tes 2007, die Aufzeichnung der Videodaten bis zum Ende des Jahres auf alle 170 U-<br />
Bahnhöfe auszuweiten. Laut eigenen Angaben habe sich die Videoaufzeichnung <strong>im</strong> Pilot-<br />
projekt bewährt, um tätliche Übergriffe, aber auch Sachbeschädigungen innerhalb der U-<br />
Bahnhöfe besser aufzuklären. 281<br />
Um in Berlin „eine öffentliche Diskussion um den Nutzen und die Folgen einer stärkeren Videoüberwa-<br />
chung bei der BVG“ führen zu können, erstritt die Humanistische Union 282 Einsicht in den<br />
Zwischenbericht.<br />
Nach der erstrittenen Veröffentlichung des Untersuchungsberichts und entsprechenden<br />
Pressereaktionen verwies die BVG auf eklatante Mängel in der Evaluation. Die Berliner Zei-<br />
tung zitiert BVG-Vorstand Necker, der feststellt: „die Studie betrachte nur einen kurzen Zeit<strong>raum</strong>,<br />
sei methodisch fragwürdig und "unwissenschaftlich". BVG-eigene Statistiken zeigten, dass die Videoauf-<br />
zeichnung auf den drei Linien bei Graffiti und Vandalismus zu einem geringeren Anstieg der Delikte als<br />
280<br />
Quelle: Lüders, Sven (2007a): Videoüberwachung in den U-Bahnen bringt keinen Sicherheitsgewinn. Humanistische<br />
Union, Berlin 08.10.2007,<br />
http://berlin.humanistischeunion.de/themen/videoueberwachung/videoueberwachung_detail/back/videoueberwachung-<br />
1/article/videoueberwachung-in-den-u-bahnen-bringt-keinen-<strong>sicherheit</strong>sgewinn/<br />
281 ebd.<br />
282 Die Humanistische Union ist eine unabhängige Bürgerrechtsorganisation. Seit deren Gründung 1961 setzt<br />
sie sich für den Schutz und die Durchsetzung der Menschen- und Bürgerrechte ein.<br />
www.berlin.humanistische-union.de<br />
105
auf den übrigen Linien geführt habe. 283 Bei einem Gespräch zwischen Humanistischer Union<br />
und BVG bekräftigte die BVG ihre Kritik an dem veröffentlichten Zwischenbericht (in<br />
Klammern der Widerspruch der Humanistischen Union): „der Untersuchungszeit<strong>raum</strong> sei zu<br />
kurz (das räumt die Studie selbst ein), die Daten der polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalstatistik POLIKS enthielten<br />
systematische Fehler, weil die Zuordnung der Straftaten zum ÖPNV stark vom Ort der Anzeigenerstat-<br />
tung abhinge (deshalb gewichtet die Studie alle Zahlen der Polizeistatistik nur mit 50 %). 284 Die BVG<br />
berief sich bei diesem Gespräch auf eigene Zahlen: Dass die Kameras einen spürbaren Sicherheitsgewinn<br />
bringen, gehe aus Kundenumfragen hervor. 285<br />
Folglich beschloss die BVG eine Ausweitung auf alle 170 Berliner U-Bahnhöfe bis Jahres-<br />
ende 2007. 286 In November 2007 beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus die heftig um-<br />
strittene Novelle des Landespolizeigesetzes mit einer St<strong>im</strong>me Mehrheit. Kern der Reform<br />
des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) ist die Ausdehnung der Möglichkeiten<br />
zur Videoüberwachung und zur Handy-Ortung. 287<br />
Warum hatte die BVG derart heftig auf die Ergebnisse von Hempel und Alish auf den Zwi-<br />
schenbericht der „Evaluation der 24-Stunden Videoaufzeichnung in U-Bahnstationen der<br />
Berliner Verkehrsbetreibe (BVG)“ 288 reagiert?<br />
283<br />
Quelle: Rogalla, Thomas: Polizei filmt künftig in der U-Bahn. Gesetzesänderung für mehr Videoüberwachung.<br />
In: Berliner Zeitung, Berlin 10.10.2007,<br />
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2007/1010/lokales/0073/index.html?group=berlinerzeitung&sgroup=&day=today&suchen=1&keywords=bvg&search_in=archive&author=&ressort=&von=09.1<br />
0.2007&bis=11.10.2007<br />
284<br />
Quelle: Lüders, Sven (2007b): Nicht überall, wo Sicherheit draufsteht, ist auch Sicherheit drin, Humanistische<br />
Union, Berlin 29.11.2007,<br />
http://berlin.humanistischeunion.de/themen/videoueberwachung/videoueberwachung_detail/back/videoueberwachung-<br />
1/article/nicht-ueberall-wo-<strong>sicherheit</strong>-draufsteht-ist-auch-<strong>sicherheit</strong>-drin/<br />
285<br />
vgl. Lüders (2007b)<br />
286 vgl. Studie: Videoüberwachung in Berliner U-Bahn brachte keinen Sicherheitsgewinn. In: Telepolis, Hannover<br />
09.10.07,<br />
http://www.heise.de/newsticker/meldung/97141<br />
287<br />
vgl. Krempl, Stefan: Hauchdünne Mehrheit für Verschärfung des Berliner Polizeigesetzes. In: Heise online,<br />
Hannover 22.11.2007,<br />
http://www.heise.de/newsticker/meldung/99443<br />
288 vgl. Hempel/Alish (2006)<br />
106
Womöglich deshalb, weil Hempel konstatierte, dass sich eine Veränderung der Kr<strong>im</strong>inali-<br />
tätsrate nicht abzeichnete? Oder weil sich darüber hinaus, sogar eher ein leichter Anstieg der<br />
Vergleichszahlen <strong>im</strong> Bereich der Sachbeschädigungen abzeichnete?. 289<br />
Hempel fasst die Ergebnisse <strong>im</strong> Management Summary wie folgt zusammen: „Die gegenwärti-<br />
ge Nutzung rechtfertigt die 24-Stunden-Videoaufzeichnung hinsichtlich best<strong>im</strong>mter Delikte wie Angriffe auf<br />
Mitarbeiter oder Raub, hinsichtlich Sachbeschädigung oder Taschendiebstahl bislang nicht. Auch ist in Be-<br />
zug auf die Gesamtheit aller durchschnittlich bekannten Vorfälle bei der gegenwärtigen Nutzung des In-<br />
struments keine erhebliche Veränderung der Sicherheitslage in der Berliner U-Bahn zu erwarten. Eine<br />
Verbesserung hinsichtlich der Kommunikation zwischen Ermittlungsbehörden und BVG ist deshalb drin-<br />
gend erforderlich, wenn die 24-Stunden-Videoaufzeichnung einen effektiven Erfolg bei der Straftatenverfolgung<br />
erfüllen soll.“ 290<br />
Im Untersuchungszeit<strong>raum</strong> wurden insgesamt 261 Ereignisse durch die Kameras erfasst,<br />
davon durch die 24-Stunden-Aufzeichnung an den Bahnhöfen 78 Delikte. Von diesen 78<br />
waren 32 % auswertbar. Von den insgesamt erfassten 261 Ereignissen erfolgten in 224 Fäl-<br />
len Anfragen durch die Polizei, die restlichen Anfragen erfolgten vor allem durch Personal<br />
und Fahrgaste. Für die Auswertung der 261 Fälle wurden 330 Arbeitsstunden benötigt.<br />
Durchschnittlich dauerte daher eine Auswertung durchschnittlich knapp über 1 Stunde und<br />
40 Minuten. Wenn man bedenkt, dass <strong>im</strong> Jahr 2005 zwischen April und Dezember <strong>im</strong> Be-<br />
reich der U-Bahn insgesamt 8729 Delikte polizeilich bekannt geworden sind, stellt sich na-<br />
türlich die Frage, wer denn bei einer selbst funktionierenden und flächendeckenden Video-<br />
überwachung diese Fülle von notwendigen Arbeitsressourcen abdecken könnte, bzw. wie<br />
diese zu finanzieren seien. 291<br />
289 vgl. Hempel/Alish (2006), S 6<br />
290 Quelle: Ebd.<br />
291 vgl. Hempel/Alish (2006) S 32 ff<br />
107
3.3.9 Metaevaluationen<br />
Wie bisher aufgezeigt, zeigen die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen zur Wirkung<br />
der Videoüberwachung ein durchaus uneinheitliches Bild. Damit gibt es in der Abwägung<br />
von Pros und Contras dieser Überwachung – gerade für Entscheidungsträger – eine unklare<br />
Entscheidungsbasis. „Für politische Entscheidungsträger sind inkonsistente Ergebnisse ein und derselben<br />
Maßnahme eine Herausforderung. Zugleich bleibt aber auf politischer Seite die Notwendigkeit einer Orientierung,<br />
wenn nicht gar ein Entscheidungszwang bestehen.“ 292<br />
Daher macht es Sinn, mehrere Evaluationen zusammenzufassen und <strong>im</strong> Vergleich nach<br />
einheitlicheren und klareren Linien zu sehen. „Aufgrund einer größeren Datenbasis soll unter statis-<br />
tischen Gesichtspunkten die Zuverlässigkeit von Aussagen erhöht werden. Aus politischer Sicht sind sie<br />
trotz uneinheitlicher Ergebnisse sinnvoll, um zwischen einzelnen Bewertungen politisch einscheidungsfähig zu<br />
bleiben.“ 293<br />
Bei der Suche nach vorhandenen Meta-Evaluationen wird man <strong>im</strong> deutsprachigen Raum<br />
derzeit (noch) nicht fündig. Die deutsprachige Literatur verweist vor allem auf zwei Meta-<br />
Studien, die in Großbritannien durchgeführt wurden.<br />
292 Quelle: Hempel (2007), S 130<br />
293 Quelle: ebd.<br />
108
3.3.10 Die Meta-Evaluation von Welsh und Farrington<br />
Im Jahr 2000 erstellten Welsh und Farrington <strong>im</strong> Auftrag des britischen Home Office die<br />
erste große Metaevaluation „Cr<strong>im</strong>e prevention effects of closed circuit television: a systema-<br />
tic review“. 294 Bei dieser Evaluation wurden insgesamt 22 Studien zusammengefasst. Alle<br />
diese Studien entsprachen den angelegten Kriterien, 24 weitere vorhandene Studien wurden<br />
ausgeschlossen, weil sie diesen Kriterien nicht entsprachen (kein Exper<strong>im</strong>entalbereich mit<br />
vergleichbarem Kontrollgebiet bzw. keine vorhandenen Kr<strong>im</strong>inalitätsraten für beide Gebie-<br />
te). Von diesen 22 Studien konnte bei der Hälfte ein erwünschter Effekt auf die Kr<strong>im</strong>inali-<br />
tät, bei fünf ein unerwünschter Effekt und bei fünf keinerlei Effekt nachgewiesen werden.<br />
Eine Studie zeigte einen unsicheren Effekt. Von 18 Untersuchungen – die anderen 4 ent-<br />
hielten keine auswertbaren Daten – wurde gefolgert, dass es zwar einen erwünschten Effekt<br />
auf die Gesamtkr<strong>im</strong>inalität gab, dieser aber eine eher bescheidene Verringerung der Kr<strong>im</strong>i-<br />
nalität um gerade 4 % erbrachte. 295<br />
Nach Deliktarten zeigte sich, dass bei Gewaltverbrechen keinerlei Wirkung festgestellt wer-<br />
den konnte, es aber bei Eigentumsdelikten – insbesondere KFZ-Delikten - signifikante Er-<br />
folge gab. In Stadtzentren und in Wohngebieten wurde eine unwesentliche Verringerung<br />
von 2 % der Kr<strong>im</strong>inalität festgestellt, ganz anders – und das ist ein großer Erfolg der Vi-<br />
deoüberwachung – sieht die Situation in Parkhäusern aus: Dort wurde eine Verringerung<br />
von 41 % gegenüber den Kontrollräumen gemessen. Vor allem begleitende Maßnahmen<br />
wie z.B. bessere Beleuchtung führten zu diesem Erfolg. 296<br />
294 Welsh, Brandon C./Farrington, David P.: Cr<strong>im</strong>e prevention effects of closed circuit television: a systematic<br />
review, Home Office Research Study 252. Home Office Research, Development and Statistics Directorate,<br />
London 2002,<br />
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/hors252.pdf<br />
295 vgl. Welsh/Farrington (2002), S 41<br />
296 vgl. Welsh/Farrington (2002) S 42<br />
109
3.3.11 Die große Studie von Gill & Spriggs<br />
Eine der umfangreichsten – und in der Debatte oft zitierten – Metastudie bildet die Studie<br />
„Assessing the <strong>im</strong>pact of CCTV“ 297 von Martin Gill und Angela Spriggs. Diese wurde 2005<br />
von der „University of Leicester“ für das „Home Office“ erstellt. In dieser umfangreichen<br />
Studie wurden neben den Auswirkungen auf die verschiedenen Formen der Kr<strong>im</strong>inalität<br />
auch der Einfluss der Videoüberwachung auf die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht, mögliche Verschie-<br />
bungseffekte und die Kosten der Videoüberwachung untersucht.<br />
Dabei wurden 14 CCTV-Systeme in 13 unterschiedlichen, über das ganze Land verteilter<br />
und anonymisierter, Städte untersucht. Die Auswahlbedingungen wurden vom Home Of-<br />
fice vorgegeben. Die Untersuchungen wurden anhand der polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalstatistik<br />
vor und nach der Installation der Anlagen <strong>im</strong> Untersuchungsgebiet durchgeführt. Diese Da-<br />
ten wurden mit den Ergebnissen aus einem ähnlichem Kontrollgebiet und einem anschlie-<br />
ßenden Puffergebiet verglichen, um die generelle Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung sowie Verlage-<br />
rungseffekte festhalten zu können. Begleitend gab es 12 Befragungen, der in den untersuch-<br />
ten Gebieten lebenden Bevölkerung und eine Untersuchung, ob es auch noch andere Ein-<br />
flussfaktoren auf die Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung in den evaluierten Gebieten gibt. 298 Die Ört-<br />
lichkeiten der 14 Überwachungsanlagen setzten sich wie folgt zusammen: sieben in Wohn-<br />
gebieten, vier in Innenstädten, eine auf einem großstädtischen Krankenhausgelände, ein<br />
System, das 60 Parkplätze in London überwacht, eines in einem Vorort.<br />
Der „Impact on Cr<strong>im</strong>e“ fällt relativ bescheiden aus: Von 13 Systemen, die das Ziel der Ver-<br />
ringerung der Kr<strong>im</strong>inalität hatten, konnte nur bei sechs Systemen ein Rückgang erreicht<br />
werden, bei nur zwei Fällen war ein Rückgang der Gesamtkr<strong>im</strong>inalität signifikant festzustel-<br />
len (wobei bei einem System auch noch weitere Faktoren ausschlaggebend waren). In sieben<br />
Fällen stieg die Kr<strong>im</strong>inalität an, jedoch könnten diese Anstiege auch nationalen Trends und<br />
weiteren Faktoren anzurechnen sein. 299<br />
297 vgl. Gill/Spriggs (2005)<br />
298 vgl. Gill/Spriggs (2005), S V<br />
299 vgl. Gill/Spriggs (2005), S VI<br />
110
Die folgende Tabelle von Glatzner wertet die Untersuchung aus und bildet eine übersicht-<br />
liche Zusammenstellung bezüglich der Veränderung der Kr<strong>im</strong>inalität in video-überwachten<br />
Zonen.<br />
Tabelle 12: Einfluss der Videoüberwachung auf Gesamtkr<strong>im</strong>inalität 300<br />
300 Quelle: Glatzner (2006), S 47<br />
111
Wie sich in der Tabelle zeigt, ist der Erfolg der Videoüberwachung ein relativer. Die Ergeb-<br />
nisse sind von Standort zu Standort sehr verschieden. Am stärksten wirkte die Kontrolle in<br />
Autoparks, in Innenstadtgebieten gab es sehr uneinheitliche Ergebnisse und in Wohngebie-<br />
ten gab es keine längerfristigen positiven Wirkungen. Es zeigt sich also, dass man Effekte<br />
auf die Gesamtkr<strong>im</strong>inalität nicht schlüssig ziehen kann, und deshalb eine Differenzierung<br />
der Deliktarten (was diese Studie auch tut) notwendig ist.<br />
Am erfolgreichsten war die Videoüberwachung bei den Eigentumsdelikten. Von den 13 un-<br />
tersuchten Systemen, die ein Eindämmen dieses Deliktbereiches als Ziel hatten, ergaben<br />
sich insgesamt 23 Fälle (KFZ-bezogene Kr<strong>im</strong>inalität, Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädi-<br />
gung [ohne Alkoholeinwirkung] und Ladendiebstahl), von denen in 16 Fällen die Zahl der<br />
Eigentumsdelikte sank, davon drei Mal signifikant. Angemerkt sei jedoch: Nur bei einem<br />
dieser drei Fälle gab es keine anderen kr<strong>im</strong>inalitätsreduzierenden Maßnahmen. Zwei der drei<br />
Fälle bezogen sich auf KFZ-bezogene Kr<strong>im</strong>inalität. Sechs mal wurde auch eine Steigerung<br />
der Eigentumsdelikte verzeichnet, davon zwe<strong>im</strong>al signifikant. Vor allem Großparkplätze<br />
scheinen sich daher für Videoüberwachung zu eignen. 301<br />
Anders stellt sich das Bild bei den Affektdelikten dar. Neun Systeme untersuchten die Wir-<br />
kung auf Körperverletzungen, Drogendelikte sowie Sachbeschädigung und Störung der öf-<br />
fentlichen Ordnung unter Einfluss von Alkohol. Von insgesamt 19 Fällen gingen bei nur<br />
vier die Delikte zurück. Drei Fälle lagen dabei <strong>im</strong> Trend mit der Einwicklung des Kontroll-<br />
gebietes und in einem Fall – der einzig signifikante – wurde zusätzlich ein privater Sicher-<br />
heitsdienst eingestellt. In den anderen 15 Fällen stieg die Deliktanzahl an, davon in sieben<br />
wie <strong>im</strong> vergleichenden Kontrollgebiet, darüber hinaus gab auch saisonelle Schwankungen,<br />
bzw. mehr Aufgriffe durch die Polizei. 302<br />
Hempel fasst die Ergebnisse der Studie folglich zusammen: „Erneut lässt sich insgesamt nur ein<br />
leichter Rückgang der Kr<strong>im</strong>inalität feststellen. Wiederum trifft dies vor allem auf geplante Straftaten, wäh-<br />
301 vgl. Glatzner (2006), S 51<br />
302 vgl. Glatzner, (2006), S 54<br />
112
end sich bei affektgeleiteten Handlungen keine signifikanten Veränderungen abzeichnen. Erneut fallen<br />
auch die Ergebnisse ganz unterschiedlich aus. In einigen Fällen sinkt die Kr<strong>im</strong>inalitätsrate, in anderen steigt<br />
sie wiederum signifikant an. Auch zeigt sich abermals, dass die Kr<strong>im</strong>inalität an geschlossenen Orten wie<br />
Parkplätzen, die außerdem von vielen Kameras erfasst werden eher zurückgeht, als an Orten mit nur einem<br />
geringeren Erfassungsgrad. Die Anzahl der Kameras spielt allerdings keine Rolle, sondern vielmehr die Or-<br />
ganisation der Überwachung. Ferner können Verdrängungseffekte nachgewiesen werden. Die Autoren der<br />
Studie kommen dann auch zu dem Schluss, dass die zentrale Wirkung der Kameras der Abschreckungsef-<br />
fekt ist. Gleichzeitig können Kameras aber auch dazu führen, dass beobachtete Straftaten nicht angezeigt<br />
werden. Gleichwohl wird eingeräumt, dass es einen erheblichen Nachholbedarf hinsichtlich der Organisation<br />
der Überwachung gebe.“ 303<br />
„Die Videoüberwachungs-Systeme haben eine Menge Geld gekostet, aber nicht die gewünschten Resultate<br />
erbracht“ 304 , resümiert Gill <strong>im</strong> Spiegel.<br />
Gegenüber Telepolis erläutert Gil, dass „die Ergebnisse weder den Befürwortern noch den Gegnern<br />
der Videoüberwachung gefallen werden. Videoüberwachung sei ein Mittel, das die Gesellschaft gerade erst zu<br />
verstehen beginne. (...) Sie ist mehr als nur eine technische Lösung. Sie erfordert menschliche Intervention, um<br />
mit größter Effizienz zu funktionieren. Die Probleme, die mir ihr angegangen werden können, sind kom-<br />
plex. Es muss ein größeres Verständnis dafür geben, dass es nicht leicht ist, Straftaten zu reduzieren und zu<br />
verhindern, und dass schlecht konzipierte Lösungen, unabhängig von der Höhe der Investitionen, keinen<br />
Erfolg haben“ 305<br />
303 Quelle: Hempel (2007) S 131<br />
304<br />
Quelle: Kurzid<strong>im</strong>, Michael: Kameras erkennen Kr<strong>im</strong>inelle – nicht. In: Spiegel online, Hamburg 12.07.2007<br />
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,493769,00.html<br />
305<br />
Quelle: Rötzer, Florian: Videoüberwachung reduziert Kr<strong>im</strong>inalität nicht. In: Telepolis, München 25.02.2005<br />
http://www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/19/19543/1.html&burl=/tp/r4/artikel/1<br />
9/19543/1.html&words=Gill&T=gr%E4bner<br />
113
3.4 Effekte der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl<br />
In der Debatte um die Videoüberwachung wird – insbesondere wenn die Effizienz dieser<br />
Maßnahme umstritten ist – <strong>im</strong>mer wieder auf die positiven Auswirkungen auf das Sicher-<br />
heitsgefühl der Menschen verwiesen und damit eine Installierung von Kameras gerechtfer-<br />
tigt. Als ein wesentliches Element der Debatte, verdient sich dieses Sicherheitsgefühl also<br />
einen genaueren Blick.<br />
3.4.1 Menschliche Sicherheit<br />
Bevor sich diese Arbeit dem Sicherheitsgefühl kr<strong>im</strong>inologischer Bedeutung widmet, lohnt es<br />
sich einen Blick auf die grundsätzlichen Bedingungen menschlicher Sicherheit zu richten.<br />
Diese entsteht – so Elmar Altvater - durch vier wesentliche Faktoren: 306<br />
(1) durch verlässliche Regeln in einem Gemeinwesen<br />
(2) durch Vermeidung von Instabilitäten und die Wiederherstellung stabiler Verhältnis-<br />
se (z.B. nach finanziellen Krisen)<br />
(3) durch "Daseinsvorsorge" in jenen Passagen des menschlichen Lebens, in denen In-<br />
dividuen oder Familien nicht selbst in der Lage sind, für notwendige Lebensressour-<br />
cen zu sorgen (Bildung, Gesundheit, Alterssicherung, Nahrung und Unterkunft,<br />
etc.)<br />
(4) durch Zugang zu allen wesentlich existentiellen Gütern.<br />
„Kurz: Menschliche Sicherheit wird durch die Bereitstellung öffentlicher Güter gewährleistet. Daher lässt sich<br />
der Diskurs über menschliche Sicherheit von demjenigen über öffentliche Güter nicht sinnvoll trennen.“ 307<br />
306 vgl: Altvater, Elmar:: "Menschliche Sicherheit" - Entwicklungsgeschichte und politische Forderungen. Thesen<br />
zu einem umfassenden friedenspolitischen Konzept. Universität Kassel 2003,<br />
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Theorie/altvater.html<br />
307 Quelle: Altvater (2003)<br />
114
3.4.2 Das Sicherheitsgefühl<br />
Über den Sacherverhalt, der landläufig als „Sicherheitsgefühl“ bezeichnet wird, befasst sich<br />
die Kr<strong>im</strong>inologie in zunehmenden Maße seit den 1960er Jahren unter den Begrifflichkeiten<br />
(Un)<strong>sicherheit</strong>sgefühl, Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht und Kr<strong>im</strong>inalitätssorgen. 308<br />
Was ist aber dieses Sicherheitsgefühl, von dem die Polizei selbst sagt: „Kr<strong>im</strong>inalitätsängste spie-<br />
geln dabei nicht <strong>im</strong>mer den tatsächlichen individuellen potenziellen Gefährdungsgrad einzelner Personengrup-<br />
pen wider. Vielfach gibt die objektive Sicherheitslage weit weniger Anlass zur Sorge als das subjektive Si-<br />
cherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.“ 309 ?<br />
3.4.3 Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht beinhaltet einerseits eine kognitive (Risikoeinschätzung selbst Opfer<br />
werden zu können), andererseits eine emotionale bzw. affektuelle Komponente (Furcht-<br />
empfinden). Zu unterscheiden ist darüber hinaus eine konative Komponente, die sich auf<br />
das Verhalten (insbesondere Schutz- und Vermeidungsverhalten) richtet. Davon abzugren-<br />
zen ist die kognitive Wahrnehmung der Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung, die zwar mit der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht<br />
korreliert, aber doch einen eigenen Sachverhalt darstellt. 310<br />
Mit der Forschung beginnend, vermutete man, dass tatsächliche Vikt<strong>im</strong>isierung die Ursache<br />
für die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht ist. Allerdings ergaben die meisten Untersuchungen nur schwa-<br />
che Zusammenhänge zwischen polizeilichen Kr<strong>im</strong>inalitäts-Registrierungen und Kr<strong>im</strong>inali-<br />
308 vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 486,<br />
309 Quelle: Zentrale Geschäftsstelle Polizeiliche Kr<strong>im</strong>inalprävention der Länder und des Bundes: Städtebau und Kr<strong>im</strong>inalprävention.<br />
Eine Broschüre für die planerische Praxis. Stuttgart o.J., S 1<br />
http://www.polizeiberatung.de/mediathek/kommunikationsmittel/sonstige_medien/index/content_socket/sonstiges/display/97<br />
/<br />
310 vgl. Windzio, Michael/S<strong>im</strong>onson, Julia/Pfeiffer, Christian/Kle<strong>im</strong>ann, Matthias: Kr<strong>im</strong>inalitätswahrnehmung und<br />
Punitivität in der Bevölkerung - Welche Rolle spielen die Massenmedien? Ergebnisse der Befragungen zu<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätswahrnehmung und Strafeinstellungen 2004 und 2006. Kr<strong>im</strong>inologisches Forschungsinstitut<br />
Niedersachsen, Hannover 2007, S 10<br />
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb103.pdf<br />
115
tätsfurcht. 311 Zahlreiche Studien in den folgenden Jahrzehnten bestätigten, dass das Unsi-<br />
cherheitsgefühl einerseits und die tatsächliche Kr<strong>im</strong>inalitätslage und -entwicklung oft nicht<br />
korrespondieren. 312 Festgestellt wurde vielmehr, dass die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht mit anderen<br />
sozialen Indikatoren zusammenhängt. Beispielsweise sank die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht in<br />
Deutschland seit Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts, während andere Problem-<br />
bereiche (Friedenserhaltung, Umweltschutz, wirtschaftliche Situation) einen Bedeutungsge-<br />
winn erzielten. Daher kann interpretiert werden, dass Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht weniger aus objek-<br />
tiven Bedrohungsszenarien resultiert, „sondern aus einer selektiven Wahrnehmung allgemeiner sozia-<br />
ler Problemkonstellationen resultiert. Es scheint, als würde die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht unmittelbar an Bedeu-<br />
tung verlieren, sobald andere Problembereiche in den Vordergrund rücken.“ 313 Generell kommt mit<br />
dem Sicherheitsgefühl über die Kr<strong>im</strong>inalitätssituation hinaus zum Ausdruck, wie der Zustand<br />
des Gemeinwesens insgesamt bewertet wird. 314<br />
Eine wesentlichere Beeinflussung auf das subjektive Sicherheitsgefühl als die objektive<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätssituation dürften vor allem die Medien spielen. Harald Kania schreibt in seiner<br />
Dissertation zum Thema „Kr<strong>im</strong>inalitätsvorstellungen in der Bevölkerung“, dass sich die<br />
Massenmedien durch ihre Art der Berichterstattung einer rationalen gesellschaftlichen Ver-<br />
arbeitung des Phänomen Kr<strong>im</strong>inalität in den Weg stellen und den Blick auf eine allgegen-<br />
wärtige Bedrohung der Schwerstkr<strong>im</strong>inalität lenken, und dabei Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht erzeugen<br />
bzw. ankurbeln. Dieser Befund wird auch durch eine Studie des Bereichs „Eigentum &<br />
Feuer“ <strong>im</strong> Kuratorium für Verkehrs<strong>sicherheit</strong> in Zusammenarbeit mit der Österreichische<br />
Gesellschaft für Marketing (OGM) 2007 erhärtet: Von den 500 befragten Personen, gaben<br />
5 % der Studienteilnehmer/innen an, sich durch Kr<strong>im</strong>inalität sehr beunruhigt zu fühlen.<br />
Laut eigenen Angaben der Teilnehmer/innen waren dafür in erster Linie die Medien Auslö-<br />
311 vgl. Kania, Harald: Kr<strong>im</strong>inalitätsvorstellungen in der Bevölkerung - Eine qualitative Analyse von Alltagsvorstellungen<br />
und -theorien über Kr<strong>im</strong>inalität, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der<br />
Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg <strong>im</strong> Breisgau<br />
2004, S 33<br />
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3595/pdf/071125_Diss_Kania_Veroeffentlichungsfassung.pdf<br />
312 vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 486<br />
313 Quelle: Windzio/S<strong>im</strong>onson/Pfeiffer/Kle<strong>im</strong>ann (2007), S 10<br />
314 vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 487<br />
116
ser der Furcht. 315<br />
Dabei tritt ein Verstärkungskreislauf in Gang: Im Zuge dieses Prozesses werden die Me-<br />
dienberichte als realistisch bis eher untertreibend wahrgenommen und folglich „eilen also die<br />
durch Medienprodukte losgetretenen subjektiven Erwartungen der Versorgung durch eben diese voraus“. 316<br />
Abgesehen von der Anheizung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht ist die Rolle der (Boulevard)Medien<br />
eine durchaus weiter zweifelhafte: Einerseits werden die Hintergründe von Kr<strong>im</strong>inalität (ge-<br />
sellschaftliche Wurzeln, Entstehungsbedingungen) wenig bis nicht gezeigt bzw. analysiert,<br />
andererseits wird die Bedeutung intakter Strukturen der informellen Sozialkontrolle für eine<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätsprävention nicht oder kaum beleuchtet. 317<br />
Die Macht der Medien auf die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht wird darin begründet, dass die Bür-<br />
ger/innen gerade bei sehr seltenen Delikten auf die Information Dritter angewiesen sind, da<br />
hier kaum eigene Erfahrungen und Beobachtungen vorliegen. Entscheidend für die Auswir-<br />
kung auf das Sicherheitsempfinden ist auch, wie diese Medienberichte <strong>im</strong> sozialen Netzwerk<br />
interpretiert wird. 318<br />
Kania fasst diesen Prozess zusammen: „Diese eigenständige Kr<strong>im</strong>inalitätsrealität wird jeden Tag aufs<br />
Neue konstruiert, und zwar durch die morgendliche Tageszeitung, durch das vormittägliche Gespräch mit<br />
einem Kollegen, durch Radiomeldungen auf der He<strong>im</strong>fahrt oder durch den abendlichen Kinofilm und vor<br />
allem durch die allgegenwärtigen Berichte <strong>im</strong> Fernsehen. Dabei bedeutet diese ‚Kr<strong>im</strong>inalität’ oft nicht nur<br />
Angst, Ärger und Verlust (zumindest auf Seiten der Opfer), sondern eben auch ‚Spannung’, ‚Unterhaltung’<br />
und die Faszination des Verbotenen (ohne die Gefahr, erwischt und bestraft zu werden)“. 319<br />
Müller sieht die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht sogar als einen wichtigen politischen Faktor, da diese<br />
von politisch Verantwortlichen zum Teil bewusst genutzt oder gar ausgelöst wird, aber an-<br />
dererseits von dieser teilweise auch – beispielsweise in der Konkurrenz zur Opposition –<br />
315 vgl. Kuratorium für Verkehrs<strong>sicherheit</strong>: Krankheit und Einbrüche machen Angst, Wien 2007<br />
http://www.kfv.at/index.php?id=1007<br />
316 Quelle: Kania (2004), S 24<br />
317 vgl. Kania (2004), S 22<br />
318 vgl. Windzio/S<strong>im</strong>onson/Pfeiffer/Kle<strong>im</strong>ann (2007), S 11<br />
319 Quelle: Kania (2004), S 17 ff<br />
117
zum politischen Handeln genötigt wird. 320<br />
EU-weit ist die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht leicht <strong>im</strong> Wachsen begriffen. Von 1996 bis 2002 wuchs<br />
der Anteil jener, die auf die Frage „Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach Einbruch der<br />
Dunkelheit allein zu Fuß in der Gegend unterwegs sind, in der Sie wohnen“ mit „etwas<br />
unsicher“ oder „sehr unsicher“ geantwortet haben von 32 % auf 35 %. Österreich liegt da-<br />
bei mit über den Zeit<strong>raum</strong> annähernd gleichen 19 % nur knapp hinter Dänemark (mit 15<br />
%) <strong>im</strong> Spitzenfeld der gefühlten Sicherheit, Deutschland mit einer sinkenden Angst von 34<br />
% <strong>im</strong> Jahr 2002 (39 % 1996) <strong>im</strong> Mittelfeld und Länder wie Großbritannien, Italien und<br />
Griechenland mit jeweils 43 % (2002) und stark steigender Furcht bilden die Schluss-<br />
lichter. 321<br />
3.4.4 Messung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht<br />
Die gängige Methode, um die Entwicklung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
Videoüberwachung zu messen, ist eine Befragung der betroffenen Personen unmittelbar<br />
vor und nach der Installierung der Kameras. Dabei wird in Anlehnung an den weltweit ge-<br />
nutzten Standardindikator für Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht üblicherweise gefragt: „Wie sicher fühlen<br />
Sie sich in ihrer Wohngegend, wenn Sie bei Dunkelheit allein auf die Straße gehen oder ge-<br />
hen würden?" Diese Frage kann natürlich auch die jeweilige videoüberwachte Zone (zentra-<br />
le Plätze etc.) abgeändert werden. Bei diesen Messungen gibt es mehrere methodische Be-<br />
denken. Fraglich ist beispielsweise, ob die sprachliche Reflexion über Furcht mit dem<br />
zugrunde liegenden tatsächlichem Gefühlsempfinden identisch ist. Oder ob es bei der Dis-<br />
kussion <strong>im</strong> Vorfeld nicht schon ein Gefühl nach mehr Sicherheitsbedürfnis ausgelöst wur-<br />
de. Auch durch Nennung zusätzlicher Aspekte (z.B. wurden in Großbritannien durch die<br />
<strong>im</strong>mensen Kosten der Videoüberwachung Personalkosten bei der Polizei eingespart) kann<br />
320<br />
vgl. Müller (2003)<br />
321<br />
vgl. Dittmann, Jörg: Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht sinkt in Deutschland entgegen dem EU-Trend. In: Zentrum für Umfragen,<br />
Methoden und Analysen (ZUMA): ISI 34, Informationsdienst Soziale Indikatoren, Ausgabe 34, , Mannhe<strong>im</strong><br />
2005, S 6 ff<br />
http://www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/ISI/pdf-files/isi-34.pdf<br />
118
der Gewinn an (erfragtem) Sicherheitsgefühl in sein Gegenteil verkehrt werden. Daher wäre<br />
es grundsätzlich erforderlich, entsprechende Befragungen zeitlich und thematisch unabhän-<br />
gig von einer lokalen Videoüberwachungsdiskussion durchzuführen bzw. diese nach einem<br />
längeren Zeit<strong>raum</strong> mit einer Befragungswiederholung zu kontrollieren. 322<br />
Wie Müller feststellt, stellt es „noch keine Evaluationsforschung betreffend Beeinflussung des Sicher-<br />
heitsgefühls durch Videoüberwachung dar, wenn Personen nach ihrer Einstellung zur Videoüberwachung<br />
gefragt werden, auch dann nicht, wenn sie sich für die Kameraüberwachung mit dem Argument aussprechen,<br />
sie würden sich dann sicherer fühlen.“ 323<br />
3.4.5 Auswirkung der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl<br />
Obwohl - wie vorher ausgeführt – das Sicherheitsgefühl bzw. die Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht eine<br />
sehr komplexe bzw. empirisch sehr fragile Angelegenheit ist, spielt es einen wichtigen As-<br />
pekt in der Debatte um die Wirksamkeit der Videoüberwachung.<br />
Nichts desto trotz sind die Aussagen in den Evaluationen zu diesem Thema oftmals ziem-<br />
lich schwach.<br />
Bei der <strong>im</strong> Kapitel 3.3.5. zitierten Evaluation in Bremen bezieht sich die Polizei darauf, dass<br />
„seit Beginn der Videoüberwachung Einzelhändler, die ihre Geschäfte <strong>im</strong> Bereich des Bahnhofes betreiben,<br />
sowie Passanten sich den in dem überwachten Bereich eingesetzten Polizeibeamten gegenüber positiv über die<br />
Videoüberwachung geäußert und sie als einen Beitrag zu mehr Sicherheit beschrieben“ 324 haben. Darüber<br />
hinaus haben Polizeivollzugsbeamte <strong>im</strong> Rahmen ihres Hochschulstudiums 98 Personen be-<br />
fragt, die mehrheitlich angaben, sich sicherer zu fühlen. Jedoch räumt der Bericht sachlich-<br />
erweise ein, dass bezüglich Sicherheitsempfinden der Bevölkerung keine wissenschaftlich<br />
gestützten Aussagen getroffen werden können, weil hierzu eine umfassende Untersuchung<br />
notwendig wäre. 325<br />
322<br />
vgl. Müller (2003)<br />
323<br />
Quelle: Müller (2003)<br />
324<br />
Quelle: Bremische Bürgerschaft (2008), S 8<br />
325<br />
vgl. Bremische Bürgerschaft (2005), S 8<br />
119
Auch in der Bielefelder Evaluation (vergleiche Kapitel 3.3.4.) wird aufgrund schwacher<br />
Grundlagen eine Hebung des Sicherheitsgefühl diagnostiziert. „In Befragungen teilten vor allem<br />
die weiblichen Besucher und Mitarbeiter der Volkshochschule mit, dass sie sich sicherer fühlen würden, als<br />
vor der Installierung der Kameras. Einige sagten allerdings auch, dass die Angst bei Dunkelheit den Park<br />
zu durchqueren, sich schon nach den ersten Maßnahmen der Stadt (bessere Ausleuchtung und Auslichtung<br />
des Buschwerkes in Verbindung mit der Polizeipräsenz) gelegt hätte.“ 326 Diese Befragungen waren<br />
allerdings stichprobenartiger Natur und nicht repräsentativ.<br />
Gill und Spriggs ziehen in ihrer <strong>im</strong> vorigen Kapitel ausführlich dargestellten Studie eine<br />
durchwegs kritische Bilanz betreffend Sicherheitsgefühl: Obwohl die Reduzierung der Kri-<br />
minalitätsangst ein wesentliches Ziel der Projekte war, resümieren die Studienautoren:<br />
„CCTV was found to have played no part in reducing fear of cr<strong>im</strong>e; indeed those who were aware of the<br />
cameras admitted higher levels of fear of cr<strong>im</strong>e than those who were unaware of them. The reduction in fear<br />
levels was more likely to be the result of less cr<strong>im</strong>e, reflected in reduced reported vict<strong>im</strong>isation and reduced<br />
recorded cr<strong>im</strong>e.” 327<br />
Immerhin zeigte sich in fünf Fällen eine Erhöhung der Furcht in videoüberwachten Berei-<br />
chen – durch jene, die sich der Überwachung bewusst sind. Erst durch die Videoüberwachung<br />
dürften hier unsicherere Räume produziert worden sein. 328<br />
Darüber hinaus stellt die Studie eine generelle Desillusionierung der Menschen nach Instal-<br />
lierung der Kameras fest: Die Zust<strong>im</strong>mung dieser Maßnahme sank nach der Implementie-<br />
rung um bis zu 20 %. Gill sieht darin eine Anpassung an die tatsächlichen Möglichkeiten<br />
jenseits der (zu) hohen Erwartungen an diese Maßnahme. „Während sich etwa 80 % der Men-<br />
schen eine Senkung der Kr<strong>im</strong>inalitätsrate durch die Installation von Kameras erhofft hatten, glaubten nach<br />
erfolgter Installation nur noch 45 % an eine kr<strong>im</strong>inalitätssenkende Wirkung. Ebenso fiel die Zahl derjenigen,<br />
die auf schnellere Reaktionen der Polizei hofften, von 56 % auf 35%.“ 329<br />
326 Quelle: Kubera (o.J.)<br />
327 Quelle: Gill/Spriggs (2005), S 60<br />
328 vgl. Glatzner (2006), S 59<br />
329 Quelle: Glatzner (2006), S 59<br />
120
Bornewasser untersuchte in seiner Brandenburger Studie auch die Auswirkungen der Vi-<br />
deoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl intensiv. In fünf Befragungswellen von Oktober<br />
2002 bis April 2005 wurden insgesamt über 3000 Menschen (1.588 in den videoüberwach-<br />
ten Räumen, 1.825 in den nicht überwachten Kontrollräumen) befragt und darüber hinaus<br />
<strong>im</strong> April 2004 126 Interviews geführt. In der ersten Befragungswelle lagen die gefühlten Si-<br />
cherheitswerte in den überwachten Zonen leicht über den nicht überwachten Kontrollräu-<br />
men (z.B. 25,5 % sehr sicher am Tag <strong>im</strong> videoüberwachten Bereich gegenüber 21,6 % <strong>im</strong><br />
nicht überwachten; 2,8 sehr unsicher in der Nacht <strong>im</strong> überwachten Bereich gegenüber 4,9<br />
<strong>im</strong> nichtüberwachten). In den folgenden Befragungen kommt es <strong>im</strong> Laufe der Zeit zu einer<br />
starken Angleichung des Sicherheitsgefühles in den verschiedenen Räumen. 330<br />
Vor allem Geschäftstreibende profitierten von einem erhöhten Sicherheitsgefühl dank der<br />
Videoüberwachung. Bei Anwohnern/Passanten/Pendlern gab es hingegen keinen Unter-<br />
schied in überwachten oder nichtüberwachten Bereichen zu messen. Im Laufe der Zeit<br />
wurde selbst bei den Geschäftstreibenden der Unterschied zwischen den nicht- und den<br />
videoüberwachten Gebieten kleiner, was Bornemann mit Gewöhnungseffekten oder einer<br />
generell abflachenden Abschreckung durch die ausbleibende Polizeipräsenz an den überwachten<br />
Plätzen deutet. 331<br />
Auch nach der konkreten Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht - also der Angst selbst konkret Opfer zu wer-<br />
den - fragte Bornemann. Hier waren nur min<strong>im</strong>ale Differenzen zwischen überwachten und<br />
nicht überwachten Zonen festzustellen, die Verlaufsmuster waren identisch und Abwei-<br />
chungen zufällig. Eine Beeinflussung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht <strong>mittels</strong> Videoüberwachung<br />
findet demnach nicht statt. 332<br />
Im Zuge der Interviews <strong>im</strong> Frühjahr 2004 fragte Bornemann auch nach den Einflussfakto-<br />
ren auf das Sicherheitsgefühl. Dabei spielen - wie in der Abbildung unten ersichtlich - <strong>im</strong><br />
wesentlichen die Beleuchtung bei Nacht, das Wissen um die Videoüberwachung vor Ort,<br />
330 vgl. Bornewasser (2005), S 67<br />
331 vgl. Bornewasser (2005), S 69 ff<br />
332 vgl. Bornewasser (2005), S 70<br />
121
die Begleitung oder Anwesenheit anderer Personen, Polizeipräsenz, Pressemitteilungen über<br />
Straftaten und die Anwesenheit von Jugendlichen, Betrunkenen und Gruppierungen eine<br />
Rolle. Interessant dabei ist, dass die Videoüberwachung hier nur eine nachgereihte Wirkung<br />
hat und in der Regel die Helligkeit und die Anwesenheit anderer Personen eine wesentliche-<br />
re positive Rolle spielt. Auf der negativen Seite sind Belästigungen sehr präsent.<br />
Tabelle 13: Allgemein wirkende Einflussfaktoren auf das Sicherheitsgefühl 333<br />
In Regensburg führte Gabriele Glocke mit einer Studiengruppe 2001 eine Untersuchung<br />
mit 120 Passant/innen zwischen 19 und 85 Jahren durch. Davor führte sie eine Explorati-<br />
onsstudie zum Thema „Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht und Tatgelegenheitsstrukturen“ durch. Dabei<br />
konnten sich Hundert Regensburger Bürger/innen frei zu Themen wie „Kontrollpräsenz“<br />
und „Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht“ äußern. Dabei nahmen – obwohl das Pilotprojekt erst einige Mo-<br />
nate davor angelaufen war – nur 10 Befragte eigenständig Bezug auf die Videoüberwa-<br />
chung. Bei der Untersuchung stellte Glocke fest, dass zwar 53 % die Videoüberwachung<br />
befürworten, aber dies nicht begründen konnten und sich die Befragung für die Befragten<br />
oft als peinlich herausstellte, da sie deren Unwissenheit darlegte. Im Schnitt erinnerte man<br />
sich an 1,2 von 7 Kamerastandorten, von mindestens 5 möglichen Wissenselementen über<br />
die Art der Kameranutzung waren <strong>im</strong> Schnitt 0,5 % bekannt und ein Drittel wähnte sich<br />
irrtümlicherweise <strong>im</strong> überwachten Bereich. Glocke stellte daher fest: „Sie befürworten Kameras,<br />
weil sie Kameras befürworten“. Obwohl sich die Hinweisschilder der Kameras auf die Sicherheit<br />
für Passant/innen beziehen, nahmen nur 29, 2 % der Befragten auf die Sinnkategorie Kri-<br />
333 Quelle: Bornewasser (2005), S 84<br />
122
minalitätsfurcht Bezug, wobei ein Drittel der Nennungen sich darauf bezog, sich nicht sicherer<br />
zu fühlen. 334<br />
Dass be<strong>im</strong> Sicherheitsgefühl nicht die Überwachung, sondern vielmehr ein Raumgefühl eine<br />
wesentliche Rolle spielt, zeigt die Untersuchung von Nils Zurawski „Kultur, Kontrolle,<br />
Weltbild – Projekt Videoüberwachung Hamburg“ 335 . Die zweistufige Studie (qualitative In-<br />
terviews und quantitative Umfrage) ging den Zusammenhängen von räumlichen Vorstel-<br />
lungen, subjektiven Sicherheitsempfindungen und Videoüberwachung nach. Die wichtigsten<br />
Ergebnisse zeigen: 336<br />
• Die emotionale Bindung an einen Raum verringert Un<strong>sicherheit</strong>en. In positiv erleb-<br />
ten Räumen wird Videoüberwachung als Sicherheitsmaßnahme weniger positiv be-<br />
wertet als in negativ besetzten Räumen.<br />
• Die Zust<strong>im</strong>mung zur Videoüberwachung ist sehr stark <strong>raum</strong>- und situationsgebun-<br />
den. Prozentzahlen, die eine sehr hohe Zust<strong>im</strong>mung zeigen, sind daher mit Vorsicht<br />
zu betrachten 337 , da dahinter eine Fülle von kontextuellen Vorstellungen stecken.<br />
Einfache Ja- oder Nein-Fragen berücksichtigen die Komplexität nicht.<br />
• In der Beurteilung eines Raumes ist die Bedeutung von Videoüberwachung eine<br />
334<br />
vgl. Klocke, Gabriele: Vom Hintertürchen des Nichtwissens. Was Regensburger BürgerInnen über die Videoüberwachung<br />
in ihrer Stadt wissen und denken. In: Bürgerrechte und Polizei/CILIP, Berlin 2001,<br />
http://www.cilip.de/ausgabe/69/video.htm<br />
335<br />
vgl. Zurawski, Nils (2007a): „Kultur, Kontrolle, Weltbild. Räumliche Wahrnehmung und Videoüberwachung<br />
in urbanen Räumen“. Videoüberwachung in Hamburg. Abschlussbericht (März 2007). Institut für<br />
kr<strong>im</strong>inologische Sozialforschung der Universität Hamburg, Hamburg 2007<br />
http://www1.uni-hamburg.de/kr<strong>im</strong>inol/surveillance/abschlussbericht_A.pdf<br />
336<br />
vgl. Zurawski, Nils (2007b): Videoüberwachung in Hamburg, Teil B. Institut für kr<strong>im</strong>inologische Sozialforschung<br />
der Universität Hamburg, Hamburg 2007, S 65<br />
http://www1.uni-hamburg.de/kr<strong>im</strong>inol/surveillance/abschlussbericht_B.pdf<br />
337<br />
Ergebnisse der Befragung auf der Reeperbahn zeigen exemplarisch diesen Trend: Die Zust<strong>im</strong>mung zu<br />
der Aussage “Videoüberwachung verbessert die Sicherheit der Bürger” lag bei 59,8% (32,2% volle Zust<strong>im</strong>mung). Bei<br />
der Frage “Ich fühle mich durch die Kameras vor Überfällen und Diebstählen besser geschützt” sank die Zust<strong>im</strong>mung auf<br />
43% (18,7%)zu. Bei der Aussage “Ich würde Kameras auch in meiner Straße begrüßen“ sank die Zust<strong>im</strong>mung weiter<br />
ab auf lediglich 27,2% (16%) zu. Die Bewertung der auf St. Pauli lebenden Personen unterschied sich nicht<br />
signifikant von anderen.<br />
123
sehr geringe, Kameras können zu einem gewissen Grad dazu beitragen, diesen als<br />
eher unsicher einzuschätzen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Raum vorher unbe-<br />
kannt war und keinerlei emotionale Einstellung oder Bindung gegeben ist. Darüber<br />
hinaus „kann Videoüberwachung ablehnende Haltungen zu Räumen verstärken, indem die Ka-<br />
meras auf Un<strong>sicherheit</strong>en hinweisen, die nun auf diesen Raum projiziert werden können.“ 338<br />
Zurawski fasst die Ergebnisse folglich zusammen: „Raum und dessen Wahrnehmung und Bedeu-<br />
tung für den Einzelnen spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung von Videoüberwachung. Sie ba-<br />
sieren auf Erfahrungen und Vorstellungen, die einer Videoüberwachung vorausgehen. Kameras beeinflussen<br />
weniger den Raum, als dass die individuelle Raumvorstellung die Einstellung zu Videoüberwachung lenkt.<br />
Insgesamt zeigt sich an diesen Zusammenhängen ein komplexes und dynamisches Bild gesellschaftlicher<br />
Wahrnehmung von Raum, Sicherheit und Kontrollmechanismen, welches sich jenseits einfacher Argumenta-<br />
tion von Videoüberwachung und öffentlicher Sicherheit befindet, zumal Un<strong>sicherheit</strong>en nur zum Teil mit<br />
Aspekten, die sich auf Kr<strong>im</strong>inalität beziehen, in Verbindung gebracht werden können. Über die Wirk-<br />
samkeit von Videoüberwachung sagt diese Studie nichts aus, auch wenn wir <strong>im</strong> Anschluss an unsere Studie<br />
sagen können, dass das oft proklamierte Ziel ‚die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls’ unseres Er-<br />
achtens nicht durch Kameras erreicht werden kann.“ 339<br />
Den Zusammenhang zwischen Raum- und Sicherheitsgefühl unterstreicht auch der „Zweite<br />
periodische Sicherheitsbericht“ aus Deutschland: „Wenn Indikatoren der Messung von Unsicher-<br />
heitsgefühlen verwendet werden, die nach Örtlichkeiten und Zeiten differenzieren, sind Un<strong>sicherheit</strong>sgefühle<br />
für die Zeit der Nacht stets am stärksten ausgeprägt. Es findet sich ein plausibles Muster: Je unbekannter<br />
der Ort und die sich dort aufhaltenden Menschen sind, bzw. je weniger potenzielle Unterstützer verfügbar<br />
sind, desto ausgeprägter ist auch das subjektive Un<strong>sicherheit</strong>sgefühl.“ 340<br />
Darüber hinaus hält der Bericht fest, dass „die Ausprägung der Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht der Bevölkerung<br />
best<strong>im</strong>mter Gebiete oder Regionen nicht durch die Belastung dieser Gebiete mit registrierter Kr<strong>im</strong>inalität<br />
erklärbar“ ist. 341 .<br />
338<br />
Quelle: Zurawski (2007b), S 66<br />
339<br />
Quelle: Zurawski, (2007b), S 66<br />
340<br />
Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium für Justiz (2006), S 506<br />
341 Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium für Justiz (2006), S 507<br />
124
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse der Linzer Stadtbefragung<br />
2004 342 . Grundsätzlich wird in dieser Bürger/innen-Umfrage festgestellt, dass sich das Si-<br />
cherheitsgefühl der Linzer/innen in der Wohngegend <strong>im</strong> Zeit<strong>raum</strong> von 1995 auf 2004 er-<br />
höht hat: Von 11 % sehr sicher auf 15 % und von 21 % sehr unsicher auf 16 %. Dabei<br />
wurden auf <strong>mittels</strong> offener Frage ohne vorgegebene Antworten die zukünftigen als notwen-<br />
dig erachteten Schwerpunkte zur Erhöhung der Sicherheit erfragt: Die gewünschten<br />
Schwerpunkte führen „Präsenz, verstärkte Kontrolle“ mit 32 % und die „Verkehrsüberwa-<br />
chung“ mit 10 % an. Die „Videoüberwachung“ spielt dabei mit 1 % eine sehr untergeordnete<br />
Rolle. 343<br />
Tabelle 14: Gewünschte zukünftige Sicherheitsschwerpunkte in Linz 344<br />
342 Stadtforschung Linz: Analyse Bürgerbefragung 2004, Linz 2005<br />
http://www.linz.at/zahlen/110%5FForschungsprojekte/BBef2004.pdf#xml=?cmd=pdfhits&DocId=3213&<br />
Index=d%3a%5cdaten%5cdt%2dsearch%5cwebserver%5clinz%5fde&HitCount=74&hits=187+1f7+292+30f<br />
+355+39a+3df+42a+46f+4bd+5b9+63a+6c1+740+79d+7f0+875+8f2+975+9c6+a4a+ac9+b4d+bcd+c2<br />
d+c7e+d0c+d5f+db4+e0f+e84+ea8+ee1+f23+f90+1010+107b+10b1+10e1+1117+1147+117d+11ae+11<br />
e6+12b9+131c+1379+13db+143a+149c+1500+157b+15a4+15c7+15e8+162d+1685+16d7+1731+1786+<br />
17b7+17f1+182c+189f+18df+1919+1963+198c+19c2+19f3+1a28+1a55+1a70+1a88+&hc=2018&req=st<br />
adtforschung%26<br />
343 In den Detailauswertungen gibt es hier auch kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtvierteln<br />
344 Quelle: Stadtforschung Linz (2005), S 20<br />
125
Allerdings ist es auch mit diesen allseits gewünschten Maßnahmen schwierig, das gefühlte<br />
Sicherheitsgefühl positiv zu beeinflussen. Selbst hier deuten die Befunde keine eindeutige<br />
Wirkung an: Erhöhe Polizeipräsenz kann keinerlei Effekte nach sich ziehen, oder sogar in<br />
eine unerwünschte Richtung gehen: „Das kann einerseits damit in Zusammenhang gebracht werden,<br />
dass die meisten Menschen Bedrohungen, wie die Darlegungen zur sozialen Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht gezeigt ha-<br />
ben, gar nicht in ihren eigenen Stadtteilen verorten. Ferner kann eine hohe Polizeipräsenz bzw. deren Ver-<br />
änderung in der näheren Umgebung durchaus auch als Hinweise darauf interpretiert werden, dass offenbar<br />
ein Anlass dafür bestehen könnte <strong>im</strong> Sinne dessen, dass vermehrt Kr<strong>im</strong>inalitätsprobleme <strong>im</strong> Umfeld beste-<br />
hen.“ 345<br />
Die Lage stellt sich nur dann anders dar, wenn nicht nur Präsenz und Kontrolle erhöht<br />
werden, sondern die Kontakte zwischen Polizei und Bürger/innen (z.B. <strong>mittels</strong> Kontaktbü-<br />
ro) tatsächlich verbessert werden. Ziel dieser Ansätze des „Community Policing“ ist es un-<br />
ter anderem, lokale Problemlagen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen <strong>im</strong> Stadtteil<br />
genau zu analysieren und die lokalen Instanzen der informellen Kontrolle zu stärken. 346<br />
Furchtreduzierende Effekte treten nur dann auf, wenn nicht nur eine erhöhte Präsenz ob-<br />
jektiv gegeben ist, „sondern von den Bürgern auch subjektiv wahrgenommen wird und mit einer Redukti-<br />
on äußerlich sichtbarer Anzeichen sozialer Desorganisation einhergeht. Die Verminderung von Kr<strong>im</strong>inali-<br />
tätsfurcht wird also vor allem darüber vermittelt, dass subjektiv die Gewissheit einer positiven Beziehung zur<br />
Polizei <strong>im</strong> Stadtteil etabliert werden und über das kommunale Engagement der Polizei tatsächlich auch der<br />
soziale Zusammenhalt zwischen den Bürgern befördert werden kann, und zugleich äußerlich erkennbare<br />
Anzeichen sozialer Desorganisation abgebaut werden. Demnach hat die Kommunikation <strong>im</strong> sozialen Nah-<br />
<strong>raum</strong> – neben der Wahrnehmung fremder, bislang unbekannter Erscheinungen und neben unspezifischen<br />
Hinweisen auf mögliche Bedrohungen – einen erheblichen Einfluss auf die subjektive Einschätzung von Risiken<br />
und Bedrohungen.“ 347<br />
345 Quelle: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 510<br />
346 vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 512<br />
347 vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (2006), S 513<br />
126
3.5 Wer wird überwacht?<br />
Grundsätzlich sollte die Videoüberwachung das Ziel haben, „Täter“ abzuschrecken bzw.<br />
diese durch die Mithilfe der Kameras nach begangener Tag zu überführen. Diesem Vorha-<br />
ben stellen sich allerdings <strong>im</strong> Wesentlichen drei Phänomene in den Weg, die leider auch zu<br />
„unerwünschten Nebenwirkungen“ führen:<br />
1) Grundsätzlich werden nicht Personen überwacht, sondern der Raum<br />
2) Die Menge an Informationen kann nicht zielführend verarbeitet werden<br />
3) Die Straftäter selbst stehen der Videoüberwachung gelassen gegenüber<br />
3.5.1 Problem 1: Die Überwachung des Raumes<br />
Wie Zurawski ausführt, steht bei der Videoüberwachung nicht eine best<strong>im</strong>mte Person unter<br />
Beobachtung, sondern jede Person, die sich <strong>im</strong> überwachten Raum befindet. Daher kann<br />
auch jede Person „potentiell das Objekt einer Überprüfung von vorher festgelegten Parametern werden.<br />
Bei einer Übereinst<strong>im</strong>mung werden weitergehende Maßnahmen eingeleitet – Fehler eingeschlossen. Ein sol-<br />
ches System ist weniger personen – als vielmehr kontextorientiert und bezieht sich auf Räume, Orte, Zeitabschnitte,<br />
Kategorien von Personen und auf die Repräsentationen von Wirklichkeiten“ 348<br />
„Aus dem Zusammenspiel von Datensammeln, Überwachungsparadigmen und der Repräsentation von<br />
Wirklichkeit durch Muster ergeben sich weitrechende Konsequenzen. Kartierungen – mentale oder kartogra-<br />
fische - die auf diesen Daten und ihren sozial-räumlichen Imaginationen aufbauen, sind vielfältig und kön-<br />
nen folgenreich für mögliche Betroffene sein. Was hier über eine kartografische Darstellung von Daten mög-<br />
lich wird, ist die gezielte soziale Sortierung von Menschen und Gruppen von Menschen anhand von Ort und<br />
Raum. Dabei geht es nicht mehr um das Individuum, sondern um statische Gesamtheiten, die eine eigene<br />
Wirklichkeit bilden und eventuell ein Eigenleben bekommt, welches dann direkt auf die sozial-räumlichen<br />
Vorstellungen anderer Menschen zurückwirkt. Es entsteht ein feedback loop einer sich selbst erfüllenden<br />
348 Quelle: Zurawski, Nils (2007 c): Wissen und Weltbilder. Konstruktionen der Wirklichkeit, cognitive mapping<br />
und Überwachung. In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes.<br />
Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 92<br />
127
Prophezeiung.“ 349<br />
3.5.2 Problem 2: Überforderung durch die Datenflut<br />
Die Kr<strong>im</strong>inologen Clive Norris und Gary Armstrong stellen <strong>im</strong> Zuge ihrer Studie, bei der<br />
sie 600 Stunden die Beobachter in drei Videokontrollzentren selbst beobachtet haben, die<br />
Frage, wie es denn für die Überwacher möglich sei, bei der Überwachung belebter Plätze<br />
oder Einkaufszentren verdächtiges Verhalten zu erkennen. Die Überforderung der Beob-<br />
achter durch diese gewaltigen Informationsmengen hindurchzublicken, führte zu einer ein-<br />
fachen Antwort: „die Operateure werfen ein Auge auf die sozialen Gruppen, die am ehesten für abwei-<br />
chend gehalten werden.“ 350<br />
Nicht dass die Menschen hinter den Monitoren schlechte Menschen wären, aber das Über-<br />
maß der Informationen führt geradezu zwangsweise dazu, „dass häufig stereotype Klassifizierun-<br />
gen bei der Entscheidung, wer überwacht werden muss, herangezogen werden, sowie zu einer Reihe vereinfa-<br />
chender und relativ unergiebiger Arbeitsregeln in bezug darauf, welche Verhaltensweisen auf eine verbrecheri-<br />
sche Absicht hindeuten. Der Überwachungsblick ist <strong>im</strong>mer noch einseitig, sowie willkürlich und diskr<strong>im</strong>i-<br />
nierend.“ 351<br />
Diese Beobachtung wird durch Frank Helten, die in zwei Berliner Shopping-Malls die Kon-<br />
trollräume unter genauere Begutachtung nahm, gestützt. Er resümiert: „Die Beobachtungsweise<br />
des Sicherheitspersonals konzentriert sich nicht so sehr auf die Überwachung von konkreten Personen, viel-<br />
mehr werden vorab selektierte Orte und auffälliges Verhalten der „üblichen Verdächtigen“ beobachtet. Da-<br />
zu zählen: Schüler/Jugendliche, Männer, Alkoholiker und Obdachlose, hauptsächlich aber Ausländer<br />
(„Südeuropäer“)“ 352<br />
349 Quelle: Zuraswki (2007c), S 96 ff<br />
350 Quelle: Norris, Clive/Armstrong, Gary: Smile, you 're on camera. Flächendeckende Videoüberwachung in<br />
Großbritannien. In: Bürgerrechte & Polizei/CILIP, Berlin 1998,<br />
http://www.cilip.de/ausgabe/61/norris.htm<br />
351 Quelle: Norris, Clive: Vom Persönlichen zum Digitalen. Videoüberwachung, das Panopticon und die technologische<br />
Verbindung von Verdacht und gesellschaftlicher Kontrolle. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg<br />
(Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 384 ff<br />
352 Quelle: Helten, Frank: Reaktive Aufmerksamkeit. Videoüberwachung in Berliner Shopping Malls. In: Hem-<br />
128
Bedingt durch die Überforderung aus der Bilderflut resultierend, lassen die Ergebnisse er-<br />
kennen, „dass sich reaktive und selektive Überwachungskonstellationen ergeben, die sowohl die symbolische<br />
Macht der VÜ-Technik nutzen, als auch rationalisierte Überwachungsnormen zur Betriebsopt<strong>im</strong>ierung an<br />
strategischen Orten praktizieren. Diese zielen pr<strong>im</strong>är nicht auf eine unmittelbare Kontrolle von Personen,<br />
sondern von Verhalten, von Betriebsabläufen und von räumlichen Ordnungen.“ 353<br />
3.5.3 Problem 3: Die Straf-Täter sehen die Überwachung gelassen<br />
Weil das Verhalten als verdächtig gilt, wenn es ungewöhnlicht ist, richten die Beobachter<br />
ihren Blick auf das „auffällige“ Verhalten. Wie Norris feststellt, ist es unwahrscheinlich, Tä-<br />
ter zu identifizieren, bevor sie zuschlagen, denn diese versuchen schließlich ihre Pläne zu<br />
verbergen, nicht aufzufallen und daher als „normal“ durchzugehen. 354<br />
In Bezug auf die Untersuchung von Ditton und Short (1988) weist Hempel darauf hin, dass<br />
die meisten Täter sehr genaue Kenntnis über die Standorte der Kameras haben. Sie wissen<br />
genau, welche Bereiche von den Kameras gefilmt werden und welche nicht <strong>im</strong> Kamera-<br />
blickfeld liegen. Weiters ist die Einstellung von Tätern selbst gegenüber den Kameras eine<br />
weniger negative als man glauben könnte. „Immerhin behaupteten zehn von 27 Tätern, dass sie sich<br />
durch das Vorhandensein von Kameras selbst sicherer fühlten.“ 355<br />
Weiters führt Hempel die Täterbefragungen von Gill und Loveday (2003) ins Treffen, bei<br />
der auch nach Deliktarten unterschieden wurde: „Das Ergebnis lässt aufmerken. Von den 32 Tä-<br />
tern, die sich über die Präsenz einer Kamera bewusst waren, bestätigten lediglich 2 Taschendiebe (2,59% des<br />
Gesamtsamples), dass das Vorhandensein einer Kamera einen Einfluss auf die Ausübung ihrer Tat gehabt<br />
habe. Insgesamt haben die Maßnahme es lediglich erschwert, den Taschendiebstahl auszuführen. Der tat-<br />
sächliche Abschreckungseffekt durch die sichtbare Präsenz einer Kamera scheint also eher marginal, was<br />
durch die Ergebnisse der Evaluationen ebenfalls bestätigt schien, sofern es sich nicht um abgeschlossene und<br />
pel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 167<br />
353 Quelle: Helten (2005), S 170<br />
354 vgl. Norris (2005), S 381<br />
355 Quelle: Hempel (2007), S 120<br />
129
gut überschaubare Orte, die Parkplätze handelt.“ 356<br />
3.5.4 Wer wird überwacht?<br />
Angesichts der oben angeführten Problemlagen stellt sich natürlich die Frage, wer denn nun<br />
tatsächlich in das Auge der Kamera genommen wird.<br />
Eric Töpfer führt dazu bündig aus, „Dass bei der ‚Säuberung’ innerstädtischer Einkaufs- und Erleb-<br />
nismeilen weniger schwere Straftaten ins Visier geraten, sondern vielmehr marginalisierte und unerwünschte<br />
Randgruppen“. Als Beleg zieht er dazu die Erfahrungen mit Videoüberwachung in Leipzig<br />
und Westerland/Sylt heran. 357<br />
Lutz Ellrich weist exemplarisch auf Arbeiten aus dem Umfeld der „Cultural Studies“ hin,<br />
bei denen die Auswirkungen der Videoüberwachung untersucht wurden. „John Fiske etwa<br />
zeigte, wie die scheinbar neutrale, zum allseits gedeihlichen Erhalt sicherer Städte installierte Technik eine<br />
Politik rassischer Differenz begünstig und hochgradig effizient macht.“ 358<br />
Aldo Legnaro schreibt, sich ebenfalls auf Fiske beziehend: „Das Weiße hat die Macht, sich<br />
selbst als 'das Normale' zu setzen, und Überwachung ‚makes the city operate as a machine<br />
of whiteness’." 359<br />
Norris und Armstrong stellen ihre Untersuchungsergebnisse wie folgt dar: „Männer, vor allem<br />
wenn sie jung sind und schwarze Hautfarbe haben, sind bei dieser Beobachtung überrepräsentiert. 90 % der<br />
gezielt Observierten sind männlich, 40 % sind Jugendliche. Schwarze werden anderthalb bis zweieinhalb<br />
mal so häufig observiert, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. (...) Von den fast 900 geziel-<br />
ten Überwachungen, die wir dokumentieren konnten, führten nur 45 zu Einsätzen (vornehmlich wegen<br />
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten), und nur zwölf hatten eine Festnahme zur Folge. Davon bezog sich<br />
356<br />
Quelle: Hempel (2007), S 138<br />
357<br />
Quelle: Töpfer (2007), S 42<br />
358<br />
Quelle: Ellrich, Lutz: Gefangen <strong>im</strong> Bild? "Big Brother" und die gesellschaftliche Wahrnehmung der Überwachung.<br />
In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am<br />
Main 2005, S 36<br />
359 Legnaro, Aldo: Aus der Neuen Welt: Freiheit, Furcht und Strafe als Trias der Regulation, Berlin 2000,<br />
http://www.isip.uni-hamburg.de/04%20Texte/AL%20Trias.htm<br />
130
die Hälfte auf kleinere Ordnungswidrigkeiten.“ 360<br />
In der Studie zeigt sich, dass 36 % der Menschen, die länger überwacht wurden „aus keinem<br />
offensichtlichen Grund“ gefilmt wurden. 24 % der Personen wurden gezielt aufgrund ihres<br />
Verhaltens überwacht, 34 % aber deshalb, weil sie zu einer best<strong>im</strong>mten gesellschaftlichen<br />
Gruppierung oder kulturellen Minderheit gehörten. Der ungerechtfertigte Verdacht verteilte<br />
sich ungleichmäßig auf alle gesellschaftlichen Gruppen: 65 % der Jugendlichen wurden oh-<br />
ne best<strong>im</strong>mten Grund überwacht – dem gegenüber stehen 21 % der über Dreißig-Jährigen.<br />
68 % der Schwarzen gegenüber 35 % der Weißen wurden grundlos überwacht, genauso wie<br />
47,5 % der Männer und 16 % der Frauen. 361<br />
Auch Frank Helten machte bei der Untersuchung in den Berliner Shopping Malls ähnliche<br />
Beobachtungen. Insbesondere wenn eine Videoüberwachung stattfindet, werden Verstöße<br />
gegen die (oft strengen) Hausordnungen in der Alltagswirklichkeit großzügig ausgelegt und<br />
Verstöße vom Sicherheitspersonal oft toleriert, übersehen oder nicht angemessen interpre-<br />
tiert. „Da Shopping-Mall-Manager ebenso wie das Sicherheitspersonal wissen, dass eine strikte Anwen-<br />
dung der Hausordnung Kunden abstoßen würde, müssen sie eine Güterabwägung vornehmen, die häufig<br />
zugunsten des Konsumenten ausfällt, der in der Sicht der Shopping-Mall-Betreiber einen aktiven Part in der<br />
Ausübung sozialer Kontrolle spielt. Rigider werden Verstöße gegen die Regeln der Hausordnung gehand-<br />
habt, wenn damit Handlungen wie Rauchen, Rad- oder Skateboardfahren etc. geahndet werden sollen, von<br />
denen das Sicherheitspersonal ann<strong>im</strong>mt, dass die Durchschnittsbesucher aufgrund geteilter Überzeugungen<br />
und Feindbilder – vor allem gegenüber Jugendlichen – entsprechende Eingriffe gutheißen. 362<br />
360 Quelle: Norris/Armstrong (1988)<br />
361 vgl. Norris (2005), S 382<br />
362 Quelle: Helten (2005), S 161<br />
131
3.6 Ursachen der Videoüberwachung<br />
Wenn man die tatsächliche Effizienz der Videoüberwachung analysiert und - wie in dieser<br />
Arbeit dargestellt - die Wirkung dieser Maßnahme bezogen auf Kr<strong>im</strong>inalität und Sicher-<br />
heitsgefühl wenig bis keinen Einfluss hat, stellt sich die Frage, warum die Kameras trotzdem<br />
diesen Siegeszug in die <strong>öffentlichen</strong> Räume angetreten haben. Natürlich greifen vermutete<br />
Erklärungen wie „wachsendes Un<strong>sicherheit</strong>sgefühl“ oder „steigende Kr<strong>im</strong>inalität“ zu kurz<br />
und beschreiben das Phänomen – wenn überhaupt – zu oberflächlich.<br />
Fakt ist: Das Geschäft mit der Überwachung ist ein stark wachsendes. Alleine in Großbri-<br />
tannien sind schätzungsweise vier Millionen Kameras installiert, die den öffentlich zugängli-<br />
chen Raum überwachen. 363 Eine Umfrage unter 1.400 Geschäften und Institutionen in sie-<br />
ben europäischen Hauptstädten <strong>im</strong> Sommer 2002 ergab, dass jede dritte öffentlich zugängli-<br />
che Einrichtung ihre Räumlichkeiten und auch teilweise angrenzende Verkehrsflächen mit<br />
Kameras überwacht. 364 Die Sicherheitsindustrie boomt in einer Art und Weise, dass nach<br />
Gilbert van Elsbergen die Installation von Überwachungstechnologie volkswirtschaftlich als<br />
Pro-Argument gewertet muss. 365 . Die ökonomische Potenz dieser - privaten - Sicherheits-<br />
industrie, die „durch die oberflächlichen Hochglanz-Versprechen von Entwicklern und Herstellern und<br />
ihren Marketingabteilungen und Lobbyisten“ 366 , die laut Töpfer die Faszination für neue Technik<br />
und den naiven Glauben an eine einfache Lösung <strong>im</strong> komplexen Themenbereich sozialer<br />
Probleme nähren, spielt eine wesentliche Rolle <strong>im</strong> Ausbau der Videoüberwachung. Gleich-<br />
zeitig lässt der Sparzwang der <strong>öffentlichen</strong> Hand – auch <strong>im</strong> Bereich der <strong>öffentlichen</strong> Sicher-<br />
heit – die technische Überwachung als eine kostengünstige Alternative zu personalintensi-<br />
ven Kontrolltätigkeiten vor Ort bieten. Natürlich muss dabei „hinterfragt werden, ob der Gewinn<br />
für die Haushälter auch ein Gewinn für die öffentliche Sicherheit ist“. 367<br />
363 Quelle: Hempel (2007), S 117<br />
364 vgl. Töpfer (2007), S 33<br />
365 vgl. van Elsbergen Gilbert (2007), Kr<strong>im</strong>inologische Implikationen der Videoüberwachung. In: Zurawski,<br />
Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag Barbara Budrich, Opladen &<br />
Farmington Hills 2007, S 108<br />
366 Quelle: Töpfer (2007), S 38<br />
367 Quelle: Töpfer (2007), S 40<br />
132
Von vielen Erklärungsmodellen will ich auf lediglich drei zurückgreifen, die in engem Zu-<br />
sammenhang mit der grundsätzlichen Intention dieser Arbeit – Jugend und öffentlicher<br />
Raum – stehen und ein Verständnis für die rasante Entwicklung der Videoüberwachung<br />
eröffnen:<br />
1) Der gesellschaftliche Wandel – und damit <strong>im</strong>pliziert ein neues Verständnis von Gesell-<br />
schaft, Sicherheit und Kr<strong>im</strong>inalität;<br />
2) die Kommerzialisierung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes und damit verbunden eine zusätzliche<br />
Dynamik des gesellschaftlichen Wandels;<br />
3) die Rolle der Gesetzgebung<br />
3.6.1 Der gesellschaftliche Wandel<br />
Unsere Welt ist seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts <strong>im</strong> Umbruch. Hatten sich seit Mit-<br />
te des 20. Jahrhunderts noch zwei Gesellschaftsentwürfe (die freie Marktwirtschaft mit sozi-<br />
alwirtschaftlicher Prägung einerseits und der realsozialistische Entwurf andererseits) feind-<br />
lich gegenübergestanden, brach Ende der Achtzigerjahre der Realsozialismus in sich zu-<br />
sammen und der (Neo)Liberalismus setzte sich als relevantes Denkkonzept in den Köpfen<br />
und der konkreten Ausgestaltung der Lebens- und Gesetzentwürfe fest. „Der Neoliberalismus<br />
ist jene Form der Politik, mit dem Ziel, die sozialen Errungenschaften, wie zum Beispiel Arbeitsschutz oder<br />
Mitbest<strong>im</strong>mung zurückzudrängen, und die wirtschaftlichen Interessen auf Kosten der sozialen Sicherheit<br />
durchzusetzen. Dadurch entsteht eine Art Restauration, eine negative Anpassungsspirale der sozialen Rechte,<br />
eine Art Sozialdarwinismus, das der Wiederkehr des Sozialchauvinismus Tür und Tor öffnet.“ 368<br />
Ein global entfesselter Markt, die fortschreitende Globalisierung prägt seither die Entwick-<br />
lung der Gesellschaft: Die Flexibilisierung der Arbeitskräfte, Modernisierung und Umstruk-<br />
turierung des <strong>öffentlichen</strong> Dienstes, die Orientierung der Unternehmen am „shareholder<br />
368 Quelle: Mörth, Ingo/Baum, Doris (Hrsg.): Gesellschaft und Lebensführung an der Schwelle zum neuen Jahrtausend.<br />
Gegenwart und Zukunft der Erlebnis-, Risiko-, Informations- und Weltgesellschaft. Referate und<br />
Arbeitsergebnisse aus dem Seminar "Soziologische Theorie" WS 1999/2000. Johannes Kepler Universität,<br />
Linz 2000, S 79<br />
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/STSGesellschaft.pdf<br />
133
value“, der Rückzug von Politik und Staat aus der ökonomischen Gestaltungsfähigkeit, der<br />
Druck auf Reduzierung der sozialen Sicherheit sind nur einige Schlagworte um die Entwick-<br />
lung zu beschreiben. Traditionelle Lebensmuster und Bezugssysteme befinden sich in Auf-<br />
lösung, der einzelne Mensch wird zunehmend als „Ich-AG“ gefordert, und muss sich eben-<br />
so wie jedes beliebige andere Produkt am Markt behaupten.<br />
Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach sozialer Absicherung, kann oder will vom Staat <strong>im</strong>mer<br />
weniger befriedigt werden. „Die Macht der Ökonomie, der Technokratie, der Finanzmärkte und die<br />
Unfähigkeit des Staates, welcher sich <strong>im</strong>mer weiter aus der Wirtschaft zurückzieht und folglich seine dring-<br />
lichste Aufgabe, nämlich die soziale Sicherheit eines jeden Bürgers in einem Land zu gewährleisten, nicht<br />
mehr wahrnehmen kann, sind Brennpunkte der heutigen Industriegesellschaft.“ 369<br />
Diese Entwicklung hin zur Un<strong>sicherheit</strong>, kann man nach Beck als Entwicklung zur „Risiko-<br />
gesellschaft“ lesen. Während es bei der „Industrie- oder Klassengesellschaft“ vor allem um<br />
Verteilungsfragen des erwirtschafteten Reichtums ging, stellt sich die wesentliche Vertei-<br />
lungsfrage in der Risikogesellschaft etwas anders: „Wie können die <strong>im</strong> fortgeschrittenen Modernisie-<br />
rungsprozess systematisch mitproduzierten Risiken und Gefährdungen verhindert, verharmlost, dramatisiert,<br />
kanalisiert und dort, wo sie nun einmal in Gestalt „latenter Nebenwirkungen“ das Licht der Welt erblickt<br />
haben, so eingegrenzt und wegverteilt werden, dass sie weder den Modernisierungsprozess behindern noch die<br />
Grenzen des „Zumutbaren“ überschreiten?“ 370<br />
Um die latente individuelle Un<strong>sicherheit</strong> zu kompensieren, steigt die gesellschaftliche Be-<br />
deutung persönlicher Sicherheit und Kontrolle. Sicherheit wird nicht mehr in erster Linie als<br />
gemeinschaftliches Ziel aller durch gegenseitige Unterstützung verstanden, sondern als indi-<br />
viduelle Absicherung und soziale Abgrenzung gegenüber anderen. Dabei werden Abwei-<br />
chung und Kr<strong>im</strong>inalität als die zentralen Bedrohungen wahrgenommen. Sicherheit wird<br />
heute „weniger <strong>im</strong> Humboldtschen 371 Sinne als Sicherheit vor staatlichen Eingriffen, als Plädoyer für einen<br />
369 Quelle: Mörth/Baum (2000), S 79<br />
370<br />
Quelle: Mörth/Baum (2000), S 78<br />
371<br />
Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt, kurz: Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835)<br />
war ein deutscher Gelehrter, Staatsmann und Mitbegründer der Universität Berlin (heute: Humboldt-Universität<br />
zu Berlin).<br />
134
gebändigten rechtsstaatlichen Staat oder <strong>im</strong> wohlfahrtstaatlichen Sinne als soziale Absicherung angesehen,<br />
sondern als persönliche Sicherheit vor Bedrohungen und Gefahren.“ 372 Individuelle Sicherheit und<br />
Abgrenzung werden zum gesellschaftlichen Leitbild, bei dem andere zentrale gesellschaftli-<br />
che Prinzipien und Wertvorstellungen nur mehr eine nachgeordnete Rolle spielen.<br />
Im Zuge des Strebens nach individueller Sicherheit in Abgrenzung zu anderen, etabliert sich<br />
ein gesellschaftliches Kl<strong>im</strong>a, bei dem auch zunehmend subjektive Ordnungsvorstellungen<br />
eine Bedeutung gewinnen: man will nicht mehr angebettelt werden, man will keine Betrun-<br />
kenen sehen müssen, man will nicht mit Armut und anderen gesellschaftlichen Zuständen<br />
konfrontiert werden. Abweichendes Verhalten wird nicht mehr mit den gesellschaftlichen<br />
Umständen erklärt, sondern wird individualisiert und damit als persönliche Verfehlung<br />
wahrgenommen, die jeder Einzelne zu verantworten und damit auch deren Folgen zu tragen<br />
hat. 373<br />
Gleichzeitig ist der individualisierte Mensch <strong>im</strong>mer weniger bereit anzuerkennen, dass das<br />
Risiko ein Grundmerkmal der menschlichen Existenz ist, dass soziale Konflikte gesell-<br />
schaftlich produziert sind und damit zum kollektiv geschaffenen allgemeinen Lebensrisiko<br />
gehören. 374<br />
Soziologisch kann man den gesellschaftlichen Wandel auch als Transformation der Diszip-<br />
linargesellschaft zur Kontrollgesellschaft lesen. Michel Foucault beschrieb die Disziplinarge-<br />
sellschaft als Gesellschaftsformation, die auf der Technik der Einschließung beruhte. Diese<br />
Einschließung durchzog das ganze Leben. Die Weiterreichung erfolgte von einem diszipli-<br />
nierendem Einschließungsmilieu zum anderen: Familie, Schule, Universität, Militär, Büro,<br />
Fabrik, etc. (bei Versagen auch Gefängnis, oder psychiatrische Anstalt).<br />
Die Welt war reglementiert wie die Produktionsabläufe in einer Fabrik. Das Individuum war<br />
372 Quelle: Singelnstein, Tobias/Stolle, Peer: Von der sozialen Integration zur Sicherheit durch Kontrolle und<br />
Ausschluss. In: Zurawski Nils (Hrsg.): , in: Surveillance Studies, Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag<br />
Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, 2007, S 55<br />
373 vgl. Singelnstein/Stolle (2007), S 54<br />
374 vgl. Singelnstein/Stolle (2007), S 55<br />
135
in ein umfassendes Beziehungssystem eingeschlossen, das ein umfangreiches Netz sozialer<br />
Kontrolle darstellte: Kirche, Klubs, Berufsvereine, Parteien. Dieses dichte Netz von Bezie-<br />
hungen schrieb der einzelnen Person ein streng geordnetes Alltagsleben vor. Ergänzt wurde<br />
dieses Disziplinarreg<strong>im</strong>e durch die Kulturindustrie: Dieses integrierte neben dem Körper<br />
auch die Seele. „Denn hier durfte sich der in der Produktion eingespannte und disziplinierte Körper nach<br />
Feierabend erholen, um sich für den nächsten Tag wiederherzustellen.“ 375<br />
Die „Einschließungsmilieus“ (der alten Disziplinargesellschaft) befinden sich in einer<br />
schweren Krise: Man spricht laufend über die Probleme von Familie, Schule, Parteien, Ge-<br />
werkschaften, Kirche und den Nationalstaaten. Aus den ehemals versicherten, betreuten,<br />
aber auch disziplinierten Individuen entstehen freie Unternehmen. Sie sind freier von<br />
Zwängen, aber auch frei von gesellschaftlicher Fürsorge.<br />
In Anlehnung als Gilles Deleuze, der für diese neue Gellschafsformation den Begriff „Kon-<br />
trollgesellschaft“ prägt, schreibt Mörth: „Die Ersetzung der Einschließungsmilieus, durch eine per-<br />
manente Kontrolle hat bereits begonnen. So, wie das Unternehmen die Fabrik ablöst, tritt die permanente<br />
Weiterbildung an die Stelle der Schule, die kontinuierliche Kontrolle an die Stelle der Prüfung. In den Dis-<br />
ziplinargesellschaften hört man nie auf, anzufangen: von der Schule gelangt man in die Kaserne, von der<br />
Kaserne in die Fabrik. In den Kontrollgesellschaften wird man dagegen nie mit etwas fertig: Unternehmen,<br />
Weiterbildung, Dienstleistung, ... Die Kontrollgesellschaft bietet dem Individuum eine Freiheit des Vergnü-<br />
gens, die in der Welt der Einschließung so nicht möglich war. Das Fürchterliche an der Kontrolle ist aber,<br />
dass sie in den Fluchtorten selbst stattfindet. Die heutige Kontrollgesellschaft bejaht den Spaß, aber sie kontrolliert<br />
und verändert ihn. 376<br />
Heute geht es weniger um die Bearbeitung von sozialen Konflikten oder um die Interventi-<br />
on in konkrete Bedrohungsszenarien, die eine Schädigung nach sich ziehen könnten. Vielmehr<br />
ist an dessen Stelle das Risiko „als erwartbarer, technisch zu regulierender Sacherverhalt“ 377<br />
getreten. Der Definition, Verteilung, Bekämpfung und Abschirmung von diesem Risiko<br />
375 Quelle: Mörth/Baum (2000), S 51<br />
376 Quelle: Mörth/Baum (2000), S 53<br />
377 Quelle: Singelnstein/Stolle (2007), S 55<br />
136
kommt eine erhebliche Bedeutung zu. „Das Risiko basiert auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung,<br />
deren Grundlage Faktoren und Merkmale bilden, die als Risiko erhöhend klassifiziert werden. Diese<br />
Denklogik ‚entdeckt’ und produziert mit ihrem Streben nach möglichst genauer Prognose und Erfassung von<br />
Risikofaktoren ständig neue Risiken. Somit macht das Risiko als Gegenstand sozialer Kontrolle heute be-<br />
reits deutlich mehr und wesentlich frühere Eingriffe und Maßnahmen notwendig, die unabhängig von einer<br />
konkret bestehenden Bedrohungslage erfolgen.“ 378<br />
Damit wird der Gegenstand „staatliche Sozialkontrolle“ vorverlagert und ausgeweitet.<br />
Demgegenüber wird ein Verständnis von Sicherheit gestellt, das in der Realität nicht haltbar<br />
ist. „Dies gilt zum einen, da umfassender Schutz vor Risiken gar nicht möglich ist. Dabei steigt die Unsi-<br />
cherheit nicht, OBWOHL wir in einer der sichersten und auf Sicherheit setzenden Gesellschaft leben, son-<br />
dern gerade DESWEGEN. Das ständige Streben nach Sicherheit kann zwar unter Umständen einen<br />
objektiven Sicherheitsgewinn darstellen – subjektiv wird damit aber weitere Un<strong>sicherheit</strong> produziert. Die<br />
herrschende Un<strong>sicherheit</strong> entsteht also durch die Differenz zwischen einer gesellschaftlich produzierten - und<br />
prinzipiell unbegrenzt steigerbaren - Sicherheitserwartung und dem begrenzten Vermögen der Gesellschaft,<br />
diese in der Praxis auch zu gewährleisten. Zum anderen ist Sicherheit auch deswegen nicht zu erreichen, da<br />
die ständige Un<strong>sicherheit</strong> einen notwendigen Gegenpart zur größer werdenden, individualisierten Freiheit des<br />
Liberalismus darstellt.“ 379<br />
Die Bedrohung dieser Freiheit begründet daher nicht nur Sicherheitsmaßnahmen, sondern<br />
führt auch zur Selbstbeschränkung des Einzelnen, da die Freiheit auch <strong>im</strong> Liberalismus<br />
nicht ungezügelt ausgelegt werden darf.<br />
Dieses neue Bild von Sicherheit – also die Wegwendung von der sozialen Sicherheit diag-<br />
nostiziert auch Lutz Ellrich: „Die traditionellen politischen Institutionen reduzieren jenes Engagement,<br />
das mit dem Projekt des Sozial- beziehungsweise Wohlfahrtsstaats verknüpft ist, und verlegen den Schwer-<br />
punkt ihrer Eingriffe in die gesellschaftlichen Prozesse auf das Feld der sogenannten inneren Sicherheit. Die-<br />
se Art der Obhut umfasst allerdings <strong>im</strong>mer weniger die Belange der Altersvorsorge und der Krankenpflege.<br />
Gesteigerte Investitionen in technische Überwachungs- und Kontrollsysteme gehen – darüber herrscht kaum<br />
378 Quelle: Singelnstein/Stolle (2007), S 56<br />
379 Quelle: Singelnstein/Stolle (2007), S 57<br />
137
Dissens – heute mit einer Entsicherung des individuellen Daseins einher. Der schwindenden Privatheit zahl-<br />
reicher (zum Beispiel int<strong>im</strong>er) Handlungen steht die Reprivatisierung vormals sozial entschärfter Lebensrisiken<br />
gegenüber.“ 380<br />
Auch Nils Leopold zeichnet dieses neue Verständnis nach Sicherheit und dessen Folgen<br />
nach: „Heute erscheint es als nahezu selbstverständlich, wenn der Staat proaktiv gegen mögliche Gefahren<br />
vorgehend, Risiken und Gefahrenquellen antizipiert und seine Institutionen nach diesen Zielsetzungen um-<br />
strukturiert. Zur Erfüllung dieses umfassenden präventiven Selbstverständnisses bedarf es aus staatlicher<br />
Sicht umfassender Informationen aus allen Bereichen der Gesellschaft.“ 381<br />
Auch Krasmann analysiert diese Zusammenhänge ähnlich: „Der Modus der Kontrolle, den Vi-<br />
deoüberwachung erzeugt, entspricht, so lässt die These sich weiter zuspitzen, in nuce einer Gouvernementali-<br />
tät der Gegenwart , die sich durch Strategien wie den ‚Rückzug des wohltätigen Staates’ zugunsten von mehr<br />
Initiative, Engagement und Eigenverantwortung des Bürgers sowie durch Prozesse der ‚Privatisierung’,<br />
‚Kommodifzierung’ oder ‚Markvergesellschaftung’ kennzeichnen lässt.“ 382<br />
Aus den vorher beschriebenen Entwicklungen resultiert auch – so Töpfer - ein neues Bild<br />
von Kr<strong>im</strong>inalität. Diese wird nicht mehr als ein pathologisches gesellschellschaflichtes Phä-<br />
nomen verstanden, dem mit der Bekämpfung seiner Ursache (soziale Missstände Armut<br />
etc.) bzw. gut gemeinter Resozialisierungsmaßnahmen beizukommen sei. Vielmehr sind<br />
Verbrechen ein unausrottbares Übel, dem als Risiko versicherungsmathematisch zu begeg-<br />
nen sei. „Mit dieser kr<strong>im</strong>inalpolitischen Kehre wandelt sich die repressive, auf individuelle Verdächtige und<br />
Störer ausgerichtete Polizeiarbeit und wird ergänzt und zum Teil abgelöst von einem präventiven und ver-<br />
dachtstunabhängigen, auf Risikogruppen und –orte fokussierten Polizieren in Netzwerken <strong>öffentlichen</strong> und<br />
privater Akteure.“ 383<br />
380<br />
Quelle: Ellrich(2005), S 45<br />
381<br />
Quelle: Leopold, Nils: Rechtskulturbruch. Die Ausbreitung der Videoüberwachung und die unzulängliche<br />
Reaktion des Rechts. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag,<br />
Frankfurt am Main 2005, S 285<br />
382<br />
Quelle: Krasmann, Susanne: Mobilität: Videoüberwachung als Chiffre einer Gouvernementalität der Gegenwart.<br />
In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main<br />
2005, S 309<br />
383<br />
Quelle: Töpfer (2007), S 41<br />
138
Die parallele Entwicklung einer umfassenden Kontrolle und des Bedeutungsgewinnes des<br />
repressiven Ausschlusses diagnostizierten auch Singelnstein und Stolle: „Statt den normverlet-<br />
zenden Individuen die soziale Reintegration offen zu halten, werden sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen,<br />
d.h. es wird ihnen in unterschiedlicher Intensität gesellschaftliche Partizipation vorenthalten - von der sozialen<br />
Benachteiligung über die Ressourcchenbegrenzung bis hin zur physischen Vernichtung.“ 384<br />
Die Definition dieser Risikogruppen und –orte ist <strong>im</strong> Wesentlichen eine Machtfrage und<br />
hängt stark mit wirtschaftlichen Intentionen zusammen.<br />
„Die eigentliche Normabweichung als Handlung bekommt in diesem Zusammenhang eine andere Bedeu-<br />
tung. Sie wird nicht mehr als Symptom angesehen, sondern als das eigentliche Problem, das so weit wie mög-<br />
lich <strong>im</strong> Vorfeld erkannt und dort verhindert bzw. unterdrückt werden soll. Damit kommt der Kontrolle eine<br />
umfassendere Bedeutung zu: Sie soll selbst unmittelbar für Sicherheit <strong>im</strong> Sinne der (Wieder-) Herstellung<br />
von sozialer Ordnung und nicht nur für die Feststellung und Verfolgung von abweichendem Verhalten sor-<br />
gen“. 385<br />
Überwachung wird daher unabhängig von konkreten Anlassfällen und hat die Tendenz all-<br />
umfassend zu werden. Zunehmend setzt sich ein allseitiges Misstrauen durch und jede/r<br />
wird als potentielle Gefahr angesehen. Nicht mehr ein Normenverstoß oder eine Gesetzes-<br />
übertretung wird abgewartet, sondern die „Kontrolle ist nicht mehr als Reaktion konzipiert, sondern<br />
proaktiv ausgestaltet. Folgerichtiges Ziel eines solchen Verständnisses ist ein allgegenwärtiger, umfassender<br />
Einsatz von Kontrolltechniken, dem gegenwärtig (noch) durch mangelnde Ressourcen und verfassungsreichliche<br />
Beschränkungen Einhalt geboten wird.“ 386<br />
Zu einer identen Analyse der Entwicklung kommen auch Hempel und Metelmann: „In der<br />
Polizei- und Sicherheitsarbeit lässt sich <strong>im</strong> Laufe der vergangenen Jahre ein Wandel von reaktiven Strate-<br />
gien zu proaktivem Risikomanagement feststellen, das sich <strong>mittels</strong> verschiedenster Verfahren wie DNA-<br />
Tests oder eben Videoüberwachung in den Innenstädten auf die Erstellung von Datenbanken, Täterprofilen<br />
und die Möglichkeit präventiven Handelns konzentriert. In der Risikogesellschaft bildet nicht mehr ein<br />
384 Quelle: Singelnstein/Stolle (2007), S 50<br />
385 Quelle: Singelnstein/Stolle (2007), S 49<br />
386 Quelle: Singelstein/Stolle (2007), S 49<br />
139
konkreter Verdacht die Basis, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum zum Täter werden<br />
könnte.“ 387<br />
3.6.2 Die Kommerzialisierung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes<br />
Zunehmend wird die Transformation des urbanen Raumes in der Diskussion unter dem<br />
Stichwort „Revitalisierung der Innenstädte thematisiert. Stadtzentren werden in diesem Pro-<br />
zess wieder zu Konsumräumen umgestaltet, um die wirtschaftliche Potenz der Einkaufs-<br />
kraft, die sich in der Vergangenheit sehr stark um die Einkaufszentren an der Peripherie<br />
scharrte, wieder zurück in die Zentren zu bringen. Um in diesen Konsumräumen eine<br />
kaufanregende Wohlfühlatmosphäre zu schaffen (und damit auch unerwünschte - siehe o-<br />
ben beschriebenes Risikoparadigma - Gruppen hinwegzuhalten) bedient man sich - ebenso<br />
wie in den Einkaufszentren am Rande der Stadt - der Videoüberwachung. 388<br />
Töpfer weist darauf hin, dass angesichts der gewachsenen wirtschaftlichen Bedeutung von<br />
Konsum und Dienstleistung <strong>im</strong> globalen, nationalen und lokalen Standortwettbewerb we-<br />
sentlich auf das positive Image der urbanen Räume ankommt. In diesem Kontext postmoderner<br />
Stadtentwicklung sei auch der Aufstieg der Videoüberwachung zu lesen. 389<br />
Diese Entwicklung ist eine durchaus dynamische Entwicklung, die Georg Frank bündig auf<br />
den Punkt bringt: „Zwei Entwicklungen haben die Städte stärker verändert, als Architektur und Städ-<br />
tebau es vermocht hätten: Die Invasion der Marken und die Invasion der Kameras.“ 390 Franck be-<br />
schreibt folglich diese Kommerzialisierung aus einem „Paarlauf“ von Werbung und Über-<br />
wachung. Die Videoüberwachung schließt die Interessen von Überwachung und Marketing<br />
kurz: „Es dient der Konditionierung eines dem Konsum förderlichen Erlebnis<strong>raum</strong>s. Die Abwehr störender<br />
Einflüsse und die Beeinflussung <strong>im</strong> geneigt machenden Sinn gehen ineinander über. Die Shopping Malls und<br />
Erlebniswelten sind nicht nur <strong>im</strong> kl<strong>im</strong>atechnischen Sinn konditionierte Räume, sie sind es auch <strong>im</strong> Sinn des<br />
387<br />
Quelle: Hempel/Metelmann (2005), S 14<br />
388<br />
vgl. Hempel/Metelmann (2005), S 15<br />
389<br />
vgl. Töpfer (2005), 259<br />
390<br />
Quelle: Franck (2005), S 141<br />
140
Lebensgefühles, das sie den Besuchern vermitteln. 391 Sowohl die Werbung, als auch die Videoüber-<br />
wachung bedrängen den <strong>öffentlichen</strong> Erlebnis<strong>raum</strong> mit einer Art Privatisierung. Keines die-<br />
ser beiden Elemente verwehrt den Zugang in diesen Raum, aber beide fordern ihren Tribut.<br />
Die Werbung „erhebt (...) eine Gebühr in der Form des geforderten Konsums. Sie taucht auf, wohin wir<br />
blicken. Wir geben Aufmerksamkeit aus und leiden unter der Kontamination des Erlebnis<strong>raum</strong>s. Den<br />
Nutzen haben die, die die Aufmerksamkeit abschöpfen und uns die Aussicht verderben, aber auch diejeni-<br />
gen, die Oberflächen an die Werbewirtschaft vermieten.“ 392 . Die Videoüberwachung erklärt - wie <strong>im</strong><br />
Kapitel „Wer wird überwacht“ ausgeführt – Mitglieder gewisser Gesellschaftsgruppen ohne<br />
eine konkrete Straftat begangen zu haben – vorsorglich als unerwünscht: „Eine Person, die so<br />
aussieht, als könnte sie Straftaten begehen oder stören wollen, wird selbst zu einem unerwünschten Indivi-<br />
duum“. 393 Dabei arbeitet Franck ein interessantes Paradoxon heraus: Beide Phänomene<br />
markieren - allerdings unterschiedlich - das soziale Gefälle innerhalb der Stadt. Während die<br />
Werbung mit dem Steigen des sozialen Status in den betreffenden Stadtvierteln abn<strong>im</strong>mt –<br />
sich die Reichen diese Belästigung also vom Leib halten können – aber auch die „tiefen Lagen<br />
von dem Gerangel um Beachtung gezeichnet“ 394 sind, verhält es sich mit der Überwachung anders:<br />
„Die Kameradichte n<strong>im</strong>mt mit dem sozialen Status ab. Die Überwachung ist dort am intensivsten, wo am<br />
meisten Reichtum ist. Elend sind die Quartiere, die niemand mehr überwachen will oder kann.“ 395<br />
Frank Helten sieht die Shopping Malls überhaupt als Labor, in dem sich Mechanismen der<br />
Videoüberwachung – bedingt durch die Tatsache, dass sich diese an strategischen Orten mit<br />
hoher Besucherfrequenz befinden – allmählich „als spontane Verräumlichung von Überwachung<br />
oder als Bausteine einer Ökologie der Übehrwachung“ 396 in das Stadtgeflecht einschreiben. Die Fol-<br />
gen dieser Entwicklung - und hier greife ich dem Kapitel „Auswirkungen der Videoüberwa-<br />
chung“ voraus - drohen aber weit über die bloße Überwachung hinauszugehen: „So mutiert<br />
391 Quelle: Franck (2005), S 143<br />
392 Quelle: Franck (2005) S 143<br />
393 Quelle: Krasmann (2005), S 320 ff<br />
394 Quelle: Franck (2005), S 148<br />
395 Quelle: Franck, (2005), 149 ff<br />
396 Quelle: Helten (2005), S 162<br />
141
die videoüberwachte Shopping Mall zu einem postmodernen Labor oder Teilzeitgefängnis zur Konditionie-<br />
rung des Konsumenten, dessen Performanz per Video aufgezeichnet wird, was Erkenntnisse darüber liefert,<br />
wie das Einkaufen und verweilende Konsumieren opt<strong>im</strong>iert werden könnte. Der Fokus der Überwachung in<br />
der Überwachungsgesellschaft ändert sich und bildet neue Schwerpunkte: Neben der Kontrolle und Sanktio-<br />
nierung abweichenden Verhaltens und der Opt<strong>im</strong>ierung des Betriebsablaufes könnte die Zukunft der VÜ<br />
und weiterer Überwachungstechnologien durch die Funktion gekennzeichnet sein, die ‚Leichtigkeit’ des Konsumierens<br />
zu beschleunigen.“ 397<br />
3.6.3 Die Rolle bzw. die Veränderung des geltenden Rechtes<br />
Eine wesentliche Ursache in der Verbreitung der Videoüberwachung basiert auf dem (sich<br />
veränderten) geltenden Recht.<br />
Marianne Gras weist darauf hin, dass Großbritannien auch deshalb zum „Mutterland der<br />
Videoüberwachung“ mutierte, weil es in England und Wales keinerlei rechtliche Hindernis-<br />
se dafür gab: „Eine Entwicklung (ist) bis zu dieser Stufe möglich gewesen, weil das Rechtssystem traditionell<br />
keinerlei Recht auf „Privacy“ (Privatheit) <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum anerkennt. 398<br />
Die Überwachungs-Freiheit wurde zwar als bedenklich wahrgenommen, eine gesetzliche<br />
Regelung wurde aber nie ernsthafter angedacht. Gegen möglichen Missbrauch wurden zwar<br />
„Codes of Practice“ – zunächst freiwillig, inzwischen obligatorisch – entwickelt, die eine<br />
funktionierende Praxis sicherstellen sollen. Diese schaffen zwar einen Rahmen, der rechtliche<br />
Status ist jedoch unklar und ohne Konsequenzen bei Nichteinhaltung. 399<br />
Der starke Zuwachs an installierten Kameras und die Tendenz zu leichterer Billigung der<br />
Videoüberwachung auch in den kontinentaleuropäischen Ländern ist darin begründet, „dass<br />
bei der Bewertung ein Systems oftmals eben nur diese eine Installation in den Blick genommen wird. Sie wird<br />
so auch in der Regel für zulässig gehalten, denn für sich genommen stellt eine einzelne Kamera kaum eine<br />
397 Quelle: Helten (2005) S 172<br />
398 Quelle: Gras, Marianne: Überwachungsgesellschaft. Herausforderung für das Recht in Europa. In: Hempel,<br />
Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 295<br />
399 vgl. Gras (2005), S 295 ff<br />
142
Bedrohung der Grundrechte dar. Erst durch die Gesamtwirkung vieler Installationen entsteht die Notwen-<br />
digkeit, ihre Zahl zu beschränken.“ 400 Genau darin sieht Gras auch die Crux der Entwicklung:<br />
Aus einem eher flüchtigen Eingriff <strong>im</strong> Einzelfall (aus durchaus berechtigten Interessen her-<br />
aus, z.B. einen Überfall <strong>im</strong> Geschäft abzuwenden) entsteht eine zunehmend flächendecken-<br />
de Überwachung.<br />
Auch bei den Beispielen, die <strong>im</strong> Kapitel „Effektivität der Videoüberwachung“ genauer dar-<br />
gestellt werden, ist zu erkennen, dass die Änderung des geltenden Rechts naturgemäß eine<br />
wesentliche Grundlage für den Ausbau der Videoüberwachung ist.<br />
Nils Leopold sieht in der Vermischung verschiedener Anforderungen und Interessen <strong>im</strong><br />
Politikfeld der sogenannten inneren Sicherheit und des vorherrschenden Zweckdenkens<br />
eine Ausweichbewegung des Rechtsstaates, die eingeschränkte Grund- bzw. Bürgerrechte in<br />
Kauf n<strong>im</strong>mt: „Zu den spezifischen Ausweichstrategien des Gesetzgebers gehört es deshalb auch, das recht-<br />
staatlich kaum fassbare Ziel der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung anzuführen. Unter Ver-<br />
weis auf ein in seinen eigentlichen Ursachen nicht näher belegbares, empirisch höchst heterogenen nachweisba-<br />
res Un<strong>sicherheit</strong>sgefühl soll damit eine vermeintlich nicht weiter angreifbare Legit<strong>im</strong>ation des Videoeinsatzes<br />
geschaffen werden. Damit ist eine argumentative Selbst<strong>im</strong>munisierungsstrategie umrissen, die einer rationalen<br />
gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Chancen und Risiken der VÜ erkennbar, entgegensteht.“ 401<br />
Grundsätzlich ist (auch) die Videoüberwachung – neben den nationalen Best<strong>im</strong>mungen –<br />
<strong>im</strong> Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) geregelt. Damit ist der<br />
Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre geregelt. Allerdings lässt die EMRK durch Artikel<br />
8 Abs. 2 „staatliche Eingriffe“ zu, solange diese auf der Basis gesetzlicher Regelungen statt-<br />
finden und „notwendig in einer demokratischen Gesellschaft“, das heißt verhältnismäßig<br />
sind. 402<br />
Diese Verhältnismäßigkeit ist jedoch laut Gras weniger ein zu rechtlich klärender, sondern<br />
vielmehr ein politisch auszuhandelnder Faktor: „Zunächst ist sie pr<strong>im</strong>är ein rechtliches Instrument<br />
400 Quelle: Gras (2005), S 297<br />
401 Quelle: Leopold (2005), S 291<br />
402 vgl. Gras (2005), S 299<br />
143
für die oben erwähnte Interessensabwägung zwischen zwei Parteien. Eine einzelfallbezogene Entscheidung<br />
der Gerichte darüber, wie viel Überwachung insgesamt gegenüber wie viel Kr<strong>im</strong>inalprävention und strafrecht-<br />
licher Aufklärung geboten ist, ist weitaus schwieriger herbeizuführen. Letzteres ist wohl die Grundfrage,<br />
aber der Rahmen um darüber zu entscheiden, ist nicht ohne weiteres dem Recht zu entnehmen. Im Kern ist<br />
dies eher eine politische Entscheidung als eine gerichtlich durchführbare Interessenabwägung.“ 403<br />
403 Quelle: Gras (2005), S 300<br />
144
3.7 Auswirkungen der Videoüberwachung<br />
In der Diskussion oft wenig berücksichtigt sind die Auswirkungen - also die „unerwünsch-<br />
ten Nebenwirkungen“ - der Videoüberwachung auf Mensch und Gesellschaft. Mögliche<br />
Auswirkungen spielen auch in den Evaluationen keine erhellende Rolle. Dies ist insofern<br />
bedenklich, da in der Debatte um die Videoüberwachung wiederholt weitreichende Beden-<br />
ken geäußert wurden. Töpfer spricht sogar an Anlehnung an die Gentechnologie von einer<br />
„Risikotechnologie“, da „ihr Einsatz mit dem Anspruch gerechtfertig wird, auf technologischem Wege zur<br />
Eindämmung und Kontrolle gesellschaftlicher Risiken beizutragen, während gleichzeitig von ihren mögli-<br />
cherweise unkontrollierbaren Folgen für Individuen und Gesellschaft gewarnt wird.“ 404 .<br />
Wie <strong>im</strong> vorigen Kapitel „Ursachen der Videoüberwachung“ dargestellt, ist die Grenze zwi-<br />
schen Ursachen und Auswirkungen der Videoüberwachung eine fließende: Ursachen sind<br />
nicht nur Grundlage der Einführung der Videoüberwachung sondern verstärken sich selbst<br />
durch die real existierende Videoüberwachung. Dabei entwickeln vorhandene Tendenzen<br />
eine Spirale nach „unten“: Die Gesellschaft wird <strong>im</strong>mer unsicherer, die Kommerzialisierung<br />
des <strong>öffentlichen</strong> Raumes bekommt eine zusätzliche Dynamik, das geltende Recht wird zu-<br />
nehmend repressiver, etc.<br />
Der Standsatz der Videoüberwachungsbefürworter „Wer nichts zu verbergen hat, hat auch<br />
nichts zu befürchten“ trifft den Sachverhalt nicht richtig. Denn selbst jene, die nichts zu<br />
verbergen haben, haben doch auch die Auswirkungen der Videoüberwachung auf die Ent-<br />
wicklung von Mensch, Gesellschaft und Stadt zu befürchten und sind ebenfalls davon be-<br />
troffen.<br />
3.7.1 Änderung des Anzeigenverhaltens<br />
Eine sehr konkrete Befürchtung ist beispielsweise, dass die Kameras das Melde- und Anzei-<br />
genverhalten der Bürger/innen – und damit die soziale Kontrolle insgesamt – verändern.<br />
„Es kann davon ausgegangen werden, dass Passanten aufgrund einer Kamera weniger Delikte melden, da<br />
404 Quelle: Töpfer (2007), S 35<br />
145
die Technik suggeriert, die Polizei und andere beauftragte Institutionen würden sich um die Sicherheitsbelan-<br />
ge <strong>im</strong> überwachten Raum kümmern. So kann die Kamera eine Diffusion der Verantwortung bewirken, da<br />
diese ausschließlich der Technik übertragen wird. Umfragen <strong>im</strong> Bereich des <strong>öffentlichen</strong> Nahverkehrs zeigen,<br />
dass Fahrgäste davon ausgehen, Polizei und Sicherheitsdienste haben für die Sicherheit zu sorgen. Erste<br />
Befragungen Londoner Busbetreibern deuten hierauf hin. (...) Seit Einführung der Kameras können in Bus-<br />
sen zeitlich begrenzte Erfolge u.a. bei der Bekämpfung von Vandalismus verbucht werden, zugleich hat sich<br />
das Melde- und Anzeigeverhalten der Fahrgäste jedoch erheblich verändert. Kam es vor der Inbetriebnahme<br />
zu durchschnittlich 40 Anzeigen <strong>im</strong> Monat – die aber aufgrund fehlenden Beweismaterials oftmals nicht<br />
zur Strafverfolgung führten – sank die Zahl der Meldungen und Anzeigen seit Einführung der Kameras<br />
auf durchschnittlich unter zehn.“ 405<br />
3.7.2 Verlust von Kommunikation und Nähe der Exekutive<br />
Durch die Distanz der Videoüberwachung geht außerdem die Kommunikation zwischen<br />
Überwachern und Überwachten <strong>im</strong> Nah<strong>raum</strong> verloren. Daher kann sie – <strong>im</strong> Vergleich zu<br />
Streifenbeamten – nur sehr beschränkt die Rolle eines Mediators einnehmen: Sie n<strong>im</strong>mt den<br />
Beobachteten die Möglichkeit unmittelbar zu reagieren, z.B. <strong>mittels</strong> Entschuldigung, Erklä-<br />
rungen oder ergänzender Informationen. „Der Überwachte ist zwar Informationsobjekt, nicht aber<br />
Kommunikationssubjekt.“ 406 Somit wird <strong>mittels</strong> Videoüberwachung – <strong>im</strong> Gegensatz zur sozia-<br />
len Kontrolle – eine räumliche Differenz gezeugt, die „die sozialräumliche Realität des öffentli-<br />
chen Raumes neu strukturiert und damit eine, die urbanen Ballungsräume <strong>im</strong>mer dichter überziehende Geografie<br />
der Macht begründet.“ 407<br />
Gleichzeitig schwächt diese Distanz aber auch die Sicherheit: Eine Kamera kann <strong>im</strong> Gegen-<br />
satz zu engagierten Anwesenden nicht unmittelbar in das Geschehen eingreifen. Wegen der<br />
<strong>im</strong>mensen Kosten die Videoüberwachung verursacht, stellt Norris darüber hinaus einen<br />
405<br />
Quelle: Hempel (2007), S 143<br />
406<br />
Quelle: Klauser, Francisco: Raum = Energie + Information. Videoüberwachung als Raumaneignung. In:<br />
Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S<br />
195<br />
407<br />
Quelle: Klauser (2005), S 189 ff<br />
146
Wechsel von lokalisierten zu zentralisierten Überwachungsstationen – die mehrere separate<br />
Systeme zentral zusammenfassen – fest, mit der Folge: „Obwohl mehr gesehen werden kann, kann<br />
jedoch weniger gewusst werden. Insofern die Entfernung größer wird, verliert sich situationsbedingtes Wis-<br />
sen.“ 408 Einerseits schränkt sich dadurch die „panoptische Macht der Überwachung“ ein,<br />
andererseits geht dabei auch das Wissen der Exekutive um ihre „Pappenhe<strong>im</strong>er“ verloren.<br />
3.7.3 Unerwünschte Beeinflussung des Verhaltens <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum<br />
Ob Videoüberwachung das menschliche Verhalten beeinflusst, ist empirisch schwer nach-<br />
zuweisen. Es gibt allerdings Befunde, die diesen Schluss nahe legen.<br />
Krasmann zeigt beispielsweise auf, dass Maschinen sehr wohl das menschliche Verhalten<br />
beeinflussen und Verhaltensweisen prägen können. „So inkorporieren Menschen das Wissen dar-<br />
um, wie technische Instrumente zu bedienen sind, oder passen ihre Lebensweise dem Komfort an, den jene<br />
bieten. Insofern kann man durchaus sagen, dass Maschinen Macht ausüben, nicht von sich aus und doch<br />
ohne dass jemand ‚dahinter’ Regie führte.“ 409<br />
Sie sieht Videoüberwachung nicht als Disziplinartechnik, die Einstellungen ändern oder er-<br />
ziehen will, sondern vielmehr als ein Instrument, das darauf abzielt, dass die Passanten das<br />
Funktionsgefüge nicht stören. Weil es keine soziale Kommunikation oder die Möglichkeit<br />
einer direkten Interaktion zwischen Menschen nicht gibt, werden Normen abhängig vom<br />
räumlichen Kontext und sind damit unverhandelbar: „Die Videotechnik hingegen erzeugt keine<br />
Ordnung, sondern reflektiert die Ordnung, die sie scannt, und setzt das räsonierende, sich selbst kontrollie-<br />
rende Individuum bereits voraus. Dieses kann sich adressiert fühlen oder auch nicht, und es kann sich selbst<br />
ausrechnen, welche Verhaltensweise und welches Erscheinungsbild hier erwartet und erwünscht sind. Es<br />
muss sich nur die Umgebung ansehen, den Fokus und die Bewegung des Kameraauges nachvollziehen und<br />
dies schließlich auf sich selbst beziehen, auf die Figur, die es macht vor dem Hintergrund, vor dem es für<br />
einen möglichen Betrachter am Kontrollbildschirm sichtbar wird.“ 410<br />
408<br />
Quelle: Norris (2005), S 370<br />
409<br />
Quelle: Krasmann (2005), S 308<br />
410<br />
Quelle: Krasmann (2005), 316<br />
147
Die Untersuchung der Berliner Shopping Malls führt Helten zum Schluss: „dass sichtbare VÜ<br />
eine Verhaltensanpassung bewirkt und als Symbol dafür steht.“ 411 Es könne aufgrund der symboli-<br />
schen Wirkung nicht von der Hand gewiesen werden, „dass wahrgenommene Videoüberwachung<br />
als Verstärker wirkt, das eigene Verhalten zu kontrollieren und zu normieren.“ 412<br />
Auch langfristige psychische Folgen der Überwachung sind laut der von Psychologen be-<br />
schriebenen „Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit“ möglich. „Diese Theorie besagt,<br />
dass, wenn sich ein Mensch seiner ständigen Überwachung bewusst wird, er sich dann als Objekt wahr-<br />
n<strong>im</strong>mt und sich dementsprechend normgerecht verhält. Eine unter Beobachtung stehende Person, so vermuten<br />
Psychologen, wird insgesamt umsichtiger, furchtsamer und argwöhnischer. Die Videoüberwachung (<strong>im</strong> Dau-<br />
erbetrieb), die <strong>im</strong> Gegensatz zu gewöhnlichen polizeidienstlichen Tätigkeiten permanent und anonym durchgeführt<br />
werden kann, ist somit ein typisches Beispiel für die Gefährdung individueller Handlungsfreiheit.“ 413<br />
3.7.4 Ausgrenzung<br />
Mit Videoüberwachung werden - wie Chen-Yu Lin ausführt - exklusive Räume geschaffen.<br />
Die Überwachung führt soweit, dass es sogar zur „Sippenhaftung“ kommt: „Die exklusive<br />
Nutzung ‚sauberer’ und ‚sicherer’ Räume scheint <strong>im</strong> Sinne der Videoüberwachung nur für die normkonfor-<br />
men Bürger vorgesehen. Nachdem die auffälligen Randgruppen vertrieben wurden, geht es anschließend um<br />
die Einhaltung der vorgegebenen Regeln in dem überwachten Bereich. Wer nicht die von Überwachern be-<br />
st<strong>im</strong>mten Regeln beachtet, dem droht ebenfalls das Schicksal der Vertriebenen. (...) Demnach handelt es sich<br />
bei Videoüberwachung lediglich um eine technische Notlösung der sozialen Probleme, die meistens nicht nur<br />
die Kr<strong>im</strong>inalität, sondern auch damit verbundene gesellschaftliche Probleme verdrängt, wobei notwendige soziale<br />
Prozesse zur tatsächlichen Konfliktbeseitigung ausbleiben.“ 414<br />
411 Quelle: Helten (2005), S 170<br />
412 Quelle: Helten (2005) S 171<br />
413 Quelle: Lin, Chen-Yu: Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland - Ein<br />
Drei-Länder-Vergleich. Dissertation zur Erlangung des sozialwissenschaftlichen Doktorgrades der sozialwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen , Göttingen 2006, S 81<br />
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2006/lin/lin.pdf<br />
414 Quelle: Lin (2006) S 81<br />
148
Jan Wehrhe<strong>im</strong> sieht in der Kombination räumlicher Ausschluss und Disziplinierung den<br />
Versuch, die Stadt neu zu ordnen bzw. das urbane Leben an partikularen Interessen auszu-<br />
richten: „Dies erscheint am deutlichsten in „kommerzialisierten Räumen“ wie Passagen, Einkaufszentren<br />
oder auch Business Improvement Districts (vgl. Wehrhe<strong>im</strong> 2002). Disziplinierung bedeutet auch hier die<br />
Regulation von Handeln, sie dient dem Zweck der Integration, d.h. der Partizipation unter der Bedingung<br />
der Konformität, und beinhaltet ein „Nützlichmachen“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2000: 46). Der Nutzen<br />
besteht <strong>im</strong> Konsum. Ist Disziplinierung, also das Bewahren eines Kunden nicht möglich, dient Ausgrenzung<br />
indirekt dem Konsum: Die für die übrigen Nutzer als störend definierten Personen werden entfernt, der<br />
„feel-good-factor“ erhöht sich und führt so zu verstärktem Konsum der konformen Konsumenten. Diszipli-<br />
nierung und Verdrängung werden zwar mit moralischen Defiziten der zu Exkludierenden begründet, da sie<br />
gegen die scheinbar guten Sitten des Konsumierens und Flanierens verstoßen, aber sie folgen letztendlich ökonomischrationalen<br />
Kriterien.“ 415<br />
Im Zuge dieser Neuordnung der Stadt formieren sich auch neue formale Normen, mit de-<br />
ren Überwachung sich auch die normativen Erwartungen verändern: „Dadurch können sich<br />
neue Verhaltensstandards und somit auch neue Ordnungen etablieren. Gleichzeitig ist das Aufstellen neuer<br />
Normen zwangsläufig darauf angelegt, Abweichungen und Dysfunktionalität zu produzieren, denn ohne<br />
Normen keine Normverstöße (vgl. Bauman 1997: 118). Ausgrenzung, oder hier genauer ‚Ausschließung’<br />
(vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998), ist eine weitere Funktion von CCTV, die Normabweichung dient als<br />
Legit<strong>im</strong>ation von Ausschließung. Kameras werden zur Detektion von (neuen) Normverstößen eingesetzt und<br />
deren Sanktionierung variiert mit dem Zweck, dem ein Raum dienen soll und den personellen Möglichkeiten<br />
diese auch umzusetzen.“ 416<br />
3.7.5 Veränderung des Sozialverhaltens<br />
Dass die „Maschine Videoüberwachung“ tief in das soziale Handeln hineingeht, beschreibt<br />
Christine Ketzer in ihrer Inauguraldissertation: „Die (sozial-) pädagogische Intervention geht zu-<br />
415 Quelle: Wehrhe<strong>im</strong>, Jan: Technische Konstruktion urbaner Ordnung. In: Menzel, Birgit/Ratzke, Kerstin<br />
(Hrsg.): Grenzenlose Konstruktivität? Standortbest<strong>im</strong>mung und Zukunftsperspektiven konstruktivistischer<br />
Theorien abweichenden Verhaltens. BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg 2006, S 255<br />
http://docserver.bis.uni-oldenburg.de/publikationen/bisverlag/2006/mengre06/pdf/mengre06.pdf<br />
416 Quelle: Wehrhe<strong>im</strong> (2006) S 257<br />
149
ück, wenn in einem sich verändernden Strafrecht nicht mehr versucht wird, Delinquente zu reintegrieren,<br />
sondern Kr<strong>im</strong>inalität als dazugehörend akzeptiert wird und – wie de Marinis es formulierte – In- und Out-<br />
Zonen geschaffen werden, in denen best<strong>im</strong>mte Dinge geduldet oder eben nicht geduldet werden. Es besteht<br />
weder die wirtschaftliche Notwendigkeit noch der moralische Druck, die Ausgeschlossenen wieder in die Ge-<br />
sellschaft zu integrieren (...). Sie fallen schlicht aus der Gesellschaft heraus, denn technische Kontroll- und<br />
Überwachungssysteme können hier in Verbindung mit Computertechnologie vermeintlich Konformität, Sicherheit<br />
und Ordnung herstellen.“ 417<br />
Sie führt in dieser Arbeit aus, dass die Überwachungstechnik (z.B. Ortungssysteme über das<br />
Handy etc.) bereits dermaßen in die Gesellschaft eingeschrieben ist, dass sie bis in die Er-<br />
ziehung der Kinder hineinwirkt: „Der durch diese Systeme entstehende Konformitätsdruck ist nicht<br />
mehr moralisch legit<strong>im</strong>iert, sondern schlicht wird über das Vorhandensein technischer Kontrollsysteme ver-<br />
mittelt. (...) Die Kontrolle legit<strong>im</strong>ierte sich z.B. <strong>im</strong> Ansatz der Kontrollgesellschaft nicht mehr über die Mo-<br />
ral, sondern über die Sicherheit, ein Trend, der sich <strong>im</strong> familiären Umfeld ebenso wie in anderen gesellschaft-<br />
lichen Bereichen zeigt. Die technischen Kontrollsysteme ermöglichen nicht nur diese andere Art der Kontrolle,<br />
sie setzen vielmehr Erziehungswerte, indem sie als neuer Erziehungsmaßstab fungieren und die totale Kontrolle<br />
propagieren.“ 418<br />
Zunehmend wird versucht, soziale Probleme <strong>mittels</strong> (Überwachungs)technik, sowie fal-<br />
schen Erwartungen und Versprechen zu lösen: „Hier muss die Pädagogik aufmerksam sein, dass<br />
Erziehung nicht unter dem Vorzeichen der technischen Möglichkeiten neu definiert wird, da solche Systeme<br />
quasi das angestammte Wirkfeld der Pädagogik umformulieren und per Technik wegrationalisieren. Das<br />
heißt, nicht nur die Folgen einer technisch organisierten Kontrolle stellen ein Problem dar, sondern bereits die<br />
<strong>im</strong> Vorfeld ihrer Implementierung geweckten Erwartungen, die nämlich eine „schöne, heile Welt“ ohne Kon-<br />
flikte suggerieren. Wichtig wäre es an dieser Stelle, die Grenzen der Technik klar aufzuzeigen und zu ver-<br />
deutlichen, dass zwischenmenschliche und soziale Probleme sich nie durch Technik bewältigen lassen, sondern<br />
417 Quelle: Ketzer, Christine: Securitas ex Machina. Von der Bedeutung technischer Kontroll- und Überwachungssysteme<br />
für Gesellschaft und Pädagogik, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der<br />
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Köln 2005, S 180<br />
http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=982095422&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=982095422.pdf<br />
418 Quelle: Ketzer (2005), S 186<br />
150
diese sie nur verschieben und verlagern kann.“ 419<br />
3.7.6 Stadt als unsicherer (und geteilter) Ort<br />
Videoüberwachung und das neue Sicherheitsparadigma können die Einstellung gegenüber<br />
Städten, langfristig baulich-räumliche Strukturen und die Nutzung der Stadträume verän-<br />
dern: „Städte könnten zunehmend als unsichere Orte wahrgenommen werden. Damit würde einer neuen<br />
‚Stadtfeindlichkeit’ Vorschub geleistet. Grundsätzlich sind Städte vergleichsweise „unübersichtliche Orte“<br />
und könnten damit unter den Generalverdacht geraten, Versteck für alle möglichen Formen von Sicherheits-<br />
bedrohung zu sein (...) Folgt <strong>im</strong> Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnik der Festungsmauer<br />
das elektronische Portal?” 420<br />
Die Stadträume würden folglich nach ihrem Sicherheitsstatus unterschiedlich bewertet und<br />
damit in sichere und unsichere Räume polarisiert werden können, die von unerwünschter<br />
Nachbarschaft gekennzeichnet sein könnten und von Sicherheitszonen voneinander ge-<br />
trennt werden. „In den Großstädten entstünde ein Inselsystem von sich überlagernden Milieus (die ortsge-<br />
bundenen Armutsmilieus, die Arbeits-, Freizeit- und Wohnorte der Lebensstilgruppen und das Milieu in-<br />
ternational orientierter, hoch qualifizierter Arbeitskräfte), die bestrebt sind, sich mit tiefer gehender sozialer<br />
Spaltung kontrolliert von einander abzugrenzen. „Sicherheitszonen“ um „gefährdete Einrichtungen“ könn-<br />
ten entstehen, die über das bisher gekannte Maß hinausgehen, z. B. auch Wohngebäude betreffen. Je nach<br />
gewünschtem Sicherheitsstatus könnten temporär begrenzbare Zugangsbeschränkungen für best<strong>im</strong>mte Stadt-<br />
bereiche ausgesprochen und technisch überwacht werden. (...) Öffentliche Räume würden ihren Charakter<br />
durch zunehmende technische Überwachung verändern − bis hin zum Verlust von <strong>öffentlichen</strong> Räumen und<br />
zur Vermischung von <strong>öffentlichen</strong> und privaten Räumen. Befürchtet wird beispielsweise, dass öffentliche<br />
Räume ‚zu privatrechtlich sanktionierten Enklaven des gehobenen Konsums’ werden“ 421<br />
Als letzte Konsequenz – so Floeting – könnte das subjektive Sicherheitsgefühl die mensch-<br />
419 Quelle: Ketzer (2005), S 188 ff<br />
420 Quelle: Floeting, Holger: Sicherheitstechnologien und neue urbane Sicherheitsreg<strong>im</strong>es. Ita manu:script, Österreichische<br />
Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, S 18<br />
http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-manuscript/ita_06_05.pdf<br />
421 Quelle: Floeting (2006), S 20<br />
151
lichen Aktivitäten weg von der realen Stadt hin zu virtuellen Aktivitäten verlagern.<br />
Schlussendlich stellt sich die Frage: „wie Städte aussehen, die bei sinkenden finanziellen Mitteln zu-<br />
nehmende Anteile für Sicherheitsinfrastrukturen investieren müssen oder wollen. Die Gefahr besteht, dass<br />
sich die baulichen, technischen und regulatorischen Sicherheitsmaßnahmen in den Städten als wirksam gegen<br />
Bedrohungen erweisen und dennoch dafür sorgen, dass urbane Lebensräume zerstört und städtisches Leben<br />
behindert wird − und damit letztlich ein Ziel des Terrors gegen Städte erreicht wird. 422<br />
422 Quelle: Floeting (2006), S 21<br />
152
3.8 Situation in Österreich<br />
3.8.1 Rechtliche Situation<br />
In Österreich bilden neben den internationalen Best<strong>im</strong>mungen zwei Grundlagen die rechtli-<br />
che Situation für die Videoüberwachung. Einerseits regelt das Datenschutzgesetz 2000 die<br />
Videoüberwachung für Private (gleichgestellt sind auch öffentliche Bereiche, die Aufgaben<br />
der Privatwirtschaft ausüben). Andererseits ist für Behörden die Videoüberwachung durch<br />
das Sicherheitspolizeigesetz geregelt.<br />
Jede private Videoüberwachung, die digitale Daten aufzeichnet (und die über rein private<br />
Zwecke hinausgeht – also z.B. strafrechtlich relevante Daten aufzeichnen will), ist dem Da-<br />
tenverarbeitungsregister (DVR) bei der Datenschutzkommission zu melden. Die Anlage<br />
darf grundsätzlich erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Registrierung <strong>im</strong> DVR<br />
erfolgte. Private dürfen grundsätzlich nicht <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Bereich videoüberwachen, sondern<br />
nur dort, „wo das Bestehen bzw. der Schutz eines „Hausrechts <strong>im</strong> weiteren Sinn“ denkbar ist.“ 423<br />
Wer eine Anlage in Betrieb n<strong>im</strong>mt (oder bereits in Betrieb hat) und dieser Meldepflicht<br />
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Geldstrafe von<br />
bis zu € 9.445,-- belegt werden.<br />
Gegen nicht bewilligte Anlagen kann man <strong>mittels</strong> Eingabe nach § 30 DSG 2000 bei der<br />
DSK Beschwerde führen. „Diese wird den Fall prüfen, und sich um die Beseitigung rechtswidriger Zu-<br />
stände bemühen, wobei sie allerdings die Einstellung einer privaten Videoüberwachung nicht erzwingen<br />
kann. Dazu wäre eine Klage bei Gericht auf Unterlassung erforderlich.“ 424<br />
Ob eine Anlage <strong>im</strong> Datenverarbeitungsregister gemeldet ist oder nicht, kann man bei der<br />
Datenschutzkommission – bei Glaubhaftmachung, dass man Betroffene/r der jeweiligen<br />
Überwachung ist und der Auskunft keine überwiegende schutzwürdige Gehe<strong>im</strong>haltungsin-<br />
teressen des Auftraggebers oder anderer Personen entgegenstehen - kostenlos erkunden.<br />
423 Datenschutzkommission (2007)<br />
424 Quelle: Datenschutzkommission: Videoüberwachung <strong>im</strong> privaten Bereich. Wien o.J.<br />
http://www.dsk.gv.at/faq_de/faqd_video_allgemein.htm<br />
153
Grundsätzlich ist auch die Datenschutzkommission mit der derzeitigen Rechtslage unzu-<br />
frieden: „Mangels einschlägiger detaillierter gesetzlicher Regelungen war es notwendig, Leitlinien für die<br />
Registrierung von Videoüberwachungsmeldungen zu entwickeln, um dem DVR Anhaltspunkte dafür zu<br />
geben, wann es registrieren darf und wann ein ablehnender Bescheid für die Beschlussfassung durch das Kol-<br />
legium der DSK vorzubereiten ist“. 425 Die DSK artikuliert daher <strong>im</strong> Datenschutzbericht 2007 ihr<br />
dringendes Bedürfnis nach einer näheren gesetzlichen Regelung <strong>im</strong> Zusammenhang mit den<br />
Meldungen an das DVR „hinsichtlich der Zulässigkeit der Durchführung von Videoüberwachung für<br />
nichtbehördliche (‚private’) Zwecke. (...) Im Spannungsverhältnis zwischen der Privatautonomie, die den<br />
Schutz der eigenen Sicherheit z.B. vor Einbruch oder Sachbeschädigung durch Videoüberwachung, als<br />
selbstverständlich zulässig postuliert, und den Datenschutzinteressen von gefilmten Personen muss ein<br />
Gleichgewicht geschaffen werden. Dabei ist angesichts der Allgemeinheit der zugrunde liegenden geltenden<br />
Regelungen ein so großer Interpretationsspiel<strong>raum</strong> gegeben, dass die Vollziehung mangels ausdrücklicher<br />
gesetzlicher Regelungen überfordert erscheint. Die DSK hofft daher, dass das <strong>im</strong> Regierungsprogramm in<br />
Aussicht gestellte Gesetz über die Videoüberwachung bald vorliegen wird.“ 426<br />
Die Videoüberwachung für behördliche Zwecke ist gesetzlicher eindeutiger geregelt. Sie<br />
bedarf laut Datenschutzgesetz einer besonderen Grundlage. Die Best<strong>im</strong>mungen sind <strong>im</strong><br />
Sicherheitspolizei (vgl. § 54 Abs. 6 und 7 SPG) geregelt. Die Sicherheitsbehörden dürfen die<br />
Videoüberwachung nur an „<strong>öffentlichen</strong> Orten“ betreiben, also an Orten, die von einem<br />
nicht von vornherein best<strong>im</strong>mten Personenkreis betreten werden können (§ 27 Abs. 2<br />
SPG).<br />
In Österreich begann man sich <strong>im</strong> Innenministerium – motiviert durch die bundesdeutsche<br />
Entwicklung und Beispiele in Großbritannien - gegen Ende 2002 intensiver mit dem Thema<br />
Videoüberwachung zu beschäftigten, <strong>mittels</strong> Öffentlichkeitsarbeit die öffentliche Meinung<br />
aufzubereiten und in einer Arbeitsgruppe über gesetzliche Änderungen nachzudenken. Die<br />
Bemühungen wurden nach dem Madrider Bombenanschlag 2004 intensiviert. 427<br />
425<br />
Quelle: Datenschutzkommission (2007), S 61<br />
426<br />
Quelle: Datenschutzkommission (2007), S 47<br />
427<br />
vgl. Kunnert, Gerhard: Big Brother in U-Bahn, Bus und B<strong>im</strong>. Videoaufzeichnungen in <strong>öffentlichen</strong> Ver-<br />
154
Die Gesetzgebung zur polizeilichen Videoüberwachung in Österreich dürfte sich grundsätz-<br />
lich sehr an den „positiven“ Erfahrungen in Großbritannien und Deutschland einerseits, als<br />
an der Terrorbekämpfung (nach New York 2001 und Madrid 2004) orientieren, wie das<br />
Symposium des Bundesministerium für Inneres „Videoüberwachung zu <strong>sicherheit</strong>s- und<br />
kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Zwecken“ am 23. Juni 2004 wiederholt dokumentiert. Für diese Ver-<br />
anstaltung – bei der u.a. hochrangige Polizeibeamte aus Deutschland über die Erfolge der<br />
Videoüberwachung aufgrund interner Bewertungen berichten, gab der Präsident des Kura-<br />
toriums Sicheres Österreich - Michael Sika - <strong>im</strong> Eröffnungsstatement auch gleich die Stoß-<br />
richtung vor: „Es kann daher das Motto nur lauten: ein Ja zur Schaffung der rechtlichen Grundlage für<br />
die Videoüberwachung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum durch die Polizei zum Zweck der Erhöhung der Sicherheit der<br />
Menschen.“ 428 Sowohl <strong>im</strong> Zuge der Novelle des Sicherheitspolizeigesetztes 2005 (Schaffung<br />
sogenannter „gefährlicher Orte“ - die wesentliche Grundlage für folgende Überwachungs-<br />
anlagen bildet - durch Ergänzung § 54 durch Absatz 6 429 )als auch jener des Jahres 2006<br />
(Verwendung von Datenmaterial Dritter 430 ) wurden die Best<strong>im</strong>mungen betreffend Befug-<br />
nisse zur Videoüberwachung erweitert.<br />
Diese - vom Sicherheitsapparat gewünschte - gesetzliche Entwicklung löst bei Juristen Un-<br />
behagen aus. Bei der Herbsttagung der Österreichischen Juristenkommission zur „Sicher-<br />
heit <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum“ wird die zunehmende Überwachung durchwegs kritisch disku-<br />
tiert. Der Rechtsprofessor Christian Funk diagnostiziert aufgrund des gesetzlichen Flick-<br />
werks und Unschärfen „ein rechtsstaatliches Untermaß, das die Entwicklung eines Eingriffs-<br />
Übermaßes begünstigt. Ein Placebo scheinbarer rechtlicher Schrankensetzung, das dem Dammbruch zum<br />
kehrsmitteln aus datenschutzrechtlicher Sicht, In: Juridikum 2006/1. Der gläserne Mensch. Verlag Österreich,<br />
Wien 2006, S 43<br />
http://www.verlagoesterreich.at/pdf/voe/magazine/juridikum/200601/09.pdf<br />
428<br />
Quelle: Sika, Michael: Sicherheit hat Vorrang. In: Bundesministerium für Inneres (Hrsg): Videoüberwachung zu<br />
<strong>sicherheit</strong>s- und kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Zwecken. Schriftenreihe BM.I. – Band 3, BMI-KSÖ-Enquete: 23. Juni<br />
2004. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2004, S 7<br />
429<br />
vgl. Republik Österreich: Bundesgesetzblatt, 151. Bundesgesetz: SPG-Novelle 2005<br />
http://ris1.bka.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=html&docid=COO_2026_100_2_137<br />
404<br />
430<br />
Quelle: Brünner, Christian: Sicherheitspolizeigesetz (SPG) – Novelle 2006, Graz o.J.<br />
www.uni-graz.at/~bruenn/vo-vw-verfahren-2h/zusammenfassung-novelle-spg-06.doc<br />
155
Überwachungsstaat Vorschub leistet“ 431<br />
3.8.2 Ausmaß der Videoüberwachung<br />
Seit mit Anfang 2005 die polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Räume erlaubt ist,<br />
wurden bis Anfang Jänner 2008 folgende 16 öffentliche Plätze mit Überwachungssystemen<br />
(nach § 54 Abs. 6 SPG) ausgestattet 432 :<br />
Wien: Karlsplatz/Kärntnertorpassage; sowie Schwedenplatz und Westbahnhof; Schwechat:<br />
Flughafen; Wiener Neustadt; Vösendorf – Shopping City Süd (Parkplatz); St. Pölten (vorü-<br />
bergehend); Linz: Altstadt und Hinsenkampplatz; Klagenfurt: Pfarrplatz, Villach Lederer-<br />
gasse, Graz Jakominiplatz und Hauptbahnhof; Salzburg Stadt: Rudolfskai und Südtiroler<br />
Platz; Innsbruck: Rapoldipark.<br />
Darüber hinaus gibt es mit 2007 300 gemeldete Videoanlagen 433 und eine beachtliche An-<br />
zahl von illegalen (also nicht gemeldeten Kameras), deren Anzahl nur geschätzt werden<br />
kann. Die Schätzungen reichen dabei von 100.000 434 über 200.000 435 bis zu 250.000 436 Ü-<br />
berwachungsanlagen. Allein in Linz wird die Anzahl der Kameras auf etwa 5000 ge-<br />
schätzt 437 .<br />
431<br />
Quelle: Funk, Bernd-Christian: Schutzzonen und Bildaufzeichnung - Sicherheits-Placebo oder Dammbruch<br />
zum Überwachungsstaat?. In: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Sicherheit <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum. Neuer<br />
Wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz 2006, S 20<br />
432<br />
vgl. Platter, Günter: Anfragebeantwortung an die Präsidentin des Nationalrates Barbara Prammer. GZ:<br />
BMI-LR2220/0911-II/2/a/2008, Wien 07.03.2008,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_03124/<strong>im</strong>fname_102913.pdf<br />
433<br />
Quelle: Datenschutzkommission (2007), S 61<br />
434<br />
vgl. Soklov, Daniel: Videoüberwachung in Österreich kommt mit Salamitaktik. In: heise online, Hannover<br />
13.04.2007<br />
http://www.heise.de/newsticker/Videoueberwachung-in-Oesterreich-kommt-mit-Salamitaktik--<br />
/meldung/88186<br />
435<br />
vgl. Wetz, Andreas: "Boom bei Spionagekameras". Die Presse, Wien 19.10.2007<br />
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/338173/index.do<br />
436<br />
vgl. Steinhauser, Albert/Abg. z. NR: Entschließungsantrag. Parlamentarische Materialien, 528/A(E)<br />
XXIII.GP, Wien 06.12.2007<br />
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/A/A_00528/<strong>im</strong>fname_094165.pdf<br />
437<br />
vgl. 5000 Kameras überwachen Linz. In: Oberösterreichische Nachrichten, Linz 18.03.2006,<br />
156
3.8.3 Wirkungsevaluationen in Österreich<br />
In Österreich geht man davon aus, dass Videoüberwachung funktioniert, große Erfolge er-<br />
zielt und keinerlei Nachteile mit sich bringt. Es werden zwar interne Daten veröffentlicht,<br />
eine wirklich fundierte (wissenschaftliche) Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der<br />
Videoüberwachung erfolgt aber offensichtlich nicht. Trotz bemühter Recherchen wurde mir<br />
keine aussagekräftige Evaluation bekannt, auch die ARGE Daten hat über keinerlei aussa-<br />
gekräftige Evaluation Kenntnis 438 . Darüber hinaus zeigen sich die entsprechenden Stellen<br />
generell wenig auskunftsfreudig und stellen nur sehr grobe, nicht differenzierte oder aufge-<br />
schlüsselte Zahlen zur Verfügung. Je nach Anlass werden Zahlen kommuniziert, die auf an-<br />
derer Seite als nicht erhoben dargestellt werden bzw. werden Daten genannt, die sich an<br />
anderer Stelle als nicht nachvollziehbar erweisen. Effekte auf das Sicherheitsgefühl oder<br />
mögliche Verdrängungseffekte finden keinerlei Rücksichtnahme in österreichischen Evalua-<br />
tionsbemühungen. Kurz gesagt: Die österreichischen Behörden sind sich offensichtlich un-<br />
reflektiert sicher, dass Videoüberwachung ohnehin funktioniert.<br />
Selbst nachfragende Politiker bekommen nur dürre und häufig nichtssagende Informatio-<br />
nen.<br />
Im Zuge der Diskussion über die Videoüberwachung in der Linzer Altstadt wandte sich<br />
der Linzer Stadtrat Johann Mayr am 19. August 2005 439 an die Innenministerin und wollte<br />
wissen, welche Ergebnisse von der Videoüberwachung erwartet werden. Fragen wie „In wel-<br />
chen Deliktsgruppen erwartet das Innenministerium welche Veränderung? ... Welche Evaluierungsmethode<br />
wird gewählt? Welche Kontrollgebiete <strong>im</strong> Sinne von Kontrollgruppen einer wissenschaftlichen Überprüfung<br />
werden gewählt? Welchen internationalen wissenschaftlichen Mindestnormen bei der Evaluierung unterwirft<br />
sich das Ministerium bei der Erfolgskontrolle? ... Welche begleitenden Maßnahmen plant das Bundesminis-<br />
terium für Inneres? ... Wird bei der Evaluierung darauf geachtet, dass die Wirkungen der einzelnen Maß-<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q1/m03/t18/ph/s001/002_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&d<br />
atum=18.03.2006&seite=001&set=21&PHPSESSID=381081b330fc082e30e5d6de6ca33e9d<br />
438 Telefonische Anfrage des Verfassers bei der Arge Daten am 22.02.2008<br />
439<br />
vgl. Mayr, Johann, Stadtrat: Schreiben an Bundesministerin Liese Prokop betreffend Auskunft über Videoüberwachung<br />
in Linz, 19. August 2005<br />
157
nahmen korrekt auseinander gehalten werden, um Fehlschlüsse bei der Maßnahmenerfolgskontrolle zu ver-<br />
meiden.“ 440 prägen dieses 3-seitige Schreiben, deren Beantwortung sicherlich einen genaueren<br />
Blick auf die Möglichkeiten dieser Maßnahme ermöglicht hätte.<br />
Im Antwortschreiben durch Mag. Peter Webinger am 6. September 2005 hält sich das In-<br />
nenministerium kurz: Neben dem Hinweis auf das geltende Sicherheitspolizeigesetz und<br />
dem Hinweis auf einen flankierenden Streifendienst werden die Fragen zur Evaluation<br />
kaum einmal gestreift: „ Jeder Videoüberwachung geht nicht nur eine profunde Analyse insbesondere in<br />
puncto Quantität und Qualität der Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung bzw. zu verzeichnende gefährliche Angriffe <strong>im</strong><br />
Sinne des SPG, sondern auch eine Verhältnismäßigkeitsabwägung dahingehend voran, ob der intendierte<br />
Zweck nicht auch durch alternative polizeiliche Maßnahmen, wie z.B. Verstärkung des Überwachungs- und<br />
Streifendienstes und Schwerpunktaktionen, erreicht werden kann. Wird eine Videoüberwachung durchgeführt,<br />
so werden die Effekte begleitend beobachtet und durch Analyseexperten ausgewertet.“ 441<br />
Am 14. März 2006 wurden die 4 Kameras in der Linzer Altstadt durch die Innenministerin<br />
Prokop persönlich in Betrieb genommen. 442 In den Medien wurde diese Inbetriebnahme<br />
mit dem Verweis auf die Erfolge der Videoüberwachung in der Shopping City Süd kom-<br />
mentiert: Lt. ORF konnte dort ein Rückgang der Straftaten um 70 % verzeichnet werden 443 ,<br />
die Oberösterreichischen Nachrichten berichten von minus 70 % bei den PKW-<br />
Einbrüchen 444 .<br />
Bereits <strong>im</strong> Juli nach der Inbetriebnahme kolportierten die Sicherheitsbehörden beieindru-<br />
ckende Erfolge der Sicherheitsmaßnahmen in den Medien: Nach 223 Körperverletzungen<br />
440 Quelle: Mayr (2005)<br />
441<br />
Quelle: Webinger, Peter: Antwortschreiben an Mayr Johann. Bundesministerium für Inneres. Kabinett der<br />
Bundesministerin. GZ 36005/27-KBM/05. Wien 06. 09 2005<br />
442<br />
vgl. Novak, Sabine (2006a): Videokameras in Linzer Altstadt erst mit Verzögerung in Betrieb. In: Oberösterreichische<br />
Nachrichten, Linz 15.03.06,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q1/m03/t15/ph/s025/001_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&d<br />
atum=15.03.2006&seite=025&set=21<br />
443<br />
vgl. Videoüberwachung in Linz startet. In: ORF online, Linz 14.03.2006,<br />
http://ooe.orf.at/stories/95528/<br />
444 vgl. Novak (2006a)<br />
158
2005 waren bis Juli 2006 erst 60 aktenkundig. Es wurden 45 % weniger Anzeigen wegen<br />
Suchtgiftdelikten erstattet. Es gab nur ein „ein halbes Duzend große Raufereien, um die<br />
Hälfte weniger als 2005“ und 15 Straftaten wurden von den Kameras aufgezeichnet. Ob<br />
nun die beiden ersten Halbjahre verglichen wurden, oder ob das Halbjahr 2006 mit dem<br />
ganzen Jahr 2005 verglichen wurde, geht aus dem Artikel nicht hervor. Der zitierte Polizei-<br />
jurist Erwin Fuchs bringt diese Zahlen allerdings mit den generell verstärkten Sicherheits-<br />
bemühungen – vermehrte Streifentätigkeit und Sperrstunden-Überprüfungen mit Mitarbei-<br />
tern des Magistrats in Verbindung. 445 Nicht einmal ein Jahr später sieht die Sache in der<br />
medialen Darstellung schon anders aus: „Im Vorjahr ist die Zahl der Körperverletzungen <strong>im</strong> Linzer<br />
Bermudadreieck um 44 Prozent gesunken. Bei der Linzer Polizei führt man das allein auf die vier Video-<br />
kameras zurück, die rund 80 Prozent der Altstadt überblicken und 24 Stunden lang durchgehend alles<br />
aufzeichnen.“ 446 Weder der Streifendienst, noch die <strong>im</strong> August 2006 eingeführte neue Sperr-<br />
stundenregelung (Sperrstunde um 4 Uhr) spielen demnach mehr eine Rolle.<br />
Unmittelbar als Erfolg der Videoüberwachung kommuniziert wird ein Sinken der angezeig-<br />
ten Straftaten in der Altstadt um 40 % (Zeit<strong>raum</strong> Jänner bis Juli 2006 <strong>im</strong> Vergleich zum<br />
Vorjahr) auch bereits in einer Aussendung der Polizei Anfang September anlässlich der Er-<br />
öffnung der Videoüberwachungsanlage am Linzer Hinsenkampplatz am 30. August 2006<br />
durch die Innenministerin. 447<br />
Im September 2006 stellt der Parlamentsabgeordnete Johann Maier eine Anfrage an die<br />
Bundesministerin, in der er unter anderem wissen will:<br />
445<br />
vgl. Novak, Sabine (2006b): Nur noch halb so viele Rauferein in Altstadt. In: Oberösterreichische Nachrichten,<br />
Linz 27.07.2006<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q3/m07/t27/ph/s024/001_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&d<br />
atum=27.07.2006&seite=024&set=5&PHPSESSID=d79e54d362def8b0b5dee8d786dd6317<br />
446<br />
vgl. Videokameras schrecken ab. In: Oberösterreichische Nachrichten, Linz 21.05.2007,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2007/q2/m05/t21/ph/s021/001_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&d<br />
atum=21.05.2007&seite=021&set=2<br />
447<br />
vgl. Landespolizeikommando Oberösterreich: Videoüberwachung Linz Hinsenkampplatz in Betrieb, Presseaussendung<br />
vom 4. September 2006<br />
http://www.bundespolizei.gv.at/lpdreader/lpd_news_standard.aspx?id=65546B4471364B2B4C486B3D&inc<br />
=ooe<br />
159
„Wie viele personenbezogene Bilddaten wurden von den Sicherheitsbehörden bislang verwendet, die Rechts-<br />
träger des <strong>öffentlichen</strong> oder privaten Bereiches <strong>mittels</strong> Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten<br />
rechtsmäßig ermittelt und den Sicherheitsbehörden bis zum Stichtag 30.09.2006 übermittelt haben (Auf-<br />
schlüsselung auf Bundesländer)? (...)<br />
Welche konkreten kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Erfolge sind durch den Einsatz von genehmigten Videokameras<br />
bzw. Videoüberwachungssystemen in den überwachten Gebieten, Örtlichkeiten, Gebäuden oder Straßen in<br />
den Jahren 2005 und 2006 belegbar (ersuche um Darstellung der Erfolge)?<br />
In welchen genehmigten videoüberwachten Gebieten, Örtlichkeiten, Gebäuden bzw. Straßen gab es in diesem<br />
Zeit<strong>raum</strong> dadurch einen nachweisbaren Rückgang von Straftaten (präventive Wirkung) (ersuche um detail-<br />
lierte Darstellung)?<br />
Können Sie ausschließen, dass sich die Straftaten durch die Videoüberwachung lediglich an andere Orte, die<br />
noch nicht überwacht werden, verlagert haben? (...)<br />
Welche sonstigen Nachteile sind durch die Videoüberwachung von Gebieten, Örtlichkeiten, Gebäuden oder<br />
Straßen aufgetreten?“ 448<br />
Die Innenministerin gibt sich in der Beantwortung kurz angebunden: Zu den ermittelten<br />
Personen aufgrund von Videoüberwachung wird festgehalten, dass von den Sicherheitsbe-<br />
hörden keine statistischen Aufzeichnungen geführt werden und eine Erfassung <strong>im</strong> Nachhi-<br />
nein zu teuer wäre.<br />
Zu der angefragten Evaluation gibt es überhaupt nur wenig brauchbare Daten: „Im Bezug auf<br />
konkrete polizeiliche Erfolge werden keine gesonderten statistischen Aufzeichnungen geführt, da dies in kei-<br />
ner Relation zum administrativen Aufwand stehen würde. Ergänzend darf jedoch darauf hingewiesen wer-<br />
den, dass es zu einem ausgesprochen starken Rückgang der bekannt gewordenen Straftaten an folgenden<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätsbrennpunkten gekommen ist (verglichen wurde jeweils der entsprechende Zeit<strong>raum</strong> vor und nach<br />
der Aktivierung der Videoüberwachung) 449 :<br />
448<br />
Quelle: Maier, Johann (Abg. z. NR): Anfrage an die Bundesministerin für Inneres betreffend „Videoüberwachung<br />
in Österreich“. Parlamentarische Materialien 4727/J XXII. GP, Wien 19.09.2006,<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXII/J/J_04727/<strong>im</strong>fname_069890.pdf<br />
449<br />
Quelle: Prokop, Liese: Anfragebeantwortung an die Präsidentin des Nationalrates. GZ: BMI-LR2220/0321-<br />
II/2/a/2006, Wien 16.11.2006, S 2 ff<br />
160
Tabelle 15: Veränderung der Gesamtkr<strong>im</strong>inalität bei Videoüberwachung 450<br />
Auch die Frage zu möglichen Verdrängungseffekten wird eher salopp beantwortet: Es kann<br />
nicht ausgeschlossen werden, dass ein best<strong>im</strong>mter Teil der Kr<strong>im</strong>inalität an videoüberwachten Örtlichkeiten<br />
verdrängt wird. Erfahrungen in anderen europäischen Staaten, die bereits länger mit dem Instrument Vi-<br />
deoüberwachung arbeiten, zeigen, dass es durch den Einsatz der Videoüberwachung einerseits mittelfristig zu<br />
einem realen Rückgang der Deliktshäufigkeit kommt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewie-<br />
sen, dass die bloße Verdrängung von best<strong>im</strong>mten Kr<strong>im</strong>inalitätsformen aber durchaus ebenfalls ein strategi-<br />
sches Ziel der Videoüberwachung sein kann. Dies in erster Linie dann, wenn es gilt, eine Drogenszene von<br />
einer Jugendszene abzudrängen. 451<br />
Darüber hinaus wird festgehalten, dass bezüglich der Videoüberwachung keine Nachteile<br />
bekannt sind.<br />
Im Jänner 2008 wiederholt Johann Meier seine 2006 gestellten Anfragen, um die Daten für<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXII/AB/AB_04659/<strong>im</strong>fname_070617.pdf<br />
450 Quelle: Prokop (2006), S 3<br />
451 Quelle: Prokop (2006), S 3<br />
161
das Jahr 2007 zu erhalten. 452<br />
Die Beantwortung durch Innenminister Platter fällt ähnlich oberflächlich aus wie in der Be-<br />
antwortung 2006: Bezüglich ermittelter Personen durch die Videoüberwachung werden<br />
noch <strong>im</strong>mer keine statistischen Aufzeichnungen geführt und „Im Bezug auf konkrete polizeiliche<br />
Erfolge, werden in der II/BK/Abteilung 4 keine gesonderten statistischen Aufzeichnungen geführt, da dies<br />
in keiner Relation zum administrativen Aufwand stehen würde.“ 453<br />
Die großen Erfolge in der Prävention werden durch 4 Beispiele (siehe folgende Tabelle)<br />
belegt und zusammenfassend kommentiert: „Aufgrund der Rückgänge in den angeführten Berei-<br />
chen, ist aus analytischer Sicht der Schluss zulässig, dass die Videoüberwachungen auch präventiv eine<br />
nachhaltige Wirkung zeigen.“ 454<br />
Tabelle 16: Veränderung der Gesamtkr<strong>im</strong>inalität bei Videoüberwachung 455<br />
Der starke Rückgang <strong>im</strong> Jahr 2007 gegenüber dem Jahr 2006 wird mit einer detaillierteren<br />
Datenerfassung- Abfrage und Auswertungsmethodik erläutert, mit der nun der videoüber-<br />
wachte Bereich präziser ausgewertet werden kann.<br />
Die Fragen nach möglichen Verdrängungseffekten bzw. möglichen Nachteilen durch die<br />
Videoüberwachung werden wortgleich mit der Anfragebeantwortung 2006 beantwortet.<br />
452 vgl. Maier, Johann (Abg. z. NR): Anfrage an den Bundesminister für Inneres betreffend „Videoüberwachung<br />
in Österreich“. Parlamentarische Materialien 3108/J XXIII. GP, Wien 10.01.2008<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/J/J_03108/<strong>im</strong>fname_097431.pdf<br />
453 Quelle: Platter (2008), S 8<br />
454 Quelle: Platter (2008), S 9<br />
455 Quelle: Platter (2008), S 8 ff<br />
162
Genaueres zu ermittelten Tatverdächtigen weiß aber der ORF zu berichten. Dieser berichtet<br />
am 24.10.2007 von 82 Fahndungserfolgen in der Linzer Altstadt, wo die Kameras die rele-<br />
vanten Hinweis-Bilder zum Täter geliefert haben sollen. 456 Bei Kenntnis der Beantwortung<br />
durch den Innenminister stellt sich hierbei natürlich die Frage, ob nicht hinter dem Rücken<br />
des Ministeriums kostenintensive Aufzeichnungen geführt werden.<br />
Kritik an der herrschenden Überwachungspraxis gibt es in Österreich von seiten der Daten-<br />
schützer.<br />
So besorgte sich die ARGE Daten die Deliktzahlen für SCS und den Schwedenplatz. Sie<br />
bestätigte zwar den Rückgang der gesamten Delikte bei der SCS (115 Delikte <strong>im</strong> Jahr [März<br />
2004 bis Februar 2005] vor der Überwachung, <strong>im</strong> Folgejahr mit Überwachung 60 Delikte),<br />
stellt aber fest, dass aber Sachbeschädigung während der Überwachung um 60 % (von 10<br />
auf 16 Fälle) gestiegen sein. Bei Untersuchung der Halbjahreswerte stieß die ARGE auf in-<br />
teressante Details: „Waren in der ersten Jahreshälfte ohne Videoüberwachung 68 Diebstahlsdelikte zu<br />
verzeichnen (03-08/04), sank diese <strong>im</strong> ersten Jahreshälfte mit Videoüberwachung auf 14 Delikte, also ein<br />
Minus von 80%. Offenbar zeigte sich die präventive Wirkung von Videoüberwachung. Die Wirkung war<br />
jedoch nur von kurzer Dauer. Im darauffolgenden Halbjahr mit Videoüberwachung stiegen die Delikte<br />
wieder um 35 % (auf 19 Delikte) an. Interessant aber auch der Halbjahresvergleich <strong>im</strong> Jahr vor der Vi-<br />
deoüberwachung. Hier gingen die Delikte von 68 Diebstählen (1. HJ) auf 34 (2. HJ) zurück, also satte<br />
50 % ohne jede Videoüberwachung.“ 457<br />
Auch für den Schwedenplatz zieht die ARGE Daten ernüchternde Bilanz: Während das In-<br />
nenministerium einen erheblichen Rückgang der Gesamtkr<strong>im</strong>inalität von 38,4 % vermel-<br />
det 458 , kontert die Arge: „Neben Diebstahl sind Körperverletzung und Drogenkr<strong>im</strong>inalität die Top-<br />
456<br />
vgl. Fahndungserfolge durch Videoüberwachung. In: Orf online, Linz 24.10.2007,<br />
http://ooe.orf.at/stories/230891/<br />
457<br />
Quelle: Arge Daten: Polizeiliche Videoüberwachung – wenig Grund zur Euphorie, Wien 12.04.2006,<br />
http://www2.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=39982svs<br />
458 vgl. Platter (2008), S 8 ff<br />
163
Delikte, Sachbeschädigungen eher von geringerer Bedeutung. Die Rückgangsraten über alle Deliktgruppen<br />
zusammen (ohne Drogenkr<strong>im</strong>inalität) betrugen über das Jahr hinweg bescheidene 17 %, ein Wert der wohl<br />
eher durch die verbesserte Polizeipräsenz, als durch die Videoüberwachung zu begründen ist. (...) Auffällig<br />
und daher aus propagandistischen Gründen besonders hervorgekehrt ist der "Rückgang" der Drogendelikte.<br />
Etwa drei Monate nach Installation der Videoüberwachung wurde am Schwedenplatz kein Drogenfall mehr<br />
registriert. Leider kann das nicht als Erfolg gewertet werden, wenn gleichzeitig der Drogenbericht des BMI<br />
für das letzte Jahr einen bundesweiten Anstieg der Drogendelikte um 2% gegenüber dem Vorjahr feststellt.<br />
Am Schwedenplatz wurde offenbar die Prognose der Videoskeptiker zu hundert Prozent erfüllt: Mobile<br />
Kr<strong>im</strong>inalität weicht nach kürzester Zeit auf nicht überwachte Orte aus, ohne dass es zu einer Verhaltensänderung<br />
kommt.“ 459<br />
Demgegenüber werten die Sicherheitsbehörden aber gerade diese Verdrängung als Erfolg:<br />
„Es ist eine ganz klare Strategie der Polizeidirektion Wien, diesen Platz absolut drogenfrei zu halten. Dort<br />
wo es Jugendliche gibt, darf es keine Drogen geben. Natürlich kann man mit solchen Videomaßnahmen<br />
genau solche Strategien umsetzen.“ 460<br />
Noch dazu sollen Aktivisten des Vereines „Quintessenz“ die Überwachungsanlage gehackt<br />
haben und die Polizei dabei beobachtet haben, dass diese in private Wohnungen hineinfilm-<br />
ten. 461<br />
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass es in Österreich keine wissenschaftli-<br />
che Evaluation von Videoüberwachung gibt.<br />
3.9 Fazit der Videoüberwachung<br />
Die Einführung bzw. der weitere Ausbau von Videoüberwachung wird als Fazit der bisheri-<br />
gen Ausführungen nicht als wirkliche Lösung von möglichen Problemen auf <strong>öffentlichen</strong><br />
459<br />
vgl. Arge Daten (2006)<br />
460<br />
Quelle: Zwettler, Erich: Videoüberwachung in der kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Praxis. In: In: Bundesministerium für<br />
Inneres (Hrsg): Videoüberwachung zu <strong>sicherheit</strong>s- und kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Zwecken. Schriftenreihe BM.I. –<br />
Band 3, BMI-KSÖ-Enquete: 23. Juni 2004. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2004, S 50<br />
461 vgl. Quintessenz: Von NSA zu Wiener Cops, Wien 31.12.2005<br />
http://www.quintessenz.at/d/000100003453<br />
164
Plätzen gesehen. Dies vor allem, weil sie den zusammenschauenden Kriterien und wechsel-<br />
seitigen Bedingungen von Räumen und den Menschen nicht genügt und noch weniger, weil<br />
sie etwas an den übergeordneten Dynamiken (sozialen Notlagen) etwas entgegen zu setzen<br />
hat. Als symbolische Maßnahme mag die Videoüberwachung den Ansprüchen von man-<br />
chen genügen, tatsächliche Lösungskompetenz ist der Videoüberwachung allerdings nur<br />
selten – unter gewissen Voraussetzungen, wie genauer Planung und entsprechenden, spe-<br />
ziellen räumlichen Gegebenheiten und Einbindung in ein Maßnahmenbündel - zu diagnos-<br />
tizieren. Auch in der konkreten Auswirkung in Kr<strong>im</strong>inalitätsentwicklung oder der Erhö-<br />
hung des subjektiven Sicherheitsgefühls ist Videoüberwachung in der Regel nicht bis wenig<br />
erfolgreich (zumindest wenn man wissenschaftliche Kriterien zur Prüfung heranzieht). Im<br />
Gegenteil: Die Videoüberwachung fördert wie gezeigt die weitere Ausgrenzung von sozia-<br />
len Randgruppen, wandelt teilweise den Raum zusätzlich in „Angstorte“ und grenzt die<br />
mögliche Aneignung von <strong>öffentlichen</strong> Plätzen bei Jugendlichen weiter ein. Dort wo ohne-<br />
hin sozialer Druck und Notlagen <strong>im</strong> Vordergrund stehen, sorgt die Überwachung für weite-<br />
ren Verdrängungs- oder Ausschließungsdruck und ist Teil einer Strategie, die sich - statt<br />
dem tatsächlichen sozialpolitischen Handlungsbedarf - lieber um eine Debatte über die<br />
(vermeintliche) Sicherheit kümmert. Zusammenfassend kann man über Videoüberwachung<br />
mit Detlef Nogola zusammenfassend festhalten: Die Videoüberwachung verdankt ihren<br />
prominenten Status einem doppelten Mythos: Weder verhindert sie zuverlässig Devinanz,<br />
noch bedingt sie unvermeidlich einen Polizeistaat orwellscher Ausprägung. 462<br />
462 vgl. Kammerer, Dietmar: "Are you dressed for it?" Der Mythos der Videoüberwachung in der visuellen Kultur.<br />
In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main<br />
2005, S 91<br />
165
4 LÖSUNGSANSÄTZE<br />
Obwohl in dieser Arbeit die Themen Raum, Jugend und die Videoüberwachung getrennt<br />
abgehandelt wurden, ist diese Trennung und Isolierung in eigene Zugänge in der Praxis<br />
(und auch – wie sich in der Arbeit gezeigt hat – theoretisch) nicht möglich. Zu verwoben<br />
sind diese Bereiche von Natur aus in sich, wie Martina Löw in der Raumsoziologie aufzeigt<br />
und hier zusammenfassend noch einmal dargestellt sei: „Um die Dynamik der Räume, ihre Pro-<br />
zesshaftigkeit, ihr Gewordensein, ihre Vielfältigkeit, aber auch ihre Strukturierungskraft zu begreifen,<br />
schlage ich vor, Räume als relationale (An)Ordnungen von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten zu<br />
begreifen. Mit dem Begriff der (An)Ordnung wird betont, dass Räume erstens auf der Praxis des Anord-<br />
nens (als Leistung der wahrnehmend-kognitiven Verknüpfung sowie auch als Platzierungspraxis) basieren,<br />
Räume aber zweitens auch eine gesellschaftliche Ordnung vorgeben. Diese Ordnung <strong>im</strong> Sinne von gesell-<br />
schaftlichen Strukturen ist sowohl dem Handeln vorgängig als auch Folge des Handelns. [...] Neben politi-<br />
schen, ökonomischen, rechtlichen etc. Strukturen existieren demnach auch räumliche (und zeitliche) Struktu-<br />
ren. Sie gemeinsam bilden die gesellschaftliche Struktur. Räumliche Strukturen müssen, wie jede Form von<br />
Strukturen, <strong>im</strong> Handeln verwirklicht werden, strukturieren aber auch das Handeln. Die Dualität von<br />
Handeln und Struktur ist in diesem Sinne auch die Dualität von Raum. Das bedeutet, dass räumliche<br />
Strukturen eine Form von Handeln hervorbringen, welches in der Konstitution von Räumen eben jene räum-<br />
lichen Strukturen reproduziert. Die Rede von einer Dualität von Raum bringt so die Überlegung zum<br />
Ausdruck, dass Räume nicht einfach nur existieren, sondern dass sie <strong>im</strong> Handeln geschaffen werden und als<br />
räumliche Strukturen, eingelagert in Institutionen, Handeln steuern.“ 463<br />
Ein möglicher Lösungsansatz muss daher über einen eind<strong>im</strong>ensionalen Ansatz hinausgehen<br />
und kann nicht auf einem herausgelösten Aspekt (z.B. das Individuum ohne den Raum mit-<br />
zudenken oder andererseits den Raum als leeren - erst zu befüllbaren - Container zu den-<br />
ken) basieren. Das individuelle Subjekt muss gemeinsam mit dem Raum verstanden werden:<br />
Im Sinne der Begriff der Lebenswelt findet sich diese Individualität wieder, die durch räum-<br />
463 Quelle: Löw (2007), S 16 ff<br />
166
liche und soziale Bezüge geformt wird. 464<br />
Wenn man über Lösungsansätze in dem Spannungsfeld (in diesem Zusammenhang ver-<br />
standen als sowohl positiv wie auch negativ assoziierte Begrifflichkeit) Jugend und öffentli-<br />
cher Raum nachdenkt, und versucht diese Lösungsansätze aus einer sinnvollen Jugendarbeit<br />
bzw. Impulsen aus dem sozialen Management herauszuarbeiten, sollte man diese Verwo-<br />
benheit <strong>im</strong> Blick haben. Mit einem „geschärften Blick“ kann man aus dem Raum relativ ein-<br />
fach soziale Wirklichkeiten herauslesen:<br />
� Die grundsätzliche soziale Situation: Armut, Arbeitslosigkeit, Wohlstand und Bil-<br />
dung bilden sich <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum ab (Beispielhaft ist dies am Zustand der je-<br />
weiligen Stadtteile erkennbar oder auch in der Sichtbarkeit von Armut durch z.B.<br />
Betteln oder Obdachlose). Aber auch Herrschaft und Macht schreibt sich über die<br />
Stadtplanung in den <strong>öffentlichen</strong> Raum ein.<br />
� Die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen (bzw. des einzelnen Jugendlichen) heute:<br />
Werte, Überzeugungen, Haltungen und Verhaltensformen, die die Jugend heute<br />
prägen, finden sich <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum wieder (Zeichen, Symbole, wie z.B. Graf-<br />
fiti, Trendsport, Cliquen ....)<br />
� Die räumliche Situation <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum selbst: Ob ein Aufenthalt bzw. eine<br />
Aneignung leicht möglich ist oder ob es schwer überwindbare Barrieren gibt, ob es<br />
genügend Raum für Jugendliche gibt oder ob sie an den Rand gedrängt sind, spielt<br />
sich <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum erkennbar wieder.<br />
Um die Probleme <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum zu lösen, müsste man auch darüber liegende (sozia-<br />
le) Probleme lösen. Da es abseits der (Spitzen)Politik und vor allem <strong>im</strong> Bereich des Sozial-<br />
managements oder auf kommunaler Ebene schwierig ist, die soziale bzw. sozialpolitische<br />
464 vgl. Deinet, Ulrich: Die Sozial<strong>raum</strong>debatte in der Jugendhilfe. In: Deinet Ulrich/Krisch Richard (Hrsg.): Der<br />
sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung.<br />
Leske + Budrich, Opladen 2002, S 32<br />
167
Situation kurzfristig und nachhaltig zum Besseren zu ändern und alle sozialen Notlagen zu<br />
bekämpfen, müssen in der Projektentwicklung zumindest die beiden Aspekte Lebenswirk-<br />
lichkeit der Jugendlichen und Raum miteinander verknüpft und bearbeitet werden. Aller-<br />
dings darf man sich nicht von der grundsätzlichen gesellschaftlichen und sozialen Frage<br />
verabschieden: Soll es (irgendwann einmal) eine tatsächlich wirksame Lösung der Probleme<br />
<strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum geben, müssen die sozialen Fragen auch auf „großer“ Ebene <strong>im</strong>mer<br />
wieder thematisiert und Verbesserungen eingefordert werden.<br />
4.1 Herausforderungen in der real existierenden Gegenwärtigkeit der<br />
Situation<br />
Bei der Konzeptionierung von Lösungsmöglichkeiten ist es wichtig, folgende Realitäten <strong>im</strong><br />
Auge zu behalten und bei der Projektentwicklung mit zu berücksichtigen.<br />
4.1.1 Jugendliche <strong>im</strong> Raum, der als nicht ihnen zugedacht gesehen wird<br />
Wie in den Ausführungen <strong>im</strong> Abschnitt zum „Öffentlichen Raum“ in dieser Arbeit darge-<br />
stellt, wird dieser zunehmend funktionalisiert und privatisiert und damit verstärkt (zumin-<br />
dest durch die zugedachte Nutzung) den Jugendlichen und ihren Frei<strong>raum</strong>bedürfnissen ent-<br />
zogen. Die Planung und Umsetzung der Stadtgestaltung findet grundsätzlich durch Erwach-<br />
sene <strong>im</strong> Sinne deren Interessen und unter Ausschluss der Jugendlichen statt. Die Räume<br />
bilden – wie Martina Löw ausführt – die gesellschaftliche Realität <strong>im</strong> Raum ab. 465 Nachdem<br />
Räume Zugangschancen und Ausschlüsse steuern können, werden über Raumkonstitutionen<br />
auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausgehandelt. 466<br />
Jugendliche – und auch die Jugendarbeit – werden in der Konstituierung des <strong>öffentlichen</strong><br />
Raums oftmals erst dann interessant, wenn es in dieser durch Erwachsenen vorgefertigten<br />
Welt zu Konflikten kommt. Weil die Verteilung der Macht <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum in der<br />
465 vgl. Löw (2007), S 16<br />
466 vgl. Löw (2007), S 19<br />
168
Praxis eine relativ eindeutige ist, ist die Jugendarbeit permanent in der Rolle der klassischen<br />
„Feuerwehr“ mit der Aufgabe, die Situation <strong>im</strong> Sinne der Machthabenden zu klären: Dies<br />
bedeutet in der Regel, dass die Jugendlichen <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum ruhiggestellt werden sol-<br />
len. Damit ist die Jugendarbeit in einer unlösbaren Situation: Konflikte, die eigentlich in<br />
stadtplanerischen und folglich politischen (Fehl)Entscheidungen ihren Ursprung haben, sol-<br />
len <strong>im</strong> Sinne der Machtverhältnisse <strong>im</strong> Rahmen dieser sich fortschreibenden Fehlentschei-<br />
dungen gelöst werden.<br />
Ein Beispiel, wie es in der Praxis der Jugendarbeit <strong>im</strong>mer wieder vorkommt: Am Spielplatz,<br />
der eigentlich für Kleinkinder gedacht ist, treffen sich Jugendliche. Eltern von Kleinkindern<br />
oder Anrainer/innen richten ihre Beschwerde – <strong>im</strong> Wissen, dass dieser Platz nicht für die<br />
Jugendlichen gedacht ist – an die Stadtverwaltung oder an die Polizei direkt. Diese „Beset-<br />
zungsmaßnahme“ durch Jugendliche wird grundsätzlich nicht als notwendiges Ausweichen<br />
mangels Alternativen für die Jugendlichen gelesen (siehe Kapitel 1.5. Jugend <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong><br />
Raum), sondern als Störung der Funktionalität (verschärft durch Lärm und Vermüllung),<br />
die durch Intervention und Einflussnahme durch die Jugendarbeit gelöst werden soll. Die<br />
Jugendarbeit ist somit in einer Rolle, die in diesem Kontext mangels Alternativen nicht zu<br />
managen ist: Agierende finden sich dabei grundsätzlich in einer Loose-Loose-Situation wie-<br />
der: Gelingt es, die Jugendlichen zu disziplinieren – ihnen sozusagen diesen Raum wieder zu<br />
entreißen - unterstreicht die Jugendarbeit sowohl die eigene, als auch die Ohnmächtigkeit<br />
der Jugendlichen gegenüber anderen Interessen bzw. Interessenten. Sie verliert damit Ges-<br />
taltungsspiel<strong>raum</strong> und folglich auch Zugänge zu ihrer eigentlichen Klientel. Gelingt der Ju-<br />
gendarbeit diese Beruhigung der konfliktbelasteten Zonen nicht, wird in der Regel mit re-<br />
pressiven Maßnahmen (Polizeikontrollen, Alkoholverbote, Sicherheitsdienste, Videoüber-<br />
wachung) reagiert, den Jugendlichen auf diese Weise die mögliche Aneignung des Raumes<br />
entzogen und die Jugendarbeit bzw. deren Lösungskompetenz in Frage gestellt.<br />
Daher braucht es bei anzudenkenden Lösungsmaßnahmen zumindest zwei Gewissheiten,<br />
die am Anfang der Lösungsentwicklung abzuklären sind:<br />
1. Jugendarbeit darf nicht verstanden werden – und sich nicht selbst verstehen – als<br />
„Krisenfeuerwehr“ in (Konflikt)Situationen, die durch größere Zusammenhänge auf<br />
169
anderen Ebenen geschaffen werden. Für die Auftraggeber/innen bzw. Entwick-<br />
ler/innen von Lösungskonzepten muss klar sein, dass die Jugendarbeit nicht in diese<br />
Rolle einseitiger Umsetzung der existierenden Machtverhältnisse gedrängt werden<br />
darf, da ansonsten die Lösungsansätze bereits aufgrund der fehlenden Grundbasis<br />
zum Scheitern verurteilt sind.<br />
2. Es muss klar sein, dass junge Menschen Recht auf Raum haben. Dieser Raum ist in<br />
Abst<strong>im</strong>mung mit Jugendlichen und idealerweise mit Unterstützung durch Jugendar-<br />
beiter/innen zu gestalten und in der Folge auch gegenüber anderen Interessen abzu-<br />
sichern. Raum ist hierbei nicht nur als Schaffung von Jugendtreffpunkten zu verste-<br />
hen, sondern es sind auch die Interessen von Jugendlichen in allgemein <strong>öffentlichen</strong><br />
Plätzen abzusichern.<br />
4.1.2 Wahrnehmung der Jugendlichen als eine Ansammlung von Defiziten<br />
Diese Arbeit setzt sich (nicht ohne Grund) mit den „dunklen“ Seiten – also den Defiziten –<br />
Jugendlicher auseinander: Die Konfrontation mit diesen Defiziten ist Alltag in der Praxis<br />
der Jugendarbeit. Dies ist nicht unbedingt durch die Jugendlichen – sondern eher durch das<br />
Umfeld – bedingt. Jugendliche werden einseitig als (zu bearbeitendes) Problem wahrge-<br />
nommen: Stadtverantwortliche reflektieren Jugendliche oftmals als Zerstörer <strong>öffentlichen</strong><br />
Gutes und Problembringer an <strong>öffentlichen</strong> Plätzen, Anrainer/innen reflektieren Jugendliche<br />
als Vermüller, Störer und Bedrohung der <strong>öffentlichen</strong> Ordnung an <strong>öffentlichen</strong> Plätzen, die<br />
Meinungsbildung, Berichterstattung, Forschung und schließlich auch die Jugendarbeit ori-<br />
entiert sich zunehmend an Defiziten (wie Kr<strong>im</strong>inalität, Gewalt, Vandalismus ...) und bildet<br />
diese in unverhältnismäßig überzeichneten D<strong>im</strong>ensionen ab. Diese wahrgenommenen Defi-<br />
zite können für die Jugendarbeit natürlich auch ein gutes Geschäft bilden: Immer wieder<br />
stellen diese Defizite eine Überforderung bestehender Strukturen dar und bilden die Grund-<br />
lage für die Schaffung von Jugendprojekten bzw. legit<strong>im</strong>ieren die Jugendarbeit, die perma-<br />
nent unter (Anerkennungs- und Rechtfertigungs-) Druck steht. 467 Unbestritten steigen die<br />
467 vgl. Lindner, Werner: "Prävention" in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ein Nachruf zu Lebzeiten. In:<br />
170
Herausforderungen an junge Menschen an: „Wie die Wachstumsraten etwa bei psychischen Er-<br />
krankungen, Stresssymptomen, Drogengebrauch oder Ersteinstieg be<strong>im</strong> Nikotingenuss dokumentieren,<br />
nehmen die Bewältigungsanforderungen von Kindern und Jugendlichen auf der individuell-subjektiven Ebene<br />
offenbar zu. Parallel dazu wird die Anzahl Jugendlicher in den nächsten Jahren ansteigen, ohne dass dies<br />
mit den Institutionen der Betreuung, Bildung und beruflichen Integration hinreichend synchronisiert würde.<br />
Gegenwärtig und in Zukunft werden <strong>im</strong>mer mehr Kinder und Jugendliche belastenden Lebensumständen<br />
und erhöhten Anforderungen an Verarbeitungs- und Integrationsfähigkeiten für subjektiv befriedigende Le-<br />
bensentwürfe ausgesetzt. Für sie ergibt sich ein Hochspannungsfeld s<strong>im</strong>ultan wirksamer Abtrennungen von<br />
angemessenen Entfaltungs- und Entwicklungschancen aus rasend in sich selbst rotierendem Konsum- und<br />
Erlebniskommerz, Bewältigungsstress, Leistungsdruck, <strong>öffentlichen</strong> Finanzfiaskos, der Erosion pädagogischer<br />
Moratorien und der Krise sozialer Unterstützungssysteme.“ 468<br />
Diese Orientierung an den Defiziten bildet sich folglich auch konkret räumlich ab: Jugend-<br />
einrichtungen und öffentliche Freiräume für Jugendliche werden defizitär (unoriginell, lieb-<br />
los, billig) geplant, räumlich abgesichert (Zäune, abseits zentral zugänglicher Zonen gelegen)<br />
und streng kontrolliert (Polizeikontrollen, Sicherheitsdienst, Videoüberwachung). Inhaltlich<br />
findet sich diese Defizitorientierung an der präventiven Ausrichtung der Jugendarbeit wie-<br />
der.<br />
Wenn Jugendarbeit in diese Defizitorientierung mit einsteigt, begibt sie sich zumindest in<br />
drei wesentlichen Bereichen auf sehr dünnes Eis 469 :<br />
1) Sie gibt Präventionsversprechen ab, die durch die Jugendarbeit nicht lösbar<br />
sind (sondern gesellschaftliche und soziale Herausforderungen bilden und<br />
oft nur auf übergeordneten [Macht]ebenen lösbar sind)<br />
2) Sie stigmatisiert und diskr<strong>im</strong>iniert die eigene Zielgruppe (indem Defizite und<br />
Probleme zumindest unterstellt, manchmal auch die damit einhergehenden<br />
Gefahren dramatisiert und fachliche Ziele in Richtung Prävention umfrisiert<br />
Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag<br />
für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 258 ff<br />
468 Quelle: Lindner (2005), S 255<br />
469 vgl. Lindner (2003), S 259 ff<br />
171
werden<br />
3) Sie macht sich folglich <strong>im</strong> Bereich eines offensiven Eintretens für <strong>jugend</strong>li-<br />
che Belange (sofern dabei überhaupt noch solch defizitär gesehene Jugendli-<br />
che in solch einem Ansatz miteingebunden sind oder sein wollen) hand-<br />
lungsunfähig.<br />
Zu Beginn einer Lösungsentwicklung muss daher sowohl für Auftraggeber/innen als auch<br />
Projektentwickler/innen ein positiver, offensiver und ressourcenorientierter Blick auf die<br />
Jugendlichen <strong>im</strong> Zentrum stehen: Jugendliche müssen mit ihren Stärken, Fähigkeiten und<br />
Möglichkeiten gesehen und erkannt werden. Nur dieser offensive Blick lässt tatsächlich in-<br />
novative, in die Zukunft gerichtete Maßnahmen zu, da es nicht darum gehen darf, die Defi-<br />
zite zu verwalten und damit permanent selbst in einer defizitären Situation zu sein.<br />
4.1.3 Jugendliche ohne Macht <strong>im</strong> Beteiligungs(sand)spielkasten<br />
Jung sein bringt es mit sich, in wesentlichen Entscheidungsbelangen nicht viel mitzureden<br />
zu haben. Die Notwendigkeit von Partizipation von Jugendlichen ist fachlich – sowohl aus<br />
der Sicht auf Jugendliche (Bildungsprozess hin zur Mündigkeit) als auch <strong>im</strong> Hinblick auf<br />
eine gelingende Stadtentwicklung (Jugendfreundlichkeit, Entwicklung von Jugendangebo-<br />
ten) unumstritten, die Praxis sieht in der Realität in der Regel aber anders aus. Wenn man<br />
die gängigen Beteiligungsmöglichkeiten (Jugendforen, Jugendparlament, Projektgruppen...)<br />
einer kritischen Prüfung unterzieht, stellt man fest, dass es bei diesen Beteiligungsformen<br />
oftmals um „Peanuts“ geht. Häufig geht es in diesen Foren darum, getroffene Entschei-<br />
dungen oder ohnehin gewollte (Jugend)Maßnahmen <strong>im</strong> Sinne eines <strong>jugend</strong>gerechten Marke-<br />
tings oder möglichst billig (ehrenamtliche Hilfsarbeit) in die Realität umzusetzen. Die wirk-<br />
lich wesentlichen Entscheidungen werden nach wie vor grundsätzlich entlang der Machtli-<br />
nien und von Erwachsenen getroffen. In der Realität stellt sich das folgendermaßen dar:<br />
Von Erwachsenen wird entschieden, dass beispielsweise ein Jugendzentrum mit festgelegten<br />
finanziellen Aufwand und an einem festgelegten Standort mit einem festgelegten Grund-<br />
konzept geschaffen wird. Im Zuge der Schaffung dieses Jugendzentrums dürfen junge Men-<br />
172
schen <strong>im</strong> Sinne einer „Partizipation“ bei dem Ausmalen der Räumlichkeiten helfen und viel-<br />
leicht auch mitentscheiden, welche Form und welche Farbe das entsprechende Sofa haben<br />
darf. Nachdem die Altersbest<strong>im</strong>mungen und Hausregeln des Jugendzentrums durch Auf-<br />
traggeber/innen oder Projektbetreiber/innen grundsätzlich festgelegt wurden, dürfen die<br />
Jugendlichen <strong>im</strong> Rahmen eines „partizipativen Dialoges“ sich an der Detailauslegung dieser<br />
Reglungen beteiligen bzw. bekommen diese in Form einer vorgeschobenen Diskussion auf<br />
gleicher Augenhöhe nicht zur Aushandlung, sondern zur „verstehenden Kenntnisnahme“<br />
vorgelegt. Der Grund dafür ist nicht unbedingt <strong>im</strong> Unwillen der Jugendarbeiter/innen an<br />
einer möglichen Beteiligung von Jugendlichen begründet, sondern liegt in der Regel an der<br />
notwendigen Verteidigung der meist unter intensiven Kraftanstrengungen erstrittenen<br />
(Klein)Räume für Jugendliche gegenüber anderen Interessen. Folge: Der (pädagogische)<br />
Anpassungsdruck, dem die Jugendlichen unterliegen, ist teilweise rigider, als man ihn in pri-<br />
vaten Lokalitäten oder in Kultureinrichtungen vorfindet.<br />
Fakt ist: Jugendliche haben nichts mitzuentscheiden, vor allem dann nicht, wenn sie viel-<br />
leicht auch noch auffällig werden. Wenn sich ein einzelner Anrainer über Gruppen von Ju-<br />
gendlichen auf einem <strong>öffentlichen</strong> Platz beschwert, dann ist er in der Regel in der Machtpo-<br />
sition die Situation für seine Interessen zu gewinnen. Anrainer/innen, Exekutive und Ent-<br />
scheidungsträger/innen handeln dann meist aus einem Guss: Die Jugendlichen haben sich -<br />
ohne Mitsprache oder Verhandlungsmandat - diesem einzelnen Willen zu beugen. Nicht auf<br />
gleicher Augenhöhe zwischen Jugendlichen und betroffenen Anrainer/innen wird ein Dia-<br />
log versucht und eine gemeinsame Lösung ausverhandelt, sondern eher werden noch beste-<br />
hende Regelungen restriktiver formuliert, zusätzliche Verbote erlassen, zusätzliche Verbots-<br />
schilder aufgestellt oder bei deren Unwirksamkeit, die Jugendlichen durch Einsatz repressi-<br />
ver Maßnahmen vertrieben oder in letzter Konsequenz die Einrichtungen (seien es Jugend-<br />
zentren oder Spielplätze) wieder abgeschafft.<br />
Es wird zwar viel über Partizipation gesprochen und es gibt auch (vereinzelt) Ansätze, in<br />
denen Partizipation von Kindern und Jugendlichen versucht und auch verwirklich wird.<br />
Problematisch sind viele diese Ansätze aber in zweierlei Hinsicht: Einerseits geht es in der<br />
Regel um dezidierte und dadurch oft isolierte Jugendthematiken (Spielplätze) und anderer-<br />
173
seits betreffen diese Ansätze eher weiche Bereiche (Ausstattung) und keine harten (Ent-<br />
scheidungs-)Bereiche. Eine weiterreichende – und damit gesellschaftlich wirksame Beteili-<br />
gung - ist <strong>im</strong> Regelfall nicht möglich. Als positiver Ansatz ist sicherlich das Wahlrecht ab 16<br />
Jahre zu werten – damit wird zumindest ein Teil der Macht (und damit Mitgestaltungsmög-<br />
lichkeit) in die Hände junger Menschen gelegt. Damit wird vielleicht ein größeres Maß von<br />
Aufmerksamkeit von erwachsenen Entscheidungsträger/innen auf die jungen Menschen<br />
gerichtet.<br />
Damit Jugendliche – und auch Jugendarbeiter/innen die notwendige Partizipationsmöglich-<br />
keit und damit Gestaltungsmöglichkeit erhalten, sind wirksamere Modelle einer (verbindli-<br />
chen) Partizipation bei der Projektentwicklung zu berücksichtigen.<br />
4.2 Das Konzept der Raumaneignung als Basis einer Lösungssuche<br />
Bei dem Konzept der Raumaneignung geht es nicht nur um die Struktur, sondern <strong>im</strong> We-<br />
sentlichen um die Qualität von Räumen. Durch die in Räumen liegenden (neuen) Möglich-<br />
keiten werden diese zu sozialen Räumen. Diese Möglichkeiten der Raumaneignung zeigen<br />
gerade Jugendliche <strong>im</strong>mer wieder auf: Obwohl der Raum verinselt, verplant und funktiona-<br />
lisiert ist, werden auch heute Räume –teilweise mit hohem Risiko – angeeignet, Jugendliche<br />
inszenieren sich (Trendsport) und bilden sich ab (Graffities). 470<br />
Ihre Ursprünge hat das Aneignungskonzept in der sogenannten kulturhistorischen Schule<br />
der sowjetischen Psychologie, vor allem Leontjew wird hier genannt. Die zugrunde liegende<br />
Überlegung hinter diesem Ansatz besteht darin, „die Entwicklung des Menschen als tätige Ausei-<br />
nandersetzung mit seiner Umwelt und als Aneignungsprozess der gegenständlichen und symbolischen Kultur<br />
zu verstehen.“ 471<br />
Holzkamp überträgt den Leontjewschen Begriff der Gegenstandsbedeutung (die Vergegens-<br />
470 vgl. Deinet, Ulrich: Aneignung und Raum - sozialräumliche Orientierungen von Kindern und Jugendlichen.<br />
In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung.<br />
D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur,<br />
Berlin 2007, S 48<br />
471 Quelle: Deinet (2007), S 49<br />
174
tändlichung gesellschaftlicher Erfahrung, die <strong>im</strong> Aneignungsprozess erschlossen werden<br />
muss) auf die gesellschaftliche Ebene komplexer sozialer Beziehungen, „die in der individuellen<br />
Entwicklung ebenfalls von einfachen (gegenständlichen) Formen bis zu hochkomplexen Zusammenhängen<br />
verallgemeinert werden müssen.“ 472<br />
Deinet lehnt sich in seinem Aneignungskonzept an Holzkamp an und geht davon aus, „dass<br />
sich die konkreten Verhältnisse der Gesellschaft, so wie sie Kinder und jüngere Jugendliche, die nicht am<br />
Produktionsprozess teilnehmen, erleben, diesen vor allem räumlich vermittelt werden. Leontjews Gegens-<br />
tandsbedeutung <strong>im</strong> Aneignungsprozess ist für Kinder und Jugendliche quasi eingebettet in den ‚Raum’ unserer<br />
Gesellschaft, in die konkreten, durch die Strukturen geschaffenen, räumlichen Gegebenheiten.“ 473<br />
Da die – vor allem städtischen Räume – heute nicht naturbelassen, sondern bearbeitet,<br />
strukturiert und funktionalisiert sind, müssen sich die jungen Menschen diese Räume und<br />
ihre eingeschriebenen Bedeutungen wie Gegenstände und Werkzeuge der unmittelbaren<br />
Umgebung aneignen. Die schöpferische Leistung, als Eigentätigkeit, die den Aneignungs-<br />
prozessen innewohnt, wird durch die realen Anforderungs- und Möglichkeitsstrukturen ge-<br />
formt. Die äußeren Bedingungen und Anregungen sind die wesentlichen Faktoren, die die<br />
Möglichkeit einer Aneignung als Eigentätigkeit best<strong>im</strong>men. 474<br />
Martina Löw hat – wie <strong>im</strong> Kapitel Mediatisierung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes beschrieben –<br />
darauf hingewiesen, dass sich, bedingt durch die neuen Medien und die starke Verinselung<br />
der Lebensräume, ein neues Bild von Raum konstituiert hat, bei dem Raum als beweglich,<br />
uneinheitlich und diskontinuierlich wahrgenommen wird. Für Deinet kann der Aneig-<br />
nungsbegriff insofern aktualisiert werden, „als er nach wie vor die tätige Auseinandersetzung des<br />
Individuums mit seiner Umwelt meint und bezogen auf die heutigen Raumveränderung der Begriff dafür sein<br />
kann, wie Kinder und Jugendlich eigentätig Räume schaffen (Spacing) und die (verinselten) Räume ihrer<br />
Lebenswelt verbinden. (...) Aneignung der Lebenswelt heute bedeutet, Räume zu schaffen (Spacing) und sich<br />
nicht nur vorhandene gegenständlich anzueigenen.“ 475<br />
472<br />
Quelle: Deinet (2007), S 49<br />
473<br />
Quelle: Deinet (2007) S 49<br />
474<br />
vgl. Deinet (2007), S 50 ff<br />
475<br />
Quelle: Deinet (2007), S 59<br />
175
Deinet meint mit dem Aneignungsbegriff: 476<br />
� eigentätige Auseinandersetzung mit der Umwelt<br />
� (kreative) Gestaltung von Räumen mit Symbolen etc.<br />
� Inszenierung Verortung <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum (Nischen, Ecken, Bühnen) und in Institutionen<br />
� Erweiterung des Handlungs<strong>raum</strong>es (die neuen Möglichkeiten, die in neuen Räumen liegen)<br />
� Veränderung vorgegebener Situationen und Arrangements<br />
� Erweiterung motorischer, gegenständlicher, kreativer und medialer Kompetenz<br />
� Eigentätige Nutzung neuer Medien zur Erschließung virtueller sozialer Räume<br />
� Erprobung des erweiterten Verhaltensrepertoires und neuer Fähigkeiten in neuen Situationen<br />
� Entwicklung situationsübergreifender Kompetenzen <strong>im</strong> Sinne einer ‚Unmittelbarkeitsüberschrei-<br />
tung’ und ‚Bedeutungsverallgemeinerung’<br />
Reutlinger streicht diese Möglichkeiten eines sozial<strong>raum</strong>orientierten Ansatzes ebenfalls her-<br />
aus:„Sozial<strong>raum</strong>orientierte Jugendarbeit unterstützt Aneignungs- und Bildungsprozesse auch außerhalb<br />
ihrer Orte, insbesondere <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum. Mit ihrem ‚sozialräumlichen Blick’, d.h. durch die mit Hilfe<br />
qualitativer Methoden gewonnenen Erkenntnisse über Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, unter-<br />
stützt sie Prozesse zur Revitalisierung öffentlicher Räume für Kinder und Jugendliche, die diesen intensive<br />
Aneignungs- und Bildungsmöglichkeiten gibt.“ 477<br />
Reutlinger denkt dabei über räumliche Bezugnahmen hinaus. Er beruft sich dabei auf seine<br />
empirischen Untersuchungen in Deutschland, Frankreich und Spanien, die zeigen, dass Ju-<br />
gendliche heute unter den Bedingungen der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft nicht nur<br />
aneignungsfähige für sie gedachte Flächen benötigen, sondern vor allem materielle und ge-<br />
sellschaftliche Teilhabe: „Überspitzt ließe sich formulieren, dass die Jugendlichen heute keine Abenteu-<br />
erspielplätze mehr brauchen, denn durch die gesellschaftlichen Veränderungen ist ihr ganzes Leben zum A-<br />
476 Quelle: Deinet (2007), S 60<br />
477 Quelle: Reutlinger (2007), S 31<br />
176
enteuer geworden.“ 478<br />
Heutige Aneignungsformen ‚reiben’ sich nicht mehr an der Gesellschaft, sondern sozial-<br />
räumliche Strukturen werden ‚wild“ angeeignet. Diese Bewältigungsformen vermitteln in-<br />
nerhalb der Gruppe zwar Zugehörigkeit, die Jugendlichen sind aber der Gesellschaft nicht<br />
mehr zugehörig. Jugendliche sind damit – ohne Erwachsenen zugänglich zu sein - in der<br />
Unsichtbarkeit verschwunden. Jugendliche schotten sich räumlich sozusagen ab und bleiben<br />
unter sich. In diesem physisch-materiellen Raum (Reutlinger verwendet das Beispiel einer<br />
Bretterbude) kann keine gesellschaftliche Integration mehr erfolgen, da bedingt durch die<br />
gesellschaftliche Spaltung, die soziale Funktion davon entkoppelt ist. 479<br />
Für Reutlinger besteht der Eindruck, dass wir es mit einer jungen Generation zu tun haben,<br />
die keinerlei Zugang in diese Welt hat und nicht mehr eintreten kann. Dadurch, dass Men-<br />
schen (durch gesellschaftlichen Ausschluss, Arbeitslosigkeit, Weiterreichung von Maßnah-<br />
me zu Maßnahme) überflüssig werden, gehe es nicht mehr nur darum, die sichtbaren Le-<br />
bensbereiche zu erforschen und zu bearbeiten, sondern jene Lebensbereiche, mit denen<br />
Kinder und Jugendliche keine Reaktion erzeugen, nichts provozieren können, in den Blick<br />
zu nehmen: „Es geht um das Verständnis der Lebensbereiche als eine Einheit: In einer unübersichtlichen<br />
Welt, in welcher die Bezüge <strong>im</strong>mer komplizierter und unübersichtlicher werden, müssen verstärkt beide Le-<br />
bensbereiche in den Blick genommen werden: Die sichtbaren Bereiche, in denen die Jugendlichen gefordert<br />
sind, in denen sie sich darstellen müssen, und diejenigen Lebensbereiche, die eher dafür da sind, den ständig<br />
ansteigenden Druck, bedingt durch den Kampf um soziale Zugangsmöglichkeiten, Generationenkonkurrenz,<br />
Bewältigungs- und Bewährungsdruck usw. bewältigen zu können. (...) Und dies ist die Hauptidee meines<br />
Ansatzes der ‚unsichtbaren Bewältigungskarten’: Indem Jugendliche diesen Mithaltedruck biographisch be-<br />
wältigen, gestalten sie ihre sozialen Räume. Bei diesen sozialen Räumen handelt es sich um gesellschaftlich<br />
ausgeklinkte Rückzugsräume. Manchmal sind diese physisch-materiell und territorial verortbar, (...), ver-<br />
stärkt aber virtuelle, nicht sicht- und greifbar. Junge Menschen wollen trotz ihrer Erfahrung des Nicht-<br />
Mithalten-Könnens akzeptiert sein. (...) Sie müssen, trotz der vermeintlichen Unmöglichkeit etwas bewirken<br />
478 Quelle: Reutlinger (2007), S 35<br />
479 vgl. Reutlinger (2007), S 35<br />
177
zu können, handlungsfähig bleiben und ihr Leben bewältigen und über die Gestaltung eigene Räume konsti-<br />
tuieren.“ 480<br />
4.3 Grundsätzliche Projektvoraussetzungen<br />
Wolfgang Hinte geht davon aus, dass es bei der Umsetzung der Sozial<strong>raum</strong>orientierung eine<br />
Vielzahl von Widerständen geben kann und benennt unter anderem folgende Aspekte als<br />
Grundlagen einer möglichen Implementierung: 481<br />
• Entsprechende politische Entschlüsse zur Sozial<strong>raum</strong>orientierung auf Kommunal-<br />
ebene<br />
• Lokaler Konsens über die Kernphilosophie<br />
• Erschließung von Ressourcen <strong>im</strong> Sozial<strong>raum</strong> zwecks gemeinsamer Nutzung auf Sei-<br />
ten aller Träger<br />
• Übernahme und Verteilung von Zuständigkeiten von jeweils einem oder auch meh-<br />
rerer Träger<br />
• Regelhaft installierte Kooperation auf Fachkräfteebene zwischen <strong>öffentlichen</strong> und<br />
freien Trägern<br />
• Regelmäßige und gemeinsame Qualifizierung der beteiligten Fachkräfte<br />
4.4 Gemeinwesenarbeit und sozialräumliche Jugendarbeit als ideale<br />
Ergänzung<br />
Idealerweise agiert die Jugendarbeit mit einem sozialräumlichen Ansatz nicht alleine Vor<br />
Ort, sondern ist in einem breiteren Kontext von Gemeinwesenarbeit eingebettet.<br />
Deinet arbeitet die Verbindungen und Vorteile einer stadtteilbezogenen Arbeit (angelehnt<br />
480 Quelle: Reutlinger (2007), S 36 ff<br />
481 vgl. Deinet (2002), S 18<br />
178
an Hinte) und der sozialräumlichen Jugendarbeit heraus. 482 Dort wo Hinte von der „Betrof-<br />
fenheit der Wohnbevölkerung“ spricht und eine nichtmanipulative pädagogische Herange-<br />
hensweise an die Alltagwirklichkeit einfordert, kann die sozialräumliche Jugendarbeit mit<br />
der Max<strong>im</strong>e, sich an den alltags- und lebensweltlichen Äußerungen von Jugendlichen zu<br />
orientieren, anknüpfen. „Sozialräumliche Jugendarbeit versucht darüber hinaus Problemstellungen und<br />
Interessen von Kindern und Jugendlichen aber auch ihre konkreten Aneignungsmöglichkeiten <strong>im</strong> Stadtteil zu<br />
beziehen und nutzt in der Kinder- und Jugendarbeit entwickelte Methoden der Sozial<strong>raum</strong>analyse als<br />
Grundlage der Bedarfsermittlung.“ 483<br />
Analog zu Hinte, der den Verzicht auf eine „Belehrungs-Pädagogik“ fordert, versucht die<br />
sozialräumliche Jugendarbeit selbstbest<strong>im</strong>mte Aneignungsprozesse zu ermöglichen und<br />
Lernprozesse zu fördern. So wie Hinte durch das Aufgreifen von stadtteilbezogenen (lösba-<br />
rer) Problemlagen noch vor der „Klientelisierung“ aufgreifen will, so versucht die sozial-<br />
räumliche Jugendarbeit aus konkreten alltagsweltlichen Themen und Problemlagen Arbeits-<br />
ansätze zu entwickeln. So wie Hinte bei den Selbsthilfepotentialen der Menschen ansetzt, so<br />
geht die sozialräumliche Jugendarbeit ebenfalls von den vorhandenen Potentialen in den<br />
Jugendlichen (abseits eines defizitären) Ansatzes aus. So wie Hinte eine Etikettierung von<br />
Problemgruppen verhindern will, so erkennt offene Jugendarbeit die Verschiedenartigkeit<br />
der (Jugend)kulturen an und akzeptiert diese, macht diese (z.B. ethnischen) Unterschiede<br />
nicht zum Ausgangspunkt einer „speziellen“ Pädagogik, sondern sieht die Förderung der<br />
Begegnung und Akzeptanz zwischen verschiedenen Kulturen <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum als we-<br />
sentlichen Zugang der sozialräumlichen Arbeit. „Sozialräumliche Jugendarbeit sieht einen wesentli-<br />
chen Aufgabenbereich in der Moderation von Konflikten zwischen Heranwachsenden und Erwachsenen und<br />
definiert sich aber als Mandatsträger für Kinder und Jugendliche.“ 484<br />
Wesentlich ist beiden Ansätzen eine notwendige Kooperation und Vernetzung. „Eine sozial-<br />
räumlich orientierte Kinder- und Jugendarbeit sucht Kooperationspartner nicht nur innerhalb der Jugendhilfe,<br />
sondern auch in Institutionen und Bereichen darüber hinaus. Nur so können soziale Räume als Aneig-<br />
482<br />
vgl. Deinet (2002), S 22 ff<br />
483<br />
Quelle: Deinet (2002), S 22<br />
484<br />
Quelle: Deinet (2002), S 23<br />
179
nungsräume für Kinder und Jugendliche qualifiziert werden.“ 485<br />
Deinet stellt also fest, dass grundsätzlich das gemeinsame Ziel verfolgt wird, die Handlungs-<br />
und Selbstorganisationsfähigkeiten der jeweiligen Zielgruppe zu erweitern. „Der Unterschied<br />
zwischen der modernen Gemeinwesenarbeit und einer sozial<strong>raum</strong>orientierten Kinder- und Jugendarbeit be-<br />
steht nicht <strong>im</strong> Hinblick auf die grundsätzlichen Arbeitsprinzipien, sondern differenziert sich dahingehend,<br />
dass Kinder- und Jugendarbeit vornehmlich Kinder und Jugendliche <strong>im</strong> Blick hat, während die gemeinwesen-<br />
orientierte Arbeit viel stärker erwachsenenorientiert ist und alle Bürgerinnen und Bürger eines Sozial<strong>raum</strong>es<br />
in den Blick n<strong>im</strong>mt. Dementsprechend ist das Verhältnis zur räumlichen Umgebung, zur Nutzung von<br />
Räumen sehr stark unterschiedlich. Für Erwachsene haben best<strong>im</strong>mte räumliche Strukturen <strong>im</strong> Stadtteil<br />
sehr funktionale und rationale Bedeutungen und werden gebrauchswertsorientiert verwendet.“ 486 Die An-<br />
eignung macht hier sozusagen den großen Unterschied.<br />
4.5 Wesentliche Aspekte der sozialräumlichen Jugendarbeit<br />
4.5.1 Gestaltung des Ortes der Jugendarbeit als Aneignungs- und Bildungs<strong>raum</strong><br />
Dabei geht es um die Schaffung einer möglichst aneignungs- und bildungsfördernden Um-<br />
gebung - und weniger um intentionale Bildungsangebote, Programme oder Projekte - an<br />
und in den Orten der Jugendarbeit. „Aus dem sozialräumlichen Verständnis der Gestaltung von<br />
Räumen als soziale Räume heraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Bildung, die in der Form in der<br />
Jugendarbeit nicht genutzt werden. In dem der „Raum“ der Jugendarbeit anregend wirkt, Kindern und Ju-<br />
gendlichen Gestaltung und Veränderung, Konfrontation und alternative Erfahrungen ermöglicht, wird er<br />
selbst zu einem Aneignungs- und Bilds<strong>raum</strong> <strong>im</strong> Bereich des informellen Lernens.“ 487<br />
Wichtig dabei sind - neben dem möglichen Oszillieren (also dem wandeln) zwischen Innen-<br />
485 Quelle: Deinet (2002), S 23<br />
486 Quelle: Deinet (2002), S 24<br />
487 Quelle: Deinet (2002), S 40<br />
180
und Außen(welt) - das Materialangebot und die strukturierende Kompetenz der Mitarbei-<br />
ter/innen für das Zustandekommen von Situationsveränderungen.<br />
„Im Gegensatz zu den durchfunktionalisierten Institutionen, mit den Kinder und Jugendliche sonst zu tun<br />
haben, hat die Offene Kinder- und Jugendarbeit auch räumlich und architektonisch die Chance, einen Ges-<br />
taltungs<strong>raum</strong> zu bilden, der sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass <strong>im</strong>mer wieder Räume und Bereiche<br />
umgestaltet werden können. Solche Gestaltungsprozesse haben neben der aktiven Aneignung des Raumes<br />
hinaus sehr stark soziale Bezüge, weil es darum geht, sich <strong>im</strong> Haus mit anderen Cliquen zu arrangieren,<br />
Ideen und Entwürfe in einer Clique bzw. Gruppe zu einem Entwurf zu entwickeln, den Gestaltungsprozess<br />
selbst zu organisieren etc.“ 488<br />
4.5.2 Positive Sicht öffentlicher Räume gegenüber der „gefährlichen Straße“<br />
Der Blickwinkel in der Beschreibung von Orten richtet sich zuerst auf die Qualität dieser<br />
Räume und nicht auf die Gefahren, weil diese Orte für Jugendliche meist eine ganz andere<br />
Bedeutung als Spiel- oder Erfahrungsorte haben. 489 Jugendliche schaffen sich durch He-<br />
rumhängen, Blödeln und Action einen Spiel<strong>raum</strong> in der sozialen Realität und erproben so<br />
ihr Selbstverständnis in Abgrenzung zu ihrer Umwelt. „’Herumhängen, Blödeln, Action machen’<br />
beschreiben sicher nur einige Qualitäten, die öffentliche Räume für <strong>jugend</strong>liche attraktiv machen. Aber be-<br />
reits damit wird deutlich: gegenüber dem verbreiteten Konstrukt der ‚gefährlichen’ Straße hat eine sozial-<br />
räumliche Jugendarbeit eine ganz andere Sicht auf die Qualitäten von Räumen. Überspitzt könnte man<br />
sagen: Prävention bedeutet, den Öffentlichen Raum zum ‚Herumhängen...’ zurückzugewinnen und nicht<br />
nur, ihn ‚sicherer’ zu machen.“ 490<br />
488 Quelle: Deinet (2002), S 41<br />
489 vgl. Deinet (2002), S 42<br />
490 vgl. Deinet (2002), S 42<br />
181
4.5.3 Revitalisierung öffentlicher Räume als <strong>jugend</strong>politisches Mandat<br />
Jugendarbeit ist aus Sicht der Jugendlichen selbst Bestandteil öffentlicher Räume und macht<br />
ihre Aneignungs-Angebote für die Erweiterung und Veränderung nutzbar. „Jugendarbeit wird<br />
aber auch selbst zum Medium der Raumaneigung, indem sich Kinder und Jugendliche die Räume der Ju-<br />
gendarbeit aneignen und verändern. Aufgabe der Jugendarbeit ist es, diese Zusammenhänge zu erkennen,<br />
entsprechend zu reagieren und sie entsprechend <strong>im</strong> Aneignungskonzept umzusetzen.“ 491<br />
Jugendarbeit als Ausgangspunkt der Erweiterung des Handlungsspiel<strong>raum</strong>es hat damit eine<br />
<strong>jugend</strong>politische D<strong>im</strong>ension. Sozialräumliche Jugendarbeit, die subjekt- und lebensweltori-<br />
entiert ist, überschreitet die formale, geografische D<strong>im</strong>ension: „Kinder- und Jugendarbeit mit<br />
diesem Selbstverständnis hat das Mandat, sich für Kinder und Jugendliche <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum einzuset-<br />
zen, mit ihnen gemeinsam oder als Mandatsträger advokatorisch öffentliches politisches Bewusstsein für die<br />
Themen von Kindern und Jugendlichen (wieder)herzustellen und sich für die Aneignung, Revitalisierung und<br />
Sicherung öffentlicher Räume zu engagieren.“ 492<br />
4.5.4 Kooperation und Vernetzung<br />
Bei der Umsetzung von sozialräumlichen Ansätzen geht es wesentlich auch um Vernetzung<br />
und Kooperation, wobei die Jugendarbeit wertvolle Impulse einbringen kann. „Aus ihrem<br />
sozialräumlich/<strong>jugend</strong>politischen Mandat heraus, bei dem es um die Revitalisierung öffentlicher Räume geht,<br />
ist die Kinder- und Jugendarbeit beispielsweise auch Partner von Spiel<strong>raum</strong>planung und Stadtentwicklung.“<br />
493<br />
Eine Lebensweltanalyse der Jugendlichen macht dann wirklich Sinn, wenn alle Einrichtun-<br />
gen innerhalb des jeweiligen Sozial<strong>raum</strong>s zusammenarbeiten. Dabei können sich die Mitar-<br />
beiter/innen der verschiedenen Einrichtungen gegenseitig unterstützen und von der Einbe-<br />
ziehung von anderen Arbeitsformen Nutzen ziehen. Eine solche Analyse bildet die Grund-<br />
lage für eine gemeinsame Planung und Schwerpunktsetzungen bei den Maßnahmen und<br />
491<br />
Quelle: Deinet (2002), S 42<br />
492<br />
Quelle: Deinet (2002), S 43<br />
493<br />
Quelle: Deint (2002), s 43<br />
182
Einrichtungen. „Entscheidende Fragen für diesen Prozess lauten: Was müsste auf Grund der Analyse<br />
der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen <strong>im</strong> Stadtteil geschehen? Welche Maßnahme/Einrichtung<br />
kann welche neue Funktion und Rolle übernehmen? Welche alten Funktionen und Angebote können ver-<br />
ändert oder evtl. abgebaut werden? Welche Rahmenbedingungen der Einrichtungen (z.B. Lage <strong>im</strong> Stadtteil,<br />
räumliche Ressourcen) machen welche Schwerpunktsetzungen möglich?“ 494<br />
4.6 Sozialräumliche Konzeptentwicklung als Projekt<br />
DAS Projekt auf DIE Antwort auf Probleme <strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum gibt es wohl nicht. Al-<br />
lerdings geben Deinet und Krisch wesentliche Anregungen darin, bereits eine Konzeptent-<br />
wicklung als Projekt anzulegen. In diesen Prozess fließen die Situationen und Herausforde-<br />
rungen der Gegenebenheiten vor Ort ein und bilden Grundlage für wesentliche Schritte<br />
und Entwicklungslinien.<br />
Damit ist auch getroffen, was Sandra Nüß als „Projektarbeit als Chance für Innovationen“<br />
beschreibt: „Ein Projekt ist unter anderem dadurch definiert, dass es eine neuartige, komplexe Aufgaben-<br />
stellung hat. Das heißt: Es handelt sich nicht um eine Routineangelegenheit und grenzt sich somit vom All-<br />
tagsgeschäft und den Regelangebot ab. Projekte arbeiten beispielweise mit neuen Konzepten, greifen neue<br />
Themen auf, sprechen andere als die üblichen Zielgruppen an oder erfordern neue Arbeitsstrukturen. Per<br />
Definition geht es bei Projekten also <strong>im</strong>mer auch um Innovationen. (...) In der Folge können dadurch Pro-<br />
gramme, Verfahren und Abläufe der Einrichtung bzw. Organisation überprüft, opt<strong>im</strong>iert oder hervorge-<br />
bracht sowie Strukturen verändert oder ersetzt werden. Das Ergebnis von Projektarbeit kann so beispiels-<br />
weise die Entwicklung neuartiger Konzepte und Angebote oder das Erschließen und die Ansprache neuer<br />
Zielgruppen und Kunden sein.“ 495<br />
Damit sinnvoll gearbeitet werden kann, sind für die Konzeptionierung natürlich entspre-<br />
chende Ressourcen einzuplanen. Grundsätzlich ist ein Zeit<strong>raum</strong> von ein- bis eineinhalb Jah-<br />
494<br />
Quelle: Deinet (2002), S 44<br />
495<br />
Quelle: Nüß, Sandra: Projektmanagement. In: Schubert, Herbert (Hrsg.): Sozialmanagement. Zwischen Wirtschaftlichkeit<br />
und fachlichen Zielen. 2. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 182<br />
183
e vorzusehen. 496<br />
4.6.1 Klärung von Zielen<br />
Wie bei jedem Projekt, gilt es zuerst die Ziele abzuklären. Auch wenn mit Methoden gear-<br />
beitet wird, die den Sozial<strong>raum</strong> erforschen und auch Grundlage für eine Neukonzeption der<br />
Arbeit oder Einrichtung sein können, ergeben sich diese grundlegenden Ziele nicht aus den<br />
praktischen Erfahrungen <strong>im</strong> Zuge des Prozesses, sondern: „Die Festlegung der Ziele hat weitrei-<br />
chende Konsequenzen sowohl für die Sozial<strong>raum</strong>analyse und Konzeptentwicklung als auch für die Gestaltung<br />
und Bewertung der eigenen Praxis.“ 497<br />
Es macht in der Analyse, der Konzeptentwicklung und folgend für den Erfolg in der Praxis<br />
einen großen Unterschied, ob es darum geht, störende Jugendliche weg von der Straße in<br />
Einrichtungen hinein gelockt werden sollen oder ob es darum geht, isolierte Jugendliche<br />
von zu Hause <strong>mittels</strong> sinnvoller Freizeitgestaltung in den <strong>öffentlichen</strong> Raum hineinzubrin-<br />
gen. Während des Prozesses wird man diese unterschiedlichen Zielformulierungen mit ver-<br />
schiedenen Fragestellungen, verschiedenen Jugendgruppen als Fokus und verschiedenen<br />
Konzepten bearbeiten.<br />
4.6.2 Der Sozial<strong>raum</strong> bildet die Ausgangslage<br />
Grundlage einer sozialräumlichen Konzeptentwicklung ist der Sozial<strong>raum</strong>/die Lebenswelt<br />
der Jugendlichen. Auf einer detaillierten Analyse dieser Lebenswelten bauen Anforderun-<br />
gen, Ziele und Aufgaben der Jugendarbeit auf.<br />
„Grundlage sozialräumlicher Konzeptentwicklung ist eine Sozial<strong>raum</strong>- und Lebensweltanalyse, die neben<br />
der Verwendung von statistischem Material zur Bevölkerungsstruktur und anderen relevanten Daten des<br />
jeweiligen Sozial<strong>raum</strong>s in einer Lebensweltanalyse qualitative Methoden empirischer Sozialforschung <strong>im</strong><br />
496<br />
vgl. Deinet/Krisch (2002), S 50<br />
497<br />
Quelle: Scherr, Albert: Benötigt sozialräumliche Konzeptentwicklung Theorien? In: Deinet Ulrich/Krisch Richard<br />
(Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung<br />
und Qualifizierung. Leske + Budrich, Opladen 2002, S 66<br />
184
Rahmen einer „kleinen Feldforschung“ einsetzt.“ 498<br />
Solche Methoden sind beispielsweise:<br />
• Stadtteilbegehung mit Jugendlichen<br />
• Nadelmethode<br />
• Cliquenraster<br />
• Institutionenbefragung<br />
• Strukturierte Stadtteilbegehung<br />
• Autofotografie<br />
• Subjektive Landkarten<br />
• Zeitbudget von Jugendlichen<br />
• Fremdbilderkundung 499<br />
Vor Einsatz der ausgewählten Methoden geht es um die präzise Erarbeitung von Fragen,<br />
um einerseits die Richtung in die geforscht werden soll zu best<strong>im</strong>men und andererseits die<br />
entsprechende Methode auszuwählen. Fragen können in etwa lauten:<br />
„Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil?<br />
Welche Qualitäten haben Orte und Räume?<br />
Wie sieht die Struktur der Lebensräume best<strong>im</strong>mter Zielgruppen aus?“ 500<br />
498 Quelle: Deinet, Ulrich/Krisch, Richard: Sozialräumliche Konzeptentwicklung als Projekt: Schritte und Modelle.<br />
In: Deinet Ulrich/Krisch Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine<br />
zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung. Leske + Budrich, Opladen 2002, S 45<br />
499 Eine detaillierte Darstellung dieser Methoden findet sich bei Krisch, Richard: Methoden der sozialräumlichen<br />
Konzeptentwicklung. In: Deinet, Ulrich/Krisch Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit.<br />
Leske+Budrich, Opladen 2002, S 87 ff oder auch bei: Ortmann, Norbert: Methoden der Erkundung von<br />
Lebenswelten. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Konzepte entwickeln. Anregungen und Arbeitshilfen<br />
zur Klärung und Legit<strong>im</strong>ation. Juventa Verlag, Weinhe<strong>im</strong> und München 1996, S 26 ff<br />
500 Quelle: Deinet/Krisch (2002), S 47<br />
185
Einbeziehung relevanter Literatur und Studien<br />
Wie bei anderen Forschungsvorhaben auch, gilt es auch hier, einen Überblick über die aktu-<br />
elle Literatur, den aktuellen Forschungsstand und Ergebnisse von relevanten Jugendstudien<br />
zu sichten. Diese ergänzenden Unterlagen werden natürlich auf die konkreten Verhältnisse<br />
vor Ort angewandt.<br />
Ziel dieser Lebensweltanalyse ist ein qualitativer Einblick in die Lebenswelt der Jugendli-<br />
chen <strong>im</strong> best<strong>im</strong>mten Sozial<strong>raum</strong>, der als Grundlage für die Konzeptentwicklung der Ju-<br />
gendarbeit dient. 501 Die Anforderungen die sich aus dieser Analyse für die Jugendarbeit ergeben,<br />
schließen direkt an die Lebenswelten der Jugendlichen an. 502<br />
In die Analyse können auch Kriterien eingearbeitet werden, die später auch in die Arbeits-<br />
konzeption eingeschrieben werden. Solche Kriterien können beispielsweise sein:<br />
• Aktivierung und Beteiligung, um Prozesse der Partizipation in Gang zu setzen<br />
• Geschlechterorientierung, mit der auch spezifische Interessen und Bedürfnisse von<br />
Mädchen und Jungen berücksichtigt werden<br />
• Kooperation und Vernetzung mit anderen Personen und Institutionen 503<br />
501<br />
vgl. Deinet/Krisch (2002), S 50<br />
502<br />
vgl. Deinet, Ulrich/Krisch,Richard: Der „sozialräumliche“ Blick der Kinder- und Jugendarbeit. In: Deinet,<br />
Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen<br />
– Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007,<br />
S 160<br />
503<br />
vgl. Deinet/Krisch (2002), S 52<br />
186
Ute Dithmar regt an, aufgrund des schwierigen Umfanges solch einer Konzeptentwicklung<br />
folgende Phasen einzuplanen 504 :<br />
1. Schaffung einer Arbeitsbasis<br />
Über das Warum des Prozesses soll Klarheit herrschen, alle Beteiligten sol-<br />
len über die Gründe, den Zusammenhang der Entstehung und die verfolg-<br />
ten Ziele Bescheid wissen.<br />
2. Bestandsaufnahme von vorhandenen Wissensbeständen<br />
Das vorhandene sozialräumliche Wissen der Mitarbeiter/innen ist Aus-<br />
gangspunkt. Es gilt jedoch, dieses Wissen zu ordnen, zu reflektieren und zu-<br />
sammenzutragen. Es geht quasi darum, das Wissen aus den einzelnen Köp-<br />
fen gemeinsam sichtbar und nutzbar zu machen. Damit wird erkennbar, was<br />
schon bekannt ist und was nicht. „Diese systematische ‚Vergewisserung der eigenen<br />
Praxis’ erscheint banal, ist aber eine zentrale Voraussetzung für die Konzeptentwicklung,<br />
weil sie die Wirksamkeit der eigenen Praxis ordnen und bewerten hilft.“ 505<br />
3. Durchführung der systematischen Lebensweltanalyse<br />
Ausgehend von den entwickelten Fragen (siehe oben) werden die angeführ-<br />
ten Feldforschungs-Methoden angewandt.<br />
4. Ergebnisverarbeitung<br />
Die gewonnenen Ergebnisse werden für eine Gestaltung der zukünftigen<br />
Arbeitspraxis nutzbar gemacht. „Diese Verschränkung bildet den neuralgischen<br />
Punkt der Konzeptentwicklung und umfasst die Arbeitsschritte der Verdichtung, Struk-<br />
turierung und Interpretation der Daten (d.h. was bedeuten die Informationen für die Gestaltung<br />
meiner professionellen Praxis?).“ 506<br />
504 vgl. Dithmar, Ute: Sozialräumliche Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit - Erfahrungen aus der Praxis.<br />
In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung.<br />
D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur,<br />
Berlin 2007, S 193 ff<br />
505 Quelle: Dithmar (2007), S 195<br />
506 Quelle: Dithmar (2007), S 200<br />
187
Dieser Prozessabschnitt verläuft meist als krisenhafter Prozess, der zu inten-<br />
siven Auseinandersetzungen der Beteiligten führt.<br />
Nach den Ergebnissen dieser Analyse kann die Entwicklung von konkreten Konzeptionen<br />
für die Einrichtung/en und Projekte erfolgen. Diese Konzeption beinhaltet Zielorientierun-<br />
gen, Arbeitschwerpunkte und Angebote für die eigene Praxis.<br />
Aufgrund der Lebensweltanalyse kann <strong>im</strong> Rahmen der gemeinsamen Planung über Schwer-<br />
punktsetzungen und Maßnahmen in den Einrichtungen diskutiert und entschieden werden.<br />
Entscheidende Fragen für diesen Prozess lauten:<br />
Was müsste aufgrund der Analyse der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen <strong>im</strong> Stadtteil geschehen?<br />
Welche Maßnahme/Einrichtung kann welche neue Funktion und Rolle übernehmen?<br />
Welche alten Funktionen und Angebote können verändert oder evtl. abgebaut werden? Welche Rahmenbe-<br />
dingungen der Einrichtungen (z.B. Lage <strong>im</strong> Stadtteil, räumliche Ressourcen) machen welche Schwerpunktsetzung<br />
möglich? 507<br />
4.6.3 Planen und Entscheiden<br />
In einem Prozess der Synthese werden die Ergebnisse der Sozial<strong>raum</strong>analyse, die Ergebnis-<br />
se des Ist-Zustandes und die Selbsterkenntnisse der Mitarbeiter/innen zusammengeführt,<br />
miteinander abgeglichen, diskutiert und folglich als Schritt der Neukonstruktion von innovativen<br />
Zielen bzw. Handlungsorientierungen weiter gedacht und entwickelt. 508<br />
„Ziele sind Aussagen über Zustände, Handlungen und Vorgänge, die erreicht werden sollen. Ziele beziehen<br />
sich <strong>im</strong>mer auf einen festgelegten Zeit<strong>raum</strong>.“ 509<br />
Für eine Orientierung <strong>im</strong> Zuge der Zielformulierung ist die Zielpyramide von Gilles hilf-<br />
507 Quelle: Deinet/Krisch (2007), S 162<br />
508 vgl. Gilles Christoph (2007), Qualität durch Konzeptentwicklung: Die Sozial<strong>raum</strong>analyse als Basis einer<br />
innovativen Zielfindung, in: Neue Perspektiven der Sozial<strong>raum</strong>orientierung, S 176<br />
509 Quelle: Gilles (2007), S 176<br />
188
eich:<br />
Abbildung 1: Zielpyramide nach Gilles 510<br />
An der Spitze der Pyramide steht das Leitbild, das die Philosophie, das Selbstverständnis<br />
der Einrichtung und die übergeordneten Zielvorstellungen der Einrichtung(en) oder der<br />
Arbeit beschreibt.<br />
Darunter finden sich die Handlungsstandards (auch Qualitätsstandards genannt). Mit diesen<br />
werden leitende Rahmenziele oder Prinzipien beschrieben, die das gesamte Handeln der<br />
Einrichtung betreffen und dem Arbeitschwerpunkte, Handlungsziele und Angebote, sowie<br />
die Struktur zugeordnet wird.<br />
Darunter gruppieren sich die Arbeitsschwerpunkte. Hier sind die jeweiligen Aktivitäten und<br />
Angebote gebündelt.<br />
510 Quelle: Gilles, Christoph: Qualität durch Konzeptentwicklung. Die Sozial<strong>raum</strong>analyse als Basis einer innovativen<br />
Zielfindung. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung.<br />
D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche<br />
Literatur, Berlin 2007, S 177<br />
189
Die Handlungsziele formulieren die Ziele, die mit den jeweiligen Angeboten oder Aktivitä-<br />
ten erreicht werden sollen.<br />
Angebote und Projekte beschreiben die konkret umzusetzenden Vorhaben.<br />
Die Indikatoren der Zielerreichung beschreiben die festgehaltenen Ziele und dienen der<br />
Evaluation der Zielsetzungen. „Indikatoren sind Anzeiger, an denen man die Praxisumsetzung und<br />
den Erfolg, der in Leitbild, Handlungsstandards und Arbeitsschwerpunkten festgelegten Ziele erkennen und<br />
überprüfen kann. Die Ergebnisse der Evaluation erlauben Aussagen über das Ganze der pädagogischen<br />
Praxis.“ 511<br />
Eine sinnvolle Evaluation findet auf mehreren Ebenen statt. Gilles erwähnt folgende Ebe-<br />
nen, die bei einer solchen integriert sein sollen:<br />
• Auf der Strukturebene werden Indikatoren entwickelt, die eindeutig zu quantifizieren und zu mes-<br />
sen sind<br />
• Die Prozessebene beschränkt sich auf den eigentlichen pädagogischen Prozess – also das, was wäh-<br />
rend des Angebotes passieren soll<br />
• Die Wirkungsebene beschreibt, welche Erwartungen in Bezug auf die Auswirkungen der pädagogischen<br />
Arbeit über das Angebot hinaus bestehen 512<br />
4.7 Ergebnisse und Wirkungen sozialräumlicher Konzeptentwicklungsprozesse<br />
– Ein Ausblick<br />
Die Materie Jugend und öffentlicher Raum ist (wie <strong>im</strong> Zuge dieser Arbeit gezeigt) eine sehr<br />
komplexe Angelegenheit. Wie bereits festgehalten, ist DIE Lösungsmöglichkeit für ein kon-<br />
fliktärmeres Mit- oder Nebeneinander von Jugendlichen und erwachsenen Nutzer/innen<br />
oder Interessent/innen einfach nicht festzumachen. Videoüberwachung ist – abgesehen von<br />
symbolischen Versprechungen – keine wirksame Lösung, da sie vielleicht das eine oder an-<br />
dere Symptom bekämpfen kann, aber grundsätzlich abseits von (gesellschaftlichen, sozialen<br />
511<br />
Quelle: Gilles (2007), S 180<br />
512<br />
Quelle: Gilles (2007), S 180<br />
190
und räumlichen) Ursachen wirkt (oder eben nicht). Bei der Sichtung und dem Durchdenken<br />
von möglichen Lösungsansätzen, zog der sozialräumliche Ansatz meine Aufmerksamkeit<br />
auf sich. Ein wesentlicher Grund für die Entscheidung für diesen Ansatz war, dass wir es<br />
hier nicht mit einem fertigen Modell zu tun haben (das für die eine Stadt oder Situation<br />
passt und für die andere nicht), sondern dass dieser Prozess grundsätzlich überall eingesetzt<br />
werden kann, da er an der Situation und den Kompetenzen der jeweiligen Orte ansetzt. Die<br />
Prozessergebnisse erlauben also, differenzierte, an der Sozial<strong>raum</strong>struktur angepasste Ange-<br />
bote zu initiieren. Darüber hinaus profitieren auch Projektbetreiber/innen von diesen Pro-<br />
zessen: Mitarbeiter/innen erfahren mehr über die Lebenssituationen von Jugendlichen,<br />
können deren Bedürfnisse besser einschätzen und „Nicht selten geraten dabei Zielgruppen in den<br />
Blick, die vorher nicht gesehen wurden, Arbeitsschwerpunkte werden stärker auf den Bedarf zugeschnitten<br />
und einrichtungsbezogene Arbeitsweisen zugunsten einer mobilen, aufsuchenden Arbeit verändert.“ 513 Die<br />
Jugendarbeit als ‚ein Raum unter vielen’ kann hier entsprechend der Bedürfnisse und Interessen, aber auch<br />
der <strong>im</strong> Sozial<strong>raum</strong> bestehenden ‚Angebotsnischen’ ihre besondere und differenzierte Qualität’ entfalten.“ 514<br />
Schließlich kann die Jugendarbeit selbst gegenüber Dritten oder Außenstehender verständli-<br />
cher begründet werden. „Die Darlegung von konkreten Problemstellungen und Vorgängen <strong>im</strong> Bezug<br />
zum Stadtteil und der damit gegründete konzeptionelle Bezug der Jugendarbeit, führt zu einer nachvollziehbareren<br />
Beschreibung der oft schwer darstellbaren ‚offenen Jugendarbeit.“ 515<br />
Damit verändert sich auch die Bedeutung der Einrichtung und der Mitarbeiter/innen. Die<br />
Mitarbeiter/innen werden zu Sozial<strong>raum</strong>-Expert/innen, die auch für andere Einrichtungen<br />
vor Ort zu wertvollen Wissensträger/innen und –vermittler/innen werden. 516 Dies betrifft<br />
sowohl soziale Einrichtungen als auch Öffentlichkeit und politische Gremien: „Anders als<br />
zuvor, werden sie wieder als handelnde Akteure innerhalb der Kommune wahrgenommen und geachtet.“ 517<br />
Der gemeinwesenorientierte Blick der bisher standortorientierten Mitarbeiter/innen wird<br />
513<br />
Quelle: Dithmar (2007), S 211<br />
514<br />
Quelle: Deinet/Krisch (2002), S 58<br />
515<br />
Quelle: Deinet/Krisch (2002), S 59<br />
516<br />
vgl. Deinet/Krisch (2002), S 59<br />
517<br />
Quelle: Dithmar (2007), S 212<br />
191
gefördert und damit die Situation „außerhalb“ der Einrichtung wesentlich besser einge-<br />
schätzt. 518 Der Ansatz der „Sozial<strong>raum</strong>orientierung“ wird für viele erst durch den Prozess<br />
greifbar, auch wenn vorher schon (mit Elementen) sozialräumlich gearbeitet wurde. 519<br />
Schließlich erweitert der Prozess den Kontakt zu bisher unbekannten Jugendlichen. „Dies ist<br />
oft mit Anerkennung der JugendarbeiterInnen gekoppelt, was wiederum nicht nur deren Bekanntheit <strong>im</strong><br />
Stadtteil steigert, sondern auch zu vielen Anfragen über die Angebote der Einrichtung führt.“ 520 Darüber<br />
hinaus können sich die Anbieter der verschiedenen Jugendeinrichtungen aufgrund von trag-<br />
fähigen Kontakten und Kooperationen gut untereinander abst<strong>im</strong>men und müssen Heraus-<br />
forderungen nicht mehr alleine meistern, sondern können gemeinsam nach Lösungen su-<br />
chen. 521<br />
Im Gegensatz zu Maßnahmen, die vor allem die Sicherheit in den Vordergrund stellen bzw.<br />
diese vorgaukeln, also Maßnahmen, die defizitär orientiert und vom Misstrauen zwischen<br />
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen geprägt sind (und die diese Kluft nicht nur doku-<br />
mentieren, sondern auch zementieren), bietet sich mit Hilfe von sozialräumlichen Ansätzen<br />
die Chance, neue Zugänge und Partnerschaften zu schaffen und Menschen verschiedener<br />
Interessen an einen Tisch zu bringen, den einen oder anderen lange grassierenden Konflikt<br />
einer Lösung zuzuführen und schließlich auch die Interessen von Jugendlichen in ihrem<br />
Lebensumfeld – in ihrem Ort, in ihrer Stadt – abzusichern und Jugendlichen damit wieder<br />
„ganzheitliche“ Entwicklungs- und Lernchancen zu ermöglichen.<br />
518 vgl. Deinet/Krisch (2002), S 59<br />
519 vgl. Dithmar (2007), S 211<br />
520 Quelle: Deinet/Krisch (2002), S 60<br />
521 vgl. Dithmar (2007), S 213<br />
192
LITERATURVERZEICHNIS<br />
5000 Kameras überwachen Linz. In: Oberösterreichische Nachrichten, Linz 18.03.2006,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q1/m03/t18/ph/s001/002_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&datum=18.03.2006&seite=001&set=21&PHPSESSID=381081b330fc082e30e5d6de6c<br />
a33e9d<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Altvater, Elmar:: "Menschliche Sicherheit" - Entwicklungsgeschichte und politische Forderungen.<br />
Thesen zu einem umfassenden friedenspolitischen Konzept. Universität Kassel<br />
2003,<br />
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Theorie/altvater.html<br />
Abruf am 12.02.2008.<br />
Arge Daten: Polizeiliche Videoüberwachung – wenig Grund zur Euphorie, Wien 12.04.2006,<br />
http://www2.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-<br />
ARGEDATEN&s=39982svs<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Berliner Verkehrsbetriebe: Pilotversuch auf ausgewählten U-Bahnlinien. Berliner Datenschützer<br />
und BVG einigen sich auf Videoaufzeichnung. Presseaussendung vom 19. Juli 2005,<br />
http://www.bvg.de/index.php/de/Bvg/Detail/folder/301/rewindaction/Index/archive/1<br />
/id/276/name/Pilotversuch+auf+ausgew%26auml%3Bhlten+U-Bahnlinien<br />
Abruf am 14.01.2008.<br />
Bihler, Michael A.: Stadt, Zivilgesellschaft und öffentlicher Raum. Reihe Region - Nation –<br />
Europa. Lit Verlag, Münster - Hamburg – London 2004.<br />
Boers, Klaus: Möglichkeiten einer empirischen Begleitforschung der polizeilichen Videoüberwachung<br />
<strong>im</strong> Ravensberger und Roachdale Park in Bielefeld. Kr<strong>im</strong>inologisches Gutachten.<br />
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 2001,<br />
http://www.befreite-dokumente.de/eingereichte-akten/44-1-1800-1/<br />
Abruf am 12.02.2008.<br />
193
Boers, Klaus/Walburg, Christian/Reinecke, Jost: Jugendkr<strong>im</strong>inalität - Keine Zunahme <strong>im</strong> Dunkelfeld,<br />
kaum Unterschiede zwischen Einhe<strong>im</strong>ischen und Migranten. Befunde aus Duisburger<br />
und Münsteraner Längsschnittstudien. o.O. 2006,<br />
http://www.dasroteteam.de/docs/JugKr<strong>im</strong>Migr2.pdf<br />
Abruf am: 17.01.2008.<br />
Bornewasser, Manfred: Evaluation der polizeilichen Videoüberwachung öffentlicher Straßen<br />
und Plätze <strong>im</strong> Land Brandenburg – Endbericht. Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald<br />
2005. In: Landtag Brandenburg: Bericht der Landesregierung an den Landtag über die<br />
polizeiliche Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Straßen und Plätze zu präventiven<br />
Zwecken <strong>im</strong> Land Brandenburg. Drucksache 4/2347. Potsdam 2006,<br />
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w4/drs/ab%5F2300/2347.pdf<br />
Abruf am: 19.01.2008.<br />
Breitfuß, Günter/Klausberger, Werner: Das Wohnumfeld. Qualitätskriterien für Siedlungsfreiräume.<br />
Eigenverlag Breitfuß-Klausberger OEG, Linz – Vöcklabruck 1999.<br />
Bremische Bürgerschaft: Bericht des Senators für Inneres und Sport "Videoüberwachung <strong>im</strong><br />
<strong>öffentlichen</strong> Raum als Teil der Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung - Erfahrungsbericht". Mitteilung<br />
des Senats vom 12. Dezember 2005. Drucksache 16/867. Bremen 2005,<br />
http://www.bremische-buergerschaft.de/drucksachen/143/2894_1.pdf<br />
Abruf am 11.01.2008.<br />
Brünner, Christian: Sicherheitspolizeigesetz (SPG) – Novelle 2006, Graz o.J.,<br />
www.uni-graz.at/~bruenn/vo-vw-verfahren-2h/zusammenfassung-novelle-spg-06.doc<br />
Abruf am 27.02.2008<br />
Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz: , Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht.<br />
Berlin 2006,<br />
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2006/2__P<br />
eriodischer__Sicherheitsbericht/2__Periodischer__Sicherheitsbericht__Langfassung__de,templat<br />
eId=raw,property=publicationFile.pdf/2_Periodischer_Sicherheitsbericht_Langfassung_de.<br />
pdf<br />
Abruf am 13.02.2008.<br />
Bundesministerium für Inneres: Kr<strong>im</strong>inalitätsbericht. Statistik und Analyse 2005. Wien 2006,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00005/<strong>im</strong>fname_070806.pdf<br />
Abruf am 06.04.2008.<br />
194
Bundesministerium für Inneres (2008a): Sicherheitsbericht 2006. Kr<strong>im</strong>inalität 2006. Vorbeugung,<br />
Aufklärung und Strafrechtspflege. Bericht über die innere Sicherheit in Österreich. Wien<br />
2008,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/<strong>im</strong>fname_100251.pdf<br />
Abruf am 03.04.2008.<br />
Bundesministerium für Inneres (2008b): Kr<strong>im</strong>inalitätsbericht Statistik und Analyse 2006. Wien<br />
2008,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/III/III_00114/<strong>im</strong>fname_100252.pdf<br />
Abruf am 03.04.2008.<br />
Bundesministerium für Inneres (2008c): Kr<strong>im</strong>inalstatistik des BM.I für das Jahr 2007, Wien 2008,<br />
http://www.bmi.gv.at/downloadarea/kr<strong>im</strong>stat/2007/Jahresstatistik_2007.pdf<br />
Abruf am 04.04.2008<br />
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz: 4. Bericht zur Lage<br />
der Jugend in Österreich. Teil A: Jugendradar 2003. Wien, 2003<br />
Dangschat, Jens S./Frey, Oliver: Stadt- und Regionalsoziologie. In: Kessl, Fabian/Reutlinger,<br />
Christian/Maurer, Susanne/Frey, Oliver (Hrsg.): Handbuch Sozial<strong>raum</strong>. VS Verlag für Sozialwissenschaften,<br />
Wiesbaden 2005<br />
Datenschutzkommission: Datenschutzbericht 2005 - 2007, Wien 2007<br />
http://www.dsk.gv.at/Datenschutzbericht2007.pdf<br />
Abruf am 19.02.2007<br />
Datenschutzkommission: Videoüberwachung <strong>im</strong> privaten Bereich. Wien o.J.<br />
http://www.dsk.gv.at/faq_de/faqd_video_allgemein.htm<br />
Abruf am 19.02.2007<br />
Deinet, Ulrich: Die Sozial<strong>raum</strong>debatte in der Jugendhilfe. In: Deinet Ulrich/Krisch Richard<br />
(Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung<br />
und Qualifizierung. Leske + Budrich, Opladen 2002, S 13 – 30.<br />
Deinet, Ulrich/Krisch, Richard: Sozialräumliche Konzeptentwicklung als Projekt: Schritte und<br />
Modelle. In: Deinet Ulrich/Krisch Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit.<br />
Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung. Leske + Budrich,<br />
Opladen 2002, S 45 – 60.<br />
195
Deinet, Ulrich: Aneignung und Raum - sozialräumliche Orientierungen von Kindern und Jugendlichen.<br />
In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in<br />
der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und<br />
T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 44 – 63.<br />
Deinet, Ulrich/Krisch,Richard: Der „sozialräumliche“ Blick der Kinder- und Jugendarbeit. In:<br />
Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung.<br />
D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für<br />
wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 148 - 165.<br />
Dithmar, Ute: Sozialräumliche Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit - Erfahrungen aus<br />
der Praxis. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in<br />
der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl., Frank und<br />
T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 186 - 214.<br />
Dittmann, Jörg: Kr<strong>im</strong>inalitätsfurcht sinkt in Deutschland entgegen dem EU-Trend. In: Zentrum<br />
für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA): ISI 34, Informationsdienst Soziale Indikatoren,<br />
Ausgabe 34, , Mannhe<strong>im</strong> 2005, S 6 – 9,<br />
http://www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/ISI/pdf-files/isi-34.pdf<br />
Dummreicher, Heidi/Kolb, Bettina: Sieben Thesen zur Qualität der Stadt. Öffentlicher Raum als<br />
Erlebens<strong>raum</strong>. Universität Wien, Wien 2000<br />
http://www.univie.ac.at/OEGS-Kongress-2000/On-line-Publikation/kolb.pdf<br />
Abruf am: 19.04.2008<br />
Dünkel, Frieder/Gebauer, Dirk/Geng, Bernd: Gewalterfahrungen, gesellschaftliche Orientierungen<br />
und Risikofaktoren von Jugendlichen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald<br />
1998 - 2002 – 2006. Erste zentrale Ergebnisse einer Langzeitstudie zur Lebenssituation und<br />
Delinquenz von Jugendlichen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Ernst-<br />
Moritz-Arndt Universität, Greifswald 2007<br />
http://www.rsf.unigreifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/duenkel/Schuelerbefragung_HGW_1998_2002<br />
_2006.pdf<br />
Abruf am: 07.03.2008.<br />
Ellrich, Lutz: Gefangen <strong>im</strong> Bild? "Big Brother" und die gesellschaftliche Wahrnehmung der<br />
Überwachung. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp<br />
Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 35 – 50.<br />
196
Fahndungserfolge durch Videoüberwachung. In: Orf online, Linz 24.10.2007,<br />
http://ooe.orf.at/stories/230891/<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Floeting, Holger: Sicherheitstechnologien und neue urbane Sicherheitsreg<strong>im</strong>es. Ita manu:script,<br />
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2006,<br />
http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-manuscript/ita_06_05.pdf<br />
Abruf am 12.03.2008.<br />
Franck, Georg: Werben und Überwachen. Zur Transformation des städtischen Raums. In:<br />
Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am<br />
Main 2005, S 141 – 155.<br />
Frey, Oliver: Urbane öffentliche Räume als Aneignungsräume. Lernorte eines konkreten Urbanismus?.<br />
In: Deinet, Ulrich/Reutlinger, Christian (Hrsg.): "Aneignung" als Bildungskonzept<br />
der Sozialpädagogik, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, S 219 – 242.<br />
Friis, Roland: Das Wichtigste zum Jugendstrafrecht. Wien o.J.,<br />
http://www.strafverteidiger-friis.at/DAS-WICHTIGSTE-ZUM-<br />
JUGENDSTRAFRECHT/DAS-WICHTIGSTE-ZUM-JUGENDSTRAFRECHT.pdf<br />
Abruf am 22.03.2008.<br />
Fuchs, Walter: Zwischen Deskription und Dekonstruktion: Empirische Forschung zur Jugendkr<strong>im</strong>inalität<br />
in Österreich von 1968 bis 2005. Eine Literaturstudie. irks working paper<br />
no 5, Wien 2007,<br />
http://www.irks.at/downloads/05_irks-fuchs.pdf<br />
Abruf am: 05.04.2008.<br />
Funk, Bernd-Christian: Schutzzonen und Bildaufzeichnung - Sicherheits-Placebo oder<br />
Dammbruch zum Überwachungsstaat?. In: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Sicherheit<br />
<strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz 2006, S 10 – 21.<br />
Gill, Martin/Spriggs, Angela: Assessing the <strong>im</strong>pact of CCTV. Home Office Research Study<br />
292. Home Office Research, Development and Statistics Directorate, London 2005,<br />
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf<br />
Abruf am: 14.12.2007.<br />
197
Gilles, Christoph: Qualität durch Konzeptentwicklung. Die Sozial<strong>raum</strong>analyse als Basis einer<br />
innovativen Zielfindung. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue<br />
Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung. 2. Aufl.,<br />
Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 166 – 185<br />
Glatzner, Florian: Die Staatliche Videoüberwachung des <strong>öffentlichen</strong> Raumes als Instrument<br />
der Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung. Magisterarbeit, Münster 2006,<br />
www.foebud.org/video/magisterarbeit-florian-glatzner.pdf<br />
Abruf: 14.12.2007.<br />
Gohde-Ahrens, Rixa: Jugendliche <strong>im</strong> städtischen Frei<strong>raum</strong> und ihre Berücksichtigung in der<br />
räumlichen Planung. Ermittlung von Frei<strong>raum</strong>ansprüchen Jugendlicher <strong>im</strong> Hamburger<br />
Stadtteil Wilhelmsburg. Schriftenreihe des Fachbereiches Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung<br />
der Universität Hannover, Hannover 1998.<br />
Gras, Marianne: Überwachungsgesellschaft. Herausforderung für das Recht in Europa. In:<br />
Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am<br />
Main 2005, S 293 - 307.<br />
Handler, Veronika: Ursachen des Vandalismus – psychologisch betrachtet. In: Gendarmerie<br />
aktiv, Wien 2004,<br />
http://www.gendarmerie-aktiv.at/zeitung/200404_vandalismus.html<br />
Abruf: 12.04.2008.<br />
Heinzelmaier, Bernhard: Jugend unter Druck: Das Leben der Jugend in der Leistungsgesellschaft<br />
und die Krise der Partizipation in der Ära des posttraditionellen Materialismus. E-<br />
Papier, Wien 2007,<br />
http://www.<strong>jugend</strong>kultur.at/Leistungsdruck%20Report_2007_<strong>jugend</strong>kultur.at.pdf<br />
Abruf: 16.12.2007.<br />
Helten, Frank: Reaktive Aufmerksamkeit. Videoüberwachung in Berliner Shopping Malls. In:<br />
Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am<br />
Main 2005, S 156 - 173.<br />
Hempel, Leon/Metelmann, Jörg: Bild – Raum – Kontrolle. Videoüberwachung als Zeichen gesellschaftlichen<br />
Wandels. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle.<br />
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 9 – 21.<br />
198
Hempel, Leon/Alisch Christian: Evaluation der 24-Stunden Videoaufzeichnung in U-<br />
Bahnstationen der Berliner Verkehrsbetriebe(BVG); Zwischenbericht. D:4 BaSE/Büro für<br />
angewandte Statistik und Evaluation, Berlin 2006,<br />
http://berlin.humanistischeunion.de/fileadmin/hu_upload/berlin/2007/04_Evaluationsbericht.pdf<br />
Abruf: 21.02.2008.<br />
Hempel, Leon: Zur Evaluation von Videoüberwachung. In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance<br />
Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag Barbara Budrich, Opladen &<br />
Farmington Hills 2007, S 117 - 147<br />
Heinz, Wolfgang: Jugendkr<strong>im</strong>inalität in Deutschland. Kr<strong>im</strong>inalstatistische und kr<strong>im</strong>inologische<br />
Befunde. Aktualisierte Ausgabe Juli 2003. Universität Konstanz, Konstanz 2003,<br />
http://www.uni-konstanz.de/rtf/kik/Jugendkr<strong>im</strong>inalitaet-2003-7-e.pdf<br />
Abruf am 16.02.2008.<br />
Herlyn, Ulfert/Seggern, Hille/Heinzelmann, Claudia/Karow, Daniela: Jugendliche in <strong>öffentlichen</strong><br />
Räumen der Stadt. Leske+Budrich, Opladen 2003<br />
Hill, Burkhard: "Musik-Machen" in Gleichaltrigengruppen als sozialpädagogisches Angebot.<br />
Siegen o.J.,<br />
http://www.musiktherapie.uni-siegen.de/forum/<strong>jugend</strong>liche/vortraege/31hill.pdf<br />
Abruf am 17.04.2008.<br />
House of Lords: Fifth Report. Digital Images as Evidence. Committee on Science and Technology,<br />
London 1998,<br />
http://www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/064v/st0506.htm#a24<br />
Abruf am 19.02.2008.<br />
Jesionek, Udo: Reaktionen auf entwicklungsbedingte Straffälligkeit junger Menschen. In: Cizek,<br />
Brigitte/Schipfer, Karl (Hrsg.): Zwischen Identität und Provokation. Das Spannungsfeld<br />
Jugendliche - Erwachsenwerden – Familie. Dokumentation des Symposiums Familie in<br />
Wissenschaft und Praxis. 20. – 22. November 2002, Strobl am Wolfgangsee. ÖIF Materialien<br />
Heft 19, Wien 2004, S 35 - 40<br />
199
Kania, Harald: Kr<strong>im</strong>inalitätsvorstellungen in der Bevölkerung - Eine qualitative Analyse von<br />
Alltagsvorstellungen und -theorien über Kr<strong>im</strong>inalität, Inaugural-Dissertation zur Erlangung<br />
der Doktorwürde der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Albert-<br />
Ludwigs-Universität, Freiburg <strong>im</strong> Breisgau 2004<br />
http://www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/3595/pdf/071125_Diss_Kania_Veroeffentlichungsfassung.pdf<br />
Abruf am 23.03.2008.<br />
Kammerer, Dietmar: "Are you dressed for it?" Der Mythos der Videoüberwachung in der visuellen<br />
Kultur. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp<br />
Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 91 – 105.<br />
Ketzer, Christine: Securitas ex Machina. Von der Bedeutung technischer Kontroll- und Überwachungssysteme<br />
für Gesellschaft und Pädagogik, Inauguraldissertation zur Erlangung des<br />
Doktorgrades der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Köln<br />
2005,<br />
http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=982095422&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=982095422.pdf<br />
Abruf am 07.12.2007.<br />
Klauser, Francisco: Raum = Energie + Information. Videoüberwachung als Raumaneignung.<br />
In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt<br />
am Main 2005, S 189 - 203.<br />
Klocke, Gabriele: Vom Hintertürchen des Nichtwissens. Was Regensburger BürgerInnen über<br />
die Videoüberwachung in ihrer Stadt wissen und denken. In: Bürgerrechte und Polizei/CILIP,<br />
Berlin 2001,<br />
http://www.cilip.de/ausgabe/69/video.htm<br />
Abruf am 09.12.2007.<br />
Klosinski, Gunther: Pubertät heute. Lebenssituationen – Konflikte – Herausforderungen. Kösel-Verlag,<br />
München 2004.<br />
Kniebeler, Markus: Nach sechs Jahren endet die polizeiliche Videoüberwachung in Rathenow.<br />
In: Märkische Allgemeine, Potsdam 13.11.2007,<br />
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11064175/61759/#http://www.maerk<br />
ischeallgemeine.de/cms/beitrag/11064175/61759/%23<br />
Abruf am 23.01.2008.<br />
200
Krafeld, Franz Josef: Jungen und Mädchen in Cliquen. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt<br />
(Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften,<br />
Wiesbaden 2005, S 71 – 77.<br />
Krasmann, Susanne: Mobilität: Videoüberwachung als Chiffre einer Gouvernementalität der<br />
Gegenwart. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag,<br />
Frankfurt am Main 2005, S 308 – 324.<br />
Krempl, Stefan: Hauchdünne Mehrheit für Verschärfung des Berliner Polizeigesetzes. In: Heise<br />
online, Hannover 22.11.2007,<br />
http://www.heise.de/newsticker/meldung/99443<br />
Abruf am 27.01.2008.<br />
Krisch, Richard: Methoden der sozialräumlichen Konzeptentwicklung. In: Deinet, Ulrich/Krisch<br />
Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Leske+Budrich, Opladen 2002,<br />
S 87 – 154.<br />
Kubera, Thomas: Videoschutz Bielefeld, Gütersloh o.J.,<br />
http://www.thomas-kubera.de/videoschutz.htm<br />
Abruf am 12.01.2008.<br />
Kunnert, Gerhard: Big Brother in U-Bahn, Bus und B<strong>im</strong>. Videoaufzeichnungen in <strong>öffentlichen</strong><br />
Verkehrsmitteln aus datenschutzrechtlicher Sicht, In: Juridikum 2006/1. Der gläserne<br />
Mensch. Verlag Österreich, Wien 2006, S 42 – 50,<br />
http://www.verlagoesterreich.at/pdf/voe/magazine/juridikum/200601/09.pdf<br />
Abruf: 12.03.2008.<br />
Kuratorium für Verkehrs<strong>sicherheit</strong>: Krankheit und Einbrüche machen Angst, Wien 2007<br />
http://www.kfv.at/index.php?id=1007<br />
Abruf am 28.12.2007.<br />
Kurzid<strong>im</strong>, Michael: Kameras erkennen Kr<strong>im</strong>inelle – nicht. In: Spiegel online, Hamburg<br />
12.07.2007<br />
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,493769,00.html<br />
Abruf am 24.02.2008<br />
201
Land Brandenburg (2006a): Schönböhm: Videoüberwachung hat sich in Brandenburg bewährt.<br />
Presseaussendung des Ministerium des Innern Brandenburg, Potsdam 26.01.06,<br />
http://www.lds-bb.de/sixcms/detail.php?id=245916<br />
Abruf am 17.02.2008.<br />
Land Brandenburg (2006b): Kabinett beschließt Änderung des Polizeigesetzes. Presseaussendung<br />
der Staatskanzlei, Potsdam 26.09.2006<br />
http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.370364.de<br />
Abruf am 17.02.2008.<br />
Landespolizeikommando Oberösterreich: Videoüberwachung Linz Hinsenkampplatz in Betrieb,<br />
Presseaussendung vom 4. September 2006,<br />
http://www.bundespolizei.gv.at/lpdreader/lpd_news_standard.aspx?id=65546B4471364B2<br />
B4C486B3D&inc=ooe<br />
Abruf am 19.02.2008.<br />
Landtag Brandenburg: Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 788 des Abgeordneten<br />
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, Drucksache 4/2057, Potsdam 2005<br />
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w4/drs/ab_2000/2057.pdf<br />
Abruf am 18.02.2008.<br />
Laninger, Tanja: Videokameras in U-Bahn bringen keine Sicherheit. In: Berliner Morgenpost,<br />
Berlin 16.10.2007,<br />
http://www.morgenpost.de/desk/1268075.html<br />
Abruf am 17.01.2008<br />
Legnaro, Aldo: Aus der Neuen Welt: Freiheit, Furcht und Strafe als Trias der Regulation, Berlin<br />
2000,<br />
http://www.isip.uni-hamburg.de/04%20Texte/AL%20Trias.htm<br />
Abruf am 29.12.2007.<br />
Leopold, Nils: Rechtskulturbruch. Die Ausbreitung der Videoüberwachung und die unzulängliche<br />
Reaktion des Rechts. In: Hempel, Leon/Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-<br />
Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, S 273 - 292.<br />
202
Liebentritt, Sabine: Erwachsen werden heute - ein harter Job, In: Nichts passt. Fachreader zur<br />
Gewaltprävention in der Arbeit mit Jugendlichen. EfEU, Friedensbüro Salzburg, koje, Wien<br />
– Salzburg - Bregenz 2002,<br />
http://www.efeu.or.at/seiten/download/fachreader.pdf<br />
Abruf am: 19.11.2007.<br />
Lietz, Haiko: Videoüberwachung: Sicherheit oder Scheinlösung. In: Telepolis, München<br />
06.07.2004,<br />
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/17/17813/1.html<br />
Abruf am: 19.01.2008<br />
Lin, Chen-Yu: Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland<br />
- Ein Drei-Länder-Vergleich. Dissertation zur Erlangung des sozialwissenschaftlichen<br />
Doktorgrades der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen<br />
, Göttingen 2006,<br />
http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2006/lin/lin.pdf<br />
Abruf am 04.01.2008.<br />
Lindner, Werner: "Prävention" in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ein Nachruf zu<br />
Lebzeiten. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und<br />
Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 254 - 262.<br />
Löw, Martina: Einstein, Techno und der Raum. Überlegungen zu einem neuen Raumverständnis<br />
in den Sozialwissenschaften. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold<br />
(Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung.<br />
2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 9 –<br />
22.<br />
Löw, Martina/Steets, Silke/ Stoetzer, Sergej: Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie, Verlag<br />
Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2008.<br />
Lüders, Sven (2007a): Videoüberwachung in den U-Bahnen bringt keinen Sicherheitsgewinn.<br />
Humanistische Union, Berlin 08.10.2007,<br />
http://berlin.humanistischeunion.de/themen/videoueberwachung/videoueberwachung_detail/back/videoueberwachung-<br />
1/article/videoueberwachung-in-den-u-bahnen-bringt-keinen-<strong>sicherheit</strong>sgewinn/<br />
Abruf am 13.01.2008.<br />
203
Lüders, Sven (2007b): Nicht überall, wo Sicherheit draufsteht, ist auch Sicherheit drin, Humanistische<br />
Union, Berlin 29.11.2007,<br />
http://berlin.humanistischeunion.de/themen/videoueberwachung/videoueberwachung_detail/back/videoueberwachung-<br />
1/article/nicht-ueberall-wo-<strong>sicherheit</strong>-draufsteht-ist-auch-<strong>sicherheit</strong>-drin/<br />
Abruf am 13.01.2008.<br />
Maier, Johann (Abg. z. NR): Anfrage an die Bundesministerin für Inneres betreffend „Videoüberwachung<br />
in Österreich“. Parlamentarische Materialien 4727/J XXII. GP, Wien<br />
19.09.2006,<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXII/J/J_04727/<strong>im</strong>fname_069890.pdf<br />
Abruf am 10.02.2008.<br />
Maier, Johann (Abg. z. NR): Anfrage an den Bundesminister für Inneres betreffend „Videoüberwachung<br />
in Österreich“. Parlamentarische Materialien 3108/J XXIII. GP, Wien<br />
10.01.2008,<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXIII/J/J_03108/<strong>im</strong>fname_097431.pdf<br />
Abruf am 10.02.2008<br />
Mayr, Johann, Stadtrat: Schreiben an Bundesministerin Liese Prokop betreffend Auskunft<br />
über Videoüberwachung in Linz, 19.August 2005, <strong>im</strong> Besitz des Verfassers<br />
Möller, Claudia: Videoschutz <strong>im</strong> Ravensberger Park - Projektarbeit zur Videoüberwachung<br />
<strong>im</strong> <strong>öffentlichen</strong> Raum, o.O. o.J.,<br />
http://www.thomas-kubera.de/auszuege01.htm#M%F6ller<br />
Abruf am 12.01.2008.<br />
Mörth, Ingo/Baum, Doris (Hrsg.): Gesellschaft und Lebensführung an der Schwelle zum neuen<br />
Jahrtausend. Gegenwart und Zukunft der Erlebnis-, Risiko-, Informations- und Weltgesellschaft.<br />
Referate und Arbeitsergebnisse aus dem Seminar "Soziologische Theorie" WS<br />
1999/2000. Johannes Kepler Universität, Linz 2000,<br />
http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/STSGesellschaft.pdf<br />
Abruf am 29.10.2007.<br />
204
Müller, Henning Ernst: Zur Kr<strong>im</strong>inologie der Videoüberwachung. Humanistische Union, Berlin<br />
2003<br />
http://www.humanistischeunion.de/themen/innere_<strong>sicherheit</strong>/<strong>sicherheit</strong>_vor_freiheit/mueller/<br />
Abruf am 19.01.2008.<br />
Müller, Mathias:, Jungenleben – Männerwelten. In: Männer gegen Männergewalt (Hrsg.): Handbuch<br />
der Gewaltberatung, OLE-Verlag, Hamburg 2002.<br />
Norris, Clive/Armstrong, Gary: Smile, you 're on camera. Flächendeckende Videoüberwachung<br />
in Großbritannien. In: Bürgerrechte & Polizei/CILIP, Berlin 1998,<br />
http://www.cilip.de/ausgabe/61/norris.htm<br />
Abruf am 09.12.2007.<br />
Norris, Clive: Vom Persönlichen zum Digitalen. Videoüberwachung, das Panopticon und die<br />
technologische Verbindung von Verdacht und gesellschaftlicher Kontrolle. In: Hempel, Leon/Metelmann,<br />
Jörg (Hrsg.): Bild-Raum-Kontrolle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main<br />
2005, S 360-401.<br />
Novak, Sabine (2006a): Videokameras in Linzer Altstadt erst mit Verzögerung in Betrieb. In:<br />
Oberösterreichische Nachrichten, Linz 15.03.06,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q1/m03/t15/ph/s025/001_001.dcs&ausgabe=H:<br />
Hauptausgabe&datum=15.03.2006&seite=025&set=21<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Novak, Sabine (2006b): Nur noch halb so viele Rauferein in Altstadt. In: Oberösterreichische<br />
Nachrichten, Linz 27.07.2006,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2006/q3/m07/t27/ph/s024/001_001.dcs&ausgabe=H:Hauptausgabe&datum=27.07.2006&seite=024&set=5&PHPSESSID=d79e54d362def8b0b5dee8d786d<br />
d6317<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Nüß, Sandra: Projektmanagement. In: Schubert, Herbert (Hrsg.): Sozialmanagement. Zwischen<br />
Wirtschaftlichkeit und fachlichen Zielen. 2. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften,<br />
Wiesbaden 2005<br />
205
Oelemann, Burkhard: Vater Morgana oder: "Neue" Väterlichkeit, die ungestillte Sehnsucht.<br />
Gewaltberatung Hamburg, Hamburg 2002,<br />
http://www.gewaltberatunghamburg.org/mgm2007/<strong>im</strong>ages/stories/pdf/_vatermorgana.pdf<br />
Abruf am 15.12.2007<br />
Oelemann, Burkhard: "Cool, aber einsam ... Wie Jungen ihr Leben erleben. Forum Intervention,<br />
o.O. 2003,<br />
http://www.eduhi.at/dl/Cool_aber_einsam.pdf<br />
Abruf am 15.12.2007<br />
Ortmann, Norbert: Methoden der Erkundung von Lebenswelten. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker,<br />
Benedikt (Hrsg.): Konzepte entwickeln. Anregungen und Arbeitshilfen zur<br />
Klärung und Legit<strong>im</strong>ation. Juventa Verlag, Weinhe<strong>im</strong> und München 1996, S 26 - 34<br />
Österreichischer Gemeindebund: Vandalismus n<strong>im</strong>mt stark zu. Presseaussendung, Wien 10.08.<br />
2007,<br />
http://www.gemeindebund.at/news.php?id=432<br />
Abruf am 19.10.2007.<br />
Österreichisches Institut für Jugendforschung: Jugend und Gewalt: Gewalt innerhalb und außerhalb<br />
der Schule. Wien 2006<br />
http://www.oeij.at/site/article_list.siteswift?so=all&do=all&c=download&d=article%3A1<br />
86%3A1<br />
Abruf: 29.10.2007.<br />
Platter, Günter: Anfragebeantwortung an die Präsidentin des Nationalrates Barbara Prammer.<br />
GZ: BMI-LR2220/0911-II/2/a/2008, Wien 07.03.2008,<br />
http://www.parlinkom.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_03124/<strong>im</strong>fname_102913.pdf<br />
Abruf am: 16.04.2008.<br />
Polizei Bayern: Polizeidirektion Regensburg: Videoüberwachung in Regensburg. Regensburg<br />
o.J.<br />
http://www.polizei.bayern.de/content/3/1/3/3/1/video_berwachung_regensburg.pdf<br />
Abruf am: 04.02.2008.<br />
206
Polizei Bayern: Videoüberwachung in Regensburg. Presseaussendung, Regensburg 10.01.2008<br />
http://www.polizei.bayern.de/niederbayern/regensburg/schuetzenvorbeugen/kr<strong>im</strong>inalitaet<br />
/index.html/31331<br />
Abruf am: 04.02.2008.<br />
Prokop, Liese: Anfragebeantwortung an die Präsidentin des Nationalrates. GZ: BMI-<br />
LR2220/0321-II/2/a/2006, Wien 16.11.2006,<br />
http://www.parlinkom.gv.at/PG/DE/XXII/AB/AB_04659/<strong>im</strong>fname_070617.pdf<br />
Abruf am: 19.02.2008.<br />
Polizeiliche Kr<strong>im</strong>inalprävention der Länder und des Bundes: Hauptsache kaputt?, Stuttgart o.J.,<br />
http://www.polizeiberatung.de/vorbeugung/<strong>jugend</strong>kr<strong>im</strong>inalitaet/taeter_von_vandalismus/fakten/<br />
Abruf am 27.09.2007.<br />
Püschel, Hannes: Einführung und Etablierung der Videoüberwachung in Brandenburg, Köln<br />
2007,<br />
http://www.linksnet.de/artikel.php?id=3322<br />
Abruf am 12.03.2008.<br />
Quintessenz: Von NSA zu Wiener Cops, Wien 31.12.2005<br />
http://www.quintessenz.at/d/000100003453<br />
Abruf am 17.02.2008.<br />
Reutlinger, Christian: Sozialpädagogische Räume - sozialräumliche Pädagogik. Chancen und<br />
Grenzen der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. In: Deinet, Ulrich/Gilles, Christoph/Knopp, Reinhold<br />
(Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozial<strong>raum</strong>orientierung. D<strong>im</strong>ensionen – Planung – Gestaltung.<br />
2. Aufl., Frank und T<strong>im</strong>me Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2007, S 23<br />
- 43.<br />
Republik Österreich: Bundesgesetzblatt, 151. Bundesgesetz: SPG-Novelle 2005<br />
http://ris1.bka.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=html&docid=COO<br />
_2026_100_2_137404<br />
Abruf am 27.03.2008.<br />
207
Rogalla, Thomas: Polizei filmt künftig in der U-Bahn. Gesetzesänderung für mehr Videoüberwachung.<br />
In: Berliner Zeitung, Berlin 10.10.2007,<br />
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2007/1010/lokales/0073/index.html?group=berlinerzeitung&sgroup=&day=today&suchen=1&keywords=bvg&search_in=archive&author=&res<br />
sort=&von=09.10.2007&bis=11.10.2007<br />
Abruf am 19.01.2008<br />
Scherr, Albert: Benötigt sozialräumliche Konzeptentwicklung Theorien? In: Deinet Ulrich/Krisch<br />
Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine<br />
zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung. Leske + Budrich, Opladen 2002, S 61 –<br />
68.<br />
Schröder, Ach<strong>im</strong>: Jugendliche. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene<br />
Kinder- und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden<br />
2005, S 89 - 97.<br />
Schubert, Herbert: Städtischer Raum und Verhalten - Zu einer integrierten Theorie des <strong>öffentlichen</strong><br />
Raumes. Leske+Budrich, Opladen 2000.<br />
Schulz, Felix: Jugendkr<strong>im</strong>inalität. o.O. o.J.,<br />
http://www.kr<strong>im</strong>lex.de/artikel.php?BUCHSTABE=J&KL_ID=93<br />
Abruf am 02.04.2008.<br />
Sielert, Uwe: Jungen. In: Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder-<br />
und Jugendarbeit. 3. Aufl., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S 65 -<br />
71.<br />
Sika, Michael: Sicherheit hat Vorrang. In: Bundesministerium für Inneres (Hrsg): Videoüberwachung<br />
zu <strong>sicherheit</strong>s- und kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Zwecken. Schriftenreihe BM.I. – Band 3,<br />
BMI-KSÖ-Enquete: 23. Juni 2004. Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2004, S 7.<br />
Singelnstein, Tobias/Stolle, Peer: Von der sozialen Integration zur Sicherheit durch Kontrolle<br />
und Ausschluss. In: Zurawski Nils (Hrsg.): , in: Surveillance Studies, Perspektiven eines Forschungsfeldes.<br />
Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, 2007, S 47 – 66.<br />
208
Soklov, Daniel: Videoüberwachung in Österreich kommt mit Salamitaktik. In: heise online,<br />
Hannover 13.04.2007,<br />
http://www.heise.de/newsticker/Videoueberwachung-in-Oesterreich-kommt-mit-<br />
Salamitaktik--/meldung/88186<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Stadtforschung Linz: Analyse Bürgerbefragung 2004, Linz 2005<br />
http://www.linz.at/zahlen/110%5FForschungsprojekte/BBef2004.pdf#xml=?cmd=pdfhit<br />
s&DocId=3213&Index=d%3a%5cdaten%5cdt%2dsearch%5cwebserver%5clinz%5fde&Hi<br />
tCount=74&hits=187+1f7+292+30f+355+39a+3df+42a+46f+4bd+5b9+63a+6c1+740+<br />
79d+7f0+875+8f2+975+9c6+a4a+ac9+b4d+bcd+c2d+c7e+d0c+d5f+db4+e0f+e84+ea8<br />
+ee1+f23+f90+1010+107b+10b1+10e1+1117+1147+117d+11ae+11e6+12b9+131c+13<br />
79+13db+143a+149c+1500+157b+15a4+15c7+15e8+162d+1685+16d7+1731+1786+17<br />
b7+17f1+182c+189f+18df+1919+1963+198c+19c2+19f3+1a28+1a55+1a70+1a88+&hc<br />
=2018&req=stadtforschung%26<br />
Abruf am 21.11.2007.<br />
Steinhauser, Albert/Abg. z. NR: Entschließungsantrag. Parlamentarische Materialien,<br />
528/A(E) XXIII.GP, Wien 06.12.2007<br />
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/A/A_00528/<strong>im</strong>fname_094165.pdf<br />
Abruf am 23.01.2008.<br />
Studie: Videoüberwachung in Berliner U-Bahn brachte keinen Sicherheitsgewinn. In: Telepolis,<br />
Hannover 09.10.07,<br />
http://www.heise.de/newsticker/meldung/97141<br />
Abruf am 27.01.2008.<br />
Rötzer, Florian: Videoüberwachung reduziert Kr<strong>im</strong>inalität nicht. In: Telepolis, München<br />
25.02.2005,<br />
http://www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/19/19543/1.html&burl<br />
=/tp/r4/artikel/19/19543/1.html&words=Gill&T=gr%E4bner<br />
Abruf am 08.02.2008.<br />
Tessin Wulf: , Frei<strong>raum</strong> und Verhalten. Soziologische Aspekte der Nutzung und Planung<br />
städtischer Freiräume. Eine Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden<br />
2004.<br />
209
Töpfer, Eric: Videoüberwachung - Eine Risikotechnologie zwischen Sicherheitsversprechen<br />
und Kontrolldystopien. In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven eines<br />
Forschungsfeldes. Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 33 – 46.<br />
Tschemer, Marlies: Ansfeldner Jugendstudie, Erstauswertung der Rohdaten, Johannes Kepler<br />
Universität, Linz 2006, <strong>im</strong> Besitz des Verfassers<br />
van Elsbergen Gilbert (2007), Kr<strong>im</strong>inologische Implikationen der Videoüberwachung. In:<br />
Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes. Verlag<br />
Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 103 - 116.<br />
Veil, Katja: Raumkontrolle. Videokontrolle und Planung für den <strong>öffentlichen</strong> Raum, Diplomarbeit<br />
<strong>im</strong> Rahmen des Studiums der Stadt- und Regionalplanung an der Technischen<br />
Universität Berlin, Berlin 2001,<br />
http://de.geocities.com/veilkatja/<br />
Abruf am 19.12.2007.<br />
Videokameras schrecken ab. In: Oberösterreichische Nachrichten, Linz 21.05.2007,<br />
http://www.nachrichten.at/archiv?query=shlyc:client/ooen/ooen/textarch/j2007/q2/m05/t21/ph/s021/001_001.dcs&ausgabe=H:<br />
Hauptausgabe&datum=21.05.2007&seite=021&set=2<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Videoüberwachung in Linz startet. In: ORF online, Linz 14.03.2006,<br />
http://ooe.orf.at/stories/95528/<br />
Abruf am 09.01.2008.<br />
Webinger, Peter: Antwortschreiben an Mayr Johann. Bundesministerium für Inneres. Kabinett<br />
der Bundesministerin. GZ 36005/27-KBM/05. Wien 06. 09 2005. Im Besitz des Verfassers.<br />
Wehrhe<strong>im</strong>, Jan: Technische Konstruktion urbaner Ordnung. In: Menzel, Birgit/Ratzke, Kerstin<br />
(Hrsg.): Grenzenlose Konstruktivität? Standortbest<strong>im</strong>mung und Zukunftsperspektiven konstruktivistischer<br />
Theorien abweichenden Verhaltens. BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität,<br />
Oldenburg 2006, S 243 – 265.<br />
http://docserver.bis.unioldenburg.de/publikationen/bisverlag/2006/mengre06/pdf/mengre06.pdf<br />
210
Weilbacher, Jan C.: Die Kameras werden wieder abgeschaltet. Märkische Oberzeitung, Frankfurt<br />
(Oder) 03.08.2007<br />
http://www.moz.de/index.php/Moz/Article/category/Bernau/id/195489<br />
Abruf am 19.01.2008<br />
Welsh, Brandon C./Farrington, David P.: Cr<strong>im</strong>e prevention effects of closed circuit television: a<br />
systematic review, Home Office Research Study 252. Home Office Research, Development<br />
and Statistics Directorate, London 2002,<br />
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/hors252.pdf<br />
Abruf am 11.01.2008.<br />
Wetz, Andreas: "Boom bei Spionagekameras". Die Presse, Wien 19.10.2007<br />
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/338173/index.do<br />
Abruf am 14.03.2008.<br />
Wiebke, Steffen: Junge Intensivtäter -kr<strong>im</strong>inologische Befunde. Bayrisches Landeskr<strong>im</strong>inalamt,<br />
München 2003,<br />
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/kr<strong>im</strong>i/DVJJ/Aufsaetze/Steffen2003.pdf<br />
Abruf am 24.11.2007.<br />
Wiebke, Steffen: Jugendkr<strong>im</strong>inalität und ihre Verhinderung zwischen Wahrnehmung und empirischen<br />
Befunden. Gutachten zum 12. Deutscher Präventionstag am 18. und 19. Juni 2007<br />
in Wiesbaden. o.O. 2007,<br />
http://www.praeventionstag.de/html/GetDokumentation.cms?XID=227<br />
Abruf am 22.11.2007.<br />
Windzio, Michael/S<strong>im</strong>onson, Julia/Pfeiffer, Christian/Kle<strong>im</strong>ann, Matthias: Kr<strong>im</strong>inalitätswahrnehmung<br />
und Punitivität in der Bevölkerung - Welche Rolle spielen die Massenmedien? Ergebnisse<br />
der Befragungen zu Kr<strong>im</strong>inalitätswahrnehmung und Strafeinstellungen 2004 und<br />
2006. Kr<strong>im</strong>inologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, Hannover 2007,<br />
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb103.pdf<br />
Abruf am 27.04.2008.<br />
211
Zentrale Geschäftsstelle Polizeiliche Kr<strong>im</strong>inalprävention der Länder und des Bundes: Städtebau und<br />
Kr<strong>im</strong>inalprävention. Eine Broschüre für die planerische Praxis. Stuttgart o.J.,<br />
http://www.polizeiberatung.de/mediathek/kommunikationsmittel/sonstige_medien/index/content_socket/sonsti<br />
ges/display/97/<br />
Abruf 19.11.2007.<br />
Zieger, Matthias: Verteidigung in Jugendstrafsachen. 4. Aufl., C.F. Müller Verlag, Heidelberg<br />
2002<br />
Zurawski, Nils (2007a): „Kultur, Kontrolle, Weltbild. Räumliche Wahrnehmung und Videoüberwachung<br />
in urbanen Räumen“. Videoüberwachung in Hamburg. Abschlussbericht<br />
(März 2007). Institut für kr<strong>im</strong>inologische Sozialforschung der Universität Hamburg, Hamburg<br />
2007,<br />
http://www1.uni-hamburg.de/kr<strong>im</strong>inol/surveillance/abschlussbericht_A.pdf<br />
Abruf: 19.12.2007.<br />
Zurawski, Nils (2007b): Videoüberwachung in Hamburg, Teil B. Institut für kr<strong>im</strong>inologische<br />
Sozialforschung der Universität Hamburg, Hamburg 2007,<br />
http://www1.uni-hamburg.de/kr<strong>im</strong>inol/surveillance/abschlussbericht_B.pdf<br />
Abruf: 19.12.2007<br />
Zurawski, Nils (2007 c): Wissen und Weltbilder. Konstruktionen der Wirklichkeit, cognitive<br />
mapping und Überwachung. In: Zurawski, Nils (Hrsg.): Surveillance Studies. Perspektiven<br />
eines Forschungsfeldes. Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007, S 85 –<br />
102.<br />
Zwettler, Erich: Videoüberwachung in der kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Praxis. In: In: Bundesministerium<br />
für Inneres (Hrsg): Videoüberwachung zu <strong>sicherheit</strong>s- und kr<strong>im</strong>inalpolizeilichen Zwecken.<br />
Schriftenreihe BM.I. – Band 3, BMI-KSÖ-Enquete: 23. Juni 2004. Neuer wissenschaftlicher<br />
Verlag, Wien - Graz 2004, S 45 – 52.<br />
Alle Downloads überprüft am 08.05.2008.<br />
212