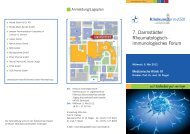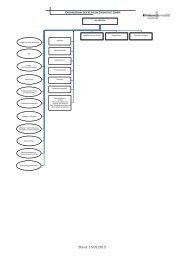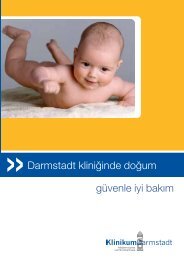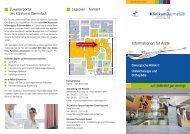Newsletter - Klinikum Darmstadt
Newsletter - Klinikum Darmstadt
Newsletter - Klinikum Darmstadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Newsletter</strong><br />
für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte<br />
Ausgabe 4/2006<br />
Editorial<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
der Magistrat der Stadt <strong>Darmstadt</strong> hat Herrn Privatdozenten<br />
Dr. Sven Ackermann, derzeit leitender Oberarzt<br />
der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen (Direktor:<br />
Professor Dr. M.W. Beckmann) als Nachfolger<br />
von Herrn Prof. Dr. Gerhard Leyendecker zum neuen Direktor<br />
der Frauenklinik des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong> gewählt.<br />
Herr Privatdozent Dr. Ackermann hat die Anerkennung<br />
der Schwerpunktbezeichnungen "Gynäkologische Onkologie",<br />
"Geburtshilfe und Perinatalmedizin" und die fakultative<br />
Weiterbildung „Operative Gynäkologie". Er ist Prüfer<br />
der bayerischen Landesärztekammer für den<br />
Schwerpunkt „Gynäkologische Onkologie".<br />
Wesentliche Schwerpunkte von Herrn Kollegen Ackermann<br />
sind die laparaskopischen onkologischen Operationen<br />
und die Perinatalmedizin. Der neue Direktor der<br />
Frauenklinik wird daher den onkologischen Schwerpunkt<br />
des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong> und das Perinatalzentrum im<br />
<strong>Klinikum</strong> <strong>Darmstadt</strong> wesentlich bereichern.<br />
Führungswechsel in der Frauenklinik<br />
Zum Jahreswechsel tritt Prof. Dr. med. Gerhard Leyendecker,<br />
Direktor der Frauenklinik des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong>,<br />
in den Ruhestand. Am 15. November hat der Magistrat<br />
der Stadt <strong>Darmstadt</strong> Priv. Doz. Dr. med. Sven<br />
Ackermann aus Erlangen zu seinem Nachfolger bestimmt.<br />
Wenn Prof. Dr. med. Gerhard Leyendecker am 31. Dezember<br />
als Direktor der Frauenklinik in den Ruhestand<br />
tritt, ist das kein Abschied von der Medizin. Er wird seine<br />
berufliche Tätigkeit in einer eigenen Kinderwunschpraxis<br />
in <strong>Darmstadt</strong> fortsetzen. Dem <strong>Klinikum</strong> bleibt er über einen<br />
Kooperationsvertrag verbunden.<br />
Prof. Leyendecker leitet die Frauenklinik seit 1984. Als<br />
Direktor übernahm er die Strukturprinzipien, die er während<br />
seiner Zeit an der Universitätsfrauenklinik Bonn<br />
kennen- und schätzen gelernt hatte: Die drei Säulen der<br />
Frauenheilkunde – der operative, der geburtshilfliche und<br />
der reproduktionsmedizinische Teil des Faches – müssen<br />
kompetent vertreten werden.<br />
Zunächst führte er die Brustchirurgie unter Einschluss<br />
der plastischen Operationen ein und baute den Bereich<br />
weiter auf. Neue Entwicklungen, wie das brusterhaltende<br />
Operieren und die selektive Entfernung des Wächterlymphknotens,<br />
wurden rasch in das Brustkrebs-<br />
Behandlungskonzept übernommen. Leyendecker legte<br />
damit die Grundlagen dafür, dass die Frauenklinik in<br />
<strong>Darmstadt</strong> heute Koordinationskrankenhaus des Süd-<br />
Was die In-vitro-Fertilisation betrifft, freue ich mich besonders,<br />
Ihnen mitteilen zu können, dass Prof. Leyendecker<br />
eine ambulante Kinderwunsch-Praxis in <strong>Darmstadt</strong><br />
eröffnet und im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit<br />
seinem Nachfolger bzw. dem <strong>Klinikum</strong> <strong>Darmstadt</strong> zusammenarbeiten<br />
wird.<br />
Herr Kollege Ackermann wird der Darmstädter Ärzteschaft<br />
nach seinem Amtsantritt am 1.1.2007 ausführlich<br />
vorgestellt werden. Die Direktoren des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong><br />
freuen sich sehr auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
mit ihm.<br />
Mit besten kollegialen Grüßen<br />
Prof. Dr. med. Gerhard Mall<br />
Leitender Ärztlicher Direktor<br />
hessischen Brustkompetenzzentrums im Disease Management<br />
Programm Brustkrebs und Referenzklinik für das<br />
Brustkrebsscreening ist.<br />
Der zweite Schwerpunkt ist die prospektive Geburthilfe,<br />
denn: „Von Komplikationen ist nur derjenige überrascht,<br />
der sie vorher nicht bedacht hat“, so Leyendecker. Durch<br />
die mittlerweile sehr hoch entwickelte Ultraschalldiagnostik<br />
lassen sich bereits sehr früh Einblicke in eine bestehende<br />
Schwangerschaft gewinnen. Bis heute ist es für<br />
Leyendecker ein Muss, dass ein hervorragender Pränataldiagnostiker<br />
zum Team seiner Klinik gehört.<br />
1997 gelang es Leyendecker, das Südhessische Perinatalzentrum<br />
in der Frauenklinik zu realisieren: Im Gebäude<br />
der Frauenklinik wird die neonatologische Intensivstation<br />
der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margret untergebracht<br />
und bildet gemeinsam mit der Frauenklinik<br />
den Kern des Mutter-Kind-Zentrums.<br />
Als Leyendecker 1984 nach <strong>Darmstadt</strong> kam, gehörte<br />
auch der Aufbau eines Kinderwunschzentrums zu seinen<br />
Aufgaben. Schnell stellte er das Team aus Ärzten, Biologen<br />
und technischen Assistentinnen zusammen und bereits<br />
1986 kommt es zur ersten Schwangerschaft durch<br />
In-vitro-Fertilisation. Seine Arbeitsgruppe zählt mit zu den<br />
bekanntesten Deutschlands. Bis heute sind es etwa<br />
5.000 Kinder, die Dank der Darmstädter Reproduktionsmediziner<br />
geboren wurden.<br />
1
Die Beschäftigung mit der Reproduktionsmedizin hat<br />
auch zu einer Ausweitung der operativen Tätigkeit geführt.<br />
Hierzu gehören z.B. die erweiterten Operationen<br />
bei Endometriose. Die Darmstädter Frauenklinik ist eins<br />
der wenigen „Endometriosezentren“ in Deutschland.<br />
Auch die organerhaltende operative Behandlung von<br />
Myomen der Gebärmutter hat die Darmstädter Frauenklinik<br />
weit über <strong>Darmstadt</strong> hinaus bekannt gemacht. Damit<br />
hat Leyendecker einen Paradigmenwechsel mit eingeleitet,<br />
nämlich Frauen, auch wenn sie keinen Kinderwunsch<br />
mehr haben, – wenn möglich – die Gebärmutter<br />
zu erhalten.<br />
Neben seiner Arbeit als Kliniker hat Leyendecker sich<br />
immer auch sehr erfolgreich wissenschaftlich betätigt.<br />
Tagesklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist eröffnet<br />
Am 01. November hat die neu eingerichtete Abteilung<br />
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am<br />
<strong>Klinikum</strong> <strong>Darmstadt</strong> ihre Arbeit aufgenommen. Die Abteilung<br />
ist zunächst als Tagesklinik organisiert und verfügt<br />
über zehn Plätze. Die Zuweisung in die Tagesklinik erfolgt<br />
entweder durch den niedergelassenen Haus-<br />
/Facharzt (geplante Aufnahme) oder als Übernahme aus<br />
einer somatischen Abteilung. Das Behandlungsspektrum<br />
reicht von organischen Erkrankungen mit psychischer<br />
Komorbidität, somatoformen/funktionellen Krankheitsbildern<br />
bis zu Angststörungen und depressiven Störungen.<br />
Insbesondere, wenn frühere Belastungen und Traumatisierungen<br />
für die Entstehung der Erkrankung mitverantwortlich<br />
sind, ist eine Aufnahme indiziert.<br />
Der neu geschaffene Bereich ist organisatorisch Teil des<br />
Instituts für Radioonkologie und Strahlentherapie (Direktor:<br />
Prof. Dr. Bernd Kober). Fachlich eigenständig wird er<br />
Seine Publikationsliste umfasst mehr als 150 Beiträge in<br />
hochrangigen wissenschaftlichen Journalen, außerdem<br />
trägt er den Schoeller-Junkmann-Preis der Deutschen<br />
Gesellschaft für Endokrinologie und den Preis der Deutschen<br />
Therapiewoche. Den Weg von der wissenschaftlichen<br />
Idee bis zum medizinisch anwendbaren Produkt<br />
beschritten zu haben, betrachtet Leyendecker als eines<br />
der beglückendsten Erlebnisse in seinem beruflichen Leben<br />
als Wissenschaftler und Arzt.<br />
Prof. Leyendeckers Nachfolger wird Priv. Doz. Dr. Sven<br />
Ackermann aus Erlangen. Ihn stellen wir in der nächsten<br />
Ausgabe dieses <strong>Newsletter</strong>s ausführlich vor.<br />
geleitet von Dr. Alexandra Mihm, die auch für den Bereich<br />
Psychoonkologie verantwortlich zeichnet. Mittelfristig<br />
ist geplant, das Angebot der Abteilung um einen vollstationären<br />
Bereich zu erweitern. Zum Team gehören<br />
neben der Leiterin, die Fachärztin für Innere Medizin und<br />
Psychotherapeutische Medizin ist, ein Facharzt für Psychosomatische<br />
Medizin und Psychotherapie, ein weiterer<br />
Arzt, eine Bewegungs- und eine Gestaltungstherapeutin<br />
sowie Pflegekräfte.<br />
Am 14. Dezember wird Bürgermeister und Klinikdezernent<br />
Wolfgang Glenz die Tagesklinik dem Fachpublikum<br />
im Rahmen einer Feierstunde vorstellen. Anschließend<br />
stehen Fachvorträge auf dem Programm. Interessierte<br />
Ärzte sind zu dieser Veranstaltung, die um 14.00 beginnt,<br />
herzlich in die Tagesklinik auf dem Eberstädter Klinikgelände<br />
eingeladen.<br />
Hochmoderne Angiographieanlage bietet Vorteile bei Chemoembolisation der Leber<br />
Seit September ist im Institut für Diagnostische und Interventionelle<br />
Radiologie (Direktor Prof. Dr. Peter Huppert)<br />
eine neue Angiographieanlage der Fa. Siemens<br />
(AXIOM Artis dTA) in Betrieb.<br />
An diesem Arbeitsplatz werden digitale Substraktionsangiographien<br />
(DAS) und damit verbundene interventionellradiologische<br />
Behandlungen vorgenommen. Die Anlage<br />
gehört zur neuesten Generation von Angiograpiegeräten,<br />
die seit etwa 1,5 Jahren in Deutschland und international<br />
im klinischen Einsatz sind und bei denen der bisher übliche<br />
Röntgenbildverstärker durch einen digitalen Detektor<br />
ersetzt wurde. Die daraus resultierende primär digitale<br />
Aufnahmetechnik ergibt für Gefäßdiagnostik und interventionelle<br />
Therapie mehrere Verbesserungen: höherwertige<br />
Bildqualität, geringere Strahlenexposition, digitale<br />
Bildnachverarbeitung, digitale Bildspeicherung. Für die<br />
Untersuchung und Behandlung von Patienten mit Gefäßerkrankungen<br />
ergeben sich somit unmittelbare Vorteile.<br />
Eine weitere Innovation ist der Hybridcharakter dieser<br />
Anlage: Dank der digitalen Aufnahmeeigenschaften des<br />
Detektors können neben angiographischen Aufnahmen<br />
auch computertomographische Bilder erzeugt werden.<br />
Hierzu wird mit dem Detektor eine Rotationsbewegung<br />
ausgeführt. Aus den dabei gewonnenen digitalen Bildern<br />
werden durch elektronische Nachverarbeitung computertomographische<br />
Schnittbilder rekonstruiert. Hieraus ergeben<br />
sich u.a. nutzbringende Anwendungsmöglichkeiten<br />
bei der Behandlung von Tumorerkrankungen der Leber<br />
mittels Chemoembolisation, einem der Schwerpunkte<br />
des Institutes: Im ersten Schritt wird angiographisch der<br />
2
Katheter in dem vermuteten Gefäß platziert, im zweiten<br />
Schritt wird mit Hilfe einer CT-Aufnahme mit Kontrastmittelgabe<br />
über den Katheter geprüft, ob der Tumor auch<br />
vollständig erfasst wird. Danach kann in gleicher oder<br />
ggf. geänderter Position die Gabe der Medikamente erfolgen.<br />
Dieses spezielle CT- Verfahren (bei Siemens Dyna-CT<br />
genannt) wurde im Institut inzwischen bei mehreren<br />
Patienten mit Lebertumoren und -metastasen erfolgreich<br />
eingesetzt.<br />
Deutschlandweit sind gegenwärtig zehn vergleichbare<br />
Siemens-Anlagen mit Dyna-CT Technologie installiert.<br />
Für Patienten mit Lebertumoren und Lebermetastasen,<br />
für die eine Behandlung mittels Chemoembolisation in<br />
Betracht kommt, ergibt sich durch den Einsatz ein deutlicher<br />
untersuchungstechnischer Vorteil. Im gesamten<br />
südhessischen Raum (einschließlich der Unikliniken in<br />
Mainz und Frankfurt) gibt es kein vergleichbares Gerät.<br />
Am 20.10. 2006 wurde im Institut der 3. Workshop<br />
„Chemoembolisation von Lebertumoren“ durchgeführt,<br />
an dem Ärzte aus verschiedenen Bundesländern teilnahmen.<br />
Die neue Technologie Dyna-CT’s wurde dabei<br />
erfolgreich eingesetzt.<br />
Molekularpathologische Diagnostik bei chronischen lymphatischen Leukämien (CLL) zur Verbesserung<br />
der individuellen Therapieindikation<br />
Das Institut für Pathologie des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong> hat<br />
in Ergänzung zur konventionellen histopathologischen<br />
Diagnostik mit Immunhistologie zusätzlich molekularpathologische<br />
Verfahren eingeführt, die bei chronisch<br />
lymphatischer Leukämie und anderen malignen Erkrankungen<br />
für die Therapie wichtig sind.<br />
Auch heute noch beruht die Krebsdiagnostik auf der pathohistologischen<br />
Beurteilung des Krebsgewebes am<br />
Mikroskop. Bei hämatologischen und lymphoproliferativen<br />
Erkrankungen sind in der Regel ergänzende immunhistochemische<br />
Techniken für die Diagnostik erforderlich,<br />
die seit 15 Jahren Standard in der Pathologie sind. Trotz<br />
standardisierter Krebsdiagnosen beobachtet man aber<br />
immer wieder ganz unterschiedliche Verläufe der Erkrankungen.<br />
Bei der chronischen lymphatischen Leukämie beispielsweise<br />
sind Verläufe zwischen drei Jahren und mehreren<br />
Jahrzehnten bekannt, erst kürzlich wurde im <strong>Klinikum</strong><br />
<strong>Darmstadt</strong> ein Fall von chronischer lymphatischer Leukämie<br />
gesehen, der schon im Jahr 1968 von Professor<br />
Gross in Köln diagnostiziert worden war.<br />
Mittels der im Institut für Pathologie etablierten Technik<br />
der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) lassen sich<br />
durch Darstellung bestimmter Genabschnitte auf den<br />
einzelnen Chromosomen definierte somatische Mutationen<br />
der neoplastischen Lymphozyten nachweisen. Es<br />
konnte gezeigt werden, dass diese Veränderungen des<br />
Genoms unabhängig von Morphologie und Immunprofil<br />
Grundsteinlegung für den Neubau der Medizinischen Kliniken<br />
Rund ein halbes Jahr nach der Wiederaufnahme der Arbeiten<br />
am Neubau der Medizinischen Kliniken des <strong>Klinikum</strong>s<br />
<strong>Darmstadt</strong> konnte Klinikdezernent Wolfgang Glenz<br />
am 20. November in Anwesenheit der hessischen Sozialministerin<br />
Silke Lautenschläger den Grundstein legen.<br />
der neoplastischen Lymphozyten eine enge Korrelation<br />
mit der klinischen Aggressivität der CLL aufweisen.<br />
In der folgenden Tabelle erkennt man die Korrelation molekulargenetischer<br />
Veränderungen wie Chromosomenverluste<br />
(-) und Trisomien mit den mittleren Überlebensraten<br />
bei chronischer lymphatischer Leukämie.<br />
Kategorie der chromsomalen<br />
Aberration bei CLL<br />
Mittlere Überlebensrate<br />
in Monaten<br />
17p- 32 Monate<br />
11q- ohne 17p- 79 Monate<br />
Trisomie 12 ohne 11q- oder 114 Monate<br />
17p-<br />
Normaler Karyotyp 111 Monate<br />
13q- als einzige Abnormität 133 Monate<br />
Andere Abnormitäten<br />
Nach: Dohner et al., NEJM 2000<br />
Diese FISH-gestützte molekularpathologische Subklassifikation<br />
erlaubt es dem klinischen Onkologen, die Indikation<br />
zur Chemotherapie auf einer differenzierteren<br />
Grundlage zu stellen, als es bisher möglich war.<br />
Auch bei anderen Neoplasien wie beispielsweise dem<br />
Plasmozytom wird die FISH-Technik im Institut für Pathologie<br />
eingesetzt, um die Prognose besser abschätzen zu<br />
können. In beiden Fällen zeigt sich die künftige neue<br />
Aufgabe der Pathologie, zusätzlich zur Krebsdiagnostik<br />
auch Therapie relevante Prognosefaktoren zu bestimmen.<br />
Mit dem Neubau werden die fünf Medizinischen Kliniken<br />
des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong> in einem Gebäude zusammen<br />
geführt. Das Gebäude wird zehn Stationen mit insgesamt<br />
268 stationären Betten einschließlich einer internistischen<br />
Intensivstation, sowie zehn teilstationäre Betten<br />
3
und Funktionsabteilungen beinhalten. Die Patientenzimmer<br />
sind überwiegend als Zwei-Bett-Zimmer angelegt.<br />
Die Gesamtbauzeit wird von jetzt an voraussichtlich noch<br />
etwa zwei Jahre betragen, so dass mit der Fertigstellung<br />
Ende 2008 gerechnet werden kann.<br />
Zusammenführung der Medizinischen Kliniken<br />
Das medizinische Leistungsspektrum des <strong>Klinikum</strong>s<br />
<strong>Darmstadt</strong> ergibt sich aus den diagnostischen und therapeutischen<br />
Angeboten seiner insgesamt 18 Kliniken und<br />
Institute, die derzeit auf zwei Standorte – Innenstadt und<br />
10.000ste Katheter-Angioplastie durchgeführt<br />
Vergangene Woche wurde im Herzkatheter-Labor (HKL)<br />
der Medizinischen Klinik I die 10.000ste Koronarangioplastie<br />
durchgeführt. Das HKL wurde im August 1990<br />
eröffnet, ein Jahr später bereits die erste Koronarangioplastie<br />
durchgeführt. Waren es im ersten Jahr des Bestehens<br />
110 Eingriffe im Jahr, so war die Tendenz ständig<br />
steigend bis auf rund 850 pro Jahr in 2004. Seit<br />
Amtsantritt von Prof. Dr. Gerald Werner als Direktor der<br />
Klinik konnte die Zahl weiter gesteigert werden bis auf<br />
etwa 1080 Angioplastien in 2006. Hinzu kommen zusätzliche<br />
Eingriffe wie Mitralklappensprengungen, PFO-<br />
Verschlüsse und elektrophysiologische Untersuchungen<br />
und Ablationen.<br />
Neben den klassischen Einsatzgebieten der Angioplastie<br />
– akuter Myokardinfarkt, instabile und stabile Angina –<br />
Direktor der Augenklinik erhält außerplanmäßige Professur<br />
Am 04. September 2006 hat die Universität Rostock den<br />
Direktor der Augenklinik des <strong>Klinikum</strong>s <strong>Darmstadt</strong>, Dr.<br />
Karl-Heinz-Emmerich, zum außerplanmäßigen Professor<br />
Personalia<br />
In der Urologischen Klinik (Direktor Prof. Dr. Stephan Peter)<br />
wurde zum 1. November 2006 Priv. Doz. Dr. Stephan<br />
Bross als weiterer habilitierter Oberarzt eingestellt. Dr.<br />
Bross ist an der Universitätsklinik in Mannheim ausgebildet<br />
worden und hat in den letzten Monaten in den SLK-<br />
Kliniken in Heilbronn gearbeitet. Seine Arbeitsschwerpunkte<br />
sind Blasenentleerungsstörungen und Inkontinenzbehandlungen.<br />
Zum Leitenden Oberarzt und ständigen Vertreter des Direktors<br />
der Urologischen Klinik wurde Priv. Doz. Dr. Detlef<br />
Rohde bestellt.<br />
Eberstadt – verteilt sind. Von den fünf Medizinischen Kliniken<br />
befinden sich vier (Kardiologie, Gastroenterologie,<br />
Nephrologie und Onkologie) bereits in der Innenstadt, die<br />
Medizinische Klinik IV (Angiologie) in Eberstadt. Diese<br />
wird im ersten Quartal 2007 in die Grafenstraße umziehen,<br />
allerdings werden die fünf Einrichtungen nach wie<br />
vor über verschiedene Gebäude verteilt sein. Mit der Fertigstellung<br />
des Neubaus können dann alle fünf Kliniken<br />
des Schwerpunktes Innere Medizin in einem hochmodernen<br />
Klinikbau unter einem Dach zusammen arbeiten.<br />
wurden in den letzten beiden Jahren durch den Einsatz<br />
von Medikamenten-freisetzenden Stents die Behandlung<br />
auf schwere Mehrgefäßverengungen ausgedehnt. Damit<br />
steht nun auch in Fällen, wo früher nur die Bypass-<br />
Operation in Frage kam, eine Behandlungsalternative zur<br />
Verfügung. Die Langzeiterfolgsrate, die man durch die<br />
Medikamente-freisetzenden Stents erreicht, ist der der<br />
Bypassoperation mindestens gleichwertig. Vor allem die<br />
auch international anerkannte große Erfahrung und hohe<br />
Erfolgsrate bei langjährig verschlossenen Gefäßen führt<br />
heute Patienten auch außerhalb Hessens ins <strong>Klinikum</strong><br />
<strong>Darmstadt</strong>. Im ablaufenden Jahr wurden mehr als 100<br />
solcher chronischer Gefäßverschlüsse behandelt..<br />
ernannt. Prof. Emmerich leitet die Augenklinik seit 1991.<br />
Seine Habilitation erfolgte 1989 an der Universität Münster/Westfalen.<br />
Am Institut für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin<br />
und Schmerztherapie (Direktor Prof. Dr. Martin Welte)<br />
gibt es zwei neue Fachärztinnen: Dr. Ulrike Kreuzig und<br />
Julia Wäßle haben im August bzw. im Oktober die Facharztprüfung<br />
vor der LÄK Hessen bestanden. Beide werden<br />
zur weiteren Spezialisierung am Institut bleiben.<br />
Frau Dr. Kreuzig hat den Schwerpunkt Anästhesie und<br />
Intensivmedizin, Frau Wäßle Anästhesie und Schmerztherapie.<br />
4
Das Portrait: Die Medizinische Klinik III – Nieren-, Hochdruck- und Rheumaerkrankungen<br />
Die Medizinische Klinik III vertritt am <strong>Klinikum</strong> <strong>Darmstadt</strong><br />
die Schwerpunkte Nieren-, Hochdruck- und<br />
Rheumaerkrankungen. Das Spektrum umfasst die<br />
Abklärung von Nieren- und Hochdruckkrankheiten in<br />
allen Stadien, die Diagnostik von Rheuma- und immunologischen<br />
Systemerkrankungen sowie die<br />
Durchführung aller Nierenersatzverfahren bei chronischem<br />
und akutem Nierenversagen. Die interdisziplinäre<br />
Arbeitsweise besitzt einen hohen Stellenwert<br />
besonders bei Systemerkrankungen. Patienten mit<br />
akutem Nierenversagen werden auch in Kooperation<br />
mit den verschiedenen Intensivstationen des <strong>Klinikum</strong>s<br />
interdisziplinär betreut.<br />
Besondere Versorgungsschwerpunkte<br />
Die Medizinische Klinik III ist in der Region Südhessen<br />
der klinische Schwerpunkt zur Versorgung von Patienten<br />
mit Nieren- und Hochdruckerkrankungen. Unabhängig<br />
von dieser definierten Rolle erfüllt sie weitere besondere<br />
Aufgaben:<br />
Diagnostik von Nierenerkrankungen<br />
Die zentrale Kompetenz der Medizinischen Klinik III ist<br />
die Abklärung von Nierenerkrankungen. Urinanalyse,<br />
Nierenhistologie und Duplexsonographie sind die wesentlichen<br />
„Bausteine“, die zusammen mit den Laboranalysen<br />
im Serum eine nahezu vollständige Diagnosesicherung<br />
der Erkrankung der Nieren gewährleisten. Die Kooperation<br />
mit dem Institut für Pathologie (Direktor Prof.<br />
Dr. Gerhard Mall) führte im vergangenen Jahr in 50 Fällen<br />
zu einer histopathologischen Diagnose. Durch gezielte<br />
Pharmakotherapie konnte bei einer Vielzahl von Patienten<br />
eine Heilung erreicht werden oder zumindest die<br />
Progression einer Nierenerkrankung (zur Dialysepflichtigkeit)<br />
verhindert werden.<br />
Die Abklärung (und Therapie) der Nierenarterienstenose<br />
hat einen besonderen Stellenwert im diagnostischen und<br />
therapeutischen Spektrum der Klinik: Bei unklarer Nierenfunktionsverschlechterung<br />
und/oder schwer kontrollierbarer<br />
Hypertonie ist die Duplexsonographie unverzichtbar.<br />
In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für<br />
Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Direktor<br />
Prof. Dr. Peter Huppert) wird die Entscheidung zur Angiographie<br />
und interventionellen Therapie getroffen. Die<br />
PTA der Nierenarterien (meist Stentangioplastien) wurde<br />
im vergangenen Jahr 36 mal durchgeführt. Die detaillierten<br />
Dokumentationen und Nachuntersuchungen lassen<br />
auf ein interessantes Ergebnis hoffen, das in Kürze erwartet<br />
wird.<br />
Dialysezugänge<br />
Sowohl Peritonealdialyse als auch Hämodialyse erfordern<br />
einen Zugang, der eine ausreichende Blutreinigung<br />
harnpflichtiger Substanzen gewährleistet.<br />
Vorhofkatheter<br />
Der Vorhofkatheter gewinnt an Bedeutung, weil die Gefäßverhältnisse<br />
der Dialysepatienten problematisch sind,<br />
die zunehmend älter und komorbider werden. Initial war<br />
der weithin bekannte „Demerskatheter“ als Übergangsverfahren<br />
von dem gleichnamigen Oberarzt der Medizinischen<br />
Klinik III in <strong>Darmstadt</strong> etabliert worden. Heute wird<br />
der weiterentwickelte und oft doppelläufige Verweilkatheter<br />
von den Mitarbeitern der Medizinischen Klinik III auch<br />
ambulant implantiert. Wartezeiten sind so auf wenige<br />
Tage geschrumpft.<br />
Shuntfunktionsdiagnostik<br />
Der intakte Gefäßzugang aus den körpereigenen Gefäßen<br />
ist für Hämodialysepatienten die beste Voraussetzung<br />
für die Durchführung der lebenserhaltenden Therapie.<br />
Eine konsequente Diagnostik der Shuntfunktion<br />
vermeidet akute Problemsituationen und gewährleistet<br />
eine optimale Funktion. Die Medizinische Klinik III führt<br />
regelmäßig ein klinisches Screening durch und verfügt<br />
über eine exzellente apparative Diagnostik des arteriovenösen<br />
Gefäßzugangs (Transonic), die sie auch für Patienten<br />
aus ambulanten Einrichtungen vorhält.<br />
Peritonealdialyse<br />
Wie neuere Untersuchungen zeigen, ist die Peritonealdialyse<br />
ein unverzichtbarer und integrativer Bestandteil der<br />
Nierenersatztherapie. Die Medizinische Klinik III hat sich<br />
mittlerweile zum Kooperationszentrum für Peritonealdialyse<br />
entwickelt. Dies zeigt sich darin, dass 18 ambulant<br />
tätige Nephrologen das breite Leistungsspektrum nutzen.<br />
Dies umfasst Kathetereinlage (in Kooperation mit der<br />
Chirurgischen Klinik I), Training (auch der automatisierten<br />
Peritonealdialyse), Nachschulung und die stationäre<br />
Betreuung (24stündige Notfalldienstleistung) bei unterschiedlichen<br />
interkurrenten Problemstellungen In wenigen<br />
Fällen wird auch die intermittierende Peritonealdialyse<br />
durchgeführt.<br />
„Ich bedaure, dass der prozentuale Anteil der Peritonealdialyse<br />
(PD) mit 4,6 Prozent in Deutschland im internationalen<br />
Vergleich recht niedrig liegt“, so Prof. Dr. Werner<br />
Riegel, Direktor der Medizinischen Klinik III. In vielen europäischen<br />
Ländern liegt er über 20 Prozent und mehr.<br />
„Verschiedene Untersuchungen belegen Vorteile der PD<br />
in den ersten Jahren der Dialysepflichtigkeit. Ein wichti-<br />
5
ger Parameter ist dabei die Nierenrestfunktion, die unter<br />
PD besser erhalten werden kann“, so Riegel. Die Konsequenz<br />
hieraus ist eine höhere Lebensqualität, da die<br />
Flüssigkeitszufuhr und auch die Kalium- und Phosphataufnahme<br />
nicht so restriktiv gehandhabt werden müssen.<br />
Daraus wiederum scheinen ein besserer Ernährungszustand,<br />
weniger Infekte, sowie weniger Begleit- und Folgeerkrankungen<br />
zu resultieren. „Auch wenn diese Vorteile<br />
beim Nachlassen der Nierenrestfunktion an Bedeutung<br />
verlieren, ist für die weitere Behandlung von Nutzen,<br />
dass die Gefäße bis dahin geschont wurden und das<br />
Herz(-zeitvolumen) unbelastet blieb, da noch kein Hämodialyseshunt<br />
vorhanden war“, erläutert Riegel.<br />
Nach Ansicht vieler Nephrologen in Deutschland wäre<br />
auch hierzulande ein PD-Anteil von mehr als 20 Prozent<br />
durchaus möglich, so belegt eine Umfrage. Dass die tatsächlichen<br />
Zahlen weit dahinter zurück bleiben, liegt<br />
möglicherweise daran, dass sich rund 50 Prozent der Befragten<br />
in der PD nicht ausreichend ausgebildet fühlen.<br />
„Mehr Sicherheit für alle Beteiligten lässt sich durch Kooperation<br />
erreichen: In Südhessen z.B. kooperieren Nierenzentren<br />
des Kuratoriums für Dialyse und Transplantation<br />
(KfH) sehr eng miteinander und halten die PD<br />
schwerpunktmäßig an einem Zentrum vor. Dort finden<br />
Sprechstunden, Routinekontrollen u.ä. statt. Dieses Zentrum<br />
wiederum steht in enger Kooperation mit der Medizinischen<br />
Klinik III, die die komplette Infrastruktur vorhält,<br />
um eine umfassende Diagnostik und Therapie zu gewährleisten.<br />
Außerdem kooperiert die Klinik mit niedergelassenen<br />
Kollegen und Einrichtungen. Letztendlich ist eine<br />
enge Zusammenarbeit aller am Behandlungsprozess<br />
Beteiligten die unverzichtbare Voraussetzung für regionale<br />
Kompetenz in der PD“, so Riegel.<br />
Transplantation<br />
Obwohl am <strong>Klinikum</strong> in <strong>Darmstadt</strong> keine Transplantationen<br />
stattfinden, werden Patienten zur Transplantation<br />
vorbereitet und nachgesorgt. Die langjährige Erfahrung<br />
Riegels als Leiter einer Transplantationseinrichtung<br />
kommt hier voll zum tragen. Es besteht eine Kooperation<br />
mit den Transplantationszentren an den Universitäten in<br />
Frankfurt, Heidelberg und Mainz. Bei Organspenden erfolgt<br />
die Zusammenarbeit mit der DSO (Deutsche Stiftung<br />
Organspende). Oberarzt Dr. Sucké ist Transplantationsbeauftragter<br />
des <strong>Klinikum</strong>s.<br />
Plasmapherese und Immunadsorption<br />
Die therapeutische Plasmapherese – also das Filtrieren<br />
oder die Membranadsorption von hochmolekularen Stoffen<br />
wie z.B. Antikörper- und Fettmolekülen aus dem Blut<br />
– wird ebenfalls in der Medizinischen Klinik III durchgeführt.<br />
Einsatz findet diese Form der Behandlung z.B. bei<br />
Autoimmunerkrankungen, die eine schnelle Elimination<br />
der Antikörper bedürfen, sowie bei einer pathologischen<br />
Erhöhung von Plasmaeiweißen mit konsekutiver Viskositätssteigerung.<br />
Rheumatologie<br />
Seit dem 01.01.2006 ist an der Medizinischen Klinik III<br />
zusätzlich ein Schwerpunktbereich Rheumatologie angesiedelt.<br />
Damit ist sie die einzige Klinik in Südhessen mit<br />
einer Abteilung für die stationäre Behandlung von Rheumapatienten.<br />
Der Schwerpunkt liegt auf der Diagnostik<br />
des gesamten Spektrums entzündlich-rheumatischer Erkrankungen<br />
wie der rheumatoiden Artritis, Vaskulitiden,<br />
Kollagenosen und HLA B27-assoziierten Erkrankungen<br />
bis hin zur anschließenden medikamentösen Einstellung<br />
und Therapieempfehlungen. Im Bereich der Rheumatologie<br />
ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders<br />
ausgeprägt, die besonders von Oberarzt Dr. Stöckl kompetent<br />
gepflegt wird: Enge Verbindungen bestehen zur<br />
Hautklinik, der Klinik für Neurologie, der HNO-Klinik und<br />
dem Bereich Pneumologie der Medizinischen Klinik II.<br />
Die enge Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer<br />
Medizin sowie der Einbezug der Patienten durch eine<br />
intensive Zusammenarbeit mit der Rheumaliga sind ein<br />
wichtiges Anliegen.<br />
Schon nach dem ersten Jahr ist absehbar, dass die<br />
Rheumatologie ein stark wachsender Bereich ist.<br />
Hypertonie<br />
Patienten mit arterieller Hypertonie befinden sich aufgrund<br />
der hohen Inzidenz in der Bevölkerung und der<br />
multifaktoriellen Genese dieser Erkrankung in vielen Bereichen<br />
der Medizin. Die Medizinische Klinik III führt eine<br />
intensive Diagnostik und die Behandlung schwerer Formen<br />
des Bluthochdrucks durch. Direktor und Oberärzte<br />
führen die Bezeichnung Hypertensiologe DHL. Die Klinik<br />
bietet regelmäßige Schulungen für Patienten mit Bluthochdruck<br />
an, die von zertifiziertem Schulungspersonal<br />
durchgeführt und auch von ambulant tätigen Kollegen<br />
genutzt werden können.<br />
Kooperationen<br />
„Die Medizinische Klinik III lebt von ihren internen und<br />
externen Kooperationen“, so beschreibt ihr Direktor die<br />
Stellung seines Hauses. Die wichtigsten Schnittstellen intern<br />
bestehen mit der Fachabteilung für Diabetologie (Diabetischen<br />
Nephropathie und Hypertonie), der Urologie<br />
(sowohl bei unklaren Formen der Erythrozyturie als auch<br />
schweren Infektionen der Nieren und Harnwege), der<br />
Kardiologie und Angiologie (Gefäßschäden und Hypertonie),<br />
dem Institut für Diagnotische und Interventionelle<br />
Radiologie (Nierenarterienstenosen) und dem Institut für<br />
Pathologie (Biopsien). Die Medizinische Klinik III bietet<br />
Rheumakonsile und -sprechstunden an und führt die 24-<br />
Stunden-Blutdruckmessung im <strong>Klinikum</strong> durch.<br />
Auch nach extern wird der Kooperationsgedanke gelebt:<br />
Ein umfangreiches Angebot an ärztlichen Fortbildungen,<br />
die Mitarbeit in Arbeitskreisen wie dem Dachverband „Fit<br />
6
für Dialyse“ oder Interessenvertretungen wie dem Kuratorium<br />
für Dialyse und Nierentransplantation sowie der<br />
Rheumaliga und Zystenniere e.V. illustrieren dies. Mit<br />
Blick auf die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen<br />
Kollegen sagt Riegel: „Wir sind auf bestimmten ‚Streckenabschnitten’<br />
der (chronischen) Erkrankungen für die<br />
Patienten da. Danach gehen die Patienten selbstverständlich<br />
wieder zurück zu ihrem ambulanten Spezialisten.<br />
Im Ernstfall werden wir erneut unseren Beitrag leisten.“<br />
Schulungen<br />
Nach Riegels Ansicht können Patienten mit chronischen<br />
Erkrankungen nur dann dauerhaft erfolgreich therapiert<br />
werden, wenn es gelingt, sie zum Partner im Behandlungsprozess<br />
zu machen, d.h. ihre Einsicht, Zuverlässigkeit<br />
und ihr Verantwortungsbewusstsein zu wecken. „Validierte<br />
und strukturierte Schulungsprogramme – oft auch<br />
unter Einbezug der Angehörigen – scheinen hierfür am<br />
besten geeignet“, so Riegel. Programme, in denen die<br />
Medizinische Klinik III diesen Ansatz umsetzt, sind z.B.<br />
„Fit für Dialyse“ (bereitet Patienten und deren Angehörige<br />
auf den bevorstehenden Dialysebeginn vor) oder die<br />
Hochdruck- und Rheumaschulungen.<br />
Ärztliche Fortbildungen<br />
Das Angebot an ärztlichen Fortbildungen ist umfangreich:<br />
Nierenbiopsie-Konferenzen finden 3 bis 4 mal pro<br />
Jahr, ein Duplex-Workshop für ambulant tätige Ärzte<br />
einmal jährlich statt. Ebenfalls einmal pro Jahr veranstaltet<br />
die Klinik einen Peritonealdialyse-Workshop mit reger<br />
Beteiligung der regionalen Fachärzte. Weitere Angebote<br />
für Ärzte sind das Darmstädter Rheumaforum, Hypertonie<br />
im Dialog und das Darmstädter Dialyseforum (in Zusammenarbeit<br />
mit der Nephrologischen Arbeitsgemeinschaft<br />
Rhein Main).<br />
Qualitätssicherung<br />
Diagnostische und therapeutische Verfahren sind über<br />
SOP`s definiert. Grundlagen der therapeutischen Standards<br />
sind:<br />
- KDOQI-Guidelines (Kidney Disease Outcome<br />
Quality – Guidelines der National Kidney Foundation,<br />
USA),<br />
Ärztliche Fortbildungen<br />
- European Best Practice Guidelines,<br />
- Meldung an Quasi-Niere („Qualitätssicherung<br />
Niere“ Berlin),<br />
- interne Protokollbögen zur Beurteilung der Behandlungsqualität<br />
an der Hämodialyse mit statistischer<br />
Darstellung.<br />
- Zugang zu allen relevanten Literaturquellen und<br />
„Uptodate“<br />
Direktor Prof. Riegel<br />
Prof. Dr. Werner Riegel leitet die Klinik seit dem 1. Mai<br />
2000. Zuvor war er Leitender Oberarzt und kommissarischer<br />
Direktor der Universitätsklinik Homburg/Saar. Sein<br />
Medizinstudium absolvierte er in Würzburg, die Facharztausbildung<br />
in Freiburg. Er besitzt die volle Weiterbildungsermächtigung<br />
für die Zusatzbezeichnung Nephrologie.<br />
Er ist Mitglied in vielen Fachgesellschaften. Das<br />
Bundesland Hessen vertritt er im erweiterten Vorstand<br />
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für klinische Nephrologie.<br />
Prof. Riegel ist Initiator und Mit-Autor von „Efficacy<br />
2004“, einer Software zur validen Bestimmung von Dialysedosis<br />
und Nierenfunktion, die in einer Vielzahl von<br />
nephrologischen Praxen zur Qualitätssicherung eingesetzt<br />
wird.<br />
Als Erst-Autor hat er maßgeblich an BENEFIT Niere, einer<br />
multizentrischen Studie zur nephrologischen Versorgungslage<br />
chronisch Nierenkranker zum Zeitpunkt des<br />
Dialysebeginns mitgewirkt (Riegel et al., DMW 2005).<br />
Die Klinik<br />
Das ärztliche Team der Medizinischen Klinik III besteht<br />
aus zwei Oberärzten und fünf Assistenten. Im pflegerischen<br />
Team sind 39 Mitarbeiter/innen tätig. Die Klinik<br />
verfügt über 36 stationäre Behandlungsplätze, die durchschnittliche<br />
Verweildauer beträgt bei rund 1.000 Patienten<br />
jährlich circa 7,6 Tage.<br />
An dieser Stelle finden Sie einen Ausschnitt aus dem Fortbildungsangebot für Ärzte, zu dem unsere Kliniken und Institute<br />
Sie herzlich einladen. Da im Rahmen dieser Informationsschrift nicht alle Veranstaltungen und Termine kommuniziert<br />
werden können, empfehlen wir, auch die Bekanntmachungen in der Tagespresse sowie auf unserer<br />
Homepage www.klinikum-darmstadt.de zu beachten.<br />
Hinweis: Bei Redaktionsschluss waren die Fortbildungstermine vieler Kliniken und Institute für 2007 noch nicht verfügbar.<br />
Bei Interesse an bestimmten Veranstaltungen bitte wir Sie, sich auch direkt telefonisch mit den Sekretariaten<br />
der Direktoren in Verbindung zu setzen.<br />
7
Der Onkologische Arbeitskreis (Medizinische Kliniken, Radiologie I und II, Chirurgische Klinik I, Frauenklinik, HNO-Klinik<br />
und Urologie) findet montags von 16.00 bis 17.00 Uhr im Konferenzraum der Medizinischen Kliniken, 3. Stock, statt und<br />
bietet die Möglichkeit, onkologische Fragestellungen interdisziplinär zu diskutieren. Die Veranstaltung ist zertifiziert.<br />
Zur klinikinternen Fortbildung der Medizinischen Kliniken (donnerstags, 15.00 Uhr, im Konferenzsaal der Medizinischen<br />
Kliniken) sind auch die niedergelassenen Kollegen herzlich eingeladen.<br />
Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie bietet folgende Fortbildungen an:<br />
17.01.07 Dr. med. Müller, Oberarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle<br />
Radiologie, <strong>Klinikum</strong> <strong>Darmstadt</strong><br />
Tipps und Tricks der Unterschenkel-PTA<br />
Beginn ist um 17.00 Uhr c.t. im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Demoraum E 83.<br />
Zur Teilnahme an der Klinisch-pathologischen Konferenz (dienstags von 13.15 bis 14.00 Uhr, Hörsaal der Pathologie)<br />
laden die Medizinischen Kliniken, Radiologie I und II und das Institut für Pathologie ein.<br />
An der zertifizierten Fortbildung ist auch das Elisabethenstift beteiligt.<br />
Das Institut für Anaesthesiologie und operative Intensivmedizin bietet im Rahmen des „Anästhesiologisch-<br />
Intensivmedizinischen Kolloquiums“ u.a. folgende Termine an:<br />
06.12.06 Störungen des Säure-Basen-Haushalts Prof. Knichwitz, Münster<br />
20.12.06 30 Jahre Anästhesie - ein persönlicher Rückblick auf die Entwicklung Dr. S. Bogosyan, <strong>Darmstadt</strong><br />
17.01.07 Anästhesie bei herzchirurgischen Eingriffen PD Dr. D. Meininger, Frankfurt<br />
24.01.07 Kardiogener Schock Prof. G. Werner, <strong>Darmstadt</strong><br />
31.01.07 Direkte Thrombin-Inhibitoren in der Anästhesie und Intensivmedizin Frau Dr. S. Krisch, <strong>Darmstadt</strong><br />
07.02.07 Schmerztherapie bei Kindern Frau Krstevska, <strong>Darmstadt</strong><br />
21.02.07<br />
Präklinische Versorgung des Polytraumatisierten – Permissive Hypotension<br />
und Vasopressin statt Volumen?<br />
Dr. L. von Beck, <strong>Darmstadt</strong><br />
28.02.07 Lebensqualität nach ARDS – Neurokognitive Folgen? Dr. G. Gutscher, <strong>Darmstadt</strong><br />
Zeit: 6.45–7.30 Uhr, Ort: Konferenzraum des Instituts<br />
Sie finden das vollständige Programm auch auf der Homepage des Instituts unter www.klinikum-darmstadt.de, hier Institut<br />
für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin.<br />
Die Neurologische Klinik lädt ein zu ihrer wöchentlichen internen Fortbildung, die donnerstags um 16.30 Uhr in der Biblio-<br />
thek der Klinik stattfindet. Die nächsten Termine und Themen sind:<br />
07.12.06 Neurologie aktuell Prof. Dr. Claus, Direktor<br />
14.12.07 Tysabri (Monoklonale Antikörper bei MS) Herr Ibe, Assistenzarzt<br />
Im Darmstädter Angiologischen Arbeitskreis – einer gemeinsamen Veranstaltung der Angiologischen Klinik, der Chirurgischen<br />
Klinik I und des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie – treffen sich regelmäßig niedergelassene<br />
Ärzte und Klinikärzte, die Gefäßpatienten versorgen. Interdisziplinär werden interessante, schwierige, lehrreiche<br />
oder ungelöste angiologische Fälle diskutiert.<br />
Zusätzlich werden systematisch interessante Themen aus dem gesamten Gebiet der Gefäßmedizin aufgearbeitet.<br />
Die Veranstaltung findet vierteljährlich statt. Interessierte Ärzte können sich im Sekretariat der Medizinischen Klinik IV<br />
(06151/107-4401) anmelden. Die Veranstaltung wird mit 3 Fortbildungspunkten der Landesärztekammer Hessen<br />
zertifiziert.<br />
Das aktuelle Programm der ärztlichen Fortbildungen des Instituts für Notfallmedizin finden Sie im Internet unter<br />
www.notfallmedizin-darmstadt.de.<br />
8