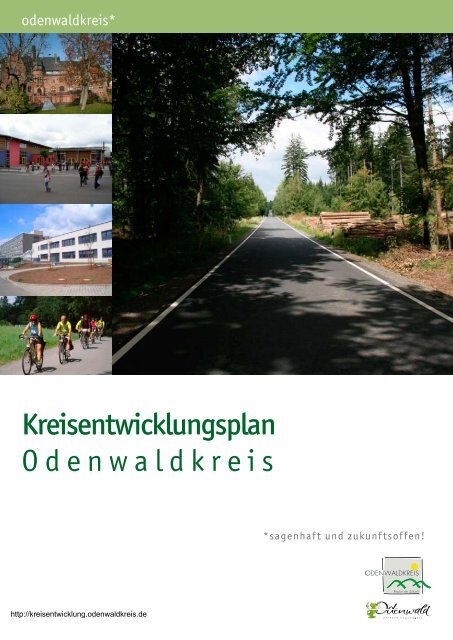Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis
Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis
Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
odenwaldkreis*<br />
odenwaldkreis*<br />
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong><br />
O d e n w a l d k r e i s<br />
*sagenhaf t und zukunf tsof f en!
Herausgeber:<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
Hauptabteilung IV – Bauwesen<br />
Bauberatung, Bauleitplanung, Denkmalschutz/<br />
Kreisentwicklung und Regionalplanung<br />
Michelstädter Straße 12<br />
64711 Erbach<br />
Tel.: 06062 / 70-0<br />
Fax: 06062 / 70-390<br />
Internet: www.odenwaldkreis.de<br />
E-Mail: info@odenwaldkreis.de<br />
Ansprechpartner:<br />
Erwin Wagner Tel.: 06062 / 70-257<br />
Thomas Lüsse Tel.: 06062 / 70-366<br />
Petra Karg Tel.: 06062 / 70-301<br />
Erbach, Februar 2009
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
KREISENTWICKLUNGSPLANUNG ODENWALDKREIS<br />
I. Einführung.........................................................................................................7<br />
1. Einleitung ..................................................................................................... 7<br />
2. Ausgangssituation........................................................................................ 9<br />
3. Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Wirkung des<br />
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong>es............................................................................ 10<br />
4. Lage des Kreises und seine Beziehungen zu den Nachbarkreisen ........... 11<br />
5. Raumstruktur, Zahlen, Daten und Prognosen ............................................ 11<br />
5.1. Der ländliche periphere Raum............................................................. 11<br />
5.2. Landesplanerische Vorgaben.............................................................. 13<br />
5.3. Bevölkerungsentwicklung .................................................................... 15<br />
5.4. Arbeitsmarkt ........................................................................................ 17<br />
II. Fachplanungen................................................................................................19<br />
1. Verkehrsentwicklung .................................................................................. 19<br />
1.1. Straßenverkehr.................................................................................... 19<br />
1.2. Radwegenetz ...................................................................................... 24<br />
1.3. Öffentlicher Personennahverkehr........................................................ 29<br />
2. Natur- und Umweltschutz ........................................................................... 33<br />
2.1. Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe, Öko-Konto,<br />
Naturschutzdatenhaltung..................................................................... 36<br />
2.2. Landschaftspflege und Naturschutz .................................................... 37<br />
2.3. Streuobstregion ................................................................................... 37<br />
2.4. Natura 2000-Gebiete........................................................................... 39<br />
2.5. Naturschutzgebiete.............................................................................. 40<br />
2.6. Naturdenkmale .................................................................................... 41<br />
2.7. Besondere Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten............................. 42<br />
2.8. Artenschutz ......................................................................................... 43<br />
2.9. Naturschutz- und Landschaftspflege-Projekte..................................... 44<br />
2.10. Odenwaldprogramm „Mensch – Natur – Kulturlandschaft".................. 47<br />
2.11. Eingriffsregelung im Zuge der Siedlungsentwicklung und Schutz des<br />
Außenbereichs .................................................................................... 49<br />
3. Landwirtschaft und ländlicher Raum .......................................................... 50<br />
3.1. Landwirtschaft ..................................................................................... 50<br />
3.2. Regional- und Direktvermarktung........................................................ 54<br />
3.3. Landwirtschaft und Landschaftspflege ................................................ 57<br />
3.4. Dorf- und Regionalentwicklung............................................................ 60<br />
3.5. Ziele/Entwicklungen............................................................................. 63<br />
4. Wald- und Forstwirtschaft........................................................................... 66<br />
4.1. Wald- und Forstwirtschaft.................................................................... 66<br />
4.2. Waldrodung/Waldneuanlage ............................................................... 67<br />
4.3. Wald und Naherholung........................................................................ 67<br />
5. Ver- und Entsorgung .................................................................................. 69<br />
5.1. Energieversorgung .............................................................................. 69<br />
5.2. Wasserversorgung/Trinkwasserschutzgebiete .................................... 88<br />
5.3. Abwasser............................................................................................. 93<br />
5.4. Anlagenbezogener Gewässerschutz................................................... 94<br />
5.5. Bodenschutz........................................................................................ 94<br />
3
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5.6. Abfallentsorgung ................................................................................. 95<br />
6. Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen ...................................... 97<br />
6.1. Feuerwehrwesen................................................................................. 97<br />
6.2. Rettung und Brandbekämpfung........................................................... 98<br />
6.3. Rettungswesen.................................................................................. 100<br />
6.4. Entwicklungstrategien........................................................................ 101<br />
7. Denkmalschutz......................................................................................... 102<br />
7.1. Kulturdenkmäler ................................................................................ 102<br />
7.2. Denkmalnetzwerk.............................................................................. 102<br />
7.3. Maßnahmen ...................................................................................... 102<br />
8. Tourismus und Naherholung .................................................................... 104<br />
8.1. Analyseergebnisse ............................................................................ 105<br />
8.2. Marketingstrategie............................................................................. 106<br />
8.3. Organisationskonzept........................................................................ 109<br />
9. Lokale Ökonomie ..................................................................................... 112<br />
9.1. Regionalmarke .................................................................................. 112<br />
9.2. Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsplanung ................................... 112<br />
9.3. Cluster ............................................................................................... 113<br />
9.4. Standortmarketingkampagne Darmstadt RheinMainNeckar – addicted<br />
to innovation ...................................................................................... 114<br />
10. Bildung ..................................................................................................... 117<br />
10.1. Istzustand .......................................................................................... 117<br />
10.2. Schulenentwicklung........................................................................... 118<br />
11. Erwachsenenbildung................................................................................ 134<br />
11.1. VHS – Akademie für lebenslanges Lernen........................................ 134<br />
11.2. Odenwald-Akademie ......................................................................... 136<br />
11.3. Energy Center ................................................................................... 137<br />
11.4. Bildungs- und Schulungsangebot in der Land- und Forstwirtschaft... 137<br />
12. Schulen und Weiterbildungsangebot der Gesundheitszentrum<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH.............................................................................. 138<br />
13. Kultur und Sport ....................................................................................... 139<br />
13.1. Kultursommer Südhessen e. V. (KuSS) ............................................ 139<br />
13.2. Kulturinfrastruktur in der Region........................................................ 140<br />
13.3. Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport........................................... 140<br />
13.4. Sport.................................................................................................. 141<br />
14. Familien- und Sozialpolitik........................................................................ 143<br />
14.1. Bündnis für Familien.......................................................................... 143<br />
14.2. Jugendhilfe ........................................................................................ 144<br />
14.3. Kommunales Jobcenter..................................................................... 165<br />
14.4. Soziale Sicherung.............................................................................. 168<br />
14.5. Sozialplanung und Seniorenarbeit..................................................... 169<br />
14.6. Behindertenhilfe ................................................................................ 171<br />
15. Gesundheitswesen................................................................................... 174<br />
15.1. Gesundheitsamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ............................................. 174<br />
15.2. Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH ..................................... 180<br />
15.3. Odenwald-Vitalness „Gesundheitscluster <strong>Odenwaldkreis</strong>“ ................ 182<br />
16. Veterinärwesen und Verbraucherschutz .................................................. 183<br />
16.1. Tiergesundheitsschutz....................................................................... 183<br />
16.2. Tierseuchenbekämpfung................................................................... 184<br />
16.3. Lebensmittelüberwachung................................................................. 185<br />
17. Kommunikationssysteme ......................................................................... 188<br />
4
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
18. Interkommunale Zusammenarbeit und Verwaltungsmodernisierung........ 191<br />
18.1. Interkommunale Zusammenarbeit im <strong>Odenwaldkreis</strong>........................ 192<br />
18.2. Interregionale Zusammenarbeit......................................................... 194<br />
18.3. Verwaltungsmodernisierung .............................................................. 194<br />
19. Europäische Vorgaben............................................................................. 195<br />
19.1. EUREK .............................................................................................. 195<br />
19.2. Metropolregionen, Lissabon-Strategie und<br />
Verantwortungspartnerschaften ........................................................ 195<br />
19.3. Regionales Entwicklungskonzept für ELER....................................... 196<br />
III. Literatur .........................................................................................................202<br />
IV. Abkürzungsverzeichnis................................................................................205<br />
5
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
6
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
I. Einführung<br />
1. Einleitung<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> ist als ländlicher Raum von den Auswirkungen der Globalisierung, dem<br />
bevorstehenden demografischen Wandel und der Entwicklung der Energiekosten im Klimawandel<br />
betroffen.<br />
Die Leitgedanken für die Regionalentwicklung sind gekennzeichnet durch ganzheitliches<br />
Denken der kommunalen Politik. Dabei werden Ökonomie, Ökologie, Kultur und Soziales in<br />
ihrer jeweiligen Vielfalt in einer ganzheitlichen Denkweise ineinander fließen, was zugleich<br />
die Komplexität von Verwaltungshandeln aufzeigt.<br />
Ziel ist es im Sinne einer lokalen Ökonomie, die Wertschöpfungsketten durch Kooperationsvereinbarungen<br />
zu verstärken. Die Faktoren Bildung und Standortbedingungen werden an<br />
dieser Stelle zusammengeführt. Eine Schwächung des ländlichen Raums muss langfristig<br />
verhindert werden. Kurz- bis mittelfristig gilt es diese Entwicklung deutlich zu verlangsamen.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> sieht sich an der Spitze einer kommunalen Familie als Dienstleistungskonzern<br />
mit neuen Steuerungsmodellen in der Verwaltung und als Katalysator für die Entwicklungsprozesse<br />
im Odenwald.<br />
Die anstehende europäische Dienstleistungsrichtlinie ist Ansporn, das Verwaltungshandeln<br />
noch kundenorientierter und servicefreundlicher zu gestalten.<br />
Basisziel für alle Akteure in der Regionalentwicklung im Odenwald ist der kontinuierliche<br />
Ausbau der Infrastruktur. Hierdurch werden wichtige Impulse ausgelöst für die Bereiche Arbeiten,<br />
Mobilität, Versorgen und Entsorgen, Soziales, Bildung, Familien, Freizeit und Erholung.<br />
Der Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es hat im Jahr 2007 beschlossen, einen <strong>Kreisentwicklungsplan</strong><br />
zu erstellen, der einen Überblick über die Entwicklung des Kreises geben soll. Darin<br />
werden die Planungen verschiedener Fachbereiche aufgezeigt und soweit möglich aufeinander<br />
abgestimmt.<br />
Nach einer Beschreibung der Ausgangssituation werden die rechtlichen Grundlagen, die<br />
Aufgaben und die Wirkung des <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>s behandelt. In den darauf folgend<br />
beschriebenen Fachplanungen werden deren Ist-Zustände erfasst und anschließend die<br />
Ziele aufgezeigt.<br />
Einzelne Themengebiete sind Verkehrsentwicklung, Energieversorgung, Tourismus, lokale<br />
Ökonomie, Bildung, Familien- und Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Kommunikationssysteme<br />
sowie Feuerwehr- und Rettungswesen. Weitere Themengebiete umfassen Land-<br />
und Forstwirtschaft, Ver- und Entsorgung, Hochwasserschutz, interkommunale Zusammenarbeit,<br />
Verwaltungsmodernisierung, Kultur und Sport, Natur- und Umweltschutz, Denkmalschutz<br />
sowie die Vorgaben der Europäischen Union.<br />
Beschrieben werden ferner Defizite, wie z. B. der prognostizierte Bevölkerungsrückgang des<br />
ohnehin bereits gering verdichteten Raums. Dennoch wird im Vergleich zu anderen hessischen<br />
Flächenkreisen der <strong>Odenwaldkreis</strong> künftig einen weniger starken Bevölkerungsrückgang<br />
zu verzeichnen haben.<br />
7
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Grundlage für die Planungen wird u. a. die künftig zu erwartende Altersstruktur sein. Zum<br />
einen stellt die Abwanderung der 20- bis 30-Jährigen ein ernstzunehmendes Problem für den<br />
ländlichen Raum dar, weil dies den Fortbestand als funktionsfähigen Siedlungsraum langfristig<br />
gefährdet. Andererseits erhöht sich durch den demografischen Wandel der Anteil der<br />
Menschen im so genannten dritten Lebensabschnitt (Best Ager). Diese Gruppe hat die Zeit<br />
und die Freiheit, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Sie stellt eine äußerst interessante<br />
Zielgruppe für Wirtschaft und Tourismus dar.<br />
Das Bruttoinlandsprodukt für den <strong>Odenwaldkreis</strong> lag im Jahr 2006 bei etwa 2.150 Mio. € und<br />
hatte einen Anteil von 1 % am Bruttoinlandsprodukt des Landes Hessen. Bezogen auf die<br />
Einwohner wurden ca. 63 % des hessischen Durchschnittes erreicht. Vorteilhaft ist, dass<br />
aufgrund der Wirtschaftsstruktur, bei der keine großen Abhängigkeiten vieler (Zuliefer-) Betriebe<br />
von einem einzigen Unternehmen bestehen, einzelne Schließungen weniger fatale<br />
Folgen für den gesamten Arbeitsmarkt im <strong>Odenwaldkreis</strong> haben.<br />
Das Land Hessen hat sich bis zum Jahr 2015 zum Ziel gesetzt, 15 % des Energiebedarfs<br />
aus regenerativen Energiequellen zu decken. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat in einer Potenzialstudie<br />
des Witzenhausen-Instituts dargelegt, dass dieses Ziel durch gemäßigten Ausbau der Windkraft<br />
zu erreichen ist. Allerdings ist bei der Nutzung von Biomasse und Photovoltaik eine viel<br />
höhere Wertschöpfung innerhalb der Region <strong>Odenwaldkreis</strong> zu erreichen, als dies jemals<br />
durch Windkraft möglich wäre. Die Erschließung dieser Ressourcen stellt für den <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
eine große wirtschaftliche Chance dar.<br />
Der vorliegende <strong>Kreisentwicklungsplan</strong> wird nun als Arbeitsfassung in den politischen Gremien<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es behandelt. Anregungen, Ergänzungen und Änderungswünsche<br />
werden in noch zu gründenden Arbeitsgruppen erarbeitet und anschließend in den <strong>Kreisentwicklungsplan</strong><br />
eingearbeitet. Die genannten Ziele einzelner Bereiche werden mit den Zielen<br />
andere Themenfelder abgeglichen und entsprechend gewichtet.<br />
Die <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>ung ist mit Leben zu füllen. Fortlaufend sind wichtige Ziele zu formulieren,<br />
die Zielerreichung ist zu erfassen und auf dieser Grundlage kann die Entwicklung<br />
aktiv gesteuert werden.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> sieht die Notwendigkeit für eine über gemeindliche Grenzen hinausschauende<br />
abgestimmte Planung, von deren Umsetzung die Bewohner dieser Region profitieren<br />
können.<br />
8
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
2. Ausgangssituation<br />
Die Entwicklung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ist durch die (raumbedeutsamen) Planungen des<br />
Landes stark beeinflusst, wobei kreisspezifische Belange unzureichend berücksichtigt werden.<br />
Um einerseits in die übergeordneten Planungen besser einzugreifen, andererseits die<br />
vielfältigen gemeindlichen Belange gemeinsam besser zu vertreten, ist es sinnvoll, diesen<br />
Vorgaben eine eigene Planung gegenüberzustellen.<br />
Zum anderen sind mit dieser Form der Regionalplanung vorhandene strukturelle Defizite vor<br />
Ort nicht zu beseitigen, wenn dies nicht auf der Grundlage einer umfassenden Erfassung,<br />
Bestandsanalyse, Zustandsbeschreibung, Perspektivenentwicklung und –umsetzung geschieht.<br />
Dazu ist eine <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>ung für den <strong>Odenwaldkreis</strong> umzusetzen, die sich einerseits<br />
auf die vorhandenen externen Formen der regionalplanerischen Zusammenarbeit<br />
stützt, aber auch und insbesondere die Entwicklung eines eigenständigen aktiven Standortmarketings<br />
und eine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und struktureller Anpassungsprozesse<br />
im Kreis selbst beinhaltet. Im Hinblick auf die immer größere Bedeutung interkommunaler<br />
Zusammenarbeit soll diese Planung gemeinsam mit den Städten und Gemeinden<br />
angegangen werden, um überörtliche Zielsetzungen zu formulieren, die gesamten<br />
Potenziale der Region zu mobilisieren und damit in künftigen externen und internen Standortfragen<br />
bestehen zu können.<br />
Grundlagen bilden die bereits in vielfältiger Form und in den verschiedensten Institutionen<br />
vorhandenen Datenbestände wie die gemeindlichen Flächennutzungspläne, die überörtlichen<br />
Fachplanungen (z. B. Landwirtschaftsplan, Straßenplanungen) und die nicht raumbezogenen<br />
Planungen, die sich nur sekundär auf die räumliche Planung auswirken wie z. B.<br />
die Schulentwicklungsplanung.<br />
Wesentliche Inhalte der <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>ung <strong>Odenwaldkreis</strong> sind:<br />
- Grunddaten (Einwohnerentwicklung/Demografie/Steuerkraft/Arbeitsplätze)<br />
- Verkehr (Straßen/Radwege/Schiene/Nahverkehr)<br />
- Versorgung (Energie/Wasser)<br />
- Entsorgung (Abwasser/Abfall)<br />
- Informations- und Kommunikationstechnologie<br />
- Hochwasserschutz (Mümling/Gersprenz)<br />
- Schulen (Schulentwicklungsplanung)<br />
- Sport (Sportstätten)<br />
- Soziales (Gesundheitswesen/Pflege)<br />
- Katastrophenschutz<br />
- Natur- und Umweltschutz<br />
- Landwirtschaft und Forsten<br />
- Interkommunale und interregionale Zusammenarbeit<br />
Klausurtagung 2004 in Mossautal/Güttersbach<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> wurde bereits 2004 der Grundstein für eine kreisweite Regionalentwicklung<br />
gelegt und eine Kreisleitbilddiskussion angestoßen. Am 26. und 27. Januar 2004 fand in<br />
Mossautal/Güttersbach mit den Bürgermeistern und Vertretern aus dem Kreisausschuss und<br />
dem Kreistagspräsidium eine Strategieklausur statt. Die Veranstaltung sollte als Einstieg in<br />
eine gemeinsame Strategieentwicklung zwischen dem Kreis und seinen Städten und Gemeinden<br />
dienen, wie dies zuvor in den Kreisgremien und in der Bürgermeisterversammlung<br />
vereinbart worden war. Die mit der Moderation beauftragte Unternehmensberatung hat zu<br />
der Veranstaltung einen umfangreichen Abschlussbericht erstellt, der den Fraktionsvorsitzenden<br />
zur Kenntnis gegeben wurde.<br />
9
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Auf der Klausurtagung wurden unter den Überschriften „Wirtschaft und Arbeit“, „Verkehr und<br />
Infrastruktur“, „Wissenschaft und Bildung“, „Freizeit und Sport“, „Natur und Umwelt“, „Kultur<br />
und Brauchtum“, „Jugend und Soziales“ sowie „Gemeinde- und Kreisstrukturen“ vielfältige<br />
Themen diskutiert und zunächst allgemeine Ziele formuliert.<br />
Einige Projekte wurden weiterentwickelt und teilweise bereits abgeschlossen:<br />
• die Modernisierung der Odenwaldbahn<br />
• die Ortsumgehung Höchst<br />
• die Bildung verschiedener Netzwerke (CLEO, Pferdecluster etc.) zur Wirtschaftsförderung<br />
• verstärkte Förderung regenerativer Energien (rEnergO 1 )<br />
• flächendeckende Breitbandversorgung im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Darüber hinaus haben sich einige Rahmenbedingungen (Anerkennung als Projektregion<br />
Bioregio Holz, Gesetzesänderungen, Neuaufstellung des Regionalplans) verändert, verschiedene<br />
Themen wurden noch nicht abschließend behandelt. Mit der Erstellung des <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>s<br />
wird eine Aktualisierung und Weiterführung der Diskussion aufgegriffen.<br />
3. Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Wirkung des <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>es<br />
Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Absatz 2 GG 2 und Art. 137 der Hessischen Landesverfassung<br />
3 beinhaltet unter anderem die Planungshoheit der Gemeinden. Diese wird<br />
lediglich durch Gesetze, Fachplanungen und übergeordnete Planungen eingeschränkt. Der<br />
übergeordnete Plan, der im Gegenstromprinzip die gemeindlichen Planungen berücksichtigen<br />
muss, ist der Regionalplan Südhessen, der vom Regierungspräsidium Darmstadt erstellt<br />
und von der Regionalversammlung Südhessen beschlossen wird. Er regelt grundsätzliche<br />
Raumnutzungen und beinhaltet Planungen von überörtlicher Bedeutung. Prinzipiell sind in<br />
Deutschland wie anderen europäischen Staaten Deregulierungstendenzen in der formellen<br />
Planung zu erkennen.<br />
Ergänzend zur formellen Raumordnung – insbesondere vor dem Hintergrund europäischer<br />
Fördermöglichkeiten und der Verwaltungsstrukturreform – werden zunehmend informelle<br />
Instrumente eingesetzt wie Regionale Entwicklungskonzepte, Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte<br />
und Kreisentwicklungspläne. Der Bedeutungsgewinn von Entwicklungsplänen<br />
gegenüber den Ordnungsplänen lässt sich auf die größere Flexibilität der informellen Instrumente<br />
bei Erstellung, Inhalt, Ausprägung und Form zurückführen. Die informellen Pläne und<br />
Programme entfalten keine rechtliche Bindung, die betroffenen Gebietskörperschaften (und<br />
Dritte) können eine Selbstbindung beschließen.<br />
Bei der <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>ung ist darauf zu achten, dass in die Planungshoheit der Gemeinden<br />
nicht eingegriffen wird bzw. in Zusammenarbeit mit den Gemeinden übergeordnete<br />
Themen behandelt werden. Die bestehenden raumbedeutsamen Fach- und Gesamtplanungen<br />
müssen in die <strong>Kreisentwicklungsplan</strong>ung übernommen werden, für zukünftige Planungen<br />
sollte der Plan als richtungsweisende Gesamtkonzeption angesehen werden. Deshalb<br />
muss er kontinuierlich fortgeschrieben werden.<br />
1 rEnergO: Gesellschaft zur Förderung, Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien mbH als ein<br />
Tochterunternehmen der Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH<br />
2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer<br />
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom<br />
28.08.2006 (BGBl. I S. 2034)<br />
3 Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229), berichtigt GVBl. 1947 S.<br />
106; 1948 S. 68, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2002 (GVBl. S. 626-628)<br />
10
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Wie andere Planungen auch müssen Entwicklungspläne durch prozesshafte Anpassung an<br />
veränderte Rahmenbedingungen durch kontinuierliche Fortschreibung aktualisiert werden.<br />
Dazu ist ein Monitoring durchzuführen.<br />
Der <strong>Kreisentwicklungsplan</strong> formuliert ein Leitbild für den Kreis, die Abstimmung der einzelnen<br />
konkurrierenden Belange und leitet übergeordnete Ziele ab. Er zielt nicht auf die Erarbeitung<br />
eines neuen Planwerkes, sondern führt vielmehr Planungen zusammen, hat Programmcharakter<br />
und beinhaltet konkrete Maßnahmen. Mit der Kreisentwicklung soll gleichzeitig<br />
die Voraussetzung geschaffen werden, die Belange des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in übergeordnete<br />
Planungen wie den Regionalplan einzubringen.<br />
4. Lage des Kreises und seine Beziehungen zu den Nachbarkreisen<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> liegt im Süden Hessens und nimmt den größten Teil des naturräumlichen<br />
Odenwaldes ein. Im Westen grenzt er an den Landkreis Bergstraße, im Norden an den Kreis<br />
Darmstadt-Dieburg, im Osten an den bayrischen Landkreis Miltenberg und im Süden an den<br />
baden-württembergischen Neckar-<strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Abb.: <strong>Odenwaldkreis</strong>, Lage im Raum<br />
Quelle: Regionalplan Südhessen Entwurf 2007/ www.odenwaldkreis.de<br />
5. Raumstruktur, Zahlen, Daten und Prognosen<br />
5.1. Der ländliche periphere Raum<br />
Raumstrukturtypen dienen der Beschreibung von Raum- und Siedlungsstruktur und der<br />
Formulierung von raumordnerischen Politikansätzen. Das Bundesamt für Bauwesen und<br />
Raumordnung (BBR) hat in seinem Raumordnungsbericht 2005 eine neue Methode zur<br />
Grundtypisierung der Raumstruktur vorgestellt, die sich auf weniger Basisindikatoren als<br />
11
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
bisher stützt und problemorientierter angewendet wird. Die Länder unterteilen ihr Zuständigkeitsgebiet<br />
in ihren Landesentwicklungsplänen und Regionalplänen in siedlungsstrukturelle<br />
Regionstypen, um raumstrukturell differenzierte Aussagen für „Ordnungsraum“, „Verdichtungsraum“<br />
und „ländlichen Raum“ (Bsp. Hessen) treffen zu können. Diese Gebietstypen<br />
basieren in ihrer Abgrenzung auf administrativen Gebietseinheiten, da statistische Daten<br />
ebenfalls für diese Gebiete erhoben werden und dementsprechend bereits zur Verfügung<br />
stehen. Unter raumordnerischen Gesichtspunkten ist diese Gebietskulisse jedoch ungeeignet,<br />
adäquate Handlungsprogramme zu entwickeln, da viele Kreise beispielsweise eine heterogene<br />
Raumstruktur aufweisen. Der neue Ansatz des BBR basiert deshalb nicht auf administrativen<br />
Grenzen, sondern auf geographischen Gegebenheiten. Als Parameter zur raumstrukturellen<br />
Einstufung dienen dem BBR im Raumordnungsbericht 2005 einerseits die Bevölkerungsdichte<br />
und die Lage zu den zentralen Orten (Zentrenerreichbarkeit).<br />
Bei der Bestimmung der Bevölkerungsdichte wird für eine Vielzahl von Messpunkten im<br />
Raum eine Dichtedarstellung vorgenommen, die auch die Dichte im Umkreis von 12 km um<br />
den Messpunkt herum berücksichtigt. Damit werden Ungleichgewichte in der Dichte berücksichtigt<br />
4 .<br />
Der Zentrenerreichbarkeit liegt zugrunde, dass „von jedem beliebigen Punkt im Bundesgebiet<br />
alle Zielorte des Zentrensystems (Oberzentren und metropolitane europäische Wachstumsregionen)<br />
in gewissen Fahrzeiten im Straßennetz erreichbar“ 5 sind. Die einzelnen Fahrzeiten<br />
wurden in einem Index zusammengefasst, der alle Zielorte nach ihrer Bedeutung und<br />
in Abhängigkeit von der zu ihrer Erreichung notwendigen PKW-Fahrzeit gewichtet aufaddiert.<br />
Der Index zeigt, dass die Attraktivität von Zielen mit deren Größe zunimmt und gleichzeitig<br />
bei wachsendem Zeitaufwand zur Erreichung sinkt. Die Bedeutungsstufen, die sich aus den<br />
indizierten Fahrzeiten ergeben, werden verwendet, um die Zonen der Zentrenerreichbarkeit<br />
„sehr peripher“, „peripher“, „zentrennah“, „erweiterter zentraler Raum“ und „zentral“ festzulegen.<br />
Die Peripherräume nehmen etwa 60 % des Bundesgebietes ein, und trotz der geringen<br />
Bevölkerungsdichte lebt hier knapp ein Viertel der Bevölkerung. In den Peripherräumen ist<br />
die Bevölkerungsdichte sehr gering (teils unter 100 Einwohnern pro qkm) und Zentren liegen<br />
oft in weiter Entfernung. Signifikant sind Bevölkerungs- und Arbeitsplatzrückgang, die hier<br />
wesentlich stärker ausgeprägt sind als in den Verdichtungsräumen.<br />
Betrachtet man Räume nach ihrer jeweiligen spezifischen Funktion, so verwendet man die in<br />
der Landes- und Regionalplanung üblichen Begriffe wie „Verdichtungsraum“ oder „ländlicher<br />
Raum“. Nicht alle peripheren Räume sind gleichzeitig ländliche Räume und allein die Betrachtung<br />
nach der Siedlungsstruktur und der Zentrenerreichbarkeit charakterisieren den<br />
Raum nicht nach seiner Funktionalität. Durch die zunehmende Angleichung der ländlichen<br />
Räume an städtische (z.B. durch Suburbanisierung, Ausdifferenzierung der Wirtschaftsstruktur<br />
und Anschluss an moderne Kommunikationstechnologien) wird die Unterscheidung<br />
immer schwieriger und „der ländliche Raum“ ist immer weniger eine einheitliche Raumkategorie<br />
6 . Europaweit wird die Multifunktionalität des ländlichen Raumes als Leitbild angesehen<br />
7 . Ländliche Räume haben insbesondere funktionale Schwerpunkte oder Funktionspotenzial<br />
in den Schwerpunkten Wohnen, Ökotop und Naturschutz, Tourismus und wohnortnahe<br />
Erholung, Wirtschaft, Ressourcenbereitstellung und Standort für Infrastrukturen.<br />
Im Raumordnungsbericht 2005 wird der <strong>Odenwaldkreis</strong> die Bevölkerungsdichte betreffend<br />
etwa hälftig als „dünn besiedelter“ und als „gering verdichteter“ Raum eingestuft. In der Einstufung<br />
über die Zentrenerreichbarkeit gehört der <strong>Odenwaldkreis</strong> überwiegend zum „peripheren<br />
Raum“. Bei der Überlagerung von Bevölkerungsdichte und Zentralität ergibt sich für den<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> eine Zugehörigkeit zum „Peripherraum“ (mit kleinen Ansätzen zum Zwischenraum)<br />
und in der stärkeren Ausdifferenzierung zum „Peripherraum sehr geringer Dichte“ und<br />
kleine Teile im Norden des Kreises gehören zum „Peripherraum mit Verdichtungsansätzen“,<br />
4<br />
Raumordnungsbericht 2005, S. 16<br />
5<br />
a. a. O., S. 17<br />
6<br />
a. a. O.,, S. 203<br />
7<br />
So schlägt es die Europäische Charta des ländlichen Raumes des Europarates vor und so wurde es auch von<br />
der OECD 2001 angenommen<br />
12
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
wobei sich die beiden Kategorien vor allem hinsichtlich der Bevölkerungsdichte unterscheiden.<br />
5.2. Landesplanerische Vorgaben<br />
Der Landesentwicklungsplan Hessen, der geltende neu genehmigte Regionalplan Südhessen<br />
2000 (RPS) und der Regionalplanentwurf 2007 definieren den <strong>Odenwaldkreis</strong> als ländlichen<br />
Raum und geben ihm damit die Zielsetzung, als „eigenständiger und attraktiver Lebens-<br />
und Wirtschaftsraum gestaltet [zu] werden; eine einseitige Entwicklung zum Wohnstandort<br />
und Ergänzungsraum für den Ordnungsraum ist zu vermeiden. Seine wirtschaftliche<br />
Kompetenz ist zu stärken. Dazu ist/sind:<br />
• die Mittelzentren in ihren Versorgungs-, Arbeitsplatz- und Infrastrukturfunktionen für ihr<br />
ländliches Umland zu stärken,<br />
• in den Mittelzentren günstige Standortbedingungen für Entwicklung, Ansiedlung und Neugründung<br />
sowie Erweiterung nicht agglomerationsabhängiger Unternehmen zu schaffen,<br />
• die über die Eigenentwicklung hinausgehende Wohnsiedlungstätigkeit vorrangig in den<br />
Mittelzentren zu konzentrieren und die Tragfähigkeit und Eigenart ländlicher Strukturen<br />
bei der weiteren Siedlungstätigkeit als begrenzende Faktoren zu berücksichtigen,<br />
• das Potenzial an noch weitgehend unbelasteten, landschaftlich attraktiven und ökologisch<br />
empfindlichen Räumen zu sichern und vor Beeinträchtigungen durch konkurrierende Nutzungen<br />
zu schützen,<br />
• die land- und forstwirtschaftliche Nutzung in ihrer ökonomischen Funktion und im Hinblick<br />
auf die Pflege der ländlichen Kulturlandschaft zu erhalten,<br />
• regionaltypische Formen von Tourismus und Erholung bei schonender Nutzung der landschaftlichen<br />
Potenziale auch als Wirtschaftsfaktor weiter zu entwickeln,<br />
• leistungsfähige Verkehrsanbindungen mit den Zentren des Verdichtungsraums durch<br />
geeignete Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu gewährleisten und<br />
eine angemessene ÖPNV-Bedienung flächendeckend sicherzustellen,<br />
• vorhandene Infrastruktureinrichtungen zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen,<br />
• Voraussetzungen für vielfältige und zukunftssichere wohnstättennahe Erwerbsmöglichkeiten,<br />
vor allem auch für Frauen, zu schaffen.“ 8<br />
Zentrale Orte und Entwicklungsachsen<br />
Das Zentrale-Orte-System wurde 1926 von Christaller entwickelt und seither kaum verändert.<br />
Ziel des Systems ist es, überall gleiche Lebensstandards zu erreichen. Dazu werden<br />
durch den RPS den einzelnen Städten und Gemeinden zentralörtliche Funktionen zugewiesen,<br />
aus denen sich ergibt, welche Erweiterungen im Siedlungs- und Gewerbebereich zulässig<br />
sind, welche Einzelhandelsunternehmen sich ansiedeln etc. Das System wurde zu einer<br />
Zeit entwickelt, als die Mobilität der Menschen noch wesentlich eingeschränkter war und<br />
Regionalisierung, interkommunale Kooperation sowie Globalisierung noch keine Rolle spielten.<br />
Dementsprechend treffen viele Voraussetzungen nicht mehr zu, z. B. die Größe des<br />
Verflechtungsbereichs.<br />
Finanzielle Auswirkungen entstehen, weil Landeszuweisungen an die zentralörtliche Funktion<br />
einer Gemeinde/Stadt geknüpft sind.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind nur Erbach und Michelstadt als Mittelzentren ausgewiesen. Die<br />
Trasse der B 45 und der Odenwaldbahn entlang des Mümlingtals ist zwar als Regionalachse<br />
(bedeutsame Verbindung zwischen Mittelzentren) ausgewiesen, überörtliche Nahverkehrs-<br />
8 Textteil zum Regionalplan Südhessen Entwurf 2007, S. 12, entwickelt aus den Vorgaben des LEP<br />
2000 S. 11<br />
13
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
und Siedlungsachsen, an denen die Entwicklung zukünftig konzentriert werden soll, führen<br />
jedoch keine in oder durch den <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Die Lage an einer überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachse ist Voraussetzung für<br />
eine Entwicklung des Raumes entlang der Achse über eine Eigenentwicklung hinaus.<br />
Der Regionalplan Südhessen (Entwurf 2007) definiert überörtliche Nahverkehrs- und Siedlungsachsen<br />
ausnahmslos nur bis an die Grenze des <strong>Odenwaldkreis</strong>es. Alle Achsen enden<br />
vor dem <strong>Odenwaldkreis</strong> (in Fürth, Groß-Umstadt, Eberbach/ Hirschhorn), wodurch das<br />
Kreisgebiet vollständig von einer gezielten Entwicklung ausgeschlossen wird. Um dem ländlichen<br />
Raum eine angemessene Möglichkeit zu geben, sich (gemäß dem nach wie vor aktuellen<br />
Postulat der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“) mit den Metropolregionen fortzuentwickeln,<br />
darf ein solcher „Konservierungsstatus“ nicht Ziel der Planungen sein.<br />
Die neue EU-Politik erfordert die Auseinandersetzung mit der Frage, wie die ländlichen<br />
Räume der Peripherie von der Entwicklung profitieren können und den Metropolregionen als<br />
Supportregionen dienen können. Wenn der <strong>Odenwaldkreis</strong> Versorgungsraum für die Metropolregionen<br />
im Sinne der Lissabon-Strategie sein soll, muss er durch die Funktion auch eine<br />
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit haben.<br />
Aus diesem Grund sollten die Achse Darmstadt-Michelstadt-Erbach(-Eberbach) im Regionalplan<br />
Südhessen als überörtliche Nahverkehrs- und Siedlungsachse ausgewiesen und die<br />
überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachsen, die bis nach Fürth und Reinheim geführt<br />
sind, über Brensbach und Reichelsheim verbunden werden.<br />
Die B 426 zwischen Höchst i. Odw. und Obernburg am Main sollte als Regionalachse eingestuft<br />
werden. Die B 426 ist derzeit die einzige für Schwerlastverkehr geeignete Anbindung<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es an das bayerische Maintal und hat damit die überörtliche Bedeutung<br />
einer Regionalachse.<br />
Abb.: Zentrale Orte und Verkehrsachsen Region Darmstadt<br />
Quelle: Regionalplan Südhessen Entwurf 2007<br />
Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main hat sich für die Erstellung ihres Regionalplans und<br />
des parallel aufgestellten Regionalen Flächennutzungsplans ein Leitbild gegeben. Darin sind<br />
14
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
fünf gleichberechtigte Ziele enthalten, die der Annahme entsprechen, die Räume weisen<br />
eine Funktionsmischung auf:<br />
- Region der starken Zentren<br />
- Region der jungen Leute und Familien<br />
- Region der Wissenschaft und der Ausbildung<br />
- Region der innovativen Branchen<br />
- Region der Mobilität und Logistik<br />
- Region der attraktiven Landschaft und Kultur<br />
5.3. Bevölkerungsentwicklung<br />
Obwohl der <strong>Odenwaldkreis</strong> in den Jahren 1990 bis 2003 einen über dem hessischen Durchschnitt<br />
liegenden Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen hatte, wird die Bevölkerungszahl<br />
aktuellen Prognosen zufolge in den kommenden Jahren wie in den letzten drei Jahren zunächst<br />
leicht, dann stärker rückläufig sein. 2006 lebten bereits weniger als 100.000 Einwohner<br />
im Landkreis. Der Abwärtstrend liegt in der Tatsache begründet, dass in den letzten Jahren<br />
die Wanderungsgewinne stark gesunken sind und sich die Altersstruktur immer weiter zu<br />
den über 60-Jährigen verschiebt. Mit knapp 20 % über 64-Jährigen liegt der <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
etwa zwei Prozent über dem Landesdurchschnitt. Obwohl der Kreis mit 25 % über 6-Jährigen<br />
nur knapp über dem Landesdurchschnitt liegt, wird dem Land Hessen insgesamt ein fast<br />
doppelt so hoher Bevölkerungsrückgang prognostiziert 9 . Damit wird der <strong>Odenwaldkreis</strong> im<br />
Vergleich zu anderen hessischen Flächenkreisen deutlich weniger von Bevölkerungsrückgang<br />
betroffen sein, das Problem wird eher in der Altersstruktur liegen. Im Moment hat der<br />
Odenwalkreis allerdings einen überdurchschnittliche Bevölkerungsrückgang (2004 zu 2005 -<br />
0,3 %, Hessen -0,1).<br />
Die stark schwankenden Bevölkerungsentwicklungen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden<br />
bedingt auch ein großes Gefälle bezüglich der Voraussetzungen für gleichwertige<br />
Lebensbedingungen. Während 2004 die großen Gemeinden wie Erbach, Michelstadt, Reichelsheim<br />
(Odenwald) und Höchst i. Odw. bis zu 19,6 % Bevölkerungszuwachs gegenüber<br />
1990 zu verzeichnen hatten, mussten die kleinen Gemeinden wie Hesseneck und Sensbachtal<br />
im gleichen Zeitraum bis zu 9,3 % Bevölkerungsverluste hinnehmen 10 , wobei der<br />
Anteil der über 65-Jährigen auffällig hoch und auf einen verstärkten Wegzug der Jüngeren<br />
zurückzuführen ist. Gerade diese Abwanderung der 20- bis 30-Jährigen stellt den ländlichen<br />
Raum vor ein ernstzunehmendes Problem, weil sie den Fortbestand als funktionsfähigen<br />
Siedlungsraum langfristig gefährdet.<br />
9 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL), Regionale Bevölkerungsvorausberechnung Basis<br />
31.12.2003, mittlere Variante (13)<br />
10 HSL, Hessische Gemeindestatistik<br />
15
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Grafik: Einwohnerentwicklung<br />
105.000<br />
100.000<br />
95.000<br />
90.000<br />
85.000<br />
80.000<br />
75.000<br />
Quelle: hsl<br />
1987<br />
1990<br />
1995<br />
Einwohner <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
2000<br />
2002<br />
16<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Prognose 2020<br />
Prognose 2050<br />
Der demographische Wandel stellt auch den <strong>Odenwaldkreis</strong> vor große Herausforderungen<br />
für die Zukunft. Während sich bis zum Jahre 2020 wenig Veränderungen bei der Gesamtbevölkerung<br />
ergeben, sind deutliche Umschichtungen bei den Altersgruppen zu erwarten,<br />
die sich nach 2020 noch verstärken werden, wenn die Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand<br />
tritt. Dadurch finden sich durch den demographischen Wandel Menschen im sogenannten<br />
dritten Lebensabschnitt – auch Best Ager genannt –, die Zeit und Freiheit haben,<br />
sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern und die somit eine interessante Zielgruppe für<br />
Wirtschaft und Tourismus darstellen.<br />
Tabelle: Absolute Altersstrukturentwicklung 2003 bis 2020<br />
Veränderung<br />
Altersgruppen 2003 2020 absolut in Prozent<br />
0-5 Jahre 5603 4671 -932 -16,6%<br />
6-18 Jahre 15647 11767 -3880 -24,8%<br />
19-29 Jahre 11853 10976 -877 -7,4%<br />
30-49 Jahre 30075 23472 -6603 -22,0%<br />
50-64 Jahre 18936 24199 5263 27,8%<br />
65-79 Jahre 14156 16921 2765 19,5%<br />
über 80 Jahre 4384 8274 3890 88,7%<br />
Gesamt 100654 100280 -374 -0,4%<br />
Quelle: Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH (ies)
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5.4. Arbeitsmarkt<br />
Als Wirtschaftsstandort ist der <strong>Odenwaldkreis</strong> Sitz vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen,<br />
zahlreicher Handwerksbetriebe sowie einiger Großbetriebe 11 . Ein deutlicher<br />
Schwerpunkt liegt im Bereich des produzierenden Gewerbes mit Konzentration auf die<br />
Gummi- und Kunststoffindustrie, insbesondere als Zulieferer für die Kraftfahrzeugindustrie.<br />
Das verarbeitende Gewerbe ist im <strong>Odenwaldkreis</strong> nach wie vor führend, gleichzeitig ist ein<br />
deutlicher Rückgang der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem<br />
Bereich zu erkennen. Die Landwirtschaft hat nur noch einen Anteil von 1 % an der gesamten<br />
Bruttowertschöpfung des Kreises 12 , der Dienstleistungssektor bleibt hinter den Erwartungen<br />
zurück. Obwohl der Tourismus nicht die dominierende Erwerbsquelle darstellt, hat er einen<br />
qualitativen Wert für die Region: Kulturlandschaft und tradierte Handwerke werden häufig<br />
aus touristischen Gründen gepflegt und fördern gleichzeitig die regionale Identität.<br />
In weiten Teilen prägt die Landwirtschaft zwar noch die Landschaft der ländlichen Räume,<br />
die eigentliche wirtschaftliche Basis ist sie aber schon lange nicht mehr. Viele Landwirte haben<br />
durch die Nebenerwerbslandwirtschaft und die Aufnahme zusätzlicher Einkommensquellen<br />
in den Bereichen Veredelung, Direktvermarktung, Tourismus und Landschaftspflege<br />
eine Existenzsicherungsstrategie gefunden. Für die Kulturlandschaften ist die Land- und<br />
Forstwirtschaft existenziell. Der ländliche Raum bietet vor allem für verarbeitendes Gewerbe<br />
die ideale Umgebung. Sowohl Handwerkerbesatz als auch Gründungsquoten liegen hier<br />
deutlich über den Zahlen der urbanen Räume, was vor allem auf das große Flächenangebot<br />
zurückzuführen ist. Die Attraktivität des Raumes steigt mit der Anbindung an Autobahnen. In<br />
der Entwicklung des Dienstleistungssektors hinken die meisten ländlichen Räume hinterher.<br />
Auch der Tourismus ist in vielen Gebieten nicht die Basis guter Einkommensmöglichkeiten,<br />
obwohl in vielen Regionen ein hohes Potenzial vorhanden ist. Wie in vielen ländlichen Räumen<br />
kumulieren auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> die wirtschaftsstrukturellen Problemlagen, die sich<br />
außerdem noch gegenseitig verstärken: geringe Bevölkerungsdichte, suboptimale Versorgung<br />
mit technischen und sozialen Einrichtungen, mangelndes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln,<br />
ungünstige Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft (kleine Flächen in<br />
einer gegliederten, topographisch bewegten Landschaft), wenig Dynamik im Dienstleistungssektor<br />
und damit wenig Arbeitsplatzalternativen und ein geringes Niveau an Investitionstätigkeit.<br />
Die besondere geographische Lage im Einzugsbereich der beiden Metropolregionen Rhein-<br />
Main und Rhein-Neckar wird sowohl als Chance als auch als Risiko angesehen. Einerseits<br />
kumulieren die Metropolregionen Kaufkraft, Arbeitsplätze und inzwischen auch wieder Einwohner<br />
auf sich, andererseits finden auch viele Odenwälder dort Arbeit, Handwerker weitere<br />
Absatzmärkte und Gaststätten Wochenendbesucher aus den Metropolregionen.<br />
2004 stieg das Bruttoinlandsprodukt im <strong>Odenwaldkreis</strong> mit 4,3 % (Hessen 1,8 %) überdurchschnittlich,<br />
dennoch hat der <strong>Odenwaldkreis</strong> von allen Kreisen und kreisfreien Städten mit 1 %<br />
den kleinsten Anteil des Bruttoinlandsproduktes von Hessen 13 . Bis 2006 war ein leichter<br />
Rückgang zu verzeichnen und das Bruttoinlandsprodukt für den <strong>Odenwaldkreis</strong> lag bei etwa<br />
2.150 Mio. €. Bezogen auf die Einwohner wurden ca. 63 % des hessischen Durchschnitts<br />
erreicht.<br />
Die Wirtschaftsstruktur darf nicht nur negativ bewertet werden, schließlich bestehen im<br />
Kreisgebiet nicht so große Abhängigkeiten vieler (Zuliefer-)Betriebe von einem großen.<br />
Somit haben einzelne Schließungen weniger fatale Folgen für den Arbeitsmarkt.<br />
11 Standortkonzept für den <strong>Odenwaldkreis</strong>, IHK Darmstadt, 2003<br />
12 Laufende Raumbeobachtung des BBR, Stand 2002<br />
13 HSL am 19.02.2007 und 05.08.2008<br />
17
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Pendlerströme:<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> muss mit einer PKW-Fahrzeit von durchschnittlich 36 Minuten zur nächsten<br />
Autobahnanschlussstelle gerechnet werden, mehr als doppelt so lange wie für den hessischen<br />
Durchschnitt 14 .<br />
Das bedeutet nicht nur für die Wirtschaft eine kostenintensive Logistik, sondern auch einen<br />
finanziellen wie zeitlichen Aspekt für die Einwohner und letztendlich die wirtschaftliche Lage<br />
des Kreises insgesamt: Etwa die Hälfte der Pendler aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong> haben ihren<br />
Arbeitsplatz außerhalb des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, etwa 40 % davon haben eines der Oberzentren<br />
zum Ziel, knapp 10 % nehmen eine Strecke von mehr als 50 km zu ihrem Arbeitsplatz in<br />
Kauf 15 . Die Verflechtungen bestehen weitestgehend zum Ballungsraum Frankfurt-Rhein-<br />
Main (insgesamt etwa 36 %). Lediglich aus der Oberzent pendeln zwischen 8-35 % (gemeindespezifische<br />
Angaben) der Arbeitnehmer zum Großraum Heidelberg/Mannheim. Die<br />
Gemeinden Lützelbach und Breuberg haben Verkehrsströme nach Bayern zu verzeichnen<br />
(ca. 20 % der dortigen Pendler). Im südlichen Gersprenztal verliert Darmstadt von seiner<br />
Dominanz, dafür verstärken sich hier Verflechtungen in den Kreis Bergstraße 16 .<br />
Folgen dieser starken Pendlerverflechtungen sind Kosten für PKW, Instandhaltung der Straßen,<br />
aber auch Abfluss von Kaufkraft (Einkäufe werden in der Mittagspause am Arbeitsort<br />
erledigt) und Umweltbelastung durch Staus.<br />
Seit dem 1.1.2005 wurde der <strong>Odenwaldkreis</strong> mit der Einführung des Sozialgesetzbuches<br />
Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zugelassener kommunaler<br />
Träger für die Leistungen nach dem SGB II. Er nimmt seit diesem Zeitpunkt als Optionskommune<br />
die Aufgaben der Leistungsgewährung, des Fallmanagements und der Arbeitsvermittlung<br />
für die im <strong>Odenwaldkreis</strong> wohnenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wahr, die<br />
Ansprüche aus Arbeitslosengeld II haben. Der Kreis ist mit dem dazu geschaffenen Kommunalen<br />
Job-Center seit diesem Zeitpunkt neben der Agentur für Arbeit mit ihrer Geschäftsstelle<br />
in Erbach maßgeblicher Akteur bei der Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik im Kreis.<br />
Die Arbeitslosenquote (arbeitslos gemeldeten Personen im Verhältnis zur Zahl aller zivilen<br />
Erwerbspersonen im Kreisgebiet) konnte im <strong>Odenwaldkreis</strong> seit 2005 deutlich gesenkt werden.<br />
Lag sie im Januar 2005 noch bei 9,0 %, so wurde zum 31.12.2007 nur noch eine Quote<br />
von 5,5 % festgestellt. Im Hessenvergleich lagen dabei lediglich die von der guten Arbeitsmarktlage<br />
im Rhein-Main-Gebiet profitierenden Landkreise Hochtaunus, Main-Taunus und<br />
Rheingau-Taunus sowie die Städte Fulda und Darmstadt vor dem Odenwald. Die absolute<br />
Zahl an Arbeitslosen sank dabei von Januar 2005 bis Dezember 2007 von 5.128 auf 2.823.<br />
Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte das Kommunale Job-Center des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Vor allem die Fokussierung auf den Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen<br />
brachte einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen der Unter-25-Jährigen von 819<br />
im Januar 2005 auf 320 im Dezember 2007.<br />
Das statistisch ermittelte verfügbare Jahreseinkommen der Odenwälder lag 2004 – im deutlichen<br />
Gegensatz zu dem der Bewohner angrenzender Kreise – mit 16.764 € pro Person weit<br />
unter dem hessischen Mittel und knapp über 10.000 € unter dem Einkommen der einkommensstärksten<br />
Bewohner des Hochtaunuskreises. Prozentual haben die privaten Haushalte<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> mit 1,5 % landesweit den geringsten Anteil am verfügbaren Einkommen in<br />
Hessen, obwohl es der Regierungsbezirk Darmstadt insgesamt auf einen Anteil von 65 %<br />
des hessischen Einkommens bringt 17 . Dadurch werden die Ungleichgewichte in der Region<br />
Südhessen sehr deutlich.<br />
14 BBR-Bericht 2003, Bd. 17<br />
15 Raumordnungsbericht 2005, S. 81<br />
16 Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG): Nahverkehrsplan <strong>Odenwaldkreis</strong> Januar 2007, S. 6<br />
17 HSL: Statistisches Jahrbuch 2005/2006<br />
18
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
II. Fachplanungen<br />
1. Verkehrsentwicklung<br />
Die aktuellen Statistiken und darauf aufbauenden Zukunftsszenarien, unter anderem von<br />
Prognos AG, Berlin und der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, versuchen dem <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
einen wirtschaftlichen „Niedergang“ (Investitionsverweigerung für Breitbandtechnologie,<br />
Verlust von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen) zuzuordnen, der auf die Verkehrsverhältnisse<br />
und die schlechte Anbindung an die Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-<br />
Neckar zurückgeführt wird.<br />
Rechtliche Anforderungen:<br />
§ 13 ÖPNV-G 18 „Integrierte Verkehrs- und Siedlungsplanung<br />
Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung haben die Erfordernisse<br />
der Nahverkehrsplanung zu berücksichtigen; die Wechselwirkungen zwischen<br />
Siedlungsstrukturen und Bebauungsdichten sowie Verkehrsinfrastrukturen<br />
und Verkehrssystemen sind im Rahmen dieser Planungen abzuwägen.“<br />
1.1. Straßenverkehr<br />
1. Ist-Zustand<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> verfügt als einziger hessischer Kreis über keinen eigenen Autobahnanschluss.<br />
Die Sicherung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es als Wirtschaftsstandort sowie die Ansiedlung<br />
neuer Gewerbe- und Industriebetriebe hängt daher sehr stark von der Leistungsfähigkeit der<br />
B 45 als Hauptverkehrsachse in Nord-Süd-Richtung und der B 38 ab. Dies gilt insbesondere<br />
für die Mittelzentren Erbach und Michelstadt. Insoweit würde die stärkere Einbindung der<br />
Planungsregion Südhessen in das nationale und europäische Verkehrsnetz begrüßt.<br />
Rechtliche Grundlagen: Nach § 41 Abs. 2 HStrG 19 sind die Landkreise Träger der<br />
Straßenbaulast bei Kreisstraßen. Der Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
ist in Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Bensheim<br />
für Verwaltung, Betrieb und Bauunterhaltung sowie für Planungs- und Bauaufgaben an den<br />
Kreisstraßen im <strong>Odenwaldkreis</strong> zuständig.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten immer wieder für Straßenbauprojekte<br />
auch außerhalb seiner direkten Straßenbaulastträgerschaft eingesetzt. Die Ortsumgehungen<br />
Höchst i. Odw. und Erbach sind Beispiele dafür.<br />
2. Entwicklungsstrategie<br />
Die B 426 zwischen Höchst i. Odw. und Obernburg am Main ist derzeit die einzige für<br />
Schwerlastverkehr geeignete Anbindung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es an das bayerische Maintal<br />
und dementsprechend durch Schwerlastverkehr stark belastet. Sie führt durch den Breuber-<br />
18<br />
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNV-G) vom 01.12.2005, GVBl. I<br />
S. 786<br />
19<br />
Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der Fassung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851)<br />
19
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
ger Stadtteil Hainstadt und verursacht dort eine Lärmbelastung, die die Wohnfunktion des<br />
Stadtteils nachhaltig einschränkt. Eine Ortsumgehung ist deshalb notwendig.<br />
Zum Maintal sollte außerdem eine zusätzliche überörtliche Verkehrsanbindung des oberen<br />
Mümlingtals an die östlich gelegene B 469 geschaffen werden, da die derzeitige Anbindung<br />
von Michelstadt/Vielbrunn (Hainhaus nach Miltenberg/Laudenbach über die K 94) unzureichend<br />
ist. Durch diese Maßnahme ließe sich eine stärkere Nutzung der Mainschiene als<br />
Verbindung zum Rhein-Main-Gebiet erreichen und würde zu einer weiteren Entlastung der<br />
stark frequentierten B 45 führen.<br />
Die B 45 kann zwischen Dieburg (Einmündung in die B 26) und Eberbach (Einmündung in<br />
die B 37) vielfach ihrer hervorgehobenen Verkehrsfunktion für den <strong>Odenwaldkreis</strong> nicht mehr<br />
gerecht werden. Nachdem vor einigen Jahren bereits die Ummarkierung der B 45 zwischen<br />
Michelstadt und Groß-Umstadt in eine dreispurige Betriebsform (sog. 2+1-Markierung), der<br />
Einbau neuer Steuergeräte in die Lichtzeichenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrten von<br />
Höchst i. Odw., Michelstadt und Erbach sowie die Umgestaltung der mit Lichtzeichen geregelten<br />
Einmündung der K 104 nach Heubach (bei Groß-Umstadt) erfolgt ist, werden derzeit<br />
folgende Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit gefordert und positiv<br />
begleitet:<br />
• die sich im Bau befindliche Ortsumgehung Höchst i. Odw. (Fertigstellung voraussichtlich<br />
2009)<br />
• Ortsumgehung Erbach<br />
• punktueller vierspuriger Ausbau von vier Knotenpunkten in Michelstadt<br />
• Ausbau des Semder Kreuzes sowie des Knotenpunktes Groß-Umstadt Nord<br />
• vierspuriger Ausbau zwischen Groß-Umstadt und Dieburg (Einmündung in die B 26).<br />
Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wird zu den täglichen Hauptverkehrszeiten am Vor-<br />
und Nachmittag in Anbetracht der steigenden Pendlerzahlen mehr als deutlich.<br />
Als hinterliegender Landkreis ist der <strong>Odenwaldkreis</strong> und die heimische Wirtschaft ganz entscheidend<br />
von leistungsfähigen Straßen zu und von den Autobahnen angewiesen. Zum<br />
Ausbau oder zumindest Erhaltung des Wirtschaftsstandortes <strong>Odenwaldkreis</strong> ist daher die<br />
Beseitigung von bestehenden Hemmnissen von elementarer Bedeutung. In diesem Zusammenhang<br />
werden von hier folgende Maßnahmen ausdrücklich unterstützt und positiv begleitet:<br />
• B 26 Nordostumgehung Darmstadt<br />
• B 38 Ortsumgehungen Reinheim/Spachbrücken, Groß-Bieberau, Fürth/Lörzenbach, Rimbach,<br />
Mörlenbach.<br />
Ganz besondere Bedeutung kommt hierbei dem Nadelöhr Darmstadt zu, wo sich die problematische<br />
Verkehrssituation durch die Maßnahmen des Feinstaub-Aktionsplanes noch verschärft<br />
hat.<br />
Des Weiteren wird künftig u. U. der Bau von Ortsumgehungen zur Vermeidung von Sperrungen<br />
– insbesondere für den Schwerlastverkehr – im Zusammenhang mit den vom Regierungspräsidium<br />
Darmstadt zu erstellenden Lärm-Aktionsplänen notwendig werden.<br />
Für den Bereich Kreisstraßen hat der Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Bensheim ein<br />
Planungs- und Bauprogramm erstellt. In dieser Prioritätenliste (Stand: 06.02.2009) sind neben<br />
den Bauaufgaben an den Kreisstraßen auch die geplanten Maßnahmen des Bereichs<br />
Radwegebau enthalten.<br />
20
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
21
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
22
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Straßenverkehrsbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Bensheim<br />
• Straßenverkehrsbehörden der Städte und Gemeinden<br />
23
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
1.2. Radwegenetz<br />
Bei dem Ausbau des Radwegenetzes steht im Kreisgebiet die Förderung des Fahrradtourismus<br />
im Vordergrund. Aufgrund der topografischen Verhältnisse sowie der zu Arbeitsplatz<br />
und/oder Freizeiteinrichtung in der Regel zurückzulegenden Entfernung nimmt der Alltagsradverkehr<br />
eher eine untergeordnete Rolle ein.<br />
Zur Entwicklung eines attraktiven Radwegenetzes hat der <strong>Odenwaldkreis</strong> Anfang der 90er<br />
Jahre mit den Städten und Gemeinden vereinbart, dass der <strong>Odenwaldkreis</strong> die hierzu erforderlichen<br />
Planungen übernimmt. Die Kommunen haben im Gegenzug die Aufgabe der Unterhaltung<br />
und Kontrolle der ausgewiesenen Radwege zu tragen.<br />
1. Bestehendes Radwegenetz<br />
Bereits 1993 wurden die ersten Themenradwege ausgewiesen. Inzwischen verfügt der Kreis<br />
über ein Radwegenetz, das rund 250 km umfasst. Es setzt sich zusammen aus<br />
� 11 regionalen Routen<br />
� 3 überregionalen Routen (großräumige Routen, verlaufen über längere Distanzen<br />
und i. d. R. mehrere Kreise)<br />
� vernetzende Radwege<br />
24
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die regionalen Routen umfassen folgende Radwanderwege:<br />
Radwanderweg<br />
R1 – Mümlingtalradweg<br />
R2 – Gersprenztalradweg<br />
Beerfelder Rundkurs<br />
Haselburg Rundkurs<br />
Rodenstein Rundkurs<br />
Höhenradwanderweg<br />
Würzberg - Gaimühle<br />
Radwanderweg „Hohe<br />
Straße“<br />
Siegfriedradweg<br />
2-Burgen-Radweg<br />
Rhein-Main-Vergnügen<br />
Route 7a<br />
Rhein-Main-Vergnügen<br />
Route 7b<br />
Verlauf<br />
Obernburg – Mömlingen – Breuberg – Höchst i.<br />
Odw. – Bad König – Michelstadt – Erbach – Beerfelden<br />
– Rothenberg – Hirschhorn<br />
Groß-Bieberau – Wersau – Brensbach – Fränkisch-<br />
Crumbach – Beerfurth – Reichelsheim (Odenwald)<br />
– Gumpen<br />
Hetzbach – Beerfelden – Rothenberg – Finkenbach<br />
– Olfen – Beerfelden – Hetzbach<br />
Höchst i. Odw. – Pfirschbach – Hummetroth –<br />
Ober-/ Nieder-Kinzig – Bad König – Etzen-Gesäß –<br />
Mümling-Grumbach – Höchst i. Odw.<br />
Reichelsheim (Odenwald) – Beerfurth – Fränkisch-<br />
Crumbach – Ruine Rodenstein – Reichelsheim<br />
(Odenwald)<br />
Würzberg – Bullau – Reußenkreuz – Salmshütte –<br />
Gaimühle<br />
Elsbach – Böllstein – Hassenroth<br />
Hetzbach – Hüttenthal – Hiltersklingen – Grasellenbach<br />
– Wald-Michelbach<br />
Burg Breuberg – Heubach – Wiebelsbach – Hering<br />
Höchst i. Odw. – Breuberg – Heubach – Wiebelsbach<br />
– Hering – Hassenroth – Hummetroth –<br />
Forstel – Mümling-Grumbach – Höchst i. Odw.<br />
Bad König – Breitenbrunn – Lützelbach – Breuberg<br />
– Höchst i. Odw. – Bad König<br />
25<br />
Länge<br />
75<br />
15<br />
42<br />
24<br />
15<br />
21<br />
20<br />
ausgewiesen<br />
Bei den drei überregionalen Radrouten, die das Kreisgebiet in Teilbereichen tangieren, handelt<br />
es sich um den<br />
• Hessischen Radfernweg „R 4“, der über eine Streckenlänge von 385 km von Bad Karlshafen<br />
bis Hirschhorn verläuft und das Kreisgebiet von Höchst i. Odw. über Bad König –<br />
Michelstadt – Erbach – Beerfelden – Rothenberg quert<br />
• Hessischen Radfernweg „R 9“, der über eine Streckenlänge von 70 km von Bürstadt bis<br />
Breuberg/Hainstadt verläuft und das Kreisgebiet von Reichelsheim (Odenwald) über<br />
Brensbach – Höchst i. Odw. – Breuberg quert<br />
• 3-Länder-Radweg einen vom <strong>Odenwaldkreis</strong> gemeinsam mit dem Kreis Miltenberg und<br />
dem Neckar-<strong>Odenwaldkreis</strong> ausgewiesenen 225 km langen Rundkurs.<br />
Die „vernetzenden Radwege“ mit einer Gesamtstreckenlänge von rund 70 km<br />
• verbinden die regionalen Routen untereinander<br />
• stellen Anschlüsse an das Radwegenetz der Landkreise Darmstadt-Dieburg und Miltenberg<br />
her<br />
21<br />
16<br />
33<br />
29<br />
1993<br />
1994<br />
1996<br />
1996<br />
1996<br />
2000<br />
2001<br />
2003<br />
2004<br />
2006<br />
2006
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• schaffen Verbindungen von NaTourBus-Haltestellen zum Radwegenetz<br />
• umfassen das kommunale Radwegenetz der Stadt Breuberg und der Gemeinde Lützelbach<br />
2. Ausbaumaßnahmen<br />
Zur Ermöglichung von neuen regionalen Routen oder der Verbesserung des bestehenden<br />
Netzes hat der Odenwald folgende Ausbaumaßnahmen durchgeführt:<br />
• 2000/01 Abschnitt zwischen dem Forsthaus Hubertus in Würzberg bis zum Bullauer Bild<br />
(1,4 km) – Ausbau war zur Ausweisung des Höhenradweges Würzberg – Gaimühle erforderlich<br />
• 2002 Asselbrunn – Steinbach (3 km) – Erneuerung des schlechten Abschnittes des<br />
R1/R4, 3-Länder-Radweg<br />
• 2003 Abschnitt in Hiltersklingen (700 m) – Ausbau war zur Ausweisung des Radweges<br />
Himbächel-Viadukt bis Wald-Michelbach (Siegfriedradweg) erforderlich<br />
• 2005 Asselbrunn – Steinbach (800 m) – Erneuerung des schlechten Abschnittes des<br />
R1/R4, 3-Länder-Radweg<br />
3. Bewerbung/Aktivitäten<br />
Alle seit 2000 ausgewiesenen Themenrouten wurden unmittelbar nach der Beschilderung<br />
durch eine offizielle Einweihungsfahrt der Öffentlichkeit vorgestellt.<br />
Die Themenrouten werden über den TouristikService Odenwald-Bergstraße e. V. und die<br />
OREG mbH touristisch beworben.<br />
Eine besondere Stellung in der touristischen Werbung nimmt der 3-Länder-<br />
Radweg ein, der sich aufgrund seiner Streckenlänge auch für mehrtägige<br />
Fahrten mit Übernachtungen eignet. In diesem Zusammenhang findet seit<br />
2002 jedes Jahr im Sommer ein 3-tägiges Event auf dem Radweg statt, das<br />
als Pauschalangebot mit Übernachtungen und Programm gebucht werden<br />
kann und sich großer Beliebtheit erfreut.<br />
Zu den Themenrouten entwickelt die Odenwald Tourismus GmbH als zentrale Marketingorganisation<br />
des Odenwaldes unter Einbeziehung von Leistungsanbietern aus Gastronomie<br />
und Beherbergung sowie des ÖPNV entlang der Routen buchbare touristische Angebote.<br />
Gleichzeitig werden analog dem seit 2002 jährlich stattfindenden 3-Länder-Rad-Event am 3-<br />
Länder-Radweg weitere Events entwickelt und durchgeführt, um die touristische In-Wertsetzung<br />
der übrigen thematischen Radrouten zu fördern.<br />
Angestrebt wird der qualitative Ausbau der Routen durch das Aufstellen von Informationstafeln,<br />
die Einrichtung von Rastplätzen und die Ausschilderung von Gastronomie und Beherbergung<br />
an den Routen.<br />
Zur Bewerbung der thematischen Radrouten des Odenwaldes soll zukünftig die Plattform<br />
des RMV stärker genutzt werden.<br />
Darüber hinaus ist das Radwegenetz des <strong>Odenwaldkreis</strong>es mit Informationen zu den einzelnen<br />
Themenrouten in dem vom Land Hessen 2007 eingeführten Radroutenplaner enthalten.<br />
Der Radroutenplaner ist im Internet unter der Adresse www.radroutenplaner.hessen.de zu<br />
finden.<br />
26
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4. Entwicklungsstrategie<br />
Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Radwegenetzes werden folgende Planungen verfolgt:<br />
1. Limesradweg<br />
Die Römer und der Limes sind in dem neuen Tourismuskonzept des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ein<br />
Themenschwerpunkt.<br />
Der Odenwaldlimes stellt mit seinen erhaltenen Denkmälern einen herausragenden Teil<br />
des römischen Kulturerbes in Deutschland dar. Er wurde gegen Ende des 1. Jahrhunderts<br />
n. Chr. eingerichtet und verläuft über eine Länge von annähernd 80 km von Wörth am<br />
Main bis Bad Wimpfen am Neckar.<br />
Um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. wurde der Odenwaldlimes von den Römern auf<br />
ganzer Strecke aufgegeben und die Grenze auf eine neue Linie, die des sogenannten<br />
Vorderen Limes verlegt.<br />
In wissenschaftlicher und forschungsgeschichtlicher Hinsicht kommt dem Odenwaldlimes<br />
eine außerordentliche Bedeutung zu. Aufgrund seiner Existenzzeit von knapp 60 Jahren<br />
lassen sich Fragen der römischen Heeres- und Limesgeschichte, der Limesarchitektur,<br />
des archäologischen Fundmaterials besonders in chronologischer Hinsicht beantworten.<br />
Er liegt im Bereich des Naturparks Bergstraße-Odenwald und dient zahlreichen Menschen<br />
der Ballungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar als Naherholungsgebiet. Außerdem<br />
existiert seit 2002 bzw. 2003 der Geopark Odenwald, versehen mit den Prädikaten „Europäischer<br />
Geopark“ und „Nationaler Geopark“ – eine in Deutschland einmalige Auszeichnung.<br />
Um den Odenwaldlimes nicht nur für Wanderer, sondern auch für Radwanderer erlebbar<br />
zu machen, soll entlang des Limes ein Radwanderweg ausgewiesen werden.<br />
Dem Radwanderer erschließen sich auf seiner Tour<br />
• das Kohortenkastell Oberscheidental<br />
• der Limeslehrpfad zwischen Schlossau und Hesselbach mit Resten römischer Wachposten<br />
• ein rekonstruierter Wachturm mit Pallisadenzaun bei Hesselbach<br />
• das Römerbad bei Würzberg<br />
• römische Denkmäler im Eulbacher Park<br />
• Reste römischer Wachtürme und Kastelle zwischen Würzberg und Lützelbach. In diesem<br />
Bereich ist die Aufstellung von 30 Informationstafeln zu der römischen Heeres-<br />
und Limesgeschichte, der Limesarchitektur und dem archäologischen Fundmaterial<br />
vorgesehen.<br />
• das Römermuseum in Obernburg.<br />
Aufgrund seiner geschichtsträchtigen Führung sowie dem landschaftlichen und topografischen<br />
reizvollen Verlauf wird der Limesradweg als touristisch sehr interessant eingestuft.<br />
Durch den relativ ebenen Verlauf zwischen Mudau und Lützelbach ist der Limesradweg<br />
auch für Familien und sportlich weniger ambitionierte Personen geeignet. Erst ab Lützelbach<br />
zum Main hin ist eine stärkere Gefällstrecke zu bewältigen.<br />
Verlauf des Limesradweges und Einbindung ins Radwegenetz<br />
Der südliche Beginn des Radwanderweges ist in Mudau (Baden-Württemberg) vorgesehen.<br />
Der weitere Verlauf führt über Schlossau – Hesselbach (Hessen) – Würzberg –<br />
Vielbrunn – Hainhaus – Sportplatz „Windlücke“ bei Haingrund – Lützelbach – Obernburger<br />
Waldhaus (Bayern) nach Obernburg.<br />
Insgesamt misst der Limesradweg eine Länge von 45 km.<br />
Zeitliche Abwicklung:<br />
In den Jahren 2009 und 2010 sollen die Planungsarbeiten durchgeführt und das Baurecht<br />
beschafft werden.<br />
27
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
2011 werden die Abschnitte<br />
• Mangelsbach bis zur B 47 und<br />
• entlang der B 47 und der L 3349 bis zur „Vielbrunner Kreuzung“ (L 3349 / L 3318)<br />
ausgebaut.<br />
Voraussichtlich 2012 erfolgt dann der Ausbau<br />
• des letzten Bauabschnittes entlang der L 3349 zwischen der „Vielbrunner Kreuzung“<br />
und dem Sportplatz „Windlücke“ (Einmündung L 3106 in die L 3349)<br />
• des Waldweges zwischen der Landesgrenze und Hesselbach.<br />
2. Beerfelder Rundkurs<br />
Der Beerfelder Rundkurs verläuft zwischen der „Olfener Höhe“ und Airlenbach rund 350 m<br />
auf der insbesondere an schönen Wochenenden stark durch den Motorradverkehr frequentierten<br />
L 3120. Bedingt durch Ausbaumaßnahmen im Flurbereinigungsverfahren<br />
Güttersbach wurde das forstwirtschaftliche Wegenetz ausgebaut. Hierdurch eröffnet sich<br />
nun die Möglichkeit, den Rundkurs auf forstwirtschaftliche Wege umzulegen. Voraussetzung<br />
ist allerdings noch der Ausbau eines rund 600 m langen Teilstückes.<br />
Der Ausbau des Wegeabschnittes soll im Laufe des Jahres 2009 erfolgen.<br />
3. Radwanderweg Hohe Straße – Ausbaumaßnahmen<br />
Im Bereich von Böllstein wird der Radwanderweg auf einer Strecke von rund 2 km auf der<br />
K 211 geführt. Es ist geplant, in Fahrtrichtung B 47 zwischen der Einmündung der K 88<br />
und dem Abzweig des Radwanderweges auf einen land-/forstwirtschaftlichen Weg in<br />
Höhe des Waldbeginns einen straßenbegleitenden Radweg anzulegen (Baulänge rund<br />
1,3 km).<br />
Im weiteren Verlauf des Radweges ist der Bau einer direkten Radwegeverbindung zwischen<br />
dem Ober-Kainsbacher Galgen und der B47 in Höhe des Abzweigs Richtung Mossautal<br />
(Länge rund 200 m) geplant.<br />
4. Einhardsradweg<br />
auf einer Länge von 61 km rund um die Mark Michelstadt mit Vernetzungen auf einer<br />
Länge von 31 km<br />
Um das bestehende Radwegenetz weiter zu entwickeln und einen sinnvollen Ausbau zu fördern,<br />
sollte ein kreisübergreifendes Radverkehrskonzept erarbeitet und vom Kreistag beschlossen<br />
werden. Ziel des Radverkehrskonzeptes sollte sein:<br />
• Schließung bestehender Lücken im radtouristischen Wegenetz<br />
• Förderung des Schüler- und Alltagsverkehrs zwischen den Orten<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Verkehrsabteilung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Bensheim<br />
• Städte und Gemeinden<br />
• Odenwald Tourismus GmbH<br />
28
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
1.3. Öffentlicher Personennahverkehr<br />
1. rechtliche Grundlagen<br />
a) Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz<br />
– RegG) 20 v. 27.12.1993 (BGBl I S. 2378)<br />
b) Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNV-G)<br />
c) Nahverkehrsplan des <strong>Odenwaldkreis</strong>es 2007<br />
d) Regionalplan Südhessen 2007 (Entwurf)<br />
2. Anforderungen<br />
Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen<br />
im öffentlichen Personennahverkehr ist eine (öffentliche) Aufgabe der Daseinsvorsorge (§ 1<br />
Abs. 1 RegG).<br />
Der Landkreis als ÖPNV-Aufgabenträger regelt im Nahverkehrsplan nach objektiven Kriterien<br />
den quantitativen Umfang und die qualitativen Grundlagen einer im öffentlichen Verkehrsinteresse<br />
ausreichenden Verkehrsbedienung.<br />
Nach den im ÖPNV-G genannten Zielen und Anforderungen ist der ÖPNV Teil des Gesamtverkehrssystems<br />
und trägt dazu bei, die Mobilitätsnachfrage zu befriedigen. Im Sinne einer<br />
integrierten Verkehrs- und Siedlungsplanung haben Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung<br />
die Erfordernisse der Nahverkehrsplanung zu berücksichtigen (§ 13 ÖPNV-G).<br />
Im Regionalplan Südhessen soll die Achse Darmstadt – Michelstadt / Erbach – Eberbach als<br />
überörtliche Nahverkehrs- und Siedlungsachse ausgewiesen werden.<br />
3. Ist-Zustand<br />
Der Nahverkehrsplan des <strong>Odenwaldkreis</strong>es 2007 enthält hinsichtlich der Bedienungsqualität<br />
� die Anzahl der mindestens anzubietenden Busfahrten in einem Ort<br />
� den Umfang und die Qualität der Verbindung zu den „zentralen Orten“<br />
� Regelungen zum Kapazitäteneinsatz und zur Ortserschließung<br />
für den Jedermann- und Ausbildungsverkehr.<br />
Der Nahverkehrsplan und die ihm zu Grunde liegenden Schülerbeförderungsstandards gehen<br />
von einem angebotsorientierten Bedienungsumfang nach der Größe der zu bedienenden<br />
Orte und der Einzugsbereiche von Zentren und Schulen aus.<br />
Es wird zwischen den Angebotsstufen „Grundversorgung“, „erweiterte Grundversorgung“,<br />
„Hauptlinienstandard“ und „Innerortslinien“ unterschieden.<br />
Im Rahmen von Qualitätskriterien wird festgelegt, dass außerhalb von Zeiten des Schülerverkehrs<br />
und bei schwacher Verkehrsnachfrage (in Tagesrandlagen, am Wochenende und in<br />
Orten mit geringer Einwohnerzahl) bei der Angebotsplanung im Jedermannverkehr „RufBus“-<br />
20 Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz –<br />
RegG) vom 27.12.1993 (BGBl I S. 2378), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 12. Dezember 2007<br />
(GVBl. I S. 2871)<br />
29
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Bedienungen zulässig sind. Kriterium ist das Vorliegen einer regelmäßigen Verkehrsnachfrage<br />
von weniger als 9 Fahrgästen pro Fahrt.<br />
Angebotsstufe Innerorts-<br />
verkehr<br />
Kriterium geschl. Siedlungen<br />
ab 9.000<br />
Einw.<br />
Montag bis Freitag zwischen<br />
6:00 Uhr und<br />
19:00 Uhr<br />
täglich<br />
nach 19:00 Uhr<br />
Hauptlinien-<br />
standard<br />
Orte ab 3.000<br />
Einw.<br />
30<br />
erweiterte<br />
Gerundversorgung<br />
Orte ab 1.000<br />
Einw.<br />
nein nein ja ja<br />
ja ja ja --<br />
Wochenende Sa ab 14:00 Uhr Sa ab 14:00 Uhr ja --<br />
Grundversorgung<br />
Orte ab 250<br />
Einw.<br />
Tabelle: Zulässigkeit von Rufbus-Bedienung im Rahmen der im Nahverkehrsplan des <strong>Odenwaldkreis</strong>es definierten<br />
Angebotsstandards zur „ausreichenden Bedienung“<br />
Eine RufBus-Leistung unterscheidet sich von der regulären Linienverkehrsfahrt nur dadurch,<br />
dass der Fahrtwunsch vor der fahrplanmäßigen Abfahrt anzumelden ist. Nur dann entsteht<br />
für das Verkehrsunternehmen eine Betriebspflicht nach § 21 PBefG und eine Beförderungspflicht<br />
gem. § 22 PBefG gegenüber den angemeldeten Fahrgästen. Bedarfsgesteuerte Verkehre<br />
ermöglichen auf diese Weise die Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsversorgung<br />
zu kostengünstigen Bedingungen, da Betriebskosten nur bei entsprechender Nachfrage<br />
entstehen.<br />
Im Rahmen der Beförderungsqualität erfolgen zudem Regelungen zur Ausstattung von Haltestellen<br />
und Fahrzeugen, zur Qualifizierung des Fahrpersonals und zur Betriebsorganisation.<br />
4. Entwicklungsstrategie<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> ist sowohl im Landesentwicklungsplan als auch im Regionalen Raumordnungsplan<br />
vollständig als „ländlicher Raum“ ausgewiesen, der als solcher als eigenständiger<br />
und attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum gestaltet werden soll. Eine einseitige Entwicklung<br />
zum Wohnstandort soll vermieden und seine wirtschaftliche Struktur über eine Eigenentwicklung<br />
hinaus gestärkt werden.<br />
Auch angesichts der demografischen Effekte besteht das strategische Ziel, dass der <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
attraktives Zuzugsgebiet bleibt, denn nur durch einen positiven Wanderungssaldo<br />
kann der natürliche Saldo in der Bevölkerungsentwicklung ausgeglichen werden. Der <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
stellt sich damit in der globalen Standortkonkurrenz in den Wettbewerb mit anderen<br />
ländlichen Regionen, wobei seine Ausgangssituation durch die bevorzugte Lage zwischen<br />
den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar als günstig beurteilt wird.<br />
Strategisches Ziel des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ist eine qualitative, über eine Eigenentwicklung<br />
hinausgehende Entwicklung als Lebens- und Wirtschaftsraum, die entlang von Siedlungsachsen<br />
im Gersprenztal und im Mümlingtal stattfindet. Neben einer Stärkung dieser Regionalachsen<br />
sieht der <strong>Odenwaldkreis</strong> den Erhalt des dörflichen Charakters, seiner traditionellen<br />
Kultur und seiner einzigartigen Landschaft als wichtiges Ziel und als Stärke, um seine<br />
raumordnerische Funktion als Naherholungsraum für die Metropolregionen erfüllen zu können.
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5. Ziele<br />
Um die strategischen Ziele zu erreichen, bedarf es unabdingbar der Sicherung der Mobilität<br />
sowohl im Individualverkehr als auch im öffentlichen Personennahverkehr. Steigende Infrastrukturkosten<br />
für die Bereitstellung von Straßen aber auch steigende Betriebskosten für die<br />
Vorhaltung eines öffentlichen Verkehrsangebotes wie auch für die Nutzung von Kraftfahrzeugen<br />
führen zu Zielkonflikten, die Lösungen erforderlich machen.<br />
Mobilität ist der entscheidende Faktor für den Weiterbestand und auch für die Weiterentwicklung<br />
unserer Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftsordnung. Die Kosten für die Bereitstellung<br />
von Mobilität sind dabei in ländlichen Regionen ungleich größer als im Ballungsraum.<br />
Dennoch ist die Bereitstellung von Mobilität unverzichtbarer Standortfaktor und bestimmt<br />
zunehmend die Infrastrukturpolitik der Kommunen. Mobilität wird zum Wettbewerbsfaktor.<br />
Die Gemeinden, die über ein innerörtliches ÖPNV-Angebot verfügen, werden Standortvorteile<br />
bei der Wohnansiedlung gegenüber anderen Gemeinden haben.<br />
Es ist insbesondere in ländlichen Regionen nicht Aufgabe des ÖPNV, Individualverkehr zu<br />
ersetzen. Dies kann er nicht leisten. Er kann aber mit überzeugenden Produkten für attraktive<br />
Angebote sorgen. Diese Zielsetzung gilt es, weiter auszubauen:<br />
Odenwaldbahn<br />
Mit Abschluss der Modernisierung von Infrastruktur und Betrieb ist die ehemals von der Stilllegung<br />
bedrohte Odenwaldbahn nicht nur zu einem bundesweit bedeutsamen Projekt der<br />
Regionalisierung geworden, sondern hat den Odenwald mit schnelleren und dichteren Verbindungen<br />
näher an die Metropolregionen gebracht. Damit wird ein vielfach geäußerter<br />
Standortnachteil für den Odenwald beseitigt. In kurzer Zeit waren erhebliche Fahrgastzuwächse<br />
zu verzeichnen.<br />
Die Zug-km-Leistung beträgt pro Kalenderjahr 2 Mio. km.<br />
Das Bedienungsangebot ist weiter auszubauen und zu beschleunigen. Insbesondere bedarf<br />
es späterer Verbindungen aus und in den Odenwald Richtung Darmstadt / Frankfurt aber<br />
auch auf dem Südabschnitt mit Anschluss an die S-Bahn in Eberbach. Die Möglichkeit der<br />
Fahrradmitnahme in den Zügen der Odenwaldbahn ist besser zu organisieren, damit die<br />
Nutzung im Rahmen des Tourismuskonzepts auch beworben werden kann. Auch eine entsprechende<br />
Begleitung durch innovative Tarifprodukte für Ausflüge in den Odenwald aus der<br />
Rhein-Main-Gegend ist nach wie vor nicht realisiert.<br />
Busverkehr<br />
Die Verbindungen von den Mittel- und Unterzentren in die Ortschaften sowie innerhalb der<br />
Kernstädte sind weiter zu verbessern. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Schaffung von<br />
Abend- und Wochenendbedienungen. Im Rahmen alternativer Bedienungskonzepte ist eine<br />
stündliche Bedienung auch von Orten unter 3.000 Einwohner zu prüfen. Die erfolgreiche<br />
Produktphilosophie ist fortzuführen. Dies umfasst auch die kontinuierliche Fortentwicklung<br />
von Produkten im Bereich des Freizeitverkehrs, wie den NaTourBus am Wochenende oder<br />
eines KulTourBus-Angebots in den Abendstunden, welche den Aspekt hoher Lebensqualität<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> aufgreifen würden. In den Mittelzentren ist insbesondere in den Abendstunden<br />
die Einführung flexibler Abbringerservices von den neuen Spätzügen der Odenwaldbahn<br />
in die Wohngebiete anzustreben.<br />
Um frühzeitig in die Überlegungen und Planungen zur Verkehrsentwicklung eingebunden zu<br />
sein, erfolgt insbesondere über die Teilnahme an Arbeitskreissitzungen eine Zusammenar-<br />
31
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
beit mit der Stadt Darmstadt sowie dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (unter Einbeziehung<br />
des sich dort in der Aufstellung befindlichen Verkehrsentwicklungsplanes).<br />
Aus Gründen der Daseinsvorsorge und der Wettbewerbsfähigkeit des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ist<br />
die Vorhaltung eines qualitativ hochwertigen, flexiblen und zielgruppenorientierten öffentlichen<br />
Verkehrsangebot zu sozial verträglichen Preisen und mit flächendeckender Erschließung<br />
notwendig, um die strukturelle Entwicklung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es vor dem Hintergrund<br />
des demografischen Wandels durch einen positiven Wanderungssaldo nachhaltig zu sichern.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Geschäftsbereich „Öffentlicher Personennahverkehr“ der<br />
OREG<br />
32
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
2. Natur- und Umweltschutz<br />
Die Odenwälder Landschaft war bis März 2008 durch die geltende Landschaftsschutzgebietsverordnung<br />
geschützt. Die Verordnung sicherte die Landschaft als öffentlichen Belang<br />
und verlieh ihm ein Gewicht, das ansonsten nach § 35 BauGB privilegierte Vorhaben im<br />
Außenbereich wirksam entgegenstehen kann. Richterlich überprüftes Beispiel ist der aus<br />
Gründen des Landschaftsschutzes abgelehnte Bau zweier Windkraftanlagen am Morsberg in<br />
Reichelsheim (Odenwald).<br />
Derzeit ist die Odenwälder Landschaft nach Außerkrafttreten der Landschaftsschutzgebietsverordnung<br />
in bestimmten Bereichen durch die Natura 2000-Verordnung 21 geschützt. (Näheres<br />
hierzu siehe unter 2.4.)<br />
Durch das außer Kraft setzen der „Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße-Odenwald“<br />
vom 22. April 2002“ durch das „Gesetz zur Reform des Naturschutzrechts,<br />
zur Änderung des Hessischen Forstgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 4. Dezember<br />
2006“ wird die Erfüllung der im Entwurf zum Regionalplan Südhessen formulierten<br />
Vorgaben erschwert, teilweise sogar verhindert:<br />
Nach außer Kraft treten der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße-Odenwald“<br />
ist im Odenwald nicht einmal ein Landschaftsschutz in Form eines „Auenverbunds“<br />
verblieben: Das „Auenschutzgebiet“ war hier, einmalig in Hessen, als sogenannte „Zone I“<br />
integraler Bestandteil der Schutzgebietsverordnung. Bei den anderen weggefallenen Groß-<br />
Landschaftsschutzgebieten bestehen dagegen zumindest die eigenständigen „Auen-Schutzgebiete“<br />
weiter.<br />
An erster Stelle steht daher die Forderung, die Landschaftsschutzverordnung „Bergstraße-<br />
Odenwald“ durch eine entsprechende Gesetzesänderung wieder in Kraft zu setzen oder das<br />
Landschaftsschutzgebiet, gegebenenfalls mit redaktionellen und inhaltlichen Änderungen,<br />
neu auszuweisen, zumindest aber ein Auenverbund-Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße-<br />
Odenwald“, was jedoch lediglich eine Minimal-Lösung darstellen würde.<br />
Schutzgebiete und Schutzobjekte<br />
Bedeutsame und große Flächenanteile im Kreisgebiet einnehmende, für den Naturraum<br />
repräsentative Landschaftsstrukturen und Potenziale sind vor allem die Fließgewässersysteme<br />
mit ihren, in weiten Abschnitten, noch naturnahen Auen sowie die in weiten Teilen<br />
naturnah bewirtschafteten Wälder, teilweise mit natürlichen Sonderstandorten, wie Blockhalden,<br />
Felsbildungen, Quellbereichen und Waldbächen.<br />
Im Kreisgebiet sind zur Zeit 12 Naturschutzgebiete gemäß § 21 HENatG 22 rechtskräftig ausgewiesen.<br />
Sämtliche bestehenden Naturschutzgebiete sind größer als 5 ha, so dass für keines<br />
dieser Gebiete eine unmittelbare Zuständigkeit der Naturschutzbehörde besteht (z. B. für<br />
Pflegepläne und -maßnahmen, Befreiungen). Eine Zuständigkeit ist jedoch bei Ordnungswidrigkeiten,<br />
d. h. bei Verstößen gegen die Schutzgebietsverordnungen gegeben.<br />
Gegenwärtig ist die Ausweisung von zwei weiteren Naturschutzgebieten geplant bzw. beantragt:<br />
der Auenbereich der Mümling zwischen Michelstadt/Asselbrunn und Bad König/Zell,<br />
oberhalb des neuen Rückhaltebeckens (NSG „Mümling-Aue zwischen Zell und Asselbrunn“)<br />
und der Offenland- und Waldbereich „Mies“ bei Michelstadt/Würzberg. Da das letztere Gebiet<br />
kleiner als 5 ha sein wird, ist für dieses Ausweisungsverfahren gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 3<br />
HENatG die Untere Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es zuständig.<br />
21 Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen vom 16.01.2008<br />
22 Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Naturschutzgesetz –<br />
HeNatG – GVBl. II 881-47) vom 4.12.2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes<br />
vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 851)<br />
33
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> besteht derzeit kein Landschaftsschutzgebiet gemäß § 24 HENatG (siehe<br />
oben). Den Bestand des UNESCO-Geoparks und Naturparks gemäß § 25 HENatG „Bergstraße-Odenwald“<br />
sieht das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und<br />
Verbraucherschutz durch die Aufhebung des Landschaftsschutzgebiets nicht gefährdet.<br />
Es sind zur Zeit noch 64 Naturdenkmale rechtskräftig ausgewiesen, dabei handelt es sich<br />
um 52 Bäume oder Baumgruppen und 12 Felsbildungen bzw. geologische Besonderheiten.<br />
Diese Naturdenkmale wurden im Jahr 1995, im Zusammenhang mit dem Verfahren zur<br />
neuen Naturdenkmal-Sammelverordnung, in der mittlerweile vergriffenen Veröffentlichung<br />
„Naturdenkmale im <strong>Odenwaldkreis</strong>“ umfassend dokumentiert. Die „Verordnung zum Schutze<br />
der Naturdenkmale im <strong>Odenwaldkreis</strong>“ wurde am 22. Juni 1996 verkündet und trat am darauf<br />
folgenden Tag in Kraft. Von den damals noch 57 Bäumen sind in der Zwischenzeit 5 Bäume<br />
abgestorben oder aus Verkehrssicherungsgründen gefällt worden.<br />
Der Naturschutzbehörde obliegen die Ausweisung und die Pflege der Naturdenkmale. Als<br />
Naturdenkmale können gemäß § 26 Abs. 1 HENatG Einzelschöpfungen der Natur ausgewiesen<br />
werden, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder<br />
landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich<br />
ist.<br />
Zur Zeit liegen etwa 30 Vorschläge auf Ausweisung neuer Naturdenkmale vor – hierbei sind<br />
auch öffentliche Planungen, d. h. die zur Zeit vorliegenden Landschaftspläne der Städte und<br />
Gemeinden berücksichtigt. Bei allen Vorschlägen ist zunächst der aktuelle Zustand zu überprüfen,<br />
Schutzwürdigkeit und -bedürfnis sind entweder zu bestätigen oder zu verneinen, der<br />
genaue Standort der Objekte ist zu ermitteln und die Eigentumsverhältnisse sind zu klären.<br />
Für jedes potentielle Naturdenkmal ist abzuklären, ob zu seinem Schutz auch vertragliche<br />
Regelungen in Betracht kommen.<br />
Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 27 HENatG sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> nicht ausgewiesen.<br />
Folgende, nach § 31 HENatG gesetzlich geschützte Biotope sind für das Gebiet des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
relevant:<br />
• natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Gewässer einschließlich<br />
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation<br />
sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig<br />
überschwemmten Bereiche,<br />
• Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche,<br />
• offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-,<br />
Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen,<br />
• Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder,<br />
• offene Felsbildungen,<br />
• Alleen und<br />
• Streuobstbestände im Außenbereich.<br />
Die Zerstörung oder eine sonstige erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung dieser Biotope<br />
ist verboten, nur unter bestimmten Voraussetzungen können durch die Naturschutzbehörde<br />
Ausnahmen zugelassen werden.<br />
Fließgewässer und Auen<br />
Wie oben schon dargelegt, ist zumindest für die Auenbereiche ein besonderer, über die Regelungen<br />
des Hessischen Naturschutzgesetzes hinaus gehender Schutz für die Auen zun<br />
fordern. Die Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es hat daher die Ausweisung des zukünftigen<br />
Naturschutzgebiets „Mümling-Aue zwischen Asselbrunn und Zell“ mit initiiert. Die<br />
34
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Inhalte der zukünftigen Schutzgebietsverordnung sind zwischen dem Regierungspräsidium<br />
Darmstadt und der Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es abgestimmt worden.<br />
Die Zuständigkeit der Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es im Bereich der Fliegewässer<br />
erfordert eine enge Zusammenarbeit bzw. Vernetzung mit den Aufgabenbereich der<br />
Wasserbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es und mit dem Tätigkeitsfeld der beiden Wasserverbände<br />
für das Gersprenz- und das Mümlingtal. Ausdruck findet diese Verflechtung unter anderem<br />
in der regelmäßigen Teilnahme an den Gewässerschauen dieser beiden Wasserverbände<br />
und der Wasserbehörde: Naturschutzrelevanten Fragen können bei diesen Terminen<br />
direkt und in der Regel abschließend erörtert werden. Die vor Ort abgestimmten Bachschau-<br />
Protokolle haben den Charakter von „Pflegeplänen“ und bieten dem Gewässerunterhaltungspflichtigen<br />
Planungssicherheit.<br />
Schon jetzt leistet die Naturschutzbehörde – in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Umweltamt<br />
beim Regierungspräsidium Darmstadt und im Einvernehmen mit der Wasserbehörde<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es – einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien:<br />
• Renaturierung naturferner oder ausgebauter Gewässerläufe in Verbindung mit der Schaffung<br />
der Durchgängigkeit für die im Fließgewässer lebenden Tiere und der Ausweisung<br />
von Uferschutzstreifen, in denen die Bäche natürlich mäandrieren können (Verbesserung<br />
der Gewässerstruktur);<br />
• Schaffung von Uferschonstreifen, in denen sich Landwirtschaft und Tierhaltung dem<br />
Gewässer anpassen und auf dessen Veränderung Rücksicht nehmen;<br />
• Umwandlung der Ackerbauflächen in den Talaue bzw. in den Überschwemmungsgebieten<br />
zu Grünland, um beispielsweise das Einbringen von Pflanzenschutzmitteln und deren Abdrift<br />
zu reduzieren (Verbesserung der Gewässergüte).<br />
Sonderstandorte im Offenland<br />
Durch ihre ausdrückliche Erwähnung hebt der Entwurf zum Regionalplan Südhessen die<br />
Odenwälder Kalkstandorte besonders hervor. Diese Kalkböden nehmen allerdings nur einen<br />
geringen Teil des Offenlands ein, begrenzt auf das mittlere Mümlingtal bei Erbach und Michelstadt.<br />
Vielfach ist die Siedlungsfläche auf diese Sonderstandorte vorgedrungen. Waldflächen<br />
auf Kalkstandorten sind im Gebiet nicht mehr vorhanden.<br />
Zwei Karst-Phänomene sind als Naturdenkmale ausgewiesen: die Erdbach-Versickerung in<br />
Erbach/Dorf-Erbach und der Erdbach-Austritt in Michelstadt/Stockheim. Die Naturschutzbehörde<br />
berät – im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die ausgewiesenen Naturdenkmale – die<br />
Kreisstadt Erbach hinsichtlich der in nächsten Zeit anstehenden Neugestaltung des Erdbachs<br />
und der Grünfläche im Bereich des Einschlupfs vor der Felswand, da immer wieder<br />
Schäden an der vor Jahrzehnten angelegten Wasserführung zu den einzelnen „Schlucklöchern“<br />
auftreten. Ziel ist eine möglichst naturnahe und die Seltenheit und Besonderheit<br />
dieser geologischen Situation unterstreichende Anlage.<br />
Eine weitere markante Karst-Erscheinung befindet sich in der Gemarkung Michelstadt: die<br />
sogenannte „Doline“ am Kiliansfloß; es handelt sich hier jedoch nicht um eine Doline, sondern<br />
um Tiefenerosion. Die Stadt Michelstadt wird bei ihrem Vorhaben, das umliegende Gelände<br />
anzukaufen und in einen naturnahen Zustand zu versetzen, von der Naturschutzbehörde<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sowohl beraten als auch durch eine Zuwendung aus den Mitteln<br />
der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe finanziell unterstützt. Aufgrund verschiedener<br />
ersichtlicher Zwangspunkte – vor allem wegen des Hochwasserschutzes und der erforderlichen<br />
Verkehrssicherung – wird eine Ausweisung der „Doline“ als Naturdenkmal jedoch nicht<br />
erwogen.<br />
Die Naturschutzbehörde unterstützt die Bestrebungen öffentlicher Träger, das Erbach-Michelstädter<br />
Muschelkalk-Gebiet und andere Odenwälder Besonderheiten – wie beispiels-<br />
35
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
weise kulturhistorisch bemerkenswerte Sonderstandorte, wie der Breuberg-Hang, Kulturdenkmäler,<br />
wie der Odenwaldlimes, oder alte Bergbau-Gebiete – zu erschließen (beispielsweise<br />
über sogenannte „Geopark-Pfade“) und so ihren Wert der Allgemeinheit mehr ins Bewusstsein<br />
zu bringen. Hier bringt sich die Naturschutzbehörde mit entsprechender Beratung<br />
ein wird dem öffentlichen Interesse bei erforderlichen Genehmigungen durch dessen hohe<br />
Gewichtung im naturschutzrechtlichen Abwägungsprozess gerecht.<br />
Ein Antrag auf die Ausweisung eines Naturschutzgebiets „Mies“ bei Würzberg wird zur Zeit<br />
geprüft. Aufgrund der Größe des Gebiets unter 5 ha besteht in diesem Verfahren die Zuständigkeit<br />
der Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es. Derzeit erfolgen weitergehende<br />
Untersuchungen des Geländes durch Mitglieder und Beauftragte der örtlichen Naturschutzverbände.<br />
Wald<br />
Die teilweise im Wald liegenden Schutzobjekte und Schutzgebiete (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete,<br />
FFH- und Vogelschutzgebiete) und Belange des Artenschutzes bedingen<br />
vielfach auch Überschneidungen mit dem Arbeits- bzw. Zuständigkeitsbereich der hessischen<br />
Forstverwaltung (Hessen-Forst mit den beiden Forstämter Michelstadt und Beerfelden)<br />
und den selbstverwalteten großen Privat-Forstbetrieben. Vielfach liegen Kompensationsflächen,<br />
auch sogenannte „Ökokonto-Maßnahmen“, im Wald.<br />
Innerhalb der Kreisverwaltung besteht eine Zusammenarbeit mit der Abteilung Landwirtschaft<br />
und Forsten des Amts für den ländlichen Raum in Reichelsheim; so ist z. B. bei der<br />
forstrechtlichen Genehmigung von Rodungen und Aufforstungen das Benehmen mit der<br />
Naturschutzbehörde herzustellen. Aufgrund des hohen Waldanteils in vielen Gemarkungen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind die Möglichkeiten für Ersatz- oder Neuaufforstungen eingeschränkt:<br />
Den Aufforstungswünschen auf guten landwirtschaftlichen Nutzflächen stehen einerseits die<br />
Belange der Landwirtschaft, einem diesen Belangen entsprechenden Ausweichen auf landwirtschaftlich<br />
weniger interessante, ökologisch aber gegebenenfalls hochwertigen „Grenzertragsflächen“,<br />
stehen andererseits die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
entgegen.<br />
Die im <strong>Odenwaldkreis</strong> geübte Praxis, auch bei naturschutzrechtlich genehmigungsfreien<br />
Vorhaben im Wald, wie beispielsweise bei dem Ausbau von forstwirtschaftlichen Wegen, in<br />
„Zweifelsfällen“ eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Interessen des Bewirtschafters<br />
und den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes herbeizuführen, hat sich bewährt<br />
und wird beibehalten.<br />
2.1. Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe, Öko-Konto, Naturschutzdatenhaltung<br />
Die Erhebung und die Verwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe obliegt der<br />
unteren Naturschutzbehörde. Bis heute konnten damit zahlreiche Naturschutzprojekte im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> gefördert werden: seit 1993 wurden über 1.000.000 € für 88 Projekte verausgabt.<br />
Nach dem Wegfall der Abgabe für Vorhaben im Innenbereich – seit nunmehr einem<br />
Jahrzehnt kann sie nur noch für nicht ausgleichbare Eingriffe im Außenbereich festgesetzt<br />
werden – sind heute jedoch nur noch begrenzt Mittel vorhanden. Die Naturschutzbehörde<br />
strebt eine zeitnahe Verwendung der Ausgleichsabgabemittel an, um ihre Einbehaltung<br />
durch das Land Hessen und damit den Abfluss der Gelder aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong> zu vermeiden.<br />
Die Naturschutzbehörde berät auch bei der Anlage und bei „Verzinsung“ sogenannter „Ökokonten“,<br />
die zur Kompensation eigener zukünftiger Eingriffe in Natur und Landschaft herangezogen<br />
oder an Dritte veräußert werden können. Die hessische „Ökokonto-Regelung“ ist<br />
insbesondere für die Städte und Gemeinden interessant, die Naturschutzprojekte umsetzen<br />
36
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
wollen, jedoch wegen begrenzt vorhandener Ausgleichsabgabemittel finanziell nicht unterstützt<br />
werden können. Bis Ende 2008 wurden von der Naturschutzbehörde 32 Ökokonto-<br />
Maßnahmen fachlich begleitet.<br />
Im Jahre 2009 soll u. a. mit Mitteln der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe in einem<br />
objektbezogenen Flurbereinigungsverfahren die Kinzig zwischen Nieder-Kinzig und Etzen-<br />
Gesäß aus ihrem derzeit künstlichen Bett entlang der Landesstraße in ihr ursprüngliches<br />
Bachbett verlegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch ein ca. 15 m langes Durchlass-Rohr<br />
zugunsten eines offenen, mit einer Brücke überspannten Bachlaufs entfernt werden.<br />
Die Schwerpunkte der Projektförderung liegen bislang bei der Finanzierung des Grunderwerbs<br />
durch die Städte und Gemeinde mit Ausgleichsabgabemittel, um auf diesen so erworbenen<br />
Grundstücken Naturschutzprojekte umsetzen zu können: Anlage von Streuobstwiesen,<br />
Renaturierung von Fließgewässern in Verbindung mit Ausweisung von Uferschutz- bzw.<br />
Uferschonstreifen, Umbau nicht standortgerechter Waldgesellschaften, wie beispielsweise<br />
die „Entfichtung“ von Waldbächen; daneben aber auch Einzelmaßnahmen zum Schutz bedrohter<br />
Tierarten, wie beispielsweise die Herstellung der Durchgängigkeit für die Aqua-<br />
Fauna in den Fließgewässern, Schutzmaßnahmen für Amphibien oder Fledermäusen.<br />
Gegenwärtig wird geprüft, ob das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim eine immobile<br />
Leit-Einrichtung für Amphibien mit mehreren Unterquerungen der Bundesstraße B 47<br />
als Ökokonto errichten kann.<br />
2.2. Landschaftspflege und Naturschutz<br />
Das regionale Leitbild der Region „Der Odenwald – die landschaftlich und kulturell attraktive<br />
und ökologisch intakte Region mit klarem Qualitätsprofil in Rhein-Main-Neckar" zeigt auf,<br />
dass insbesondere im Kerngebiet, dem <strong>Odenwaldkreis</strong>, den Umweltbelangen und insbesondere<br />
der Landschaftspflege und dem Naturschutz eine wichtige Bedeutung zukommt.<br />
Der hohe Waldanteil und die insbesondere in allen Gemeinden ausgedehnten Streuobstbestände<br />
prägen die auf Grünlandnutzung ausgerichtete Kulturlandschaft des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
In der Bestandsaufnahme für das Kreisgebiet kommt daher dem Streuobst ein hoher<br />
Rang zu.<br />
Weiterhin soll die Situation aus Sicht gesetzlich festgelegter Schutzgebiete und Objekte<br />
(Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale) und der staatlichen Förderprogramme<br />
beleuchtet werden. Neben dem administrativen Handeln haben die gemeinsamen<br />
Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit NGOs 23 eine die Kultur und das Heimatbewusstsein<br />
stärkende Bedeutung, wie die vielen lokalen Projekte. Hier ist der Ansatzpunkt des Odenwaldprogrammes<br />
„Mensch – Natur – Kulturlandschaft" zu sehen.<br />
2.3. Streuobstregion<br />
Die im <strong>Odenwaldkreis</strong> typischen Streuobstwiesen sind Obstbaumbestände aus hochstämmigen<br />
in Gruppen oder in Reihen gepflanzten Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Zwetschen-, Kirsch-<br />
und/oder Walnussbäumen. Streuobstbestände sind i. d. R. auf mittleren Grünlandstandorten<br />
anzutreffen. Das Grünland wird kleinflächig wechselnd mehr oder weniger extensiv als Mähwiese<br />
oder Weide genutzt. Streuobstbestände liegen meist im Ortsrandbereich und prägen<br />
das Bild der Kulturlandschaft im Odenwald.<br />
23 Nichtregierungsorganisation (NRO), d. h. eine nichtstaatliche Organisation (engl. non-governmental<br />
organization, abgekürzt NGO)<br />
37
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die Bestände sind durch Rodung, Nutzungsaufgabe und insbesondere durch Siedlungserweiterung,<br />
selten durch Nutzungsintensivierung gefährdet. Abgängige Bäume wurden in<br />
der Vergangenheit meist nicht ersetzt. Streuobstgebiete sind darüber hinaus durch verstärkte<br />
Freizeitnutzung gefährdet.<br />
Fachliche Grundlagen<br />
In den verschiedenen Planungsinstrumenten des früheren Landschaftsrahmenplans des<br />
Regionalplans und der kommunalen Landschaftspläne sind die Streuobstbestände jeweils<br />
als erhaltungswürdige Schutzgüter dargestellt.<br />
Verbreitung der Streuobstbestände im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Im Regionalen Landschaftspflegekonzept für den <strong>Odenwaldkreis</strong> wurden die Streuobstbestände<br />
durch Auswertung der Fachplanungen sowie durch Luftbilder erfasst. So beträgt<br />
die Gesamtfläche rund 1.300 ha. Der Flächenanteil bezogen auf die landwirtschaftliche Fläche<br />
liegt in den einzelnen Gemeinden zwischen 4 und 12 %. Den größten Bestand mit über<br />
300 ha gibt es in Reichelsheim (Odenwald). Etwa 100 ha Streuobst wurden in Bad König,<br />
Brensbach und Lützelbach festgestellt. In vier weiteren Gemeinden gibt es noch mehr als 75<br />
ha Streuobstwiesen.<br />
Streuobstflächen<br />
in den Gemeinden<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
100 ha<br />
Fränkisch<br />
- Crumbac<br />
h<br />
Reichelshei<br />
m<br />
Brensbac<br />
h<br />
Mossauta<br />
l<br />
Rothenber<br />
g<br />
Brombachta<br />
l<br />
Beerfelde<br />
n<br />
Höchs<br />
t<br />
Erbac<br />
h<br />
Sensbachta<br />
l<br />
Breuber<br />
g<br />
Bad<br />
König<br />
Michelstad<br />
t<br />
Lützelbac<br />
h<br />
Hessenec<br />
k<br />
Streuobst-Anteil<br />
an der landwirtschaftlichen<br />
Fläche<br />
(<strong>Odenwaldkreis</strong> 6 %)<br />
Anteil der Streuobstfläche<br />
an der landwirtschaftlichen Fläche<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Vogelarten<br />
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Insbesondere<br />
die Größe von Streuobstflächen hat auf den Artenbestand einen erheblichen Einfluss. Beispielhaft<br />
seien hier die für Streuobst typischen Vogelarten genannt. Bei einer Größe von ca.<br />
10 ha ist mit durchschnittlich 10 Brutvogelarten zu rechnen. Bei dieser Größenordnung fehlen<br />
jedoch i. d. R. Streuobst-Indikatorarten wie z. B. der Steinkauz. Erst bei Streuobstbeständen<br />
über 100 ha ist in der Regel das Brutvogelspektrum vollständig vorhanden.<br />
Die typischen im <strong>Odenwaldkreis</strong> anzutreffenden Vogelarten der Streuobstwiesen sind:<br />
• Steinkauz (ca. 20 Brutpaare)<br />
• Grünspecht<br />
• Neuntöter<br />
• Wendehals<br />
• Dorngrasmücke<br />
• Grauspecht und Gartenrotschwanz.<br />
4 % - 5 %<br />
6 % - 7 %<br />
8 % - 9 %<br />
10 % - 12 %<br />
38<br />
Fränkisch<br />
- Crumbac<br />
h<br />
Reichelshei<br />
m<br />
Brensbac<br />
h<br />
Mossauta<br />
l<br />
Rothenber<br />
g<br />
Brombachta<br />
l<br />
Beerfelde<br />
n<br />
Höchs<br />
t<br />
Erbac<br />
h<br />
Sensbachta<br />
l<br />
Breuber<br />
g<br />
Bad<br />
König<br />
Michelstad<br />
t<br />
Lützelbac<br />
h<br />
Hessenec<br />
k
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Sortenvielfalt<br />
Die zahlreichen Obstarten und –sorten, die in den Odenwälder Streuobstbeständen zu finden<br />
sind, stellen im Hinblick auf Biodiversität ein beachtliches Genreservoir dar. Dieses gewinnt<br />
im Zuge des bereits stattfindenden Klimawandels zunehmend an Bedeutung für den<br />
Erhalt und die Züchtung neuer klimatisch angepasster Sorten. Nach derzeitigem Stand der<br />
Erhebungen sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> rund 150 verschiedene Sorten von Apfel, Birne und<br />
sonstigen Obstarten verbreitet. Darunter auch einige lokale Sorten wie Kumpfenapfel, Beerbacher<br />
Taffetapfel oder Reichelsheimer Mostapfel, die nur in der Odenwaldregion vorkommen.<br />
Aktivitäten<br />
Zahlreiche Aktivitäten, Projekte und Maßnahmen verdeutlichen, dass die Streuobstkultur im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> von den Menschen gepflegt und gelebt wird:<br />
• Streuobstpflanzaktion<br />
• Ausbildung zum Fachwirt für Obstbau<br />
• Keltereien<br />
• Odenwälder Streuobsttag in der Pudermühle in Nieder-Kinzig.<br />
2.4. Natura 2000-Gebiete<br />
„Natura 2000“ ist die Bezeichnung für das im Aufbau befindliche europaweite Netz von<br />
Schutzgebieten. Es setzt sich zusammen aus Schutzgebieten nach der Vogelschutz-Richtlinie<br />
(VS-RL) der EU von 1979 und aus Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
(FFH-RL) der EU von 1992. Vorrangiges Ziel ist es, die in Europa vorhandene biologische<br />
Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Maßgebend bei der Auswahl der Gebiete ist das<br />
Vorkommen bestimmter Lebensräume und ausgewählter Tier- und Pflanzenarten. Neben<br />
bereits bestehenden Schutzgebieten wurde daher auch eine Vielzahl weiterer bedeutender<br />
Lebensräume in das Schutzgebietsnetz aufgenommen.<br />
Zu Natura 2000, dem europäischen Schutzgebietssystem für gefährdete, ökologisch wertvolle<br />
Naturräume, zählen im <strong>Odenwaldkreis</strong> 16 Flora-Fauna-Habitat-Gebiete mit rund 2.000<br />
ha. Weiterhin sind der „Südliche Odenwald" mit rund 8.700 ha Waldfläche und kleinflächig<br />
einige „Felswände des nördlichen Odenwaldes" als Vogelschutzgebiete ausgewiesen.<br />
Nur etwa 500 ha der Natura 2000-Fläche im <strong>Odenwaldkreis</strong> kann als Offenland bezeichnet<br />
werden, wovon knapp 200 ha Grünland-Lebensraumtypen als Schutzgrund angegeben sind.<br />
Neben dem Schwerpunkt im Wald gibt es auch 138 km ausgewiesene Gewässerläufe. Etwa<br />
80 ha sind gleichzeitig als Naturschutzgebiet ausgewiesen.<br />
39
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
NATURA 2000-Gebiete im Überblick:<br />
2.5. Naturschutzgebiete<br />
Das erste Naturschutzgebiet (NSG) im <strong>Odenwaldkreis</strong> wurde mit dem Bruch von Bad König<br />
1980 ausgewiesen. Es folgten elf weitere NSG-Ausweisungen bis zum Jahr 2000. Die gesamte<br />
Fläche im <strong>Odenwaldkreis</strong> beträgt 180,96 ha. 85,58 ha der Fläche werden als Grünland<br />
bewirtschaftet bzw. gepflegt.<br />
Naturschutzgebiete im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
1. Bruch von Bad König (1980, Erweiterung 2001)<br />
2. Rotes Wasser von Olfen (1980)<br />
3. Steinbacher Teich und Fürstenauer Park (1981)<br />
4. Finkenbachtal bei Finkenbach (1981)<br />
5. Bruch von Brensbach (1983)<br />
6. Rohrsee von Rehbach (1986)<br />
7. Eutergrund von Bullau (1987)<br />
8. Stollwiese bei Erzbach (1989)<br />
9. Bruchwiesen von Dorndiel (1990)<br />
10. Jakobsgrund bei Gammelsbach (1996)<br />
11. Hinterbachtal bei Raubach (1999)<br />
12. Geierstal von Vielbrunn (2000)<br />
40<br />
17 FFH-Gebiete (1.327 ha)<br />
6120-301 Wald bei Wald-Amorbach 2 ha<br />
6218-302 Buchenwälder des vorderen<br />
Odenwaldes 260 ha<br />
6219-301 Grünlandbereiche östlich von<br />
Brensbach 75 ha<br />
6220-350 Ohrenbach zwischen Bremhof<br />
und Ohrenbach 8 ha<br />
6319-301 Rotes Wasser von Olfen mit<br />
angrenzenden Flächen 16 ha<br />
6319-302 Oberläufe der Gersprenz 63 ha<br />
6319-303 Oberlauf und Nebenbäche der<br />
Mümling 83 ha<br />
6320-301 Ebersberger Felsenmeer 17 ha<br />
6320-302 Erdbachhöhle bei Erbach
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
2.6. Naturdenkmale<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind derzeit 69 Naturdenkmale rechtsverbindlich unter Schutz gestellt. Es<br />
handelt sich um 13 Felsbildungen und geologische Besonderheiten sowie 56 Bäume oder<br />
Baumgruppen, überwiegend Eichen, daneben Buchen, Linden und Kiefern sowie zwei Speierlinge<br />
und eine Rosskastanie.<br />
Die meisten der Naturdenkmale im Odenwaldkeis wurden in den dreißiger Jahren ausgewiesen,<br />
einige wurden bereits im ersten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts in das „Verzeichnis<br />
der Naturdenkmale im Kreis Erbach" aufgenommen.<br />
32 frühere Naturdenkmale sind im Laufe der Jahrzehnte untergegangen oder waren wegen<br />
ihres schlechten Zustandes aus dem Naturdenkmal-Verzeichnis zu löschen, dabei so markante<br />
und einmalige Bäume wie die „Drei-Stufen-Linde" auf dem Friedhof Breitenbrunn oder<br />
die „Zentlinde" am Beerfelder Galgen (Stand 1995).<br />
Unter dem folgenden Link können die Naturdenkmale in Google maps oder Google earth<br />
virtuell besucht werden und auch Wanderungen und Spaziergänge zu den Naturdenkmalen<br />
können bequem vorbereitet werden:<br />
http://maps.google.de/maps/ms?f=q&hl=de&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=110436056260907<br />
019052.000442d17d08f3f96c1e3&ll=49.689345,8.94787&spn=0.426448,0.925598&z=10&o<br />
m=1<br />
Naturdenkmale im <strong>Odenwaldkreis</strong> bei Google maps<br />
41
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
2.7. Besondere Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten<br />
Für den <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es bisher keine Gesamtliste der vorkommenden Tier- und Pflanzenarten<br />
und der für sie jeweils relevanten Lebensräume. Für die dauerhafte Erhaltung seltener<br />
und bedrohter Arten ist die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des Biotopverbundes,<br />
wie im Regionalen Landschaftspflegekonzept für den <strong>Odenwaldkreis</strong> ausgeführt,<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Stellvertretend für die vielen bemerkenswerten Arten im <strong>Odenwaldkreis</strong>, die bisher<br />
keinem besonderen staatlichen Schutzregime (Pflege- und Entwicklungskonzepte)<br />
unterliegen, seien an dieser Stelle genannt:<br />
• Luchs<br />
• Eisenhutblättriger Hahnenfuß<br />
• Weißes Waldvögelein<br />
• Breitblättriges Knabenkraut<br />
• Lungenenzian<br />
• Moorglöckchen<br />
• Kleiner Frauenspiegel.<br />
Europäisch bedeutsam im Sinne des Natura 2000-Konzeptes und der FFH- und Vogelschutzrichtlinie<br />
24 sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> die folgenden Lebensräume und Arten, die unter<br />
besonderem Monitoring stehen und deren Zustand in einer Grunddatenerfassung dokumentiert<br />
ist:<br />
24 1992 wurde die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), eine Naturschutz-Richtlinie der<br />
Europäischen Union beschlossen, welche gemeinsam mit der Vogelschutzrichtlinie im Wesentlichen<br />
der Umsetzung der Berner Konvention dient. Eines ihrer wesentlichen Instrumente ist ein zusammenhängendes<br />
Schutzgebietenetz, das „Natura 2000“ genannt wird.<br />
42
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
FFH- / VS-Richtline Code Name<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer<br />
mit Strandlings- und/oder Zwergbinsenvegetation<br />
(Littorelletea und/oder Isoeto-<br />
Nanojunceta)<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 3260 Fließgewässer der planaren bis montanen<br />
Stufe mit Vegetation des Flutenden Hahnenfußes<br />
(Ranunculion fluitantis)<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 4030 Trockene europäische Heiden<br />
Anhang 1 FFH Prioritärer Lebensraumtyp 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen auf<br />
Silikatböden (und submontan auf dem<br />
europäischen Festland)<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 6410 Pfeifengraswiesen<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 6430 Feuchte Hochstaudenfluren<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 6510 Extensive Mähwiesen der planaren bis<br />
submontanen Stufe<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 8150 Silikatschutthalden<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 9110 Hainsimsen-Buchen-Wald<br />
Anhang 1 FFH Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-Buchen-Wald<br />
Anhang 1 FFH Prioritärer Lebensraumtyp 9180 Schlucht- und Hangmischwälder<br />
Anhang 1 FFH Prioritärer Lebensraumtyp 91E0 Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauen<br />
an Fließgewässern<br />
Anhang 2 FFH Art Käfer Hirschkäfer<br />
Anhang 2 FFH Art Amphibien Gelbbauchunke<br />
Anhang 2 FFH Art Fisch Bachneunauge<br />
Anhang 2 FFH Art Fisch Groppe<br />
Anhang 2 FFH Art Fledermaus Großes Mausohr<br />
Anhang 2 FFH Art Fledermaus Bechsteinfledermaus<br />
Anhang 2 FFH Prioritäre Art Schmetterling Spanische Flagge oder Russischer Bär<br />
Anhang 2 FFH Art Schmetterling Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling<br />
oder Schwarzblauer Bläuling<br />
Anhang 2 FFH Art Schmetterling Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling<br />
Anhang 2 FFH Art Moos Grünes Besenmoos<br />
Anhang 2 FFH Art Farn Prächtiger Dünnfarn<br />
Anhang 1 VS Vogel Raufußkautz<br />
Anhang 1 VS Vogel Sperlingskautz<br />
Anhang 1 VS Vogel Grauspecht<br />
Anhang 1 VS Vogel Schwarzspecht<br />
Anhang 1 VS Vogel Uhu<br />
Anhang 1 VS Vogel Wanderfalke<br />
2.8. Artenschutz<br />
Mit Festsetzung der „Natura 2000“-Gebieten (FFH- und Vogelschutzgebiete) sind die Belange<br />
des Artenschutzes aufgewertet worden; diese höhere Bedeutung spiegelt sich u. a.<br />
auch im Umweltschadensgesetz wider. Die Naturschutzbehörde muss den Belangen des<br />
Artenschutzes in allen Verfahren, mit entsprechend erhöhten Anforderungen gerecht werden.<br />
Wie bereits erwähnt, begleitet und fördert die Naturschutzbehörde auch Einzelmaßnahmen<br />
zum Schutz bedrohter Tierarten, wie beispielsweise den Abbau funktionslos gewordener<br />
Wehranlagen oder die Herstellung der Durchgängigkeit für die Aqua-Fauna in den Fließ-<br />
43
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
gewässern durch die Entnahme von Durchlass-Rohren. Dies wird von der Naturschutzbehörde<br />
in den letzten Jahren in nahezu allen Flurbereinigungsverfahren gefordert.<br />
Ebenso begleitet die Naturschutzbehörde die Errichtung von Schutzzäunen und von Tümpeln<br />
für Amphibien: Hier sind insbesondere die Kröten-Schutzzäune an der Bundesstraße B<br />
47 in der Hutzwiese und zwischen Rehbach und Steinbach, an der Bundesstraße B 460 in<br />
Höhe des Hochwasser-Rückhaltebeckens Marbach zu nennen. Daneben unterstützt die<br />
Naturschutzbehörde noch weitere, kleinere Schutzeinrichtungen – u. a. mittels eine alljährliche<br />
Zuwendung an den Odenwälder Kreisverband des Naturschutzbunds (NABU) in Höhe<br />
von 500 €.<br />
Die Naturschutzbehörde begleitet mit der Abteilung Landschaftspflege des Amts für den<br />
ländlichen Raum Reichelsheim einen „Arbeitskreis Amphibien“, in dem eng mit dem Amt für<br />
Straßen- und Verkehrswesen Bensheim, HESSEN-Forst und den örtlichen Naturschutzgruppen<br />
zusammengearbeitet wird. Nachdem im Jahre 2008 der NABU Laichtümpel für die in der<br />
Roten Liste besonders geschützte Gelbbauch-Unke im Bereich des alten Steinbruchs auf<br />
dem Gelände der Grünschnitt-Deponie des Müllabfuhr-Zweckverbands in Kirch-Brombach<br />
geschaffen wurden, unterstützt die Naturschutzbehörde den Nabu auch im Jahre 2009: Im<br />
Zuge der Rekultivierung der Tongrube „Vier Stöck“ soll auf die Verfüllung und auf die Wiederaufforstung<br />
auf Teilflächen verzichtet und statt dessen auch hier Tümpel für Amphibien –<br />
und insbesondere für die auch dort vorkommende Gelbbauch-Unke – angelegt werden.<br />
Die Naturschutzbehörde unterstützt auch die Arbeit des Kimbacher Naturschutzzentrums<br />
Odenwald – Stiftung Georg Raitz (NZO), das sich in den letzten Jahren insbesondere um<br />
den Schutz einzelner Tierarten, wie beispielsweise um den Schutz der Ameisen, der Eulen,<br />
der Steinkäuze, der Uhus, der Fledermäuse oder um den an der Mümling im Naturschutzgebiet<br />
„Bruch von Bad König und Etzen-Gesäß“ vorkommenden Biber kümmert. Stellvertretend<br />
hierfür ist das fledermausgerecht eingerichtete Dachgeschoss des Bahnhofsgebäudes<br />
auf dem Bahnhof Höchst/Mümling-Grumbach zu nennen. Daneben bemüht sich das NZO<br />
aber auch um den Schutz seltener Biotope, wie beispielsweise um die Halb-Magerrasengesellschaften<br />
am „Gräsig“ in Michelstadt, die Wald- und Offenlandflächen „Mies“ in Würzberg<br />
oder um das in Hessen einzige Vorkommen einer Moorglöckchen-Art in Kimbach.<br />
Im Süden des Odenwaldes, im Bereich des in den <strong>Odenwaldkreis</strong> ausstrahlenden Vorkommens<br />
des Äskulapnatter bei Hirschhorn – einem von vier voneinander isolierten Arealen im<br />
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland – ist ein Informationsaustausch über Kreis- und<br />
Landesgrenzen hinweg gewährleistet. Es erfolgt eine Koordination zwischen dem Kreis<br />
Bergstraße, dem badischen Rhein-Neckar-Kreis und dem <strong>Odenwaldkreis</strong>, den Städten<br />
Hirschhorn und Eberbach und der „Arbeitsgemeinschaft Äskulapnatter“. Nach neuesten Erkenntnissen<br />
ist das Hirschhorner Verbreitungsgebiet deutlich größer als in der Vergangenheit<br />
angenommen. Es ist beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde<br />
und der Gemeinde Rothenberg auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> biotopverbessernde Maßnahmen für<br />
die Art durchzuführen, beispielsweise die Anlage sonnenexponierter Eiablageplätze. Nach<br />
den bisherigen Erfahrungen sind für die einfachen, aber nachweislich effektiven Maßnahmen<br />
nur geringe Kosten zu veranschlagen. Die fachlichen Grundlagen sollen von der badischen<br />
„Arbeitsgemeinschaft Äskulapnatter“ erarbeitet werden.<br />
2.9. Naturschutz- und Landschaftspflege-Projekte<br />
Einen Überblick über die im <strong>Odenwaldkreis</strong> bedeutsamen Projekte des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege mit Hinweis auf die jeweiligen Akteure gewährt die nachfolgende<br />
Tabelle:<br />
44
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Akteure Für den <strong>Odenwaldkreis</strong> bedeutsame Naturschutzprojekte und Planungen und ihre<br />
Zielsetzung<br />
Agenda21-Gruppe Michelstadt,<br />
Obst- und Gartenbauvereine<br />
Agenda21-Projekt Stadt Michelstadt „Erhalt und Vermehrung der Seckel-Löbs-<br />
Birne": Letzte Standorte von Bäumen der Sorte „Seckel-Löbs-Birne" wurden ausfindig<br />
gemacht; Geschichte der nach dem Züchter benannten Sorte wurde dokumentiert; mittels<br />
Reiser-Veredlung wurden Jungbäume aufgezogen und ausgepflanzt.<br />
Agenda21-Projektgruppe Agenda21-Projekt Region Starkenburg Konzept Heubörse: Verbindung von ökonomisch<br />
tragfähiger landwirtschaftlicher Grünland-Nutzung und der Erhaltung einer reichhaltigen<br />
und ökologisch vielfältigen kulturlandschaftlichen Erhaltung und Entwicklung regio-<br />
Eigentümer und Jäger<br />
bzw. Jagdgenossen um<br />
W. Scharmann<br />
Pflegegemeinschaft Lenz<br />
bzw. Landwirt, ALR<br />
Gemeinsame Abstimmungen<br />
zwischen Landwirtschaft,<br />
Naturschutz,<br />
Kommunen und Behörden,<br />
den Trägern öffentlicher<br />
Belange (TÖB)<br />
Stadt Erbach, Schäferei<br />
Chur/Hönig, Naturschutzbehörde,<br />
ALR<br />
GAZ Georg-August-Zinn-<br />
Schule, ALR, Öko-Landwirt<br />
Müller<br />
GAZ Georg-August-Zinn-<br />
Schule, ALR<br />
Landwirt Heilmann mit<br />
fachlicher Unterstützung<br />
von IAVL 25 , ALR<br />
naler Wirtschaftskreisläufe im Bereich Futtermittel. Gezielter Arten- und Biotopschutz<br />
Heckenpflanzung Rehbach/Zell/Langenbrombach: Anlage neuer Heckenstrukturen in<br />
ausgeräumter Landschaft zur Gliederung und ökologischen Aufwertung<br />
Heckenpflege in Hebstahl und Bullau: Abschnittsweises Pflegen und „Auf-den-Stocksetzen“<br />
und damit Erhaltung traditioneller Heckenlandschaften, Verwendung als Brennholz<br />
Novellierung und Neuabgrenzung LSG Bergstraße Odenwald im Jahr 2002: Mit der<br />
letzten Novellierung und Neuabgrenzung des LSG (vor der umstrittenen Aufhebung<br />
2007) ist es gelungen die Ziele der Landschaftsrahmenplanung umzusetzen und für die<br />
Region den Schutz der Kulturlandschaft sowie seiner Naturgüter zu gewährleisten. Eine<br />
umfassende Beteiligung der TÖB insbesondere der Kommunen, der Naturschutzverbände<br />
und der Landnutzer hat zu einer hohen Akzeptanz der Grenzziehung und der Schutzziele<br />
geführt. Insbesondere für die landwirtschaftliche Nutzung wurden neue Regelungen diskutiert,<br />
entwickelt und eingeführt, die ihrer Bedeutung zur Erhaltung der traditionell landwirtschaftlich<br />
geprägten Kulturlandschaft Rechnung tragen.<br />
Jugend-Workcamp IJGD Eutergrund: 4-wöchiges internationales Workcamp mit Jugendlichen,<br />
Grabeninstandsetzungen, Entbuschungen und Anlage eines Rundweges im<br />
NSG Eutergrund, Naturerlebnis und Vermittlung von Wissen und Zusammenhängen über<br />
die Kulturlandschaft<br />
Schulprojektwoche Grabenrenaturierung im NSG Stollwiese bei Erzbach: 1-wöchiges<br />
Schulprojekt zur Grabenrenaturierung und Öffnung eines verrohrten Bachlaufes,<br />
Naturerlebnis und Vermittlung von Wissen und Zusammenhängen über die Kulturland-<br />
schaft<br />
Schulprojektwoche Trockenmauer: 1-wöchiges Schulprojekt, Instandsetzung und Wiederaufbau<br />
einer Trockenmauer am Reichelsheimer Schlossberg, Erhaltung alter traditioneller<br />
Terrassierung, Naturerlebnis und Vermittlung von Wissen und Zusammenhängen<br />
über die Kulturlandschaft<br />
Umwandlung von Acker in Grünland: Ansaat mit standortgerechter Grünlandmischung<br />
auf nassen Ackerflächen im Überschwemmungsbereich der Mümling, sowie dauerhafte<br />
extensive Grünlandnutzung<br />
Landwirte, ALR Hammergrund in Unter-Mossau: Entwicklung eines Pflegekonzeptes, Offenhaltung des<br />
Talraumes, Grabeninstandsetzung, Abschluss dauerhafter Pacht- und Nutzungsvereinbarungen<br />
Schäferei Ries, Gemeinde<br />
Mosautal, Naturschutzbehörden,<br />
Flurbereinigung,<br />
ALR<br />
Landwirte, Gemeinde<br />
Mossautal, Naturschutzbehörden,Flurbereinigung,<br />
ALR<br />
Schäferei Chur bzw. seit<br />
2008 Schäferei Kobold<br />
sowie Bayerische Pflegegemeinschaft,<br />
ALR<br />
Harrasloch in Güttersbach: Ankauf und Neuordnung der Grundstücke, Grabeninstandsetzung,<br />
Sicherung und Entwicklung für den Odenwald einzigartiger Pflanzengesellschaften,<br />
Abschluss dauerhafter Pacht- und Nutzungsvereinbarungen<br />
Mösselbachtal in Güttersbach: Ankauf und Neuordnung der Grundstücke, Ausweisung<br />
von Pufferstreifen entlang des Mösselbachs, Entwicklung eines Pflegekonzeptes, naturverträgliche<br />
Beweidung mit Pferden, Abschluss dauerhafter Pacht- und Nutzungsvereinbarungen<br />
Eutergrund: Entwicklung eines Pflegekonzeptes, Wiederaufnahme der Nutzung eines<br />
gesamten Talgrundes z. T. NSG und neuerdings FFH, Offenhaltung des Talraumes, Grabeninstandsetzung,<br />
Entfichtung, Entbuschung, naturverträgliche Beweidung mit Extensiv-<br />
Schafrasse, Sicherung und Entwicklung für den Odenwald einzigartiger Pflanzenarten z.<br />
B. „Eisenhutblättriger Hahnenfuß", Abschluss dauerhafter Pacht- und Nutzungsvereinbarungen,<br />
Entwicklung und Umsetzung des NSG-Pflegeplans im Rahmen des Vertragsnaturschutzes<br />
(Kreis- und Landesgrenzen überschreitend)<br />
25 Institut für angewandte Vegetationskunde und Landschaftsökologie<br />
45
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Schäferei Kobold, Pflegegemeinschaft<br />
Lenz, Naturschutzgruppe,Gemeinde<br />
Sensbachtal, Flurbereinigung,<br />
Naturschutz-<br />
und Wasserbehörden,<br />
ALR<br />
Schäferei Gimber und<br />
Landschaftspflegebetrieb<br />
Klausmann Kreis HP, ALR<br />
Schäferei Ries, Naturschutzbehörden,<br />
ALR<br />
Öko-Landwirt Müller,<br />
Eigentümer, Gemeinde<br />
Reichelsheim, Flurbereinigung,Naturschutzbehörden,<br />
ALR<br />
Gemeinde Brensbach,<br />
Eigentümer, Flurbereinigung,<br />
Naturschutz- und<br />
Wasserbehörden, ALR<br />
Naturschutzgruppen,<br />
Naturschutzbehörden,<br />
Straßenbaubehörde, teils<br />
Kommunen, ALR<br />
Naturschutzverbände,<br />
Stiftung, Stadt Bad König,<br />
beim NZO angesiedelte<br />
Arbeitsgruppen u. a.<br />
Fledermausschutz,<br />
Waldameisen, Amphibien<br />
OGV, NZO, Naturschutzverbände,Naturschutzbehörden,GrundstückseigentümerStreuobstwie-<br />
senbesitzer, ALR<br />
Naturschutzgruppen,<br />
Streuobstwiesenbesitzer,<br />
Keltereien, ALR<br />
Streuobstfreunde Lützelbach,<br />
OGV, Naturschutzgruppe,<br />
Gemeinde Lützelbach,<br />
ALR<br />
Kreisverband für Obstbau,<br />
Garten und Landschaftspflege,<br />
ALR<br />
Talgrund Hebstahl: Entwicklung eines Pflegekonzeptes, Neuordnung der Grundstücke,<br />
Offenhaltung des Talraumes, Entbuschung, Entfichtung, naturgerechte Nutzung des<br />
Grünlandes durch Schafbeweidung, Entwicklung des Orchideenbestandes, Abschluss<br />
dauerhafter Pacht- und Nutzungsvereinbarungen (Kreis- und Landesgrenzen überschreitend)<br />
Finkenbachtal: Entwicklung eines Pflegekonzeptes, Wiederaufnahme der Nutzung eines<br />
gesamten Talgrundes z. T. NSG und neuerdings FFH, Offenhaltung des Talraumes, Grabeninstandsetzung,<br />
Entfichtung, Entbuschung, naturverträgliche Beweidung mit Schafen,<br />
Sicherung und Entwicklung bedrohter Pflanzengesellschaften, Abschluss dauerhafter<br />
Pacht- und Nutzungsvereinbarungen (Kreis- und Landesgrenzen überschreitend)<br />
Hinterbachtal: Entwicklung eines Pflegekonzeptes, Wiederaufnahme der Nutzung eines<br />
gesamten Talgrundes z. T. NSG und neuerdings FFH, Grabeninstandsetzung, z. T. naturverträgliche<br />
Beweidung mit Schafen, z. T. Heumahd und Sicherung und Entwicklung für<br />
den Odenwald einzigartiger Pflanzengesellschaften, Offenhaltung des Talraumes<br />
Entflechtung von Nutzungsinteressen im NSG Stollwiese bei Erzbach: Ankauf und<br />
Neuordnung der Grundstücke, Offenhaltung des Talraumes, Entbuschung, Entfichtung,<br />
Grabenrenaturierung, Streuobstpflege, naturgerechte Nutzung des Grünlandes durch<br />
Heumahd und teils durch Beweidung (Öko-Betrieb), Abschluss dauerhafter Pacht- und<br />
Nutzungsvereinbarungen, Entwicklung und Umsetzung des NSG-Pflegeplans im Rahmen<br />
des Vertragsnaturschutzes<br />
Gewässerrenaturierung und Anlage von Pufferstreifen in der Gersprenzaue bei<br />
Brensbach: Im Auenbereich der Gerspenz und des NSG werden Flächen im Rahmen<br />
der Flurbereinigung aufgekauft. Es findet eine Neuordnung der Grundstücke statt zur<br />
Einrichtung von Pufferstreifen um das NSG Bruch von Brensbach und an der Gersprenz,<br />
auf denen eine natur- und umweltgerechte Nutzung stattfindet. Uferbereiche und verrohrte<br />
Bach- und Grabenabschnitte werden z. T. renaturiert.<br />
Runder Tisch Amphibien: Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es rund 20 Schwerpunkte von Straßen<br />
querenden Amphibienwanderungen. Der Runde Tisch dient der Abstimmung und dem<br />
Informationsaustausch der Akteure hinsichtlich der Schutzmaßnahmen bzw. des Baus<br />
und der Betreuung von Leiteinrichtungen und Untertunnelungen und der Bestandsentwicklungen<br />
Naturschutzzentrum Odenwald Stiftung Georg Raitz: Anlässlich der Auszeichnung als<br />
Stiftung des Monats durch das Land Hessen: „Der Trägerorganisation gehören nicht nur<br />
alle Naturschutzverbände des Landstrichs an; sie füllen unser Zentrum auch gemeinsam<br />
mit Leben“, freut sich Horn, der einräumt, dies so nicht unbedingt erwartet zu haben:<br />
„Anfangs habe ich mir schon Sorgen gemacht, ob da nicht eine Einrichtung entsteht, die<br />
letztlich gar nicht ausreichend genutzt wird.“ Vor allem aber dank der Begeisterung seines<br />
Mitstreiters Karl Rapp, den Horn die gute Seele des Hauses Raitz nennt, sei genau das<br />
Gegenteil eingetreten: „Wir erleben das Anwesen heute als quicklebendige Begegnungsstätte<br />
von Tier- und Pflanzenfreunden unterschiedlichster Ausrichtung“, berichtet der<br />
Vorstandsvorsitzende, der sich über die rege Gruppenarbeit freut. Gut 100 Naturschützer<br />
nutzen den Treffpunkt nach seinen Angaben allein in rund einem Dutzend von fachorientierten<br />
Arbeitsgruppen regelmäßig.<br />
Streuobstaktion: Jährliche Streuobstpflanzaktionen im Herbst (rund 1.000 Bäume bzw.<br />
ca. 150 Teilnehmer), Sammelbestellung traditioneller und standortangepasster Streuobstsorten,<br />
Förderung der Beschaffungskosten<br />
Streuobst-Aufpreisvermarktung mit FES und FÖG: Natur- und Verbraucherorganisationen<br />
aus dem Bereich Darmstadt sowie Heidelberg/Mannheim haben eine Aufpreisvermarktung<br />
organisiert. Nach Öko-Richtlinien wirtschaftende Streuobstwiesen-Besitzer<br />
liefern zu garantierten deutlich höheren Preisen Kelterobst. Zwei Keltereien aus der Region<br />
sind beteiligt. Um die Vermarktung kümmern sich im Wesentlichen FES und FÖG.<br />
Streuobstlehrpfad: Am Ortsrand von Seckmauern befindet sich ein ausgedehntes<br />
Streuobstgebiet. Örtliche Streuobstfreunde und Naturschutzgruppen haben die Errichtung<br />
eines Rundweges zur Information von Besuchern und insbesondere auch Schulklassen<br />
angeregt und mit Unterstützung durch das ALR errichtet.<br />
Ausbildung FachwartInnen für Obstbau: Jährlicher Ausbildungskurs (72 Std.) mit<br />
Schwerpunkt im Streuobstbereich. Inhaltlich werden Grund- und Aufbaukurse angeboten,<br />
TeilnehmerInnen auch aus Nachbarkreisen sowie Bayern und Baden-Württemberg<br />
46
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
ALR www.streuobstregion.de Internetseite mit Informationen zur Natur und Landschaft des<br />
Odenwaldes insbesondere als Streuobstregion, sowie mit einem eingebundenen Forum<br />
zum Informationsaustausch der Fachwarte<br />
Arbeitskreis bestehend<br />
aus Fachbehörden (Wasser,<br />
Forst, Naturschutz),<br />
Kommunen, Naturschutzverbänden<br />
und landwirtschaftliche<br />
Gremien, ALR<br />
Geplantes Projekt<br />
Regional bedeutsame<br />
Naturschutzprojekte und<br />
Planungen<br />
Gewinnung autochthonen<br />
Saatgutes für Wiesennachsaat<br />
Heumatte<br />
Regionales Landschaftspflegekonzept wird ab 2008 als Regionales Agrarumwelt<br />
Konzept fortgeführt: Seit 1995 besteht eine Arbeitsgruppe für das Regionale Landschaftspflegekonzept<br />
(RLK) im <strong>Odenwaldkreis</strong>. Naturschutzverbände, Naturschutzbehörden,<br />
Forstämter, Wasserbehörde und das ALR engagieren sich gemeinsam für die Erhaltung<br />
und Entwicklung der heimischen Kulturlandschaft. Auf der Grundlage des zusammengetragenen<br />
Fachwissens über die Natur und Landschaft sowie über die Landwirtschaft<br />
in der Region werden Handlungsgebiete und Maßnahmen der Landschaftspflege<br />
im Offenland und ggf. auch im Wald abgestimmt. Dabei achten die Akteure des<br />
Arbeitskreises darauf, dass kommunale und staatliche Planungen im Einklang stehen und<br />
Maßnahmen gemeinsam mit Landwirten und Naturschützern umgesetzt werden. Das<br />
Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses ist das Regionale Landschaftspflegekonzept.<br />
Alle Handlungsgebiete für die Landschaftspflege sind in einer Übersichtskarte (1 : 25.000)<br />
dargestellt. An der farblichen Markierung der Flächen ist zu erkennen, welche landschaftspflegerischen<br />
Ziele jeweils im Handlungsgebiet verfolgt werden. So geht es um<br />
Auen- und Gewässerschutz, Schutz von Hecken, Streuobstbeständen und artenreichen<br />
Wiesen. Auch die ökologische Entwicklung von bisher intensiv genutzten Flächen ist vorgesehen,<br />
damit sie im Verbund mit anderen Biotopen bestimmte Funktionen, z. B. Nahrungs-<br />
und Brutgebiet für Vogelarten oder als Trittstein bei der Ausbreitung und Wanderung<br />
übernehmen können (Biotopvernetzung).<br />
Akteure Zielsetzung<br />
örtlicher Saatgutbetrieb,<br />
ALR<br />
47<br />
Zur Beseitigung und Instandsetzung von Wildschweinschäden<br />
auf einzigartigen<br />
Mähwiesen (FFH) soll zur dauerhaften Erhaltung<br />
bedrohter Pflanzengesellschaften geeignetes<br />
autochthones Saatgut verwendet werden.<br />
2.10. Odenwaldprogramm „Mensch – Natur – Kulturlandschaft"<br />
Mit „Mensch – Natur – Kulturlandschaft“ hat der <strong>Odenwaldkreis</strong> im Jahr 2007 erstmals ein<br />
eigenes Programm zur Förderung der Kulturlandschaft auf den Weg gebracht. Bewirtschafter<br />
ökologisch wertvoller Grünland- und Streuobstbestände, die Lebensraum für seltene und für<br />
den Odenwald bedeutsame Pflanzen- und Tierarten bieten, wurden prämiert.<br />
Das Odenwaldprogramm erweist sich zugleich als wichtiger Baustein des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
und greift den Leitbildgedanken der Regionalen Entwicklungsgruppe<br />
auf, die den Odenwald als „eine landschaftlich und kulturell attraktive, ökologisch intakte Region<br />
mit klarem Qualitätsprofil in Rhein-Main-Neckar“ beschreibt. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> will<br />
diese besonderen Qualitäten bewahren und weiterentwickeln.<br />
Das Programm knüpft an die Erfahrung an, dass der Odenwald insbesondere über seine<br />
Wiesentäler und die reich mit Hecken, Feldgehölzen und Streuobstbeständen gegliederten<br />
Bergrücken als abwechslungsreiche Kulturlandschaft wahrgenommen wird. Besucher und<br />
Gäste des Odenwaldes, Einheimische und insbesondere auch Naturschutzexperten schätzen<br />
den hohen Naturreichtum und die intakte bäuerliche Landwirtschaft. Die Odenwald-<br />
Landschaft ist das Ergebnis einer naturgerechten Landbewirtschaftung und damit Kulturlandschaft<br />
im besten Sinne. Mit dem Odenwaldprogramm „Mensch-Natur-Kulturlandschaft“<br />
setzt der Landkreis ein deutliches Signal, dass er sich dieses Potenzials bewusst ist und die<br />
Leistungen der Bevölkerung anerkennt. Die Prämien in der Größenordnung bis 1.000 € dienen<br />
vor allem dazu, das bisher durch naturgerechte landwirtschaftliche Nutzung Erreichte<br />
auf Dauer zu erhalten und weiter zu entwickeln. Gleichzeitig stärkt das Programm die
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Glaubwürdigkeit hinsichtlich der von Politik und Verwaltung mit Landwirtschaft und Naturschutz<br />
erarbeiteten Ziele und Leitbilder.<br />
Ausgewählt wurden Bewirtschafter solcher Flächen, auf denen festgestellt wurde, dass sie<br />
zum Beispiel bunt und artenreich u. a. mit vielen Margeriten blühen und seltene Orchideen<br />
oder andere vom Aussterben bedrohte Kräuter und Gräser vorkommen. Auch seltene Tierarten<br />
wie der Schmetterling Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling oder der Grünspecht und<br />
Steinkauz als Brutvögel in Streuobstwiesen geben den Hinweis auf ökologisch wertvolle Flächen<br />
und sind der Naturschutzbehörde oder dem ALR gemeldet worden. Die Bewertung und<br />
Auswahl der Flächen erfolgte durch die beiden Fachbehörden des <strong>Odenwaldkreis</strong>es auf der<br />
Grundlage des Regionalen Landschaftspflegekonzeptes, der Biotopkartierung, der Landschaftspläne<br />
und weiterer Gutachten unter Beteiligung des Naturschutzbeirats bzw. des Gebietsagrarausschusses.<br />
Die Bewertung und Auswahl der Flächen erfolgt durch die Fachbehörden des Kreises auf der<br />
Grundlage des Regionalen Landschaftspflegekonzeptes, der Biotopkartierung, der Landschaftspläne<br />
und weiterer Gutachten unter Beteiligung der jeweiligen Beiräte.<br />
Im Jahr 2007 wurden 35 Personen im <strong>Odenwaldkreis</strong> für eine Prämierung durch das Odenwaldprogramm<br />
„Mensch – Natur – Kulturlandschaft“ ausgewählt. Die Prämien mit einem Gesamtbetrag<br />
von 29.000 € wurden ihnen dafür verliehen, dass sie diese Flächen in eigener<br />
Verantwortung, teils auch in Absprache mit Naturschutzgruppen oder Naturschutzbehörden,<br />
in einem für die Natur wertvollen Zustand erhalten – und dies zum Teil schon seit vielen Jahren<br />
oder gar Jahrzehnten.<br />
Lage der prämierten Flächen im Jahr 2007<br />
(Quelle: Google)<br />
48
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Generationen-Leistung<br />
Den Prämienempfängern wird die Anerkennung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es auch für eine Generationen-Leistung<br />
ausgesprochen, die über das hinausgeht, was mit staatlichen Fördermitteln<br />
oder gesetzlichen Einschränkungen und Verboten zugunsten des Naturschutzes erreicht<br />
werden kann. Die Prämierung ist nicht an besondere Auflagen und Verpflichtungen geknüpft.<br />
Sie orientiert sich ausschließlich daran, dass der Pflanzen- und Tierbestand der Flächen<br />
selten oder für den <strong>Odenwaldkreis</strong> bedeutsam ist. Die Prämierung gibt vor allem Landwirten<br />
und Bewirtschaftern als Produzenten und Bewahrern von naturnahen Grünland und Streuobstbeständen,<br />
den „Glanzlichtern der Odenwälder Kulturlandschaft“, ein Zeichen der Anerkennung.<br />
2.11. Eingriffsregelung im Zuge der Siedlungsentwicklung und Schutz des<br />
Außenbereichs<br />
In Fragen der zukünftigen Entwicklung der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet besteht<br />
innerhalb der Kreisverwaltung eine enge Verflechtung mit den Aufgabenbereichen des<br />
Kreisbauamts. Dies betrifft sowohl öffentliche Planungen als auch Einzelprojekte. Gemäß<br />
ihrem gesetzlichen Auftrag hat die Naturschutzbehörde auf allen Planungsebenen für eine<br />
angemessene Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
und in Baugenehmigungsverfahren für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsgenehmigung<br />
zu sorgen.<br />
Das Ziel zur Innenentwicklung der Kommunen muss Vorrang vor der Neuausweisungen von<br />
Baugebieten und einer Entwicklung nach außen haben. Auf die Möglichkeiten im Rahmen<br />
des Dorferneuerungsprogramms in Hessen wird in diesem Zusammenhang verwiesen: Für<br />
die äußere Gestalt zahlreicher Ortskerne und für die Aktivierung des Gemeindelebens hat<br />
das Dorferneuerungsprogramm wertvolle räumliche Voraussetzungen geschaffen und Entwicklungen<br />
in Gang gesetzt. Flächensparendes Bauen durch Umnutzung leer stehender und<br />
Sanierung alter Bausubstanz unterstützen den Grundsatz einer nachhaltigen Regionalentwicklung.<br />
Aufgrund der demographischen Entwicklung lassen sich Neubaugebiete, die Flächen im<br />
Außenbereich beanspruchen, nicht mehr begründen.<br />
Hinsichtlich der „illegalen Kleinbauten im Außenbereich“ haben die hessischen Bauaufsichtsbehörden<br />
nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches und gemäß<br />
den Vorgaben des Landes Hessen auch in Zukunft gegen illegal im Außenbereich errichtete<br />
Bauten vorzugehen. Im <strong>Odenwaldkreis</strong> arbeiten die Bauaufsichtsbehörde und die<br />
Naturschutzbehörde dabei eng zusammen, um den – aufgrund der zahlreichen „Altfälle“ –<br />
erheblichen Verwaltungsaufwand bewältigen zu können.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Untere Naturschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Amt für den ländlichen Raum (ALR) des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in Reichelsheim (Odenwald)<br />
• Naturschutzgruppen und Arbeitskreise<br />
49
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
3. Landwirtschaft und ländlicher Raum<br />
3.1. Landwirtschaft<br />
Landwirtschaft im <strong>Odenwaldkreis</strong> im Jahr 2007/2008<br />
Gesamtfläche<br />
Landwirtschaftliche<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> 62.397 ha Betriebe/Antragsteller2 Rinder<br />
664 insgesamt1 21.120<br />
Landwirtschaftsfläche 1 17.502 ha Haupterwerbsbetriebe 2 433 Milchkühe 1 6.734<br />
Mutterkühe 1.754<br />
Ackerland 1 6.378 ha Nebenerwerbsbetriebe 2 207 Schweine 1 9.730<br />
Dauergrünland 1 11.124 ha Unternehmenszusammenschlüsse<br />
2 Pferde<br />
24<br />
1 1.686<br />
Wald 35.148 ha Öko-Betriebe 2 24 Schafe 1 5.044<br />
1] Statistisches Landesamt Mai 2007<br />
2] ALR-Erhebungen Mai 2007<br />
Die durchschnittliche Betriebsgröße im <strong>Odenwaldkreis</strong> liegt bei 26,4 ha 1, 2 (21,4 ha im Jahr<br />
1999 1 ).<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> zählt mit einem Anteil von 56 % zu den waldreichsten Gebieten in Hessen.<br />
Nur 28 % der Fläche im <strong>Odenwaldkreis</strong> wird landwirtschaftlich genutzt. Der Landkreis ist<br />
heute geprägt von der Grünlandnutzung mit 64 % der landwirtschaftlichen Fläche. Der<br />
Dauergrünlandanteil beträgt in den Gemeinden am Nordrand 30-40 %, in den südlichen<br />
Oberzent-Gemeinden 70-90 %.<br />
Der Ackerbau wird ebenfalls durch die Mittelgebirgslage geprägt und dient zu einem großen<br />
Teil der Viehhaltung, d. h. für Futterpflanzen, insbesondere Silomais. Weitere wichtige Feldfrüchte<br />
sind Winterweizen, Wintergerste, Raps, Triticale und Hafer.<br />
Aufgrund des hohen Grünlandanteiles und der Topographie des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sind der<br />
Energieerzeugung durch Biomasse zwar Grenzen gesetzt, so dass die Nahrungsmittelproduktion<br />
auch weiterhin der Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Nutzung bleiben wird, dennoch<br />
ist das vorhandene Potenzial der Biomassennutzung bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.<br />
Der Braugerstenanbau spielte in der Vergangenheit für die regionale Bierproduktion bereits<br />
eine wichtige Rolle. Zurzeit wird an neuen Konzepten gearbeitet, um den Braugerstenanbau<br />
zu forcieren.<br />
Raps bestimmt im Frühsommer das Landschaftsbild in den wenigen Gunstlagen des nördlichen<br />
Kreisgebietes, wo auch Zuckerrüben- und Kartoffeln zu finden sind.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind 946 Personen in der Landwirtschaft tätig. Die Betriebe sind überwiegend<br />
als Familienbetrieb organisiert.<br />
Der landwirtschaftlichen Nutzung im <strong>Odenwaldkreis</strong> gingen zwischen 1999 und 2003 jährlich<br />
38 ha durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen verloren. Dies entspricht einem jährlichen<br />
Flächenverlust von etwa 1,5 Betrieben. Zwischen 2003 und 2007 trat ein Verlust an landwirtschaftlicher<br />
Fläche von 19,8 ha auf. Insoweit ist eine Reduzierung des Flächenverbrauchs zu<br />
verzeichnen.<br />
50
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die prozentuale Verteilung bei den Haupterwerbs- (34 %) und Nebenerwerbsbetrieben (66<br />
%) ist seit Jahren konstant. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe wird weiter abnehmen.<br />
Es ist zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren ein Großteil von Flächen der Nebenerwerbsbetriebe<br />
von der nachfolgenden Generation nicht mehr bewirtschaftet wird. Die<br />
Haupterwerbsbetriebe werden nur einen Teil dieser Flächen aufnehmen können. Damit ist<br />
die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft in weiterer Zukunft punktuell gefährdet.<br />
Unter den Nebenerwerbsbetrieben finden sich zum einen intensiv wirtschaftende Betriebe,<br />
aber auch Kleinstbetriebe, insbesondere in der Pferde- und Schafhaltung.<br />
Die Milchviehhaltung genießt Vorrang auf den landwirtschaftlichen Flächen. Einige Betriebe<br />
setzten schon früh auf Diversifizierung: Direktvermarktung, Hofläden, Bauernmärkte, Urlaub<br />
auf dem Bauernhof, Spielscheune, Bauernhofcafé, Hofkäserei, Heuhotel, Pensionspferdehaltung,<br />
Reiterhof, Biogasanlage, Fischzucht, Obstkelterei.<br />
Die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft in der reich strukturierten und abwechslungsreichen<br />
Mittelgebirgslage bildet einen zusätzlichen Nutzen durch die Landwirtschaft für die<br />
Region. Einen erheblichen Anteil zur Erhaltung der Kulturlandschaft hatten dabei die Ausgleichsmaßnahmen<br />
für benachteiligte Gebiete (AGZ 26 ) das Hessische Kulturlandschaftprogramm<br />
(HEKUL 27 ) und das Hessische Landschaftspflegeprogramm (HELP), weil<br />
sie einen Ausgleich für natürliche Standortnachteile und umweltfreundliche und nachhaltige<br />
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen fördern. Das Nachfolgeprogramm HIAP 28 stellt<br />
weniger Mittel mit einer Verschärfung der Förderbedingungen zur Verfügung (siehe Agrarumweltprogramme).<br />
Investitionen im Agrarbereich<br />
Mit Beginn der neuen Förderperiode 2007-2013 ist ein starker Anstieg der Investitionen im<br />
Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung (EFP) für Wirtschaftsgebäude und nutzungsspezifische<br />
Technik zu verzeichnen. Allein im Jahr 2007 wurden von den Betrieben 1,5 Mio. € in<br />
Wirtschaftsgebäude (meist Milchviehställe) investiert. Hierfür wurden Zuschüsse in Höhe von<br />
400.000 € gezahlt. Diese Zahlen werden im laufenden Jahr 2008 jedoch um ein Vielfaches<br />
überschritten (geschätzt: mehr als 5 Mio. € Investitionen in Wirtschaftsgebäude – Milchvieh-,<br />
Mutterkuh- und Schweineställe). Durch eine Priorisierung bei der Zuteilung der Fördermittel<br />
konnten in 2007 und 2008 keine landwirtschaftlichen Maschinen- und Mehrzweckhallen<br />
ebenso wie Investitionen im Bereich der Pferdehaltung bezuschusst werden.<br />
Bei allen baulichen Investitionen in der Landwirtschaft hat die Standortsuche höchste Priorität.<br />
Um Konflikten mit naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Belangen (Landschaftsbild,<br />
Biotopschutz, Abstandsregelung) vorzubeugen, werden behörden-übergreifende<br />
scoping-Termine frühzeitig durchgeführt. Im Regelfall kann so eine Einigung mit den Bauherren<br />
unter Beachtung der Einfügung der Baumaßnahme in das Landschaftsbild erzielt werden.<br />
Milchproduktion im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Die Mittelgebirgslage und damit der hohe Grünlandanteil erzwingen die Verwertung über die<br />
Milch- und Rindfleischproduktion. Darüber hinaus trägt die Milchviehhaltung wesentlich zur<br />
Erhaltung der Kulturlandschaft bei und erhöht die Attraktivität als Naherholungs- und Ferienregion.<br />
26<br />
Ausgleichszulage<br />
27<br />
Hessisches Kulturlandschaftsprogramm, HEKUL-Richtlinien vom 10. Dezember 2004 (StAnz.<br />
52/2004, S. 3902)<br />
28<br />
Hessiches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)<br />
51
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Milchproduktion<br />
2007 im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
40.053 Tonnen 1<br />
Veränderung<br />
2006/2007<br />
+ 0,24 % 1<br />
52<br />
Anzahl<br />
Milcherzeuger<br />
165 1<br />
Milchabnehmer<br />
Molkerei Hüttenthal<br />
Schwälbchen Molkerei<br />
Hochwald-Erbeskopf-<br />
Eifelperle e.G.<br />
Die Milchproduktion ist im Vergleich zu anderen südhessischen Kreisen, die sich aus der<br />
Milchproduktion zunehmend verabschieden, im Odenwald stabil.<br />
Es werden zwei große überregionale Molkereien und eine regionale Molkerei beliefert.<br />
Die Odenwälder Milcherzeuger profitierten 2007 von höheren Auszahlungspreisen der Molkereien.<br />
Steigende Energie- (um 20 %) und Produktionskosten (Düngemittel um knapp 70<br />
%) und wieder fallende Milchpreise verschärfen seit Anfang 2008 jedoch weiter die Einkommenssituation<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe.<br />
Der Verkauf über die Milchbörse und die Übertragung von Milchquoten wird vom Amt für den<br />
ländlichen Raum (ALR) in Reichelsheim (Odenwald) abgewickelt. Durch Beratung der Milcherzeuger<br />
wird das Ziel verfolgt, die Milchquote im Odenwald zu halten und einer Abwanderung<br />
entgegenzuwirken. Die Existenz vieler Milchproduzenten, die in den letzten Jahren in<br />
die Milchproduktion investiert haben, ist durch die geplante Abschaffung der Milchquoten<br />
2015 und die schwankenden Milchpreise gefährdet. Für die Milchwirtschaft des Odenwalds<br />
sind begleitende Maßnahmen zum Quotenausstieg von Seiten der EU bzw. des Bundes von<br />
existenzieller Bedeutung.<br />
Mutterkuhhaltung im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Neben der intensiv betriebenen und nur so konkurrenzfähigen Milchproduktion hat die extensive<br />
Mutterkuhhaltung einen großen Stellenwert und gehört zum typischen Landschaftsbild<br />
der Odenwälder Kulturlandschaft. Wo Grünlandflächen wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit<br />
nicht so ertragreich sind, grasen fast ganzjährig Mutterkuhherden auf den Weiden.<br />
Mutter- oder Ammenkühe, Kälber und heranwachsende Jungrinder werden hier gemeinsam<br />
gehalten und es erfolgt keine oder nur eine reduzierte Düngung der Flächen. Diese naturgerechte<br />
Wirtschaftsweise wird mit den Förderprogrammen HELP und HEKUL bzw. seit 2007<br />
mit HIAP gefördert.<br />
Agrarförderung<br />
EU- Förderprogramme unterstützten die Wettbewerbsfähigkeit und den Strukturwandel in der<br />
Landwirtschaft; sie sollen Nachteile der globalisierten Märkte abfangen und eine umweltverträgliche<br />
Landwirtschaft forcieren.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> werden die folgenden Direktzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe<br />
durch das ALR bewilligt.<br />
Förderprogramm Antragsteller/ Anträge 2 Auszahlungsbeträge 2007/Mio 2<br />
Betriebsprämie 664 5,06 €<br />
AGZ 494 0,85 €<br />
HEKUL 94 0,23 €<br />
HIAP Öko 24 0,08 €<br />
Summe 1.276 6,22 €<br />
Im Durchschnitt wurden im Jahr 2007 4.474 € / Antragsteller und Betrieb bewilligt.
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> im Ranking bei der Betriebsprämienzahlung<br />
Eine Auswertung der hessischen Betriebsprämienzahlungen hat gezeigt, dass Landkreise<br />
mit einem hohen Grünlandanteil in Hessen Schlusslicht sind. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> gehört<br />
dazu. Der durchschnittliche Betriebsprämienbetrag pro Betrieb ist in Ackerbauregionen fast<br />
doppelt so hoch wie in Grünlandregionen. Hinzu kommt, dass die Ackerbauregionen von den<br />
steigenden Preisen für Getreide zusätzlich profitieren. Die Förderprogramme AGZ, HEKUL,<br />
HELP und HIAP konnten die Standortnachteile und die Benachteiligung bei der Betriebsprämie<br />
bisher nicht ausgleichen. Bis zum Jahr 2013 ist zwar eine Angleichung für Ackerbauflächen<br />
und Grünlandflächen vorgesehen, die Grünlandregionen werden die Benachteilungen<br />
aus den Jahren 2005 bis 2013 nicht mehr aufholen können. EU, Bund und Land müssen<br />
dringend handeln.<br />
Benachteiligtes Gebiet <strong>Odenwaldkreis</strong> und Ausgleichszulage<br />
Die Ausgleichszulage (AGZ) für benachteiligte Regionen soll Anreize geben, dass auf<br />
Grenzstandorten im <strong>Odenwaldkreis</strong> weiterhin landwirtschaftliche Flächen in Bewirtschaftung<br />
gehalten werden. Dazu gehört u. a. die Offenhaltung von Tälern durch Bewirtschaftung,<br />
Pflege und Erhaltung von Grünland, von Streuobstflächen (der Odenwald ist Streuobstregion)<br />
und den Erhalt von Ackerflächen, wo es sich anbietet. Aufgrund mangelnder anderer<br />
Erwerbsalternativen, trägt AGZ zur Einkommenssicherung der Landwirtschaft in benachteiligten<br />
Regionen wie dem <strong>Odenwaldkreis</strong> bei. Durch die teilweise Kürzung der Fördersumme<br />
in den letzten Jahren hat sich die Einkommenssituation für die landwirtschaftlichen Betriebe<br />
in den benachteiligten Regionen so auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> verschlechtert. Ein weiteres<br />
Problem ist, dass die jährliche Höhe der Ausgleichszulage je nach Haushaltslage des Landes<br />
schwankt. Ein stabiler Betrag mit geringen Schwankungen würde die Planungssicherheit<br />
für landwirtschaftliche Betriebe erhöhen. Die Landesregierung hat versichert, dass die Ausgleichszulage<br />
bis zum Jahr 2013 als Förderprogramm Bestand hat.<br />
Beratung und Weiterbildung für die Landwirtschaft und interessierte Bürger<br />
Landwirtschaftliche Betriebe mit gut ausgebildeten Betriebsleitern und Hofnachfolgern haben<br />
gute Entwicklungschancen. Im Schuljahr 2007/2008 besuchen zwei Schüler aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
die Landwirtschaftliche Fachschule in Griesheim.<br />
Das Amt für den ländlichen Raum ist bemüht, den landwirtschaftlichen Betrieben Beratungs-<br />
und Weiterbildungsmöglichkeiten an seinem Standort Reichelsheim zu bieten. In enger Zusammenarbeit<br />
mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), der in Hessen für die<br />
Beratung der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betriebe zuständig ist, dem Regionalbauernverband<br />
Starkenburg, dem Landfrauenverband, den Odenwälder Direktvermarktern,<br />
dem Verband für landwirtschaftliche Fortbildung und den Obst- und Gartenbauvereinen werden<br />
mit Erfolg folgende Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten:<br />
• Ausbildung zur Agrarbürofachfrau<br />
• Schulungen für Nebenerwerbslandwirte<br />
• Ausbildung zum Fachwart im Obstbau<br />
• Arbeitskreise für Landwirte/Energiewirt, Milchviehhalter, Odenwälder Fleischrinderhalter,<br />
für Direktvermarkter, Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof und Bauernhofcafés<br />
• ein jährlicher Informationstag für Milcherzeuger<br />
• Mitwirkung beim Beerfelder Pferdemarkt<br />
• Informationsstände beim Odenwälder Bauernmarkt und beim Michelsmarkt in Reichelsheim<br />
(Odenwald).<br />
Der Landesbetrieb Landwirtschaft (LLH) hat eine Beratungsstelle in Reichelsheim (Odenwald)<br />
mit Pflanzenproduktion- und Pflanzenschutzberatung, Tierproduktionsberatung, Pferdehaltungsberatung<br />
und betriebswirtschaftlicher Beratung. Der Regionalbauernverband<br />
Starkenburg hat seinen Odenwälder Standort mit Beratungszeiten im Amt für den ländlichen<br />
Raum in Reichelsheim (Odenwald).<br />
53
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
3.2. Regional- und Direktvermarktung<br />
Odenwälder Bauernmarkt<br />
Besonders die Nähe zu den Ballungszentren Rhein-Main und Rhein-Neckar einerseits wie die<br />
wirtschaftliche Notwendigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe andererseits haben schon seit<br />
den 70er Jahren dazu geführt, dass zusätzliche Standbeine in den Höfen aufgebaut werden<br />
mussten, um das Überleben zu sichern. So ist die landwirtschaftliche Direktvermarktung und<br />
damit der Verkauf von selbst erzeugten Produkten ab Hof oder auf dem Wochenmarkt zu<br />
einem wirtschaftlich bedeutsamen Standbein für viele Betriebe geworden.<br />
Seit 1989 gibt es einmal jährlich am zweiten Wochenende im Oktober den organisierten<br />
Bauernmarkt in der Kreisstadt Erbach, wo an drei Tagen (Freitag bis Sonntag) an über 30<br />
Ständen frische Naturprodukte und veredelte Waren direkt vom Erzeuger angeboten werden.<br />
Nähere Informationen findet man unter dem Link www.odenwaelder-bauernmarkt.de.<br />
Die Gemeinschaft der Odenwälder Direktvermarkter (www.odenwaelder-direktvermarkter.de)<br />
macht so mit ihrer Produktvielfalt auf sich aufmerksam. Der Odenwälder Bauernmarkt ist<br />
längst zu einer festen und attraktiven Einrichtung im Veranstaltungskalender für die Region<br />
geworden. Wie jedes Jahr werden mehrere tausend Besucher in den Erbacher Markthallen an<br />
der Pferderennbahn erwartet.<br />
Das ALR unterstützt die Odenwälder Direktvermarkter jedes Jahr mit einem Stand zu einem<br />
speziellen Fachthema wie z. B. „Grüne Energie aus Feld und Wald“ und organisiert Fortbildungsveranstaltungen.<br />
Es ist geplant, den Markt einer Stärken-Schwächen-Analyse durch ein<br />
unabhängiges Beratungsinstitut zu unterziehen. Die Besucherzahlen sollen erhalten und evtl.<br />
noch gesteigert werden, um so einen Beitrag zur Stärkung der Landwirtschaft / Direktvermarktung<br />
in der strukturschwachen Region zu leisten.<br />
Workshop Regionale Vermarktung<br />
Seit Anfang 2006 ist am ALR in Reichelsheim (Odenwald) der Workshop „Regionale Vermarktung“<br />
installiert. Ziel ist es, (noch) mehr und weitere Chancen für die regionale Vermarktung<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> und der Region aufzuspüren.<br />
Der Teilnehmerkreis des Workshops setzt sich wie folgt zusammen:<br />
• Gemeinschaft der Odenwälder Direktvermarkter<br />
• Odenwälder Bioprodukte<br />
• Interessengemeinschaft der Odenwälder Fleischrinderhalter<br />
• Imker im Odenwald<br />
• Schäferverein Odenwald<br />
• Verein Odenwälder Regionalprodukte e. V.<br />
• Gastronomen der Odenwaldgasthäuser<br />
• Odenwald Tourismus GmbH<br />
• Touristik Service Odenwald<br />
• Bauernhof und Landurlaub<br />
• Molkerei Hüttenthal<br />
• LANDMARKT<br />
• GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald<br />
• OREG und<br />
• Apfelwein- und Obstwiesenroute.<br />
54<br />
Logo der Apfelwein-<br />
und Obstwiesenroute<br />
Ein Teilziel ist die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der genannten Organisationen/Einrichtungen.<br />
Dem ALR obliegt die Aufgabe, die Akteure in der Region zusammenzuführen<br />
sowie die einzelnen Aktivitäten im Bereich der regionalen Vermarktung zu bündeln. So ist<br />
als erste gemeinsame Arbeit die Broschüre „Lust auf Odenwald“ entstanden, die aufgrund der
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
großen Nachfrage nach einem Jahr bereits nachgedruckt werden muss. Die Mitglieder des<br />
Workshops erwägen die Einführung eines Qualitäts-Sigi als Regionalmarke. Die Verwendung<br />
desselben soll auf bereits bestehende Siegel (z. B. Bio, Gutes aus Hessen, …) oder auf der<br />
Basis einer besonderen anerkannten Qualitätsauszeichnung (z. B. Odenwälder Frühstückskäse)<br />
erfolgen.<br />
In der Arbeitsgruppe wurde ein „Qualitätsausschuss“ geschaffen und Kriterien für die Vergabe<br />
der Regionalmarke „Odenwald“ erarbeitet. Verschiedene Unternehmen haben bereits<br />
Anträge auf die Nutzung der Regionalmarke für ausgewählte regionale Produkte gestellt. Die<br />
Odenwald Tourismus GmbH übernimmt die zukünftige Vermarktung der regionalen Produkte<br />
auch über die Grenzen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es hinaus. Sie wird dabei weiterhin vom Qualitätsausschuss<br />
begleitet, der die Einhaltung der erarbeiteten Kriterien überwacht und über die<br />
Vergabe der Regionalmarke an die einzelnen Antragsteller entscheidet.<br />
Ferner finden regelmäßig im Odenwald kulinarischen Veranstaltungen statt, die in großem<br />
Maße der Vermarktung regionaler Produkte dienen, wie die „Odenwälder Kartoffelwochen“,<br />
die „Odenwälder Lammwochen“ oder die „Wildwochen“. Diese Aktionswochen werden gemeinsam<br />
vom Hotel- und Gaststättenverband und den Odenwald Gasthäusern durchgeführt<br />
und machen Odenwälder Produkte und Spezialitäten einem breiten Publikum bekannt.<br />
Schlachthof Brensbach<br />
Seit 1997 ist der regionale Schlachthof in Brensbach in Betrieb. Das Einzugsgebiet für Großvieh<br />
ist der Raum Starkenburg, bei Schweinen kommen zusätzlich 20 % aus dem benachbarten<br />
Baden-Württemberg (Badischer Odenwald). Es werden wöchentlich 600-700 Schweine<br />
und 70 Stück Großvieh geschlachtet. Aus dem Einzugsgebiet Starkenburg schlachten zurzeit<br />
ca. 30 Metzger und ca. 30 Direktvermarkter in Brensbach.<br />
Landmarkt<br />
Seit Oktober 2004 haben sich acht Betriebe im Odenwald diesem Zeichen<br />
der Hessischen Direktvermarkter angeschlossen. Die Betriebe unterziehen<br />
sich einer unabhängigen Kontrolle; sie verpflichten sich, nur selbst hergestellte<br />
Produkte unter dem Landmarkt Logo anzubieten. Die Produkte werden<br />
zusätzlich über den Einzelhandel (EDEKA in Reichelsheim (Odenwald)<br />
und Mörlenbach sowie REWE in Höchst i. Odw.) abgesetzt. Die<br />
Kunden schätzen die Präsenz der regionalen Produkte im Supermarkt. Das zusätzliche Angebot<br />
heimischer Produkte lockt viele Neukunden in die Landmarkt-Supermärkte.<br />
Bauernhof als Klassenzimmer<br />
Es gibt viel zu sehen, zu entdecken und zu lernen auf den 20 ausgewählten landwirtschaftlichen<br />
Betrieben aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong>. Bei der Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer"<br />
werden Themen rund um den Bauernhof vermittelt (Milcherzeugung, Getreidebau, Biogasanlagen,<br />
Schweinehaltung oder Apfelverarbeitung), angesprochen und die Beziehungen der<br />
Landwirtschaft zu unserer Umwelt altersgerecht vermittelt. Dieser verstärkte Dialog ist ein<br />
wichtiges Anliegen der Initiative. Das Angebot richtet sich überwiegend an Kindergärten und<br />
Schulen.<br />
Zurzeit wird die Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ dahingehend ausgeweitet, dass<br />
Patenschaften zwischen Schulen und den Betrieben entstehen. Mehrere Betriebsbesuche im<br />
Jahr sollen den Schülern einen Einblick in die Landwirtschaft zu verschiedenen Jahreszeiten<br />
ermöglichen.<br />
55
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Gefördert wird die komplette Initiative, die bereits erfolgreich seit 2001 läuft, vom Kreisausschuss<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es. Das ALR ist Ansprechpartner und Vermittler zwischen den<br />
Betrieben und den Schulen, nicht nur des <strong>Odenwaldkreis</strong>es. Zurzeit wird die allgemeine Broschüre<br />
„Bauernhof als Klassenzimmer“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz überarbeitet und neu aufgelegt. Aktuelle Informationen sind auf<br />
der Internetseite www.bauernhof-als-klassenzimmer.hessen.de zu entnehmen.<br />
Keilvelter Hof<br />
Der im Reichelsheimer Ortteil Unter-Ostern gelegene Keilvelter Hof wurde<br />
von der Museumsstraße Odenwald-Bergstraße e. V. 1998 erworben und<br />
fand 1640 zum ersten Mal urkundliche Erwähnung. 2003 wurde die Odenwald-Regionalgesellschaft<br />
(OREG mbH) vom Verein mit der Geschäftsbesorgung<br />
für den Hof beauftragt. Als Museum stellt der Keilvelter Hof inzwischen<br />
die Entwicklung der Landwirtschaft im Odenwald sehr anschaulich<br />
dar und vermittelt dies auch an zukünftige Generationen. Er ist ferner fester<br />
Bestandteil des touristischen Konzeps des UNESCO-Georparks Odenwald-<br />
Bergstraße.<br />
56<br />
Logo des Vereins<br />
Museumsstraße<br />
Odenwald-Bergstraße<br />
e. V.<br />
Auf dem denkmalgeschützten Keilvelterhof werden darüber hinaus Projekte der Jugendberufshilfe<br />
für arbeitslose Jugendliche erfolgreich durchgeführt. Der berufsvorbereitende<br />
Prozess mündet in der Regel in ein Ausbildungsverhältnis.
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
3.3. Landwirtschaft und Landschaftspflege<br />
Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes<br />
Vertragsnaturschutz hat sich seit 1989 neben dem hoheitlichen Naturschutz zu einem wichtigen<br />
Instrument des Naturschutzes entwickelt. Für den Naturschutz wertvolle Flächen in der<br />
Kulturlandschaft sind überwiegend auf eine regelmäßige landwirtschaftliche Nutzung angewiesen.<br />
Die angepasste naturgerechte Nutzung von artenreichen Grünlandbeständen und<br />
Streuobstwiesen wird als besondere Leistung honoriert.<br />
Bis Ende 2009 gibt es drei Förderprogramme mit ähnlichen, sich ergänzenden Zielsetzungen<br />
nebeneinander:<br />
• Hessisches Landschaftspflegeprogramm HELP und<br />
• Hessisches Kulturlandschaftsprogramm HEKUL 29 und als Fortsetzung bis 2013<br />
• Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm HIAP 30 .<br />
HELP und HEKUL im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Auf dem Höhepunkt der Förderung waren im <strong>Odenwaldkreis</strong> im Jahr 2006 rund 52 % der<br />
Grünlandfläche in extensiver, naturgerechter Nutzung. Rund 1.500 ha wurden ohne Düngung<br />
und Pflanzenschutzmittel nach HELP-Vorgaben und rund 3.500 ha mit eingeschränkter<br />
Tierhaltung und reduzierter Düngung (max. 60 kg Stickstoff pro ha) bewirtschaftet.<br />
29<br />
Hessisches Kulturlandschaftsprogramm, HEKUL-Richtlinien vom 10. Dezember 2004 (StAnz.<br />
52/2004, S. 3902)<br />
30<br />
Hessiches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)<br />
57
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Mit Einführung des Nachfolgeprogrammes HIAP, das ähnliche Anforderungen hat wie HELP<br />
(keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel), können HEKUL-Betriebe, die bisher mit ihrer<br />
gesamten Betriebsfläche in der Extensivierung waren, nur für einen Teil der Flächen die<br />
HIAP-Bewirtschaftung und Förderung vereinbaren. Es kommen nur noch Flächen in Frage,<br />
die in der prioritären Förderkulisse des Regionalen Agrarumweltkonzeptes, der Fortschreibung<br />
des Regionalen Landschaftspflegekonzeptes, liegen und auf denen keine Dünge- und<br />
Pflanzenschutzmittel angewendet werden.<br />
Hektar<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Gesamtfläche HELP- und HIAP-Grünland im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong><br />
99<br />
188 206<br />
252<br />
309<br />
357<br />
687<br />
58<br />
1063<br />
1343<br />
1450 1489 1498 1488<br />
1552<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)<br />
Mit diesem Programm soll für landwirtschaftliche Unternehmen ein Anreiz geschaffen werden,<br />
sich zu Produktionsverfahren zu verpflichten, die in besonderem Maße auf den Schutz<br />
der Umwelt und der Erhaltung des ländlichen Lebensraumes ausgerichtet sind. Der Vertragszeitraum<br />
umfasst fünf Jahre.<br />
Das „Hessische Integrierte Agrarumweltprogramm" beinhaltet folgende Förderprogramme:<br />
• Ökologischer Landbau<br />
• Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten<br />
• Anlage von Blühflächen oder Schonstreifen<br />
• Pheromoneinsatz im Weinbau<br />
• Standortangepasste Grünlandextensivierung<br />
• Besondere Lebensräume und Habitate<br />
• Weinbau in Steillagen<br />
Von den angebotenen Fördervarianten gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong> nur für den Bereich „Ökologischer<br />
Landbau“ und „Standortangepasste Grünlandextensivierung“ Interesse und Nachfrage<br />
seitens der Landwirtschaft. Das Modul „Besondere Lebensräume“ ist auf Maßnahmen<br />
in Natura 2000-Gebieten sowie Habitaten bestimmter nach der Natura 2000-Richtlinie geschützten<br />
Arten ausgerichtet, so dass wegen des geringen Flächenpotenzials (im Offenland,<br />
siehe hierzu auch Kapitel Natura 2000) nicht mit größeren Förderbeträgen zu rechnen ist. Im<br />
Jahr 2008 stehen erstmals rund 20.000 € zur Verfügung.<br />
1697
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Fördermittel für Agrarumweltmaßnahmen<br />
Das Budget (HELP, HEKUL, HIAP) für 2007 liegt bei rund 400.000 €. Die Schätzungen für<br />
die Nachfolgejahre lassen noch eine Steigerung erwarten. Allerdings wird das ursprüngliche<br />
Niveau von über 800.000 bis knapp 1 Mio. € nicht wieder erreicht werden, da mit dem neuen<br />
HIAP eine Kürzung von 30 % der Mittel für Agrarumweltmaßnahmen in Hessen einherging.<br />
800000,00<br />
700000,00<br />
600000,00<br />
500000,00<br />
400000,00<br />
300000,00<br />
200000,00<br />
100000,00<br />
0,00<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Fördermittel für Agrarumweltmaßnahmen<br />
59<br />
HELP HeKul_Ökol. Landbau<br />
HeKul_Grünlandextensivierung HIAPOR06<br />
HIAPGR06 incl. NSL HIAPOR07<br />
HIAPGR07 incl. NSL HIAPOR08-13<br />
HIAPGR08-13 HIAPOR09-13<br />
HIAPGR09-13 HIAPOR10-13<br />
HIAPGR10-13 HIAPOR11-13<br />
HIAPGR11-13
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
3.4. Dorf- und Regionalentwicklung<br />
Dorferneuerungsschwerpunkte im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Gumpen<br />
Wersau<br />
Fränkisch-<br />
Crumbach<br />
Ober-<br />
Ostern<br />
Unter-<br />
Ostern<br />
Laufende Verfahren DE<br />
Abgeschlossene Verfahren DE<br />
Einfache Stadterneuerung<br />
Brensbach<br />
Erzbach<br />
Nieder<br />
-kainsbach <br />
Höllerbach<br />
Aff-<br />
höllerbach<br />
Mossautal<br />
Ober-<br />
Hiltersklingen<br />
Güttersbach<br />
Olfen<br />
Raubach<br />
Finkenbach<br />
PfirschHassenbachrothHummetAnnelsrothbach<br />
Forstel<br />
Wallbach<br />
Ober-Kinzig<br />
Birkert<br />
BöllKirchstein Brombach<br />
Ger-<br />
Brombachtal<br />
sprenzHem-<br />
Eberbach<br />
bach Langen-<br />
Pfaffen-<br />
Laudenau<br />
Ober-<br />
Brombach<br />
Beerfurth<br />
Kainsbach<br />
Reichels- Kirch-<br />
Klein-<br />
Beerfurth<br />
heim<br />
Gumpen Frohn-<br />
Bockenrod<br />
hofen<br />
Rehbach<br />
Rohrbach<br />
Unter-<br />
Hiltersklingen<br />
Ober-Mossau<br />
Unter-<br />
Mossau<br />
Hüttenthal<br />
Airlenbach<br />
Falken-<br />
Gesäß<br />
Rothenberg<br />
Steinbuch<br />
Etzean<br />
60<br />
HetschbachDusenbach<br />
Höchst<br />
Etzen-Gesäß Fürstengrund<br />
Nieder-<br />
Kinzig<br />
Erbach<br />
Haisterbach<br />
Michelstadt<br />
Dorf-<br />
Erbach<br />
Stand: August 2008<br />
Lützelbach<br />
Beerfelden<br />
Ober-<br />
Schöllenbach<br />
Sensbach<br />
Hesseneck<br />
Sensbachtal<br />
Gammelsbach<br />
Mümling-<br />
Grumbach<br />
Zell<br />
Steinbach<br />
Ebersberg<br />
Hetzbach<br />
Sandbach<br />
Unter-<br />
Sensbach<br />
Hebstahl<br />
Hainstadt<br />
Neustadt<br />
Breuberg<br />
Rimhorn<br />
Bad König<br />
Momart<br />
Stockheim<br />
Bullau<br />
Rai-<br />
Breitenbach<br />
Breitenbrunn<br />
Weiten-<br />
Gesaß<br />
Elsbach<br />
LauerErlenbachbach<br />
Erbuch<br />
Günterfürst<br />
Schönnen<br />
Wald-<br />
Amorbach<br />
Lützel-<br />
Wiebelsbach<br />
Kimbach<br />
Ernsbach<br />
Würzberg<br />
Hesselbach<br />
Kailbach<br />
Seckmauern<br />
Haingrund<br />
Vielbrunn
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Dorferneuerung<br />
Der Odenwald hat eine sehr differenzierte Dorfstruktur. Abhängig von Gründungszeit und<br />
wirtschaftlicher und politischer Funktion gibt es zum einen die Straßendörfer der alten Waldhubensiedlungen<br />
und zum anderen Weiler und Haufendörfer mit zentralen Funktionen, etwa<br />
als Standort der Hauptkirche eines Kirchspiels. Neben den Baudenkmalen der feudalen<br />
Kultur bergen die Dörfer eine Fülle schützenswerter Gebäude.<br />
Ziel der ländlichen Entwicklung ist es, das historische Potenzial des ländlichen Raumes zu<br />
erhalten und die Ortskerne auch unter den Aspekten des demographischen Wandels zu<br />
attraktiven Lebensräumen zu entwickeln. In enger Abstimmung mit den Ortsbürgern wird<br />
dazu ein Dorfentwicklungskonzept erstellt, in dem im wesentlichen Aussagen zur künftigen<br />
Nutzung der Gemeinbedarfseinrichtungen gemacht werden.<br />
Regelmäßig sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> neun Dörfer für einen Zeitraum von neun Jahren als<br />
Dorferneuerungsschwerpunkt anerkannt. Sowohl private als auch kommunale Maßnahmen<br />
können gefördert werden. Im Jahr 2007 wurden hierfür insgesamt 955.120,-- € an Zuschuss<br />
ausgezahlt. Grundlage für diese Aufgabe der Abteilung Dorf- und Regionalentwicklung ist<br />
das „Programm und die Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen“.<br />
Regionalentwicklung<br />
Im Bereich Regionalentwicklung konnten im Jahr 2007 Zuschüsse in Höhe von 59.922,-- €<br />
ausgezahlt werden. Der gesamte <strong>Odenwaldkreis</strong> ist wesentlicher Teil der im Rahmen des<br />
europäischen ELER 31 -Programms (vormals LEADER 32 und LEADER+) anerkannten<br />
Entwicklungsregion Odenwald. Für die Anerkennung als Entwicklungsregion hat der Odenwald,<br />
d. h. die im Odenwald gelegenen Kommunen des Kreises Bergstrasse, drei Kommunen<br />
aus Darmstadt-Dieburg und der <strong>Odenwaldkreis</strong>, ein umfangreiches Entwicklungskonzept<br />
vorgelegt. Gemäß dem erarbeiteten Leitbild „Der Odenwald – die landschaftlich und kulturell<br />
attraktivste und ökologisch intakte Region mit klarem Qualitätsprofil in Rhein-Main-Neckar“<br />
(REKO) wurde als strategisches Oberziel formuliert „Der Odenwald – die Qualitätsregion in<br />
Rhein-Main-Neckar“. Maßnahmen, die den daraus abgeleiteten Teilzielen dienen, können im<br />
Rahmen des ELER-Programms gefördert werden. Aber auch weitere unterstützende<br />
Programme können hierfür herangezogen werden (EFRE 33 ). Die<br />
Aufgabe der Leitung der Regionalen Entwicklungsgruppe obliegt der Interessengemeinschaft<br />
Odenwald e. V. (IGO). Hier wurde ein Förderausschuss<br />
eingerichtet, der über Zielkonformität und Priorität vorgelegter Förder-anträge<br />
entscheidet.<br />
Dorfwettbewerb<br />
Die besondere Bindung der Bürger an ihre Gemeinde und an die Region wird auch in der<br />
Teilnahme an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ deutlich. Neben dem Erhalt der<br />
regionaltypischen baulichen Dorfelemente werden hier Beispiele gelungenen Zusammenlebens<br />
vorgestellt. Das Dorf als aktives Sozialwesen macht eine der Stärken des ländlichen<br />
Raumes aus. Aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong> beteiligen sich vier Ortschaften an der Wettbewerbsrunde<br />
2008 – 2010 (die Breuberger Stadtteile Rai-Breitenbach und Wald-Amorbach sowie<br />
die Erbacher Stadtteile Bullau und Ebersberg).<br />
Urlaub auf dem Bauernhof<br />
In jahrzehntelanger Arbeit wurde ein qualitativ hochwertiges Angebot für Urlauber, „die Lust<br />
auf das Land“ haben, erarbeitet. Frühzeitig wurden Veränderungen in der Besucherzusammensetzung<br />
und deren Erwartungen an einen attraktiven Aufenthalt aufgegriffen und neue<br />
31 ELER = Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes<br />
32 LEADER = (frz.) Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, dt.: Verbindung zwischen<br />
Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft<br />
33 EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung<br />
61
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Angebote entwickelt. Erfolgreiche Betriebe weisen Belegungszahlen von über 200 Tagen pro<br />
Jahr auf. Damit stellt der Bauernhof- und Landurlaub mit seinen über die Jahre konstanten<br />
Übernachtungszahlen eine feste Größe innerhalb der Odenwälder Touristik dar.<br />
Der Touristik Service Odenwald-Bergstraße e. V. bringt jährlich eine Broschüre „Urlaub auf<br />
dem Bauernhof“ heraus, in der entsprechende Angebote aus dem <strong>Odenwaldkreis</strong> dargestellt<br />
sind. Diese Broschüre wird auf Reisemessen verteilt und auf Anfrage an interessierte Gäste<br />
verschickt.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Amt für den ländlichen Raum (ALR) des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in Reichelsheim (Odenwald)<br />
• Arbeitsgruppe „Regionalmarke Odenwald“<br />
• Workshop „Regionale Vermarktung“<br />
• Odenwald Tourismus GmbH<br />
• landwirtschaftliche Betriebe<br />
• Interessengemeinschaft Odenwald e. V. (IGO)<br />
62
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
3.5. Ziele/Entwicklungen<br />
Die Direktzahlungen der Europäischen Union an die landwirtschaftlichen Betriebe machen<br />
inzwischen den größten Teil der EU-Agrarausgaben aus. Im <strong>Odenwaldkreis</strong> bilden sie ca.<br />
50 % des landwirtschaftlichen Einkommens. Damit zeichnet sich eine hohe Abhängigkeit der<br />
wirtschaftlichen Situation der Betriebe von Beschlüssen im „fernen Brüssel“ ab. Unter sich<br />
immer wieder verändernden Rahmenbedingungen die klare Linie für den eigenen Betrieb zu<br />
bewahren und zu entwickeln, gehört zu den besonderen Herausforderungen der Landwirtschaft<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> in den kommenden Jahren.<br />
Landwirtschaft zwischen Globalisierung und Direktvermarktung<br />
Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die betriebliche Entwicklung weiterhin. Sowohl im<br />
Bereich der Milch wie der Fleischproduktion sind in Einzelfällen betriebliche Entwicklung,<br />
Faktorausstattung und Qualifikation soweit vorangeschritten, dass eine Teilnahme am Weltmarkt<br />
stattfindet. Den Schwerpunkt allerdings bildet im <strong>Odenwaldkreis</strong> auch weiterhin die<br />
landwirtschaftliche Produktion für regionale Märkte, um das mehr oder minder ausgeprägte<br />
Bedürfnis der Gesellschaft nach regionalem Konsum, von Produkten, die in nachvollziehbaren<br />
Prozessen hergestellt, Vertrauen in die Qualität auslösen, zu befriedigen.<br />
Klein- und mittelbäuerliche Familienunternehmen werden auch weiterhin wesentlich zur<br />
Wertschöpfung in unserem ländlichen Raum beitragen. Dabei geht der Unternehmenserfolg<br />
nicht zwingend mit viel Fläche und großen Tierbeständen einher. Erfolgsfaktoren sind hier<br />
vielmehr die unternehmerische Kraft, Fleiß und Kreativität der Landwirtsfamilie, die die<br />
Marktnischen in Form von Direktvermarktung, Hofkäserei, Urlaub auf dem Bauernhof, Hofcafes,<br />
erneuerbare Energien und anderes nutzen.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass die weiteren Beschlüsse der EU zum Agrarhaushalt den Klein- und<br />
mittelbäuerlichen Familienbetrieben in schwer zu bewirtschaftenden Mittelgebirgsregionen<br />
wie dem <strong>Odenwaldkreis</strong> Unterstützung bieten.<br />
Die Landwirtschaft im Odenwald ist für die Zukunft unter drei Aspekten zu entwickeln:<br />
1. Erzeugung landwirtschaftlicher Rohprodukte für das Ernährungsgewerbe.<br />
Hierfür sind Einheiten zu formen, die dem überregionalen Wettbewerb Stand halten. Dies<br />
wird schwerpunktmäßig in den Bereichen Milch und Rindfleisch, ggf. Ölsaaten geschehen.<br />
Instrumentarium hierfür ist die gruppenspezifische Beratung/Fachschule (LLH), flankiert<br />
durch die einzelbetriebliche Förderung.<br />
2. Entwicklung/Erzeugung von Produkten und Dienstleistungen, die ihren Wettbewerbsvorteil<br />
in der Regionalität suchen und deren Zusammenfassung unter einem Dach/einer<br />
Dachmarke.<br />
Hierfür sind Organisationsformen zu finden, die verbindliche Qualitätskriterien entwickeln<br />
und diese nachhaltig verwalten/betreuen können. Die hierfür zu nutzenden Potenziale<br />
sind die regionalen Spezialitäten, direkter Kundenkontakt, Kombination mit Zusatznutzen,<br />
Netzwerkpartnerschaften mit Tourismusanbietern, Schulen etc.<br />
Instrumentarium für diesen Prozess ist die Arbeitsgruppe „Regionalmarke Odenwald“.<br />
Ausgangsbasis für die weitere Arbeit dieser AG ist die Broschüre „Lust auf Odenwald“.<br />
3. Für die Erhaltung und Pflege der ökologisch wertvollen Flächen sind ausreichend<br />
Ressourcen hinsichtlich einsatzfähiger Technik und fachlichen Kenntnissen vor Ort vorzuhalten.<br />
Durch Brachfallen und Verbuschen besteht die Gefahr, dass wertvolle Landschaftsteile<br />
und Biotope verloren gehen. Es sind Anreize zu setzen, dass für eine Nutzung<br />
der meist abgelegenen Flächen eine ausreichende Infrastruktur vorgehalten werden kann.<br />
Instrumentarium hierfür sind die Agrarumweltprogramme sowie das speziell hierfür entwickelte<br />
Odenwaldprogramm.<br />
Milchproduktion im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Nach einem kurzen Intervall eines „fairen Milchpreises“ in 2007 ist der derzeitige Milchauszahlungspreis<br />
für die Milchproduktion in Ungunstlagen und in weiten Teilen benachteiligten<br />
63
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Gemarkungen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in keiner Weise zufrieden stellend. Eine Erhöhung ist<br />
nicht abzusehen. Die kürzlich beschlossene Erhöhung der Milchquote durch die EU verschärft<br />
die Problematik noch. Mittel im Rahmen eines „Milchfonds“ sollen die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Milcherzeuger verbessern und „Problemstandorte“ auf den Ausstieg aus der<br />
Milchquote in 2015 vorbereiten. Die konkreten Auswirkungen dieser Maßnahme auf die<br />
Odenwälder Milchviehbetriebe hängt sehr stark von der tatsächlichen Ausgestaltung des<br />
Milchfonds ab. Derzeit bleibt nur zu hoffen, dass diese Art der bäuerlichen Landwirtschaft,<br />
wie sie hier in weiten Teilen noch vorherrschend ist, Unterstützung durch den Milchfonds<br />
erfahren darf. Für die Milchwirtschaft im Odenwald sind begleitende Maßnahmen zum Quotenausstieg<br />
von existenzieller Bedeutung.<br />
Benachteiligtes Gebiet und Ausgleichszulage<br />
Die Ausgleichszulage, wie sie derzeit in über 80 % der Gemarkungen an die bewirtschaftenden<br />
Betriebe gewährt wird, sollte auch zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Einkommenssicherung<br />
darstellen. Aktuelle Aussagen der Hessischen Landesregierung bestätigen die Beibehaltung<br />
bis 2013. Der Gebietsagrarausschuss beim Amt für den ländlichen Raum Reichelsheim<br />
(Odenwald) wird sich weiterhin für diese Form der Unterstützung in benachteiligten<br />
Gebieten einsetzen.<br />
Regionalmarke Odenwald<br />
Der begleitende Arbeitskreis unter Federführung des Amtes für den ländlichen Raum Reichelsheim<br />
(Odenwald) sieht in der Bündelung Odenwälder Produkte unter einer einheitlichen<br />
Wert-Bild-Marke eine gute Chance zur Vermarktung der Region. Im Frühsommer 2009 sollen<br />
erste Kennzeichnungen an Odenwälder Erzeugnisse verliehen werden. Der Ausschuss zur<br />
Erarbeitung bzw. Prüfung der Qualitätskriterien ist berufen. Mittelfristig sollte es Ziel sein, die<br />
Regionalmarke nicht nur für Produkte aus der Landwirtschaft zu etablieren, sondern auch auf<br />
andere Sparten auszuweiten wie Forstwirtschaft, touristische Dienstleister u.a.m.<br />
Dorferneuerung im Odenwald<br />
Das Dorferneuerungsprogramm, das aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes gespeist<br />
wird, stellt auch im Odenwald nach wie vor eine wichtige Stütze in der viel beschriebenen<br />
Entwicklung ländlicher Räume dar. Die Ausgestaltung des Förderprogramms wird sich<br />
auch zukünftig nach den Richtlinien des Fachministeriums richten. Im <strong>Odenwaldkreis</strong> stehen<br />
rund ein Drittel der Dörfer für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den kommenden<br />
Jahren an. Ziel ist es auch weiterhin, die Entwicklungskonzepte in enger Abstimmung und<br />
unter aktiver Mitwirkung von der jeweiligen Dorfbevölkerung und den kommunal Verantwortlichen<br />
festzulegen. Die inhaltliche Ausrichtung des Förderprogramms sollte die Herausforderungen<br />
des demographischen Wandels wie des Klimawandels in den kommenden Jahren<br />
noch stärker berücksichtigen.<br />
Dorfwettbewerb „Unser Dorf“<br />
Nach dem Erfolg von Rai-Breitenbach im Regionalentscheid 2008 (1. Platz) wird noch mal<br />
mehr die Bedeutung dieses vergleichbar „günstigen“ Instruments zur Stärkung des dörflichen<br />
Gemeinwesens wie des ländlichen Raumes betont. Ziel sollte es sein, dass sich der Kreisausschuss<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es an einer Prämierung der Siegergemeinden beteiligt.<br />
Agrarumweltprogramme – HIAP<br />
Ziel ist es, die Agrarumweltprogramme auf die Bedürfnisse dieser Mittelgebirgsregion abzustellen.<br />
Das heißt insbesondere eine Anpassung und Prämienerhöhung im Bereich „Standortangepasste<br />
Grünlandextensivierung“ vorzunehmen. Festzustellen ist, dass die Identifikation<br />
der Vertragsnehmer mit dem Programm an sich und zum Teil auch mit den Vertragsinhalten<br />
gegenüber dem Vorgängerprogramm HELP schwindet und die Zielsetzung schwer<br />
nachvollzogen werden kann. Notwendige Anpassungen sind nur durch entsprechende Einflussnahme<br />
beim Land Hessen möglich. Für drohende Flächenaufgaben in besonderen Ungunstlagen<br />
im südlichen Odenwald (Hängigkeit, enge Tallagen) sind kommunale Programme<br />
und Initiativen zur Pflege der jeweiligen Gemarkung einzuleiten (Beispiele dazu sind in ande-<br />
64
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
ren Bundesländern vorhanden). Als übergeordnetes Ziel im Sinne einer integrierten Politik<br />
für Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege ist die volle Verantwortung auch für<br />
die fachlich-inhaltliche Umsetzung der Agrarumweltprogramme auf Kreisebene erforderlich.<br />
Derzeit ist dies überwiegend auf die verwaltungsfachliche Umsetzung beschränkt.<br />
Biotopverbund<br />
Die Aufrechterhaltung insgesamt bzw. Wiederherstellung des Biotopverbundes in einzelnen<br />
Gemarkungen ist für die Funktionsfähigkeit der Kulturlandschaft von entscheidender Bedeutung.<br />
Im ALR wird in 2009 dazu das Regionale Landschaftspflegekonzept (RLK) in Form des<br />
Regionalen Agrarumweltkonzeptes (RAK) fortgeschrieben und in breiter Form mit Naturschutzverbänden,<br />
Landwirtschaft, Kommunen, Wasser- und Forstwirtschaft abgestimmt.<br />
Dieses Konzept bildet die Grundlage für weitere biotopverbundgestaltende Maßnahmen,<br />
Einsatz der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, evtl. zukünftige Förderprogramme der 2. Säule<br />
der Gemeinsamen Agrarpolitik und des Kreisausschusses <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Streuobst – Fachwartausbildung<br />
Ziel ist es, den vorhandenen Bestand an Streuobst im <strong>Odenwaldkreis</strong> in der gegebenen<br />
Größenordnung zu erhalten. Um dies gewährleisten zu können, ist weiterhin eine enge Zusammenarbeit<br />
mit dem Kreisverband für Obst- und Gartenbau, dem Naturschutzzentrum<br />
Odenwald und den Naturschutzorganisationen erforderlich. Die notwendige Pflege der Bestände<br />
wie auch Nachpflanzungen mit regionaltypischen Sorten bilden den Schwerpunkt.<br />
Um die Pflege sicherstellen zu können, sollen am ALR auch weiterhin die bereits 2002 ins<br />
Leben gerufene Fachwartausbildung fortgesetzt werden. Finanzielle Aufwendungen der<br />
kommunalen Gremien sind dazu weiterhin erforderlich. Für die Umsetzung der seit Herbst<br />
1988 jährlich stattfindenden Streuobst-Pflanzaktion werden zukünftig keine staatlichen Fördermittel<br />
zur Verfügung gestellt. Um diese bewährte und etablierte Maßnahme fortsetzen zu<br />
können, ist es wünschenswert, dass der Kreisausschuss finanzielle Mittel zur Verfügung<br />
stellt, z. B. aus der Ausgleichsabgabe (jährlich ca. 10.000 Euro).<br />
65
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4. Wald- und Forstwirtschaft<br />
4.1. Wald- und Forstwirtschaft<br />
Das Wuchsgebiet Odenwald ist mit einem Waldanteil von 54 % innerhalb Hessens als überdurchschnittlich<br />
waldreich zu bezeichnen. In Hessen liegt der durchschnittliche Wald-Anteil<br />
bei 42 %. Der Anteil der Waldfläche ist in den einzelnen Kommunen des Landkreises sehr<br />
unterschiedlich. Der höchste Bestockungsgrad mit über 70 % ist im südlichen Buntsandstein-<br />
Odenwald. (Beerfelden 4.533 ha, Sensbachtal 2.656 ha, Hesseneck 2.467 ha und Rothenberg<br />
2.245 ha) festzustellen.<br />
Der vordere Odenwald ist ein charakteristisches Buchenwaldgebiet mit Buchen- und Edellaubmischwäldern<br />
und deren Ersatzformationen. Der natürliche Laubwald im Wuchsbezirk<br />
„Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald“ (Bewaldung 72 %) ist heute weitgehend durch<br />
Nadelwald ersetzt. Zuständig sind die Forstämter Beerfelden und Michelstadt. Die Betreuung<br />
der ca. 9.600 ha Kleinprivatwald ist durch die ortsansässige Forstbetriebsgemeinschaft<br />
Odenwald (FBG) sichergestellt. Der weitaus größte Teil der Forstbetriebe im Odenwald ist<br />
zertifiziert.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind 4.295 ha Wald in staatlichem Besitz, 7.873 ha Kommunalwald und<br />
23.622 ha Privatwald.<br />
Waldflächen:<br />
Forstamtsbereich Staatswald Kommunalwald Privatwald Summe<br />
Gesamt 12 % 22 % 66 % 35.790 ha<br />
Der Privatwaldanteil liegt im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt mit 20 % deutlich<br />
unter dem Landesdurchschnitt (25 %). Ein Schwerpunkt des Privatwaldes in Südhessen befindet<br />
sich im <strong>Odenwaldkreis</strong> (66 % ) mit den Forstämtern Beerfelden und Michelstadt.<br />
Insbesondere der Kleinprivatwald stellt für landwirtschaftliche Betriebe einen wichtigen Faktor<br />
zur Einkommensbeschaffung dar. Da beim Kleinprivatwald zum Teil erhebliche Mängel im<br />
Hinblick auf die Besitzstruktur und die Erschließung festzustellen sind, wurden bereits<br />
mehrfach Waldbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz mit Erfolg durchgeführt.<br />
Größere Privatforstbetriebe verfügen häufig über eine eigene Forstorganisation, während der<br />
kleinere und Kleinprivatwald überwiegend das Betreuungsangebot der Hessischen Staatsforstverwaltung<br />
wahrnimmt.<br />
Die innere Bindung aller privaten Waldeigentümer an ihren Besitz ist in der Regel sehr groß<br />
und trägt damit bereits im Wege der Eigenverantwortung wesentlich zur langfristigen Erfüllung<br />
der Waldfunktionen bei.<br />
66
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4.2. Waldrodung/Waldneuanlage<br />
In 2007 betrug der Anteil der Waldrodung gemäß § 12 Hessisches Forstgesetz 34 900 m² und<br />
war damit sehr niedrig (2005/2006: 0,8 ha). Waldneuanlagen gem. § 13 Hessisches Forstgesetz<br />
(inkl. Weihnachtsbaumkulturen) beliefen sich auf 3,26 ha gegenüber 3,6 ha in<br />
2005/2006.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> ist aufgrund des natürlichen hohen Waldanteils die Vorgabe nach § 12 (3)<br />
des Hessischen Forstgesetzes problematisch, wonach für jede Waldinanspruchnahme eine<br />
Ersatzaufforstung geleistet werden muss bzw. eine Walderhaltungsabgabe (durchschnittlich<br />
2-5 €/m²) gezahlt werden muss. So erhöht sich der Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen.<br />
Zur Zeit ist das mit 9 ha vom Volumen größte Verfahren für Waldrodung und Ersatzaufforstung<br />
am „Park für grüne Technologien“, Hainhaus bei der Genehmigungsbehörde<br />
(ALR) in Prüfung. Die Suche nach Ersatzaufforstungsflächen durch den Betreiber gestaltet<br />
sich schwierig; zusammenhängend ist die Aufforstung nicht zu realisieren. Es wird angestrebt,<br />
die Aufforstung auf 2 bis 3 Teilflächen und in zeitlichen Teilabschnitten zu realisieren.<br />
Waldneuanlagen werden schwerpunktmäßig in der nördlichen Kreishälfte in Abhängigkeit<br />
vom Waldanteil der jeweiligen Gemarkung und der landwirtschaftlichen Situation genehmigt.<br />
In der südlichen Kreishälfte werden Anträge auf Waldneuanlage aufgrund des hohen Waldanteils<br />
äußerst restriktiv behandelt.<br />
Um die Arbeitsplätze in der Gewinnung und Weiterverarbeitung von Holz im Kreis zu halten,<br />
wird die Versorgung des regionalen Gewerbes mit Holz angestrebt. Derzeit gewinnt der Verkauf<br />
von Holzprodukten über die örtlichen Sägewerke an Bedeutung.<br />
4.3. Wald und Naherholung<br />
Der Odenwald verfügt über eines der am besten ausgebauten und markierten Wanderwegenetze<br />
Hessens.<br />
Von besonderer Bedeutung ist der als Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland zertifizierte<br />
Alemannenweg. An diesem Weg wird die Odenwald Tourismus GmbH unter Einbeziehung<br />
von touristischen Leistungsanbietern und ÖPNV buchbare Angebote entwickeln, um<br />
damit die regionale Wertschöpfung zu steigern. Neben dem Alemannenweg verfügt der<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> über weitere thematische Wanderwege wie z. B. den Limes-Wanderweg und<br />
darüber hinaus über zahlreiche Geopark-Pfade. Konzipiert, umgesetzt und unterhalten wird<br />
das umfangreiche Wanderwegenetz von den Kommunen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in enger Kooperation<br />
mit dem Odenwaldklub e. V.<br />
Sinnvoll ist es, künftig für die Wanderwege ein kreisübergreifendes Wanderwegenetz zu<br />
entwickeln und zu beschließen. Dabei ist es wichtig, das Wanderwegenetz mit dem Forst<br />
und sonstigen Waldbesitzern abzustimmen, um bereits bestehende Nutzungskonflikte zu<br />
lösen und zukünftige Konflikte zu verhindern.<br />
Im Marketingkonzept des Odenwaldes wurde das Ziel formuliert, den Odenwald als Wanderregion<br />
Nr. 1 für die Ballungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar zu entwickeln. Um dieses<br />
Ziel zu erreichen, muss auch im Wanderwegenetz nach höchster Qualität gestrebt werden.<br />
Das erfordert den gezielten kreisübergreifenden Ausbau qualitativ hochwertiger Wegeführungen<br />
durch das Aufstellen von Pfeilwegweisern mit Orts- und Kilometerangaben sowie die<br />
Ausstattung der Wege mit Waldmöbeln, Schutzhütten und Informationstafeln.<br />
34 Hessisches Forstgesetz in der Fassung vom 10.09.2002 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch<br />
Gesetz vom 07.09.2007 (GVBl. I S. 567)<br />
67
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Hessische Forstämter Beerfelden und Michelstadt<br />
• Forstbetriebsgemeinschaft<br />
• Odenwald Tourismus GmbH<br />
• Amt für den ländlichen Raum (ALR) des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in Reichelsheim (Odenwald)<br />
• Koordinierungsstelle „Biomasse“<br />
• rEnergO GmbH (Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien im Odenwald)<br />
• Odenwald Tourismus GmbH<br />
68
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5. Ver- und Entsorgung<br />
5.1. Energieversorgung<br />
1. Vorbemerkung:<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> sowie die Region Odenwald, vertreten durch die Interessengemeinschaft<br />
Odenwald (IGO e. V.), haben sich in einem breiten gesellschaftlichen Konsens im Regionalen<br />
Entwicklungskonzept das Ziel gesetzt, den Odenwald zur Kompetenzregion für eine zukunftsweisende<br />
Energie-Nutzung zu entwickeln. Hierbei geht es um das gesamte Spektrum<br />
der regenerativen Energien, um die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe und um<br />
den Bereich der Energie-Effizienz.<br />
Die Odenwald-Regionalgesellschaft (OREG mbH) begleitet diese Entwicklung zur Kompetenzregion<br />
mit ihrem Tochterunternehmen rEnergO GmbH (Gesellschaft zur Förderung regenerativer<br />
Energien im Odenwald). Neben der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung<br />
im internationalen Klimaschutz sind hierbei vor allem die<br />
planvolle und zukunftsorientierte Regionalentwicklung sowie die<br />
Wirtschaftsförderung in regionalen Wertschöpfungskreisläufen die<br />
Maxime des Handelns.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat seine Priorität auf die Förderung der regionalen Wirtschaft gesetzt<br />
und unterstützt deshalb die Produktion und Verwertung von Biomasse, die Herstellung innovativer<br />
Stoffe (wie Dämmstoffe aus Gras) und den Erhalt der Landschaft als ursprüngliches<br />
touristisches Angebot (siehe Tourismus).<br />
2. Erste Erfolge:<br />
Mit ihrer beharrlichen Arbeit, sich zu einer anerkannten Kompetenzregion für Zukunftsenergien<br />
zu entwickeln, hat die Region Odenwald landesweit beachtete Erfolge erzielt und wurde<br />
hierfür mehrfach von der hessischen Landesregierung ausgezeichnet:<br />
• 2004 verlieh das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
(HMULV) den Titel „Region BIOENERGIE Odenwald“ an den <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
• 2007 wurde der Zusammenschluss der Kreise Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
vom HMULV zur „BIOREGIO Holz Odenwald-Bergstraße“ ernannt (siehe hierzu<br />
auch unter 9.).<br />
• 2008 zeichnete das Hessische Wirtschaftsministerium das Cluster Erneuerbare Energien<br />
Odenwald (CLEO) im 1. Clusterwettbewerb des Landes Hessen aus (siehe hierzu auch<br />
unter 10.).<br />
3. Windkraft<br />
Windkraft wird aus Gründen des Landschaftsschutzes und der mangelnden Windhöffigkeit<br />
abgelehnt. Eine Wertschöpfung für die ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen oder die<br />
Verbraucher kann nicht festgestellt werden. Nach Willen der Regionalversammlung Südhessen<br />
soll der <strong>Odenwaldkreis</strong> als größter Teil des Naturparks Bergstraße-Odenwald und als<br />
damit schützenswerte Landschaft Tabufläche für Windenergieanlagen (WEA) werden.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> stehen der Errichtung von Windparks folgende öffentliche Belange entgegen:<br />
69
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• Die Bedeutung des Tourismus im <strong>Odenwaldkreis</strong> und die Unverträglichkeit mit Windparks:<br />
Ländliche Gebiete wie der <strong>Odenwaldkreis</strong> müssen besonders die lokale Wirtschaft fördern<br />
und Wertschöpfungsketten schließen. Dazu gehört auch die Unterstützung der Tourismuswirtschaft.<br />
Auch das Regierungspräsidium Darmstadt hat die Bedeutung des Tourismus<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> erkannt und die Förderungen der Tourismuswirtschaft aus der<br />
Liste der disponiblen Leistungen herausgenommen und somit den hier vorzufindenden<br />
Tourismus in seinem Stellenwert aufgewertet. Windparks wirken sich sehr negativ auf das<br />
Landschaftsbild und damit auf die Grundlage des Tourismus im Odenwald aus. Der VGH<br />
Baden-Württemberg urteilte am 20. Mai 2003, das Landschaftsbild werde durch die Errichtung<br />
von drei WEA im Südschwarzwald verunstaltet und versagte den Bau der Anlagen,<br />
weil diese „das Erscheinungsbild einer ruhigen, weitgehend unberührten Landschaft<br />
zerstören würde“. Im gleichen Urteil argumentiert das Gericht, das Landschaftsbild sei<br />
nicht nennenswert vorbelastet und damit besonders schutzwürdig. Auch der Deutsche<br />
Tourismusverband hat sich in einem Positionspapier ausdrücklich gegen die Errichtung<br />
von WEA in landschaftlich reizvollen und touristisch genutzten Gebieten ausgesprochen.<br />
• Die Substituierung durch andere regenerative Energiequellen, darunter insbesondere<br />
Holz:<br />
Im Text zum Vorentwurf des Regionalplans wird den Kreisen und Gemeinden die Möglichkeit<br />
zur Erstellung eines Konzeptes zur Überprüfung der örtlichen und regionalen<br />
Einsatzfähigkeit von Techniken zur Gewinnung regenerativer Energien gegeben (G 8.2-<br />
1). Der <strong>Odenwaldkreis</strong> möchte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, denn er hat genügend<br />
Potenzial, um das dort genannte Ziel auch ohne Ausbau weiterer Windenergieanlagen<br />
zu erreichen. Das Hessische Umweltministerium hat in seiner Studie zur Erfassung<br />
der Biomassepotenziale von 2006 für den <strong>Odenwaldkreis</strong> ein technisches Biomassepotenzial<br />
von insgesamt 295.000 MWh/a angegeben. Eine Substituierung der Windkraft<br />
durch Biomasse ist also durchaus gewährleistet.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat bei seiner Bewerbung zur BioRegio bereits ein Energiekonzept<br />
vorgelegt, das ausdrücklich die Förderung von Biomasse als Energieträger hervorhebt,<br />
was zur Anerkennung als Region BioEnergie 2004 geführt hat. Die Anerkennungen des<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>es als Region BioEnergie und unlängst als BioRegio Holz durch das Land<br />
Hessen würdigt die Arbeit des <strong>Odenwaldkreis</strong>es im Bereich der Förderung, Erforschung<br />
und modellhaften Anwendung von Techniken, die Biomasse energetisch und stofflich zu<br />
nutzen. Pilotprojekte wie die Anlagen Biokraft und Biowert in Brensbach und die Mitbegründung<br />
der Landesvereinigung HeRo 35 sowie des Bioenergiedorfs Rai-Breitenbach machen<br />
ebenfalls den Entwicklungsschwerpunkt deutlich. Durch die vorhandenen Anlagen<br />
kann der <strong>Odenwaldkreis</strong> die mögliche Substituierung der Windkraft unter Beweis stellen.<br />
• Der Flächenverbrauch bei Errichtung der Anlagen im Waldgebiet:<br />
Die geplanten Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von etwa 740 ha liegen fast ausnahmslos<br />
in Waldgebieten, was eine wirtschaftliche Belastung insbesondere für die<br />
Landwirtschaft bedeutet: Die ca. 120 Anlagen, die auf diesen Flächen Platz finden könnten,<br />
benötigen enorme Rodungen. Die Ersatzmaßnahmen für die Rodungsflächen mussten<br />
auf Kosten der Landwirtschaft ausgeführt werden, Forsterhaltungsabgaben kommen<br />
nicht dem Landkreis (z. B. für Regionalentwicklung) zugute. Der Eingriff in die Natur durch<br />
eine WEA ist noch relativ gering, jedoch bringen der Anschluss an das Stromnetz und die<br />
Baumaßnahme selbst Rodungen in großem Umfang mit sich.<br />
Unter G 4.1 ist als Grundsatz der Raumordnung beschrieben, dass „eine weitere quantitative<br />
und qualitative Beeinträchtigung und Trennwirkung [des Freiraums] auf ein Minimum<br />
beschränkt“ werden müsse. In der Begründung heißt es dazu, dass es in der Vergangenheit<br />
insbesondere durch Versorgungstrassen Zerschneidungen gegeben habe, die<br />
35 Das 2004 gegründete Kompetenzzentrum HessenRohstoffe Witzenhausen (HeRo) hat zum Ziel, die<br />
Bereiche Forschung, Produktion und Nutzung Nachwachsender Rohstoffe in Hessen zu fördern und<br />
damit einen Beitrag zur Sicherung des ländlichen Raums und einer nachhaltigen Energiepolitik zu<br />
leisten.<br />
70
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
zu erheblichen Freiraumverlusten geführt habe. Der Anschluss von WEA in Waldgebieten<br />
an das Stromnetz würde ebensolche Zerschneidungen in hohem Maße bedingen.<br />
Für die Trassierung von Leitungen gilt nach G 8.1-6 der Grundsatz, dass geprüft werden<br />
muss, ob der Neubau von Leitungen vermieden werden kann. Pauschal kann „die Stromversorgung<br />
für Bevölkerung und Wirtschaft in der Planungsregion als gesichert angesehen<br />
werden. Es geht also vorwiegend darum, im Energiebereich entstehende Umweltbeeinträchtigungen<br />
zu minimieren.“ (S. 93 Begründung zu 8 und 8.1). Dazu sind erneuerbare<br />
Energien einzusetzen. Aus Sicht des <strong>Odenwaldkreis</strong>es wird die Notwendigkeit, bei<br />
der Anlage von Windparks in Waldgebieten Leistungstrassen zu errichten, völlig übersehen.<br />
Die Vielzahl der Vorrangflächen und der damit verbundenen Trassen, führt die Feststellung,<br />
neue Leitungstrassen zu vermeiden, ad absurdum.<br />
• Landwirtschaft und Kulturlandschaft – Ressourcen für die Metropolregion:<br />
Die Aufstellung von WEA durch auswärtige Firmen und die dadurch verursachte Beeinträchtigung<br />
des Landschaftsbildes gehören sicherlich nicht zu den Möglichkeiten, den<br />
ländlichen Raum adäquat zu entwickeln. Vielmehr entspricht der Anbau nachwachsender<br />
Rohstoffe einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne des G 3.1-3 (Zielsetzungen für den<br />
ländlichen Raum). Hierdurch wird die Landwirtschaft (durch Anbau von Energiepflanzen<br />
beispielsweise) gestärkt, die Kulturlandschaft erhalten, eine dezentrale Energieversorgung<br />
ermöglicht und der Tourismus nicht beeinträchtigt.<br />
• Die hohen Kosten für die Windenergie:<br />
Ergebnis der dena-Netzstudie 36 , die für die Bundesregierung durchgeführt wurde, um die<br />
energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie bis zum Jahr 2020<br />
zu untersuchen, war: Die Mehrkosten für den Ausbau der Windenergie betragen für private<br />
Haushalte im Jahr 2015 zwischen 0,39 und 0,49 Cent je kWh. Darin sind die Kosten<br />
für den in enormem Umfang notwendigen Ausbau des Stromnetzes noch nicht enthalten.<br />
Die Kosten sprechen eindeutig für eine Substituierung der Windenergie durch andere regenerative<br />
Energien.<br />
• Landschaftsschutz und UNESCO-Geopark:<br />
Zur Gewährleistung eines wirtschaftlichen Betriebes müssen an Waldstandorten Windkraftanlagen<br />
mit großer Turmhöhe errichtet werden. Bereits die beiden im Bereich des<br />
Windparks „Hainhaus“ vorhandenen Windkraftanlagen – Anlagen auf Rohrmasten mit<br />
einer Nabenhöhe von „nur“ 109 m – sind von weither, von zahlreichen freien Höhenlagen<br />
des Sandstein-Odenwaldes aus, als technische Elemente deutlich wahrnehmbar. Windkraftanlagen<br />
für Waldstandorte erfordern jedoch Nabenhöhen von 160 m und mehr.<br />
Derartige Anlagen sprengen – an allen Standorten im Odenwald – endgültig die Dimensionen<br />
technischer Elemente, die in diesem Naturraum im Allgemeinen noch hingenommen<br />
werden können, wie z. B. Freileitungsmaste, Sende- und Mobilfunkmaste und landwirtschaftliche<br />
Großbauten. Zwar stellen auch diese visuelle Belastungen der Landschaft<br />
dar, doch kommt ihnen der Charakter von „ruhenden Störfaktoren“ zu. Windkraftanlagen<br />
können, im Hinblick auf ihre besondere Eigenart, nicht ohne weiteres mit solchen technischen<br />
Anlagen verglichen werden. Als sich bewegendes, dynamisches Element wirken<br />
sie vielmehr zusätzlich standortfremd, auffällig und beunruhigend. Auf einen „Gewöhnungseffekt“<br />
darf dabei nicht gesetzt werden.<br />
Ein eventuelles Vorhandensein anderer technischer Bauwerke im Umfeld solcher Anlagen<br />
fällt bei der Beurteilung der Windkraftstandorte, aufgrund der Größe der Windkraftanlagen,<br />
entsprechend gering ins Gewicht.<br />
Die neue Generation von Windkraftanlagen ist also geeignet, über alle bereits bestehenden<br />
Vorbelastungen deutlich hinausgehend, die in § 12 Abs. 1 HeNatG genannten<br />
Schutzgüter, hier insbesondere das Landschaftsbild, erheblich zu beeinträchtigen. Eine<br />
36 Mit dem Titel „Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland<br />
an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ hat die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) eine<br />
erste Studie am 18. Februar 2005 veröffentlicht.<br />
71
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
solche zusätzliche, erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht zu vermeiden<br />
oder in angemessener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren.<br />
Zu berücksichtigen ist bei dieser Beurteilung insbesondere der Status des Odenwaldes<br />
als Naturpark und UNESCO-Geopark. Er eignet sich aufgrund seiner landschaftlichen<br />
Voraussetzungen besonders für die stille, naturgebundene Erholung. Naturparke sollen<br />
der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten<br />
Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen, in ihnen soll zu diesem<br />
Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt werden.<br />
Zur Zeit steht der Darstellung der Vorranggebiete für die Windenergienutzung außerdem<br />
noch die Landschaftsschutzverordnung „Bergstraße-Odenwald“ entgegen. Die großräumig<br />
unter Schutz gestellte Mittelgebirgslandschaft des Odenwaldes ist als Lebensgrundlage<br />
des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in der Natur zu erhalten.<br />
Neben dem in der Landschaftsschutzverordnung genannten Verbotstatbestand der Naturschädigung<br />
sind insbesondere die Verbote der Verunstaltung des Landschaftsbildes und<br />
der Beeinträchtigung des Naturgenusses relevant. Um die Ziele der Landschaftsschutzverordnung<br />
insgesamt zu erreichen, hat der Verordnungsgeber ein generelles Bauverbot<br />
verhängt, wenn negative Auswirkungen auf die schutzwürdigen Güter zu erwarten sind.<br />
Die vorhandene Kulturlandschaft ist zu erhalten und von technischen Elementen freizuhalten.<br />
Bei dieser Bezugnahme auf die Landschaftsschutzverordnung „Bergstraße-Odenwald“,<br />
deren Aufhebung bevorsteht, ist davon auszugehen, dass ihre wesentlichen Inhalte bzw.<br />
Ziele in eine zukünftige Naturpark-Verordnung übernommen werden (s. o.).<br />
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gehen, trotz der beabsichtigten<br />
Aufhebung des Landschaftsschutzgebietes „Bergstraße-Odenwald“, bei der Abwägung<br />
gegenüber allen sonstigen Anforderungen an Natur und Landschaft diesen anderen<br />
Belangen im Range vor. Daher dürfen im Regionalplan für den <strong>Odenwaldkreis</strong>, abgesehen<br />
von dem bestehenden Windpark „Hainhaus“, keine weiteren Vorranggebiete für die<br />
Windenergienutzung ausgewiesen werden.<br />
Landschaftsbildbewertung und Sichtbarkeitsanalyse können nur von heutigen Standards<br />
ausgehen. Die rasante technische Entwicklung ermöglicht immer neue Höhenrekorde, vor<br />
wenigen Jahren wurden WEA mit einer Nabenhöhe von 108 m errichtet, heute sind diese<br />
Modelle veraltet. Stattdessen werden Anlagen mit einer Gesamthöhe von 210 m und mit<br />
Gittermasten (Grundfläche z. B. 30 x 30 m) errichtet. Dadurch wird zukünftig nicht nur an<br />
allen Standorten eine Höhe mit ausreichender Windgeschwindigkeit erreicht, die Sichtbarkeitsanalysen<br />
und Landschaftsbildbewertungen werden keine Gültigkeit mehr haben und<br />
die für die landesplanerischen Festsetzungen vorgenommene Abwägung wird somit angreifbar.<br />
Vorranggebiete, die danach einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten, bringen<br />
keine verlässliche Ausschlusswirkung, weshalb für den <strong>Odenwaldkreis</strong> ein Ausschluss<br />
in den Regionalplan aufgenommen werden soll.<br />
• Planungen der Nachbarländer und -kreise:<br />
Im Vorderen Odenwald bzw. im Landkreis Bergstraße als auch im badischen und bayerischen<br />
Teil des Odenwaldes ist die Errichtung von Windparks nicht bzw. nur an „Ausnahmestandorten“<br />
vorgesehen. Dies bedeutet, dass in diesem Mittelgebirgsraum allein die<br />
Landschaft des <strong>Odenwaldkreis</strong>es mit WEA belastet würde. Die genannten negativen<br />
Auswirkungen werden dadurch noch verstärkt. Die Errichtung von WEA in direkter Sichtbeziehung<br />
zum bayerischen und badischen Odenwald die Planungen der beiden Nachbarländer<br />
konterkarieren und diese in die hessischen Planungen unbedingt einbezogen<br />
werden müssten.<br />
72
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4. Potenzialstudie und Energiekonzept für den <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
4.1. Feststellungen<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> strebt einen weiteren zügigen Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien<br />
an. Das Land Hessen hat es sich als Ziel gesetzt bis zum Jahr 2015 insgesamt 15%<br />
des Energieverbrauchs mit regenerativen Energien abzudecken. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> will dieses<br />
Ziel insbesondere durch Nutzung von Biomasse und durch gemäßigten Ausbau von<br />
Windkraft erreichen. Bei der Nutzung von im <strong>Odenwaldkreis</strong> reichlich vorhandener Biomasse<br />
ist eine viel höhere Wertschöpfung innerhalb der Region des <strong>Odenwaldkreis</strong>es zu erreichen,<br />
als dies jemals durch Windkraft möglich wäre. Somit stellt dies für den <strong>Odenwaldkreis</strong> eine<br />
große wirtschaftliche Chance dar.<br />
Im Jahr 2007 wurde das Witzenhausen-Institut beauftragt eine Potenzialstudie zu erstellen,<br />
um u. a. den derzeitigen Gesamtenergieverbrauch und das derzeit genutzte, aber auch das<br />
noch zur Verfügung stehende Potenzial von regenerativen Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong> aufzuzeigen.<br />
Gesamtenergieverbrauch im <strong>Odenwaldkreis</strong> 2006:<br />
Quelle: Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong> 37 , S. 9<br />
37 Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong>, Grunddaten und Optionen für den Ausbau der Nutzung erneuerba-<br />
rer Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong>, Dezember 2007<br />
73
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Gesamterzeugung regenerativer Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong> (Stand 2006):<br />
Quelle: Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong> 38 , S. 20<br />
In einem nächsten Schritt wurde das technische Gesamtpotenzial regenerativer Energien im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> abgeschätzt. Dieses beläuft sich auf insgesamt knapp 557.000 MWh pro<br />
Jahr. Ohne Berücksichtigung des Verkehrssektors könnte somit die Nutzung regenerativer<br />
Energien gegenüber dem Jahr 2006 nahezu verfünffacht werden.<br />
38 a. a. O.<br />
74
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Abschätzung des technischen Gesamtpotenzials regenerativer Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
Quelle: Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong> 39 , S. 41<br />
Gemäß einer Prognose für das Jahr 2015 wird die benötigte Gesamtenergie im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
ca. 2.830.000 MWh pro Jahr betragen. Mit der Ausschöpfung der Potenziale im Bereich<br />
Biomasse, Solarenergie und Geothermie könnten bereits 18% des Endenergieverbrauchs<br />
(ohne Verkehrssektor) über regenerative Quellen ohne weiteren Ausbau der Windenergie<br />
bereitgestellt werden.<br />
39 a. a. O.<br />
75
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Erwartete Entwicklung der Energieverbrauchswerte im <strong>Odenwaldkreis</strong> auf der Grundlage des<br />
Leitszenarios 2006 für Deutschland:<br />
Quelle: Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong> 40 , S. 45<br />
Da dieses Potenzial vermutlich nicht vollständig ausgeschöpft wird, ist von einem gemäßigtem<br />
Ausbau der Windkraftnutzung auszugehen um im Jahr 2015 das Ziel von 15% Anteil<br />
regenerativer Energien am Gesamtverbrauch zu erreichen.<br />
Technisches Potenzial für den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>es:<br />
Quelle: Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong> 41 , S. 49<br />
40 a. a. O.<br />
41 a. a. O.<br />
76
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4.2. Entwicklung<br />
Die Konzentration auf die vorhandenen Ressourcen wie Holz, landwirtschaftliche „Abfallprodukte“<br />
und Sonnenenergie gibt den ansässigen Landwirten und mittelständischen Unternehmen<br />
die Möglichkeit, neue Einnahmequellen und Berufszweige zu erschließen. Damit<br />
entstehen neue Wertschöpfungsketten.<br />
Im Übrigen wird angeregt, den Energieverbrauch zu drosseln. Die vorhandenen Einsparungspotenziale<br />
können dazu führen durch Substituierung auf Windenergieanlagen (WEA)<br />
zu verzichten. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> leistet mit der Einführung des Gebäudemanagements<br />
bereits seinen Beitrag und wird den Energieverbrauch weiterhin erheblich senken.<br />
Ein weitgehender Verzicht auf WEA ist durch die genannten Maßnahmen möglich und es<br />
kann die Zielsetzung des Landes Hessens, den Anteil erneuerbarer Energien auf 15 % im<br />
Jahr 2015 anzuheben, effektiv unterstützt werden.<br />
Spätestens mit Kreistagsbeschluss vom 03. November 2008 ist auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> politische<br />
Zielsetzung den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien mindestens auf einen<br />
Anteil von 15 % bis zum Jahr 2015 zu entwickeln. Ende 2006 lag der Anteil bei 5,5 % des<br />
Endenergieverbrauches. Das genannte Ziel entspricht somit einem Ausbau von etwa<br />
300.000 MWh/a erneuerbarer Energien. Geeignete und priorisierte Energieträger sind Holz,<br />
Biogas, Solarthermie und wegen der bereits genannten schädlichen Auswirkungen mit Einschränkung<br />
Windkraft. Die vom <strong>Odenwaldkreis</strong> eingerichtete Koordinierungsstelle Biomasse<br />
hat folgende Vorgehensweise erarbeitet:<br />
• Forcierter Ausbau der Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien von derzeit 83.000<br />
MWh/a auf ca. 250.000 MWh/a. Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Holznutzung<br />
(ca. 160.000 MWh/a), einer erheblichen Steigerung der Solarthermie auf ca. 80.000<br />
MWh/a sowie durch verstärkte Geothermienutzung mit ca. 10.000 MWh/a.<br />
• Eine verhaltene Erhöhung des Stromanteils auf ca. 50.000 MWh/a von derzeit rund<br />
21.000 MWh/a mit den Schwerpunkten Photovoltaik- und Biogasanlagen sowie Windenergieanlagen.<br />
Dabei wird von einer Verdoppelung der 2 bereits installierten Windräder<br />
(Hainhaus) durch die bereits genehmigten Einheiten mit höherem Wirkungsgrad ausgegangen.<br />
• Der Miscanthus- (Chinaschilf) Anbau, die Nutzung des Straßenbegleitgrüns und die<br />
Begründung von Energiewald können als zusätzlicher Puffer betrachtet werden. In den<br />
nächsten Jahren ist gerade im Bereich „Miscanthus“ mit einer Zunahme der Anbauflächen<br />
zu rechnen (2007 ca. 2 Hektar, für 2008 sind bereits ca. 17 Hektar geplant).<br />
Es kann festgestellt werden, dass das vorgegebene Ziel eine nachhaltige Mobilisierung der<br />
Potenziale an Holz/Energiepflanzen, Solarthermie, Biogas und Geothermie sowie einen kontrollierten<br />
Ausbau der Windenergie erfordert. Als mindestens gleichwertig zum Ausbau erneuerbarer<br />
Energien ist auch die Nutzung des Energieeinsparpotenzials an privaten wie öffentlichen<br />
Gebäuden zu bewerten.<br />
5. Koordinierungsstelle Biomasse<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat 2005 eine Koordinierungsstelle Biomasse eingerichtet, die sich regelmäßig<br />
trifft, um Projekte im Bereich regenerative Energien abzustimmen oder zu initiieren.<br />
Unter Leitung des Amtes für den ländlichen Raum in Reichelsheim (Odenwald) treffen sich<br />
etwa vier- bis sechsmal jährlich der Erste Kreisbeigeordnete (Beauftragter für Land- und<br />
Forstwirtschaft, für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz), Vertreter der Wirtschaftsplanung,<br />
des Hessen Forst, der rEnergO und des Landratsamtes.<br />
77
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Im Jahr 2007 betrugen die eingesetzten Fördermittel, aus dem Programm „Bio-Rohstoffe aus<br />
Land- und Forstwirtschaft“, in der Summe etwa 250.000 €. Über das Bundesamt für Wirtschaft<br />
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wurden im Jahr 2007 im <strong>Odenwaldkreis</strong> gefördert:<br />
in 2007: 279 Solarkollektoranlagen mit 157.000 €<br />
64 Pellettanlagen mit 81.000 €<br />
38 Scheitholzvergaserkessel mit 36.000 €<br />
2 Holzhackschnitzelanlagen mit 4.600 €<br />
6. Arbeitskreis (AK) Landwirt als Energiewirt<br />
Das Amt für den ländlichen Raum in Reichelsheim (Odenwald) bietet den Odenwälder<br />
Landwirten ein Austausch- und Informationsforum zum Thema „Landwirt als Energiewirt“ an.<br />
7. Hainhaus<br />
7.1. Ist-Zustand<br />
Im „Park für grüne Technologie“, auf dem Gelände des ehemaligen Munitionslagers Hainhaus,<br />
werden Ideen, Erfolge und Kompetenzen der gesamten Region zum Thema zukunftsweisende<br />
Energie-Nutzung zu einem Kompetenzzentrum fokussiert. Regionale Firmen aus<br />
den Bereichen regenerative Energien, nachwachsende Rohstoffe und Energie-Effizienz werden<br />
hier ihre Produkte und Dienstleistungen gemeinsam präsentieren und bei Bedarf eigene<br />
Firmenniederlassungen aufbauen.<br />
Für Innovationen und Investitionen, die von regionalen Firmen nicht geleistet werden können,<br />
sollen Kompetenzträger aus anderen Regionen für eine Ansiedlung gewonnen werden.<br />
Hierbei wird auf eine Integration der neuen Firmen in den regionalen Wertschöpfungskreislauf<br />
und auf eine mögliche Partizipation der ansässigen Firmen geachtet. Zur Qualitätssicherung<br />
der regionalen Kompetenzen sowie zur Generierung und Vermittlung wegweisender<br />
Innovationen im Themenfeld der alternativen Energie-Nutzung wird auch dem Bereich Forschung<br />
und Lehre am Standort ein hoher Stellenwert zukommen: Durch die Vernetzung regionaler,<br />
nationaler und internationaler Institutionen soll hier ein Knotenpunkt für Forschungsaktivitäten<br />
und Wissenstransfer geschaffen werden.<br />
Das Munitionslager Hainhaus wurde im September 2007 von der OREG erworben und wird<br />
als Sondergebiet Grüne Technologien projektiert.<br />
78
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die Liegenschaft Munitionsdepot Hainhaus liegt an der Landesstraße L 3349 in der Gemarkung<br />
Breitenbrunn der Gemeinde Lützelbach und hat eine Größe von 74 ha. Das Gelände ist<br />
vollständig erschlossen. Aktuell befinden sich hier 120 ehemalige Militärbunker aus Beton,<br />
davon 23 aus dem Jahr 1955, die zuletzt 1979 saniert wurden.<br />
Die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH hat dieses Gelände von dem Eigentümer<br />
HESSEN-Forst am 14.09.2007 käuflich erworben und wird hier einen Technologienpark entwickeln.<br />
Aktuell befinden sich 120 ehemalige Munitionsbunker auf dem Gelände. Insgesamt stehen<br />
etwa 20.000 m 2 überdachte und zusätzlich 10.000 m 2 offene Lagerfläche zur Verfügung.<br />
Das Lagervolumen aller Bunker beträgt ca. 50.000 m 3 . Bunker sind nur einseitig erschlossen.<br />
Das Raumvolumen beträgt 400 m 3 pro Bunker.<br />
Daten:<br />
469.778 m 2 Gewerbe- und Freifläche<br />
271.800 m 2 Waldfläche<br />
15.400 m 2 Bunkerfläche<br />
3.852 m 2 Hallenfläche<br />
160 m 2 Gebäudefläche des Wachgebäudes<br />
7.377 m 2 Bunkerfläche (Vorratsfläche)<br />
79
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
7.2. Entwicklungsstrategie<br />
Langfristig ist geplant, dass das ehemalige Munitionsdepot Hainhaus als Lagerstätte für diverse<br />
Objekte genutzt werden wird. Mit Pirelli Deutschland GmbH wird daher ein langfristiges<br />
Mietverhältnis angestrebt. Die angemieteten Bunker durch Pirelli werden sich reduzieren, um<br />
weitere Bunkerflächen regionalen Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen erneuerbare<br />
Energien ihr Kerngeschäft haben, zur Verfügung zu stellen.<br />
Beim Einsatz von natürlich nachwachsenden Energielieferanten, die aus dem täglichen Entstehungsprozess<br />
von Gräsern, Pflanzen, Sträuchern und Bäumen anfallen, entstehen bei<br />
der Verbrennung keine oder nur geringste Mengen von CO2. Im Biomassehof Odenwald<br />
kann eine Bündelung von Biomassebrennstoffen, zur kontinuierlichen Belieferung von neu<br />
entstehenden Biomasseheizwerken, Hackschnitzelfeuerungsanlagen und Pelletsheizungen,<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Biomassehof<br />
Der neue Biomassehof wird einen großen Anteil in der Entwicklung des Technologien-Parks<br />
darstellen. Die Nutzung heimischer nachwachsender Rohstoffe sichert dem Verbraucher die<br />
zukünftige Energieversorgung und der Land- und Forstwirtschaft sowie Handwerkern zusätzliche<br />
Einnahmequellen. Dezentrale Lösungen bieten dem strukturschwachen ländlichen<br />
Raum neue Chancen im Sinne der lokalen Ökonomie. Gleichzeitig ist die Energiebereitstellung<br />
aus regenerativen Rohstoffen nahezu klimaneutral: Bei der Verbrennung wird nur so<br />
viel Kohlendioxid freigesetzt, wie vorher in der Pflanze festgelegt wurde. Aktiver Klimaschutz<br />
fängt vor der eigenen Haustür an. Statt tonnenweise Patronenhülsen zu lagern, könnte das<br />
Gelände des ehemaligen Munitionsdepots jetzt für regenerative Energieträger Platz bieten,<br />
die für die Bevölkerung des Odenwaldes eine lebenswerte Zukunft sichern helfen.<br />
Der Biomassehof Odenwald übernimmt folgende Funktionen:<br />
• Aufkauf und Produktion von Wald-Hackschnitzeln sowie Holzpellets<br />
• Sammlung und Verwertung von kommunalen und privaten Holzabfällen<br />
• Trocknung und Aufbereitung der angelieferten Biomasse, Logistik und Lagerung<br />
• Langfristige Belieferung der öffentlichen und privaten Haushalten mit Biomasse<br />
• Vertrieb von speziellen Biomassesegmenten wie z.B. Kaminholz<br />
• Initiierung und Hilfe bei der Errichtung von weiteren Biomassehöfen und -anlagen<br />
• Besucherzentrum<br />
• Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien, Energiemanagement, sinnvolle<br />
Energienutzung, Umweltbildung<br />
• Forschungsstation in Verbindung mit der Odenwald-Akademie<br />
• Repräsentanz des Clusters CLEO (www.odenwald-biomasse.de)<br />
Der geplante Biomassehof wird langfristig Biomasse anbauen, ernten und verarbeiten, den<br />
zentralen Vertrieb energetisch nutzbarer Biomasse, bis hin zur Bereitstellung von Endenergie<br />
in Form von Wärme und Strom die gesamte Wertschöpfungskette von Bioenergie übernehmen.<br />
Als erste Maßnahme zur Eröffnung und Belebung des „Park für grüne Technologie“ entsteht<br />
am Standort ein Biomassehof zur Erzeugung und Vermarktung von Holzbrennstoffen.<br />
Scheitholz und Holzhackschnitzel sollen hier produziert, technisch getrocknet und vermarktet<br />
werden. Hinzu kommt die Zwischenlagerung und Vermarktung von Holzpellets und Holzbriketts.<br />
Neben der regionalen Vermarktung stehen die umliegenden Ballungsräume im Fokus des<br />
Vertriebes. Durch die gesicherte Qualität, professionelle Vermarktung und Service sowie die<br />
vergleichbar kurzen Wege in die Ballungsräume kann hier ein neues Absatzgebiet für die<br />
Region erschlossen werden. Der lokale Absatz wird durch das höhere Preisniveau gegen-<br />
80
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
über nebenberuflichen Brennholzverkäufern mit freierer Maschinen- und Lohnkostenrechnung<br />
beschränkt bleiben.<br />
Der neue Biomassehof wird einen großen Anteil in der Entwicklung des Technologien-Parks<br />
darstellen.<br />
Offizielle Inbetriebnahme des regionalen Biomassehofes ist nach zwölf Monaten vorgesehen.<br />
Auf einem Areal von ca. 3 ha würde in einjähriger Bauzeit ein Biomassehof entstehen.<br />
Holzvergasung<br />
Mit wissenschaftlicher Begleitung soll eine Konzeption für Holzvergasertechnologie, Strom<br />
aus Holzgas und die Nutzung der Restwärme für eine Gärtnerei entwickelt und realisiert<br />
werden.<br />
Zur Verstromung von Holzhackschnitzeln und um eine günstige Abwärmequelle am Standort<br />
zur Verfügung zu stellen, wird im Anschluss an den Biomassehof eine Holzvergasungsanlage<br />
geplant. Eine Anlage vom Typ „Güssingen“ soll hier in Wasserdampf-Wirbelschicht-<br />
Technologie mit einer Inputleistung von 10 MW und einem Output von 3,3 MW elektrisch und<br />
4,5 MW thermisch arbeiten. Die produzierte Wärme soll in ein lokales Fernwärmenetz am<br />
Standort eingespeist und neben Gebäudeheizung und Prozessenergie auch der technischen<br />
Holztrocknung am Biomassehof zur Verfügung stehen.<br />
Pyrolyse<br />
Um den verhältnismäßig hochwertigen Brennstoffbestand an Holzhackschnitzeln zu schonen<br />
und um neue Möglichkeiten anzubieten, geringwertige Biomassepotenziale einer energetischen<br />
Verwertung zuzuführen, soll der Holzvergasungsanlage in einem zweiten Schritt eine<br />
Pyrolyseanlage vorgeschaltet werden. Hier werden die Einsatzstoffe (z. B. Straßenbegleitgrün,<br />
landwirtschaftliche Reststoffe) unter Sauerstoffabschluss thermisch vergast und die<br />
brennbaren Gase der Holzvergasungsanlage zugeführt.<br />
Dies schont die regionalen Holzressourcen und es entstehen der lokalen Landwirtschaft attraktive<br />
Absatzmöglichkeiten für biogene Reststoffe. Der in der Holzvergasung und der Pyrolyse<br />
entstehende Bio-Koks kann entweder zur thermischen Verwertung vermarktet oder als<br />
hochwertiges Düngemittel in der Landwirtschaft genutzt werden. Die mit Bio-Koks entstehenden<br />
Schwarzerde-Konglomerate haben neben einem hohen Nährstoffgehalt eine hohe<br />
Speicherfähigkeit für Nährstoffe und Wasser. Der enthaltende Kohlenstoff wird hierbei langfristig<br />
im Boden gebunden und sorgt damit für eine CO2-negativen Energiebilanz des Pyrolyseprozesses.<br />
Informationszentrum<br />
Das geplante Informationszentrum am Standort Hainhaus hat die Aufgabe, dem interessierten<br />
Verbraucher die Themen regenerative Energien, nachwachsende Rohstoffe und Energie-<br />
Effizienz nahe zu bringen. Zu diesem Zweck sind Ausstellungen mit Informationsmaterial,<br />
Informationsveranstaltungen und eine Beratungsstelle geplant.<br />
Des Weiteren wird hier die Möglichkeit geschaffen, dass sich die themenbezogenen regionalen<br />
Firmen des CLEO über Ausstellungen, Showrooms oder Infowände präsentieren können.<br />
Damit erhält der Verbraucher die Möglichkeit, sich nach einer unabhängigen Beratung<br />
über die regionale Anbieter und ihre Leistungen zu informieren.<br />
Forschungs- und Lehrzentrum<br />
Verschiedene wissenschaftliche Institutionen begleiten die Entwicklungen im „Park für grüne<br />
Technologie“. Die Wichtigsten sind:<br />
• TU-Darmstadt mit dem TU-Darmstadt Energy-Center<br />
• Aston University mit dem EBRI (European Bioenergy Research Institut)<br />
• KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.)<br />
• Odenwald Akademie<br />
81
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Diese und andere Institutionen planen bereits heute, den Standort Hainhaus als Ort für Forschung<br />
und Lehre zu nutzen. Hierfür sollen Infrastrukturen wie Hörsäle, Laboratorien, Teststände,<br />
Veranstaltungsräume und Büros errichtet werden. Die Asten University entwickelt<br />
aktuell Konzepte für akademische Qualifizierungen im europäischen Austausch mit Lehr-<br />
und Praxiseinheiten am Standort Hainhaus.<br />
Als wichtigstes Forschungsobjekt gelten hierbei der Pyrolysekomplex und seine Einbindung<br />
in lokale Stoff- und Energiekreisläufe. Weitere Firmen und Institutionen können sich mit<br />
Problem- und Fragestellungen sowie mit eigenen Anlagen in wissenschaftliche Kooperationen<br />
einbringen.<br />
Geplante Aktivitäten auf der Restfläche:<br />
• Erweiterungsflächen „Park für grüne Technologie“<br />
Die im Regionalplan noch nicht definierten Flächen des Areals Hainhaus bergen noch erhebliche<br />
Erweiterungsmöglichkeiten für den „Park für grüne Technologie“. Bei einem<br />
weiterhin anzunehmenden und erwünschten Engagement von Pirelli auf dem Gelände ist<br />
jedoch auf eine praxisorientierte Berücksichtigung bzw. Trennung der Werksabläufe zu<br />
achten.<br />
Unter dieser Maßgabe steht als Erweiterungsfläche kurzfristig die Dreiecks-Fläche nordwestlich<br />
des Biomassehofes zur Verfügung. Mittelfristig ist eine Trennung der Waldgebiete<br />
im äußersten Norden des Gesamtareals vom Werksverkehr Pirelli ebenfalls möglich.<br />
Auf diesen Flächen könnten auch die bisher nicht erwähnten Nutzungskonzepte wie:<br />
o ein Rundholzplatz als Lagerkapazität regionaler Sägewerke mit Sortierung und<br />
Konfektionierung sowie für Wertholzsubmissionen<br />
o ein Gärtnereibetrieb in Kooperation mit der Integra als zusätzliche Wärme- und CO2-<br />
Senke der örtlichen Verstromungsprozesse<br />
realisiert werden. Neue flächenintensive Infrastruktureinrichtungen des Parks, wie z. B. eine<br />
mögliche Erweiterung der Kläranlagenkapazitäten oder zusätzliche Wasserreservats, könnten<br />
ebenfalls ohne relevante Störungen innerhalb des Pirelli-Bereiches errichtet werden.<br />
• Algenreaktor<br />
Im direkten Zusammenhang mit der geplanten Pyrolyseanlage steht das Konzept eines<br />
Algenreaktors zur Produktion von energetisch nutzbarer Biomasse sowie als Wärme- und<br />
CO2-Senke der örtlichen Verstromungsprozesse. Hierfür ist geplant, die nach Süden ausgerichteten<br />
Bunkerflächen, die bisher für eine Belegung mit Photovoltaikmodulen gedacht<br />
waren, mit transparenten Kunststoffleitungen für die Aufzucht von Algenkulturen zu belegen.<br />
Die so produzierten Algen können energetisch (in der Pyrolyse) oder stofflich (Ölproduktion,<br />
Futtermittelproduktion) genutzt werden und wären so eine örtlich biogene Rohstoffquelle,<br />
die ohne größere Transportwege und ohne den Verbrauch landwirtschaftlicher<br />
Fläche genutzt werden kann.<br />
• Reifenlagerung<br />
Der komplette Bestand der 120 oberirdischen Bunker wird zurzeit von Pirelli als Reifenlager<br />
zur Materialausreifung und Zwischenlagerung genutzt. Diese Nutzung hat schon vor<br />
dem Flächenerwerb durch die Odenwald-Regionalgesellschaft bestanden und ist durch<br />
einen langfristigen Mietvertrag festgeschrieben. Auch wenn diese Nutzungsform das<br />
Thema des geplanten Technologieparks nicht aufnimmt, hat erst diese sichere Grundpacht<br />
den Erwerb und die weitere Entwicklungsplanung des Hainhauses finanziell ermöglicht.<br />
82
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
7.3. Zielsetzung:<br />
Modell „Hainhaus“<br />
Die Vision einer Endausbaustufe für den „Park für grüne Technologie“ am Standort Hainhaus<br />
zeigt einen themenorientierten Technologiepark, der die Themen regenerative Energien,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Energie-Effizienz an einem zentralen Standort fokussiert und<br />
die entsprechenden Kompetenzen der gesamten Region zum Ausdruck bringt.<br />
Innerhalb der 74 ha Fläche sollen sich Produzenten und Nutzer alternativer Energiesysteme<br />
ansiedeln und Synergien in Stoff- und Energieströmen sowie in Vermarktung und Management<br />
heben.<br />
Hierdurch entsteht ein Themenpark, in dem interessierte Besucher ein breites Spektrum zukunftsweisender<br />
Energie-Nutzung im realen Betrieb erfahren können. Diese Möglichkeiten<br />
für Wissensbildung und Produktinformation für Endverbraucher werden zudem im beschriebenen<br />
Informationszentrum begleite.<br />
Das Thema Energie-Effizienz wird sich am Standort nicht nur in vermarkteten Produkten<br />
wieder finden, sondern ist auch Maxime in Bau, Betrieb und Produktion der einzelnen Standortkomponenten.<br />
Neben dem effizienten Einsatz von Nutzenergie sind hierbei auch die Themen<br />
Wasser-, Ressourcen- und Flächenverbrauch sowie das Thema Recycling Teil des<br />
ganzheitlichen Effizienz-Konzeptes.<br />
Die begleitende Forschung und Lehre wird von nationalen und internationalen Partnern am<br />
Standort betrieben. Universitäten und Institutionen generieren hier im Schulterschluss mit<br />
engagierten Firmen und Industriepartnern neues Wissen für die Wettbewerbsfähigkeit des<br />
Standortes und der Region.<br />
Die neuen Arbeitsplatzkapazitäten, die Forschungs-, Lehr- und Lernkapazitäten sowie die<br />
große Anzahl von Besuchen sorgen für eine dauerhafte Belebung des Standortes mit allen<br />
Bedürfnissen einer sekundären Infrastruktur. D. h., auch Hotellerie und Gastronomie in der<br />
näheren Umgebung werden profitieren. Die ländlichen Gemeinden können ihren Bewohnern<br />
direkt oder indirekt zukunftsorientierte Arbeitsplätze bieten und sind attraktiver Wohnraum für<br />
zuziehendes Fachpersonal des Technologieparks.<br />
So wird der „Park für grüne Technologie“ Motor eines regionalen Wirtschaftskreislaufes und<br />
einer planvollen Regionalentwicklung hin zu einer Kompetenzregion auf nationaler und inter-<br />
83
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
nationaler Ebene. Durch den strukturellen Aufbau des Park-Managements ist hierbei die<br />
Rückkopplung mit der Region sowie die gestalterische Einflussnahme der Bevölkerung immer<br />
gegeben und der gesellschaftliche Konsens für den gemeinsamen Weg in die Zukunft<br />
gelegt.<br />
Zusammenfassung<br />
Das Gelände des ehemaligen Munitionslagers Hainhaus bietet gute Voraussetzungen für<br />
den Bau und Betrieb des Biomassehofes Odenwald zur regionalen Vermarktung von Holzbrennstoffen.<br />
Die nötigen örtlichen Voraussetzungen mit infrastruktureller Erschließung, genügend<br />
Entwicklungsfläche und minimiertem Landschaftsplanerischem Konfliktpotenzial sind<br />
äußerst positiv zu bewerten.<br />
Der vergleichbare und etablierte Biomassehof Allgäu kann mit seinen kontinuierlich steigenden<br />
Umsatzzahlen bei wesentlich schlechteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Waldanteil<br />
bei 17 % mit wenig Buchenanteil; kleinere und unkomfortablere Bunker; höherer Kaufpreis<br />
pro Hektar) einen guten Ausblick aus das Entwicklungspotenzial des Biomassehof<br />
Odenwald geben. Mit einem solchen Zentrum für die regionale Vermarktung regenerativer<br />
Holzbrennstoffe kann der <strong>Odenwaldkreis</strong> seinem Anspruch als Kompetenzregion für regenerative<br />
Energien Nachdruck verleihen. Die Kombination aus gestärkter Regionalwirtschaft,<br />
energetischer Versorgungssicherheit und der Verbreitung regenerativer und CO2-neutraler<br />
Brennstoffe unterstützt hierbei die erklärte politische Zielsetzung des Kreises, der Landes-<br />
sowie Bundesregierung. Durch die Synergieeffekte dieser Komponenten entsteht eine „winwin-Situation“<br />
für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette und für die gesamte Region im<br />
Sinne der lokalen Ökonomie.<br />
Kurzfristiges Szenario<br />
Der Hauptmieter wird weiterhin die Pirelli Deutschland GmbH sein. Die 120 Bunker auf dem<br />
Gelände werden auch künftig zur Reifeneinlagerung dienen. Des Weiteren wird das ehemalige<br />
Wachhäuschen im oberen Bereich aktiviert. Hier wird ein Werkschutz installiert, um<br />
den Sicherheitsanforderungen eines Technologie-Parks gerecht zu werden.<br />
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen der Versorgungsinfrastrukur werden begonnen<br />
(elektrische Leitungen, Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Heizung, etc.). Grundlage<br />
hierfür sind die Infrastrukturpläne der Gemeinde Lützelbach. Der Baumbestand auf dem<br />
Teilgebiet von 8 ha wird reduziert. Es ist angedacht, Holzhackschnitzel und weitere Biomasse-Energieträger<br />
wie Stückholz aus dem gefälltem Material herzustellen und an Endverbraucher<br />
direkt vor Ort zu verkaufen.<br />
Mittelfristiges Szenario<br />
Als ersten mittelfristigen Schritt plant die OREG mbH folgende Bauabschnitte:<br />
• Errichtung einer überdachten Lagerstätte für Holzhackschnitzel etc.<br />
• Aufbau einer Unterstellmöglichkeit für die technischen Maschinen<br />
• Instandsetzungsmaßnahmen Betriebsgebäude<br />
• Ausbesserung Versorgungsinfrastruktur<br />
• Inbetriebnahme Biomassehof Odenwald<br />
8. BIOREGIO Holz<br />
Mit einer erfolgreichen Projektbewerbung der rEnergO wurde die Kooperationsgemeinschaft<br />
aus den Kreisen <strong>Odenwaldkreis</strong>, Bergstraße und<br />
Darmstadt-Dieburg in Jahr 2007 mit den Titel "BIOREGIO Holz Odenwald-Bergstraße"<br />
ausgezeichnet.<br />
84
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Dieses Leuchtturmprojekt des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlicher Raum und<br />
Verbraucherschutz hat das Ziel, in ausgewählten Projektregionen systematisch die nachhaltige<br />
Nutzung von Holz-Brennstoffen voranzutreiben.<br />
Hierbei sollen vor allem die Wärmeversorgung von kreiseigenen Liegenschaften auf Holzhackschnitzel-<br />
oder Pelletheizanlagen umgerüstet werden und neue Logistikketten für diese<br />
regenerativen Brennstoffe entstehen.<br />
Die hierbei gesammelten Erfahrungen und Ideen sollen dann in andere hessische Regionen<br />
getragen werden und helfen, die Synergien aus nachhaltiger regionaler Wertschöpfung und<br />
angewandtem Klimaschutz landesweit zu Nutzen.<br />
9. CLEO<br />
Das „Cluster erneuerbare Energien <strong>Odenwaldkreis</strong>" ist eine internetbasierte<br />
Datenbank der rEnergO, in der regionale Firmen aus den Branchen<br />
erneuerbare Energien, nachwachsende Rohstoffe und Energie-<br />
Effizienz zusammengefasst werden. Der Grundgedanke war, dem Endverbraucher<br />
einen schnellen und umfassenden Überblick der regionalen<br />
Dienstleistungen zu verschaffen. So konnten Wertschöpfungspotenziale auf dem Gebiet<br />
der erneuerbaren Energien in der Region gehalten werden und der Branche wurde die Möglichkeit<br />
gegeben, eine überregionale Kompetenz zu entwickeln.<br />
Für dieses Konzept wurde das CLEO 2008 mit einer Auszeichnung beim 1. Clusterwettbewerb<br />
des Landes Hessen belohnt. Im Projektzeitraum 2009 bis 2011 fördert das hessische<br />
Wirtschaftsministerium nun den Ausbau zu einem echten Wirtschaftscluster, in dem neue<br />
Firmenkooperationen, der Wissenstransfer und die Nutzung von Synergieeffekten von einem<br />
professionellen Clustermanagement moderiert werden. www.odenwald-biomasse.de<br />
10. Rai-Breitenbach<br />
Der Breuberger Ortsteil Rai-Breitenbach ist seit 2007 Bioenergiedorf und<br />
versorgt sich seit August 2008 über ein Nahwärmenetz aus einer gemeinschaftlichen<br />
Anlage auf Basis erneuerbarere Energien<br />
(www.bioenergiedorf-odenwald.de). Der <strong>Odenwaldkreis</strong> ist Mitglied des<br />
genossenschaftlich organisierten Bioenergiedorfs und mit der Georg-<br />
Ackermann-Schule und der Breuberg-Schule der größte Abnehmer.<br />
11. Niederschlagswassernutzung<br />
Gemäß § 42 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz soll insbesondere Niederschlagswasser verwertet<br />
werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.<br />
So kann zum Beispiel nicht verunreinigtes Niederschlagswasser der Dachflächen versickert<br />
werden. Alternativ kann es auch in einer Zisterne oder einem sonstigen Behälter aufgefangen<br />
und zum Beispiel für Tränk- und Beregnungszwecke, aber auch für die Hausinstallation<br />
(Toilette, Dusche, Waschmaschine etc.) genutzt werden. Die jeweilige Abwassersatzung<br />
ist zu beachten. Eine weitere Möglichkeit ist die unmittelbare Einleitung in ein Fließgewässer.<br />
Durch die genannten Möglichkeiten kann der Wasserverbrauch gesenkt werden. Ein Vorteil<br />
bei einer Versickerung und Gewässereinleitung liegt darin, dass das Wasser unmittelbar<br />
85
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. Darüber hinausgehende Flächen, bei denen<br />
davon auszugehen ist, dass das Niederschlagswasser verunreinigt ist (zum Beispiel gewerbliche<br />
Flächen, größere Anzahl von Stellplätzen usw.), ist im Regelfall bei der Versickerung<br />
oder Gewässereinleitung eine Aufbereitung erforderlich. Zudem ist eine wasserrechtliche<br />
Erlaubnis zu beantragen. Es ist empfehlenswert, dieses Wasser der Kläranlage zuzuführen.<br />
12. Wasserkraftnutzung<br />
In Deutschland werden Kraftwerke von weniger als 1 MW als Kleinwasserkraftanlagen bezeichnet.<br />
In der Regel handelt es sich dabei um turbinenbetriebene Kraftwerke deutlich geringerer<br />
Ausbauleistung. Die Ausbauleistungen bei Anlagen mit Wasserrädern bleiben i. d.<br />
R. unter 10 kWel.<br />
Der Hessische Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung führte bezüglich der<br />
Wasserkraftnutzung in Hessen am 20.07.2006 (Drucksache 16/5485) Folgendes aus:<br />
„Ein nennenswerter Ausbau der Wasserkraft hat in den letzten Jahren nicht stattgefunden,<br />
denn bereits Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich ab, dass das reaktivierbare Potenzial (...)<br />
in Hessen weitestgehend ausgeschöpft war. (...) aus heutiger Sicht scheint ein weiterer Ausbau<br />
der Wasserkraft in Hessen allenfalls beschränkt möglich.“<br />
Für den <strong>Odenwaldkreis</strong> sind 23 Anlagen dokumentiert, von denen 22 aktuell in Betrieb sind.<br />
Detaillierte Angaben zu Nennleistungen etc. liegen in zusammengestellter Form nicht vor.<br />
Sieben Anlagen können zu den vergleichsweise leistungsstärkeren Turbinen gerechnet werden.<br />
Bei den übrigen handelt es sich zumeist um Turbinen unterer Nennleistungen und<br />
einige wenige Wasserräder. Nach Angaben der HSE lag die von allen Wasserkraftanlagen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> eingespeiste Strommenge bei 1.217 MWh.<br />
Die Anlage am Marbacher Stausee ist mit max. 75 kW eine der leistungsstärkeren im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Diese Anlage wird seit 1993 vom Wasserverband Mümling und der HEAG 42 Darmstadt<br />
betrieben. Die erzeugte Energie wird für die Versorgung der Anlagen des Wasserverbandes<br />
(Betriebsgebäude, Rückhaltebecken) genutzt. Die überschüssige Energie wird in das<br />
Netz der HEAG eingespeist.<br />
Wasserkraftanlagen sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> an nahezu allen möglichen Standorten installiert.<br />
Gemäß des Energiekonzeptes <strong>Odenwaldkreis</strong> 43 wird jedoch von einer nur sehr geringen<br />
Steigerungsmöglichkeit der Wasserkraftverstromung ausgegangen. Dieses Potenzial gilt es<br />
zu nutzen.<br />
Neben der Wasserkraftanlage des Wasserverbandes Mümling gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
weitere kleinere Anlagen hauptsächlich an den größeren Gewässern. Im Wesentlichen werden<br />
hier Turbinen (zum Beispiel Kaplan- und Francis-Turbinen) zur Wasserkraftnutzung<br />
zwecks Stromerzeugung eingesetzt. Exemplarisch sei genannt<br />
• die Spatmühle in Breuberg, Ortsteil Hainstadt<br />
• die Rosenbacher Mühle in Breuberg, Ortsteil Rosenbach<br />
• die Killinger Mühle in Breuberg, Ortsteil Neustadt<br />
• Lutzmühle in Höchst i. Odw.<br />
• die Wasserkraftanlage Schönnen in Erbach, Ortsteil Schönnen<br />
• die Wasserkraftanlage am Ebersberger Hammer in Erbach, Ortsteil Ebersberg<br />
• die Herrenmühle in Reichelsheim (Odenwald)<br />
42 HEAG: Hessische Elektrizitäts-AG, 64283 Darmstadt<br />
43 Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong>, Grunddaten und Optionen für den Ausbau der Nutzung erneuerba-<br />
rer Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong>, Dezember 2007<br />
86
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Lediglich bei wenigen Mühlen werden auch (oberschlächtige) Wasserräder zur Strom-erzeugung<br />
genutzt:<br />
• Köppelsmühle in Beerfelden, Ortsteil Falkengesäß<br />
• Mühle der Familie Klingler in Unter-Mossau<br />
Im Laufe der Zeit sind jedoch viele Mühlen stillgelegt worden und die alten Wasserrechte<br />
verfallen bzw. aufgegeben worden. Die alten Mühlgräben und Bauwerke sind auch heute<br />
teilweise in der Landschaft noch zu erkennen.<br />
Weiterhin gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong> günstige Standortbedingungen (z. B. in Bezug auf Fallhöhe,<br />
Wasserdargebot usw.) für eine Wasserkraftnutzung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass<br />
neue Wasserkraftanlagen häufig nicht (durch das Regierungspräsidium Darmstadt) genehmigungsfähig<br />
sind.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Koordinierungsstelle „Biomasse“<br />
• Amt für den ländlichen Raum (ALR) des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in Reichelsheim (Odenwald)<br />
• rEnergO GmbH (Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien im Odenwald)<br />
• Bau- und Immobilienmanagement Odenwald<br />
• Kommunen<br />
• Bioenergiedorf Rai-Breitenbach<br />
• Wasserverbände<br />
87
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5.2. Wasserversorgung/Trinkwasserschutzgebiete<br />
Oberflächengewässer<br />
Einteilung der Gewässer/Unterhaltungspflicht<br />
Die Oberflächengewässer (Bäche, Flüsse) werden unterteilt in die Gewässer erster, zweiter<br />
und dritter Ordnung. Die Mümling ab Einmündung des Marbaches sowie die Gersprenz ab<br />
Einmündung des Osterbaches werden als Gewässer zweiter Ordnung eingeordnet, alle anderen<br />
Gewässer des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sind Gewässer dritter Ordnung.<br />
Die Unterhaltungspflicht an den Gewässern liegt bei den 15 Anliegergemeinden des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Um große Aufgaben (z. B. Errichtung und Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken)<br />
umsetzen zu können, haben sich die Kommunen teilweise zu Wasserverbänden<br />
(Unterhaltungsverbänden) zusammengeschlossen.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es insgesamt zwei Wasserverbände:<br />
Wasserverband Mümling<br />
Im Auftrage des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde im Jahre 1968 ein genereller Entwurf<br />
für die Abflussregelung im Niederschlagsgebiet der Mümling erstellt. In diesem Entwurf<br />
sind Maßnahmen untersucht und vorgeschlagen, die sowohl schadbringende Überschwemmungen<br />
landwirtschaftlich genutzter Flächen verhüten als auch geschlossene Bebauungsgebiete<br />
vor Hochwasser schützen. Diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die<br />
Abflussregelung in ihrer wirtschaftlichen Form nur durch eine Kombination von Hochwasserrückhalteanlagen<br />
und Gewässerausbaumaßnahmen erfolgen kann. Der erste Verbandsplan<br />
sah den Bau von sechs Hochwasserrückhaltebecken und den Ausbau von weiteren Teilen<br />
der Mümling vor.<br />
Für die größeren Hochwasserschutzziele werden zur Vergrößerung der natürlichen Überschwemmungsgebiete<br />
auch weiterhin bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig<br />
sein. Diese großen Aufgaben können von einer Stadt oder Gemeinde alleine nicht übernommen<br />
werden. Als Träger für die Umsetzung dieser vorgesehenen Maßnahmen wurde<br />
daher am 16. April 1970 der Wasserverband Mümling gegründet.<br />
Der Verband verfügt über einen Verbandsvorsteher, einen stellvertretenden Verbandsvorsteher<br />
und die Geschäftsführung.<br />
Aufgaben und Ziele sind der Ausbau – einschließlich naturnahem Rückbau – und Unterhaltung<br />
der Verbandsgewässer sowie der Bau und das Betreiben geeigneter Hochwasserschutzeinrichtungen.<br />
Der Verband kann darüber hinaus auch weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen übernehmen,<br />
soweit sie Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz sein können.<br />
Neben dem Hochwasserschutz ist die Gewässerunterhaltung und Pflege eine der Hauptaufgaben<br />
des Wasserverbandes. Die auszuführenden Maßnahmen gliedern sich in regelmäßig<br />
wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten und in unregelmäßig wiederkehrende Arbeiten.<br />
Dem Wasserverband Mümling gehören folgende zwölf Verbandsgewässer an:<br />
• Walterbach, von der Brücke bei der alten Kläranlage Beerfelden bis zum Beginn der<br />
Mümling bei Hetzbach<br />
• Mümling, vom Beginn bei Hetzbach bis zur hessischen-bayerischen Landesgrenze (Die<br />
Ortsmitte von Erbach wird von der Stadt Erbach betreut)<br />
88
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• Mossaubach, von der Brücke auf Höhe der Brauerei Schmucker bis zur Mündung in den<br />
Marbach<br />
• Marbach, von der Brücke auf Höhe des Firmengeländes Brohm bis zur Mündung in die<br />
Mümling<br />
• Erdbach, ab den Teichen im Dreiseental bis zur Mündung in die Mümling<br />
• Waldbach, ab der Brücke bei der Heuselsmühle bis zur Mündung in die Mümling<br />
• Brombach, Beginn in freier Gemarkung, oberhalb des Erholungsheimes Brombachtal, bis<br />
zur Mündung in die Mümling<br />
• Kimbach, Beginn auf der Höhe der Brunnen der Stadt Bad König (Höhe Pegel) bis zur<br />
Mündung in die Mümling<br />
• Kinzig, ab der Brücke oberhalb von Nieder-Kinzig bis zur Mündung in die Mümling<br />
• Oberhöchster Bach, ab Zusammenfluss Annelsbach und Oberhöchster Bach bis zur Mündung<br />
in die Mümling<br />
• Lützelbach, ab Brücke L3259 in Lützelbach bis zur Mündung in den Breitenbach<br />
• Breitenbach, Beginn am Ende der Verdolung in Breitenbrunn bis zur Mündung in die<br />
Mümling<br />
Der Verband unterhält die Retentionsräume Zell und das Hochwasserrückhaltebecken Marbach.<br />
Retentionsraum Zell:<br />
Aufgrund einer Untersuchung des Niederschlagsgebietes der Mümling wurde die Schaffung<br />
eines Hochwasserrückhalteraumes zwischen Asselbrunn und Zell vorgenommen. Die Planungen<br />
wurden im Jahr 2001 begonnen und die Baumaßnahme ist Anfang 2008 fertig gestellt<br />
worden. Es handelt sich um die Errichtung einer ca. 5,80 m hohen Verwallung, quer<br />
zum Tal. Das Volumen des Dammes beträgt etwa 12.000 m³, bei einer Länge von nahezu<br />
240 m. Durch diese Maßnahme wird ein Rückhaltevolumen von ca. 200.000 m³ aktiviert.<br />
Geplante Maßnahmen:<br />
Retentionsraum Schönnen<br />
Der Retentionsraum Schönnen soll oberhalb der Bundesstraßenbrücke, auf Ebersberger<br />
Gemarkung, entstehen. Auch hier soll durch einen höheren Einstau im vorhandenen Überschwemmungsgebiet<br />
ein zusätzlicher Rückhalt geschaffen werden.<br />
Im Einzugsgebiet des Marbaches befindet sich das Hochwasserrückhaltebecken Marbach.<br />
Mit diesem werden die Abflussspitzen eines ca. 56 km² großen Gebietes kontrolliert.<br />
Der Retentionsraum Schönnen dient zur Pufferung der Spitzenabflüsse aus dem Einzugsgebiet<br />
von Walterbach und Mümling bis zur Sperrstelle. Nach derzeitiger Planung soll ein ca. 5<br />
m hoher Wall ein zusätzliches Rückhaltevolumen von etwa 80.000 m³ aktivieren.<br />
Geplanter Baubeginn ist 2011.<br />
Wasserverband Gersprenzgebiet<br />
Am 12. Mai 1971 wurde der Wasserverband Gersprenzgebiet gegründet. Der Verband ist ein<br />
Wasser- und Bodenverband nach dem Wasserverbandsgesetz. Er ist eine Körperschaft des<br />
öffentlichen Rechts. Dem Wasserverband Gersprenzgebiet gehören 21 Städte und Gemeinden<br />
sowie der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der <strong>Odenwaldkreis</strong> als Mitglieder an.<br />
Mitglieder des Verbandes sind:<br />
1. Babenhausen<br />
2. Brensbach<br />
3. Dieburg<br />
4. Eppertshausen<br />
5. Fischbachtal<br />
6. Fränkisch-Crumbach<br />
7. Fürth / Odw.<br />
89
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
8. Groß-Bieberau<br />
9. Groß-Umstadt<br />
10. Groß-Zimmern<br />
11. Lindenfels<br />
12. Mainhausen<br />
13. Modautal<br />
14. Münster<br />
15. Ober-Ramstadt<br />
16. Otzberg<br />
17. Reichelsheim (Odenwald)<br />
18. Reinheim<br />
19. Roßdorf<br />
20. Rödermark<br />
21. Schaafheim<br />
sowie der <strong>Odenwaldkreis</strong> und der Landkreis Darmstadt Dieburg.<br />
Der Verband verwaltet sich selbst unter eigener Verantwortung durch seine Organe (Verbandsversammlung/Verbandsvorstand).<br />
Der Wasserverband Gersprenzgebiet hat mit dem<br />
Wasserverband Mümling einen Kooperationsvertrag geschlossen und dem Geschäftsführer<br />
des Wasserverbandes Gersprenzgebiet auch die Geschäftsführung beim Wasserverband<br />
Mümling übertragen. Ziel der getroffenen Kooperation war die Schaffung und der Betrieb<br />
einer gemeinsamen Geschäftsstelle.<br />
Aufgaben und Ziele:<br />
• Ausbau, einschließlich naturnahem Rückbau und Unterhaltung der Verbandgewässer<br />
• geeignete Hochwassereinrichtungen bauen und betreiben (wie beispielsweise zwischen<br />
Wersau und Groß-Bieberau an der Gersprenz)<br />
• Der Verband kann darüber hinaus auch weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen übernehmen,<br />
soweit sie Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz sein können.<br />
Geplante Maßnahmen:<br />
Aktivierung von Retentionsraum an der Gersprenz in der Gemarkung Reichelsheim-Bockenrod<br />
Für den Standort Reichelsheim-Bockenrod wurden auf der Grundlage der vorliegenden konzeptionellen<br />
Planung zunächst eine Vorplanung und eine Baugrunduntersuchung durchgeführt.<br />
Im Jahre 2001 wurde vom Wasserverband Gersprenzgebiet ein Ingenieurbüro mit der<br />
Vorplanung, Baugrunduntersuchung und einer ergänzenden Vermessung des geplanten<br />
Retentionsraumes beauftragt. Die Vorstellung der Maßnahme erfolgte im Januar 2003 in der<br />
Reichenberghalle in Reichelsheim (Odenwald).<br />
Der Vorstand des Wasserverbandes Gersprenzgebiet hat zwei Ingenieurbüros mit der<br />
Durchführung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die wasserbaulichen und landschaftspflegerischen<br />
Leistungen beauftragt.<br />
Baubeginn der Maßnahme war Sommer 2008 (Ende: voraussichtlich 2010).<br />
Überschwemmungsgebiet/Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind folgende Überschwemmungsgebiete festgestellt:<br />
• Mergbach/Gersprenz (StAnz. 7/2002 S. 778),<br />
• Mümling (StAnz. 52/53 2001 S. 4780),<br />
• Marbach (StAnz. 28/2007 S. 1361) und<br />
• Falkengesäßerbach/Finkenbach (StAnz. 25/2008 S. 1576).<br />
90
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Ferner liegen Arbeitskarten der Wasserwirtschaftsverwaltung mit Darstellung von Überschwemmungsgebieten<br />
vor für den<br />
• Mossaubach (StAnz9/2006 S. 532)<br />
• Waldbach (StAnz. 22/2008 S. 1385).<br />
Mit einer Feststellung der in den Arbeitskarten aufgeführten Überschwemmungsgebiete<br />
durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt<br />
ist in den nächsten Jahren zu rechnen.<br />
Die Überschwemmungsgebietskarten können unter anderem bei den Gewässer anliegenden<br />
Kommunen, bei der Wasserbehörde beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sowie beim<br />
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt eingesehen<br />
werden.<br />
Zu den Überschwemmungsgebieten zählen auch die Staubereiche der Talsperren und Rückhaltebecken<br />
(Retentionsräume).<br />
Bauen und Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet<br />
Für Bauvorhaben und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten ist eine wasserrechtliche<br />
Genehmigung nach § 14 Hessisches Wassergesetz 44 – HWG – erforderlich. Eine wasserrechtliche<br />
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr<br />
und im Rahmen der Eigenvorsorge entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen sind, der<br />
ordnungsgemäße Wasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt<br />
ist und keine Gefahren für die Gewässerqualität zu erwarten sind. Es gibt keinen<br />
Rechtsanspruch auf eine wasserrechtliche Genehmigung. Über mögliche Einschränkungen<br />
und Verbote (zum Beispiel Festmistlagerung) im Überschwemmungsgebiet gibt die Wasserbehörde<br />
beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es Auskunft.<br />
Hochwasseralarmplan<br />
Die Wasserbehörde beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es hat für die Mümling eine<br />
Hochwasserdienstordnung 45 (HWDO) aufgestellt. Die HWDO umfasst ein Melde- und Warnsystem,<br />
das dem Zweck dient, durch entsprechende Meldungen Sicherheitsvorkehrungen zu<br />
veranlassen und somit die Bevölkerung und hochwassergefährdete Einrichtungen vor vermeidbaren<br />
Hochwasserschäden zu schützen. Sie gilt für die Mümling bis zur Landesgrenze<br />
(Bundesland Bayern) in der Gemarkung Hainstadt der Stadt Breuberg. Eine Warnung der<br />
Unterlieger unterhalb Hainstadt wird vom Landratsamt Miltenberg übernommen und geregelt.<br />
In Abhängigkeit von den Wasserständen ist das Hochwassermelde- und Warnsystem in drei<br />
Alarmstufen gegliedert:<br />
Alarmstufe I = Beginn des Hochwasserdienstes<br />
Alarmstufe II = Größeres Hochwasser, Gefahr für mehrere Gebiete<br />
Alarmstufe III = Katastrophenhochwasser<br />
Zur Ermittlung der Wasserstände können die Pegel Ebersberg, Michelstadt und Hainstadt<br />
herangezogen werden.<br />
Wasserversorgung:<br />
Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßiger und chemischer<br />
Zustand erricht wird und ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwas-<br />
44 Hessisches Wassergesetz (HWG) – GVBl. II 85-61 – vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305)<br />
45 Hochwasserdienstordnung (HWDO) für den dezentralen Hochwasserdienst der Mümling des Landrats<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es vom 24.01.2002 (Stand: September 2005)<br />
91
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
serneubildung gewährleistet ist (32 Abs. 1 HWG). Dabei hat die öffentliche Wasserversorgung<br />
Vorrang vor allen anderen Benutzungen.<br />
Gemäß § 39 Abs. 1 HWG haben die Gemeinden in Ihrem Gebiet die Bevölkerung und die<br />
gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Trink- und Betriebswasser zu<br />
versorgen. Sie können diese Verpflichtung nach § 39 Abs. 2 HWG auch auf andere öffentlich-rechtliche<br />
Körperschaften oder privater Dritte übertragen (z. B. an die HEAG Südhessische<br />
Energie AG, Darmstadt für die Stadt Erbach) oder Wasser- / Zweckverbände (z. B.<br />
Stadtwerke Michelstadt GmbH) bilden. Die hygienische Überwachung der einzelnen Wasserversorgungsanlagen<br />
obliegt dem Kreisgesundheitsamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es (Trinkwasserverordnung<br />
46 – TringwV von 2001).<br />
Schutzgebiete<br />
Zum Schutz der Wassergewinnungsanlagen vor Verunreinigungen bzw. schädlichen Einwirkungen<br />
werden Trinkwasserschutzgebiete festgestellt. Die Art und Beschaffenheit des<br />
Grundwasserleiters, der Grundwassertiefe sowie Mächtigkeit und Dichte der Deckschichten<br />
haben Auswirkung auf die Größe des Trinkwasserschutzgebietes. Die entsprechenden<br />
Trinkwasserverordnungen unterscheiden im Regelfall drei Schutzzonen<br />
Zone I Fassungsbereich/Brunnen<br />
Zone II engere Schutzzone<br />
Zone III weitere Schutzzone<br />
Je nach Trinkwasserzone sind Maßnahmen und Handlungen im Trinkwasserschutzgebiet<br />
verboten (z. B. die Intensivbeweidung, die Anlage von Fischteichen, Dränen und Vorflutgräben,<br />
verletzen der belebten Bodenschicht usw.). Die Verbote sind der entsprechenden<br />
Trinkwasserschutzgebietsverordnung zu entnehmen.<br />
In der Stadt Bad König ist zudem ein quantitatives Heilquellenschutzgebiet ausgewiesen.<br />
Maßnahmen in der ersten und zweiten Zone bedürfen in Abhängigkeit von der Eingriffstiefe<br />
eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Auskunft über die Trinkwassergebiete bzw. das Heilquellenschutzgebiet geben die Kommunen<br />
oder die Wasserbehörde beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Untere Wasserbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Wasserverband Mümling<br />
• Wasserverband Gersprenzgebiet)<br />
• Regierungspräsidium Darmstadt<br />
46 Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung<br />
– TrinkwV 2001) vom 21.05.2001 (BGBl. I S. 959), geändert durch Artikel 363 der Verordnung vom<br />
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407)<br />
92
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
5.3. Abwasser<br />
Abwasser ist das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwasser),<br />
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder künstlich befestigten<br />
Flächen abfließende Wasser (Niederschlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit<br />
Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in Abwasseranlagen abfließende Wasser (§ 42<br />
Abs. 1 HWG).<br />
Der Gemeinde obliegt bis auf die im § 43 Abs. 4 HWG genannten Ausnahmen die Abwasserbeseitigungspflicht.<br />
Die Kommunen haben für ihr Gebiet eine Abwassersatzung erstellt.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind folgende Kläranlagen vorhanden:<br />
• Kläranlage Hainstadt des Abwasserverbandes Unterzent<br />
• Kläranlage Brensbach des Abwasserverbandes Obere Gersprenz<br />
• Kläranlage Michelstadt–Asselbrunn des Abwasserverbandes Mittlere Mümling<br />
• Kläranlage in Mümling-Grumbach des Abwasserverbandes Bad König<br />
• Kläranlage Bullau der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung des Kreisstadt Erbach<br />
• Kläranlage Rossbach der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung des Kreisstadt Erbach<br />
• Kläranlage Würzberg der Stadt Michelstadt<br />
• Kläranlage Weiten-Gesäß der Stadt Michelstadt<br />
• Kläranlage Hüttenthal der Gemeinde Mossautal<br />
• Kläranlage Hebstahl der Gemeinde Sensbachtal.<br />
In seltenen Fällen (z. B. weit außerhalb liegende Anwesen) können auch Kleinkläranlagen<br />
betrieben werden.<br />
Aufgrund der Topographie und Nähe zur Kreisgrenze/Landesgrenze wird Abwasser von bestimmten<br />
Gemeinden (z. B. Hesseneck, Rothenberg) bzw. Ortsteilen (z. B. Haingrund,<br />
Seckmauern, Hassenroth) auch Kläranlagen außerhalb des <strong>Odenwaldkreis</strong>es zugeführt.<br />
Zu den oben genannten Kläranlagen sind auch Firmenkläranlagen vorhanden (z. B.<br />
Schlachthof Betriebsgesellschaft mbH, Brensbach oder Odenwaldfrüchte GmbH, Breuberg).<br />
Eine Ausnahme bilden zudem die Verwertung von häuslichem Abwasser im Rahmen der<br />
Landwirtschaft.<br />
Gewerbliches Abwasser aus bestimmten Bereich (z. B. mineralölhaltiges Abwasser, Abwasser<br />
aus Wäschereien und Zahnartpraxen) müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um in<br />
die Kanalnetze bzw. in das Gewässer eingeleitet zu werden.<br />
Die Einleitebedingungen für Abwasser sind der Abwasserverordnung zu entnehmen.<br />
Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden die Kläranlagen und Kanalnetze periodisch<br />
überprüft.<br />
Odenwälder Wasser- und Abwasser-Service GmbH (OWAS)<br />
Die Odenwälder Abwasserverbände, die Stadtwerke Michelstadt, der<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> und die Entsorgungs-Aktiengesellschaft Darmstadt<br />
(EAG) haben 1994 die OWAS gegründet. Die OWAS, mit Sitz in Erbach,<br />
erbringt Laborleistungen im Trinkwasserbereich, prüft entsprechend der Eigenkontrollverordnung<br />
und nimmt Einleiterkontrollen vor. Weiterhin übernimmt die Gesellschaft auch<br />
Dienstleistungen des kommunalen Umweltschutzes.<br />
93
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Regelmäßig prüft die OWAS die Wasserqualität der Schulschwimmbäder des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
sowie das Trink- bzw. Duschwasser auf Einhalten der Grenzwerte für z. B. Legionellen.<br />
5.4. Anlagenbezogener Gewässerschutz<br />
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen den gesetzlichen (z. B.<br />
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 47 , Abwasserverordnung (AbwV) 48 , Anlagenverordnung-<br />
VAwS 49 ) und technischen Vorgaben (DIN, DIN-EN) entsprechen. Zu den wassergefährdenden<br />
Stoffen zählen unter anderem Heizöle, Betriebsöle, Altöle, Benzine, Diesel, Emmulsionen,<br />
aber auch Jauche, Gülle, Silagesickersäfte und Festmist. Die Stoffe werden in Wassergefährdungsklassen<br />
eingeordnet. In Abhängigkeit von der Lagermenge, Wassergefährdungsklasse<br />
und Standort (Schutzgebiet, oberirdisch/unterirdisch) sind die Lagerungen bei<br />
der Wasserbehörde beim Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es anzuzeigen und durch eine<br />
sachverständige Stelle zu überprüfen.<br />
Die vielfältigen Aufgaben der Unteren Wasserbehörde umfassen auch die Überwachung der<br />
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (vom einfachen Heizöltank bis hin zur Tankstelle).<br />
Die Anpassung der Lagerqualität an den neuesten Stand der Technik ist dabei unverzichtbar<br />
und muss, wenn es nicht freiwillig geschieht, durch die Behörde durchgesetzt werden.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind 25.049 Anlagen zur Lagerung mit wassergefährdeten Stoffen<br />
erfasst. Wenn wassergefährdende Stoffe ausgelaufen sind, muss der Schaden eingegrenzt,<br />
behoben und die ordnungsgemäße Beseitigung des angefallenen Schadpotenzials veranlasst<br />
werden. Die Gefahr für das Gewässer (Oberflächen- und Grundwasser) ist auszuschließen,<br />
zumindest aber zu minimieren.<br />
5.5. Bodenschutz<br />
Der Boden ist die oberste Schicht der Erdkruste einschließlich der flüssigen und gasförmigen<br />
Bestandteile. Er ist Lebensgrundlage für Mensch, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,<br />
Bestandteil des Naturhaushalts sowie Filter und Puffer. Die Funktion des Bodens ist zu<br />
sichern oder wiederherzustellen. Dabei sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren,<br />
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren<br />
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen (Bundes-Bodenschutzgesetz<br />
50 ). Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen<br />
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit<br />
wie möglich vermieden werden.<br />
Die Untere Wasserbehörde hat einen Gewässer- und Bodenschutz-Alarmplan aufgestellt,<br />
der regelmäßig aktualisiert wird. Zweck des Gewässer- und Bodenschutz-Alarmplans ist die<br />
schnelle Information von Behörden und Betroffenen bei Unfällen, Betriebsstörungen und<br />
sonstigen Ereignissen, bei denen umweltgefährdende Stoffe freigesetzt werden und eine<br />
47 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes<br />
vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666)<br />
48 Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung<br />
– AbwV), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), geändert<br />
durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2461)<br />
49 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe<br />
(Anlagenverordnung – VAwS) vom 18.01.2006, geändert durch Verordnung vom 15. Februar 2008<br />
(GVBl Nr. 2/2006, S. 63 mit den Änderungen GVBl Nr. 4/2008, S. 65)<br />
50 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz<br />
– BbodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel<br />
3 des Gesetzes vom 09.12.2004 (BGBl. I S. 3214)<br />
94
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
akute Gefahr für Oberflächengewässer, Boden und Grundwasser besteht. Der Alarmplan gilt<br />
auch für Veränderungen der Gewässerzustände, die zu einer Schädigung der Gewässerbiozönose<br />
(Fischsterben) führen.<br />
5.6. Abfallentsorgung<br />
Rechtsgrundlagen: Das Land Hessen stellt den Abfallwirtschaftsplan auf. Europarechtliche<br />
Grundlage für Abfallwirtschaftspläne ist Artikel 7 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über<br />
Abfälle (Abfallrahmenrichtlinie - geändert durch Richtlinie 91/156/EWG und Richtlinie<br />
91/692/EWG), wonach die zuständigen Behörden zur Verwirklichung der Ziele der Abfallrahmenrichtlinie<br />
Abfallbewirtschaftungspläne aufzustellen haben. Mit § 29 KrW-/AbfG 51 wurden<br />
diese Bestimmungen in nationales Recht umgesetzt.<br />
Der Abfallwirtschaftsplan Hessen wird nach überörtlichen Gesichtspunkten aufgestellt. Dargestellt<br />
werden u. a. die Ziele der Abfallvermeidung und -verwertung sowie die zur Sicherung<br />
der Inlandsbeseitigung erforderlichen Abfallbeseitigungsanlagen.<br />
Der Abfallwirtschaftsplan weist die zugelassenen Abfallbehandlungsanlagen und geeignete<br />
Flächen für Beseitigungsanlagen zur Endablagerung von Abfällen (Deponien) sowie für<br />
sonstige Abfallbeseitigungsanlagen aus.<br />
Der Plan kann ferner den Entsorgungsträger bestimmen und festlegen, welcher Abfallbeseitigungsanlage<br />
sich die Beseitigungspflichtigen zu bedienen haben. Ergänzende Regelungen<br />
zu § 29 KrW-/AbfG trifft § 16 HAKA 52 .<br />
Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien<br />
Städte und die Landkreise. Die kreisangehörigen Gemeinden und die kreisfreien<br />
Städte haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle einzusammeln.<br />
Innerhalb ihres Gebietes obliegt die erforderliche Beförderung dieser Abfälle den kreisangehörigen<br />
Gemeinden. Die Landkreise und kreisfreien Städte (Entsorgungspflichtige) haben die<br />
in ihrem Gebiet eingesammelten oder in ihrem Gebiet angefallene und ihnen angelieferte<br />
Abfälle nach Maßgabe des § 15 des KrW-/AbfG zu verwerten oder zu beseitigen.<br />
Die Entsorgungspflichtigen haben ferner bestimmte Abfälle getrennt einzusammeln, zu befördern<br />
und einer geeigneten Stelle anzudienen, soweit sie nicht selbst zu einer Verwertung<br />
in der Lage sind.<br />
Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die notwendigen<br />
Sammelsysteme, Einrichtungen und Anlagen zu schaffen oder bereitzuhalten. Im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> haben sich alle 15 Kommunen im Müllabfuhrzweckverband zusammengeschlossen,<br />
der Landrat des <strong>Odenwaldkreis</strong>es nimmt mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen<br />
teil. Der MZVO 53 ist seit 1998 seinerseits Mitglied im Zweckverband<br />
Abfallverwertung Südhessen, wodurch die Verwertung und Deponierung von Abfällen aus<br />
dem Kreis auch nach der Schließung der Deponie Kirchbrombach gesichert ist.<br />
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger regeln durch Satzung den Anschluss der<br />
Grundstücke an die Sammelsysteme, Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung und<br />
51 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung<br />
von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I<br />
S. 2705), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462)<br />
52 Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA) in der Fassung<br />
vom 20. Juli 2004 (GVBl. I S. 252), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember<br />
2006 (GVBl. I S. 619)<br />
53 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (MZVO), www.mzvo.de<br />
95
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
deren Benutzung. Sie regeln ferner durch Satzung, unter welchen Voraussetzungen, in welcher<br />
Weise, an welchem Ort und zu welcher Zeit ihnen die Abfälle zu überlassen sind. Dabei<br />
kann ein Mindestbehältervolumen oder eine Mindestanzahl von Einsammlungen festgelegt<br />
werden.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Untere Wasserbehörde<br />
• Wasserverbände<br />
• Städte und Gemeinden, <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Odenwälder Wasser- und Abwasser-Service GmbH (OWAS)<br />
• Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (MZVO)<br />
96
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
6. Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen<br />
6.1. Feuerwehrwesen<br />
Feuerwehrwesen umfasst die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und<br />
Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen<br />
(Technische Hilfe), die Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender<br />
Brandschutz) und die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Die Landkreise haben nach § 4<br />
HBKG 54 folgende Verpflichtungen:<br />
„(1) Die Landkreise haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen<br />
Hilfe<br />
1. die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des<br />
Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten und zu unterstützen,<br />
2. Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe<br />
im Kreisgebiet zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren zu planen und die bei<br />
Durchführung der Maßnahmen gegenüber den örtlichen Bedürfnissen anfallenden<br />
Mehrkosten einschließlich der Unterhaltungskosten mit Ausnahme der Personalkosten<br />
zu tragen,<br />
3. die Brandschutzerziehung zu planen und zu fördern,<br />
4. Alarmpläne und Einsatzpläne für die Gewährung nachbarlicher Hilfeleistung innerhalb<br />
und über die Grenzen des Kreisgebietes hinaus aufzustellen und mit den benachbarten<br />
Landkreisen oder kreisfreien Städten abzustimmen,<br />
5. gemeinsame Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen der Feuerwehren<br />
im Landkreis oder im Einvernehmen mit benachbarten Landkreisen oder kreisfreien<br />
Städten zu planen und durchzuführen,<br />
6. eine ständig erreichbare und betriebsbereite gemeinsame Leitstelle (Zentrale Leitstelle)<br />
für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst<br />
einzurichten und zu betreiben.<br />
(2) Die Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und<br />
des Katastrophenschutzes sollen organisatorisch zusammengefasst werden.“<br />
Die Gemeinden, die von den Landkreisen unterstützt werden sollen, haben nach § 3 HBKG<br />
• eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Landkreisen zu erarbeiten,<br />
fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende<br />
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen<br />
• für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen,<br />
• Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen,<br />
fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen,<br />
• für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen,<br />
• Notrufmöglichkeiten und Brandmeldeanlagen einzurichten, an die zuständige Zentrale<br />
Leitstelle anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung<br />
der Bevölkerung sicherzustellen,<br />
• den Selbstschutz der Bevölkerung und die Brandschutzerziehung zu fördern.<br />
„(2) Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an<br />
jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung<br />
wirksame Hilfe einleiten kann.“<br />
54 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz<br />
(HBKG) GVBl. II 312-22 vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch Artikel 1<br />
des Gesetzes vom 15. November 2007 (GVBl. I S. 757)<br />
97
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Der Brandschutz ist gekennzeichnet durch ein ganzes Bündel von Auflagen und Vorschriften,<br />
um die Entstehung und Ausbreitung von Bränden in Gebäuden zu verhindern sowie im<br />
Ernstfall eine schnelle Rettung und effektive Löscharbeiten zu gewährleisten. Als Generalklausel<br />
für den Brandschutz gelten die für das jeweilige Bundesland spezifischen Anforderungen<br />
der einzelnen Landesbauordnungen. Darin ist festgelegt, dass Gebäude hinsichtlich<br />
ihres Brandschutzes folgenden Anforderungen genügen müssen:<br />
1. Der Entstehung eines Brandes muss vorgebeugt werden.<br />
2. Bricht trotz präventiver Maßnahmen ein Brand aus, muss das Bauwerk so beschaffen<br />
sein, dass sich Feuer und Rauch nicht oder nur so langsam wie möglich ausbreiten.<br />
3. Das Innere des Gebäudes wie auch die Anfahrtswege müssen so geplant sein, dass<br />
Menschen und Tiere schnell gerettet werden können.<br />
4. Schließlich müssen Bauwerk sowie Zugänge und Zufahrten eine wirksame Brandbekämpfung<br />
durch die Feuerwehr ermöglichen.<br />
Bei Sonderbauten sind neben den Brandschutzanforderungen auch die Arbeitsstättenverordnung<br />
(ArbStättV 55 ) und gegebenenfalls die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten<br />
(VbF 56 ) zu beachten.<br />
Die Brandschutzmaßnahmen im Einzelnen<br />
Eine wichtige Rolle bei der Feuerprävention spielen die Baustoffe. Von ihrer Wahl hängt es<br />
letztlich ab, ob und wie schnell sich ein Feuer ausbreiten kann. Darüber hinaus muss das<br />
Gebäude in einzelne Brandabschnitte gegliedert sein. Auf diese Weise lässt sich ein Brand<br />
leichter eindämmen und von der Feuerwehr wirksamer kontrollieren. Für diese Abschnitte<br />
schreibt die Landesbauordnung spezielle Brandwände von hohem Feuerwiderstand vor. Üblicherweise<br />
darf kein Brandabschnitt länger sein als 40 m, doch sind in dieser Hinsicht Ausnahmen<br />
möglich, wenn die vorgesehene Nutzung des Gebäudes der Anwendung dieser<br />
Vorschrift im Wege steht. Im Gegenzug müssen dann allerdings häufig zusätzliche Brandschutzeinrichtungen<br />
geschaffen werden, wie zum Beispiel Sprinkleranlagen, Feueralarmanlagen<br />
usw.<br />
6.2. Rettung und Brandbekämpfung<br />
Damit sich Bewohner im Brandfall sicher ins Freie retten können, müssen jedes nicht zu ebener<br />
Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes über mindes-<br />
55 Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) vom 12. August 2004<br />
(BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1595)<br />
56 Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung oder Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zu<br />
Lande (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – VbF) in der Fassung der Bekanntmachung vom<br />
13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937); außer Kraft am 1. Januar 2003 durch Artikel 8 Abs. 3 Nr. 6 der<br />
Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777) *) , zuletzt geändert durch Artikel 82 des Gesetzes<br />
vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818)<br />
*) Gemäß Artikel 8 Abs. 3 Nr. 6 der Verordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777) gilt § 7<br />
Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit den §§ 5 und 6, des § 9 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3<br />
sowie des § 24 S. 1, die für Rohrfernleitungsanlagen im Sinne des Artikels 4 § 2 Abs. 1 Nr. 1 und<br />
Abs. 2, welche der Verteidigung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen dienen, bis<br />
zum Inkrafttreten einer ablösenden gesetzlichen Regelung zur Zulassung dieser Anlagen und zur<br />
Aufsicht über diese Anlagen entsprechend fort.<br />
98
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
tens eine notwendige Treppe zugänglich sein (vgl. § 30 Abs. 1 HBO 57 ). Die HBO enthält weitere<br />
wichtige Brandschutzvorschriften, deren Schutzziele einzuhalten sind.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> kontrolliert insbesondere die Einhaltung der Brandschutzvorschriften im<br />
Rahmen der präventiven Ordnungsverwaltung.<br />
Örtliche Freiwillige Feuerwehren – Bestand im <strong>Odenwaldkreis</strong> (mit jeweiligen Ortsteilfeuerwehren):<br />
Bad König:<br />
Bad König<br />
Etzen-Gesäß<br />
Fürstengrund<br />
Kimbach<br />
Momart<br />
Nieder-Kinzig<br />
Ober-Kinzig<br />
Beerfelden:<br />
Airlenbach<br />
Beerfelden<br />
Falken-Gesäß<br />
Gammelsbach<br />
Hetzbach<br />
Olfen<br />
Brensbach:<br />
Affhöllerbach<br />
Brensbach<br />
Höllerbach<br />
Nieder-Kainsbach<br />
Wallbach<br />
Wersau<br />
Breuberg:<br />
Hainstadt<br />
Neustadt<br />
Sandbach<br />
Wald-Amorbach<br />
Brombachtal:<br />
Birkert<br />
Böllstein<br />
Hembach<br />
Kirchbrombach<br />
Langenbrombach<br />
Erbach:<br />
Bullau<br />
Dorf-Erbach<br />
Ebersberg<br />
Erbach<br />
Ernsbach-Erbuch<br />
Günterfürst<br />
Haisterbach<br />
Lauerbach<br />
Schönnen<br />
Fränkisch-Crumbach<br />
Hesseneck:<br />
Hesselbach<br />
Kailbach<br />
Schöllenbach<br />
Höchst i. Odw.:<br />
Annelsbach-Forstel<br />
Hassenroth<br />
Höchst i. Odw.<br />
Hummetroth<br />
Mümling-Grumbach<br />
Pfirschbach<br />
Lützelbach:<br />
Breitenbrunn<br />
Haingrund<br />
Lützel-Wiebelsbach<br />
Rimhorn<br />
Seckmauern<br />
99<br />
Michelstadt:<br />
Michelstadt<br />
Rehbach<br />
Steinbach<br />
Steinbuch<br />
Stockheim<br />
Vielbrunn<br />
Weiten-Gesäß<br />
Würzberg<br />
Mossautal:<br />
Güttersbach<br />
Hiltersklingen<br />
Hüttenthal<br />
Mossau<br />
Reichelsheim (Odenwald):<br />
Beerfurth<br />
Bockenrod *)<br />
Erzbach *)<br />
Gersprenz<br />
Gumpen<br />
Laudenau<br />
Ober-Kainsbach<br />
Reichelsheim<br />
Rohrbach<br />
Unter-Ostern<br />
Rothenberg:<br />
Finkenbach<br />
Kortelshütte<br />
Ober-Hainbrunn<br />
Rothenberg<br />
Sensbachtal:<br />
Hebstahl<br />
Ober-Sensbach<br />
Unter-Sensbach<br />
*) .. nur Verein<br />
57 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert durch Artikel 12<br />
des Gesetzes vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548)
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Neben örtlichen Freiwilligen Feuerwehren existiert der Kreisfeuerwehrverband <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
e. V.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Bauaufsicht des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Feuerwehren<br />
6.3. Rettungswesen<br />
Ziel des Rettungsdienstes ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten Notfallversorgung<br />
(Aufgabe der Gefahrenabwehr) und des Krankentransportes (Aufgabe der Gesundheitsvorsorge).<br />
Rechtsgrundlage für die Durchführung und den Aufbau des Rettungsdienstes ist das<br />
zum 1.3.1999 in Kraft getretene (HRDG) 58 .<br />
Unter Notfallversorgung im Sinne der gesetzlichen und ministerialen Vorgaben ist dabei die<br />
medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und<br />
ggf. ihre Beförderung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln einschließlich der<br />
notärztlichen Versorgung zu verstehen.<br />
Die Aufgabe des Krankentransportes besteht darin, kranke, verletzte oder sonst hilfsbedürftige<br />
Personen, die keine Notfallpatienten sind, in einem geeigneten Rettungsmittel durch entsprechend<br />
qualifiziertes Personal zu befördern und während der Fahrt zu betreuen.<br />
Die Kreise als Träger der bodengebundenen Notfallversorgung sind danach verpflichtet, für<br />
den Aufbau der Notfallversorgung vorzusehen, dass ein geeignetes Rettungsmittel jeden an<br />
einer Straße gelegenen Notfallort in der Regel innerhalb von 10 Minuten (Hilfsfrist) erreichen<br />
kann und zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung einen Bereichsplan aufzustellen, in dem<br />
u. a. der Gesamtbedarf für den Rettungsdienst entsprechend den Kriterien des Rettungsdienstplanes<br />
des Landes Hessen in der überarbeiteten Fassung von 2006 festgelegt ist.<br />
Die Kreise sind zudem im Rahmen der Notfallversorgung verpflichtet, die notärztliche Versorgung<br />
flächendeckend durch den Aufbau geeigneter Notarztsysteme sicherzustellen. Bei<br />
der Ermittlung des Bedarfs gilt dabei nicht die im Rettungsdienst vorgegebene 10-minütige<br />
Hilfsfrist, sondern eine 15-minütige Eintrefffrist.<br />
Die notfallmäßige Regelversorgung nach den Ausführungen des Hessischen Rettungsdienstplanes<br />
gilt dann als erfüllt, wenn mindestens 90 % aller an einer Straße gelegenen<br />
Einsatzorte innerhalb von 10 Minuten und 95 % aller Notfälle innerhalb von 15 Minuten erreicht<br />
werden können. Davon ausgenommen sind Einsatzorte, die an nicht öffentlichen Straßen<br />
oder in nur dünn besiedelten Stadt- und Gemeindebereichen liegen.<br />
Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen sind im <strong>Odenwaldkreis</strong> derzeit 4 dezentrale Rettungswachen<br />
mit rund-um-die-Uhr-Besetzung und eine Tagwache eingerichtet:<br />
• Rettungswache Beerfelden, Mümlingtalstraße<br />
• Rettungswache Brensbach, Nieder-Kainsbach<br />
• Rettungswache Erbach, Illigstraße<br />
• Rettungswache Höchst, Wernher-von-Braun-Straße<br />
• Tagwache Breuberg/Sandbach, Marktplatz<br />
58 2. Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (HRDG) vom 24.11.1998 (GVBl. I S.<br />
499)<br />
100
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Auf diese Wachen sind 7 Rettungswagen und 3 Krankentransportwagen zur zeitgerechten<br />
Versorgung der rund 3.500 Notfälle und zur Erledigung der rd. 6.000 Krankentransporte<br />
verteilt. Zur notärztlichen Versorgung der Notfälle hält der <strong>Odenwaldkreis</strong> ein Notarztsystem<br />
(Rendevouzsystem) beim Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong>, Albert-Schweitzer-Straße in<br />
Erbach vor.<br />
6.4. Entwicklungstrategien<br />
Der Neubau bzw. die Erweiterung von Feuerwehrgerätehäusern ist in mehreren Gemeinden<br />
des Kreises im Fortschreibungszeitraum geplant. Daneben ist in verschiedenen Gemeinden<br />
die Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Förderungen erhalten die Feuerwehren gemäß<br />
der Förderrichtlinie des Kreises. Zum aktuellen Entwicklungsstand wird an dieser Stelle<br />
auf das Berichtswesen zum Kreisreport verwiesen.<br />
Neben der bereits beschlossenen neuen Rettungswache in Erbach, Michelstädter Straße,<br />
und der geplanten Verlagerung der Notfallversorgung von der Wache in Brensbach nach<br />
Reichelsheim (Odenwald) in den Kreuzungsbereich der B 38/B 47 wird zur Optimierung der<br />
Notfallversorgung im Bereich der Gemeinde Lützelbach der nach der risikoabhängigen Bemessung<br />
vorzuhaltende zweite Rettungswagen in der im Frühjahr 2009 neu errichteten Wache<br />
in Breuberg/Neustadt (unmittelbar im Kreuzungsbereich B 426/L 3259) untergebracht.<br />
Mit der getrennten Unterbringung wird somit im Rahmen der Vorhaltung auch der „enge“<br />
Teilbereich des Lützelbacher Ortsteiles Haingrund mit einem größeren Teilbereich der L<br />
3349 (bis zum Hainhaus) innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist tagsüber notfallmäßig versorgt<br />
sein.<br />
Zur duplizitären notfallmäßigen Versorgung des Mossautaler Ortsteils Hiltersklingen (Primärversorgung<br />
durch RW Fürth/Bergstraße) wird zudem der dritte Rettungswagen im Versorgungsbereich<br />
der Rettungswache Erbach, künftig Michelstädter Straße, weiter in der Illigstraße<br />
11 beim DRK-Kreisverband vorgehalten.<br />
Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme benachbarter Rettungsmittel werden danach<br />
rund 98,5 % des Rettungsdienstbereiches notfallmäßig versorgt, so dass mit hinreichender<br />
Sicherheit der vorgegebene Erfüllungsgrad von 90 % innerhalb von 10 Minuten und 95 %<br />
innerhalb von 15 Minuten erzielt werden kann.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• DRK usw.<br />
• Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH<br />
101
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
7. Denkmalschutz<br />
7.1. Kulturdenkmäler<br />
Kulturdenkmäler sind nach § 2 des hessischen Denkmalschutzgesetzes 59 „Sachen, Sachteile<br />
und Sachgesamtheiten, an deren Erhaltung aus künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen,<br />
geschichtlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.“<br />
Diese Denkmäler sind zu erfassen und zu dokumentieren.<br />
Das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung ergibt sich daraus, dass sie Geschichtszeugnisse<br />
mit Erinnerungswert für eine Gemeinde, eine Region oder sogar das ganze Land sind.<br />
Neben Objekten von hohem Alter und überregionaler Bedeutung bezieht das heutige Denkmalverständnis<br />
auch vielfältigste historische Hinterlassenschaften mit ein; die Bandbreite<br />
reicht von Kirchen und Schlössern über Bürger- oder Bauernhäuser mit deren Nebengebäuden<br />
bis hin zu Hochhäusern. Auch ganze Siedlungen und Gartenanlagen, Brücken, Wegkreuzen<br />
und sogar Lokomotiven sind in den Denkmalschutz integriert.<br />
Die für den <strong>Odenwaldkreis</strong> erarbeitete Denkmaltopographie wurde im Jahr 1998 veröffentlicht<br />
und enthält alle Einzeldenkmale und denkmalgeschützte Gesamtanlagen. Im Jahr 2005<br />
erschien daneben die Denkmaltopographie „Eisenbahn in Hessen“, welche bedeutsame<br />
Objekte im Bereich der Bahnanlagen enthält.<br />
Der Denkmalschutz soll den schützenden und erhaltenden Umgang mit dem Denkmal über<br />
eine Genehmigungspflicht für Veränderungen des Erscheinungsbildes, der schützenswerten<br />
Bestandteile und Eingriffe in die Substanz des Gebäudes sicherstellen.<br />
Neben dem Objektschutz gibt es den Ensembleschutz. Durch ihn können besondere historische<br />
Ortslagen als Gesamtanlage unter Schutz gestellt werden, wodurch das äußere Erscheinungsbild<br />
bewahrt werden soll.<br />
Archäologische Denkmäler sind in der Denkmaltopographie nicht erfasst. Dennoch spielen<br />
sie eine wichtige Rolle für die regionale Identität und touristische Attraktivität. Zu den wichtigsten<br />
archäologischen Denkmäler des <strong>Odenwaldkreis</strong>es zählen die Villa Haselburg bei<br />
Höchst i. Odw., eine römische Ausgrabung, und der Odenwald-Limes.<br />
7.2. Denkmalnetzwerk<br />
Die Untere Denkmalschutzbehörde hat zusammen mit der Abteilung Informations- und<br />
Kommunikationstechnik ein Internetportal erarbeitet, welches seit 08.08.2008 unter<br />
www.denkmal.odenwaldkreis.de frei geschaltet ist. Hier findet man Erläuterungen über<br />
steuerliche Sonderabschreibungen bei Denkmalobjekten, eine Aufzählung verschiedener<br />
Stellen und Ansprechpartner, welche im Einzelfall Zuschüsse zu der Sanierung gewähren<br />
und hinsichtlich der Sanierung von Altbauten beraten. Alle Denkmalobjekte sind nach Städte<br />
und Gemeinden sortiert aufgeführt.<br />
7.3. Maßnahmen<br />
Der Denkmalbeirat berät die Untere Denkmalschutzbehörde bei wichtigen Entscheidungen<br />
und unterstützt ihre Arbeit. Aktuell bilden die Standortsuche für den derzeit in einer Restaurierungswerkstätte<br />
befindlichen Schöllenbacher Altar sowie die Erfassung und Dokumenta-<br />
59 Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) in der Fassung vom 05.09.1986<br />
(GVBl. I S. 262, 270), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 06.09.2007 (GVBl. I S. 548)<br />
102
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
tion der Kriegerdenkmale im <strong>Odenwaldkreis</strong> Themenschwerpunkte. Ferner wurden im Jahr<br />
2008 die Maßnahmen am Odenwaldlimes fachgerecht betreut. Es wurden dort 32 Erläuterungstafeln<br />
an den Kastellen und Turmstellen errichtet, die die römische Verteidigungsanlage<br />
in verschiedenen Sprachen erläutern. Auch das Römerbad Würzberg wurde mit<br />
einem Kostenaufwand von 50.000,-- € grundsaniert.<br />
2009 stehen Sanierungsarbeiten der Turmstellen am Odenwaldlimes aus Mitteln der Deutschen<br />
Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 50.000,-- € an. Ferner sollen eine Vielzahl von<br />
römischen Turmstellen mittels geophysikalischer Prospektion untersucht werden.<br />
Darüber hinaus wird ein zukunftsweisendes Projekt hinsichtlich der Restaurierung des Zentralgebäudes<br />
der überregional bedeutsamen römischen Ausgrabung „Haselburg“ entwickelt.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Untere Denkmalschutzbehörde des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Landesamt für Denkmalpflege<br />
• Denkmalbeirat<br />
103
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
8. Tourismus und Naherholung<br />
Die Leistungsfähigkeit des Raumes als Tourismusgebiet hängt von einem attraktiven Landschaftsbild<br />
(ursprüngliches Angebot) und ausreichender Fremdenverkehrsinfrastruktur (abgeleitetes<br />
Angebot) ab. Durch die im März 2008 in Kraft getretene Natura 2000-Verordnung<br />
sind einige Gebiete des Odenwaldes als FFH- bzw. Vogelschutzgebiete ausgewiesen und<br />
somit geschützt. Die vorher bestehenden Landschaftsschutzgebiete – mit einer größeren<br />
Schutzwirkung – sind entfallen.<br />
Die reizvolle Landschaft des Odenwaldes ist für den Tourismus äußerst wertvoll, weil das<br />
Landschaftsbild als ursprüngliches Angebot ein wichtiger Teil der Grundlage für die Eignung<br />
des Odenwaldes als Tourismusregion darstellt. Als positiv ist ferner das gute Verhältnis von<br />
kleineren landwirtschaftlich genutzten Flächen und bewaldeten Kuppen anzusehen. Die<br />
Kulturlandschaften mit einem ausgewogenen Verhältnis von land- und forstwirtschaftlich genutzten<br />
Flächen, topographisch bewegte und dörflich strukturierte Landschaften gelten als<br />
überaus attraktiv. Zu bemängeln ist, dass der Landschaft größere Wasserflächen fehlen,<br />
außerdem sind Teile des nördlichen Kreises zu stark überformt (Zersiedlung, teils durch<br />
große Gewerbebetriebe).<br />
Dem Tourist bietet der Odenwald ein gut entwickeltes abgeleitetes Angebot (Wanderwege,<br />
Hotels, Gaststätten etc.). Nach dem Index der touristischen und landschaftlichen Attraktivität,<br />
der sich aus den laufenden Raumbeobachtungen des BBR entwickelt, stellt das Gebiet eine<br />
additive Verknüpfung des Zerschneidungs- und Bewaldungsgrades, Reliefenergie, Wasserflächen<br />
und Übernachtungen dar. 2001 wurde der <strong>Odenwaldkreis</strong> deutschlandweit im oberen<br />
Mittelfeld eingeordnet 60 . Man findet im Odenwald einen umfangreichen Besatz an Einrichtungen<br />
in den besonders wichtigen Bereichen 61 :<br />
• Sport (Skilifte, Loipen, Bäder)<br />
• Kultur (Museen, Festivals, geführte Touren)<br />
• Medizin und Wellness (Kur, Kneipp, Spezialkliniken) .<br />
Gute Beispiele für attraktive Tourismusprojekte sind u. a. Themenwanderwege, der Einsatz<br />
von Geopark-Rangern, der Ausbau der Odenwald-Therme in Bad König, Vitalness, Sterne-<br />
Hotels, Odenwaldgasthäuser, KUSS 62 etc.<br />
Die PROJECT M GmbH wurde durch Kreistagsbeschluss vom 18.12.2007 damit beauftragt,<br />
ein touristisches Marketing- und Organisationskonzept für den Odenwald, zunächst bezogen<br />
auf das Verbandsgebiet des Touristik Service Odenwald-Bergstraße, zu erstellen. Das Konzept<br />
wurde im Dezember 2007 vom Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es beschlossen und umfasst<br />
vier Arbeitsschritte: Analyse, Marketingstrategie, Organisationskonzept und Umsetzungsplanung.<br />
Im Rahmen der Analyse wurde auch eine Image- und Kompetenzanalyse mittels Befragung<br />
von 600 potenziellen Gästen des Odenwaldes durchgeführt. Die folgenden Inhalte<br />
sind dem Tourismuskonzept entnommen 63 .<br />
Prozessablauf: Das Konzept wurde unter breiter Einbindung aller touristisch relevanten und<br />
tourismusnahen Gruppen, Strukturen und Organisationen im Odenwald erstellt. Die Abstimmung<br />
mit der parallel zum touristischen Konzept laufenden Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
wurde sicher gestellt. Eine projektbegleitende Arbeitsgruppe tagte siebenmal,<br />
die Steuerungsgruppe fünfmal im Projektverlauf. Am 10.07.2007 wurde die touristische<br />
Fachöffentlichkeit im Rahmen eines Tourismusforums in die Arbeiten integriert. Am<br />
60 Ebd.<br />
61 Vgl. Raumordnungsbericht 2005, S. 209<br />
62 Kultursommer e.V. mit Geschäftsstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt (KUSS)<br />
63 projekt m GmbH (Hrsg.): Touristisches Marketing- und Organisationskonzept Odenwald, Manage-<br />
ment Summary, Lüneburg 2007<br />
104
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
19.12.2007 wurden die Gesamtergebnisse im Rahmen des Tourismustages Odenwald wiederum<br />
der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Der Ausschuss für Bauen, Agenda 21, Regionalentwicklung<br />
und Verkehr wurde in seiner Sitzung am 13.06.2007 über die bisherigen Arbeitsergebnisse<br />
unterrichtet. Er hat den Zwischenbericht zur Kenntnis genommen und die<br />
vorgeschlagene Vorgehensweise befürwortet.<br />
8.1. Analyseergebnisse<br />
Ökonomische Effekte: Tagesreisen generieren über drei Viertel des touristischen Umsatzes<br />
im Odenwald. Betrachtet man die drei Hauptprofiteure vom Tourismus, so sind dies in folgender<br />
Reihenfolge:<br />
1. Gastronomie<br />
2. Einzelhandel<br />
3. Hotellerie.<br />
Gegenwärtig sind im gesamten Odenwald mehr als 18.000 Arbeitsplatzäquivalente direkt<br />
oder indirekt vom Tourismus abhängig. Durch den Rückgang von 15 % nach amtlicher Übernachtungsstatistik<br />
zwischen 1996 und 2006 im Odenwald insgesamt (<strong>Odenwaldkreis</strong>: -22 %)<br />
hat der Odenwald über 4.000 Arbeitsplätze verloren. Heute hängen deutlich mehr als 10 %<br />
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im <strong>Odenwaldkreis</strong> direkt oder indirekt am Tourismus.<br />
Der Tourismus hat im <strong>Odenwaldkreis</strong> einen Bruttowertschöpfungsanteil von 4,4 %.<br />
Bekanntheitsgrad: Der Bekanntheitsgrad des Odenwalds als Ferien- und Kurzurlaubsgebiet<br />
bewegt sich auf einem mit den Mittelgebirgen Spessart, Hunsrück, Westerwald, Rhön und<br />
Taunus vergleichbaren Niveau. Der Odenwald verfügt über ein erhebliches Steigerungspotenzial<br />
des Bekanntheitsgrades, welches abgerufen werden kann, wenn er verstärkt bei<br />
den potenziellen Gästen verankert wird. Hierzu muss das Marketing weiter ausgebaut werden.<br />
Destinationsabgrenzung: Der Odenwald kann auf Basis verschiedener Quellen (z. B. Bundesanstalt<br />
für Landeskunde, den Landschaftssteckbriefen des Bundesamtes für Naturschutz,<br />
Selbstzuordnung der Gemeinden, Imageanalyse) in einen Kern- und einen Übergangsbereich<br />
abgegrenzt werden. Kerngebiet und ein Übergangsbereich müssen in das Marketing<br />
für den Odenwald eingebunden werden.<br />
Profilierung: Von den Regionen im näheren Umfeld sind nur der Odenwald und die Bergstraße<br />
touristisch profiliert. Nibelungenland und Ried werden von potenziellen Gästen regional<br />
nicht richtig zugeordnet und sind touristisch kaum profiliert. Die Bergstraße weist im Vergleich<br />
zum Odenwald touristisch unterschiedliche Kompetenzzuschreibungen auf. Der Geopark<br />
weist lediglich eine auf den Bereich „Naturerlebnis und Umweltbildung“ zugespitzte<br />
Kompetenzzuschreibung auf. Die richtigen Destinationsbegriffe sind Odenwald und Bergstraße.<br />
Die gemeinsame Verwendung beider Destinationsbegriffe ist aufgrund unterschiedlicher<br />
Profile nur über eine kooperative „Markenführung“ der beiden Einzelmarken möglich.<br />
Der Geopark kann für beide Destinationen eine übergreifende ergänzende Qualitätsmarkierung<br />
darstellen.<br />
Besuchsanlässe: Ein Besuch des Odenwalds gilt bei potenziellen Gästen als attraktiv (u.a.<br />
wegen Natur, Wandern, Landschaft, Erholung). Die höchsten Potenziale hat der Odenwald<br />
im Tages- und Kurzreisetourismus. In einem Umkreis von 3 PKW-Stunden leben rund 26<br />
Mio. Menschen, die für eine Kurzreise gewonnen werden können. Der Odenwald ist bisher<br />
nur in Spezialsegmenten Destination für längere Urlaubsreisen (z.B. Kur-/Gesundheitsurlaub<br />
und Urlaub auf dem Lande/Bauernhof) attraktiv.<br />
105
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Kompetenzfelder: Bringt man die Kompetenzzuschreibungen zum Odenwald und das Interesse<br />
der Odenwald-affinen Zielgruppen zusammen, so ergeben sich vorrangig folgende<br />
Themenfelder: Wandern (höchste Kompetenz!), Radfahren (& Mountainbiking), Gesundheit,<br />
Naturerlebnis (& Umweltbildung), historische Bauwerke und kulturelle Sehenswürdigkeiten,<br />
regionaltypischer Genuss und Feste. Diese Kompetenzzuschreibungen treffen auf ausbaufähige<br />
Angebotspotenziale. Damit ist eine gute Ausgangsbasis für marketingstrategische<br />
Überlegungen gelegt.<br />
8.2. Marketingstrategie<br />
Mit der Gründung der Odenwald Tourismus GmbH im August 2008 wurde die praktische<br />
Umsetzung des vom Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es beschlossenen touristischen Marketing-<br />
und Organisationskonzeptes eingeleitet. Die Odenwald Tourismus GmbH hat damit begonnen,<br />
zu den im Marketingkonzept festgeschriebenen Profilthemen in thematischen Arbeitsgruppen<br />
buchbare Angebote zu entwickeln. Parallel dazu arbeitet die GmbH am Aufbau von<br />
touristischen Arbeitsgemeinschaften, was auch dem vom Land Hessen entwickelten Marketingplan<br />
entspricht. Die Aufgaben der touristischen Arbeitsgemeinschaften bestehen in der<br />
Bündelung von Marketingaktivitäten, der Abstimmung von Maßnahmen zur Entwicklung der<br />
touristischen Infrastruktur und der Optimierung und Vernetzung der Touristinformationen, um<br />
eine bessere Betreuung der Gäste vor Ort zu gewährleisten.<br />
Die Odenwald Tourismus GmbH hat auch mit der Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen<br />
begonnen. So wurde der Touristik Service Odenwald-Bergstraße e. V. in einen<br />
kommunal ausgerichteten Verband umstrukturiert. Die Tourismuswirtschaft wird im Tourismusverband<br />
Odenwald gebündelt. Beide Organisationen werden zukünftig Gesellschafteranteile<br />
an der Odenwald Tourismus GmbH erwerben und so an dem neu aufzubauenden<br />
Tourismusmarketing mitwirken.<br />
Die Umstellung des bisherigen Marketings auf das neu ausgerichtete, vertriebsorientierte<br />
Marketing erfolgt im Herbst 2009.<br />
Alle folgenden Planungen sind dem touristischen Marketing- und Organisationskonzept<br />
Odenwald der projekt m GmbH entnommen.<br />
106
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Abbildung: Marketingstrategie<br />
Die Odenwald Tourismus GmbH hat mit der Umsetzung des vom Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
beschlossenen touristischen Marketing- und Organisationskonzeptes begonnen.<br />
Folgende Ziele sollen dabei bis Ende 2009 erreicht werden:<br />
• Tourismusmarketing<br />
- Ausbau der vier Profilthemen des Odenwaldes durch die Entwicklung von buchbaren<br />
Angeboten in thematischen Arbeitsgruppen unter Einbindung der Tourismuswirtschaft<br />
und des ÖPNV<br />
- Weiterentwicklung des bestehenden Corporate Design Odenwald<br />
- Darstellung und Bündelung des touristischen Angebotes des Odenwaldes unter Beachtung<br />
der vier Profilthemen im Internet unter www.odenwald.de<br />
- Kommunikation der vier Profilthemen über Broschüren<br />
- Aufbau eines vertriebsorientierten Marketings durch die Einführung eines odenwaldweiten<br />
Buchungssystems und Umwandlung der Touristinformationen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
in Buchungszentren<br />
• Organisationsstrukturen<br />
- Gründung von sechs überregionalen touristischen Arbeitsgemeinschaften im Odenwald<br />
- Einbindung der Kommunen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in die touristischen Arbeitsgemeinschaften<br />
- Verkauf der vom <strong>Odenwaldkreis</strong> bisher allein getragenen Gesellschafteranteile der<br />
Odenwald Tourismus GmbH an den TouristikService Odenwald-Bergstraße e. V. und<br />
an die Tourismuswirtschaft über die Gründung des Tourismusverbandes Odenwald e.<br />
V.<br />
Beim Ausbau der touristischen Infrastruktur sollten folgende Ziele angestrebt werden:<br />
• Entwicklung eines kreisübergreifenden Radverkehrskonzeptes<br />
• Entwicklung eines kreisübergreifenden Wanderwegekonzeptes<br />
107
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• Digitalisierung der Rad- und Wanderwege, Aufnahme in das GIS-System des<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Erarbeitung eines Konzeptes „Multifunktionales Wegenetz“ zur langfristigen Abstimmung<br />
der Interessen von Land- und Forstwirtschaft mit dem touristischen Wegenetz und der Minimierung<br />
von Nutzungs- und Interessenkonflikten<br />
Ursache-/Wirkungskette:<br />
Die Gründe für den Übernachtungsrückgang in den letzten Jahren lassen sich – neben der<br />
allgemeinen Marktentwicklung, die für viele Binnen-Mittelgebirgsregionen negativ verlaufen<br />
ist – in hausgemachten Ursachen finden: Trotz bestehender Kooperationsaktivitäten verhindern<br />
kommunale Grenzen sowie politisch motivierte Konflikte Fokussierung, Konzentration<br />
und Vernetzung. Es fehlt an Schwerpunktsetzung, Zielgruppenorientierung und themenspezifischer<br />
Produktqualität. Finanzielle und personelle Ressourcen für die erforderliche Entwicklungs-<br />
und Marketingarbeit fehlen oder sind seither nicht gebündelt. Die Ausrichtung der<br />
Organisations- und Marketingstrukturen auf die erforderlichen Aktivitäten unterbleibt.<br />
Abbildung 1: Ursache-/Wirkungskette der touristischen Entwicklung des Odenwaldes<br />
Ansatzpunkte<br />
Den vorhandenen Problemen soll die Marketingstrategie gezielt entgegen wirken. Zentrale<br />
Elemente: Fokussierung und Mittelbündelung auf wenige, dafür gestaltbare Schwerpunkte,<br />
Kreis- und Landesgrenzen übergreifende Ausrichtung, Aufbau eines zielgruppen- und themenbezogenen,<br />
kompetenz- und qualitätsgestützten, glaubhaften touristischen Profils für<br />
den Odenwald, ganzheitliche Beeinflussung der Marketingkette:<br />
Infrastruktur – Angebot – Produkte – Services – Kommunikation – Vertrieb.<br />
Vision, Mission, Werte<br />
Als grundsätzliche Positionierungsleitlinie wurden für den Odenwald Vision, Mission und<br />
Werte festgelegt. Diese stellen die Grundlage der gesamten Marktbearbeitung für die kommenden<br />
Jahre dar.<br />
108
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Abbildung: Grundsätzliche Profilierungsleitlinie<br />
System für den Tourismus im Odenwald<br />
Zur Umsetzung der Positionierung wurden sämtliche Werte, Zielgruppen und Themen des<br />
Odenwaldes in ein umfassendes System, bestehend aus Produktlinien, Profilthemen, Einzelthemen<br />
sowie Basis- und Spezialthemen eingeordnet.<br />
Profilthemen<br />
Zentral für die Aktivitäten der kommenden Jahre sind vier Profilthemen („WanderWald<br />
Odenwald“, „Geopark Bergstraße-Odenwald“, „Odenwälder Jahreszeiten“ und „SagenWald<br />
Odenwald“). Diese Profilthemen stellen die „Speerspitze des Marketings“ dar. Sie werden in<br />
besonderem Maße kommuniziert und liefern potenziellen Gästen Reise/Besuchsanlässe.<br />
Profilthemen werden mit Top-Qualität in Bezug auf Infrastruktur, Angebots-/ Produktgestaltung,<br />
Vermarktung, Vertrieb bearbeitet. Hieraus entsteht ein mehrjähriger Entwicklungsaufwand,<br />
der unter Einbeziehung aller themenspezifischen und allgemein touristischen Akteure<br />
im Odenwald vorgenommen werden muss.<br />
Hinsichtlich der im Rahmen des Workshops Regionale Produkte entwickelte Regionalmarke<br />
„Odenwald“ ist geplant, dass die ersten Produkte im Mai 2009 mit der Regionalmarke ausgezeichnet<br />
werden. Die Odenwald Tourismus GmbH übernimmt deren Vermarktung über das<br />
im Marketingkonzept Odenwald vorgesehene Profilthema „Odenwälder Jahreszeiten“.<br />
Leitprojekte<br />
Zehn Leitprojekte bilden die Brücke zwischen Konzept und Umsetzung: Je ein Leitprojekt<br />
bezieht sich auf den Aufbau der Profilthemen. Im Bereich Vermarktung und Vertrieb sind<br />
ebenfalls vier Leitprojekte definiert (Marken- und Gestaltungssicherung, Marketing- und Mediaplanung,<br />
Vertriebs- und Partnerkonzept sowie Binnenmarketing. Zur Prozess- und Strukturentwicklung<br />
werden zwei Leitprojekte definiert: Touristische Standortentwicklung und<br />
Wirtschaftsförderung sowie die Optimierung der Organisationsstrukturen.<br />
8.3. Organisationskonzept<br />
Ansatzpunkte: Die gegenwärtigen Organisationsstrukturen im Odenwald sind vielfältig, es<br />
mangelt jedoch an Abstimmung und Bündelung. Positiv herauszuheben sind die vorhandenen<br />
privatwirtschaftlichen Kooperationsstrukturen, welche, wie im Fall der Odenwald Sterne<br />
109
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Hotels, Kreis- und Ländergrenzen übergreifend agieren. Folgende Ansätze sollen im Rahmen<br />
des Organisationskonzeptes zugrunde gelegt werden: Klare Aufgabenteilung der Ebenen<br />
und strukturelle Vernetzung der Akteure, Professionalisierung durch Umorientierung in<br />
Richtung vertriebsorientiertes Marketing, ausgebaute und gestärkte Kooperation von hessischem,<br />
bayrischem und baden-württembergischem Odenwald, vereinheitlichte Gebietsbezüge<br />
der Organisationsstrukturen (gesamter Odenwald) und Auflösung des Denkens in politischen<br />
und Verwaltungsgrenzen. Hierbei werden die nachfolgend dargestellten Ziele verfolgt.<br />
Abbildung: Ziele für optimale Organisationsstrukturen<br />
Teilregionale Strukturen: In Einklang mit dem im Tourismus in Hessen gültigen Drei-Ebenen-<br />
Modell bündeln die Städte und Gemeinden ihre Ressourcen in Touristischen Arbeitsgemeinschaften<br />
(TAG). Empfohlen werden, je nach kommunalen Bereitschaften, vier bis sechs touristische<br />
Arbeitsgemeinschaften. Ein erster Modellentwurf für die Gebietsabgrenzung liegt<br />
vor, diese muss jedoch im Verlauf der TAG-Bildung fortgeschrieben werden. Die TAG-<br />
Strukturen sollen bis zur Saison 2009/2010 (Herbst 2009) aufgebaut sein. Verantwortlich für<br />
die TAG-Bildung sind die Städte und Gemeinden.<br />
Odenwaldweite Dachorganisation („Reisebüro Odenwald“): Empfohlen wird eine odenwaldweite<br />
Dachorganisation mit klaren vertriebsorientierten Zielsetzungen in Rechtsform einer<br />
GmbH. Zur Saison 2009/2010 (Herbst 2009) soll das Reisebüro Odenwald funktionsfähig<br />
stehen. Zielgesellschafter sind TGO, TouristikService Odenwald-Bergstraße (TSOB) und<br />
private Gesellschafter in Form eines odenwaldweiten Tourismusvereins (OTV). Ziel ist es,<br />
möglichst alle Ressourcen, welche bislang auf Ebene der Gesellschafter vorgehalten wurden,<br />
in der gemeinsamen Dachorganisation zu bündeln. Vertiefte und detaillierte Gespräche<br />
mit den Zielgesellschaftern sind in den kommenden Wochen und Monaten zu führen.<br />
110
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Geschäftsplan: Der Personalbedarf für das Reisebüro Odenwald beträgt 5,0 Vollzeitäquivalente.<br />
Die jährlichen Gesamtkosten liegen bei 526 Tsd. €. Durch Einnahmen kann das Reisebüro<br />
Odenwald einen immer größer werdenden Teil seiner Kosten erwirtschaften. Im ersten<br />
Jahr kann der Kostendeckungsgrad durch eigene Einnahmen ca. 27 % betragen. Er<br />
steigt bis zum fünften Betriebsjahr prognostisch auf rund 80 % an und bleibt dann konstant.<br />
Maßnahmen- und Umsetzungsplanung<br />
Umsetzungsphasen: Der zur Neuausrichtung des Tourismus im Odenwald erforderliche Zeitraum<br />
wird auf zwei Jahre angesetzt. In dieser Aufbau- und Entwicklungsphase erfolgt der<br />
Aufbau zielgruppenorientierter Produktlinien und Produkte, der marketingbezogenen Voraussetzungen,<br />
der Strukturen des Reisebüros Odenwald und der TAGStrukturen. Eine Detailplanung<br />
für die Aufbau- und Entwicklungsphase liegt vor.<br />
Abbildung: Umsetzungsphasen<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Odenwald Tourismus GmbH mit Sitz in Erbach<br />
• OREG (Geschäftsbereich TouristikService Odenwald-Bergstraße)<br />
111
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
9. Lokale Ökonomie<br />
Direktvermarkter<br />
Ziel der Wirtschaftsförderung ist, die lokale Ökonomie zu stärken und den<br />
Wertschöpfungsprozess im <strong>Odenwaldkreis</strong> stattfinden zu lassen.<br />
Zur lokalen Ökonomie gehören natürlich auch die Direktvermarkter, die mit<br />
ihren hervorrgenden Produkten eine wichtige Nische in der Nahrungsmittelherstellung<br />
und im Verkauf einnehmen. Ziel ist es, Odenwälder Produkte<br />
(insbesondere die der Direktvermarkter) in die Regale der Supermärkte in<br />
der Region zu bekommen.<br />
Hierzu hat sich eine Kooperation mit der landesweiten Vereinigung der Direktvermarkter<br />
(Landmarkt) gebildet. Ein erster Schritt konnte mit dem Edeka-Markt Graulich in Reichelsheim<br />
(Odenwald) erreicht werden. Am 10.04.2006 wurde im Beisein vom Ersten Kreisbeigeordneten<br />
die Kooperation von Landmark mit dem Edekamarkt Graulich der Öffentlichkeit<br />
präsentiert.<br />
9.1. Regionalmarke<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> und seine Produkte benötigen ein einheitliches Erkennungsbild und ein<br />
Identitätszeichen. Derzeit gibt es unter der Marke „Gutes aus Hessen“ einen Regionalbezug<br />
zum Odenwald. Darunter können aber manche Anbieter ihre Produkte nicht in Baden-Württemberg<br />
oder Bayern verkaufen (z. B. Fa. Falter Fruchtsäfte), wodurch dem Kreis im „Drei-<br />
Ländereck“ Handelsnachteile entstehen. EDEKA hat versucht, die Marke „Unsere Heimat“ in<br />
Verbindung mit der Marketinggesellschaft „Gutes aus Hessen“ zu etablieren. Diese Marke<br />
läuft jedoch nicht gut, da der Bezug zur Region nicht vorhanden ist. Die regionalen Stände<br />
Landmarkt in den REWE-Märkten laufen gut. Hier werden noch weitere Produzenten gesucht,<br />
um die vermehrte Nachfrage zu decken.<br />
9.2. Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsplanung<br />
Die Ziele der Wirtschaftsförderung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sind die Steigerung der Attraktivität<br />
und der Wettbewerbsfähigkeit der Region, um Standortentscheidung von Firmen positiv zu<br />
beeinflussen, sowie die Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur.<br />
Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Wirtschaftsförderung neu positioniert. Die Wirtschaftsförderung<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es gliedert sich in die Bereiche Wirtschafts- und -<br />
regionale Entwicklung (strategische und administrative Wirtschaftsförderung bei der Kreisverwaltung)<br />
und Wirtschaftsservice (operative Wirtschaftsförderung bei der OREG mbH).<br />
Durch die Struktur soll einerseits die Schaffung einer effizienten und wirkungsvollen Service-<br />
Einrichtung für die Belange der regionalen Wirtschaft ermöglicht, der Ausbau der wirtschaftsnahen<br />
Infrastruktur unterstützt und die Ausgestaltung sanfter Standortfaktoren begünstigt<br />
werden. Andererseits sollen auch die politischen und administrativen Voraussetzungen<br />
für eine unterstützende Begleitung dieses Prozesses verbessert werden. So wirkt die<br />
Abteilung Wirtschaftsplanung auch bei der Planung von den verschiedenen Veranstaltungen<br />
mit. Zu nennen sind hier vor allem die von der Odenwald-Akademie initiierten Odenwald-<br />
Dialoge (siehe hierzu Kapital 11.2.), die sich mit den verschiedensten Themenfeldern beschäftigen,<br />
um die Kooperation zwischen Firmen und Institutionen zu fördern und weiter<br />
auszubauen.<br />
112
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Fortlaufende Aktivitäten und Strategien der Wirtschaftsplanung sind:<br />
• Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Zusammenarbeit mit der Partnerregion<br />
Falkirk in Schottland, Betreuung der Partnerschaft und des Vereins „Schottland Vereinigung“<br />
(Ausrichtung verschiedener regelmäßig stattfindender Veranstaltungen)<br />
• Organisation der Veranstaltungen der Odenwald Akademie<br />
• Zusammenführung von Denkmalpflege/Restaurierung und Handwerk im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Verschiedenste Aktionen zum Standortmarketing und zur Strategie der „Lokalen Ökonomie“<br />
(Entwicklung und Initiierung von Clustern zu verschiednen Themen wie „Reiterland<br />
Odenwald“, „Gesundheitscluster Odenwald“, Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen,<br />
Vermarktungskonzept für Gewerbeflächen zusammen mit den Kommunen, Visitenkarten-<br />
CD)<br />
• Unterschiedliche Veranstaltungen zur Förderung der Kulturwirtschaft („Crime time“:<br />
Lesungen von Krimiautoren, auch parallel zur Buchmesse Frankfurt und im Rahmen der<br />
Aktion „Leseland Hessen“, Etablierung eines kulturellen Festivals)<br />
• Innenmarketing durch Projekte wie Macher-Dinner (Anerkennung der wirtschaftlichen<br />
Akteure in der lokalen Ökonomie in Handwerk, Handel, Dienstleistung, Gewerbe und<br />
Landwirtschaft in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, Leistungsauszeichnungen<br />
und Innovationsfähigkeit)<br />
• Ausschreibung von Krimi-Schreibwettbewerben.<br />
9.3. Cluster<br />
Aus ökonomischer Sicht wird der Begriff „Cluster“ (engl. cluster = Traube, Bündel, Schwarm,<br />
Haufen) als ein Netzwerk von Produzenten, Zulieferern, Forschungseinrichtungen,<br />
Dienstleistern und verbundenen Institutionen (z. B. Handels- und Handwerkskammern) mit<br />
einer gewissen regionalen Nähe zueinander definiert. Er wird über gemeinsame Austauschbeziehungen<br />
entlang einer Wertschöpfungskette gebildet.<br />
Durch die Nutzung der Verbund- und Synergieeffekte von Netzwerkstrukturen wird das<br />
Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft gestärkt. Netzwerke<br />
bieten ein günstiges Umfeld für Forschung und Entwicklung sowie Innovationen, fördern die<br />
wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.<br />
Dadurch erhöht sich die Attraktivität des Standorts. Im <strong>Odenwaldkreis</strong> werden<br />
dafür drei im Internet zur Verfügung stehende Datenbanken – Cluster – vorgehalten. Die<br />
Teilnahme am Netzwerk ist kostenlos.<br />
Pferde-Cluster<br />
Seit 2004 ist das „Pferde-Cluster" online (www.odenwald-pferd.de). Alle<br />
Bereiche rund um das Thema Pferd (Zucht, Haltung, Futter, Hufschmied,<br />
Reitunterricht, Reitmöglichkeiten usw.) sind beinhaltet. Nach<br />
zögerlicher Inanspruchnahme der Möglichkeiten des Clusters ist diese<br />
Dienstleistung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es mittlerweile nicht mehr wegzudenken.<br />
Als Synergieeffekt des Clusters hat sich die Vernetzung und engere<br />
Zusammenarbeit der Reitstationen entwickelt. In den letzten 1 1 /2 Jahren<br />
wurde gemeinsam mit den Reitstationen und der OREG eine Reitstationenkarte aufgestellt<br />
und finanziert. Diese wurde im März 2008 der Öffentlichkeit präsentiert und war trotz einer<br />
Auflage von 2000 Stück schnell vergriffen. Inzwischen ist eine Neuauflage erschienen.<br />
Am 8.7.2007 wurde die neue Webseite des Pferde-Clusters in Beerfelden während des Pferdemarktes<br />
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Wirtschaftsförderung erhofft sich dadurch eine<br />
Steigerung der Attraktivität des Clusters und der Zugriffe auf die Webseite. Bisher konnten<br />
jährlich ca. 20.000 Zugriffe verzeichnet werden.<br />
113
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
In der touristischen Vermarktung des Potenzials für Reittourismus im Odenwald gibt es noch<br />
große Reserven. Die Odenwald Tourismus GmbH wird dieses Thema unter dem Profilthema<br />
„Wanderwald Odenwald“ aufgreifen, basierend auf den über den Pferde-Cluster bereits gebündelten<br />
Informationen.<br />
Cleo-Cluster<br />
Das „Cluster Erneuerbare Energie <strong>Odenwaldkreis</strong> (Cleo)" ist eine im Internet<br />
zur Verfügung stehende Datenbank, die alle Bereiche des Themenfeldes<br />
„Erneuerbare Energien“ beinhaltet (www.odenwaldbiomasse.de/).<br />
Cluster „odenwald-vitalness“<br />
Alle Anbieter im Bereiche des Themenfeldes „Gesundheit“ können<br />
das Cluster „www.odenwald-vitalness.de“ – die im Internet zur<br />
Verfügung stehende Datenbank – nutzen.<br />
9.4. Standortmarketingkampagne Darmstadt RheinMainNeckar – addicted to<br />
innovation<br />
Aus dem Positionspapier der IHK Darmstadt zur Standortmarketingkampagne Darmstadt<br />
RheinMainNeckar – addicted to innovation, Darmstadt 2007 ist zu entnehmen:<br />
Ökonomische Kraftzentren der Welt sind heute nicht mehr Nationalstaaten, sondern Regionen.<br />
Nicht nationale Kriterien wie Steuer- und Arbeitsgesetze entscheiden über die Attraktivität<br />
der Arbeitsmärkte von morgen, sondern deren regionale Ausprägung. Alles hängt also<br />
davon ab, innovative Unternehmer und kreative Arbeitnehmer anzuziehen. In Darmstadt<br />
RheinMainNeckar finden Unternehmen die wichtigsten Faktoren für deren Unternehmenserfolg<br />
vereint: Qualifizierte Arbeitskräfte, Schlüsseltechnologien der Zukunft, entspanntes<br />
Leben, produktives Arbeiten und ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot. Die Region ist<br />
folgerichtig wiederholt wegen ihrer Standortvorteile ausgezeichnet worden. Aber andere Regionen<br />
haben sich im internationalen Standortwettbewerb längst positioniert: auch sie haben<br />
ausgezeichnete Stärken, auch sie locken erfolgreich innovative Untenehmen an und rekrutieren<br />
Spitzenpersonal. Darmstadt RheinMainNeckar kann sich dem Wettbewerb nicht länger<br />
entziehen. Die kommunale Selbstverwaltung auf Gemeinde- und Kreisebene bleibt hiervon<br />
völlig unberührt. Es geht allein um gemeinsame Werbung für die Region Darmstadt Rhein-<br />
MainNeckar als Teil des wirtschaftsstärksten deutschen Ballungsraums mit den beiden Metropolregionen<br />
Rhein-Main und Rhein-Neckar.<br />
Die IHK Darmstadt und die Handwerkskammer Rhein-Main haben deshalb 2007 eine ARGE<br />
als BGB-Gesellschaft gegründet, um die Region Darmstadt RheinMainNeckar im Wettbewerb<br />
der Regionen zu positionieren. Mit Beschluss vom 19.11.2007 hat der Kreisausschuss<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es der ARGE bis 2010 jährlich 20.000 € zur Verfügung gestellt,<br />
um die Standortmarketingkampagne „addicted to innovation“ oder „Innovation aus Leidenschaft“<br />
zu unterstützen. Gemeinsam mit den Landkreisen und der Stadt Darmstadt strebt die<br />
ARGE an, weitere Mittel aus Wirtschaft und Wissenschaft zu akquirieren. Oberstes Ziel ist<br />
es, die Zukunftsfähigkeit der Region zu erhöhen, indem die Position im internationalen Wettbewerb<br />
der Wirtschaftsstandorte dauerhaft gesichert und gestärkt wird.<br />
Um im Standortwettbewerb bestehen zu können, braucht Darmstadt RheinMainNeckar ein<br />
professionelles und innovatives Marketing. Die Region muss externe Investoren und Unternehmen,<br />
aber auch Politik, Wirtschaft uns Wissenschaft aus der Region auf sich aufmerksam<br />
machen, um sich gegenüber anderen Wirtschaftsstandorten behaupten und positionieren<br />
zu können.<br />
114
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Das gemeinsam erarbeitete Profil von Darmstadt RheinMainNeckar beinhaltet additiv:<br />
• Ingenieurswissenschaftliche Kompetenz einschließlich Biomassetechnologie<br />
• Hochqualifizierte Arbeitskräfte und Spitzenqualität in Forschung und Ausbildung<br />
• Flughafen mit weltweiten Direktverbindungen.<br />
Der Kontakt zu potenziellen Investoren oder Ansiedlungsinteressierten läuft über die Wirtschaftsförderungen<br />
der Kreise bzw. der Stadt Darmstadt. Für die internationale Präsenz der<br />
Region wird besonders auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Frankfurt RheinMain<br />
GmbH und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH hingearbeitet. Die IHK übernimmt auf<br />
eigene Rechnung die Koordination und Federführung der ARGE. Die Beteiligung an der<br />
Kampagne steht interessierten öffentlichen und privaten, juristischen und natürlichen Personen<br />
offen.<br />
Die Wirtschaftsförderer der Stadt Darmstadt und der Landkreise, Vertreter der Handwerkskammer<br />
Rhein Main und des IHK-Standortmarketingausschusses haben mit einer Werbeagentur<br />
die Konzeption und einen Umsetzungsplan für eine Standortmarketing-Kampagne<br />
entwickelt: das geschärfte Profil der Region wird durch die Standortmarketing-Kampagne<br />
„Darmstadt RheinMainNeckar – addicted to innovation“ bzw. „Darmstadt RheinMainNeckar –<br />
Innovativ aus Leidenschaft“ professionell vermarktet. Diese erfolgreich gestartete Kampagne<br />
für Darmstadt RheinMainNeckar muss kontinuierlich fortgesetzt werden, um Wirkung zu zeigen.<br />
Den Start der Standortmarketingkampagne bildete der Messeauftritt auf der Gewerbeimmobilienmesse<br />
ExpoReal 2007, auf der die Region sich mit dem Schwerpunkt „Engineering“<br />
und neuem Logo unter dem Motto „Addicted to innovation“ präsentierte. In einer Imagebroschüre<br />
„ENGINEERING REGION Darmstadt RheinMainNeckar: Leute mit Ideen – Produkte<br />
mit Chancen“ wurden die enormen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kompetenzen<br />
und Potenziale der Region dargestellt. Durch den Leserwettbewerb „Erfindungen finden“, der<br />
gemeinsam mit dem Darmstädter Echo durchgeführt wurde, ist die Bevölkerung im Sinne<br />
des Binnenmarketings einbezogen worden. Die Überarbeitung der Imagebroschüre, die<br />
Produktion von fünf Flyern zu den sechs Branchenschwerpunkten (Fahrzeugbau, Automation,<br />
Chemie, Luft- und Raumfahrt, IuKTechnologien und Logistik) und der Aufbau eines<br />
Internetauftritts standen 2007 als Meilensteine auf dem Programm. Die Standortmarketing-<br />
Aktivitäten werden als Bausteine für die Kooperation mit der Frankfurt RheinMain GmbH und<br />
der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH gesehen und daher eng mit diesen Institutionen<br />
abgestimmt. Das Automotive-Cluster Rhein Main Neckar beispielsweise wird von der Frankfurt<br />
RheinMain GmbH bereits jetzt aktiv als Marketinginstrument genutzt und international<br />
positioniert.<br />
Die Arbeit soll künftig als „Kooperation“ ausgerichtet werden: gemeinsames Standortmarketing<br />
als offenes Projekt zwischen Kreisen, Stadt, Handwerkskammer, IHK und weiteren an<br />
der Vermarktung der Region interessierten Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die<br />
IHK Darmstadt ist bereit, die Koordination und die Geschäftsführung des Projektes zu übernehmen.<br />
Die Ausrichtung der Region soll in einer jährlichen Strategiekonferenz, bestehend<br />
aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erarbeitet werden. Für die inhaltliche<br />
Konkretisierung ist ein Koordinierungsgremium von IHKStandortmarketingausschuss,<br />
Wirtschaftsförderer der Landkreise/Stadt Darmstadt, Handwerkskammer und Wissenschaft<br />
vorgesehen.<br />
Die Region muss mit ihren landschaftlichen und kulturellen Qualitäten, ihrer Wirtschaftskraft<br />
und den Potenzialen in Wissenschaft und Forschung Menschen anziehen, die hier leben und<br />
arbeiten wollen. Es geht um die Ansiedlung neuer Unternehmen. Es ist eine Zuwanderungsregion<br />
für qualifizierte Menschen angestrebt, die hier Ausbildung und Zukunft suchen oder<br />
bereits qualifiziert sind. Die Stärken und Zukunftschancen von Darmstadt RheinMainNeckar<br />
müssen in der Region bewusst gemacht werden. Nur, wenn diese Identifikation nach innen<br />
115
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
funktioniert, kann die Region auch erfolgreich national und international vermarktet werden.<br />
Es ist eine starke, geschlossene und kreative Vermarktung der Standvorteile unserer Region<br />
im Wettstreit der Regionen unabdingbar. Hierzu bedient sich die Region Darmstadt Rhein-<br />
MainNeckar der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region wie auch<br />
der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, weil nur die Bündelung der Kräfte gewährleistet,<br />
international Aufmerksamkeit zu erzielen. Diese beiden Gesellschaften können nur vermarkten,<br />
was sie aus der Region zugeliefert bekommen. Mit einem gut aufbereiteten und<br />
kontinuierlich fortgesetzten Jahresprogramm (Kampagne) wird es gelingen, die Themen und<br />
Inhalte in der Darstellung der Großregion Rhein-Main-Neckar mit Gewicht zu positionieren.<br />
Derzeit ist Darmstadt RheinMainNeckar der einzige Gesellschafter, der sich mit eigenen<br />
Netzwerken (z. B. AutomotiveCluster – federführend: Kreis Groß Gerau und IHK Darmstadt)<br />
und Marketingmaterial bei der Frankfurt RheinMain GmbH erfolgreich positioniert. Eine künftige,<br />
selbstbewusste Mitwirkung an der Gestaltung der Rhein-Main-Neckar-Region ist notwendig,<br />
um die Prosperität dieser Region zu erhalten und auszubauen.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• OREG (Wirtschaftsservice)<br />
• Abteilung „Wirtschaftsförderung“ des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Direktvermarkter<br />
• Betriebe<br />
• Handwerkskammer<br />
• Industrie- und Handelskammer<br />
• ERGE Region Darmstadt Rhein Main Neckar GbR<br />
116
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
10. Bildung<br />
10.1. Istzustand<br />
117
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Nach den Bestimmungen des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) 64 sind die Landkreise und<br />
kreisfreien Städte Träger der Schulen. Das Land trägt die Personalkosten der Lehrkräfte an<br />
den öffentlichen Schulen, während der Schulträger die Sachkosten, wie Bau- und Unterhaltung<br />
der Schulgebäude, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf<br />
usw. aufbringt. Hinzu kommen die Personalkosten für die Schulhausmeister, die Schulsekretärinnen<br />
sowie die Reinigungskräfte.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat im Jahre 1970 die Trägerschaft über die Schulen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
übernommen. Im Zuge der Gebietsreform wurden viele kleinere Schulen aufgelöst<br />
und die Schulgebäude entwidmet. Heute ist der <strong>Odenwaldkreis</strong> Träger von 37 Schulen:<br />
• 25 Grundschulen<br />
• 5 Gesamtschulen<br />
• 2 Haupt- und Realschulen<br />
• 1 Gymnasium<br />
• 1 Berufliche Schule<br />
• 3 Förderschulen<br />
10.2. Schulenentwicklung<br />
Schülerzahlen<br />
Die Schülerzahlen im <strong>Odenwaldkreis</strong> gehen aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge<br />
teilweise bereits stark zurück, dies vor allem an den Haupt- und Realschulen (Theodor-Litt-<br />
Schule in Michelstadt, Schule am Sportpark in Erbach). Die Nachfrage für Plätze an Kooperativen<br />
Gesamtschulen (Ernst-Göbel-Schule in Höchst i. Odw., Georg-August-Zinn-Schule in<br />
Reichelsheim (Odenwald) und Georg-Ackermann-Schule in Breuberg) ist stabil. An den Integrierten<br />
Gesamtschulen (Carl-Weyprecht-Schule Bad König, Oberzentschule Beerfelden)<br />
und am einzigen „reinen“ Gymnasium im <strong>Odenwaldkreis</strong> in Michelstadt steigen die Schülerzahlen.<br />
Anzahl der Schüler<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
3934<br />
Entwicklung der Schülerzahlen an den<br />
Grundschulen<br />
3719<br />
3596 3507<br />
118<br />
3338<br />
3158<br />
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13<br />
Schuljahr<br />
Gesamt<br />
Quelle: Schulentwicklungsplan 65 , S. 13<br />
64 Hessisches Schulgesetz (Schulgesetz – HSchG –) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S.<br />
442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GVBl. I S. 921)<br />
65 Schulentwicklungsplan des <strong>Odenwaldkreis</strong>es – Fortschreibung 2007–2012, Kreistagsbeschluss<br />
vom 17.12.2007
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Anzahl der Schüler<br />
11.400<br />
11.200<br />
11.000<br />
10.800<br />
10.600<br />
10.400<br />
10.200<br />
10.000<br />
9.800<br />
Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
11.292<br />
11.142<br />
10.989<br />
119<br />
10.746<br />
10.575<br />
10.323<br />
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13<br />
Schuljahr<br />
Gesamt<br />
Quelle: Schulentwicklungsplan, S. 18<br />
Eine bessere Abstimmung mit den angrenzenden Kreisen wird im Schulentwicklungsplan vor<br />
allem für die grenznahen Standorte als sinnvoll erachtet, wie z. B. Reichelsheim (Odenwald).<br />
Mit der Aufnahme der Ernst-Göbel-Schule in Höchst i. Odw. in das Hessische Landesprogramm<br />
„Ganztagsangebote nach Maß“ gem. § 15 HSchG haben alle weiterführenden Schulen<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es ihre Anerkennung als „Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung“<br />
erreicht. Mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 ist nun darüber hinaus auch mit der<br />
Stadtschule in Michelstadt die erste Grundschule anerkannt worden.<br />
Schule Schulform Anerkennung seit Umfang<br />
Theodor-Litt-Schule<br />
Michelstadt<br />
HR<br />
1994<br />
Erweiterung 03/04<br />
1,5 Stellen<br />
+ 1 Stelle in Geld<br />
Georg-Ackermann-<br />
Schule Breuberg<br />
KGS 2003/04<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Schule am Sportpark<br />
Erbach<br />
HR 2003/04<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Georg-August-Zinn<br />
Schule Reichelsheim<br />
KGS mit Oberstufe 2004/05<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Oberzentschule Beerfelden<br />
IGS 2004/05<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Carl-Weyprecht-Schule<br />
Bad König<br />
IGS 2005/06<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Gymnasium Michelstadt<br />
Gymnasium 2006/07<br />
1,0 Stelle + 0,5 Stelle<br />
in Geld 23T€<br />
Ernst-Göbel-Schule<br />
Höchst<br />
KGS mit Oberstufe 2007/08<br />
1,0 Stelle + 0,5 Stelle<br />
in Geld 23T€<br />
Stadtschule<br />
Michelstadt<br />
Grundschule 2008/2009<br />
0,5 Stelle + Geld<br />
23T€<br />
Quelle: Schulentwicklungsplan, S. 36<br />
Die bis 2004/05 eingerichteten Maßnahmen wurden ohne Beteiligung des Schulträgers eingerichtet.<br />
Mit Änderung des Schulgesetzes zum 01.08.2005 handelt es sich bei der Einrichtung<br />
einer pädagogischen Mittagsbetreuung um eine Schulorganisationsmaßnahme, die eine<br />
Beteiligung des Schulträgers voraussetzt.
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Nach § 145 Abs. 1 HSchG stellt der Schulträger für sein Gebiet einen Schulentwicklungsplan<br />
auf. Der aktuelle Plan wurde vom Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es am 17.12.2007 beschlossen<br />
und dem Hessischen Kultusministerium gemäß § 145 Abs. 6 HSchG zur Zustimmung<br />
vorgelegt.<br />
Der im Januar 2007 gegründete Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
ist nach § 2 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung für „die Durchführung von Baumaßnahmen,<br />
das Betreiben (Verwaltung) und die Bewirtschaftung, einschließlich des Energiemanagements,<br />
die Bauunterhaltung und Planung von Gebäuden und Liegenschaften [...] des<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>es“ zuständig. Die Entwicklung der kreiseigenen Schulen und deren Sportstätten<br />
fallen u. a. in seine Zuständigkeit.<br />
Auf den folgenden Seiten ist die Hochbauprioritätenliste, Bereich Schulen, des Wirtschaftsplanes<br />
2009 dargestellt (Stand: 06.02.2009). Zuerst ist der Investitionsplan für den Bereich<br />
des Schulbaus dargestellt. Im Anschluss folgt die Prioritätenliste für das Sonderinvestitionsprogramm<br />
des Landes Hessen, mit dem die negativen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
verringert werden sollen.<br />
120
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
121
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
122
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
123
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
124
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
125
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
126
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
127
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
128
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
129
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
130
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Ziele<br />
Schulerweiterungsbauten sind künftig einer noch stärkeren Bedarfsprüfung zu unterziehen.<br />
Es ist in Zukunft verstärkt an räumliche Provisorien, wie etwa das Anmieten von Gebäuden,<br />
zu denken.<br />
Es besteht das strategische Ziel, die Grundschulangebote vor Ort zu erhalten.<br />
Etwaige Leerstände sind z. B. im Grundschulbereich durch den Ausbau von Ganztagseinrichtungen<br />
oder auch durch Kooperation mit Kindergartenträgern zu kompensieren. Die<br />
Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und den Grundschulen ist kreisweit auszubauen.<br />
Die Ganztagsangebote im Sekundarstufen-I-Bereich sind in Ganztagsangebote in offener,<br />
bzw. gebundener Form in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und Jugendpflege weiterzuentwickeln.<br />
Im Förderschulbereich ist dem Vorschlag des Staatlichen Schulamtes Bergstraße Odenwald<br />
zu folgen, das Beratungs- und Förderzentrum für Lernhilfe in Bad König zu einem Zentrum<br />
für alle Förderschulformen weiterzuentwickeln.<br />
Das Berufsschulzentrum soll in Zukunft mit der Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> den Mittelpunkt der Entwicklung eines Kompetenzzentrums für<br />
den gesamten Bereich der Beruflichen Erst- und Weiterbildung darstellen (Odenwaldcampus).<br />
Es besteht das strategische Ziel, die Zahl der Abiturienten zu steigern.<br />
Eine gemeinsam abgestimmte Schulentwicklungsplanung Darmstadt-Dieburg, Bergstraße<br />
und <strong>Odenwaldkreis</strong> ist anzustreben.<br />
Der Kreistag des <strong>Odenwaldkreis</strong>es hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2007 den Schulentwicklungsplan<br />
bis 2012 beschlossen.<br />
Die Schülerzahlen werden voraussichtlich im Planungszeitraum von 11.292 im Schuljahr<br />
2007/2008 auf 10.323 sinken. Mit rund 1000 Personen weniger könnte der Kreis damit rechnerisch<br />
ab 2012 auf zwei Schulen verzichten. Die Grundschulen sollten dabei auf jeden Fall<br />
erhalten bleiben, auch wenn dort ein Rückgang von 3.934 auf 3.158 Schüler zu erwarten ist,<br />
weil die wohnortnahen Ausbildungsstätten wichtig für eine Gleichberechtigung der Bildungschancen<br />
ist und ein Kostenfaktor nicht nur für die Eltern. Der Schulentwicklungsplan sieht<br />
deshalb Bildungseinheiten von Kindergarten und Grundschule an den derzeitigen Standorten<br />
als geeignete Entwicklung an, was natürlich mit den Gemeinden als Träger der Kindergärten<br />
abgestimmt werden müsste.<br />
Im Gymnasium Michelstadt, an dem die Schülerzahlen steigen, wird voraussichtlich bis 2010<br />
mit 1.650 Schülern der Höchststand erreicht werden. Für die Gymnasiasten sollten laut<br />
Schulentwicklungsplan deshalb bis 2012/13 keine Räume mehr gebaut, sondern leer stehende<br />
für die vorübergehende Nutzung gesucht werden.<br />
An den Schulen für Lernhilfe und für praktisch Bildbare wurde festgestellt, dass neue Räume<br />
nötig seien.<br />
Berufliche Schulen: An den Beruflichen Schulen in Michelstadt soll das Angebot qualitativ<br />
verbessert und die Selbstverwaltung der Schule (Selbstverantwortung plus) vorangetrieben<br />
werden.<br />
Die immer kleiner werdenden Klassen sollten nicht dazu führen, durch eine regionsübergreifende<br />
Schulentwicklungsplanung immer mehr Schüler an den Nachbarkreis Darmstadt-<br />
131
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Dieburg und die Wissenschaftsstadt Darmstadt zu verlieren. Dadurch werden die hier ansässigen<br />
Unternehmen immer weniger ausbilden und die beruflichen Schulen Odenwald verlieren<br />
immer mehr an Bedeutung. Vielmehr sollten sich Unternehmensverbände wie die IHK<br />
Darmstadt gemeinsam mit dem <strong>Odenwaldkreis</strong> dafür stark machen, dass die Mindestanzahl<br />
an Schülern pro Klasse von der Landesregierung ausnahmsweise herabgesetzt wird und<br />
auch kleine Klassen mit etwa 15 Schülern unterrichtet werden können. Das BSO wendet<br />
bereits erfolgreich Konzepte wie das jahrgangsübergreifende Unterrichten an, der Ausbildungs-<br />
und damit Wirtschaftsstandort <strong>Odenwaldkreis</strong> würde gestärkt und die Abwanderung<br />
von Auszubildenden gemindert.<br />
Vision „Odenwaldcampus“ für die Region<br />
Langfristig sollte die Bündelung von verschiedenen Bildungsressourcen bei gleichzeitiger<br />
Optimierung von pädagogischen wie wirtschaftlichen Aspekten ein teilweise selbsttragendes,<br />
offenes Haus für die gesamte Bevölkerung sein. Die ortsansässigen Wirtschaftsbetriebe,<br />
Kammern, Vereine usw. finden idealer Weise an einem Ort alles, was man für Erst-, Aus-<br />
Fort- und Weiterbildung benötigt. Somit sollte dieses Kompetenzzentrum in formaler und<br />
nicht formaler Bildung Angebote bereitstellen, die sich am regionalen Markt orientieren.<br />
Der Mehrwert für die Bevölkerung liegt in der Transparenz eines umfassenden Bildungsangebotes<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong>. Mit der Schaffung der Bildungsberatung aus einer Hand liefern<br />
die Kerneinrichtungen den Service des „one face to the costumer“ und damit für den Bildungsnehmer<br />
eine individuelle Beratung und Betreuung.<br />
Der Standort soll im Zentrum des Kreises für jeden zugänglich sein und über eine moderne<br />
Kommunikationsstruktur verfügen, die ihn auch für Menschen in den abgelegenen Regionen<br />
nutzbar macht.<br />
Funktionen und Aufgaben:<br />
Wer den Odenwaldcampus betritt erhält an der „Eingangstür“ einen Ansprechpartner, der<br />
über eine Kompetenzfeststellung/Beratung, den Bedarf erfasst und den geeigneten Weg mit<br />
dem „Kunden“ vereinbart (Lebenswegberatung). Nach Klärung des Bedarfs kann die Maßnahme<br />
entweder vor Ort im Campus erfolgen oder es wird an andere Institutionen weitergegeben<br />
(Schnittstellenfinder). Ist die Maßnahme beendet, wird über Zertifikate nach Europäischer<br />
ECVET das individuelle Portfolio aufgefüllt (Europäische Anerkennung). Weitere Aufgaben<br />
sind die Bereitstellung von „Hardware- und Pädagogischer Kompetenz“ an einem Ort,<br />
nutzbar für alle.<br />
Die Rolle der öffentlich verantworteten Erwachsenenbildung:<br />
Die Erwachsenbildung (Abendgymnasium), ist wie die beruflichen Schulen im Bereich der<br />
formalen Bildung angesiedelt. Das heißt der Staatsauftrag hat erste Priorität. Die Arbeit der<br />
Volkshochschulen ist schon jetzt nach selbsttragenden Faktoren ausgerichtet und entsprechend<br />
am „Markt“ präsent. Durch die Kooperation der drei Bildungseinrichtungen und der<br />
damit einhergehenden Synergieeffekte in der Pädagogik wird in wirtschaftlicher Hinsicht das<br />
Angebot wesentlich verbessert. Dies wird nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ seinen<br />
Niederschlag finden. Durch veränderte Bildungsbiographien, wird der Erwachsenenbildung<br />
somit eine Schlüsselrolle für lebenslanges Lernen zukommen.<br />
Mögliche Kooperationsmodelle mit der Bildungswirtschaft, der Wirtschaft und den Hochschulen:<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> besitzt jetzt schon Kooperationsvereinbarungen über das BSO und die<br />
VHS mit zahlreichen Partnern im süddeutschen Raum. Das BSO pflegt Kooperationen mit<br />
den Fachbereichen Elektrotechnik – Informationstechnik und Physik der TU Darmstadt, mit<br />
dem Fachbereich Automatisierungstechnik der Hochschule Darmstadt, mit der Fakultät Ingenieurwissenschaften<br />
der Hochschule Aschaffenburg und auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften<br />
mit der Universität Frankfurt am Main.<br />
Der Fachbereich Holz-Elfenbein kooperiert seit 14 Jahren mit der Sparkasse <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
in der Förderung der jungen Kunsthandwerker, die jedes Jahr an dem Gestaltungswettbe-<br />
132
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
werb Holz-Elfenbein teilnehmen, der von der Sparkasse ausgelobt wird. Zusammen mit der<br />
Industrievereinigung Odenwald (IVO) und maßgeblichen Firmen der Region (Pirelli, Koziol,<br />
Bosch, Rowenta) werden Marketingprojekte durchgeführt und einer breiten Öffentlichkeit<br />
präsentiert. Im Bereich der Informationstechnologie besteht eine rege Kooperation mit Firmen<br />
der Region, die für die Studierenden Praktikumsplätze zur Verfügung stellen.<br />
Im Bereich der Ausbildung der Sozialpädagogen gibt es erste Kontakte zur Fachhochschule<br />
für Sozialpädagogik in Erfurt und zur Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt.<br />
Die seit 20 Jahren existierende Kooperation im Bildungsbereich zwischen der TU Darmstadt<br />
und dem <strong>Odenwaldkreis</strong> über die Odenwald-Akademie, hat wesentlich dazu beigetragen,<br />
dass universitäres Wissen in die Region transferiert werden konnte.<br />
Dies hat sich niedergeschlagen in Angebote für die Weiterbildung von Ingenieuren und Architekten,<br />
aber auch in einem Technologietransfer in den Bereichen Kunststoff und regenerative<br />
Energien.<br />
Die Akademie sieht es als eine Querschnittsaufgabe an, Politik, Region und Wissenschaft zu<br />
verzahnen. In diesem Zusammenhang ist auch das im März 2007 an der Technischen Universität<br />
Darmstadt gegründete „TU Darmstadt Energy Center“ zu sehen. Durch die Verknüpfung<br />
verschiedener Projekte im Bereich regenerativer Energien im <strong>Odenwaldkreis</strong> ist<br />
der Wirkungsgrad eines Technologie- und Wissenstransfers als äußerst wirkungsvoll anzusehen.<br />
Die Odenwald-Akademie wird als Transfer-Agentur zwischen dem Energy-Center und<br />
der Region stehen.<br />
Das der Region angemessene Profil für den regionalen HESSENCAMPUS:<br />
Zu Beginn wird ein zum Großteil additiver Ansatz der Beteiligten notwendig sein. In der gemeinsamen<br />
anschließenden Zusammenarbeit werden sich dann die jeweiligen Kernkompetenzen<br />
herausstellen und damit zu einem eigenen Profil entwickeln. Dies kann allerdings nur<br />
mit allen Beteiligten geschehen und sollte ein Balance zwischen guten, vorhandenen und<br />
notwendigen neuen Bildungsangeboten darstellen. Die Vision ist ein ODENWALDCAMPUS,<br />
der von allen Menschen auch im Jahr 2020 noch für Bildung aufgesucht wird.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Schulverwaltung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Schulen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Kooperationspartner<br />
133
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
11. Erwachsenenbildung<br />
Nach den §§ 45 und 46 HSchG bietet der <strong>Odenwaldkreis</strong> am Abendgymnasium und an der<br />
Abendrealschule in Michelstadt berufstätigen Erwachsenen an, schulische Abschlüsse<br />
nachträglich und damit Zugangsberechtigungen zu Fachschulen, Fachoberschulen bzw. zur<br />
Fachhochschule und zur Universität zu erwerben. Die Abschlüsse sind den entsprechenden<br />
Abschlüssen des allgemein bildenden Schulwesens gleichgestellt. Dies geschieht in Kooperation<br />
mit der Stadt Darmstadt.<br />
11.1. VHS – Akademie für lebenslanges Lernen<br />
1. Ist-Zustand<br />
Die Gründung und Unterhaltung einer Volkshochschule ist für die Kreise und<br />
kreisfreien Städte sowie die Sonderstatusstädte eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br />
nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung<br />
und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (HWBG) 66 . Die<br />
Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule <strong>Odenwaldkreis</strong> (Akademie/VHS)<br />
steht als Eigenbetrieb des <strong>Odenwaldkreis</strong>es für ein anspruchsvolles<br />
Bildungsangebot. Der Eigenbetrieb ist seit Mai 2005 eine qualifizierte Bildungseinrichtung<br />
nach LQW 67 und unterliegt somit strengen Qualitätskriterien in der Bildung. Darüber<br />
hinaus gehört die Akademie/VHS seit Januar 2008 dem Verein Weiterbildung Hessen e.V.<br />
an, der vom Hessischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen wurde und sich ebenfalls<br />
Qualitätsstandards in der Weiterbildung gesetzt hat. Es ist das Selbstverständnis der Akademie/VHS<br />
nach all diesen Qualitätsansprüchen die Bildungsleistung vorzubereiten, durchzuführen<br />
und zu kontrollieren. Dabei wird großen Wert auf die Weiterentwicklung der Lehr-<br />
und Lernmethoden sowie die fachlichen- und pädagogischen Kompetenzen ihrer Dozentinnen<br />
und Dozenten gelegt, ob im „klassischen“ Präsenzangebot oder in den neuen Formen<br />
multimedialen Lernens. Zertifikate bieten ergänzend die Möglichkeit, den eigenen Lernerfolg<br />
in Bezug auf Kenntnisse und Fertigkeiten nachweisen zu können.<br />
Jährlich finden ca. 500 Bildungsveranstaltungen in unterschiedlichen Formen statt:<br />
� Sprachkurse<br />
� Gesundheitskurse<br />
� IT-Kurse<br />
� Bildungsurlaube<br />
� Einzelvorträge<br />
� Wochenendseminare<br />
� Firmenkurse<br />
� Lehrerfortbildung<br />
� europaweit anerkannte Zertifikatskurse<br />
Das Programmangebot erstreckt sich in den Bereichen:<br />
� Gesellschaft und Politik<br />
� Kultur, Gestalten und Kreativität<br />
� Gesundheitsbildung und -erhaltung<br />
66 Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen<br />
(Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) vom 25. August 2001 (GVBl. I S. 370), geändert durch<br />
Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2006 (GVBl. I S. 342)<br />
67 Das Modell Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung (LQW) wurde speziell für die Weiterbildung<br />
entwickelt und ist nach Abschluss der Testphase inzwischen in der Umsetzung.<br />
134
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
� sprachliche Weiterbildung<br />
� Pädagogik<br />
� berufliche Weiterbildung und Personalentwicklung<br />
� Angebote für Zielgruppen, Unternehmen und Verwaltungen<br />
� Studienreisen, Kultur nach Feierabend<br />
� Sonderveranstaltungen<br />
Dieses Bildungsangebot der Akademie/VHS stellt eine breit gefächerte, bedarfsorientierte<br />
und wohnortnahe Weiterbildungsmöglichkeit dar und wird jährlich von ca. 5.000 Bürgerinnen<br />
und Bürgern des <strong>Odenwaldkreis</strong>es nachgefragt.<br />
Die Leitung und das Team der Akademie/VHS setzen alles daran, den gesetzlichen Auftrag<br />
zu erfüllen, um alle Bevölkerungsgruppen mit der bedarfsgerechten Weiterbildung zu versorgen.<br />
Einen Überblick über die Entwicklung in den letzten fünf Jahren ergibt sich aus der folgenden<br />
Aufstellung:<br />
Leistungsbilanz<br />
Grundlage DVV-Berichtsbogen<br />
Kalenderjahr <br />
Kursleitungen<br />
Kursbetrieb Einzelveranstaltungen Studienfahrten, -reisen<br />
Kurse Unterrichts- Teilnehmer Prü- Anzahl Teilnehmer Anzahl Teilnehmer<br />
einheiten (innen) fungen<br />
(innen)<br />
(innen)<br />
2007 139 427 12.670 4.119 227 29 732 7 121<br />
2006 121 416 11.863 4.134 238 26 700 15 323<br />
2005 128 402 10.903 4.324 64 24 829 11 229<br />
2004 133 498 12.584 5.387 61 10 365 11 257<br />
2003 142 503 13.874 5.210 56 15 554 16 458<br />
Ø 133 449 12.379 4.635 129 21 636 12 278<br />
Über das aktuelle Programm kann man sich auf der Homepage der Akademie/VHS unter<br />
www.vhs-odenwald.de informieren.<br />
2. Entwicklungsstrategie<br />
Ziele<br />
� Modernisierung des Internet-Auftritts für die Bedarfserschließung neuer Kundengruppen<br />
mit der Intension, dass Blogs oder andere direktere Kommunikationsformen die notwendige<br />
Informationen liefern<br />
� Neuausrichtung der Kursbesuche:<br />
Gemeinsame Absprache und Vereinbarung über die Kursbesuche der Pädagogen aufgrund<br />
neu definierter Kriterien<br />
Ausbau und mögliche Implementierung von spezifischen Evaluationsverfahren<br />
135
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Bildung verbessert die beruflichen Perspektiven und erhöht Lebensqualität und -chancen.<br />
Teilnehmer(innen) erweitern ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen und können sich<br />
aktiver an den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen.<br />
Gelungenes Lernen findet dann statt, wenn die fachlichen, pädagogischen und organisatorischen<br />
Rahmenbedingungen sowie ein angenehmes Lernumfeld es den Teilnehmenden ermöglichen,<br />
Freude am Lernen zu entwickeln, den Lernprozess mitzugestalten, ihre persönliche<br />
Kompetenz zu erweitern, ihre Kreativität zu nutzen und damit schließlich ihre individuellen<br />
Ziele zu erreichen. Zertifikate bieten ergänzend die Möglichkeit, den eigenen Lernerfolg<br />
in Bezug auf Kenntnisse und Fertigkeiten nachweisen zu können.<br />
Im Rahmen der Initiative Hessencampus der Landesregierung bildet die Volkshochschule<br />
eine der Kerninstitutionen. Gemeinsam mit dem Beruflichen Schulzentrum <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
und der Schule für Erwachsene leistet sie einen Beitrag zum Aufbau eines Odenwaldcampus.<br />
Als eine nach LQW zertifizierte und von Weiterbildung Hessen e. V. anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung<br />
achtet die Volkshochschule bei der Planung ihres Jahresprogrammes<br />
darauf, dass sich die Kursinhalte sowie die Kursleitungen auf einem erwachsenpädagogischen<br />
modernen Stand befinden. Hierzu kann auf ein breites Netz von Kooperationspartnern<br />
auf Landes- wie auch auf Kreisebene zurückgegriffen werden, das künftig noch weiter<br />
ausgebaut wird. Zu diesen Netzwerk zählen unter anderem: die Landesarbeitsgemeinschaft<br />
Arbeit und Leben, die Qualifizieungsoffensive, das Bildungswerk des Landessportbundes,<br />
Netzwerk Demenz, der Förderverein der Beruflichen Schulen Odenwald, der Sportkreis<br />
Odenwald, die Mary-Anne-Kübel-Stiftung, die Lernstubb u. v. m.<br />
11.2. Odenwald-Akademie<br />
Die Odenwald-Akademie ist eine Kooperation der Technischen Universität<br />
Darmstadt (TUD) und des <strong>Odenwaldkreis</strong>es. In enger Zusammenarbeit verfolgt<br />
sie das Ziel, zum Nutzen der Odenwälder Wirtschaft und der Öffentlichkeit<br />
universitäres Wissen ortsnah in diversen Veranstaltungen zu vermitteln.<br />
Mit diesen Veranstaltungen bietet die Odenwald-Akademie allen Fach- und<br />
Führungskräften sowie allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu vertiefen.<br />
Inzwischen ist die Odenwald-Akademie als Fortbildungs- und Qualifizierungsanbieter beim<br />
Institut für Qualitätsentwicklung zugelassen.<br />
Weiterführende Informationen sowie das aktuelle Programm kann man der Homepage der<br />
Odenwald-Akademie unter www.odenwald-akademie.de entnehmen.<br />
Initiiert durch den Landrat des <strong>Odenwaldkreis</strong>e führt die Odenwald-Akademie seit März 2007<br />
Odenwald-Dialoge zu aktuellen Themen durch. Die Odenwald-Dialoge sind als Podiumsdiskussionen<br />
ausgelegt, bei denen Interessenvertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Politik<br />
und Forschung diskutieren und Fragen der Zuschauer beantworten. Daneben gibt es bereits<br />
seit 1988 die Michelstädter Rathausvorlesungen. Diese Vortragsreihe wird von Professorinnen<br />
und Professoren der Technischen Universität Darmstadt gestaltet und garantiert damit<br />
Aktualität sowie Qualität der umfangreichen Themen. Diese hochkarätigen Vorlesungen finden<br />
im Wintersemester (von Oktober bis März) eines jeden Jahres statt: Sie sind für die Teilnehmenden<br />
kostenfrei und ohne Voranmeldung zu besuchen. Auch hier besteht nach jedem<br />
Vortrag die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Referenten. Die Gesamtdauer jeder Veranstaltung<br />
beträgt etwa zwei Stunden. Bis heute wurde jede Vorlesung, seit dem Wintersemester<br />
2005/06, beim Institut für Qualitätsentwicklung akkreditiert und mit Leistungspunkten<br />
für teilnehmende hessische Lehrkräfte anerkannt.<br />
136
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
11.3. Energy Center<br />
Das auf Initiative der TU Darmstadt gegründete Energy Center hat sich als Ziel die Forschung,<br />
Lehre und Entwicklung wissenschaftlicher und technologischer Grundlagen für eine<br />
ganzheitliche und nachhaltige Energieversorgung gesetzt.<br />
Um künftig eine sichere, wirtschaftliche und vor allem auch umweltverträgliche Energieversorgung<br />
für die Gesellschaft sicherstellen zu können, ist die weitere Entwicklung der Energiesysteme<br />
unabdingbar. Dies ist nur mit interdisziplinärer und enger Zusammenarbeit von<br />
den Bereichen Wissenschaft, Industrie und Politik unter den folgenden Gesichtspunkten zu<br />
bewältigen:<br />
• Entwicklung der notwendigen Technologien und Strukturen<br />
• Schaffung geeigneter politischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen<br />
• Implementierung am Markt.<br />
Der Landrat ist seit Juni 2007 Vorstandmitglied des Beirat des TU Darmstadt Energy Centers.<br />
11.4. Bildungs- und Schulungsangebot in der Land- und Forstwirtschaft<br />
Das Amt für den ländlichen Raum (ALR) zeigt den Landwirten des <strong>Odenwaldkreis</strong>es Möglichkeiten<br />
auf, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, den Landschaftsschutz und den Tourismus<br />
zu unterstützen und gleichzeitig neue Erwerbszweige zu erschließen.<br />
Dazu werden die folgenden Fortbildungen angeboten:<br />
• Ausbildung zur Agrarbürofachfrau<br />
• Schulungen für Nebenerwerbslandwirte<br />
• Ausbildung zum Fachwart im Obstbau<br />
Das ALR und der Kreisverband Obstbau, Garten und Landschaftspflege bieten seit 2003<br />
die Fachwartausbildung Obstbau an. Der Kurs erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das<br />
ALR hat das Projekt auch in den Nachbarkreisen vorgestellt und für eine finanzielle Unterstützung<br />
der dort wohnenden Teilnehmer.<br />
• Arbeitskreise für Landwirte/Energiewirt,<br />
Milchviehhalter,<br />
Odenwälder Fleischrinderhalter,<br />
Direktvermarkter<br />
Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof und Bauernhofcafés<br />
• ein jährlicher Informationstag für Milcherzeuger<br />
• Mitwirkung beim Beerfelder Pferdemarkt<br />
• Informationsstände beim Odenwälder Bauernmarkt und beim Michelsmarkt in Reichelsheim<br />
(Odenwald).<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• VHS – Akademie für lebenslanges Lernen<br />
• Odenwald-Akademie<br />
• Energy Center<br />
• Amt für den ländlichen Raum (ALR) des <strong>Odenwaldkreis</strong>es in Reichelsheim (Odenwald)<br />
137
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
12. Schulen und Weiterbildungsangebot der Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
GmbH<br />
Die Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH betreibt zwei Ausbildungsstätten, an denen<br />
berufliche Ausbildungen zum Kranken- und Altenpfleger angeboten werden.<br />
Krankenpflegeschule<br />
Die Ausbildung an der Krankenpflegeschule des Gesundheitszentrums dauert insgesamt<br />
drei Jahre. Wird die Ausbildung erfolgreich absolviert, ist man berechtigt, die Berufsbezeichnung<br />
Gesundheits- und Krankenpfleger/in zu führen. Die Lehrgänge beginnen jeweils am 1.<br />
Oktober und schließen nach insgesamt drei Jahren mit einer schriftlichen, praktischen und<br />
mündlichen Prüfung ab.<br />
Die praktische Ausbildung umfasst ca. 2.500 Stunden und erfolgt am Kreiskrankenhaus Erbach<br />
in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Kinderkrankenpflege<br />
und wahlweise<br />
• Intensivpflege, Wachstation, OP oder Anästhesie<br />
• beim Zentrum Gemeinschaftshilfe (Sozialstation)<br />
• beim Bad Königer Pflegedienst oder der Integra<br />
• fünf Wochen im Zentrum für soziale Psychiatrie Bergstraße Heppenheim oder<br />
• fünf Wochen im Elisabethenstift in Darmstadt<br />
• fünf Wochen in der psychiatrischen Institutsambulanz der Psychiatrie Bergstraße Heppenheim.<br />
Weiterhin bietet diese Ausbildungsstätte:<br />
• 60 Ausbildungsplätze<br />
• vier hauptamtliche und weitere nebenamtliche Dozenten<br />
• ausgebildete Praxisanleiter<br />
• Schülerbegleitung durch die hauptamtlichen Lehrer/innen<br />
• gut ausgestattete Schule in lernfreundlicher Atmosphäre<br />
• schülerorientierten Unterricht<br />
• preiswerte Wohn- und Verpflegungsmöglichkeiten<br />
• individuell betreute Ausbildung<br />
• eine Berufsausbildung mit Zukunft.<br />
Altenpflegeschule<br />
In einem Abstand von drei Jahren besteht bei der Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
GmbH die Möglichkeit, eine Ausbildung zur/zum Altenpfleger/in zu absolvieren. Diese Ausbildung<br />
dauert ebenfalls drei Jahre und endet mit der staatlichen Prüfung. Die Abschlussprüfung<br />
besteht auch hier aus einem schriftlichen, praktischen und mündlichen Teil.<br />
Folgende Weiterbildungsangebote sind vorhanden:<br />
• zum Lehrer/in für Pflegeberufe<br />
• zum Pflegedienstleiter/in<br />
• zum Heimleiter/in<br />
• zum Stations- und Gruppenleiter/in<br />
• Fachkraft Rehabilitation<br />
• Fachkraft Psychiatrie/Gerontopsychiatrie<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH<br />
• Kooperationspartner<br />
138
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
13. Kultur und Sport<br />
Im September 2007 wurden die Förderrichtlinien des <strong>Odenwaldkreis</strong>es beschlossen; die<br />
Förderung steht unter folgenden Grundaspekten:<br />
• Wahrung der Ausgleichsfunktion des Kreises<br />
• verstärkte Berücksichtigung des überörtlichen Wirkungskreises von Vereinen und Verbänden<br />
• verstärkte Unterstützung der Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden.<br />
Die Förderung von Vereinen ist in ihren Resultaten unmittelbar vor Ort erkennbar, im Bau<br />
oder Ausbau, in Unterhaltung oder Instandsetzung von Sportanlagen. Unterstützung gewährt<br />
der Kreis den Vereinen auch bei der Anschaffung langlebiger Sportgeräte und anderer für<br />
sportliche Betätigung erforderliche Gegenstände.<br />
In die kulturelle Förderung fallen Zuschüsse für Gesangvereine, Trachtengruppen und ähnliche<br />
Vereinigungen, z. B. die Anschaffung von Musikinstrumenten oder auch bei umfangreichen<br />
Investitionen in der Vereins- und Jugendarbeit.<br />
Der Bereich Sport und Kultur organisiert die Sportler-, Kleintierzüchter- und Sängerehrung.<br />
Hinzu kommt die Mitarbeit bei der Gestaltung von Informationsbroschüren und -schriften.<br />
Außerdem ist die Abteilung Schnittstelle der Kreisverwaltung für den Kultursommer Südhessen<br />
und den Natur- und Geopark Bergstraße-Odenwald.<br />
13.1. Kultursommer Südhessen e. V. (KuSS)<br />
Der Kultursommer Südhessen e. V. (KuSS) ist eine Initiative der Landkreise<br />
Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald und Offenbach<br />
sowie der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die kulturelle Projekte in<br />
der gesamten Region unter einem gemeinsamen Dach bündelt und fördert.<br />
Der KuSS wurde 1994 ins Leben gerufen, um das vielseitige kulturelle<br />
Angebot der Region bekannter zu machen. Gleichzeitig erhoffen sich<br />
die Beteiligten sich eine stärkere Vernetzung der Kulturschaffenden. Im<br />
Jahr 1997 wurde der Verein Kultursommer Südhessen gegründet, dem die<br />
vorgenannten Gebietskörperschaften und zwischenzeitlich die Städte Dieburg<br />
und Erbach sowie die Gemeinde Fischbachtal angehören.<br />
Gefördert werden Veranstaltungen, in denen regional und überregional anerkannte Künstler/innen<br />
ihr Können präsentieren. Die Förderung regionaler Initiativen und Nachwuchsförderung<br />
ist ebenfalls ein Anliegen des KuSS.<br />
Im Vorstand des Kultursommer Südhessen e.V. sind die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-<br />
Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald und Offenbach sowie der Stadt Darmstadt und der Regierungspräsident<br />
Darmstadt mit beratender Stimme vertreten. Seit 2000 ist ein Kuratorium eingerichtet,<br />
das den Kultursommer Südhessen ideell unterstützt. Ein Arbeitskreis, der sich aus<br />
jeweils einem Vertreter der oben genannten Gebietskörperschaften zusammensetzt, bereitet<br />
die Aktivitäten des KuSS vor und sorgt für einen reibungslosen Programmablauf. Die Arbeitskreismitglieder<br />
fungieren auch als Ansprechpartner für den KuSS in den jeweiligen<br />
Landratsämtern bzw. Rathäusern.<br />
139
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
13.2. Kulturinfrastruktur in der Region<br />
• Museen: Elfenbeinmuseum, Regionalmuseum in Reichelsheim (Odenwald), privates<br />
Motorradmuseum, Odenwälder Spielzeugmuseum<br />
• Gräfliche Sammlungen im Schloss Erbach (überregionale Bedeutung)<br />
• Theater, Ausstellungen, Konzerte<br />
• Büchereiwesen<br />
• Musikschulen: Musikschule Odenwald<br />
• etc.<br />
Auch hier gilt es, die vielfältigen Angebote in einer kreisübergreifenden Internet-Plattform und<br />
Publikation zu bündeln und Interessenten auf übersichtliche Weise zugänglich zu machen.<br />
Der Gästeführer Odenwald e.V. trägt mit seinen ca. 70 Mitgliedern in bedeutendem Maße<br />
dazu bei, Besuchern des Odenwaldes die kulturellen Schätze der Region nahe zu bringen.<br />
Die Odenwald Tourismus GmbH wird das vielfältige kulturelle Angebot des Odenwaldes zukünftig<br />
entsprechend dem Marketingkonzept über das Profilthema „Sagenwald Odenwald“<br />
bündeln und kommunizieren.<br />
13.3. Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat 2007 eine Ehrenamtsagentur gegründet, die Anlaufstelle für alle<br />
ehrenamtlich arbeitende Organisationen, Vereine, Verbände, aber auch für den einzelnen<br />
freiwillig Tätigen ist (www.ehrenamt.odenwaldkreis.de). Die Agentur steht mit Beratung und<br />
Fortbildungsangeboten zur Seite und sorgt für die Vernetzung ehrenamtlicher Aktivitäten in<br />
den Städten und Gemeinden. Formale Angelegenheiten wie die Umsetzung der Förderrichtlinien<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es werden geregelt und die Durchführung der Sänger-, Sportler-<br />
und Kleintierzüchterehrung durchgeführt, die Vergabe der Ehrenamtscard sowie die Beratung<br />
von Vereinen und Personen im Einzelfall. Außerdem ist die Agentur Vernetzungsstelle<br />
für das Projekt „Integration braucht Paten“.<br />
Die Mission besteht darin, das bürgerschaftliche Engagement im <strong>Odenwaldkreis</strong> zu fördern<br />
und dabei Menschen glücklich zu machen.<br />
Ehrenamtsagentur<br />
Die Ehrenamtsagentur als ein Teilbereich der Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport hat es<br />
sich zur Aufgabe gemacht, das Thema „Ehrenamt“ im <strong>Odenwaldkreis</strong> stärker zu beleuchten.<br />
Es werden dabei viele neue ehrenamtliche Aufgaben in Zusammenarbeit mit Organisationen,<br />
Vereinen, Städten und Gemeinden konzipiert und alte weiter ausgefüllt und am Leben erhalten.<br />
Dies nach dem Motto: „Wir verknüpfen Menschen, die etwas Sinnvolles tun möchten,<br />
mit Aufgaben, die durch sie erst möglich werden“.<br />
Der Freiwilligensurvey, der im Auftrag der Bundesregierung 2006 erstellt wurde, hat unter<br />
anderem ergeben, dass das „neue“ Ehrenamt bei der Bevölkerung verstärkt gefragt ist: Meist<br />
zeitlich begrenzte Aufgaben, die auch außerhalb eines Vereins, projekt- oder personenbezogen<br />
immer öfter stattfinden.<br />
Gleichzeitig fördert die Ehrenamtsagentur aber auch das „alte“ Ehrenamt in den über 1200<br />
Vereinen und Organisationen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, die in der Vereinsdatenbank der Internetpräsenz<br />
vertreten sind.<br />
140
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Ehrenamtscard<br />
Mit der 2006 eingeführten Ehrenamtscard (E-Card) und der seit 2008 durchgeführten Verleihungsveranstaltung<br />
soll eine Anerkennungskultur fortgeführt und weiter aufgebaut werden.<br />
Gleichzeitig wird der Kreis der teilnehmenden E-Card-Sponsoren, die eine Vergünstigung in<br />
Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen hessenweit anbieten, auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> stetig<br />
erweitert.<br />
www.ehrenamt.odenwaldkreis.de<br />
Herzstück der Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport ist die interaktive Internetseite<br />
www.ehrenamt.odenwaldkreis.de, in der ehrenamtliche Aufgaben von Organisationen selbstständig<br />
eingestellt und von Bürgern, die etwas Sinnvolles tun möchten, gefunden werden.<br />
Diese informative Seite bietet zudem wichtige Informationen rund um das Thema „Ehrenamt“<br />
sowie einen Überblick über alle Aktivitäten und Projekte der Ehrenamtsagentur & Servicestelle<br />
Sport, wie u. a. die Sport– und Vereinsförderung nach Förderrichtlinien, Kulturförderung,<br />
Organisation verschiedenster Veranstaltungen, Fortbildungen, Beratung und Begleitung<br />
von Projekten.<br />
Vorrangige Ziele sind:<br />
• nachhaltige Verstärkung der Anerkennungskultur,<br />
• Ausbau des ehrenamtlichen Netzes mit den Städten und Gemeinden,<br />
• Förderung und Schaffung von Projekten mit ehrenamtlichen Aufgaben in allen Bereichen<br />
gesellschaftlichen Zusammenlebens.<br />
13.4. Sport<br />
Die Anforderungen an den Sport können allgemein folgendermaßen dargestellt werden:<br />
• Der Sport übernimmt mehr und mehr erzieherische Aufgaben.<br />
• Präventivarbeit für Gesundheit<br />
• Integration<br />
• sinnvolle Beschäftigung von Jugendlichen<br />
Sport hat Verfassungsrang und stellt trotzdem eine freiwillige Aufgabe dar, die also dem<br />
Sparzwang besonders unterliegt.<br />
Das Sportverhalten der Bevölkerung ändert sich: Es ist sehr individuell und wandelt sich<br />
auch im Hinblick auf die zunehmende Zahl älterer Sporttreibender.<br />
In der Literatur 68 wird differenziert zwischen „bewegungsaktiver Erholung“ und „Sporttreiben“,<br />
wobei ersteres gemütliches Schwimmen, Radfahren und Spazieren umfasst und „Sporttreiben“<br />
Regelmäßigkeit und Anstrengung voraussetzt.<br />
Im Alter steigt rapide der Anteil der bewegungsaktiven Erholung. Die Motive sind aber in jeder<br />
Altersgruppe ähnlich gelagert: sich fit halten, Gesundheitsvorsorge, Spaß an der Bewegung,<br />
Ausgleich, Entspannung 69 .<br />
Das Breitensportangebot im <strong>Odenwaldkreis</strong> ist gut ausgebildet und bietet auch eine gute<br />
Infrastruktur (Sporthallen, Hallenbäder, Sportplätze, Schützenhäuser etc.).<br />
68 Wetterich, Schrader, Eckl: Regionale Sportentwicklungsplanung im Landkreis Groß-Gerau, Berlin<br />
2007, S. 17 mit weiteren Quellenangaben<br />
69 Wetterich, Schrade, Eckl 2007, S. 20<br />
141
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die Sportkommission des Kreisausschusses des <strong>Odenwaldkreis</strong>es fördert investive Maßnahmen<br />
von Vereinen (z. B. Ausbau in Steinbach).<br />
Der Aufbau im Vereinsbereich gestaltet sich folgendermaßen: Deutsche Olympische Gesellschaft<br />
Sektion Odenwald (z. B. Aktion „Junge Könner brauchen Gönner“) und den Landessportbund<br />
als Dachorganisation, dem jeder Verein angehören muss, der bei Wettkämpfen<br />
zugelassen werden möchte. Unter dem Dachverband sind die regionalen Einrichtungen angesiedelt<br />
(Sportkreis), der jetzt auch eine Teilzeitbeschäftigung in der Kreisservicestelle<br />
Sport fördert; der Sportkreis hilft den Vereinen des Kreises vor allem in rechtlichen Fragestellungen<br />
wie Versicherungsfällen und kümmert sich um das Fortbildungsangebot.<br />
Das Anbieterspektrum ist oft sehr groß und birgt die Gefahr der Unübersichtlichkeit in sich (z.<br />
B. bei Frühschwimmer: AWO, Schwimmverein, Schwimmbäder etc.).<br />
Sportanlagenentwicklung: Die favorisierten Sportarten sind Ausdauersportarten, die nicht<br />
unbedingt eine normierte und vordefinierte Sportstätte benötigen, z. B. Radfahren, Laufen,<br />
Walken und Spazierengehen. Diese Tatsache muss bei der Sportstättenplanung beachtet<br />
werden. Sportstätten des Kreises dienen deshalb vor allem dem Schulsport und diesen Anforderungen<br />
müssen die Anlagen zuerst gerecht werden. In zweiter Linie ermöglicht der<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> die Nutzung von Schulsporthallen und Hallenbädern durch Vereins-, Behinderten-<br />
und Seniorensport.<br />
Der Unterhalt von Sportstätten und die Förderungen im Sportbereich stellen einen beträchtlichen<br />
Kostenfaktor im Haushalt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es bzw. im Wirtschaftsplan seines Eigenbetriebes<br />
Bau- und Immobilienmanagement <strong>Odenwaldkreis</strong> dar. Da der Spielraum für<br />
Neu-, Umbau und Sanierung sehr begrenzt ist, rücken Modelle für die optimale Nutzung der<br />
vorhandenen Anlagen, die Neuregelung von Sportstättenbelegung, neue Betreibermodelle<br />
und ein kostendeckender Mietzins in den Vordergrund der Sportentwicklungsplanung. Die<br />
Förderung des Vereinssports auf der einen und die Notwendigkeit der Kostendeckung beim<br />
Betreiben der Sportanlagen auf der anderen Seite bilden für den Kreis einen kaum zu lösenden<br />
Konflikt.<br />
Einsparmöglichkeiten durch energetische Optimierungen werden durch die Firma Heidec<br />
GmbH untersucht, jedoch sind auch in diesem Bereich Grenzen gesetzt. Die Umstellung von<br />
Heizungen auf regenerative Energieträger sind Beispiele von wichtigen und kostenintensiven<br />
Investitionen.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Abteilung „Organisation, Bürger- und Gremienservice“ des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Arbeitskreis KuSS<br />
• Vereine und Organisationen<br />
• Museen<br />
• Büchereien<br />
• Musikschule Odenwald<br />
142
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
14. Familien- und Sozialpolitik<br />
14.1. Bündnis für Familien<br />
Lokale Bündnisse für Familie sind:<br />
• Zusammenschlüsse von Partnern aus Politik und Verwaltung, Unternehmen, Kammern<br />
und Gewerkschaften, freien Trägern, sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden, Initiativen<br />
etc.<br />
• Kontaktplattform, Diskussionsforum, Ideenschmiede, Lobby für Familien und Ansatzpunkt<br />
für Vereinbarungen und Maßnahmen.<br />
Lokale Bündnisse für Familie schaffen:<br />
• Netzwerke von Akteuren, die sich in einer Region für Familien engagieren<br />
• konkrete Verbesserungen für Familien durch Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern:<br />
Balance von Familie und Beruf, Kinderbetreuung, Verkehr und Wohnen, Bildung und Erziehung,<br />
Information und Beratung, Familienrollen von Vätern und Müttern, Gesundheit<br />
• Beteiligungsmöglichkeiten an familienrelevanten Entscheidungen in der Kommune.<br />
Die bundesweite Initiative Lokale Bündnisse für Familie will:<br />
• lokale Zusammenschlüsse für Familien, die es an vielen Orten schon gibt, durch kostenlose<br />
Beratungsangebote wirkungsvoll unterstützen<br />
• die Gründung neuer Lokaler Bündnisse für Familie anstoßen, wobei das Servicebüro<br />
ebenfalls kostenlose Hilfestellung anbietet<br />
• lokalen Bündnissen durch Erfahrungsaustausch und Vernetzung neue Anregungen geben<br />
• das Thema Familienfreundlichkeit vor Ort und auf Bundesebene, in Politik, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft ins Gespräch bringen<br />
• dazu beitragen, dass das unmittelbare Lebensumfeld von Familien in Stadt, Gemeinde,<br />
Wohnviertel und Betrieb familienfreundlicher wird.<br />
Lokale Bündnisse für Familie nutzen:<br />
• den Städten und Gemeinden, die für Familien attraktiver werden<br />
• den Unternehmen, die im Bündnis zum Beispiel überbetriebliche Angebote für Beschäftigte<br />
entwickeln und umsetzen können<br />
• den Initiatoren, weil ihr familienfreundliches Engagement im Bündnis mehr Anerkennung,<br />
mehr Wirkung und eine breitere Plattform findet. 70<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> hat sich das lokale Bündnis für Familien bereits etabliert und diverse Aktionen<br />
durchgeführt. So war das Bündnis auf dem Dekanatskirchentag am 26. Juni 2007 vertreten,<br />
engagiert sich in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Kinderbetreuung, familienfreundliche<br />
Betriebe und familienfreundlicher Tourismus.<br />
Bündnispartner sind neben dem <strong>Odenwaldkreis</strong> die Städte und Gemeinden Breuberg, Hesseneck,<br />
Lützelbach, Michelstadt, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Odw. e. V., Michelstadt,<br />
der Caritasverband Darmstadt e. V., Erbach, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Odw.<br />
e. V., Erbach, das Deutsche Dekanat Erbach im Odenwald, Erbach, das<br />
Evangelische Dekanat, Reinheim, das Diakonische Werk Odenwald, Bad<br />
König, das Gesundheitszentrum Odenwald GmbH, Erbach, der Verein<br />
Kindergärtchen e. V., Michelstadt, die Mary-Anne-Kübler-Stiftung, Reichelsheim<br />
(Odenwald) und die Odenwald Stiftung.<br />
Die Aufgaben in Bereich der Sozialpolitik sind überwiegend Pflichtaufgaben nach Weisung.<br />
70 Text aus www.lokales-buendnis-fuer-familie.de, Stand 12/2007<br />
143
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
14.2. Jugendhilfe<br />
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden unterteilt in örtliche und überörtliche Träger.<br />
Örtliche Träger sind die Kreise und die kreisfreien Städte. Landesrecht regelt, wer überörtlicher<br />
Träger ist (§ 69 Abs. 1 SGB VIII 71 ). Die Aufgabenaufteilung zwischen örtlichen und<br />
überörtlichen öffentlichen Jugendhilfeträgern ist geprägt vom Grundsatz der Allzuständigkeit<br />
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgaben des Jugendamtes leiten<br />
sich aus dem SGB VIII her. Zu den Leistungen (§§ 11 bis 41 SGB VIII) gehören:<br />
• Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 bis 14<br />
SGB VIII)<br />
• Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)<br />
• Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25 SGB VIII)<br />
• Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)<br />
• Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)<br />
• Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII).<br />
• Die Angebote werden grundsätzlich von den verschiedenen Adressaten freiwillig in Anspruch<br />
genommen. Der Begriff "Leistungen" bezieht sich auf Einrichtungen und Dienste<br />
der Jugendhilfe (vgl. § 5 Satz 1 SGB VIII). Deren Bedarf festzustellen und entsprechende<br />
Maßnahmen zu planen, ist originäre Aufgabe des Jugendamtes (Jugendhilfeplanung).<br />
Das Jugendamt muss die genannten Leistungen keineswegs selbst anbieten. Lediglich<br />
wenn Bedarf besteht und freie Träger der Jugendhilfe entsprechende Leistungen nicht<br />
anbieten, hat das Jugendamt als öffentlicher Träger für die Leistung selbst zu sorgen<br />
(Subsidiarität, § 4 Abs. 2 SGB VIII).<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem<br />
Jugendamt und den freien Trägern der Jugendhilfe. Eingebunden in diese Kooperation sind<br />
auch die Städte und Gemeinden, die für einzelne Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe (z.B.<br />
Kinderbetreuung) Verantwortung mit übernommen haben. Hierdurch sind gute Bedingungen<br />
vorhanden, die dazu beitragen, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Jugendhilfeleistungen<br />
entwickelt werden kann.<br />
14.2.1. Jugendarbeit/Jugendbildungsarbeit, § 11 SGB VIII<br />
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der<br />
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen<br />
und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen<br />
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen<br />
und hinführen. Jugendarbeit ist ergebnis- und prozessoffen und orientiert sich an der Lebenswelt<br />
und dem Alltag der Jugendlichen im jeweiligen Sozialraum.<br />
Die Jugendarbeit hat durch die PISA-Studie 72 mit ihrem Hinweis auf den Stellenwert informeller<br />
Bildung in der aktuellen Bildungsdebatte an Bedeutung gewonnen. Jugendarbeit ist neben<br />
der Bildung und Erziehung im Elternhaus, Kindergarten, Schule und beruflicher Ausbildung<br />
ein wichtiger, ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen.<br />
Dabei gilt Jugendarbeit insbesondere als:<br />
• Lern-Ort differenzierter Beziehungen,<br />
• Erprobungsraum für eine geschlechtliche Identität,<br />
• Ort interkultureller Erfahrungen,<br />
71 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, zuletzt geändert durch Art. 2<br />
Abs. 23 G v. 19.2.2007 I 122<br />
72 www.pisa.oecd.org<br />
144
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• Aneignungsort für Kompetenzen,<br />
• Ort der Erprobung von Verantwortungsübernahme und Ehrenamtlichkeit,<br />
• Ort ästhetischer Selbstinszenierung.<br />
Die Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren,<br />
hauptsächlich jedoch an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren und<br />
nicht in erster Linie an sogenannte „Problemgruppen“.<br />
Die Angebote in diesem Bereich werden im <strong>Odenwaldkreis</strong> von kommunalen Trägern und<br />
freien Trägern der Jugendarbeit durchgeführt.<br />
Kommunale Träger<br />
Angebote der Abteilung Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung:<br />
Freizeitangebote:<br />
Neben dem Spielmobil werden Angebote für die Ferienzeit erarbeitet, die von pädagogisch<br />
geschulten Kräften durchgeführt werden. Das Spielmobil steht jeweils eine Woche in den<br />
Sommerferien in einer Kommune, zusätzlich steht das Spielmobil den Kommunen, Vereinen<br />
und Verbänden für Feste und Aktivitäten zur Ausleihe zur Verfügung.<br />
Kinderfilmtreff:<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> findet in vielen Kommunen ein Kinderfilmangebot statt, das von der Abteilung<br />
koordiniert wird. Die Kinderfilme werden nach pädagogischen Fragestellungen sorgfältig<br />
ausgewählt und altersgemäß eingesetzt.<br />
Internationale Begegnungen:<br />
Multinationale und binationale Jugendbegegnungen finden in der Regel mit europäischen<br />
Regionen statt, mit denen auch in anderen Projekten, insbesondere in der Jugendberufshilfe<br />
sowie im Bereich Partizipation, kooperiert wird.<br />
Kulturelle Bildung:<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es ein gut ausgebautes Angebot an Theatergruppen für Kinder und<br />
Jugendliche. Die Abteilung bietet an fast allen weiterführenden Schulen Theater-Arbeitsgemeinschaften<br />
an.<br />
Freie Theater- und Schultheatergruppen werden in ihren Produktionen unterstützt und bringen<br />
ihre Stücke in öffentlichem Rahmen zum Auftritt. Für Jugendliche finden Wochenendseminare<br />
im Bereich Musik, Theater und Tanz statt.<br />
Angebote im medienpädagogischen Bereich:<br />
Im Rahmen von Seminaren, Workshops und Arbeitsgemeinschaften wird die Möglichkeit<br />
geboten, sich kreativ und kritisch mit den neuen Medien auseinander zu setzen. Jugendliche<br />
sollen befähigt werden, eigenständig und selbstbestimmt mit Medien umzugehen.<br />
Methoden:<br />
• Erwerb von Medienkompetenz durch praktische Erkundung und Einübung an konkreten<br />
Fällen<br />
• Gestaltung eigener Internetseiten<br />
• Produzieren von Videofilmen zu selbsterstellten Drehbüchern u. a. m.<br />
Angebote zur Partizipation:<br />
Mit der Gründung von Jugendforen wird Jugendlichen vor Ort die Möglichkeit geboten, sich<br />
in ihren jeweiligen Kommunen aktiv am Gemeinwesen zu beteiligen.<br />
Die Mitarbeit in einem Jugendforum ermöglicht, Demokratie und aktive Mitgestaltung live zu<br />
erleben.<br />
Zur erfolgreichen Umsetzung dieser Form der Partizipation hat die Abteilung Jugendamt -<br />
Kinder- und Jugendförderung ein Konzept erstellt, was derzeit in zwei Gemeinden (Erbach<br />
und Reichelsheim (Odenwald)) unter Beteiligung verschiedener Institutionen und Akteure vor<br />
Ort durchgeführt wird.<br />
Training sozialer Kompetenzen:<br />
In Tagesveranstaltungen, schulischen Projekten oder in Wochenend- und Wochenseminarveranstaltungen<br />
schulen Jugendliche durch eine Vielzahl von Methoden, Übungen und<br />
145
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Spielen ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung, ihr Vertrauen zu sich und anderen, ihre Kommunikations-<br />
und Konfliktfähigkeit, ihre Teamfähigkeit, sowie ihre Toleranz gegenüber Fremdem.<br />
Sie erfahren, wie wichtig z. B. die Fähigkeit zur Kooperation und Konfliktfähigkeit für<br />
ihre berufliche und private Zukunft in einer multikulturellen Gesellschaft sein kann.<br />
Dieses Angebot besteht für Klassen der 5. – 8. Jahrgangsstufe, insbesondere für solche, die<br />
aufgrund ihrer benachteiligten Lebenssituation einen besonderen Bedarf haben.<br />
Mediation an Schulen:<br />
Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt Schulen bei der Umsetzung dieses Projektes.<br />
Konkret bedeutet dies u. U.: Beratung bei der Erstellung von Rahmenbedingungen und Zeitplan,<br />
Information der Schulgemeinde (Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Eltern, Schulsozialarbeiter/-innen),<br />
Werbung und Ausbildung der Schüler/-innengruppe, Vorbereitung der Umsetzung<br />
des Projektes an der Schule und Einbindung in ein Gesamtkonzept<br />
Streitvermittlungs- und Konflikttrainingsprogramm an Grundschulen:<br />
In Absprache mit Schulen wird ein Gewaltpräventionsprojekt zur Stärkung der sozialen Kompetenzen<br />
von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern angeboten.<br />
Das Projekt hilft Regeln für das Zusammenleben in der Schule und im Elternhaus zu erarbeiten<br />
und das Klima zu entspannen. Es fördert die gegenseitige Achtung und Kooperation<br />
zwischen Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern.<br />
Fachtage:<br />
Im Rahmen der Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit finden Fachtage z. B. zum Thema<br />
Aufsichtspflicht und Haftung satt.<br />
Jugendinitiativen, örtliche Jugendpflegen, Vereine und Verbände:<br />
Jugendinitiativen sowie örtliche Jugendpflegen steht die Abteilung Jugendamt - Kinder- und<br />
Jugendförderung beratend und unterstützend zur Seite. Gemeinsam können Projekte erarbeitet<br />
und durchgeführt werden.<br />
Für Vereine und Verbände leistet die Abteilung neben der finanziellen Förderung von Fahrten<br />
und Lager, Jugendbildungsangeboten und Materialanschaffungen Beratungsarbeit im<br />
Bereich Jugendarbeit und stellt die Jugendleitercard (JULEICA) aus.<br />
Sie organisiert die Jugendsammelwoche des Hessischen Jugendrings und ist Ansprechpartnerin<br />
für den Kreisjugendring.<br />
Angebote der kommunalen Jugendpflegen:<br />
Zum Stichtag 01.10.2008 waren in 8 Kommunen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es kommunale Jugendarbeiter<br />
und Jugendarbeiterinnen mit insgesamt 5,44 Stellen tätig. Die Jugendarbeit findet in<br />
fast allen Kommunen, außer in Michelstadt, in eigenen Räumen statt.<br />
Die Stellenanteile reichen von halben Stellen bis Vollzeitstellen pro Kommune. Angeboten<br />
werden neben den offenen Treffs Arbeitsgemeinschaften und Seminare zu Themen wie Bewerbertraining,<br />
kreative Angebote, medienpädagogische Angebote, erlebnispädagogische<br />
Angebote, Suchtprävention, Sport und Natur. Außerdem werden in einigen Kommunen die<br />
Ferienspiele von der Jugendpflege ausgerichtet. Hinzu kommen einzelne Events und Ausflüge.<br />
In drei Kommunen gibt es spezielle Angebote nur für Mädchen.<br />
Zielgruppe sind in der Regel (Ferienspiele ausgenommen) 11- bis 18-jährige Jungen und<br />
Mädchen, in Brensbach gibt es Angebote für die bis 21 Jährigen und in Lützelbach für Kinder<br />
ab 8 Jahren.<br />
In Reichelsheim (Odenwald) übernimmt der Jugendpfleger die Koordination und Betreuung<br />
des Schutzburg-Projekts für Kinder sowie die Beratung, Unterstützung von und Mitarbeit bei<br />
Reichelsheimer Vereinen (Erstes Jugendcamp mit Jugendlichen der Partnerstädte, Erste<br />
School-Out-Party).<br />
In Beerfelden und Mossautal sind Jugendräume vorhanden, die ehrenamtlich betreut bzw.<br />
über die Kommune verwaltet werden.<br />
146
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Angebote der freien Träger der Jugendarbeit:<br />
Die Angebote der freien Träger der Jugendarbeit sind vielfältig und finden im gesamten<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> statt.<br />
Neben Fahrten und Lagern finden sowohl Bildungsveranstaltungen als auch Tagesaktivitäten<br />
und Gruppenstunden statt.<br />
Die kirchlichen Träger verfügen über je eine Dekanatsjugendreferentin beim Evangelischen<br />
Dekanat und bei der Katholischen Jugendzentrale. Beide sind jedoch für einen größeren<br />
Einzugsbereich zuständig.<br />
Beim Roten Kreuz ist die Fachstelle für Suchtprävention mit einem Stellenanteil von 100 %<br />
angesiedelt. Hier liegt der Schwerpunkt in der Arbeit mit den Multiplikatoren und in der Öffentlichkeits-<br />
und Gremienarbeit.<br />
Die Arbeit der freien Träger der Jugendarbeit wird nach § 12 SGB VIII sowohl inhaltlich als<br />
auch finanziell unterstützt.<br />
In 2007 sind folgende Maßnahmen der Jugendvereine/-verbände von Seiten der Abteilung<br />
Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung bewilligt worden.<br />
Fahrten und Lager Bildungsangebote Materialzuschuss<br />
70 2 14<br />
Insgesamt wurden 52 Vereine und Verbände, die in der Jugendarbeit aktiv sind, bezuschusst.<br />
In einigen Kommunen existieren Jugendräume in kirchlicher Trägerschaft.<br />
14.2.2. Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII<br />
In diesen Bereich gehört die Schulsozialarbeit und die Jugendberufshilfe sowie weitere Maßnahmen<br />
zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen.<br />
Schulsozialarbeit<br />
Die Schulsozialarbeit ist an den weiterführenden Schulen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es fest etabliert.<br />
Die Gesamtorganisation dieses Arbeitsbereiches übernimmt die Abteilung Jugendamt – Kinder-<br />
und Jugendförderung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Schulen bietet sie bei der Entwicklung/Weiterentwicklung von Schulsozialarbeit ihre fachliche<br />
Unterstützung bei der Ausarbeitung des Konzeptes an.<br />
Die Konzepte werden jährlich evaluiert.<br />
Die soziale Arbeit an den weiterführenden Schulen steht auf mehreren Säulen:<br />
• An den jeweiligen Sek. I-Schulen wurden vom <strong>Odenwaldkreis</strong> halbe Stellen „Schulsozialarbeit“<br />
geschaffen und finanziert.<br />
• Projektbezogene Kooperationen finden aus den einzelnen Schwerpunkten der Abteilung<br />
Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung heraus statt.<br />
• In das Gesamtkonzept fließen die Nachmittagsangebote sowie weitere Angebote der<br />
Schulgemeinde ein.<br />
• Die Abteilung Jugendamt – Besondere Soziale Dienste führt in allen 6. Klassen das Projekt<br />
„Kids gegen Gewalt“ durch.<br />
• Ferner ist sie neben dem schulpsychologischen Dienst und Vertretern der Schule Teil<br />
des „Beratungsteams“ an allen Schulen<br />
147
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• für Schüler/-innen mit Erziehungshilfebedarf wurden an den jeweiligen Schulen<br />
Sozialpädagogen auf ½ Stellen eingestellt, die ein integratives Konzept an den jeweiligen<br />
Schulen verfolgen<br />
• Die Herkunftskommunen der Schüler/-innen beteiligen sich je nach Ausgangslage.<br />
Träger der Schulsozialarbeit im <strong>Odenwaldkreis</strong> sind der Odenwälder Verein für Bildungs-<br />
und Kulturarbeit e. V. (Lernstubb), die AWO <strong>Odenwaldkreis</strong> e. V. und Familienhilfezentrum<br />
Odenwald gGmbh.<br />
Hinzugekommen sind nun auch die Grundschulen, die ins Förderprogramm des Kultusministeriums<br />
der „Ganztagsschule nach Maß“ aufgenommen sind oder werden. Hier werden<br />
vom <strong>Odenwaldkreis</strong> entsprechend der Schüler/-innenzahlen „Schulsozialarbeit-Stellen“ geschaffen<br />
und finanziert.<br />
Im Rahmen der Schulsozialarbeit finden Fachtage zum Beispiel zum Thema „Mobbing“ oder<br />
„Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen“ statt.<br />
Weitere Maßnahmen:<br />
Zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen<br />
wird derzeit ein Projekt zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte<br />
– „Chancenreich – Projekt“ durchgeführt.<br />
Jugendberufshilfe<br />
Die Jugendberufshilfe des Jugendamtes unterstützt den Eingliederungsprozess von Jugendlichen<br />
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nachhaltig. Neben konkreten Angeboten werden<br />
die Strukturen im Übergang Schule – Beruf weiter ausgebaut. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten<br />
wird prozessbegleitend evaluiert.<br />
Netzwerk Übergang Schule – Beruf im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Das Netzwerk "Übergang Schule – Beruf im <strong>Odenwaldkreis</strong>" ist eine Kooperation aller Akteure,<br />
die sich mit Schülerinnen, Schülern und jungen Erwachsenen als Fachleute beschäftigen.<br />
Sie alle arbeiten mit an der strukturellen Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendamt,<br />
Schulen und Staatlichem Schulamt, Kammern, Agentur für Arbeit, Kommunalem<br />
Job-Center, Jugendberufshilfeträgern, freien Jugendhilfeträgern, Kirchen, Betrieben, Arbeitgebern<br />
und dem Wirtschaftsservice der OREG mbH.<br />
Eine intensive organisationsübergreifende Kooperation in der Region gewährleistet einen<br />
umfassenden Erfahrungs- und Informationsaustausch, da die Beteiligten ihre unterschiedlichen<br />
Kompetenzen und Ressourcen mit einbringen. Alle regionalen Akteure sind sich einig,<br />
dass sie sich noch mehr darüber informieren müssen, wer an welchen Schwerpunkten arbeitet,<br />
um sich gegenseitig bei der Arbeit unterstützen zu können. Neben einer systematischen<br />
Erfassung der Fördermaßnahmen geht es dabei auch um Abstimmungsprozesse und<br />
Synergien, damit Maßnahmen sinnvoller und bedarfsorientierter aufeinander bezogen und<br />
geplant werden können.<br />
Das Netzwerk ist ein Forum mit verbindlichen Kooperationsstrukturen, das zukunfts- und<br />
zielgerichtet agiert, neue innovative Ansätze erarbeitet und umsetzt.<br />
Um gemeinsame Ziele zu erreichen, haben die regionalen Partner im <strong>Odenwaldkreis</strong> bereits<br />
zwei Instrumente erarbeitet, die auch für andere hessischen Regionen Beispielcharakter<br />
haben können: ein Netzwerkbuch, das alle notwendigen Informationen für "Netzwerker" auf<br />
einen Blick enthält und eine Kooperationsvereinbarung der regionalen Akteure. Beide Instrumente<br />
wollen wir an dieser Stelle vorstellen.<br />
148
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Netzwerkbuch im Übergang Schule – Beruf im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Das Netzwerkbuch bietet einen Überblick und Grundinformationen über bestehende Programme,<br />
Angebote und Maßnahmen beruflicher Bildung und Ausbildung für Jugendliche und<br />
junge Erwachsene.<br />
Neben der Übersicht der schulischen Angebote, die aufsteigend<br />
nach möglichen Schulabschlüssen beschrieben sind, werden<br />
auch die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen dargestellt.<br />
Diese bieten Jugendlichen die Möglichkeit ihre Ausbildungsreife<br />
zu verbessern oder leisten Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche.<br />
Beschrieben werden auch schulische Ausbildungsgänge und<br />
außerbetriebliche Ausbildungsmöglichkeiten, die über Bildungsträger<br />
angeboten werden, bis hin zu qualifizierenden Beschäftigungsmaßnahmen<br />
und Hilfen bei Bewerbungen sowie bei der<br />
Eingliederung in Ausbildung und Arbeit.<br />
Informiert wird zudem über die rechtlichen Bestimmungen des Arbeitsmarktes, über Good-<br />
Practice-Beispiele und über Institutionen, die beim Bewältigen von sozialen Problemlagen<br />
flankierend helfen können, damit eine Eingliederung besser gelingt.<br />
Das Nachschlagewerk enthält eine Anschriftenliste der Maßnahmeträger mit den jeweiligen<br />
Ansprechpartner/innen und Informationen zu den Angeboten der betreffenden Institution.<br />
Damit das Buch zeitnah und aktuell sein kann, haben sich die Herausgeber/innen für eine<br />
Loseblatt-Sammlung in einem handlichen Ringhefter entschieden. So kann das Handbuch<br />
regelmäßig aktualisiert werden, damit seine Nutzer/innen jederzeit schnell und sicher die<br />
passenden Informationen aus der Vielfalt der Möglichkeiten nachschlagen können.<br />
Kooperationsvereinbarung<br />
In den Arbeitstreffen des Netzwerks wurde eine von allen Beteiligten unterschriebene Kooperationsvereinbarung<br />
erarbeitet, in der sich alle Akteure verpflichten, zukünftig eine gemeinsame,<br />
verbindliche und effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die zu erbringenden<br />
Aufgaben der jeweiligen Institutionen sind in der Kooperationsvereinbarung genau beschrieben.<br />
Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit<br />
bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen<br />
Das Netzwerk ist inzwischen in das Projekt OloV eingebunden.<br />
Die Mitglieder im Netzwerk setzen die Vorgaben des Hessischen Ausbildungspaktes zur<br />
Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit zur Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen<br />
in Hessen (OloV) für den <strong>Odenwaldkreis</strong> um.<br />
Das Projekt OloV hat im Auftrag des Hessischen Ausbildungspaktes hessenweite Standards<br />
zu den Themenbereichen<br />
• Berufsorientierung mit Förderung der Ausbildungsreife<br />
• Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen<br />
• Matching und Vermittlung<br />
erarbeitet:<br />
Die Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben bei der Umsetzung der Qualitätsstandards<br />
übernimmt die regionale Koordinatorin im Jugendamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
149
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Zusammen mit dem Ansprechpartner des Staatlichen Schulamtes für den Kreis Bergstraße<br />
und den <strong>Odenwaldkreis</strong> und den anderen regionalen Akteuren sorgen sie für die Umsetzung<br />
der Qualitätsstandards. Zur Erprobung und Umsetzung dieser Qualitätsstandards werden<br />
gemeinsam Zielvereinbarungen erarbeitet.<br />
Die Projektlaufzeit ist zunächst auf 31.12.2009 festgelegt.<br />
Projekt „Spinach for Popeye“<br />
Das Projekt „Spinach for Popeye“ wird sich weiterhin im europäischen Kontext spiegeln.<br />
Es richtet sich auf europäischer Ebene an benachteiligte junge Menschen, die besondere<br />
Schwierigkeiten haben, den beruflichen Einstieg zu schaffen. Zur Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten<br />
geht der <strong>Odenwaldkreis</strong> mit dem seit 1997 initiierten europäischen Projekt<br />
neue Wege. Gemeinsam mit unseren derzeitigen Partnern Schweden, Schottland und<br />
Holland vernetzen wir europaweit Kompetenzen, Innovation, Erfahrung und Kreativität, um<br />
hieraus wichtige Impulse für die Jugendberufshilfe im <strong>Odenwaldkreis</strong> zu gewinnen. Gerade<br />
jetzt erleben wir durch die Finanzkrise deutlicher als jemals zuvor, wie sehr wir in einer globalisierten<br />
Welt leben und die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Veränderungen uns gemeinsame<br />
Anstrengungen abfordern.<br />
Das Projekt bietet: Möglichkeit eines jährlichen Fachkongresses zu ausgewählten Themen<br />
der Jugendberufshilfe, individuellen Fachkräfteaustausch, internationalen Jugendaustausch<br />
im jährlichen Wechsel zur besseren Verständigung und dem Abbau von Vorurteilen im Sinne<br />
des europäischen Gedankens.<br />
Ausbildung in Partnerschaften<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> bildet bereits seit 2003 (neben den regelhaften Verwaltungsausbildungsberufen)<br />
im Verbund mit gewerblichen Betrieben und öffentlicher Verwaltung hauptsächlich<br />
in den Berufsfeldern Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, Industriekauffrau/-mann<br />
und Informatikkauffrau/-mann aus. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> schafft hierüber neue und zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze und trägt damit in überdurchschnittlichem Maße zur Sicherung des qualifizierten<br />
Fachkräftenachwuchses des regionalen Arbeitsmarktes bei.<br />
In jedem Ausbildungsjahr werden durchschnittlich 6 Verbundausbildungsplätze zusätzlich<br />
geschaffen, der Leitbetrieb ist der <strong>Odenwaldkreis</strong>, er ist für die Ausbildung insgesamt verantwortlich,<br />
schließt die Ausbildungsverträge ab und organisiert die Ausbildung in den Partnerbetrieben.<br />
Während der gesamten Ausbildungsdauer steht den Auszubildenden, den Betrieben und den<br />
Lehrer/-innen eine permanente Ansprechpartnerin zur Verfügung.<br />
Den Betrieben wird neben niedrigeren Ausbildungskosten eine qualitativ hochwertige Ausbildung<br />
zugesichert. Die Auszubildenden erhalten ein Paket an kostenfreien Fortbildungsmöglichkeiten<br />
(z. B. EDV, Sozialkompetenzen, Englisch) und erhalten Einblicke in unterschiedliche<br />
Betriebsstrukturen und Arbeitsabläufe, die ihre Sozialkompetenzen erweitern und ihre<br />
Arbeitsplatzchancen erhöhen.<br />
Die Nachwuchskräfte werden durch gute, fundierte Ausbildung im eigenen Betrieb und zusätzliche<br />
Erfahrungen aus anderen Betrieben qualifiziert. Sie erhalten somit eine abwechslungsreiche<br />
Ausbildung auf hohem Niveau bei gleichzeitiger Entlastung der Unternehmen<br />
von organisatorischen Aufgaben und formalen Anforderungen.<br />
Alle bisher beteiligten Betriebe und Kommunen bewerten die Ausbildung in Partnerschaften<br />
durchweg sehr positiv.<br />
150
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die Ausbildung in Partnerschaften wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und<br />
über Mittel des Landes Hessen.<br />
14.2.3 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern §§ 22 – 25 SGB VIII<br />
Bedingt durch Veränderungen der Familienstrukturen bzw. von sozialen Strukturen hat in<br />
den letzten Jahren die außerhäusliche Betreuung von Kindern im Elementarbereich zunehmend<br />
an Bedeutung gewonnen. Bereits 1996 hat die Europäische Kommission in einem Papier<br />
zum Ausbau der Kinderbetreuung festgehalten: „Qualitativ hochwertige Einrichtungen für<br />
kleine Kinder sind ein notwendiger Teil der ökonomischen und sozialen Infrastruktur. Gleichberechtigter<br />
Zugang ist unerlässlich für die Chancengleichheit von Männern und Frauen, für<br />
das Wohl von Kindern, Familien und Gemeinwesen sowie für eine produktive Wirtschaft“.<br />
Nach § 22 SGB VIII soll durch Angebote in Tageseinrichtungen und durch Kindertagespflege<br />
die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit<br />
gefördert werden, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt und ergänzt<br />
werden und den Eltern dabei geholfen werden, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung<br />
besser miteinander vereinbaren zu können.<br />
Entwicklungspsychologische Untersuchungen haben ergeben, dass frühe Lernerfahrungen<br />
im Kleinkindalter nachhaltigen Einfluss auf spätere Bildungsprozesse haben. Indem Kinder<br />
bereits im Vorschulbereich pädagogisch betreut und Kindertageseinrichtungen in ihrer Funktion<br />
als Betreuungs- und Bildungseinrichtungen genutzt werden, können Bildungspotenziale<br />
der Kinder früh entwickelt werden. Eine diese Aspekte berücksichtigende qualifizierte außerhäusliche<br />
Betreuung und Erziehung leistet einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration<br />
von Kindern und erhöht die Chancengerechtigkeit.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat als örtlicher öffentlicher Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) in der<br />
Vergangenheit gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und freien Trägern der Jugendhilfe<br />
erhebliche Anstrengungen unternommen, den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz<br />
sowie den bedarfsgerechten Ausbau der Angebote für Kleinkinder und Kinder im<br />
Grundschulalter zu gewährleisten. Dem Landkreis obliegt hierfür die Gesamtverantwortung.<br />
Unbeschadet dieser Gesamtverantwortung ist es nach § 30 Abs. 1 des Hessischen Kinder-<br />
und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) Aufgabe der Städte und Gemeinden in Zusammenarbeit<br />
mit den freien Trägern der Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen<br />
und in Kindertagespflege in ihrer Gemeinde festzustellen. Der Bedarfsplan hat die<br />
voraussichtliche Bedarfsentwicklung zu berücksichtigen und ist mit dem Jugendamt abzustimmen.<br />
Die Kommunen haben nach § 30 Abs. 2 HKJGB dafür zu sorgen, dass die erforderlichen<br />
Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung stehen bzw. im Rahmen<br />
der Ausbauplanung geschaffen werden.<br />
151
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Angebote für Kleinkinder<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> stehen für die Kleinkinder unterschiedliche Betreuungsmodelle zur Verfügung.<br />
Neben Plätzen im kommunalen und privaten Kinderkrippen wird die institutionelle<br />
Betreuung der Kleinkinder in Kindertageseinrichtungen in altersstufenübergreifenden Gruppen<br />
angeboten. Weiterhin bieten Kindertagespflegestellen ein individuelles Betreuungsangebot.<br />
Die Plätze für Kindertagespflege werden im Auftrag des Jugendamtes vom Kindertagespflegebüro<br />
des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt in Michelstadt vermittelt. In den letzten<br />
Jahren ist es durch gemeinsame Aktionen von Jugendamt und AWO sowie durch eine entsprechende<br />
Landesförderung gelungen, zahlreiche neue Tagespflegeeltern für die Betreuung<br />
von Kinder unter 3 Jahren zu gewinnen und zu qualifizieren. Bei einer Gesamtzahl von<br />
2295 (Stand 31.12.2007) Kindern unter drei Jahren gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong> derzeit 358<br />
Betreuungsplätze. Damit sind für 15,6 % der Kinder unter drei Jahren entsprechende<br />
Betreuungsmöglichkeiten vorhanden. Dieses Platzangebot entspricht in etwa dem bundesdeutschen<br />
Durchschnitt von 15,5 % (Stand 31.12.2007). Es liegt allerdings deutlich über dem<br />
Durchschnittswert von 9,9 % in den westlichen Bundesländern. 69% der Plätze stehen in<br />
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung und 31% werden von Tagespflegeeltern angeboten.<br />
Ziel ist es im Jahr 2013, für 35% der Kinder unter 3 Jahren ein entsprechendes Platzangebot<br />
im Landkreis vorzuhalten.<br />
Angebote im Kindergartenalter<br />
Kindergärten sind heute zu einem selbstverständlichen Bestandteil kindlicher Sozialisation<br />
geworden. Die Betreuung der Kindergartenkinder wird im <strong>Odenwaldkreis</strong> in insgesamt 54<br />
Einrichtungen angeboten. Die Einrichtungen sind in kommunaler, kirchlicher und freier Trägerschaft.<br />
Für 3448 (Stand 31.12.2007) Kinder stehen 3415 Kindergartenplätze zur Verfügung.<br />
Dies entspricht bei 4 Altersjahrgängen einem Versorgungsgrad von 99%. Damit wird<br />
der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im <strong>Odenwaldkreis</strong> voll erfüllt.<br />
Die Betreuungsangebote sind unterschiedlich strukturiert und bieten von einer Halbtagsbetreuung<br />
bis zu einer Ganztagsbetreuung mit Mittagsversorgung eine Vielzahl von unterschiedlichen<br />
Betreuungsmodellen. Die Ganztagsbetreuung der Kinder mit Mittagessen wird<br />
jedoch nicht in allen Kommunen angeboten. Gerade in kleineren Gemeinden gibt es im Hinblick<br />
auf die Öffnungszeiten noch Handlungsbedarf. Für Eltern, die durch ihre Berufstätigkeit<br />
auf flexible und umfassende Betreuungszeiten angewiesen sind, ist es in einem Flächenkreis<br />
wie dem <strong>Odenwaldkreis</strong> deshalb ganz wichtig, dass es ergänzend zu den Kindertageseinrichtungen<br />
auch ein ausgebautes Betreuungsangebot durch Tagespflegeeltern gibt.<br />
Angebote für Grundschulkinder<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es keine klassischen Horte für Schulkinder. Stattdessen hat sich das<br />
Angebot der betreuenden Grundschule herausgebildet. Diese Betreuungsangebote sind entsprechend<br />
den jeweiligen örtlichen Vorraussetzungen verschieden ausgestaltet. Sie unterscheiden<br />
sie sich sowohl im Hinblick auf die Betreuungszeiten als auch den personellen<br />
Ressourcen: Da es sich um eine Maßnahme des Kultusministeriums handelt, gilt nicht das<br />
für die Jugendhilfe verbindliche Fachkräftegebot. Erfreulicherweise werden jedoch in den<br />
meisten Fällen pädagogisch ausgebildete Kräfte eingesetzt. An 16 Grundschulen werden<br />
insgesamt 340 Kinder in diesem Rahmen betreut. An drei weiteren Schulstandorten wird<br />
aktuell über die Einrichtung der betreuenden Grundschule nachgedacht. In einzelnen Kommunen<br />
wird die Betreuung der Grundschulkinder auch in Kindertageseinrichtungen angeboten.<br />
Die Kinder werden entweder in altersstufenübergreifenden Gruppen betreut oder es bestehen<br />
eigenständige Betreuungsangebote für die Grundschulkinder in den Einrichtungen.<br />
Mit dem geplanten Einstieg von Grundschulen im Landkreis in das Förderprogramm des<br />
Landes zum Ausbau von Ganztagsangeboten werden sich auch die Rahmenbedingungen<br />
für die Betreuungsmaßnahmen in den Schulen verbessern.<br />
152
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Bildungsauftrag<br />
Der Elementarbereich hat gemäß § 22 SGB VIII auch einen Bildungsauftrag.<br />
Mittelweile haben alle Bundeslände Bildungspläne und Bildungsprogramme als inhaltlichfachlichen<br />
Orientierungsrahmen. Im Hessen wurde ab 2005 der Hessische Bildungs- und<br />
Erziehungsplan für Kinder von 0 – 10 Jahren eingeführt. Die Kindertageseinrichtungen sollen<br />
zu eigenständigen Bildungseinrichtungen fortentwickelt werden.<br />
Wichtiger Grundsätze sind:<br />
• Das Kind und die Stärken seiner Entwicklung stehen ausdrücklich im Mittelpunkt aller<br />
Überlegungen.<br />
• Alle Lern- und Bildungsorte arbeiten eng und verzahnt zusammen, um Kindern einen<br />
gesicherten und kontinuierlichen Bildungsverlauf zu ermöglichen.<br />
• Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Träger und Eltern<br />
können bei der Begleitung der Entwicklung der Bildung und Erziehung der Kinder<br />
auf gemeinsame Grundlagen und Inhalte zurückgreifen.<br />
Nach Abschluss der Erprobungsphase wird der Bildungs- und Erziehungsplan von 2008 bis<br />
2012 in den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen implementiert.<br />
Integration<br />
Integration von Kinder mit Migrationshintergrund:<br />
Um soziale Nachteile auszugleichen, gehören in den Kindertageseinrichtungen auch der<br />
Erwerb der deutschen Sprache und die Sprachförderung zum Kernbereich der frühkindlichen<br />
Bildung und Erziehung. Insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund ist Sprachförderung<br />
besonders wichtig, damit sie mit ausreichenden Deutschkenntnissen eingeschult werden.<br />
Oftmals sind die Kindertageseinrichtungen die einzigen Orte, wo die Kinder die Gelegenheit<br />
haben deutsch zu lernen und zu sprechen. Der Landkreis legt Wert auf die Sprachförderung<br />
von Kinder mit Migrationshintergrund.<br />
Integration von Kindern mit Behinderung:<br />
Kinder mit Behinderung sind nach Möglichkeit gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu<br />
betreuen. Die integrative Betreuung dient der individuellen und sozialen Entwicklung der<br />
Kinder.<br />
Durchschnittlich werden im <strong>Odenwaldkreis</strong> jährlich 50 Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen<br />
durchgeführt. Integrationsmaßnahmen werden für Kinder mit körperlich,<br />
geistiger und seelischer Behinderung gewährt.<br />
Fast alle Kindertageseinrichtungen im Kreis führen diese Maßnahmen durch, so dass eine<br />
wohnortnahe Betreuung der Kinder mit Behinderung möglich ist. Die Mitarbeiter/innen der<br />
Einrichtungen sind aufgefordert sich durch Fortbildungen zu qualifizieren.<br />
Weiterhin bestehen im <strong>Odenwaldkreis</strong> umfangreich Strukturen zur Qualitätssicherung der<br />
integrativen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen.<br />
14.2.4. Familien- und Erziehungshilfe sowie Eingliederungshilfe<br />
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu<br />
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.<br />
Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvorderst<br />
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.<br />
Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere<br />
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen,<br />
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,<br />
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,<br />
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,<br />
153
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie<br />
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“<br />
(§ 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder und Jugendhilfe)<br />
Hilfen zur Erziehung gemäß dem SGB VIII:<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> ist ein vielfältiges Leistungsangebot unterschiedlich ausgeprägter Hilfen<br />
zur Erziehung, die zum Teil vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe (dem Jugendamt) und in<br />
deutlich größerem Maß mit höherer Differenziertheit von freien Trägern der Jugendhilfe angeboten<br />
werden, vorhanden.<br />
Der Schwerpunkt der Hilfen liegt auf niederschwelligen und präventiven Maßnahmen. Dies<br />
nicht nur aus der Intention heraus, mehr Familien und deren Kinder frühzeitig zu erreichen,<br />
um durch geeignete Interventionen und Unterstützungen deren Erziehungsfähigkeit wieder<br />
herzustellen oder zu erhalten, sondern auch um möglichst auf intensive lang andauernde<br />
und meist mit einem starken Bruch innerhalb der Familie einhergehenden Hilfen verzichten<br />
zu können.<br />
Derzeit gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong> folgende klassische Angebote (nach dem SGB VIII) durch<br />
das Jugendamt und der freien Träger der Jugendhilfe:<br />
§ 27 Hilfe zur Erziehung alle Träger<br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit i. V. mit integrativer Erziehungshilfe<br />
AWO <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit i. V. mit integrativer Erziehungshilfe<br />
FHZ Odenwald<br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit i. V. mit integrativer Erziehungshilfe<br />
Kinderhof Fürstengrund<br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit i. V. mit integrativer Erziehungshilfe<br />
Lernstubb<br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit i. V. mit integrativer Erziehungs- Verein f. Jugendwerkstäthilfeten<br />
§ 30 Erziehungsbeistandschaft Jugendamt<br />
§ 30 Erziehungsbeistandschaft FHZ Odenwald<br />
§ 30 Erziehungsbeistandschaft Sozialberatung Schley<br />
§ 30 Erziehungsbeistandschaft akzent mobil<br />
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe Jugendamt<br />
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe Sozialberatung Schley<br />
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe FHZ Odenwald<br />
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe Sozialberatung Schley<br />
§ 32 Tagesgruppe AWO <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
§ 32 Tagesgruppe FHZ Odenwald<br />
§ 33 Vollzeitpflege Jugendamt<br />
§ 34 Heimerziehung *, sonstige betreute Wohnform akzent mobil<br />
§ 34 Heimerziehung *, sonstige betreute Wohnform Erbacher Regenbogenhaus<br />
§ 34 Heimerziehung *, sonstige betreute Wohnform FHZ Odenwald<br />
§ 34 Heimerziehung *, sonstige betreute Wohnform Kinderhof Fürstengrund<br />
§ 34 Heimerziehung *, sonstige betreute Wohnform Kinderhaus Sensbachtal<br />
§ 35 a Eingliederungshilfe, ambulant, teilstationär und stationär<br />
alle Träger **<br />
(** Lernstubb nicht stationär)<br />
154
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
(* Die Angebote (Plätze für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) im Bereich der<br />
Heimerziehung stehen neben dem Jugendamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es natürlich auch anderen<br />
Jugendämtern offen, da vom Jugendamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es alleine weder eine Beleggarantie<br />
gegeben werden könnte, noch der Bedarf an so vielen Plätzen vorhanden ist)<br />
Erziehungsbeistandschaft (EBSCH) § 30 SGB VIII<br />
Zur Zielgruppe der Erziehungsbeistandschaft gehören neben Kindern und Jugendlichen<br />
auch junge Erwachsene. Der Erziehungsbeistand soll den Klienten bei der Bewältigung von<br />
Entwicklungsproblemen, möglichst mit der Einbeziehung des sozialen Umfeldes, unterstützende<br />
Hilfe bieten und unter Erhaltung des Lebensbezugs der Familie seine Verselbstständigung<br />
fördern. Es soll erreicht werden, dass die Erziehungsfunktion der Familie verbessert<br />
und gefestigt wird. Der Erziehungsbeistand will Minderjährige, deren Familien, aber auch<br />
junge Volljährige ansprechen, die sich in Konflikten untereinander oder mit ihrem Umfeld<br />
befinden, z. B. bei Schule-, Erziehungs-, Wohnungs- und wirtschaftlichen Problemen.<br />
Der Erziehungsbeistand steht dem Minderjährigen und jungen Erwachsenen mit Rat und Tat<br />
zur Seite. Er unterliegt innerhalb und außerhalb der Behörde der Schweigepflicht.<br />
Konkret bedeutet das Angebot:<br />
• regelmäßige Hausbesuche und Einzelgespräche,<br />
• Gruppengespräche mit der gesamten Familie,<br />
• Hilfen bei schulischen Problemen, der Lehrstellensuche, Problemen bei der Berufsausbildung<br />
und der Verselbstständigung in ein eigenverantwortliches Leben, mit der Möglichkeit<br />
des betreuten Wohnens, gemeinsame Freizeitaktivitäten und vieles andere mehr.<br />
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII<br />
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) will die Familie befähigen, ihre Probleme<br />
selbstständig zu lösen. Sie will Hilfe und Beratung den Familien geben, die sich in Schwierigkeiten<br />
befinden und für sich keine Lösungswege finden können. Eine Vielzahl von Themen<br />
und Bereichen, die für die Familie Probleme darstellen, können gemeinsam bearbeitet werden.<br />
Diese ambulante Hilfe ist jedoch kein Wundermittel. Erfolge können erzielt werden,<br />
wenn die Familie bereit und motiviert ist, ihre Probleme zu bearbeiten. Nicht die Mitarbeiter /<br />
innen der SPFH sollen die Probleme lösen, sondern die Betroffenen selbst. Die SPFH ist<br />
„Wegweiser“ und „Wegbegleiter“. Die Mitarbeiter/ innen der SPFH unterliegen der Schweigepflicht<br />
– auch innerhalb der Behörde.<br />
Die SPFH bietet damit die Chance:<br />
• vorbeugend die Familien bei dem Erhalt der notwendigen Familienfunktionen zu unterstützen,<br />
• Hilfestellung bei einer zu entwickelnden befriedigenden Lebensgestaltung für alle<br />
Familienmitglieder zu geben,<br />
• Kriseninterventionen durchzuführen.<br />
Honorarkräfte<br />
Im Bereich der Ambulanten Hilfen nach §§ 30/31 SGB VIII steht dem Jugendamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
ein großer Kreis von selbstständigen Honorarkräften zur Verfügung. In dessen<br />
Auftrag werden viele Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene betreut.<br />
Der Einsatz dieser Honorarkräfte hat sich im Laufe der Jahre als ambulante Hilfe bewährt,<br />
die schnell und in hohem Maße flexibel, im Rahmen der Jugendhilfe des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
eingesetzt werden kann.<br />
155
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII<br />
Die Vollzeitpflege gehört zu den klassischen Leistungsangeboten der Jugendhilfe. Die Erziehung<br />
eines Kindes in einer anderen Familie als seiner Herkunftsfamilie hat es schon immer<br />
gegeben. Die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Pflegefamilie unterscheidet<br />
sich grundsätzlich von anderen Erziehungshilfen, da sie in der Regel nicht von ausgebildeten<br />
Fachkräften erbracht wird, sondern von engagierten Laien. Hinter dem Begriff<br />
Vollzeitpflege verbirgt sich eine Vielfalt unterschiedlichster Hilfsangebote, die von der kurzfristigen<br />
Aufnahme von Kinder in Notsituationen in Bereitschaftspflegefamilien bis in zu langfristigen<br />
Lebensperspektive für Kinder reichen können. Die Ausgestaltung richtet sich nach<br />
dem erzieherischen Bedarf des Einzelfalls und dem Wohl des zu betreuenden Kindes.<br />
Entsprechend dem Vorrang der elterlichen Erziehung ist die Rückkehr des Kindes in die<br />
Herkunftsfamilie innerhalb von zwei Jahren anzustreben. Erscheint dies aussichtslos, ist der<br />
Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie als dauerhafte Hilfe anzusehen.<br />
Die Jugendämter haben die Aufgabe, geeignete Pflegefamilien für dies Hilfeart bereitzustellen.<br />
Diese müssen geworben, beraten und für ihre Aufgabe qualifiziert werden. Ist ein Pflegekind<br />
vermittelt, soll die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie unterstützt<br />
und in schwierigen Situation vermittelt werden. Zudem werden die Pflegfamilien kontinuierlich<br />
begleitet. Die Herkunftsfamilien soll bei der Verbesserung ihrer Erziehungsbedingungen<br />
unterstützt werden.<br />
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII<br />
Heimerziehung als Hilfe zur Erziehung will Kindern und Jugendlichen, die in Folge individueller,<br />
sozialer und gesellschaftlicher Problemlagen in ihrer Herkunftsfamilie überfordert oder<br />
gefährdet erscheinen, vorübergehend einen neuen, pädagogisch gestalteten und professionell<br />
strukturierten Lebensort bieten. Neben der Arbeit in Bezug auf eventuelle Entwicklungs-<br />
bzw. Verhaltensdefizite oder familiäre Dispositionen steht die Schaffung einer schulischen<br />
oder beruflichen Perspektive, gerade auch im Hinblick auf eine spätere eigenverantwortliche<br />
Lebensführung, im Vordergrund.<br />
Außer den traditionellen Heimeinrichtungen gibt es inzwischen eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Formen der Unterbringung. Hierzu zählen u. a. Jugendwohngemeinschaften aber auch<br />
betreutes Einzelwohnen. Neben der Belegung entsprechender Angebote im <strong>Odenwaldkreis</strong>,<br />
macht es in einzelnen Fällen auch Sinn, junge Menschen außerhalb des Kreises unterzubringen.<br />
Ursache kann sein, dass es erforderlich ist, Abstand vom bisherigen negativen sozialen<br />
Umfeld zu gewinnen, oder dass besondere pädagogische bzw. therapeutische Angebote<br />
im Landkreis aktuell nicht zur Verfügung stehen. Ein Ziel unseres Jugendamtes ist es,<br />
durch eine frühzeitige Begleitung unserer Ambulanten Dienste im Rahmen der Heimrückführung,<br />
junge Menschen und ihre Familien so weit wieder zu stabilisieren, dass eine zeitnahe<br />
Rückkehr in die Herkunftsfamilie möglich wird.<br />
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII<br />
Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung haben die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen<br />
einen eigenen, originären Anspruch auf Eingliederungshilfen.<br />
Die Feststellung einer seelischen Behinderung oder einer Bedrohung einer seelischen Behinderung<br />
muss in der Regel unter Hinzuziehen eines entsprechenden Facharztes für Kinder-<br />
und Jugendpsychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychotherapeuten erfolgen. Die Beurteilung<br />
orientiert sich meist an der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-<br />
10).<br />
Eingliederungshilfen werden in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form geleistet.<br />
Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Ausgrenzung zu vermeiden oder die (Re)-Integration bzw.<br />
die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu sichern. Dies geschieht durch unterschied-<br />
156
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
lichste Maßnahmen wie z. B. therapeutische Angebote, heilpädagogische Leistungen, Hilfen<br />
zu einer angemessenen Schulausbildung oder Hilfen für eine sonstige angemessene Tätigkeit.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> werden von den unterschiedlichen Trägern Leistungen in allen Bereichen<br />
angeboten.<br />
Durch die institutionalisierte Kooperation (IFKo) zwischen Jugendamt (ASD), Kinder- und<br />
Jugendpsychiatrie (Institutsambulanz), Schule (Schulpsychologischer Dienst), Gemeindepsychiatrie<br />
und den Trägern der Jugendhilfe (AG 78) soll versucht werden, für die betroffenen<br />
Kinder und Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf wohnortnahe und umfassende<br />
Hilfsangebote zu schaffen.<br />
In bestimmten Einzelfällen kann es dennoch vorkommen, dass Eingliederungshilfen nur in<br />
besonders geeigneten Einrichtungen außerhalb des <strong>Odenwaldkreis</strong>es angeboten werden<br />
können.<br />
Fallzahlen 2007:<br />
Förderung der Erziehung, Erziehungs- und Eingliederungshilfe, Inobhutnahme<br />
Fallzahlen vom 01.01.2007 - 31.12.2007<br />
Hilfeart Fälle<br />
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 257<br />
§ 17 Beratung Fragen Partnerschaft, Trennung u. Scheidung ASD 42<br />
§ 17 Beratung Fragen Partnerschaft, Trennung u. Scheidung AWO 70<br />
§ 18 Beratung, Unterstützung Personensorge, Umgang ASD 58<br />
§ 18 Beratung, Unterstützung Personensorge, Umgang AWO + Honorarkraft 11<br />
§ 18 Beratung, Unterstützung Personensorge, Umgang 16<br />
§ 18 Beratung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 91<br />
§ 19 Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter u. Kinder 1<br />
§ 20 Betreuung u. Versorgung in Notsituationen 4<br />
§ 27 Sonstige Hilfe zur Erziehung 33<br />
§ 29 Soziale Gruppenarbeit 77<br />
§ 30 Erziehungsbeistandschaft 132<br />
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 167<br />
§ 32 Familienpflege 16<br />
§ 32 Tagesgruppe 28<br />
§ 33 Vollzeitpflege 109<br />
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 60<br />
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 0<br />
§ 35a Eingliederungshilfe seelisch Behinderte ambulant LRS und Dyskalkulie 58<br />
§ 35a Eingliederungshilfe seelisch Behinderte ambulant 30<br />
§ 35a Eingliederungshilfe seelisch Behinderte teilstationär 10<br />
§ 35a Eingliederungshilfe Vollzeitpflege 1<br />
§ 35a Eingliederungshilfe stationär 50<br />
§ 42 Inobhutnahme Bereitschaftspflege 32<br />
§ 42 Inobhutnahme stationäre Einrichtung 21<br />
Summe 1374<br />
157
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Von den 109 Fällen nach § 33 waren 25 Fälle von anderen Jugendämtern, die hierfür Kostenerstattung<br />
leisten.<br />
In 18 Fällen werden Kinder außerhalb des Kreises betreut und hierfür wird von uns Kostenerstattung<br />
gewährt.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> verfügt im Hinblick auf die dargestellten Erziehungshilfen über ein umfassendes<br />
Angebot. Die bestehende Leistungsvielfalt wurde und wird durch entsprechende<br />
Planungen, Leistungsvereinbarungen und Qualitätsentwicklungen weiterentwickelt und in<br />
enger Abstimmung zwischen den Trägern und dem Jugendamt den Bedürfnissen im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
angepasst.<br />
Bereits in der Vergangenheit wurden Angebote oder Projekte geschaffen, die sich nicht ausschließlich<br />
in den einzelnen Säulen der Hilfen gemäß den §§ 27 ff. SGB VIII wieder finden<br />
lassen, sondern auf den Bedarf entsprechend individuell zugeschnitten sind.<br />
Hierzu zählen zum Beispiel die enge Vernetzung von sozialpädagogischer Betreuung und<br />
Angeboten in Verknüpfung mit der Beschulung in der Zentrale für Erziehungshilfe in Erbach,<br />
ebenso wie ein in Ober-Kainsbach realisiertes Projekt einer intensiven sozialpädagogischen<br />
Betreuung mehrerer Familien in deren Umfeld (durch einen freien Träger) mit dem Ziel evtl.<br />
ansonsten erforderliche Fremdunterbringungen der Kinder zu verhindern und weiterhin auch<br />
noch die sozialpädagogische Betreuung von Schülern im Sekundarstufen- bzw. inzwischen<br />
auch im Grundstufenbereich; hier bei entsprechender Beteiligung der Schulen und der<br />
Städte und Gemeinden.<br />
Mit den (beziehungsweise durch die) Trägern wurden daher, je nach deren inhaltlichen<br />
Schwerpunkten oder Qualifikationen, Leistungsangebote im Bereich der integrativen Erziehungshilfe<br />
an den Schulen, der tagesorientierten sozialen Gruppenarbeit, der sozialen Gruppenarbeit<br />
für die unterschiedlichen Alters- bzw. Schulstufen sowie im Bereich Tagesgruppen<br />
geschaffen. Durch diese Angebote ist es möglich, einen relativ großen Bereich, sowohl inhaltlich<br />
wie räumlich, abzudecken.<br />
Alle diese Hilfen sind nach dem SGB VIII als Unterstützung oder Beratung der Sorgeberechtigten<br />
zu sehen und demgemäß auch von diesen auf freiwilliger Basis beim Jugendamt zu<br />
beantragen. Die Sorgeberechtigten und deren Kinder sollen motiviert mitarbeiten und zum<br />
Gelingen der Hilfe beitragen. Die Mitarbeiter des Jugendamtes und hier im Besonderen die<br />
des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) sind in der Regel die ersten Ansprechpartner für<br />
diese Familien. Die Familien werden vom ASD begleitet und unterstützt. Im Rahmen der<br />
regelmäßig stattfindenden Hilfeplanung, werden die Ziele der Hilfen konkretisiert, überprüft<br />
und gegebenenfalls angepasst.<br />
Zielsetzung für die Weiterentwicklung der Leistungsangebote im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
Trotz der bereits vorhandenen Möglichkeiten soll eine kontinuierliche Weiterentwicklung und<br />
Anpassung der bestehenden und vielfältigen Angebote im Bereich der Jugendhilfe erfolgen.<br />
Hierbei wirken, neben der Jugendhilfeplanung des <strong>Odenwaldkreis</strong>es und dem Jugendhilfeausschuss,<br />
natürlich die freien Träger selbst sowie die Mitarbeiter der öffentlichen Jugendhilfe<br />
(maßgeblich der ASD), welche jeweils die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen<br />
bezüglich der vorherrschenden Bedürfnislagen mit einbringen, mit.<br />
Neben dieser Entwicklung im inhaltlichen und fachlichen Bereich muss des Weiteren immer<br />
wieder geprüft werden, wie sich der Zugang zu den Angeboten der Jugendhilfe für die Anspruchsberechtigten<br />
im Sinne eines modernen Dienstleistungserbringers in Verknüpfung mit<br />
dem SGB VIII, verbessern lässt; dies besonders unter dem Aspekt der Mobilität der Bürger in<br />
Bezug auf die großen Entfernungen im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Dies bedeutet zum einen, dass die Erreichbarkeit der öffentlichen Jugendhilfe auch in den<br />
weniger zentralen Regionen des Kreises sichergestellt sein muss (Hausbesuche, Außendienst,<br />
evtl. Außenbüros) und gleichzeitig, dass die Angebote der freien Träger (besonders<br />
158
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
im ambulanten und teilstationären Bereich) flächendeckend vorhanden sind (auch um unnötig<br />
lange Fahrzeiten zu ersparen).<br />
Besonderes Ziel ist daher weiterhin, durch präventive und frühzeitige Hilfsangebote (die nicht<br />
so einschneidend oder gar beängstigend und auch nicht so teuer sind) eine vergleichbar<br />
große Zahl an Familien oder Kindern und Jugendlichen zu erreichen. Dies bedeutet, dass<br />
nicht nur der Erhalt der vielfältigen Hilfen im ambulanten oder teilstationären Bereich angestrebt<br />
werden muss, sondern eine behutsame Erweiterung.<br />
Besonderes Augenmerk gilt daher der Weiterentwicklung bei der<br />
• Ausrichtung der Leistungsangebote an den individuellen Problemlagen der Familien (Alltags-<br />
und Lebenswelt)<br />
• Unterstützung der vorhandenen Stärken der Klienten (Ressourcen)<br />
• Einbindung der Erziehungshilfen in die bereits vorhandenen Angebote des Gemeinwesens<br />
(Vernetzung)<br />
• Intensivierung der Kooperation der Träger im Bereich Erziehungs- und Jugendhilfe<br />
Hier in diesem Bereich der Planung und Weiterentwicklung wird ein Großteil an Aufgaben<br />
und Übernahme von Verantwortung durch die Jugendhilfeplanung zu leisten sein.<br />
Um adäquate, räumlich wie auch zeitlich vertretbare Kontakte, Angebote oder Leistungen<br />
vorzuhalten oder zu ermöglichen, ist aber nicht nur die Kenntnis der regionalen Gegebenheiten<br />
mit den vorhandenen Ressourcen, der bestehenden Netzwerke und natürlich auch<br />
des Lebensumfeldes der Betroffenen von großer Bedeutung, sondern ganz besonders auch<br />
das Sicherstellen entsprechender Strukturen, interner Verteilungen, Zuständigkeiten wie<br />
auch ausreichender personeller Ressourcen im Jugendamt unabdingbar.<br />
Ungeachtet des großen Spektrums an Angeboten, das vorgehalten werden kann, gelingt es<br />
dennoch in einigen speziellen Fällen mit komplexem Hilfebedarf (oft in Verbindung mit einer<br />
drohenden oder vorhandenen seelische Behinderung der Kinder oder Jugendlichen und unter<br />
Beteiligung verschiedener Institutionen) nicht immer eine geeignete Hilfeform anbieten zu<br />
können, so dass zum Teil Leistungen, die dann auch noch meist sehr kostenintensiv sind,<br />
außerhalb des Kreises in Anspruch genommen werden müssen.<br />
Um diesem wenig befriedigenden Phänomen entgegentreten zu können, wird durch eine<br />
geeignete und institutionalisierte Kooperationsform zwischen Trägern der Jugendhilfe und<br />
anderer Institutionen im <strong>Odenwaldkreis</strong> (unter Beteiligung von Schule und Psychiatrie) in<br />
besonderen Entscheidungskonferenzen (IFKo – Institutionenübergreifende Fallkonferenzen<br />
Odenwald) im Beisein der Sorgeberechtigten nach Lösungen gesucht, die einen Verbleib der<br />
Kinder im <strong>Odenwaldkreis</strong> sicherstellen sollen. Dieses Instrumentarium wird sich noch bewähren<br />
müssen und wird laufend überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt.<br />
14.2.5 Erziehungs- und Familienberatung § 28 SGB VIII<br />
Erziehungsberatung ist eine Leistung der Jugendhilfe. Sie soll Kinder, Jugendliche, Eltern<br />
und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener<br />
Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren bei der Lösung von Erziehungsfragen<br />
sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Erziehungsberatung wird im<br />
Landkreis durch die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
erbracht. Dabei wirken Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammen, die mit unterschiedlichen<br />
methodischen Ansätzen vertraut sind (§ 28 SGB VIII).<br />
Die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung erfolgt freiwillig, ist kostenfrei und vertraulich.<br />
159
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
1. Rechtliche Grundlagen<br />
Erziehungsberatung gehört laut Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung<br />
(KGSt Nr. 3/93) zu den zentralen Beratungsangeboten der Jugendhilfe.<br />
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) wird Erziehungsberatung als Pflichtaufgabe des<br />
örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträgers definiert. Eltern und andere Personensorgeberechtigte<br />
haben hierauf einen Rechtsanspruch (§ 28 i. V. m. § 27 SGB VIII).<br />
Hauptsächlich basieren Erziehungs- und Familienberatungsstellen auf folgender Grundlage:<br />
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,<br />
§ 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung,<br />
§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,<br />
§ 27 Hilfe zur Erziehung,<br />
§ 28 Erziehungsberatung.<br />
2. Einzugsgebiet<br />
Die Beratungsstelle ist die einzige Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Landkreis.<br />
Einzugsgebiet ist der gesamte <strong>Odenwaldkreis</strong> mit ca. 100 000 Einwohnern.<br />
Inanspruchnahme<br />
Die Fallzahl in 2007 betrug 469. Diese Zahl ist über die letzten Jahre stabil geblieben. Bei<br />
den 469 Fällen ist nicht berücksichtigt, ob nur mit einer Person oder der gesamten Familie<br />
gearbeitet worden ist. Unter Berücksichtigung dieser Familienmitglieder wurden 731 Bürger<br />
des Kreises von uns mit Beratung und Therapie unmittelbar versorgt.<br />
Mit den präventiven Aktivitäten wurden 423 Bürgerinnen und Bürger des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
erreicht. Somit haben im Berichtsjahr 2007 insgesamt 1154 Personen die Dienstleistungen<br />
der Beratungsstelle in Anspruch genommen.<br />
Dezentrales Beratungsangebot<br />
Die Beratungsstelle bietet z. Zt. An zwei Kindergärten im <strong>Odenwaldkreis</strong> direkt vor Ort Elternberatung<br />
an. Diese findet zweimal im Monat für jeweils drei Stunden statt. Die Erfahrungen<br />
zeigen, dass es sinnvoll ist, diese Außensprechstunden auch an anderen Kindergärten im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> anzubieten. Dies wäre aber nur denkbar im Rahmen eines personellen Ausbaues<br />
der Beratungsstelle.<br />
In der Vergangenheit gab es eine Außenstelle im Gersprenztal in Reichelsheim für einige<br />
Jahre. Diese musste im Rahmen der Streichung der Landesmittel geschlossen werden. Die<br />
Wiederaufnahme eines dezentralen Beratungsangebotes in Form von Außenstellen erscheint<br />
sinnvoll und sollte umgesetzt werden. Als Standorte kämen dafür sicherlich wieder<br />
Reichelsheim (Odenwald) wie auch die Stadt Beerfelden in Frage. Zur Umsetzung dieser<br />
Maßnahmen ist aber auch ein personeller Ausbau der Beratungsstelle von Nöten. Mit den<br />
derzeitigen personellen Kapazitäten lässt sich kein dezentrales Beratungsangebot umsetzen.<br />
14.2.6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe<br />
Zu den anderen Aufgaben (§§ 42 bis 60 SGB VIII) der Jugendämter gehören:<br />
• Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)<br />
• Erteilung, Widerruf und Rücknahme der Pflegeerlaubnis für Tagespflegepersonen und<br />
Vollzeitpflegepersonen (§§ 43 und 44 SGB VIII)<br />
• Erteilung, Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sowie<br />
Erteilung nachträglicher Auflagen bzw. Tätigkeitsuntersagung (§§ 45 bis 48a SGB VIII)<br />
• Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten<br />
(§ 50 SGB VIII)<br />
• Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51 SGB VIII)<br />
160
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
• Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)<br />
• Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung<br />
von Unterhaltsansprüchen (§ 52a SGB VIII)<br />
• Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53 SGB VIII)<br />
• Erteilung, Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften<br />
(§ 54 SGB VIII)<br />
• Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts<br />
(§§ 55 bis 58 SGB VIII)<br />
• Beurkundung und Beglaubigung sowie die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§§<br />
59 und 60 SGB VIII)<br />
Bei den vorgenannten anderen Aufgaben handelt es sich um hoheitliche Aufgaben, welche<br />
von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen werden müssen. Das Jugendamt<br />
muss sie nicht nur planen, sondern auch tatsächlich anbieten (§ 3 Abs. 3 Satz 1 SGB<br />
VIII).<br />
Adoptionsverfahren<br />
Die soziale Bedeutung der Adoption hat sich im Laufe der Zeit grundlegend geändert. Standen<br />
früher die Sicherung des Fortbestandes des Familiennamens und des Vermögens einer<br />
Familie im Vordergrund, ist heute eine Adoption nur noch zulässig, wenn sie dem Wohl des<br />
Kindes dient und seine volle Integration in die Adoptivfamilie zu erwarten ist. Für die Kinder,<br />
die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, stellt die Adoption eine Möglichkeit dar,<br />
unter den förderlichen Entwicklungsbedingungen einer Familie aufzuwachsen. Allerdings<br />
steht der Zahl der Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, eine viel größere Bewerberzahl<br />
gegenüber.<br />
Die Adoptionsvermittlung obliegt ausschließlich den Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter,<br />
der Landesjugendämter und anderen zur Adoption anerkannten Organisationen.<br />
Der gesetzliche Auftrag bestehet darin, zum Wohl des betroffenen Kindes geeignete Eltern<br />
zu suchen.<br />
Hinsichtlich der Vermittlung von Kindern aus dem Ausland gelten besondere Verfahrensvorschriften.<br />
Vor Ausspruch einer Adoption eines Minderjährigen gibt die Adoptionsvermittlungsstelle eine<br />
gutachtliche Stellungnahme dazu ab, ob die Adoption dem Wohl des Kindes entspricht und<br />
die Entstehung eines Eltern-Kind-Verhältnisses zu erwarten ist. Dies gilt auch für Verwandten-<br />
und Stiefelternadoptionen.<br />
Jugendgerichtshilfe<br />
Das SGB VIII legt in § 2 Abs. 3 Nr. 8 die Zuständigkeit der Jugendhilfe für die „Mitwirkung in<br />
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)“ fest. Es bezieht in § 52 SGB VIII die gesetzlichen<br />
Vorgaben des Jugendgerichtsgesetzes über Tätigkeit und Rechte der „Jugendgerichtshilfe“<br />
(§§ 38 und 50 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz) ein und bettet diese damit in die<br />
Grundsätze des Sozialgesetzbuches I wie die des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB<br />
VIII) ein. Damit ist klargestellt, dass die Jugendhilfe die Aufgaben nach § 52 SGB VIII Kinder-<br />
und Jugendhilfegesetz in eigener Zuständigkeit wahrnimmt und dass dabei die Datenschutzbestimmungen<br />
des Sozialgesetzbuches, insbesondere nach §§ 61 bis 67 SGB VIII maßgebend<br />
sind.<br />
Im Mittelpunkt des Tätigwerdens aus Anlass eines Strafverfahrens steht der Auftrag, einen<br />
Hilfeprozess zu fördern – soweit der Jugendliche diesen bedarf. Dazu muss das Vertrauen<br />
und die aktive Mitarbeit der Klienten gewonnen werden. Ebenso ist die Fachkraft der Jugendhilfe<br />
bei der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren auf die Mitarbeit des Betroffenen angewiesen.<br />
Die Tätigkeit nach § 52 SGB VIII ist gerichtsbezogen, aber sie erfolgt gleichwohl<br />
nach sozialpädagogischen Handlungsprinzipien.<br />
161
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Der Jugendgerichtshilfe obliegt es, in dem vorgenannten Rahmen die beteiligten Justizbehörden<br />
zu unterstützen.<br />
Auch während des möglichen Vollzugs oder während einer Bewährungszeit soll die Jugendgerichtshilfe<br />
(JGH) mit dem Verurteilten und seinem Bewährungshelfer in Verbindung bleiben<br />
und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft anstreben.<br />
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, ist die JGH im gesamten Verfahren heranzuziehen.<br />
Ihre Nichtbeteiligung im Verfahren kann ein Revisionsgrund sein. Aus dieser Rechtsstellung<br />
der JGH leiten sich gewisse Rechte wie u. a. das Recht auf mündlichen und schriftlichen<br />
Verkehr mit dem Beschuldigten ab.<br />
Bei Untersuchungshäftlingen ist der JGH der Kontakt im gleichen Umfang wie einem Verteidiger<br />
gestattet.<br />
Ausgehend vom Leitgedanken der Erziehung ist der „Maßnahmenkatalog“ des JGG breiter<br />
gefächert als die Sanktionsmöglichkeiten des allgemeinen Strafrechts.<br />
Im Wesentlichen können die Sanktionen in vier Gruppen untergliedert werden:<br />
1. Absehen von der Verfolgung bzw. Einstellung des Verfahrens unter bestimmten<br />
Voraussetzungen<br />
2. Erziehungsmaßregeln<br />
3. Zuchtmittel<br />
4. Jugendstrafe<br />
Die Präventionsarbeit ist ein weitere Arbeitsschwerpunkt der Jugendgerichtshilfe.<br />
Im Jahr 2007 wurde das Gewaltpräventionsprojekt an Schulen „Kids gegen Gewalt – wir<br />
üben dafür“ weitergeführt. Es werden flächendeckend alle 6. Klassen, inklusive Lernhilfeklassen,<br />
im Odenwald erreicht.<br />
Beistandschaften und Beratungen zur Feststellung der Vaterschaft und des Unterhaltsanspruches<br />
Mütter und Väter die allein erziehend sind, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung<br />
bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen. Das gleiche Angebot<br />
gilt für junge Volljährige bis zur Vollendung ihres 21. Lebensjahres.<br />
Mütter, die mit dem Vater ihres Kindes nicht verheiratet sind, haben unmittelbar nach der<br />
Geburt ihres Kindes einen Anspruch auf Beratung in Fragen der Feststellung der Vaterschaft<br />
und Regelung des Unterhaltsanspruches (§ 52 a SGB VIII).<br />
Auf Antrag des allein erziehenden Elternteiles kann das Jugendamt als Beistand (§ 55 SGB<br />
VIII) zum gesetzlichen Vertreter des Kindes oder Jugendlichen für diese Angelegenheiten<br />
bestellt werden.<br />
Die folgenden Leistungen werden angeboten:<br />
• Beratung (auch vorgeburtlich) zur Vaterschaftsanerkennung, Wahrnehmung der<br />
gemeinsamen elterliche Sorge und Regelung des Unterhaltes<br />
• Berechnung des Unterhaltes für die Mutter und/oder das Kind<br />
• Überprüfen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Unterhaltsverpflichteten<br />
• Führen von Gerichtsverfahren zur Feststellung der Vaterschaft und des Unterhaltsanspruches<br />
• Zwangvollstreckung der Unterhaltsforderung<br />
162
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die hoheitliche Aufgabe wird von dem örtlichen Jugendhilfeträger angeboten. Vergleichbare<br />
Beratungsangebote freier Träger gibt es im <strong>Odenwaldkreis</strong> nicht. Im Rahmen ihrer Schwangerenberatung<br />
informieren die Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtsverbände über das<br />
kostenfreie Unterstützungs- und Beratungsangebot des Jugendhilfeträgers.<br />
Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften<br />
In bestimmten Fällen kann das elterliche Sorgerecht ganz (Vormundschaft) oder teilweise<br />
(Pflegschaft) von dem Familiengericht auf das Jugendamt übertragen werden. Voraussetzung<br />
hierfür ist, dass die Eltern das Sorgerecht für ihr Kind nicht angemessen wahrnehmen<br />
und das „Kindeswohl“ gefährdet ist.<br />
In Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) erfolgt,<br />
wenn freiwillig keine Hilfen zur Erziehung durch die Sorgeberechtigten angenommen werden,<br />
ein Antrag des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) bei dem zuständigen Familiengericht<br />
auf Entzug oder Teilentzug der elterlichen Sorge. Der Allgemeine Soziale Dienst nimmt,<br />
in der Regel mit dem Vormund oder Pfleger, an allen Verfahren vor dem Familiengericht teil.<br />
Die Mitwirkung des Jugendamtes nach § 50 SGB VIII ist somit sichergestellt.<br />
Kraft Gesetz und ohne gerichtliche Entscheidung wird das Jugendamt mit der Geburt des<br />
Kindes einer minderjährigen Mutter zu seinem Vormund bestellt.<br />
Das Jugendamt übernimmt in dem Umfang der Sorgerechtsübertragung die gesetzliche Vertretung<br />
des Kindes und ist in dieser Funktion als Behörde nicht öffentlichrechtlich sondern<br />
zivilrechtlich tätig (§§ 55 ,56 SGB VIII).<br />
Der Amtsvormund trägt die persönliche Verantwortung für den jungen Menschen. Er tritt in<br />
dieser Funktion an die Stelle der Eltern und trifft seine Entscheidungen unabhängig und weisungsfrei<br />
zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen. Sein Wirkungskreis umfasst die gesamte<br />
Bandbreite der elterlichen Sorge und somit alle Lebensbereiche eines Kindes oder Jugendlichen.<br />
Als Vorbild und Vertrauensperson ist seine Aufgabe den jungen Menschen zu führen,<br />
ihm Orientierung zu geben und ihn auf dem Weg in ein selbständiges Leben zu begleiten.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es keinen freien Träger der Wohlfahrtspflege (§ 54 SGB VIII), der<br />
berechtigt ist, die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen wahr zu nehmen. Zum Teil stehen<br />
Angehörige (Großeltern, Geschwister etc.) oder Pflegeeltern für die Aufgabe zur Verfügung.<br />
Einzelpersonen die als Berufsvormund die gesetzliche Vertretung anbieten gibt es in<br />
unserer Region nicht.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> ansässige Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger sind in einzelnen Fällen<br />
bereit eine teilweise gesetzliche Vertretung (z. B. Umgangspflegschaft) zu übernehmen.<br />
Beurkundungen und Beglaubigungen<br />
Das Jugendamt bietet die Möglichkeit, wie in der Funktion eines Notars, Erklärungen von<br />
Betroffenen als Urkunde nieder zu schreiben (§§ 59,60 SGB VIII).<br />
Die Urkundstätigkeit im Jugendamt ist als Vollzug sozialstaatlicher Verwaltung zu sehen und<br />
hat seinen formalen Rahmen im Beurkundungsgesetz. Der Adressat des Beurkundungsgesetzes<br />
ist in erster Linie der Notar. Es erstreckt seine Geltung jedoch auch auf andere Urkundspersonen<br />
und somit auch auf die Beurkundungen nach §§ 59, 60 SGB VIII.<br />
Der juristische Rang der Urkundstätigkeit beruft den hierzu Ermächtigten in eine herausragende<br />
Verantwortung. Er beurkundet auf der gleichen Ebene wie der Notar. Er ist in seiner<br />
Aufgabe zur strikten Neutralität verpflichtet. Im Wesen seines Amtes liegt es, dass er weisungsfrei<br />
ist hinsichtlich seiner Entscheidung, ob eine Beurkundung vorgenommen oder abgelehnt<br />
wird und mit welchem Inhalt und Wortlaut sie vorgenommen werden soll.<br />
163
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand: 16. Februar 2009<br />
Die meisten Urkunden betreffen Anerkennungen einer Vaterschaft, Verpflichtungen zu Unterhaltsleistungen<br />
und Abgabe von Erklärungen zur Wahrnehmung einer gemeinsamen<br />
elterlichen Sorge.<br />
Neben dem Jugendamt sind die Standesämter der Städte und Gemeinden und das Amtsgericht<br />
in Michelstadt berechtigt, Urkunden zur Vaterschaftsanerkennung aufzunehmen.<br />
Fallzahlen 2007:<br />
Andere Aufgaben der Jugendhilfe<br />
Fallzahlen vom 01.01.2007 – 31.12.2007<br />
H i l f e a r t Anzahl<br />
§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht ASD 62<br />
§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht AWO 43<br />
§ 51 Adoptionsverfahren 9<br />
§ 52 Jugendgerichtshilfe 518 (darunter 61 Kinder)<br />
§ 52a Beratungen zur Feststellung der Vaterschaft und 27<br />
des Unterhaltsanspruches<br />
§§ 50/56 Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften 488<br />
§§ 59/60 Beurkundungen und Beglaubigungen 254<br />
Summe 1401<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Jugendamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• verschiedene Akteure: AWO, FHZ, Kinderhof Fürstengrund, Lernstubb, Verein für<br />
Jugendwerkstätten, akzent mobil, Sozialberatungen, Erbacher Regenbogenhaus,<br />
Kinderhaus Sensbachtal etc.<br />
164
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
14.3. Kommunales Jobcenter<br />
14.3.1. Istzustand<br />
Der Kreis hat mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches Zweites Buch – Grundsicherung für<br />
Arbeitsuchende (SGB II) 73 am 1.1.2005 die Zulassung als kommunaler Träger anstelle der<br />
Agentur für Arbeit für die Arbeitslosengeld II-Empfänger im <strong>Odenwaldkreis</strong> erhalten. Ziel dieser<br />
Zulassung als Optionskommunen war die Weiterentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende<br />
durch die Erprobung insbesondere von alternativen Modellen der Eingliederung<br />
in Arbeit im Wettbewerb zu den Eingliederungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen. Die<br />
Zulassung ist bis zum 31.12.2010 befristet. Nach einem Beschluss des Bundes und der Länder<br />
aus Mitte 2008 ist beabsichtigt, die bisherigen Optionskommunen dauerhaft als SGB II-<br />
Träger zuzulassen und durch eine Änderung des Grundsgesetzes verfassungsrechtlich abzusichern.<br />
Die SGB II-Umsetzung beinhaltet die drei wesentlichen Kernprozesse: Leistungsgewährung,<br />
Fallmanagement und Arbeitsvermittlung.<br />
• Die Leistungsgewährung beinhaltet die Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung der<br />
SGB II-Leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sowie die Kosten der Unterkunft<br />
und Heizung), Einkommens- und Vermögensüberprüfung, Außendienst, Sanktionierungen,<br />
Unterhaltsheranziehung und Widerspruchssachbearbeitung.<br />
• Zum Fallmanagement gehören Erstberatungen, Profiling, diagnoseaktivierende Anamnese<br />
von Kunden, Hilfeplanung und –steuerung und Abschlüsse von Eingliederungsvereinbarungen.<br />
Hauptaufgabe des Fallmanagements ist die Beseitigung von (multiplen)<br />
Vermittlungshemmnissen bei den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wie Verschuldung,<br />
Suchterkrankungen, fehlende Qualifikationen, psychosoziale oder familiäre Problemlagen.<br />
Das Fallmanagement bedient sich hierbei in Kooperation der kommunalen Akteure<br />
des Netzwerkes im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
• Unter den Prozess der Arbeitsvermittlung fallen Arbeitgeberkontakte und Beratung von<br />
Unternehmen, Stellenakquise und Erfassung der Stellenangebote, Matching, Stellenbesetzung<br />
und die Nachbetreuung der Unternehmen und erwerbsfähigen Hilfebedürftigen<br />
nach einer erfolgreichen Vermittlung. Die Arbeitsvermittlung ist die Kernaufgabe nach<br />
dem SGB II. Ziel ist eine schnellstmögliche und passgenaue Vermittlung der erwerbsfähigen<br />
Hilfebedürftigen in den ersten Arbeitsmarkt.<br />
Bei der personellen Aufgabenwahrnehmung hat sich der Kreis für das Modell des integrierten<br />
Fallmanagements entschieden. Dies bedeutet, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager<br />
des Kommunalen Job-Centers alle drei Kernprozesse als ganzheitliche Aufgabe<br />
wahrnehmen. Auf eine spezialisierte Sachbearbeitung, die nur Teilprozesse durchführt,<br />
wurde verzichtet, um Schnittstellen zwischen Leistungssachbearbeitung, Fallmanagement<br />
und Arbeitsvermittlung zu vermeiden.<br />
Zum 30.06.2008 führen 35 Fallmanagerinnen und Fallmanager mit 31,6 Vollzeitäquivalenten<br />
das integrierte Fallmanagement durch. Dies entspricht einem Schlüssel von 1 Fallmanager/in<br />
zu 88 Bedarfsgemeinschaften. Zusätzlich stehen drei sozialpädagogische Fachkräfte ergänzend<br />
für die Zielgruppe der Unter-25-Jährigen zur Verfügung, die ihre Aufgaben vor allem im<br />
Fallmanagement und im Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf haben. Ein<br />
weiterer Sozialpädagoge ist für die Zielgruppe der Über-58-Jährigen zusätzlich eingesetzt.<br />
73 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende, zuletzt geändert<br />
durch Art. 2 G v. 8.4.2008 I 681<br />
165
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
14.3.2. Entwicklungsstrategie/Ziele<br />
Der Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden Jahren verändern. Der demographische<br />
Wandel mit einer Zunahme des Fachkräftemangels wird sich vor allem bei den arbeitsmarktnahen<br />
Kunden der Agentur für Arbeit auswirken und dort zu einem weiteren Rückgang der<br />
Arbeitslosigkeit führen. Dagegen werden die langzeitarbeitslosen Kunden des Kommunalen<br />
Job-Centers, insbesondere bei fehlender Qualifikation, trotz eines größeren Arbeitsangebotes<br />
nicht im gleichen Maße von der steigenden Arbeitskräftenachfrage profitieren. Eine Verfestigung<br />
der Langzeitarbeitslosigkeit ist die Folge, die eine Herausforderung für den <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
darstellt. Flexible, passgenaue Instrumente im Fallmanagement und zur Arbeitsmarktintegration,<br />
die auf die sich verändernden Profile der Kunden einstellen lassen, werden<br />
in zunehmendem Maße benötigt. Der Kernprozess der Arbeitsvermittlung wird sich reduzieren<br />
und der Kernprozess des Fallmanagements wird in den Vordergrund rücken.<br />
Es gilt, zum Ende des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend die strategische Ausrichtung<br />
der kommunalen Beschäftigungspolitik neu festzulegen, um den Anforderungen in der zweiten<br />
Dekade bis zum Jahre 2020 gewachsen zu sein. Das Jahr 2009 sollte genutzt werden,<br />
um diese Neuausrichtung voranzutreiben. Folgende Vorgehensweise bietet sich an:<br />
1. Kreispolitik (Kreistag und Landrätin/Landrat) formuliert strategische Ziele für die Beschäftigungspolitik<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es auf der Grundlage<br />
• der Beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen Union;<br />
• der Beschäftigungspolitik des Bundes und des Landes Hessen;<br />
• den Zahlen, Daten und Fakten zum Arbeitsmarkt und der Situation der Arbeitslosen im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> (Berichte des Kommunalen Job-Centers und der Agentur für Arbeit);<br />
• den vom Kommunalen Job-Center erarbeiteten Vorschläge und Hinweise.<br />
2. Zur Erreichung der strategischen Ziele schließt der Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
mit dem Kommunalen Job-Center eine Zielvereinbarung ab, in der die operativen Ziele<br />
festgelegt werden.<br />
166
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
EU-Beschäftigungspolitik<br />
-<br />
Leitlinien<br />
Kommunales<br />
Job-Center<br />
Berichte,<br />
Zahlen, Daten<br />
und Fakten;<br />
Vorschläge zur<br />
strategischen<br />
Ausrichtung.<br />
Kommunales<br />
Job-Center<br />
Beschäftigungs-<br />
und<br />
Bildungs-träger<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
des Bundes<br />
Kreispolitik<br />
Kreistag<br />
Landrätin/Landrat<br />
Strategische Ziele<br />
Zielvereinbarung<br />
Operative Ziele<br />
Kommunales<br />
Job-Center<br />
Maßnahmeplanung* Fallmanagement<br />
Berichtswesen/Prüfung Zielerreichung<br />
*Maßnahmeplanung ggf. unter Einbeziehung der Agentur für Arbeit<br />
3. Die Umsetzung erfolgt durch das Kommunale Job-Center in enger Zusammenarbeit mit<br />
den Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Maßnahmeträger und den anderen lokalen<br />
Akteuren der lokalen Beschäftigungspolitik durch<br />
• eine kurz- und mittelfristige Maßnahmeplanung ggf. unter Beteilung der Agentur für Arbeit<br />
und in Abstimmung mit dem Beirat SGB II;<br />
• die Einzelfallarbeit im integrierten Fallmanagement.<br />
4. Das Kommunale Job-Center führt ein enges Berichtswesen über die Entwicklung der Arbeitsmarktdaten<br />
und der Zielerreichung.<br />
167<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
des Landes<br />
Agentur für<br />
Arbeit<br />
Berichte,<br />
Zahlen, Daten<br />
und Fakten.<br />
Kreisausschuss<br />
Fallmanagerinnen<br />
und<br />
Fallmanager
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
14.4. Soziale Sicherung<br />
Der Bereich der sozialen Sicherung beinhaltet im Wesentlichen die Aufgaben des örtlichen<br />
Sozialhilfeträgers nach dem zum 1.1.2005 eingeführten Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch<br />
Sozialhilfe (SGB XII) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.<br />
Zu den Aufgaben der Sozialhilfe nach dem SGB XII gehören<br />
• Hilfe zum Lebensunterhalt durch laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des<br />
Lebensunterhaltes von Menschen, die keine Ansprüche nach dem SGB II (Arbeitslosengeld<br />
II und Sozialgeld) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei<br />
Erwerbsminderung) haben. Neben Geld- und Sachleistungen werden Dienstleistungen<br />
durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen erbracht.<br />
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Form von Leistungen zur<br />
Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter (für Personen die das 65. Lebensjahr vollendet<br />
haben) und bei dauerhafter Erwerbsminderung, sofern der Rentenversicherungsträger<br />
dies durch ein Gutachten festgestellt hat.<br />
• Hilfen zur Gesundheit durch Sicherung der erforderlichen Versorgung von bedürftigen<br />
Menschen bei fehlender Krankenversicherung. Die Leistungen der Sozialhilfe bei Krankheit<br />
werden vor allem für nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende<br />
gewährt. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung<br />
nach Art und Umfang. Die Leistungen schließen Hilfen zur Familienplanung, bei<br />
Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation ein.<br />
• Eingliederungshilfe für behinderte Menschen durch die Gewährung von Unterstützungsleistungen,<br />
die dem Zweck dienen, Behinderungen zu beseitigen, zu bessern oder<br />
deren Folgen zu mildern sowie von denen abzuwenden, die von einer Behinderung bedroht<br />
sind. Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sind in medizinische Rehabilitation,<br />
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in einer anerkannten Werkstatt<br />
für behinderte Menschen und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br />
gegliedert. Die Leistungen werden ambulant, teilstationär und stationär erbracht.<br />
Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren im Bereich der Eingliederungsleistungen<br />
für Menschen mit Behinderungen sowie mit dem Landeswohlfahrtsverband<br />
Hessen.<br />
• Hilfe zur Pflege und damit Sicherstellung des Bedarfs an häuslicher Pflege, Hilfsmitteln,<br />
teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege, soweit die Leistungen der<br />
Pflegeversicherung nach dem SGB XI nicht vorhanden oder nicht ausreichend sind. Persönliche<br />
Beratung und Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in<br />
Angelegenheiten der Pflege. Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren<br />
im Bereich der Pflege.<br />
• Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten insbesondere für die Personengruppe<br />
der Nichtsesshaften und Wohnungslosen sowie Hilfen in anderen Lebenslagen<br />
wie Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten<br />
und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen werden als Geld- und Sachleistungen<br />
sowie als Dienstleistungen durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen<br />
und ihrer Angehörigen erbracht.<br />
Darüber hinaus gewährt der <strong>Odenwaldkreis</strong> noch Hilfen für Spätaussiedler nach dem Landesaufnahmegesetz<br />
und Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.<br />
Dies sind insbesondere<br />
• Sicherstellung der Unterbringung von dem <strong>Odenwaldkreis</strong> zugewiesenen Spätaussiedlern<br />
durch Beratung und Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung und in anderen<br />
Lebenslagen.<br />
• Gewährung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die<br />
Leistungen umfassen Sachleistungen durch die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften<br />
und Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterkunfts-<br />
168
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
kosten in Privatwohnungen. Darüber hinaus erfolgen Beratung und Unterstützung und<br />
eine sozialpädagogische Betreuung des Personenkreises.<br />
CAP<br />
Ein aktuelles Integrationsprojekt wurde mit dem servicefreundlich gestalteten Supermarkt<br />
CAP in Höchst i. Odw. in Zusammenarbeit zwischen der Integra gGmbH, der Werkstatt für<br />
Behinderte, und der Edeka-Kette realisiert. Mit Hilfe dieses Projekts wurden 40 Arbeitsplätze<br />
für Behinderte und Nichtbehinderte geschaffen.<br />
14.5. Sozialplanung und Seniorenarbeit<br />
Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe des Kreises darauf hinzuwirken,<br />
dass soziale Dienste und Einrichtungen in ausreichendem Umfange zur Verfügung stehen.<br />
Dies erfolgt durch die kommunale Sozial- und Altenhilfeplanung. Der Ausbau und die<br />
Versorgung mit sozialen Diensten und Einrichtungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit<br />
den Städten und Gemeinden, den Verbänden der freien Wohlfahrtpflege und den Anbietern<br />
sozialer Hilfen. Das Land Hessen und der Landeswohlfahrtsverband Hessen wirken unterstützend<br />
im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen durch die Bereitstellung von Fördermitteln<br />
im Rahmen des Sozialbudgets mit.<br />
Der zunehmenden Bedeutung der Sozialplanung und der Seniorenarbeit wurde der Kreis<br />
dadurch gerecht, dass er zum 1.4.2008 die Stelle der Sozial- und Altenhilfeplanung eingerichtet<br />
hat. Zu den Aufgaben, die durch die Sozial- und Altenhilfeplanung wahrgenommen<br />
werden sollen, gehören insbesondere:<br />
• Ermittlung und Bereitstellung von Daten zur Infrastruktur und zu den Bedarfen im sozialen<br />
Bereich durch statistischer Auswertungen, Armut- und Reichtumsbericht und andere<br />
Berichte<br />
• Erstellung und Fortschreibung der Sozialplanung und Altenhilfeplanung durch eine<br />
Bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Organisation<br />
und Durchführung von Fachkonferenzen, Begleitung der Umsetzung der Planungsergebnisse<br />
und Überprüfung der Zielerreichung und der Bedarfsplanung<br />
Entwicklungsstrategie (Soziale Sicherung und Sozialplanung und Seniorenarbeit) /<br />
Ziele<br />
Der demographische Wandel wird sich in großem Umfang in den Aufgabenbereichen der<br />
Sozialen Sicherung auswirken und vor allem die Sozial- und Altenhilfeplanung und die Seniorenarbeit<br />
vor vielfältige und komplexe Herausforderungen stellen. Besonders einschneidend<br />
ist der erwartete Anstieg der Über 65-Jährigen um ca. 36 % von heute ca. 19.000 bis<br />
zum Jahre 2020 auf über 25.000. Die Schaffung von adäquaten Angeboten für die ältere,<br />
zum Teil sehr aktive Generation und deren Einbeziehung in die gesellschaftlichen Prozesse<br />
wird eine umfangreiche Aufgabe für den <strong>Odenwaldkreis</strong> sein. Für die Zukunftsfähigkeit der<br />
Städte und Gemeinden und des <strong>Odenwaldkreis</strong>es selbst, wird die persönliche Zufriedenheit<br />
der Bevölkerung mit ihrer Wohn-, Arbeits- und Lebenssituation ein entscheidender (Standort-)<br />
Faktor werden. Die Sozial- und Altenhilfeplanung kann hierzu maßgebliche Kenngrößen<br />
herausarbeiten, Bedarfe feststellen und Anregungen zur Umsetzung geben.<br />
Bei den Über-80-Jährigen ist bis 2020 mit nahezu einer Verdopplung der Bevölkerungszahl<br />
von derzeit ca. 4.500 auf über 8.000 zu rechnen ist. Daraus ergeben sich große Herausforderungen<br />
für die soziale Infrastruktur im <strong>Odenwaldkreis</strong>, insbesondere im Bereich der stationären<br />
und ambulanten Versorgung von Pflegebedürftigen. Die Sozial- und Altenhilfeplanung<br />
kann mit einer bedarfsgerechten und abgestimmten Planung dazu beitragen, dass die<br />
erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.<br />
Die Pflegebedarfsplanung ist fortzuschreiben.<br />
169
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelt es sich um laufende<br />
Leistungen zum Lebensunterhalt an Personen, die das 65 Lebensjahr vollendet haben, oder<br />
die vor Vollendung des 65 Lebensjahres dauerhaft erwerbsgemindert sind. Seit der Einführung<br />
dieser Grundsicherungsleistung zum 1.1.2004 hat sich die Zahl der Bedürftigen nahezu<br />
verdoppelt. Durch Einschränkungen bei den zukünftigen Rentenleistungen ist mit einem<br />
weiteren deutlichen Anstieg in der nächsten Dekade bis 2020 zu rechnen.<br />
Altenhilfe<br />
Die Altenhilfe stellt nach § 8 Nr. 7 SGB XII 74 eine Leistung im Rahmen der Hilfe in anderen<br />
Lebenslagen dar und wird vom Träger der Sozialhilfe gemäß § 71 SGB XII gewährt.<br />
Die Altenhilfe soll die altersbedingten Schwierigkeiten verhüten und mildern sowie den älteren<br />
Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Als<br />
Maßnahmen der Altenhilfe kommen gemäß § 71 Abs. 2 SGB II in Betracht:<br />
• Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom<br />
alten Menschen gewünscht wird<br />
• Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen<br />
des alten Menschen entspricht<br />
• Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung, die der<br />
Betreuung alter Menschen dient, insbesondere bei der Beschaffung eines geeigneten<br />
Heimplatzes<br />
• Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter<br />
Dienste<br />
• Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der<br />
Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen<br />
• Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen.<br />
Daneben gibt es freiwillige Aufgaben wie die Durchführung des Kreisseniorennachmittags<br />
und die Herausgabe des Seniorenwegweisers.<br />
Seniorennetz:<br />
Auf der Seite www.senioren.odenwaldkreis.de sind spezielle Angebote für die ältere Bevölkerung<br />
und deren pflegende Familienangehörigen zusammengefasst.<br />
74 Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) – Gesetzliche Unfallversicherung, zuletzt geändert<br />
durch Art. 2 Abs. 13 G v. 16.5.2008 I 842<br />
170
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
14.6. Behindertenhilfe<br />
Im Rahmen der Behindertenhilfe im <strong>Odenwaldkreis</strong> wurde die Aufgabe zur Förderung und<br />
Betreuung von Menschen mit Behinderung der Integra GmbH – Gemeinnützige Gesellschaft<br />
für soziale Arbeit – übertragen. Sie wurde 1995 gegründet, alleiniger Gesellschafter ist der<br />
Verein „Behindertenhilfe Odenwald“. In diesem Verein sind insgesamt zwölf Institutionen,<br />
Verbände und gemeinnützige Organisationen zusammengeschlossen, die Menschen mit<br />
Behinderung betreuen. Die einzelnen Mitglieder sind:<br />
• Aktion behindertes Kind e. V. (www.aktion-behindertes-kind.de)<br />
• Arbeiterwohlfahrt Odenwald (www.awo-odenwald.de)<br />
• Behindertenclub Odenwald e. V.<br />
• Deutsches Rotes Kreuz (www.drk.de)<br />
• Evangelisches Dekanat Odenwald (www.ev-dekanat-erbach.de)<br />
• Gemeinde Höchst i. Odw. (www.hoechst-i-odw.de)<br />
• Hilfe für das autistische Kind e. V. (www.autismus.de)<br />
• Industrievereinigung Odenwald e. V. (www.ivo-odw.de)<br />
• Katholisches Dekanat Odenwald<br />
(www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-erbach)<br />
• Lebenshilfe Odenwald e. V.<br />
• <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Zentrum Gemeinschaftshilfe<br />
Integra GmbH<br />
Die Integra GmbH erbringt in erster Linie Rehabilitations- und Eingliederungshilfeleistungen<br />
für Menschen mit Behinderung. Für die Betroffenen<br />
sind dies soziale Dienstleistungen, die sich in der Regel aus gesetzlichen<br />
Ansprüchen ergeben. Es werden primär Leistungen erbracht, die sich nach dem Sozialgesetzbuch<br />
IX definieren und dort unter der Überschrift „Rehabilitation und Teilhabe“ im<br />
Einzelnen beschrieben sind. Die Integra GmbH ist somit Bestandteil des staatlichen Sozialwesens<br />
in der Bundesrepublik und unterliegt zwangsläufig den dort geltenden Rahmenbedingungen.<br />
Die Integra GmbH bietet Angebote für Menschen mit körperlicher, geistiger sowie seelischer<br />
Behinderung und psychischer Erkrankung. Im Rahmen der ambulanten Dienste können alle<br />
Menschen im Kreisgebiet eine Unterstützung in Anspruch nehmen. Zielsetzung der Bereiche<br />
„Arbeit und Tagesstruktur“ sowie „Wohnen und Freizeit“ ist die Unterstützung individueller<br />
Unabhängigkeit, die Förderung eigener Fähigkeiten und die Integration oder Reintegration in<br />
ein Leben, wie es jedem Menschen ganz selbstverständlich zusteht. Perspektiven in die<br />
Selbstständigkeit werden aufgezeigt und es wird nach einem differenzierten Konzept gearbeitet.<br />
Jeder ist wichtig, jeder wird gebraucht, jeder ist geschätzt.<br />
1. Bereiche bzw. Einrichtungen der Integra GmbH<br />
Arbeit<br />
Die drei Werkstätten der Integra GmbH in Mümling-Grumbach und Erbach bieten als anerkannte<br />
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zurzeit über 300 Menschen mit Behinderung<br />
je nach Fähigkeit und Neigung einen Arbeitsplatz in verschiedensten Tätigkeitsbereichen.<br />
Tagesstruktur<br />
Die Tagesstätte ist regelmäßiger Treffpunkt für Menschen mit psychischer Erkrankung oder<br />
seelischer Behinderung.<br />
171
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Wohnen<br />
Im Bereich Wohnen verfügt die Integra GmbH über ein Wohnheim für Menschen mit geistiger<br />
und körperlicher Behinderung, über ein stationär begleitetes Wohnangebot und über ein<br />
betreutes Wohnangebot.<br />
Freizeit<br />
Der Bereich Offene Hilfen der Integra GmbH steht als Anlaufstelle für Anfragen und Informationen<br />
zur Verfügung, um im Einzelfall die erforderlichen und gewünschten Angebote und<br />
Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zu den Angeboten hier gehören u. a. ambulante<br />
Dienste, familienentlastende Dienste, Schulintegration, Gruppenangebote und -freizeiten<br />
sowie sonstige Aktivitäten.<br />
Im Mittelpunkt der Arbeit der Integra steht der Begriff „Zufriedenheit”. Gemeint ist die Zufriedenheit<br />
der Kunden und die der Mitarbeiter. Mit dem Begriff „Zufriedenheit“ wird ein Entwicklungsprozess<br />
beschrieben, der dazu führt, mit sich im Einklang zu sein, Wünsche und<br />
Bedürfnisse mit der Umwelt und den Mitmenschen in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen.<br />
Dies kann unter anderem bedeuten, dass Menschen ihre Behinderung akzeptieren lernen<br />
und alle verstehen, dass es Dinge gibt, die so sind, wie sie sind und nicht geändert werden<br />
können. Zu diesem Prozess gehören Eigenschaften und Begriffe wie Selbstbewusstsein,<br />
Selbstbestimmung, Kritik- und Beziehungsfähigkeit, Flexibilität, Religiosität, Liebesfähigkeit.<br />
Für die Ziele und die tägliche Arbeit der Integra GmbH bedeutet dies, dass die Angebote<br />
ständig an den aktuellen und den zukünftigen Bedarf angepasst werden müssen. Dazu ist<br />
eine dynamische Erarbeitung und Fortschreibung der Konzeptionen der jeweiligen Einrichtungen<br />
notwendig. Die dauerhafte Weiterentwicklung einer umfassenden Unternehmenskultur<br />
zählt ebenso zu den ständigen Herausforderungen wie der Ausbau der Qualitätsmanagementsysteme<br />
sowie der Organisationsstruktur.<br />
Alles wird getragen von der grundlegenden Bereitschaft, sich in die Einstellungen der Kunden<br />
einzufühlen. Hinzu kommen Veränderungen grundlegender Natur. Zum einen ist es die<br />
Entwicklung zur Selbstbestimmung und Individualisierung, die das gewohnte Vergütungssystem<br />
nachhaltig verändert, zum anderen ist es die definierte Zielsetzung der politisch verantwortlichen,<br />
einen „freien“ Markt der sozialen Dienstleistungen zu schaffen. Die Integra<br />
GmbH wird sich als Organisation diesen Veränderungen stellen und auf neue Entwicklungen<br />
durch entsprechende Angebote für den neuen Markt reagieren.<br />
2. Integrationsbetriebe der Integra<br />
Die Integra GmbH verfügt über zwei Tochterfirmen, die beide als Integrationsbetrieb das Ziel<br />
der Förderung von Beschäftigung von Menschen mit Behinderung verfolgen.<br />
Die Integra Service GmbH wurde im Jahr 2004 gegründet als Trägergesellschaft<br />
und Integrationsbetrieb für das Projekt „CAP – der Lebensmittelpunkt“.<br />
Es handelt sich hier um ein Integrationsunternehmen<br />
gem. § 132 SGB IX. Aufgabe der Integra Service GmbH ist es, Menschen mit Behinderung<br />
auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance zu geben. Ziel ist, möglichst viele Menschen mit<br />
Behinderung in einem normalen alltäglichen Arbeitsumfeld zu beschäftigen und zu integrieren.<br />
Die Integra Dienstleistung GmbH ist ein ebenfalls Integrationsunternehmen<br />
im Sinne von § 132 SGB IX. Als gemeinnützige Gesellschaft<br />
zur Förderung von Beschäftigung für Menschen mit Behinderung<br />
wurde das Unternehmen 2005 mit dem Ziel, ein Dienstleistungsangebot rund um<br />
die Immobilie zu schaffen, gegründet. Die Hauptaufgabe besteht darin, benachteiligten Men-<br />
172
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
schen zur Anerkennung zu verhelfen, indem auch im Dienstleistungsbereich Arbeitsplätze für<br />
Schwerbehinderte geschaffen werden.<br />
Weitere Informationen rund um die Arbeit und die Angebote der Integra GmbH kann der<br />
Homepage www.integra-home.de entnommen werden.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Hauptabteilung „Arbeit und Soziale Sicherung“ des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Städte und Gemeinden<br />
• Verbände der freien Wohlfahrtspflege<br />
• Integra GmbH – Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Arbeit –<br />
• Integra Service GmbH<br />
• Integra Dienstleistung GmbH<br />
173
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
15. Gesundheitswesen<br />
15.1. Gesundheitsamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
Eine der wichtigsten Aufgaben im Gesundheitswesen ist der umfassende Gesundheitsschutz<br />
der Kreisbevölkerung. Ein gut organisiertes Meldewesen für Infektionskrankheiten gewährleistet<br />
eine schnelle Erfassung und sofortige Reaktion beispielsweise in Fällen von Tuberkulose,<br />
Meningitis und bei der Influenza-Beobachtung. Die Überwachung der Trinkwasser-Hygiene,<br />
der Badegewässer und Schwimmbäder fällt ebenso in den Aufgabenbereich, wie die<br />
Überwachung der Krankenhäuser und Praxen, die Aids-Beratung, das Impf- und Gutachtenwesen.<br />
Einen besonderen Schwerpunkt legt das Kreisgesundheitsamt auf gesundheitliche<br />
Präventionsprojekte. Daneben hält das Kreisgesundheitsamt ein umfassendes Beratungsangebot<br />
mit Hilfen beispielsweise für psychisch Beeinträchtigte, Suchtkranke und Drogenabhängige,<br />
Selbsthilfegruppen, Schwangerschaftskonflikte usw. Ergänzt werden die Aktivitäten<br />
durch eigene Fachtagungen, Fortbildungsangebote und Gesundheitsaktionstage.<br />
Besonders wichtig ist in den letzten Jahren der Aufbau von tragfähigen Netzwerkstrukturen<br />
zwischen den regionalen Akteuren im Gesundheitswesen.<br />
Aufgaben<br />
Das Gesundheitsamt hat folgende Aufgabenschwerpunkte:<br />
• Gesundheitsschutz (Aufgaben nach Infektionsschutzgesetz und Trinkwasserverordnung<br />
2001)<br />
• Aufgaben der Medizinalaufsicht (Überwachung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen<br />
und anderer Gemeinschaftseinrichtungen)<br />
• Mitwirkung im Rettungswesen<br />
• Amtsärztlicher Dienst<br />
• Kinder- und Jugendärztlicher Dienst<br />
• Sprachheilbeauftragter des <strong>Odenwaldkreis</strong>es am Kreisgesundheitsamt<br />
• Kinder- und Jugendzahnpflege, zahnärztliche Gesundheitsfürsorge, zahnärztliche Gutachtertätigkeit<br />
• Sozialpsychiatrischer Dienst<br />
• Betreuungsstelle<br />
• Suchtberatungsstelle<br />
• Spezielle Beratungsstellen (Impfberatung, Schwangeren-/Schwangerenkonfliktberatung)<br />
• Spezielle, sozialkompensatorische Gesundheitshilfen (AIDS-Beratung, kostenlose HIV-<br />
Testung)<br />
• Maßnahmen der Gesundheitsförderung<br />
• Sozialplanung (Gemeindepsychiatrie- und Suchthilfeplanung)<br />
• Umwelthygiene/-medizin<br />
• Sportmedizin als lizenzierte Untersuchungsstelle für D-Kader-Athletinnen/Athleten<br />
Im öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD) hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Aufgabenwandel<br />
vollzogen. Im Verhältnis zu den Aufgaben der Medizinalaufsicht, des Gesundheitsschutzes<br />
und der Begutachtung gewinnen solche der Gesundheitsförderung, der Umweltmedizin<br />
und –hygiene, der Planung, Koordination und Steuerung im Rahmen regionaler<br />
Netzwerkstrukturen erheblich an Gewicht.<br />
Das Theorie- und Handlungsprinzip richtet sich hierbei in erster Linie an den Gesundheitsbelangen<br />
der Bevölkerung und von Bevölkerungsgruppen aus, ist präventiv orientiert sowie<br />
gesundheitsfördernd, interdisziplinär und multiprofessionell angelegt.<br />
Rechtsgrundlage für die Arbeit der Gesundheitsämter in Hessen stellt das hessische Gesetz<br />
über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 29.09.2007 dar. Eine der wichtigsten Aufgaben<br />
174
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
ist dabei der umfassende Gesundheitsschutz der Kreisbevölkerung. Hierbei hat das Kreisgesundheitsamt<br />
gesundheitliche Gefahren von der Bevölkerung abzuwehren sowie übertragbare<br />
Krankheiten bei Menschen zu verhüten und zu bekämpfen. Ein gut organisiertes Meldewesen<br />
für Infektionskrankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gewährleistet<br />
eine schnelle Erfassung und sofortige Reaktion beispielsweise in Fällen von Tuberkulose,<br />
hochansteckender Hirnhautentzündung und anderen hochkontaktiösen Erkrankungen.<br />
Die Überwachung der Trinkwasserhygiene, der Badegewässer und Schwimmbäder gehört<br />
ebenso in den Aufgabenbereich, wie die infektionshygienische Überwachung der Krankenhäuser,<br />
Praxen, der Alten- und Pflegeheime sowie der sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen<br />
im Kreis.<br />
Im Zuge der Überwachungstätigkeiten übt das Kreisgesundheitsamt auch die Medizinalaufsicht<br />
über die Berufe des Gesundheitswesens (z. B. Ärzte, Hebammen) aus, soweit keine<br />
andere gesetzliche Zuständigkeit gegeben ist.<br />
Im Amtsärztlichen Dienst werden vor allem Untersuchungen und Begutachtungen für die<br />
eigene sowie für andere Behörden, Institutionen aber auch Gerichte vorgenommen. Der Kinder-<br />
und Jugendärztliche Dienst führt Hör- und Sehtestssreening-Untersuchungen im Vorschulalter<br />
sowie die Untersuchungen der Einschülerinnen / Einschüler als auch der 4. Klassen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> durch. Ein Aufgabenschwerpunkt stellt hierbei die Optimierung des<br />
Impfschutzes bei Kindern und Jugendlichen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es dar. Hierzu werden die<br />
Impfdaten bei allen Einschülern sowie den Schülerinnen und Schülern des 4. Schuljahres<br />
erhoben. 1999 implementierte der Schulärztliche Dienst zusätzlich eine Impfberatung der 7.<br />
Klassen aller Schulen im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Auch der Jugendzahnärztliche Dienst / Zahnärztliche Dienst am Kreisgesundheitsamt ist<br />
hinsichtlich seiner Arbeit präventiv ausgerichtet. So wurden in den letzten Jahren durchschnittlich<br />
mit 2.600 Schülerinnen und Schülern pro Jahr Zahngesundheits- sowie Kariesprophylaxe<br />
betrieben. Dabei wurden Aktionen wie „Kariestunnel“, Theaterveranstaltungen,<br />
Gruppen- und Einzelprophylaxe sowie Elternarbeit durchgeführt.<br />
Daneben hält das Kreisgesundheitsamt ein umfassendes Beratungsangebot mit Hilfen beispielsweise<br />
für Suchtkranke, psychisch Beeinträchtigte, Behinderte, Schwangere, Eltern mit<br />
sprachauffälligen Kindern im Vorschulalter, HIV- sowie Tuberkulose-Infizierte etc. vor.<br />
Gerade die Arbeit des Sprachheilbeauftragten ist im Hinblick auf die Früherkennung, Aufklärung<br />
und Beratung bei Sprachauffälligkeiten bzw. –behinderungen äußerst wertvoll. Organisatorisch<br />
ist der Sprachheilbeauftragte dem Kreisgesundheitsamt zugeordnet und hält dort<br />
14-tägig eine Beratungssprechstunde ab.<br />
Die Betreuungsstelle am Kreisgesundheitsamt berät und unterstützt Bürgerinnen und Bürger<br />
in Fragen der gesetzlichen Betreuung, zum Betreuungsverfahren und zu Vorsorgeregelungen.<br />
Daneben nimmt sie alle behördlichen Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten, bzw.<br />
Angelegenheiten der Vormundschaftsgerichtshilfe, einschließlich Sachverhaltsermittlung,<br />
Sozialberichtserstattung, Vorführung und Unterbringung von Betroffenen wahr. Darüber hinaus<br />
gilt es die ehrenamtlichen Betreuer sowie Berufsbetreuer in der Wahrnehmung ihrer<br />
Aufgaben, einschließlich Vollzugshilfe, zu unterstützen. Aber auch die Gewinnung, Aus- und<br />
Weiterbildung sowie Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer ist eine wichtige Aufgabe der<br />
Betreuungsstelle.<br />
Im Weiteren obliegt dem Kreisgesundheitsamt Planungsarbeit sowohl auf dem Feld der Gefahrenabwehr<br />
bei besonderen Gefahrenlagen für die Gesundheit der Bevölkerung als auch<br />
im Zuge der Sozialplanungen des <strong>Odenwaldkreis</strong>es (hier: Gemeindepsychiatrie- sowie<br />
Suchthilfeplan). Die Planungsarbeit auf dem Feld Gefahrenabwehr bei besonderen Gefahrenlagen<br />
für die Bevölkerung war in den letzten drei Jahren durch die Umsetzung des durch<br />
175
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
das Robert-Koch-Institut 2005 veröffentlichten Nationalen Influenzapandemieplanes in Hessen<br />
geprägt.<br />
Im Laufe des Jahres 2006 stellte das Hessische Sozialministerium den Landespandemieplan<br />
auf, welcher fortlaufend aktualisiert wird. Seit mehreren Jahren wird die Gefahr einer Influenzapandemie<br />
intensiv diskutiert. Welches Influenzavirus die Pandemie auslösen wird, ist jedoch<br />
spekulativ. Die Befürchtungen gehen dahin, dass ein aviärer Influenzavirus direkt oder<br />
über eine andere Spezies in die menschliche Population gelangen und sich etablieren<br />
könnte. Ein solches Virus mit neuen Antigeneigenschaften könnte bei einer effektiven Übertragung<br />
von Mensch zu Mensch eine Pandemie auslösen. Auf der Grundlage des Nationalen<br />
sowie Landes-Influenza-pandemieplanes hat das Kreisgesundheitsamt einen Ersten Pandemieplan<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> Stand 10/07 erarbeitet. Des Weiteren wurde ein Arbeitskreis mit<br />
Vertretern der Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Bezirksstelle Darmstadt, Vertretern der<br />
Kreisärzteschaft, dem GZO Kreiskrankenhaus Erbach, dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst,<br />
dem Rettungsdienst, der Hauptabteilung V.30, Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz,<br />
dem Kreisbrandinspektor, einem regionalen Vertreter der Landesapothekenkammer sowie<br />
dem Gesundheitsamt implementiert.<br />
Für den Bereich der seelisch behinderten und suchtkranken Menschen, der geistig behinderten<br />
sowie der körperlich- und sinnesbehinderten Menschen nimmt das Kreisgesundheitsamt<br />
an den durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen für die jeweiligen Bereiche überregional<br />
organisierten Planungskonferenzen regelmäßig teil.<br />
Für die Behindertenarbeit im <strong>Odenwaldkreis</strong> hat sich sowohl die Implementierung des Beirates<br />
für Menschen mit Behinderung, in dem alle in der Behindertenarbeit tätigen Organisationen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> vertreten sind als auch die Schaffung der Stelle der ehrenamtlich<br />
Beauftragten für Menschen mit Behinderung, äußerst positiv ausgewirkt. Das Kreisgesundheitsamt<br />
hat diese Prozesse aktiv und nachhaltig unterstützt und nimmt seit Schaffung des<br />
Behindertenbeirates die Geschäftsstellenfunktion für diesen wahr. Des Weiteren wurde die<br />
Anlaufstelle der Beauftragten für Behinderte Mitbürger/-Innen deren Angehörige und sonstige<br />
mit der Behindertenhilfe befassten Personen, Stellen und Gremien beim Gesundheitsamt<br />
eingerichtet.<br />
Aber nicht nur in diesen Arbeitsfeldern hat sich gezeigt, dass der Aufbau von tragfähigen<br />
Netzwerkstrukturen zwischen den regionalen Akteuren im Gesundheitswesen von eminenter<br />
Bedeutung ist.<br />
So ist das Gesundheitsamt / die Amtsleitung aktives Mitglied in nachstehenden Netzwerkstrukturen<br />
des <strong>Odenwaldkreis</strong>es:<br />
a) Dem Odenwälder Ärztenetzwerk „Gesundheitsnetz <strong>Odenwaldkreis</strong>“.<br />
b) Arbeitsgemeinschaft Trinkwasser.<br />
Im Zuge der zum 01.01.03 in Kraft getretenen TrinkwasserVO konnte unter der Federführung<br />
des Kreisgesundheitsamtes im <strong>Odenwaldkreis</strong> 2003 eine AG „Trinkwasser“ gebildet<br />
werden. In dieser AG sind vertreten der Bürgermeister der Gemeinde Hesseneck, der Laborleiter<br />
Hessenwasser, die Hessenwasser GmbH und Co KG, Darmstadt, der Leiter der<br />
Wasserwerke Michelstadt, die für den Trinkwasserschutz der Gemeinde Reichelsheim<br />
(Odenwald) und der Stadt Breuberg Zuständigen, die OWAS, die Wasser-behörde beim<br />
Landrat des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sowie das Kreisgesundheitsamt.<br />
c) Netzwerk der Schwangeren- sowie Schwangerenkonfliktberatungsstellen.<br />
In den letzten drei Jahren konnte die Zusammenarbeit der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle<br />
des Kreisgesundheitsamtes mit den Beratungsstellen des Diakonischen<br />
Werkes Odenwald in Bad König-Zell, des Frauenzentrums Odenwald, der AWO in Michelstadt<br />
sowie der Caritas in Erbach intensiviert werden. In die Netzwerkstrukturen sind<br />
176
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
jedoch auch die Frauenärzte des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, die Frauenklinik in Erbach sowie die<br />
Frauenbeauftragte des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, miteinbezogen. Zudem besteht ein enger Kontakt<br />
zu den Hebammen im Odenwald.<br />
d) Netzwerk „Hebammen im Odenwald“.<br />
Das Kreisgesundheitsamt unterstützt die Hebammenzusammenarbeit in Form einer einmal<br />
jährlich stattfindenden Tagung, die insbesondere dem Erfahrungsaustausch dient.<br />
e) Netzwerk der lizenzierten Sportmedizinischen Untersuchungsstellen in Hessen.<br />
Im Mai 1999 wurde die Sportmedizinische Untersuchungsstelle des Kreisgesundheitsamtes<br />
durch den Landessportbund Hessen als Untersuchungsstelle für Sportlerinnen und<br />
Sportler der Landeskader D / E lizenziert. Seit dem führt das Kreisgesundheitsamt für<br />
diese Athletinnen und Athleten die notwendigen jährlichen sportmedizinischen Untersuchungen<br />
durch. Ferner nimmt das Kreisgesundheitsamt regelmäßig an den vom Sportmedizinischen<br />
Institut Frankfurt unter Teilnahme des Hess. Innenministeriums und des<br />
Landessportbundes organisierten Zusammenkünften teil. Die Sportmedizinischen Untersuchungen<br />
der übrigen Kinder und Jugendlichen erfolgt im <strong>Odenwaldkreis</strong> durch niedergelassene<br />
Kolleginnen und Kollegen mit der Zusatzbezeichnung “Sportmedizin“.<br />
Darüber hinaus unterhält das Kreisgesundheitsamt nachstehende ständige Einrichtungen:<br />
• Regelmäßige Unterrichtung und Besprechung mit den Erzieherinnen der Regelkindergärten,<br />
Kindertagesstätten sowie den Einrichtungen, die gem. Integrationsplatzmodell Integrationsmaßnahmen<br />
im Vorschulalter durchführen.<br />
• Ferner ist das Kreisgesundheitsamt ständiges Konferenzmitglied in der Fachkonferenz<br />
Integration, welche mindestens zweimal pro Jahr tagt. Schwerpunkt dieser Fachkonferenz<br />
stellt die Sicherung und Weiterentwicklung von Fortbildungsangeboten für Einrichtungen<br />
dar. Daneben werden in der Fachkonferenz grundsätzliche Fragen zur Qualitätssicherung<br />
und –entwicklung behandelt. Somit werden die Vorgaben der Rahmenvereinbarung Integration<br />
umgesetzt, welche vorsieht, dass die Qualitätsentwicklung und –sicherung in diesem<br />
Bereich zwischen den Beteiligten vor Ort konkret zu entwickeln ist. Im Zuge dieser<br />
Bemühungen ist auch die fest implementierte Planungskonferenz zwischen dem Jugendamt,<br />
dem Sozialamt, dem Sprachheilbeauftragten des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, dem Gesundheitsamt<br />
sowie dem Staatl. Schulamt und den sonderpädagogischen Schuleinrichtungen<br />
im Kreis zu sehen. Hierbei hat sich der für die Ablaufstruktur entwickelte gemeinsame<br />
“Fahrplan“ für den Übergang der Vorschulkinder in die Schule in den letzten Jahren bestens<br />
bewährt. Ziel dabei ist es, frühzeitig Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf<br />
ausfindig zu machen, damit eine optimale Beschulung möglich wird. Des Weiteren<br />
gilt es für einen eventuell gemeinsamen Unterricht den Umfang des so genannten Integrationshelfereinsatzes<br />
als Maßnahme der Eingliederungshilfe gem. SGB XII zu bestimmen.<br />
In Vorbereitung dieser Planungskonferenz hat sich das Case-Management (Fallmanagement)<br />
in Form so genannter “Beratungskonferenzen“ äußerst bewährt. Die Federführung<br />
im Hinblick auf die Organisation dieser Beratungskonferenzen obliegt meist dem Gesundheitsamt<br />
in enger Zusammenarbeit mit der Frühberatungsstelle des Zentrums Gemeinschaftshilfe<br />
in Erbach und dem Sprachheilbeauftragten des <strong>Odenwaldkreis</strong>es.<br />
Im Zuge des Aufgabenwandels im öffentlichen Gesundheitsdienst rücken präventiv orientierte<br />
sowie gesundheitsfördernde Projekte mehr und mehr in den Interessensfocus.<br />
Interdisziplinäre Projekte<br />
Als Beispiele für erfolgreiche interdisziplinäre Projekte sollen drei herausgegriffen werden<br />
• Optimierung der FSME – Durchimpfungsraten im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Angestoßen durch die Beobachtungen des Kreisgesundheitsamtes konnte der <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
im Jahr 1999 im Zuge einer Zeckendirektuntersuchung zweifelsfrei als FSME-Risiko-<br />
Gebiet identifiziert werden. Dies führte dazu, dass nachfolgend das Sozialministerium die<br />
177
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
FSME-Schutzimpfung für die Region Odenwald öffentlich empfahl und auch weiterhin<br />
empfiehlt. Das Kreisgesundheitsamt betreibt seitdem eine intensive Kreis- sowie Regionbezogene<br />
Fallsammlung autochthoner (in der Region erworbene Infektionen) und nichtautochthoner<br />
FSME-Fälle.<br />
Des Weiteren wurde die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern Darmstadt, Darmstadt-Dieburg,<br />
Bergstraße, Miltenberg, Neckar-Odenwald-Kreis und Rhein-Neckar-Kreis<br />
intensiviert. Seit 1999 werden die Kreisbevölkerung sowie die Fachinstitutionen (Ärzte,<br />
Krankenhäuser, Kreisalten- und Pflegeeinrichtungen) aber auch die Gemeinschaftseinrichtungen<br />
wie Kindertagesstätten und Schulen im <strong>Odenwaldkreis</strong> gezielt über die Gefahren<br />
der FSME- sowie die aktuellen Schutzmöglichkeiten informiert. Im Weiteren erfasst<br />
das Kreisgesundheitsamt über die Einschulungsuntersuchungen, die Untersuchungen der<br />
4. Klassen sowie das Impfberatungsangebot aller 7. Klassen im Kreis die entsprechenden<br />
FSME-Durchimpfungsraten.<br />
Im Rahmen dieser Aufklärungsarbeit wurde auch ein spezieller Zecken-Flyer mit der Zielgruppe<br />
„Vorschul- und Schulalter“ aufgelegt. Durch seitens des Kreisgesundheitsamtes<br />
initiierte Informationsveranstaltungen, Aktionstage, Symposien bzw. Tagungen konnte<br />
mittlerweile die FSME-Durchimpfungsrate bei den Kindern und Jugendlichen signifikant<br />
verbessert werden. Verfügte beispielsweise im Jahr 2004 nur 23,9 % der Schülerinnen<br />
und Schüler der 7. Schulklassen im <strong>Odenwaldkreis</strong> einen vollständigen FSME-Impfschutz<br />
so wuchs der Anteil dieser Schüler im Jahr 2007 auf 62,6 %.<br />
• Rauchpräventionsprojekt „ohne kippe“.<br />
Der Raucheranteil in der deutschen Bevölkerung beträgt etwa 30 %. Ob jemand Raucher<br />
wird, entscheidet sich meist vor dem 20. Lebensjahr. Neugierde, Nachahmung und sozialer<br />
Druck verleiten viele Kinder und Jugendliche zum Rauchen. Für das Weiterrauchen<br />
kommt dem tabakspezifischen Nikotinkonsum eine entscheidende Bedeutung zu. Nikotin<br />
ist die zentrale psychoaktive Substanz im Tabakrauch. Bei fortgesetztem Nikotinkonsum<br />
kommt es zur Gewohnheitsbildung und pharmakologischen Abhängigkeit. Das Rauchen<br />
kann nur noch bedingt vom Raucher selbst gesteuert werden. Bei anhaltendem Rauchen<br />
treten Gesundheitsschäden auf, die nicht durch das Nikotin, sondern durch andere Inhaltstoffe<br />
des Tabakrauches verursacht werden. Es kommt dabei zu dauerhaften Schäden,<br />
vor allem an den Bronchien, der Lunge, dem Herzen und den Gefäßen. Tabakrauch ist<br />
der wesentliche Risikofaktor für die Lungenkrebserkrankung oder für die chronische Bronchitis,<br />
mit allen ihren Komplikationen. Aus diesen Gründen und weil das Einstiegsalter jugendlicher<br />
Raucher nach wir vor niedrig ist, hat sich im Rahmen des Projektes “ohne<br />
kippe“ der Heidelberger Thoraxklinik im <strong>Odenwaldkreis</strong> eine Kooperationsgemeinschaft<br />
zwischen Gesundheitsamt, GZO GmbH, Kreiskrankenhaus Erbach, Staatl. Schulamt für<br />
den Kreis Bergstraße und den <strong>Odenwaldkreis</strong>, der Fachstelle für Suchtprävention im<br />
Suchthilfezentrum des DRK <strong>Odenwaldkreis</strong> und der DAK, Geschäftsstelle Erbach gebildet.<br />
Am Weltnichtrauchertag am 31.05.2007 fand im Kreiskrankenhaus Erbach die Auftaktveranstaltung<br />
statt. Seit dem 04.07.2007 werden für die 6. Jahrgangsstufe der Schulen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong> die entsprechenden Programmveranstaltungen durchgeführt. Hierbei<br />
wird über zwei Fachvorträge, die u. a. die Risiken des Tabakrauches behandeln, die<br />
Demonstration einer Lungenspiegelung und einer Patientendiskussion der Dialog mit den<br />
Schülerinnen und Schülern der 6. Jahrgangsstufe gesucht.<br />
Seither können alle Sechsklässler des <strong>Odenwaldkreis</strong>es (ca. 1.000 bis 1.300) in ihrem<br />
Jahrgang mit dem Projekt erreicht werden.<br />
• Projekt „InGA – Initiative für Gesundheit im Arbeitsleben“ der AG Gesundheit und Ernährung<br />
im Rahmen des Lokalen Bündnisses für Familie im <strong>Odenwaldkreis</strong>.<br />
Im Rahmen des Lokalen Bündnisses für Familie im <strong>Odenwaldkreis</strong> wurde auch eine AG<br />
Gesundheit und Ernährung gegründet. Dieser AG ist auch das Kreisgesundheitsamt angehörig.<br />
In mehreren gemeinsamen Arbeitssitzungen ist ein Konzept für die innerbetriebliche<br />
Gesundheitsförderung – InGA entwickelt worden.<br />
Nachdem am 22.10.2007 das Projekt den Krankenkassen (AOK, Barmer Ersatzkasse,<br />
DAK, KKH und IKK) präsentiert worden war, gaben die AOK, Barmer Ersatzkasse und die<br />
178
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
DAK die konkrete Zusicherung, das Projekt zu unterstützen. Nachfolgend konnte am<br />
16.01.2008 das Projekt der Industrievereinigung <strong>Odenwaldkreis</strong> sowie ausgewählten Vertretern<br />
verschiedener Odenwälder Betriebe am 16.01.2008 präsentiert werden. Inzwischen<br />
ist der Schritt von der Pilot- zur Durchführungsphase geschafft.<br />
Hierbei wurde deutlich, dass das Thema Gesundheit in der Sozial- und Wirtschaftspolitik<br />
immer aktueller wird. Im Weiteren ist feststellbar, dass Krankheit jedoch umgekehrt für<br />
den Einzelnen als auch für den Arbeitgeber immer teurer wird.<br />
Durch Heraufsetzung des Rentenalters wird es ferner notwendig werden, länger gesund<br />
und arbeitsfähig zu bleiben. Gleichzeitig steigt allerdings die Zahl chronisch kranker Menschen,<br />
was auch eine Folge von Fehl- und Überernährung ist.<br />
Das Wissen um Gesundheitsfür- und vorsorge durch richtige Ernährung ist jedoch in der<br />
Bevölkerung nach wie vor gering. Fehlinformationen sind sehr häufig. Selbst wo Kenntnisse<br />
vorliegen, werden diese nicht hinreichend umgesetzt. Ungünstig ist zudem, dass die<br />
nachfolgende Generation zu Fehlverhalten erzogen wird. Das Sozialsystem muss daher<br />
immer größere Anstrengungen unternehmen, um diese Fehler zu tragen bzw. auszumerzen.<br />
Über das Projekt InGA soll Problembewusstsein bei den Betriebsleitungen geschaffen<br />
werden. Es sollen die Zusammenhänge zwischen falscher Ernährung und Krankheit<br />
aufgezeigt werden. Für den Betrieb ergeben sich nachstehende Benefite: weniger Krankheitstage,<br />
höhere physische und mentale Belastbarkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br />
Reduktion der Stressbelastung, bessere Motivation, höhere Arbeitszufriedenheit,<br />
bessere Identifikation mit dem Betríeb – steigende Leistungsbereitschaft.<br />
Dies soll dadurch erreicht werden, dass durch professionelle Kräfte bei der Belegschaft<br />
Motivation geschaffen und ein Problembewusstsein hergestellt wird.<br />
Im Zuge einer erlebnis- bzw. erkenntnisorientierten Schulung sollen Lerninhalte vertieft<br />
werden. Hierzu ist die Einrichtung von entsprechenden „Lernplätzen“ vorgesehen, die mit<br />
Ernährungsberaterinnen / -beratern besetzt sind und wo Informationen in Form „Sehen-<br />
Fühlen-Begreifen“ vermittelt werden sollen. Darüber hinaus sollen durch Aktionstage, Bewegungs-Events<br />
sowie durch von den Betrieben selbst initiierte Maßnahmen wie Wahl<br />
betrieblicher Gesundheitsbeauftragter, Einführung von Betriebssport bzw. Bewegungsaktionen<br />
weitere „Verstärker“ gesetzt werden.<br />
Zusammenfassend hat das Gesundheitsamt nachstehende Hauptaufgabenschwerpunkte:<br />
• Gesundheitsschutz (Aufgaben nach Infektionsschutzgesetz und TrinkwasserVO);<br />
• Aufgaben der Medizinalaufsicht (Überwachung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen<br />
und andere Gemeinschaftseinrichtungen);<br />
• Amtsärztlicher Dienst;<br />
• Kinder- und Jugendärztlicher Dienst;<br />
• Kinder- und Jugendzahnpflege, zahnärztliche Gesundheitsfürsorge, zahnärztliche Gutachtertätigkeit;<br />
• Sprachheilbeauftragter des <strong>Odenwaldkreis</strong>es am Gesundheitsamt;<br />
• Sozialpsychiatrischer Dienst;<br />
• Suchtberatungsstelle;<br />
• Betreuungsstelle;<br />
• spezielle Beratungsangebote (Impfberatung; Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung);<br />
• spezielle sozialkompensatorische Gesundheitshilfen (AIDS-Beratung; kostenlose HIV-<br />
Testung);<br />
• Sozialplanung (Gemeindepsychiatrie- und Suchthilfeplanung);<br />
• Maßnahmen der Gesundheitsförderung / Präventionsprojekte;<br />
• Unterhaltung und Ausbau der lokalen Netzwerkarbeit.<br />
179
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Ziel<br />
In den nächsten Jahren sollen die bereits im <strong>Odenwaldkreis</strong> zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens<br />
existierenden Netzwerkstrukturen weiter ausgebaut und die Netzwerkarbeit<br />
intensiviert werden. Nur so ist ein optimaler und umfassender Gesundheits- und medizinischer<br />
Verbraucherschutz der Kreisbevölkerung zu erreichen.<br />
Transparenz, Partnerschaftlichkeit, Auskömmlichkeit und Nachhaltigkeit stellen hierbei wichtige<br />
Voraussetzungen dar. Wichtig ist, dass der Wettbewerb sich qualitäts- und nicht konkurrenzbestimmt<br />
entwickelt.<br />
15.2. Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH<br />
Die Krankenhausversorgung in Deutschland unterliegt seit längerem<br />
einem Umstrukturierungsprozess. Seit der Einführung von Diagnosebezogenen<br />
Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, kurz DRG) im<br />
Vergütungssystem für stationäre Leistungen werden verstärkt Wettbewerbselemente<br />
in die Krankenhausfinanzierung eingebracht, die einen weiteren Abbau<br />
von Kapazitäten erwarten lassen, einerseits durch Konzentrationsprozesse etwa in Ballungsräumen,<br />
aber auch durch Schließungen von unterausgelasteten Standorten. Krankenhausstandorte<br />
mit gefährdeter Tragfähigkeit sollen einen so genannten Sicherstellungszuschlag<br />
erhalten, wenn ihr Erhalt für die regionale Versorgung unverzichtbar ist. Insgesamt sind aufgrund<br />
dieses DRG-Systems bei steigenden Fallzahlen kürzere Liegezeiten zu verzeichnen.<br />
Gerade die Erreichbarkeit von Akutkrankenhäusern bestimmt die Lebenserwartung mit. Der<br />
Abbau von regionalen Überkapazitäten kann dazu genutzt werden, die flächendeckende<br />
Sicherstellung der Versorgung zu unterstützen. Die Krankenhausversorgung im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
wurde bereits vor 40 Jahren zugunsten eines Standortes im Kreis in Erbach im damals<br />
neu eröffneten Kreiskrankenhaus konzentriert.<br />
Heute leistet das Kreiskrankenhaus Erbach, das gemeinsam mit den Alteneinrichtungen des<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>es in der Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH (GZO) organisiert ist, im<br />
Verbund mit den niedergelassenen Ärzten und den ambulanten Pflegediensten (Zentrum<br />
Gemeinschaftshilfe, Sozialstationen) einen erheblichen Beitrag zur Sicherstellung der gesundheitlichen<br />
Versorgung.<br />
Das Leistungsangebot konnte kontinuierlich ausgebaut und dem heutigen Standard angepasst<br />
werden. Seit dem 1. April 2006 betreibt die PhysioZentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH, die<br />
mehrheitlich vom GZO getragen wird, eine physiotherapeutische Praxis in den Räumlichkeiten<br />
des Kreiskrankenhauses Erbach, die inzwischen auch ein umfangreiches Rehabilitationsangebot<br />
bietet.<br />
Im August 2008 wurde ein neues Funktionsgebäude sowie ein neuer Hubschrauberlandeplatz<br />
(etwa 25,9 Mio. €) am Kreiskrankenhaus eingeweiht, in dem die Räume der Notaufnahme/Funktionsdiagnostik,<br />
Röntgen/Radiologie sowie Intensivstation mit Intermediate Care<br />
und OP-Trakt mit Aufwachraum und Holding-Area untergebracht sind.<br />
Im Bereich der Radiologie sind bereits die Räumlichkeiten für CT und MRT vorgesehen, es<br />
wird angestrebt, baldmöglichst diese diagnostischen Möglichkeiten – ggf. in Zusammenarbeit<br />
mit niedergelassenen Radiologen – auch im <strong>Odenwaldkreis</strong> umfassend anbieten zu können.<br />
Zum Jahresende 2008 wurde eine Ärztehaus am Kreiskrankenhaus in Betrieb genommen, in<br />
dem eng mit dem Krankenhaus zusammenarbeitende Fachärzte tätig sein werden. Daneben<br />
wird auch das Gesundheitsamt des <strong>Odenwaldkreis</strong> dort seinen neuen Räume beziehen.<br />
Die Kapazitäten des Kreiskrankenhauses Erbach:<br />
180
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
• Medizinische Klinik: 91 Betten / Stationen 2 u. 3, Intensivstation<br />
• Geriatrie: 20 Betten / Station 9<br />
• Chirurgische Klinik: 82 Betten / Stationen 1, 5, 6<br />
• Frauenklinik: 38 Betten / Stationen 7 und 8<br />
• HNO-Belegabteilung: 4 Betten / Station 10<br />
• Urologische Belegabteilung: 12 Betten / Station 10<br />
• Psychiatrie: 43 Betten + 15 Tagesklinische Plätze<br />
Gesamt: 290 Planbetten<br />
Alten- und Pflegeheim 88 Plätze<br />
• Krankenpflegeschule: 60 Ausbildungsplätze<br />
• Altenpflegeschule 50 Ausbildungsplätze<br />
Aufgrund der regionalen Lage und der relativ weiten Entfernungen zum nächsten Krankenhaus<br />
verfolgt das GZO die Strategie der Entwicklung zum Gesundheitszentrum; dies wird<br />
umgesetzt über Maßnahmen der integrierten Versorgung. Darunter versteht man die enge<br />
Zusammenarbeit des niedergelassenen Bereiches (in Praxen tätige Haus- und Fachärzte)<br />
mit dem stationären Krankenhausbereich.<br />
Zur Umsetzung dieser Strategie wurden mannigfaltige Einzelmaßnahmen durchgeführt:<br />
• Vertrag „Hüft- und Kniegelenksendoprothetik“<br />
(Gesundheitszentrum Odenwald, AOK)<br />
• Integrierte KV-Notdienstzentrale am Wochenende<br />
• Kreiskrankenhaus und Alten- und Pflegeheim unter einem Dach<br />
• Integration niedergelassene Dialyse im Altenheim<br />
• Ambulanter Pflegedienst auf dem Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft (Zentrum Gemeinschaftshilfe)<br />
• Psychiatrische Tagesklinik in direkter Nachbarschaft<br />
• Mitgliedschaft im Gesundheitsnetz Odenwald e.V.<br />
Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit des Kreiskrankenhauses mit den niedergelassenen<br />
Ärzten. Die hausärztliche Versorgung ist im <strong>Odenwaldkreis</strong> flächendeckend sichergestellt.<br />
Die fachärztliche Versorgung ist derzeit auch gewährleistet, längerfristig sind hierfür<br />
aber geeignete Anstrengungen erforderlich. Insbesondere ist die Attraktivität des Standortes<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> für die Mediziner in den Vordergrund zu stellen. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> verfügt<br />
über alle Schulformen und bietet im kulturellen aber auch sportlichen Bereich ein breit gefächertes<br />
Angebot.<br />
Als Beispiele für erfolgreiche Konzepte der Zusammenarbeit von Krankenhäuser und niedergelassenen<br />
Ärzten sollen exemplarisch zwei herausgegriffen werden:<br />
• Schlaganfallschwerpunktstation:<br />
Das Kreiskrankenhaus Erbach versorgt Schlaganfallpatienten auf hohem Niveau nach<br />
den heute gültigen Standards und Leitlinien in der Medizin. Hierfür war die Sicherstellung<br />
einer 24- Stunden-Verfügbarkeit des Computertomographen sowie eine 24-Stunden-Verfügbarkeit<br />
eines Neurologen erforderlich. Beides ist umgesetzt, die neurologische Nachbetreuung<br />
der Schlaganfallpatienten ist über regelmäßige Visiten und Konsiliartätigkeit<br />
der niedergelassenen Neurologen sichergestellt. Damit konnte die Versorgung der zeitkritischen<br />
Schlaganfallpatienten erheblich verbessert werden.<br />
• Beckenbodenzentrum Südhessen:<br />
Das Alice-Hospital Darmstadt, das Kreiskrankenhaus Erbach, Fachärzte aus Darmstadt<br />
181
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
und der Region sowie das Zentrum für ambulante Rehabilitation kooperieren, um zugunsten<br />
der von Blasen- und Darmschwäche (Inkontinenz) betroffenen Personen optimale<br />
diagnostische und therapeutische Lösungen anbieten zu können. Die Kooperation<br />
von Frauenärzten und Urologen der Region sowie die konsiliarische Mitarbeit eines anerkannten<br />
Beckenbodenspezialisten stärken nachhaltig die medizinische Versorgung in der<br />
Region.<br />
Im <strong>Odenwaldkreis</strong> gibt es neben dem Kreiskrankenhaus in Erbach die Asklepios Schlossbergklinik<br />
in Bad König, die sich auf die neurologische Frührehabilitation von Patienten mit<br />
schweren Hirnschäden spezialisiert hat. Im 3. Quartal 2008 wurde die AHG Klinik Hardberg<br />
in Breuberg-Sandbach, ehemals Ernst-Ludwig-Klinik, als eine Klinik für Psychosomatik, Psychotherapie<br />
und Abhängigkeitserkrankungen eröffnet. Mit der Stadt Breuberg gibt es die Kooperation,<br />
dass Kinder, die sich mit ihren Müttern in der Klinik Hardberg befinden, in den<br />
städtischen Kindergärten aufgenommen werden.<br />
Seit Mai 2008 gibt es in Erbach ein Mammographie-Screening-Zentrum, in dem alle Frauen<br />
zwischen 50 und 69 Jahren, zentral organisiert durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen,<br />
untersucht werden können. Nicht mehr im <strong>Odenwaldkreis</strong> vorhanden ist eine Onkologische<br />
Nachsorgeklinik bei Krebserkrankungen.<br />
15.3. Odenwald-Vitalness „Gesundheitscluster <strong>Odenwaldkreis</strong>“<br />
Der Gesundheits-Cluster ist ein branchenübergreifendes Netzwerk zur<br />
Stärkung der Innovationskraft und internationalen Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessbereich und den<br />
Endabnehmer/innen der erbrachten Leistungen.<br />
Gewünscht ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit der Unternehmen und Einrichtungen,<br />
um den <strong>Odenwaldkreis</strong> in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und für die Abnehmer der<br />
Dienstleistungen qualitativ hochwertige Angebote zu entwickeln. So können Unternehmen<br />
und Einrichtungen frühzeitig wettbewerbsbestimmende Entwicklungen und Trends quer<br />
durch alle Unternehmensbereiche vorwegnehmen und in kooperativer Form ihre Wettbewerbsfähigkeit<br />
erhöhen.<br />
Diese verstärkte zwischenbetriebliche Zusammenarbeit eröffnet vor allem kleinen und mittleren<br />
Unternehmen (KMU) Chancen zur Nutzung von Synergie- und Innovationspotenzialen<br />
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.<br />
Unter www.odenwald-vitalness.de findet man über 250 Unternehmen die mit den Branchen<br />
Gesundheit, Wellness und Vitalness zu tun haben. Aufgenommen in dieser Datenbank wurden<br />
nunmehr auch viele Selbsthilfegruppen, die im <strong>Odenwaldkreis</strong> existieren. Zwischenzeitlich<br />
konnten über 56.000 Zugriffe (Stand: August 2008) auf die Internetseite verzeichnet<br />
werden. Dies zeigt, das der Inhalt auf großes Interesse stößt.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Gesundheitsamt des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Gesundheitszentrum <strong>Odenwaldkreis</strong> GmbH<br />
182
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
16. Veterinärwesen und Verbraucherschutz<br />
Im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (kurz: AVV) sind neben Verwaltungspersonal<br />
Amtstierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher und Fleischbeschaupersonal<br />
tätig, um vor Ort regelmäßige Kontrollen und Probennahmen durchzuführen.<br />
Die Aufgaben sind gesetzlich definiert und lassen wenig Gestaltungsspielraum.<br />
Rechtliche Grundlagen<br />
Die meisten Vorgaben macht die EU in über 130 Richtlinien in den Bereichen<br />
• Handel<br />
• Gesundheitsschutz/Kontrolle<br />
• Tierzucht<br />
• Futtermittel<br />
• Lebensmittel<br />
• Tierschutz<br />
• Tierarzneimittel und<br />
• tierärztlicher Beruf<br />
16.1. Tiergesundheitsschutz<br />
Nach dem Tierschutzgesetz muss derjenige, der ein Tier hält oder betreut, dieses seiner Art<br />
und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht<br />
unterbringen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden<br />
oder Schäden zufügen.<br />
Die Abteilung Tiergesundheitsschutz nimmt die Überwachung dieser gesetzlichen Vorgaben<br />
zum Schutz der Tiere wahr.<br />
Der amtlichen Überwachung unterliegen:<br />
• landwirtschaftliche Nutztierhaltungen<br />
• private Tierhaltungen<br />
• Tierheime und Tierpensionen<br />
• Haltung und Umgang mit Tieren auf Ausstellungen, Börsen und Sportveranstaltungen<br />
• Ausbildung von Tieren<br />
• Schlachten von Tieren<br />
• Tötung von Tieren<br />
• Tiertransporte<br />
• Versuchstierhaltungen<br />
Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen ist das AVV auch für die Bearbeitung von<br />
Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung zuständig.<br />
Bestimmte Tätigkeiten im Bereich von Tierhaltungen, z. B. das Betreiben eines Tierheimes<br />
oder die gewerblichen Zucht von Tieren sind nach dem Tierschutzgesetz erlaubnispflichtig.<br />
Für die Erteilung dieser Erlaubnisse ist das AVV zuständig.<br />
Zu den Aufgaben des Tiergesundheitsschutzes zählt auch die Überwachung der frei verkäuflichen<br />
Tierarzneimittel und der Arzneimittelanwendung durch Nutztierhalter.<br />
183
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
16.2. Tierseuchenbekämpfung<br />
Zur Tierseuchenbekämpfung gehören die Verhütung und Bekämpfung sowohl der vom Tier<br />
auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen), wie z. B. BSE, Salmonellosen,<br />
Tuberkulose, Brucellose oder Tollwut als auch von wirtschaftlich bedeutsamen Tierseuchen<br />
wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest, Geflügelpest, BHV1, BVD oder Blauzungenkrankheit.<br />
Sie umfasst die regelmäßige Überwachung der Tierbestände durch Blut- oder Milchuntersuchungen<br />
und der lückenlosen Kennzeichnung der Tiere, ein zentrales Melde- und Berichtswesen<br />
sowie im Rahmen der Tierkörperbeseitigung eine unschädliche Entsorgung von allen<br />
Stoffen tierischer Herkunft, die seuchenhygienisch bedenklich sein könnten.<br />
Der Aufgabenbereich dieser Abteilung stellt sich daher wie folgt dar:<br />
• Überwachung von Tierbeständen und tierischen Erzeugnissen<br />
• Probeentnahmen<br />
• Überwachung von Tiertransporten<br />
• Untersuchung von Tieren und tierischen Erzeugnissen für Ein- und Ausfuhr<br />
• Ausstellen von Zertifikaten und Gesundheitsbescheinigungen<br />
• Krisenmanagement bei Seuchenverdacht oder Seuchenausbruch (Quarantänemaßnahmen,<br />
Sperrmaßnahmen, Tötungsmaßnahmen)<br />
• Bearbeitung von Entschädigungen und Beihilfen bei Tierverlusten durch eine Tierseuche<br />
Seit dem Jahr 2005 wird die Gewährung von EU-Direktzahlungen an Landwirte auch an die<br />
Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit<br />
sowie Tiergesundheit und Tierschutz („Cross Compliance“) geknüpft. Verstöße gegen<br />
diese Vorschriften führen zu einer Kürzung der Direktzahlungen. Die Kontrollen in den entsprechenden<br />
Bereichen führt das AVV durch.<br />
Der amtlichen Überwachung unterliegen:<br />
• landwirtschaftliche Nutztierhaltungen:<br />
306 Schweinehaltungen → davon 50 kontrolliert<br />
447 Rinderhaltungen → davon 80 kontrolliert<br />
317 Schafhaltungen → davon 33 kontrolliert<br />
116 Ziegenhaltungen → davon 27 kontrolliert<br />
596 Hühnerhaltungen → davon 40 kontrolliert<br />
72 Entenhaltungen → davon 4 kontrolliert<br />
61 Gänsehaltungen → davon 8 kontrolliert<br />
19 Truthühnerhaltungen → davon 2 kontrolliert<br />
• private Tierhaltungen<br />
• 2 Tierheime<br />
• 10 Tierpensionen<br />
• 1 EU Besamungsstation<br />
• 80 Sittichzuchten<br />
• 5 Zoogeschäfte<br />
• Haltung und Umgang mit Tieren auf Ausstellungen, Börsen und Sportveranstaltungen<br />
• Ausbildung von Tieren<br />
• Schlachten von Tieren<br />
• Töten von Tieren<br />
• Tiertransporte<br />
Seit dem Jahr 2005 wird die Gewährung von EU-Direktzahlungen an Landwirte auch an die<br />
Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtermittelsicher-<br />
184
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
heit sowie Tiergesundheit und Tierschutz („Cross Compliance“) geknüpft. Verstöße gegen<br />
diese Vorschriften führen zu einer Kürzung der Direktzahlungen. Die Kontrollen in den entsprechenden<br />
Bereichen führt das AVV durch.<br />
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit Typ 8<br />
Impfung von empfänglichen Tieren im Jahr 2009:<br />
Mit Erlass vom 22.01.2009 teilt das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und<br />
Verbraucherschutz mit, dass auch 2009 wieder eine Impfung der Wiederkäuer gegen Blauzungenkrankheit<br />
Typ 8 durchgeführt wird.<br />
Dieser Impfmaßnahme unterliegen alle Tierbestände an Rindern, Schafen und Ziegen.<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> wird wieder in Impfbezirke eingeteilt, in denen benannte Tierärzte die<br />
Impfungen vornehmen.<br />
Die Kosten für die Impfstoffe teilen sich in Hessen das Land und die Tierseuchenkasse. Die<br />
Kosten für die Impfung durch den Tierarzt sind hingegen vom Tierhalter zu tragen.<br />
16.3. Lebensmittelüberwachung<br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Die Lebensmittelüberwachung als Kontrollwesen sorgt für die Umsetzung der rechtlichen<br />
Regelungen zur Herstellung, zum Transport, zur Lagerung und zum Verkehr von Lebensmitteln.<br />
Der Schutz der Verbraucher vor möglichen Gefahren, die von Lebensmitteln ausgehen können,<br />
gehört zu den wichtigsten Aufgaben des AVV. Der Verbraucherschutz fängt mit der<br />
Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln bereits bei der Urproduktion<br />
im landwirtschaftlichen Betrieb an. Er erstreckt sich lückenlos über alle Verarbeitungs- und<br />
Vermarktungsstufen bis hin zum Endverbraucher.<br />
Die Überwachung erfolgt in Form von regelmäßigen Betriebskontrollen und Probeentnahmen<br />
(Plan-, Verdachts- und Beschwerdeproben). Sie erstreckt sich auf alle Handelsstufen wie z.<br />
B. Groß- und Einzelhandel, Importeure, Produktionsbetriebe und Gaststätten. In den Betrieben<br />
werden die Einhaltung der hygienischen Vorschriften, die ordnungsgemäße Lagerung<br />
und ausreichende Kühlung von Lebensmitteln, die Verkehrsfähigkeit, die gesetzmäßige<br />
Kennzeichnung der Produkte, die Sachkunde des Personals und die sorgfältige Durchführung<br />
der vorgeschriebenen Eigenkontrolle überprüft.<br />
Dem AVV obliegt auch die Überwachung der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Lebensmitteln.<br />
In diesem Bereich werden von den Amtstierärzten entsprechende Zertifikate und<br />
Gesundheitszeugnisse ausgestellt.<br />
Amtstierärzte und Lebensmittelkontrolleure nehmen außerdem Stellung in Baugenehmigungsverfahren<br />
und stehen in Kontakt mit Verbraucherverbänden, Herstellervereinigungen<br />
und Innungen.<br />
Jahresbericht 2007 – Lebensmittelüberwachung<br />
Im Jahr 2007 führte die Amtliche Lebensmittelüberwachung im <strong>Odenwaldkreis</strong> insgesamt<br />
789 Kontrollen durch. Überprüft wurden 785 der 1442 kreisansässigen Lebensmittelunternehmen.<br />
Ferner fanden bei drei Lebensmitteltransporten Kontrollen statt.<br />
Verstöße<br />
Bei 282 der 785 kontrollierten Lebensmittelunternehmen wurden Verstöße gegen Rechtsvorschriften<br />
festgestellt. Diese verteilen sich auf Mängel in der Betriebshygiene, Mängel in den<br />
betrieblichen Eigenkontrollen, Mängel in der Zusammensetzung der Lebensmittel, Kennzeichnungsmängel<br />
und sonstige Mängel.<br />
185
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Die Anzahl der Betriebe sowie die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die Anzahl der Betriebs-<br />
und Transportkontrollen sowie die Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße gegen<br />
Rechtsvorschriften vorlagen, sind für das Jahr 2007 in nachfolgender Tabelle dargestellt.<br />
Anzahl der Anzahl der kontroll. Anzahl der<br />
Anzahl der Verstöße<br />
Betriebe Betriebe Betriebskontrollen Transportkontrollen<br />
1442 785 789 3 282<br />
Durch die Amtliche Lebensmittelüberwachung wurden im Jahr 2007 463 Lebensmittel, 29<br />
kosmetische Mittel und 37 Bedarfsgegenstände als Proben erhoben und dem Landesbetrieb<br />
Hessisches Landeslabor zur Untersuchung zugeführt.<br />
Bei 75 Proben erfolgte eine Beanstandung. In der Regel lagen die Beanstandungsgründe in<br />
Mängeln bei der Kennzeichnung oder der Zusammensetzung der Produkte.<br />
Fleischhygieneüberwachung<br />
Die wesentliche Aufgabe der Fleischhygieneüberwachung besteht in der Schlachttier- und<br />
Fleischuntersuchung. Alle Schlachttiere werden obligatorisch vor dem Schlachten (Lebendbeschau)<br />
und nach dem Schlachten (Fleischbeschau) untersucht. Mit der Fleischuntersuchung<br />
erfolgt die generelle Beurteilung des Fleisches hinsichtlich seiner qualitativen Eignung<br />
(Tauglichkeit) als Lebensmittel. Sie dient damit nicht allein dem Schutz der Menschen vor<br />
einer Gefährdung durch Tierkrankheiten (Zoonosen), sondern auch dem Schutz vor eventuell<br />
noch im Fleisch vorhandenen Resten von Tierarzneimitteln wie z. B. Antibiotika oder<br />
Masthilfsmitteln. Auf derartige Stoffe wird das Fleisch von Schlachttieren im Rahmen von<br />
Rückstandsuntersuchungen regelmäßig überprüft.<br />
Schweine, Wildschweine, Pferde und Dachse, deren Fleisch zum Genuss für Menschen<br />
verwendet werden soll, sind nach der Schlachtung zusätzlich auf Trichinen zu untersuchen.<br />
Im Rahmen der Fleischuntersuchung wird außerdem die Probenentnahme für die BSE-Untersuchung<br />
durchgeführt.<br />
In den Aufgabenbereich dieser Abteilung fallen auch die Überwachung, Zulassung und Registrierung<br />
von Fleischbetrieben (Schlachtstätten, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe) und<br />
die Überwachung des Fleischimports und –exports.<br />
Jahresbericht 2007 – Fleischhygieneüberwachung<br />
Die Schlachtzahlen für den <strong>Odenwaldkreis</strong> im Jahr 2007 sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.<br />
Tierkategorie Schlachtzahlen genusstauglich untauglich<br />
Rinder, gesamt 6.952 6.935 17<br />
- Bullen 4.018 4.016 2<br />
- Ochsen 9 9 -<br />
- Kühe 1.223 1.210 13<br />
- weibl. Rinder 1.475 1.474 1<br />
- Kälber 227 226 1<br />
Schweine 41.433 41.339 94<br />
Schafe 20.331 20.329 2<br />
Ziegen 32 32 -<br />
Pferde 66 66 -<br />
insgesamt 68.814 68.701 113<br />
Für den menschlichen Verzehr als untauglich beurteilt wurden lediglich 113 Schlachttiere.<br />
186
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Verbraucherverbände<br />
• Herstellervereinigungen<br />
187
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
17. Kommunikationssysteme<br />
Der <strong>Odenwaldkreis</strong> hat mit erheblichen infrastrukturellen Defiziten zu kämpfen. Das Regionale<br />
Entwicklungskonzept Odenwald 2007 stellt eben dieses Defizit als eine der Hauptschwächen<br />
des Landkreises heraus. Dabei ist nicht nur von einer adäquaten Verkehrsanbindung<br />
die Rede, sondern auch von einem flächendeckenden Breitbandanschluss. Dienstleistungsunternehmen<br />
wandern ab, weil sie mit ihren Partnern in aller Welt nicht ausreichend<br />
schnell kommunizieren können.<br />
Bereits stattgefundene Aktivitäten:<br />
Odenwald Dialog Funknetz (Odenwald-Akademie)<br />
Am 23. Mai 2007 fand der Odenwald Dialog „Funktnetz“ statt. Unter dem Motto „Talk im<br />
Hangar“ wurde die immer dringlicher werdende Frage der Breitbandversorgung von Unternehmen<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong>, die dringend auf ausreichenden Kapazitäten warten, aufgegriffen.<br />
Auf dem Podium saßen Vertreter der Telekom, Heag MediaNet, der TU-Darmstadt, der<br />
FH Aschaffenburg, der Hessen-Agentur und der damalige TUD-Präsident Johann Wörner als<br />
Moderator. Die über 100 Teilnehmer erlebten eine spannende Diskussion. Viele Unternehmer<br />
und Unternehmerinnen hatten die Möglichkeit, ihren Unmut über die schlechte Versorgung<br />
zu äußern. Der Landrat des <strong>Odenwaldkreis</strong>es wird dieses Thema weiter verfolgen und<br />
erinnerte die Landesregierung daran, sich nicht aus den ländlichen Regionen zurück zu ziehen.<br />
Förderung durch EFRE<br />
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) dient der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
und dem Abbau regionaler Disparitäten. Fördergebiet ist ganz Hessen, einige<br />
strukturschwache Regionen sind Vorranggebiete. In der Förderperiode 2007-2013 sind über<br />
die Prioritätsachse 1 „Innovation und wissensbasierte Wirtschaft“ der Zugang zu und der<br />
effiziente Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in kleinen und mittleren<br />
Unternehmen (KMU) förderfähig. Zunächst ist davon auszugehen, dass lediglich Beratungstätigkeiten<br />
in diesem Bereich gefördert werden, nicht etwa der Bau der Leitungen, dennoch<br />
setzt sich der <strong>Odenwaldkreis</strong> dafür ein, Strukturfondsmittel für den flächendeckenden Breitbandanschluss<br />
zu akquirieren.<br />
Marktversagen<br />
Ein Marktversagen liegt vor, wenn der Marktmechanismus aus Angebot und Nachfrage nicht<br />
fähig ist, die Güter jenen Personen zuzuordnen, die sie am meisten wertschätzen. Bei einem<br />
Marktversagen können nicht pareto-effiziente Verteilungen auftreten.<br />
Die wichtigsten Gründe für Marktversagen sind:<br />
• Bei nicht nicht-privaten Gütern versagt das Ausschluss- bzw. Rivalitätsprinzip, weshalb<br />
sie nicht auf freien Märkten angeboten werden. Zu den nicht-privaten Gütern gehören sowohl<br />
die öffentlichen Güter (wie z. B. die Straßenbeleuchtung), natürliche Monopole (wie<br />
z. B. die Wasserversorgung) als auch gesellschaftliche Ressourcen (wie z. B. die saubere<br />
Luft).<br />
• In einem freien Markt können externe Effekte entstehen, die in Form von externen Kosten<br />
(z. B. Umweltverschmutzung) oder externen Nutzen (z. B. Erholungswert eines gepflegten<br />
Waldes) auftreten. Der Markt kann diese externen Effekte nicht selbst internalisieren. So<br />
übernimmt diese Aufgabe in vielen solchen Fällen der Staat, indem er für externe Kosten<br />
möglichst verursachergerechte Abgaben (z. B. Besteuerung von fossilen Brennstoffen)<br />
fordert und die externe Nutzen z. B. in Form von Subventionen entschädigt.<br />
• Ebenfalls zum Marktversagen zählen Monopole und Kartelle. Durch Preisabsprachen<br />
bzw. monopolistische Preisbildung wird eine optimale Zuteilung durch den Markt verhin-<br />
188
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
dert. Auch gegen dieses Problem können staatliche Stellen geschaffen werden, die Kartelle<br />
und Monopole aufbrechen bzw. bestrafen.<br />
• Informationsasymmetrien können das Marktergebnis ebenfalls negativ beeinflussen. Da<br />
Nachfrager, aber auch Anbieter, oftmals keinen Überblick über sämtliche Angebote bzw.<br />
Nachfrager haben und zudem über gewisse Produkte nur sehr beschränkt Bescheid wissen<br />
(z. B. im Gesundheitswesen), kann die Marktzuteilung oft nicht optimal stattfinden.<br />
• Als Marktversagen im weiteren Sinne kann auch die Verteilungsgerechtigkeit betrachtet<br />
werden. Im weiteren Sinne deshalb, weil auch ein funktionierender Markt zu Verteilungen<br />
führen kann, die als ungerecht empfunden werden. Dieses Problem besteht hauptsächlich<br />
bei den Einkommen aber auch bei lebenswichtigen Gütern wie z. B. Trinkwasser. Sehr<br />
ungleiche, wenn auch effiziente Verteilungen können bei Einkommen bzw. lebensnotwendigen<br />
Gütern zu sozialen Spannungen führen. Auch in solchen Fällen kann der Staat Umverteilungen<br />
vornehmen oder bestimmte Güter rationieren, um eine gerechtere Verteilung<br />
zu erreichen. Ab wann eine Verteilung gerecht ist bzw. wie stark marktwirtschaftliche<br />
Verteilungen nachträglich noch umverteilt werden sollten, kann nicht eindeutig festgelegt<br />
werden und bietet deshalb auch immer wieder eine Grundlage für ordnungspolitische<br />
Auseinandersetzungen.<br />
Zur Zeit liegt einerseits eine Verteilungsungerechtigkeit vor, weil der <strong>Odenwaldkreis</strong> als direkter<br />
Einzugsbereich der Metropolregionen Frankfurt-Rhein-Main und Rhein-Main-Neckar<br />
durch den Abzug von Arbeitsplätzen und Kaufkraft in die Metropolen und die Standortnachteile<br />
durch die Unterausstattung mit Breitbandanschlüssen. Außerdem muss eine dünn<br />
besiedelte Mittelgebirgsregion wie der <strong>Odenwaldkreis</strong> um eine Anbindung stärker kämpfen,<br />
weil für die Anbieter Kosten entstehen, die den Nutzen für den Anbieter eher überwiegen.<br />
Breitbandanbindung für das gesamte Kreisgebiet, Breitbandoffensive der OREG, REKO...<br />
Um Standortnachteile möglichst weitgehend abzubauen ist die flächendeckende Anbindung<br />
an das Breitbandnetz für den <strong>Odenwaldkreis</strong> unerlässlich. Die Breitbandanbindung kann<br />
Arbeitsplätze in der Region erhalten und schaffen, denn einige Unternehmen, insbesondere<br />
kleine innovative Ingenieurbüros wandern in das Rhein-Main-Gebiet ab, weil die Übertragung<br />
von großen Datenmengen vom <strong>Odenwaldkreis</strong> aus kaum möglich ist, neue Arbeitsformen<br />
wie die gleichzeitige Bearbeitung von Plänen und Konstruktionsplanungen ohne diese technischen<br />
Einrichtungen nicht angewandt werden können und damit ein internationales Agieren<br />
verhindert wird.<br />
Im Juli 2008 hat die EU-Kommission Zuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe für den Ausbau<br />
schneller Internetverbindungen in ländlichen Regionen Deutschlands genehmigt (siehe<br />
Pressemitteilung der EU). Auch das Land Hessen hat für diesen Zweck Fördermittel<br />
bereitgestellt. Um Fördermittel erhalten zu können, müssen Ausschreibungen sowohl technik-<br />
aus auch anbeiterneutral verfasst sein. Der Höchstbetrag an Fördermitteln beträgt pro<br />
Kommune 200.000 €. Regional organisierte Kooperationen werden durch das erforderliche<br />
Vergabeverfahren bereits im Vorfeld ausgeschlossen.<br />
Für die Gemeinde Beerfelden gibt es eine Kooperation zwischen der Odinet, der Firma Klink<br />
und der HEAG-Medianet, die eine kabelgebundene Breitbandlösung für die Kernstadt und<br />
die Stadtteile der Gemeinde anstreben. Die derzeit vorliegenden Berechnungen berücksichtigen<br />
keine Fördermittel. Nur so kann eine Ausschreibung entsprechend der Zuwendungsbestimmungen<br />
ausbleiben. Die HEAG-Medianet hat signalisiert, dass sie einen Zuschuss in<br />
Höhe von etwa 1.000€ pro genutztem Anschluss zur Verfügung stellen wird. Auf diese Weise<br />
wäre bereits bei 200 Anschlüssen pro Kommune der Höchstbetrag der möglichen Fördermittel<br />
abgedeckt.<br />
Die Realisierungszeit beläuft sich im Falle der Stadt Beerfelden auf maximal sechs Monate.<br />
Ein Problem ist der Zugang zu den Verteilerkästen der Deutschen Telekom. Dieser ist<br />
zwangsweise notwendig um die entsprechenden Verkabelungen zum Hausanschluss vornehmen<br />
zu können. Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post<br />
189
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
und Eisenbahnen regelt auf Antrag der Kommunen die Zugänge zu den Verteilerkästen der<br />
Deutschen Telekom und könnte den Zugriff gestatten.<br />
Alle Bürgermeister des <strong>Odenwaldkreis</strong>es sind daran interessiert möglichst schnell flächendeckend<br />
ihre Gemeindegebiete mit Breitbandtechniken zu versorgen. Um das beschriebene<br />
Beispiel der Stadt Beerfelden auch auf andere Gemeinden übertragen zu können, ist noch<br />
zu prüfen inwieweit solche Kooperationen ohne Ausschreibungsverfahren vergaberechtlich<br />
durchgeführt werden können.<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
• Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG)<br />
• ODENWALD-INTRANET Odinet GmbH<br />
• Städte und Gemeinden<br />
190
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
18. Interkommunale Zusammenarbeit und Verwaltungsmodernisierung<br />
Nach dem KGG 75 können Kommunen, die eine enge Kooperation gründen und dieser Aufgaben<br />
übertragen möchten, zwischen zwei verschiedenen Formen der Zusammenarbeit wählen:<br />
dem Zweckverband und der öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Diese Formen der Zusammenarbeit<br />
ziehen unterschiedlich starke Verpflichtungen nach sich.<br />
Zu Zweckverbänden können sich Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 5 ff KGG zusammenschließen,<br />
um einzelne Aufgaben, zu deren Wahrnehmung sie berechtigt oder verpflichtet<br />
sind, gemeinsam zu erfüllen. Ein solcher Zusammenschluss kann auf freiwilliger<br />
Basis erfolgen (Freiverband) oder durch aufsichtsbehördliche Verfügung (Pflichtverband).<br />
Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet seine Angelegenheiten<br />
in eigener Verantwortung (§ 6 KGG). Ihm steht die Personal-, Satzungs- und<br />
Finanzhoheit zu; Willensbildung und Entscheidungsbefugnis obliegt seinen Organen (§ 14<br />
KGG). Damit schafft der Zweckverband mit einigem Organisationsaufwand eine eigene Entscheidungsebene,<br />
die aber durch die personelle Zusammensetzung eine intensive Mitwirkung<br />
aller Beteiligten gewährleistet.<br />
Spezialfall des Zweckverbandes ist der Gemeindeverwaltungsverband zur Stärkung der gemeindlichen<br />
Verwaltungskraft, dessen Aufgabenbereich sich gem. § 30 III KGG auf die verwaltungsmäßige<br />
Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, die Kassen- und<br />
Rechnungsgeschäfte und die Veranlagung und Einziehung der gemeindlichen Abgaben erstreckt.<br />
Der Aufgabenbereich ist erweiterbar. Da die verbandsangehörigen Gemeinden Träger<br />
der Aufgaben bleiben, setzen sich im Gegensatz zum Zweckverband seine Organe nur<br />
aus Mitgliedern dieser Gemeinden zusammen.<br />
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung (§ 24 ff KGG) ist die einfachere Form der Zusammenarbeit,<br />
da sie im Gegensatz zum Zweckverband nicht die Bildung einer neuen Körperschaft<br />
des öffentlichen Rechts voraussetzt und keine eigene Rechtsfähigkeit hat. Gegenstand einer<br />
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung kann grundsätzlich jede kommunale Aufgabe sein. Bestimmt<br />
werden kann, dass ein Beteiligter für die anderen eine Aufgabe in seine Zuständigkeit<br />
übernimmt (Aufgabenträger) oder dass ein Beteiligter eine Aufgabe für die anderen durchführt,<br />
die Aufgabenträgerschaft bei den jeweiligen Kommunen aber bleibt. Eine durch öffentlich-rechtliche<br />
Vereinbarung übertragene Aufgabe kann nur von einem Beteiligten übernommen<br />
werden. Ist eine gemeinsame Aufgabendurchführung gewünscht, muss ein Zweckverband<br />
gegründet werden. Den Beteiligten kann aber ein Mitwirkungsrecht eingeräumt werden.<br />
Die Verwaltungsgemeinschaft nach § 33 KGG ist eine besondere Form der öffentlich-rechtlichen<br />
Vereinbarung. Eine leistungsfähige Gemeinde übernimmt für umliegende leistungsschwächere<br />
die gleichen Aufgaben, die ein Zweckverband übernehmen kann (siehe oben, §<br />
30 III KGG). Hierfür werden entsprechende Teile der Personal- und Sachkosten erstattet.<br />
75 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307)<br />
191
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
18.1. Interkommunale Zusammenarbeit im <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Kooperationen des Kreises 76<br />
Körperschaften des öffentlichen Rechts Beteiligte<br />
Müllabfuhrzweckverband alle kreisangehörigen Kommunen + öffentlich-rechtliche<br />
Vereinbarung mit dem Kreis<br />
Wasserverband<br />
1. Mümling<br />
192<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>, Bad König, Beerfelden, Breuberg,<br />
Brombachtal, Erbach, Höchst i. Odw., Lützelbach,<br />
Mossautal, Michelstadt<br />
2. Gersprenz<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong>, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Brensbach,<br />
Brombachtal-Böllstein, Fränkisch-Crumbach,<br />
Reichelsheim und einige Kommunen der Landkreise<br />
Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Offenbach<br />
Hallenbadzweckverband Erbach, Michelstadt, <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Zweckverband führt den Namen „KommunalService Beerfelden, Hesseneck, Mossautal, Rothenberg und<br />
Oberzent“ (KSO)<br />
Sensbachtal<br />
Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe <strong>Odenwaldkreis</strong> und alle kreisangehörigen Kommunen<br />
ohne Breuberg, AWO <strong>Odenwaldkreis</strong>, Kath. Und Ev.<br />
Dekanat Erbach, DRK <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Süd <strong>Odenwaldkreis</strong>, Landkreise Bergstraße und Darmstadt-Dieburg,<br />
Rhein-Neckar, Stadt Darmstadt, Kreise<br />
und kreisfreie Städte des Ballungsraums Frankfurt<br />
Rhein-Main<br />
Landeswohlfahrtsverband Alle Landkreise und kreisfreien Städte Hessens<br />
Kommunales Gebietsrechenzentrum<br />
Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen<br />
(KIV)<br />
Anstalten des öffentlichen Rechts Gewährträger<br />
Sparkasse <strong>Odenwaldkreis</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
die Landkreise Süd- und Mittelhessens ohne Wiesbaden<br />
Aktiengesellschaften Aktionäre<br />
HEAG Südhessische Energie AG (HSE) HEAG AG, Thüga AG, Streubesitz Landkreise und<br />
kreisfreie Städte (darunter <strong>Odenwaldkreis</strong>), kreisangehörige<br />
Kommunen<br />
GmbH Gesellschafter<br />
gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigung, Aus- <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
und Weiterbildung im <strong>Odenwaldkreis</strong> mbH (BAW)<br />
Gesundheitszentrum Odenwald GmbH <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Kurgesellschaft Bad König insg. 226 Gesellschafter, darunter <strong>Odenwaldkreis</strong> und<br />
Stadt Bad König<br />
Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) <strong>Odenwaldkreis</strong>, alle 15 kreisangehörigen Kommunen,<br />
Volksbank Odenwald, Sparkasse <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Odenwälder Schlachthof Bauträger GmbH <strong>Odenwaldkreis</strong>, 10 Kommunen und 38 privatrechtliche<br />
Gesellschaften oder Privatpersonen<br />
Odenwälder Wasser- und Abwasserservice GmbH <strong>Odenwaldkreis</strong>, Abwasserverband Bad König, Abwas-<br />
(OWAS)<br />
serverband Obere Gersprenz, Abwasserverband<br />
Mittlere Mümling, Abwasserverband Unterzent-Untere<br />
Mümling, EAG Entsorgungs AG, Stadtwerke Michelstadt<br />
Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV 27 hessische Kreise und kreisfreie Städte, darunter<br />
der <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
Vereine Mitglieder<br />
Hessischer Landkreistag (HLT) Alle hessischen Landkreise<br />
Geo- und Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. Alle Städte und Gemeinden sowie die Landkreise im<br />
Gebiet des Naturparks<br />
Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V. Alle Städte und Gemeinden im Gebiet des Naturparks<br />
Odenwald sowie die Landkreise Darmstadt-Dieburg<br />
und <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
76 Beteiligungsbericht
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Kommunale Kooperationen<br />
Abwasserverband<br />
1. Mittlere Mümling<br />
2. Bad König<br />
3. Unterzent, untere Mümling<br />
4. Obere Gersprenz<br />
Feldwege- u. Gräbenunterhaltungsverband alle 15 Kommunen<br />
Wasserbeschaffungsverband Bad König (Trinkwasser)<br />
193<br />
Beerfelden, Erbach, Michelstadt<br />
Bad König, Brombachtal, Höchst<br />
Breuberg, Höchst i. Odw., Lützelbach, (Groß-Umstadt)<br />
Brensbach, Fr.-Crumbach, Reichelsheim<br />
Bad König, Brombachtal<br />
2002 fand in Mossautal/Güttersbach unter Teilnahme der Bürgermeister der kreisangehörigen<br />
Kommunen, Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie der Verwaltungen eine Leitbilddiskussion<br />
statt. Als wesentliches Ergebnis der Klausur war herauszustellen, dass dem Bereich<br />
kommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Strategiediskussion ein besonderes<br />
Augenmerk gilt und die grundsätzliche Bereitschaft der Prozessbeteiligten besteht, in dieser<br />
Frage offen für neue Wege und Modelle zu sein. Ausgehend von dieser Einschätzung ist ein<br />
Argumentations- und Diskussionspapier zur Entwicklung einer neuen regionalen Verwaltungsstruktur<br />
erforderlich. Da diese Aufgabe aufgrund ihres Umfanges und ihrer Komplexität<br />
von der Verwaltung nicht zusätzlich geleistet werden konnte, wurde das Papier extern durch<br />
eine im Landratsamt tätige Rechtsreferendarin auf der Basis eines Werkvertrages erstellt.<br />
Die Arbeit wurde Ministerialdirigent Pflock vorgestellt. Dieser hat grundsätzliche verfassungsrechtliche<br />
Bedenken geäußert, weshalb der Gedanke zunächst nicht weiterverfolgt wurde.<br />
Zweckverband „KommunalService Oberzent“ (KSO)<br />
Die Stadt Beerfelden sowie die Gemeinden Hesseneck, Mossautal, Rothenberg und Sensbachtal<br />
haben mit Wirkung vom 01.08.2008 die Bildung des Zweckverbandes „Kommunal-<br />
Service Oberzent“ auf der Basis des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit<br />
(KGG) 77 beschlossen. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung fand am<br />
29.09.2008 statt.<br />
Der Zweckverband hat die Aufgabe, in der Verwaltungseinrichtung des Verbandes die Kassen-<br />
und Rechnungsgeschäfte sowie die Veranlagung und Einziehung der gemeindlichen<br />
Abgaben für alle Verbandsmitglieder abzuwickeln. Sein Sitz befindet sich in Beerfelden.<br />
Ziele<br />
Aufgrund der Notwendigkeit einer intensiveren kommunalen Zusammenarbeit soll nun der<br />
Dialog mit den Bürgermeistern, dem Kreisausschuss und dem Kreistagspräsidium fortgesetzt<br />
werden. Angestrebt wird, schrittweise die Zusammenarbeit zu stärken und das neue regionale<br />
Verwaltungsmodell dadurch eventuell vorzubereiten. Dazu sollen als erstes Verwaltungsgemeinschaften<br />
in der Oberzent, dem Gersprenztal und der Unterzent angeregt und<br />
der Fusionsgedanke von Michelstadt und Erbach weiterhin unterstützt werden.<br />
Im Bereich der Bauleitplanung sind Gemeindegrenzen übergreifende Kooperationen anzustreben.<br />
Im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis bieten vier Interkommunale Gewerbegebiete<br />
auf über 130 ha großzügige Gewerbeflächen für Industrie, Dienstleister und Handwerker.<br />
Hier profitieren die beteiligten Gemeinden miteinander.<br />
77 Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I S.307), zuletzt<br />
geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757)
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
18.2. Interregionale Zusammenarbeit<br />
Auf regionaler Ebene bestehen Kooperationen zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt,<br />
dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem <strong>Odenwaldkreis</strong> in den Bereichen Schulentwicklungsplanung,<br />
Verkehrsplanung und Infrastruktur auf Basis eines Kooperationsvertrages,<br />
den die Gebietskörperschaften im Dezember 2007 beschlossen haben. Außerdem wird an<br />
der gemeinsamen Wahrnehmung der staatlichen Aufgabe Veterinärwesen und Verbraucherschutz<br />
gearbeitet. Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird ein gemeinsames<br />
Mediencenter eingerichtet.<br />
18.3. Verwaltungsmodernisierung<br />
• Neues Steuerungsmodell<br />
• Einführung der Doppik<br />
Produkthaushalt<br />
• Aufbau des Controllings und Einführung der elektronischen Aktenverwaltung<br />
• Berichtswesen im Rahmen des Kreisreports mit Hilfe eines standardisierten Abfragebogens<br />
• eGovernment, medienbruchfreie Möglichkeiten, hauptsächlich im Baubereich<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• verschiedene Abteilungen des Landratsamtes<br />
• Verbände<br />
• Sparkasse <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• HEAG Südhessische Energie AG (HSE)<br />
• Vereine und Verbände<br />
• gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung im<br />
<strong>Odenwaldkreis</strong> mbH (BAW)<br />
• Gesundheitszentrum Odenwald GmbH<br />
• Kurgesellschaft Bad König<br />
• Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG)<br />
• Odenwälder Schlachthof Bauträger GmbH<br />
• Odenwälder Wasser- und Abwasserservice GmbH (OWAS)<br />
• Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV<br />
194
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
19. Europäische Vorgaben<br />
19.1. EUREK<br />
Das Europäische Entwicklungskonzept wurde von den für Raumordnung zuständigen Ministern<br />
beschlossen und ist nicht rechtlich bindend. Es hat Programmcharakter und wird nur<br />
im Bereich „Entwicklung des ländlichen Raumes“ ein wenig konkreter. Die Zielsetzungen<br />
entsprechen weitgehend denen des Landesentwicklungsplans (LEP).<br />
19.2. Metropolregionen, Lissabon-Strategie und Verantwortungspartnerschaften<br />
Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben Europa im Jahr 2000 auf einem Sondergipfel<br />
in Lissabon ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2010 soll die EU der stärkste wissensbasierte<br />
Wirtschaftsraum der Welt sein. Die so genannte Lissabon-Strategie sieht vor, Innovation<br />
und Bildung besonders zu fördern.<br />
Der globale Wettbewerb und die zunehmenden weltweiten Verflechtungen lassen die Metropolregionen<br />
verstärkt als regionalökonomische und raumordnungspolitische Stellschrauben<br />
erscheinen. Metropolregionen gelten gemeinhin als Kristallisationspunkte und Träger des<br />
gesamtwirtschaftlichen Wachstums und damit als Basispunkte für die Lissabon-Strategie.<br />
In vielen Fällen hat sich die Theorie, nach der die Metropolregionen Motoren für die Gesamtwirtschaft<br />
sind, nicht bestätigt. Vielmehr fließen Kaufkraft und Wertschöpfung aus dem<br />
Umland ab in die Ballungsräume, die Immobilienmärkte in den ländlichen Gegenden brechen<br />
ein (Bsp. Lüchow-Dannenberg) und von einem politischen Gleichgewicht kann in Anbetracht<br />
der asymmetrischen Wirtschafts- und Siedlungsstruktur keine Rede sein.<br />
In der Raumordnung wird dadurch immer häufiger die Frage nach der Vereinbarkeit der Politik,<br />
die Stärken zu stärken und ihrer Vereinbarkeit mit dem Leitbild der territorialen Kohärenz<br />
gestellt. Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat 2006 das Wachstums- und das Ausgleichsziel<br />
gleichwertig nebeneinander gestellt und die Bundesregierung hat dieses Leitbild<br />
2007 ausdrücklich bestätigt.<br />
Verantwortungspartnerschaft<br />
Metropolregionen haben keine definierten Grenzen, sondern sind Räume, die sich aus Verflechtungsbereichen<br />
ergeben. Der <strong>Odenwaldkreis</strong> liegt im Einzugsbereich der beiden Metropolregionen<br />
Frankfurt Rhein Main und Rhein Neckar, die teilweise auch als eine Metropolregion<br />
gesehen werden. Positive Effekte durch die Lage können nicht eindeutig bewiesen oder<br />
dementiert werden. Die Metropolregion Rhein Neckar wird die Funktionalität von Verantwortungspartnerschaften<br />
zwischen Metropolregionen und ländlichen Räumen wie dem <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
ab Herbst 2007 mit Fördergeldern aus der EU erproben. Die TU Darmstadt wird<br />
den Aufbau dieser Verantwortungspartnerschaften etwa ein Jahr lang wissenschaftlich begleiten.<br />
Die Verantwortungspartnerschaften werden bestimmte Aufgaben festlegen, die der ländliche<br />
Raum für die Metropolregion erfüllen kann und umgekehrt. Die aktuelle klimapolitische Diskussion<br />
könnte gerade für die ländlichen Räume eine Chance darstellen, ihre Rolle in den<br />
Metropolregionen neu zu definieren und tatsächlich von der wirtschaftlichen Entwicklung zu<br />
partizipieren. Grundlage ist das am 10. Januar 2007 von der Europäischen Kommission verabschiedete<br />
„Energiepaket“, das zum Ziel hat, die Abhängigkeit der EU von importierten<br />
Kohlenwasserstoffen zu reduzieren und gleichzeitig die Vorreiterrolle der EU im Bereich der<br />
CO2-Einsparung und der erneuerbaren Energien auszubauen.<br />
Aus siedlungs- und wirtschaftsstrukturellen Gründen sind die ländlichen Räume schon immer<br />
Grundlage der Versorgung, zunächst nur aus Sicht der Nahrungsmittelbeschaffung, heute<br />
195
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
gleichsam als Lieferanten regenerativer Energien. Damit sind sie als Versorgungsräume einzustufen,<br />
die in immer stärkerem Maße Energie auf regenerativer Basis liefern.<br />
Schon in den vergangenen Jahren war der <strong>Odenwaldkreis</strong> bemüht, den Anteil der regenerativen<br />
Energien am Primärenergiebedarf zu erhöhen. Die Energie wird vor allem aus heimischer<br />
Biomasse gewonnen, der Import von Bioenergie aus anderen Regionen Europas soll<br />
möglichst vermieden werden.<br />
Im Sinne der geschilderten Bedeutung des ländlichen Raumes als Versorgungsraum und der<br />
Zielsetzung, regenerative Energien weiter auszubauen, kann der <strong>Odenwaldkreis</strong> nicht nur<br />
seine eigene Wertschöpfung in diesem Bereich verbessern, sondern langfristig selbst Exporteur<br />
von Bioenergie für den Ballungsraum werden.<br />
Förderperiode/Förderziele<br />
Ziele sind u. a. der Ausbau nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten, die Unterstützung der Gründung<br />
von Kleinstunternehmen und die Förderung von Fremdenverkehr und Dorferneuerung.<br />
19.3. Regionales Entwicklungskonzept für ELER<br />
Zu den vorhandenen Plänen und Programmen, auf die zurückgegriffen werden kann, gehört<br />
auch das Regionale Entwicklungskonzept Odenwald (REKO). Das REKO ist ein informelles<br />
Regionalentwicklungsinstrument und nicht rechtlich bindend. Im ersten Halbjahr 2007 erarbeitete<br />
die Interessengemeinschaft Odenwald e. V. (IGO) zusammen mit einer Steuerungsgruppe,<br />
in der die IGO, die Ämter für den ländlichen Raum von Darmstadt-Dieburg, Bergstraße<br />
und <strong>Odenwaldkreis</strong>, der TouristikService Odenwald-Bergstraße, der Hotel- und<br />
Gaststättenverband Odenwald und der Geopark vertreten sind, die Grundlage für das<br />
REKO. Es gilt für die ganze Region hessischer Odenwald mit Ausnahme einiger Kommunen<br />
des Kreises Bergstraße. Mit dem Konzept bewirbt sich das bisherige Leader+-Fördergebiet<br />
(mit geringfügigen Veränderungen) für Gelder des Europäischen Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) der neuen Förderperiode 2007-2013 bei der<br />
EU.<br />
Das Entwicklungsleitbild bleibt auch in der Förderperiode 2007-2013 das gleiche wie in der<br />
vorhergehenden: Lebensqualität, die auf einem ausgewogenen Verhältnis von Ökologie und<br />
Ökonomie und der kulturellen Identität der Menschen beruht.<br />
Die Lenkungsgruppe hat einen Fragebogen zur Entwicklung des Odenwaldes erstellt, der<br />
von einer weitgefächerten Gruppe von Vertretern regionaler Interessen beantwortet wurde.<br />
Die IGO hat die Antworten in einem Innovationsradar ausgewertet. Anschließend wurden im<br />
Sinne des Bottom-up-Prinzips mehrere Workshops durchgeführt, in denen Bürgerinnen und<br />
Bürger der Region Odenwald die grundsätzliche Weiterentwicklung dieser Region diskutiert<br />
und konkrete Maßnahmen und Projektvorschläge eingebracht haben.<br />
Die Steuerungsgruppe hat auf Basis der statistischen Daten, der subjektiven Einschätzungen<br />
(Inno-Radar) und den Workshops Stärken und Schwächen zu jedem der Themen räumliche<br />
Lage/Infrastruktur, Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Situation allgemein (und einzelne<br />
Wirtschaftssektoren Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, erneuerbare Energien) und<br />
Dorfentwicklung erarbeitet. Die SWOT-Analyse 78 wurden gewichtet und zur folgenden<br />
Kernstärken und –schwächen, -chancen und –risiken verdichtet:<br />
Kernstärken:<br />
• hohe Dichte an Kulturgütern<br />
78 SWOT-Analyse: Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und<br />
Threats (Gefahren)<br />
196
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
• Natur- und Umweltqualität<br />
• gut ausgebildete Facharbeiter<br />
• lebendige und authentische Ortskerne in den Haufendörfern<br />
• Identifikation mit der Region<br />
• bürgerschaftliches Engagement<br />
• traditionelles Handwerk<br />
Kernschwächen:<br />
• Mobilität<br />
• öffentliche Finanzen<br />
• Kapitalmarkt und Kapitalversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)<br />
• regionaler Arbeitsmarkt (Diversifizierung um höherwertige Dienstleistungen)<br />
• Zukunftstechnologien<br />
• Breitbandanbindung<br />
• Außendarstellung Tourismus<br />
• fehlendes Marken- und Qualitätsbewusstsein<br />
• Gastronomieangebot<br />
Kernchancen:<br />
• steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRo)<br />
• räumliche Lage (zu Rhein-Main und Rhein-Neckar)<br />
Kernrisiken:<br />
• demographischer Wandel<br />
• Randlage und schlechte Verkehrsanbindung<br />
• Konzentration der Breitbandversorgung auf Ballungszentren<br />
• Wegfall der Grünlandprämie<br />
• schlechte Bodenqualität<br />
Daraus erwachsen folgende Handlungsfelder:<br />
• Infrastrukturdefizite ausgleichen/abbauen (Breitband, Verkehr, Technologie, Wissen)<br />
• Tourismus: Wanderwald und Geopark<br />
• Genuss- und Kulturregion Odenwald<br />
• Klimaschutzregion Odenwald<br />
Das Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in<br />
Frankfurt am Main (ifls) hat gemeinsam mit der Steuerungsgruppe Oberziele zu den Handlungsfeldern<br />
formuliert. Leitprojekte und Maßnahmen zu den Zielen ergaben sich vor allem<br />
aus den Workshops.<br />
Das Entwicklungsleitbild lautet: „Der Odenwald – die landschaftlich und kulturell attraktivste<br />
und ökologisch intakte Region mit klarem Qualitätsprofil in Rhein-Main-Neckar“. Das strategische<br />
Oberziel ist, den Odenwald zu der Qualitätsregion in Rhein-Main-Neckar zu entwickeln.<br />
Darunter wurden thematische/sektorale Teilziele formuliert, die der folgenden Reihenfolge<br />
nach gewichtet sind:<br />
• Der Odenwald – die Biomasseregion in Rhein-Main-Neckar<br />
• Der Odenwald – die Wanderregion in Rhein-Main-Neckar<br />
• Der Odenwald – die Genussregion in Rhein-Main-Neckar<br />
• Der Odenwald – die Geo-Region in Rhein-Main-Neckar<br />
• Der Odenwald – die Kultur-Erlebnis-Region in Rhein-Main-Neckar<br />
• Der Odenwald – die Gemeinschaftsregion in Rhein-Main-Neckar<br />
Basisziel ist der kontinuierliche Ausbau der Infrastruktur.<br />
197
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Evaluierung:<br />
Die Outputindikatoren auf Maßnahmenebene beziehen sich auf die Maßnahmen innerhalb<br />
des Leader-Programmes, die von der Region Odenwald absehbar in Anspruch genommen<br />
werden sollen. Um die Anschlussfähigkeit des Monitorings der Region Odenwald an das<br />
Land Hessen zu gewährleisten, wurden bei der Auflistung relevanter Indikatoren in Kapitel 3<br />
des REKO in der Regel die im Entwicklungsplan für den ländlichen Raum (EPLR) des Landes<br />
Hessen abgebildeten Indikatoren übernommen bzw. nachempfunden. Dabei handelt es<br />
sich um Output-Indikatoren, Ergebnisindikatoren und Wirkungsindikatoren. In den beiden<br />
untenstehenden Tabellen sind diese verschiedenen Indikatoren für die Erfolgsmessung der<br />
Maßnahmen aus dem EPLR/Leader zusammenfassend dargestellt. Sollte im Verlauf des<br />
Umsetzungsprozesses auf weitere Maßnahmen des Hessischen EPLR-Programms zurückgegriffen<br />
werden, wird der Indikatorenkatalog entsprechend erweitert. Der Maßnahmenerfolg<br />
wird im jährlichen Rhythmus anhand der definierten Indikatoren überprüft und das Ergebnis<br />
der Überprüfung im Monitoring-Bericht in Form eines Soll-Ist-Vergleiches dokumentiert.<br />
Indikatorensystem der Region Odenwald:<br />
Quelle: REKO, S. 98<br />
Neben dem Monitoring hinsichtlich der Erreichung operationeller und strategischer Ziele soll<br />
auch der regionale Kooperationsprozess selbst sowie die Arbeit des Regionalmanagements<br />
einer ständigen Erfolgskontrolle unterzogen und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess<br />
198
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
ermöglicht werden. Hierfür ist die Entwicklung einer Balanced Score Card oder alternativ der<br />
Einsatz des im Rahmen von „Regionen aktiv“ entwickelten „Selbstbewertungsbogen für Regionalentwicklungsprozesse“<br />
zur jährlichen Erfolgskontrolle des regionalen Kooperationsprozesses<br />
und der Arbeit des Regionalmanagement vorgesehen. Eine verbindliche Entscheidung<br />
über das gewählte Verfahren wird binnen eines halben Jahres nach Aufnahme der Region<br />
in das Leader-Programm durch den Förderausschuss der IGO gefällt werden.<br />
Grundsätzlich ist für das Prozesssteuerungscontrolling ebenfalls das Regionalmanagement<br />
zuständig. Die Ergebnisse, Schlussfolgerungen und eventuell notwendige Korrekturen innerhalb<br />
des Prozesses gehen in den jährlichen Monitoringbericht ein und werden dem Förderausschuss<br />
der IGO zur Diskussion vorgelegt. Dieser entscheidet auch darüber, ob und in<br />
welchem Umfang zum Controlling der Arbeit des Regionalmanagements externe Fachleute<br />
hinzugezogen werden sollen.<br />
Ziele:<br />
Aus den Handlungsfeldern des REKO ergeben sich folgende konkrete Projekte, die in den<br />
nächsten Jahren umgesetzt werden sollen:<br />
199
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
200
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Handelnde Akteure im <strong>Odenwaldkreis</strong>:<br />
• <strong>Odenwaldkreis</strong><br />
• Städte und Gemeinden<br />
• Interessengemeinschaft Odenwald e. V.<br />
• Bürger<br />
201
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
III. Literatur<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es: OdenwaldKREISREPORT<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es: Sozialstrukturatlas zur Situation der jungen Bevölkerung<br />
im <strong>Odenwaldkreis</strong>, Ausgabe 2007<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es: Wegweiser für Seniorinnen und Senioren im <strong>Odenwaldkreis</strong>,<br />
Ausgabe 12/2008<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es: Sozialhandbuch<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es, PP – Die Bildungsagentur GmbH im Frankfurt am<br />
Main: Schulentwicklungsplan 2007 – 2012<br />
Kreisausschuss des <strong>Odenwaldkreis</strong>es: Beteiligungsbericht 2006<br />
rEnergO / Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH / Ingenieurgemeinschaft<br />
Witzenhausen Fricke & Turk GmbH Energiekonzept <strong>Odenwaldkreis</strong>, Dezember 2007<br />
BBR (Hrsg.): Raumordnungsbericht 2005, Berichte Bd. 21, Bonn 2005<br />
Europäische Kommission: Europäisches Raumentwicklungskonzept – Wege zu einer räumlich<br />
ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union, Luxemburg/Italien<br />
1999<br />
OREG (Hrsg.): Nahverkehrsplan 2007<br />
IGO/ifls (Hrsg.): Regionales Entwicklungskonzept Odenwald 2007<br />
Wetterich, Schrader, Eckl: Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung: Regionale<br />
Sportentwicklungsplanung im Landkreis Groß-Gerau 2007, LIT Verlag Berlin<br />
Förderrichtlinien des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
Positionspapier der IHK Darmstadt zur Standortmarketingkampagne Darmstadt RheinMain-<br />
Neckar – addicted to innovation<br />
projekt m GmbH (Hrsg.): Touristisches Marketing- und Organisationskonzept Odenwald,<br />
Management Summary, Lüneburg 2007<br />
Landkreisportrait <strong>Odenwaldkreis</strong>, IHK, Januar 2009<br />
Hessisches Statistisches Landesamt: Statistische Berichte, 2008<br />
Online-Quellen:<br />
www.aktion-behindertes-kind.de<br />
www.apfelroute.de<br />
www.autismus.de<br />
202
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
www.awo-odenwald.de<br />
www.bauernhof-als-klassenzimmer.hessen.de<br />
www.baw-odenwaldkreis.de<br />
www.bioenergiedorf-odenwald.de<br />
www.bioregio-odenwald-bergstrasse.de<br />
www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-erbach<br />
www.bmbf.de<br />
www.bmvbs.de<br />
www.denkmal.odenwaldkreis.de<br />
www.drk.de<br />
www.ehrenamt.odenwaldkreis.de<br />
www.europa.eu<br />
www.ev-dekanat-erbach.de<br />
www.gz-odw.de<br />
www.integra-home.de<br />
www.ivo-odw.de<br />
www.keilvelterhof.de<br />
www.kultursommer-suedhessen.de<br />
www.lokales-buendnis-fuer-familien.de<br />
www.mzvo.de<br />
www.odenwald.de<br />
www.odenwaldkreis.de<br />
www.odenwald-akademie.de<br />
www.odenwaelder-bauernmarkt.de<br />
www.odenwald-behoerde.de<br />
www.odenwald-biomasse.de<br />
www.odenwaelder-direktvermarkter.de<br />
www.odenwald-pferd.de<br />
203
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
www.odenwald-radwandern.de<br />
www.odenwald-vitalness.de<br />
www.odinet.de<br />
www.oreg.de<br />
www.oreg.de/nahverkehr<br />
www.oreg.de/regionalentwicklung<br />
www.oreg.de/touristik<br />
www.oreg.de/wirtschaftsservice<br />
www.pisa.oecd.org<br />
www.radroutenplaner.hessen.de<br />
www.renergo.de<br />
www.rp-darmstadt.hessen.de<br />
www.senioren.odenwaldkreis.de<br />
www.vhs-odenwald.de<br />
www.weiterbildung-odenwald.de<br />
Bildnachweis<br />
Das Bildmaterial wurde von den entsprechenden Abteilungen/Organisationen zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Weitere Bilder: Pressestelle des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
204
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
IV. Abkürzungsverzeichnis<br />
ALR Amt für den ländlichen Raum<br />
AbwV Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser<br />
in Gewässer (Abwasserverordnung)<br />
AK Arbeitskreis<br />
ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung)<br />
ASD Allgemeiner Sozialer Dienst<br />
BbodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und<br />
zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz –<br />
BbodSchG)<br />
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung<br />
EAG Entsorgungs-Aktiengesellschaft Darmstadt<br />
ELER Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des<br />
ländlichen Raumes (ELER)<br />
FES Freundeskreis Eberstädter Streuobstwiesen e.V.<br />
FFH Fauna-Flora-Habitat<br />
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
FÖG Fördergemeinschaft regionaler Streuobstbau Bergstraße -<br />
Odenwald – Kraichgau (FÖG) e.V.<br />
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt<br />
HAKA Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und<br />
Abfallgesetz<br />
HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe<br />
und den Katastrophenschutz<br />
HBO Hessische Bauordnung<br />
HEKUL Hessisches Kulturlandschaftsprogramm<br />
HeNatG Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(Hessisches Naturschutzgesetz)<br />
HeRo Kompetenzzentrum HessenRohstoffe Witzenhausen<br />
Hess. Verf. Verfassung des Landes Hessen<br />
HIAP Hessiches Integriertes Agrarumweltprogramm<br />
HRB Hochwasserrückhaltebecken<br />
HRDG 2. Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen vom<br />
24.11.1998 (GVBl. I S. 499)<br />
HSL Hessisches Statistisches Landesamt<br />
HWDO Hochwasserdienstordnung (HWDO) für den dezentralen Hochwasserdienst<br />
der Mümling des Landrats des <strong>Odenwaldkreis</strong>es<br />
HWG Hessisches Wassergesetz<br />
IAVL Institut für angewandte Vegetationskunde und Landschaftsökologie<br />
ifls Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johann-Wolfgang-<br />
Goethe-Universität in Frankfurt am Main<br />
IGO Interessengemeinschaft Odenwald e. V.<br />
ijgd Internationale Jugendgemeinschaftsdienste<br />
JGH Jugendgerichtshilfe<br />
KGG Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit<br />
KMU kleinen und mittleren Unternehmen<br />
KrW-/AbfG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der<br />
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-<br />
und Abfallgesetz)<br />
KSO Zweckverbandes „KommunalService Oberzent“<br />
KuSS Kultursommer Südhessen (KuSS) e. V. mit Geschäftsstelle beim<br />
205
<strong>Kreisentwicklungsplan</strong> <strong>Odenwaldkreis</strong> 2009 Stand 16. Februar 2009<br />
Regierungspräsidium Darmstadt<br />
LEADER (frz.) Liaison entre actions de développement de l'économie<br />
rurale, dt.: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der<br />
ländlichen Wirtschaft<br />
LEP Landesentwicklungsplan<br />
LSG Landschaftsschutzgebiet<br />
LWQ Modell Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung<br />
MZVO Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald<br />
Natura 2000-Verordnung Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen vom<br />
16.01.2008<br />
NGO Nichtregierungsorganisation (NRO), d. h. eine nichtstaatliche<br />
Organisation (engl. non-governmental organization, abgekürzt<br />
NGO)<br />
NSG Naturschutzgebiet<br />
NZO Naturschutzzentrum Odenwald<br />
OGV Obst- und Gartenbauverein<br />
ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr<br />
ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen<br />
OREG Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG)<br />
OWAS Odenwälder Wasser- und Abwasser-Service GmbH<br />
REKO Regionales Entwicklungskonzept Odenwald<br />
rEnergO Gesellschaft zur Förderung, Gewinnung und Nutzung regenerativer<br />
Energien mbH als ein Tochterunternehmen der Odenwald-<br />
Regional-Gesellschaft (OREG) mbH<br />
RLK Regionale Landschaftspflegekonzept<br />
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund<br />
RPS Regionalplan Südhessen<br />
SGB Sozialgesetzbuch<br />
TAG Touristischen Arbeitsgemeinschaften<br />
TÖB Träger öffentlicher Belange<br />
TrinkwV Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen<br />
Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001)<br />
TSOB TouristikService Odenwald-Bergstraße<br />
u. a. unter anderem, und andere<br />
u. v. m. und Vieles mehr<br />
VbF Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung oder Beförderung<br />
brennbarer Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung über<br />
brennbare Flüssigkeiten)<br />
VS-RL Vogelschutz-Richtlinie<br />
WEA Windenergieanlage<br />
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)<br />
StAnz Staatsanzeiger<br />
206