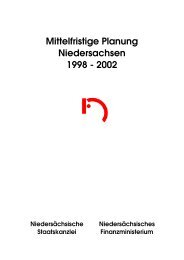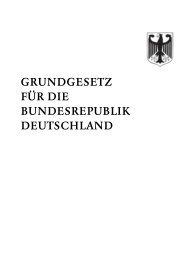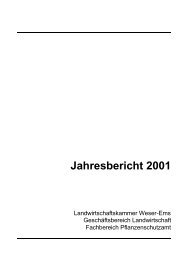3. Schwerpunkte - Niedersachsen
3. Schwerpunkte - Niedersachsen
3. Schwerpunkte - Niedersachsen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Das Jahr 2006 war aus Sicht des Niedersächsischen Landesamtes<br />
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) im<br />
Wesentlichen von zwei Ereignissen geprägt: Auf der einen Seite<br />
stellte die ständige Bedrohung unserer Geflügelbestände durch<br />
die mögliche Einschleppung der Aviären Influenza für alle beteiligten<br />
Veterinärbehörden eine große Herausforderung dar. So<br />
wurden allein im Jahr 2006 in <strong>Niedersachsen</strong> rund 9.000 Vögel<br />
auf den Erreger untersucht, die Zahl der serologischen und virologischen<br />
Untersuchungen lag bei über 20.000. Auf der anderen<br />
Seite führten immer wieder neue Funde von überlagertem bzw.<br />
altem Fleisch zur Verunsicherung der Verbraucher.<br />
Das LAVES hat im vergangenen Jahr durch seine Untersuchungsund<br />
Beratungskompetenz einen maßgeblichen Beitrag zur Aufklärung<br />
der Vorfälle geleistet und wird dies auch in Zukunft tun.<br />
Dabei sind die Erkenntnisse aus Analytik und Überwachung als<br />
Garant für eine objektive Berichterstattung in den Medien zu<br />
sehen. Besondere Beachtung für das Jahr 2006 verdient auch<br />
die Anerkennung der Behörde über die Landesgrenzen <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
hinaus. Insbesondere verdient die Zuweisung einer geschäftsführenden<br />
Aufgabe bei der Tierseuchenbekämpfung (Einrichtung<br />
eines Mobilen Bekämpfungszentrums (MBZ)) für alle<br />
Bundesländer eine besondere Beachtung.<br />
Dezidierte Darstellungen von Einzelergebnissen und Analysen<br />
finden Sie im Internet unter www.laves.niedersachsen.de.<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Präsident des Niedersächsischen Landesamtes<br />
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
Vorwort<br />
Vorwort
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Mehr Sicherheit für den Verbraucher....................................................................... 8<br />
1.1 Aufgaben und Aufbau des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(LAVES)...................................................................................................................................................<br />
1.1.1 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Verbraucherinformation, Fachinformation zur Ernährungsberatung.......................... 10<br />
1.1.2 Stabsstelle Qualitätsmanagement............................................................................................................................... 11<br />
1.1.3 Abteilung 1: Zentrale Aufgaben.................................................................................................................................<br />
Dezernat 11: Personal, Organisation, Liegenschaften, Innerer Dienst..........................................................................<br />
Dezernat 12: IuK-Technik, Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente, Datenmanagement...................................<br />
Dezernat 13: Recht.....................................................................................................................................................<br />
Dezernat 14: Fachbezogene Ausbildungs- und Prüfungsangelegenheiten...................................................................<br />
Dezernat 15: Technische Sachverständige...................................................................................................................<br />
1.1.4 Abteilung 2: Lebensmittelsicherheit............................................................................................................................<br />
Dezernat 21: Lebensmittelüberwachung.....................................................................................................................<br />
Dezernat 22: Lebensmittelkontrolldienst.....................................................................................................................<br />
Dezernat 23: Tierarzneimittelüberwachung und Rückstandskontrolldienst..................................................................<br />
1.1.5 Abteilung 3: Tiergesundheit.......................................................................................................................................<br />
Dezernat 31: Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte......................................................<br />
Dezernat 32: Task-Force Veterinärwesen....................................................................................................................<br />
Dezernat 33: Tierschutzdienst.....................................................................................................................................<br />
1.1.6 Abteilung 4: Futtermittelsicherheit, Marktüberwachung.............................................................................................<br />
Dezernat 41: Futtermittelüberwachung......................................................................................................................<br />
Dezernat 42: Ökologischer Landbau...........................................................................................................................<br />
Dezernat 43: Marktüberwachung...............................................................................................................................<br />
1.1.7 Abteilung 5 : Untersuchungseinrichtungen.................................................................................................................<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig (LI BS)...................................................................................................................<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg (LI OL)........................................................................................................................<br />
Institut für Fischkunde Cuxhaven (IfF CUX).................................................................................................................<br />
Veterinärinstitut Hannover (VI H)……………………………………………………………………………………………..<br />
Veterinärinstitut Oldenburg (VI OL).............................................................................................................................<br />
Futtermittelinstitut Stade (FI STD)................................................................................................................................<br />
Institut für Bienenkunde Celle (IB CE).........................................................................................................................<br />
Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG)......................................................................................................<br />
1.1.8 Personalstärke............................................................................................................................................................ 32<br />
1.1.9 Ausbildung................................................................................................................................................................. 34<br />
2. Amtliche Kontrollen in <strong>Niedersachsen</strong>...................................................................... 36<br />
2.1 Futtermittelüberwachung..................................................................................................................... 37<br />
2.2 Marktüberwachung............................................................................................................................... 38<br />
2.3 Tiergesundheit.......................................................................................................................................<br />
Tierarzneimittel..........................................................................................................................................................<br />
2.4 Lebensmittel.......................................................................................................................................... 40<br />
2<br />
8<br />
12<br />
12<br />
12<br />
12<br />
13<br />
13<br />
14<br />
14<br />
14<br />
15<br />
15<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
18<br />
19<br />
21<br />
21<br />
21<br />
24<br />
25<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
38<br />
40
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong> des LAVES in 2006 ............................................................................<br />
V e r b r a u c h e r s c h u t z i n N i e d er s a c h s e n…………............................................<br />
LAVES: Arbeit im Dienste des Verbrauchers.………………..………………………………………………………….<br />
L e b e n s m i t t e l u n d B e d a r f s g e g e n s t ä n d e ……………………………………<br />
Untersuchungen zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren………………………………………..<br />
Salmonellen-Belastung bei Geflügel – Erkenntnisse aus dem Eu-weiten Salmonellenmonitoring............................<br />
Nematodenlarven in Wildlachs: Beurteilung und Bewertung..................................................................................<br />
Salomonellen in Kauartikeln für Hunde – bei Kontakt mit Produkten Hygiene einhalten…….................................<br />
Kontrolle Lebensmittelkennzeichnung – Schutz vor Verbrauchertäuschung…………………………………<br />
„Fleischskandale“ in <strong>Niedersachsen</strong>…...................................................................................................................<br />
Wieviel echtes Vanilleeis gibt es noch?..................................................................................................................<br />
Irreführende Kennzeichnung: Mild gesalzener Lachsersatz im Test…….................................................................<br />
Ökologische Produkte im Trend…………………………………………………………………………………………..<br />
Schutz der „Kleinen Verbraucher“ in <strong>Niedersachsen</strong>…………………………………………………………………<br />
Fläschchen, Gläschen, Babybrei – Fallstricke in der Werbung für Säuglings- und Kleinkindernahrung...................<br />
Cumarin in zimthaltigen Lebensmitteln: besonders für Kinder bedenklich…………………………………………..<br />
Holzspielzeug für Kinder formaldehydfrei?..........................................................................................................<br />
Rückstände in Lebensmitteln…............................................................................................................<br />
Neue Untersuchungsergebnisse zu Schimmelpilzgiften (Mykotoxinen)…...............................................................<br />
Mehrfachrückstände von Pflanzenschutzmitteln in Obst und Gemüse: sind Mischproben repräsentativ?..............<br />
Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich bleibt Thema……..................................................<br />
Gentechnik in Lebensmitteln……….....................................................................................................<br />
Nicht zugelassene gentechnisch veränderte Bestandteile in Lebens- und Futtermitteln in der EU……...................<br />
Transparenter Verbraucherschutz bei Bedarfsgegenständen……..........................................................<br />
Mehr Sicherheit durch neue Regelungen bei Haarfarben……..............................................................................<br />
Tätowiermittel teilweise mit Keimen belastet………….........................................................................................<br />
Verbraucherbeschwerden: Was ist zu tun, wenn Lebensmittel nicht in Ordnung sind……...........<br />
F u t t e r m i t t e l - a m A n f a n g d e r N a h r u n g s k e t t e……………………………..<br />
Dioxinuntersuchungen in Futtermitteln………………………..............................................................<br />
Schwermetalle bei Importfuttermitteln…………………………………………………………………….<br />
„Cross Compliance“ – Bedingungen für Prämienzahlungen der EU – Landwirte an Einhaltung<br />
von Verpflichtungen gebunden……………………………………………………………………………...<br />
T i e r g e s u n d h e i t ………………………………………………………………………………<br />
Tierseuchen……………..........................................................................................................................................<br />
Mobiles Bekämpfungszentrum für Tierseuchen in Deutschland – das 3,4 Millionen-Projekt…................................<br />
Geflügelpest – weiterhin Seuchengefahr für <strong>Niedersachsen</strong>…………………………………………………….……..<br />
Schweinepest………………………………………………………………………………………………………………<br />
Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen – Herausforderung für die hiesige Tierseuchenbekämpfung………<br />
Tierkrankheiten – mehr als nur Tierseuchen.......................................................................................<br />
Gefahr für Weidetiere durch giftiges Jakobskreuzkraut.........................................................................................<br />
3<br />
42<br />
43<br />
43<br />
44<br />
44<br />
44<br />
50<br />
52<br />
53<br />
53<br />
54<br />
56<br />
58<br />
59<br />
59<br />
61<br />
62<br />
63<br />
63<br />
64<br />
66<br />
70<br />
70<br />
72<br />
72<br />
74<br />
73<br />
77<br />
77<br />
78<br />
80<br />
82<br />
82<br />
82<br />
83<br />
86<br />
88<br />
90<br />
90
Inhaltsverzeichnis<br />
Tierschutz……………………………………………….........................................................................................<br />
Beratung zur Haltung gefährlicher Tiere nimmt zu.................................................................................................<br />
Neue EU-Tiertransportverordnung in Kraft…………………………………………………………………………….…<br />
Nationale Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Kraft………………………………………………………….…..<br />
Zierfischhaltung in Diskotheken – tierschutzfachlich vertretbar?.............................................................................<br />
V e r b r a u c h e r s c h u t z „ V o m A c k e r b i s z u m T e l l e r „…...................................<br />
Neues EU-Recht zur Lebensmittelsicherheit und –hygiene (einschließlich Futtermitteln)................................<br />
Wer kontrolliert die Lebensmittel?....................................................................................................................<br />
Betriebliche Eigenkontrollen der Lebensmittelunternehmer und amtliche Überwachung durch die Behören……...<br />
W a s d a s L A V E S s o n s t n o c h m a c h t….........................................................................<br />
Qualitätsmanagement im LAVES………………………………………………………………….................................<br />
LAVES wird zertifiziert: Vereinheitlichung von Abläufen kommt auch Verbrauchern zugute…............................<br />
LAVES verfasst Checklisten zur Überprüfung von Biogasanlagen...............................................................<br />
Walstrandungen an der niedersächsischen Küste………………………………………………………………<br />
4. Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse des LAVES............................................... 111<br />
4.1<br />
4.1.1<br />
4.1.1.1<br />
4.1.1.2<br />
4.1.1.3<br />
4.1.1.4<br />
4.1.1.5<br />
4.1.2<br />
4.2<br />
4.2.1<br />
4.2.2<br />
4.2.3<br />
4.2.4<br />
4.2.5<br />
4.3<br />
4.<strong>3.</strong>1<br />
4.<strong>3.</strong>2<br />
4.<strong>3.</strong>2.1<br />
4.<strong>3.</strong>2.2<br />
4.<strong>3.</strong>2.3<br />
4.<strong>3.</strong>2.4<br />
Futtermittelüberwachung.....................................................................................................................<br />
Amtliche Futtermittelüberwachung............................................................................................................................<br />
Zulassung und Registrierung……………………………...............................................................................................<br />
Betriebsinspektionen..................................................................................................................................................<br />
Buchprüfungen..........................................................................................................................................................<br />
Proben und Analysen – Nationales Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit…….......................................................<br />
Analytik im Futtermittelinstitut Stade..........................................................................................................................<br />
Fütterungsarzneimittel................................................................................................................................................<br />
Marktüberwachung...............................................................................................................................<br />
Eier............................................................................................................................................................................<br />
Geflügelfleisch-Kontrollen..........................................................................................................................................<br />
Obst, Gemüse und Kartoffeln.....................................................................................................................................<br />
Vieh und Fleisch.........................................................................................................................................................<br />
Medienüberwachung.................................................................................................................................................<br />
Tiergesundheit.......................................................................................................................................<br />
TSE (Transmissible Spongiforme Enzephalopathien)....................................................................................................<br />
Anzeigepflichtige Tierseuchen....................................................................................................................................<br />
Blauzungenkrankheit…………...................................................................................................................................<br />
Geflügelpest-Monitoring………………………………………………………………………………………………………<br />
Brucellose………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Tollwutdiagnostik.…………………………………………………………………………………………………………….<br />
4<br />
92<br />
92<br />
94<br />
95<br />
96<br />
99<br />
99<br />
101<br />
101<br />
103<br />
103<br />
101<br />
104<br />
105<br />
111<br />
111<br />
112<br />
113<br />
113<br />
114<br />
115<br />
119<br />
120<br />
120<br />
122<br />
123<br />
124<br />
125<br />
125<br />
125<br />
127<br />
129<br />
130<br />
130<br />
130
Inhaltsverzeichnis<br />
4.<strong>3.</strong>3<br />
4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1<br />
4.<strong>3.</strong>4<br />
4.<strong>3.</strong>5<br />
4.<strong>3.</strong>6<br />
4.<strong>3.</strong>7<br />
4.<strong>3.</strong>8<br />
4.<strong>3.</strong>9<br />
4.<strong>3.</strong>10<br />
4.<strong>3.</strong>11<br />
4.<strong>3.</strong>12<br />
4.4<br />
4.4.1<br />
4.4.1.1<br />
4.4.1.2<br />
4.4.1.3<br />
4.4.1.4<br />
4.4.2<br />
4.4.2.1<br />
4.4.2.2<br />
Meldepflichtige Tierkrankheiten.................................................................................................................................<br />
Chlamydien…………………………………………………………………………………………………………………….<br />
Sonstige Tierkrankheiten............................................................................................................................................<br />
Fischuntersuchungen..................................................................................................................................................<br />
Bienenkrankheiten.....................................................................................................................................................<br />
Wildtieruntersuchungen.............................................................................................................................................<br />
Zulassung und Überwachung der Betriebe zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten........................................<br />
Zulassung von Besamungs- und Embryotransferstationen und von Affenhaltungen zum innergemeinschaftlichen<br />
Handel.......................................................................................................................................................................<br />
Erlaubniserteilung an Labore zum Arbeiten mit Tierseuchenerregern..........................................................................<br />
Ausstellungen, Auktionen, Körungen, Turniere und Viehmärkte.................................................................................<br />
TRACES – System der EU für den Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen......……………………………………<br />
Zoonosen................................................................................................................................................<br />
Überwachungspflichtige Zoonosen und Zoonoseerreger ............................................................................................<br />
Campylobacteriose…………………………………………………………………………………………………………….<br />
Salmonellose……………………………………………………………………………………………………………………<br />
Tuberkulose…………………………………………………………………………………………………………………….<br />
Resistenzmonitoring – Resistenzprüfungen im Mikrodilutionsverfahren…………………………………………………..<br />
Besondere Überwachungsprogramme aus zoonotischer Sicht………………………………………………....................<br />
Fuchsbandwurm-Monitoring………………………………………………………………………………………………….<br />
Samonellennachweise im Rahmen des EU-Salmonellenmonitorings………………………………………………………<br />
4.5 Tierschutz...............................................................................................................................................<br />
4.6<br />
4.6.1<br />
4.6.2<br />
4.6.3<br />
4.6.4<br />
4.6.5<br />
4.6.6<br />
Hygieneuntersuchungen in der Fleisch- und Geflügelfleischgewinnung.........................................<br />
Amtliche Kontrolle der Reinigung und Desinfektion in der Fleischgewinnung……………………….………………..….<br />
Amtliche Kontrolle der Produkte……………………………………………………………………………………………...<br />
Untersuchungen auf Salmonellen im Rahmen der Hygieneuntersuchungen………………………………………………<br />
Salmonellenmonitoring bei Schlachtschweinen……………………………………………………………………………...<br />
Untersuchungen von Hackfleisch……………………………………………………………………………………………..<br />
Sonstige Untersuchungen……………………………………………………………………………………………………..<br />
4.7 Hygieneuntersuchungen bei Milch und Milchprodukten, Eiern und Eiprodukten...........................<br />
4.8 Bakteriologische Fleischuntersuchung.................................................................................................<br />
4.9 Schädlingsbekämpfung.........................................................................................................................<br />
4.10 Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährlichkeit...............................................<br />
4.11 EU-Grenzkontrollstellen....................................................................................................................... 165<br />
5<br />
131<br />
132<br />
133<br />
134<br />
138<br />
139<br />
140<br />
140<br />
140<br />
140<br />
141<br />
141<br />
141<br />
141<br />
142<br />
146<br />
146<br />
149<br />
149<br />
150<br />
150<br />
153<br />
153<br />
154<br />
156<br />
156<br />
157<br />
158<br />
158<br />
161<br />
162<br />
164
Inhaltsverzeichnis<br />
4.12 EU-Schnellwarnsystem………………………………………………………………………………………... 165<br />
4.13 Zulassung von Betrieben für die Vermarktung von Lebensmitteln tierischer Herkunft.................. 169<br />
4.14<br />
4.14.1<br />
4.14.2<br />
4.14.3<br />
4.15<br />
4.15.1<br />
4.15.2<br />
4.16<br />
4.16.1<br />
4.16.2<br />
4.16.3<br />
4.16.4<br />
4.16.4.1<br />
4.16.5<br />
4.16.6<br />
4.16.7<br />
4.16.8<br />
4.16.9<br />
4.16.10<br />
4.16.11<br />
4.16.12<br />
4.16.13<br />
4.16.14<br />
4.16.15<br />
4.16.16<br />
4.16.17<br />
4.16.18<br />
4.16.19<br />
4.16.20<br />
4.16.21<br />
4.16.22<br />
4.16.23<br />
4.16.24<br />
4.16.25<br />
4.16.26<br />
4.16.27<br />
4.16.28<br />
4.16.29<br />
Sonstige Genehmigungen und amtliche Anerkennungen.................................................................<br />
Amtlich anerkannte natürliche Mineralwässer.............................................................................................................<br />
Genehmigungen zur Herstellung von bestimmten diätetischen Lebensmitteln nach § 11 Diätverordnung...................<br />
Ausnahmegenehmigung gem. § 68 LFBG………………………………………………………………….........................<br />
Überwachungsprogramme...................................................................................................................<br />
Nationaler Rückstandskontrollplan..............................................................................................................................<br />
Seehundmonitoring..................................................................................................................................................<br />
Lebensmittel..........................................................................................................................................<br />
Überwachungsprogramme……………………………………………………………………………………………………<br />
Milch- und Milcherzeugnisse......................................................................................................................................<br />
Eier und Eiprodukte....................................................................................................................................................<br />
Fleisch und Fleischerzeugnisse....................................................................................................................................<br />
Untersuchung auf Fremdwasser in Geflügel................................................................................................................<br />
Wurstwaren...............................................................................................................................................................<br />
Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus................................................................................................<br />
Öle, Fette...................................................................................................................................................................<br />
Suppen, Soßen, Mayonnaisen....................................................................................................................................<br />
Feinkostsalate, vorgefertigte Salatmischungen<br />
Getreide und Getreideerzeugnisse einschließlich Brot und Backwaren........................................................................<br />
Teigwaren..................................................................................................................................................................<br />
Frisches Obst, Gemüse und Kartoffeln........................................................................................................................<br />
Obsterzeugnisse, Konfitüren, Honig, süße Brotaufstriche............................................................................................<br />
Gemüse- und Kartoffelerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Frischpilze und Pilzerzeugnisse……………………………………...<br />
Nüsse, Ölsaaten, Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse..........................................................................<br />
Fruchtsäfte und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Getränkepulver............................................................................<br />
Wein und Erzeugnisse aus Wein einschließlich weinähnlicher Getränke......................................................................<br />
Bier............................................................................................................................................................................<br />
Spirituosen und alkoholhaltige Getränke....................................................................................................................<br />
Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse......................................................................................................................<br />
Pudding, Cremespeisen, süße Suppen und Saucen……..............................................................................................<br />
Süßwaren und Kaugummi, Zucker…….....................................................................................................................<br />
Kakao, Schokolade und –erzeugnisse........................................................................................................................<br />
Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeegetränke, Tee und Teeerzeugnisse..........................................................................<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung............................................................................................................................<br />
Nährstoffkonzentrate und Nahrungsergänzungsmittel................................................................................................<br />
Fertiggerichte, zubereitete Speisen.............................................................................................................................<br />
Gewürze und Würzmittel...........................................................................................................................................<br />
Essenzen, Aromastoffe...............................................................................................................................................<br />
6<br />
171<br />
171<br />
171<br />
171<br />
172<br />
172<br />
176<br />
178<br />
179<br />
181<br />
185<br />
186<br />
189<br />
189<br />
191<br />
197<br />
198<br />
201<br />
202<br />
209<br />
210<br />
214<br />
221<br />
228<br />
229<br />
233<br />
236<br />
238<br />
241<br />
242<br />
243<br />
245<br />
246<br />
249<br />
251<br />
254<br />
257<br />
262
Inhaltsverzeichnis<br />
4.16.30<br />
4.16.31<br />
4.17<br />
4.17.1<br />
4.17.2<br />
4.17.3<br />
4.17.4<br />
4.17.5<br />
4.17.6<br />
4.17.7<br />
4.17.8<br />
4.17.9<br />
4.17.10<br />
4.17.11<br />
4.18<br />
4.18.1<br />
4.18.2<br />
4.18.3<br />
4.18.4<br />
4.18.5<br />
4.19<br />
4.20<br />
Zusatzstoffe und Hilfsmittel aus Zusatzstoffen............................................................................................................<br />
Mineral- und Tafelwasser, Trinkwasser.......................................................................................................................<br />
Schwerpunktuntersuchungen bei Lebensmitteln.............................................................................<br />
Mikrobiologischer Status von Lebensmitteln...............................................................................................................<br />
Untersuchung von Lebensmitteln auf Bestandteile aus gentechnischen Veränderungen………...................................<br />
Tierartnachweis und Fremdeiweißbestimmung in Lebensmitteln.................................................................................<br />
Mykotoxine…………………………............................................................................................................................<br />
Pestizide und Nitrat….................................................................................................................................................<br />
Kontaminanten und unerwünschte Stoffe…………………………………………………………………………………..<br />
Schwermetalle............................................................................................................................................................<br />
Behandlung mit ionisierenden Strahlen.......................................................................................................................<br />
Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln auf Dioxine und dioxinähnliche PCB…….................................<br />
Umweltradioaktivität..................................................................................................................................................<br />
Authentizitätsanalyse.................................................................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände.............................................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt.............................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände mit Haut- und Schleimhautkontakt.............................................................................................<br />
Spielwaren und Scherzartikel......................................................................................................................................<br />
Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel sowie sonstige Haushaltschemikalien...............................................................<br />
Kosmetische Mittel.....................................................................................................................................................<br />
Betriebskontrollen.................................................................................................................................<br />
Fischereikundlicher Dienst (Aussenstelle des IfF Cuxhaven)……………………………………………<br />
5. Anhang....................................................................................................................................<br />
5.1 Verzeichnis der Mitwirkung in Gremien/Twinning-Projekte.............................................................<br />
5.2 Verzeichnis der wissenschaftlichen Vorträge und Veröffentlichungen............................................<br />
5.3 Verzeichnis der Ringversuche und Laborvergleichsuntersuchungen................................................<br />
5.4 Sachverständige....................................................................................................................................<br />
5.5 Forschungsaufgaben.............................................................................................................................<br />
6. Index........................................................................................................................................<br />
7. Fotoverzeichnis....................................................................................................................... 355<br />
7<br />
263<br />
263<br />
266<br />
266<br />
270<br />
272<br />
273<br />
276<br />
278<br />
279<br />
280<br />
280<br />
285<br />
291<br />
294<br />
294<br />
295<br />
296<br />
297<br />
298<br />
301<br />
301<br />
305<br />
305<br />
317<br />
334<br />
346<br />
347<br />
351
8<br />
1. Mehr Sicherheit für den Verbraucher *<br />
1.1 Aufgaben und Aufbau des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)<br />
Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(LAVES), mit zur Zeit ca. 800 Beschäftigten,<br />
ist die zentrale Behörde für alle Angelegenheiten des gesundheitlichen<br />
Verbraucherschutzes. Im LAVES werden alle amtlichen<br />
Untersuchungen im Bereich der Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-,<br />
Futtermittel- und Veterinärüberwachung durchgeführt.<br />
Mit der Umsetzung der Verwaltungsreform sind neue Aufgaben<br />
aus Lebensmittel- und Veterinärbereichen hinzugekommen: neben<br />
Teilaufgaben der Lebensmittelkontrolle auch die Tierarzneimittelüberwachung,<br />
die zuvor von den niedersächsischen Bezirksregierungen<br />
wahrgenommen wurde. In der Abteilung »Tiergesundheit«<br />
zählen Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung<br />
neben bereits bestehender Task-Force und Tierschutz zu<br />
den neuen Arbeitsgebieten der Dezernate, inklusive Seehundmonitoring.<br />
Die Futtermittelüberwachung deckt das LAVES seit<br />
seiner Gründung ab. Zusätzlich gehören jetzt aber auch die<br />
Marktüberwachung sowie die Kontrolle der Handelsklassen landesweit<br />
zum Aufgabenspektrum des Amtes. Die Arbeitsgebiete<br />
des Institutes für Fischkunde in Cuxhaven wurden durch die<br />
Integration der »Binnenfischerei – Fischkundlicher Dienst« um<br />
wichtige Elemente erweitert.<br />
Auch die Zahl der Institute, die zum LAVES zählen, ist seit der<br />
Gründung 2001 von ehemals sechs auf mittlerweile acht Institute<br />
angestiegen, die sich über <strong>Niedersachsen</strong> verteilen.<br />
2003 wurde für die Durchführung der Analysen in Stade ein<br />
Futtermittelinstitut eingerichtet. Zudem wurde ab 2004 das<br />
Institut für Bienenkunde in Celle in das LAVES integriert.<br />
Ergebnisse amtlicher Kontrollen und realisierter Analysen werden<br />
im LAVES zentral zusammengeführt und ausgewertet. Dies<br />
ermöglicht, frühzeitig Tendenzen im Hinblick auf eine mögliche<br />
Gefährdung des Verbrauchers durch belastete Lebens- und Futtermittel<br />
zu erkennen und notwendige Maßnahmen zu deren<br />
Minimierung zu ergreifen.<br />
Dr. Haunhorst, E. (Präsident)<br />
Angaben zur Personalstärke und zur Ausbildung im<br />
LAVES befinden sich ebenfalls in Kapitel 1.<br />
Im LAVES werden alle amtlichen Untersuchungen im Bereich<br />
der Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Futtermittel- und<br />
Veterinärüberwachung durchgeführt. Die LAVES-Zentrale mit Sitz in Oldenburg<br />
*Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird im folgenden<br />
Text nur die männliche Form verwendet. Dies schließt die weibliche<br />
Form mit ein.
Aufbau des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
Frauenbeauftragte<br />
LAVES-Zentrale<br />
Dr. Martina Mahnken<br />
Abteilung 1<br />
Zentrale Aufgaben<br />
Konrad Scholz<br />
11 Personal, Organisation,<br />
Haushalt, Liegenschaften,<br />
Innerer Dienst<br />
Anja Völker<br />
12 IuK-Technik, Betriebswirtschaftl.Steuerungsinstrumente,<br />
Datenmanagement<br />
Uwe Bollerslev<br />
13 Recht<br />
Franz-Christian Falck<br />
14 Fachbezogene Ausbildungs-<br />
und Prüfungsangelegenheiten<br />
Dr. Heini Treu<br />
15 Technische<br />
Sachverständige<br />
Rainer Thomes<br />
(m.d.W.d.G.b.)<br />
01 Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Hiltrud Schrandt<br />
QM Qualititätsmanagement<br />
Dr. Dorit Stehr<br />
Abteilung 2<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Dr. Reinhard Velleuer<br />
21 Lebensmittelüberwachung<br />
Dr. Uwe Jark<br />
22 Lebensmittelkontrolldienst<br />
Dr. Reinhard Velleuer<br />
23 Tierarzneimittelüberwachung,Rückstandskontrolldienst<br />
Dr. Elke Kleiminger<br />
Präsident<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Abteilung 3<br />
Tiergesundheit<br />
Dr. Ursula Gerdes<br />
31 Tierseuchenbekämpfung,<br />
Beseitigung tierischer<br />
Nebenprodukte<br />
Dr. Torsten Schumacher<br />
32 Task-Force<br />
Veterinärwesen<br />
Dr. Ursula Gerdes<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Vizepräsident<br />
Konrad Scholz<br />
33 Tierschutzdienst<br />
Dr. Sabine Petermann<br />
Beauftragte des ML<br />
für den Tierschutz<br />
Dr. Sabine Petermann<br />
Beauftragte des ML f. d.<br />
Qualitätsmanagement<br />
Dr. Dorit Stehr<br />
Abteilung 4<br />
Futtermittelsicherheit,<br />
Marktüberwachung<br />
Dr. Reinhold Schütte<br />
41 Futtermittelüberwachung<br />
Dr. Reinhold Schütte<br />
42 Ökologischer Landbau<br />
Diethelm Rohrdanz<br />
43 Marktüberwachung<br />
Dr. Bernhard Aue<br />
Beirat<br />
Abteilung 5<br />
Untersuchungseinrichtungen<br />
Dr. Michael Kühne<br />
51 Lebensmittelinstitut<br />
Oldenburg<br />
Dr. Ingeborg Block<br />
(m.d.W.d.G.b.)<br />
52 Lebensmittelinstitut<br />
Braunschweig<br />
Dr. Brigitte Thoms<br />
(zugleich Leiterin VI H)<br />
53 Veterinärinstitut<br />
Oldenburg<br />
Prof. Dr. Günter<br />
Thalmann<br />
54 Veterinärinstitut<br />
Hannover<br />
Dr. Brigitte Thoms<br />
(zugleich Leiterin LI BS)<br />
55 Institut für Fischkunde<br />
Cuxhaven<br />
Dr. Edda Bartelt<br />
56 Institut für Bedarfsgegenstände<br />
Lüneburg<br />
Dr. Astrid Rohrdanz<br />
57 Futtermittelinstitut<br />
Stade<br />
Dr. Gerhard Ady<br />
57 Institut für Bienenkunde<br />
Celle<br />
Dr. Werner von der Ohe<br />
9
10<br />
1.1.1 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verbraucherinformation, Fachinformation zur<br />
Ernährungsberatung<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 180-184<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 179<br />
E-Mail: pressestelle@laves.niedersachsen.de<br />
Auf Aufklärungsarbeit legt die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
besonderen Wert. Sachlich, verständlich, aktuell, dialogorientiert<br />
und schnell wird rund um die Themen gesundheitlicher<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informiert.<br />
Der Informationsfluss mit internen und externen Institutionen wird<br />
kontinuierlich gepflegt, Sympathie und Vertrauen in der Öffentlichkeit<br />
durch Transparenz und Service gewonnen und gehalten.<br />
Die Stabsstelle koordiniert und aktualisiert den Internet-Auftritt<br />
und betreut das Gesamtangebot des LAVES im WorldWideWeb.<br />
Aktuelle Themen werden umgehend und regelmäßig für das Internet<br />
aufbereitet. Außerdem haben Verbraucher die Möglichkeit,<br />
sich telefonisch, per E-Mail oder schriftlich beraten zu lassen.<br />
Vorträge über die Öffentlichkeitsarbeit des LAVES, beispielsweise<br />
in Schulen, sind zentrale Veranstaltungen für Multiplikatoren.<br />
Dazu gehört auch die Koordination und Organisation für die Teilnahme<br />
an Messen: Neben regionalen Veranstaltungen, wie dem<br />
jährlich von einer anderen Stadt ausgerichteten »Tag der <strong>Niedersachsen</strong>«,<br />
präsentiert sich das LAVES ebenso auf Messen wie der<br />
Internationalen Grünen Woche in Berlin.<br />
Die Stabsstelle ist bei der Planung und Durchführung von beispielsweise<br />
Symposien unterstützend tätig.<br />
Der Jahresbericht ist eine wichtige Informationsquelle für Experten<br />
und Verbraucher. Die Gesamtkoordination und -redaktion obliegt<br />
der Stabsstelle, ebenso die Aufbereitung für das Internet. Der<br />
jährliche Bericht des LAVES steht im Internet komplett zum Download<br />
zur Verfügung oder kann bestellt werden.<br />
Eigene Informationsbroschüren zu Themen aus unterschiedlichen<br />
Arbeitsbereichen des LAVES werden aufgelegt und stehen<br />
als Download im Internet zur Verfügung oder können bestellt<br />
werden.<br />
Die Mitarbeit in Gremien im Bereich der Ernährungswissenschaft<br />
gehört ebenfalls zu den vielfältigen Aufgaben der Stabsstelle.<br />
Um für den Krisenfall gewappnet zu sein, sind Kommunikationsschulungen<br />
für eine optimale Vorbereitung angeboten worden.<br />
Außerdem wird in Krisenzeiten in enger Zusammenarbeit mit<br />
dem entsprechenden Fachreferat eine Verbraucherhotline eingerichtet.<br />
Denn insbesondere Krisen wie MKS oder Geflügelpest<br />
können zu Verunsicherungen beim Verbraucher führen.<br />
Ein wichtiges Bindeglied in der Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeit<br />
sind die Medien: Die Vorbereitung von Pressegesprächen,<br />
Interviews und die Unterstützung der Journalistinnen und<br />
Journalisten bei der Informationsbeschaffung zur aktuellen Lage<br />
gehören zum Tagesgeschäft. Ebenso das Verfassen von Pressemeldungen,<br />
das Ausrichten von Pressekonferenzen und die Kontaktpflege<br />
zu allen Medien. Zur weiteren Unterstützung der Printmedien<br />
wird ein umfangreiches Bildarchiv gepflegt. Die Analyse<br />
und Bewertung von Medienbeiträgen gehören u. a. zu den täglichen<br />
Aufgaben der Pressestelle.<br />
Neben der Betreuung von Praktikanten werden auch Studenten<br />
im Praxissemester und/oder auf dem Weg zum Diplom im Bereich<br />
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von den Mitarbeitern intensiv<br />
begleitet und unterstützt.<br />
Die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LAVES ist<br />
mit Angestellten aus verschiedenen Fachrichtungen besetzt, in<br />
der Leitungsposition mit einer Politologin (M.A.) und Redakteurin.<br />
Drei weitere Stellen sind mit einer Politologin (M.A.) und Redakteurin,<br />
einer Diplom Oecotrophologin und einer Verwaltungsfachwirtin<br />
besetzt.<br />
Die Stabsstelle ist dem Präsidenten direkt unterstellt.<br />
Schrandt, H., M.A. (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
1.1.2 Stabsstelle Qualitätsmanagement<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Qualitätsmanagement<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (0 41 31) 15 - 11 00<br />
Telefax: (0 41 31) 15 - 11 28<br />
E-Mail: dorit.stehr@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Die Qualitätsmanagementbeauftragte des LAVES mit der Stabsstelle<br />
Qualitätsmanagement ist räumlich in Lüneburg angesiedelt.<br />
Von hier aus wird die Einführung eines einheitlichen, abteilungsübergreifenden<br />
Managementsystems mit dem Ziel einer Gesamtzertifizierung<br />
des LAVES nach EN ISO 9001:2000 koordiniert.<br />
Basis hierfür ist das in <strong>Niedersachsen</strong> von allen Behörden des<br />
gesundheitlichen Verbraucherschutzes gemeinsam entwickelte<br />
System EQUINO.<br />
Darüber hinaus fungieren Qualitätsmanagementassistenten als<br />
Ansprechpartner in den einzelnen Abteilungen des Hauses. Ihnen<br />
obliegt u. a. die Kommunikation des Systems in ihren Abteilungen.<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Präsidium, Stabsstelle QM und die ersten QM-Assistenten<br />
Die Einführung eines zertifizierungsfähigen Managementsystems<br />
im LAVES soll durch dokumentierte Verfahren zu mehr Transparenz<br />
im Verwaltungshandeln führen und den EU-Forderungen<br />
nach einheitlichen Kontrollen auf konstant hohem Niveau nachkommen.<br />
Die Umsetzung der ISO 9000 ff. schafft mit der Festlegung<br />
von Kennzahlen, die in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
einfließen, ferner ein effektives Steuerungsinstrument<br />
für noch mehr Kunden- und Produktorientierung im Hause.<br />
Auch diese Stabsstelle ist dem Präsidenten direkt unterstellt.<br />
Dr. Stehr, D. (QMB)<br />
11
12<br />
1.1.3 Abteilung 1: Zentrale Aufgaben<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Abteilung Zentrale Aufgaben<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 57 026 - 0<br />
Telefax: (04 41) 57 026 - 179<br />
E-Mail: poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Die Abteilung Zentrale Aufgaben umfasst fünf Dezernate:<br />
1.1.<strong>3.</strong>1 Dezernat 11: Personal, Organisation,<br />
Haushalt, Liegenschaften, Innerer Dienst<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Im Dezernat 11 – Personal, Organisation, Haushalt, Liegenschaften,<br />
Innerer Dienst – werden die klassischen Dienstleistungen der<br />
inneren Verwaltung erbracht:<br />
• Haushaltsplanung/Haushaltsbewirtschaftung, Volumen in 2006:<br />
47 Mio. €, davon rund 30 Mio. € für Personalausgaben, rund<br />
4,2 Mio. € für Investitionen (Geräteausstattung, technische<br />
Apparaturen überwiegend im Untersuchungsbereich)<br />
• Personal- und Stellenbewirtschaftung für ca. 870 Beschäftigte<br />
(Vollzeit, Teilzeit, Beurlaubte, inklusive ca. 40 Auszubildenden).<br />
Die Personalsachbearbeitung erfolgt überwiegend in Oldenburg,<br />
im Übrigen dezentral in den Untersuchungseinrichtungen<br />
• Organisation des inneren Dienstbetriebes<br />
In fünf Dezernate teilt sich die Abteilung 1 – Zentrale Aufgaben<br />
1.1.<strong>3.</strong>2 Dezernat 12: IuK-Technik, Betriebswirtschaftliche<br />
Steuerungsinstrumente,<br />
Datenmanagement<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Dezernat 12 – IuK-Technik, Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente,<br />
Datenmanagement – ist innerhalb des LAVES<br />
verantwortlich für die Bereitstellung einer funktionierenden und<br />
effektiven IuK-Infrastruktur, eines zuverlässigen Berichtswesens<br />
sowie für den Aufbau einer internen Kosten- und Leistungsrechnung<br />
für die Auswertung und Aufbereitung aller steuerungsrelevanten<br />
Informationen zur Unterstützung des gesundheitsbezogenen<br />
Verbraucherschutzes.<br />
Weitere Arbeitsschwerpunkte/Projekte:<br />
• Einführung eines einheitlichen Labor-, Informations- und Management-Systems<br />
(LIMS) für alle Institute des LAVES<br />
• Aufbau eines zentralen Landesservers mit den Daten/Informationen<br />
aller unmittelbaren und auch mittelbaren Landesbehörden<br />
(also auch der kommunalen Lebensmittel- und Veterinärüberwachungsbehörden)<br />
1.1.<strong>3.</strong>3 Dezernat 13: Recht<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Durch das Dezernat 13 – Recht – wird an zentraler Stelle für<br />
verschiedene Aufgabenbereiche des LAVES juristische Unterstützung<br />
geleistet, u. a. in:<br />
• Vertragsangelegenheiten<br />
• Verwaltungsstreitverfahren<br />
• arbeitsgerichtlichen Verfahren<br />
• Vergabeverfahren<br />
• Stellungnahmen zu Rechtsakten<br />
• rechtliche Einzelfallwürdigungen<br />
Daneben werden regelmäßig auch juristische Referendare und<br />
Praktikanten ausgebildet.
1.1.<strong>3.</strong>4 Dezernat 14: Fachbezogene Ausbildungsund<br />
Prüfungsangelegenheiten<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Im Dezernat 14 – Fachbezogene Ausbildungs- und Prüfungsangelegenheiten<br />
– werden folgende Ausbildungsbereiche, in denen<br />
sich das LAVES engagiert, betreut und organisiert:<br />
• Veterinärreferendare (Koordinierung der Ausbildung nach der<br />
Ausbildungs- u. Prüfungs-VO für die Laufbahn des höheren<br />
Veterinärdienstes des Landes <strong>Niedersachsen</strong>)<br />
• Lebensmittelchemiker (1. Staatsexamen im Fach Lebensmittelchemie)<br />
• Lebensmittelkontrolleure<br />
• Amtliche Fachassistenten für die Fleisch- und Geflügelfleischkontrolle<br />
• Futtermittelkontrolleure<br />
• Veterinärmedizinisch-technische Assistenten<br />
• Hufbeschlagswesen<br />
1.1.<strong>3.</strong>5 Dezernat 15: Technische Sachverständige<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Dezernat 15 – Technische Sachverständige – nimmt innerhalb<br />
der Abteilung eine Sonderstellung ein. Ingenieure mit<br />
technischer Qualifikation erbringen Dienstleistungen verschiedenster<br />
Art:<br />
• technische Abnahmen/Überprüfungen<br />
• Beratung und fachliche Unterstützung der zuständigen Überwachungsbehörden<br />
in Zusammenarbeit und im Aufgabenbereich<br />
der Fachabteilungen 2-4 des LAVES, sowohl im Bereich<br />
der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes wie auch<br />
in den Aufgabenfeldern der Lebensmittelüberwachung und<br />
der Futtermittelüberwachung<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Das LAVES betreut und organisiert Ausbildungsbereiche<br />
In Themenbereichen wie z. B. der Geflügelpest kommt der Arbeit<br />
der technischen Sachverständigen etwa unter dem Aspekt der<br />
tierschutzgerechten (auch Massen-) Tötung besondere Bedeutung<br />
zu; ein weiteres aktuelles Thema der Arbeit war und ist nach<br />
wie vor die Bewertung der technischen Anforderungen an Biogasanlagen,<br />
letztlich nicht nur vor dem Hintergrund der rechtlichen<br />
Anforderungen, sondern auch in Anbetracht möglicher<br />
Gefahrenabwehraspekte im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung.<br />
Scholz, K. (Vizepräsident)<br />
13
14<br />
1.1.4 Abteilung 2: Lebensmittelsicherheit<br />
1.1.4.1 Dezernat 21: Lebensmittelüberwachung<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Lebensmittelüberwachung<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (05 31) 68 04 - 307<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 107<br />
E-Mail: dezernat21@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
• Beratung der Landkreise und kreisfreien Städte in allen Fragen<br />
der Überwachung und des Verkehrs mit Lebensmitteln<br />
tierischer und nichttierischer Herkunft<br />
• Zulassung von Lebensmittelbetrieben tierischer Herkunft nach<br />
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sowie Anerkennung von<br />
Mineralwasserbrunnen<br />
• Kontaktstelle <strong>Niedersachsen</strong> für das EU-Schnellwarnsystem<br />
• Bearbeitung von Krisenfällen und Hilfe bei staatsanwaltlichen<br />
Ermittlungsverfahren<br />
Personalstärke: 21 Mitarbeiter an den vier Standorten Braunschweig,<br />
Hannover, Lüneburg und Oldenburg, davon fünf Veterinärmediziner,<br />
fünf Lebensmittelchemiker und elf Verwaltungsfachkräfte.<br />
Dr. Bisping, M. (Dez. 21)<br />
1.1.4.2 Dezernat 22: Lebensmittelkontrolldienst<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Lebensmittelüberwachung<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 150<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 107<br />
E-Mail: lebensmittelkontrolldienst@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
• Beratung der kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
in Fachfragen der Sicherheit tierischer<br />
und pflanzlicher Lebensmittel, Kosmetika, Tabakerzeugnisse<br />
und Bedarfsgegenstände<br />
• Entwicklung neuer Konzepte für die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung,<br />
z. B. Ausführungshinweise zur amtlichen<br />
Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle, risikoorientiertes<br />
Probenmanagement, etc.<br />
• Auswertung der Daten aus dem EU-Schnellwarnsystem<br />
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Gemeinsamen<br />
Verbraucherinformationssystems<br />
Personalstärke: Fünf Mitarbeiter am Standort Oldenburg, davon<br />
ein Veterinämediziner, ein Lebensmittelchemiker, zwei Lebensmitteltechnologen<br />
und eine Verwaltungsfachkraft.<br />
Dr. Velleuer, R. (Dez. 22)
1.1.4.3 Dezernat 23: Tierarzneimittelüberwachung<br />
und Rückstandskontrolldienst<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Tierarzneimittelüberwachung/Rückstandskontrolldienst<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 243<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 107<br />
E-Mail: dezernat23@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
• Überwachung der ca. 1.400 tierärztlichen Hausapotheken in<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
• ca. 400 Genehmigungen pro Jahr gemäß § 34 der Tierimpfstoff-Verordnung<br />
für Tierärzte<br />
• Anzeigen klinischer Prüfungen gemäß § 67 des Arzneimittelgesetzes<br />
(AMG) in Verbindung mit § 59 AMG<br />
• Anzeigen über das Verbringen von Tierarzneimitteln aus EU-<br />
Mitgliedsstaaten gemäß § 73 (3) AMG<br />
• Aufgaben aus dem Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet<br />
des Heilwesens – im Falle von Tierarzneimitteln<br />
• Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung des Nationalen<br />
Rückstandskontrollplanes<br />
• Planung spezieller Untersuchungsprogramme<br />
• Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung der Rückstandsüberwachung<br />
• Koordinierung von Maßnahmen in Krisenfällen<br />
• Stellungnahmen und Auswertungen im Bereich der Tierarzneimittel-<br />
und Rückstandsüberwachung<br />
Personalstärke: Elf Mitarbeiter an den drei Standorten Hannover,<br />
Lüneburg und Oldenburg, davon fünf Verwaltungsfachkräfte<br />
und sechs Veterinärmediziner, welche überwiegend in Teilzeit<br />
beschäftigt sind.<br />
Dr. Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1.1.5 Abteilung 3: Tiergesundheit<br />
1.1.5.1 Dezernat 31: Tierseuchenbekämpfung<br />
und Beseitigung tierischer Nebenprodukte<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Tierseuchenbekämpfung/Beseitigung tierischer<br />
Nebenprodukte<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 330<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 179, - 304<br />
E-Mail: dezernat31@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Dezernat 31 – Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung<br />
tierischer Nebenprodukte (Tierkörperbeseitigung) – ist 2005<br />
innerhalb des LAVES im Zusammenhang der Verwaltungsreform<br />
und Auflösung der vier Bezirksregierungen neu gebildet worden.<br />
Mitarbeiter der ehemaligen Bezirksregierungen zählen jetzt mit<br />
zum Dezernat 31 und sind an vier Standorten des LAVES tätig:<br />
in Oldenburg, Lüneburg, Hannover und Braunschweig.<br />
Dem Dezernat 31 sind durch die Neuregelung der Zuständigkeiten<br />
umfangreiche Aufgaben in der Beratung der kommunalen<br />
Veterinärbehörden übertragen worden. Die Erarbeitung von Berichten/Statistiken<br />
(für EU, Bund, Land) sowie Stellungnahmen<br />
im Bereich der Tierseuchenbekämpfung, zur Koordination von<br />
Maßnahmen bei der Feststellung von Tierseuchen (auch in Zusammenarbeit<br />
mit dem Dezernat 32) und zur Beseitigung von<br />
tierischen Nebenprodukten gehören ebenfalls zu den Aufgaben<br />
des Dezernates. Folgende <strong>Schwerpunkte</strong> sind zu benennen:<br />
• Mitwirkung und Beratung bei der Erfüllung von Aufgaben in<br />
der amtlichen Tierseuchenbekämpfung<br />
• Überwachung von überregionalen, nationalen und internationalen<br />
Ausstellungen und Märkten mit Tieren (in <strong>Niedersachsen</strong>)<br />
• Beratungen zur Ein-, Aus- und Durchfuhr (innergemeinschaftlicher<br />
Handel) sowie dem Import/Export von Tieren und tierischen<br />
Erzeugnissen<br />
15
16<br />
• Beratung zur Anwendung der europäischen Datenbank TRACES<br />
(Programm der EU für den Handel mit Tieren und tierischen<br />
Erzeugnissen), einschließlich Bearbeitung fehlerhafter TRACES-<br />
Meldungen<br />
• Zulassung von Besamungs- und Embryotransferstationen sowie<br />
Affenhaltungen für den innergemeinschaftlichen (europäischen)<br />
Handel<br />
• Erteilung von Erlaubnissen für das Arbeiten mit Tierseuchenerregern<br />
in Laboren<br />
• Zulassung und Überwachung von Beseitigungseinrichtungen<br />
nach VO (EG) 1774/2002 (Tierkörperbeseitigungsbetriebe)<br />
• Beratungen zu Fragen der Tierkörperbeseitigung gemäß Verordnung<br />
(EG) 1774/2002<br />
• Mitwirkung bei der Übertragung der Beseitigungspflicht tierischer<br />
Nebenprodukte und der Genehmigung von Entgeltlisten<br />
(Tierkörperbeseitigung; in Zusammenarbeit mit Dezernat 13)<br />
• Mitwirkung bei der fachlichen Ausbildung von Veterinärreferendaren<br />
und veterinärmedizinisch-technischen Assistenten<br />
(VMTA)<br />
• Zulassung von Aquakulturbetrieben als frei von Fischseuchen<br />
(in Zusammenarbeit mit Dezernat 32)<br />
Weitere <strong>Schwerpunkte</strong>:<br />
Schulung für Mitarbeiter von kommunalen Veterinärbehörden<br />
und Tierkörperbeseitigungsbetrieben zur zentralen nationalen<br />
Rinderdatenbank HI-Tier (Herkunftssicherungs- und Informationssystem<br />
für Tiere) sowie zur europäischen Datenbank TRACES<br />
(TRAde Control and Expert System).<br />
In Zusammenarbeit mit dem Dezernat 32 – Task-Force Veterinärwesen<br />
– werden Besprechungen mit den kommunalen niedersächsischen<br />
Landesbehörden durchgeführt.<br />
Goehl, R. (Dez. 31)<br />
Das Dezernat 31 – Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung<br />
tierischer Nebenprodukte – ist beteiligt wenn es darum geht,<br />
daß in Laboren mit Tierseuchenerregern gearbeitet wird<br />
1.1.5.2 Dezernat 32: Task-Force Veterinärwesen<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Task-Force Veterinärwesen<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 134<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 304<br />
E-Mail: task-force@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Die Task-Force Veterinärwesen wurde 2002 gegründet. Da<br />
Staatlicher Tierseuchenbekämpfungsdienst, Fischseuchenbekämpfungsdienst<br />
sowie Schädlingsbekämpfungsdienst in die<br />
Task-Force Veterinärwesen integriert wurden, bestehen innerhalb<br />
des Dezernates drei Fachbereiche:<br />
• Tierseuchenbekämpfung<br />
• Fischseuchenbekämpfung und<br />
• Schädlingsbekämpfung<br />
Laufende Aufgaben zur Tierseuchenbekämpfung<br />
Die Task-Force soll organisatorische Voraussetzungen für die<br />
Tierseuchenbekämpfung so treffen, dass im Ausbruchsfall eine<br />
effiziente Bekämpfung der Seuche möglich ist. Dies soll insbesondere<br />
durch folgende Maßnahmen erreicht werden:<br />
• Erstellung, EDV-mäßige Aufarbeitung sowie Weiterentwicklung<br />
des Niedersächsischen Tierseuchenbekämpfungshandbuchs<br />
• fachliche Unterstützung der kommunalen Veterinärbehörden<br />
bei der Planung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen<br />
• Planung von Personaleinsatz, Sachmitteleinsatz und Schätzung<br />
• Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen<br />
• Auswertung der Erfahrungen anderer deutscher Länder und<br />
EU-Mitgliedsstaaten bei der Tierseuchenbekämpfung<br />
• Organisation der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der<br />
Krisenzentren im Rahmen von Planübungen<br />
• sonstige Aufgaben im Zusammenhang mit der Tierseuchenvorbeugung<br />
und -bekämpfung nach Weisung des niedersächsischen<br />
Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz<br />
• Organisation von Monitoringprogrammen<br />
• operative Beratung im Hinblick auf Fischseuchen- und Tierseuchenbekämpfung
• Tierschutz bei Fischen und in der Aquakultur<br />
• Beratung der Gemeinden in dem Bereich der Schädlingsbekämpfung<br />
• Kontrolle der Effektivität von Schadnager- und Arthropodenbekämpfung,<br />
Schädlingsdiagnostik, Kontrolle von Rattenbekämpfungsmaßnahmen<br />
• Organisation des Seehundmonitorings<br />
• Bekämpfung von Tierseuchen bei jagdbarem Wild<br />
• Erarbeitung von Krisenplänen bei der Beseitigung verendeter<br />
Meeressäuger<br />
• Ausarbeitung eines Alarmplans zur Versorgung verölter Seevögel<br />
Aufgaben in Krisensituationen<br />
• Mitwirkung bei der Organisation der Bekämpfung auf Ortsebene<br />
im Krisenzentrum<br />
• Zusammenarbeit mit den Krisenzentren auf Landes- und Kreisebene<br />
und Kontaktaufnahme zu Polizei, Grenzschutz und<br />
Bundeswehr<br />
• Mitwirkung bei der Erstellung von Präsentationen bei Inspektionsbesuchen<br />
von EU-Dienststellen und für die Sitzungen<br />
des nationalen Krisenstabes sowie des Ständigen Veterinärausschusses<br />
der EU.<br />
Gerdes, U. (Abtlg.-Leiterin 3)<br />
Der Tierschutzdienst kümmert sich auch um die Durchführung<br />
und Umsetzung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei Zoound<br />
Zirkustieren<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1.1.5.3 Dezernat 33: Tierschutzdienst<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Tierschutzdienst<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 130<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 178<br />
E-Mail: dezernat33@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Der Tierschutzdienst berät und unterstützt insbesondere die Veterinärbehörden<br />
des Landes <strong>Niedersachsen</strong> bei der Durchführung<br />
und Umsetzung tierschutzrechtlicher Bestimmungen. Das Beratungsangebot<br />
umfasst dabei die gesamte Palette des amtstierärztlichen<br />
Dienstes: von der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung<br />
über die Haus- und Heimtiere bis hin zu Zoo- und Zirkustieren<br />
oder Tiertransporten und Schlachtung. Im Einzelnen:<br />
• Beratung der Veterinärbehörden in Tierschutzfragen, insbesondere<br />
bei problematischen Tierhaltungen Erarbeitung von<br />
Leitlinien für Tierhaltungen<br />
• Bearbeitung von Spezialproblemen in der Tierhaltung (u. a.<br />
Durchführung von Pilotprojekten und Felduntersuchungen)<br />
• Ausarbeitung von Vorschlägen für Förderprogramme tiergerechter<br />
Haltungssysteme in der Landwirtschaft<br />
• Erstellung gerichtsverwertbarer Gutachten zu tierschutzrelevanten<br />
Sachverhalten<br />
• gutachterliche Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben<br />
17
18<br />
• Mitarbeit in Arbeitsgruppen auf Landes- und auf Bundesebene<br />
(in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für<br />
den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)<br />
(ML)<br />
• Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen,<br />
u. a. des Niedersächsischen Tierschutzsymposiums in<br />
zweijährigem Rhythmus<br />
• Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen, einschließlich<br />
Erstellung von Informationsmaterial<br />
• Bearbeitung von Anfragen und Anregungen aus der Bevölkerung<br />
(in Abstimmung mit Nds. ML)<br />
• Teilnahme an Tierschutzbeiratssitzungen in beratender Funktion<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
• Aus- und Weiterbildung (Zulassung des TSD als Weiterbildungsstätte<br />
für die Weiterbildung zum Fachtierarzt für Tierschutzkunde,<br />
Mitwirkung bei der Ausbildung der Veterinärreferendare)<br />
• Sammlung und Bereitstellung von Fachliteratur und Informationsmaterial<br />
zu tierschutzrelevanten Sachverhalten<br />
• Führen einer Datenbank zu tierschutzrelevanten Gerichtsurteilen<br />
• Aufbau eines Fotoarchivs zur Tierhaltung<br />
Seit 2005 ist der Tierschutzdienst neben seiner beratenden Tätigkeit<br />
auch für Tierversuchsangelegenheiten, einschließlich der<br />
Erteilung von Genehmigungen dafür, zuständig:<br />
• Bearbeitung genehmigungspflichtiger Tierversuche<br />
• Bearbeitung anzeigepflichtiger Tierversuche und Vorhaben<br />
• Geschäftsführung der beratenden Ethikkommission nach § 15<br />
Abs. 1 Tierschutzgesetz einschließlich Bestellung neuer Mitglieder<br />
der Kommission<br />
• Entgegennahme der Anzeige der Bestellung von Tierschutzbeauftragten<br />
nach § 8 b Tierschutzgesetz<br />
• Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Abs. 1<br />
Satz 4 Tierschutzgesetz<br />
• Bearbeitung von Einfuhrgenehmigungen gemäß § 11 a Abs. 4<br />
Tierschutzgesetz<br />
• Einsichtnahme in Aufzeichnungen zu Tierversuchen gemäß<br />
§ 9 a Tierschutzgesetz<br />
• Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Berichte bezüglich<br />
Tierversuchen<br />
Die Aufgaben werden themenbezogen von den drei Standorten<br />
des Dezernats 33 in Braunschweig, Lüneburg und in Oldenburg<br />
bearbeitet.<br />
Dr. Petermann, S. (Dez.33)<br />
1.1.6 Abteilung 4: Futtermittelsicherheit,<br />
Marktüberwachung<br />
1.1.6.1 Dezernat 41: Futtermittelüberwachung<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Futtermittelüberwachung<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 110, - 115<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 139<br />
E-Mail: dezernat41@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Dezernat 41 – Futtermittelüberwachung – des LAVES ist für<br />
das Land <strong>Niedersachsen</strong> und für das Land Bremen auf allen Stufen<br />
der Produktion, Vermarktung und Verwendung von Futtermitteln<br />
zuständig. Durch Kontrolle und Vollzug trägt das Dezernat<br />
dazu bei, dass über sichere Futtermittel die Lebensmittel tierischer<br />
Herkunft in ihrer Qualität und Sicherheit einen hohen Standard<br />
haben.<br />
Auch der Schutz der Tiere vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
durch »nicht sichere« Futtermittel sowie der Schutz der<br />
Umwelt vor Stoffen, die über solche Futtermittel eingetragen<br />
werden könnten, ist wichtiger Teil der Überwachung. Vorrangiges
Ziel des Dezernates ist die Minimierung von Einträgen an unzulässigen<br />
und unerwünschten Stoffen, sowie die Kontrolle der Einhaltung<br />
von Verfütterungsverboten. Die Aufgaben im Einzelnen:<br />
• Zulassung und Registrierung von Futtermittelunternehmen auf<br />
allen Stufen gemäß EU-Vorschriften (Zusatzstoff- , Vormischungs-<br />
und Futtermittelhersteller, Händler, Spediteure und landwirtschaftliche<br />
Betriebe)<br />
• Vor-Ort-Kontrollen auf Einhaltung der futtermittelrechtlichen<br />
Vorgaben im Rahmen der genannten Zulassungen und Registrierungen<br />
• Importkontrollen von Drittlandeinfuhren über niedersächsische<br />
Einlassstellen<br />
• formale Überprüfung der Verkehrsfähigkeit von Futtermittelprodukten<br />
• Prüfung betrieblicher Unterlagen auf Einhaltung futtermittelrechtlicher<br />
Vorgaben, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes<br />
von Zusatzstoffen und die Einhaltung von festgelegten Grenzwerten<br />
• Kontrolle der Einhaltung von Kennzeichnungsvorschriften<br />
• Probenentnahmen und Erteilung der entsprechenden Untersuchungsaufträge<br />
mit Schwerpunkt auf verbotene, unerwünschte<br />
und nicht-zugelassene Stoffe<br />
• Bewertung der daraus resultierenden Analyseergebnisse<br />
• seit 2006: »Cross Compliance« – Kontrollen auf landwirtschaftlichen<br />
Betrieben<br />
• Durchführung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren aufgrund<br />
von festgestellten Verstößen<br />
• Stellungnahmen und fachliche Beratungen<br />
• statistische Erhebungen und Abfragen für Land, Bund und EU<br />
• Ausnahmegenehmigungen und Exportbescheinigungen<br />
• Umsetzung des EU-Schnellwarnsystems für Futtermittel<br />
• Verfügungen im Rahmen der Gefahrenabwehr, z. B. Verkehrsverbote,<br />
Reinigungsgebote, Entsorgungsverfügungen, Meldepflichten<br />
Im Dezernat Futtermittelüberwachung sind 12 Mitarbeiter im<br />
Außendienst und sechs Mitarbeiter im Innendienst tätig.<br />
Dr. Schütte, R.; Böming, J.; Kay, C. (Dez. 41)<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1.1.6.2 Dezernat 42: Ökologischer Landbau<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Ökologischer Landbau<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (0 41 31) 15 10 - 00, - 60, - 61<br />
Telefax: (0 41 31) 15 10 - 03<br />
E-Mail: dezernat42@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das LAVES ist in <strong>Niedersachsen</strong> seit 1. Juli 2002 zuständige Kontrollbehörde<br />
nach der Verordnung (EW G) Nr. 2092/91 des Rates<br />
über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung<br />
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel<br />
(EG-Öko-VO), mit geltenden Rechtsnormen der EU und dem<br />
Öko-Landbaugesetz (ÖLG).<br />
In diesem Rahmen nimmt das Dezernat 42 – Ökologischer Landbau<br />
– für die z. Zt. ca. 1.500 ökologisch wirtschaftenden Betriebe<br />
(Tendenz steigend) sowie 20 in <strong>Niedersachsen</strong> tätigen<br />
Kontrollstellen u. a. folgende Aufgaben wahr:<br />
• Überwachung der Tätigkeit privater Kontrollstellen hinsichtlich<br />
der Objektivität und der Wirksamkeit der Kontrollen<br />
• Erfassung der festgestellten Unregelmäßigkeiten und Verstöße<br />
und der durch Kontrollstellen verhängten Sanktionen, auch<br />
Entfernung des Hinweises auf den ökologischen Landbau<br />
19
20<br />
• Entgegennahme der Meldungen der Unternehmen und Überwachung<br />
der Einhaltung der Meldepflicht<br />
• Bearbeitung von Anträgen auf mögliche Genehmigungen nach<br />
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91<br />
• Bearbeitung von Anträgen zum Einsatz konventionellen Saatund<br />
Pflanzgutes zu Forschungszwecken und zur Saatguterhaltung<br />
• Beschluss über rückwirkende Anerkennung von Zeiträumen<br />
als Teil der Umstellungszeit oder über die Verlängerung der<br />
Umstellungszeit mit Zustimmung der Behörde, Zustimmung<br />
gegenüber der Kontrollstelle<br />
• Unterrichtung anderer Behörden über getroffene Entscheidungen<br />
und erteilte Genehmigungen und ggf. Unregelmäßigkeiten<br />
mit überregionaler Wirkung<br />
Nur wenn z. B. Tierhaltung und Futtermittel stimmen, darf bei<br />
Fleischerzeugnissen die Kennzeichnung »Bio« auf der Verpackung<br />
stehen<br />
• Beratung interessierter Personen und Unternehmen, die sich<br />
einem Kontrollverfahren unterstellen wollen<br />
• Rückverfolgung der Kontrolle der Fleischerzeugung vom Verkauf<br />
zum landwirtschaftlichen Erzeuger<br />
• Kontrollen der ordnungsgemäßen Kennzeichnung mit den<br />
Begriffen »Bio« und »Öko« sowie dem Vermerk über die im<br />
Kontrollverfahren festgestellte Konformität<br />
• ggf. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw.<br />
Abgabe von Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft<br />
Für das Dezernat sind zwei Mitarbeiter tätig.<br />
Rohrdanz, D.; Engelke, N. (Dez. 42)
1.1.6.3 Dezernat 43: Marktüberwachung<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Marktüberwachung<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 310, - 331<br />
Telefax: (0 41 31) 15 - 139<br />
E-Mail: dezernat43@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Überwachung von Qualitätsnormen und Handelsklassen:<br />
Das Dezernat 43 – Marktüberwachung – ist landesweit zuständig<br />
für die Überwachung der Einhaltung von EU-einheitlichen bzw.<br />
deutschen Qualitätsnormen, Güteeigenschaften und Handelsklassen<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse tierischer und pflanzlicher<br />
Herkunft.<br />
Die Prüfungstätigkeit des Dezernates gliedert sich dabei in folgende<br />
Fachbereiche:<br />
• Eier<br />
• Geflügelfleisch<br />
• Obst, Gemüse und Speisekartoffeln<br />
• Vieh und Fleisch<br />
Die Prüfungen erfolgen in Erzeugerbetrieben, Schlachtbetrieben,<br />
Sortier-, Pack- und Lagereinrichtungen, sowie im Großhandel und<br />
in den Verteilerzentren des Einzelhandels.<br />
Weitere Tätigkeitsschwerpunkte des Dezernates:<br />
• Legehennenbetriebsregistrierung<br />
• Zulassung besonderer Haltungsformen für Geflügelhalter<br />
• Zulassung von Eierpackstellen sowie die Eintragung von Eiersammelstellen<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
• Preisnotierung für Rindfleisch und Schweinehälften nach der<br />
4. DVO des Vieh- und Fleischgesetzes<br />
• Ausbildung, Bestellung und Vereidigung der Sachverständigen<br />
für die Einreihung von Schlachtkörpern in Handelsklassen sowie<br />
für deren Gewichtsfeststellung<br />
• Überwachung der Abrechnungen von Schlachtvieh<br />
• Kontrolle der Rindfleischetikettierung<br />
• Medienaufsicht gemäß Mediendienstestaatsvertrag bzw.<br />
Teledienste- und dem Pressegesetz<br />
In allen Tätigkeitsbereichen obliegt dem Dezernat Marktüberwachung<br />
auch die aufgrund der Prüftätigkeit erforderliche<br />
Durchführung von Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.<br />
Die genannten Aufgaben werden von insgesamt 24 Mitarbeitern<br />
erledigt, wobei neun im Innendienst und 15 im Außendienst<br />
tätig sind.<br />
Grauer, A. (Dez. 43)<br />
21
22<br />
1.1.7 Abteilung 5: Untersuchungseinrichtungen<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Abteilung 5<br />
Postfach 39 49, 26029 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 570 26 - 342<br />
Telefax: (04 41) 570 26 - 179<br />
E-Mail: lavesabteilung5@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Die acht Institute des LAVES in Oldenburg, Braunschweig, Hannover,<br />
Lüneburg, Stade, Cuxhaven und Celle decken mit Ihren<br />
umfassenden Untersuchungsleistungen alle Bereiche des vorbeugenden<br />
Verbraucherschutzes und der Überwachung von Tierkrankheiten<br />
ab. Damit ist das Land <strong>Niedersachsen</strong> in der Lage,<br />
alle amtlichen Proben auf höchstem qualitativem Niveau in<br />
staatlichen, akkreditierten Untersuchungseinrichtungen untersuchen<br />
zu lassen.<br />
Neben Untersuchungstätigkeiten wird von den Instituten eine<br />
Vielzahl weiterer Aufgaben wahrgenommen. Dazu gehören insbesondere<br />
die so genannte operative Beratung von Lebensmittelüberwachungsbehörden,<br />
die Erarbeitung von Stellungnahmen<br />
für Ministerien, umfangreiche Ausbildungstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit<br />
und die Mitarbeit in nationalen und internationalen<br />
Expertengremien.<br />
Die Institute leisten darüber hinaus durch eigene Forschungsund<br />
Entwicklungsarbeiten einen Beitrag zur kontinuierlichen<br />
Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Sicherung gesunder<br />
Tierbestände in <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Um diese Leistungen mit gleichbleibender Qualität erbringen zu<br />
können, werden jedes Jahr erhebliche Mittel in Ausbau und technische<br />
Ausrüstung der Labore investiert. Die Institute sehen sich<br />
einerseits einer Übertragung neuer zusätzlicher Aufgaben und<br />
andererseits signifikanten Änderungen der Personalausstattung<br />
gegenüber. Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Veränderungen<br />
sind die fachliche Qualifikation sowie das Engagement der Mitarbeiter<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Priv.-Doz. Dr. Kühne, M. (Abtlg.-Leiter 5)<br />
1.1.7.1 Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Dresdenstraße 2 und 6, 38124 Braunschweig<br />
Postfach 45 18, 38035 Braunschweig<br />
Telefon: (05 31) 68 04 - 100<br />
Telefax: (05 31) 68 04 - 101<br />
E-Mail: poststelle.li-bs@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Lebensmittelinstitut Braunschweig (LI BS) ist im Rahmen<br />
der amtlichen Lebensmittelüberwachung zuständig für die<br />
Untersuchung und Beurteilung von:<br />
• Milch, Milcherzeugnissen, Speiseeis (regional), Eiern, Fetten<br />
• Getreide und Getreideerzeugnissen, Backwaren, Teigwaren<br />
• Nahrungsergänzungsmitteln<br />
• Nährstoffkonzentraten, diätetischen Lebensmitteln, Fertiggerichten,<br />
Zusatzstoffen<br />
• Honig, süßen Brotaufstrichen<br />
• Säften, Nektaren, alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Bier<br />
• Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser<br />
Mitarbeiterinnen des Lebensmittelinstitutes Braunschweig (LI BS)<br />
beim Verkosten von Fritierfett aus Imbissbetrieben
• Wein, Erzeugnissen aus Wein, weinähnlichen Getränken,<br />
Spirituosen<br />
• Obsterzeugnissen, Konfitüren, Ölsamen, Schalenobst, Gewürzen,<br />
Würzmitteln, Aromen<br />
sowie für folgende Spezialuntersuchungen bzw. -aufgaben:<br />
• organische und anorganische Kontaminanten in Lebensmitteln<br />
• Mykotoxine in Lebensmitteln<br />
• mittels gentechnischer Verfahren hergestellte Lebensmittel<br />
• Proteindifferenzierung in Lebensmitteln<br />
• Weinkontrollen<br />
• Überwachung der Umweltradioaktivität, soweit diese nicht<br />
von den regional zuständigen Messstellen durchgeführt werden<br />
Auf Anforderung oder in Absprache mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
der Landkreise und der kreisfreien Städte<br />
nehmen Sachverständige des Institutes an Betriebsinspektionen<br />
teil.<br />
Das LI BS ist in eine Zentralgruppe und vier fachbezogene Abteilungen<br />
gegliedert. Der Zentralgruppe sind neben dem Verwaltungsund<br />
Büropersonal insbesondere auch die zentrale Datenverarbeitung,<br />
die Probenannahme und die Qualitätsmanagementgruppe<br />
zugeordnet, wobei hier für spezielle Aufgaben auf wissenschaftliches<br />
Personal zurückgegriffen wird.<br />
Die fachbezogenen Abteilungen nehmen Aufgaben folgender<br />
Bereiche wahr:<br />
• Abteilung 1: Lebensmittel tierischer Herkunft, Milch, Speiseeis,<br />
Fette, Mikrobiologie, biologische Testsysteme<br />
• Abteilung 2: Getreide, Erzeugnisse aus Getreide, Nährstoffkonzentrate,<br />
Gesamtkost, Honig, Ernährungsmedizin<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
• Abteilung 3: Getränke, Obsterzeugnisse, Gewürze, Aromen<br />
• Abteilung 4: Spurenanalytik, Radioaktivitätsuntersuchung,<br />
Lebensmittel aus gentechnischen Verfahren, Proteindifferenzierung<br />
Die einzelnen Abteilungen sind in jeweils drei Fachbereiche gegliedert,<br />
die aus mehreren Arbeitsgruppen bestehen. Die einzelnen<br />
Arbeitsgruppen werden jeweils von wissenschaftlichen Sachverständigen<br />
geleitet. Bereits auf Fachbereichsebene ist die interdisziplinäre<br />
wissenschaftliche Zusammenarbeit gewährleistet.<br />
Dr. Thoms, B. (LI BS/VI H)<br />
23
24<br />
1.1.7.2 Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
Martin-Niemöller-Straße 2, 26133 Oldenburg<br />
Postfach 24 62, 26014 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 99 85 - 0<br />
Telefax: (04 41) 99 85 - 121<br />
E-Mail: poststelle.li-ol@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Lebensmittelinstitut Oldenburg (LI OL) ist im Rahmen der<br />
amtlichen Lebensmittelüberwachung zuständig für die Untersuchung<br />
und Beurteilung von:<br />
• Fleisch, Fleischerzeugnissen, Wurstwaren<br />
• frischem Obst und Gemüse, Kartoffeln<br />
• Gemüse- und Kartoffelerzeugnissen, Salaten<br />
• Pilzen und Pilzerzeugnissen<br />
• Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
• Süßwaren, Süßspeisen, Zucker, Speiseeis (regional)<br />
sowie für folgende Spezialuntersuchungen:<br />
• Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln und Futtermitteln<br />
• Dioxine und coplanare PCB`s in Lebensmitteln, Futtermitteln<br />
und Bioindikatoren<br />
• Kontaminanten in Lebensmitteln<br />
Eine Vielfalt von Lebensmitteln wird täglich im Lebensmittelinstitut<br />
Oldenburg (LI OL) untersucht<br />
• Nachweis der Behandlung von Lebensmitteln mit ionisierenden<br />
Strahlen (Bestrahlung)<br />
• Authentizitäts- und Herkunftsnachweis von Lebensmitteln<br />
und Futtermitteln mit Hilfe der Isotopentechnik<br />
• mikrobiologische Untersuchungen der im Lebensmittelinstitut<br />
Oldenburg zu bearbeitenden Lebensmittel sowie sämtlicher<br />
Proben, die in Zusammenhang mit Erkrankungsfällen entnommen<br />
werden (regional)<br />
• Untersuchungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität<br />
von Humanmilch (landesweit) sowie von Lebensmitteln<br />
(regional)<br />
Auf Anforderung oder in Absprache mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
der Landkreise und der kreisfreien Städte<br />
nehmen Sachverständige des Institutes an Betriebsinspektionen<br />
teil.<br />
Das LI OL ist in eine Zentralgruppe und in vier Abteilungen untergliedert.<br />
Die Zentralgruppe umfasst die Verwaltung, Datenverarbeitung,<br />
Probenannahme und weitere zentrale Aufgabenbereiche.<br />
Den Abteilungen sind folgende Aufgabengebiete zugeordnet:<br />
• Abteilung 1: Fleisch, Fleischerzeugnisse, Wurstwaren, Mikrobiologie<br />
• Abteilung 2: Gemüse- und Kartoffelerzeugnisse, Pilze, Pilzerzeugnisse,<br />
Säuglingsnahrung<br />
• Abteilung 3: Süßwaren, Authentizitätsnachweis<br />
• Abteilung 4: Analytik von Rückständen und Kontaminanten,<br />
Lebensmittelbestrahlung, Radioaktivitätsuntersuchungen<br />
Im LI OL werden Auszubildende im Beruf »Chemielaborant«<br />
ausgebildet. Weiterhin ist das Institut an der Ausbildung von<br />
Lebensmittelchemikern, Tierärzten und Lebensmittelkontrolleuren<br />
beteiligt.<br />
Dr. Ende; M. (LI OL)
1.1.7.3 Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
Schleusenstraße 1, 27472 Cuxhaven<br />
Telefon: (0 47 21) 69 89 - 0<br />
Telefax: (0 47 21) 69 89 - 16<br />
E-mail: poststelle.ifF-cux@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Institut für Fischkunde (IfF CUX) ist schwerpunktmäßig ein<br />
speziell für Fische und Fischereierzeugnisse ausgerichtetes Untersuchungsinstitut<br />
mit Forschungsaufgaben. Durch den Staatsvertrag<br />
zwischen <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen sind die Aufgabenbereiche<br />
des IfF CUX sowie fischspezifische Teilbereiche des Lebensmitteluntersuchungsamtes<br />
Bremen (LUA Bremen), Außenstelle Bremerhaven<br />
und des Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienstes<br />
des Landes Bremen (LMTVet Bremen) zum »Fischkompetenzzentrum<br />
Nord« (FKN) zusammengefasst worden. In<br />
der Außenstelle Bremerhaven des LUA Bremen erfolgen die amtlichen<br />
bakteriologischen Untersuchungen von Fisch und Fischereierzeugnissen<br />
aus <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen.<br />
Innerhalb des FKN werden im IfF CUX die organoleptischen, chemisch-analytischen,<br />
virologisch-molekularen und parasitologischen<br />
Untersuchungen von Fisch und Fischereierzeugnissen aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
und Bremen durchgeführt. Das Institut ist für die amtliche<br />
Untersuchung von Muscheln im niedersächsischen Wattenmeer<br />
nach geltendem Hygienerecht zuständig. Zudem ist Forschungs-<br />
und Entwicklungsarbeit zu leisten, insbesondere auf<br />
dem Gebiet der Aquakulturen. Von der Außenstelle »Binnenfischerei«<br />
mit Sitz in Hannover werden landesweite Belange<br />
der Binnenfischerei und die Aufgaben des fischereikundlichen<br />
Dienstes wahrgenommen.<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Folgende Arbeitsschwerpunkte werden im IfF CUX bearbeitet:<br />
• chemische, organoleptische, parasitologische und virologische<br />
Beurteilung sowie allgemeinlebensmittelrechtliche Überprüfung<br />
von Fisch und Fischereierzeugnissen aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
und Bremen, einschließlich der in die EU eingeführten Fische<br />
und Fischereierzeugnisse durch die Grenzkontrollstellen <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
und Bremens<br />
• für die Überwachung der Umweltradioaktivität (Gamma- und<br />
Beta-Strahlen) in Fischereierzeugnissen landesweite und in Lebensmitteln<br />
allgemein (außer Rohmilch) regionale (ehem. Reg.-<br />
Bez. Lüneburg) Zuständigkeit (»Radiologische Messstelle«)<br />
• Monitoring der Muschel-Erntegebiete im Wattenmeer gemäß<br />
geltendem Hygienerecht<br />
• Untersuchung von Seefischen, Meeressäugern und Muscheln<br />
auf Krankheiten für das Land <strong>Niedersachsen</strong><br />
• Überwachung der niedersächsischen Aquakulturen im Rahmen<br />
des europaweiten Rückstandskontrollplanes<br />
• Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der<br />
Aquakulturen <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
• Tätigkeit als fischereikundlicher Dienst für die Binnengewässer<br />
in <strong>Niedersachsen</strong><br />
25
26<br />
• Mitwirkung als Experten bei der Hygieneüberwachung von<br />
EU-zugelassenen Fischverarbeitungsbetrieben, Verteilzentren,<br />
Fangfabrikschiffen sowie Aquakulturbetrieben in <strong>Niedersachsen</strong><br />
gemäß EU-Hygienerecht<br />
• Koordinierung von Arbeitsgruppen und Stellungnahmen des<br />
FKN<br />
Der im Institut gebündelte Sachverstand zu Fisch und Fischereierzeugnissen<br />
findet Eingang in Inspektionsreisen des Food and<br />
Veterinary Office (FVO), bei Twinning-Einsätzen, in teilweise federführend<br />
geleiteten landes- und bundesweiten Arbeitsgruppen,<br />
in die Beratung oberster Landesbehörden <strong>Niedersachsen</strong>s und<br />
Bremens im Zuge von Rechtssetzungs- und Strategieaufgaben<br />
sowie als Experten bei EU-Gesetzesvorhaben. Zur Entwicklung<br />
von neuen Untersuchungsmethoden auf chemisch-analytischem<br />
sowie bakteriologischem und virologischem Gebiet werden Doktoranden<br />
und Diplomanden eingesetzt.<br />
Das IfF CUX verfügt derzeit über 31 planmäßige Mitarbeiter<br />
(ohne Auszubildende) sowie drei Mitarbeiter aus Drittmitteln,<br />
wobei elf Mitarbeiter verkürzt arbeiten.<br />
Das Institut gliedert sich organisatorisch in eine Zentralgruppe<br />
und sechs Fachbereiche am Standort Cuxhaven sowie in eine in<br />
Hannover angesiedelte Abteilung »Binnenfischerei-Fischereikundlicher<br />
Dienst«.<br />
Seit 1977 werden im IfF CUX sechs bis acht Auszubildende zu<br />
Chemielaboranten ausgebildet. Weiterhin werden Fortbildungsseminare<br />
für in der tierärztlichen Lebensmittelüberwachung tätige<br />
Tierärzte aus der Bundesrepublik und Nachbarländern sowie für<br />
Lebensmittelkontrolleure aus dem Bundesgebiet durchgeführt.<br />
Dr. Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
Das Institut beteiligt sich am Monitoring der Muschelerntegebiete im<br />
niedersächsischen Wattenmeer
1.1.7.4 Veterinärinstitut Hannover<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Veterinärinstitut Hannover<br />
Eintrachtweg 17, 30173 Hannover<br />
Telefon: (05 11) 288 97 - 0<br />
Telefax: (05 11) 288 97 - 298<br />
E-mail: poststelle.vi-h@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Tiergesundheit und Verbraucherschutz<br />
• Diagnostik von Tierseuchenerregern und Erregern anderer<br />
übertragbarer Krankheiten bei Nutz- und Haustieren, Wild,<br />
Wirtschafts- und Wildgeflügel sowie Süßwasserfischen; <strong>Schwerpunkte</strong>:<br />
Nachweis von Zoonosen (vom Tier auf den Menschen<br />
übertragbare Krankheiten), Wildtierkrankheiten, Infektionserregern<br />
in Süßwasserfischen und Chlamydiendiagnostik<br />
• Tierschutz<br />
• mikrobiologische Untersuchungen zur betrieblichen Hygienekontrolle<br />
in Milch und Ei erzeugenden und verarbeitenden<br />
Betrieben; <strong>Schwerpunkte</strong>: Nachweis von Zoonoseerregern<br />
und anderen Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Verbraucher<br />
darstellen oder die Erzeugnisse nachteilig beeinflussen<br />
können, Mitarbeit im Kompetenzzentrum Hygieneberatung<br />
durch Betriebsinspektionen und Laboruntersuchungen<br />
• Analytik zum Nachweis verbotener oder nicht zugelassener<br />
Stoffe, zum vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Arzneimitteln<br />
sowie zur Belastung mit Kontaminationen aus der<br />
Umwelt an vom Tier stammenden Proben<br />
• Überwachung der Umweltradioaktivität in Lebensmitteln regional<br />
und in Rohmilch und Wildtieren landesweit<br />
• wissenschaftliche Projekte zur Verbreitung von Zoonoseerregern<br />
und Erregern von Tierkrankheiten, z. T. in Kooperation<br />
mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, dem Friedrich-<br />
Loeffler-Institut und anderen Forschungseinrichtungen<br />
Das Veterinärinstitut Hannover (VI H) ist zudem an der Aus- und<br />
Weiterbildung von Veterinärreferendaren, VMTA-Schülern, Studierenden<br />
der Veterinärmedizin und Anwärtern für den Lebensmittelkontrolldienst<br />
beteiligt. Es ist Ausbildungsbetrieb für den<br />
Beruf »Biologielaborant«.<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Das VI H ist in die Abteilungen »Verwaltung, Zentrale Dienste«,<br />
»Diagnostik, Tierkrankheiten, Tierseuchen«, »Veterinärhygiene,<br />
Rückstandsanalytik« und »Sondersachgebiete (Molekularbiologie<br />
und Radiologie)« mit jeweils entsprechenden Fachbereichen und<br />
Sachgebieten gegliedert.<br />
Priv.-Doz. Dr. Runge, M. (VI H)<br />
27
28<br />
1.1.7.5 Veterinärinstitut Oldenburg<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Veterinärinstitut Oldenburg<br />
Philosophenweg 38, 26121 Oldenburg<br />
Postfach 24 03, 26014 Oldenburg<br />
Telefon: (04 41) 97 13 - 0<br />
Telefax: (04 41) 97 13 - 814<br />
E-Mail: poststelle.vi-ol@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Veterinärinstitut Oldenburg (VI OL) erfüllt wichtige Aufgaben<br />
des Verbraucherschutzes und der Sicherung der Tiergesundheit<br />
in <strong>Niedersachsen</strong> und hier besonders in den viehdichten Gebieten<br />
im Norden des Landes zwischen niederländischer Grenze<br />
und Elbe.<br />
Als wissenschaftliche Untersuchungseinrichtung bearbeitet das<br />
VI OL schwerpunktmäßig folgende Aufgabenkomplexe:<br />
Untersuchungen gemäß Tierseuchengesetz sowie tierseuchenbehördlicher<br />
Verordnungen und Verfügungen einschließlich<br />
entsprechender Richtlinien der EU.<br />
Den Schwerpunkt bilden anzeigepflichtige Tierseuchen und Zoonosen.<br />
Besondere Erfahrungen und Zuständigkeiten liegen landesweit<br />
bei Viruserkrankungen des Geflügels, Paratuberkulose-<br />
Untersuchungen sowie TSE- und serologischen Untersuchungen<br />
vor. Modernste Untersuchungsmethoden einschließlich molekularbiologischer<br />
Verfahren und eine leistungsfähige Laborautomatisierung<br />
garantieren eine hochwertige Diagnostik und sichern<br />
die erwartete Leistungsfähigkeit in Gefahrensituationen.<br />
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Überwachungstätigkeit<br />
nach dem Tierschutzgesetz.<br />
Die landesweite Zuständigkeit für Hygieneuntersuchungen von<br />
Fleisch und Geflügelfleisch (Fleischkompetenz-Zentrum) baut auf<br />
jahrelangen Erfahrungen der Kontrolle betrieblicher Eigenkontrolle<br />
auf diesem Gebiet und von Exportuntersuchungen auf.<br />
Umfangreiche Diagnostikarbeit zum Nachweis von Zoonoseerregern<br />
und Durchführung von Monitoringprogrammen im Rahmen<br />
der Zoonosebekämpfung (Salmonellen und Campylobacter bei<br />
Geflügel, Salmonellen beim Schwein).<br />
Gemeinsam mit dem VI Hannover werden die landesweiten Aufgaben<br />
im Rahmen der Rückstandsuntersuchung entsprechend<br />
Nationalem Rückstandskontrollplan, Niedersächsischem Kälbermontoring,<br />
Norddeutscher Kooperation und Zusammenarbeit mit<br />
dem Land Bremen realisiert.<br />
Umfassende Mitarbeit bei der Bearbeitung von Tierseuchenbekämpfungsdokumenten<br />
des Landes und des Bundes.<br />
Die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften (Biologielaboranten,<br />
Medizinisch-Technischen Assistenten, Veterinärreferendaren usw.)<br />
gehören ebenfalls zu den ständigen Aufgaben des Institutes.<br />
Das VI OL ist in eine Abteilung »Organisation, Koordination, Verwaltung<br />
und Innere Dienste« (Abteilung 1), sowie in die zwei<br />
Fachabteilungen »Diagnostik Tierkrankheiten und -seuchen«<br />
(Abteilung 2) und »Veterinärhygiene und Rückstandsuntersuchungen«<br />
(Abteilung 3) gegliedert.<br />
Prof. Dr. Thalmann, G. (VI OL)<br />
Untersuchung von Proben im Labor des Veterinärinstitutes<br />
Oldenburg (VI OL)
1.1.7.6 Futtermittelinstitut Stade<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Futtermittelinstitut Stade<br />
Heckenweg 6, 21680 Stade<br />
Telefon: (0 41 41) 933 - 6<br />
Telefax: (0 41 41) 933 - 777<br />
E-Mail: poststelle.fi-stade@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Futtermittelinstitut Stade (FI STD) wurde am 2. Januar 2003<br />
gegründet. Es ist zuständig für die amtliche Untersuchung von<br />
Futtermittelproben, entnommen vom Futtermittelkontrolldienst,<br />
im Rahmen der amtlichen Futtermittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong><br />
und Bremen. An speziellen Futtermitteluntersuchungen<br />
sind mehrere Institute der Abteilung 5 des LAVES beteiligt.<br />
Weitere Aufgabengebiete sind der Nachweis von Tierseuchenerregern<br />
und Krankheitserregern, die zur Anzeige- und zur Meldepflicht<br />
gemäß Tierseuchenrecht führen, sowie die bakteriologische<br />
Fleischuntersuchung und der biologische Hemmstofftest,<br />
ferner die Auftauverlustbestimmung bei Gefrierhähnchen.<br />
Untersuchungsspektrum:<br />
Futtermittel:<br />
• Zusatzstoffe (u. a. Kokzidiostatika, Spurenelemente, Antioxidantien,<br />
Probiotika)<br />
• unerwünschte Stoffe (u. a. Mykotoxine, PCBs, CKWs,<br />
Schwermetalle, Dioxine, Mutterkorn)<br />
• unzulässige Stoffe (z. B. Zusatzstoffe, denen die Zulassung<br />
entzogen wurde, nicht zugelassene Pharmaka)<br />
• verbotene Stoffe (u. a. Teile von warmblütigen Landsäugetieren)<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
• wertgebende Bestandteile<br />
• mikrobiologische Belastung (Bakterien, Hefen,<br />
Schimmelpilze, Zoonosenerreger)<br />
• genveränderte Organismen<br />
Diagnostisches Material:<br />
• Sektionen<br />
• klassische bakterielle und virale Tierseuchenerreger<br />
• Zoonosenerreger<br />
• Parasiten<br />
• Mykobakterien (als Spezialaufgabe, landesweit)<br />
• Faulbruterreger (als Spezialaufgabe, landesweit)<br />
Schlachttierkörperproben:<br />
• bakteriologische Fleischuntersuchung (BU)<br />
• biologischer Hemmstofftest<br />
Gefrierhähnchen:<br />
• Fremdwasserbestimmung (Dripverlust)<br />
Das FI STD ist in eine Zentralgruppe und in zwei Abteilungen<br />
mit diversen Fachbereichen untergliedert. Die Abteilungen und<br />
Fachbereiche werden von z. T. hochspezialisierten wissenschaftlichen<br />
Sachverständigen geleitet, denen jeweils ein Team von<br />
spezifisch ausgebildeten und ständig geschulten Mitarbeitern<br />
zur Seite steht.<br />
Dr. Ady, G. (FI STD)<br />
29
30<br />
1.1.7.7 Institut für Bienenkunde Celle<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Institut für Bienenkunde Celle<br />
Herzogin-Eleonore-Allee 5, 29221 Celle<br />
Telefon: (0 51 41) 9 05 03 - 40<br />
Telefax: (0 51 41) 9 05 03 - 44<br />
E-Mail: poststelle.ib-ce@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Institut für Bienenkunde Celle (IB CE) wurde 1927 gegründet<br />
und untersteht seit 2004 dem Niedersächsischen Landesamt<br />
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES).<br />
Bienenzucht und praktische Imkerei werden durch die Arbeit des<br />
IB CE gefördert, um die flächendeckende Versorgung des Landes<br />
mit Bienenvölkern zu sichern. Aus ökologischer und ökonomischer<br />
Sicht ist die Bestäubung von Blütenpflanzen durch Honigbienen<br />
von großer Bedeutung für die Volkswirtschaft. Bienenhaltung<br />
dient dem Gemeinwohl.<br />
Das IB CE ist ein Kompetenzzentrum für alle Belange der Bienenhaltung<br />
sowie angrenzender Bereiche. Durch Fortbildungskurse,<br />
Beratung, Krankheitsdiagnostik, Forschung und Entwicklung sowie<br />
zahlreiche weitere Hilfen durch das IB CE wird erreicht, dass<br />
Imker die Bienenhaltung auch in Problemsituationen möglichst<br />
optimal und versiert durchführen können.<br />
Das Institut in Celle hat durch seine Tätigkeit über die Landesgrenzen<br />
hinaus bundesweite und internationale Anerkennung.<br />
Die Aufgaben des IB CE:<br />
• Bienenzuchtberatungsdienst<br />
• Fortbildungskurse für Freizeitimker<br />
• Ausbildung von Tierwirten, Fachrichtung Imkerei<br />
• Bundesweite Berufsfachschule für den Tierwirt Fachrichtung<br />
Imkerei sowie – in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong> – Durchführung von Gesellen- und Meisterprüfungen<br />
• Innovationen in den imkerlichen Verfahrensweisen und<br />
Techniken<br />
• Zucht: Bereitstellung von leistungsfähigen Königinnen<br />
• Untersuchung von Honig: Auftraggeber sind Imker, Imkerorganisationen<br />
aus dem In- und Ausland, sowie Händler und<br />
Abfüllbetriebe<br />
• Pollenanalyse: Bestimmung der botanischen und geographischen<br />
Herkunft von Honig sowie bei anderen Fragestellungen<br />
(Pflanzenschutzmittelprüfungen, Pollenproben, GVO-Monitoring,<br />
Untersuchungen im Rahmen der Luftreinhaltung sowie<br />
vegetationskundlicher Studien etc.)<br />
• Untersuchung und Bekämpfung von Bienenkrankheiten<br />
• Prüfung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährlichkeit<br />
• Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />
Weiterhin ist das Institut an der Ausbildung von Technischen<br />
Assistenten beteiligt und bietet für den Bereich Honig- und Pollenanalyse<br />
sowie für die Diagnose von Bienenkrankheiten Fortbildungen<br />
für Wissenschaftler, Veterinäre und Laborpersonal an.<br />
Dr. von der Ohe, W. (IB CE)
1.1.7.8 Institut für Bedarfsgegenstände<br />
Lüneburg<br />
Dienstanschrift:<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
- Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg<br />
Am Alten Eisenwerk 2A, 21339 Lüneburg<br />
Telefon: (0 41 31) 15 - 10 00<br />
Telefax: (0 41 31) 15 - 10 03<br />
E-mail: poststelle.ifb-lg@laves.niedersachsen.de<br />
Aufgaben und Organisation<br />
Das Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG) ist im<br />
Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung<br />
landesweit zuständig für die Untersuchung und<br />
Beurteilung von:<br />
• Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt<br />
• Bedarfsgegenständen mit Haut- und Schleimhautkontakt<br />
• Spielwaren und Scherzartikeln<br />
• kosmetischen Mitteln<br />
• Wasch-, Reinigungs- und Pflegemitteln<br />
• Raumluftverbesserern<br />
• Elementanalytik in Futtermitteln<br />
• Wasch- und Reinigungsmitteln nach dem Wasch- und<br />
Reinigungsmittelgesetz (WRMG)<br />
sowie für weitere Auftraggeber zuständig für die:<br />
• Untersuchung und Beurteilung von Bedarfsgegenständen und<br />
kosmetischen Mitteln für die zuständigen Behörden der Freien<br />
Hansestadt Bremen (Verwaltungsvereinbarung vom 15. August<br />
1996)<br />
• Untersuchungen im Rahmen des WRMG, Erstellung von Beurteilungen<br />
und Unterstützung der Ordnungsbehörden bei der<br />
Überwachungstätigkeit für das Land Schleswig-Holstein (Verwaltungsvereinbarung<br />
vom 1. August 1999)<br />
• bis 31. Januar 2007 Untersuchung und Beurteilung von Trinkund<br />
Badewässern (Erfüllung der Voraussetzung als Untersuchungsstelle<br />
nach § 15 Abs. 4 und als bestellte Stelle nach § 19<br />
Abs. 2 der Trinkwasserverordnung 2001 sowie Aufnahme in<br />
die Niedersächsische Landesliste)<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Auf Anforderung oder in Absprache mit den Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
der Landkreise und der kreisfreien Städte<br />
nehmen Sachverständige des Institutes an Betriebsinspektionen<br />
teil.<br />
Das IfB LG ist organisatorisch neben der Zentralgruppe in drei<br />
(ab 1. Februar 2007 in zwei) Fachbereiche untergliedert. Die Zentralgruppe<br />
umfasst die Verwaltung, Datenverarbeitung, Probenannahme,<br />
Ausbildung und weitere zentrale Aufgabenbereiche.<br />
Den Fachbereichen sind folgende Aufgabengebiete zugeordnet:<br />
Bis 31. Januar 2007<br />
• Fachbereich 51: Bedarfsgegenstände mit Lebensmittel-, Hautund<br />
Schleimhautkontakt, Spielwaren<br />
• Fachbereich 52: kosmetische Mittel, Wasch-, Reinigungs- und<br />
Pflegemittel, Raumluftverbesserer<br />
• Fachbereich 54: Mikrobiologie, Wasseruntersuchungen<br />
Ab 1. Februar 2007<br />
• Fachbereich 51: Bedarfsgegenstände mit Lebensmittel-, Hautund<br />
Schleimhautkontakt, Spielwaren, Mikrobiologie<br />
• Fachbereich 52: kosmetische Mittel, Wasch-, Reinigungs- und<br />
Pflegemittel, Raumluftverbesserer<br />
Im IfB LG werden Auszubildende für den Beruf Chemielaborant<br />
ausgebildet. Zusätzlich zu den Praktikanten der Lebensmittelchemie<br />
aus <strong>Niedersachsen</strong> wurden im Jahr 2006 19 Praktikanten<br />
aus Hamburg im IfB LG ausgebildet und legten die praktische<br />
Prüfung für diesen Ausbildungsabschnitt ab. Weiterhin ist das<br />
Institut an der Ausbildung von Lebensmittelkontrolleuren beteiligt.<br />
Dr. Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
31
32<br />
1.1.8 Personalstärke (Stand 31. Dezember 2006)<br />
Personal-Kopfzahlen,<br />
Stand 31. Dez. 2006<br />
(ohne Auszubildende pp.)<br />
Auszubildende, Referendare,<br />
Praktikanten Lebensmittelchemie<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Beschäftigungsumfang<br />
vollzeitbeschäftigt<br />
teilzeitbeschäftigt<br />
beurlaubt<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Qualifikationen<br />
Tierärzte, Lebensmittelchemiker<br />
und andere<br />
Universitätsabschlüsse<br />
Laboranten<br />
MTA, CTA, BTA, VMTA<br />
Laborhilfskräfte<br />
Ingenieure (FH), Fachrichtungen<br />
Agrar, Lebensmitteltechnologie,<br />
und andere<br />
Verwaltungskräfte<br />
Sonstige<br />
insgesamt<br />
812<br />
80<br />
481<br />
266<br />
65<br />
557<br />
255<br />
190<br />
91<br />
210<br />
55<br />
52<br />
145<br />
69<br />
Zentrale (Abteilungen<br />
1 bis 4 + Leitung)<br />
175<br />
22<br />
121<br />
33<br />
21<br />
94<br />
81<br />
52<br />
0<br />
0<br />
0<br />
43<br />
74<br />
6<br />
davon<br />
LI Oldenburg LI Braunschweig VI Oldenburg<br />
117<br />
11<br />
61<br />
48<br />
8<br />
94<br />
23<br />
32<br />
17<br />
42<br />
10<br />
0<br />
13<br />
3<br />
158<br />
16<br />
83<br />
62<br />
13<br />
120<br />
38<br />
38<br />
9<br />
69<br />
11<br />
5<br />
11<br />
15<br />
126<br />
8<br />
72<br />
47<br />
7<br />
89<br />
37<br />
18<br />
27<br />
35<br />
14<br />
2<br />
17<br />
13
Personal-Kopfzahlen,<br />
Stand 31. Dez. 2006<br />
(ohne Auszubildende pp.)<br />
Auszubildende, Referendare,<br />
Praktikanten Lebensmittelchemie<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Beschäftigungsumfang<br />
vollzeitbeschäftigt<br />
teilzeitbeschäftigt<br />
beurlaubt<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.), unterteilt nach<br />
Qualifikationen<br />
Tierärzte, Lebensmittelchemiker<br />
und andere<br />
Universitätsabschlüsse<br />
Laboranten<br />
MTA, CTA, BTA, VMTA<br />
Laborhilfskräfte<br />
Ingenieure (FH), Fachrichtungen<br />
Agrar, Lebensmitteltechnologie,<br />
und andere<br />
Verwaltungskräfte<br />
Sonstige<br />
VI Hannover<br />
59<br />
1<br />
45<br />
9<br />
5<br />
39<br />
20<br />
14<br />
8<br />
22<br />
2<br />
0<br />
9<br />
4<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
davon<br />
IfF Cuxhaven IfB Lüneburg FI Stade IB Celle<br />
36<br />
7<br />
28<br />
7<br />
1<br />
21<br />
15<br />
13<br />
4<br />
6<br />
3<br />
1<br />
5<br />
4<br />
53<br />
7<br />
28<br />
21<br />
4<br />
40<br />
13<br />
9<br />
18<br />
13<br />
3<br />
0<br />
7<br />
3<br />
64<br />
0<br />
29<br />
30<br />
5<br />
51<br />
13<br />
9<br />
8<br />
20<br />
11<br />
1<br />
4<br />
11<br />
24<br />
8<br />
14<br />
9<br />
1<br />
9<br />
15<br />
5<br />
0<br />
3<br />
1<br />
0<br />
5<br />
10<br />
33
34<br />
1.1.9 Ausbildung<br />
Bezeichnung der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
Berufliche Ausbildung im LAVES<br />
ChemielaborantIn<br />
BiologielaborantIn<br />
TierwirtIn, Fachbereich Bienenhaltung<br />
Praktika im Rahmen einer beruflichen Ausbildung<br />
LebensmittelkontrollassistentanwärterIn<br />
Medizinisch-technische AssistentIn<br />
Veterinärmedizinisch-technische<br />
AssistentIn<br />
FuttermittelkontrolleurIn<br />
GesundheitsaufseherIn<br />
HygienekontrolleurIn<br />
Anzahl der Auszubildenden/<br />
Praktikanten<br />
27<br />
9<br />
8<br />
12<br />
10<br />
4<br />
1<br />
2<br />
1<br />
Dauer der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
3,5 Jahre<br />
(kann auf 3 Jahre verkürzt werden)<br />
3,5 Jahre<br />
(kann auf 3 Jahre verkürzt werden)<br />
3 Jahre<br />
10 Wochen im Rahmen ihrer<br />
2-jährigen Ausbildung<br />
zwei, fünf oder sechs Wochen<br />
im Rahmen ihrer Ausbildung<br />
zwei Monate bzw. fünf Monate<br />
im Rahmen ihrer Ausbildung<br />
eine Woche im Rahmen ihrer<br />
Ausbildung<br />
zwei Wochen im Rahmen der<br />
Berufsausbildung<br />
eine Woche im Rahmen einer<br />
2-jährigen Ausbildung<br />
Voraussetzung für die<br />
Ausbildung/das Praktikum<br />
Realschulabschluss oder Abitur<br />
Realschulabschluss oder Abitur<br />
Hauptschulabschluss<br />
Begonnene Ausbildung zum<br />
Lebensmittelkontrolleur<br />
Realschulabschluss, erweiterter<br />
Hauptschulabschluss, abgeschlossene<br />
Berufsausbildung nach Hauptschulabschluss<br />
Realschulabschluss, erweiterter<br />
Hauptschulabschluss, abgeschlossene<br />
Berufsausbildung nach Hauptschulabschluss<br />
FuttermittelkontrolleurIn mit abgeschlossener<br />
Berufsausbildung<br />
Begonnene Ausbildung zur/zum<br />
GesundheitsaufseherIn<br />
Realschulabschluss
Bezeichnung der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
Ausbildungen/Pflichtpraktika (die insgesamt im LAVES absolviert werden) im Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium<br />
VeterinärreferendarIn<br />
LebensmittelchemikerIn<br />
Praktika im Rahmen eines Hochschulstudiums<br />
Studierende der Veterinärmedizin<br />
Studierende u. Referendare der<br />
Rechtswissenschaften sowie<br />
Studierende der Fachhochschulstudiengänge<br />
»Verwaltung«<br />
Sonstige Ausbildungen/Praktika<br />
Ausbildung/Betreuung im Rahmen<br />
einer Promotion<br />
DoktorandIn<br />
Schulpraktika<br />
SchülerInnen<br />
Sonstige Praktika<br />
Anzahl der Auszubildenden/<br />
Praktikanten<br />
11<br />
30<br />
27<br />
5<br />
3<br />
48<br />
20<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
1. Aufgaben und Aufbau des LAVES<br />
Dauer der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
durchschnittlich jeweils sieben<br />
Monate im Rahmen ihrer Ausbildung<br />
1 Jahr nach Abschluss des<br />
Hochschulstudiums<br />
2 Wochen im Rahmen ihrer<br />
Ausbildung<br />
mehrere Wochen im Rahmen des<br />
Studiums oder eines anschließenden<br />
Referendariats<br />
bis zur Promotion<br />
2-3 Wochen im Rahmen der<br />
Schulausbildung<br />
Voraussetzung für die<br />
Ausbildung/das Praktikum<br />
Anforderung gemäß Ausbildungsund<br />
Prüfungsverordnung für die<br />
Laufbahn des höheren Veterinärdienstes<br />
des Landes <strong>Niedersachsen</strong><br />
1. Staatsexamen im Fach<br />
Lebensmittelchemie<br />
Studium der Tiermedizin nach<br />
Abschluss des 9. Fachsemesters<br />
gemäß Approbationsordnung<br />
für Tierärzte<br />
abgeschlossenes Studium der<br />
Tiermedizin<br />
Schüler an Allgemeinbildenden<br />
Schulen, Berufsschulen, Techniker-,<br />
Chemieschulen sowie sonstige<br />
Fachschulen<br />
u.a. Studierende der Oecotrophologie,<br />
berufliche Wiedereingliederung,<br />
fachliche Weiterbildung<br />
35
36<br />
2. Amtliche Kontrollen in <strong>Niedersachsen</strong><br />
In Deutschland fällt die Lebensmittel- und Veterinärüberwachung<br />
in die Zuständigkeit der 16 Bundesländer. In <strong>Niedersachsen</strong> gibt<br />
es derzeit 43 kommunale Ämter für Veterinärwesen, Verbraucherschutz<br />
und Lebensmittelüberwachung. Sie überprüfen die an der<br />
Lebensmittelproduktion und am Handel beteiligten Betriebe vor<br />
Ort, dokumentieren Ergebnisse und entnehmen Proben. Bei festgestellten<br />
Mängeln werden von den kommunalen Überwachungsbehörden<br />
entsprechende Maßnahmen ergriffen und ggf.<br />
Sanktionen ausgesprochen.<br />
Den kommunalen Überwachungsbehörden steht das Niedersächsische<br />
Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(LAVES) beratend und koordinierend zur Verfügung. Bestimmte<br />
Kontrollaufgaben, insbesondere die der amtlichen Futtermittelüberwachung<br />
und der Marktüberwachung, werden zentral von<br />
Fachdezernaten des LAVES durchgeführt. Darüber hinaus beraten<br />
die Dezernate des LAVES die kommunalen Veterinär- und Lebens-<br />
Abbildung 2.1: Organisation der amtlichen Lebensmittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Untersuchungsergebnisse<br />
Berichte<br />
Konzepte<br />
ML<br />
LAVES<br />
43 Veterinärämter<br />
Maßnahmen Proben<br />
mittelüberwachungsbehörden in fachlicher Hinsicht. In den verschiedenen<br />
Instituten des LAVES werden amtliche Proben untersucht,<br />
Risikobewertungen vorgenommen, Verbraucherschutzaufgaben<br />
koordiniert und in bestimmten Bereichen Vollzugsaufgaben<br />
wahrgenommen. In Krisenfällen übernimmt das LAVES wesentliche<br />
Aufgaben des Risikomanagements.<br />
Das LAVES untersteht unmittelbar dem niedersächsischen Ministerium<br />
für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz (ML). Neben der Fachaufsicht über das LAVES<br />
und über die kommunalen Überwachungsbehörden, sowie die<br />
Vertretung <strong>Niedersachsen</strong>s im Bund, erfolgt hier die Festlegung<br />
verbraucherschutzpolitischer Grundsätze und die Steuerung der<br />
Aufgaben der Lebensmittel- und Veterinärüberwachung.<br />
Fach- und<br />
Dienstaufsicht<br />
Proben Beratung<br />
Koordination<br />
Tiere/Lebens- + Futtermittel/Bedarfsgegenstände/Betriebe<br />
Kontrollen
2.1 Futtermittelüberwachung<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> als dem bedeutendsten Futtermittelstandort<br />
Deutschlands (der Anteil an der gesamten Mischfutterproduktion<br />
liegt bei 40 %) ist die Futtermittelkontrolle besonders wichtig.<br />
Sie wird innerhalb des LAVES durch das Dezernat 41 – Futtermittelüberwachung<br />
– realisiert und ist dort bereits seit 2002 mit<br />
Kontrollen und Vollzug zentral angesiedelt. Dadurch ergeben<br />
sich kurze Wege und im Bedarfsfall schnelle, unmittelbare Zugriffsmöglichkeiten.<br />
Eine Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Überwachungsbehörden gibt es in Einzelfällen (gegenseitige<br />
Amtshilfe) oder bei sich überschneidenden Prüfungsanlässen, z. B.<br />
in Betrieben, die futtermittelrechtlicher, aber auch veterinärrechtlicher<br />
Kontrolle unterliegen. Die Kontrollen des Dezernates Futtermittelüberwachung<br />
– Betriebsinspektionen, Zulassungs- und Registrierungsprüfungen,<br />
Buchprüfungen und Probenahmen – finden<br />
auf allen Stufen der Produktion, der Vermarktung und der<br />
Verwendung von Futtermitteln, Vormischungen und Zusatzstoffen<br />
einschließlich der Landwirtschaft statt.<br />
Bis zum Jahre 2005 unterlagen ca. <strong>3.</strong>000 Betriebe der Futtermittelüberwachung.<br />
Aufgrund der 2005 in Kraft getretenen<br />
»Futtermittelhygieneverordnung« mit einer neuen Meldepflicht<br />
u. a. für Primärproduzenten hat sich diese Zahl bis Ende 2006<br />
auf ca. 45.000 Betriebe erhöht.<br />
Art und Umfang der durchgeführten Kontrollen basieren zum<br />
einen auf den Vorgaben des »Nationalen Kontrollprogramms<br />
Futtermittelsicherheit«, insbesondere jedoch aus den Ergebnissen<br />
der in <strong>Niedersachsen</strong> für die hiesigen Futtermittelhersteller<br />
seit 2003 durchgeführten »Risikoanalyse« der Betriebe.<br />
Die vom Dezernat Futtermittelüberwachung entnommenen Proben<br />
werden im Futtermittelinstitut Stade (FI STD) des LAVES analysiert.<br />
Durch die direkte Kommunikation ist ein rascher Austausch<br />
der Informationen gewährleistet.<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
Eine enge Zusammenarbeit des Dezernates findet innerhalb des<br />
LAVES besonders mit den anderen Dezernaten der Abteilung 4<br />
(Dezernat 42 – Ökologischer Landbau sowie Dezernat 43 –<br />
Marktüberwachung) statt, aber auch z. B. mit dem Dezernat<br />
23 – Tierarzneimittel/Rückstandkontrolldienst.<br />
Das Dezernat Ökologischer Landbau führt in eigener Zuständigkeit<br />
– spezialisiert auf ökologisch wirtschaftende Betriebe – Kontrollen<br />
in Futtermittelunternehmen durch.<br />
Das FI STD untersucht vorwiegend amtliche Futtermittelproben,<br />
die von den Prüfern des Dezernates Futtermittelüberwachung<br />
anlässlich von Betriebskontrollen entnommen werden. Daneben<br />
werden auch Proben untersucht, bei denen der Verdacht auf<br />
Übertragung von Zoonoseerregern durch Futtermittel auf Nutztiere<br />
und/oder Haustiere besteht. In diesen Fällen sind auch die<br />
Veterinärämter der Landkreise und die praktizierenden Tierärzte<br />
beteiligt.<br />
Ferner werden Tierkörpermehlproben aus Tierkörperbeseitigungsanstalten<br />
zur Untersuchung auf tierpathogene Erreger eingesandt.<br />
In einer weiteren Zusammenarbeit mit Veterinärämtern und<br />
technischen Sachverständigen des LAVES untersucht das FI STD<br />
auch Speiseabfälle, die zu Futterzwecken bestimmt sind, auf<br />
mögliche tier- und/oder menschenpathogene Bakterien.<br />
Dr. Schütte, R.; Kay, C.; Böming, J. (Dez. 41); Schlägel, E. (FI STD)<br />
37
38<br />
2.2 Marktüberwachung<br />
Für landwirtschaftliche Erzeugnisse tierischer und pflanzlicher<br />
Herkunft wurden EU-einheitliche, bzw. deutsche Qualitätsnormen,<br />
Güteeigenschaften und Handelsklassen geschaffen, um<br />
durch diese einheitlichen Qualitätskriterien den gemeinschaftlichen<br />
Handel zu erleichtern und um für den Verbraucher ein<br />
Angebot von gleich bleibend hoher Qualität zu sichern.<br />
Das Dezernat 43 – Marktüberwachung – stellt durch Kontrollen<br />
auf den Vermarktungsstufen vor dem Einzelhandel sicher, dass<br />
die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden und damit eine<br />
Vergleichbarkeit gegeben ist.<br />
Daneben gibt es weitere, für den Verbraucher bedeutende Aufgaben,<br />
so z. B. die Haltungsformen von Legehennen oder die<br />
Herkunftsangaben bei Lebensmitteln. Durch Maßnahmen, wie<br />
beispielsweise Registrierung und Zulassung von Betrieben sowie<br />
durch regelmäßige Kontrollen sichert das Dezernat Marktüberwachung<br />
die Zuverlässigkeit der jeweiligen Angaben.<br />
Ein weiteres Instrument zur Verbesserung der Markttransparenz<br />
stellt die amtliche Preisnotierung für Rindfleisch und Schweinehälften<br />
nach 4. DVO des Vieh- und Fleischgesetzes dar, der Einsatz<br />
von öffentlich bestellten Sachverständigen für die Gewichtsfeststellung<br />
und die Einreihung von Schlachtkörpern in Handelsklassen<br />
sowie die Vorgaben zur Abrechnungen von Schlachtvieh.<br />
Diese Maßnahmen betreffen allerdings die dem Einzelhandel<br />
vorgelagerten Vermarktungsstufen.<br />
Im Dezernat Marktüberwachung wird auch die Medienaufsicht<br />
gemäß Mediendienststaatsvertrag bzw. Teledienste- und Pressegesetz<br />
wahrgenommen. Die Medienaufsicht überwacht die Angebote<br />
im Internet hinsichtlich der korrekten Anbieterkennzeichnung<br />
(Webimpressum) bzw. des Impressums bei Angeboten nach<br />
dem Teledienstgesetz und bei Druckwerken. Bei Beanstandungen<br />
obliegt dem Dezernat 43 in allen Tätigkeitsbereichen die erforderliche<br />
Durchführung von Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.<br />
Im Bereich der Rindfleischetikettierung ist die Marktüberwachung<br />
einerseits selbst für Kontrollen zuständig, koordiniert aber<br />
auch die Überwachung auf der Einzelhandelsstufe durch die Behörden<br />
der Landkreise und kreisfreien Städte mittels Erstellung<br />
einer Risikoanalyse.<br />
Auch im Bereich Obst und Gemüse findet ein reger Austausch<br />
mit den Kommunalbehörden statt. Im Jahre 2006 führte das<br />
LAVES für die Kommunen fünf zweitägige Schulungen durch,<br />
die auch 2007 fortgeführt werden.<br />
Die Zusammenarbeit mit den Überwachungsbehörden auf Kommunalebene<br />
ist aber auch in allen anderen Fachbereichen gegeben<br />
– und das Dezernat steht bei Anfragen zur Verfügung.<br />
Grauer, A. (Dez. 43)<br />
In der Tierseuchenbekämpfung und im Tierschutz spielen amtliche<br />
Kontrollen, z. B. die der Tierhaltung, eine große Rolle<br />
2.3 Tiergesundheit<br />
Amtliche Kontrollen spielen in der Tierseuchenbekämpfung und<br />
im Tierschutz eine große Rolle. In <strong>Niedersachsen</strong> werden diese<br />
Kontrollen in der Regel von den Veterinärbehörden der Landkreise,<br />
der kreisfreien Städte sowie von der Region Hannover durchgeführt.<br />
Für die Kontrolle, Zulassung oder Genehmigung von Betrieben<br />
oder Tätigkeiten von übergeordneter Bedeutung, bzw.<br />
für die Spezialwissen erforderlich ist, ist das LAVES zuständig.<br />
So werden z. B. die Zulassungen und die Überwachung von Betrieben,<br />
die tierische Nebenprodukte verarbeiten, oder von Besamungsstationen<br />
durch das Dezernat 31 – Tierseuchenbekämpfung,<br />
Beseitigung tierischer Nebenprodukte – durchgeführt, während<br />
das Tierschutzdezernat u. a. die Anträge auf Genehmigung<br />
von Tierversuchen bearbeitet.
Die Untersuchungen auf Tierseuchenerreger werden in den Veterinärinstituten<br />
Hannover und Oldenburg, im Institut für Bienenkunde<br />
Celle sowie im Futtermittelinstitut in Stade des LAVES<br />
durchgeführt.<br />
Hier werden u. a. Blut- und Milchproben oder gestorbene Tiere<br />
auf Viren und Bakterien untersucht, die Tierseuchen auslösen<br />
können. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage für die<br />
seuchenrechtliche Einstufung einer Tierhaltung und letztlich des<br />
gesamten Landes <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Die Veterinärinstitute sind zudem bei Untersuchungen mit tierschutzrechtlichen<br />
Fragestellungen tätig.<br />
Darüber hinaus fällt dem LAVES im Bereich »amtliche Kontrolle<br />
Tiere« eine wichtige Koordinierungsfunktion zu. So werden<br />
gemeinsam mit Tierschutzorganisationen und Tierhaltern Leitlinien<br />
und Empfehlungen für das Halten von landwirtschaftlich<br />
Abbildung 2.<strong>3.</strong>1: Koordinierungsfunktion des LAVES im Bereich Tiergesundheit<br />
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum,<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Kommunale Veterinärbehörden,<br />
Gemeinden<br />
LAVES<br />
Abteilung 3/Tiergesundheit<br />
Veterinärinstitute<br />
Institut für Bienenkunde<br />
Verarbeitungsbetriebe<br />
Besamungsstationen<br />
Labore<br />
Tierversuchseinrichtungen<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
genutzten Tieren erarbeitet, Fortbildungsveranstaltungen zu<br />
speziellen Fragestellungen des Tierschutzes oder der Tier- und<br />
Fischseuchenbekämpfung sowie der Schädlingsbekämpfung<br />
insbesondere für die kommunalen Veterinärbehörden organisiert.<br />
Außerdem werden Pläne zur Bewältigung von Tierseuchenkrisenfällen<br />
oder für den Umgang mit verölten Seevögeln erarbeitet<br />
und kommuniziert.<br />
Für die kommunalen Veterinärbehörden im Lande <strong>Niedersachsen</strong><br />
sind die Abteilung 3 – Tiergesundheit – sowie die Institute wichtige<br />
Ansprechpartner in Fragen der Umsetzung des Tierschutzes,<br />
der Tierseuchenbekämpfung, der Fischseuchenbekämpfung und<br />
der Schädlingsbekämpfung. Die vielfältigen Aufgaben dieser Bereiche<br />
erfordern Spezialisten, die sich bestimmter Fragestellungen<br />
annehmen und Auskunft geben können.<br />
Dr. Gerdes, U. (Abtlg.-Leiterin 3)<br />
Polizei, Staatsanwaltschaften<br />
Bundesländer<br />
BMELV<br />
Landvolkverband<br />
Tierseuchenkasse<br />
Hoch- und Fachhochschulen<br />
Landwirtschaftskammer<br />
Tierschutzorganisationen<br />
Politische Parteien<br />
Naturschutzbehörden<br />
Katastrophenschutzbehörden<br />
Tierärztekammer, Schädlingsbekämpfer<br />
39
40<br />
2.<strong>3.</strong>1 Tierarzneimittel<br />
Tierarzneimittel werden vom Bundesamt für Verbraucherschutz<br />
und Lebensmittelsicherheit in Berlin speziell für die Anwendung<br />
am Tier zugelassen. Für Tierarzneimittel, die bei Tieren eingesetzt<br />
werden sollen, die der Lebensmittelgewinnung dienen, werden<br />
Wartezeiten festgesetzt. Diese sollen gewährleisten, dass der Verbraucher<br />
nicht durch Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln<br />
gefährdet wird.<br />
Die Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln erfolgt<br />
durch die Bundesländer gemäß einem bundesweit einheitlichen<br />
Qualitätssystem.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> ist die Arzneimittelüberwachung bei drei Behörden<br />
angesiedelt: Die Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken<br />
erfolgt durch das Dezernat 23 des LAVES. Das Dezernat<br />
arbeitet dazu intensiv mit den kommunalen Veterinärbehörden<br />
zusammen, die für die Überwachung der Tierarzneimittelanwendung<br />
in den landwirtschaftlichen Betrieben zuständig sind.<br />
Ebenso bestehen enge Kontakte zu den staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern,<br />
die Herstellung und Großhandel von Arzneimitteln<br />
überwachen.<br />
Dr. Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Die Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln erfolgt durch<br />
die Bundesländer gemäß einem bundesweit einheitlichen Qualitätssystem<br />
2.4 Lebensmittel<br />
Ziel der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist es, Verbraucher<br />
vor gesundheitlichen Risiken und vor nachgemachten bzw. gefälschten<br />
Produkten (Täuschung oder Irreführung) zu schützen.<br />
Daher kontrolliert die amtliche Lebensmittelüberwachung regelmäßig<br />
Betriebe, die Lebensmittel herstellen und/oder sie in Verkehr<br />
bringen (in <strong>Niedersachsen</strong> z. Zt. ca. 90.100 Betriebe). Dazu<br />
gehören Molkereien und Schlachthöfe ebenso wie Supermärkte<br />
oder Restaurants. Kontrolliert wird, ob die Hygienebestimmungen<br />
und die baulichen Voraussetzungen eingehalten werden, ob die<br />
Betriebe die vorgeschriebenen Eigenkontrollsysteme vorhalten<br />
und ob die Beschäftigten im Umgang mit Lebensmitteln geschult<br />
sind. Bei landwirtschaftlichen Betrieben wird überprüft, welche<br />
Arznei- oder Pflanzenschutzmittel angewendet werden, ob alle<br />
Tiere registriert sind und ob die Einhaltung der Hygieneanforderungen<br />
sowie tierschutzrechtlicher Standards gewährleistet ist.<br />
Ein besonderes Augenmerk gilt den verarbeitenden Betrieben,<br />
wie zum Beispiel Schlachthöfen oder Zerlegebetrieben. Kontrolliert<br />
werden hier Hygienestandards sowie die Gesundheit jedes einzelnen<br />
Tieres bzw. Schlachtkörpers.
Zuständig für die amtliche Überwachung sind die Ämter für Veterinärwesen,<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung<br />
in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die dort angestellten<br />
amtlichen Tierärzte bzw. Lebensmittelkontrolleure suchen alle<br />
Betriebe, die an der Lebensmittelproduktion beteiligt sind, unangekündigt<br />
und in unregelmäßigen Abständen auf. Sie überprüfen<br />
die Betriebe vor Ort und halten die Ergebnisse der Inspektion in<br />
einem Bericht fest, entnehmen Lebensmittelproben und schicken<br />
diese zur Untersuchung in die LAVES-Institute. Aus den Ergebnissen<br />
der Analysen und den Auswertungen der Betriebsinspektionen<br />
ergibt sich die (Risiko)Bewertung eines Betriebes. Wenn die<br />
Lebensmittelüberwachungsbehörde Verstöße gegen lebensmittelrechtliche<br />
Vorschriften feststellt, leitet sie rechtliche Schritte ein:<br />
je nach Schwere des Falles können die Sanktionen von einer Ermahnung<br />
über das Verhängen von Bußgeldern bis hin zu Strafanzeigen<br />
reichen.<br />
Die Aufgaben der kommunalen Lebensmittelüberwachungs- und<br />
Veterinärbehörden in <strong>Niedersachsen</strong> wurden bis 2004 von den<br />
Bezirksregierungen gesteuert. Seit Auflösung der vier Behörden<br />
zum 31. Dezember 2004 wird die sog. Fachaufsicht vom Niedersächsischen<br />
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz wahrgenommen, das auch<br />
die verbraucherschutzpolitischen Grundsätze für das Land festlegt.<br />
Die kommunalen Überwachungsbehörden können bei den Fachdiensten<br />
des LAVES Unterstützung anfordern und sie zur Beratung<br />
hinzuziehen. Darüber hinaus nimmt das LAVES seit 2005<br />
Vollzugsaufgaben wahr, die früher bei den Bezirksregierungen<br />
angesiedelt waren, beispielsweise die Zulassung und Überprüfung<br />
von Betrieben für die Vermarktung von Lebensmitteln innerhalb<br />
der Europäischen Union (z. Zt. ca. 740) oder für den Export in<br />
Drittländer (z. Zt. ca. 100). Das Inkrafttreten des sog. Hygiene-<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
2. Amtliche Lebensmittelüberwachung<br />
Die amtliche Lebensmittelüberwachung kontrolliert, ob<br />
Hygienebestimmungen eingehalten werden<br />
pakets am 1. Januar 2006 hat zur Folge, dass in <strong>Niedersachsen</strong><br />
weitere Betriebe unter die Zulassungspflicht fallen. Insgesamt<br />
müssen bis zum 31. Dezember 2009 rund 1.250 weitere Betriebe<br />
vom LAVES zugelassen werden.<br />
Jeder Verbraucher hat das Recht, sich mit Bedenken oder Beschwerden<br />
an die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde<br />
oder das LAVES zu wenden. Schimmeliger Käse im Supermarktregal<br />
ist dabei genauso ein Grund wie die beschädigte<br />
Verpackung des Tiefkühlspinats oder eine falsche Gewichtsangabe.<br />
Verdorbene Lebensmittel werden direkt zur Untersuchung<br />
in die LAVES-Institute geschickt. Außerdem suchen in der Regel<br />
Lebensmittelkontrolleure den betreffenden Hersteller oder Händler<br />
auf, um amtliche Proben zu nehmen.<br />
Dr. Jürgens, T.; Fischer, J. (Dez. 21)<br />
41
42<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong> des LAVES in 2006<br />
Einmal jährlich geben die Artikel in dem Kapitel »<strong>Schwerpunkte</strong>«<br />
– neben Kapitel 4 mit seinen detaillierten Untersuchungsergebnissen<br />
– Einblicke in die vielfältige Arbeit der LAVES-Mitarbeiter.<br />
Die beispielhaft gewählten Themen machen deutlich, welche Aufgaben<br />
das LAVES im amtlichen Kontrollsystem wahrnimmt und<br />
welche Bedeutung die noch junge Behörde als amtliche Untersuchungseinrichtung<br />
einnimmt. Nicht allein im Tierseuchenbereich<br />
verfügt das LAVES über große Untersuchungskapazitäten,<br />
sondern es ist eine der wenigen Einrichtungen bundesweit, die<br />
ein separates Futtermittelinstitut sowie ein Institut für Bedarfsgegenstände<br />
betreibt. Das LAVES verfügt über modernste Methoden<br />
zum Nachweis von Rückständen. Investitionen in die Analytik<br />
haben dazu geführt, dass das Landesamt weit fortgeschritten<br />
ist in der Entwicklung und Einführung neuer Untersuchungsmethoden<br />
in der Lebensmittelanalytik.<br />
Über die tägliche Arbeit hinaus neue Wege zu gestalten und mitzuwirken<br />
an Forschungsvorhaben, an Untersuchungs- und an<br />
Monitoringprogrammen, die länderübergreifend gelten und dem<br />
Schutz des Verbrauchers gelten, ist für viele Mitarbeiter im LAVES<br />
selbstverständlich. Die hier erzielten Untersuchungsergebnisse<br />
können auch zukünftig einen wichtigen Beitrag dazu leisten,<br />
neue bundes- oder EU-weit geltende Verordnungen oder Gesetze<br />
auf den Weg zu bringen.<br />
Auch die kontinuierlich stattfindende Zusammenarbeit mit anderen<br />
Behörden dient einem Ziel: den gesundheitlichen Verbraucherschutz<br />
sicherzustellen.<br />
In der Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden in der Lebensmittelanalytik<br />
ist das LAVES, dank Investitionen, weit fortgeschritten
Verbraucherschutz in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Vorbeugender Verbraucherschutz beinhaltet den Schutz der<br />
Menschen vor gesundheitlichen Gefahren. Die Untersuchung<br />
von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln ist<br />
dabei ein sehr wichtiger Baustein. Sie dient der Kontrolle der<br />
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften zur Lebensmittel- und<br />
Futtermittelsicherheit sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene.<br />
Da viele Lebensmittelskandale in der Vergangenheit durch<br />
Kontamination oder Verunreinigung von Futtermitteln hervorgerufen<br />
wurden (z. B. BSE bei Rindern durch Verfütterung kontaminierter<br />
Tiermehle, Dioxin in Eiern durch altölhaltiges Futter<br />
von Legehennen), wurden in die neue EU-Gesetzgebung zur Lebensmittelsicherheit<br />
und -hygiene Futtermittel mit einbezogen.<br />
LAVES: Arbeit im Dienste des Verbrauchers<br />
Im Folgenden werden einige Untersuchungsergebnisse aus dem<br />
letzten Jahr dargestellt, die von besonderem Interesse waren.<br />
Hierbei werden vor allem die »Kleinen Verbraucher« berücksichtigt<br />
(z. B. Formaldehyd in Holzspielzeug, irreführende Bewerbung<br />
von Babynahrung etc.), aber auch 2006 im Fokus stehende Ereignisse<br />
(»Gammelfleischskandale«, Reis mit gentechnisch veränderten<br />
Organismen) und brisante und »aktuelle« Lebensmittelthemen<br />
aufgegriffen (Bio-Lebensmittel, gesunde Lebensmittel).<br />
Der Verbraucher wird ebenso über die neue EU-Gesetzgebung<br />
zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit informiert, wie darüber<br />
was er tun kann, wenn gekaufte Lebensmittel nicht in Ordnung<br />
sind.<br />
Im 2. Teil des Kapitels werden aktuelle Themen aus dem Bereich<br />
der Tierseuchen (z. B. Geflügelpest) und des Tierschutzes sowie<br />
einige LAVES-Sonderthemen vorgestellt.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Wesentliche <strong>Schwerpunkte</strong> der Untersuchung von Lebensmitteln<br />
und Futtermitteln bilden die Untersuchung auf mikrobiologische<br />
Kontaminationen (z. B. Salmonellen in Geflügel), der Zusammensetzung,<br />
der Kennzeichnung (z. B. »Gammelfleisch«), die Prüfung<br />
auf Rückstände an Pflanzenschutzmitteln, pharmakologisch wirksamen<br />
Stoffen und weiteren Kontaminanten (z. B. Schwermetalle<br />
in Futtermitteln).<br />
Die Untersuchung und Kontrolle von Bedarfsgegenständen –<br />
Gegenstände des täglichen Bedarfs, mit denen Menschen in<br />
Berührung kommen – sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von<br />
Tierseuchen und des Tierschutzes sind ebenfalls unerlässlich zur<br />
Sicherstellung des Verbraucherschutzes.<br />
43
44<br />
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände<br />
Untersuchungen zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren<br />
Salmonellen-Belastung bei Geflügel – Erkenntnisse aus dem EU-weiten Salmonellenmonitoring<br />
Ergebnis der Untersuchungen<br />
2006 wurden EU-weit durchgeführte Untersuchungen zum Nachweis<br />
der Verbreitung von Salmonellen bei Broilern abgeschlossen,<br />
ebenso wurde das Monitoring bei Puten und Schlachtschweinen<br />
begonnen. Nachdem im Jahr zuvor schon für Legehennen haltende<br />
Betriebe eine starke Belastung mit Salmonellen festgestellt<br />
wurde, konnte dieses für Broiler ebenfalls bestätigt werden. Die<br />
Ergebnisse aus der geflügeldichten Region Weser-Ems sind in<br />
Tabelle <strong>3.</strong>1 in Beziehung zu den bundesweiten Untersuchungsergebnissen<br />
gestellt. Die bislang abgeschlossenen Untersuchungen<br />
wurden nach einem statistisch begründeten Probenschlüssel<br />
unter Berücksichtigung aller Betriebsgrößenklassen beprobt (siehe<br />
Tabelle <strong>3.</strong>2 und Tabelle <strong>3.</strong>3).<br />
Entsprechend der hohen Geflügeldichte in der Weser-Ems-Region<br />
betrug bei Legehennen bzw. Broilern der Anteil der Betriebe in<br />
Weser-Ems 19,2 % bzw. 60,6 % und in <strong>Niedersachsen</strong> 29,3 %<br />
bzw. 62,7 % der bundesweit untersuchten Betriebe. Anhand<br />
dieser Zahlen wird ersichtlich, dass das bundesweite Gesamtergebnis<br />
durch die niedersächsischen Betriebe in entscheidendem<br />
Maße geprägt wird.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>1: EU-Salmonellenmonitoring 2005 und 2006,<br />
Salmonellennachweise bei Legehennen und Broilern<br />
Proben von<br />
Legehennen<br />
Betriebe<br />
Betriebe mit<br />
Salmonellen<br />
Proben mit<br />
Salmonellen<br />
Proben von Broilern<br />
Betriebe<br />
Betriebe mit<br />
Salmonellen<br />
Proben mit<br />
Salmonellen<br />
Weser-Ems Deutschland<br />
n % positiv n % positiv<br />
609<br />
108<br />
47<br />
116<br />
1.138<br />
226<br />
39<br />
149<br />
43,5%<br />
19,1%<br />
17,3%<br />
13,1%<br />
<strong>3.</strong>941<br />
563<br />
165<br />
561<br />
1.892<br />
378<br />
66<br />
221<br />
29,3%<br />
14,2%<br />
17,5%<br />
11,7%
Tabelle <strong>3.</strong>2: EU-Salmonellenmonitoring 2005 und 2006,<br />
Betriebsgrößenklassen bei Legehennen<br />
Betriebsgrößen<br />
Legehennen<br />
< 1.000<br />
1.000-2.999<br />
<strong>3.</strong>000-4.999<br />
5.000-9.999<br />
10.000-29.999<br />
> 30.000<br />
Gesamt<br />
Tabelle <strong>3.</strong>3: EU-Salmonellenmonitoring 2005 und 2006,<br />
Betriebsgrößenklassen bei Broilern<br />
Betriebsgrößen<br />
Broiler<br />
5.000-9.999<br />
10.000-49.999<br />
50.000-99.999<br />
> 100.000<br />
Gesamt<br />
<strong>Niedersachsen</strong> Deutschland Anteil je<br />
Klasse<br />
8<br />
39<br />
21<br />
28<br />
43<br />
26<br />
165<br />
19<br />
224<br />
78<br />
88<br />
92<br />
62<br />
563<br />
3%<br />
40%<br />
14%<br />
16%<br />
16%<br />
11%<br />
100%<br />
<strong>Niedersachsen</strong> Deutschland Anteil je<br />
Klasse<br />
10<br />
157<br />
50<br />
17<br />
234<br />
17<br />
243<br />
79<br />
34<br />
373<br />
5%<br />
65%<br />
21%<br />
9%<br />
100%<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Schon im Jahr zuvor wurde, wie auch in diesem Jahr, in Legehennen<br />
haltenden Betrieben eine hohe Belastung mit Salmonellen festgestellt<br />
45
46<br />
In Weser-Ems waren 43,5 % der Legehennenbetriebe und 17,3 %<br />
der Broiler-Betriebe mit Salmonellen belastet. Gegenüber den<br />
bundesweiten Angaben bestand bei den Legehennen eine deutlich<br />
stärkere Belastung der Betriebe, da in anderen Regionen<br />
25,9 % der Betriebe mit Salmonellen infiziert waren. Bundesweite<br />
Auswertungen ergaben auch eine stärkere Salmonellennachweisrate<br />
in größeren Betriebseinheiten sowie in Käfighaltungen gegenüber<br />
der Bodenhaltung. Nähere Erklärungen oder begleitende<br />
Faktoren für diesen Sachverhalt konnten bislang nicht ermittelt<br />
werden. In Legehennenhaltungen zeigte sich zudem ein anderes<br />
Bild bei den isolierten Salmonellentypen als bei den Broilern.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>4: Salmonellen bei Broilern<br />
Nachgewiesene Salmonellen-<br />
Typen<br />
S. Paratyphi B<br />
S. 4,12:D:- (monophasisch)<br />
S. Anatum<br />
S. Infantis<br />
S. Typhimurium<br />
S. Mbandaka<br />
S. Gruppe B<br />
S. Heidelberg<br />
S. Typhimurium var. Copenh.<br />
S. Enteritidis<br />
S. Virchow<br />
S. Indiana<br />
S. Gr. I Rauhform<br />
Gesamt<br />
Weser-Ems Deutschland<br />
29<br />
28<br />
18<br />
16<br />
13<br />
10<br />
7<br />
7<br />
6<br />
5<br />
5<br />
4<br />
1<br />
149<br />
19,5%<br />
18,8%<br />
12,1%<br />
10,7%<br />
8,7%<br />
6,7%<br />
4,7%<br />
4,7%<br />
4,0%<br />
3,4%<br />
3,4%<br />
2,7%<br />
0,7%<br />
100,0%<br />
15,6%<br />
23,1%<br />
14,7%<br />
8,9%<br />
8,4%<br />
7,1%<br />
3,1%<br />
4,9%<br />
3,1%<br />
2,2%<br />
0,9%<br />
Im Gegensatz zu den Ergebnissen des Legehennenmonitorings<br />
mit einem deutlich dominierenden Anteil von über 80 % S. Enteritidis-Isolaten<br />
ergab sich bei den Broilern ein weit gefächertes<br />
Bild mit den häufigsten Typen S. Paratyphi B (19,5 %) und<br />
S. 4,12:D:– (monophasisch) (18,8 %). Die Ergebnisse der Untersuchungen<br />
von Broilern sind in Tabelle <strong>3.</strong>4 wiedergegeben. Als<br />
Untersuchungsmaterial dienten so genannte Sockentupfer (»Boot<br />
swaps«). Mit jeweils fünf Paaren, nachdem diese über die Stiefel<br />
gezogen wurden, erfolgte durch Abgehen der Stallflächen eine<br />
systematische Probenahme in jedem Betrieb. Als Untersuchungsverfahren<br />
wurde ein vom EU-Referenzlabor für Salmonellen<br />
empfohlenes Nachweisverfahren (»MSRV«) eingesetzt, dass<br />
zuvor auch in einem Ringversuch erfolgreich auf Eignung geprüft<br />
wurde. Bei einem Großteil der Betriebe mit Salmonellennachweisen<br />
konnten in allen fünf Untersuchungsansätzen positive Nachweise<br />
erzielt werden (siehe Tabelle <strong>3.</strong>5).<br />
Tabelle <strong>3.</strong>5: Anzahl der positiven Ansätze bei Betrieben<br />
mit Salmonellennachweis in Weser-Ems<br />
Salmonellennachweis je Betrieb in Betriebe<br />
5 Proben<br />
4 Proben<br />
3 Proben<br />
2 Proben<br />
1 Probe<br />
19<br />
7<br />
3<br />
7<br />
3
Im Gegensatz zu den zahlreichen Nachweisen von Salmonellen<br />
im EU-Monitoring ergaben in den letzten Jahren die Untersuchung<br />
von Zuchtgeflügel keine oder nur unbedeutende Salmonellenfunde<br />
(siehe Tabelle <strong>3.</strong>6). Allerdings wurde bei den so genannten<br />
amtlichen Kontrollen der Eigenkontrollen ein anderes Untersuchungsverfahren<br />
angewendet, welches nach eigenen Erkenntnissen<br />
eine geringere Nachweisempfindlichkeit aufweist.<br />
Auch im Jahr 2006 ist S. Enteritidis der beim Menschen mit einem<br />
Anteil von 43,94 % dominierende Serotyp bei insgesamt 52.319<br />
gemeldeten Salmonella-Enteritiden gefolgt von S. Typhimurium<br />
mit 24,81 %. Roheispeisen stellen ein bedeutendes hygienisches<br />
Risiko dar, wie Ausführungen des Robert-Koch-Institutes belegen<br />
(RKI, Epidem. Bulletin Nr. 3, 2007). Aber auch von anderen Serovaren<br />
geht nach der Statistik ein Risiko für Erkrankungen des<br />
Menschen aus (so auch S. Paratyphi B und S. 4,12:D). Nach einem<br />
Rückgang der Salmonelleninfektionen in den vergangenen Jahren<br />
ist im Vergleich von 2006 zu 2005 eine Stagnation auf hohem<br />
Niveau zu erkennen. Eine deutliche Zunahme auch in der öffentlichen<br />
Wahrnehmung ist insbesondere bei anderen Darmerkrankungen<br />
(Noro-Virus, Rotavirus) zu erkennen, jedoch geht nach<br />
wie vor von Salmonellen ein hohes Risiko mit besonderem zoonotischen<br />
Potential aus.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>6: Salmonellenachweise in <strong>Niedersachsen</strong> beim Zuchtgeflügel (Huhn)<br />
Jahr<br />
2003 2004 2005 2006<br />
n % positiv n % positiv n % positiv n % positiv<br />
Zuchtgeflügel <strong>3.</strong>335 1,17* 2.512 0 2.694 0 2.631 0**<br />
* 2003 wurde Salmonella anatum (ohne Maßregelungen) nachgewiesen.<br />
** 2006 wurde ein S. Enteritidis-Lebendimpfstamm nachgewiesen.<br />
Im Weser-Ems-Gebiet waren 43,5 % der Legehennenbetriebe mit<br />
Salmonellen belastet<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
47
48<br />
Bekämpfungsstrategien<br />
Das EU-Monitoring belegt, dass Deutschland mit einer vergleichsweise<br />
hohen Salmonellenbelastung der Betriebe im EG-weiten<br />
Vergleich einen mittleren Platz einnimmt. Gerade die geringe Salmonellennachweisrate<br />
in skandinavischen Ländern zeigt, dass<br />
intensive Bekämpfungsmaßnahmen zur Reduktion der Salmonellen<br />
deutlich beitragen. Wesentliche Zielvorgaben zur Reduktion<br />
der Salmonellenbelastung sind durch entsprechende Richtlinien<br />
und EG-Verordnungen (RL 2003/99/EG, VO (EG) 2160/2003,<br />
VO (EG) 1091/2005, VO (EG) 1003/2005, VO (EG) 1168/2006)<br />
vorgegeben und müssen durch nationale Ausführungsbestimmungen<br />
(hier auch Änderung der Hühner-Salmonellen-Verordnung<br />
(Bgbl I 2001 Nr. 16, S. 543 vom 20. April 2001)) entsprechend<br />
umgesetzt werden. So muss in Anbetracht der bisherigen<br />
Infektionsrate die Salmonellenbelastung in Legehennenherden<br />
innerhalb von zwei Jahren durch nationale Überwachungsprogramme<br />
pauschal um 30 % auf maximal 17 % gesenkt werden.<br />
Die derzeitige Bekämpfung ist insbesondere auf S. Enteritidis<br />
und S. Typhimurium ausgerichtet, kann aber auch auf andere<br />
Serotypen ausgeweitet werden, sofern eine besondere gesundheitliche<br />
Relevanz für den Menschen angenommen wird. Da<br />
die Bekämpfung wahrscheinlich aber auch parallele Effekte auf<br />
andere Serovare hat, dürfte es zu einer allgemeinen Reduktion<br />
der Salmonellennachweise bei konsequenter Umsetzung hygienischer<br />
Maßnahmen und Impfungen kommen. Eingeschränkte<br />
Vermarktungsmöglichkeiten von Eiern und Tieren aus infizierten<br />
Betrieben werden vermehrt Druck auf die Erzeuger ausüben.<br />
Der Einsatz von Antibiotika ist bis auf wenige Ausnahmen stark<br />
eingeschränkt (erkrankte Tiere, wertvolle Zuchtbestände, Einsatz<br />
amtlich überwacht).<br />
Wesentliche Elemente der Bekämpfung von Salmonellen in den<br />
Betrieben sind die konsequente Umsetzung bekannter Vorgaben<br />
zur Betriebshygiene und Einsatz von Impfstoffen, um beim nicht<br />
immer zu vermeidbaren Erregerkontakt eine Infektion und Ausbreitung<br />
im Bestand zu vermeiden. Niedrige Nachweisraten bzw.<br />
keine Salmonellennachweise in Zuchtgeflügelbeständen in den<br />
letzten Jahren lassen vermuten, dass intensiven Hygienemaßnahmen<br />
und Impfungen eine wesentliche Bedeutung bei der Zurückdrängung<br />
von Salmonellen zukommt.<br />
Regelmäßige Untersuchungen (Eigenkontrollen, amtliche Kontrolluntersuchungen,<br />
Monitoring) unter standardisierten Untersuchungsbedingungen<br />
sind der Gradmesser für die Salmonellenbelastung<br />
in den Tierbeständen.<br />
Dr. Klarmann, D. (VI OL)<br />
Regelmäßige amtliche Kontrolluntersuchungen, Eigenkontrollen und<br />
Monitorings sind Gradmesser für die Salmonellenbelastung in den<br />
Tierbeständen
Wie können Salmonellen-Infektionen vermieden werden?<br />
Salmonellen sind die häufigsten Verursacher einer bakteriellen<br />
Magen-Darm-Erkrankung. Besonders in der warmen Jahreszeit<br />
treten Salmonellen-Infektionen verstärkt auf. Salmonellen vermehren<br />
sich rasch bei Zimmertemperatur. Auch wenn Lebensmittel<br />
monatelang tiefgefroren werden, können die Salmonellen darin<br />
überleben. Nur eine vollständige Erhitzung der Speisen durch<br />
Braten, Backen, Kochen oder Grillen tötet die Salmonellen in der<br />
Regel ab.<br />
Hauptursachen für das Gedeihen von Salmonellen sind eine unsaubere<br />
Verarbeitung und warme Lagerung von Lebensmitteln.<br />
Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(LAVES) hat einige einfache Regeln zusammengestellt,<br />
die helfen können, eine Salmonellen-Infektion zu<br />
vermeiden:<br />
• Fleisch, vor allem Geflügel, im Kühlschrank zugedeckt auftauen,<br />
dabei das Abtropfwasser in einem Gefäß auffangen und<br />
wegschütten. Wichtig ist, dass andere Lebensmittel damit nicht<br />
in Berührung kommen<br />
• Für das Zerteilen von Fleisch am besten Plastikbretter verwenden,<br />
da sich Holzschneidebretter nicht bis in die Holzfasern<br />
reinigen lassen<br />
• Nach der Verarbeitung von rohem Fleisch Hände gründlich waschen,<br />
Geräte und Arbeitsflächen, die mit dem rohen Fleisch<br />
in Kontakt gekommen sind, säubern<br />
• Obst und Gemüse gründlich waschen<br />
• auf Sauberkeit in der Küche achten: Abwaschlappen, Schwämme,<br />
Hand- und Geschirrtücher öfter wechseln<br />
• auch die persönliche Hygiene ist ein wichtiger Aspekt, auf jeden<br />
Fall nach der Toilettenbenutzung und dem Kinderwickeln<br />
Hände waschen<br />
Grillgut sollte stets gut durch gebraten werden, um eine<br />
Salmonellen-Infektion zu vermeiden<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
• Fleisch vor dem Verzehr gleichmäßig (d. h. auch im Inneren<br />
des Fleischstückes) zehn Minuten auf eine Temperatur von<br />
mind. 70 °C erhitzen<br />
• kein rohes oder halbgares Fleisch essen (Grillgut stets gut durchbraten!)<br />
• gegarte Lebensmittel möglichst rasch abkühlen<br />
• Rohmilch, die nicht erhitzt wird und die man direkt vom Bauernhof<br />
beziehen kann, muss aufgekocht werden<br />
• für alle Speisen, die rohe oder nicht ganz durcherhitzte Eier<br />
enthalten – wie z. B. Pudding, Cremes, Tiramisu, selbsthergestellte<br />
Mayonnaise – immer ganz frische Eier verwenden. Die<br />
Speisen möglichst unmittelbar nach der Zubereitung verzehren<br />
(innerhalb von zwei Stunden) oder bis zum Verzehr kühl<br />
(unter +7 °C) nicht länger als einen Tag lagern.<br />
Ahlborn, D. (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)<br />
49
50<br />
Nematodenlarven in Wildlachs: Beurteilung und Bewertung<br />
Im Institut für Fischkunde Cuxhaven (IfF CUX) werden seit 1999<br />
schwerpunktmäßig Proben von Wildlachs untersucht, sowohl<br />
ganze Fische als auch Filets in Fertigpackungen. Dabei konnten<br />
die in der Literatur erwähnten Nematodenlarvenfunde in Erzeugnissen<br />
aus überwiegend pazifischem Wildlachs bestätigt werden.<br />
Auffallend scheint eine Zunahme der Nematodenzahl pro Jahr<br />
zu sein, auch Befunde bis zu 200 Nematodenlarven pro Kilogramm<br />
waren keine Ausnahme.<br />
Die einschlägigen Vorschriften der EU regeln ausschließlich das<br />
Vorkommen sichtbarer Parasiten. Als optisches Hilfsmittel ist in<br />
diesem Zusammenhang nur die Durchleuchtung vorgesehen. Diese<br />
Methode führte bei den Untersuchungen im IfF CUX mehr<br />
oder weniger nur zufällig zu einem positiven Befund, selbst hochgradige<br />
Vorkommen an Nematodenlarven waren per Leuchttisch<br />
nicht nachweisbar. Am effektivsten war die enzymatische Digestion<br />
(Verdauungsmethode), auch wenn bei dem optischen Verfahren<br />
keine Nematodenlarven nachweisbar waren.<br />
Untersuchungen von Lebensmitteln zur Sicherung des<br />
gesundheitlichen Verbraucherschutzes<br />
Bei Wildlachs ist aufgrund seiner zeitweise intensiven Eigenfärbung<br />
der Muskulatur die Durchleuchtungsmethode nicht ge-<br />
Wildlachsfiletteile eignen sich nicht zum Durchleuchten<br />
eignet um zu verhindern, dass (entsprechend Verordnung (EG)<br />
Nr. 853/2004) eindeutig von Parasiten befallene Fischereierzeugnisse<br />
für den menschlichen Verzehr in den Verkehr gebracht werden<br />
können.<br />
Hochgradig mit Nematodenlarven befallene Erzeugnisse aus Wildlachs<br />
sind als ekelerregend anzusehen und entsprechend (Lebensmittel-<br />
und Futtermittelgesetzbuch in der derzeit gültigen Fassung)<br />
zu beurteilen.<br />
Grundsätzlich ist jedoch das Vorkommen von Nematodenlarven<br />
bei Wildfischen wie Wildlachs möglich und deshalb deren Vorkommen<br />
in Fischereierzeugnissen nicht auszuschließen. Für eine<br />
sichere Erhebung des Befallsstatus einer gegebenen Ware ist<br />
daher neben der vorgesehenen Durchleuchtungsmethode der<br />
Einsatz zerstörender Methoden wie zum Beispiel der Digestion<br />
im Rahmen der Eigenkontrollen notwendig.<br />
Im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrollen muss der Hersteller<br />
bzw. Verarbeiter entscheiden, ob seine Verarbeitungsverfahren<br />
geeignet sind, die Anzahl an Nematodenlarven auf ein vermeidbares<br />
Maß zu senken.<br />
Bewährt hat sich zum Erkennen von Nematodenlarven bei<br />
hellfleischigen Fischfilets ein Leuchttisch
Unter Berücksichtigung,<br />
• dass Wildlachs wissenschaftlich nachweisbar überwiegend parasitär<br />
belastet ist<br />
• dass der europäische Verbraucher ein verbrieftes Recht auf<br />
sichere Lebensmittel hat<br />
• dass es zu den Kernverpflichtungen eines Lebensmittelherstellers<br />
oder Händlers gehört, unsichere Lebensmittel nicht in den<br />
Verkehr zu bringen<br />
• dass die Sichtkontrolle als Mindestmaßnahme für das Erkennen<br />
von Parasitenformen nicht ausreicht<br />
muss zur Gewährleistung der Sicherheit des Lebensmittels Lachs<br />
eine andere Methode des Nachweises von Parasiten verwendet<br />
werden. Die Digestionsmethode erfüllt die geforderte Sicherheit<br />
unter Berücksichtigung von Wirksamkeit, Zumutbarkeit und<br />
Wirtschaftlichkeit.<br />
Fischkompetenzzentrum erarbeitet Positionspapier<br />
Weiterhin ist die Digestionsmethode von hoher Aussagekraft<br />
und die Methode der Wahl bei der Überprüfung der in den Betrieben<br />
angewandten Sorgfaltspflicht durch die Überwachungsbehörden<br />
(VO 854/2004) zur Feststellung der Beschaffenheit<br />
von Wildlachspartien hinsichtlich der Befallsintensität mit Parasiten.<br />
Für die Überwachung von Fischereierzeugnissen ist es in<br />
diesem Zusammenhang notwendig, Vorstellungen zu entwickeln,<br />
schließlich zu entscheiden und festzulegen, welche Anzahl an<br />
Nematodenlarven bei Wildlachs unvermeidbar und damit duldbar,<br />
für welche Revisionen notwendig und welche letztlich nicht<br />
akzeptabel ist.<br />
Das Fischkompetenzzentrum Nord (FKN) hat hierzu ein Positionspapier<br />
erarbeitet, das von der Länderarbeitsgemeinschaft Gesundheitlicher<br />
Verbraucherschutz namens »Arbeitsgruppe Fleischund<br />
Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln<br />
tierischer Herkunft« (AFFL) zustimmend aufgenommen<br />
und an den Bund mit der Bitte um Berücksichtigung auf<br />
EU-Ebene weitergeleitet wurde. In dem Positionspapier wird<br />
bei Wildlachs eine Anzahl von bis zu zehn Nematodenlarven pro<br />
Kein seltener Befund: Fischeier (Rogen) mit deutlich erkennbaren<br />
Nematodenlarven<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Kilogramm Fischereierzeugnis (per Digestion ermittelt) als eine<br />
duldbare Größe bzw. akzeptable Bewertungsgrundlage vorgeschlagen.<br />
Mehr als 20 Nematodenlarven pro Kilogramm Fischereierzeugnis<br />
werden grundsätzlich als ekelerregend angesehen<br />
und entsprechend beanstandet.<br />
Grundsätzlich sollten die Hersteller/Verarbeiter auch noch in geeigneter<br />
Weise die Verbraucher informieren, dass in Wildlachs<br />
unvermeidbare Nematodenlarven vorkommen können.<br />
Dr. Etzel, V. (IfF CUX); Dr. Boiselle, C. (LMTVet BRE, Außenstelle BRHV)<br />
51
52<br />
Salmonellen in Kauartikeln für Hunde – bei Kontakt mit Produkten Hygiene einhalten<br />
Getrocknete Schlachtnebenprodukte wie beispielsweise Schweineohren,<br />
Ochsenziemer, Rinderpansen und Hähnchenhälse werden<br />
gerne als Kauartikel für Hunde verwendet. Diese Erzeugnisse<br />
müssen gemäß EG-Verordnung 1774/2002 bei der Herstellung so<br />
erhitzt werden, dass Krankheitserreger (einschließlich Salmonellen)<br />
wirksam abgetötet werden. In der Regel sterben Bakterien der<br />
Gattung Salmonella bei einer Temperatur von 70 °C ab. Nach<br />
der Erhitzung sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,<br />
um eine Kontamination zu vermeiden.<br />
Trotz dieser Vorgaben fielen Kauartikel bereits mehrfach durch<br />
Nachweise von Salmonellen auf. Salmonellen können nicht nur<br />
die Gesundheit des Tieres schädigen, auch der Mensch, der mit<br />
infizierten Kauartikeln oder Tieren Kontakt hat, kann erkranken.<br />
Kauartikel für Hunde aus getrockneten Schlachtnebenprodukten<br />
müssen bei der Herstellung so erhitzt werden, dass Krankheitserreger<br />
wirksam abgetötet werden<br />
Um einen Überblick über die aktuelle Situation zu gewinnen,<br />
wurden im Futtermittelinstitut Stade des LAVES insgesamt 111<br />
Proben verschiedenster Kauartikel aus Schlachtnebenprodukten<br />
untersucht. Dabei fanden sich Bakterien der Gattung Salmonella<br />
in über 25 % der Proben. Nachgewiesen wurden elf verschiedene<br />
Salmonella-Serovare. Die Ursachenforschung zur Salmonellenbelastung<br />
dauert an. Die These, dass überwiegend unverpackte<br />
Produkte betroffen seien, konnte nicht bestätigt werden.<br />
Da grundsätzlich alle Salmonella-Serovare auf den Menschen<br />
übertragen werden und Erkrankungen auslösen können, rät das<br />
LAVES zu besonderer hygienischer Sorgfalt beim Umgang mit<br />
diesen Kauartikeln.<br />
Schlägel, E. (FI STD)
Kontrolle Lebensmittelkennzeichnung – Schutz vor Verbrauchertäuschung<br />
»Fleischskandale« in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Themen im Zusammenhang mit der Ware Fleisch blieben auch<br />
2006 im Fokus. Berichte in den Medien um »Fleischskandale«<br />
führten zu einer Verunsicherung von Verbrauchern.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> war von diesen Skandalen in zwei Fällen betroffen.<br />
Aufsehen erregte zunächst im April ein Lebensmittelunternehmer<br />
aus dem Landkreis Cloppenburg, der aus einem Kühlhaus<br />
in Hamburg beschlagnahmtes Fleisch entwendete und in den Verkehr<br />
brachte, obwohl ihm dieses ausdrücklich von der zuständigen<br />
Lebensmittelüberwachungsbehörde in Hamburg untersagt<br />
worden war. Es war derselbe Lebensmittelunternehmer, dem das<br />
LAVES als zuständige Behörde im November 2005 die Zulassung<br />
ausgesetzt hatte, die für den innergemeinschaftlichen Handel<br />
erforderlich ist.<br />
Vorangegangen war die durch die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde<br />
angeordnete Sicherstellung von 25 Tonnen<br />
Geflügelfleischprodukten in seinem im Landkreis Cloppenburg<br />
ansässigen EU-zugelassenen Betrieb. Weitere 45 Tonnen in einem<br />
Gefrierlager des Nachbarkreises wurden sichergestellt, bei<br />
denen das Ergebnis der Untersuchungen dieser Produkte durch<br />
das LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg – bestätigte, dass es<br />
sich um verdorbenes und/oder mit deutlich überhöhter Keimzahl<br />
belastetes Fleisch handelte. Im September desselben Jahres folgte<br />
die Inhaftierung wegen Wiederholungsgefahr. Vor dem Landgericht<br />
Oldenburg wurde Anfang 2007 der Strafprozess eröffnet.<br />
Im Juni wurde das Urteil verkündet und der Angeklagte zu vier<br />
Jahren und drei Monaten Haftstrafe verurteilt, dazu verhängte<br />
das Gericht ein fünfjähriges Berufsverbot.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Ein weiterer Fall erschütterte Ende September die Verbraucher.<br />
Ein Wurst- und Fleischwarenhersteller aus dem Landkreis Vechta<br />
sollte 2004 und 2005 Wurst aus Schlachtabfällen in den Handel<br />
gebracht haben. 130 Tonnen Stichfleisch sollte er dazu verarbeitet<br />
haben. Unter die Bezeichnung Stichfleisch fällt das Halsfleisch,<br />
das an der Stelle entsteht, wo der Schlachter den tödlichen Stich<br />
mit seinem Messer setzt. Verwendet werden darf es nach den<br />
gesetzlichen Bestimmungen nur für Hundefutter oder für technische<br />
Fette.<br />
Neue Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang<br />
nahm das LAVES zum Anlass, um die Zuverlässigkeit<br />
des Betriebsinhabers erneut zu überprüfen. Neben der Zuverlässigkeit<br />
des Betriebsinhabers sind auch die strukturellen<br />
Gegebenheiten der Betriebsstätte Voraussetzung für die Erteilung<br />
einer Zulassung. Das LAVES kam nach eingehender Prüfung zu<br />
dem Ergebnis, dass die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben war<br />
und versagte die Zulassung. Mittlerweile hat ein neuer Betriebsinhaber<br />
die Produktion in der Betriebsstätte aufgenommen. Vorausgegangen<br />
war hier eine Überprüfung der strukturellen Gegebenheiten<br />
vor Ort, sowie der Zuverlässigkeit des neuen Betriebsinhabers<br />
durch das LAVES in Zusammenarbeit mit dem Landkreis<br />
Vechta. Die Zulassung konnte daraufhin erteilt werden.<br />
53
54<br />
Effektive Zusammenarbeit zwischen Behörden<br />
Die funktionierende Interaktion zwischen verschiedenen Behörden<br />
(z. B. LAVES, kommunalen Veterinärämtern, Staatsanwaltschaft)<br />
ist eine Grundvoraussetzung, um unhygienische Zustände und<br />
kriminelle Machenschaften schnell zu unterbinden und damit den<br />
Ansprüchen der Verbraucher auf sichere Lebensmittel gerecht<br />
zu werden.<br />
Die für den Verbraucherschutz zuständigen Minister und Senatoren<br />
haben am 7. September 2006 in Berlin ein 13-Punkte-Programm<br />
beschlossen. Die Zusammenarbeit zwischen Ländern und<br />
Bund sollte nicht nur fortgesetzt, sondern vielmehr auch intensiviert<br />
werden.<br />
Der Bund ist ebenfalls einer wesentlichen Forderung aus dem Programm<br />
nachgekommen und hat den Entwurf eines Verbraucherinformationsgesetzes<br />
auf den Weg gebracht. Nachdem der Bundespräsident<br />
Horst Köhler 2006 die Ausfertigung des Gesetzes<br />
wegen verfassungsrechtlicher Bedenken verweigert hatte, soll<br />
2007 ein neuer verfassungsmäßiger Gesetzentwurf auf Bundesebene<br />
verabschiedet werden. Das Bundeskabinett hat Anfang<br />
April 2007 eine Neufassung auf den Weg gebracht. Dieses Gesetz<br />
soll eine umfassendere Information der Verbraucher gewährleisten.<br />
Im Juli 2007 hat der Bundestag ein neues Verbraucherinformationsgesetz<br />
verabschiedet. Wesentliche Neuerungen dieses<br />
Gesetzes sind:<br />
• Erweiterung der Befugnisse der Behörden, um die Öffentlichkeit<br />
über marktrelevante Vorkommnisse mit Nennung des Namens<br />
informieren zu können<br />
• Recht der Verbraucher auf Zugang zu den bei Behörden vorhandenen<br />
Informationen<br />
Inwieweit ein neues Verbraucherinformationsgesetz, und auch<br />
die anderen Maßnahmen des beschlossenen 13-Punkte Programms<br />
zu einer Verbesserung des Verbraucherschutzes beitragen,<br />
bleibt abzuwarten und hängt auch davon ab, wie die Inhalte<br />
des neuen Gesetzes tatsächlich aussehen werden.<br />
Fischer, J. (Dez. 21)<br />
Wieviel echtes Vanilleeis gibt es noch?<br />
Die Vanillepflanze, ein in den Tropen beheimatetes Orchideengewächs,<br />
liefert eines der beliebtesten, wichtigsten und auch<br />
teuersten Gewürze der Welt. Echte Vanille wird aus den noch<br />
unreif geernteten, fermentierten und getrockneten Vanilleschoten<br />
gewonnen. Während des Fermentationsprozesses bildet sich<br />
sowohl das charakteristische Vanillearoma als auch die bekannte<br />
dunkle Farbe der Schoten.<br />
Die für das Vanillearoma wichtigste Komponente ist das Vanillin.<br />
Es kommt in Mengen von etwa 1 bis 2 % in den Vanilleschoten<br />
vor. Neben Vanillin tragen noch eine Vielzahl von Substanzen zum<br />
Vanillearoma bei, die oftmals nur in sehr geringen Mengen vorhanden<br />
sind.<br />
LAVES: Breites Untersuchungsfeld zum Schutz vor<br />
Verbrauchertäuschung<br />
Der hohe Preis der Vanille und die steigende Nachfrage machen<br />
es leider zu einem lukrativen Ziel, Vanilleextrakte zu verfälschen.<br />
Dies stellt eine große Herausforderung an den Analytiker dar.<br />
Um festzustellen ob Vanillin aus einer echten Schote extrahiert oder<br />
ob es synthetisch oder biotechnologisch hergestellt wurde, bedarf es<br />
einer komplizierten und aufwändigen Analytik
So ist es beispielsweise möglich, den Hauptaromastoff Vanillin<br />
aus bestimmten Substanzen synthetisch oder biotechnologisch,<br />
also mit Hilfe von Mikroorganismen, herzustellen. Durch Verwendung<br />
dieses Vanillins kann man dann entweder echtes Vanillearoma<br />
vortäuschen oder echte Vanilleextrakte »strecken« – natürlich<br />
unerlaubterweise.<br />
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, durch ein bestimmtes<br />
Extraktionsverfahren nahezu ausschließlich Vanillin aus den<br />
Schoten zu extrahieren. Um dieses »echte« Vanillin von synthetisch<br />
oder biotechnologisch hergestelltem zu unterscheiden, bedarf<br />
es einer äußerst komplizierten und aufwändigen Analytik,<br />
der Stabilisotopenanalytik.<br />
Rechtlich ist die Situation eindeutig: Überall da, wo »Vanille«<br />
draufsteht, muss auch echte Vanille drin sein, und zwar ausschließlich<br />
oder nahezu ausschließlich. Wird synthetisch oder<br />
biotechnologisch hergestelltes Vanillin zur Aromatisierung verwendet,<br />
entweder allein oder als Zusatz zu echtem Vanillearoma,<br />
so ist der Hersteller verpflichtet, dies durch die Angabe »mit<br />
Vanillegeschmack« in der Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels<br />
kenntlich zu machen. Die Bezeichnung »Vanille« wäre in<br />
diesem Fall irreführend.<br />
LI OL untersucht Ausgangsstoffproben für Eisherstellung<br />
Nachdem im Sommer 2005 im Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
des LAVES 20 Proben Vanilleeis auf ihre Aromastoffgehalte untersucht<br />
wurden und lediglich bei einer Probe sicher davon ausgegangen<br />
werden konnte, dass ausschließlich aus Vanilleschoten<br />
stammende Verbindungen zur Aromatisierung eingesetzt wurden,<br />
forderten die Experten im vergangenen Jahr Ausgangsstoffproben<br />
für die Vanilleeisherstellung an. Es wurden insgesamt<br />
18 Proben untersucht. Die Hälfte der Proben hatte deutsche<br />
Hersteller, die anderen Proben kamen aus dem europäischen<br />
Ausland. Mit der Hochdruckflüssig-Chromatographie (HPLC)<br />
wurden die quantitativen Gehalte von Vanillin, p-Hydroxybenzaldehyd,<br />
Vanillinsäure und p-Hydroxybenzoesäure als Hauptinhaltsstoffe<br />
bestimmt und ihre Verhältniszahlen zueinander.<br />
Nur zwei deutsche Proben wiesen die für »echte Vanille« typischen<br />
Gehalte und Verhältniszahlen auf.<br />
Von 18 Proben Vanilleeis wiesen nur zwei Proben die für »echte<br />
Vanille« typischen Gehalte und Verhältniszahlen auf<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
55
56<br />
Die Stabilisotopenanalyse gestattet den Nachweis der Verwendung<br />
von naturidentischem Vanillin (chemisch synthetisiert) und<br />
von biotechnologisch hergestelltem Vanillin, da das Isotopenverhältnis<br />
des Kohlenstoffes je nach Herkunft einen anderen Wert<br />
trägt. Die 13 C–Werte für Vanillin aus der Vanilleschote liegen zwischen<br />
-21,5 ‰ und -15,9 ‰ VPDB. Das häufig aus Abfallstoffen<br />
der Papierherstellung synthetisierte Vanillin hat bei 13 C–Werten<br />
von -32,2 ‰ und -25,4 ‰ VPDB ein deutlich niedrigeres Kohlenstoff-Isotopenverhältnis.<br />
Der 13 C–Wert von biotechnologisch hergestelltem<br />
Vanillin, das lebensmittelrechtlich als natürliches Vanillin<br />
gilt, ist noch negativer als der von chemisch-synthetisch hergestelltem.<br />
Die Ergebnisse der HPLC wurden bei allen 16 zu beanstandenden<br />
Ausgangsstoffproben für die Vanilleeisherstellung bestätigt,<br />
da bei diesen Proben 13 C–Werte zwischen -26,7 ‰ und -29,3 ‰<br />
VPDB ermittelt wurden. Eindeutig Werte für synthetisch hergestelltes<br />
Vanillin.<br />
Wie die Ergebnisse zeigen, dürfte ein sehr hoher Anteil des Vanilleeises<br />
nur als »Eis mit Vanillegeschmack« in den Verkehr gebracht<br />
werden.<br />
Aufgrund der hohen Verfälschungsquote werden diese Untersuchungen<br />
im Jahr 2007 auf weitere Produktgruppen, die mit<br />
»Vanille« ausgelobt werden, wie Pudding oder Soja-Produkte,<br />
ausgeweitet.<br />
Übrigens: Bei den »braunen Stippen« im »Vanilleeis« handelt es<br />
sich um gemahlene (häufig extrahierte) Vanilleschoten. Sie werden<br />
Lebensmitteln aus optischen Gründen zugesetzt, ihr Beitrag<br />
zum Geschmack ist minimal. Bei den hier untersuchten und beanstandeten<br />
Ausgangsstoffproben wurden diese in 14 von 16<br />
Proben zugesetzt. Ein Garant für die Verwendung von echtem<br />
Vanillearoma sind sie leider nicht.<br />
Dr. Nuyken-Hamelmann, C.; Dr. Nutt, S. (LI OL)<br />
Irreführende Kennzeichnung: Mild gesalzener<br />
Lachsersatz im Test<br />
Gestiegen ist in den vergangenen Jahren die Herstellung mild<br />
gesalzener Fisch-Erzeugnisse. Diese Feststellung des Fischkompetenzzentrums<br />
Nord (FKN) hat auch für 2006 Bestand. Eine<br />
Entwicklung, die auch vor typisch hartgesalzenen Fischerzeugnissen<br />
– wie Lachsersatz – nicht halt macht. Das heißt: Neben<br />
den klassischen als Seelachsschnitzel/Lachsersatz gekennzeichneten<br />
Produkten fanden sich auch Erzeugnisse als Seelachsschnitzel/Lachsersatz<br />
mild gesalzen. Hier wird dem Verbraucher suggeriert,<br />
er kaufe Produkte mit vermindertem Salzgehalt. Anhand<br />
von Untersuchungen im FKN wurde jetzt aber festgestellt, dass<br />
sich die herkömmlichen Produkte im Salzgehalt nicht unterscheiden<br />
– wohl jedoch in der Qualität und damit in der Höherwertigkeit.<br />
Das liegt am Herstellungsprozess. Im Einzelnen: 2006 lief ein umfangreiches<br />
Untersuchungsprogramm des FKN an, das den Vergleich<br />
zwischen Seelachsschnitzeln und Lachsersatz beinhaltete.<br />
Dabei wurden unter anderem die unterschiedlichen Herstellungstechnologien<br />
gegenübergestellt, untersucht wurden Organoleptik,<br />
bakteriologischer Status sowie Wasser- und Salzgehalt.
Die herkömmliche Ware unterscheidet sich von mild gesalzenen<br />
Produkten schon durch die Herstellung, und hier durch den sechswöchigen<br />
Salzungsschritt. Dadurch entsteht eine sogenannte salzgare<br />
Fischmuskulatur, durch die Reifung ein typisches Aroma und<br />
die bissfeste Textur. All dies fehlte bei mild gesalzenen Erzeugnissen.<br />
Diese Unterschiede in der Herstellung wurden durch organoleptische<br />
Ergebnisse eindeutig bestätigt. Als Beurteilungskriterium<br />
für die Produktqualität waren als chemische Parameter insbesondere<br />
die Wasser-, Salz- und Proteingehalte entscheidend. Die<br />
durch eine Vielzahl von Untersuchungen am klassischen Produkt<br />
»Seelachsschnitzel« belegten Normalwerte erstreckten sich in<br />
der großen Mehrzahl der Fälle über Salzgehalte von 6 bis 12 %<br />
und gleichzeitig über Wassergehalte von 70 bis 80 %.<br />
Die Salzgehalte (ermittelt nach Priebe et al.) bei den aktuell untersuchten<br />
Proben lagen mit 8,3 bzw. 7,9 % nahezu auf gleich<br />
hohem Niveau. Also entsprachen sowohl mild gesalzene als auch<br />
herkömmliche Seelachsschnitzel den Qualitätsanforderungen.<br />
Von besonderer Relevanz für die Beurteilung waren jedoch die<br />
Wassergehalte. Das in der jetzt vorgelegten Studie untersuchte<br />
»klassische« Produkt stimmte mit einem Wassergehalt (ermittelt<br />
nach Priebe et al.) von 70,5 % sehr gut mit den Normwerten<br />
überein. Ganz anders das »mild gesalzene Erzeugnis«: dessen<br />
Wassergehalt von 81,1 % überschritt deutlich den genannten<br />
Normbereich und belegte den grundsätzlich niedrigeren Qualitätsstandard<br />
dieses Erzeugnisses.<br />
Erhöhter Wassergehalt<br />
Erhärtet wurde dies zusätzlich durch die Ermittlung der Protein-<br />
Anteile (bezogen auf das gesamte Erzeugnis), die die wertmäßigen<br />
Unterschiede zwischen den beiden Erzeugnissen besonders<br />
klar zum Ausdruck brachten. Beim mild gesalzenen Produkt wurde<br />
ein weitaus geringerer Protein-Anteil als beim klassisch hergestellten<br />
und zweifelsfrei als höherwertig auszuzeichnenden Produkt<br />
ermittelt.<br />
Aus den Untersuchungsergebnissen wurde nun deutlich, dass<br />
sich die beiden Produkte nicht im Salzgehalt unterscheiden. Wesentliche<br />
Unterschiede gab es jedoch durch den erhöhten Wasserund<br />
durch den niedrigeren Eiweißgehalt als bei herkömmlicher<br />
Ware.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Der Salzgehalt des »klassischen« Seelachsschnitzels, wie auch der<br />
des »mild gesalzenen« Produktes, lag nahezu auf gleichem Niveau<br />
Die Experten sind daher der Auffassung, dass es sich bei den als<br />
»mild gesalzen« gekennzeichneten Seelachserzeugnissen um ein<br />
Produkt eigener Art handelt, das entsprechend eindeutig gekennzeichnet<br />
werden muss. Das FKN hat zur Problematik der Kennzeichnung<br />
und Verkehrsfähigkeit von »Seelachserzeugnissen«,<br />
»Seelachsschnitzel, mild gesalzen – Lachsersatz« für den »Arbeitskreis<br />
der Lebensmittelhygienisch-tierärztlichen Sachverständigen«<br />
eine entsprechende Stellungnahme erarbeitet. Dieser Position<br />
wurde seitens der »Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene<br />
und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln<br />
tierischer Herkunft« der Länderarbeitsgemeinschaft gesundheitlicher<br />
Verbraucherschutz zugestimmt, so dass nunmehr eine bundesweit<br />
einheitliche Auffassung dazu vorliegt.<br />
Berges, M. (LUA BRE, Außenstelle BRHV); Dr. Etzel, V. (IfF CUX)<br />
57
58<br />
Ökologische Produkte im Trend<br />
Das Vertrauen der Verbraucher in Produkte mit »Bio«-Hinweis ist<br />
groß und Erzeugung und Markt dafür nehmen zu. Neben handwerklichen<br />
Betrieben und Hofläden hat nahezu jede Handelskette<br />
inzwischen ein Bio-Angebot.<br />
»Bio«, »Öko« und »Biosiegel« sind erkennbare Zeichen für Lebensmittel,<br />
Futtermittel und für landwirtschaftliche Erzeugnisse,<br />
die nach den Regeln der EU-Verordnung über den ökologischen<br />
Landbau und über die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen<br />
Erzeugnisse und Lebensmittel (EU-Öko-Verordnung)<br />
erzeugt werden. Entscheidend für kontrollierte Erzeugnisse<br />
ist immer die Angabe der Kontrollstelle. In Deutschland wird<br />
dies durch die folgende Code-Nr.: »DE-0xx-Öko-Kontrollstelle«<br />
gewährleistet.<br />
Die xx stehen dabei für die Ziffer, nach der die Kontrollstelle in<br />
Deutschland registriert ist. Öko-Produkte aus anderen Mitgliedsstaaten<br />
können auch nur den Namen einer Kontrollstelle aufweisen.<br />
Markt für ökologische Lebensmittel und Futtermittel<br />
wächst – Kontrolle ist garantiert<br />
Die in Deutschland für die Kontrolle von Bio-Erzeugnissen zugelassenen<br />
Kontrollstellen sind private Stellen, die durch ihr geprüftes<br />
Kontrollmanagement gewährleisten müssen, dass die Kontrollen<br />
wirksam durchgeführt werden.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> sind derzeit 21 Kontrollstellen tätig, die rund<br />
1.800 Bio-Betriebe kontrollieren. Mindestens einmal im Jahr wird<br />
ein Bio-Betrieb überprüft, es gibt ein festgelegtes Kontrollprogramm.<br />
Das LAVES mit seinem Dezernat »Ökologischer Landbau« überwacht<br />
diese Kontrollstellen unter anderem dadurch, dass es etwa<br />
4 % der Kontrollen begleitet und dass dabei die Umsetzung<br />
des Kontrollprogramms und die Qualität der Kontrollen geprüft<br />
werden. Dieses Kontrollsystem gibt nicht nur dem Verbraucher<br />
Auch Bio-Erzeugnisse aus dem Ausland, wie z. B. Kaffee, werden<br />
nach EU-Regeln an den Erzeugungsstätten kontrolliert<br />
die Sicherheit bei Bio-Erzeugnissen, sondern auch der konkurrierenden<br />
Wirtschaft die Gewähr, wirklich Bio-Produkte zu handeln<br />
und zu verarbeiten.<br />
Durch Änderung der EG-Öko-Verordnung im Juli 2005 ist die<br />
letzte Lücke im Warenstrom von Bio-Lebensmitteln geschlossen<br />
worden. Nun unterliegt auch der Großhandel mit seinem Warenfluss<br />
der Kontrolle. Der Einzelhandel ist von der Kontrolle ausgenommen,<br />
wenn er verpackte Erzeugnisse vermarktet oder nur<br />
vor den Augen des Kunden einen Teil eines Originalgebindes abnimmt.<br />
Bei eigener Bio-Kennzeichnung wird auch der Einzelhandel<br />
kontrollpflichtig.<br />
Bio-Erzeugnisse aus nicht EU-Staaten, wie z. B. manche Gewürze,<br />
exotische Früchte, Kaffee, Tee, Kakao, die in der EU vermarktet<br />
werden, werden an den Erzeugungsstätten nach den gleichen<br />
Regeln wie innerhalb der EU vorgesehen, kontrolliert. Auch hier<br />
ist also eine Kontrolle garantiert, bevor die Produkte überhaupt<br />
die EU erreichen.<br />
Rohrdanz, D. (Dez. 42)
Schutz der »Kleinen Verbraucher« in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Eine Verbrauchergruppe liegt dem Gesetzgeber besonders am<br />
Herzen, und das sind unsere Kleinsten. Säuglinge (laut gesetzlicher<br />
Definition Kinder bis zu einem Lebensjahr) und Kleinkinder<br />
(ein bis drei Jahre alt) sind ganz besonders schutzbedürftig, und<br />
daher sind die Lebensmittel, die für sie bestimmt sind, auch außerordentlich<br />
streng geregelt. Die Diätverordnung macht sehr genaue<br />
und umfangreiche Vorgaben zur Zusammensetzung und<br />
zur Kennzeichnung der verschiedenen Säuglings- und Kleinkinder-Lebensmittel,<br />
die natürlich regelmäßig überprüft werden.<br />
Irreführende Werbung für Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
Bei der Durchsicht der Verpackungen der unterschiedlichen Produkte<br />
fallen einige Werbebehauptungen auf. So werden viele<br />
Gläschen mit der Aussage »natriumreduziert lt. Gesetz« ausgelobt.<br />
Für Beikost – so die »offizielle« Bezeichnung für Gläschennahrung<br />
– sieht die Diätverordnung einen Höchstwert an Natrium<br />
von 200 mg/100 g vor. Dieser wird in der Regel eingehalten. Allerdings<br />
werden auch solche Produkte mit der Angabe »natriumreduziert«<br />
beworben, deren Natriumgehalt mit 180 mg oder gar<br />
190 mg pro 100 g nur sehr knapp unter der vorgeschriebenen<br />
Höchstmenge liegt. Nach Meinung der Experten des Lebensmittelinstitutes<br />
Oldenburg des LAVES trägt diese Aussage in solchen<br />
Fällen zur Irreführung des Verbrauchers bei, deshalb werden diese<br />
Proben immer wieder beanstandet. Weist ein Produkt einen solch<br />
hohen Natriumwert auf, muss der Hersteller seine Rezeptur nicht<br />
ändern, er hält ja die Höchstmenge ein, aber er darf sein Produkt<br />
dann nicht als »natriumreduziert« ausloben. Übrigens empfiehlt<br />
das Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund, auf einen<br />
Zusatz von Salz, also auch jodiertem Speisesalz, zu Beikost<br />
völlig zu verzichten. Ein Blick ins Zutatenverzeichnis lohnt sich<br />
hier also.<br />
Vorsicht geboten ist auch bei der Aussage »kristallzuckerfrei«.<br />
Bei Kristallzucker handelt es sich um Saccharose, unseren gewöhnlichen<br />
Haushaltszucker, das am häufigsten verwendete Lebensmittel,<br />
wenn es um süßen Geschmack geht. Ins Gerede gekommen<br />
ist er, weil er Karies auslöst, eine Krankheit, die schon vor<br />
dem Durchbruch der ersten Zähnchen beginnen kann. Von dem<br />
Zusatz von Kristallzucker wird daher abgeraten. Zudem fördert<br />
er die frühzeitige Gewöhnung an den süßen Geschmack. Und<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Fläschchen, Gläschen, Babybrei – Fallstricke in der Werbung für Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
überflüssig ist er auch, da Babies, wenn sie noch nicht an Zucker<br />
gewöhnt sind, ungesüßte Produkte ohne weiteres tolerieren. Die<br />
Angabe »kristallzuckerfrei« stellt also durchaus einen sinnvollen<br />
Hinweis für die Kaufentscheidung dar. Aber Vorsicht: Nicht nur<br />
Saccharose ist an der Entstehung von Karies beteiligt, auch andere<br />
Zucker tragen dazu bei, und die können sich verbergen hinter<br />
Angaben wie »Fructose«, »Fruchtzucker«, »Glucose«, »Glucosesirup«,<br />
»Honig«, »Maltodextrin«, »Maltose« sowie verschiedenen<br />
Dicksäften und Sirupen. Auch hier sollte man sich also<br />
das Zutatenverzeichnis genauer anschauen. Die Angabe »kristallzuckerfrei«<br />
bedeutet nicht »zuckerfrei«; sie dient in vielen Fällen<br />
eher dazu, einen Zusatz anderer Zucker zu »vertuschen«.<br />
Aber nicht alle Werbeaussagen müssen misstrauisch machen. So<br />
sind z. B. die Angaben »glutenfrei« bzw. »glutenhaltig« bei Produkten<br />
für Kinder unter sechs Monaten gesetzlich vorgeschrieben.<br />
Bei Gluten handelt es sich um das so genannte Klebereiweiß,<br />
das in Weizen und einigen anderen Getreidesorten vorkommt.<br />
Es muss unbedingt vermieden werden von Personen, die<br />
an Zöliakie leiden, einer chronischen Erkrankung der Dünndarmschleimhaut.<br />
59
60<br />
Häufig beworben: Vitamine<br />
Die Angabe »ohne Milcheiweiß« ist als Allergieinformation äußerst<br />
hilfreich, ebenso wie die Werbebehauptungen »ohne Verdickungsmittel«<br />
und »ohne Aromastoffzusatz« sinnvolle Hinweise<br />
bei der Kaufentscheidung liefern, wenn man Zusatz- und Aromastoffe<br />
vermeiden möchte. Die Angaben »ohne Konservierungsstoffe«<br />
oder »ohne Farbstoffe« mit dem Zusatz »lt. Gesetz«<br />
sind dagegen eigentlich überflüssig, da Konservierungs- und<br />
Farbstoffe für Babynahrung ohnehin nicht zugelassen sind.<br />
Sehr häufig beworben werden Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.<br />
Ihre Verwendung scheint ein Garant für Qualität<br />
zu sein - frei nach dem Motto „je mehr, desto besser“. Dem ist<br />
nicht ganz so. Natürlich sind die genannten Nährstoffe unentbehrlich<br />
für jeden Menschen und ganz besonders wichtig für<br />
Wachstum und Entwicklung von Kindern. Nicht bekannt ist jedoch<br />
häufig, dass es auch Hypervitaminosen gibt, also Krankheitserscheinungen<br />
bei der Gabe von zu hohen Dosen eines Vitamins.<br />
Beispiele hierfür sind die Vitamine A und D. Daher hat der Gesetzgeber<br />
den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen<br />
sehr genau geregelt, und zwar um so strenger, je jünger<br />
die Personengruppe ist, für die das Lebensmittel vorgesehen<br />
ist. Bei Säuglingsanfangsnahrung, die als ausschließliche Nahrungsquelle<br />
in den ersten Lebensmonaten dient, wenn nicht gestillt<br />
wird, sind beispielsweise alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente<br />
mit Mindest- und zum Teil mit Höchstmengen festgelegt.<br />
Produkte für ältere Säuglinge und Kleinkinder sind nicht<br />
ganz so streng geregelt, hier sind nur einige dieser Nährstoffe<br />
vorgeschrieben. Werden nun weitere Vitamine, Mineralstoffe oder<br />
Spurenelemente in sinnvollen Mengen zugesetzt, so mag das<br />
durchaus einen Zusatznutzen erbringen, und es ist das gute Recht<br />
des Herstellers, diese Besonderheiten werblich hervorzuheben.<br />
Nicht rechtmäßig ist allerdings die Auslobung eines Nährstoffes,<br />
der ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. So musste die Angabe<br />
»mit Vitamin B1« bei einer Probe Kekse für Kleinkinder, die ohnehin<br />
Vitamin B1 enthalten müssen, als Werbung mit Selbstverständlichkeiten<br />
beanstandet werden.<br />
Unbegrenzt scheint darüber hinaus der Ideenreichtum, mit dem<br />
Hersteller immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen.<br />
»Getreidebrei Straciatella«, »Trinkmahlzeit Butterkeks Biskuit«,<br />
»Mediterrane Tomatensuppe« sind nur einige interessante Beispiele<br />
aus diesem Sortiment. Nährwert und Geschmack dieser<br />
Lebensmittel sind durchaus zufrieden stellend, allerdings scheint<br />
es zweifelhaft, ob solche neuartigen Kreationen für die Kleinen<br />
tatsächlich von Nutzen sind. Vermutlich sollen sie vor allem »Mamas«<br />
Fantasie anregen. Auch hier sei noch einmal das Forschungsinstitut<br />
für Kinderernährung zitiert: »Die Produkte sollten möglichst<br />
frei von geschmacksgebenden Zutaten wie Gewürzen, Nüssen,<br />
Schokolade, Kakao, Aromen etc. sein. So können potentielle<br />
Allergieauslöser vermieden werden. Zudem haben Säuglinge<br />
einen sehr fein ausgeprägten Geschmackssinn.«<br />
Detaillierte Informationen zu den in <strong>Niedersachsen</strong> im Jahr 2006<br />
durchgeführten Untersuchungen finden Sie im Internet unter<br />
www.laves.niedersachsen.de in Kapitel 4.16.25 des Jahresberichtes.<br />
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Säuglings- und Kleinkindernahrung,<br />
die bei uns auf dem Markt ist, streng kontrolliert und<br />
qualitativ hochwertig ist, aber es ist durchaus empfehlenswert,<br />
die Kennzeichnung aufmerksam zu lesen und die Produkte kritisch<br />
auszuwählen.<br />
Dr. Nutt, S.; Dr. Morales Coello, G. (LI OL)<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung sollte frei sein von potenziellen<br />
Allergieauslösern, wie z. B. Gewürzen, Nüssen, Kakao, Aromen, etc.
Cumarin in zimthaltigen Lebensmitteln:<br />
besonders für Kinder bedenklich<br />
Zimt wird seit langer Zeit als würzende Zutat zur Zubereitung von<br />
zahlreichen Speisen und Getränken verwendet. In Europa wird<br />
Zimt in der häuslichen wie in der industriellen Verarbeitung hauptsächlich<br />
zur Zubereitung von Backwaren, Frühstückscerealien, Getränken<br />
und Milcherzeugnissen eingesetzt und ist gerade in den<br />
Rezepten der vorweihnachtlichen Küche ein wichtiger Bestandteil.<br />
Einige Zimtsorten enthalten den in der Pflanzenwelt weit verbreiteten<br />
natürlichen Aromastoff Cumarin in beachtlichen Konzentrationen.<br />
Toxikologische Untersuchungen und Bewertungen der<br />
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und des<br />
deutschen Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) haben ergeben,<br />
dass bei übermäßiger Aufnahme von Cumarin eine leberschädigende<br />
Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Bei<br />
normalen Verzehrgewohnheiten eines erwachsenen Menschens<br />
wird die aus toxikologischer Sicht akzeptable tägliche Aufnahmemenge<br />
an Cumarin jedoch nicht überschritten. Diese akzeptablen<br />
Aufnahmemengen können bei Kindern jedoch aufgrund des geringeren<br />
Körpergewichts überschritten werden. Diese neue Erkenntnislage<br />
hat das LAVES in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen<br />
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und den kommunalen<br />
Lebensmittelüberwachungsbehörden dazu bewogen, kurzfristig<br />
ein Überwachungsprogramm hinsichtlich Cumarin in zimthaltigen<br />
Lebensmitteln zu organisieren und durchzuführen.<br />
Innerhalb kürzester Zeit wurden Probenahmen koordiniert und<br />
entsprechende laboranalytische Untersuchungskapazitäten aufgebaut.<br />
Bis Ende 2006 konnten somit in den LAVES-Instituten<br />
insgesamt 309 Lebensmittel (z. B. Backwaren, Milcherzeugnisse,<br />
Frühstückscerealien, Glühwein, Kinderpunsch) auf deren Cumaringehalte<br />
untersucht werden.<br />
Im Ergebnis wurden zehn Beanstandungen aufgrund erhöhter<br />
Gehalte ausgesprochen. Diese Lebensmittel wurden daraufhin<br />
sofort aus dem Handel genommen.<br />
Zeitgleich hat eine Information der Verbraucher über den aktuellen<br />
Sachstand und daraus resultierende Verzehrsempfehlungen<br />
durch Pressemitteilungen und Internetveröffentlichungen stattgefunden.<br />
Die niedersächsischen Untersuchungsergebnisse wurden<br />
zeitnah auf der Homepage des LAVES unter Nennung der<br />
Produkte und Hersteller veröffentlicht – ein gutes Beispiel für<br />
den effektiven transparenten Verbraucherschutz in <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Lay, J. (Dez. 21)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Gerade in den Rezepten der vorweihnachtlichen Küche ist Zimt ein<br />
wichtiger Bestandteil<br />
61
62<br />
Holzspielzeug für Kinder formaldehydfrei?<br />
Holzspielzeug für Kinder sollte frei von gesundheitsgefährdenden<br />
Stoffen sein. Die Experten des Institutes für Bedarfsgegenstände<br />
Lüneburg haben darauf ein Augenmerk ihrer Untersuchungen<br />
gelegt. Denn zahlreiches Holzspielzeug (z. B. Puzzles, Lege- und<br />
Steckspiele) wird aus verleimten Holzwerkstoffen wie Sperrholz,<br />
Holzfaserplatten oder Spannplatten hergestellt. Zur Verleimung<br />
nutzen die Hersteller oftmals formaldehydhaltige Kunstharze.<br />
Formaldehyd ist bei Raumtemperatur ein farbloses, auch in geringen<br />
Konzentrationen stechend riechendes Gas. Es wirkt reizend<br />
auf Haut, Augen, Schleimhaut und Atemwege. Die schädliche<br />
Wirkung von Formaldehyd ist konzentrationsabhängig. Schon<br />
geringe Mengen können Allergien verursachen sowie Übelkeit<br />
und Kopfschmerzen hervorrufen. Nach einer wissenschaftlichen<br />
Bewertung neuer Studien durch das Bundesinstitut für Risikobewertung<br />
(BfR) kann Formaldehyd, wenn es eingeatmet wird,<br />
Krebs im Nasen-Rachenraum auslösen. Gehalte von oder unterhalb<br />
von 0,125 mg Formaldehyd pro m 3 Raumluft werden vom<br />
BfR als sicher angesehen. Unterhalb dieser Konzentration ist eine<br />
krebsauslösende Wirkung nicht zu erwarten.<br />
In der Chemikalien-Verbotsverordnung ist festgelegt, dass höchstens<br />
0,1 ml Formaldehyd pro m 3 Innenraumluft, entsprechend<br />
0,12 mg pro m 3 von Holzwerkstoffen abgegeben werden dürfen.<br />
Nach einer Stellungnahme des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes<br />
entspricht dieser Wert annähernd einem Gehalt von 110<br />
mg Formaldehyd pro kg Holzwerkstoff, ermittelt unter definierten<br />
Prüfbedingungen.<br />
Holzspielzeug für Kinder unter drei Jahren darf nach EU-Norm<br />
nicht mehr als 80 mg Formaldehyd pro kg Holzwerkstoff innerhalb<br />
von drei Stunden an die Raumluft abgeben.<br />
2006 hat das Lüneburger Institut des LAVES im Rahmen des bundesweiten<br />
Überwachungsprogramms 45 Puzzles, Lege- und<br />
Steckspiele aus Holz auf ihren Gehalt an Formaldehyd, der an<br />
die Raumluft abgegeben wird, untersucht. Es wurden die Abgabewerte<br />
über den Dampfraum in Wasser nach drei Stunden sowie<br />
nach 24 Stunden ermittelt. Nur eine der untersuchten Proben<br />
überschritt den angeführten Grenzwert von 80 mg nach der<br />
3-Stunden-Migration. Allerdings war dieses Spielzeug für Kinder<br />
bestimmt, die älter als drei Jahre sind. Der überwiegende Anteil<br />
der untersuchten Produkte (80 %) gab nach drei Stunden weniger<br />
als 10 mg Formaldehyd pro kg Holzspielzeug ab.<br />
Nach 24 Stunden drei Proben formaldehydabgabefrei<br />
Nach 24 Stunden wiesen acht der untersuchten Proben Formaldehyd-Abgaben<br />
von mehr als 110 mg pro kg Spielzeugmaterial<br />
auf. Unter Berücksichtigung des Gesamtgewichtes des jeweiligen<br />
Holzspielzeugs, der Größe und des Raumvolumens eines durchschnittlichen<br />
Kinderzimmers sowie der möglichen Luftwechselrate<br />
gaben drei dieser Proben mehr als den als unbedenklich<br />
empfohlenen Gehalt ab. Es wurde eine Kontrolle der Maßnahmen<br />
empfohlen, zu denen der Hersteller als Nachweis für die<br />
Sicherheit des Spielzeugs verpflichtet ist, bzw. die Überprüfung<br />
der eingesetzten Rohstoffe angeraten. Hierdurch sollte eine Reduzierung<br />
der Formaldehydabgabe erreicht werden. Auffällig<br />
war, dass nur drei Proben bzw. Teilproben formaldehydabgabefrei<br />
waren bzw. die Abgabewerte unterhalb der Nachweisgrenze<br />
lagen (24-Stunden-Migration).<br />
Zusammenfassend waren bei mehr als 80 % des untersuchten<br />
Holzspielzeugs die Formaldehyd-Abgaben als unbedenklich zu<br />
bewerten.<br />
Schnug-Reuter, B. (IfB LG)<br />
Holzspielzeug für Kinder sollte frei sein von gesundheitsgefährdenden<br />
Stoffen
Rückstände in Lebensmitteln<br />
Neue Untersuchungsergebnisse zu Schimmelpilzgiften (Mykotoxinen)<br />
Mykotoxine sind Giftstoffe, die von Schimmelpilzen gebildet werden<br />
und weitgehend hitzestabil sind. Durch den Verarbeitungsprozess<br />
werden sie nicht zerstört und können somit auch im<br />
Endprodukt noch in hohen Mengen vorhanden sein. Während<br />
verschimmelte Lebensmittel im Haushalt leicht erkannt werden<br />
können, ist dem verpackten Lebensmittel nicht anzusehen, ob<br />
kontaminierte Rohware verarbeitet wurde.<br />
Das LAVES hat dazu eine Broschüre herausgegeben, im Internet<br />
zu finden unter:<br />
www.laves.niedersachsen.de/master/C15118412_N1223_L<br />
20_D0_I826.html<br />
Allein im zweiten Halbjahr des Jahres 2006 waren Mykotoxine<br />
rund 400-mal Anlass für Meldungen im Schnellwarnsystem. In<br />
15 Fällen musste die bereits ausgelieferte Ware wieder zurückgerufen<br />
werden. Seitdem im Jahre 1960 Aflatoxine als Ursache für<br />
das Massensterben von jungen Puten entdeckt wurden, hat sich<br />
auch in der Lebens- und Futtermittelüberwachung die Erkenntnis<br />
durchgesetzt, dass die Giftstoffe der Schimmelpilze eine bedeutende<br />
Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Für den Lebensmittelbereich<br />
sind allerdings nur wenige der über 300 verschiedenen<br />
Mykotoxine von Bedeutung (dazu im Internet des LAVES<br />
mehr unter:<br />
www.laves.niedersachsen.de/master/C4077834_N1245_L2<br />
0_D0_I826.html).<br />
Hierzu zählen die Aflatoxine, Ochratoxin A (OTA), die Fusarientoxine<br />
Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZON), T2- und HT2-<br />
Toxin und die Fumonisine, Patulin und außerdem die Mutterkornalkaloide,<br />
die seit 2004 wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit<br />
gerückt sind (auch hierzu mehr im Internet des LAVES unter:<br />
www.laves.niedersachsen.de/master/C12527064_N1225_L<br />
20_D0_I826).<br />
Im Lebensmittelinstitut Braunschweig des LAVES ist seit Anfang<br />
2005 der Schwerpunkt für Mykotoxinuntersuchungen angesiedelt.<br />
Hier wurden 2006 über 2.000 Untersuchungen auf verschiedene<br />
Mykotoxine durchgeführt. Dafür wurden sowohl Einzelals<br />
auch Multimethoden eingesetzt.<br />
In 37,4 % der Fälle ergaben die Untersuchungen positive Befunde.<br />
Prozentual am häufigsten wurden Fumonisine (Gifte der Fusarien<br />
– Fusarien: Gattung der Schimmelpilze, die meist in pflanzlichem<br />
Gewebe wachsen) nachgewiesen, die in 77 % der auf<br />
diese Mykotoxine untersuchten Lebensmittel enthalten waren.<br />
Der höchste Wert von 2082 µg (ein Millionstel Gramm)/kg, der<br />
in einem Maismehl ermittelt wurde, entspricht der vierfachen<br />
Höchstmenge von 500 µg/kg.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>7: TDI*-Werte von Fusarien-Toxinen<br />
TDI*-Werte von Fusarien-Toxinen in µg/kg Körpergewicht und Tag<br />
Deoxynivalenol (DON)<br />
Nivalenol<br />
Summe aus T2- und HT2-Toxin<br />
Zearalenon (ZON)<br />
Summe aus Fumonisin B 1 und B 2<br />
* tolerierbare tägliche Aufnahme<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
1<br />
0,7<br />
0,06<br />
Eine Portion Polenta, die aus diesem Maismehl zubereitet würde,<br />
enthielte 83 µg Fumonisine und würde den TDI (Tolerable Daily<br />
Intake – die tolerierbare tägliche Aufnahme von Wirkstoffen) für<br />
einen 60 kg schweren Menschen zu 70 % ausschöpfen. Für ein<br />
40 kg schweres Schulkind wäre die tolerierbare tägliche Aufnahme<br />
an Fumonisinen bereits mit dieser einen Portion Polenta vollständig<br />
ausgeschöpft. Während die Fumonisine und auch das<br />
Zearalenon in größeren Mengen hauptsächlich in Maisprodukten<br />
zu finden sind, kommt das am weitesten verbreitete Fusarientoxin,<br />
das DON, im Wesentlichen in Getreide und Getreideprodukten<br />
vor. 1998 waren aufgrund der ungünstigen Witterung 93 %<br />
des Getreides in Norddeutschland mit Fusarien befallen und die<br />
in den darauf folgenden Jahren im bundesweiten Lebensmittelmonitoring<br />
ausgewerteten Daten zeigten, dass der TDI für DON<br />
zu etwa 80 % ausgeschöpft wurde. In einer 2001 veröffentlichten<br />
0,2<br />
2<br />
63
64<br />
niederländischen Studie wurde darauf hingewiesen, dass durch<br />
die durchschnittliche DON-Belastung des niederländischen Weizens<br />
bei 80 % der einjährigen Kinder und bei 50 % der vierjährigen<br />
Kinder der TDI überschritten wurde. Die Forschungsergebnisse<br />
des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) zeigten,<br />
dass in den Jahren 2001 bis 2004 bei fast 30 % der vier- bis<br />
sechsjährigen Kinder der TDI überschritten wurde und damit mehr<br />
DON aufgenommen wurde als aus Sicht des vorbeugenden Verbraucherschutzes<br />
tolerierbar war.<br />
Im Jahr 2006 ging die Belastung der Lebensmittel mit DON stark<br />
zurück. Der höchste im Lebensmittelinstitut Braunschweig gefundene<br />
Wert lag bei 243 µg/kg, nachgewiesen in Nudeln. Aus Sicht<br />
des BfR lassen sich Überschreitungen der duldbaren täglichen<br />
DON-Aufnahme, insbesondere auch bei Kindern nur dann vermeiden,<br />
wenn die DON-Belastung bei Lebensmitteln, besonders<br />
bei Brot, Brötchen und Teigwaren auf Werte unter 100 µg/kg<br />
minimiert werden.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen im Einzelnen sind, auch für<br />
weitere Mykotoxine, im Kapitel 4.17.4 im Internet unter<br />
www.laves.niedersachsen.de zusammengestellt.<br />
Dr. Reinhold, L. (LI BS)<br />
Der höchste Wert von Mykotoxinen wurde in einem Maismehl<br />
gefunden. Er entsprach etwa dem vierfachen der tolerierbaren<br />
Höchstmenge<br />
Mehrfachrückstände von Pflanzenschutzmitteln<br />
in Obst und Gemüse: sind Mischproben<br />
repräsentativ?<br />
Die Ergebnisse der Rückstandsuntersuchungen an Obst- und Gemüseproben<br />
aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass<br />
die Anzahl der nachgewiesenen Wirkstoffe und die Anzahl an<br />
Proben mit Mehrfachrückständen stetig zugenommen haben. Die<br />
Gründe für diese Entwicklung sind sehr vielfältig. Insbesondere<br />
als Folge des Einsatzes neuerer und empfindlicherer Analysentechnik<br />
steigt der Anteil an Proben mit nachweisbaren Pestizidrückständen<br />
und ebenso die Anzahl der Wirkstoffe pro Probe.<br />
Auch die Anwendungspraxis von Pflanzenschutzmitteln (PSM)<br />
hat sich gewandelt. Bei vielen Kulturen werden die PSM als Kombinationspräparate<br />
eingesetzt, das heißt, sie bestehen aus mehreren<br />
Wirkstoffen.<br />
Die Behandlung unterschiedlicher Krankheiten bzw. Schädlinge<br />
erfordert verschiedene Wirkstoffe, wobei es im Sinne des Pflanzenschutzes<br />
notwendig ist, verschiedene Wirkstoffe auch gegen<br />
gleiche Krankheiten/Schaderreger einzusetzen, um Resistenzen<br />
zu vermeiden. Dazu kommt, dass neuere Pestizide spezifischer<br />
wirken, das heißt, es werden gegen verschiedene Krankheiten/<br />
Schaderreger mehr verschiedene Wirkstoffe benötigt.<br />
Die genannten Gründe erläutern das vermehrte Auftreten von<br />
Mehrfachrückständen und führen gleichzeitig dazu, dass die<br />
Wahrscheinlichkeit von Höchstmengenüberschreitungen abnimmt.<br />
Das heißt, es sind immer häufiger Produkte mit Mehrfachrückständen<br />
auf dem Markt, die aber keinen Anlass zu Beanstandungen<br />
geben, da die gesetzlich festgelegten Höchstmengen<br />
nicht überschritten werden.<br />
Die Probenahme zur Kontrolle der Einhaltung der zulässigen<br />
Höchstwerte für Pestizidrückstände erfolgt nach § 64 des Lebensmittel-<br />
und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Für Gemüse wie<br />
Paprika sind für eine repräsentative Untersuchung auf Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
mindestens zehn Paprikafrüchte mit einem<br />
Gesamtgewicht von mindestens 1 kg erforderlich, aus denen<br />
eine Mischprobe hergestellt wird.
Im Handel findet man häufig Mischungen von Ware verschiedener<br />
Erzeuger. Diese Tatsache führt zu Mischproben aus verschiedenen<br />
Partien, die mit ganz unterschiedlichen Pestiziden<br />
behandelt worden sind. Damit stellen die Analysenergebnisse<br />
aus einer Mischprobe keinen repräsentativen Mittelwert mehr<br />
dar, da gegebenenfalls jede Paprikafrucht mit anderen Pestiziden<br />
behandelt worden sein kann. Eine sachgerechte Beurteilung der<br />
Ergebnisse von Mehrfachrückständen entsprechender Proben<br />
ist problematisch, da einzelne Früchte durchaus Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
über der Höchstmenge enthalten können, während<br />
andere Früchte der gleichen Probe keine Rückstände aufweisen.<br />
In Expertenkreisen wird derzeit die Frage nach einer möglichen<br />
Beurteilung von Mehrfachrückständen eingehend diskutiert.<br />
Monitoring: »Einzelfruchtanalyse von Paprika«<br />
Um diesem Sachverhalt nachzugehen, wurde im Rahmen des Lebensmittel-Monitorings<br />
2006 im Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
des LAVES ein Projekt »Einzelfruchtanalyse von Paprika« bearbeitet.<br />
Für dieses Projekt wurde keine Mischprobe, sondern jede der<br />
zehn einzelnen Früchte separat untersucht, um grundsätzliche Informationen<br />
über die Notwendigkeit und die Praktikabilität von<br />
Einzelfruchtanalysen zu gewinnen und daraus möglicherweise<br />
später eine risikoorientierte Beurteilungspraxis zu erarbeiten.<br />
Im Lebensmittelinstitut Oldenburg wurden im Rahmen dieses<br />
Projektes drei Proben spanischer Paprika untersucht, bestehend<br />
aus je zehn Früchten.<br />
Die Untersuchungsergebnisse sind in dieser Grafik dargestellt:<br />
Abbildung <strong>3.</strong>1: Einzelfruchtanalyse Paprika<br />
Anzahl Wirkstoffe<br />
Einzelfruchtanalyse Paprika<br />
Nummer der einzelnen Paprikafrüchte<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Die Belastung der einzelnen Proben war sehr unterschiedlich. Auf<br />
den Einzelfrüchten bei Probe 1 fanden sich zwischen drei bis zu<br />
zwölf verschiedene Wirkstoffe, was darauf hin deutet, dass diese<br />
Probe eine Mischung aus Früchten verschiedener Kulturen war.<br />
In Probe 3 dagegen konnte auf allen zehn Früchten ein und derselbe<br />
Wirkstoff nachgewiesen werden, weshalb diese Früchte<br />
höchstwahrscheinlich aus einer Kultur stammten.<br />
An dieser Verteilung der Wirkstoffe und der Mehrfachrückstände<br />
wird deutlich, dass die bisherige Untersuchungs- und Beurteilungspraxis,<br />
nämlich die Untersuchung einer Mischprobe, bei<br />
Proben wie z. B. hier Paprika, kein Ergebnis liefert, das ein mögliches<br />
gesundheitliches Risiko für den Verbraucher zufrieden stellend<br />
beschreibt. Wenn in einer Mischprobe keine Höchstmengenüberschreitung<br />
festgestellt wird, ist nicht ausgeschlossen, dass eine<br />
Einzelfrucht gegebenenfalls einen Wirkstoffgehalt oberhalb einer<br />
Höchstgrenze aufweist. Ebenso können Mehrfachrückstände<br />
in einer Mischprobe auf Einzelfrüchte aus verschiedenen Anbauorten<br />
zurückzuführen sein.<br />
Die Auswertung dieses bundesweit durchgeführten Monitoring-<br />
Projektes wird im Bericht zur Lebensmittelsicherheit 2006 des<br />
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(BVL) veröffentlicht.<br />
Schon das Ergebnis der wenigen hier durchgeführten Untersuchungen<br />
zeigt, dass die Notwendigkeit besteht, an dieser Thematik<br />
der Einzelfruchtanalysen und in diesem Zusammenhang an<br />
der Problematik der Beurteilung von Mehrfachrückständen weiterzuarbeiten.<br />
Im laufenden Jahr 2007 soll ergänzend eine Einzelfruchtanalyse<br />
an Trauben (Traubenbüscheln) durchgeführt<br />
werden.<br />
Richter, A. (LI OL)<br />
65
66<br />
Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich bleibt Thema<br />
Einwandfreie Lebensmittelhygiene im Einzelhandel notwendig<br />
Krabbelnde, kriechende oder fliegende Tiere sind mit dem Grundgedanken<br />
an eine einwandfreie Lebensmittelhygiene nicht zu<br />
vereinbaren, da von diesen Tieren bei direktem oder indirektem<br />
Kontakt mit den Lebensmitteln Krankheiten auf den Menschen<br />
übertragen werden können. Darüber hinaus spielt die ekelerregende<br />
Wirkung beim Verbraucher eine große Rolle: Rattenknochen<br />
im Müsli, Mäusekot in der Backstube oder Fliegenlarven auf<br />
Obst und Gemüse sind nicht zu akzeptieren. Lebensmittelunternehmer<br />
sind daher rechtlich verpflichtet, eine regelmäßige und<br />
sachgerechte Schädlingsbekämpfung durchzuführen. Das betrifft<br />
alle Produktions- und Vermarktungsstufen entlang der gesamten<br />
Prozesskette. Denn überall dort, wo Lebensmittel hergestellt, verarbeitet,<br />
gelagert oder an den Verbraucher abgegeben werden,<br />
können sich Schädlinge gut ernähren und vermehren.<br />
Besondere Problembereiche im Lebensmitteleinzelhandel wurden<br />
durch die Zusammenarbeit einer kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörde<br />
mit dem LAVES identifiziert: Kartonagenpressen<br />
und Leergutrücknahmeautomaten.<br />
Aufgrund des sehr hohen Anfalls von Kartonverpackungsmaterial<br />
im Lebensmitteleinzelhandel wird nahezu in jedem Verbrauchermarkt<br />
eine Kartonagepresse zur Komprimierung und vorbereitenden<br />
Entsorgung vorgehalten. Diese Anlagen werden oftmals<br />
in Räumen betrieben, in denen auch zum Teil nicht verpackte Lebensmittel<br />
gelagert werden. Im straff organisierten Arbeitsablauf<br />
in den Geschäften des Lebensmitteleinzelhandels kann nicht immer<br />
vermieden werden, dass auch mit Lebensmittelresten behaftete<br />
Kartonagen in die Pressen gelangen. In der Pressanlage<br />
wiederum lagern sich diese Reste in schlecht zugänglichen Ritzen<br />
und Ecken ab und bilden ein hervorragendes Nährmedium für<br />
Insekten. Die Insekten verteilen sich nach ihrem Entwicklungszyklus<br />
im gesamten Lagerbereich und finden somit Zugang zu<br />
den Lebensmitteln. Vorbeugende Abhilfe ist nur durch den Einsatz<br />
von Kartonagenpressen zu erreichen, die leicht zu reinigen<br />
sind und einer regelmäßigen Reinigung unterworfen werden.<br />
Dies allerdings ist bei vielen der derzeit eingesetzten Pressen noch<br />
nicht der Fall.<br />
Schädlingsbekämpfung wichtiger Beitrag zur Sicherung<br />
einer gesunden Lebensmittelkette<br />
Auch in einem weiteren Bereich des Einzelhandels stellt die intensive<br />
und regelmäßige Reinigung die notwendige Maßnahme<br />
dar, um den Schädlingsbefall zu minimieren: In Automaten zur<br />
Rücknahme von Pfandflaschen. Seit kurzer Zeit setzt der Lebensmitteleinzelhandel<br />
unterschiedliche Rücknahmesysteme ein, um<br />
den stark angestiegenen Rücklauf von Pfandflaschen zu organisieren.<br />
Teilweise werden diese Geräte im Verkaufsraum so betrieben,<br />
dass die vom Kunden in den Automaten gesteckten Kunststoffflaschen<br />
aufgeschlitzt und komprimiert werden. Die bei diesem<br />
Vorgang entweichende Restflüssigkeit sammelt sich dabei<br />
in den Automaten und bildet ein gutes Nährmedium für Insekten.<br />
Kartonagepresse im Lebensmitteleinzelhandel zur Komprimierung<br />
und Entsorgung
Wenn die Geräte nicht einer regelmäßigen Reinigung unterzogen<br />
werden, stellt sich insbesondere in den Sommermonaten ein starker<br />
Befall mit Fruchtfliegen ein. Diese Insekten können sich dann<br />
im Verkaufsraum verteilen und werden auch von nicht verpacktem<br />
Obst und Gemüse angezogen. Zudem geht durch den einsetzenden<br />
Gärprozess von den Getränkerückständen ein unangenehmer<br />
Geruch aus.<br />
Die verantwortlichen Lebensmittelunternehmer haben Maßnahmen<br />
ergriffen, um diese Missstände abzustellen.<br />
Das LAVES beabsichtigt, zusammen mit den kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
die Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen<br />
durch den Lebensmitteleinzelhandel<br />
intensiver zu kontrollieren.<br />
Lay, J. (Dez. 21); Dr. Freise, J. F. (Dez. 32); Dr. Türnau, D. (LK ROW)<br />
Erfolgreiche Rattenbekämpfung im Fischereihafen Cuxhaven<br />
Von der Notwendigkeit amtlicher Kontrollen zeugt dieser Fall, der<br />
deutlich macht, wie wichtig »grenzüberschreitende« Kooperation<br />
zwischen den Behörden und über Landesgrenzen hinaus ist<br />
und funktioniert. Durch in Kisten verpackter Fisch, der zuhauf<br />
im Fischereihafen in Cuxhaven lagert, können Tiere wie Ratten<br />
durch Gerüche angezogen werden. Das erlebte eine amtliche<br />
Tierärztin des Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienstes<br />
des Landes Bremen (LMTVet) im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit<br />
in der Nähe der Produktionslinie eines EUzugelassenen<br />
Fischverarbeitungsbetriebes: umherlaufende Ratten.<br />
Ungewöhnlich für das Auftreten der Ratten innerhalb von geschlossenen<br />
Räumen – eben in den Fischhallen von Cuxhaven –<br />
war der Zeitpunkt, denn es war Frühsommer; ein Jahresabschnitt,<br />
in der Ratten in der freien Natur zur Genüge Nahrung und trockene<br />
Schlafplätze finden.<br />
Der Betrieb und das Dezernat »Lebensmittelüberwachung« sowie<br />
der Fachbereich »Schädlingsbekämpfung« des LAVES wurden<br />
vom LMTVet aus informiert. Der Verwalter der landeseigenen<br />
Immobilien im Fischereihafen Cuxhaven wurde vom LAVES in<br />
Kenntnis gesetzt. Auszugehen war, dass sich die Rattenproblematik<br />
aufgrund der Weitläufigkeit und der Offenheit des Gebäudekomplexes<br />
über weitere Räume der Fischhallen erstrecken<br />
würde. Zwei Mitarbeiter der oben genannten Dezernate des<br />
LAVES kamen nach Cuxhaven und konnten in weiten Teilen der<br />
Im Fischereihaven Cuxhaven fanden Mitarbeiter des LAVES, neben<br />
zahlreichen Spuren für den Rattenbefall, unzureichend gewartete<br />
Rattenfallen<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Fischhallen Rattenkot von Wanderratten entdecken. An einigen<br />
Gummilippen und Wandanschlüssen von Rolltoren waren massive<br />
Nagespuren erkennbar. Im Lagerraum eines registrierten Fischeinzelhändlers<br />
wurden eine mit Loch versehene Styroporkiste<br />
mit Deckel, ein Futternapf mit Katzentrockenfutter, ein Wassernapf<br />
sowie geräucherte Heilbuttabschnitte vorgefunden; vermutlich<br />
eine Katzenlagerstätte. In unmittelbarer Nähe einer Rattenköderstation<br />
wurden etwa 25 Kothaufen vorgefunden, die mit<br />
ziemlicher Sicherheit von Katzen stammten. In einem Lagerraum<br />
eines weiteren Fischeinzelhändlers wurden unzureichend gewartete<br />
Rattenfallen und angenagte sowie ausgefressene Butterportionspackungen<br />
vorgefunden.<br />
67
68<br />
Der nächste besuchte registrierte Fischeinzelhändler führte die<br />
Schädlingsbekämpfung nach eigenen Angaben in seinen Lagerräumen<br />
selbstständig durch. Hier konnten vor Ort frei ausgelegte<br />
Rattenköder verschiedenster Formulierung in unmittelbarer<br />
Nähe von Lebensmitteln (Kartoffeln und Mohrrüben) entdeckt<br />
werden. In einer Styroporkiste wurden frei zugänglich verschiedene<br />
Rattenbekämpfungsmittel aufbewahrt, darunter ein Haftpulver,<br />
das am Fellkleid der Ratten anhaftet, beim Putzen oral<br />
aufgenommen wird und die Tiere anschließend tötet. Offenbar<br />
war dieses Haftpulver frei und unverdeckt ausgebracht worden.<br />
Die Experten gingen davon aus, dass kontaminierte Ratten den<br />
Wirkstoff in den gesamten Lagerbereich verschleppt hatten. Im<br />
Lager des EU-zugelassenen Fisch verarbeitenden Betriebes wurde<br />
der Kadaver einer jungen Wanderratte (seit ca. vier Wochen<br />
tot), zwei sehr alte Köderkisten aus Holz, eine davon mit einem<br />
verlassenen Rattennest sowie frischer Rattenkot vorgefunden.<br />
Ein weiteres Indiz für den Rattenbefall waren im Bereich der Hafenkaje<br />
an einer Gebäudewand gestapelte Fischkisten, die mit<br />
zahlreichen Nagespuren versehen waren.<br />
Neben der Herstellung einer allgemeinen Grundordnung und<br />
Grundhygiene in den Fischhallen, der Beseitigung von Zuwanderungswegen,<br />
der Entfernung von Köderresten und Rattenkadavern,<br />
der Aufstellung von Köderstationen im Außenbereich<br />
Die frei zugängliche Aufbewahrung von Rattenbekämpfungsmitteln<br />
wurde in einem Lager im direktem Umfeld von Lebensmitteln aufgefunden<br />
empfahl das LAVES dem Verwalter, dass alle in den Gebäuden<br />
in der Schädlingsbekämpfung tätigen Personen sich hinsichtlich<br />
der Wirkstoffwahl sowie der Formulierung der Köder absprechen<br />
sollten.<br />
In einer Mieterversammlung, zu der der Verwalter geladen hatte,<br />
wurde eine Hallenordnung beschlossen, die wesentlich zur<br />
Verbesserung der Schadnagersituation beitragen konnte.<br />
Unter Beteiligung des LAVES, des Verwalters, des LMTVet Bremen,<br />
des Veterinäramtes des Landkreises Cuxhaven und der im<br />
Fischereihafen tätigen Schädlingsbekämpfungsfirmen wurden<br />
während eines »Runden Tisches zur Schädlingsbekämpfung« die<br />
Empfehlungen des LAVES zur Rattenbekämpfung vorgetragen<br />
und angenommen.<br />
Im November 2007 wird ein zweiter Runder Tisch stattfinden;<br />
die Experten gehen davon aus, dass bis dahin ein Teil der Rattenpopulation<br />
erfolgreich bekämpft worden ist.<br />
Dr. Jark, U. (Dez. 21); Dr. Freise, J. F. (Dez. 32)<br />
Ein verlassenes Rattennest in einer alten Köderkiste aus Holz. Eines<br />
der vielen Indizien für den Rattenbefall bestimmter Lagerräume im<br />
Fischereihafen Cuxhaven
Fraßschäden an Futtermitteln durch Schädlinge<br />
Auch an Futtermitteln haben die Experten des Futtermittelinstitutes<br />
Stade des LAVES Fraßschäden durch Schädlinge feststellen<br />
können. So fielen Futtererbsen durch ihre unregelmäßige Oberfläche<br />
und durch zahlreiche Einbuchtungen auf. Da nicht erkennbar<br />
war, ob es sich um mechanische Zerstörungen (Ernte) oder<br />
um Fraßspuren von Schädlingen handelte, kamen als Spezialisten<br />
Schädlingsbekämpfer aus dem LAVES zum Einsatz. Diese konnten<br />
über ein Hochleistungsstereomikroskop an vielen Erbsen<br />
Fraßspuren von Kleinlebewesen feststellen. Die Erbsen wiesen<br />
darüber hinaus Kot-, Häutungs- und Gespinstreste von Kleinstschmetterlingsraupen<br />
auf.<br />
Die eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Tierart war aufgrund<br />
der fortgeschrittenen Eintrocknung schwierig. Mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit handelte es sich hier aber um Raupen des<br />
sogenannten Erbsenwicklers (Cydia nigricana).<br />
Der Befall findet in der Regel bereits auf dem Feld statt. Die Eiablage<br />
erfolgt im Sommer an den Blüten- und Kelchblättern. Die<br />
schlüpfenden Raupen bohren sich in die Schoten ein und erzeugen<br />
erhebliche Fraßschäden an den Samenkörnern. Das führt<br />
zu Qualitätsverlusten und Ertragsminderungen. Die Fraßperiode<br />
der Raupen dauert etwa drei Wochen. Danach verlassen die Raupen<br />
die aufplatzenden Hülsen der Futterpflanze und wandern<br />
in den Boden ab, wo sie sich verpuppen.<br />
Gravierende Veränderungen wie in diesem Fall blieben zwar bisher<br />
die Ausnahme, sollen aber dennoch dokumentieren, dass<br />
Landwirte mit dem Befall von Schädlingen an ihren Ernteerzeugnissen<br />
rechnen müssen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Ungeziefer im Weizen<br />
Bei der mikrobiologischen Untersuchung von Weizen fiel im Futtermittelinstitut<br />
in Stade eine Vielzahl an gekeimten Körnern auf.<br />
Geruchsabweichungen – typisch für mikrobiell verdorbenen Weizen<br />
– wurden festgestellt.<br />
Im Ergebnis wurde ein überhöhter Gehalt an verderbanzeigenden<br />
Bakterien und Schimmelpilzen sowie Hefen festgestellt. Unter<br />
dem Mikroskop machten die Spezialisten des Fachbereiches<br />
»Schädlingsbekämpfung« eine erstaunliche Entdeckung: Der<br />
Weizen enthielt ein ganzes Spektrum verschiedenster Vorratsschädlinge:<br />
Behaarte Baumschwammkäfer (Typhaea stercorea),<br />
Rotbraune Reismehlkäfer (Tribolium castaneum), Rotbraune Leistenkopfplattkäfer<br />
(Laemophloeus ferrugineus), Getreideplattkäfer<br />
(Oryzaephilus surinamensis), Schimmelplattkäfer (Ahasverus<br />
advena), Modermilben (Tyroglyphidae), Raubmilben (Gamasina),<br />
Pseudoskorpione (Chelifer spec.) und Erzwespen (Terebrantes).<br />
Mit Ausnahme der Wespen sind die Schädlinge den primären<br />
oder sekundären Vorratsschädlingen zuzuordnen, die auch als<br />
Feuchtigkeitsanzeiger gelten.<br />
Diese Untersuchungsergebnisse lassen auf eine unsachgemäße<br />
Lagerung (Feuchtigkeit) des Getreides schließen. Von einer Verfütterung<br />
derartig veränderten Getreides rieten die Experten ab.<br />
Stelling, K. (Dez. 32); Dr. Ady, G. (FI STD)<br />
69
70<br />
Gentechnik in Lebensmitteln<br />
Nicht zugelassene gentechnisch veränderte Bestandteile in Lebens- und Futtermitteln in der EU<br />
Im August 2006 gaben die in den USA mit Landwirtschaft und<br />
Lebensmittelsicherheit befassten Behörden USDA und FDA bekannt,<br />
dass auf dem nordamerikanischen Markt befindliche Reischargen<br />
in Spuren nicht zugelassene gentechnisch veränderte<br />
Reiskörner enthielten. Die nachgewiesene Reislinie LL601 (auch<br />
als LLRICE601 bezeichnet) war weder in der EU noch in den USA<br />
für den Handel oder den Anbau zugelassen. Da Langkorn-Reis<br />
aus den USA in die EU importiert wird, konnte nicht ausgeschlossen<br />
werden, dass nicht zugelassener gentechnisch veränderter<br />
Reis auch auf den europäischen Markt gelangt ist.<br />
Ursprünglich war den amerikanischen Behörden die Verunreinigung<br />
von dem Produzenten des LL601, Bayer CropScience, mitgeteilt<br />
worden. Die Reislinie LL601 wurde zwischen 1998 und<br />
2001 in den USA in Freisetzungsexperimenten angebaut, war jedoch<br />
nicht für die Vermarktung vorgesehen. Auf welchem Weg<br />
LL601-Reis in den Handel gelangte, ist unbekannt. Nach Papaya<br />
(2004) und Bt10-Mais (2005) wurden hiermit zum dritten Mal<br />
in Folge in der EU nicht zugelassene gentechnisch veränderte Sorten<br />
illegal eingeführt.<br />
Zum Hintergrund: Bis eine gentechnisch veränderte Pflanze marktfähig<br />
ist, sind zuvor zahlreiche Forschungsarbeiten erforderlich.<br />
Nicht alle gentechnisch veränderten Pflanzen aus den Entwicklungslaboren<br />
erfüllen die Wünsche ihrer Züchter. Wie bei der<br />
konventionellen Züchtung setzt sich die Herstellung neuer Pflanzensorten<br />
aus vielen Einzelschritten zusammen, bei denen eine<br />
fortlaufende Auswahl der für den Züchter geeigneten Pflanzen<br />
stattfindet. So wurden neben der Reislinie LL601 die Reislinien<br />
LL62 und LL06 getestet mit vergleichbaren gentechnischen Veränderungen.<br />
Für diese Linien wurde anschließend in den USA<br />
die Zulassung beantragt und erteilt. Vor dem Hintergrund der<br />
Funde von LL601-Reis in den Handelsprodukten wurde Reis<br />
LL601 in den USA einer weiteren Sicherheitsbewertung unterzogen<br />
und ist seit 25. November 2006 in den USA zugelassen.<br />
In der EU liegt für die Reislinie LL62 ein Zulassungsantrag seit<br />
August 2004 vor.<br />
Einige Reislinien, die in den Handel gelangt sind, waren weder in der<br />
EU noch in den USA für den Handel oder den Anbau zugelassen, sondern<br />
lediglich für ein Freisetzungsexperiment vorgesehen
Weiterhin im Fokus: GVO<br />
Im September 2006 wurde ebenfalls bekannt, dass gentechnisch<br />
veränderter Reis aus China (Bezeichnung Shanyou 63 oder Bt63)<br />
exportiert wurde. Obwohl von den chinesischen Behörden nur<br />
für Freisetzungsversuche, nicht jedoch für den Anbau vorgesehen,<br />
gelangte Bt63-Reis in die Verarbeitung zur Lebensmittelherstellung.<br />
Auch dieser gentechnisch veränderte Reis ist in der EU<br />
weder zugelassen noch liegt ein Zulassungsantrag nach Verordnung<br />
(EG) 1829/2003 vor.<br />
In der EU dürfen nach der Verordnung (EG) 1829/2003 nicht<br />
zugelassene gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel<br />
nicht vermarktet werden. Es gilt die Nulltoleranz, d. h. Lebensund<br />
Futtermittel, die nicht zugelassenes gentechnisch verändertes<br />
Material enthalten – auch wenn die Bestandteile nur in Spuren<br />
nachzuweisen sind – dürfen nicht auf den Markt gebracht<br />
werden.<br />
Analysenzertifikat zur Bestätigung<br />
Als Reaktion auf die Meldungen aus den USA beschloss die EU-<br />
Kommission im August 2006 die Einfuhr von US-Langkornreis<br />
nur noch dann zu gestatten, wenn ein Analysenzertifikat bestätigte,<br />
dass die Lieferung keinen LL601-Reis enthielt. Im November<br />
2006 wurde diese Entscheidung u. a. um die genaue Festlegung<br />
von Probenahme- und Analyseverfahren erweitert (Entscheidung<br />
2006/754/EG).<br />
Neben den Importkontrollen wurde EU-weit ebenso bereits auf<br />
dem Markt befindlicher Reis auf gentechnische Veränderung hin<br />
untersucht. Die amtliche Untersuchung von Lebensmitteln, Futtermitteln<br />
und Saatgut auf gentechnisch veränderte Bestandteile<br />
wird in <strong>Niedersachsen</strong> von dem Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
des LAVES durchgeführt. Hier wurde schnell reagiert und die vorhandenen<br />
Nachweisverfahren wurden um die für diese gentechnisch<br />
veränderten Reislinien spezifischen Analyseverfahren erweitert.<br />
In einem Untersuchungsschwerpunkt wurden über 200<br />
Reis- und reishaltige Proben untersucht. Dabei konnte in acht<br />
Proben LL601-Reis und in zwei Proben Bt63-Reis nachgewiesen<br />
werden. Noch vorhandene Lagerbestände dieser Erzeugnisse wurden<br />
daraufhin durch die Überwachungsbehörden bzw. Unternehmen<br />
vom Markt genommen und die weiteren Schritte (z. B.<br />
Schnellwarnungen) wurden eingeleitet.<br />
Weitere Ergebnisse sind in Kapitel 4 aufgeführt.<br />
Dr. Schulze, M.; Dr. Ohrt, G.; Dr. Gebhard, F.; Dr. Eichner, C. (LI BS)<br />
In China gelangte gentechnisch veränderter Reis, der nicht für den<br />
Anbau vorgesehen war, in die Verarbeitung zur Lebensmittelherstellung<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
71
72<br />
Transparenter Verbraucherschutz bei Bedarfsgegenständen<br />
Mehr Sicherheit durch neue Regelungen bei Haarfarben<br />
In Europa färben sich mehr als 60 % aller Frauen und 5 bis 10 %<br />
der Männer durchschnittlich mehrmals im Jahr (sechs bis achtmal)<br />
die Haare (EU-Studie). Durch die Entwicklung der synthetischen<br />
Färbemittel wird dem Verbraucher heute ein breites Spektrum<br />
an Farbnuancen in einer fast unüberschaubaren Produktpalette<br />
angeboten. Diese chemischen Haarfärbemittel lassen sich in drei<br />
Gruppen einteilen:<br />
• temporäre Färbungen: Diese schon mit einer Haarwäsche auswaschbaren<br />
Färbungen werden durch Farbstoffe erzeugt, die<br />
nur oberflächlich auf dem Haar haften<br />
• semipermanente Färbungen: Bei dieser »halbbeständigen«<br />
Farbveränderung werden sogenannte »direktziehende« Farbstoffe<br />
eingesetzt, die nicht nur oberflächlich auf dem Haar haften,<br />
sondern teilweise auch in die Schuppenschicht eindringen<br />
und mehrere Haarwäschen überstehen<br />
• permanente Färbungen: Erzeugnisse, die zu einer dauerhaften<br />
Veränderung der Haarfarbe führen, bestehen aus einem Gemisch<br />
farbloser Vorstufen, die erst durch eine chemische Reaktion<br />
während des Färbevorganges zu den eigentlichen Farbstoffen<br />
reagieren. Diese sind fest im Haar eingelagert und können<br />
nicht heraus gewaschen werden<br />
Synthetische Haarfarbstoffe stehen seit vielen Jahren in der Kritik;<br />
neben dem allergenen Potential, das viele der eingesetzten Verbindungen<br />
aufweisen, gaben Hinweise auf einen Zusammenhang<br />
zwischen der dauerhaften Verwendung von Haarfärbemitteln<br />
und einem erhöhtem Krebsrisiko Anlass zur Besorgnis. Neuere<br />
Studien können diese Hinweise jedoch nicht bestätigen.<br />
EU fordert umfangreiche toxikologische Prüfung<br />
Dennoch hat der wissenschaftliche Ausschuss für Konsumgüter<br />
(Scientific Committee on Consumer Products – SCCP) bei der EU<br />
gefordert, dass alle in Europa verwendeten Haarfarben erneut<br />
einer umfangreichen toxikologischen Prüfung und Bewertung<br />
unterzogen werden sollen.<br />
Rechtliche Regelungen bestanden lange Zeit nur für wenige dieser<br />
Stoffe. Während in anderen kosmetischen Mitteln nur zugelassene<br />
Farbstoffe eingesetzt werden dürfen, sind Erzeugnisse<br />
zur Haarfärbung oder Haartönung von dieser Vorgabe ausgenommen.<br />
Hier können bislang auch andere Substanzen verwendet<br />
werden. Die Verantwortung für die Prüfung der gesundheitlichen<br />
Unbedenklichkeit der verwendeten Farbstoffe in Mitteln zum<br />
Durch die Entwicklung der synthetischen Färbemittel wird dem<br />
Verbraucher ein breites Spektrum an Farbnuancen geboten
Färben und Tönen von Haaren lag bislang allein beim Hersteller<br />
und Vertreiber. Die EU-Kommission hat 2003 zusammen mit den<br />
Mitgliedsstaaten und den Interessenvertretern ein ausführliches<br />
Programm (»Haarfarben-Strategie«) eingeleitet, dessen Ziel die<br />
Einführung einer Positivliste für Haarfarbstoffe ist. Zu diesem<br />
Zweck sind die Hersteller aufgefordert, Sicherheitsdossiers dieser<br />
Substanzen vorzulegen, wobei in einem weiteren Schritt auch<br />
die bei der Anwendung entstehenden Reaktionsprodukte mit in<br />
die Prüfungen einbezogen werden sollen. Stoffe, die sich als gesundheitlich<br />
bedenklich erweisen oder für die kein Sicherheitsdossier<br />
vorliegt, sollen verboten werden.<br />
Im ersten Schritt erhielten 60 Haarfarbstoffe eine vorläufige Zulassung<br />
mit jeweiliger Höchstmengenregelung. Für 115 der ca.<br />
300 ursprünglich verwendeten Haarfarbstoffe wurden mittlerweile<br />
toxikologische Studien vorgelegt, die vom SCCP bewertet<br />
werden müssen. Im Jahr 2006 wurden 22 Substanzen – darunter<br />
vier der vorläufig zugelassenen – für die Verwendung in Haarfärbemitteln<br />
verboten; an diesen Stoffen hat die Industrie kein<br />
ausdrückliches Interesse mehr gezeigt und infolgedessen keine<br />
Dossiers vorgelegt. Das Verbot weiterer Haarfarben befindet sich<br />
im Entwurfsstadium.<br />
Institut in Lüneburg untersucht Haarfärbemittel<br />
Zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften werden die<br />
Haarfärbemittel im Institut in Lüneburg auf ihre qualitative und<br />
quantitative Zusammensetzung untersucht. Die Untersuchungsmethode<br />
umfasst bis jetzt 47 Haarfarbstoffe, darunter befinden<br />
sich sowohl eingeschränkt zugelassene, als auch verbotene Substanzen<br />
sowie bislang ungeregelte Verbindungen. Begrenzt wird<br />
das Untersuchungsspektrum unter anderem dadurch, dass die<br />
als Vergleichssubstanzen benötigten Stoffe z. T. nur schwer oder<br />
gar nicht zu erwerben sind. Bei der Untersuchung ist aufgrund<br />
der Reaktionsfähigkeit der Haarfarbstoffe eine zügige Aufarbeitung<br />
unter Oxidationsschutz für eine reproduzierbare Bestimmung<br />
wichtig. Neben der stofflichen Zusammensetzung wird<br />
überprüft, ob die Kennzeichnung den rechtlichen Vorgaben entspricht,<br />
d. h. ob alle Substanzen in der Liste der Bestandteile angegeben<br />
und ggf. erforderliche Warnhinweise vorhanden sind.<br />
Hersteller müßen für ihre Haarfarbstoffe Sicherheitsdossiers vorlegen.<br />
Stoffe für die kein solches Dossier vorliegt, oder die sich als<br />
gesundheitlich bedenklich erweisen, sollen verboten werden<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Im Jahr 2006 sind 32 Haarfärbemittel – überwiegend zur Erzielung<br />
einer rötlichen Färbung – zur Untersuchung eingegangen,<br />
Verstöße wurden an diesen Proben nicht festgestellt. In 22 Haarfärbemitteln<br />
zur permanenten Farbveränderung konnten jeweils<br />
zwei bis sieben verschiedene Farbstoffe festgestellt werden. Die<br />
am häufigsten gefundenen Substanzen waren 2,5-Toluylendiamin<br />
und 4-Amino-2-hydroxytoluol, sie waren jeweils in 70 % der<br />
permanenten Haarfärbemittel zu finden, gefolgt von Resorcin,<br />
das in knapp der Hälfte dieser Erzeugnisse vorhanden war. Diese<br />
drei Stoffe sind mit Höchstmengenvorgaben geregelt. Toluylendiamin<br />
und Resorcin weisen bekanntermaßen ein allergenes Potential<br />
auf, darauf muss bei Verwendung dieser Verbindungen<br />
durch entsprechende Warnhinweise auf den Erzeugnissen hingewiesen<br />
werden.<br />
Weßels, B. (IfB LG)<br />
73
74<br />
Tätowiermittel teilweise mit Keimen belastet<br />
Wie ist es um die Sicherheit von Alltagsprodukten bestellt, mit<br />
denen der Verbraucher in Berührung kommt – dieser Frage gehen<br />
die Experten des Institutes für Bedarfsgegenstände Lüneburg<br />
(IfB LG) tagtäglich nach. Es kommt vor, dass die Wissenschaftler<br />
sich bei Ihrer Arbeit mit der Situation konfrontiert sehen, dass<br />
rechtliche Bestimmungen fehlten oder fehlen, wie z. B. bei Tätowiermitteln.<br />
Diese sind natürlich keine Erzeugnisse des täglichen<br />
Bedarfs; sie werden einmalig in die Haut gespritzt und nicht<br />
wie kosmetische Mittel auf die Haut aufgetragen. Seitdem das<br />
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 2005 in Kraft getreten<br />
ist, sind Tätowiermittel nun in dieser Rechtsvorgabe erfasst. Das<br />
heißt, dass die für kosmetische Mittel geltenden Bestimmungen<br />
dieses Gesetzes auch hier anzuwenden sind. Danach darf keine<br />
gesundheitsschädigende Wirkung von den Erzeugnissen ausgehen.<br />
Das jedoch ist insbesondere bei Tätowiermitteln, die bereits<br />
in Gebrauch sind, sich in geöffneten Behältnissen befinden oder<br />
die zur Anwendung gar im Vorfeld vom Tätowierer verdünnt<br />
wurden, nicht auszuschließen. Solche Erzeugnisse sind häufig<br />
nicht unerheblich mit Keimen belastet, die gesundheitsgefährdend<br />
sein können – so das Ergebnis der LAVES-Experten.<br />
Im Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg wurden im vergangenen<br />
Jahr 40 Tätowiermittel insbesondere auf mikrobielle<br />
Kontamination und in geringerem Umfang auf den Gehalt an<br />
Schwermetallen und Konservierungsstoffen untersucht.<br />
Bei neun Proben – diese zählten zu den 30 Tätowiermitteln aus<br />
bereits geöffneten Behältnissen – wurden pro Milliliter Erzeugnis<br />
Keime bis zu 100 Millionen festgestellt. Ob es durch Keime<br />
bei Tätowierungen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen<br />
kann, hängt von den Keimen selbst ab, von ihrer Konzentration<br />
sowie von der Menge an Tätowiermittel, die in die Haut<br />
eingebracht wird. Die vier Erzeugnisse, in denen der allgemein<br />
als pathogen bekannte Keim Pseudomonas aeruginosa, aber auch<br />
der Keim Ochrobactrum anthropi festgestellt wurde, wurden als<br />
gesundheitsgefährend beurteilt. Für solche Keime gilt praktisch<br />
der Nullwert. Als gesundheitlich bedenklich wurden die weiteren<br />
fünf Proben eingestuft. Hier sind Keime festgestellt worden, die<br />
bei allgemeiner Anwendung ganz vereinzelt Schäden hervorgerufen<br />
haben sollen, und zwar insbesondere bei Personen, die<br />
bereits gesundheitsgeschädigt sind.<br />
Die Experten aus Lüneburg raten: Tätowiermitteln aus geöffneten<br />
Behältnissen sieht man nicht an, ob sie mikrobiell belastet<br />
sind oder nicht. Um dieses Risiko zu minimieren, sollte der Verbraucher<br />
sich vor der Behandlung vergewissern, dass offenkundig<br />
keine hygienischen Mängel in dem Studio bestehen – also<br />
äußerste Sauberkeit herrscht, Einweghandschuhe benutzt, sterile<br />
Bestecke verwendet werden etc. Zu bevorzugen sind solche<br />
Studios, in denen Portionspackungen mit Tätowiermittel benutzt<br />
werden; statt der üblichen Flaschen mit 20 ml und mehr Inhalt,<br />
sind auch Erzeugnisse in kleinsten Behältnissen von ca. 1 ml im<br />
Verkehr.<br />
Behm, F. (IfB LG)<br />
Der Verbraucher sollte Tätowierstudios bevorzugen, in denen kleine<br />
Portionspackungen des Tätowiermittels benutzt werden
Verbraucherbeschwerden: Was ist zu tun, wenn Lebensmittel nicht in<br />
Ordnung sind<br />
»Mein frisch gekaufter Joghurt ist schlecht.« – »Ich habe mir im<br />
Supermarkt Fruchtsaft gekauft, der beim Öffnen komisch riecht.«<br />
– »In meinem Brotaufstrich habe ich Glassplitter gefunden.« Solche<br />
oder ähnliche Aussagen tragen Verbraucher immer wieder<br />
den Mitarbeitern des LAVES vor. Diese Informationen an die Kontrollbehörden<br />
sind sehr wichtig, damit rasch Maßnahmen ergriffen<br />
werden können, um den vorhandenen Missstand beheben<br />
zu können. Gegebenenfalls müssen vergleichbare Produkteinheiten<br />
sofort vom Markt genommen werden, um eine Schädigung<br />
der Verbraucher zu verhindern. Dabei muss zunächst geklärt werden,<br />
an welche Stelle der Lebensmittelkette die nachteilige Beeinflussung<br />
des Lebensmittels stattgefunden hat. Bei der Herstellung?<br />
Beim Transport? Während der Lagerung? Bei der Zubereitung?<br />
Beim Verbraucher?<br />
Bei derartigen Verbraucherbeschwerden können die Fachleute<br />
des LAVES den Verbraucher zwar dahingehend beraten, welche<br />
Anforderungen ein einwandfrei hergestelltes und verkauftes Produkt<br />
zu erfüllen hat. Für die Entgegennahme einer Verbraucherbeschwerde<br />
und die Einleitung entsprechender Kontrollmaßnahmen<br />
ist jedoch das Veterinär- oder Lebensmittelüberwachungsamt<br />
der Kommune zuständig, in der das zur Beschwerde führende<br />
Produkt erworben wurde. Diese kommunalen Überwachungsbehörden<br />
sind in <strong>Niedersachsen</strong> bei den Landkreisen, kreisfreien<br />
Städten und der Region Hannover eingerichtet. Also kann ein<br />
Verbraucher, der einen Fisch in Wittmund erworben hat und zu<br />
Hause feststellt, dass dieser verdorben riecht und nicht typische<br />
Flecken aufweist, diesen beim Zweckverband Veterinäramt Jade-<br />
Weser als Verbraucherbeschwerde einreichen.<br />
Lay, J.; Haring, S. (Dez. 21)<br />
Beschwerdeproben<br />
Für die einwandfreie Beschaffenheit von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen,<br />
Kosmetika und Tabakerzeugnissen, die sich auf<br />
dem Markt befinden, sind die Hersteller, bzw. die Händler verantwortlich,<br />
die die Ware in den Verkehr bringen. Sind Verbraucher<br />
mit der Qualität im Hinblick auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit<br />
oder der Haltbarkeit nicht zufrieden, so besteht für<br />
sie die Möglichkeit, die für den gesundheitlichen Verbraucherschutz<br />
zuständigen lokalen Behörden (Veterinärämter der Landkreise/kreisfreien<br />
Städte) hinzuzuziehen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Die Hersteller, bzw. die Händler sind für die einwandfreie Beschaffenheit<br />
der Lebensmittel verantwortlich<br />
Die Beschwerde von Bürgern bei der Behörde stellt jedoch eher<br />
die Ausnahme dar. So wurden im Bereich des Landkreises Wittmund<br />
im Jahr 2006 lediglich sechs Verbraucherbeschwerden<br />
registriert.<br />
In den meisten Fällen reklamieren die Verbraucher die beanstandete<br />
Ware dort, wo diese erworben wurde (Handel) oder direkt<br />
beim Hersteller. Vorrangig werden diese Beanstandungen dort<br />
positiv aufgenommen und die Ware wird ersetzt oder der Kaufpreis<br />
wird zurückerstattet. Es werden innerbetriebliche Maßnahmen<br />
zur Qualitätsverbesserung eingeleitet.<br />
75
76<br />
Beschwerden bei der Behörde beschränken sich in der Regel auf<br />
diejenigen Fälle, in denen der Kunde im Geschäft nicht das nötige<br />
Gehör gefunden hat, es bereits mehrfach zu Beanstandungen<br />
kam oder es zu tatsächlichen Gesundheitsbeeinträchtigungen<br />
gekommen ist.<br />
In der Lebensmittelüberwachungsbehörde wird die Probe entgegengenommen<br />
und der Sachverhalt ermittelt. Hierzu sind nähere<br />
Angaben zum Ort und Zeitpunkt des Erwerbs, die weiteren<br />
Transportwege und Transportbedingungen sowie die Umstände<br />
der weiteren Lagerung wichtig. Notwendig sind weiterhin die<br />
Verpackung mit Kennzeichnung sowie möglichst ein Kaufbeleg<br />
als Nachweis darüber, wo und zu welchem Zeitpunkt ein Produkt<br />
erworben wurde.<br />
Sind nach dem Verzehr eines Lebensmittels gesundheitliche Beeinträchtigungen<br />
aufgetreten, werden der Zeitpunkt des Verzehrs<br />
und das Auftreten der ersten Symptome sowie die Aufnahme<br />
weiterer Lebensmittel erfragt, um zu klären inwieweit es tatsächlich<br />
einen Zusammenhang zwischen dem Nahrungsmittel und<br />
den klinischen Symptomen gibt, oder ob es eventuell nur eine<br />
zufällige Überschneidung gibt und die Erkrankung durch andere<br />
infektiöse Ursache ausgelöst wurde. Hierzu wird ein möglichst<br />
genauer Vorbericht erfragt.<br />
Alle erhobenen Daten werden in einem Beschwerdeprotokoll<br />
zusammengefasst.<br />
Damit der Sachverhalt der Probe ermittelt werden kann, müssen u. a.<br />
die Verpackung mit Kennzeichnung, Angaben zu Ort und Zeitpunkt<br />
des Erwerbs, sowie Angaben zum weiteren Transport vorliegen<br />
Die Beschwerdeprobe wird, soweit dies möglich ist, durch das<br />
Fachpersonal der Lebensmittelüberwachungsbehörde begutachtet,<br />
ob die Beschwerde gerechtfertigt erscheint. In den meisten<br />
Fällen ist jedoch zur Abklärung eine Laboruntersuchung notwendig.<br />
Hierzu werden die Beschwerdeproben zusammen mit dem<br />
Beschwerdeprotokoll an die zuständigen amtlichen Untersuchungseinrichtungen<br />
des LAVES weitergeleitet.<br />
Aufgrund der Verbraucherbeschwerde werden die Betriebe durch<br />
das Kontrollpersonal der Behörde aufgesucht und gezielt überprüft.<br />
Neben der Kontrolle der Hygiene im Betrieb werden auch<br />
die Aufbewahrungseinrichtungen und -temperaturen, sowie betriebseigene<br />
Dokumentationen im Rahmen der Eigenkontrolle<br />
überprüft. Bei Abweichungen werden die entsprechenden Maßnahmen<br />
zum Abstellen der Mängel eingeleitet. Es werden zudem<br />
Verfolgsproben zu den Beschwerdeproben entnommen.<br />
Sollte das Ergebnis der Laboruntersuchung zu einer nachweislich<br />
durch den Hersteller/Inverkehrbringer zu verantwortenden<br />
Beanstandung führen, werden Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />
oder Strafverfahren eingeleitet.<br />
Der Verbraucher, der die Beschwerdeprobe abgegeben hatte,<br />
wird selbstverständlich über das Ergebnis der Untersuchung und<br />
die weiteren Maßnahmen informiert.<br />
Dr. Ackermann, G. (Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser)
Futtermittel – am Anfang der Nahrungskette<br />
Dioxinuntersuchungen in Futtermitteln<br />
Das Dezernat »Futtermittelüberwachung« des LAVES ist an einer<br />
besonderen, nunmehr drei Jahre währenden Überprüfung<br />
beteiligt, die den niedersächsischen Teil des Elbdeichvorlandes,<br />
und dort insbesondere den Bereich des Biosphärenreservates<br />
Elbtalauen betrifft.<br />
Durch die jährlichen Elbehochwasser werden Schlick und Sedimente<br />
auf den Überflutungsflächen im Elbdeichvorland abgelagert.<br />
Seit Anfang der neunziger Jahre ist bekannt, dass es durch<br />
diese Ablagerungen stellenweise zu Belastungen dieser Flächen<br />
mit dem Umweltgift Dioxin kommen kann. Die Überflutungsflächen<br />
werden teilweise landwirtschaftlich genutzt – sowohl durch<br />
Beweidung als auch durch Heu- und Silagewerbung.<br />
Die risikoorientierte amtliche Futtermittelüberwachung stellt durch<br />
Vor-Ort-Kontrollen (Beprobung des Grasaufwuchses von diesen<br />
Flächen bzw. der von diesen Flächen gewonnenen Silage oder<br />
des Heus) sicher, dass kein Gras oder ein Erzeugnis aus Gras mit<br />
überhöhten Dioxinwerten an Tiere verfüttert wird, die der Lebensmittelgewinnung<br />
dienen.<br />
Während der Vegetationsperiode in den Monaten April bis Oktober<br />
werden Aufwuchsproben, in erster Linie von Flächen die<br />
auch beweidet werden, entnommen und auf Dioxingehalte im<br />
LAVES untersucht.<br />
Insgesamt wurden im Jahre 2006 30 Aufwuchsproben entnommen.<br />
Bei vier dieser Proben wurde ein Dioxingehalt über dem<br />
zulässigen Grenzwert festgestellt. Die betroffenen Landwirte wurden<br />
informiert und entsprechende Maßnahmen wie Sperrung<br />
der betroffenen Flächen bzw. schadlose Beseitigung der betroffenen<br />
Futtermittel wurden angeordnet.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Bei dem jährlichen Elbehochwasser werden auch landwirtschaftlich genutzte<br />
Flächen überflutet. Die dabei entstehenden Ablagerungen können<br />
die Überflutungsflächen belasten<br />
Nur durch die gezielte Zusammenarbeit der amtlichen Futtermittelüberwachung<br />
mit der Lebensmittelüberwachungsbehörde sowie<br />
der Landwirtschaftskammer <strong>Niedersachsen</strong> als beratender<br />
Einrichtung ist es möglich, Erfolge in diesem komplexen Bereich<br />
zu erzielen. Die Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse der<br />
Futtermittelüberwachung zieht demzufolge eine anlassbezogene<br />
Probenahme von Rindfleisch, Schaffleisch, Wildfleisch oder Rohmilch<br />
nach sich. Umgekehrt erfolgt eine gezielte Probenahme<br />
von Grundfutter nach positiven Ergebnissen nach systematischen<br />
Untersuchungen von Fleisch und Milch.<br />
Dr. Schütte, R.; von der Weiden, K. (Dez. 41)<br />
77
78<br />
Schwermetalle bei Importfuttermitteln<br />
Geringe Belastung<br />
Erfreuliches Ergebnis bei der Untersuchung von Einzelfuttermitteln<br />
auf Schwermetallbelastung: Die Belastung ist – wenn überhaupt<br />
– gering. Zu diesem Ergebnis kam das Futtermittelinstitut<br />
Stade des LAVES nach Untersuchungen.<br />
Einzelfuttermittel werden zu einem nicht unerheblichen Teil aus<br />
nicht EU-Staaten auf dem Schiffsweg nach Deutschland importiert.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> besitzt in Brake einen bedeutenden Umschlagplatz.<br />
Eingeführt werden hier in großen Mengen Maiskleber,<br />
Palmkernextraktionsschrot, Rapssaat, Sojabohnenextraktionsschrot,<br />
Sojaschrot und Sojapellets. Lieferländer sind zum Beispiel<br />
Argentinien und Brasilien.<br />
Um zu gewährleisten, dass diese importierten Futtermittel den<br />
europäischen gesetzlichen Anforderungen genügen, werden die<br />
Schiffsladungen regelmäßig durch das LAVES überprüft. Im Fut-<br />
Ein nicht unerheblicher Teil der Einzelfuttermittel wird aus nicht EU-<br />
Ländern über den Schiffsweg nach Deutschland importiert<br />
termittelinstitut Stade werden diese Futtermittel u. a. auf die<br />
sogenannten unerwünschten Stoffe Arsen, Blei, Cadmium und<br />
Quecksilber untersucht.<br />
Im Jahr 2006 wurde die Ladung von über 50 Schiffen kontrolliert,<br />
das bedeutete für die Experten die Analyse von insgesamt<br />
275 Proben auf die vier genannten Elemente. Zusammenfassend<br />
kann festgestellt werden, dass nur Palmkernextraktionsschrot<br />
gegenüber den anderen Futtermitteln durch messbare Bleigehalte<br />
in fast allen Proben auffiel. Die gemessenen Werte lagen jedoch<br />
bei allen Futtermitteln deutlich unter den zulässigen Höchstgehalten.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>8: Verteilung der Bleigehalte in Palmkernextraktionsschrot<br />
Gehalt<br />
(mg/kg)<br />
< 0,2 0,2 bis 0,5 0,51 bis 1 1,1 bis 2<br />
Anzahl 6 26 11 4
Insgesamt wiesen die untersuchten Importproben des Jahres<br />
2006 eine nur geringe Belastung mit den unerwünschten Stoffen<br />
Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber auf.<br />
In der Tabelle <strong>3.</strong>9 sind die im Untersuchungsjahr gültigen Höchstgehalte<br />
aufgelistet.<br />
Die Anzahl der Proben, bei denen messbare Gehalte an den gesuchten<br />
Schadmetallen festgestellt wurden, ist in der Tabelle<br />
<strong>3.</strong>10 dargestellt.<br />
Dr. Rasenack, U. (FI STD)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>9: Höchstgehalte (lt. Anlage 5 Futtermittelverordnung)<br />
und Bestimmungsgrenzen der unerwünschten<br />
Stoffe in mg/kg bezogen auf 88 % Trockenmasse<br />
Unerwünschter<br />
Stoff<br />
Blei (Pb)<br />
Cadmium (Cd)<br />
Arsen (As)<br />
Quecksilber (Hg)<br />
Einzelfuttermittel<br />
Höchstgehalt<br />
(mg/kg)<br />
Anzahl Schiffe Anzahl beprobte<br />
Luken<br />
Bestimmungsgrenze<br />
(mg/kg)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>10: Aufstellung der Proben mit messbaren Gehalten<br />
Maiskleber<br />
Palmkernextraktionsschrot<br />
Rapssaat<br />
Sojabohnenextraktionsschrot<br />
Sojapellets<br />
Sojaschrot<br />
Sonnenblumenextraktionsschrot<br />
* analysiert durch VI Hannover<br />
5<br />
7<br />
1<br />
30<br />
5<br />
7<br />
1<br />
10<br />
1<br />
2<br />
0,1<br />
25<br />
47<br />
1<br />
162<br />
10<br />
29<br />
1<br />
≥ 0,20<br />
≥ 0,05<br />
≥ 0,24<br />
≥ 0,004<br />
Anzahl der beprobten Luken mit Gehalten für<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Pb ≥ 0,20 mg/kg Cd ≥ 0,05 mg/kg As* ≥ 0,24 mg/kg Hg* ≥ 0,004 mg/kg<br />
5<br />
41<br />
0<br />
1<br />
1<br />
1<br />
0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
4<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
79
80<br />
»Cross Compliance« – Bedingungen für Prämienzahlungen der EU –<br />
Landwirte an Einhaltung von Verpflichtungen gebunden<br />
Landwirte erhielten in der Vergangenheit aus unterschiedlichen<br />
Programmen Fördergelder der EU. Es gab Prämien für Rindfleischerzeuger,<br />
Mutterschafhalter, Naturschutzmaßnahmen u. a.. Um<br />
die Vielzahl der möglichen Anträge, die Daten und die Termine<br />
der Antragstellung zu vereinheitlichen, wurde bei der Reform der<br />
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU im Jahre 2005 eine Neuregelung<br />
geschaffen. Es ist jetzt nur noch ein Antrag zu stellen, der<br />
sich in verschiedene Abschnitte gliedert. Die Antragstellung ist<br />
an die Flächenausstattung des Betriebes gebunden. Gleichzeitig<br />
wurden die vom Landwirt einzuhaltenden Rechtsvorschriften und<br />
Verpflichtungen harmonisiert und verschärft.<br />
Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch die jeweils zuständigen<br />
Fachbehörden überprüft. Diese Überprüfungen sind die<br />
sogenannten »Cross Compliance«-Kontrollen.<br />
Erweitertes Aufgabengebiet bei Futtermittelkontrollen<br />
auf landwirtschaftlichen Betrieben<br />
Als für die Futtermittelüberwachung zuständige Fachbehörde in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>/Bremen ist das LAVES, Dezernat »Futtermittelüberwachung«,<br />
in die »Cross Compliance«-Kontrollen eingebunden<br />
und kontrolliert seit 2006 die Vorgaben der Rechtsbereiche »Futtermittelsicherheit«<br />
und »Verfütterungsverbote.«<br />
Für den feststehenden Begriff »Cross Compliance« gibt es keine<br />
perfekt treffende Übersetzung. Man kann »Cross Compliance«<br />
damit beschreiben, dass die vom Landwirt zu beachtenden Rechtsvorschriften<br />
Einfluss aufeinander haben. Ein Verstoß in einem<br />
Fachbereich kann Auswirkungen auf andere Fachbereiche haben<br />
und Folgeprüfungen nach sich ziehen.<br />
So ist ein leck geschlagenes Dieselfass neben Futtermittelsäcken<br />
ein Verstoß gegen futtermittelrechtliche Auflagen, aber auch Bestimmungen,<br />
z. B. zum Wasserschutz sind davon betroffen.<br />
Die Sicherstellung der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit<br />
ist ein zentraler Punkt der vom Landwirt einzuhaltenden Verpflichtungen.<br />
Die Lebensmittelkette beginnt in der Primärproduktion<br />
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Futtermittel spielen deshalb<br />
bei der Herstellung ordnungsgemäßer Lebensmittel eine<br />
bedeutsame Rolle.<br />
Bei den Kontrollen des LAVES wird insbesondere auf die Vermeidung<br />
von Verunreinigungen von Futtermitteln, die Sicherstellung<br />
der Rückverfolgbarkeit des Bezugs und der Abgabe von Futtermitteln<br />
sowie die Einhaltung der besonderen Bedingungen bei<br />
der Verfütterung geachtet.<br />
Die Auswahl der im Rahmen von »Cross Compliance« zu prüfenden<br />
Betriebe erfolgt im Rahmen einer Risikoanalyse und umfasst<br />
mindestens 1 % aller Antragsteller. Dies betraf in <strong>Niedersachsen</strong>/<br />
Bremen 589 Betriebe im Jahre 2006.<br />
Da Futtermittel bei der Lebensmittelherstellung eine bedeutende Rolle<br />
spielen, ist die Sicherstellung der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit<br />
ein zentraler Punkt der Verpflichtungen des Landwirtes
Die Kontrolle teilt sich auf in eine Buchprüfung zur so genannten<br />
»Rückverfolgbarkeit« im Antragsjahr und eine Betriebsbesichtigung.<br />
Die Rückverfolgbarkeit wird geprüft durch Einsichtnahme in Unterlagen<br />
zu Bezug und Abgabe von Futtermitteln an Hand von<br />
Lieferbelegen und/oder Rechnungen. Bei der Erzeugung von Futtermitteln<br />
im Betrieb, z. B. Weidegras und Futtergetreide, werden<br />
zudem Bezug und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln,<br />
Bioziden und eventuell der Einsatz genetisch veränderten Saatguts<br />
durch Lieferbelege und/oder Rechnungen im Zusammenhang<br />
mit betriebsinternen Aufzeichnungen, wie z. B. einer Ackerschlagkartei,<br />
kontrolliert.<br />
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Kontrolle ist der Betriebsrundgang<br />
mit dem Betriebsleiter. Hierbei wird insbesondere die<br />
Lagerung und Handhabung von Abfallprodukten und futtermittelrechtlich<br />
verbotenen oder als gefährlich eingestuften Stoffen<br />
in Augenschein genommen (beispielsweise die Lagerung von gebeiztem<br />
Saatgut oder Tiermehl, das als Düngemittel Verwendung<br />
findet). Schwerpunkt dieser Überprüfung ist die Verhinderung<br />
von möglichen Kontaminationen von Futtermitteln. Futtermittel<br />
müssen getrennt gelagert werden zu Pflanzenschutzmitteln,<br />
Bioziden und Fütterungsarzneimitteln enthaltenden Futtermitteln.<br />
Auch der Aspekt der Futtermittelhygiene spielt dabei selbstverständlich<br />
eine Rolle.<br />
Ergänzend dazu werden im Rahmen von »Cross Checks« weitere<br />
futtermittelrechtliche Anforderungen geprüft. Hier geht es insbesondere<br />
um die Einhaltung von futtermittelrechtlichen Grenzwerten<br />
(beispielswese für Spurenelemente, Kokzidiostatika) und<br />
die Einhaltung von Fütterungshinweisen, so zum Beispiel: Futtermittel<br />
für Ferkel, aber nicht für Mastschweine zu verwenden.<br />
Beanstandungen werden der Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong> gemeldet und führen zwangsläufig<br />
zu einer Prämienkürzung und meist zu einer Wiederholungsprüfung<br />
bei erneuter Antragstellung.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Im Rahmen von »Cross Checks« werden auch futtermittelrechtliche<br />
Anforderungen geprüft, wie z. B. die Einhaltung von Fütterungshinweisen.<br />
So darf Futtermittel für Ferkel nicht für Mastschweine verwendet<br />
werden<br />
Es wird den Landwirten empfohlen, bei Bedarf auch das betriebliche<br />
Managementsystem (BMS) der Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong> als Beratungsunterstützung zu nutzen. Es enthält<br />
nützliche Hinweise über einzuhaltende »Cross Compliance«-Anforderungen.<br />
Dr. Schütte, R.; Heyne, S. (Dez. 41)<br />
81
82<br />
Tiergesundheit<br />
Das Thema Tiergesundheit nimmt in der Arbeit des LAVES einen<br />
breiten Raum ein: Es umfasst die Erhaltung gesunder Tierbestände,<br />
die Bekämpfung von Tierseuchen und den Tierschutz – mit<br />
dem Ziel, gesunde Lebensmittel tierischen Ursprungs für den Verbraucher<br />
bereitzustellen und das Wohlbefinden und den Schutz<br />
der Tiere zu gewährleisten. Nachfolgend werden neue Strategien<br />
und Bekämpfungsansätze aus dem LAVES vorgestellt.<br />
Tierseuchen<br />
Aufbau des Mobilen Bekämpfungszentrums für Tierseuchen (MBZ)<br />
Mobiles Bekämpfungszentrum für Tierseuchen in Deutschland – das 3,4-Millionen-Projekt<br />
Im September 2002 von den Agrarministern der Bundesländer<br />
beschlossen, von 2003 bis 2004 von der AG Mobiles Bekämpfungszentrum<br />
(MBZ) projektiert, von 2004 bis 2006 von den Bundesländern<br />
diskutiert, ab 2005 vom Bundesamt für Wehrtechnik<br />
und Beschaffung geplant, im Sommer 2006 Beginn des Baus der<br />
Container, im Herbst 2006 Anschaffung und Lagerung von Material<br />
und Sachmitteln, seit November 2006 an seinem Nicht-Tierseuchenzeiten-Standort<br />
in Barme, Landkreis Verden, aufgebaut:<br />
so liest sich die Entstehungshistorie des Mobilen Bekämpfungszentrums<br />
für Tierseuchen in der Kurzfassung.<br />
Das MBZ ist ein neues Element der Tierseuchenbekämpfung. Es<br />
soll die Personen, die »mit dem Kuhschwanz in Berührung kommen«,<br />
also alle Teams, die während einer Tierseuche auf die landwirtschaftlichen<br />
Betriebe fahren und von dort möglicherweise<br />
Krankheitserreger verschleppen können, von denjenigen trennen,<br />
die im Krisenzentrum mit reinen Verwaltungstätigkeiten zu tun<br />
haben.<br />
Die Teams bestehen aus Tierärzten, Hilfskräften für das Handling<br />
der Tiere und Verwaltungsmitarbeitern zur überaus wichtigen Dokumentation<br />
aller Tätigkeiten (EU-Prinzip bei der Entschädigung<br />
von Kosten: »Nur was aufgeschrieben wurde, gilt auch als gemacht!«)<br />
auf den Betrieben. Die Teilnehmer werden morgens<br />
im MBZ auf der »reinen« Seite (das ist die saubere ohne Tierseuchenerreger)<br />
mit Informationen, Aktionsplänen und Material<br />
ausgestattet. Nach der Rückkehr von den Betrieben geben sie<br />
im »unreinen« Bereich (hier könnten eventuell noch Tierseuchenerreger<br />
verschleppt worden sein) beim Debriefing ihre Proben,<br />
Berichte und Dokumentationen ab, und gelangen dann über die<br />
Duschcontainer und Umkleideräume, wo sie neue Schutzkleidung<br />
anziehen, wieder in den »reinen« Bereich.<br />
Geschäftsführendes Bundesland für das MBZ ist <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Stellvertretend für alle Bundesländer wurden sowohl die Ausschreibungen<br />
vorbereitet als auch die notwendigen Verträge abgeschlossen.<br />
Das Niedersächsische Ministerium für den ländlichen<br />
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat<br />
dabei viele Aufgaben dem LAVES (Dezernate IuK-Technik, Recht<br />
und Task-Force Veterinärwesen) übertragen.<br />
Task-Force Veterinärwesen koordiniert MBZ-Projekt<br />
Im Jahr 2006 bestand ein großer Teil der Arbeit für die Task-Force<br />
Veterinärwesen (Dez. 32) in der Koordination des MBZ-Projektes.<br />
Die Mustercontainer mussten begutachtet und mit Verbesserungswünschen<br />
versehen werden, die Herrichtung des vom Technischen<br />
Hilfswerk gemieteten Platzes musste vorangetrieben werden<br />
(was aufgrund der Vielzahl der beteiligten Behörden nicht immer
leicht war), die Halle für das Sachmittellager musste renoviert,<br />
isoliert und mit einem Palettenregallager ausgestattet werden<br />
(auch hier waren Hindernisse aus dem Weg zu räumen), die notwendigen<br />
Strom-, Wasser- und Kommunikationsanschlüsse waren<br />
zu beantragen und die Ausführung zu begleiten, der Terminplan<br />
für die Anlieferung und den Aufbau des MBZ unter Beteiligung<br />
der THW-Spezialistentruppe aus Soltau war zu koordinieren<br />
– und schließlich gab es am 11. Dezember 2006 eine offizielle<br />
Eröffnungsveranstaltung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministers<br />
Hans-Heinrich Ehlen, zu der Vertreter aller Bundesländer<br />
und der an der Entstehung beteiligten Organisationen und<br />
Firmen geladen waren.<br />
MBZ und Sachmittel sind nun da – jetzt gilt es, das Ganze durch<br />
Schulungen und Übungen mit Leben zu füllen, damit es im Fall<br />
eines Tierseuchenausbruches auch den angestrebten Effekt hat<br />
– die Ausbreitung der Tierseuche schnellstmöglich einzudämmen.<br />
Dr. Mahnken, M.; Dr. Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Geflügelpest – weiterhin Seuchengefahr für <strong>Niedersachsen</strong><br />
Im Jahre 2006 traten in mehreren Ländern Europas Ausbrüche<br />
der hochpathogenen aviären Influenza vom Viustyp H5N1 auf.<br />
Das Virus hatte damit seinen Zug von Südostasien aus in kurzer<br />
Zeit nach Westen fortgesetzt und war bis Mitte des Jahres in den<br />
Wildvogel- und/oder Wirtschaftsgeflügelpopulationen von insgesamt<br />
38 Ländern Asiens, Afrikas und Europas nachgewiesen<br />
worden.<br />
Damit zeigte sich, dass alle Maßnahmen, die Ausbreitung der<br />
Seuche aufzuhalten, nicht den erwarteten Erfolg brachten und<br />
die Gesamtsituation weiterhin bedenklich ist. Daran änderte auch<br />
der großflächige Einsatz von Impfstoffen in einigen asiatischen<br />
Ländern nichts.<br />
Etwa 220 Millionen Stück Nutzgeflügel waren bis dahin an der<br />
Seuche verendet oder präventiv getötet worden. Betroffen sind<br />
davon nach wie vor die Länder Südostasiens, die aufgrund der<br />
herrschenden Haltungsformen ein nicht versiegendes Virusreservoir<br />
mit einem hohen Potential für genetische Veränderungen<br />
des Virus und damit ein unter den gegebenen Bedingungen langfristig<br />
nicht zu bewältigendes epidemiologisches Problem darstellen.<br />
Nach kurzen, teils mit drastischen Maßnahmen durchgesetzten<br />
Perioden scheinbarer Seuchenfreiheit mussten mehrere Länder<br />
nach bereits verkündeten Erfolgsmeldungen neue Seuchenausbrüche<br />
verzeichnen. Auch in Afrika, wo 2006 ebenfalls die ersten<br />
H5N1-Fälle bei Hausgeflügel auftraten, hat sich die Situation alles<br />
andere als beruhigt.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>2: Wege der Teams im MBZ<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Auch wurde deutlich, dass die hochpathogene aviäre Influenza<br />
zu einem wachsenden humanmedizinischen Problem geworden<br />
ist. Von den zwischen 2003 und Dezember 2006 insgesamt gemeldeten<br />
263 Infektionen beim Menschen traten 116 allein 2006<br />
auf. Die Anzahl der davon tödlich endenden Fälle stieg auf 80<br />
gegenüber 42 im Vorjahr. Besonders betroffen ist davon Indonesien,<br />
das allein 46 Todesfälle meldete und für 2007 bereits fünf<br />
der bisher sieben tödlichen Ausgänge meldete. Auch aus Afrika<br />
(Ägypten, Nigeria) ist es inzwischen zu Infektionen des Menschen<br />
mit zum Teil tödlichen Ausgang gekommen.<br />
83
84<br />
Dabei haben die seit längerer Zeit in der Diskussion stehenden,<br />
mit einer erhöhten Infektiosität für den Menschen einhergehenden<br />
Virusmutationen ebenso neue Nahrung erhalten, wie die Hinweise<br />
auf eine direkte Übertragung des H5N1-Virus von Mensch<br />
zu Mensch.<br />
Wie die ersten Wochen des Jahres 2007 zeigen, hält die Entwicklung<br />
sowohl im human- als auch im veterinärmedizinischen Bereich<br />
unvermindert an. Seitens internationaler Fachgremien (WHO,<br />
FAO) wird inzwischen eingeschätzt, dass die hochpathogene aviäre<br />
Influenza ein Problem (Pandemiegefahr) darstellt, zu dessen<br />
Lösung aus gegenwärtiger Sicht noch wenigstens zehn Jahre intensiver<br />
Bemühungen nötig sein werden.<br />
Angesichts der weltweiten Seuchensituation muss nach wie vor<br />
von einem mäßigen bis hohen Einschleppungsrisiko für die Nutzgeflügelbestände<br />
in der Europäischen Union und in Deutschland<br />
ausgegangen werden.<br />
Es resultiert vorrangig aus der Gefährdung durch Wild- und Zugvögel<br />
und dem illegalen Handel mit Ländern, in denen Geflügelpest<br />
nachgewiesen wurde.<br />
Zwischen dem 15. Februar und dem <strong>3.</strong> August 2006 wurde H5N1<br />
in Deutschland bei 344 Wildvögeln, drei Hauskatzen und einem<br />
Steinmarder festgestellt. Im April kam es zum bisher einzigen<br />
Seuchenausbruch bei Nutzgeflügel (Puten) in Deutschland (Sachsen).<br />
Nach dem <strong>3.</strong> August 2006 wurden in Deutschland keine<br />
H5N1-Nachweise mehr geführt. Das trifft auch für das übrige<br />
Europa zu.<br />
Außerhalb Europas hält dagegen das Seuchengeschehen unvermindert<br />
an. Südkorea und Japan meldeten Neuausbrüche an<br />
H5N1, in Afrika ist die Situation völlig unübersichtlich.<br />
Zur Verhinderung der Einschleppung von H5N1 in die Nutzgeflügelbestände<br />
und zur Vermeidung der Weiterverbreitung des<br />
Virus wurde am 9. Mai 2006 die Geflügel-Aufstallungsverordnung<br />
erlassen, die ein Verbot der Freilandhaltung in nach bestimmten<br />
Kriterien (Geflügeldichte, Nähe zu Wildvögeln, etc.) definierten<br />
Restriktions- und Risikogebieten vorsieht.<br />
Vorzugsweise in diesen Gebieten wurden auch 2006 die im Rahmen<br />
des EU-Geflügelpestmonitorings untersuchten Proben gezogen.<br />
Geflügelpest: Veterinärinstitut Oldenburg untersucht dazu<br />
mehr als 20.000 Proben<br />
Im Veterinärinstitut Oldenburg (VI OL) wurden in diesem Rahmen<br />
insgesamt annähernd 20.000 Proben aus <strong>Niedersachsen</strong> mit virologischen/molekularbiologischen<br />
und serologischen Verfahren<br />
bearbeitet. Aus zwei der darunter befindlichen rund 6.000 von<br />
Wildvögeln stammenden Proben wurde H5N1-Virus isoliert.<br />
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Gefahr für die Geflügelbestände<br />
der Europäischen Union wird es in den Mitgliedsstaaten<br />
auch im Jahre 2007 ein Geflügelpest-Monitoring bei<br />
Hausgeflügel und bei Wildvögeln geben.<br />
Für das Land <strong>Niedersachsen</strong> werden die erforderlichen Untersuchungen<br />
im Veterinärinstitut Oldenburg durchgeführt.<br />
Dr. Nöckler, A. (VI OL)<br />
Task-Force Veterinärwesen des LAVES bietet<br />
Verbrauchern Telefon-Hotline an<br />
Telefoniert bis die Akkus der schnurlosen Geflügelpest-Hotline-<br />
Telefone leer waren: die Referendare hatten im Frühjahr 2006<br />
mit über 200 Telefonaten pro Tag keinen leichten Job. Die Top-<br />
Ten-Liste der Fragen wurde angeführt von »Kann meine Katze<br />
auch Vogelgrippe bekommen, wenn sie einen Vogel fängt?«.<br />
Die Referendare der Geflügelpest-Hotline hatten im Frühjahr 2006<br />
keinen leichten Job. Mehr als 200 Anrufe pro Tag wurden entgegengenommen
Nebenbei wurden die Antworten auf die häufig gestellten Fragen<br />
ständig auf dem Laufenden gehalten, die LAVES-Seite und<br />
das www.tierseucheninfo.niedersachsen.de aktualisiert.<br />
Grund für die sprunghaft gestiegenen Nachfragen – im Vergleich<br />
zu den bereits häufigen Anfragen in den Vorjahren – waren zwei<br />
positive Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln in Soltau-Fallingbostel<br />
und Stade. Die Task-Force hat den Landkreisen ihre Unterstützung<br />
(z. B. bei der Erstellung der Restriktionszonen in TSN,<br />
dem Tierseuchennachrichtenprogramm) angeboten, was sehr<br />
gut angenommen worden ist. Hier hat sich die auf Langfristigkeit<br />
angelegte gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen<br />
LAVES und kommunalen Veterinärbehörden positiv bemerkbar<br />
gemacht.<br />
Vielfältige Unterstützung<br />
Auch das Tierseuchenbekämpfungshandbuch <strong>Niedersachsen</strong>/<br />
Nordrhein-Westfalen (TSBH), die internetbasierte gemeinsame<br />
Sammlung von Ablaufplänen, Vorlagen für Verwaltungsschreiben,<br />
Checklisten und Informationen für die Veterinärämter mussten<br />
oft mehrfach täglich aktualisiert werden, weil es wieder neue EU-<br />
Vorschriften oder Änderungen von Bundesverordnungen gab.<br />
Im Februar fand eine Informationsveranstaltung in der Landesfeuerwehrschule<br />
Celle statt, an der Feuerwehrleute aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
und anderen Bundesländern teilnahmen. Dabei wurden<br />
Abläufe bei der Geflügelpestbekämpfung erläutert, Reinigungsund<br />
Desinfektionsmaßnahmen sowie der Personenschutz behandelt.<br />
Das Thema Personenschutz mit den Stichworten »Impfung« und<br />
»Tamiflu« wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen<br />
Landesgesundheitsamt (NLGA), Dr. Matthias Pulz, bearbeitet.<br />
Vom NLGA ist dazu ein Merkblatt herausgegeben worden,<br />
das laufend aktualisiert wird.<br />
Gemeinsam mit den Technischen Sachverständigen wurden kurzfristig<br />
im März alle kommunalen Veterinärbehörden in Sachen<br />
Geflügeltötung geschult. Dazu waren in der LAVES-Zentrale mobile<br />
Elektrotötungsanlagen, CO2-Behälter, Trockeneisbehälter und<br />
Elektrozangen aufgebaut, an denen die Verfahren demonstriert<br />
werden konnten. Die Verträge mit den Firmen Air Liquide und<br />
Linde zur CO2- Stallbegasung wurden von den beiden Dezernaten<br />
begleitend weiterentwickelt. Aus anderen Bundesländern<br />
kamen viele Anfragen zu den einzelnen Verfahren an die Technischen<br />
Sachverständigen und an die Task-Force, weil <strong>Niedersachsen</strong><br />
eigene praktische Erfahrungen mit allen vorgestellten<br />
Verfahren hat.<br />
Alle kommunalen Veterinärbehörden wurden gemeinsam mit den<br />
Technischen Sachverständigen in Sachen Geflügeltötung geschult<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Im November waren die in <strong>Niedersachsen</strong> tätigen Geflügel-Ausstallunternehmen<br />
gemeinsam vom Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverband<br />
und dem LAVES in die LAVES-Zentrale nach<br />
Oldenburg eingeladen worden, um sich über das niedersächsische<br />
Konzept zum Vorgehen bei Ausbruch der Geflügelpest sowie<br />
den Schutz der Mitarbeiter (hier übernahm Dr. Pulz vom NLGA<br />
die Präsentation der aktuellen Erkenntnisse) zu informieren.<br />
Über das ganze Jahr liefen das EU-Monitoring zur aviären Influenza<br />
in Wirtschaftsgeflügelbeständen sowie beim Wildgeflügel,<br />
die von der Task-Force Veterinärwesen koordiniert wurden.<br />
Dr. Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
85
86<br />
Schweinepest<br />
Schweinepest in NRW - Maßnahmen verhindern<br />
Ausbreitung in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Die Klassische Schweinepest (KSP) ist nach wie vor eine der meist<br />
gefürchteten Tierseuchen. Und das zu Recht, wie der Seuchenzug<br />
in <strong>Niedersachsen</strong> Anfang der neunziger Jahre gezeigt hat. So<br />
bedroht die Schweinepest Tierbestände und Landwirte mit millionenschweren<br />
wirtschaftlichen Schäden durch Tierverluste und<br />
Handelsbeschränkungen und führt durch die bei Ausbrüchen derzeit<br />
im EU-Raum praktizierten Bekämpfungsmaßnahmen in Form<br />
von Massentötungen von Schweinen zu dramatischen Szenarien.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> ist zur allseitigen Erleichterung seit 2002 kein<br />
Fall von Schweinepest bei Hausschweinen mehr aufgetreten, und<br />
auch bei Wildschweinen konnte das Virus durch Impfungen erfolgreich<br />
verdrängt werden. Wie fragil die Seuchenfreiheit jedoch<br />
ist, zeigte ein Ausbruch im März 2006 in Nordrhein-Westfalen.<br />
Im Kreis Recklinghausen in der Gemeinde Haltern am See wurde<br />
aus Schweinemastbeständen nach klinischem Seuchenverdacht<br />
das Virus der KSP isoliert. Aufgrund der räumlichen Nähe<br />
zum Primärausbruch wurden auch in einem klinisch unauffälligen<br />
Betrieb Blutproben positiv getestet. Von Recklinghausen breitete<br />
sich das Geschehen nach Borken aus, innerhalb von etwas mehr<br />
als einem Monat wurde KSP 8-mal festgestellt. Verantwortlich für<br />
diese Ausbrüche war der KSP-Subtyp 2.3 Güstrow.<br />
Um zu vermeiden, dass die über NRW verhängten wirtschaftlichen<br />
Sanktionen auf <strong>Niedersachsen</strong> übergreifen, wurden ergänzende<br />
Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der KSP<br />
nach <strong>Niedersachsen</strong> beschlossen. Im Zusammenhang mit dem<br />
Primärausbruch in NRW wurden sämtliche Verbringungen aus<br />
dem Seuchengebiet nach <strong>Niedersachsen</strong> überprüft und der einzige<br />
von dort mit Ferkeln belieferte Schweinebestand vorsorglich<br />
getötet und unschädlich beseitigt. Alle dort durchgeführten Untersuchungen<br />
auf KSP verliefen negativ. Anschließend wurden<br />
alle Betriebe, die in den zurückliegenden 45 Tagen Schweine aus<br />
NRW bezogen hatten, klinisch untersucht und nach Stichprobenschlüssel<br />
beprobt. Die Nachverfolgung der Verbringungen aus<br />
NRW wurde durch die Task-Force Veterinärwesen in enger und<br />
guter Zusammenarbeit mit den kommunalen Veterinärbehörden<br />
koordiniert und durchgeführt. Die entnommenen Blutproben<br />
wurden an den Veterinärinstituten Hannover und Oldenburg des<br />
LAVES innerhalb kürzester Zeit serologisch und virologisch auf<br />
KSP untersucht. Diese Aktion konnte mit großem personellem<br />
Einsatz gemeistert werden. An den Veterinärinstituten wurde<br />
auch an Wochenenden und Feiertagen fast rund um die Uhr gearbeitet.<br />
Mit Erfolg! Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium<br />
konnte schon am 18. April 2006 berichten, dass alle 401<br />
aus NRW belieferten Betriebe sowohl klinisch als auch serologisch<br />
und virologisch mit negativem Ergebnis untersucht worden waren.<br />
Bis dato waren 9.100 Blutproben mittels Antikörper- und<br />
Antigen-ELISA sowie 6.800 Proben mittels PCR und in einzelnen<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> konnte das Schweinepest-Virus durch Impfungen<br />
bei den Wildschweinen erfolgreich verdrängt werden
Fällen auch in der Zellkultur untersucht worden. Um die Sicherheit<br />
zu erhöhen, waren zu diesem Zeitpunkt auch schon 98 weitere<br />
Schweine haltende Betriebe untersucht worden, die seit Mitte<br />
Januar aus den NRW-Restriktionsgebieten beliefert worden<br />
waren. Aus 57 dieser klinisch unauffälligen Betriebe stammen<br />
weitere 1.367 serologische negative Proben.<br />
Laufende Vorbeugemaßnahmen<br />
Um einer unerkannten Verbreitung der Schweinepest bei neuerlichen<br />
Ausbrüchen vorzubeugen, wurde auch 2006 ein Schweinepest-Monitoring<br />
bei Haus- und Wildschweinen durchgeführt.<br />
Die Verteilung der Probenmenge auf die kommunalen Veterinärbehörden<br />
wurde für die Hausschweine durch die Task-Force Veterinärwesen<br />
festgelegt. Die kommunalen Veterinärbehörden haben<br />
die Probenahme insbesondere in Risikobetrieben, zu denen<br />
u. a. Freiland- und Auslaufhaltungen sowie Babyferkelbetriebe<br />
gehören, durchgeführt. Die Untersuchung der Proben von Hausund<br />
Wildschweinen erfolgte in den Veterinärinstituten des LAVES.<br />
Insgesamt wurden in den Veterinärinstituten des LAVES im vergangenen<br />
Jahr 1<strong>3.</strong>731 Blutproben von Haus- und Wildschweinen<br />
virologisch (im Antigen-ELISA, zum Großteil auch in der PCR und<br />
vereinzelt in der Zellkultur) und 21.616 serologisch auf KSP überprüft.<br />
Ein weiteres wichtiges Instrument zur Früherkennung von Neuausbrüchen<br />
der Schweinepest sind die nach § 8 Schweinehaltungshygieneverordnung<br />
vorgeschriebenen Untersuchungen in<br />
Beständen mit fieberhaften Erkrankungen und anderen verdächtigen<br />
Symptomen. Da es sich in der Regel um reine Vorsorgemaßnahmen<br />
und nicht etwa einen Seuchenverdacht handelt, sind<br />
für die Betriebe keinerlei Nachteile zu befürchten.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Freiland- und Auslaufhaltungen sowie Babyferkelbetriebe gelten als<br />
Risikobetriebe. Insbesondere in diesen Betrieben haben die kommunalen<br />
Veterinärbehörden Probenahmen durchgeführt<br />
Seit September 2006 werden unter bestimmten Mindestvoraussetzungen<br />
die Untersuchungskosten von »§ 8-Untersuchungen«<br />
durch die Tierseuchenkasse übernommen. Dieses Vorgehen ist<br />
noch nicht allen Tierärzten und Schweinehaltern bekannt, ein<br />
Anstieg der Untersuchungszahlen wäre jedoch zu erwarten und<br />
zu begrüßen.<br />
Dr. Keller, B.; Dr. Nagel-Kohl, U.; Dr. Probst, D. (VI H); Dr. Mahnken, M. (TF);<br />
Dr. Boetcher, L.; Dr. Nöckler, A.; Dr. Moss, A. (VI OL)<br />
87
88<br />
Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen – Herausforderung für die hiesige Tierseuchenbekämpfung<br />
Plötzlich ist sie auch bei uns, die Krankheit mit dem seltsamen<br />
Namen, die Blauzungenkrankheit (engl. blue-tongue disease). Bisher<br />
war sie nur als exotische Tierseuche bekannt, die ihr Verbreitungsgebiet<br />
weltweit hauptsächlich in den Tropen und Subtropen<br />
hat. In Europa kam diese Erkrankung nur in Süd- und Südosteuropa<br />
vor. Die ersten Ausbrüche in Mitteleuropa wurden in den<br />
Niederlanden festgestellt. Schnell breitete sich die Erkrankung<br />
aus, so dass kurze Zeit später auch Nordrhein-Westfalen betroffen<br />
war. Wie kommt diese Erkrankung nun plötzlich nach Deutschland<br />
und was kann gegen eine Ausbreitung und gegen die Krankheit<br />
an sich getan werden? Diese Fragen und Herausforderungen<br />
stellen sich seit Mitte des Jahres 2006 dem LAVES und allen übrigen<br />
mit der Tierseuchenbekämpfung befassten Stellen. Im November<br />
2006 wurde der erste Fall in <strong>Niedersachsen</strong> im Veterinärinstitut<br />
Oldenburg des LAVES diagnostiziert und durch das<br />
Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt.<br />
Was ist Blauzungenkrankheit?<br />
Die Blauzungenkrankheit wird von einem Virus (Orbivirus) verursacht,<br />
das in 24 verschiedenen sogenannten Serotypen vorkommt.<br />
Bemerkenswert ist, dass der Serotyp 8, der das Geschehen<br />
in Mitteleuropa ausgelöst hat, bisher nur in Regionen südlich<br />
der Sahara vorgekommen ist. In Südeuropa wurden verschiedene<br />
andere Serotypen nachgewiesen. Betroffen sind Wiederkäuer,<br />
vorwiegend Schafe und auch Rinder, wobei verschiedene<br />
Serotypen des Erregers Unterschiede in den Krankheit erzeugenden<br />
Eigenschaften (der Virulenz), im Wirtsspektrum und in den<br />
Krankheitsbildern aufweisen. Der Mensch erkrankt niemals. Fleisch-<br />
verzehr und Tierkontakt sind also in jedem Falle ungefährlich. Einen<br />
tödlichen Verlauf kann die Blauzungenkrankheit hauptsächlich<br />
bei Schafen nehmen. Generell werden durch die Virusinfektion<br />
vornehmlich die Schleimhäute betroffen (siehe Abbildung).<br />
Bei Schafen zeigt der akute Verlauf neben Fieber, Apathie und<br />
Absonderung von der Herde, ein Anschwellen von Maulschleimhaut<br />
und Zunge. Durch starke Schwellung kann die Zunge aus<br />
dem Maul hängen und sich bläulich verfärben, so entstand der<br />
etwas seltsam anmutende Name: Blauzungenkrankheit. Auch<br />
bei Rindern sind Schleimhäute an Augen, Maul und Genitalien<br />
betroffen, daneben kommt es vorwiegend zu Entzündungen im<br />
Bereich der Euter- und Zitzenhaut. Die Krankheit kann ausheilen<br />
und bei den Tieren bildet sich eine Immunität.<br />
Verbreitungswege<br />
Die Übertragung der Blauzungenkrankheit erfolgt durch stechende<br />
Insekten.
Bekannte Überträger sind in erster Linie Gnitzen der Gattung<br />
Culicoides, die das Virus beim Stechen aufnehmen. Danach entwickelt<br />
sich das Virus im Insekt, überlebt dort und kann bei weiteren<br />
Blutmahlzeiten auf neue Wirte übertragen werden. Eine<br />
direkte Übertragung der Blauzungenkrankheit von Tier zu Tier<br />
ohne die Beteiligung von Insekten ist nicht möglich.<br />
Diagnostik im LAVES<br />
Unabdingbar für die Seuchenbekämpfung ist das Vorhandensein<br />
einer geeigneten Diagnostik und somit der Möglichkeit, ein infiziertes<br />
oder erkranktes Tier sicher und eindeutig zu erkennen.<br />
Hier standen die betroffenen europäischen Länder und in <strong>Niedersachsen</strong><br />
insbesondere das LAVES vor neuen Herausforderungen,<br />
denn bisher war hier ja keine Blauzungenkrankheit vorgekommen<br />
und eine entsprechende Diagnostik weder erforderlich noch<br />
vorhanden. Innerhalb kürzester Zeit nach dem hiesigen Auftreten<br />
der Blauzungenkrankheit wurden in den Veterinärinstituten<br />
des LAVES in enger Kooperation mit dem Nationalen Referenzlabor<br />
im Friederich-Loeffler-Institut die Möglichkeiten zum Nachweis<br />
der entsprechenden Erregervariante und der entsprechenden<br />
Antikörper aus dem Blut infizierter Tiere geschaffen. Außerdem<br />
wurde der Erregernachweis aus Organproben verendeter<br />
Tiere etabliert. Bis zum Ende des Jahres waren dann auch schon<br />
mehrere Tausend Blutproben mittels diagnostischer Methoden<br />
wie der PCR und dem ELISA auf Blauzungenkrankheitserreger und<br />
Antikörper in den Laboren untersucht worden (siehe Tabelle).<br />
Tabelle <strong>3.</strong>11: Untersuchung auf Blauzungenkrankheitserreger<br />
und Antikörper 2006<br />
Blutproben<br />
Organproben<br />
PCR<br />
ELISA<br />
PCR<br />
Proben davon positiv<br />
Bekämpfungsmaßnahmen<br />
Für eine sinnvolle Seuchenbekämpfung sind genaue Kenntnisse<br />
über die Verbreitungswege der Krankheitserreger von ausschlaggebender<br />
Bedeutung. Zu den epidemiologischen Voraussetzungen<br />
von durch Insekten, so genannten Vektoren, übertragenen<br />
Krankheiten zählen eine ausreichende Dichte der Vektoren, das<br />
Vorhandensein von Infektionsquellen, d. h. entsprechenden infizierten<br />
Tieren und klimatische Bedingungen, die eine genügende<br />
Lebensspanne des Vektors zulassen und die für die Entwicklung<br />
des Erregers im Vektor geeignet sind.<br />
19<br />
224<br />
78<br />
3%<br />
40%<br />
14%<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Nicht endgültig geklärt ist die Frage, wie die Blauzungenkrankheit<br />
zu uns gelangt ist. Denkbar sind sowohl die Verschleppung<br />
und Verbreitung infizierter Gnitzen als auch ein Verbringen virustragender<br />
Tiere und die Weiterverbreitung über hiesige Insektenpopulationen.<br />
Epidemiologische Forschungen sind im Gange<br />
und es kommen stetig neue Erkenntnisse hinzu.<br />
Die Bekämpfungsmaßnahmen erstreckten sich in <strong>Niedersachsen</strong><br />
schwerpunktmäßig auf die Reglementierung des Verbringens<br />
von Rindern, Schafen und Ziegen aus den betroffenen Sperrbezirken<br />
in freie Gebiete. Damit sollte die Ausbreitung der Tierseuche<br />
über den Handel vermieden werden. Hier übernahm das<br />
LAVES im Jahr 2006 die Koordination der verwaltungsrechtlichen<br />
Maßnahmen. So wurden für das Tierseuchenbekämpfungshandbuch<br />
in Zusammenarbeit einiger Veterinärämter Vorlagen<br />
u. a. für die notwendigen Allgemeinverfügungen und Genehmigungen<br />
erstellt. Im Vordergrund stand aber auch die Einrichtung<br />
der jeweils aktuellen Gebietskulissen, da sich mit Feststellung<br />
weiterer Fälle im nördlichen Nordrhein-Westfalen die Grenzen<br />
der Beobachtungsgebiete und später auch der Sperrbezirke immer<br />
weiter in das Land vorschoben.<br />
Bei der fachlichen Beratung der Veterinärbehörden war der Fachbereich<br />
Schädlingsbekämpfung der Task-Force Veterinärwesen<br />
insbesondere zu den Insektiziden und Repellentien, aber auch<br />
zur Diagnostik der Gnitzen vielseitig gefragt.<br />
Für Verkaufstiere wurden von den kommunalen Veterinärbehörden<br />
und privaten Tierärzten Blutproben in erster Linie von Rindern<br />
genommen, die insbesondere in den Veterinärinstituten des<br />
LAVES zur Untersuchung kamen.<br />
Als einer der ersten Schritte wurde ein entsprechendes Monitoring<br />
ins Leben gerufen, dessen Umsetzung in <strong>Niedersachsen</strong> zu<br />
großen Teilen der Task-Force des LAVES zufiel. Nun werden durch<br />
Übersichtsuntersuchungen im ganzen Land die bisherige Verbreitung<br />
und über regelmäßige Untersuchungen bisher negativer<br />
Tiere eine mögliche Neuausbreitung genau im Auge behalten<br />
und wertvolle Erkenntnisse für kommende Strategien gewonnen.<br />
Dr. Probst, D.; PD Dr. Runge, M. (VI H); Dr. Gerdes, U. (Abt. 3);<br />
Dr. Bötcher, L.; Krah, B. (VI OL)<br />
89
90<br />
Tierkrankheiten – mehr als nur Tierseuchen<br />
Gefahr für Weidetiere durch giftiges Jakobskreuzkraut<br />
Nicht jedem Weidetierbesitzer ist bekannt, dass gifthaltige Pflanzen,<br />
auf Wiesen und Weiden wachsend, zu einer Gefahr für die<br />
eigenen Tiere werden können. So wurde im Sommer des vergangenen<br />
Jahres im Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES ein Pferd<br />
seziert, das infolge der Aufnahme von toxischen Inhaltsstoffen<br />
der Pflanze Jakobskreuzkraut verendet war. Todesursache: eine<br />
toxisch-degenerative Schädigung des Lebergewebes.<br />
Norweger-Wallach, der an einer toxischen Hepatose verendet ist<br />
Seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts ist das Problem bekannt.<br />
Von besonderer Bedeutung ist die zu den Korbblütlern zählende<br />
Gattung Senecio, die weltweit verbreitet ist und circa 1.300 Vertreter<br />
umfasst. Ein wichtiger Vertreter ist das Alpenkreuzkraut<br />
(Senecio alpinus), das in der Schweiz und den Ostalpen bis zu<br />
einer Höhe von 2.000 Metern weit verbreitet ist. Durch intensiven<br />
Weidebetrieb ist diese Art ein schnell wachsendes Unkraut<br />
auf den stark gedüngten Plätzen der Bergweiden geworden.<br />
Zwei weitere Vertreter, das Jakobskreuzkraut mit dem botanischen<br />
Namen Senecio jacobaea und das gemeine Kreuzkraut<br />
(Senecio vulgaris) breiten sich in den letzten Jahren in Mitteleuropa<br />
relativ rasch aus.<br />
Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea)<br />
Die Berichte über das Vorkommen der Pflanzen und damit einhergehende<br />
Erkrankungen häufen sich. Jakobskreuzkraut ist jetzt<br />
auch auf der Insel Sylt gefunden worden; es kommt vor allem<br />
an Bahndämmen, an Straßen- und Wegrändern, als Ackerwildkraut<br />
und in Wiesen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt vor. Kreuzkräuter<br />
werden wegen ihres bitteren Geschmacks von Weidetieren<br />
im allgemeinen gemieden. Aufgenommen werden sie daher<br />
nur bei Futterknappheit und nur in geringen Mengen oder im<br />
Heu bzw. der Silage, in der sie nicht als bitterer Inhaltsstoff vom<br />
Tier selektiert werden können. Giftig ist die ganze Pflanze; die<br />
toxischen Inhaltsstoffe, die sogenannten Pyrrolizidinalkaloide sind<br />
auch in Trockenfutter und Silage wirksam; die Blüten und junge
Pflanzen weisen die höchsten Konzentrationen auf. Die Pyrrolizidinalkaloide<br />
schädigen die Leber der Tiere, die makroskopisch<br />
verkleinert ist, von derber Konsistenz und das histologische Bild<br />
einer mikronodulären Leberzirrhose aufweist. Selbst kleinere<br />
Mengen der Senecio-Arten führen – regelmäßig konsumiert –<br />
zu chronischen Vergiftungen bei Weidetieren.<br />
Bei der Sektion des eingesandten Pferdes wurde diese Form der<br />
Leberzirrhose festgestellt.<br />
Mikronoduläre Leberzirrhose<br />
Zusätzlich wurden bei der histologischen Untersuchung extrem<br />
große Leberzellen beobachtet, die für eine Intoxikation mit Pyrrolizidinalkaloiden<br />
sprechen.<br />
Leberzirrhose, histologisches Präparat<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Durch weiterführende Laboruntersuchungen wurde dieser Verdacht<br />
durch den Nachweis toxischer Pyrrolverbindungen im Lebergewebe<br />
bestätigt.<br />
Im Verlauf von drei Tagen bis sechs Monaten nach Pflanzenaufnahme<br />
treten erste Symptome auf. Als erste unspezifische Symptome<br />
werden schlechte Futteraufnahme, Gewichtsverlust, vereinzelt<br />
Durchfall und häufiges Gähnen beobachtet. Hinweise<br />
für das Auftreten eines hepatoenzephalen Syndroms (zentralnervöse<br />
Störungen aufgrund der eingeschränkten Leberfunktion)<br />
sind das längere Stehenbleiben auf der Weide mit stumpfem<br />
Gesichtsausdruck und Bewusstseinstrübung. Im Terminalstadium<br />
zeigen die Pferde Inkoordinationen mit Vorwärtsdrängen,<br />
eine zunehmende Apathie, Kaukrämpfe oder Anfälle mit<br />
Aggressivität bis hin zum Festliegen im Koma.<br />
Kreuzkraut abmähen oder vernichten<br />
Der hier vorgestellte Fall bestätigt somit die Bedeutung möglicher<br />
Pflanzenvergiftungen. Durch eine extensivere Landnutzung<br />
sowie durch Rationalisierungs- und Ökologisierungsmaßnahmen<br />
haben spätblühende Arten wie das Jakobskreuzkraut vermehrt<br />
die Möglichkeit, ungehindert zu versamen und sich in landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen auszubreiten. Dies vorwiegend in<br />
Weiden. Eine chemische Bekämpfung ist nur begrenzt möglich.<br />
Nach Angaben von Fachleuten sollte das Kreuzkraut vernichtet<br />
oder gemäht und das Mähgut von den Grünlandflächen entsorgt<br />
werden, bevor es zur Blüte und Samenreife kommt.<br />
Dr. Brügmann, M. (VI OL)<br />
91
92<br />
Tierschutz<br />
Beratung zur Haltung gefährlicher Tiere nimmt zu<br />
Die Mitarbeiter des Dezernates Tierschutzdienst (Dez. 33) des<br />
LAVES werden zunehmend mit Fragen zur Haltung und Pflege<br />
potentiell gefährlicher Wildtiere konfrontiert, insbesondere zu<br />
Arten, die den Klassen Reptilien, Amphibien und Spinnentiere<br />
(darunter Spinnen und Skorpione) angehören.<br />
Eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung über das Halten gefährlicher<br />
Tiere wildlebender Arten besteht nicht und nur einige<br />
Bundesländer verfügen über entsprechende Verordnungen. Die<br />
auf Länderebene existierenden Bestimmungen sind durchaus unterschiedlich<br />
hinsichtlich ihrer Auffassung, welche Tiere als gefährlich<br />
einzustufen sind.<br />
Landesrechtliche Regelung in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Die »Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere« (Gefahrtier-<br />
Verordnung – GefTVO) regelt in <strong>Niedersachsen</strong> die nicht gewerbliche<br />
Haltungen der als gefährlich eingestuften Tiere.<br />
Demnach ist die Haltung von Giftschlangen, Giftechsen, tropischen<br />
Giftspinnen und giftigen Skorpionen grundsätzlich verboten.<br />
Die für die Durchführung der Verordnung zuständigen Landkreise<br />
und kreisfreien Städte können jedoch Ausnahmen von diesem<br />
Verbot genehmigen, wenn durch die Haltung keine Gefahr<br />
für Dritte entsteht und sichergestellt ist, dass bestimmte Gegenmittel<br />
(Seren) und Behandlungsempfehlungen bereitgehalten<br />
werden.<br />
Die Haltung einer Reihe von weiteren Tieren, darunter auch Krokodile,<br />
bedarf laut GefTVO einer Genehmigung. Diese ist zu erteilen,<br />
wenn durch die Tierhaltung im Einzelfall die Sicherheit<br />
Dritter nicht gefährdet ist.<br />
Die Haltung von Krokodilen bedarf laut GefTVO einer Genehmigung.<br />
Diese wird erteilt, wenn durch die Haltung des Krokodils die Sicherheit<br />
von Dritten nicht gefährdet ist<br />
Tierschutzfachliche und sicherheitsrelevante Aspekte<br />
Die Haltungsanforderungen der aus unterschiedlichsten Herkunftsbiotopen<br />
stammenden Arten mit ihren verschiedenen Lebensweisen<br />
sind vielgestaltig. Somit sind auch an den Halter hohe Ansprüche<br />
hinsichtlich seiner Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu<br />
stellen. Er muss den Grundbedürfnissen (Ernährung, Pflege, verhaltensgerechte<br />
Unterbringung) seines Tieres, der Art und Bedürfnisse<br />
entsprechend, nachkommen. Mindestanforderungen<br />
bezüglich der Größe von Behausungen dürfen nicht unterschritten<br />
werden. Die mögliche endgültige Größe des Tieres ist daher<br />
zu berücksichtigen. Elementar sind jedoch die Strukturierung und<br />
die Ausstattung von Terrarien, samt Bodengrund, die Luftfeuchtigkeit<br />
und der Zugang zu Wasser, eine wirksame Luftzirkulation,
die Temperatur, das Temperaturgefälle und besonders die Beleuchtung<br />
bzw. Lichtqualität. Das Vorhandensein von Thermo- und<br />
Hygrometern muss zur Standardausstattung eines Terrariums gehören.<br />
Allein die im Handel erhältlichen Terrarientypen werden<br />
der Artenvielfalt nicht gerecht. Auch hier sind Kompetenz und<br />
fachliche Kreativität des Halters gefragt. Spezifische Kenntnisse<br />
hinsichtlich der Futteransprüche müssen beim Tierhalter vorausgesetzt<br />
werden, um die Gesunderhaltung seines Bestandes<br />
unterstützen zu können. Ein häufiger Schwachpunkt ist sicherlich<br />
das Wahrnehmen von Krankheitssymptomen bei Reptilien,<br />
Amphibien und Spinnentieren, die, wenn überhaupt, häufig erst<br />
spät erkannt werden und zu einem langsamen und qualvollen<br />
Tod der Tiere führen können.<br />
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
hat mit dem »Gutachten über Mindestanforderungen<br />
an die Haltung von Reptilien« (1997) eine Orientierungshilfe<br />
erstellt, die bei der Haltung, dem Handel und der Zucht<br />
beachtet werden soll. Der Bundesverband für fachgerechten Arten-<br />
und Naturschutz e.V. beispielsweise, bietet die Möglichkeit<br />
eines Sachkundenachweises an, der auch von privaten Haltern<br />
abgelegt werden sollte.<br />
Die Gefährlichkeit eines Tieres geht von seinen körpereigenen<br />
Giften oder seinen körperlichen Kräften aus. Halter derartiger<br />
Tiere müssen daher über ein erhebliches Maß an Fachkompetenz<br />
und Zuverlässigkeit hinsichtlich zu treffender Sicherheitsmaßnahmen<br />
verfügen. Im Falle eines Unfalls muss der Halter<br />
mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen, eine strafrechtliche<br />
Ahndung ist denkbar.<br />
Gefährliche Tiere müssen absolut aus- und einbruchsicher sowie<br />
abschließbar untergebracht werden. Schleusen verringern das<br />
Risiko eines Ausbruchs. Terrarienscheiben müssen bruchsicher<br />
sein. Jedes Terrarium ist mit Informationen zu der darin lebenden<br />
Art, auch ihres lateinischen Namens, zu versehen, ergänzt<br />
durch eine im Haltungsraum ausgehängte Liste aller Arten, unter<br />
Angabe der Anzahl vorhandener Tiere. Verschließbare Schlupfkästen<br />
in den Terrarien sollen den Halter beim Säubern des Behältnisses<br />
schützen. Arbeiten, die das Öffnen von Terrarien erfordern,<br />
dürfen nie ohne eine weitere, in Rufweite befindliche<br />
Person, durchgeführt werden. Der Terrarienraum sollte zudem<br />
mit Hilfsmitteln zum Einfangen der Tiere (Greifzange, Metallhaken<br />
oder Fanggabeln) ausgestattet sein. Schließlich ist ein stets<br />
aktualisierter Notfallplan auszuhängen, der Angaben über die<br />
schnelle Verfügbarkeit von Sera, Notrufnummern und Erstmaßnahmen<br />
enthalten muss.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Fazit<br />
Auf eine Zunahme der Haltungen gefährlicher Tiere weist eine<br />
vermehrte Registrierung von Bissverletzungen durch giftige Exoten,<br />
eine ansteigende Zahl von Exotenhändlern, aber auch der<br />
Einsatz der Feuerwehren zur Sicherstellung von Schlangen, Echsen<br />
u. a. exotischen Tieren hin.<br />
Potentiell gefährliche Tiere gehören nicht in die Obhut unerfahrener<br />
und unzuverlässiger Personen. Mangelnde Sachkenntnisse<br />
im Hinblick auf die Haltung dieser Tiere führen zu erheblichen<br />
Risiken für das Leben und die körperliche Unversehrtheit von<br />
Menschen und anderen Tieren. Auch der Verkauf gefährlicher<br />
Tiere gehört in kompetente Hände und sollte nur über den Fachhandel<br />
oder qualifizierte Zuchtbetriebe stattfinden. Grundsätzlich<br />
wäre eine Verpflichtung, sich vor dem Verkauf eine Sachkundebescheinigung<br />
des Käufers vorlegen zu lassen, zu begrüßen.<br />
Der Tierschutzdienst befasst sich seit Jahren mit der Beratung zur<br />
artgerechten Unterbringung und Pflege dieser, meistens exotischen,<br />
Tiere. Im Rahmen ihrer beratenden Tätigkeit müssen die<br />
Mitarbeiter des Dezernates Tierschutzdienst aber häufig über<br />
ihren eigentlichen Aufgabenbereich hinausgehen und sich mit<br />
Fragen der Sicherheit und der Gefahrenabwehr beschäftigen.<br />
Dazu gehören auch Ortsbegehungen nach Anforderung durch<br />
die zuständigen kommunalen Veterinärbehörden.<br />
Mit einer Zunahme der operativen Beratung in diesem Fachgebiet<br />
ist in den kommenden Jahren zu rechnen.<br />
Dr. Welzel, A. M. (Dez. 33)<br />
93
94<br />
Neue EU-Tiertransportverordnung in Kraft<br />
Herausforderung für die Veterinärverwaltung<br />
Der Rat der Europäischen Union (EU) hat 2004 eine Verordnung<br />
verabschiedet, die verbindlich ab dem 5. Januar 2007 gelten soll.<br />
Das Ziel dieser Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von<br />
Tieren beim Transport soll sein, die Durchsetzung der Tiertransportvorschriften<br />
in den Mitgliedstaaten der EU drastisch zu verschärfen<br />
und dadurch beizutragen, dass sich Tierschutzbedingungen<br />
verbessern.<br />
Die Verordnung, die unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat der EU<br />
rechtsgültig ist, um eine Einheitlichkeit innerhalb der EU herzustellen,<br />
ist das Ergebnis einer radikalen Überprüfung der bisherigen<br />
Tiertransportregelung in den einzelnen Mitgliedstaaten der<br />
Gemeinschaft und löst in weiten Teilen die auf einer alten EU-<br />
Richtlinie basierende nationale Tierschutztransportverordnung ab.<br />
Da sich die Mitgliedstaaten aber nicht hinsichtlich einer Überarbeitung<br />
der seit langem strittigen Höchstfahrtzeiten und der Besatzdichte<br />
von Tiertransportmitteln einigen konnten, erklärte sich<br />
die Kommission damit einverstanden, diese beiden Fragen zunächst<br />
auszuklammern und in einem separaten Vorschlag zu klären.<br />
Dieser soll spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung<br />
vorliegen und den Erfahrungen mit der Durchsetzung<br />
der neuen Vorschriften in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen.<br />
Einige der wichtigsten Neuregelungen sind:<br />
• die Benennung der Verantwortlichkeit während der gesamten<br />
Transportkette<br />
• höhere Anforderungen für Transporte über acht Stunden<br />
• Zulassung von Transportunternehmen und Transportmitteln<br />
• Befähigungsnachweise für Fahrer und Begleitpersonal<br />
• ein neues Begleitscheinsystem (Fahrtenbuch) bei langen Transporten<br />
• Einführung neuer Kontrollsysteme auf den Fahrzeugen (Satellitennavigationssysteme)<br />
Die neue EU-Tiertransportregelung soll die Bedingungen der zu<br />
transportierenden Tiere verbessern<br />
Bei der Frage, wie die Verordnung in <strong>Niedersachsen</strong> anzuwenden<br />
ist, zeigte sich schnell, dass noch viele Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten<br />
bestehen. Der Tierschutzdienst hat sich<br />
2006 dieser Problematik schwerpunktmäßig angenommen und<br />
die noch zu klärenden Fragen gemeinsam mit den kommunalen<br />
Veterinärbehörden zusammengetragen, um eine einheitliche Anwendung<br />
der Verordnung sicherzustellen. Dieser Fragenkatalog<br />
war dann auch Diskussionsgrundlage von Besprechungen der<br />
Bundesländer. Es zeigte sich, dass bundesweit hierzu weiterer<br />
Diskussionsbedarf besteht. Ziel wird es nun sein, Ausführungshinweise<br />
zu erarbeiten sowie das »Handbuch Tiertransporte« zu<br />
überarbeiten, da nur so ein einheitlicher Vollzug der neuen EU-<br />
Tiertransportverordnung sichergestellt werden kann.<br />
Das Einbringen der Fachkompetenz des Tierschutzdienstes auf<br />
Landes- und Bundesebene sowie die operative Beratung der kommunalen<br />
Veterinärbehörden und der Wirtschafts- und Interessenverbände<br />
werden auch im nächsten Jahr ein Arbeitsschwerpunkt<br />
des Tierschutzdienstes sein.<br />
Dr. Franzky, A. (Dez. 33)
Nationale Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Kraft<br />
Schweinehaltung<br />
Die kontroverse Diskussion, ob die EU-Richtlinie zur Schweinehaltung<br />
aus Wettbewerbsgründen strikt eins zu eins in nationales<br />
Recht umgesetzt werden sollte, oder ob zum Wohle der 26<br />
Millionen Schweine in Deutschland über die Brüsseler Vorgaben<br />
hinausgehende Anforderungen festgeschrieben werden sollten,<br />
ist im August 2006 nach rund fünf Jahren beendet worden – die<br />
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung wurde um den Abschnitt<br />
4: »Anforderungen an das Halten von Schweinen« ergänzt.<br />
Die neuen Vorschriften basieren in weiten Teilen auf den »Niedersächsischen<br />
Tierschutzleitlinien für die Schweinehaltung«, die bereits<br />
2002 in Zusammenarbeit mit den Veterinärbehörden, Landwirtschaftskammern<br />
und der Wissenschaft unter Federführung<br />
des LAVES, Dezernat »Tierschutzdienst« erstellt worden sind und<br />
seit dem per Erlass in <strong>Niedersachsen</strong> flächendeckend für Neuund<br />
Umbauten erfolgreich umgesetzt wurden. Damit konnten<br />
in wesentlichen Kernpunkten höhere tierschutzfachliche Anforderungen<br />
etabliert werden, als die EU-Richtlinie vorschreibt. Dies<br />
gilt insbesondere für ein vergrößertes Platzangebot in der Mast,<br />
das Angebot von »schweinefreundlichem« Beschäftigungsmaterial<br />
und den zwingend erforderlichen Einfall von natürlichem Tageslicht.<br />
Dass Tierschutz und Wirtschaftlichkeit sich nicht widersprechen<br />
müssen, zeigt die breite Akzeptanz der Vorgaben auch<br />
seitens der Landwirtschaft.<br />
Legehennen<br />
Nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ist die Haltung<br />
von Legehennen in konventionellen Käfigbatterien in Deutschland<br />
seit Ende 2006 verboten. Durch die Änderung der Verordnung<br />
im August 2006 können jedoch Altanlagen, für die bei der<br />
zuständigen Behörde ein verbindliches und plausibles Konzept<br />
zur Umstellung auf Boden- oder Kleingruppenhaltung eingereicht<br />
wurde, übergangsweise noch bis Ende 2008 weitergenutzt<br />
werden. Im Rahmen einer strengen Einzelfallprüfung kann<br />
für diese Haltungen eine Verlängerung um ein weiteres Jahr genehmigt<br />
werden, wenn der Tierhalter entstehende Verzögerungen<br />
in der Umsetzung der Umstellungspläne nicht zu vertreten<br />
hat. Da die bei den Veterinärbehörden eingereichten Anträge<br />
von sehr unterschiedlicher Qualität sind und von gut begründeten<br />
und nachvollziehbaren Umstellungskonzepten bis hin zum<br />
Versuch reichen, nur eine Verlängerung der konventionellen Batteriehaltung<br />
ohne tatsächliche Umstellung zu erzielen, gibt es vermehrt<br />
Anfragen beim Dezernat »Tierschutzdienst«, in wie weit<br />
Anträge akzeptiert beziehungsweise abgelehnt werden können.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Neu eingeführt worden ist die sogenannte Kleingruppenhaltung,<br />
deren Anforderungen hinsichtlich Fläche pro Tier, Höhe der Haltungseinrichtung<br />
sowie Ausgestaltung von Nest- und Einstreubereich<br />
deutlich über den EU-Anforderungen vergleichbarer<br />
Haltungssysteme liegen. Wie sich die Kleingruppenhaltung in<br />
Deutschland zahlenmäßig entwickeln und welchen Einfluss sie<br />
auf die Verbreitung der übrigen Haltungsverfahren haben wird,<br />
bleibt abzuwarten.<br />
Noch nicht näher geregelt ist die Aufzucht der Legehennen; hier<br />
ist lediglich eine Gewöhnung der Tiere an die spätere Haltungseinrichtung<br />
vorgeschrieben. In der Praxis werden aber gerade<br />
in dieser Phase häufig tierschutzrelevante Mängel beobachtet,<br />
die negative Auswirkungen auf die gesamte spätere Legeperiode<br />
haben können; Vorgaben insbesondere zur Besatzdichte, zum<br />
Lichtregime und zum Angebot von Einstreumaterial sind dringend<br />
erforderlich.<br />
Insgesamt ist der Bedarf an Beratung sowohl der Veterinärbehörden<br />
als auch der Tierhalter durch die Änderung der Tierschutz-<br />
Nutztierhaltungsverordnung noch deutlich gestiegen. Um diesem<br />
Anliegen nicht nur in Einzelgesprächen Rechnung zu tragen,<br />
sondern umfassende Lösungsansätze anzubieten, war und ist<br />
der Tierschutzdienst des LAVES sowohl in die Ausarbeitung von<br />
Ausführungshinweisen des Landes <strong>Niedersachsen</strong> zur Schweineals<br />
auch zur Legehennenhaltung intensiv eingebunden.<br />
Dr. Petermann, S. (Dez. 33)<br />
95
96<br />
Zierfischhaltung in Diskotheken – tierschutzfachlich vertretbar?<br />
Auf Speisekarten oder im Fischeinzelhandel angebotene Fische,<br />
Hummer und andere Krebstiere werden vor Ort auch der Frische<br />
wegen in begrenztem Vorrat in Aquarien gehalten. Doch darüber<br />
hinaus ist auch das Zurschaustellen von Zierfischen in Restaurants<br />
und zunehmend mehr auch in Tanzlokalen zu beobachten.<br />
Besonders die Haltung von Fischen in Diskotheken erfordert durch<br />
die möglichen Belastungen der Tiere durch Lärm, Vibrationen und<br />
Lichtimpulse eine tierschutzrechtliche Bewertung.<br />
Tierschutzrechtliche Grundsätze<br />
Der Tierschutz stellt ein hohes gesellschaftliches Gut dar und wurde<br />
nicht zuletzt deshalb 2002 als Staatsziel im Grundgesetz verankert<br />
(Art. 20a). Im Einzelnen wird die Verantwortung des Menschen<br />
für das Tier als Mitgeschöpf im Tierschutzgesetz (TierSchG)<br />
geregelt. Es gibt mit § 1 vor, dass »niemand einem Tier ohne vernünftigen<br />
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden« zufügen darf.<br />
Hierzu werden in § 2 TierSchG grundlegende Anforderungen an<br />
die Haltung definiert:<br />
Bei der Haltung von Fischen, gerade in Diskotheken, ist zu prüfen, ob<br />
den Tieren durch z.B. Lichtimpulse Schmerzen, Leiden oder Schäden<br />
zugefügt werden<br />
• angemessene Ernährung und Pflege sowie verhaltensgerechte<br />
Unterbringung<br />
• keine Einschränkung der Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung<br />
• Sachkunde des Tierhalters<br />
Für Süßwasser-Zierfische sind die Haltungsnormen in dem Gutachten<br />
»Mindestanforderungen an die Haltung von Zierfischen«<br />
1998 präzisiert worden.<br />
Inwieweit eine Zurschaustellung von Zierfischen in Diskotheken<br />
nach dem Tierschutzgesetz erlaubnispflichtig ist, kann an dieser<br />
Stelle nicht abschließend erörtert werden. Sofern damit Schmerzen,<br />
Leiden oder Schäden verbunden sind, gilt nach dem Gesetz<br />
ein Verbot. Wenngleich für Fische eine bewusste Schmerzwahrnehmung<br />
bislang nicht eindeutig wissenschaftlich belegt werden<br />
konnte, ist ihre Leidensfähigkeit hingegen rechtlich unumstritten.<br />
Schallmessung in einer Diskothek, die Zierfische in den gewerblichen<br />
Räumen hält
Einzelfallbeurteilungen notwendig<br />
Gleich mehrfach wurde der Expertenrat der Task-Force Veterinärwesen,<br />
Fachbereich Fischseuchenbekämpfung des LAVES, jeweils<br />
auf Anfragen der zuständigen kommunalen Veterinärbehörden<br />
benötigt.<br />
Die Fälle im Einzelnen:<br />
In einer Diskothek in <strong>Niedersachsen</strong> wurden marine Zierfische in<br />
den Betriebsräumen gehalten.<br />
Als problematisch sahen die Experten des LAVES es an, dass das<br />
aufgestellte Aquarium sich im Bereich der Tanzfläche befand, so<br />
dass nicht auszuschließen war, dass während eines Diskobetriebes<br />
Vibrationen und Lichtimpulse sowie der Schalldruck der Geräuschkulisse<br />
bei den Fischen tierschutzrelevante Leiden und Schäden<br />
verursachen konnten. Die behördliche Anordnung zur pfleglichen,<br />
anderweitigen Unterbringung der gehaltenen Fische wurde<br />
zwar im Zuge eines Rechtsstreites von dem zuständigen Verwaltungsgericht<br />
bestätigt. Eine Überprüfung der Zierfischhaltung sowie<br />
weitergehende Untersuchungen zur Wirkung der Betriebsbedingungen<br />
auf das Tierverhalten unterblieben jedoch, nachdem<br />
im Rahmen des Rechtsstreites das Hauptsacheverfahren entfallen<br />
war.<br />
In einem weiteren Fall bezog sich die Anfrage auf das Einbeziehen<br />
des Fachrates in die Bauplanung, und dort ein die Bauplanung<br />
einer beabsichtigen Fischhaltung.<br />
In einem nächsten Fall kam es erneut zu einer Vor-Ort-Überprüfung.<br />
Auf Wunsch eines Diskothekenbetreibers und nach Anfrage<br />
der zuständigen kommunalen Veterinärbehörde prüfte das<br />
LAVES in Zusammenarbeit mit dem Dritten Physikalischen Institut<br />
der Universität Göttingen die Haltung von Zierfischen unter<br />
den Betriebsbedingungen einer Diskothek aus tierschutzfachlicher<br />
Sicht.<br />
Das Aquarium war vibrationssicher und für den Besucher nicht<br />
zugänglich im Barbereich aufgestellt. Im Aquarium befanden<br />
sich ostafrikanische Süßwasser-Zierfische. Die Haltungsbedingungen<br />
wurden auf der Grundlage von Wasseruntersuchungen, der<br />
Beurteilung der Beckenstrukturierung (Bepflanzung, Bodengrund,<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Rückzugsmöglichkeiten), der Einschätzung des Tierverhaltens<br />
und des äußeren Erscheinungsbildes der Einzeltiere bewertet.<br />
Weder die Befunde der Wasseruntersuchungen noch die Beobachtungen<br />
führten zu einer Beanstandung.<br />
Um zu beurteilen, ob die Zierfischhaltung unter den Bedingungen<br />
des Diskothekenbetriebs zu beanstanden war, fand eine<br />
Bestimmung der Lichtstärke der variierenden Lichteffekte mithilfe<br />
eines Luxmeters direkt vor dem Aquarium statt. Außerdem<br />
wurde der Schalldruck unmittelbar vor dem Becken und unter<br />
Anwendung eines Hydrophons im Wasser gemessen. Die erste<br />
Messung erfolgte unter Einhaltung des für Geräuschemissionen<br />
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertes von 85 dB(A). Für die<br />
zweite Messung wurde die Musikanlage unter Volllast mit einem<br />
Schalldruck von 101 dB(A) aufgedreht.<br />
97
98<br />
Im Ergebnis zeigte sich, dass die Lichtimpulse vernachlässigbar<br />
geringe Messwerte von maximal 6 Lux annahmen. Für die Schalldruckmessungen<br />
galt, dass im Fall der unter Volllast betriebenen<br />
Musikanlage Messsignale oberhalb der unteren Messbereichsgrenze<br />
nur dann im Wasser zu ermitteln waren, wenn impulsartige<br />
Basssignale erzeugt wurden. Die Zierfische ließen für die<br />
Dauer der Untersuchungen keine Verhaltensänderungen erkennen.<br />
Fazit<br />
Zumindest für den zuletzt vorgestellten Einzelfall kann als Fazit<br />
gelten, dass das Beschallen eines Glasaquariums durch die Musikanlage<br />
einer Diskothek selbst bei einem äußeren Schalldruck<br />
von 101 dB(A) zu keinen erkennbaren Änderungen des Tierverhaltens<br />
im Fischbestand geführt hatte. Auch die gemessenen<br />
Lichtimpulse schienen keinen Einfluss auf das Verhalten der Zierfische<br />
zu haben. Es gab keine Hinweise bei den Fischen, die den<br />
Rückschluss auf tierschutzrelevante Leiden bzw. Schäden zuließen<br />
– obwohl Fische auf Schalleinwirkungen sehr empfindlich reagieren.<br />
Annehmbar ist, dass die Schallwellen überwiegend von dem<br />
Glasbecken reflektiert, oder auch absorbiert, jedoch nicht mit<br />
Selbst bei einem Schalldruck von 101 dB(A) konnte man keine Verhaltensänderungen<br />
der Fische in dem beschallten Aquarium erkennen, obwohl<br />
Fische empfindlich auf Schalleinwirkung reagieren<br />
dem Wasser fortgeleitet wurden. Für einen üblichen Diskothekenbetrieb<br />
ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Teil der<br />
emittierten Schallwellen von den Besuchern absorbiert wird. Darüber<br />
hinaus darf der Schalldruck den gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Grenzwert von 85 dB(A) nicht überschreiten. Inwieweit eine<br />
dauerhafte Schalleinwirkung mit der Zeit Fische schädigen kann,<br />
ist nicht bekannt.<br />
Auch künftig sind Einzelfallbeurteilungen unverzichtbar, da eine<br />
allgemeinverbindliche Bewertung von Zierfischhaltungen in Diskotheken<br />
mit dem aktuellen Wissensstand nicht möglich ist. Die<br />
Einzelfallbeurteilungen sollten neben allgemeinen Haltungsbedingungen<br />
berücksichtigen, dass ein Zierfischbecken so aufgestellt<br />
wird, das es vor Vibrationen und Lichtimpulsen geschützt<br />
ist und sich möglichst außerhalb des unmittelbaren Einwirkungsbereiches<br />
der Besucher befindet.<br />
Kleingeld, D. W. (Dez. 32); Redetzky, R. (Vet. Ref.)
Verbraucherschutz »Vom Acker bis zum Teller«<br />
Neues EU-Recht zur Lebensmittelsicherheit und -hygiene<br />
(einschließlich Futtermitteln)<br />
Seit Januar 2006 wurde durch Inkrafttreten der EU-Verordnungen<br />
852-854/2004 zur Lebensmittelhygiene sowie der Verordnung<br />
882/2004 zur amtlichen Kontrolle ein gemeinsamer rechtlicher<br />
Rahmen für alle Mitgliedsstaaten geschaffen. Damit gelten für<br />
Unternehmen und Überwachungsbehörden innerhalb der Europäischen<br />
Union mehr als zehn Jahre nach Verwirklichung des gemeinsamen<br />
Binnenmarktes endlich gleiche rechtliche Rahmenbedingungen.<br />
EU-Lebensmittel- und -hygienerecht<br />
Die neuen Verordnungen bieten für die Wirtschaftsbeteiligten in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, insbesondere in den Veredelungsregionen des<br />
Nordwestens, zusätzliche Marktchancen, da sie Wettbewerbsverzerrungen<br />
durch frühere strengere nationale Vorgaben minimieren<br />
und den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten erleichtern.<br />
Teilweise wird an den neuen Verordnungen Kritik geübt, da diese<br />
mit ihrem System von recht unkonkreten Rechtsbegriffen neue<br />
Interpretationsräume für Behörden und Unternehmen im Hinblick<br />
auf die Ausgestaltung des Rechts schaffen. Statt konkreter baulicher<br />
und technischer Anforderungen begegnet man im neuen<br />
EU-Hygienerecht zielorientierten Formulierungen, die sachverständig<br />
mit Inhalt zu füllen sind. Beispielsweise sind Betriebsstätten<br />
so anzulegen, zu bauen und zu konzipieren, dass eine angemessene<br />
Instandhaltung, Reinigung und Desinfektion möglich ist.<br />
Aus Sicht des LAVES wird durch diesen weniger konkreten Rechtsrahmen<br />
die Lebensmittelsicherheit nicht grundsätzlich gefährdet,<br />
er bietet vielmehr die notwendige Möglichkeit, individuelle Lösungen<br />
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu schaffen.<br />
Im Gegensatz zu starren, konkret ausformulierten Rechtsvorgaben<br />
tragen die neuen Hygienevorschriften zudem einem rasch<br />
wechselnden Stand technischer Möglichkeiten Rechnung.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Für Unternehmen und Überwachungsbehörden gelten nun EU-weit<br />
die gleichen Rahmenbedingungen<br />
Im Umkehrschluss lassen unkonkrete Rechtsvorgaben Spielraum<br />
für voneinander abweichende Interpretationen des Hygienerechts,<br />
was im ungünstigen Fall zu einer Wettbewerbsverzerrung durch<br />
eine Ungleichbehandlung der Unternehmen führen kann. Deshalb<br />
wird es zukünftig noch bedeutsamer, eine umfassende Abstimmung<br />
der beteiligten Behörden in Überwachungsfragen herbeizuführen.<br />
Zielsetzung aller neuen hygienerechtlichen Vorschriften ist es,<br />
dem Verbraucher nur sichere Lebensmittel anzubieten. Dies kann<br />
nur durch den Unternehmer gewährleistet werden. Vor dem<br />
99
100<br />
Hintergrund des Produkthaftungsrechts ist der Lebensmittelunternehmer<br />
gut beraten, Leitlinien für gute Hygienepraxis sowie<br />
DIN-Normen als Auslegungshilfe zur Erarbeitung von Hygienekonzepten<br />
und Durchführung von Eigenkontrollen heranzuziehen,<br />
da ihm die Umsetzung derart etablierter Vorgehensweisen<br />
im Zweifelsfall ein gewisse Rechtssicherheit bietet. Des Weiteren<br />
ist es auch nicht schädlich, bewährte Vorgaben, die in der Vergangenheit<br />
Anwendung fanden, (z. B. Hygieneregelungen der Hackfleischverordnung)<br />
auch zukünftig als Maßstab beizubehalten.<br />
Zulassungspflicht für alle Schlachtbetriebe<br />
Besondere Beachtung verdient aus Sicht des LAVES die obligatorische<br />
Einführung einer Zulassungspflicht für alle Schlachtbetriebe<br />
und die schon bald in Kraft tretenden Regelungen zur Lebensmittelketteninformation.<br />
Damit werden Landwirte verpflichtet,<br />
umfassende Auskünfte zum Gesundheitsstatus der Tiere an<br />
den Schlachtbetrieb zu übermitteln. Hiermit wird eine wesentliche<br />
Informationslücke zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit<br />
geschlossen.<br />
Landwirte werden verpflichtet, umfassende Auskünfte zum Gesundheitsstatus<br />
der Tiere an den Schlachtbetrieb zu übermitteln<br />
Die neuen Verordnungen führen allerdings auch zu einem deutlich<br />
erhöhten Aufwand für die Überwachungs- und Zulassungsbehörden.<br />
Insbesondere wird zukünftig noch mehr als heute<br />
eine Spezialisierung der Sachverständigen auf die verschiedenartigen<br />
Lebensmittelbetriebe (Schlachtbetriebe, Fischverarbeitungsbetriebe,<br />
Eiverarbeitungsbetriebe, etc.) notwendig werden, um<br />
die kommunalen Veterinärbehörden und beteiligten Unternehmen<br />
immer kompetent zu beraten. Dem erhöhten Arbeitsanfall<br />
durch Auswertung der Zulassungspflicht trägt das LAVES durch<br />
die Einstellung fünf neuer Tierärzte zu Beginn des Jahres 2007<br />
Rechnung. Damit werden auch die Möglichkeiten geschaffen,<br />
den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Export niedersächsischer<br />
Produkte in Länder außerhalb der Europäischen Union<br />
(z. B. USA) durch fachkundige Beratung interessierter Unternehmen<br />
zu unterstützen.<br />
Dr. Haunhorst, K. (Dez. 21)
Wer kontrolliert die Lebensmittel?<br />
Betriebliche Eigenkontrollen der Lebensmittelunternehmer und amtliche Überwachung durch die<br />
Behörden<br />
Jeder Lebensmittelunternehmer ist gesetzlich verpflichtet, in seinem<br />
Lebensmittelbetrieb ein Eigenkontrollsystem einzurichten.<br />
Wer ist Lebensmittelunternehmer?<br />
Natürliche oder juristische Personen, die dafür verantwortlich sind,<br />
dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle<br />
unterstehenden Lebensmittelunternehmen erfüllt werden<br />
(Definition der EU-Verordnung 178/2002, der sog. »Basis«-Verordnung).<br />
Was ist ein Lebensmittelunternehmen?<br />
Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet<br />
sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind,<br />
die eine mit<br />
• der Produktion<br />
• der Verarbeitung<br />
• und dem Vertrieb<br />
von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen (Definition<br />
der EU-Verordnung 178/2002).<br />
Lebensmittelunternehmer sind verpflichtet, die Lebensmittelsicherheit<br />
und die Verfolgbarkeit der Lebensmittel auf allen oben<br />
genannten Stufen (Produktion, Verarbeitung, Vertrieb) jeweils eine<br />
Stufe zurück (»one step down«) und eine nach vorne (»one<br />
step forward«) zu gewährleisten.<br />
Das Eigenkontrollsystem dient u. a. dazu, diese Verpflichtungen<br />
zu erfüllen. Es soll ferner sicherstellen, dass ein Unternehmer<br />
rechtskonform arbeitet. Es erleichtert bei Abweichungen oder<br />
Fehlern die schnelle Beseitigung von Mängeln. Ursachen solcher<br />
Fehler können einfacher und schneller ermittelt werden. Es bietet<br />
nicht zuletzt dem Unternehmer erhöhte Rechtssicherheit. Insgesamt<br />
schützen Eigenkontrollsysteme die Gesundheit des Verbrauchers<br />
und bieten ihm Schutz vor Täuschung.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Lebensmittelunternehmer sind verpflichtet, die Lebensmittelsicherheit<br />
und die Verfolgbarkeit der Lebensmittel, je eine Stufe vor und<br />
zurück, zu gewährleisten<br />
101
102<br />
Das Eigenkontrollsystem eines Lebensmittelunternehmens besteht<br />
insbesondere aus folgenden Teilbereichen:<br />
• Trinkwasserhygiene<br />
• Reinigung und Desinfektion von Räumen und deren Einrichtung<br />
• Personalhygiene (u. a. Hygieneschulungen)<br />
• Temperaturüberwachung<br />
• Schädlingsbekämpfung<br />
• Wartung und Instandhaltung<br />
• Beseitigung von Abfällen<br />
• Wareneingangs- und -ausgangskontrollen<br />
• Kontrollen des Produktionsprozesses<br />
• HACCP (»hazard analysis and critical control point«)-Konzept<br />
Der Umfang eines solchen Systems hängt von der Betriebsart<br />
und -größe ab. Wie der Name schon sagt, sollen sämtliche Maßnahmen<br />
systematisch und geplant erfolgen. Ein Unternehmer<br />
soll für jeden der genannten Teilbereiche Pläne entwickeln, aufschreiben<br />
und anwenden.<br />
Die Trinkwasserhygiene ist ein wichtiger Teilbereich des Eigenkontrollsystems<br />
eines Lebensmittelunternehmens<br />
Verantwortliche Mitarbeiter jedes Unternehmens prüfen täglich,<br />
ob das Eigenkontrollsystem regelgerecht arbeitet. Diese Prüfungen<br />
müssen dokumentiert werden (Motto: »Was nicht dokumentiert<br />
ist, ist nicht gemacht worden«).<br />
Das LAVES im amtlichen Kontrollsystem <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
Zuständig für die amtliche Überprüfung der Eigenkontrollsysteme<br />
sind die kommunalen Überwachungsbehörden (»Kontrolle der<br />
Kontrolle«). Es werden schriftliche Unterlagen und Aufzeichnungen<br />
sowie die operative Umsetzung kontrolliert. Das LAVES ist<br />
zuständig für die Zulassung von Betrieben zum innergemeinschaftlichen<br />
Handel (EU-weiter Handel). Im Rahmen des Zulassungsverfahrens<br />
findet eine umfassende Betriebsüberprüfung<br />
statt. In enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Überwachungsbehörden<br />
wird die Einhaltung der Anforderungen an EUweit<br />
zugelassene Betriebe überwacht.<br />
Dr. Graf, K. (Dez. 21)<br />
Bei der Überprüfung der Eigenkontrollsysteme werden schriftliche<br />
Unterlagen und Aufzeichnungen sowie die operative Umsetzung<br />
kontrolliert
Was das LAVES sonst noch macht<br />
Qualitätsmanagement im LAVES<br />
LAVES wird zertifiziert: Vereinheitlichung von Abläufen kommt auch Verbrauchern zugute<br />
Mit großem Engagement wurde 2006 im LAVES begonnen, das<br />
einheitliche Qualitätsmanagementsystem EQUINO als modernes<br />
Führungsinstrument umzusetzen.<br />
In den Abteilungen 1 bis 4 konnten bereits interne Audits durchgeführt<br />
werden; dabei war die Abteilung 1 eine der ersten auditierten<br />
Organisationseinheiten innerhalb des niedersächsischen<br />
Systems und damit Vorreiter für zahlreiche andere Organisationen.<br />
Neben dem »Tagesgeschäft«, das über die operative Beratung<br />
hinaus, originären Vollzugsaufgaben und vielem mehr auch in<br />
der Abarbeitung von Lebensmittelkrisen, Tierseuchen und anderen<br />
Sonderaufgaben besteht, bedeutet die Einführung eines<br />
neuen Managementsystems eine hohe Belastung für alle Mitarbeiter.<br />
Die angestrebte Zertifizierung des gesamten Hauses nach ISO<br />
9001 ist ein ehrgeiziges Ziel für eine Behörde dieser Größe mit<br />
ihren verschiedenen Standorten und unterschiedlicher Historie.<br />
Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Einbindung der<br />
einzelakkreditierten Institute der Abteilung 5 dar.<br />
Zentrale Themenfelder eines umfassenden Qualitätsmanagements<br />
sind die Kunden- wie auch Mitarbeiterzufriedenheit, Produkt- und<br />
Prozessqualität sowie Steigerung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.<br />
Internes Audit 2006 am Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin der<br />
Abteilung 2<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Das QM-System des LAVES wird durch Mitarbeiter, für Kunden<br />
nachvollziehbar, anhand der tatsächlichen betrieblichen Abläufe<br />
(Prozesse) im Rahmen von EQUINO gestaltet. Die Akzeptanz und<br />
Wirksamkeit des Systems hängt dabei wesentlich von der behördenindividuellen<br />
Interpretation der technokratischen Normsprache<br />
ab. Die dadurch gewährleistete praxisnahe Umsetzung der<br />
internationalen Norm sorgt nachhaltig für kontinuierliche Qualitäts-<br />
und Leistungsverbesserungen in der öffentlichen Verwaltung.<br />
Das kommt Kunden und LAVES-Mitarbeitern gleichermaßen<br />
zugute.<br />
Dr. Stehr, D. (QMB)<br />
103
104<br />
LAVES verfasst Checklisten zur Überprüfung von Biogasanlagen<br />
Die steigende Anzahl an Biogasanlagen hat auch erhebliche Auswirkungen<br />
auf die veterinärbehördliche Zulassung, wenn tierische<br />
Nebenprodukte eingesetzt werden.<br />
Biogasanlagen, die tierische Nebenprodukte wie Schlachtabfälle,<br />
Küchen- und Speiseabfälle verarbeiten, müssen veterinärrechtlich<br />
zugelassen werden (Verordnung (EG) Nr. 1774/2002). Biogasanlagen<br />
sind grob in zwei Kategorien einzuteilen. Zu der<br />
ersten Kategorie gehören Anlagen, die ausschließlich mit Gülle<br />
und nachwachsenden Rohstoffen beliefert werden, und bei denen<br />
kein Pasteurisierungszwang besteht.<br />
Zu der zweiten Kategorie gehören sogenannte Kofermentationsanlagen,<br />
die außer Gülle auch tierische Nebenprodukte einsetzen<br />
und daher in der Regel einem Erhitzungszwang unterliegen.<br />
LAVES als Dienstleister für Behörden<br />
Um den für die Zulassung verantwortlichen kommunalen Behörden<br />
(Bauämter oder Gewerbeaufsichtsämter der Landkreise und<br />
kreisfreien Städte) eine Hilfe an die Hand zu geben, wurden im<br />
LAVES Dezernat »Technische Sachverständige« Überprüfungsmethoden,<br />
Ablaufpläne sowie Checklisten entwickelt, deren<br />
Praxistauglichkeit erfolgreich nachgewiesen wurde. Im Rahmen<br />
von Vortragsveranstaltungen wurden den Zulassungsbehörden<br />
Checklisten und deren Anwendung vorgestellt. Praktische Schulungen<br />
wurden und werden auf Anforderung durchgeführt.<br />
Weiterhin haben die kommunalen Veterinärbehörden die Möglichkeit,<br />
für die Bewertung der technischen Abläufe eine Abnahme<br />
durch das Dezernat durchführen zu lassen. Hier werden<br />
beispielsweise das Material-/Verfahrensfließbild, die Verfahrensbeschreibung,<br />
bei automatischer Steuerung die Darstellung aller<br />
Prozessschritte und auch die verfahrenstechnische Trennung<br />
zwischen reiner und unreiner Seite bewertet.<br />
Bei der Planung und dem Bau von Biogasanlagen hat sich die<br />
Einbeziehung der Technischen Sachverständigen bereits in der<br />
Planungsphase und bei den späteren Zulassungsüberprüfungen<br />
als sinnvoll erwiesen.<br />
Thomes, R. (Dez. 15)<br />
Biogasanlagen, die tierische Nebenprodukte wie Küchen- und<br />
Speiseabfälle verarbeiten, müssen veterinärrechtlich zugelassen<br />
werden
Walstrandungen an der niedersächsischen Küste<br />
Für großes Interesse in der Öffentlichkeit sorgte im September<br />
des vergangenen Jahres ein im äußeren Mündungsbereich der<br />
Elbe treibender Wal. Das Säugetier wurde von der Seefahrtspolizei<br />
des Bundes in den Hafen von Cuxhaven eingeschleppt. Die<br />
Experten des Institutes für Fischkunde Cuxhaven waren sofort vor<br />
Ort. Sie stellten fest, dass es sich um einen männlichen Finnwal<br />
von rund 20 Tonnen Gewicht und 17 Meter Länge handelte. Der<br />
Kadaver befand sich im Zustand der fortgeschrittenen Zersetzung,<br />
der Leib war aufgerissen, Darmschlingen traten aus. Blutergüsse<br />
unter der Haut des Brustkorbes ließen auf Quetschungen schließen.<br />
Diese konnten durch das Trockenfallen des Tieres möglicherweise<br />
auf hartem Untergrund entstanden sein. Es käme spekulativ<br />
auch eine Kollision mit einem Schiff im Zustand allgemeiner<br />
Schwäche des Tieres in Frage. Geschwächte Wale »kippen« im<br />
Wasser orientierungslos auf die Seite und ertrinken schließlich.<br />
Der Wal wurde zerlegt und in eine Tierkörperbeseitigungsanlage<br />
gebracht.<br />
Im Zusammenhang damit tauchen immer wieder Fragen nach<br />
Ursache und Häufigkeit von Walstrandungen auf, verbunden mit<br />
der Frage, wie mit Walkadavern umzugehen ist.<br />
Wale in Küstennähe oder gar Strandungen waren in früheren<br />
Jahrhunderten willkommene Gaben der Natur, die selbstverständlich<br />
zum Fischereirecht zählten und dazu beitrugen, das karge<br />
Leben der Küstenbevölkerung zu verbessern. Bei den auf natürliche<br />
Weise verendeten Tieren waren immerhin »Speck« und<br />
Knochen geschätzte Teile, die intensiv verwertet wurden. So gab<br />
es zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Cuxhaven eine Polizeiverordnung<br />
zur Regelung der Trankocherei, weil anlässlich einer Massenstrandung<br />
von mehr als 20 Pottwalen bei der Insel Neuwerk<br />
Waltran in großen Massen abgekocht wurde und dabei wohl<br />
zahlreiche Häuser in Brand gerieten. Über die Strandungsursachen<br />
machte man sich wenig Gedanken; - höchstens darüber,<br />
wie man die reichen Gaben der Natur mehren könnte.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
In früheren Jahrhunderten waren Walstrandungen willkommene<br />
Gaben der Natur. Anders als heute wurden die verendeten Wale von<br />
der Bevölkerung verwertet. Heute werden Walkadaver aufwändig,<br />
und mit hohen Kosten, entsorgt<br />
Walstrandungen Indikator für Veränderungen der Meeresumwelt<br />
Heute werden Walstrandungen zu jenen Ereignissen gezählt, die<br />
als Indikatoren auf die vom Menschen betriebenen Explorationen<br />
und Veränderungen der Meeresumwelt hinweisen. Eine Verwertung<br />
von Walmaterialien findet nicht mehr statt. Stattdessen<br />
muss ein aufwändiges Programm für die Beseitigung des Kadavers<br />
durchgeführt werden, dessen Kosten je nach Lage des Falles,<br />
der Zahl der bei einem Ereignis gestrandeten Wale und der<br />
betroffenen Art zwischen 20.000 und 100.000 Euro liegen kann.<br />
Zur Gewährleistung eines schnellen und kooperativen Behördenhandelns<br />
wurde ein Ablaufplan festgelegt. Adressenlisten und<br />
105
106<br />
vereinbarte Kommunikationswege stellen einen schnellen Informationsaustausch<br />
sicher. Großwale stranden praktisch immer<br />
seewärts der mittleren Hochwasserlinie, wo das Land, vertreten<br />
durch das LAVES, mit Unterstützung der Seefahrtsbehörden alle<br />
notwendigen Maßnahmen durchführen muss. In dem sehr unwahrscheinlichen<br />
Fall, dass ein Wal eventuell bei einer Sturmflut<br />
an Land getragen wird, fällt diese Aufgabe dem betroffenen<br />
Landkreis zu, der natürlich mit der Unterstützung des Landes<br />
rechnen kann.<br />
Bei der Bearbeitung der Strandung von großen Walen, wie Pottwalen<br />
oder Finnwalen, sind Datenerfassungen zur Strandung<br />
und über das Tieres selbst zu berücksichtigen, wozu die Bundesrepublik<br />
durch die Mitgliedschaft in der Internationale Walfangkommission<br />
(IWC) verpflichtet ist. Für die ordnungsgemäße Beseitigung<br />
ist ein umfangreiches Team verschiedenster Disziplinen,<br />
wie z. B. der Veterinärmedizin, des Naturschutzes, der Seefahrt,<br />
des Hafenbaues, der Abwassertechnik und des Transportwesens<br />
sowie verschiedenster sachlich betroffener Behörden notwendig.<br />
Versuche, die Strandungsursachen mit dem Ziel eventueller,<br />
möglicher Präventivmaßnahmen zu entwickeln, führten bislang<br />
nicht zum gewünschten Erfolg. Es werden zahlreiche Ursachen<br />
diskutiert, die sich auf die Exploration und Nutzung der Meere<br />
besonders im Offshorebereich beziehen. Diese können aber keinen<br />
Beitrag zur Erklärung für Walstrandungen leisten, die zahlreich<br />
dokumentiert zu früheren Jahrhunderten stattfanden.<br />
Die hydrographischen Verhältnisse im Wattenmeer ergeben einen<br />
für Großwale feindlichen Lebensraum, der durch geringe<br />
Wassertiefe, Ebbe und Flut mit einer Differenz von 3 bis 3,5 m<br />
unterschiedlichster Strömungsrichtungen und durch einen Mangel<br />
an geeigneten Nahrungstieren gekennzeichnet ist. Bei großen<br />
Walen, die in die Rinnen des Wattenmeeres hineinschwimmen,<br />
ist bei ablaufendem Wasser und Festsitzen der Tod vorprogrammiert.<br />
Der Todeskampf der Tiere dauert in solchen Situationen<br />
viele Stunden. Der Tod tritt durch Überhitzen und durch Schock<br />
Für Großwale kann das Hineinschwimmen in das Wattenmeer, mit<br />
der durch die Tide bedingten schwankenden Wassertiefe, lebensgefährlich<br />
sein
ein. Das Erdrücken des Brustkorbes durch das hohe Eigengewicht<br />
als Todesursache, gehört mehr in den Bereich der Fantasien und<br />
wird durch keinen Befund gestützt.<br />
Die Ursachen dafür, dass beispielsweise Pottwalbullen auf ihrem<br />
Weg nach Süden nicht westlich der britischen Inseln entlang ziehen,<br />
sondern in die Nordsee gelangen, könnte zumindest damit<br />
zusammenhängen, dass einerseits auf diese Walart keine Jagd<br />
stattfindet und deshalb auch Wanderwege küstennah verlaufen<br />
und zwangsläufig in die Nordsee führen. Andererseits sind nordostatlantische<br />
Veränderungen von Strömungen und Wassertemperaturen<br />
sowie damit zusammenhängende Wanderungen von<br />
Nahrungstieren als Leitfaktoren nicht außer Acht zu lassen.<br />
Anzahl der Walstrandungen an der Nordseeküste<br />
Seit 1994 sind im Bereich der niedersächsischen Nordseeküste<br />
und der Elbemündung neun Pottwale und ein Finnwal sowie Reste<br />
eines ausgewachsenen Finnwales neben zahlreichen Kleinwalen<br />
gestrandet, wobei ein Pottwal zwischen der Insel Neuwerk<br />
und Cuxhaven lebend strandete und verendete. Bei solchen Fällen<br />
ergeben sich Fragen nach den Möglichkeiten der Rettung<br />
oder der tierschutzgerechten Tötung zum Beenden der Leiden.<br />
Eine Befreiung von Tieren der Größenordnung eines Pottwales<br />
aus dem Wattenmeer ist leider nicht möglich, die zur Verfügung<br />
stehende Zeit ist zu kurz, um mit angemessenen Techniken an<br />
den Strandungsort zu gelangen. Die schnelle Tötung von Pottwalen<br />
ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ebenfalls<br />
nicht möglich, weil die Schädelkapsel von einem Weichteilmantel<br />
hoher Dichte und Stärke umhüllt wird, und die Verwendung<br />
von Geschossen deshalb unkalkulierbare Risiken bergen, die das<br />
Leiden der Tiere verschlimmern könnten.<br />
Bartenwale, wie beispielsweise der Anfang September treibend<br />
aufgefundene und über Cuxhaven beseitigte Finnwal, würden<br />
sich mit sehr starker Jagdmunition durch einen Schuss in den<br />
Schädel tierschutzgerecht töten lassen.<br />
Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse des LAVES sowie<br />
Verzeichnisse über die Mitwirkung in Gremien, über<br />
wissenschaftliche Vorträge und Veröffentlichungen, über<br />
Ringversuche und Laborvergleichsuntersuchungen sowie<br />
über die Teilnahme an Twinning-Projekten finden Sie im<br />
Internet unter www.laves.niedersachsen.de.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong><br />
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze dafür, warum beispielsweise<br />
Pottwalbullen auf ihrem Weg in den Süden in die Nordsee gelangen<br />
Berichte aus Großbritannien, 2006, ergaben eine auffällige Häufigkeit<br />
von Walsichtungen im Bereich des westlichen Ärmelkanals.<br />
Ferner waren Sichtungen von Finnwalen in der Ostsee auffällig.<br />
Berücksichtigt man die Strandungshäufigkeit von Großwalen im<br />
gesamten Nordseebereich in den vergangenen Jahren, so muss<br />
man mit weiteren Strandungen auch in der deutschen Bucht und<br />
entlang der niedersächsischen Küste rechnen: Im Sommer überwiegend<br />
mit der Möglichkeit der Finnwalstrandung; im Winter<br />
sind wieder Pottwalstrandungen zu erwarten.<br />
Dr. Stede, M. (IfF CUX)<br />
107
4. Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse des LAVES<br />
I n h a l t s v e r z e i c h n i s<br />
4. Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse des LAVES.......................................................... 111<br />
4.1 Futtermittelüberwachung..................................................................................................................... 111<br />
4.1.1<br />
4.1.1.1<br />
4.1.1.2<br />
4.1.1.3<br />
4.1.1.4<br />
4.1.1.5<br />
4.1.2<br />
4.2<br />
4.2.1<br />
4.2.2<br />
4.2.3<br />
4.2.4<br />
4.2.5<br />
4.3<br />
4.<strong>3.</strong>1<br />
4.<strong>3.</strong>2<br />
4.<strong>3.</strong>2.1<br />
4.<strong>3.</strong>2.2<br />
4.<strong>3.</strong>2.3<br />
4.<strong>3.</strong>2.4<br />
4.<strong>3.</strong>3<br />
4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1<br />
4.<strong>3.</strong>4<br />
4.<strong>3.</strong>5<br />
4.<strong>3.</strong>6<br />
4.<strong>3.</strong>7<br />
4.<strong>3.</strong>8<br />
4.<strong>3.</strong>9<br />
4.<strong>3.</strong>10<br />
Amtliche Futtermittelüberwachung............................................................................................................................<br />
Zulassung und Registrierung……………………………...............................................................................................<br />
Betriebsinspektionen..................................................................................................................................................<br />
Buchprüfungen..........................................................................................................................................................<br />
Proben und Analysen – Nationales Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit…….......................................................<br />
Analytik im Futtermittelinstitut Stade..........................................................................................................................<br />
Fütterungsarzneimittel................................................................................................................................................<br />
Marktüberwachung...............................................................................................................................<br />
Eier............................................................................................................................................................................<br />
Geflügelfleisch-Kontrollen..........................................................................................................................................<br />
Obst, Gemüse und Kartoffeln.....................................................................................................................................<br />
Vieh und Fleisch.........................................................................................................................................................<br />
Medienüberwachung.................................................................................................................................................<br />
Tiergesundheit.......................................................................................................................................<br />
TSE (Transmissible Spongiforme Enzephalopathien)....................................................................................................<br />
Anzeigepflichtige Tierseuchen....................................................................................................................................<br />
Blauzungenkrankheit…………...................................................................................................................................<br />
Geflügelpest-<br />
Monitoring………………………………………………………………………………………………………<br />
Brucellose………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Tollwutdiagnostik.…………………………………………………………………………………………………………….<br />
Meldepflichtige Tierkrankheiten.................................................................................................................................<br />
Chlamydien…………………………………………………………………………………………………………………….<br />
Sonstige Tierkrankheiten............................................................................................................................................<br />
Fischuntersuchungen..................................................................................................................................................<br />
Bienenkrankheiten.....................................................................................................................................................<br />
Wildtieruntersuchungen.............................................................................................................................................<br />
Zulassung und Überwachung der Betriebe zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten........................................<br />
Zulassung von Besamungs- und Embryotransferstationen und von Affenhaltungen zum innergemeinschaftlichen<br />
Handel.......................................................................................................................................................................<br />
108<br />
111<br />
112<br />
113<br />
113<br />
114<br />
115<br />
119<br />
120<br />
120<br />
122<br />
123<br />
124<br />
125<br />
125<br />
125<br />
127<br />
129<br />
130<br />
130<br />
130<br />
131<br />
132<br />
133<br />
134<br />
138<br />
139<br />
140<br />
140<br />
140
4.<strong>3.</strong>11<br />
4.<strong>3.</strong>12<br />
4.4<br />
4.4.1<br />
4.4.1.1<br />
4.4.1.2<br />
4.4.1.3<br />
4.4.1.4<br />
4.4.2<br />
4.4.2.1<br />
4.4.2.2<br />
Erlaubniserteilung an Labore zum Arbeiten mit Tierseuchenerregern..........................................................................<br />
Ausstellungen, Auktionen, Körungen, Turniere und Viehmärkte.................................................................................<br />
TRACES – System der EU für den Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen......……………………………………<br />
Zoonosen................................................................................................................................................<br />
Überwachungspflichtige Zoonosen und Zoonoseerreger ............................................................................................<br />
Campylobacteriose…………………………………………………………………………………………………………….<br />
Salmonellose…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…<br />
Tuberkulose…………………………………………………………………………………………………………………….<br />
Resistenzmonitoring – Resistenzprüfungen im<br />
Mikrodilutionsverfahren…………………………………………………..<br />
Besondere Überwachungsprogramme aus zoonotischer Sicht………………………………………………....................<br />
Fuchsbandwurm-<br />
Monitoring………………………………………………………………………………………………….<br />
Samonellennachweise im Rahmen des EU-<br />
Salmonellenmonitorings………………………………………………………<br />
4.5 Tierschutz...............................................................................................................................................<br />
4.6<br />
4.6.1<br />
4.6.2<br />
4.6.3<br />
4.6.4<br />
4.6.5<br />
4.6.6<br />
Hygieneuntersuchungen in der Fleisch- und Geflügelfleischgewinnung.........................................<br />
Amtliche Kontrolle der Reinigung und Desinfektion in der<br />
Fleischgewinnung……………………….………………..….<br />
Amtliche Kontrolle der Produkte……………………………………………………………………………………………...<br />
Untersuchungen auf Salmonellen im Rahmen der<br />
Hygieneuntersuchungen………………………………………………<br />
Salmonellenmonitoring bei<br />
Schlachtschweinen……………………………………………………………………………...<br />
Untersuchungen von<br />
Hackfleisch……………………………………………………………………………………………..<br />
Sonstige<br />
Untersuchungen……………………………………………………………………………………………………..<br />
4.7 Hygieneuntersuchungen bei Milch und Milchprodukten, Eiern und Eiprodukten...........................<br />
4.8 Bakteriologische Fleischuntersuchung.................................................................................................<br />
4.9 Schädlingsbekämpfung......................................................................................................................... 162<br />
4.10 Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährlichkeit............................................... 164<br />
4.11<br />
4.12<br />
EU-Grenzkontrollstellen.......................................................................................................................<br />
EU-Schnellwarnsystem………………………………………………………………………………………...<br />
4.13 Zulassung von Betrieben für die Vermarktung von Lebensmitteln tierischer Herkunft.................. 169<br />
109<br />
140<br />
141<br />
141<br />
141<br />
141<br />
142<br />
146<br />
146<br />
149<br />
149<br />
150<br />
150<br />
153<br />
153<br />
154<br />
156<br />
156<br />
157<br />
158<br />
158<br />
161<br />
165<br />
165
4.14<br />
4.14.1<br />
4.14.2<br />
4.14.3<br />
4.15<br />
4.15.1<br />
4.15.2<br />
4.16<br />
4.16.1<br />
4.16.2<br />
4.16.3<br />
4.16.4<br />
4.16.4.1<br />
4.16.5<br />
4.16.6<br />
4.16.7<br />
4.16.8<br />
4.16.9<br />
4.16.10<br />
4.16.11<br />
4.16.12<br />
4.16.13<br />
4.16.14<br />
4.16.15<br />
4.16.16<br />
4.16.17<br />
4.16.18<br />
4.16.19<br />
4.16.20<br />
4.16.21<br />
4.16.22<br />
4.16.23<br />
4.16.24<br />
4.16.25<br />
4.16.26<br />
Sonstige Genehmigungen und amtliche Anerkennungen.................................................................<br />
Amtlich anerkannte natürliche Mineralwässer.............................................................................................................<br />
Genehmigungen zur Herstellung von bestimmten diätetischen Lebensmitteln nach § 11 Diätverordnung...................<br />
Ausnahmegenehmigung gem. § 68 LFBG………………………………………………………………….........................<br />
Überwachungsprogramme...................................................................................................................<br />
Nationaler Rückstandskontrollplan..............................................................................................................................<br />
Seehundmonitoring............................................................................................................................................<br />
Lebensmittel..........................................................................................................................................<br />
Überwachungsprogramme…………………………………………………………………………………………………<br />
…<br />
Milch- und Milcherzeugnisse......................................................................................................................................<br />
Eier und Eiprodukte....................................................................................................................................................<br />
Fleisch und Fleischerzeugnisse....................................................................................................................................<br />
Untersuchung auf Fremdwasser in Geflügel................................................................................................................<br />
Wurstwaren...............................................................................................................................................................<br />
Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus................................................................................................<br />
Öle, Fette...................................................................................................................................................................<br />
Suppen, Soßen, Mayonnaisen....................................................................................................................................<br />
Feinkostsalate, vorgefertigte<br />
Salatmischungen………………………………………………………………………………<br />
Getreide und Getreideerzeugnisse einschließlich Brot und Backwaren........................................................................<br />
Teigwaren..................................................................................................................................................................<br />
Frisches Obst, Gemüse und Kartoffeln........................................................................................................................<br />
Obsterzeugnisse, Konfitüren, Honig, süße Brotaufstriche............................................................................................<br />
Gemüse- und Kartoffelerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Frischpilze und<br />
Pilzerzeugnisse……………………………………...<br />
Nüsse, Ölsaaten, Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse..........................................................................<br />
Fruchtsäfte und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Getränkepulver............................................................................<br />
Wein und Erzeugnisse aus Wein einschließlich weinähnlicher Getränke......................................................................<br />
Bier............................................................................................................................................................................<br />
Spirituosen und alkoholhaltige Getränke....................................................................................................................<br />
Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse......................................................................................................................<br />
Pudding, Cremespeisen, süße Suppen und Saucen……..............................................................................................<br />
Süßwaren und Kaugummi, Zucker…….....................................................................................................................<br />
Kakao, Schokolade und –erzeugnisse........................................................................................................................<br />
Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeegetränke, Tee und Teeerzeugnisse..........................................................................<br />
110<br />
171<br />
171<br />
171<br />
171<br />
172<br />
172<br />
176<br />
178<br />
179<br />
181<br />
185<br />
186<br />
189<br />
189<br />
191<br />
197<br />
198<br />
201<br />
202<br />
209<br />
210<br />
214<br />
221<br />
228<br />
229<br />
233<br />
236<br />
238<br />
241<br />
242<br />
243<br />
245<br />
246<br />
249<br />
251
4.16.27<br />
4.16.28<br />
4.16.29<br />
4.16.30<br />
4.16.31<br />
4.17<br />
4.17.1<br />
4.17.2<br />
4.17.3<br />
4.17.4<br />
4.17.5<br />
4.17.6<br />
4.17.7<br />
4.17.8<br />
4.17.9<br />
4.17.10<br />
4.17.11<br />
4.18<br />
4.18.1<br />
4.18.2<br />
4.18.3<br />
4.18.4<br />
4.18.5<br />
4.19<br />
4.20<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung............................................................................................................................<br />
Nährstoffkonzentrate und Nahrungsergänzungsmittel................................................................................................<br />
Fertiggerichte, zubereitete Speisen.............................................................................................................................<br />
Gewürze und Würzmittel...........................................................................................................................................<br />
Essenzen, Aromastoffe...............................................................................................................................................<br />
Zusatzstoffe und Hilfsmittel aus Zusatzstoffen............................................................................................................<br />
Mineral- und Tafelwasser, Trinkwasser.......................................................................................................................<br />
Schwerpunktuntersuchungen bei Lebensmitteln.............................................................................<br />
Mikrobiologischer Status von Lebensmitteln...............................................................................................................<br />
Untersuchung von Lebensmitteln auf Bestandteile aus gentechnischen Veränderungen………...................................<br />
Tierartnachweis und Fremdeiweißbestimmung in Lebensmitteln.................................................................................<br />
Mykotoxine…………………………............................................................................................................................<br />
Pestizide und Nitrat….................................................................................................................................................<br />
Kontaminanten und unerwünschte Stoffe…………………………………………………………………………………..<br />
Schwermetalle............................................................................................................................................................<br />
Behandlung mit ionisierenden Strahlen.......................................................................................................................<br />
Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln auf Dioxine und dioxinähnliche PCB…….................................<br />
Umweltradioaktivität..................................................................................................................................................<br />
Authentizitätsanalyse.................................................................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände.............................................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt.............................................................................................................<br />
Bedarfsgegenstände mit Haut- und Schleimhautkontakt.............................................................................................<br />
Spielwaren und Scherzartikel......................................................................................................................................<br />
Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel sowie sonstige Haushaltschemikalien...............................................................<br />
Kosmetische Mittel.....................................................................................................................................................<br />
Betriebskontrollen.................................................................................................................................<br />
Fischereikundlicher Dienst (Aussenstelle des IfF Cuxhaven)……………………………………………<br />
4 Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse im LAVES<br />
4.1 Futtermittelüberwachung<br />
Im Kapitel „Futtermittelüberwachung“ werden die Tätigkeiten des Dezernates 41 – Futtermittelüberwachung – dargestellt. Dem Dez.<br />
41 obliegt die Amtliche Futtermittelüberwachung für ganz <strong>Niedersachsen</strong> und das Land Bremen. Ein weiterer großer Bereich des<br />
Kapitels 4.1 widmet sich den Tätigkeiten des Futtermittelinstitutes Stade (FI STD). Der Schwerpunkt der dortigen Tätigkeit ist die<br />
Analyse der vom Dez. 41 entnommenen Futtermittelproben. Daneben werden auch mikrobiologische Untersuchungen für andere<br />
111<br />
254<br />
257<br />
262<br />
263<br />
263<br />
266<br />
266<br />
270<br />
272<br />
273<br />
276<br />
278<br />
279<br />
280<br />
280<br />
285<br />
291<br />
294<br />
294<br />
295<br />
296<br />
297<br />
298<br />
301<br />
301
Dezernate des LAVES und weitere öffentliche Auftraggeber durchgeführt. Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Kontrollen im<br />
Bereich Fütterungsarzneimittel<br />
4.1.1 Amtliche Futtermittelüberwachung<br />
Die Amtliche Futtermittelüberwachung vor neuen Herausforderungen: auch im Jahre 2006 haben sich Struktur und Umfang der<br />
Kontrollen verändert. Mussten sie im Jahre 2005 noch einem zunehmenden Aufwand an Beratungstätigkeiten u.a. durch das<br />
Inkrafttreten der Futtermittelhygieneverordnung angepasst werden, wurde im Jahre 2006 die Durchführung der verbindlich<br />
vorgeschriebenen sogenannten „Cross Compliance“ – Kontrollen auf landwirtschaftlichen Betrieben etabliert (siehe auch Kapitel 3).<br />
Die Zusammenarbeit mit dem Futtermittelinstitut Stade (FI STD) hat sich weiterhin bewährt. Unter dem Dach des LAVES sind im<br />
Bereich der Futtermittelüberwachung die Kontrollen der Unternehmen, die Probennahme, die Analytik und der Vollzug in einer<br />
Behörde vereint. Dies stellt sicher, dass gewonnene Erkenntnisse auf allen Ebenen schnell und effektiv weitergeleitet und<br />
berücksichtigt werden. Bei Vorliegen von „kritischen“ Befunden können im Bedarfsfall durch das Dez. 41 umgehend Folgeprüfungen<br />
durchgeführt und Maßnahmen eingeleitet werden.<br />
Zu den Routineaufgaben des Dez. 41 gehört die Betriebskontrolle der Unternehmen des Futtermittelsektors mit dem<br />
Schwerpunkt auf den gewerblichen Herstellerbetrieben. Die Zahl der nach der Futtermittelhygieneverordnung registrierten Betriebe<br />
liegt aktuell bei ca. 5<strong>3.</strong>000. Durch diese Verordnung wurde die Meldepflicht von den Betrieben, die im klassischen Sinne als<br />
Futtermittelunternehmer gelten (Hersteller und Mischfutterhändler), erweitert um den gesamten Zwischenhandel, Speditionen,<br />
Makler und den überwiegenden Teil der Landwirte<br />
4.1.1.1 Zulassung und Registrierung<br />
Gemäß Futtermittelhygieneverordnung müssen sich alle im Futtermittelbereich tätigen Unternehmen mit ihren<br />
Betriebsstätten registrieren lassen; bestimmte Tätigkeiten erfordern zukünftig eine Zulassung. Der Begriff der<br />
„Anerkennung“ entfällt. Da die rechtlichen Bestimmungen für alle Betriebe verschärft wurden (z.B. müssen alle<br />
registrierten gewerblichen Unternehmen und bestimmte Tierhalter Sachkenntnis und Verantwortlichkeiten sowie ein<br />
HACCP-Konzept nachweisen), sind nur noch bestimmte Sachverhalte wie z.B. die Herstellung, die Verarbeitung und<br />
der Handel von Kokzidiostatika oder Wachstumsförderern an die Zulassung gebunden (siehe Tabelle 4.1.1.1.1).<br />
Bereits anerkannte Betriebe gelten bis Ende 2007 als zugelassen, so dass sich die Zahl dieser Betriebe im Jahre 2006<br />
im Vergleich zu 2005 kaum verändert hat.<br />
Die Anforderungen, die an die zugelassenen Betriebe gestellt werden, sind besonders hoch. Vorgaben hinsichtlich<br />
Räumlichkeiten und Ausrüstung, Personal, Qualitätskontrolle, Lagerung, Dokumentation, Produktrückruf u.a. müssen<br />
erfüllt werden. Die Erteilung der Zulassung bedarf einer speziellen Vor-Ort-Kontrolle.<br />
Die Kontrollen auf Einhaltung der Anforderungen und Pflichten aus den Zulassungen für Hersteller und Händler von<br />
Zusatzstoffen, Vormischungen und Mischfuttermitteln sind jährlich ein wesentlicher Bestandteil der<br />
Überwachungstätigkeit.<br />
Tab. 4.1.1.1.1: Anzahl der Zulassungen, Stand 31. Dezember 2006<br />
Herstellerbetriebe Handelsbetriebe<br />
Zusatzstoffe Vormischungen Mischfuttermittel insgesamt davon Vertreter von<br />
Drittlandsherstellern<br />
8 47 141 130 30<br />
Mit der VO (EG) 1234 / 2003 zur Änderung der VO (EG) 999/2001 wurde das Verfütterungsverbot für bestimmte<br />
Futtermittel tierischer Herkunft gelockert. Auch Wiederkäuer haltende Betriebe dürfen nach Erhalt einer so genannten<br />
„Gestattung“ Mischfuttermittel mit Fischmehl u. a. beziehen. Eine jährliche Prüfung der Betriebe in Bezug auf die<br />
Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften ist vorgesehen.<br />
Tab. 4.1.1.1.2: Zulassungen und Registrierungen zur Verarbeitung von Fischmehl/Ergänzungsfuttermitteln mit<br />
Fischmehl u. a. und Verfütterung, Stand 31. Dezember 2006<br />
Zulassung (Verarbeitung<br />
Fischmehl / Futtermittel ><br />
50% Rohprotein mit<br />
Fischmehl u.a.)<br />
Registrierung<br />
(Verarbeitung<br />
Futtermittel < 50%<br />
Rohprotein mit<br />
112<br />
Gestattungen für<br />
Betriebe, die auch<br />
Wiederkäuer halten
113<br />
Fischmehl u.a.) und<br />
Gestattung<br />
gewerbliche Hersteller 39 entfällt entfällt<br />
Landwirtschaftliche<br />
Betriebe<br />
123 140 262<br />
4.1.1.2 Betriebsinspektionen<br />
Eine Basis für die Durchführung von Kontrollen war bis 2006 das „Nationale Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit“ (NKP), das in<br />
2007 vom „Rahmenplan zum mehrjährigen Nationalen Kontrollplan/MNKP“ gem. VO (EG) 882/2005 abgelöst wurde. Das NKP sollte<br />
zu einer Harmonisierung der Kontrollen unter Berücksichtigung der besonderen Standortgegebenheiten der Länder führen.<br />
Abweichungen von den Vorgaben aus fachlicher Sicht waren möglich und wurden bei der Fortschreibung berücksichtigt.<br />
Mit der Version 2005/2006 wurden die Empfehlungen für die Anzahl und Verteilung der Inspektionen und Buchprüfungen<br />
erstmals vor die Empfehlungen für die Probennahme und Analysenzahl und Analysenverteilung gestellt, um die Gewichtung zu<br />
verdeutlichen. Je nach Status (z.B. ob zugelassen/registriert, ob Hersteller, Händler oder Landwirt usw.) sollen die Betriebe alle zwei<br />
Jahre bis mehrmals im Jahr überprüft werden. In <strong>Niedersachsen</strong> orientiert sich die Prüfungsfrequenz ausserdem nach der jährlich<br />
durchzuführenden Risikobewertung der Betriebe.<br />
Die Inspektionen könnten gemäß Nationalem Kontrollprogramm unabhängig durchgeführt werden vom Aufsuchen der Betriebe<br />
zur Probennahme. Dies erfolgt in <strong>Niedersachsen</strong> nur in Einzelfällen, da die hier angestrebte risikoorientierte Probenahme nur nach<br />
Beurteilung der betrieblichen Gegebenheiten durch den Kontrolleur erfolgen kann.<br />
Je nach Betriebsart können bei den Inspektionen diverse Kontrollparameter ausgewählt werden. Kontrollparameter bei<br />
Betriebsprüfungen sind – je nach Umfang der Inspektion - z. B. die Kontrolle auf Einhaltung der Anforderungen und Pflichten bei<br />
anerkannten und registrierten Betrieben (Dokumentation, Chargenfolgen, Lagerung, Qualitätskontrollplan, Partieproben), Räume<br />
und Anlagen, Fütterungsvorschriften (bei Tierhaltern). Zusätzlich erfolgt eine Kontrolle formaler Kennzeichnungsvorschriften.<br />
Die Summe der Unternehmensprüfungen ist wieder angestiegen auf 1.462 (2005: 1.257, 2004: 1.401). Dabei ist die Summe der<br />
Orte der Kontrolle stark gestiegen auf 1.767 (1.227 in 2004, 1.236 in 2005), wobei jede Tätigkeit eines Betriebes nur einfach gezählt<br />
wird d.h., die Prüfungen wurden weiter gestreut. Dies ist insbesondere auf die erhöhte Zahl der Inspektionen im Rahmen der „Cross<br />
Compliance“-Kontrollen auf landwirtschaftlichen Betrieben zurückzuführen.<br />
Beanstandungen bezüglich der Kennzeichnungsvorschriften wurden überwiegend wegen der Nicht-Einhaltung der sogenannten<br />
„Offenen Deklaration“ (Angabe der enthaltenen Einzelfuttermittel mit prozentualem Gehalt) ausgesprochen. Aber es kam auch zu<br />
Beanstandungen wegen falscher Mengenangabe oder falscher Benennung bei Zusatzstoffen sowie fehlender oder fehlerhafter<br />
Anerkennungs-/ Registrierungsnummer des Herstellerbetriebes (mangelhafte Rückverfolgbarkeit). Es wurden 9.641<br />
Kennzeichnungen geprüft, von denen 1.191 beanstandet werden mussten.<br />
Bei den Verstößen gegen sonstige Vorschriften handelte es sich überwiegend um Beanstandungen, die sich aus den<br />
Anforderungen und Pflichten zur Zulassung (Anerkennung) und Registrierung ergaben (z. B. mangelhafte Partiebeprobung,<br />
fehlende Spülchargen nach kritischen Rezepturwechseln, Lagerung, Hygienemängel, Dokumentation). Insgesamt ist festzustellen,<br />
dass bei den Unternehmen aufgrund der anzuwendenden neuen rechtlichen Bestimmungen besonders im Bereich der<br />
Hygienevorschriften noch Handlungsbedarf besteht. Dies gilt auch für landwirtschaftliche Betriebe.<br />
4.1.1.3 Buchprüfungen<br />
Ein wichtiger Teil der Kontrolltätigkeit sind die bei den gewerblichen Unternehmen von den Inspektionen unabhängigen<br />
Buchprüfungen. Dabei handelt es sich um Zeitraumkontrollen. D.h., es wird vorher festgelegt, welcher Zeitraum (z.B. nur ein Monat<br />
oder bis zu 10 Jahre zurück), und welcher Inhalt zu prüfen ist (z.B. Warenein- und –ausgänge, verarbeitete Mengen bestimmter<br />
Zusatzstoffe z.B. in Bezug auf Höchstgehalte, Zweckbestimmung, Zulassung, die Produktion und der Verbleib von Vormischungen,<br />
Dokumentation der Abgabe von reglementierten Stoffen u.v.a.m.). Daraus ergibt sich, dass der Aufwand für Buchprüfungen sehr<br />
unterschiedlich sein und sich über mehrere Tage erstrecken kann. Bereits 2004 wurden die routinemäßigen Buchprüfungen<br />
zugunsten der umfassenden Prüfungen zur „Rückverfolgbarkeit“ eingeschränkt . Der Übergang von den Kontrollen zur<br />
Rückverfolgbarkeit zu den Buchprüfungen ist fließend und wird deshalb nicht mehr gesondert ausgewiesen. Für die<br />
Rückverfolgbarkeit wird wie in der Verordnung (EG) 178/2002 gefordert, der Warenfluss „einen Schritt vor und einen Schritt zurück“<br />
geprüft. Eine Buchprüfung kann umfassender sein und sich über mehrere Verarbeitungsstufen erstrecken. 2005 war die Zahl der<br />
Buchprüfungen aufgrund vermehrter Durchführung anderer Aufgaben gesunken. Im Jahre 2006 ist die Summe der Prüfungen zwar<br />
gestiegen, die Zahl der Buchprüfungen bei den gewerblichen Unternehmen musste aber nochmals stark reduziert werden (113 im<br />
Jahre 2005, 70 im Jahre 2006) zugunsten der Buchprüfungen im Rahmen der „Cross-Compliance“-Kontrollen auf<br />
landwirtschaftlichen Betrieben.<br />
Tabelle 4.1.1.<strong>3.</strong>1: Inspektionen, Buchprüfungen und Orte der Kontrolle 2004 bis 2006
Anzahl im Jahr… 2004 2005 2006<br />
Aufgesuchte Orte der<br />
Kontrolle<br />
1.227 1.170 1.767<br />
Unternehmensprüfungen 1.401 1.257 1.462<br />
Buchprüfungen /<br />
Rückverfolgbarkeit<br />
376 135<br />
(davon 113 bei<br />
gewerblichen<br />
Herstellern/Händlern)<br />
4.1.1.4 Proben und Analysen - Nationales Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit<br />
114<br />
628<br />
(davon 70 bei<br />
gewerblichen<br />
Herstellern/Händlern)<br />
In der Jahresstatistik der Amtlichen Futtermittelüberwachung werden ausschließlich die Proben und<br />
Analysenergebnisse erfasst, die vom Dezernat 41 selbst entnommen bzw. in Auftrag gegeben wurden. Die<br />
Ergebnisse von Untersuchungen, die aus veterinärhygienischer Veranlassung (z. B. nach VO (EG) 1774 / 2002)<br />
durchgeführt wurden, sind nicht der Amtlichen Futtermittelüberwachung zuzurechnen.<br />
Abbildung 4.1.1.4.1: Verteilung der untersuchten Proben des Dez. 41 (ohne Einzelfuttermittel) 2006<br />
Geflügel Schweine<br />
Wiederkäuer andere Nutztiere<br />
Heimtiere Vormischungen<br />
Zusatzstoffe<br />
Insgesamt wurden 2.311 Proben untersucht, von denen 365 (15,8 %) beanstandet werden mussten (2005:<br />
2.185 Proben untersucht / 394 Proben beanstandet; 2004: 2.501 Proben untersucht / 286 beanstandet). Die<br />
Beanstandungsquote bei den Mischfuttermitteln ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (von 24,3 % auf<br />
22,7 %). Bei den Mineralfuttermitteln lag sie mit 33,3 % wie in den Vorjahren über dem Durchschnitt (2005: 31,7<br />
%).<br />
Die Proben wurden auf verschiedenste Parameter untersucht, wobei die Zahl der Parameter pro Probe
gestiegen ist. Einerseits erfolgt die Auswahl der Aufträge risikoorientiert, also in Abhängigkeit von der Historie<br />
des kontrollierten Betriebes, der Art der Probe usw. Die Untersuchungen dienen deshalb nicht nur der Kontrolle<br />
deklarierter Gehalte sondern werden durch die Kontrolleure prüfungsbegleitend als Mittel zur Beweissicherung<br />
ausgewählt (z. B. hinsichtlich des Verdachts auf mangelhafte Spülchargen, Belastung mit Schadstoffen).<br />
Andererseits ist die Parameter-Auswahl mit Blick auf die Vorgaben des Nationalen Kontrollprogramms<br />
durchzuführen. Die Daten für <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen werden in den Planzahlen sowie in der Futtermittel-<br />
Jahresstatistik gemeinsam aufgeführt, da das LAVES - Dez. 41 - für die Überwachung in beiden Bundesländern<br />
zuständig ist. Die Gesamtzahl der durchgeführten Analysen betrug insgesamt 40.092 (2005: 42.171). Der<br />
Rückgang ist ausschließlich auf die Verringerung der untersuchten Parameter bei dem Untersuchungsauftrag<br />
„Schädlingsbekämpfungsmittel“, dessen Matrix in 2006 an die Vorgaben des NKP angepasst worden ist,<br />
zurückzuführen. In anderen Bereichen, insbesondere bei unerwünschten Stoffen, Zusatzstoffen und<br />
Inhaltsstoffen, konnte die Zahl der Untersuchungen gesteigert werden. Die Vorgabe des NKP (ca. 30.000<br />
Analysen) wurde insgesamt wieder weit überschritten. Die Beanstandungsquote über alle in Auftrag gegebenen<br />
Parameter lag 2006 wie 2005 bei 0,8 % (2004: 0,7 %, 2003: 2,5 %), wobei die Zahl der Beanstandungen bei<br />
Zusatzstoffen (Grenzwertüberschreitungen bzw. Minimum-Unterschreitungen) und bei Inhaltsstoffen<br />
abgenommen hat.<br />
Tabelle 4.1.1.4.1: <strong>Schwerpunkte</strong> der Untersuchungen<br />
<strong>Schwerpunkte</strong> der Untersuchungen 2005 2006<br />
Anzahl Beanstandet in Anzahl Beanstandet in<br />
%<br />
%<br />
Inhaltsstoffe / Energie 4.593 3,0 5.200 1,9<br />
Zusatzstoffe 1.464 5,5 1.829 3,3<br />
Unzulässige Stoffe 12.487 0,5 12.213 0,8<br />
Unerwünschte Stoffe 2<strong>3.</strong>002 0,1 20.514 0,2<br />
Unter „unzulässigen“ Stoffen werden zusammengefasst:<br />
• verbotene Stoffe nach Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) bzw. VO (EG) 999 / 2001<br />
• verbotener Zusatz und Verschleppungen von Arzneimitteln und Hormonen oder nicht mehr<br />
zugelassenen Zusatzstoffen sowie Zusatz und Verschleppungen von antibiotisch wirksamen<br />
Zusatzstoffen<br />
• Nachweise sonstiger in Futtermitteln unzulässiger Stoffe, wie z. B. das Desinfektionsmittel Nikotinsulfat<br />
Unzulässige tierische Proteine und Fette wurden wiederum nicht nachgewiesen. Die Beanstandungen im Bereich<br />
der sonstigen unzulässigen Stoffe sind – nachdem sie 2005 gesunken waren – wieder leicht angestiegen. Eine<br />
Ursache ist das Verbot antibiotisch wirksamer Leistungsförderer zum 1. Januar 2006. Einige dieser Substanzen<br />
sind jedoch als Kokzidiostatika weiterhin zugelassen. Verschleppungen in Mischfuttermitteln für die Nicht-<br />
Zieltierart kamen vor und wurden entsprechend beanstandet. Eine weitere Ursache ist der Vorgang „Nikotinsulfat<br />
in Legehennenfutter“, der durch unsachgemäße Verwendung eines Biozids in Ställen ausgelöst worden war.<br />
Unter „unerwünschten“ Stoffen werden zusammengefasst:<br />
• Stoffe mit Grenzwertregelung nach Anl. 5 und 5 a zur FMV, z. B. Schwermetalle, chlorierte<br />
Kohlenwasserstoffe, Dioxin, Aflatoxin B1, Mutterkorn<br />
• Stoffe ohne Grenzwertregelung; Beanstandung möglich über § 17 LFGB hinsichtlich einer möglichen<br />
Gesundheitsgefährdung für das Tier und durch „Carry-over“ – Effekte für den Menschen, z.B.<br />
Salmonellen, sonstige Mykotoxine, PCB.<br />
Es wurden 20.514 Analysen zu unerwünschten Stoffen durchgeführt. Erstmals konnten die sogenannten<br />
„dioxinähnlichen PCB“ untersucht werden. Die Beanstandungsquote ist insgesamt fortgesetzt sehr niedrig, dabei<br />
gab es jedoch Nachweise bestimmter Stoffe (Dioxin, Schwermetalle, Mutterkorn).<br />
4.1.1.5 Analytik im Futtermittelinstitut Stade<br />
115<br />
Dr. Schütte, R.; Kay, C. (Dez. 41)<br />
Das Futtermittelinstitut Stade (FI STD) untersucht im Rahmen der amtlichen Futtermittelüberwachung<br />
vorwiegend Proben folgender Futtermittel:
- Einzelfuttermittel<br />
- Futtermittelzusatzstoffe<br />
- Vormischungen<br />
- Mischfuttermittel<br />
- Heimtierfuttermittel<br />
Diese Untersuchungen dienen der Sicherstellung der Unbedenklichkeit der vom Tier stammenden<br />
Lebensmittel für die menschliche Gesundheit, dem Schutz der Tiergesundheit und der Verhinderung der<br />
Gefährdung des Naturhaushaltes sowie der Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere. Das<br />
Untersuchungsspektrum umfasst die unerwünschten, unzulässigen und verbotenen Stoffe, Rückstände von<br />
Schädlingsbekämpfungsmitteln, genveränderten Organismen, Dioxine, pathogenen Keime, Probiotika und<br />
Zusammensetzung (chemisch, mikroskopisch).<br />
Die Proben werden zum weit überwiegenden Teil durch die Prüfer des Dez. 41- Futtermittelüberwachung -,<br />
aber auch über die Veterinärämter an das FI STD gesandt. Das FI STD wird bei den Analysen innerhalb des<br />
LAVES durch die Lebensmittelinstitute in Oldenburg und in Braunschweig, durch das Veterinärinstitut Hannover,<br />
durch das Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg und durch ggf. andere Untersuchungseinrichtungen<br />
unterstützt.<br />
Futtermittel sind ein wichtiges Glied am Beginn der Nahrungskette, die mit dem Menschen als Konsument<br />
endet. Futtermittel stehen heute im Hinblick auf das Überwachungsniveau auf gleicher Höhe mit Lebensmitteln<br />
und Bedarfsgegenständen. Dies ist das Ergebnis einer begrüßenswerten europäischen Entwicklung.<br />
Im Jahr 2006 wurden dem FI STD 2.975 Futtermittelproben übersandt. Daraus resultierten 19.205<br />
Untersuchungsaufträge, die zur Bestimmung von 59.649 Einzelparametern führten (siehe Tabelle 4.1.1.5.1).<br />
Diese Zahlen liegen in der Größenordnung des Berichtsjahres 2005 beim Futtermittelkontrolldienst.<br />
Die Summe der untersuchten Parameter muss nicht mit der Summe der Untersuchungsaufträge<br />
übereinstimmen, da bei einigen Methoden mehrere Parameter in einer Untersuchung erfasst werden.<br />
Im folgenden werden einzelne Untersuchungsbereiche beispielhaft dargestellt.<br />
Mykotoxin-Analytik<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden 2.215 Untersuchungen auf Mykotoxine (Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Zearalenon,<br />
Deoxinivalenol und Fumonisin B1 und B2) vorgenommen.<br />
Von den 564 Untersuchungen auf Aflatoxin B1 lagen nur 15 Werte (2,7 %) über der Nachweisgrenze der<br />
Methode, wobei lediglich 3 Proben (0,5 %) einen bedenklichen Gehalt aufwiesen und bemängelt werden<br />
mussten.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen auf die übrigen Mykotoxine zeigten im Hinblick auf die Anzahl der Werte<br />
über der jeweiligen Nachweisgrenze folgendes Bild:<br />
Ochratoxin A von 564 Werten = 16 (2,8 %)<br />
Zearalenon von 564 Werten = 139 (24,6 %)<br />
Deoxinivalenol von 364 Werten = 62 (17,0 %)<br />
Fumonisin B1 u. B2 von 159 Proben = 15 (9,4 %)<br />
Alle Werte lagen unterhalb der jeweiligen „Richtwerte“, soweit vorhanden.<br />
Aus den für 2006 vorliegenden Mykotoxin-Analysendaten lässt sich insgesamt eine relativ geringe<br />
Belastung der untersuchten Futtermittel ableiten. Die ermittelten Analysendaten dienen u. a. als Basis zur<br />
Festsetzung von Höchstgehalten für die verschiedenen Mykotoxine.<br />
Untersuchungen auf wertgebende Inhaltsstoffe<br />
Im FI STD wurden im Berichtsjahr insgesamt 642 Futtermittel auf verschiedene Inhaltsstoffe untersucht. Zu<br />
zwei Dritteln handelte es sich dabei um Mischfuttermittel zur Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere.<br />
Die zu untersuchenden Parameter umfassen den Rohprotein-, Rohfett-, Rohfaser-, Stärke-, Zucker- und<br />
Rohaschegehalt. Zur Einschätzung von Erdverunreinigungen wird der Gehalt an säureunlöslicher Asche<br />
herangezogen. Diesbezüglich wurden 92 Futtermittel, überwiegend Einzelfuttermittel und Mineralfuttermittel,<br />
untersucht.<br />
Die Analyse zur Bestimmung des energetischen Wertes der Futtermittel, basierend auf einer erweiterten<br />
Weender Analyse, wurde an 241 Proben vorgenommen. Dafür waren insgesamt 1.927 Analysen notwendig.<br />
Beanstandungen wegen einer Über- oder Unterschreitung des deklarierten Gehaltes an Inhaltsstoffen (§<br />
15 und § 7 Futtermittelverordnung) wurden lediglich bei 8 % der untersuchten Futtermittel ausgesprochen und<br />
bezogen sich vorwiegend auf den deklarierten Rohfettgehalt. Hierbei sind die Untersuchungen auf den<br />
Energiegehalt von laktierenden Kühen nicht enthalten.<br />
Mikroskopische Futtermitteluntersuchungen<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden 1.321 Futtermittelproben mikroskopisch untersucht. Das bedeutet im Vergleich zu<br />
2005 eine leichte Steigerung um 7,6 %.<br />
116
Die Gesamtprobenzahl teilt sich auf die nachstehenden Untersuchungsparameter wie folgt auf:<br />
Unzulässige tierische Bestandteile 784<br />
Botanische Reinheit 370<br />
Verpackungsmaterial 15<br />
Mutterkorn 105<br />
Zusammensetzung 47<br />
Von den insgesamt 105 auf Mutterkorn untersuchten Futtermittelproben konnten in 23 Fällen<br />
Mutterkornsklerotien nachgewiesen werden. Der kritische Wert von mehr als 1.000 mg/kg wurde von neun<br />
Proben überschritten, das bedeutet einen prozentualen beanstandungswürdigen Mutterkorngehalt von<br />
8,6 %. In 2005 lag die Quote der diesbezüglich aufgefallenen Proben bei 3,5 %.<br />
Tabelle 4.1.1.5.1: Übersicht über Art und Umfang von Futtermitteluntersuchungen im FI STD<br />
Alleinfuttermittel <br />
Einzelfuttermittel <br />
Ergänzungsfuttermittel <br />
Mineralfutter<br />
117<br />
Dr. Ady, G. (FI STD)<br />
Sonstige VormischuZusatzstof<br />
Summe<br />
ng -fe der<br />
Aufträge<br />
Summe<br />
der Einzelparameter<br />
Elemente<br />
Arsen 85 363 52 31 1 13 18 563 563<br />
Blei 204 487 124 53 2 32 18 920 920<br />
Cadmium 197 490 120 43 1 32 18 901 901<br />
Calcium 41 11 43 33 1 4 1 134 134<br />
Chrom 3 3 2 3 11 11<br />
Eisen 28 3 17 15 1 16 5 85 85<br />
Kalium 3 4 7 7<br />
Kobalt 22 1 14 11 9 57 57<br />
Kupfer 236 12 102 61 1 41 5 458 458<br />
Magnesium 2 10 16 4 2 34 34<br />
Mangan 17 1 14 28 1 17 2 80 80<br />
Molybdän 2 3 1 1 7 7<br />
Natrium 14 4 26 19 1 64 64<br />
Nickel 1 3 2 4 2 12 12<br />
Phosphor 38 3 34 28 1 104 104<br />
Quecksilber 76 362 43 21 1 12 10 525 525<br />
Selen 126 6 58 30 3 29 1 253 253<br />
Zink<br />
Mykotoxine<br />
174 4 58 51 2 38 8 335 335<br />
Aflatoxin B1 220 232 107 1 1 561 561<br />
DON 202 93 62 1 358 358<br />
Fumonisine 68 26 61 2 157 157<br />
Ochratoxin 220 232 107 1 1 561 561<br />
Zearalenon 220 232 107 1 1 561 561<br />
CKW 162 421 165 9 8 15 6 786 1<strong>3.</strong>362
PCB 177 435 170 9 7 18 9 825 5.775<br />
Dioxin 62 125 35 2 2 5 12 243 4.131<br />
Pflanzenschutzmittel 5 169 2 1 177 8.496<br />
GVO 20 38 16 74 74<br />
Nikotin 39 39 39<br />
Acrylamid 2 2 2<br />
Radioaktivität 1 1 1<br />
Pharmakologisch<br />
wirksame<br />
Substanzen<br />
Deklarationskontrolle<br />
Lasalocid 7 1 8 8<br />
Maduramycin 5 1 6 6<br />
Monensin 15 1 16 16<br />
Narasin 4 4 4<br />
Nicarbazin 4 4 4<br />
Salinomycin 9 2 11 11<br />
AlleinEinzelErgänMineral- Sonstige VormischuZusatzstof<br />
Summe Summe<br />
futtermittelfutterzungsfutfutter ng -fe der der Einzelmittel<br />
Rückstandskontrolle<br />
Pharmakologisch<br />
wirksame<br />
termittel<br />
Aufträge parameter<br />
Substanzen 287 21 159 36 1 26 530 10.600<br />
Chloramphenicol 44 7 20 4 5 80 80<br />
Tetracycline<br />
Wertgebende<br />
Bestandteile<br />
109 109 545<br />
Asche säureunlösl. 7 49 15 15 1 87 87<br />
ELOS 4 28 32 32<br />
Lactose 135 1 11 147 147<br />
Energie Geflügel 39 1 7 47 47<br />
Energie Rind 23 23 23<br />
Energie Schwein<br />
Rohasche<br />
114 1 6 121 121<br />
mineralisch 15 15 15<br />
Rohasche 210 25 118 1 4 1 359 359<br />
Rohfaser 255 60 139 1 455 455<br />
Rohfett A 5 3 5 13 13<br />
Rohfett B 248 28 106 1 383 383<br />
Rohprotein 294 64 162 1 1 522 522<br />
Stärke 185 5 19 209 209<br />
Trockenmasse 800 871 445 99 28 67 32 2342 2.342<br />
Zucker gesamt 185 8 19 212 212<br />
Zucker 53 3 56 56<br />
Mikroskopie<br />
Botanische Reinheit 2 368 370 370<br />
Mutterkorn 45 35 17 97 97<br />
Tier. Bestandteile 190 384 185 18 2 4 1 784 784<br />
118
Verpackungsmateria<br />
l 5 7 3 15 15<br />
Zusammensetzung 22 5 18 2 47 47<br />
Sonstige<br />
Aminosäuren 4 1 5 20<br />
Antioxidantien 19 2 10 2 33 66<br />
Chlorid 2 1 3 6 6<br />
Fluor 24 23 12 19 2 5 85 85<br />
Harnstoff 4 18 1 23 23<br />
Nitrit 1 1 1<br />
perfluorierte Tenside 2 4 6 6<br />
pH-Wert 1 4 5 5<br />
Phytase 13 1 3 5 4 26 26<br />
Vitamin_A1 68 3 58 29 1 25 184 184<br />
Vitamin_E 70 1 55 29 1 22 3 181 181<br />
AlleinEinzelErgänMineral- Sonstige VormischuZusatzstof<br />
Summe Summe<br />
futtermittelfutterzungsfutfutter ng -fe der der Einzelmittel<br />
Futtermittelhygiene<br />
termittel<br />
Aufträge parameter<br />
Bakterien<br />
Clostridien,<br />
49 77 36 12 1 175 175<br />
quantitativ 1 15 16 16<br />
Clostridien, qualitativ 1 94 95 95<br />
E.coli 296 296 296<br />
Enterobacteriaceen 1 336 337 337<br />
Hefen 49 74 37 11 1 172 172<br />
kulturelle<br />
Untersuchung 49 75 37 15 1 177 177<br />
Listerien 50 87 36 10 1 184 184<br />
Salmonellen 82 128 53 413 2 678 678<br />
Schimmelpilze 49 77 36 12 1 175 175<br />
Sensorik 83 140 52 31 2 308 308<br />
Coliforme Keime 1 1 1<br />
Probiotika 14 6 3 1 7 1 32 32<br />
Gesamtkeimzahl 1 2 1 4 4<br />
Pseudomonaden 1 1 1<br />
Total 6.457 6.423 <strong>3.</strong>528 746 1.423 458 170 19.205 57.307<br />
4.1.2 Fütterungsarzneimittel<br />
Die Verabreichung von Arzneimitteln in Tierbeständen erfolgt überwiegend über das Futtermittel oder über das<br />
Tränkewasser. Bei einer Behandlung über das Futter unterscheidet man zwischen dem sog. „top dressing“ und<br />
den Fütterungsarzneimitteln. Im Falle des „top dressings“ werden pulverförmige Arzneimittel gemäß den<br />
Anwendungshinweisen des Tierarztes dem Futter im Tierbestand durch den Tierhalter zugefügt. Es dient zur<br />
gezielten Behandlung einzelner – in der Regel kleinerer – Tiergruppen. Die Fütterungsarzneimittel werden aus<br />
einer speziell zugelassenen Arzneimittelvormischung und einem Futtermittel in einem<br />
Futtermittelherstellungsbetrieb hergestellt und auf Verordnung eines Tierarztes abgegeben.<br />
Das Arzneimittelgesetz regelt die Herstellung der Fütterungsarzneimittel. Daneben sind futtermittelrechtliche<br />
Vorgaben ebenso einzuhalten wie die Antibiotika-Leitlinien.<br />
Über Fütterungsarzneimittel werden regelmäßig Anthelminthika (z. B. Benzimidazole) zur Behandlung von<br />
Parasitenbefall eingesetzt. Antibiotikahaltige Fütterungsarzneimittel, z. B. mit Tetracyclinen, dienen der<br />
Behandlung bakterieller Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane. Im Jahr 2003 wurden in der<br />
Bundesrepublik insgesamt ca. 735 t Tierarzneimittel 1 verabreicht, rund 91 % davon waren Antibiotika. Seit der<br />
119
Novellierung des AMG 2 mit neuen spezifischen Regelungen für Fütterungsarzneimittel, sind deren Herstellung<br />
und Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland stark rückläufig. Es wird hingegen ein Anstieg des Einsatzes des<br />
„top dressings“ beobachtet. Konkretes Zahlenmaterial ist leider nicht verfügbar, da die entsprechende<br />
Rechtsverordnung noch nicht erlassen wurde.<br />
Wirkstoffbestimmungen in Fütterungsarzneimitteln<br />
Proben von Fütterungsarzneimitteln aus <strong>Niedersachsen</strong> und Schleswig-Holstein wurden im Veterinärinstitut<br />
Hannover auf Einhaltung der verordneten Wirkstoffgehalte geprüft. Mindergehalte haben nicht nur zur Folge, dass<br />
die Tiere weiterhin krank bleiben, sondern können auch die Entwicklung von Antibiotika-Resistenzen fördern. Die<br />
Resistenzentwicklung kann auch durch Verschleppung von Spuren antimikrobieller Wirkstoffe begünstigt werden.<br />
Ist der Wirkstoffgehalt höher als verordnet, können im essbaren Gewebe der lebensmittelliefernden Tiere<br />
Rückstände über den erlaubten Höchstmengen auftreten, da die angegebenen Wartezeiten ggf. nicht mehr<br />
ausreichend sind.ur Wirkstoffbestimmung in Fütterungsarzneimitteln kommen meist instrumentelle<br />
chromatografische Verfahren zum Einsatz, aber z. T. auch mikrobiologische Wertbestimmungen (Screening). Im<br />
Berichtsjahr 2006 wurden 14 Planproben untersucht, davon 11 Proben auf Chlortetracyclin (Gehalte von 600 –<br />
4000 mg/kg), eine Probe auf Tetracyclin ( 1000 mg/kg) und zwei Proben auf Amoxicillin (500 -1000 mg/kg).<br />
Größere Abweichungen vom Sollgehalt wurden bei 4 von 11 Chlortetracyclin-Proben festgestellt; hier betrugen<br />
die Gehalte nur 47%-56% des deklarierten Sollgehaltes.<br />
1) Vortrag Dr. M. Schneidereit (BfT): UBA-Symposium, Berlin 29./30.09.2004<br />
2) 11. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 21. August 2002; BGBl. 2002, Teil 1 Nr. 60, S.<br />
3348 sowie nachfolgende Änderungen<br />
4.2. Marktüberwachung<br />
120<br />
Dr. Schnarr, K. (VI H)<br />
Nach Auflösung der vier Bezirksregierungen in <strong>Niedersachsen</strong> ist der Bereich der Marktüberwachung seit<br />
nunmehr zwei Jahren dem LAVES angegliedert.<br />
War das erste Jahr noch sehr stark bestimmt durch verwaltungstechnische und räumliche Anpassungen, so<br />
hat sich 2006 in den einzelnen Fachbereichen des Dezernates, nämlich<br />
- Eier und Geflügel<br />
- Obst und Gemüse<br />
- Vieh und Fleisch sowie<br />
- Medienaufsicht<br />
eine landesweit noch einheitlichere Vorgehensweise etabliert. Für die zu überwachenden Betriebe ist durch<br />
landesweite Festlegung entsprechender Toleranzen und Richtlinien innerhalb des Ermessensspielraums damit<br />
mehr Klarheit gegeben.<br />
In der Zusammenarbeit mit anderen Behörden konnten durch gemeinsame, vom Dezernat Marktüberwachung<br />
organisierte Fortbildungsmaßnahmen erste <strong>Schwerpunkte</strong> gesetzt werden.<br />
4.2.1 Eier<br />
Grauer, A. (Dez. 43)<br />
<strong>Niedersachsen</strong> ist Deutschlands größter Eierproduzent; mehr als 40 % aller in Deutschland produzierten Eier<br />
werden hier gelegt. Entsprechend hat die Überwachung der europaweit gültigen Vermarktungsnorm für Eier<br />
(EWG-VO Nr. 1907/90) und der dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen (EG-VO Nr. 2295/2003) eine<br />
besondere Bedeutung.<br />
Eier erzeugende Betriebe sind entsprechend dem Legehennenbetriebsregistergesetz (LegRegG) in einem<br />
europaweit einheitlichen System zu registrieren. Mit der Registrierung ist die Zuweisung eines Erzeugercodes<br />
verbunden, mit dem die Eier zu kennzeichnen sind.<br />
Neben der Registrierung der Erzeuger ist das LAVES auch zuständig für die Zulassung der Packstellen und die<br />
Eintragung der Sammelstellen gem. Art.4 der EG-VO 2295/200<strong>3.</strong> Auch den Packstellen wird dabei eine Nummer<br />
zugeteilt, die auf einem europaweit einheitlichen System beruht.
Betriebsart<br />
in 2006<br />
121<br />
Änderungs- und<br />
Registrierungsanträge<br />
Erzeuger 891 406<br />
Packstellen 369 35<br />
Sammelstellen 12 3<br />
Insgesamt wurden durch das LAVES 444 Anträge auf Neuregistrierung/-zulassung, Änderung bestehender<br />
Registrierungen und Löschungen bearbeitet.<br />
In 2006 wurde infolge der Aviären Influenza (H5N1) ein Aufstallungsgebot für Hausgeflügel erlassen, welches<br />
insbesondere die auf Freilandhaltung registrierten Betriebe betraf. Im Rahmen der dazu erlassenen<br />
Aufstallungsverordnung musste allen zu diesem Zeitpunkt registrierten 193 Freilandhaltern von Amts wegen eine<br />
Änderung ihrer Haltungsform auf Bodenhaltung mitgeteilt werden. Soweit die Betriebe eine<br />
Ausnahmegenehmigung vom Aufstallungsgebot durch den zuständigen Landkreis erhielten, bzw. in einem durch<br />
Allgemeinverfügung für unproblematisch erklärten Bereich lagen, konnten sie im Anschluss jedoch wieder eine<br />
Rückregistrierung auf die Freilandhaltung beantragen. Auch durch Neuregistrierungen konnte die Zahl der<br />
Freilandbetriebe damit stabil gehalten werden. Zum Jahresende 2006 waren wieder 190 Betriebe für diese<br />
Haltungsform registriert.<br />
Bei den Kontrollen auf Einhaltung der Vermarktungsnormen werden die Register- und Kennzeichnungspflichten<br />
sowie die Qualität (Einhaltung der Güteklasse „A“) auf allen Stufen außer der des Lebensmitteleinzelhandels<br />
überwacht. Damit unterliegen Erzeuger, Sammelstellen, Packstellen, sowie Unternehmen der<br />
Nahrungsmittelindustrie, Großhandel und Verteilerzentren der Überwachung durch das LAVES.<br />
Zusätzlich obliegt den Prüfern auch die Abnahme und Überwachung der Zulassungsbedingungen für Packstellen<br />
und Sammelstellen gem. Art. 3 der EG-VO 2295/2003 sowie die Abnahme des Freilandes bei Neuregistrierungen<br />
und die Überwachung des tagsüber uneingeschränkten Auslaufes für Freilandhennen.<br />
Die dominierende Stellung der niedersächsischen Eierwirtschaft sowohl im bundesweiten wie auch im<br />
europaweiten Vergleich führt dazu, dass Kontrollen anderer Bundesländer oder Mitgliedsstaaten zu Hinweisen an<br />
das LAVES führen, denen entsprechend nachgegangen wird.<br />
In 2006 wurden durch das Dezernat 1.100 Kontrollen mit 2.194 Prüfaufträgen im Fachbereich „Eier“ durchgeführt.<br />
Aus der folgenden Tabelle geht die Verteilung der Kontrollen und dabei festgestellte Beanstandungsquote hervor.<br />
Prüfaufträge in 2006 Anzahl Beanstandungsquote<br />
Buchführung 661 22,6 %<br />
Tätigkeiten/Pflichten 128 13,3 %<br />
Güte- und Gewichtsklassen 320 4,7 %<br />
Haltungsangaben 223 10,8 %<br />
Kennzeichnung 565 24,3 %<br />
Beratung 8 0 %<br />
Legehennenbetriebsregister 135 33,3 %<br />
Registrierung Erzeuger 79 36,7 %<br />
Zulassung Packstellen 33 33,3 %<br />
Eintragung Sammelstellen 3 0%<br />
sonstiges 35 28,6 %<br />
Prüfungsverweigerungen 4 -<br />
Wegen Kennzeichnungs- und/oder Qualitätsmängeln wurden 15 Vermarktungsverbote ausgesprochen. Dabei<br />
waren z. T. erhebliche Partiegrößen betroffen. Auffällig auch in 2006 ist dabei die hohe Beanstandungsquote für<br />
nicht oder nicht leserlich gestempelte Eier sowie für verschmutzte Eier.<br />
Obwohl insbesondere in Fällen einer ersten Beanstandung mit Beratung und Hinweisen eine künftige Befolgung<br />
der Vermarktungsnormen erreicht werden soll, führten die Kontrollen in 2006 zu einer erheblichen Zahl von<br />
Ordnungswidrigkeitenverfahren.<br />
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren in 2006<br />
Eingeleitete Verfahren 107<br />
Abgeschlossene Verfahren 97<br />
davon durch
4.2.2 Geflügelfleisch-Kontrollen<br />
Verwarnungen mit Verwarngeld 47<br />
Bußgeldern 32<br />
Einstellung des Verfahrens 4<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft 2<br />
Abgabe an andere Bundesländer/EU-Staaten 12<br />
122<br />
Dr. Aue, B. (Dez. 43)<br />
Die Geflügelwirtschaft wird insgesamt durch eine Konzentration auf wenige Schlacht- und Zerlegebetriebe und<br />
eine vertikale Integration charakterisiert, die alle Bereiche der Erzeugung umfasst. <strong>Niedersachsen</strong> nimmt dabei im<br />
bundesweiten Vergleich eine herausgehobene Stellung ein.<br />
Das Dezernat Marktüberwachung ist zuständig für die Überwachung der Europäischen Verordnung (VO) Nr.<br />
1906/90 über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften der<br />
EU-Verordnung 1538/91.<br />
Überwachung Dezernat 43<br />
Anzahl der<br />
Betriebe<br />
Geflügelschlachtbetriebe 9<br />
Geflügel-Zerlegebetriebe 6<br />
Sonstige Betriebe (Großhandel,<br />
Verteilerzentren, Kühlhäuser) 127<br />
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit im Jahr 2006 lag im Bereich der Fremdwasserkontrollen von ganzen<br />
Geflügelschlachtkörpern und Geflügelteilstücken. Für den zulässigen und technisch unvermeidbaren<br />
Fremdwassergehalt sind Grenzwerte in Abhängigkeit vom gewählten Kühlverfahren festgelegt, die in einem durch<br />
die VO 1538/91 vorgegebenen Rhythmus in Schlacht- und Zerlegebetrieben durch Probenahme überprüft<br />
werden. Zusätzlich erfolgt eine Probenahme im Großhandel und in Verteilerzentren des<br />
Lebensmitteleinzelhandels (LEH). Die Untersuchung erfolgt im Veterinärinstitut Oldenburg (VI OL) (Teilstücke)<br />
bzw. Futtermittelinstitut Stade (FI STD) (ganze Schlachtkörper) nach EU-weit standardisierten Verfahren.<br />
In 2006 wurden 45 Fremdwasserproben bei Teilstücken gezogen. Dabei ergab sich eine Überschreitung der<br />
zulässigen Gehalte bei sechs Proben (Beanstandungsquote 13,3 %). Für die betroffenen Partien wurden<br />
Vermarktungsverbote ausgesprochen und soweit erforderlich Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (OwiG-Verfahren)<br />
eingeleitet.<br />
Die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte für ganze Schlachtkörper wurde in 14 Fremdwasserproben<br />
überprüft. Dabei mussten Überschreitungen in drei Fällen (21,4 %-Quote) festgestellt werden, die zu<br />
Vermarktungsverboten für die betroffenen Partien und zur Einleitung von drei OwiG-Verfahren führten.<br />
Nach den Vermarktungsnormen ist auch eine Überprüfung der Einstufung des Geflügels in die dafür<br />
vorgesehenen Handelsklassen und der Angaben auf Verpackungen und Warenbegleitpapieren vorgesehen. In<br />
250 Kontrollen mussten 54 Verstöße gegen die Rechtsvorschriften festgestellt werden, die mit<br />
Vermarktungsverboten in sechs Fällen und der Einleitung von elf OwiG-Verfahren geahndet wurden.<br />
Ab dem Dezember 2005 wurde ein zusätzlicher Schwerpunkt in der Überprüfung der Kühlhaus-Betriebe in<br />
<strong>Niedersachsen</strong> gebildet. In der Nachfolge des sog. „Gammelfleischskandals“ ging es dabei um die Feststellung,<br />
welche Betriebe Geflügelfleisch einlagern und ggf. selber als Zwischenhändler auftreten. Insgesamt wurden dabei<br />
70 Kühlhäuser überprüft.<br />
Für 2006 wurde festgestellt, dass in 34 Kühlhaus-Betrieben Geflügelfleisch einlagert wurde und in weiteren<br />
kontrollierten 36 Kühlhaus-Betrieben kein Geflügelfleisch vorzufinden war. Die Überprüfung der Kühlhäuser wird<br />
auch künftig einen Kontrollschwerpunkt bilden.<br />
Dr. Aue, B. (Dez. 43)
4.2.3 Obst, Gemüse und Kartoffeln<br />
Fast jeder Verbraucher hat schon einmal erlebt, dass das als Klasse I eingekaufte frische Obst und Gemüse nicht<br />
den Erwartungen entsprach. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Verkaufstelle hinsichtlich dieses<br />
Erzeugnisses seinen Verpflichtungen zur Qualitätskontrolle nicht hinreichend nachgekommen ist.<br />
Um den gemeinschaftlichen Handel zu erleichtern und um die Bevölkerung mit Produkten hoher Qualität zu<br />
versorgen, hat die EG für zahlreiche Erzeugnisse Qualitätsnormen entwickelt, die EG-weit gelten und an die sich<br />
die Vermarkter aller Handelsstufen halten müssen. Den Mitgliedstaaten steht es frei, für weitere Erzeugnisse<br />
national geltende Qualitätsnormen zu entwickeln. Hiervon hatte auch Deutschland Gebrauch gemacht. Diese<br />
Handelsklassenverordnung ist jedoch - mit Ausnahme der Qualitätsnorm für Speisekartoffeln - mit Wirkung zum<br />
1. Januar 2007 ersatzlos aufgehoben worden.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> wird die Einhaltung der Qualitätsnormen/Handelsklassenangaben auf allen<br />
Vermarktungsstufen außer dem Lebensmitteleinzelhandel durch das LAVES, Dezernat 43 - Marktüberwachung -<br />
kontrolliert. Der Einzelhandel wird durch die Landkreise und kreisfreien Städte überwacht.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> unterliegt eine Vielzahl von Betrieben auf unterschiedlicher Vermarktungsstufe der Kontrolle<br />
durch das LAVES:<br />
Betriebsart<br />
123<br />
Anzahl der<br />
Betriebe<br />
Erzeuger/Selbstvermarkter 298<br />
Sortier-, Pack, Lagerbetriebe 80<br />
Großhandel 179<br />
Erzeugerorganisationen 21<br />
Handelsagenturen<br />
Verteilerzentren des<br />
7<br />
Lebensmitteleinzelhandels 18<br />
Summe 603<br />
Durch die Kontrollen des LAVES bereits vor der Einzelhandelsstufe wird dem Inverkehrbringen nicht<br />
geeigneter Ware effektiv vorgebeugt. Der Prüfungsumfang und die Beanstandungsquote des LAVES ergeben<br />
sich aus nachfolgender Tabelle:<br />
Betriebsart<br />
Prüfungen<br />
2006<br />
Gepr.<br />
Partien<br />
Beanst.<br />
Partien<br />
Erzeuger/Selbstvermarkter 240 667 4 (0,6 %)<br />
Sortier-, Pack,<br />
Lagerbetriebe<br />
136 593 25 (4,2 %)<br />
Großhandel 133 1683 95 (5,6 %)<br />
Erzeugerorganisationen 54 284 1 (0,4 %)<br />
Handelsagenturen 4 5 0<br />
Verteilerzentren des<br />
Lebensmitteleinzelhandels<br />
26 525 26 (5,0 %)<br />
Summe 593 3757 151 (4,0 %)<br />
Beanstandungen führen ggf. zu Vermarktungsverboten, mit denen die betroffenen Partien belegt werden.<br />
Soweit möglich, wird eine normkonforme Aufbereitung ermöglicht. Nicht aufbereitungsfähige Partien sind zu<br />
entsorgen. Auf Grund solcher Verbote wurden 2006 insgesamt 30 Kostenfestsetzungsbescheide verhängt. Des<br />
Weiteren wurden wegen diverser Verstöße 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.<br />
Ein Schwerpunkt der Kontrollen war auch in 2006 die Überprüfung von Spargel. Bei 143 Prüfungen von<br />
Partien wurden 20 beanstandet. Allein 18 dieser beanstandeten Partien wurden im Großhandel und in<br />
Verteilerzentren des Lebensmitteleinzelhandels vorgefunden. Unverändert hoch liegen auch die Beanstandungen<br />
bei in Folienbeuteln abgepackter Äpfel. In diesen Beuteln zeigen die Äpfel oft erhebliche Mängel durch häufig<br />
bereits braun verfärbte Druckstellen, die den Genuss dieser wichtigsten Obstart einschränken. Als problematisch<br />
erweist sich, dass die Zulieferer und der Handel mögliche Verschlechterung der Ware auf dem Transportweg<br />
nicht hinreichend einkalkulieren.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> ist der bundesweit größte Erzeuger von Kartoffeln, die entsprechend von großer
wirtschaftlicher Bedeutung für die Landwirtschaft und den nachgelagerten Handel sind. Für die Kartoffel gilt keine<br />
europäische Norm, sondern die deutsche Handelsklassenverordnung für Speisekartoffeln. Bei 556 kontrollierten<br />
Partien mussten lediglich 14 Beanstandungen ausgesprochen werden.<br />
4.2.4 Vieh und Fleisch<br />
124<br />
Wiecking, H. (Dez. 43)<br />
Im Bereich Vieh und Fleisch kontrolliert das Dezernat 43 - Marktüberwachung - mit sieben Prüfern in erster Linie<br />
die Schlachtbetriebe und die Schlachtvieh handelnden Betriebe. Gesetzliche Basis dieser Kontrollen sind im<br />
Wesentlichen das Vieh- und Fleischgesetz mit den entsprechenden Durchführungsverordnungen sowie die EG-<br />
Vermarktungsnormen bzw. das Handelsklassengesetz mit den jeweiligen Verordnungen für die einzelnen<br />
Tierarten.<br />
Überwachung Dezernat 43<br />
Anzahl der<br />
Betriebe<br />
Schlachtbetriebe insgesamt 1.007<br />
- davon EU-zugelassen 50<br />
Zerlegebetriebe 131<br />
Viehhandelsbetriebe 875<br />
Ein Schwerpunkt ist die Kontrolle der Einstufung von Schlachtkörpern in Handelsklassen. Ein weiterer<br />
Prüfungsschwerpunkt ist die Kontrolle der korrekten Gewichtsfeststellung, zum einen hinsichtlich der<br />
einwandfreien Funktion der Waage, zum anderen hinsichtlich der Einhaltung der zum Zeitpunkt der Verwiegung<br />
genau vorgeschriebenen Schnittführung der Schlachtkörper von Rindern, Schweinen und Schafen.<br />
Die Einstufung der Schlachtkörper in Handelsklassen wird ebenso wie die Verwiegung dieser Schlachtkörper<br />
in den so genannten meldepflichtigen Schlachtbetrieben von öffentlich bestellten Sachverständigen<br />
vorgenommen. Das Dezernat Marktüberwachung ist für die Aus- und Fortbildung sowie für die Bestellung und<br />
Vereidigung dieser Sachverständigen zuständig. In 2006 waren für das Land <strong>Niedersachsen</strong> 120<br />
Sachverständige bestellt und vereidigt.<br />
Des Weiteren werden die Abrechnungen der Schlachtbetriebe und der Viehhändler mit den Erzeugern auf die<br />
korrekte Weitergabe von Handelsklassen und Gewichten hin überprüft.<br />
Das Marktgeschehen auf dem Schlachtviehsektor ist aufgrund des ständigen Wechsels von Angebot und<br />
Nachfrage starken Schwankungen unterworfen. Zudem gibt es eine Vielzahl von Anlieferern und Abnehmern,<br />
was die Marktübersicht sehr erschwert. Um dennoch eine Markttransparenz zu gewährleisten, gibt es das<br />
Instrument der amtlichen Preisnotierung für Rindfleisch und Schweinehälften. Schlachtbetriebe sind ab einer<br />
bestimmten wöchentlichen Schlachtzahl gesetzlich verpflichtet, wöchentlich die Anzahl der geschlachteten Tiere,<br />
deren Gewicht sowie die Auszahlungspreise an das LAVES zu melden. Hier werden die Zahlen<br />
zusammengefasst und als amtliche Preisnotierung für das Land <strong>Niedersachsen</strong> veröffentlicht. Die Kontrolle der<br />
korrekten Abgabe der Meldungen gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Marktüberwachung.<br />
Preisnotierung<br />
2005 2006<br />
Schweine Rinder Schweine Rinder<br />
Meldepflichtige Betriebe 33 16 30 15<br />
Schlachtungen<br />
in Stück<br />
12.917.991 404.998 14.491.312 405.682<br />
Die Überwachung der Rindfleischetikettierung ist ein weiteres Tätigkeitsfeld des Dezernates<br />
Marktüberwachung. Zum einen obliegen dem Dezernat in Schlacht-, Zerlege- und Großhandelsbetrieben direkte<br />
Kontrollaufgaben. Zum anderen wurde durch das Dezernat eine landesweite Datenbank aufgebaut, die auch die<br />
Daten der von den Veterinärbehörden auf Kreisebene zu kontrollierenden Betriebe erfasst. Auf Basis dieser<br />
Daten wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben durch die EU in 2006 erstmals eine Risikoanalyse unter<br />
Berücksichtigung von Risikoklassen, in die die prüfpflichtigen Betriebe eingestuft wurden, erarbeitet. Zukünftig<br />
wird jährlich eine solche Risikoanalyse erstellt, die sowohl dem LAVES selbst als auch den Veterinärbehörden auf<br />
Kreisebene vorgibt, welche Betriebe zu prüfen sind. Neben den Prüfungen nach der Risikoanalyse werden<br />
selbstverständlich auch anlassbezogene Prüfungen durchgeführt.
In allen Bereichen des Fachbereichs Vieh und Fleisch gehört zur Überwachung neben den Vor-Ort-Kontrollen<br />
auch die Durchführung der Verwaltungsverfahren sowie die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren mit der<br />
Festsetzung von Geldbußen, die als Ergebnis der Prüfungen notwendig werden.<br />
4.2.5 Medienüberwachung<br />
Prüfungen und Verfahren in 2006<br />
Durchgeführte Prüfungen insgesamt 880<br />
Hinweise / Abmahnungen 28<br />
Eingeleitete Verfahren<br />
davon wurden abgeschlossen mit<br />
27<br />
Verwarnungen 10<br />
- davon mit Verwarngeld 5<br />
Bußgeld 8<br />
Einstellung des Verfahrens 8<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft 1<br />
125<br />
Grauer, A. (Dez. 43)<br />
Das Dezernat 43 - Marktüberwachung - ist landesweit zuständig für die Überwachung der Impressums-Pflichten<br />
im Internet, bei Teledienstleistern und in Druckwerken. Zusätzlich wird das Trenngebot zwischen Werbung und<br />
redaktionellen Beiträgen überprüft. Die Beurteilung, ob Medienangebote inhaltlich unzulässig sind (z. B. wegen<br />
Verstoß gegen § 4 des Jugendmedienschutzgesetz-Staatsvertrages), nimmt dagegen die Landesmedienanstalt in<br />
Hannover vor.<br />
Die Medienaufsicht wird in der Regel aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung oder von Mitwettbewerbern<br />
auf mögliche Impressumsverstöße aufmerksam gemacht. In diesen Fällen wird geprüft, ob bei Internetauftritten<br />
und bei Teledienstangeboten u. a. Name und Anschrift des Anbieters (bei juristischen Personen zusätzlich der<br />
Name eines Vertretungsberechtigten), bei geschäftsmäßigen Auftritten zusätzlich u. a. die elektronische<br />
Postadresse sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer enthalten sind. Bei Druckwerken müssen Name oder<br />
Firma und Anschrift des Druckers und des Verlegers genannt sein, beim Selbstverlag Name und Anschrift des<br />
Verfassers oder des Herausgebers.<br />
Im Jahre 2006 sind insgesamt 36 Hinweise auf mögliche Verstöße eingegangen. Diesen Sachverhalten wurde<br />
jeweils nachgegangen und mit einem Hinweisschreiben, Abgabe an eine andere zuständige Behörde oder in<br />
hartnäckigen Fällen mit einem Bußgeldbescheid abgeschlossen.<br />
4.3 Tiergesundheit<br />
4.<strong>3.</strong>1 TSE (Transmissible Spongiforme Enzephalopathien)<br />
Allgemeines<br />
Wiecking, H. (Dez. 43)<br />
Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE) sind stets tödlich verlaufende degenerative Erkrankungen<br />
des zentralen Nervensystems und werden als so genannte Prionenerkrankungen bezeichnet. Zu den TSE zählen<br />
eine Reihe von Erkrankungen beim Menschen (New Variant Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Gerstmann-Sträussler-<br />
Scheinker-Syndrom, Tödliche familiäre Schlaflosigkeit, Kuru) und bei Tieren (Chronic Wasting Disease, Scrapie,<br />
Transmissible Mink Enzephalopathie, Bovine Spongiforme Enzephalopathie). Die Erregerausbreitung und<br />
Pathogenese der Erkrankung sind bei den einzelnen Spezies unterschiedlich. Eine spezifische Therapie der TSE<br />
gibt es bislang nicht. Die älteste Krankheit, die unter den Begriff „TSE“ fällt, ist die Traberkrankheit (Scrapie) der<br />
Schafe und Ziegen. Während Scrapie schon seit Jahrhunderten bekannt und weltweit verbreitet ist, wurde die<br />
Bovine Spongiforme Enzephalopathie des Rindes (BSE) erstmals 1985 in Großbritannien beobachtet. Auslöser<br />
der Erkrankung ist ein bestimmtes Prionprotein (PrPsc), ein infektiöses Eiweiß-Aggregat. Eine Theorie zum<br />
Ursprung von BSE besagt, dass die Verfütterung von ungenügend behandeltem Tierkörpermehl an Rinder,
welches mit dem Scrapie-Erreger kontaminiert war, den Ausgangspunkt für die BSE-Epidemie im Vereinigten<br />
Königreich darstellt. Andere Wissenschaftler vermuten, dass spontane Fälle von originärer BSE bei Rindern zur<br />
Kontamination von Tierkörpermehlen mit dem BSE-Erreger und damit zum Ausbruch der BSE-Epidemie führten.<br />
TSE-Fälle in Deutschland<br />
Am 24. November 2000 wurde der erste deutsche BSE-Fall bei einem Rind gemeldet. Seitdem gab es in<br />
Deutschland (Stand: 31.12.2006) insgesamt 405 bestätigte BSE-Fälle bei Rindern mit <strong>Schwerpunkte</strong>n in Bayern<br />
(143), <strong>Niedersachsen</strong> (73) und Baden-Württemberg (47). In Deutschland ist ein kontinuierlicher Rückgang der<br />
BSE-Erkrankungsrate von 125 im Jahr 2001 auf 16 im Jahr 2006 zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren hat<br />
sich die Anzahl der BSE-Erkrankungen jeweils halbiert. Scrapie ist in den Jahren 2000 bis 2006 insgesamt 136<br />
mal in elf Bundesländern aufgetreten (Stand: 31.12.2006).<br />
Überwachungsprogramme<br />
Da die Rinderkrankheit BSE auf den Menschen übertragbar ist, wurden EU-weit seit dem Jahr 2000<br />
umfangreiche Präventivmaßnahmen getroffen. Dazu gehören ein generelles Verfütterungsverbot für Tiermehl,<br />
flächendeckende BSE-Tests und das Verbot von Hochrisikomaterialien in Nahrungsmitteln und Tierfutter. Zudem<br />
wurde ein umfassendes Forschungskonzept auf den Weg gebracht.<br />
Gemäß EU-Verordnung Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter<br />
transmissibler spongiformer Enzephalopathien in der jeweils geltenden Fassung sind BSE-Untersuchungen bei<br />
allen über 30 Monate alten für den menschlichen Verzehr geschlachteten Rindern mittels BSE-Schnelltest Pflicht.<br />
Alle über 24 Monate alten Rinder, die verendet sind, not- oder krankgeschlachtet oder getötet werden, müssen<br />
ebenso untersucht werden.<br />
Schafe und Ziegen unterliegen bisher keiner flächendeckenden Untersuchung auf TSE. Seit BSE bei Rindern<br />
festgestellt wurde, gibt es ein stichprobenartiges Kontroll- und Überwachungssystem für die Traberkrankheit und<br />
BSE bei Schafen und Ziegen. Die aktive Überwachung einer Stichprobe gesunder Schlachttiere und über 18<br />
Monate alter risikobehafteter Tiere mit Hilfe des TSE-Schnelltests wurde im Juni 2002 in Deutschland<br />
aufgenommen. Dabei werden die gleichen Tests wie für die BSE-Testung bei Rindern verwendet, da man damit<br />
auch TSE der Schafe und Ziegen mit hoher Sicherheit erkennen kann. Nachdem Anfang 2005 der Nachweis von<br />
BSE bei einer Ziege bestätigt wurde, legte die Kommission der Europäischen Gemeinschaften einen Vorschlag<br />
zur verstärkten Untersuchung auf TSE bei Ziegen vor. Für Deutschland bedeutet die Neuregelung, dass jährlich<br />
alle über 18 Monate alten Ziegen, die für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden, und mindestens 1.000<br />
über 18 Monate alte Ziegen, die verendet sind oder getötet wurden, untersucht werden.<br />
Nachweismethoden<br />
Die TSE-Diagnostik erfolgt in Deutschland anhand der EU-Verordnung Nr. 999/2001, in der jeweils geltenden<br />
Fassung, als gesetzliche Grundlage. Vorgeschrieben sind so genannte Screening-Methoden in Form von<br />
Schnelltests. Diese Verfahren (post-mortem-Labortests) sind zur Untersuchung großer Probenzahlen geeignet.<br />
Methoden der TSE-Untersuchung am lebenden Tier gibt es zurzeit nicht. In den Veterinärinstituten des LAVES<br />
wurde im Jahr 2006 als Schnelltest der Bio-Rad TeSeE® BSE Test eingesetzt, der im Laufe des Jahres vom<br />
IDEXX HerdChek® BSE-Scrapie Antigen Test abgelöst wurde. Alle Tests weisen das pathologisch veränderte<br />
Prionprotein (PrPsc) in der Obex-Region des Zentralnervensystems nach, weil dort die höchste<br />
Prionenkonzentration vorzufinden ist. Bei der Anwendung des TSE-Tests der Firma IDEXX für kleine<br />
Wiederkäuer (Schaf, Ziege) erfolgt der Nachweis von PrPsc auch im Lymphknoten oder Milzgewebe. Für Blut,<br />
Fleisch oder Milch sind diese Tests jedoch ungeeignet. Voraussetzung für die Nachweisbarkeit der derzeit<br />
eingesetzten Testverfahren ist, dass genügend Erreger vorhanden sind, das Infektionsgeschehen also weit<br />
fortgeschritten ist. In der Regel ist dies erst bei älteren Tieren der Fall. Bei reaktiven Ergebnissen im Schnelltest<br />
werden aufwändige, vom Internationalen Tierseuchenamt zugelassene Bestätigungsuntersuchungen (O.I.E.<br />
Immunoblot, Immunhistochemische Untersuchung) im nationalen TSE-Referenzlaboratorium, im Friedrich-<br />
Loeffler-Institut Insel Riems (FLI), durchgeführt.<br />
Untersuchungsergebnisse<br />
Im Berichtszeitraum 2006 wurden in den Veterinärinstituten des LAVES insgesamt 229.241 TSE-Untersuchungen<br />
durchgeführt. Insgesamt gab es im Jahr 2006 fünf bestätigte TSE-Fälle bei Rindern und zwei bei Schafen. Details<br />
zu den Untersuchungsergebnissen sind in den Tabellen dargestellt.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>1.1: TSE-Untersuchungen von Rindern 2006<br />
126
Kategorie Anzahl<br />
Gesundschlachtung 184.862<br />
Monitoring<br />
verendet 37.456<br />
not-/krankgeschlachtet <strong>3.</strong>971<br />
Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der Schlachtung 156<br />
Getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung 45<br />
Summe 226.490<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>1.2: Bestätigte TSE-Fälle 2006<br />
Monat Landkreis Kategorie Tierart Geburtsdatum/Alter<br />
Januar CUX verendet Schaf 6 Jahre<br />
Februar VER verendet Rind 16.11.1995<br />
Februar DH verendet Schaf 5 Jahre<br />
Juni FRI verendet Rind 22.01.2000<br />
Juli CUX Normalschlachtung Rind 06.09.1999<br />
August EL Normalschlachtung Rind 04.08.1999<br />
August CUX verendet Rind 27.10.1998<br />
Summe 7<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>1.3: Untersuchungen von kleinen Wiederkäuern 2006<br />
Tierart Kategorie<br />
Schaf Gesundschlachtung<br />
verendet<br />
not-/krankgeschlachtet<br />
Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der Schlachtung<br />
Getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung<br />
Ziege Gesundschlachtung<br />
verendet<br />
not-/krankgeschlachtet<br />
Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der Schlachtung<br />
127<br />
Anzahl<br />
1.496<br />
922<br />
4<br />
2<br />
108<br />
13<br />
204<br />
0<br />
2<br />
Summe 2.751<br />
Dr. Gräfe, A. (VI OL)<br />
4.<strong>3.</strong>2 Anzeigepflichtige Tierseuchen<br />
In Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.1 sind die im Berichtsjahr 2006 erfolgten Untersuchungen zum Nachweis bzw. Ausschluss von<br />
anzeigepflichtigen Krankheiten mittels Erreger- oder Antikörpernachweis aufgeführt. Anteilsmäßig dominierten<br />
beim Probenaufkommen wie in den Vorjahren die Einsendungen im Rahmen der Bekämpfung des Bovinen<br />
Herpes Virus 1 (BHV1).<br />
Nach Neuaufnahme der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD) in die Anzeigepflicht 2005<br />
entwickelte sich das Probenaufkommen der BVD-Virusdiagnostik stetig. Das freiwillige Bekämpfungsverfahren<br />
hat bislang noch Bestand. Die Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen<br />
Virusdiarrhoe-Virus (BVD-Verordnung) ist bislang noch nicht in Kraft getreten.<br />
Im Rahmen der Bestandsüberwachung auf die Enzootische Rinderleukose und auf Brucellose fallen weiterhin<br />
regelmäßige Untersuchungen an. Die genannten Krankheiten gelten in <strong>Niedersachsen</strong> als getilgt. Trotz Status<br />
der Seuchenfreiheit kommt es bei der Tuberkulose des Rindes immer wieder zu einzelnen Nachweisen. Die<br />
Untersuchungstätigkeit ergibt sich in erster Linie aus der Aufklärung von verdächtigem Material aus der<br />
Schlachtung.<br />
Aufgrund des Schweinepestausbruchs in NRW im Frühjahr 2006 waren umfangreiche serologische und<br />
virologische Untersuchungen erforderlich, um Restriktionen für <strong>Niedersachsen</strong> durch die EU zu verhindern.<br />
Bei der Tollwutuntersuchung 2006 erfolgte dreimal der Nachweis von Fledermaustollwut in <strong>Niedersachsen</strong>. Die
Überwachung der Tollwut erfolgt durch die Untersuchungen an Rotfüchsen sowie in akuten Verdachtsfällen bei<br />
allen Tierarten. Ein einzelner Nachweis von Campylobacter fetus ssp. venerealis zeigt, dass dieser<br />
Tierseuchenerreger immer noch in der Population vorkommt. Der Erregernachweis hängt in besonderem Maße<br />
von der Qualität der Probenahme ab. In Tierseuchenberichten wird relativ selten von Neuausbrüchen<br />
(Süddeutschland und in Nachbarländern wie z. B. Tschechien) berichtet. Das Geschehen bei den<br />
anzeigepflichtigen Tierseuchen wird derzeit dominiert von der Blauzungenkrankheit (siehe Kap. 4.<strong>3.</strong>2.1). Bei<br />
Geflügelpest (AIV) sollte weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit bestehen, da derzeit immer noch ein hohes Risiko<br />
bezüglich eines möglichen Ausbruchs besteht (siehe auch Kap. 4.<strong>3.</strong>2.2).<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.1: Untersuchungen zu anzeigepflichtigen Tierseuchen<br />
Erkrankung Nachweis von Nachweismethode* 1)<br />
128<br />
Dr. Bötcher, L.; Dr. Klarmann, D.; Dr. Nöckler, K. (VI Ol)<br />
Untersuchung<br />
en insgesamt<br />
davon<br />
positiv<br />
Aujeszkysche Krankheit<br />
Virus/Antigen Zellkultur, IFT 1.495 0<br />
(Pseudowut) Antikörpern ELISA, SNT 2<strong>3.</strong>478 0<br />
Aviäre Influenza (Geflügelpest)<br />
Virus/Antigen/RNA<br />
Antikörpern<br />
Eikultur, HA, PCR<br />
HAH, ELISA<br />
12.031<br />
17.947<br />
2<br />
2<br />
Beschälseuche der Pferde Antikörpern KBR 55 0<br />
Blauzungenkrankheit Virus/Antigen PCR 12.489 70<br />
Bovines Herpesvirus 1 (BHV1), Virus/Antigen Zellkultur, IFT 272 5<br />
Infektiöse Bovine Rhinotracheitis<br />
(IBR)<br />
Antikörpern ELISA, SNT 516.812 31.155<br />
Bovine Virusdiarrhoe/ Mucosal Virus/Antigen/RNA Zellkultur, IFT, ELISA, PCR 88.983 1.415<br />
Disease (BVD/MD) Antikörpern ELISA 5.195 505<br />
Bösartige Faulbrut der Bienen Bakterien Kultur 700 118<br />
Bakterien, DNA Kultur, PCR 351 0<br />
Brucellose<br />
Antikörpern<br />
Langsamaggl., Rose-Bengal-<br />
Test, KBR, ELISA<br />
82.270 0<br />
Enzootische Rinderleukose Antikörpern IDT, ELISA 67.382 4<br />
Infektiöse Anämie der Einhufer Antikörpern Agarimmundiffusionstest 121 0<br />
Klassische Schweinepest<br />
Virus/Antigen/RNA Zellkultur, IFT, ELISA, PCR 20.660 0<br />
(Hausschwein) Antikörpern ELISA, SNT 20.783 0<br />
Klassische Schweinepest<br />
Virus/Antigen/RNA Zellkultur, IFT, ELISA, PCR 1.418 0<br />
(Wildschwein) Antikörpern ELISA, SNT 1.478 0<br />
Koi-Herpesvirus DNA PCR 450 103<br />
Lungenseuche der Rinder Antikörper KBR 0 0<br />
Newcastle Disease Virus/Antigen/RNA Eikultur, HA, PCR 173 0<br />
(Atypische Geflügelpest) Antikörpern HAH 103 67 (Impftiter)<br />
Psittakose (Papageienkrankheit) Bakterien/DNA IFT, PCR 350 6<br />
Rauschbrand Bakterien Kultur 73 6<br />
Rotz Antikörpern KBR 55 0<br />
Salmonellose des Rindes Bakterien Kultur 7.616 316<br />
S. Typhimurium, S. Enteritidis<br />
Zuchtgeflügel<br />
Bakterien Kultur 2.603 1<br />
*2)<br />
Teschener Krankheit Virus/Antigen Zellkultur 0 0<br />
Tollwut Virus/Antigen Zellkultur, IFT 1.709 3<br />
*3)<br />
Trichomonadenseuche Rind Erreger Kultur 323 0<br />
Tuberkulose des Rindes Bakterien Kultur 2 1<br />
Vibrionenseuche des Rindes Bakterien Kultur 345 1<br />
Virale Hämorrhagische Septikämie<br />
(VHS) der Forellen<br />
Virus/Antigen Zellkultur, ELISA 162 3<br />
Infektiöse Hämatopoetische<br />
Nekrose (IHN) der Forellen<br />
Virus/Antigen Zellkultur, ELISA 162 0<br />
*1) Eikultur: Virusnachweis durch Kultivierung im embryonierten Hühnerei; ELISA: Enzyme-linked immunosorbent<br />
assay; HA(H): Hämagglutinations(hemm-)test; IDT: Immundiffusionstest; IFT: Immunfluoreszenztest; KBR:<br />
Komplementbindungsreaktion; Kultur: Bakterienkultur; NAT: Nukleinsäureamplifikationstest; SNT:<br />
Serumneutralisationstest; Zellkultur: Virusnachweis in der Zellkultur
*2) Salmonella-Lebendimpfstamm<br />
*3) Fledermäuse<br />
4.<strong>3.</strong>2.1 Blauzungenkrankheit<br />
Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue disease, BTD) wurde im nördlichen Europa erstmalig im August 2006 im<br />
Dreiländereck Niederlande, Belgien, Deutschland festgestellt. Seitdem kam es zur schnellen und stetigen<br />
Ausbreitung der Erkrankung. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, <strong>Niedersachsen</strong> (ab<br />
November 2006) und Hessen waren direkt betroffen. Dadurch wurden große Teile des Bundesgebietes zu<br />
Schutz- und Restriktionszonen.<br />
Erreger der BTD ist das Bluetongue-Virus (BTV), ein Orbivirus aus der Familie der Reoviridae, bei dem 24<br />
Serotypen unterschieden werden können. Bereits 1998 – 2004 kam es zur Einschleppung des BTV in einzelne<br />
EU-Mitgliedstaaten (Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien), an der die Serotypen 1, 2, 4, 9 und 16 beteiligt<br />
waren. Bei den derzeitigen Ausbrüchen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland wurde bislang nur der<br />
Serotyp 8 nachgewiesen, der in Afrika südlich der Sahara, im indischen Subkontinent sowie Süd- und<br />
Mittelamerika verbreitet ist.<br />
Die BTD wird in der Liste „Diseases notifiable to the OIE“ des internationalen Tierseuchenamtes (OIE) geführt.<br />
Es handelt sich um eine übertragbare Erkrankung mit Potential zur schnellen und grenzübergreifenden<br />
Ausbreitung, wie sich sehr eindrucksvoll auch 2006 gezeigt hat. Die Auswirkungen auf den internationalen Handel<br />
mit Tieren und tierischen Produkten sind erheblich. In Deutschland besteht Anzeigepflicht.<br />
Betroffen sind Schafe, wobei europäische Rassen besonders gefährdet sind, Rinder sowie andere domestizierte<br />
und wildlebende Wiederkäuer. Für den Menschen besteht keine Gefahr. Drastisch erweiterte sich das<br />
Wirtsspektrum 1994, als in den USA nach einer Serie von Aborten und Todesfällen bei Hündinnen das BTV als<br />
Ursache erkannt wurde. Die Hündinnen waren mit einem Impfstoff geimpft worden, der auf kontaminierten<br />
Zellkulturen hergestellt worden war. In afrikanischen Carnivoren konnte in anschließenden Untersuchungen das<br />
BTV ebenfalls nachgewiesen werden.<br />
Die Frage nach der Einschleppung nach Nordeuropa und Deutschland kann nur hypothetisch beantwortet<br />
werden. Der Eintrag des BTV wäre über den Import von virämischen Nutz-, Zoo- oder Wildtieren, die aus dem<br />
südlichen Afrika (z. B. Nigeria) stammen, in denen der Serotyp 8 verbeitet ist, zu erklären. Auch die<br />
Einschleppung über infizierte Vektoren könnte eine Möglichkeit sein und wird unter den Experten favorisiert.<br />
Weiterhin könnten infizierte Samen, Eizellen, Embryonen oder kontaminierte Impfstoffe, Seren oder Medikamente<br />
ursächlich beteiligt sein.<br />
Die Übertragung des BTV erfolgt vorzugsweise über Vektoren. Die biologisch effektiven Vektoren sind Gnitzen<br />
(Culicoides spp.), 1 bis 1,5 mm große Stechmücken. In Nordeuropa wurde das Virus aber auch aus heimischen<br />
Mücken Culicoides (C.) obsoletus und C. dewulfi isoliert. Die Virusvermehrung findet in den Speicheldrüsen der<br />
Insekten bei Temperaturen zwischen 25 ° und 30 ° Celsius statt. Unter 15 ° Celsius ist keine Virusreplikation<br />
möglich. Eine einmal infizierte Mücke ist lebenslang infektiös. Die Lebensdauer der Vektoren beträgt 10-40 Tage<br />
und verlängert sich bei niedrigen Außentemperaturen. Die Inkubationszeit beträgt durchschnittlich drei bis 12,<br />
maximal 21 Tage. Der Nachweis BTV-spezifischer Gensequenzen ist bei infizierten Tieren ab dem 2. bis <strong>3.</strong> Tag<br />
p. i. möglich. Die Infektion dauert bei Schaf und Ziege bis zu 60 Tage, bei Rindern 60-100 Tage. Spezifische<br />
Antikörper können spätestens ab den 10. Tag p. i. nachgewiesen werden. Das BTV ist assoziiert mit Erythrozyten<br />
und mittels PCR beim Schaf bis zu 100 Tagen und beim Rind bis zu 220 Tage nachweisbar.<br />
Das klinische Bild bei Rindern und Schafen ist stark variierend. Es können inapparente, milde<br />
Krankheitsverläufe mit völliger Ausheilung sowie akute Krankheitsverläufe mit Todesfällen auftreten. Als klinische<br />
Symptome werden hohes Fieber über 6 bis 8 Tage, Dyspnoe, Hyperämie der Kopfschleimhäute sowie im<br />
weiteren Verlauf eitrige Rhinitis und Lippen- und Zungenödem mit Blaufärbung der Zunge, die der Krankheit den<br />
Namen gab, festgestellt. Daneben können Ulzera und Erosionen der Schleimhäute beobachtet werden. Mit<br />
beginnender Heilung der nasalen oder oralen Läsionen können sich Pododermatitiden entwickeln. Die<br />
epithelialen Läsionen von Maul und nasolabialer Gegend können chronisch werden und mit Ulzeration und<br />
Sekundärinfektionen zu Nekrosen führen. Bei Jungtieren treten Diarrhöen auf und die Mortalität ist sehr hoch. Im<br />
Verlauf von intrauterinen Infektionen entstehen Fetopathien wie Hydrocephalus, Nekrosen, Verkürzung der<br />
Gliedmassen und Aborte. Als Differentialdiagonse kommen die Bovine Virus Diarrhoe/Mucosal Disease, Bovine<br />
Herpes Virus 1 Infektion, Maul- und Klauenseuche, Vesikuläre Stomatitis, das Bösartiges Katarrhalfieber, oder<br />
andere Stomatitiden in Frage.<br />
Anders als in Südeuropa wurden in Belgien, den Niederlanden und Deutschland vor allem bei Rindern<br />
klinische Symptome wie Flotzmaulläsionen, Klauensaumentzündungen und Zitzennekrosen beobachtet. Bei<br />
Schafen wurde eine vergleichsweise geringere Sterblichkeit festgestellt.<br />
Die schnelle Ausbreitung des Virus und die damit verbundene große Anzahl zu untersuchender Proben<br />
machte es erforderlich, in kürzester Zeit die labordiagnostischen Methoden an den regionalen<br />
Untersuchungsämtern zu etablieren. Aufgrund der ausgesprochen langen Nachweisbarkeit von BTV-Genomen im<br />
Vollblut kann neben dem Antikörpernachweis auch der Genomnachweis als geeignetes Verfahren zur Diagnostik<br />
von BTV herangezogen werden. Bei Untersuchungen des nationalen Referenzlabors (NRL) konnte eine<br />
Übereinstimmung der serologischen und virologischen Analysen von über 98 % ermittelt werden. Neben der<br />
Serologie mittels kommerzieller ELISAs, für die das NRL Referenzmaterial bereitgestellt hatte, war auch der<br />
virologische Nachweis mittels einer vom NRL entwickelten BTV-8-spezifischen real-time RT-PCR an den<br />
regionalen Untersuchungsämter zu etablieren. Im November 2006 nahmen die Veterinärinstitute Hannover und<br />
129
Oldenburg erfolgreich am nationalen Ringtest teil. 16 Feld- und Tierversuchsproben wurden mittels Serologie und<br />
RT-PCR auf BTV Serotyp 8 untersucht.<br />
4.<strong>3.</strong>2.2 Geflügelpest-Monitoring<br />
130<br />
Dr. Nagel-Kohl, U.; PD Dr. Runge, M. (VI H)<br />
Die im Jahre 2005 erfolgten Nachweise des hochpathogenen Geflügelpestvirus asiatischer Herkunft in einigen<br />
Gebieten Ost- und Südosteuropas erhärteten den Verdacht auf eine Virusverbreitung über Zugvögel und<br />
unterstrichen die Notwendigkeit einer intensivierten Überwachung in den EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland und<br />
damit auch in <strong>Niedersachsen</strong> sollten sich die Untersuchungen einerseits auf ausgewählte Wildvogelspezies<br />
konzentrieren. Bezüglich des Wirtschaftsgeflügels standen bestimmte Haltungsformen und besonders exponierte<br />
Standorte im Mittelpunkt des Interesses.<br />
Am 14. Februar 2006 wurde der „asiatische“ Subtyp H5N1 erstmalig bei Wildvögeln in Deutschland (Insel<br />
Rügen) nachgewiesen. In den folgenden Monaten erfolgten in ganz Deutschland weitere Nachweise bei 344<br />
Wildvögeln. Der bisher einzige Ausbruch bei Hausgeflügel ereignete sich am 04. April 2006 in der Nähe von<br />
Leipzig.<br />
Nachdem auch drei Katzen und ein Steinmarder positiv getestet worden waren, wurden in den Sperr- und<br />
Überwachungsgebieten bestimmte Säugetierspezies ebenfalls in das AIV-Monitoring einbezogen.<br />
Im VI Oldenburg wurden im Jahr 2006 annähernd 20.000 Proben im Rahmen des Geflügelpest-Monitorings mit<br />
virologisch/molekularbiologischen und serologischen Methoden untersucht (Details und Ergebnisse s. Kapitel 3<br />
und Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.1).<br />
Dr. Nöckler, A. (VI OL)<br />
4.<strong>3.</strong>2.3 Brucellose<br />
Im Rahmen der Brucella-Untersuchungen nach EU-Vorgaben haben sich bei dieser Krankheit in <strong>Niedersachsen</strong><br />
im Verhältnis zu den Vorjahren keine Änderungen ergeben, die auf eine Gefährdung des Menschen durch diese<br />
Zoonose schließen lassen. Auch 2006 konnte per Tankmilch- und Blutuntersuchung kein positiver serologischer<br />
Befund gegen die drei wichtigsten Brucellaspezies (B. melitensis, B. abortus, B. suis) erhoben werden. Ebenso<br />
blieben alle kulturellen Untersuchungen negativ (siehe Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.1). Auf Grund dieser Rahmenbedingungen<br />
werden ab 2007 die Monitoringuntersuchungen eingeschränkt.<br />
Schöttker-Wegner, H.-H. (VI OL)<br />
4.<strong>3.</strong>2.4 Tollwutdiagnostik<br />
Die Tollwut ist eine der ältesten bekannten Infektionskrankheiten und weltweit verbreitet. Die Erkrankung wird<br />
durch ein Virus des Genus Lyssavirus aus der Familie Rhabdoviridae verursacht und gewöhnlich durch den Biss<br />
infizierter Tiere übertragen. Unbehandelt verläuft die Erkrankung tödlich. Obwohl die Möglichkeit sowohl einer<br />
prophylaktischen als auch post-expositionellen Therapie besteht, sterben auch heutzutage immer noch jährlich<br />
bis zu 55.000 Menschen an der Infektion. Ein Großteil der Opfer stammt aus Asien und Afrika, 30 – 50 % der<br />
Betroffenen sind Kinder. Die modernen Impfstoffe sind zwar gut verträglich und schützen zuverlässig, aber<br />
verhältnismäßig teuer und werden daher z. B. in einigen Ländern Asiens nicht eingesetzt. Dort kommt eine in der<br />
Anwendung aufwändige und mit zahlreichen Nebenwirkungen behaftete Vakzine zum Einsatz.<br />
Das klinische Bild der Tollwut ist durch ausgeprägte zentralnervöse Störungen in Form von<br />
Bewusstseinsstörungen, Exzitationen und Lähmungen gekennzeichnet. Im Gegensatz zu Ländern der dritten<br />
Welt, wo Hunde die Hauptüberträger des Tollwutvirus sind, ist es in Europa vor allem der Rotfuchs. In den letzten<br />
Jahren ist die Wildtollwut wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten, da im Jahre 2005 z. B. 33 Fälle<br />
von Wildtollwut in Rheinland-Pfalz, fünf in Hessen und drei in Baden-Württemberg registriert wurden. Nach<br />
erfolgreicher Impfkampagne konnte der Nachweis 2006 auf drei Füchse aus Rheinland-Pfalz reduziert werden.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> ist seit 1995 „tollwutfreie Region“. Um diesen Status zu erhalten, wird jährlich eine bestimmte<br />
Anzahl an Füchsen, die in der Tollwutverordnung festgelegt ist, pro Landkreis untersucht.<br />
Im Rahmen dieses Fuchstollwutmonitorings wurden im LAVES im Berichtsjahr 1.310 Füchse mit negativem<br />
Ergebnis auf Tollwut untersucht. Bei weiteren 120 Wildtieren und 178 Haustieren (Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.4.1 und 4.<strong>3.</strong>2.4.2)<br />
wurde zum Ausschluss von Tollwutinfektionen bei unklarem Krankheitsbild, bei tot aufgefundenen Tieren sowie<br />
bei Personenkontakt eine Untersuchung durchgeführt. Das Europäische Fledermaustollwutvirus, eine Variante<br />
des Tollwutvirus, konnte 2006 bei drei von 24 untersuchten Fledermäusen festgestellt werden. Das<br />
Infektionsrisiko für den Menschen und andere Tiere ist jedoch sehr gering. Trotzdem stellt die Fledermaus ein<br />
zusätzliches Tollwutvirusreservoir dar, weshalb nach Biss und direktem Kontakt mit einer Fledermaus eine<br />
nachträgliche Impfung erforderlich ist.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.4.1: Untersuchung von Wildtieren auf Tollwutvirus
Tierart Anzahl untersuchter Anzahl positiver<br />
Tiere<br />
Tiere<br />
Alpaka 2 0<br />
Bison 2 0<br />
Dachs 5 0<br />
Eichhörnchen 10 0<br />
Elch 2 0<br />
Feldhase 1 0<br />
Fledermaus 24 3<br />
Frettchen 1 0<br />
Fuchs 1.310 0<br />
Hirsch 1 0<br />
Igel 1 0<br />
Iltis 1 0<br />
Löwe 1 0<br />
Marder 32 0<br />
Maus 4 0<br />
Ratte 3 0<br />
Reh 23 0<br />
Rentier 3 0<br />
Waschbär 2 0<br />
Wisent 2 0<br />
Insgesamt 1.430 3<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>2.4.2: Untersuchung von Haustieren auf Tollwutvirus<br />
Tierart Anzahl untersuchter Anzahl positiver<br />
Tiere<br />
Tiere<br />
Hauskaninchen 1 0<br />
Hausratte 1 0<br />
Hund 34 0<br />
Katze 45 0<br />
Paarhufer 2 0<br />
Pferd 28 0<br />
Rind 37 0<br />
Schaf 22 0<br />
Ziege 8 0<br />
Insgesamt 178 0<br />
Der Virusantigennachweis erfolgt im Abklatschpräparat von bestimmten Gehirnregionen (Ammonshorn,<br />
Cerebellum sowie Pons oder Medulla oblongata) mittels direkter Immunfluoreszenz, bei Personenkontakt oder<br />
unklarem Ergebnis auch durch Virusanzüchtung in der Zellkultur. Die Qualität der Diagnostik wurde im<br />
Berichtsjahr anhand eines bundesweiten, vom NRL und WHO-Zentrum am Friedrich-Loeffler-Institut in<br />
Wusterhausen durchgeführten Ringversuches überprüft, an welchem beide Veterinärinstitute des LAVES mit sehr<br />
gutem Ergebnis teilgenommen haben.<br />
4.<strong>3.</strong>3 Meldepflichtige Tierkrankheiten<br />
131<br />
Dr. Keller, B.; Dr. Rickling, S. (VI H)<br />
Die Erfassung des Auftretens von meldepflichtigen Tierkrankheiten soll einen ständigen Überblick über die<br />
Verbreitung wichtiger Tierkrankheiten verschaffen. Kenntnisse über das Auftreten wichtiger Erkrankungen sind<br />
Voraussetzung für Entscheidungen über geeignete Bekämpfungsmaßnahmen.<br />
Eine solche meldepflichtige Erkrankung ist zum Beispiel die Paratuberkulose. Ein freiwilliges<br />
Bekämpfungsverfahren dieser vornehmlich bei Rindern aber auch bei Schafen und anderen Tieren auftretenden<br />
chronischen, nicht heilbaren Darmerkrankung, welches von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse initiiert<br />
wurde und finanziell unterstützt wird, hat Modellcharakter. Über die Erfolge einer Sanierung dieser regional<br />
gehäuften und verlustreichen Tierseuche können derzeit nur begrenzte Aussagen getroffen werden. Die<br />
Diskussion über eine mögliche Bedeutung als Zoonose und die Beteiligung an der menschlichen Erkrankung<br />
Morbus Crohn ist derzeit noch immer nicht abgeschlossen.<br />
Die Meldepflicht liefert wie bei vielen anderen Erkrankungen auch nur begrenzt verwertbare Hinweise auf die<br />
Verbreitung. Bei der Paratuberkulose erkrankt nur ein kleiner Teil der infizierten Tiere sichtbar. Eine<br />
flächendeckende Untersuchung zur Verbreitung der Erkrankung besteht nicht. Die Diagnostik zur Erkennung<br />
infizierter Tiere ist zudem noch mit einigen Unsicherheiten verbunden und sehr aufwändig (siehe auch Kapitel 3).
Die in der Tabelle 4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1 aufgeführten Untersuchungszahlen geben wesentliche Untersuchungszahlen und<br />
Ergebnisse aus den Untersuchungslaboren der LAVES-Institute wieder. Ein Bericht über die Situation und<br />
Erregernachweise von Mykobakterien (Tuberkulose), Chlamydien, Coxiellen, Ecchinokokkose und Salmonellen<br />
(u. a. in Geflügelzuchtbeständen) erfolgt an anderer Stelle.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1: Untersuchungen zu meldepflichtigen Tierkrankheiten<br />
132<br />
Dr. Bötcher, L.; Dr. Klarmann, D.; Dr. Nöckler, A. (VI OL)<br />
Erkrankung Nachweis von Nachweismethode 1) Untersuchungen<br />
insgesamt<br />
davon<br />
positiv<br />
Ansteckende Metritis der Pferde<br />
(CEM)<br />
Bakterien Kultur 106 0<br />
Campylobacteriose (thermophile C.) Bakterien Kultur, PCR 701 156<br />
Caprine Arthritis/Encephalitis (CAE)<br />
und Maedi/Visna<br />
Antikörpern ELISA 323 5<br />
Chlamydiose (Chlamydophila spec.) Bakterien/Antigen/DNA ELISA, IFT, PCR 379 18<br />
Echinokokkose Erreger Mikroskopie 159 25<br />
Equine virale Arteriitis (EVA) Antikörpern SNT 12 0<br />
Infektiöse Laryngotracheitits des<br />
Geflügels<br />
Virus/Antigen Histologie<br />
Infektiöse Pankreasnekrose der<br />
Forellen und Forellenartigen (IPN) 2) Virus/Antigen<br />
Zellkultur, ELISA,<br />
IFT<br />
156 1<br />
Kontagiöse Equine Metritis (CEM) Bakterien Kultur<br />
Leptospirose Antikörpern MAR 1.410 31<br />
Listeriose Bakterien/DNA Kultur, NAT 198 14<br />
Paratuberkulose<br />
Bakterien<br />
Antikörpern<br />
ZN-Färbung<br />
ELISA<br />
83<br />
15.688<br />
11<br />
45<br />
Bakterien<br />
Paratuberkulose-Sanierungsbetriebe<br />
Antikörpern<br />
Kultur<br />
ELISA<br />
1.364<br />
4.125<br />
96<br />
150<br />
Q-Fieber<br />
Salmonella spp. (alle Tierarten<br />
Bakterien/DNA<br />
Antikörpern<br />
mikroskopisch, PCR<br />
ELISA<br />
328<br />
782<br />
0<br />
30<br />
außer Rind und<br />
Geflügelzuchtbestände)<br />
Bakterien Kultur 680 43<br />
Tuberkulose Bakterien Histologie 32 14<br />
VETEC Bakterien 1 1<br />
1) ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay; IFT: Immunfluoreszenztest; KBR: Komplementbindungsreaktion;<br />
Kultur: Bakterienkultur; MAR: Mikroagglutinationsreaktion; NAT: Nukleinsäureamplifikationstest; SNT: Serumneutralisationstest;<br />
Zellkultur: Virusnachweis in der Zellkultur<br />
2) IPN wird parallel zu VHSV/IHNV untersucht<br />
4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1 Chlamydien<br />
Im Berichtsjahr wurden im LAVES insgesamt 1.061 Untersuchungen auf Chlamydien durchgeführt (Tab. 4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1).<br />
Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Diagnostik der anzeigepflichtigen Psittakose. Mittels Antigen-ELISA, blocking-<br />
ELISA und PCR wurden in sechs (1,7 %) der 350 von Psittaciden stammenden Proben Chlamydien festgestellt.<br />
Damit lag die Nachweisrate ungefähr halb so hoch wie im Vorjahr (2005: 3,3 %). Die meldepflichtige Ornithose<br />
wurde bei einer von 128 Proben anderer Vogelarten nachgewiesen.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong><strong>3.</strong>1.1: Untersuchungen auf Chlamydien<br />
Antigennachweis<br />
Tierart Untersuchungszahl Davon positiv<br />
Psittaciden 350 6<br />
Andere Vögel 128 1 (Huhn)<br />
Schaf 67 14<br />
Ziege 36 0
Rind 148 3<br />
Schwein 68 0<br />
Pferd 66 0<br />
Sonstige 104 1 (Chinchilla)<br />
Gesamt 967 25<br />
Antikörpernachweis<br />
Rind 94 22<br />
Durch Einführung einer verbesserten PCR, die vom Nationalen Referenzlabor für Psittakose (Friedrich-<br />
Loeffler-Institut, Jena) entwickelt wurde, soll zukünftig Chlamydophila psittaci trotz der engen phylogenetischen<br />
Verwandtschaft eindeutig von anderen Chlamydienspezies abgegrenzt werden können. Diese real-time PCR<br />
wurde 2006 in einem AVID-Ringversuch u. a. unter Beteiligung des Veterinärinstituts Hannover erfolgreich<br />
getestet. Zurzeit wird die Methode im Routinebetrieb im Veterinärinstitut Hannover validiert. Die ersten<br />
Ergebnisse sind sehr viel versprechend.<br />
Wie schon im Vorjahr wurden 2006 Chlamydien häufig auch in Feten und Abortmaterial von Schafen<br />
nachgewiesen. Da immer wieder Doppelinfektionen mit dem Q-Fiebererreger Coxiella (C.) burnetii festgestellt<br />
werden, ist es fraglich, welcher Erreger ursächlich für die Aborte ist. In vorangegangenen Untersuchungen wurde<br />
beobachtet, das C. burnetii häufig in klinisch symptomlosen, komplikationslos lammenden Schafen, Chlamydien<br />
jedoch bei den meisten Aborten nachweisbar sind. Es ist daher davon auszugehen, dass Chlamydophila abortus<br />
die primäre Ursache der Aborte ist. Bei beiden Erregern – und insbesondere bei C. burnetii - muss zudem<br />
bedacht werden, dass sie Zoonosen hervorrufen können!<br />
Der Antikörpernachweis bei 94 Rinderblutproben verlief in 22 Fällen positiv. Die Aussagekraft dieser<br />
serologischen Befunde ist jedoch von begrenztem Wert, da Chlamydien bei Rindern häufig vorkommen und eine<br />
Begleiterscheinung der eigentlichen Krankheitsursache sein können.<br />
4.<strong>3.</strong>4 Sonstige Tierkrankheiten<br />
133<br />
PD Dr. Runge, M.; Dr. Keller, B. (VI H)<br />
Das Spektrum der Tierkrankheiten neben den melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen ist weit gefächert. In<br />
den Veterinärinstituten des LAVES wird dieses Spektrum nur insofern abgedeckt, als von den Einsendern neben<br />
der Untersuchung auf melde- und anzeigepflichtige Tierseuchen eine Abklärung der Ursachen von verlustreichen<br />
Erkrankungen und Todesfällen bei Haustieren erwartet wird. Zudem ist der Aufwand für eine Weiterleitung von<br />
Untersuchungsmaterialen oft mit unvertretbar hohem Aufwand und zeitlichen Verzögerungen verbunden, so dass<br />
diese Untersuchungen in den regional gut erreichbaren Instituten des LAVES durchgeführt werden. In der<br />
Mehrzahl der Fälle handelt es sich um differentialdiagnostische Untersuchungen, z. B. zur Klärung von<br />
Abortursachen neben der Brucellose, zur Ursachenklärung von Kälberdurchfällen neben Salmonelleninfektionen,<br />
zur Abklärung der Krankheits- oder Todesursache von Nutz- und Heimtieren neben dem Nachweis von<br />
Zoonosen.<br />
Die Sicherung der Tiergesundheit und der Schutz des Menschen vor Zoonoseerregern sind vorrangige<br />
Aufgaben der Veterinärdiagnostik des LAVES. Zusätzlich zur Untersuchung eingesandter Organ- und<br />
Probenmaterialien wurden hierzu im Jahr 2006 insgesamt <strong>3.</strong>280 Sektionen von Tierkörpern durchgeführt.<br />
In der Tabelle 4.<strong>3.</strong>4.1 wird ein Ausschnitt aus dem Spektrum der 2006 durchgeführten Untersuchungen<br />
wiedergegeben.<br />
Dr. Steffens, H.-W. (FIS), Dr. Klarmann, D. (VI OL)<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>4.1: Untersuchungen zu sonstigen Tierkrankheiten – Virusnachweise und Sondernachweise<br />
spezif. Erreger<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode *1) Untersuchungen<br />
insgesamt<br />
Border Disease Virus/Antigen Zellkultur, IFT 8 0<br />
Bovine Respiratory Syncytial Virus<br />
Calicivirus, Rabbit Hemorrhagic Disease<br />
Virus/Antigen Zellkultur, IFT 109 4<br />
(RHD)/ European Brown Hare Syndrome<br />
(EBHS)<br />
Virus/Antigen HA, PCR 107 17<br />
Calicivirus, European Brown Hare<br />
Syndrome (EBHS)<br />
Virus/Antigen HA, PCR 25 2<br />
Chlamydiose (außer Chlamydophila Bakterien/Antigen ELISA, IFT, PCR 238 0<br />
spec.) Antikörpern ELISA 94 22<br />
Coronavirus Virus/Antigen ELISA, PCR 529 91<br />
davon<br />
positiv
Coxiella (außer C. burnettii) Virus/Antigen PCR 5 0<br />
Equines Herpes-1-Virus Virus/Antigen Zellkultur, IFT<br />
Fischkrankheiten viraler Genese (ohne<br />
VHS, IHN, IPN, KHV)<br />
Virus Zellkultur 24 3 *2)<br />
Hantavirus RNA PCR<br />
Neospora caninum Erreger/Antikörper PCR, ELISA 1117 66<br />
Parainfluenza-3-Virus Virus/Antigen Zellkultur, IFT 113 1<br />
Porcines Circovirus (PCV2) DNA PCR 24 10<br />
Porcine Reproductive and Respiratory<br />
Syndrome (PRRS)<br />
Antikörpern ELISA 23 4<br />
Rotavirus Virus/Antigen ELISA, Latextest, IFT 528 162<br />
Staupe Virus/Antigen Zellkultur, IFT 39 2<br />
*1) ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay; HA: Hämagglutinationstest; IFT: Immunfluoreszenztest; Kultur:<br />
Bakterienkultur; NAT: Nukleinsäureamplifikationstest; Zellkultur: Virusnachweis in der Zellkultur<br />
*2) Nachweis von HVA, EVEX und Picornavirus<br />
4.<strong>3.</strong>5 Fischuntersuchungen<br />
Fischseuchenbekämpfung<br />
Im Rahmen der Überwachung von Fischhaltungsbetrieben wurden im Jahr 2006 in insgesamt 42<br />
Fischhaltungsbetrieben Fischproben im Rahmen amtlicher Untersuchungen zwecks Aufrechterhaltung oder<br />
Anerkennung des EU-Seuchenfreiheitstatus und gemäß § 5 der Fischseuchen-Verordnung entnommen. Für die<br />
Probenahme sind neben der Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung, auch die<br />
weiteren Partner des Kompetenzzentrums Fischgesundheitsfürsorge <strong>Niedersachsen</strong> zuständig.<br />
Flächendeckende Kontrolluntersuchungen sind für eine Seuchenprophylaxe unerlässlich. Für Untersuchungen<br />
gemäß § 5 der Fischseuchen-Verordnung sind jeweils eine klinische und virologische Untersuchung pro jährliche<br />
Betriebsbeprobung vorgegeben. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 71 Fischproben hinsichtlich einer<br />
Pflichtbeprobung bearbeitet.<br />
Die virologischen Untersuchungen werden im Veterinärinstitut Hannover, Fachbereich 23 (Virologie),<br />
durchgeführt. Es wird jeweils eine Stichprobe von bis zu zehn Fischen kontrolliert. Diese Fische werden<br />
tierschutzgerecht getötet und anschließend gemäß den Vorgaben der EU-Entscheidung 2001/183/EG beprobt.<br />
Die Ergebnisse der pathologisch-anatomischen Begutachtung werden dem Fischhalter in einem schriftlichen<br />
Befund übermittelt. Die beprobten Geweben (Milz, Pylorusgewebe, Kopfniere, Gehirn, Herz, ggf. auch Kieme)<br />
werden dem Fachbereich 23 des Veterinärinstitutes Hannover zwecks virologischer Untersuchung zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Fischseuchenentwicklung im Jahr 2006<br />
Im Jahr 2006 wurde die anzeigepflichtige Forellenseuche VHS (Virale Hämorrhagische Septikämie) in zwei<br />
Fischbeständen festgestellt (insgesamt drei Nachweise). Im ersten Halbjahr des Berichtszeitraumes erfolgte der<br />
Nachweis der VHS in einem Angelseebestand mit Regenbogenforellen. Als Einschleppungsursache wurde hier<br />
der Zukauf von infizierten Besatzfischen aus anderen Mitgliedsstaaten der EU vermutet. Dabei konnte jedoch die<br />
Herkunft der eingesetzten Fische nicht sicher festgestellt werden, da keine amtlichen<br />
Gesundheitsbescheinigungen im Zusammenhang mit dem zugekauften Besatzmaterial vorgelegt werden<br />
konnten. Dieses Problem traf auch auf die Feststellung der VHS im zweiten Halbjahr in einem kleinen<br />
verarbeitenden Fischhaltungsbetrieb zu. Auch hier wurden Fische über einen Lebendfischtransporteur eines<br />
anderen EU-Mitgliedsstaates zugekauft. Andere Einschleppungsursachen konnten ausgeschlossen werden. Das<br />
Ergebnis der Genotypisierung des VHS-Isolates durch das FLI-Tübingen zeigte in diesem Fall jedoch, dass das<br />
VHS-Isolat nicht mit den üblichen VHS-Erregern aus dem Herkunftsland des Fischtransporteurs verwandt war.<br />
Offensichtlich wurden Regenbogenforellen transportiert, die nicht aus dem Land stammten, in dem der<br />
Transporteur ansässig war. Damit wird bestätigt, dass die Genotypisierung in der Fischepidemiologie ein<br />
unerlässliches Instrument ist<br />
Anhand dieser Darstellung und aufgrund der Tatsache, dass Fische nicht über Ohrmarken eindeutig<br />
identifiziert werden können, wird das Problem der Rückverfolgbarkeit von Fischlieferungen verdeutlicht.<br />
Untersuchungen des LAVES aus den Jahren 2004 und 2005 (Aquakulturprojekt) konnten jedoch belegen, dass<br />
mittels Stabilisotopenanalyse ein Herkunftsnachweis bei Fischen möglich ist, sofern die Beprobung zeitnah nach<br />
Zukauf der Fische stattfindet.<br />
Die Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung, empfiehlt den Erwerb von<br />
Lebendfischen aus EU-zugelassenen seuchenfreien bzw. aus fischgesundheitsdienstlich überprüften<br />
Fischbeständen. In <strong>Niedersachsen</strong> gibt es derzeit neun Forellen produzierende Betriebe, die den EU-Status als<br />
seuchenfreier Betrieb hinsichtlich der VHS und IHN besitzen. Zwei weitere Betriebe nehmen seit 2003 am<br />
134
Programm zur Zulassung als seuchenfreier Betrieb teil.<br />
Die Koi-Herpesvirus-Infektion der Karpfen (KHV) wurde 2006 in <strong>Niedersachsen</strong> in insgesamt 103 eingesandten<br />
Fischproben, in der Regel bei Koikarpfen nachgewiesen. Dabei erfolgten auch Nachweise in kleinen<br />
Nutzfischbeständen (Karpfen, Silberkarpfen). Die KHV-Infektion der Karpfen ist derzeit zwar anzeigepflichtig, es<br />
besteht jedoch nicht die Verpflichtung zur Bekämpfung.<br />
Die anzeigepflichtigen Fischvirusseuchen ISA (Infektiöse Lachsanämie) und die Infektiöse Hämatopoetische<br />
Nekrose (IHN) wurden im Berichtszeitraum in <strong>Niedersachsen</strong> nicht nachgewiesen. Die meldepflichtige<br />
Fischkrankheit IPN (Infektiöse Pankreasnekrose der Salmoniden) wurde in einem Regenbogenforellenbestand<br />
festgestellt. In einem niedersächsischen Wildaalbestand konnte im August das Aal-Herpesvirus nachgewiesen<br />
werden. Es kam in dem betroffenen See zu sehr hohen Verlusten als Folge dieser Erkrankung. Da es sich um<br />
einen Badesee handelte war das Medieninteresse sehr groß. Erstmalig konnte im Zuge eines Fischsterbens beim<br />
Karpfen ein Picornavirus (Nachweis durch das FLI Insel Riems) festgestellt werden. Es handelte sich hier jedoch<br />
wohl um einen Zufallsbefund ohne kausalen Zusammenhang mit dem Fischsterben.<br />
Die zuständigen Behörden der Landkreise und kreisfreien Städte wurden durch die Task-Force<br />
Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung sowohl schriftlich als auch telefonisch in zahlreichen<br />
Fällen eingehend beraten. Es wurden von der Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich<br />
Fischseuchenbekämpfung, im Berichtszeitraum insgesamt 25 Stellungnahmen und amtliche Vermerke,<br />
insbesondere zu der geplanten Revidierung der EU-Fischseuchengesetzgebung und zu den Seuchengeschehen,<br />
erstellt.<br />
Im Bereich der Ausbildung von Veterinärreferendaren, im Rahmen eines Workshops der Stiftung Tierärztlichen<br />
Hochschule Hannover für praktische Tierärzte, bei den Fortbildungslehrgängen für Gewässerwarte sowie im<br />
Rahmen von Vorträgen und Internetpräsentationen fand weitere Aufklärung zum Thema<br />
Fischseuchenbekämpfung statt.<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Virologische Untersuchungsergebnisse aus dem VI Hannover<br />
Das Veterinärinstitut Hannover ist landesweit für die Diagnose anzeigepflichtiger Fischseuchen wie die VHS, die<br />
IHN und die ISA sowie der meldepflichtigen Fischkrankheit IPN zuständig. Auch Untersuchungen auf Erreger<br />
anderer Fischkrankheiten viraler Genese, wie das seit Dezember 2005 anzeigepflichtige KHV, die<br />
Frühjahrsvirämie der Karpfen (SVC), das Wels-Iridovirus, das Aalrhabdovirus/EVEX und das Aal-<br />
Herpesvirus/HVA, werden routinemäßig durchgeführt.<br />
Untersucht werden Verdachtsproben klinisch auffälliger oder verendeter Fische aus dem Fachgebiet<br />
Fischkrankheiten und Fischhaltung der Tierärztliche Hochschule Hannover, aus der Praxis der Task-Force<br />
Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung, sowie anderer Einsender. Für die Schaffung und<br />
Aufrechterhaltung des Status „seuchenfreier Fischhaltungsbetrieb“ nach der Fischseuchenverordnung werden<br />
niedersächsische Betriebe regelmäßig von den oben genannten Institutionen beprobt. Die zu untersuchenden<br />
Organpools bestehen aus Milz und Kopfniere, Herz oder Gehirn, Pylorusgewebe und Ovarienflüssigkeit. Dieses<br />
Probenmaterial wird nach Aufarbeitung auf verschiedene, für die jeweiligen Krankheitserreger empfängliche<br />
Zelllinien verimpft. Diese Zellkulturen werden 2-malig sieben- bis zehn Tage bei der für die Vermehrung der<br />
gesuchten Viren optimalen Temperatur bebrütet. Bei Auftreten eines zellschädigenden Effektes (ZPE) werden zur<br />
Bestätigung einer Virusinfektion spezifische Antikörper, unter Anwendung verschiedener Untersuchungstechniken<br />
(Peroxidase-linked-antibody-assay, Immunfluoreszenztest, ELISA etc.) eingesetzt.<br />
Im Jahr 2006 wurden im Virologielabor des VI Hannover insgesamt 180 Organ- bzw. Organpoolproben auf das<br />
Vorhandensein fischpathogener Viren untersucht (siehe Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht<br />
gefunden werden.). Die eingesandten Proben stammten zum größten Teil von Regenbogenforellen, aber auch<br />
andere Fischarten waren vertreten (siehe Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.2). Im Falle von Organpools mehrerer Fischarten wurde<br />
nur eine aufgeführt.<br />
Es wurden in zwei Forellenbeständen das VHS-Virus isoliert (drei Nachweise), IPN wurde ebenfalls in einem<br />
Bestand diagnostiziert, die IHN jedoch wurde im Berichtsjahr nicht festgestellt. Ferner gab es ein HVA-Nachweis<br />
in einem Wildaalbestand und das EVEX-Virus wurde in einem Farmaalbestand festgestellt. Bei der Untersuchung<br />
einer Karpfenprobe, wurde erstmals ein Picornavirus diagnostiziert. Die Differenzierung erfolgte in dem Fall im<br />
nationalen Referenzlabor für Fischkrankheiten des FLI Insel<br />
Riems.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.1 Nachweise von Viruserregern bei Fischen (2006)<br />
Fischgruppe Nutzfische Zierfische Summe<br />
Einsendungen – Virologie 177 3 180<br />
Einsendungen –<br />
Molekularbiologie (KHV)<br />
51 399 450<br />
VHS* 156 / 6** 0 156 / 6**<br />
IHN* (156) / 6** 0 (156) / 6**<br />
KHV 51 399 450<br />
135
IPN* (156) 0 (156)<br />
SVC 13 3 16<br />
Sonstige 8 0 8<br />
Gesamt 228 / 12** 402 630 / 12**<br />
* Die Untersuchung von Fischproben auf IHN, VHS, IPN und anderer Erreger erfolgt im selben Ansatz, deshalb werden die<br />
Untersuchungszahlen nur einmal angegeben, weitere Parameter in Klammern.<br />
** zusätzliche Einsendungen für die Molekularbiologie<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.2 Virologische und molekularbiologische Untersuchungen von Fischproben (2006)<br />
Fischart /<br />
Einsendungen<br />
Ergebnis<br />
Untersuchungsanlass<br />
(Einzelproben / Pools)<br />
VHS/IHN<br />
Regenbogenforelle 135 3 positiv VHS<br />
Bachforelle 2 negativ<br />
Lachs 5 negativ<br />
Steinbutt 5 negativ<br />
Hecht 3 negativ<br />
Rotfeder 1 negativ<br />
Saibling 4 negativ<br />
Stör 1 negativ<br />
Summe VHS/IHN 156 3 positiv VHS<br />
KHV<br />
Koikarpfen 361 90 positiv KHV (24,9 %)<br />
Goldfisch 38 7 positiv KHV<br />
Karpfen (Nutzfische) 45 4 positiv KHV<br />
Graskarpfen 1 negativ<br />
Silberkarpfen 1 1 positiv KHV<br />
Stör 1 negativ<br />
Aal 1 negativ<br />
unbekannt 2 1 positiv KHV<br />
Summe KHV 450 103 positiv KHV<br />
SVC<br />
Karpfen 12 negativ<br />
Koi 3 negativ<br />
Elritze 1 negativ<br />
Summe SVC 16<br />
Sonstige Krankheiten viraler Genese<br />
Aal 6<br />
1 positiv HVA<br />
1 positiv EVEX<br />
Regenbogenforelle (135)* 1 positiv IPN<br />
Karpfen (12)* 1 positiv Picornavirus<br />
Tilapia 1 negativ<br />
Wolfbarsch 1 negativ<br />
Summe sonstige 8 4 Nachweise<br />
136
Summe gesamt 630 110 Nachweise (17,5 %)<br />
* Die Untersuchung von Fischproben auf IHN, VHS, IPN erfolgt im selben Ansatz, deshalb<br />
werden die Untersuchungszahlen nur einmal angegeben, weitere Parameter in Klammern.<br />
137<br />
Dr. Keller, B. (VI H); Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Molekularbiologische Untersuchungen aus dem VI Hannover<br />
Insbesondere bei Erkrankungen viraler Genese spielen molekularbiologische Untersuchungsverfahren wie die<br />
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eine immer wichtigere Rolle in der Diagnostik. Im VI Hannover wird die PCR<br />
seit einigen Jahren zum Nachweis oder Differenzierung der viralen Fischseuchenerreger wie dem Koi-<br />
Herpesvirus (KHV), den Viren der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) und der Viralen<br />
Hämorrhagischen Septikämie (VHS) der Salmoniden sowie dem bakteriellen Fischpathogen Flavobacterium<br />
psychrophilum in der Routinediagnostik durchgeführt. Abgesehen von der kurzen Untersuchungsdauer kann bei<br />
der Diagnostik des KHV auf die PCR nicht verzichtet werden, da das Virus in der Regel auf Zellen nicht oder nur<br />
schlecht kultivierbar ist.<br />
Zur kontinuierlichen Optimierung der Untersuchungsmethoden wurde im VI Hannover in Zusammenarbeit mit<br />
der Abteilung Fischkrankheiten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover im Rahmen eines<br />
Forschungsprojektes begonnen, eine real-time PCR zur Diagnostik des KHV auf Basis des Thymidinkinase-Gens<br />
zu etablieren. Dieses Projekt wird 2007 abgeschlossen sein.<br />
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 462 Proben von Fischen mit Hilfe der PCR untersucht, wovon 446 Proben<br />
von den beiden Partnerinstitutionen des Kompetenzzentrums Fischgesundheitsfürsorge <strong>Niedersachsen</strong><br />
eingebracht wurden (Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.1). 450 Proben wurden zur Untersuchung auf KHV eingesandt. KHVspezifische<br />
Nukleinsäuresequenzen wurden in insgesamt 103 (22,8 %) Einsendungen ermittelt, wobei vor allem<br />
Koikarpfen, aber auch Nutzkarpfen betroffen waren (Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.2). Im Vergleich zum Jahr 2005 ist die<br />
Nachweisrate gleich bleibend auf hohem Niveau.<br />
Bakteriologische und mykologische Untersuchungsergebnisse aus dem VI Hannover<br />
Priv.-Doz. Dr. Runge, M. (VI H); Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Im Jahr 2006 wurden im Fachbereich Fischbakteriologie des Veterinärinstitutes Hannover 433 Einsendungen<br />
bearbeitet. Damit setzte sich der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend im Anstieg der<br />
Probeneinsendungen fort. Einsendungen erfolgten durch die Partnerinstitutionen des Kompetenzzentrums<br />
Fischgesundheitsfürsorge <strong>Niedersachsen</strong> (Abteilung Fischkrankheiten und Fischhaltung der Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover und Tiergesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer <strong>Niedersachsen</strong>) sowie aus der<br />
operativ beratenden Praxis der Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung.<br />
Sowohl bei den Nutzfischen als auch bei den Zierfischen wurde ein erfreulich geringer Anteil an obligat<br />
fischpathogenen Krankheitserregern nachgewiesen. Bei den Nutzfischen stand der Erreger der Furunkulose,<br />
Aeromonas salmonicida im Vordergrund und bei den Zierfischen wie im Vorjahr Bakterien aus der Gruppe der<br />
Flavobacterien/Flexibacter. Zudem wurden bei den Zierfischen in drei Fällen Mykobacterien nachgewiesen (M.<br />
marinum). Der primär fischpathogene Erreger Vibrio anguillarum wurde in 2006 nicht nachgewiesen (siehe<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.3). Bei den Nachweisen im Bereich der Gruppe der fakultativ fischpathogenen Bakterien wurden wie<br />
im Vorjahr im Wesentlichen insbesondere bei den Zierfischen Bakterien der Gattungen Aeromonas,<br />
Pseudomonas und Cytophaga isoliert (siehe Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.4). In 2006 wurden im Rahmen der mykologischen<br />
Untersuchungen wie im Vorjahr im Wesentlichen Schimmelpilze der Gattungen Mucor und Aspergillus sowie in<br />
28 Fällen durch Saprolegnia (Fischschimmel) verursachte Organmykosen nachgewiesen.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.3: Nachweis obligat fischpathogener Bakterien (2006)<br />
Fischgruppe Nutzfische Zierfische Wasser Summe<br />
Einsendungen<br />
Bakteriengattungen / -arten<br />
131 289 13 433<br />
Aeromonas salmonicida 8 0 0 8<br />
Edwardsiella sp. 2 2 0 4<br />
Flavobakterium sp./<br />
Flexibacter sp.<br />
0 3 1 4<br />
Mykobakterien 0 3 0 3<br />
Streptokokkus iniae 0 1 0 1<br />
Vibrio anguillarum 0 0 0 0<br />
Yersinia ruckeri 5 0 0 5
Tabelle 4.<strong>3.</strong>5.4 Nachweis fakultativ fischpathogener Bakterien und Mykosen<br />
(2006)<br />
Fischgruppe Nutzfische Zierfische Wasser Summe<br />
Einsendungen 131 289 13 433<br />
Bakteriengattungen / -arten<br />
bewegliche Aeromonaden 10 29 0 39<br />
Aeromonas hydrophila 15 91 0 106<br />
Aeromonas sobria 40 129 6 175<br />
Acinetobacter 7 11 2 20<br />
Citrobacter freundii 3 11 2 16<br />
Cytophaga 2 16 1 19<br />
Pseudomonas 36 155 7 198<br />
Vibrio 2 5 0 7<br />
Weitere Bakteriengattungen 4 10 1 15<br />
Saprolegnia 18 9 1 28<br />
Weitere Mykosen 9 15 0 24<br />
Fischgesundheitsfürsorge im Jahr 2006<br />
138<br />
Dr. Braune, S. (VI H); Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Im Berichtszeitraum haben die Partnerinstitutionen des Kompetenzzentrums Fischgesundheitsfürsorge<br />
<strong>Niedersachsen</strong> im Rahmen der kurativen Betreuung von Fischhaltungsbetrieben und Zierfischhaltungen<br />
insgesamt über 1000 Fisch- und Wasserproben untersucht (insgesamt 2430 Untersuchungsaufträge).<br />
Problemschwerpunkt war neben der Koi-Herpesvirus-Infektion insbesondere die Haltungsproblematik.<br />
Tätigkeit bei Gewässerschäden und sonstige Tätigkeiten<br />
Bei der Aufklärung von Fischsterben in <strong>Niedersachsen</strong> findet in Amtshilfe eine Zusammenarbeit mit den Polizei-<br />
und Umweltbehörden vor Ort statt. Im Berichtszeitraum wurden in acht Fällen Fischproben nach Fischsterben in<br />
Freigewässern untersucht (deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr). Rückstandsanalytische Untersuchungen<br />
im Rahmen von Fischsterben werden im IfF Cuxhaven des LAVES durchgeführt.<br />
4.<strong>3.</strong>6 Bienenkrankheiten<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Dank der intensiven Inanspruchnahme des Bienenzuchtberatungsdienstes durch die niedersächsischen Imker<br />
werden zahlreiche Krankheiten bereits direkt vor Ort auf den Bienenständen von den Bienenzuchtberatern<br />
diagnostiziert. Nach Feststellung der Krankheiten leiten die Bienenzuchtberater die durchzuführenden notwenigen<br />
Maßnahmen ein. Die meisten Bienenkrankheiten sind keine Tierseuchen und können durch imkerliche<br />
Maßnahmen nach guter imkerlicher Praxis kuriert werden.<br />
Die anzeigepflichtige Bienenseuche „Amerikanische Faulbrut“ wird an den jeweils zuständigen Veterinär<br />
gemeldet und verdächtiges Material bakteriologisch untersucht. Zusätzlich wurden im Labor des Institutes für<br />
Bienenkunde insgesamt 474 Brut- und Bienenproben untersucht. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2.997<br />
Futterkranzproben auf Sporen des Erregers der Amerikanischen Faulbrut untersucht. Davon waren 323<br />
Verdachtsproben. Unter diesen gibt es naturgemäß einen überproportional hohen Anteil positiver Proben – also<br />
niedriger und hoher Sporenwerte. Von den restlichen 2.674 Proben hatten 50 (= 1,9 %) einen niedrigen und 36 (=<br />
1,3 %) einen hohen Sporenwert. Die von uns entwickelte Standard-Sporensuspension RSK16 - wichtig im<br />
Rahmen des Qualitätsmanagements der Laborpraxis beim Nachweisverfahren von Paenibacillus-larvae-Sporen -<br />
ist von zahlreichen Untersuchungsstellen auch aus benachbarten Staaten bestellt worden.<br />
Im Futtermittelinstitut Stade ist die Anzahl der amtlichen Einsendungen aus AFB-Sperrbezirken im Vergleich<br />
zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Von insgesamt 700 Proben entfielen 654 auf Futterkranz- und<br />
Honigproben, von denen 17 (2,6 %) hohe Belastungen und 62 (9,5 %) niedrige Belastungen mit Paenibacillus-
larvae-Sporen aufwiesen. 66 Proben (10,1%) waren wegen einer hochgradigen unspezifischen<br />
Kontaminationsflora nicht beurteilbar und 509 Proben (77,8 %) erwiesen sich als negativ. Von den 46<br />
eingesandten Brutwaben waren 39 (84,8%) Faulbrut-positiv und 7 (15,2 %) negativ. Die rückläufige Entwicklung<br />
sowohl bei der Zahl der amtlichen Einsendungen als auch bei dem Anteil der positiven Befunde bei den<br />
Futterkranzproben (12,1 % gegenüber 30,2 % im Jahr 2005) kann - sofern sich dies als Trend fortsetzt - als ein<br />
Sanierungserfolg interpretiert werden.<br />
4.<strong>3.</strong>7 Wildtieruntersuchungen<br />
139<br />
von der Ohe, W.; Steffens,H.-W.; Lienau, F.-W. (IB CE)<br />
Die Einsendezahlen auf dem Gebiet der Wildtieruntersuchungen wurden im Vergleich zum Vorjahr (2005: 1.562<br />
Einsendungen) mit 6.614 eingesandten Wildtierkörpern mehr als vervierfacht. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf<br />
Einsendungen zum Ausschluss der Aviären Influenza (AIV, „Vogelgrippe“) zurückzuführen.<br />
Eine vergleichbare Steigerung der Einsendezahlen bei Hasen und Kaninchen ergab sich durch die Einrichtung eines neuen<br />
Monitoringprojektes zum Vorkommen und der Verbreitung des Tularämieerregers Francisella tularensis und Brucellen in<br />
niedersächsischen Hasen- und Wildkaninchenpopulationen, das vom Veterinärinstitut Hannover in Kooperation mit der<br />
niedersächsischen Landesjägerschaft, dem Institut für Wildtiertierforschung sowie dem Institut für bakterielle Infektionen und<br />
Zoonosen des Friederich-Loeffler-Instituts in Jena durchgeführt wird.<br />
Nach wie vor nimmt bei diesen Tierarten bezüglich der erregerbedingten Einzeltiererkrankungen die Calicivirose (als so<br />
genannte „China-Seuche“) mit den Krankheitsbildern der RHD bei Kaninchen bzw. EBHS bei Hasen einen herausragenden<br />
Platz ein. Ebenfalls in – allerdings negativer Weise – hervorzuhebender Größenordnung sind die Vergiftungsnachweise<br />
speziell auch bei Wildvögeln in immerhin 59 Fällen zu nennen. Die nach Krankheitsursache bzw. Erregernachweisen<br />
aufgeführte Darstellung ist der Tabelle 4.<strong>3.</strong>7.1 zu entnehmen.<br />
Tabelle 4.<strong>3.</strong>7.1: Ergebnisse der Wildtieruntersuchungen<br />
Tierart Einsend- Trauma Yersiniose Pasteurellose RHD/ Staupe Myxomatose Tuberkulose<br />
ungen<br />
EBHS<br />
Reh 50 4 1<br />
Hase/Kaninchen* 732 15 6 13 30 6<br />
Marder 35 2 4 1<br />
Wildschwein 9<br />
Wildvögel** 5540 11<br />
Fuchs*** 188 4<br />
Dachs/<br />
Waschbär/<br />
Marderhund<br />
11 1<br />
Rot-, Dam-<br />
Muffelwild<br />
15 4<br />
Andere 34 6<br />
Tierart Einsen- bakterielle Parasitose Enzephalitis Toxo- Vergiftung Amyloidose andere<br />
dungen Infektion<br />
plasmose<br />
Ursachen<br />
Reh 50 9 14 13 1 12<br />
Hase/Kaninchen* 732 25 16 1 5 7 57<br />
Marder 35 3 7 12 1 3 6 12<br />
Wildschwein 9 3 4 1 3<br />
Wildvögel** 5540 18 53 2 13<br />
Fuchs*** 188 7 6 6 1 1 3<br />
Dachs/<br />
Waschbär/<br />
Marderhund<br />
11 2 3 3 4<br />
Rot-, Dam-<br />
Muffelwild<br />
15 2 8 1 2<br />
Andere 34 2 2 6<br />
Gesamtzahl: 6614<br />
* davon 582 aus dem Projekt „Vorkommen und Verbreitung des Tularämieerregers (Francisella tularensis) und Brucellen in<br />
niedersächsischen Hasen- und Wildkaninchenpopulationen“ (150 sind Fallwild)
** 135 wurden zusätzlich zu AIV auf Todesursache untersucht<br />
*** davon 162 aus dem Fuchsbandwurmprojekt (26 sind Fallwild)<br />
4.<strong>3.</strong>8 Zulassung und Überwachung der Betriebe zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten<br />
140<br />
Dr. von Keyserlingk, M. (VI H)<br />
Durch die EU-Verordnung Nr. 1774/2002 und das dazugehörige deutsche Nebenproduktebeseitigungsrecht sind die Hygienevorschriften<br />
für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte einheitlich geregelt worden.<br />
Es werden nachfolgende 3 Arten (Kategorien) von Materialien unterschieden.<br />
Material der Kategorie 1 umfasst alle Körperteile von TSE-kranken Tieren (einschl. Kohortentieren), Heim-, Zoo- und Zirkustieren,<br />
Versuchstieren, kranken Wildtieren sowie sogen. spezifisches Risikomaterial (SRM) und SRM-enthaltende Tierkörper, Erzeugnisse<br />
tierischen Ursprungs mit verbotenen Rückständen, Küchen- und Speiseabfälle aus dem grenzüberschreitenden Verkehr u.a.<br />
Material der Kategorie 2 umfasst Gülle sowie Magen- und Darminhalt, alle Tiermaterialen aus Abwässern von Schlachthöfen,<br />
Erzeugnisse tierischen Ursprungs mit Tierarzneimittelrückständen, nicht einfuhrfähige Erzeugnisse tierischen Ursprungs, gefallene,<br />
verendete oder getötete Tiere u.a.<br />
Material der Kategorie 3 umfasst beanstandete Schlachtkörperteile, Häute, Hufe, Hörner, Borsten und Federn von<br />
geschlachteten Tieren, Blut von geschlachteten Tieren (keine Rinder/ Wiederkäuer), tierische Nebenprodukte aus der Schlachtung<br />
und Verarbeitung (einschl. Knochen u. Grieben), ehemalige, beanstandete Lebensmittel tierischer Herkunft, Fische und<br />
Fischabfälle, andere Küchen- und Speiseabfälle u.a.<br />
Für Betriebe, denen die Beseitigungspflicht für Materialien der Kategorien 1 und 2 von den Kreisen übertragen wurde, ist das<br />
Dezernat 31 des LAVES die zuständige Behörde. In <strong>Niedersachsen</strong> sind 7 Betriebe dafür zugelassen. Diese Betriebe wurden im<br />
Jahr 2006 regelmäßig überprüft.<br />
Goehl, R.; Dr. Schumacher, T. (Dezernat 31)<br />
4.<strong>3.</strong>9 Zulassung von Besamungs- und Embryotransferstationen und von Affenhaltungen zum innergemeinschaftlichen<br />
Handel<br />
Der Handel zwischen EU-Staaten und die Ein- und Durchfuhr von Tieren und deren Erzeugnissen ist im Hinblick auf die<br />
Tiergesundheit in der Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-Verordnung geregelt. Bestimmte Betriebe, die Tiere oder tierische<br />
Erzeugnisse innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verbringen möchten, bedürfen der Zulassung durch die zuständige Behörde.<br />
Für die Zulassung von Betrieben, die mit Samen von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen oder Ziegen sowie Eizellen oder<br />
Embryonen dieser Tiere oder mit Affen innergemeinschaftlich handeln, ist das LAVES zuständig.<br />
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens sind die Betriebe auf die Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Voraussetzungen für den<br />
Handel mit Affen bzw. mit Tiersamen und Tierembryonen zu überprüfen.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> sind 9 Einrichtungen für den Handel mit Affen und 55 Betriebe für den Handel mit Sperma, Eizellen und<br />
Embryonen zugelassen. Überprüft wurden im Jahr 2006 eine Affenhaltung, zwei Besamungsstationen für die Tierart Pferd, eine<br />
Besamungsstation und ein Samendepot für die Tierart Rind und eine Embryotransferstation für die Tierart Rind. Neu erteilt wurden<br />
Zulassungen für zwei Besamungsstationen für die Tierart Pferd.<br />
4.<strong>3.</strong>10 Erlaubnisserteilung an Labore zum Arbeiten mit Tierseuchenerregern<br />
Goehl, R. (Dezernat 31)<br />
Ein Labor und Personen, die mit lebenden Tierseuchenerregern arbeiten, bedürfen hierfür einer Erlaubnis nach der<br />
Tierseuchenerreger-Verordnung.<br />
Für die Erteilung dieser Erlaubnis ist in <strong>Niedersachsen</strong> das LAVES zuständig. In <strong>Niedersachsen</strong> gibt es 58 Labore, die die<br />
Erlaubnis haben, mit infektiösen Tierseuchenerregern zu arbeiten. Im Jahr 2006 wurden 9 Laboratorien überprüft und die<br />
Erlaubnisbescheide ergänzt oder neu erteilt.<br />
4.<strong>3.</strong>11 Ausstellungen, Auktionen, Körungen, Turniere und Viehmärkte<br />
Goehl, R. (Dezernat 31)<br />
Nach § 6 der Viehverkehrsverordnung sind Viehausstellungen, Viehmärkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mindestens vier<br />
Wochen vor Beginn der Veranstaltung zum Schutz vor der Verschleppung von Tierseuchen vom Veranstalter bei der zuständigen<br />
Behörde anzuzeigen.<br />
Wenn zur Veranstaltung voraussichtlich Tiere aus einem Zuständigkeitsbereich außerhalb des Landkreises oder der
kreisfreien Stadt aufgetrieben werden sollen, liegt die Zuständigkeit als Vollzugsaufgabe in Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Veterinärbehörden beim LAVES.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> wurden 2006 ca. 640 Veranstaltungen mit Rindern, Pferden, Ziegen, Schafen, Schweinen, Geflügel und<br />
anderen Tieren angezeigt. Dabei waren Schafkörungen, internationale Reitturniere, Auktionen und Eliteschauen von Rindern wie<br />
z.B. der Internationale Holstein-Wettbewerb, ebenso vertreten wie die EuroTier, kleine traditionelle Viehmärkte oder die Erste<br />
Norddeutsche Lama- und Alpakaschau.<br />
Den meisten Veranstaltungen konnte ohne Einschränkungen zugestimmt werden. Durch das Auftreten der Blauzungenkrankheit<br />
ab Sommer 2006 waren die Veranstaltungen mit Rindern, Schafen und Ziegen allerdings mit hohem organisatorischen Aufwand für<br />
alle Beteiligten zu maßregeln.<br />
Wie bereits 2005, wurde durch die Geflügelpestschutzverordnung die Durchführung von Geflügelausstellungen, -schauen und -<br />
märkten mit Ausnahme von Tauben- und Ziervogelveranstaltungen verboten. Den Veranstaltern war es jedoch möglich, im Rahmen<br />
der Anzeigepflicht eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Von der Möglichkeit zur Beantragung einer Ausnahmegenehmigung<br />
(darunter die Deutsche Junggeflügelschau mit über 17.000 Hühnern, Enten und Gänsen) wurde von der Mehrzahl der Veranstalter<br />
im November und Dezember, traditionell die Monate der Geflügelausstellungen, Gebrauch gemacht.<br />
4.<strong>3.</strong>12 TRACES – System der EU für den Handel mit Tieren und tierischen Erzeugnissen<br />
141<br />
Dr. Schwochow, K. (Dezernat 31)<br />
Aufgrund der Abschaffung der Veterinärkontrollen an den Binnengrenzen und die zunehmende Harmonisierung des<br />
Veterinärsektors in der EU musste der Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten verbessert<br />
werden.<br />
Aus diesem Grunde wurde mit dem System TRACES (Trade Control and Expert System) eine einheitliche elektronische<br />
Datenbank geschaffen, mit der sich Transporte von Tieren und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs innerhalb der EU<br />
sowie aus Drittländern verfolgen lassen.<br />
TRACES zeichnet sich durch einen elektronischen Informationsaustausch, die zentrale Verwaltung der in den Rechtsvorschriften<br />
vorgesehenen Referenzdaten und durch Mehrsprachigkeit aus. Es erleichtert den zuständigen Behörden damit die Ausstellung der<br />
erforderlichen Begleitdokumente, die sich dann auch in der Sprache des Bestimmungsmitgliedsstaates ausdrucken lassen.<br />
Das LAVES bietet den kommunalen Veterinärbehörden Hilfestellung bei Problemen mit TRACES und beantwortet auftretende<br />
Fragen bei der Anwendung. Die Einrichtung und Verwaltung der TRACES - Nutzer in <strong>Niedersachsen</strong> wird hier vorgenommen sowie<br />
Beanstandungen von anderen Mitgliedsstaaten bearbeitet. Im Jahre 2006 wurden 63 Sendungen beanstandet, wobei hauptsächlich<br />
fehlerhafte Angaben in den Gesundheitsbescheinigungen bemängelt wurden oder Angaben fehlten.<br />
Es finden regelmäßig Schulungen für die niedersächsischen Nutzer von TRACES statt. Im Jahre 2006 wurden zwei<br />
Anfängerschulungen, sieben für Fortgeschrittene sowie zusätzlich je eine Schulung für die Bediensteten der Polizei und für<br />
Marktteilnehmer angeboten.<br />
4.4 Zoonosen<br />
4.4.1 Überwachungspflichtige Zoonosen und Zoonoseerreger<br />
4.4.1.1 Campylobacteriose<br />
Dr. Kurlbaum, S. (Dezernat 31)<br />
Thermophile Spezies der Gattung Campylobacter sind in Deutschland neben Salmonellen die häufigsten Verursacher von<br />
bakteriellen Gastroenteritiden des Menschen. Die Zahl der jährlich an das Robert-Koch-Institut gemeldeten Campylobacter-<br />
Infektionen bewegt sich mit 50.000 bis 60.000 Fällen pro Jahr auf sehr hohem Niveau. In 2006 wurden in Deutschland 51.764<br />
Erkrankungsfälle gemeldet, davon <strong>3.</strong>964 in <strong>Niedersachsen</strong>. Typische Symptome einer Campylobacteriose sind Bauchschmerzen,<br />
Durchfall, Übelkeit und Fieber. In seltenen Fällen können Gelenkentzündungen sowie eine mit Lähmungserscheinungen<br />
einhergehende Nervenerkrankung (Guillian-Barré-Syndrom) auftreten.<br />
Als Ursache von Campylobacter-Infektionen beim Menschen wird in erster Linie die Aufnahme der Bakterien über kontaminierte<br />
Lebensmittel tierischer Herkunft verantwortlich gemacht. Hierzu zählen vor allem unzureichend erhitztes Geflügelfleisch und<br />
Geflügelfleischprodukte sowie Milch und Milchprodukte. Vorzugsmilch oder Rohmilch-ab-Hof gelten hier als besonders kritisch.<br />
Im Rahmen eines landesweiten Projektes des Veterinärinstituts Hannover wurden 2006 insgesamt 470 Milchproben von Rindern,<br />
Schafen und Pferden auf thermophile Campylobacterarten untersucht. Lediglich in einer Milchprobe vom Rind wurden
entsprechende DNA-Sequenzen festgestellt. Kulturell konnten die Bakterien in keiner Probe nachgewiesen werden.<br />
Seit Mai 2004 sind die Veterinärinstitute des LAVES an einem bundesweiten Überwachungsprogramm zum Vorkommen von<br />
Campylobacter bei Masthähnchen beteiligt. Das Forschungsvorhaben wird im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz federführend vom Bundesinstitut für Risikobewertung durchgeführt. Grundlage dieses<br />
Forschungsvorhabens ist die Umsetzung der Richtlinie 2003/99/EG, die zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern die<br />
Erfassung einschlägiger Daten fordert. Dieses Monitoringprogramm wird bis Ende 2007 fortgeführt und anschließend in ein EUweites<br />
Monitoringprogramm überführt.<br />
Im Berichtsjahr wurden in den Veterinärinstituten des LAVES 948 Masthähnchen-Herden aus fünf Geflügelgroßschlachtereien<br />
<strong>Niedersachsen</strong>s auf Campylobacter untersucht. In 411 Herden wurden thermophile Campylobacterarten nachgewiesen (43,4 %). Im<br />
Vorjahr wurden bereits 772 Masthähnchen-Herden untersucht, bei 45,5 % konnten Campylobacterarten festgestellt werden. 297<br />
Isolate wurden weiter differenziert: Bei 65,7 % handelte es sich um Campylobacter jejuni, bei 34,3 % um Campylobacter coli.<br />
4.4.1.2 Salmonellose<br />
Dr. Braune, S.; PD Dr. Runge, M. (VI H); Dr. Schleuter, G.; Hohmann, M. (VI OL)<br />
Im Jahre 2006 wurden an den LAVES-Standorten insgesamt 2<strong>3.</strong>384 Untersuchungen zum Nachweis von Salmonellen durchgeführt.<br />
Dabei wurden 859 Salmonellen nachgewiesen, was einer durchschnittlichen Nachweisrate von 3,7 % entspricht. In den<br />
verschiedenen Untersuchungsmaterialien wie Lebensmitteln, Futtermitteln und Tieren gelangten unterschiedliche<br />
Nachweistechniken zum Einsatz, neben diversen kulturellen Techniken ebenso molekularbiologische Nachweise (PCR).<br />
Die Angaben zu Untersuchungen von Tierbeständen, Hygieneproben und Lebensmitteln sind Teil eines jährlichen Trendberichts<br />
(EU-Zoonosenbericht) nach Artikel 5 der Richtlinie 92/117/EWG über Zoonoseerreger bei Tieren, Lebensmitteln, Futtermitteln und<br />
Umweltproben. Eine detailliertere Darstellung der Einzeluntersuchungsergebnisse erfolgt an anderer Stelle des Jahresberichtes<br />
(Futtermittel-, Hygiene- und Lebensmitteluntersuchungen).<br />
- Salmonellennachweise in Futtermitteln<br />
Insgesamt wurden im Futtermittelinstitut Stade 297 Futtermittelproben auf Salmonellen untersucht. Davon waren 17 Proben<br />
(5,72 %) positiv. Der Schwerpunkt der Salmonellennachweise lag wie in den Vorjahren bei eiweißreichen pflanzlichen Futtermitteln<br />
(Ölsaaten) und Fleischfressernahrung mit deutlicher Kontamination verschiedenster Salmonellentypen (dominierend S.<br />
Typhimurium mit sechs Isolaten). Andere Futtermittel waren deutlich geringer mit Salmonellen belastet (Tabelle 4.4.1.2.1).<br />
Tabelle 4.4.1.2.1: Salmonellen in Futtermitteln 2006<br />
Material untersuchte<br />
Proben<br />
- Salmonellennachweise in Tierbeständen<br />
davon positiv Salmonellentyp<br />
Milchprodukte 1<br />
Blutprodukte 5<br />
69 13 6 S. Typhimurium, 5 S. Gruppe B, S. Derby, S.<br />
Fleischfressernahrung<br />
Rissen<br />
Tier-, Fleisch-, Knochenmehle, Grieben 94<br />
Mais, Getreide, Schrote, Mehle 14<br />
Ölsaaten, Extraktionsschrote 15 4 S. Havana, 2 S. Lexington, S. Tennessee<br />
Mischfuttermittel pelletiert 26<br />
Mischfuttermittel nicht pelletiert 23<br />
Speisereste 3<br />
Futtermittel für Schweine 27<br />
Futtermittel für Rinder 12<br />
Futtermittel für Hühner 7<br />
Silage 1<br />
142
Salmonellen beim Rind<br />
Die Zahl der Neuausbrüche an Rindersalmonellosen ist in <strong>Niedersachsen</strong> weiterhin rückläufig. Im Gegensatz dazu konnten im<br />
übrigen Bundesgebiet zeitweilig wieder vermehrt Neuausbrüche festgestellt werden (siehe Tabelle 4.4.1.2.2 und Abbildung<br />
4.4.1.2.1, Auszug aus dem Tierseuchenbericht des BMELF, veröffentlicht im Deutschen Tierärzteblatt).<br />
Tabelle 4.4.1.2.2: Salmonellose der Rinder<br />
Land/Region Neuausbrüche während der Jahre 2002 bis 2006<br />
(Zahl der Gehöfte, Auszüge aus dem Tierseuchenbericht des BMELF)<br />
2002 2003 2004 2005 2006<br />
<strong>Niedersachsen</strong> 61 79 47 15 16<br />
Deutschland 223 214 138 97 95<br />
Abb. 4.4.1.2.1 Neuausbrüche während der Jahre 2002 bis 2006<br />
Die geringe Anzahl der Neuausbrüche spiegelt sich auch in den Untersuchungszahlen für das Jahr 2006 mit vergleichsweise<br />
niedrigen Probenzahlen gegenüber den Vorjahren wieder (siehe Tabelle 4.4.1.2.3).<br />
143
Tabelle 4.4.1.2.3: Nachweis von Salmonellen<br />
Tierart<br />
untersucht<br />
2003 2004 2005 2006<br />
davon<br />
positiv<br />
in %<br />
untersucht<br />
144<br />
davon<br />
positiv<br />
in %<br />
untersucht<br />
davon<br />
positiv<br />
in %<br />
untersucht<br />
davon<br />
positiv<br />
in %<br />
Rind 20.945 9,60 29.989 3,5 7.548 7,5 7.616 4,8<br />
Zuchtgeflügel <strong>3.</strong>061 0,03 2.512 0 2.694 0 2.603 0 *<br />
Geflügelmonitoring Masthuhn (EU) 1.473 19,9 855 13,5<br />
Salmonellenmonitoring Schwein<br />
(EU)*<br />
83 14,5<br />
Geflügelmonitoring Pute (EU) 105 14,3<br />
übrige Tiere 2.144 4,70 1.589 5,6 726 5,4 798 6,8<br />
* Nachweis eines Lebendimpfstamms S. Enterititdis ** überwiegend S. Typhimurium (4)<br />
Beim Rind stehen auch 2006 Salmonella Dublin und Salmonella Typhimurium als Erregertypen der Salmonellose im Vordergrund<br />
(Tabelle 4.4.1.2.4). Besondere Ausbruchsserien wurden bei Tieren im Berichtsjahr nicht festgestellt.<br />
Salmonellen beim Geflügel<br />
2006 wurden in 2.603 Poolproben Geflügelkot aus 54 Geflügelzuchtbetrieben im Rahmen der amtlichen<br />
Überwachungsuntersuchungen (nach der Hühner-Salmonellen-Verordnung) auf Salmonellen untersucht. Salmonellen konnten wie<br />
im Vorjahr nicht nachgewiesen werden (siehe Tabelle 4.4.1.2.4). Es wurde lediglich ein Salmonella-Lebendimpfstamm<br />
nachgewiesen, für den es keine Erklärung gibt. Der Nachweis eines Impfstamms könnte Hinweise auf einen nicht sachgerechten<br />
Einsatz des Impfstoffs bzw. längere Persistenz oder Ausscheidung von S.-Lebendimpfstämmen geben. Salmonellen kommen beim<br />
Nutzgeflügel jedoch verbreitet vor, wie Ergebnisse des EU-Salmonellenmonitorings (Untersuchung von Masthähnchen- und<br />
Putenbeständen 2006) zeigen (siehe Kapitel 4.4.2.2). Auch bei anderen Vogelarten ist mit dem Nachweis von Salmonellen zu<br />
rechnen (siehe Tabelle 4.4.1.2.4).<br />
Tabelle 4.4.1.2.4: Salmonellennachweise bei Tieren 2006 (ohne Salmonella-Monitoring und Zuchtgeflügeluntersuchungen)<br />
Rind Schaf, Ziege Schwein<br />
Hausgeflügel,<br />
Tauben Hund, Katze sonstige Tiere Gesamt<br />
Untersuchungen 7.065 91 110 227 128 242 7.863<br />
Nachweise in Prozent 4,8 1,1 5,5 16,3 2,3 2,1 5,0<br />
Salmonellentypen<br />
S. Typhimurium 210 6 11 1 1 229<br />
S. Dublin 116 116<br />
S. Enterititidis 4 4<br />
S. Derby 1 1<br />
S. Havana 3 3<br />
S. Hvitting 1 1<br />
S. Infantis 2 2<br />
S. Kottbus 5 5<br />
S. London 1 1<br />
S. Mbandaka 3 3<br />
S. Montevideo 1 1
S. München 1 1<br />
S. Gr. B 1 1<br />
S. Gr. E 17 17<br />
S. Spec. 4 1 4 9<br />
S. Subspec. III b 1 1<br />
Gesamt 342 1 6 37 3 6<br />
- Salmonellen nach Schlachtung und Zerlegung, sowie bei Eiern und Milch<br />
Im Rahmen von bakteriologischen Fleischuntersuchungen und Hygieneüberwachung der Schlachtung, sowie bei der Untersuchung<br />
von Milch und Eiern wurden 2006 insgesamt 5.705 Salmonellenuntersuchungen durchgeführt. Salmonellen konnten dabei 275 mal<br />
(4,8 %) nachgewiesen werden. Trotz einer relativ großen Bandbreite mit Nachweis diverser Salmonellentypen bei verschiedenen<br />
Herkünften wurde S. Enteritidis generell am häufigsten bei Hühnern, Hühnerfleisch und Eiern isoliert (insgesamt 119 Nachweise).<br />
Mit deutlichem Abstand folgt S. Typhimurium (n = 38) und relativ häufigem Nachweis im Zusammenhang mit der Untersuchung von<br />
Schweinen bzw. Schweinefleisch. Andere Untersuchungsverfahren können der Grund von relativ niedrigen Nachweisraten von<br />
Salmonellen im Zusammenhang mit der Bakteriologischen Untersuchung von aufgefallenen Schlachtproben bei Rindern und<br />
Schweinen sein. Im Rahmen des EU-Salmonellenmonitorings wurden solche Erfahrungen bereits gemacht. Erste Ergebnisse der<br />
Untersuchung von Schlachtschweinen des derzeit laufenden EU-Monitorings haben bislang eine Salmonelleninfektionsrate von<br />
14,5 % und einen häufigen Nachweis von S. Typhimurium ergeben.<br />
Die Ergebnisse der Fleischuntersuchungen von Geflügel, Rind, Schwein und anderen Schlachttieren im Rahmen von Hygieneuntersuchungen<br />
der Schlachtung sowie von Eiern, Eiprodukten, Milch und Milchprodukten als auch Hygienetupfern sind in Tabelle<br />
4.4.1.2.5 dargestellt. Bei Puten wurden relativ häufig die Serovare S. Saintpaul (viermal), S. Hadar (dreimal) und S. Kottbus<br />
(dreimal) nachgewiesen.<br />
Tabelle 4.4.1.2.5: Nachweis von Salmonellen 2006 im Rahmen der bakteriologischen Untersuchung und von<br />
Hygieneuntersuchungen aus Schlacht- und Fleischproben, sowie aus Eiern, Milch und Hygienetupfern<br />
Proben untersucht davon positiv in % davon positiv in %<br />
S. Typhimurium<br />
145<br />
davon positiv in %<br />
S. Enteritidis<br />
Rind 767 0,4<br />
Schwein 191 1,0 1<br />
Pferd, Schaf, Ziege, Wild 4 0<br />
Fleisch,<br />
Fleischerzeugnisse Rind<br />
149 0,7 1<br />
Fleisch,<br />
Fleischerzeugnisse<br />
Schwein<br />
487 2,9 9<br />
Fleisch,<br />
Fleischerzeugnisse,<br />
sonstige Produkte<br />
672 8,2 21<br />
Huhn, Hühnerfleisch 160 30,0 10<br />
Pute, Putenfleisch * 164 7,3 1<br />
Geflügel, Geflügelfleisch<br />
anderer Tiere<br />
91 12,1 3 10<br />
Eier, Eiprodukte 620 19,0 95<br />
Milch, Milchprodukte 1748 0<br />
sonst. Material,<br />
Hygieneproben<br />
652 1,7 2 4<br />
* Anmerkung zu Puten: relativ häufiger Nachweis der Serovare S. Saintpaul (4), S. Hadar (3) und S. Kottbus (3).
Der Salmonellentyp S. Hadar (Lysotypen 10, 11 und 55) wurde 2006 nach einer Mitteilung des BfR für gehäufte<br />
lebensmittelbedingte Infektionsausbrüche bei Menschen verantwortlich gemacht. Es wurde in diesem Zusammenhang auch von<br />
zwei Todesfällen berichtet. Putenfleisch galt als Quelle der Infektionen, wobei Unklarheiten bestanden, ob hygienische<br />
Schwachpunkte bei der Schlachtung oder infizierte Bruteier als weitergehende Ausbruchsquelle verantwortlich waren. Allerdings<br />
wurde im Zusammenhang mit dem Ausbruch weder von einer erhöhten Untersuchungsfrequenz in den LAVES-Laboren noch von<br />
auffälligen Isolaten berichtet. Bei der Untersuchung von Puten werden S. Hadar und S. Saintpaul häufiger nachgewiesen.<br />
Die hohe Belastung von Schweinefleisch mit Salmonella Typhimurium und von Geflügelfleisch und -produkten (Eiern) mit<br />
Salmonella Enteritidis ist ein langjährig bekannter Sachverhalt und Gegenstand vielfältiger Bemühungen zur Zoonosenbekämpfung.<br />
Salmonellen in Lebensmitteln<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden 5.322 Salmonellenuntersuchungen in Lebensmitteln durchgeführt und in 83 Lebensmittelproben<br />
Salmonellen nachgewiesen. Davon entfielen 74 Nachweise auf die Produktgruppe Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren,<br />
gefolgt von sechs Nachweisen in Muscheln. In diesem Jahr wurden die positiven Geflügelfleischproben (30) erstmalig von den<br />
Produkten aus oder mit Schweinefleisch (39 mal positiv) überholt. Die Palette der nachgewiesenen Serovare ist vielfältig. Die vom<br />
BfR fokussierten Salmonella Hadar wurden zwar fünfmal nachgewiesen (im Vorjahr zweimal), werden nach den<br />
Untersuchungsstatistiken im Lebensmittelinstitut aber als normale Schwankungsbreite nachgewiesener Serovare angesehen.<br />
Details zum Thema Salmonellen in Lebensmitteln sind dem Kapitel 4.17.1 zu entnehmen.<br />
Dr. Klarmann, D. (VI OL)<br />
4.4.1.3 Tuberkulose<br />
Die Tuberkulose der Rinder ist eine anzeigepflichtigeTierseuche und Zoonose. Sie wird verursacht durch Mycobacterium bovis und<br />
Mycobacterium caprae und tritt in der Bundesrepublik Deutschland nur noch sporadisch auf. So gab es im Jahre 2005 bundesweit<br />
lediglich fünf Ausbrüche. Gemäß Entscheidung 96/76/EG bzw. 99/467/EG liegt Deutschland damit unter einem entsprechenden<br />
Limit und ist – wie schon seit 01.01.1997 – von der EU amtlich als frei von Rindertuberkulose anerkannt. Eine vormals verbindlich<br />
vorgeschriebene flächendeckende Untersuchung der Rinder (Tuberkulinisierung) ist seither durch eine gezielte<br />
Schlachttieruntersuchung abgelöst worden.<br />
Tuberkuloseerkrankungen bei anderen Tierarten und/oder hervorgerufen durch andere Mykobakterienspezies unterliegen laut<br />
Tierseuchengesetz der Meldepflicht.<br />
Im LAVES wurden im Jahre 2006 insgesamt 26 weitergehende Untersuchungen auf Tuberkulose durchgeführt. In 13 Fällen<br />
wurden dabei Mykobakterien nachgewiesen und zwar einmal M. bovis beim Rind, elfmal M. avium bei Schwein und Gefügel sowie<br />
einmal M. microti bei einem Marder. M. microti wird als spezifisches Mykobakterium dem Mycobacterium-tuberculosis-Komplex<br />
zugerechnet und gilt als Zoonoseerreger. Aus Großbritannien sind hierzu Berichte bekannt, nach denen Marderartige (z.B. Dachse)<br />
ein Erregerreservoir für Tuberkulose darstellen.<br />
Dr. Steffens, H.-W. (FIS)<br />
4.4.1.4 Resistenzmonitoring – Resistenzprüfungen im Mikrodilutionsverfahren – Ergebnisse und Resistenzentwicklung 2006<br />
In der Zoonoserichtlinie der EG (2003/99/EG vom 17. November 2003) wird die generelle Überwachung der Resistenzlage<br />
festgelegt. Neben dem Hinweis für Therapieempfehlungen ist die Ermittlung der Resistenzlage von bedeutsamen Zoonoseerregern<br />
aus Gründen des Verbraucherschutzes von besonderem Interesse, da verschiedene Infektionserreger genetisch fixierte<br />
Eigenschaften der Resistenzen austauschen können. Die fortwährende Erfassung der Resistenzen in den Mitgliedsstaaten mittels<br />
standardisierter Technik ermöglicht das rechtzeitige Erkennen entsprechender Gefahren.<br />
Als Untersuchungstechnik wird aus verschieden Gründen heraus mittlerweile eine Resistenzprüfungen mittels Mikrodilutionstest<br />
(MDT) empfohlen. Dieses Verfahren wird derzeit nur in der Untersuchungsroutine des Veterinärinstitutes Oldenburg eingesetzt.<br />
Daher beziehen sich nachfolgende Angaben zu Auswertungen im Wesentlichen auf die Ergebnisse von dort.<br />
Aus Tabellen 4.4.1.4.1 und 4.4.1.4.2 ist die Anzahl der im Jahr 2006 durchgeführten Resistenzprüfungen im Vergleich zum<br />
Vorjahr zu entnehmen. Einschließlich der Kontrollstämme wurden 2006 insgesamt 546 Isolate mit 12.003 getesteten<br />
Einzelreaktionen geprüft. Im Rahmen der Qualitätssicherung – regelmäßig mitgeführte Kontrollstämme und bei<br />
Laborvergleichsuntersuchungen und Ringtesten geprüfte Stämme – wurden allein 28 Isolate mit 136 Prüfungen im Rahmen der<br />
Qualitätssicherung einbezogen.<br />
Tabelle 4.4.1.4.1: Anzahl Resistenzprüfungen 2006<br />
Infektionserreger Salmonellen 2005 2006<br />
146
Salmonella Agona 10<br />
Salmonella Anatum 14<br />
Salmonella Braenderup 3<br />
Salmonella der Gruppe B 4,12:d:- monophasisch 47<br />
Salmonella der Gruppe B 4,5:i:- monophasisch 10<br />
Salmonella der Gruppe C1 6,7:k:- monophasisch 1<br />
Salmonella der Gruppe E1 3,10:-:- 2<br />
Salmonella Derby 16<br />
Salmonella Dublin 37<br />
S. Enteritidis 158 13<br />
S. Gruppe B 26 3<br />
S. Gruppe C 20 1<br />
S. Gruppe D 21 1<br />
S. Gruppe D1 5<br />
S. Gruppe E 6<br />
Salmonella Hadar 4<br />
Salmonella Heidelberg 2<br />
Salmonella Indiana 8<br />
Salmonella infantis 23<br />
Salmonella Kiambu 4<br />
Salmonella Kottbus 4<br />
Salmonella Lexington 6<br />
Salmonella Livingstone 1<br />
Salmonella Mbandaka 10<br />
Salmonella Ohio 1<br />
Salmonella paratyphi B 26<br />
Salmonella Saintpaul 4<br />
Salmonella Subspec. I Rauhform 7<br />
Salmonella Thompson 2<br />
Salmonella Typhimurium 38 63<br />
Salmonella Typhimurium var. cop. 10<br />
Salmonella Virchow 6<br />
S. species (andere Gruppen) 15 1<br />
Salmonellen (S.) gesamt 284 345<br />
Tabelle 4.4.1.4.2: Anzahl Resistenzprüfungen 2006<br />
Übrige Infektionserreger 2005 2006<br />
Acinetobacter spec. 4<br />
Bordetella bronchiseptica 1<br />
Burkholderia cepacia<br />
Clostridium perfringens 4<br />
Enterococcus faecalis 4<br />
Enterococcus species 1<br />
E. coli 27 39<br />
Gallibacterium anatis 1<br />
Mannheimia haemolytica 4 4<br />
147
Pasteurella multocida 6 8<br />
Pasteurella species 1<br />
Proteus mirabilis 2<br />
Staphylococcus aureus 13 4<br />
Staphylococcus carnosus 1<br />
Staphylococcus equorum 1<br />
Staphylococcus haemolyticus 1<br />
Staphylococcus intermedius 1<br />
Staphylococcus xylosus 1<br />
Streptococcus canis 1<br />
Streptococcus dysgalactiae 2<br />
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 2<br />
Streptococcus equi s.zooepidemicus<br />
Streptococcus Gruppe C 1<br />
Streptococcus Gruppe G 1<br />
Streptococcus species 4<br />
Streptococcus suis 1<br />
Vibrio parahaemolyticus 1<br />
Yersinia pseudotuberculosis 1<br />
insgesamt geprüfte Isolate 118 76<br />
Ein weiterer großer Anteil der Untersuchungen wurde an Salmonellen durchgeführt, die unter anderem im Rahmen eines EU-Salmonellenmonitorings<br />
beim Wirtschaftsgeflügel (Huhn und Pute) isoliert wurden. Weiterhin wurde ein großer Teil der im Rahmen von<br />
Schlachtung und Hygieneuntersuchungen isolierten Salmonellen ebenfalls einer Resistenzerfassung unterzogen. Insgesamt wurde<br />
die Resistenz von 345 Salmonellen geprüft, davon 235 mit Angabe einer bestimmten Tierart als Herkunft.<br />
Ein Großteil der Erreger stammte vom Huhn mit 133 Isolaten, gefolgt von Rindern mit 102 Isolaten, 46 stammten vom Schwein.<br />
Im Rahmen der Hygieneüberwachung wurden Salmonellen auf Resistenzen geprüft.<br />
In Tabelle 4.4.1.4.3 ist die Verteilung der MHK-Werte (µg/ml) aller Salmonellenisolate bei den wichtigsten geprüften<br />
Antibiotikagruppen wiedergegeben. Der MHK 50 %-Wert gibt die Konzentration eines Antibiotikums an, die 50 % der isolierten<br />
Bakterienstämme hemmt, der 90 %-Wert entsprechend die Konzentration, welche 90 % der Isolate im Wachstum hemmt.<br />
Tabelle 4.4.1.4.3: MHK-Werte der isolierten Salmonellen (2005: n = 284; 2003/2004: n = 73)<br />
Antibiotikum<br />
MHK 50 % MHK 90 %<br />
2005 2006 2005 2006<br />
Amoxycillin/Clavulansäure 2/1 2/1 8/4 (#) 16/8<br />
Ampicillin 1 1 >32 >32<br />
Apramycin 8 8 8 8<br />
Cephalotin 4 4 4 16<br />
Cefquinom 1 1 1 1<br />
Ceftiofur 1 1 1 1<br />
Colistin 0,5 0,5 2 1<br />
Enrofloxacin 0,0625 0,0625 0,125 0,5<br />
Florfenicol 4 4 8 >8<br />
Gentamicin 2 (#) 2 (#) 2 (#) 2 (#)<br />
Neomycin 8 8 8 8<br />
Spectinomycin 128 64 >128 >128<br />
Tetracyclin 2 (#) 2 (#) >16 >16<br />
Trimethoprim/Sulfamethoxazol (SI) 4/76 >4/76 >4/76 >4/76<br />
148
Mit Graustufen unterlegt sind die Felder der Antibiotika, bei denen ein hoher Anteil der isolierten Salmonellenstämme (bis zu 50 %<br />
bei MHK 50 % oder bis zu 10 % bei MHK 90 %) nicht mehr in einem wirksamen MHK-Wertebereich liegt und damit als resistent gilt.<br />
Eine veränderte Einstufung, ab welchem MHK-Wert eine Resistenz angenommen wird, hat einen deutlichen Einfluss auf die<br />
Beurteilung der Gesamtsituation (siehe Tabelle 4.4.1.4.3 mit gelben Markierungen (#) für abweichende Einschätzung nach DIN<br />
gegenüber CLSI). Zudem erschweren unterschiedliche Testkonzentrationen nach DIN und CLSI bei den Antibiotikakombinationen<br />
Amoxycillin/Clavulansäure und Trimethoprim/Sulfonamid (Cotrimoxazol) den Vergleich von Resistenzen.<br />
Von einer guten generellen Wirksamkeit ist nur bei Aminoglykosidantibiotika (Apramycin, Gentamycin, Neomycin, Kanamycin),<br />
Colistin, neueren Cephalosporinen (Cefquinom, Ceftiofur) und Fluorchinolonen (Enrofloxacin) auszugehen. Auffällige Entwicklungen<br />
der Resistenzlage und deutliche Abweichungen hinsichtlich der Herkunft (Tierart, Hygieneüberwachung) waren 2006 gegenüber<br />
2005 nicht festzustellen.<br />
Beim Vergleich verschiedener Salmonellen-Serovare fällt auf, dass Multiresistenz häufig bei Salmonella (S.) Typhimurium-Isolaten<br />
zu finden ist. Andere Serovare, wie z. B. S. Dublin, häufig beim Rind, und S. Enterititdis, überwiegend von Hühnern isoliert,<br />
weisen in geringem Maße Multiresistenzen auf. Multiresistenz bezeichnet das gleichzeitige Auftreten von Resistenz gegenüber einer<br />
Vielzahl von einzelnen Antibiotika und Antibiotikaklassen. Bei S. Typhimurium wird Multiresistenz gegenüber Ampicillin und<br />
Tetracyclin auch häufig mit Trimethoprim/Sulfonamid oder anderen Stoffen nachgewiesen. Insgesamt lag bei 63 % der isolierten S.<br />
Typhimurium-Isolate eine bedeutsame Mehrfachresistenz vor. Diese Situation deckt sich mit früheren Beobachtungen (siehe<br />
LAVES-Jahresberichte 2005 und 2004).<br />
Bedeutsam ist auch eine vereinzelt auftretende Resistenz gegenüber Fluorchinolonen, einer neuen Gruppe an Präparaten,<br />
sogenannten Gyrasehemmern, getestet als Enrofloxacin. Diese wurde im Rahmen des Salmonellenmonitorings beim Geflügel bei<br />
immerhin drei Salmonella-Isolaten – hier S. Gruppe B, S. Saintpaul, S. Typhimurium – festgestellt.<br />
E.coli-Stämme (n = 39) wurden überwiegend von an Enteritis erkrankten Kälbern isoliert und zeigten eine ähnliche<br />
Resistenzsituation wie im Vorjahr. So war bei mehr als 50 % der Isolate eine Resistenz gegenüber Ampicillin, Tetracyclin und<br />
Trimethoprim/Sulfonamid feststellbar, sowie bei 33 % eine Resistenz gegenüber Enrofloxacin (Gyrasehemmer).<br />
Pasteurellenstämme und Mannheimia haemolytica (n = 14) zeigten bei den ß-Laktam-Antibiotika (Penicillin, Ampicillin,<br />
Cephalosporine) vereinzelt Resistenzen. Bei den Makrolidantibiotika Erythromycin und Clindamycin) bestand bei allen getesteten<br />
Stämmen Resistenz, bei Tilmicosin sowie Tiamutin bei mehr als 50 % der Stämme. Eine prozentuale Betrachtung der Ergebnisse<br />
ergibt allerdings wegen der geringen Untersuchungszahlen kein vollständiges Gesamtbild wieder. Ausreichende Empfindlichkeiten<br />
waren bis auf eine Ausnahme bei wichtigen Präparaten zur Behandlung von Atemwegsinfektionen (Cephalosporine neuerer<br />
Generation, Enrofloxacin und Florfenicol) zu verzeichnen.<br />
Von den wenigen geprüften Staphylokokken-Isolaten (n = 8) (Staph. aureus, Staph. epidermidis, Staph. equorum, Staph.<br />
haemolyticus und Staph. xylosus) reagierten mehr als die Hälfte der Stämme mit ß-Laktamaseaktivität und wurden als<br />
penicillinresistent eingeordnet. Bei einem Staph. aureus-Stamm bestand eine weitgehende Resistenz gegen Erythromycin,<br />
Lincosamiden und Cephalosporinen.<br />
Bei den isolierten Streptokokken bestanden keine auffälligen Resistenzen.<br />
Dr. Klarmann, D. (VI OL)<br />
4.4.2 Besondere Überwachungsprogramme aus zoonotischer Sicht<br />
4.4.2.1 Fuchsbandwurm-Monitoring<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden im Nachgang zu dem 2005 abgeschlossenen landesweiten Fuchsbandwurm-Monitoring 162 Füchse<br />
aus Landkreisen bzw. kreisfreien Städten eingesandt, in denen auf Grund fehlender oder zu geringer Untersuchungszahlen keine<br />
statistisch belastbare Aussage gemacht werden konnte.<br />
Die Ergebnisse sind in ihrer Gesamtheit, d.h. unter Einbeziehung der auch bereits in 2005 erfolgten Einsendungen, in Tabelle<br />
4.4.2.1 dargestellt und entsprechen in ihrer Bewertung der im Vorjahr getroffenen Einschätzung, dass die Prävalenzen dieses<br />
Parasiten (fast) überall deutlich zugenommen haben. Unter Berücksichtigung der ebenfalls deutlich angestiegenen<br />
Marderhundstrecken ist geplant, diesen Neozoen in zukünftige Untersuchungen mit einzubeziehen.<br />
Tabelle 4.4.2.1.1: Untersuchung auf Fuchsbandwurm<br />
Landkreis<br />
Anzahl der untersuchten<br />
Proben<br />
davon positiv [%]<br />
Cuxhaven 141 29 (20,6)<br />
Friesland 30 7 (23,3)<br />
Helmstedt 38 9 (23,7)<br />
Nienburg 83 5 (6,0)<br />
Soltau Fallingbostel 96 23 (24,0)<br />
Stadt Braunschweig 13 2 (15,4)<br />
Insgesamt 401 75 (18,7)<br />
149
150<br />
Dr. von Keyserlingk, M. (VI H)<br />
4.4.2.2 Salmonellennachweise im Rahmen des EU-Salmonellenmonitorings ( Masthähnchen, Mastschweine und Puten)<br />
Die Ergebnisse der im Jahre 2006 im Rahmen eines EU-Salmonellenmonitorings in <strong>Niedersachsen</strong> von bei Masthähnchen<br />
nachgewiesenen Salmonellen werden in Kapitel 3 vorgestellt. Aus Tabelle 4.4.1.2.3 und 4.4.2.2.1 sind erste Ergebnisse des seit<br />
Oktober 2006 durchgeführten Monitorings zum Salmonellennachweis bei Puten und Schlachtschweinen ersichtlich. Erste<br />
Ergebnisse weisen bei den Tieren auf eine deutliche Salmonellenbelastung in Höhe von jeweils ungefähr 14 % der untersuchten<br />
Proben (Sockentupfer, Darmlymphknoten) hin. Bei den Salmonellennachweisen in den Putenbetrieben handelte es sich<br />
überwiegend um Mehrfachnachweise. Weitere Aspekte zu diesen Untersuchungen sind in Kapitel 3 dargestellt.<br />
Tabelle 4.4.2.2.1: Ergebnisse des EU-Salmonellenmonitorings 2006 bei Puten in <strong>Niedersachsen</strong><br />
n positiv %<br />
Betriebe 22 5 22,7<br />
Proben (Poolproben Kot, Staub) 110 20 18,2<br />
Nachgewiesene Salmonellentypen<br />
S. Enteritidis 2<br />
S. Typhimurium 10<br />
S. Agona 10<br />
n = Anzahl der Untersuchungen, positiv = Nachweise<br />
4.5 Tierschutz<br />
Beratungstätigkeit des Tierschutzdienstes<br />
Dr. Klarmann, D. (VI OL)<br />
Im Jahr 2006 gingen insgesamt 1.865 Anfragen im Dezernat Tierschutzdienst des LAVES ein. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet<br />
dies eine nochmalige Steigerung um ca. 18 %. Der größte Anteil der Anfragen betraf mit 48 % die Nutztiere (Säuger und Vögel). Auf<br />
andere Arten, wie Haus- und Heim-, Zoo- und Zirkus- sowie Wildtiere, Fische und Wirbellose entfielen 26 % der Anfragen, auf<br />
spezielle Sachgebiete, u. a. Tiertransporte, Schlachtungen und Tierversuche 26 %. Der Anteil an Anfragen zu speziellen<br />
Sachgebieten ist im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum um 8 % gestiegen, was in erster Linie auf eine deutliche Zunahme der<br />
Anfragen zu Tierversuchen und Tiertransporten zurückzuführen ist.<br />
Nahezu verdoppelt haben sich auch die Anfragen im Bereich „Schweinehaltung“. Dies liegt darin begründet, dass im August 2006<br />
die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung nach rund 5 Jahren kontroverser Diskussion um den Abschnitt 4 „Anforderungen an das<br />
Halten von Schweinen“ ergänzt worden ist. Daraus haben sich zahlreiche Fragen zur Umsetzung der Bestimmungen für Neubauten,<br />
aber auch hinsichtlich der Handhabung von Übergangsregelungen für Altbauten ergeben. Die neuen Vorschriften basieren in weiten<br />
Teilen auf den „Niedersächsischen Tierschutzleitlinien für die Schweinehaltung“, die bereits 2002 in Zusammenarbeit mit den<br />
Veterinärbehörden, Landwirtschaftskammern und der Wissenschaft unter Federführung des LAVES, Tierschutzdienst, erstellt<br />
worden sind und seit dem per Erlass in <strong>Niedersachsen</strong> flächendeckend für Neu- und Umbauten erfolgreich umgesetzt wurden. Dies<br />
gilt insbesondere für ein vergrößertes Platzangebot in der Mast, das Angebot von „schweinefreundlichem“ Beschäftigungsmaterial<br />
und den zwingend erforderlichen Einfall von natürlichem Tageslicht.<br />
Um auch zukünftig eine landesweit einheitliche Umsetzung zu erreichen, erarbeitet der Tierschutzdienst derzeit gemeinsam mit ML<br />
Ausführungshinweise zu den neuen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.<br />
Immer noch aktuell ist auch die Diskussion um die Anforderungen an die Legehennenhaltung. Mit der Änderung der Tierschutz-<br />
Nutztierhaltungsverordnung wurde einerseits die Kleingruppenhaltung eingeführt und andererseits grundsätzlich das „Aus“ der<br />
konventionellen Käfighaltung bestätigt. Betreibern von Altanlagen, die sich zur Umstellung auf alternative Haltungsformen<br />
verpflichtet haben, wird dazu eine Übergangsfrist von 2 Jahren eingeräumt. Die Einführung der sog. Kleinvoliere ist jedoch durchaus<br />
umstritten und auch die alternativen Haltungsformen lassen noch viele Fragen offen.
Erarbeitung von Tierschutzleitlinien zur Milchkuhhaltung<br />
Da die nationale Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung hinsichtlich der Rinderhaltung nur Kälber bis zum Alter von sechs Monaten<br />
berücksichtigt und konkrete tierschutzfachliche Vorgaben für die Milchkuh- und Mastrinderhaltung sowohl national als auch auf EU-<br />
Ebene fehlen, hat der Tierschutzdienst mit Vertretern der Veterinärbehörden, Landwirtschaftskammern, des Tierschutzbeirates und<br />
der Wissenschaft eine Tierschutzleitlinie mit speziellen Anforderungen an die Stallhaltung von Milchkühen erarbeitet. Die Leitlinie<br />
soll Behörden und Tierhaltern bei der tierschutzfachlichen Beurteilung von Neu- und Umbauten einerseits und bestehenden<br />
Rinderhaltungen andererseits Hilfestellung geben. Es werden vor allem diejenigen Bereiche angesprochen, die erfahrungsgemäß<br />
Anlass zu Diskussionen geben, wie beispielsweise Abmessungen in Boxenlaufställen oder die erforderliche Anzahl von Fress- und<br />
Liegeplätzen. Dabei werden für Neubauten Mindestanforderungen festgelegt, während für Altbauten lediglich Richtwerte angegeben<br />
werden. Werden diese nicht erfüllt, ist eine Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Pflegezustandes der<br />
Tiere erforderlich.<br />
Die Leitlinien ermöglichen eine niedersachsenweit einheitliche Beurteilung von Milchkuhhaltungen durch die kommunalen<br />
Veterinärbehörden und geben Bauherren Sicherheit bei der Planung von Neubauten. Darüber hinaus tragen sie dazu bei,<br />
niedersächsische Positionen und Vorstellungen sowohl bundesweit als auch auf EU-Ebene zu vertreten.<br />
Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der Mindestanforderungen in der Junghühnermast<br />
Im Jahr 2003 wurde zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz (ML) sowie der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft eine Vereinbarung geschlossen, mit dem Ziel, objektive<br />
Parameter für eine gute Tierhaltungspraxis, die gleichzeitig als Kriterien für die tierschutzfachliche Beurteilung von Broilerhaltungen<br />
genutzt werden können, zu entwickeln. Dazu wurden unter Federführung des Tierschutzdienstes auf den Schlachthöfen Daten zur<br />
Fußballengesundheit von Jungmasthühnern gesammelt und gleichzeitig in den Mastbetrieben managementspezifische Erhebungen<br />
durchgeführt. Die Ergebnisse lassen eine gewisse Abhängigkeit der Fußballengesundheit von der Ausstattung der Ställe und der<br />
Witterung, insbesondere aber vom Management des Betriebes vermuten. Derzeit erfolgt die detaillierte statistische Auswertung<br />
durch das Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Prof.<br />
Dr. Kreienbrock. Erste Empfehlungen zur Verbesserung der Fußballengesundheit von Broilern wurden gemeinsam mit der<br />
Landwirtschaftskammer <strong>Niedersachsen</strong>, der Geflügelwirtschaft und den kommunalen Veterinärbehörden erarbeitet. Im Rahmen<br />
einer groß angelegten Felduntersuchung sollen sie niedersachsenweit umgesetzt werden und leisten damit einen wesentlichen<br />
Beitrag zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Jungmasthühner. Dies ist vor dem Hintergrund, dass auch auf EU-<br />
Ebene entsprechende Regelungen zur Sicherstellung einer „guten“ Fußballengesundheit zu erwarten sind, von großer Bedeutung<br />
für die niedersächsische Geflügelwirtschaft.<br />
Seminar zur Ersteinschätzung von gefährlichen Hunden<br />
Intensiv nachgefragt wurde 2006 auch der Bereich Hundehaltung, insbesondere „gefährliche“ Hunde waren nach wie vor häufig<br />
Thema. Erhält die zuständige Behörde einen Hinweis auf die möglicherweise gesteigerte Aggressivität eines Hundes, muss sie<br />
prüfen, ob der Verdacht, dass von diesem Tier eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, gerechtfertigt ist. Um<br />
die Beurteilung des fraglichen Hundes nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gewissenhaft durchführen zu können,<br />
haben sich viele Amtstierärzte in <strong>Niedersachsen</strong> erneut eine spezielle Fortbildung zu diesem Thema gewünscht. Daher hat das<br />
LAVES, Dez. 33, Tierschutzdienst, am 15. November 2006 gemeinsam mit ML und der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
(TiHo) zum zweiten Mal ein Seminar zur „Ersteinschätzung potentiell gefährlicher Hunde“ angeboten. An die Vorstellung der<br />
aktuellen Rechtslage in <strong>Niedersachsen</strong> schloss sich ein umfassendes Referat über aggressives Verhalten bei Hunden an, dass<br />
durch die Beurteilung von Fotos und verschiedener Videosequenzen zum Hundeverhalten anschaulich ergänzt wurde. Der<br />
Erfahrungsbericht einer zuständigen Veterinärbehörde zur Umsetzung des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von<br />
Hunden (NHundG) rundete das Bild praxisnah ab. Die Veranstaltung war auch in diesem Jahr wieder voll ausgebucht.<br />
Tierversuche<br />
Im laufenden Jahr wurden insgesamt 1.429 Bescheide im Bereich Tierversuche durch das Dezernat 33 des LAVES erstellt; dabei<br />
wurden u.a. 272 anzeigepflichtige und 263 genehmigungspflichtige Tierversuchsanträge bearbeitet.<br />
Bei jedem Versuchsvorhaben ist die Tierzahl vom Antragsteller genau zu begründen. Einerseits sollen möglichst wenig Tiere<br />
eingesetzt werden, andererseits die gewonnenen Ergebnisse aussagekräftig sein. In der Vergangenheit waren häufig zu<br />
Nachfragen erforderlich, da die angegebene Tierzahl nicht immer nachvollzogen werden konnte. Dies verzögerte die Bearbeitung<br />
zum Teil erheblich. Es ist daher geplant, die bestehenden Antragsformulare bezüglich der statistischen Parameter zu optimieren.<br />
Kompetente Unterstützung kommt dabei von Prof. Dr. Kreienbrock, dem Leiter des Instituts für Biometrie, Epidemiologie und<br />
Informationsverarbeitung der TiHo. Im Rahmen einer Dissertation wurden ausgewählte Tierversuchs-Anträge der vergangenen<br />
Jahre eingesehen und anonymisiert ausgewertet. Mit Hilfe der dabei gewonnenen Erkenntnisse soll ein neues Antragsformular<br />
entwickelt werden.<br />
151
Herkunft der Anfragen<br />
Der Tierschutzdienst wurde auch im aktuellen Berichtszeitraum vor allem von Veterinärbehörden (67 %) in Anspruch genommen;<br />
der größte Teil der Anfragen kam dabei naturgemäß aus dem Land <strong>Niedersachsen</strong> (60 %). Der Anteil aus anderen Bundesländern,<br />
BMELV und dem Ausland betrug wie im Vorjahr 7 %. Die Anfragen von wissenschaftlichen Einrichtungen, wie Universitäten,<br />
Fachhochschulen und Instituten haben sich im Vergleich zu 2005 auf gleich bleibend hohem Niveau stabilisiert (16 %). Rückläufig<br />
waren dagegen die Anfragen von Verbänden, wie z. B. Tierschutzorganisationen, Landvolk oder Geflügelwirtschaftsverband (4 %).<br />
Abbildung 4.5.1: Anfragen an den Tierschutzdienst 1995-2006<br />
2000<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Tierschutz bei Fischen<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
152<br />
Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Der Fachbereich Fischseuchenbekämpfung der Task-Force Veterinärwesen, ist in Bezug auf Anfragen, die den Tierschutz bei<br />
Fischen und aquatischen Invertebraten (Wirbellose) betreffen, operativ beratend tätig. Im Berichtszeitraum wurden über 60<br />
Anfragen des Tierschutzdienstes (Dez. 33), der Veterinärbehörden der Landkreise, kreisfreien Städte und der Region Hannover<br />
sowie des Nds. Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), zur<br />
tierschutzgerechten Haltung und Tötung von Fischen und Krebstieren und zur Angelteichproblematik beantwortet. In insgesamt 23<br />
Stellungnahmen, darunter auch Gutachten für die Staatsanwaltschaft, wurden nachfolgende Themenbereiche bearbeitet.<br />
- Einsatz von Setzkeschern in der Angelfischerei<br />
- Wettangeln/Königsangeln<br />
- Angelteichproblematik<br />
- Ferienpassangeln<br />
- Novellierung der Tierschutzschlacht-Verordnung<br />
- Lebende Fische in einer Theaterinszenierung<br />
- Niedersächsische Gefahrtierverordnung<br />
- Internethandel mit tierschutzwidrigen Wandaquarien<br />
- Wasserkraftanlagen – Probleme bei der Zulassung aus Sicht des Tierschutzes<br />
- Tierschutzgerechte Betäubung von Krebstieren<br />
- Haltung von Zierfischen in Diskotheken<br />
- Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bei Nutz- und Zierfischen<br />
- Entwurf des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren i.V.m. dem Halten von<br />
Zuchtfischen<br />
- Entwurf des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren i.V.m. dem Töten von
Fischen im Notfall<br />
- Haltung von Kampffischen im Zoofachhandel<br />
- Überprüfung der Fischhaltung in Zoofachbetrieben nach Aufforderung und im Beisein der zuständigen Behörden.<br />
- Bauvoranträge zum Bau von Fischzuchtanlagen<br />
Ein Merkblatt mit Empfehlungen und Hinweisen zum tierschutzgerechten Betrieb von Angelteichen wurde im Auftrag des ML<br />
ausgearbeitet. Dieses Merkblatt soll im Jahr 2007 veröffentlicht werden und die amtstierärztliche Überprüfung von Angelteichen<br />
erleichtern sowie einheitlich gestalten.<br />
Ferner wurden die zuständigen Behörden bei insgesamt zwölf Überprüfungen von Zierfischhaltungen und von Nutzfischbetrieben<br />
von der Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich Fischseuchenbekämpfung, unterstützt.<br />
Der Lehrgang „Sachkundenachweis Zierfische“ findet zweimal jährlich auf dem Gelände der Lehr- und Versuchsanstalt der<br />
Landwirtschaftskammer Hannover in Echem bei Lüneburg statt. Es werden maximal 20 Prüfungskandidaten pro<br />
Vorbereitungslehrgang zugelassen. Die dreitägige Schulung besteht aus einem theoretischen und praktischen Abschnitt. Nach<br />
erfolgreichem Prüfungsabschluss wird die Sachkunde durch eine dreiköpfige Prüfungskommission unter Vorsitz des Landkreises<br />
Lüneburg beurkundet. Im Berichtsjahr wurden 39 Kandidaten im Rahmen von zwei Schulungsterminen geprüft. Darüber hinaus<br />
nahmen 17 beamtete Tierärzte, Referendare und Zoofachhändler im Rahmen einer Fortbildung an der Schulung teil.<br />
4.6. Hygieneuntersuchungen in der Fleisch- und Geflügelfleischgewinnung<br />
153<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Seit Beginn des Berichtsjahres 2006 haben die Vorschriften der EU-Gesetzgebung bezüglich der Fleischgewinnung direkte Wirkung<br />
in den EU-Mitgliedsstaaten, d. h. das „Hygienepaket“ mit den VO 178/2002, 882/2004, 852, 853 und 854/2004 sowie auch die EU-<br />
VO 2073/2005 müssen umgesetzt werden. Für die Lebensmittelunternehmer bedeutet dies unter anderem, dass die<br />
vorgeschriebenen Eigenkontrollen durchgeführt werden müssen, für die Überwachungsbehörden, dass diese Eigenkontrollen<br />
amtlich überprüft werden müssen. Parameter und Grenzwerte für einige Matrices sind in der EU-VO 2073/2005 explizit genannt,<br />
aber auch andere, von den Lebensmittelunternehmern durchgeführte Eigenkontrollen müssen amtlich kontrolliert werden. Soweit<br />
erforderlich, müssen alle amtlichen Kontrollen der betrieblichen Eigenkontrollen auch durch amtliche Probennahmen und<br />
Untersuchungen verifiziert werden. Um die Laboruntersuchungen gleichmäßig über das Jahr zu verteilen, wird vom VI Oldenburg<br />
ein Probenplan für die Hygieneuntersuchungen der Fleischgewinnung erstellt, wobei es den Aufsichtsbehörden freigestellt ist,<br />
zusätzliche oder alternative Betriebe zu beproben, wenn sie dies für notwendig erachten. Ziel ist es, die Eigenkontrollergebnisse in<br />
jedem EU-Betrieb jährlich einmal und in jedem bisher registrierten Betrieb alle zwei Jahre durch amtliche Untersuchungen von<br />
Proben zu verifizieren.<br />
4.6.1 Amtliche Kontrolle der Reinigung und Desinfektion in der Fleischgewinnung<br />
So wie früher in dem EU-Entscheid 2001/471 die Kontrolle der Reinigung und Desinfektion für die Eigenkontrolle für Schlacht- und<br />
Zerlegebetriebe mit Probennahmetechnik und Untersuchungsverfahren vorgeschrieben war, verweist jetzt Artikel 5 der EU-VO<br />
2073/2005 auf eine ISO-Norm, nach der solche Kontrollen bei allen Lebensmittelunternehmen durchzuführen sind. Die Methoden<br />
der ISO-Norm entsprechen im Wesentlichen der früheren Vorgehensweise. Das EU-Recht schreibt jetzt solche Kontrollen aber für<br />
jedes Lebensmittelunternehmen vor. Die einschlägigen Aufzeichnungen der Lebensmittelunternehmer müssen amtlich kontrolliert<br />
und verifiziert werden. Unstrittig ist, dass mikrobiologische Werte sich nur durch mikrobiologische Gegenuntersuchungen verifizieren<br />
lassen, eine visuelle Kontrolle der Reinigung und Desinfektion ist also nicht ausreichend. In ganz <strong>Niedersachsen</strong> soll für die amtliche<br />
Kontrolle der Reinigung und Desinfektion einheitlich die Nass-Tupfermethode nach ISO 18593 verwendet werden, da man weiß,<br />
dass Abklatschverfahren nur zwischen 30 und 70 % der Oberflächenkeime abnehmen und daher oft eine Sauberkeit vortäuschen,<br />
die nicht besteht. Die Festlegung der Grenzwerte von 10 KbE/cm² der mit dem Nass-Tupferverfahren beprobten Oberfläche gilt nur<br />
für dieses Verfahren und ist ein von vielen Qualitätszirkeln anerkannter Richtwert zur Beurteilung des Erfolges von Reinigung und<br />
Desinfektion. Zur Beurteilung eines Betriebes sollen zwischen fünf und 20 Tupfer je nach Betriebsgröße entnommen werden und<br />
auf die Parameter Gesamtkeimzahl und Anzahl Enterobacteriaceae untersucht werden. Die Auswahl der Lokalisationen erfolgt Vor-<br />
Ort nach den Betriebsgegebenheiten und dem Ermessen der Überwachungsbehörde. Es sollen zur Kontrolle der Reinigung und<br />
Desinfektion jedoch vorwiegend die Lokalisationen beprobt werden, die in direkten Kontakt mit den Lebensmitteln kommen. Bei<br />
speziellen Betriebsproblemen kann nach Maßgabe der Überwachungsbehörde aus denselben Tupfern auch auf weitere Parameter,<br />
z.B. Listeria monocytogenes, Salmonellen oder EHEC untersucht werden. Aus der Tupferserie eines Betriebes wird unter<br />
Berücksichtigung der beprobten Lokalisationen der Hygienezustand nach Reinigung und Desinfektion beurteilt und der<br />
Überwachungsbehörde als kurzer Hinweis mitgeteilt. Die Bewertung der Laborergebnisse gliedert sich in vier Kategorien: „ohne<br />
Mängel“, „geringe Mängel“, „deutliche Mängel“ und „schwerwiegende Mängel“, wobei die Gesamtbeurteilung der Betriebshygiene<br />
natürlich bei den Überwachungsbehörden liegt.
Im Berichtsjahr 2006 wurden durch amtliche Untersuchung die Eigenkontrollergebnisse der Reinigungs-/Desinfektionskontrolle<br />
von insgesamt 334 Betrieben in 382 Betriebsbegehungen durchgeführt, das waren 173 Kontrollen in 125 Betriebsstätten mit EU-<br />
Zulassung und 209 Betriebsstätten ohne EU-Zulassung (sogenannte registrierte Betriebe). Dabei kamen <strong>3.</strong>273 Tupfer zur<br />
Untersuchung. Von 1.919 untersuchten Tupfern aus EU-Betrieben belegten 1.289 (67 %) gut gereinigte Lokalisationen, während<br />
von 1.245 untersuchten Tupfern aus registrierten Betrieben nur 648 (52 %) gut gereinigte Oberflächen auswiesen. Aus EU-<br />
Betrieben wurden durchschnittlich zwölf, aus registrierten Betrieben sechs Tupfer untersucht, um den Reinigungserfolg des<br />
jeweiligen Betriebes zu bewerten. Die Beurteilung aller im Berichtsjahr untersuchten Betriebe ist aus Tabelle 4.6.1.1 zu ersehen<br />
Tabelle 4.6.1.1 Beurteilung der Betriebe: Kontrolle der Reinigung und Desinfektion<br />
Betriebe ohne Mängel<br />
mit geringen<br />
Mängeln<br />
154<br />
mit deutlichen<br />
Mängeln<br />
mit schwerwiegenden<br />
Mängeln<br />
Anzahl<br />
Betriebe<br />
EU-Betriebe 36 (20 %) 60 (35 %) 48 (28 %) 29 (17 %) 173<br />
registrierte Betriebe 31 (15 %) 52 (25 %) 62 (30 %) 64 (30 %) 209<br />
alle Betriebe 67 (18 %) 112 (29 %) 110 (29 %) 94 (24 %) 382<br />
Aus schlechten Ergebnissen müssen Maßnahmen in den Betrieben zur Verbesserung des Reinigungsregimes erfolgen, die<br />
wiederum nachkontrolliert werden müssen, gegebenenfalls durch erneute Probennahme. Seit 1995, seitdem die Kontrollen der<br />
Reinigung und Desinfektion in <strong>Niedersachsen</strong> in den meisten EU-Betrieben durchgeführt wurden, haben sich dort deutliche<br />
Verbesserungen gezeigt. Nicht nur die Qualität der Reinigung und das Verständnis für Hygiene, sondern auch die Eigenkontrollen<br />
sind teilweise sehr gut organisiert und Maßnahmen bei aufgedeckten Mängeln werden schnellstens eingeleitet. Auch die kleineren<br />
Betriebe sind nach EU-Recht gleichrangige Lebensmittelunternehmer und müssen in den kommenden Jahren die Vorschriften des<br />
„Hygienepaketes“ erfüllen.<br />
4.6.2 Amtliche Kontrolle der Produkte<br />
Die EU-Verordnung 2073/2005 schreibt für einige Matrices Hygieneparameter vor, deren Einhaltung der Lebensmittelunternehmer<br />
durch Eigenkontrollen in der Regel am Ende des Produktionsprozesses nachweisen muss. Auch für einige<br />
Lebensmittelsicherheitskriterien ist es sinnvoll, diese vor dem Verlassen der Produktionsstätte zu kontrollieren (Salmonellen, Listeria<br />
moncytogenes). Für Schlachtkörper Rotfleisch sind Oberflächenkeimgehalte vorgeschrieben, die nicht überschritten werden dürfen.<br />
Auch für Hackfleisch, das nach EU-VO 853/2004, ANHANG I, 1.1<strong>3.</strong> definiert ist als „Hackfleisch/Faschiertes“ (entbeintes Fleisch,<br />
das durch Hacken/Faschieren zerkleinert wurde und weniger als 1 % Salz enthält) und für Separatorenfleisch und<br />
Fleischzubereitungen gibt es Prozesshygieneparameter und Grenzwerte in dieser EU-Verordnung. Zusätzlich ist die akzeptable<br />
Salmonellenrate für diese Produkte und für Schlachtkörper Rot- und Geflügelfleisch sowie Listeria monocytogenes-Toleranz<br />
festgeschrieben. Generell gilt, dass die Produkte, die an den Verbraucher abgegeben werden, sicher sein müssen. Zur Erlangung<br />
dieser Sicherheit ist die Produktionshygiene von entscheidender Bedeutung, denn für roh abgegebenes Fleisch, für Hackfleisch und<br />
Fleischzubereitungen besteht keine Möglichkeit der Keimabtötung am Ende der Produktion, bevor die Produkte an den Verbraucher<br />
abgegeben werden. Die Eigenkontrollen und die amtlichen Kontrollen müssen daher die in der EU-VO 2073/2005 genannten<br />
Matrices erfassen.<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden aus Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben mit EU-Zulassung insgesamt 1.286 Produkte<br />
und aus registrierten Betrieben 311 Produkte im Rahmen der Hygienekontrollen der Überwachungsbehörden auf Keimzahlen<br />
untersucht, von denen die wichtigsten Matrices in den Tabellen 4.6.2.1 und 4.6.2.2 dargestellt sind. Zusätzlich wurden 20<br />
hackfleischherstellende Betriebsstätten im Rahmen eines Projektes auf Hygieneparameter überprüft.<br />
Tabelle 4.6.2.1 Kontrolle Keimzahlen von Rotfleisch aus amtlichen Hygienekontrollen<br />
Material Proben aus EU-Betrieben Proben aus registrierten Betrieben gesamt
Schlachtkörper<br />
Schwein<br />
untersucht über Grenzwert untersucht über Grenzwert untersucht über Grenzwert<br />
211 86 128 46 338 132<br />
Schlachtkörper Rind 22 4 19 15 41 19<br />
Schlachtkörper Pferd 1 0 2 1 3 1<br />
Organe 53 27 53 27<br />
Hackfleisch<br />
5<br />
5<br />
(zwischen m und M)<br />
1 1 6 6<br />
Separatorenfleisch 1 1 1 1<br />
Fleischerzeugnisse 15 nicht beurteilbar 15 0<br />
Zerlegeteile Schwein 260 140 54 38 314 179<br />
Zerlegeteile Rind 41 14 23 15 64 29<br />
609 277(45 %) 227 116 (51 %) 835 393 (51 %)<br />
Für Zerlegeteile sind in der EU-Rechtssetzung keine Grenzwerte vorgegeben, die Qualitätszirkel der Lebensmittelunternehmer<br />
schreiben jedoch auch für diese Produkte Richtwerte vor und Eigenkontrollen dazu werden durchgeführt. Im Rahmen der amtlichen<br />
Kontrolle solcher Eigenkontrollen wurden auch Zerlegeprodukte zur Untersuchung eingesandt und diese anhand von<br />
Erfahrungswerten beurteilt. Die Zerlegung ist nach wie vor ein sehr sensibler Bereich, wo es durch das intensive Handling des<br />
Fleisches unter unhygienischen Bedingungen zu sehr hohen Keimzahlen, bis 1 × 10 7 KbE/cm², kommen kann. Erfahrungsgemäß ist<br />
bei guter Hygiene ein Oberflächenkeimgehalt bei zerlegtem Fleisch von 5 × 10³ KbE/cm² zu erreichen.<br />
Kontrolle der Produkte: Geflügelfleisch<br />
Für Schlachtkörper und Zerlegeteile vom Geflügel gibt das EU-Recht keine Grenzwerte vor, wie dies bei Rotfleischschlachtkörpern<br />
geregelt ist. Da aber die Lebensmittelunternehmer seit vielen Jahren solche Eigenkontrollen im Rahmen ihres<br />
Qualitätsmanagements durchführen, wurden amtliche Kontrolluntersuchungen eingeleitet. Die Proben stammten überwiegend aus<br />
Betrieben mit EU-Zulassung, lediglich zwei Putenzerlegeteile und vier Schlachtkörper vom Huhn kamen aus registrierten Betrieben<br />
zur Einsendung. Zerlegtes Putenfleisch zeigt den besten Hygienestand, nur bei 20 % kam es zu Überschreitungen der Richtwerte<br />
für die Oberflächenkeimgehalte. Einen besonders hohen Prozentsatz an Überschreitungen der Richtwerte für Gesamtkeimzahlen<br />
wurde bei den Schlachtkörpern vom Huhn gefunden und auch die Herstellung von Separatorenfleisch bzw. Baaderfleisch ist noch<br />
immer ein Hygieneproblem.<br />
Tabelle 4.6.2.2 Kontrolle Keimzahlen von Geflügelfleisch aus amtlichen Hygienekontrollen<br />
Material<br />
155<br />
Proben aus EU-Betrieben<br />
untersucht davon über Richtwert<br />
Schlachtkörper Huhn 69 47<br />
Schlachtkörper Pute 115 32<br />
Schlachtkörper Ente/Gans 13 4<br />
Organe 13 3<br />
sonstiges Fleisch<br />
Zerlegeteile Huhn 57 15<br />
Zerlegeteile Pute 42 15<br />
Zerlegeteile Ente 3 0
Separatorenfleisch 42 24<br />
Summen 329 134 (38 %)<br />
4.6.3 Untersuchungen auf Salmonellen im Rahmen der Hygieneuntersuchungen<br />
Seit Beginn des Jahres 2006 gelten gemäß EU-VO 2073/2004 für Schlachtkörper, Hackfleisch, Separatorenfleisch und<br />
Fleischerzeugnisse akzeptable und nicht akzeptable Salmonellenraten. Diese zu überwachen ist Gegenstand der betrieblichen<br />
Eigenkontrollen und muss von den Überwachungsbehörden überprüft werden. Dabei können jedoch nur Stichproben zur amtlichen<br />
Untersuchung entnommen werden, während die EU-Verordnung für die Eigenkontrollen Verlaufsuntersuchungen zum Zweck der<br />
Trendanalyse vorsieht. Für Schlachtkörper Rotfleisch ist eine neue Probennahmemethode vorgeschrieben, die einen sichereren<br />
Nachweis der auf dem Schlachtkörper ungleichmäßig verteilten Salmonellen gewährleisten soll. Die dazu notwendigen Materialien<br />
standen im Berichtsjahr noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, so dass alle Salmonellenuntersuchungen von<br />
Rotfleischschlachtkörpern vorerst aus 20 cm²-Stanzproben durchgeführt wurden. Auch die meisten Salmonellenuntersuchungen bei<br />
Geflügelschlachtkörpern wurden aus solchen Proben durchgeführt.<br />
Tabelle 4.6.<strong>3.</strong>1 Untersuchungen auf Salmonellen aus amtlichen Hygienekontrollen<br />
Material<br />
untersuchte<br />
Proben davon positiv Salmonellentyp<br />
Schlachtkörper Schwein 339 10 S. Typhimurium DT104L, DT193, RDNC, S. Derby, S.Ohio,<br />
Schlachtkörper Rind 41 0<br />
Schlachtkörper Pferd 3 0<br />
Schlachtkörper Huhn/Hähnchen 63 28<br />
S. Infantis, S. Paratyphi B, S. Brenderup, S.indiana, S.<br />
Kiambu,<br />
S. enteritidis, S. Thompson, S. Livingstone, S. Typhimurium<br />
PT4<br />
Schlachtkörper Pute 100 5 S. Saintpaul, S. Typhimurium DT066<br />
Schlachtkörper Ente/Gans 11 4 S. Indiana, S. Typhimurium DT008<br />
Hackfleisch 6 1 S. Typhimurium DT208<br />
Separatorenfleisch 45 4 S. Virchow, S. Hadar, S. Infantis, S. Typhimurium DT104L<br />
Fleischerzeugnisse 15 0<br />
frisches Fleisch vom Schwein 313 14 S. Typhimurium RDNC, DT104L, S. Derby, S. Infantis<br />
frisches Fleisch vom Rind 63 2 S. Typhimurium DT104L, S. Derby<br />
frisches Fleisch vom Huhn 58 7 S. Brenderup, S. Enteritidis, S. Infantis, S. Kiambu<br />
frisches Fleisch von Pute 44 3 S. Kottbus<br />
frisches Fleisch vom Wild 3 0<br />
Schlachtblut 8 3 S. Typhimurium, S. Derby<br />
Sonstiges Fleisch 116 14<br />
S. Anatum, S. Kottbus, S. monophasisch, S. Typhimurium<br />
RDNC, S. Derby, S. Rauhform<br />
gesamt 1.228 95 (7,7 %)<br />
4.6.4 Salmonellenmonitoring bei Schlachtschweinen<br />
Im Rahmen des Salmonellen-Bundesmonitorings bei Schlachtschweinen wurden die kulturellen Untersuchungen von<br />
Darmlymphknoten auf Salmonellen nach ISO 6579, Anhang D, begonnen. Aus 180 Lymphknoten wurden zehn Salmonellen isoliert.<br />
Das Monitoring wird im Jahr 2007 weitergeführt.<br />
156
4.6.5 Untersuchungen von Hackfleisch<br />
In einem Projekt wurden aus 20 Betrieben mit unmittelbarer Abgabe an den Verbraucher Untersuchungen sowohl der Vorprodukte<br />
zur Hackfleischherstellung als auch des Hackfleisches durchgeführt. Der Erfolg der Reinigung und Desinfektion wurde mittels Nass-<br />
Tupferproben kontrolliert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.6.5.1 aufgeführt und zeigen sehr deutlich, dass in vielen Fällen die<br />
Kriterien, die die VO 2073/2005 vorschreibt, nicht eingehalten werden. Auch sind die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen<br />
nicht in allen Betrieben so erfolgreich, wie das insbesondere in der sensiblen Produktion von Hackfleisch sein sollte. Die<br />
Betriebshygiene wurde anhand der Tupferserien beurteilt. Eine gute Reinigung konnte nur bei zwei Betrieben nachgewiesen<br />
werden, geringe Mängel wurden bei acht Betrieben festgestellt. Die Hälfte der Betriebe hatte nach den Ergebnissen der amtlichen<br />
Tupferproben deutliche Mängel (drei Betriebe) oder schwerwiegende Mängel (sieben Betriebe) bei der Reinigung und Desinfektion<br />
der Lokalisationen, die in unmittelbaren Kontakt mit dem Fleisch kommen.<br />
Bei der Betrachtung der einzelnen Betriebe wurde deutlich, dass das Hackfleisch dann hohe Keimzahlen hatte, wenn schon die<br />
Ausgangsprodukte die Warnwerte m erreichten. In einer Hackfleischprobe wurden Salmonellen und in zwei weiteren Listeria<br />
moncytogenes nachgewiesen. Die Untersuchungen der Rindfleischproben auf das Vorhandensein von EHEC verliefen in allen<br />
Proben negativ.<br />
Tabelle 4.6.5.1 Untersuchungen von Hackfleisch<br />
Kontrolle<br />
der<br />
Vorprodukte<br />
und<br />
Produkte<br />
Vorprodukte<br />
Schwein<br />
Hackfleisch<br />
Schwein<br />
Vorprodukte<br />
Rind<br />
Hackfleisch<br />
Rind<br />
Kontrolle<br />
Reinigung<br />
und<br />
Desinfektion<br />
Tupfer<br />
Kontrolle<br />
Reinigung<br />
und<br />
Desinfektion<br />
untersucht<br />
Gesamtkeimzahl<br />
zwischen m und M<br />
Gesamtkeimzahl<br />
über M<br />
157<br />
E. coli<br />
zw. m<br />
und M<br />
E. coli<br />
über M<br />
Listeria<br />
monocytogenes<br />
Salmonellen<br />
60 15 10 3 1 2<br />
63 26 9 6 5 1 1<br />
57 23 15 4 6<br />
57 24 16 8 8 2<br />
Gesamtkeimzahl<br />
über 10 KbE/cm²<br />
ohne<br />
Mängel<br />
304 109 2 Betriebe<br />
geringe<br />
Mängel<br />
8<br />
Betriebe<br />
deutliche<br />
Mängel<br />
schwerwiegende<br />
Mängel<br />
3 Betriebe 7 Betriebe
Die Untersuchungen in 20 Betrieben zeigten sehr deutlich, dass die Verwendung länger gelagerter keimreicher Fleischabschnitte<br />
als Grundlage für die Hackfleischherstellung und Fehler im Hygienemanagement häufig sind und zur Herstellung eines nicht<br />
sicheren Lebensmittels wesentlich beitragen.<br />
4.6.6 Sonstige Untersuchungen<br />
Von 83 untersuchten Proben Fleischerzeugnisse für den Export wurde in einer Probe Listeria monocytogenes nachgewiesen.<br />
Acht Proben Gelatine für den Export wurden untersucht auf die Parameter der Gelatineverordnung, in allen Fällen waren die<br />
Anforderungen erfüllt.<br />
Sieben Proben von Schlachtblut, das zur Lebensmittelproduktion vorgesehen war, wurden untersucht auf Gesamtkeimzahl,<br />
Anzahl Enterobacteriaceae und Staphylokokken sowie Salmonellen. In drei Proben wurden Salmonellen nachgewiesen.<br />
Dr. Schleuter, G. (VI OL)<br />
4.7 Hygieneuntersuchungen bei Milch und Milchprodukten, Eiern und Eiprodukten<br />
Um die Gesundheit der Verbraucher bestmöglich zu schützen, hat die EU ein umfassendes Kontrollsystem eingerichtet, das alle<br />
Phasen von der Gewinnung der Lebensmittel über die Be- und Verarbeitung bis hin zur Abgabe an den Verbraucher umfasst.<br />
Am 01.01.2006 trat das so genannte EU-Hygienepaket in Kraft. Grundlage sind hier die drei EU-Verordnungen Nr. 852/2004 über<br />
Lebensmittelhygiene, Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs und Nr. 854/2004 mit<br />
Vorschriften für die amtliche Lebensmittelüberwachung. Grundlegende Neuerungen sind die Ausdehnung auf die Urproduktion,<br />
sowie die Anpassung an die Basisverordnung Nr. 178/2002, in der die Forderung nach vollständiger Rückverfolgbarkeit auf allen<br />
Stufen der Lebensmittelproduktion verankert ist. Flankiert werden diese Verordnungen durch vier Durchführungsbestimmungen (VO<br />
(EG) Nr.2073/2005-2076/2005), in denen unter anderem mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel definiert sind. In den Fällen, in<br />
denen noch keine Kriterien durch die EU festgelegt worden sind, gelten Teile der nationalen Verordnungen weiterhin, wie z. B. Teile<br />
der Milchverordnung und Teile der Eiprodukteverordnung.<br />
Ergänzt durch die Zoonosenverordnung ergibt sich aus all diesen einzelnen Vorschriften ein abgestimmtes Verfahren zum<br />
Schutze des Verbrauchers von der Urproduktion bis hin zum Endprodukt, dem fertigen Lebensmittel.<br />
Ganz generell ist die Verantwortung der Hersteller durch die Einbeziehung in das Hygienerecht gestiegen. Die<br />
Lebensmittelunternehmer tragen die Eigenverantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften in ihrem Betrieb. Sie sind<br />
verpflichtet ein Eigenkontrollsystem für jeden Betrieb nachzuweisen. Dieses System, zu dem auch das HACCP-Konzept gehört,<br />
wird von den Vorortbehörden im Rahmen von Hygienekontrollen überprüft und von den Instituten des LAVES durch<br />
mikrobiologische Hygieneuntersuchungen zur Verifizierung der betriebseigenen Untersuchungsergebnisse begleitet. Dies erfordert<br />
neben der notwendigen Kontrollfunktion der Behörde eine gegenseitig vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Betrieben<br />
und den Kontrollorganen. Die Häufigkeit und Tiefe der Kontrollen richtet sich neben Faktoren wie Produktart, Betriebsart und<br />
Produktionsmenge entscheidend nach der Akzeptanz des betrieblichen Eigenkontrollsystems durch die Geschäftsleitung und die<br />
Mitarbeiter.<br />
Die Ergebnisse der Hygieneuntersuchungen im LAVES Veterinärinstitut Hannover zeigen auch in diesem Jahr, dass ein<br />
amtliches Kontrollsystem nach wie vor unverzichtbar ist. Immerhin haben alle durch Untersuchungen aufgedeckte Mängel in der<br />
Betriebshygiene sowie bei den Vorprodukten oder Endprodukten einen direkten Bezug zur Verbrauchergesundheit. Die im Text und<br />
in den folgenden Tabellen aufgeführte Anzahl an nachgewiesenen Keimarten überschreiten häufig nur Warngrenzen, die noch nicht<br />
zu einer Reglementierung der Endprodukte führen. Sie sind aber trotzdem für die Vorortbehörde ein Alarmzeichen und werden im<br />
Gespräch mit den Firmen verwendet, um die Schwachstellen in den Hygienekonzepten zu ermitteln und unter Einbeziehung der<br />
Institute des LAVES und des Kompetenzteams Hygieneberatung im Sinne des präventiven Verbraucherschutzes nach Lösungen zu<br />
suchen.<br />
Das Aufgabenspektrum der Hygieneuntersuchungen umfasst neben der Überwachung von Reinigung und Desinfektion durch die<br />
Untersuchung von Tupferproben, sog. Spülproben und Umgebungsproben insbesondere die Untersuchung von Vor-, Zwischen- und<br />
Endprodukten sowie die Haltbarkeitsüberprüfung durch Lagerungsversuche. Insgesamt wurden an Milch, Milchprodukten und Eiern<br />
und Eiprodukten circa 22.000 Untersuchungen durchgeführt, die sich auf insgesamt <strong>3.</strong>663 Milch und Milchprodukte aus 80<br />
Betrieben und 1.600 Eier und Eiprodukte aus ca. 30 Betrieben verteilten. Die hohe Zahl an Untersuchungen ergibt sich dadurch,<br />
dass bei jeder Probe eine ganze Reihe von Keimspektren aus dem Bereich der Hygieneindikatoren und Verderbsorganismen und<br />
dem Bereich der Pathogenen Keime untersucht werden müssen.<br />
Kontrolle der Mich und Milchprodukte<br />
Die Probeneinsendungen der Milch und Milchprodukte lassen sich im Wesentlichen in zwei Bereiche aufteilen. Dazu gehören die<br />
molkereimäßige Be- und Verarbeitung der Milch, die außer bei Käse immer eine Wärmebehandlung beinhaltet. Sie stellt einen<br />
158
großen Anteil der Untersuchungen dar.<br />
Sie umfasst Industriemilch zur Weiterverarbeitung, pasteurisierte Milch, Milchpulver und Ähnliches. Tendenziell lässt sich<br />
feststellen, dass großtechnisch bzw. industriell strukturierte Betriebe meist sehr gute Eigenkontrollsysteme unterhalten. Da hier der<br />
Rohstoff Milch einer Wärmebehandlung unterworfen wird, ist zu erwarten, dass der Anteil an potenziellen Keimen eher gering ist.<br />
Bei einer Untersuchungszahl von ca. 288 Proben sind trotzdem bei ca. 52 Proben Keimgehalte an Enterobacteriaceae,<br />
Pseudomonaden, aeroben mesophilen Keimen und coliformen Keimen festgestellt worden.<br />
Bei hocherhitzten Produkten wie H-Milch und H-Sahne sind keine Keimgehalte festgestellt worden.<br />
Weitere untersuchte Produkte wie Joghurt, Joghurt mit Früchten Quark, Doppelrahmkäse, Sauermilchprodukte zeigten ebenfalls<br />
keine Abweichungen.<br />
Die Untersuchung auf den Hygienestatus in diesen Großbetrieben wurde mittels Tupferproben, ca. 164 Untersuchungen,<br />
durchgeführt. Diese zeigten, dass das Hygienekonzept in diesen Betrieben, wie Reinigung und Desinfektion, kaum zu<br />
Beanstandungen Anlass gab.<br />
Der zweite Bereich umfasst die Gruppe der kleinen und mittleren Hersteller, und hier insbesondere die Direktvermarktung. Einen<br />
besonderen Überwachungsbereich stellt dabei die Vorzugsmilch dar. Die Hersteller von Vorzugsmilch und den daraus hergestellten<br />
Produkten bedienen einen Kundenkreis, der Wert auf die Naturbelassenheit des Produktes legt und der eine besondere Frische<br />
erwarte. Da Vorzugsmilch Rohmilch ist, die zum direkten Rohverzehr bestimmt ist, sind spezielle Hygienemaßnahmen erforderlich.<br />
Die Überwachung der Gesundheit der Milchtiere und der Melkhygiene sowie die Hygiene im Betrieb spielen dabei eine sehr große<br />
Rolle.<br />
Im Jahre 2006 wurde bei Hygieneuntersuchungen eine ganze Anzahl von Befunden erhoben. In mehreren Fällen gab es in<br />
Vorzugsmilch und Erzeugnissen aus Rohmilch durch den Nachweis auf Verotoxin Hinweise auf das Vorkommen verotoxinbidender<br />
E.coli (VTEC). Angesichts der hohen Pathogenität von VTEC-Keimen ist bereits beim ersten Verdacht, also schon beim Nachweis<br />
des Verotoxins, sofortiges konsequentes Handeln erforderlich. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Behörden und dem LAVES ein Handlungsschema erstellt, das ein konsequentes und systematisches Abarbeiten der Problematik<br />
ermöglicht.<br />
Der Nachweis von coliformen Keimen und E. coli gilt als Hinweis auf mangelnde Hygiene oder Fehler bei der Umsetzung der<br />
Betriebskonzepte. Dies können kontaminierte Rohstoffe, Be- und Verarbeitungsfehler oder eine Rekontamination sein.<br />
Koagulaspositive Staphylokokken wurden überwiegend in Vorzugsmilchen und Rohmilchprodukten gefunden. Da sie beim<br />
Menschen zu Erbrechen und Durchfall führen können, sind sie besonders bei Vorzugsmilch, die häufig von Kindern und älteren<br />
Leuten getrunken wird, als kritisch einzustufen.<br />
Auch der Nachweis von Schimmelpilzen und Hefen in Nahrungsmitteln sind für den Verbraucher nicht hinnehmbar. Während die<br />
Hefen eher als Verderbniserreger fungieren, kommt den Schimmelpilzen zusätzlich wegen der Gefahr der Mykotoxinbildung und der<br />
potenziellen Gefahr von aerogenen Infektionen durch Sporen auch gesundheitliche Bedeutung zu.<br />
Tabelle 4.7.1 : Mich und Milchprodukte<br />
Dargestellt sind die Keimarten, die bei der jeweiligen Produktgruppe auffällig waren. Die in den Klammern genannten Zahlen<br />
repräsentieren die Nachweishäufigkeit der Keimarten.<br />
a. Lebensmittel aus Rohmilch<br />
Anzahl Produkte Ergebnisse 1 Ergebnisse 2 Ergebnisse 3 Ergebnisse 4 Ergebnisse 5<br />
230 Vorzugsmilch Aerobe<br />
mesophile Keime<br />
(60)<br />
Enterobacteriaceae<br />
(5)<br />
159<br />
Listeria spp.<br />
(10)<br />
Staphylokokken,<br />
koagulasepositiv<br />
(6)<br />
241 Einzelgemelke / / / / /<br />
194 Sammelmilch Aerobe<br />
/ / / /<br />
(Tank usw.) mesophile Keime<br />
(24)<br />
133 Rohmilch<br />
Aerobe<br />
Enterobacteriaceae VTEC/ / /<br />
unbehandelt mesophile Keime (15)<br />
Verotoxin<br />
(15)<br />
(1)<br />
83 Rohmilch-Käse Staphylokokken, VTEC/Verotoxin / / /<br />
koagulasepositiv<br />
(10)<br />
(1)<br />
23 Rohmilch-Schaf Aerobe<br />
VTEC/Verotoxin / / /<br />
mesophile<br />
(2)<br />
(1)<br />
VTEC/<br />
Verotoxin (2)
18 Rohmilch-Ziege Aerobe<br />
mesophile Keime<br />
(5)<br />
2 Rohmilchprodukte<br />
anderer Tierarten<br />
Aerobe<br />
mesophile Keime<br />
(10)<br />
8 Brauchwasser Aerobe<br />
mesophile Keime<br />
(2)<br />
164 Tupferproben Pseudomonaden<br />
(1)<br />
b. Lebensmittel aus pasteurisierter Milch<br />
/ / / /<br />
/ / / /<br />
/ / / /<br />
/ / / /<br />
Anzahl Produkte Ergebnisse 1 Ergebnisse 2 Ergebnisse 3 Ergebnisse 4<br />
288 Milch pasteurisiert Aerobe mesophile Enterobacteriaceae (10) Pseudomonaden Coliforme Keime (2)<br />
Keime (30)<br />
(10)<br />
30 Milch, Produkte<br />
UHT<br />
/ / / /<br />
205 Käse, einschl. Hefen<br />
St. aureus<br />
Coliforme /<br />
Vorprodukte (16)<br />
(6)<br />
Keime<br />
(5)<br />
24 Butter Enterobacteriaceae<br />
(1)<br />
/ / /<br />
127 Trockenprodukte / / / /<br />
262 Milchprodukte Bacillus cereus Pseudomonaden<br />
/ /<br />
sonst<br />
(5)<br />
(5)<br />
90 Michmixgetränke Pseudomonaden Bacillus cereus<br />
/ /<br />
(5)<br />
(5)<br />
5 Ziegenkäse / / / /<br />
35 Eis Aerobe mesophile Enterobacteriaceae Bacillus cereus Coliforme<br />
Keime (4)<br />
(1)<br />
(3)<br />
Keime (1)<br />
20 Zaziki Schimmelpilze Hefen<br />
/ /<br />
(5)<br />
(15)<br />
Untersuchung bei Ei und Eiprodukten<br />
Um bei Eiern und Eiprodukten für salmonellenfreie Eier zu sorgen, ist schon der Aufbau von gesunden Legehennenbeständen<br />
durch Überwachung der Elternbetriebe (Kontrolle Bruteier) von großer Bedeutung. Im LAVES wurden 282 Bruteier auf den Eintrag<br />
von Zoonosen untersucht. Alle Proben zeigten ein negatives Ergebnis.<br />
Der Verzehr von Eiern und Eiprodukten ist nach wie vor eine der Eintragsquellen für die Salmonellenerkrankung beim Menschen.<br />
Am häufigsten ist hierbei Salmonella Enteritidis beteiligt, wie es auch die Zoonosestatistiken des BfR belegen. Das Ei selbst kann<br />
zum einen mit dem Darminhalt des Geflügels oder anderen Verunreinigungen äußerlich, also auf der Schale, kontaminiert werden.<br />
Das Dotter bietet den Salmonellen auf Grund des hohen Eisengehaltes optimale Bedingungen für eine Vermehrung. Nach längerer<br />
und ungekühlter Lagerung oder bei unsachgemäßer Verwendung können mehr als eine Milliarde Salmonellen in einem Milliliter<br />
Eidotter vorhanden sein. Daher sollten Eier nach Möglichkeit nicht zu Speisen verarbeitet werden, die anschließend nicht erhitzt<br />
werden. Auch sollte man sich immer bei Kontakt mit der kotverschmierter Eischale die Hände waschen. Dies sind einfache<br />
Hygieneregeln, die für den Verbraucher eigentlich selbstverständlich sein sollten.<br />
2006 wurden 990 Hühnereier im Hühnereimonitoring, Schale und Eidotter getrennt, auf Salmonellen untersucht. Hierbei wurde 58<br />
Proben Salmonella positiv getestet, davon 48 Proben mit Salmonella Enteritidis.<br />
Neben den Eiern, die als Direktverzehr im Haushalt dienen, werden der größte Teil der Eier industriell vermarktet z. B. in<br />
Bäckereien, Fertiggerichten, Teigwaren usw. Hierbei kommen Eiprodukte zum Einsatz, die aus dem ganzen Eiinhalt oder Teile<br />
davon gewonnen werden. Je nach Bestimmungszweck, unterscheidet man Vollei, Eiklar oder Eidotter, die getrocknet, gefroren oder<br />
als Flüssigprodukt ihre Verwendung in der Nahrungsmittelindustrie finden. Sie stellen ein hygienisch unbedenkliches<br />
Lebensmittelvorprodukt dar, wenn die Rohware ausreichend pasteurisiert worden ist. Da der Eiinhalt nach Entfernung der Schale für<br />
160
Kontaminationen mit verderbniserregenden Mikroorganismen sehr anfällig ist, müssen Eiprodukte vor dem Inverkehrbringen einer<br />
Hitzebehandlung mit anschließender Verpackung unterzogen werden. Diese Behandlung darf nur in behördlich zugelassenen<br />
Betrieben erfolgen.<br />
Ingesamt wurden bei Eiern und Eiprodukten 30 Betriebe kontrolliert und dabei 1.520 Proben untersucht. Der Schwerpunkt in den<br />
Untersuchungen liegt hier eindeutig in der Umsetzung der Hygienekonzepte und in der Untersuchung der Rohware. Die<br />
Technologie durch Pasteurisierung ist in den Betrieben so ausgreift, dass ein Eintrag in die verpackte Probe, außer durch<br />
Rekontamination, kaum möglich ist. So ist es keine Überraschung, dass die Kontamination mit Salmonellen in der Rohware fast 50<br />
Prozent betrug. Nach Pasteurisierung waren keine Salmonellen mehr nachweisbar.<br />
Bei der Kontrolle der Betriebshygiene mittels Tupferproben zeigte es sich, dass die Hygienekonzepte in den Betrieben noch<br />
verbesserungswürdig sind. Bei 167 Tupferproben wurden nach Reinigung immerhin noch 4 Proben Salmonella Enteritidis gefunden.<br />
Der Nachweis von aeroben mesophilen Keimen in 73 Proben stellt den Betrieben in Bezug auf eine erfolgreiche Desinfektion nicht<br />
gerade das beste Zeugnis aus.<br />
Kritisch zu würdigen ist der hohe Keimgehalt der Urproduktion. Hier müssen die Haltungsbedingungen der Hühnerpopulation und<br />
deren Gesundheitsstatus optimiert werden. In den nachfolgenden Betrieben erfolgt der Eintrag von Keimen im überwiegenden<br />
Maße durch eine Rekontaminierung der Produkte in Folge mangelnder Hygiene.<br />
Tabelle 4.7.2: Eiprodukte<br />
Dargestellt sind die Keimarten, die bei der jeweiligen Produktgruppe auffällig waren. Die in den Klammern genannten Zahlen<br />
repräsentieren die Nachweishäufigkeit der Keimarten.<br />
Anzahl Produkte Ergebnisse 1 Ergebnisse 2 Ergebnisse 3<br />
81 Vollei flüssig<br />
Aerobe mesophile Keime Salmonella Enteritidis Salmonella Livingstone<br />
nicht pasteurisiert (67)<br />
(40)<br />
(5)<br />
167 Tupferproben Aerobe mesophile Keime Salmonella Enteritidis /<br />
(73)<br />
(4)<br />
990 Hühnereier Salmonella Enteritidis Salmonella spp. /<br />
(48)<br />
(10)<br />
282 Bruteier / / /<br />
8 Eiprodukte pasteurisiert / / /<br />
4.8 Bakteriologische Fleischuntersuchung<br />
161<br />
Dr. Körfer, K.H.; Dr. Dildei, C. (VI H)<br />
Die bakteriologische Fleischuntersuchung (BU) dient der Feststellung bakterieller Krankheitserreger sowie der Verderbnisflora im<br />
Schlachtkörper. Bei Feststellung dieser Keimgruppen wird die Weitergabe an den Verbraucher gezielt verhindert. Der amtliche<br />
Tierarzt auf dem Schlachthof muss die BU einleiten, wenn auffällige pathologisch-anatomische Veränderungen am Schlachtkörper<br />
zu sehen sind. Aber auch, wenn rechtlich fixierte Gründe vorliegen, die auf ein infektiöses Geschehen, eine Kontamination oder auf<br />
die Möglichkeit einer nicht eingehaltenen Wartezeit bei Medikamenten hinweisen. Die Untersuchungen werden ausschließlich als<br />
amtliche Untersuchungen in den Instituten des LAVES durchgeführt.<br />
Die Anfänge der BU liegen 90 Jahre zurück, die amtliche Einführung erfolgte 1922. Sinn dieser Einführung war es, den<br />
Verbraucher vor Krankheiten zu schützen, die durch den Verzehr von Fleisch kranker Schlachttiere auf den Menschen übertragen<br />
werden können (z.B. Salmonellose).<br />
Die BU ist Teil der amtlichen Fleischuntersuchung. Bis zum 31.12.2005 war die Durchführung der BU durch die<br />
Fleischhygieneverordnung, die allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung nach dem<br />
Fleischhygienegesetz und dem Geflügelfleischhygienegesetz geregelt. Am 1.1. 2006 wurden diese nationalen Bestimmungen durch<br />
gesetzliche Regelungen der Europäischen Union ersetzt. Die BU erfolgt seitdem auf der Grundlage der EG-Verordnung 854 mit<br />
besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen<br />
tierischen Ursprungs.<br />
Aufgrund strikter Beurteilungsvorschriften für Fleisch kranker und anderweitig mängelbehafteter Tiere ist die bakteriologische<br />
Untersuchung aus Kostengründen heute häufig unrentabel (besonders auf dem Schweinesektor). Kranke und mängelbehaftete<br />
Tiere werden daher, weil eine BU erforderlich wäre, oft ohne Untersuchung direkt verworfen. In diesen Fällen ist die BU indirekt<br />
dennoch für den Verbraucherschutz bedeutsam.
Ergebnisse des Veterinärinstitutes Oldenburg, des Veterinärinstitutes Hannover und des Futtermittelinstitutes Stade<br />
Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg der bakteriologischen Fleischuntersuchungen (BU) zu verzeichnen: Im Rahmen der<br />
BU wurden in den Veterinärinstituten des Laves 992 Einsendungen untersucht. Von den Proben stammten insgesamt 764 vom<br />
Rind, 214 vom Schwein, elf vom Kalb und drei vom Schaf.<br />
Bei 498 Einsendungen (50,2 % der Proben) wurden potentielle Krankheitserreger nachgewiesen. In 304 Fällen wurde<br />
Arcanobacterium pyogenes, in 86 Fällen E. coli, in 31 Fällen Streptokokken, in 22 Fällen Rotlauferreger, in 13 Fällen Pasteurellen, in<br />
zehn Fällen Staphylococcus aureus, in vier Fällen Salmonellen und in 29 weiteren Fällen andere potentiell pathogene Keime<br />
gefunden. In zwölf Proben wurden gleichzeitig mehrere verschiedene potentiell pathogene Erreger nachgewiesen, in einer Probe<br />
vom Rind wurden EHEC-Toxine gefunden.<br />
Zusätzlich erfolgten bei neun Proben weitergehende histologische Untersuchungen. In fünf Fällen wurden maligne Tumore<br />
nachgewiesen. In einem Fall wurde mit dem Nachweis von Mycobacterium bovis der Tuberkuloseverdacht bei einem Rind bestätigt.<br />
Hemmstofftest im Rahmen der bakteriologischen Fleischuntersuchung<br />
Der Nachweis von Arzneimittelrückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft hat seinen Niederschlag in der Einfügung<br />
entsprechender Vorschriften in verschiedene Rechtsnormen gefunden. Häufig handelt es sich bei diesen Rückständen um<br />
Antibiotika, Sulfonamide und andere Stoffe mit antimikrobieller Wirkung, die sich unter dem Oberbegriff „Hemmstoffe“<br />
zusammenfassen lassen. Es wird diskutiert, dass durch die unkontrollierte Aufnahme von Hemmstoffen mit der vom Tier<br />
stammenden Nahrung beim Menschen Erkrankungen ausgelöst und antibiotikaresistente Bakterien induziert werden können. So<br />
wurden für alle Arzneimittel, die bei Lebensmittel liefernden Tieren Anwendung finden, Wartezeiten festgelegt, vor deren Ablauf eine<br />
Schlachtung oder sonstige Gewinnung tierischer Produkte als Lebensmittel nicht zulässig ist. Damit soll erreicht werden, dass vom<br />
Tier stammende Lebensmittel zum Zeitpunkt der Gewinnung frei von bedenklichen Rückständen sind. Ein wesentliches Ergebnis<br />
dieser Überlegungen war daher die Einführung des so genannten Hemmstofftestes.<br />
An Organmaterial wird je ein Stück Niere und ein Stück Muskulatur von definierter Größe des zu untersuchenden Tieres auf drei<br />
mit Bacillus subtilis BGA beimpfte Agarplatten aufgelegt und mindestens 18 Stunden bei 30 °C bebrütet.<br />
Das Wirkungsprinzip des Dreiplattentest (DPT) genannten Hemmstofftests beruht auf einer Wachstumshemmung dieser<br />
standardisierten Bakterienkultur (Bacillus subtilis BGA) durch Rückstände wie Antibiotika oder Sulfonamide. Bei diesem qualitativen<br />
Schnelltest spielen für die Beurteilung nur die abgelesenen Hemmhofgrößen eine Rolle. Eine Quantifizierung der Ergebnisse wird<br />
im Rahmen der BU nicht gefordert. Jede Hemmhofgröße mit einem Radius von mindestens zwei Millimetern wird als positiv<br />
angesehen. Ist nur die Niere betroffen, werden nur die Organe untauglich. Ist zusätzlich auch die Muskulatur betroffen, so ist das<br />
ganze Tier als untauglich anzusehen.<br />
Im Rahmen der Bakteriologischen Fleischuntersuchungen wurden Proben von 992 Schlachttieren (764 vom Rind, 214 vom<br />
Schwein, elf vom Kalb und drei vom Schaf) auch auf Hemmstoffe untersucht. Hiervon waren acht Proben (drei Schweine, fünf<br />
Rinder) im VI Oldenburg positiv getestet worden(0,8 %). Der Anteil positiv getesteter Tiere ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.<br />
4.9 Schädlingsbekämpfung<br />
Der Aufgabenbereich „Untersuchung und Bestimmung von Ungeziefer“ ist sowohl für die Tierseuchenbekämpfung als auch für die<br />
Lebensmittelhygiene, Futtermittelüberwachung und Gesundheitsvorsorge von großer Bedeutung. Die Schädlingsdiagnostik wird vor<br />
allem in Stade durchgeführt.<br />
Im Jahre 2006 sind 614 Einsendungen bearbeitet worden. Von diesen Einsendungen, die in 196 Fällen Mehrfachuntersuchungen<br />
(Einzelbestimmungen insgesamt 1909) erforderlich machten, entfielen auf<br />
- Gesundheitsämter 225 (+1)<br />
- Veterinärämter 10 (±0)<br />
- andere Ämter 2 (-3)<br />
- LAVES intern 54 (+10)<br />
- Firmen (Schädlingsbekämpfer) 293 (+44)<br />
- Privatpersonen 29 (-16)<br />
- niedergelassene Ärzte 1 (+1)<br />
- zusammen 614 (+37)<br />
Einsendungen. Die in Klammern gesetzten Zahlen weisen auf die Veränderungen zum Vorjahr hin.<br />
Für die insgesamt 1909 Einzelbestimmungen lässt sich folgende Übersicht geben:<br />
- Flöhe 31 (-9)<br />
- Wanzen/Zecken/Läuse 16 (+2)<br />
- Krebstiere (Asseln) 17 (+6)<br />
162
- Dipteren 479 (+344)<br />
- Springschwänze 10 (+4)<br />
- Schaben 19 (-4)<br />
- Tausendfüßer 9 (+1)<br />
- Milben 35 (+1)<br />
- Spinnen 25 (+5)<br />
- Ameisen (Ameisenmüll) 92 (+31)<br />
- Nichtschädlinge 312 (+181)<br />
- Feuchtigkeitsanzeiger 102 (+40)<br />
- Pflanzenschädlinge 143 (+76)<br />
- Nagetiere (Ratten/Mäuse) 1 (-1)<br />
- Kotproben 19 (-4)<br />
- Pilze (Schimmelpilznachweis) 78 (+26)<br />
- Vorratsschädlinge 200 (+42)<br />
- Fraßschäden (Material) 8 (+6)<br />
- Textil/Materialschädlinge 155 (+37)<br />
- Holzschädlinge 41 (+12)<br />
- Ungezieferwahn-Proben 3 (+1)<br />
- Bienen/Hummeln 5 (+2)<br />
- Pflanzenmaterial 3 (-1)<br />
- Heimchen 2 (+1)<br />
- Ringelwürmer 4 (+2)<br />
- Wespen/Hornissen 6 (+6)<br />
- Schmetterlinge 33 (+23)<br />
- ohne Befund 25 (-9)<br />
- Leerprobe 1 (-3)<br />
- nicht bestimmbar 35 (+19)<br />
- zusammen: 1909 (+829)<br />
Von den 31 Einsendungen mit Flöhen entfielen auf<br />
- Katzenflöhe 19 (+3)<br />
- Menschenfloh 1 (±0)<br />
- Vogelflöhe 10 (-13)<br />
- Igelfloh 1 (+1)<br />
Die in Klammern gesetzten Zahlen weisen auf die Veränderungen zum Vorjahr hin.<br />
Im Rahmen des Projektes „Geflügelkompostierung“ sind im Jahr 2006 Untersuchungen von Schaben- und Gelbklebefallen<br />
durchgeführt worden. Es wurden mehrere als Detektoren installierte Gelbklebefallen (für Fluginsekten) sowie Schabenklebefallen<br />
auf Arthropoden untersucht. Die gefangenen 7891 Individuen wurden bis mindestens zur Familie, in einigen Fällen bis zur Gattung<br />
oder sogar bis zur Art determiniert und quantitativ erfasst.<br />
Es wurden im Jahr 2006 also insgesamt fast 10000 Einzelbestimmungen durchgeführt!<br />
Bei der Schädlingsdiagnostik sind im Jahr 2006 folgende Auffälligkeiten zu verzeichnen:<br />
Die Schädlingsbekämpfungsfirmen haben 2006 wieder mehr Probenmaterial als im Vorjahr zur Untersuchung an das LAVES<br />
geschickt (Anstieg ca. 18 %), dagegen ist der Anteil der nicht gebührenpflichtigen Einsendungen (Behörden) gegenüber 2005 in<br />
etwa gleich geblieben. Der Anteil an Einsendungen von Privatpersonen ist abermals rückläufig (um ca. 35 %). Die Einsendungen<br />
LAVES-eigener Institutionen (Futtermittelinstitut, Lebensmittelüberwachung etc.) sind dagegen um ca. 22 % angestiegen.<br />
Bei den an das LAVES eingesandten Flohproben ist gegenüber 2005 ein Rückgang von ca. 22 % zu verzeichnen, wobei aber<br />
insbesondere die wiederholte Einsendung von Menschenflöhen darauf schließen lässt, dass mit einer weiteren Ausbreitung der Art<br />
in den nächsten Jahren zu rechnen ist.<br />
Rund 30 % der an das LAVES eingesandten Schabenproben betrafen 2006 Waldschaben (E. sylvestris und lapponicus), welche<br />
innerhalb von waldnahen Gebäuden gefunden worden sind. Dies ist ein bemerkenswert hoher Anteil und dürfte mit einer hohen<br />
Vermehrungsrate im letzten Jahr zusammenhängen.<br />
Der gewaltige Anstieg von Fliegen- und Mückeneinsendungen um fast 300 % hängt mit der Auswertung von Licht- und<br />
Klebefallen zusammen, welche insbesondere von Schädlingsbekämpfungsfirmen eingesandt worden sind.<br />
Die Einsendung von Vorratsschädlingen ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25 % angestiegen, wobei insbesondere die<br />
klassischen Lebensmittelmotten dafür verantwortlich zu machen waren.<br />
Weiterhin auffällig ist der Befall mehrerer Filialen einiger großen Lebensmittelketten im Landkreis Rotenburg/W. mit dem<br />
163
Australischen Diebkäfer, Ptinus tectus. Dieser Befall wurde bei der Untersuchung von Kartonagen-Abfallmaterial festgestellt.<br />
Im Rahmen der Beratungstätigkeit des LAVES wurden im Jahr 2006 1522 Anfragen hilfesuchender Verbraucher<br />
entgegengenommen. Hierbei handelte es sich in erster Linie um telefonische Beratungen betreffend Schädlingsdiagnostik,<br />
Bekämpfungsmethoden, rechtlichen Fragen zur Schädlingsbekämpfung und Biozidzulassung sowie um Fragen der<br />
Schadnagerbekämpfung (Kontrolle großräumiger Rattenbekämpfungsmaßnahmen). Ca. 36 % der Anfragen kamen von Behörden,<br />
31% von Privatpersonen, 10 % von Presse und Funk und 23 % von Schädlingsbekämpfungsfirmen. In 21 Fällen erfolgte zeitgleich<br />
mit der Bestimmung hereingereichter Schadorganismen eine Beratung vor Ort in Stade.<br />
Der auf der LAVES-Web-Seite angebotene Service über ein Formular Fragen zu Schädlingen und zur Schädlingsbekämpfung<br />
allgemein an uns zu senden, wurde insgesamt 29-mal genutzt. Weiterhin erreichten uns 192 schriftliche Anfragen, bzw. Anfragen<br />
per Fax oder E-Mail.<br />
Im Jahr 2006 wurden durch den Fachbereich Schädlingsbekämpfung 61 Ortsbesichtigungen vorgenommen, alle auf Anforderung<br />
von Landkreisen/Gemeinden.<br />
Großen Anklang fand das Schädlingsbekämpfungssymposium, das in dieser Form erstmalig unter Leitung des Fachbereiches in<br />
Kooperation mit der TiHo Hannover organisiert worden war. Im Dezember 2006 hatten die Interessenten am Tagungsort Oldenburg<br />
(Museum für Natur und Mensch) die Möglichkeit, sich umfassend über das Thema Schädlingsbekämpfung zu informieren;<br />
zahlreiche fachkundige Referenten standen dafür zur Verfügung.<br />
Zu dem Symposium waren 186 Teilnehmer aus ganz Deutschland erschienen, die sich auf die verschiedenen „Berufsgruppen“<br />
wie folgt verteilten:<br />
stattliche Lebensmittelkontrolle 32,8 %<br />
(Veterinärämter [LKs] und Ministerien)<br />
Gesundheitsbereich 22,6 %<br />
(Gesundheitsämter [LKs] und Ministerien)<br />
staatliche Futtermittelkontrolle 10, 8 %<br />
Schädlingsbekämpfer 14,5 %<br />
Schädlingsbekämpfungsmittel<br />
hersteller / -vertreiber 12,4 %<br />
Industrie (Lebens-/Futtermittel) 6 %<br />
Städte / Gemeinden 1,2 %<br />
Andere 2,7 %<br />
Die Kontrollen großräumiger Rattenbekämpfungen werden auf Anforderung durch Gemeinden und Städte vom Fachbereich<br />
Schädlingsbekämpfung wahrgenommen. Nur fachgerechte Rattenbekämpfung in den Gemeinden kann zur dauerhaften Senkung<br />
von Rattenpopulationen und der Vermeidung von Resistenzen gegen Rodentizide führen. Auch vom humanmedizinischen und<br />
hygienischen Standpunkt ist eine flächendeckende Rattenbekämpfung unbedingt notwendig. Die Erfahrungen in der Praxis haben<br />
gezeigt, dass diese Bekämpfungsmaßnahmen kontrolliert werden müssen.<br />
Im Jahr 2006 sind insgesamt 83 Kontrollen großräumiger Rattenbekämpfungsmaßnahmen, davon 89 in Kurorten und<br />
Luftkurorten, durchgeführt worden. Die Beanstandungsquote lag bei 15 % (zwölf Orte). Das sind weniger Beanstandungen als in<br />
den Vorjahren 2003 bis 2005 und um 10 % geringer als 200<strong>3.</strong> Bei 42 % (35 Orte) der durchgeführten Kontrollen wurde keine<br />
Bekämpfungsdokumentation vorgelegt, obwohl diese durch die Gefahrstoffverordnung vorgeschrieben wird. Bis Ende 2006 wurden<br />
zwölf Nachkontrollen durchgeführt, bei denen keine weiteren Mängel aufgedeckt wurden.<br />
Im Rahmen der Überprüfung von Müllplätzen und Deponien auf Befall von Gesundheitsschädlingen wurden 2006 fünf Objekte<br />
auf Anforderung hin überprüft.<br />
Ferner sind zwölf Kontrollen im Rahmen des Projektes „Erstellung eines neuen Bewertungsschlüssels für die Kontrollen<br />
großräumiger Rattenbekämpfungsmaßnahmen“ durchgeführt worden.<br />
Im Mai 2006 wurde der Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong> fertiggestellt und veröffentlicht.<br />
4.10. Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährlichkeit<br />
164<br />
Dr. Freise, J.F.; Stelling, K. (TF/SB)
Im Rahmen der amtlichen Zulassung von Pflanzenschutzmittel werden diese auch bezüglich ihres Risikopotentials auf Honigbienen<br />
geprüft. Neben dem Pflanzenschutzgesetz ist hierfür die Bienenschutz-Verordnung Grundlage. Je nach Ergebnis der Prüfungen<br />
werden die Pflanzenschutzmittel mit unterschiedlichen Auflagen versehen. Die Kategorisierung geht von „nicht bienengefährlich“ bis<br />
„bienengefährlich.“ Je nach Kategorie hat der Anwender (Landwirt) bestimmte Auflagen zu beachten. Das Institut für Bienenkunde<br />
Celle bietet als Produkt die Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährlichkeit an. 2006 wurden Pflanzenschutzmittel<br />
nach der Guideline OEPP/EPPO No. 170 im Freiland getestet (sechs Prüfglieder). Zu elf weiteren Studien wurden begleitende<br />
Arbeiten durchgeführt. Bei den Versuchen handelte es sich um Auftragsarbeiten.<br />
4.11 EU-Grenzkontrollstellen<br />
165<br />
Janke, M.; Schönberger, E.; von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Der LMTVet des Landes Bremen ist auf der Basis des Staatsvertrages mit <strong>Niedersachsen</strong> für die Lebensmittelüberwachung der für<br />
den innergemeinschaftlichen Handel zugelassenen Fischereierzeugnisbetriebe sowie für die Einfuhrkontrolle in Cuxhaven<br />
zuständig.<br />
Im vorliegenden Berichtsjahr wurden insgesamt 89 Einfuhrvorgänge bearbeitet. Dabei wurden abweichend zu den Standorten in<br />
Bremen und Bremerhaven nur Anlandungen von Transportschiffen untersucht, es wurden in Cuxhaven keine Container gestellt. Im<br />
Rahmen der Einfuhruntersuchung und der durchgeführten Rückstandskontrollen wurden keine Abweichungen festgestellt. Somit<br />
konnten alle Sendungen für den freien Verkehr in der Europäischen Union abgefertigt werden. Die Einfuhr von tiefgefrorenem Fisch<br />
aus Drittländern hat sich in Cuxhaven im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht.<br />
Von der Außenstelle Cuxhaven wurden im Berichtsjahr 153 Exportzertifikate ausgestellt.<br />
Tabelle 4.11.1 Einfuhr tiefgefrorener Fischereierzeugnisse in Cuxhaven im Jahr 2006<br />
Herkunft Russland<br />
USA<br />
2006 (Vorjahr) 2006 (Vorjahr)<br />
Anzahl Schiffe 5 (9) 9 (8)<br />
Tonnage 24 (2.520) 35.963 (30.900)<br />
4.12 EU-Schnellwarnsystem<br />
Dr. Prange D.; Oltmann, E. (LMTVet Bremen/Bremerhaven)<br />
Das EU–Schnellwarnsystem besteht bereit seit 1979, es ist jedoch besonders in den letzten Jahren zu einem fest integrierten<br />
Bestandteil des gesundheitlichen Verbraucherschutzes in der EU geworden. Seine Aufgabe ist der rasche Informationsaustausch<br />
zwischen den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission über Gesundheitsrisiken, die im Rahmen der amtlichen Überwachung, der<br />
Eigenkontrolle des Lebensmittelunternehmers, der Importkontrolle oder einer Verbraucherbeschwerde bekannt werden.<br />
Es existieren zwei parallele Systeme: das RASFF (Rapid Alert System Food and Feed) für Informationen bezüglich Lebensmitteln<br />
und Futtermitteln, sowie das RAPEX (System for the rapid exchange of information) für Informationen über gefährliche Produkte, die<br />
keine Lebensmittel sind.<br />
Die Meldungen über gesundheitliche Risiken bei Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika aus allen<br />
Mitgliedsstaaten werden durch die Kommission der EU zentral koordiniert und durch die nationale Kontaktstelle, das Bundesamt für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) bzw. die Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitssicherheit (BAuA), an die<br />
Kontaktstellen der Bundesländer weitergeleitet.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> nimmt seit 2002 das LAVES die Aufgabe als Kontaktstelle für beide Systeme wahr: Das Dezernat 21 -<br />
„Lebensmittelüberwachung“ als Kontaktstelle für Meldungen bezüglich Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika und<br />
das Dezernat 41 - „Futtermittelüberwachung“ - als Kontaktstelle für Meldungen, die Informationen über Futtermittel beinhalten.
Das Dezernat „Futtermittelüberwachung“ kann bei Bedarf direkt Maßnahmen einleiten, das Dezernat „Lebensmittelüberwachung“<br />
hingegen gibt Meldungen, die <strong>Niedersachsen</strong> betreffen, an die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen kommunalen<br />
Behörden weiter.<br />
Wird im Rahmen der Lebensmittelüberwachung ein Risiko für die menschliche Gesundheit festgestellt, so erstellt die<br />
Lebensmittelüberwachungsbehörde eine Meldung, die von der Kontaktstelle nach Prüfung und Zustimmung durch das<br />
Niedersächsische Ministerium für den ländliche Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz an das BVL weitergeleitet<br />
wird und schließlich über die Kommission alle Mitgliedstaaten der EU erreicht.<br />
Um eine Auswertung möglich zu machen und um neue Entwicklungen und Tendenzen zu erkennen, werden die Informationen aus<br />
allen Meldungen bezüglich Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika im Dezernat „Lebensmittelüberwachung“ in eine<br />
Datenbank eingegeben. So hat die Auswertung für das Jahr 2006 ergeben, dass etwa 5.500 Meldungen zu über <strong>3.</strong>000 Vorgängen<br />
durch das Schnellwarnsystem in den Mitgliedsstaaten der EU verbreitet wurden.<br />
Je nach Inhalt werden die Meldungen unterschiedlich kategorisiert: Eine Warnmeldung beinhaltet Informationen über ein Produkt,<br />
von dem ein ernstes Risiko für die menschliche Gesundheit ausgeht und das sich bereits in den Mitgliedsstaaten in Verkehr<br />
befindet. Besteht trotz ernstem Risiko für die menschliche Gesundheit kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da sich das Produkt<br />
nicht auf dem gemeinsamen Markt befindet, wie z. B. bei der Rückweisung an einer Grenzkontrollstelle, so wird die Meldung als<br />
Informationsmeldung eingestuft.<br />
Werden zusätzliche Informationen zu einer bereits eingestellten Warn- oder Informationsmeldung gewonnen, die für die anderen<br />
Staaten von Interesse sein könnten, so werden sie als Folgemeldung zur jeweiligen Hauptmeldung eingestellt. Dies ist<br />
beispielsweise der Fall, wenn weitere Vertriebswege oder eine zuvor unbekannte Herkunft ermittelt wurden. Alle anderen<br />
Informationen, die mit der Sicherheit von Lebensmitteln oder Futtermitteln in Verbindung stehen und für alle beteiligten Staaten von<br />
Interesse sein könnten, werden als Nachrichten kategorisiert, dies können z. B. Listen der Unterzeichnungsberechtigten von<br />
Gesundheitszertifikaten sein.<br />
RAPEX-Meldungen betreffen generell die Produktsicherheit und werden nur dann in die Datenbank aufgenommen, wenn die<br />
Lebensmittelüberwachung von ihrem Inhalt betroffen ist. Beispiele hierfür sind die mikrobiologische Kontamination von<br />
kosmetischen Produkten oder die Vergiftungsgefahr durch Wasch- und Reinigungsmittel, während Meldungen über Haushaltsgeräte<br />
oder Kraftfahrzeuge nicht aufgenommen werden.<br />
In Abbildung 14.12.1 ist die Anzahl der Meldungen nach Art der Meldung wiedergegeben.<br />
Von etwa 750 Meldungen war Deutschland 2006 betroffen, ein Viertel davon betraf auch <strong>Niedersachsen</strong>. Hier wird eine wichtige<br />
Funktion der Kontaktstelle im LAVES deutlich: durch Filtern der Meldungen wird eine gezielte und effiziente Reaktion vor Ort<br />
ermöglicht.<br />
Aus <strong>Niedersachsen</strong> wurden zu folgenden Sachverhalten Schnellwarnmeldungen an das BVL übermittelt:<br />
• Benzo(a)pyren und schwere PAKs in geräucherten Sprotten in Pflanzenöl aus Lettland<br />
• nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes gegartes Hähnchenbrustfilet im Backteig aus den Niederlanden<br />
• unzulässiges Inverkehrbringen von Kräutertee aus Polen, der Sennesblätter enthält<br />
• nicht zugelassene gentechnisch veränderte Reisnudeln aus China<br />
• nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes Rinderfett aus den Niederlanden<br />
• Farbstoff Sudan 1 in Teigwaren aus Italien<br />
• überhöhter Jodgehalt in getrocknetem Seegras aus China via die Niederlande<br />
• nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes Rindfleisch- und Hähnchen- Döner aus Deutschland<br />
• Salmonellen in Rohwurst mit Truthahn aus Deutschland<br />
• überhöhte Cumaringehalte in Frühstückscerealien mit Zimtgeschmack aus Deutschland<br />
EU-weit stellt sich die Verteilung des Risikos -gemessen an der Anzahl der Meldungen - wie folgt dar (siehe Abb. 4.12.2):<br />
Den größten Anteil nehmen mit fast 900 Meldungen die Mykotoxine ein. Bei den zugehörigen Meldungen handelt es sich jedoch in<br />
90 % der Fälle um Informationsmeldungen. Es bestand demnach kein unmittelbarer Handlungsbedarf für die zuständigen Behörden,<br />
da sich das Lebensmittel in keinem der an Netz der beteiligten Mitgliedsstaaten im Verkehr befand.<br />
Der Anteil an Meldungen aufgrund der genetischen Veränderung eines Lebensmittels ist im Vergleich zu 2005 enorm angestiegen.<br />
Wurden im Jahr 2005 nur drei Meldungen aufgrund einer gentechnischen Veränderung in einem Lebensmittel ins<br />
Schnellwarnsystem eingestellt, so waren es 2006 131 Meldungen, die sich bis auf einige Ausnahmen auf genetisch veränderten<br />
Reis bezogen.<br />
166
Die Abbildung 4.12.3 gibt einen Überblick darüber, wie sich die Meldungen auf die einzelnen Produktgruppen verteilen:<br />
Ein Viertel der Vorgänge betrafen die Produktgruppe Nüsse, da Erdnüsse, Pistazien, Haselnüsse, Paranüsse und getrocknete<br />
Feigen aufgrund von Sondervorschriften bei der Einfuhr intensiv auf Mykotoxine untersucht werden. Die Anzahl an<br />
Schnellwarnmeldungen spiegelt zum einen die Risiken wider, die mit den Produkten verbunden sind, sie sind jedoch genauso von<br />
der Ausrichtung der Untersuchungsschwerpunkte in den EU-Mitgliedsstaaten abhängig.<br />
Eine Häufig von Meldungen zu einem bestimmten Risiko kann andererseits auch Anlass für eine EU-Inspektion im Ursprungsland,<br />
die Festlegung von Grenzwerten oder eine verstärkte Importkontrolle sein, wie es 2006 bei der Importkontrolle von Mandeln aus den<br />
USA der Fall war.<br />
Djalvand, M.(Dez.22), Dr. Hartl, M. (Dez. 21)<br />
Abb. 4.12.1<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Hauptmeldungen Folgemeldungen<br />
167<br />
Nachricht<br />
Information<br />
Warnung<br />
Gesamtergebnis<br />
RAPEX-Meldung
Abb. 4.12.2<br />
Abb. 4.12.3<br />
7%<br />
7%<br />
4%<br />
6%<br />
8%<br />
3%<br />
5%<br />
11%<br />
11%<br />
3%<br />
8%<br />
4%<br />
15%<br />
3%<br />
4%<br />
26%<br />
7%<br />
168<br />
26%<br />
3%<br />
19%<br />
Bakterien<br />
andere mikrobiolog. Risiken<br />
Mykotoxine<br />
sonstige Toxine<br />
Schwermetalle<br />
andere Fremdstoffe/-körper<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Tierarzneimittel<br />
Zusatzstoffe<br />
Kennzeichnung<br />
GVO<br />
Migration<br />
Schädlinge<br />
Sensorik<br />
sonstige<br />
Nüsse u.ä.<br />
Fisch<br />
Sonstige<br />
Gemüse und Obst<br />
Getreide<br />
Fleisch<br />
Gewürze<br />
Bedarfsgegenstände u.ä.<br />
Milch
4.13 Zulassung von Betrieben für die Vermarktung von Lebensmitteln tierischer Herkunft<br />
Nach den veterinär- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften der EU benötigen bestimmte Betriebe, die Lebensmittel tierischer<br />
Herkunft in Verkehr bringen wollen, eine Zulassung. Hierzu gehören im Bereich des Rotfleisches (z. B. Schweine- oder Rindfleisch)<br />
und Weißfleisches (Geflügelfleisch) in der Regel Schlachtbetriebe, Zerlegebetriebe und Verarbeitungsbetriebe. Ferner müssen<br />
bestimmte Milch- und Fischverarbeitende Betriebe sowie bestimmte Hersteller von Eiprodukten zugelassen werden.<br />
Das LAVES, Dezernat 21- „Lebensmittelüberwachung“, ist in <strong>Niedersachsen</strong> zuständige Behörde für die Erteilung, das Aussetzen<br />
und den Entzug von Zulassungen in diesem Bereich.<br />
Gemeinsam mit den kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden werden die Zulassungsvoraussetzungen<br />
überprüft. Die Überprüfungsfrequenz nach erfolgter Zulassung soll sich zukünftig stärker nach einer Risikoeinstufung der Betriebe<br />
richten.<br />
So sollen Betriebe, in denen in der Vergangenheit keine oder wenige Mängel festgestellt wurden, seltener überprüft werden als<br />
solche, bei denen häufige Mängel festgestellt wurden. Aber auch das Risikopotential der hergestellten Produkte soll zukünftig<br />
stärker berücksichtigt werden. So ist ein Betrieb, der Dauerwaren herstellt, potentiell weniger risikobehaftet als zum Beispiel ein<br />
Betrieb, der leichtverderbliches Hackfleisch produziert.<br />
Durch das neue ab 2006 gültige Gemeinschaftsrecht sind nun wesentlich mehr Betriebe zulassungspflichtig als bisher. Für das<br />
Dezernat „Lebensmittelüberwachung“ bedeutet dies einen hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand, da bis zum Ablauf einer<br />
Übergangsfrist am 31. Dezember 2009 eine Vielzahl neuer Zulassungsanträge bearbeitet werden müssen. Dabei ist jede Zulassung<br />
mindestens mit einem Besichtigungstermin vor Ort verbunden.<br />
Die nachfolgende Übersicht informiert über die Anzahl der bisher zugelassenen Betriebe in <strong>Niedersachsen</strong> sowie die Anzahl der<br />
durch das LAVES durchgeführten Zulassungsüberprüfungen in 2006.<br />
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene<br />
Schlachtbetriebe/ Zerlegebetriebe/ Kühlhäuser<br />
Anzahl der Betriebe: 324<br />
Anzahl der kontrollierten Betriebe: 55<br />
Verarbeitungsbetriebe/ Sonstige (Gelatine, Kollagen)<br />
Anzahl der Betriebe: 255<br />
Anzahl der kontrollierten Betriebe: 62<br />
Milchhygiene<br />
Anzahl der Betriebe: 81<br />
Anzahl der kontrollierten Betriebe: 17<br />
Eiprodukthygiene<br />
Anzahl der Betriebe: 48<br />
Anzahl der kontrollierten Betriebe: 6<br />
Fischhygiene<br />
Anzahl der Betriebe: 96<br />
Anzahl der kontrollierten Betriebe: 21<br />
169
Abb. 4.1<strong>3.</strong>1<br />
Abb. 4.1<strong>3.</strong>2<br />
170<br />
Dr. Bisping, M. (Dez. 21); Haring, S. (Dez. 22); Schulze, B. (Dez. 21)
4. 14 Sonstige Genehmigungen und amtliche Anerkennungen<br />
4.14.1 Amtlich anerkannte natürliche Mineralwässer<br />
Natürliches Mineralwasser hat seinen Ursprung in einem unterirdischen, geschützten Wasservorkommen und ist von ursprünglicher<br />
Reinheit.<br />
Behandlungsverfahren sind nur in einem sehr eingeschränkten Umfang gemäß der Mineral - und Tafelwasser-Verordnung zulässig,<br />
so dass bei natürlichem Mineralwasser ein nahezu unverändertes, ursprüngliches Lebensmittel vorliegt.<br />
Natürliche Mineralwässer dürfen nur in den Handel gebracht werden, wenn sie ein amtliches Anerkennungsverfahren durchlaufen<br />
haben und wenn für ihre Abfüllung eine Nutzungsgenehmigung erteilt wurde.<br />
Beim gewerbsmäßigen Inverkehrbringen dient neben der analytischen Zusammensetzung die Angabe des Quellnamens und des<br />
Quellortes zur Charakterisierung eines natürlichen Mineralwassers.<br />
Die amtliche Anerkennung und Erteilung der Nutzungsgenehmigung für natürliche Mineralwässer erfolgt zentral für ganz<br />
<strong>Niedersachsen</strong> durch das Dezernat 21 - „Lebensmittelüberwachung“ - des LAVES am Standort Braunschweig.<br />
Im Jahre 2006 erfolgten vier neue amtliche Anerkennungen mit Erteilung der Nutzungsgenehmigung.<br />
Bis Ende 2006 waren insgesamt 58 natürliche Mineralwässer an 22 Standorten in <strong>Niedersachsen</strong> amtlich anerkannt; 40 % der<br />
Quellnutzungen befinden sich im Harz /Harzvorland.<br />
4.14.2 Genehmigungen zur Herstellung von bestimmten diätetischen Lebensmitteln nach § 11 DiätV<br />
171<br />
Dr. Hartl, M. (Dez. 21)<br />
Die Herstellung von bestimmten diätetischen Lebensmitteln (jodierter Kochsalzersatz, andere diätetische Lebensmittel mit einem<br />
Zusatz von Jodverbindungen oder bilanzierte Diäten) ist an eine Genehmigung der der zuständigen Behörde gebunden. In<br />
<strong>Niedersachsen</strong> ist das LAVES die zuständige Genehmigungsbehörde.<br />
Marktrelevanz hat diese Genehmigung insbesondere für die Hersteller von so genannten bilanzierten Diäten oder ergänzenden<br />
bilanzierten Diäten. Hierunter sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zu verstehen, die den besonderen<br />
Ernährungserfordernissen von Personen mit beispielsweise gestörtem Verdauungs- oder Resorptionsprozess gerecht werden. Eine<br />
Heilung oder Linderung von Krankheiten ist mit diesen Lebensmitteln nicht zu verbinden. Durch den speziellen Bedarf bestimmter<br />
Nährstoffe ist der angesprochene Verbraucherkreis sehr sensibel und somit auf die besondere Verarbeitung und Formulierung der<br />
bilanzierten Diäten angewiesen. Schon geringste Fehldosierungen oder sonstige Produktions- oder Lagerungsfehler können eine<br />
ungleichmäßige Verteilung der essentiellen Nährstoffe hervorrufen und damit zu Fehlernährungserscheinungen bis hin zur<br />
Gesundheitsgefährdung führen. Die Herstellungsgenehmigung dient somit dem vorbeugenden Gesundheitsschutz des<br />
Verbrauchers.<br />
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden besondere Anforderungen an die technischen Anlagen zur genauen Einwaage<br />
der Rohstoffe und deren Vermischung gestellt. Eine entsprechende Produktkontrolle im Herstellungsbetrieb ist nachzuweisen.<br />
Darüber hinaus muss der Herstellungsleiter über eine besondere Fachausbildung zum Lebensmittelchemiker, Chemiker oder<br />
Apotheker verfügen und zuverlässig sein. Die Herstellungsgenehmigung wird nach Prüfung dieser Voraussetzungen<br />
betriebsstätten- und personengebunden erteilt.<br />
Im Jahr 2006 wurde vom LAVES eine Genehmigungen neu erteilt und eine Genehmigung geändert.<br />
4.14.3 Ausnahmegenehmigung gem. § 68 LFGB<br />
Lay, J. (Dez. 21)<br />
Lebensmittel sind dazu bestimmt, den Menschen gesund zu ernähren. Durch die immer weiter fortschreitende Technologie werden<br />
aber auch immer neue Methoden und Stoffe zur Lebensmittelherstellung entwickelt. Diese entsprechen jedoch nicht immer den<br />
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Auf Antrag können Ausnahmen gem. § 68 LFGB von den Vorschriften des Lebensmittelrechtes<br />
zugelassen werden. Diese gelten dann jedoch nur für Einzelfälle und sind nicht allgemeinverbindlich, d. h. ein bestimmtes<br />
Lebensmittel wird von einer Firma, abweichend von den bestehenden Bestimmungen, hergestellt und in den Verkehr gebracht. Die
Ausnahmegenehmigung ist nicht auf andere Lebensmittel oder andere Firmen übertragbar. Für jedes Produkt und jede Firma muss<br />
ein eigener Antrag gestellt werden. Sobald bei der Antragsprüfung ersichtlich wird, dass eine Gesundheitsgefährdung für den<br />
Menschen besteht, wird die Ausnahmegenehmigung nicht erteilt.<br />
Die Ausnahmegenehmigung wird mit Auflagen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugelassen. Die<br />
Einhaltung der Auflagen wird durch das LAVES amtlich überwacht.<br />
Ausnahmegenehmigungen werden mit dem Ziel künftiger Änderungen und Ergänzungen lebensmittelrechtlicher Vorschriften unter<br />
Berücksichtigung weiterer Kriterien erteilt.<br />
Mit den Ausnahmegenehmigungen werden jedoch nicht die Vorschriften über Verbote zum Schutz der Gesundheit,<br />
Hygienevorschriften und krankheitsbezogene Werbeverbote unterlaufen. Von diesen Vorschriften sind Ausnahmen nicht möglich.<br />
In 2006 gab es nur eine neue Ausnahmegenehmigung für das Herstellen und Inverkehrbringen von Frühstückscerealien mit Zusatz<br />
von Eisen.<br />
Oppermann, H. (Dez. 21)<br />
4.15 Überwachungsprogramme<br />
4.15.1 Nationaler Rückstandskontrollplan<br />
Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans 2006<br />
Die zur Lebensmittelgewinnung dienenden lebenden und geschlachteten Tiere, inklusive Aquakulturen sowie die Primärerzeugnisse<br />
vom Tier (Milch, Eier, Honig) werden auf der Basis der Richtlinie 96/23/EG hinsichtlich Rückstände kontrolliert.<br />
Die Überwachungsmaßnahmen dienen dem Verbraucherschutz und zielen darauf ab, die illegale Anwendung verbotener Stoffe<br />
bzw. nicht zugelassener Stoffe aufzudecken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Arzneimitteln zu kontrollieren<br />
sowie die Belastung mit verschiedenen Umweltkontaminanten (z.B. chlorierte Kohlenwasserstoffe) zu erfassen.<br />
Besonders durch die Kontrolle am lebenden Tier und seinem Umfeld wird ein vorbeugender Verbraucherschutz realisiert. Bei<br />
abgesicherten Rückstandsnachweisen oder nachgewiesenen Überschreitungen von Höchstmengen werden die Ursachen der<br />
Rückstandsbelastung verfolgt, und es greift ein abgestimmter Maßnahmenkatalog nach nationalem Recht.<br />
Im Rückstandskontrollplan - ein europäisch harmonisiertes und jährlich aktualisiertes Programm zur Rückstandsüberwachung in<br />
der tierischen Urproduktion - ist der Mindestrahmen für die Probenhäufigkeit (in Abhängigkeit von Tierart bzw. Erzeugnis und<br />
Produktionsstufe), das Untersuchungsspektrum und die Untersuchungsbedingungen festgelegt. Länderspezifisch wird der Plan den<br />
aktuellen Erfordernissen angepasst. In <strong>Niedersachsen</strong> werden ca. 1<strong>3.</strong>000 Rückstandskontrollproben (ohne Hemmstoffproben) unter<br />
Beteiligung der Laboratorien in Hannover, Oldenburg und Cuxhaven (Aquakulturen) untersucht. Ein Teil der Proben wird im<br />
Rahmen der Norddeutschen Kooperation (NoKo) von anderen Instituten untersucht. Durch Austausch von Proben innerhalb der<br />
NoKo soll eine höhere Effizienz erreicht werden, da Untersuchungen von kleinen Probenserien in Schwerpunktlabors erfolgt.<br />
Hemmstoffuntersuchungen<br />
Als Screening auf Antibiotikarückstände in Fleischproben wird der Hemmstofftest nach der AVVFlH Kap. IV,5 (Allgemeine<br />
Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung nach dem Fleischhygienegesetz und dem<br />
Geflügelfleischgesetz) eingesetzt. Insgesamt wurden in den Veterinärinstituten Hannover und Oldenburg sowie FI STD 50.229<br />
Proben untersucht, und zwar 48.152 vom Schwein, 1.614 von Kälbern, 914 von Rindern, 77 von Schafen und 122 von sonstigen<br />
Tieren.<br />
In 141 Proben (0,28 % der untersuchten Proben) wurden Hemmstoffe festgestellt. Dabei stammten 103 positive Proben von<br />
Schweinen, zehn von Rindern und 28 von Kälbern. In Proben von Schaf und Pferd wurden keine Hemmstoffe nachgewiesen<br />
Rückstandsuntersuchungen<br />
Zusätzlich zu den Hemmstoffuntersuchungen wurden in den Veterinärinstituten des Landes <strong>Niedersachsen</strong> entsprechend den<br />
Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplans insgesamt 20.000 Untersuchungen auf Rückstände von pharmakologisch<br />
wirksamen Substanzen und Umweltkontaminanten in unterschiedlichen tierischen Matrices (Muskulatur, Niere, Leber, Blut, Urin,<br />
Haare, Milch, Eier und Honig) durchgeführt. Die Proben stammten überwiegend aus dem Rotfleischbereich (Schwein, Rind, Kalb,<br />
Schaf und Pferd) und dem Weißfleischbereich (Hähnchen, Puten, Legehennen, Ente und Gans). Dabei erfolgte die Probenahme<br />
sowohl im Schlachtbetrieb als auch im Erzeugerbetrieb. Außerdem wurden Proben von tierischen Erzeugnissen (Milch, Eier und<br />
Honig) sowie Proben von Zucht- und Jagdwild und Aquakulturen in die Rückstandsuntersuchungen einbezogen.<br />
Neben Screeningtests, wie radioimmunologische (RIA) und enzymimmunologische (ELISA) Tests, wurden instrumentelle<br />
chromatographische Methoden wie die Gas- und Hochdruckflüssigkeitschromatographie sowie die Atomabsorptionsspektrometrie<br />
(Elemente) zur Prüfung auf Rückstände und Kontaminanten eingesetzt.<br />
Eine Übersicht über das Untersuchungsspektrum der Rückstandsuntersuchungen mit den Untersuchungszahlen für die<br />
verschiedenen Tierart- und Erzeugnisgruppen ist in Tabelle 4.15.1.1 dargestellt.<br />
172
Tabelle 4.15.1.1: Rückstandsuntersuchungen in den Veterinärinstituten des Landes <strong>Niedersachsen</strong> - Auflistung nach<br />
Tierarten und Analytgruppen<br />
Gruppe A – Stoffe mit anaboler Wirkung und nicht zugelassene Stoffe<br />
Anzahl Rinder Schweine Geflügel Aqua- Milch Eier Honig Sonstige<br />
Untersuchte<br />
Unter- /<br />
kultur<br />
Parameter<br />
suchungen Kälber<br />
A<br />
1<br />
Stilbene 434 139 199 92 3 1<br />
A<br />
2<br />
Thyreostatika 361 92 187 81 1<br />
A Synth.<br />
709 370 190 137 4 8<br />
3 Androgene<br />
A<br />
3<br />
Synth. Estrogene 606 295 166 137 8<br />
A Synth.<br />
166 59 107<br />
3 Gestagene<br />
A<br />
3<br />
Natürl. Hormone 215 215<br />
A Resorcylsäure- 654 165 363 125 1<br />
4 Lactone<br />
A<br />
5<br />
A<br />
5<br />
A<br />
6<br />
A<br />
6<br />
A<br />
6<br />
A<br />
6<br />
A<br />
6<br />
ß - Agonisten 911 347 274 249 38 3<br />
Ractopamin 297 76 220 1<br />
Chloramphenicol 2876 686 560 1387 5 201 21 6 10<br />
Nitroimidazole 2008 2 561 1386 58 1<br />
Nitrofurane 610 6 170 374 9 49 2<br />
Chlorpromazin 134 134<br />
Phenylbutazon 1137 575 358 201 3<br />
B1 Stoffe – mit antibakterieller Wirkung<br />
Gruppe B – Tierarzneimittel und Kotaminanten<br />
B<br />
1<br />
Sulfonamide 661 112 520 12 9 8<br />
B<br />
1<br />
Tetracycline 1616 258 826 291 201 25 8 7<br />
B<br />
1<br />
Chinolone 986 98 451 382 4 5 45 0 1<br />
B<br />
1<br />
Aminoglycoside 197 72 112 7 1 5<br />
B<br />
1<br />
Penicilline 4 2 2<br />
B<br />
1<br />
Makrolide 391 3 229 155 3 1<br />
B<br />
1<br />
Trimethoprim 5 0 0 0 5<br />
B2 – sonstige Tierarzneimittel<br />
B<br />
2<br />
Anthelminthika<br />
(Avermectine)<br />
484 45 208 18 9 201 3<br />
173
a<br />
B<br />
2<br />
a<br />
B<br />
2<br />
b<br />
B<br />
2<br />
c<br />
B<br />
2<br />
d<br />
B<br />
2<br />
e<br />
B<br />
2<br />
f<br />
B<br />
3<br />
a<br />
B<br />
3<br />
a<br />
B<br />
3<br />
b<br />
B<br />
3<br />
c<br />
B<br />
3<br />
d<br />
B<br />
3<br />
f<br />
Anthelminthika<br />
(Benzimidazole)<br />
100 15 82 3<br />
Kokzidiostatika 397 83 132 178 4<br />
Carbamate /<br />
Pyrethroide<br />
168 22 105 34 5 2<br />
Sedativa 433 1 432<br />
NSAID (Profene) 581 55 187 134 201 4<br />
Synth.<br />
Kortikosteroide<br />
156 62 86 6 2<br />
B3 – andere Stoffe und Kontaminanten<br />
Pestizide/PCB 1489 249 855 153 7 192 33<br />
Dioxine 48 48<br />
Organische<br />
Phosphorverb.<br />
Chemische<br />
Elemente<br />
85 9 62 10 4<br />
413 86 195 53 6 6 48 6 13<br />
Mykotoxine 89 1 29 36 3 20<br />
Sonstige 533 253 70 210<br />
Insgesamt: 19.874 4.332 7.866 56.829 120 1.087 696 53 118<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine geringe Steigerung der Untersuchungzahlen zu verzeichnen. Seit 2004 zählen<br />
Dioxinuntersuchungen von Eiproben zum Untersuchungsspektrum (in diesem Jahr inklusive dioxinähnliche PCB’s), um eine breitere<br />
Basis für die Abschätzung der Dioxinbelastung zu bekommen. Dabei sollte geprüft werden, ob eine Korrelation zwischen der<br />
Dioxinbelastung in Eiern und der Haltungsform (z. B. Freiland-, Käfighaltung) besteht. Diese Untersuchungen wurden im Dioxinlabor<br />
des Lebensmittelinstituts Oldenburg durchgeführt.<br />
Positive Befunde<br />
In 71 von rund 1<strong>3.</strong>000 nach Plan zielorientiert beprobten Tieren bzw. Erzeugnissen konnten Rückstände (bzw. Überschreitungen<br />
der erlaubten Höchstmengen) festgestellt werden. Eine Auflistung nach Tierarten und Analytgruppen ist in der Tabelle 4.15.1.2,<br />
Rückstandsbefunde betreffend Muskelfleisch und die tierischen Erzeugnisse Hühnerei und Milch sind in Tabelle 4.15.1.3 dargestellt.<br />
Bei den verbotenen/ nicht zugelassenen Substanzen wurden hormonell wirksame Androgene, das seit 1994 verbotene<br />
Chloramphenicol und das nicht zugelassene Phenylbutazon in lebensmittelliefernden Tieren nachgewiesen. Synthetische<br />
Androgene wurden in fünf Proben nachgewiesen, welche allerdings im physiologischen Konzentrationsbereich für die jeweilige<br />
Tierart lagen. Bei den vier Chloramphenicolnachweisen (Gehalte von 0,6-1,9 µg/kg in Muskelfleisch) konnte in der Rückverfolgung<br />
keine Ursache der Belastung festgestellt werden. Der für Masthähnchen zugelassene Futtermittelzusatzstoff Nicarbazin<br />
(Kokzidiostatikum) konnte in drei Proben von Masthähnchen und in einer Hühnereiprobe nachgewiesen werden. Ursache hierfür<br />
174
sind die Nichteinhaltung der Wartezeit, Verschleppungen bzw. Kontaminationen im Futtermittel. Überschreitungen des zulässigen<br />
Grenzwertes für Dioxine (inkl. dioxinähnliche PCB’s) konnten bei einer Eiprobe und einer Legehenne festgestellt werden.<br />
Bei der Untersuchung von essbaren Geweben von Rindern, Kälbern und Schweinen auf Rückstände von erlaubten Tierarzneimitteln<br />
wurden 91 mal Überschreitungen der erlaubten Höchstmengen (MRL) für Antibiotika festgestellt, allerdings nur 33 mal bei<br />
Muskelfleischproben. Am häufigsten wurden Tetracycline, neben Sulfonamiden, Aminoglykosiden und Chinolonen nachgewiesen (s.<br />
Tabellen 4.10.1.2 und 4.10.1.3). In einem Fall wurde eine MRL-Überschreitung bei dem Anthelminthikum Levamisol in der Leber<br />
eines Mastschweines festgestellt.<br />
Nach mehreren Jahren ohne Rückstandsnachweise in Kuhmilch wurden in einer Planprobe Rückstände von Antibiotika festgestellt<br />
(Benzylpenicillin, Nafcillin, Dihydrostreptomycin), wobei nur im Fall des Benzylpenicillins mit 47 µg/kg eine Überschreitung des MRL-<br />
Wertes (4 µg/kg) vorlag.<br />
Andere Tierarzneimittel oder Umweltkontaminanten wurden nicht nachgewiesen bzw. wurden nicht beanstandet, wenn die<br />
festgestellten Konzentrationen keine Höchstmengenüberschreitung aufwiesen.<br />
Tabelle 4.15.1.2 : Positive Ergebnisse* in den Veterinärinstituten des Landes <strong>Niedersachsen</strong> - Auflistung nach Tierarten<br />
und Analytgruppen<br />
Gruppe A – Stoffe mit anaboler Wirkung und nicht zugelassene Stoffe<br />
Untersuchte Parameter Summe<br />
Rinder /<br />
Kälber Schweine Aquakultur Geflügel Milch Eier<br />
A 3 Synth. Androgene 5 3** 2**<br />
A 6 Chloramphenicol 4 1 3<br />
A 6 Phenylbutazon 2 2<br />
Gruppe B – Tierarzneimittel und Kontaminanten<br />
B1 Stoffe - mit antibakterieller Wirkung<br />
B1 Sulfonamide 21 21*<br />
B1 Tetracycline 36 22* 14*<br />
B1 Chinolone 8 2* 6*<br />
B1 Aminoglycoside 13 6* 7*<br />
B1 Penicilline 4 1 2* 1<br />
B1 Makrolide 1 1<br />
B1 Trimethoprim 8 8*<br />
B2 – sonstige Tierarzneimittel<br />
B 2 a Anthelminthika<br />
(Benzimidazole)<br />
1 1<br />
B 2 b Kokzidiostatika 4 3 1<br />
B3 - andere Stoffe und Kontaminanten<br />
B3a Dioxine 3 2* 1*<br />
Insgesamt: 110 38 64 0 5 1 2<br />
* teilweise Mehrfachnennungen einzelner Tiere oder Erzeugnisse durch mehrfache Stoff/Matrix-Kombinationen<br />
** bestätigt, jedoch im Rahmen der Nachforschungen nicht beanstandet<br />
Tabelle 4.15.1.3: Festgestellte Rückstände in bestimmten Lebensmitteln<br />
a) Festgestellte Rückstände in Muskelfleisch<br />
nicht erlaubte Stoffe* Tierart Anzahl Gehalte Bemerkung<br />
Chloramphenicol Schwein 4 0,6 - 1,9 µg/kg Ursache unklar<br />
Nicarbazin Masthähnchen 3 2,6 - 3 µg/kg zugelassener Zusatzstoff; Nichteinhaltung Wartezeit<br />
Dioxine Legehenne 1 7 ng/kg Fett WHO-PCDD/F-TEQ<br />
zugelassene Arzneimittel mit Höchstmengen (MRL)<br />
Aminoglycoside Rind 1 262 µg/kg Gentamicin<br />
Aminoglycoside Schwein 2 1300 - 1342 µg/kg DHS, Gentamicin<br />
175
Chinolone Rind 1 305 µg/kg Marbofloxacin<br />
Chinolone Schwein 3 390 - 1170 µg/kg Dano-, Marbo-, Enro/Ciprofloxacin<br />
Sulfonamide Schwein 10 138 - 1073 µg/kg<br />
Tetracycline Kalb 6 117- 272 µg/kg Tetracyclin<br />
Tetracycline Rind 1 613 µg/kg Tetracyclin<br />
Tetracycline Schwein 6 213 - 888 µg/kg<br />
Trimethoprim Schwein 3 210 - 4199 µg/kg in Verbindung mit Sulfonamiden<br />
b) Festgestellte Rückstände in tierischen Erzeugnissen<br />
Stoff Erzeugnis Anzahl Gehalte Bemerkung<br />
Penicilline Kuhmilch 1 47 µg/kg Benzylpenicillin (MRL = 4 µg/kg)<br />
Nicarbazin Hühnerei 1 2,5 µg/kg Nicht zugelassen für Legehennen<br />
Dioxine (inkl. dl PCB) Hühnerei 1 9 ng/kg Fett<br />
* inkl. Kontaminanten<br />
Nikotinsulfat<br />
Aufgrund eines Verdachts auf den Einsatz von Nikotinsulfat wurden in einem Erzeugerbebtrieb Tierkörper und Eier von Legehennen<br />
genommen. Der Verdacht wurde bestätigt: In den untersuchten Matrizes Federn, Muskulatur und Eiern wurde Nikotin<br />
nachgewiesen.<br />
Daraufhin wurden in 24 Betriebsstätten Verfolgsproben genommen. Insgesamt wurden 386 Probensätze (789 Proben)<br />
untersucht. In 141 von 163 Fällen konnte in den Federn von Legehennen Nikotin mit Gehalten von 0,24 bis 1.112 mg/kg festgestellt<br />
werden. 253 Eiproben wurden untersucht, wobei in 205 Proben kein Nikotin nachgewiesen werden konnte. Dagegen wurden in 21<br />
Proben Nikotingehalte von 2,5 µg/kg (Bestimmungsgrenze) bis 7 µg/kg festgestellt. Untersuchungen von Haut/Fett von Legehennen<br />
ergaben bei 40 von 105 Proben quantifizierbare Nikotingehalte im Bereich 4,2 bis 19 µg/kg. Ähnliche Konzentrationen wurden in elf<br />
von 120 Proben von Muskelfleisch festgestellt. Höhere Gehalte wiesen Proben von Vollei auf (3,5 – 120 µg/kg).<br />
4.15.2 Seehundmonitoring<br />
176<br />
Dr. Schnarr, K.; Dr. Schwarze, D. (VI H);<br />
Dr. Christof, O. (VI OL); Dr. Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Der Seehund (Phoca vitulina) zählt zu den im Wattenmeer heimischen Meeressäugern. Er verbringt die meiste Zeit im Wasser, aber<br />
beansprucht auch andere Lebensräume wie Sandbänke im Tidebereich und Sandstrände. Das Wattenmeer mit seinen vielen<br />
Sandbänken ist die Kinderstube des Seehundes. Hier erfolgt im Sommer die Geburt und Aufzucht der Junghunde, der Haarwechsel<br />
und die Paarung.<br />
Der besondere Schutz des Seehundes ist durch internationale Vereinbarungen geregelt. Bereits die “Bonner Konvention“ zur<br />
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (1979) beschreibt den Seehund als „Art mit ungünstiger Erhaltungssituation“,<br />
dessen Erhalt und Management internationale Übereinkünfte erfordert. Im Rahmen der trilateralen Kooperation zum Schutz des<br />
Wattenmeeres der Wattenmeeranrainerstaaten Niederlande, Deutschland und Dänemark wurde durch den Abschluss des<br />
Regionalabkommens “Agreement on the Conservation of Seals in the Wadden Sea“ (1990) diese Forderung erfüllt. Die Umsetzung<br />
dieses Abkommens erfolgt auf Grundlage eines von internationalen Experten erarbeiteten Management- und Monitoringplanes.<br />
Das Seehundmonitoring umfasst neben der Erhebung veterinärmedizinischer Parameter zur Beurteilung des<br />
Gesundheitszustandes eine Bestandserhebung der Seehundpopulation, aber auch administrative Aspekte des Schutzes der<br />
Seehundpopulation auf nationaler und internationaler Ebene.<br />
Kenntnisse über die Höhe des Seehundbestandes an der Niedersächsischen Nordseeküste liegen seit 1958 vor, allerdings<br />
erfolgen systematische Zählungen aus der Luft bei Niedrigwasser erst seit 197<strong>3.</strong> Gezählt wurde 2006 an fünf mit den<br />
Vertragsstaaten vereinbarten Terminen in den Monaten Juni bis August. In dieser Zeit der Jungtieraufzucht und des Haarwechsels<br />
befinden sich viele Seehunde auf den Sandbänken und Stränden. Die Zählungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der<br />
Landesjägerschaft <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Die Populationsentwicklung ist der Tabelle 4.15.<strong>3.</strong>1 zu entnehmen. Der Rückgang in den Jahren 1989 und 2003 ist Folge der<br />
Seehundstaupe. Nach Auswertung der Ergebnisse aller Wattenmeeranrainerstaaten ist in den nächsten Jahren ein weiteres<br />
anwachsen der Seehundpopulation zu erwarten.<br />
Abbildung 4.15.2.1<br />
Huesmann, J. (Dez. 32)
7000<br />
6500<br />
6000<br />
5500<br />
5000<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Seehunde<br />
Jungtiere<br />
Erfassung der Seehundpopulation<br />
Niedersächsisches/Hamburgisches Wattenmeer<br />
0<br />
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />
177
4.16 Lebensmittel<br />
Berichterstattung zur amtlichen Lebensmittelüberwachung<br />
(gemäß Artikel 14 Abs. (2) der Richtlinie des Rates 89/397/EWG)<br />
Ergebnisse der im Labor<br />
untersuchten Planproben<br />
Nr<br />
Produktgruppe<br />
Gesamtzahl der Proben<br />
Anzahl beanstandeter Proben<br />
1 Milch und Michprodukte 2430 489 510 147 8 93 248 14<br />
2 Eier und Eierprodukte<br />
Fleisch, Wild, Geflügel und<br />
203 22 22 3 0 1 10 8<br />
3 Erzeugnisse hieraus<br />
Fisch, Krusten-, Schalen-,<br />
Weichtiere und Erzeugnisse<br />
5269 1619 1740 134 30 149 1368 59<br />
4 daraus 1650 208 222 18 93 14 94 3<br />
5 Fette und Öle 453 43 45 1 20 4 18 2<br />
6 Suppen, Brühen, Sossen 659 114 123 4 0 10 106 3<br />
7 Getreide und Backwaren 3550 614 657 79 30 100 414 34<br />
8 Obst und Gemüse 3975 539 606 16 145 56 385 4<br />
9 Kräuter und Gewürze 686 128 131 1 9 13 105 3<br />
10 Alkoholfreie Getränke 1519 321 346 4 1 26 278 37<br />
11 Wein<br />
Alkoholische Getränke (außer<br />
837 183 216 0 3 37 152 24<br />
12 Wein) 776 157 151 1 3 5 136 6<br />
13 Eis und Dessert<br />
Schokolade, Kakao, und<br />
kakaohaltige Erzeugnisse,<br />
1429 377 383 278 0 0 104 1<br />
14 Kaffe, Tee 929 133 134 0 3 9 115 7<br />
15 Zuckerwaren<br />
Nüsse, Nusserzeugnisse,<br />
941 290 308 0 3 8 264 33<br />
16 Knabberwaren 178 31 32 0 4 4 22 2<br />
17 Fertiggerichte<br />
Lebensmittel für besondere<br />
740 149 152 29 3 11 108 1<br />
18 Ernährungsformen 919 231 252 0 2 11 208 31<br />
19 Zusatzstoffe<br />
Bedarfsgegenstände,<br />
Gegenstände und Materialien<br />
64 6 6 1 0 0 5 0<br />
20 mit Lebensmittelkontakt 1954 169 169 2 0 44 123 0<br />
21 Andere 1104 381 438 12 3 64 315 44<br />
178<br />
Gesamtsumme Verstösse<br />
Mikrobiologische Verunreinigung<br />
30.265 6.204 6.643 730 360 659 4.578 316<br />
Andere Verunreinigung<br />
Zusammensetzung<br />
Kennzeichnung (Aufmachung)<br />
Sonstige
Tabelle 4.16.1: Überwachungsprogramme<br />
LI OL<br />
Programm<br />
Nationaler<br />
Rückstandskontrollplan<br />
(NRKP)<br />
Probenart Untersuchungsziel Vorgaben/Rechtsgrundlagen<br />
Lebensmittel<br />
tierischer Herkunft<br />
auf der Stufe der<br />
Urproduktion<br />
Lebensmittel-Monitoring Aubergine<br />
Orangensaft<br />
Einzelfruchtanalyse<br />
von Gemüsepaprika<br />
Diverse<br />
Gemüsearten<br />
Untersuchung auf Stoffe mit<br />
pharmakologischer Wirkung<br />
und Umweltkontaminanten<br />
Untersuchung auf<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Diverse fetthaltige<br />
Lebensmittel<br />
Untersuchung auf Phthalate<br />
Säuglings- und Untersuchung auf Dioxine<br />
Kleinkindernahrung und dl-PCB<br />
Maishaltige Untersuchung auf<br />
Säuglingsnahrung Fumonisine<br />
Koordiniertes<br />
Aubergine<br />
Untersuchung auf<br />
Überwachungsprogramm<br />
(KÜP)<br />
Orangensaft Pflanzenschutzmittel<br />
Stichprobenkontrollen Butter<br />
Untersuchung auf<br />
Joghurt<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Bundesweiter<br />
Aquakulturerzeugnis Untersuchung auf Dioxine<br />
Überwachungsplan (BÜp) se<br />
Fisch<br />
Dorschleberkonserv<br />
en<br />
Geflügelfleisch<br />
Schaffleisch<br />
Rindfleisch<br />
Schweinefleisch<br />
Schweineleber<br />
Milch<br />
und dl-PCB<br />
Kochschinken Zusammensetzung,<br />
Fremdeiweiß, Verfälschung<br />
Streichfähige<br />
Rohwürste<br />
Verotoxin bildende E. coli<br />
Schweinefleischzub<br />
ereitungen zum<br />
Rohverzehr<br />
Campylobacter jejuni / coli<br />
179<br />
RL 96/23 EG vom 29.04.1996<br />
LFGB §§ 50 – 52<br />
RL 90/642/EWG und Empfehlung<br />
2005/178/EG<br />
RL 86/363/EWG Art. 4 (4)<br />
EU-Dioxin-Monitoring in<br />
Lebensmitteln: Empfehlung<br />
2004/705/EG<br />
AVV RÜb § 11<br />
VO 178/2002 Art. 14<br />
VO 178/2002 Art. 14<br />
Frische<br />
Zwiebelmettwurst<br />
Campylobacter jejuni / coli VO 178/2002 Art. 14<br />
Tofu Koloniezahl, Salmonellen,<br />
coag. pos. Staphylokokken,<br />
Bacillus cereus,<br />
Enterobacteriaceae<br />
AVV RÜb § 11<br />
Pulverformige<br />
Säuglingsnahrung<br />
Entero. Sakazakii AVV RÜb § 11<br />
Säuglingsnahrung Zearalenon: Überwachung<br />
neu eingeführter<br />
Höchstmengen<br />
AVV RÜb § 11<br />
Gemüse-, Obst- und Prüfung der Einhaltung von AVV RÜb § 11
Sonstige Ad hoc<br />
Programme<br />
LI BS<br />
Pilzkonserven aus<br />
Osteuropa<br />
Zusatzstoffvorschriften:<br />
Konservierungsstoffe,<br />
Süßstoffe, Farbstoffe<br />
Algen Datenerhebung: Gehalte an<br />
anorganischem Arsen<br />
AVV RÜb § 11<br />
Getreidebeikost DON, Trichothecene, u.a. AVV RÜb § 11<br />
Babynahrung in<br />
Gläschen<br />
Furan AVV RÜb § 11<br />
Mit Benzoesäure Untersuchung auf Benzol Erlass ML v. 18.01.2006<br />
konservierte als mögliches<br />
Lebensmittel die<br />
auch Ascorbinsäure<br />
enthalten<br />
Reaktionsprodukt<br />
Lebensmittel-<br />
BÜP<br />
monitoring<br />
KÜP<br />
PAK Fette und Öle 4 22<br />
Käse 1<br />
Phthalate Fette und Öle 35<br />
Käse 8<br />
Trinkwasser,Mineralwasser 5<br />
DON Getreideprodukte 28 8<br />
Brote, Kleingebäck 4 18<br />
Feine Backwaren 26<br />
Teigwaren 20<br />
Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung<br />
5 1<br />
Urethan Spirituosen 19<br />
Furan Brote, Kleingebäck 15<br />
Fertiggerichte, zubereitete<br />
Speisen<br />
26<br />
Suppen und Soßen 39<br />
Säuglings und<br />
Kleinkindernahrung<br />
6<br />
OTA Getreide 10<br />
Getreideprodukte 15<br />
Brote, Kleingebäck 11<br />
Feine Backwaren 1<br />
Fruchtsäfte, Fruchtnektare usw. 23<br />
Obstprodukte 19<br />
Fumonisine Getreide 10<br />
Getreideprodukte 24<br />
Säuglings und<br />
Kleinkindernahrung<br />
12<br />
ZEA Getreide 10<br />
Getreideprodukte 23<br />
180
Brote, Kleingebäck 13<br />
Feine Backwaren 12<br />
Säuglings und<br />
Kleinkindernahrung 10<br />
Diätetische LM 1<br />
Aflatoxin B1 Getreide 10<br />
Getreideprodukte 15<br />
Nitrat Gereifter Käse 40<br />
Schwefeldioxid Getrocknete Aprikosen 19<br />
Rot- und Weißwein 36<br />
Uran Mineralwasser 118<br />
Mikrobiolog.<br />
Status<br />
Quellwasser 8<br />
Tafelwasser 20<br />
Mozarella<br />
Sahne 27<br />
Teigwaren 5<br />
Rückverfolgbarkeit Betriebsprüfungen 10<br />
Gesamtzahl 93 640 75<br />
4.16.2 Milch und Milcherzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 2.461<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 531<br />
Geschlagene Sahne aus Eisdielen, Konditoreien und Bäckereien<br />
Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde auch in diesem Berichtsjahr wieder verstärkt geschlagene<br />
Sahne aus Eisdielen, Konditoreien und Bäckereien mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Die Beurteilung<br />
erfolgte anhand der Richt- und Warnwerte für aufgeschlagene Sahne der Deutschen Gesellschaft für Hygiene<br />
und Mikrobiologie (DGHM). Dort enthaltene Parameter sind Gesamtkeimzahl, coliforme Keime, Pseudomonaden,<br />
Escherichia coli, koagulase-positive Staphylokokken und Salmonellen. Die Ergebnisse können der folgenden<br />
Tabelle entnommen werden.<br />
Tabelle 4.16.2.1: Ergebnisse Sahne aus Eisdielen, Konditoreien und Bäckereien (ohne BÜP-Proben)<br />
Probenart Anzahl Bemängelung<br />
Art. 4 Abs. 2 VO<br />
(EG) Nr. 852/2004<br />
181<br />
16<br />
Beanstandung<br />
Art. 4 Abs. 2 VO<br />
(EG) Nr. 852/2004<br />
Planproben<br />
Sahne geschlagen<br />
136 64 (47 %) 45 (33 %) 1 (1 %)<br />
Planproben<br />
Sahne ungeschlagen<br />
100 33 (33 %) 11 (11 %) 0<br />
Verfolgs-, Verdachtsu.<br />
Beschwerdeproben<br />
Sahne geschlagen<br />
18 10 6 2<br />
Verfolgs-, Verdachtsu.<br />
Beschwerdeproben<br />
12 3 1 3<br />
Beanstandung<br />
Art. 14 Abs. 1 und 2<br />
b VO (EG) Nr.<br />
178/2002
Sahne ungeschlagen<br />
In keiner der untersuchten Proben wurden Salmonellen nachgewiesen. Die nach Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr.<br />
852/2004 bemängelten und beanstandeten Proben zeigten zumeist eine erhöhte Gesamtkeimzahl und/oder<br />
erhöhte Gehalte an Pseudomonaden und/oder coliformen Keimen. Bei den nach Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2b VO<br />
(EG) Nr. 178/2002 beanstandeten Proben wurden neben den auffälligen Keimgehalten auch sensorische Mängel<br />
festgestellt. Diese Proben waren für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet.<br />
Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig die fachgerechte tägliche Reinigung und Desinfektion der<br />
Sahneaufschlagmaschinen ist.<br />
Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsprogramms (BÜP) wurden im Berichtsjahr insgesamt 27 Proben<br />
Sahne untersucht. In der Gastronomie werden zum Aufschlagen von Schlagsahne in der Regel<br />
Sahneaufschlagmaschinen verwendet. In diesen Geräten kann es in Folge ungenügender oder fehlerhafter<br />
Reinigung, häufig kombiniert mit einer ungenügenden Kühlung und zu langen Lagerung, zu erheblichen<br />
Keimbelastungen kommen. Aufgrund dieser Problematik war Ziel der Untersuchung, festzustellen, ob im<br />
Endprodukt pathogene Mikroorganismen und/oder hohe Keimzahlen vorhanden sind. Jede Probe bestand aus<br />
drei Teilproben, wobei es sich bei der ersten um flüssige Sahne aus dem Originalgebinde, bei der zweiten um<br />
flüssige Sahne aus der Aufschlagmaschine und bei der dritten um geschlagene Sahne ebenfalls aus der<br />
Aufschlagmaschine handelte. Untersucht wurde auf sensorische Abweichungen, Gesamtkeimzahl,<br />
Enterobacteriaceen, coliforme Keime, Pseudomonaden, koagulase-positive Staphylokokken und Salmonellen.<br />
Vier Proben (15 %) zeigten einen unauffälligen mikrobiologischen und sensorischen Befund. Bei drei Proben (11<br />
%) waren die flüssigen Sahnen nicht zu beanstanden, die geschlagene Sahne wies jedoch auffällige Keimgehalte<br />
auf. Bei dem größten Teil der Proben (19 Proben bzw. 70 %) war die flüssige Sahne aus dem Originalgebinde<br />
mikrobiologisch einwandfrei, beide Sahnen aus der Aufschlagmaschine zeigten jedoch mikrobiologische<br />
Auffälligkeiten. Bei einer Probe (4 %) waren alle drei Teilproben zu beanstanden. Neben den hohen<br />
Keimgehalten wiesen diese Teilproben bereits einen bitteren Geschmack auf. In keiner der Proben wurden<br />
Salmonellen oder koagulase-positive Staphylokokken nachgewiesen. Die mikrobiologischen Auffälligkeiten<br />
bestanden zumeist in einer erhöhten Gesamtkeimzahl und/oder in hohen Gehalten an Pseudomonaden,<br />
Enterobacteriaceen und coliformen Keimen.<br />
Milch<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 133<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 21<br />
Konsummilch wurde nach den Vorgaben der VO (EG) Nr. 852/2004 bis VO (EG) Nr. 854/2004 hinsichtlich ihrer<br />
mikrobiologischen und physikalisch - chemischen Beschaffenheit überprüft.<br />
Eine fettarme hocherhitzte Milch wies sensorisch einen abweichenden Befund auf. Geruch und Geschmack<br />
wurden als harzig und terpenartig angegeben. Analytisch waren mehrere Terpene, darunter Limonen, alpha- und<br />
beta-Pinen sowie Myrcen, mit erhöhtem Gehalt nachweisbar. Terpene sind organische Verbindungen, die in der<br />
Natur weit verbreitet in Blüten, Blättern, Früchten, Rinden und Wurzeln und in den daraus gewinnbaren<br />
ätherischen Ölen vorkommen. Terpene werden eingesetzt vor allem als Lösemittel in Lacken und Klebern, als<br />
Riech- und Geschmackstoffe (Campher, Menthol, Limonen), in Pharmazeutika, Desinfektionsmitteln und als<br />
Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Textilien. Wie die nachgewiesenen Stoffe in die betreffende Milch gelangt<br />
sein können, konnte abschließend nicht geklärt werden. Die Probe wurde als für den Verzehr nicht geeignet<br />
beanstandet.<br />
Mehrere Packungen derselben Charge einer Beschwerdeprobe Milch enthielten viele braune, kristalline<br />
Rückstände. Dabei handelte es sich um so genannten Milchstein, welcher aus Kasein, einem Bestandteil des<br />
Milch-Eiweißes, entsteht. Die Milch führenden Anlagen einer Molkerei werden regelmäßigen Reinigungsverfahren<br />
unterzogen, um unter anderem die Bildung von Milchstein zu verhindern oder entstandenen Milchstein mit Hilfe<br />
von sauren Reinigungsmitteln zu entfernen. Die genaue Ursache der hier vorliegenden Verunreinigung konnte<br />
nicht ermittelt werden, angeforderte Nachproben der Charge wiesen keinen Befund auf. Möglicherweise wurde<br />
nach dem Reinigungsvorgang zu früh in die Milchabfüllung gegangen und Reste von Milchstein gelangten in die<br />
Milch für den Verbraucher. Die in Rede stehende Probe wurde als zum Verzehr nicht geeignet beanstandet.<br />
Im Berichtsjahr wurden 17 Proben Vorzugsmilch mikrobiologisch untersucht. Die Beurteilung erfolgte anhand<br />
der Anforderungen an die Beschaffenheit von Vorzugsmilch in der VO (EG) Nr. 853/2004 Art. 3 i. V. m. Anhang III<br />
Abschnitt IX dieser Verordnung.<br />
Fünf der untersuchten Milchproben entsprachen nicht den rechtlichen Anforderungen an die mikrobiologische<br />
Beschaffenheit. So war bei drei Proben die Gesamtkeimzahl erhöht, in einer weiteren wurden Enterobakterien<br />
nachgewiesen. Salmonellen, Listerien und Campylobacter spp. wurden nicht nachgewiesen.<br />
Bezüglich der Untersuchung von Milch auf Aflatoxin M1 wird auf das Kapitel 4.17.4 verwiesen.<br />
Milcherzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 894<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 249<br />
182
Es wurden Beanstandungen wegen sensorischer und/oder mikrobieller Verderbnis (zwei Proben), irreführender<br />
Angaben (23 Proben), fehlender Zusatzstoffdeklaration (zwei Proben) sowie wegen Deklarationsmängeln<br />
ausgesprochen. Einige Untersuchungsprogramme sind hier exemplarisch dargestellt.<br />
Bei Milchmischerzeugnissen steigt die Zahl der Produkte, die spezielle Zusätze enthalten und die mit einem<br />
Zusatznutzen ausgelobt werden.<br />
So wurden im Berichtszeitraum fünf Getränke aus Molke und Magermilchjoghurt eingeliefert, die mit<br />
konjugierten Linolsäuren (CLA conjugated linoleic acid) angereichert waren. CLA sind Abkömmlinge der<br />
essentiellen Linolsäure, deren Doppelbindung in cis und/oder trans-Stellung konjugiert sind. Sie entstehen im<br />
Pansen von Wiederkäuern u. a. durch Hydrierung von Linolsäure und sind folglich in Milch und Milchprodukten<br />
und im Fleisch von Wiederkäuern enthalten. In zahlreichen Tierversuchen (u. a. an Mäusen und Ratten) sowie an<br />
Zellkulturen konnte gezeigt werden, dass durch eine Zugabe von CLA die Fettmasse reduziert und die<br />
Magermasse erhöht werden. Beim Menschen hingegen ist ein Nutzen bislang nicht eindeutig nachgewiesen,<br />
negative Wirkungen wie beispielsweise eine Absenkung des HDL-Cholesterols sind nicht auszuschließen.<br />
Auf den Verpackungen der hier beurteilten Proben wurde u. a. mit folgenden Aussagen geworben: … ,,CLA<br />
kann helfen, die Körperzusammensetzung positiv zu beeinflussen, indem der Fettanteil im Körper verringert und<br />
der Muskelanteil erhöht wird.“ „CLA kann die Funktion eines Fat Managers übernehmen“…. ,,Der regelmäßige<br />
Verzehr kann einen Beitrag zum Abbau von Körperfett leisten.“ Diese Wirkaussagen wurden als wissenschaftlich<br />
nicht hinreichend gesichert und somit als irreführend im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2 LFGB beanstandet.<br />
CLA wurde als den Zusatzstoffen gleichgestellter Stoff gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr.1 LFGB eingestuft. Diese<br />
dürfen nur dann gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind. Nach hiesigem<br />
Kenntnisstand lag eine derartige Zulassung nicht vor. CLA wurde somit als nicht zugelassener Zusatzstoff<br />
eingestuft, seine Verwendung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a LFGB beanstandet.<br />
Auch vitaminisierte Milcherzeugnisse und deren werbewirksame Auslobung erfreuen sich großer Beliebtheit.<br />
Vitamine sind essentielle Nahrungsbestandteile, deren ausreichende und dosierte Zufuhr für die Aufrecherhaltung<br />
vieler Körperfunktionen notwendig ist. Werden sie Lebensmitteln zugesetzt, so muss ihr Gehalt auf der<br />
Verpackung ausgewiesen werden. Insgesamt wurden bei 22 vitaminisierten Milcherzeugnissen die deklarierten<br />
Vitamingehalte überprüft, bei zwei Proben wurden diese nicht eingehalten.<br />
Im Berichtszeitraum wurden 88 Proben verschiedener Milcherzeugnisse wie Joghurts und Joghurterzeugnisse<br />
mit Fruchtzubereitungen sowie Dips und andere Zubereitungen auf Milchbasis (Fertigpackungen und lose Ware)<br />
auf Konservierungsstoffe und deren Kenntlichmachung untersucht.<br />
Nur bei zwei der untersuchten Produkte fehlte die Kenntlichmachung des Konservierungsstoffes Sorbinsäure<br />
bzw. Benzoesäure. Ein Hersteller lobte einen Joghurt natur mit dem Hinweis „ohne Zusatz von<br />
Konservierungsstoffen“ aus. Da Joghurt gar nicht konserviert werden darf, wurde die Angabe als Werbung mit<br />
Selbstverständlichkeiten beanstandet. Mehrere Fruchtjoghurterzeugnisse eines ansässigen Herstellers enthielten<br />
höhere Sorbinsäuregehalte als zu erwarten gewesen wäre, legt man die zulässige Höchstmenge an Sorbinsäure<br />
in der Fruchtzubereitung und den Mengenanteil an Fruchtzubereitung im Endprodukt zugrunde. Eine Überprüfung<br />
des Sachverhalts im Herstellerbetrieb wurde angeregt.<br />
Kondensmilch eines ansässigen Herstellers zeigte bereits im Vorjahr bei Ablauf des angegebenen<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) Abweichungen in der Konsistenz in Form eines Bodensatzes. Eine Änderung<br />
der Technologie brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch im Berichtsjahr untersuchte Verfolgsproben zeigten<br />
nach der Lagerung bis zum Ende des MHD Abweichungen in der Konsistenz und teilweise auch im Geruch und<br />
Geschmack. Die Lagerung erfolgte bei Raumtemperatur unter nicht konstanten Temperaturbedingungen, wie sie<br />
üblicherweise auch beim Verbraucher anzutreffen sind. Da die DLG-Prüfbestimmungen zur Überprüfung der<br />
Lagerstabilität von Kondensmilch eine konstante Temperatur von 20 °C vorsehen, sollen im Folgejahr erneut<br />
Verfolgsproben unter veränderten Lagerbedingungen überprüft werden.<br />
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 20 Proben aus sog. „Melkhuskes“ oder „Melkhus“ untersucht. Diese<br />
„Milchhäuser“ sind vor allem im nördlichen <strong>Niedersachsen</strong> ansässig und an bestimmten Routen, den sog.<br />
„Milchstraßen“, zu finden. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger kleine Gastronomiebetriebe, die<br />
vorwiegend in der warmen Jahreszeit vor allem selbst hergestellte Milchprodukte anbieten. Aufgrund dessen war<br />
die Überprüfung des mikrobiologischen Status der Erzeugnisse von Interesse. Die eingesandten Proben wurden<br />
auf Hygieneparameter und pathogene Mikroorganismen untersucht. 18 Proben wiesen einen unauffälligen<br />
mikrobiologischen Befund auf. Eine Probe „pasteurisierte Vollmilch“ zeigte eine erhöhte Gesamtkeimzahl sowie<br />
einen erhöhten Gehalt an Pseudomonaden. Bei einer Probe „Erdbeermixmilch“ war der Gehalt an<br />
Enterobacteriaceae auffällig. Beide Proben wurden aus hygienischen Gründen bemängelt.<br />
Neun Joghurtproben, überwiegend Erzeugnisse mit Getreideanteil, wurden im Rahmen des<br />
Stichprobenkontrollplans nach der EU-Richtlinie 86/363 auf Pestizidrückstände untersucht. Es wurden keine<br />
Rückstände nachgewiesen.<br />
Käse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1.323<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 248<br />
183
Im Berichtsjahr wurden Käseproben unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung (von Frisch- bis zum<br />
Hartkäse) auf verschiedene Parameter untersucht, wie z. B. die Zusammensetzung (Fettgehalt, Trockenmasse),<br />
Haltbarkeit (MHD), Zusatzstoffe und Tierart.<br />
Beanstandet wurden sensorische Abweichungen (mikrobieller Verderb durch Schimmelpilze und/oder Hefenbefall<br />
vor Ablauf des MHD), Differenzen in der Fettgehaltsangabe sowie Kennzeichnungsmängel.<br />
Im Jahr 2006 wurde ein bundesweites Überwachungsprogramm durchgeführt, das diverse Käseartikel auf<br />
Verfälschungen mit Pflanzenfett überprüfen sollte. Die Bezeichnung „Käse“ ist nach der Milch-<br />
Bezeichnungsschutzverordnung VO(EWG) 1898/87 unzulässig für ein Produkt mit Fremdfett. In <strong>Niedersachsen</strong><br />
wurden 87 Käseproben diesbezüglich untersucht. Es handelte sich um als Schaf- und Ziegenkäse, Weichkäse<br />
und Feta bezeichnete Käsesorten, die lose oder als Fertigpackung angeboten wurden. Bei vier Proben wurden<br />
erhebliche Gehalte an Laurinsäure in der Fettsäuremethylesterverteilung (ca. 45 %) festgestellt. Buttersäure war<br />
praktisch nicht nachweisbar. Die Gehalte lagen unter 0,2 g / 100 g Triglycerid. Bei vier weiteren Proben wurden<br />
Laurinsäureanteile zwischen 12 und 19 % ermittelt. In diesen Fällen wurde als weiterer charakteristischer<br />
Bestandteil Linolsäure in einer Größenordnung von 30 bis 38 % bzw. Palmitinsäure festgestellt. Solche hohen<br />
Gehalte an Laurinsäure geben einen Hinweis auf die ausschließliche bzw. überwiegende Verwendung von<br />
Pflanzenfett bei der Herstellung des Erzeugnisses. Es handelte sich bei den beanstandeten Proben in allen<br />
Fällen um lose Ware. Die Untersuchungsbefunde des Vorjahres wurden durch die neuen Analysenergebnisse<br />
tendenziell bestätigt.<br />
Wie im Vorjahr wurden Käseproben (66) auf ihren Gehalt an Natamycin untersucht. Natamycin ist ein<br />
Antibiotikum, welches von bestimmten Bakterien produziert wird und gegen Schimmelpilze und Hefen wirkt. Es<br />
wird als Konservierungsstoff zur Oberflächenbehandlung von Hartkäse, Schnittkäse und halbfesten Schnittkäse<br />
eingesetzt. Seine Zulassung ist in der ZZulV, Anlage 5 Liste 2 geregelt, seine Verwendung muss kenntlich<br />
gemacht werden. Bei 16 der untersuchten Käse (24 %) wurde Natamycin nachgewiesen, ohne dass dies<br />
kenntlich gemacht war.<br />
In einem weiteren Untersuchungsprogramm wurden 19 Käseproben (geräuchert oder mit geräucherten<br />
Zusätzen, wie z. B. Schinken) auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. PAK<br />
entstehen bei jeglicher Verbrennung von organischem Material und somit auch beim Räuchern von<br />
Lebensmitteln. Einige von ihnen besitzen kanzerogene Eigenschaften. Als analytische Leitsubstanz wird<br />
Benz(a)pyren herangezogen. Es wurden keine Rückstände nachgewiesen.<br />
32 Käseproben in Fertigpackungen aus Kunststoff wurden auf Phthalate untersucht. Phthalate dienen u. a. als<br />
Weichmacher z. B. in Kunststoffverpackungen. Fettreiche Lebensmittel stellen im Bereich der Nahrungsmittel die<br />
Hauptaufnahmequelle dar, denn darin können sich Phthalate aufgrund ihrer Fettlöslichkeit anreichern.<br />
Erfreulicherweise wurden keine Rückstände nachgewiesen.<br />
Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt war die Überprüfung von Käse auf Nitrat, davon 40 Proben im<br />
Rahmen des bundesweiten Überwachungsprogramms (BÜP). Nitrate (E 251 und E 252) sind gemäß Anlage 5<br />
Teil C Liste 1 ZZulV für Hartkäse, Schnittkäse und halbfesten Schnittkäse zugelassen, die Höchstmenge beträgt<br />
50 mg/kg berechnet als Natriumnitrat. Im gereiften Käse nutzt man die bakterizide Eigenschaft des Nitrats bzw.<br />
Nitrits zur Verhinderung von Spätblähungen.<br />
Die Toxizität des Nitrats beruht auf seiner Reduktion zu Nitrit. Nitrat wird bereits in der Mundhöhle wie auch im<br />
Magen- und Darmtrakt durch die dort angesiedelte mikrobielle Flora zu Nitrit reduziert. Dieses kann das<br />
Hämoglobin zu Methämoglobin umwandeln, welches dann nicht mehr für den Sauerstofftransport im Körper zur<br />
Verfügung steht. Daraus resultiert eine Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff (Zyanose). Eine weitere<br />
gesundheitsschädliche Wirkung des Nitrits besteht in der Bildung von N-Nitrosaminen aus sekundären Aminen<br />
insbesondere im sauren Milieu. Nitrosamine zählen zu den krebserregendsten Stoffen überhaupt.<br />
Insgesamt wurden 79 Käseproben auf Nitrat untersucht. Bei 43 Proben war eine Kenntlichmachung<br />
vorhanden, 33 Proben waren nicht entsprechend gekennzeichnet. Bei drei weiteren Proben konnte aufgrund<br />
unvollständiger Zutatenverzeichnisse keine Aussage hinsichtlich der Kenntlichmachung von Nitrat gemacht<br />
werden. Beanstandungen wegen fehlender Kenntlichmachung wurden nicht ausgesprochen, da Käse auch von<br />
Natur aus Nitrat enthalten kann und die Untersuchungen zur Ermittlung eines unteren Richtwertes, von dem ab<br />
mit Sicherheit von einem Zusatz ausgegangen werden kann, noch nicht abgeschlossen sind.<br />
Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsprogramms (BÜP) wurden im Berichtsjahr insgesamt 16 Proben<br />
Mozzarella untersucht. Es handelte sich um abgepackte Ware in Kleinverbraucherpackungen aus dem Handel.<br />
Ziel der Untersuchung war die Überprüfung der Qualität und der mikrobiologischen Beschaffenheit der<br />
Erzeugnisse, insbesondere auch am Ende der Mindesthaltbarkeit. Das Untersuchungsspektrum erstreckte sich<br />
auf eine sensorische Untersuchung sowie auf den Nachweis der aeroben mesophilen Keime, coliformen Keime,<br />
Escherichia (E.) coli, verotoxinbildenden E. coli (VTEC), koagulasepositiven Staphylokokken, Pseudomonaden,<br />
Hefen, Salmonellen und Listeria monocytogenes.<br />
Es wurden jeweils zwei Packungen einer Charge zur Untersuchung eingesandt. Die Teilprobe 01 wurde sofort<br />
nach Eingang in das Institut der Untersuchung zugeführt, mit der Teilprobe 02 wurde ein Lagerversuch<br />
durchgeführt. Hierfür wurden die Packungen entsprechend der Herstellerhinweise bis zum Ende des<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums gekühlt gelagert und anschließend untersucht.<br />
Sechs der insgesamt 16 Proben wurden bemängelt. Zwar war der sensorische Befund unauffällig, der<br />
mikrobiologische Befund war jedoch bei beiden Teilproben aller bemängelten Erzeugnisse auffällig. Insbesondere<br />
184
wurden erhöhte Gehalte an aeroben mesophilen Keimen sowie Pseudomonaden festgestellt. In zwei Proben war<br />
der Gehalt an coliformen Keimen auffällig. Coliforme Keime gelten als Indikatororganismen für mangelhafte<br />
Produkthygiene.<br />
Bei zwei Proben Büffelmilch-Mozzarella aus Italien zeigte die sensorische Untersuchung am Ende der<br />
Mindesthaltbarkeitsdauer Auffälligkeiten. Ein Käse besaß einen milchsauren, bitteren Geschmack, der andere<br />
war teilweise zerfasert und wies einen säuerlichen Geruch und Geschmack auf. Weiterhin waren bereits in den<br />
Teilproben 01 in einem der Käse erhöhte Gehalte an aeroben mesophilen Keimen, im anderen erhöhte Gehalte<br />
an coliformen Keimen enthalten. Die Proben wurden beanstandet.<br />
Eine Erklärung für die sensorischen Veränderungen der Erzeugnisse liegt möglicherweise in einer zu lang<br />
bemessenen Mindesthaltbarkeitsdauer durch den Hersteller oder in einer Unterbrechung der Kühlkette während<br />
der Lagerung und Distribution.<br />
Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass es sich bei Mozzarella um ein in mikrobiologischer Hinsicht<br />
sensibles Produkt handelt. Positiv zu bewerten ist, dass in keiner Probe pathogene Mikroorganismen<br />
nachgewiesen wurden.<br />
Insgesamt 69 Frischkäse und Frischkäsezubereitungen wurden hinsichtlich der Verwendung von<br />
Konservierungsstoffen (Sorbin- und Benzoesäure) untersucht. Sorbinsäure ist als Konservierungsstoff für<br />
derartige Erzeugnisse mit einer Höchstmenge von 1000 mg/kg zugelassen, während Benzoesäure für diese<br />
Produktgruppe nicht zugelassen ist. Die unzulässige Verwendung von Benzoesäure als Konservierungsstoff für<br />
die o. g. Warengruppe konnte erfreulicherweise nicht nachgewiesen werden. Bei einer Probe fehlte die<br />
erforderliche Kenntlichmachung der Sorbinsäure gemäß § 9 Abs. 1 ZZulV.<br />
Im Berichtsjahr wurde an 24 Proben Sauermilchkäse (z. B. Harzerkäse, Stangenkäse, Bauernhandkäse) eine<br />
mikrobiologische Untersuchung auf Listeria monocytogenes durchgeführt. Zu beanstanden war keine der Proben.<br />
Butter<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 111<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 13<br />
Die im Berichtsjahr zur Untersuchung eingereichten Butterproben wurden v.a. auf ihre chemische<br />
Zusammensetzung und die Kennzeichnung überprüft.<br />
Bei einer Sauerrahmbutter wiesen alle vier Butterstücke Stockflecken (Schimmelbefall) auf. Die Butter wurde<br />
als nicht zum Verzehr geeignet beanstandet. Eine Bio-Sauerrahmbutter war ranzig und wurde als wertgemindert<br />
beurteilt. Drei Proben wiesen einen erhöhten Wassergehalt auf und eine Markenbutter fiel durch eine porige<br />
Textur auf. Vier weitere Proben waren auf der Verpackung unzureichend gekennzeichnet.<br />
Zwölf Proben Kräuterbutter wurden im Rahmen des Stichprobenkontrollplans nach der EU-Richtlinie 86/363<br />
auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht. Hexachlorbenzol konnte in fast allen Proben in Spuren<br />
nachgewiesen werden. Weitere Rückstände wurden nicht festgestellt.<br />
Dr. Böhmler, G.; Burmeister, A.; Geßener, C.; Dr. Keck, S.; Dr. Orth, G.; Skerbs, C.; Dr. Thielke S. (LI BS)<br />
4.16.3 Eier und Eiprodukte<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 394<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 43<br />
Rohe Eier<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 107<br />
Anzahl der Beanstandungen*: 41<br />
Die Beurteilung von rohen Eiern richtet sich bezüglich der Qualitätseinstufung, der hygienischen Anforderungen<br />
und der Kennzeichnung nach den EG-Verordnungen 1907/90, 2295/03 und 853/04.<br />
„Frische Eier“ der Güteklasse A müssen bestimmte Frischekriterien erfüllen; die Schale muss sauber und<br />
unverletzt sein, die Luftkammerhöhe darf nur maximal 6 mm betragen, das Eiklar muss klar, durchsichtig und<br />
gallertartig (deutliche Eiklarschichtung sichtbar) sein, das Dotter muss frei von Einschlüssen und fremden<br />
Auflagerungen sein, ein Keim darf nicht erkennbar und der Geruch muss frei von Fremdgeruch sein.<br />
Elf Proben wurden wegen zu großer Luftkammerhöhe und/oder nicht mehr sichtbarer Eiklarschichtung<br />
und/oder sichtbarer Einschlüsse den Anforderungen an Eier der Güteklasse A nicht gerecht.<br />
Beanstandungen bezüglich der Kennzeichnung ergaben sich insbesondere bei der losen Abgabe von Eiern.<br />
Bei „Lose-Verkauf“ von Eiern sind neben den Angaben der Güte- und Gewichtsklasse, die Art der<br />
Legehennenhaltung, die Kenn-Nr. der Packstelle und das Mindesthaltbarkeitsdatum verbunden mit der<br />
Empfehlung für die geeignete Lagerung (nach Kauf kühl lagern) für den Verbraucher deutlich sichtbar am<br />
Verkaufsregal anzubringen.<br />
Weiterhin muss bei Eiern (lose und verpackt) der Erzeugercode auf dem Ei aufgestempelt sein. Dies gilt auch für<br />
die lose Abgabe auf Märkten, jedoch nicht für Eier, die vom Erzeuger ab Hof oder an der Tür unmittelbar an den<br />
185
Endverbraucher abgegeben werden.<br />
Bei 24 Proben war die Kennzeichnung unvollständig und/oder der Erzeugercode fehlte bzw. war teilweise nicht<br />
oder nur schlecht lesbar, da die Stempelfarbe verwischt war.<br />
Benutzte Kleinpackungen von Eiern dürfen nach den Vorgaben des Art. 36 der VO (EG) 2295/03 nicht wieder<br />
verwendet werden.<br />
Bei vier Proben war dies offenbar unzulässigerweise erfolgt.<br />
Als Ekel erregend wurden zwei Proben beurteilt. Bei einer Probe wurden in der Verpackung kleine Insekten<br />
vorgefunden, eine Beschwerdeprobe wies Schimmelbefall sowie einen fauligen Geruch auf.<br />
Insgesamt 19 Proben, davon 16 Planproben, eine Verfolgs- und zwei Beschwerdeproben, wurden auf<br />
Salmonellen untersucht. Bei keiner Probe waren Salmonellen nachweisbar.<br />
Hühnereier gekocht, gefärbt<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 20<br />
Anzahl der Beanstandungen*: 2<br />
Diese Warengruppe kam im Berichtsjahr nicht nur in der vorösterlichen Zeit, sondern das ganze Jahr über z. B.<br />
als „Brotzeiteier“ in den Handel. Geprüft wurde die Genusstauglichkeit (Aussehen, Geruch, Geschmack)<br />
insbesondere bei Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nach Lagerung im Kühlschrank oder bei<br />
Raumtemperatur je nach Hinweis auf der Verpackung, sowie die Art und Weise der Kennzeichnung bzw.<br />
Kenntlichmachung der verwendeten Farbstoffe und die evtl. Verwendung von nicht zugelassenen Farbstoffen.<br />
Bei zwei Proben war das Mindesthaltbarkeitsdatum offenbar zu lang bemessen. Sie wiesen bei Ablauf des<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums deutliche sensorische Mängel (fischiger oder alt/öliger Geruch und/oder Geschmack)<br />
auf.<br />
Eiprodukte und Eizubereitungen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 267<br />
Anzahl der Beanstandungen*: 6<br />
Zu den Eiprodukten zählen z. B. flüssiges und pulverförmiges Vollei, Eiweiß und Eigelb. Zu den Eizubereitungen<br />
zählen z.B. Eierstich, gekochte geschälte Eier und Soleier.<br />
Nikotinrückstände in Eiern eines großen niedersächsischen Eiproduzenten führten zu umfangreichen<br />
Folgeuntersuchungen. Nähere Informationen zu dem Thema sind im Kapitel 4.17.6 zu finden.<br />
Im Berichtszeitraum wurden 17 Proben gekochte, geschälte und in einigen Fällen halbierte Eier aus<br />
Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben mikrobiologisch untersucht. Diese Eier werden z. B. zum<br />
Belegen von Brötchen verwendet oder werden in Salattheken angeboten. Die Proben setzten sich aus Eiern aus<br />
Fertigpackungen sowie losen Proben zusammen. Hart gekochte Eier sind nach dem Kochen nahezu steril. Durch<br />
Hygienemängel beim weiteren Behandeln der Eier wie das Schälen und/oder das Lagern kann es zu einer<br />
Keimbelastung der Eier kommen. Bei drei Proben wurde eine erhöhte Gesamtkeimzahl festgestellt. In keiner der<br />
auf Salmonellen und Enterobacteriaceae untersuchten Proben wurden diese Keime nachgewiesen.<br />
Neben der mikrobiologischen Untersuchung wurde die Temperatur, bei der die Erzeugnisse im Betrieb<br />
gelagert wurden, überprüft. Gekochte, geschälte und ggf. halbierte Eier zählen zu den leichtverderblichen<br />
Lebensmitteln. In zwei Fällen wurde die vom Hersteller der Eier geforderte Lagertemperatur von 0 - 4 °C<br />
überschritten, davon wies eine Probe bereits eine erhöhte Gesamtkeimzahl auf. In einem Fall wurden die<br />
halbierten Eier in einer Salattheke bei 11,4 °C gelagert. Salattheken müssen eine Lagertemperatur von max. 7 °C<br />
gewährleisten. In diesen drei Fällen wurden die Lagerbedingungen in den Entnahmebetrieben bemängelt.<br />
*Mehrfachnennungen pro Probe sind möglich<br />
Nickel, S.; Dr. Thielke, S. (LI BS)<br />
4.16.4 Fleisch und Fleischerzeugnisse<br />
Planproben<br />
Anzahl der untersuchten Planproben: 2.140<br />
Anzahl der beanstandeten Planproben: 715 (33,4%)<br />
Die Beanstandungsgründe ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.<br />
Tabelle 4.16.4.1: Beanstandungsgründe bei Planproben<br />
Anzahl Prozent<br />
2005 2006 2005 2006<br />
gesundheitsschädlich 24 16 0,8 0,7<br />
gesundheitsgefährdend 34 29 1,2 1,4<br />
186
zum Verzehr nicht geeignet 90 76 3,1 3,6<br />
wertgemindert oder irreführend<br />
gekennzeichnet<br />
405 370 13,9 17,3<br />
Verstöße gegen Kennzeichnungs- Vorschriften 432 369 14,9 17,2<br />
unzulässige Verwendung von Zusatzstoffen 22 22 0,8 1,0<br />
Verstöße gegen sonstige Vorschriften 53 51 1,8 2,4<br />
Ziel der Untersuchungstätigkeit war jeweils die Überprüfung, ob die Probe mit den rechtlichen Vorschriften übereinstimmte.<br />
Ist sie geeignet, bei Verzehr die Gesundheit zu schädigen; sind Vorschriften zum vorbeugenden<br />
Gesundheitsschutz missachtet worden; ist die Probe zum Verzehr geeignet; ist sie in ihrem Wert mehr als nur<br />
unerheblich gemindert; stimmt ihre Zusammensetzung mit der Kennzeichnung überein; ist die Kennzeichnung<br />
ausreichend; sind unzulässige Zutaten verwendet worden?<br />
Je nach Fragestellung erfolgte eine Untersuchung auf den mikrobiologischen Status, die stoffliche und<br />
tierartliche Zusammensetzung der Probe bzw. auf die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kenntlich<br />
gemachter Zusatzstoffe. Dazu wurden die Proben nach einer sensorischen Prüfung mit mikroskopischen, mikrobiologischen,<br />
präparativ-gravimetrischen, histologischen, immunologischen und/oder chemischen und<br />
physikalischen Methoden untersucht. Im Anschluss werden schwerpunktmäßig einige der behandelten Themen<br />
dargestellt.<br />
- Mikrobiologische Beschaffenheit von Hackfleisch: keine Änderung bei den Salmonellen<br />
320 Planproben Hackfleisch vom Rind und/ oder Schwein, gewürzt oder ungewürzt, wurden mikrobiologisch<br />
untersucht. In 15 Proben (4,7%) wurden Salmonellen qualitativ nachgewiesen. Dabei handelte es sich in fast<br />
allen Fällen um Salmonella (S.) Typhimurium.<br />
Von 51 Proben Rinderhackfleisch konnte lediglich in einer Probe (0,2%) Verotoxin bildende E. coli und<br />
Verotoxin nachgewiesen werden.<br />
- Campylobacter und Salmonellen in Geflügelfleisch: Campylobacter nach wie vor problematisch<br />
Auch im Jahr 2006 wurde wieder zahlreich frisches Geflügelfleisch auf Campylobacter untersucht. Bei 41,4 % der<br />
128 untersuchten Proben konnten Campylobacter nachgewiesen werden. 40 Proben waren mit Campylobacter<br />
jejuni, acht Proben mit Campylobacter coli und fünf weitere Proben mit beiden kontaminiert. Diese im Vergleich<br />
zum Vorjahr etwas geringere Kontaminationsrate (2006: 45,4%) ist dabei als Schwankungsbreite und nicht als<br />
Rückläufigkeit zu betrachten, denn Aufklärungsarbeit durch entsprechende Angaben in der Kennzeichnung zum<br />
Schutz des Verbrauchers vor Infektionen durch kontaminiertes Geflügelfleisch oder vor Kreuzkontaminationen<br />
durch Zubereitungsfehler ist bisher nicht geleistet worden. Dabei fordert die drastische Zunahme an<br />
Campylobacteriosen des Menschen bei gleichzeitiger Unkenntnis des Verbrauchers bzgl. der Kontaminationsrate<br />
von Geflügelfleisch dringenden Handlungsbedarf sowohl von Herstellerseite als auch von Gesetz gebender Seite.<br />
Salmonellen konnten dagegen nur in 14 Proben nachgewiesen werden (10,9 %). Aus sechs Proben (4,7%)<br />
wurden sowohl Salmonellen als auch Campylobacter isoliert.<br />
- Überprüfung der Haltbarkeitsdauer bei Fleischerzeugnissen in Fertigpackungen: jede fünfte Probe<br />
beanstandet<br />
Im SB-Verkauf angebotene Fertigpackungen mit den verschiedensten Fleischerzeugnissen und<br />
Fleischzuschnitten werden immer beliebter. Zur Überprüfung des auf den Packungen angegebenen<br />
Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatums wurden zahlreiche Lagerungsversuche durchgeführt. Bei Ankunft<br />
erfolgte die Eingangsuntersuchung einer Fertigpackung. Die restlichen Packungen wurden nach Lagerung bis<br />
zum Ende der angegebenen Haltbarkeitsfrist untersucht. Lagen bereits deutliche Veränderungen vor, wurde das<br />
Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum als irreführend beurteilt.<br />
Untersucht wurden 58 Proben Rohschinken in Fertigpackungen, was zur Beanstandung des MHD bei 16<br />
Proben (27,6%) führte. Von 35 Proben rohen Fleischzuschnitten wie z. B. Gulasch wurden neun Proben (25,7%)<br />
diesbezüglich beanstandet. Insgesamt lag die Beanstandungsrate der Lagerungsversuche von<br />
Fleischerzeugnissen bei 19,4% (201 Proben, davon 39 beanstandet).<br />
- Nitrit und Nitrat in Rohschinken: manchmal zu viel<br />
Die Zugabe von Pökelstoffen wie Nitrit und Nitrat muss so dosiert sein, dass beim Inverkehrbringen nach<br />
entsprechender Reifung der Schinken die zugelassenen Höchstmengen von Nitrit (50 mg/kg) und Nitrat<br />
(250mg/kg) nicht überschritten werden. Insgesamt wurden 121 Rohschinken auf ihre Nitrit- und Nitratgehalte<br />
untersucht; 7 Proben wiesen zu hohe Nitritrestgehalte auf. Bei 11 Proben war die zulässige Höchstmenge an<br />
Nitrat überschritten, wobei teilweise mit über 800 mg/kg mehr als das Dreifache der zulässigen Höchstmenge<br />
enthalten war. Ein zu hoher Gehalt an Pökelstoffen wird oft durch Zugabe von zuviel Pökelsalz verursacht. Auch<br />
ist eine hohe Salzkonzentration geschmacklich und aus gesundheitlichen Gründen nicht wünschenswert. Daher<br />
wurde bei 35 Proben der Kochsalzgehalt bestimmt. Bei 6 Proben wurden Salzgehalte über 7 % gefunden, was<br />
zur Beanstandung als „wertgemindert“ führte.<br />
187
- Zusammensetzung von Corned beef und Corned beef in Gelee / Deutschem Corned beef: Oft zu wenig<br />
BEFFE<br />
Für Corned beef, Deutsches Corned beef bzw. Corned beef in Gelee sind Mindestwerte für den Gehalt an<br />
bindegewebsfreiem Muskelfleisch (sogen. BEFFE-Werte) festgelegt, wobei Corned beef als qualitativ<br />
hochwertiger anzusehen ist als Deutsches Corned beef oder Corned beef in Gelee, bei denen der Anteil an<br />
Bindegewebe üblicherweise durch Verarbeitung von Schwarten oder Gelatine höher liegt. 48 Proben wurden auf<br />
Einhaltung der Mindest- BEFFE- Werte untersucht. Bei 15 Proben (31 %) wurden Beanstandungen wegen<br />
Wertminderung oder irreführender Bezeichnung ausgesprochen.<br />
- Konservierungsstoffe in marinierten Fleischerzeugnissen: kein Thema<br />
50 Proben marinierter Fleischerzeugnisse wurden auf nicht deklarierten Zusatz oder eine<br />
Höchstmengenüberschreitung von Sorbin- und Benzoesäure untersucht. Keine der Proben enthielt nicht<br />
deklarierte Konservierungsstoffe.<br />
- Zusammensetzung von Kochschinken: hier besteht Handlungsbedarf<br />
Die Untersuchung von 95 Proben Kochschinken, davon 37 Proben im Rahmen eines Bundesweiten<br />
Überwachungsplans (BÜP), führte zu zahlreichen Beanstandungen. Bei Kochschinken handelt es sich<br />
traditionellerweise um ein hochwertiges Erzeugnis aus gewachsenem Schinkenfleisch, das kein rechnerisch<br />
ermittelbares Fremdwasser enthalten darf und einen Mindestgehalt an Fleischeiweiß im fettfreien Anteil<br />
aufweisen muss. Insgesamt wurden 43 (45,3%) der 95 Proben beanstandet, davon zehn allein aufgrund des<br />
optischen Eindruckes. Es handelte sich um kleinstückig zusammengefügte Erzeugnisse, die einen bereits<br />
grobsinnlich wahrnehmbaren Anteil an brätartiger Substanz aufwiesen. Bei 55 histologisch untersuchten Proben<br />
wurde ebenfalls in 14 Fällen derselben Tatbestand festgestellt. 11 Proben mussten wegen Unterschreitung des<br />
Eiweißgehaltes bzw. entsprechend überhöhter Fremdwassergehalte beanstandet werden.<br />
Collagenabbauprodukte („hydrolysierte Gelatine“) wurde in keiner Probe nachgewiesen. Weiterhin erfolgte eine<br />
Untersuchung der Proben auf Fremdeiweißzusätze (Casein, Molkenprotein, Hühnereialbumin und Sojaprotein). In<br />
keiner der Proben wurden derartige Fremdeiweiße nachgewiesen.<br />
- Zusammensetzung von Rohkasseler und Zusatzstoff- Deklaration: wenig zu bemängeln<br />
Bei rohen Kochpökelwaren wie Rohkasseler, die für eine Zubereitung im Haushalt bestimmt sind, muss der<br />
Eiweißgehalt im fettfreien Anteil mindestens 17 % betragen. 58 Proben wurden in dieser Hinsicht untersucht,<br />
lediglich zwei Proben erfüllten die übliche Anforderung nicht, sondern enthielten dagegen zuviel Wasser. Bei 31<br />
Proben wurde zudem der Gehalt an den Pökelstoffen Nitrit und Nitrat sowie 29 Proben auf einen Phosphatzusatz<br />
untersucht. Lediglich in einer Probe war der Phosphatzusatz nicht kenntlich gemacht. Die Gehalte an Nitrit und<br />
Nitrat waren dagegen bei keiner Probe zu beanstanden.<br />
- Panierte bzw. flüssig gewürzte Puten- und Hähnchenbrustfilets: nicht immer korrekt gekennzeichnet<br />
Puten- und Hähnchenbrustfilets werden häufig „flüssig gewürzt“, d. h. unter Zusatz von Fremdwasser und<br />
Geschmack gebenden Stoffen wie Salz, Zucker und Geschmacksverstärker in den Verkehr gebracht. Eine<br />
derartige Praxis ist zulässig, jedoch muss der Verbraucher aus der Kennzeichnung eindeutig entnehmen können,<br />
dass es sich um ein verarbeitetes Produkt und nicht um reines Hähnchen- oder Putenbrustfleisch handelt.<br />
Außerdem darf die Menge an Flüssigwürzung 8 % bezogen auf den Fleischanteil nicht übersteigen. Insgesamt 26<br />
Proben wurden hinsichtlich Zusammensetzung und korrekter Kennzeichnung untersucht. Sieben Proben wurden<br />
wegen eines deutlich geringeren Fleischanteils als deklariert beanstandet. In diesen Proben wurden<br />
entsprechend zu hohe Mengen an Fremdwasser und/oder Panade gefunden. Der Hinweis auf die Flüssigwürzung<br />
war bei fünf Proben nicht ausreichend vorhanden.<br />
- Separatorenfleisch: Verarbeitung zum Teil ohne ausreichende Kenntlichmachung<br />
Die Verarbeitung von Separatorenfleisch ohne entsprechende Kenntlichmachung wurde auch dieses Jahr in<br />
verschiedenen Produkten wie Brühwurst und Döner Kebab festgestellt. Die Ursache der fehlenden Angabe des<br />
Separatorenfleisches liegt u. a. darin, dass oftmals Rohmaterialien unter falscher Bezeichnung in den Verkehr<br />
gebracht werden. Es wurden 14 Proben mit den Bezeichnungen „Baaderfleisch“, „3 mm Fleisch“,<br />
„Verarbeitungsfleisch“ und „entsehntes Fleisch“ von Schwein und Pute auf ihren Gehalt an Calcium und z. T.<br />
auch histologisch untersucht. Bei fünf der 14 Proben wurde auf Grund des deutlich erhöhten Calciumwertes bzw.<br />
der erhöhten Anzahl an Knochenpartikeln die Diagnose „Separatorenfleisch“ gestellt.<br />
Separatorenfleisch darf in zahlreichen Fleischerzeugnissen verarbeitet werden, insbesondere in<br />
Hitzebehandelten Produkten wie z. B. Brühwurst. Der Zusatz von Separatorenfleisch muss jedoch für den<br />
Verbraucher ersichtlich kenntlich gemacht werden, z. B. im Verzeichnis der Zutaten.<br />
Sonstige Untersuchungen (insbesondere Verdachts- und Beschwerdefälle)<br />
- Anzahl der untersuchten Verdachtsproben: 315 Davon beanstandete Proben: 125<br />
(39,7%)<br />
188
- Anzahl der untersuchten Beschwerdeproben: 88 Davon beanstandete Proben: 43<br />
(48,9%)<br />
- Anzahl der untersuchten Verfolgsproben: 122 Davon beanstandete Proben:<br />
67 (54,9%)<br />
Die Beanstandungsgründe ergeben sich aus Tabelle 4.16.4.2<br />
Tabelle 4.16.4.2: Verdachts-, Beschwerde- und Verfolgsproben<br />
Anzahl Prozent<br />
2006 2005 2006 2005<br />
Untersuchte Proben 525 483 100,0 100,0<br />
davon förmlich beanstandet 335 268 63,8 55,5<br />
gesundheitsschädlich 8 9 1,5 1,9<br />
gesundheitsgefährdend 14 20 2,7 4,1<br />
zum Verzehr nicht geeignet 234 139 44,6 28,8<br />
wertgemindert oder irreführend gekennzeichnet 120 116 22,9 24,0<br />
Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften 40 48 7,6 9,9<br />
unzulässige Verwendung von Zusatzstoffen 0 2 0 0,4<br />
sonstige Beanstandungen 12 11 2,3 2,3<br />
Diese Proben wurden aus besonderem Anlass zusätzlich zu den oben aufgeführten Planproben von den<br />
Überwachungsbehörden eingereicht. Es handelte sich z. B. um Verbraucherbeschwerden oder aufgrund eines<br />
Verdachtsmoments entnommene Proben. Die Untersuchung beschränkte sich auf die Klärung des Anlasses, aus<br />
dem die Proben entnommen wurden. Die Beanstandungshäufigkeit lag naturgemäß deutlich höher als bei den<br />
Planproben.<br />
Als Beanstandungsgründe sind hier insbesondere Verderb bzw. Überlagerung zu nennen. An zweiter Stelle<br />
stehen Beanstandungen aufgrund von Wertminderungen oder irreführender Kennzeichnung.<br />
Dr. Rieckhoff, D.; Dr. Kirchhoff, H.; Dr. Orellana, A.;<br />
Dr. Leidreiter, M.; Dr. Pust, J. (LI OL)<br />
4.16.4.1 Untersuchung auf Fremdwasser in Geflügel<br />
Geflügelfleischprodukte enthalten aufgrund des Herstellungsprozesses immer einen unvermeidbaren Anteil an<br />
Fremdwasser, das bei der Abkühlung der Schlachtkörper aufgenommen wird. Zum Schutz des Verbrauchers ist<br />
dieser Anteil durch die EG Verordnung 1072/2000 auf einen festgelegten Prozentsatz begrenzt worden. In<br />
<strong>Niedersachsen</strong> wird die Einhaltung der Verordnung im Veterinärinstitut Oldenburg an Stichproben überprüft. Bei<br />
Geflügelteilstücken erfolgt die Kontrolle über eine chemische Analyse des Wassergehalts im Verhältnis zum<br />
Stickstoffgehalt. Bei erhöhtem Wassergehalt werden Handelsbeschränkungen für das Produkt ausgesprochen.<br />
Von 42 untersuchten Proben von Geflügelteilstücken wiesen fünf Proben erhöhte Fremdwassergehalte auf.<br />
Dr. Djuren, M. (VI OL)<br />
4.16.5 Wurstwaren<br />
Planproben<br />
Anzahl der untersuchten Planproben: 2.327<br />
Anzahl der beanstandeten Planproben: 854 (33,4%)<br />
Ziele und Methoden der Wurstwarenuntersuchung entsprechen prinzipiell denen, die für Fleisch und<br />
Fleischerzeugnisse gelten (siehe 4.16.4). Das kontinuierliche Ansteigen der Irreführungstatbestände seit 2004<br />
prägt den Trend zu steigenden Beanstandungsraten im Wurstwarenbereich mit. Die Beanstandungsrate ist 2006<br />
erneut leicht angestiegen und beträgt für Planproben 36,7 %. (Tabelle 4.16.5.1). Einige ausgewählte<br />
<strong>Schwerpunkte</strong> der amtlichen Untersuchung waren:<br />
Lebensmittelinfektionserreger: weniger Funde bei Wurstwaren<br />
6-mal waren diese mit Infektionserregern kontaminiert und damit im Sinne des geltenden Rechts<br />
gesundheitsschädlich: 393 Rohwürste wurden auf Salmonellen untersucht, dabei erfolgten von manchen Proben<br />
Mehrfachansätze (insgesamt 534). Von 288 (416 Unterproben) streichfähigen Rohwürsten, bei denen ein<br />
erhöhtes Risiko besteht, waren vier positiv. In einem Fall konnten Salmonellen in Teewurst (101 Proben mit 131<br />
189
Unterproben) festgestellt werden. Bei frischen rohen Erzeugnissen wie Zwiebel-Mettwürsten, die als Rohwürste<br />
im Verkehr sind, auch aus oder mit Geflügelfleisch, erwiesen sich deutlich weniger als im Vorjahr (zwei von 125)<br />
als salmonellenhaltig. Von 131 untersuchten Erzeugnissen derselben Produktklasse waren 14 ungenügend<br />
gereift, wiesen noch keinen Rohwurst-Charakter auf und wurden als Rohwurst-Halbfabrikate beurteilt<br />
(Beanstandungsrate: 10,7 %).<br />
Campylobacter, STEC und lebensmittelrechtlich als gesundheitsschädlich geltende Keimzahlen von Listeria<br />
monocytogenes (mehr als 100 Keime/g Lebensmittel) wurden 2006 in verzehrsfertigen Wurstwaren nicht<br />
nachgewiesen. Insbesondere in keiner der gemäß dem bundesweiten Überwachungsplan untersuchten 38<br />
Streichmettwürste (z. B. Teewürste) konnte bei Probeneingang und gegen Ende der Mindesthaltbarkeitsfrist<br />
STEC nachgewiesen werden.<br />
Mindesthaltbarkeit: Mängel bei Haltbarkeits- und Kühlungshinweisen<br />
Lagerungsversuche wurden mit 279 Planproben (insgesamt 780 Packungseinheiten) durchgeführt. Bei Erreichen<br />
des Mindesthaltbarkeitsdatums zeigten davon 75 deutliche Verderbsanzeichen. Das kontrollierte<br />
Mindesthaltbarkeitsdatum war also bei jeder vierten Planprobe nicht zutreffend und als irreführend zu beurteilen<br />
(Beanstandungsrate: 26,9 %).<br />
Wenn bei der Konservenherstellung die Erhitzung praktisch einer Erhitzung im offenen Kessel entspricht, dann<br />
handelt es sich bei dem Erzeugnis um „Kesselkonserven“, bei denen ein geringerer Sterilitätsgrad als bei<br />
Vollkonserven erzielt wird. Kesselkonserven sind bei unter 10 °C gekühlt aufzubewahren und dann etwa ein Jahr<br />
haltbar. Zur Ermittlung der mikrobiellen Beschaffenheit wurden 124 Konservenproben bebrütet und dann<br />
mikrobiologisch und mikroskopisch untersucht. Bei 20 Proben (16,1 %) waren aufgrund des festgestellten<br />
Keimwachstums der fehlende Kühlhinweis bzw. die zu lange Mindesthaltbarkeit zu beanstanden.<br />
Eintrag von Knochengewebe: mehr denn je Betriebskontrollen notwendig<br />
Als ursächlich für den Eintrag von Knochengewebe wird die Verwendung von Separatorenfleisch, welches nach<br />
dem Entbeinen maschinell von Knochen getrennt wird, angesehen. Separatorenfleisch darf nur als solches<br />
gekennzeichnet Verwendung finden. Insgesamt wurde bei 54 Wurstproben der Calciumgehalt im Sediment<br />
bestimmt und der Eintrag von Knochengewebe zum Herstellungszeitpunkt berechnet.<br />
Fünf Proben (9,3 %) galten wegen Knochengehalten über 0,7 % als wertgemindert. Untersuchungsergebnisse,<br />
die zumindest auf Separatorenfleisch hinweisen (Knochengehalte zwischen 0,5 und 0,7 % und histologische<br />
Knochenfunde), aber noch keine Wertminderung begründen, sind weiterhin häufig. Wichtiger Faktor in diesem<br />
Bereich der amtlichen Überwachung ist mehr denn je die Kontrolle verwendeter Zutaten in den<br />
Herstellerbetrieben selbst.<br />
Zusammensetzung von Wurstwaren<br />
Bei Wurstwaren sind in erster Linie der absolute bindegewebsfreie Fleischanteil (BEFFE) und dessen relativer<br />
Anteil am Gesamtfleisch (BEFFE im Fleischeiweiß) von Bedeutung. Insgesamt wurden 1.037 Proben Würste<br />
hierzu untersucht; 38 Proben wurden wegen zu geringer Fleischgehalte und/oder mangelhafter Fleischqualität<br />
beanstandet.<br />
Für Bierschinken ist ein BEFFE- Gehalt von mindestens 13 % als handelsüblich anzusehen; lediglich von einer<br />
Probe wurde dieser Mindestwert unterschritten. Die Fleischqualität war bei keiner Probe zu beanstanden.<br />
Von 107 untersuchten Leberwürsten musste eine Probe wegen zu geringen BEFFE-Wertes beanstandet<br />
werden; die Werte für BEFFE im Fleischeiweiß wurden von drei Proben unterschritten, wobei es sich 2-mal um<br />
Delikatess-Leberwurst handelte. Von 163 Bratwürsten wurde dagegen nur eine Probe beanstandet.<br />
Neben einem Mindestanteil an Fleisch dürfen nach allgemeiner Verkehrsauffassung auch die Gehalte an Fett<br />
und Fremdwasser nicht über das herkömmliche Maß hinausgehen. Bei 18 Proben wurde ein erhöhter<br />
Fremdwasseranteil nachgewiesen, dagegen wurde keine Probe aufgrund eines erhöhten Fettgehaltes<br />
beanstandet.<br />
Anteil und Charakter von Fleisch- bzw. Geflügelfleischeinlage sind sortenabhängig gesetzlichen<br />
Anforderungen unterworfen (siehe Deutsches Lebensmittelbuch, Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse).<br />
Die Grobfleischeinlagen von 182 Proben (darunter Bierschinken, Geflügelfleisch in Aspik, Rotwürste) wurden<br />
manuell frei präpariert und ausgewogen. Laut Deutschem Lebensmittelbuch darf der Verbraucher mindestens 50<br />
% bei Bierschinken erwarten, allein 20 von 129 Bierschinken unterschritten diesen Gewichts- Mindestanteil.<br />
Sechs weitere Beanstandungen fielen auf „Geflügelfleisch in Aspik“. Insgesamt ergaben sich in 29 Fällen<br />
lebensmittelrechtlich relevante Abweichungen wegen Irreführung durch Kennzeichnung (Beanstandungsrate:<br />
15,9 %).<br />
190
Zusatzstoffe in Wurstwaren<br />
Zum Zeitpunkt des Verkaufs von Rohwürsten dürfen diese maximal 50 mg/kg Nitrit und 250 mg/kg Nitrat<br />
enthalten. 203 Proben wurden auf die Einhaltung der Höchstmengen untersucht; eine Probe wies einen zu hohen<br />
Restnitritgehalt auf, 4 Proben mussten wegen einer Höchstmengenüberschreitung an Nitrat beanstandet werden.<br />
Phosphate werden vor allem in Brühwürsten eingesetzt, wo sie das Wasserbindungsvermögen der<br />
Fleischzutaten erhöhen. Ein derartiger Zusatz ist zulässig, muss aber kenntlich gemacht werden. Von 181 Proben<br />
wurden 33 (vor allem Bratwürste und Bierschinken) aufgrund eines nicht deklarierten Zusatzes von Diphosphat<br />
beanstandet; bei weiteren 15 Proben ergab sich ein diesbezüglicher Verdacht, der durch eine Vor-Ort-Kontrolle<br />
überprüft werden sollte.<br />
Bestimmte Farbstoffe dürfen in Wurstwaren bei Kenntlichmachung eingesetzt werden. 35 Proben wurden auf<br />
Farbstoffe untersucht. Bei zwei Proben wurde jeweils ein nicht zugelassener Farbstoff (Angkak bzw. Sandelholz)<br />
nachgewiesen.11-mal war der zugelassene Farbstoff Karminsäure nicht kenntlich gemacht.<br />
Die mit Abstand am häufigsten eingesetzten zugelassenen Geschmacksverstärker sind die Glutaminsäure<br />
bzw. deren Salze. Insgesamt 288 Proben wurden auf Zusatz von Glutaminsäure untersucht. Da aufgrund des<br />
absoluten Gehaltes an Glutaminsäure ein Zusatz nicht immer eindeutig nachgewiesen werden kann, wurde bei<br />
39 Proben zur weiteren Absicherung ein Aminosäurenspektrum erstellt. 37 Proben wurden beanstandet: Bei fast<br />
90 % der beanstandeten Proben fehlte die Kenntlichmachung bei loser Abgabe, bei lediglich 10 % fehlte die<br />
Auflistung im Zutatenverzeichnis.<br />
Ascorbinsäure und Isoascorbinsäure sind beide als Zusatzstoffe zugelassen. Während für Isoascorbinsäure<br />
eine Höchstmenge von 500 mg/kg gilt, darf Ascorbinsäure (Vitamin C) quantum satis bis zu der Menge zugesetzt<br />
werden, die notwendig ist, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Bei 4 von 237 untersuchten Proben fehlte die<br />
Kenntlichmachung von Isoascorbinsäure, 15-mal war die Kenntlichmachung von Ascorbinsäure nicht erfolgt.<br />
Tabelle 4.16.5.1 Beanstandungsgründe, Wurstwaren, Anzahl [N] und prozentuale Anteile [%]<br />
Planproben Nicht- Planproben<br />
[N] [%] [N] [%]<br />
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006<br />
untersuchte Wurstwaren 2806 2327 100,0 100,0 162 122 100,0 100,0<br />
beanstandete Wurstwaren 1004 854 35,8 36,7 87 55 53,7 45,1<br />
nicht sicher (gesundheitsschädlich) 12 6 0,4 0,3 1 0 0,6 0<br />
gesundheitsgefährdend 5 8 0,2 0,3 0 0 0 0<br />
nicht sicher (nicht zum Verzehr geeignet) 23 26 0,8 1,1 22 14 13,6 11,5<br />
Wertminderung 55 82 2,0 3,5<br />
Irreführung 302 265 10,8 11,4<br />
191<br />
45 30 27,8 24,6<br />
Andere 852 587 30,3 25,2 43 36 26,5 29,5<br />
Außerplanmäßige Proben: Beschwerdeproben 20 (davon 7 beanstandet)<br />
Verdachtsproben 26 (davon 18 beanstandet)<br />
Verfolgsproben 72 (davon 30 beanstandet)<br />
Verbraucher reichten 20 Beschwerdeproben über die kommunalen Überwachungsbehörden ein. Jede dritte<br />
Beschwerde zog eine Beanstandung nach sich. Im Rahmen der üblichen Lebensmittelüberwachung obliegt es<br />
den Überwachungsbehörden, zur Klärung von verschiedensten Verdachtsmomenten Verdachts- bzw.<br />
Verfolgsproben einzusenden. Bei vier Verdachtsproben, bei denen laut Vorbericht eine Gesundheitsschädigung<br />
zugrunde lag, wurde keine Ursache für eine solche nachgewiesen.<br />
Anzahl und Beanstandungsrate waren gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig (Tabelle 4.16.5.1). Die<br />
gegenüber Planproben vergleichsweise hohe Beanstandungsrate von 45,1 % (69,2 % bei Verdachts-, 41,7 % bei<br />
Verfolgs- und 35,0 % bei Beschwerdeproben) zeigt aber, dass die außerplanmäßigen Proben als ein effektives<br />
Werkzeug der amtlichen Lebensmittelüberwachung angesehen werden können.<br />
Dr. Kirchhoff, H.; Dr. Leidreiter, M.; Dr. Orellana, A., Dr. Rieckhoff, D. (LI OL)<br />
4.16.6 Fische, Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus<br />
Gemäß Staatsvertrag zwischen den Ländern Bremen und <strong>Niedersachsen</strong> wird die amtliche Untersuchung von<br />
Fisch als Lebensmittel zwischen den beiden zuständigen Landesinstituten aufgeteilt. Die mikrobiologisch zu
untersuchenden Proben werden durch die Außenstelle Bremerhaven des Landesuntersuchungsamtes Bremen<br />
(LUA Bremerhaven) bearbeitet, inklusive der organoleptischen und Kennzeichnungsprüfung sowie der<br />
Beurteilung dieser Proben. Die Bearbeitung der mittels aller übrigen Verfahren zu untersuchenden Proben (auch<br />
in diesen Fällen inklusive deren organoleptischer und Kennzeichnungsprüfung sowie deren Beurteilung) obliegen<br />
dem Institut für Fischkunde Cuxhaven (IfF CUX).<br />
IFF Cux<br />
Im Berichtsjahr wurden im IfF CUX 4.979 Proben (<strong>3.</strong>672 aus <strong>Niedersachsen</strong>, 1.307 aus dem Land Bremen) an<br />
Fischen, Krebs- und Weichtieren und daraus hergestellter Erzeugnissen untersucht, die in 2.604 Einsendungen<br />
(2.046 aus <strong>Niedersachsen</strong>, 558 aus dem Land Bremen) enthalten waren.<br />
Bei den von den niedersächsischen Überwachungsbehörden eingesandten Proben handelte es sich zum einen<br />
um solche, die zufällig, also ohne besonderen Anlass gezogen worden waren. Bei der Untersuchung dieser<br />
Proben waren bei der überwiegenden Zahl keine auffälligen Befunde bzw. Normabweichungen zu erheben. Zum<br />
anderen wurden gezielt Proben für Schwerpunktuntersuchungen angefordert und/oder eingesandt, deren<br />
Auswahl auf Grund eines bestimmten Anlasses oder einer spezifischen Fragestellung erfolgte und bei denen<br />
Normabweichungen von vorn herein zu erwarten waren.<br />
Kennzeichnungsüberprüfungen<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurde bei sämtlichen Fertigverpackungen die Kennzeichnung überprüft. Dabei fiel ein<br />
erheblicher Teil wegen unzureichender oder ungenauer Angaben bezüglich der Haltbarkeitsdaten bei<br />
„Räucherlachs in Scheiben“ auf.<br />
Organoleptische Beschaffenheit und TVB-N-Wert<br />
Von 2.604 Einsendungen waren 32 aus <strong>Niedersachsen</strong> (keine aus Bremen) wegen erheblicher organoleptischer<br />
Abweichungen zu beanstanden. Bei der Ermittlung des TVB-N-Wertes von 69 Einsendungen (53 aus<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, 16 aus Bremen) wurde in 20 Fällen (elf aus <strong>Niedersachsen</strong>, neun aus Bremen) die<br />
organoleptische Beanstandung durch den erhöhten TVB-N-Wert bestätigt.<br />
Frisch – oder Frostfisch (außer Wildlachs)<br />
Nach wie vor ist im Bewusstsein des deutschen Verbrauchers die Sicherheit und die Qualität des auf dem<br />
deutschen Markt im Verkehr befindlichen Frisch – oder Frostfisches generell von herausragender Bedeutung.<br />
Das IfF CUX hat sich daher auch 2006 intensiv mit dieser Fragestellung befasst. Unter anderem wurden die<br />
eingegangenen Proben auch auf das Vorkommen von Parasiten untersucht. Insgesamt kamen 180 Fischproben<br />
zur Untersuchung (95 aus <strong>Niedersachsen</strong> und 85 aus Bremen), von denen 44 Proben (sieben aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
und 37 aus Bremen) zu beanstanden waren.<br />
Parasiten in Frischfisch<br />
Das Auftreten von Parasiten in Fischen ist natürlich bedingt und lässt sich durch den Menschen nicht immer<br />
vermindern. In Fischen treten Parasiten - hierbei speziell Nematodenlarven - vorwiegend in und an den<br />
Eingeweiden und/oder in den sog. Bauchlappen auf und werden beim Ausnehmen der Fische oder beim<br />
Filetieren zum größten Teil entfernt. Ihr Vorkommen und die Befallstärke sind recht unterschiedlich und vom<br />
Fanggebiet, von der Jahreszeit, von der Fischart und vom Alter des Fisches abhängig. Folgende Parasitenarten<br />
spielen beim Fisch als Lebensmittel eine besondere Rolle: Nematoden, Cestoden, Trematoden, Copepoden,<br />
Mikrosporidien. Eine gesundheitliche Gefährdung des Menschen kann in seltenen Fällen lediglich vom lebenden<br />
Parasiten ausgehen. Da alle Parasitenarten ab +60 °C nach wenigen Minuten oder bei – 18°C nach wenigen<br />
Tagen abgetötet werden, wird durch alle thermischen Garprozesse oder durch Tiefgefrieren ein Schutz für den<br />
Menschen vor Erkrankungen erreicht. Grundsätzlich ist jedoch (zumal in Deutschland) davon auszugehen, dass<br />
der Anblick oder der Verzehr von parasitenhaltigem Fisch beim Verbraucher Ekel erregen kann und daher nicht<br />
zu tolerieren ist. Beim Verzehr von rohem Fisch mit lebenden Parasiten ist eine Erkrankung nicht auszuschließen,<br />
in Europa und den USA sind derartige Fälle jedoch wegen der dortigen Verzehrsgewohnheiten bis jetzt sehr<br />
selten.<br />
Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen in der EU müssen Unternehmer im Fischereisektor auf jeder Stufe der<br />
Herstellung von Fischereierzeugnissen, d. h. vom Filetierbetrieb über den Fischgroßhandel bis zum Einzelhändler<br />
192
Eigenkontrollen durchführen um zu verhindern, dass sichtbar mit Nematoden befallene Fische als Speisefisch<br />
vermarktet werden. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden heute in Deutschland auf allen Stufen der Vermarktung<br />
Sichtkontrollen mit der Durchleuchtungsmethode gefordert. Maßgeblich bedeutend zur Reduzierung der<br />
Nematodenbefallswahrscheinlichkeit von Fischfilets ist jedoch die sachgerechte vollständige Entfernung der<br />
Bauchlappen, da dadurch der überwiegende Teil der Nematodenlarven entfernt werden kann. Aufgrund der nach<br />
wie vor in Deutschland vorhandenen Verbrauchersensibilität bezüglich des Vorkommens von Nematoden in<br />
Fischereierzeugnissen wurden 2006 wiederum Frischfischfiletproben mit der Durchleuchtungsmethode auf<br />
Parasiten untersucht. Mehr als in den Jahren zuvor waren ca 25 % der untersuchten Frischfischproben wegen<br />
Nematodenbefunden zu beanstanden.<br />
In der überwiegenden Zahl der Fälle gingen die Parasitennachweise mit einer nicht ausreichenden Entfernung<br />
der Bauchlappen am Ende des Filetierens einher. Dies ist als eindeutiger Verstoß gegen die „gute<br />
Verarbeitungspraxis“ im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahmen der Filetierbetriebe zu bewerten. Auch<br />
wenn die Durchleuchtungsmethode während der Filetierung und die anschließende stichprobenartige Kontrolle<br />
der Endprodukte in Verbindung mit der Sichtkontrolle auf allen Folgestufen der Vermarktung keine absolute<br />
Sicherheit des Parasitenausschlusses gewährleisten können, sind die Untersuchungsergebnisse doch<br />
unbefriedigend. Es bestehen Anzeichen und das unzureichende Entfernen von nematodenhaltigen Bauchlappen<br />
ist ein Beleg dafür, dass die Parasitenproblematik wieder etwas lockerer gesehen und gehandhabt wird, deshalb<br />
scheint es angebracht, die Frischfisch verarbeitenden Betriebe daran zu erinnern, die Produktion selbst intensiver<br />
zu kontrollieren und auch daran, dass sie insbesondere von den Überwachungsbehörden wieder regelmäßig und<br />
bis ins Detail im Sinne des Verbraucherschutzes überprüft werden.<br />
Fischartenbestimmungen bei Frischfischfilets<br />
193<br />
Dr. Etzel, V. (IfF CUX)<br />
Im Untersuchungsjahr wurden 78 Frischfischproben durch Auftrennung der Muskelproteine und den jeweiligen<br />
Vergleich mit Referenzmaterial in der Elektrophorese auf die tatsächliche Fischart hin untersucht. In keinem Fall<br />
wurde eine Beanstandung ausgesprochen.<br />
Forschungsschwerpunkt „Aquakulturprojekt“ : Aquakulturprojekt III „Entwicklung eines Beprobungs- Konzeptes<br />
zur Überwachung der Betriebshygiene in Aquakulturbetrieben in <strong>Niedersachsen</strong> im Zuge der EU- Überwachung“<br />
In Fortsetzung des Forschungsschwerpunktes „Aquakulturen in <strong>Niedersachsen</strong>“ wurde im Jahr 2006 der<br />
Schwerpunkt auf Untersuchungen zur Betriebshygiene Niedersächsischer Aquakulturbetriebe gelegt. In der Stufe<br />
1 „Voruntersuchungen“ war es das Ziel, unter Berücksichtigung optimaler Probenentnahmeverfahren und je nach<br />
Betriebsstruktur die Probenentnahmepunkte und Hygieneparameter zu ermitteln, insbesondere vor dem<br />
Hintergrund der Listerien- Problematik bei Räucherfisch. Insgesamt wurden aus 5 Niedersächsichen<br />
Aquakulturbetrieben unterschiedlicher Betriebsstruktur 246 Proben genommen.<br />
Aus den Ergebnissen der Voruntersuchungen für die Bereiche<br />
(a) Kontrolle der Reinigung und Desinfektion („R+D“) an insgesamt 130 Proben (NTT-Verfahren),<br />
(b) Beprobungen während der Verarbeitungsschritte („Verarbeitung“) (n=47 Proben) und<br />
(c) Beprobungen von Erzeugnissen („Produkte“, n=69 Proben)<br />
sind folgende Schlussfolgerungen abzuleiten:<br />
• Obwohl sehr unterschiedliche Bedingungen der Produktion in den Betrieben gegeben waren, wurden<br />
ähnlich gelagerte Hygieneschwachstellen festgestellt.<br />
• Die Hygieneschwachstellen sowohl bei der Kontrolle der Reinigung und Desinfektion als auch bei der<br />
Prozesskontrolle waren Siele, Gitter, Bürsten, Messer und Handschuhe.<br />
• Es wurden z.T. sehr hohe Keimgehalte nach Reinigung und Desinfektion (R+D) sowie während der<br />
Schlachtung und Verarbeitung ermittelt .<br />
• Die Beprobungen nach erfolgter R+D ähnlich wiesen häufig ähnlich hohe Keimbelastungen an<br />
bestimmten Probenentnahmestellen auf wie die Beprobungen während der Verarbeitung (je nach<br />
Probenahmepunkt mittels NTT-Verfahren bis zu 105 KBE/cm2 Gesamtkeimzahl sowie<br />
Pseudomonaden).<br />
• In Einzelfällen wurden sowohl in den Tupferproben als auch bei den Untersuchungen der Erzeugnisse<br />
Listerien nachgewiesen, die Hinweise auf betriebsspezifische Probleme gaben.<br />
In den nun folgenden Untersuchungen (Stufe 2) in 2007 wird an einer größeren Anzahl von Betrieben nach einem<br />
abgestimmten Beprobungsschema vorzugsweise die Kontrolle der Reinigung und Desinfektion durchgeführt. Bei<br />
der Produktkontrolle sind Lagerversuche zu berücksichtigen (Beginn MHD, Ende MHD). Die zu untersuchenden<br />
Parameter sind neben der Bestimmung der Gesamtkeimzahl die quantitative Bestimmung der Pseudomonaden<br />
und Enterobakteriaceae sowie die qualitative und quantitative Bestimmung von Listeria spp..
Untersuchung auf Viren in Fischereiprodukten mittels Polymerasekettenreaktion (PCR)<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden im IfF CUX insgesamt 156 Proben auf Noroviren und Hepatitis A-Viren untersucht.<br />
Davon entfielen 94 Proben auf die amtliche Lebensmittelüberwachung, von denen im Berichtszeitraum keine<br />
Proben zu beanstanden waren. Von den 62 Forschungsproben entfielen 52 Proben auf das amtliche<br />
Muschelmonitoring, in dessen Rahmen die Untersuchung auf Viren zu Forschungszwecken durchgeführt wurde.<br />
Weitere 10 Forschungsproben wurden im Rahmen des Verbundprojektes „Mytifit“ mit dem Alfred-Wegener-Institut<br />
für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven bearbeitet. Ziel dieser Untersuchung ist die Erfassung des<br />
Gesundheitszustandes und des Hygienestatus’ von Miesmuscheln aus Offshore-Windparkanlagen im Hinblick auf<br />
die mögliche Verkehrsfähigkeit. In den Forschungsproben konnte ebenfalls kein Nachweis von Viren geführt<br />
werden.<br />
LUA Bremerhaven<br />
194<br />
Dr. Bartelt, E., Dr. Ramdohr, S. (IfF CUX)<br />
Mikrobiologie, Organoleptik, Kennzeichnung.<br />
Im Berichtsjahr 2006 gelangten in der Außenstelle Bremerhaven des Landesuntersuchungsamtes Bremen (LUA<br />
Bremerhaven) insgesamt 1050 Proben aus dem Bereich Fisch zur Untersuchung. 958 amtliche Proben<br />
Fischereierzeugnisse der Lebensmittelüberwachung (514 aus <strong>Niedersachsen</strong>, 444 aus Bremen) wurden<br />
federführend hinsichtlich Mikrobiologie, Organoleptik und Kennzeichnung untersucht und begutachtet. Bei diesen<br />
Proben wurden auch die im Service im IFF Cuxhaven untersuchten chemischen Parameter mit in die Beurteilung<br />
einbezogen. Bei den eingesandten Proben handelte es sich um Plan-, Beschwerde-, Verdachts- und<br />
Verfolgsproben.<br />
24 Proben wurden für das IfF Cuxhaven als mikrobiologische Service-Untersuchungen im LUA Bremerhaven<br />
durchgeführt. Weiterhin gelangten 73 Tupferproben (43 <strong>Niedersachsen</strong>, 30 Bremen) von Herstellerbetrieben zur<br />
Untersuchung.<br />
Die Warenaufteilung ist in Abb. 1 dargestellt.<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Frischfisch<br />
heißgeräucherter Fisch<br />
Räucherlachs<br />
Graved Lachs<br />
Thunfisch in Lake od. Oel<br />
Nordseekrabben<br />
Salate mit Fischereierz.<br />
Lachsersatz<br />
sonstige Fischereierz.<br />
gesamt<br />
n.b.<br />
beanst.<br />
Insgesamt wurden 15 % der eingesandten Proben der Warengruppen 10, 11, 12 (Fischereierzeugnisse)<br />
beanstandet. Das Verhältnis von nicht zu beanstandeten zu beanstandeten Proben innerhalb der Warengruppen<br />
ist den Abb. 2 und 3 zu entnehmen.
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Frischfisch<br />
heißgeräucherter Fisch<br />
Räucherlachs<br />
sonstige Fischereierz.; 291<br />
Lachsersatz; 65<br />
Graved Lachs<br />
Feinkostsalate; 145<br />
Mikrobiologie Räucherlachs, Graved Lachs<br />
Thunfisch in Lake od. Oel<br />
195<br />
Nordseekrabben<br />
Salate mit Fischereierz.<br />
Nordseekrabben; 73<br />
Lachsersatz<br />
Frischfisch; 173<br />
sonstige Fischereierz.<br />
beanst.<br />
n.b.<br />
heißgeräucherter Fisch; 93<br />
Räucherlachs; 83<br />
Graved Lachs; 21<br />
Thunfisch in Lake od. Oel; 68<br />
2006 wurden 83 Räucherlachse, zum größten Teil als Räucherlachs in Scheiben, untersucht. Wie auch in den<br />
Berichtsjahren zuvor, wiesen die Räucherlachse eine hohe Listeria monocytogenes (L. m.) – Belastung auf.<br />
Gegenüber dem Vorjahr wurde sogar ein Anstieg festgestellt. Während im Jahr 2005 die Kontamination 26%<br />
betrug, waren es 2006 33% Räucherlachse, die eine L. m. – Belastung aufwiesen. Erfreulicherweise lagen die<br />
gefundenen Belastungen, bis auf zwei Proben, unter 100 KBE/g. Keine Probe musste als „geeignet die<br />
Gesundheit zu schädigen“ eingestuft werden. Des weiteren wurden 21 Graved Lachs - Proben zur Untersuchung<br />
eingesandt. Listeria monocytogenes Gehalte unter 100 KBE/g wurden bei 4 Proben (19%), Werte darüber, jedoch<br />
unter 1000 KBE/g, bei einem Erzeugnis (5%) nachgewiesen. Als „gesundheitsschädlich“ wurde keine Probe<br />
eingestuft.<br />
Insgesamt wurden 20 % der eingesandten Räucher- und Graved Lachse beanstandet. Häufigster
Beanstandungsgrund waren fehlerhafte Kennzeichnungen.<br />
Mikrobiologie Heißgeräucherter Fisch<br />
Im Berichtsjahr wurden 93 Proben heiß geräucherter Fische untersucht. Davon wurden zwei Proben beanstandet.<br />
Bei einer Probe handelte es sich um eine Verfolgsprobe „geräucherter Heilbutt“ bestehend aus fünf<br />
Einzeluntersuchungen. Hier wurden in einer Probe 300 KBE Listeria monocytogenes /g nachgewiesen.<br />
Die 2. Probe „ger. Heilbuttmittelstücke“ wurde aufgrund einer erhöhten Gesamtkeimzahl und<br />
Enterobacteriaceen als wertgemindert hinsichtlich der Lagerfähigkeit, beanstandet.<br />
Wie auch im Berichtsjahr zuvor waren die mikrobiologischen Beanstandungen in der Warengruppe heiß<br />
geräucherter Fisch niedrig (2%).<br />
Mikrobiologie Frischfisch<br />
Wie in jedem Jahr gehörten auch im Berichtsjahr 2006 Frischfische zum Untersuchungsspektrum. Insgesamt<br />
gelangten 173 Frischfischproben zur Untersuchung. Hiervon waren 31 (18%) zu beanstanden. Die überwiegende<br />
Anzahl von Beanstandungen wurde aufgrund abweichender Organoleptik - vorwiegend ammoniakalischer Geruch<br />
- und wegen erhöhten TVB-N-Gehalten ausgesprochen. Sechs Frischfischproben wurden ausschließlich wegen<br />
abweichender Organloleptik beanstandet. Zwei Rotbarschproben wiesen sogar Verwesungsmerkmale auf. Drei<br />
Proben wurden wegen unerwartet hohen Keimzahlen, z. T. auch in Verbindung mit einer abweichenden<br />
Organoleptik, beanstandet.<br />
Mikrobiologie Thunfisch in Lake oder Öl<br />
Im Jahr 2005 wurden bei der Beprobung von Thunfisch in geöffneten Behältnissen aus Gaststätten und Imbissen<br />
insgesamt 38% der Proben beanstandet. Aufgrund der hohen Beanstandungsquote wurde dieses Programm in<br />
2006 nochmals durchgeführt. Bei unsachgemäßer Lagerung (zu lange und/oder zu warm) von Thunfisch in<br />
geöffneten Behältnissen kann es in Folge hoher Keimbelastungen zur Histaminbildung kommen. Die Befunde aus<br />
2005 belegen, dass eine hohe Keimzahl notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für hohe<br />
Histamingehalte darstellt. Eine praktikable und sichere Methode zur Vermeidung von hoher Keimbelastung und<br />
Histaminbildung ist die Verwendung von kleinen Packungseinheiten.<br />
Im Berichtsjahr gelangten 68 Thunfischproben in Lake oder Öl aus geöffneten Behältnissen zur Untersuchung.<br />
25 Proben wurden beanstandet aufgrund von zu hohen Keimzahlen, vorwiegend Gesamtkeimzahl und<br />
Pseudomonaden, in einigen Fällen in Verbindung mit einer abweichenden Organoleptik.<br />
Die Beanstandungsquote lag unverändert im Bereich des Vorjahres, so dass nach wie vor<br />
Untersuchungsbedarf in dieser Warengruppe besteht.<br />
Mikrobiologie Nordseekrabben mit und ohne Schale<br />
Im Berichtsjahr wurden 73 Proben Nordseekrabben, u. a. auch auf Vibrionen, untersucht. Bereits im Jahr 2003<br />
wurde im LUA Bremerhaven erstmalig V. vulnificus aus gekochten Nordseegarnelen (Crangon crangon) isoliert.<br />
Wie Untersuchungen auch 2006 an der Ostsee zeigten, stellt V. vulnificus in warmen Sommern eine<br />
ernstzunehmende mikrobiologische Kontamination dar. Neben der Ansteckung über Wunden kann es auch bei<br />
der Verarbeitung von kontaminierten Meeresfrüchten sowie deren Verzehr zu Infektionen kommen. Neben<br />
schwersten Wundinfektionen mit Gewebenekrosen sind nach dem Verzehr Septikämien mit hoher Mortalität<br />
beobachtet worden. Vibrio alginolyticus wurde aus 19 Proben isoliert. Potentiell pathogene Spezies wie V.<br />
cholerae, V. vulnificus und V. parahaemolyticus konnten ausgeschlossen werden. Die Beanstandungsquote lag<br />
bei 16%. Drei Proben Krabben in Schale wurden wegen abweichender Organoleptik beanstandet, zwei Proben<br />
waren aufgrund erhöhter Keimzahlen wertgemindert. Ungewöhnlich hohe Keimzahlen führten in vier Fällen zu der<br />
Einstufung verdorben.<br />
Mikrobiologie Lachsersatz<br />
In den letzten Jahren wurde im LUA Bremerhaven die Zunahme der Herstellung von mild gesalzenen<br />
Erzeugnissen im Fischbereich beobachtet. Da diese Entwicklung auch vor typischen hart gesalzenen<br />
Fischerzeugnissen wie Lachsersatz nicht halt machte, wurde ein Programm initiiert, in dem 65 Lachsersatzproben<br />
hinsichtlich Organoleptik, Mikrobiologie, Wasser abs. und Farbstoffe untersucht wurden. Die chemischen<br />
Parameter wurden im IfF Cuxhaven als Service durchgeführt. Ziel dieser Untersuchung war es,<br />
196
Unterscheidungsmerkmale für hart gesalzenen und sog. mild gesalzenen Lachsersatz herauszuarbeiten. Neben<br />
dem absoluten Wassergehalt stellte sich die Organoleptik als zusätzlicher Abgrenzungsparameter heraus.<br />
(Näheres hierzu s. Brennpunkte)<br />
In mikrobiologischer Hinsicht konnten keine signifikanten Unterschiede, sofern die Kühlbedingungen innerhalb<br />
des Mindesthaltbarkeitsdatums eingehalten wurden, festgestellt werden. In neun der 65 untersuchten Proben<br />
(14%) wurde der Nachweis Listeria monocytogenes erbracht, 100 KBE/g wurden jedoch nicht überschritten.<br />
Insgesamt wurden sieben Proben (11%) „Lachsersatz“ beanstandet. Die Beanstandungen erfolgten aufgrund<br />
von zu hohen Hefengehalten, abweichender Organoleptik und irreführender Kennzeichnung.<br />
Mikrobiologie Salate mit Fischereierzeugnissen<br />
Die Untersuchung von 145 Fisch- und Nordseekrabbensalaten stellte 2006 ein weiteres Planprobenprogramm<br />
dar. Es waren zwölf Proben (8%) zu beanstanden. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um<br />
Kennzeichnungsmängel.<br />
Berges, M., Dr. Lindena, U. (LUA Bremen, Außenstelle Bremerhaven)<br />
4.16.7 Öle, Fette<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 417<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 54<br />
Pflanzliche Öle<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 205<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 14<br />
Überprüft wurden fettlösliche Kontaminanten, unerlaubte Herstellungsverfahren, Identität und Kennzeichnung. Die<br />
Proben wurden u.a. wegen irreführender Werbeangaben und Kennzeichnungsmängeln aus den Bereichen<br />
Lebensmittel-, Nährwert- und Loskennzeichnungsverordnung beanstandet.<br />
- Sudanrotfarbstoffe in Speiseölen<br />
Vier Proben Palmöl wurden auf nicht zugelassene Azofarbstoffe geprüft. Eine Beanstandung ergab sich nicht.<br />
Laut einer Entscheidung der Kommission vom 2<strong>3.</strong> Mai 2005 über Dringlichkeitsmaßnahmen hinsichtlich Chilis,<br />
Chilierzeugnissen, Kurkuma und Palmöl sind Partien, in denen die Sudanfarbstoffe I bis IV nachgewiesen<br />
wurden, zu vernichten. Partien, die keine Sudanfarbstoffe enthalten, sind der EU-Kommission zu melden. Eine<br />
Probe wurde aufgrund von Kennzeichnungsmängeln beanstandet.<br />
- Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Speiseölen<br />
Seit dem 1. April 2005 gibt es für Benzo(a)pyren eine gesetzlich festgelegte Höchstmenge von 2,0 µg/kg [ siehe<br />
Verordnung (EG) Nr. 466/2001 der Kommission vom 8. März 2001, geändert durch die Verordnung (EG) Nr.<br />
208/2005 der Kommission vom 4. Februar 2005 ]. 82 Speiseöle wurden diesbezüglich überprüft, bei zwei Ölen<br />
wurden Beanstandungen wegen Höchstmengenüberschreitung ausgesprochen. Die Summe aller PAK lag bei<br />
zehn Proben über 50 µg/kg, d. h. der Richtwert der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung wurde um mehr als<br />
das Doppelte überschritten. Spitzenreiter war eine Probe Kürbiskernöl mit 441 µg/kg.<br />
- Weichmacher (Phthalate) in Speiseölen<br />
Schwerpunktmäßig wurden im Berichtsjahr 87 Ölproben auf Weichmacheranteile untersucht. Zu den Ergebnissen<br />
im Einzelnen wird auf die Ausführungen im Kapitel 4.17.6 verwiesen.<br />
- Stigmastadien in Speiseölen<br />
Insgesamt wurden 57 Proben Speiseöle auf Stigmastadien untersucht. Stigmastadien ist ein Abbauprodukt eines<br />
in Olivenöl und anderen Pflanzenölen enthaltenen pflanzlichen Sterins. Es entsteht bei der starken thermischen<br />
Belastung bzw. Bleichung von Ölen und kann deshalb als Leitsubstanz für eine Raffination herangezogen<br />
werden. Für kaltgepresstes natives Olivenöl gilt ein Stigmastadien-Grenzwert von 0,15 mg/kg. Drei als<br />
„kaltgepresst“ ausgelobte Speiseöle wurden aufgrund stark erhöhter Stigmastadiengehalte beanstandet.<br />
- Fettsäureverteilung (FSV) in Speiseölen<br />
136 Speiseöle wurden auf die Verteilung der Fettsäuren überprüft. Man erhält hierdurch wertvolle Informationen<br />
über die authentische Zusammensetzung von sortenreinen Ölen, korrekte Nährwertkennzeichnung und wichtige<br />
197
Inhaltsstoffe wie essentielle mehrfach ungesättigte Fettsäuren (omega-3 und omega-6-Fettsäuren) oder den<br />
Nachweis von Behandlungsverfahren z. B. über die trans-Fettsäuren. Eine Beanstandung ergab sich im<br />
Berichtsjahr nicht.<br />
- Überprüfung von Olivenölen<br />
84 Olivenöle wurden u. a. auf korrekte Komponentenangabe (Angabe der zutreffenden Olivenölkategorie), FSV,<br />
Fettkennzahlen, Stigmastadien, Kontaminanten (PAK und Weichmacher) und Kennzeichnung untersucht.<br />
Eine Probe natives Olivenöl extra wurde aufgrund einer sensorischen Paneluntersuchung als natives Olivenöl<br />
eingestuft und wegen falscher Angabe der Olivenölkategorie beanstandet.<br />
Zwei Proben wiesen Kennzeichnungsmängel auf. Der gesetzlich tolerierte Gehalt an Benz(a)pyren wurde nicht<br />
überschritten.<br />
Pflanzliche und tierische Fette, flüssige Pflanzencremes und Fettglasuren<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 24<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 3<br />
Bei den pflanzlichen Fetten handelte es sich überwiegend um Brat- und Backfette, bei den tierischen Fetten um<br />
Schmalz. Überprüft wurden Kennzeichnung, Identität und Genusstauglichkeit. Beanstandet wurden fehlende<br />
Kenntlichmachung der Fetthärtung bzw. fehlende Quidangabe (Mengenkennzeichnung von Zutaten) sowie eine<br />
nicht zutreffende Verkehrsbezeichnung.<br />
Frittierfett gebraucht und ungebraucht<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 159<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 32<br />
Gebrauchte Frittierfette und zum Teil die zugehörigen Ausgangsfette wurden regelmäßig auf Genusstauglichkeit<br />
sowie chemische und physikalische Qualitätsparameter geprüft. Bezogen auf die gebrauchten Frittierfette (95<br />
Proben) lag die Beanstandungsquote bei 34 %.<br />
Margarinen und Brotaufstriche incl. Diäterzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 29<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 5<br />
Überprüft wurden die Nährwertangaben, die Kenntlichmachung der Fetthärtung und die Sorte des verwendeten<br />
Pflanzenfettes, wenn eine entsprechende Hervorhebung vorhanden war. Bei den Beanstandungen handelte es<br />
sich um Kennzeichnungsmängel aus dem Bereich der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung sowie der<br />
Margarine- und Mischfettverordnung.<br />
Skerbs, C. (LI BS)<br />
4.16.8 Suppen, Soßen, Mayonnaisen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 549<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 88<br />
Suppen, Soßen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 384<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 64<br />
davon Kennzeichnungsmängel: 40<br />
Es existieren keine Rechtsvorschriften, in denen Beschaffenheitsmerkmale dieser Erzeugnisse verbindlich<br />
festgelegt sind.<br />
Eine Beschreibung der nach allgemeiner Verkehrsauffassung üblichen Beschaffenheit dieser Erzeugnisse liegt<br />
auf nationaler Ebene in den Richtlinien zur Beurteilung von Suppen und Soßen des Bundes für Lebensmittelrecht<br />
198
und Lebensmittelkunde vor, denen auch der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder<br />
und des Bundes (ALS) zugestimmt hat.<br />
Darüber hinaus werden vom Verband der Europäischen Suppenindustrie Beschaffenheitsmerkmale für Brühen<br />
(Bouillons) und Consommés beschrieben, die im Vergleich zur nationalen Verkehrsauffassung zum Teil deutlich<br />
geringere Anforderungen an diese Erzeugnisse stellen.<br />
Die Untersuchung umfasste die Bestimmung wertgebender Zutaten, die Überprüfung deklarierter<br />
Nährstoffgehalte, die Untersuchung auf gentechnisch veränderte Anteile von Reis, Mais und Soja, die Einhaltung<br />
von Höchstmengenregelungen bei der Verwendung von Zusatzstoffen, deren verordnungskonforme Deklaration,<br />
insbesondere bei Abgabe als lose Ware in Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung und<br />
vergleichbaren Einrichtungen.<br />
- Rahmsuppen und -soßen, Sauce Hollandaise<br />
Nach allgemeiner Verkehrsauffassung, wie sie u. a. in der Richtlinie zur Beurteilung von Suppen und Soßen des<br />
Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) beschrieben wird, beträgt der Milchfettanteil in Rahmsuppen<br />
mindestens 10 g/l und in Rahmsoßen mindestens 30 g/l.<br />
In 19 von 20 untersuchten Erzeugnissen entsprachen die Milchfettanteile dem nach allgemeiner<br />
Verkehrsauffassung zu erwartenden Mindestgehalt. In einem unter der Verkehrsbezeichnung „Tomatensuppe mir<br />
Sauerrahm & Shrimps“ in den Verkehr gebrachten Erzeugnis konnte nur ein geringer von Milchfettanteil von<br />
weniger als 4 g/l festgestellt werden.<br />
- Glutamat in Suppen und Soßen<br />
Glutaminsäure und ihre Salze, die Glutamate, werden als Geschmacksverstärker eingesetzt. Die Verwendung<br />
des Geschmacksverstärkers ist insbesondere in der asiatischen Küche weit verbreitet.<br />
Glutaminsäure darf in Lebensmitteln bis zu einer Höchstmenge von 10 g/kg verwendet werden. Ihr Zusatz zu<br />
Lebensmitteln muss kenntlich gemacht werden.<br />
Während ein Gehalt an Glutaminsäure in Fertigerzeugnissen verordnungskonform im Verzeichnis der Zutaten<br />
aufgeführt und die Höchstmengenregelung beachtet wird – dies gilt auch für Erzeugnisse von Herstellern in<br />
asiatischen Ländern – wird nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre eine Kenntlichmachung bei Abgabe<br />
loser Proben in der Gastronomie oft unterlassen und die festgelegte Höchstmenge nicht immer eingehalten. Die<br />
Untersuchung auf Glutamat in zubereiteten Suppen und Soßen, insbesondere aus der asiatischen Gastronomie,<br />
gehört seit Jahren zu den Untersuchungsschwerpunkten mit der immer wiederkehrenden Erfahrung, dass eine<br />
erhebliche Anzahl der eingesandten Erzeugnisse wegen fehlender Kenntlichmachung und<br />
Höchstmengenüberschreitung zu beanstanden waren.<br />
Die hohe Beanstandungsquote insbesondere bei losen Proben zeigt, dass gerade in der Gastronomie und hier<br />
vor allem in asiatischen Restaurants auch in Zukunft ein verstärktes Augenmerk auf die genannte Problematik<br />
gerichtet werden muss.<br />
Von 82 Proben mussten 30 wegen fehlender Kenntlichmachung beanstandet werden.<br />
In zwölf Proben war die Höchstmenge zum Teil erheblich überschritten. Spitzenreiter war eine Gemüsesuppe<br />
aus einem Chinarestaurant mit 20,6 g Glutamat pro kg.<br />
- Überprüfung von Nährwertangaben<br />
In 30 Proben wurden ausgewählte Nährstoffe (Hauptinhaltsstoffe und Vitamine) untersucht. In allen untersuchten<br />
Proben stimmten deklarierte Nährstoffgehalte mit den ermittelten Gehalten hinreichend überein. Hinsichtlich zu<br />
tolerierender Abweichungen wurden die Empfehlung zu Toleranzen für Nährstoffschwankungen bei der<br />
Nährwertkennzeichnung der Arbeitsgruppe „Fragen zur Ernährung“ in der Gesellschaft Deutscher Chemiker,<br />
veröffentlicht in: Lebensmittelchemie (1998) 52:25, zu Grunde gelegt.<br />
- Untersuchung auf gentechnisch veränderte Lebensmittel<br />
Für gentechnisch veränderte Lebensmittel und solche Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Zutaten<br />
enthalten gelten die Etikettierungsvorschriften der Verordnungen 1829/2003/EG und 1830/2003/EG. Mit der<br />
Etikettierung werden Verbraucher und Benutzer des Erzeugnisses über einen Gehalt an gentechnisch<br />
veränderten Anteilen in einem Lebensmittel informiert.<br />
Beprobt wurden Instantsuppen aus der Türkei, Griechenland und osteuropäischen Ländern zur Untersuchung<br />
auf gentechnisch veränderte Anteile an Soja, Mais und Reis.<br />
In zwei von 17 untersuchten Proben konnte gentechnisch verändertes Soja nachgewiesen werden. Die<br />
Kennzeichnung dieser Proben enthielt keinen entsprechenden Hinweis.<br />
Weitere Einzelheiten zur Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnisch veränderte Anteile sind dem<br />
Kapitel 4.17.2. zu entnehmen.<br />
- Kohlsuppe<br />
Die Kohlsuppe wird von vielen Übergewichtigen als Geheimtipp für die Gewichtsabnahme gehandelt, nach dem<br />
Motto: Iss Kohlsuppe und du wirst an Gewicht abnehmen. Die Diät mancher Abnehmwilliger beruht vollständig<br />
auf der Kohlsuppe. Bei der Kohlsuppe handelt es sich um eine kalorienarme Gemüsesuppe, die, wenn sie fast<br />
199
ausschließlich verzehrt wird, zu einer deutlich negativen Energiebilanz führt. Ob die Kohlsuppe darüber hinaus<br />
besondere Effekte auf die Gewichtsabnahme hat, wurde bisher wissenschaftlich nicht belegt. Eine besondere<br />
Wirkung der Kohlsuppe – über die geringe Kalorienaufnahme hinaus – wird jedoch von den<br />
Kohlsuppenanhängern vermutet. Teilweise liest man auch von einer angeblich „magischen“ Wirkung.<br />
Ein niedersächsischer Hersteller ist auf diesen Zug gesprungen und bringt unter der Bezeichnung „magische<br />
Kohlsuppe“ eine Serie von Erzeugnissen in den Verkehr, die neben verschiedensten Gemüsearten Weißkohl als<br />
wesentlichen Bestandteil enthalten, als kalorienarm deklariert werden und dem Zweck einer figurbewussten<br />
Ernährung dienen sollen, um dem persönlichen Wohlfühlgewicht ein Stück näher zu kommen. In diesem<br />
Zusammenhang wird auf mangelnde körperliche Aktivitäten sowie auf eine ungesunde Ernährungsweise - zuviel,<br />
zu fett, zu wenig Obst und Gemüse – hingewiesen. Auf der Internetseite des Herstellers, die in der<br />
Kennzeichnung angegeben wurde, erfährt der Verbraucher unter der Überschrift „Gesund Abnehmen mit der<br />
magischen Kohlsuppe“, dass die magische Kohlsuppe aufgrund des geringen Fettgehalts optimal in eine<br />
energiereduzierte und fettarme Mischkost zur Gewichtsreduktion aber auch zum Gewicht halten integriert werden<br />
kann. Auf der Internetseite wird ein Menüplan zur Gewichtsreduktion vorgestellt, der die „magische Kohlsuppe“<br />
als wesentlichen Bestandteil beschreibt.<br />
Die Aufmachung in ihrer Gesamtheit wurde als geeignet beurteilt, dem Lebensmittel schlankmachende,<br />
schlankheitsfördernde bzw. gewichtsverringernde Eigenschaften zugewiesen.<br />
Eine derartige Bewerbung ist für Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs gemäß § 6 Abs. 1 NKV unzulässig.<br />
- Kennzeichnungsmängel<br />
Von den untersuchten Proben wiesen 40 Proben Kennzeichnungsmängel auf. Es fehlte u. a. die Mengenangabe<br />
wertgebender und für das Lebensmittel charakteristischer Zutaten (QUID) wie Fleisch, Pilze, Gemüse und Sahne<br />
oder diese entsprach nicht der vorgeschriebenen Art und Weise.<br />
Andere Kennzeichnungsmängel betrafen u.a. unvollständige Zutatenverzeichnisse, unvollständige<br />
Nährwertangaben, fehlende Kennzeichnungselemente in deutscher Sprache bei Importware, fehlende<br />
Loskennzeichnung, fehlende Klassennamen und unleserliche Mindesthaltbarkeitsdaten.<br />
- Sonstige Untersuchungen (insbesondere Verdachts- und Beschwerdeproben)<br />
In den sechs eingelieferten Proben konnten die genannten Gründe, die Anlass zur Vorlage der Proben gegeben<br />
hatten, nach dem Ergebnis der Untersuchungen nicht bestätigt werden. Es handelte sich um eine Gemüsesuppe<br />
mit angeblichem Geruch nach Zigarettenrauch, zwei Suppen aus Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung<br />
mit dem Verdacht auf Gesundheitsschädigung, eine erheblich überlagerte Instantsuppe sowie eine Pekingsuppe<br />
und eine Probe „Jägersauce“ mit dem Verdacht der Höchstmengenüberschreitung an Konservierungsstoffen bzw.<br />
an Glutaminsäure.<br />
Mayonnaisen, Salatmayonnaisen, Remouladen, Dressings<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 165<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 24<br />
davon mikrobiologische Befunde: 10<br />
davon Kennzeichnungsmängel: 20<br />
Im Berichtsjahr umfasste die Untersuchung die Überprüfung des Fettgehaltes, des Eigehaltes, die Einhaltung der<br />
Höchstmengen von Süßstoffen und Konservierungsstoffen nebst deren Kenntlichmachung sowie des<br />
mikrobiologischen Status von loser und abgepackter Ware.<br />
Anforderungen an die Beschaffenheit von Mayonnaisen, Salatmayonnaisen und Remouladen werden in den<br />
Europäischen Beurteilungsmerkmalen für Mayonnaise (Code of Practice) beschrieben. Danach beträgt der<br />
Mindestfettgehalt in Mayonnaisen 70%, der Gehalt an reinem Eigelb wird mit mindestens 5 % angegeben.<br />
Konservierungsstoffe und Süßstoffe dürfen unter Einhaltung der in der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung<br />
(ZZulV) festgelegten Höchstmengen zugesetzt werden.<br />
Zwei als Mayonnaisen gekennzeichnete Proben wiesen geringere Fettgehalte auf als für diese Klasse üblich.<br />
Es handelte sich bei diesen Proben der allgemeinen Verkehrsauffassung zufolge nicht um Mayonnaisen. Die<br />
Proben waren als irreführend gekennzeichnet zu beanstanden.<br />
Bei zwölf Proben fehlte die Kenntlichmachung der Konservierungsstoffe Benzoe- und Sorbinsäure. Auffällig<br />
war, dass es sich dabei mit einer Ausnahme um lose angebotene Soßen und Dressings aus Bringdiensten,<br />
Imbissen etc. handelte.<br />
Eine lose Probe French Dressing von einem Pizzastand enthielt den Süßstoff Saccharin, eine entsprechende<br />
Kenntlichmachung fehlte.<br />
- Mikrobiologische Beschaffenheit<br />
200
Hohe Gesamtkeimzahlen sind ein Zeichen für ungenügende Lagerungsbedingungen, daher wurden im<br />
Berichtsjahr auch bei Mayonnaisen, Dressings und Soßen Untersuchungen des mikrobiologischen Status<br />
vorgenommen.<br />
Bei zwei Proben wurde eine erhöhte Gesamtkeimzahl festgestellt, in einer Kräutersoße eines Grillimbisses<br />
wurden daneben Hefekulturen nachgewiesen. Hefebakterien stellen einen notwendigen Ausgangsstoff bei der<br />
Herstellung von vielen Lebensmitteln dar. In Mayonnaisen, Dressings und Soßen jedoch sind sie unerwünscht, da<br />
sie Verderbnis und Fäulnis verursachen.<br />
Gemäß Lebensmittelrecht sind Lebensmittelunternehmer zu Hygienemaßnahmen verpflichtet. Unter anderem<br />
müssen sie dafür Sorge tragen, dass die Aufrechterhaltung der Kühlkette gewährleistet ist (EU (VO) Nr. 852/2004<br />
und EU (VO) Nr. 853/2004). In acht der hier untersuchten Proben unterblieb die vorgeschriebene Kühlung der<br />
Ware, was zur Bemängelung führte.<br />
Dr. Held, R.; Burmeister, A. (LI BS)<br />
4.16.9 Feinkostsalate, vorgefertigte Salatmischungen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 308<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 131(= 43 %)<br />
Das Angebot an Salaten nimmt ständig zu. Mittlerweile werden in fast allen großen Lebensmittelgeschäften<br />
sowie in vielen Backwaren-Verkaufsshops, insbesondere in Bahnhöfen, vorgefertigte Salatmischungen in<br />
Fertigpackungen angeboten – manchmal ist die Plastikgabel gleich dabei. Aber auch Feinkostsalate erfreuen sich<br />
großer Beliebtheit. In 2006 wurden 110 lose Proben und 198 Fertigpackungen Salatmischungen und<br />
Feinkostsalate zur Untersuchung eingereicht, darunter die „Klassiker“ Fleisch-, Geflügel-, Nudel- und<br />
Kartoffelsalat, aber auch etwas ausgefallenere Varianten wie „Grüner Salat Manhattan Mix“, „New York<br />
Salatschale Geflügel“ oder „Griechischer Hirtensalat mit Feta“.<br />
Von den 198 Fertigpackungen mussten 61 wegen Kennzeichnungsmängeln beanstandet werden. Ein häufiger<br />
Beanstandungsgrund: Die Zutaten von zusammengesetzten Zutaten wurden nicht aufgeführt. Die dieser<br />
Beanstandung zugrunde liegende Änderung der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung vom November 2005<br />
(Wegfall der „25 %-Regelung“) wurde von vielen Herstellern noch nicht umgesetzt.<br />
Untersuchung auf Zusatzstoffe<br />
Insgesamt wurden 190 Proben (69 lose Proben und 121 Fertigpackungen) auf ihre Gehalte an Zusatzstoffen<br />
untersucht. 25 lose Proben mussten wegen der fehlenden Kenntlichmachung von Konservierungsstoffen (auch<br />
Nitritpökelsalz) und/oder Süßstoffen beanstandet werden. Bei einem „Kräuterfleischsalat“ wurde die Angabe<br />
„ohne Konservierungsstoffe“ als irreführend beurteilt, weil das Fleischbrät mit Nitritpökelsalz umgerötet war, das<br />
bekanntlich die Konservierungsstoffe Natrium- und/oder Kaliumnitrit enthält. In einer losen Probe Bohnensalat<br />
wurde ein Gehalt an dem Süßstoff Saccharin von 219 mg/kg nachgewiesen. Die zulässige Höchstmenge von 160<br />
mg/kg war hier deutlich überschritten. Auch eine lose Probe Porreesalat musste aufgrund einer<br />
Höchstmengenüberschreitung, diesmal an dem Konservierungsstoff Sorbinsäure (2300 mg/kg statt maximal 1500<br />
mg/kg), beanstandet werden.<br />
Von 121 Fertigpackungen fehlten immerhin bei elf Proben die Angaben von Zusatzstoffen im<br />
Zutatenverzeichnis, davon war in sechs Fällen Saccharin nicht angegeben und auch nicht in Verbindung mit der<br />
Verkehrsbezeichnung kenntlich gemacht. Der Süßstoff Saccharin ist häufig in Gewürzgurken enthalten und<br />
gelangt über diese in Feinkostsalate. Ein Gehalt an Süßstoffen muss – unabhängig von der Höhe – deklariert und<br />
zusätzlich in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung kenntlich gemacht werden. Die Ausnahme, dass eine<br />
Angabe nur dann erforderlich ist, wenn der Zusatzstoff technologisch wirksam ist, gilt hier nicht.<br />
Untersuchung auf Benzol<br />
Acht mit Benzoesäure konservierte Feinkostsalate wurden auf das krebserregende und erbgutschädigende<br />
Benzol untersucht, das möglicherweise aus Benzoesäure entsteht. Die ermittelten Benzol-Gehalte lagen<br />
zwischen 0,9 und 7,4 µg/kg, im Mittel bei 3,9 µg/kg. Eine ausführliche Erläuterung der Problematik findet sich in<br />
Kapitel 4.17.6.<br />
Untersuchung fettreduzierter Feinkostsalate auf ihren Fettgehalt<br />
Bei zwölf Feinkostsalaten, die als „light“ oder in ähnlicher Form als fettreduziert ausgelobt waren, wurden die<br />
Fettgehaltsangaben überprüft. Eine Beanstandung ergab sich hieraus nicht, die ermittelten Werte stimmten mit<br />
201
den deklarierten gut überein.<br />
Allerdings fiel eine Probe Eiersalat auf, die mit der Aussage „40 % weniger Fett“ beworben worden war. Sie<br />
wies einen Fettgehalt von 14,1 % auf. Nach hier vorliegenden Informationen enthalten herkömmliche Eiersalate<br />
21 bis 22 % Fett. Bei einer Reduktion des Fettgehaltes um 40 %, wie auf der Probe ausgelobt, errechnet sich ein<br />
Fettgehalt von 12,6 bis 13,2 %. Der Fettgehalt der Probe lag mit 14,1 % deutlich darüber. Die Angabe „40 %<br />
weniger Fett“ wurde daher als irreführend beurteilt, der Hersteller wurde um Stellungnahme gebeten.<br />
Entsprechendes gilt für einen „Kartoffelsalat mit Bärlauch“, der auf der Verpackung die Angabe „30 % weniger<br />
Fett“ trug und einen Fettgehalt von 11,3 % aufwies. Hier zur Untersuchung vorgelegte Kartoffelsalate enthielten<br />
zwischen 9 und 15 % Fett, lediglich einer lag mit 19 % deutlich höher im Fettgehalt. Selbst bezogen auf ein<br />
Produkt mit 15 % Fett dürfte ein Kartoffelsalat mit einem um 30 % reduzierten Fettgehalt maximal 10,5 % Fett<br />
aufweisen. Hiesigen Erachtens ist von einem durchschnittlichen Fettgehalt bei Kartoffelsalaten von unter 15 %<br />
auszugehen. Entsprechend liegen die Fettgehalte der fettreduzierten Ware anderer Hersteller bei 7 bis 8 %. Auch<br />
hier wurde die Angabe „30 % weniger Fett“ als irreführend beurteilt und der Hersteller aufgefordert, Stellung zu<br />
nehmen.<br />
Die weiteren fettreduzierten Feinkostsalate dieser Probenserie, darunter Geflügelsalate, ein Fleischsalat,<br />
Nudel- und Eiersalate, ein Blumenkohl-Brokkoli-Salat und ein Krabbensalat, enthielten zwischen 3,9 und 10 %<br />
Fett.<br />
Überprüfung des mikrobiologischen Status von Feinkostsalaten<br />
32 als Planproben eingesandte Feinkostsalate (19 lose Proben, 13 Fertigpackungen) unterschiedlicher Art<br />
wurden nach dem Untersuchungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie(DGHM)<br />
mikrobiologisch untersucht. Davon mussten 11 Proben (34,4 %) bemängelt bzw. als nicht zum Verzehr geeignet i.<br />
S. von Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 b der VO (EG) 178/2002 oder bei entsprechendem Befund am<br />
Ende des angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums als irreführend i. S. des § 11 Abs. 1 LFGB beanstandet<br />
werden. Am häufigsten fielen die Proben durch hohe Gehalte an Hefen auf, die z. T. auch zu sensorischen<br />
Veränderungen führten. Pathogene Keime wurden erfreulicherweise auch in diesem Jahr nicht nachgewiesen.<br />
Neun Feinkostsalate wurden als Verdachts-, Beschwerde- oder Verfolgsproben zur mikrobiologischen<br />
Untersuchung eingereicht. Sechs von ihnen waren hygienisch einwandfrei, zwei Proben mussten wegen erhöhter<br />
Hefengehalte bemängelt werden, und eine Probe wurde als nicht zum Verzehr geeignet beanstandet.<br />
Dr. Nutt, S.; Dr. Pust, J. (LI OL)<br />
4.16.10 Getreide und Getreideerzeugnisse einschließlich Brot und Backwaren<br />
Getreide<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 159<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 5<br />
Untersucht wurden u. a. die Brotgetreidearten Weizen (48) und Roggen (21), aber auch Hafer (14), Mais (16) und<br />
Reis (49), wobei die Zahlen beim Reis nicht die Proben auf die gentechnischen Untersuchungen einbeziehen. Die<br />
Beanstandungsquote ist mit 3,1% erfreulich niedrig. Die Untersuchungen auf Mutterkorn in Roggen – vorwiegend<br />
aus niedersächsischen Mühlen - führten zu keiner Beanstandung. Der Trend zu geringen Beanstandungen<br />
hinsichtlich dieser Problematik setzt sich im Berichtsjahr fort. In der Regel wird Mutterkorn wirkungsvoll durch die<br />
Mühlenwirtschaft aus dem Getreide herausgereinigt, bevor es vermahlen wird.<br />
Insgesamt wurden 52 Proben Roggen und Weizen auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln geprüft. Die<br />
meisten Proben stammten aus niedersächsischem Anbau. Im Frühjahr 2006 wurden die Ernteprodukte der<br />
Vorjahresernte geprüft und im Herbst 2006 die frisch geernteten Produkte. Das Ergebnis der Untersuchungen ist<br />
als sehr positiv zu bewerten: 75 % aller Getreideproben waren rückstandsfrei. In zehn Proben wurde das<br />
Vorratsschutzmittel Pirimiphosmethyl in Mengen weit unterhalb der Höchstmenge nachgewiesen. Drei weitere<br />
Produkte wiesen geringe Gehalte anderer Pflanzenschutzmittel auf.<br />
In einer Probe Milchreis waren zahlreiche Käfer (Reiskäfer) vorhanden. Die Entwicklung des Käfers verläuft<br />
ähnlich wie beim Kornkäfer in einem Getreidekorn ab. Ein Befall ist daher zunächst nicht erkennbar. Erst am<br />
Ende der Entwicklung verlässt der Käfer das Korn. In einer Probe Popcorn-Mais befand sich ein dunkler, harter<br />
nicht näher identifizierbarer Fremdkörper. Auf einer Fertigpackung mit Buchweizen fehlte das<br />
Mindesthaltbarkeitsdatum; eine Probe musste wegen unzureichender Nährwertangaben beanstandet werden.<br />
Während beim Mais (zur Herstellung von Popcorn) nach der Untersuchung auf gentechnische Veränderungen<br />
die Proben durchweg nicht zu beanstanden waren, wurden in zahlreichen Reisproben gentechnische<br />
Veränderungen entdeckt, die in der EU nicht zugelassenen sind, was zu entsprechenden Beanstandungen<br />
führte. Die Ergebnisse hierzu sind in dem Kapitel 4.17.2 „Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische<br />
202
Veränderung“ nachzulesen.<br />
Weitere Schwerpunktuntersuchungen sind in den Kapiteln 4.17.4 „Mykotoxine“ und 4.17.5 „Pestizide und<br />
Nitrate“ zu finden.<br />
Getreideerzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 472<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 77<br />
Zu den Getreideerzeugnissen gehören Erzeugnisse wie Schrote, Mehle und Gries, Kleie, Flocken,<br />
Frühstückscerealien, Müsli und Müsliriegel, Popcorn, Reiswaffeln usw. Fertigmehle und Grundmischungen für<br />
Brot und Feine Backwaren sowie Teige und Massen zur Herstellung von Brot und Kuchen.<br />
- Mehle und Grieße<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 150<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 20<br />
In Roggenmehlen wird Mutterkorn über dessen Inhaltsstoffe, die Mutterkornalkaloide, bestimmt. In den Mehlen<br />
unterschiedlicher Typen wurden die Alkaloide nachgewiesen. Aber nur in einer Probe (Roggenmehl Type 1150)<br />
lag ein erhöhter Gehalt vor. In der Nachprobe Roggen(körner) wurde allerdings nur ein sehr geringer<br />
Mutterkornanteil von 0,02% ermittelt (siehe Abbildung 4.16.10.1).<br />
Abbildung 4.16.10.1: Mutterkornalkaloide<br />
Anzahl<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Bei drei von 48 Proben wurde die Type beanstandet. Mehle sind nach der Mehltypenregelung DIN 10355 in<br />
unterschiedliche Typen eingestuft. Die Typenzahl (z.B. 550) gibt dabei den Mineralstoffgehalt in Milligramm pro<br />
100 Gramm der Trockenmasse des Mehles an. Der Gehalt darf sich dabei in bestimmten Bandbreiten bewegen.<br />
Weizenmehl mit der Type 550 darf einen Mineralstoffgehalt von 500 bis 630 mg pro 100 g Trockenmasse<br />
aufweisen.<br />
Weitere Beanstandungen wurden ausgesprochen wegen tierischer Schädlinge wie Bücherläuse, Mehlmotten<br />
und Käfer. Vereinzelt wiesen Proben auch ein erhebliches Untergewicht auf.<br />
Sechs Proben Maismehl wurden wegen Überschreitung der Höchstmengen für verschiedene Mykotoxine<br />
(Fumonisine, Zearalenon, Aflatoxine) beanstandet. Die Untersuchungsergebnisse sind in dem Kapitel 4.17.4<br />
„Mykotoxine“ dargestellt. Eine Probe einer Mischung aus Mais- und Cassavamehl fiel durch einen abweichenden,<br />
stark sauren Geschmack auf. Außerdem wurde die zulässige Höchstmenge für Aflatoxine überschritten; daneben<br />
wies die Verpackung diverse Kennzeichnungsmängel auf.<br />
Wegen der Untersuchungen auf gentechnische Veränderungen z.B. in Polenta, Maismehl und -grieß, Popcorn<br />
usw. siehe in dem Kapitel 4.17.2 „Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderung“.<br />
- Frühstückscerealien<br />
Mutterkornalkaloide<br />
< 10 10 - 250 250-500<br />
µg/kg<br />
500-1000 > 1000<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 216<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 35<br />
Die breite Vielfalt der Frühstückscerealien ist durchaus beeindruckend. Hierzu zählen die verschiedenen<br />
Müsliarten und „Crunchis“, Cornflakes, gepuffte „Poppies“ und weitere gefüllte und ungefüllte Getreideprodukte.<br />
Viele Erzeugnisse sind mit Vitaminen und/oder verschiedenen Mineralstoffen angereichert.<br />
Zu Beanstandungen führen immer wieder falsche Nährwertangaben z.B. in Bezug auf den Eiweiß-, Fett-,<br />
203
Vitamin- oder Ballaststoffgehalt. Diese Angaben sind im Grundsatz freiwillig. Wenn der Hersteller aber eine<br />
bestimmte Auslobung vornimmt, wie z.B. „mit vielen Ballaststoffen“ oder „fettarm“ oder die Angabe von<br />
Nährwerten wie Vitaminen oder Mineralstoffen vornimmt, müssen die Anforderungen der<br />
Nährwertkennzeichnungsverordnung eingehalten werden. Außerdem müssen die Angaben im Rahmen<br />
bestimmter Schwankungen auch richtig sein. Weiterhin führten Mängel bei der Kennzeichnung wie unleserliche<br />
Mindesthaltbarkeitsdaten oder die fehlende Loskennzeichnung zu Beanstandungen. Über diese Daten kann sich<br />
der Verbraucher informieren, wie lange das Produkt haltbar ist. Weiterhin hat der Hersteller im Falle einer<br />
Rückrufaktion die Möglichkeit, die Ware gezielt auf dem Verkehr zu nehmen, so dass der wirtschaftliche Schaden<br />
möglichst gering bleiben kann.<br />
Auf die Cumarinproblematik, die aus der Zutat Zimt resultiert, wird auch im Hinblick auf Frühstückscerealien<br />
weiter unten in diesem Kapitel sowie auf die Kapitel 4.16.17, 4.16.26 und 4.16.28 und auf die übergeordneten<br />
Zusammenhänge im Kapitel 3 verwiesen.<br />
Brot und Kleingebäck<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 602<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 112<br />
Deutschland ist wegen seiner großen Vielfalt als „Brotland“ bekannt. Viele Regionen haben ihre<br />
Brotspezialitäten, die außerhalb dieser Regionen oft nur wenig bekannt sind. Die Anzahl der Sorten geht in die<br />
Hunderte. Daher kann nur über einige wenige berichtet werden.<br />
- Mischbrote<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 85<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 13<br />
Die beliebtesten Brotsorten gehören zu den Mischbroten, wobei es sich um Mischungen aus Weizen- und<br />
Roggenmehl handelt. Überwiegt der Weizen(mehl)anteil, liegt ein Weizenmischbrot vor. Im umgekehrten Fall liegt<br />
ein Roggenmischbrot vor. Beanstandet wurde eine stark verbrannte, schwarze Kruste (3-mal), Fremdkörper bei<br />
zwei Broten, wobei es sich Einlagerungen in der Krume von Mehl- bzw. Brotanteilen handelte. Die Brotfehler<br />
wurden als Wertminderung beurteilt. Weitere Beanstandungen ergaben sich wegen der Schimmelbildung bei der<br />
Lagerung von Brot in Fertigpackungen vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum (5x), fader Geschmack<br />
wegen eines zu geringen Salzgehaltes (1-mal), eines muffigen, gärigen und säuerlichen Geruchs bereits bei der<br />
Einlieferung (1-mal) sowie die fehlenden Nährwertangaben nach der NKV (1-mal).<br />
- Roggenbrot und Pumpernickel<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 102<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 20<br />
Zu den Roggenbroten zählen Vollkornbrote aus Roggen, Schinkenbrot, Schwarzbrot und Pumpernickel.<br />
Fünf Proben wurden wegen des Konservierungsstoffs Sorbinsäure beanstandet. Bei den „losen Proben“ war<br />
der Konservierungsstoff nicht kenntlich gemacht, z. B. mit einem Schild an der Ware; bei den verpackten Broten<br />
war der Stoff nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt. Ein Schwarzbrot wurde beanstandet wegen der Auslobung<br />
„ohne Konservierungsstoff“, obwohl ein Sorbinsäuregehalt von 81 mg/kg ermittelt wurde.<br />
Überschreitungen der zulässigen Höchstmenge gab es aber nicht. Weitere Beanstandungen ergaben sich<br />
wegen eines nicht näher identifizierbaren Fremdkörpers im Brot, der Schimmelbildung bei der Lagerung von Brot<br />
in Fertigpackungen bis zum angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum (3x), des fehlenden<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums, der fehlenden Losangabe, des Fehlens einzelner Zutaten im Zutatenverzeichnis oder<br />
auch das Fehlen aller Kennzeichnungselemente.<br />
- Buttertoast<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 30<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 7<br />
Die am häufigsten anzutreffende Produktgruppe aus dem Brotbereich, die Butter enthält, ist Buttertoast. Von den<br />
30 untersuchten Broten war nur eins in Bezug auf den erforderlichen Buttergehalt zu beanstanden. Weitere<br />
Beanstandungen resultierten aus Kennzeichnungsmängeln wie ein fehlendes Mindesthaltbarkeitsdatum, eine<br />
fehlende Zutatenliste, eine fehlende Angabe des Wert gebenden Anteils, der fehlenden Losangabe. Eine Probe<br />
wurde beanstandet wegen der Auslobung „ohne Konservierungsstoffe“, obwohl ein – wenn auch niedriger Gehalt<br />
– an Sorbinsäure in dem Brot vorhanden war.<br />
204
Feine Backwaren insgesamt<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1.853<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 423<br />
- Mikrobiologische Untersuchung<br />
Im Berichtsjahr wurden im LI BS 270 Proben von Feinen Backwaren wie z. B. Produkte mit Obstbelag sowie<br />
Krem- oder Sahnefüllungen mikrobiologisch untersucht, wobei auch die Lagertemperatur im Betrieb überprüft<br />
wurde.<br />
Für die rechtliche Beurteilung wurden die von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie<br />
(DGHM) veröffentlichten Richt- und Warnwerte zugrunde gelegt. In 78 der untersuchten Proben lagen die<br />
nachgewiesenen Keimgehalte über den Richtwerten der DGHM und wurden bemängelt. In den meisten Fällen<br />
wurden die Richtwerte für die Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceae und/oder Hefen überschritten. Einige Proben<br />
wiesen auffällige Gehalte an Pseudomonaden auf. Richtwerte geben eine Orientierung, welches<br />
produktspezifische Mikroorganismenspektrum zu erwarten und welche Mikroorganismengehalte in den jeweiligen<br />
Lebensmitteln bei Einhaltung einer guten Herstellungspraxis zu erwarten sind.<br />
Es wurden 40 Proben aufgrund hoher Keimgehalte beanstandet. In zwei Fällen wiesen die Proben zudem<br />
auch sensorische Abweichungen auf und wurden als zum Verzehr nicht geeignet beurteilt und nach Art. 14 Abs. 1<br />
in Verbindung mit Abs. 2 Buchstabe b VO (EG) Nr. 178/2002 beanstandet. 38 Proben wurden gemäß Art. 4 Abs.<br />
2 VO (EG) Nr. 852/2004 beanstandet. In den meisten Fällen wurden der Richtwert für die Gesamtkeimzahl<br />
und/oder der Warnwert für Enterobacteriaceae deutlich überschritten. Warnwerte geben Mikroorganismen an,<br />
deren Überschreitung einen Hinweis darauf gibt, dass die Prinzipien einer guten Herstellungspraxis verletzt<br />
wurden und zudem eine Gesundheitsgefährdung des Verbrauchers nicht auszuschließen ist. Zu den<br />
Enterobacteriaceae gehört auch Escherichia coli (E. coli). E. coli gilt als Indikatororganismus für faekale<br />
Verunreinigungen, kann aber auch als Krankheitserreger eine Rolle spielen, da enterohämorrhagische E. coli ein<br />
Spektrum verschiedener Erkrankungen verursachen können. Der Warnwert für E. coli wurde in elf Proben<br />
überschritten. In einer Probe wurde ein hoher Gehalt an Bacillus cereus und in zwei Proben wurden koagulasepositive<br />
Staphylokokken über dem Warnwert nachgewiesen. Fünf der aufgrund mikrobiologischer Ergebnisse<br />
beanstandeten Proben wurden ungekühlt und drei Proben unzureichend gekühlt gelagert.<br />
Feine Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung zählen zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Die<br />
Verkehrsfähigkeit dieser Produkte kann nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen erhalten werden, da<br />
hierdurch eine unerwünschte Vermehrung von Mikroorganismen in Grenzen gehalten wird. Nach der DIN 10508<br />
„Temperaturen für Lebensmittel“ sollten Backwaren mit nicht durcherhitzten Auflagen oder Füllungen bei<br />
höchstens +7 °C gelagert werden.<br />
Es wurden 39 Proben aufgrund fehlender Kühllagerung gemäß Art. 4 Abs. 3 Buchstabe d VO (EG) Nr.<br />
852/2004 beanstandet. 14 Proben wurden unzureichend gekühlt. Von den ungekühlt gelagerten Proben wiesen<br />
zehn erhöhte Keimgehalte auf. Darüber hinaus wurden auch bei acht der unzureichend gekühlten Proben<br />
Keimgehalte über den Richtwerten der DGHM nachgewiesen.<br />
- Cumarin<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 197<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 10<br />
Abbildung 4.16.10.2: Cumarin in Getreidprodukten<br />
205
Anzahl<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Unerwartet hohe Cumaringehalte in Zimt, die zuerst durch das CVUA Münster entdeckt wurden, führte zu einer<br />
regen bundesweiten Untersuchungstätigkeit, um einen Überblick über die tatsächliche Datenlage zu erhalten. Da<br />
über die Ergebnisse und toxikologische Bewertung bereits an anderen Stellen ausführlich Stellung genommen<br />
wurde (Links siehe unten), soll an dieser Stelle nur in aller Kürze auf den Sachverhalt eingegangen werden.<br />
Zimt ist eine wichtige Zutat bei der Herstellung u. a. für Lebkuchen, Spekulatius und Zimtsternen. Das<br />
traditionelle Gewürz ist aus der Weihnachtsbäckerei nicht wegzudenken, da es den Gebäcken ein besonderes,<br />
charakteristisches Aroma verleiht. Aber auch andere Lebensmittel wie bestimmte Frühstückscerealien oder<br />
„Milchreis mit Zimt“ werden mit Zimt gewürzt. Im Wesentlichen werden Zimtsorten eingesetzt, die unter dem<br />
Begriff Ceylon-Zimt bzw. Cassia-Zimt zusammengefasst werden. Ceylon-Zimt enthält wenig Cumarin. Cassia-<br />
Zimt weist hohe Cumaringhalte auf, hat aber intensivere und damit bessere sensorische Eigenschaften,<br />
besonders bei Produkten, die einem Erhitzungsverfahren unterzogen worden sind. Daher wird Cassia-Zimt sehr<br />
häufig verwendet, was zu entsprechend erhöhten Cumaringehalten in den entsprechenden Lebensmitteln führt.<br />
Das BfR und die EFSA haben sich mit der toxikologischen Bewertung befasst und einen TDI-Wert (tolerierbare<br />
tägliche Aufnahme) von 0,1 mg/kg und kg Körpergewicht festgelegt. Der Wert gibt die Cumarinmenge an, die<br />
täglich ein Leben lang ohne gesundheitliche Schäden aufgenommen werden kann. Bei normalen<br />
Verzehrsgewohnheiten eines erwachsenen Menschen wird diese Aufnahmenmenge nicht überschritten. Bei<br />
Kindern kann diese Menge jedoch aufgrund des geringeren Körpergewichts leichter überschritten werden. Von<br />
den 197 Proben Getreideerzeugnisse und Backwaren wurden drei Proben Zimtsterne und sieben verschiedene<br />
Proben Frühstückscerealien beanstandet, wobei sich die Bewertung am Schutzbedürfnis von Kindern orientiert<br />
hat. Erstere können wegen ihrer Herstellungsart (Name!) hohe Mengen Cumarin enthalten. Bei letzteren ist die<br />
Aufnahmemenge und das geringe Körpergewicht der Zielgruppe (Kinder) als problematisch anzusehen, so dass<br />
aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes die Waren wegen Überschreitung des TDI-Wertes aus<br />
dem Verkehr genommen werden mussten. Die Hersteller sind von den Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
aufgefordert worden, für eine Minimierung der Cumaringehalte in ihren Produkten zu sorgen. Erste<br />
Untersuchungen deuten an, dass es den Herstellern gelungen ist, die Rezepturen in diesem Sinne umzustellen.<br />
Ob das Ziel dieser Maßnahmen erreicht worden ist, wird in dem Jahresbericht 2007 nachzulesen sein.<br />
Zur Cumarinproblematik wird auch auf die Kapitel 4.16.17 (Glühwein), 4.16.26 (Zimtkapseln) und 4.16.28<br />
(Zimt) sowie auf die übergeordneten Zusammenhänge im Kapitel 3 verwiesen.<br />
Links zum Thema: http://www.laves.niedersachsen.de/master/C27974673_N15<br />
510554_L20_D0_I826.html;<br />
http://www.ml.niedersachsen.de/master/C27872824_N8825_<br />
L20_D0_I655.html<br />
http://www.bfr.bund.de/cd/432<br />
- Muffins, Muffinteige, Muffin-Backmischungen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 26<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 2<br />
Cumarin in Getreideprodukten<br />
< 2 2 -
Verwendung säurehaltiger Zutaten wie Buttermilch, Joghurt oder Früchte in Kombination mit<br />
Natriumhydrogencarbonat (Natron) charakteristisch. Die festen und die flüssigen Zutaten werden zunächst jeweils<br />
in getrennten Gefäßen vermischt und vor dem Einfüllen des Teigs in die Backformen nur noch kurz miteinander<br />
verrührt.<br />
Im Handel sind Muffins sowohl lose als auch in Fertigpackungen erhältlich. Die hohe Produktvielfalt spiegelt<br />
sich auch im Untersuchungsspektrum wieder. Je nach Art der Probe wurde auf wertgebende Bestandteile wie<br />
Butterfett- und Kakaogehalt, Richtigkeit der vorhandenen Nährwertangaben oder auf Zusatzstoffe wie Farbstoffe<br />
und Konservierungsstoffe hin untersucht. Backfertige Muffinteige wurden mikrobiologisch untersucht und<br />
Backmischungen auf bestimmte Mykotoxine hin analysiert.<br />
Die auszusprechenden Beanstandungen beschränkten sich auf Kennzeichnungsmängel bei Erzeugnissen in<br />
Fertigpackungen.<br />
- Baumkuchen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 31<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 3<br />
Im Rahmen eines Untersuchungsprogramms wurden Baumkuchen-Erzeugnisse untersucht. Baumkuchen ist ein<br />
besonders in der Vorweihnachtszeit beliebtes Gebäck, das traditionell hergestellt wird, indem eine Teigmasse<br />
sukzessive in mehreren dünnen Schichten auf einer rotierenden Walze gebacken wird. Die Schichten des fertigen<br />
Produktes erinnern an Jahresringe von Bäumen.<br />
Baumkuchenmassen müssen auf 100 kg Getreideerzeugnisse und/oder Stärken unter anderem mindestens<br />
100 kg Butter oder die entsprechende Menge Butterreinfett und/oder Butterfett und mindestens 200 kg Vollei oder<br />
entsprechende Mengen Volleierzeugnisse enthalten. Mandeln, Marzipanrohmasse, Nüsse und/oder Nugat<br />
können zugesetzt werden. Backpulver wird nicht verwendet. Die fertig gebackenen Erzeugnisse werden mit<br />
Schokoladeüberzugsmasse oder Zuckerglasur überzogen.<br />
Für die Herstellung von Baumkuchenspitzen schneidet man Baumkuchenringe in trapezförmige Stücke, die<br />
einzeln mit Glasur überzogen werden.<br />
- Beanstandungen<br />
Bei einem Erzeugnis wurde vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmelbefall in der Krume festgestellt.<br />
In einer Probe wurde kein Butterfett nachgewiesen und der vorgeschriebene Mindestanteil an Vollei nicht<br />
erreicht.<br />
Eine Probe Baumkuchen, die in einer Fertigpackung in den Verkehr gebracht wurde, entsprach in mehreren<br />
Punkten nicht den Kennzeichnungsvorschriften der LMKV und war nicht mit einer Loskennzeichnung versehen.<br />
- Überprüfung der Auslobungen „glutenfrei“, „eifrei“, „milchfrei“<br />
In Deutschland und vielen anderen Industriestaaten leiden in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen an<br />
allergischen Erkrankungen. In vielen Lebensmitteln befinden sich Substanzen (vornehmlich Proteine), die<br />
sensibilisierend oder allergieauslösend wirken können. Lebensmittelallergene sind u. a. in glutenhaltigem<br />
Getreide (z.B. Weizen, Roggen, Gerste), in Eiern, Erdnüssen, Soja, Kuhmilch, Schalenfrüchten (z. B. Haselnuss,<br />
Mandel) und in Sesam enthalten, die als Zutaten für Feine Backwaren verwendet werden.<br />
Untersucht wurden insgesamt 28 Proben, darunter Kekse, Waffeln und salziges Gebäck, die mit einem<br />
Hinweis „glutenfrei“ „eifrei“ bzw. „milchfrei“ versehen waren. Die so gekennzeichneten Lebensmittel wurden<br />
überprüft, ob sie tatsächlich frei von Gluten bzw. kein Milcheiweiß oder Eibestandteile enthalten. Zudem wurden<br />
Reiswaffeln und Erzeugnisse aus Mais, die kein Gluten enthalten, auf Verunreinigung mit glutenhaltigem Getreide<br />
überprüft. Die Untersuchungen zeigten, dass die jeweilige Auslobung gerechtfertigt war.<br />
- Prüfung auf wertgebende Bestandteile<br />
- Überprüfung der Anforderungen der Leitsätze<br />
Ein wichtiges Beurteilungskriterium für Feine Backwaren sind die Leitsätze des Deutschen<br />
Lebensmittelbuches. Darin werden die Herstellung, Beschaffenheit oder sonstige Merkmale von Lebensmitteln,<br />
die für ihre Verkehrsfähigkeit von Bedeutung sind, beschrieben.<br />
Bei Erzeugnissen, für die Beurteilungskriterien in den Leitsätzen festgelegt sind, wurde durch präparative oder<br />
chemische Analyse überprüft, ob diese Kriterien eingehalten werden. Im Berichtsjahr mussten 50 Proben<br />
beanstandet werden, weil die festgestellte Zusammensetzung nicht den in den Leitsätzen vorgegebenen<br />
Mindestanforderungen z. B. an den erforderlichen Butteranteil genügte.<br />
- Verwendung von kakaohaltiger Fettglasur bzw. Konsumstreuseln<br />
Gebäckstücke wie Schweineohren, Halbmonde, Bärentatzen, Donauwellen usw. sind in der Regel mit<br />
schokoladenartigen Glasuren überzogen. Besteht die Fettkomponente dieser Glasuren nicht ausschließlich aus<br />
207
Kakaobutter sondern ganz oder teilweise aus anderen Fetten (z. B. Kokos- oder Palmkernfett), so liegt eine<br />
kakaohaltige Fettglasur und keine Schokolade (Kuvertüre) vor. Kakaohaltige Fettglasur ist leichter zu verarbeiten<br />
und zeigt einen schönen Glanz, ist aber ein nachgemachtes Lebensmittel, weil sie mit Kuvertüre verwechselbar<br />
ist. Sie muss deshalb kenntlich gemacht werden. Eine ausreichende Kenntlichmachung ist z.B. die Angabe "mit<br />
kakaohaltiger Fettglasur".<br />
Ähnliches gilt für Gebäcke mit Schokoladenstreuseln wie z. B. Rumkugeln. Werden fremdfetthaltige<br />
geringwertigere Konsumstreusel verarbeitet, so muss dies kenntlich gemacht werden, da es sich bei<br />
Konsumstreuseln um ein nachgemachtes Erzeugnis handelt, das vom Aussehen her mit Schokoladestreuseln<br />
verwechselbar ist.<br />
Von den insgesamt untersuchten Gebäckproben mussten 39 Proben beanstandet werden. Die Abweichung<br />
war nicht ausreichend kenntlich gemacht worden, obwohl es sich bei den Überzugsmassen um kakaohaltige<br />
Fettglasuren bzw. bei den Streuseln um Konsumstreusel handelte.<br />
- Verwendung von Persipan<br />
Marzipan oder Marzipanrohmasse wird in vielen Feinen Backwaren verarbeitet. Dabei handelt es sich um eine<br />
aus zerkleinerten, geschälten Mandeln und Zucker hergestellte Masse. Anstelle von Marzipan wird zur<br />
Herstellung von Gebäcken auch Persipan verwendet, das genauso aussieht, etwas kräftiger nach Bittermandel<br />
schmeckt und ähnlich zusammengesetzt ist, aber anstelle von Mandeln Aprikosen- oder Pfirsichkerne bzw.<br />
entbitterte bittere Mandeln enthält. Persipan gilt als nachgemachtes Marzipan und muss deshalb kenntlich<br />
gemacht werden, wenn nach der Verkehrsauffassung eine Verwendung von Persipan nicht üblich ist.<br />
Handwerklich hergestellte Gebäcke wie z. B. Ochsenaugen und Eisenbahnschienen wurden auf die<br />
Verwendung von Persipan hin geprüft. In fünf Fällen konnte Persipan nachgewiesen werden, ohne dass dies<br />
entsprechend kenntlich gemacht worden war.<br />
- Deklaration von Zusatzstoffen<br />
- Farbstoffe<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 162<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 35<br />
Zur Dekoration Feiner Backwaren werden häufig auch Farbstoffe verwendet. Beispiele sind gefärbte Glasuren<br />
oder Gelees, Fruchtmassen, Belegkirschen oder Zuckerstreusel.<br />
Ein Farbstoffgehalt in einem Lebensmittel muss gemäß Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) bei loser<br />
Abgabe an Verbraucher kenntlich gemacht werden. Bei Lebensmitteln in Fertigpackungen muss im<br />
Zutatenverzeichnis der Klassenname „Farbstoff(e)“, gefolgt von der Verkehrsbezeichnung oder der E-Nummer<br />
der jeweiligen Farbstoffe, aufgeführt werden.<br />
Beanstandungen<br />
30 Proben waren wegen fehlender Kenntlichmachung des Farbstoffgehalts bei loser Abgabe zu beanstanden. Bei<br />
fünf Proben war die Angabe der Farbstoffe im Zutatenverzeichnis nicht erfolgt oder fehlerhaft.<br />
Eine Probe, in der der Farbstoff Azorubin (E122) nachgewiesen wurde, war mit der irreführenden Angabe<br />
„ohne Zusatzstoffe“ ausgelobt.<br />
In den im Rahmen eines Untersuchungsprogramms untersuchten gefüllten Berlinern und hierfür vorgesehenen<br />
Fruchtfüllungen waren keine Farbstoffe nachweisbar.<br />
Nicht zugelassene Farbstoffe wurden im Rahmen der Untersuchungen nicht nachgewiesen.<br />
- Konservierungsstoffe-Kenntlichmachung<br />
Zur Konservierung von Feinen Backwaren ist Sorbinsäure bis zu einer Höchstmenge von 2000 mg/kg<br />
zugelassen. Der Zusatzstoff Schwefeldioxid gelangt häufig über bestimmte Zutaten wie z. B. geschwefelte<br />
Rosinen oder geschwefelte Apfelprodukte in Feine Backwaren. Bei der Herstellung der o.g. Obsterzeugnisse wird<br />
Schwefeldioxid zur Vermeidung oxidativer Veränderungen (z.B. Bräunung) eingesetzt.<br />
Bei der losen Abgabe von Lebensmitteln ist die Verwendung von Konservierungsstoffen durch die Angabe „mit<br />
Konservierungsstoff“ oder „konserviert“ kenntlich zu machen. Bei einem Gehalte von mehr als 10 mg/kg<br />
Schwefeldioxid ist die Angabe „geschwefelt“ erforderlich.<br />
Von den untersuchten Proben wurde eine Probe als irreführend bezeichnet beanstandet, die Sorbinsäure<br />
enthielt, obwohl sie als frei von Konservierungsstoffen ausgelobt worden war. Wegen fehlender Deklaration des<br />
Schwefeldioxids wurde ebenfalls eine Probe beanstandet.<br />
Überprüfung der Kennzeichnung<br />
208
Eine große Zahl an Beanstandungen ergab sich wegen Fehlern in der Kennzeichnung von Feinen Backwaren.<br />
So wurden 171 Proben in Fertigpackungen wegen fehlerhafter Kennzeichnung nach der Lebensmittel-<br />
Kennzeichnungsverordnung, darunter 28 Proben bei denen die vorgeschriebene quantitative Zutatenangabe, die<br />
sogenannte QUID-Angabe fehlte, obwohl die Verkehrsbezeichnung eine Angabe dieser wertgebenden Zutaten<br />
erwarten ließ. Fünf Proben waren wegen einer fehlerhaften Nährwert-Kennzeichnung, zwei Proben wegen<br />
fehlerhafter Angaben nach der Diätverordnung und 22 Proben wegen fehlender Los-Kennzeichnung nach der<br />
Los-Kennzeichnungsverordnung zu beanstanden. Drei tiefgefrorene Feine Backwaren wurden beanstandet, da<br />
die zusätzlich nach der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben<br />
nicht korrekt vorhanden waren.<br />
Dr. Bronner, M.; Dr. Eichhorn, S.; Scharf, D.; Dr. Wald, B. (LI BS)<br />
4.16.11 Teigwaren<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 264<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 25<br />
Teigwaren werden überwiegend aus Weizengrieß oder -mehl durch Einteigen und anschließendes Ausformen<br />
und Trocknen hergestellt. Aber auch die Herstellung aus Mahlerzeugnissen anderer Getreidearten wie Roggen,<br />
Dinkel, Gerste, Hafer, Hirse, Reis, Mais und Triticale sowie Buchweizen ist zulässig. Sie unterscheiden sich von<br />
Backwaren dadurch, dass der Teig weder einer Gärung noch einem Backverfahren unterworfen wird.<br />
Die Beurteilungsmerkmale und die Verkehrsauffassung für Teigwaren finden sich in den „Leitsätzen für<br />
Teigwaren“.<br />
Zu den darin enthaltenen allgemeinen Beurteilungsmerkmalen zählen u. a. Beschaffenheitsmerkmale wie der<br />
Natriumchloridgehalt und der Wassergehalt. Bezeichnung und Aufmachung der Teigwaren hängen vom Eigehalt,<br />
der Form (Spaghetti, Makkaroni, Spätzle, etc.) und evtl. weiteren besonderen Zutaten, wie z. B. Gemüse,<br />
Karotten und Spinat ab.<br />
In den besonderen Beurteilungsmerkmalen werden für spezielle Teigwaren spezifische Anforderungen gestellt,<br />
wie z. B. für verschiedene Eierteigwaren Volleigehalte oder die entsprechende Menge Eigelb bzw. Vollei-<br />
und/oder Eigelbprodukte.<br />
Bei zahlreichen Teigwaren in Fertigpackungen war die Kennzeichnung nicht ausreichend, schwer lesbar,<br />
verwischt, fehlte oder war nicht in deutscher Sprache angegeben. So wurden drei Proben aufgrund der fehlenden<br />
QUID- Angabe beanstandet. Weiterhin wurden verschiedene andere Kennzeichnungsmängel festgestellt wie<br />
fehlendes oder unzureichend angegebenes Mindesthaltbarkeitsdatum, Zutatenverzeichnis mit unvollständigen<br />
oder unzureichenden Angaben, nicht ausreichende Verkehrsbezeichnung. Bei einer Probe war die erforderliche<br />
Losangabe unzureichend, bei zwei Proben fehlte die Gewichtsangabe.<br />
In den Leitsätzen für Teigwaren sind für diese Erzeugnisse allgemein ein Höchstwert für Kochsalz<br />
(Natriumchlorid) von 1 % und ein maximal zulässiger Wassergehalt von 13 % angegeben. Erhöhte<br />
Kochsalzgehalte wurden ebenso wenig festgestellt wie Wassergehalte über 13 %.<br />
Auch im Hinblick auf den Ei-Gehalt war keine der Proben zu beanstanden.<br />
Teigwaren mit einem Zusatz von Paprika oder Chili wurden insbesondere auf die für Lebensmittel nicht<br />
zugelassenen Sudanfarbstoffe untersucht. In keiner der 16 untersuchten Proben waren diese Farbstoffe<br />
nachweisbar.<br />
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 64 Proben von Teigwaren auf die Mykotoxine Desoxynivalenol (DON) und<br />
Ochratoxin A (OTA) untersucht, davon 20 Proben im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsprogramms<br />
(BÜP). Eine Überschreitung der festgesetzten Höchstmengen nach der Mykotoxin-Höchstmengenverordnung<br />
wurde dabei nicht festgestellt.<br />
Zwei Proben von glutenfreien Teigwaren mussten jedoch beanstandet werden, da die festgesetzte<br />
Höchstmenge an Fumonisinen überschritten wurde. Auf Kapitel 4.17.4 (Mykotoxine) wird verwiesen.<br />
Es wurden auch Teigwaren auf gentechnische Veränderungen untersucht. Auf Kapitel 4.17.2 (Untersuchung<br />
von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderungen) wird verwiesen.<br />
Die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) hat für feuchte verpackte Teigwaren Richt-<br />
und Warnwerte veröffentlicht. Zwei Proben von feuchten Teigwaren, die in einem Kühlraum eines Restaurants<br />
entnommen wurden, wurden beanstandet, da der Richtwert für die Gesamtkeimzahl und der Warnwert für<br />
koagulase-positive Staphylokokken überschritten wurde.<br />
Bei der handwerklichen Herstellung von Teigwaren in Kleinbetrieben können der Eintrag und die Vermehrung<br />
von pathogenen Mikroorganismen in mehreren Produktionsschritten erfolgen, insbesondere wenn rohe Eier im<br />
Produktionsraum aufgeschlagen werden und lediglich ein Vortrocknungsschritt bei 30-40 °C erfolgt sowie keine<br />
geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die Abtötung von pathogenen Mikroorganismen sicherzustellen.<br />
Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsprogramms (BÜP) wurden im Berichtsjahr insgesamt fünf<br />
Proben Teigwaren aus Kleinbetrieben mikrobiologisch untersucht. Aufgrund der Tatsache, dass relativ wenig<br />
derartiger Betriebe existieren, ging lediglich eine geringe Probenzahl ein.<br />
Ziel der Untersuchung war die Überprüfung der selbst hergestellten Teigwaren auf pathogene<br />
209
Mikroorganismen (Salmonellen und koagulase-positive Staphylokokken). Dies ist insofern von Interesse, da<br />
davon ausgegangen werden muss, dass insbesondere Kinder diese Erzeugnisse auch roh verzehren könnten.<br />
In keiner der eingelieferten Proben konnten die genannten Mikroorganismen nachgewiesen werden.<br />
4.16.12 Frisches Obst, Gemüse und Kartoffeln<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 2.359<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 182<br />
210<br />
Scharf, D.; Dr. Wald, B. (LI BS)<br />
Im Berichtzeitraum wurden im Lebensmittelinstitut Oldenburg insgesamt 2.359 Proben an frischem Obst- Gemüse<br />
und Kartoffeln auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Insgesamt wurden 182 (7,7%) Proben aufgrund<br />
von Höchstmengenüberschreitungen, unzulässigen Anwendungen, Kennzeichnungsmängeln, Wertminderung<br />
oder Verdorbenheit beanstandet. Die Ergebnisse der Rückstandsuntersuchungen für Auberginen, Salat,<br />
Wintergemüse (verschiedene Kohlsorten und Knollensellerie), Paprika, Kartoffeln, Tafeltrauben, Kiwi und<br />
Kirschen sind nachfolgend detaillierter dargestellt. Weiterhin werden die Ergebnisse der Herbiziduntersuchungen<br />
für Kräuter, Rote Bete, Fenchel und Grüne Bohnen aufgeführt.<br />
Salat<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 112<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 17<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 21<br />
Im Berichtjahr wurden 112 Salat-Proben auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Es handelte sich um 25<br />
Proben Feldsalat, 25 Proben Eisbergsalat, 13 Proben Kopfsalat, 13 Proben Rucola, elf Proben Radicchio und 15<br />
Proben weiterer Salatarten (Römischer Salat, Lollo Rosso/Bianco, Eichblattsalat und Baby Salat). 42% aller<br />
Salate kamen aus Deutschland, 16% Spanien, 15% Frankreich, 13% Italien und 10% aus Belgien. Weitere<br />
Proben stammten aus Schweden und den Niederlanden (siehe Abbildung 4.16.12.1).<br />
Abbildung 4.16.12.1: Herkunft und Sorte der untersuchten Salate<br />
Probenanzahl<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
8<br />
15<br />
12 12<br />
11<br />
3<br />
Deutschland<br />
6<br />
1<br />
4<br />
2<br />
Frankreich<br />
10<br />
1 1 1 1 1<br />
Spanien<br />
4<br />
Italien<br />
4<br />
In 79 Salat-Proben konnten Wirkstoffe gefunden werden. Keine Rückstände wurden in 28 Proben Salat<br />
nachgewiesen. In 15 Proben wurden Pflanzenschutzmittelrückstände oberhalb der gesetzlich festgesetzten<br />
2<br />
9<br />
Belgien<br />
1<br />
Niederlande<br />
1<br />
1<br />
Schweden<br />
Feldsalat<br />
Eisbergsalat<br />
Kopfsalat<br />
Rucola<br />
Radicchio<br />
Mini Romana<br />
Lollo Rosso<br />
Eichblattsalat<br />
Baby Salat<br />
ohne Angaben<br />
1
Höchstmengen nachgewiesen. Es handelte sich dabei um fünf Kopfsalate, fünf Rucola, drei Lollo Rosso, einen<br />
Feldsalat und einen Römischen Salat. In zwei weiteren Kopfsalatproben wurden ebenfalls<br />
Höchstmengenüberschreitungen nachgewiesen. Die Gehalte lagen jedoch noch innerhalb der Messunsicherheit<br />
und wurden daher nicht beanstandet. In einem deutschen Rucola wurde der Wirkstoff Metobromuron bestimmt.<br />
Die Anwendung dieses Fungizids ist in Deutschland nicht zulässig. Das zuständige Pflanzenschutzamt wurde<br />
gebeten, den Sachverhalt zu prüfen.<br />
Ein Unterschied in der Pestizidbelastung lässt sich aufgrund der Herkunft (Deutschland/Ausland) nicht feststellen.<br />
In 47% der Proben wurden Mehrfachrückstände bestimmt. Zwei belgische Kopfsalate enthielten zehn bzw. neun<br />
verschiedene Wirkstoffe (siehe Abbildung 4.15.12.2). In einem spanischen Babysalat wurden ebenfalls neun<br />
verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen. Insgesamt wurden in den Salatproben 42 verschiedene Wirkstoffe<br />
nachgewiesen.<br />
Abbildung 4.16.12.2 Anzahl der Rückstände bei Salat<br />
Anzahl der Proben<br />
14<br />
12<br />
10<br />
Paprika<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Anzahl der Wirkstoffe<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 111<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 10<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 9<br />
Im Jahr 2006 sind 101 Proben Gemüsepaprika sind auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht<br />
worden. 40% der Paprikaproben kamen aus den Niederlanden, 23% aus Spanien, und 15% aus Israel. Weitere<br />
Proben stammten aus der Türkei, Marokko, Ungarn und Griechenland.<br />
38 Proben Paprika waren rückstandsfrei. In 59 Proben Gemüsepaprika konnten Wirkstoffe nachgewiesen<br />
werden. Drei Paprikaproben wurden aufgrund von Höchstmengenüberschreitungen beanstandet. Weiterhin<br />
konnten in sieben Proben aus Spanien, der Türkei, Ungarn, Israel und den Niederlanden Rückstände über der<br />
Höchstmenge nachgewiesen werden. Die Gehalte lagen jedoch innerhalb der Messunsicherheit, daher konnten<br />
diese Proben nicht beanstandet werden.<br />
In 27% der Proben wurden Mehrfachrückstände bestimmt. Besonders positiv fielen die Proben aus Israel auf. In<br />
keiner Paprikaprobe konnten Mehrfachrückstände nachgewiesen werden, 73% der israelischen Paprika waren<br />
rückstandsfrei. Insgesamt wurden 35 verschiedene Wirkstoffe in den Proben gefunden. Am Häufigsten (36x)<br />
wurde das Insektizid Imidacloprid nachgewiesen.<br />
211<br />
Kopfsalat<br />
Eisbergsalat<br />
Feldsalat<br />
Rucola<br />
Radicchio<br />
übrige Salate
Wintergemüse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 46<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 1<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 6<br />
Im LI OL wurden im Jahr 2006 insgesamt 46 Proben Wintergemüse auf Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
untersucht. Hauptsächlich handelte es sich hierbei um Rosenkohl und Knollensellerie, außerdem wurden<br />
Weißkohl, Rotkohl und Wirsingkohl berücksichtigt.<br />
Dreiviertel der Proben kam aus Deutschland, lediglich vom Rosenkohl stammte die Hälfe der Proben (13) aus<br />
den Niederlanden.<br />
Erfreulicherweise enthielten 41% der Proben keine nachweisbaren Rückstände von Pflanzenschutzmitteln (zwölf<br />
Rosenkohl-Proben, drei Weißkohl-Proben, zwei Sellerie-Proben und zwei Rotkohlproben). In zwei weiteren<br />
Proben Rosenkohl wurden nur Spuren von Rückständen nachgewiesen. Eine Höchstmengenüberschreitung<br />
wurde in einer Sellerie-Probe festgestellt. In sechs Sellerie-Proben wurden Wirkstoffe bestimmt, die in<br />
Deutschland nicht zugelassen sind bzw. deren Anwendung für diese Kultur nicht zulässig ist. Diese Sachverhalte<br />
werden derzeit vom Pflanzenschutzamt geprüft. In den meisten Proben wurden ein bis zwei Wirkstoffe<br />
nachgewiesen. Das Fungizid Difenoconazol wurde hauptsächlich in Sellerie, während das Fungizid Tebuconazol<br />
häufig in Rosenkohl bestimmt wurde. Das Herbizid Linuron wurde ausschließlich in Knollensellerie nachgewiesen.<br />
Insgesamt wurden zwölf verschiedene Wirkstoffe in den Proben gefunden.<br />
Kartoffeln<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 167<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 1<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 23<br />
167 Proben Kartoffeln - darunter elf aus ökologischem Landbau - sind im Jahr 2006 auf<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht worden. 135 Proben stammten aus Deutschland, davon knapp 70%<br />
von niedersächsischen Erzeugern. Die weiteren Proben kamen aus Ägypten, Frankreich, Israel, Spanien, Zypern,<br />
Italien, den Niederlanden und Marokko.<br />
76% der deutschen und 28% der ausländischen Proben Kartoffeln waren rückstandsfrei. Rückstände von<br />
Pestiziden wurden in 43 Proben nachgewiesen und elf weitere Proben enthielten Spuren von Wirkstoffen. In einer<br />
ägyptischen Kartoffel wurde der fungizid wirkende Stoff Metalaxyl über der rechtlich festgesetzten Höchstmenge<br />
gefunden. Der Gehalt lag jedoch noch innerhalb der Messunsicherheit, so dass die Probe nicht beanstandet<br />
werden konnte.<br />
In Kartoffeln wurden insgesamt sechs verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen. Am häufigsten wurde<br />
Chlorpropham bestimmt (33-mal). Chlorpropham soll die Auskeimung der eingelagerten Kartoffeln verhindern. Es<br />
darf nur gewerbsmäßig, z. B. in Betrieben mit Lagerhaltung, verwendet werden. Die gewerbliche Anwendung von<br />
Chlorpropham muss mit der Angabe "nach der Ernte behandelt" kenntlich gemacht werden. Bei 13 Proben fehlte<br />
diese Kennzeichnung, sie wurden deshalb beanstandet. Drei Bio-Proben, die Chlorpropham bzw. Propamocarb<br />
enthielten, wurden beanstandet. Diese Stoffe dürfen nach Öko-Erzeugnis-Verordnung nicht in Produkten aus dem<br />
ökologischen Landbau enthalten sein.<br />
Tafeltrauben<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 116<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 9<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 4<br />
Insgesamt wurden im Jahr 2006 116 Tafeltrauben-Proben (86 helle und 30 blaue) auf Rückstände von Pestiziden<br />
untersucht. 49 Proben, überwiegend aus den Ländern der Südhalbkugel wie Südafrika und Argentinien<br />
stammend, wurden in der ersten Jahreshälfte entnommen. Die in der zweiten Jahreshälfte angeforderten Proben<br />
kamen hauptsächlich aus Italien (42). Weitere Proben stammten aus Griechenland (13), der Türkei (5), Spanien<br />
(3), Frankreich (1), Ägypten (1) und Südafrika (1).<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen aus der ersten Jahreshälfte unterschieden sich deutlich von denen der<br />
zweiten Jahreshälfte. Während in der ersten Hälfte des Jahres 2006 37% der Proben rückstandsfrei waren und<br />
keine Höchstmengenüberschreitung nachgewiesen werden konnte, wurden in der zweiten Jahreshälfte nur in 9%<br />
der Trauben keine Rückstände nachgewiesen. In neun Proben wurden Wirkstoffe mit Gehalten über der rechtlich<br />
festgelegten Höchstmenge nachgewiesen. Eine spanische Traube enthielt zwei Höchstmengenüberschreitungen<br />
in einer Probe. Unter Berücksichtigung der Messunsicherheit lagen in sechs Trauben-Proben die Gehalte im<br />
Streubereich der zulässigen Höchstmenge, so dass die Proben nicht beanstandet wurden.<br />
212
In der ersten Jahreshälfte wurden in 46% der Trauben Mehrfachrückstände analysiert, in der zweiten Hälfte in<br />
85% der Proben. Insgesamt wurden in den Trauben bis zu elf Wirkstoffe pro Probe bestimmt. Überwiegend<br />
konnten ein bis fünf Wirkstoffe analysiert werden. Die in Spuren nachgewiesenen Wirkstoffe wurden nicht<br />
berücksichtigt.<br />
In den Proben aus dem ersten Quartal wurden 22 verschiedene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe nachgewiesen,<br />
in den Tafeltrauben aus dem dritten und vierten Quartal waren 46 verschiedene Wirkstoffe enthalten. Die<br />
Fungizide Cyprodinil (27) und Procymidon (27) wurden am häufigsten bestimmt. Das Fungizid Fenhexamid wurde<br />
in jeweils 21 Proben analysiert.<br />
Kiwi<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 78<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 2<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 0<br />
Im Jahr 2006 sind insgesamt 78 Proben Kiwi auf Pestizidrückstände untersucht worden. Überwiegend stammten<br />
die Kiwiproben aus Italien und Neuseeland, die übrigen kamen aus Chile, Griechenland und Spanien.<br />
Mehr als die Hälfte der Kiwifrüchte 58% (45 Proben) enthielten keine Rückstände an Pflanzenschutzmitteln. In<br />
drei Proben wurden nur Spuren von Wirkstoffen festgestellt. In 28 Proben konnten Rückstände gefunden werden<br />
und in zwei Kiwiproben wurden Höchstmengenüberschreitungen nachgewiesen. Die Gehalte lagen jedoch<br />
innerhalb der Messunsicherheit, so dass die Proben nicht beanstandet werden konnten. In 25 Proben wurde nur<br />
ein Wirkstoff nachgewiesen. Nur in fünf Kiwiproben konnten mehrere Wirkstoffe nachgewiesen werden. Das<br />
Maximum lag bei vier Stoffen in einer Probe aus Italien. Insgesamt wurden elf verschiedene Wirkstoffe gefunden.<br />
Die Fungizide Iprodion (14x) und Fenhexamid (13x) wurden am häufigsten bestimmt.<br />
Kirschen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 55<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 2<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 1<br />
55 Proben Kirschen wurden 2006 auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Mehr als die Hälfte aller<br />
Kirschen kamen aus der Türkei, etwa ein Drittel stammte aus Deutschland und die übrigen Kirsch-Proben hatten<br />
ihre Herkunft in Spanien, Griechenland, Italien und Frankreich.<br />
Keine Rückstände wurden in 25 Kirsch-Proben nachgewiesen. In sechs weiteren Proben wurden lediglich<br />
Spuren von Pestiziden bestimmt. In 24 Proben Kirschen konnten Wirkstoffe gefunden werden.<br />
Aufgrund von Höchstmengenüberschreitungen musste keine Probe beanstandet werden. In einer italienischen<br />
Probe wurde eine Höchstmengenüberschreitung festgestellt. Unter Berücksichtigung der Messunsicherheit lag<br />
der Gehalt im Streubereich der rechtlich zulässigen Höchstmenge, so dass die Probe daher nicht beanstandet<br />
wurde. Überwiegend konnten ein oder zwei Wirkstoffe analysiert werden. Es wurden 18 verschiedene Wirkstoffe<br />
in den Kirsch-Proben gefunden. In sechs Kirsch-Proben konnte das Insektizid Omethoat nachgewiesen werden.<br />
Das Fungizid Fenhexamid wurde ebenfalls in sechs Proben bestimmt.<br />
Auberginen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 40<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 3<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 2<br />
Im Jahr 2006 sind 40 Proben Auberginen aus konventionellem Anbau auf Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
untersucht worden. 80% der Auberginen-Proben kamen aus den Niederlanden, 10% aus Spanien und 5% aus<br />
Italien.<br />
In 30 Proben Auberginen konnten Wirkstoffe bestimmt werden. Drei Proben wiesen Spuren von Rückständen<br />
auf. Sieben Auberginen-Proben wiesen keine Rückstände auf. In drei Proben wurden Gehalte über der<br />
Höchstmenge nachgewiesen. Unter Berücksichtigung der Messunsicherheit lagen die Gehalte im Streubereich<br />
der rechtlich zulässigen Höchstmenge, so dass die Proben nicht beanstandet werden konnten.<br />
In den Proben wurden ein bis drei Wirkstoffe bestimmt - meist handelte es sich nur um einen Wirkstoff. In 28<br />
Proben konnte das Insektizid Imidacloprid nachgewiesen werden. Das Fungizid Propamocarb wurde in sieben<br />
Proben bestimmt.<br />
213
Herbizidrückstände in bestimmten Gemüsearten:<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 70<br />
Anzahl der Höchstmengenüberschreitungen: 1<br />
Anzahl der beanstandeten Proben 4<br />
Herbizide sind Mittel, die gegen das Wachstum von Unkräutern angewendet werden. Herbizide kommen vor der<br />
Aussaat in oder auf dem Substrat zur Anwendung. In den geernteten Lebensmitteln sollten die Gehalte an<br />
Herbiziden deshalb gering sein. In diesem Projekt wurden Kräuter wie Petersilie, Dill aber auch andere erdnah<br />
wachsende Gemüsesorten wie Rote Bete, grüne Bohnen und Fenchel untersucht.<br />
In den Proben wurden vier dieser Herbizide (Fluazifop-butyl, Prosulfocarb, Haloxyfop und Linuron) gefunden.<br />
Eine grüne Bohnenprobe wurde aufgrund einer Höchstmengenüberschreitung eines nicht zugelassenen<br />
Wirkstoffs beanstandet. Weiterhin wurden drei Proben Fenchel beanstandet, die das Herbizid Linuron enthielten,<br />
das in Deutschland nicht für die Anwendung in Fenchelkulturen zulässig ist.<br />
Diese Ergebnisse bestätigen, dass Ernteprodukte mit Herbiziden gering belastet sind.<br />
Dr. Wenzel, C. (LI OL)<br />
4.16.13 Obsterzeugnisse, Konfitüren, Honig, süße Brotaufstriche<br />
Obsterzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 405<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 109<br />
- Obstkonserven<br />
Im Berichtsjahr wurden 195 Proben verschiedener Obstkonserven untersucht. Zu den <strong>Schwerpunkte</strong>n gehörten<br />
Steinobstkonserven (Mirabellen, Pflaumen, Süß- und Sauerkirschen), Beerenobstkonserven (Himbeeren,<br />
Brombeeren), Birnenkonserven sowie Preiselbeerkonserven.<br />
Überprüft wurden vor allem die Beschaffenheit und der Extraktgehalt, daneben Zusatzstoffe sowie bei<br />
unlackierten Dosen Zinn- und Eisengehalte.<br />
- Beanstandungen<br />
Beanstandungen resultierten überwiegend aus Kennzeichnungsmängeln. Bei sechs Proben war das<br />
Zutatenverzeichnis unkorrekt, es fehlten die Klassennamen von Zutaten. Neun Proben wiesen unvollständige<br />
Bezeichnungen oder unvollständige Mindesthaltbarkeitsdaten auf. Bei acht Preiselbeerkonserven fehlte die<br />
QUID-Angabe für den Fruchtanteil. Bei einer Himbeerkonserve war überhaupt keine deutsche Kennzeichnung<br />
vorhanden. In 14 Fällen war die deklarierte Nährwerttabelle unkorrekt. Zum Teil wurden die Nährwertangaben auf<br />
den abgetropften Anteil bezogen. Eine Ananaskonserve wies einen abweichenden Kohlenhydratgehalt auf.<br />
Insgesamt waren bei acht Obstkonserven die Angaben der Zuckerungsstufen irreführend, die Extrakte lagen<br />
entweder höher oder niedriger als für die deklarierte Zuckerkonzentrationsstufe vorgesehen. Bei einer<br />
Süßkirschkonserve und zwei Lycheekonserven fehlte die Angabe der Zuckerkonzentrationsstufe völlig. Eine<br />
Pfirsichkonserve enthielt eine unzutreffende Angabe des Gesamtzuckergehaltes im Zutatenverzeichnis. Der<br />
festgestellte Zuckergehalt war höher als der deklarierte.<br />
Qualitätsmängel wurden bei einer Pfirsich- und einer Süßkirschkonserve festgestellt Die Kirschen waren<br />
blass-gräulich, die Pfirsiche orange-bräunlich verfärbt. Die Proben wurden als im Genusswert gemindert<br />
beanstandet.<br />
- Schwermetalle<br />
Lebensmittelkonserven dürfen höchstens 200 mg Zinn pro kg enthalten. 18 auf ihren Zinngehalt überprüfte<br />
Obstkonserven gaben keinen Anlass zu einer Beanstandung, die ermittelten Zinngehalte lagen zwischen 10 und<br />
50 mg/kg. Lediglich zwei Birnenkonserven wiesen Zinngehalte um 100 mg/kg auf. Es handelte sich um Dosen mit<br />
einem unlackierten Dosenmantel.<br />
- Benzol<br />
Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Bildung von Benzol aus Benzoesäure in Gegenwart von<br />
214
Ascorbinsäure in Lebensmitteln wurden 18 Preiselbeerkonserven auf einen Gehalt an Benzol überprüft.<br />
Preiselbeeren enthalten von Natur aus hohe Gehalte an Benzoesäure. Ascorbinsäure war keiner Probe als Zutat<br />
zugesetzt worden. Da die Beeren aber Vitamin C-haltig sind, war eine Bildung von Benzol nicht von vornherein<br />
auszuschließen. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass Benzol in Preiselbeerkonserven kein Problem darstellt. Die<br />
Gehalte lagen im Spurenbereich (siehe hierzu Kapitel 4.17.6 – Kontaminanten und unerwünschte Stoffe).<br />
- Prüfung auf eine Aromatisierung<br />
53 Steinobstkonserven (23 Kirsch-, elf Mirabellen- und 19 Pflaumenkonserven) wurden auf eine<br />
Aromatisierung mit einem benzaldehydhaltigen Aroma überprüft. Benzaldehyd hat eine Bittermandelnote, die in<br />
Steinobstkonserven häufig stärker ausgeprägt ist als die eigentliche Fruchtnote. Zwar kommt Benzaldehyd in den<br />
Früchten natürlicherweise vor. Bei einer Aromatisierung liegen die Gehalte jedoch deutlich höher.<br />
Die ermittelten Benzaldehydgehalte lagen bei 52 Proben so niedrig, dass von einer Aromatisierung nicht<br />
ausgegangen werden konnte. Auffällig war lediglich eine Pflaumenkonserve aus Osteuropa. Es handelte sich um<br />
Pflaumen mit Steinen, die sensorisch eine ausgeprägte Bittermandelnote aufwiesen. Der ermittelte<br />
Benzaldehydgehalt lag ca. um den Faktor 100 über den bei Pflaumenkonserven üblicherweise festgestellten<br />
Gehalten. Ein Aroma war im Zutatenverzeichnis nicht angegeben (siehe hierzu Kapitel 4.16.29 – Essenzen,<br />
Aromastoffe).<br />
- Farbstoffe<br />
Himbeerkonserven wurden auf künstliche Farbstoffe und färbende Lebensmittel wie<br />
Holunderbeersaftkonzentrat überprüft. Beanstandungen resultierten nicht, da die Verwendung ordnungsgemäß<br />
gekennzeichnet war.<br />
- Trockenfrüchte<br />
Im Berichtsjahr wurden 172 Proben Trockenfrüchte untersucht. Überwiegend handelte es sich um getrocknete<br />
Weinbeeren, Aprikosen, Datteln, Feigen und Pflaumen sowie einige weitere exotische Fruchtarten.<br />
- Beanstandungen<br />
Ein erhöhter Anteil an Früchten mit Schädlingsbefall in Form von toten Maden, Madenkot, Gespinsten und<br />
Schimmel wurde vor allem bei Feigen und Datteln festgestellt, acht Proben Feigen und sechs Proben Datteln<br />
wurden als wertgemindert beanstandet. Eine Aprikosenprobe war übersät mit lebenden Milben, sie wurde als zum<br />
Verzehr nicht geeignet beurteilt.<br />
Die übrigen Beanstandungen betrafen überwiegend die Kennzeichnung, z. B. nicht ausreichende<br />
Bezeichnungen, fehlerhafte Zutatenverzeichnisse, unvollständige Mindesthaltbarkeitsdaten und fehlende<br />
Losangaben.<br />
- Mykotoxine<br />
82 Proben getrocknete Weinbeeren, Aprikosen, Pflaumen, Datteln und Feigen wurden auf ihren Gehalt an<br />
dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A untersucht, darunter 19 Proben Pflaumen im Rahmen des bundesweiten<br />
Monitorings.<br />
In 86 % der Weinbeeren, in 43 % der Datteln und in 73 % der Feigen konnten Ochratoxin A-Gehalte<br />
festgestellt werden, die allerdings unter den festgesetzten Höchstmengen lagen. Bei einer Probe Feigen war mit<br />
einem Gehalt von 26,7 µg/kg die zulässige Höchstmenge von 8 µg/kg überschritten. In Trockenpflaumen war<br />
dagegen kein Ochratoxin A nachweisbar.<br />
Feigen und Datteln wurden auch auf einen Gehalt an Aflatoxinen überprüft. Höchstmengenüberschreitungen<br />
wurden nicht festgestellt. 7 % der Datteln und 82 % der Feigen wiesen jedoch eine geringe Belastung mit<br />
Aflatoxin B1 auf (unter 1 µg/kg) (siehe hierzu auch Kapitel 4.16.1- Überwachungsprogramme- und 4.17.4 –<br />
Mykotoxine).<br />
- Zusatzstoffe<br />
Trockenobst darf zur Verbesserung der Haltbarkeit geschwefelt werden. Für die verschiedenen<br />
Trockenobstarten sind in der ZZulV unterschiedliche Höchstmengen an Schwefeldioxid festgelegt. 54 Proben,<br />
darunter schwerpunktmäßig in diesem Berichtsjahr Aprikosen, getrocknete Weinbeeren, Apfelringe, Feigen und<br />
weitere exotische Früchte (wie Mango) wurden auf einen Gehalt an Schwefeldioxid überprüft, davon 19 Proben<br />
getrocknete Aprikosen im Rahmen des bundesweiten Überwachungsplans 2006 (BÜP). Bei 32 Proben war der<br />
Nachweis positiv. Eine Aprikosenprobe wies eine Höchstmengenschreitung auf. Das Herkunftsland der Aprikosen<br />
war unbekannt.<br />
Bei zwei lose angebotenen Proben (Apfelringe und Aprikosen) fehlte die Kenntlichmachung geschwefelt, bei<br />
215
einer Probe Rosinen war die Zutat Schwefeldioxid nicht im Zutatenverzeichnis angegeben.<br />
Alle Proben Feigen erwiesen sich als ungeschwefelt.<br />
Die Überprüfung von Feigen und Datteln auf die Konservierungsstoffe Sorbin- und Benzoesäure führte zu<br />
keiner Beanstandung.<br />
Konfitüren, Gelees, Marmeladen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 138<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 53<br />
Begriffsbestimmungen und Kennzeichnungsregelungen für Konfitüren und ähnliche Erzeugnisse sind u. a. in der<br />
KonfV festgelegt. Danach werden Konfitüre extra und Konfitüre sowie Gelee extra und Gelee unterschieden. Als<br />
Zutaten dürfen nur die dort genannten Lebensmittel sowie die in der ZZulV aufgeführten Zusatzstoffe verwendet<br />
werden. Die lösliche Trockenmasse dieser Erzeugnisse beträgt mindestens 60 %. Bei Diätkonfitüren und<br />
ähnlichen Erzeugnissen handelt es sich um Produkte zur besonderen Ernährung bei Diabetes mellitus. Im<br />
Vergleich zu herkömmlichen Konfitüren wird der üblicherweise verwendete Zucker oder Glukosesirup durch<br />
Zuckeraustauschstoffe wie Fruktose und Sorbit oder Süßstoffe ersetzt.<br />
Die Untersuchungen erstreckten sich auf die Überprüfung des Frucht- und Gesamtzuckergehaltes in<br />
Verbindung mit der Deklaration sowie von diätetischen und nährwertbezogenen Angaben. Je nach Erzeugnis<br />
erfolgte auch eine Ermittlung des Konservierungsstoff- und Süßstoffgehaltes.<br />
Bei einzelnen Konfitüren, in diesem Berichtsjahr insbesondere Erdbeerkonfitüren, wurde auf Trägerstoffe<br />
geprüft, die einen Hinweis auf eine Aromatisierung geben.<br />
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Untersuchung von Erzeugnissen von Direktvermarktern.<br />
- Prüfung auf eine Aromatisierung<br />
Zehn Erdbeerkonfitüren und eine Sauerkirschkonfitüre wurden auf die für Aromen zugelassenen Trägerstoffe<br />
Glycerintriacetat und Triethylcitrat sowie auf die geschmacksbeeinflussenden Stoffe Maltol und Ethylmaltol<br />
untersucht. Eine Erdbeerkonfitüre wies einen deutlichen Gehalt an Glycerintriacetat sowie drei weitere<br />
Erdbeerkonfitüren einen Maltolgehalt auf. Die Proben wurden beanstandet, da diese Stoffe einen Hinweis auf<br />
eine Aromatisierung geben. Für Erzeugnisse im Sinne der KonfV ist eine Aromatisierung jedoch nicht zulässig. Es<br />
wurde empfohlen am Ort der Herstellung zu prüfen, ob während der Produktion eine Kontamination mit<br />
aromatisierten Erzeugnissen stattgefunden haben könnte (siehe hierzu Kapitel 4.16.29 –Essenzen, Aromastoffe).<br />
- Beanstandungen<br />
Die Zahl der Beanstandungen von Konfitüren, Gelees und Marmeladen, einschließlich Diäterzeugnissen, aus der<br />
Produktion überregionaler Hersteller, die häufig im Warenangebot anzutreffen sind, war wie auch in den<br />
Vorjahren vergleichsweise gering. Es handelte sich dabei überwiegend um Kennzeichnungsmängel wie<br />
unleserliche oder unvollständige Mindesthaltbarkeitsdaten, nicht eindeutige oder fehlende Losangaben sowie<br />
fehlende Klassennamen von Zutaten. In drei Fällen fehlte zusätzlich zum Gesamtfruchtgehalt die Quidangabe der<br />
einzelnen Früchte. Werden bei Zwei- oder Mehrfruchterzeugnissen die Früchte namentlich in der<br />
Verkehrsbezeichnung genannt, so reicht die Deklaration des Gesamtfruchtgehaltes allein nicht aus. Hier ist auch<br />
eine Quidangabe der einzelnen Früchte vorzunehmen.<br />
Drei Konfitüren, darunter zwei Konfitüren (Eberesche und Kirsche) aus Osteuropa, wiesen zu niedrige lösliche<br />
Trockenmassen auf. Auffällig war auch die fast dünnflüssige Beschaffenheit der osteuropäischen Konfitüren, so<br />
dass eine Streichfähigkeit nicht mehr gegeben war.<br />
Zwei Hagebuttenkonfitüren eines Herstellers trugen im Etikett die Auslobung „mit Vanilleauszügen“. Im<br />
Zutatenverzeichnis war natürliches Vanillearoma angegeben. Vanillin konnte jedoch weder sensorisch noch<br />
analytisch festgestellt werden. Vom Hersteller wird zukünftig auf den Einsatz von Vanillearoma verzichtet, das<br />
Etikett wird neu gestaltet.<br />
Zwei als „Gelee“ bezeichnete Erzeugnisse wurden mit der Aussage „70 % Fruchtanteil“ beworben. In den<br />
Zutatenverzeichnissen waren lediglich Säfte als Zutat aufgeführt. Die lösliche Trockenmasse entsprach den<br />
geforderten 60%. Durch einen derart hohen Fruchtgehalt wird jedoch ein so hoher Wassergehalt in die<br />
Erzeugnisse eingebracht, dass eine lösliche Trockenmasse von 60 % nicht erreicht werden kann. Ermittlungen<br />
beim Hersteller ergaben den Einsatz von Saftkonzentraten. Die Etiketten wurden umgestaltet und die<br />
Saftkonzentrate in das Zutatenverzeichnis aufgenommen.<br />
Eine Feigenkonfitüre aus Syrien enthielt das für Konfitüren nicht zugelassene Verdickungsmittel Gummi<br />
arabicum.<br />
In einer „Diät Erdbeer Konfitüre Extra“ wurde der künstliche Farbstoff Amaranth (E 123) nachgewiesen, der im<br />
Zutatenverzeichnis als „Echtes Karmin“ aufgeführt war. Nach den Vorschriften der ZZulV ist eine Färbung von<br />
Konfitüren Extra nicht zulässig. Der Farbstoff „Echtes Karmin“ darf lediglich Konfitüren zugesetzt werden, nicht<br />
jedoch der Farbstoff „Amaranth“.<br />
216
- Konfitüren, Gelees, Marmeladen von Direktvermarktern<br />
Als auffällig erwiesen sich auch in diesem Berichtsjahr wieder die Erzeugnisse von Direktvermarktern.<br />
Die Mehrzahl der Proben stammte aus Hofläden, einige auch von örtlichen Märkten. Von 41 untersuchten<br />
Proben entsprach lediglich eine den lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Eine Ausnahmeregelung für derartige<br />
Erzeugnisse gibt es nicht. Zu erwähnen sind die zahlreichen Kennzeichnungsmängel sowie die unzulässige<br />
Verwendung des Konservierungsstoffes Sorbinsäure.<br />
Die Kennzeichnungselemente der KonfitürenVerordnung KonfV wie Fruchtgehalt und Gesamtzuckergehalt<br />
fehlten in zehn Fällen völlig, in 13 Fällen waren sie unvollständig.<br />
Bei sieben Proben erreichte der Gesamtzuckergehalt nicht den für Konfitüren und Gelees vorgeschriebenen<br />
Mindestwert von 60 %, bei vier Proben stimmte der ermittelte Gesamtzuckergehalt nicht mit dem deklarierten<br />
Wert überein.<br />
Neun Proben waren unzulässigerweise mit Sorbinsäure konserviert.<br />
Bei einem roten Johannisbeergelee lag der Fruchtgehalt unter dem Mindestfruchtgehalt von 45 %.<br />
Ein „Holunder-Apfel-Gelee“ und eine „Apfel-Holunder-Konfitüre“ waren unzulässigerweise als Gelee extra und<br />
Konfitüre extra bezeichnet. Nach den Vorschriften der KonfV dürfen Äpfel nicht in Mischungen mit anderen<br />
Früchten zur Herstellung von Konfitüre extra und Gelee extra verwendet werden.<br />
Bei drei Diät-Konfitüren fehlten alle Angaben im Sinne der DiätV. Die Proben waren lediglich als „Diät...“ oder<br />
„Diabetes....“ bezeichnet.<br />
Bei 21 Proben wies das Zutatenverzeichnis Mängel auf; es fehlten z. B. Klassennamen von Zutaten oder die<br />
einzelnen Zutaten des Gelierzuckers. In 5 Fällen fehlte die Zutat Citronensäure. Zu beanstanden waren auch<br />
ungewöhnliche Wortschöpfungen wie „zuckersparendes Geliermittel“ oder die Verwendung von Produktnahmen<br />
für Zutaten wie „gelfix“ und „Einmachhilfe“. Zwei Erzeugnisse wiesen überhaupt kein Zutatenverzeichnis auf.<br />
Die Angabe des Frucht- und Gesamtzuckergehaltes fehlte in zehn Fällen, bei 13 Proben waren diese Angaben<br />
unkorrekt oder unvollständig. 29 Proben wiesen Kennzeichnungsmängel im Bereich des<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums und des Loses auf, bei einer Blaubeermarmelade fehlte jegliche Kennzeichnung.<br />
Lediglich ein Schild an der Ware wies das Erzeugnis als „Blaubeermarmelade“ aus.<br />
Seit der letzten Änderung der KonfV im Oktober 2004 darf für Erzeugnisse im Sinne der KonfV, die nicht aus<br />
Zitrusfrüchten hergestellt wurden, der Begriff „Marmelade“ verwendet werden, wenn die Erzeugnisse auf örtlichen<br />
Märkten, insbesondere Bauernmärkten, oder Wochenmärkten an Verbraucher abgegeben werden. Durch diese<br />
Regelung ist dem immer noch umgangssprachlich verwendeten Begriff „Marmelade“ statt Konfitüre Rechnung<br />
getragen worden.<br />
Beanstandet wurde auch in sieben Fällen die fehlende Quidangabe der einzelnen Früchte. Bei Zwei- und<br />
Mehrfruchterzeugnissen muss zusätzlich zum Gesamtfruchtgehalt auch der Anteil der einzelnen Früchte<br />
angegeben werden, wenn diese namentlich in der Verkehrsbezeichnung genannt werden.<br />
Fruchtaufstriche<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 119<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 34<br />
Fruchtaufstriche entsprechen in ihrer Gesamtaufmachung einer Konfitüre bzw. einem Gelee. Da sie jedoch als<br />
Fruchtaufstrich bezeichnet sind, finden die Vorschriften der Konfitüren- Verordnung keine Anwendung. Dadurch<br />
ist z.B. auch eine Konservierung ohne Anbindung an eine Brennwertverminderung zulässig. Auch ein<br />
Mindestgehalt für den Gesamtzucker und die verwendeten Früchte ist nicht festgelegt. Die Kennzeichnung des<br />
Gesamtzuckergehaltes ist nicht erforderlich. Die meisten Fruchtaufstriche weisen Gesamtzuckergehalte auf, die<br />
mit 45 bis 50% deutlich niedriger liegen als bei Konfitüren. Die Fruchtgehalte entsprechen dagegen überwiegend<br />
denen von Konfitüren.<br />
- Beanstandungen<br />
Einige wenige Beanstandungen ergaben sich bei Fruchtaufstrichen überregionaler Hersteller hauptsächlich<br />
aufgrund von Kennzeichnungsmängeln im Bereich der LMKV und LKV.<br />
Ein „Dänischer Winteraufstrich“ mit den Früchten Erdbeeren, Rhabarber, Himbeeren und Heidelbeeren enthielt<br />
in der Kennzeichnung den Hinweis „natürliche Vanille“. Im Zutatenverzeichnis wurden als Zutaten natürliche<br />
Vanille und Vanillearoma angegeben. Ermittelt wurde neben einem geringen Vanillingehalt ein deutlicher<br />
Ethylvanillingehalt. Ethylvanillin ist ein künstlicher Aromastoff, der natürlicherweise nicht vorkommt. Er ist nach<br />
den Vorschriften der AromenV für fruchthaltige Brotaufstriche nicht zugelassen. Die Probe wurde beanstandet.<br />
Der Hersteller reagierte sofort. Das Aroma, das Ethylvanillin enthält, wird nicht mehr verwendet. Die Rezeptur<br />
wurde geändert.<br />
- Pflaumenmus<br />
217
20 Proben Pflaumenmus wurden auf ihren Gehalt an Hydroxymethylfurfural (HMF) und Eisen überprüft. HMF<br />
dient als Hinweis auf erhitzte Lebensmittel. Die ermittelten Gehalte handelsüblicher Pflaumenmuserzeugnisse<br />
lagen zwischen 52 und 666 mg/kg und sind somit im Bereich der Vorjahre geblieben. Die außerordentlich hohen<br />
HMF-Gehalte von über 2000 bis über 4000 mg/kg, die Ende der neunziger Jahre und Anfang 2000 festgestellt<br />
wurden, gehören erfreulicherweise der Vergangenheit an. Lediglich zwei Pflaumenmuserzeugnisse eines<br />
Direktvermarkters fielen durch HMF-Gehalte von über 2400 mg/kg auf. Die Ursache lag in der verwendeten<br />
Pflaumenpaste. Der Hersteller wurde aufgefordert, den HMF-Gehalt zu minimieren.<br />
Die ermittelten Eisengehalte von 5,1 bis 21 mg/kg erwiesen sich in allen Proben als unauffällig. Erhöhte<br />
Eisengehalte deuten auf die Verwendung einer Pflaumenpaste hin, die in ungeeigneten Gefäßen hergestellt oder<br />
gelagert wurde.<br />
Die Mehrheit der Pflaumenmusproben war gewürzt. Die typische würzige Note wird durch Zimt geprägt.<br />
Cumarin war jedoch in keiner Probe nachweisbar.<br />
- Fruchtaufstriche von Direktvermarktern<br />
Viele Direktvermarkter sind dazu übergegangen, ihre Produkte als Fruchtaufstriche anzubieten, um die<br />
Regelungen der KonfV zu umgehen. Dennoch ist die Beanstandungsquote hoch. Von 27 untersuchten<br />
Fruchtaufstrichen wurden 26 beanstandet. Es handelte sich hierbei allerdings weniger um Bemängelungen der<br />
stofflichen Beschaffenheit wie bei den Konfitüren, sondern überwiegend um Kennzeichnungsmängel. In fünf<br />
Fällen fehlten die Einzelzutaten des Gelierzuckers. Bei sieben Proben fehlte die Angabe des<br />
Konservierungsstoffes Sorbinsäure im Zutatenverzeichnis. Ein Erdbeerfruchtaufstrich enthielt die Angabe „in<br />
Spuren Sorbinsäure“. Ermittelt wurden jedoch 266 mg/kg Sorbinsäure. Es handelt sich hierbei um eine<br />
erhebliche, technologisch wirksame Menge, die als Zutat angegeben werden muss. 14 Proben fielen durch<br />
unkorrekte Zutatenverzeichnisse auf. Neben fehlenden Zutaten führten fehlende Klassennamen zu einer<br />
Beanstandung.<br />
Bemängelt wurden auch unvollständige Bezeichnungen sowie unkorrekte Formulierungen des<br />
Mindesthaltbarkeitsdatums. In fünf Fällen fehlten Abgaben zum Los.<br />
13 Fruchtaufstriche wurden aufgrund einer fehlenden Mengenkennzeichnung des Fruchtanteils (Quidangabe)<br />
beanstandet.<br />
Bei einem Diät-Erdbeer- und einem Stachelbeerfruchtaufstrich wich der Gesamtzuckergehalt deutlich vom<br />
freiwillig deklarierten Wert ab. Auch bei freiwilligen Kennzeichnungen müssen die Angaben korrekt sein.<br />
Zwei Diätfruchtaufstriche fielen durch fehlende Angaben der DiätV auf.<br />
Ein als „Spezial-Erdbeerfruchtaufstrich“ bezeichnetes Erzeugnis enthielt den Zuckeraustauschstoff Sorbit und<br />
den Süßstoff Saccharin. Beide Zutaten waren im Zutatenverzeichnis angegeben. Sorbit und Saccharin sind für<br />
brennwertverminderte Erzeugnisse zugelassen. Da die Probe nicht als brennwertvermindert bezeichnet und<br />
aufgemacht war, erfolgte eine Beanstandung aufgrund nicht zugelassener Zusatzstoffe.<br />
Mikrobiologische Überprüfung von Erzeugnissen der Direktvermarkter<br />
Alle zwölf untersuchten Erzeugnisse erwiesen sich mikrobiologisch als völlig unauffällig.<br />
Verbraucherbeschwerden<br />
Ein Pflaumenmus enthielt einen Fremdkörper aus Metall, der einem Tropfen aus einem Lötkolben ähnelte. Bei<br />
der Verbraucherbeschwerde handelte es sich um ein bereits geöffnetes Glas, das nur noch zu ¼ mit<br />
Pflaumenmus befüllt war. Die amtliche Probe mit gleichem Mindesthaltbarkeitsdatum war einwandfrei.<br />
Wiederholt wurde eine Diät-Erdbeer-Konfitüre extra, die den Zuckeraustauschstoff Sorbit enthielt, als<br />
Beschwerdeprobe eingereicht. Bei dem Beschwerdeführer trat nach dem Verzehr starker Durchfall auf. Auf dem<br />
Etikett ist der Hinweis „kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“ als Warnhinweis deklariert.<br />
Besonderheiten<br />
Ein Erzeugnis eines Direktvermarkters wurde mit der Bezeichnung „Fichtentriebgelee“ in den Verkehr gebracht.<br />
Laut Zutatenverzeichnis wurden die Zutaten Wasser, Fichtentriebe und Zucker verwendet. Im Geruch und<br />
Geschmack war neben einer süßen und säuerlichen Note vorrangig eine harzige Note feststellbar. Da<br />
Fichtentriebe vor dem 15. Mai 1997 nach hiesigem Kenntnisstand nicht in nennenswertem Umfang für den<br />
menschlichen Verzehr in der EG verwendet wurden, erfolgte eine Einstufung als neuartiges Lebensmittel.<br />
Der Begriff „Gelee“ ist in der KonfV genau definiert ist. Als Ausgangserzeugnisse dürfen nur Früchte und wässrige<br />
Auszüge von Früchten verwendet werden. Die Bezeichnung „Gelee“ ist daher für die Probe unzulässig.<br />
Außerdem konnte eine Konservierung mit Sorbinsäure sowie die Verwendung von Citronensäure als<br />
218
Säuerungsmittel nachgewiesen werden. Eine Konservierung ist nicht zulässig. Darüber hinaus fehlte das<br />
Geliermittel als Zutat.<br />
Ein „Minze-Wein-Gelee“, ebenfalls hergestellt von einem Direktvermarkter, war gefärbt mit den künstlichen<br />
Farbstoffen E 104, E 110 und E 131. Für ein Erzeugnis in der Art der Probe ist eine Färbung mit diesen<br />
Farbstoffen nicht zulässig.<br />
Tabelle 4.16.1<strong>3.</strong>1 Konfitüren und Fruchtaufstriche: Übersicht über die Probenzahlen und<br />
Beanstandungsquoten<br />
Konfitüren, Gelees<br />
gesamt<br />
Konfitüren, Gelees<br />
überregionaler<br />
Hersteller<br />
Konfitüren, Gelees<br />
von Direktvermarktern<br />
Fruchtaufstriche<br />
gesamt<br />
Fruchtaufstriche<br />
überregionaler<br />
Hersteller<br />
Fruchtaufstriche von<br />
Direktvermarktern<br />
Honig<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 281<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 106<br />
Anzahl Proben davon beanstandet in %<br />
138 53 38<br />
97 13 13<br />
41 40 98<br />
119 34 29<br />
92 8 9<br />
27 26 96<br />
Zur Untersuchung kamen Proben aus Imkereien, von Direktvermarktern, Honigabfüllbetrieben und dem<br />
Lebensmitteleinzelhandel, hierunter auch Marktstände und Reformhäuser. Neben Honigen im Sinne der<br />
Honigverordnung wurden Mischungen von Honig mit Gelee royale, Invertzuckercreme, Fruchtzubereitungen und<br />
Vanille zur Untersuchung eingereicht.<br />
Der Untersuchungsumfang zielt auf die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Honigverordnung<br />
sowie bei Verwendung besonderer Auslobungen oder Markenzeichen auf die jeweiligen Qualitätsanforderungen<br />
ab. Häufig untersuchte Parameter sind insbesondere der HMF-Gehalt als Maßstab für eine Wärmeschädigung<br />
sowie die Diastase- und Saccharaseaktivität und der Wassergehalt. Gemäß Honigverordnung besteht eine<br />
Verpflichtung zur Angabe des Ursprungslandes oder der Ursprungsländer, in dem oder denen der Honig erzeugt<br />
wurde. Eine Angabe der Trachtquelle ist möglich, wenn der Honig vollständig oder überwiegend den genannten<br />
Blüten oder Pflanzen entstammt und die entsprechenden organoleptischen, physikalisch-chemischen und<br />
mikroskopischen Merkmale aufweist.<br />
Herkunftsangaben werden anhand der mikroskopischen Pollenanalyse, Trachtangaben anhand der<br />
Pollenanalyse in Verbindung mit chemisch-physikalischen Parametern und der Sensorik überprüft. Auch<br />
Verunreinigungen durch Hefen oder Stärke können im mikroskopischen Bild erkannt werden.<br />
- Beanstandungen<br />
30 Proben waren aufgrund stofflicher Mängel zu beanstanden, 98 Proben wiesen Kennzeichnungsmängel auf.<br />
Von sieben Proben wurde die in der Honigverordnung gestellte Anforderung an den HMF-Höchstgehalt nicht<br />
eingehalten.<br />
Fünf mit Begriffen wie „kaltgeschleudert“ oder „ohne Erwärmung geschleudert“ beworbene Erzeugnisse<br />
erfüllten die in den Leitsätzen für Honig als Voraussetzung für derartige Auslobungen beschriebenen<br />
Anforderungen hinsichtlich des HMF-Höchstgehalts oder der Saccharaseaktivität nicht.<br />
Bei vier Proben, die unter dem Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes vermarktet wurden, waren die<br />
Anforderungen dieses Verbandes hinsichtlich der Saccharaseaktivität und/oder des HMF-Höchstgehaltes nicht<br />
erfüllt. Die Vermarktung der Erzeugnisse unter diesem vom Verbraucher mit einem besonderen<br />
Qualitätsanspruch verbundenen Warenzeichen wird als irreführend beurteilt.<br />
Basierend auf der mikroskopischen Untersuchung in Verbindung mit der Leitfähigkeit, dem Glucose- und<br />
Fructosegehalt sowie der sensorischen Untersuchung wurde bei insgesamt acht Proben die Trachtangabe<br />
(darunter als Linden-, Sonnenblumen-, Wald-, Spättracht-, Klee- und Akazienhonig bezeichnete Erzeugnisse) als<br />
ungerechtfertigt beurteilt.<br />
219
Bei der mikroskopischen Untersuchung fiel im Präparat von sechs Proben ein erhöhter Anteil an Hefen auf.<br />
Honige dürfen gemäß Honigverordnung keine anderen Stoffe als Honig zugefügt werden. Die Bezeichnung<br />
eines unter Zusatz von Fructose hergestellten Erzeugnisses als „Honig mit Wabe“ wurde als nicht zulässig<br />
beurteilt.<br />
Bei eine Probe „Rosskastanie Spezialität“, die in einer für Honig typischen Aufmachung in den Verkehr<br />
gebracht wurde, deuteten die Untersuchungsergebnisse (Prolingehalt, Mikroskopie) darauf hin, dass es sich nicht<br />
um ein Erzeugnis im Sinne der Honigverordnung handelte.<br />
Bei einer Probe Wabenhonig ließen der sensorische Befund (fehlende Honignote), die nahezu vollständige<br />
Abwesenheit von Pollen im mikroskopischen Präparat sowie ein vergleichsweise geringer Prolingehalt auf einen<br />
Zuckerfütterungshonig schließen.<br />
Am Rand eines Glases einer Probe Honig wurde Schimmelbefall festgestellt. Das Erzeugnis wurde als zum<br />
Verzehr ungeeignet beurteilt.<br />
Eine Probe Honig war mit der Auslobung „(…)ohne Zutaten“ versehen. Da Honig gemäß Honigverordnung keine<br />
anderen Stoffe als Honig hinzugefügt werden dürfen, handelt es sich bei der Aussage „ohne Zutaten“ um<br />
Werbung mit Selbstverständlichkeiten, denn es wird zu verstehen gegeben, dass dieses Lebensmittel besondere<br />
Eigenschaften hat, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften haben. Gleiches gilt für die<br />
Auslobung von Honigen mit Angaben wie „ausgereift“ oder „Reifegarantie“, da Honig nach der Honigverordnung<br />
immer in den Waben des Bienenstocks reifen muss.<br />
Einige Proben wiesen noch Hinweise auf, nach denen Honig als Rohkost in ungekochtem Zustand für Kinder<br />
bis ein Jahr ungeeignet ist. Hierdurch sollen offenbar immer wieder vereinzelt auftretende Fälle von<br />
Säuglingsbotulismus vermieden werden. Beim haushaltsmäßigen Kochen werden die Botulinumsporen jedoch<br />
nicht abgetötet und können im Darm von Kleinkindern auskeimen und Krankheitssymptome mit Todesfolge<br />
hervorrufen. Sofern durch eine Verzehrsempfehlung die Gefahr des Säuglings-Botulismus durch den Verzehr von<br />
Honig vermieden werden soll, muss die Empfehlung dahingehen, Kindern unter zwölf Monaten keinen Honig zu<br />
verabreichen. Obige Empfehlung wiegt den Verbraucher in einer trügerischen Sicherheit. Sie ist daher zur<br />
Irreführung geeignet.<br />
Seit Inkrafttreten der Neufassung der Honigverordnung am 29. Januar 2004 unterliegen Fertigpackungen mit<br />
Honig den Vorschriften der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Eine weitere Neuerung ist die Verpflichtung<br />
zur Herkunftsangabe.<br />
Häufige Kennzeichnungsmängel sind dem gemäß nach wie vor fehlende Herkunftsangaben oder<br />
Herkunftsangaben, die nicht dem in der Honigverordnung vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; weiterhin den<br />
Vorschriften der LMKV formal nicht entsprechende Angaben zur Mindesthaltbarkeit sowie die Angabe von<br />
Verkehrsbezeichnung, Mindesthaltbarkeitsdatum und Mengenangabe in mehr als einem Sichtfeld. Weitere<br />
Mängel betrafen Kennzeichnungsvorschriften der LKV und FPackV.<br />
- Rückstandsuntersuchungen<br />
Auf Rückstände von pharmakologischen Stoffen wie z. B. Chloramphenicol, Sulfonamide, Tetracycline und<br />
Streptomycin wurden insgesamt 55 Proben untersucht. Die Verwendung dieser Stoffe zur Behandlung von<br />
Bienenvölkern ist nicht zulässig, somit dürfen sie auch im Honig nicht vorkommen.<br />
In einer Probe Wabenhonig wurde das Sulfonamid Sulfadimidin (Sulfamethazin) in Spuren nachgewiesen.<br />
Streptomycin ist ein Antibiotikum, das beispielsweise als Pflanzenschutzmittel im Obstbau eingesetzt werden<br />
kann. In einer Probe wurde ein derart hoher Streptomycingehalt festgestellt, dass statt eines Eintrags aufgrund<br />
der Verwendung als Pflanzenschutzmittel im Trachtgebiet von einer unzulässigen direkten Anwendung im<br />
Bienenvolk auszugehen war.<br />
- Authentizität<br />
Für Untersuchungen zur Bestimmung der geographischen Herkunft von Honigen mittels Stabilisotopenanalytik<br />
wurden 17 Honige mit eindeutigen Herkunftsangaben zur Verfügung gestellt. Auf Kapitel 4.17.11 wird verwiesen.<br />
- Untersuchungen im Institut für Bienenkunde<br />
Insgesamt wurden 1.937 Proben chemisch-physikalisch und/oder mikroskopisch untersucht. Die Zahl gliederte<br />
sich in 678 Forschungsproben, 461 Orientierungsproben, 376 Marktkontrollen sowie diverse andere<br />
Fragestellungen, die nicht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung durchgeführt wurden.<br />
Die Datenbank mit Honigparametern wurde erweitert, die statistischen Auswertungen werden ständig<br />
aktualisiert. Ebenso wurde auch die Pollendatenbank erweitert. Die daraus resultierenden Veröffentlichungen<br />
werden vielfach von anderen Einrichtungen genutzt.<br />
Weitere Forschungsprojekte, teilweise in Kooperation mit anderen Instituten, befassen sich u.a. mit der<br />
Differenzierung von Honigen spezifischer Regionen über Pollen- und Isotopenanalyse, der Enzymaktivität von<br />
Honigen mit verschiedenen Zielsetzungen, der Charakterisierung von Sortenhonigen, der Bestimmung von<br />
organischen Säuren im Honig sowie Belastung mit Pyrrolizidinen, Varroaziden und Pflanzenschutzmitteln.<br />
220
Süße Brotaufstriche<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 95<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 13<br />
Untersuchungsprogramme erstreckten sich auf das Vorkommen von Aflatoxinen in Erdnusscremes, das<br />
Vorhandensein von Zutaten auf Basis gentechnisch veränderter Organismen (z.B. Sojalecithin) sowie die<br />
Überprüfung vorhandener Nährwertdeklarationen und QUID-Angaben (Kakaogehalt, Lactose) bei Milch-Schoko-<br />
Cremes und Carobencremes. Carobpulver ist ein Pulver aus der Frucht des Johannisbrotbaums. Hieraus werden<br />
Brotaufstriche nach Art von Nuss-Nougat-Cremes hergestellt, die statt Kakaopulver Carobpulver enthalten.<br />
Zu den Ergebnissen der Untersuchung auf gentechnisch veränderte Organismen wird auf Kap. 4.16.2<br />
verwiesen.<br />
Die Untersuchungen des Aflatoxingehalts in Erdnusscremes ergaben keine Auffälligkeiten.<br />
Der deklarierte Natriumgehalt in den Carobencremes sowie in einer Probe Schokocreme mit Haselnüssen war<br />
unzutreffend. Die Untersuchung ergab jeweils um ein Vielfaches höhere Natriumgehalte.<br />
Weitere Beanstandungen betrafen Kennzeichnungsmängel im Bereich der LMKV, der LKV, der NKV, und der<br />
Fertigpackungsverordnung.<br />
Weiß, H.; Dr. Eichhorn, S.; Dr. Bronner, M. (LI BS); Janke, M.; von der Ohe, K.; von der Ohe, W. (IB CE)<br />
4.16.14 Gemüse- und Kartoffelerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Frischpilze und Pilzerzeugnisse<br />
Gemüseerzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 502<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 124 (= 25 %)<br />
Im Folgenden werden beispielhaft die Ergebnisse einzelner Serienuntersuchungen aus dem Bereich der<br />
Gemüseerzeugnisse berichtet:<br />
- Spinat<br />
20 Proben Tiefkühlspinat wurden auf Nitratrückstände aus der Düngemittelanwendung und den Trockenmasse-<br />
und Sandgehalt als Qualitätsparameter untersucht.<br />
Nach der EG-Verordnung über Höchstgehalte für bestimmte<br />
Kontaminanten in Lebensmitteln darf tiefgekühlter oder<br />
gefrorener Spinat maximal 2000 mg Nitrat pro kg enthalten. Die<br />
Nitratgehalte der untersuchten Proben variierten erheblich von<br />
130 mg/kg bei gering belasteten Erzeugnissen bis gerade<br />
unterhalb der Höchstmenge.<br />
Qualitätsparameter für den redlichen Handelsbrauch bei<br />
tiefgefrorenem Spinat werden in den Leitsätzen für<br />
tiefgefrorenes Obst und Gemüse beschrieben. Danach darf die<br />
Gesamttrockenmasse von tiefgefrorenem Spinat nicht unter 6 %<br />
und der Sandgehalt höchstens 0,1 % betragen. Diese<br />
Parameter wurden von allen Proben erfüllt. Salzsäureunlösliche<br />
Aschebestandteile als Maßstab für Sandverunreinigungen<br />
waren in keiner Probe nachweisbar, und die Trockenmassen<br />
lagen zwischen 6,2 und 9,2 %.<br />
- Karotten – Gläser und Konserven<br />
Vereinzelt wird bei Gemüsekonserven Calciumchlorid als Festigungsmittel deklariert. Festigungsmittel können<br />
das Zellgewebe von Obst und Gemüse stabilisieren und ihm dadurch ein frischeres Aussehen verleihen. Anhand<br />
von elf Proben Karotten in Gläsern und Konserven sollte geprüft werden, ob aus den Calciumgehalten des<br />
Gemüses und der Aufgussflüssigkeiten Rückschlüsse auf den Zusatz von Calciumsalzen möglich sind. Die<br />
Calciumgehalte der Karotten lagen zwischen 180 und 311 Milligramm pro Kilogramm und damit im Bereich der<br />
natürlichen Gehalte nach Souci, Fachmann, Kraut (Souci, Fachmann, Kraut: Zusammensetzung der<br />
Lebensmittel, akt. Auflage). Die Calciumgehalte der Aufgussflüssigkeiten (70 bis 150 mg/kg) waren vermutlich auf<br />
den Stoffübergang aus dem Gemüse zurückzuführen. Bei keiner Probe war ein Zusatz einer Calciumverbindung<br />
deklariert, und auch aus den Ergebnissen konnte nicht auf einen Calciumzusatz geschlossen werden.<br />
221
Die Zinn und Eisengehalte der Karottenkonserven wiesen mit unter 5 Milligramm Eisen pro Kilogramm und<br />
maximal 0,2 Milligramm Zinn pro Kilogramm sehr niedrige Werte auf. Die zulässige Höchstmenge für Zinn in<br />
Lebensmittelkonserven ist 200 mg/kg.<br />
- Rotkohl<br />
Nach der Richtlinie für die Herstellung, Beurteilung und Kennzeichnung von verarbeitetem Rotkohl hat<br />
Rotkohlgemüse<br />
− eine Gesamtrefraktion von mind. 8 % (Extraktgehalt)<br />
− einen Gesamtsäuregehalt (berechnet als Essigsäure) von mind. 0,25 %<br />
(Bestimmungen aus der Presslake). Der Hinweis „Delikatess“ ist nur üblich, wenn die Presslake mindestens eine<br />
Gesamtrefraktion von 13 % aufweist.<br />
In einem Untersuchungsprogramm wurden im März 2006 22 Proben Rotkohlkonserven, darunter viermal<br />
Delikatess-Rotkohl, auf die oben genannten Parameter untersucht. Die Extraktgehalte variierten zwischen knapp<br />
9 und 19 % (Mittelwert: 14 %), wobei höhere Gehalte auch von vielen nicht als „Delikatess“ ausgelobten<br />
Erzeugnissen erreicht wurden. Der Extraktgehalt wird wesentlich vom Zuckergehalt der Erzeugnisse beeinflusst,<br />
so ist ein hoher Extraktgehalt nur bedingt als Qualitätsparameter geeignet. Die Gesamtsäuregehalte lagen bei<br />
den meisten Proben weit über dem Mindestwert (Mittelwert: 0,62 %). Nur von einer Probe wurde dieser aufgrund<br />
des auffallend hohen Apfelanteils (27%!) leicht unterschritten, was toleriert wurde.<br />
Erfolgt im Zusammenhang mit der Verkehrsbezeichnung ein Hinweis auf Wein, so enthalten 100 Kilogramm<br />
Rotkohlgemüse mindestens 2 kg Wein. Bei den hier eingereichten Proben war ein solcher Hinweis nicht erfolgt.<br />
Die Schwermetalle Blei, Cadmium, Eisen, Thallium und Zinn waren bei allen Proben unauffällig.<br />
Von den 22 Proben wurden drei beanstandet: In einem Fall fehlte die Kenntlichmachung des enthaltenen<br />
Süßstoffes in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung, zweimal war der Mengenanteil der Zutat Apfel nicht<br />
angegeben.<br />
- Schwarze Oliven<br />
Oliven werden häufig mit Benzoesäure oder Sorbinsäure<br />
konserviert, und bei schwarzen Oliven ist die Anwendung von<br />
Eisenverbindungen zur Vertiefung der schwarzen Farbe üblich.<br />
Diese Zusatzstoffe müssen nicht nur auf den Fertigpackungen,<br />
sondern auch bei der losen Abgabe von Oliven kenntlich gemacht<br />
werden. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass von 20<br />
Proben viermal die Konservierung gar nicht und zweimal nicht in<br />
der vorgeschriebenen Art und Weise angegeben war. Von 15<br />
untersuchten schwarzen Oliven war die Schwärzung elfmal<br />
deklariert und der Eisengehalt jeweils unterhalb der Höchstmenge<br />
von 150 mg/kg. Bei einer Probe lose angebotener schwarzer Oliven<br />
aus einem griechischen Spezialitätengeschäft mit einem Eisengehalt von 125 mg/kg fehlte die Kenntlichmachung<br />
der Schwärzung.<br />
Aufgrund eines Berichtes des Chemischen und Veterinärinstitutes Sigmaringen, wonach geschwärzte Oliven<br />
auffällig hohe Mengen an Acrylamid von bis zu 1548 µg/kg enthielten, wurden im dritten Quartal zwölf Proben<br />
geschwärzte Oliven auch auf ihren Acrylamidgehalt untersucht. Dabei wurden Gehalte bis 865 µg/kg gefunden,<br />
mit einer Ausnahme lag der Acrylamidgehalt immer über 100 µg und bei einem Drittel der Proben über 500 µg/kg.<br />
In einer Probe grüne Oliven war Acrylamid dagegen nicht nachweisbar. Acrylamid ist im Tierversuch nachweislich<br />
krebserregend. Es bildet sich z. B. bei der trockenen Erhitzung von Kartoffelprodukten und der dabei ablaufenden<br />
Bräunung aus den Inhaltsstoffen Asparagin und reduzierenden Zuckern. Um ein gesundheitliches Risiko für<br />
Menschen so gering wie möglich zu halten, wird angestrebt die Acrylamid-Gehalte in Lebensmitteln zu<br />
minimieren. Siehe hierzu auch Kapitel 4.17.6. Bisher ungeklärt ist dagegen die Ursache der Acrylamidgehalte in<br />
geschwärzten Oliven.<br />
- Gemüseerzeugnisse aus osteuropäischen Ländern<br />
Im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsprogrammes wurden gezielt Gemüse- und Pilzerzeugnisse aus<br />
Osteuropäischen Ländern auf die Verwendung von Zusatzstoffen, insbesondere Konservierungsstoffen,<br />
Süßstoffen und Farbstoffen, untersucht. 50 % der Erzeugnisse mussten beanstandet werden (von insgesamt 48<br />
Proben). Gründe hierfür waren die fehlende Deklaration der Zusatzstoffe, häufig aber auch sonstige<br />
Kennzeichnungsmängel oder eine irreführende Bezeichnung der Erzeugnisse.<br />
222
- Gefülltes Gemüse mit Schafskäse<br />
Die Beanstandung von „Schafskäse“, bei dem es sich nicht um Käse aus Schaf-, sondern aus Kuhmilch handelt,<br />
ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Auch in 2006 mussten von sechs mit „Schafskäse“ gefüllten Gemüsen zwei<br />
Proben „Griechische Peperoni mit Schafsmilchkäse“ beanstandet werden, weil sie ausschließlich aus Kuhmilch<br />
hergestellten Käse enthielten.<br />
Untersuchungen von Gemüseerzeugnissen auf Pestizidrückstände<br />
- Spargelerzeugnisse<br />
Zur Spargelsaison im Mai wurden neun Spargelprodukte auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht.<br />
Es handelte sich dabei sowohl um Tiefkühlware als auch um Spargel in Gläsern bzw. Konservendosen. Das<br />
Ergebnis deckt sich mit dem Untersuchungsergebnis der frischen Ware: die neun Proben waren rückstandsfrei.<br />
- Weinblätter<br />
Auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln wurden zehn Proben Weinblätter geprüft. Nur eine Probe war<br />
rückstandsfrei. In zwei weiteren Proben konnte je ein Wirkstoff nachgewiesen werden. Sechs Proben mussten<br />
wegen Höchstmengenüberschreitungen beanstandet werden. Zwei dieser Proben wiesen jeweils<br />
neun verschiedene Wirkstoffe auf und in einer dieser Proben überschritten sieben Wirkstoffe die jeweiligen<br />
Höchstmengen. Insgesamt wurden 23 verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen.<br />
Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchungen, dass sich an der Rückstandssituation von Weinblättern<br />
in den letzten Jahren kaum etwas verändert hat. Auch frühere Untersuchungen führten zu ähnlichen Ergebnissen.<br />
- Grünkohlerzeugnisse<br />
In den Wintermonaten wurden verschiedene Grünkohlprodukte auf Pflanzenschutzmittelrückstände geprüft. Von<br />
den untersuchten 32 Proben wurden 4 Proben (Grünkohl in Konservendosen) beanstandet. Nachfragen beim<br />
Hersteller ergaben, dass es sich bei dem verarbeiteten Grünkohl um deutsche Ware handelte. In den<br />
beanstandeten Proben wurde jeweils ein Stoff nachgewiesen, der für die Anwendung bei Grünkohl in<br />
Deutschland nicht zugelassen ist. Die Prüfung durch die zuständigen Behörden ergab mittlerweile, dass Abdrift<br />
von Nachbarfeldern als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann.<br />
Gemüsesäfte<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 78<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 7 (= 9 %)<br />
Die Verarbeitung von altem Gemüse oder eine beginnende Gärung ist bei Obst- und Gemüsesäften anhand von<br />
erhöhten Gehalten an Gärungsprodukten wie flüchtigen Säuren, Alkohol und Milchsäure nachweisbar. Bei allen<br />
untersuchten Gemüsesäften und Gemüsetrunken lagen die Gehalte dieser Verderbsindikatoren im<br />
Toleranzbereich. Dabei handelte es sich um Säfte oder verdünnte Säfte (Trunke) aus Tomaten (30 Proben),<br />
Karotten (15 Proben), Roten Beten (8 Proben) und anderen Gemüsen sowie Mischungen daraus. Die Gehalte der<br />
genannten Gärungsprodukte liegen üblicherweise deutlich unter den Richtwerten, z. B. lag der Alkoholgehalt bei<br />
vielen Produkten unter 10 mg/l. Der Richtwert von max. 3000 mg/l wird hier als viel zu hoch angesehen. Bei<br />
einigen Produkten war der Alkoholgehalt andererseits mit über 200 mg/l auffällig hoch, musste jedoch aufgrund<br />
des hohen Richtwertes toleriert werden.<br />
Die Mineralstoffzusammensetzung wurde bei einem Tomaten-Direktsaft beanstandet, der nur 40 % des<br />
deklarierten Jodgehaltes und das zwanzigfache des deklarierten Natriumgehaltes aufwies. Weitere<br />
Beanstandungen bezogen sich ausschließlich auf die Kennzeichnung.<br />
- Tomatensäfte<br />
Für die handelsübliche Zusammensetzung von Tomatensaft hat der europäische Industrieverband A.I.J.N.<br />
(Association of the Industrie of Juices and Nectars from Fruits and Vegetables of the European Union) einen<br />
„Code of Practice“ erstellt. Anhand von 14 Proben wurden die Extraktgehalte und Zuckeranteile überprüft.<br />
Fructose und Glucose sind die Hauptzuckerarten in Tomaten. Der Glucose-Gehalt muss zwischen 10 und 16 g/l,<br />
der Fructose-Gehalt zwischen 12 und 18 g/l und das Glucose/Fructose-Verhältnis zwischen 0,8 und 1,0 liegen.<br />
223
Die untersuchten Säfte enthielten im Mittel 11,1 g Glucose und 12,8 g Fructose pro Liter, bei einem mittleren<br />
Glucose-/Fructose-Verhältnis von 0,87. Die Extraktgehalte lagen überwiegend bei 5,7 (Minimum: 5,3; Maximum:<br />
6,0), womit der Mindestgehalt von 5,0 (bzw. 4,5 excl. Salz) jeweils erfüllt war. Alle untersuchten Tomatensäfte<br />
waren gesalzen, worauf nach deutschem Handelsbrauch in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung<br />
hinzuweisen ist. Die untersuchten Säfte enthielten nur 0,8 % Salz.<br />
Der Patulingehalt lag bei allen Proben unter der Nachweisgrenze von 10 µg/kg.<br />
Kartoffelerzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 88<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 13 (= 15 %)<br />
Kartoffelpüree wird gemäß den Leitsätzen für Kartoffelerzeugnisse aus geschälten und gekochten Kartoffeln<br />
unter möglicher Verwendung von Zutaten wie Milch(erzeugnissen), Salz, Gewürzen, Kräutern und Aromen<br />
hergestellt. Trockenerzeugnisse weisen einen Feuchtigkeitsgehalt von höchstens 10 % auf. Wird im<br />
Zusammenhang mit der Verkehrsbezeichnung auf einen Gehalt an Milch hingewiesen, so muss dieser deklariert<br />
werden (QUID-Angabe). In 40 Proben Kartoffelpüreepulver wurden die Trockenmasse und – soweit angegeben –<br />
der Anteil an Milchpulver (anhand des Lactosegehaltes) überprüft. Bei vier Proben musste die QUID-Angabe<br />
aufgrund eines zu geringen Milchpulveranteils als irreführend beanstandet werden. Der Feuchtigkeitsgehalt<br />
wurde bei keiner Probe überschritten.<br />
Anders sah dies bei einer Probe Pommes frites aus, die wegen eines zu hohen Wassergehaltes von 72 % (er<br />
darf bei vorfritierten, tiefgefrorenen Pommes frites 70 % nicht überschreiten) als wertgemindert beanstandet<br />
wurde. Insgesamt wurden 20 Proben Pommes frites und Backofen-Pommes frites auf ihren Feuchtigkeits- und<br />
Fettgehalt untersucht. Bis auf Kennzeichnungsmängel bei zwei Proben ergaben sich keine weiteren<br />
Beanstandungen.<br />
Bei einer Probe „Rösti bratfertig“ war die Höchstmenge an SO2 überschritten, ebenso bei einer losen Probe<br />
rohe Kartoffeln, bei der zudem die Kenntlichmachung dieses Zusatzstoffes fehlte. Eine Probe „Backofen Herzogin<br />
Kartoffeln“ wies einen deutlich niedrigeren Fettgehalt als deklariert auf.<br />
Eine im Rahmen einer Verbraucherbeschwerde eingereichte Probe sowie eine Verdachtsprobe „Backofen-<br />
Fritten“, bei denen es sich zufällig um das gleiche Produkt mit derselben Chargen-Nr. handelte, mussten beide<br />
aufgrund eines zwar wenig intensiven, aber unangenehmen Geruchs nach Urin und Stall beanstandet werden.<br />
Nicht süße Brotaufstriche<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 58<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 19 (= 33 %)<br />
Bei 58 vegetarischen Brotaufstrichen wurden insbesondere die<br />
Nährwertangaben, die verwendeten Zusatzstoffe und die<br />
Kennzeichnung überprüft. In vier Fällen trafen die Angaben des<br />
Eiweiß- oder Fettgehaltes oder die Angaben zu Fettsäuregehalten<br />
nicht zu. Bei zwei losen Proben war der Geschmacksverstärker<br />
Glutamat nicht kenntlich gemacht, bei zwei weiteren Proben<br />
fehlten die Angaben der Konservierungsstoffe im<br />
Zutatenverzeichnis. Vier Brotaufstriche, die eine intensiv rote<br />
Farbe aufwiesen, wurden auf die toxikologisch bedenklichen und<br />
daher nicht zugelassenen Farbstoffe Sudanrot I bis IV, Sudan<br />
Orange G und Sudan Red 7B untersucht; glücklicherweise konnte<br />
jedoch keine dieser Verbindungen nachgewiesen werden. Die<br />
übrigen Beanstandungen betrafen Kennzeichnungsmängel, wobei<br />
auffiel, dass häufig bei der Angabe einer zusammengesetzten Zutat im Zutatenverzeichnis die Aufzählung der<br />
Zutaten dieser zusammengesetzten Zutat fehlte. Diese relativ neue Kennzeichnungsregelung (Wegfall der „25 %-<br />
Klausel“) wird von vielen Herstellern noch nicht beachtet.<br />
Eine „Gärtnerwurst mit Algen“, die im Wesentlichen aus Wasser, Speiseöl, Getreide, Algen (Laminaria),<br />
Erbseneiweiß, Hühnereiweiß, Paprika und Zwiebeln bestand, musste aufgrund ihres hohen Jodgehaltes als<br />
gesundheitsschädlich eingestuft werden. Da Deutschland ein Jodmangelgebiet ist, kann eine übermäßige<br />
Jodaufnahme insbesondere bei älteren Menschen mit unbekannter Autonomie der Schilddrüse zu<br />
gesundheitlichen Schäden führen. Die Probe enthielt bereits in 20 g, einer Menge, die deutlich unter der<br />
Tagesverzehrsmenge von Wurst liegt, so viel Jod, dass die vom Bundesinstitut für Risikobewertung als<br />
unbedenklich eingestufte Jodmenge überschritten war.<br />
224
Sojaerzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 100<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 30 (= 30 %)<br />
Alle Sojaerzeugnisse wurden auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht, eine Beanstandung ergab<br />
sich hieraus jedoch nicht.<br />
- Soja-Drinks<br />
Einen Großteil der Sojaerzeugnisse machen die Soja-Drinks aus, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.<br />
In 2006 wurden 36 solcher Proben untersucht, 22 davon auf ihren Calcium-Gehalt. Calcium wird vielen Soja-<br />
Drinks in Form von Calciumcarbonat zugesetzt. Sie weisen in der Regel einen Calcium-Gehalt von 120 mg in 100<br />
ml auf und decken mit dieser Menge 15 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen, was auf den Produkten<br />
natürlich auch werblich hervorgehoben wird. Unsere Untersuchungen führten in fünf Fällen zu Beanstandungen<br />
aufgrund eines Calcium-Gehaltes, der deutlich unter dem deklarierten lag. Auffällig war bei einigen dieser Proben<br />
ein Bodensatz aus einer zähen, klebrigen, möglicherweise sehr proteinreichen Masse. Die Untersuchung dieses<br />
Bodensatzes bei einer Probe ergab einen Calcium-Gehalt von 17 %! Allerdings korrelierte die Menge des<br />
Bodensatzes nicht bei allen Proben mit einem geringen Calcium-Gehalt im Getränk, so dass hier noch andere<br />
Einflussfaktoren vermutet werden.<br />
Neben den Calcium-Gehalten wurden in einigen Soja-Drinks die deklarierten Mengen an Zuckern, Fettsäuren<br />
und bei einer Probe an Vitamin B2 und Vitamin E überprüft. Lediglich die Angabe des Vitamin E-Gehaltes wurde<br />
beanstandet, weil die tatsächliche Menge fast dreimal so hoch lag wie auf der Verpackung angegeben.<br />
Neun Soja-Drinks fielen mit Kennzeichnungsmängeln auf, darunter zwei, bei denen der genau<br />
vorgeschriebene Wortlaut „ohne Gentechnik“ nicht eingehalten war. Weitere Beanstandungen mussten bei dieser<br />
Produktgruppe nicht ausgesprochen werden.<br />
- Fleischanaloge auf Sojabasis<br />
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Untersuchung von Fleischanalogen auf Sojabasis. Bei 21 Produkten,<br />
darunter „Vegetarische Wienerle“, „Tofu Grillknacker“ und eine „Soja Fleischwurst“, wurden insbesondere die<br />
Nährwertangaben überprüft. Drei Proben, alle vom selben Hersteller, mussten beanstandet werden, weil die<br />
Eiweiß-, Fett- und/oder Fettsäuregehalte deutlich von den deklarierten Werten abwichen. Bei einer vierten Probe<br />
wurde eine Beanstandung ausgesprochen, weil sie mit dem Slogan „natürlicher Genuss“ ausgelobt worden war,<br />
obwohl sie den synthetischen Farbstoff E 124 Cochenillerot A enthielt. Die genannte Werbeaussage wurde als<br />
irreführend beurteilt. Drei weitere Beanstandungen betrafen lediglich Kennzeichnungsmängel.<br />
- Tofu<br />
Bei zwölf Proben Tofu wurde der hygienische Status überprüft. Die Untersuchung erfolgte nach den von der<br />
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) erarbeiteten mikrobiologischen Kriterien. Alle<br />
zwölf Proben entsprachen den Vorgaben.<br />
225
Pilze und Pilzerzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben:<br />
Anzahl<br />
Probe<br />
n<br />
Anzahl<br />
beanstandet<br />
226<br />
%<br />
beanstan<br />
det<br />
Frischpilze<br />
Kulturpilze,<br />
frisch<br />
25 8 32 %<br />
davon Champignons 14 5 36 %<br />
Wildpilze, frisch 35 16 46 %<br />
davon Pfifferlinge 28 12 43%<br />
Frischpilze<br />
Pilzerzeugnisse<br />
insgesamt 60 24 40 %<br />
davon Champignons 19 3 16 %<br />
davon Pfifferlinge 6 1 17 %<br />
davon MuErr 17 9 53 %<br />
davon Mischpilze 15 7 47 %<br />
Pilzerzeugnisse insgesamt 90 32 35 %<br />
- Frische Pilze<br />
Insgesamt wurden 60 Proben Frischpilze,<br />
überwiegend Champignons und Pfifferlinge,<br />
untersucht. Frischpilze werden im Handel in der Regel<br />
ohne Kühlung angeboten. Da für frische Pilze wie für<br />
frisches Gemüse kein Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
anzugeben ist, werden diese oft zu lange zum Kauf<br />
angeboten. So bezogen sich Beanstandungen<br />
meistens auf mit Schimmel behaftete oder<br />
anderweitig verdorbene Ware bzw. als Vorstufe dazu<br />
auf eine Wert geminderte Beschaffenheit.<br />
Die hohe Beanstandungsquote bei frischen Pilzen in<br />
dieser Hinsicht ergibt sich auch aus der gezielten<br />
Entnahme vom Anschein her bereits auffälliger Ware.<br />
Durch Pressemitteilungen, insbesondere über<br />
verdorbene Pfifferlinge im Handel im Herbst 2006,<br />
wurde das Augenmerk der Lebensmittelkontrolle<br />
Foto: Verdorbene Pilzmischung<br />
verschärft darauf gerichtet und Anlass bezogen eine<br />
besonders hohe Probenzahl an entsprechend auffälligen Pfifferlingen entnommen.<br />
Bei Pfifferlingen wurden außerdem Messungen zur Erhebung der Isotopenverhältniszahlen in Abhängigkeit<br />
von der geografischen Herkunft durchgeführt. Die vorliegenden Daten reichen z. Z. jedoch für die eindeutige<br />
regionale Zuordnung bei unbekannter Herkunft noch nicht aus.<br />
Siehe hierzu auch Kapitel 4.16.10.<br />
Eine Probe frische Champignons wies eine gehäufte Anzahl<br />
von so genannten „Bakterienflecken“ (siehe Foto) auf. Dabei<br />
handelt es sich um eine pilzliche Erkrankung der Fruchtkörper,<br />
die für den Menschen beim Verzehr zwar unbedenklich, jedoch<br />
als Qualitätsmangel anzusehen ist. Die Ware war daher als<br />
zum Verzehr inakzeptabel zu beurteilen.
- Untersuchungen von frischen Pilzen auf Pestizidrückstände<br />
Drei der insgesamt sechs Proben frische Pilze, die auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht wurden,<br />
waren rückstandsfrei. In drei Proben wurde der Wachstumsregulator Chlormequat in geringen, unbedenklichen<br />
Mengen nachgewiesen. Die Höchstmenge für Zuchtpilze liegt bei 10 mg/kg.<br />
Der Wachstumsregulator Chlormequat wird verbreitet im Getreideanbau verwendet, um die Halme kurz zu halten.<br />
Stroh ist ein wichtiger Bestandteil des Substrates bei Zuchtpilzen. Durch das Substrat kann somit Chlormequat in<br />
die Pilze gelangen.<br />
- Pilzerzeugnisse<br />
90 Pilzerzeugnisse wurden untersucht, wovon 32 Erzeugnisse (= 35 %) beanstandet wurden.<br />
<strong>Schwerpunkte</strong> wurden im Berichtsjahr auf die Untersuchung von Pilzkonserven aus osteuropäischen Ländern,<br />
Tiefkühlware und getrocknete Mu Err-Pilze gelegt.<br />
13 Proben getrocknete Mu Err-Pilze, zwei getrocknete Pilzmischungen sowie eine Probe getrocknete<br />
Shiitakepilze aus dem asiatischen Raum wurden mikrobiologisch auf Salmonellen, Schimmelpilze und Bacillus<br />
cereus untersucht. Die Ergebnisse der letzten Jahre hatten gezeigt, dass diese Produkte als besonders sensibel<br />
im Hinblick auf Verunreinigungen durch die genannten Kontaminanten anzusehen sind. Durch die Art der<br />
vorgesehenen Zubereitung über einen „Einweichvorgang“ der getrockneten Pilze kann es zu einer massiven<br />
Vermehrung evtl. vorhandener Salmonellen oder Toxin bildender Bacillus cereus kommen. Die weitere<br />
Verarbeitung stellt dann für den Verbraucher ein nicht unerhebliches Risiko dar, sich aufgrund einer nicht<br />
ausreichenden Durcherhitzung oder Kreuzkontamination anderer Speisen zu infizieren. Erfreulicherweise konnten<br />
in keiner Probe Salmonellen nachgewiesen werden. Allerdings musste eine Probe Mu Err-Pilze aufgrund eines<br />
hohen Schimmelpilzgehaltes und eine weitere Probe wegen eines hohen Bacillus cereus Gehaltes als nicht zum<br />
Verzehr geeignet beanstandet werden.<br />
Verunreinigungen in Form von mineralischer Asche (Sand) lagen jeweils unter dem Toleranzwert von 2 %. Der<br />
maximal zulässige Wassergehalt von 12 % wurde bei zwei Proben getrocknete Mu Err-Pilze mit 15 bzw. 13 %<br />
überschritten. Der erhöhte Wassergehalt stellt eine Wertminderung des Erzeugnisses dar, die kenntlich gemacht<br />
werden muss. Auch während der Lagerung könnte von den Pilzen zu viel Feuchtigkeit aufgenommen worden<br />
sein, wogegen von den Verantwortlichen entsprechende Maßnahmen zu treffen sind (Lagerbedingungen, MHD,<br />
Verpackungsart, Trockenmittel).<br />
Wie bereits im Vorjahr wurde bei drei Proben getrockneter Mu Err-Pilze die Bestrahlung mit ionisierenden<br />
Strahlen nachgewiesen. Auf der Verpackung wurde auf die Bestrahlung hingewiesen. Für Pilze ist eine<br />
Bestrahlung jedoch, anders als für Gewürze, nicht zulässig. Weitere Informationen zur Bestrahlung von<br />
Lebensmitteln sind im Kapitel 4.12.6 zu finden.<br />
Beanstandungen resultierten bei Pilzerzeugnissen darüber hinaus mehrheitlich aus Kennzeichnungsmängeln.<br />
Pilzerzeugnisse werden häufig unter unzureichender oder sogar irreführender Bezeichnung angeboten. Zum<br />
Beispiel dürfen die üblichen deutschen Bezeichnungen Morcheln, Steinpilze, Stockschwämmchen nur für die<br />
entsprechenden hiesigen Pilze verwendet werden. Aufgrund fehlender hier geläufiger Verkehrsbezeichnungen für<br />
viele in asiatischen Ländern übliche Speisepilze werden diese Bezeichnungen häufig auch für asiatische Pilze<br />
ganz anderer Art verwendet. Die Bezeichnungen von seltenen und hochwertigen europäischen Speisepilzen sind<br />
dabei besonders beliebt. Bei einer als „Morcheln“ bezeichneten Probe handelte es sich z. B. tatsächlich um<br />
Mu Err-Pilze, bei als „Chinesische Steinpilze“ bezeichneten Pilzen handelte es sich um eine in China in großer<br />
Menge gezüchtete Seitlingsart. Die hier üblichen Bezeichnungen von Speisepilzen sind in den Leitsätzen des<br />
deutschen Lebensmittelbuches festgelegt. Eine Verwechslung mit hiesigen, i. d. R. hochwertigeren Pilzarten<br />
muss durch die Bezeichnung eindeutig ausgeschlossen werden.<br />
Eine als Beschwerdeprobe eingereichte Konserve aus eingesalzenen Pfifferlingen enthielt als Verunreinigung<br />
einen durchgeweichten Zigarettenstummel. Der betreffende Hersteller war bereits im Vorjahr durch eine<br />
unzureichende Aussortierung von pflanzlichem Begleitmaterial der Waldpilze aufgefallen, worauf von der<br />
zuständigen Kontrollbehörde im Zusammenhang mit dem vorliegenden Befund erneut hingewiesen wurde.<br />
Eine Probe Mischpilze wurde mit der Fragestellung eingereicht, ob die bildliche Darstellung von Pilzen auf dem<br />
Etikett dem Inhalt entspräche. Bei Mischpilzen kann h. E. nicht erwartet werden, dass auf dem Etikett alle in der<br />
Probe enthaltenen Pilze abgebildet werden. Aus der Angebotsform der Mischpilze als Konserve war ersichtlich,<br />
dass es sich um Pilze in Lake handelt, die durch Sterilisation haltbar gemacht worden waren. Diesbezüglich<br />
besteht auch bei Abbildung von frischen Pilzen auf dem Etikett keine andere Verbrauchererwartung. Fraglich war<br />
bei der Probe insbesondere, ob es sich bei einem Teil der enthaltenen Pilze um die deklarierten Reizker handelte.<br />
Unter der Bezeichnung „Reizker“ dürfen nach den Leitsätzen für Pilze und Pilzerzeugnisse neben dem „Echten<br />
Reizker“ (wiss. Bez. Lactarius deliciosus L.) auch verwandte Arten im weiteren Sinne, d. h. auch andere rot<br />
milchende Lactariusarten, angeboten werden. Die abgebildeten Pilzarten waren in der Probe alle enthalten, die<br />
Aufmachung war daher nicht zu beanstanden.<br />
227<br />
Dr. Morales, G.; Dr. Nutt, S.; Dr. Pust, J; Dr. Suckrau, I. (LI OL)
4.16.15 Nüsse, Ölsaaten und daraus hergestellte Erzeugnisse<br />
Nüsse, Schalenobst und Nuss-Fruchtmischungen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 178<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 34<br />
Untersucht wurden verschiedene Schalenobstarten, insbesondere Pistazien, Erdnüsse, Macadamianüsse,<br />
Aprikosenkerne und Maronen (Edelkastanien). Neben der allgemeinen Beschaffenheit und Kennzeichnung<br />
wurden auch die Gehalte an Mykotoxinen überprüft.<br />
- Beanstandungen<br />
Beanstandungen ergaben sich vor allem aufgrund von Kennzeichnungsmängeln, darunter unvollständige<br />
Bezeichnungen, unkorrekte oder fehlende Zutatenverzeichnisse sowie fehlerhafte Nährwertangaben.<br />
Von zwölf Maronenproben wurde eine aufgrund des Anteils an schimmeligen Kernen und des<br />
Schädlingsbefalls als wertgemindert beanstandet.<br />
Zwei Proben Macadamianüsse und eine Frucht-Nuss-Mischung fielen durch einen alten, leicht ranzigen<br />
Geruch und Geschmack auf. Sie wurden als im Genusswert gemindert beurteilt. Bei vier Frucht-Nuss-<br />
Mischungen war die Farbstoffangabe im Zutatenverzeichnis unkorrekt. Zwei Proben (Frucht-Nuss-Mischung und<br />
gezuckerte Erdnüsse) wurden ohne Kennzeichnung in den Verkehr gebracht.<br />
Ein türkisches Erzeugnis, bestehend aus Walnüssen in angedicktem Traubensaft und bezeichnet als „Strudel<br />
mit Trauben“ wurde mit völlig unkorrekten Nährwertangaben ausgelobt, u. a. mit der Aussage „Vitamin Ekipman“<br />
statt „Vitamin E“. Zusätzlich erfolgten krankheitsbezogene Angaben wie „Ernährt Blutzellen und<br />
Lebensmittelaufbauzellen, deshalb wird das Risiko für Herzkreislaufkrankheiten und Krebs gesenkt“. Die Probe<br />
wurde beanstandet.<br />
- Mykotoxine<br />
Für Pistazien aus dem Iran und der Türkei sowie für Haselnüsse ebenfalls türkischer Herkunft sind aufgrund<br />
häufig überhöhter Aflatoxingehalte Sondervorschriften für die Einfuhr oder Vorführpflichten erlassen worden.<br />
Mandeln aus Kalifornien sind im Rahmen des Schnellwarnsystems durch hohe Aflatoxingehalte aufgefallen.<br />
Im Berichtsjahr wurden drei Partien gehackte Haselnusskerne aus der Türkei sowie zwei Partien ungeschälte<br />
Mandeln aus Kalifornien zur Einfuhr vorgeführt.<br />
Die Haselnüsse wiesen keine Aflatoxine auf, die Ware wurde freigegeben. In einer Teilprobe einer Partie<br />
Mandeln wurde ein Aflatoxin B1-Gehalt von 32,7 µg/kg sowie ein Gesamtaflatoxingehalt von 36,9 µg/kg ermittelt.<br />
Die Ware wurde zurückgewiesen.<br />
Weitere Aflatoxinuntersuchungen erstreckten sich auf Pistazien geröstet und gesalzen (13 Proben), Erdnüsse<br />
geröstet und/oder gesalzen, auch mit Hülsen (20 Proben), Macadamianüsse (9 Proben) sowie Mandeln ganz<br />
oder gemahlen (8 Proben).<br />
Eine Probe Pistazien geröstet und gesalzen und eine Probe Erdmandeln enthielten hohe Gehalte an Aflatoxin<br />
B1 (24,7 µg/kg und 9,39 µg/kg). Das Herkunftsland der Pistazien und der Erdmandeln war unbekannt. Die Proben<br />
wurden beanstandet.<br />
Die Untersuchung auf Ochratoxin A in 10 Proben Pistazien und 13 Proben Erdnüssen führte in keinem Fall zu<br />
Beanstandungen. Ochratoxin A war in allen Proben nicht nachweisbar o der nur in geringsten Spuren vorhanden<br />
(siehe hierzu Kapitel 4.17.4 –Mykotoxine).<br />
- Aprikosenkerne<br />
Aprikosenkerne dienen z. B. zur Herstellung von Persipan und wurden bislang daher hauptsächlich in<br />
weiterverarbeitenden Betrieben eingesetzt. Die Marktrelevanz hat jedoch deutlich zugenommen, seitdem<br />
Aprikosenkerne, überwiegend türkischer Herkunft, als Knabberartikel angeboten werden. Neben süßen<br />
Aprikosenkernen finden sich im Warenregal auch bittere Aprikosenkerne. Da durch die in den Kernen enthaltene<br />
Blausäure eine mögliche gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen ist, wurden 22 Proben<br />
Aprikosenkerne auf ihren Gehalt an Blausäure untersucht. Bei süßen Aprikosenkernen lagen die<br />
Blausäuregehalte unter 70 mg/kg, so dass der Verzehr als unbedenklich eingestuft werden konnte. Bittere<br />
Aprikosenkerne weisen dagegen so hohe Blausäuregehalte auf wie bittere Mandeln (2000 bis 3000 mg/kg).<br />
Während sich bittere Mandeln in kleinen Packungseinheiten mit Warnhinweisen versehen im Handel befinden,<br />
werden bittere Aprikosenkerne ohne Einschränkungen zum Kauf angeboten. Im Internet und in einschlägigen<br />
Naturkostläden werden bittere Aprikosenkerne bevorzugt zur alternativen Krebsbehandlung angepriesen.<br />
Ausgelobt wird vor allem das „Vitamin B 17“, bei dem es sich nicht um einen Stoff mit Vitaminwirkung handelt,<br />
sondern um das Amygdalin. Amygdalin ist ein Glycosid, aus dem Blausäure freigesetzt wird. Fünf Proben bittere<br />
Aprikosenkerne wurden als nicht sicheres Lebensmittel beurteilt und beanstandet. Bei zwei Proben, bezeichnet<br />
228
als süße Aprikosenkerne, wurden Blausäuregehalte von 240 mg/kg und 390 mg/kg ermittelt. Diese Gehalte<br />
deuten auf einen nicht unerheblichen Anteil an bitteren Kernen hin. Auch diese Proben wurden als nicht sichere<br />
Lebensmittel angesehen.<br />
Ölsamen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 101<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 18<br />
In diesem Berichtsjahr lag der Schwerpunkt auf Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen und Sesam. Geprüft wurde<br />
auf Mykotoxine. Zusätzlich wurden Sonnenblumenkerne auch auf GVO-Material sowie Sesam und Kokos auf<br />
Salmonellen untersucht.<br />
- Beanstandungen<br />
Die Beanstandungen resultierten überwiegend aus Kennzeichnungsmängeln. Zu erwähnen sind z. B.<br />
unvollständige Bezeichnungen, unvollständige Mindesthaltbarkeitsdaten und Zutatenverzeichnisse sowie Mängel<br />
im Bereich der Losangaben. Eine Probe Sonnenblumenkerne wurde aufgrund eines alten und ranzigen<br />
sensorischen Eindrucks als im Genusswert gemindert beurteilt.<br />
- Salmonellen in Sesam und Kokos<br />
Aufgrund sich wiederholender EU-Schnellwarnmeldungen über den Nachweis von Salmonellen in Sesamsamen<br />
wurden auch in diesem Berichtsjahr verstärkt Sesamproben, geschält und ungeschält untersucht. Es handelte<br />
sich überwiegend um lose Abfüllungen aus Bäckereien. Alle neun Proben erwiesen sich als unauffällig,<br />
Salmonellen waren nicht nachweisbar. Zum gleichen Ergebnis führte die Untersuchung in zwei Sesampasten,<br />
vier Kokosmilchproben und zwei Proben getrocknete Kokosraspeln (siehe hierzu Kapitel 4.17.1 –<br />
Mikrobiologischer Status von Lebensmitteln-).<br />
- Mykotoxine und GVO<br />
14 Proben Sonnenblumenkerne und 18 Proben Kürbiskerne enthielten erfreulicherweise keine Aflatoxine.<br />
Eine Probe Wassermelonenkerne fiel allerdings durch einen hohen Aflatoxin B1 –Gehalt von 11,52 µg/kg auf.<br />
Die zulässige Höchstmenge von 2 µg/kg war deutlich überschritten.<br />
Gentechnisch veränderte DNA konnte in keiner Probe Sonnenblumenkerne nachgewiesen werden (siehe<br />
hierzu Kapitel 4.17.2 –Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderungen).<br />
Verbraucherbeschwerden<br />
Geschälte Sonnenblumenkerne führten in zwei Fällen zu Beanstandungen. Der Beschwerdegrund war bei beiden<br />
Proben ein auffallend chemisch-medizinischer Geruchseindruck, der auch geschmacklich feststellbar war. Es<br />
handelte sich bei den Proben um zwei völlig unterschiedliche Abfüllungen verschiedener Hersteller. Die Proben<br />
wurden als im Genusswert gemindert beurteilt. Die Ursache der sensorischen Abweichung konnte nicht ermittelt<br />
werden.<br />
Ein Verbraucher beschwerte sich über einen abweichenden Geschmack von Walnusskernen. Die Probe<br />
erwies sich jedoch als völlig einwandfrei.<br />
Eine Probe Pinienkerne, vom Beschwerdeführer sensorisch als abweichend und lösungsmittelartig<br />
beschrieben, fiel durch einen sehr harzigen, leicht phenolischen, rauchigen Geruch und Geschmack auf. Die<br />
Probe, ausgelobt als mild und cremig im Geschmack, wurde als im Genusswert gemindert beurteilt.<br />
Bei einer Beschwerdeführerin traten nach dem Verzehr von Haselnüssen Halsbrennen, Atemnot und<br />
Schwellungen auf. Diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen deuten auf eine allergische Reaktion hin. Die<br />
Probe war unauffällig.<br />
Bei einer Probe Walnüsse wurde als Beschwerdegrund Schimmel angegeben. Sowohl die Walnusskerne der<br />
Beschwerdeprobe als auch die Walnusskerne der amtlichen Verfolgsprobe wiesen deutlichen Schimmelbefall auf.<br />
Die Proben wurden als zum Verzehr nicht geeignet beurteilt.<br />
Eine Kokosnuss eines Beschwerdeführers erwies sich ebenfalls als schimmelig.<br />
Weiß, H. (LI BS)<br />
4.16.16 Fruchtsäfte und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Getränkepulver<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1.389<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 340<br />
229
Im Berichtsjahr wurden 1.389 Proben dieser Lebensmittelkategorie untersucht. Davon entfallen 705 Proben und<br />
139 Beanstandungen auf den Bereich Fruchtsäfte und Fruchtnektare und 684 Proben und 201 Beanstandungen<br />
auf die alkoholfreien Erfrischungsgetränke und Getränkepulver.<br />
Fruchtsaft und Fruchtnektar<br />
Untersuchungsschwerpunkte dieser Produktgruppe sind neben der Authentizitätsüberprüfung der Nachweis von<br />
Zusatzstoffen, die Ermittlung der Beschaffenheit (Verderbnisparameter, Vitamingehalt, Hydroxymethylfurfural<br />
(HMF) u. ä.) sowie die Überprüfung der Einhaltung spezieller Kennzeichnungsvorschriften. In den angeforderten<br />
Proben werden die dargelegten Untersuchungsbereiche mit unterschiedlicher Gewichtung je nach Entnahmeort<br />
(beim Hersteller, im Handel oder in der Gastronomie) und mit einem jeweils auf die Fruchtart abgestimmten<br />
Umfang durchgeführt. Schwerpunktmäßig wurden u. a. Trauben-, Grapefruit-, Apfel-, Orangen- und<br />
Holundersäfte, Ananassäfte und –nektare, Multivitamin-Mehrfruchtsäfte und –nektare, Birnensäfte und –nektare<br />
sowie Maracuja-, Kirsch-, Bananen-, Aprikosen-, Pfirsich- und roter sowie schwarzer Johannisbeernektar<br />
untersucht. Darüber hinaus wurden Fruchtsäfte aus Saftbars und Fruchtsäfte und –nektare in<br />
Verbundverpackungen gesondert in Untersuchungsprogramme eingebunden.<br />
- Authentizitätsüberprüfung<br />
Bei der Authentizitätsüberprüfung waren in diesem Berichtszeitraum mehrere Erzeugnisse auffällig. Bei zwei<br />
Erzeugnissen mit den Verkehrsbezeichnungen „Heidelbeersaft“ und „Apfelsaft“ wurde der Zusatz von Wasser<br />
beanstandet. Gemäß den Vorschriften der Fruchtsaftverordnung (FRUSAV) darf einem Fruchtsaft zur Erzielung<br />
eines süßen Geschmackes Zucker in einer Menge von höchstens 150 g/l zugesetzt werden, wenn dieses<br />
Erzeugnis mit der Ergänzung in der Verkehrsbezeichnung „gezuckert“ oder „mit Zuckerzusatz“ in den Verkehr<br />
gebracht. Im Falle des „Heidelbeersaftes“ wurden deutlich mehr als 150 g/l Zucker zugesetzt. Beide Produkte<br />
dürfen auf Grund des Wasser- bzw. auch des Zuckerzusatzes nicht als Fruchtsaft in den Verkehr gebracht<br />
werden. Anhand der analytisch bestimmten Fruchtinhaltsstoffe ist der Fruchtsaftgehalt einer Probe ermittelbar.<br />
Ein „schwarzer Johannisbeernektar“ enthielt nicht den gemäß der FRUSAV geforderten Mindestfruchtgehalt von<br />
25 %, so dass das Erzeugnis nicht als Fruchtnektar bezeichnet werden darf. Die Probe wurde entsprechend<br />
beanstandet. Im Verlauf einer Betriebskontrolle beim Hersteller dieses Erzeugnisses konnte der zu geringe<br />
Fruchtsaftgehalt auf einen systembedingten Fehler beim Ausmischvorgang zurückgeführt werden. Bei zwei<br />
Pfirsichnektaren war schon der deklarierte Gehalt geringer als der nach der FRUSAV geforderte Mindestgehalt.<br />
33 Erzeugnisse, darunter hauptsächlich schwarze Johannisbeernektare und Holundersäfte, wurden auf ihr<br />
Anthocyanspektrum hin untersucht. Die vorhandene Menge an Anthocyanen bzw. ihr Spektrum ist<br />
fruchtartspezifisch und gibt einen Aufschluss über Abbaureaktionen z. B. infolge von unsachgemäßer Lagerung.<br />
Es waren fünf Erzeugnisse (ein Holunder- und ein Heidelbeersaft, sowie ein roter und zwei schwarze<br />
Johannisbeernektare) auffällig.<br />
Gemäß den Leitsätzen für Fruchtsäfte dürfen bei Fruchtsäften die Angabe „mild“ und gleichsinnige Angaben<br />
nur verwendet werden, wenn der Gesamtsäuregehalt deutlich niedriger ist als der in den Leitsätzen festgelegte<br />
Mindestgehalt und sie in ihrem Gesamtbild einen milden Charakter aufweisen. Drei Traubensäfte erfüllten diese<br />
Anforderung trotz vorhandener Auslobung nicht.<br />
Das Verhältnis der Zucker Glucose und Fruktose zueinander ist je nach Fruchtart sehr spezifisch.<br />
Abweichungen deuten auf einen Zuckerzusatz oder eine Fremdfrucht hin. In einem Traubensaftkonzentrat wurde<br />
eine deutliche Abweichung zu den erfahrungsgemäß in Trauben vorkommenden Gehalten festgestellt. Das<br />
Erzeugnis ist daher als Traubensaftkonzentrat bzw. das rekonstituierte Erzeugnis als Traubensaft aus<br />
Traubensaftkonzentrat nicht verkehrsfähig.<br />
Bezüglich eines Untersuchungsprogramms zum Nachweis von Rückverdünnungen bei der Herstellung von<br />
Apfelsäften aus Apfelsaftkonzentrat mit Hilfe der Isotopenanalyse wird auf Kapitel 4.17.11 verwiesen.<br />
- Überprüfung der Beschaffenheit<br />
Gemäß der Definition in der FRUSAV ist ein Fruchtsaft der gärfähige, aber nicht gegorene Saft, der die<br />
charakteristische Farbe, das charakteristische Aroma und den charakteristischen Geschmack der Säfte der<br />
Früchte besitzt, von denen er stammt. Welche Mengen an Alkohol und den biogenen Säuren, wie Milchsäure und<br />
flüchtige Säure, toleriert werden können, um diesen Anforderungen zu entsprechen, ist in den Leitsätzen für<br />
Fruchtsäfte festgelegt. Im Berichtszeitraum wurden vier als Nonisäfte bezeichnete Erzeugnisse als gegoren<br />
beurteilt.<br />
Eine unsachgemäße Herstellung bzw. Behandlung von Fruchtsäften und –nektaren, im Herstellerbetrieb wie<br />
auch im Handel, kann Qualitäts- und Vitaminverluste bedingen, was zu einer nicht unerheblichen Minderung im<br />
Genuss- und Nährwert führt und entsprechend beanstandet wird. Zwei Apfelsäfte wiesen einen überhöhten<br />
Gehalt an HMF auf. HMF wird bei längerer und/oder hoher Wärmeeinwirkung insbesondere aus Zucker und<br />
Aminosäuren gebildet und führt in Geruch und Geschmack zu einer brenzligen Kochnote. Ein erhöhter Gehalt<br />
stellt eine Wertminderung dar. Andere 19 Erzeugnisse enthielten eine unzureichende Menge an Vitamin C. Bei<br />
einem werblich hervorgehobenen aber nicht zutreffenden Vitamingehalt ergab sich eine Beanstandung wegen<br />
irreführender Kennzeichnung.<br />
230
Fruchtsäfte aus Saftbars wurden u. a. auf ihren Keimstatus hin untersucht. Von acht Proben wurden vier auf<br />
Grund zu hoher Keimgehalte bemängelt, eine Probe wurde zusätzlich als gegoren beurteilt. Bei zwei<br />
Orangensäften ergab sich eine Beanstandung wegen fehlender Kühllagerung.<br />
Für Blei ist gemäß der Verordnung (EG) zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in<br />
Lebensmitteln für Fruchtsäfte ein Höchstgehalt von 0,05 mg/kg festgelegt. Wie bereits im Vorjahr wurden<br />
Traubensäfte auf ihren Bleigehalt untersucht. In keiner der 92 Proben wurde eine Überschreitung festgestellt. Der<br />
höchste ermittelte Gehalt betrug 0,028 mg/kg. Der Medianwert lag bei 0,018 mg/kg.<br />
Bezüglich der Mykotoxinuntersuchungen, insbesondere von Patulin in Apfel- und Birnensäften und Ochratoxin<br />
in Traubensäften, wird auf das Kapitel 4.17.4 verwiesen.<br />
Weiterhin wurden 16 Fruchtsäfte und -nektare, die in Verbundverpackungen in den Verkehr gebracht wurden,<br />
auf Isopropylthioxanthon (ITX) untersucht. ITX ist ein UV-Photoinitiator, der beim Bedrucken von<br />
Getränkeverpackungen eingesetzt wurde. Nach der Befüllung dieser Verpackungen kann das ITX in die<br />
Getränke gelangen. Nach bekannt werden dieses Problems haben die Getränkeverpackungshersteller auf ITXfreie<br />
Verpackungen umgestellt. In keiner der untersuchten Getränkeproben konnte ITX nachgewiesen werden.<br />
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 26 Proben Orangensaft und eine Probe Grapefruitsaft auf Rückstände<br />
von Pflanzenschutzmitteln überprüft. Hiervon erfolgte bei 23 Orangensaftproben die Untersuchung im Rahmen<br />
des Lebensmittel-Monitorings 2006. In den meisten Proben wurden keine oder lediglich geringe Spuren von<br />
Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. Lediglich vier Orangensäfte und der Grapefruitsaft enthielten<br />
Pestizidgehalte oberhalb des Spurenbereichs, jedoch unterhalb der jeweils zulässigen Höchstmengen. Im<br />
Einzelnen handelte es sich hierbei um Rückstände von Imazalil (4-mal), sowie jeweils einmal von Oxadixyl und<br />
Thiabendazol. In dem untersuchten Grapefruitsaft wurden sowohl Imazalil als auch Thiabendazol nachgewiesen.<br />
Der relativ häufige Befund von Imazalil - wie Oxadixyl und Thiabendazol fungizid wirksam - dürfte darauf<br />
zurückzuführen sein, dass dieser Wirkstoff besonders gerne und in vergleichsweise hohen Konzentrationen bei<br />
Zitrusfrüchten gegen Schimmelpilzbefall eingesetzt wird.<br />
- Zusatzstoffverwendung<br />
Die Verwendung von Konservierungs- und Farbstoffen ist in Fruchtsäften und –nektaren nicht zulässig. In einem<br />
Orangensaft war der Konservierungsstoff Benzoesäure, in einem Granatapfelsaft und einem Diät-Apfel-<br />
Bananennektar war Sorbinsäure und in einem Mehrfruchtnektar waren sowohl Benzoesäure als auch<br />
Sorbinsäure in technologisch wirksamen Konzentrationen nachweisbar. Ein Guavennektar war mit den<br />
Zusatzstoffen Carboxymethylcellulose E 466 und Xanthan E 415 versetzt.<br />
Bei einem Erdbeersaft und einem Orangennektar wurde der Zusatz des Antioxidationsmittels Ascorbinsäure<br />
nachgewiesen. Der Zusatz von Ascorbinsäure zu Fruchtsäften ist in der für die Oxidationshemmung<br />
erforderlichen Menge nach den Vorschriften der ZZULV zulässig. Die Beanstandung bezog sich daher auf die<br />
fehlende Aufzählung im Zutatenverzeichnis.<br />
In kalorienreduzierten Nektaren ist der Zusatz des Süßstoffs Cyclamat bis zu einer Höchstmenge von 250 mg/l<br />
zulässig. In einem Multivitaminnektar wurde dieser Wert deutlich überschritten.<br />
In drei Sauerkirschnektaren war Citronensäure nachweisbar. Von Natur aus ist in Sauerkirschen die<br />
Gesamtsäure fast ausschließlich durch den Gehalt an L-Äpfelsäure bedingt, der Citronensäuregehalt<br />
überschreitet nach Literaturangaben und eigenen Erfahrungen in der Regel 2% der Gesamtsäure nicht. Dieser<br />
Wert wurde in den auffälligen Erzeugnissen deutlich überschritten. Die fehlende Aufzählung im<br />
Zutatenverzeichnis führte zur Beanstandung, da es sich bei Citronensäure um einen zulässigen Zusatzstoff<br />
handelt und die zulässige Höchstmenge nicht überschritten wurde.<br />
- Kennzeichnung<br />
Neben unzureichender Kennzeichnung nach den Vorgaben der LMKV (49) ergaben sich auch zahlreiche<br />
Beanstandungen entgegen den Bestimmungen der NKV (23). Werden in der Werbung für ein Lebensmittel<br />
Angaben gemacht, die sich auf den Nährwert beziehen, so ist eine Nährwertkennzeichnung erforderlich. Dies<br />
sind insbesondere Angaben, die sich auf Vitamine und Mineralstoffe aber auch Zucker beziehen. In sieben Fällen<br />
fehlte die Nährwertkennzeichnung völlig, in 16 Fällen war sie unvollständig oder unzureichend. Bei vier<br />
diätetischen Erzeugnissen fehlten die gemäß der DIÄTV erforderlichen Angaben bezüglich der besonderen<br />
ernährungsbezogenen Eigenschaften.<br />
Alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Getränkepulver<br />
An alkoholfreien Erfrischungsgetränken wurden im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig u. a. Getränke mit<br />
Hinweis auf „Energy“, „Wellness“, Cola und Chinin untersucht. Weiterhin wurde bei Apfel- und<br />
Orangensaftgetränken der Fruchtgehalt überprüft. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Getränke ausländischer<br />
Herstellung. Eistee wurde auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung besonders des verwendeten Tee- Extraktes<br />
(Schwarztee/Früchtetee) hin kontrolliert; bei Verwendung von Schwarz- bzw. Grüntee sind deutliche<br />
Koffeingehalte vorhanden. Im Winter wurde Kinderpunsch entsprechend der Aufmachung auf (frucht)spezifische<br />
Inhaltsstoffe, auf den aus dem Zimtgewürz resultierenden Cumaringehalt (24 Proben; s. a. Kap.4.16.10) und ggf.<br />
231
ei Verarbeitung von Traubensaft auf das Schimmelpilzgift Ochratoxin hin überprüft. Eine Kinderpunschprobe<br />
vom Weihnachtsmarkt, bei der Zimtstangen zum Würzen verwendet wurden, wies einen auffällig hohen<br />
Cumaringehalt auf. Bei 15 Getränken mit Zusatz von Ascorbinsäure (Vitamin C) und dem Konservierungsstoff<br />
Benzoesäure wurde aufgrund von aktuellen Hinweisen die eventuelle Bildung des toxischen Stoffes Benzol aus<br />
diesen Zutaten überprüft. Da die Aufnahme von Benzol nach Möglichkeit zu minimieren ist, werden Daten<br />
gesammelt, um ein möglicherweise mit der Verwendung von Benzoe- und Ascorbinsäure verbundenes Risiko<br />
erkennen zu können. In den meisten Fällen waren geringe Mengen Benzol (bis 12,6 µg/kg) nachweisbar. Die<br />
Untersuchungen werden im Rahmen des bundesweiten Überwachungsprogramms fortgeführt. Zudem wurden zur<br />
Kontrolle der Verwendung neuartiger Süßungsmittel wie Sucralose und Isomaltulose in Getränken entsprechende<br />
Untersuchungsmethoden etabliert.<br />
Zwei Proben waren mikrobiell verdorben und daher zum Verzehr nicht geeignet. 13 weitere Proben waren<br />
wertgemindert wegen deutlicher Geruchsabweichungen wie z. B. nach Terpenen infolge von Veränderungen des<br />
Citrusaromas. Auch der mikrobiell bedingte Abbau des Konservierungsstoffes Sorbinsäure hatte<br />
Geruchsabweichungen zur Folge, die an organische Lösungsmittel erinnern. In einigen als alkoholfreier Punsch<br />
deklarierten Getränken war kein Punschgewürz feststellbar.<br />
54 Proben wurden wegen irreführender Kennzeichnung beanstandet. In zwölf Fällen waren die Gehalte an<br />
Inhaltsstoffen wie Mineralstoffen z. B. im Rahmen der Nährwertkennzeichnungstabelle nicht zutreffend oder sie<br />
wurden beworben, obwohl sie entsprechend dem Anteil an der empfohlenen Tagesdosis nicht in ausreichender<br />
Menge vorhanden waren. Bei mehreren „Energy“- Getränken war der angegebene Koffein-, Taurin- oder<br />
Inositgehalt nicht zutreffend. Bei neun Proben entsprach der Vitamin C- Gehalt nicht mehr der deklarierten bzw.<br />
zu erwartenden Menge. Vitamin C wird im Laufe der Zeit abgebaut und muss in ausreichender Menge zugesetzt<br />
bzw. vorhanden sein, damit der deklarierte Gehalt bis zum Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nachweisbar<br />
ist. Bei acht Proben ließ die Aufmachung mit abgebildeten naturgetreuen Früchten einen Fruchtanteil vermuten,<br />
obwohl lt. Zutatenverzeichnis kein Fruchtanteil, sondern nur Aroma verwendet worden war. Nach den Leitsätzen<br />
für Erfrischungsgetränke ist diese Aufmachung nur für klare Limonaden zulässig. Neun Proben wiesen trotz der<br />
Kennzeichnung als energiehaltiges Getränk mit Angaben wie „Energy“ oder „Power“ nur einen geringen<br />
Brennwert unter 40kcal (170kJ)auf.<br />
Bei der Überprüfung der Zusatzstoffverwendung bzw. –kenntlichmachung wurden bei dieser Produktgruppe<br />
viele Abweichungen von den rechtlichen Vorschriften beanstandet. Bei elf auf Süßstoffe hin untersuchten Proben<br />
war die vorgeschriebene Kenntlichmachung fehlerhaft oder nicht vorhanden. Süßstoffe müssen in der<br />
Verkehrsbezeichnung als „mit Süßungsmitteln“ und zusätzlich im Zutatenverzeichnis angegeben sein. In einer<br />
Probe wurde die erlaubte Höchstmenge für den Süßstoff Cyclamat überschritten. In zwei Proben fehlte die<br />
Kenntlichmachung der Konservierungsstoffe Benzoe- und/oder Sorbinsäure. Zwei Proben enthielten über dem<br />
Höchstwert liegende Sorbinsäuremengen. In einer Probe wurde ein unzulässiger Farbstoff nachgewiesen. Bei<br />
fünf Proben waren zulässige Farbstoffe im Zutatenverzeichnis nicht deklariert. In sechs weiteren Fällen fehlte die<br />
Angabe des Antioxidationsmittels Ascorbinsäure.<br />
Eine große Zahl an Beanstandungen ergab sich wegen fehlerhafter Kennzeichnung nach den Vorschriften der<br />
LMKV (166), überwiegend wegen unzureichender Zutatenangaben (46 Fälle) wie fehlende oder falsche<br />
Zutatenbezeichnungen oder Zutatenreihenfolge. In vielen Fällen waren die zusätzlich zu den Bezeichnungen oder<br />
E- Nummern anzugebenden Klassennamen unzureichend. 32 Beanstandungen bezogen sich auf die fehlende<br />
Mengenangabe von Zutaten. Die Mengenangabe gemäß § 8 LMKV ist erforderlich, wenn auf diese Zutaten in der<br />
Getränkebezeichnung (z. B. „mit Taurin“; Erfrischungsgetränk „mit Kirsche“) oder durch bildliche Darstellungen<br />
hingewiesen wird, sofern nicht ausdrücklich bei einer Fruchtangabe „mit …geschmack“ als Hinweis auf eine<br />
Aromatisierung angegeben ist.<br />
44 Beanstandungen ergaben sich auch bei dieser Produktgruppe infolge fehlerhafter Nährwertangaben nach<br />
den Vorschriften der NKV. In acht Fällen fehlte eine Nährwertkennzeichnung, obwohl in der Probenaufmachung<br />
auf besondere Nährwerteigenschaften hingewiesen wurde (z. B. „mit Vitamin C“), die eine<br />
Nährwertkennzeichnung erforderlich machen.<br />
Bei dieser Produktgruppe der alkoholfreien Erfrischungsgetränke wird festgestellt, dass die Hersteller<br />
zunehmend ihre kalorienverminderten Getränke als Diätgetränke in den Verkehr bringen. Diese Erzeugnisse in<br />
Einwegverpackungen fallen nicht unter die Pfandregelungen. Bei zehn dieser Proben ergaben sich<br />
Beanstandungen wegen unzureichender Angaben nach den Erfordernissen der DiätV.<br />
Zahlreiche aus dem Ausland importierte Getränke waren in mehrfacher Hinsicht falsch gekennzeichnet.<br />
Während in manchen Fällen die deutsche Kennzeichnung völlig fehlte, lagen teilweise offenbar<br />
Übersetzungsfehler vor, oder die deutsche Kennzeichnung wich von der fremdsprachigen Kennzeichnung, soweit<br />
verständlich, inhaltlich ab.<br />
Dr. de Wreede, I.; Dr. Duske, E.; Dr. Schmidt, A. (LI BS); Monitoring: Dr. Kombal, R. (LI OL)<br />
232
4.16.17 Wein und Erzeugnisse aus Wein einschließlich weinähnlicher Getränke<br />
Für die Untersuchung, die fachspezifische Beurteilung und die lebensmittelrechtliche Begutachtung von Wein,<br />
Erzeugnissen aus Wein, weinähnlichen Getränken und Erzeugnissen aus weinähnlichen Getränken ist in<br />
<strong>Niedersachsen</strong> das Lebensmittelinstitut (LI) Braunschweig zuständig. Integriert sind die für das Land<br />
<strong>Niedersachsen</strong> zur Unterstützung der Überwachungsbehörden bestellten Weinkontrolleure.<br />
Weinkontrolle durch die Weinkontrolleure<br />
Weinkontrolleure sind Weinsachverständige im Sinne von § 31 Abs. 3 des Weingesetzes von 1994.<br />
Die Weinkontrolleure sind ausgebildete Oenologen und zur Unterstützung der Überwachungsbehörden<br />
bestellt. Sie sind im Fachbereich 33 des LI Braunschweig integriert. Damit ist eine enge Zusammenarbeit mit den<br />
für die chemische Untersuchung und die weinrechtliche Beurteilung verantwortlichen Sachverständigen<br />
gewährleistet. Das Aufgabenspektrum umfasst die mit den örtlichen Überwachungsbehörden durchzuführenden<br />
Betriebsprüfungen, insbesondere hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungspflichten, der<br />
Weinbuchführung und Prüfung des für Weine vorgeschriebenen Begleitscheinwesens, sowie die rechtskonforme<br />
Kennzeichnung und Herstellung der Produkte. In besonderen Fällen werden die Weinkontrolleure auch für die<br />
Staatsanwaltschaften tätig.<br />
Innerhalb des Institutes gehört die Erstellung von Kostgutachten sämtlicher eingegangener Proben, verbunden<br />
mit einer Kennzeichnungsprüfung zu den wesentlichen Aufgaben.<br />
Außergewöhnliche Ereignisse<br />
Auch in diesem Jahr mussten im Rahmen der Einfuhruntersuchung von Drittlandweinen mehrere Weine aus<br />
Moldawien wegen unzulässiger Manipulation von der Einfuhr zurückgewiesen werden.<br />
Insbesondere erfreut sich die Bezeichnung „Kagor“ einer besonderen Wertschätzung. Wein mit derartiger<br />
Bezeichnung wird überwiegend in sog. „Russenshops“ angeboten. Der Begriff „Kagor“ ist ein Synonym für<br />
bestimmte Erzeugnisse des Weinbaus, insbesondere für Likörwein aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion.<br />
Hier musste ein Wein, hergestellt aus Weinen der Europäischen Gemeinschaft (ein so genannter EWG-<br />
Verschnitt) wegen Irreführungsgefahr beanstandet werden: Es wurde der Eindruck erweckt, dass das Erzeugnis<br />
aus Russland stammt. Für den Käufer, der insbesondere die russische Sprache versteht, entsteht der Eindruck,<br />
er erwerbe mit diesem Wein einen „Kagor“, wie er in Russland seit dem 19. Jahrhundert hergestellt wird.<br />
Um geschmacklich „vollmundige“ Weine zu erhalten, wird immer wieder versucht, die Weine mit<br />
Glyzerinzusatz „aufzupeppen.“ Der Zusatz von Glyzerin wurde in einem „Vinho Verde“, der als Sonderaktion<br />
angeboten wurde, festgestellt.<br />
Auch in diesem Berichtsjahr wurden mehrere deutsche Weine ohne gültige amtl. Prüfungsnummer im Verkehr<br />
angetroffen. Darunter befand sich auch ein Wein mit einer unzulässig dekorierten Goldmedaille. Ein Wein musste<br />
wegen „Überschwefelung“ (Gesundheitsgefährdung) aus dem Verkauf genommen werden.<br />
„Gammelweine“ aus einem Sonderpostenmarkt standen wegen unzulässigem Inverkehrbringen zur<br />
Verhandlung bei dem zuständigen Amtsgericht an. Während der Verhandlung wurde der Einspruch durch den<br />
Inhaber zurückgenommen.<br />
Wein, Likörwein, Schaumwein, Perlwein<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 698<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 176<br />
Die grundlegende Untersuchung von Weinen erstreckt sich auf die Sensorik, die als Screening-Verfahren von den<br />
hiesigen Weinkontrolleuren durchgeführt wird, die Analyse der Hauptbestandteile wie vorhandener Alkoholgehalt,<br />
Extraktwerte, Zucker-, Säure- und Glyceringehalte sowie die Bestimmung der Gehalte der Konservierungsstoffe,<br />
insbesondere Schwefeldioxid und Sorbinsäure. Bei Schaum- und Perlweinen wird außerdem der<br />
wertbestimmende Kohlensäuredruck überprüft.<br />
Durch den Einsatz des im letzten Jahr neu angeschafften Analysengerätes konnten bei fast allen Proben die<br />
meisten Inhaltsstoffe wie einzelne Säuren (Milch-, Äpfel- und Weinsäure), verschiedene Zuckerarten (Glucose,<br />
Fructose, Saccharose), Glycerin schnell und, da keine Chemikalien notwendig sind, auch kostengünstig bestimmt<br />
werden. Bei abweichenden Analysendaten sind unter Beachtung der Plausibilitäten Bestätigungen der<br />
Analysendaten durch andere, meist chemische/enzymatische Verfahren, notwendig.<br />
Ohne dieses Analyseverfahren wäre der Glycerinzusatz bei einem „Vinho verde“ nicht ohne Weiteres zu<br />
erkennen gewesen; lediglich der im Verhältnis zu anderen Weinen dieser Kategorie erhöhte Extrakt hätte bei dem<br />
herkömmlichen Screeningverfahren (kleine Handelsanalyse) auf einen nicht zulässigen Zusatz schließen lassen.<br />
Für die Erhöhung des Extraktes können aber auch andere Substanzen in Frage kommen.<br />
233
Anhand des Glyceringehaltes ist aber auch zu erkennen, ob der Alkoholgehalt ausschließlich aus der Gärung<br />
des Weines stammt,. Bei zwei osteuropäischen „vin de consum de current“ mit einem Alkoholgehalt von<br />
11,5 % vol stammte ein Teil aus zugesetztem Alkohol. Der Zusatz von Alkohol ist bei Weinen verboten, nicht aber<br />
bei Likörweinen, die jedoch einen Mindestalkoholgehalt von 15 % vol aufweisen müssen. Außerdem war die für<br />
portugiesische Likörweine geschützte Bezeichnung „Portwein“ unabhängig von der nicht rechtskonformen<br />
Zusammensetzung unzulässig.<br />
Erzeugnisse der vorgenannten Art sind nach den weinrechtlichen Bestimmungen weder Wein (Alkoholzusatz)<br />
noch Likörwein (Alkoholgehalt < 15 % vol). Um sie dennoch in der EG vermarkten zu können, wurden sie als<br />
alkoholhaltige Getränke mit der Bezeichnung „Kagor“ eingeführt und im Rahmen der Einfuhrkontrolle untersucht.<br />
Die auf ein Weinerzeugnis hinweisende Bezeichnung „Kagor“ wurde wie auch bei dem „EWG-Verschnitt“ (s.<br />
Weinkontrolle durch die Weinkontrolleure)) beanstandet.<br />
Routinemäßig wird mit dem grundlegenden Untersuchungsumfang (kleine Handelsanalyse) die Identität von<br />
deutschen Qualitätsweinen überprüft. Zu diesem Zweck wird bei der Prüfstelle der Antrag auf Erteilung einer<br />
amtlichen Prüfungsnummer (A.P.Nr.) angefordert, der neben der Kennzeichnung (Anbaugebiet, Rebsorte,<br />
Bereich/Lage, Qualitätsstufe) auch die kleine Handelsanalyse des angestellten Weines beinhaltet. Als nicht<br />
identisch mit dem zur Prüfung angestellten Wein erwies sich eine Probe. Bei einem weiteren Wein waren die<br />
Gehalte an schwefliger Säure (Schwefeldioxid) sehr unterschiedlich; von sechs untersuchten Flaschen lag in drei<br />
Flaschen der Schwefeldioxidgehalt mit der zweieinhalbfachen Menge auch deutlich über dem Grenzwert.<br />
Die routinemäßig, ohne zusätzlichen Aufwand erhaltenen Werte an Glucose und Fructose vereinfachen auch<br />
die Überprüfung der Zusammensetzung der Weine. So war bei zwei Weinen die im Prüfantrag deklarierte<br />
Süßreserve aufgrund des Glucose/Fructose-Verhältnisses in Frage zu stellen. Auch die Geschmacksangaben<br />
stimmen mit denen im Prüfantrag angegebenen und bei der Überprüfung bestätigten Zuckergehalten nicht immer<br />
überein. Mehrere als „lieblich“ bezeichnete Weine entsprachen mit einem Zuckergehalt von mehr als 45 g/l der<br />
Geschmacksangabe „süß“.<br />
Wegen sensorischer Fehler waren 29 Flaschen Wein/Schaumwein/Perlwein zu beanstanden. Zehn Flaschen<br />
waren überlagert und wiesen teilweise sehr ausgeprägte Oxidationsnoten auf; bei zwei dieser Proben war<br />
zusätzlich die untypische Alterungsnote (UTA), feststellbar, 13 Flaschen wiesen ausschließlich die untypische<br />
Alterungsnote auf (die UTA kann geruchliche Noten aufweisen wie nach Bohnerwachs, Dosenchampignon,<br />
Mottenkugeln oder nassen Waschlappen). Während im Vorjahr die überwiegende Anzahl solcher Proben in<br />
Sonderpostenmärkten im Rahmen der Betriebskontrollen der Weinkontrolleure entnommen worden waren,<br />
stammen die Proben dieses Berichtszeitraumes zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem gängigen<br />
Einzelhandel. Hier dürfte eine nicht ausreichende Regalkontrolle der Grund sein. Weitere Gründe zur<br />
abweichenden Beschaffenheit waren u. a. zu hoher Gehalt an flüchtiger Säure (Essigstich), Geranienton und ein<br />
an Abwasser erinnernder Böckser.<br />
Abweichende Beschaffenheit weisen nach wie vor Perlweine auf, die sich von den Schaumweinen<br />
insbesondere durch ihren geringeren Kohlensäuredruck unterscheiden. Der bei Perlweinen auf 2,5 bar<br />
beschränkte Druck lag bei einigen Erzeugnissen deutlich darüber. Sie entsprechen in ihrem sensorischen<br />
Eindruck einem Schaumwein, für die in Gegensatz zum Perlwein in Deutschland Schaumweinsteuer erhoben<br />
wird.<br />
Als irreführend, unzutreffend und/oder unzulässig mussten u. a. folgende Angaben beanstandet werden: Nur<br />
bei Qualitätsschaumweinen b. A., die aus einem bestimmten Anbaugebiet (b. A.) stammen, darf die<br />
Zusatzbezeichnung „Classic“ verwendet werden. In der Etikettierung eines einfachen italienischen Tafelweines,<br />
der in einem Russenshop verkauft wurde, war das Erzeugnis unter der Abbildung eines Klosters in russischer<br />
Sprache ausgelobt als „Tafelwein von hoher Qualität, klösterlich. Bei einem aus den Rebsorten Garganega und<br />
Prosecco hergestellter Perlwein wurde nur die Rebsorte Prosecco groß herausgestellt. Die italienische<br />
Verkehrsbezeichnung „Mosto parzialamente fermentato“ wurde als nicht leicht verständlich beurteilt.<br />
Vielfältig waren auch die Gründe für mangelhafte bzw. nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung. Zu<br />
beanstanden waren u. a. fehlende Importeursangaben, nur codierte Angaben sowie fehlende und nicht<br />
ausreichende Anschriften, was insbesondere für den Käufer, aber auch für die Lebensmittelüberwachung<br />
gegebenenfalls mit einer fehlenden Inverkehrbringerangabe gleich zu setzen ist.<br />
Weitere Beanstandungsgründe waren unzutreffender Alkoholgehalt, Auslobungen, Täuschungen über die<br />
Herkunft und über den Abfüllort, fehlende Verkehrsbezeichnungen sowie andere Verstöße gegen das<br />
Bezeichnungsrecht. So war die Bezeichnung „Tafelwein“ „versteckt“, ein „EWG-Verschnitt“ war als traditioneller<br />
roter (auf russisch) „Kindzmarauli“ gekennzeichnet, durch die unzulässige Art der Abfüllerangabe wurde ein<br />
Flaschenimport aus dem Ursprungsland vorgetäuscht.<br />
Die seit November 2005 vorgeschriebene Kennzeichnung des allergenen Stoffes Schwefeldioxid führte zu<br />
keinen nennenswerten Beanstandungen.<br />
Erzeugnisse aus Wein (außer Likörwein )<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 175<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 23<br />
234
Bezogen auf den Warenkorb sind hier als wesentliche Erzeugnisse aromatisierte Weine, aromatisierte<br />
weinhaltige Getränke und aromatisierte weinhaltige Cocktails zu nennen.<br />
Als Rechtsnormen gelten insbesondere die Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates zur Festlegung der<br />
allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierter Weine,<br />
aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails, das Weingesetz sowie die<br />
Weinverordnung.<br />
Das Untersuchungsspektrum umfasste aromatisierte weinhaltige Getränke und aromatisierte weinhaltige<br />
Cocktails mit saisonbedingten <strong>Schwerpunkte</strong>n bei Wermut oder Wermutwein, Sangria und Glühwein.<br />
Als wesentliche Untersuchungsparameter sind neben der Sinnenprüfung die Bestimmung des vorhandenen<br />
Alkohols und des Gesamtextrakts, die Bestimmung von Kupfer und Cumarin bei Glühweinen sowie<br />
stichprobenartig die Bestimmung von Farb- und Konservierungsstoffen zu nennen. Die wesentlichen Ergebnisse<br />
werden im Folgenden erläutert.<br />
Bei den Produktgruppen der aromatisierten weinhaltigen Cocktails und aromatisierten weinhaltigen Getränke<br />
waren mit Ausnahme der Glühweine insgesamt nur wenige Beanstandungen auszusprechen. Die<br />
Beanstandungen beruhten z. B. auf Kennzeichnungsmängeln wie fremdsprachiger Verkehrsbezeichnung,<br />
mangelhafter Allergenkennzeichnung oder Loskennzeichnung. Bei zwei Proben Sangria war die Angabe des<br />
Alkoholgehaltes auch unter Berücksichtigung der weinrechtlich zulässigen Abweichung von ± 0,3 % vol sowie der<br />
Ergebnisunsicherheit von ± 0,32 % vol unzutreffend und irreführend.<br />
Auch in diesem Jahr wurden wieder Heißgetränke wie „Glühwein“, „Feuerzangenbowle“ oder „Punsch“ in das<br />
Untersuchungsprogramm aufgenommen. Bei rund 40 zur Untersuchung und Beurteilung eingesandten Proben<br />
handelte es sich um lose Proben von Weihnachtsmärkten im Zuständigkeitsbereich. Mit der Bezeichnung<br />
„Glühwein“ in den Verkehr gebrachte Heißgetränke sind weinrechtlich „aromatisierte weinhaltige Getränke“ im<br />
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates. Nach der Verordnung handelt es sich um Getränke, die<br />
ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein gewonnen und hauptsächlich mit Zimt und/oder Gewürznelken<br />
gewürzt werden. Abgesehen von der Wassermenge, die aufgrund der Süßung zugesetzt wird, ist der Zusatz von<br />
Wasser bei der Bereitung von Glühwein untersagt. Für den Gehalt an vorhandenem Alkohol gilt eine Spanne von<br />
mindestens 7 %vol und höchstens 14,5 %vol. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Begriff<br />
„Glühwein“ die offizielle Bezeichnung „aromatisiertes weinhaltiges Getränk“ ersetzen. Die Begriffe<br />
„Feuerzangenbowle“ oder „Punsch“ sind weinrechtlich weder im Gemeinschaftsrecht noch im nationalen Recht<br />
definiert und können nur als Ergänzung zu der offiziellen Verkehrsbezeichnung verwendet werden. Acht Proben<br />
mussten wegen irreführender bzw. nicht korrekter Verkehrsbezeichnung beanstandet werden, weil der gesetzlich<br />
vorgeschriebene Mindestalkoholgehalt unterschritten wurde, weil unzulässigerweise Obst- und Beerenwein<br />
verwendet wurde und die Erzeugnisse nicht der gemeinschaftsrechtlichen Spezifikation für „Glühwein“<br />
entsprachen, oder weil nicht rechtskonforme Verkehrsbezeichnungen wie „Feuerzangenbowle“ verwendet<br />
wurden.<br />
Eine Probe wurde als nicht unerheblich wertgemindert beurteilt. Das untypische Röstaroma sowie der<br />
brenzlige Geschmack waren ein Hinweis auf eine unsachgemäße und zu lange Erhitzung.<br />
Alle lose abgegebenen Proben wurden auch in diesem Jahr wieder auf ihren Gehalt an Kupfer untersucht.<br />
Gemäß Weinverordnung liegt die Höchstmengen für Kupfer bei 2 mg/l.<br />
Die Verantwortlichen der Weihnachtsmarktstände müssen eigenverantwortlich dafür Sorge tragen, dass zur<br />
Herstellung und Aufbewahrung derartiger Heißgetränke nur Gerätschaften zum Einsatz kommen, die die<br />
Einhaltung der gesetzlich festgelegten Höchstmenge gewährleisten.<br />
Drei Proben aus dem Erhitzungstopf mussten wegen eines zu hohen Kupfergehaltes beanstandet werden.<br />
Im Hinblick auf die Minimierung von Cumarin in zimthaltigen Lebensmitteln hatte das LAVES vor Beginn der<br />
Weihnachtsmärkte ein Infoblatt zur Herstellung von Glühweinen, die nach individuellen Rezepturen unter<br />
Verwendung von Zimt hergestellt werden, herausgegeben. Zimt kann deutliche Mengen an Cumarin enthalten,<br />
das eine Leber schädigende Wirkung aufweist. Erfreulicherweise konnte Cumarin in keiner der untersuchten<br />
Weihnachtsmarkt-Proben nachgewiesen werden, ebenfalls nicht bei rund 20 untersuchten Handelsprodukten in<br />
Fertigpackungen, die wie im vorangegangenen Jahr auch sonst von handelsüblicher Beschaffenheit und nicht zu<br />
beanstanden waren.<br />
Weinähnliche Getränke und Erzeugnisse aus weinähnlichen Getränken<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 95<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 17<br />
Das Probenspektrum umfasste diverse weinähnliche Getränke wie Honigwein (Met), Brombeerwein, Kirschwein,<br />
Johannisbeerwein oder Cidre. Zum Untersuchungsumfang sind insbesondere die Sinnenprüfung, die<br />
Bestimmung des vorhandenen Alkohols, des zuckerfreien Extrakts, der flüchtigen und nichtflüchtigen Säure, der<br />
schwefligen Säure und konservierender Stoffe sowie stichprobenartig die Bestimmung von Farbstoffen.<br />
Zusammenfassend sind folgende Normabweichungen hervorzuheben:<br />
235
Bei zwei Kirschweinen stand der analytisch ermittelte Alkoholgehalt nicht mit dem deklarierten Alkoholgehalt im<br />
Einklang. Die dem Verbraucher vermittelten Gehalte überschritten auch unter Berücksichtigung der<br />
Ergebnisunsicherheit die lebensmittelrechtlich zulässige Toleranz von 1,0 % vol und waren daher als irreführende<br />
Angaben zu beurteilen. Die handelsübliche Beschaffenheit für derartige Erzeugnisse wird in den Leitsätzen für<br />
weinähnliche und schaumweinähnliche Getränke beschrieben. Die dort festgelegten Mindestalkoholgehalte<br />
wurden von keiner Probe unterschritten.<br />
Wegen irreführender Aufmachung, fehlender oder nicht korrekter Verkehrsbezeichnung mussten vier Proben<br />
beanstandet werden. So war zum Beispiel ein alkoholhaltiges Getränk als „Holunderblütensekt“ deklariert. Der<br />
Begriff „Sekt“ als Verkehrsbezeichnung ist Qualitätsschaumweinen im Sinne des Gemeinschaftsrechts<br />
vorbehalten. Nicht rechtskonform war auch die Bezeichnung „Moussierende Cider; Prickelnder Fruchtwein“ für ein<br />
aromatisiertes, mit künstlichem Farbstoff und Fruchtsaft versetztes Erzeugnis.<br />
Nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet waren vier Proben, weil die Angabe des Alkoholgehaltes nicht den<br />
Kennzeichnungs-anforderungen entsprach, oder die Anschrift des Verantwortlichen und die Angabe des<br />
Alkoholgehaltes gänzlich fehlten.<br />
Ein Kirschdessertwein wurde beanstandet, weil der analysierte Zusatzstoff Sorbinsäure nicht kenntlich<br />
gemacht war. Die Verwendung dieses Zusatzstoffes hat zur Konsequenz, dass in der Etikettierung eine<br />
Kenntlichmachung durch die Angabe „mit Konservierungsstoff“ oder „konserviert“ zu erfolgen hat. Die Probe<br />
wurde zusätzlich als wertgemindert beurteilt, weil der Gehalt an nichtflüchtiger Säure unterhalb des<br />
handelsüblichen Gehaltes gemäß der Leitsätze für Wein- und schaumwein-ähnliche Getränke lag. Niedrigere<br />
Gehalte können als Indiz für eine unerlaubte Streckung mit Wasser gewertet werden.<br />
Schließlich wurden vier Beanstandungen ausgesprochen, weil die Angabe des Loses verwischt und nicht<br />
identifizierbar und die Anforderungen der Los-Kennzeichnungs-Verordnung nicht erfüllt war.<br />
Weinähnliche Getränke in Fertigpackungen dürfen gemäß der eichrechtlichen Vorschriften nur in den Verkehr<br />
gebracht werden, wenn u.a. die Nennfüllmenge angegeben ist und verbindliche Werte für Nennfüllmengen und<br />
deren Schriftgröße nach Maßgabe der Verordnung eingehalten sind. In fünf Fällen wurden Normabweichungen<br />
festgestellt, weil die Angabe der Füllmenge fehlte. Zwei Proben fielen durch eine unzulässige Flaschengröße<br />
bzw. unzureichende Schriftgröße auf.<br />
Proben, die gleich mehrere Beanstandungsgründe aufwiesen, waren auch in diesem Jahr wieder vertreten.<br />
4.16.18 Bier<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 327<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 70<br />
Borck-Strohbusch, C.; Dr. Hucke, J.; Fischer, M.; Zehmer, H. (LI BS)<br />
Biere werden entsprechend den Vorschriften der Bierverordnung (BIERV) in Verbindung mit der Verordnung zur<br />
Durchführung des Vorläufigen Biergesetzes und dem Vorläufigen Biergesetz nach dem Stammwürzegehalt in<br />
Biergattungen eingeteilt.<br />
Der Stammwürzegehalt eines Bieres ist definiert als der Gehalt an löslichen Stoffen der ungegorenen<br />
Anstellwürze, aus der das Bier hergestellt ist oder nach seiner Beschaffenheit hätte hergestellt sein können. Er<br />
wird aus dem Restextraktgehalt und dem Alkoholgehalt des Bieres errechnet.<br />
Demzufolge zählt die Ermittlung des Stammwürze- und Alkoholgehaltes zur Basisanalytik bei der Beurteilung<br />
der Biere. Sechs Beanstandungen beziehen sich auf einen zu geringen nachweisbaren Stammwürzegehalt.<br />
Gemäß der BIERV darf Bier unter der Bezeichnung „Bockbier“ gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht<br />
werden, wenn der Stammwürzegehalt 16g/100 g oder mehr beträgt. Bei vier Proben, die als „Maibock“<br />
gekennzeichnet waren, wurde diese Anforderung nicht erfüllt. Zwei dieser Proben wurden in<br />
Gaststättenbrauereien angeboten. Ein „Doppelbock“ muss sich durch einen noch höheren Stammwürzegehalt im<br />
Vergleich zu einem Bockbier auszeichnen. Eine Probe war diesbezüglich irreführend gekennzeichnet. Wird ein<br />
Bier mit einem Stammwürzegehalt von unter 11g/100g aber über 7g/100g eingebraut, so darf es nur mit der<br />
Bezeichnung „Schankbier“ vertrieben werden. Eine Beanstandung bezieht sich auf diese fehlende Angabe und<br />
damit irreführende Kennzeichnung.<br />
Die weitere Analytik dieser Produktgruppe einschließlich der Biermischgetränke bezieht sich auf die<br />
Überprüfung der Beschaffenheit und der Zusammensetzung der Erzeugnisse, insbesondere unter<br />
Berücksichtigung der Vorschriften der ZZULV und der Einhaltung der kennzeichnungsrechtlichen Vorschriften. U.<br />
a. wurden Untersuchungsprogramme in Pilsbieren, Malztrunken, Mai-Bockbieren, Weizenbieren, Importbieren,<br />
alkoholfreien Bieren, Biermischgetränken, losen Bierproben aus Gaststätten und speziell Oktoberfestbieren aus<br />
Gaststättenbrauereien durchgeführt.<br />
In zwei aus Osteuropa importierten Bieren wurde der Konservierungsstoff Sorbinsäure in einer Konzentration<br />
von 180 bzw. 140 mg/L nachgewiesen. Sorbinsäure ist ein für Bier nicht zugelassener Zusatzstoff. Die<br />
Erzeugnisse wurden wegen unzulässiger Zusatzstoffverwendung beanstandet. In einem weiteren Bier wurde das<br />
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure nachgewiesen. Da das Erzeugnis mit dem Hinweis „gebraut nach dem<br />
236
deutschen Reinheitsgebot von 1516“ beworben wurde, liegt auch hier ein Verstoß gegen die Vorschriften der<br />
ZZULV vor.<br />
Bei insgesamt 82 losen, in der Gastronomie entnommenen Proben wurden erfreulicherweise keine überhöhten<br />
Keimzahlen nachgewiesen. Nur in einem Fall war der Gehalt an Schimmelpilzen der Gattung Penicillium auffällig.<br />
Weiterhin wurden im Berichtszeitraum in allen untersuchten Bierproben (143) keine erhöhten Gehalte an<br />
Ochratoxin gefunden. Die Ergebnisse zu den Mykotoxinuntersuchungen im Bier werden im Kapitel 4.17.4<br />
dargestellt.<br />
Ein weiteres Untersuchungsprogramm im Berichtszeitraum beinhaltete die Ermittlung der Antimongehalte in<br />
Bieren. Das Programm wurde schwerpunktmäßig in Bieren niedersächsischer Brauereien durchgeführt, ergänzt<br />
durch Proben aus dem Handel von Brauereien aus den anderen Bundesländern und aus dem Ausland. Von den<br />
32 untersuchten Bieren aus <strong>Niedersachsen</strong> enthielt nur ein Bier Antimon in einer Konzentration über 0,005 mg/l,<br />
bei zwei Bieren lag der Gehalt bei 0,0036 bzw. 0,0031 mg/l, bei allen anderen unter 0,0012 mg/l. Die<br />
Nachweisgrenze beträgt 0,0005 mg/l. Bei den anderen Bieren aus dem Handel waren es von den 35 Proben<br />
sieben Erzeugnisse, die Gehalte über 0,005 mg/l aufweisen. Eine Probe war auffällig mit einem Gehalt von<br />
0,0219 mg/l. Es wurde bestätigt, dass es sich bei erhöhten Werten um Einzelfälle handelt. Als mögliche<br />
Kontaminationsquelle für Antimon wird in Fachkreisen das verwendete Filtermaterial (Kieselgur) diskutiert.<br />
Demzufolge handelt es sich um technologisch vermeidbare Kontaminationen, die vom Hersteller minimiert<br />
werden können. Für diese Produktgruppe gibt es keinen in Rechtsvorschriften festgelegten Grenzwert. Der<br />
zurzeit gültige Grenzwert für Mineralwasser und für Trinkwasser beträgt 0,005 mg/l. Die Ergebnisse sind in der<br />
Abbildung 4.16.18.1 dargestellt.<br />
Abbildung 4.16.18.1: Antimongehalte in Bier<br />
Ein obergäriges Bier wurde gemäß den Angaben im Zutatenverzeichnis zusätzlich zu den zulässigen Zutaten<br />
wie Wasser, Gersten- und Weizenmalz, Hopfen und Hefe unter Verwendung von Salz und Koriander hergestellt.<br />
Damit entspricht die Zusammensetzung nicht den Vorgaben des Vorläufigen Biergesetzes und das Erzeugnis<br />
darf nicht mit der Bezeichnung Bier in den Verkehr gebracht werden. Aufgrund der werbenden Hinweise auf<br />
mittelalterliche Rezepturen wurde auf die Möglichkeit eines Antrages einer Ausnahmegenehmigung hingewiesen.<br />
Inzwischen liegt diese Ausnahmegenehmigung vor, und das Bier darf mit dieser Rezeptur hergestellt werden.<br />
In zunehmendem Maße wird auf den Flaschenetiketten der Biere auf Internetseiten des Inverkehrbringers<br />
verwiesen. Bei zwei Produkten befanden sich dort werbende Aussagen, die als unzulässige krankheitsbezogene<br />
Werbung beurteilt und beanstandet wurden. Zum Beispiel: „Bier ist gut für den Cholesterinspiegel“, „mäßiger<br />
Biergenuss hemmt die Arterienverkalkung und schützt vor Herzinfarkt und Schlaganfall“ oder „Bier vermindert das<br />
Krebsrisiko“.<br />
Bei den werbenden Angaben auf Bieretiketten werden weiterhin oft Worte oder Abbildungen verwendet, die als<br />
geographische Herkunftsangaben gedeutet werden können. Trifft diese Assoziation nicht zu, so liegt auch hier<br />
237
eine mögliche Irreführung des Verbrauchers vor, da damit qualitätshebende Eigenschaften verbunden werden<br />
können. In einem Fall wurde ein Klostergut abgebildet und auch ein Wortbestandteil des Namens übernommen,<br />
obwohl das Bier dort nicht hergestellt wird. Bei einer weiteren Probe bezog sich der Name des Bieres<br />
unzutreffender Weise auf einen Fluss- bzw. Stadtnamen. Die Kennzeichnung wird akzeptiert, wenn ein<br />
unmissverständlicher „entlokalisierender Hinweis“ vorhanden ist.<br />
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeiten auslösen können, müssen seit Änderung der LMKV<br />
im Jahre 2004 mit einer eindeutigen Bezeichnung aufgeführt werden. Für die Bierkennzeichnung bedeutet diese<br />
Änderung, dass die Angabe „Malz“ als nicht mehr ausreichend beurteilt wird, da es sich um ein glutenhaltiges<br />
Getreide handelt. Bis Ende November 2005 durften Erzeugnisse noch ohne eine entsprechende Angabe bis zum<br />
Aufbrauchen der Bestände in den Verkehr gebracht werden. Im Jahre 2006 wurden nun nach Ablauf dieser<br />
Übergangsvorschrift bei fünf Proben Beanstandungen wegen unzureichender Malzkennzeichnung<br />
ausgesprochen.<br />
4.16.19 Spirituosen und alkoholhaltige Getränke<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 409<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 80<br />
238<br />
Dr. de Wreede, I.; Dr. Duske, E.; Dr. Schmidt, A. (LI BS)<br />
Spirituosen sind zum menschlichen Verzehr bestimmte alkoholische Flüssigkeiten mit besonderen<br />
organoleptischen Eigenschaften, die einen Mindestalkoholgehalt von 15 % vol aufweisen (Ausnahme von<br />
Eierlikör: 14 % vol). Die alkoholische Komponente muss durch Gärung und nachfolgende Destillation aus<br />
landwirtschaftlichen Rohstoffen gewonnen sein.<br />
Als Rechtsnormen gelten insbesondere die Verordnung<br />
(EWG) Nr. 1576/89 des Rates zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung<br />
und Aufmachung von Spirituosen und die Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 der Kommission mit<br />
Durchführungsbestimmungen sowie die Alkoholhaltige Getränke-Verordnung – AGeV. In dieser Verordnung ist<br />
insbesondere auch die Straf- und Bußgeldbewehrung der Verstöße gegen die gemeinschaftsrechtlichen<br />
Bestimmungen geregelt.<br />
Die auf Prüfplänen des Instituts basierende Probenanforderung umfasste folgende Spirituosen:<br />
Kräuterlikör, Pastis, Maraschino, Weinbrand bzw. Brandy, Steinobstbrände wie Kirschbrand, Pflaumenbrand,<br />
Kirschwasser oder Zwetschgenwasser, Kaffee- oder Mokkaliköre, Beerenobstbrände wie Himbeerbrand und<br />
Brombeerbrand, Getreidespirituosen wie Getreidebrand, Kornbrand und Korn, Kümmelliköre und Mandelliköre.<br />
Von den Lebensmittelüberwachungsbehörden wurden aber auch andere Spirituosen wie Sahnelikör, Eierlikör,<br />
Kräuterlikör, Lakritzlikör, Fruchtliköre, Williams, Whisky, Rum, Spirituosen mit Anis wie Raki, Zimtliköre und<br />
diverse alkoholhaltige Mischgetränke eingesandt.<br />
Der in den Prüfplänen vorgegebene Untersuchungsumfang umfasste insbesondere die Sinnenprüfung, die<br />
Bestimmung des vorhandenen Alkohols und des Gesamtextrakts bzw. des Invertzuckergehaltes, die<br />
gaschromatographische Bestimmung flüchtiger Inhaltsstoffe (höhere Alkohole und Ester) bei Obstbränden, von<br />
Ethylcarbamat bei Steinobstbränden, von Anethol bei Pastis sowie den Nachweis künstlicher Farbstoffe bei<br />
bestimmten Likören. Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse hervorzuheben:<br />
Sinnenprüfung<br />
Sämtliche Proben werden vor Beginn der chemischen Untersuchung einer Sinnenprüfung durch die<br />
Weinkontrolleure unterzogen. Bewertet wird, ob die Erzeugnisse von einwandfreier handelsüblicher<br />
Beschaffenheit oder aber als fehlerhaft abzulehnen sind. Aufgrund des Sinnenbefundes können weitere<br />
chemische Parameter in den Prüfplan aufgenommen werden. In Verbindung mit dieser Prüfung erfolgt eine erste<br />
Überprüfung der Kennzeichnung und Aufmachung, die in einer Checkliste zum Prüfbericht dokumentiert wird.<br />
Ein Likör mit Eizusatz musste im Berichtszeitraum aufgrund von Abweichungen im Geruch und Geschmack als<br />
fehlerhaft und wertgemindert beurteilt werden. Die Probe war deutlich oxidiert und wies sensorische Merkmale<br />
wie „sämige Konsistenz, alt, muffig und ranzig“ auf. Eine Beschwerdeprobe „Weißer Rum“ erwies sich nach der<br />
Verkostung durch die Sachverständigen und der durchgeführten Analysen als von handelsüblicher<br />
Beschaffenheit. Zwei Proben (ein Kümmel, ein Bitter) wurden beanstandet, weil die sensorischen Merkmale<br />
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 für diese Spirituosen nicht wahrnehmbar waren.
Alkoholgehalt<br />
Der in Spirituosen enthaltene Alkohol entstammt landwirtschaftlichen Rohstoffen und wird durch Gärung und<br />
anschließende Destillation (Brennen) gewonnen. Alkohol ist der wesensmäßige wert bestimmende Bestandteil<br />
einer Spirituose. Somit gehört die Bestimmung des Alkoholgehaltes zu den obligaten chemischen<br />
Untersuchungen. Der angegebene Alkoholgehalt war unter Berücksichtigung der lebensmittelrechtlich zulässigen<br />
Abweichung von 0,3 % vol sowie der Ergebnisunsicherheit von 0,32 % vol, bei einem Zwetschgenbrand deutlich<br />
überschritten. Unterschritten wurde der deklarierte Alkoholgehalt bei insgesamt sieben Proben (drei Fruchtliköre,<br />
sowie je ein Honiglikör, Eierlikör, Sahnelikör und Kräuterlikör). Die Anforderungen an den Mindestalkoholgehalt,<br />
der in den Verordnungen (EWG) Nr. 1576/89 und (EWG) Nr. 1014/19 für verschiedene Spirituosen festgelegt ist,<br />
wurden bei den genannten Likören jedoch erfüllt. Der Begriff „Mindestalkoholgehalt“ sagt aus, dass der in der<br />
Verordnung genannte Wert keinesfalls unterschritten werden darf. Weil der Mindestalkoholgehalt für die jeweilige<br />
Spirituosenkategorie nicht erreicht wurde, mussten 6 Proben beanstandet werden (zwei Weizenkorn sowie je ein<br />
Sahnelikör, Obstbrand, Brandy und Scotch Whisky. Spirituosen, die nicht den Spezifikationen für die in den<br />
Verordnungen (EWG) Nr. 1576/89 und 1014/90 definierten Erzeugnisse entsprechen, müssen nach Maßgabe der<br />
Verordnung mit der Verkehrsbezeichnung „Spirituose“ oder „Alkoholisches Getränk“ bezeichnet werden.<br />
Gemäß der Begriffsbestimmungen für Spirituosen in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 gilt als<br />
Spirituose die alkoholische Flüssigkeit, die, mit Ausnahme von Eierlikör, einen Mindestalkoholgehalt von 15 % vol<br />
aufweist. Diese Anforderung wurde von drei Proben, die als Apfellikör, Amaretto Likör bzw. Lakritzlikör ausgelobt<br />
waren, nicht erfüllt. Es handelte sich folglich um Lebensmittel eigener Art.<br />
Bei fünf Proben war das vorgeschriebene Symbol „% vol“ nicht korrekt angegeben.<br />
- Verkehrsbezeichnung<br />
Wegen fehlender bzw. irreführender oder nicht rechts-konformer Verkehrsbezeichnung mussten im<br />
Berichtszeitraum insgesamt 25 Proben beanstandet werden.<br />
So gibt der Extraktgehalt in Verbindung mit dem Gehalt an reduzierenden Zuckern unter anderem Aufschluss<br />
darüber, ob die zu beurteilende Spirituose als Likör einzuordnen ist oder nicht. Die Verordnung (EWG) Nr.<br />
1576/89 definiert Likör als Spirituose, die einen Mindestzuckergehalt von 100 g/l aufweist. Mehrere Proben<br />
mussten beanstandet werden, weil z. B. die Angabe der Verkehrsbezeichnung „Likör“ oder auch „Spirituose“<br />
fehlte und durch Angaben wie „Kräuterschnaps“ oder „Heilbalsam“ ersetzt worden war. Derartige Angaben<br />
können die Verkehrsbezeichnung zwar ergänzen aber nicht ersetzen. Zwei Proben wurden beanstandet, weil die<br />
Bezeichnung „Likör“ aufgrund des zu geringen Zuckergehaltes bzw. die Bezeichnung „Eierlikör“ aufgrund des zu<br />
geringen Eigelbgehaltes nicht gerechtfertigt waren.<br />
Auch zu beanstanden waren fünf Proben, weil die Verkehrsbezeichnung „Spirituose mit Anis“ fehlte, die<br />
Bezeichnung „Bitter“ bzw. „Kümmel“ aufgrund des sensorischen Befundes unzutreffend war und die<br />
ausschließliche Angabe „Amaro“ für einen Bitter, Kräuterbitter oder italienischen Kräuterlikör als nicht<br />
leichtverständlich im Sinne der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung bewertet wurde. In einem Fall war die<br />
Verkehrsbezeichnung „Beerenburg“ nicht ausreichend. Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 darf diese<br />
Bezeichnung lediglich als Zusatz zur Verkehrsbezeichnung (hier: „Spirituose“) geführt werden. Bei einer weiteren<br />
Probe entsprach die Angabe „alkoholhaltiges Getränk“ nicht der verbindlich vorgeschriebenen Deklaration.<br />
Wegen irreführender Aufmachung bzw. werbender Angaben und unvollständiger bzw. fehlender<br />
Herstellerangabe mussten acht Proben beanstandet werden. In zwei Fällen war ein postalisches Auffinden des<br />
Herstellers nicht möglich, weil die Anschrift fehlte. In zwei Fällen fehlten Hersteller und Anschrift gänzlich.<br />
Für eine irreführende Aufmachung ist beispielhaft ein Erzeugnis zu nennen, das als „Spirituose“ in den Verkehr<br />
gebracht wurde. Die Verkehrsbezeichnung wurde durch die Angabe „Williams“ sowie die Abbildung einer Birne<br />
ergänzt, wobei die Angabe „Williams“ durch Schriftfarbe und Schriftgröße gegenüber der Verkehrsbezeichnung<br />
deutlich hervorgehoben war. Die Angabe wurde als irreführend bewertet, da fälschlicherweise der Eindruck<br />
erweckt wird, es handele sich um einen Obstbrand bzw. Birnenbrand im Sinne der EU-Spirituosenverordnung.<br />
Danach ist unter anderem festgelegt, dass die Bezeichnung „Williams“ Birnenbränden vorbehalten ist, die<br />
ausschließlich aus Birnen der Sorte Williams gewonnen werden. Nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet waren<br />
fünf Proben, weil Verkehrsbezeichnung, Füllmenge und Alkoholgehalt nicht im gleichen Sichtfeld angebracht<br />
waren.<br />
Flüchtige Inhaltsstoffe und Aromastoffe<br />
Im Berichtszeitraum wurde bei über 50 Spirituosen, insbesondere Weinbrand und Obstbrand sowie vereinzelt<br />
Tequila und Scotch Whisky der Gehalt an flüchtigen Inhaltsstoffen bestimmt. Soweit Mindestgehalte an flüchtigen<br />
Bestandteilen oder Höchstgehalte für Methanol für bestimmte Spirituosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89<br />
festgelegt sind, wurden mit einer Ausnahme keine Auffälligkeiten festgestellt.<br />
Eine als Brandy in den Verkehr gebrachte armenische Spirituose erfüllte nicht die Anforderungen der EU-<br />
Spirituosenverordnung. Der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen (höhere Alkohole und Ester) lag mit 40 g/hL r. A.<br />
deutlich unter dem geforderten Mindestgehalt für Brandy oder Weinbrand von 125 g/hL r.A.<br />
239
Bei den untersuchten Weinbränden, Whiskys und Obstbränden lagen die ermittelten Methanolgehalte<br />
durchweg unterhalb den gesetzlich festgelegten Höchstgehalten. Hinsichtlich der Mexikanischen Norm für Tequila<br />
waren die hier untersuchten Tequilas ebenfalls von handelsüblicher Beschaffenheit.<br />
Sechs Spirituosen mit Anis wie Pastis (fünf Proben) und Sambuca (eine Probe) wurden auf ihren Gehalt an<br />
Anethol untersucht. Nach Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 muss Sambuca einen Gehalt an<br />
natürlichem Anethol von mindestens 1 g/l und höchstens 2 g/l aufweisen, der Anetholgehalt bei Pastis ist von 1,5<br />
g/L bis 2 g/L festgelegt. Beanstandungen mussten nicht ausgesprochen werden, da die Proben den gesetzlichen<br />
Anforderungen entsprachen.<br />
Ethylcarbamat (Carbamidsäureethylester, Urethan)<br />
19 Steinobstbrände wurden im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsplans auf ihren Gehalt an<br />
Ethylcarbamat untersucht. Ethylcarbamat wird in Steinobstbränden im Wesentlichen aus Blausäure gebildet, die<br />
beim Brennvorgang in das Destillat übergehen kann. Die Blausäure wird zuvor aus natürlichen<br />
Vorläufersubstanzen freigesetzt, die besonders in den Obststeinen vorkommen. Darüber hinaus erscheint es als<br />
erwiesen, dass die Bildung von Ethylcarbamat auch durch Einwirkung von Tageslicht forciert wird. Betroffen sind<br />
insbesondere Steinobstbrände, die in Flaschen oder in Ballons aus Weißglas zum Verkauf vorrätig gehalten<br />
werden. Inzwischen stehen den Herstellern jedoch geeignete technologische Verfahren zur Reduzierung von<br />
Ethylcarbamat zur Verfügung. Dem Ethylcarbamat werden aufgrund tier-experimenteller Ergebnisse genotoxische<br />
und kanzerogene Eigenschaften zugeschrieben. Seitens des früheren Bundesgesundheitsamtes wurden deshalb<br />
hinsichtlich der Aufnahme dieses Stoffes in nennenswerten Mengen bereits 1986 ernste Bedenken geäußert.<br />
Dementsprechend wurde für Obstbrände ein Maßnahmen auslösender Richt- bzw. Toleranzwert von 0,4 mg/L<br />
vorgeschlagen. Ist in einer Spirituose der doppelte Wert, d.h. 0,8 mg/L, überschritten, liegt nach Auffassung der<br />
Behörde eine maßgebliche Überschreitung vor, die eine Beanstandung rechtfertigt. Letzterer Wert war in drei<br />
Fällen (ein Zwetschgenbrand, zwei Kirschwässer) deutlich überschritten. Derartige Erzeugnisse entsprechen<br />
nicht den Anforderungen, die nach derzeitigem Stand brennerei-technischer Möglichkeiten an einen<br />
Steinobstbrand zu stellen sind und wurden im Sinne von Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 als für den<br />
Verzehr durch den Menschen inakzeptabel beurteilt.<br />
- Farbstoffe und Konservierungsstoffe<br />
Die Verwendung künstlicher Farbstoffe ist bei Spirituosen durch die Angabe „mit Farbstoff“ kenntlich zu machen,<br />
ebenso wie der Zusatz von Konservierungsstoffen bei alkoholhaltigen Getränken mit weniger als 15<br />
Volumenprozent Alkohol durch die Angabe „mit Konservierungsstoff“ oder „konserviert“. Hinsichtlich der<br />
fehlenden Kenntlichmachung von Farbstoffen waren sechs Beanstandungen auszusprechen (drei Liköre, zwei<br />
Spirituosen und ein alkoholhaltiges Getränk).<br />
Als irreführend bewertet wurde die Angabe „Enthält weder Farb- noch Konservierungsstoffe“, da in der<br />
betreffenden Probe ein künstlicher Farbstoff nachgewiesen wurde. Ein Likör mit der Angabe „Maraschino“ enthielt<br />
unzulässigerweise einen künstlichen Farbstoff. Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 handelt es sich bei<br />
„Maraschino“ um einen farblosen Likör.<br />
Ein alkoholhaltiges Mischgetränk war als Alkopop im Sinne des Alkopopsteuergesetzes einzustufen. Das<br />
Erzeugnis entsprach nicht den Vorschriften, weil der Warnhinweis „Abgabe an Personen unter 18 Jahren<br />
verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ fehlte.<br />
Füllmengenangabe und Los-Kennzeichnung<br />
Lebensmittel in Fertigpackungen dürfen gemäß Fertigpackungsverordnung nur in den Verkehr gebracht werden,<br />
wenn u.a. die Nennfüllmenge angegeben ist und verbindliche Werte für Nennfüllmengen und deren Schriftgröße<br />
nach Maßgabe der Verordnung eingehalten sind. In 15 Fällen wurden Normabweichungen festgestellt weil die<br />
Schriftgröße unzureichend war.<br />
Gemäß Los-Kennzeichnungsverordnung dürfen Lebensmittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie<br />
mit einer Angabe gekennzeichnet sind, aus der das Los zu ersehen ist. Die Los-Kennzeichnung erfüllt den<br />
Zweck, die Identität eines Erzeugnisses möglichst schnell und einfach feststellen zu können, um im Falle einer<br />
Beanstandung effektiv eingreifen zu können. Verstöße wurden bei insgesamt 23 Proben festgestellt. Die Los-<br />
Kennzeichnung fehlte entweder gänzlich oder war schlecht lesbar bzw. verwischt und nicht identifizierbar.<br />
Im Berichtszeitraum fielen wiederum diverse Proben auf, bei denen gleichzeitig mehrere Normabweichungen<br />
vorlagen. Beispielhaft genannt sei eine Probe mit abweichendem Alkoholgehalt, nicht rechtskonformer<br />
Verkehrsbezeichnung, fehlender Kenntlichmachung des zugesetzten Farbstoffes und fehlender Los-<br />
Kennzeichnung.<br />
Dr. Hucke, J (LI BS)<br />
240
4.16.20 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1.266<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 381 (30,1 %)<br />
Mikrobiologische Untersuchungen<br />
Die mikrobiologische Untersuchung von Speiseeis aus handwerklicher Produktion (Eisdielen) sowie von<br />
Speiseeis-Halberzeugnissen (Speiseeispulver, -ansätze, Aromen und Pasten) im Sommerhalbjahr ist seit Jahren<br />
fester Bestandteil des Untersuchungsumfangs. Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung wurden<br />
Hygieneparameter wie der Gehalt an coliformen Keimen, die Gesamtkeimzahl und der Gehalt an koagulasepositiven<br />
Staphylokokken bestimmt. Des Weiteren wurde auf Krankheitserreger wie Salmonella spp.,<br />
verotoxinbildende Escherichia coli und Listeria monocytogenes untersucht.<br />
Im Berichtsjahr wurden von den o. g. 1.266 Proben 1.081 mikrobiologisch untersucht. Bei insgesamt 328 Proben<br />
erfolgte eine mikrobiologische Beanstandung, was einer Rate von 30,3% entspricht. Erfreulicherweise wurden<br />
wiederum in keiner der untersuchten Eisproben die o. g. pathogenen Mikroorganismen nachgewiesen. Wie auch<br />
in den Vorjahren basierte der Großteil der Beanstandungen auf Überschreitungen der Hygieneparameter.<br />
Ursächlich hierfür waren bei 261 der 328 mikrobiologischen Beanstandungen erhöhte Gehalte an coliformen<br />
Keimen (80%), gefolgt von erhöhten Gehalten an aeroben mesophilen Keimen in 29 Eisproben. Bei 19 Eisproben<br />
waren beide Parameter erhöht. In weiteren 19 Eisproben konnte eine Kontamination mit koagulase-positiven<br />
Staphylokokken nachgewiesen werden.<br />
Bei weiteren 173 Speiseeisproben wurden die Schwellenwerte dieser Keime bei nur einer eingesandten<br />
Ausgangsprobe überschritten, wobei auch hier mit 123 Proben die Überschreitung durch coliforme Keime<br />
dominierte (71%). In 7 Fällen wurde der Schwellenwert für koagulase-positive Staphylokokken überschritten. In<br />
diesen Fällen wurden zur abschließenden Beurteilung mit dem Befund fünf Nachproben angefordert.<br />
Sonstige Untersuchungen (chemische Untersuchung, Zusammensetzung, Kennzeichnung)<br />
Weiterhin wurden 185 Proben dieser Lebensmittelkategorie chemisch auf den Zusatz von Farbstoffen und die<br />
entsprechende Kenntlichmachung, die Zusammensetzung (Fruchtanteil, Milchfettanteil, Pflanzenfettanteil, etc.)<br />
und die korrekte Verkehrsbezeichnung gemäß den Leitsätzen für Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse<br />
überprüft. Die Beanstandungsquote lag in diesem Bereich bei 29% (53 Proben). 14 Proben Fruchteis mussten<br />
beanstandet werden, da sie nicht den in den Leitsätzen für Speiseeis geforderten Anteil an Frucht von<br />
mindestens 20 % aufwiesen. Eine Probe Zitroneneis wies nicht den in den Leitsätzen für Fruchteis aus<br />
Zitrusfrüchten vorgeschriebenen Fruchtanteil von 10 % auf. Die Verkehrsbezeichnung einer Probe „Maracuja-Eis“<br />
wurde beanstandet, da das Eis neben Maracuja als Fruchtkomponente zusätzlich Pfirsich als stückige<br />
Fruchtzubereitung enthielt. Diese Frucht wurde in der Verkehrsbezeichnung nicht genannt. Bei als Milcheissorten<br />
angebotenen Eissorten wurde die per Etikett deklarierte Verwendung von Pflanzenfett beanstandet, da für diese<br />
Eissorten gemäß den o. g. Leitsätzen ausschließlich der Milch entstammendes Fett und/oder Eiweiß verwendet<br />
werden darf. Bei acht losen Eisproben waren die verwendeten Farbstoffe nicht kenntlich gemacht. Bei sieben<br />
Eisproben in Fertigpackungen waren die nach der LMKV geforderten Angaben nicht korrekt angegeben. Bei einer<br />
Probe war die Nährwertkennzeichnung nicht wie vorgeschrieben in einer Tabelle zusammengefasst. Bei einer<br />
original verschlossenen Dose Erdbeer Eispaste wurde nach dem Öffnen im Doseninneren im Bereich der<br />
Füllstandshöhe eine Abblätterung des Lackes festgestellt sowie Korrosionsstellen am Deckel. Die Probe wurde<br />
wegen der festgestellten Abweichungen als für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet beanstandet.<br />
Außerdem war darüber hinaus der Erdbeeranteil der Paste nicht ausreichend, so dass bei Einhaltung der<br />
empfohlenen Dosierungsanleitung kein Erdbeerfruchteis mit einem Fruchtanteil von 20% hergestellt werden<br />
konnte. Eine als „Waldmeister Fruchteis“ bezeichnete lose Probe wurde als irreführend bezeichnet beanstandet,<br />
da Waldmeister keine Frucht im Sinne der Leitsätze für Speiseeis ist.<br />
28 überwiegend lose Proben Speiseeis wurden auf ihren Gehalt an Silber untersucht. Silberhaltige<br />
Zusatzstoffe zur Reduktion des Keimgehaltes sind bei der Herstellung von Speiseeis nicht erlaubt. Trinkwasser,<br />
das zur Herstellung von Speiseeis verwendet wird, darf nur in Ausnahmefällen mit silberhaltigen<br />
Desinfektionsmitteln behandelt werden. Wird z.B. der Portionierer, mit welchem loses Speiseeis entnommen wird,<br />
in Wasser aufbewahrt, das silberhaltige Entkeimungsmittel enthält, so muss er gründlich mit unbelastetem<br />
Wasser abgespült werden, damit keine silberhaltigen Rückstände ins Eis gelangen. Bei vier Proben wurden<br />
nennenswerte Silbergehalte im Bereich von 0,02 bis 0,08 mg/kg festgestellt, eine weitere Probe enthielt einen<br />
relativ hohen Gehalt von 0,55 mg/kg. In allen Fällen wurde eine Überprüfung vor Ort empfohlen.<br />
Schwerpunktmäßig wurden zudem Ausgangsstoffproben für die Vanilleeisherstellung auf die Verwendung<br />
natürlicher Vanille untersucht. Diese Ergebnisse sind in Kapitel 3 zusammengestellt.<br />
Dr. Böhmler, G; Dr. Keck, S.(LI BS); Lemmler, S.; Dr. Woitag, T. (LI OL)<br />
241
4.16.21 Pudding, Cremespeisen, süße Suppen und Saucen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 223<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 38 (17 %)<br />
Süße Dessertsaucen<br />
Im Berichtszeitraum wurden 47 Dessertsaucen zur Untersuchung eingereicht, darunter vor allem verschiedene<br />
Fruchtsaucen, Schoko-, Vanille- und Sahnesaucen, aber auch eine Caramellsauce und eine Waldmeistersauce.<br />
Nur eine Probe war lose an Verbraucher abgegeben worden, die anderen befanden sich in Fertigpackungen.<br />
Das Hauptaugenmerk richtete sich auf die Gehalte an Zusatzstoffen, und zwar in erster Linie auf<br />
Konservierungs- und Süßstoffe. Erfreulicherweise ergaben sich keine Beanstandungen: Weder waren<br />
Zusatzstoffe unerlaubt zugesetzt worden noch waren Höchstmengen überschritten, und auch die Kennzeichnung<br />
der Zusatzstoffe war einwandfrei.<br />
Darüber hinaus wurde bei einigen Proben die Zusammensetzung überprüft. In den Fällen, in denen<br />
Fettgehalte deklariert waren, wurden diese kontrolliert. Bei Sahnesaucen wurden anhand der Milchfettgehalte die<br />
„gequiddeten“ Sahneanteile, bei Schokoladensaucen anhand der Puringehalte die Kakaoanteile bestimmt und mit<br />
den Vorgaben – hier insbesondere aus den Leitsätzen für Puddinge, andere süße Desserts und verwandte<br />
Erzeugnisse – verglichen. Auffälligkeiten ergaben sich nicht. Lediglich bei einer Probe „Vanille Soße“ wurde die<br />
Verkehrsbezeichnung als irreführend beanstandet, weil nicht natürliches Vanille-Aroma, sondern lediglich der<br />
Aromastoff Vanillin zur Aromatisierung verwendet worden war.<br />
Weitere vier Beanstandungen betrafen Kennzeichnungsmängel.<br />
Fruchtkaltschalen<br />
Im heißen Sommer 2006 waren Fruchtkaltschalen sehr beliebt, sorgten sie doch anstelle einer heißen Suppe für<br />
etwas Abkühlung. Acht Produkte wurden im Labor eingereicht, darunter zwei lose Proben aus Kantinen und<br />
sechs Fertigpackungen. Die Untersuchung auf Farbstoffe führte zu keiner Beanstandung. Entweder waren keine<br />
synthetischen Farbstoffe enthalten oder sie waren gekennzeichnet. Allerdings musste eine lose Probe<br />
beanstandet werden, weil der Süßstoff Cyclamat nicht ausreichend kenntlich gemacht war.<br />
Mousse au Chocolat<br />
Eine Mousse ist ein aufgeschlagenes, schaumiges, süßes Dessert. Handelt es sich um eine Mousse au Chocolat,<br />
so enthält sie –gemäß den Leitsätzen für Puddinge, andere süße Desserts und verwandte Erzeugnisse –<br />
mindestens 30 g Kakaoerzeugnisse, wie z. B. Schokolade, Kakaomasse oder Schokoladenpulver, oder<br />
mindestens 20 g reines Kakaopulver in 500 g verzehrfertigem Erzeugnis.<br />
Bei 19 Proben Mousse au Chocolat wurde anhand des Puringehaltes der Kakaoanteil überprüft. Eine<br />
Beanstandung ergab sich erfreulicherweise nicht, bei allen Proben handelte es sich um hochwertige Produkte.<br />
Milchreis<br />
Milchreis ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen auf dem Markt erhältlich: von „natur“ über Milchreis mit<br />
Zimt und Zucker bis hin zu Milchreis mit Schokoladen-, Vanille- oder verschiedenen Fruchtsaucen. Dieses<br />
Sortiment spiegelte sich auch in den hier eingereichten 16 Proben wider. Sie wurden in erster Linie auf<br />
Konservierungs- und Süßstoffe untersucht, die insbesondere über die Saucen in die Produkte gelangen können.<br />
Beanstandungen mussten allerdings diesbezüglich nicht ausgesprochen werden.<br />
Dagegen wurde eine Probe „Milchreis mit Erdbeer-Rhabarber“ beanstandet. Auf der Vorder- und Rückseite der<br />
Verpackung waren eine Vanilleblüte und einige Vanilleschoten abgebildet. In solch einem Fall erwartet der<br />
Verbraucher ein Produkt, das ausschließlich mit natürlichem Vanillearoma aromatisiert wurde. Da im<br />
Zutatenverzeichnis nur der naturidentische Aromastoff Vanillin aufgeführt war, wurde die Aufmachung der Probe<br />
als irreführend beurteilt.<br />
242
Untersuchung von Roter Grütze, Fruchtdesserts und Fruchtsoßen auf Benzol<br />
Insgesamt wurden 29 Proben (allesamt Fertigpackungen) auf das krebserregende und erbgutschädigende Benzol<br />
untersucht, das möglicherweise in geringen Mengen aus Benzoesäure in Gegenwart von Ascorbinsäure entsteht.<br />
Bei den Proben handelte es sich überwiegend um die klassische „ Rote Grütze“, aber auch drei „Wintergrützen“,<br />
zwei Grützen aus Waldbeeren, zwei aus Erdbeeren und Rhabarber und drei Fruchtsoßen waren darunter.<br />
Sämtliche Proben waren nicht mit Benzoesäure konserviert worden.<br />
In einer Roten Grütze wurde ein Benzolgehalt von 3,6 µg/kg ermittelt, bei allen anderen Proben lagen die<br />
Gehalte unter 1 µg/kg, z. T. sogar unter der Nachweisgrenze von 0,1 µg/kg.<br />
Zu einer ausführlichen Darstellung dieser Problematik wird auf Kapitel 4.17.6 verwiesen.<br />
4.16.22 Süßwaren und Kaugummi, Zucker<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 566<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 191 (35 %)<br />
243<br />
Dr. Nutt, S. (LI OL)<br />
Für die Produktgruppe Süßwaren gibt es neben den allgemein geltenden horizontalen lebensmittelrechtlichen<br />
Vorschriften, den Leitsätzen für Ölsamen und daraus hergestellten Massen und Süßwaren und Vorschriften zu<br />
einzelnen Inhaltsstoffen in der Aromenverordnung oder LMKV noch die »Richtlinie für Zuckerwaren« des BLL,<br />
Heft 123, Bonn 123 1995, eine Publikation der Wirtschaftsverbände, als Beurteilungsgrundlage.<br />
Die Analytik richtete sich vor allem auf wertbestimmende Zutaten, die in der Verkehrsbezeichnung genannt oder<br />
beworben werden, auf Zusatzstoffe sowie auf die Überprüfung der deklarierten Nährwertangaben.<br />
Wertgebende Anteile sind zum Beispiel Schokoladenanteile in Süßwaren wie Karamellen oder Dragees oder<br />
Ethanolanteile in Rumkugeln.<br />
Insbesondere wurden Untersuchungsprogramme zu Halva, Nougat, kandierten Früchten, Fondant,<br />
Fruchtschnitten. Schaumzuckerwaren, Lakritz, dragierten Nüssen und Ölsamen, Rumkugeln und Süßwaren für<br />
Diabetikern und Traubenzucker durchgeführt.<br />
70 Süßwaren aus Nüssen und Ölsamen wie Halva, Nougat und dragierte Produkte wurden auf Aflatoxine<br />
untersucht. In keiner der Proben wurden die Grenzwerte für Aflatoxine der Mykotoxinverordnung überschritten.<br />
Beanstandungen<br />
Beanstandungen bei Süßwaren ergaben sich hauptsachlich aus einer fehlerhaften Kennzeichnung und weniger<br />
aus der Zusammensetzung der Produkte. So wurden 113 Proben aufgrund von Kennzeichnungsmängeln im<br />
Bereich der LMKV beanstandet.<br />
Halva<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 26<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 24 (92 %)<br />
Halva ist eine Süßware, die ursprünglich aus Indien und Persien kommt, aber auch in Russland, Griechenland,<br />
Libanon und der Türkei sehr verbreitet ist. Die Grundmasse von Halva besteht aus Sesamsamen oder<br />
Sonnenblumenkernen, die mit Zucker, Honig und Pflanzenöl fein vermahlen sind. Je nach Art werden Erdnüsse,<br />
Kakao, Pistazien oder Mandeln beigefügt.<br />
Die hohe Beanstandungsquote ist darauf zurückzuführen, dass die hier untersuchten Halva-Proben Importe<br />
waren und hauptsächlich fehlerhafte Kennzeichnungen sowohl im Bereich der LMKV als auch NKV aufwiesen.<br />
Je eine Probe enthielt Echtes Seifenkraut bzw. Silberdistelwurzelextrakt. Dies sind nicht zugelassene<br />
Zusatzstoffe daher wurden die Proben diesbezüglich beanstandet.<br />
Sehr kleine Süßwaren ohne Zuckerzusatz zur Erfrischung des Atems<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 29<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 9 (31 %)<br />
Dies sind in der Regel kleine Presslinge oder Blättchen, die auf der Zunge zergehen.
Eine Probe enthielt 8296 mg/kg Acesulfam K und wurde aufgrund dieser Höchstmengenüberschreitung<br />
beanstandet. Die Höchstmenge liegt bei 2500mg/kg. Weitere Beanstandungsgründe waren bei dieser Probe der<br />
nicht korrekte Warnhinweis für den Süßstoff Aspartam, die fehlende Kennzeichnung der Süßstoffe in der<br />
Verkehrsbezeichnung, ein fehlerhaftes Zutatenverzeichnis und weitere Mängel nach der LMKV.<br />
Kennzeichnungsmängel im Bereich der LMKV führten zu den anderen acht Beanstandungen.<br />
Diätetische Süßwaren<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 21<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 5 (24 %)<br />
Falsche Nährwertangaben bei den Eiweißgehalten führten zu 2 Beanstandungen. Die weiteren Beanstandungen<br />
wurden aufgrund von fehlerhaften Kennzeichnungen ausgesprochen.<br />
Rumkugeln<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 18<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 3 (16 %)<br />
Rum, häufig Jamaika-Rum, ist der wertbestimmende Bestandteil von Rumkugeln. Zwei Proben enthielten<br />
zuwenig Ethanol, bei einer Probe fehlte die Mengenangabe des Rumanteils.<br />
Lakritz<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 39<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 10 (26 %)<br />
Lakritz enthält zwei gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe, Glycyrrhizin und Ammonumchlorid, die beide den<br />
Elektrolythaushalt des Körpers beeinflussen können.<br />
Glycyrrhizin ist ein natürlicher Bestandteil der Süßholzwurzel. Lakritzprodukte, die in Deutschland mehr als 0,2<br />
g/100g Glycyrrhizin enthalten, müssen als Starklakritz gekennzeichnet werden.<br />
In salziger Lakritz ist ohne Warnhinweis ein maximaler Gehalt von 2 % Ammoniumchlorid erlaubt. Lakritz mit<br />
Ammoniumgehalten von 2 %-4,49 % müssen den Warnhinweis „Erwachsenenlakritz- kein Kinderlakritz“<br />
enthalten, und Lakritz mit Ammoniumgehalten von 4,5 %-7,99 % müssen den Warnhinweis „Extra stark,<br />
Erwachsenenlakritz- kein Kinderlakritz“ enthalten.<br />
Zwei Proben wurden aufgrund von Ammoniumchloridgehalten von 8,4 % und 12,1 % beanstandet.<br />
Zwei weitere Proben wurden wegen fehlender Warnhinweise beanstandet.<br />
Kennzeichnungsmängel im Bereich der LMKV führten zu den anderen Beanstandungen.<br />
Fruchtschnitten<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 32<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 12 (38 %)<br />
Fruchtschnitten sind Riegel aus getrockneten Früchten mit Getreide und Nüssen zwischen zwei Oblaten, die<br />
häufig vitaminisiert sind.<br />
Elf Proben wurden aufgrund von unzutreffenden Nährwertkennzeichnungen beanstandet. Abweichungen wurden<br />
sowohl bei den Hauptbestandteilen Fett und Eiweiß als auch bei den Mineralien und Vitaminen festgestellt. So<br />
wurden für das Vitamin E Abweichungen von -75 % bis +126 % analytisch gemessen.<br />
Kandierte Früchte<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 14<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 5 (36 %)<br />
Bei drei Produkten fehlte der Hinweis auf die Konservierung durch Schwefelung.<br />
244
Zucker<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 32<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 6 (19 %)<br />
Es wurde Vanille-Zucker als Ausgangsstoff aus Bäckereien angefordert. Von sieben Proben waren fünf als<br />
Vanillin-Zucker (naturidentisches Vanillin) gekennzeichnet. Aber auch zwei als Vanille-Zucker gekennzeichnete<br />
Proben enthielten nur naturidentisches Vanillin und mussten wegen Täuschung beanstandet werden.<br />
Zwei Produkte, Rumkandis bzw. Orangen Candy Zucker, wurden beanstandet, da die Mengenangabe des jeweils<br />
wertgebenden Bestandteils fehlte.<br />
Beschwerdeproben<br />
Eine Milchschokolade in Stückchen, einzeln eingepackt in Folie und in einer Tüte verschweißt, wurde aufgrund<br />
der starken sensorischen Abweichung (Geruch und Geschmack) als nicht zum Verzehr geeignet und Ekel<br />
erregend beanstandet. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Kontamination durch einen Lufterfrischer, der<br />
in der gleichen Filiale angeboten wurde, verursacht worden war.<br />
Dr. Nuyken-Hamelmann, C. (LI OL)<br />
4.16.23 Kakao, Schokolade und -erzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 380<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 76<br />
Als Grundlage für die Untersuchung und Beurteilung von Kakao- und Schokoladenprodukten dient die<br />
Kakaoverordnung. Dort sind unter anderem die Mindestwerte für wertbestimmende Zutaten festgelegt. Überprüft<br />
wurden die Gehalte an Milchfett, Kakao- und/oder Milchtrockenmasse in Milch-, Bitter- und weißen Schokoladen<br />
sowie im Schokoladenanteil gefüllter Schokoladen.<br />
Bei kakaohaltigen Getränkepulvern und bei Schokoladenerzeugnissen für Diabetiker wurden die<br />
Mengenangaben bestimmter Zutaten und die Angaben zur Nährwertkennzeichnung kontrolliert. Mit Schokolade<br />
überzogene Früchte wurden auf Fremdfettzusatz untersucht.<br />
Das Angebot an bitteren Schokoladen, die häufig auch unter Verwendung von Edelkakao hergestellt werden,<br />
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Edelkakao, insbesondere aus Südamerika, weist naturbedingt hohe<br />
Cadmiumgehalte auf. Rechtsverbindliche Grenzwerte für Cadmium in Schokolade gibt es zurzeit nicht. Als<br />
Beurteilungshilfe können die ehemaligen Richtwerte der Zentralen Erfassungs- und Bewertungsstelle für<br />
Umweltchemikalien dienen. Danach liegt der Richtwert für Schokolade bei 0,3 mg/kg. Im Berichtsjahr 2006<br />
wurden bei 36 Schokoladen mit einem Kakaoanteil von 46% bis 85% die Cadmiumgehalte bestimmt. Die<br />
ermittelten Gehalte bewegten sich zwischen 0,01 mg/kg und 0,58 mg/kg. Fünf von neun Proben mit Hinweis auf<br />
die südamerikanische Herkunft des Edelkakaos (Mittelwert: 0,35 mg/kg), sechs von 22 Proben ohne oder mit<br />
nicht südamerikanischer Herkunftsangabe des Edelkakaos (Mittelwert: 0,21 mg/kg) und keine von fünf Proben<br />
ohne Hinweis auf Qualität des Kakaos (Mittelwert: 0,09 mg/kg) lagen oberhalb des Richtwertes von 0,3 mg/kg.<br />
14 Pralinenproben und eine Zartbitterschokolade wurden auf Pflanzenschutzmittelrückstände geprüft. In zwei<br />
Pralinenmischungen wurden Spuren des Insektizids Chlorpyrifos nachgewiesen.<br />
17 Schokoladen mit Zusatz von ganzen oder gehackten Haselnüssen, Mandeln, Rosinen oder Pekanüssen<br />
wurden auf ihren Gehalt an Aflatoxinen untersucht. Aflatoxin B1 wurde in sieben Proben (Zusatz: dreimal ganze<br />
Haselnüsse, dreimal gehackte Haselnüsse und einmal Pekanüsse) nachgewiesen. Bei zwei Proben lagen die<br />
Gehalte im Spurenbereich unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,1 µg/kg Schokolade, die Gehalte der anderen<br />
fünf Proben lagen zwischen 0,13 µg/kg und 0,35 µg/kg Schokolade. Berechnet man aus den ermittelten Gehalten<br />
den Aflatoxingehalt bezogen auf den Nussanteil, so ergeben sich Werte von 1,2 µg/kg bis 2,6 µg/kg. Somit<br />
wurden zum Teil Werte im Bereich der Höchstmenge für Schalenfrüchte festgestellt.<br />
Bestimmte Lebensmittelzutaten können bei einigen Verbrauchern Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen.<br />
Unbeabsichtigte Beimischungen gelten nicht als Zutat und müssen somit nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt<br />
werden. Im Rahmen einer Herstellerkontrolle wurden drei Schokoladen ohne Zusatz von Nüssen als Probe<br />
entnommen und auf Haselnuss- und Erdnusskontaminationen untersucht. In keiner Probe wurden entsprechende<br />
Kontaminationen nachgewiesen (Nachweisgrenze: 5 mg/kg).<br />
Vier Schokoladenartikel mit Zimtzusatz und eine Schokolade mit Zimtgeschmack wurden auf den<br />
Pflanzeninhaltsstoff Cumarin untersucht. In zwei Proben wurde kein Cumarin nachwiesen. Die Werte der anderen<br />
drei Proben lagen zwischen 8 mg/kg und 27 mg/kg. Unter Einbeziehung einer durchschnittlichen täglichen<br />
Verzehrsmenge von 50 g Schokolade, gelten die Erzeugnisse noch als sicher (Erläuterungen hierzu siehe Kapitel<br />
4.16.24).<br />
245
Beanstandungen<br />
Der größte Anteil der Beanstandungen beruht auf Kennzeichnungsmängeln überwiegend nach LMKV und<br />
Kakaoverordnung.<br />
Die Mindestvorgaben der Kakaoverordnung wurden von allen untersuchten Proben eingehalten. Besonders<br />
ausgelobte Gehalte an Kakao- und Milchtrockenmasse wurden in drei Fällen erheblich unterschritten und als<br />
irreführend beanstandet. Die Verkehrsbezeichnung oder die Bezeichnung der Füllung war bei sechs<br />
Schokoladenerzeugnissen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Zutatenverzeichnis als irreführend anzusehen.<br />
Ein Erzeugnis in Tafelform, das laut Zutatenverzeichnis unter Verwendung von Pflanzenfett und 13,5%<br />
Kakaomasse hergestellt wurde und nur mit einer Fantasiebezeichnung versehen war, wurde wegen irreführender<br />
Aufmachung beanstandet.<br />
Bei drei Schokoladenartikeln war die Verwendung nicht zugelassener Zusatzstoffe zu beanstanden. Zwei<br />
Milchschokoladen wurden mit Ethylvanillin aromatisiert und die Masse einer weißen Schokolade war mit den<br />
Farbstoffen E 100 und E 132 eingefärbt.<br />
Als nicht zum Verzehr geeignet erwies sich eine Pralinenmischung wegen Ungezieferbefall. Erheblich in Wert<br />
gemindert waren vier nicht sachgemäß gelagerte Schokoladenwaren, die mit Verformungen, starker<br />
Fettreifbildung oder eingetrockneter Füllung in den Verkehr gebracht wurden.<br />
Die überprüften Angaben zum Nährwert bei den Diätprodukten und den Getränkepulvern lagen im Rahmen<br />
der Toleranz für technologische Schwankungen. Bei drei Milchschokoladen erfolgten Angaben zum Nährwert<br />
nicht im Rahmen der Nährwertkennzeichnung, sondern zum Teil im Zutatenverzeichnis. Die dort aufgeführten<br />
Glukosewerte wurden aufgrund zu niedriger Gehalte und als irreführend beanstandet.<br />
Ein Fruchtspieß enthielt in der als Kuvertüre bezeichneten Überzugsmasse neben Kakaobutter auch<br />
laurinsäurehaltiges Fett.<br />
Wiegmann, R. (LUA Bremen)<br />
4.16.24 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeegetränke, Tee und Teeerzeugnisse<br />
Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeegetränke<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 209<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 13<br />
Insgesamt wurden 30 Kaffeeproben (28 Röstkaffees und zwei lösliche Kaffees) auf Acrylamid untersucht<br />
(Mittelwert von 28 Röstkaffees = 240 µg/kg). Nur in einer Probe war der Signalwert von 370 µg/kg für Röstkaffee<br />
mit 515 µg/kg deutlich überschritten. In 2004 lagen noch 16 %, in 2005 keine der untersuchten Proben oberhalb<br />
des Signalwertes.<br />
Ein rechtsverbindlicher Grenzwert ist noch nicht festgelegt. Wegen offener toxikologischer Fragen sind<br />
Signalwerte und ein Minimierungskonzept festgelegt worden. Der Gehalt soll soweit wie technologisch machbar,<br />
gesenkt werden, da Acrylamid für den Menschen als möglicherweise mutagen (erbgutschädigend) bzw.<br />
krebserregend eingestuft wird.<br />
Bei Überschreitung des Signalwertes wird der betroffene Hersteller aufgefordert, unverzüglich geeignete<br />
Maßnahmen zur Reduzierung der Gehalte zu ergreifen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen und die betrieblichen<br />
Eigenkontrollsysteme werden durch entsprechende Nachkontrollen der Behörden überprüft.<br />
Die beiden Proben löslichen Kaffees lagen im Mittel bei 625 µg/kg und somit unter dem Signalwert von 1000<br />
µg/kg.<br />
Es wurden auch elf Proben Kaffeeersatzprodukte, sogenannte Land- und Kornkaffees, auf Acrylamid<br />
untersucht. Dabei lagen fünf Proben eines Marktführers mit 1010 µg/kg direkt am Signalwert (910 bis 1070<br />
µg/kg). Eine weitere Marke lag mit 510 (370 bis 590 µg/kg) nur halb so hoch. Als Erklärung können die<br />
Rohstoffauswahl oder die Röstverfahren dienen. Zwei weitere Proben wiesen mit 490 einen mittleren und mit<br />
1790 µg/kg einen sehr hohen Gehalt auf, bei dem der Hersteller zu Minimierungsmaßnahmen aufgefordert wurde.<br />
19 kaffeehaltige Getränkezubereitungen und Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee enthielten die<br />
deklarierten Gehalte an Coffein bzw. die gemäß der Deklaration errechneten Kaffeezusätze (75 bis 129 % des<br />
errechneten Solls).<br />
Auffällig waren fünf Proben Kaffeegetränke mit Milch, die neben der Zutat Kaffee (ca. 50 % aus löslichem<br />
Bohnenkaffee) weiter hinten in der Zutatenliste nochmals löslichen Bohnenkaffee aufführten und mit ca. 150 %<br />
Coffein deutlich mehr als andere Getränke enthielten. Der Zweck dieser Doppelnennung ist fraglich und lässt den<br />
Verbraucher im Unklaren über den tatsächlichen Coffeingehalt.<br />
Zwei Proben wurden wegen fehlender Mengenangaben (Quid) nach § 8 Abs. 1 LMKV beanstandet. Die<br />
Werbeaussagen wie „Doseninhalt entspricht zwei starken Tassen Kaffee“ entsprach nicht immer den gefundenen<br />
Werten, der Coffeingehalt lag deutlich niedriger (56 bis 84 %).<br />
60 Proben Röstkaffee und Kaffeeextrakte wurden auf das Mykotoxin Ochratoxin A (= OTA) untersucht. Bei<br />
246
keiner Probe wurde die Höchstmenge überschritten. Der Mittelwert lag mit 0,51 µg/kg sehr niedrig, der höchste<br />
Wert bei 1,94 µg/kg, in 25 Proben war OTA nicht nachweisbar.<br />
Zwei Kaffeesurrogate wiesen mit je 0,8 µg/kg Ochratoxin ebenfalls sehr geringe Werte auf.<br />
Anzumerken ist wie im Vorjahr, dass die Höchstmengen für OTA aus der Mykotoxin-Höchstmengenverordnung<br />
von 3 µg auf 5 µg je kg Röstkaffee und von 5 µg auf 10 µg je kg löslicher Kaffee in der geänderten<br />
Kontaminanten-Höchstgehalt VO (VO (EG) 466/2001) hochgesetzt wurden. Diese Heraufsetzung der<br />
Höchstmengen ist durch unsere und andere Analysenergebnisse nicht zu rechtfertigen. Bereits 95 % der Proben<br />
in 2004 und 100 % der Proben in 2005 und 2006 unterschritten die „alten“ niedrigeren Höchstmengen deutlich.<br />
Dazu wird im Bericht zum „Lebensmittel-Monitoring 2004“ auf Seite 49 folgendes ausgeführt: „Die von der EU<br />
festgesetzte Höchstmenge wird in keinem Fall erreicht und erscheint als zu hoch, um den Verbraucher vor höher<br />
kontaminierten Produkten zu schützen.“ Unnötig hoch angesetzte Höchstmengen hindern ggf. einzelne<br />
Industriebetriebe daran, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontaminanten weiter zu reduzieren. Die<br />
Kaffeeindustrie hatte schon jahrelange Bemühungen zur Reduktion der OTA-Gehalte bei Ernte, Verarbeitung,<br />
Lagerung und Transport unternommen, die eine deutliche Verminderung der Gehalte bei den Produkten ergab.<br />
Es wäre schade, wenn das in weiten Bereichen erlangte gute Niveau verschlechtert würde.<br />
32 Proben wurden auf Furane untersucht. Furane werden während des Röstprozesses gebildet. Die Werte<br />
lagen im Mittel bei 18 µg/Liter Kaffeegetränk nach Zubereitung gemäß Anleitung der Hersteller (meist 5 g/150 ml)<br />
und sind stark von der Zubereitungsart abhängig (z.B. haben Espressos höhere Gehalte als Filterkaffees).<br />
Furane stehen im Verdacht, Krebs zu erzeugen und gelten als erbgutschädigend. Aufgrund zu geringer Daten<br />
gibt es weder Höchstmengen noch einen ADI-Wert. Die gefundenen Gehalte werden nach derzeitigem<br />
Kenntnisstand als unproblematisch eingestuft.<br />
14 entkoffeinierte Kaffees wurden auf Lösemittelrückstände (Dichlormethan), die nach der Entkoffeinierung als<br />
Spuren im Kaffee enthalten sein können, untersucht. In 13 Proben waren keine Spuren zu finden, eine Probe<br />
wies mit 0,22 µg/kg einen sehr geringen Gehalt unter der Höchstmenge von 2µg/kg auf.<br />
Beanstandungen<br />
Fünf Proben wiesen Kennzeichnungsmängel im Bereich unvollständiger MHD, fehlender Loskennzeichnung und<br />
zu kleiner unleserlicher Schrift (0,8 mm) auf. Hier sind wie auch schon im Vorjahr insbesondere die<br />
Kaffeegetränke zu nennen. Drei Proben kaffeehaltige aromatisierte Getränkepulver mussten wegen fehlender<br />
Mengenangaben zu besonders hervorgehobenen Zutaten beanstandet werden.<br />
Sechs Proben wurden wegen Irreführung beanstandet, weil Kennzeichnung und Abbildung auf Zutaten<br />
hinwiesen, die jedoch gar nicht zugesetzt waren.<br />
Tee und teeähnliche Erzeugnisse<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 321<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 49<br />
247<br />
Dr. Gabel, B. (LUA HB)<br />
Folgende Produkte wurden untersucht: schwarze und grüne Tees, aromatisierte Schwarztees, Früchte- und<br />
Kräutertees („Stilltees“), Yogi Tees und Ayurveda Tees, teeähnliche Erzeugnisse mit Früchten, Gewürzen und<br />
Aromen („Weihnachtstees“) und zimthaltige Teeerzeugnisse.<br />
Geprüft wurden die Einhaltung der Leitsätze und der Kennzeichnung sowie die Gehalte an Rückständen<br />
(Pestizide), Kontaminanten (Schwermetalle) und unerwünschten natürlichen Stoffen (Cumarin in Zimttees). Auch<br />
wurden mikrobiologische Parameter sowie die Coffeingehalte analysiert.<br />
Ein Sonderprogramm galt der Untersuchung auf Cumarin, das in Zimt in gesundheitlich bedenklichen Mengen<br />
auftreten kann.<br />
Der mit den Herstellern vereinbarte Warnhinweis für Still- und Kindertees: „nur mit sprudelnd kochendem<br />
Wasser aufgießen“ war auch häufig bei Schwarztees und teeähnlichen Erzeugnissen vorhanden.<br />
Beanstandungen<br />
30 Teeproben wurden im Rahmen des Monitorings auf Pflanzenschutzmittel untersucht. Sie wiesen, genau wie<br />
weitere Schwarz- und Grüntees, keine erhöhten Rückstandsgehalte auf.<br />
Ebenso ergab die Untersuchung von entkoffeinierten Tees keinen Hinweis auf Rückstände von Lösemitteln,<br />
die zur Entkoffeinierung zum Einsatz kommen.<br />
Die Untersuchung von Fenchel-, Anis- und Kamillentees („Stilltees“), von Früchte- und Kräutertees<br />
(„Kindertees“) und Yogi und Ayurvedische Tees auf ihren mikrobiellen Status ergab keine Auffälligkeiten.<br />
Von 24 auf Blei und Cadmium untersuchten Proben Früchte-, Kräuter- und Wintertees wies eine Probe erhöhte<br />
Bleigehalte von 8,9 µg/l im Teeaufguss auf (im Mittel 4,5 µg/l). Der Übergang in den Teeaufguss ist<br />
matrixabhängig mit ca. 5 % bis 19 % niedrig. Die Werte lagen bei Blei mit 2,6 bis 8,9 µg/l Tee deutlich unter der
derzeitigen Höchstmenge für Trinkwasser (0,025 mg/l). Ab 01.01.2008 gilt allerdings eine mit 10 µg/l Trinkwasser<br />
niedrigere Höchstmenge.<br />
Die Cadmiumgehalte waren im Teeaufguss sehr niedrig (20 von 24 Proben lagen unter der<br />
Bestimmungsgrenze von 0,1 µg/l). Der höchste Wert lag mit 0,99 µg/l deutlich unter der für Trinkwasser<br />
vorgesehenen Höchstmenge von 5 µg/l.<br />
Wiederum häufig zu finden waren irreführende Angaben und Aufmachungen bei aromatisierten Tees,<br />
teeähnlichen Erzeugnissen und Zubereitungen, z. B. bei Früchteteegetränken und „Ice-Teas“. In 17 Fällen<br />
entsprachen die hervorgehobenen bildlichen Darstellungen und Kennzeichnungen nicht dem Inhalt des<br />
Produktes. Die Leitsätze für Tee schreiben vor, dass die Abbildungen dem Inhalt entsprechen müssen,<br />
Aromatisierungen keine Zutaten vortäuschen dürfen und die Geschmacksrichtung anzugeben ist. Jedoch sind auf<br />
den Verpackungen häufig Vanilleschoten und -blüten oder diverse Früchte und z. B. Schokoladestückchen neben<br />
Teetassen und Früchteteegläsern abgebildet (aromatisierte Tees, Früchtetees, Eistees und Zubereitungen für<br />
teeähnliche Getränke) und wecken damit die Erwartung, dass diese im Produkt enthalten seien. Den Produkten<br />
waren jedoch lediglich Aromen zugesetzt worden.<br />
Drei „Schlankheitstees“ wurden wegen Verstoß gegen die Nährwertkennzeichnungsverordnung und wegen<br />
Kennzeichnungsmängeln beanstandet.<br />
14 weitere Tees und teeähnliche Erzeugnisse wiesen kleinere aber auch gravierende Kennzeichnungsmängel<br />
auf. Dies reichte von fehlendem oder fehlerhaftem MHD und Los, über unzureichende Verkehrsbezeichnungen<br />
und Zutatenlisten bis zum Fehlen jeglicher Kennzeichnung in deutscher Schrift.<br />
Nach wie vor werden Tees und teeähnlichen Erzeugnissen Stoffe zugesetzt, die in größeren Mengen<br />
arzneilich wirksam sind und auch eine Zulassung als Arzneimittel haben. Zwischen den Herstellern und dem<br />
Teeverband auf der einen Seite und den Überwachungs- und Untersuchungsämtern auf der anderen Seite<br />
herrschen zur Bewertung unterschiedliche Auffassungen.<br />
In der sogenannten Inventarliste (WKF-Liste) der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetees werden<br />
viele Erzeugnisse mit arzneilicher Wirkung den teeähnlichen Erzeugnissen gleichgestellt oder als Zutat, z. T. mit<br />
Mengenbegrenzung, für verkehrsfähig erklärt.<br />
Die Überwachungsämter und andere staatliche Stellen sowie Verbände haben diese Vorgehensweise deutlich<br />
kritisiert und in der sogenannten ALS-Liste sinnvolle Einordnungen vorgenommen (s. DLR 98 Jg. Heft 2, 2002, S.<br />
35 ff). Etliche Produkte aus der WKF-Liste werden vom ALS und der beteiligten Fachwelt eindeutig als<br />
Arzneimittel eingestuft und sind, wenn sie pharmakologisch wirksam sind oder Nebenwirkungen haben, weder als<br />
Lebensmittel noch als Zutat verkehrsfähig.<br />
Zu diesen arzneilich wirksamen Stoffen gehören z. B. Ginseng, Ginkgoblätter, Johanniskraut, Mistelkraut,<br />
Erdrauchkraut, Frauenmantelkraut und Myrtenblätter. Aufmachung und Werbung dieser Proben sind oft geeignet,<br />
beim Verbraucher die Erwartung zu wecken, dass diese Stoffe einen arzneilichen Zusatznutzen haben.<br />
Bei weiteren Zutaten hat sich noch keine gefestigte Verkehrsauffassung gebildet da sie (je nach Gehalt und<br />
Aufmachung) sowohl Arzneimittel- als auch Lebensmitteleigenschaften aufweisen. Dazu gehören unter anderen:<br />
Ruhrkraut und Ritterspornblüten.<br />
Weitere exotische Zutaten wie Zweizahnkraut und Catuabo sind hier nicht als Lebensmittel(zutat) bekannt und<br />
bedürfen vor dem in Verkehr bringen einer Zulassung als neuartige Lebensmittel oder den Nachweis, dass sie<br />
schon vor 1997 in nennenswerten Mengen in der EG im Verkehr waren und keine gesundheitlichen Probleme<br />
bereiten.<br />
Die Hersteller geben an, diese Stoffe (Ginseng, Ginkgo, Johanniskraut usw.) dem Lebensmittel zur<br />
geschmacklichen Abrundung zuzusetzen. Dies wirkt wenig überzeugend, wenn nur kleine Mengen dieser Stoffe<br />
neben kräftiger Aromatisierung mit anderen Aromen eingesetzt werden. In größeren Mengen dürfen diese<br />
Zutaten nicht zugesetzt werden, da sie dann arzneilich wirksam wären und/oder Nebenwirkungen hervorrufen<br />
könnten, was ihre Verkehrsfähigkeit ausschließt. Eine geschmackliche Abrundung ist auch mit anderen, nicht<br />
arzneilich wirksamen Ausgangsstoffen möglich.<br />
Auch die Kennzeichnung derartiger Produkte ist umstritten. Eine Hervorhebung außerhalb der Zutatenliste wird<br />
abgelehnt, da dies als verdeckter Hinweis auf die Arzneimitteleigenschaft gewertet wird.<br />
In diesen Fragen sind der Gesetzgeber und die Verbände gefordert, für mehr Klarheit auf beiden Seiten zu<br />
sorgen.<br />
24 Teeerzeugnisse mit der Zutat Zimt wurden auf den unerwünschten Begleitstoff Cumarin geprüft. Cumarin<br />
kann, wenn es über längere Zeit oberhalb der akzeptablen täglichen Aufnahmemenge von 0,1 mg/kg<br />
Körpergewicht (=TDI-Wert) aufgenommen wird, zu reversiblen Leberschäden führen.<br />
In 13 von 24 Proben wurde kein Cumarin nachgewiesen, in elf Erzeugnissen lagen die Werte zwischen 0,8<br />
und 8,6 mg im Liter Teeaufguss.<br />
Wird bei einer angenommenen Verzehrsmenge von täglich 200 ml Teegetränk der TDI-Wert zu mehr als 50 %<br />
ausgeschöpft (= 7 Proben), so wird der Hersteller aufgefordert, durch Prüfung und Auswahl der Rohware Zimt die<br />
Cumarinwerte deutlich zu senken. Nur Cassiazimt weist sehr hohe Cumaringehalte auf und sollte durch<br />
unbelasteten Ceylonzimt ersetzt werden. Der Erfolg der Maßnahmen soll durch die Überwachung überprüft<br />
werden. Im Sommer 2007 soll die neue Produktion der „Wintertees mit Zimt“ geprüft werden, damit mangelhafte<br />
248
Ware gar nicht erst wieder in den Handel und zum Verbraucher gelangt.<br />
4.16.25 Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 352<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 110<br />
249<br />
Dr. Gabel, B. (LUA HB)<br />
Säuglinge und Kleinkinder haben wegen der noch nicht ausgereiften körperlichen Entwicklung ein besonderes<br />
Ernährungsbedürfnis. Im Rahmen von europäischen Richtlinien und nationalen Vorschriften wurden für<br />
Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung, Getreidebeikost und andere Beikost sehr strenge Regelungen an die<br />
Zusammensetzung und Kennzeichnung getroffen. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Einhaltung<br />
der geforderten Nährstoffzusammensetzung.<br />
Makronährstoffe<br />
Die Überprüfung der Kohlenhydrate Glucose, Fructose, Saccharose, Maltose und Stärke ergab keine<br />
Auffälligkeiten. Bei einer Probe Getreidebrei entsprach der Anteil des Eiweißes zwar der Anforderung nach der<br />
DiätV, allerdings war der analytisch ermittelte Eiweißgehalt deutlich abweichend von der Herstellerangabe. Die<br />
Probe musste als irreführend beanstandet werden.<br />
Gluten ist ein Bestandteil des Klebereiweißes und für Zöliakiekranke unverträglich. Zur Kontrolle wurden 21<br />
Anfangs- und Folgenahrungen auf Gluten geprüft. Gluten wurde nicht nachgewiesen. 48 Breie und Menüs, die<br />
nach Kennzeichnung glutenfrei sein sollten, wurden auf das Vorhandensein von Gluten kontrolliert.<br />
Beanstandungen mussten nicht ausgesprochen werden.<br />
28 milchfreie Breie und Menüs wurden auf die Anwesenheit von Milcheiweiß (Casein) geprüft. Casein wurde<br />
nicht nachgewiesen.<br />
Ferner wurde bei 21 Anfangs- und Folgenahrungen überprüft, ob neben der zu erwarteten Eiweißquelle noch<br />
weitere Fremdeiweiße vorhanden waren. Es ergab sich auch hier kein Beanstandungsgrund.<br />
Hypoallergene Anfangs- und Folgenahrung enthält stark hydrolysiertes Protein. Es wurde kontrolliert, ob<br />
tierische Proteine noch nachweisbar waren. Das war hier nicht der Fall.<br />
Bei 18 Menüs mit Fleischanteil wurde geprüft, ob neben dem Fleisch der genannten Tierart noch weitere<br />
Tierarten verwandt wurden. Auffälligkeiten ergaben sich nicht.<br />
Aufgrund des Aminosäurespektrums kann die Zusammensetzung des Eiweißes und damit die biologische<br />
Wertigkeit abgeschätzt werden. Von 18 untersuchten Proben mussten drei Folgenahrungen wegen<br />
unzureichender Aminosäurezusammensetzung der Eiweiße beanstandet werden. Der chemische Index lag<br />
deutlich unter 80 % des Referenzproteins.<br />
Die Anforderungen an Mindest- und Höchstmengen für Fett wurden bei den Proben stets erfüllt. Für mehrfach<br />
ungesättigte Fettsäuren wie Linolsäure und alpha-Linolensäure sind Mindestmengen für Anfangs- und<br />
Folgenahrung festgelegt. Ferner ist der Anteil der gesättigten Fettsäuren Laurin- und Myristinsäure begrenzt. Die<br />
Anforderungen wurden bei den sechs untersuchten Proben eingehalten.<br />
Mineralstoffe, Vitamine<br />
Anforderungen an die Gehalte von Mineralstoffen und Vitaminen sind für Anfangs- und Folgenahrung,<br />
Getreidebeikost und andere Beikost sehr differenziert. Entsprechend den spezifischen Regelungen wurde bei den<br />
Untersuchungsprogrammen eine Auswahl der Mineralstoffe Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor,<br />
Eisen, Jod, Mangan, Selen, Zink, Chrom, Kupfer, Zinn, Molybdän sowie der unerwünschten Elemente Blei,<br />
Cadmium und Quecksilber getroffen. Ferner wurde bei den Vitaminen A, B1, B2, B6, C, E und Niacin eine<br />
entsprechende Auswahl vorgenommen.<br />
Insgesamt wurden bei 204 Proben die Mineralstoffgehalte und bei 120 Proben die Vitamingehalte übergeprüft.<br />
Die deklarierten Gehalte stimmten überwiegend mit den tatsächlichen überein. Es mussten jedoch 45 Proben<br />
beanstandet werden, weil sie den Vorgaben nicht entsprachen (7-mal wegen Mineralstoffen; 3-mal wegen<br />
Vitaminen) oder weil der deklarierte Gehalt vom festgestellten nicht unerheblich abwich ( 23-mal wegen<br />
Mineralstoffen; 12-mal wegen Vitaminen).<br />
Im Berichtsjahr wurde besonderes Augenmerk auf den Jodgehalt von Anfangs- und Folgenahrung gelegt. Für<br />
die Hersteller besteht das Problem, dass der Jodgehalt der Zutaten wie Milchpulver großen Schwankungen<br />
unterliegt. Die Mindestanforderungen an den Jodgehalt wurden zwar erfüllt, jedoch stimmten bei 16 Proben die<br />
ermittelten Werte mit den deklarierten nicht überein.<br />
In einem Projekt sollte festgestellt werden, ob durch Obstbreie, Obstsäfte oder Getreidebreie mit Fruchtanteil<br />
eine ausreichende Zufuhr von Vitamin C gewährleistet wird. Die Mindestanforderungen waren bei den 17
untersuchten Proben sehr gut erfüllt. Drei Proben wiesen gegenüber der Deklaration allerdings Überdosierungen<br />
von 170 % bis 210 % auf und wurden als irreführend beurteilt.<br />
Unerwünschte Stoffe<br />
In verschiedenen Untersuchungsprogrammen wurde auf organische Schadstoffe wie z. B. Fumonisine, Patulin,<br />
Zearalenon, DON, Aflatoxine, Ochratoxin A, Furan, Phthalate, Dioxine und PCB geprüft. Beanstandungsgründe<br />
ergaben sich nicht. Siehe Kapitel 4.17.<br />
Nitrat wird hauptsächlich durch Gemüse aufgenommen. Durch gute landwirtschaftliche und technologische<br />
Praxis kann der Nitratgehalt von Lebensmitteln beeinflusst werden. Um die Nitratexposition durch Lebensmittel zu<br />
reduzieren, hat der Gesetzgeber Höchstmengen festgesetzt (siehe VO (EG) 466/2001). Für Beikost beträgt die<br />
Nitrat-Höchstmenge 200 mg/kg bezogen auf das verzehrsfertige Lebensmittel. 26 Proben Kleinkindernahrung auf<br />
Gemüsebasis wurden auf ihren Nitratgehalt geprüft. Die ermittelten Gehalte lagen zwischen 24 mg/kg und<br />
127 mg/kg und somit unterhalb der Höchstmenge.<br />
Erfreulicherweise waren alle 15 Proben Kleinkindernahrung auf Gemüsebasis, die auf Rückstände von<br />
Pflanzenschutzmitteln geprüft wurden, rückstandsfrei.<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung auf Sojabasis wurde auf gentechnisch verändertes Soja geprüft. In fünf<br />
Fällen konnten Spuren von GVO festgestellt werden. Die Hersteller konnten aber nachweisen, dass sie im<br />
Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht gehandelt hatten.<br />
Im Berichtsjahr wurde die Problematik Cumarin in zimthaltigen Lebensmitteln bekannt. Daher wurden zwei<br />
Proben Getreidebreie mit Apfel und Zimt auf Cumarin geprüft. Es konnten 1,1 bzw. 1,4 mg Cumarin pro kg Pulver<br />
ermittelt werden. Diese Mengen sind nach Zubereitung des Breies als unauffällig zu beurteilen.<br />
Mikrobiologie<br />
Im Berichtsjahr wurden sieben pulverförmige Säuglingsnahrungen auf Enterobacter sakazakii untersucht. Dieser<br />
Erreger verursacht Sepsis, Meningitis und nekrotisierende Enterokolitis und wird als Verursacher von<br />
lebensmittelassoziierten Infektionen speziell bei Säuglingen und Frühgeborenen angesehen. In keiner der<br />
untersuchten Proben konnte dieser Erreger nachgewiesen werden, auch entsprachen die Proben den strengen<br />
mikrobiologischen Anforderungen, die an diese besondere Lebensmittelgruppe gestellt werden.<br />
Sensorik, Verunreinigungen<br />
Bei einer Plan- und einer Verfolgsprobe Getreidebrei rochen die Verpackungen auffallend stark nach<br />
Waschmitteln. Dieser Fremdgeruch war bereits teilweise auf das in der Pappfaltschachtel mit Papierinnenbeutel<br />
befindliche Getreidepulver übergegangen. Das Rückstellmuster der Hersteller war einwandfrei. Der Lagerungsort<br />
der Proben war offensichtlich unpassend gewesen. Die Proben wurden als nicht unerheblich gemindert beurteilt<br />
und nach § 11 Abs. 2 Nr. 2b LFGB beanstandet.<br />
Eine Probe Milchbreipulver wies einen ranzigen, firnisartigen Geruch und Geschmack auf. Die erhöhte<br />
Peroxidzahl des kalt extrahierten Fettes unterstützte den Verdacht auf Fettverderb. Die Verpackung, ein<br />
zugeschweißter Aluminiumbeutel, wies keine Beschädigungen auf. Nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
(MHD)sollte die Probe noch vier Monate haltbar sein. Die Probe wurde daher nicht nur als wertgemindert,<br />
sondern das MHD auch als irreführend beurteilt.<br />
In einer Beschwerdeprobe Babytee + Saft wurde eine leere Kapselhülle, möglicherweise von einem<br />
Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel, festgestellt. Der Verursacher konnte im Berichtsjahr nicht ermittelt<br />
werden. Die Probe wurde als nicht zum Verzehr geeignet beurteilt.<br />
Kennzeichnungsmängel<br />
Die Kennzeichnung von zwei Proben entsprach nicht den speziell für Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
festgelegten Anforderungen. Es fehlte die Angabe zum Glutengehalt.<br />
Andere Kennzeichnungsmängel betrafen z. B. fehlende oder nicht ausreichende Angaben zur Menge der<br />
Zutaten (QUID), zum Mindesthaltbarkeitsdatum und zur Losangabe, zur falschen Reihenfolge der Zutaten im<br />
Zutatenverzeichnis und zu fehlenden Zutatenangaben bei zusammengesetzten Zutaten wie Zwieback und<br />
Keksen.<br />
Wie im Vorjahr ergaben sich auch im Berichtsjahr bei 44 Proben Beikost mit Angaben wie „natriumreduziert (lt.<br />
Gesetz)“ bzw. „salzreduziert (lt. Gesetz)“ Beanstandungen. Die DiätV legt für Natrium in Beikost einen Höchstwert<br />
von 200 mg/100g fest. Es gibt keine spezielle Regelung über eine Natriumreduzierung. Die gewählte<br />
Formulierung „-reduziert lt. Gesetz“ macht somit keinen Sinn. Hinweise auf eine Natriumreduzierung sind<br />
250
dagegen in der Nährwertkennzeichnungsverordnung (NKV) geregelt. Danach darf auf eine Natriumverminderung<br />
nur bei den in Anlage 2 genannten Lebensmitteln hingewiesen werden. Beikost bzw. Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung sind in der Anlage 2 der Nährwertkennzeichnungsverordnung nicht enthalten. Die Auslobung<br />
„natriumreduziert“ ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 NKV unzulässig.<br />
Buntrock-Taux, E.; Dr. Pust, J.; Dr. Suckrau, I. (LI OL)<br />
4.16.26 Nährstoffkonzentrate und Nahrungsergänzungsmittel<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 290<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 128<br />
Nahrungsergänzungsmittel gemäß Anzeigeverfahren nach § 5 NemV<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 71<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 41<br />
Die Nahrungsergänzungsmittelverordnung (NemV), die am 24. Mai 2004 in Kraft getreten war, fordert in § 5, dass<br />
derjenige, der als Hersteller oder Einführer ein Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr bringen will, dies<br />
spätestens beim ersten Inverkehrbringen dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit<br />
(BVL) unter Vorlage eines Musters des für das Erzeugnis verwendeten Etiketts anzuzeigen hat. Das BVL<br />
übermittelt die Anzeige unverzüglich dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz und den für die Lebensmittelüberwachung zuständigen obersten Landesbehörden. Von dort<br />
werden die Anzeigen an die zuständigen Überwachungsbehörden vor Ort weitergeleitet, die direkt für die<br />
Überwachung der angezeigten Produkte zuständig sind. Die Prüfung umfasst in der Regel die Entnahme von<br />
Proben, die den zuständigen Untersuchungseinrichtungen zur Untersuchung und Beurteilung vorgelegt werden.<br />
Die Beanstandungen reichten von einer unzureichenden Kennzeichnung im Sinne der LMKV bis zur<br />
Einstufung von Präparaten als Arzneimittel. Aussagen wie „Stärkung der Prostata“ sind als krankheitsbezogen<br />
und damit als unzulässig beurteilt worden. Aussagen zur Wirkung von Stoffen wie L-Carnitin, Ubichinon Q10,<br />
konjugierte Linolsäure (CLA) etc. sind als irreführend beurteilt worden, da sie in den meisten Fällen zur Zeit als<br />
wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert gelten. Darüber hinaus ist die Verwendung von CLA als unzulässig<br />
beurteilt worden, da es sich um einen nicht zugelassenen Zusatzstoff handelt. In gleicher Weise sind Stoffe wie<br />
Glucosamin, Chondroitin, Methylsulfonylmethan (MSM), Rutosid, Zeaxanthin und Lutein als nicht zugelassene<br />
Zusatzstoffe beurteilt worden. Auch Extrakte aus Lebensmitteln, die in immer größeren Maße in<br />
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden, wie Weintraubenschalen,- kernen, Citrusschalen, Chlorella,<br />
Spirulina, Soja, Rosmarin, Kurkuma, Soja etc. werden in dem Fall als nicht zugelassen eingestuft, wenn sie in<br />
ihrer Zusammensetzung keinerlei Ähnlichkeit mehr mit den Ausgangsstoffen aufweisen; mitunter sind die Extrakte<br />
maßgeschneidert auf bestimmte Stoffe bzw. einen bestimmten Stoff zugeschnitten. Die Verkehrsfähigkeit nicht<br />
zugelassener Stoffe kann nur über die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 68 LFGB bzw. einer<br />
Allgemeinverfügung gemäß § 54 LFGB hergestellt werden. Solche Ausnahmegenehmigungen bzw.<br />
Allgemeinverfügungen sind in jüngster Zeit erteilt worden. So gibt es zwei Ausnahmegenehmigungen für den<br />
Stoff L-Carnitin-Tartrat, eine Ausnahmegenehmigung für den Stoff Lycopin sowie eine Allgemeinverfügung für die<br />
Zutat Citrusbioflavonoide einschließlich Hesperidin und Rutin. In diesem Zusammenhang sei das viel zitierte und<br />
kontrovers diskutierte Gerichtsurteil des OVG NRW vom 17.März 2006 erwähnt. Das Gericht hat befunden, dass<br />
es sich bei dem verfahrensgegenständlichen OPC-haltigen Präparat um kein Arzneimittel sondern um ein<br />
verkehrsfähiges Lebensmittel handelt. OPC (Oligomere Polycyanidine) in Nahrungsergänzungen sind danach<br />
keine Zusatzstoffe. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil ist die Revision beim<br />
Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig beantragt worden. Die Entscheidung des BVG steht noch aus und<br />
bleibt abzuwarten. An der Auffassung, dass es sich bei besagten Stoffen um nicht zugelassene Zusatzstoffe<br />
handelt, wird bis zu einer Entscheidung festgehalten. Bei sechs flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln mit Zusatz<br />
von Ascorbinsäure (Vitamin C) und dem Konservierungsstoff Benzoesäure wurde aufgrund von aktuellen<br />
Hinweisen die eventuelle Bildung des toxischen Stoffes Benzol aus diesen Zutaten überprüft. Da die Aufnahme<br />
von Benzol nach Möglichkeit zu minimieren ist, werden Daten gesammelt, um ein möglicherweise mit der<br />
Verwendung von Benzoe- und Ascorbinsäure verbundenes Risiko erkennen zu können. In den meisten Fällen<br />
waren geringe Mengen Benzol in der Größenordnung von 0,65 µg/kg bis 4,71 µg/kg nachweisbar (siehe Kapitel<br />
4.17.6). Die Untersuchungen werden im Rahmen des bundesweiten Überwachungsprogramms fortgeführt.<br />
Mumijohaltige Präparate<br />
Acht Proben, die u.a. bzw. ausschließlich Mumijo enthielten, sind als nicht verkehrsfähig beurteilt worden. Die<br />
Zutat „Mumijo“ wird aus hiesiger Sicht als „Humus“, eine Art Kompost angesehen werden, der durch einen<br />
251
Fermentationsprozess entstanden ist, wie von indischen Wissenschaftlern dargelegt. „Humus“ wird nicht als<br />
Lebensmittel beurteilt. Für Mumijo gibt es keine Verkehrsauffassung, wonach es wegen seines Nähr- oder<br />
Geschmackwertes oder als Genussmittel verzehrt wird. Reiner Mumijo riecht nach Kuhurin. Dieser für Mumijo<br />
charakteristische Geruch kommt besonders beim Lösen in Wasser zum Tragen. Ein Lebensmittel, das nach Kuh-<br />
Urin riecht, wird üblicherweise von einem durchschnittlich empfindenden Verbraucher als ekelerregend und damit<br />
als nicht verkehrsfähig angesehen. Von einer Erde bzw. einem Verrottungsprodukt wie Torf oder Humus ist<br />
normalerweise nicht zu erwarten, dass es vom Menschen verzehrt wird. Bei Mumijo handelt es sich um kein<br />
Lebensmittel im Sinne des Art. 2 der VO(EG) 178/2002.<br />
Einstufung von Nahrungsergänzungsmitteln/diätetischen Lebensmitteln als Arzneimittel<br />
Acht zimthaltige bzw. zimtextrakthaltige Präparate sind als Arzneimittel eingestuft worden. Zimt ist Ende letzten<br />
Jahres durch den natürlich enthaltenen Stoff Cumarin in das Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt. Insbesondere<br />
chinesischer Zimt weist recht hohe Gehalte an Cumarin auf (siehe auch Kapitel 3). In diesem Zusammenhang<br />
sind acht zimthaltige Präparate, die diätetische Lebensmittel aber auch als Nahrungsergänzungsmittel in den<br />
Verkehr gebracht worden sind, untersucht und beurteilt worden. Zweckbestimmung dieser Präparate ist die<br />
positive Beeinflussung des Blutzuckerspiegels bzw. des Zuckerstoffwechsels.<br />
Zimt, der zu geruchs- und geschmacksgebenden Zwecken als Gewürz Lebensmitteln und Speisen zugesetzt<br />
wird, ist nach allgemeiner Verkehrsauffassung als Lebensmittel im Sinne von Art. 2 VO(EG) 178/2002<br />
anzusehen. Zimthaltige Präparate in Kapselform, wie im vorliegenden Fall, dienen anderen Zwecken als der<br />
Ernährung. Die gezielte Beeinflussung des Blutzuckerspiegels durch die regelmäßige Einnahme dient<br />
arzneilichen Zwecken. In dieser Darreichungsform ist der Genuss, der den Lebensmittelbegriff stützt, nicht<br />
vorhanden. Wie bei vielen pflanzlichen Zubereitungen kommt es auch bei Zimt auf die Zweckbestimmung an, ob<br />
es sich um ein Lebensmittel zum Würzen von Speisen oder um ein Arzneimittel zum Behandeln von<br />
Beschwerden/Erkrankungen handelt. In der Monographie der Kommission E, veröffentlicht im Bundesanzeiger<br />
am 01. Februar 1990, Heft Nr. 22a wird Zimt als Arzneimittel beschrieben. Hagers Handbuch der<br />
Pharmazeutischen Praxis, Band 4 (Drogen A-D), Springer Verlag, 1992 werden pharmakologische Wirkungen wie<br />
antibakteriell, fungistatisch, Wirkung auf die Immunabwehr, antiulcerogen, Wirkung auf den Verdauungstrakt des<br />
Chinesischen Zimts beschrieben. Anwendungsgebiete sind Appetitlosigkeit, dyspeptischen Beschwerden wie<br />
leichte krampfartige Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, Völlegefühl und Blähungen. Zur Dosierung und Art<br />
der Anwendung wird beschrieben, dass die zerkleinerte Droge für Teeaufgüsse sowie andere galenische<br />
Zubereitungen zum Einnehmen eingesetzt wird. Tagesdosis, soweit nicht anders verordnet, sind 2 bis 4 g Droge.<br />
Das BfR und BfArM haben am 15. November 2006 gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht (BfR 29/2006).<br />
Zwei Proben enthielten gemäß der empfohlenen Tagesverzehrsmenge Ubichinon (Q10)-Gehalte von 200 mg<br />
bzw. 250 mg. Nach derzeitiger Verkehrsauffassung sind derartige Präparate als Arzneimittel einzustufen.<br />
Eine Probe Flohsamenschalen sowie eine Probe Maca sind auf Grund ihrer Zweckbestimmung als Arzneimittel<br />
eingestuft worden.<br />
Ein Phaseolamin-haltiges Präparat ist auf Grund seiner Zweckbestimmung und Funktion als Arzneimittel<br />
eingestuft worden. Phaseolamin bzw. Phaseolin, ein Eiweißbaustein der Bohne wird in besagten Präparaten als<br />
„Kohlenhydratregulator“ während einer gewichtsreduzierenden Diät eingesetzt.<br />
Ein Präparat „Gute Nacht“, dass Klatschmohn, Weißdorn und Passionsblume enthielt, ist als Arzneimittel<br />
eingestuft worden.<br />
Kieselerde<br />
Vier Kieselerde-Haltige Präparate sind als nicht verkehrsfähig beurteilt worden, da zum einen die Stoffverbindung<br />
Kieselerde sowie der Stoff Silicium als wesentlicher Bestandteil der Kieselerde gemäß den Anlagen 1 und 2 der<br />
NemV zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmittel nicht zugelassen ist. Es dürfen nur die dort genannten<br />
Stoffe bzw. Stoffverbindungen verwendet werden.<br />
Irreführende Angaben/Aufmachung<br />
Bei elf Proben stimmten die deklarierten Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sowie der<br />
Makronährstoffe Eiweiß und Fett nicht mit den ermittelten Gehalten überein.<br />
Fünf Carnitin-haltige Präparate sind wegen irreführender Aufmachung beanstandet worden. Diese Produkte<br />
werden mit Aussagen wie „Zur Unterstützung der Fettverbrennung bei gleichzeitiger körperlicher Aktivität“,<br />
„Unterstützt die Fettverbrennung bei körperlicher Aktivität“, „Es kann in Verbindung mit körperlicher Aktivität die<br />
Fettverbrennung unterstützen und die Balance von Körperfett und Muskulatur positiv beeinflussen“, „Die<br />
Aufnahme von L-Carnitin als Nahrungsergänzung empfiehlt sich besonders für Menschen, die hoher körperlicher<br />
Belastung ausgesetzt sind (z. B. Ausdauersportler).“ L-Carnitin ist ein Stoff, der im menschlichen Körper selbst<br />
252
hergestellt werden kann und mit der Nahrung aufgenommen wird. L-Carnitin ist an dem Fettstoffwechsel beteiligt.<br />
Es liegen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, dass bestimmte Menschen einen erhöhten Bedarf an L-<br />
Carnitin haben, der ausgeglichen werden muss. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber,<br />
dass sich eine zusätzliche externe Zufuhr erhöhter Mengen an L-Carnitin positiv auf die Fettverbrennung bei<br />
gleichzeitiger körperlicher Aktivität auswirken.<br />
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten)<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 13<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 7<br />
Ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen<br />
und Spurenelementen ist zur diätetischen Behandlung von Frauen mit koronaren Herzerkrankungen in den<br />
Verkehr gebracht worden. Der Hersteller/Inverkehrbringer ist aufgefordert worden, entsprechende Auswertungen<br />
wissenschaftlich anerkannter Unterlagen vorzulegen, nach denen er beim vorliegenden Produkt zu der<br />
Entscheidung gelangt ist, dass die Eignung des Präparates als bilanzierte Diät wissenschaftlich hinreichend<br />
belegt ist.<br />
Ein weiteres diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ist zur diätetischen Behandlung<br />
von nutritiv bedingten Immundefiziten in den Verkehr gebracht. Hinweise auf die Vogelgrippe in der<br />
produktbegleitenden Werbung sind als irreführend und damit unzulässig beurteilt worden. Auch hier ist der<br />
Hersteller/Inverkehrbringer aufgefordert worden, entsprechende Auswertungen wissenschaftlich anerkannter<br />
Unterlagen vorzulegen, nach denen er beim vorliegenden Produkt zu der Entscheidung gelangt ist, dass die<br />
Eignung des Präparates als bilanzierte Diät wissenschaftlich hinreichend belegt ist.<br />
Zwei diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke sind zur diätetischen Behandlung von<br />
Erwachsenen und Heranwachsenden ab dem 12. Lebensjahr bei Fettassimilationssyndrom bzw. von<br />
Erwachsenen und Heranwachsenden ab dem 12. Lebensjahr bei Störungen der Ausnutzung lebenswichtiger<br />
Nährstoffe in den Verkehr gebracht worden. Nach Prüfung und Bewertung der vorgelegten Unterlagen sind die<br />
Proben dahingehend beurteilt worden, dass die den Präparaten zugeordneten Krankheitskataloge einer<br />
Überarbeitung erfordern und dass angegeben werden sollte, für welche genaue Patientengruppe die<br />
entsprechenden die enthaltenen und empfohlenen Dosierungen ausgewählt wurden.<br />
Sportlernahrung<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 51<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 8<br />
In zwei Proben Eiweißkonzentrat auf Sojabasis konnte gentechnisch verändertes Soja nachgewiesen werden.<br />
Detaillierte Ausführungen sind in Kapitel 4.17.2 zu finden.<br />
Bei zwei Proben stimmten in einem Fall die deklarierte Menge an Vitamin C und in einem weiteren Fall die<br />
deklarierten Menge an Kupfer und Zink nicht mit den ermittelten Gehalten überein.<br />
In einer Probe ist ein Traubenkernextrakt als Zutat zugesetzt worden, der als nicht zugelassener Zusatzstoff<br />
eingestuft wird, wenn er Inhaltsstoffe in isolierter bzw. in der derart angereicherter Form enthält, so dass der<br />
gewonnene Extrakt keinerlei Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Lebensmittel mehr aufweist.<br />
In einem Fall sind in der Kennzeichnung zu einer Probe Molkeneiweiß-Kohlenhydrat-Gemisch die nicht mehr<br />
gebräuchlichen Bezeichnungen „Vitamin B3“ und „Vitamin B10“ verwendet worden. Vitamin B3 steht für Niacin.<br />
Bei der Angabe „Vitamin B10“ konnte nicht geklärt werden, ob es sich um die nicht zugelassene „p-<br />
Aminobenzoesäure“ handelt, die einen Baustein in dem Folsäuremolekül darstellt oder ob die eigentliche<br />
Folsäure gemeint war, deren alte und im deutschen Sprachraum nicht mehr übliche Bezeichnung „B9“ lautet.<br />
Im Zuge der Verbreitung von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedsstaaten tauchen in deren Kennzeichnung<br />
auffällig oft die in Deutschland nicht mehr gebräuchlichen Bezeichnungen für bestimmte Vitamine auf. Diese<br />
Beobachtung lässt sich nur so erklären, dass in einigen anderen Mitgliedsstaaten diese Bezeichnungen weiterhin<br />
Bestand haben und bei der Übertragung der Kennzeichnung ins Deutsche automatisch übernommen werden.<br />
Abgesehen davon, dass es sich bei den Bezeichnungen um überholte und nicht mehr gebräuchliche Begriffe<br />
handelt, ist die Verwendung dieser Begriffe gemäß der NemV und DiätV nicht zu lässig. Gemäß dieser<br />
Vorschriften sind nur die in den Anlagen genannten Bezeichnungen zu verwenden.<br />
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 17<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 9<br />
253
In acht Proben Pulvernahrung auf Sojabasis konnte gentechnisch verändertes Soja nachgewiesen werden.<br />
Detaillierte Ausführungen sind in Kapitel 4.17.2 zu finden.<br />
Bei einer Probe stimmten die deklarierten Mengen an Vitamin C und Kalium nicht mit den ermittelten Gehalten<br />
überein. Die ermittelten Gehalte waren zu niedrig.<br />
In einer Probe war der verwendete Süßstoff Aspartam nicht kenntlich gemacht. Gemäß ZZulV muss die<br />
Verwendung von Süßstoffen zusätzlich zu der Kennzeichnung im Zutatenverzeichnis durch die Angabe „mit<br />
Süßungsmitteln“ deutlich in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung kenntlich gemacht werden.<br />
Sonstige Untersuchungen<br />
Es sind sechs Beschwerdeproben, zwei Verdachtsproben, drei Verfolgsproben sowie eine Probe mit Verdacht<br />
Gesundheitsschädigung eingeliefert und untersucht worden. Von den 13 Proben sind zehn Proben beanstandet<br />
worden. Die Beanstandungen erstreckten sich auf Angaben, die den Anschein eines Arzneimittels erweckten, auf<br />
die Verwendung nicht zugelassener Zusatzstoffe wie Zeaxanthin, PABA, Hafergrün, auf wissenschaftlich nicht<br />
gesicherte bzw. krankheitsbezogene Aussagen, die fehlende Kenntlichmachung von Zusatzstoffen sowie<br />
unzureichende Kennzeichnungen im Sinne der LMKV bzw. NemV. Grund der Beschwerde bei der Probe mit<br />
Verdacht auf Gesundheitsschädigung ist das Auftreten eines Hautausschlags gewesen. Bei der Probe handelte<br />
es sich um ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, dass mit Sorbinsäure konserviert war. Sorbinsäure kann in<br />
seltenen Fällen zu Unverträglichkeitsreaktionen führen.<br />
Dr. Täubert, T. (LI BS)<br />
4.16.27 Fertiggerichte, zubereitete Speisen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 736<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 176<br />
Verarbeitete Lebensmittel, insbesondere Lebensmittel mit einer hohen Zubereitungsbequemlichkeit<br />
(„Convenience“), erfreuen sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Die Gründe hierfür liegen in einem<br />
grundlegenden gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahrzehnten: die veränderte Rolle der Frau, wachsende<br />
Mobilität, die Zunahme von Single-Haushalten, die Zunahme der Außerhausverpflegung, der Wegfall fester<br />
Mahlzeitensysteme, ein zunehmender Verlust von Kochfertigkeiten, sinkende Bereitschaft, „freie Zeit“ in der<br />
Küche zu verbringen, sowie veränderte Einkaufsgewohnheiten. Hinzu kommt eine steigende Nachfrage nach<br />
ausländischen Produkten – nicht nur durch die in Deutschland lebenden Ausländer. Dies alles spiegelt sich wider<br />
in einer steigenden Zahl und Vielfalt von Fertiggerichten sowie einem wachsenden Angebot an<br />
Außerhausmahlzeiten.<br />
Die Untersuchung von Proben dieser Warengruppe richtete sich auf die Überprüfung der deklarierten<br />
Nährstoffe, auf wertbestimmende Beschaffenheitsmerkmale und auf die Verwendung und Kenntlichmachung von<br />
Zusatzstoffen bei loser Abgabe von Lebensmitteln. Untersuchungsschwerpunkte lagen insbesondere auf dem<br />
mikrobiologischen Status von Lebensmitteln aus der Gastronomie bzw. aus Einrichtungen zur<br />
Gemeinschaftsverpflegung und auf dem Gehalt an gentechnisch veränderten Zutaten (Soja, Mais, Reis).<br />
Überprüfung der deklarierten Nährwerte<br />
Wie im Vorjahr war die Beanstandungsquote erfreulich gering. Bei lediglich acht von 94 untersuchten Proben<br />
waren deklarierte Nährwertangaben als irreführend zu beanstanden, weil die analytisch ermittelten Gehalte<br />
deutlich abwichen. Zur Beurteilung wurden die „Empfehlungen zu Toleranzen für Nährstoffschwankungen bei der<br />
Nährwertkennzeichnung“ der Arbeitsgruppe „Fragen zur Ernährung“ in der Gesellschaft Deutscher Chemiker<br />
(veröffentlicht in: Lebensmittelchemie (1998) 52:25) zu Grunde gelegt.<br />
Das Ergebnis zeigt, dass diejenigen Hersteller, die eine Nährwertkennzeichnung anbringen, diese in der Regel<br />
selbst ausreichend kontrollieren.<br />
Schafskäse als wertgebende Zutat von zusammengesetzten Gerichten<br />
Schafskäse erfreut sich zunehmender Beliebtheit als Zutat verschiedenster Erzeugnisse. Als Belag auf Baguette<br />
und Pizzen, in gefüllten Teigtaschen und als Bestandteil anderer zusammengesetzter Lebensmittel ist er deshalb<br />
häufig zu finden bzw. wird in Speisekarten/Preisverzeichnissen als solcher aufgeführt. In vielen Fällen erhält der<br />
Verbraucher aber nicht den erwarteten Käse aus Schafsmilch, sondern Kuhmilchkäse. Nach dem Ergebnis der<br />
254
Proteindifferenzierung bestand in acht von 18 untersuchten Proben der Käseanteil aus Kuhmilchprotein. Die<br />
Angaben auf der Speisekarte/dem Preisverzeichnis wurden als irreführend beanstandet.<br />
Kenntlichmachung von Zusatzstoffen<br />
Bei loser Abgabe von Lebensmitteln müssen nach § 9 ZZulV bestimmte Zusatzstoffe, wie Farbstoffe,<br />
Konservierungsstoffe, Süßstoffe oder Geschmacksverstärker kenntlich gemacht werden. Diese Vorschrift wird<br />
von den Anbietern loser Ware nicht immer eingehalten. So waren acht Proben wegen fehlender<br />
Kenntlichmachung von Zusatzstoffen zu beanstanden.<br />
Die Beanstandungen betrafen Seelachsbrötchen von Weihnachtsmärkten, die ohne Kenntlichmachung von<br />
Konservierungsstoffen in den Verkehr gebracht wurden und zubereitete Speisen aus asiatischen Gaststätten<br />
ohne Kenntlichmachung von Geschmacksverstärkern (Glutaminsäure).<br />
Höchstmengenüberschreitungen wurden in drei Proben beanstandet: zwei Seelachsbrötchen mit überhöhtem<br />
Gehalt an Benzoesäure und ein Menü aus einer asiatischen Gaststätte mit einer Höchstmengenüberschreitung<br />
von Glutaminsäure.<br />
Mikrobieller Status von Lebensmitteln - gekochter Reis und gekochte Nudeln aus Gaststätten<br />
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 43 Planproben gekochter Reis und gekochte Nudeln aus Gaststätten,<br />
Restaurants und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung mikrobiologisch untersucht. Diese Erzeugnisse<br />
zählen zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Der Umgang mit Ihnen erfordert eine große hygienische<br />
Sorgfalt. Nach dem Kochen sind diese Lebensmittel sehr keimarm, der Keimgehalt kann jedoch durch einen<br />
unsachgemäßen Umgang schnell wieder ansteigen. Beispiele dafür sind die Verwendung von unsauberen<br />
Gefäßen und Besteck sowie die falsche Lagerung der Erzeugnisse (nicht gekühlt, zu lange). Aufgrund dessen<br />
war die Überprüfung des mikrobiologischen Status der Erzeugnisse von Interesse. Die eingesandten Proben<br />
wurden auf Gesamtkeimzahl, Hefen, Schimmelpilze, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus und koagulase-positive<br />
Staphylokokken untersucht.<br />
25 Proben zeigten einen unauffälligen mikrobiologischen Befund. zwölf Proben wiesen auffällige Keimgehalte<br />
auf und wurden mit Hinweis auf Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 aus hygienischen Gründen bemängelt. Eine<br />
Probe zeigte so hohe Keimgehalte, dass eine Beanstandung nach Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 erfolgte.<br />
Bei fünf Proben waren neben den hohen Keimgehalten bereits sensorische Veränderungen vorhanden, so dass<br />
diese Proben nach Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe b VO (EG) Nr. 178/2002 beanstandet wurden. Diese<br />
Proben waren für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet.<br />
Die mikrobiologisch auffälligen Proben zeigten in den meisten Fällen eine auffällige Gesamtkeimzahl, auch<br />
Hefen und Enterobacteriaceae wurden des Öfteren nachgewiesen.<br />
Außerdem wurden drei Verfolgsproben untersucht. Zwei Proben waren nicht zu beanstanden, eine Probe wies<br />
jedoch eine so hohe Gesamtkeimzahl auf, dass eine Beanstandung nach Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004<br />
ausgesprochen wurde.<br />
Neben den Keimgehalten wurde auch die Temperatur, bei der die Erzeugnisse im Betrieb gelagert wurden,<br />
überprüft. Als leichtverderbliche Lebensmittel sollten gekochte Nudeln und gekochter Reis gekühlt bei max. 7°C<br />
aufbewahrt werden. Nach der DIN 10508 „Temperaturen für Lebensmittel“ sollte bei heiß zu haltenden,<br />
verzehrsfertigen Lebensmitteln eine Produkttemperatur von mindestens 65°C eingehalten werden. Beim<br />
Abkühlen heißer Lebensmittel sollte der Bereich zwischen 65°C und 10°C innerhalb von drei Stunden<br />
durchschritten werden um eine Keimvermehrung zu vermeiden. Bei 22 Planproben wurde eine Bemängelung der<br />
Lagertemperatur ausgesprochen, davon zeigten zwölf Proben einen unauffälligen mikrobiologischen Befund,<br />
zehn Proben zeigten bereits auffällige Keimgehalte.<br />
Bei den Verfolgsproben wurde eine Probe nicht ausreichend gekühlt, bei dieser wurde aufgrund der hohen<br />
Keimgehalte eine Beanstandung ausgesprochen.<br />
Die Ergebnisse zeigen sehr eindrücklich, wie wichtig die mikrobiologische Überprüfung von vorgekochten<br />
Speisen aus Gaststätten, Restaurants und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung ist. Die Bemängelungs-<br />
und Beanstandungsquote zeigt, dass hinsichtlich des Umgangs mit leichtverderblichen Lebensmitteln in<br />
Gaststätten, Restaurants und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung Schwachstellen vorhanden sind, die<br />
durch derartige Untersuchungen aufgedeckt werden. Im kommenden Jahr wird diese Untersuchung daher in<br />
verstärktem Maße fortgesetzt.<br />
Erzeugnisse mit Zutaten aus gentechnisch veränderten Lebensmitteln<br />
Für gentechnisch veränderte Lebensmittel und solche Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Zutaten<br />
enthalten, gelten die Etikettierungsvorschriften der Verordnungen 1829/2003/EG und 1830/2003/EG. Mit der<br />
255
Etikettierung werden Verbraucher und Benutzer des Erzeugnisses über einen Gehalt an gentechnisch<br />
veränderten Anteilen in einem Lebensmittel informiert.<br />
Beprobt wurden Fertiggerichte mit einem Anteil an Mais, Soja oder Reis. In die Untersuchungen wurde der<br />
Nachweis von gentechnisch verändertem Reis einbezogen, weil eine Zulassung in der EU bisher nicht besteht<br />
und über die USA Reis mit gentechnisch veränderten Anteilen nach Europa exportiert worden ist.<br />
In den 33 untersuchten Proben konnte gentechnisch veränderter Reis nicht nachgewiesen werden.<br />
Eine Probe Nudelgericht eines asiatischen Herstellers enthielt gentechnisch veränderte Soja, ohne dass eine<br />
Deklaration in der Etikettierung erfolgt war.<br />
Die Probe wurde beanstandet.<br />
Himalayasalz<br />
Gelegentlich entwickeln Hersteller bei der Vermarktung und Bewerbung ihrer Produkte mehr Phantasie, als es die<br />
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen erlauben.<br />
So kam ein niedersächsischer Hersteller auf die Idee, Eintöpfe unter Verwendung von so genanntem<br />
Himalayasalz in den Verkehr zu bringen und diese Zutat plakativ zu bewerben. Auf dem Etikett konnte der<br />
Verbraucher lesen, dass „Alle unsere hochwertigen Qualitäts-Feinkost-Konserven mit naturbelassenem<br />
Himalaya-Kristall-Salz hergestellt“ und „Naturbelassene Salzkristalle aus dem Himalaya eine Quelle für gute<br />
Gesundheit und Steigerung der Vitalität“ sind. „Mit Echtheits-Zertifikat“.<br />
Um Himalayasalz wird viel Wirbel gemacht. Gepriesen werden vor allem zwei Dinge: Zum einen, dass es ein<br />
Kristallsalz ist, und daher besonders viele Mineralstoffe enthalten soll. Zum anderen hat es angeblich<br />
energetische Schwingungen, die sich günstig auf den Körper auswirken und seine Selbstheilung anregen. Diese<br />
besonderen Energien soll das Salz dadurch bekommen haben, dass es für Jahrmillionen dem Druck des<br />
Himalaya-Massivs ausgesetzt war.<br />
Himalayasalz stammt häufig aus den Minen der Salt Range in der Mitte Pakistans und hat wenig mit dem<br />
Himalaya zu tun. Es wird bergmännisch abgebaut und zur Weiterverarbeitung nicht raffiniert, sondern lediglich<br />
äußerlich gereinigt, infolge der nicht durchgeführten Raffination liegt ein etwas größerer Gehalt an mineralischen<br />
Bestandteilen vor, der aber im Vergleich zu Kochsalz gering ausfällt und unter Berücksichtigung der relativ<br />
geringen, beim Würzen von Speisen verwendeten Menge an Salz keine entscheidende Rolle spielt. Eine im<br />
Vergleich zur Verwendung von Kochsalz bestehende besondere Wirkung in Bezug auf Gesundheit und Vitalität<br />
ist nicht zu erwarten. Anderslautende Untersuchungen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, sind nicht<br />
bekannt.<br />
Die Bewerbung wurde als irreführend beurteilt.<br />
Kennzeichnungsmängel<br />
Von den beanstandeten Proben wiesen 74 Proben Kennzeichnungsmängel auf (keine Angabe in deutscher<br />
Sprache, fehlende Herstellerangabe, fehlende oder unzutreffende Klassenamen, unvollständiges<br />
Zutatenverzeichnis, fehlende Aufzählung der Zutaten von zusammengesetzten Zutaten, fehlende oder<br />
unleserliche Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums, fehlende Loskennzeichnung). Vor allem die QUID-<br />
Kennzeichnung gibt immer wieder Grund zu Beanstandungen. Sie fehlte bei 13 Proben, bzw. entsprach nicht den<br />
festgelegten Anforderungen.<br />
Sonstige Untersuchungen (insbesondere Verdachts- und Beschwerdeproben)<br />
Insgesamt wurden 79 Beschwerde-, Verdachts- und Verfolgsproben eingeliefert. Darunter befanden sich u.a.:<br />
32 Proben aus Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung wie Krankenhäusern, Altenheimen,<br />
Kindertagesstätten, Gastronomiebetrieben, MenüBringdiensten und Cateringbetrieben. Anlass zur Untersuchung<br />
gaben Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie Magen- und Darmkrämpfe nach Verzehr dieser<br />
Speisen.<br />
Sechs Proben wurden beanstandet bzw. bemängelt:<br />
- Rückstellprobe „Französische Huhnpfanne“<br />
Eine Probe wurde als Beschwerdeprobe mit Verdacht auf Gesundheitsschädigung in das Lebensmittelinstitut<br />
Braunschweig eingesandt.<br />
Das Fertiggericht wurde in einer Einrichtung zur Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Dabei handelte es sich<br />
um eine Restmenge, die nach mehrmaligem Aufwärmen nur noch für eine achtköpfige Personengruppe reichte.<br />
Diese hat ausschließlich von dem Menü gegessen. Drei Stunden nach dem Verzehr sind die gesamten Personen<br />
an Durchfall erkrankt.<br />
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung wurden in der Rückstellprobe 1,3 x 105 KbE/g Clostridium<br />
256
(Cl.) perfringens Keime nachgewiesen.<br />
Weitere Einzelheiten sind aus Kapitel 4.17.1 – mikrobiologischer Status von Lebensmitteln - zu entnehmen.<br />
- Thunfischpizza mit hohem Histamingehalt<br />
Nach dem Verzehr einer mit Thunfisch belegten Pizza traten eine starke Schwellung der Lippen sowie<br />
Atembeklemmungen auf.<br />
Die Untersuchung auf biogene Amine hat im Fischanteil einen Gehalt an Histamin in Höhe von 1215 mg/kg<br />
ergeben. Die angegebenen Symptome sind als Folge einer Histaminzufuhr durch das vorliegende Lebensmittel<br />
mit einem hohen Histamingehalt erklärbar.<br />
Das biogene Amin Histamin wird im menschlichen Organismus beispielsweise bei allergischen Reaktionen<br />
freigesetzt und ist mitverantwortlich für die Ausbildung der Symptome wie Jucken und Hautrötung. Werden hohe<br />
Dosen an Histamin mit der Nahrung aufgenommen, kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen. Symptome<br />
wie Hautrötung, Übelkeit, Durchfall, Magenkrämpfe, Kopfschmerzen und Schwindel treten dabei relativ schnell,<br />
meist schon innerhalb von 30 – 60 Minuten auf.<br />
Zu den durch Histaminzufuhr ausgelösten Reaktion gehört u.a. die als „Quincke-Ödem“ bezeichnete starke<br />
Schwellung von Lippen und Augenlidern. Als weitere typische Symptome werden Hautrötungen und Tachykardie,<br />
Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Harndrang, Bauchschmerzen und Beklemmungsgefühl beschrieben.<br />
Histamin wird in Fischerzeugnissen durch die Einwirkung von Bakterienenzymen aus der Aminosäure Histidin<br />
gebildet. Zu den Fischen mit einem relativ hohen Histidingehalt gehört u.a. die Gattung Thunnus (Thunfisch) aus<br />
der Familie Scombridae (Makrelenfische).<br />
In diesen Fischen können dann bakteriell entsprechende Mengen an Histamin gebildet werden. Für Fische<br />
dieser Familien und Erzeugnisse daraus wurde daher ein Grenzwert für Histamin von 200 mg/kg Fischfleisch<br />
festgesetzt (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 Fischhygiene-Verordnung).<br />
Bakterien, die Histidin in Histamin umwandeln können, gehören zur normalen Oberflächenmikroflora roher<br />
Fische, stellen aber bei frischen Fischen nur 0,1 bis 1,0 % der gesamten Mikroflora dar. Durch unzureichende<br />
Kühlung nach dem Fang kann es zu einer starken Vermehrung der Bakterien und dadurch zu einer hohen<br />
Histaminbildung kommen. Auch in zunächst unbelasteten, keimarmen Produkten dieser Fischarten, wie z. B.<br />
Dauerkonserven, kann nach dem Öffnen durch bakterielle Kontamination bei mangelnder Hygiene in Verbindung<br />
mit zu warmer und zu langer Lagerung Histamin gebildet werden.<br />
Der Thunfischanteil wurde aufgrund des hohen, erheblich über dem Grenzwert liegenden, für<br />
Fischereierzeugnisse festgelegten Histamingehaltes als verdorben und die Probe als für den Verzehr durch den<br />
Menschen nicht geeignet und damit nicht sicher im Sinne von Art. 14 Abs. 1 und 2 Buchstabe b in Verbindung mit<br />
Art. 14 Abs. 5 der VO (EG) 178/2002 beurteilt<br />
Der hohe Histamingehalt im Fischanteil legte den begründeten Verdacht nahe, dass die hier festgestellte<br />
Beschaffenheit auf unsachgemäße Lagerung des Fischereierzeugnisses zurückzuführen ist. Eine Überprüfung<br />
der Lagerbedingungen vor Ort wurde angeregt.<br />
4.16.28 Gewürze und Würzmittel<br />
Tabelle 4.16.28.1 Übersicht über die Probenzahlen und Beanstandungsquoten<br />
Anzahl Proben davon beanstandet in %<br />
Gewürze, Kräuter 195 42 22<br />
Gewürzzubereitungen,<br />
Gewürzsalze, Würzmischungen<br />
79 27 34<br />
Würzsoßen und –pasten (ohne<br />
Sojasoßen und Speisewürzen)<br />
179 40 22<br />
Sojasoßen und Speisewürzen 37 9 24<br />
Essig 41 12 29<br />
Speisesalz 25 2 8<br />
Senf 44 17 39<br />
Gewürze, Kräuter, Gewürzubereitungen, Gewürzsalze und Würzmischungen<br />
- Definitionen<br />
257<br />
Dr. Held, R.; Dr. Thielke, S. (LI BS)
Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches für Gewürze und andere würzende Zutaten geben u .a.<br />
folgende Definitionen:<br />
Gewürze und Kräuter sind Pflanzenteile, die aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe als geschmack- und/oder<br />
geruchgebende Zutaten zu Lebensmitteln bestimmt sind.<br />
Gewürzzubereitungen sind Mischungen von einem oder mehreren Gewürzen mit anderen<br />
geschmackgebenden oder geschmackbeeinflussenden Zutaten und enthalten mindestens 60 % Gewürze.<br />
Gewürzsalze bestehen aus einer Mischung von Speisesalz mit einem oder mehreren Gewürzen und/oder mit<br />
Gewürzzubereitungen und Würzen (geschmackbeeinflussende Erzeugnisse aus Eiweißhydrolysaten). Sie<br />
enthalten mindestens 15 % Gewürze und mehr als 40 % Speisesalz.<br />
Als Würzmischungen werden feste oder flüssige Erzeugnisse bezeichnet, die überwiegend aus<br />
Geschmacksverstärkern, Speisesalz, Zuckerarten oder anderen Trägerstoffen bestehen. Sie können außerdem<br />
Würzen sowie Hefe, Gemüse, Pilze, Gewürze, Kräuter und/oder Extrakte daraus enthalten.<br />
- Wertbestimmende Bestandteile<br />
Zur Überprüfung einer einwandfreien Qualität werden Gewürze und Kräuter in der Regel auf ihren Gehalt an<br />
wertbestimmenden Inhaltsstoffen geprüft, wie etwa auf ätherische Öle, Asche und Sand. Im Jahr 2006 wurden in<br />
dieser Hinsicht insbesondere Kardamom, Chili, Ingwer, Nelke, Paprika, schwarzer Pfeffer, Piment und Zimt sowie<br />
Majoran und Oregano untersucht.<br />
Der Anteil des Piperins im schwarzen Pfeffer lag mit 2,9 bis 6,6 g/100g im Normbereich. Abweichungen im<br />
ätherischen Ölgehalt wurden bei jeweils einer Probe Pfeffer und Piment, bei jeweils zwei Proben Kardamom und<br />
Ingwer sowie bei drei Proben Majoran festgestellt. Eine Probe Fenchelsamen fiel durch den hohen Anteil an<br />
Stielen und anderen Fremdbestandteilen auf.<br />
- Mikrobiologischer Status<br />
Im Berichtsjahr gelangten insgesamt 31 Gewürze und Kräuter (einschließlich Mischungen) sowie neun<br />
Gewürzzubereitungen, Gewürzsalze und Würzmischungen zur mikrobiologischen Untersuchung. Mit Blick auf<br />
entsprechende Schnellwarnmeldungen der EU wurde insbesondere schwarzer Pfeffer auf das Vorhandensein<br />
von Salmonellen und Bacillus cereus geprüft.<br />
Zur Beurteilung der Analysenergebnisse wurden die von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und<br />
Mikrobiologie (DGHM) veröffentlichten Richt- und Warnwerte für Gewürze herangezogen. Salmonellen, E. coli<br />
und Enterobacteriaceae waren in keinem Fall nachweisbar, die Keimzahlen für einige wenige Befunde an<br />
Clostridium perfringens und Bacillus cereus lagen allesamt unter den Richtwerten der DGHM. 17 der 31 Gewürz-<br />
und Kräuterproben enthielten Schimmelpilze, der entsprechende Richtwert war in einem Chilipulver überschritten.<br />
Bei Gewürzzubereitungen, Gewürzsalzen und Würzmischungen ergaben sich allesamt unauffällige<br />
mikrobiologische Befunde.<br />
Um beim Umgang mit Gewürzen im Haushalt eine Kontamination der Erzeugnisse mit Mikroorganismen bzw.<br />
deren Vermehrung zu vermeiden, sollten einige Hygieneregeln eingehalten werden: Speisen, die Gewürze<br />
enthalten und vor dem Verzehr nicht erhitzt werden, sollten Gewürze immer erst kurz vor dem Verzehr<br />
zugegeben werden. Verbleibende Mengen sollten gekühlt (unter 7°C) gelagert werden, um eine Keimvermehrung<br />
zu verhindern. Gewürze sollten immer in Gewürzstreuern gelagert werden, um einen direkten Kontakt mit<br />
möglicherweise kontaminierten Fingern zu vermeiden. Da ein erhöhter Wassergehalt der Gewürze das<br />
Keimwachstum fördert, ist die Aufbewahrung an einem trockenen Ort angezeigt. So sollten Gewürze<br />
beispielsweise nicht über dem Herd aufbewahrt oder direkt aus einem Gewürzstreuer in die erhitzte Speise<br />
gegeben werden, da andernfalls mit dem aufsteigenden Wasserdampf Feuchtigkeit in die Gewürzbehälter<br />
gelangen kann (siehe hierzu Kapitel 4.17.1 –Mikrobiologischer Status von Lebensmitteln-).<br />
- Farbstoffe<br />
40 Gewürze und Gewürzmischungen (im Schwerpunkt Paprika, Chili und Kurkuma) sowie 18 Erzeugnisse aus<br />
der Gruppe der Gewürzzubereitungen, Gewürzsalze und Würzmischungen wurden auf den Zusatz von<br />
zugelassenen und nicht zugelassenen künstlichen Farbstoffen geprüft. Ein aus China stammendes Produkt mit<br />
der Bezeichnung „Szechuan Pfeffer“ war unzulässigerweise mit Conchenillerot (E 124) gefärbt, eine georgische<br />
Gewürzmischung enthielt die nicht zugelassenen Farbstoffe Sudan I, Sudan Red G und Para Red.<br />
- Mykotoxine<br />
Einige Gewürzsorten sind aufgrund der klimatischen Gegebenheiten in den Erzeugerländern oder aufgrund der<br />
Bedingungen, unter denen die Ware transportiert, gelagert und verarbeitet wird, verstärkt der Gefahr einer<br />
Kontamination mit Schimmelpilzgiften ausgesetzt. Deshalb wurden 93 Gewürze, zehn Currys und eine<br />
Würzmischung auf Ochratoxin A sowie 100 Gewürze, elf Currys, zwei Würzmischungen und ein Würzsalz auf<br />
Aflatoxine untersucht.<br />
Bei den Untersuchungen auf Ochratoxin A erwiesen sich Ingwer, Nelke und Zimt in mehr als 90 % der Fälle als<br />
im Rahmen der Nachweisgrenzen kontaminationsfrei. Rund die Hälfte der Proben von Muskatnuss und Piment,<br />
die meisten Proben von Chili, Kardamom und Pfeffer sowie alle untersuchten Currys enthielten geringe Mengen<br />
des Mykotoxins. Drei Proben der ebenfalls nahezu durchgehend belasteten Paprikapulver fielen aufgrund ihrer<br />
258
hohen Gehalte an Ochratoxin A zwischen 36,1 µg/kg und 70,4 µg/kg auf.<br />
Vergleichbare Befunde waren bereits im Vorjahr ermittelt worden. Eine Höchstmenge für Ochratoxin A in<br />
dieser Produktkategorie – insbesondere für das auch in der gewerblichen Lebensmittelherstellung breite<br />
Verwendung findende Paprikagewürz – wäre im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes wünschenswert,<br />
existiert bislang jedoch nicht.<br />
Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Aflatoxingehalten ab. In Kardamom, Ingwer, Nelke, Piment und Zimt<br />
waren die Stoffe in nur wenigen Erzeugnissen und in meist geringer Menge nachweisbar. Ebenfalls nur geringe<br />
Aflatoxinmengen wurden in den Currys gefunden, allerdings waren hier neun von elf Erzeugnissen betroffen.<br />
Etwa die Hälfte der Proben von Chili und Pfeffer wies Aflatoxinkonzentrationen bis zu einem Drittel der<br />
Höchstmenge der VO (EG) 466/2001 auf. Unter den nahezu durchgehend belasteten Paprika- und<br />
Muskatgewürzen wurden zwei Paprikaproben mit Gehalten an Aflatoxin B1 von 8,2 und 18,0 µg/kg sowie zwei<br />
Muskatnussproben mit summarischen Gehalten von 80,3 und 101 µg/kg an Aflatoxin B1+B2+G1+G2 beanstandet<br />
(siehe hierzu Kapitel 4.17.4 –Mykotoxine).<br />
- Bestrahlung<br />
Durch eine Bestrahlung können Keimzahlen effizient verringert und pathogene Keime abgetötet werden. Eine<br />
besondere Kenntlichmachung ist auf jeder Handelsstufe bis zur Abgabe an den Endverbraucher durch die<br />
Angabe „bestrahlt“ oder „mit ionisierenden Strahlen behandelt“ vorgeschrieben.<br />
108 Gewürze, Kräuter und entsprechende Mischungen sowie 26 Gewürzzubereitungen, Gewürzsalze und<br />
Würzmischungen wurden auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen geprüft. Bei zwei Paprikapulvern sowie<br />
einem als „Hähnchenwürzsalz“ bezeichneten Produkt fiel der Nachweis positiv aus. Eine Kenntlichmachung der<br />
Bestrahlung fehlte, die Proben wurden beanstandet (siehe hierzu Kapitel 4.17.8 –Behandlung mit ionisierenden<br />
Strahlen).<br />
- Sonstige Untersuchungen<br />
Aus Zimtaldehyd, dem Hauptaromastoff des Zimts, kann bei ungünstigen Lagerungs- und Transportbedingungen<br />
Styrol entstehen, das nativ nur in sehr geringen Mengen im Gewürz vorkommt. Höhere Anteile an Styrol können<br />
sich sensorisch insbesondere durch einen produktuntypischen, lösungsmittelartigen Geruch bemerkbar machen.<br />
Drei Proben gemahlener Zimt fielen durch Styrolgehalte von mehr als 20 mg/kg und eine damit einher gehende<br />
sensorische Abweichung auf. Die Proben wurden als zum Verzehr nicht geeignet beurteilt. Es ist geplant,<br />
entsprechende Untersuchungen im Folgejahr fortzuführen.<br />
Der in China beheimatete Cassia-Zimt (Cinnamomum cassia), auch „Gewürzrinde“ genannt, gilt im Handel als<br />
minderwertige Sorte. Während bei Ceylon-Zimt (Cinnamomum verum) nur die dünnen, aromareichen<br />
Innenschichten der Rinde zum Gewürz verarbeitet werden, wird bei Cassia-Zimt die gesamte, einzig vom<br />
Korkmantel befreite Rinde verwendet. Cassia-Zimt ist vergleichsweise gerbstoffreich und weist mit etwa 2 g/kg bis<br />
zu 100-fach höhere Cumaringehalte als Ceylon-Zimt auf. Insbesondere bei der industriellen Herstellung von<br />
Lebensmitteln wird Ceylon-Zimt immer wieder mit dem preiswerteren Cassiazimt verschnitten oder durch diesen<br />
ersetzt, so dass erhebliche Cumarinmengen in die Endprodukte gelangen können.<br />
Bei 16 von insgesamt 19 untersuchten Proben wurde ein Cumaringehalt zwischen 2,55 und 3,72 g/kg ermittelt,<br />
bei den verbleibenden drei Proben reichte er von 0,37 bis 0,96 g/kg. Somit dürfte es sich in ersteren Fällen mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit um reinen Cassia-Zimt gehandelt haben. Ob mit den anderen drei Erzeugnissen ein<br />
Verschnitt vorlag, konnte nicht beurteilt werden. Die Bezeichnung eines Produktes als „Ceylon-Zimt“ wurde in<br />
Anbetracht eines Cumaringehaltes von 3,51 g/kg als irreführend beanstandet (weiteres zur Cumarinproblematik<br />
siehe Kapitel 4.16.17, 4.16.26).<br />
- Kennzeichnung<br />
Die Kennzeichnung von insgesamt 48 der 274 untersuchten Erzeugnisse (entspr. 17,5 %) genügte nicht den<br />
rechtlichen Vorschriften. Neben den bereits geschilderten Fällen musste die Verkehrsbezeichnungen „Gewürz“<br />
oder „Gewürzmischung“ bzw. die als Verkehrsbezeichnung aufzufassende Angabe des Gewürznamens mehrfach<br />
beanstandet werden. Fünf Proben geschrotete Chili- und Paprikafrüchte sowie vier als Gewürzmischung in den<br />
Verkehr gebrachte Produkte enthielten teilweise erhebliche Mengen an Kochsalz, zwei Mischungen war<br />
Natriumglutamat zugesetzt worden. Anders als bei Gewürzzubereitungen entsprechen geschmackbeeinflussende<br />
Zusätze bei reinen Gewürzen jedoch nicht der in den Leitsätzen beschriebenen allgemeinen Verkehrsauffassung.<br />
Darüber hinaus wurden vor allem unkorrekte oder unvollständige Zutatenverzeichnisse bemängelt.<br />
Bei den Gewürzzubereitungen, Gewürzsalzen und Würzmischungen führten vor allem unkorrekte oder<br />
unvollständige Zutatenverzeichnisse, unzutreffende Verkehrsbezeichnungen und unvollständige Formulierungen<br />
des Mindesthaltbarkeitsdatums zur Beanstandung. Eine entscheidende Rolle spielte auch hier oft der<br />
Kochsalzanteil, der in manchen Zutatenverzeichnissen gar nicht oder in falscher Position aufgeführt war. In<br />
anderen Fällen lag er so hoch, dass daraus ein zu niedriger Gewürzanteil resultierte. So fiel beispielsweise ein als<br />
Gewürzzubereitung bezeichnetes Produkt mit 51,8 % und ein als Gewürzsalz bezeichnetes Erzeugnis mit 91,4 %<br />
Natriumchlorid auf. Der Gewürzanteil konnte hier nicht mehr als 48,2 % bzw. 8,6 % betragen. Da<br />
Gewürzzubereitungen mindestens 60 % und Gewürzsalze mindestens 15 % Gewürze enthalten müssen, wurden<br />
die jeweils unzutreffenden Verkehrsbezeichnungen beanstandet.<br />
259
Würzmittel<br />
Die Produktgruppe der Würzmittel umfasst eine Vielzahl von Erzeugnissen, darunter Speisesalz, Speisesenf,<br />
Würzsoßen, Speisewürzen, Essige und Meerrettichzubereitungen. In diesem Berichtsjahr lag der Schwerpunkt<br />
auf der Untersuchung von Tomatenketchup, Sojasoßen, Speisewürzen, Grillsoßen, Speisesenf, Obstessig und<br />
Speisesalz.<br />
- Würzsoßen und Würzpasten (außer Sojasoßen und Speisewürzen)<br />
Würzsoßen sind häufig konserviert und mit Süßstoff gesüßt. 109 Würzsoßen verschiedener<br />
Geschmacksrichtungen, darunter 26 Tomatenketchups, wurden daher auf ihren Gehalt an Zusatzstoffen<br />
untersucht. Bei Soßen mit Paprika, Chilli oder Curry wurde auch auf einen Gehalt an nicht zugelassenen<br />
Sudanfarbstoffen geprüft.<br />
Neun Proben enthielten Benzoesäure und Sorbinsäure, acht Proben nur Sorbinsäure und drei nur Benzoesäure.<br />
Höchstmengenüberschreitungen wurden nicht festgestellt. Bei einer losen Proben Currysoße eines<br />
Imbissbetriebes fehlte die Kenntlichmachung der Konservierungsstoffe. Bei einer Probe Curry-Ketchup eines<br />
ansässigen Herstellers waren die Konservierungsstoffe Sorbin- und Benzoesäure im Zutatenverzeichnis<br />
angegeben, aber analytisch nicht nachweisbar. Vom Hersteller wurde eine Etikettenänderung vorgenommen.<br />
Bei einer schwarzen Olivenpaste fehlte die Benzoesäure im Zutatenverzeichnis. Darüber hinaus wurde<br />
festgestellt, dass es sich um ein mit Eisenglukonat geschwärztes Erzeugnis handelte. Auch diese Zutat fehlte im<br />
Zutatenverzeichnis.<br />
Bei der Untersuchung von 72 Würzsoßen auf die Süßstoffe Saccharin, Acesulfam K und Aspartam wurden bei<br />
zehn Proben Saccharingehalte ermittelt. Acesulfam K war lediglich in einer Probe Tomatenketchup enthalten.<br />
Aspartam war in keiner Probe nachweisbar. Eine Höchstmengenüberschreitung für Saccharin konnte bei einem<br />
Tomatenketchup festgestellt werden. Süßstoffe müssen gemäß den Vorschriften der LMKV in Verbindung mit der<br />
Verkehrsbezeichnung durch die Angabe „mit Süßungsmittel“ kenntlich gemacht werden. Bei einer Probe<br />
Zigeunersoße war der verwendete Wortlaut unkorrekt.<br />
Die Untersuchung auf Sudanfarbstoffe wurde bei solchen Erzeugnissen durchgeführt, in deren<br />
Zutatenverzeichnis die Zutaten Chili oder Paprika aufgeführt waren. 31 Würzsoßen wurden überprüft, positive<br />
Befunde waren erfreulicherweise nicht zu verzeichnen.<br />
Bei 18 Tomatenketchup-Proben wurde der deklarierte Tomatenanteil überprüft. Nach der Richtlinie für<br />
Tomatenketchup ist ein Mindestgehalt an Tomatentrockenmasse von 7 % handelsüblich.<br />
Dieser Mindestwert wurde in keiner Probe unterschritten. Die deklarierten Tomatengehalte wurden<br />
eingehalten. Lediglich bei einer Bio-Tomatenketchup-Probe wurde der Tomatenanteil im Zutatenverzeichnis an<br />
falscher Stelle aufgeführt. Nach einer Rezepturüberprüfung wurde vom Hersteller eine Etikettenänderung<br />
vorgenommen.<br />
Beanstandungen resultierten auch aus Kennzeichnungsmängeln. Insgesamt wurden bei 29 Proben<br />
verschiedenartiger Würzsoßen Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften der LMKV, LKV oder NKV<br />
festgestellt. Dazu zählen unkorrekte Zutatenverzeichnisse durch fehlende Klassennamen oder fehlende Zutaten<br />
von zusammengesetzten Zutaten, unvollständige oder undeutliche Mindesthaltbarkeitsdaten und unkorrekte<br />
Nährwerttabellen.<br />
Drei Erzeugnisse, die als „Feigen-Senfsauce bzw. Orangen-Senfsauce“ bezeichnet waren, aber keine<br />
typischen geruchlichen und geschmacklichen Merkmale eines Senfes aufwiesen, wurden als irreführend<br />
aufgemacht beurteilt. Als Zutat enthielten sie keine Senfsaat, sondern lediglich Senföl für den scharfen<br />
Geschmack.<br />
Würzsoßen verschiedener Geschmacksrichtungen eines Herstellers vielen durch die Zutat Glycerin auf, die in<br />
den Zutatenverzeichnisses an erster Stelle aufgeführt und in einer Menge von ca. 30% enthalten war. Glycerin ist<br />
zu technologischen Zwecken für diese Würzsoßen durchaus zugelassen. Die Verwendung von derart hohen<br />
Mengen geht jedoch über eine technologische Wirkung hinaus. Hier wurde ein Zusatzstoff zu einer Haupt-Zutat<br />
gemacht. Der Hersteller wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert, die bislang allerdings noch nicht vorliegt.<br />
- Sojasoßen und Speisewürzen<br />
21 Sojasoßen und vier flüssige Speisewürzen wurden auf einen Gehalt an 3-MCPD überprüft. In zwölf Proben<br />
war 3-MCPD nachweisbar, in elf Proben lag der Gehalt unter der Höchstmenge von 0,05 mg/kg Trockenmasse.<br />
In einer Soßenzubereitung mit einem Sojasoßenanteil von 25 % wurde die Höchstmenge erheblich überschritten.<br />
Die Probe wurde beanstandet. Eine Sojasoße wurde mit dem Hinweis „Frei von GVO“ beworben. Nach der NLV<br />
darf nur der Wortlaut „ohne Gentechnik“ verwendet werden.<br />
Zusätzlich erstreckte sich der Untersuchungsumfang der Sojasoßen und Speisewürzen auch auf eine Prüfung auf<br />
Konservierungsstoffe. In sechs Sojasoßen konnte entweder der Konservierungsstoff Sorbinsäure oder der<br />
Konservierungsstoff Benzoesäure nachgewiesen werden. Nur eine Probe enthielt beide Konservierungsstoffe.<br />
Höchstmengenüberschreitungen lagen nicht vor. Die Kennzeichnungen waren korrekt.<br />
260
Sechs weitere Sojasoßen und drei Speisewürzen wiesen Kennzeichnungsmängel durch fehlende Klassennamen,<br />
unvollständige Formulierungen des Mindesthaltbarkeitsdatums oder unvollständige Bezeichnungen von Zutaten<br />
auf.<br />
- Essig<br />
Der Schwerpunkt lag in diesem Berichtsjahr auf der Untersuchung von Obstessigen. In 13 Apfelessigen wurden<br />
neben dem Säuregehalt und Zusatzstoffen wie Schwefeldioxid auch Inhaltsstoffe wie z.B. L-Äpfelsäure, Sorbit,<br />
Shikimisäure, Chinasäure und Mineralstoffe überprüft, um Verfälschungen nachzuweisen. Beanstandungen<br />
resultierten daraus nicht. In einem Apfelessig eines Direktvermarkters lag der Säuregehalt unter 5 %, die<br />
Bezeichnung „Essig“ wurde daher beanstandet.<br />
21 weitere unterschiedliche Essige wie Balsamessig, Thymianessig, Pfirsichessig wurden ebenfalls hinsichtlich<br />
ihres Säuregehaltes überprüft sowie auf einen Zusatz an Schwefeldioxid untersucht. Zehn Essige waren<br />
geschwefelt, die Schwefeldioxidgehalte lagen jedoch in allen Fällen unter der Höchstmenge. Bei einem<br />
Balsamessig fehlte allerdings Schwefeldioxid als Zutat im Zutatenverzeichnis. Drei Essige wiesen Säuregehalte<br />
unter 5 % auf. Die Bezeichnung „Essig“ wurde beanstandet.<br />
Ein Pfirsich-Balsam-Essig wurde mit dem Hinweis „natürliches Pfirsicharoma“ ausgelobt. Durch<br />
Stereodifferenzierung der chiralen gamma-Lactone wurde festgestellt, dass die Aromastoffe gamma-Deca- und<br />
gamma-Dodecalacton in racemischer Form, d.h. in gleichen Anteilen der R- und S-Enantiomeren vorliegen. Dies<br />
ist ein Hinweis darauf, dass diese Aromastoffe chemisch synthetisiert wurden und daher nicht natürlich sind. Die<br />
Probe wurde als irreführend aufgemacht beurteilt.<br />
Ein Reisessig enthielt deutliche Gehalte an Glukose und Fruktose. Sensorisch wurde ein süßer Geschmack<br />
festgestellt. Die Zutat Zucker fehlte im Zutatenverzeichnis. Außerdem wurde auch ein Gehalt an Glutaminsäure<br />
ermittelt, eine Aufführung im Zutatenverzeichnis war nicht vorhanden. Da bei dieser Probe der Säuregehalt<br />
deutlich unter 5 % lag, handelte es sich insgesamt nicht um einen handelsüblichen Essig.<br />
Bei einem als „Kirsch-Essig“ bezeichneten Erzeugnis wurden die Süßstoffe Acesulfam K und Cyclamat<br />
nachgewiesen. Süßstoffe sind für Essig nicht zugelassen. Darüber hinaus wurde die Bezeichnung Kirschessig als<br />
irreführend beurteilt, da der Säuregehalt unter 5 % lag und das Erzeugnis nicht ausschließlich aus Kirschwein<br />
hergestellt worden war.<br />
Einige wenige Beanstandungen ergaben sich für Essige aufgrund von Kennzeichnungsmängeln im Bereich<br />
der LMKV durch unkorrekte oder fehlende Klassennamen oder einen unvollständigen Wortlaut für das<br />
Mindesthaltbarkeitsdatum sowie im Bereich der EssigV durch die fehlende Angabe der Ausgangsstoffe.<br />
- Speisesenf<br />
44 Proben Senf, darunter 22 Proben scharfer Senf, drei Proben extra scharfer Senf, vier Proben Dijon-Senf,<br />
neun Proben mittelscharfer Senf und sechs Proben Senf mit besonderen Zutaten wie Knoblauch, Bärlauch,<br />
wurden u. a. auf einen Zusatz an Konservierungsstoffen und Schwefeldioxid untersucht. Die Konservierungsstoffe<br />
Sorbinsäure, Benzoesäure und pHB-Ester waren in keiner Probe nachweisbar. Auch ein Gehalt an<br />
Schwefeldioxid konnte in den Proben nicht festgestellt werden.<br />
Zwei Proben wiesen einen Gehalt an dem Süßstoff Saccharin auf. Höchstmengenüberschreitungen lagen nicht<br />
vor.<br />
Bei zwei Proben wurde Saccharin im Zutatenverzeichnis als Zutat angegeben; auch die entsprechende<br />
Kenntlichmachung „mit Süßungsmittel“ war deklariert. In beiden Fällen war Saccharin jedoch nicht nachweisbar.<br />
Das Zutatenverzeichnis sowie die Kenntlichmachung wurden als unkorrekt beurteilt.<br />
Eine Probe scharfer Senf wies im Geruch und Geschmack keine charakteristische Schärfe mehr auf. Der<br />
Allylsenfölgehalt lag mit 36 mg/100 g vergleichsweise niedrig. Nach eigenen Untersuchungen weist scharfer Senf<br />
üblicherweise Allylsenfölgehalte von mehr als 60 mg/100 g auf. Das deklarierte Mindesthaltbarkeitsdatum war um<br />
mehr als acht Monate überschritten. Die Probe wurde als wertgemindert beanstandet.<br />
Bei 24 Senfproben, insbesondere scharfem Senf, erfolgte auch eine Prüfung auf gentechnisch veränderten<br />
Raps. In neun Fällen (sieben Proben scharfer Senf, ein Dijonsenf und ein mittelscharfer Senf) war der Nachweis<br />
positiv. Eine Kennzeichnung war nicht vorhanden. Von einer zuständigen Überwachungsbehörde wurde<br />
mitgeteilt, dass in einer amtlichen Probe einer braunen Senfsaat aus Kanada keine Anteile von gentechnisch<br />
verändertem Raps nachgewiesen werden konnten. Durch entsprechende Produktspezifikationen und PCR-<br />
Prüfberichte für jede Lieferung Senfsaat hat der Hersteller geeignete Schritte unternommen, um das<br />
Vorhandensein von genetisch verändertem Raps in der Senfsaat zu vermeiden (siehe hierzu Kapitel 4.17.2 –<br />
Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderungen).<br />
Einige wenige Beanstandungen resultierten auch aus Kennzeichnungsmängeln wie z.B. fehlende Losangaben<br />
oder unvollständige Bezeichnungen von Zutaten.<br />
Ein scharfer Senf wies laut eines Beschwerdeprotokolls einen abweichenden Geschmack sowie einen<br />
Fremdgeruch nach Parfüm auf. Diese sensorischen Eindrücke konnten nicht bestätigt werden. Allerdings hatte<br />
der Senf kaum noch Senfschärfe. Das Mindesthaltbarkeitsdatum war bereits über drei Monaten überschritten.<br />
- Speisesalz<br />
261
Im Handel anzutreffen sind neben normalem Speisesalz immer häufiger jodiertes Speisesalz sowie jodiertes<br />
Speisesalz mit Zusatz von Fluorid. Der Jodgehalt von jodiertem Salz liegt zwischen 15 mg/kg und 25 mg/kg.<br />
Verwendet werden Natriumjodat oder Kaliumjodat. Für den Zusatz von Fluorid ist eine Ausnahmegenehmigung<br />
durch das BVL erforderlich. Der Fluoridgehalt sollte im Mittel bei 250 mg/kg liegen und nicht mehr als 15 % nach<br />
oben oder unten abweichen. Verwendet werden Zusätze von Natrium- bzw. Kaliumfluorid, deren Gehalte jeweils<br />
im Zutatenverzeichnis angegeben sind. Da derartige Erzeugnisse leicht verklumpen, werden häufig Mittel zur<br />
Erhaltung der Rieselfähigkeit zugesetzt, wie z.B. Blutlaugensalz (E 535, E 536 und E 538). Die zulässige<br />
Höchstmenge beträgt 20 mg/kg.<br />
Untersucht wurden in diesem Berichtsjahr 25 Speisesalze, davon 18 Jodsalze mit Fluoridzusatz und drei<br />
Jodsalze. Die ermittelten Gehalte an Jodid und Fluorid entsprachen den gesetzlichen Vorgaben. Beanstandungen<br />
resultierten nicht. Die in zwölf Proben ermittelten Gehalte an Blutlaugensalz lagen alle unter der zulässigen<br />
Höchstmenge. Eine Aufführung des Blutlaugensalzes als Zutat im Zutatenverzeichnis war in allen Fällen erfolgt.<br />
Ein Jodsalz wies Kennzeichnungsmängel im Bereich der Nährwerttabelle auf. Ein „ayurvedisches Zaubersalz“<br />
aus Pakistan wurde mit nähwertbezogenen Aussagen ausgelobt, die deklarierte Nährwerttabelle war jedoch völlig<br />
unvollständig.<br />
Dr. Hausch, M; Weiß, H. (LI BS)<br />
4.16.29 Essenzen, Aromastoffe<br />
Lebensmittel enthalten von Natur aus eine Vielzahl von Aromastoffen mit unterschiedlichsten chemischen<br />
Strukturen in verschiedensten Konzentrationen. Darüber hinaus werden viele Lebensmittel aus handwerklicher<br />
und industrieller Produktion mit Aromakonzentraten versetzt, um den Produkten einen gleichbleibend<br />
ansprechenden Geruch und Geschmack zu verleihen. Schwankungen der sensorischen Eigenschaften der<br />
verwendeten Rohwaren und im Zuge der industriellen Fertigung erlittene Aromaverluste können so ausgeglichen<br />
werden.<br />
Zur Aromatisierung von Lebensmitteln stehen sowohl natürliche als auch synthetische Stoffe zur Verfügung.<br />
Die Anforderungen an Lebensmittelaromen sind in der Aromenverordnung definiert. Dort wird u. a. zwischen<br />
natürlichen, naturidentischen und künstlichen Aromastoffen sowie Aromaextrakten unterschieden. Natürliche<br />
Aromastoffe und Aromenextrakte werden mit physikalischen Methoden (z. B. Destillation) oder durch<br />
enzymatische oder mikrobiologische Verfahren (z. B. Fermentation) aus pflanzlichen und tierischen Rohstoffen<br />
gewonnen.<br />
Naturidentische Aromastoffe sind den natürlichen chemisch gleich, werden aber durch chemische Synthese<br />
gewonnen. Künstliche Aromastoffe werden ebenfalls chemisch synthetisiert, haben in der Natur jedoch keine<br />
Entsprechung.<br />
Die Möglichkeiten der Gewinnung von natürlichen Aromastoffen und Aromaextrakten sind oft saisonalen<br />
Bedingungen unterworfen und hängen stark von der Qualität und Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe auf dem<br />
Weltmarkt ab. Naturidentische Aromastoffe können dagegen jederzeit aus Industriechemikalien produziert<br />
werden und sind in der Regel deutlich preisgünstiger.<br />
Aufgrund ihrer chemischen Gleichheit ist eine analytische Unterscheidung zwischen natürlichen und<br />
naturidentischen Aromastoffen bisher nur bei bestimmten Stoffgruppen möglich.<br />
Eines der Verfahren, die zum Nachweis einer Verfälschung natürlicher Aromen herangezogen werden können,<br />
ist die Enantiomerentrennung: Aromastoffe, die ein optisch aktives Kohlenstoffatom enthalten, existieren in zwei<br />
stereoisomeren Formen, die sich wie Bild und Spiegelbild zueinander verhalten. Diese werden als Enantiomere<br />
bezeichnet, wobei das R-Enantiomer linear polarisiertes Licht nach rechts, das S-Enantiomer dagegen nach links<br />
dreht. Aufgrund ihres unterschiedlichen physikalischen Verhaltens können die Enantiomeren eines Aromastoffs<br />
an speziellen chromatographischen Phasen getrennt werden.<br />
Bei natürlichen Aromastoffen überwiegt in der Regel eines der beiden Stereoisomeren. Naturidentische<br />
Aromastoffe sind dagegen üblicherweise racemisch, d. h. R- und S-Enantiomere liegen zu gleichen Anteilen vor.<br />
Im LAVES wird zur Enantiomerentrennung von chiralen Aromastoffen die zweidimensionale<br />
Gaschromatographie in Kombination mit der Massenspektrometrie eingesetzt. So können beispielsweise γ- und δ-<br />
Lactone sowie α-Ionon, die für Fruchtaromen wie Pfirsich, Erdbeere oder Himbeere typisch sind, auf ihre<br />
natürliche Herkunft überprüft werden.<br />
Weitere Aromauntersuchungen befassen sich z. B. mit der quantitativen Bestimmung von Aromastoffen, für die<br />
in bestimmten Lebensmitteln Höchstmengen festgelegt sind, oder mit der Identifizierung von Fehlaromen.<br />
Untersuchungen von Aromen und Aromaextrakten<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 10<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 2<br />
262
Zur Untersuchung gelangten fünf für den Endverbraucher und drei für die gewerbliche Lebensmittelherstellung<br />
bestimmte Aromen. Zwei Aromaextrakte - ein Rosenwasser libanesischer Herkunft sowie ein Thymianwasser aus<br />
der Türkei - waren nach Aromenverordnung unvollständig gekennzeichnet. Darüber hinaus wurde das<br />
Thymianwasser wegen seiner zur Täuschung geeigneten Aufmachung als „Heilwasser“ beanstandet.<br />
Aromauntersuchungen in Lebensmitteln<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 85<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 6<br />
- Konfitüren und Fruchtaufstriche<br />
Konfitüren dürfen nicht aromatisiert werden. Fruchtaufstrichen dürfen Aromen zugesetzt werden, dies muss<br />
allerdings im Zutatenverzeichnis angegeben sein. Ob diese Bestimmungen eingehalten wurden, kann indirekt<br />
über den Nachweis von Trägerstoffen für Aromen überprüft werden.<br />
Zehn Erdbeer- und eine Kirschkonfitüre sowie acht Erdbeer- und ein Himbeerfruchtaufstrich wurden auf die<br />
Anwesenheit der Trägerstoffe Glycerintriacetat und Triethylcitrat sowie der geschmackbeeinflussenden Stoffe<br />
Maltol und Ethylmaltol untersucht. In drei Erdbeerkonfitüren desselben Herstellers fand sich Maltol, in einer Diät-<br />
Erdbeerkonfitüre Glycerintriacetat. Es wurde empfohlen, am Ort der Herstellung zu überprüfen, ob während der<br />
Produktion eine Kontamination mit aromatisierten Erzeugnissen hatte stattfinden können.<br />
Bei einem Fruchtaufstrich war die Zutat „natürliche Vanille“ ausgelobt. Das Erzeugnis enthielt jedoch kein<br />
natürliches (Methyl-)Vanillin sondern synthetisches Ethylvanillin (siehe auch Kapitel. 4.16.13).<br />
- Mirabellen-, Kirsch- und Pflaumenkonserven<br />
In insgesamt 53 Mirabellen-, Kirsch- und Pflaumenkonserven wurde der Gehalt an Benzaldehyd bestimmt. Eine<br />
Pflaumenkonserve war bei der Genusstauglichkeitsprüfung durch eine intensive Bittermandelnote aufgefallen. Mit<br />
31 mg/l lag der Gehalt an Benzaldehyd in der Aufgussflüssigkeit um ein Vielfaches über den üblichen Werten, so<br />
dass von einem Zusatz auszugehen war. Die fehlende Deklaration der Aromatisierung wurde beanstandet.<br />
- Pfirsich-Balsamessig<br />
In der Zutatenliste eines als „Pfirsich-Balsamessig“ bezeichneten Erzeugnisses war u. a. die Zutat natürliches<br />
Pfirsicharoma aufgeführt. Die Aromastoffe gamma-Dekalacton und gamma-Dodekalacton lagen jedoch jeweils zu<br />
gleichen Anteilen in der (R)- und (S)-Form vor, was als Nachweis dafür gewertet wurde, dass sie synthetischen<br />
Ursprungs waren. Die Auslobung des Aromas als „natürlich“ wurde nach LFGB in Verbindung mit der<br />
Aromenverordnung als irreführend beanstandet.<br />
Dr. Hausch, M.; Dr. Keck, S. (LI-BS)<br />
4.16.30 Zusatzstoffe und Hilfsmittel aus Zusatzstoffen<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 11<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 3<br />
Bei den untersuchten Proben handelte es sich um sechs Lecithine, vier Farbstoffe zum Färben von<br />
Lebensmitteln, eine Zitronensäure und einen Konservierungsstoff.<br />
Zwei Proben sind wegen unzureichender bzw. fehlender Kennzeichnung (LMKV, ZVerkV) bzw. irreführender<br />
Angaben beanstandet worden. Eine Probe Lecithin ist wegen des Nachweis gentechnisch veränderten Materials<br />
beanstandet worden.<br />
Dr. Täubert, T. (LI BS)<br />
4.16.31 Mineral- und Tafelwasser, Trinkwasser<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 5.442<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 944<br />
Eine Übersicht über die Anzahl der am IfB LG und am LI BS durchgeführten Untersuchungen sowie über den<br />
Anteil der Beanstandungen kann der Tabelle 4.16.31.1 entnommen werden.<br />
Tabelle 4.16.31.1: 2006 in <strong>Niedersachsen</strong> untersuchte Wässer<br />
Probenart Gesamtzahl beanstandet beanstandet<br />
[N] [N] [%]<br />
263
Brauch- und<br />
Badewasser<br />
Trink- und<br />
Rohwasser<br />
Eis aus<br />
Trinkwasser<br />
848 210 24,8<br />
4267 665 15,6<br />
39 19 48,7<br />
Mineralwasser 236 41 17,4<br />
Quellwasser 16 4 25,0<br />
Tafelwasser 36 5 13,9<br />
Summe 5442 944 17,3<br />
Mineral-, Quell- und Tafelwasser<br />
Von 288 untersuchten Mineral-, Quell- und Tafelwässern entsprachen 50 (17,4 %) nicht den rechtlichen<br />
Vorgaben. Die häufigsten Gründe dafür waren folgende:<br />
- unleserliche oder fehlende Kennzeichnungselemente<br />
- irreführende Angaben zum Ort der Quellnutzung;<br />
- keine Übereinstimmung der Mineralisierung mit den Angaben im Analysenauszug auf dem Etikett<br />
- unzutreffende Auslobungen und Hinweise<br />
- vorgeschriebene Warnhinweise fehlen<br />
- Kennzeichnung nicht in deutscher Sprache<br />
- Grenzwertüberschreitungen bei den Parametern Nitrat, Nitrit, Barium, Bor, Arsen oder Bromat<br />
- abweichender Geruch oder Geschmack bzw. Verunreinigungen (bei Beschwerdeproben)<br />
In drei Proben Mineralwasser wurde die Substanz Bromat nachgewiesen, die bei einer Behandlung mit<br />
ozonangereicherter Luft aus im Wasser natürlicherweise vorhandenem Bromid entstehen kann. Die für<br />
natürliches Mineralwasser und Quellwasser festgelegte Höchstmenge von 3 µg/l Bromat wurde hierbei<br />
überschritten. Die Anwendung des Ozonisierungsverfahrens hätte darüber hinaus in der Etikettierung der<br />
genannten Wässer kenntlich gemacht werden müssen.<br />
Arsen und Uran<br />
Das Schwermetall Arsen ist ein potentiell toxisches Spurenelement. Es kann in Mineralwässer durch<br />
Auswaschung natürlicher Lagerstätten gelangen, insbesondere wenn diese in Regionen aus vulkanischem<br />
Untergrundgestein liegen. Mineralwässer, deren Gehalt an bestimmten Bestandteilen (wie Arsen) die<br />
Höchstgrenzen überschreiten, sind zum Schutz der öffentlichen Gesundheit einer Behandlung zum Abtrennen<br />
dieser Stoffe zu unterziehen. Für Arsen ist ab 1. Januar 2006 der zulässige Höchstgehalt von 50 µg/L auf 10 µg/L<br />
abgesenkt worden.<br />
In 134 von 218 auf Arsen untersuchten Mineralwässern konnte das Element nicht nachgewiesen werden<br />
(Nachweisgrenze < 0,5 µg/L). Der Gehalt an Arsen in 80 (36,7 %) Mineralwässern lag unterhalb der festgelegten<br />
Höchstmenge. In vier Proben Mineralwasser eines in <strong>Niedersachsen</strong> ansässigen Abfüllers wurde der Höchstwert<br />
überschritten. Dies machte eine Optimierung des Wasserbehandlungsverfahrens im Betrieb erforderlich.<br />
Nachfolgeuntersuchungen der Mineralwässer des Herstellers belegten die erfolgreiche Umsetzung der<br />
betrieblichen Maßnahmen zur Abtrennung von Arsen: in keiner Probe konnten überhöhte Arsengehalte mehr<br />
festgestellt werden.<br />
Das Vorkommen von Uran in Mineral- und Quellwässern ist geogen bedingt. Uran kann als Schwermetall im<br />
Körper angereichert werden und langfristig insbesondere eine nierentoxische sowie als Radionuklid eine<br />
strahlenbiologische Wirkung entfalten.<br />
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vertritt zu Uran in zum Verzehr bestimmten Wässern die<br />
Auffassung, dass der seitens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser festgesetzte Leitwert in<br />
Höhe von 15 µg/l auch für die Bewertung von Uran in Mineralwasser geeignet sei. Aus Gründen des<br />
vorsorglichen gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist für die gegenüber Uran besonders empfindlichen<br />
Säuglinge in Mineral-, Quell- und Tafelwässern, die als „geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung“<br />
ausgelobt werden, ab 1. Dezember 2006 ein Höchstwert an Uran von 2 µg/l festgelegt worden.<br />
264
Im Rahmen einer 2006 erneut durchgeführten Schwerpunktuntersuchung von Mineral-, Quell- und<br />
Tafelwässern auf den Gehalt an Uran konnte in 190 (76,3 %) von 249 untersuchten Wässern kein Uran<br />
nachgewiesen werden (Nachweisgrenze < 0,5 µg/L). 32 Proben (12,9 %) wiesen Urangehalte zwischen 0,5 und 2<br />
µg/L auf; bei 27 Wässern (10,8 %) wurden mehr als 2 µg/l Uran gefunden. In keiner Probe wurde der WHO-<br />
Leitwert überschritten. Grafik 4.16.31.1 zeigt die Befunde in der Übersicht.<br />
Anteil an der Gesamprobenzahl<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
Abbildung 4.16.31.1: Uran in Mineralwasser<br />
40 der im Verlauf des Jahres auf Uran untersuchten Mineral-, Quell- und Tafelwässer trugen einen speziellen<br />
Hinweis auf die Eignung zur Zubereitung von Säuglingsnahrung. In keiner dieser Proben wurde der ab Dezember<br />
für Uran geltende Höchstwert der Mineral- und Tafelwasserverordnung erreicht.<br />
Trinkwasser<br />
0%<br />
nicht<br />
nachweis bar<br />
0,5 - 2 µ/l > 2 - 15 µg/l > 15 µg/l<br />
Am IfB LG und am LI BS wurden auch im Jahr 2006 wieder eine große Anzahl von Trink- und Rohwässern<br />
untersucht. Die Beanstandungsrate ist mit 17,3 % gegenüber 18,5 % im Vorjahr leicht gesunken.<br />
Rund 2 % der Beanstandungen wurden wegen des Nachweises coliformer Keime ausgesprochen, überhöhte<br />
Keimzahlen trugen zu etwa 5 % der Beanstandungen bei. Weitere 6 % der Bemängelungen gingen –<br />
insbesondere bei Wässern aus Eigenversorgungsanlagen – auf zu hohe Eisen- oder Mangangehalte bzw. zu<br />
hohe Trübungswerte zurück. Durch den Einbau entsprechender Aufbereitungsanlagen bzw. durch Sanierung<br />
bereits vorhandener Systeme können solche Wässer in aller Regel so aufbereitet werden, dass sie weiterhin als<br />
Trinkwasser verwendet werden können.<br />
Bei etwa der Hälfte der aus Trinkwasser hergestellten Eisproben aus Restaurants, Gaststätten, Cafés,<br />
Eisdielen etc. waren die mikrobiologischen Vorgaben der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten.<br />
Dr. Schmidt, E.; Dr. Hausch, M. (LI BS ); Dr. Rohrdanz, A. (IFB LG)<br />
265
4.17 Schwerpunktuntersuchung bei Lebensmitteln<br />
4.17.1 Mikrobiologischer Status von Lebensmitteln<br />
Einführung<br />
In diesem Kapitel werden sowohl Ergebnisse zur mikrobiologischen Belastung von Lebensmitteln in<br />
<strong>Niedersachsen</strong> vorgestellt, als auch über Trends im Zusammenhang mit der mikrobiologischen Kontamination<br />
bestimmter Lebensmittel berichtet. Produktbezogene mikrobiologische Untersuchungsergebnisse befinden sich in<br />
den einzelnen Produktkapiteln. Die zugrunde liegenden Probenzahlen setzen sich aus den Untersuchungen von<br />
Planproben (Proben ohne besondere Veranlassung) und aus Untersuchungen aus besonderen Anlässen<br />
(Beschwerden, Verdacht und Verfolgung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht) zusammen (Werte in<br />
Klammern sind Planproben, Werte ohne Klammer sind Plan- und Anlassproben).<br />
Im Zusammenhang mit Lebensmitteln unterscheidet man zwischen natürlichem Keimgehalt,<br />
Verderbniserregern, technologisch erwünschten Keimen, Hygieneindikatoren und pathogenen Keimen.<br />
Werden in Lebensmitteln bestimmte Mikroorganismen nachgewiesen, ist es für die Beurteilung wichtig, in<br />
welche Gruppe die gefundenen Keimarten einzuordnen sind.<br />
Belastung mit pathogenen Mikroorganismen und ihren Toxinen<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden an 9.505 (7.707) Lebensmittelproben mikrobiologische Untersuchungen<br />
durchgeführt (virologische Untersuchungen s.u.). Davon wurden 1.747 (1.271) aufgrund von mikrobiologischen<br />
Untersuchungsergebnissen als gesundheitsschädlich oder zum Verzehr nicht geeignet beanstandet und bei<br />
1.186 (1.073) ein hygienischer Mangel festgestellt, der auf unzureichende Bedingungen bei der Herstellung oder<br />
Lagerung hinweist. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Beanstandungsquote um ca. ein Drittel an, was vermutlich<br />
auf die Auswirkungen der im Winter 2005/2006 aufgefallenen „Gammelfleischskandale“ zurückzuführen ist.<br />
Die Nachweisraten von Campylobacter (von 36,0 % auf 21,6 %) und Verotoxinbildenden E.coli (von 6,7 % auf<br />
3,8 %) liegen zwar niedriger als im Vorjahr, aber da die Untersuchung in Programmen erfolgt und diese in jedem<br />
Jahr anders zusammengestellt werden, gibt diese Veränderung keinen Hinweis auf eine Besonderheit in diesem<br />
Bereich.<br />
Bei den anderen Keimarten liegt die Nachweisrate in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen auf pathogene Mikroorganismen ergeben sich aus der nachfolgenden<br />
Tabelle.<br />
Tabelle 4.17.1.3 Untersuchungen auf pathogene Mikroorganismen<br />
Keimart/Toxin Anzahl untersucht Anzahl nachgewiesen Anzahl beanstandet<br />
Gesamt Planproben Gesamt Planproben Gesamt Planproben<br />
Bacillus cereus 1.223 906 66 62 5 4<br />
Campylobacter spp. 283 254 61 59 0<br />
Campylobacter jejuni/coli 47 Cb. jejuni 45<br />
0<br />
19 Cb. coli 19<br />
Clostridium perfringens 905 651 11 8 2 1<br />
Clostridium botulinum 0<br />
E.coli 2402 2069 127 113 38 31<br />
Verotoxinbildende E.coli 210 206 8 Verotoxin 8 Verotoxin 1 1<br />
3 VTEC 3 VTEC<br />
Listeria monocytogenes 1805 1684 112 110 0<br />
Pseudomonas aeruginosa 28 18 4 3 0<br />
Salmonella spp. 5322 4805 83 66 30 24<br />
Staphylococcus aureus 3321 2885 189 159 58 43<br />
Vibrio spp. 192 182 75 75 0<br />
Yersinia enterocolitica 135 46 0<br />
Staphylokokkenenterotoxin 75 8 5 0 5 0<br />
Bacilluscereusenterotoxin 10 1 0<br />
Botulinumtoxin 0<br />
266
Erläuterungen:<br />
Anzahl untersucht: Anzahl der Lebensmittel, die auf die jeweilige Keimart untersucht wurden<br />
Anzahl nachgewiesen: Anzahl der Lebensmittel in der die entsprechende Keimart nachgewiesen wurde<br />
Anzahl beanstandet: Anzahl der Lebensmittel, die aufgrund des Nachweises der entsprechenden Keimart<br />
beanstandet wurden<br />
Planproben sind Proben nach dem Vorausschätzungsprogramm<br />
- Campylobacter<br />
Campylobacter steht als bakterieller Enteritiserreger bei Lebensmittelinfektionen in Deutschland nach den<br />
Salmonellen an erster Stelle. Die Erreger kommen insbesondere im Darm von Geflügel vor und können während<br />
des Schlachtprozesses auf Haut und Fleisch gelangen (lt. Literaturangaben liegt die Belastung dort bei 80 %) und<br />
von dort durch küchentechnische Fehler verzehrsfertige Lebensmittel kontaminieren. Campylobacter sind sehr<br />
empfindlich gegenüber Hitze und Austrocknung, daher kommen für die Infektion insbesondere rohe und/oder<br />
Lebensmittel mit ausreichendem Wassergehalt in Frage.<br />
Da schon eine Infektionsdosis von vier Campylobacter jejuni für eine Erkrankung ausreicht, wurden<br />
verschiedene Lebensmittel (Geflügelfleisch, Mett, Zwiebelmettwurst, Vorzugsmilch und Rohmilch) über ein<br />
Anreicherungsverfahren auf Campylobacter untersucht.<br />
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 283 (254) Lebensmittel auf Campylobacter untersucht. 61-mal (59)wurden<br />
Campylobacter nachgewiesen, davon 47-mal (45)Campylobacter jejuni und 19-mal(19) Campylobacter coli. Alle<br />
positiven Ergebnisse entstammten einem Untersuchungsprogramm an 184 Proben von rohem Geflügelfleisch<br />
und –innereien (Nachweisrate 33,2 %).<br />
- Listerien<br />
Listerien sind relativ widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und deshalb in der Natur weit verbreitet. Die<br />
pathogene Art Listeria monocytogenes kann die kurzfristige Erhitzung der Milch auf 80 °C überleben und ist daher<br />
in pasteurisierter Mich und daraus hergestellten Produkten nachweisbar. Eine Vermehrung ist sogar noch bei<br />
Kühlschranktemperaturen möglich. Listerien können vor allem über den Verzehr von kontaminierten rohen<br />
Lebensmitteln tierischer Herkunft wie Milch, Rohmilchprodukte, Fleisch oder Fisch aufgenommen werden, aber<br />
auch durch Verzehr erhitzter nachträglich kontaminierter Produkte wie Käse aus pasteurisierter Milch. Nicht<br />
selten werden Listerien auch auf pflanzlichen Lebensmitteln wie vorgeschnittenen Salaten gefunden.<br />
Im Berichtsjahr wurden an 1.805 (1.684) Lebensmitteln Untersuchungen auf Listerien durchgeführt. Dabei<br />
wurden in 112 (110) Fällen L. monocytogenes nachgewiesen. Die positiven Befunde wurden an Fisch und -<br />
erzeugnissen, Brühwurst und Schinken/Braten, Milcherzeugnissen/Käse und Rohwürsten erhoben.<br />
Bei den positiven Proben wurden überwiegend Keimmengen von unter zehn Keimen pro Gramm<br />
nachgewiesen. Nur eine Probe Räucherlachs wies einen Keimgehalt von 300 KBE/g auf. Von einer möglichen<br />
Gesundheitsgefährdung wird ab einem Keimgehalt von über 100 Keimen pro Gramm ausgegangen.<br />
- Salmonellen<br />
Infektionen durch Salmonellen sind in Deutschland die zweithäufigste erfasste bakterielle Ursache von<br />
Durchfallerkrankungen. Hauptreservoir sind landwirtschaftliche Nutztiere. Damit sind vom Tier stammende<br />
Lebensmittel am häufigsten mit Salmonellen kontaminiert. Aber auch auf pflanzlichen Lebensmitteln wie<br />
Gewürzen, Kräutertees, Schokolade oder getrockneten Pilzen konnten in den letzten Jahren Salmonellen<br />
nachgewiesen werden. Die Kontamination erfolgte aufgrund ihrer Herstellungsweise durch Vogelkot (Trocknung<br />
unter freiem Himmel). Werden Lebensmitteln bei der Zubereitung keinem Verfahren mehr unterzogen, bei dem<br />
Salmonellen mit Sicherheit abgetötet werden, können nach Verzehr Infektionen auftreten.<br />
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 5.322 (4.805) Lebensmittel auf Salmonellen untersucht. Die Verteilung auf<br />
einzelne Lebensmittelgruppen sind der Tabelle 4.17.1.2 zu entnehmen.<br />
Tabelle 4.17.1.2 Salmonellen in einzelnen Produktgruppen<br />
Produktgruppe Anzahl<br />
untersucht<br />
267<br />
Anzahl<br />
nachgewiesen<br />
Angabe<br />
in %<br />
Bemerkung<br />
Milch, Milcherzeugnisse, Käse, Butter 622 0<br />
Eier, Eiprodukte 115 0<br />
Fleisch, roh, ungewürzt 582 53 9,1 Hackfleisch 12,1 %<br />
Geflügel 13,3 %<br />
Wild 9,3 %<br />
Fleischerzeugnisse 511 14 2,7 Geflügelerz. 3,2 %<br />
Thüringer Mett 2,2 %<br />
Wurstwaren 605 7 1,2 Rohwurst 1,2 %
Fisch, Muscheln u.erzeugnisse 624 6 Muscheln 5,8 %<br />
Feine Backwaren, Brot 276 0<br />
Feinkostsalate, Dressings 96 0<br />
Süßspeisen, süße Aufstriche 31 0<br />
Tofu, Kokos, Nüsse 32 0<br />
Gemüse, Gemüsesalate 14 0<br />
Pilze 20 1 5<br />
Speiseeis 1.220 0<br />
Kinder-, Diätnahrung 15 0<br />
Fertiggerichte 292 2 Forelle mit Brot und<br />
Vanilleflammeri aus einem<br />
Menue<br />
Gewürzsoßen, Gewürze 55 0<br />
Schokolade, Kakao, Tee, Kaffee 90 0<br />
Sonstige Lebensmittel 122 0<br />
Zusammen 5.322 83<br />
Wie in den Vorjahren wurden die meisten Salmonellen aus dem Bereich Fleisch und –erzeugnisse,<br />
Wurstwaren isoliert. Von 74 positiven Lebensmitteln aus dieser Gruppe entfielen 30 Isolate auf Geflügelfleisch<br />
und -erzeugnisse, 39 auf Schweinefleisch bzw. Produkte bei denen u.a. Schweinefleisch verarbeitet wurde, 4-mal<br />
auf Wildfleisch und 1-mal auf Kaninchen. Da aus Rindfleisch in diesem Jahr keine Salmonellen nachgewiesen<br />
werden konnten, wird davon ausgegangen, dass der Eintrag in die gemischten Produkte durch das<br />
Schweinefleisch zustande kam. Im Gegensatz zu der langjährigen hohen Kontaminationsrate bei Geflügelfleisch<br />
handelt es sich bei den Schweineerzeugnissen auch um verzehrsfertige Lebensmittel wie frische Mettwurst oder<br />
Thüringer Mett, die keinem Keim abtötenden Verfahren mehr unterzogen werden.<br />
Die restlichen positiven Befunde fielen auf sechs Proben Muscheln, eine Probe getrocknete Pilze und zwei<br />
Fertiggerichte.<br />
78 Salmonellen-Isolate (für die Isolate aus Muscheln stehen keine Serovarbestimmungen zur Verfügung)<br />
wurden in einem anerkannten Referenzlabor differenziert. Die Ergebnisse der Serovare sind in der Tabelle<br />
4.17.1.3 zusammengefasst. Wie schon in den Vorjahren wurde am häufigsten S. typhimurium nachgewiesen, an<br />
zweiter Stelle stand in diesem Jahr allerdings S. Gr. B 4,5; i mono und der übliche Zweitplatzierte S. enteritidis<br />
rangierte diesmal auf Platz <strong>3.</strong> Insgesamt sind keine Tendenzen zu erkennen. Die in den vergangenen Jahren<br />
intensiv diskutierten Serovare S. goldcoast und S. bovismorbificans wurden in 2006 überhaupt nicht<br />
nachgewiesen..<br />
Tabelle 4.17.1.3 Salmonellenserovare<br />
Serovare Anzahl Angenommene Quelle Bemerkungen /Vergleich<br />
Vorjahr<br />
S. typhimurium 27 22 Schwein, 3 Geflügel,<br />
2 Wild<br />
Vorjahr 34<br />
S.Gr.B 4,5i- mon 6 5 Schwein, 1 Geflügel Vorjahr 7<br />
S. enteritidis 5 2 Geflügel, 1<br />
Kaninchen, 2 Menue<br />
Vorjahr 8<br />
S. hadar 5 4 Geflügel, 1 Schwein Vorjahr 2<br />
S. saintpaul 4 2 Geflügel, 2 Schwein Vorjahr 3<br />
S. Gr. B 4.12 D Subsp.I 4 4 Geflügel Vorjahr 4<br />
S. infantis 3 2 Geflügel, 1 Schwein Vorjahr 6<br />
S. ohio 3 3 Geflügel Vorjahr 3<br />
S. I Rauhform 3 3 Schwein Vorjahr 3<br />
S. derby 3 3 Schwein Vorjahr 6<br />
S. paratyphi B 3 3 Geflügel Vorjahr 2<br />
S. indiana 2 2 Geflügel Vorjahr 5<br />
S. virchow 2 2 Geflügel Vorjahr -<br />
S. anatum 1 Geflügel Vorjahr 2<br />
S. newport 1 Geflügel Vorjahr 2<br />
S. Gr.B mono 1,4,12; B 1 Hirsch Vorjahr -<br />
S. 4,12; I Subsp. I 1 Schwein Vorjahr -<br />
S. stanley 1 Pilze Vorjahr 1<br />
S. Gr. C1 6,7,-1,5 mono 1 Wildschwein Vorjahr 1<br />
268
S. meleagridis 1 Schwein Vorjahr -<br />
S. kiambu 1 Geflügel Vorjahr -<br />
Gesamt 78<br />
Die nachgewiesenen Keimzahlen lagen 9 mal unter der Nachweisgrenze (< 0,03 Salmonella / g), 12-mal < 1<br />
Salmonella / g, 4-mal bei 1 – 10 Salmonellen / g und nur 1 x > 10 KBE / g. Im letzten Fall handelte es sich um ein<br />
Vanilleflammeri mit 10 5 KBE / g, welches Auslöser einer Gruppenerkrankung war. Insgesamt liegen die<br />
Salmonellengehalte in verzehrsfertigen Lebensmitteln (bei anderen Lebensmitteln wurden keine Keimzahlen<br />
ermittelt) in einem sehr niedrigen Bereich.<br />
- Verotoxinbildende E.coli<br />
In den letzten Jahren sind eine Gruppe pathogener E.coli als Ursache schwerer Magen-Darm-Infektionen mit<br />
lebensbedrohlichen Komplikationen vermehrt nachgewiesen worden. Neben der Fähigkeit Verotoxin zu bilden,<br />
zeichnet diese Bakterien ihr Anheftungsvermögen an die Darmwand aus. Infektionsquellen sind vor allem rohes<br />
(nicht vollständig durchgegartes) Fleisch und rohe Milch.<br />
Im Berichtsjahr 2006 wurden insgesamt 210 (206) Lebensmittel auf die Anwesenheit des Verotoxins geprüft. In<br />
8 (8) Fällen wurde Verotoxin nachgewiesen. Der kulturelle Nachweis von verotoxinbildenden E.coli gelang 3mal(3).<br />
Dabei handelte es sich um Rinderhackfleisch, Rentierfleisch und Rinderhüftsteak.<br />
- Viren in Lebensmitteln<br />
Lebensmittelbedingte Infektionen durch Viren wurden in den letzten Jahren von den Untersuchungseinrichtungen<br />
in das Untersuchungsspektrum aufgenommen. Bisher liegen noch wenige Daten vor, da diese aufwändige<br />
Untersuchung nur in Verdachtsfällen eingeleitet wird und in diesen Fällen der Schwerpunkt auf Tupferproben der<br />
Umgebung und von Bedarfsgegenständen liegt.<br />
Routinemäßig werden virologische Untersuchungen an Muscheln durchgeführt. Im Berichtsjahr wurde 151-mal<br />
(143)auf Noroviren und 80-mal(76)auf Hepatitis-A-Viren untersucht. Alle Untersuchungen verliefen negativ.<br />
Lebensmittelbedingte Erkrankungen und Besonderheiten<br />
Im Berichtsjahr gibt es über zwei aus mikrobiologischer Sicht auffällige Fälle zu berichten.<br />
- „Gastroenteritis-Ausbruch“ in Jugendherberge<br />
Im September 2006 kam es in einer Jugendherberge in Bispingen zu einem akuten Gastroenteritis-Ausbruch als<br />
Kollektiverkrankung. 24 Schüler mehrerer Schulklassen sowie drei Lehrer erkrankten mit den Symptomen<br />
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall und mussten teilweise stationär im Krankenhaus behandelt werden.<br />
Eine mikrobiologische Ursache durch pathogene Keime oder Toxine konnte in den zahlreichen zur<br />
Untersuchung vorgelegten Lebensmitteln – die auch ansonsten hygienisch einwandfrei waren - ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Akute Gastroenteritiden mit den Symptomen „Erbrechen und Durchfall“ werden vermehrt durch nichtbakterielle<br />
Infektionserreger wie z. B. den Noroviren („Norwalk-like Viren“) verursacht. Man geht derzeit davon<br />
aus, dass mehr als die Hälfte aller Gastroenteritiden in Gemeinschafts-einrichtungen auf Norovirus-Infektionen<br />
zurückzuführen sind.<br />
Die Virusübertragung erfolgt überwiegend direkt von „Mensch zu Mensch“ „fäkal-oral“ (Schmierinfektionen mit<br />
Stuhlgang und anschließende perorale Aufnahme von Virus über den Mund). Die für Noroviren typische rasche<br />
Infektionsausbreitung innerhalb von Gemeinschaften lässt jedoch darauf schließen, dass neben der fäkal-oralen<br />
Übertragung auch andere Übertragungswege möglich sind, wie z. B. die aerogene Übertragung durch Bildung<br />
virushaltiger Aerosole während des Erbrechens. Lebensmittel als Überträger für Noroviren sind hierbei<br />
hauptsächlich als kontaminierte Vektoren einzustufen, ebenso wie kontaminierte Gegenstände.<br />
Bei einem Teil der untersuchten Stuhlproben der Erkrankten durch den Fachbereich Gesundheit des Landkreis<br />
Soltau-Fallingbostel (Fachgruppe Hygiene und Umweltmedizin) fiel der Norovirus-Nachweis positiv aus, so dass<br />
auch hier von einem ursächlichen Zusammenhang zwischen den akuten Erkrankungsfällen durch Noroviren<br />
ausgegangen werden kann.<br />
- Cl. perfringens in „Franz. Huhnpfanne“<br />
Eine Rückstellprobe „Französische Huhnpfanne“ wurde als Beschwerdeprobe mit Verdacht auf<br />
Gesundheitsschädigung in das Lebensmittelinstitut Braunschweig des LAVES eingesandt.<br />
Das Fertiggericht wurde in einer Einrichtung zur Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Dabei handelte es sich<br />
um eine Restmenge, die nach mehrmaligem Aufwärmen nur noch für eine achtköpfige Personengruppe reichte.<br />
Diese hat ausschließlich von dem Menü gegessen. Drei Stunden nach dem Verzehr sind die gesamten Personen<br />
an Durchfall erkrankt.<br />
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung wurden in der Rückstellprobe 1,3 x 105 KbE/g Clostridium<br />
269
(Cl.) perfringens Keime nachgewiesen.<br />
Cl. perfringens kommen weit verbreitet in der Umwelt vor. Es handelt sich um einen Sporenbildner. Dieser<br />
Keim kann verschiedene Toxine, die eine Lebensmittelvergiftung hervorrufen können, produzieren. Die<br />
Untersuchung des isolierten Stammes in einem Referenzlabor ergab, dass der Stamm die Fähigkeit zur<br />
Toxinbildung besaß. Die Gefahr einer Lebensmittelinfektion entsteht ab einer Aufnahme von mindestens 10 5 bis<br />
10 6 Keimen je Gramm Lebensmittel. Die Sporen von Cl. perfringens können das Kochen überstehen, während<br />
andere Mikroorganismen im Lebensmittel abgetötet werden. Bei zu langsamer Abkühlung oder ungenügender<br />
Kühlhaltung können die Sporen auskeimen und sich ungehemmt vermehren. Dieses Risiko ist besonders hoch<br />
bei großen Fleischstücken oder Suppen in großen Gefäßen, da hier die Abkühlung lange dauert und im Inneren<br />
des Lebensmittels noch eine ausreichende Vermehrungstemperatur vorliegt. Das gleiche gilt, wenn Lebensmittel<br />
über längere Zeit bei einer Temperatur von unter 65 °C heiß gehalten werden. Da das Wiederaufwärmen von<br />
Speisen das Wiederauskeimen der Sporen anregen kann, sollte sich der Verbrauch des Lebensmittels sofort<br />
ohne längeres Warmhalten anschließen.<br />
Auf welchem Wege die Cl. perfringens Keime in das Lebensmittel gelangten, konnte nicht abschließend geklärt<br />
werden. In einer Originalpackung des Fertiggerichtes, die ebenfalls in der Einrichtung zur<br />
Gemeinschaftsverpflegung entnommen wurde, wurden keine Cl. perfringens Keime nachgewiesen. Ob es durch<br />
das wiederholte Erwärmen des Menüs zu einer Vermehrung der Keime kam, kann nicht ausgeschlossen werden.<br />
Die Probe wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.<br />
270<br />
Dr. Mauermann, U..; Dr. Woitag, T. (LI OL)<br />
Dr. Thielke, S.. (LI BS)<br />
4.17.2. Untersuchung von Lebensmitteln auf Bestandteile aus gentechnischen Veränderungen<br />
Im Jahr 2006 wurden am Lebensmittelinstitut Braunschweig insgesamt 1.107 Proben molekularbiologisch<br />
untersucht. Dabei handelte es sich um 848 Lebensmittelproben, 146 Saatgutproben, sowie 78 Futtermittelproben.<br />
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Bundesland Bremen wurden 36 Proben untersucht (s.u.).<br />
Unter anderem wurden folgende Lebensmittelgruppen 2006 in das Untersuchungsprogramm mit einbezogen:<br />
Fertiggerichte mit Soja und/oder Mais, vegetarische Gerichte auf Sojabasis, Frühstückscerealien, Eiweißpulver<br />
auf Sojabasis, Sportlernahrung auf Sojabasis, Maismehl, Maisgrieß, Backwaren, Diabetikerkekse, sojahaltige<br />
Nahrungsergänzung, Papaya, Nussnougat-Cremes, Cornflakes, maishaltige Knabberartikel, Säuglings- und<br />
Kleinkindnahrung, Senf, Gewürzmischungen, Trockensuppen, Frischeiwaffeln, Teigwaren, Diätnudeln, Lecithin,<br />
Reis und Reisprodukte.<br />
In 878 Untersuchungen wurden Lebensmittelproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile hin untersucht<br />
bzw. auf molekularbiologischem Weg eine Artendifferenzierung durchgeführt. Es wurden Lebensmittel auf<br />
Bestandteile gentechnisch veränderter Linien der Pflanzengattungen Soja, Mais, Raps, Papaya untersucht Die<br />
Analytik wurde um die Untersuchung von gentechnisch verändertem Reis erweitert (Tabelle 4.17.2.1 und weiter<br />
unten im Text).<br />
Tabelle 4.17.2.1 GVO-Linien, auf die Lebensmittel im LAVES im Jahr 2006 standardmäßig untersucht<br />
worden sind.<br />
Pflanzengattung GVO-Linie<br />
Soja Roundup Ready<br />
Mais Bt176, T25, Mon 810, Bt11, StarLink, NK603, GA21,<br />
Mon 863, Herculex, Bt10<br />
Raps Falcon GS/40/90, Topas 19/2, Liberator pHoe6/Ac,<br />
GT73, MS8/RF3, MS1/RF1, MS1/RF2, Laurat, Trierucin<br />
Papaya 55-1, 63-1<br />
Reis LL62, LL601, Bt63-Reis<br />
Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Soja in Lebensmitteln, lag ein Schwerpunkt erneut in der<br />
Untersuchung auf Bestandteile der Roundup Ready-Sojabohnenlinie. In 27 der untersuchten 297 sojahaltigen<br />
Lebensmittel wurde die gentechnisch veränderte Sojabohnenlinie oberhalb des Schwellenwerts von 0,9 %<br />
nachgewiesen. Keine Probe wies eine entsprechende Kennzeichnung auf. Die Ergebnisse sind in Tabelle<br />
4.17.2.2 aufgeführt.<br />
Tabelle 4.17.2.2 Ergebnisse der molekularbiologischen Untersuchungen von Lebensmitteln im Jahr 2006<br />
Untersuchungen Anzahl der Positive Befunde Positive Befunde Nachgewiesene
auf Bestandteile<br />
von<br />
GVO-Linien<br />
Untersuchungen* > 0,9%<br />
(Anteil an der Anzahl<br />
der Untersuchungen)<br />
271<br />
< 0,9%<br />
(Anteil an der Anzahl<br />
der Untersuchungen)<br />
GVO-Linie(n) in<br />
positiven Befunden<br />
>0,9%<br />
Soja 297 3 (1 %) 97 (32,7 %)** Roundup Ready<br />
Mais 189 1 (0,5 %) 8 (4,2 %) MON 810, Bt176<br />
Raps 36 0 21 (58,3 %)*** GT 73, MS8/RF3<br />
Papaya 3 0 0 -<br />
Reis 218 8 (3,7 %) -<br />
Darüber hinaus wurden 135 Proben in der molekularbiologischen Artendifferenzierung untersucht.<br />
* Z. T. wurden Proben parallel auf mehrere GVO-Linien untersucht. Die Summe der Untersuchungen ist daher höher als die der<br />
untersuchten Proben.<br />
** Der Sachverhalt der Zufälligkeit bzw. der technischen Unvermeidbarkeit war bei 23 Proben zu prüfen.<br />
*** Darunter: Neun der untersuchten Senfproben (siehe Text).<br />
Auch dieses Jahr wurden 24 Senfproben auf Bestandteile von GVO-Rapslinien hin untersucht, die in neun Fällen<br />
ein positives Ergebnis zeigten. Aufgrund der sehr engen botanischen Verwandschaft zwischen der Senf- und der<br />
Rapspflanze ist jedoch zurzeit kein zuverlässiges Quantifizierungssystem verfügbar, daher konnte der GVO-<br />
Gehalt nicht bestimmt werden. Die zuständigen Überwachungsbehörden wurden über den positiven Befund<br />
benachrichtigt.<br />
Gentechnisch veränderter Reis<br />
Im Zusammenhang mit dem Import von in der EU nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Reislinien (siehe<br />
Kapitel 3), wurde am LI BS der Nachweis der Reislinien LLReis601, LLReis62, LLReis06 und Bt63-Reis etabliert.<br />
Insgesamt wurden für das Land <strong>Niedersachsen</strong> 218 Lebensmittel- und fünf Futtermittelproben auf das<br />
Vorhandensein der spezifischen Gensequenzen untersucht.<br />
Tabelle 4.17.2.3 Ergebnisse der Untersuchungen von Lebens- und Futtermitteln auf Bestandteile der<br />
Reislinien LLReis62, LLReis601 und Bt63-Reis im Jahr 2006<br />
Proben positiv untersucht positiv untersucht positiv untersucht<br />
auf LLReis62 auf LLReis601 auf Bt63-Reis<br />
Lebensmittel 218 0 6 2<br />
Futtermittel 5 0 2 0<br />
Es wurden in zehn der untersuchten Proben Bestandteile der Reislinien LLReis601 bzw. Bt63-Reis<br />
nachgewiesen. Aufgrund der fehlenden Zulassung in der EU besteht für diese Linien eine Nulltoleranz. Alle<br />
Partien aus denen die zehn betroffenen Proben stammten, wurden aus dem Handel entfernt.<br />
Betriebskontrollen<br />
Im Rahmen des bundesweiten Überwachungsplans (BÜP) hat das LI-Braunschweig in Zusammenarbeit mit den<br />
kommunalen Behörden sieben niedersächsische Betriebe überprüft. Es wurden dabei die jeweiligen<br />
betriebseigenen Konzepte zum Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln geprüft. In allen Fällen war<br />
eine Sensibilität für das Thema festzustellen. Ziel war in allen Betrieben den Einsatz gentechnisch veränderter<br />
Bestandteile in der Produktion zu vermeiden. Die Konzepte, mit denen dieses umgesetzt wurde, waren in allen<br />
Fällen schlüssig und entsprachen den gesetzlichen Vorgaben der EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/200<strong>3.</strong><br />
Bremer Proben<br />
Im Rahmen der für das Land Bremen durchgeführten molekularbiologischen Untersuchungen auf Bestandteile<br />
aus GVO in amtlichen Lebensmittel- und Saatgutproben im LAVES wurden 36 Proben analysiert (31<br />
Lebensmittelproben und 5 Saatgutproben). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.17.2.4 zusammengefasst.<br />
Tabelle 4.17.2.4 Übersicht der molekularbiologischen Untersuchungen in Lebensmittel- und<br />
Saatgutproben aus Bremen im Jahr 2006<br />
* untersucht auf untersucht auf untersucht auf untersucht auf andere<br />
Proben GVO- Sojalinie* GVO-Maislinien* GVO-<br />
Rapslinien*<br />
GVO-Bestandteile*
insges. pos. insges. pos. insges. pos.<br />
(GVO<br />
-Linie)<br />
Lebensmittelproben * 31 12 6 1 10 2<br />
(MON<br />
810)<br />
Saatgutproben 5 0 0 0 4 0<br />
272<br />
insges. pos. untersuchter<br />
Organismus<br />
(Probenzahl)<br />
pos<br />
4 0 Reis (13) 9<br />
Sonnenblume<br />
(1)<br />
*<br />
Mehrere Proben wurden auf Bestandteile verschiedener gentechnischer Veränderungen hin untersucht. Die Summe der<br />
Untersuchungen ist daher höher als die der untersuchten Proben.<br />
Dr. Gebhard, F.; Dr. Eichner, Ch; Dr. Schulze, M. (LI BS)<br />
4.17.3 Tierartnachweis und Fremdeiweißbestimmung in Lebensmitteln<br />
Das Lebensmittelinstitut Braunschweig (LI BS) ist schwerpunktmäßig für die Tierartdifferenzierung und für die<br />
Fremdeiweißbestimmung in Lebensmitteln im Land <strong>Niedersachsen</strong> zuständig. Bei den Untersuchungen kommen<br />
neben den proteinbasierten Verfahren seit einigen Jahren auch molekularbiologische Verfahren zum Einsatz. So<br />
wird zum Beispiel die Unterscheidung von Geflügelfleisch in Huhn und Pute, sowie verschiedener Wildarten vor<br />
allem in stark erhitzten Proben, molekularbiologisch getroffen.<br />
Insgesamt wurden im Jahr 2006 1.586 amtliche Lebensmittelproben untersucht. Eine Reihe von Proben wurde<br />
sowohl zur Tierartbestimmung als auch zur Analyse auf Fremdeiweiß eingesandt.<br />
Zur Untersuchung auf die Tierart gelangten 1.189 Proben, wobei es sich neben Fleisch, Fleischwaren,<br />
Wurstwaren (708 Proben) auch um Milch und Milchprodukte (481 Proben), und Fertigerzeugnisse (49 Proben wie<br />
z. B. Pizzabelag, belegte Brötchen, gefülltes Gemüse, Börek) handelte.<br />
Es wurden außerdem Lebensmittelproben auf verschiedene Fremdeiweiße untersucht, dazu auch auf Proteine<br />
die Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können. In den meisten Proben wurden mehrere Proteine bestimmt.<br />
Die Untersuchungen schlüsselten sich auf in 716 Proben auf Gluten, 668 Proben auf Casein, 619 Proben auf β-<br />
Lactoglobulin, 630 Proben auf Eiprotein, 619 Proben auf Sojaprotein, 94Proben auf Bluteiweiß davon 18 Proben<br />
mit Gewürzen und Hilfsmitteln zur Wurstherstellung, 4 Proben auf Nussproteine.<br />
Viele dieser Proteine spielen auch als Unverträglichkeiten auslösende Stoffe eine Rolle. Daher wird auch<br />
weiterhin an der Entwicklung neuer amtlicher Methoden mitgearbeitet.<br />
Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Untersuchung von Milch und Milchprodukten auf ihren<br />
tierartlichen Ursprung gezeigt, dass eine Reihe von Produkten nicht korrekt gekennzeichnet war (siehe Tabelle<br />
4.16.<strong>3.</strong>1). Hier fallen besonders Produkte aus oder mit Schafskäse auf. Dieser Befund wird als Irreführung des<br />
Verbrauchers gewertet. Die Unterscheidung der Tierart erfolgt elektrophoretisch im Vergleich zu Referenzmaterial<br />
(siehe Abbildung 4.16.<strong>3.</strong>1).<br />
Feta ist in der Europäischen Gemeinschaft eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Griechischer Feta darf<br />
daher nur aus Schafmilch mit Ziegenmilch verfeinert hergestellt werden. Für die nicht griechischen<br />
Fetaproduzenten gilt eine Übergangszeit bis November 2007. Bis dahin kann ein Feta auch aus Kuhmilch<br />
hergestellt sein.<br />
Die Tierart spielt auch für Allergiker eine Rolle, da Schaf- und Ziegenmilchprodukte von Kuhmilchallergikern<br />
häufig als Ausweichprodukte genutzt werden.<br />
Detaillierte Untersuchungsergebnisse sind in den Kapiteln über die einzelnen Lebensmittel aufgeführt.<br />
Abbildung 4.17.<strong>3.</strong>1: Isoelektrische Fokussierung (PAGIF), Polyacrylamidgel, Coomassie® Brilliant Blue-<br />
Färbung, elektrophoretische Trennung der Proteinfraktion verschiedener Referenzmaterialien<br />
0
Tabelle 4.17.<strong>3.</strong>1 Untersuchungen von Lebensmitteln auf die Verarbeitung von Milch der angegebenen<br />
Tierart (Jahr 2006)<br />
Lebensmittel beanstandet nicht beanstandet gesamt Beanstandungen in<br />
[%]<br />
Schafskäse 35 154 189 19<br />
Grillkäse mit<br />
Schafskäse (außer<br />
Halloumi)<br />
2 2 4 50*<br />
Feta 4 83 87 5<br />
Ziegenmilch 0 8 8 0*<br />
Weichkäse 0 33 33 0<br />
Ziegenkäse 2 103 105 2<br />
Kuhmilchkäse 0 123 123 0<br />
Stutenmilch 0 1 1 0*<br />
Gesamtprobenzahl 43 507 550 8<br />
* aufgrund der geringen Probenzahl nicht als repräsentativ anzusehen<br />
Dr. Ohrt, G. (LI BS)<br />
4.17.4 Mykotoxine<br />
Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die bei Menschen und Tieren bei häufiger Aufnahme<br />
krebserregend und erbgutschädigend wirken. Diese Stoffe können von mehr als 250 Schimmelpilzarten gebildet<br />
werden. Einige Mykotoxine kommen in Lebensmitteln häufig vor und sind daher für die Lebensmittelsicherheit von<br />
Bedeutung.<br />
Eine Übersicht der im Jahre 2006 durchgeführten Mykotoxinuntersuchungen findet sich in der Tabelle 4.17.4.1.<br />
Tabelle 4.17.4.1: Untersuchungen auf Mykotoxine, Anzahl der Proben (inklusive Monitoring- und BUEP-<br />
Proben) unterhalb der jeweiligen Nachweisgrenze im Vergleich zur Anzahl aller untersuchten Proben<br />
(fettgedruckt)<br />
AFLA-<br />
TOXIN B1<br />
OCHRA-<br />
TOXIN<br />
PATULIN<br />
Citrinin<br />
Probenart<br />
Fleisch und<br />
Wurstwaren<br />
2 17<br />
Getreide 40 53 58 81 10 24 39 41 36 38 33 38 45 66 3 25 5 9<br />
Getreideprodukte 58 63 73 144 0 2 92 135 118 120 117 120 76 139 11 109 8 31<br />
Brote, Kleingebäck 1 17 52 63 63 63 63 63 18 19 1 2<br />
Feine Backwaren 1 1 6 38 22 28 27 27 27 27 8 19 4 12<br />
Pudding usw. 2 2 2 2<br />
Teigwaren<br />
Hülsenfrüchte,<br />
4 11 43 53 53 53 52 53<br />
Oelsamen,<br />
Schalenobst<br />
75 95 29 30<br />
Gemüseerzeugnisse 1 1 13 13<br />
Obstprodukte 39 45 23 76<br />
Fruchtsäfte,<br />
Fruchtnektare usw<br />
4 31 60 62<br />
Alkoholfreie<br />
Getränke<br />
5 20 1 1<br />
Wein usw. 5 25<br />
Biere,<br />
bierähnliche<br />
25 144<br />
273<br />
DEOXY-<br />
NIVALENOL<br />
T-2-Toxin<br />
HT-2-Toxin<br />
ZEARAL-<br />
ENON<br />
FUMO-<br />
NISINE<br />
Ergotalkaloide
Getränke<br />
Honige usw<br />
Speiseeis,<br />
5 19<br />
Speisehalbeiserzeugnisse<br />
1<br />
Süsswaren 40 44<br />
Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung<br />
16 16 11 18 2 2 5 5 5 5 5 5 16 17 13 17<br />
Diätetische<br />
Lebensmittel<br />
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3<br />
Nährstoffkonzentrate,<br />
Ergänzungsnahrung<br />
2<br />
Würzmittel 3 14 11<br />
Gewürze<br />
Hilfsmittel aus<br />
Zusatzstoffen<br />
55 100 39 93<br />
u./o. LM und<br />
Convenience-<br />
Produkte<br />
1 1 1 1<br />
Aflatoxine<br />
Aflatoxine werden ausschließlich von den Schimmelpilzarten Aspergillus flavus und A. parasiticus gebildet. Da<br />
diese zur Bildung der Aflatoxine B1, B2, G1 und G2 Temperaturen zwischen 25 und 40 °C brauchen, sind diese<br />
Toxine vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten bedeutsam, wo der Pilz schon auf dem Feld oder<br />
während der Lagerung die Produkte befallen kann. In Milch und Milchprodukten kann Aflatoxin M1 als Metabolit<br />
von Aflatoxin B1 auftreten, das über die Fütterung mit kontaminierten Tierfutter in die Milch übergehen kann.<br />
In den elf untersuchten Milchproben wurde kein Aflatoxin M1 nachgewiesen.<br />
Aflatoxin-B1-Gehalte über den Höchstgehalten der VO(EG) Nr. 466/2001 wurden in elf Proben festgestellt: in je<br />
einer Probe Maismehl, Wassermelonenkernen, Erdmandeln (Wurzelknollen von Cyperus esculentus),<br />
Tapiokamehl, Mandeln, Erdnüssen* ) , Pistazien sowie in je zwei Proben Paprika und Muskatnuss. Hier wurden bei<br />
einem zulässigen Höchstgehalt von 5 µg/kg Gehalte von 8,2 bis 89,5 µg/kg ermittelt. Insgesamt wurden 455<br />
Proben auf ihren Gehalt an Aflatoxinen B1, B2, G1 und G2 untersucht.<br />
(* ) Amtshilfe für Bremen)<br />
Ochratoxin A<br />
Ochratoxine werden von typischen Lagerpilzen gebildet. Sie sind weltweit in Ernteprodukten wie Mais, Hafer,<br />
Gerste, Weizen, Roggen, Buchweizen, Reis, Hirse, Sojabohnen, Erdnüssen, Paranüssen und Pfeffer zu finden<br />
und wurden in jüngster Zeit auch in Kaffee, Bier, Traubensaft, Wein und Trockenobst nachgewiesen.<br />
Ingesamt wurden 761 Proben unterschiedlicher Lebensmittel auf ihren Gehalt an Ochratoxin A, dem<br />
häufigsten Ochratoxin, untersucht.Beanstandungen ergaben sich lediglich bei je einer Probe Trockenfeigen und<br />
Roggenflocken.<br />
Patulin<br />
Patulin wird von Schimmelpilzen in Faulstellen von Obst und Gemüse gebildet und kann durch die Verarbeitung<br />
von angefaulter Rohware in daraus hergestellte Erzeugnissen gelangen.<br />
Im Laufe des Jahres wurden 78 Proben untersucht. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um Apfel-, Birnen<br />
und Tomatensäfte. 97,5 % der Proben enthielten kein Patulin. In einer Probe Birnensaft konnte Patulin in Spuren<br />
nachgewiesen werden, und eine Probe Apfelsaft enthielt Patulin in einer Konzentration von 22,9 µg/kg. Der<br />
wissenschaftliche Lebensmittelausschuss hat in einer Stellungnahme zu Patulin eine vorläufige maximale<br />
tolerierbare tägliche Aufnahme (PMTDI) von 0,4 µg pro kg Körpergewicht und Tag befürwortet. Dies entspricht für<br />
einen 60 kg schweren Menschen 24 µg Patulin am Tag. 1 l der positiv getesteten Apfelsaftprobe während eines<br />
Tages getrunken würde diese maximale Aufnahme schon fast erreichen.<br />
274
Citrinin<br />
Citrinin wird von zahlreichen Penicillium-Arten, die niedrige Temperaturen bevorzugen, sowie einigen Aspergillus-<br />
Arten gebildet. Betroffen sind vor allem die diversen Getreide in Ländern mit gemässigtem Klima. Citrinin ist ein<br />
wirksames Nephrotoxin. Ebenfalls wird eine cancerogene Wirkung diskutiert. Die bisher ermittelten niedrigen<br />
Gehalte in Lebensmitteln und der schnelle Zerfall des Toxins beim Erhitzen lassen jedoch eine Gefährdung<br />
unwahrscheinlich erscheinen.<br />
Im LI BS wurde im Jahr 2006 eine zuverlässige Methode zur Bestimmung von Citrinin etabliert. Bisher wurden<br />
26 Proben verschiedener Getreide untersucht. Die Gehalte lagen bei zehn Proben unter der Nachweisgrenze von<br />
0,6 µg/kg, in sechs Proben wurden Spuren bis 2 µg/kg festgestellt. In zehn Proben wurden messbare Gehalte bis<br />
9,2 µg/kg bestimmt. Bisher wurde für Citrinin kein Höchstgehalt festgelegt.<br />
Deoxynivalenol (DON)<br />
DON ist das am weitesten verbreitete Fusarientoxin. In Deutschland gilt derzeit noch eine Höchstmenge von<br />
500 µg/kg für Getreideerzeugnisse, ausgenommen Hartweizenerzeugnisse, und 350 µg/kg für Brot,<br />
Kleingebäck und feine Backwaren.<br />
Insgesamt wurden 326 Proben untersucht. In Säuglingsnahrung war kein DON nachzuweisen. Die untersuchten<br />
Proben Getreide und Getreideprodukte verteilten sich auf folgende Lebensmittelgruppen:<br />
41 Proben Getreide, hauptsächlich Weizen und Hafer, 69 Proben Getreidemehle und –grieße, 20<br />
Weizenmehle,<br />
12 Roggenmehle, 33 Maismehle und –grieße und vier Dinkelmehle, 30 Frühstückscerealien, davon 16 Cornflakes<br />
und 18 Proben Getreideflocken, bei denen es sich im Wesentlichen um Haferflocken handelte.<br />
74 % der untersuchten Proben wiesen keinen DON – Gehalt über der Nachweisgrenze von 30 µg/kg auf. Die<br />
höchsten ermittelten Werte lagen für Getreide bei 195 µg/kg (Weizenmehl), für Maismehl bei 240 µg/kg, für<br />
Cornflakes bei 184 µg/kg und für Haferflocken bei 410 µg/kg. Die 91 Proben Brot, Kleingebäck und feine<br />
Backwaren waren unauffällig, der höchste gemessen Wert lag bei 71 µg/kg in einem Butterkeks. Von den<br />
insgesamt 52 Proben Nudeln waren 10 Proben positiv. Die Konzentration lag zwischen 70 µg/kg bis 309 µg/kg.<br />
T2- und HT2- Toxin<br />
Die Toxine wurden zusammen mit anderen Trichothecenen in insgesamt 307 Proben untersucht. T2-Toxin wurde<br />
in nur vier Proben und HT2-Toxin in neun Proben nachgewiesen. In sechs dieser Proben waren nur Spuren<br />
enthalten. Gehalte über der Bestimmungsgrenze von 20 µg/kg waren nachweisbar in Haferkörnern: T2-Toxin 165<br />
µg/kg und 83 µg/kg; HT2-Toxin 149 µg/kg und 215 µg/kg; Haferflocken: HT2-Toxin 22 µg/kg und 29 µg/kg und in<br />
Müsli: HT2-Toxin 36 µg/kg.<br />
Höchstmengen für die beiden Toxine sind bisher noch nicht festgelegt. Es ist jedoch vorgesehen für beide<br />
zusammen einen Summengrenzwert festzusetzen.<br />
Zearalenon<br />
Zearalenon (ZON) wird durch eine Reihe von Fusarien gebildet. Hauptbildner sind dieselben Pilze, die auch für<br />
die Deoxynivalenolbildung verantwortlich sind.<br />
264 Proben verschiedener Matrices, in der Hauptsache Produkte auf Getreidebasis, wurden auf ihren Gehalt<br />
an Zearalenon untersucht. Gehalte über den Höchstgehalten wurden in drei Proben Maismehl ermittelt.<br />
Fumonisine<br />
Fumonisine sind weltweit verbreitete Mykotoxine, die durch verschiedene Fusarium-Arten gebildet werden.<br />
Fusarien befallen hauptsächlich Hafer, Mais und Weizen. Gerste und Roggen gelten als weniger anfällig. Je nach<br />
Witterung weist die Befallshäufigkeit große Unterschiede auf. 139 Proben von Mais und -erzeugnissen, neun<br />
Proben Roggenkörner, eine Probe Hirse sowie 17 Proben Kinderkekse (auf Maisbasis) wurden untersucht.<br />
Beanstandet wegen überhöhter Fumonisingehalte wurden fünf Proben: drei Proben Maismehl und zwei<br />
Proben glutenfreie Teigwaren.<br />
Ergotalkaloide<br />
Die toxische Wirkung von Ergotalkaloiden oder auch Mutterkornalkaloiden ist schon seit vielen Jahren bekannt.<br />
Die quantitative Bestimmung des Mutterkornanteils am Getreide ist einfach, wenn die Körner noch nicht<br />
vermahlen wurden, da die Sklerotien sich deutlich vom gesunden Getreidekorn unterscheiden. Sind die Körner<br />
jedoch gemahlen oder auch nur grob zerkleinert muss der Anteil an Mutterkorn über die Alkaloide bestimmt<br />
werden. Zurzeit werden hierfür folgende Vertreter herangezogen: Ergometrin, Ergotamin, Ergosin, Ergocristin, a-<br />
275
Ergocryptin und Ergocornin. Die genaue Bestimmung der Alkaloide ist äußerst schwierig, da sich abhängig von<br />
der Methode aus der „–in“ die „–inin“-Form bildet. Für eine sichere rechtliche Beurteilung ist es daher dringend<br />
notwendig die Methode festzuschreiben.<br />
Im Jahre 2006 wurden insgesamt 42 Proben auf Mutterkorn-alkaloide geprüft. In der überwiegenden Zahl,<br />
wurden Roggenkörner, -mehle und –schrote untersucht. eine Probe Weizenmehl und eine Probe Dinkelmehl<br />
enthielten keine Alkaloide. In einem Roggenmehl wurden 2441 µg/kg Alkaloide nachgewiesen und in<br />
Roggenkörnern der Ernte 2006 lag der Gehalt an Alkaloiden bei 1210 µg/kg. Der gravimetrisch bestimmte Gehalt<br />
der Sklerotien lag bei dieser Probe bei 0,05 %. Näheres zu den Proben ist in Kap. 4.16.10 beschrieben.<br />
4.17.5 Pestizide und Nitrat<br />
Pestizide<br />
276<br />
Bartels, I.; Eppert, D.; Dr. Reinhold, L. (LI BS)<br />
Die Ergebnisse der Pestiziduntersuchungen finden sich in den Kapiteln 4.16.2, 4.16.10, 4.16.14, 4.16.16 und<br />
4.16.25.<br />
Nitrat<br />
Hauptquelle für Nitrat ist Gemüse, das - wie fast alle Pflanzen - seinen Stickstoffbedarf in erster Linie mit Nitrat<br />
deckt. Das von den Pflanzen mit dem Wasser aufgenommene Nitrat wird überwiegend zu Eiweiß und anderen<br />
organischen Stickstoffverbindungen umgewandelt. Hierzu ist Sonnenlicht erforderlich. Ein mehr oder weniger<br />
großer Teil des Nitrats wird aber auch in den Pflanzen gespeichert. Bestimmte Gemüsearten reichern Nitrat in<br />
besonders großem Stil an, vor allem nach reichlicher Stickstoffdüngung und bei fehlendem Sonnenlicht in den<br />
Wintermonaten. Nitrat selbst ist zwar für den Menschen relativ ungiftig, kann jedoch bei Transport, Lagerung und<br />
Zubereitung von Nahrungspflanzen, sowie im menschlichen Verdauungstrakt durch Bakterien in Nitrit<br />
umgewandelt werden. Dieses Nitrit ist in der Lage, den roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) in Methämoglobin<br />
umzuwandeln und somit den Sauerstofftransport im Blut zu verringern (Methämoglobinämie). Da dieser Vorgang<br />
für Säuglinge und Kleinkinder lebensgefährlich sein kann, wird davon abgeraten, hinsichtlich des Nitratgehalts<br />
kritische Gemüsearten an Kleinkinder zu verfüttern. Weiterhin kann Nitrit mit den allgegenwärtigen Aminen in der<br />
Nahrung und im Körper zu Nitrosaminen reagieren, die krebserregend wirken können.<br />
Unter Beachtung der toxikologischen Relevanz des Nitrats einerseits, der wichtigen ernährungsphysiologischen<br />
Wirkungen vieler Gemüseinhaltsstoffe für die Verbraucher andererseits und der Bedeutung bestimmter<br />
Gemüsearten für den Binnenmarkt, hat die Europäische Kommission für bestimmte Erzeugnisse<br />
Nitrathöchstgehalte festgelegt. Die Grenzwerte der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 der Kommission<br />
berücksichtigen den Einfluss von Klima, Anbauart (Freiland, Gewächshaus/Folie) und Sorte (Kopfsalat/Typ<br />
„Eisbergsalat“) auf den Nitratgehalt bei Kopfsalat und Spinat zum Zeitpunkt der Ernte (Winterhalbjahr,<br />
Sommerhalbjahr). Die zusätzlich vorgenommene sortenspezifische Trennung bei Kopfsalat liegt an der<br />
Einberechnung der tendenziell niedrigeren Nitratkonzentration in Eisbergsalat. Separate Nitrathöchstgehalte hat<br />
die Kommission für Säuglings- und Kleinkindernahrung bzw. für tief gefrorenen Spinat festgelegt. Durch<br />
entsprechende Auswahl der Rohprodukte und Prozessführung ist die Industrie in der Lage, diese Erzeugnisse mit<br />
niedrigeren Nitratgehalten herzustellen.<br />
Wer wenig Nitrat aufnehmen möchte, sollte auf nitratärmere Gemüsearten ausweichen, sehr nitratreiche<br />
Gemüsearten im Winterhalbjahr meiden und Gemüse generell gut waschen, um äußerlich anhaftende<br />
Düngemittelrückstände wegzuspülen. Bei Blattgemüse kann der Nitratgehalt zusätzlich gesenkt werden durch<br />
Entfernen der äußeren Blätter, der dicken Blattrippen und der Stiele, da diese Pflanzenteile die höchsten<br />
Nitratkonzentrationen aufweisen. Zur Vermeidung der mikrobiellen Umwandlung von Nitrat in Nitrit, sollte z. B.<br />
Spinat auch nicht längere Zeit bei Raumtemperatur stehen gelassen und dann wieder aufgewärmt werden.<br />
Tabelle 4.17.5.1 Nitratgehalte (gerundet) in Gemüse und Gemüseerzeugnissen<br />
Probenart Anzahl Proben Minimale<br />
Konzentration<br />
[mg/kg]<br />
Maximale<br />
Konzentration<br />
[mg/kg]<br />
Mittelwert<br />
[mg/kg]<br />
Medianwert<br />
[mg/kg]<br />
Auberginen 5 106 620 345 348<br />
Broccoli 3 107 465 304 339<br />
Chicoree 4 262 349 302 298<br />
Chinakohl 2 915 1.524 1.220 1.220
Eichblattsalat 3 592 1.768 1.099 936<br />
Eisbergsalat 27 191 1.524 732 685<br />
Endiviensalat 1 338 - - -<br />
Feldsalat 24 274 <strong>3.</strong>833 1.525 1.292<br />
Fenchel 20 116 2.085 1.261 1.270<br />
Grünkohl 4 21 703 233 103<br />
Grünkohl,<br />
Konserve<br />
29 276 1.814 711 632<br />
Gurken 1 312 - - -<br />
Kartoffeln 8 < 7 185 83 64<br />
Kohlrabi 2 11 1.543 777 777<br />
Kopfsalat 25 375 4.007 2.128 2.160<br />
Lollo Rossa/Bionda 7 1.094 <strong>3.</strong>531 2170 1.930<br />
Mangold 3 928 2.661 1.771 1.724<br />
Möhren 1 59 - - -<br />
Paprika 3 < 7 36 - -<br />
Porree 3 69 522 344 440<br />
Radicchio 7 80 668 420 437<br />
Romanasalat 8 242 1.008 756 805<br />
Rosenkohl 27 < 7 8 - -<br />
Rotkohl 2 132 511 322 322<br />
Rote Bete 12 74 4.332 2.102 2.249<br />
Rote Bete,<br />
Konserve<br />
5 298 1.629 779 544<br />
Rote Bete, Saft 1 1.035<br />
Rucola 13 <strong>3.</strong>134 7.462 4.814 4.868<br />
Salatherzen 2 1.178 1.625 1.402 1.402<br />
Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung<br />
27 < 7 127 43 33<br />
Spinat, frisch 17 27 <strong>3.</strong>077 852 461<br />
Spinat, tiefgefroren<br />
21 134 1.916 847 929<br />
Steckrüben 2 7 59 33 33<br />
Weißkohl 5 42 670 246 145<br />
Wirsing 2 230 288 259 259<br />
Die Tabelle 4.17.5.1 der 326 auf Nitrat untersuchten Gemüse- und Gemüseerzeugnis-Proben zeigt, dass der<br />
höchste Nitratgehalt in Rucolaproben mit bis zu 7.462 mg/kg gemessen wurde. Der hohe Median- bzw. Mittelwert<br />
weist ferner darauf hin, dass Rucola generell ein extrem nitratreiches Gemüse darstellt. Hier gab es gegenüber<br />
den Vorjahren auch keine sichtbare Verbesserung, denn bereits seit 2001 weist Rucola den höchsten Nitratgehalt<br />
aller untersuchten Gemüsearten auf. Leider waren in der Vergangenheit alle Bemühungen von Deutschland<br />
vergebens, mit einer EU-weiten Nitrat-Höchstgehaltsregelung für Rucola die Gehalte zu begrenzen.<br />
Ebenfalls stark mit Nitrat kontaminiert waren Rote Bete mit maximal 4.332 mg/kg, Kopfsalat mit maximal<br />
4.007 mg/kg, Feldsalat mit maximal <strong>3.</strong>833 mg/kg, Lollo Bionda mit maximal <strong>3.</strong>531 mg/kg und frischer Spinat mit<br />
maximal <strong>3.</strong>077 mg/kg.<br />
Wegen Überschreitung der jeweils gültigen Höchstgehalte der VO (EG) Nr. 466/2001 wurden drei Proben<br />
beanstandet. Hierbei handelte es sich um zwei Proben frischer Spinat mit <strong>3.</strong>077 mg/kg und 2891 mg/kg<br />
(Höchstgehalt: 2.500 mg/kg) sowie eine Probe Kopfsalat mit 2.894 mg/kg (Höchstgehalt: 2.500 mg/kg).<br />
Dagegen hielt - wie bereits seit Jahren - auch 2006 der bei den Verbrauchern in Deutschland sehr beliebte tief<br />
gefrorene Spinat mit maximal 1.916 mg/kg Nitrat den Höchstgehalt (2.000 mg/kg) ein.<br />
Als besonders nitratarm erwies sich - wie in den Vorjahren - Rosenkohl, aber auch die untersuchten Paprika-,<br />
Kartoffel- und Steckrüben-Proben enthielten nur niedrige Nitratgehalte.<br />
Alle Proben Säuglings- und Kleinkindernahrung lagen mit maximal 127 mg/kg deutlich unterhalb des<br />
zulässigen EU-Höchstgehalts (200 mg/kg).<br />
Dr. Kombal, R. (LI OL)<br />
277
4.17.6 Kontaminanten und unerwünschte Stoffe<br />
Acrylamid<br />
Es wurden 218 Proben untersucht. Im Wesentlichen verteilten sich diese Proben auf Frühstückscerealien,<br />
braune Kuchen, Butterkekse und Spekulatius, Brot und Kleingebäck sowie Kartoffelchips. Der überwiegende Teil<br />
der ermittelten Werte war unauffällig. Der höchste Gehalt in Frühstückscerealien lag bei 338 µg/kg, der höchste<br />
Wert für Knäckebrot war 550 µg/kg und in Gewürzspekulatius wurde ein Maximalwert von 436 µg/kg gemessen.<br />
Weit über dem Signalwert von 1000 µg/kg waren die Acrylamidgehalte in zwei Proben Braune Kuchen mit 2376<br />
µg/kg und 1651 µg/kg. In Kartoffelchips und –sticks wurde der Signalwert in fünf Proben überschritten, wobei der<br />
höchste Wert bei 2378 µg/kg lag.<br />
Benzol<br />
Insgesamt wurden 41 Proben auf Benzol geprüft. Der Gehalt in Wildpreiselbeeren (18 Proben) lag zwischen 0,64<br />
µg/kg und 3,85 µg/kg. In einer Probe lag der Gehalt unter der Nachweisgrenze von 0,2 µg/kg. In Getränken (17<br />
Proben) lagen die Gehalte im Bereich von 0,58 µg/kg – 12,58 µg/kg. Auch hier war Benzol in einer Probe nicht<br />
nachweisbar. Die untersuchten Nahrungsergänzungsmittel (sechs Proben) enthielten Benzol in einer<br />
Größenordnung von 0,65 µg/kg bis 4,71 µg/kg.<br />
Furan<br />
Furan wurde in 40 Proben Suppen und Soßen, 30 Proben Toast und Milchbrötchen, 27 Fertiggerichten und 6<br />
Proben Klein-kindernahrung untersucht. In allen Suppen und Soßen war Furan nachweisbar. Die Werte lagen im<br />
Bereich von 1,2 µg/kg bis 43,0 µg/kg. In 11 Proben Toastbrot und Milchbrötchen war kein Furan nachweisbar.<br />
Der höchste Wert in einem Toastbrot lag bei 0,7 µg/kg. Die Fertiggerichte enthielten Furan zwischen 0,7 µg/kg<br />
und 40,75 µg/kg. Der kleinste Wert in einer Probe Kleinkindernahrung war 3,6 µg/kg, der höchste Wert lag bei<br />
40,1 µg/kg.<br />
3-MCPD<br />
Es wurden 33 Proben Soyasoßen, Würzsoßen und Speisewürzen untersucht. In 13 Proben war kein 3-MCPD<br />
nachweisbar, sechs Proben enthielten Spuren zwischen 3 µg/kg und 5 µg/kg und in 14 Proben lagen die Gehalte<br />
zwischen 5,7 µg/kg und 34,4 µg/kg. In einem Drittel der untersuchten Proben lagen die Gehalte über 10 µg/kg. In<br />
drei Proben wurde der Höchstwert von 20 µg/kg überschritten. Dieser Höchstwert bezieht sich auf das flüssige<br />
Erzeugnis mit 40% Trockenmasse; dies entspricht einem Höchstgehalt von 50 µg/kg Trockenmasse. Eine Probe<br />
wurde beanstandet.<br />
Nikotin<br />
Im Lebensmittelinstitut Braunschweig wurden 223 Proben Eiprodukte untersucht. Hauptsächlich waren dies<br />
Volleipulver, Eiweißpulver und Eigelbpulver. In 81 Proben war Nikotin nicht nachweisbar (< 3 µg/kg), 61 Proben<br />
wiesen Spuren zwischen 3 µg/kg und 8 µg/kg auf. Der höchste nachgewiesene Gehalt wurde in einem<br />
Volleipulver gemessen. Er betrug 51,8 µg/kg.<br />
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)<br />
Im Berichtsjahr wurden 82 Speiseöle und 19 Käseproben auf PAKs geprüft. Das Untersuchungsprogramm<br />
umfasst die 16 Vertreter der EPA-Liste. Alle untersuchten Käseproben enthielten keine PAKs. In den Ölproben<br />
waren zum Teil sehr hohe Werte nachzuweisen. Detaillierte Angaben zu den Ölen finden sich im Kapitel 4.16.7<br />
Öle, Fette.<br />
Phtalate<br />
89 Öle, 28 in Folie verschweißte Käseproben und 26 Mineral- und Trinkwässer wurden auf sieben verschiedenen<br />
Phthalate geprüft. In etwa 50 % der Ölproben war DEHP (Diethylhexyl-phthalat) enthalten. Der höchste ermittelte<br />
278
Gehalt betrug 18,7 µg/kg. DEP (Dibutylphthalat) und BEBP (Butylbenzylphthalat) war in sechs bzw. drei Proben<br />
nachzuweisen. In den Käseproben war am häufigsten DEP nachzuweisen. Die Gehalte lagen zwischen 2,25<br />
µg/kg und 17,0 µg/kg. In fünf Proben war DBP (Dibutyl-phthalat) in Konzentrationen von 0,2 – 0,3 µg/kg enthalten<br />
und zwei Käseproben enthielten Gehalte an BEBP von 0,9 µg/kg und 2 µg/kg. Die Hälfte der Wasserproben<br />
enthielten DEP und DBP. Die Gehalte lagen für DEP unter 1 µg/kg und der höchste Wert für DBP lag bei 2,3<br />
µg/kg.<br />
Perfluorierte organische Tenside (PFT)<br />
279<br />
Bartels,I.; Dr. Reinhold, L. (LI BS)<br />
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 37 Fischproben, 79 Proben Kartoffeln, eine Probe Möhren und 14 Proben<br />
vorfrittierte, tiefgefrorene Pommes frites in Fertigpackungen auf eine Kontamination mit Perfluoroctansäure<br />
(PFOA) und Perfluoroctansulfonat (PFOS) überprüft. Lediglich in zwei Proben Fisch aus dem Landkreis<br />
Holzminden wurden geringe Mengen PFOS (< 10 µg/kg) nachgewiesen. Laut Stellungnahme des<br />
Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) Nr. 035/2006 vom 27.Juni 2006 sind Fische erst mit PFT-<br />
Konzentrationen oberhalb von 20 µg/kg als nicht verkehrsfähig einzustufen.<br />
Die Untersuchung der Proben erfolgte gezielt, nachdem bekannt wurde, dass PFT-haltige Klärschlämme zur<br />
Düngung von Feldern in Nordrhein-Westfalen ausgebracht worden waren und möglicherweise auch nach<br />
<strong>Niedersachsen</strong> gelangt sein könnten. PFT sind Verbindungen, die in vielen industriellen Produkten zu finden sind.<br />
Als Stoffe, welche die Oberflächenspannung herabsetzen, sind sie z. B. in Teflonbeschichtungen von<br />
Bratpfannen sowie in der Imprägnierung von Textilien zu finden. PFT sind für Mensch und Tier toxisch. Darüber<br />
hinaus sind PFT bioakkumulierend: D. h., sie reichern sich im Körper an und werden dort nur sehr langsam<br />
abgebaut. PFT sind weltweit verbreitet und wurden sogar schon in Leberproben von Eisbären nachgewiesen.<br />
4.17.7 Schwermetalle<br />
Dr. Kombal, R. (LI OL); Dr. Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Schwermetalle sind natürliche Bestandteile der Erdoberfläche, z. B. in Form von Erzen und deren<br />
Verwitterungsprodukten, die u. a. durch Wasserläufe verbreitet werden. Sie gelangen deshalb von Natur aus, also<br />
ohne menschliche Einwirkung wie Bergbau oder Verhüttung, in die Umwelt und somit auch in die Nahrung. Sie<br />
können zum einen als lebensnotwendige Spurenelemente wie Kupfer, Zink, Eisen, Chrom und Selen auftreten<br />
oder als Schadstoffe wie z.B. Blei, Cadmium und Quecksilber. Entscheidend ist die Konzentration, in der sie im<br />
Lebensmittel vorliegen, so wirkt auch das lebensnotwendige Spurenelement Selen in zu hoher Dosierung toxisch.<br />
Lebensmittelrechtliche Vorschriften bezüglich Höchstmengen von Schwermetallen gibt es in der Trinkwasser-<br />
Verordnung (VO), der Wein-VO, der Schadstoffhöchstmengen-VO, der Rückstandshöchstmengen-VO, der<br />
Fleischhygiene-VO und seit dem 5. April 2002 in der VO (EG) Nr. 466/2001 der Kommission zur Festsetzung der<br />
Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (ab 1. März 2007 ersetzt durch VO(EG) Nr.<br />
1881/2006).<br />
Neben solchen in Rechtsvorschriften festgelegten Höchstmengen gibt es vom BgVV veröffentlichte Richtwerte<br />
für Blei, Cadmium und Quecksilber in Lebensmitteln. Diese Richtwerte wurden zwar durch eine Bekanntmachung<br />
des BgVV im Bundesgesundheitsblatt 12/2000 zurückgezogen, laut Stellungnahme des ALS (77. Sitzung<br />
Arbeitskreis lebensmittelchemischer Sachverständiger am 28./29. März 2001) können sie weiterhin als<br />
Beurteilungsgrundlage für Sachverhalte dienen, die in der VO(EG) Nr. 1881/2006 nicht geregelt sind.<br />
Im Berichtszeitraum wurden <strong>3.</strong>676 Proben Lebensmittel auf ihren Gehalt an Elementen untersucht<br />
(ausgenommen Fisch und Fischerzeugnisse). Dabei wurden etwa 19.500 Parameter bestimmt, z. T. mit<br />
Multielementverfahren.<br />
Insgesamt stellt sich die Belastungssituation insbesondere hinsichtlich der Elemente Blei und Cadmium<br />
günstig dar. Die Belastung von Obst und Gemüse mit Blei ist entsprechend den Tendenzen in den Vorjahren<br />
außer bei vorbelasteten Böden gering.<br />
Auch die Cadmiumgehalte sind insgesamt als niedrig zu beurteilen, ausgenommen sind nach wie vor Ölsaaten<br />
wie z. B. Mohn und Leinsamen, die je nach geologischem Standort Cadmium ansammeln können. Ebenso<br />
kommen vereinzelt bei Wildpilzen hohe Cadmium-, Blei- und auch Quecksilberbelastungen vor. Die hierzu<br />
untersuchten Proben waren 2006 im Unterschied zu anderen Jahren jedoch unauffällig. Bei getrockneten<br />
Pilzerzeugnissen ist dagegen zum Teil mit deutlichen Gehalten zu rechen.<br />
In getrockneten Algen und Erzeugnissen daraus wurden zum Teil hohe Jodgehalte bis zu 4.690 mg/kg<br />
analysiert.<br />
Aufmerksamkeit sollte weiterhin auf den Markt für Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel und<br />
Säuglingsnahrung gerichtet werden, da die dort gemessenen Gehalte an Mineralstoffen oder Spurenelementen<br />
zum Teil als nicht unproblematisch anzusehen sind und auch längst nicht immer mit den deklarierten Mengen<br />
übereinstimmten.
Die Bewertung weiterer Ergebnisse ist gegebenenfalls in den Kapiteln der jeweiligen Einzellebensmittel<br />
aufgeführt.<br />
4.17.8 Behandlung mit ionisierenden Strahlen<br />
280<br />
Dr. Block, I. (LI OL); Kühne, H. (LI BS)<br />
Mit den Richtlinien 1999/2/EG und 1999/3/EG waren EU-einheitliche Regelungen über bestrahlte Lebensmittel<br />
geschaffen worden, unter anderem eine erste gemeinschaftliche Positivliste für Lebensmittel, die mit<br />
ionisierenden Strahlen behandelt werden dürfen. Die Lebensmittelbestrahlungsverordnung (LMBestrV) vom<br />
14.12.2000 setzte diese beiden EU-Richtlinien in nationales Recht um. Damit ist in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, wie in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eine Strahlenbehandlung von<br />
getrockneten aromatischen Kräutern und Gewürzen mit Strahlungsdosen von maximal 10 Kilogray zulässig.<br />
Weitere Lebensmittelkategorien sind in der gemeinschaftlichen Positivliste der EU zunächst nicht enthalten.<br />
Allerdings sind in einigen Mitgliedstaaten der EU nationale Zulassungen für die Bestrahlung einzelner<br />
Lebensmittel weiterhin in Kraft. Um derartige bestrahlte Lebensmittel auch in Deutschland in den Verkehr bringen<br />
zu können, ist der Erlass einer Allgemeinverfügung nach § 54 LFGB Voraussetzung. Im Jahr 2006 wurde eine<br />
solche Allgemeinverfügung erlassen, sie betrifft bestrahlte Froschschenkel.<br />
Die Lebensmittelbestrahlungsverordnung regelt, dass bestrahlte Lebensmittel bei der Abgabe an den<br />
Verbraucher durch die Angabe „bestrahlt“ oder die Worte „mit ionisierenden Strahlen behandelt“ kenntlich<br />
gemacht werden müssen. Diese Angabe muss auch dann erfolgen, wenn das bestrahlte Lebensmittel als Zutat in<br />
einem anderen Lebensmittel enthalten ist – unabhängig vom Mengenanteil.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> werden Untersuchungen zum Nachweis einer eventuell erfolgten Strahlenbehandlung von<br />
Lebensmitteln im Lebensmittelinstitut Oldenburg durchgeführt. Im Jahr 2006 wurden insgesamt 206<br />
Lebensmittelproben auf Bestrahlung untersucht. Die wichtigsten Untersuchungsmethoden beruhen auf dem<br />
gaschromatographischen Nachweis von strahlungsspezifischen Fettabbauprodukten, der Elektronen-Spin-<br />
Resonanz(ESR)-Spektroskopie und insbesondere auf der Messung der Thermolumineszenz. Tabelle 4.17.8.1<br />
zeigt die Aufteilung der untersuchten Proben auf die einzelnen Warengruppen.<br />
Eine unzulässige Strahlenbehandlung konnten bei drei Proben von getrockneten asiatischen Pilzen<br />
nachgewiesen werden. Bei grünem Tee und bei Algenpräparaten fanden sich anders als 2005 keine bestrahlten<br />
Proben.<br />
Bei zwei Proben Paprikapulver und einem Gewürzsalz wurde eine – zulässige – Behandlung mit ionisierenden<br />
Strahlen nachgewiesen, diese war jedoch nicht kenntlich gemacht worden. Auch eine ostasiatische Instant-<br />
Nudelsuppe enthielt bestrahlte Gewürze oder andere bestrahlte Zutaten, ohne dass im Zutatenverzeichnis darauf<br />
hingewiesen worden wäre.<br />
Tabelle 4.17.8.1 Untersuchungen auf eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen<br />
J. Pfordt (LI OL)<br />
Warenbezeichnung Anzahl der untersuchten Proben davon als bestrahlt identifiziert<br />
Fleisch, einschließlich Geflügel 4<br />
Trockensuppen 1 1<br />
Kartoffeln 1<br />
Pilze und Pilzerzeugnisse 23 3<br />
Tee und teeähnliche Erzeugnisse 40<br />
Algenpräparate 3<br />
Würzmittel und Gewürze 134 3<br />
4.17.9 Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln auf Dioxine und dioxinähnliche PCB<br />
Dioxine<br />
Bei den polychlorierten Dibenzodioxinen und Dibenzofuranen (PCDD/F), zusammengefasst kurz „Dioxine“<br />
genannt, handelt es sich um eine Gruppe von tricyclischen aromatischen Ethern. Je nach Chlorierungsgrad und<br />
Stellung der Chloratome sind 75 Dioxin- (PCDD-Kongenere) und 135 Furan-Strukturen (PCDF-Kongenere)<br />
möglich.<br />
Dioxine wurden nie gezielt synthetisiert und kommen - außer in Kaolinit-Tonerden - natürlicherweise nicht vor.
In Gegenwart von Chlor werden sie praktisch bei allen thermischen Prozessen gebildet, z. B. bei der<br />
Sondermüllverbrennung und bei Verfahren in der Metall verarbeitenden Industrie. Weiterhin wurden sie durch<br />
kontaminierte Chlorchemikalien, wie z. B. Polychlorierte Biphenyle (PCB) und durch die Chlorbleiche von<br />
Cellulose ubiquitär verbreitet.<br />
Dioxine werden vom tierischen und menschlichen Organismus überwiegend über die Nahrungskette<br />
aufgenommen. Aufgrund ihrer guten Fettlöslichkeit, der langsamen Ausscheidung sowie der geringen<br />
Abbaubarkeit werden sie im Fettgewebe angereichert. Die Gruppe der 2,3,7,8-substituierten PCDD/F-<br />
Verbindungen sind aufgrund ihrer hohen Toxizität und Persistenz besonders bedeutsam.<br />
Die einzelnen PCDD/F-Verbindungen unterscheiden sich sehr stark in ihren Toxizitäten. Die höchste Toxizität<br />
besitzt das als „Seveso-Gift” bekannt gewordene 2,3,7,8-Tetrachlor-dibenzo-dioxin (TCDD). Um das<br />
toxikologische Gefährdungspotential der vorhandenen PCDD/F-Verbindungen in einem Lebensmittel oder<br />
Futtermittel bewerten zu können, werden so genannte Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF) herangezogen. Die<br />
jeweilige Toxizität eines Kongeners wird bei diesen Systemen in Relation zur Toxizität des 2,3,7,8-TCDD gesetzt,<br />
dem ein Äquivalentfaktor von 1 zugewiesen wird. Durch Multiplikation des Gehaltes jedes einzelnen Kongeners<br />
mit dem ihm zugewiesenen TEF-Wert und anschließender Addition der Einzelbeträge ergeben sich als<br />
Summenparameter die TCDD-Toxizitätsäquivalente (TEQ) der Probe (WHO-PCDD/F-TEQ). Die zurzeit gültigen<br />
TEF-Werte wurden 1997 von einer Expertenkommission der WHO festgelegt.<br />
In Proben tierischen Ursprungs (wie z. B. Milch und Fleisch) werden überwiegend die schwer abbaubaren<br />
2,3,7,8-substituierten Kongenere gefunden. In pflanzlichen Proben, Eiern und Fischen kann dagegen das<br />
gesamte Kongenerenspektrum enthalten sein.<br />
Die EU Kommission setzte im Juli 2002 erstmals Höchstgehalte für Dioxine in Lebensmitteln und Futtermitteln<br />
fest, zusätzlich wurden im März 2002 Auslösewerte für Dioxine eingeführt, die deutlich machen sollen, wo<br />
Hintergrundwerte signifikant überschritten werden.<br />
Dioxinähnliche PCB (dl-PCB)<br />
Bestimmte Kongenere aus der Verbindungsklasse der Polychlorierten Biphenyle (PCB) besitzen eine den<br />
Dioxinen ähnliche räumliche Struktur und zeigen auch eine vergleichbare Struktur-Wirkungsbeziehung. Eine<br />
Arbeitsgruppe der WHO ordnete diesen so genannten dioxinähnlichen PCB-Kongeneren (dl-PCB) ebenfalls<br />
Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF) in Relation zum 2,3,7,8-TCDD zu, mit denen die ermittelten Gehalte an dl-PCB<br />
in TCDD-Toxizitätsäquivalente umgerechnet werden können. Diese werden entsprechend als WHO-PCB-TEQ<br />
bezeichnet. Es handelt sich bei den dioxinähnlichen PCB um 4 non-ortho-PCB-Kongenere, die im Molekül in<br />
ortho-Position keine Chlorsubstitution aufweisen und 8 mono-ortho-PCB-Kongenere, die in ortho-Position einfach<br />
chlorsubstituiert sind.<br />
Die aus dem Dioxingehalt (WHO-PCDD/F-TEQ) und die aus dem dl-PCB-Gehalt berechneten<br />
Toxizitätsäquivalente (WHO-PCB-TEQ) werden zusammenaddiert zur Summe aus Dioxinen und dioxinähnlichen<br />
PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ).<br />
Neben den während einer Übergangsphase weiter geltenden Höchstgehalten für Dioxine, gelten ab November<br />
2006 zusätzlich in Lebensmitteln und Futtermitteln Höchstgehalte für die Summe aus Dioxinen und dl-PCB.<br />
Weiterhin sind ab November 2006 getrennte Auslösewerte für Dioxine und dl-PCB gültig.<br />
Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln auf Dioxine und dl-PCB<br />
Im Berichtszeitraum 2006 wurden insgesamt 622 Proben auf polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) und<br />
Dibenzofurane (PCDF) untersucht, 212 dieser Proben wurden zusätzlich auch auf dioxinähnliche PCB untersucht.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden nach Lebensmitteln und Futtermitteln gegliedert erläutert.<br />
Ergebnisse aus Sonderprojekten wurden nicht aufgeführt.<br />
Tabelle 4.17.9.1 gibt eine Übersicht über die Ergebnisse von Lebensmitteln, die nur auf Dioxine untersucht<br />
wurden. In Tabelle 4.17.9.2 sind die Ergebnisse der Lebensmittelproben zusammengestellt, die parallel auf<br />
Dioxine und dl-PCB untersucht wurden.<br />
281
Tabelle 4.17.9.1 Übersicht über Ergebnisse von Dioxinuntersuchungen in Lebensmitteln<br />
Lebensmittelgruppe Probenzahl Mittelwert Median Minimum Maximum<br />
Frauenmilch 1)<br />
36 6,76 6,61 2,44 12,31<br />
Rohmilch Milchhygiene 1)<br />
49 0,35 0,32 0,15 0,94<br />
Hofsammelmilch SAD 1)<br />
14 0,32 0,33 0,21 0,42<br />
Gelatine 3)<br />
2 0,03 - 0,03 0,03<br />
Fleisch 1)<br />
15 0,17 0,10 0,04 0,80<br />
Grünkohl 2)<br />
11 0,25 0,21 0,03 0,71<br />
Kopfsalat 2) 1 0,03 * - - -<br />
Zucker 3) 2 0,03 - 0,02 0,04<br />
1) Angaben in pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett 2) Angaben in pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Frischgewicht<br />
3) Angaben in pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Produkt * Einzelwert<br />
Tabelle 4.17.9.2 Übersicht über Ergebnisse von Untersuchungen auf Dioxine und dioxinähnliche PCB in<br />
Lebensmitteln<br />
Lebensmittelgruppe<br />
1. Dioxine<br />
(pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett)<br />
Probenzahl Mittelwert Median Minimum Maximum<br />
Eier NRKP<br />
39 0,39 0,20 0,09 3,16<br />
Babynahrung<br />
20 0,017 0,017 0,017 0,020<br />
Dorschleber<br />
18 23,35 25,03 1,78 44,02<br />
Dorschleberöl<br />
18 19,16 20,70 1,62 37,98<br />
Fleisch BÜP<br />
12 0,30 0,18 0,04 0,74<br />
Fisch BÜP<br />
2. Dioxinähnliche PCB<br />
(pg WHO-PCB-TEQ/g Fett)<br />
5 0,72 - 0,05 2,15<br />
Eier NRKP<br />
39 0,57 0,21 0,06 4,74<br />
Babynahrung<br />
20 0,004 0,001 0,001 0,023<br />
Dorschleber<br />
18 124,20 89,85 10,22 652,46<br />
Dorschleberöl<br />
18 93,11 85,21 9,82 400,90<br />
Fleisch BÜP<br />
12 0,60 0,42 0,02 1,86<br />
Fisch BÜP<br />
<strong>3.</strong>Summe Dioxine und dl-PCB<br />
(pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett)<br />
5 1,19 - 0,01 2,77<br />
Eier NRKP<br />
39 0,96 0,42 0,15 7,59<br />
Babynahrung<br />
20 0,021 0,018 0,018 0,040<br />
Dorschleber<br />
18 147,55 116,20 13,60 689,85<br />
Dorschleberöl<br />
18 112,27 107,05 12,10 429,18<br />
Fleisch BÜP<br />
12 0,90 0,74 0,06 2,56<br />
Fisch BÜP 5 1,92 - 0,06 4,92<br />
Einige Untersuchungsschwerpunkte bei den Lebensmitteln werden im Folgenden exemplarisch erläutert.<br />
Frauenmilch<br />
Neben der besonderen Bedeutung als erstes Nahrungsmittel für Säuglinge besitzt Frauenmilch weiterhin eine<br />
wichtige Funktion als Bioindikator: sie liefert Informationen hinsichtlich der internen Belastung des Menschen mit<br />
persistenten Umweltschadstoffen. Anhand des Zeitverlaufs der Schadstoffe in der Frauenmilch kann verfolgt<br />
werden, inwieweit Maßnahmen zur Minimierung der Emissionen und der Exposition des Menschen Erfolge<br />
zeigen.<br />
Im Berichtszeitraum wurden 36 Proben auf Dioxine untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in<br />
Tabelle 4.17.9.1 dargestellt. Die ermittelten Dioxingehalte lagen zwischen 2,44 und 12,31 pg WHO-PCCD/F-<br />
TEQ/g Fett mit einem Mittelwert von 6,76 und einem Medianwert von 6,61 pg WHO-PCCD/F-TEQ/g Fett.<br />
Der zeitliche Verlauf der Dioxin-Belastung (Medianwerte) der Frauenmilch von 1986 bis 2006 kann Abbildung<br />
4.17.9.1 entnommen werden.<br />
282
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,0 0<br />
10 ,0 0<br />
5,00<br />
0,00<br />
Aus der Abbildung ist klar ersichtlich, dass die Dioxingehalte in der Frauenmilch seit 1990 auf weniger als ein<br />
Drittel zurückgegangen sind. Diese Entwicklung lässt den Schluss zu, dass die Belastung des Menschen und der<br />
Umwelt mit Dioxinen wesentlich reduziert wurde. Schwankungen können durch unterschiedliche Probenzahlen<br />
und der statistischen Schwankungsbreite erklärt werden.<br />
Rohmilch<br />
Abbildung 4.17.9.1 Zeitlicher Verlauf der Dioxin-Belastung der Frauenm ilch (1986 -<br />
2006)<br />
86 -<br />
89<br />
Kuhmilch ist einerseits ein überaus bedeutendes Lebensmittel, anderseits aber auch ein sehr empfindlicher<br />
Bioindikator für den ländlichen Raum. Der Dioxingehalt der Kuhmilch ist abhängig von Emissionen im Bereich der<br />
Grünfutteranbauflächen. Aber auch Belastungen der Zusatzfuttermittel mit Dioxinen sind in der Milch deutlich zu<br />
erkennen. Da es sich bei den Dioxinen um fettlösliche, persistente Umweltkontaminanten handelt, findet im<br />
tierischen Organismus eine Akkumulation bevorzugt im Fettgewebe und in der Leber statt. Durch diese<br />
Akkumulation können im tierischen Fettgewebe - und damit in der Milch - auch solche Dioxingehalte bei geringer<br />
Futter- und Umweltbelastung sicher nachgewiesen werden, die im Grasaufwuchs noch nicht oder nur mit großen<br />
analytischen Unsicherheiten nachweisbar sind.<br />
- Hofsammelmilchproben SAD<br />
Seit 1992 werden in regelmäßigen Abständen Hofsammelmilchproben von vier landwirtschaftlichen Betrieben<br />
aus der Umgebung der ehemaligen Sonderabfalldeponie Münchehagen (SAD) auf Dioxine untersucht, um den<br />
zeitlichen Verlauf der Belastung mit Umweltkontaminanten in einem engen regionalen Rahmen verfolgen zu<br />
können.<br />
Im Jahr 2006 wurden 14 Hofsammelmilchproben untersucht, wobei Dioxingehalte zwischen 0,21 und 0,42 pg<br />
WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett mit einem Mittelwert von 0,32 und einem Medianwert von 0,33 pg WHO-PCDD/F-<br />
TEQ/g Fett ermittelt wurden. In keinem Fall wurde der Auslösewert von 2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett oder der<br />
Höchstgehalt von 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett überschritten.<br />
In Abbildung 4.17.9.2 ist der zeitliche Verlauf der Dioxinbelastung der Hofsammelmilch von 1992 - 2006<br />
dargestellt. Gut zu erkennen ist, dass die Belastung der Hofsammelmilch mit Dioxinen in diesem Zeitraum auf<br />
ungefähr ein Drittel zurückgegangen ist, wobei in der ersten Hälfte der neunziger Jahre stärkere jährliche<br />
Rückgänge zu verzeichnen waren, der Rückgang scheint exponentiell zu verlaufen. Schwankungen erklären sich<br />
durch zusätzliche Einträge aus Futtermittelkontaminationen, wie z. B. beim Zitrustrester in den Jahren 1997/1998,<br />
aber auch durch unterschiedliche Probenahmezeitpunkte, da die Milch erfahrungsgemäß im Winterhalbjahr höher<br />
belastet ist als im Sommerhalbjahr.<br />
- Rohmilch Milchhygiene<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Es wurden 49 Tankwagen- bzw. Hofsammelmilchproben auf Dioxine, Chlorkohlenwasserstoffe und Indikator-<br />
PCB untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist es, zeitliche Trends festzustellen und die Hintergrundbelastung<br />
der Rohmilch zu ermitteln. Dazu finden über einen Zeitraum von mehreren Jahren regelmäßige Untersuchungen<br />
283
von Proben statt, die jeweils in weitgehend emmissionsfernen Regionen erhoben werden. Die Ergebnisse der<br />
Untersuchungen von 2006 sind in Tabelle 4.17.9.1 aufgeführt.<br />
Der Mittelwert der Dioxingehalte der Tankwagen- und Hofsammelmilch beträgt für das Jahr 2006 0,35 pg WHO-<br />
PCCD/F-TEQ/g Fett, der Medianwert liegt bei 0,32 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett. Die Ergebnisse aller Proben<br />
lagen unterhalb des zulässigen Auslösewertes bzw. des Höchstgehaltes.<br />
Eier<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0<br />
Abb. 4.17.9.2 Zeitlicher Verlauf der Dioxin-Belastung der SAD-Hofsam m elm ilch (1992 -<br />
2006)<br />
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Nach Nationalem Rückstandskontrollplan 2006 wurden 39 Eiproben auf Dioxine und dl-PCB untersucht. Die<br />
Ergebnisse und die Summenwerte aus Dioxinen und dl-PCB sind zusammengefasst in Tabelle 4.17.9.2<br />
aufgeführt, in Tabelle 4.17.9.3 werden die Ergebnisse nochmals differenziert nach Haltungsform der Legehennen<br />
dargestellt.<br />
Seit Juli 2002 gilt für Eier ein Höchstgehalt von 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett. Wie in den vorangegangenen<br />
Jahren zeigte sich, dass Eier aus Käfighaltung geringer mit Dioxinen belastet sind als Eier aus Boden- und<br />
Freilandhaltung. Höchstgehaltsüberschreitungen für Dioxine wurden nicht festgestellt, allerdings lagen 2<br />
Untersuchungsergebnisse (eine Probe aus Bodenhaltung und eine Probe ohne Angabe der Haltungsart) im<br />
Bereich des zulässigen Höchstgehaltes für Dioxine.<br />
Ab dem 4.November 2006 gilt für Eier ein Höchstgehalt für die Summe aus Dioxinen und dl-PCB von 6 pg<br />
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett. Eine Eierprobe aus Bodenhaltung überschritt diesen zum Zeitpunkt der<br />
Probenahme noch nicht gültigen Höchstgehalt aufgrund eines erhöhten Gehaltes an dl-PCB. Eine Nachprobe<br />
bestätigte diesen Befund. Untersuchungen von dem in dem Betrieb eingesetzten Futtermittel konnten die<br />
erhöhten Gehalte nicht erklären. Die Ursachenermittlung gestaltet sich bei erhöhten Gehalten in Eiern aus<br />
Boden- oder Freilandhaltung erfahrungsgemäß sehr schwierig.<br />
284
Tabelle 4.17.9.3 Dioxine und dl- PCB in Hühnereiern verschiedener Haltungsformen<br />
Probenzahl Mittelwert Median Minimum Maximum<br />
1. Dioxine<br />
(pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett)<br />
Käfig 18 0,19 0,18 0,09 0,40<br />
Boden 9 0,49 0,20 0,12 2,85<br />
Freiland 6 0,39 0,25 0,12 0,83<br />
ohne Angabe<br />
2. Dioxinähnliche PCB<br />
(pg WHO-PCB-TEQ/g Fett)<br />
6 0,85 0,37 0,16 3,16<br />
Käfig 18 0,48 0,19 0,06 2,71<br />
Boden 9 0,82 0,20 0,08 4,74<br />
Freiland 6 0,32 0,30 0,12 0,56<br />
ohne Angabe<br />
<strong>3.</strong>Summe Dioxine und dl-PCB<br />
(pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett)<br />
6 0,67 0,39 0,12 1,87<br />
Käfig 18 0,68 0,41 0,15 3,06<br />
Boden 9 1,32 0,42 0,20 7,59<br />
Freiland 6 0,71 0,55 0,24 1,40<br />
ohne Angabe 6 1,52 1,30 0,28 3,50<br />
Futtermittel<br />
Über 95% der Dioxinaufnahme des Menschen erfolgt über die Nahrung, wobei Lebensmittel tierischen Ursprungs<br />
den überwiegenden Anteil an der Dioxinexposition haben. Da die Dioxinbelastung der Tiere wiederum<br />
größtenteils auf Futtermittel zurückzuführen ist, ist die Untersuchung von Futtermitteln für die Ermittlung von<br />
potentiellen Dioxin-Eintragsquellen in die Nahrungskette von größter Wichtigkeit.<br />
Im Jahr 2006 wurden 158 Futtermittel nur auf Dioxine untersucht, in weiteren 57 Futtermitteln wurden sowohl<br />
Dioxine als auch dl-PCB bestimmt. Eine Übersicht der Ergebnisse wird in Tabelle 4.17.9.4 wiedergegeben.<br />
Tabelle 4.17.9.4 Übersicht über die auf Dioxine und dl-PCB untersuchten Futtermittel<br />
1. Dioxine<br />
(ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg<br />
Futtermittel<br />
(12% Feuchte))<br />
2. Dioxinähnliche PCB<br />
(ng WHO-PCB-TEQ/kg Futtermittel<br />
(12% Feuchte))<br />
<strong>3.</strong>Summe Dioxine und dl-PCB<br />
(ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg<br />
Futtermittel (12% Feuchte))<br />
4.17.10 Umweltradioaktivität<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1044<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 2<br />
Probenzahl Mittelwert Median Minimum Maximum<br />
215 0,18 0,04 0,03 3,50<br />
57 0,09 0,01
Auswirkungen unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung aller Umstände durch angemessene<br />
Maßnahmen so gering wie möglich zu halten.<br />
Die Überwachung der Radioaktivität der Lebensmittel geschieht zum Schutz der Bevölkerung. Sie soll eine Beurteilung darüber<br />
ermöglichen, in welchem Maße der Mensch radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist, die von der Umwelt ausgeht.<br />
Umfangreiches Untersuchungsprogramm<br />
Es gehört zu den Aufgaben der Länder, für das Bundesumweltministerium die Radioaktivität u.a. in Lebensmitteln,<br />
Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Trinkwasser zu ermitteln. Die vorgegebenen Programme des Bundes (z. B. das<br />
Routinemessprogramm zur Überwachung der Umweltradioaktivität) sind in ein umfangreicheres Untersuchungsprogramm<br />
<strong>Niedersachsen</strong>s eingearbeitet, dessen Probenauswahl folgende Kriterien zugrunde liegen:<br />
- in <strong>Niedersachsen</strong> angebotene Lebensmittel<br />
- in <strong>Niedersachsen</strong> hergestellte bzw. erzeugte Lebensmittel<br />
- Gesamtkost (1. Verifizierung der prognostizierten Belastungen)<br />
- Humanmilch (2. Verifizierung der prognostizierten Belastungen)<br />
- Proben mit Indikatorfunktion ( Gras, Blätter, Nadeln)<br />
Weitere Sonderprogramme werden durch besondere Belastungssituationen bei Wildfleisch, wildwachsenden Speisepilzen,<br />
Honig, sowie Süßwasser- und Seefischen aus besonderen Fanggebieten durchgeführt.<br />
Die von der EG für Importe aus Drittländern festgesetzten Höchstwerte für Cäsium 134 und 137 (Gesamtcäsium) betragen für<br />
Milch und Säuglingsnahrung 370 Bq/l und für andere Lebensmittel 600 Bq/kg bzw. Bq/l – jeweils bezogen auf das verzehrsfertige<br />
Lebensmittel. Diese Werte werden seit Januar 1988 auch auf in <strong>Niedersachsen</strong> gehandelte inländische Lebensmittel sinngemäß<br />
angewandt.<br />
Die Tabelle 4.17.10.4 und 4.17.10.2 geben eine Übersicht der Untersuchungen auf Gesamtcäsium und Strontium 90.<br />
Tabelle 4.17.10.4 Untersuchungen auf Cs137 in 2006 - Inland und Ausland-Proben<br />
Material Probenzahl<br />
kleiner<br />
Bereich in [Bq/kg] bzw. [Bq/L]<br />
gesamt NG Mittelwert Medianwert Maximalwert Minimalwert<br />
Milch 179 80 0,27 0,2 4,0 < 0,05<br />
Käse 21 18 0,16 0,16 < 0,29 < 0,07<br />
Butter 1 0 3,8 3,8 3,8 3,8<br />
Fleisch warmblütiger<br />
Tiere<br />
104 63 0,7 0,18 40,6 < 0,05<br />
Schwarzwild 14 0 210 32,6 1592 2,8<br />
Fische,<br />
Fischzuschnitte<br />
40 14 1,18 0,2 6,2 < 0,1<br />
Krusten-, Schalen-,<br />
Weichtiere,<br />
sonstige Tiere und<br />
Erzeugnisse daraus<br />
20 19 0,15 0,14 < 0,2 < 0,1<br />
Getreide 106 80 0,27 0,16 2,4 < 0,04<br />
Getreideprodukte<br />
Backvormischungen,<br />
Brotteige, Massen<br />
und Teige für<br />
Backwaren<br />
1 1 0,2 0,2 < 0,2 < 0,2<br />
Hülsenfrüchte, Ölsamen,<br />
Schalenobst<br />
4 2 0,25 0,23 0,5 < 0,05<br />
Kartoffeln, stärkereiche<br />
Pflanzenteile<br />
48 39 0,20 0,14 1,6 < 0,08<br />
Frischgemüse 162 142 0,27 0,14 17 < 0,05<br />
Pilze 95 3 74,0 26,0 451 < < 0,08<br />
Frischobst 55 54 0,13 0,11 < 0,29 < 0,06<br />
Honige, Imkereierzeugnisse<br />
und<br />
Brotaufstriche<br />
44 17 5,8 0,28 76,2 < 0,14<br />
286
Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung<br />
22 18 0,21 0,12 1,3 < 0,06<br />
Fertiggerichte,<br />
zubereitete Speisen<br />
103 67 0,17 0,12 1,3 < 0,04<br />
Trink-, Mineral-, Tafel-<br />
,<br />
Quell-, Brauchwasser<br />
26 26 0,02 0,01 0,27 < 0,01<br />
technische<br />
Untersuchungen<br />
3 0 30,63 26,1 40 25,8<br />
Frauenmilch 34 34 0,20 0,2 < 0,30 < 0,18<br />
Tabelle 4.17.10.5 Untersuchungen auf Sr-90 in 2006 - Inland-Proben<br />
Material Probenzahl Bereich i [Bq/kg] bzw. [Bq/L]<br />
Gesamt Kleiner<br />
NG Mittelwert Medianwert Maximalwert Minimalwert<br />
Milch 57 0 0,04 0,04 0,14 0,025<br />
Fische und<br />
Fischzuschnitte<br />
4 1 0,03 0,026 0,047 < 0,02<br />
Krusten- Schalen-<br />
Weichtiere und<br />
Erzeugnisse daraus<br />
12 11 0,02 0,02 0,03 < 0,02<br />
Getreide 12 0 0,156 0,173 0,258 0,05<br />
Kartoffeln und<br />
stärkereiche<br />
Pflanzenteile<br />
4 1 0,04 0,037 0,07 < 0,02<br />
Frischgemüse 12 0 0,21 0,17 0,42 0,077<br />
Pilze 1 0 0,027 0,027 0,027 0,027<br />
Frischobst<br />
einschließlich<br />
Rhabarber<br />
4 3 0,044 0,03 0,094 < 0,02<br />
Säuglings- und<br />
Kleinkindernahrung<br />
5 2 0,029 0,02 0,049 < 0,019<br />
Fertiggerichte,<br />
zubereitete Speisen<br />
24 4 0,047 0,044 0,126 < 0,02<br />
Trinkwasser 5 0 0,004 0,004 0,006 0,003<br />
Strahlenschutzvorsorgegesetz<br />
An der Durchführung ist das Niedersächsische Landesamt für Wasser-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), die Landwirtschaftliche<br />
Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Oldenburg, sowie das LAVES beteiligt. Im Durchführungserlass sind die<br />
Zuständigkeiten und die jeweiligen Probenzahlen für die in den Lebensmittelinstituten Braunschweig und Oldenburg, sowie im<br />
Institut für Fischkunde Cuxhaven und im veterinärinstitut Hannover angesiedelten vier Messstellen des LAVES festgelegt. An der<br />
von den Messstellen direkt in Auftrag gegebenen Probenahme sind die Lebensmittel-Überwachungsbehörden, die<br />
Gesundheitsämter und die Forstämter eingebunden. Die Untersuchungsergebnisse werden mit dem Integrierten Mess- und<br />
Informationssystem des Bundes (IMIS) über die Zentrale des Bundes an die Leitstellen übertragen, dort auf Plausibilität geprüft und<br />
zur Information der Öffentlichkeit und des Bundes ausgewertet. Zum Zweck des schnellen Datentransfers (Erfahrung aus der<br />
Tschernobyl–Katastrophe) wurde 1989 das IMIS eingeführt. Um die sofortige Einsatzbereitschaft auch für den Ereignisfall zu<br />
sichern, wird unter Anwendung verschiedener Übungsmodule über das System der Alarmzustand simuliert. Grundlage ist das in der<br />
Richtlinie für die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (Teil II: Intensivmessprogramm) beschriebene Konzept bezüglich<br />
Alarmierung, Probenauswahl, Probenahme, Messung und Datenübermittlung.<br />
Die in der Vergangenheit jeweils erfolgreiche Teilnahme an IMIS-Übungen hat gezeigt, dass die Messstellen für die<br />
Überwachung der Umweltradioaktivität nach § 3 StrVG in <strong>Niedersachsen</strong> im Falle einer radiologischen Notstandssituation alle<br />
287
erforderlichen Messdaten dem Bund und dem Land <strong>Niedersachsen</strong> für eine schnelle Lagedarstellung innerhalb der geforderten<br />
kurzen Zeiträume zur Verfügung stellen können.<br />
Die durch den Unfall in Tschernobyl und in den Übungen gemachten positiven Erfahrungen bezüglich der Arbeitsabläufe im<br />
Ereignisfall, wie auch die Erfahrungen aus den Ergebnissen der Überwachung der Umweltradioaktivität wurden von den<br />
Radioaktivitätsmessstellen in den Durchführungserlass eingearbeitet. Dieser wurde vom ML mit allen beteiligten Behörden<br />
abgestimmt, und dient seit dem 1. Januar 2001 als Arbeitsgrundlage der Messstellen des LAVES. Mit den jährlich durchgeführten<br />
IMIS - Übungen ist sie weiterhin aktuell.<br />
Die Organisation der Radioaktivitätsüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> wurde deshalb mit Errichtung des Niedersächsischen<br />
Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) beibehalten.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> ist daher auch weiterhin in der Lage, im Falle eines radiologischen Ereignisses die Radioaktivität in<br />
Lebensmitteln, Trinkwasser und Bioindikatoren zielgerichtet und zeitnah zu ermitteln.<br />
Sonderprogramm Wildpilze<br />
Von den Wildpilzen waren wie in den vorherigen Jahren die Maronenröhrlinge am höchsten belastet. Im Vergleich zu den Vorjahren<br />
war das Jahr 2005 ebenso wie das Jahr 2003 auf Grund der witterungsbedingten Einflüsse und der damit verbundenen sehr<br />
geringen Probenzahl (42) nicht repräsentativ (siehe<br />
Abbildung 4.17.10.1). Vorgesehen ist für jedes Jahr 160 Proben an wildwachsenden sortenreinen Speisepilzen zu untersuchen. Die<br />
Maronenröhrlinge sind weiterhin höher als Steinpilze mit radioaktivem Cäsium belastet. Eine Ursache ist, dass die<br />
Pflanzenverfügbarkeit des Cäsiums von der Zusammensetzung und dem Säuregrad des Bodens abhängig ist. In sauren<br />
Heideböden wie auch im unbearbeiteten Waldboden ist das Cäsium nicht an Tonminerale gebunden und daher sehr mobil. Auf<br />
Grund von Niederschlägen und den dadurch bedingten Auswaschungen wurde das radioaktive Cäsium in tiefere Bodenschichten<br />
verlagert und befindet sich nun im Bereich des Mycels der Steinpilze, welches im Vergleich zur Marone tiefer im Waldboden liegt.<br />
Während der Tiefenverlagerung findet eine Verbreiterung der aktivitätsführenden Bodenschicht statt, was einer Verdünnung im<br />
Boden gleichkommt. Dadurch ist die spezifische Aktivität des Bodens im Bereich des Steinpilzmycels niedriger als die ursprüngliche<br />
spezifische Aktivität des Bodens im Bereich des Mycels der Maronenröhrlinge. Es ist zu erwarten, dass die Cäsiumgehalte der<br />
Steinpilze über einen längeren Zeitraum konstant bleiben, da sich die spezifische Aktivität der Bodenschicht des Steinpilzmycels<br />
solange nicht ändert, wie radioaktives Cäsium aus höheren Bodenschichten zugeführt wird und gleichzeitig durch Auswaschung<br />
verlässt. Dadurch besteht ein Zusammenhang zwischen der Aufnahme über das Mycel der Steinpilze und weiterer Zufuhr von<br />
Cäsium-137 aus höheren Bodenschichten. Vermutlich wird die spezifische Aktivität der Steinpilze erst dann deutlich abnehmen,<br />
wenn die Cäsium-137-Gehalte in Maronen die gleiche Größenordnung wie in Steinpilzen aufweisen oder sogar niedriger liegen.<br />
Dieser Trend scheint für die trockenen Jahre 2001 und 2002 durchbrochen zu sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass die durch<br />
Verdunstung im Boden aufsteigende Feuchtigkeit das sehr mobile Cs-Nuklid wieder zurück in höhere Schichten verfrachtet und das<br />
Ausbleiben des weiteren Absinkens der Cs-137 Gehalte der Maronenröhrlinge erklären könnte.<br />
Die Messergebnisse des Jahres 2005 zeigen die Fortführung des zeitlichen Verlaufs der Aktivitätskonzentration in<br />
wildwachsenden Speisepilzen aus <strong>Niedersachsen</strong>. Der niedrige Wert für das Jahr 2003 und 2005 begründet sich aus<br />
witterungsbedingtem Ausbleiben der Fruchtkörperbildung an höher belasteten Standorten. Dadurch wurden vermehrt relativ<br />
unbelastete Pilze zur Messung eingeliefert. Als Nahrungsmittel für Mensch und Tier tragen in <strong>Niedersachsen</strong> Maronenröhrlinge,<br />
sowie in untergeordnetem Maße auch andere wildwachsende Speisepilze zur Dosisbelastung über den Nahrungsmittelpfad bei.<br />
Weiszenburger, W. (LI BS)<br />
288
Bq / kg (Frischsubstanz)<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Abbildung 4.17.10.1 Mittelwerte der Gesamtcäsiumaktivität in essbaren Wildpilzen aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
Wildfleisch (Sonderprogramm Wild)<br />
Mittelwerte der Gesamtcäsiumaktivität in eßbaren Wildpilzen aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Maronen Steinpilze Hallimasch<br />
Nach dem Tschernobylunfall wurde verstärkt Wildfleisch untersucht, da bei diesem aufgrund früherer Messungen Werte von<br />
deutlich über dem Grenzwert von 600 Bq/kg zu vermuten waren. Diese Untersuchungen waren allerdings in <strong>Niedersachsen</strong><br />
zunächst auf Wildwiederkäuer höher belasteter Gebiete konzentriert. Da nahezu alle in diesen Regionen erlegten Stücke untersucht<br />
werden, waren sie entsprechend überrepräsentiert. Das führte zu einer Verfälschung der statistischen Mittel- und Medianwerte im<br />
Sinne einer Überhöhung. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde das „Sonderprogramm Wild“ initiiert.<br />
Seit 1988 werden im Rahmen dieses Sonderprogramms jährlich 160 Proben unterschiedlicher Haarwildarten abhängig vom<br />
Jagdaufkommen aus allen Teilen <strong>Niedersachsen</strong>s angefordert. Dieses ist bundesweit das umfangreichste, kontinuierlich<br />
durchgeführte Wild-Messprogramm. Da Rehwild aufgrund seiner Standorttreue als gut geeigneter Bioindikator gilt, wird diese<br />
Wildart mit ca. 75 % der Proben bevorzugt untersucht. Anhand dieses Programms lassen sich recht zuverlässige Beobachtungen<br />
bezüglich der durchschnittlichen Strahlenbelastung im niedersächsischen Wild, der örtlichen Belastungsschwerpunkte sowie<br />
langfristiger Entwicklungen durchführen.<br />
289
Reh, Rot- und Damwild<br />
Seit 1994 stagniert der Medianwert für Gesamtcäsium beim Rehwild um 20 Bq/kg nachdem in den Vorjahren zunächst eine<br />
kontinuierliche Abnahme zu verzeichnen war. Geringe Schwankungen sind vermutlich witterungs- bzw. vegetationsbedingt und<br />
abhängig von der Jahreszeit. Die Belastung des Rot- und Damwildes liegt für 2006 bei Werten zwischen 2,6 Bq/kg und 20 Bq/kg.<br />
Der Medianwert entspricht in den letzten Jahren der des Rehwildes. Bei Rehwild wird dagegen eine höhere Bandbreite (
4.17.11 Authentizitätsanalyse<br />
Einführung<br />
Im Jahr 2006 wurden über 450 Proben zur Untersuchung angenommen. Die Analysen dienten dem Aufbau und der Erweiterung des<br />
Wissens über die Isotopenverteilung in Lebensmitteln, der Vorbereitung weiterer Projekte und der konkreten Lebensmittelkontrolle.<br />
Das Untersuchungsspektrum wurde erweitert. Die hohe Probenzahl war nur durch die Zuverlässigkeit der Analysengeräte und die<br />
hohe Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter/in möglich.<br />
Untersuchungen<br />
- Spargel<br />
Im Berichtsjahr wurden 88 Spargelproben untersucht. 26 Proben stammten aus dem Handel. 44 Proben wurden im Rahmen des<br />
Aufbaus der bundesweiten Spargeldatenbank untersucht oder waren Vergleichsproben zu beanstandeten Proben oder<br />
Verdachtsproben. Für das Land Brandenburg wurden zehn Referenzproben und neun Proben mit der Herkunft Polen untersucht.<br />
Hierbei sollte herausgefunden werden, ob Spargel aus dem Brandenburger Anbaugebiet um Beelitz und Spargel aus dem<br />
Anbaugebiet bei Posen voneinander unterschieden werden können, was letztendlich bejaht werden konnte (DLR 11, 2006 523-<br />
526). Außerdem wurden in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Osnabrück (Fachbereich Gartenbau) acht Proben im Laufe<br />
der Saison von einem Feld untersucht, um die natürliche Streuung der Spargelisotopenwerte kennen zu lernen. Das ist wichtig, um<br />
bei Proben, die in Verdacht stehen, falsch gekennzeichnet zu sein, mit Hilfe von Vergleichsproben vom Feld die tatsächliche<br />
Herkunft überprüfen zu können (DLR 12, 2006, 545-547).<br />
Die Proben wurden im Lebensmittelinstitut Oldenburg untersucht auf die Parameter<br />
• d 18 O/ 16 O im Gewebewasser des Spargels<br />
• d 13 C/ 12 C im Protein des Spargels und<br />
• d 15 N/ 14 N im Protein des Spargels<br />
- Niederschlag<br />
Die Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde fortgesetzt. Die Mitarbeiter des DWD auf dem Flugplatz im<br />
Stadtnorden Oldenburgs sammeln Niederschlag für das Isotopenlabor des Lebensmittelinstituts Oldenburg. Jeweils der innerhalb<br />
eines Monats gesammelte Niederschlag wird im Lebensmittelinstitut gemessen.<br />
- Honig<br />
Die Untersuchungen an Honig wurden im Berichtsjahr fortgeführt. Insgesamt wurden 76 Honige untersucht, davon 27 authentische<br />
Honige, die vom Bieneninstitut (25 Honige) bzw. von den litauischen Lebensmittelkontrollbehörden (zwei Honige) zur Verfügung<br />
gestellt worden waren (Lebensmittelchemie 60, 2006 99-100). Bei Honigen aus dem Handel in Deutschland ergaben sich keine<br />
Verdachtsmomente für Falschdeklaration. Die Abbildungen 4.17.11.1 und 4.17.11.2 zeigen zwei Beispiele für die Unterscheidung<br />
von Honig aus Mittel- oder Süd-Amerika (Kreis und Viereck) und Honig aus Asien (Raute und Dreieck). Als besonders interessant<br />
erwies sich die Untersuchung der Isotopenverhältnisse im aus dem Honig isolierten Wasser.<br />
Abbildung 4.17.11.1: Kohlenstoff-Isotopenverhältnisse in Honig<br />
aus Süd- und Mittelamerika und aus Asien<br />
291
Abbildung 4.17.11.2: Wasserstoff-Isotopenverhältnisse in Honig aus Süd- und Mittelamerika und aus Asien<br />
- Geflügel<br />
Zum Beispiel um dem Ausbruch von Tierkrankheiten vorzubeugen, ist die<br />
Einfuhr von Geflügel aus verschiedenen Staaten verboten. Es wird<br />
vermutet, dass Einfuhrverbote durch Angabe der falschen Herkunft<br />
umgangen werden. Die Analyse der Stabilen Isotope ist eine Möglichkeit,<br />
den Fälschern auf die Spur zu kommen. Am Anfang steht jedoch, wie<br />
immer, das Sammeln von Daten. Im Jahr 2005 wurde mit der Analyse von<br />
Geflügelfleisch, das über die Grenzkontrollstelle Hamburg-Harburg<br />
importiert wurde, begonnen. Im Jahr 2006 folgte eine zweite Serie von<br />
Proben.<br />
Die Untersuchung stützt sich auf zwei Säulen:<br />
Zunächst wird davon ausgegangen, dass das Tränkewasser die<br />
Isotopensignatur der Region widerspiegelt, in der die Tiere gehalten<br />
werden. Das Futter, kommt es aus der Region, trägt ebenfalls dazu bei.<br />
Um diese Informationen zu gewinnen, werden sowohl im Fleischsaft als<br />
auch im Rohprotein die Wasserstoff- und Sauerstoffisotopenverhältnisse<br />
gemessen. Da die Haltungs- und Fütterungsformen sich in verschiedenen<br />
Teilen der Welt unterscheiden, können sowohl das<br />
Stabilisotopenverhältnis des Kohlenstoffs (Ausmaß des Einsatzes von<br />
Mais) als auch das des Stickstoffs (Düngung) zur regionalen Zuordnung<br />
beitragen. Abbildung 4.17.11.3 zeigt die Unterschiede zwischen<br />
Geflügelprodukten verschiedener Herkünfte.<br />
Abbildung 4.17.11.3: Wasserstoff- und Sauerstoffisotopenverhältnisse bei Geflügelprodukten verschiedener Herkünfte<br />
- Apfelsaft<br />
Die Fruchtsaftindustrie nutzt häufig die Möglichkeit, Säfte durch Wasserentzug zu konzentrieren und sie dadurch besser lagerfähig<br />
zu machen. Gleichzeitig kann auf diese Weise mehr Fruchtsaft in weniger Volumen (also kostengünstiger) gelagert oder<br />
transportiert werden. Durch Zusatz speziell aufbereiteten Trinkwassers wird aus dem Konzentrat wieder Fruchtsaft hergestellt. Nach<br />
der Fruchtsaftverordnung werden "Fruchtsaft" und "Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat" unterschieden. Der Verbraucher würde bei<br />
gleichem Preis Ware bevorzugen, die nicht konzentriert und wieder rückverdünnt wurde. Um bei Fruchtsaft, der direkt nach dem<br />
Pressen und Pasteurisieren abgefüllt wurde und in den Handel gegeben wird, darauf aufmerksam zu machen, dass kein<br />
rückverdünntes Produkt vorliegt, wird häufig mit dem Begriff Direktsaft geworben. Rückverdünnter Fruchtsaft ist in der Regel<br />
preiswerter als Direktsaft. Es gibt keine Legaldefinition für "Direktsaft".<br />
Um über die klassische Analytik hinaus zu überprüfen, ob die Kennzeichnung bei Apfelsaft keine falschen Angaben über die<br />
Verarbeitung (aus Konzentrat rückverdünnt oder unverändert) enthielt und ob Verfälschungen durch den Zusatz von Zucker oder<br />
Säure vorgenommen worden waren, wurden 25 Proben Apfelsaft und eine Probe Apfel-Acerola-Saft mit Hilfe der Abbildung<br />
292
4.17.11.4: Wasserstoff- und Sauerstoffisotopenwerte bei Apfelsaft<br />
Stabilisotopenanalyse untersucht. Abbildung 4.17.11.4 zeigt, dass bereits durch die alleinige Messung des<br />
Sauerstoffisotopenverhältnisses des Wassers zwischen Fruchtsaft und rückverdünntem Saft unterschieden werden kann. Durch die<br />
2-dimensionale Darstellung wird deutlich, dass der rückverdünnte Saft der "meteoric water line" folgt, während der Fruchtsaft<br />
weniger stark an schweren Isotopen abgereichert ist. Eine Probe Saft, die sicherlich nicht aus Konzentrat hergestellt worden war,<br />
war als rückverdünnt gekennzeichnet. Abbildung 4.17.11.5 zeigt Unterschiede der Kohlenstoffisotopenverhältnisse bei Fruchtsaft<br />
und aus Konzentrat rückverdünntem Saft. Das liegt daran, dass wegen der höheren Transportkosten bei Fruchtsaft dieser eher aus<br />
näher gelegenen Anbaugebieten stammt, während Apfelsaftkonzentrat auch aus weiter entfernt liegenden und klimatisch anderen<br />
Regionen kommt. Fazit der Untersuchungen: Eine Kennzeichnung zum Nachteil des Verbrauchers wurde nicht gefunden.<br />
Abbildung 4.17.11.5: Kohlenstoffisotopenwerte im Zucker und in der Säure des Apfelsaftes<br />
- Äpfel<br />
Zur Statuserhebung und zur Unterstützung der Beurteilung von Apfelsäften wurden 43 Äpfel der Saison 2006 untersucht. Die<br />
meisten Äpfel wurden in den Landkreisen Stade, Harburg und Cuxhaven, wo sich die bedeutendsten Anbaugebiete Deutschlands<br />
befinden, direkt beim Erzeuger entnommen. Ein Teil entstammte dem Handel. In Tabelle 4.17.11.1 werden die aus den Jahren<br />
2003, 2004 und 2006 ermittelten Kennzahlen dargestellt.<br />
N Mittelw. Median Minimum Maximum<br />
d 18 O (Saft) 75 -4,1 -4,1 -4,9 -2,6<br />
d 2 H (Saft) 53 -39,3 -39,6 -48,2 -28,8<br />
d 13 C (Zucker) 75 -26,3 -26,3 -29,7 -23,9<br />
d 13 C (Pulpe) 75 -27,2 -27,2 -29,9 -23,8<br />
d 13 C (Säure-Ca-Salz) 75 -26,3 -26,3 -28,6 -23,6<br />
Tabelle 4.17.11.1: Apfelkennzahlen (2003, 2004, 2006)<br />
293
- Vanille<br />
Die Stabilisotopenanalyse gestattet den Nachweis der Verwendung von naturidentischem Vanillin (chemisch synthetisiert) und von<br />
biotechnologisch hergestelltem Vanillin. Man nutzt dabei, dass das Isotopenverhältnis des Kohlenstoffes je nach Herkunft einen<br />
anderen Wert trägt. Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 3 dargestellt.<br />
- Danksagung<br />
Für ihren Einsatz bei der Probenahme und der Gewinnung der zusätzlichen Informationen zur Probe sei den Mitarbeiter/innen der<br />
Lebensmittelkontrolle in Brandenburg und Berlin, der Grenzkontrollstelle Hamburg-Harburg, der FH Osnabrück, des Instituts für<br />
Bienenkunde, des DWD und nicht zuletzt den Lebensmittelkontrolleuren/innen in <strong>Niedersachsen</strong>, die durch ihre Probenlieferungen<br />
zum wachsenden Erfahrungsschatz der Messstelle für Stabile Isotope im LI Oldenburg beigetragen haben, gedankt.<br />
Dr. Meylahn, K.; Wolf, E. (LI OL)<br />
4.18 Bedarfsgegenstände<br />
4.18.1 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 2.071<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 182<br />
Den Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt sind die Bereiche Verpackungsmaterial, Gegenstände zum Verzehr von<br />
Lebensmitteln, Gegenstände zum Kochen, Braten, Grillen, sonstige Gegenstände zur Herstellung und Behandlung von<br />
Lebensmitteln sowie Maschinen zur gewerblichen Herstellung von Lebensmitteln zuzuordnen. Ausgerichtet an der Produktpalette<br />
werden Erzeugnisse im Rahmen der Probenpläne angefordert. Unter bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren Bedingungen<br />
ihrer Verwendung dürfen an die Lebensmittel keine Bestandteile in einer Menge abgeben werden, die geeignet ist<br />
- eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darzustellen<br />
- die Zusammensetzung oder Eigenschaften der Lebensmittel in Geruch, Geschmack oder Aussehen nachteilig zu<br />
beeinflussen<br />
Kennzeichnung von Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt<br />
Mit Inkrafttreten der sogenannten EG-Bedarfsgegenstände Verordnung (VO (EG) 1935/2004) am <strong>3.</strong> Dezember 2004 wurde u. a.<br />
auch die Kennzeichnung von Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt umfassender geregelt. Dies hat insbesondere<br />
Auswirkungen auf die Herstellerkennzeichnung von Bedarfsgegenständen, die noch nicht mit Lebensmitteln in Berührung<br />
gekommen sind. War zuvor die alleinige Angabe des eingetragen Warenzeichen des Herstellers, des Verarbeiters oder eines in der<br />
Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufers als Herstellerkennzeichnung ausreichend, so muss nunmehr gemäß Artikel 15 Abs. 1<br />
c) zusätzlich eine Anschrift des Herstellers, Verarbeiters oder eines in der Gemeinschaft niedergelassenen und für das<br />
Inverkehrbringen verantwortlichen Verkäufers angegeben werden. Die Übergangsregelung in Art. 27 ermöglicht jedoch für<br />
Materialien und Gegenstände, die vor dem <strong>3.</strong> Dezember 2004 rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, den Abverkauf von<br />
Restbeständen auf unbestimmte Zeit.<br />
Obwohl viele Hersteller mittlerweile die Kennzeichnung ihrer Produkte entsprechend den Anforderungen der VO (EG) 1935/2004<br />
erweitert haben, waren im 4. Quartal 2006 noch häufig Produkte mit unzureichender Herstellerkennzeichnung im Handel<br />
anzutreffen. Dementsprechend musste der überwiegende Teil der zur Untersuchung eingereichten Proben dahin gehend überprüft<br />
werden, ob die Übergangsregelung aus Art. 27 anzuwenden ist.<br />
Es ist davon auszugehen, dass der Abverkauf der Restbestände auch in den nächsten Jahren noch andauern wird und somit ein<br />
beträchtlicher Teil der Proben auf Anwendbarkeit der Übergangsregelung hin überprüft werden muss.<br />
Küchenhelfer aus Polyamid<br />
Pfannenwender und „Küchenhelfer“ aus Polyamid sind in den Vorjahren wegen einer erhöhten Abgabe von primären aromatischen<br />
Aminen (PAA) aufgefallen, insbesondere entsprachen sog. "Billigprodukte“ nicht den an sie zu stellenden Anforderungen. Die<br />
Untersuchung von „Küchenutensilien“ wurde daher im Jahr 2006 in den Bundesweiten Überwachungsplan (BÜP) aufgenommen,<br />
wobei insbesondere Produkte aus dem asiatischen Bereich Berücksichtigung finden sollten. Diese Vorgabe führt bei den<br />
294
Probenahmen vor Ort zu Schwierigkeiten, da eine Angabe des Herstellungslandes in der Regel nicht vorhanden ist - auch nicht<br />
gefordert werden kann - und somit nur im Einzelfall bekannt ist.<br />
Nach Artikel 3 der VO (EG) 1935/2004 sind Gegenstände nach guter Herstellungspraxis so herzustellen, dass sie bestimmte<br />
Anforderungen (siehe Einleitung) erfüllen. Zur Interpretation dieser allgemeinen Anforderung dient die<br />
Bedarfsgegenständeverordnung. Danach dürfen Bedarfsgegenstände aus Kunststoff, die unter Verwendung aromatischer<br />
Isocyanate oder durch Diazokupplung gewonnener Farbstoffe hergestellt werden, primäre aromatische Amine (ausgedrückt als<br />
Anilin) nicht in einer nachweisbaren Menge abgeben (Nachweisgrenze: 0,02 mg/kg Lebensmittelsimulanz - entsprechend 3,3<br />
µg/dm²). Bei der Untersuchung erfolgte zunächst die photometrische Bestimmung der PAA im Migrat (Migrationsbedingungen:<br />
Essigsäure 3 %ig, 2 Stunden, 70 °C). Bei einer erhöhten Abgabe von PAA ist die Migration an demselben Gegenstand zweimal zu<br />
wiederholen; im <strong>3.</strong> Migrat erfolgt dann eine spezifische Aminbestimmung.<br />
Im Rahmen des BÜP sind insgesamt 37 Proben Pfannenwender, Schaumkellen, Schöpfkellen, Spaghettilöffel, Schneebesen<br />
sowie Multizangen aus Polyamid eingesandt worden. Bei sieben Proben wurde eine überhöhte Abgabe von PAA festgestellt. Bei<br />
der spezifischen Aminbestimmung mittels HPLC wurde 4,4’-Diaminodiphenylmethan nachgewiesen und bestimmt. Dieser Stoff<br />
gehört zu der Gruppe der aromatischen primären Amine. Gemäß RL 67/548/EWG wird 4,4’-Diaminodiphenylmethan als<br />
krebserzeugend der Kategorie 2 und erbgutverändernd der Kategorie 3 eingestuft. Nach Kunststoffempfehlung X des BfR ist<br />
Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat ein für Polyamid zulässiger, monomerer Stoff; daraus lässt sich nach hiesiger Ansicht die<br />
Anwesenheit von 4,4’-Diaminodiphenylmethan ableiten.<br />
Weiterhin ist bei den Küchenhelfern, die aufgrund einer überhöhten Abgabe an PAA zu beanstanden waren, anzumerken, dass<br />
sie häufig auch in Hinblick auf die organoleptischen Eigenschaften auffällig waren – intensiver Geruch nach Kunststoff, brenzlig,<br />
bitterer Geschmack - und auch in dieser Hinsicht nicht den rechtlichen Anforderungen entsprachen.<br />
Eichhoff, S.; Schmidt, O. (IFB LG)<br />
4.18.2 Bedarfsgegenstände mit Haut- und Schleimhautkontakt<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 375<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 10<br />
WM Fanartikel<br />
In Verbindung mit der FIFA WM 2006 in Deutschland waren Fanartikel schon Monate vor Beginn der WM im Handel. Neben reinen<br />
Dekorationserzeugnissen und Spielwaren wurden auch Sport- Bekleidungsgegenstände wie T-Shirts, Fußball-Trikots,<br />
Torwarthandschuhe, Schweißbänder sowie Socken und Hosen zum Verkauf angeboten. Entsprechende Produkte wurden im<br />
Rahmen des Verbraucherschutzes für das 1. Quartal 2006 berücksichtigt. Im Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG)<br />
sind textile Erzeugnisse mit dem speziellen Aufdruck „Official Liccensed Product FIFA World CUP Germany 2006“ und einer Lizenz-<br />
Nr. ausgestattet zur Untersuchung eingereicht worden und Bedarfsgegenstände mit nicht nur vorübergehendem Körperkontakt, die<br />
in Zusammenhang mit dem Großereignis gesehen werden können, da sie Aufdrucke wie Germany, eine Landesflagge oder Namen<br />
von Fußballverein tragen, von den niedersächsischen Kreisen und Städten zur Untersuchung übersandt worden. Diese insgesamt<br />
38 Bekleidungsgegenstände wurden auf Textilhilfsmittel hin überprüft. Weiterhin gab es acht Proben Spielwaren bzw.<br />
Dekorationsartikel. Bei der Untersuchung der Proben wurden die folgenden Analysenparameter berücksichtigt:<br />
- Formaldehyd<br />
- Schweiß- und Farbechtheit<br />
- flüchtige Substanzen<br />
- verbotene Azofarbstoffe<br />
- allergieauslösende Dispersionsfarbstoffe<br />
- Schwermetallmigration<br />
- organische Zinnverbindungen<br />
- organische Quecksilberverbindungen<br />
Das erfreuliche Ergebnis: Die untersuchten Produkte ergaben wenig Anlass zur Beanstandung. Zwei Sport-T-Shirts, ein Paar<br />
Torwarthandschuhe und ein Schweißband zeigten keine ausreichende Farbechtheit. Gerade bei sportlicher Aktivität und damit<br />
Schweißabsonderung ist hier eine Abfärbung auf die Haut vorhersehbar. Bei einem roten Sport-T-Shirt wurde der Allergie<br />
auslösende Farbstoff Dispersionsrot 1 festgestellt. Beim Tragen ist hier eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen; gefährdet<br />
sind dafür disponierte Personen.<br />
Bei einem Sportschal mit Vereinsaufdruck fehlte die Kennzeichnung der verwendeten Textilrohstoffe. Dies ist gemäß<br />
Textilkennzeichnungsgesetz vorgeschrieben.<br />
Bei einem WM-Maskottchen wurden die organischen Zinnverbindungen Monobutylzinn und Dibutylzinn nachgewiesen. Basierend<br />
auf Risikoabschätzungen entspricht die Verwendung von organischen Zinnverbindungen bei bestimmten Bedarfsgegenständen im<br />
295
Rahmen der Guten Herstellungspraxis nicht mehr dem EU-Standard (Opinion of the Scienitific commitee). Es ist empfehlenswert<br />
diese Anforderungen auch auf Spielwaren / Dekoartikel zu übertragen und vollständig auf die Verwendung und den Einsatz von<br />
organischen Zinnverbindungen zu verzichten.<br />
Dr. Punkert, M. (IfB LG)<br />
4.18.3 Spielwaren und Scherzartikel<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 475<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 49<br />
Fingermalfarben – nicht immer mikrobiologisch einwandfrei<br />
Spielwaren sind nach der Richtlinie 88/378/EWG über die Sicherheit von Spielzeug derart zu gestalten und herzustellen, dass<br />
Hygiene- und Reinheitsanforderungen erfüllt werden, damit Infektions-, Krankheits- und Ansteckungsgefahren vermieden werden.<br />
Aufgrund ihrer Zusammensetzung aus u. a. Füllstoffen, Binde- und Feuchthaltemitteln wie Gips, Kreide, Stärken, Dextrine, Glycerin,<br />
Polyglykole und Wasser gehören Fingermalfarben zu den für Mikroorganismen anfälligen Erzeugnissen. Sie werden daher in der<br />
Regel unter Zusatz von Konservierungsstoffen hergestellt. In 2006 wurden im IfB LG 24 Einzelproben Fingermalfarbe auf ihre<br />
mikrobiologische Beschaffenheit überprüft. Die Fingermalfarben wurden als einzelne Packungen und in 3er- oder 4er-Packungen<br />
mit unterschiedlichen Farben eingesandt. Neun Einzelproben Fingermalfarben erwiesen sich als mikrobiell belastet.<br />
Bei drei Fingermalfarben einer 4er-Packung wurde die Kontamination mit Pseudomonas aeruginosa in einer Konzentration von<br />
bis zu 1,5 x 10 5 KBE/g ermittelt. Für Spielzeug existiert kein Grenzwert für die Belastung mit Keimen. In einer Stellungnahme des<br />
ehemaligen Bundesinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (jetzt Bundesinstitutes für<br />
Risikobewertung (BfR)) betreffend der Keimbelastung von Kosmetika mit Pseudomonas spp. vom 7. Februar 2000 wird der Keim<br />
Pseudomonas aeruginosa als primär pathogen eingestuft. Er ist als Infektionserreger bekannt, insbesondere bei Personen mit<br />
vorgeschädigter Haut oder Schleimhaut oder bei Säuglingen. Der Nachweis von Pseudomonas aeruginosa in kosmetischen Mitteln<br />
weist auf eine potentielle Gesundheitsgefährdung hin. Fingermalfarben sind speziell für Kinder angefertigte farbige Zubereitungen in<br />
Form von Pasten, die dazu bestimmt sind, direkt mit den Fingern und Händen auf geeignete Flächen aufgetragen zu werden. Ein<br />
längerer Kontakt mit der Haut ist beabsichtigt, ein Kontakt mit den Augen ist insbesondere bei kleineren Kindern nicht<br />
auszuschließen. Beim Spielen mit derart kontaminierter Fingermalfarbe können - insbesondere bei Kindern mit verletzter Haut -<br />
Infektionen auftreten.<br />
Bei den übrigen kontaminierten Fingermalfarben - bei einer 4er-Packung waren drei Einzelproben keimbelastet - wurden diverse<br />
Keime nicht pathogener Art wie Pseudomonas spec., Aerococcus spec., Enterococcus spec. in Konzentrationen von bis zu 2,1 x 10 6<br />
KBE/g nachgewiesen. Diese Keime sind als Hinweis auf unzureichende Betriebshygiene und/oder mikrobiologisch belastetes<br />
Ausgangsmaterial zu werten.<br />
Es wurde die Überprüfung der Produktionshygiene der betreffenden Betriebe sowie die Ausschaltung der Kontaminationsquellen<br />
gefordert.<br />
Dr. Lobsien, M.; Schnug-Reuter, B. (IFB LG)<br />
Spielsand<br />
Für die Sandkiste im Garten kann der Verbraucher Spielsand in 25 kg- oder 15 kg-Gebinden im Fachgeschäft oder Baumarkt<br />
erwerben. Dieser Spielsand muss wie jedes Spielzeug die Forderungen der Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug (2.<br />
GPSGV) sowie des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) erfüllen. Allgemeine Forderungen<br />
sind:<br />
- Spielsand muss sicher sein<br />
- er muss so beschaffen sein, dass beim Spielen die Gesundheit der Kinder insbesondere durch die stoffliche<br />
Zusammensetzung sowie den hygienischen Zustand nicht geschädigt wird<br />
- jede Gefahr von Verletzung oder Vergiftung durch den Kontakt mit dem Spielzeug Sand (Verschlucken, Einatmen,<br />
Berührung mit der Haut, den Schleimhäuten oder den Augen) muss ausgeschlossen sein<br />
- zur Information und Sicherheit des Verbrauchers muss der Spielsand bestimmte Kennzeichnungselemente tragen<br />
Auf seiner Verpackung sind anzugeben:<br />
- die CE-Kennzeichnung: durch das Anbringen des CE-Kennzeichens bestätigt der Hersteller oder sein Bevollmächtigter,<br />
dass der Spielsand den europäischen Sicherheitsanforderungen entspricht<br />
- der Name ggf. die Firma oder das Zeichen sowie die Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten<br />
Es wurden fünf Proben Spielsand drei verschiedener Hersteller überprüft. Im Vergleich zu derartigen Untersuchungen im Jahr 2001<br />
296
lieb die hygienische Beschaffenheit der Proben ohne Beanstandungen. Auch die chemische Beschaffenheit – hier wurden<br />
Schwermetallgehalte, Säuregrad, Gehalt an organischen Bestandteilen (entspricht Anteil an pflanzlichen u. a. organischen<br />
Verunreinigungen) untersucht - wies keine Mängel auf.<br />
Allein die Kennzeichnung der eingesandten Produkte entsprach nicht den oben genannten Anforderungen. Bei allen Proben<br />
fehlten Kennzeichnungselemente wie die CE-Kennzeichnung oder Angaben zum Hersteller, die die Verordnung über die Sicherheit<br />
von Spielzeug fordert. Seitens des Lüneburger Institutes wurde empfohlen, die zuständigen Behörden hierüber zu informieren.<br />
Schnug-Reuter, B. (IfB LG)<br />
4.18.4 Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel sowie sonstige Haushaltschemikalien<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 462<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 14<br />
Rolle der allergenen Duftstoffe in Wasch-, Reinigungs- und Pflegemitteln<br />
Duftstoffe sind nach Nickel die häufigsten Verursacher von Kontaktallergien. Seit dem Inkrafttreten der EU-Detergenzien-<br />
Verordnung am 8. Oktober 2005 müssen auf den Verpackungen von Wasch-, Reinigungs- und Pflegemitteln 26 der als allergen<br />
eingestuften Duftstoffe gekennzeichnet werden, wenn ihr Gehalt im Endprodukt 0,01 % überschreitet.<br />
Im IfB LG wurden im Jahr 2006 die allergenen Duftstoffe (mit Ausnahme von Baummoos- und Eichenmoosextrakt) in 44<br />
Flüssigwaschmitteln (Voll-, Color- und Feinwaschmittel), 22 Weichspülern sowie 25 Allesreinigern untersucht. Dabei konnte<br />
festgestellt werden, dass nur ca. die Hälfte dieser Duftstoffe eine nennenswerte Rolle in Wasch-, Reinigungs- und Pflegemitteln<br />
spielt.<br />
Zu den am häufigsten eingesetzten Duftstoffen gehören Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional (Lilial) und Hexyl<br />
Cinnamal, sie sind jeweils in mehr als 80 % der untersuchten Proben enthalten. Benzyl Alcohol, α-Isomethyl Ionone, Citronellol und<br />
Eugenol konnten in 50 bis 80 % der Erzeugnisse festgestellt werden. Benzyl Salicylate, Coumarin, Amyl Cinnamal und Geraniol<br />
waren in 20 bis 50 % vorhanden. Vier Substanzen (Amylcinnamyl Alcohol, Anise Alcohol, Farnesol und Methyl-2-otynoate) konnten<br />
in keinem Erzeugnis nachgewiesen werden, die restlichen Duftstoffe mit allergenem Potential traten vereinzelt auf.<br />
In den einzelnen Erzeugnissen konnten zwischen zwei und 13 allergene Duftstoffe nachgewiesen werden. Der Gehalt betrug<br />
häufig jedoch weniger als 0,01 %, so dass durchschnittlich nur drei allergene Duftstoffe in kennzeichnungspflichtigen<br />
Konzentrationen pro Probe enthalten waren. Bemerkenswert ist, dass nur die Hälfte der untersuchten Weichspüler allergene<br />
Duftstoffen in Konzentrationen von jeweils über 0,01 % enthielt. Es handelte sich hierbei überwiegend um Weichspülkonzentrate,<br />
die auch einen höheren Wirkstoffgehalt aufwiesen und demzufolge in niedrigerer Dosierung eingesetzt werden.<br />
Der Verbraucher kommt mit Wasch- und Reinigungsmitteln in der Regel nur indirekt oder in stark verdünnter Form in Kontakt. Im<br />
Vergleich zu kosmetischen Mitteln, die meistens direkt und z. T. auf der Haut verbleibend angewendet werden, spielen die<br />
Duftstoffe in Wasch-, Reinigungs- und Pflegemitteln für die Auslösung von Allergien deshalb nur eine geringe Rolle. Besonders<br />
empfindliche Personen, die bereits eine Allergie gegen einen bestimmten Duftstoff entwickelt haben, können anhand der<br />
Kennzeichnung die für sie kritischen Produkte meiden oder auf parfümfreie Erzeugnisse zurückgreifen.<br />
Weßels, B. (IfB LG)<br />
297
4.18.5 Kosmetische Mittel<br />
Anzahl der untersuchten Proben: 1.515<br />
Anzahl der beanstandeten Proben: 184<br />
Die Aufschlüsselung der Beanstandungen nach Beanstandungsgründen ist in Abbildung 4.18.5.1 dargestellt. Die Zahl der<br />
beanstandeten Proben ist niedriger, da vielfach mehrere Beanstandungsgründe vorlagen.<br />
Chargenkennung<br />
(§ 4 Abs. 1 u. 3 KosmetikV)<br />
26<br />
Warnhinweise<br />
(§ 4 Abs. 2 KosmetikV)<br />
6<br />
Abbildung 4.18.5.1: Anzahl der Beanstandungen kosmetischer Mittel, aufgeschlüsselt nach Beanstandungsgründen<br />
Mikrobiologische Beschaffenheit<br />
verbotene bzw.<br />
nicht zugelassene Stoffe,<br />
Höchstmengenüberschreitungen<br />
(§ 28 LFGB,<br />
§§ 1 – 3b KosmetikV)<br />
32<br />
Im IfB LG wurden insgesamt 808 kosmetische Mittel und 40 Tätowiermittel mikrobiologisch untersucht. Rechtsverbindliche<br />
Regelungen für die Beurteilung der mikrobiologischen Beschaffenheit gibt es derzeit nicht. Empfehlungen für kosmetische Mittel<br />
wurden vom Wissenschaftlichen Ausschuss für Konsumgüter bei der EU (SCCP) erarbeitet. Danach soll die Gesamtkeimzahl<br />
bei Produkten, die für Kinder unter drei Jahren, für die Anwendung im Augenbereich oder der Schleimhäute bestimmt sind, nicht<br />
mehr als 10 2 KBE/g oder ml betragen, bei anderen Produkten nicht mehr als 10 3 KBE/g oder ml. Pathogene Keime wie<br />
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oder Candida albicans dürfen nicht nachweisbar sein.<br />
Im Allgemeinen sind kosmetische Mittel mikrobiologisch nicht belastet. Bei fünf Proben wurden Gesamtkeimzahlen in einer<br />
Größenordnung von 10 4 bis 10 7 KBE/g festgestellt. Diese Erzeugnisse waren mit Keimen wie Pseudomonas fluorescens,<br />
Pseudomonas putida und Ralstonia pickettii belastet, die ein vergleichsweise geringes pathogenes Risiko aufweisen. Hier musste<br />
hinterfragt werden, ob entsprechend der rechtlichen Vorgaben die Produktion nach Guter Herstellungspraxis nach § 5c KosmetikV<br />
erfolgt ist.<br />
In Ungarn wurden sieben pflanzliche Haarfärbemittel eines niedersächsischen Herstellers aufgrund „nicht ausreichender<br />
mikrobieller Reinheit“ als geeignet, die Gesundheit zu schädigen, beurteilt. Die festgestellten Gesamtkeimzahlen mit bis zu<br />
298<br />
Kennzeichnung<br />
(§ 5 KosmetikV)<br />
145<br />
gesundheitsschädlich<br />
(§ 26 LFGB)<br />
5<br />
irreführende Angaben<br />
(§ 27 LFGB)<br />
34
10 6 KBE/g lagen oberhalb der Empfehlungen des SCCP, wobei in einem Erzeugnis Staphylococcus aureus nachgewiesen wurde, in<br />
einem anderen Pseudomonas aeruginosa. Die Empfehlungen des SCCP differenzieren nicht zwischen Produkten, die überwiegend<br />
aus pflanzlichen Bestandteilen bestehen, und anderen kosmetischen Mitteln. Pflanzliche Rohstoffe sind in der Regel naturbelassen<br />
und mit Mikroorganismen belastet. Diesen Gegebenheiten wird bei den mikrobiologischen Qualitätsanforderungen, wie sie an<br />
pflanzliche Arzneimittel gestellt werden, eher Rechnung getragen. Pflanzliche Arzneimittel, denen vor der Anwendung siedendes<br />
Wasser zugesetzt wird, dürfen max. 10 7 KBE/g aufweisen. Gemäß Gebrauchsanweisung werden die Haarfärbemittel mit<br />
kochendem Wasser angerührt. Die mikrobiologischen Untersuchungen derartiger Erzeugnisse werden im IfB Lüneburg deshalb<br />
sowohl aus einem „Kaltansatz“ als auch aus einem „Heißansatz“ durchgeführt. Die Rückstellmuster der in Ungarn beanstandeten<br />
Erzeugnisse sowie die Erzeugnisse aus jüngerer Produktion wiesen beim Kaltansatz Gesamtkeimgehalte im Bereich von 10 5 bis<br />
10 6 KBE/g auf, in einer Probe konnte Staphylococcus aureus nachgewiesen werden. Im Heißansatz war die Gesamtkeimzahl auf 10<br />
bis 80 % des ursprünglichen Gehaltes gesunken. Staphylococcus aureus konnte nicht mehr nachgewiesen werden, so dass von<br />
einer Beanstandung nach § 26 LFGB wegen Eignung zur Gesundheitsschädigung abgesehen wurde.<br />
Unverträglichkeiten<br />
Es lagen drei Beschwerden zu Unverträglichkeiten vor: „Nach dem Auftragen des Lippenstiftes bekam die Beschwerdeführerin<br />
starke Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit“ - oder zu einem Eau de Cologne: „…beim Ehemann: Augenbrauen weggeätzt bei<br />
Anwendung auf den Händen (dann Kontakt mit Augenbrauen)“. Die Beschwerden waren an den zur Untersuchung eingesandten<br />
Erzeugnissen nicht nachvollziehbar.<br />
Ein anderer Sachverhalt war bei einer Malseife gegeben, die aufgrund einer Schnellwarnung als Probe entnommen wurde. Hier<br />
sollte es zu Hautirritationen gekommen sein. Malseifen sind farbige Erzeugnisse von cremiger bis pastöser Beschaffenheit, die<br />
insbesondere für Kleinkinder den Waschvorgang attraktiv machen sollen, mit denen sie sich spielerisch bemalen und die bei<br />
Wasseranwendung abwaschbar sind. Auftragsmenge sowie Verbleibzeit auf dem kindlichen Körper dürften unterschiedlich sein,<br />
wobei hier bezüglich der Zeitspanne zwischen Auftragen und Abwaschen durchaus von 10 bis zu 30 Minuten ausgegangen wird.<br />
Bei drei von zehn erwachsenen Probanden zeigten sich nach einer Einwirkzeit von über 10 Minuten Hautreizungen und Juckreiz.<br />
Die Ursache dürfte in dem verwendetem Konservierungsstoffsystem Sorbinsäure/Benzoesäure zu sehen sein. Ein vergleichbarer<br />
Fall wurde im Jahr 2000 an einer Malseife, die ebenfalls mit dem System konserviert war, festgestellt. Während damals keine<br />
Höchstmengenüberschreitung an Konservierungsstoffen gegeben war, lag dieses Mal der ermittelte Gehalt an Benzoesäure von<br />
0,65 % oberhalb des zulässigen Wertes von 0,5 %. Das Erzeugnis wurde als geeignet die Gesundheit zu schädigen im Sinne des<br />
§ 26 LFGB beurteilt.<br />
Verbotene bzw. zu vorgesehenem Verwendungszweck nicht zugelassene Stoffe<br />
Stoffe, die nicht zur Herstellung kosmetischer Mittel verwendet werden dürfen, sind in Anlage 1 (zu § 1) KosmetikV geregelt, Stoffe,<br />
die eingeschränkt zugelassen sind, sind in der Verordnung in Anlage 2 (zu § 2) gelistet. Insgesamt erfolgte 32-mal der Nachweis<br />
solcher Substanzen in kosmetischen Mitteln, die dann nach § 28 Abs. 2 LFGB in Verbindung mit den betreffenden Paragraphen der<br />
KosmetikV beanstandet wurden. In den meisten Fällen sind es immer die gleichen Stoffe, die in denselben Produktgruppen<br />
festgestellt wurden. In jedem Jahr wird Dioxan in Badeerzeugnissen oder Haarwaschmitteln, die unter Verwendung des Tensids<br />
Natrium Laureth Sulfate hergestellt wurden, nachgewiesen (drei positive Befunde bei 143 Untersuchungen); ebenfalls wird alljährlich<br />
in tensidhaltigen Produkten die wegen möglicher Nitrosaminbildung nicht zugelassene Wirkstoffkombination von Cocamide DEA mit<br />
dem Konservierungsstoff Bronopol festgestellt, und Nitrosamine als solche lassen sich immer wieder in Maskara oder<br />
Handwaschpasten ermitteln (zwei positive Befunde bei 25 Untersuchungen). Gleiches gilt für den verbotenen Duftstoff Moschus<br />
Ambrette und den Farbstoff CI 13065, die sich seit Jahren in Erzeugnissen osteuropäischer Herkunft nachweisen lassen, oder für<br />
die seit Ende des Jahres 2000 zum Bleichen der Haut nicht mehr zugelassene Substanz Hydrochinon. In außereuropäischen<br />
Ländern wird Hydrochinon als Wirksubstanz in Hautbleichmitteln eingesetzt, die dann weiterhin unzulässigerweise über Afro- oder<br />
Asiashops in der EU vertrieben werden. Erzeugnisse, die Dibutylphthalat oder andere gelistete Phthalate enthalten, dürfen seit Mitte<br />
des Jahres 2005 nicht mehr an Endverbraucher abgegeben werden, und auch diese Verbindungen lassen sich noch immer in<br />
Nagellack oder Duftwässern nachweisen. Sämtliche nachgewiesenen Substanzen lagen in solcher Konzentration in den<br />
kosmetischen Mitteln vor, dass von einer konkreten Gesundheitsgefahr bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht ausgegangen<br />
werden konnte.<br />
299
Geregelte Stoffe<br />
In der KosmetikV ist die Verwendung von Konservierungsstoffen, UV-Filtern und Farbstoffen in so genannten Positivlisten detailliert<br />
geregelt; daneben enthält die KosmetikV noch eine Liste mit verschiedenen Stoffen, deren Einsatz z.B. durch vorgegebene<br />
Anwendungsgebiete oder Höchstmengen eingeschränkt ist.<br />
Zur Überprüfung der Einhaltung rechtlich festgesetzter Höchstmengen und Anwendungsbeschränkungen sowie zur Feststellung<br />
ordnungsgemäßer Kennzeichnung der Bestandteile und Angabe obligatorischer Warnhinweise wurden beispielsweise 1.001 Proben<br />
auf den Gehalt an Konservierungsstoffen überprüft, 150 Proben auf UV-Filter und 81 Zahnpasten und weitere Erzeugnisse zur<br />
Mundpflege auf Fluorid untersucht. Ferner wurde bei 244 Proben der Gehalt an allergenen Duftstoffen bestimmt, da diese ab<br />
bestimmten Konzentrationen in kosmetischen Mitteln deklariert werden müssen. Auf dem Markt befinden sich noch zahlreiche<br />
Produkte ohne eine entsprechende Kennzeichnung, ein Abverkauf ist ohne Fristablauf zulässig.<br />
Irreführung<br />
Auslobungen haben bei kosmetischen Mitteln nach wie vor einen hohen Stellenwert; insgesamt erfolgten 34 Beanstandungen<br />
wegen des Tatbestands der Irreführung.<br />
Auch hier werden Jahr für Jahr Beanstandungen zu gleichartigen Sachverhalten ausgesprochen. Hinweise auf wertgebende<br />
Bestandteile wie zur Verwendung von Olivenöl, Kamille bzw. dem Kamillenbestandteil Bisabolol, auf die Vitamine A und E sowie<br />
das Provitamin B5 (Panthenol) und auf die Wirksubstanz Q10 erwiesen sich als unzutreffend, da die Stoffe nicht eingesetzt oder in<br />
solcher Konzentration vorlagen, dass ein Nachweis nicht zu erbringen war.<br />
Nicht bekannt waren bisher der Einsatz von Stevia-Extrakten in Badezusätzen und deren Auslobungen zu andersartigem<br />
Verwendungszweck. In den Blättern der in Südamerika heimischen Pflanze Stevia rebaudiana sind als Wirkstoffe Stevioside, die<br />
süßende Eigenschaften aufweisen, enthalten. In der EU ist im Lebensmittelbereich die Verwendung dieser Stoffe als Süßungsmittel<br />
nicht zulässig. Badezusätze unterliegen den Vorgaben des Kosmetikrechts und sind bezüglich der Zusammensetzung nicht weiter<br />
definiert. Diese Badeerzeugnisse werden in der EU unter Hinweis auf das Verkehrsverbot für Steviaprodukte nach<br />
lebensmittelrechtlichen Regelungen in den Verkehr gebracht; gleichzeitig ist auf dem Produkt vermerkt, dass das Erzeugnis selbst<br />
in Lebensmittelqualität vorläge. Die weitere Kennzeichnung - wie auch die Zusammensetzung - waren bei dem Produkt eines<br />
Inverkehrbringers in einzelnen Chargen unterschiedlich. Zweimal wurde ergänzend auf Kalorienfreiheit und auf den reinen Auszug<br />
aus Steviablättern, geerntet von Pflanzen aus naturgemäßem Anbau, hingewiesen; nicht kenntlich gemacht war dagegen die<br />
Verwendung von Konservierungsstoff und von Saccharin. Das mit Konservierungsstoff Sorbinsäure haltbar gemachte Erzeugnis war<br />
aufgrund eines Anteils an Süßstoff Saccharin von 1,5 % extrem süß. Bei einer weiteren Probe entfiel der Hinweis auf den reinen<br />
Pflanzenauszug; in der Zusammensetzung war nunmehr statt Saccharin ein Glycerinanteil von 50 % festzustellen. Der Brennwert<br />
von Glycerin entspricht den Werten für Saccharose (4 kcal pro g), so dass der Hinweis auf Kalorienfreiheit unzutreffend erfolgte. Die<br />
Erzeugnisse wurden als irreführend gekennzeichnet beanstandet; es wurde Einsichtnahme in die für kosmetische Mittel<br />
erforderliche Sicherheitsbewertung empfohlen. Gegen den Hinweis auf Vorliegen eines Erzeugnisses in Lebensmittelqualität und<br />
somit einer indirekten Ermunterung zur zweckentfremden Nutzung werden nach Kosmetikrecht keine Handhabe zur Beanstandung<br />
gesehen.<br />
Kennzeichnung<br />
Nicht ordnungsgemäße Kennzeichnung im Sinne der Vorgaben der §§ 4 und 5 KosmetikV wurde 177-mal festgestellt. Die Zahl der<br />
beanstandeten Proben ist niedriger, denn oft lagen bei einzelnen Proben mehrere Kennzeichnungsmängel vor, die zur<br />
Beanstandung führten. Die Kennzeichnung der Bestandteile stellte den häufigsten Beanstandungsgrund in dieser Rubrik dar;<br />
meistens wurde die vorgegebene Nomenklatur nicht eingehalten. In einigen Fällen wurden andere Stoffe als tatsächlich verwendet<br />
angegeben wie z. B. bei der Farb- und Konservierungsstoffdeklaration. Änderung der Rezeptur - zum Teil bedingt durch<br />
vergleichsweise kurzfristige Änderung der Rechtsvorgaben - und weiterer Einsatz des verbliebenen Kennzeichnungsmaterials dürfte<br />
im Wesentlichen die Ursache sein.<br />
Behm, F.; Weßels, B. (IfB LG)<br />
300
4.19 Betriebskontrollen<br />
Kontrolle vor Ort<br />
Anzahl und Art der festgestellten Verstöße (*)<br />
Erzeuger<br />
(Urproduktion)<br />
Hersteller<br />
und<br />
Abpacker<br />
Vertriebsunternehmer<br />
und Transporteure <br />
Einzelhändler(Einzelhandel)<br />
301<br />
Dienstleistungsbetriebe<br />
Hersteller, die im<br />
wesentlichen auf<br />
der<br />
Einzelhandelsstufe<br />
verkaufen<br />
Insgesamt<br />
Zahl der Betriebe<br />
Zahl der<br />
kontrollierten<br />
12.527 1.716 1.865 3<strong>3.</strong>093 40.398 6.080 95.679<br />
Betriebe<br />
Zahl der<br />
1.121 916 655 16.620 20.390 <strong>3.</strong>944 4<strong>3.</strong>646<br />
Kontrollbesuche<br />
Zahl der Betriebe<br />
mit<br />
1.606 4.382 1.383 26.970 28.775 6.337 69.453<br />
Verstößen (*)<br />
Art der Verstöße<br />
(*)<br />
Hygiene<br />
(HACCP,<br />
176 170 66 1.767 <strong>3.</strong>641 586 6.406<br />
Ausbildung) 12 58 23 410 1.023 170 1.696<br />
Hygiene allgemein<br />
Zusammensetzung<br />
(nicht<br />
33 134 46 1.325 <strong>3.</strong>218 471 5.227<br />
mikrobiologisch)<br />
Kennzeichnung<br />
und<br />
3 9 4 51 60 12 139<br />
Aufmachung 13 33 25 654 557 126 1.408<br />
Andere Verstöße<br />
140 33 11 160 238 38 620<br />
(*) Nur diejenigen Verstöße, die zu formellen Maßnahmen der zuständigen Behörden im Sinne der Leitlinien geführt<br />
haben.<br />
4.20 Fischereikundlicher Dienst (Außenstelle des IfF Cuxhaven)<br />
Die Abteilung Binnenfischerei – Fischereikundlicher Dienst des Landes <strong>Niedersachsen</strong>- bildet die Mittelinstanz der<br />
Fischerverwaltung und ist als Träger öffentlicher Belange sowie als Fachbehörde beratend tätig gegenüber den mit dem<br />
Fischereigesetz als Verwaltungsgesetz befassten Behörden durch die Abgabe von Stellungnahmen, Gutachten und<br />
Entscheidungsvorschlägen. Zudem werden hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. Einen ausschnittsweisen Überblick zu<br />
abgegebenen Stellungnahmen gibt Tabelle 1.<br />
Kategorie Anzahl Stellungnahmen<br />
Verfahren zu wasserrechtlichen Anträgen 94<br />
Verfahren zu Bauvorhaben im Außenbereich<br />
(Privilegierung)<br />
2
Anträge auf Genehmigung zur Elektrofischerei<br />
Pachtwerteinschätzungen für fiskalische<br />
Fischereirechte<br />
Verfahren zur Ausweisung oder Änderung von<br />
Naturschutzgebieten<br />
Verfahren zur Ausweisung oder Änderung von<br />
Landschaftsschutzgebieten<br />
Gutachten 25<br />
Tab.1: Anzahl Stellungnahmen Binnenfischerei 2006<br />
Die zum Zweck für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer sowie zur Hege der Fischbestände gem.<br />
Binnenfischereiordnung erteilten Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung der Elektrofischerei sind mit entsprechenden<br />
Rückmeldeverpflichtungen der Fangergebnisse verbunden und tragen zum jährlichen Zuwachs des Datenbestandes im<br />
Fischartenkataster <strong>Niedersachsen</strong> bei. Die Entwicklung der Anzahl erteilter Elektrofischfangergebnisse sowie der Anzahl der<br />
Befischungen (Datensätze im Fischartenkataster) ist in Abbildung 1 dargestellt.<br />
E-Genehmigungen<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
302<br />
116<br />
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06<br />
Jahr<br />
27<br />
14<br />
E-Genehmigungen Datensätze<br />
1<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
Abb. 1: Anzahl erteilter Elektrofischfanggenehmigungen und Anzahl Datensätze im Fischartenkataster von 1979 bis 2006<br />
Die Abteilung Binnenfischerei ist zuständig für die Vergabe von Zuschüssen aus dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der<br />
Fischerei (FIAF) und Landesmitteln nach den Richtlinien zur Förderung der Hege niedersächsischer Binnengewässer und zur<br />
Förderung der niedersächsischen Binnenfischerei. Im Berichtsjahr wurde ein Antrag auf Förderung eines Aquakulturvorhabens<br />
vorgelegt und bewilligt. Darüber hinaus wurde ein Pilotprojekt zur Wiederauffüllung des Aalbestandes in der Elbe bezuschusst. Es<br />
wurden 3 Anträge auf Zuschüsse zu den Gewässerwartelehrgängen der anerkannten Landesfischereiverbände bewilligt.<br />
Von den Bediensteten der Abteilung Binnenfischerei wurden insgesamt 19 Vorträge im Rahmen von fischereifachlichen und<br />
fachübergreifenden Veranstaltungen niedersächsischer und bundesweiter Gremien gehalten und an 4 Veröffentlichungen als<br />
Autoren bzw. Co-Autoren mitgewirkt.<br />
Ein Lehrgang zum Erwerb des Bedienungsscheines für Elektrofischfanggeräte wurde angeboten, jedoch aufgrund<br />
unzureichender Nachfrage nicht durchgeführt.<br />
Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie organisierte die Abt. Binnenfischerei federführend die Probennahme<br />
an 49 Überblicksmessstellen sowie an ca. 270 Messstellen des operativen Monitorings. Die Arbeiten zur Erstellung von<br />
Referenzzönosen und zur Bewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer anhand der Fischfauna wurden fortgesetzt. Im<br />
500<br />
0<br />
Datensätze
Hinblick auf das überregionale Bewirtschaftungsziel Durchgängigkeit der Fischfauna war die Abt. Binnenfischerei in die<br />
länderübergreifenden Abstimmungen für die Flusseinzugsgebiete Elbe und Weser eingebunden.<br />
Vor dem Hintergrund der Umsetzung eines gemeinschaftlichen Aktionsplans zur Bewirtschaftung des europäischen Aals war die<br />
Abt. Binnenfischerei mit der Zusammenstellung von Daten zur Aalwirtschaft in <strong>Niedersachsen</strong> befasst.<br />
Für den gemäß den Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zu erstellenden „Bericht 2007“ wurden für die Daten für die<br />
FFH-relevanten Fischarten zusammengestellt und die Populationszustände bewertet.<br />
Im Berichtsjahr wurden die seit Mitte der 70er Jahre durch die Abteilung Binnenfischerei durchgeführten fischereilichen<br />
Untersuchungen an der Oberweser und Werra fortgeführt. Aus der Gegenüberstellung der Entwicklung der Chloridkonzentration<br />
und des Fischartenspektrums zeigt sich, dass seit Beginn der Reduzierung der Kaliendlaugeneinleitungen Anfang der 90er Jahre<br />
ein steter Anstieg der in den Untersuchungen erfassten Fischartenzahlen festzustellen ist (Abb. 2 und 3). Diese Entwicklung setzt<br />
sich mit Beginn der Vergleichmäßigung der Chlorideinleitungen ab 1999 fort.<br />
Chlorid-(mg/l)<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
Jahr<br />
Abb. 2: Entwicklung des Chloridgehaltes der Oberweser bei Hemeln (Messstelle Hemeln)<br />
1999<br />
2000<br />
303<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Mittelwert<br />
Minimum<br />
Maximum
Anzahl Fischarten<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06<br />
Untersuchungsjahr<br />
Abb. 3: Anzahl der mittels Elektrofischfang an der Oberweser erfassten Fischarten in den Jahren 1982-1987 und 1993 bis 2006<br />
Die seit 1989 durch die Abt. Binnenfischerei geführte Statistik Fischsterben in <strong>Niedersachsen</strong> wurde auch in 2006<br />
fortgeschrieben. Grundlage sind neben Meldungen Dritter die durch die unteren Wasserbehörden an die Abt. Binnenfischerei<br />
gemeldeten Fischsterben. In Abbildung 4 ist die Entwicklung bis 2005 dargestellt. Seit Beginn der Erhebung von Fischsterben bis<br />
heute ist insgesamt ein rückläufiger Trend zu beobachten.<br />
Anzahl gemeldeter Fischsterben<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
Jahr<br />
1998<br />
Abb. 4: Anzahl der gemeldeten Fischsterben 1989 bis 2005<br />
1999<br />
2000<br />
304<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Kämmereit, M.; Lecour, C.; Matthes, U. (IfF Cuxhaven, Abt. Binnenfischerei)
5. Anhang<br />
5.1 Verzeichnis der Mitwirkung in Gremien<br />
Aalkommission des Deutschen Fischerei-Verbandes e.V. Meyer, L. (IfF CUX)<br />
ALS ad-hoc Arbeitsgruppe „Bedarfsgegenstände“ Punkert, M. (IFB) LG<br />
ALS: Vertretung des Landes <strong>Niedersachsen</strong> Block, I. (LI-OL)<br />
ALS-Arbeitsgruppe „Diätetische Lebensmittel, Ernährungs- und Abgrenzungsfragen“ Maslo, R. (LI BS)<br />
ALS-Arbeitsgruppe „Kosmetische Mittel“ Behm, F. (IFB LG)<br />
ALS-Arbeitsgruppe „Überwachung gentechnisch veränderter Lebensmittel“ Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
ALS-Arbeitsgruppe „Wein und Spirituosen“ Hucke, J. (LI BS)<br />
ALTS: ad-hoc Arbeitsgruppe zur „Umsetzung des neuen EU-Hygienerechts<br />
und der VO 2073/2005“<br />
305<br />
Kirchhoff, H. (LI OL)<br />
ALTS: Arbeitsgruppe „Histologischer Nachweis von Verfälschungen bei Kochschinken“ Orellana, A. (LI OL)<br />
ALTS: Arbeitsgruppe „Lebensmittelrechtliche Bewertung von Viren in Lebensmitteln“ Mauermann, U. (LI OL)<br />
ALTS: Arbeitsgruppe „Validierung mikrobiologischer Nachweisverfahren“ Mauermann, U. (LI OL)<br />
ALTS: Arbeitskreis Lebensmittelhygienischer Tierärztlicher Sachverständiger Kirchhoff, H. (LI OL)<br />
Analysenausschuss der Kunststoff-Kommission des Bundesinstituts für Risikobewertung<br />
(BfR)<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Analytikarbeitsgruppe „Nitrosamine“ Reinhold, L. (LI BS)<br />
Apimondia – Standing Commission of Technology and Bee Products von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V. Boecking, O. ;Janke, M. ; von der<br />
Ohe, W.; van Praagh, J.P. (IB CE)<br />
Arbeitsgruppe „Fortentwicklung des Bundestierseuchenbekämpfungshandbuchs und der<br />
UAG „Impfung“<br />
Thalmann, G. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe “Aquakulturprojekt II” des ML Bartelt, E., Etzel, V., Effkemann, S.<br />
(IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe „ Ausführungshinweise für die Überwachungsbehörden zur Durchführung<br />
der Muschelhygieneüberwachung“<br />
Velleuer, R. ; Scheike, S. (Dez.<br />
22); Jark, Uwe (Dez. 21); Sassen,<br />
K. (ML)<br />
Arbeitsgruppe „ Ausführungshinweise für die Überwachungsbehörden der Bundesländer<br />
zur Durchführung der amtlichen Kontrolle in für den US-Export zugelassenen<br />
Fleischverarbeitungsbetrieben“<br />
Arbeitsgruppe „ Ausführungshinweise zur amtlichen Kontrolle zur Durchführung der<br />
amtlichen Kontrolle in zugelassenen Fischbe- und Fischverarbeitungsbetrieben“<br />
Velleuer, R.; Scheike, S. (Dez. 22);<br />
Graf, Karljosef (Dez. 21)<br />
Velleuer, R.; Scheike, S. (Dez. 22);<br />
Jark, U. (Dez. 21); Sassen, K. (ML)
Arbeitsgruppe „§ 64 LFGB – Tierarzneimittelrückstände in Lebensmitteln“ Christof, O. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe „Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and<br />
North Sea” (ASCOBANS)<br />
306<br />
Stede, M. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe „Aquakulturprojekt II“ des ML Rasenack, U.; Zierenberg, B. (FI<br />
STD)<br />
Arbeitsgruppe „Ausführungshinweise zur amtlichen Kontrolle der betrieblichen<br />
Eigenkontrolle in zugelassenen Fischbe- und Fischverarbeitungsbetrieben“<br />
Arbeitsgruppe „Ausführungshinweise zur amtlichen Kontrolle der betrieblichen<br />
Eigenkontrolle im Bereich der Muschelhygiene“<br />
Bartelt, E. (IfF CUX); Jark, U. (Dez.<br />
21/IfF CUX); Scheike, S. (Dez. 22)<br />
Bartelt, E. (IfF Cux; Jark, U. (Dez.<br />
21/IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe „BALVI – EDV in der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung“ Beckhuis, A. ;Scheike, S. (Dez. 22)<br />
Arbeitsgruppe „Bienenschutz“ Janke, M.; von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Arbeitsgruppe „Bundestierseuchenhandbuch“ Nöckler, A. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe „Datenträgeraustausch zwischen Untersuchungseinrichtungen und<br />
Veterinärämtern“<br />
Arbeitsgruppe „EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle bei Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln“<br />
Bötcher, L.; Knorr, G. (VI OL)<br />
Vollmers, D. (Dez. 43)<br />
Arbeitsgruppe „Jungmasthühnerhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen Vereinbarung“ Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe „Methodenentwicklung nach Optivall“<br />
Siemer, H.; Christof, O.; Heemken,<br />
O. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe „Moschusentenhaltung „Weiterentwicklung der Mindestanforderungen“, Petermann, S.; Maiworm, K. (Dez.<br />
33)<br />
Arbeitsgruppe „Norddeutsche Kooperation“ Siemer, H.; Christof, O. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe „Pekingentenhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen Vereinbarung“ Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe „Pilotprojekt zur Fußballengesundheit von Jungmasthühnern“ Petermann, S.; Maiworm, K. (Dez.<br />
33)<br />
Arbeitsgruppe „Probenplanung“ Velleuer, R; Djalvand, M.. (Dez.<br />
22); Meylahn, K.); Potratz, U. (LI<br />
OL); Dildei, C. (VI H); Schleuter, G.<br />
(VI OL), Eichhoff, S. (IfB LG);<br />
Böhmler, G. (LI BS; Helmsmüller,<br />
H. (ML); Hänsel, A. (Dez. 23);<br />
Etzel, V. (IfF Cux)<br />
Arbeitsgruppe „Putenhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen Vereinbarung“, Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe „Schnabelkürzen bei Nutzgeflügel“ Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe „Tierschutz, verölte Vögel und gestrandete Meeressäuger“ beim Nds. ML Stede, M. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe „Tierschutz-Leitlinien für die Michvieh- und Mastrinderhaltung“ Petermann, S.; Maiworm, K. (Dez.<br />
33)<br />
Arbeitsgruppe „Tierseuchenbekämpfungshandbuch Nds./ NRW“<br />
Unterarbeitsgruppe „Epidemiologie/ Probenahme“<br />
Kurlbaum, S. (Dez. 31)
Arbeitsgruppe „Tierseuchenbekämpfungshandbuch Nds./ NRW“<br />
Unterarbeitsgruppe „Impfung“<br />
Arbeitsgruppe „Tierseuchendiagnostik der Niedersächsischen Untersuchungseinrichtungen“<br />
Arbeitsgruppe „Validierung mikrobiologischer Untersuchungsverfahren“ des<br />
Arbeitskreises der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der vom Tier<br />
stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen (ALTS)<br />
307<br />
Schwochow, K. (Dez. 31)<br />
Bötcher, L.; Klarmann, D.;<br />
Schöttker-Wegner, H.-H.;<br />
Thalmann, G. (VI OL)<br />
Dildei, C. (VI H)<br />
Arbeitsgruppe „Verbraucherschutz“ der beamteten Tierärzte in <strong>Niedersachsen</strong> Ady, G. (FI STD)<br />
Arbeitsgruppe „Wildbrethygiene“ des Deutschen Jagdschutz-Verbandes, Bonn Treu, H. (Dez. 14/31)<br />
Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit der Untersuchungseinrichtungen im Norddeutschen<br />
Raum“<br />
Haunhorst, K. (Dez. 22)<br />
Arbeitsgruppe beim BVL „Nationaler Rückstandskontrollplan“ Hänsel, A. (Dez. 23)<br />
Arbeitsgruppe Biogasanlagen Thomes, R. (Dez. 15)<br />
Arbeitsgruppe Datenübertragung in der Tierseuchendiagnostik Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe der Laborleiter innerhalb der Norddeutschen Kooperation (NoKo) Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe Geflügeltötung Thomes, R. (Dez. 15)<br />
Arbeitsgruppe Geflügeltötung (LAVES und Nds. Geflügelwirtschaft) Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe Kontrolle Nutztierhaltungen Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe Lebensmittelüberwachung des VbT Bisping, M. (Dez. 21)<br />
Arbeitsgruppe Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong> Freise, J.F. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe Mobiles Bekämpfungszentrum Gerdes, U., Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe nach § 35 LMBG “Analytik von Delta-9-THC in Hanf enthaltenden<br />
Lebensmitteln“<br />
Pfordt, J. (LI OL)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFBG „Kosmetische Mittel“ Behm, F. (IFB LG)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Backwaren“ Wald, B. (LI BS)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Chemische und physikalische Untersuchungsverfahren<br />
für Milch und Milchprodukte“<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Entwicklung von Methoden zum Nachweis mit Hilfe<br />
gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel“<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Entwicklung von molekularbiologischen Methoden zur<br />
Pflanzen- und Tierartendifferenzierung“<br />
Knechtel-Lietz, L. (LI BS)<br />
Schulze, M. (Vorsitz) (LI BS/VI H)<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Hemmstoffnachweis in Milch – chemische Methoden“ Schnarr, K.; Johannes, B. (VI H)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Immunologische Lebensmittelanalytik“ Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Molekularbiologische Methoden – Mikrobiologie“ Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Tierartendifferenzierung – Fleisch“ Ohrt, G. (LI BS)
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Tierarzneimittelrückstände“ Johannes, B.; Schnarr, K. (VI H)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Vitamine“ Täubert, Th. (LI BS)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LFGB „Wirkungsbezogene Analytik“ Böhmler, G. (Obfrau) (LI BS)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LMBG “Arsen in Fischen” Ballin, U. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LMBG “Muscheltoxine” Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LMBG “Probenahme Fische“ Ballin, U. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe nach § 64 LMBG “Tierarzneimittelrückstände” Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Arbeitsgruppe Speisekartoffeln im AK Qualitätskontrolle bei Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln im Verband der Landwirtschaftskammern<br />
Arbeitsgruppe Stallklima<br />
308<br />
Hahnkemeyer, E. (Dez. 43)<br />
Könneke, K (Dez. 15)<br />
Arbeitsgruppe Süßstoffe nach § 64 LFGB Nuyken-Hamelmann, C. (LI OL)<br />
Arbeitsgruppe Tierseuchenbekämpfungshandbuch <strong>Niedersachsen</strong> - Nordrhein-Westfalen Diekmann, J.; Dörrie, H.G.; Freise,<br />
J.F.; Gerdes, U.; Grothusmann, M.;<br />
Jeske, C.; Kleingeld, D.W.;<br />
Mahnken, M.; Schmedt auf der<br />
Günne, H.; Tapper, S. (Dez. 32),<br />
Kurlbaum, S.; Schumacher, T.<br />
(Dez. 31); Thalmann, G.: Nöckler,<br />
A (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe Tierseuchendiagnostik-Institute <strong>Niedersachsen</strong> Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe Überarbeitung der Nds. Zirkusleitlinie Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe Überarbeitung des Nds. Kutschenerlasses Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe Vergraben von Tierkörpern im Krisenfall Dörrie, H.-G (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe zum Einsatz Tierärztlichen Fachpersonals im Tierseuchenkrisenfall Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe zur Fortentwicklung der Tierseuchenbekämpfungshandbücher<br />
Unterarbeitsgruppe „TSE/ BSE“<br />
Arbeitsgruppe Zusammenführung der Gebührenordnung-LebensmBG sowie der<br />
Gebührenordnung –Veterinärwesen und der Gebühren im Futtermittelbereich zu einer<br />
Gebührenordnung für den Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes<br />
Arbeitskreis „Fischereiliche Besatzmaßnahmen“ des Verbandes Deutscher<br />
Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V.<br />
Schumacher, T. (Dez. 31)<br />
Falck, F. (Dez 13); Jürgens, T.<br />
(Dez 21);<br />
Scholz, K. (VP);<br />
Wiecking, H. (Dez 43)<br />
Meyer, L. (IfF CUX)<br />
Arbeitskreis „Futtermittelmikrobiologie“ der VDLUFA Schlägel, E. (FI STD)<br />
Arbeitskreis „Gummi“ der Kunststoff-Kommission des Bundesinstituts für Risikobewertung<br />
(BfR)<br />
Arbeitskreis „Umweltradioaktivität“ der Radioaktivitätsmessstellen des Landes<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Nordmeyer, K. (LI OL);<br />
Ballin, U. (IfF Cux); Weiszenburger,<br />
W. (LI BS); v.Keyserlingk, I. (VI H);<br />
Runge, M. (VI H)
Arbeitskreis der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der vom Tier stammenden<br />
Lebensmittel tätigen Sachverständigen (ALTS)<br />
Arbeitskreis der Ausbilder der deutschen Bieneninstitute<br />
309<br />
Dildei, C. (VI H)<br />
Lembke, S.; Schell, H.;<br />
Schönberger, H. (IB CE)<br />
Arbeitskreis der Fischgesundheitsdienste der Bundesrepublik Deutschland Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis der niedersächsischen Beauftragten für Biologische Sicherheit gemäß<br />
GenTSV<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Arbeitskreis der Niedersächsischen Tierseuchendiagnostik-Institute (Leitung) Diekmann, J. ; Gerdes, U.;<br />
Mahnken, M. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis der Qualitätssicherungsbeauftragten Nord Ballin, U. (IfF CUX)<br />
Arbeitskreis Einspurfahrzeuge des LAVES Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Lückenindikation, § 18 lfSG. Freise, J.F. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Medizinische Arachno-Entomologie Freise, J.F., Stelling, K. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Nord der QM-Beauftragten Keck, S. (LI BS; Braune, S.;<br />
Schnarr, K. (VI H); Behm, F.;<br />
Eichhoff, S.;<br />
Schnug-Reuter, B. (IFB LG);<br />
Buntrock-Taux , E. (LI OL)<br />
Leymers, H. (Dez. 43)<br />
Arbeitskreis Qualitätskontrolle Obst & Gemüse<br />
Arbeitskreis Risikoanalyse zur Vermarktungsnorm Eier mit Mecklenburg-Vorpommern Rahlfs, B.; Mörler, T.; Aue, B. (Dez.<br />
und Schleswig-Holstein<br />
43)<br />
Arbeitskreis Schabenbekämpfung. LK Vechta, Damme Freise, J.F. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Vorratsschutz Freise, J.F., Oltmann, B. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Wirbeltiere Freise, J.F., Oltmann, B. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Zierfischkrankheiten der Deutschen Sektion der European Association of<br />
Fish Pathologists (EAFP)<br />
Beirat des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und<br />
Fischereiwissenschaftler e.V.<br />
Beirat zur Rahmenvereinbarung <strong>Niedersachsen</strong> zur Klassifizierung, Verwiegung und<br />
Kennzeichnung von Schweine- u. Rinderschlachtkörpern<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Lecour, C. (IfF CUX)<br />
Aue, B. (Dez. 43)<br />
BLAPS Unterarbeitsgruppe Analytik Suckrau, I (LI OL)<br />
Bund/Länder-Arbeitsgruppe Rückverfolgbarkeit mit Hilfe der stabilen Isotopentechnik Meylahn, K., Wolf, E. (LI OL)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe „AI und ND“ zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe „Mobiles Bekämpfungszentrum“ Diekmann, J., Mahnken, M. (Dez.<br />
32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe „Schätzung, Tötung, Beseitigung“ zum<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch<br />
Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Bluetongue zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Freise, J.F. (Dez. 32)
Bundes-Arbeitsgruppe EDV und Kommunikation zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Entwesung, Reinigung, Desinfektion zum<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch<br />
Freise, J.F. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Impfung zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Lungenseuche zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe SVD zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Mahnken, M. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Tötung zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Verwaltung zum Tierseuchenbekämpfungshandbuch Tapper, S. (Dez. 32)<br />
Bundes-Arbeitsgruppe Viehhandel, Kontrolle, Transport und Verkehr zum<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch<br />
Bundeseinheitliche Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von<br />
Jungmasthühnern und Mastputen<br />
310<br />
Mahnken, M. (Dez. 32)<br />
Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Bund-Länder-AG „Qualitätsmanagement“ Böming, J. (Dez. 41)<br />
Bund-Länder-Arbeitsgruppe - Änderung der Tierschutzschlachtverordnung - Boosen, M. (Dez. 15)<br />
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Aal“ des BMELV Meyer, L. (IfF CUX)<br />
Bund-Länder-UAG „Futtermittelstatistik / Datenkataloge“ Diers, F. (Dez. 41)<br />
Bund-Länder-UAG „Statistik / Datenkataloge“ Diers, F. (Dez. 41)<br />
BUND-Projekt Forellenzucht Dullborn Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
BVL Lebensmittel-Monitoring<br />
Expertengruppe „Organische Kontaminanten und migrierende Stoffe“<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
BWK-Arbeitskreis 1.5 „Effizienzkontrolle von Wanderhilfen in Fließgewässern“ Lecour, C. (IfF CUX)<br />
Campylobactermonitoring des BfR Berlin Schleuter, G. (VI OL)<br />
CCFH, Codex Committee Food Hygiene, Member of the german delegation Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
CCFH-Working Group „Risk management – Listeria in foods” Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
CEN TC 275 WG 11 Genetically modified foodstuffs Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
CEN TC 275 WG 6 TAG 3 PCR for the detection of food-borne pathogens in food Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
CEN Working group Ambient air - Monitoring of genetically modified organisms (GMO) von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Consultant der Arbeitsgruppe bei IAEA (Internationale Atomenergie Behörde) zur<br />
Etablierung von QM-Systemen in Veterinädiagnostik Laboratorien<br />
Thoms, B. (VI H)<br />
DIN – Ausschuss – Schlachttierbetäubung Thomes, R. (Dez. 15)<br />
DIN AG: „Hygienische Anforderungen an das Geschirrspülen“ im Arbeitskreis „Außer<br />
Haus Verpflegung“ (Arbeitskreis des Arbeitsausschusses „Lebensmittelhygiene“)<br />
Rohrdanz, A. (IFB LG)<br />
DIN Arbeitsausschuss „Honiguntersuchung“ von der Ohe, W. (IB CE)
DIN NA 039 Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD)<br />
NA 039-02-01-03 UA „Unterausschuss organisch chemische Substanzen in Spielzeug“<br />
DIN NA 039 Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD)<br />
NA 039-02-02 AA „Arbeitsausschuss Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Essen,<br />
Trinken, Saugen und ähnliche Funktionen“<br />
DIN NA 057 Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)<br />
NA 057-02-01-22 AK „Arbeitskreis Werkstoffe in Kontakt mit Lebensmitteln“<br />
DIN NA 062 Normenausschuss Materialprüfung (NMP)<br />
NA 062-08-93 AA „Arbeitsausschuss Bedarfsgegenstände aus Kunststoff in Kontakt mit<br />
Lebensmitteln – Prüfung der Migration aus Kunststoffen“<br />
DIN NA 078 Normenausschuss Pigmente und Füllstoffe (NPF)<br />
NA 078-00-14-01 GAK „Gemeinschaftsarbeitskreis NPF/NAB; Speichel- und<br />
Schweißechtheit“<br />
DIN –Normenausschuss „Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte – Arbeitskreis<br />
Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelkette“<br />
DIN –Normenausschuss „Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte – Arbeitskreis<br />
Hygieneschleusen“<br />
DIN Normenausschuss Materialprüfung (NMP)<br />
NMP 552 „Chemische Prüfverfahren für Leder“<br />
DIN Normenausschuss Materialprüfung (NMP)<br />
NMP 421/NPa „Chemisch-technologische Prüfverfahren für Papier, Pappe, Halbstoff und<br />
Chemiezellstoff“<br />
DIN Normenausschuss Materialprüfung (NMP)<br />
NMP 512 „Textilchemische Prüfverfahren und Fasertrennung“<br />
DIN-Arbeitsausschuss “Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln einschließlich<br />
Schnellverfahren”<br />
311<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Eichhoff, S. (IFB LG)<br />
Velleuer, R. (Dez. 22)<br />
Velleuer, R. (Dez. 22),<br />
Schumacher, T (Dez. 31)<br />
Punkert, M. (IFB LG)<br />
Punkert, M. (IFB LG)<br />
Punkert, M. (IFB LG)<br />
Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Bestrahlte Lebensmittel“ Pfordt, J. (LI OL)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Biotoxine“ Reinhold, L. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Gentechnisch modifizierte Lebensmittel“ Schulze, M. (stellvertr. Obfrau)<br />
(LI BS/VI H)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Gewürze und würzende Zutaten“ Keck, S. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Honiguntersuchung“ Kohnen, R. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Lebensmittelsicherheit-Managementsysteme“ Bartelt, E. (Obfrau) (IfF CUX)<br />
DIN-Arbeitsausschuss „Vitamine“ Täubert, Th. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitskreis – Abtrennung von nicht allseitig geschlossenen<br />
Lebensmittelverkaufsstätten -<br />
Könneke, K (Dez. 15)<br />
DIN-Arbeitskreis – Automatische Melkverfahren - Scheele, W. (Dez. 15)<br />
DIN-Arbeitskreis „Acrylamid in Wasser“ Reinhold, L. (LI BS)<br />
DIN-Unterarbeitsausschuss „Polymerase-Kettenreaktion zum Nachweis von<br />
Mikroorganismen des DIN-Arbeitsausschusses Mikrobiologische<br />
Lebensmitteluntersuchung einschließlich Schnellverfahren“<br />
Schulze, M. (stellvertr. Obfrau)<br />
(LI BS/VI H)
DLG-Kommission Siliermittel Zierenberg, B. (FI STD)<br />
DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) Arbeitsgruppe Resistenzen Klarmann, D. (VI OL)<br />
DWA-Arbeitsgruppe GB-5.4 „Salzbelastung der Fließgewässer“ Matthes, U. (IfF CUX)<br />
EFMO (European Feed Microbiology Organisation) Schlägel, E. (FI STD)<br />
Einführung eines einheitlichen Qualitätsmanagements in niedersächsischen<br />
Organisationen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (EQUINO);<br />
Steuerungsgruppe (<strong>Niedersachsen</strong>)<br />
312<br />
Beckhuis, A. (Dez. 22)<br />
EU-Arbeitsgruppe Good practice regarding the cleaning and rehabilitation of oiled wildlife Huesmann, J. (Dez. 32)<br />
EU-Arbeitsgruppe Impact of oil spills on seabirds Huesmann, J. (Dez. 32)<br />
EU-Arbeitsgruppe Wildlife response planning Huesmann, J. (Dez. 32)<br />
EU-Kommissionsgremium „Expertenkomitee Umwelt- und Industriekontaminanten in<br />
Lebensmitteln“ (als Bundesratsvertreter)<br />
Expertenfachgruppe 13 der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei<br />
Arzneimitteln und Medizinprodukten<br />
Pfordt, J. (LI OL)<br />
Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Expertenfachgruppe 16 (Tierimpfstoffe) der ZLG Thalmann, G. (VI OL)<br />
Expertenfachgruppe Fütterungsarzneimittel (EFG14) der ZLG Schnarr, K (VI H)<br />
Expertengruppe zur Optimierung des Nationalen Rückstandskontrollplanes Hänsel, A.; Kleiminger, E. (Dez.<br />
23)<br />
Expertenkomitee-Arbeitsgruppe „Agrarkontaminanten“ bei der Europäischen Kommission<br />
(Bundesratsvertreterin)<br />
Expertenkomitee-Arbeitsgruppen “Dioxine und PCBs” bei der Europäischen Kommission,<br />
(Bundesratsvertreter)<br />
Reinhold, L. (LI BS)<br />
Bruns-Weller, E., Knoll, A. (LI OL)<br />
Facharbeitsgruppe der Länder EDV-Tierschutzmodul Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Facharbeitsgruppe Tierarzneimittelüberwachung der Arbeitsgruppe der Länder zur<br />
Entwicklung eines integrierten EDV-gestützten Informationssystems für das<br />
Veterinärwesen und die Lebensmittelüberwachung<br />
Kleiminger, E.; Zeit, S. (Dez. 23)<br />
Fachausschuss „Aquatische genetische Ressourcen“ des BMELV Arzbach, H.-H. (IfF CUX)<br />
Fachausschuss Diagnostik bei der AKS Thoms, B. (Leiterin), (VI H)<br />
Fachausschuss Rodentizidresistenz Freise, J.F. (Dez. 32)<br />
Fachexpertin der Staatlichen Akkreditierungsstelle Hannover Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Fischereiausschuss Steinhuder Meer Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Fortbildungsprogramm für Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungsländern / Herr<br />
Athanase Ouedraogo aus Burkina Faso / Betreuung an der Station Laves<br />
Heskamp, H.; Schulte, J.; Aue, B.<br />
(Dez. 43)<br />
Forum Waschen für die Zukunft Rohrdanz, A. (IFB LG)<br />
Forum Waschen für die Zukunft, Projektgruppe „Riechstoffe“ Weßels, B. (IFB LG)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe “Pestizide“ Johannes, B. (korrespondierendes
313<br />
Mitglied), (VI H)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe “Pharmakologisch wirksame Stoffe“ Johannes, B. (korrespondierendes<br />
Mitglied), (VI H)<br />
GDCh–Arbeitsgruppe „Bedarfsgegenstände“ Punkert, M. (IFB LG)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Enzymatische, immunchemische und molekularbiologische<br />
Analytik“<br />
Schulze, M. (ordentliches Mitglied)<br />
(LI BS/VI H)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Fisch“ Ballin, U.; Kruse, R. (IfF CUX)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Fleischwaren“ Rieckhoff, D. (LI OL)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Fruchtsäfte und alkoholfreie Getränke“ de Wreede, I. (ordentliches<br />
Mitglied) (LI BS)<br />
GDCh–Arbeitsgruppe „Kosmetische Mittel“ Behm, F. (IFB LG)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Milch und Milcherzeugnisse“ Knechtel-Lietz, L.<br />
(korrespondierendes Mitglied)<br />
(LI BS)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe „Pestizide“ Suckrau, I. (korrespondierendes<br />
Mitglied), (LI OL); Nguyen, T. H.<br />
(ordentliches Mitglied) (LI BS)<br />
GDCh-Fachgruppe Waschmittelchemie „Hauptausschuss Detergentien“ Rohrdanz, A. (IFB LG)<br />
GDCh-Fachgruppe Waschmittelchemie, Vorstand Rohrdanz, A. (IFB LG)<br />
Gemeinsame Projektgruppe von LAGV (AFFL und ALB) „Risikobeurteilung bei der<br />
Überwachung von Lebensmittelbetrieben“<br />
Gemeinsamer Arbeitskreis „Umweltradioaktivität“ der Radioaktivitätsmessstellen des<br />
Landes <strong>Niedersachsen</strong><br />
Honiganalytik-Workshop<br />
Beckhuis, A. (Dez. 22)<br />
Ballin, U. (IfF CUX);<br />
Weiszenburger, W. (LI BS); v.<br />
Keyserlingk, M.; Runge, M. (VI H)<br />
Janke, M. (IB CE); von der Ohe, K.;<br />
von der Ohe, W. (IB CE)<br />
IAG (Internationale Arbeitsgemeinschaft) Futtermittelmikroskopie Warnecke, H. (FI STD)<br />
Informations- und Dialogforum „Tierversuche in der Forschung“ Welzel, A. (Dez. 33)<br />
Initiative Nachhaltige Putenwirtschaft, Arbeitsgruppe Tierschutz Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Inspektion des Lebensmittel- und Veterinäramtes (FVO) der Europäischen Kommission,<br />
Dublin zur Berücksichtigung des EG-Rechtes betr. Lebensmittel aus gentechnisch<br />
veränderten Organismen oder deren Bestandteile vom 21.11. bis 28.11.2006 in<br />
Argentinien<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Interdisziplinärer Sachverständigenrat der Akkreditierungsstelle AKS Täubert, Th. (LI BS)<br />
Interdisziplinärer Sachverständigenrat der AKS Thoms, B. (VI H)<br />
International Commission of Plant and Bee Relationship Janke, M.; von der Ohe, W. (IB CE)<br />
International Honey Commission von der Ohe, W. (IB CE)
International Research Programme on Comparative Mycoplasmology; Cell Culture,<br />
Taxonomy, Diagnostic Team und Ruminant Mycoplasmas Team der International<br />
Organization for Mycoplasmology<br />
314<br />
Runge, M. (VI H)<br />
INvitRA (Ring Test Group on the In-vitro Bee Larvae Rearing) Janke, M. (IB CE)<br />
ISO WG 8, Working Group „Food safety management systems” Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
LAGV-Arbeitsgruppe Überarbeitung Handbuch Tiertransporte Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Länderarbeitsgemeinschaft gesundheitlicher Verbraucherschutz – Arbeitsgruppe<br />
Tierarzneimittel – (stellvertretendes Mitglied für das Niedersächsische Ministerium für den<br />
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – Referat 204)<br />
Länderübergreifende Arbeitsgruppe "Durchgängigkeit/Fische" im Bereich der<br />
Flussgebietsgemeinschaft Elbe zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie<br />
Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Lecour, C. (IfF CUX)<br />
Länderübergreifende Arbeitsgruppe des BfN „FFH-Monitoring“ Arzbach, H.-H. (IfF CUX)<br />
Länderübergreifende Projektgruppe „Finanzierung der amtlichen Kontrollen der<br />
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit“<br />
Länderübergreifender Arbeitskreis „Fischereiliche Gewässerzustandsüberwachung“ (EG-<br />
WRRL)<br />
Wiecking, H. (Dez. 43)<br />
Kämmereit, M. (IfF CUX)<br />
Länderübergreifender Arbeitskreis „Wiederansiedlung von Wanderfischen in der Weser“ Lecour, C. (IfF CUX)<br />
Landesarbeitsgruppe „Stallklima“, Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd, NRW Maiworm, K. (Dez. 33)<br />
Landesfachgruppe Oberflächengewässer zur Umsetzung der EG-WRRL beim NLWKN Meyer, L. (IfF CUX)<br />
Landesmarktverband <strong>Niedersachsen</strong> für Vieh und Fleisch e.V.<br />
Aue, B.; Grauer, A. (Dez. 43)<br />
Lebensmittelmonitoring-ad-hoc-Arbeitsgruppe „Probenvorbereitungsvorschriften“ Suckrau, I. (LI OL)<br />
Lebensmittelmonitoring-Expertengruppe „Natürliche Toxine“ Reinhold, L. (LI BS)<br />
Lebensmittelmonitoring-Expertengruppe „Pflanzenschutz- und<br />
Schädlingsbekämpfungsmittel, Biozide“<br />
Suckrau, I. (LI OL)<br />
Lehrtätigkeit für die Schulung von Auszubildenden im Beruf „Revierjäger“ Bisping, M. (Dez. 21)<br />
Monitoring Ausschuss Kombal, R. (Vertretung) (LI OL)<br />
Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Anorganische Rückstandsanalytik“ Christof, O. (VI OL)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Etablierung eines kontinuierlichen Tankmilchmonitorings für<br />
Brucellose/ Leukose“<br />
Schwochow, K. (Dez. 31)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Organische Rückstandsanalytik“ Christof, O., Heemken, O. (VI OL)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Umsetzung des nationalen Rückstandskontrollplanes“<br />
Siemer, H.; Heemken, O; Christof,<br />
O. (VI OL)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes“ Hänsel, A. (Dez. 23)<br />
Nds. Arbeitsgruppe „Vergabe von Registriernummern nach Viehverkehrsverordnung und<br />
Prämienrecht“<br />
Schwochow, K. (Dez. 31)<br />
Niedersächsische Arbeitsgruppe „BALVI IP Tierseuchen“ Schumacher, T. (Dez. 31)
Niedersächsische GLP-Kommission Hucke, J. (LI BS)<br />
Norddeutsche Kooperation, Laborleitertreffen Pflanzenschutzmittel Richter A. (LI OL), Suckrau, I. (LI<br />
OL)<br />
Norddeutsche Kooperation, Laborleitertreffen Rückstandskontrollplan Richter, A. (LI OL); Johannes, B.;<br />
Schnarr, K. (VI H)<br />
Normausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)<br />
Schumacher, T. (Dez. 31)<br />
Arbeitskreis „Hygieneschleusen“<br />
des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) in Berlin<br />
Notierungskommission für die amtliche Notierung von Mengenumsätzen und Preisen von<br />
Rindfleisch und Schweinehälften für das Preisgebiet <strong>Niedersachsen</strong><br />
315<br />
Grauer, A.; Aue, B.; Böker, H.;<br />
Juilfs, H. (Dez. 43)<br />
Optimierung landeseigener Labors AG IV Mikrobiologie Schleuter, G. (VI OL)<br />
Paul-Ehrlich-Gesellschaft f. Chemotherapie Klarmann, D. (VI OL)<br />
Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie, Sektion Antiparasitäre Chemotherapie, AG<br />
Echinokokkose<br />
v. Keyserlingk, M. (VI H)<br />
Pollen-Workshop von der Ohe, K. (IB CE)<br />
Private Expert in der Small Working Group „Sampling and sample preparation of fish and<br />
fishery products for the analysis of dioxins“ der EU<br />
Projektgruppe „Fischartenatlas von Deutschland und Österreich“, Leitung Hochschule<br />
Bremen<br />
Kruse, R. (IfF CUX)<br />
Meyer, L. (IfF CUX)<br />
Projektgruppe „Risikobeurteilung von Betrieben“ Graf, K. (Dez. 21)<br />
Prüfungsausschuss „Fachkräfte für Lebensmitteltechnologie“ bei der IHK Stade Kruse, R. (IfF CUX)<br />
Prüfungsausschuss Biologielaborant/-in der Industrie- und Handelskammer Hannover Nagel-Kohl, U.; Runge, M. (VI H)<br />
Prüfungsausschuss Chemielaboranten, Handelskammer Hamburg Hadler, E. (FI STD)<br />
Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer Hannover für den Ausbildungsberuf<br />
Tierwirt/Tierwirtin – Teilbereich Bienenhaltung<br />
Boecking, O. ; Lembke, S.; von der<br />
Ohe, W.; Schell, H.; Schönberger,<br />
H. (IB CE)<br />
Prüfungsausschuss für Chemielaboranten der IHK Lüneburg-Wolfsburg Raasch, B. (IFB LG)<br />
Prüfungsausschuss für Chemielaboranten der IHK Stade Lühmann, D. (IFB LG)<br />
Prüfungsausschuss für den höheren Veterinärdienst im Lande <strong>Niedersachsen</strong> Bisping, M. (Dez. 21)<br />
Prüfungsausschuss für die Meisterprüfung im Bereich der LWK <strong>Niedersachsen</strong> im<br />
Ausbildungsberuf Revierjäger/in<br />
Prüfungskommission „ordnungsgemäße Fischhaltung“ (Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, LVA Echem) - Mitglied<br />
Bisping, M. (Dez. 21)<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Prüfungskommission „Professionelle Klauenpflege“ der LWK <strong>Niedersachsen</strong>, Echem Maiworm, K. (Dez. 33)<br />
Prüfungskommission „Sachkundelehrgang Aquaristik“, Echem Maiworm, K. (Dez. 33)<br />
Prüfungskommission „Sachkundelehrgang Zierfische“ Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Qualitätszirkel Schädlingsbekämpfung Freise, J.F. (Dez. 32)
Redaktionelle Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsberichtes zum Bundesweiten Lebensmittelmonitoring“<br />
beim BVL<br />
Risikobeurteilung bei der Überwachung von Lebensmittelbetrieben; AG zur Umsetzung in<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
316<br />
Kruse, R. (IfF CUX)<br />
Beckhuis, A. (Dez. 22)<br />
Sachverständigenkommission „Neuartige Lebensmittel“ beim BfR Maslo, R. (LI BS)<br />
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover (Begutachter/in)<br />
Stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises der Technischen Sachverständigen der<br />
Länder<br />
Stellvertretendes Mitglied im Prüfungsausschuss für Lebensmittelkontrolleure beim<br />
LAVES<br />
Gräfe, A. (VI OL); Buntrock-Taux,<br />
E., Lemmler, S., Leskow, C.,<br />
Suckrau, I. (LI OL); Ballin, U (IfF<br />
CUX); Braune, S.; Nagel-Kohl, U.;<br />
Thoms, B. (Leitende<br />
Begutachterin), (VI H)<br />
Könneke, K. (Dez. 15)<br />
Bisping, M. (Dez. 21)<br />
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz ( TVT ) Etzel, V. ( IfF CUX ); Thomes, R.<br />
(Dez. 15)<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch – Bundesunterarbeitsgruppe Fischseuchen Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
(stellvertretender Vorsitz)<br />
Training für Begutachter, Mitarbeit als Tutor bei der AKS und im DAR Thoms, B. (VI H)<br />
Twinning- Projekt Bosnien Graf, K. (Dez. 21)<br />
Twinning Projekt Estland EE 05 IB AG 01, 16.10.-20.10.2006 Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Twinning Projekt Lettland (LV 05 IB AG 02): Adjustment of control of origin products<br />
foreseen for human consumption (fish products)<br />
Twinning Projekt Lettland LV/2004/EC/02 Food control: beverages and specific food<br />
25.09. bis 29.09.2006 und 20.11. bis 24.11.2006<br />
Jark, U. (Dez. 21/ IfF CUX)<br />
de Wreede. I. (LI BS)<br />
Twinning Projekt Litauen LT 04 AG 04; Thema: GC-MSD Suckrau, I (LI OL)<br />
Twinning Projekt Litauen LT 2003 IB AG 03, 21.-2<strong>3.</strong>2.2006 Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Twinning Projekt Litauen LT/2004/AG/04 „Strengthening of Official Control of Food Safety<br />
and Residues in Food in the Republic of Lithuania”<br />
Twinning Projekt PL 05 IB AG 07 in Polen (Bienenkrankheiten)<br />
Twinning Projekt TR 04 IB AG 02 „Lebensmittelsicherheit“ in Ankara, Türkei, 19.-<br />
22.6.2006, 11.9.-15.9.2006 und 30.10.-0<strong>3.</strong>11.2006<br />
Twinning Projekt Türkei TR2004/IB/AG/02 „Restructuring and Strengthening of the Food<br />
Safety and Control System in Turkey”, Activity 4 “Sector specific guides are prepared,<br />
distributed and introduced”, Ankara 17.-21.07.2006, Antalya 20.-24.11.2006<br />
Hänsel, A. (Dez. 23)<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Schaefer, C. (Dez. 33)<br />
Lay, J. (Dez. 21)<br />
UAG-Referenz-Messprogramm im Rahmen der Bund/Länder-Arbeitsgruppe Dioxine Bruns-Weller, E.; Knoll, A. (LI OL) (<br />
Umgang mit verölten Seevögeln und Walstrandungen Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Unterausschuss Methodenentwicklung (UAM) des Länderausschusses Gentechnik (LAG) Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
VDI/DIN-Fachbeirat „Monitoring der Wirkung von gentechnisch veränderten Organismen“ von der Ohe, W. (IB CE)<br />
VDLUFA, Fachgruppe Futtermittel Rasenack, U.; Schlägel, E.; Warnecke,<br />
H.; Zierenberg, B (FI STD)
VDLUFA, Projektgruppe LC/MS der Fachgruppen VI und VIII Suckrau, I (LI OL)<br />
Vorsitzender der Prüfungskommission für amtliche Fachassistenten Treu, H. (Dez. 14/31)<br />
Vorsitzender der Prüfungskommission für Hufbeschlagschmiede Treu, H. (Dez. 14/31)<br />
Vorsitzender der Prüfungskommission für veterinärmedizinisch-technische Assistenten Treu, H. (Dez. 14/31)<br />
Vorstandsmitglied des Verbandes beamteter Tierärzte in <strong>Niedersachsen</strong> Bisping, M. (Dez. 21)<br />
VWJD (Vereinigung der Wildbiologen und Jagdwissenschaftler Deutschlands ) v. Keyserlingk, M. (VI H)<br />
ZLG Expertenfachgruppe 14 (Fütterungsarzneimittel) Schnarr, K. (VI H)<br />
Zoonosenbeauftragter des Landes <strong>Niedersachsen</strong> Körfer, K.-H. (VI H)<br />
5.2 Verzeichnis der wissenschaftlichen Vorträge und Veröfentlichungen<br />
Arzbach, H.-H. (IfF<br />
CUX)<br />
Vortrag: Wiederauffüllung des Aalbestandes - Information und Sachstand,<br />
Jahreshauptversammlung der Fischereigenossenschaft Weser I, 30.0<strong>3.</strong>2006.<br />
Aue, B. (Dez. 43) Vortrag: Spargel-Vermarktungsnorm und Kontrollen in <strong>Niedersachsen</strong>, 19.01.2006,<br />
Jahreshauptversammlung der Vereinigung der Spargelanbauer in <strong>Niedersachsen</strong> e.V., Stadthalle<br />
Walsrode<br />
Vortrag: Vermarktungsnormen und deren praktische Umsetzung – Konsequenzen für Erzeuger und<br />
Verbraucher, 14.06.2006, „Agrarforum Legehennen – Legehennenhaltung in Deutschland – wohin<br />
geht der Weg“ – Forum der LWK <strong>Niedersachsen</strong> und des NGW, Hausstette<br />
Ballin, U. (IfF CUX) Vorträge: Zur Gefahrenanalyse von begrenzt haltbaren Heringserzeugnissen /<br />
Fischereierzeugnisse- Fang und Verarbeitung- eine Übersicht / Technologie von Marinaden,<br />
Anchosen und gesalzenen Fischereierzeugnissen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der<br />
Länder <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 08.05.-10.05.2006.<br />
Vortrag: Anorganische Schadstoffe in Fischereierzeugnissen: aktueller Stand und Bewertung,<br />
Seminar des Instituts für Fischkunde Cuxhaven „Fische und Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-17.05.2006.<br />
Bartelt, E. (IfF CUX) Vorträge: Risikoorientierte Untersuchung von Fischereierzeugnissen / Forellenproduktion in<br />
niedersächsischen Aquakulturen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der Länder<br />
<strong>Niedersachsen</strong> und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 08.05.-10.05.2006. / Seminar des Instituts für Fischkunde Cuxhaven „Fische und<br />
Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-17.05.2006.<br />
Vortrag: Risikoorientierte Untersuchung von Fischereierzeugnissen, Seminar des Instituts für<br />
Fischkunde Cuxhaven „Fische und Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-<br />
17.05.2006.<br />
Vortrag: Campylobacteriose durch Hähnchenfleisch – eine Risikoabschätzung, Campylobacter -<br />
Symposium: Bedeutung für Tier und Mensch. Bayerisches Landesamt für Gesundheit und<br />
Lebensmittelsicherheit (LGL) Akademie für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz<br />
(AGEV), Oberschleißheim, 30.05.2006.<br />
Vortrag: DIN EN ISO 22000 - Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit – Anforderungen<br />
an Organisationen in der Lebensmittelkette. Was will der internationale Standard erreichen?,<br />
Tagung ‚Die Qualitätssicherungssysteme der Land- und Ernährungswirtschaft auf dem EU-Markt<br />
der Zukunft, Bestandsaunahme und Ausblick’. Leipzig, Sächsische Landesanstalt für<br />
317
Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
(Mitautorin)<br />
Landwirtschaft, 22.06.2006.<br />
Vortrag: DIN EN ISO 22000 - Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit, Anforderungen<br />
an Organisationen in der Lebensmittelkette, Entstehung und Inhalte der Norm, BVQi Food<br />
Workshop, Dortmund, 12.09.2006.<br />
Vortrag: Campylobacter in Lebensmitteln – ein unterschätztes Problem ?, „bioMerieux -<br />
Symposium: Aktuelle Themen der Lebensmittelmikrobiologie“, Osnabrück, 10.10.2006.<br />
Vortrag: Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit – Anforderungen an Organisationen in<br />
der Lebensmittelkette, Aufbau und Inhalt der DIN EN ISO 22000 sowie der Technischen<br />
Spezifikationen ISO/TS 22003 und 22004, DIN, NAL-UA „Lebensmittelsicherheit - Management-<br />
Systeme“, DIN –Tagung „Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit nach DIN EN ISO<br />
22000“, DIN e.V., Berlin, 27.10.2006.<br />
Vortrag: Aquakulturen in <strong>Niedersachsen</strong> - Untersuchungen an Forellen aus niedersächsischen<br />
Teichwirtschaften („Aquakultur II“) und Schlussfolgerungen für weitergehende Untersuchungen zur<br />
Betriebshygiene („Aquakultur III“), 47. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der<br />
DVG, Garmisch-Partenkirchen, 26.09.-29.09 2006.<br />
Vortrag: Aquakulturen in <strong>Niedersachsen</strong> - Hygienebeprobungen zur Überwachung der<br />
Betriebshygiene in Aquakulturbetrieben <strong>Niedersachsen</strong>s im Zuge von EU-Zulassungen: Darstellung<br />
von Ergebnissen aus Voruntersuchungen („Aquakultur III“). LAVES-Informationsveranstaltung<br />
„Lebensmittelüberwachung West und Ost“, LAVES -Zentrale Oldenburg, 31.10.2006;<br />
Behördenhaus Hannover, 08.11.2006.<br />
Veröffentlichung: Quantification of Campylobacter on the surface and in the muscle of chicken legs<br />
at retail, Journal of Food Protection, 69/4, (2006), S. 757-61.<br />
Veröffentlichung: Quantification of Campylobacter Species Cross-Contamination during Handling of<br />
Contaminated Fresh Chicken Parts in Kitchens, Applied Environmental Microbiology, 72/1, (2006),<br />
S. 66–70.<br />
Veröffentlichung: Comparison of different sampling techniques and enumeration methods for the<br />
isolation and quantification of Campylobacter spp. in raw retail chicken legs, International Journal of<br />
Food Microbiology, 108/1, (2006), S. 115-119.<br />
Veröffentlichung: Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit: Anforderungen an<br />
Organisationen in der Lebensmittelkette, DIN EN ISO 22000, Amtstierärztlicher Dienst und<br />
Lebensmittelkontrolle, 13/1, (2006), S. 10-1<strong>3.</strong><br />
Bisping, M. (Dez. 21) Vortrag: Wildhygiene vor dem Verband der Niedersächsischen Jagdaufseher, 21.10.06<br />
Vortrag: „Regionale Lebensmittelproduktion und das neue Hygienerecht“ im Rahmen des Bayreuth-<br />
Kulmbacher Fachgesprächs, 17.11.2006, Kulmbach<br />
Teilnahme an einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe in Stuttgart zur Erstellung von Betriebslisten im<br />
Rahmen des neuen EU-Rechts, 18./19.9.06<br />
Boecking, O. (IB CE) Veröffentlichung: Parasitosen der Honigbiene. In T. Schnieder (Hrsg.) Veterinärmedizinische<br />
Parasitologie. 6.Auflage Parey in MVS Medizinverlage Stuttgart 699-714.<br />
Veröffentlichung: Honig ist nicht gleich Honig, Süß ja – sauer nein. BWagrar Landwirtschaftliches<br />
Wochenblatt 10/2006 11.März, 41.<br />
Veröffentlichung: Winterverluste 2005/2006. Bienenpflege 2/2006: 63 und ADIZ/db/IF 2/2006: 7-8.<br />
Veröffentlichung: Winterbehandlung mit Perizin® zur Varroa-Bekämpfung. Die neue Bienenzucht<br />
1/2006: 1<strong>3.</strong><br />
Veröffentlichung: Bienenvölkerverluste nicht durch übertriebenen Medikamenteneinsatz fördern.<br />
Die neue Bienenzucht 2/2006: 41.<br />
Veröffentlichung: Varroo-Bekämpfung. Die neue Bienenzucht 11/2006: 361-362.<br />
Vortrag: Epidemiologische Studie zur Nosemose an unterschiedlich stark mit Varroa infizierten<br />
Honigbienenvölkern. Jahrestagung der AG der Bieneninstitute, Hohenheim, 28.-30.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Amtliche Bienenseuchenbekämpfung – AFB Leitfaden, Untersuchungs- und<br />
Sanierungsablauf.<br />
Niedersächsisches Veterinärreferendariat, Celle, 27.06.06<br />
Vortrag: Amtliche Bienenseuchenbekämpfung – AFB Leitfaden, Untersuchungs- und<br />
Sanierungsablauf. Verband der beamteten Tierärzte Hamburg, Hamburg, 12.10.06<br />
Vortrag: Residues of organic acids are in conflict with „best beekeeping practice“. EurBeeconference,<br />
Prague, 1<strong>3.</strong>09.06<br />
Vortrag: Winterverluste – Rückblick und Ausblick. IV Stadt Celle, Celle, 10.10.06<br />
Vortrag: Die fachgerechte Anwendung von Oxalsäure im brutfreien Bienenvolk. KIV Northeim,<br />
318
Boecking, O., Kubersky<br />
U., Janke M. (IB CE)<br />
Northeim, 10.10.06<br />
Vortrag: Förderung der Wildbienen in Obstanlagen. ÖON-Seminarreihe,, Jork, 12.11.06<br />
Veröffentlichung: Residues of organic acids are in conflict with „best beekeeping practice“<br />
Proceedings of the Second European Conference of Apidologie EurBee Prague (Czech Republic)<br />
10-16. September 2006. 135-136<br />
Böhmler G. (LI BS) „Wirkungsbezogene Analytik im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung“, Vortrag im<br />
Rahmen einer Sitzung der § 64 LFGB Arbeitsgruppe „Wirkungsbezogene Analytik“, Berlin,<br />
2<strong>3.</strong>01.2006.<br />
„Lebensmittelhygiene – Aktuelle lebensmittelrechtliche Anforderungen in Hinblick auf die<br />
Gemeinschaftsverpflegung“, Vortrag im Rahmen eines Treffens des VHD (Vereinigung der<br />
Hygiene-Fachkräfte der Bundesrepublik Deutschland e. V.) im Niedersächsischen<br />
Landesgesundheitsamt, Hannover, 11.10.2006.<br />
Veröffentlichung: Böhmler G., Brack W., Gareis M., Goerlich R.: „Von der Wirkung zur Substanz:<br />
Wirkungsbezogene Analytik als neue Untersuchungsstrategie in der Lebensmittelkontrolle“, Journal<br />
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (JVL), 1, 4, 294-300.<br />
Veröffentlichung: Böhmler G., Kohnen R., Borowski U., Rühe A .: „Einsatz eines biologischen<br />
Testsystems (E-Screen) in der amtlichen Lebensmittelüberwachung zum Nachweis estrogen<br />
wirksamer Substanzen“, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (JVL), 1, 4, 325-<br />
331.<br />
Veröffentlichung: Thiem I., Böhmler G., Borowski U.: „Nachweis von Dioxinen und dioxinähnlichen<br />
Substanzen mit dem Micro-EROD-Bioassay: Untersuchungen von Milch und Rinderfett“, Journal für<br />
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (JVL), 1, 4, 310-316.<br />
Bötcher, L. (VI OL)<br />
(Mitautor)<br />
Bötcher, L.; Schöttker-<br />
Wegner, H.H.; Moss, A.<br />
(VI OL)<br />
Brügmann, M. (VI OL)<br />
(Mitautor)<br />
Brügmann, M., H.-H.<br />
Fiedler (VI OL)<br />
Bruns-Weller, E.<br />
(LI OL)<br />
Artikel: „The significance of genotyping for the epidemiological tracing of classical swine fever<br />
(CSF)”,. Depner et al.; Dtsch. tieärztl. Wschr. 113, 121–168, Heft 4, 2006<br />
Vortrag: BVD-Bekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong> – Ein Erfahrungsbericht. AVID Tagung Virologie,<br />
Kloster Banz , 1<strong>3.</strong>9.–15.9.2006<br />
Artikel: Ein außergewöhnlicher Fall von craniomandibulärer Osteopathie bei einem West Highland<br />
White Terrier, Schulte-Loh et. al.; Kleintierpraxis 51, 639-642, Heft 12, 2006<br />
Vortrag: Euthanasiemethoden: Plenumsdiskussion mit Empfehlungen zur Umsetzung rechtlicher<br />
Vorschriften, Tagung des Arbeitskreises Diagnostische Veterinärpathologie, Erbenhausen, 08.06.-<br />
10.06.2006<br />
Vortrag: Chemische und wirkungsbezogene Analytik, 34. Seminar Umwelthygiene: Dioxine in der<br />
Lebensmittelkette, WHO Collaborating Centre der Stiftung Tierärztlichen Hochschule, 10.02.2006,<br />
Hannover<br />
Veröffentlichung: Chemische und wirkungsbezogene Analytik der Dioxine und dioxinähnlichen PCB,<br />
Dtsch. Tierärztl. Wschr. 113, 289-320, Heft 8, August 2006<br />
Diekmann, J. (Dez. 32) Vortrag: Praxisrelevante Methoden zur Tötung und Beseitigung von Geflügel, AKNZ-Seminar<br />
„Fallstudie Tierseuchen – Aviäre Influenza“, 01.02.2006, Ahrweiler<br />
Vortrag: Möglichkeiten eines Mobilen Bekämpfungszentrums, AKNZ-Seminar „Fallstudie<br />
Tierseuchen – Aviäre Influenza“, 01.02.2006, Ahrweiler<br />
Vortrag: Aufgaben der Feuerwehr/des THW - Desinfektions-/ Dekontaminationsschleusen,<br />
Informationsveranstaltung der niedersächsischen Feuerwehren, 2<strong>3.</strong>02.2006,<br />
Landesfeuerwehrschule Celle<br />
Vortrag: Abläufe bei der Bekämpfung der Geflügelpest - Reinigung und Desinfektion<br />
- Persönlicher Schutz, LINDE-Workshop „Bekämpfung und Ausbreitung der Vogelgrippe“,<br />
27.0<strong>3.</strong>2006, Hamburg<br />
Vortrag: Schweinehaltungshygieneverordnung - Tierseuchenrecht, Weiterbildungsveranstaltung für<br />
prakt. Tierärzte der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Außenstelle Bakum, 22.04.2006, Vechta<br />
Vortrag: Möglichkeiten eines Mobiles Bekämpfungszentrum, AKNZ-Seminar „Krisenmanagement<br />
im Veterinärwesen“, 24.05.2006, Ahrweiler<br />
Vortrag: Methoden zur Tötung von Geflügel, AKNZ-Workshop „Möglichkeiten und Grenzen des<br />
Einsatzes einer Expertengruppe im Tierseuchenkrisenfall“, 18.10.2006, Ahrweiler<br />
319
Diekmann, J.; Dörrie,<br />
H-G.; Freise, J.;<br />
Gerdes, U.;<br />
Grothusmann, M.;<br />
Huesmann, J.; Jeske,<br />
C.; Kleingeld, D-W.;<br />
Mahnken, M.; Tapper,<br />
S.<br />
Vortrag: MBZ, AKNZ-Workshop „Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes einer Expertengruppe<br />
im Tierseuchenkrisenfall“, 18.10.2006, Ahrweiler<br />
Vortrag: Möglichkeiten eines Mobiles Bekämpfungszentrum, Länder übergreifende Krisenübung<br />
des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom 31.10.-<br />
0<strong>3.</strong>11.2006, Koblenz<br />
Vortrag: Methods for the culling of poultry, Twinning Project LT 2003/IB/AG/02, 1<strong>3.</strong>11.2006, Vilnius,<br />
Litauen<br />
Vortrag: Task Force Veterinary Affairs and AI-Situation, Twinning Project LT 2003/IB/AG/02,<br />
17.11.2006, Vilnius, Litauen<br />
Vortrag: LAVES - was ist denn das?; Arbeitskreis aktive Bäuerinnen und Landfrauenkreisverbände<br />
Oldenburg und Wesermarsch e. V., 01.12.2006, Rastede<br />
Veröffentlichung: Bericht zur Tierseuchenübung 2005, Oldenburg, Juni 2006<br />
Veröffentlichung: Jahresbericht 2005 der Task-Force Veterinärwesen des LAVES, Oldenburg,<br />
August 2006<br />
Diers, F. (Dez. 41) Seminar: Buchprüfung in der Futtermittelkontrolle, 22. / 2<strong>3.</strong>0<strong>3.</strong>2006, Sachkundelehrgang<br />
Futtermittelkontrolleurverordnung, Burg Warberg<br />
Dildei, C.; Dolzinski, B.;<br />
Runge, M. (VI H)<br />
Dildei, C.; Kirchhoff, H.<br />
(VI H/ LI BS)<br />
Dildei, C.; Kirchhoff, H.;<br />
Orellana, A. (VI H/LI<br />
BS)<br />
Kurzvortrag: Vorschlag für ein Handlungsschema als Sofortmaßnahme im Sinne des vorbeugenden<br />
Verbraucherschutzes zur einheitlichen Vorgehensweise beim Nachweis von Verotoxin bzw. VTEC<br />
in Vorzugsmilch. 58. Arbeitstagung des Arbeitskreises der auf dem Gebiet der<br />
Lebensmittelhygiene und der vom Tier stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen<br />
(ALTS), Berlin, 06.2006.<br />
Vortrag: Vorgehensweise in Vorzugsmilchbetrieben als Beispiel für angewandten<br />
Verbraucherschutz zur Vorbeugung von EHEC-Erkrankungen beim Menschen – Darstellung eines<br />
Handlungsschemas als Beispiel für die Zusammenarbeit von kommunalen Veterinärbehörden und<br />
dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES).<br />
47. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der DVG, Garmisch-Partenkirchen,<br />
26.-29.09.2006.<br />
Kurzvortrag: Zur Verkehrsbezeichnung von Döner Kebap und dönerähnlichen Produkten<br />
Kurzvortrag auf der 58. Arbeitstagung des Arbeitskreises der auf dem Gebiet der<br />
Lebensmittelhygiene und der vom Tier stammenden Lebensmittel tätigen Sachverständigen<br />
(ALTS), Berlin, 06.2006.<br />
Döner Kebap, Hackfleisch-Drehspieß oder Hackfleischzubereitung am Spieß? Zur<br />
Verkehrsbezeichnung von Döner Kebap und dönerähnlichen Produkten bei Abgabe in<br />
Fertigpackungen und in loser Form. 2006. Fleischwirtschaft, Juni.<br />
Djuren, M. (VI OL) Vortrag: Amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle der Reinigung und Desinfektion;<br />
Informationsveranstaltung zur Probennahme im Rahmen der amtlichen Kontrollen der<br />
Betriebshygiene in Fleisch- und Geflügelfleischbetrieben, Oldenburg, 5.,11. und 18.7.06<br />
Vortrag: Ergebnisse der amtlichen Kontrollen der Reinigung und Desinfektion in EU-Betrieben auf<br />
Basis der Hygieneuntersuchungen; Fachgespräch über die Anwendung der VO Nr. 2073/2005/EG;<br />
Oldenburg 25.9.06<br />
Döpker, M. (Dez. 41) Vortrag: <strong>Schwerpunkte</strong> der amtlichen Betriebs- und Buchprüfung, 25.09.2006, Fortbildung für in der<br />
Futtermittelüberwachung tätige Personen, Veranstalter: MUNLV NRW, Kleve / Haus Riswick<br />
Dörrie, H.-G. (Dez. 32) Vortrag: Was kommt auf die Jäger zu - Neues zum Hygienerecht, Hegering Großenkneten,<br />
1<strong>3.</strong>06.2006<br />
Vortrag: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, Seminar<br />
Vogelgrippe, Was kommt auf die Bereuungsstationen zu? 0<strong>3.</strong>11.06, Rastede<br />
Vortrag: Neues zum Hygienerecht - Auswirkungen auf den praktischen Jagdbetrieb, Nds. Forstamt<br />
Ahlhorn, 14.11.2006, Großenkneten<br />
Vortrag: Neues zum Hygienerecht, Nds. Landesforsten, Gebiet Süd, 15.11.2006, Münchehof<br />
320
Effkemann, S. (IfF<br />
CUX)<br />
Veröffentlichung: Jäger sind wieder dabei – Fortsetzung des Wildvogelmonitoring,<br />
Niedersächsischer Jäger, Nr. 5, 8 - 9<br />
Veröffentlichung: Wildvogelmonitoring Herbst 2006, Der Oldenburger Waidmann, 36 – 37<br />
Veröffentlichung: Untersuchung von Geflügelpestvorkommen bei Wildvögeln, Landesjagdbericht<br />
2005, 112 – 115<br />
Veröffentlichung: Schweinepest im Vormarsch, Niedersächsischer Jäger Nr.24, S.12<br />
Vorträge: Determination of veterinary drugs in food samples – legal aspects / Applications of LC-<br />
MS/MS in a German fishery control laboratory, LC-MS/MS SYMPOSIUM, 18.02.2006, Muscat,<br />
Oman.<br />
Vortrag: Determination of drug residues and shellfish toxins in seafood, ANALYTICA 2006,<br />
26.04.2006, München.<br />
Vorträge: Chemisch-analytische Methoden, eine Übersicht / Rückstandsproblematik bei<br />
Fischereierzeugnissen / Analytik von Biotoxinen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der<br />
Länder <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 08.05.-10.05.2006.<br />
Vorträge: Die Analytik von marinen Biotoxinen im Wandel der Zeit / Malachitgrün – verboten und<br />
trotzdem stark verbreitet, Seminar des Instituts für Fischkunde Cuxhaven „Fische und Fischwaren“<br />
für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-17.05.2006.<br />
Vortrag: Anwendung der LC-MS/MS in der amtlichen Lebensmittelüberwachung, Westfälische<br />
Wilhelms-Universität Münster, 30. Mai 2006, Münster.<br />
Vortrag: Is the use of biological approaches for diarrhetic shellfish poisoning still justifiable?, ICES<br />
Annual Science Conference, Maastricht, The Netherlands, 19.05.-2<strong>3.</strong>05.2006.<br />
Vortrag: Ultraspurenanalytik von Triphenylmethanfarbstoffen in Fischen, DVG-Tagung des<br />
Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene, Garmisch-Patenkirchen, 28. September 2002.<br />
Poster: Malachitgrün - Verboten und doch weit verbreitet, DVG-Tagung des Arbeitsgebietes<br />
Lebensmittelhygiene, Garmisch-Patenkirchen, 28. September 2002.<br />
Vortrag: Determination of marine biotoxins according to European requirements, TWINNING,<br />
Canakkale, Türkei, 06.10.2006.<br />
Veröffentlichung: Miese Muscheln?, GDCh Broschüre „HighChem hautnah - Aktuelles aus der<br />
Analytischen Chemie“, Frankfurt am Main, (2006) S. 64-65.<br />
Veröffentlichung: DSP-Toxine in Austern und Muscheln, GIT Laborfachzeitschrift, Heft 09 (2006) S.<br />
747-749.<br />
Veröffentlichung: Malachitgrün im Fisch, Labor&more, Heft 04 (2006) S. 14<br />
Etzel, V. (IfF CUX) Vortrag: Parasiten in Fischereierzeugnissen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der<br />
Länder <strong>Niedersachsen</strong> und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 08.05.-10.05.2006. / Seminar des Instituts für Fischkunde Cuxhaven „Fische und<br />
Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-17.05.2006.<br />
Etzel, V.; Ramdohr, S.<br />
(IfF CUX) Berges, M.<br />
(LUA BRHV)<br />
Etzel, V; Ramdohr, S.<br />
(IfF CUX)<br />
Vortrag: Zur Problematik von Gewichtsangaben bei Rollmops, 59. Arbeitstagung des ALTS, Berlin,<br />
12.-14.06.2006<br />
Vortrag: Bemerkungen zu Untersuchungsmethoden und Beurteilung von Nematodenlarven in<br />
Wildlachs, 59. Arbeitstagung des ALTS, Berlin, 12.06.-14.06.2006<br />
Franzky, A., (Dez. 33) Vortrag: „Pferdehaltung – alles in (Ver-) Ordnung?“ Pferdemesse „Hansepferd“ in Hamburg,<br />
30.04.2006<br />
Vortrag: „Rodeo-Veranstaltungen in Deutschland unter tierschutzrechtlichen, ethologischen und<br />
ethischen Gesichtspunkten“ Meeting „Rodeo in Europa“ EU-Kommission, Brüssel, 19.06.2006<br />
Vortrag: „Länder-Arbeitsgruppe EDV-Tierschutzmodul“, Dienstbesprechung der Landkreise<br />
<strong>Niedersachsen</strong>s, Hannover, 06.07.2006<br />
Vortrag: „Beurteilung von Ponyreitbahnen unter Tierschutzgesichtspunkten“, TVT-Tagung<br />
Tierschutz in Zoo und Zirkus, Köln, 22.09.2006<br />
Vortrag: „Umsetzung der neuen EU-Tiertransportverordnung“ Polizei <strong>Niedersachsen</strong>, Oldenburg,<br />
12.10.2006<br />
Vortrag: „Umsetzung der neuen EU-Tiertransportverordnung“ Besprechung Richter und<br />
Staatsanwälte <strong>Niedersachsen</strong>, Oldenburg, 14.11.2006<br />
321
Freise, J. F. (Dez. 32)<br />
Vortrag: „Umsetzung der neuen EU-Tiertransportverordnung“ Verband der beamteten Tierärzte<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, Verden, 2<strong>3.</strong>11.2006<br />
Veröffentlichung: „Tierschutzaspekte bei der Euthanasie von Pferden“ TVT-Nachrichten 2/2006, S.<br />
22-23<br />
Veröffentlichung: Großräumiger Schabenbefall in Damme. Der praktische Schädlingsbekämpfer 2:<br />
18-19.<br />
Veröffentlichung: Mögliche Gefahren in Tierställen und der Stallhygiene. UBA: Texte 22/06:<br />
Gesundheitsschutz durch Schädlingsbekämpfung – weiterhin möglich: 87-92.<br />
Veröffentlichung: Management eines großräumigen Schabenbefalls. UBA: Texte 22/06:<br />
Gesundheitsschutz durch Schädlingsbekämpfung – weiterhin möglich:208<br />
Veröffentlichung: Leitfaden zur Großräumigen Rattenbekämpfung. Eigenverlag LAVES: 24 pp.<br />
Veröffentlichung: Management eines großräumigen Schabenbefalls in Norddeutschland.<br />
Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle 2: 112-117.<br />
Veröffentlichung: Schädlingsbekämpfung in der Tierhaltung. Tagungsband des<br />
Schädlingsbekämpfungssymposiums am 07.12.2006 in Oldenburg. Eigenverlag LAVES: 39-49.<br />
Flyer: Rosskastanien in Gefahr?<br />
Veröffentlichung: Leitfaden großräumige Rattenbekämpfung. Der praktische Schädlingsbekämpfer<br />
9: 16-17.<br />
Veröffentlichung: Schädlingsbekämpfung ist Teil der Stallhygiene. Rundschau für Fleischhygiene<br />
und Lebensmittelüberwachung 12: 315-317.<br />
Veröffentlichung: Schädlinge als Überträger von Salmonellen bei Schweinen und Geflügel.<br />
Tagungsband zum Themenforum Salmonellenbekämpfung bei Schwein und Geflügel, EU-<br />
Gesetzgebung und Stand der Umsetzung: 42-52.<br />
Posterpräsentation: Management eines großräumigen Schabenbefalls. Fachtagung des UBA:<br />
Gesundheitsschutz durch Schädlingsbekämpfung - weiterhin möglich?. Berlin: 16. u. 17.0<strong>3.</strong>2006.<br />
Vortrag: Mögliche Gefahren in Tierställen und der Stallhygiene. . Fachtagung des UBA:<br />
Gesundheitsschutz durch Schädlingsbekämpfung - weiterhin möglich?. Berlin: 16. u. 17.0<strong>3.</strong>2006.<br />
Vortrag: Ungezieferproblematik in Zwischenlagern - Schädlingsbekämpfung auf<br />
Abfallbeseitigungsanlagen. Arbeitskreissitzung der Deponiebetreiber. Lüneburg: 15.06.2006.<br />
Vortrag: Ansatzpunkte für die Etablierung eines Resistenzmonitoringsystems für Ratten in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>. Fachgespräch Rodentizidresistenz in der BBA. Münster: 22. u. 2<strong>3.</strong>06.2006.<br />
Vortrag: Schädlinge als Überträger von Salmonellen bei Schweinen und Geflügel. Themenforum<br />
Salmonellenbekämpfung bei Schwein und Geflügel - EU-Gesetzgebung und Stand der Umsetzung.<br />
Hannover: 07.07.2006.<br />
Vortrag: Einsatzmöglichkeiten von Insektiziden/ (Repellentien) bei der Bekämpfung der<br />
Blauzungenkrankheit. Treffen der Vertreter der beamteten Veterinäre. Mainz: 28.08.2006.<br />
Vortrag: Befall einer Stadt mit Schaben - Fallbericht: Erfassung und Umsetzung der Bekämpfung.<br />
Fortbildung: Qualitätssicherung bei der Schädlingsbekämpfung und Maßnahmen zur Vermeidung<br />
von Schädlingsbefall. Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Düsseldorf. Düsseldorf:<br />
30.08.2006.<br />
Vortrag: Befall einer Stadt mit Schaben - Fallbericht: Erfassung und Umsetzung der Bekämpfung.<br />
Fortbildung des hafenärztlichen Dienstes. Akademie für öffentliches Gesundheitswesen,<br />
Düsseldorf. Bremerhaven: 14.09.2006.<br />
Vortrag: Rattenmonitoring und –bekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong> - Aspekte eines geplanten<br />
Resitenzmonitorings. Fortbildung des hafenärztlichen Dienstes. Akademie für öffentliches<br />
Gesundheitswesen, Düsseldorf. Bremerhaven: 14.09.2006.<br />
Vortrag: Befallsnachweis, -umfang und –stärke sowie Bestimmung der in <strong>Niedersachsen</strong> häufig<br />
vorkommenden Schädlingsarten anhand der Befallsspuren Treffen der Gesundheitsaufseher des<br />
ehem. Regierungsbezirkes Weser-Ems. Leer: 12.10.2006.<br />
Vortrag: Schädlingsbekämpfung in der Tierhaltung. Schädlingsbekämpfungssymposium.<br />
Oldenburg: 07.12.2006.<br />
Vortrag: Ansatzpunkte für die Etablierung eines Resistenzmonitoringsystems für Ratten in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>. Mitgliederversammlung des Landesverbandes <strong>Niedersachsen</strong> / Bremen des<br />
Deutschen Schädlingsbebkämpferverbandes. Hannover: 1<strong>3.</strong>12.2006.<br />
Gallisch, P. (Dez. 41) Seminar: Anerkennung, Registrierung und Zulassung von Betrieben, 27. / 28.0<strong>3.</strong>2006,<br />
Sachkundelehrgang Futtermittelkontrolleurverordnung, Burg Warberg<br />
Gässler, N.; Paul, H.; Veröffentlichung: Rapid detection of urinary tract infection – evaluation of flow cytometry. 2006.<br />
322
Runge, M. (VI H) Clin. Nephrol. 66 (5) 331-335.<br />
Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Vortrag: Das Tierseuchenkoordinierungszentrum des LAVES, Einführungsveranstaltung,<br />
Oldenburg, 01.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Aktuelle Lage und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest bei Wildvögeln;<br />
Landräte-Konferenz, Hannover, 08.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Aufgaben und Tätigkeiten der Task-Force Veterinärwesen, Tierseuchenausschuss des<br />
Landvolkverbandes <strong>Niedersachsen</strong>, Verden, 14.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Rechtsgrundlagen zur Tötung von Geflügel im Tierseuchenfall, Fortbildungsveranstaltung<br />
zur Tötung von Geflügel, Oldenburg, 06.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Maßnahmen zur Bekämpfung der Klassischen Geflügelpest, Jahreshauptversammlung<br />
des Rassegeflügelzuchtverbandes Hannover, Soltau, 08.04.2006<br />
Vortrag: Einsatz von Tierärzten im Tierseuchenkrisenfall, Vortrag im Rahmen der Erstellung eines<br />
e-learning-Programms der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Hannover 24.05.2006<br />
Vortrag: Tierseuchenkrisenmanagement in <strong>Niedersachsen</strong>, Seminar zur Ausbildung der<br />
Veterinärreferendare, Hannover, 06.06.2006<br />
Vortrag: Crisis management in Lower Saxony, Workshop Classical Swine Fever, Hannover,<br />
11.10.2006<br />
Vortrag: Vogelgrippe und Krisenmanagement aus jagdlicher Sicht, Mitgliederversammlung des<br />
Hegerings Großenkneten, Döhlen, 06.10.2006<br />
Vortrag: Struktur der Veterinärverwaltung und Tierseuchenkrisenmanagement in <strong>Niedersachsen</strong>,<br />
Berufsbildende Schulen II in Oldenburg, 06.10.2006<br />
Vortrag: Gemeinsame Tierseuchenkrisenzentren und Kompartimentierung, Dienstbesprechung des<br />
LAVES mit den kommunalen Veterinärbehörden, Verden, 21.11.2006<br />
Vortrag: Tätigkeit von Tierärzten in der Tierseuchenbekämpfung, Informationsveranstaltung der<br />
Tierärztlichen Hochschule zum Berufsbild Amtstierärztlicher Dienst, Oldenburg, 27.11.2006<br />
Vortrag: Das Mobile Bekämpfungszentrum als Baustein im Tierseuchenkrisenmanagement, MBZ-<br />
Einweihungsveranstaltung, Barme, 11.12.2006<br />
Graf, K. (Dez. 21) Vortrag: Lebensmittelrecht und Wildbrethygiene“ im Forstamt Stavenhagen, M-V am 07.04.06<br />
Vortrag: „Sensorik von Wildbret: Einflüsse der Jagdpraxis“ im Lebensmittelinstitut Oldenburg am<br />
20.06.06<br />
Vortrag: „Ablauf des EU-Zulassungsverfahrens“ im LK Aurich am 26.09.06<br />
Hänsel, A.<br />
(Dez. 23)<br />
Vortrag: National Residue Control Plan (NRCP) 2005 –Positive results and measures in Lower<br />
Saxony- Final meeting im Rahmen des Twinning Projektes LT/2004/AG/04 “Strengthening of<br />
Official Control of Food Safety and Residues in Food in the Republic of Lithuania” in Litauen am<br />
14./15.09.2006<br />
Vortrag: National Residue Control Plan (NRCP) –Implementation in Lower Saxony- im Rahmen des<br />
Twinning Projektes BA05/IB/AG/01 activity „Exchange of best practice, focussed on administrative<br />
organisation, legislation, food control and animal health and welfare” in Oldenburg am 04. und<br />
06.12.2006<br />
Hashem, A. (FI STD) Vortrag auf den LC-MS Tagen im LI OL, 20.0<strong>3.</strong>2006: Q-Trap 2000: Erfahrung in der<br />
Futtermittelanalytik im FI STD<br />
Mykotoxine. Auf der Suche nach dem DON – Clean-up und LC-MS-Bestimmung von<br />
Deoxynivalenol in Futtermitteln; Labor&more, 4, 2006<br />
Haunhorst, K. (Dez. 21) Vortrag: Amtliche Überwachung von Kühlhausern; Beispiele aus der Praxis-Praxisseminar des<br />
Verbandes Deutscher Kühlhauser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) am 14. Februar in Bonn<br />
Vortrag: Official Control of food safety and residues in food- Vortragsveranstaltung am 6.10.06 in<br />
Vilnius (Litauen)<br />
Janke, M. (IB CE) Veröffentlichung: Honigbienen im Kartoffelacker - Betrachtungen zu einer problematischen<br />
Beziehung. ADIZ/db/IF 142. (157.) Jahrgang, 10, 2006, S. 14-15<br />
Vortrag: Colony losses - Interactions of plant protection products and other factors. EurBeeconference,<br />
Prague, 1<strong>3.</strong>09.06<br />
Vortrag: Bienenvergiftungen - Wechselwirkungen von PSM und anderen Faktoren. „Runder Tisch“<br />
Deutscher Bauernverband, Bonn, 09.11.06<br />
323
Janke, M. et al. (IB CE) Intoxication of honeybees – Interaction of Plant Protection Products and other Factors.<br />
In: Proceedings of the 2nd European Conference of Apidology, Prag 2006, S. 79<br />
Jark, U. (Dez. 21)<br />
Vortrag: Bericht über die EU- Mission „Fisch und Muschelhygiene“ im Oktober 2005 einschl.<br />
Schlussfolgerungen / Zulassung von Fischverarbeitenden Betrieben ab 2006 (Teichbetriebe,<br />
Fischereifahrzeuge), Arbeitsbesprechungen "Lebensmittel-Ost" und "Lebensmittel-West",<br />
Braunschweig u. Hannover, 24. / 25.01.06<br />
Vortrag: Das neue EU-Lebensmittelhygienepaket – Änderungen und deren Umsetzung im Betrieb,<br />
Mitgliederversammlung des Landesfischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong>, Großburgwedel,<br />
28.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Wie stelle ich meinen Betrieb auf die Anforderungen der neuen EU-Hygieneverordnung um<br />
– ein praktischer Leitfaden, EuroTier 2006, Hannover, 16.11.06<br />
Juilfs, H. (Dez. 43) Schulung / Vortrag: Schlachtkörperklassifizierung, 28.-30.0<strong>3.</strong>2006, 04.-06.07.2006,06.-09.11.2006,<br />
Ausbildung von Sachverständigen für die Einreihung von Schlachtkörpern in Handelsklassen, mit<br />
LWK <strong>Niedersachsen</strong> und BFEL Kulmbach, wechselnde Orte<br />
Kämmereit, M. (IfF<br />
CUX)<br />
Kirchhoff, H.; Orellana,<br />
A.; Leidreiter, M. (LI<br />
OL)<br />
Kirchhoff, H.; Rieckhoff,<br />
D.<br />
(LI OL)<br />
Kirchhoff, H.;<br />
Ziegelmann, B.<br />
(LI OL)<br />
Klarmann, D. (VI OL)<br />
(Mitautor)<br />
Vortrag: Fließgewässer als Lebensraum für die Fischfauna / Fischereiliche<br />
Gewässerbewirtschaftung, Lehrgang für Gewässerwarte und andere Fachkräfte des<br />
Umweltschutzes des Landessportfischerverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e.V., 09.05.2006 und<br />
12.09.2006.<br />
Vortrag: Wiederauffüllung des Aalbestandes - Information und Sachstand, Jahrestagung der<br />
Arbeitsgemeinschaft der Fischereigenossenschaften an der Weser, 01.06.2006.<br />
Vortrag: Wiederauffüllung des Aalbestandes - Information und Sachstand, Bzirksfischereiverband<br />
für Ostfriesland e.V., 12.06.2006.<br />
Vortrag: Fließgewässer als Lebensraum für die Fischfauna/Methoden der Fischbestandsaufnahme,<br />
Gewässerkundliche Arbeitstagung für Gewässerwarte des Landesfischereiverbandes Weser-Ems<br />
e.V. - Sportfischerverband, 06.11.2005.<br />
Poster: Untersuchungen zur Aalabwanderung an Wasserkraftanlagen in <strong>Niedersachsen</strong>, Tagung<br />
"Fischfauna der Weser - Vernetzung von Lebensräumen" der Flussgebietsgemeinschaft Weser,<br />
30.10.2006.<br />
Veröffentlichung: Zur Entwicklung der Fischbestände im Dümmer, Arbeiten des Deutschen<br />
Fischereiverbandes e.V., Heft 82, S. 7-39 (2005, erschienen 2006).<br />
Vortrag: Widersprüchliche Verkehrsbezeichnung auf Fertigpackungen – Systematischer Versuch<br />
der Verbrauchertäuschung oder korrekte Kennzeichnung? 59. Arbeitstagung des ALTS, Berlin,12.–<br />
14.06.2006<br />
Vortrag: QUID bei Fleischerzeugnissen, die unter Verwendung von Fleisch verschiedener Tierarten<br />
hergestellt werden / 59. Arbeitstagung des ALTS, Berlin,12.–14.06.2006<br />
Vortrag: Wie weitreichend ist der Schutz der „geschützten geographischen Angaben“ (g.g.A.)<br />
gemäß VO (EWG) 2081/92? 59. Arbeitstagung des ALTS, Berlin,12.–14.06.2006<br />
Artikel: „Results of an interlaboratory testb on antimicrobial susceptibility testing of bacteria from<br />
animals by broth microdilution“, J. Wallmann et. al., Int. J. Antimicrobial Agents (2006), 27: 482–490<br />
Artikel:„Mögliche Gründe für das Versagen einer antibakteriellen Therapie in der tierärztlichen<br />
Praxis“, A. Richter et. al., Der Prakt. Tierarzt (2006), 87: 624-631.<br />
Poster: „Layout-Vorschlag für die in-vitro Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Erreger von<br />
Kleintieren gegenüber antimikrobiellen Wirkstoffen“, Tagung der Fachgruppe Bakteriologie und<br />
Mykologie, Wetzlar, 14. – 17.06.2006, publiziert als Abstract in der Berl. Münch. Tierärztl. Wschr.<br />
(2007), 120, P38, Seite 24.<br />
Poster: „Layout proposals for microtitre plates to be used in routine antimicrobial susceptibility<br />
testing of bacterial pathogens from pet and companion animals” und „Layout proposals for<br />
microtitre plates to be used in routine antimicrobial susceptibility testing of bacterial pathogens from<br />
large food-producing animals and from mastitis cases”, 3rd Intern. Conf. on Antimicrobial Agents in<br />
Veterinary Medicine (AAVM), Orlando, USA, 16.–20.05.2006<br />
Klarmann, D.; Moss, A. Vortrag: „Nachweis von Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis bei Rindern in <strong>Niedersachsen</strong><br />
324
(VI OL) – Erkenntnisse nach Umstellung der Untersuchung im Rahmen des Niedersächsischen<br />
Sanierungsverfahrens“, <strong>3.</strong> Arbeitstagung „Mykobakterieninfektionen“ des NRL<br />
Tuberkulose/Paratuberkulose beim FLI, 11.–12.Okt..2006, Jena.<br />
Vorträge: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>,<br />
Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Tierarzneimittelüberwachung im kleinen Grenzverkehr,<br />
Organisation der Rückstandsüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> gem. Rückstandskontrollplan (NRKP);<br />
Fortbildungsreihe „Lebensmittel u. Arzneien“ des Bildungsinstitutes der Polizei am 2<strong>3.</strong>02.2006 in<br />
Wennigsen<br />
Vortrag: Erfahrungen aus der arzneimittelrechtlichen Kontrollpraxis, 25. Internationaler<br />
Veterinärkongress Deutschland – Österreich – Schweiz, Bad Staffelstein, 24.04.2006<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>,<br />
Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP) – Umsetzung in <strong>Niedersachsen</strong> -, Arbeitsbesprechung<br />
mit dem Bundeskriminalamt in Oldenburg, 2<strong>3.</strong>07.2006<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> – Überwachung tierärztlicher<br />
Hausapotheken, einschließlich häufig festgestellter Mängel -, Fortbildungsveranstaltung der<br />
Kreisstelle Oldenburg der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, 1<strong>3.</strong>09.2006<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung im kleinen Grenzverkehr – rechtliche Grundlagen und<br />
Erfahrungsberichte (Beispiel: <strong>Niedersachsen</strong> – Niederlande), Jahrestagung der pharmazeutischen<br />
und veterinärmedizinischen Überwachungsbeamten in Ulm, am 20.09.2006<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> – Überwachung tierärztlicher<br />
Hausapotheken, einschließlich häufig festgestellter Mängel -, Fortbildungsveranstaltung der<br />
Kreisstelle Wesermarsch der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, 22.11.2006<br />
Vortrag: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit –<br />
Abteilung 2 – Lebensmittelsicherheit -, TiHo-Praxisexkursion in Oldenburg, 27.11.2006<br />
Kleingeld, D.W. (Dez.<br />
32)<br />
Vorlesung Aquakultur I: Krankheiten und Hygiene in der Fischhaltung, Institut für Tierzucht und<br />
Haustiergenetik, Universität Göttingen, 04. – 05.01.2006, Göttingen<br />
Gastvorlesung: Fish epizootics and fish disease control in Germany, emphasized on Lower-<br />
Saxony, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Centro de Estudios del Mar y<br />
Acuicultura (CEMA), 02.02.2006, Ciudad Guatemala, Guatemala<br />
Vortrag: Einsatz von Setzkeschern in der Angelfischerei – eine tierschutzrechtliche Betrachtung,<br />
6<strong>3.</strong> Sitzung des Niedersächsischen Tierschutzbeirates, 14.02.2006, Hannover<br />
Broschüre „Fischseuchenprävention bei der Wiederansiedlung von Wanderfischen“ (fachliche<br />
Beratung); FGG Weser, 2006<br />
Berichterstattung Fischseuchen und Fischkrankheiten in <strong>Niedersachsen</strong>. In: Jahresbericht über die<br />
Deutsch Fischereiwirtschaft 2005 (BMELV) , S. 141-142<br />
Vortrag: Konditionierung von Fischen; Workshop „Der Fisch als Patient“, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, 04.0<strong>3.</strong>2006, Hannover<br />
Vortrag: Probenahme bei Fischen; Workshop „Der Fisch als Patient“, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, 04.0<strong>3.</strong>2006, Hannover<br />
Vortrag: Gesunde Fische als gesunde Lebensmittel; Mitgliederversammlung des<br />
Landesfischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e.V., 28.0<strong>3.</strong>2006, Großburgwedel<br />
Vortrag: Aktuelles zur Fischseuchenbekämpfung; Mitgliederversammlung des<br />
Landesfischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e.V., 28.0<strong>3.</strong>2006, Großburgwedel<br />
Vortrag: Fischseuchen im Tierseuchenbekämpfungshandbuch; Sitzung der Arbeitsgruppenleiter zur<br />
„Fortentwicklung des Tierseuchenbekämpfungshandbuchs“, 05.04.2006, Bonn<br />
Vortrag: Fischseuchenbekämpfung in der behördlichen Praxis; Fachseminar des<br />
niedersächsischen Veterinärreferendariats, 25.04.2006, Hannover<br />
Organisation des Lehrgangs „Sachkundenachweis bei Zierfischen“; Vorträge: Fischkrankheiten,<br />
Fischseuchengesetzgebung, Arzneimittelgesetzgebung, Dokumentation im Zoofachhandlung; Koi-<br />
Herpesvirus – aktuelle Informationen, 05.-07.05.2006 und 24. – 26.11.2006, Echem<br />
Vortrag: Die wichtigsten Krankheiten der einheimischen Süßwasserfische,<br />
Fischseuchenbekämpfung aus Sicht der behördlichen Praxis; Gewässerwartelehrgang, 12.05.2006<br />
und 15.09.2006, Bad Salzdetfurth<br />
Vortrag: Zum amtstierärztlichen Umgang mit Koi-Herpesvirus-Infektionen, Sitzung der<br />
Arbeitsgemeinschaft der Fischgesundheitsdienste, 24.05.2006, Weimar<br />
Vortrag: Probleme mit Gesundheitsbescheinigungen gemäß der Entscheidung 1999/567/EG,<br />
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Fischgesundheitsdienste, 24.05.2006, Weimar<br />
Vortrag: Zum Vorhaben einer Gebietszulassung nach § 13 Fischseuchen-VO im niedersächsischen<br />
325
Teil des Wassereinzugsbereiches der Warmen Bode , 22.06.2006, Wernigerode<br />
Vortrag: Neuentwurf eines Niedersächsischen Merkblatts über den Betrieb von Angelteichen, 64.<br />
Sitzung des Niedersächsischen Tierschutzbeirates, 04.07.2006, Hannover<br />
Vortrag: Anforderungen an die Fisch- und Anlagenhygiene, Lehrgangsveranstaltung „Der Weg zur<br />
eigenen Fischproduktion“ der LWK <strong>Niedersachsen</strong>, 06.10.2006, Echem<br />
Vortrag: Fischseuchen im bundeseinheitlichen Tierseuchenbekämpfungshandbuch, IX.<br />
Gemeinschaftstagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Sektionen der EAFP,<br />
„Gesunde Fische überall“, 11. – 1<strong>3.</strong>10.2006, Murten (CH)<br />
Vortrag: Die künftige EU-Fischseuchengesetzgebung und ihre Folgen, Infotagung für Fischwirte,<br />
LÖBF NRW, 24.10.2006, Albaum<br />
Vortrag: Aal-Herpesvirus – Eine Gefahr für Wildaalbestände, Weiterbildungsveranstaltung für<br />
niedersächsische Gewässerwarte, 11.11.2006, Verden<br />
Vortrag: Epidemiologie der Fischseuchen, 6. Lehrgang zur Vorbereitung auf die Anstellungsprüfung<br />
für die Laufbahn des höheren Veterinärdienstes, 15.12.2006, Oberschleißheim<br />
Kombal, R. (LI OL) Vortrag: „Unerwünschte Rückstände und Kontaminanten in pflanzlichen Lebensmitteln“ auf der<br />
NieKE/DGE-Fachtagung „Rückstände im Blickpunkt, Ernährungswirtschaft - Medizin –<br />
Verbraucher“ am 1<strong>3.</strong>09.2006 im Landesmuseum für Natur und Mensch, Oldenburg<br />
Kruse, R. (IfF CUX) Vorträge: Nachweis und Bewertung organischer Schadstoffe in Fischereierzeugnissen /<br />
Phosphatanwendung bei Fischereierzeugnissen / Kohlenmonoxidbehandlung von<br />
Fischereierzeugnissen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong><br />
und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der<br />
amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven, Bremerhaven,<br />
08.05.-10.05.2006.<br />
Vorträge: Organische Schadstoffe und Rückstände / Verbrauchertäuschung durch den Einsatz von<br />
CO und Polyphosphat, Seminar des Instituts für Fischkunde Cuxhaven „Fische und Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-17.05.2006.<br />
Poster: Automated determination of Hg-species in marine biota by means of GC-CVAFS after<br />
TMAH digestion and solvent stripping as serial sample preparation, ICES Annual Science<br />
Conference, Maastricht, The Netherlands, 19.05.-2<strong>3.</strong>05.2006.<br />
Kruse, R. (IfF CUX)<br />
(Mitautor)<br />
Veröffentlichung: Bestimmung der Organozinn-Belastung in Miesmuscheln (Mytilus<br />
galloprovincialis), Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102/8 (2006), S. 378-380.<br />
Kubersky, U. (IB CE) Vortrag: Ökologische Bienenhaltung. Vortragsveranstaltung der Gesellschaft der Freunde des<br />
Bieneninstituts Celle, 04.0<strong>3.</strong>06<br />
Vortrag: Förderung von Wildbienen in Obstanlagen. ÖON-Seminarreihe „Förderung der<br />
Artenvielfalt“, 16.10.06<br />
Kubersky, U.,<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Veröffentlichung: Pollen sprühen statt Bienenflug? Deutsches Bienen-Journal 5/2006: 205.<br />
Poster: Bestäubungsversuche bei Kulturheidelbeeren und Erdbeeren im ökologischen Landbau.<br />
Jahrestagung der AG der Bieneninstitute, Hohenheim, 28.-30.0<strong>3.</strong>2006<br />
Kühne, M. (AL 5) Lehrtätigkeit im Rahmen der Vorlesungen „Lebensmittelkunde“, „Querschnittsfach Lebensmittel“<br />
und „Fleischhygiene“ an der Tierärztlichen Hochschule, WS 2005/6, SS 2006, WS 2006/7<br />
Vortrag: Aktuelle Probleme mit Rückständen und Kontaminanten aus der Sicht der<br />
Lebensmittelüberwachung. DGPT- Fachtoxikologenkursus „Lebensmitteltoxikologie“, Hannover,<br />
10.10.2006<br />
Vortrag: Zukünftige Entwicklung der Abteilung 5 Untersuchungseinrichtungen (VW-Reform, interne<br />
Optimierung, wissenschaftliche Weiterentwicklung, Risikobewertung), Landesverband der<br />
Lebensmittelchemiker Nds., 14.6.2006, Bremen<br />
Kühne, M. (AL 5)<br />
(Mitautor)<br />
Die zukünftige Rolle des amtlichen Tierarztes bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Dtsch.<br />
Tierärztl. Wschr. 113, 69-72<br />
Food Processing Effects on Tetracycline Residues in Gelatin derived from Bones: Methodology and<br />
Comparison of Manufacturing Conditions. Arch. Lebensmittelhyg. 57, 8-10<br />
Is visual diagnosis of Taenia saginata Cysticercosis during meat inspection unequivocal?<br />
Parasitology Research 99, 405-409<br />
Ist die Miesmuschel mies? Nachweis von potentiell humanpathogenen Erregern in Miesmuscheln.<br />
Forschungsmagazin der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (ISSN 0947-0956), 2006, 9-<br />
326
11.<br />
Lay, J. (Dez. 21) Vorträge: Einführung in das Lebensmittelrecht, Schulungsreihe der Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong> für Cross Compliance- Berater, Nienburg, Meppen, Hannover, Osnabrück, Uelzen,<br />
Cloppenburg, Braunschweig, Bremervörde, Oldenburg, 10.-1<strong>3.</strong>01. und 16.-19.01. und 26.01.2006<br />
Vortrag: Cross Compliance – Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen im Hinblick auf die<br />
Lebensmittelsicherheit, Arbeitstagung 2006 des Regionalverbandes Nord der<br />
Lebensmittelchemischen Gesellschaft, Oldenburg, 07.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vortrag: Lebensmittelhygiene in Schulen mit Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung,<br />
Arbeitskreis Schule des Niedersächsischen Städtetages, Lüneburg, 30.0<strong>3.</strong>2006<br />
Vorträge: Geplantes amtliches Überwachungsprogramm hinsichtlich Futtermittel- und Lebensmittel<br />
aus dem Überschwemmungsbereich der Elbe, Infoveranstaltung der Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong> für betroffene Landwirte. Damnatz, Gartow, Neuhaus, Bleckede, Marschacht, 15.-<br />
17.05.2006<br />
Vortrag: Das neue Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und die Konsequenzen für die<br />
Kontrolle auf Schiffen, Fortbildungsveranstaltung „Überwachung der Hafen-, Flughafen- und<br />
Schiffshygiene“ der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Bremerhaven, 14.09.2006<br />
Vortrag: Die Lebensmittelhygiene – aktuelle Änderungen der lebensmittelrechtlichen<br />
Anforderungen im Hinblick auf die Milchhygiene, Milchsachkundelehrgang der LUFA Nord-West,<br />
Hannover, 12.10.2006<br />
Vorträge: Erfahrungen bei der Lebensmittelüberwachung von Discountern im Landkreis<br />
Rotenburg/Wümme, Arbeitsbesprechung Lebensmittelüberwachung, Oldenburg, Hannover, 31.10.<br />
und 08.11.2006<br />
Lecour, C. (IfF CUX) Vortrag: Möglichkeiten zur Gewährleistung des Fischabstiegs im Bereich von Wasserkraftanlagen<br />
in <strong>Niedersachsen</strong>, <strong>3.</strong> Fachtagung der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. - Probleme des<br />
Fischartenschutzes -, 0<strong>3.</strong>/04.0<strong>3.</strong>2006. Fischaufstieg und Fischabstieg im Bereich von<br />
Querbauwerken in <strong>Niedersachsen</strong> - aus Sicht der Fischereiverwaltung, Mitgliederversammlung des<br />
Landesfischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e.V., 28.0<strong>3.</strong>2006. Anforderungen an Bau und Gestaltung<br />
von Fischaufstiegsanlagen, 46. Fortbildungsveranstaltung des BWK, 2<strong>3.</strong>05.2006. Durchgängigkeit<br />
von Fischaufstiegsanlagen und Rückstaubereichen, Informationsveranstaltung der Stadt<br />
Braunschweig für die Landkreise im Einzugsgebeit der Oker, 19.06.2006. Ökologische<br />
Durchgängigkeit von Fließgewässern, Fortbildungsveranstaltung des NLWKN, 14.07.2006.<br />
Fischartenschutz/Fischwanderungen/Fischsterben, Lehrgang für Gewässerwarte und andere<br />
Fachkräfte des Umweltschutzes des Landessportfischerverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e.V., 11.05.2006<br />
und 14.09.2006.<br />
Poster: Untersuchungen zur Abwanderung von Smolts in der Oker im Frühjahr 2004, Tagung<br />
"Fischfauna der Weser - Vernetzung von Lebensräumen" der Flussgebietsgemeinschaft Weser,<br />
30.10.2006.<br />
Veröffentlichung: Möglichkeiten zur Gewährleistung des Fischabstiegs im Bereich von<br />
Kleinwasserkraftanlagen in <strong>Niedersachsen</strong>, Artenschutzreport, (Sonder-)Heft Fischartenschutz, 19<br />
(2006), S. 18-22.<br />
Lecour, C. (IfF CUX)<br />
(Mitautorin)<br />
Veröffentlichungen: Abwanderung von Fischen im Bereich von Wasserkraftanlagen, LAVES<br />
Binnenfischerei in <strong>Niedersachsen</strong>, H. 8, 51 pp.. Methodenstandard für die Funktionskontrolle von<br />
Fischaufstiegsanlagen, BWK-Fachinformation 1/2006, 115 pp..<br />
Lehmann, I. (Dez. 23) Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>, Veranstaltung der Kreisstelle Nienburg der<br />
Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, 2<strong>3.</strong>08.2006<br />
Luger, A. (IFB LG)<br />
Mahnken, M. (Dez. 32)<br />
Poster: Untersuchungen zur Kobaltlässigkeit von Lebensmittelbedarfsgegenständen,<br />
35. Deutscher Lebensmittelchemikertag, Dresden 18.-20.9.2006<br />
Vortrag: Hygiene-Grundlagen im Tierseuchenfall, Vortrag im Rahmen der Erstellung eines elearning-Programms<br />
der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Oldenburg, 2<strong>3.</strong>08.2006<br />
Vortrag: Mobiles Tierseuchenbekämpfungszentrum (MBZ), Informationsveranstaltung des THW für<br />
eine SPD-Delegation auf dem Wasserübungsplatz in Barme; Dörverden / Barme, 24.08.2006<br />
Maiworm, K., (Dez. 33) Veröffentlichung: Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: Abschnitt Schweine,<br />
BAUMGARTE, J., S. PETERMANN, K. MAIWORM, ATF-Tagung, Aktuelle Probleme des<br />
Tierschutzes am 14./15.09.2006 in Hannover, DTW im Druck<br />
327
Veröffentlichung: Alternative Legehennenhaltung in der Praxis – Situation in Deutschland,<br />
PETERMANN, S., K. MAIWORM Internationale Tagung der FAL Celle, Uni Kassel und der IGN am<br />
5./6.10.2006 in Celle, FAL Sonderheft 302 Landbauforschung Völkenrode, S. 21-26<br />
Veröffentlichung: Geflügel (Hühner) in kleinen Schlachtbetrieben; Zur Eignung von Geräten zur<br />
elektrischen Betäubung, v. WENZLAWOWICZ, M., M. BOOSEN, C. KIEPKER, K. KÖNNEKE, U.<br />
LANDMANN, D. LANDMANN, K. MAIWORM, Deutsches Tierärzteblatt 5, S. 554-558<br />
Veröffentlichung: Stallklimaprüfung in der landwirtschaftlichen Tierhaltung, Empfehlung der Länder<br />
AG Stallklima, Autorenteam<br />
Vortrag: Tierschutzrecht, Sachkundelehrgang „Aquaristik“, LVA Echem, 05.05.2006, 24.11.2006<br />
Maslo, R. (LI BS) “Neuartige/ funktionelle Lebensmittel: bestehende Regelungen und Vorgehensweisen bei der<br />
Sicherheitsbewertung” Vortrag im Kurs “Lebensmittelsicherheit/ Lebensmitteltoxikologie” im<br />
Rahmen der Weiterbildung “Fachtoxikologe/ Fachtoxikologin” DGPT (Deutsche Gesellschaft für<br />
Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie), Kaiserslautern, 12.04.2005<br />
“Neuartige/ funktionelle Lebensmittel: bestehende Regelungen und Vorgehensweisen bei der<br />
Sicherheitsbewertung” Vortrag beim Landesverband <strong>Niedersachsen</strong> der Lebensmittelchemiker und<br />
Lebensmittelchemikerinnen im öffentlichen Dienst (LNL), Oldenburg, 02.11.2005<br />
Matthes, U. (IfF CUX) Vortrag: Die hydrologische Situation der Oberweser im Jahr 2005/Ergebnisse der<br />
Elektrobefischungen von Werra und Oberweser im Jahr 2005, Fischbesatzbesprechung Oberweser<br />
mit Vertretern der Fischereibehörden und Fischereiberechtigten, 08.0<strong>3.</strong>2006.<br />
Vortrag: Vergleich der Fängigkeit von zwei Elektrofischfanggeräten in einem salzbelasteten<br />
Gewässer, Seminar Elektrofischerei, Naturschutzakademie Hessen, 22.0<strong>3.</strong>2006.<br />
Vortrag: Ergebnisse der Elekrobefischungen von Werra und Oberweser im Jahr 2006, DWA-<br />
Arbeitsgruppensitzung GB-5.4 „Salzbelastung der Fließgewässer“, 11.07.2006.<br />
Mellenthin, A. (Dez. 22) Vortrag: Das neue Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), 04.04. (Hannover) und<br />
11.04.2006 (Darmstadt), Fortbildungsveranstaltung der Akademie für öffentliches<br />
Gesundheitswesen zur Rechtssetzung auf Bundesebene (Modul 2)<br />
Meyer, L. (IfF CUX) Vortrag: Zur Fischfauna von Heidegewässern, 16. Lachsforum AOLG, Müden/Örtze, 10.06.2006.<br />
Meylahn, K., Wolf, E.<br />
(LI OL), von der Ohe,<br />
W., von der Ohe, K. (IB<br />
CE)<br />
Meylahn, K.; Rückert,<br />
A.; Wolf, E. (LI OL)<br />
Meylahn, K.; von der<br />
Ohe, W.; Wolf, E. (LI<br />
OL)<br />
Meylahn, K.; Wolf, E.;<br />
Wonneberger, C. (LI<br />
OL)<br />
Veröffentlichung: Einsatz der Stabilenisotopenanalytik in der Lebensmittelüberwachung am Beispiel<br />
Honig. Lebensmittelchemie 60 2006: 99-100<br />
Veröffentlichung: Herkunftsanalyse von Spargel mittels Stabilisotopenanalyse, Deutsche<br />
Lebensmittel-Rundschau 102. Jahrgang, 11, S. 523-526<br />
Vortrag: Einsatz der Stabilisotopenanalytik in der Lebensmittelüberwachung – am Beispiel Honig,<br />
Tagung am 07.0<strong>3.</strong>2006 des Regionalverbands Nord der GDCh<br />
Veröffentlichung: Einsatz der Stabilisotopenanalytik in der Lebensmittelüberwachung – am Beispiel<br />
Honig, Lebensmittelchemie, 60, S. 99-100<br />
Veröffentlichung: Reproduzierbarkeit von Messungen stabiler Isotope bei Spargel; Deutsche<br />
Lebensmittel-Rundschau 102. Jahrgang, 12, S. 545-547<br />
Mosch, E.-C. (IfF CUX) Vortrag: Umsetzung der EU-WRRL in <strong>Niedersachsen</strong>, Workshop der Vechte-Anrainerländer<br />
"Monitoring im EG-Bearbeitungsgebiet Vechte", 14.02.2006.<br />
Vortrag: Die Qualitätskomponente Fische in der EU-WRRL, Tagung der Fischereivertreter der<br />
Gebietskooperationen, 30.09.2006.<br />
Nöckler, A. (Mitautor) Artikel: „Einsatz der Immunhistologie in der Diagnostik der Klassischen Schweinepest“, Tierärztl.<br />
Umschau 61, 123–127 (2006)<br />
Petermann, S. (Dez.<br />
33)<br />
Veröffentlichung: Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: Abschnitt Schweine,<br />
BAUMGARTE, J., S. PETERMANN, K. MAIWORM, ATF-Tagung, Aktuelle Probleme des<br />
Tierschutzes am 14./15.09.2006 in Hannover, DTW im Druck<br />
Veröffentlichung: Alternative Legehennenhaltung in der Praxis – Situation in Deutschland,<br />
PETERMANN, S., K. MAIWORM Internationale Tagung der FAL Celle, Uni Kassel und der IGN am<br />
5./6.10.2006 in Celle, FAL Sonderheft 302 Landbauforschung Völkenrode, S. 21-26<br />
328
Ramdohr, S., Etzel, V.,<br />
Jark, U., Bartelt, E. (IfF<br />
CUX)<br />
Ramdohr, S., Etzel, V.,<br />
Jark, U., Kirschke, C.,<br />
Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
Ramdohr, S., Jark, U.<br />
(IfF CUX)<br />
Veröffentlichung: Geflügelhaltung, in Krankheitsursache Haltung, Beurteilung von Nutztierställen-<br />
ein tierärztlicher Leitfaden, Hrsg. T, RICHTER, Enke Verlag, S. 152-218<br />
Vortrag: Tierschutz: Stand der Rechtsetzung Schweinehaltung, FH OS, Seminar Nutztierhaltung,<br />
02.05.2006<br />
Vortrag: Tierschutz: Stand der Rechtsetzung Legehennenhaltung, FH OS, Seminar Nutztierhaltung,<br />
02.05.2006<br />
Vortrag: Vorstellung der Tierschutzleitlinien Milchkuhhaltung, 65. Sitzung des Tierschutzbeirates<br />
des Landes <strong>Niedersachsen</strong>, 09.10.2006<br />
Vortrag: Vorstellung der Aufgaben des Tierschutzdienstes, Besuchergruppe der Tierärztlichen<br />
Hochschule Hannover am 20.11.2006 im LAVES in Oldenburg<br />
Vortrag: Aktuelle Themen „Tierschutz“, Dienstbesprechung Nds. ML, kommunale<br />
Veterinärbehörden, LAVES am 22.11.2006 in Verden<br />
Vortrag: Geschichtliche Entwicklung des Tierschutzrechtes, internationales und supranationales<br />
Tierschutzrecht, Fachhochschule Osnabrück am 16.11.2006<br />
Vortrag: Nationales Tierschutzrecht Teil I, Fachhochschule Osnabrück am 30.11.2006<br />
Vortrag: Nationales Tierschutzrecht Teil II, Fachhochschule Osnabrück am 07.12.2006<br />
Vortrag: Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Fachhochschule Osnabrück am 21.12.2006<br />
Vortrag: Hygienebeprobungen zur Überwachung der Betriebshygiene in Aquakulturbetrieben<br />
<strong>Niedersachsen</strong>s im Zuge der EU-Zulassungen, Darstellung von Ergebnissen aus<br />
Voruntersuchungen (Aquakulturprojekt III), Informationsveranstaltungen „Lebensmittelüberwachung<br />
Ost“ am 08. November 2006, Hannover.<br />
Poster: Entwicklung eines Beprobungskonzeptes zur Überwachung der Betriebshygiene in<br />
Aquakulturbetrieben in <strong>Niedersachsen</strong> im Zuge der EU-Überwachung, 47. DVG-Arbeitstagung des<br />
Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene, Garmisch-Partenkirchen, 26.09.-29.09.2006.<br />
Vortrag: Viren in Fischereierzeugnissen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der Länder<br />
<strong>Niedersachsen</strong> und Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung und der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 08.05.-10.05.2006.<br />
Reinhold, L. (LI BS) „Beurteilung und Interpretation von Ergebnissen in der Rückstandsanalytik“, Vortrag im Rahmen<br />
der Fortbildungsveranstaltung für Richter und Staatsanwälte , Oldenburg, 10.0<strong>3.</strong>2005<br />
„Probenahme und Probenahmeverfahren, Nitrat und Mykotoxine“, Vortrag im Rahmen der<br />
Fortbildungs-veranstaltung für Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure,<br />
Oldenburg, 19.10.2005<br />
Rohmann-Wrede, K.;<br />
Diers, F. (Dez. 41)<br />
Seminar: Prüfungsvorbereitung zum Sachkundelehrgang, 0<strong>3.</strong>07.2006, Sachkundelehrgang<br />
Futtermittelkontrolleurverordnung, Burg Warberg<br />
Runge, M. (VI H) Vorlesung: Brucellen, Chlamydien, Mykoplasmen. Im Rahmen der Wahlpflicht-Vorlesung „Spezielle<br />
Bakteriologie“. Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, Winterstudienhalbjahr 2006/07.<br />
Vorlesung: Methoden der molekularen Infektionsbiologie. Im Rahmen der Ringvorlesung<br />
„Allgemeine Medizinische Mikrobiologie“. Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin,<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Winterstudienhalbjahr 2006/07.<br />
Vorlesung: Mykoplasmen und Chlamydien. Im Rahmen der Vorlesung „Spezielle Medizinische<br />
Mikrobiologie”. Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, Sommerstudienhalbjahr 2006.<br />
Vorlesung: Helicobacter pylori und Campylobacteriaceae. Im Rahmen der Vorlesung „Spezielle<br />
Medizinische Mikrobiologie”. Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung<br />
Tierärztliche Hochschule Hannover, Sommerstudienhalbjahr 2006.<br />
Vortrag: Lungenseuche. Im Rahmen des Kurses „Tropenveterinärmedizin II“. Institut für<br />
Parasitologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Sommerstudienhalbjahr 2006.<br />
Vorlesung: Molekularbiologie für VMTA-SchülerInnen. VMTA-Schule, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, Winterstudienhalbjahr 2006/07<br />
Runge, M. (VI H),<br />
Schulz, J.;<br />
Vortrag: Untersuchungen auf Coxiella burnetii in einer positiven Schafherde. 14. Kolloquium des<br />
Arbeitskreises Schafgesundheitsdienste, Hannover, 8.06.2006.<br />
329
Andrzejewski, M.;<br />
Binder, A.; von<br />
Keyserlingk, M. (VI H);<br />
Hartung, J.; Ganter, M.<br />
Runge, M. (VI H);<br />
Schröder, C.; Binder,<br />
A.; Schotte, U.; Ganter,<br />
M.<br />
Ruoff, K., von der Ohe,<br />
K.; von der Ohe, W. (IB<br />
CE) u.a.<br />
Vortrag: Epidemiological investigation of Coxiella burnetii in sheep in Lower Saxony, Germany. 24.<br />
Symposium of the Veterinary Comparative Respiratory Society, Jena, 8.-10.10.2006<br />
Veröffentlichung: Authentication of botanical and geographical origin of honey by front-face<br />
fluorescence spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 6858-6866<br />
Veröffentlichung: Authentication of botanical and geographical origin of honey by mid-infrared<br />
spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 6873-6880<br />
Schaefer, C. (Dez. 33) Vortrag: Krisenmanagement in der Lebensmittelsicherheit auf der Ebene der Bundesländer;<br />
Vortrag: Krisennotfallpläne – Inhalte und Beispiele.<br />
(beide Vorträge im Rahmen des Twinning-Projekt TR 04 IB AG 02 „Lebensmittelsicherheit“ in<br />
Ankara, Türkei, 30.10.-<strong>3.</strong>11.2006)<br />
Schleuter, G. (VI OL) Vortrag: Amtliche Kotrolle der betrieblichen Eigenkontrolle. Probenahme Schlachtkörper und<br />
Produkte nach EU VO 207<strong>3.</strong> Informationsveranstaltung für die Veterinärbehörden in Nds. 5., 11.<br />
und 18.7.2006<br />
Vortrag: Amtliche Kotrolle der betrieblichen Eigenkontrolle: Rechtsgrundlagen der<br />
Hygieneuntersuchungen. Informationsveranstaltung für die Veterinärbehörden in Nds. 5., 11. und<br />
18.7.2006<br />
Vortrag: Erfahrungen bei Entnahme und Untersuchungen von Hygieneproben. Fachgespräch mit<br />
Fleischerfachverband Nds./HB 6.9.2006<br />
Schulze, M. (LI BS/VI<br />
H)<br />
“Genetically modified organisms – Official surveillance in the Federal State Lower Saxony”, Vilnius,<br />
22.2.2006<br />
“Genetically modified organisms – Official surveillance in the Federal State Lower Saxony”, Vortrag<br />
im Rahmen des Twinning Projektes LT/2003/IB/AG/03“ LI BS, 12.5.2006<br />
Akkreditierung von Diagnostik Laboratorien, Vortrag im Rahmen des Fachgespräches über<br />
Qualitätssicherung der Labordiagnostik von Schadorganismen, BBA Braunschweig, 11.7.2006<br />
„Neuartige und gentechnisch veränderte Lebensmittel“, Taschenbuch für Lebensmittelchemiker,<br />
Springer-Verlag, S. 783 - 803<br />
Schulze. M. (VI OL) Vortrag: „Nachweismöglichkeiten von Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in<br />
Organen vom Rind”, <strong>3.</strong> Arbeitstagung des Nationalen Referenzlabors für Tuberkulose und des<br />
Nationalen Refernezlabors für Paratuberkulose, Mykobakterieninfektionen, 11./12.10.2006, Jena<br />
Vortrag: „Untersuchungen zur Stammdifferenzierung von M. avium subsp. paratuberculosis”, 1.<br />
Doktoranden-Symposium am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin,<br />
2<strong>3.</strong>06.2006, Berlin<br />
Schumacher, T. (Dez.<br />
31)<br />
Schumacher, T. (Dez.<br />
31) u.<br />
Teskin (Dez. 21)<br />
Schütte, R. (Dez. 41)<br />
Vortrag und Seminar: Rechtsgrundlagen und Durchführung der Beseitigung von tierischen<br />
Nebenprodukten („Tierkörperbeseitigung“) – mit Betriebsbesichtigung (in Zusammenarbeit mit den<br />
technischen Sachverständigen des Dez. 15 des LAVES) im Fachseminar zur Ausbildung der<br />
Veterinärreferendare am 02.05.2006<br />
Vortrag: „Mögliche Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenbekämpfung (MKS,<br />
Schweinepest, Vogelgrippe) für Lebensmittelproduzenten – Inhalt und Aufgaben für eine<br />
Krisenfallplanung“ im Seminar der ARS PROBATA GmbH am 21.09.20065 in Kassel<br />
Vortrag: „Hygieneschleusen in landwirtschaftlichen Betrieben“ in der Sitzung des Arbeitskreises<br />
„Hygieneschleusen“ im Deutschen Institut für Normung (DIN) e.V.<br />
am 02.11.2006 in Berlin<br />
Vortrag: Futtermittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>, 07.0<strong>3.</strong>2006, Arbeitstagung 2006 -<br />
Lebensmittelchemische Gesellschaft, Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker,<br />
Regionalverband Nord, LI Oldenburg<br />
Vortrag: Amtliche Futtermittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> / Bremen, 28.0<strong>3.</strong>2006, DVT<br />
Regionalgruppe Nord e.V., Großenkneten<br />
330
Schütte, R.; Heyne, S.<br />
(Dez. 41)<br />
Schwochow, K. (Dez.<br />
31) u.<br />
Ahrens, N. (Nds. TSK)<br />
Vortrag: Das Futtermittelrecht, 28.04.2006, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik,<br />
Quakenbrück<br />
Vortrag: Europäisches Schnellwarnsystem / Futtermittel, 07.09.2006, Twinning Delegation Türkei,<br />
LI Braunschweig<br />
Niedersächsischer Leitfaden für die BHV1-Reagentenerfassung in HIT – Benutzerhinweise für die<br />
Veterinärverwaltung (August 2006)<br />
Siemer, H.(VI OL) Vortrag: Application of Biacore SPR technology in official controll of drug residues in a chemical<br />
investigation office in Lower Saxony, Biacore Food Analysis Symposium 2006, on September 27th<br />
& 28th, Berlin<br />
Stede, M. (IfF CUX) Vorträge: Gemeinschaftsrecht bei Fischereierzeugnissen / Sichtbare Hinweise auf den Verderb von<br />
Fischereierzeugnissen / Fremdwassergehalt in Fischereierzeugnissen, Seminar des Instituts für<br />
Fischkunde Cuxhaven „Fische und Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 15.05.-<br />
17.05.2006.<br />
Vortrag: Training and retraining of staff involved in preparation of residue monitoring programmes<br />
and food safety inspectors responsible for practical implementation of the programmes and<br />
sampling (fish), Twinning Projekt LT/2004/AG/04, Klaipeda, 02.09.2006.<br />
Vorträge: Requirements for vessels, and landing areas/Monitoring of harvest areas for bivalve<br />
molluscs / General import requirements and new rules on food hygiene and on official controls /<br />
Official EU FVO Inspections, Workshop on EU Fishery and Aquaculture Standards, Jakarta, 25.04.-<br />
27.04.2006.<br />
Stede, M. (IfF CUX)<br />
(Mitautor)<br />
Veröffentlichung: Aerial Surveys of Harbour and Grey Seals in the Wadden Sea in 2006, Wadden<br />
Sea Newsletters, Heft 1 (2006) S. 26-27.<br />
Suckrau, I. (LI OL) Vortrag: „Die QuEChERS-Methode Erfahrungen und Ergebnisse aus der Pestizidanalytik“ im<br />
Rahmen der Lebensmittelanalytik-Seminartour der Firma Supelco/Sigma-Aldrich am 14.11.06 in<br />
Hamburg, am 15.11.06 in Düsseldorf und am 24.11.06 in Berlin<br />
Vortrag: „Einführung in die Pestizidanalytik“ im Rahmen des Winter Workshops der Firma LECO<br />
am 11.12.06 in Mönchengladbach<br />
Thalmann, G. (VI OL) Vortrag: „Aviäre Influenza – Geflügelpestgeschehen (H5N1) 2003–2006“, Vortrag auf Sitzung der<br />
AG „Tierseuchenbekämpfungshandbuch Nds./NRW am 1<strong>3.</strong>06.06 in Münster<br />
Vortrag: „Aviäre Influenza – wie gefährlich ist die Vogelgrippefür Tier und Mensch“, Vortrag auf der<br />
Sitzung des Erfahrungskreises „Umweltschutz“ der IHK Oldenburg, am 11.05.2006 in Oldenburg<br />
Vortrag: „Bei den GMP-Inspektionen festgestellte Mängel und deren Eingruppierung“, Vortrag auf<br />
der 9. Sitzung der Expertenfachgruppe 16 „Tierimpfstoffe“, 14.–16.02.2006 in Erlangen<br />
Vortrag: „Das Aide Memoire Bio- und Gentechnologie und seine Nutzung bei der GMP-Inspektion<br />
von Tierimpfstoffherstellern“, Vortrag auf der 10. Sitzung der Expertenfachgruppe 16<br />
„Tierimpfstoffe“ am 10.–12.10.2006 in Hilden<br />
Vortrag: „Impfung bei Geflügelpest“, Vortrag für das E-Learning-Programm „Aviäre Influenza“,<br />
Oldenburg, den 2<strong>3.</strong>08.06<br />
Vortrag: „Impfung und Impfstoffe bei Aviärer Influenza“, Vortrag auf der 10. Sitzung der<br />
Expertenfachgruppe 16 „Tierimpfstoffe“ am 10.–12.10.2006 in Hilden<br />
Vortrag: „Umsetzung der Biostoffverordnung in der Virologie“, Vortrag auf der 25. AVID-Tagung<br />
„Virologie“, 1<strong>3.</strong>–15.09.06, Kloster Banz<br />
Thielke, S. (LI BS) Mitautorin des Artikels “Zartheit und mikrobieller Status von Hähnchen-Brustfilets“ Fleischwirtschaft<br />
9/2005, 130-132<br />
Mitautorin des Artikels „Effects of aging prior to freezing on poultry meat tenderness“ Poultry<br />
Science 84, 607-612<br />
Thiem, I.; Böhmler, G.<br />
(LI BS); Kamphues, J.<br />
(TiHo Hannover, Institut<br />
für Tierernährung)<br />
Chances and Limits of the Micro-EROD-Bio-Assay demonstrated with Milk for Dioxins, Poster auf<br />
der Tagung der ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition) in Turin, 2<strong>3.</strong>-<br />
25.09.2005<br />
Thoms, B. (VI H) Vortrag: Lebensmitteltoxikologie, Risiken und Verbraucherschutz; DGPT Fachtoxikologiekurs,<br />
9.10.2006<br />
331
Treu, H. (Dez. 14 u.<br />
Dez. 31)<br />
Vortrag: Rechtsgrundlagen der Bienenseuchenbekämpfung im Fachseminar des<br />
niedersächsischen Veterinärreferendariats im Institut für Bienenkunde in Celle am 27.06.2006<br />
Vortrag und Praxisseminar: Wildbrethygiene und Wildkrankheiten im Fachlehrgang für<br />
Forstinspektorenanwärter, Münchenhof, am 10.11.2006<br />
Velleuer, R. (Dez.22) Vortrag: Das neue EU – Hygienerecht Auswirkungen für den Milcherzeuger<br />
Mitgliederversammlung des MKU Uelzen e.V. am 20.06.2006<br />
Vortrag : Organisation of Food Surveillance in Germany<br />
Twinning Project Restructuring an Strengthening of the Food Safety and the Control System in<br />
Turkey am 04.07.2006 in Ankara<br />
Vortrag: Networked data bank structures electronic data processing (EDP)<br />
Twinning Project Restructuring an Strengthening of the Food Safety and the Control System in<br />
Turkey am 04.07.2006 in Ankara<br />
Vortrag: Organisation of the official food controls<br />
Twinning Project Strengthening of Official Control Of Food Safety and Residues in Food in the<br />
Republic of Lithuania am 29.08.2006<br />
Vortrag: Darstellung der Organisationsstruktur des LAVES und der Veterinär- und<br />
Lebensmittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> (LAVES).<br />
Fleischerverband <strong>Niedersachsen</strong> Bremen am 06.09.2006<br />
Vortrag: EU – Lebensmittelhygienerecht - Beispiele aus der Praxis<br />
Landesverband der Milchwirtschaftler in <strong>Niedersachsen</strong> und Sachsen Anhalt e.V. Hannover, Weser<br />
Ems e.V. Oldenburg am 19.09.2006<br />
Vortrag : Betriebliche Ausgangslage im Bereich der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene<br />
in <strong>Niedersachsen</strong> - Anzahl zugelassener und registrierter Betriebe<br />
Verband der Fleischwirtschaft am 25.09.2006<br />
Vortrag: Adjustment of control of animal products foreseen for human consumption<br />
The new legislation of the European Union about hygiene of foodstuffs – implementation in the<br />
Federal State Lower Saxony<br />
Twinning Project LV 05 IB AG 02 Kick off am 12.10.2006<br />
Vortrag: Hinweise zur Verwaltungsstruktur des LAVES, zum neuen EU Hygienerecht, zum<br />
Zulassungsverfahren und der Risikobeurteilung von Betrieben<br />
Landesverbandstag der Fleischkontrolleure mit Fortbildungsveranstaltung in Bramsche-Engter am<br />
29.10.2006<br />
Vortrag: Staatlicher Verbraucherschutz in der Europäischen Union am Beispiel der Bundesrepublik<br />
Deutschland und des Bundeslandes <strong>Niedersachsen</strong>, Vorlesung an der Tierärztlichen Hochschule<br />
Hannover, Querschnittsfach Lebensmittel - Zentrumsabteilung für Lebensmitteltoxikologie am<br />
10.11. und 17. 11.2006 in Hanover<br />
Vortrag: Introduction lecture on horizontal EU-legislation on sampling for the micobiological<br />
laboratory control of products of animal origin<br />
Official Sampling in the state Lower Saxony - Overview of the authority structure incl. the<br />
laboratories as well as establishments<br />
Twinning Project LV 05 IB AG 02 Activity <strong>3.</strong>1 am 10.11.2006 in Riga<br />
Vortrag: Introduction lecture on horizontal EU-legislation on sampling for the micobiological<br />
laboratory control of products of animal origin<br />
Legal foundation on sampling and analysis<br />
Twinning Project LV 05 IB AG 02 Activity <strong>3.</strong>1 am 10.11.2006 in Riga<br />
Vortrag: Introduction lecture on horizontal EU-legislation on sampling for the micobiological<br />
laboratory control of products of animal origin<br />
Quality management in case of sampling<br />
Twinning Project LV 05 IB AG 02 Activity <strong>3.</strong>1 am 10.11.2006 in Riga<br />
Vortrag: Strukturen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong><br />
am Berufsbildende Schulen III der Stadt Oldenburg am 27.11.2006<br />
Vortrag: Vom alten Veterinär- und Lebensmittelrecht zum neuen Veterinär- und Lebensmittelrecht<br />
Berufsbildende Schulen III der Stadt Oldenburg am 27.11.2006<br />
Vortrag : Organisation der Veterinärüberwachung der Lebensmittel tierischer Herkunft in der<br />
Europäischen Union am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Projekt Stärkung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit in der<br />
332
Russischen Föderation<br />
Institut für Fleischindustrie der Russischen Akademie für landwirtschaftliche Wissenschaften in<br />
Moskau am 18.12.2006<br />
von der Ohe, K. (IB CE) Vortrag: Pollenspektrum polnischer Honige. Pollenworkshop. Stuttgart, 27.04.06<br />
Vortrag: Pollenmorphologie – Beispiele zur Terminologie. Pollenworkshop, Stuttgart, 27.04.06<br />
von der Ohe, W. (IB<br />
CE)<br />
von der Ohe, W. (IB<br />
CE), et al.<br />
von Keyserlingk, M. (VI<br />
H)<br />
Veröffentlichung: Honig und Botulismus. Das Bienenmütterchen 01/2006: 15<br />
Veröffentlichung: Blütenbildung im Honigglas. Deutsches Bienen-Journal 02/2006: 80<br />
Veröffentlichung: Warum mit Bienen wandern? Deutsches Bienen-Journal 03/2006: 114<br />
Veröffentlichung: Mögliches Zusammenwirken von Stressoren – ein multifaktorieller<br />
Erklärungsansatz für die Ursachen der Völkerverluste im Herbst/Winter 2002. In: Das<br />
Bienensterben im Winter 2002/2003 in Deutschland, BVL Braunschweig 2006, S. 20-24<br />
Veröffentlichung: Schwerpunkt Bestäubung – Von Bienen und Blüten. Deutsches Bienen-Journal<br />
05/2006: 196-197<br />
Veröffentlichung: Wissenswertes zum Sortenhonig. Deutsches Bienen-Journal 07/2006: 298-299<br />
Veröffentlichung: Amerikanische Faulbrut – Bekämpfungsstrategie in <strong>Niedersachsen</strong>. Kongress des<br />
Bundesverbandes der beamteten Tierärzte, Bad Staffelstein, 24.-25.04.06, Kongressband S. 291-<br />
293<br />
Veröffentlichung: Vaerd at vide om sortshonning. Tidsskrift for Biavl 08/2006: 260-262<br />
Veröffentlichung: Phasentrennung im Honigglas. Deutsches Bienen-Journal 09/2006: 412<br />
Veröffentlichung: Pollen tut not. Deutsches Bienen-Journal 10/2006: 450<br />
Veröffentlichung: Honey: Authenticity of Botanical and Geographical Origin. In: Proceedings of the<br />
2nd European Conference of Apidology, Prag 2006, S. 105-106<br />
Veröffentlichung: Bestäubung aus botanischer Sicht. Letzeburger Bienen-Zeitung 117 10/2006:<br />
245-249<br />
Vortrag: Jahresrückblick 2005. Tagung der Gesellschaft der Freunde des IB CE, Celle, 04.0<strong>3.</strong>06<br />
Vortrag: Pollenversorgung des Bienenvolkes. Nordhannoverscher Imkertag, Tostedt, 19.0<strong>3.</strong>06<br />
Vortrag: Pollenversorgung des Bienenvolkes. Imker Landesverband Rheinland, Kast, 25.0<strong>3.</strong>06<br />
Vortrag: Amerikanische Faulbrut – Bekämpfungsstrategie in <strong>Niedersachsen</strong>. Staffelstein, 25.04.06<br />
Vortrag: Qualitätsmanagement im Bienenvolk. Ärzteklub Celle, Celle, 06.06.06<br />
Vortrag: Amerikanische Faulbrut – Messpunktmonitoring in <strong>Niedersachsen</strong>. Niedersächsisches<br />
Veterinärreferendariat, Celle, 27.06.06<br />
Vortrag: Honey: Authenticity of botanical and geographical origin. 1<strong>3.</strong>09.06, EurBee-conference in<br />
Prague (Czech Republic)<br />
Vortrag: Amerikanische Faulbrut – Messpunktmonitoring in <strong>Niedersachsen</strong>. Verband der beamteten<br />
Tierärzte Hamburg, Hamburg, 12.10.06<br />
Vortrag: Pollenversorgung des Bienenvolkes. Bioland Tagung, Visselhövede, 09.11.2006<br />
Veröffentlichung: Aus der Arbeit des Niedersächsischen Landesinstitutes für Bienenkunde Celle -<br />
Jahresbericht 2005. Deutsches Bienen-Journal, (2006), 271-281.<br />
Veröffentlichung: Beitrag zur Harmonisierung der Sortenbezeichnung „Wildblütenhonig“ Deutsche<br />
Lebensmittel Rundschau 102 (8) 365-368<br />
Vortrag: Niederwildkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung von Zoonoseerregern,<br />
Kreisjägerschaft Landkreis Leer, 16.0<strong>3.</strong>06<br />
Veröffentlichungen: Diverse zu Wildkrankheiten in jagdlichen Fachzeitschriften<br />
Wald, B. (LI BS) „Aktuelle Änderungen im Lebensmittelrecht“<br />
Vortrag bei der Jahreshauptversammlung der Bäckerinnung Wolfenbüttel, 06.0<strong>3.</strong>2006<br />
Welzel, A. (Dez. 33) Vortrag: Ausführungen zum Tierschutzgesetz unter besonderer Berücksichtigung des 5. Abschnitts,<br />
Versuchstierkundlicher Kurs an der Georg-August-Universität Göttingen, 0<strong>3.</strong>04.2006 und<br />
25.09.2006<br />
Vortrag: Einführung zum Thema Tierversuchsvorhaben, Fachseminar für Praktikanten der<br />
Lebensmittelchemie, Braunschweig, 22.08.2006 und 22.12.2006<br />
Vortrag: Aktuelle Informationen zum Tierschutz und zu Tierversuchen, Veranstaltung im Deutschen<br />
Primatenzentrum Göttingen, 22.06.2006<br />
Wiecking, H. (Dez. 43) Vortrag: Ordnungswidrigkeitenrecht im Prüferalltag, Juni 2006, Fortbildung PrüferInnen Dez. 41 und<br />
43, Laves Zentrale Oldenburg<br />
333
Wiecking, H.; Leymers,<br />
H.; Schulte, J.; Rick, T.;<br />
Vollmers, D.;<br />
Schammler, H. (Dez.<br />
43)<br />
Schulung (u. Erfahrungstausch) der LMK der Kommunen „Handelsklassenkontrolle im LEH für<br />
frisches Obst und Gemüse“, 21./22.06.2006, 27.-30.06.2006, 04.-07.07.2006, Fortbildung LMK der<br />
Kommunen / operative Beratung (mit BLE), Laves-Zentrale, IfB Lüneburg, LWK <strong>Niedersachsen</strong><br />
Hannover<br />
Zeit, S. (Dez. 23) Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> (Überprüfung tierärztlicher<br />
Hausapotheken), Fortbildung der Kreisstelle Harburg unter Beteiligung der Kreisstellen Lüneburg,<br />
Rotenburg/Wümme, Stade der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Rosengarten, 31.01.2006.<br />
Zeit, S.; Kleiminger, E.;<br />
Lehmann, I.; Praß, U.<br />
(Dez. 23)<br />
Veröffentlichung: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> (Überwachung tierärztlicher<br />
Hausapotheken), Mitteilungsblatt des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte/Landesverband<br />
<strong>Niedersachsen</strong>/Bremen e. V. <strong>3.</strong> Quartal 2006.<br />
5.3 Verzeichnis der Ringversuche und Laborvergleichsuntersuchungen<br />
Im Verzeichnis der Ringversuche ist der Veranstalter im Feld (Ver.) wie folgt gekennzeichnet:<br />
Nr. im Feld<br />
(Ver.)<br />
Veranstalter<br />
1 AG nach § 35 LMBG „Fleisch“<br />
2 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit<br />
3 Bundesamt für Risikobewertung<br />
4 Bundesamt für Strahlenschutz<br />
5 Bundesanstalt für Milchforschung<br />
6 Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel<br />
7 BVL<br />
8 BVL § 35 AG „Lebensmittelallergene“<br />
9 BVL Analysenausschuss<br />
10 CVUA Münster<br />
11 Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), Nationales Referenzlabor für<br />
KSP<br />
12 Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), Institut für neue und neuartige<br />
Tierseuchenerreger, Institut f. Biotechn. Diagnostik der GBD Berlin; Charité-Universitätamedizin Berlin,<br />
Campus Benjamin Franklin, Institut f. Infektionsmedizin der FU Berlin<br />
13 DACH<br />
14 Deutsche Gesellschaft für Fettforschung (DGF)<br />
15 DIN<br />
16 DIN/VdC<br />
17 Europäische Kommission/University of Almeria<br />
18 FAPAS<br />
19 FEPAS<br />
20 Food and Consumer Product Safety Authority (voedsel en waren, Niederlande)<br />
21 GDCh Arbeitsgruppe „Pestizide“<br />
22 Health Protection Agency<br />
23 Hüfner<br />
24 IB Celle (für Honiganalytik-Workshop)<br />
25 IB Celle (für Pollen-Workshop)<br />
26 Institut für Laborkontrolle (Lab-control)<br />
27 Institut für Veterinär-Anatomie, - Histologie und Embryologie, Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
28 Institute for Interlaboratory Studies, 3301 CE Dordrecht, Netherlands (iis)<br />
29 International Atomic Energy Agency (IAEA)<br />
334
30 International Leptospiroris MAT Proficiency Tesing Schme, Dr. Chappel<br />
31 Keuringsdienst van Waren, CHEK proficiency study<br />
32 Leitstelle Trinkwasserringversuch NRW (Lögd)<br />
33 NLGA-Außenstelle Aurich<br />
34 LVU Lippold<br />
35 Milchwirtschaftliche Untersuchungs- und Versuchsanstalt Kempten (MUVA)<br />
36 Oxoid, QM: Quality in microbiology scheme<br />
37 Pflanzendirektorat des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei, Dänemark<br />
38 Q-Bioanalytik GmbH<br />
39 SUERC (Scottish Universities Environmental Research Centre)<br />
40 USDA GIPSA Proficiency Program<br />
41 Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs– und Forschungsanstalten (VDLUFA)<br />
42 Veterinary Laboratory Quality Assessment / United Kingdom<br />
43 VI Oldenburg<br />
44 RIKILT Wageningen (NL)<br />
45 CVUA Ostwestfalen-Lippe<br />
46 CEN (Comité Européen de Normalisation)<br />
47 Defence Science and Technology Laboratory; UK<br />
48 Europäisches Referenzlabor (CRL): Universitiy of Almeria/Spanien<br />
49 Europäisches Referenzlabor (CRL): CVUA Stuttgart<br />
50 Bundesanstalt für Gewässerkunde<br />
51 SUERC<br />
52 Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet)<br />
53 INSTAND e.V., Institut für Standardisierung und Dokumentation im medizinischen Laboratorium<br />
54 BVL, Berlin, DVG-Arbeitsgruppe Resistenzen<br />
55 BfR, Berlin, NRL Salmonellen<br />
56 Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI), Nationales Referenzlabor<br />
Paratuberkulose<br />
57 Institut für Parasitologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (Laborvergleichsuntersuchung)<br />
58 Fachgruppe Pathologie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG)<br />
59 FLI Wusterhausen<br />
60 FLI Insel Riems<br />
61 BVL § 64 LFGB, AG Kosmetische Mittel<br />
62 GDCh AG Kosmetische Mittel<br />
63 National Serology Reference Laboratory Australia, Dr. R. Chappel<br />
5.<strong>3.</strong>1 LAVES-LI Braunschweig<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Apfelsaft 34 Kalium, Calcium, Magnesium, Asche, Phosphat, rel.<br />
Dichte, pH-Wert, Gesamtsäure pH 8,1,Glucose,<br />
Fructose, Saccharose, Sorbit<br />
Fruchtsaft<br />
(Orangensaft)<br />
Backware 15 Trockenmasse, Asche, Ballaststoffe, Stärke, Anteil<br />
Vollkornmehl<br />
34 Vitamin C HPLC-DAD<br />
335<br />
AAS, Gravimetrie, Photometrie,<br />
Biegeschwinger, Potentiometrie,<br />
HPLC-RI<br />
Gravimetrie, Polarimetrie, Berechnung
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Backware 34 Wasser, Asche, Rohprotein, Fett, Butterfett, Stärke, Gravimetrie, Kjeldahl, Weibull-Stoldt,<br />
Saccharose<br />
Tiritmetrie, GC, Polarimetrie, Enzymatik<br />
Bier Pils 34 Alkohol, wirklicher Extrakt, rel. Dichte, Stammwürze, pyknometrisch, Destillation, ,<br />
scheinbarer Extrakt, pH-Wert, Gesamtsäure pH 8,1 Biegeschwinger, Titrimetrie<br />
Bier 36 Keimzahl, Hefen, Schimmelpilze, Milchsäurebakterien,<br />
E. coli<br />
Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Blumenkohl 9 As, Pb, Cd, Cu, Se, Th, Zn ICP-MS Hydrid-AAS<br />
Blumenkohl 9 Nitrat, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Selen, Thallium Photometrie / ICP-MS<br />
Brühwurst 34 Tierartbestimmung, Bestimmung von Fremdeiweiß Serologische, nicht-serologische und<br />
mikrobiologische Analytik<br />
Brühwurst 34 Kochsalz, Gesamtpökelstoffe, NPN, Niedermolekulares Titrimetrie, Photometrie, Enzymatik<br />
Bindegewebseiweiß, Glutaminsäure<br />
Brühwurst 34 ZNS-Material/Separatorenfleisch Serologische Analytik, Western Blot<br />
Brühwurst 34 Wasser, Fett, Rohprotein, Hydroxyprolin, Asche,<br />
Gesamtphosphor<br />
Gravimetrie, Kjeldahl, Photometrie,<br />
Brühwurst 34 Blei, Cadmium, Quecksilber ICP-MS, Kaltdampf-AAS<br />
Butter 35 Wasser, pH-Wert, fettfreie Trockenmasse Gravimetrie, Potentiometrie<br />
Chilli-Pulver 18 Nicht zugelassene Farbstoffe HPLC-DAD<br />
Chilli-Pulver 7 Fumonisine HPLC<br />
Chinesisches<br />
Essen (Reis)<br />
49 Glutaminsäure Enzymatik<br />
Diätetisches<br />
Lebensmittel<br />
33 Saccharin, Cyclamat, Benzoesäure, Sorbinsäure HPLC-DAD<br />
Diät.<br />
Erdbeerzubereitung<br />
20 Lactit, Maltit, Sorbit HPLC-RI<br />
Dry cake mix 18 Erdnussprotein DGD, ELISA<br />
Feinkostsalat 18 Benzoesäure, Sorbinsäure Photometrie, HPLC<br />
Fleischerzeugnis 1 NPN , Niedermolekulares Bindegewebseiweiß Kjeldahlaufschluss, Titrimetrie,<br />
Photometrie<br />
Fischölmischung 14 Säurezahl, Peroxidzahl, Buttersäure, FSV, Polare Titrimetrie, GC-FID,<br />
Anteile, Stigmastadien<br />
Säulenchromatografie, Gravimetrie,<br />
HPLC-DAD<br />
Frittierfett 14 Polare Anteile, Säurezahl Säulenchromatographie, Gravimetrie,<br />
Titrimetrie<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Vitamin B2 HPLC-FD<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Zearalenon HPLC<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Acrylamid GC-MSD<br />
Gewürze 15 Koagulase pos. Staphylokokken, Keimzahl,<br />
Diverse quantitative mikrobiologische<br />
Enterobacteriaceae, E. coli, Coliforme Keime, Hefen,<br />
Schimmelpilze, Salmonellen, sulfitred. Clostridien,<br />
Bacillus cereus<br />
Methoden<br />
Hafermehl 36 Pseudomonas species. Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Hafermehl 36 Milchsäurebakterien Quantitative mikrobiologische Methode<br />
Haselnuss 9 Haselnuss in Schokolade Serologische und molekularbiologische<br />
Methoden<br />
Haselnuss 18 Haselnussprotein in Schokolade ELISA<br />
Honig 34 Glucose, Fructose, Maltose, freie Säuren, HMF, HPLC, Titration, Konduktometrie,<br />
Leitfähigkeit, pH-Wert, Wasser, Prolin, Diastase Refraktometrie, Photometrie<br />
Honig 45 Freie Säure Titration<br />
336
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Honig 18 Streptomycin LC-MS/MS<br />
Honig 18 Nitrofuranmetaboliten: AOZ, AMOZ, SEM, AHD LC-MS/MS<br />
Jam 18 Citronensäure, Sorbinsäure, Brix, pH-Wert Enzymatik, HPLC, Refraktometrie,<br />
Potentiometrie<br />
Kakaoerzeugnis 34 Fett, Butterfett, Theobromin/Coffein, Wasser Weibull-Stoldt, GC, HPLC, Gravimetrie<br />
Käse 35 Fett, Trockenmasse, Laktose, Eiweiß, Kochsalz Weibull-Stoldt,Gravimetrie, Enzymatik,<br />
Kjeldahl, Titrimetrie<br />
Kesselkonserven<br />
und DNA<br />
Extrakte daraus<br />
45 Nachweis von spezifischem Risikomaterial Real time-PCR, Westernblot<br />
Kindernahrung 34 Na, Mg, Fe, K, Ca Flammen–AAS<br />
Kokosnussölmischung<br />
14 Säurezahl, Buttersäure, FSV Titrimetrie, GC-FID<br />
Kondensmilch 35 Fett, Trockenmasse, Asche, Protein Röse-Gottlieb, Gravimetrie, Kjeldahl<br />
Kurkuma 18 Nicht zugelassene Farbstoffe HPLC-DAD<br />
Lachssalat 31 Acesulfam-K, Saccharin, Aspartam, Benzoesäure,<br />
Sorbinsäure<br />
HPLC<br />
Limonade<br />
kalorienreduziert<br />
34 pH-Wert, Aspartam, künstliche Farbstoffe, Cyclamat,<br />
Saccharin, Acesulfam-K, Diketopiperazin,<br />
Aspartylphenylalanin<br />
337<br />
Potentiometrie, HPLC-DAD, PC<br />
Limonade 10 Chinin, Koffein HPLC-DAD<br />
Magermilchpulver<br />
36 Campylobacter spec. Molekularbiologische Analytik<br />
Magermilchpulver<br />
36 Hefen, Schimmelpilze Quantitative mikrobiologische Methode<br />
Magermilchpulver<br />
36 Staph. aureus, Bacillus cereus Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Magermilch- 36 Genus Clostridium, Clostridium perfringens, Qualitative und quantitative<br />
pulver<br />
mikrobiologische Methoden<br />
Magermilchpulver<br />
36 Salmonellen Qualtitative mikrobiologische Methode<br />
Magermilchpulver<br />
36 Campylobacter Qualitative mikrobiologische Methode<br />
Magermilch- 36 Genus Listeria, L. monocytogenes Quantitative und qualitative<br />
pulver<br />
mikrobiologische Methoden<br />
Magermilch- 36 Aerobe mesophile Keime, E. coli, Coliforme, Entero- Diverse quantitative mikrobiologische<br />
pulverbacteriaceae<br />
Methoden<br />
Maismehl 18 Fumonisine HPLC<br />
Maismehle 40 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Mehl 34 Asche, Wasser, Stärke, Rohprotein, Type Veraschung, Gravimetrie, Polarimetrie,<br />
Kjeldahl, Berechnet<br />
Milch 35 Fett, Trockenmasse, Gefrierpunkt, Laktose, Protein Röse-Gottlieb, Gravimetrie, Kryoskopie,<br />
Enzymatik, Kjehldahl<br />
Milch 35 E. coli Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Milch 23 Gesamtkeimzahl Quantitative mikrobiologische Methode<br />
Milchbrot 31 Milchfett, Chlorid GC-FID, potentiometrische Titration<br />
Milcherzeugnisse<br />
6 Prolin Kjeldahl<br />
Milchpulver 34 Fett, Rohprotein, Wasser, Asche, HBsZ Weibull-Stoldt, Kjeldahl, Gravimetrie,<br />
Titration<br />
Milchpulver 4 Salmonellen Real time-PCR, Qualitative<br />
mikrobiologische Methode<br />
Milchpulver 3 Listerien (qual. und quant.), Salmonellen Quantitative und qualitative<br />
mikrobiologische Methoden
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Mischfett 20 Buttersäure, Fett GC, PE-Extraktion/ Gravimetrie<br />
Molkenpulver 35 Trockenmasse, Asche, Rohprotein, Fett, Lactose Gravimetrie, Kjeldahl, Weibull-Stoldt,<br />
Enzymatik,<br />
Molkenpulvermischung<br />
35 Lactose Enzymatik<br />
Nahrungsergänzung,<br />
flüssig<br />
18 Vitamin B1, Vitamin B2 HPLC-Fluoreszenzdetektion<br />
Oliven 15 Sorbinsäure, Benzoesäure HPLC<br />
Olivenöl 18 Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen,<br />
Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren),<br />
Benzo(g,h,i)perylen<br />
GC-MSD<br />
Olivenöl-<br />
14 Säurezahl, Peroxidzahl, FSV, Isomere Diglyceride, K- Titrimetrie, GC-FID, Fotometrie, Säulenmischung<br />
Werte, Stigmastadien<br />
chromatografie, HPLC-DAD<br />
Papaya 8 qualitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Qualitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Pflanzliches Öl 20 Fettsäureverteilung, Transfettsäuren, Transfettsäuren,<br />
Buttersäure, Säurezahl<br />
GC, Titrimetrie<br />
Roggenbrot 31 Chlorid, Propionsäure, Sorbinsäure Potentiometrie, GC, HPLC<br />
Sahne 35 Fett, Trockenmasse, Protein Röse-Gottlieb,Gravimetrie, Kjeldahl<br />
Salatdressing 31 Sorbinsäure, Benzoesäure HPLC<br />
Säuglingsanfangsnahrung<br />
18 Vitamin A, Vitamin C HPLC-DAD, HPLC-FD<br />
Snack Food<br />
Flavouring<br />
18 Chlorid, Glutaminsäure Potentiometrie, Enzymatik<br />
Sojamehle 40 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Sojasoße 18 3-MCPD GC-MSD<br />
Speiseöl 34 Tocopherolverteilung, Gesamttocopherole HPLC-Fluoreszenzdetektion<br />
Speiseöl 34 Säurezahl, Peroxidzahl, FSV Titrimetrie, GC-FID<br />
Spirituosen 34 Relative Dichte 20 °C/20 °C, Alkohol in % vol.,<br />
Gärungsbegleitstoffe (Ester, Aldehyde, höhere<br />
Alkohole, Methanol)<br />
Pyknometrie, Gaschromatographie<br />
Spirituosen 34 Ethylcarbamat LC-MS/MS<br />
Teigware 34 Wasser, Fett, Rohprotein, Asche, Kochsalz,<br />
Gravimetrie, Weibull-Stoldt, Kjeldahl,<br />
Cholesterin, Eigehalt<br />
Potentiometrie, GC, Berechnung<br />
Tomatenmark 34 pH-Wert, titrierbare Gesamtsäure, Citronensäure,<br />
Glukose, Fruktose, Kochsalz<br />
Potentiometrie, Enzymatik<br />
Tomatenmark 9/18 Nitrat, Al, Pb, Cd, Cu, Ni, Hg, Se, Zn, Sn HPLC-IC, ICP-MS, Hydrid-AAS,<br />
Kaltdampf-AAS<br />
Tomatenpüree 18 Blei, Cadmium, Quecksilber ICP-MS, Kaltdampf-AAS<br />
Tomatensauce 18 Brix, pH-Wert, Gesamtsäure, Chlorid, Natrium Refraktometrie, Potentiometrie, AES<br />
Trinkwasser 33 Aluminium, Ammonium, Eisen, Kupfer, pH-Wert,<br />
Leitfähigkeit, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit,<br />
Färbung, Trübung, TOC<br />
Trinkwasser 32 Ammonium, Calcium, Magnesium, Silikat, pH-Wert,<br />
Bor Quecksilber<br />
Trinkwasser 32 Aldrin, Dieldrin, HCB, Heptachlor, pp-DDE GC-ECD<br />
Trinkwasser 32 Bromat, Chlorid, Cyanid, Fluorid, Nitrat, Nitrit,<br />
Phosphat, Sulfat, Trübung<br />
338<br />
Konduktometrie, Photometrie,<br />
Ionenchromatographie, Titrimetrie,<br />
Trübungsmessgerät, ICP-MS<br />
Konduktometrie, Photometrie,<br />
Ionenchromatographie, ICP-MS<br />
Konduktometrie, Photometrie,<br />
Ionenchromatographie, Titrimetrie,<br />
Trübungsmessgerät<br />
LC-MS-MS<br />
Trinkwasser 32 Atrazin, Chlortoluron, Desethylatrazin, Diuron,<br />
Isoproturon, Metobromuron, Metribuzin, Terbuthylazin<br />
Trinkwasser 10 Natrium, Calcium, Magnesium, Sulfat, Chlorid Ionenchromatographie<br />
Trinkwasser 28 1,2-Dichlorethan, Trichlorethen, Trichlormethan,<br />
Bromdichlormethan, Dibromchlormethan,<br />
GC-ECD, GC-Headspace/MS
Matrix Ver. Parameter<br />
Tetrachlorethen, Tribrommethan, Benzol<br />
Methodik<br />
Trinkwasser 28 Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,<br />
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3cd)pyren<br />
HPLC<br />
Trinkwasser 33 Coliforme Bakterien, E. coli, Koloniezahl, Intestinale Quantitative und qualitative<br />
Enterokokken, C. perfringens, Pseudomonas<br />
aeruginosa, Legionellen<br />
mikrobiologische Methoden<br />
Trinkwasser 15 Acrylamid LC-MS/MS<br />
Trinkwasser 32 Aldrin, Dieldrin, HCB, Heptachlor, pp-DDE GC-MSD<br />
Trinkwasser 32 Atrazin, Chlortoluron, Desethylatrazin, Diuron,<br />
Isoproturon, Metobromuron, Metribuzin, Terbuthylazin<br />
LC-MS/MS<br />
Wasserprobe 5 Gamma-Radionuklide<br />
Gammaspektrometrie<br />
1 Modellwasser Am-241<br />
alphanuklidspezifischer Nachweis<br />
Sr-90<br />
beta-low-level-Messung<br />
Wasserprobe 5 Gamma-Radionuklide<br />
Gammaspektrometrie<br />
2 Reales<br />
Am-241<br />
alphanuklidspezifischer Nachweis<br />
Wasser<br />
Sr-90<br />
beta-low-level-Messung<br />
Wein 34 Relative Dichte 20 °C/20 °C, Gesamtalkohol, Pyknometrie, potent. Titrimetrie,<br />
vorhandener Alkohol, Gesamtextrakt, vergärbarer Photometrie, Enzymatik, Gravimetrie,<br />
Zucker, Glucose, Fructose, Gesamtsäure, Weinsäure,<br />
Gesamte Äpfelsäure, L-Äpfelsäure, D-Äpfelsäure,<br />
Gesamte Milchsäure, L-Milchsäure, D-Milchsäure,<br />
Flüchtige Säure, Citronensäure, Reduktone, freie<br />
schweflige Säure, gesamte schweflige Säure, Glycerin,<br />
L-Äpfelsäure, D-Äpfelsäure, L-Milchsäure, D-<br />
Milchsäure, Shikimisäure, Sorbinsäure, Asche,<br />
Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Chlorid,<br />
Phosphat, Sulfat als Kaliumsulfat<br />
HPLC, AAS<br />
Wein 34 Sensorische Überprüfung von sechs Weinen (2004) Sensorik<br />
Wein 10 Ochratoxin A HPLC<br />
5.<strong>3.</strong>2 LAVES – LI Oldenburg<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Apfelsaft 49 Chlormequat, MCPA HPLC<br />
Aprikosenbrei,<br />
getrocknet<br />
18 SO2 Reith-Willems<br />
Aubergine 48 Acetamiprid, Azoxystrobin, Bifenthrin, Brompropylat,<br />
Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cyprodinil,<br />
Diazinon, Dichlofluanid, Fludioxonil, Imazalil, Lambda-<br />
Cyhalothrin, Myclobutanil, Parathion, Pirimicarb<br />
GC, HPLC<br />
Breakfast<br />
Cereals<br />
18 Niacin, Folsäure, Vitamin B2, B6 HPLC<br />
Brühwurst 34 Rohprotein, Wasser, Asche, Fett, Hydroxyprolin, Kjeldahl, Gravimetrie, Photometrie,<br />
Gesamtphosphat, Kochsalz, Stärke<br />
Weibull-Stoldt, Potentiometrie, Titration<br />
Brühwurst 34 Citrat, Acetat, Gluconsäure, L-Lactat,<br />
Glutaminsäure, NPN, Kollagenabbauprodukte,<br />
Farbstoffe<br />
Enzymatik, Kjeldahl, Photometrie, DC<br />
Diätetisches<br />
Lebensmittel<br />
49 Zuckeraustauschstoffe HPLC-RI<br />
Dorschleberöl 18 PCDD/F und dl-PCB GC/MS<br />
Eigelb 52 PCDD/F und dl-PCB GC/MS<br />
Feinkostsalat 31 Benzoe-/Sorbinsäure HPLC<br />
339
Fisch 18 J, Se, ICP-MS<br />
Fischsalat 31 Konservierungsstoffe HPLC<br />
Fleisch 18 SO2 Reith-Willems<br />
Fleisch 25 Nitrit, Nitrat Fließinjektionsanalyse, Photometrie<br />
Fleisch 36 aerobe Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceen,<br />
coliforme Keime, E.coli, Salmonella spp.<br />
Mikrobiologische Untersuchung<br />
Frauenmilch 52 PCDD/F und dl-PCB GC/MS<br />
Fruchtsaft 32 Stabile Isotope IRMS-EA<br />
Geflügelfleisch 19 Campylobacter spp. Mikrobiologische Untersuchung<br />
Gewürze 51 Behandlung mit ionisierenden Strahlen Photostimulierte Lumineszenz (PSL)<br />
Haare 47 Stabile Isotope IRMS-EA<br />
Hafermehl,<br />
Milchpulver<br />
36 Gesamtkeimzahl, Clostr. Perfringens, E.coli, coliforme<br />
Keime, Enterokokken, Enterobacter sakazakii,<br />
Enterobacteriaceen, Listeria spp., Salmonella spp.,<br />
Hefen, Schimmelpilze, Lactobazillen, Staphylococcus<br />
aureus, Pseudomonas spp., Vibrio spp., Bacillus<br />
cereus, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica,<br />
340<br />
Mikrobiologische Untersuchung<br />
Heilbutt 52 PCDD/F und dl-PCB GC/MS<br />
Honig 32 Stabile Isotope IRMS-EA<br />
Kalorien-<br />
34 pH-Wert, Saccharin, Cyclamat, Acesulfam-K, Potentiometrie, HPLC<br />
reduzierte<br />
Getränke<br />
Aspartam, Gesamtsäure, künstliche Farbstoffe<br />
Kindernahrung<br />
auf Milchbasis<br />
(Pulver)<br />
35 Saccharose, Fructose, Glucose, Stärke, Vitamin C + E Enzymatik, HPLC<br />
Kindernahrungs<br />
mittel<br />
18 Fett, Fettsäure-Verteilung, Trans-Fettsäuren Büchi-Caviezel, GC<br />
Kindernahrungs 34 Wasser, Asche, Fett, Butterfett, Eiweiß, Jod,<br />
Büchi-Caviezel, Titration (Kjeldahl), ICP,<br />
mittel<br />
Rohprotein<br />
Gravimetrie, GC<br />
Kindernahrungs<br />
mittel<br />
34 J ICP-MS<br />
Knäckebrot 18 Acrylamid GC/MS<br />
Kuchen 31 Fettsäure-Verteilung (cis/trans) GC<br />
Lyophylisat<br />
einer Kultur<br />
36 pathogenes Isolat Mikrobiologische Untersuchung<br />
Milch 23 aerobe Gesamtkeimzahl Mikrobiologische Untersuchung<br />
Milchpulver 18 Vitamin A, C, E HPLC<br />
Milchpulver 18 Ca, J, Se ICP-MS<br />
Papier 47 Stabile Isotope IRMS-EA<br />
Pflanzenöl 18 -HCH, cis-Chlordan, pp’-DDD, PCB 180 GC<br />
Pflanzliches Öl 18 CLKW und PCB GC/ECD<br />
Protein 32 Stabile Isotope IRMS-EA<br />
Reis 19 Bacillus cereus Mikrobiologische Untersuchung<br />
Salat 19 Enterobacteriaceen Mikrobiologische Untersuchung<br />
Salat 18 Nitrat HPLC<br />
Sauerkraut 34 Ascorbinsäure, Gesamtsäure, pH-Wert, Essigsäure, HPLC, Potentiometrie, Titration,<br />
Milchsäure, Kochsalz<br />
Enzymatik<br />
Sediment 50 Gamma-Strahler Gamma-Spektrometrie<br />
Seetang 18 Anorg. As, Gesamt As, J ICP-MS, Hydridtechnik und GF AAS<br />
Speisefett 34 Fettsäureverteilung, Tocopherolverteilung,<br />
Fettkennzahlen<br />
GC, HPLC, Titration<br />
Speiseöl 34 Säurezahl, Peroxidzahl Titration<br />
Spinat 18 pp-DDE, Fenvalerate, gamma-HCH, Permethrin,<br />
Tolclofos-methyl<br />
GC, HPLC<br />
Tomatenpüree 18 Sn, Fe ICP-MS
Tomatensaft 34 pH-Wert, Gesamtsäure, lösliche Trockenmasse,<br />
relative Dichte, Zitronensäure, Glucose, Fructose,<br />
Chlorid<br />
Vanille-Extrakt<br />
Wasser<br />
(Modellwasser,<br />
Reales<br />
Wasser)<br />
32 Stabile Isotope IRMS-GC<br />
341<br />
HPLC, Titration, Potentiometrie,<br />
Enzymatik<br />
4 Gamma-Strahler, Strontium-90 Gamma-Spektrometrie, beta-low-level-<br />
Messung<br />
Weizenmehl 18 Deltamethrin, Fenamiphos, Fenitrothion GC, HPLC<br />
Weizenmehl 18 Chlorpyrifos, Bifenthrin, Permethrin GC, HPLC<br />
5.<strong>3.</strong>3 LAVES – Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Mayonnaise 34 Salz, Fett, Titration, Gravimetrie<br />
Modell-Wasser 4 Gamma-Radionuklide, Strontium-90 Gammaspektrometrie, beta-low-level-<br />
Messung<br />
Reales Wasser 4 Gamma-Radionuklide, Strontium-90 Gammaspektrometrie, beta-low-level-<br />
Messung<br />
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
Lyophilisat 22 Norovirus/Hepatitis A PCR/Qualitativ<br />
Fischsalat 31 Konservierungsstoffe LC-UV/vis<br />
Trockenei 7 Nitrofuranmetaboliten LC-MS/MS<br />
Muscheln 7 DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)-Toxine LC-MS/MS<br />
Tränkewasser 43 Chloramphenicol LC-MS/MS<br />
5.<strong>3.</strong>4 LAVES – VI Hannover<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Auftauwasser<br />
(Masthähnchen)<br />
Auftauwasser<br />
(Masthähnchen)<br />
3 Nachweis thermophiler Campylobacter spp. Real-time PCR nach<br />
Anreicherungskultur, mikrobiologische<br />
Methoden<br />
3 Nachweis thermophiler Campylobacter spp. ISO 10272:1996, modifiziert, gem.<br />
Laborstandardarbeitsanweisung des<br />
BfR, Berlin<br />
Babynahrung 6 Gamma-Nuklide, Sr-90 Gamma-Spektroskopie, Beta-Low-Level-<br />
Counter<br />
Blutproben 12 BTV8-Genom Real-time RT-PCR<br />
Blutseren 63 Leptospirose-Antikörper Mikroagglutinationstest (MAT)<br />
Blutseren 11 Lungenseuche-Antikörper Komplementbindungsreaktion (KBR)<br />
Blutseren 12 BTV8-Antikörper ELISA<br />
Fleisch (Niere<br />
und Muskulatur<br />
vom Schwein)<br />
44 Rückstände von Penicillinen LC-MS/MS; HPLC
Gehirnhomogenate <br />
Magermilchpulver<br />
Geflügelkot<br />
(Masthähnchen)<br />
Haut<br />
(Regenbogenforelle),<br />
Nierentupfer<br />
(Regenbogenforelle)<br />
Haut<br />
(Bachforelle),<br />
Haut<br />
(Regenbogenforelle),<br />
Haut (Atlant.<br />
Lachs)<br />
Leber (Schaf),<br />
Milch (Kuh),<br />
Foetale Leber<br />
(Schaf)<br />
11 Tollwutvirus/-antigen Direkter Immunfluoreszenztest,<br />
Viruskultur auf zwei verschiedenen<br />
Zelllinien<br />
36 Campylobacter spp. Real-time PCR nach<br />
Anreicherungskultur<br />
3 Nachweis von Salmonellen ISO 6579:2002, modifiziert nach<br />
Empfehlungen des CRL-Salmonella<br />
Bilthoven<br />
42 Nachweis bakterieller Krankheits-erreger bei Mikrobiologische Methoden<br />
Kaltwasserfischen<br />
(Pseudomonas fluorescens, Hafnia alvei, Yersinia<br />
ruckeri)<br />
42<br />
42<br />
Nachweis bakterieller Krankheits-erreger bei<br />
Kaltwasserfischen<br />
(Aeromonas hydrophila, Shewanella putrefaciens,<br />
Hafnia alvei, Aeromonas salmonicida subsp.<br />
Salmonicida)<br />
Nachweis primär pathogener Bakterien und<br />
Begleitflora<br />
(Fusobacterium necrophorum, Prototheca zopfii,<br />
Salmonella Arizonae, E. coli, Enterococcus faecalis)<br />
342<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Modellwasser 4 Gamma-Nuklide, Sr-90 Gamma-Spektroskopie, Beta-Low-Level-<br />
Counter<br />
Muskelproben 3 Nachweis von Trichinella-Muskellarven Magnetrührverfahren<br />
Realwasser 4 Gamma-Nuklide, Sr-90 Gamma-Spektroskopie, Beta-Low-Level-<br />
Counter<br />
Rinderblutproben,<br />
lyophilisiert,<br />
Ohrstanzproben<br />
11 BVD-Genom Real-time RT-PCR<br />
Rinderblutproben,<br />
lyophilisiert,<br />
Ohrstanzproben<br />
Kryostatschnitte<br />
von<br />
Hautstanzproben<br />
11 BVD-Antikörper Antikörper-ELISA<br />
Rinderblutpro- 11 BVD-Virus<br />
Zellkultur, Neutralisationstest (NPLA),<br />
ben, lyophilisiert,<br />
Ohrstanzproben<br />
Kryostatschnitte<br />
von<br />
Hautstanzproben,<br />
BVD-Antigen<br />
Antigen-ELISA<br />
Samen (Schaf), 42 Nachweis primär pathogener Bakterien und<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Kot (Kuh),<br />
Begleitflora<br />
Leber (Pferd)<br />
(Histophilus ovis, E. coli, Citrobacter freundii,<br />
Enterococcus faecalis, Rhodococcus equi, Bacillus<br />
cereus)<br />
Schweineblutproben,<br />
lyophilisiert<br />
11 KSP-Antikörper Antikörper-ELISA
Schweineblutproben,<br />
lyophilisiert<br />
Schweineblutproben<br />
11 KSP-Virus<br />
KSP-Antigen<br />
KSP-Antikörper<br />
343<br />
Zellkultur, Neutralisationstest (NPLA),<br />
Antigen-ELISA<br />
11 KSP-Genom Real-time RT-PCR<br />
Tupferproben 11 1. Nachweis von Chlamydiaceae<br />
2. Nachweis von Chlamydophila psittaci<br />
Urin (Kuh),<br />
42 Nachweis primär pathogener Bakterien und<br />
Lunge<br />
Begleitflora<br />
(Schwein),<br />
(Corynebacterium renale, Actinobacillus<br />
Lunge (Schaf) pleuropneumoniae, Arcanobacterium pyogenes)<br />
Vollei<br />
(Lyophillisat)<br />
Vollei<br />
(Lyophillisat)<br />
5.<strong>3.</strong>5 LAVES-VI Oldenburg<br />
Real-time PCR, PCR<br />
7 Rückstände von Kokzidiostatika LC-MS/MS<br />
7 Rückstände von Nitrofuran-Metaboliten LC-MS/MS<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Serum 59 Nachweis von Bluetongue-Typ8-Antigen PCR<br />
Serum 59 Nachweis von Antigen des BVD-Virus in<br />
Serum<br />
PCR<br />
Serum/Plasma 59 Nachweis von Antikörpern gegen das<br />
Bluetongue-Virus<br />
Antikörper-ELISA<br />
Serum/Plasma,<br />
59 Nachweis von Antikörpern gegen das Virus Antikörper-ELISA; Antigen-ELISA, Zellkultur,<br />
Ohrstanzproben<br />
der Bovinen Virusdiarrhoe im<br />
Serum/Plasma; Nachweis von Antigen des<br />
BVD-Virus in Serum/Plasma und<br />
Ohrstanzproben<br />
Immunfluoreszen<br />
Gehirnhomogenate/<br />
Abklatschpräparate<br />
60 Nachweis von Tollwutvirus/Negrikörpern Immunfluoreszenz, Zellkultur<br />
Serum 11 Nachweis von Antikörpern gegen das Virus Antikörper-ELISA; Antigen-ELISA, PCR,<br />
der klassischen Schweinepest, Nachweis<br />
von KSP-Antigen<br />
Virusisolierung, SNT<br />
Hirnpräparationen 12 Nachweis anormales Prionprotein (PrPSC) HerdChek® Bovine Spongiforme<br />
Enzephalopathie (BSE) Antigen-Testkit, EIA,<br />
Firma IDEXX<br />
Lyophilisiertes Hühnerfleisch<br />
18 Salmonellen in 25 g ISO 6579, FSIS, MLG 4,03<br />
Lyophilisiertes Hühner- 18 List. monocytogenes in 25 g und<br />
FSIS MLG 8,03<br />
fleisch<br />
Keimzählung<br />
Lyophilisiertes Hühnerfleisch<br />
18 Campylobacter ISO 10272<br />
Lyophilisiertes Rind- 18 Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl, Anzahl ISO 4833, ISO 21528, Spiralplater<br />
fleisch<br />
Enterobacteriacceae<br />
Lyophilisiertes Rindfleisch<br />
18 Anzahl E. coli ISO 16649-2<br />
Fleisch 19 Listerien Kultureller Nachweis<br />
Fleisch 19 Salmonellen Kultur mit Voranreicherung gemäß AVVFLH;<br />
biochem. u serolog. Differenzierung<br />
Fleisch 19 Escherichia coli Kultureller Nachweis<br />
Milch, tiefgefroren 23 Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl ISO 4833, Spiralplater<br />
Milchpulver 36 Salmonellen Kultur mit Voranreicherung gemäß AVVFLH;
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
biochem. u serolog. Differenzierung<br />
Milchpulver 36 Clostridien Kultur mit Voranreicherung gemäß AVVFLH;<br />
biochem. Differenzierung<br />
Chloramphenicol in 43 Qualifizierung und gg. Quantifizierung von GC-MS und Screnning (2X)<br />
Tränkewasser<br />
Chloramphenicol in Tränkewasser<br />
Bakterienstämme, 53 Identifizierung, Resistenzbestimmung, Mikrobiologische Techniken (Kultur,<br />
lyophilisiert<br />
zweimal jährlich jeweils 5 verschiedene Biochemie, Molekularbiologie, Mikroskopie,<br />
Stämme<br />
u.a. anerkannte Verfahren)<br />
Unbekanntes<br />
53 Bakteriengenom-Nachweis EHEC (Stx1 und PCR<br />
Lyophilisat<br />
Stx2)<br />
Unbekanntes<br />
53 Bakteriengenom-Nachweis Salmonella PCR<br />
Lyophilisat<br />
enterica<br />
Bakterienstämme, 54 Identifizierung von 5 Stämmen,<br />
Mikrobiologische Techniken (Kultur,<br />
lyophilisiert,<br />
Resistenzbestimmung mit jeweils 32 versch. Biochemie, Molekularbiologie, Mikroskopie,<br />
Mikrotiterplatten versch. Antibiotika<br />
u.a. anerkannte Verfahren), Resistenzprüfung<br />
Antibiotika in<br />
und Bewertung nach NCCLS M31-A2 (2002)<br />
unterschiedlichen<br />
im Mikrodilutionsverfahren, Angabe der MHK-<br />
Konzentrationen<br />
Werte<br />
Hühnerkot 55 Nachweis von Salmonellen, 28 Proben Vor- und Hauptanreicherung, serologische<br />
und biochemische Differenzierung, Verfahren<br />
„MSRV“ nach EU-Referenzlabor,<br />
Salmonellen-Prävalenzstudie<br />
Rinderkot 56 Nachweis von Mycobacterium avium ssp. Kultureller und molekularbiologischer<br />
paratuberculosis (MAP), 15 Proben Erregernachweis<br />
Kotprobe Bussard 57 Nachweis und Identifizierung von Magen-<br />
Darm-Parasiten<br />
Flotation, Mikroskopie<br />
Paraffinschnitte (HE- 58 Feststellung physiologischer oder spontan Lichtmikroskopie<br />
und/oder PAS-Färbun- entstandener Veränderungen (Hyperplasie,<br />
gen)<br />
Dysplasie, Tumor, Entzündung u.a.)<br />
5.<strong>3.</strong>6 LAVES – FI Stade<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Hafermehl 36 Gesamtkeimzahl, E. coli, Coliforme,<br />
Enterobacteriaceen<br />
§ 64 LFGB<br />
Hafermehl 36 Clostridium perfringens (qualitativ und quantitativ) § 64 LFGB<br />
Hafermehl 36 Hefen/Schimmelpilze (Keimzählung) VDLUFA<br />
Milcheiweiß 36 Salmonellen (qualitativ) gem. Rindersalmonellose-VO<br />
Milcheiweiß 36 Salmonellen (qualitativ) VwVFlHV<br />
Kälberfutter<br />
(Mehl)<br />
37 tierische Bestandteile EU-Richtlinie 2003/126/EG<br />
Legehennenfutter<br />
41 Fluor RL 2005/87 EG<br />
Milchleistungsfutter<br />
41 Fluor RL 2005/87 EG<br />
3 verschiedene<br />
Futtermittel<br />
41 Feuchte, Rohasche, Rohfaser, Fett, ELOS, Rohprotein Gravimetrie, Kjeldahl<br />
3 verschiedene<br />
Futtermittel<br />
41 Elemente ICP-OES<br />
3 verschiedene<br />
Futtermittel<br />
41 Vitamine HPLC<br />
344
Mineralfutter<br />
für Ferkel<br />
6 verschiedene<br />
Futtermittel<br />
5.<strong>3.</strong>7 LAVES – IB Celle<br />
41 Chlorid Titration<br />
46 CKWs und PCBs GC-ECD<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Honig 24 Wasser, elektr. Leitfähigkeit, Invertase, Diastase, freie<br />
Säure, Zucker- + Pollenspektrum<br />
Honig 25 Pollenspektrum Mikroskopie<br />
Honig 15 Freie Säure Photometrie<br />
5.<strong>3.</strong>8 LAVES-IfB Lüneburg<br />
345<br />
Refraktometrie, Konduktometrie,<br />
Titration, Photometrie, HPLC,<br />
Mikroskopie<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Badegewässer 33 Faekalcoliforme und Gesamtcoliforme Bakterien, MPN,<br />
Pseudomonas aeruginosa<br />
Membranfiltration nach PrEN 12780<br />
Creme 10 NDELA GC-TEA<br />
Creme /<br />
Duschgel<br />
61 Iodopropinylbutylcarbamat (IPBC) LC-MSD<br />
Futtermittel 41 Ca, Na, P, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Se, As, Cd, Pb,<br />
Hg<br />
ICP-MS, Hg-Analysator<br />
Kunststoff 28 Weichmacher Phthalate GC/GCMSD<br />
Lidschatten 62 Chrom-VI Photometrie<br />
Lotion 61 UV-Filter HPLC-DAD<br />
Lotion 34 UV-Filter, Vitamin E, Konservierungsstoffe, Titandioxid HPLC-DAD, Photometrie<br />
Milch 23 Gesamtkeimzahl Plattenguss- und Spatelverfahren<br />
PVC-Folie 10 DOA, DOA im Migrat GC<br />
Shampoo 61 Antischuppenwirkstoffe: Zinc Pyrithione, Piroctone<br />
Olamine, Climbazole<br />
HPLC-DAD<br />
Trinkwasser 33 Cu, Mn, Al, Fe, Ammonium, Nitrat, Nitrit, pH-Wert, ICP-MS, Photometrie, Elektrometrie,<br />
Leitfähigkeit, Färbung, Trübung, Oxidierbarkeit, Titration, Plattengussanreicherungsverf.,<br />
KBE 20 °C und 36 °C, E.coli, Coliforme, Enterokokken, Membranfiltration, MPN-Verfahren,<br />
Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Membranfiltr.verf. n. prEN 12780,<br />
Legionellen<br />
Filtration und Direktausstrich<br />
Trinkwasser 32 Ammonium, B, Ca, Mg, Hg, pH-Wert Photometrie, ICP-MS, Hg-Analysator,<br />
Elektrometrie,<br />
Trinkwasser 32 Bromat, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Sulfat, Trübung, Nitrit,<br />
Phosphat<br />
Ionenchromatographie, Photometrie<br />
Trinkwasser 32 Epichlorhydrin GC-MS<br />
Vollei 26 Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceen, Hefen, E.coli Plattenguss- und Spatelverfahren<br />
Wasser 32 Chlorhaltige Pestizide GC-ECD
5.4 Sachverständige<br />
Amtsgericht Osnabrück, Ladung als Sachverständiger zur Hauptverhandlung in einer Bußgeldsache<br />
wegen irreführender Haltbarkeitsangaben bei Fleischerzeugnissen<br />
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE, Projektträger Agrarforschung und –<br />
entwicklung, Bereich Projekte Bienenforschung<br />
346<br />
Kirchhoff, H. (LI OL)<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) -Projekt „Marine Aquakultur Technologie“ Kleingeld, D.W. (Dez.<br />
32)<br />
Fachexpertin der Staatlichen Akkreditierungsstelle Hannover Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Fachexpertin im Twinning Projekt mit Estland EE 05 IB AG 01 „Development of GMO Chain<br />
Management for Co-Existence of Genetically Modified, Conventional and Organic Crops” vom<br />
16.10. bis 20.10.2006<br />
Fachexpertin im Twinning Projekt mit Litauen „-Twinning Project No LT/2003/IB/AG/03“ zum Thema<br />
Gentechnisch veränderte Organismen vom 21.2. bis 2<strong>3.</strong>2.2006<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
GMP-Inspektion bei der Fa. Essex, Burgwedel 0<strong>3.</strong> und 04.05.2006 Thalmann, G. (VI OL)<br />
GMP-Inspektion bei der Fa. Lohmann Animal Health Cuxhaven, Inspektionsbericht vom 24.02.2006 Thalmann, G. (VI OL)<br />
GMP-Inspektion bei der Fa. WdT, Serumwerk Memsen, 16.05.2006 Thalmann, G. (VI OL)<br />
GMP-Inspektion bei der Fa. WdT, Serumwerk Memsen, Inspektionsbebericht vom 25.01.2006 Thalmann, G. (VI OL)<br />
Inspektionsbegehung bei der Fa. Anicon, Höltinghausen, 21.11.2006, zu Fragen<br />
bestandsspezifischer Impfstoffe<br />
Inspektionsbegehung bei Fa. LTZ, Cuxhaven zu Fragen bestandsspezifischer Impfstoffe,<br />
2<strong>3.</strong>02.2006<br />
Inspektionsbegehung bei IVD (Innovative Veterinärdiagnostik) GmbH, Hannover-Ahlem am<br />
04.12.2006, zu Fragen bestandsspezifischer Impfstoffe<br />
Key-Expert im Twinning-Projekt Bosnien-Herzegowina BA05/IB/AG/01<br />
Thalmann, G.;<br />
Klarmann, D. (VI OL)<br />
Thalmann, G. (VI OL)<br />
Thalmann, G.;<br />
Klarmann, D. (VI OL)<br />
Moss, A. (VI OL)<br />
Landgericht Osnabrück in einer Strafsache (Einsatz von Clenbuterol) am 24.8.06 Siemer, H.(VI OL)<br />
Nationale Expertin bei der Inspektion des Lebensmittel- und Veterinäramtes (FVO) der Europäischen<br />
Kommission, Dublin zur Umsetzung des EG-Rechtes betr. Lebensmittel aus gentechnisch<br />
veränderten Organismen oder deren Bestandteile vom 21.11. bis 28.11.2006 in Argentinien<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H)<br />
OECD - Expert Consultation on the draft Guidance Document on Honey Bee Brood Test Janke, M., von der Ohe,<br />
W. (IB CE)<br />
Rechtsgutachten (5) von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Short-Time-Expert im Twinning-Projekt Bosnien-Herzegowina BA05/IB/AG/01<br />
Djuren, M. (VI OL)<br />
Short-Time-Expert im Twinning-Projekt Lettland, Komponente 3 Hygieneuntersuchungen Schleuter, G. (VI OL)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Kleingeld, D.W. (Dez.<br />
32)
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Maiworm, K. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Welzel, A. (Dez. 33)<br />
Wissenschaftliche Zeitschriften (Referee): Journal of Apicultural Research Boecking, O. (IB CE)<br />
5.5 Forschungsaufgaben<br />
Aufgabe Auftraggeber Verantwortlicher Wissenschaftler<br />
Statuserhebung zum Eintrag von PBT<br />
und vPvB in die Nahrungskette durch<br />
globale Destillation. Vergleich von<br />
Kontaminanten in Heringen aus drei<br />
maritimen Regionen, der Nordsee, der<br />
Ostsee und dem Atlantik nördlich des<br />
Polarkreises<br />
Fortsetzung des Forschungsauftrages<br />
„Exposition mit Methylquecksilber durch<br />
Fischverzehr“<br />
Schwermetalluntersuchungen an<br />
Fischen und Flusswasser aus<br />
ausgewählten Gewässern im Harz und<br />
Harzvorland<br />
Schwermetalluntersuchungen an<br />
Fischen aus ausgewählten Gewässern<br />
im Harz und Harzvorland<br />
Aquakulturprojekt III: „Aquakulturen in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>: Untersuchungen zur<br />
Hygiene der Schlachtung und<br />
Verarbeitung in niedersächsischen<br />
Aquakulturbetrieben“<br />
„Globale Destillation: Belastuung von<br />
Heringen in arktischen Gewässern,<br />
Barentsee, Nordsee und Ostsee mit<br />
PBT- und vPvB-Substanzen“;<br />
Nachweis relevanter PBT bzw. vPvB-<br />
Substanzen in ausgewählten Fischen<br />
Entwicklung eines Verfahrens zur<br />
Bestimmung von Perfluorierten<br />
Tensiden in Fischen<br />
„MytiFit“ : Eignung des Seegebietes am<br />
geplanten Offshore-Windpark<br />
„Nordergründe“ für die Zucht von<br />
Miesmuscheln“; Projektteil<br />
‚Bestimmung von<br />
lebensmittelhygienisch relevanten<br />
Parametern und Mikroparasiten<br />
Bundesamt für Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit (BVL)<br />
BfR Kruse, R. (IfF Cux)<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
347<br />
Ende, M.; Pfordt, J. (LI OL); Effkemann,<br />
S.; Kruse, R. (IfF CUX)<br />
Arzbach, H.-H.; Ballin, U. (IfF Cux);<br />
Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit Arzbach, H.-H.; Ballin, U. (IfF Cux)<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Bartelt, E.; Ramdohr, S.; Etzel, V. (IfF<br />
Cux)<br />
BVL Effkemann, S.; Kruse, R. (IfF Cux); in<br />
Kooperation mit LI OL und dem LALF<br />
M.-V.<br />
BVL Effkemann, S. (IfF Cux)<br />
AWI Bremerhaven, Niedersächsisches<br />
Landesamt für Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Stede, M.; Ramdohr, S.; Effkemann, S.;<br />
Bartelt, E. (IfF Cux)
Statuserhebung zur mikrobiellen und<br />
Virusbelastung von Miesmuscheln und<br />
Austern aus dem Beifang im Rahmen<br />
des Muschelmonitorings<br />
Erstellung von fischfaunistischen<br />
Referenzen und Bewertung der<br />
Fischfauna zur Umsetzung der EG-<br />
Wasserrahmenrichtlinie<br />
Fischereibiologische Begleitung<br />
exemplarischer Rückstandsanalysen<br />
auf Schadstoffe in Fischen in<br />
Zusammenarbeit mit NLWKN –<br />
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim vor<br />
dem Hintergrund der EG-<br />
Wasserrahmenrichtlinie<br />
Monitoring des natürlichen Aufstiegs<br />
von Glas- und Steigaalen am Stauwehr<br />
Geesthacht vor dem Hintergrund des<br />
EU-Aktionsplans zum Schutz des Aals<br />
Fischbestandsentwicklung in Werra und<br />
Weser unter Berücksichtigung der<br />
Belastung mit Kaliendlaugen<br />
Fischereiliche Beweissicherung der<br />
Auswirkungen von lethalen<br />
Vergrämungsmaßnahmen vor dem<br />
Hintergrund einer<br />
artenschutzrechtlichen<br />
Ausnahmegenehmigung zum<br />
Einzelabschuss von Kormoranen im<br />
NSG Emmertal<br />
Nematoden in Wildlachs, Beurteilung<br />
und Bewertung<br />
Beurteilung und Bewertung des neu<br />
entwickelten Produktes „Mild gesalzene<br />
Seelachsschnitzel“ im Vergleich zu<br />
herkömmlich hergestellten<br />
Seelachsscnitzeln (Lachsersatz).<br />
Austernsterben im ostfriesischen<br />
Wattenmeer<br />
Erschließung und Management von<br />
adäquaten Bestäubern für den Erd- und<br />
Kulturheidelbeerenanbau<br />
Optimierung der Varroose-Behandlung<br />
bei brutfreien Völkern und bei<br />
Wirtschaftsvölkern während der<br />
Zwischentrachtzeiten<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
348<br />
Bartelt, E.; Ramdohr, S.; Effkemann, S.<br />
(IfF Cux)<br />
MU Mosch, E. (IfF Cux)<br />
NLWKN Kämmereit, M. (IfF Cux) et al.<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Kämmereit, M. (IfF Cux); Bearbeitung:<br />
externe Auftragnehmer<br />
Matthes, U. (IfF Cux)<br />
Landkreis Hameln-Pyrmont Meyer, L. (IfF Cux) et al.<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Etzel, V., (IfF CUX); Berges, M., (LUA<br />
Bremen); Boiselle, C. (LMT-Vet Brhv)<br />
Etzel, V.; Kruse, R. (IfF CUX), Berges,<br />
M. (LUA Bremen); Boiselle, C. (LMT-<br />
Vet Brhv.)<br />
Stede, M. (IfF CUX) et al.<br />
BLE Boecking, O.; Kubersky, U. (IB CE)<br />
EU und ML (EG 1221/97) Boecking, O. (IB CE)
Frühdiagnose der Amerikanischen<br />
Faulbrut mittels Messpunktmonitoring<br />
Differenziertes Hygieneverhalten – als<br />
Abwehrverhalten der Bienen gegen<br />
Brutkrankheiten<br />
ML von der Ohe, W. (IB CE)<br />
ML Boecking, O. (IB CE)<br />
Deutsches Bienenmonitoring BMELV, ML, IVA, DIB, DBIB von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Versuche zur Klärung von<br />
Bienenschäden bisher nicht bekannter<br />
Ursache<br />
Vergleichsuntersuchungen - Haltung<br />
von Bienenvölkern in unterschiedlichen<br />
Umwelten<br />
BVL von der Ohe, W.; Janke, M. (IB CE)<br />
Uni Göttingen, ML von der Ohe, W.; Boecking, O. (IB CE);<br />
Stefan-Deventer, I. (UNI GÖ)<br />
Charakterisierung von Sortenhonigen ML von der Ohe, W.; Janke, M. (IB CE)<br />
Differenzierung von Honigen<br />
spezifischer Regionen<br />
Pyrrolizidine in Honig<br />
Pollenanalyse: Strukturanalyse,<br />
Bildverarbeitung und Datenbank<br />
Optimierung der Honiguntersuchung im<br />
Rahmen von Qualitätssicherung und -<br />
kontrolle<br />
Überprüfung der Paarungssicherheit<br />
von Belegstellen<br />
Evaluierung einer real-time PCR zum<br />
qualitativen und quantitativen Nachweis<br />
des Koi-Herpesvirus<br />
Prävalenz von Coxiella burnetii in<br />
Schafhaltungen in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Untersuchungen zur Rolle des<br />
Rotfuchses als Trichinenträger<br />
ML von der Ohe, W.; Janke, M. (IB CE);<br />
Meylahn (LI OL)<br />
Uni Braunschweig von der Ohe, W. (IB CE)<br />
ML von der Ohe, W. (IB CE)<br />
EU und ML (EG 1221/97) von der Ohe, W.; Janke, M. (IB CE);<br />
ML (Kooperation mit dem Bieneninstitut<br />
Kirchhain/Hessen)<br />
Niedersächsisches Ministerium für den<br />
ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Niedersächsisches Ministerium für den<br />
ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz;<br />
Klinik für kleine Klauentiere, Stiftung<br />
Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Schafs- und Ziegengesundheitsdienst;<br />
Zentrales Institut des Sanitätsdienstes<br />
der Bundeswehr Kiel (Bw)<br />
Niedersächsisches Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit; Institut für<br />
Wildtierforschung, Stiftung TiHo H<br />
349<br />
Boecking, O.; van Praagh, J.P. (IB CE);<br />
Büchler, R. (BI Kirchhain)<br />
Runge, M. (VI H); Steinhagen, D.<br />
(Abteilung Fischkrankheiten, TiHo<br />
Hannover)<br />
Runge, M.; v. Keyserlingk, M. (VI H);<br />
Ganter, M. (Klinik für kleine Klauentiere,<br />
TiHo Hannover); Binder, A. (Bw)<br />
v. Keyserlingk, M. (VI H); Pohlmeyer,<br />
C. (Institut für Wildtierforschung, TiHo<br />
Hannover)
Campylobacter-Monitoring bei<br />
Masthähnchen<br />
Bundesministerium für<br />
Verbraucherschutz, Ernährung und<br />
Landwirtschaft<br />
Salmonellen-Prävalenzstudie in Puten Bundesministerium für<br />
Verbraucherschutz, Ernährung und<br />
Landwirtschaft<br />
Wirksamkeit der Putenkompostierung<br />
unter Seuchenbedingungen in<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Untersuchungen zur Verbreitung von<br />
Francisella tularensis und Brucellen in<br />
niedersächsischen Hasenpopulationen<br />
Niedersächsisches Ministerium für den<br />
ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
350<br />
Braune, S. (VI H); Schleuter, G.;<br />
Hohmann, M. (VI OL); Ellerbroek (BfR)<br />
Braune, S. (VI H); Klarmann, D. (VI OL);<br />
Helmuth, R.; Käsbohrer, A. (BfR)<br />
Schwarzlose, I.; Jeske, C.; Gerdes, U.<br />
(TF); Gerlach, G-F. (Institut für<br />
Mikrobiologie, TiHo Hannover);.<br />
Neumann (Klinik für Geflügel, TiHo<br />
Hannover); Runge, M. (VI H);<br />
Thalmann, G. (VI OL); Behr, K.-P.<br />
(Heidemark Mästerkreis GmbH);<br />
Hartung, J. (Inst. F. Tierhygiene,<br />
Tierschutz und Nutztierethologie, TiHo<br />
Hannover)<br />
Niedersächsische Landesjägerschaft von Keyserlingk, M. (VI H); Pohlmeyer,<br />
K. (Institut für Wildtierforschung, TiHo<br />
Hannover); Neubauer, H. (Institut für<br />
bakterielle Infektionen und Zoonosen,<br />
Friederich-Loeffler-Institut, Jena)
351<br />
Index für Kapitel 3<br />
A<br />
Amphibien 92 f<br />
Analytik 42, 55<br />
Lebensmittelanalytik 42<br />
Stabilisotopenanalytik 55<br />
Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügelhygiene 51, 57<br />
und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln<br />
tierischer Herkunft (AFFL)<br />
Aviäre Influenza (siehe Geflügelpest)<br />
B<br />
Babynahrung (siehe Säuglingsanfangsnahrung)<br />
Backwaren 61<br />
Bedarfsgegenstände 42 ff, 62, 72, 74<br />
Beschwerdeproben 75 f<br />
Betriebliche Eigenkontrolle 101<br />
Biogasanlagen 104<br />
Biosiegel 58<br />
Blauzungenkrankheit 88 f<br />
BSE 43<br />
C<br />
Cross Compliance 80 f<br />
Cumarin 61<br />
D<br />
Diagnostik 89<br />
Digestionsmethode 51<br />
Dioxin 43, 77<br />
E<br />
EQUINO 103<br />
EU-Lebensmittel- und -hygienerecht 99<br />
EU-Tiertransportverordnung 94<br />
F<br />
Fischkompetenzzentrum Nord (FKN) 51, 56 f<br />
Formaldehyd 43, 62<br />
Futtermittel 42 f, 58, 63, 69 ff, 77 ff, 99<br />
Futtermittelkontrollen 80<br />
Futtermittelüberwachung 63, 77, 80
G<br />
Gammelfleisch 43, 53 f<br />
Geflügelpest 43, 83 ff<br />
Geflügel-Aufstallungsverordnung 84<br />
Genreis 43, 70 f<br />
Glühwein 61<br />
H<br />
Haarfärbemittel 72 f<br />
Hackfleischverordnung 100<br />
Holzspielzeug 43, 62<br />
Hundefutter 53<br />
Hygiene 43, 48 f, 52, 68, 76, 87, 102<br />
Betriebshygiene 48<br />
Futtermittelhygiene 81<br />
Lebensmittelhygiene 66, 99<br />
Trinkwasserhygiene 102<br />
I<br />
Index<br />
ISO 9001 103<br />
J<br />
Jakobskreuzkraut 90 f<br />
K<br />
Keime 74<br />
Kennzeichnung 43, 53, 56 ff, 73, 76<br />
Kommunale Lebensmittel- 53, 61, 66 f, 76 f<br />
überwachungsbehörde<br />
Index<br />
352
353<br />
L<br />
Lachsersatz 56 f<br />
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 43, 80<br />
Legehennen 43 ff, 48, 95<br />
M<br />
Mehrfachrückstände 64 f<br />
Mineralstoffe 60<br />
Mobiles Bekämpfungszentrum (MBZ) 82 f<br />
Monitoringprogramme 42, 44 f, 47 f, 63 f, 85<br />
Blauzungenkrankheit 89<br />
Einzelfruchtanalyse von Paprika 65<br />
Geflügelpest 84<br />
Lebensmittel 63<br />
Legehennen 46<br />
Salmonellen 44, 45, 47, 48<br />
Schweinepest 87<br />
Mykotoxine 63 f<br />
N<br />
Nematodenlarven 50 f<br />
O<br />
Öko-Kontrollstellen 58<br />
Ökologische Produkte 58<br />
Ökosiegel 58<br />
P<br />
Paprika 64 f<br />
Pestizide 42, 43, 64, 81<br />
Rückstände 42 f, 63 ff<br />
Q<br />
Qualitätsmanagement 103<br />
R<br />
Rattenbekämpfung, -problematik 67 f<br />
Reptilien 92 f<br />
Rückverfolgbarkeit 80 f
S<br />
Salmonellen 43 f, 46 ff, 52<br />
Salmonellen-Infektion vorbeugen 46 f, 49<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung 59, 60<br />
Säuglingsanfangsnahrung 43, 60<br />
Schädlinge 64, 66, 69<br />
Befall 66<br />
Bekämpfung 66 ff, 89, 102<br />
Schimmelpilzgifte (siehe Mykotoxine)<br />
Schlachtnebenprodukte, getrocknete 52<br />
Schnellwarnsystem 63<br />
Schweinepest, Klassische (KSP) 86 f<br />
Schwermetalle 43, 74, 78<br />
Schwermetallbelastung 78<br />
Seelachserzeugnisse 57<br />
Spurenelemente 60, 81<br />
T<br />
Tätowiermittel 74<br />
Telefon-Hotline 84<br />
Tierschutz 43, 67, 82, 92 ff, 96, 98, 107<br />
Tierschutzleitlinien 95<br />
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 95<br />
Tierseuchen 43, 82 ff, 90, 97, 103<br />
Tierseuchenbekämpfung 82, 88 f<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch 85<br />
<strong>Niedersachsen</strong>/Nordrhein-Westfalen<br />
(TSBH)<br />
V<br />
Index<br />
Vanillin 54 ff<br />
Verbraucherbeschwerden 75 f<br />
Verbrauchertäuschung 53 f<br />
Vitamine 60<br />
W<br />
Walstrandungen 106 f<br />
Wildlachs 50 f<br />
Z<br />
Zertifizierung 103<br />
Zierfischhaltung 96 ff<br />
Zimt 61<br />
Zulassung 53, 70 f, 73, 94, 100, 102, 104<br />
Zulassungspflicht 100<br />
Index<br />
354
355<br />
Fotoverzeichnis<br />
Titel<br />
Vorwort<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
1. Mehr Sicherheit für den Verbraucher<br />
2. Amtliche Kontrollen in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Groß: Objektivrevolver eines Mikroskops<br />
Orangen<br />
Kühe<br />
Frau hält Apfel<br />
Fisch<br />
Teddy<br />
Fleisch auf Grill<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Äpfel<br />
Tomaten<br />
Objektivrevolver eines Mikroskops<br />
LAVES-Zentrale, 2-mal<br />
Zeitungen<br />
Präsidium, Stabsstelle QM und die ersten<br />
QM-Assistenten<br />
Tastatur<br />
Bürotätigkeit<br />
Kugelschreiber<br />
Aktenordner<br />
Schinken<br />
Käseproduktion<br />
Laborinstrumente<br />
Petrischalen<br />
Kamele<br />
Küken<br />
Mais<br />
Getreideähren<br />
Kühe<br />
Landwirtschaftliches Fahrzeug auf dem Acker<br />
Gans<br />
Mitarbeiterinnen des Lebensmittelinstitutes<br />
Braunschweig<br />
Brötchen<br />
Konfitürengläser<br />
Reagenzgläser<br />
Lauchzwiebeln und Radieschen<br />
Fisch<br />
Mitarbeiter im Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
Muschelzucht<br />
Mitarbeiterin des Veterinärinstitutes Hannover<br />
Hände und Petrischalen<br />
Mitarbeiterin des Veterinärinstitutes Oldenburg<br />
Hahn<br />
Nährmediengießanlage<br />
Biene<br />
Teddybär<br />
Labormaterial<br />
Reagenzgläser<br />
Maiskolben<br />
Schweine<br />
Labormaterial<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES<br />
MW • Grafik-Design<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
LAVES<br />
MW • Grafik-Design<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung/-kontrolldienst<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung/-kontrolldienst<br />
LAVES – Veterinärinstitut Hannover<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Futtermittelüberwachung<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
LAVES – Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
photocase<br />
LAVES – Veterinärinstitut Hannover<br />
LAVES – Veterinärinstitut Hannover<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
photocase<br />
LAVES – Futtermittelinstitut Stade<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Veterinärinstitut Hannover<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong> des LAVES 2006<br />
Spritze<br />
Orangen<br />
Salat mit gebratenen Geflügelstreifen<br />
Johannisbeeren<br />
Frau hält Apfel<br />
Laborgerät<br />
Supermarkt<br />
Legehennen (weiß)<br />
Broiler<br />
Legehennen (braun)<br />
Probenröhrchen<br />
Freilaufende Hühner<br />
Petrischalen<br />
Fleisch auf dem Grill<br />
Eier<br />
Wildlachsfilet<br />
Fischuntersuchung<br />
Fischeier mit Nematodenlarven<br />
Schuppenkleid des Lachses<br />
Schweineohren<br />
Hund mit Kauartikel<br />
Fleisch<br />
Vanilleschote<br />
Vanilleeis<br />
Rote Grütze mit Vanillesauce<br />
Seelachs<br />
Salz<br />
Lachsstückchen auf Reis<br />
Kaffeebohnen<br />
Säuglings- und Kleinkindernahrung<br />
Baby<br />
Zimtsterne<br />
Zimtstangen<br />
Spielfiguren aus Holz<br />
Mehl und Messbecher<br />
Paprika<br />
Kartonagenpresse<br />
Ratte in Falle<br />
Ratte<br />
Rattengift<br />
Rattennest<br />
Erbsen<br />
Weizenkörner<br />
Reisfeld<br />
Reis in Schale<br />
Reagenzgläser<br />
Haarfärbeutensilien<br />
Rote Haare<br />
Haarfarbstofftube<br />
Blonde Haarsträhne<br />
Hand mit Sterntätowierung<br />
Zitrone im Netz<br />
Joghurtbecher<br />
Fotoverzeichnis<br />
Fotoverzeichnis<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
LAVES – Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
LAVES – Institut für Fischkunde Cuxhaven<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
MW • Grafik-Design<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen/Schädlingsbekämpfung<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen/Schädlingsbekämpfung<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
356
357<br />
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
<strong>3.</strong> <strong>Schwerpunkte</strong> des LAVES 2006<br />
Index für Kapitel 3<br />
Fotoverzeichnis<br />
Verpackte Tomaten<br />
Kühltheke<br />
Elbe<br />
Kuh<br />
Containerschiff<br />
Gestapelte Reagenzgläser<br />
Rapsfeld<br />
Maisfeld<br />
Ferkelnest mit Ferkelmatte<br />
Silageballen<br />
Aufbau MBZ<br />
Ente<br />
Schnurloses Telefon<br />
Mobile Bekämpfungsanlage<br />
Braunes Huhn<br />
Wildschwein<br />
Ferkel<br />
Schweine im offenen Stall<br />
Erkrankung an Blauzungenkrankheit<br />
Gnitze<br />
Verendeter Norwegerwallach<br />
Jakobskreuzkraut<br />
Mikronoduläre Leberzirrhose<br />
Leberzirrhose, histologisches Präparat<br />
Grasendes Pferd<br />
Krokodil<br />
Hornviper<br />
Schaftransport<br />
Hühner<br />
Diskokugeln<br />
Schallmessung in einer Diskothek<br />
Fisch im Aquarium<br />
Lautstärkeregler<br />
Bunter Fisch<br />
EU-Flagge<br />
Gemüsekisten<br />
Schweinehälften<br />
Eiverarbeitung<br />
Silo<br />
Frau vor dem Kühlregal<br />
Wasser<br />
Liegender Aktenordner<br />
QM-Audit im LAVES<br />
Akten<br />
Füller<br />
Küchenabfälle<br />
Walkopf<br />
Meer<br />
Wale<br />
Wattenmeer<br />
Walflosse<br />
Möwe<br />
Buchstabennudeln<br />
Register<br />
Kamera<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
photocase<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
LAVES – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
MW • Grafik-Design<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
Dr. Wilfried Adams/Landwirtschaftskammer NRW<br />
photocase<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
Dr. Marianne Krug/Landwirtschaftskammer NRW<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Tierschutzdienst (aus: Staatliches<br />
Naturhistorisches Museum Braunschweig)<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
photocase<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen/Fischseuchenbekämfung<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
LAVES – Qualitätsmanagement<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
photocase<br />
MW • Grafik-Design<br />
MW • Grafik-Design