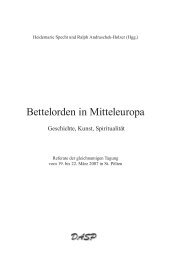21 MeHr alS BlOSS eXOrzISMUS - Carlos Watzka
21 MeHr alS BlOSS eXOrzISMUS - Carlos Watzka
21 MeHr alS BlOSS eXOrzISMUS - Carlos Watzka
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
legen können – ausgesprochen eng<br />
verwoben sein.<br />
88 Vgl. Christa PETERS, Hospitäler der<br />
Barmherzigen Brüder des Johannes<br />
von Gott und der Elisabethinerinnen<br />
zwischen Rhein und Weichsel<br />
(1600–1900) (Medizinische Dissertation,<br />
Köln 1994) bes. 91–93, sowie:<br />
Richard BAMBERGER et al. (Hg.),<br />
Österreich Lexikon (Wien 1995) I<br />
288.<br />
89 Krankenprotokollbuch der Elisabethinen<br />
in Graz (1694–1730): Steiermärkisches<br />
Landesarchiv, Archiv<br />
Graz, Sch. 154, H. 451a. (im Folgenden<br />
als „Krankenprotokollbuch der<br />
Elisabethinen“) Die Zuordnung der<br />
Archivalie zu diesem Hospital kann<br />
nunmehr als ausreichend gesichert<br />
gelten. Vgl. hierzu: <strong>Carlos</strong> WATZKA,<br />
Vom Armenhaus zur Landesnervenklinik<br />
Sigmund Freud. Zur Geschichte<br />
psychisch Kranker und des gesellschaftlichen<br />
Umgangs mit ihnen in<br />
der steirischen Landeshauptstadt vom<br />
16. bis zum <strong>21</strong>. Jahrhundert. In: Historisches<br />
Jahrbuch der Stadt Graz 36<br />
(2006) 331 (Anm. 43).<br />
90 Für diesen Zeitraum wurden die Protokolle<br />
vom Verfasser bisher ausgewertet.<br />
91 Krankenprotokollbuch der Elisabethinen,<br />
Aufnahmenummern 141,<br />
200. 255, 494, 548, 574.<br />
92 Die Berechnung erfolgte anhand der<br />
jeweils angegebenen Aufnahme- und<br />
Entlassungsdaten.<br />
93 Vgl. WATZKA, Arme, Kranke, Verrückte,<br />
sowie: WATZKA, Krankenhaus.<br />
94 Vgl. zu den Orten der Niederlassungen<br />
bes. Hermenegild STROHMAy-<br />
ER (OH), Der Hospitalorden des<br />
Hl. Johannes von Gott. Barmherzige<br />
Brüder (Regensburg 1978) 144–154<br />
und Bernhard Zahrl, 400 Jahre Barmherzige<br />
Brüder in Mitteleuropa (Wien<br />
2005) 30f. Die Bettenzahlen in der<br />
Zeit um 1790 stammen aus einer Zusammenstellung<br />
im Archiv der Lombardo-Venezianischen<br />
Ordensprovinz<br />
der Barmherzigen Brüder in Monguzzo/Como:<br />
Karton 15: Consignatio.<br />
36<br />
Linz (1745), Teschen (1753) und Budapest (1785), 88 deren für die Sozialgeschichte<br />
der Medizin relevante Quellenbestände allerdings bislang<br />
großteils unaufgearbeitet geblieben sind. Ein im Steiermärkischen<br />
Landesarchiv erhaltenes Krankenprotokollbuch der Grazer Niederlassung<br />
89 für den Zeitraum von 1694 bis 1730 belegt aber schon für das<br />
beginnende 18. Jahrhundert eindeutig sowohl die Aufnahme als auch<br />
die therapeutische Behandlung nicht nur von körperlich kranken Frauen,<br />
sondern auch von solchen mit psychischen Problemen. Allerdings<br />
stellten dieselben nur einen sehr kleinen Anteil an der Gesamtzahl der<br />
Patientinnen: Unter den 1336 stationär behandelten Personen der Jahre<br />
1694 bis 1709 90 litten 6 (0,5 %) eindeutig an psychischen Störungen,<br />
und zwar an „Melancoley“ (3), an „verruckten Haubt“ bzw. Kopf (2)<br />
oder an „Narheit“ (1). 91 Deutlich zahlreicher sind demgegenüber Behandlungsfälle,<br />
in welchen psychische Auffälligkeit als ein (Teil-)Motiv<br />
der Anstaltsaufnahme plausibel erscheint, jedoch wegen der Polyvalenz<br />
der im Protokoll gebrauchten Zustandsbeschreibungen nicht definitiv<br />
nachgewiesen werden kann. Insbesondere imponieren in diesem Zusammenhang<br />
die relativ häufigen Fälle von „Bleichsucht“ (65 Patientinnen,<br />
ca. 5 %); auch „Muetter Zuestandt“ bzw. „Muetter Krankheit“<br />
(10), „Muetter Frayß“ (2), „Frayß“ (4) sind aber diesbezüglich<br />
„verdächtig“. Hier könnten aber, dies muss betont werden, ebenso gut<br />
rein „somatische“ Beschwerdebilder vorgelegen haben. Die sechs im<br />
genannten Zeitraum aufgenommenen Frauen, die definitiv an psychischen<br />
Erkrankungen gelitten hatten, wurden jedenfalls sämtlich nach<br />
einiger Zeit (im Durchschnitt nach 41 Tagen) wieder als „gesundt“<br />
entlassen; der kürzeste Aufenthalt dauerte nur 2 Tage (!), der längste<br />
etwas mehr als 4 Monate. 92<br />
Weit detailliertere Informationen über den Krankenhausbetrieb insgesamt<br />
und den Stellenwert der Behandlung psychisch Kranker innerhalb<br />
desselben liegen aber für den Orden der Barmherzigen Brüder vor: 93<br />
Diese geistliche Gemeinschaft, die – wie auch die Elisabethinen – von<br />
den „Klosteraufhebungen“ des Josephinismus wegen ihrer „Gemeinnützigkeit“<br />
nicht betroffen war und bis heute in Österreich präsent<br />
ist, siedelte sich erstmals 1605 auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie<br />
an, und zwar im Städtchen Feldsberg im niederösterreichischmährischen<br />
Grenzgebiet; bis 1780 waren in diesem Raum (das ab 1772<br />
österreichische Galizien nicht mit eingerechnet), neben einigen kurzlebigeren<br />
Einrichtungen insgesamt 20 Krankenanstalten des „Hospitalordens<br />
des Heiligen Johannes von Gott“ in Betrieb. Darunter befanden<br />
sich, als die größenordnungsmäßig bedeutenderen (neben jener<br />
in Feldsberg) die Niederlassungen in Wien (ab 1614), Graz (1615),<br />
Prag (1620), Görz (1656), Preßburg (1672), Kukus in Böhmen (1743),<br />
Brünn (1747) und Linz (1757), die am Ende des 18. Jahrhunderts jeweils<br />
über 40 bis 55 Krankenbetten verfügten, im Falle von Prag und<br />
Wien aber über jeweils mehr als 100. 94<br />
Es ist anzunehmen, dass in mehr oder weniger allen „Hospitälern“ der<br />
Barmherzigen Brüder im 17. und 18. Jahrhundert auch Personen mit