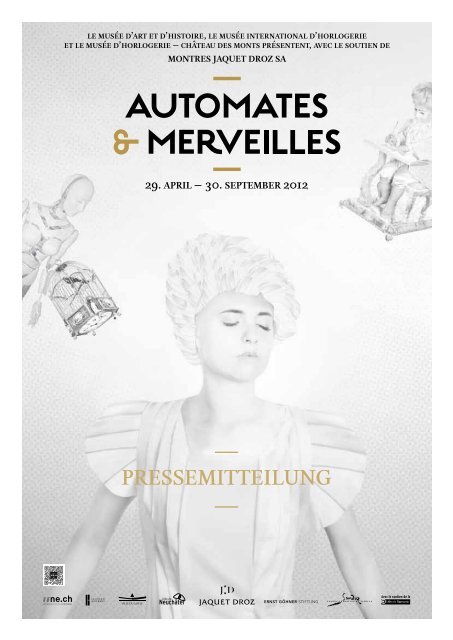Pressekonferenz zur Ausstellung „Automates & Merveilles“
Pressekonferenz zur Ausstellung „Automates & Merveilles“
Pressekonferenz zur Ausstellung „Automates & Merveilles“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
29. april – 30. september 2012<br />
Pressemitteilung<br />
1
InhaltsverzeIchnIs<br />
–<br />
neuchâtel<br />
les Jaquet-Droz et leschot<br />
seiten 5–15<br />
la chaux-De-FonDs<br />
merveilleux mouvements… surprenantes mécaniques<br />
seiten 17–27<br />
le locle<br />
chefs-d’œuvre de luxe et de miniaturisation<br />
seiten 29–36<br />
www. automatesetmerveilles.ch<br />
3
Automate l’Ecrivain<br />
(détail)<br />
Pierre Jaquet-Droz.<br />
1768-1772<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel, inv. AA 2<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
les Jaquet-Droz et leschot<br />
–<br />
Ausgewählte texte der <strong>Ausstellung</strong> :<br />
–<br />
Im 18. Jahrhundert zählen Pierre Jaquet-Droz, sein Sohn Henri-Louis und ihr Mitarbeiter<br />
Jean-Frédéric Leschot zu den wichtigsten Vertretern der Uhrmacherei in der<br />
Schweiz und in Europa. Neben Pendel- und Luxusuhren zeugen zahlreiche ihrer Kreationen,<br />
wie z. B. Uhren mit Flötenspiel, Wanduhren, Tabakdosen und Käfige mit singenden<br />
Vögeln, von einer ebenso erfindungsreichen wie künstlerischen Arbeit.<br />
Es sind drei geschickte Techniker, die sich von einem visionären, schöpferischen<br />
Geist leiten lassen, als sie im Bereich der Automaten zu arbeiten beginnen. Im Jahr<br />
1774 setzen sich ihre Meisterwerke, ihre drei androiden Automaten, zum ersten Mal<br />
in Bewegung : der Schriftsteller, der Zeichner und die Musikerin, begleitet von der<br />
Grotte. Erst rufen sie beim Publikum in La Chaux-de-Fonds Begeisterungsstürme<br />
hervor, dann klatscht ganz Europa Beifall.<br />
Diese Werke erinnern nicht nur an den forschenden Geist der Aufklärung, sie zeugen<br />
auch von reichen und aussergewöhnlichen Lebensläufen. Wie konnten diese drei<br />
Uhrmacher einen so hohen Grad an technischer Perfektion erreichen ? Auf welchen<br />
Wegen gelangten ihre Werke in die ganze Welt ? Oder ganz allgemein : Was sind<br />
die Herausforderungen an die mechanische Reproduktion eines möglichst realistischen<br />
Bewegungsablaufs ? Ist diese Suche nach der Bewegung nicht bereits eine<br />
Vorwegnahme der künftigen Robotik und der wissenschaftlichen Laborversuche des<br />
21. Jahrhunderts ?<br />
5<br />
Automate l’Ecrivain<br />
Pierre Jaquet-Droz.<br />
1768-1772<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel, inv. AA 2<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
Texte de l’Ecrivain<br />
“ Les Jaquet-Droz et<br />
Leschot à Neuchâtel ”<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel
Pierre Jaquet-Droz<br />
Emanuel Witz. 1758<br />
Huile sur toile<br />
Collection privée<br />
© Collection privée<br />
Au centre :<br />
Henri-Louis Jaquet-Droz<br />
Non signé. Vers 1780<br />
Huile sur toile<br />
Collection privée<br />
© Collection privée<br />
rAum 1<br />
die JAquet-droz und leschot :<br />
drei männer der Aufklärung<br />
Der in La Chaux-de-Fonds geborene Pierre Jaquet-Droz (1721–1790) gilt als talentierter<br />
Mechaniker und genialer Uhrmacher. Nach einem Studium an der philosophischen Fakultät<br />
in Basel macht er eine Lehre als Pendulier im Neuenburger Jura, wo dieser Zweig der<br />
Uhrmacherei sich seit dem 17. Jahrhundert entwickelt hat. Schon 1749 fällt Jaquet-Droz<br />
durch eine bemerkenswerte Produktion auf, die Mitbürger sowie hochangesehene Persönlichkeiten<br />
in sein „ Sur le Pont ” genanntes Haus locken, später in die „ Ferme du Jet d’Eau ”.<br />
1750 heiratet er Marie-Anne Sandoz, mit der er drei Kinder hat, von denen zwei das Erwachsenenalter<br />
erreichen werden : Julie und Henri-Louis. Ab 1755 verwitwet, widmet er<br />
sich ganz seinen Uhren und dem Verkauf.<br />
Sein Sohn henri-louis Jaquet-Droz (1752–1791) beteiligt sich an der schöpferischen Arbeit<br />
des Vaters und trägt wesentlich <strong>zur</strong> Ausstrahlung des Unternehmens bei. Mit 15 Jahren<br />
erhält er eine humanistische Ausbildung beim Mathematiker und Physiker Abbé de Servan<br />
in Nancy. Er studiert dort auch Musik und Zeichnen, einige von seinen eigenen Automaten<br />
gespielte Musikstücke werden ihm zugeschrieben. Ab 1774 reist er quer durch Europa, um<br />
eine Gruppe von Androiden vorzuführen, die er zusammen mit seinem Vater und Leschot<br />
entworfen hat. Das erlaubt ihm, geschäftliche Verbindungen zu den grossen Metropolen<br />
zu knüpfen. Im Lauf seiner zahlreichen Reisen kommt er mit der gesellschaftlichen Elite<br />
von London, Paris und Genf zusammen. Mode und Geschmack einer raffinierten Kundschaft<br />
sind ihm vertraut. Es ist auch bekannt, dass er sich in der Genfer „ Société des Arts ”<br />
engagierte.<br />
Jean-Frédéric leschot (1746–1824), Lehrling von Pierre Jaquet-Droz, fällt schon früh durch<br />
sein technisches Geschick auf. Er stammt aus einer Bürgerfamilie von Valangin und führt<br />
seine ersten Arbeiten als Uhrmacher an der Seite des sechs Jahre jüngeren Henri-Louis aus.<br />
Die beiden in tiefer Freundschaft verbundenen Männer werden zu engen Mitarbeitern des<br />
Vaters. Wie Henri-Louis wird auch Leschot Ehrenbürger von Genf und in die „ Société des<br />
Arts ” aufgenommen. Dank diesem hochqualifizierten Konstrukteur können mehrere Werke<br />
der Firma verwirklicht werden. Nach dem Tod der Jaquet-Droz übernimmt Leschot die<br />
Leitung des Unternehmens bis zu dessen endgültiger Schliessung kurz nach 1810.<br />
6<br />
Jean-Frédéric Leschot<br />
Non signé. Début 19 e<br />
siècle<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel, inv. AA 4882<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel
Pendule à la française<br />
(neuchâteloise)<br />
Signée “ P. Jaquet Droz<br />
a La Chaux de Fonds en<br />
Suisse ”. Vers 1760-1775<br />
Bois, écaille de tortue,<br />
bronze doré.<br />
Musée d'horlogerie du<br />
Locle – Château des<br />
Monts, inv. MHL 1<br />
© Musée d'horlogerie du Locle –<br />
Château des Monts.<br />
Photo R. Sterchi<br />
Pendule à jeu d’orgue et<br />
cabinet en écaille<br />
Signée “ Pierre Jaquet Droz<br />
à la Chaux-de-Fonds ”.<br />
1750-1790.<br />
Bois, écaille de tortue,<br />
bronze, émail<br />
Musée international<br />
d’horlogerie,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
inv. IV-390<br />
© Musée international<br />
d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
Au centre : Montre à carillon<br />
Signée “ Jaquet Droz London ”.<br />
Londres, vers 1780<br />
Perles, émail<br />
Uhrenmuseum Beyer, Zurich, inv. 4374.68<br />
(…)<br />
eine vielfältige Produktion :<br />
von der Pendeluhr <strong>zur</strong> luxusuhr<br />
© Uhrenmuseum Beyer, Zurich<br />
Ci-dessus : Montre à oiseau chanteur, dite “ Evening ”<br />
Attribuée aux Jaquet-Droz. Londres (?), vers 1785<br />
Email, rubis, perles<br />
Collection Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds, inv. J2<br />
© Collection Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds<br />
rAum 2<br />
Auf der suche nAch der Bewegung :<br />
die AutomAten im lAuf der zeit<br />
7<br />
Vue de la première<br />
salle de l’exposition<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel. Photo Stefano Iori<br />
Pendule de parquet,<br />
dite “ longue-ligne ”<br />
Signée “ P. Jaquet Droz<br />
a La Chaux de Fonds ”.<br />
Vers 1785-1790<br />
Poirier teint en noir<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Genève, inv. AD 2823<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Genève.<br />
Photo Maurice Aeschimann
Journal d’Abraham-<br />
Louis Sandoz, contenant<br />
la relation du voyage<br />
en Espagne entreprise<br />
avec son beau-fils Pierre<br />
Jaquet-Droz (1758-1759)<br />
1737-1759<br />
Bibliothèque de la Ville,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
Fonds Neuchâtelois,<br />
D.1853<br />
© Bibliothèque de la Ville,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
Vue de la salle 2 :<br />
le mécanisme de l’Ecrivain<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel. Photo Stefano Iori<br />
Texte de l’Ecrivain<br />
“ Automates et Merveilles ”<br />
2012<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
© Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel<br />
(…)<br />
Pierre JAquet-droz :<br />
eine ungewöhnliche technische meisterschAft<br />
die reise nAch sPAnien :<br />
Pierre JAquet-droz Am hof ferdinAnds vi<br />
8<br />
Am 4. April unternimmt Pierre Jaquet-Droz<br />
in Begleitung seines Schwiegervaters, Abraham<br />
Louis Sandoz, und eines jungen Arbeiters,<br />
Jacques Gevril, eine ausgedehnte Reise,<br />
die ihn von La Chaux-de-Fonds bis an den<br />
Hof des Königs von Spanien führt. Mit einem<br />
Empfehlungsschreiben von Lord George<br />
Keith, dem Gouverneur des Fürstentums<br />
Neuenburg, in der Tasche will der Uhrmacher<br />
seine Kreationen Ferdinand VI. vorstellen<br />
(…)<br />
die schriftsteller-AutomAten im 18. JAhrhundert<br />
Die Schriftsteller stellen einen Automatentyp dar, der in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts<br />
grossen Auftrieb erhält (…)<br />
Die ausserordentliche Eigentümlichkeit von Jaquet-Droz’ Schriftsteller, welcher im November<br />
1774 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgeführt wird, liegt darin, dass der ganze Mechanismus<br />
im Körper selbst des Automaten eingebaut ist. Die Schreibvorrichtung besteht aus<br />
übereinander liegenden Kurvenscheiben, drei pro Buchstabe, und einem Programmierungssystem,<br />
das es erlaubt, einen beliebigen Text mit 40 Zeichen auf 4 Linien zu schreiben (…)<br />
Détail du mécanisme<br />
de l’Ecrivain<br />
Pierre Jaquet-Droz.<br />
1768-1772<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel, inv. AA 2<br />
© Claude Bornand, Lausanne
Aum 3<br />
die AutomAten Auf reisen :<br />
verkAufsstrAtegie der JAquet-droz<br />
Ab Ende 1774 machen sich Henri-Louis Jaquet-Droz und Jean-Frédéric Leschot auf eine<br />
Tournee quer durch Europa auf, um ihre vier Automaten zu präsentieren. Erst gehen sie<br />
nach Paris, wo sie am Hof Ludwigs XVI. empfangen werden. Darauf folgt ein Aufenthalt in<br />
London, dann in anderen europäischen Städten in Holland, Flandern und Nordfrankreich.<br />
Elf Jahre später, nach Stationen in Paris, Lyon und Genf kehren die Automaten für eine<br />
letzte Vorführung unter Anwesenheit von Henri-Louis wieder nach La Chaux-de-Fonds<br />
<strong>zur</strong>ück.<br />
Mit Ausnahme des Hofs von Versailles finden die Vorführungen in der Regel in speziell<br />
hergerichteten Salons statt. Sie sind kostenpflichtig, man unterscheidet zwei Kategorien<br />
von Plätzen. So kostet für die Vorstellungen 1775 im Hôtel Lubert in Paris ein guter Platz<br />
6 Pfund, ein Platz der zweiten Kategorie 3 Pfund. Hausangestellte haben keinen Zutritt.<br />
Über die eigentliche Vorstellung hinaus ist es das Ziel dieser Demonstrationen, die Uhren<br />
der Jaquet-Droz zu propagieren und den Verkauf zu fördern. Die vier Automaten werden so<br />
zu einem wichtigen Mittel der Werbung im Dienst einer globalen Verkaufsstrategie.<br />
nAch den JAquet-droz :<br />
der PArcours der AutomAten<br />
Nach einer Tournee von über zehn Jahren verkaufen die Jaquet-Droz in Jahre 1788 ihre vier<br />
Automaten an die Gebrüder Gendre, französische Händler, die sich in Madrid niedergelassen<br />
haben. Diese nehmen sie für Demonstrationen mit nach Spanien, dann verliert sich<br />
die Spur der Automaten (…)<br />
Ende des 19. Jahrhunderts setzen sich angesehene Persönlichkeiten des Kantons Neuenburg<br />
für die Rückkehr der Automaten in ihre Heimatregion ein. Das Interesse für die drei<br />
Androiden geht mit einer Neubewertung des Werks der Jaquet-Droz und Leschots einher,<br />
in der Lokalgeschichte wird die Uhrmacherei des Jurabogens als identitätsstiftend gefeiert.<br />
Dank dem Einsatz der Gesellschaft für Geschichte und Archäologie des Kantons Neuenburg,<br />
der finanziellen Unterstützung durch die Eidgenossenschaft und grosszügigen<br />
Spendern werden die Automaten von einem Berliner Sammler <strong>zur</strong>ückgekauft. Nach einer<br />
triumphalen vierjährigen Tournee durch die Schweiz finden sie als Schenkung ihren Platz<br />
im Kunstmuseum Neuenburg.<br />
(…)<br />
die grotte :<br />
der verschollene AutomAt<br />
rAum 4<br />
von london nAch chinA :<br />
ein weltweites, Professionelles netz<br />
Die Demonstrationen seiner Automaten führen Henri-Louis Jaquet-Droz nach London.<br />
So kommt er in dieser Stadt, damals weltweit eines der wichtigsten Zentren der Uhrmacherei,<br />
mit berühmten Uhrmachern und Handwerkern in Kontakt. Er richtet dort seine<br />
eigene Werkstatt ein (…)<br />
9
Horloge de vestibule<br />
(détail). Attribuée<br />
aux Jaquet-Droz.<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
Genève ou Bienne,<br />
1765-1790<br />
Bronze, émail, verre<br />
Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
inv. J31<br />
© Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
Montre en forme de flacon<br />
avec carillon. Attribuée<br />
aux Jaquet-Droz.<br />
Genève ( ?), vers 1790<br />
Email. Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
inv. J6<br />
© Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
Montre à carillon à 3 airs<br />
Mouvement attribué<br />
aux Jaquet-Droz ; émail<br />
attribué à Jean Abraham<br />
Lissignol (1749–1819).<br />
Genève ( ?), vers 1790<br />
Perles, rubis, émail<br />
Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
inv. J3<br />
© Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
Ci-dessus : Montre à carillon. Signée “ Jaquet Droz London ”.<br />
Londres ou Genève, vers 1780. Email<br />
Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, inv. I-101<br />
© Collection Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds<br />
JAquet-droz in genf :<br />
immer mehr luxus<br />
1783 verlässt Henri-Louis Jaquet-Droz London für immer<br />
und lässt sich mit seinem Partner Jean-Frédéric Leschot in<br />
Genf nieder (…)<br />
10<br />
Vue de la salle 4 :<br />
Jaquet-Droz à Genève :<br />
un luxe accru<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel. Photo Stefano Iori<br />
Horloge de vestibule<br />
Attribuée aux Jaquet-Droz<br />
et à Henri Maillardet.<br />
La Chaux-de-Fonds ( ?),<br />
vers 1780<br />
Bronze doré, porcelaine de<br />
Meissen<br />
Uhrenmuseum Beyer, Zurich,<br />
inv. 1452.84
Montre en forme d’étoile<br />
dite “ L'abeille ”<br />
Attribuée aux<br />
Jaquet-Droz. Genève,<br />
entre 1790-1795<br />
Email translucide sur fond<br />
guilloché, perles<br />
Patek Philippe Museum,<br />
Genève, inv. S-452<br />
© Patek Philippe Museum,<br />
Genève<br />
(…)<br />
(…)<br />
(…)<br />
die signAturen :<br />
eine verkAufsstrAtegie<br />
rAum 6<br />
Begeisterung für die mechAnik :<br />
den körPer sezieren, um ihn zu erforschen<br />
eine mechAnische welt :<br />
der AutomAt zum verständnis<br />
Physiologischer Bewegungen<br />
11<br />
Vue du mécanisme<br />
d’une montre<br />
Signée “ Jaquet Droz,<br />
London ”.<br />
Londres ou Genève,<br />
vers 1785<br />
Rubis, perles, émail,<br />
ivoire sculpté<br />
Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
inv. J9<br />
© Collection<br />
Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
Vue de la salle 6 :<br />
un monde mécanique :<br />
l’automate pour<br />
comprendre<br />
les mouvements<br />
physiologiques<br />
Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel. Photo Stefano Iori
Robot Verre. 2008<br />
Groupe Mobots,<br />
Laboratoire de systèmes<br />
robotiques (LSRO),<br />
EPFL, Lausanne<br />
© Groupe Mobots,<br />
Laboratoire de systèmes<br />
robotiques (LSRO),<br />
EPFL, Lausanne.<br />
Photo Alain Herzog<br />
die orthoPädischen Prothesen :<br />
meisterwerke der mechAnik<br />
(…) Mit ihrer Kompetenz als Mechaniker und ihrer grossen Kenntnis der menschlichen<br />
Bewegungen, die sie bei der Realisierung androider Automaten bewiesen haben, können<br />
Henri-Louis Jaquet-Droz und Jean-Frédéric Leschot auf Sonderwünsche wie die Herstellung<br />
von beweglichen Prothesen eingehen (…)<br />
rAum 7<br />
im 21. JAhrhundert :<br />
suPer-AutomAten und roBoter<br />
Die Geschichte der Automaten zieht sich über das ganze 19. Jahrhundert hinweg. Sie verlassen<br />
Salons und Labors, um auf Jahrmärkten aufzutauchen. Im 20. Jahrhundert erscheint<br />
ein neuer Typ dieser Maschinen : der Roboter (…)<br />
roBoter für die forschung :<br />
in den lABors der ePfl<br />
Im 18. Jahrhundert wurden Automaten konzipiert, um natürliche Prozesse im Rahmen<br />
wissenschaftlicher Experimente besser zu verstehen, im 20. Jahrhundert helfen Roboter,<br />
die Wissenschaft weiterzuentwickeln (…)<br />
12<br />
die roBoter :<br />
menschenArtige formen<br />
oder sPeziAlisierte formen<br />
(…)<br />
Robot Poulbot utilisé<br />
pour des études<br />
sur les interactions<br />
animal-robot<br />
2010<br />
Groupe Mobots,<br />
Laboratoire de systèmes<br />
robotiques (LSRO), EPFL,<br />
Lausanne<br />
© Groupe Mobots,<br />
Laboratoire de systèmes<br />
robotiques (LSRO),<br />
EPFL, Lausanne.<br />
Photo José Halloy
Aum 8<br />
frAnçois Junod (*1959)<br />
Lebt und arbeitet in Sainte-Croix.<br />
Schon als Kind ist François Junod von der Kunst und der Mechanik fasziniert. Im Alter<br />
von fünf Jahren, an der Landessausstellung 1964, bleibt er verzaubert vor den Maschinen<br />
Tinguelys stehen. Später, nach einer Ausbildung als Feinmechaniker, macht er eine Lehre<br />
als Reparateur und Konstrukteur von Automaten. Diese ergänzt er mit einem Studium in<br />
den Fächern Zeichnen und Bildhauerei an der Ecole cantonale des Beaux-Arts in Lausanne<br />
(ECAL).<br />
Ende 1983 eröffnet er sein eigenes Atelier in Sainte-Croix. Dort baut er seine ersten Werke.<br />
Er ist phantasiebegabt und in der Neuinterpretation von traditionellen Themen für Automaten<br />
ebenso geschickt wie in der Entwicklung neuer Formen, zum Beispiel von bewegten<br />
Skulpturen, wie sie in diesem Saal gezeigt werden.<br />
Die drei androiden Automaten der Jaquet-Droz, die im Neuenburger Musée d’art et<br />
d‘histoire aufbewahrt werden, sind für François Junod eine Quelle der Inspiration und eine<br />
wichtige Motivation. Er studierte ihre Funktionsweise und konstruierte mehrere Neuinterpretationen<br />
des Zeichners und des Schriftstellers. Heute ist François Junod als Automatenbauer<br />
und Bildhauer weltweit bekannt.<br />
Wenn er auch, wie im Fall der Tänzerin oder der Parade der Automaten (Spanien), gelegentlich<br />
auf die Elektronik <strong>zur</strong>ückgreift, so realisiert er doch seine Stücke meistens mit<br />
Hilfe der Mechanik, die manchmal von kleinen elektrischen Motoren unterstützt wird.<br />
Unermüdlich erforscht er neue Techniken und bleibt dabei ein zeitgenössischer Künstler,<br />
der nicht zögert, moderne mechanische Systeme zu verwenden. In seinen Neuinterpretationen<br />
alter Automaten verwendet er Kugellager, ein Verfahren, das bereits im 18. Jahrhundert<br />
existiert, das man aber bei den Stücken der Jaquet-Droz nicht findet.<br />
Eines seiner letzten Werke ist der Android Alexandre Pouchkine, Zeichner und Dichter.<br />
Hier besteht die Meisterleistung in einem mechanischen System, das es erlaubt, nach dem<br />
Zufallsprinzip Wörter zu wählen, die ein Gedicht ergeben; insgesamt sind 1'458 Kombinationen<br />
möglich.<br />
13
musée d’Art et d’histoire, neuchâtel<br />
Automates & merveilles : Les Jaquet-Droz et Leschot<br />
Direction, conception et coordination<br />
Caroline Junier, conservatrice du dpt des<br />
arts appliqués<br />
Conception et commissariat de l’exposition<br />
Claude-Alain Künzi, assistant-conservateur<br />
du dpt des arts appliqués<br />
Collaborations scientifiques<br />
Julie Noël, Isaline Deléderray,<br />
Camille Collaud, Leda Minolli<br />
Recherches FNS, Université de Neuchâtel<br />
Sandrine Girardier, Heloisa Munoz,<br />
Rossella Baldi<br />
Conseils EPFL Francesco Mondada<br />
Automate l’Ecrivain de P. Jaquet-Droz,<br />
démonstrations<br />
Thierry Amstutz, Yves Piller<br />
Scénographie<br />
THEMATIS SA, Vevey, Michel Etter<br />
Cheffe de projet Johanne Blanchet Dufour<br />
Design Laura Brenni<br />
Graphisme Carl Laliberté<br />
Communication MAHN, MIH, MHL<br />
Polygone, La Chaux-de-Fonds, Alain<br />
Fornage, Fabienne Lini, Maric Laperrouza<br />
Administration et finances<br />
Renée Knecht<br />
Secrétariat et site internet (MAHN)<br />
Nadia Orlando Kandil,<br />
Nathalie Diso-vom-Endt<br />
Conservation-restauration<br />
Béatrice Zahnd<br />
Nettoyage et restauration<br />
des 3 Automates Jaquet-Droz<br />
Thierry Amstutz<br />
Chef technique Samuel Gyger<br />
Peinture<br />
François Ducommun, Sestilio Vignoli<br />
Eclairage Nino Giorgianni<br />
Soclage et encadrement<br />
Tan Chen, Julie Tüller<br />
Traductions<br />
Ilona Bodmer, Carole Chabrel, Andràs<br />
Dörner, Clarissa Hull, Margie Mounier,<br />
Rachel Pearlman, Marcus X. Schmid<br />
14<br />
Relecture<br />
Marie-Christine Hauser, Walter Tschopp<br />
Menuiserie des affaires culturelles,<br />
Neuchâtel<br />
Philippe Joly, Daniel Gremion,<br />
Jonas Pleschberger<br />
Audiovisuels<br />
REC Production SA, Neuchâtel, Philippe<br />
Calame, Maria Nicolier, Sandra Roth<br />
Installations audiovisuelles et conseils<br />
Ateliers modernes, Pailly, Marc Wettstein<br />
Programmation numérique<br />
Alexandre Mattart<br />
Voix<br />
Arthur Baratta, Ueli Locher,<br />
Frédérique Nardin, Patrice de Montmollin,<br />
Olivier Nicola, Katie Northcott<br />
Impression numérique<br />
Polygravia, Lausanne<br />
Vitrines<br />
Vitrerie Schleppy SA, Neuchâtel<br />
Serrurerie<br />
Alfaset, La Chaux-de-Fonds<br />
Eclairage, fournitures, conseils<br />
Eric Hoffmann, Cressier<br />
Photographie<br />
Stefano Iori, Claude Bornand<br />
Réception<br />
Chantal Sester, Catherine Suzuki,<br />
Thérèse Tinet, Anouck Jeanbourquin<br />
Surveillance et sécurité<br />
Denis Basset, Thérèse Tinet,<br />
Anne-Marie Willi<br />
Atelier des musées<br />
Marianne de Reynier Nevsky,<br />
Sandra Barbetti, Bryan Kaufmann<br />
Atelier pédagogique MAHN<br />
Geneviève Petermann<br />
Catalogue<br />
Editions Alphil, presses universitaires<br />
suisses, Neuchâtel
Die <strong>Ausstellung</strong> wäre zweifellos nicht<br />
möglich gewesen ohne die Leihgaben und<br />
die Mitarbeit der folgenden Institutionen<br />
und Personen bei denen wir uns herzlich<br />
bedanken :<br />
Remerciements<br />
John Alviti, Amelia Aranda Huete, François<br />
Aubert, Thiébaut Bentz, Roland Blaettler,<br />
Laurence Bodenmann, Nicole Bosshart,<br />
Maamar Boularas, Serge Bringolf, Anne-<br />
Laure Carré, Raymond Clavel, Thomas<br />
Charenton, Thierry Chatelain, Sylvie Dricourt,<br />
Nathalie Ducatel, Estelle Fallet, Dario<br />
Floreano, Marion Gloret, Blaise Godet,<br />
Pascal Griener, Patrick Gyger, Christoph<br />
Hänggi, Eva Hörmanseder, Dora Huguenin,<br />
Monika Leonhardt, Anne-Sophie van<br />
Leeuwen, Auke Ijspeert, François Junod,<br />
Frédéric Kaplan, Yevette Karlen, Sharon<br />
Kerman, Stéphanie Kirkorian, Francis Lara,<br />
Andrzej Malik, Pierre Alain Mariaux, Jean-<br />
Léonard de Meuron, Francesco Mondada,<br />
Morghan Mootoosamy, Sylviane Musy<br />
Ramseyer, Ludwig Oechslin, Gilles Perret,<br />
Janine Perret Sgualdo, Philippe Perrot,<br />
Jean-Michel Piguet, Jean-Claude Sabrier,<br />
Arnaud Telier, Laurent Tissot, Gérard Triponez,<br />
Gérard Vouga, les auteurs, les prêteurs,<br />
Montres Jaquet Droz SA (collection<br />
ancienne), les collègues des musées publics<br />
et privés et les collectionneurs privés<br />
suisses et internationaux, le Conseil scientifique,<br />
le Comité d’honneur, l’Association<br />
Automates et Merveilles, l’Association des<br />
amis du MAHN ARTHIS, ainsi que toutes<br />
celles et ceux qui, par un conseil, une idée<br />
ou un coup de pouce, ont aussi permis<br />
que l’exposition Automates & merveilles :<br />
Les Jaquet-Droz et Leschot soit ouverte au<br />
public.<br />
15<br />
· Bibliothèque de la Ville,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
· Bibliothèque publique et universitaire,<br />
Neuchâtel<br />
· Ecole polytechnique fédérale,<br />
Lausanne<br />
· Fondation de l’hôpital Pourtalès,<br />
Neuchâtel<br />
· Fondation Maurice et Edouard<br />
Sandoz, Pully<br />
· Fonds national suisse de la recherche<br />
scientifique, Berne<br />
· Historisches Museum, Bâle<br />
· Institut d’histoire, Université de<br />
Neuchâtel<br />
· Institut d’histoire de l’art et de<br />
muséologie, Université de Neuchâtel<br />
· Istituto italiano di tecnologia,<br />
Gênes (Italie)<br />
· Medizinhistorisches Institut und<br />
Museum, Zürich<br />
· Montres Jaquet Droz SA,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
· Musée d’art et d’histoire, Fribourg<br />
· Musée d’art et d’histoire, Genève<br />
· Musée des automates,<br />
Grenoble (France)<br />
· Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds<br />
· Musée d’horlogerie<br />
du Locle – Château des Monts<br />
· Musée du Temps, Besançon (Fance)<br />
· Musée international d’horlogerie,<br />
La Chaux-de-Fonds<br />
· Museum für Musikautomaten, Seewen<br />
· Muzeum Historycznym Miasta<br />
Krakowa, Cracovie (Pologne)<br />
· Nationaal Museum van Speelklok tot<br />
Pierment, Utrecht (Pays-Bas)<br />
· Patek Philippe Museum, Genève<br />
· Patrimonio nacional, Palacio Real,<br />
Madrid (Espagne)<br />
· Technisches Museum, Vienne (Autriche)<br />
· The Franklin Institute, Philadelphie<br />
(USA)<br />
· The Palace Museum, Pékin (Chine)<br />
· Uhrenmuseum Beyer, Zürich<br />
· Université de Neuchâtel<br />
· Les prêteurs privés anonymes
Pendule à planétaire<br />
signée Raingo<br />
(planétaire, musique et<br />
décor) et Antide Janvier<br />
(mouvement de la<br />
pendule) à Paris.<br />
Premier quart du XIX e s.<br />
[détail du planétaire]<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
MagIsche Bewegungen…<br />
verBlüffenDe MechanIsMen<br />
–<br />
Étonner, émerveiller, surprendre<br />
verBlüffen, verzAuBern, üBerrAschen<br />
–<br />
Le volet de l’exposition Automates & merveilles du Musée international d’horlogerie<br />
prévoyait de présenter la musique, qu’elle soit associée aux instruments de mesure<br />
Der Teil der <strong>Ausstellung</strong> Automates & merveilles (Automaten und Meisterwerke) im In-<br />
du ternationalen temps, horloges Uhrenmuseums ou montres, (MIH) sollte où Musik aux instruments präsentieren : Musik de/à musique von Zeitmessern, mécanique.<br />
Stand- und Kleinuhren sowie mechanischen Musikinstrumenten.<br />
La Musicienne Musicienne, (die Musikerin), l’androïde der des Androide Jaquet-Droz, der Jaquet-Droz, trouvait erhielt donc daher naturellement für die Dauer sa place au<br />
musée der <strong>Ausstellung</strong> pour la selbstverständlich durée de l’exposition.<br />
einen Platz im Museum.<br />
Der Inhalt schien jedoch etwas beschränkt. Eine <strong>Ausstellung</strong> auf einigen hundert Quadrat-<br />
Le contenu paraissait cependant un peu restreint. Rester au sein d’une exposition<br />
metern, die wundervolle Gegenstände versammeln und die Geschichte der mechanischen<br />
sur une centaine de mètres carrés qui réunirait certes de magnifiques objets et<br />
Musik darstellen soll, ist ein tolles Projekt, aber sind Stand- und Kleinuhren auf ihre Art<br />
permettrait de développer une histoire de la musique mécanique était un beau projet,<br />
nicht auch Automaten ? Und was ist mit Uhren mit Planetenbewegung ? Oder Kuriositäten,<br />
mais wie die une Uhr horloge, mit Perpetuum-Mobile une montre von ne Geiser sont-elles & Sohn ? pas des automates à leur façon ? Et que<br />
dire des horloges avec planétaires? Ou des curiosités comme l’horloge des Geiser<br />
père Der Untertitel et fils? der <strong>Ausstellung</strong> „ Merveilleux mouvements… Surprenantes mécaniques ”<br />
(Magische Bewegungen… verblüffende Mechanismen) erweitert die Thematik und es<br />
[images 1 et 2]<br />
17<br />
Horloge “ à mouvement<br />
perpétuel ”,<br />
Jean et David Geiser,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
vers 1815. Détail<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Le sous-titre de l’exposition «merveilleux mouvements… surprenantes
Klatscher<br />
Kinetische Skulpturen,<br />
Martin Müller<br />
Uhrknall<br />
Kinetische Skulpturen,<br />
Martin Müller<br />
werden rund 15 <strong>Ausstellung</strong>sstücke der permanenten Sammlung des Museums unter<br />
einem neuen Gesichtspunkt gezeigt. Sie werden von Filmen und Klängen begleitet, so dass<br />
alle ihre Besonderheiten <strong>zur</strong> Geltung kommen.<br />
Und wäre dies nicht eine gute Gelegenheit, den zeitgenössischen Künstler Martin Müller<br />
zu bitten, die <strong>Ausstellung</strong> mit seinen Werken zu begleiten ?<br />
18<br />
Martin Müller, Künstler für kinetische<br />
Skulpturen, bringt sich doppelt in die<br />
<strong>Ausstellung</strong> ein – mit seinen Kreationen,<br />
die Klänge auf spielerische und interaktive<br />
Weise entfalten sowie mit Werken, die<br />
Klang und Zeit verbinden, wie zum Beispiel<br />
die Installation Uhrknall die mehrere, aufeinander<br />
folgende Big Bangs erzeugt. Ein<br />
Uhrwerk steuert ein Gerät, das Luftballons<br />
aufbläst und sie in bestimmten Intervallen<br />
platzen lässt. Und am Ende der <strong>Ausstellung</strong><br />
in fünf Monaten zeugen die zerplatzten<br />
Luftballons von der verstrichenen Zeit.<br />
Die 2000 m 2 große <strong>Ausstellung</strong>sfläche von<br />
automates & merveilles : merveilleux mouvements…<br />
surprenantes mécaniques erlaubt die Präsentation großer Werke in einer geeigneten<br />
Umgebung, wie zum Beispiel der beiden James Cox zugeschriebenen Elefanten-<br />
Pendeluhren (Privatsammlung) oder der Elefanten-Pendeluhren aus der Uhrensammlung<br />
des Kunsthistorischen Museums Genf sowie der astronomischen Pendeluhr von Antide<br />
Janvier.<br />
Geige<br />
Kinetische Skulpturen,<br />
Martin Müller
Eléphant,<br />
détail de l’œil mobile<br />
Collection particulière/Crédit<br />
photographique Daniel Narezo<br />
Pendule éléphant à<br />
automates attribuée à<br />
James Cox faisant partie<br />
d’une paire<br />
Collection particulière/Crédit<br />
photographique Daniel Narezo<br />
“ Turc buvant du café<br />
sur un tapis volant ”<br />
Collection La Semeuse<br />
die AutomAten<br />
In diesem Zusammenhang kam die Idee des Théâtre des automates (Automatentheater)<br />
auf, um die Automaten in ihrem ursprünglichen Kontext zu zeigen : Automaten wurden<br />
oft auf Jahrmärkten aufgestellt, wo sie gegen Bezahlung spielten und sie waren ursprünglich<br />
für derartige Einsätze entwickelt worden. La Musicienne (Die Musikerin) begleitet<br />
einen kostbaren Singvogelkäfig, Le Grand Magicien (Der große Zauberer) der Gebrüder<br />
Maillardet oder Le Tapis Volant (Der fliegende Teppich), ein zeitgenössisches Werk von<br />
François Junod.<br />
19<br />
Hercule portant une<br />
sphère armillaire –<br />
pendule d’Antide Janvier<br />
(1795)<br />
Collection particulière/Crédit<br />
photographique Daniel Narezo<br />
Le Grand Magicien<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH
Robot Gilberto<br />
Collection Robosphère<br />
Table de démonstration<br />
des engrenages<br />
©Espace des inventions,<br />
Lausanne<br />
20<br />
roBosPhère<br />
Um dem sehr weiten Feld der Automaten voll gerecht zu<br />
werden und die Entwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts<br />
nicht auszulassen, wurde das Konzept bald um die<br />
Welt der Roboter erweitert.<br />
Der spielerisch-didaktische Zukunftspark Robosphère im<br />
Neuenburger Jura zeigt eine Sonderausstellung, die speziell<br />
für das Museum konzipiert wurde. Hier werden verschiedene<br />
Roboter gezeigt, wie zum Beispiel humanoide Roboter,<br />
Unterhaltungsroboter, Industrieroboter, Kunstroboter,<br />
Wartungsroboter, Forschungsroboter, Mikroroboter,<br />
Flugroboter, Solarroboter, wandelbare Roboter, pädagogische<br />
Roboter, autonome Roboter, bionische Roboter,...<br />
bis hin zu RoboSnack, einer vollständig robotisierten<br />
Cafeteria !<br />
kurBeln und zAhnräder<br />
Und der letzte, aber nicht weniger bedeutende Teil ist ein vollkommen mechanischer und<br />
interaktiver Bereich, der sich vor allem an die jungen Besucher richtet : eine <strong>Ausstellung</strong><br />
des Espace des Inventions in Lausanne. Hier können wichtige technische Aspekte direkt<br />
entdeckt, erlebt und verstanden werden : von Zahnrädern über Vibratoren bis hin zu Kugellagern<br />
!
Quelques clés<br />
d'automates et<br />
de pendules<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
AutomAten, uhren und schlüssel<br />
Uhren und Automaten werden von Schlüsseln, mit denen<br />
ihre Federn aufgezogen werden, zum Leben erweckt. Und<br />
es existieren die unterschiedlichsten Schlüssel : große, kleine,<br />
funktionelle, verzierte oder schlichte – sie alle haben<br />
ihre Persönlichkeit und ohne sie gibt es keine Wunder, die<br />
Automaten erwachen nicht zum Leben.<br />
Aus diesem Grund wurden sie zum Symbol der <strong>Ausstellung</strong><br />
– im Und-Zeichen des Titels und bei dem speziell entworfenen<br />
USB-Stick. Außerdem markieren sie den Parcours<br />
der <strong>Ausstellung</strong> Automates & merveilles : Merveilleux mouvements…<br />
Surprenantes mécaniques.<br />
Die Besucherinnen und Besucher werden durch 34 Stationen<br />
geführt, vom Wasserbecken am Museumseingang bis<br />
zum monumentalen Glockenspiel im Parc des musées, und<br />
entdecken dabei die Bewegungen der Automaten und den<br />
Klang der Pendeluhren mit Musikwerken. Die Schlüssel<br />
sind das Symbol der verschiedenen Stationen.<br />
• Der verblüffende mechanismus der Uhr mit Perpetuum-<br />
Mobile von Geiser oder die monumentale Uhr von Vachey.<br />
• Die magischen Bewegungen der zwei monumentalen Elefantenpaare<br />
oder der Zauberer der Gebrüder Maillardet.<br />
• Die „ himmlische “ musik der Planetarien von Ducommun<br />
oder Janvier.<br />
21
Kinetische Skulpturen,<br />
Martin Müller<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
MUSIQUE<br />
CONTEMPORAINE<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Boite à musique, avec cylindre et<br />
jeux de cloches, vers 1880, coll.<br />
Musée Baud, L'Auberson<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
• Die spielerische musik der Werke des Basler Künstlers<br />
Martin Müller oder die Automaten mit Wecker.<br />
• Die salonmusik der Pendeluhren La Cigogne (Der<br />
Storch) und Le Renard (Der Fuchs) oder La Musicienne<br />
(Die Musikerin) von Jaquet-Droz.<br />
• Die taschenmusik der Tabakdosen mit Singvogel oder<br />
Kleinuhren mit Stundenschläger und Musik.<br />
• Der moderne Klang des monumentalen Glockenspiels.<br />
• Das herz der ausstellung stellt die geschichte der mechanischen<br />
musik dar<br />
• Das Théâtre des automates (Automatentheater), knüpft<br />
an die Tradition an : die großen Automaten werden in<br />
einem Theater ausgestellt oder bei Vorführungen zu bestimmten<br />
Zeiten von den Uhrmachern in Bewegung gesetzt.<br />
22
Pendule XXI CC,<br />
détail de l’affichage<br />
©Espace des inventions,<br />
Lausanne<br />
eine uhr der zukunft<br />
Die im Rahmen des Projektes Robosphère von Serge Bringolf für XXIst Century Clock<br />
entworfene XXICC bzw. „ Twenty-one CC “ – die Uhr des 21. Jahrhunderts – gilt aufgrund<br />
der Herkunft ihres Schöpfers und ihrer ausgeklügelten und technischen Entwicklungen<br />
als Erbin der Neuenburger Pendeluhren des 19. Jahrhunderts.<br />
Dennoch ist das Konzept vollkommen neu : der kleinste, schnellste und präziseste Industrieroboter<br />
der Welt verschiebt jede Minute tausend Uhrensteine, wodurch die genaue<br />
Uhrzeit digital angezeigt wird. Da der Roboter auf einer horizontalen Unterlage arbeitet,<br />
ermöglicht ein Spiegelsystem, die Uhrzeit aus der Ferne abzulesen. Die in Reihen<br />
verschobenen Steine bilden jede Minute eine graphische Darstellung, die in der nächsten<br />
Minute wieder verschwindet.<br />
kurze geschichte der mechAnischen musik<br />
Uhren mit Musikwerken, verblüffende Automaten und fortschrittliche Mechaniken zeigen,<br />
dass der Erfindungsgeist und das Können der Mechaniker und Uhrmacher der vergangenen<br />
Jahrhunderte in den heutigen Kreationen fortlebt.<br />
10 Schaukästen zeigen die Geschichte der Uhren, die gelegentlich mit Automaten kombiniert<br />
wurden, die Geschichte von Musikwerken – vom Glockenspiel über das Flötenspiel<br />
bis hin <strong>zur</strong> Vogelorgel – sowie die Entwicklung der Spieldose und der mechanischen<br />
Musik.<br />
AutomAten und uhren<br />
In der Renaissance entstand die Tischuhr, bei der das Gewicht durch einen Federmotor<br />
ersetzt wurde. Die Uhrmacher boten ihrer wohlhabenden Kundschaft unterschiedlich<br />
verzierte Uhren in verschiedenen Formen an, manchmal auch in Kombination mit Automaten.<br />
Die Werke der Automaten blieben einfach : sie wurden jede Stunde automatisch<br />
mit dem Schlagwerk ausgelöst oder sie wurden durch die Bewegung der Uhr zum Leben<br />
erweckt. Sie zeigten Szenen aus dem alltäglichen Leben, Jagdszenen oder Personendarstellungen.<br />
23
Horloge en fer à carillon,<br />
France, début du 17 e siècle<br />
Une des cloches porte<br />
la signature : Jean Dubois<br />
au Puy. Le carillon<br />
comporte neuf cloches<br />
dont huit servent au jeu<br />
de la mélodie et une à la<br />
sonnerie des heures.<br />
Il est déclenché à chaque<br />
quart d'heure par le mouvement<br />
de l'horloge.<br />
Musée de l'horlogerie Beyer,<br />
Zurich<br />
Planche XXVII du volume<br />
de l'Encyclopédie de<br />
Diderot et d'Alembert<br />
dédié à l'horlogerie,<br />
publié en 1765, qui<br />
présente un carillon à<br />
quinze timbres vu en<br />
perspective avec le rouage<br />
qui le fait mouvoir.<br />
Tiere nahmen bei den Automaten jener<br />
Zeit eine vorherrschende Rolle ein :<br />
es finden sich die unterschiedlichsten<br />
Tierarten und Bewegungen : Löwen, die<br />
mit den Augen rollen und das Maul öffnen,<br />
tanzende und springende Hunde,<br />
Vögel, die den Schnabel öffnen und die<br />
Flügel spreizen, tanzende Bären sowie<br />
Fantasietiere zeugen vom Erfindungsreichtum<br />
und dem Können der Handwerker<br />
der damaligen Epoche.<br />
glocken und glockensPiele<br />
Glocken hatten immer eine weltliche oder religiöse Funktion. Der Glockenschlag konnte<br />
von allen auch aus der Ferne gehört werden und wurde genutzt, um Versammlungen einzuberufen,<br />
die Bevölkerung bei Feuer zu warnen oder einfach die Uhrzeit anzugeben. In<br />
allen Religionen diente er auch als Ruf für die Gläubigen.<br />
Die ersten mechanischen Glockenspiele, die in der Regel<br />
aus vier Glocken bestanden, stammen aus dem Mittelalter.<br />
Ein mit einer mechanischen Uhr gekoppeltes Glockenspiel<br />
kann automatisch zu bestimmten Uhrzeiten Melodien<br />
spielen, die zuvor mit Stiften auf Walzen „ gespeichert “<br />
wurden, die dann die Klöppel betätigen. Glockenspiele an<br />
Bauwerken sind manchmal mit Stundenschlägern, Holz-<br />
oder Metallfiguren versehen, die <strong>zur</strong> Angabe der Uhrzeit<br />
mit einem Klöppel auf die Glocken schlagen.<br />
Pendeluhren mit glockensPiel<br />
Das Auftauchen von Beschreibungen und Bildtafeln <strong>zur</strong> mechanischen Musikwiedergabe<br />
in verschiedenen Uhrmacher-Lehrwerken im 18. Jahrhundert zeigt das Interesse der<br />
Uhrmacher, ihre Pendeluhren mit musikalischen Mechanismen zu erweitern. So findet<br />
sich in der 1765 erschienenen Enzyklopädie der Uhrmacherei von Diderot und Alembert<br />
eine Bildtafel mit einer perspektivischen Darstellung eines Glockenspiels mit 15<br />
Klängen, mitsamt dem Räderwerk <strong>zur</strong> Betätigung, das dem in Pendeluhren verwendeten<br />
stark ähnelt.<br />
Diese Glockenspiele bestehen im Allgemeinen aus einem<br />
Räderwerk wie bei einer Uhr, dessen Geschwindigkeit von<br />
einem Schwungrad, einem Gewicht oder einem Federmotor<br />
reguliert wird und das die für die Musik benötigte<br />
Energie liefert. Das wichtigste Teil ist sicherlich die Walze<br />
mit den darauf entsprechend der zu spielenden Melodie<br />
angeordneten Stiften. Die Stifte betätigen die Klöppel,<br />
welche die Glocken anschlagen. Die Anzahl der Glocken<br />
variiert je nach Größe des Instruments.<br />
24<br />
Cerf couché attaqué par<br />
un chien, cuivre doré,<br />
mouvement signé par<br />
Nicolas Le Constençois,<br />
Horloger du Roy, Paris,<br />
vers 1550, dimensions :<br />
160x178mm.<br />
Coll. particulière
Cage à deux oiseaux<br />
chanteurs et fontaine<br />
centrale, attribuée à<br />
Jaquet-Droz.<br />
Fin du 18 e siècle.<br />
Détail<br />
Collection particulière/Crédit<br />
photographique Daniel Narezo<br />
Montres à automates<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
Détail de la boîte à<br />
musique d’une horloge<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds<br />
/Crédit photographique MIH<br />
vogelkäfige und flötensPiele<br />
Vogelkäfige stellen eine etwas spezielle Entwicklung in der Geschichte der mechanischen<br />
Musik dar. Sie wurden nicht entwickelt, um Musik mechanisch zu reproduzieren, sondern<br />
sie sollten so getreu wie möglich das Gezwitscher von einem oder mehreren Vögeln<br />
nachahmen. Als Nachfolger der Vogelorgel, deren kleine Flöten den Vogelgesang weniger<br />
natürlichen wiedergaben, setzte sich ab dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts die<br />
Kolbenpfeife schnell durch, deren Erfindung Jaquet-Droz und Leschot und deren Mitarbeiter<br />
Jacob Frisard in Genf zugeschrieben wird. Vogelkäfige haben wie Volgelorgeln<br />
einen Bewegungsmotor, der mithilfe eines Blasebalgs Luft erzeugt. Die Flöten wurden<br />
jedoch durch eine Kolbenpfeife ersetzt, einer Art kleine Flöte mit einem Schieber, dessen<br />
Position von einer Zackenscheibe gesteuert wird. So kann das Instrument die gewünschte<br />
Melodie wiedergeben und gleichzeitig<br />
den Vogel bewegen : er öffnet den Schnabel,<br />
schlägt mit den Flügeln und dreht<br />
sich um die eigene Achse. In machen<br />
Käfigen hüpft der Vogel sogar auf einem<br />
Baum von einem Ast zum anderen.<br />
Diese Apparatur ermöglicht auch die<br />
Miniaturisierung der Applikationen und<br />
ihren Einbau in Schnupftabakdosen,<br />
Accessoires wie Spiegel oder Parfumzerstäuber<br />
und sogar Taschenuhren.<br />
Pendel- und sPieluhren<br />
Am Ende des 18. Jahrhunderts revolutioniert eine Erfindung die Herstellung von mechanischen<br />
Musikinstrumenten : 1796 präsentiert der Genfer Uhrmacher Antoine Favre dem<br />
Komitee für Mechanik in Genf ein mechanisches Werk „ ohne Glocke und ohne Klöppel “.<br />
In der Spieldose, die wie Glockenspiele und Orgeln ein<br />
Mechanikwerk aufweist, das eine Stiftwalze antreibt, werden<br />
die Töne durch einen Kamm mit perfekt abgestimmten,<br />
federnden Stahlzungen erzeugt. Zunächst werden sie in<br />
Kleinuhren, Ringen und Schnupftabakdosen verwendet,<br />
später werden dann größere Musikwerke in Sockel von<br />
Tischuhren und in reich verzierte Holzkästchen, die für<br />
einen hervorragenden Klang sorgen, eingesetzt.<br />
sPieldosen<br />
Im 19. Jahrhundert konzentriert sich die Herstellung von<br />
Spieldosen in der Schweiz auf ihre Wiege Genf, aber später<br />
entwickelt sich diese Industrie in Sainte Croix und<br />
L’Auberson im Waadtländer Jura.<br />
Das Hauptbauteil des Werks, die Walze, ermöglicht das<br />
Abspielen einer bestimmten Anzahl von Melodien – in der<br />
Regel zwischen vier und zehn.<br />
25
Pendulette à escamoteur<br />
Japy Fils Mignon Paris<br />
vers 1860<br />
Photo Renaud Sterchi<br />
©MHL<br />
Pendule neuchâteloise<br />
avec acrobate<br />
©Musée d'art et d'histoire,<br />
Ville de Genève, Inv. AD 3084.<br />
Photo Maurice Aeschimann<br />
Zum Wechseln der Melodie wird die Walze leicht auf ihrer Achse verschoben, so dass sich<br />
andere Stifte vor dem Tonkamm befinden. Bei bestimmten Spieldosen kann die Walze<br />
ausgewechselt und somit die Anzahl der Melodien vervielfacht werden.<br />
Große Spieldosen werden manchmal durch zusätzliche Tonkämme für tiefe Töne, kleine<br />
Trommeln, Glockenspiele oder sogar Automaten erweitert.<br />
Die Kästchen, wahre Resonanzkörper, die den Klang der Mechanismen optimieren, werden<br />
aus Edelholz hergestellt und mit aufwändigen Einlegearbeiten verziert. Eine auf der<br />
Innenseite des Deckels angebrachte „ Liederliste “ führt die Melodien und Komponisten an.<br />
Pendeluhren mit<br />
AutomAten und musikwerken<br />
Dank dem Renommee des 1805 in Blois geborenen, berühmten<br />
französischen Zauberkünstlers, Erfinders und<br />
Herstellers von Automaten, Jean-Eugène Robert-Houdin,<br />
erleben Zauberer und Taschenspieler im 19. Jahrhundert<br />
einen zunehmenden Erfolg. Sie ermuntern die Uhrmacher,<br />
magische Automaten in der Tradition der von Jean-<br />
David und Henri Maillardet entwickelten Automaten der<br />
große und der kleine Zauberer, die sich in der Sammlung<br />
des Internationalen Uhrenmuseums in La Chaux-de-<br />
Fonds befinden, in ihre Pendeluhren einzubauen.<br />
Auch dekorative Uhren, die architektonische Elemente der Gotik aufgreifen, werden mit<br />
mechanischen Spieldosen versehen. Sie werden in den Holzsockeln der Uhren verborgen<br />
und die Musik wird in der Regeln beim Schlagen der Stunden durch das Uhrwerk in Gang<br />
gesetzt.<br />
AutomAtenuhren<br />
Während dem gesamten 19. Jahrhundert zieren unzählige<br />
Kreationen aus dem alltäglichen Leben, bäuerliche Szenen<br />
und Szenen aus der Zirkuswelt die Pendeluhren mit<br />
Automaten. Die Figuren werden von Mechanismen mit<br />
Räderwerken bewegt. Zahnräder und Metallstifte setzen<br />
sich in bestimmten Intervallen in Bewegung, in der Regel<br />
zu jeder Stunde, wenn der Uhrschlag ausgelöst wird.<br />
Besonders beliebt sind Werkstätte, wie beispielsweise die<br />
Schmiedewerkstatt bei der hier gezeigten französischen<br />
Uhr, oder Zirkusszenen.<br />
Die Darstellung wird häufig von Musik begleitet. Dazu<br />
werden einfache Spieldosen, die ein oder mehrere Lieder<br />
spielen, bei spezialisierten Handwerkern in Auftrag gegeben<br />
und dann in die Sockel der Uhren eingebaut.<br />
26
Gramophone<br />
Coll. Musée international<br />
d'horlogerie, La Chaux-de-<br />
Fonds /Crédit photographique<br />
MIH<br />
singvogel-Pendeluhren<br />
Das Ende des 18. Jahrhunderts in Beaucourt gegründete Unternehmen Japy, das 1806 zu<br />
Japy Frères & Cie wird, spezialisiert sich unter anderem auf die Herstellung von Pendeluhren<br />
mit Motiven, Pendeluhren mit Automaten und Pendeluhren mit Musikwerken.<br />
Kaminuhren mit singenden Vögeln, wie die hier gezeigten,<br />
sind mit einer vom Uhrwerk unabhängigen Apparatur ausgestattet,<br />
die den Mechanismus der Vögel auslöst und einem<br />
Wind- und Flötenwerk, das den Vogelgesang imitiert. Das<br />
Windwerk befördert Luft zu einer kleinen Flöte mit variabler<br />
Länge, die von einer Zackenscheibe betätigt wird.<br />
Vor einem Wasserfall (dargestellt durch einen verdrehten<br />
Glasstamm), Felsen und einem blühenden Baum bewegen<br />
die Vögel Schnabel, Flügel und Schwanz und singen dabei<br />
eine oder mehrere Melodien.<br />
musikscheiBen und grAmmoPhone<br />
Ab Ende des 19. Jahrhunderts erhält die Herstellung traditioneller Spieldosen Konkurrenz<br />
von den in Deutschland auftauchenden Musikscheiben, deren Herstellung weniger kostspielig<br />
ist. Eine Scheibe mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter ersetzt die Stiftwalze.<br />
Auf ihrer Oberfläche stehen Zähne heraus, die den Stiften der Walze entsprechen.<br />
Die Scheiben werden in der Regel mithilfe eines Zahnrads gedreht, dessen Zähne in Aussparungen<br />
am Rand der Scheiben greifen.<br />
Gelochte Kartonstreifen, die nach ihrer Verwendung von Jaccard in Webmaschinen ab<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts für die Wiedergabe mechanischer Musik eingesetzt werden,<br />
steigern die bisherigen Möglichkeiten der Walzen deutlich. Sie sind technisch weniger<br />
kompliziert anzufertigen, leichter auszuwechseln und verlängern die Dauer der wiederzugebenden<br />
Melodien. In Kombination mit der Elektrizität ab dem Ende des Jahrhunderts<br />
bilden Sie die Grundlage für die Konstruktion großer Musikautomaten, Straßenorgeln und<br />
Orchestrien.<br />
Im 20. Jahrhundert erlebt das Grammophon, zunächst mit Rollen und später mit Platten,<br />
einen enormen Erfolg. Plötzlich ist es möglich, Musik oder die menschliche Stimme nach<br />
einer Aufnahme beliebig oft wiederzugeben. Dies bedeutet das Ende für die Herstellung<br />
traditioneller, mechanischer Musikinstrumente.<br />
27<br />
Pendule de cheminée<br />
à oiseaux chantants,<br />
Japy frères & Cie,<br />
Paris vers 1865.<br />
©Musée d'art et d'histoire,<br />
Ville de Genève, Inv. AD 3084.<br />
Photo Maurice Aeschimann
orgAnisAtion der <strong>Ausstellung</strong> :<br />
Automaten und Meisterwerke : Magische Bewegungen… verblüffende Mechanismen<br />
Szenarium und Konzeption<br />
der <strong>Ausstellung</strong><br />
Nicole Bosshart, Jean-Michel Piguet,<br />
Ludwig Oechslin<br />
Graphische Gestaltung und Umsetzung<br />
Polygone Publicité et communication<br />
Konzeption der Schaukästen<br />
Serge Perrelet, <strong>Ausstellung</strong>stechniker<br />
Konstruktion Automatentheaters,<br />
Sockel und Ständer<br />
Schreiner- und Malerarbeiten :<br />
Tiefbauamt der Stadt La Chaux-de-Fonds<br />
Restauration der Exponate :<br />
Restaurationszentrum für antike Uhren<br />
Daniel Curtit, Aurélie Michaud,<br />
Pascal Kunz, Julian Vallat<br />
Aufbau der <strong>Ausstellung</strong><br />
Serge Perrelet, Vanni Stifani, Daniel Curtit,<br />
Jean-Michel Piguet, Justo Arancibia,<br />
Laurence Schmid<br />
Technischer Aufbau<br />
Cédric Brossard<br />
AUSSTELLUNG MANIVELLES ET RoUES<br />
DENTéES (Kurbeln und Zahnräder)<br />
Konzeption<br />
Espace des Inventions, Lausanne<br />
Montage und Aufstellung<br />
Romain Roduit, Cédric Brossard,<br />
Serge Perrelet<br />
RoboSPHèRE<br />
Konzeption : Nicole Bosshart,<br />
Serge Perrelet, Serge Bringolf<br />
Montage : Serge Perrelet, Vanni Stifani,<br />
Cédric Brossard<br />
Koordination und Sekretariat<br />
Nicole Bosshart, Amandine Cabrio,<br />
Manuela Bolgiani<br />
Metallkonstruktion<br />
Alphaset<br />
Plexiglas<br />
Jauslin SA<br />
Abzüge Text und Druck<br />
Jura Néon SA<br />
Verdon SA<br />
28<br />
Teppich<br />
SolHeimo<br />
Filme<br />
Vidéo Clap<br />
Filme über die Automaten von Jaquet-Droz<br />
REC Production audiovisuel<br />
Übersetzungen<br />
Star SA<br />
Leihgaben<br />
Kunsthistorisches Museum, Neuenburg<br />
Uhrenmuseum Le Locle, Château des Monts<br />
Kunsthistorisches Museum, Genf<br />
Museum für Musikautomaten, Seewen<br />
CIMA, Ste Croix<br />
Museum Baud, L’Auberson<br />
François Junod, Ste Croix<br />
Uhrenmuseum Beyer, Zürich<br />
Uhrensammlung Kellenberger, Winterthur<br />
Martin Müller, Basel<br />
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds<br />
Private Sammlungen<br />
Die <strong>Ausstellung</strong> Automates & Merveilles<br />
(Automaten und Meisterwerke)<br />
wird unterstützt von<br />
· Montres Jaquet Droz SA<br />
· Loterie Romande<br />
· Sandoz Stiftung<br />
· Ernst Göhner Stiftung<br />
· Staat Neuenburg<br />
· Bureau de contrôle des ouvrages<br />
en métaux précieux<br />
· La Semeuse SA durch die Kreation<br />
eines speziellen Kaffees anlässlich der<br />
<strong>Ausstellung</strong><br />
· Croisitour SA, Unterstützung bei<br />
Transport und Beförderung<br />
· amisMIH<br />
· Ulysse Nardin Stiftung<br />
· Laboratoire Dubois
luxusMeIsterstücke<br />
unD MInIaturen<br />
–<br />
die werke der JAquet-droz und leschot<br />
–<br />
Ausgewählter Auszug aus dem<br />
<strong>Ausstellung</strong>skatalog des Uhrenmuseums<br />
Von Sharon Kerman, April 2012<br />
Am scheideweg<br />
Pierre Jaquet-Droz und sein Sohn Henri-Louis zählen gemeinsam mit ihrem Partner und<br />
Freund Jean-Frédéric Leschot zu den findigsten Uhrmachern, Mechanikern und Visionären<br />
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.<br />
Die Erfindungsgabe und die Anmut ihrer Werke bescherten ihnen einen besonderen Platz<br />
in der Geschichte der Uhrmacherei. Sie waren außerdem ausschlaggebende Persönlichkeiten,<br />
die sich in ihrem Zeitalter am Scheideweg des Ancien Régime und der post-revolutionären<br />
Welt befanden. Sie repräsentieren die letzte Generation der „ Établisseurs “, die<br />
Hersteller-Händler des Ancien Régime, zwischen zwei Zeitaltern – jenes des einzigartigen<br />
Werkstücks oder der sehr geringer Stückzahl für ein elitäres Publikum, und jenes der maschinenunterstützten<br />
Fertigung und der Anfänge der Serienproduktion.<br />
An einer weiteren Kreuzung, dort wo sich Wissenschaft und Vergnügen kurzzeitig vereinen,<br />
um sich anschließend endgültig zu trennen, trifft man ebenfalls auf Jaquet-Droz<br />
und Leschot. Obgleich die Automaten des 18. Jahrhunderts – denken wir hierbei an die<br />
von Vaucanson gewünschten „ beweglichen Anatomien “ – die Fragen von Denkern wie<br />
Descartes, Pascal und La Mettrie zum Geiste und der Materie widerspiegeln konnten, so<br />
sorgten sie vor allem für Verwunderung und Bezauberung. Mit diesem Ziel präsentierten<br />
Henri-Louis Jaquet-Droz und Jean-Frédéric Leschot ab 1774 ihre drei Androiden in den<br />
großen Städten Europas.<br />
Man kann in dem Werk von Jaquet-Droz und Leschot schrittweise eine Kreuzung dessen<br />
erkennen, was groß ist und dessen, was unendlich klein ist, eine Fusion von Makrokosmos<br />
und Mikrokosmos. Diese Verbundenheit mit den winzigsten Details wird von einer universellen<br />
Ambition verstärkt. Die Anfänge von Pierre Jaquet-Droz (1721–1790) sind von<br />
der Erforschung der Uhrenkomplikation geprägt. Er sah darin, wie die Mehrheit der Uhrmacher<br />
seiner Zeit, die beste Möglichkeit, sich von seinen Kollegen abzugrenzen.<br />
29
Automate Le Dessinateur<br />
Henri-Louis Jaquet-Droz,<br />
La Chaux-de-Fonds,<br />
1772-1774<br />
© Musée d’art et d’histoire,<br />
Neuchâtel<br />
Mit dem Begriff „ Komplikation “ bezeichnen Uhrmacher<br />
alles, das die einfache Uhrzeitanzeige ergänzt und<br />
dem Stück dadurch einen zusätzlichen Reiz verleiht<br />
und eine technische Herausforderung für den Uhrmacher<br />
darstellt.<br />
Die Uhrenkomplikationen umfassen wissenschaftliche<br />
und zweckorientierte Funktionen, wie die Wiederholung<br />
der Stunde und der Minuten, oder die Anzeige<br />
der Mondphasen – und wunderschöne Frivolitäten wie<br />
eine ergänzende animierte Szene oder Melodie.<br />
Bis in das dritte Viertel des 18. Jahrhunderts hatten die<br />
Stücke aufgrund der Uhrenkomplikationen eine bestimmte<br />
Größe. Eine Melodie – erzeugt von einer Volgelorgel<br />
oder einem Glockenspiel – eine Automatenszene,<br />
das Läuten <strong>zur</strong> vollen Stunde, <strong>zur</strong> Viertelstunde<br />
oder die Anzeige der Minuten erforderten den Einbau<br />
eines zusätzlichen Mechanismus.<br />
miniAturisierung und luxus :<br />
eine neue industrie<br />
Um 1770, <strong>zur</strong> Zeit der Rückkehr von Henri-Louis Jaquet-Droz (1752–1791) von seinem<br />
Studium in Nancy, hatte sich die Produktion von Jaquet-Droz und Leschot weiterentwickelt.<br />
Seitdem widmete sich das Haus der Fertigung von Uhren in kleiner Stückzahl, die<br />
besser an die sich verändernden Märkte angepasst waren, leichter herzustellen und besser<br />
zu transportieren waren.<br />
Statt ihr Sichtfeld fortwährend zu vergrößern, wie ein Astronom, der den Himmel mit seinem<br />
Teleskop absucht, drehten sie das Objektiv um, und vertieften sich in ein Miniatur-<br />
Universum.<br />
Die Singvogelautomaten sind zweifelsohne das beste Beispiel für die Miniaturisierung in<br />
den Werken von Jaquet-Droz und Leschot. Diese mechanischen Vögel, die die Bewegungen<br />
und den Gesang von echten Vögeln nachahmen, waren zu der damaligen Zeit sehr beliebt.<br />
Die Werke der ersten Generation hatten ein Orgelspiel in ihrem Boden verbaut. Diese als<br />
„ Serinetten “ oder „ Vogelorgeln “bezeichneten Mechanismen, die nach der im 17. Jahrhundert<br />
verbreiteten Zucht von Zeisigen (frz. „ serin “) als Singvögel benannt wurden,<br />
bestanden aus mehreren Orgelpfeifen, die jeweils eine Note erzeugten und einem großen<br />
Balg für die Luftzufuhr. Ein mit Spitzhämmern versehener Zylinder, oder „ Spitzzylinder “,<br />
gab die Reihenfolge der zu spielenden Noten vor.<br />
Das Haus Jaquet-Droz und Leschot stellte große Käfige mit einem oder zwei Singvögeln<br />
her, die man „ Vestibülpendeluhren “ nannte, mit einem Ziffernblatt an der Unterseite, von<br />
dem man die Uhrzeit ablesen konnte, wenn der Käfig aufgehängt wurde.<br />
Doch da der Markt gegen Ende des 18. Jahrhunderts ununterbrochen Neues forderte wurden<br />
die Singvögel durch eine neue Erfindung revolutioniert : die Kolbenschiebepfeife.<br />
Diese bedeutende Erfindung, die im Allgemeinen Jaquet-Droz und Leschot zugesprochen<br />
wird, die zu der Zeit die einzigen waren, die hochwertige mechanische Singvögel anfertigten,<br />
führte zu einer großen Aufschwung für die Singvögel.<br />
30
Tabatière à oiseau<br />
chanteur<br />
(détail mécanisme),<br />
Jaquet-Droz<br />
©MIH<br />
In den darauf folgenden Jahren und bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts erblickten<br />
unzählige Miniatur-Singvögel das Licht der Welt.<br />
Das Prinzip war einfach : Das voluminöse Orgelspiel der Serinetten erfolgte mit einem einzigen<br />
kleinen Pfeifenrohr. Die Noten wurden erzeugt, indem ein Kolben wie eine kleine<br />
Posaune durch das Rohr geschoben wurde und dabei alle Noten der Tonleiter abspielte. Ein<br />
verkleinertes Nockenspiel steuerte den Kolben sowie den kleinen Balg, der für die Luftzufuhr<br />
vorgesehen war.<br />
Die äußerst flexible Kolbenschiebepfeife konnte Trillertöne und Glissaden erzeugen.<br />
Außerdem konnte sie Noten in sehr schneller Folge wiederholen. Auf diese Weise ahmte sie<br />
die Vogelgesänge besser nach als Serinetten. Da sie sehr wenig Platz benötigte, konnten mit<br />
ihr zahlreiche kleine Dekorationsgegenstände versehen werden : Uhren, Spiegel, Tabakdosen,<br />
Flakons, kleine Käfige, Spazierstockknäufe ... und sogar Pistolen, die einen kleinen,<br />
zwitschernden Vogel preisgaben, wenn man den Abzug betätigte !<br />
Um ihre Singvogelmechanismen herstellen zu können, wandten sich Jaquet-Droz und<br />
Leschot an den unabhängigen Künstler Jacob Frisard (1753–1810). Frisard arbeitete eng<br />
mit Jean-Frédéric Leschot (1746–1824) zusammen, der das Atelier leitete. Die beiden<br />
Männer, stolz auf die Qualität ihrer Stücke, waren sich deutlich dessen bewusst, was sie<br />
von den anderen unterschied, wie es dieser Auszug aus einem Schreiben von Leschot an<br />
Frisard zeigt :<br />
„ Wir müssen versuchen, diese Branche so lange zu halten, wie es uns möglich ist. Es mangelt<br />
uns hier nicht an Neidern. Sie können sich jedoch nicht all die Schwierigkeiten vorstellen,<br />
die es zu überwinden gilt. Und ohne dies werden sie lediglich zu Schweinereien mit<br />
der Mehrpfeifenmethode imstande sein, wie es derzeit der Fall ist. Lassen wir sie einfach so<br />
weitermachen. Sie können unseren Verkaufszahlen nicht schaden. “ 1<br />
Die Gründung einer Niederlassung in London um 1775, die anschließend der Leitung von<br />
Henri Maillardet übertragen wurde, stellte einen wichtigen Wendepunkt für Jaquet-Droz<br />
und Leschot dar.<br />
31<br />
Carnet de bal Tabatière<br />
avec montre et automate,<br />
Anonyme<br />
Genève, vers 1810<br />
Photo Renaud Sterchi<br />
©MHL
Cage à oiseau chanteur,<br />
Jaquet-Droz<br />
Photo Renaud Sterchi<br />
©MHL<br />
London war zu dieser Zeit ein wichtiges und international angesehenes Zentrum der Uhrmacherei.<br />
Der auf einem Ziffernblatt eingravierte Begriff „ London “ garantierte die Qualität<br />
im Sinne des Verkäufers. Die britische Hauptstadt war Ausgangspunkt von Schiffen, die<br />
den aufblühenden Markt im Orient belieferten.<br />
Durch die Niederlassung in London näherten sich Jaquet-Droz und Leschot den großen<br />
englischen Händlern an, mit denen sie bereits arbeiteten : James Cox (anschließend Cox<br />
und Beale und danach Cox, Beale und Laurent), Duval und Magniac. Diese Händler ermöglichten<br />
den Zugang zu einer Kundschaft, die den Luxus mit all seinen Facetten liebte : hohe<br />
Qualität, Seltenheit, technische Raffinesse, reiche Verzierungen, gehobener Preis.<br />
Diese Begeisterung für hochwertige Luxusgegenstände war der Motor, der den Handel und<br />
die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern und Kontinenten antrieb. Voltaire, der<br />
sowohl Uhrmacher als auch Handelsapologet war, bemerkte :<br />
Alles dient dem Luxus, den Freuden dieser Welt.<br />
Oh, welch schöne Zeit dieses goldene Zeitalter doch ist !<br />
Der Überfluss, eine große Notwendigkeit,<br />
Vereinte eine Hemisphäre mit der anderen. 2<br />
Die für den chinesischen Markt und den Nahen Osten vorgesehenen Stücke waren gemäß<br />
vorgegebenen Kanons verziert. Für China benötigte man brillante Farben und ein reiches<br />
und ausgearbeitetes Zierwerk – nicht nur für die sichtbaren Teile der Uhr, sondern auch<br />
für das Uhrwerk, das oft vollständig graviert war. Die Lünetten waren mit Perlen und anderen<br />
Edelsteinen bestückt und die auf Emaille gemalten Szenen waren von herausragender<br />
Schönheit.<br />
Der Kaiser und die kaiserlichen Beamten waren von dem Uhrwerk, wie z. B. jenes für den<br />
Sekundenzeiger in der Mitte, fasziniert. Sie liebten die kleinen, zu einer Melodie bewegten<br />
Automatenszenen und die Käfige und Tabakdosen mit Singvögeln. Sie erwarben ihre wertvollen<br />
Uhren und animierten Stücke bevorzugt paarweise, was die Hersteller dazu ermutigte,<br />
eine „ Spiegeldekoration “ anzufertigen – jede Uhr stellt das Spiegelbild der anderen dar.<br />
Eine andere Besonderheit des chinesischen Marktes war die anhaltende Nachfrage nach<br />
Neuigkeiten, was die Händler/Établisseure dazu bewegte, das Erscheinungsbild der<br />
Gegenstände ständig zu erneuern und zu variieren.<br />
Pistolet lance-parfum. Anonyme, Genève, vers 1810<br />
Photo Philippe Pellaton. ©MIH<br />
32<br />
Chenille<br />
attribuée à Maillardet,<br />
Genève-Londres<br />
vers 1820<br />
Photo Renaud Sterchi<br />
©MHL<br />
Montre de poche signée<br />
Jaquet-Droz et Leschot,<br />
London, vers 1780<br />
Photo Laurence Bodenmann<br />
©MHL
Automaton Exhibition<br />
Gothic Hall<br />
scan Sharon Kerman lq<br />
Der türkische Markt wünschte kontrastreiche und grelle Töne, betont durch kontrastreiche<br />
Farben : Bonbonrosa, Mandelgrün, Blutrot. Und feine, auf Emaille gemalte Szenen, auf<br />
denen man schwimmende Schiffe mit gesetzten Segeln oder prosperierende Handelshäfen<br />
umgeben von hohen Minaretttürmen bewundern konnte.<br />
„ die fABrik ”<br />
1784 verließen Jaquet-Droz und Leschot La Chaux-de-Fonds und ließen sich im Herzen<br />
der Genfer „ Fabrik “ nieder. Dieser Begriff beschrieb im 18. und 19. Jahrhundert alle<br />
Berufe, die mit der Herstellung von Uhren und Schmuckstücken verbunden waren : Die<br />
Uhrmacherei, die Goldschmiedekunst, die Emaillierkunst, die Edelsteinfassung sowie alle<br />
dazugehörigen Aktivitäten.<br />
Die Organisation der Fabrik beruhte auf den Herstellern/Händlern, die man als „ Établisseure<br />
“ bezeichnete und die die Arbeiten planten, finanzierten und steuerten. Sie streckten<br />
das Geld für den Kauf der Materialien vor, bezahlten die Arbeiter und erkundeten die<br />
Absatzmärkte für den Verkauf der Fertigprodukte. Sie wurden selbst erst Monate, ja sogar<br />
Jahre später bezahlt.<br />
Die Handwerker, die oft selbstständig arbeiteten, waren geistreich und unabhängig und<br />
stolz auf ihr Können. Es sind die berühmten „ Cabinotiers “, deren kleine Ateliers oder<br />
„ Cabinets “ ganz oben in den Häusern lagen, um das Licht besser einfangen zu können,<br />
das für ihre Präzisionsarbeiten erforderlich war.<br />
Obwohl Jaquet-Droz und Leschot einige der besten Uhrmacher ihrer Zeit beschäftigten<br />
und zweifellos zum Teil ausbildeten – Isaac Daniel Piguet, Nicolas-Constant Le Maire, die<br />
Gebrüder Maillardet, die Gebrüder Rochat – blieben die meisten ihrer Mitarbeiter anonym.<br />
Die Geschäftsbücher nennen die Namen einiger Handwerker und Lieferanten : Z.<br />
B. die Goldschmiede Rémond und Lamy sowie Guidon, Blondel & Gide, die die goldenen<br />
Tabakdosen lieferten.<br />
Unter den Emaillemalern entdeckt man den Namen Soiron – ohne Zweifel Jean-François<br />
Soiron (1755–1813) – erwähnt am 18. März 1788 : „ Durch Soiron, Bemalung von 6 vergessenen<br />
Schüsseln, Frz. Livres 60 “ sowie zwei Verweise im November 1788 auf „ J. Coteau “<br />
und „ Coteau de Paris “, vermutlich der berühmte Emailleur Joseph Coteau (1740–1801).<br />
Ein gewisser Mussard, vielleicht aus der gleichnamigen Emailleur-Dynastie, wird im<br />
Oktober 1789 erwähnt.<br />
33<br />
Pendulette lyre à oiseau<br />
chantant et automate,<br />
signée<br />
P. Jaquet Droz et Leschot<br />
London<br />
Photo Renaud Sterchi<br />
©MHL
Tabatière<br />
à oiseau chanteur,<br />
Jaquet-Droz<br />
©MIH<br />
Die Goldschmiede, Ziseleure, Graveure, Edelsteinfasser und Emailleure der Fabrik<br />
beherrschten eine große Vielzahl an Techniken. Die Goldschmiedekunst umfasste Gravur-,<br />
Treibarbeits- und Ziseliertechniken sowie die Applikation von Dekorationsmotiven<br />
in Farbgold.<br />
Die animierten Szenen, mit denen die Uhren und Tabakdosen verziert wurden, waren oft<br />
aus Farbgold auf bemaltem Emaillegrund. Die kleinen Personenautomaten sind sehr fein<br />
verarbeitet. So gut, dass man selbst mit der<br />
Lupe ihre feine Schönheit bewundern kann.<br />
Im Bereich der Emaillekunst, in dem<br />
es viele außergewöhnliche Handwerker<br />
gab, glänzten bestimmte Künstler in der<br />
„ Emaillemalerei “, die so bezeichnet wurde,<br />
da sie in wahrhaften Meisterwerken der<br />
Miniaturmalerei resultierte. Andere Techniken,<br />
die große Fachkenntnis erforderten<br />
– Cloisonné, Champlevé, farbige und<br />
durchsichtige Emaille auf guillochiertem<br />
Grund – wurden bei feinen Verzierungen mit bemerkenswerten Ergebnissen angewandt.<br />
Bestimmte Techniken, wie die Nutzung von Blättchen, waren typisch für die Genfer Handwerker.<br />
Diese winzigen, zugeschnittenen Silber- oder Goldstücke wurden auf das Uhrengehäuse<br />
appliziert, das anschließend mit einer farblosen Emailleschicht, dem sogenannten<br />
Schmelzmittel, überzogen wurde. Dies schuf eine außergewöhnliche Tiefe und einen hervorragenden<br />
Glanz. Jaquet-Droz und Leschot verbanden die Goldblättchen mit fein zugeschnittenem<br />
Elfenbein auf einem Grund aus königsblauer Emaille. Ein Beispiel hierfür ist<br />
das Uhrenpaar, welches 1785 nach China geliefert wurde, verziert mit einem „ Motiv aus<br />
Elfenbein mit Sternen aus kleinen Perlen und Doppelkreisen aus Perlen und Rubinen “ 3 .<br />
Eine andere Art von „ Blättchen “, zugeschnittene oder gestanzte und bemalte Silberbleche,<br />
wurde manchmal anstelle von Federn für das Kleid der Singvögel benutzt. Das Geschäftsbuch<br />
vom 15. August 1786 erwähnt „ 4 Vögel bedeckt mit Farbblättchen “.<br />
Der internationale Charakter des Marktes brachte alle Akteure der Fabrik – Uhrmacher,<br />
Gehäusesetzer, Goldschmiede, Emailleure, Guillocheure, Graveure, Edelsteinfasser, Établisseure<br />
und Händler – dazu, ein großes Spektrum unterschiedlicher Stile mit Bravour zu<br />
beherrschen, wobei die spezifischen Vorlieben der einzelnen Märkte berücksichtigt wurden.<br />
Aus dem nest gerissen oder flug mit eigenen flügeln :<br />
mitArBeiter, rivAlen, nAchfolger<br />
Die Französische Revolution und ihre Folgen, die in ganz Europa zu spüren waren, wirkten<br />
sich negativ auf den Handel mit Luxusgütern aus. Die napoleonischen Kriege und die<br />
Kontinentalsperre verlängerten diesen Umbruch bis etwa in das Jahr 1815. Vater und Sohn<br />
Jaquet-Droz verschwanden 1790 bzw. 1791 – zu früh, um sich in Gänze auf die kommenden<br />
Veränderungen vorzubereiten.<br />
Doch ihre Zeitgenossen und all jene, die mit ihnen als Arbeiter, Partner und Mitarbeiter<br />
gearbeitet hatten – sowie ihre Rivalen – fanden sich in einer Welt wieder, in der sie keinen<br />
Anhaltspunkt mehr hatten. Perregaux und Perrot verglichen sie mit „ armen Vögeln, die<br />
vom Sturm aus ihrem Nest gerissen wurden “ 4 .<br />
34
Jean-Frédéric Leschot seinerseits gelang es nie, seinen Platz in dieser neuen Welt zu finden.<br />
Als er das Haus nach dem Tod von Henri-Louis Jaquet-Droz übernahm, war er zuversichtlich.<br />
Doch die 20 darauf folgenden Jahre waren für ihn eine Periode ständiger Kämpfe.<br />
Die Schwierigkeiten häuften sich : die Seltenheit von Rohstoffen wie Gold; die gewagten,<br />
manchmal unmöglichen Transporte von wertvollen Waren durch das vom Krieg gebeutelte<br />
Europa; die Unsicherheit des Wechselkurses; die Notwendigkeit, seine Handwerker,<br />
die sich selbst oft in großen Schwierigkeiten befanden, schnell zu bezahlen, während die<br />
Verkaufszahlen sanken und die Zahlungen der Kunden manchmal lange auf sich warten<br />
ließen.<br />
Zu diesen Problemen kamen der Bankrott seiner wichtigsten Kunden : 1792 von Cox, Beale<br />
und Laurent in Canton, wodurch Außenstände in Höhe von 4.570 Sterling-Pfund blieben.<br />
1798 traf es das Haus Duval in London.<br />
Andere Kollegen von Jaquet-Droz und Leschot kamen ebenfalls in Bedrängnis. Jacob Frisard<br />
versuchte in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts vergeblich, sich einen Namen zu<br />
machen. Nachdem er sich nach und nach von Leschot, dem er seine Unzufriedenheit darüber<br />
anvertraut hatte, im Schatten des Hauses Jaquet-Droz und Leschot gestanden zu haben,<br />
losgelöst hatte, wünschte er sich die Anerkennung seines Talentes. Nachdem er versuchte,<br />
seine Werke Napoleon Bonaparte zu präsentieren, stieß er auf die Ablehnung des Innenministers<br />
Lucien Bonaparte („ Das Etat der Staatskasse und die Notwendigkeit, dass die<br />
Regierung alles Kapital besitzt ... stehen im Gegensatz <strong>zur</strong> geringsten Ausgabe ... “) 5 . 1809<br />
reiste Frisard nach Konstantinopel, zweifellos in der Hoffnung, durch die Präsentation seiner<br />
animierten Stücke zu Geld und Ruhm zu kommen. Er starb auf der Rückreise.<br />
Henry Maillardet wurde nach der Auflösung des Londoner Unternehmens Jaquet-Droz et<br />
Maillardet um 1789 zu einem Automaten-Schausteller. Eine Broschüre seiner <strong>Ausstellung</strong><br />
in der Haymarket Gothic Hall 1811 zeigt Kreaturen von verlockender Fremdartigkeit – eine<br />
„ äthiopische Raupe “, eine „ sibirische Maus “ und eine „ ägyptische Eidechse “. Trotz eines<br />
gewissen Anfangserfolgs schienen die <strong>Ausstellung</strong>en Henri Maillardet nicht bereichert zu<br />
haben. In den letzten Jahre seines Lebens scheint er finanzielle Schwierigkeiten gehabt zu<br />
haben 6 .<br />
Einigen ehemaligen Mitarbeitern und Kollegen von Jaquet-Droz und Leschot gelang es,<br />
sich einen Namen zu machen und Erfolg zu haben. Zu erwähnen wäre der Sohn von Jean-<br />
Frédéric Leschot, Georges Auguste (1800–1884), der Maschinenwerkzeuge erfand, die die<br />
schnelle Produktion ähnlicher Teilen erleichterten. Dies war ein wichtiger Schritt <strong>zur</strong> Austauschbarkeit<br />
der Komponenten, einer der Faktoren, der die Entwicklung der Uhrmacherei<br />
im 19. Jahrhundert begünstigte.<br />
In dieser Periode erlebte die Uhrenindustrie durch die Einführung von Maschinen in die<br />
Uhrmacherateliers eine schrittweise Veränderung, die die Herstellung bei gleichzeitiger<br />
Senkung der Kosten vereinfachte und beschleunigte. Im Bereich der animierten Stücke<br />
verbreitete sich die Nutzung von Miniatur-Musikwerken mit Drehscheibe und Schwungmessern,<br />
was die Fertigung von Uhren und Tabakdosen mit Automaten und Musikwerken<br />
erleichterte.<br />
Einer der größten Erfolge der post-revolutionären Welt gelang dem Haus Piguet & Meylan.<br />
Isaac Daniel Piguet (1775–1841), ursprünglich aus Le Chenit im Joux-Tal, war als selbstständiger<br />
Arbeiter für Jean-Frédéric Leschot in Genf tätig. Sein Name erscheint in den<br />
Geschäftsbüchern von 1802. 1811 wird er Partner von Philippe Samuel Meylan (1772–1845)<br />
in Genf, der ebenfalls aus dem Joux-Tal stammte.<br />
35
Dem Haus Piguet & Meylan, das von 1811 bis zu seiner Auflösung im Jahre 1828 tätig war,<br />
gelang es, sich auf einem Markt zu behaupten, auf dem die Händler/Établisseure des<br />
Ancien Régime begannen, das Feld für neue Manufakturen zu räumen, und dies – nebenbei<br />
bemerkt – in einem noch sehr schwierigen wirtschaftlichen Klima.<br />
Sie spezialisierten sich auf hochwertige Automaten und Musikwerkstücke, in den Fußspuren<br />
von Jaquet-Droz und Leschot. Genau wie sie arbeiteten auch Piguet & Meylan für<br />
den chinesischen Markt.<br />
Interessante Tatsache : Eine ihrer bekanntesten Uhren mit einem bellenden Hund <strong>zur</strong><br />
Anzeige der Stunden und Viertelstunden erinnert an eine Uhr, die von Jaquet-Droz und<br />
Leschot für James Cox angefertigt wurde : „ Eine Uhr mit Zylinder, bei der beim Öffnen der<br />
Lünette ein Hund bellt “ 7 .<br />
Unter den anderen ehemaligen Arbeitern von Jaquet-Droz und Leschot, die sich einen<br />
Namen machen konnten, sind die Gebrüder Rochat zu erwähnen. Die Söhne von David<br />
Rochat, François Elisée (1771–1836), Frédéric (1774–1848) und Samuel Henri (1777–1854)<br />
aus der Ortschaft Brassus im Joux-Tal, waren von Jacob Frisard mit der Vorbereitung<br />
von Singvogelmechanismen beauftragte Unterauftragnehmer. Sie werden mehrfach im<br />
Schriftverkehr zwischen Frisard und Leschot erwähnt. Als Jacob Frisard seltener <strong>zur</strong> Verfügung<br />
steht, wendet sich Leschot direkt an sie.<br />
Die Gebrüder Rochat, die sich um 1813 in Genf niederließen, hatten viel Erfolg als Hersteller<br />
von Singvögeln und fertigten eine große Vielzahl sehr schöner Stücke an. Das Familienunternehmen<br />
wurde von einer zweiten Rochat-Generation übernommen und weitergeführt.<br />
In unserer heutigen Zeit, in der die Forderungen nach Rentabilität und Schnelligkeit die<br />
Fantasie vollständig verbannt zu haben scheinen, gibt es noch eine kleine Anzahl von<br />
Kunsthandwerkern, die Berufe ausüben, die sich seit der Zeit von Jaquet-Droz kaum verändert<br />
haben.<br />
Sie werden von bestimmten Uhrmacher-Manufakturen unterstützt, die den Wert dieser<br />
Fachkenntnisse und Techniken aus einer anderen Zeit zu schätzen wissen und die diese<br />
durch die Anfertigung von außergewöhnlichen und einzigartigen Stücken zelebrieren<br />
möchten.<br />
Präzision, Geduld, Sorgfalt, Liebe <strong>zur</strong> schönen Arbeit : dies sind die Qualitäten, die diese<br />
Emailleure, Edelsteinfasser, Graveure und Kunststichler ausmachen – Kunsthandwerker,<br />
die unzählige Stunden damit verbringen, ihre Kreationen zu perfektionieren.<br />
Diese zeitgenössischen Stücke der hohen Uhrmacherkunst bezeugen den Fortbestand<br />
des Schöpfergeistes von Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz und Jean-Frédéric Leschot,<br />
sowie die Zeitlosigkeit ihrer Werke, deren Faszination und Verzauberung nie an Wirkung<br />
verloren haben.<br />
1 Schreiben von Leschot an Frisard, März 1793.<br />
2 Voltaire, Le Mondain, 1736.<br />
3 Geschäftsbücher Jaquet Droz und Leschot, Dezember 1785.<br />
4 Perregaux und Perrot, Die Jaquet Droz und Leschot, Gebrüder Attinger, 1916.<br />
5 Schriftwechsel zwischen dem Präfekten des Departements Haut-Rhin<br />
und dem Innenminister, Archive des Departements Haut-Rhin.<br />
6 In seinem Testament vom 22. August 1827, bestätigt am 27. August 1830,<br />
spricht Henri Maillardet von „ dem Wenigen, das ich derzeit besitze “.<br />
7 Geschäftsbücher Jaquet Droz und Leschot, Dezember 1785.<br />
36