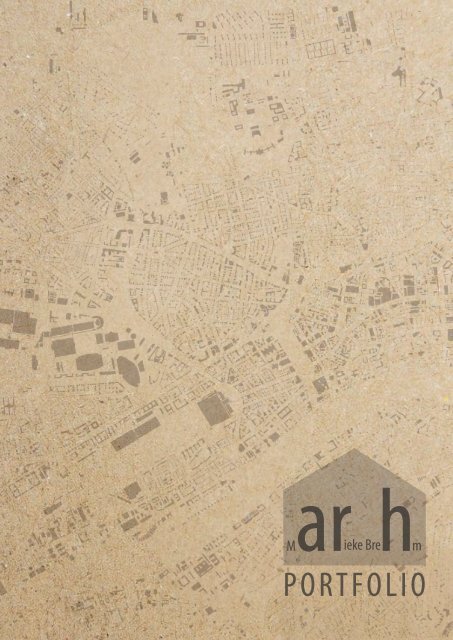Portfolio Marieke Brehm
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Mar h<br />
ieke Bre<br />
m<br />
PORTFOLIO
MARIEKE THERESE BREHM M.A.<br />
RÖDELHEIMER LANDSTRASSE 72<br />
60487 FRANKFURT<br />
+49160 7978662<br />
MARIEKEBREHM@GMAIL.COM<br />
14.08.1989<br />
CAD<br />
ADOBE<br />
SPRACHEN<br />
ARCHICAD, AUTOCAD, VECTORWORKS, SKETCHUP<br />
INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP<br />
DEUTSCH, ENGLISCH, SPANISCH
2013-2016 MASTERSTUDIUM AM FACHBEREICH ARCHITEKTUR<br />
AN DER UNIVERSITY OF APPLIED SIENCES FFM<br />
2014-2015 TUTORIN IM FACHBEREICH ARCHITEKTUR<br />
2016 ERFOLGREICHER MASTER ABSCHLUSS IM FACH ARCHITEKTUR<br />
2014-2015 WERKSTUDENTIN BEI AS&P IN DER ABTEILUNG<br />
FÜR STADTPLANUNG UND LANDSCHAFTSPLANUNG<br />
2015-2016 WERKSTUDENTIN IM ARCHITEKTURBÜRO HEROLD
KASSEL<br />
2009 - 2013 BACHELORSTUDIUM AN DER UNIVERSITÄT KASSEL (B. SC)<br />
IM FACHBEREICH ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG, LANDSCHAFTSPLANUNG<br />
2013 ERFOLGREICHER BACHEOLRABSCHLUSS IM FACH ARCHITEKTUR<br />
FRANKFURT<br />
ASCHAFFENBURG<br />
1989 GEBURT<br />
1996 - 2001 GRUNDSCHULE STRIETWALD<br />
2001 - 2009 KARL-THEODOR-V.-DALBERG GYMNASIUM<br />
2012 - 2014 PRAKTIKANTIN BEI B3 ARCHITEKTEN
1<br />
GEMEINSAMES WOHNEN IN SUDERWICK<br />
(BACHELOR THESIS)<br />
3<br />
WOHNEN AM BUNKER<br />
MUSEUM IM BUNKER<br />
2<br />
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM<br />
GSEducationalVersion
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
5<br />
TEXTILER PAVILLON<br />
4<br />
BESUCHERZENTRUM AM KAP ARKONA (MASTERTHESIS)
1<br />
GEMEINSAMES WOHNEN IN SUDERWICK<br />
(BACHELOR THESIS)
Mehrgenerationenwohnen<br />
Leben in Gemeinschaft, obgleich welchen Alters, Familien- oder Gesundheitszustands.<br />
Gemeinsame Aktivitäten, vielfältige Freizeitgestaltung,<br />
nachbarschaftliche Hilfe, aber auch private Wohnatmosphäre<br />
- diese Möglichkeiten eines selbstbestimmten, aber gemeinschaftlich<br />
organisierten Lebens werden in dem Entwurf voll ausgeschöpft.<br />
Um dem Ziel eines gemeinschaftlichen Miteinanders gerecht zu werden,<br />
stehen gemeinschaftliche Bereiche im Inneren wie im Äußeren<br />
bei diesem Entwurf im Vordergrund. Alle Gebäude sind barrierefrei<br />
geplant und somit für sämtliche Altersgruppen und auch für gesundheitlich<br />
beeinträchtigte Menschen geeignet. Der Entwurf setzt sich mit<br />
unterschiedlichen gesellschaftlichen Problematiken auseinander und<br />
möchte eine Wohntypologie vorschlagen, in der diese gelöst werden<br />
können. Besonders in ländlichen Regionen sind Modelle, die eine Alternative<br />
zum Einfamilienhaus oder dem klassischen Altersheim bieten.<br />
Obwohl viele Menschen aller Altersgruppen die Vorzüge des Landlebens<br />
zu schätzen wissen, ist die Angst vor der eventuell eintretenden<br />
Einsamkeit im Alter zunehmend Grund für eine Entscheidung gegen<br />
das Leben auf dem Land.<br />
Auf dem Grundstück befi ndet sich neben vier trapezförmigen Wohngebäuden<br />
noch ein Weiteres, das auch für die Öff entlichkeit zugänglich ist<br />
und verschiedene Nutzungen beinhaltet. Die Anordnung der Gebäude<br />
orientiert sich an dem Modell einer „Straße“; diese bildet den öff entlichen<br />
Raum aus und führt den Besucher auch zu dem öffentlichen<br />
Gebäude im hinteren Teil des Grundstücks.<br />
Hierbei läuft dieser an allen Wohngebäuden vorbei, welche mit ihren<br />
transparent gestalteten, zur Straße ausgerichteten Gemeinschaftsräumen<br />
einen Blick in ihr Innenleben freigeben. Das öff entliche Gebäude<br />
besitzt ebenfalls eine gläserne Fassade zur Straße und lädt den Besucher<br />
zum Eintreten ein.<br />
Die Straße ist wichtigster Indikator des Entwurfs: zum einen stellt sie<br />
Treffpunkt und Kommunikationsraum auf dem Grundstück dar - alle<br />
Gebäude werden von der Straßenseite her erschlossen - zum anderen<br />
fließt sie in die Gebäude hinein und bildet dort die, von den Bewohnern<br />
gemeinschaftlich genutzten Bereiche aus, die wiederum als eine Erweiterung<br />
des Straßenraumes gesehen werden können. Darüber hinaus<br />
entsteht eine Verknüpfung der Gebäude untereinander.
Das Wohnen<br />
Sieben Parteien teilen sich die dreigeschossigen, barrierefreien Wohngebäude.<br />
Die Wohnungen unterscheiden sich in ihrer Größe und sind<br />
dementsprechend für Singles, Paare oder Familien gedacht. Der Gemeinschaftsbereich<br />
jeden Hauses ist gleichzeitig der Eingangsraum;<br />
ein Hindurchlaufen ist also notwenig, bevor man die eigene Wohnung<br />
erreichen kann. Diese Struktur unterstützt und fördert das gemeinschaftliche<br />
Leben der Bewohner.<br />
Der Erschließungskern ist in form eines Keiles ausgebildet, der das Gebäude<br />
mittig durchzieht. Er ist großzügig angelegt, um<br />
weitere Kommunikationsflächen in den oberen Geschossen zu bieten.<br />
Durch Deckenversprünge werden geschossübergreifende Blickbeziehungen<br />
freigegeben.<br />
Beim Eintreten in das öffentliche Gebäude befindet man sich direkt in<br />
einem kleinen Hofladen, in dem unter anderem die Erzeugnisse aus<br />
den Gemüsegärten der Bewohner angeboten werden können. Dahinter<br />
verbirgt sich eine Erlebniswelt mit einer Kletterwand, die sich bis ins<br />
Untergeschoss erstreckt und einen großen Luftraum ausbildet. Es gibt<br />
außerdem einen Multifunktionsraum mit Mediathek<br />
und Spielnischen, die mittels mobilen Wänden von den Kindern und<br />
Jugendlichen selbst ausgebildet und definiert werden können. Im<br />
Obergeschoss des Gebäudes befinden sich ein Café mit angrenzendem<br />
Leseraum und eine Kreativwerkstatt, die einerseits von den Bewohner<br />
genutzt, andererseits aber auch als Veranstaltungsort für Kreativ- und<br />
Handwerkerkurse unterschiedlichster Art dienen kann.<br />
Durch die Nutzungsvielfalt des öff entlichen Gebäudes wird ein miteinander<br />
unterschiedlicher Altersgruppen geschaff en. Es entsteht für die<br />
Einwohner von Suderwick ein neuer Treff punkt.
2<br />
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM
DAI<br />
Deutsches<br />
Architektur<br />
Institut<br />
Das neu geplante Architekturinstitut dient als eine Erweiterung der<br />
architektonischen Einrichtungen in Frankfurt, wie zum Beispiel dem<br />
Deutschen Architekturmuseum oder der Fakultät für Architektur. Der<br />
Standort des neu geplanten Institutes befindet sich fußläufig vom<br />
Hauptbahnhof und der Innenstadt entfernt.<br />
Das neue Institut füllt das Grundstück mit einer flachen gläsernen Kubatur,<br />
die sich wie ein Teppich in die städtebauliche Struktur einflechtet.<br />
Das nach Außen hin eingeschossig wirkende Gebäude ist 8 Meter hoch<br />
und grenzt sich somit klar von seinen vielgeschossigen Nachbarn ab,<br />
nähert sich jedoch bezüglich der Gebäudehöhen an die Industriebauten<br />
an, die an dieser Stelle in zweiter Reihe zum Flussufer des Mains<br />
platziert sind<br />
Das leicht auskragende Dach des Gebäudes wird unter anderem von den<br />
massiven Körpern getragen, die sich in verschiedenen Größen innerhalb<br />
der Gebäudehülle verteilen. In diesen befinden sich unterschiedliche<br />
Nutzungen. Das Tragwerk wird außerdem durch einige schmale Stützen<br />
ergänzt. Die Dachaufsicht bekommt durch die inhomogene Deckenstruktur<br />
einen reliefartigen Charakter.<br />
Innenhöfe und ein Glasdach bringen viel Licht in das Gebäude, welches<br />
mit einer Grundfläche von 60 auf 40 Meter m eine beachtliche<br />
Tiefe hat. Der Innenhof im Bereich der Bibliothek besticht neben seiner<br />
Größe auch mit seiner besonderen Aufenthaltsqualität. Neben einer<br />
Bibliothek befinden sich in dem Institut außerdem ein Vortragssaal<br />
und eine Ausstellungsfläche, die sich im Entré befindet und somit gut<br />
geeignet für Wechselausstellungen ist. Sowohl von der Mainseite als<br />
auch von der Tiefgarage aus kann der Besucher das Gebäude betreten<br />
und kommt über das Foyer schnell an Informationen und Auskünfte,<br />
wenn gewünscht. Der Seminarraum, der für Hochschulen geeignet ist,<br />
gliedert sich ebenfalls an das Foyer an, somit findet eine offene Durchwegung<br />
im ganzen Gebäude statt.<br />
Das Institut besitzt ausserdem einen Bürotrakt, der neben dem Haupteingang<br />
auch einen eigenen Eingang erhält. Durch eine eingezogene<br />
Galerie verteilt sich das Arbeiten auf zwei Ebenen, die jedoch durch die<br />
innere Erschließung entlang eines Innenhofs verbunden bleiben. Einen<br />
kleinen Teil dieser Galerie kann auch der öffentliche Besucher des Institutes<br />
begehen und beispielsweise ein Buch aus der Bibliothek dort<br />
lesen.
3<br />
WOHNEN AM BUNKER<br />
MUSEUM IM BUNKER
Wohnen in Hamm<br />
Die fünf Gebäuderiegel verteilen sich in regelmäßigen Abständen auf<br />
dem ehemaligen Kirchengelände. Dabei bilden sich im hinteren Bereich<br />
des Grundstücks großzügige Frei- und Grünflächen aus. Die Gebäude<br />
sind durch eine Mauer straßenseitig miteinander verbunden. Somit<br />
ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild. Durch große Öffnungen in der<br />
Mauer schirmt sich die Neubebauung nicht ab sondern bildet Eingangszonen<br />
zwischen den Gebäduen aus.<br />
Der Entwurf sieht durch sein Reihenhauskonzept einen Zuzug junger<br />
Familien vor, welche das Wohnviertel mit einer gemeinschaftlichen<br />
Idee beleben soll. Die Wohnungen sind einheitlich nach Süden orientiert.<br />
Die Reihenhäuser bieten verschiedene Möglichkeiten der Außenraumnutzungen,<br />
wie Terrassen im Eingangsbereich, die sich jeweils an<br />
den Küchen orientieren, Gärten, die auf der Südseite zum Verweilen<br />
einladen, sowie Dachterrassen, welche rundum geschützt sind und<br />
somit Privatsphäre bieten. Der zur Sedanstraße ausgerichtete Gebäuderiegel<br />
lässt sich im Erdgeschoss barrierefrei erschließen und richtet<br />
sich zu dem ehemaligen Vorplatz der Kirche hin. In diesem Gebäude<br />
befinden sich vier Paarwohnungen und eine Singlewohnung, welche<br />
beispielsweise für einen Kurator oder Künstler, der mit dem Hochbunker<br />
in Verbindung steht, bezogen werden kann. In den restlichen vier Gebäuden<br />
befinden sich Familienwohnungen, die durch ein umfließendes<br />
Freiflächenkonzept miteinander verbunden sind. Die Freiflächen bieten<br />
Möglichkeiten für „urban gardening“, Spielplätze und Pflanzbeete.
Kunst im Bunker<br />
Er steht mitten in der Hammer Innenstadt, der Hochbunker aus<br />
dem zweiten Weltkrieg. Mit seinen acht Stockwerken, knapp 24<br />
m Höhe und zwei Meter dicken Betonwänden ist er ein ziemlicher<br />
Koloss, den man schon von weitem erspäen kann.<br />
Das Nutzungskonzept des Hochbunkers sieht eine Umnutzung zu<br />
einem Museumsgebäude vor. Hierbei wird eine Zusammenarbeit<br />
mit dem in Hamm ansässigen Gustav-Lübke-Museum angestrebt.<br />
Die temporären Ausstellungen sollen sich in Zukunft auf drei Ebenen<br />
verteilen. Hierfür werden einige Geschossdecken eliminiert.<br />
Eine gefaltete Stahltreppe, die sich skulptural über die gesamte<br />
Höhe des Bunkers erstreckt, ermöglicht die Erschließung der Austellungsflächen.<br />
Eine Stahlwand trennt die Ausstellungsfläche<br />
von dem Erschließungsraum. Als Material für Stahltreppe und<br />
-wand wird Cortenstahl vorgesehen. Die Treppe durchdringt im<br />
Eingangsbereich die zwei Meter dicke Bunkerwand und endet<br />
sichtbar im Außenraum.
GSEducationalVersion<br />
bauanleitung<br />
1<br />
2<br />
4<br />
5<br />
klapp<br />
stuhl<br />
3<br />
6
4<br />
BESUCHERZENTRUM AM KAP ARKONA (MASTERTHESIS)
Kap Arkona<br />
Das Kap Arkona befindet sich auf der Halbinsel Wittow im Norden der<br />
Insel Rügen und gehört zu den herausragenden Landmarken der Ostseeküste.<br />
Der Ort ist ein kulturhistorisch bedeutsames Flächendenkmal<br />
mit einer ereignisreichen Geschichte. Geprägt durch die kulturelle<br />
Entwicklung, die Veränderungen der Natur und der geologischer Formation<br />
sowie bekannt als der Sehnsuchtsort der Romantik und des<br />
Klassizismus, wird das heutige Ausflugsziel von zahlreichen Touristen<br />
aufgesucht.<br />
Die Besonderheit des Ortes kann der Besucher bestenfalls erahnen, weil<br />
die bestehende Wegeführung veraltet ist und teilweise über Barrieren<br />
führt oder in Sackgassen endet. Die Küstenwege entlang der 43 m hohen<br />
Kreideküste sind nicht abgesichert und mussten teilweise gesperrt<br />
werden.<br />
Aufgrund der Küstenabtragung von jährlich 30 Zentimetern und der<br />
üppigen Vegetation entstand ein unübersichtliches Wegenetz, das<br />
kaum einen Ausblick auf das Meer zulässt.<br />
Ziel der Masterthesis ist es, ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes<br />
Konzept für den Gesamtbereich Kap Arkona zu entwickeln und ein Besucherzentrum<br />
zu entwerfen, wo die Geschichte des Ortes in musealen<br />
Einrichtungen erlebt werden kann. Dabei soll auch der Gebäudebestand<br />
eingebunden werden, wobei unbedeutende, mit der Zeit<br />
angesiedelte Bungalows und Ferienhäuser sowie einsturzgefährdete<br />
Gebäude außer Acht gelassen werden. Die hohe Erwartungshaltung<br />
der Besucher soll nicht länger enttäuscht werden.
Das Besucherzentrum<br />
Das neue Besucherzentrum am Kap Arkona befindet sich nördlich des<br />
Schinkelturms und hält sich mit seiner Architektur auf den ersten Blick<br />
zurück, indem es sich eingräbt und gegenüber den historischen Bauten<br />
aber auch der topographisch imposanten Situation nicht in Erscheinung<br />
tritt.<br />
Die Platzierung zwischen den Leuchttürmen und dem 2000 m² großen<br />
Marineführungsbunker ermöglicht nicht nur eine barrierefreie Anbindung<br />
an die Bunkeranlage, sondern schafft auch eine Verbindung dieser<br />
völlig unterschiedlichen Bauten. Um das Eingraben des Gebäudes zu ermöglichen,<br />
muss das Geländeniveau der Bunkeranlage in Richtung der<br />
Leuchttürme erweitert werden. Das Niveau des Besucherzentrums befindet<br />
sich somit zwischen dem des Leuchtturms und der Bunkeranlage.<br />
Die in der Neuorganisierung des Kaps geplante Fußgängerzone ist<br />
Teil des neuen Besucherzentrums. Die umliegenden Radwege werden<br />
durch einen sich kreuzenden Fußgängerweg ergänzt. Dieser Weg senkt<br />
sich ab, nachdem der Schinkelturm passiert wurde. Zunächst gelangt<br />
man auf einen Ankunfts- und Verteilerplatz, an den eine schräg verlaufende<br />
Achse angrenzt. Die Neigung der Achse entstand durch die Verbindung<br />
des Sommertheaters mit dem an der steilsten Stelle der Küste<br />
befindlichen Aussichtspunkt.<br />
Ein weiterer etwas kleinerer Platz hat neben der Verteilerfunktion auch<br />
diese, dass er durch das kleine Szenentheater mit integrierter Bar auch<br />
abends zum Verweilen einläd. Die Plätze und sich aufweitenden Straßen<br />
dienen außerdem dazu, dass vor den jeweiligen Gebäudeeingängen<br />
ausreichend Raum vorhanden ist.<br />
Der Aussichtspunkt zum Meer hin ist nur vom Museum aus erreichbar<br />
und nicht über den Küstenweg. Der jährliche Küstenabbruch wird<br />
hierbei thematisiert und gibt dem Aussichtspunkt zusätzlich einen<br />
Informationscharakter. Hierbei soll durch zu erwartende Jahreskennzeichnungen<br />
der rapide Abbruch verdeutlicht werden. Am anderen<br />
Ende der schräg<br />
verlaufenden Achse befindet sich ebenfalls ein Aussichtspunkt, von<br />
dem aus man das angrenzende Naturschutzgebiet sowie Putgarten und<br />
weit in die Ferne sehen kann. Weitere Aussichtspunkte befinden sich in<br />
der parallel gelegenen Bestandsachse, die vom Sommertheater über<br />
den Schinkelturm bis hin zum Künstlerhaus führt. Der Aussichtspunkt<br />
am Meer ist frei zugänglich und ermöglicht einen unbeschränkten Blick<br />
auf das Meer. Der bestehende Leerstand erhält neue Nutzungen, die<br />
sich rund um das Thema Kunst drehen sollen. An diesem Ort sind Kunstworkshops<br />
vorgesehen, die das Kap auch in der Nebensaison bespielen<br />
sollen.
Die Ausführung<br />
Der Weg, der sich in die Erde eingräbt und somit die Architektur abbildet,<br />
besteht aus einheitlich geweißten Beton. Die aus scheinbar einem<br />
Guss geformten weißen Gebäude und der im selben weißlichen Ton<br />
gehaltene Außenbelag des Weges wurde in Anlehnung an die weiße<br />
Kreideküste gewählt, die ein markantes Wahrzeichen für diesen Ort<br />
darstellt. Mit dem Passieren der Rampe umgibt man sich gänzlich mit<br />
der Materialität des Betons. Dies soll unter anderem den Fokus auf die<br />
Architektur mit ihren engen und weiten Räumen und auf die Ausstellungen<br />
richten und einen Gegenpart zum Schinkelturm und dem oben<br />
dominierenden Backstein sein. Neben dem Beton kommt als zweites<br />
Material Glas dazu. Dies sorgt für eine thermische Trennung und trägt<br />
zu dem Konzeptes der verschiedenen Schichten bei.<br />
Durch die beiden Materialien wird ein Kontrast geschaffen zwischen<br />
den massiven Bauteilen und der transparenten Verbindung zwischen<br />
Innen und Außen.<br />
Die im Außenraum befindliche Wegedecke ist ein mit Epoxidharz versehener<br />
Edelsplit, durch den eine fugenfreie, homogene Fläche erzeugt<br />
werden kann, die sich farblich an den Beton anpasst. Sobald das Gebäude<br />
betreten wird, geht der Boden über in einen geschliffenen Estrich<br />
mit einem Zusatz an Weißzementestrich. Dieser geht farblich passend<br />
in die Wandflächen aus Beton über. Die beachtlichen Wandstärken<br />
verstärken den massiven Charakter und bieten verschiedene Varianten<br />
von raumhaltigen Wänden an. Die Deckenaufsicht ergänzt das Materialunisono<br />
und schließt mit einer nach oben gefalteten Attika ab. Diese<br />
dient unter anderem der Absturzsicherung. Die auskragende Decke in<br />
der vordersten Schicht schafft einen stützenfreien Bereich, der sich zum<br />
Platz hin öffnet.<br />
Die Vollglasfassade bildet den Kontrast zur massiven, eingegrabenen<br />
Architektur und lässt einen ungestörten Blick auf das Geschehen im gesamten<br />
Besucherzentrum zu. Die mit Silikon verbundenen Glasscheiben<br />
werden durch Glasschwerter verstärkt und ausgesteift. Die Fassade an<br />
der Logierhausstube kann durch Schiebeelemente geöffnet werden und<br />
ermöglicht im Sommer einen vergrößerten Außenraum zum Platz hin.<br />
Die Öffnungen in der hinteren Schicht des Grundrisses sind Festverglasungen,<br />
die nach außen hin verspiegelt sind, sodass der Ausstellungsbesucher<br />
das Geschehen auf dem musealen Wegenetz betrachten kann,<br />
dem Außenstehenden aber nicht die Ausstellung vorweggenommen<br />
wird.
GSEducationalVersion<br />
5<br />
TEXTILER PAVILLON
Vom Faden zum<br />
gebauten Raum<br />
Die Modelle zeigen, wie der Materialentwurf schrittweise<br />
gestaltet wurde:<br />
1 Modelle als reine Schaumgitter, die dann im zweiten<br />
Schritt mit Seilen fixiert werden<br />
2 Das Schaumgitter wird durch Seilgelege ersetzt,<br />
die über den Schaum verbunden und auf Abstand<br />
gehalten werden<br />
3 Um möglichs knotenfreie und reißfeste Verbindungen<br />
zu erhalten, wird die Netzstruktur durch<br />
Flechten bzw. Verschmelzen der Einzelseile erreicht.<br />
Das Eigengewicht der Seile ist zu hoch - erst durch die Verwendung<br />
schaumgefüllte Textilschläuche entstehen neuartige, zug- und<br />
geleichermaßen druckfeste Leichtseile, geeignet für größere<br />
Raumelemente, siehe gebauter Prototyp.<br />
Denkbar sind dabei Übergänge unterschiedlicher Dichtigkeiten und<br />
Wandtiefen innerhalb von Wandelementen und auch graduelle<br />
Übergänge von Wand zu Dach.<br />
Im Dach wird die unterste Schicht nur aus Zugseilen, die obere aus<br />
den neu entwickelten, druck- und zugstabilen Leichtseilen ausgeführt.