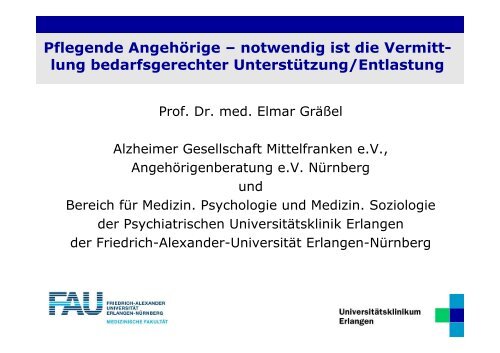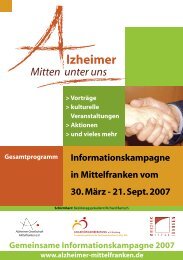(GBB-24) Subjektive Belastung Belastungs - Alzheimer Gesellschaft ...
(GBB-24) Subjektive Belastung Belastungs - Alzheimer Gesellschaft ...
(GBB-24) Subjektive Belastung Belastungs - Alzheimer Gesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pflegende Angehörige – notwendig ist die Vermittlung<br />
bedarfsgerechter Unterstützung/Entlastung<br />
Prof. Dr. med. Elmar Gräßel<br />
<strong>Alzheimer</strong> <strong>Gesellschaft</strong> Mittelfranken e.V.,<br />
Angehörigenberatung e.V. Nürnberg<br />
und<br />
Bereich für Medizin. Psychologie und Medizin. Soziologie<br />
der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen<br />
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
2<br />
� Versorgungssituation und Inanspruchnahme von<br />
Hilfen<br />
� <strong>Belastung</strong>ssituation pflegender (unterstützender)<br />
Angehöriger<br />
Thema I<br />
� Auswirkungen der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
� Entlastung: Ziele und Formen<br />
� Prävention der <strong>Belastung</strong>
Versorgung der Menschen mit regelmäßigem<br />
Pflegebedarf in Deutschland<br />
3<br />
im<br />
Pflegeheim<br />
zu Hause<br />
0,76 Millionen*<br />
1,70 Millionen**<br />
* Pflegestufe I bis III und Härtefälle am 01.01.2012 (stationärer Bereich)<br />
** Pflegestufe I bis III und Härtefälle am 01.01.2012 (ambulanter Bereich)<br />
Datenquelle:<br />
Bundesministerium für Gesundheit: Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung.<br />
www.bmg.bund.de (letzter Zugriff: 18.09.2012)
Versorgungskonstellationen bei<br />
Pflegebedürftigen in Privathaushalten<br />
4<br />
%<br />
Inanspruchnahme von Hilfen<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
nur private Pflege<br />
private & sonstige* Hilfen<br />
private & professionelle Pflege<br />
* z.B. hauswirtschaftlicher Art, Essen auf Rädern<br />
TNS Infratest Repräsentativerhebung (Schneekloth, 2005)<br />
nur professionelle Pflege<br />
Häusliche Versorgung<br />
wird<br />
in der Mehrzahl<br />
der Fälle ausschließlich<br />
als<br />
private Pflege<br />
durchgeführt!
Inanspruchnahme von „Beratungsangeboten“<br />
Regelmäßige Nutzung von „Beratungsangeboten“<br />
durch Hauptpflegepersonen bei Pflegebedürftigen in<br />
Privathaushalten<br />
%<br />
5<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Angehörigenberatung (Sprechstunde)<br />
telefonische Beratung<br />
Austausch mit professioneller Fachkraft<br />
insgesamt<br />
Angehörigenselbsthilfegruppe<br />
angeleitete Angehörigengruppe<br />
TNS Infratest Repräsentativerhebung (Schneekloth, 2005)<br />
Beratungs- und<br />
Entlastungsangebote<br />
werden von<br />
Angehörigen nur<br />
vereinzelt in<br />
Anspruch<br />
genommen!
6<br />
� Versorgungssituation und Inanspruchnahme von<br />
Hilfen<br />
� <strong>Belastung</strong>ssituation pflegender (unterstützender)<br />
Angehöriger<br />
Thema II<br />
� Auswirkungen der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
� Entlastung: Ziele und Formen<br />
� Prävention der <strong>Belastung</strong>
Hoher Zeitaufwand für pflegende Angehörige<br />
(hier: bei Demenz im leichten und mittelschweren Stadium)<br />
Pflegestunden pro Tag Pflegestunden pro Tag<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
leic hte Demenz<br />
(18-<strong>24</strong>)<br />
mittelsc hwere Demenz<br />
MMST (10-17)<br />
� über 80% der Betreuungszeit durch die<br />
Hauptpflegeperson<br />
� weitere Pflegepersonen bei Fortschreiten<br />
der Demenz<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
keine<br />
Pflegestufe<br />
Neubauer S, Holle R, Menn P, Großfeld-Schmitz M, Graesel E (2008).<br />
Measurement of informal care time in a study of patients with dementia.<br />
International Psychogeriatrics 20:1160-1176.<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
Stunden aller informellen<br />
Pflegepersonen<br />
Stunden der<br />
Hauptpflegeperson
Das Balance-Modell der Angehörigensituation<br />
(Gräßel & Adabbo, 2011)
• Allmähliche Übernahme von immer mehr Aufgaben für den<br />
Erkrankten (evtl. Aufgabe der Erwerbstätigkeit)<br />
• Konflikt mit anderen sozialen Rollen<br />
• Mangelnde Regenerationsmöglichkeit<br />
• Einschränkung sozialer Aktivitäten/Außenkontakte<br />
• Mangelnde Anerkennung der geleisteten Hilfe<br />
• Finanzielle Einbußen<br />
insbes. bei Demenz:<br />
• Desorientiertes, „unverständliches“ Verhalten<br />
• Sorge wegen selbstgefährdendem Verhalten<br />
• Allmählicher „Verlust“ der Rollenfunktion als<br />
Partner, Vater, Mutter, etc.<br />
9<br />
Stressoren in der häuslichen Pflege
Primäre und sekundäre Bewertung<br />
im Stressmodels von Lazarus und Folkman (1984)<br />
• Primäre Bewertung:<br />
Stellt eine Situation einen Verlust/eine Bedrohung dar?<br />
10<br />
ja: negative primäre Bewertung<br />
• Sekundäre Bewertung:<br />
Übersteigt eine Situation die eigenen Anpassungs-<br />
möglichkeiten?<br />
ja: negative sekundäre Bewertung
11<br />
Umgangsweisen mit Stress-Situationen:<br />
„Coping“<br />
• Emotionsorientiertes Coping:<br />
- Humor aktivieren<br />
- emotionale Unterstützung suchen<br />
- einer Sache etwas Positives abgewinnen können, …<br />
• Problemorientiertes Coping:<br />
- die eigenen Anstrengungen in der Sache erhöhen<br />
- praktische Unterstützung von anderen suchen, …<br />
• Dysfunktionales Coping:<br />
- den Umgang mit der Sache aufgeben<br />
- Selbstkritik üben<br />
- Alkohol und andere „Mittel“ einnehmen, …
12<br />
Kategorien der sozialen Unterstützung<br />
� Informationelle Unterstützung:<br />
Rat und Inforationen geben<br />
� Instrumentelle Unterstützung:<br />
Praktische Hilfe geben<br />
� Emotionale Unterstützung:<br />
Trost und Zuspruch geben<br />
� Bewertungsunterstützung:<br />
Vorstellungen/Bewertungen verstärken
13<br />
Positive Konsequenzen: Benefit<br />
• das Gefühl gebraucht zu werden<br />
• neue Fähigkeiten erlernen<br />
• Bedeutungszuwachs<br />
• Freude darüber, mit der erkrankten Person<br />
zusammen sein zu können<br />
...<br />
(Benefits treten weitgehend unabhängig vom<br />
<strong>Belastung</strong>serleben auf!)<br />
Was begünstigt das Erleben von Benefits?<br />
Unterstützung durch den (Ehe-)Partner
14<br />
Negative Konsequenz:<br />
<strong>Belastung</strong> und seine Auswirkungen<br />
Repräsentative Querschnittsuntersuchung über alle<br />
Ursachen der Pflegebedürftigkeit (Deutschland: Schneekloth,<br />
2006)<br />
Für wie belastet halten Sie sich?<br />
• gar nicht 5%<br />
• eher weniger 12%<br />
• eher stark 42%<br />
• sehr stark 41%<br />
Schneekloth U (2006). Entwicklungstrends und Perspektiven in der häuslichen Pflege.<br />
Zentrale Ergebnisse der Studie Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung<br />
(MuG III). Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 39:405-412.
Ausmaß der <strong>Belastung</strong> bei unterstützenden<br />
Angehörigen chronisch Kranker (ohne Demenz)<br />
<strong>Belastung</strong>s-<br />
ausmaß<br />
(HPS-<br />
Summenwert)<br />
0 – 41<br />
42 – 55<br />
56 – 84<br />
<strong>Subjektive</strong><br />
<strong>Belastung</strong><br />
nicht bis<br />
gering<br />
mittelgradig<br />
stark bis sehr<br />
stark<br />
Risiko<br />
psychosomatischer<br />
Beschwerden<br />
(<strong>GBB</strong>-<strong>24</strong>)<br />
nicht erhöht<br />
[bei 50%: PR > 50]<br />
erhöht<br />
stark erhöht<br />
[bei 90%: PR > 50]<br />
Häufigkeit<br />
(Referenzstichprobe<br />
N = 591)<br />
61,4 %<br />
<strong>24</strong>,4 %<br />
14,2 %<br />
Deutschlandweite Angehörigenbefragung bei 1911 pflegenden Angehörigen:<br />
Gräßel E (1998). <strong>Belastung</strong> und gesundheitliche Situation der Pflegenden. Querschnittuntersuchung<br />
zur häuslichen Pflege bei chronischem Hilfs- oder Pflegebedarf<br />
im Alter. Egelsbach u.a.: Hänsel-Hohenhausen (1997), 2. Aufl. (1998).
Ausmaß der <strong>Belastung</strong> bei unterstützenden<br />
Angehörigen von Demenzkranken<br />
<strong>Belastung</strong>s-<br />
ausmaß<br />
(HPS-<br />
Summenwert)<br />
0 – 35<br />
36 – 45<br />
46 – 84<br />
<strong>Subjektive</strong><br />
<strong>Belastung</strong><br />
nicht bis<br />
gering<br />
mittelgradig<br />
stark bis sehr<br />
stark<br />
Risiko<br />
psychosomatischer<br />
Beschwerden<br />
(<strong>GBB</strong>-<strong>24</strong>)<br />
nicht erhöht<br />
[bei 50%: PR > 50]<br />
erhöht<br />
stark erhöht<br />
[bei 90%: PR > 50]<br />
Häufigkeit<br />
(Referenzstichprobe<br />
N = 1236)<br />
33,8 %<br />
25,3 %<br />
40,9 %<br />
Deutschlandweite Angehörigenbefragung bei 1911 pflegenden Angehörigen:<br />
Gräßel E (1998). <strong>Belastung</strong> und gesundheitliche Situation der Pflegenden. Querschnittuntersuchung<br />
zur häuslichen Pflege bei chronischem Hilfs- oder Pflegebedarf<br />
im Alter. Egelsbach u.a.: Hänsel-Hohenhausen (1997), 2. Aufl. (1998).
Weiterführende Literatur<br />
• Gräßel E, Adabbo R (2011). Perceived burden of informal<br />
caregivers of a chronically ill older family member: burden in<br />
the context of the transactional stress model of Lazarus and<br />
Folkman. Journal of Gerontopsychology and Geriatric<br />
Psychiatry <strong>24</strong>:143-154.
18<br />
� Versorgungssituation und Inanspruchnahme von<br />
Hilfen<br />
� <strong>Belastung</strong>ssituation pflegender (unterstützender)<br />
Angehöriger<br />
Thema III<br />
� Auswirkungen der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
� Entlastung: Ziele und Formen<br />
� Prävention der <strong>Belastung</strong>
19<br />
Gesundheit<br />
<strong>Subjektive</strong><br />
<strong>Belastung</strong><br />
unterstützender<br />
Angehöriger<br />
Mortalitätsrisiko<br />
(Pinquart u. Sörensen, 2003) (Schulz u. Beach, 1999)<br />
“Pflegestil”<br />
(Grafström et al., 1993;<br />
Hansberry et al., 2005)<br />
<strong>Belastung</strong> als<br />
bedeutsamer Einflussfaktor<br />
Beendigung<br />
der häuslichen<br />
Pflege<br />
(z.B. Hirono et al., 2002;<br />
Yaffe et al., 2002;<br />
Nobili et al., 2004)
Körperliche und psychische Gesundheit<br />
Meta-Anlayse unter Einbeziehung von 84 Studien, die<br />
einen Vergleich zu nicht pflegenden Personengruppen<br />
ermöglichten (Pinquart u. Sörensen, 2003):<br />
•Körperliche Beschwerden:<br />
Bei pflegenden Angehörigen signifikant häufiger, jedoch kein<br />
sehr großer Unterschied zu Nichtpflegenden (g=0,18)<br />
•Depressivität:<br />
Bei pflegenden Angehörigen signifikant stärker ausgeprägt<br />
(g=0,58)<br />
Achtung: Der Zusammenhang mit der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
wurde nicht untersucht!<br />
g: Effektstärke<br />
20
Ehepartner, die die Pflege als belastend<br />
empfanden, zeigten im Gegensatz zu<br />
pflegenden Ehepartnern, für die die häusliche<br />
Pflege keine <strong>Belastung</strong> darstellte, im<br />
beobachteten Zeitraum von 4,5 Jahren ein um<br />
das 1,6-fache erhöhtes Risiko zu sterben<br />
(Schulz und Beach, 1999).<br />
21<br />
Sterblichkeitsrisiko bei unterstützenden<br />
Angehörigen
22<br />
„Abuse“ in der häuslichen Pflege<br />
„Abusive behavior“ in der häuslichen Pflege im<br />
Zusammenhang mit der subjektiven <strong>Belastung</strong> der<br />
pflegenden Angehörigen (Spontanäußerungen in<br />
Interviews)<br />
Grafström et al. (1993). Scandinavian Journal of Social Medicine 21:<strong>24</strong>7-255
23<br />
Demenz und „elder abuse“<br />
� Zusammenhang zwischen Demenz und „elder<br />
abuse“<br />
� Hypothese: „Herausfordernde“ Verhaltensweisen,<br />
Nachlassen von Fähigkeiten und die Abhängigkeit<br />
von Hilfe begünstigen „abusive behavior“<br />
� „Stress“ (subj. <strong>Belastung</strong>) der Pflegenden (zu Hause<br />
oder im Pflegeheim) als ein Risikofaktor für „abusive<br />
behavior“<br />
Hansberry et al. (2005). Clinics in Geriatric Medicine 21:315-332
<strong>24</strong><br />
Prävention und Gegenmaßnahmen<br />
� Schulung der Pflegenden:<br />
- Verlauf der Demenz<br />
- Einstellen auf die Bedürfnisse der Menschen mit<br />
Hilfe-/Pflegebedarf<br />
� Unterstützung der Pflegenden:<br />
- Vermittlung von Entlastungsangeboten<br />
- Behandlung der depressiven Verstimmungen der<br />
Pflegenden<br />
Hansberry et al. (2005). Clinics in Geriatric Medicine 21:315-332
Von allen Angehörigenmerkmalen ist eine<br />
hohe subjektive <strong>Belastung</strong> der bedeutendste<br />
Prädiktor (Vorhersagewert) für den Übertritt<br />
der demenzkranken Person ins Heim<br />
(z.B. Hirono et al., 2002; Nobili et al., 2004; Yaffe et al., 2002).<br />
25<br />
Beschleunigung des Heimübertritts
26<br />
� Versorgungssituation und Inanspruchnahme von<br />
Hilfen<br />
� <strong>Belastung</strong>ssituation pflegender (unterstützender)<br />
Angehöriger<br />
Thema IV<br />
� Auswirkungen der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
� Entlastung: Ziele und Formen<br />
� Prävention der <strong>Belastung</strong>
27<br />
Ziele der Entlastung<br />
� Psychische und körperliche Gesundheit<br />
des unterstützenden Angehörigen<br />
erhalten / verbessern<br />
� Lebensqualität des Erkranken fördern<br />
� Häusliche Versorgung stärken
Thema „Umzug in ein Heim“ bei Pflegebedürftigen in<br />
Privathaushalten<br />
„Im Falle von<br />
Pflegebedürftigkeit<br />
… stellt sich oft die<br />
Frage, ob ein<br />
Umzug in ein<br />
Heim sinnvoll sein<br />
könnte. Wie ist es<br />
in Ihrem Fall? Ist<br />
ein solcher<br />
Umzug…“<br />
TNS Infratest Repräsentativerhebung (Schneekloth, 2005)<br />
28<br />
Häusliche Versorgung<br />
als Patienten- und Angehörigenwunsch<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
sehr wahrscheinlich<br />
eher wahrscheinlich<br />
unwahrscheinlich<br />
nicht sehr wahrscheinlich<br />
aus Sicht der<br />
Angehörigen<br />
aus Sicht der<br />
Pflegebedürftigen<br />
kommt auf gar keinen Fall in Frage
29<br />
Lebensqualität (LQ)<br />
in der häuslichen Versorgung<br />
LQ der Betroffenen:<br />
� Teilhabe am Alltag – auf den einzelnen abgestimmt<br />
� Würdevoller Umgang<br />
� Emotional positive Atmosphäre<br />
� Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse<br />
� Anrecht auf therapeutische Hilfen<br />
LQ des familiären Umfeldes (pflegender Angehöriger):<br />
� Eigene Bedürfnisse nicht vernachlässigen müssen<br />
� Anrecht auf gewünschte Entlastungsangebote
• Informationelle und/oder emotionale Unterstützung:<br />
Angehörigenberatung, -gruppe, Pflegekurs,<br />
Informationen durch den Arzt, *<br />
• Instrumentelle Unterstützung / zuhause:<br />
Unterstützung durch andere Familienmitglieder*<br />
Pflegedienst, Hauswirt. Hilfe, Betreuungsdienst, …<br />
• Instrumentelle Unterstützung / außer Haus / temporär:<br />
Betreuungsgruppe, Tagespflege, Kurzzeitpflege<br />
• Instrumentelle Unterstützung / außer Haus / dauerhaft:<br />
Betreutes Wohnen, Wohngruppe, Pflegeheim<br />
30<br />
Konkrete Formen der Entlastung
31<br />
� Versorgungssituation und Inanspruchnahme von<br />
Hilfen<br />
� <strong>Belastung</strong>ssituation pflegender (unterstützender)<br />
Angehöriger<br />
Thema V<br />
� Auswirkungen der subjektiven <strong>Belastung</strong><br />
� Entlastung: Ziele und Formen<br />
� Prävention der <strong>Belastung</strong>
Rechtzeitige Hilfe<br />
durch „Zugehende Angehörigenberatung“<br />
32<br />
Lösungsansatz
� Günstige Umgangsweisen des Angehörigen<br />
fördern<br />
Angehörigenschulung<br />
� Rechtzeitig individuelle Hilfen vermitteln<br />
Angehörigenentlastung<br />
33<br />
Prävention der <strong>Belastung</strong>
Aktiver Umgang mit der Situation stärken<br />
34<br />
- sich nicht zurückziehen: soziale Kontakte nicht aufgeben<br />
- soziale Unterstützung „einwerben“ (von andern<br />
Familienmitgliedern, Freunden etc.)<br />
- „problemorientierte“ Bewältigungsstrategien aktivieren:<br />
� Wissen und Kompetenzen erweitern (z.B. Umgang mit<br />
schwierigen Situationen)<br />
� direkte Entlastungsangebote nutzen (z.B. Helferinnen/<br />
Helfer)<br />
- „intrapsychische“ Bewältigungsstrategien aktivieren:<br />
� emotionale Entspannung (z.B. Entspannungstechniken<br />
anwenden)
Nutzung in %<br />
Inanspruchnahme Angehörigengruppen<br />
und –beratung<br />
(2 Jahre nach Projektbeginn; siehe: www.projekt-ida.de)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
3,4<br />
14,9<br />
14,5<br />
16,9<br />
68,7<br />
63,6<br />
Angehörigengruppen Angehörigenberatung<br />
Gruppe B und C: Vermittlung durch den Hausarzt<br />
Gruppe A: ohne systematische Vermittlung<br />
A<br />
B<br />
C