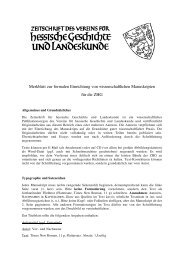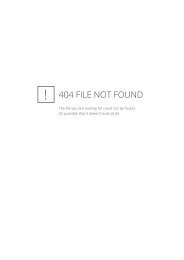Die fürstlichen Grabstätten in der Kasseler Martinskirche
Die fürstlichen Grabstätten in der Kasseler Martinskirche
Die fürstlichen Grabstätten in der Kasseler Martinskirche
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Archivalien:<br />
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Christian Presche<br />
Quellen und Literatur<br />
Akten, betreffend die unter dem Chor <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> Kassel entdeckte alte Fürstengruft<br />
1836. M<strong>in</strong>isterium des Inneren Rep. V, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand<br />
16, Nr. 5297.<br />
Decanat zu St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Cassel: Akten Chor, Sakristei, Fürstengruft, Archivsaal: Archiv des<br />
Gesamtverbandes <strong>der</strong> Evangelischen Kirchengeme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Kassel, im Landeskirchlichen<br />
Archiv Kassel. Bestand III, Kirchengeme<strong>in</strong>den, Dc 26 – IV.<br />
Königliches Consistorium für den Regierungsbezirk Cassel. Acta specialia, betreffend:<br />
<strong>Die</strong> Fürstengruft zu St. Mart<strong>in</strong>, die sogenannten Todtenfahnen daselbst, vol. I, 1888-<br />
1899; Landeskirchliches Archiv Kassel, Bestand Gesamtkonsistorium, Spezialakten,<br />
K IV / 4.<br />
Akten über die bauliche Unterhaltung von St. Mart<strong>in</strong>, 19. Jh.; Archiv des Gesamtverbandes<br />
<strong>der</strong> Evangelischen Kirchengeme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Kassel, im Landeskirchlichen Archiv Kassel,<br />
Bestand I, Stadtkirchenkasten, [GV / KS] 1005, 5.<br />
Akten des Landeskirchenamtes Kassel, St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Kassel 1946-1957, Nr. 413 VII, 462, Bd.<br />
1 und 2.<br />
Akten des Gesamtverbandes <strong>der</strong> Evangelischen Kirchengeme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Kassel, Bauabteilung,<br />
zum Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche.<br />
Tagebuch Willi Seidels; Stadtarchiv Kassel, Abt. C, Nachlaß Seidel.<br />
Schriftwechsel zwischen Pr<strong>in</strong>z Wolfgang von Hessen, Gottfried Kiesow (Landeskonservator),<br />
Dekan Giesler und dem Stadtarchiv Kassel aus den Jahren 1974/75 bezüglich <strong>der</strong> Fürstengrüfte;<br />
Stadtarchiv Kassel.<br />
Lageberichte des kommissarischen Polizeipräsidenten 1945-1948; Stadtarchiv Kassel, Abt. A,<br />
Bestand 1.10, Nr. 70-71.<br />
Zeitungsausschnitte zu St. Mart<strong>in</strong> / Mart<strong>in</strong>splatz im Stadtarchiv Kassel.<br />
Mikrofilme <strong>der</strong> hessischen Zeitungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Landesbibliothek und Murhardschen Bibliothek<br />
Kassel (Universitätsbibliothek).<br />
Zeichnungen:<br />
„Abriß <strong>der</strong>er Särge wie selbige <strong>in</strong> <strong>der</strong> Fürsten-Gruft <strong>in</strong> <strong>der</strong> grosen Kirche rangirt stehen <strong>der</strong>en<br />
Anzahl sich auf 37 erstrecket. Gezeichnet im Jahre 1758 und 1787; aquarellierte Fe<strong>der</strong>zeichnung,<br />
Signatur 2° Ms Hass. 496 [13, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Handschriftensammlung <strong>der</strong> Landesbibliothek<br />
und Murhardschen Bibliothek Kassel (Universitätsbibliothek).<br />
Jakob DEURER: Bauaufnahme <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> Kassel M 1:50 und 1:20, 1931; Pausen,<br />
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LafDH), Außenstelle Marburg, Plansammlung St.<br />
Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Kassel.<br />
Jakob DEURER: St. Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> Kassel. Aufnahmen <strong>der</strong> Grüfte und Särge, Zustand 1929,<br />
Blatt 329, J. DEURER 1933 nach e<strong>in</strong>er Aufnahme <strong>der</strong> Denkmalpflege; Pausen, LafDH Marburg,<br />
Plansammlung St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Kassel.<br />
Hugo SCHNEIDER: Entwurf für die Ausstattung <strong>der</strong> Sarghalle im Südturm (datiert: 1896);<br />
aquarellierte Fe<strong>der</strong>zeichnung, Staatliche Museen Kassel, Graphische Sammlung; Bildarchiv<br />
Foto Marburg LA 3763/53.<br />
Otto VOGEL: Entwürfe für den Wie<strong>der</strong>aufbau von St. Mart<strong>in</strong>, um 1954; Pausen und kolorierte<br />
Zeichnung, Geme<strong>in</strong>dearchiv.<br />
Zeitschrift des Vere<strong>in</strong>s für hessische Geschichte (ZHG) Band 107 (2002), S. 17-69
18<br />
Photographien:<br />
Christian Presche<br />
Stadtmuseum Kassel.<br />
Geme<strong>in</strong>dearchiv St. Mart<strong>in</strong>, (Freiheiter Geme<strong>in</strong>de) Kassel<br />
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LafDH), Außenstelle Marburg<br />
Gedruckte Quellen:<br />
Philipp LOSCH: Zwei <strong>Kasseler</strong> Chroniken des achtzehnten Jahrhun<strong>der</strong>ts, Kassel 1904.<br />
Friedrich NEBELTHAU (Hg.): <strong>Die</strong> hessische Congeries, <strong>in</strong>: ZHG 7, 1858, S. 309-384.<br />
Edith SCHLIEPER (Hg.): Das früheste Kirchenbuch <strong>der</strong> Altstadt Kassel 1565-1598 (Hessische<br />
Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 16), Kassel 1988.<br />
Friedrich Christoph SCHMINCKE: Monimenta Hassiaca, Cassel 1747-1765.<br />
Johannes SCHULTZE: Klöster, Stifter und Hospitäler <strong>der</strong> Stadt Kassel und Kloster Weißenste<strong>in</strong>.<br />
Regesten und Urkunden (VHKH 9,2), Marburg 1913.<br />
Literatur:<br />
Erw<strong>in</strong> BETTENHÄUSER (Hg.): Familienbriefe <strong>der</strong> Landgräf<strong>in</strong> Amalie Elisabeth von Hessen-<br />
Kassel und ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> (VHKH 56), Marburg 1994.<br />
Michael BRAUNE: Kirchengrüfte – unheimlich o<strong>der</strong> auch gefährlich?, <strong>in</strong>: Berichte zur Denkmalpflege<br />
<strong>in</strong> Nie<strong>der</strong>sachsen 3, 1990, S. 125-128.<br />
Hugo BRUNNER: Geschichte <strong>der</strong> Residenzstadt Cassel 913-1913, Cassel 1913.<br />
Jens Ludwig BURK: Pierre Etienne Monnot und die Entstehung des <strong>Kasseler</strong> Marmorbades –<br />
neue Archivfunde, <strong>in</strong>: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 25, 1998, S. 105-131.<br />
Wilhelm DILICH (eigentl. Wilhelm Scheffer): Hessische Chronica, Cassel 1605.<br />
Alhard VON DRACH, Gustav KÖNNECKE: <strong>Die</strong> Bildnisse Philipps des Großmütigen. Festschrift zur<br />
Feier se<strong>in</strong>es 400. Geburtstags (13. November 1904), hg. von <strong>der</strong> Historischen Kommission<br />
für Hessen und Waldeck, Marburg 1905.<br />
Ehren-Seule Dem Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Hn. Wilhelmen dem Sechsten [...]<br />
Zur ewigen höchstpreiß- und glorwürdigster Gedächtnüß auffgerichtet, R<strong>in</strong>teln o. J.<br />
Paul HEIDELBACH: Kassel. E<strong>in</strong> Jahrtausend hessischer Stadtkultur, hg. von Karl Kaltwasser, Kassel<br />
und Basel 1957.<br />
Jacob Christoph Carl HOFFMEISTER: Historisch-genealogisches Handbuch über alle L<strong>in</strong>ien des<br />
hohen Regentenhauses Hessen, 3. gänzlich umgearbeitete und ergänzte Auflage, Marburg<br />
1874.<br />
Alois HOLTMEYER: <strong>Die</strong> Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, Band VI:<br />
Kreis Cassel-Stadt, Marburg 1923.<br />
Bruno JACOB: <strong>Die</strong> <strong>Grabstätten</strong> zu St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Kassel, <strong>in</strong>: Hessenland 44, 1933, S. 22-25.<br />
G.: Noch e<strong>in</strong>mal die <strong>Grabstätten</strong> zu St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Kassel. E<strong>in</strong>ige ergänzende Bemerkungen, <strong>in</strong>:<br />
Hessenland44, 1933, S. 54 f.<br />
Jahrbuch <strong>der</strong> Denkmalpflege im Regierungsbezirk Cassel I, Marburg 1920.<br />
Carl KNETSCH: Das Haus Brabant. Genealogie <strong>der</strong> Herzoge von Brabant und <strong>der</strong> Landgrafen<br />
von Hessen, Darmstadt o. J.<br />
Volker KNÖPPEL: <strong>Die</strong> Fürstengruft <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche, <strong>in</strong>: Jahrbuch Landkreis Kassel<br />
2001, S. 110-112.<br />
Helmut KRAMM: Barocke Bauprojekte des hessischen Hofes, <strong>in</strong>: Festschrift Richard Hamann,<br />
Leipzig 1939, S. 46-65.<br />
Helmut KRAMM: <strong>Die</strong> Entstehungsgeschichte <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Orangerie und die hessischen Orangeriebauten,<br />
<strong>in</strong>: Hessenland 52/53, 1940/41, S. 82-107.<br />
Walter KRAMM: <strong>Die</strong> beiden <strong>Kasseler</strong> Hofbildhauerwerkstätten im 16. und 17. Jh., Son<strong>der</strong>druck<br />
aus dem Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft VIII / IX.<br />
Walter KRAMM: Kassel, Wilhelmshöhe, Wilhelmsthal, München 1951.<br />
Johann Christian KRIEGER (Hg.): Cassel <strong>in</strong> historisch-topographischer H<strong>in</strong>sicht nebst e<strong>in</strong>er<br />
Geschichte und Beschreibung von Wilhelmshöhe und se<strong>in</strong>en Anlagen, Marburg 1805.<br />
Friedrich KÜCH: <strong>Die</strong> Landgrafengräber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Elisabethkirche zu Marburg, <strong>in</strong>: ZHG 36, 1903,<br />
S. 145-225.<br />
Georg LANDAU: <strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> Grabmäler <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche <strong>der</strong> h. Elisabeth zu Marburg, <strong>in</strong>:<br />
ZHG 6, 1850, S. 184-195.<br />
Wilhelm LANGE: Begräbnisse zu St. Mart<strong>in</strong>, <strong>in</strong>: ZHG 34, 1901, S. 380-392.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Eberhard LEPPIN: <strong>Die</strong> Elisabethkirche <strong>in</strong> Marburg an <strong>der</strong> Lahn, Königste<strong>in</strong> im Taunus 1974.<br />
Monumentum Sepulcrale ad Illustrissimi Celsissimique Pr<strong>in</strong>cipis ac Dom<strong>in</strong>i DN Mauritii [...]<br />
memoriam gloriae sempiternam erectum, Cassel 1638.<br />
Friedrich MÜLLER: Kassel seit siebzig Jahren, Kassel 1876.<br />
Leonhard MÜLLER: Der Leichenzug Philipps des Großmütigen, <strong>in</strong>: Philipp <strong>der</strong> Großmütige,<br />
hg. von dem Historischen Vere<strong>in</strong> für das Großherzogtum Hessen, Marburg 1904, S. 590-<br />
594.<br />
Robert PESSENLEHNER: Wolf von Both und Hans Vogel, Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-<br />
Kassel, e<strong>in</strong> Fürst <strong>der</strong> Rokokozeit, München 1964 (VHKH 27,1), <strong>in</strong>: Fuldaer Gbll. 42,<br />
1966, Nr. 6, S. 197-208.<br />
Christian PRESCHE: <strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche, <strong>in</strong>: Jahrbuch<br />
des Landkreises Kassel 2002, S. 86-90.<br />
Gerhard RAFF: Hie gut Wirtemberg allewege, Stuttgart 1988 ff.<br />
Philipp Julius REHTMEIER: Braunschweig-Lüneburgische Chronica, Braunschweig 1722.<br />
Lore RITGEN, Peter THORNTON: <strong>Die</strong> Gewän<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Gruft <strong>der</strong> Landgrafen von Hessen-<br />
Kassel. I. Lore RITGEN: Beschreibung und Schnitte <strong>der</strong> Gewän<strong>der</strong>, II. Peter THORNTON:<br />
<strong>Die</strong> Seiden und ihre Herkunft, <strong>in</strong>: Waffen- und Kostümkunde. Dritte Folge <strong>der</strong> „Zeitschrift<br />
für historische Waffenkunde“. Zweiter Band, 1960, Heft 2, S. 61-70, S. 71-79.<br />
Christoph VON ROMMEL: Geschichte von Hessen, Marburg und Cassel 1820-1858.<br />
Johann Justus WINKELMANN: Gründliche und warhafte Beschreibung <strong>der</strong> Fürstenthümer<br />
Hessen und Hersfeld [...], Bremen 1697.<br />
August WORINGER: <strong>Die</strong> Entfernung <strong>der</strong> hessischen Hoheitszeichen während <strong>der</strong> westfälischen<br />
Zeit, <strong>in</strong>: MHG 1905/06, S. 43 f.<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kasseler</strong> Hauptkirche St. Mart<strong>in</strong> diente seit Landgraf Philipp dem Großmütigen<br />
fast 250 Jahre lang als Grablege des hessischen Fürstenhauses (Hauptl<strong>in</strong>ie<br />
Hessen-Kassel). Dennoch breitet sich über die Geschichte ihrer beiden Grüfte<br />
bislang immer noch e<strong>in</strong> Schleier <strong>der</strong> Unkenntnis; die Gründe hierfür liegen zum<br />
e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> <strong>der</strong> Unzugänglichkeit <strong>der</strong> älteren Chorgruft, zum an<strong>der</strong>en <strong>in</strong> den schweren<br />
Verlusten <strong>der</strong> jüngeren Gruft während und nach dem Zweiten Weltkrieg. So ist die<br />
Bedeutung dieser <strong>Grabstätten</strong> für die Landesgeschichte bislang kaum gewürdigt<br />
worden und auch im Bewusstse<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerung nur wenig verankert; zwar<br />
wird die neuere, zweite Gruft <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>mal jährlich beim Tag des Offenen<br />
Denkmals dem Publikum geöffnet, doch vermitteln die wenigen dort noch stehenden<br />
Särge kaum mehr e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck des früheren Zustandes.<br />
Im vorliegenden Aufsatz sollen daher die Fürstengrüfte <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> ihrer<br />
ursprünglichen Lage und Situation sowie im Wandel <strong>der</strong> Zeiten vorgestellt werden;<br />
dabei handelt es sich zum Teil um e<strong>in</strong>e Auswertung unveröffentlichter Kirchen-<br />
und Staatsakten, zum Teil um Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Restaurierung <strong>der</strong><br />
Kirche <strong>in</strong> den Jahren 1929-35. 1 Als Voraussetzung für die weiteren Untersuchungen<br />
dient außerdem <strong>der</strong> Versuch, e<strong>in</strong>e Übersicht über alle nachweisbaren<br />
<strong>fürstlichen</strong> Bestattungen <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> vorzulegen. Beson<strong>der</strong>es Interesse gilt auch<br />
den Umgestaltungen anlässlich mehrerer Renovierungen, sowie dem Schicksal<br />
<strong>der</strong> Särge während und nach dem Zweiten Weltkrieg – jeweils vielsagende Zeit-<br />
––––––––––<br />
1 Hierzu bisher: JACOB (vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis), sowie danach PRESCHE als<br />
Antwort auf KNÖPPEL, mit <strong>der</strong> Erstpublikation des Grundrisses.<br />
19
20<br />
Christian Presche<br />
zeugnisse. Insbeson<strong>der</strong>e wäre ohne die Kenntnis <strong>der</strong> Vorgänge nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg die gegenwärtige Situation kaum verständlich; e<strong>in</strong>e Aufarbeitung<br />
dieses „Krim<strong>in</strong>alstückes“ ist bislang ebenfalls e<strong>in</strong> Desi<strong>der</strong>at gewesen.<br />
Untrennbar mit den <strong>Grabstätten</strong> verknüpft s<strong>in</strong>d die drei <strong>fürstlichen</strong> Grabdenkmäler;<br />
auf sie wird zu späterer Zeit noch ausführlich e<strong>in</strong>gegangen werden.<br />
<strong>Die</strong> Glie<strong>der</strong>ung erfolgte chronologisch, gemäß den <strong>in</strong>haltlichen Zäsuren mit<br />
folgenden Abschnitten:<br />
I. Mittelalterliche Bestattungen<br />
II. Neuzeitliche Bestattungen<br />
1. <strong>Die</strong> Fürstengruft unter dem Chor<br />
2. <strong>Die</strong> zweite Fürstengruft unter dem Kapitelsaal, die Neuordnungen <strong>der</strong><br />
Gruft <strong>in</strong> den Jahren 1898 und 1935 sowie <strong>der</strong> Neuaufbau nach 1945<br />
Anhang: Stammtafel des Fürstenhauses.<br />
I. Mittelalterliche Bestattungen<br />
Im Mittelalter war es üblich, daß die Angehörigen des hessischen Landgrafenhauses<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Wallfahrtskirche St. Elisabeth <strong>in</strong> Marburg beigesetzt wurden; die direkte<br />
Nähe zu <strong>der</strong> Heiligen, die ja die Ahnfrau <strong>der</strong> Fürsten war, barg gleich mehrere<br />
Vorteile: Zum e<strong>in</strong>en die bedeutenden religiösen Aspekte, zum an<strong>der</strong>en die Berufung<br />
auf die Heilige zur Herrschaftslegitimation <strong>der</strong> hessischen Dynastie – beson<strong>der</strong>s<br />
das Ma<strong>in</strong>zer Erzstift stellte ja die Rechtmäßigkeit <strong>der</strong> Erbfolge seit dem Aussterben<br />
<strong>der</strong> Ludow<strong>in</strong>ger bis <strong>in</strong> das 15. Jh. h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> immer wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> Frage und versuchte<br />
mehrfach, die Territorien an sich zu br<strong>in</strong>gen. – <strong>Die</strong> Bestattungen 2 im sogenannten<br />
Landgrafenchor (südl. Querhauskonche) erfolgten meist <strong>in</strong> Holzsärgen<br />
mit Le<strong>der</strong>- o<strong>der</strong> Tuchbekleidung, die <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e, von Ste<strong>in</strong>platten gefaßte Kammern<br />
versenkt wurden, mit e<strong>in</strong>er Holzplatte abgedeckt. An e<strong>in</strong>er geeigneten freien Stelle<br />
<strong>der</strong> Konche wurde zumeist e<strong>in</strong> Grabdenkmal errichtet. <strong>Die</strong> Enge <strong>der</strong> dicht liegenden<br />
Gräber und <strong>der</strong> großen Monumente machte es häufig sogar erfor<strong>der</strong>lich,<br />
Grabdenkmäler bei neuen Bestattungen zwischenzeitig abzubauen bzw. zu versetzen<br />
und sie dann wie<strong>der</strong> an ihren alten Platz zurückzubr<strong>in</strong>gen.<br />
In Ausnahmefällen wurden Bestattungen aber auch <strong>in</strong> Kassel <strong>in</strong> <strong>der</strong> Marienkirche<br />
des Prämonstratenser<strong>in</strong>nen-Stifts auf dem Ahnaberg vorgenommen (im 16. Jh.<br />
abgebrochen) 3 ; so verzichtete man lieber darauf, den verstorbenen Landgrafen<br />
Johannes und se<strong>in</strong>e Frau von Kassel nach Marburg zu überführen: Sie waren im<br />
Jahre 1311 <strong>der</strong> Pest zum Opfer gefallen. Angeblich soll <strong>in</strong> <strong>der</strong>selben Gruft dann<br />
auch se<strong>in</strong> Bru<strong>der</strong> und Nachfolger Otto im Jahre 1328 bestattet worden se<strong>in</strong>; dabei<br />
habe man den Leichnam des Johannes „unverwesen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em silbern stück lie-<br />
––––––––––<br />
2 <strong>Die</strong> Gräber wurden anlässlich e<strong>in</strong>er Instandsetzung 1847 untersucht; s. LANDAU, S. 186,<br />
sowie den Anhang bei KÜCH.<br />
3 Vgl. zu den Bestattungen HOLTMEYER, S. 136. <strong>Die</strong> dortige Lokalisierung <strong>der</strong> Kirche wohl<br />
irrig; die fürstliche Gruft – unter dem Westchor <strong>der</strong> Kirche zu suchen – dürfte ca.30-40 m<br />
östl. des Zeughauses direkt an <strong>der</strong> Zeughausstr. noch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erde liegen. Hier könnten<br />
Grabungen bes. zur Klosteranlage des 12. Jhs. wichtige Informationen br<strong>in</strong>gen.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
gendt“ aufgefunden. 4 Außerdem fanden drei hessische Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ahnaberger<br />
Stiftskirche ihre letzte Ruhe: Nach 1370/71 wurde dort die Tochter He<strong>in</strong>richs<br />
II. und verheiratete polnische König<strong>in</strong> Adelheid beigesetzt; sie war aus <strong>der</strong><br />
Gefangenschaft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sie durch ihren untreuen Ehemann Kasimir III. gehalten<br />
wurde, wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> ihre Heimat geflohen. 5 Ebenso Adelheids jung und unverheiratet<br />
verstorbene Schwester Jutta, und als Nonne des Stiftes Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Anna (1513),<br />
Tochter Wilhelms I. 6<br />
<strong>Die</strong> zweite <strong>Kasseler</strong> Stiftskirche, St. Mart<strong>in</strong>, Maria und St. Elisabeth geweiht,<br />
hatte im Jahre 1462 ihre endgültige Weihe erhalten –etwa 120 Jahre nach Baubeg<strong>in</strong>n.<br />
7 <strong>Die</strong> Kirche mit angeglie<strong>der</strong>tem Chorherrenstift war nun das größte Gotteshaus<br />
Kassels (Abb. 1). <strong>Die</strong> erste fürstliche Bestattung erfolgte am 25. Januar 1471;<br />
beigesetzt wurde damals Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Agnes, die als Herzog<strong>in</strong> von Braunschweig-<br />
Gött<strong>in</strong>gen 9 Tage zuvor <strong>in</strong> [Hannoversch] Münden gestorben war (*1391). 8 Zu<br />
ihrem Andenken errichtete man <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche e<strong>in</strong>e Tumba nach dem Vorbild <strong>der</strong><br />
Marburger Landgrafengräber (=Grabmal <strong>in</strong> Anlehnung an e<strong>in</strong>en Sarkophag);<br />
––––––––––<br />
4 DILICH, S. 182. Danach WINKELMANN, II. Teil, S. 308, und HOLTMEYER, S. 136. WINKEL-<br />
MANN <strong>in</strong>terpretiert „stück“ als Kleidung, offenbar e<strong>in</strong>e Rüstung, HOLTMEYER hält den<br />
Sarg für silbern; die Ansicht WINKELMANNs dürfte vorzuziehen se<strong>in</strong>. Dagegen führt<br />
KNETSCH, S. 46, die Marburger Elisabethkirche als Begräbnisstätte an, mit Berufung auf<br />
die Chronik Wigand Gerstenbergs. Das Marburger Grabmal bedeutet aber nichts, es kann<br />
sich auch um e<strong>in</strong> Kenotaph handeln, wie für Johann und Adelheid (vgl. KÜCH, S. 173).<br />
Zu Johann und Adelheid s. KNETSCH, S. 47. Als Todesjahr Ottos bei DILICH 1326 angegeben,<br />
bei HOFFMEISTER, S. 8, und KNETSCH, S. 48 f., wohl richtiger 1328.<br />
5 KNETSCH, S. 50 f.; die Todesjahre 1340 <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Chronik, <strong>der</strong> „Hessischen Congeries“<br />
(NEBELTHAU, Congeries, S. 323), und 1356 bei DILICH, S. 183, falsch, da dieses Datum<br />
dort v. a. das Jahr <strong>der</strong> Flucht bezeichnet; danach HOFFMEISTER, S. 11 f., und<br />
BRUNNER, S. 43. HOLTMEYER, S. 183, ordnet ihr e<strong>in</strong> Grabste<strong>in</strong>fragment im Südturm von<br />
St. Mart<strong>in</strong> zu, JACOB vermutet es als Rest e<strong>in</strong>er Grabplatte e<strong>in</strong>es Stiftsherren aus dem abgebrochenen<br />
Kreuzgang; Bruno JACOB: Begräbnisse zu St. Mart<strong>in</strong>, <strong>in</strong>: <strong>Die</strong> Sonntagspost,<br />
Nr. 157, 48. Jg., 4. Blatt <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Post, 8. Juni 1930. <strong>Die</strong> Schrift des Ste<strong>in</strong>s nur noch<br />
stellenweise lesbar, die Identität unsicher; <strong>der</strong> Verstorbene trägt aber das Almutium (Umhang<br />
e<strong>in</strong>es Kanonikers), kniend, zu se<strong>in</strong>en Knien e<strong>in</strong> Adlerwappen.<br />
6 KNETSCH, S. 51, S. 65. HOFFMEISTER, S. 7, erwähnt fälschlich auch noch die Tochter von<br />
Johannes und Adelheid, Elisabeth; übernommen bei HOLTMEYER, S. 136. Tatsächlich<br />
starb sie erst 1369 und liegt <strong>in</strong> Neuburg im Elsaß begraben (KNETSCH, S. 50).<br />
7 <strong>Die</strong> letzten Altarweihen wurden 1461 vollzogen, im folgenden Jahr kam <strong>der</strong> Suffragan<br />
des Ma<strong>in</strong>zer Erzbischofs nochmals wegen des Kirchengebäudes nach Kassel;<br />
HOLTMEYER, S. 164 f. Der Baubeg<strong>in</strong>n dürfte <strong>in</strong> den späten 1330er o<strong>der</strong> frühen 1340er<br />
Jahren anzusetzen se<strong>in</strong>, aus denen <strong>der</strong> erste Indulgenzbrief datiert (1. Dez. 1343);<br />
SCHULTZE, Reg. 758. <strong>Die</strong> E<strong>in</strong>richtung des Stiftes fand 1366 statt, e<strong>in</strong> Jahr vor <strong>der</strong> Chorweihe<br />
(ebd., Reg. 772, 770 [mit vermutlich irriger Datierung], 773, 776). Im Sternerkrieg<br />
wurden die Arbeiten unterbrochen, ruhten ab 1402 endgültig und wurden erst 1430 wie<strong>der</strong><br />
aufgenommen (vgl. HOLTMEYER, S. 161).<br />
8 JACOB, S. 23, mit fehlerhaftem Todestag; vgl. KNETSCH, S. 53. REHTMEIER, S. 622, gibt<br />
zwar e<strong>in</strong>e Erdbestattung <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> an, wobei das Grabmal 1722 offenbar noch zu sehen<br />
war, er nennt aber ke<strong>in</strong>en Standort. Auch s<strong>in</strong>d genauere Pläne <strong>der</strong> Kirche aus <strong>der</strong> Zeit vor<br />
dem Siebenjährigen Krieg we<strong>der</strong> <strong>in</strong> Kassel noch im Staatsarchiv Marburg erhalten, so daß<br />
<strong>der</strong> Standort unbekannt bleibt. Agnes hatte das Stift im übrigen auch <strong>in</strong> ihrem Testament<br />
bedacht: Vgl. SCHULTZE, Reg.1041.<br />
21
22<br />
Christian Presche<br />
nach dem Siebenjährigen Krieg wurden die seitlichen Platten <strong>der</strong> Tumba allerd<strong>in</strong>gs<br />
für den neuen Altar <strong>der</strong> Kirche wie<strong>der</strong>verwendet. 9<br />
<strong>Die</strong> Grabstätte von Agnes soll sich im Chor <strong>der</strong> Kirche befunden haben 10 , doch<br />
s<strong>in</strong>d die genaue Lage sowie <strong>der</strong> Standort <strong>der</strong> Tumba bislang nicht festzustellen<br />
gewesen. Man könnte dabei aber an e<strong>in</strong>e gemauerte Gruft vor <strong>der</strong> Tür zum Wendelste<strong>in</strong><br />
denken; <strong>in</strong> dieser wurden 1929 nur noch <strong>der</strong>art ger<strong>in</strong>ge Reste gefunden,<br />
daß e<strong>in</strong>e Identifizierung nicht möglich war. <strong>Die</strong> übrigen aufgedeckten <strong>Grabstätten</strong><br />
scheiden jedenfalls aus. 11 Mit <strong>der</strong> späteren <strong>fürstlichen</strong> Gruft im Chor bestand ke<strong>in</strong><br />
Zusammenhang.<br />
Der Chor diente damals (neben dem Kreuzgang) vor allem als Begräbnisstätte<br />
e<strong>in</strong>iger Stiftsherren, wobei aber durch Chorgestühl, Altäre und Lettner dem Bestattungswesen<br />
enge Grenzen gesetzt waren. (<strong>Kasseler</strong> Bürger dagegen wurden z. T.<br />
im Langhaus <strong>der</strong> Kirche, vor allem aber im Kreuzgang beigesetzt.) – So wurden<br />
an <strong>der</strong> Nordseite des Chores im Jahre 1931 auch zwei Ste<strong>in</strong>särge entdeckt, <strong>in</strong> denen<br />
<strong>der</strong> Dekan Ludwig von Radehausen und <strong>der</strong> Kanoniker <strong>Die</strong>trich Schwarz<br />
beigesetzt worden waren (beide 15. Jh.). 12 Ob bzw. wieviel weitere Gräber von<br />
Stiftsherren dem Bau <strong>der</strong> ersten Fürstengruft zum Opfer gefallen s<strong>in</strong>d, ist unbekannt.<br />
II. Neuzeitliche Bestattungen<br />
1. <strong>Die</strong> Fürstengruft unter dem Chor<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse ist die große Fürstengruft unter dem Chor: Nach <strong>der</strong><br />
Reformation hatte Landgraf Philipp <strong>der</strong> Großmütige die Mart<strong>in</strong>skirche zur Begräbnisstätte<br />
des hessischen Fürstenhauses bestimmt. <strong>Die</strong>ser Bruch mit <strong>der</strong> Tradition<br />
wurde – abgesehen von an<strong>der</strong>en möglichen Gründen – alle<strong>in</strong>e schon deswegen<br />
nötig, weil die Marburger Elisabethkirche dem reichsunmittelbaren Deutschen<br />
Orden unterstand und somit bis zum Jahre 1570 weiterh<strong>in</strong> katholisch blieb. 13<br />
––––––––––<br />
9 JACOB S. 23; s. auch HOLTMEYER S. 176.<br />
10 <strong>Die</strong> Congeries meldet zum Jahre 1471: „Item starb Frau Agnese, geborne Landgräff<strong>in</strong> zu<br />
Hessen, Hertzog<strong>in</strong> zu Braunschweig, ward zu Cassel <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong>s Kirche <strong>in</strong> dem Chor<br />
begraben.“ NEBELTHAU, Congeries, S. 344. Vgl. zur unklaren Lage Anm. 8.<br />
11 Vgl. zu dieser Gruft JACOB, S. 24; er ordnet sie irrtümlich dem Pr<strong>in</strong>zen Philipp zu, wird<br />
dar<strong>in</strong> aber bereits von den BEMERKUNGEN korrigiert. Dort auch schon als Gruft <strong>der</strong><br />
Agnes vermutet (S. 55). <strong>Die</strong> Lage <strong>der</strong> Grüfte e<strong>in</strong>gezeichnet bei Jakob DEURER: St. Mart<strong>in</strong>skirche<br />
<strong>in</strong> Kassel, Grundriß-Aufnahme M 1:50, Dezember 1931; Landesamt für<br />
Denkmalpflege Hessen (LafDH), Marburg. <strong>Die</strong> übrigen <strong>Grabstätten</strong> s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Familiengruft<br />
des 17. Jhs., 2 Ste<strong>in</strong>särge von ma. Kanonikern (s. u.) und e<strong>in</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>grab, o<strong>der</strong> sie<br />
liegen unterhalb des Triumphbogens; dort befand sich aber im Mittelalter <strong>der</strong> Lettner.<br />
Von e<strong>in</strong>er Beseitigung <strong>der</strong> Grabstätte bei Anlage <strong>der</strong> Fürstengruft dürfte nicht auszugehen<br />
se<strong>in</strong>; möglicherweise nimmt <strong>der</strong>en seitlich verschobene Lage sogar auf die Gruft <strong>der</strong><br />
Agnes Rücksicht.<br />
12 JACOB, S. 23; s. die Auflistung e<strong>in</strong>iger Begräbnisse im Kreuzgang bei SCHULTZE, Reg.<br />
1003 und 1020, Anhang 28, sowie e<strong>in</strong>ige Urkunden. Vgl. zu den <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesamten<br />
Kirche DEURER, Grundriß (wie Anm. 11).<br />
13 LEPPIN, S. 14; vgl. a. HOLTMEYER, S. 168.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Zur Aufnahme <strong>der</strong> <strong>fürstlichen</strong> Toten wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche e<strong>in</strong>e Gruft<br />
unter dem Chor ausgehoben; <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zige Zugang 14 <strong>in</strong> das Gewölbe befand sich<br />
im Fußboden des ersten Langhausjoches, westlich vor dem damaligen Standort<br />
des Altares. Der E<strong>in</strong>stieg wurde – durch e<strong>in</strong>e Fußbodenplatte verschlossen – nur<br />
für die Bestattungen geöffnet 15 ; von dort führt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Stollen e<strong>in</strong>e Treppe <strong>in</strong><br />
die eigentliche Gruft h<strong>in</strong>ab. <strong>Die</strong>ses fensterlose Gewölbe ist ca. 3,10 m x 8,50 m<br />
(11´ x 30´) groß (Abb. 4) und gänzlich mit schwarzem Tuch ausgeschlagen. 16<br />
Als erster wurde dort vermutlich Pr<strong>in</strong>z Philipp Ludwig († 1535) beigesetzt, e<strong>in</strong><br />
Sohn des Landgrafen Philipp. 17<br />
<strong>Die</strong> Bestattungen <strong>in</strong> dieser ersten Fürstengruft erfolgten zunächst bis 1636,<br />
dann wurde e<strong>in</strong>e zweite Gruft unter dem ehemaligen Kapitelsaal e<strong>in</strong>gebaut;<br />
gleichwohl nahm man im Chor weiterh<strong>in</strong> noch vere<strong>in</strong>zelt Beisetzungen vor, bis<br />
die Gruft endgültig geschlossen blieb.<br />
<strong>Die</strong> erste Öffnung nach über 80 Jahren erfolgte im Jahre 1836 durch e<strong>in</strong>en Zufall,<br />
und zwar anlässlich <strong>der</strong> Restaurierung <strong>der</strong> Jahre 1834-44. Der nachfolgende<br />
Vorgang lässt dabei die historische E<strong>in</strong>stellung gegenüber dieser Begräbnisstätte<br />
––––––––––<br />
14 „Auszug aus dem Konsistorial-Protokolle, Kassel am 2ten Dezbr. 1836 Nr. 4301.“ M<strong>in</strong>isterialbeschluss<br />
vom 19.11.1836. Späterer Zusatz von an<strong>der</strong>er Hand: „Nach Aussage des Baurathes<br />
Rudolph bef<strong>in</strong>det sich dieser E<strong>in</strong>gang unmittelbar h<strong>in</strong>ter dem Altar nach Osten zu.<br />
Wird an dieser Stelle e<strong>in</strong>e Platte gehoben, so stößt man auf denselben. Von da führt e<strong>in</strong>e<br />
Treppe <strong>in</strong> dies so unter dem Chor bef<strong>in</strong>dliche durchaus dunkle Gruftgewölbe, welches mit<br />
Särgen <strong>der</strong> landgräflichen Familie angefüllt ist. Genannter Baurath leitete damals die Restaurationsarbeiten<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche.“ Decanat zu St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Cassel; Akten Chor, Sakristei,<br />
Fürstengruft, Archivsaal: Archiv des Gesamtverbandes Kassel, Bestand III, Dc 26–IV. <strong>Die</strong><br />
Bemerkung <strong>der</strong> Nähe zum Altar bezieht sich auf den Standort im 1. Joch, also nach <strong>der</strong> Restaurierung;<br />
aus dem Kommentar, daß Rudolph „damals“ die Arbeiten leitete, geht dies auch<br />
e<strong>in</strong>deutig hervor.<br />
15 <strong>Die</strong> Fußbodenplatte nicht zu verwechseln mit <strong>der</strong> Eisenplatte, die bei LANGE, S. 389, zum<br />
Jahre 1745 als vor dem Altar bef<strong>in</strong>dlich erwähnt wird: Bei dieser Platte handelt es sich<br />
um die gusseiserne Grabplatte <strong>der</strong> Freifrau von Wilmowsky († 1739), an <strong>der</strong> Treppe vor<br />
dem Altar beigesetzt (LANGE, S. 388, zur Platte HOLTMEYER, S. 183). Wenn bei<br />
KRIEGER, S. 295 ff., die umfangreiche Inschrift auf dem Sarg des Landgrafen Moritz angegeben<br />
ist, so deutet dies entgegen HOLTMEYER, S. 168, Anm. 2, nicht auf e<strong>in</strong>e Zugänglichkeit<br />
<strong>der</strong> Gruft h<strong>in</strong>; die Inschrift, die bei <strong>der</strong> dichten Stapelung auch kaum lesbar se<strong>in</strong><br />
dürfte, ist wohl aus dem MONUMENTUM SEPULCRALE, f. 47 und 48, übernommen (desgleichen<br />
die Inschrift am Epitaph des Pr<strong>in</strong>zen Philipp, mit allen Fehlern).<br />
16 Zur Lage <strong>der</strong> Gruft s. DEURER: Grundriß (wie anm. 11), und DERS.: Grüfte und Särge. Bei<br />
DEURER ist zwar ke<strong>in</strong>e Treppe e<strong>in</strong>gezeichnet, doch sche<strong>in</strong>t sie den Stollen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er ganzen<br />
Länge ausgefüllt zu haben, wie e<strong>in</strong>e Notiz des 18. Jhs. aussagt: „[...] das alte Gewölbe beim<br />
Altar ist bis auf die Treppe voll gesetzt“; samt e<strong>in</strong>er Auflistung <strong>der</strong> letzten fünf Bestattungen<br />
im Tagebuch <strong>der</strong> Hofverwaltung [Kassel] 1747-1757, zum 14.3.1754, zitiert bei<br />
PESSENLEHNER, S. 201 f.; die dort gemachten Anmerkungen im übrigen unzutreffend, da<br />
PESSENLEHNER die beiden Grüfte für identisch hält. Geme<strong>in</strong>t ist dort <strong>der</strong> alte Standort des<br />
Altars, vor <strong>der</strong> Sakristei. (Freundlicher H<strong>in</strong>weis auf diese Textstelle von Herrn Wegner,<br />
Stadtmuseum Kassel). Das schwarze Tuch gemäß e<strong>in</strong>em württembergischen Bericht von<br />
1669; freundlicher H<strong>in</strong>weis von Herrn Dr. Raff, Stuttgart; s. den <strong>in</strong> Kürze ersche<strong>in</strong>enden 3.<br />
Band von RAFF.<br />
17 Es ist allerd<strong>in</strong>gs unbekannt, wann die Gruft angelegt wurde. Anzunehmen ist, daß sie aus<br />
dem oben genannten Grund unmittelbar nach <strong>der</strong> Reformation ausgehoben wurde. <strong>Die</strong><br />
Angabe bei HOLTMEYER, S. 168, zu Christ<strong>in</strong>a ist <strong>in</strong> jedem Fall fehlerhaft (Druckfehler<br />
„1529“); übernommen bei KNÖPPEL, S. 110.<br />
23
24<br />
Christian Presche<br />
deutlich erkennen: Der E<strong>in</strong>gang war damals ebenso wie die Lage <strong>der</strong> Gruft längst<br />
<strong>in</strong> Vergessenheit geraten, wurde aber beim Abnehmen <strong>der</strong> Fußbodenplatten überraschend<br />
aufgedeckt. 18 <strong>Die</strong> Oberbaudirektion erstattete am 9.11.1836 dem Innenm<strong>in</strong>isterium<br />
darüber Bericht und kündigte e<strong>in</strong>e genaue Untersuchung <strong>der</strong> Gruft an.<br />
Das M<strong>in</strong>isterium verfügte daraufh<strong>in</strong> noch am selben Tag die sofortige Schließung<br />
des E<strong>in</strong>gangs und ersuchte den Kurpr<strong>in</strong>zen und Mitregenten um weitere Anordnungen.<br />
Schon am folgenden Tag wies Friedrich Wilhelm das M<strong>in</strong>isterium an, daß<br />
<strong>der</strong> E<strong>in</strong>gang „sofort wie<strong>der</strong> gänzlich zugemauert werde.“ Mit dem Vermerk „Eilt“<br />
wurde dieser Beschluß am 13. 11. an die Oberbaudirektion weitergeleitet, nebst<br />
dem Ausdruck des Mißfallens, „daß sie eigenmächtig zur Untersuchung <strong>der</strong> Fürstengruft<br />
zu schreiten sich habe für befugt erachten wollen.“ Oberbaudirektor Br omeis<br />
begründete am 22. 11. die Untersuchung als bautechnische Erfor<strong>der</strong>nis: E<strong>in</strong>em<br />
Gerücht zufolge bef<strong>in</strong>de sich e<strong>in</strong>e weitere Gruft außerhalb <strong>der</strong> Kirche, und<br />
e<strong>in</strong> möglicher Zugang von <strong>der</strong> Chorgruft aus müsse dann unter den Mauern des<br />
Chores verlaufen. E<strong>in</strong>e Untersuchung <strong>der</strong> Konstruktion „war <strong>in</strong> baulicher H<strong>in</strong>sicht<br />
wichtig“ gewesen, beson<strong>der</strong>s da die Mauern seit e<strong>in</strong>iger Zeit nach außen abgewichen<br />
seien. – <strong>Die</strong> Begehung <strong>der</strong> Gruft war also offenbar schon erfolgt, e<strong>in</strong> Bericht<br />
hierüber existiert aber aus naheliegenden Gründen nicht.<br />
Als 1840 <strong>der</strong> Altar aus akustischen Gründen versetzt wurde, fand er se<strong>in</strong>e Aufstellung<br />
genau am Gruftzugang (bis 1943). 19<br />
<strong>Die</strong> letzte Öffnung <strong>der</strong> Gruft erfolgte 1929, als diese bei Verlegung e<strong>in</strong>er neuen<br />
Heizung angeschnitten wurde. Das Gewölbe wurde beim Sche<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Taschenlampe<br />
durch den Regierungs- und Baurat Dr. Textor und durch Dr. Stolberg, Assistent<br />
des Bezirkskonservators, untersucht, die e<strong>in</strong>zelnen Särge erfasst. 20<br />
Nachdem die Gruft die Kriegszerstörungen unbeschadet überstanden hatte, unternahm<br />
man im Zuge des Wie<strong>der</strong>aufbaus 1957 den Versuch, von <strong>der</strong> neuen Gruft<br />
unter Kapitelsaal und Sakristei e<strong>in</strong>en Tunnel zu dem älteren Gewölbe zu brechen;<br />
er scheiterte allerd<strong>in</strong>gs an <strong>der</strong> Stärke <strong>der</strong> Chorfundamente und <strong>der</strong> Mauern <strong>der</strong><br />
dazwischenliegenden kle<strong>in</strong>eren Grüfte; die Arbeiten wurden e<strong>in</strong>gestellt, <strong>der</strong> bereits<br />
geschlagene E<strong>in</strong>gang des Tunnels wie<strong>der</strong> vermauert. 21 Im Jahre 1975 regte <strong>der</strong><br />
damalige Leiter des <strong>Kasseler</strong> Stadtarchivs, Dr. Litterscheid, erneut an, die Chorgruft<br />
zu öffnen – offenbar <strong>in</strong> völliger Unkenntnis <strong>der</strong> 1929 erfolgten Aufnahme:<br />
Für die Erhellung <strong>der</strong> hessischen Geschichte sei es äußerst wichtig, genau zu erfahren,<br />
was sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> vermauerten Gruft verberge, „nämlich ob sich dort neben<br />
Angaben über die Bestatteten weitere Inschriften, auch Grabbeigaben, künstlerische<br />
o<strong>der</strong> kunsthandwerklich bemerkenswerte Arbeiten o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e unerwartete<br />
––––––––––<br />
18 Vgl. Anm. 14. Der Schriftwechsel zwischen Oberbaudirektion, Innenm<strong>in</strong>isterium und Kurpr<strong>in</strong>zen<br />
<strong>in</strong>: Akten, betreffend die unter dem Chor <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> Kassel entdeckte alte<br />
Fürstengruft 1836, M<strong>in</strong>isterium des Innern Rep. V; StA MR, Bestand 16 Nr. 5297.<br />
19 Zur Versetzung vgl. den Kostenanschlag und die Kostenzusammenstellung <strong>der</strong> Baumeister<br />
Rudolph und Ritz von 1839/40 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> Akten über die bauliche Unterhaltung von<br />
St. Mart<strong>in</strong>: Archiv des Gesamtverbandes Kassel, Bestand I, [GV / KS] 1005, 5/1/4.<br />
20 JACOB, S. 24.<br />
21 Protokoll über die Besprechung am 10.3.1975, im Schriftwechsel zwischen Pr<strong>in</strong>z Wolfgang<br />
von Hessen, Gottfried Kiesow (Landeskonservator), Dekan Giesler und dem Stadtarchiv<br />
Kassel aus den Jahren 1974/75 bezüglich <strong>der</strong> Fürstengrüfte; Stadtarchiv Kassel.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
D<strong>in</strong>ge bef<strong>in</strong>den“.(!) 22 Der Vorschlag wurde im Kirchenvorstand diskutiert, und<br />
dieser sah z. Z. ke<strong>in</strong>e Möglichkeit für e<strong>in</strong>e solche Öffnung. Insbeson<strong>der</strong>e Dekan<br />
Giesler äußerte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Folge auch (berechtigte) Zweifel an S<strong>in</strong>n und Erfolg e<strong>in</strong>er<br />
<strong>der</strong>artigen Aktion. 23<br />
Es folgt e<strong>in</strong>e Liste <strong>der</strong> vermutlich <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Fürstengruft beigesetzten Angehörigen<br />
<strong>der</strong> landgräflichen Familie 24 , chronologisch geordnet nach dem Datum <strong>der</strong><br />
Beisetzung:<br />
(<strong>Die</strong> im Jahre 1929 identifizierten Särge s<strong>in</strong>d mit <strong>der</strong> Nummer im Lageplan versehen;<br />
neben den Lebensdaten <strong>der</strong> Verstorbenen s<strong>in</strong>d auch <strong>der</strong> Tag <strong>der</strong> Beisetzung und das<br />
Alter aufgeführt.)<br />
Name geboren am: gestorben am: beigesetzt am: Alter / Nr.<br />
Philipp Ludw. 1 29. Juni 1534 31. Aug.1535 ke<strong>in</strong> Datum 1 J 2 M<br />
L. Christ<strong>in</strong>a 25. Dez. 1505 15. April 1549 ke<strong>in</strong> Datum 43 Jahre; Nr.13?<br />
L. Philipp 13. Nov. 1504 31. März 1567 4. April 1567 62 Jahre; Nr.14?<br />
Agnes 2 30. Juni 1569 5. Sept. 1569 ke<strong>in</strong> Datum 2 Mon.<br />
Sab<strong>in</strong>a 12. Mai 1573 29. Nov. 1573 6 Mon.<br />
Sidonia 29. Juni 1574 4. April 1575 9 Mon.<br />
Christianus 14. Okt. 1575 9. Nov. 1578 3 Jahre<br />
Elisabeth 11. Mai 1577 25. Nov. 1578 1 J 6 M<br />
Juliana 9. Febr.1581 9. Febr. 1581 1 Tag<br />
L. Sab<strong>in</strong>a 2. Juli 1549 17. Aug. 1581 20. Aug. 1581 32 Jahre; Nr. 18?<br />
Wilhelm IV. 24. Juni 1532 25. Aug. 1592 8. Sept. 1592 60 Jahre; Nr. 15<br />
Moritz d. J. 3 14. Juli 1600 11. Aug. 1612 18. Aug. 1612 12 Jahre; Nr. 10<br />
Sophia 4 10. Juni 1571 18. Jan. 1616 8. Febr. 1616 44 Jahre; Nr. 17<br />
Sab<strong>in</strong>a 5 5. Juli 1610 21. Mai 1620 8. Juni 1620 9 Jahre; Nr. 16<br />
Moritz 6 24. Sept. 1621 24. Sept. 1621 3. Okt. 1621 1 Tag<br />
Elisabeth 21. Okt. 1623 13. Jan. 1624 27. Jan. 1624 fast 3 Mon.<br />
Wilhelm 31. Jan. 1625 11. Juli 1626 6. Aug. 1626 1 J. 5 M.; Nr. 43<br />
Christiana 7 9. Juli 1625 25. Juli 1626 6. Aug. 1626 1 Jahr<br />
Agnes 8 24. Nov. 1620 20. Aug. 1626 2. Sept. 1626 5 Jahre<br />
Philipp 9 26. Nov. 1604 17. Aug. 1626 14. Sept. 1626 21 Jahre; Nr. 7<br />
Juliana 7. Okt. 1608 11. Dez. 1628 30. Dez. 1628 20 Jahre; Nr. 11<br />
Philipp 28. Sept. 1626 8. Juli 1629 30. Juli 1629 2 Jahre<br />
L. Moritz 25. Mai 1572 15. März 1632 3. Mai 1632 59 Jahre; Nr. 4?<br />
Adolf 10 17. Dez. 1631 17. März 1632 3. Mai 1632 3 Mon.<br />
Elisabeth 11 23. Okt. 1628 10. Febr. 1633 11. April 1633 4 Jahre<br />
Moritz 12 13. Juni 1614 16. Febr. 1633 11. April 1633 18 Jahre; Nr. 12<br />
Carl 13 18. Juni 1633 9. März 1635 2. April 1635 1 J. 8 M.<br />
Juliana 14 25. März 1636 22. Mai 1636 8. Juni 1636 fast 2 Mon.<br />
––––––––––<br />
22 Schreiben Litterscheids vom 5.8.1975 an Dekan Giesler, <strong>in</strong>: Schriftwechsel (wie Anm. 21).<br />
Außerdem: „Mart<strong>in</strong>skirche: E<strong>in</strong>e zweite Gruft ist im Gespräch“, Hessische Allgeme<strong>in</strong>e vom<br />
1.11.1975.<br />
23 Schreiben des Kirchenvorstands an Giesler, e<strong>in</strong>gegangen am 22.8.1975, und Schreiben<br />
Quers (Stadtarchiv) an Turba (Stadt Kassel) vom 2.6.1980, beide <strong>in</strong>: Schriftwechsel (wie<br />
Anm. 21).<br />
24 Ermittelt nach KNETSCH, unter Berücksichtigung des Bestandes 1929 und unter Ausschluß<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft Bestatteten. Carl Ferd<strong>in</strong>and von Württemberg-<br />
Oels nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. Raff, Stuttgart; beigesetzt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Holzsarg mit Fenster im Deckel, s. den <strong>in</strong> Kürze ersche<strong>in</strong>enden 3. Band von RAFF.<br />
25
26<br />
Christian Presche<br />
Name geboren am: gestorben am: beigesetzt am: Alter / Nr.<br />
Sophia Juliana 15 1. April 1607 15. Sept. 1637 6. April 1638 30 Jahre; Nr. 5?<br />
Christian 16 5. Febr. 1622 14. Nov. 1640 15. Dez. 1640 18 Jahre; Nr. 6<br />
L. Juliana 3. Sept. 1587 15. Febr. 1643 23. März 1643 55 Jahre; Nr. 9?<br />
Herzog Carl Fer- 5. Jan. 1650 23. Dez. 1668 29. Dez. 1668 / 18 Jahre; Nr. 8?<br />
d<strong>in</strong>and von Württemberg-Oels<br />
1. Aug. 1669<br />
Elisabeth 17 23. Juni 1634 22. März 1688 9. April 1688 53 Jahre; Nr. 3<br />
Aemilia 11. Febr. 1626 15. Febr. 1693 11. März 1693 67 Jahre; Nr. 1<br />
Amelia 18 22. Febr. 1684 19. März 1754 ? 70 Jahre; Nr. 2?<br />
1 Sohn Philipps des Großmütigen 7 Tochter Moritz’ des Gelehrten 13 Sohn Wilhelms V.<br />
2 K<strong>in</strong>d Wilhelms IV. (des Weisen),<br />
Enkelk<strong>in</strong>d Philipps; ebenso die<br />
folgende n<br />
3 Sohn Moritz’ des Gelehrten, Enkel<br />
Wilhelms IV.<br />
8 Tochter des Erbpr<strong>in</strong>zen Wilhelm 14 Tochter Landgraf Hermanns von<br />
Hessen-Rotenburg, Enkel<strong>in</strong> Moritz‘<br />
des Gelehrten<br />
9 K<strong>in</strong>d Moritz’ des Gelehrten;<br />
ebenso die folgenden<br />
15 Frau Landgraf Hermanns von<br />
Hessen-Rotenburg, Schwiegertochter<br />
Moritz’ des Gelehrten<br />
4 Tochter Wilhelms IV. 10 Sohn Wilhelms V. 16 Sohn Moritz’ des Gelehrten<br />
5 Tochter Moritz’ des Gelehrten 11 Tochter Moritz’ des Gelehrten 17 Tochter Wilhelms V.; ebenso die<br />
6 K<strong>in</strong>d des Erbpr<strong>in</strong>zen Wilhelm (V.),<br />
Enkelk<strong>in</strong>d Moritz´ des Gelehrten;<br />
ebenso die folgenden<br />
folgende<br />
12 Sohn Moritz’ des Gelehrten 18 Tochter Landgraf Philipps von<br />
Hessen-Philippstal, Enkel<strong>in</strong> Wilhelms<br />
VI.<br />
<strong>Die</strong>s s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt 35 Beisetzungen; für 5 K<strong>in</strong><strong>der</strong> Landgraf Wilhelms IV.<br />
fehlt zwar <strong>der</strong> Nachweis für e<strong>in</strong>e Bestattung <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> 25 , da aber ke<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e<br />
Grablege bekannt ist und sie allesamt <strong>in</strong> Kassel verstorben s<strong>in</strong>d, kommt nur die<br />
Fürstengruft <strong>in</strong> Frage. Für Amelia von Hessen-Philippstal fehlt zwar ebenfalls<br />
jeglicher Nachweis e<strong>in</strong>er Bestattung; sie ist jedoch <strong>in</strong> Kassel gestorben und ruht<br />
zweifellos nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Gruft. <strong>Die</strong> Auflistung im Tagebuch <strong>der</strong> Hofverwaltung<br />
mag auch bereits mit ihrem nahenden Tod <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehen (s.<br />
Anm. 16).<br />
Bei <strong>der</strong> Untersuchung <strong>der</strong> Gruft im Jahre 1929 bot sich <strong>in</strong> ihrem Inneren folgendes<br />
Bild (s. Abb. 4). 26<br />
1. Z<strong>in</strong>nsarg, reich verziert, offenbar für Aemilia, Tochter Wilhelms V. , *1626, †<br />
1693 (∞ He<strong>in</strong>rich Carl von Tremouille)<br />
2. Holzsarg, stark vermorscht, ohne Inschrift (Amelia von Hessen-Philippstal?<br />
*1684, †1754)<br />
3. Z<strong>in</strong>nsarg mit reich vergoldeter Kartusche und Fruchtgehängen, für Elisabeth,<br />
Tochter Wilhelms V., *1634, † 1688 (Äbtiss<strong>in</strong> von Herford)<br />
4. Z<strong>in</strong>nsarg, zerdrückt und beraubt (Landgraf Moritz? *1572, † 1632)<br />
5. Z<strong>in</strong>nsarg ohne Dekor, unzugänglich (Sophia Juliana von Hessen-Rotenburg?<br />
*1607, †1637)<br />
6. Z<strong>in</strong>nsarg, für Christian, aus <strong>der</strong> 2. Ehe Landgraf Moritzens, *1622, † 1640<br />
7. Z<strong>in</strong>nsarg mit teilweise unleserlicher Inschrift; e<strong>in</strong> Sohn des Landgrafen Moritz,<br />
nach Angabe Deurers Philipp, *1604, † 1626<br />
––––––––––<br />
25 <strong>Die</strong>s besagt allerd<strong>in</strong>gs nichts; sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Kassel gestorben, und Kirchenbücher s<strong>in</strong>d für<br />
St. Mart<strong>in</strong> erst seit 1600 erhalten. Das Altstädter Kirchenbuch führt zwar e<strong>in</strong>ige Verstorbene<br />
<strong>der</strong> landgräflichen Familie auf, ist hier<strong>in</strong> aber zu lückenhaft, als daß man aus dem<br />
Fehlen Schlüsse ziehen könnte. Vgl. SCHLIEPER, Kirchenbuch <strong>der</strong> Altstadt.<br />
26 Auflistung nach DEURER, Grüfte und Särge, sowie JACOB, S. 24; s. o. <strong>Die</strong> <strong>in</strong> Klammern<br />
gesetzten Zuordnungen des Verfassers s<strong>in</strong>d im nachfolgenden Text näher erläutert.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
8. Holzsarg, völlig zerfallen (Herzog Carl Ferd<strong>in</strong>and von Württemberg-Oels?<br />
*1650, †1668)<br />
9. Z<strong>in</strong>nsarg, ke<strong>in</strong>e Inschrift festgestellt (Landgräf<strong>in</strong> Juliana? *1587, †1643)<br />
10. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift, für Moritz d. J., aus <strong>der</strong> 1. Ehe Landgraf Moritzens,<br />
*1600, † 1612<br />
11. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift, für Juliana, aus <strong>der</strong> 2. Ehe Landgraf Moritzens, *1608,<br />
† 1628<br />
12. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift, für Moritz d. J., aus <strong>der</strong> 2. Ehe Landgraf Moritzens,<br />
*1614, † 1633<br />
13. zerstört; Deurer gibt e<strong>in</strong>en Metallsarg an, Jacob vermutet e<strong>in</strong>en Holzsarg<br />
(Landgräf<strong>in</strong> Christ<strong>in</strong>a? *1505, † 1549)<br />
14. zerstört; Deurer gibt e<strong>in</strong>en Metallsarg an, Jacob vermutet e<strong>in</strong>en Holzsarg<br />
(Landgraf Philipp? *1504, † 1567)<br />
15. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift, nur <strong>der</strong> Name Wilhelm lesbar; offenbar Landgraf Wilhelm<br />
IV. 27 , *1632, † 1592<br />
16. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift, vermutlich für Sab<strong>in</strong>a, aus <strong>der</strong> 2. Ehe Landgraf Moritzens,<br />
*1610, † 1620 28<br />
17. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift und graviertem Wappenmedaillon, für Sophia, Tochter<br />
Landgraf Wilhelms IV., *1571, † 1616<br />
18. vollkommen zerdrückter Sarg; Deuerer gibt e<strong>in</strong>en Metallsarg an (Landgräf<strong>in</strong><br />
Sab<strong>in</strong>a? *1549, † 1581)<br />
19. vollkommen zerdrückter Sarg (K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
20. Z<strong>in</strong>nsarg mit Inschrift (nicht lesbar; K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
21. Z<strong>in</strong>nsarg, vollkommen zerstört (K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
22. Z<strong>in</strong>nsarg, vollkommen zerstört (K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
23. (zu vermuten<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg; s. u.)<br />
24. (zu vermuten<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
25. (zu vermuten<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg)<br />
Alle Särge s<strong>in</strong>d – <strong>in</strong> Erwartung <strong>der</strong> Auferstehung beim Jüngsten Gericht – mit<br />
dem Blick nach Osten gerichtet.<br />
<strong>Die</strong>s s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt 22 festgestellte Särge, davon 4 Särge für Säugl<strong>in</strong>ge bzw.<br />
Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>. Es fehlen gegenüber <strong>der</strong> oberen Aufstellung 13 Särge, offenbar die<br />
übrigen K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge. Daß die größeren K<strong>in</strong><strong>der</strong> und alle Erwachsenen noch hier<br />
ruhen, dürfte kaum e<strong>in</strong>em Zweifel unterliegen. Das Problem <strong>der</strong> fehlenden Särge<br />
läßt sich teilweise bei e<strong>in</strong>em Vergleich mit <strong>der</strong> zweiten Gruft unter dem Kapitelsaal<br />
lösen: <strong>Die</strong> Anzahl <strong>der</strong> Särge übertraf dort nämlich im 18. Jh. die Anzahl <strong>der</strong><br />
<strong>fürstlichen</strong> Bestattungen; offenbar waren also vor 1787 zum<strong>in</strong>dest fünf, wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
acht bis zehn K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge aus <strong>der</strong> alten Gruft <strong>in</strong> die neue überführt<br />
––––––––––<br />
27 Nach JACOB; bei DEURER, Grüfte und Särge, ke<strong>in</strong>e Angabe. Da es sich kaum um den 5<br />
Monate alten Pr<strong>in</strong>zen Wilhelm († 1626) handeln dürfte, bleibt nur Wilhelm IV.<br />
28 DEURER, Grüfte und Särge, nennt Elisabeth, setzt aber zwei Fragezeichen, JACOB gibt sie<br />
mit Gewissheit an. Statt dessen dürfte es sich eher um die an<strong>der</strong>e, hier beigesetzte Tochter<br />
Moritzens handeln: Dafür spricht sowohl die Größe des Sarges als auch <strong>der</strong> Umstand,<br />
daß man 1626 schon <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Reihe beisetzte und Nr. 18 bereits stark zerdrückt<br />
gewesen se<strong>in</strong> muß, als Nr. 11 und 12 um 1638/40 darauf gestellt wurden. Zudem ist <strong>der</strong><br />
Sarg e<strong>in</strong>er Fünfjährigen eher <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Gruft anzunehmen als <strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Neunjährigen<br />
(vgl. unten).<br />
27
28<br />
Christian Presche<br />
worden – vermutlich anläßlich <strong>der</strong> letzten Bestattungen des 17. Jhs. (vgl. den<br />
Abschnitt zur zweiten Gruft). Damit fehlen allerd<strong>in</strong>gs immer noch drei bis fünf<br />
Särge; <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Sarg Nr. 20 könnte aber noch auf e<strong>in</strong>em weiteren, vollkommen<br />
zerdrückten stehen, da er offenbar über Nr. 18 h<strong>in</strong>wegreicht; gleiches<br />
mag auch für weitere K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge gelten, so daß die 7 ältesten bis 1581 alle <strong>in</strong><br />
dieser h<strong>in</strong>tersten Reihe stehen könnten (Nr. 23-25).<br />
<strong>Die</strong> Särge Landgraf Philipps des Großmütigen und se<strong>in</strong>er Gemahl<strong>in</strong> Christ<strong>in</strong>a<br />
konnten lei<strong>der</strong> nicht identifiziert werden, ebensowenig <strong>der</strong>jenige von Sab<strong>in</strong>a,<br />
Frau des Landgrafen Wilhelm IV. Es ist aber sehr wahrsche<strong>in</strong>lich, daß Philipp<br />
und Christ<strong>in</strong>a <strong>in</strong> den beiden Särgen Nr. 14 und Nr. 13 ruhen, Sab<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Nr. 18 –<br />
wenn man vom Standort dieser 3 Särge <strong>in</strong> <strong>der</strong> h<strong>in</strong>teren unteren Reihe neben<br />
Wilhelm IV. ausgeht, sowie von ihrem offenbar frühzeitig schlechten Zustand<br />
und e<strong>in</strong>igen weiteren Indizien. 29<br />
Auch die Särge des Landgrafen Moritz († 1632) und se<strong>in</strong>er zweiten Ehefrau<br />
Juliana († 1643) blieben unerkannt. Zwar ist die Sarg<strong>in</strong>schrift für Landgraf Moritz<br />
überliefert 30 , doch s<strong>in</strong>d gerade die Langseiten <strong>der</strong> meisten Särge sowie die Deckel<br />
<strong>der</strong> unten stehenden verdeckt, so daß ke<strong>in</strong>e Zuordnung möglich war; alle<strong>in</strong> die<br />
Holzsärge Nr. 2 und Nr. 8 s<strong>in</strong>d auszuschließen, außerdem Nr. 9, vermutlich auch<br />
Nr. 5; sehr gut denkbar wäre <strong>der</strong> beraubte Sarg Nr. 4, <strong>der</strong> von den unbekannten<br />
Särgen des 17. Jhs. <strong>der</strong> prächtigste gewesen se<strong>in</strong> muß. Angesichts <strong>der</strong> Anordnung<br />
<strong>der</strong> Särge dürfte Nr. 5 dann <strong>der</strong> Sarg Sophia Julianas se<strong>in</strong>, Nr. 9 <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong><br />
Landgräf<strong>in</strong> Juliana.<br />
Der Oelser Herzog dürfte vermutlich <strong>in</strong> Sarg Nr. 8 ruhen: Unter den jüngeren<br />
Särgen s<strong>in</strong>d nur Nr. 2 und Nr. 8 Holzsärge, und das Fenster als auffälliges Kennzeichen<br />
f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> genauen Beschreibung von 1929 bei dem noch gut erhaltenen<br />
Sarg Nr. 2 nicht erwähnt; es bleibt nur <strong>der</strong> völlig zerfallene Sarg Nr. 8.<br />
Sarg Nr. 2 sche<strong>in</strong>t ohneh<strong>in</strong> als letzter, also nach 1693 <strong>in</strong> die Gruft gestellt worden<br />
zu se<strong>in</strong>. Das Fehlen e<strong>in</strong>es äußeren Z<strong>in</strong>nsarges entspricht den Bräuchen ab 1740, so<br />
daß hier an Amelia von Hessen-Philippstal zu denken ist.<br />
Zum e<strong>in</strong>en wird aus dieser Übersicht die größtmögliche Ausnutzung des zur<br />
Verfügung stehenden Raumes deutlich, zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> schlechte Zustand <strong>der</strong><br />
––––––––––<br />
29 Nr. 18 war unter dem Druck von Nr. 16 bereits so stark zerfallen, daß, als Nr. 11 und 12<br />
darauf gestellt wurden, die beiden unteren Särge schon nur noch die Höhe von Nr. 15 und<br />
Nr. 17 hatten; auch Nr. 13 und 14 dürften bereits stark e<strong>in</strong>gefallen gewesen se<strong>in</strong>, als Nr. 10<br />
darüber gesetzt wurde. E<strong>in</strong> Holzsarg würde auch eher noch den Marburger Gepflogenheiten<br />
entsprechen, während die meisten an<strong>der</strong>en Särge schon Metallsärge s<strong>in</strong>d. H<strong>in</strong>zu kommt die<br />
Verfügung Philipps, daß man ihn nicht sezieren und e<strong>in</strong>balsamieren solle, weshalb die Beisetzung<br />
<strong>in</strong> kürzester Zeit ohne lange Vorbereitungen und <strong>in</strong> großer E<strong>in</strong>fachheit stattf<strong>in</strong>den<br />
musste. <strong>Die</strong> dadurch begünstigte Verwesung mag auch <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Weise zum Zerfall des<br />
Sarges beigetragen haben. S. VON DRACH / KÖNNECKE, S. 97, rechte Spalte, Anm. 3. Alle<strong>in</strong><br />
die Tatsache, daß <strong>der</strong> Sarg beim Leichenzug mit schwarzem Tuch bedeckt war, ist ke<strong>in</strong><br />
Beweis für e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>fachen Holzsarg, da dies auch für die Beisetzung des Landgrafen Moritz<br />
überliefert ist, welcher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em verzierten Z<strong>in</strong>nsarg ruht; zu Philipp vgl. VON DRACH /<br />
KÖNNECKE, Abbildung des Leichenzuges, Tafel XXIII, sowie Text S. 98, zu Moritz das<br />
MONUMENTUM SEPULCRALE, Abbildung des Leichenzuges, f. 59. Alle Umstände zusammengenommen<br />
machen die genannte Zuordnung allerd<strong>in</strong>gs wahrsche<strong>in</strong>lich. Dabei versteht<br />
es sich von selbst, daß Philipp im größeren, unteren Sarg, Christ<strong>in</strong>a im kle<strong>in</strong>eren, oberen<br />
ruhen dürfte. Vgl. auch die BEMERKUNGEN, S. 54.<br />
30 Vgl. Anm. 16. E<strong>in</strong>e ähnliche Argumentation bereits <strong>in</strong> den BEMERKUNGEN, S. 54.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
meisten Särge; daß gerade das Stapeln mehrerer Särge nicht zur Erhaltung <strong>der</strong><br />
unteren beitrug, kann man sich leicht vorstellen – ebenso den Zustand <strong>der</strong> vollkommen<br />
zusammengedrückten! Teilweise nehmen 2 Särge nur noch die Höhe<br />
e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zelnen e<strong>in</strong>. Auch die Tatsache, daß bei zwei Särgen die Aussagen über<br />
das Material zwischen Metall und Holz differieren, lässt e<strong>in</strong>ige Schlüsse zu. Außerdem<br />
ist es offenbar auch zu bewussten Zerstörungen gekommen (Sarg Nr. 4):<br />
Wann diese Beraubung erfolgte, ist allerd<strong>in</strong>gs schwer zu sagen; möglicherweise<br />
anlässlich <strong>der</strong> späteren Bestattungen im 17. Jh. Der Zerfall dürfte <strong>in</strong> den 72 Jahren<br />
seit <strong>der</strong> letzten Öffnung, durch die wie<strong>der</strong> frischer Sauerstoff zugeführt worden<br />
war, noch weiter fortgeschritten se<strong>in</strong>; <strong>der</strong> vollständige Verschluss <strong>der</strong> Gruft hat<br />
aber die Toten jedenfalls vor weiterer Störung ihrer Ruhe bewahrt.<br />
2. <strong>Die</strong> zweite Fürstengruft unter dem Kapitelsaal,<br />
die Neuordnungen <strong>der</strong> Gruft <strong>in</strong> den Jahren 1898 und 1935<br />
sowie <strong>der</strong> Neuaufbau nach 1945<br />
Im Jahre 1637 starb Landgraf Wilhelm V. <strong>in</strong> den Wirren des Dreißigjährigen Krieges<br />
im Exil <strong>in</strong> Leer. Angesichts <strong>der</strong> Enge <strong>der</strong> Chorgruft wurde nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
<strong>der</strong> Neubau e<strong>in</strong>er zweiten Gruft vorgenommen; den Plan hierzu hatte Wilhelm<br />
offenbar noch zu Lebzeiten selbst gefasst. 31 Zu diesem Zweck trug man den<br />
Fußboden des ehemaligen Kapitelsaales ab und zog e<strong>in</strong> zusätzliches Gewölbe e<strong>in</strong><br />
(Abb. 5, 6). Der Zugang <strong>in</strong> diese Gruft erfolgte durch e<strong>in</strong>e Treppe von <strong>der</strong> benachbarten<br />
Sakristei aus; e<strong>in</strong>e weitere Treppe führte daneben <strong>in</strong> den Archivsaal über <strong>der</strong><br />
Gruft. Der Fußboden <strong>der</strong> Sakristei wurde um ca. 38 cm auf die Höhe des Chorbodens<br />
angehoben. E<strong>in</strong>e Mauer trennte Gruft und Archivsaal von <strong>der</strong> Sakristei ab. Der<br />
Grufte<strong>in</strong>gang war sowohl durch die niedrige Tür als auch durch e<strong>in</strong>e Falltür über <strong>der</strong><br />
Treppe verschlossen – ähnlich e<strong>in</strong>em Kellerhals. Über dem Rundbogen <strong>der</strong> Tür<br />
waren das hessische und das hanauische Wappen aufgemalt (→ Wilhelm V. und<br />
Amelia Elisabeth), e<strong>in</strong>e late<strong>in</strong>ische Aufschrift flankierend. 32 <strong>Die</strong> Tür, die vom Chor<br />
<strong>in</strong> die Sakristei führt, wurde <strong>in</strong> diesem Zusammenhang vergrößert. Ihre reiche Umrahmung<br />
spielt auf die Gruft an: In den Zwickeln Totenschädel, im Beschlagwerk<br />
Geb<strong>in</strong>de aus Gebe<strong>in</strong>en bzw. Hacke und Schaufel. Im Schlussste<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Sanduhr,<br />
darüber e<strong>in</strong>e Waage und zu <strong>der</strong>en Seiten die Jahreszahl 1638 (Abb. 7). Ebenso wie<br />
die erste Gruft war auch die neuere nicht öffentlich zugänglich, besaß nun aber immerh<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Tür sowie kle<strong>in</strong>e Fensteröffnungen. Das Gruftgewölbe war mit Malereien<br />
geschmückt. 33<br />
––––––––––<br />
31 <strong>Die</strong> Schrift über <strong>der</strong> Tür zur Gruft lautete: HOC / D(OMINUS) WILHELMUS / V.<br />
CONSTANS / SUAE SUORUMQUE / QUIETI / SACRUM ESSE VOLUIT (Der Herr<br />
Wilhelm V., <strong>der</strong> Beständige, hat gewollt, daß dies <strong>der</strong> Ruhe se<strong>in</strong>er selbst und <strong>der</strong> Se<strong>in</strong>en<br />
geweiht sei). Alles weitere ergibt sich aus den Bestattungsdaten.<br />
32 Abbildung <strong>in</strong>: <strong>Kasseler</strong> Sonntags-Bil<strong>der</strong>bogen. <strong>Die</strong> Totensonntags-Glocken läuten vom<br />
<strong>Kasseler</strong> Dom, o. J.; Zeitungsausschnittsammlung Stadtarchiv Kassel (Mart<strong>in</strong>skirche vor<br />
1951). Damals aber schon <strong>in</strong> sehr schlechtem Zustand. Zum Text s. Anm. 31.<br />
33 Am Ende des 19. Jhs. waren nur noch Reste vorhanden, so z. B. Flügel e<strong>in</strong>es Engels o<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>er allegorischen Gestalt; gemäß <strong>der</strong> Aufstellung zur Geschichte <strong>der</strong> Grüfte vom 3.<br />
Pfarrer <strong>der</strong> Freiheiter Geme<strong>in</strong>de, Wissemann, vom 24. März 1896, <strong>in</strong>: Königliches Consistorium<br />
für den Regierungsbezirk Cassel. Acta specialia betreffend: <strong>Die</strong> Fürstengruft zu<br />
29
30<br />
Christian Presche<br />
<strong>Die</strong> ersten Beisetzungen fanden hier am 23. April 1640 statt 34 ; e<strong>in</strong>en Monat<br />
nach <strong>der</strong> Rückkehr <strong>der</strong> landgräflichen Familie aus dem Exil, also fast drei Jahre<br />
nach dem Tod Wilhelms V. Dessen Leichnam war e<strong>in</strong>stweilen <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen beigesetzt<br />
worden und hatte erst im Februar 1639 nach Kassel überführt werden können.<br />
35<br />
Von den meisten Bestattungszeremonien <strong>in</strong> <strong>der</strong> letzten Hälfte des 17. Jhs. und<br />
im 18. Jh. ist überliefert, daß sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nachts bei Fackelsche<strong>in</strong> abgehalten<br />
wurden 36 ; dies steigerte die Feierlichkeit, dürfte zugleich aber auch e<strong>in</strong>e etwas<br />
gespenstische Atmosphäre geschaffen haben.<br />
<strong>Die</strong> offenbar letzte Bestattung erfolgte am 4. Juni 1782 37 ; Landgraf Friedrich<br />
II. wurde dann <strong>in</strong> <strong>der</strong> katholischen Hofkirche St. Elisabeth beigesetzt, se<strong>in</strong>e erste<br />
Frau, die gemäß <strong>der</strong> Assekurationsakte getrennt von ihm mit den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> Hanau<br />
lebte, ruht <strong>in</strong> <strong>der</strong> dortigen Marienkirche, se<strong>in</strong>e zweite Frau im Berl<strong>in</strong>er Dom. 38<br />
<strong>Die</strong> drei Kurfürsten zogen wie<strong>der</strong>um an<strong>der</strong>e Begräbnisstätten als St. Mart<strong>in</strong> vor 39<br />
– es war auch jene Zeit, <strong>in</strong> <strong>der</strong> man allgeme<strong>in</strong> aus hygienischen Gründen Abstand<br />
von Kirchenbestattungen nahm 40 : Wilhelm IX (I.) hatte verfügt, daß er <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kapelle<br />
<strong>der</strong> Löwenburg beigesetzt werden solle, und se<strong>in</strong>e Gemahl<strong>in</strong> wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Mausoleum <strong>in</strong>mitten <strong>der</strong> bürgerlichen <strong>Grabstätten</strong> auf dem Altstädter Friedhof<br />
bestattet. Wilhelm II. plante zunächst e<strong>in</strong> eigenes Mausoleum <strong>in</strong> Wilhelmshöhe,<br />
––––––––––<br />
St. Mart<strong>in</strong>, die sogenannten Todtenfahnen daselbst, vol. I 1888 bis 1899 (geschlossen);<br />
Landeskirchliches Archiv Kassel, Bestand Gesamtkonsistorium, Spezialakten, K IV / 4.<br />
34 Wilhelm V., se<strong>in</strong>e Tochter Louisa und se<strong>in</strong> Sohn Philipp, † 1637 und 1638; s. die Angaben<br />
bei KNETSCH.<br />
35 Zu den Zeitumständen vgl. ausführlich: VON ROMMEL, 8. Band, S. 353 ff.; zusammengefasst:<br />
BETTENHÄUSER, S. XII ff., S. XXXI, BRUNNER, S. 180. <strong>Die</strong> Folgerung HOLTMEY-<br />
ERs, die neue Gruft sei erst 1640 vollendet worden, wird damit h<strong>in</strong>fällig (HOLTMEYER, S.<br />
168).<br />
36 Bezeugt für Herzog von Oels (1668/69), Wilhelm (1676), Carl und Christian (1677), Landgräf<strong>in</strong><br />
Hedwig Sophia (1683), Elisabeth (1688), Eleonora Antonetta Frie<strong>der</strong>ica (1694), Leopold<br />
(1704), Ludwig (1706), Louise Dorothea Sophia (1706), Landgräf<strong>in</strong> Maria Amelia<br />
(1711), Wilhelm<strong>in</strong>a Charlotta (1722), Carl (1722), Wilhelm (1742), Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>a<br />
(1743), Maria Amelia (1744), Maximilian (1753), George (1755), Landgraf Wilhelm VIII.<br />
(1760), Christ<strong>in</strong>a Charlotta (1782); s. die Angaben bei KNETSCH und RAFF (wie Anm. 24).<br />
<strong>Die</strong> Ehren-Seule beschreibt, daß <strong>der</strong> Leichenzug Wilhelms VI. 1663 am 27. Oktober um 5<br />
Uhr abends vom Schloß <strong>in</strong> die Kirche führte (Blatt b 4 (rekto)), so daß die Bestattung schon<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Dämmerung bzw. Dunkelheit erfolgt se<strong>in</strong> muß.<br />
37 <strong>Die</strong>s ist die letzte bei KNETSCH verzeichnete Bestattung; aufgenommen auch im Abriß<br />
<strong>der</strong> Särge von 1758 und 1787, als letzte datierte Beisetzung; vgl. a. HOLTMEYER, S. 185,<br />
Anm. 1. Dagegen KNÖPPEL, S. 110, <strong>der</strong> sich alle<strong>in</strong>e auf die Bestandsaufnahme von HOLT-<br />
MEYER (Zustand 1923) bezieht.<br />
38 KNETSCH, S. 143.<br />
39 S. u. a. die Angaben bei KNETSCH; die <strong>Grabstätten</strong> heute noch vorhanden. Vgl. bes. a. Fr.<br />
MÜLLER, S. 122 f.; daselbst auch die Information über eigenhändige Skizzen Wilhelms<br />
II. zu e<strong>in</strong>em Mausoleum. Auf dem Altstädter Friedhof die heutige Separierung e<strong>in</strong>es<br />
Teils des Friedhofs mit Mausoleum und Erbbegräbnis durch Mauern und Gitter erst nach<br />
1875, genauer gesagt erst um 1900; <strong>der</strong> Plan von Blumenauer (1896; HOLTMEYER, Tafel<br />
18) zeigt hier noch die gesamte alte Ausdehnung dieses e<strong>in</strong>st parkartigen Friedhofteiles.<br />
40 Vgl. BRAUNE, S. 126 f.; bereits gegen Ende des 18. Jhs. wurden <strong>in</strong> mehreren Län<strong>der</strong>n Verbote<br />
für Kirchenbestattungen erlassen. Anlass waren u. a. Geruchsbelästigungen durch<br />
ständige Wie<strong>der</strong>belegungen <strong>der</strong> vielfach überbelegten Grüfte mit zerdrückten Särgen bzw.<br />
wegen <strong>in</strong>zwischen zerfallener Holzsärge.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
als Gegenstück zur Löwenburg, doch vereitelten die politischen Ereignisse dieses<br />
Vorhaben; er, <strong>der</strong> de facto abgedankt und sich nach Hanau zurückgezogen hatte,<br />
wurde „e<strong>in</strong>stweilen“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> gräflichen Gruft <strong>der</strong> dortigen Marienkirche beigesetzt;<br />
Frau und Tochter ruhen wie<strong>der</strong>um auf dem Altstädter Friedhof, neben dem Mausoleum<br />
<strong>der</strong> Mutter und Großmutter. Der letzte Kurfürst, Friedrich Wilhelm I.,<br />
wurde schließlich ebenfalls im Familiengrab auf dem Altstädter Friedhof bestattet,<br />
se<strong>in</strong>e bürgerliche Gemahl<strong>in</strong> auf dem neuen Hauptfriedhof.<br />
Für e<strong>in</strong>e fürstliche Bestattung wurde von <strong>der</strong> Kirche jeweils e<strong>in</strong> Begräbnisgeld<br />
<strong>in</strong> Höhe von 40 Gulden erhoben, seit 1741 <strong>der</strong>selbe Betrag <strong>in</strong> Reichstalern;<br />
im Jahre 1795 <strong>in</strong>formierte allerd<strong>in</strong>gs <strong>der</strong> Stiftsschreiber Büchl<strong>in</strong>g den Vorstand<br />
des Stiftes, daß ab 1743 dieses Geld nicht mehr gezahlt worden war, und schlug<br />
nachträgliche For<strong>der</strong>ungen vor. Der Vorstand war sich nun une<strong>in</strong>ig, da mehrere<br />
Mitglie<strong>der</strong> vermuteten, daß <strong>in</strong> <strong>der</strong> Repositur noch Schriftstücke über den Erlass<br />
<strong>der</strong> Gel<strong>der</strong> vorhanden se<strong>in</strong> könnten und man den Regress von den früheren<br />
Stiftsschreibern for<strong>der</strong>n müsse. Dafür wurde <strong>der</strong> Vorschlag gemacht, dem Stift<br />
die E<strong>in</strong>nahme wenigstens für kommende Zeiten zu erhalten. E<strong>in</strong> Beschluß ist<br />
nicht überliefert, ebensowenig irgendwelche weiteren Konsequenzen. 41<br />
E<strong>in</strong>e skizzenhafte Aufnahme des Jahres 1787 führt <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft<br />
37 Särge auf, von <strong>in</strong>sgesamt vermutlich 40 (s. u.); sie standen damals zumeist auf<br />
erhöhten Podesten, über denen man offenbar nachträglich regalartige Gestelle<br />
errichtet hatte (Abb. 8): An <strong>der</strong> Nordostseite <strong>in</strong>sgesamt zwei Ebenen für die ältesten<br />
Särge, an <strong>der</strong> Südostseite ebenso viele für die K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge (allerd<strong>in</strong>gs etwas<br />
niedriger), an <strong>der</strong> Westseite drei Ebenen für die meisten Särge des 18. Jhs.; an <strong>der</strong><br />
Nordseite waren im Blickpunkt, <strong>der</strong> Tür gegenüber, die beiden Särge des Landgrafen<br />
Carl und se<strong>in</strong>er Gemahl<strong>in</strong> aufgestellt. <strong>Die</strong>se Aufstellung dürfte aber bereits das<br />
Ergebnis mehrerer Verän<strong>der</strong>ungen se<strong>in</strong>, die sich unter an<strong>der</strong>em an den Särgen<br />
Wilhelms V. und Amelia Elisabeths nachvollziehen lassen: <strong>Die</strong>se waren ursprünglich<br />
auf e<strong>in</strong>em reich verzierten Podest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> Westseite aufgestellt (Abb.<br />
6 und 9) und befanden sich nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Regal-Ebene <strong>der</strong> Nordostseite 42 ;<br />
offenbar waren sie für die Aufstellung <strong>der</strong> Särge von Maria Amalia und Carl umgeräumt<br />
worden. Danach sche<strong>in</strong>en auch erst die zusätzlichen Regalebenen an <strong>der</strong><br />
Westseite e<strong>in</strong>gebaut worden zu se<strong>in</strong>. – Vere<strong>in</strong>zelt s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> dieser Gruft aus<br />
Platzmangel mehrere Särge direkt übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gestapelt worden, vor allem die<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge. Sichtbar waren zumeist nur die Fuß- bzw. Kopfenden <strong>der</strong> Särge, so<br />
daß we<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schmuck <strong>der</strong> Langseiten noch die Inschriften zu erkennen waren.<br />
Um die reich verzierten Särge Wilhelms VI. und Hedwig Sophias besser unterzubr<strong>in</strong>gen,<br />
hatte man zudem die Sargfüße und e<strong>in</strong>zelne Aufsätze abgebrochen. 43<br />
Zwar lässt die ursprüngliche Aufstellung <strong>der</strong> Särge Wilhelms V. und Amelia<br />
Elisabeths bereits e<strong>in</strong>e repräsentative Absicht erkennen; doch von e<strong>in</strong>em regelrechten<br />
Mausoleum, das gar als Sehenswürdigkeit hätte gelten können, war man<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> schlichten und demütigen Auffassung des Calv<strong>in</strong>ismus, die jeden Personenkult<br />
zu vermeiden suchte, weit entfernt. Im Barock hatte es dann zunächst<br />
den Ansche<strong>in</strong>, als sollte sich dies än<strong>der</strong>n: Denn (vermutlich) nach dem Tod sei-<br />
––––––––––<br />
41 LANGE, S. 380 f.<br />
42 1899 wurde die orig<strong>in</strong>ale Aufstellung wie<strong>der</strong> hergestellt; vgl. HOLTMEYER, Tafel 132.1, 133.2.<br />
43 Gemäß <strong>der</strong> Aufstellung wie Anm. 33.<br />
31
32<br />
Christian Presche<br />
ner Gemahl<strong>in</strong> Maria Amelia im Jahre 1711 ließ Landgraf Carl durch Francesco<br />
Guerniero (?) zwei Projekte für Grabkapellen aufstellen 44 ; Vorgabe war offenbar,<br />
zur repräsentativen Aufstellung <strong>der</strong> Prunksarkophage des Landgrafenpaares<br />
am Chor zwei gegenüberliegende Kapellen zu entwerfen (Abb. 14-15). 45 <strong>Die</strong><br />
auffallend reiche Gestaltung <strong>der</strong> beiden Särge dürfte dann auch damit im Zusammenhang<br />
stehen (Abb. 12); die Projekte hätten aber e<strong>in</strong>e Beseitigung entwe<strong>der</strong><br />
des großen Epitaphs o<strong>der</strong> <strong>der</strong> neueren Fürstengruft bed<strong>in</strong>gt und s<strong>in</strong>d wohl<br />
aus diesen Gründen nicht ausgeführt worden. 46<br />
Auch diese zweite Gruft unter dem Kapitelsaal wurde streng verschlossen<br />
gehalten, und wie<strong>der</strong>um ist e<strong>in</strong> Vorgang aus <strong>der</strong> Mitte des 19. Jhs. sehr aufschlussreich<br />
über die damalige Auffassung 47 : Im Mai des Jahres 1854 teilte das Kurfürstliche<br />
Oberhofmarschallamt dem Innenm<strong>in</strong>isterium mit, daß die Überwachung <strong>der</strong><br />
Gruft unzureichend sei; es seien als Folge „<strong>der</strong> theilweisen Zerstörung <strong>der</strong> Fenster<br />
durch fortdauernden Unfug die Särge <strong>der</strong>malen mit ganzen Haufen von Ste<strong>in</strong>en<br />
und Schmutz bedeckt“. Das Innenm<strong>in</strong>isterium möge diesen pietätlosen Zustand<br />
alsbald än<strong>der</strong>n lassen, die Aufsicht wegen <strong>der</strong> Verwahrlosung zur Rechenschaft<br />
ziehen und für e<strong>in</strong>e bessere Überwachung sorgen – das Schreiben wurde zudem<br />
nachrichtlich dem Konsistorium mitgeteilt. Auch <strong>der</strong> Kurfürst wurde darüber <strong>in</strong><br />
Kenntnis gesetzt und for<strong>der</strong>te se<strong>in</strong>erseits vom Innenm<strong>in</strong>isterium e<strong>in</strong>en Bericht e<strong>in</strong>.<br />
<strong>Die</strong> Ursachen <strong>der</strong> Verwahrlosung und die Zuständigkeit warfen nun aber e<strong>in</strong>ige<br />
Fragen auf: Das Konsistorium wies darauf h<strong>in</strong>, daß die Umzäunung des Kirchhofes<br />
samt den Bäumen nicht eigenmächtig durch den Stadtrat entfernt worden sei<br />
(um 1840), son<strong>der</strong>n durch M<strong>in</strong>isterialbeschluss gebilligt; die Befürchtung, daß das<br />
Gelände dem Anlaufe <strong>der</strong> Jugend, <strong>der</strong> Beschmutzung und Beschädigung bloßgestellt<br />
sei, habe sich nun bewahrheitet; <strong>der</strong> Kirchhof sei Tummelplatz <strong>der</strong> Jugend<br />
geworden, die ihre Zerstörungswut an den Kirchenfenstern auslasse. Man möge<br />
doch die Umfriedung wie<strong>der</strong>herstellen; die geistlichen Behörden hätten ke<strong>in</strong>e<br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Abhilfe. Man besitze ja nicht e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>en Schlüssel zur Gruft,<br />
den angeblich <strong>der</strong> Archivdirektor verwahre; erst wenn <strong>der</strong> Kirche die ihr gebüh-<br />
––––––––––<br />
44 Guerniero ist <strong>der</strong> Baumeister des Herkules-Oktogons; die Entwürfe s<strong>in</strong>d zwar nicht bezeichnet,<br />
doch s<strong>in</strong>d die Ähnlichkeiten mit den Grotten auf dem Carlsberg offenkundig,<br />
wie schon H. KRAMM festgestellt hat. Selbst die Zeichenfehler <strong>der</strong> seitlichen Bögen s<strong>in</strong>d<br />
genau dieselben wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Del<strong>in</strong>eatio Montis. <strong>Die</strong> Orig<strong>in</strong>ale im Staatsarchiv Marburg;<br />
Grundrisse abgebildet bei HOLTMEYER, Tafel 108, Schnitt und Aufriss bei H. KRAMM,<br />
Bauprojekte, Tafel 13 b, sowie DERS., Orangerie, S. 93; dort weiteres zu Guerniero als<br />
Urheber, aber ke<strong>in</strong>e Zuordnung <strong>der</strong> Projekte.<br />
45 Der „Sarkophag“, <strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schnitt des Entwurfes e<strong>in</strong>er Chorflankenkapelle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Nische e<strong>in</strong>gezeichnet ist, stimmt zwar nicht mit den tatsächlichen übere<strong>in</strong>; dies hat aber<br />
wenig zu bedeuten, da er viel zu kle<strong>in</strong> und vom Baumeister nur als re<strong>in</strong>es Monument<br />
aufgefasst ist, während die Prunksarkophage ihre Aufstellung eher im Zentrum gefunden<br />
hätten – <strong>in</strong> jedem Fall <strong>in</strong> W-O-Richtung, die liegenden Skulpturen auf den Särgen e<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
zugewandt; <strong>der</strong> Landgraf also auf <strong>der</strong> Südseite, die Landgräf<strong>in</strong> auf <strong>der</strong> Nordseite.<br />
46 <strong>Die</strong> E<strong>in</strong>richtung des Marmorbades, das <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur bisweilen als angebliches Denkmal<br />
des Landgrafenpaares und v. a. <strong>der</strong> Landgräf<strong>in</strong> angesehen wird, dürfte dabei aber<br />
ke<strong>in</strong>e Rolle als Ersatz gespielt haben: <strong>Die</strong> Erweiterung <strong>der</strong> Planungen zur heutigen Form<br />
mit den gegenüber bef<strong>in</strong>dlichen Bildnissen des Paares erfolgte erst um 1718, vermutlich<br />
ohne <strong>der</strong>artige Absichten. S. zu dieser Diskussion BURK, S. 113.<br />
47 Schriftverkehr <strong>in</strong> <strong>der</strong> Akte des Innenm<strong>in</strong>isteriums zur Chorgruft (wie Anm. 18), sowie<br />
z. T. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dekanatsakte wie Anm. 14.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
rende Aufsicht wie<strong>der</strong> zurückgegeben sei und <strong>der</strong> Zugang freigelassen werde,<br />
könne man die erfor<strong>der</strong>lichen Herstellungen anordnen. Das Schreiben schließt mit<br />
<strong>der</strong> Bitte, „geeignete Vorsorge treffen zu wollen, daß die Stätte ausschließlich den<br />
kirchlichen Behörden unterstellt wird.“ – Auf Anfrage teilte Archivdirektor von<br />
Rommel jedoch dem Innenm<strong>in</strong>isterium mit, daß <strong>der</strong> Schlüssel ihm auch nicht<br />
unterstehe. Das Oberhofmarschallamt holte ebenfalls weitere Informationen e<strong>in</strong>;<br />
nach erfolgtem Bericht des Hofkämmerers ordnete es Ende Juni an, daß um Wegräumung<br />
des Balkens zu ersuchen sei, welcher den E<strong>in</strong>gang verschließe. Nach all<br />
diesen H<strong>in</strong><strong>der</strong>nissen beim Versuch, die Gruft zu betreten, konnte erst am<br />
12.3.1856 e<strong>in</strong>e Begehung <strong>der</strong>selben erfolgen, an <strong>der</strong> auch <strong>der</strong> Kurfürst teilnahm –<br />
<strong>der</strong> Schlüssel war beim Oberhofmarschallamt <strong>in</strong> Verwahrung gewesen. Friedrich<br />
Wilhelm I. hielt e<strong>in</strong>e Re<strong>in</strong>igung ebenso für erfor<strong>der</strong>lich wie e<strong>in</strong>e „Vorbeugung des<br />
Unfugs“ und erwartete weitere Anträge des M<strong>in</strong>isteriums. Dem Konsistorium<br />
schlug er vor, die beschädigten Gitter vor den Gruftfenstern zu erneuern; die Zustimmung<br />
erfolgte umgehend mit <strong>der</strong> Ergänzung, daß zur Sicherheit verschließbare<br />
Läden („Schalter“) angebracht werden könnten, wie dies früher offenbar <strong>der</strong><br />
Fall gewesen sei. Auf Antrag des Innenm<strong>in</strong>isteriums erteilte <strong>der</strong> Kurfürst am<br />
3.12.1857 (!) schließlich die Anweisung, die Gruft zu re<strong>in</strong>igen, die Aufstellung <strong>der</strong><br />
Särge zu sichern und <strong>der</strong> Beschädigung <strong>in</strong> beantragter Weise vorzubeugen – unter<br />
Aufsicht, so daß ke<strong>in</strong> Öffnen <strong>der</strong> Särge dabei möglich sei. Das Oberhofmarschallamt<br />
habe Anweisung, den Schlüssel auszuhändigen. Am 14.9.1858, also mehr als<br />
4 Jahre nach dem ersten H<strong>in</strong>weis auf die Missstände, konnte endlich das Konsistorium<br />
über den Abschluss <strong>der</strong> Arbeiten berichten – und <strong>der</strong> Schlüssel wurde wie<strong>der</strong><br />
zurückgegeben! E<strong>in</strong> letztes Mal sorgte sich noch <strong>der</strong> Kurfürst im November um<br />
die gehörige Aufstellung <strong>der</strong> Särge, doch konnte kurz darauf das Konsistorium<br />
beric hten, daß diese nicht verrückt worden seien. – In diesem Zustand blieb die<br />
Gruft weitere 30 Jahre lang unangetastet.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> neugotischen Restaurierung, die ab 1888 unter <strong>der</strong> Leitung Prof.<br />
Hugo Schnei<strong>der</strong>s erfolgte, wurde auch die zweite Fürstengruft wie<strong>der</strong> Gegenstand<br />
neuer Planungen – doch bis zur Vollendung sollte es noch 11 Jahre dauern. <strong>Die</strong><br />
Vorgänge, die dazu führten, s<strong>in</strong>d zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>teressant, weil aus ihnen die Gründe<br />
für die später realisierte Planung hervorgehen, zum an<strong>der</strong>en zeugen sie von dem<br />
damaligen Umgang mit den <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> und ihrer unterschiedlichen<br />
Akzeptanz bei den Verantwortlichen. – Erstmals regte das <strong>Kasseler</strong> Konsistorium<br />
gegenüber <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Bezirksregierung am 22.11.1888 e<strong>in</strong>e „Herstellung bzw.<br />
Erweiterung“ <strong>der</strong> vom Fiskus unterhaltenen Begräbnisstätte an (das fürstliche<br />
Patronat über Chor und Grüfte war 1866 an die Preußische Krone übergegangen);<br />
48 die Gruft bef<strong>in</strong>de sich „im Inneren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em, jedem, auch nur ger<strong>in</strong>gsten<br />
Anspruch an Pietät und Würde gerade zu Hohn sprechenden Zustand“. <strong>Die</strong>ser<br />
Zustand wurde daraufh<strong>in</strong> zunächst von <strong>der</strong> Regierung geprüft; sie schlug am<br />
11.9.1889 vor, die 37 gezählten Särge zum<strong>in</strong>dest teilweise aus <strong>der</strong> Gruft auszuräumen<br />
und auf ihren geschichtlichen und künstlerischen Wert h<strong>in</strong> zu sichten,<br />
dann erst über e<strong>in</strong>e Erweiterung zu diskutieren. Aus Pietätsgründen schlage man<br />
den Archivsaal über <strong>der</strong> Gruft o<strong>der</strong> den Chorraum für die provisorische Unterbr<strong>in</strong>gung<br />
<strong>der</strong> Särge vor. Erhalte man hierzu die Zustimmung des Konsistoriums, wolle<br />
––––––––––<br />
48 Schriftwechsel <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte (wie Anm. 33).<br />
33
34<br />
Christian Presche<br />
man den König um die Erlaubnis zu e<strong>in</strong>er genaueren Untersuchung <strong>der</strong> Särge<br />
bitten. – <strong>Die</strong> Zustimmung aber blieb aus: Das Presbyterium stimmte im November<br />
zwar bei, daß „<strong>der</strong> gegenwärtige traurige Zustand <strong>der</strong> überfüllten und mit Unre<strong>in</strong>igkeiten<br />
beschmutzten Fürstengruft“ dr<strong>in</strong>gend Abhilfe erfor<strong>der</strong>e, und sicherte zu,<br />
„daß von Seiten <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de Nichts entgegenstehen werde, wenn die seit Jahren<br />
verschlossen gehaltene Fürstengruft hergerichtet werde“; es wies aber zum e<strong>in</strong>en<br />
darauf h<strong>in</strong>, daß die Tür zum Archivsaal zu eng sei und dieser zudem als Sitzungsraum<br />
gebraucht werde, zum an<strong>der</strong>en wandte es sich entschieden gegen e<strong>in</strong>e Aufstellung<br />
<strong>der</strong> Särge im Chor, „da die Kirche nicht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als Gruft, son<strong>der</strong>n<br />
als Versammlungsraum <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de zum Gottesdienst dient. [...] Es ist [...] nicht<br />
zu verhehlen, daß die Särge, im Chor aufgebaut, auf nicht wenige Kirchenbesucher<br />
e<strong>in</strong>en pe<strong>in</strong>lichen E<strong>in</strong>druck machen würden“. Solange aber wegen <strong>der</strong> Bauarbeiten<br />
an den Türmen <strong>der</strong> Kirchplatz ohneh<strong>in</strong> durch Zäune abgesperrt sei, solle<br />
man doch e<strong>in</strong>en Fachwerkanbau an <strong>der</strong> Nordseite <strong>der</strong> Kirche errichten und die<br />
Särge dorth<strong>in</strong> überführen – <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacht und <strong>in</strong> aller Stille, so daß kaum jemand<br />
außer den E<strong>in</strong>geweihten etwas bemerke. Am 7.3.1890 erfolgte die Ablehnung<br />
dieses Vorschlags durch die Regierung: Sowohl wegen <strong>der</strong> Kosten als auch aus<br />
Pietätsgründen könne man dem Anbau nicht zustimmen. Man habe <strong>in</strong>zwischen bei<br />
e<strong>in</strong>er Besichtigung festgestellt, daß die Tür zum Archivsaal tatsächlich zu eng sei,<br />
daß sich aber gerade jetzt <strong>der</strong> Chor hervorragend eigne – da sich wegen <strong>der</strong> Restaurierung<br />
<strong>der</strong> Kirchenraum durch Bretterverschläge ohneh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Unordnung bef<strong>in</strong>de<br />
und <strong>der</strong> Chor durch e<strong>in</strong>en weiteren Verschlag e<strong>in</strong>fach abgetrennt werden könne.<br />
Am 1.8.1890 befasste sich erneut das Presbyterium mit <strong>der</strong> Frage und beschloss<br />
abermals, daß e<strong>in</strong>e provisorische Aufstellung im Chor „niemals gestattet<br />
werden könne, weil e<strong>in</strong>e Aufstellung von Särgen gleich wie das Begraben <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Kirche ungesetzlich ist, bei den Geme<strong>in</strong>demitglie<strong>der</strong>n Anstoß erregen und die<br />
Kirche vollständig verunstalten würde.“ – Allerd<strong>in</strong>gs waren zu diesem Zeitpunkt<br />
durch das Konsistorium bereits Professor Schnei<strong>der</strong> und Regierungsbaumeister<br />
Hagen <strong>in</strong> die Diskussion e<strong>in</strong>geschaltet worden: Am 13.6.1890 äußerten sie <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Schreiben an das Konsistorium, daß e<strong>in</strong>e dauerhafte Vergrößerung des<br />
Raumes erfor<strong>der</strong>lich sei. E<strong>in</strong> unmittelbarer Anbau sei allerd<strong>in</strong>gs nicht möglich;<br />
nach Westen h<strong>in</strong> würde das nächstliegende Kirchenfenster zugebaut, nach Norden<br />
sei ke<strong>in</strong> ausreichen<strong>der</strong> Platz, nach Osten h<strong>in</strong> würde die malerische Ostansicht <strong>der</strong><br />
Kirche bee<strong>in</strong>trächtigt. Sie schlugen deshalb vor, an <strong>der</strong> Nordseite im 3. Joch von<br />
Osten, wo bis <strong>in</strong>s 18. Jh. die Stiftsgebäude anschlossen, e<strong>in</strong>en Anbau zu errichten<br />
und dorth<strong>in</strong> die künstlerisch und geschichtlich wertvollsten Särge zu überführen.<br />
<strong>Die</strong>s würde dann auch e<strong>in</strong>e provisorische Aufstellung überflüssig machen. – Damit<br />
ruhte nun die Angelegenheit erst e<strong>in</strong>mal.<br />
Im November 1891 besichtigte Konservator Persius die Gruft und stellte e<strong>in</strong>e<br />
Anregung <strong>der</strong> Sache durch die M<strong>in</strong>isterial<strong>in</strong>stanz <strong>in</strong> Aussicht. Aber im Dezember<br />
1892 waren diesbezüglich immer noch ke<strong>in</strong>e Schritte erfolgt: Nun kündigte die<br />
<strong>Kasseler</strong> Regierung an, ihrerseits gegenüber dem M<strong>in</strong>isterium <strong>der</strong> geistlichen,<br />
Unterrichts- und Mediz<strong>in</strong>alangelegenheiten e<strong>in</strong>e Neuordnung <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft<br />
anzuregen. <strong>Die</strong>s erfolgte dann auch bis zum 21.8.1893; das M<strong>in</strong>isterium<br />
hielt jedoch e<strong>in</strong>e erneute Ortsbesichtigung für notwendig – somit zog sich die<br />
Angelegenheit noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong> Jahr h<strong>in</strong>, bis am 1.9.1894 Persius, Regierungspräsident<br />
Graf Clairon d’ Haussonville, Oberregierungsrat von Altenbokum, Konsistorialrat<br />
Rohde, Regierungs- und Baurat Waldhausen, Super<strong>in</strong>tendent Kröner und
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Kreisbau<strong>in</strong>spektor Söhnchen die Gruft besuchten.<br />
Persius legte am 26.2.1895 schließlich se<strong>in</strong> Gutachten vor und empfahl dar<strong>in</strong>,<br />
den Plan Schnei<strong>der</strong>s für e<strong>in</strong>en Anbau an <strong>der</strong> Nordseite weiter zu verfolgen. E<strong>in</strong><br />
Öffnen <strong>der</strong> Särge sei allerd<strong>in</strong>gs unstatthaft und solle nur im E<strong>in</strong>zelfall nach Genehmigung<br />
des M<strong>in</strong>isters möglich se<strong>in</strong>. – Alles weitere lag wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den Händen<br />
<strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Regierung. Im März des folgenden Jahres 1896 legte nun <strong>der</strong><br />
3.Pfarrer <strong>der</strong> Freiheiter Geme<strong>in</strong>de, Wissemann, e<strong>in</strong>e eigene Stellungnahme zu den<br />
Überlegungen vor: E<strong>in</strong>en Anbau lehnte er ab, da die Freilegung <strong>der</strong> Kirche erst<br />
mit großen Kosten betrieben worden sei und diese nicht erneut wie<strong>der</strong> mit e<strong>in</strong>em<br />
Anhängsel versehen werden dürfe. Zudem sei bei e<strong>in</strong>em Zugang vom Kirchen<strong>in</strong>neren<br />
aus die Beseitigung zahlreicher Bankreihen erfor<strong>der</strong>lich, auf die man nicht<br />
verzichten könne. Deshalb schlug er alternativ e<strong>in</strong> neues Gruftgewölbe auf dem<br />
Neuen Totenhof (=Hauptfriedhof) o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e langfristigere Lösung vor: <strong>Die</strong> Geme<strong>in</strong>de<br />
plane die Erric htung e<strong>in</strong>er zweiten Kirche am E<strong>in</strong>gang dieses Friedhofes;<br />
dort könne auch e<strong>in</strong>e neue Gruft e<strong>in</strong>gebaut werden, für alle nicht regiert habenden<br />
Personen. Bis zur Verwirklichung dieses Planes könnten diese Särge im Südturm<br />
<strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche aufgestellt werden. <strong>Die</strong> Regenten sollten jedoch <strong>in</strong> <strong>der</strong> bisherigen<br />
Gruft bleiben, welche mit elektrischem Licht ausgestattet werden könne. E<strong>in</strong>e<br />
Trennung dieser Särge nach ihrem Kunstwert lehnte Wissemann ab, da das Gefühl<br />
des hessischen Volkes dadurch gewiss tief verletzt würde. In diesem Zusammenhang<br />
regte er auch an, die Beisetzungen vom Altstädter Friedhof auf die beiden<br />
Kirchengrüfte aufzuteilen. – Der Vorschlag e<strong>in</strong>er Auslagerung <strong>in</strong> den Südturm<br />
wurde nun von <strong>der</strong> Regierung an das Berl<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>isterium weitergegeben. Am<br />
16. 5. desselben Jahres fand e<strong>in</strong>e Verhandlung <strong>der</strong> Beteiligten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
statt, bei <strong>der</strong> man sich darauf e<strong>in</strong>igte, alle Regenten (e<strong>in</strong>schließlich ihrer Frauen) <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> bisherigen Gruft zu belassen und die übrigen Särge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Halle des Südturms<br />
unterzubr<strong>in</strong>gen. Zwei Tage später ersuchte die Regierung das Konsistorium bzw.<br />
die Geme<strong>in</strong>devertretung um die offizielle Zustimmung zu diesem Vorhaben. Hierbei<br />
trat nun aber e<strong>in</strong> neues Problem auf: <strong>Die</strong> alte Wendeltreppe <strong>in</strong> <strong>der</strong> nordwestlichen<br />
Mauerecke des Turmes hätte nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sarghalle begonnen; deshalb sollte<br />
sie im unteren Teil verschlossen werden und im Raum über <strong>der</strong> Sarghalle beg<strong>in</strong>nen;<br />
von diesem war e<strong>in</strong> Ausgang zur „Orgelempore“ vorgesehen, d. h. offenbar<br />
zum unteren Orgelboden, <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Turmzwischenhalle h<strong>in</strong>ter dem Instrument<br />
e<strong>in</strong>gezogen war. Statt des verschlossenen Abschnitts <strong>der</strong> Wendeltreppe sollte <strong>in</strong>nerhalb<br />
<strong>der</strong> Vorhalle e<strong>in</strong>e neue Wendeltreppe auf den Orgelboden führen. In e<strong>in</strong>er<br />
Sitzung vom 2. 6. wandte sich das Presbyterium vehement gegen diese Lösung:<br />
Man wolle unnötigen Zug für das neue Orgelwerk verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n und wies zudem auf<br />
die Treppe zum Dachboden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ecke zwischen Chor und Langhaus h<strong>in</strong>, die als<br />
Notausgang (über den Dachboden) bereits vorhanden sei. Beson<strong>der</strong>s begrüßen<br />
würde man allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>en eigenen neuen Treppenturm am Südturm. Das zuständige<br />
M<strong>in</strong>isterium <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> stimmte <strong>in</strong>dessen am 4.7.1896 dem Vorhaben <strong>der</strong> Regierung<br />
zu und empfahl, Schnei<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Planung zu beauftragen. Schnei<strong>der</strong>s<br />
detaillierter Entwurf 49 (Abb. 16) wurde dann Ende des Jahres dem Presbyterium<br />
vorgelegt – doch dieses lehnte ihn überraschend am 1.12.1896 unter dem neuen<br />
––––––––––<br />
49 Entwurf SCHNEIDERs <strong>in</strong> <strong>der</strong> Graphischen Sammlung <strong>der</strong> Staatlichen Museen Kassel,<br />
datiert 1896; Marburger Index LA 3763/53.<br />
35
36<br />
Christian Presche<br />
Vorsitzenden Fuchs gänzlich ab: 50 Zunächst kritisierte man abermals den Zugang<br />
zur Orgelempore, den man bereits abgelehnt hatte; aber selbst bei dessen Vermeidung<br />
könne man dem Plan nicht zustimmen: Auf den Raum im Südturm könne<br />
man nicht verzichten, denn auch e<strong>in</strong> weiterer Bodenraum im Nordturm sei zur<br />
Unterbr<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> Heizungsmaterialien und sonstiger Utensilien nicht ausreichend,<br />
sowie zur Anlage e<strong>in</strong>es unbed<strong>in</strong>gt erfor<strong>der</strong>lichen Abortes. „Es ist die e<strong>in</strong>stimmige<br />
Ansicht des Presbyteriums, daß <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Kirche e<strong>in</strong> Raum für e<strong>in</strong>e<br />
neue Fürstengruft sich nicht wird f<strong>in</strong>den lassen, daß aber <strong>der</strong> für fürstliche Gräber<br />
reservierte Teil des alten Friedhofs wohl e<strong>in</strong>en geeigneten Platz für die Unterbr<strong>in</strong>gung<br />
<strong>der</strong> fraglichen Särge abgeben würde.“ <strong>Die</strong>s war genau das Gegenteil des<br />
Wissemannschen Vorschlags, und alles bisher Erreichte erschien damit wie<strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
Frage gestellt! Nur zwei Tage später lehnte das Konsistorium e<strong>in</strong>e Abschiebung<br />
auf den Friedhof ebenso ab wie e<strong>in</strong>en Anbau an die Kirche. Der Beschluss des<br />
Presbyteriums wurde mit <strong>der</strong> Bemerkung zurückgeschickt, „daß <strong>der</strong>selbe höchlichst<br />
befremdet hat.“ Am 8. 12. hielt daraufh<strong>in</strong> das Presbyterium e<strong>in</strong>e außerordentliche<br />
Sitzung ab; dabei ließ man die Bedenken gegen Überlassung des Südturmes<br />
wie<strong>der</strong> fallen – unter <strong>der</strong> doppelten Bed<strong>in</strong>gung, „daß e<strong>in</strong>mal die Gefährdung<br />
<strong>der</strong> Orgel durch Anbr<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong>es durchaus sicheren Thürschlosses vermieden<br />
wird, und daß sodann e<strong>in</strong> ausreichen<strong>der</strong> Bodenraum im nördlichen Thurm für<br />
die Zwecke <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de hergestellt werde, und zwar beides auf Kosten des Staates.“<br />
51 Schon am folgenden Tag for<strong>der</strong>te das Konsistorium die umgehende nähere<br />
Darlegung dieses Anspruches 52 – damit endet <strong>der</strong> Schriftverkehr zu diesem Thema.<br />
Es sche<strong>in</strong>t jedoch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung erzielt worden zu se<strong>in</strong>; jedenfalls ist die besagte<br />
Wendeltreppe auch im oberen Teil vollständig geschlossen, ihre Funktion<br />
für den Dachboden übernimmt e<strong>in</strong>e neue, die außen an den Nordturm angebaut ist.<br />
<strong>Die</strong> Treppe, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vorhalle auf den Orgelboden führt, wurde gebaut. – Dafür<br />
meldete allerd<strong>in</strong>gs am 17.2.1897 nun das Berl<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>isterium Bedenken an 53 :<br />
Das Projekt Schnei<strong>der</strong>s könne noch nicht ohne weiteres zur Ausführung empfohlen<br />
werden; das vorgeschlagene Übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>stellen <strong>der</strong> Särge lasse erkennen, daß<br />
<strong>der</strong> Raum zu kle<strong>in</strong> sei, „um die betreffenden Särge <strong>der</strong> früheren Landesherren so<br />
würdig und pietätvoll wie<strong>der</strong> aufzustellen, daß e<strong>in</strong>e öffentliche Besichtigung zulässig<br />
ersche<strong>in</strong>t.“ Es sei zu erwägen, die kle<strong>in</strong>eren und die völlig schmucklosen<br />
Särge von den größeren, historisch wichtigen und besser ausgestatteten zu trennen,<br />
„daß von den letzteren e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong><strong>der</strong>zahl, etwa 5-6,“ übrig bleibe, die unmittelbar<br />
auf dem Fußboden auf schlichten Unterplatten aufgestellt würden, vielleicht auch<br />
e<strong>in</strong>ige etwas höher bzw. auf Konsolen an den Wänden. Der übrige, größere Teil<br />
<strong>der</strong> Särge wäre dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schlichten unterirdischen Gruft unterzubr<strong>in</strong>gen, die<br />
mit e<strong>in</strong>em Deckste<strong>in</strong> zu schließen sei. Im übrigen wurde <strong>der</strong> Vorschlag gemacht,<br />
auf e<strong>in</strong>er Wandtafel die Namen und Lebensdaten <strong>der</strong> Beigesetzten zu verzeichnen.<br />
Schnei<strong>der</strong> solle e<strong>in</strong>en zweiten Entwurf aufstellen. <strong>Die</strong> Regierung erteilte ihm dann<br />
auch den Auftrag dazu, doch kam aus Berl<strong>in</strong> mit Datum vom 27.4.1897 die Nachricht,<br />
daß man von <strong>der</strong> E<strong>in</strong>reichung e<strong>in</strong>es zweiten Entwurfes absehe und <strong>in</strong> die<br />
––––––––––<br />
50 Schreiben vom 3.12.1896 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dekanatsakte (wie Anm. 14). In <strong>der</strong> Akte sonst zumeist<br />
nur Abschriften <strong>der</strong> Orig<strong>in</strong>ale, welche <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte vorhanden s<strong>in</strong>d.<br />
51 Protokollauszug (Abschrift) <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte (wie Anm. 33).<br />
52 Schreiben vom 9.12.1896 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dekanatsakte (wie Anm. 14).<br />
53 Zum Folgenden s. wie<strong>der</strong> die Konsistorialakte (wie Anm. 33).
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Ausführung des ersten Projektes e<strong>in</strong>willige. <strong>Die</strong> Regierung beantragte daraufh<strong>in</strong><br />
am 4. 5. die Baumittel, die am 24. 5. vom M<strong>in</strong>ister <strong>in</strong> Höhe von 7984 Mark zur<br />
Verfügung gestellt wurden, und ersuchte Schnei<strong>der</strong>, die Arbeiten baldigst zur<br />
Ausführung br<strong>in</strong>gen zu lassen. Allerd<strong>in</strong>gs trat nochmals e<strong>in</strong>e Verzögerung e<strong>in</strong>:<br />
Gegenüber <strong>der</strong> Super<strong>in</strong>tendentur erklärte Schnei<strong>der</strong> im September, die Arbeiten<br />
erst im nächsten Frühjahr beg<strong>in</strong>nen zu wollen, da die nötigen Vorarbeiten noch<br />
nicht abgeschlossen seien. Über 8 Jahre waren somit nach <strong>der</strong> ersten Anregung<br />
vergangen, als im Frühjahr 1897 endlich die Renovierung begann – und diese<br />
sorgte bald für neuen Anstoß: So wandte sich am 11.3.1898 <strong>der</strong> Vorsitzende des<br />
VHG, Brunner, an das Konsistorium; dem Vere<strong>in</strong> war mitgeteilt worden, daß<br />
je<strong>der</strong>mann die Särge öffnen könne: „Man darf kommen, wann man will, e<strong>in</strong> je<strong>der</strong><br />
Arbeiter zeigt jedem zwei K<strong>in</strong><strong>der</strong>leichen.“ Das Konsistorium möge doch den Unfug<br />
abstellen – wofür Schnei<strong>der</strong> dann schließlich zu sorgen hatte. Ende April 1898<br />
waren die Arbeiten weitgehend abgeschlossen, die Ausmalung <strong>der</strong> Fürstengruft<br />
durch Hochapfel erfolgte im Sommer 1899.<br />
Aus <strong>der</strong> Gruft waren dabei die Särge <strong>der</strong> nicht regiert habenden Mitglie<strong>der</strong> des<br />
Fürstenhauses <strong>in</strong> die Halle des Südturmes ausgelagert worden 54 (Abb. 13 und 16).<br />
In <strong>der</strong> Gruft, die nun für die Kirchenbesucher geöffnet wurde, verblieben danach<br />
noch 10 Särge, die entlang e<strong>in</strong>es breiten Mittelganges aufgestellt waren – wie<strong>der</strong>um<br />
z. T. <strong>in</strong> zwei Ebenen. In <strong>der</strong> Turmhalle standen die übrigen <strong>in</strong> mehreren Regal-<br />
Ebenen. <strong>Die</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft gebliebenen Särge erhielten kle<strong>in</strong>e Täfelchen mit den<br />
Namen und Todesjahren <strong>der</strong> Verstorbenen. <strong>Die</strong> meisten Erwachsenensärge <strong>in</strong> den<br />
beiden Räumen waren mit e<strong>in</strong>er Langseite dem Betrachter zugewandt, was nun<br />
auch das Lesen <strong>der</strong> Inschriften auf den Sargdeckeln ermöglichte. Abgenommen<br />
gewesene E<strong>in</strong>zelteile wurden wie<strong>der</strong> an den Särgen angebracht.<br />
<strong>Die</strong> nächste Restaurierung <strong>der</strong> Kirche erfolgte 1928-34 und wurde unter <strong>der</strong><br />
Leitung des Baurates Fritz Keibel vom Architekten Jakob Deurer betreut; nach<br />
ihrem Abschluss nahm man nochmals e<strong>in</strong>e Umstellung vor: <strong>Die</strong> Sarghalle im<br />
Südturm wurde aufgelöst, die Särge wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> die zweite Fürstengruft gebracht;<br />
zu diesem Zweck wurde dort e<strong>in</strong> weiterer, tieferer Nebenraum unter <strong>der</strong> Sakristei<br />
geschaffen, <strong>in</strong> dem die Särge <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zen und Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong>nen dicht gedrängt<br />
neu aufgestellt wurden. Außerdem wurde auf Verlangen <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Halle des Nordturms e<strong>in</strong>e gewölbte Backste<strong>in</strong>decke e<strong>in</strong>gezogen, um Platz für die<br />
Erweiterung des Sängerchores zu schaffen; <strong>in</strong> dem neuen Erdgeschossraum<br />
fanden nun die beiden Prunksarkophage des Landgrafen Carl und se<strong>in</strong>er Gemahl<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e repräsentativere Aufstellung – die auch wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> ursprünglichen Intention<br />
näher kam. Im Zusammenhang mit dieser Neuordnung wurden 1935 die<br />
Särge <strong>der</strong> Regenten <strong>in</strong> Anwesenheit des Oberpräsidenten Pr<strong>in</strong>z Philipp von Hessen<br />
geöffnet; <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e den Leichnam Carls fand man wegen des<br />
Luftabschlusses <strong>in</strong>nerhalb des Sarges sehr gut erhalten vor. 55<br />
––––––––––<br />
54 HOLTMEYER, S. 170, JACOB, S. 22, S. 23; zur Zugänglichkeit <strong>der</strong> Gruft s. JACOB: Begräbnisse<br />
(wie Anm. 5).<br />
55 Photographien, Stadtmuseum Kassel, Negativ-Nrn. 1984, 9, 10, 12. <strong>Die</strong> Konsistorialakten<br />
und Regierungsakten zu <strong>der</strong> Restaurierung s<strong>in</strong>d im Zweiten Weltkrieg offenbar verloren<br />
gegangen, die Dekanatsakten geben über die Gruft ke<strong>in</strong>e Auskunft. <strong>Die</strong> Akten im<br />
Landesamt für Denkmalpflege <strong>in</strong> Marburg s<strong>in</strong>d wegen Umbauarbeiten für längere Zeit<br />
unzugänglich e<strong>in</strong>gelagert. Vgl. aber Abschrift von 1956 e<strong>in</strong>es Gesprächsprotokolles Vo-<br />
37
38<br />
Christian Presche<br />
Am 1. Juni 1940 fand die bislang letzte Trauerfeier statt, die für e<strong>in</strong>en hessischen<br />
Landgrafen <strong>in</strong> <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche abgehalten wurde: Friedrich Karl, <strong>der</strong><br />
Großvater des <strong>der</strong>zeitigen Landgrafen Moritz, war vier Tage zuvor <strong>in</strong> Kassel<br />
verstorben. Se<strong>in</strong> Leichnam wurde dann allerd<strong>in</strong>gs zur Bestattung nach Kronberg<br />
im Taunus überführt.<br />
Während die alte Fürstengruft unter dem Chor und die nördliche Turmhalle<br />
mit den beiden Barocksärgen die Zerstörungen des 2. Weltkrieges unbeschadet<br />
überstanden hatten, hatte <strong>der</strong> Kapitelsaal am 22. Oktober 1943 e<strong>in</strong>en Sprengbombenvolltreffer<br />
erhalten; dabei war das Gewölbe <strong>der</strong> Gruft an <strong>der</strong>en Nordseite<br />
teilweise e<strong>in</strong>gestürzt. 56 <strong>Die</strong> Gruft und die Sarghalle des Nordturms konnte man<br />
nur provisorisch verschließen.<br />
Weiteres Unheil kam mit dem Kriegsende: Im April 1945 hatte – e<strong>in</strong>em Befehl<br />
Himmlers folgend – mit den Kampftruppen auch die Ordnungspolizei aus <strong>der</strong><br />
Stadt abrücken müssen. Bei E<strong>in</strong>zug <strong>der</strong> amerikanischen Truppen war Kassel somit<br />
mehrere Tage lang schutzlos den Plün<strong>der</strong>ungen durch ehemalige Fremd- und<br />
Zwangsarbeiterausgeliefert, denn: „Auch die amerikanische Besatzungsmacht war<br />
nicht Herr <strong>der</strong> Lage. Sie trug sogar zu ihrem Teil noch dazu bei, die Zivilbevölkerung<br />
ihres Eigentums zu berauben.“ 57 Insassen <strong>der</strong> Polenlager begannen nun auch,<br />
die Grüfte <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche zu plün<strong>der</strong>n; deutsche Stellen versuchten zwar noch,<br />
die landgräflichen Särge vor e<strong>in</strong>er Beraubung zu schützen, wurden dann aber zurückgehalten<br />
und mußten die Plün<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Särge zulassen Von Vertretern <strong>der</strong><br />
Kirche sowie dem Landeskonservator wurde diese Plün<strong>der</strong>ung erst Ende Januar<br />
––––––––––<br />
gels mit Deurer, vom 25.2.1954, LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 2. (Me<strong>in</strong> Dank gilt an dieser<br />
Stelle Herrn Frede und Herrn Dr. Knöppel von <strong>der</strong> Bauabteilung des Landeskirchenamtes,<br />
die mir die entsprechenden Akten zugänglich machten.)<br />
56 Es kann jedenfalls ke<strong>in</strong>e Rede von e<strong>in</strong>em völligen E<strong>in</strong>sturz des Gewölbes se<strong>in</strong>! 1946 war<br />
die Gruft noch weitgehend begehbar, so daß mehrere Särge geborgen werden konnten.<br />
Sehr aufschlussreich ist hierzu e<strong>in</strong> Antwortschreiben von Dr. Helm (Hessisches Landesmuseum<br />
Kassel) an die Landeskirche vom 14.2.1946; dar<strong>in</strong> erklärt sich das Landesmuseum<br />
bereit, die Särge zum Schutz vor Beraubung sicherzustellen: Er rechnet auch mit e<strong>in</strong>er<br />
größeren Anzahl, so daß die e<strong>in</strong>facheren Särge zu 2 o<strong>der</strong> 3 übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gestellt werden<br />
sollen. Außerdem schreibt er: „E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Särge liegt ja nach wie vor im h<strong>in</strong>teren<br />
Teil <strong>der</strong> Gruft völlig unter Trümmern.“ (Hervorhebung durch den<br />
Verf.) Dabei genügte es zur Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bergung, wenn auch nur e<strong>in</strong> Teil e<strong>in</strong>es<br />
Sarges von den Trümmern bedeckt war. Zur Bergung vgl. u. ausführlich. Das Antwortschreiben<br />
im LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
57 S. das Tagebuch des kommissarischen Oberbürgermeisters Seidel, 1. Band, S. 3 f., <strong>der</strong><br />
die Zustände mit denen des Dreißigjährigen Krieges vergleicht. Dort auch das Zitat. Es<br />
folgt e<strong>in</strong>e Beschreibung <strong>der</strong> Situation. Weiter unten heißt es: „<strong>Die</strong> Bevölkerung musste<br />
[...] ihre Waffen ausliefern, während die Auslän<strong>der</strong> – Fremdarbeiter – es verstanden hatten,<br />
sich zu bewaffnen. <strong>Die</strong> Deutsche Bevölkerung hatte Ausgehbeschränkung, während<br />
die Auslän<strong>der</strong> die Nacht zum Tage machten und unbehelligt ihrem lichtscheuen Treiben<br />
nachg<strong>in</strong>gen. <strong>Die</strong> bald [...] e<strong>in</strong>gerichtete Hilfspolizei konnte dem Unwesen <strong>der</strong> ausländischen<br />
Arbeiter mit Erfolg nicht E<strong>in</strong>halt gebieten, da ihr von <strong>der</strong> amerikanischen Regierung<br />
das Tragen, auch <strong>der</strong> leichtesten Handwaffen verboten war.“ (Tagebuch Seidels,<br />
Stadtarchiv Kassel, Abt. C, Nachlaß Seidel). Zu den Plün<strong>der</strong>ungen vgl. auch: Lageberichte<br />
des kommissarischen Polizeipräsidenten 1945-48; Stadtarchiv Kassel, Abt. A, Bestand<br />
1.10, Nr. 70-71.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
1946 entdeckt: 58 Bei e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Begehung <strong>der</strong> Ru<strong>in</strong>e stellten sie fest, daß<br />
die Gruft unter dem Kapitelsaal und die Sarghalle im Nordturm aufgebrochen<br />
worden waren: <strong>Die</strong> Särge gewaltsam geöffnet, nach Schmuckgegenständen durchsucht<br />
und beraubt, die Gebe<strong>in</strong>e dabei teilweise auf dem Boden verstreut. Zunächst<br />
wurde e<strong>in</strong>e Vermauerung <strong>der</strong> besagten Räume vere<strong>in</strong>bart, doch wegen <strong>der</strong> zu erwartenden<br />
Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Beschaffung von Material und Arbeitskräften<br />
und wegen <strong>der</strong> Möglichkeit weiterer E<strong>in</strong>brüche aber wie<strong>der</strong> verworfen. Oberlandeskirchenrat<br />
Dr. Blesse bemühte sich am 8. 2. statt dessen um e<strong>in</strong>e sofortige<br />
sichere Unterbr<strong>in</strong>gung durch das Hessische Landesmuseum Kassel – dabei legte er<br />
Wert darauf, daß die Särge später wie<strong>der</strong> an ihre alte Stelle zurückkehren würden.<br />
59 Dr. Helm, <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Abteilung Volkskunde, sicherte sechs Tage später<br />
<strong>in</strong> Vertretung des Direktors <strong>der</strong> Staatlichen Kunstsammlungen e<strong>in</strong>e Unterbr<strong>in</strong>gung<br />
im Gebäude <strong>der</strong> Gemäldegalerie zu; <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Landesbibliothek, Dr. Hopf,<br />
hatte sich zuvor bereit erklärt, sie dort <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em von <strong>der</strong> Bibliothek angemieteten<br />
Magaz<strong>in</strong> aufzunehmen. Allerd<strong>in</strong>gs hegte Helm große Bedenken, ob es möglich<br />
sei, die beiden schweren Barocksärge im Nordturm über die Trümmer <strong>der</strong> Vorhalle<br />
zu heben und dann zu transportieren, so daß er <strong>der</strong>en E<strong>in</strong>mauerung an Ort und<br />
Stelle befürwortete. 60 Das weitere Vorgehen erfolgte <strong>in</strong> enger Abstimmung mit<br />
Landeskonservator Dr. Bleibaum, Dekan Ste<strong>in</strong>weg und den zuständigen Stellen<br />
beim Regierungspräsidium; die größte Schwierigkeit war dabei die Erlangung von<br />
Arbeitskräften und Transportmöglic hkeiten; 61 so wurde dann auch die Bergung<br />
dadurch verzögert, daß die amerikanische Militärregierung alle Arbeitskräfte aus<br />
<strong>der</strong> Stadt zu eigenen Zwecken abgezogen hatte, und daß schließlich we<strong>der</strong> die<br />
Spediteure noch die Feuerwehr den Transport übernehmen wollten. 62 Durch Be-<br />
––––––––––<br />
58 Zu <strong>der</strong> Plün<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Särge e<strong>in</strong>e Mitteilung des ehem. preußischen Kultusm<strong>in</strong>isters (vor<br />
1933) Dr. Schmidt-Ott vom Mai 1945 an Frau E. Wegner, Kassel, damals evakuiert. <strong>Die</strong><br />
Angabe stimmt mit e<strong>in</strong>er Bemerkung <strong>in</strong> den Akten <strong>der</strong> Landeskirche übere<strong>in</strong>, wonach die<br />
Plün<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Särge durch polnische Staatsangehörige erfolgte: Schreiben von Dr.<br />
Blesse (LKA) an den Gesamtverband <strong>der</strong> Evangelischen Kirchengeme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Kassel<br />
vom 27.11.1953, LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1. Aktenvermerk über die Besichtigung<br />
<strong>der</strong> Ru<strong>in</strong>e und die Besprechung vom 30.1.1946, sowie Schreiben des LKA vom 8.2.1946<br />
an den Direktor des Landesmuseums, jeweils von Blesse; LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
59 Schreiben von Blesse (LKA) vom 8.2.1946 an den Direktor des Landesmuseums; LKA,<br />
Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
60 Antwort durch Dr. Helm, Leiter <strong>der</strong> Abteilung Volkskunde, vom 14.2.1946. LKA, Akte<br />
413 VII 462, Bd. 1.<br />
61 Schreiben von Blesse vom 20.2.1946 an den Dekan Ste<strong>in</strong>weg und an den Landeskonservator<br />
Dr. Bleibaum, mit Bitte um Unterstützung beim Arbeitsamt bezüglich Arbeitskräfte<br />
und Transportmittel; Antwort des Dekans vom 2.3.1946, daß er die Angelegenheit an<br />
Regierungsdirektor Schafft weitergeleitet habe. Schreiben Blesses vom 8.3.1946 an den<br />
Regierungspräsidenten mit <strong>der</strong> Bitte um f<strong>in</strong>anzielle Hilfe für Sicherung von Mart<strong>in</strong>s- und<br />
Brü<strong>der</strong>kirche, Antwort Schaffts vom (3. 4.) bzw. 26.3.1946 mit Verweis auf den Mangel<br />
an Arbeitskräften und Material und Vorschlag e<strong>in</strong>er Besprechung. Aktenvermerk Blesses<br />
vom 13.5.1946 über die Besprechung, an <strong>der</strong> u. a. <strong>der</strong> Bischof, Schafft, Bleibaum sowie<br />
Oberregierungs- und Baurat Flügel teilnahmen: Sicherung <strong>der</strong> Särge und Instandsetzung<br />
von Chor und Brü<strong>der</strong>kirche wurden vorgesehen; hier auch die Beanspruchung <strong>der</strong> Arbeitskräfte<br />
durch die Militärregierung vermerkt. LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
62 S. den Bericht <strong>der</strong> <strong>Die</strong>nststelle Kassel des Landeskonservators vom 18.11.1946 über den<br />
Transport <strong>der</strong> Särge, LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
39
40<br />
Christian Presche<br />
mühungen des Baurates Bormann vom Staatsbauamt <strong>in</strong> Kassel fand sich dann aber<br />
die Mitteldeutsche-Straßenbau-AG (Mistra) bereit, die Arbeit zu übernehmen. Am<br />
14., 15. und 18. November wurden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ersten Maßnahme 5 Särge zu je 10<br />
Zentner Gewicht aus <strong>der</strong> Gruft unter dem Kapitelsaal <strong>in</strong> das Gebäude <strong>der</strong> Gemäldegalerie<br />
gebracht; von ihnen waren 3 stark verbogen und durchwühlt. Außerdem<br />
wurde e<strong>in</strong>e Truhe aus Eichenholz geborgen, die ebenfalls aufgebrochen worden<br />
war. 63 Damit war das Problem jedoch noch immer nicht vollständig gelöst, denn<br />
die beiden großen Barocksärge verblieben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ru<strong>in</strong>e, und auch <strong>in</strong> dem schwerer<br />
zugänglichen Teil <strong>der</strong> Gruft sowie unter dem Schutt <strong>der</strong> e<strong>in</strong>gestürzten Gewölbeteile<br />
standen immer noch Särge; so stahlen Mitte Oktober 1949 zwei Vorbestrafte<br />
dort e<strong>in</strong>en Sargdeckel aus Z<strong>in</strong>n und verkauften ihn für ca. 100 DM; sie konnten<br />
zwar überführt werden, doch war <strong>der</strong> Deckel bereits e<strong>in</strong>geschmolzen worden. 64<br />
E<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>s bezeichnendes Licht auf die Situation <strong>der</strong> 1950er Jahre werfen<br />
dann aber die Vorkommnisse um die Gruft unter dem Kapitelsaal: Am 23. und 24.<br />
November 1953 erfolgte die Enttrümmerung des vollkommen zerstörten Kapitelsaales<br />
65 , unter Fe<strong>der</strong>führung des Gesamtverbandes <strong>der</strong> Evangelischen Kirchengeme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong> Kassel. Obwohl <strong>der</strong> verantwortliche Verwaltungsdirektor Bachmann „m<strong>in</strong>destens<br />
seit <strong>der</strong> Plün<strong>der</strong>ung durch die Polen“ Kenntnis von <strong>der</strong> Existenz <strong>der</strong> Särge <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> darunter liegenden Gruft haben musste, ordnete er für <strong>der</strong>en Freilegung ke<strong>in</strong>e<br />
beson<strong>der</strong>en Vorkehrungen an; we<strong>der</strong> die Landeskirche noch <strong>der</strong> Landeskonservator,<br />
<strong>der</strong> zuvor an allen Maßnahmen beteiligt worden war, wurden benachrichtigt. 66<br />
Selbst die beauftragten Bauunternehmen erhielten ke<strong>in</strong>e Informationen, was sie <strong>in</strong><br />
dem besagten „Kellerraum des Kapitelsaales“ erwartete. 67 Im Verlauf <strong>der</strong> Arbeiten 68<br />
wurden diese Versäumnisse offenkundig, als <strong>der</strong> e<strong>in</strong>gesetzte Bagger am ersten Tag<br />
<strong>der</strong> Räumung e<strong>in</strong>en Sargdeckel aus den Trümmern zog – zum großen Entsetzen<br />
se<strong>in</strong>es Führers. Von da ab legte <strong>der</strong> Bagger weitere Deckel und Sargkästen frei.<br />
Geborgen wurden am folgenden Tag zunächst die Überreste von ca. 7 Särgen, außerdem<br />
Gebe<strong>in</strong>e, die zwischen den Brettern von Innensärgen (o<strong>der</strong> auch den Holzsärgen?)<br />
lagen; weiterh<strong>in</strong> Figuren sowie Sph<strong>in</strong>gen und Löwen, die als Füße <strong>der</strong><br />
Särge von Wilhelm VI. und Hedwig Sophia gedient hatten. Nun wurde <strong>in</strong> zahlrei-<br />
––––––––––<br />
63 Bericht über den Transport (wie Anm. 62), sowie Vermerk des LKA vom 16.11.1946 über<br />
die ersten beiden Transporte und den geplanten dritten. Alle Aktenstücke LKA, Akte 413<br />
VII 462, Bd.1. Vgl. KNÖPPEL, S. 111.<br />
64 „Z<strong>in</strong>nsargdeckel gestohlen – Täter überführt“, Hessische Nachrichten (HN) vom<br />
12.12.1949; Abschrift <strong>in</strong> <strong>der</strong> Akte 413 VII 462, Bd. 1, LKA.<br />
65 „Sargfunde bei <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche“, HN vom 25.11.1953, sowie „Särge aus Z<strong>in</strong>n im<br />
Ru<strong>in</strong>enschutt <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche gefunden“, <strong>Kasseler</strong> Zeitung (KZ) vom 25.11. 1953.<br />
66 Vermerk Blesses vom 26.11.1953 und Schreiben vom 27.11.1953 an den Gesamtverband<br />
(dort auch das Zitat), LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1.<br />
67 <strong>Die</strong> „Leistungsbeschreibung zur Enttrümmerung des Platzes an <strong>der</strong> Nordseite <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche“<br />
führt nur auf: “Der e<strong>in</strong>gestürzte Kellerraum des Kapitelsaales-Anbaues an <strong>der</strong><br />
Nordseite <strong>der</strong> Kirche ist bis auf die Kellersohle zu säubern, die Bruchste<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>d zur<br />
Wie<strong>der</strong>verwendung zu lagern und e<strong>in</strong>sturzgefährdete Gewölbereste und Mauern s<strong>in</strong>d zu<br />
beseitigen.“ Akte zur Enttrümmerung im Ordner „Restarbeiten“ zum Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong><br />
Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauabteilung des Gesamtverbandes. (Me<strong>in</strong> Dank gilt an dieser Stelle<br />
Herrn Hofmann von <strong>der</strong> Bauabteilung des Gesamtverbandes, <strong>der</strong> mir die Hausakten<br />
zugänglich machte.)<br />
68 <strong>Die</strong> Darstellung folgt Friedrich Herbordts Artikel „Sargfunde bei <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche“, HN<br />
vom 25.11.1953 (wie Anm. 65).
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
chen Telephonaten zwischen den Behörden die Kostenfrage geklärt, die Räumarbeiten<br />
erst e<strong>in</strong>mal unterbrochen. Inzwischen waren zum<strong>in</strong>dest die Staatlichen Kunstsammlungen<br />
h<strong>in</strong>zugezogen, und Bachmann ließ sich auf <strong>der</strong> Baustelle sehen; unter<br />
<strong>der</strong> Aufsicht Helms legte <strong>der</strong> Bagger noch e<strong>in</strong>en weiteren Sarg frei, außerdem wurden<br />
weitere Figuren, Wappen und Löwenfüße geborgen. Insgesamt hatte man vier<br />
vollständige Sargkästen sowie e<strong>in</strong>en zerrissenen und vier Deckel aus den Trümmern<br />
gezogen 69 (e<strong>in</strong> Deckel war 1949 geraubt worden; s. o.), außerdem vermutlich e<strong>in</strong>en<br />
vollständigen Sarg und die Überreste von zwei weiteren (K<strong>in</strong><strong>der</strong>-) Särgen. 70 An<br />
Hand <strong>der</strong> Inschriften konnten vor Ort die Särge <strong>der</strong> Landgrafen Wilhelm V. und<br />
Wilhelm VI. bestimmt werden, unter den an<strong>der</strong>en vermutete man damals diejenigen<br />
Wilhelms VII. und <strong>der</strong> Landgräf<strong>in</strong>nen Amelia Elisabeth und Hedwig Sophia. Auf<br />
e<strong>in</strong>er Photographie dreier vollständig geborgener Sargkästen erkennt man diejenigen<br />
Wilhelms VII. und <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Louise Dorothea Sophia 71 , <strong>der</strong> dritte ist von den<br />
––––––––––<br />
69 Aktenvermerk <strong>in</strong> <strong>der</strong> Akte zur Enttrümmerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauabteilung des Gesamtverbandes,<br />
betr.: „Ausgrabungen im Kapitelsaalanbaues <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche zu Kassel. / Bei<br />
<strong>der</strong> Enttrümmerung des Kellerraumes von dem Kapitelsaalanbaues <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche<br />
zu Kassel wurden am 23. und 24. November 1953 aus dem Schutt nachstehend aufgeführte<br />
Teile geborgen und bei <strong>der</strong> Firma He<strong>in</strong>rich Rä<strong>der</strong>, Kassel, Yorkstr. 6-12 zur vorläufigen<br />
Aufbewahrung sichergestellt: 4 Särge, 3 Deckel + 1 Deckel <strong>der</strong> noch angefahren<br />
wurde, 2 Seitenteile, 1 Bodenblech, 31 Teile (<strong>in</strong> Kiste, z. T. beschädigt), 5 Löwen, 10<br />
Teile (Sargbeschläge, Sargmetall usw.), 4 R<strong>in</strong>ge (Griffe). Ferner ist noch e<strong>in</strong>e Anzahl<br />
Bleche (Sargverzierungen aufbewahrt), Stoffreste u. Tücher die <strong>in</strong> dem großen Sarg lagen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dem Chorraum <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche aufbewahrt. Aufgestellt Kassel am 25.<br />
November 1953.“ Handschriftlich ist h<strong>in</strong>zugefügt: „Oben aufgeführte Gegenstände wurden<br />
am 25.11.1953 durch die Firma Schmidtmann (mit Hilfe <strong>der</strong> Berufsfeuerwehr) unter<br />
Aufsicht des Herrn Gerdt vom Staatsbauamt zum Landesmuseum gebracht. 25.11.53 Di“<br />
[= <strong>Die</strong>tzel].<br />
70 Im Artikel „Sargfunde bei <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche“, HN vom 25.11.1953, nennt Redakteur Friedrich<br />
Herbordt die Überreste von zunächst <strong>in</strong>sgesamt sieben Särgen sowie e<strong>in</strong>em zuletzt geborgenen<br />
zerdrückten Sarg. Damit bleibt e<strong>in</strong>e erhebliche Diskrepanz zur Aufstellung aus<br />
Anm. 69; aber auch <strong>der</strong> sehr kurze Artikel „Särge aus Z<strong>in</strong>n im Ru<strong>in</strong>enschutt <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
gefunden“, KZ vom 25.11.1953, berichtet nur von Überresten von fünf Prunksärgen<br />
(wobei aber möglicherweise die oben genannten E<strong>in</strong>zelteile e<strong>in</strong>es Kastens nicht enthalten<br />
s<strong>in</strong>d). Dagegen fehlen <strong>in</strong> <strong>der</strong> genannten Auflistung die großen Sph<strong>in</strong>gen vom Sarg Wilhelms<br />
VI., und <strong>in</strong> den HN wird ausdrücklich von zwei Schrotthändlern gesprochen. Zudem<br />
wurden 1946 nur fünf Särge geborgen, 1957 noch die zwei Barocksärge aus dem Nordturm<br />
<strong>in</strong> die neue Gruft gebracht, was zusammen sieben Särge ergibt; dort stehen aber acht! Es<br />
sche<strong>in</strong>en also tatsächlich zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong> vollständiger Sarg, die Reste von zwei K<strong>in</strong><strong>der</strong>särgen<br />
und die fraglichen Sph<strong>in</strong>gen sowie vielleicht weitere Teile bei e<strong>in</strong>em unbekannten<br />
zweiten Schrotthändler untergebracht worden zu se<strong>in</strong>, ohne daß e<strong>in</strong> Protokoll angefertigt<br />
wurde. Grund hierfür mag dessen Seriosität gewesen se<strong>in</strong>, während Rä<strong>der</strong> damals <strong>in</strong> Kassel<br />
im Rufe stand, auch Metallwaren aus dubiosen Quellen anzukaufen (freundliche Mitteilung<br />
von Herrn H. Germandi, Kassel). <strong>Die</strong> meisten <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche geraubten Metallteile<br />
sollen bei ihm e<strong>in</strong>geschmolzen worden se<strong>in</strong>, ebenso Statue und Reliefs des Philippdenkmals<br />
erst nach Kriegsende zu eigenem Vorteil.<br />
71 „Särge aus Z<strong>in</strong>n im Ru<strong>in</strong>enschutt <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche gefunden“, KZ vom 25.11.1953. Der<br />
vor<strong>der</strong>e Sargkasten auf <strong>der</strong> Aufnahme ist e<strong>in</strong>deutig <strong>der</strong> von Wilhelm VII. (Abb. bei<br />
HOLTMEYER, Tafel 132, 3), <strong>der</strong> rechte h<strong>in</strong>tere mit vier Fel<strong>der</strong>n an den Langseiten ist als <strong>der</strong>jenige<br />
<strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> zu identifizieren: Photographien dieser Fel<strong>der</strong> lassen die Aufschriften<br />
erkennen, aus denen die Identität <strong>der</strong> Bestatteten hervorgeht (<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Sammlung von Detailphotographien<br />
zahlreicher Särge; im Geme<strong>in</strong>dearchiv, aus <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> 1930er Jahre).<br />
41
42<br />
Christian Presche<br />
beiden an<strong>der</strong>en zu stark verdeckt, könnte aber <strong>der</strong>jenige Wilhelms V. se<strong>in</strong>; die<br />
Deckel s<strong>in</strong>d abgenommen, die Kästen zwar etwas verbogen und willkürlich aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />
gelegt, aber ansonsten vollständig <strong>in</strong>takt.<br />
Noch Jahre später wurde <strong>in</strong> Kassel mit Entsetzen von den Vorgängen bei <strong>der</strong><br />
Räumung und vom Umgang mit den Gebe<strong>in</strong>en gesprochen; erst bei diesen Arbeiten<br />
sollen auch e<strong>in</strong>ige noch vorhandene Särge zerstört worden se<strong>in</strong>, <strong>in</strong>dem die<br />
Gewölbe ohne Rücksicht auf die darunter stehenden Särge e<strong>in</strong>gerissen wurden. 72<br />
Zwei Tage nach <strong>der</strong> Räumung meldete dann das Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt<br />
Kassel dem Landeskirchenamt, daß Wagenladungen des Trümmerschuttes aus<br />
<strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche nahe <strong>der</strong> Fulda abgeladen worden seien – mit Gebe<strong>in</strong>en durchsetzt!<br />
<strong>Die</strong>se wurden e<strong>in</strong>stweilen von jenem Amt e<strong>in</strong>gesammelt, und die Landeskirche<br />
rügte den Gesamtverband schärfstens wegen des „pietätlos[en]“ Verfahrens<br />
bei <strong>der</strong> Räumung; außerdem wäre bei rechtzeitiger Information <strong>der</strong> Landeskirche<br />
und des Landeskonservators „<strong>der</strong> pe<strong>in</strong>liche Zwischenfall, <strong>der</strong> <strong>in</strong> schwerer Weise<br />
das Gefühl <strong>der</strong> anständig Denkenden verletzt hat, vermieden worden.“ 73 – <strong>Die</strong><br />
Särge und Metallteile hatte man <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zwischenzeit zunächst bei zwei Schrotthändlern<br />
(!) untergestellt. Am folgenden Tag wurden sie unter Aufsicht des<br />
Staatsbauamtes ebenfalls <strong>in</strong> das Landesmuseum transportiert – wo sie teilweise<br />
noch heute gelagert werden. <strong>Die</strong> Stoffe aus dem Sarg <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Louise Dorothea<br />
Sophia († 1705) bewahrte man zunächst im Chorraum <strong>der</strong> Kirche auf 74 ; die<br />
geborgenen Gewän<strong>der</strong> des Landgrafen Wilhelm VI. (sog. Rhe<strong>in</strong>grafenhose) und<br />
<strong>der</strong> genannten Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> (Mantel und Rock) wurden dann auf Veranlassung<br />
Helms durch das Landesmuseum restauriert, wissenschaftlich untersucht und s<strong>in</strong>d<br />
dort z. T. ausgestellt. <strong>Die</strong> (angeblichen) Gebe<strong>in</strong>e Landgraf Wilhelms VI. wurden<br />
im Museum <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Holzkiste e<strong>in</strong>gelagert und s<strong>in</strong>d – ebenso wie die übrigen geborgenen<br />
– bislang noch nicht <strong>in</strong> die Kirche zurückgekehrt. 75 Insbeson<strong>der</strong>e fehlen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft seit <strong>der</strong> Bergung von 1953 die Särge und Gebe<strong>in</strong>e Wilhelms V., Wilhelms<br />
VI., Wilhelms VII., Hedwig Sophias und Louise Dorothea Sophias (vgl.<br />
Abb. 9-11). <strong>Die</strong> sieben Holzsärge (darunter die Särge Wilhelms VIII. und se<strong>in</strong>er<br />
Frau Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>e; s. u.) sowie e<strong>in</strong>ige K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge s<strong>in</strong>d offenbar unwie<strong>der</strong>br<strong>in</strong>glich<br />
verloren. Zeitungsmeldungen zufolge sollten die geborgenen Särge<br />
––––––––––<br />
72 Vgl. Schriftwechsel zwischen Pr<strong>in</strong>z Wolfgang von Hessen, Gottfried Kiesow (Landeskonservator),<br />
Dekan Giesler und dem Stadtarchiv Kassel aus den Jahren 1974/75 bezüglich<br />
<strong>der</strong> Fürstengrüfte, beson<strong>der</strong>s Schreiben des Pr<strong>in</strong>zen vom 20.12.1974 an Kiesow und<br />
vom 15.8.1975 an Giesler; Stadtarchiv Kassel.<br />
73 Vermerk vom 26.11.1953 sowie Schreiben an den Gesamtverband vom 27.11.1953, jeweils<br />
von Blesse verfasst, LKA, Akte 413 VII 462, Bd. 1. Dabei dürfte (!) es sich aber eigentlich<br />
nicht um die Gebe<strong>in</strong>e aus den vollständig geborgenen Särgen handeln, son<strong>der</strong>n um diejenigen<br />
aus den vollkommen zertrümmerten, die dadurch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft verstreut waren.<br />
74 Nach <strong>der</strong> Aufstellung wie Anm. 69; mit dem „großen Sarg“ ist offenbar <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong><br />
Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>t, <strong>der</strong> tatsächlich deutlich größer als die an<strong>der</strong>en geborgenen war (vgl.<br />
die Maße bei HOLTMEYER, S. 185 f.).<br />
75 Vgl. Schriftwechsel wie Anm. 72; danach sollen im Landesmuseum damals angeblich<br />
noch die übrigen Metallsärge vorhanden gewesen se<strong>in</strong> – allerd<strong>in</strong>gs leer! Zu den Gewän<strong>der</strong>n<br />
s. RITGEN / THORNTON. Den H<strong>in</strong>weis auf diese Aufsätze verdanke ich Herrn Wegner<br />
vom Stadtmuseum Kassel und Herrn Dr. Schmidberger vom Hessischen Landesmuseum<br />
Kassel. Das Gewand <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> (ohne Rock) ist als „Morgenmantel“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Abteilung<br />
„Schatzkunst“ des Landesmuseums ausgestellt, mit <strong>der</strong> Mutmaßung, er könnte 1705 als<br />
Geschenk des Vaters <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> angefertigt worden se<strong>in</strong>.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
gesäubert und dann entwe<strong>der</strong> – sofern möglich – wie<strong>der</strong>hergestellt o<strong>der</strong> die<br />
Inschriften „zum Gedächtnis an die Toten“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche angebracht<br />
werden; die E<strong>in</strong>zelteile sollten sorgfältig gere<strong>in</strong>igt und ausgebessert werden. 76<br />
Am 16.2.1954 beschloß dann <strong>der</strong> kommissarische Kirchenvorstand: „Es soll<br />
angestrebt werden, die Krypten [...] zugänglich zu machen.“ In <strong>der</strong> Folgezeit wurde<br />
also auch e<strong>in</strong>e Öffnung <strong>der</strong> Chorgruft weiterh<strong>in</strong> diskutiert. Im Jahre 1957 unternahm<br />
man schließlich den Versuch, von dem Nebenraum unter <strong>der</strong> Sakristei<br />
e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die älteste Gruft zu schaffen, doch erwies sich dieser Plan<br />
glücklicherweise als nicht ausführbar. 77 Unter dem neuen Kapitelsaal wurde e<strong>in</strong><br />
Kellerraum für die Aufnahme <strong>der</strong> erhaltenen Särge e<strong>in</strong>gerichtet; am 2.5.1957 ordnete<br />
schließlich die Bauführung an: „<strong>Die</strong> Särge des Landgrafen Karl und se<strong>in</strong>er<br />
Gemahl<strong>in</strong> sollen unverzüglich aus dem Turmraum <strong>in</strong> den dafür vorgesehenen<br />
Raum unter dem Kapitelsaal gebracht werden [...]. <strong>Die</strong> fünf an<strong>der</strong>en Särge sollen<br />
dann r<strong>in</strong>gsum mit den Längsseiten vor die Wände gestellt werden.“ 78 – Bei diesen<br />
an<strong>der</strong>en Särgen handelte es sich offenbar um jene, die bereits 1946 mit dem ersten<br />
Transport <strong>in</strong> die Gemäldegalerie gebracht worden waren; von den 1953 im Landesmuseum<br />
sichergestellten Särgen ist also ke<strong>in</strong>e Rede mehr! <strong>Die</strong> Verhandlungen<br />
mit dem Museum sollte Bachmann führen.<br />
Am 1.6.1958 wurde die Kirche, die durch den Trierer Baurat He<strong>in</strong>rich Otto<br />
Vogel neu aufgebaut worden war, wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>geweiht. Der besagte Kellerraum<br />
für die Särge war nun um den neu e<strong>in</strong>gewölbten Nebenraum unter <strong>der</strong> Sakristei<br />
erweitert; im Hauptraum s<strong>in</strong>d gegenwärtig sechs Särge aufgestellt, weitere zwei<br />
im Nebenraum (s. u.). <strong>Die</strong> Spur von m<strong>in</strong>destens vier weiteren Särgen sowie<br />
––––––––––<br />
76 <strong>Die</strong> Zeitungen s<strong>in</strong>d sich dabei nicht e<strong>in</strong>ig: <strong>Die</strong> HN berichten, daß <strong>in</strong> den Werkstätten des<br />
Landesmuseums „die E<strong>in</strong>zelteile sorgfältig gere<strong>in</strong>igt und ausgebessert werden sollen. <strong>Die</strong><br />
Särge werden wohl nicht wie<strong>der</strong>hergestellt werden können. Es besteht aber die Absicht,<br />
vielleicht größere Teile, E<strong>in</strong>zelwände usw. zu erhalten.“ (Was aber die völlige Zerlegung<br />
<strong>der</strong> erhaltenen Kästen und Deckel bedeutet hätte); „Landgrafen-Särge kamen <strong>in</strong> das Landesmuseum“,<br />
HN vom 26.11.1953. <strong>Die</strong> KZ schreibt dagegen: „<strong>Die</strong> starkbeschädigten Särge,<br />
<strong>in</strong> denen noch, wie wir berichteten, Skelettreste gefunden wurden, sollen im Landesmuseum<br />
gere<strong>in</strong>igt und, soweit möglich, wie<strong>der</strong>hergestellt werden“; „Prunksärge im Landesmuseum“,<br />
KZ vom 27.11.1953. <strong>Die</strong> Wahrheit sche<strong>in</strong>t hier <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung aus beidem zu<br />
liegen: <strong>Die</strong> erhaltenen Särge sollten möglichst wie<strong>der</strong>hergestellt, die geborgenen E<strong>in</strong>zelteile<br />
restauriert werden (darunter wohl auch die Wand- und Bodenplatten des zerrissenen Sarges).<br />
Dem kommt auch <strong>der</strong> Artikel <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Post vom 27.11.1953 am nächsten: „Landgräfliche<br />
Prunksärge wurden aus Trümmern <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche geborgen“; dar<strong>in</strong> heißt es:<br />
„Sie [die Särge] s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs sehr stark beschädigt, und es besteht wenig Aussicht, daß<br />
die reichverzierten Metallsärge, die nun vorerst im Landesmuseum untergebracht wurden,<br />
wie<strong>der</strong> ganz hergestellt werden können. Außer den Särgen wurden auch zahlreiche kle<strong>in</strong>ere<br />
Bronzefiguren, Stoffreste und menschliche Gebe<strong>in</strong>e gefunden. [...] <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Teile, die<br />
aus dem Trümmergrundstück geborgen werden konnten, werden zur Zeit im Landesmuseum<br />
sorgfältig gere<strong>in</strong>igt, ausgebessert und zusammengesetzt.“<br />
77 Abschrift des Protokolls <strong>der</strong> Kirchenvorstandssitzung vom 16.2.1954, LKA, Akte 413<br />
VII 462, Bd. 2, sowie Schriftwechsel (wie Anm. 72), Protokoll <strong>der</strong> Besprechung vom<br />
10.3.1975.<br />
78 „Protokoll über das Ergebnis <strong>der</strong> Besprechungen zum Bau <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche am 2. Mai<br />
1957 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Baracke des Bauleiters an <strong>der</strong> Kirche“, Punkt 5. In <strong>der</strong> Protokollakte zum<br />
Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauabteilung des Gesamtverbandes.<br />
43
44<br />
Christian Presche<br />
e<strong>in</strong>es zerrissenen Sarges verliert sich im Landesmuseum 79 ; die angekündigten<br />
Restaurierungen s<strong>in</strong>d offenbar ebenso wenig erfolgt, wie e<strong>in</strong>e Rückführung von<br />
E<strong>in</strong>zelteilen. Lediglich <strong>der</strong> Sarg Amelia Elisabeths wurde geme<strong>in</strong>sam mit den<br />
fünf an<strong>der</strong>en Särgen <strong>in</strong> die Kirche zurückgebracht (s. u.).<br />
Im Rahmen geplanter Maßnahmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft 80 wäre es<br />
wünschenswert, wenn die sterblichen Überreste <strong>der</strong> e<strong>in</strong>st hier Bestatteten wie<strong>der</strong><br />
ermittelt und <strong>in</strong> ihrer ursprünglichen Grabstätte <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> beigesetzt werden<br />
könnten!<br />
Erwähnt sei abschließend noch, daß im Jahre 1974 auf Bitte des VHG Pr<strong>in</strong>z<br />
Wolfgang von Hessen geme<strong>in</strong>sam mit Landgraf Philipp die neue Gruft besichtigte.<br />
Danach teilte er dem Landeskonservator Dr. Kiesow den schlechten Zustand<br />
<strong>der</strong> Särge mit und regte u. a. <strong>der</strong>en Säuberung vom Staub sowie die Anbr<strong>in</strong>gung<br />
e<strong>in</strong>er Gedenktafel an. Außerdem schlug er vor, die im Landesmuseum noch aufbewahrten<br />
Särge ebenfalls <strong>in</strong> <strong>der</strong> neuen Gruft aufzustellen. Nebenbei fügte er<br />
h<strong>in</strong>zu, was ihm von <strong>der</strong> „Pietätlosigkeit“ des Baggere<strong>in</strong>satzes während <strong>der</strong> Räumungsarbeiten<br />
berichtet worden sei (fälschlich aber auf die Chorgruft bezogen).<br />
Auf diese „ungerechtfertigte[n] Anschuldigungen“ und die „beleidigende Äußerung“<br />
h<strong>in</strong> berief Dekan Giesler unverzüglich e<strong>in</strong>e Sitzung e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> <strong>der</strong> die Mitglie<strong>der</strong><br />
des provisorischen Kirchenvorstandes von 1953 die Bemerkung des Pr<strong>in</strong>zen <strong>in</strong><br />
aller Ausführlichkeit schärfstens als unrichtig zurückwiesen: <strong>Die</strong> Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Trümmer des Kapitelsaals sei „mit aller Vorsicht“ durchgeführt worden, „es<br />
wurde nichts Menschenmögliches versäumt.“ Nebenbei stimmte man <strong>in</strong> kurzer<br />
Abstimmung den vorgeschlagenen an<strong>der</strong>en Punkten zu. 81<br />
In <strong>der</strong> Folge wurde also die neue Gruft 1975 renoviert, <strong>der</strong> Staub von den<br />
Särgen entfernt. Außerdem wurde 1976 aus Mitteln <strong>der</strong> Hessischen Hausstiftung<br />
e<strong>in</strong>e Gedenktafel für die beigesetzten Landgrafen und ihre Frauen unter dem<br />
Wappenfenster <strong>der</strong> Althessischen Ritterschaft angebracht; <strong>in</strong>zwischen ist diese<br />
Tafel an die Außenseite <strong>der</strong> Kirche versetzt worden. 82<br />
In diesem Zusammenhang regte Dekan Giesler an, die (angeblichen) Gebe<strong>in</strong>e<br />
Wilhelms VI. wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche beizusetzen und die Toten aus den<br />
beiden offenen Särgen im Nebenraum <strong>der</strong> Gruft <strong>in</strong> Holzsärge umzubetten; au-<br />
––––––––––<br />
79 <strong>Die</strong> <strong>der</strong> zugehörigen Gebe<strong>in</strong>e ebenfalls; sie sollen gemäß angebl. Aussage des ehem.<br />
Direktors <strong>der</strong> Staatlichen Kunstsammlungen, Prof. Dr. Herzog, unter se<strong>in</strong>em Vorgänger,<br />
Dr. Dr. Vogel, nach 1953 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er „Nacht- und Nebel-Aktion“ aus dem Museum auf den<br />
Hauptfriedhof gebracht worden se<strong>in</strong>. Dort hat man aber gegenwärtig von e<strong>in</strong>em <strong>der</strong>artigen<br />
Vorgang ke<strong>in</strong>e Kenntnis; die Karten vermerken ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong>artige Beisetzung (freundliche<br />
Auskunft von Herrn Rehs), seit 1956 wurden lediglich <strong>in</strong>nerhalb des Friedhofs Gebe<strong>in</strong>e<br />
anlässlich <strong>der</strong> Straßenverbreiterung umgebettet, am Anfang <strong>der</strong> 1970er Jahre die<br />
Gebe<strong>in</strong>e aus <strong>der</strong> Familiengruft von Stockhausen aus Trendelburg <strong>in</strong> Abstimmung mit <strong>der</strong><br />
Familie und dem Landesmuseum e<strong>in</strong>geäschert [freundliche Auskunft von Herren H. G.<br />
Pasche, Kassel, ehem. Leiter <strong>der</strong> Friedhofsverwaltung (seit 1956 auf dem Friedhof tätig),<br />
sowie von Herrn E. Stange, Fuldatal, ehem. Gärtnermeister auf dem Hauptfriedhof (seit<br />
1960)].<br />
80 Vgl. KNÖPPEL, S. 112.<br />
81 Schriftwechsel (wie Anm. 72). Beson<strong>der</strong>s Protokoll <strong>der</strong> Besprechung vom 10.3.1975.<br />
82 „Gedenktafel er<strong>in</strong>nert an die hessischen Landgrafen“, Hessische Allgeme<strong>in</strong>e, 19.6.1976;<br />
vgl. Schriftwechsel (wie Anm. 72). <strong>Die</strong> Zahl <strong>der</strong> Bestatteten ist allerd<strong>in</strong>gs mit 58 zu niedrig<br />
angegeben.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
ßerdem brachte er noch e<strong>in</strong>mal die im Landesmuseum stehenden Särge <strong>in</strong>s Gespräch.<br />
83 <strong>Die</strong> Bemühungen blieben allerd<strong>in</strong>gs ergebnislos.<br />
Zuletzt wurde die neue Gruft im Jahre 1995 <strong>in</strong>stand gesetzt und mit neuer<br />
Beleuchtung versehen. Für die nächste Zeit ist e<strong>in</strong>e Restaurierung <strong>der</strong> Särge<br />
geplant, welche sowohl durch Kriegse<strong>in</strong>wirkung und Beraubung als auch durch<br />
chemische Prozesse stark angegriffen s<strong>in</strong>d. 84<br />
Liste <strong>der</strong> vermutlich <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft beigesetzten Angehörigen <strong>der</strong> landgräflichen<br />
Familie 85 , chronologisch geordnet nach dem Datum <strong>der</strong> Beisetzung:<br />
(<strong>Die</strong> identifizierten Särge s<strong>in</strong>d mit <strong>der</strong> Nummer im Lageplan versehen; neben den Lebensdaten<br />
<strong>der</strong> Verstorbenen s<strong>in</strong>d auch <strong>der</strong> Tag <strong>der</strong> Beisetzung und das Alter aufgeführt.)<br />
Name geboren am: gestorben am: beigesetzt am: Alter / Nr.<br />
Wilhelm V. 13. Febr. 1602 86 21. Sept. 1637 23. April 1640 35 Jahre; Nr. 54<br />
Louisa 1 5. Nov. 1636 6. Jan. 1638 23. April 1640 1 J 2 M<br />
Philipp 16. Juni 1630 17. Aug. 1638 23. April 1640 8 Jahre<br />
L. Amelia Elisa 29. Jan. 1602 8. Aug. 1651 30. Sept. 1651 49 Jahre; Nr. 53<br />
beth<br />
Louisa 2 11. Sept. 1652 23. Okt. 1652 18. Nov. 1652 1 Mon.<br />
Wilhelm VI. 23. Mai 1629 16. Juli 1663 27. Okt 1663 34 Jahre; Nr. 36<br />
Wilhelm VII. 21. Juni 1651 21. Nov. 1670 14. März 1671 19 Jahre; Nr. 34<br />
Georg 3 20. März 1658 4. Juli 1675 April 1676 17 Jahre; Nr. 33<br />
Wilhelm 4 29. März 1674 25. Juli 1676 15. Sept. 1676 2 Jahre<br />
Carl 24. Febr. 1675 7. Dez. 1677 21. Dez. 1677 2 J 9 M; Nr. 47<br />
Christian 2. Juli 1677 18. Sept. 1677 30. Sept. 1677 2 M<br />
L. Hedwig Sophia 4. Juli 1623<br />
Eleonora Antonet-<br />
16. Juni 1683 17. Juli 1683 fast 60 J.; Nr. 35<br />
ta Frie<strong>der</strong>ica 5<br />
11. Jan. 1694<br />
17. Dez. 1694<br />
22. Dez. 1694<br />
11 Mon.<br />
Carl 6 12. Juni 1680 13. Nov. 1702 11. Dez. 1702 22 Jahre; Nr. 27<br />
Leopold<br />
Louise Dorothea<br />
30. Dez. 1684 10. Sept. 1704 2. Okt. 1704 19 Jahre; Nr. 26<br />
Sophia 7<br />
19. Sept. 1680<br />
23. Dez. 1705<br />
8. Jan. 1706<br />
25 Jahre; Nr. 29<br />
Ludwig 8 5. Sept. 1686 23. Mai 1706 17. Juni 1706 19 Jahre; Nr. 55<br />
L. Maria Amelia 12. Juni 1653 16. Juni 1711 7. Juli 1711 58 Jahre; Nr. 32<br />
Carl 9 Wilhelm<strong>in</strong>a Char-<br />
21. Aug. 1718 17. Okt. 1719 26. Okt. 1719 1 J 1 M<br />
lotte 10<br />
8. Juli 1695<br />
27. Nov. 1722<br />
11. Dez. 1722<br />
27 Jahre; Nr. 56<br />
Carl 11 30. Sept. 1721 23. Nov. 1722 27. Nov. 1722 1 J 1 M<br />
Maria 25. Febr. 1726 14. März 1727 ohne Datum 1 Jahr<br />
L. Carl 3. Aug. 1654 87 23. März 1730 7. Mai 1730 75 Jahre; Nr. 31<br />
––––––––––<br />
83 Schreiben Gieslers vom 1.9.1975 an den Leiter des Stadtarchivs, Dr. Litterscheid, nachrichtlich<br />
an Landeskonservator Dr. Kiesow und den Leiter <strong>der</strong> Staatlichen Kunstsammlungen<br />
Prof. Dr. Herzog; im Schriftwechsel (wie Anm. 72). Zuletzt wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Schreiben des Stadtarchivs vom 2.6.1980 (!) dieses Vorhaben erwähnt.<br />
84 „Krypta wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> neuem Glanz“, Hessische Nie<strong>der</strong>sächsische Allgeme<strong>in</strong>e, 30.5.1995, zu<br />
den geplanten Maßnahmen s. auch KNÖPPEL, S. 112.<br />
85 Ermittelt nach KNETSCH, unter Berücksichtigung <strong>der</strong> beiden unten angeführten Listen<br />
und unter Ausschluss <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Fürstengruft Bestatteten.<br />
86 Wilhelm feierte se<strong>in</strong>en Geburtstag zwar stets am 14. Febr., <strong>der</strong> 13. ist aber das richtige<br />
Datum: KNETSCH, S. 113, Anm. 3.<br />
87 Nach <strong>der</strong> Kalen<strong>der</strong>reform des Jahres 1700 wurde <strong>der</strong> Geburtstag am 14. August gefeiert.<br />
45
46<br />
Christian Presche<br />
Name<br />
Elisabetha Sophia<br />
geboren am: gestorben am: beigesetzt am: Alter / Nr.<br />
Louisa 12<br />
Herzog<strong>in</strong> Marie<br />
Amalie von Sach-<br />
10. Nov. 1730 4. Febr. 1731 7. Febr. 1731 fast 3 Mon.<br />
sen-Zeitz 13<br />
16. Nov. 1670 17.Nov. 1739 1740<br />
69 Jahre; Nr. 30<br />
Wilhelm 14 Dorothea Wilhel-<br />
25. Dez. 1741 1. Juli 1742 4. Juli 1742 6 Mon.; Nr. 63<br />
m<strong>in</strong>a 15<br />
20. März 1691 17. März 1743 27. März 1743 fast 52 J; Nr. 28<br />
Maria Amelia 16 7. Juli 1721 19. Nov. 1744 27. Nov. 1744 23 Jahre; Nr. 49<br />
Maximilian 17 28. Mai 1689 8. Mai 1753 14. Mai 1753 fast 64 J; Nr. 50<br />
George 8. Jan. 1691 5. März 1755 11. März 1755 64 Jahre; Nr. 65<br />
L. Wilhelm VIII. 10. März 1682 1. Febr. 1760 2. März 1760 fast 78 J; Nr. 48<br />
Christ<strong>in</strong>a Charlotta 18 11. Febr. 1725 4. Juni 1782 10. Juni 1782 57 Jahre; Nr. 64<br />
1<br />
2<br />
3<br />
K<strong>in</strong>d Wilhelms V., Enkelk<strong>in</strong>d Moritz’ des Gelehrten;<br />
ebenso <strong>der</strong> folgende<br />
Tochter Wilhelms VI., Enkel<strong>in</strong> Wilhelms V.<br />
Sohn Wilhelms VI.<br />
10<br />
11<br />
12<br />
Tochter Carls<br />
K<strong>in</strong>d des Pr<strong>in</strong>zen Maximilian, Enkelk<strong>in</strong>d Carls;<br />
ebenso die folgende<br />
Tochter des Pr<strong>in</strong>zen Maximilian<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Sohn Carls, Enkel Wilhelms VI.; ebenso die folgenden<br />
Tochter Carls<br />
Sohn Carls; ebenso <strong>der</strong> folgende<br />
Frau des Erbpr<strong>in</strong>zen Friedrich<br />
Sohn Carls<br />
Sohn des Pr<strong>in</strong>zen Wilhelm (VIII.), Enkel Carls<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
Schwiegermutter des Statthalters Pr<strong>in</strong>z Wilhelm<br />
(VIII.)<br />
Sohn Friedrichs (II.), Enkel des Statthalters Pr<strong>in</strong>z<br />
Wilhelm (VIII.)<br />
Frau des Statthalters Pr<strong>in</strong>z Wilhelm (VIII.)<br />
Tochter des Statthalters Pr<strong>in</strong>z Wilhelm (VIII.)<br />
Sohn Carls; ebenso <strong>der</strong> folgende<br />
Tochter des Pr<strong>in</strong>zen Maximilian<br />
Es s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt also 32 Beisetzungen von landgräflichen Familienangehörigen<br />
<strong>in</strong> dieser Gruft nachvollziehbar; die Aufstellung <strong>der</strong> Jahre 1758 und 1787 führt<br />
allerd<strong>in</strong>gs fünf weitere K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge auf, darunter e<strong>in</strong>en von Wilhelm, angeblich<br />
Adm<strong>in</strong>istrator zu Hersfeld; es liegt nahe, daß es sich bei diesen Särgen um e<strong>in</strong>ige<br />
<strong>der</strong>jenigen handelt, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> alten Fürstengruft fehlen; anlässlich <strong>der</strong> letzten Beisetzungen<br />
des 17. Jhs. sche<strong>in</strong>t man sie, um Platz zu schaffen, <strong>in</strong> die neue Gruft<br />
überführt zu haben. Zu klären bleibt, wer mit dem Adm<strong>in</strong>istrator des Hersfel<strong>der</strong><br />
Stiftes geme<strong>in</strong>t ist; <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tat wurden zu Beg<strong>in</strong>n des 17. Jhs. mehrere noch m<strong>in</strong><strong>der</strong>jährige<br />
Pr<strong>in</strong>zen als Adm<strong>in</strong>istratoren des Stiftes postuliert 88 , bis dieses mit dem<br />
Westfälischen Frieden endgültig den Landgrafen unterstellt wurde. <strong>Die</strong> ger<strong>in</strong>ge<br />
Größe des Sarges deutet dabei auch auf e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges Alter des Verstorbenen h<strong>in</strong>:<br />
Möglich wäre, daß es sich um den Pr<strong>in</strong>zen Wilhelm († 1626) handelt, e<strong>in</strong>en Sohn<br />
Wilhelms V., <strong>der</strong> im Alter von e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Jahren als Erbpr<strong>in</strong>z verstorben war,<br />
zunächst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hersfel<strong>der</strong> Stiftskirche bestattet werden sollte 89 , dann aber doch <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> ersten Fürstengruft <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche se<strong>in</strong>e letzte Ruhe fand. – <strong>Die</strong> Zählung<br />
des Pfarrers Wissemann aus dem Jahr 1896 ergab nun im Unterschied zur letzten<br />
Bestandsaufnahme aus dem 18. Jh. <strong>in</strong>sgesamt 40 Särge, davon 23 Erwachsenen-<br />
und 17 K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge 90 ; da seit 1787 aber ke<strong>in</strong>e Bestattungen mehr vorgenommen<br />
wurden, könnte es sich bei den überzähligen 3 Särgen nur um jene handeln, die <strong>in</strong><br />
––––––––––<br />
88 Z. B. Otto als Neunjähriger im Jahre 1604 († 1617), Wilhelm V. im Alter von 6 Jahren<br />
„<strong>in</strong> eventum“, als se<strong>in</strong> Nachfolger im Alter von 15 Jahren, sowie Hermann „<strong>in</strong> eventum“<br />
im selben Jahre, im Alter von 10 Jahren. Vgl. KNETSCH.<br />
89 KNETSCH, S. 121, Anm. 4.<br />
90 Aufstellung vom 24. März 1896 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte wie Anm. 33.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
<strong>der</strong> Bilanz <strong>der</strong> Chorgruft fehlen; störend ist dabei lediglich, daß jene 3 Särge Erwachsenensärge<br />
s<strong>in</strong>d und ke<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge – wie sie es eigentlich se<strong>in</strong> müssten.<br />
Angesichts <strong>der</strong> Tatsache, daß an<strong>der</strong>e Dokumente <strong>der</strong> Zeit um 1890 ebenso wie die<br />
Auflistung von 1758 / 87 nur 37 Särge erwähnen 91 , gibt es nun die beiden Möglichkeiten,<br />
daß es sich um e<strong>in</strong>en Zählfehler handelt, o<strong>der</strong> daß lediglich die Zuordnung<br />
falsch ist; <strong>in</strong> diesem Fall sche<strong>in</strong>t es am wahrsche<strong>in</strong>lichsten zu se<strong>in</strong>, daß die<br />
besagten Särge durch an<strong>der</strong>e verdeckt waren und daher wegen <strong>der</strong> schlechten<br />
Lichtverhältnisse e<strong>in</strong>fach bei den früheren Zählungen übersehen worden waren.<br />
Unklar bleibt, ob die beiden nun noch fehlenden K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge <strong>in</strong> <strong>der</strong> neuen Gruft<br />
auch von Wissemann übersehen wurden o<strong>der</strong> 1929 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Chorgruft nicht mehr<br />
feststellbar waren.<br />
Gemäß <strong>der</strong> Aufstellung von 1758/1787 befanden sich folgende Särge <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Gruft (Beschreibung nach dem Inventar von 1923; s. Abb. 8):<br />
26. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Leopold, Sohn Landgraf Carls,<br />
*1684, † 1704<br />
27. verzierter Metallsarg gleicher Bauart mit Inschriften, für Carl, Sohn Landgraf<br />
Carls, *1680, † 1702<br />
28. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>a, Frau des<br />
Statthalters Wilhelm (VIII.), *1691, † 1743<br />
29. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Louise Dorothea Sophia, 1. Frau des<br />
Erbpr<strong>in</strong>zen Friedrich (I.), *1680, † 1705<br />
30. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Herzog<strong>in</strong> Marie Amalie von<br />
Sachsen-Zeitz, Mutter von Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>a, * 1670, † 1739<br />
31. reich verzierter Paradesarkophag aus Metall, mit Inschriften, für Landgraf<br />
Carl, *1654, † 1730<br />
32. reich verzierter Paradesarkophag gleicher Bauart mit Inschriften, für Landgräf<strong>in</strong><br />
Maria Amelia, *1653, † 1711<br />
33. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Georg, Sohn Wilhelms VI., *1658,<br />
† 1675<br />
34. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Landgraf Wilhelm VII., *1651,<br />
† 1670<br />
35. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Landgräf<strong>in</strong> Hedwig Sophia,<br />
*1623, † 1683<br />
36. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Landgraf Wilhelm VI., *1629,<br />
† 1663<br />
37. (vermuteter K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg aus <strong>der</strong> Chorgruft)<br />
38. (vermuteter K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg aus <strong>der</strong> Chorgruft)<br />
39. (vermuteter K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg aus <strong>der</strong> Chorgruft)<br />
40. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
41. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
42. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
43. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg für Wilhelm, „Adm<strong>in</strong>istrator zu Hersfeld“; offenbar das dritte<br />
K<strong>in</strong>d Wilhelms V., *1625, † 1626<br />
44. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
––––––––––<br />
91 Schreiben <strong>der</strong> Regierung vom 11.9.1889, sowie Stellungnahme Schnei<strong>der</strong>s und Hagens<br />
vom 13.6.1890, jeweils <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte wie Anm. 33.<br />
47
48<br />
Christian Presche<br />
45. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
46. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
47. schlichter Metallsarg mit Inschrift, für Carl, Sohn Carls, *1675, † 1677<br />
48. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Landgraf Wilhelm VIII.,<br />
*1682, † 1760<br />
49. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Maria Amelia, Tochter des<br />
Statthalters Wilhelm (VIII.), *1721, † 1744<br />
50. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Maximilian, Sohn Carls,<br />
*1689, † 1753<br />
51. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
52. schlichter Metallsarg mit Inschrift, für Carl, Sohn des Pr<strong>in</strong>zen Wilhelm<br />
(VIII.), *1718, † 1719<br />
53. verzierter Metallsarg mit Inschriften, für Landgräf<strong>in</strong> Amelia Elisabeth,<br />
*1602, † 1651<br />
54. verzierter, ähnlicher Metallsarg für Landgraf Wilhelm V., *1602, † 1637<br />
55. verzierter Metallsarg mit Inschriften, baugleich mit Nr.26, für Ludwig, Sohn<br />
Carls, *1686, † 1706<br />
56. verzierter Metallsarg gleicher Bauart mit Inschriften, für Wilhelm<strong>in</strong>a Charlotte,<br />
Tochter Carls, *1695, † 1722<br />
57. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
58. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
59. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
60. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
61. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
62. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg<br />
63. K<strong>in</strong><strong>der</strong>sarg für Wilhelm, Sohn des Pr<strong>in</strong>zen Friedrich (II.), *1741, † 1742<br />
64. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für Christ<strong>in</strong>a Charlotte, Tochter<br />
des Pr<strong>in</strong>zen Maximilian, *1725, † 1782<br />
65. Holzsarg mit schwarzer Samtbespannung, für George, Sohn Carls, *1691,<br />
† 1755<br />
Gesamt: 37 (40) Särge<br />
Außerdem s<strong>in</strong>d als Bemerkung aufgeführt: 5 Fässer mit Intest<strong>in</strong>a (=E<strong>in</strong>geweiden).<br />
E<strong>in</strong> weiteres Faß mit offenbar gleichem Inhalt ist e<strong>in</strong>gezeic hnet.<br />
Das Inventar von 1923 führt nun auch die vorhandenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge e<strong>in</strong>zeln<br />
auf: Es handelt sich stets um schlichte Metallsärge mit e<strong>in</strong>er Inschrift.<br />
Das Inventar von 1923 nennt: Aufstellung 2001:<br />
Wilhelm V. † 1637 Kapitelsaal verschollen (Landesmuseum?)<br />
Philipp † 1638 Südturm<br />
L. Amelia Elisabeth † 1651 K Nebenraum (?)<br />
Louisa † 1652 S<br />
Wilhelm VI.† 1663 K Sarg verschollen (Landesmuseum?);<br />
Gebe<strong>in</strong>e im Landesmuseum<br />
Wilhelm VII. † 1670 K verschollen (Landesmuseum?)<br />
Georg † 1675 S Nebenraum (?)<br />
Wilhelm † 1676 S<br />
Carl † 1677 S<br />
Christian † 1677 S<br />
L. Hedwig Sophia † 1683 K verschollen (Landesmuseum?)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Das Inventar von 1923 nennt: Aufstellung 2001:<br />
Eleonore Antonetta Frie<strong>der</strong>ica † 1694 S<br />
Carl † 1702 S K<br />
Leopold † 1704 S K<br />
Louise Dorothea Sophia † 1705 S verschollen (Landesmuseum?)<br />
Ludwig † 1706 S K<br />
L. Maria Amelia † 1711 K K<br />
Carl † 1719 S<br />
Wilhelm<strong>in</strong>a Charlotta † 1722 S K<br />
Carl † 1722 S<br />
Maria † 1727 S<br />
L. Carl † 1730 K K<br />
Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>a † 1743 K zerstört<br />
L. Wilhelm VIII. † 1760 K zerstört<br />
Außerdem 5 unbezeichnete Holzsärge S zerstört<br />
Gesamt: 29 Särge <strong>Die</strong> meisten K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge s<strong>in</strong>d zerstört;<br />
2 wurden offenbar geborgen, s<strong>in</strong>d<br />
aber ebenfalls verschollen<br />
<strong>Die</strong> identifizierten Särge, welche 1923 noch vorhanden waren, bestanden<br />
zumeist aus Metall; alle<strong>in</strong>e die Särge Landgraf Wilhelms VIII. und se<strong>in</strong>er Gemahl<strong>in</strong><br />
waren schlichte Holzsärge.<br />
Nicht identifiziert werden konnten 1899/1923 die Erwachsenensärge <strong>der</strong><br />
Herzog<strong>in</strong> von Sachsen-Zeitz († 1739), <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Maria Amelia († 1744),<br />
<strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zen Maximilian und George († 1753 und 1755), sowie <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong><br />
Christ<strong>in</strong>a Charlotta († 1782). <strong>Die</strong>sen 5 Särgen stehen gleich viele unbezeichnete<br />
Holzsärge gegenüber, die <strong>in</strong> Form und Gestaltung weitgehend denen Wilhelms<br />
VIII. und se<strong>in</strong>er Gemahl<strong>in</strong> entsprechen. Es ist daher anzunehmen, daß sie ebenfalls<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte und 2. Hälfte des 18. Jhs. angefertigt wurden; so dürfte es sich<br />
dabei um die nicht identifizierten Särge <strong>der</strong> Geschwister und K<strong>in</strong><strong>der</strong> sowie <strong>der</strong><br />
Schwiegermutter Wilhelms VIII. handeln. Auffallend ist im Inventar von 1923<br />
die Nichterwähnung von 8 bzw. 11 bis 13 K<strong>in</strong><strong>der</strong>särgen, die damals offenbar<br />
nicht mehr vorhanden waren:<br />
Es handelt sich um die K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge von Wilhelm (dem gen. Adm<strong>in</strong>istrator),<br />
Louisa († 1638), Elisabetha Sophia Louise († 1731) und Wilhelm († 1742) sowie<br />
die 4 bzw. 7 bis 9 an<strong>der</strong>en Särge, die vermutlich alle aus <strong>der</strong> ersten Gruft<br />
stammten. Ihr Verbleib ist ebenso unklar wie <strong>der</strong> Anlaß ihrer Entfernung. Möglicherweise<br />
befanden sie sich wegen <strong>der</strong> Stapelung <strong>der</strong> meisten K<strong>in</strong><strong>der</strong>särge<br />
bereits 1898 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>der</strong>art schlechten Zustand, daß sie nicht mehr <strong>in</strong> <strong>der</strong> neuen<br />
Sarghalle aufgestellt wurden.<br />
Von ursprünglich vermutlich 67 <strong>fürstlichen</strong> Särgen <strong>in</strong> den beiden Grüften<br />
konnten also <strong>in</strong> den Jahren 1923 und 1929 nur noch 51 mit Sicherheit festgestellt<br />
werden. Gegenwärtig ist die Zahl noch drastischer auf 30 reduziert – also auf<br />
etwa die Hälfte! Denn aus <strong>der</strong> zweiten Fürstengruft stehen von ehemals 40 (37)<br />
gezählten Särgen nur noch 8 Särge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche:<br />
In <strong>der</strong> neuen Gruft unter dem Kapitelsaal s<strong>in</strong>d die beiden Prunksärge des<br />
Landgrafen Carl und se<strong>in</strong>er Frau sowie 4 Särge von <strong>der</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong>n aufgestellt;<br />
e<strong>in</strong>er von diesen (<strong>der</strong> Sarg des Pr<strong>in</strong>zen Carl) ist teilweise zerdrückt, die übrigen<br />
49
50<br />
Christian Presche<br />
drei nur ger<strong>in</strong>gfügig beschädigt. <strong>Die</strong> beiden Prunksärge s<strong>in</strong>d ihres Schmuckes<br />
beraubt. 92 In e<strong>in</strong>em Nebenraum unter <strong>der</strong> Sakristei bef<strong>in</strong>den sich außerdem 2<br />
weitere; zum e<strong>in</strong>en <strong>der</strong> zerdrückte Sarg des Pr<strong>in</strong>zen Georg († 1675), zum an<strong>der</strong>en<br />
e<strong>in</strong> nur leicht beschädigter aber erheblich beraubter Sarg, vermutlich <strong>der</strong><br />
Landgräf<strong>in</strong> Amelia Elisabeth 93 (vgl. Abb. 13 und 9).<br />
<strong>Die</strong> beiden Särge im Nebenraum stehen wegen ihrer starken Schäden heute<br />
teilweise offen und stellen damit e<strong>in</strong>e gesundheitliche Gefahr für die Raumluft<br />
<strong>der</strong> beiden Grufträume dar 94 ; e<strong>in</strong>e Restaurierung bei<strong>der</strong> Särge wird <strong>in</strong>zwischen<br />
angestrebt. In dem Nebenraum s<strong>in</strong>d auch noch zwei Schmuckelemente weiterer<br />
Särge abgelegt.<br />
<strong>Die</strong> Erwähnung e<strong>in</strong>iger Fässer mit Intest<strong>in</strong>a entspricht dem Brauch jener Zeit,<br />
für e<strong>in</strong>e Konservierung <strong>der</strong> Leichname Sorge zu tragen – <strong>in</strong>dem man diejenigen<br />
E<strong>in</strong>geweide vor <strong>der</strong> Bestattung entfernte, die <strong>der</strong> Verwesung beson<strong>der</strong>s för<strong>der</strong>lich<br />
s<strong>in</strong>d. Solchermaßen präpariert und e<strong>in</strong>balsamiert wurden die verstorbenen<br />
Landgrafen zur letzten Ehrerweisung mehrere Tage lang auf dem Paradebett<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em Katafalk aufgebahrt. 95 Nach <strong>der</strong> öffentlichen Aufbahrung wurde <strong>der</strong><br />
––––––––––<br />
92 Zu ihrem gegenwärtigen Zustand vgl. KNÖPPEL S. 111; das Metall durch chemische<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Substanz angegriffen, durch den Aufbruch und die Beraubung zudem<br />
teilweise deformiert. Photographien <strong>der</strong> Details im Geme<strong>in</strong>dearchiv sowie e<strong>in</strong>zelne<br />
Reste des Schmuckes ermöglichen im übrigen e<strong>in</strong>e Rekonstruktion <strong>der</strong> fehlenden Teile;<br />
die Aufschriften am Sarg Carls zudem bei SCHMINCKE, S. 338 ff., und (danach?) bei<br />
KRIEGER, S. 297 ff. wie<strong>der</strong>gegeben. Bei SCHMINCKE, S. 340-343, außerdem die Inschriften<br />
an den Särgen <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zen Carl, Leopold und Ludwig abgedruckt, die heute auch<br />
wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft stehen. Seit <strong>der</strong> Plün<strong>der</strong>ung fehlt e<strong>in</strong> Teil des Innensarges des Landgrafen<br />
Carl, sowie die Kopfbedeckung, <strong>der</strong> Leichnam ist allerd<strong>in</strong>gs weiterh<strong>in</strong> unversehrt<br />
(soweit von außen durch die Schraubenlöcher des geraubten Schmuckes zu erkennen;<br />
freundliche Mitteilung von Herrn H. Germandi, Kassel).<br />
93 <strong>Die</strong> Seiten <strong>der</strong> Sargkastens s<strong>in</strong>d beraubt und fehlen teilweise sogar; die sichtbare Stirnseite<br />
beschädigt, die verblassten, e<strong>in</strong>st vergoldeten und kaum erhabenen Schriften auf dem Deckel<br />
nur bei günstigen Lichtverhältnissen überhaupt zu erkennen. Lesbar waren bei e<strong>in</strong>er Besichtigung<br />
durch den Verf. u. a. die Worte Pr<strong>in</strong>cipa (?) und Landgravia sowie <strong>der</strong> Name Elisabetha.<br />
– <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>zige weitere erwachsene Elisabeth, die nach 1640 <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> bestattet wurde<br />
(† 1688), ruht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft unter dem Chor, und auch HOLTMEYER führt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bestandsliste<br />
<strong>der</strong> Särge ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Elisabeth außer <strong>der</strong> Landgräf<strong>in</strong> Amelia Elisabeth auf. – Das vor Elisabeth<br />
stehende Wort <strong>der</strong> Sarg<strong>in</strong>schrift war allerd<strong>in</strong>gs unlesbar. <strong>Die</strong> Größe des Sarges entspricht<br />
aber auch etwa den bei HOLTMEYER, S. 185, angegebenen Maßen. <strong>Die</strong> an<strong>der</strong>en dort genannten<br />
Särge scheiden mit größter Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit aus.<br />
94 <strong>Die</strong> Gefahr weniger durch die erhaltenen Gebe<strong>in</strong>e, son<strong>der</strong>n vor allem durch die Textilien,<br />
<strong>in</strong> denen sich vornehmlich (Schimmel)pilze festsetzen; außerdem zerfällt die Knochensubstanz<br />
zu e<strong>in</strong>em weißlichen Pulver bzw. zu Staub. <strong>Die</strong>s alles kann <strong>in</strong> die Atemluft gelangen.<br />
Entscheidend ist die Konzentration <strong>der</strong> Sporen bzw. des Staubes <strong>in</strong> <strong>der</strong> Atemluft,<br />
also auch die Durchlüftung <strong>der</strong> Grüfte, – welche <strong>in</strong> Kassel überhaupt nicht gegeben ist.<br />
<strong>Die</strong> bisher nachgewiesenen gesundheitlichen Folgen reichen von Pilz-Allergien (angesichts<br />
<strong>der</strong> Allgegenwart von Pilzen sehr h<strong>in</strong><strong>der</strong>lich) bis h<strong>in</strong> zu schweren Infektionen.<br />
Beim Betreten <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Gruft müssten eigentlich Schutzkleidung und Staubmasken<br />
obligatorisch se<strong>in</strong>. Vgl. BRAUNE, S. 127 und 128.<br />
95 Vgl. RITGEN, S. 68, sowie das MONUMENTUM SEPULCRALE, f. 45, mit e<strong>in</strong>er Darstellung<br />
des aufgebahrten Landgrafen Moritz und e<strong>in</strong>em kritischen lat. Distichon zur E<strong>in</strong>balsamierung.<br />
Desgleichen die Ehren-Seule, Blatt a 2 (recto): „[...] <strong>in</strong> die Fürstl. Residentz und<br />
Vestung Cassel gebracht / die Balsamirung cont<strong>in</strong>uirt und vollendet / die Fürstliche Leiche<br />
<strong>in</strong> herrlichem Fürstlichen Kleid und Zierde <strong>in</strong> das gewöhnliche Fürstliche Gemach
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Verstorbene <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Holzsarg gebettet, <strong>der</strong> außen mit schwarzem Samt ummantelt<br />
und <strong>in</strong>nen mit Stoff ausgeschlagen war; am Sarg hielten auch jetzt noch<br />
Kammer- und Hofjunker Totenwache, schließlich wurde er nach Vollendung des<br />
Prunksarges <strong>in</strong> diesen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> gestellt. 96 Der geschlossene Prunksarg wurde dann<br />
nochmals im Schloss öffentlich ausgestellt. 97 Auf diese Weise konnten 3-4 Wochen<br />
bis zur Beisetzung vergehen, bis die Inschriftplatten für e<strong>in</strong>en bereits fertigen<br />
Sarg angefertigt und angebracht worden waren; musste <strong>der</strong> gesamte<br />
Prunksarg erst angefertigt werden, konnten – wie im Falle Wilhelms VI. – auch<br />
über drei Monate vergehen! 98 <strong>Die</strong> Bestattungszeremonien für nicht regierende<br />
Angehörige waren zwar bei weitem e<strong>in</strong>facher, das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> E<strong>in</strong>balsamierung,<br />
e<strong>in</strong>es hölzernen Innensarges und e<strong>in</strong>es äußeren Z<strong>in</strong>nsarges war jedoch ebenso<br />
üblich. Erst ab <strong>der</strong> Mitte des 18. Jhs. wurde dann zunehmend bei allen Verstorbenen<br />
auf die äußeren Metallsärge verzichtet; so s<strong>in</strong>d Wilhelm VIII. und se<strong>in</strong>e<br />
Ehefrau sowie die Pr<strong>in</strong>zen Georg und Maximilian und weitere Verstorbene nur<br />
<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>fachen Holzsärgen beigesetzt worden, die mit schwarzem Samt ummantelt<br />
waren (s. o.).<br />
<strong>Die</strong> Gefäße, <strong>in</strong> denen die E<strong>in</strong>geweide aufbewahrt wurden, bestanden aus Metall,<br />
<strong>der</strong> ursprüngliche Inhalt jener Eichentruhe, die 1946 geborgen wurde, ist unklar;<br />
Pfarrer Wissemann vermutete 1896, daß sie die vertrockneten E<strong>in</strong>geweide<br />
des Pr<strong>in</strong>zen Ludwig enthielt, <strong>der</strong> 1706 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schlacht bei Ramillies gefallen war.<br />
<strong>Die</strong> tödliche Kugel, die zusammen mit den E<strong>in</strong>geweiden entfernt worden war,<br />
lagerte damals noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kästchen im Untergeschoss <strong>der</strong> Gemäldegalerie. 99<br />
* * *<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d viele namhafte Bürger und hessische Adlige <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche<br />
bestattet 100 ; zwar waren alle Kirchhöfe <strong>der</strong> Stadt nach <strong>der</strong> Reformation zugunsten<br />
neuer Friedhöfe vor den Mauern aufgelöst worden 101 , doch hielt man an den<br />
Kirchenbestattungen weiterh<strong>in</strong> fest:<br />
––––––––––<br />
offentlich geleget / von viel tausend Menschen gesehen“, sowie Abb. Nr. 25 mit <strong>der</strong> Darstellung<br />
<strong>der</strong> Aufbahrung. Entfernt wurden stets die <strong>in</strong>neren Organe, aber auch das Gehirn<br />
konnte entnommen werden – <strong>der</strong> Bericht vom 18.11.1946 über den Transport <strong>der</strong> Särge<br />
(wie Anm. 62) weist auf e<strong>in</strong>e „sauber abgeschnittene Schädeldecke“ h<strong>in</strong>. Zur Aufbahrung<br />
auf dem Paradebett vgl. a. die Nachrichten zu Wilhelm VIII. und Friedrich II. <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Graßme<strong>der</strong>schen und <strong>der</strong> Gunkelschen Chronik, LOSCH, S. 114, S. 44, und S. 57. Beim<br />
Tode Carls wurden 22000 Besucher am Paradebett gezählt; Gunkelsche Chronik, LOSCH,<br />
S. 17.<br />
96 Ausführlich geschil<strong>der</strong>t <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ehren-Seule, Blatt b 3 (verso). Vgl. den Bericht vom<br />
18.11.1946 über den Transport <strong>der</strong> Särge (wie Anm. 62); die Innensärge <strong>in</strong> den meisten<br />
Fällen aber bis auf ger<strong>in</strong>ge Reste zerfallen, wie auch von den Toten selbst oftmals nur<br />
noch wenige Knochenreste vorhanden s<strong>in</strong>d (mit e<strong>in</strong>igen Ausnahmen, darunter <strong>der</strong> vollständig<br />
erhaltene Leichnam des Landgrafen Carl; vgl. Anm. 62 und 92).<br />
97 Ehren-Seule, Blatt b 3 (verso).<br />
98 Ehren-Seule, Blatt a 3 (rekto), sowie Abb. Nr. 26.<br />
99 Zusammenstellung vom 23.3.1896, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte (wie Anm. 33).<br />
100 Vgl. LANGE, JACOB, S. 24, JACOB, Begräbnisse (wie Anm. 5), und den Grundriss <strong>der</strong><br />
Kirche von DEURER, 1931.<br />
101 S. HOLTMEYER, S. 816 f. <strong>Die</strong> bei LANGE abgedruckten, z. T. offenbar nachträglich zusammengestellten<br />
Listen allerd<strong>in</strong>gs zwischen 1633 und 1747 nicht vollständig; so fehlen<br />
mehrere Pr<strong>in</strong>zen und Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong>nen.<br />
51
52<br />
Christian Presche<br />
Alle<strong>in</strong> im Chor von St. Mart<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d neben <strong>der</strong> Fürstengruft die Gruft des Generalleutnants<br />
Kaspar Cornelius von Mortaigne und se<strong>in</strong>er Frau, die Grüfte des<br />
Vizekanzlers von Dauber, des Grafen Carl von Kunowitz und se<strong>in</strong>er Frau, sowie<br />
<strong>der</strong> Familie von Halcke nachweisbar (alle aus dem 17. und 18. Jh.). Weitere<br />
<strong>Grabstätten</strong> bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Seitenschiffen und im Westteil <strong>der</strong> Kirche.<br />
Während das Begräbnisgeld für Angehörige <strong>der</strong> <strong>fürstlichen</strong> Familie 40 Gulden<br />
betrug, wurden für die übrigen Bestattungen im 17. Jh. zunächst 16 Gulden,<br />
dann 24 Gulden und 16 Albus verlangt, bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n die Hälfte. Im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
wurden die Kosten auf zumeist 20 bzw. 10 Reichstaler gesetzt, für beson<strong>der</strong>s<br />
aufwendige Bestattungen allerd<strong>in</strong>gs auch auf 50 o<strong>der</strong> sogar 100 Reichstaler<br />
erhöht – dem halben Wert e<strong>in</strong>es kle<strong>in</strong>en Fachwerkhauses!<br />
Aus hygienischen Gründen nahm man gegen Ende des 18. Jhs. allgeme<strong>in</strong><br />
Abstand von Kirchenbestattungen; die letzte nachweisbare nichtfürstliche Beisetzung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche datiert aus dem Jahre 1772. 102<br />
Von den zahlreichen Grabplatten, -tafeln und Epitaphen von Bürgertum und<br />
Adel ist <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Kirche nichts mehr zu f<strong>in</strong>den. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den Seitenschiffen<br />
und e<strong>in</strong>igen Teilen des Chores dürfte <strong>der</strong> Fußboden ursprünglich dicht<br />
mit Grabplatten besetzt gewesen se<strong>in</strong>, welche die Grufte<strong>in</strong>stiege kenntlich machten<br />
und verschlossen. <strong>Die</strong> Platten wurden offenbar bei <strong>der</strong> Renovierung um 1840<br />
beseitigt, als e<strong>in</strong> neuer Fußboden verlegt wurde 103 und das Bestattungswesen <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Kirche längst nicht mehr üblich war. <strong>Die</strong> meisten Grabplatten stellte man<br />
nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kirche an den Mauern des Langhauses und im Turmzwischenbau auf,<br />
wo sie 1943 und danach unterg<strong>in</strong>gen. Lediglich e<strong>in</strong>ige Grabplatten, die <strong>in</strong> den<br />
1930er Jahren an den Außenseiten <strong>der</strong> Kirche fest angebracht wurden, haben die<br />
Zeiten überdauert. Das Grabdenkmal des Andreas Pawel (Paulus) von Wilhelm<br />
Vernuken (seit 1933/34 über <strong>der</strong> Nordempore) war vom Architekten Vogel zwar<br />
zunächst zur Konservierung o<strong>der</strong> gar Wie<strong>der</strong>herstellung vorgesehen, wurde dann<br />
jedoch ebenfalls beseitigt. 104 E<strong>in</strong>ige Teile des Epitaphs J. C. von Dörnbergs<br />
(† 1680; auch: Dör<strong>in</strong>genberg) hatte zwar Dr. Helm vom Landesmuseum nach<br />
<strong>der</strong> Zerstörung 1943 noch sicherstellen können, die große Schrifttafel aus Bronze,<br />
die <strong>in</strong> Ermangelung von Transportmöglichkeiten weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ru<strong>in</strong>e<br />
blieb, sche<strong>in</strong>t dann aber <strong>Die</strong>ben zum Opfer gefallen zu se<strong>in</strong>; <strong>in</strong> jener Zeit siegte<br />
offenbar <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> die besseren Möglichkeiten hatte – und das war allzuoft<br />
––––––––––<br />
102 LANGE, S. 392. <strong>Die</strong> Akte wurde aber erst im Jahre 1795 abgeschlossen (S. 380), so daß<br />
jedenfalls zwischen 1772 und 1795 ke<strong>in</strong>e Beisetzung mehr erfolgte. Auch ke<strong>in</strong>e Grabplatte<br />
o<strong>der</strong> -tafel datiert aus <strong>der</strong> Zeit nach 1772. Vgl. zur Abkehr von Kirchenbestattungen<br />
Anm. 40.<br />
103 Vgl. Kostenvoranschlag von Rudolph vom 7.8.1840 und Übersicht über die Rechnungen<br />
von Ritz vom 17.3.1845 (wie Anm. 19).<br />
104 Ursprünglich im zweiten Joch des südlichen Seitenschiffes. Als Ersatz für das Fenster im<br />
fünften Joch <strong>der</strong> Nordseite, welches für das Philipps-Epitaph weitgehend zugesetzt wurde,<br />
schuf Vogel im dritten Joch (ehem. Ansatz des Kreuzganges) e<strong>in</strong> weiteres Fenster –<br />
hoch gelegen und als Rundfenster, damit das Paulus-Epitaph erhalten und konserviert<br />
werden könne. Schriftliche Zusammenstellung <strong>der</strong> Planung durch Vogel vom Januar<br />
1954, LKA Akte 413 VII 462, Bd. 2. Vgl. zur geplanten Wie<strong>der</strong>herstellung auch e<strong>in</strong>e Innenansicht<br />
<strong>der</strong> Kirche (Entwurf) von Vogel, im Geme<strong>in</strong>dearchiv von St. Mart<strong>in</strong>. Zu Vernukens<br />
Urheberschaft s. KRAMM, Bildhauer, S. 50 f.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
die falsche Seite! Weitere 3 geborgene Grabtafeln aus Bronze s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs aus<br />
dem Landesmuseum bislang auch noch nicht zurückgekehrt. 105<br />
* * *<br />
Erwähnung verdienen zum Schluss auch noch die Trauerfahnen 106 <strong>der</strong> Landgrafen,<br />
welche die Gesamtheit aus <strong>fürstlichen</strong> Grüften und Grabdenkmälern im<br />
Chor ergänzten: So bestand seit <strong>der</strong> Mitte des 17. Jhs. die Sitte, daß beim Tod<br />
e<strong>in</strong>es Fürsten jede Herrschaft, die ihm unterstand, e<strong>in</strong>e eigene Fahne mit ihrem<br />
Wappen im Leichenzug mitführte 107 , welche bei <strong>der</strong> Trauerfeier gesenkt und<br />
wie<strong>der</strong> aufgerichtet wurden 108 ; sie waren aus schwarzem Tuch gefertigt, das<br />
Wappen aufgemalt, darunter noch e<strong>in</strong> blaues Schriftband mit dem Namen <strong>der</strong><br />
Herrschaft <strong>in</strong> goldenen Buchstaben. H<strong>in</strong>zu kommen gleich gestaltete, aber gestickte<br />
Staatsfahnen mit dem Gesamtwappen, <strong>der</strong>en Tradition noch weiter zurückreicht.<br />
<strong>Die</strong> Fahnen wurden im Chor an den beiden Seiten <strong>in</strong> Höhe <strong>der</strong> Kapitelle<br />
aufgehangen; <strong>in</strong> späterer Zeit wurden sie nachträglich angefertigt, nur zur<br />
Aufhängung bestimmt. 109 E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> alten Fahnen dürfte bereits im Siebenjährigen<br />
Krieg zugrunde gegangen se<strong>in</strong>. Nachdem die westfälische Verwaltung<br />
die Fahnen unberührt gelassen hatte 110 , wurden die meisten allerd<strong>in</strong>gs „wegen<br />
allzu großer Häufung“ abgenommen und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft unter dem Kapitelsaal<br />
––––––––––<br />
105 Schreiben Helms an das Landeskirchenamt (wie Anm. 56).<br />
106 HOLTMEYER, S. 187 f., JACOB, S. 24 f. Vgl. beson<strong>der</strong>s den Stich von Wen<strong>der</strong>oth nach<br />
Höfer, HOLTMEYER, Tafel 118, 2.<br />
107 <strong>Die</strong> Abbildung des Leichenzuges von Moritz und Adolf im MONUMENTUM SEPULCRALE<br />
(f. 26) zeigt alle<strong>in</strong>e die gezackte Staatsfahne mit dem Gesamtwappen, die vor dem<br />
Schwarzen Ritter, <strong>der</strong> dem Sarg vorweg reitet, getragen wird; das schwarze Tuch, mit<br />
dem <strong>der</strong> Sarg abgedeckt ist, ist mit Ahnenwappen besetzt, eigene Herrschaftsfahnen s<strong>in</strong>d<br />
noch nicht zu erkennen. H<strong>in</strong>ter dem Sarg folgt e<strong>in</strong> Pferd, auf dessen schwarzer Decke das<br />
Gesamtwappen zu erkennen ist. <strong>Die</strong> Abbildung des Leichenzuges von Wilhelm VI. <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
EHREN-SEULE (Nr. 28) zeigt dagegen die e<strong>in</strong>zelnen Herrschaftsfahnen mit dazu gehörenden<br />
Pferden, vor dem Ritter mit <strong>der</strong> vergoldeten Rüstung und dem Schwarzen Ritter (vgl.<br />
auch die Prozessionsordnung des Zuges Blatt b 4 (verso) ff., bes. VII. Ordnung, Blatt c 1<br />
(recto) ff.). Der Sarg ist mit schwarzem Tuch abgedeckt, auf dem die Ahnenwappen zu<br />
erkennen s<strong>in</strong>d.<br />
108 VON ROMMEL, 4. Bd., S. 388, zum Begräbnis Philipps: „Da, wo <strong>in</strong> Gegenwart se<strong>in</strong>er<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> die Fahnen von fünf Län<strong>der</strong>n, die er <strong>in</strong>ne gehabt hatte (Hessen, Katzenellenbogen,<br />
<strong>Die</strong>tz, Ziegenha<strong>in</strong> und Nidda), nie<strong>der</strong>gesenkt und wie<strong>der</strong>aufgerichtet wurden, [...], <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> St. Mart<strong>in</strong>skirche [...].“ Dagegen allerd<strong>in</strong>gs fehlte gemäß VON DRACH / KÖNNECKE, S.<br />
97, r. Spalte, Anm. 3, wegen <strong>der</strong> großen Eile sogar die Trauerfahne, und auch das Stichwerk<br />
über den Leichenzug bildet ke<strong>in</strong>e Trauerfahne ab (s. L. MÜLLER). Zum<strong>in</strong>dest<br />
sche<strong>in</strong>t <strong>der</strong> durch VON ROMMEL beschriebene Brauch aber <strong>in</strong> späterer Zeit üblich gewesen<br />
zu se<strong>in</strong>.<br />
109 Für den Leichenzug Kurfürst Wilhelms I. (14.3.1821) ist z.B. <strong>der</strong> Schmuck des Leichenwagens<br />
durch Wappenschil<strong>der</strong> überliefert (Fr. MÜLLER, S. 137), die Staatsfahne für die<br />
Mart<strong>in</strong>skirche wurde sogar erst am 26.10.1822 <strong>in</strong> Auftrag gegeben! („Auszug aus <strong>der</strong> 1.<br />
Abtheilung des Oberhofmarschallamtes-Protokols Cassel vom 26. Oktbr. 1822. Nr. 953“,<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Dekanatsakte (wie Anm. 14).<br />
110 Auf die Anordnung h<strong>in</strong>, alle hessischen Hoheitszeichen zu entfernen, entschied man, daß<br />
<strong>der</strong> Aufwand, die Trauerfahnen mit den hessischen Wappen abzunehmen, nicht lohne. s.<br />
WORINGER.<br />
53
54<br />
Christian Presche<br />
aufbewahrt 111 – offenbar als nach dem Tode Kurfürst Wilhelms I. (1821) neue<br />
Fahnen h<strong>in</strong>zukamen. Nur noch <strong>in</strong>sgesamt 11 Fahnen blieben im Chor; neben 9<br />
Herrschaftsfahnen die Staatsfahnen für Friedrich II. und Wilhelm I. Anläßlich<br />
<strong>der</strong> Kirchenrestaurierung wurden 1843 diese 9 Herrschaftsfahnen von Hochapfel<br />
als Nachbildungen neu gemalt 112 , 2 weitere Staatsfahnen kamen 1847 und 1875<br />
h<strong>in</strong>zu, als Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm I. gestorben waren. Im Jahre 1888<br />
h<strong>in</strong>gen also <strong>in</strong>sgesamt 13 Fahnen im Chor 113 , von denen die gemalten Herrschaftsfahnen<br />
damals <strong>in</strong>dessen schon sehr stark verblichen waren. Bei <strong>der</strong> Renovierung<br />
um 1890 wurden alle verbliebenen Fahnen ebenfalls abgehangen und<br />
zunächst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sakristei untergebracht; nun sorgte sich 1892 die <strong>Kasseler</strong> Regierung<br />
darum, daß bei e<strong>in</strong>er Wie<strong>der</strong>anbr<strong>in</strong>gung dieser Fahnen das schwarze<br />
Tuch die „künstlerische Wirkung des neu ausgemalten Chores und se<strong>in</strong>er Fenster<br />
geradezu vernichte“; <strong>der</strong> geschichtliche Wert sei zwar vorhanden, doch sei<br />
ke<strong>in</strong>er <strong>der</strong> betroffenen Fürsten <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> bestattet; man erwog daher auch die<br />
Unterbr<strong>in</strong>gung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Museum. 114 Das Presbyterium wünschte jedoch ke<strong>in</strong>e<br />
Entfernung <strong>der</strong> Fahnen aus <strong>der</strong> Kirche, und Super<strong>in</strong>tendent Kröner hielt die<br />
gemalten Fahnen für e<strong>in</strong> Museum für ungeeignet 115 ; sie sollten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vorhalle<br />
zwischen den Türmen e<strong>in</strong>gelagert und nach Vollendung <strong>der</strong> Orgel dort am Gewölbe<br />
angebracht werden. Im Jahre 1899 teilte allerd<strong>in</strong>gs <strong>der</strong> Super<strong>in</strong>tendent<br />
dem Konsistorium mit, daß beim Abnehmen und Bewegen <strong>der</strong> Fahnen die 9<br />
gemalten zerfallen und nur noch die Staatsfahnen des Landgrafen Friedrich II.<br />
und <strong>der</strong> 3 Kurfürsten vorhanden seien; diese habe man nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft im Südturm<br />
aufgestellt und befestigt. 1923 waren außer diesen Staatsfahnen noch 34<br />
Herrschaftsfahnen feststellbar, die allerd<strong>in</strong>gs stark beschädigt und zu über zwei<br />
Dutzend bereits soweit zerfallen waren, daß nur noch die Schäfte von ihnen<br />
zeugten 116 ; Presbyterium und Denkmalpflege hatten damals bereits angeregt, die<br />
Fahnen <strong>in</strong>stand zu setzen und aus künstlerischen und geschichtlichen Gründen<br />
wie<strong>der</strong> im Chor anzubr<strong>in</strong>gen. 117 Anlässlich <strong>der</strong> Renovierung <strong>der</strong> Jahre 1932/33<br />
––––––––––<br />
111 HOLTMEYER, S. 187, Anm. 1. Wissemann führt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Zusammenstellung vom<br />
23.3.1896 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruft „verfallende Reste von Fahnen- und Bahrtüchern“ auf; <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Konsistorialakte (wie Anm. 33).<br />
112 Schreiben des Super<strong>in</strong>tendenten Kröner vom 11.2.1893 an die Regierung, gemäß eigener<br />
Aussagen Hochapfels, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte (wie Anm. 33); als Aktennotiz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dekanatsakte<br />
(wie Anm. 14).<br />
113 Super<strong>in</strong>tendent Kröner schreibt am 11.2.1893 von <strong>in</strong>sgesamt 16 Fahnen, darunter 3<br />
Staatsfahnen und 13 gemalte Grafschaftsfahnen, am 30.10.1899 dagegen von <strong>in</strong>sgesamt<br />
13 Fahnen, von denen 9 zerfallen seien; bei den erhalten gebliebenen handelt es sich um<br />
die 4 Staatsfahnen, die auch von HOLTMEYER, S. 187, genannt werden. Wenn man berücksichtigt,<br />
daß vor dem Tod Wilhelms II. 11 Fahnen im Chor h<strong>in</strong>gen, bis 1875 aber nur<br />
2 Staatsfahnen h<strong>in</strong>zugekommen s<strong>in</strong>d, so dürften die letzten Angaben die größere Glaubwürdigkeit<br />
beanspruchen.<br />
114 Schreiben <strong>der</strong> Regierung an das Konsistorium vom 24.12.1892, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konsistorialakte<br />
(wie Anm. 33).<br />
115 Antwort des Super<strong>in</strong>tendenten vom 11.2.1893 daselbst, zum Folgenden e<strong>in</strong> Schreiben<br />
vom 30.10.1899.<br />
116 HOLTMEYER; S. 187 f., JACOB, S. 24 f. <strong>Die</strong> Schuld an dem Zerfall kann aber entgegen <strong>der</strong><br />
Aussage JACOBs nicht unbed<strong>in</strong>gt dem „Unverständnis“ des späten 19. Jhs. angelastet werden.<br />
117 Jahrbuch <strong>der</strong> Denkmalpflege I, S. 25.
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
wurden die besagten Staatsfahnen wie<strong>der</strong> im Chor aufgehangen 118 (Abb. 3), wo<br />
sie 1943 unterg<strong>in</strong>gen. Reste <strong>der</strong> übrigen Trauerfahnen werden heute noch im<br />
Landesamt für Denkmalpflege <strong>in</strong> Marburg verwahrt.<br />
* * *<br />
<strong>Die</strong> Leichenzüge vom Landgrafenschloss zur Mart<strong>in</strong>skirche prägten dabei ganz<br />
entscheidend das Bewusstse<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Bevölkerung: So berichten die alten<br />
Überlieferungen davon, daß sich e<strong>in</strong> nahen<strong>der</strong> Todesfall e<strong>in</strong>es Landesherren<br />
jeweils durch zwei Anzeichen andeutete; zum e<strong>in</strong>en wurde festgehalten, daß die<br />
Fulda <strong>in</strong> den hessischen Städten stehen geblieben sei, zum an<strong>der</strong>en wurde vor<br />
allem e<strong>in</strong> nächtlicher, gespenstischer Trauerzug beobachtet, <strong>der</strong> sich durch die<br />
Straßen Kassels bewegte – auf demselben Weg, den e<strong>in</strong>ige Wochen später <strong>der</strong><br />
irdische Zug nahm! Dabei verwun<strong>der</strong>t es kaum, daß es nach den Ereignissen von<br />
1866 als böses Omen für das Schicksal des Fürstenhauses gewertet wurde, daß<br />
die letzten Generationen die traditionelle Familiengruft gemieden hatten. 119<br />
* * *<br />
In <strong>der</strong> Renaissance wurden an den beiden Seiten des Triumphbogens unterhalb<br />
<strong>der</strong> Kapitelle, etwa <strong>in</strong> Höhe <strong>der</strong> Trauerfahnen, auch hölzerne Wappenschil<strong>der</strong><br />
120 mit dem hessischen Gesamtwappen und fünf Helmen angebracht, die auf<br />
diese Weise den Zugang <strong>in</strong> den Chor flankierten. <strong>Die</strong>s hatte aber nicht etwa den<br />
Zweck, den Chor als fürstliche Gedächtniskapelle gegenüber <strong>der</strong> Kirche abzugrenzen<br />
– denn <strong>der</strong> Altar befand sich ja damals im Chorjoch, also h<strong>in</strong>ter den<br />
Wappenschil<strong>der</strong>n. <strong>Die</strong>se trennten somit nicht nur den Ort <strong>der</strong> <strong>fürstlichen</strong> Grablege<br />
und <strong>der</strong> Epitaphe, son<strong>der</strong>n vor allem auch den Altarraum vom Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>aum!<br />
Es dürfte also viel eher die Schutz- und Patronatsfunktion <strong>der</strong> hessischen<br />
Fürsten für ihre Landeskirche angesprochen worden se<strong>in</strong>. <strong>Die</strong>ses Gesamtbild<br />
wurde noch ergänzt durch das große landgräfliche Gesamtwappen auf dem<br />
prächtigen Epitaph im Chorhaupt, das den Kirchenraum anstelle des mittelalterlichen<br />
Hochaltars abschloss.<br />
Aus all dem erhellt die große Bedeutung, welche die <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
für die hessische Landesgeschichte besitzt – zumal hier auch die Gottesdienste<br />
stattfanden, die bei offiziellen Anlässen gefeiert wurden. 121 Dabei ist beson<strong>der</strong>s<br />
auch zu bedenken, daß mit <strong>der</strong> Reformation die Fürsten für die äußeren Belange<br />
<strong>der</strong> Kirche e<strong>in</strong>e führende Position übernahmen (Landesherrliches Kirchenregiment)<br />
und als die säkularen Vorgänger <strong>der</strong> heutigen evangelischen Bischöfe<br />
––––––––––<br />
118 Hessenland 1928, S. 58, sowie JACOB, S. 24 f.<br />
119 S. v. a. Fr. MÜLLER, S. 139 f., mit e<strong>in</strong>er Beschreibung <strong>der</strong> zu Protokoll gegebenen Beobachtungen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Todesnacht Wilhelms I., unmittelbar vor se<strong>in</strong>em Ableben. <strong>Die</strong> Berichte<br />
vom Stillstand <strong>der</strong> Fulda auch bei VON ROMMEL erwähnt, 4. Bd., Anm. 206 auf S. 465;<br />
dort auf Philipp, Wilhelm IV. und Moritz bezogen.<br />
120 HOLTMEYER, S. 185. Bei <strong>der</strong> Restaurierung um 1930 wurden sie abgenommen und <strong>in</strong> ca.<br />
3 m Höhe an den Seiten des Chores neu angebracht. Photographien im LafDH, Photosammlung<br />
Mart<strong>in</strong>skirche Kassel.<br />
121 Man denke u. a. an den Dankgottesdienst nach <strong>der</strong> Rückkehr Kurfürst Wilhelms I. aus<br />
dem Exil im Jahre 1813, <strong>der</strong> als beson<strong>der</strong>s feierlich und ergreifend beschrieben wird (vgl.<br />
BRUNNER, S. 353).<br />
55
56<br />
Christian Presche<br />
anzusehen s<strong>in</strong>d – neben den Super<strong>in</strong>tendenten als den geistlichen Vorgängern.<br />
St. Mart<strong>in</strong> war damit <strong>in</strong> gewisser H<strong>in</strong>sicht zugleich die Hauptkirche <strong>der</strong> gesamten<br />
Landgrafschaft geworden: E<strong>in</strong>e Bedeutung, <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Neustrukturierung<br />
<strong>der</strong> Landeskirche nach dem zweiten Weltkrieg die Erhebung von St. Mart<strong>in</strong> zur<br />
Bischofskirche Rechnung trug.<br />
Abb. 1: Ansicht <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>skirche vor 1889<br />
(HOLTMEYER, Tafel 113)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 2: Grundriß <strong>der</strong> Kirche im Zustand von 1896 (HOLTMEYER, Tafel 109,1)<br />
57
58<br />
Christian Presche<br />
Abb. 3: Innenansicht nach 1935; im Chorhaupt das Grabdenkmal für Philipp den Großmütigen und Christ<strong>in</strong>a,<br />
an <strong>der</strong> Nordseite des Chores 4 Trauerfahnen, an den Pfeilern Gedenktafeln für die hessischen Teilnehmer<br />
an den Freiheitskriegen<br />
(Bildarchiv Foto Marburg Nr. Z 31554)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 4: Grundriß des Chores mit E<strong>in</strong>tragung <strong>der</strong> Grüfte und Grabdenkmäler, im Zustand von 1929/31<br />
I Epitaph für Landgräf<strong>in</strong> Christ<strong>in</strong>a; II Epitaph für Philipp den Großmütigen und Christ<strong>in</strong>a, davor die<br />
Grabplatte (gestrichelt); III Epitaph für Pr<strong>in</strong>z Philipp (Umzeichnung des Verfassers nach den Aufnahmen<br />
Jakob DEURERs von 1931 und 1933)<br />
59
60<br />
Christian Presche<br />
Abb. 5: Schnitt durch den ehemaligen Kapitelsaal (li) und die Sakristei (re); im Kapitelsaal oben nun <strong>der</strong><br />
Archivsaal, darunter die zweite Gruft (HOLTMEYER, Tafel 110,1)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 6: Grundriß <strong>der</strong> zweiten Gruft mit E<strong>in</strong>tragung des Podestes für die Särge Wilhelms V. und Amelia<br />
Elisabeth (Zeichnung des Verfassers nach DEURER, 1931, und HOLTMEYER, Tafel 109,2)<br />
Abb. 7: Der E<strong>in</strong>gang zur Sakristei; um 1910 (HOLTMEYER, Tafel 125)<br />
61
62<br />
Christian Presche<br />
Abb. 8: <strong>Die</strong> Gruft im Zustand zwischen 1782 und 1896 (Rekonstruktion des Verfassers nach <strong>der</strong> Aufnahme<br />
von 1758 und 1787)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 9: <strong>Die</strong> Särge Wilhelms V. und Amelia Elisabeths; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 132,1)<br />
Abb. 10a: Sarg Wilhelms VI.; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 132, 2)<br />
63
64<br />
Christian Presche<br />
Abb. 10b: Sarg <strong>der</strong> Landgräf<strong>in</strong> Hedwig Sophie; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 133, 2)<br />
Abb. 11: Der Sarg Wilhelms VII.; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 132,3)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 12a: Sarg Carls; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 134)<br />
Abb. 12b: Sarg Maria Amelias; um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 134)<br />
65
66<br />
Christian Presche<br />
Abb. 13: <strong>Die</strong> Särge <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zen Leopold, Ludwig, Carl und <strong>der</strong> Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a Charlotta von<br />
Hessen, sowie des Pr<strong>in</strong>zen Georg (u.); um 1910<br />
(HOLTMEYER, Tafel 133)<br />
Abb. 14: Entwurf Francesco Guernieros für Gruftkapellen, um 1711 (?)<br />
(HOLTMEYER, Tafel 108)
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Abb. 15: Entwurf Francesco Guernieros für Gruftkapellen, um 1711 (?)<br />
(HOLTMEYER, Tafel 108)<br />
Abb. 16: Entwurf Hugo Schnei<strong>der</strong>s für die Sarghalle im Südturm, 1896 (Bildarchiv Foto Marburg)<br />
67
68<br />
Christian Presche<br />
Stammtafel des hessischen Fürstenhauses<br />
ab Landgraf Philipp dem Großmütigen bis Kurfürst Wilhelm I.<br />
Hauptl<strong>in</strong>ie (Hessen-Kassel)<br />
<strong>Die</strong> Namen aller Angehörigen des Hauses Hessen, die <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> bestattet s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d fett gedruckt.<br />
Agnes<br />
* 1527<br />
† 1555<br />
(1. Sachsen)<br />
(2. Sachsen-<br />
Coburg-<br />
Eisenach)<br />
Anna Maria<br />
* 1567<br />
† 1626<br />
Nassau-<br />
Zweibrücken<br />
Otto<br />
* 1594<br />
† 1617<br />
Agnes<br />
* 1620<br />
† 1626<br />
Moritz<br />
* 1621<br />
† 1621<br />
Anna<br />
* 1529<br />
† 1591<br />
(Zweibrücken)<br />
Agnes<br />
* 1569<br />
† 1569<br />
Elisabeth<br />
* 1596<br />
† 1625<br />
(Mecklenburg)<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1597<br />
Elisabeth<br />
* 1623<br />
† 1624<br />
Wilhelm<br />
* 1625<br />
† 1626<br />
Wilhelm<br />
IV.<br />
* 1532<br />
† 1592<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Kassel<br />
Hedwig<br />
* 1569<br />
† 1644<br />
(Holste<strong>in</strong>-<br />
Schaumburg)<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1599<br />
Moritz<br />
*1600<br />
† 1612<br />
Aemelia<br />
* 1626<br />
† 1693<br />
(La<br />
Tremoille,<br />
Tarante)<br />
Philipp<br />
Ludwig<br />
* 1534<br />
† 1535<br />
Philipp <strong>der</strong> Großmütige<br />
* 1504<br />
† 1567<br />
8<br />
Christ<strong>in</strong>a von Sachsen<br />
* 1505<br />
† 1549<br />
Barbara<br />
* 1536<br />
† 1597<br />
(1. Württemberg)<br />
(2. Waldeck)<br />
8<br />
Sab<strong>in</strong>a von Württemberg<br />
* 1549<br />
† 1581<br />
Sophia<br />
* 1571<br />
† 1616<br />
Moritz<br />
* 1572<br />
† 1632<br />
Ludwig<br />
d. Ä.<br />
* 1537<br />
† 1604<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Marburg<br />
Sab<strong>in</strong>a<br />
* 1573<br />
† 1573<br />
Sidonia<br />
* 1574<br />
† 1575<br />
Elisabeth<br />
*1539<br />
† 1582<br />
(Pfalz)<br />
Christianus<br />
* 1575<br />
† 1578<br />
8 8<br />
1.) Agnes von Solms 2.) Juliana von Nassau<br />
* 1578 * 1587<br />
† 1602 † 1643<br />
Wilhelm V.<br />
* 1602<br />
† 1637<br />
Charlotte<br />
* 1627<br />
† 1686<br />
(Pfalz)<br />
Philipp<br />
* 1604<br />
† 1626<br />
Agnes<br />
* 1606<br />
† 1650<br />
(Anhalt-<br />
Dessau)<br />
Hermann<br />
* 1607<br />
† 1658<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Rotenburg<br />
Juliana<br />
* 1608<br />
† 1628<br />
Sab<strong>in</strong>a<br />
* 1610<br />
† 1620<br />
Magdalena<br />
* 1611<br />
† 1671<br />
(Salm)<br />
Moritz d. J.<br />
* 1614<br />
† 1633<br />
Philipp<br />
d. J.<br />
* 1541<br />
+ 1583<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Rhe<strong>in</strong>fels<br />
Elisabeth<br />
* 1577<br />
† 1578<br />
Sophia<br />
* 1615<br />
† 1670<br />
Schaumburg-<br />
Lippe<br />
Friedrich<br />
* 1617<br />
† 1655<br />
Landgraf von<br />
Eschwege<br />
Christ<strong>in</strong>e<br />
*1543<br />
† 1604<br />
(Schleswig-<br />
Holste<strong>in</strong>)<br />
Christ<strong>in</strong>a<br />
* 1578<br />
† 1658<br />
(Sachsen-<br />
Eisenach)<br />
Christian<br />
* 1622<br />
† 1640<br />
Ernst<br />
* 1623<br />
† 1693<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Rhe<strong>in</strong>fels<br />
Georg I.<br />
* 1547<br />
† 1596<br />
Landgraf<br />
von<br />
Hessen-<br />
Darmstadt<br />
Juliana<br />
* 1581<br />
† 1581<br />
Christiana<br />
* 1625<br />
† 1626<br />
Philipp<br />
* 1626<br />
† 1629<br />
Elisabeth<br />
* 1628<br />
† 1633<br />
8 8 Totgeborener Pr<strong>in</strong>z<br />
Amelia Elisabeth von Hanau Sophia Juliana 1634<br />
* 1602 von Waldeck Juliana<br />
† 1651 * 1607 * 1636 † 1636<br />
† 1637<br />
Wilhelm<br />
VI.<br />
* 1629<br />
† 1663<br />
Philipp<br />
* 1630<br />
† 1638<br />
Adolf<br />
* 1631<br />
† 1632<br />
Carl<br />
* 1633<br />
† 1635<br />
Elisabeth<br />
* 1634<br />
† 1688<br />
Äbtiss<strong>in</strong> zu<br />
Herford<br />
8<br />
Hedwig Sophia von Brandenburg<br />
* 1623<br />
† 1683<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1635<br />
Louisa<br />
* 1636<br />
† 1638<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1637
Charlotta<br />
Amelia<br />
* 1650<br />
† 1714<br />
(Dänemark)<br />
Wilhelm<br />
* 1674<br />
† 1676<br />
Carl<br />
*1675<br />
† 1677<br />
Carl<br />
* 1718<br />
† 1719<br />
Wilhelm<br />
* 1741<br />
† 1742<br />
Wilhelm<br />
VII.<br />
* 1651<br />
† 1670<br />
Friedrich I.<br />
* 1676<br />
† 1751<br />
zugleich<br />
König von<br />
Schweden<br />
Friedrich<br />
II.<br />
* 1720<br />
† 1785<br />
Wilhelm<br />
IX., ab<br />
1803<br />
Kurfürst<br />
Wilhelm I.<br />
* 1743<br />
† 1821<br />
<strong>Die</strong> <strong>fürstlichen</strong> <strong>Grabstätten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Kasseler</strong> Mart<strong>in</strong>skirche<br />
Louisa<br />
* 1652<br />
† 1652<br />
Christian<br />
* 1677<br />
† 1677<br />
Sophia<br />
Charlotta<br />
* 1687<br />
† 1749<br />
(Mecklenburg-<br />
Schwer<strong>in</strong>)<br />
Carl<br />
* 1654<br />
† 1730<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1679<br />
Carl<br />
* 1680<br />
† 1702<br />
Philipp<br />
* 1655<br />
† 1721<br />
Georg<br />
* 1658<br />
† 1675<br />
8<br />
Maria Amelia von Kurland<br />
* 1653<br />
† 1711<br />
Wilhelm<br />
VIII.<br />
* 1682<br />
† 1760<br />
seit 1730<br />
Statthalter<br />
<strong>in</strong> Hessen,<br />
seit 1751<br />
Landgraf<br />
Leopold<br />
* 1684<br />
† 1704<br />
Ludwig<br />
* 1686<br />
† 1706<br />
Elisabeth<br />
Henriette<br />
* 1661<br />
† 1683<br />
(Brandse nburg)<br />
Maria<br />
Louise<br />
* 1689<br />
† 1765<br />
(Oranien-<br />
Nassau)<br />
Maximilian<br />
* 1689<br />
† 1753<br />
Totgeborene<br />
Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong><br />
1690<br />
George<br />
* 1691<br />
† 1755<br />
Eleonora<br />
Antonetta<br />
Frie<strong>der</strong>ica<br />
* 1694<br />
† 1694<br />
69<br />
Wilhelm<strong>in</strong>a<br />
Charlotta<br />
* 1695<br />
† 1722<br />
Totgeborener<br />
Pr<strong>in</strong>z<br />
1696<br />
o<strong>der</strong> später<br />
8 8 8<br />
Louise Dorothea Sophia Dorothea Wilhelm<strong>in</strong>a Marie- Frie<strong>der</strong>ike-Charlotte<br />
von Brandenburg von Sachsen-Zerbst Amalie von Hessen-Darmstadt<br />
* 1680 * 1691 * 1670 * 1698<br />
† 1705 † 1743 † 1739 † 1777<br />
Maria Amelia<br />
* 1721<br />
† 1744<br />
(Brandenburg)<br />
8<br />
Maria von<br />
Großbritannien<br />
* 1723<br />
† 1772<br />
Carl<br />
* 1744<br />
† 1836<br />
ab 1805<br />
Landgraf<br />
Friedrich<br />
* 1747<br />
† 1837<br />
ab 1805<br />
Landgraf<br />
Carl<br />
* 1721<br />
† 1722<br />
Ulrica<br />
Fri<strong>der</strong>ica<br />
Wilhelm<strong>in</strong>a<br />
* 1722<br />
† 1787<br />
(Schleswig-<br />
Holste<strong>in</strong> /<br />
Oldenburg)<br />
Christ<strong>in</strong>a<br />
Charlotta<br />
* 1725<br />
† 1782<br />
Coadjutor<strong>in</strong><br />
zu Herford<br />
Maria<br />
* 1726<br />
† 1727<br />
Wilhelm<strong>in</strong>a<br />
* 1726<br />
† 1808<br />
(Preußen)<br />
Frühgeburt<br />
1729<br />
Elisabetha<br />
Sophia<br />
Louisa<br />
* 1730<br />
† 1731<br />
Carol<strong>in</strong>a<br />
Wilhelm<strong>in</strong>a<br />
Sophia<br />
* 1732<br />
† 1759<br />
(Anhalt-<br />
Zerbst)<br />
<strong>Die</strong> Familien ab Wilhelm IX. (I.) s<strong>in</strong>d dann nicht mehr <strong>in</strong> St. Mart<strong>in</strong> bestattet<br />
worden.<br />
<strong>Die</strong>se Hauptl<strong>in</strong>ie wurde bis 1866 fortgeführt; wegen <strong>der</strong> morganatischen Ehe<br />
Kurfürst Friedrich Wilhelms I. wurde sie ab 1867 allerd<strong>in</strong>gs durch die Rumpenheimer<br />
L<strong>in</strong>ie fortgesetzt, <strong>der</strong>en Stifter Landgraf Friedrich, <strong>der</strong> 4. Sohn Friedrichs II. ist.