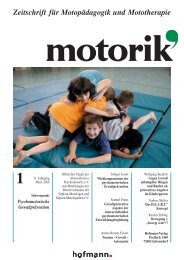Fortbildungsübersicht dakp April 2010 - Hofmann Verlag
Fortbildungsübersicht dakp April 2010 - Hofmann Verlag
Fortbildungsübersicht dakp April 2010 - Hofmann Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie<br />
Offizielles Organ des Aktionskreises<br />
Psychomotorik e. V.<br />
mit Mitteilungen des Berufsverbandes der<br />
Dipl.-Motologen/innen e. V.<br />
Herausgeber:<br />
Aktionskreis Psychomotorik e. V.<br />
Geschäftsstelle: Kleiner Schratweg 32<br />
32657 Lemgo<br />
Tel. (0 52 61) 97 09 70, Fax (0 52 61) 97 09 72<br />
Geschäftsführender Redakteur:<br />
Prof. Dr. phil. Klaus Fischer<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Motologin Dorothee Beckmann-Neuhaus<br />
Wiss. Mitarb. Melanie Behrens<br />
Prof. Dr. phil. Ruth Haas<br />
Dipl.-Motologe Dr. Holger Jessel<br />
Prof. Dr. phil. Heinz Mechling<br />
Prof. Dr. phil. Renate Zimmer<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Prof. Dr. Klaus Fischer<br />
Haselhecke 50, 35041 Marburg<br />
Tel. (0 64 21) 2 33 32 (p), Tel. (02 21) 4 70 46 73 (d)<br />
Fax (0 64 21) 2 56 92 (p), Fax (02 21) 4 70 50 85 (d)<br />
E-Mail: Klaus.Fischer@uni-koeln.de<br />
Erscheinungsweise: Vierteljährlich<br />
Bezugsbedingungen:<br />
Jahresabonnement (4 Ausgaben inkl. Versandkosten)<br />
e 46,80; Vorzugspreis für Studierende e 42,80;<br />
Einzelheft e 11,– (zuzügl. Versandkosten).<br />
Für die Mitglieder des Aktionskreises ist der<br />
Bezugspreis der Zeitschrift im Mitgliedsbeitrag<br />
enthalten.<br />
Die Abonnement-Rechnung ist sofort zahlbar<br />
rein netto nach Erhalt. Der Abonnement-Vertrag<br />
ist auf unbestimmte Zeit geschlossen, falls nicht<br />
ausdrücklich anders vereinbart.<br />
Abbestellungen sind nur zum Jahresende möglich<br />
und müssen spätestens 3 Monate vor dem<br />
31. Dezember beim <strong>Verlag</strong> eintreffen. Unregel-<br />
mäßigkeiten in der Belieferung bitte umgehend<br />
dem <strong>Verlag</strong> anzeigen.<br />
Der Versand und die Abonnement-Bearbeitung<br />
erfolgen über EDV. Für diesen Zweck sind die<br />
dafür notwendigen Daten gespeichert.<br />
Die Post sendet Zeitschriften auch bei Vorliegen<br />
eines Nachsendeantrags nicht nach! Deshalb bei<br />
Umzug bitte Nachricht an den <strong>Verlag</strong> mit alter und<br />
neuer Anschrift.<br />
Vertrieb:<br />
Anschrift siehe <strong>Verlag</strong><br />
Telefon (0 71 81) 402-127<br />
E-Mail: motorik@hofmann-verlag.de<br />
Anzeigen:<br />
Anschrift siehe <strong>Verlag</strong><br />
Telefon (0 71 81) 402-124, Fax (0 71 81) 402-111<br />
vonterzi@hofmann-verlag.de<br />
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste vom<br />
Januar <strong>2010</strong><br />
Gesamtherstellung:<br />
Druckerei Djurcic, D-73614 Schorndorf<br />
International Standard Serial Number:<br />
E 7518<br />
ISSN 0170-5792<br />
Copyright:<br />
© by Aktionskreis Psychomotorik e. V. Alle<br />
Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch in Über-<br />
setzungen, nur mit Genehmigung der Redaktion.<br />
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben<br />
nicht in jedem Falle die Meinung der Redaktion<br />
wieder. Die Redaktions behält sich vor, Leser-<br />
briefe gekürzt zu veröffentlichen und Manu-<br />
skripte redaktionell zu bearbeiten.<br />
<strong>Verlag</strong>:<br />
<strong>Hofmann</strong>-<strong>Verlag</strong> GmbH & Co. KG<br />
Postfach 1360, D-73603 Schorndorf<br />
Tel. (0 71 81) 402-0, Fax (0 71 81) 402-111<br />
E-Mail: info@hofmann-verlag.de<br />
Inhalt<br />
editorial e 1<br />
Die Bedeutung ethischer Aspekte diagnostischen<br />
Handelns für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
Christina Reichenbach e 2<br />
Sprungbrett<br />
Katrin Walter, Maike Grotz, Kristina Holl,<br />
Ilka Seidel und Klaus Bös e 9<br />
Entwicklungsdiagnostik mit dem<br />
Kestenberg Movement Profile (KMP)<br />
Sabine C. Koch e 19<br />
Im Sinne des Menschen –<br />
Ressourcenorientierung in der<br />
psychomotorischen Diagnostik<br />
Holger Jessel e 26<br />
moto.logisch – Neues aus dem BVDM e 32<br />
Berichte e 34<br />
Veranstaltungen e 36<br />
Buchbesprechungen/Neuerscheinungen e 38<br />
Zeitschriftenspiegel e 41<br />
Summaries + Résumés e 43<br />
Titelbild:<br />
Jutta Schneider, Köln<br />
Die Zeitschrift MOTORIK wird auf chlorfrei<br />
gebleichtem Papier gedruckt.<br />
Bei dieser chlorfreien Bleiche des Zellstoffs<br />
entstehen keine chlorierten organischen Verbindungen,<br />
die die Abwässer belasten könnten.
Editorial<br />
In den letzten Ausgaben der Motorik<br />
fanden sich immer wieder Beiträge zur<br />
Diagnostik. Im Rahmen einzelner<br />
Themenschwerpunkte befassten sich die<br />
Autoren u. a. mit der Entwicklung von<br />
motorischen Tests (Bader/Strüber<br />
2/2009), mit motorischer Leistungsfähigkeit<br />
von Kindern und Jugendlichen<br />
(Opper u. a. 2/2008), mit Bewegungsdiagnostik<br />
von Jugendlichen (Welsche<br />
u. a. 2/2007), mit Untersuchungen<br />
körperlicher Leistungsfähigkeit von<br />
Kindern (Scholz/Krombholz /2007)<br />
oder mit Diagnostik der Händigkeit und<br />
Grafomotorik (Schilling 3/2006).<br />
Diagnostik ist implizit oder explizit die<br />
Grundlage jeder Entwicklungsbeschreibung<br />
und überprüfung und dementsprechend<br />
bedeutend für jegliche<br />
Förderung und Evaluation. Sie ermöglicht<br />
das Erkennen von Bedarfen und<br />
Ressourcen und darum geht es in vielen<br />
Autorenbeiträgen, die bisher in der<br />
Motorik veröffentlicht wurden.<br />
Wie letztlich der Erkenntnisprozess<br />
gestaltet ist bzw. wird, obliegt jedem<br />
Forscher und Anwender, der dies im<br />
Hinblick auf seine spezifische Fragestellung<br />
und auch seine theoretische<br />
Ausrichtung entscheidet.<br />
In dem hier vorliegenden Schwerpunktheft<br />
sind nun verschiedene Beiträge<br />
zum Thema Diagnostik zu finden,<br />
welche aufgrund bereits durchgeführter<br />
Untersuchungen oder theoretischer<br />
Überlegungen jeweils zu weiterer For<br />
schung im Hinblick auf eine (psycho)<br />
motorische Förderung, ein diagnostisches<br />
Verfahren oder ein diagnostisches<br />
Vorgehen anregen. Alle Autoren zeigen<br />
insgesamt neue Forschungsfragen und<br />
perspektiven auf. Es wird deutlich,<br />
dass die Fragen bundesweit, sowie über<br />
die europäischen Grenzen hinaus,<br />
bestehen.<br />
Der erste Beitrag von Christina Reichenbach<br />
geht aus einem Vortrag zu<br />
ethischen Aspekten in der Diagnostik<br />
hervor, der auf der Jahrestagung der<br />
Wissenschaftlichen Vereinigung für<br />
Psychomotorik und Motologie (WVPM<br />
e. V.) bereits zu Diskussionen anregte.<br />
Hier werden erste Überlegungen zu<br />
Ethik in der Diagnostik vorgestellt und<br />
konkret Fragen in Bezug auf ethische<br />
Vorstellungen in der psychomotorischen<br />
Diagnostik formuliert.<br />
Der zweite Beitrag von Karin Rummer/<br />
Maike Grotz/Kristina Holl/Ilka Seidel<br />
und Klaus Bös befasst sich mit der<br />
Untersuchung motorischer Leistungsfähigkeit.<br />
Die Autoren beschreiben die<br />
Ergebnisse der Pilotstudie „Sprungbrett“,<br />
welche durch ein strukturiertes<br />
Betreuungsprogramm am Nachmittag<br />
Verbesserungen in der motorischen<br />
Leistungsfähigkeit, in den anthropometrischen<br />
Daten und der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität erreichen<br />
will. Die vorliegenden Ergebnisse sind<br />
sehr interessant und hilfreich für<br />
weitere Forschungsfragen.<br />
Ein spezielles, alt bewährtes und the<br />
oriebasiertes Verfahren zur Entwicklungsdiagnostik<br />
stellt Sabine Koch in<br />
ihrem Beitrag vor – das Kestenberg<br />
Movement Profile (KMP). Die Autorin<br />
hebt hervor, dass eine gute und<br />
differenzierte qualititative und quantitative<br />
Diagnostik von Bewegung die<br />
Grundlage für eine gute psychomotorische<br />
Intervention darstellt. Das KMP,<br />
welches seine Ursprünge in der Tanz<br />
und Bewegungstherapie hat, wird im<br />
Überblick hinsichtlich der Grundgedanken<br />
und der Anwendung vorgestellt. Die<br />
Autorin macht das Verfahren durch eine<br />
exemplarische Entwicklungsdiagnostik<br />
für einen 2½ Monate alten Jungen<br />
anschaulich. Letztlich spricht sich die<br />
Autorin für die Anwendung der KMP in<br />
der Psychomotorik aus, so dass die<br />
Diagnostik um einen psychologischpsychodynamischen<br />
Aspekt ergänzt<br />
wird.<br />
Der vorwiegend theoretische Beitrag<br />
von Holger Jessel versucht Anstöße zu<br />
einer ressourcenorientierten psychomotorischen<br />
Diagnostik zu geben, welche<br />
wiederum entwicklungsfördernde<br />
Wirkungen entfalten kann. Jessel geht<br />
der Frage nach, welche Handlungs und<br />
Problemlösungsmöglichkeiten sich im<br />
Rahmen von Diagnostik eröffnen und<br />
wie diese gestaltet sein könnten. Hier<br />
hebt er insbesondere das Betrachten<br />
von Ressourcen sowie die Einstellungen,<br />
Werte und Haltungen des Psychomotorikers<br />
hervor, welche sich jeder Diagnostiker<br />
bewusst machen sollte.<br />
Letztlich wird sich für eine Implementierung<br />
spezifischer flächendeckender<br />
Fördermaßnahmen für die untersuchte<br />
Klientel ausgesprochen.<br />
Christina Reichenbach
Die Bedeutung ethischer Aspekte diagnostischen Handelns für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
Christina Reichenbach<br />
Die Bedeutung ethischer Aspekte<br />
diagnostischen Handelns<br />
für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
Diagnostik nimmt im Rahmen von Praxis, Forschung und Ausbildung kontinuierlich<br />
eine hohe Bedeutung ein. Diagnostisches Handeln bezieht sich zumeist auf die<br />
Kenntnis und Durchführung spezieller Methoden und Verfahren. Ethische Fragen<br />
bleiben in der Regel außen vor und werden nicht thematisiert. Der vorliegende<br />
Beitrag möchte auf ethische Fragestellungen und Probleme in Bezug auf Diagnostik<br />
aufmerksam machen und zur Diskussion unter anderem im Hinblick auf Inhalte,<br />
Ziele, Qualifikationen und Richtlinien anregen.<br />
„Handle nur nach derjenigen Maxime,<br />
durch die du zugleich wollen kannst,<br />
dass sie ein allgemeines Gesetz werde“<br />
(Universalisierungsformel des Kategorischen<br />
Imperativs nach Kant 1785)<br />
Einleitung<br />
Tagtäglich werden in psychomotorischen<br />
Praxen, in Kliniken oder zu<br />
anderweitigen Untersuchungszwecken<br />
Kinder und Jugendliche mit diversen<br />
diagnostischen Verfahren untersucht.<br />
Diagnostische Methoden und Verfahren<br />
sind Inhalte in zahlreichen und verschiedenen<br />
Studien- und Ausbildungsgängen<br />
sowie in speziellen Fortbildungen<br />
für Erzieherinnen, Lehrerinnen,<br />
Motopädinnen, Motologinnen, Heilpädagoginnen,<br />
Sonderpädagoginnen,<br />
Diplompädagoginnen, Rehabilitationspädagoginnen.<br />
Zumeist geht es in der<br />
Ausbildung darum, spezielle Verfahren<br />
zu vermitteln, die dann ökonomisch in<br />
der Praxis angewendet werden können.<br />
Auch wenn seit einiger Zeit betont<br />
wird, dass es wichtig ist „von den<br />
Stärken auszugehen“, ressourcenorientiert<br />
zu arbeiten und dabei die Haltung<br />
des Pädagogen/Diagnostikers sowie die<br />
Methoden zu reflektieren (vgl. Eggert<br />
1997; Schuck 000; Jessel 010), so<br />
stellt kaum jemand die Frage, ob es<br />
ethisch vertretbar ist, Kinder und<br />
Jugendliche ohne spezielle Voraussetzungen<br />
(z. B. persönliche Einwilligung<br />
oder spezifische Qualifikation) zu<br />
diagnostizieren.<br />
Im vorliegenden Beitrag werden<br />
verschiedene Aspekte ethischen<br />
Handelns beleuchtet und deren<br />
Bedeutung sowohl allgemein für den<br />
Alltag pädagogischer sowie speziell<br />
im Hinblick auf psychomotorische<br />
Diagnostik veranschaulicht. Der Beitrag<br />
versteht sich als Anregung zur Diskussion<br />
und wird keinesfalls als „abgeschlossen“<br />
erachtet.<br />
Thematisierung<br />
Ethik wird in verschiedenen Bereichen<br />
der Wissenschaft sowie unterschiedlichen<br />
Berufsfeldern thematisiert, so<br />
z. B. in den Naturwissenschaften<br />
(Biologie, Medizin, Informatik …), den<br />
Geisteswissenschaften (Theologie,<br />
Philosophie, Psychologie, etc.) oder den<br />
Sozialwissenschaften (Medien, Pädagogik,<br />
Recht, Soziologie, Wirtschaft, etc.).<br />
Überall werden ethische Diskussionen<br />
mit verschiedenen Schwerpunkten<br />
geführt. Die Auseinandersetzung mit<br />
ethischen Aspekten erfolgte bisher vor<br />
allem in Bezug auf pränatale Diagnostik<br />
und psychologische Diagnostik. Welche<br />
Bedeutung Ethik in der pädagogischen<br />
und spezifisch psychomotorischen<br />
Diagnostik hat, ist bisher kein explizites<br />
Thema gewesen.<br />
Begriffsverständnis von Ethik<br />
So wie es mit vielen Begrifflichkeiten in<br />
der Pädagogik und Psychologie ist, so<br />
gibt es auch für den Begriff der Ethik<br />
keine allgemeingültige Definition und<br />
dementsprechend auch keine generelle<br />
Sichtweise. Ethik heißt aus dem Griech.<br />
(éthos) übersetzt erst einmal nichts<br />
weiter als Gewohnheit, Brauch,<br />
Herkommen oder Sitte. Der Begriff birgt<br />
demnach Aspekte des Handelns und<br />
Verhaltens sowie dessen begründete<br />
Entstehung. Die Menschen handeln<br />
i. d. R. entsprechend der Sitten und<br />
Bräuche mit denen sie aufgewachsen<br />
und/oder kontinuierlich konfrontiert<br />
sind. Das menschliche Handeln, ganz<br />
unabhängig in welchem Kontext, ist<br />
demnach durch leitende Handlungsregeln<br />
bzw. „Normen“ bestimmt, welche<br />
selbst gesetzt oder gesellschaftlich<br />
bestimmt sein können. Neben persön-<br />
Prof. Dr. Christina Reichenbach<br />
Professorin an der Evangelischen<br />
Fachhochschule Bochum. Ihr Lehrgebiet<br />
ist die Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt<br />
Förderung, Bildung und Integration<br />
von Kindern und Jugendlichen mit<br />
Behinderung.<br />
Arbeitsschwerpunkte: Förderdiagnostik,<br />
Schuleingang, Selbstkonzept.<br />
Anschrift der Verfasserin:<br />
Evangelische Fachhochschule<br />
R-W-L Bochum<br />
Immanuel-Kant-Str. 18– 0<br />
44803 Bochum<br />
E-Mail: christina.reichenbach@gmx.eu
lichen Erfahrungen sind Werte und<br />
Handlungsnormen von gesellschaftlichen,<br />
kulturellen, technischen und<br />
wirtschaftlichen Faktoren abhängig<br />
(vgl. Wuketits 006).<br />
„Ethik bestimmt sich aus Menschenbild<br />
und Werten, sie begründet eine<br />
Haltung“ (Ethik-Charta 1998, 3). Im<br />
Laufe der Zeit wird eine Gewohnheit<br />
(ethos) zum Charakter (äthos), welcher<br />
sich wiederum durch Grundhaltungen,<br />
Werte oder Tugenden beschreiben lässt<br />
(vgl. Gebauer/Kreis/Moisel 00 ).<br />
In jedem Fall kann gesagt werden: „Es<br />
gibt keine objektiven Werte“ (Mackie<br />
1989, 11, zit. nach Wuketits 006, 7).<br />
Ethik und Moral sind die Erzeugnisse<br />
von Menschen und damit fehlbar.<br />
„Ein Wert ist das, was uns wichtig ist.<br />
(…) Werte sind Auffassungen von<br />
Wünschenswertem“ (Reichenbach<br />
006, 3).<br />
Weiterführend fragt die ethike theoria<br />
(nach Aristoteles) „nach der Vernunft<br />
der bestehenden Sitten und Gebräuche,<br />
um sie nach Möglichkeit zu ändern,<br />
wo sie widervernünftig sind“ (Fischer<br />
u. a. 007, 0). Verschiedene hier<br />
genannte allgemeine Überlegungen<br />
zum Ethik-Begriff bieten in Bezug<br />
auf Diagnostik Grund zur Diskussion<br />
und Anlass zur Reflexion und Bewusstwerdung.<br />
Ehe wesentliche Gedanken<br />
und Fragen diesbezüglich zusammengefasst<br />
werden, folgen nun im Überblick<br />
Ausführungen zur ethischen<br />
Relevanz und Problematik von Diagnostik.<br />
Ethische Relevanz und Problematik<br />
in der Diagnostik<br />
Diagnostik bzw. die Anwendung diagnostischer<br />
Verfahren betrifft Menschen<br />
und alles was Menschen anbelangt, ist<br />
ethisch relevant. Nach Borchard ( 007)<br />
werden oft grundlegende ethische<br />
Probleme übersehen. So stellt bereits<br />
die Entscheidung zur Durchführung<br />
diagnostischer Verfahren eine Intervention<br />
und damit einen von außen<br />
bestimmten Eingriff dar. Zudem ist<br />
diagnostisches Handeln stets in<br />
(gesundheits-)politische, ökonomische,<br />
soziokulturelle und persönliche<br />
Rahmenbedingungen eingebunden und<br />
dadurch mitbestimmt (vgl. Gahl 001).<br />
Weiterhin können institutionelle<br />
Strukturen deutliche Auswirkungen auf<br />
die diagnostisch-ethische Urteilsbildung<br />
haben. Somit muss das ethische<br />
Handeln nicht unbedingt mit den<br />
eigenen ethischen Vorstellungen<br />
übereinstimmen. Eine Trennung von<br />
Diagnostik und Förderung oder aber<br />
eine mangelnde Transparenz gegenüber<br />
anderen Fachkräften können zu einer<br />
wertedivergenten Urteilsbildung führen.<br />
Auch die Vorgabe bestimmter Instrumentarien<br />
bzw. Verfahren oder zeitlicher<br />
Rahmenbedingungen können als<br />
Einengung der Persönlichkeit und der<br />
Werte des Diagnostikers gesehen<br />
werden.<br />
Gahl ( 001) führt beispielhaft zur<br />
ethischen Urteilsbildung verschiedene<br />
Ebenen auf, die pro Klient bedacht<br />
werden müssen und Teil von Diagnostik<br />
sind.<br />
• Sachebene: Erfassung und Rekonstruktion<br />
der Vorgeschichte, Auswahl<br />
diagnostischer Verfahren, Entscheidungsfindung<br />
• Kommunikation und Interaktion:<br />
Gespräche zwischen Diagnostiker und<br />
Klient sowie Bezugspersonen und<br />
weiteren Fachkräften<br />
• Psychologische Verarbeitung: Wer<br />
nimmt welche Informationen wie auf?<br />
• Recht: Schweigepflichtentbindung;<br />
Aufklärungspflicht; Selbstbestimmung<br />
• Soziale, ökonomische, soziokulturelle<br />
Ebene: Akzeptanz; Kosten-Nutzen-<br />
Abwägung<br />
• Wertebene individueller Entscheidungen:<br />
Sachlichkeit, Verantwortung,<br />
Achtung, Verschwiegenheit, Leitbilder,<br />
intuitive Wahrnehmung<br />
Die Wertungen eines Menschen sagen<br />
etwas über ihn aus; es wird deutlich,<br />
was ihm wichtig ist, was er anstrebt,<br />
was er achtet (vgl. Reichenbach 006).<br />
Übertragen auf die Diagnostik könnte<br />
dies bedeuten, dass die Auswahl und<br />
damit die individuelle Präferenz und<br />
„Wertigkeit“ spezieller diagnostischer<br />
Methoden und Verfahren etwas über<br />
den Diagnostiker aussagen. Welche<br />
Bedeutung die bisherigen Ausführungen<br />
für die eigene Diagnostik hat bzw.<br />
haben kann, wird im Folgenden anhand<br />
von Fragen formuliert.<br />
Bedeutung für PMDiagnostik<br />
• Jeder Diagnostiker bringt in der<br />
psychomotorischen Diagnostik<br />
(bewusst oder unbewusst) seine<br />
eigenen Werte ein, die ihm<br />
wichtig sind!<br />
– Sagt die Auswahl der diagnostischen<br />
Verfahren und Methoden<br />
etwas über die Wertungen<br />
und Haltungen des Diagnostikers<br />
aus?<br />
– Warum wendet wer welche<br />
diagnostischen Verfahren an?<br />
– Was ist/wird warum gewünscht?<br />
Wer misst was<br />
welchen Wert bei?<br />
– Was ist dem Diagnostiker<br />
individuell bedeutsam?<br />
• Jedem diagnostischen Verfahren<br />
liegen Werte und theorie- oder<br />
erfahrungsbasierte Bezugsnormen<br />
zugrunde.<br />
– Welche Werte und Normen<br />
liegen zugrunde?<br />
– Wer hat die Werte und Normen<br />
wann und wozu vorgegeben?<br />
• Ethik und somit auch ethische<br />
Aspekte in der Diagnostik werden<br />
von einem zugrunde gelegten<br />
Menschenbild bestimmt! In der<br />
Psychomotorik gibt es kein<br />
„einheitliches“ Menschenbild und<br />
somit unterscheiden sich auch die<br />
Methoden und das Vorgehen in<br />
der Diagnostik!<br />
– Welches Menschenbild bzw.<br />
welche Menschenbilder liegen<br />
den genutzten diagnostischen<br />
Verfahren zugrunde?<br />
• Die „Vernunft“ von Sitten und<br />
Gebräuchen hinsichtlich des<br />
diagnostischen Vorgehens sowie<br />
der Anwendung „altgedienter“<br />
diagnostischer Verfahren und den<br />
damit verbundenen Werten sollte<br />
stets reflektiert und ggf. hinterfragt<br />
werden!<br />
– Ist etwas „gut“, weil es „alt<br />
bewährt“ ist oder weil es auch<br />
in neuen wiss. Begründungszusammenhängen<br />
überzeugt?<br />
– Passen sich diagnostische<br />
Vorstellungen veränderten<br />
Zeiten und Lebensgewohnheiten<br />
an? Sollten sie dies tun?<br />
• Welche Bedeutung haben<br />
institutionelle Strukturen für die<br />
Auswahl von diagnostischen<br />
Methoden und Verfahren?<br />
•<br />
Welchen Stellenwert haben<br />
ethische Aspekte der Diagnostik<br />
im Rahmen von Ausbildungen<br />
und Professionalisierung?<br />
3
4<br />
Die Bedeutung ethischer Aspekte diagnostischen Handelns für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
• Welchen Paradigmen psychomotorischer<br />
Förderung entsprechen<br />
welchen ethischen Vorstellungen<br />
diagnostischen Handelns?<br />
Zusammenhang von Ethik<br />
und Recht<br />
Ethische Vorstellungen hinsichtlich<br />
Diagnostik sind oftmals an rechtliche<br />
Vorgaben gebunden. Dies kann den<br />
Diagnostiker erleichtern oder auch<br />
einschränken. Eine Einschränkung<br />
erfolgt dann, wenn die rechtlichen<br />
Vorgaben nicht den eigenen ethischen<br />
Vorstellungen entsprechen. In den<br />
gesetzlichen Vorgaben steckt stets auch<br />
die Frage der Auftraggeberschaft. In<br />
einigen Gesetzen (z. B. im Schulgesetz)<br />
ist dies deutlich, in anderen müssen<br />
Bezüge hergestellt werden. Für das Ziel<br />
einer guten, professionellen und ethisch<br />
vertretbaren Diagnostik ist die Frage<br />
nach der Auftraggeberschaft und die<br />
damit verbundenen Interessen wichtig.<br />
Wenn die zu diagnostizierende Person<br />
selbst der Auftraggeber ist, dann ist das<br />
Prinzip der Freiwilligkeit erfüllt. Es ist<br />
klar, um was es geht und es liegen<br />
grundlegend keine ethischen Konflikte<br />
vor. Wenn Fremde bzw. Außenstehende<br />
die Auftraggeber sind, dann müsste<br />
geprüft werden, ob die Erkenntnisinteressen<br />
des Auftraggebers über dem<br />
Schutz der Persönlichkeitssphäre stehen.<br />
Der Diagnostiker sollte dann solche<br />
Instrumente wählen, welche die<br />
benötigten Informationen unter<br />
minimaler Verletzung der Persönlichkeitssphäre<br />
erfassen (vgl. Borchard<br />
007). Wenn Dritte Entscheidungen<br />
treffen, ist dennoch daran zu denken,<br />
dass dies den Diagnostiker nicht von<br />
seiner ethischen Verantwortung<br />
entbindet (vgl. Ethik-Charta 1998).<br />
Insgesamt sollte abgewogen werden, ob<br />
der Nutzen bestimmter diagnostischer<br />
Verfahren die „Kosten“ (Zeit, Finanzen,<br />
Personal und emotionale Belastung)<br />
übersteigen. Die Verhältnismäßigkeit<br />
der Mittel soll gewahrt bleiben. Für<br />
Psychologen gibt es Richtlinien des BDP<br />
(Berufsverbands Deutscher Psychologinnen<br />
und Psychologen e. V.) und der<br />
APA (American Psychological Association);<br />
für Nicht-Psychologen gibt es<br />
keine verbindlichen Richtlinien, sondern<br />
maximal Empfehlungen.<br />
Im Folgenden werden wesentliche<br />
rechtliche Aspekte in aller Kürze<br />
angeschnitten, vor allem, um verschiedene<br />
rechtliche Ebenen herauszustellen<br />
und, um bewusst zu machen, was diese<br />
rechtlichen Vorgaben bedeuten. Hier<br />
stehen beispielhaft die Fragen im<br />
Hintergrund:<br />
• Für wen gilt welches Recht, welche<br />
gesetzliche Vorgabe?<br />
• Welche Praxisrelevanz hat das<br />
Gesetz?<br />
• Was sind bzw. wären Erfordernisse für<br />
eine optimale Umsetzung der<br />
Gesetzestexte?<br />
Auswahl von Gesetzen und ihr Einfluss<br />
auf Diagnostik<br />
In verschiedenen Gesetzestexten finden<br />
sich Paragrafen, die direkt oder indirekt<br />
auf diagnostisches Arbeiten bezogen<br />
werden (können). Im Folgenden werden<br />
vier Gesetze beispielhaft genannt:<br />
Strafgesetzbuch: Im StGb § 03, Abs. 1<br />
finden sich Ausführungen über die<br />
Schweigepflicht bei bestimmten<br />
staatlich anerkannten Berufsgrup-<br />
pen.<br />
In der pädagogischen Praxis wird<br />
oftmals formal schriftlich festgehalten,<br />
dass in einer Diagnostik erhobene Daten<br />
nicht weitergegeben werden dürfen.<br />
Hier stellt sich die Frage, ob die diagnostizierten<br />
Personen oder ihre<br />
Eltern lediglich das Recht auf Einblick<br />
haben.<br />
Grundgesetz: Der zentrale Begriff des<br />
Rechts ist in Artikel 1 des Grundgesetzes<br />
festgeschrieben: die Würde des<br />
Menschen. Die Rechtsgrundlage sollte<br />
dazu dienen, die „Rahmenbedingungen<br />
für eine freie Entfaltung der Menschen<br />
gemäß ihrer Würde zu schaffen“<br />
(Borchard, 007). Dazu gehört u. a. die<br />
freie Entfaltung der Persönlichkeit und<br />
Autonomie.<br />
In der Praxis müsste dies bedeuten, dass<br />
Menschen das Recht haben in Entscheidungen<br />
und Entscheidungsprozesse<br />
einbezogen zu werden und nicht allein<br />
allen Empfehlungen zuzustimmen. Wird<br />
das Gesetz streng definiert, so stellen<br />
diagnostische Verfahren einen Eingriff<br />
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht<br />
dar (vgl. Avenarius 1990). Es gibt jedoch<br />
immer wieder Ausnahmeregelungen,<br />
insbesondere, wenn es um die Feststellung<br />
der Schulfähigkeit geht (vgl.<br />
ebd.).<br />
Schulgesetz: Im Schulgesetz für das<br />
Land NRW wird es in § 1 6 als Ordnungswidrigkeit<br />
verstanden, wenn<br />
Eltern nicht für die Teilnahme ihres<br />
Kindes an der Feststellung des Sprachstandes<br />
sorgen, welche das Schulamt<br />
feststellt (§ 36 Abs. und 3).<br />
Damit werden Eltern dazu verpflichtet,<br />
ihr Kind diagnostischer Begutachtung<br />
auszusetzen, ohne dass sie das Recht zur<br />
Mitbestimmung haben. Konkret könnte<br />
dies jeweils angefochten werden, in dem<br />
sich auf das Verhältnismäßigkeitsgebot<br />
bezogen wird.<br />
Erfordernisse für die Umsetzung<br />
der Gesetzestexte<br />
Auch wenn bestimmte Aspekte, die die<br />
Diagnostik betreffen (z. B. Erhebung des<br />
Sprachstandes), per Gesetz festgeschrieben<br />
sind, so besteht grundsätzlich<br />
die Frage nach der Umsetzung und<br />
auch der Interpretation der Gesetzestexte.<br />
Im Folgenden wird das Problem in Bezug<br />
auf die Erfassung des Sprachstandes<br />
beispielhaft veranschaulicht.<br />
Es steht nirgends geschrieben, welche<br />
Qualität beispielsweise Verfahren zur<br />
„Feststellung des Sprachstandes“ und<br />
welche Qualifikation entsprechende<br />
Anwender/Diagnostiker haben müssen.<br />
Wird die praktische Umsetzung des<br />
Gesetzestextes betrachtet, so zeigen<br />
sich grundsätzlich Lücken und Widersprüche.<br />
So gibt es zum Erlernen von<br />
Verfahren in der Praxis mal spezielle<br />
längere Fortbildungen, mal Tageskurse,<br />
mal wird eine autodidaktische Aneignung<br />
verlangt. In der Durchführung<br />
werden Verfahren mal von außenstehenden<br />
fremden Personen allein oder<br />
im Beisein bekannter Erzieherinnen<br />
durchgeführt, ein anderes Mal wiederum<br />
ausschließlich von den gut bekannten<br />
Erzieherinnen. Schlussendlich<br />
sollen aber alle Kinder gleich „bewertet“<br />
und eingeschätzt werden und es fallen<br />
Entscheidungen, die ihr weiteres Leben<br />
beeinflussen. Diese Lücken in Form von<br />
mangelnder Qualität und ungenügender<br />
Qualifikation greifen zum Teil die Würde<br />
des Menschen, in diesem Beispiel der<br />
Kinder, an und sind ethisch nicht zu<br />
vertreten, wenn professionell gearbeitet<br />
werden soll.<br />
Das Beispiel aus dem Kita-Alltag und<br />
die dort auftretenden Differenzen, die<br />
sich aus unterschiedlicher Qualität und
Qualifikation ergeben, lassen sich sehr<br />
gut auf psychomotorische oder andere<br />
pädagogische diagnostische Handlungssituationen<br />
übertragen. Wichtige<br />
Fragestellungen dazu könnten sein:<br />
Bedeutung für PMDiagnostik<br />
– Welche Rechte hat der zu<br />
diagnostizierende Mensch in der<br />
(psychomotorischen) Diagnostik?<br />
– Inwiefern wird auf die Selbstbestimmung<br />
des zu diagnostizierenden<br />
Menschen in der PM-<br />
Diagnostik eingegangen und<br />
diese akzeptiert?<br />
– Wie kann der Diagnostiker der<br />
ethischen Verantwortung gerecht<br />
werden, wenn Dritte Entscheidungen<br />
treffen?<br />
– Welche Qualifikationen sind<br />
erforderlich, um rechtliche<br />
Vorgaben umzusetzen?<br />
– Welche fachlichen Kompetenzen<br />
und Qualifikationen sind für eine<br />
PM-Diagnostik erforderlich, die<br />
ethische Belange berücksichtigen?<br />
– Braucht die PM-Diagnostik<br />
Richtlinien bzw. Leitlinien, um<br />
ethischen Aspekten gerecht zu<br />
werden?<br />
Richtlinien für verantwortungsvolles<br />
diagnostisches Handeln<br />
Nicht jeder Forscher und Untersucher<br />
sowie auch nicht jeder Praktiker, also<br />
Diagnostiker, kann tun und lassen was<br />
er möchte. Es gibt verschiedene Arten<br />
von Richtlinien für pädagogisches und<br />
auch diagnostisches Handeln, auch<br />
wenn diese nicht immer einer Kontrolle<br />
obliegen. Die international einflussreichsten<br />
Ethikrichtlinien stammen von<br />
der American Psychological Association<br />
(APA 00 ) und beinhalten zusammengefasst<br />
folgende Punkte:<br />
• Verantwortung: „Kosten“ und Nutzen<br />
für den Klienten abwägen<br />
• Individuelle Verantwortung des<br />
Diagnostikers und aller Beteiligten<br />
• Information und Aufklärung über<br />
Untersuchung<br />
• Offenheit und Ehrlichkeit<br />
• Freiwillige Teilnahme und Möglichkeit<br />
des Abbruchs<br />
• Klienten nicht ausnutzen;<br />
Absprachen einhalten<br />
• Schaden und Stress vermeiden,<br />
über Risiken informieren<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Vollständige Aufklärung<br />
Datenschutz; Zusicherung von<br />
Anonymität<br />
Schädigungsfreiheit von Untersuchungsteilnehmern.<br />
Verantwortung gilt als wesentlicher<br />
Begriff in der Diskussion um ethische<br />
Aspekte von Diagnostik (vgl. Fischer/<br />
Gruden u. a. 007 nach Rohpohl 1998).<br />
Hier kann gefragt werden:<br />
• Wer verantwortet etwas? (Individuum,<br />
Korporation, Gesellschaft, …)<br />
• Was wird verantwortet? (Handlung,<br />
Produkt, Unterlassung, …)<br />
• Wofür wird verantwortet? (voraussehbare<br />
oder nicht voraussehbare<br />
Folgen, Fern- und Spätfolgen, …)<br />
• Weswegen wird verantwortet?<br />
(Moral, gesell. Werte, Gesetze, …)<br />
• Wovor wird verantwortet? (Gewissen,<br />
Urteil anderer, Gericht, …)<br />
• Wann wird verantwortet? (vorher,<br />
aktuell, nachher, …)<br />
• Wie wird verantwortet? (aktiv,<br />
virtuell, passiv, …)<br />
Diese Fragen können im Rahmen einer<br />
Diagnostik von einem Diagnostiker<br />
vielfältig beantwortet werden. Sicherlich<br />
hängt die Beantwortung der Fragen<br />
stets vom spezifischen Kontext bzw.<br />
den institutionellen Bedingungen sowie<br />
der Persönlichkeit des Diagnostikers ab.<br />
Schuck macht deutlich, dass es in der<br />
pädagogischen Diagnostik auch darum<br />
geht „die entwickelten und gebräuchlichen<br />
Konzepte der Diagnostik hinsichtlich<br />
ihrer Menschenbilder, ihrer<br />
wissenschaftstheoretischen Annahmen,<br />
ihrer ethischen Implikationen und ihrer<br />
klassischen Verwertungszusammenhänge<br />
wahrzunehmen und im Hinblick auf<br />
ihre Brauchbarkeit und Veränderungsnotwendigkeit<br />
auf dem Hintergrund der<br />
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen<br />
zu prüfen“ ( 000, 46 f.).<br />
In jedem Fall wäre es sinnvoll,<br />
Richtlinien für eine psychomotorische<br />
Diagnostik zu formulieren. Diese<br />
Richtlinien könnten die Qualität<br />
der Arbeit steigern und es würde<br />
ganz sicher zur Professionalisierung<br />
psychomotorischer Arbeit beitragen.<br />
Bedeutung für PMDiagnostik<br />
– Welche Verantwortungen gibt es<br />
in der Vielzahl von diagnostischen<br />
Vorgehensweisen in der<br />
Psychomotorik?<br />
– Wer verantwortet was? (der<br />
Entwickler das Verfahren; die<br />
Anwender die Auswahl und die<br />
Umsetzung der Verfahren; …)<br />
– Was könnten ethische Maßstäbe<br />
in der psychomotorischen<br />
Diagnostik sein?<br />
– Welchen Stellenwert haben<br />
ethische Aspekte der Diagnostik<br />
im Rahmen von Ausbildungen<br />
und Professionalisierung?<br />
Erfordernisse für eine<br />
psychomotorische Diagnostik<br />
unter Berücksichtigung<br />
ethischer Aspekte<br />
Interessant wäre die Frage, wie viele der<br />
Leser sich schon einmal Gedanken zur<br />
Ethik im Rahmen von psychomotorischer<br />
Diagnostik gemacht haben und wenn ja,<br />
zu welchen Positionen sie dann gelangt<br />
sind. Eigentlich müsste dies zu einer<br />
Vielzahl von Antworten führen, allein<br />
wenn man die Verschiedenheit diagnostischer<br />
Wege und Vorgehen betrachtet<br />
(vgl. Eggert 1997, Schönrade/Pütz 000,<br />
Göbel/Panten 00 , Passolt/Pinter-Theiss<br />
003, Reichenbach/Lücking 007).<br />
Unabhängig davon, welche Verfahren<br />
genutzt werden, so greift man als<br />
Diagnostiker tagtäglich in den Persönlichkeitsbereich<br />
Anderer ein.<br />
Im Folgenden werden zum einen einige<br />
ethische Aspekte von Diagnostik<br />
herausgestellt, mit denen wir, solange<br />
wir in diesem Feld aktiv sind, tagtäglich<br />
konfrontiert werden könnten. Zum<br />
anderen soll dazu angeregt werden,<br />
über die eigene Position und Qualifikation<br />
nachzudenken und diese für sich<br />
zu reflektieren. Ethische Aspekte haben<br />
Bedeutung bezüglich verschiedener<br />
Bereiche, die im Folgenden stichpunktartig<br />
zusammengefasst sind (in Anleh-<br />
nung an Moosbrugger/Höfling 006):<br />
Fachliche Kompetenz und Qualifikation<br />
• Kompetenz als Mischung aus<br />
individuellem, professionellem<br />
Wissen, Urteilsvermögen, Wertvorstellungen<br />
und technischen sowie<br />
zwischenmenschlichen Fähigkeiten;<br />
• Wissen und Können in Bezug auf<br />
Methodenvielfalt;<br />
•<br />
begründete Auswahl spezifischer<br />
Verfahren anstelle „Standard-Satz“<br />
5
6<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Die Bedeutung ethischer Aspekte diagnostischen Handelns für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
Gewährleistung einer sachgemäßen<br />
und fachgerechten Anwendung des<br />
Verfahrens;<br />
– Bei Tests: Erfordernis psychometrischer<br />
Kenntnisse;<br />
– Bei Tests: Gewährleistung der<br />
Objektivität der Durchführung;<br />
Klarwerden über Bezugsnorm des<br />
angewendeten Verfahrens;<br />
Klarheit über die Bewertung/Ein-<br />
schätzung der Information, die aus<br />
dem Verfahren resultiert;<br />
Kenntlichmachen eigener Werte<br />
und/oder Wertesystem;<br />
Bewusstmachung und Einbezug<br />
möglicher Fehlerquellen.<br />
Auswahl diagnostischer Verfahren<br />
• Warum werden vom Diagnostiker<br />
welche Verfahren ausgewählt?<br />
• Welche Vorstellungen von Entwicklung<br />
hat der Diagnostiker und finden<br />
sich diese in den genutzten Verfahren<br />
wieder?<br />
• Welche persönlichen Werte hat der<br />
Diagnostiker, die sich in der Auswahl<br />
der diagnostischen Verfahren<br />
niederschlagen? An welchen Werten<br />
muss bzw. sollte er sich orientieren?<br />
Wer bestimmt dies?<br />
• Welche Fragestellung bzw. welches<br />
Ziel steht im Vordergrund und welche<br />
Verfahren geben dem Diagnostiker<br />
diesbezüglich welche Auskunft?<br />
• Sind die Ziele der durchgeführten<br />
Verfahren aktuell überprüft?<br />
• Welche Bedeutung spielt das in der<br />
psychologischen Diagnostik angeführte<br />
Kriterium der Ökonomie, d. h.<br />
gesicherte Ergebnisse in kurzer Zeit,<br />
in pädagogisch geprägten diagnostischen<br />
Arbeitsfeldern?<br />
• Ist die Aktualität und Repräsentativität<br />
der Normen bei einer Testanwendung<br />
gesichert?<br />
• Welcher Erhebungszeitraum ist<br />
vorgesehen?<br />
• Gibt es weitere Auswertungskategorien<br />
(z. B. Fehleranalyse,<br />
Entwicklungsprofile)?<br />
• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,<br />
dass kein diagnostisches<br />
Verfahren, alle wesentlichen Aspekte<br />
einer Fragestellung eines Auftraggebers<br />
erfasst. Daher: Werden<br />
beispielsweise standardisierte<br />
Verfahren durch offenere Fragen<br />
ergänzt (z. B. Fragebogen, Interview)?<br />
Anwendung Diagnostischer Verfahren<br />
Die Auswahl diagnostischer Verfahren<br />
entscheidet oder bestimmt ebenso die<br />
Art der Anwendung. Die Anwendung<br />
unterscheidet sich in Abhängigkeit von<br />
der Methode: Test, Screening, Befragung,<br />
Arbeitsprodukte, Inventare, Gespräche<br />
u. a. Die Rolle des Diagnostikers sowie<br />
die Form und Struktur der Situation und<br />
die Möglichkeiten zu ihrer Gestaltung<br />
werden wiederum in Abhängigkeit von<br />
der Methode bestimmt.<br />
Der Anwendung von Tests scheint<br />
ethisch betrachtet beispielsweise durch<br />
befriedigende Gütekriterien Genüge<br />
getan (vgl. Avenarius 1990). Es ist<br />
jedoch eindeutig, dass dies keine<br />
hinreichenden Bedingungen sind,<br />
sondern letztlich durch die Qualität der<br />
Testanwendung bestimmt werden (vgl.<br />
Moosburger/Höfling 006).<br />
Richtlinien und Qualifikation<br />
Zunehmend wird in der psychologischen<br />
Diagnostik gefordert, dass ethische<br />
Aspekte zu berücksichtigen sind und<br />
sich diesbezüglich auch an Leitlinien<br />
orientiert werden sollte. Es gibt<br />
verschiedene Leitlinien, so z. B.:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Leitlinien der APA<br />
Ethische Richtlinien der DGP und des<br />
BDP (vgl. www.dgps.de, 1998)<br />
Von verschiedenen Autoren aufgestellte<br />
Leitlinien (vgl. Moosburger/<br />
Höfling 006)<br />
International Guidelines for Test Use<br />
(IGTU; International Test Commission<br />
000)<br />
Standards für pädagogisches und<br />
psychologisches Testen (SPPT; Häcker<br />
u. a. 1998)<br />
Weiterhin werden vielerorts auch eine<br />
Verpflichtung zur Supervision sowie<br />
die Einrichtung von Ethikkommissionen<br />
gefordert. In Deutschland gibt es<br />
verschiedene Ethikkommissionen,<br />
jedoch ist außerhalb des medizinischen<br />
Bereichs der Einbezug derartiger<br />
Kommissionen gesetzlich nicht erforderlich<br />
und nicht vorhanden. Ethische<br />
Standards und ihre Geltung sind einer<br />
Übereinkunft zu verdanken, die es<br />
ermöglicht, nach gemeinsamen<br />
Richtmaßen bei unterschiedlichen<br />
moralischen Orientierungen zu handeln<br />
(vgl. Fischer u. a. 007). Moralische<br />
Überzeugungen allein sind nicht<br />
kompromissfähig, Standards hingegen<br />
lassen Kompromisse zu.<br />
Die International Test Commission<br />
( 000, 6) hat als zentrale Zielsetzung<br />
der „International Guidelines for Test<br />
Use“ formuliert: „Ein fachlich kompetenter<br />
Testanwender setzt Tests in<br />
fachgerechter und ethisch korrekter<br />
Weise ein und berücksichtigt dabei die<br />
Bedürfnisse und Rechte der am Test-<br />
prozess Beteiligten, die Gründe für die<br />
Testung sowie den weiteren Kontext,<br />
in dem der Test stattfindet“ (Moosburger/Höfling<br />
006, 449).<br />
Hier wird deutlich, dass zum einen ver-<br />
schiedene Kompetenzen vom Diagnostiker<br />
gefordert sind und zum anderen,<br />
dass es nicht allein um die Anwendung<br />
eines Verfahrens geht, sondern auch<br />
um die Bedürfnisse und Rechte der<br />
beteiligten Menschen sowie um den<br />
Einbezug des Kontextes und des<br />
Auftrags. Der Einbezug des Umfeldes,<br />
also des Kontextes und auch die<br />
Berücksichtigung der Fragestellung der<br />
Diagnostik sowie die Berücksichtigung,<br />
wer der Auftraggeber ist oder welcher<br />
Auftrag von wem formuliert wurde,<br />
sollte in der pädagogischen und<br />
psychologischen und somit auch in der<br />
psychomotorischen Diagnostik ausdrücklich<br />
Berücksichtigung finden.<br />
Um sich selbst Gedanken über den<br />
Einbezug der Bedürfnisse und Rechte zu<br />
machen, muss der Diagnostiker sich<br />
über die Rechte im Klaren sein und<br />
einen Weg finden, um die individuellen<br />
Bedürfnisse der Klientel zu erfassen und<br />
den Ablauf seines Vorgehens sorgfältig<br />
zu planen.<br />
Zur Anwendung gehört außerdem die<br />
Gestaltung einer geeigneten Diagnostik-<br />
Atmosphäre, zu der auch ein positiver<br />
Beziehungsaufbau sowie eine wertschätzende<br />
Beziehungsgestaltung<br />
beitragen. Mögliche Störquellen sollten<br />
beseitigt und eine ablenkungsfreie und<br />
angenehme Umgebung (z. B. Licht,<br />
Temperatur) geschaffen werden.<br />
Bedenken möglicher Folgen<br />
Jeder Diagnostiker sollte sich über die<br />
Funktion, die Bedeutung und den<br />
Nutzen der gewählten Verfahren für<br />
den Beurteilungs- und Entscheidungsprozess<br />
im Klaren sein. Es geht i. d. R.<br />
um die Indikation von Fördermaßnahmen<br />
und die Frage, welche Förderung<br />
genau passend ist und/oder wie der<br />
Interventionsprozess geplant wird.<br />
Die Frage, welche möglichen negativen
Konsequenzen die Anwendung des<br />
Verfahrens für den Diagnostizierten mit<br />
sich bringen könnte, sollte immer mit<br />
bedacht werden. Wenn es um Entscheidungen<br />
von großer Tragweite geht,<br />
sollte stets versucht werden, die<br />
Lebenswirklichkeit der zu diagnostizierenden<br />
Person zu rekonstruieren (z. B.<br />
mittels Exploration) (vgl. Borchard,<br />
007). Welche familiären, emotionalen,<br />
lebensstilrelevanten, beruflichen oder<br />
ökonomischen Folgelasten können<br />
durch eine Befunderhebung oder<br />
Diagnostik entstehen?<br />
Information, Einverständnis<br />
und Transparenz<br />
Der Mensch, der diagnostiziert wird,<br />
ist ausreichend über den Zweck der<br />
Diagnostik zu informieren und ggf.<br />
aufzuklären. Eine Mitwirkung an der<br />
Diagnostik darf nicht „erschlichen“<br />
werden. Es wird unterschiedlich<br />
diskutiert, was die Information von<br />
Kindern betrifft: zum einen wird der<br />
gesetzliche Vertreter als ausreichend<br />
empfunden, zum anderen wird Wert<br />
darauf gelegt, das Kind direkt einzubeziehen<br />
und dieses als „entscheidungsfähig“<br />
zu sehen (vgl. Borchard 007).<br />
Die zu diagnostizierende Person sollte<br />
die Entscheidung darüber haben, wer<br />
was von ihr weiß. Es besteht zudem<br />
das Recht auf Einsicht aller über die<br />
eigene Person gespeicherten Daten<br />
(vgl. Borchard 007).<br />
Jeder Mensch hat das Recht, seine<br />
Ergebnisse einzusehen. Die Praxis sieht<br />
unterschiedlich aus: je nach Institution<br />
werden die über den Menschen<br />
festgehaltenen Befunde und Berichte<br />
persönlich ausgehändigt oder Einblick<br />
gewährt.<br />
Die Ergebnisse sollten möglichst in<br />
konstruktiver, sprachlich angemessener<br />
und inhaltlich verständlicher Form<br />
erläutert werden. Das Wohl des<br />
Menschen ist zu berücksichtigen und<br />
spezifische Empfehlungen sind gemeinsam<br />
abzusprechen. Das bedeutet, dass<br />
der Mensch die Möglichkeit erhält, sich<br />
selbst einzubringen.<br />
Sicherung der Daten<br />
Alle relevanten Daten müssen gesichert<br />
aufbewahrt werden. Hierzu können die<br />
Institutionen bzw. Diagnostiker<br />
spezielle Richtlinien über Verfügbarkeit,<br />
Aufbewahrungsdauer und weitere<br />
Verwendung formulieren. Bei namentlicher<br />
Zuordnung dürfen die Daten<br />
ausschließlich mit vorheriger schriftlicher<br />
Einwilligung der diagnostizierten<br />
Person anderen Personen (z. B. Ärzte,<br />
Therapeuten, Kostenträger) zugänglich<br />
gemacht werden.<br />
Fazit und Ausblick<br />
Da, wie eingangs erwähnt, bestimmte<br />
ethische Werte von Menschen selbst<br />
aufgestellt werden und somit fehlbar<br />
sind, kann es ein Ziel sein, aus Fehlern<br />
zu lernen und dementsprechend<br />
aufgestellte Werte zu revidieren (vgl.<br />
Wuketits 006). Die eigenen jeweiligen<br />
Werte und Normen spiegeln Bedürfnisse<br />
und Abneigungen wieder und können<br />
als Resultate verschiedener Lebensbedingungen<br />
gesehen werden (vgl.<br />
Wuketits 006). Aufgrund dessen wird<br />
es immer Wertekonflikte geben.<br />
Dies zeugt von einer Bejahung der<br />
Vielfalt und der Konflikthaftigkeit der<br />
individuellen Werte (vgl. Reichenbach<br />
006).<br />
Die Förderung ethischer Kompetenz,<br />
d. h. einer Fähigkeit der verantwortungsvollen<br />
Auseinandersetzung mit ethischen<br />
Fragen in der psychomotorischen<br />
Diagnostik und eigenen Wertvorstellungen<br />
unter Einbezug der jeweiligen<br />
Menschen, die diagnostiziert werden,<br />
gilt als ein wesentliches Ziel.<br />
Das eingangs erwähnte Zitat von Kant<br />
kann auch so gedeutet werden, dass<br />
jeder Diagnostiker sich auf sich zurück<br />
besinnt, seine Qualifikation auf einem<br />
aktuellen Stand hält und seine Arbeit<br />
kontinuierlich reflektiert, um sein<br />
Handeln auch für andere annehmbar zu<br />
gestalten. Im Sinne von Selbstentfaltung<br />
und Persönlichkeitsbildung wäre<br />
es eine Möglichkeit, mit dem Klienten<br />
gemeinsam Situationen zu entwickeln<br />
oder zu überlegen (vgl. Brühlmann<br />
000), die diagnostischen Erkenntnissen<br />
dienen oder aber die zu diagnostizierende<br />
Person anhand einer Auswahl<br />
entscheiden zu lassen, welche Verfahren<br />
und welches Vorgehen sie bevorzugt<br />
und wählt. Ansatzpunkte für eine<br />
weitere Diskussion sind neben den<br />
bereits im Beitrag formulierten Fragen,<br />
zusammengefasst die folgenden Thesen.<br />
Eventuell regen sie an, die Qualifikation<br />
im Rahmen von Ausbildungen und auch<br />
die eigene diagnostische Praxis zu<br />
reflektieren und ggf. zu ändern.<br />
Thesen<br />
1) Die fachlich-psychomotorische<br />
sowie diagnostische Kompetenz<br />
und Qualifikation muss ethische<br />
Belange berücksichtigen!<br />
) Verschiedenen Paradigmen<br />
pädagogischer/therapeutischer<br />
und damit psychomotorischer<br />
Arbeit bedingen verschiedene<br />
ethische Vorstellungen diagnostischen<br />
Handelns!<br />
3) Die „Vernunft“ von diagnostischen<br />
Werten sollte stets<br />
reflektiert und ggf. hinterfragt<br />
werden!<br />
4) Epochale Veränderungen<br />
erfordern ein verändertes<br />
Werteverständnis, welches sich<br />
in diagnostischen Verfahren<br />
niederschlagen sollte!<br />
5) Institutionelle Strukturen dürfen<br />
nicht die Auswahl und den<br />
Umfang von diagnostischen<br />
Methoden und Verfahren<br />
bestimmen!<br />
6) Diagnostik-Richtlinien sind<br />
sinnvoll, um ethischen Aspekten<br />
gerecht zu werden!<br />
Literatur:<br />
Avenarius, H. (1990): Anwendung<br />
diagnostischer Testverfahren in<br />
der Schule. Ein Rechtsgutachten.<br />
Weinheim: Beltz.<br />
Bavastro, P. (Hrsg.) (1998): Ethik<br />
Charta. (www.fuente.de/<br />
bioethik/ethkch1 .htm)<br />
Borchard: www.uni-koeln.de/philfak/fs-psych/<br />
serv_pro/skripte/<br />
diag/spez_ethik_borchard.doc<br />
(30.11. 007)<br />
Brühlmann, T. ( 000): Selbstenfaltungsethik<br />
in der Psychotherapie.<br />
In: Schweizer Archiv für<br />
Neurologie und Psychiatrie, 151,<br />
5, 18– .<br />
Carrier, M. ( 006): Wissenschaftstheorie.<br />
Dresden: Junius.<br />
Eggert, D. (1997): Von den Stärken<br />
ausgehen … Dortmund: borgmann.<br />
Fischer, J./Gruden, S./Imhof, E./<br />
Strub, J.( 007): Grundkurs Ethik.<br />
7
Die Bedeutung ethischer Aspekte diagnostischen Handelns für den psychomotorischen Fachdiskurs<br />
Grundbegriffe philosophischer<br />
und theologischer Ethik.<br />
Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Gahl, K. (2001): Ethische Urteilsbildung<br />
im Krankenhausalltag.<br />
Vortrag am 19.09.2001.<br />
Gebauer, D. /Kreis, L./Moisel, J.<br />
(2002): Philosophische Ethik.<br />
Freising: Stark.<br />
Göbel, H./Panten, D. (2002):<br />
HamMotScreen für Vorschulkinder.<br />
In: Praxis der Psychomotorik<br />
27, 1, 14–21.<br />
Jessel, H. (<strong>2010</strong>): Im Sinne des<br />
Menschen – Ressourcenorientierung<br />
in der psychomotorischen<br />
Diagnostik. In diesem Heft.<br />
Kornmann, R. (2006): Testung<br />
sprachlicher Minderheiten.<br />
Testing Linguistic Minorities. In:<br />
F. Petermann/M. Eid (Hrsg.),<br />
Handbuch der psychologischen<br />
Diagnostik (S. 457–464).<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
BEWEGUNG & ERNÄHRUNG<br />
Moosbrugger, H. /Höfling, V. (2006):<br />
Testdurchführung und -auswer-<br />
tung. Test Administration and<br />
Interpretation. In: F. Petermann/<br />
M. Eid (Hrsg.), Handbuch der<br />
psychologischen Diagnostik<br />
(S. 449–456). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Passolt, M./Pinter-Theiss, V. (2003):<br />
„Ich hab eine Idee …“ Psychomotorische<br />
Praxis planen, gestalten,<br />
reflektieren. Dortmund: verlag<br />
modernes lernen.<br />
Reichenbach, Chr. /Lücking, Chr.<br />
(2007): Diagnostik im Schuleingangsbereich.<br />
DiSb. Dortmund:<br />
borgmann.<br />
Reichenbach, R. (2006): Erziehung<br />
zum Guten – 7 Thesen. Referat<br />
an der Tagung „Werte unterrichten.<br />
Zur politischen Entdeckung<br />
einer schulischen Aufgabe“,<br />
Katholische Akademie Berlin,<br />
04.03.2006.<br />
Württembergischer Landessportbund e.V. (Hrsg.)<br />
Der Teller ist rund –<br />
nach dem Essen ist vor dem Essen<br />
Schönrade, S./Pütz, G. (2000):<br />
Die Abenteuer der kleinen Hexe.<br />
Dortmund: borgmann.<br />
Schuck, K. (2000): Diagnostische<br />
Konzepte. In: J. Borchert (Hrsg.),<br />
Handbuch der Sonderpädagogischen<br />
Psychologie. (S. 233–249).<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Wuketits, F. M. (2006): Bioethik.<br />
Eine kritische Einführung.<br />
München: Beck.<br />
sowie<br />
• http://www.dgps.de/dgps/<br />
aufgaben/003.php<br />
• http://www.schulministerium.nrw.<br />
de/BP/Schulrecht/Gesetze/<br />
SchulG_Info/Schulgesetz.pdf<br />
• http://www.gesetze-im-internet.<br />
de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf<br />
• http://www.aerztekammer-bw.de/<br />
20/merkblaetter/schweigepflicht.<br />
pdf<br />
Tipps zu Bewegung & Ernährung für Sporteinsteiger und aktive Sportler<br />
In unserer technisierten Welt bleibt oft zu wenig Zeit für Bewegung und gesunde Ernährung.<br />
Es ist also nicht ungewöhnlich, dass sich das ein oder andere Pfund mehr auf die Hüften<br />
schleicht. Dieses Buch soll dem aktiven Sportler sowie dem Sporteinsteiger hilfreiche Tipps zu<br />
Bewegung und gesunder Ernährung geben. Hintergrundinformationen zur Ernährung und<br />
Bewegung sowie einfach umzusetzende Übungen helfen Ihnen dabei, sich im Alltag fit und<br />
gesund zu fühlen. Zusätzlich erhalten Sie noch über fünfzig leckere und gesunde Rezepte, die<br />
sich einfach zubereiten lassen.<br />
17 x 24 cm, 172 Seiten, ISBN 978-3-7780-8540-0, Bestell-Nr. 8540 � 16.90<br />
Inhaltsverzeichnis und Musterseiten unter www.sportfachbuch.de/8540<br />
Versandkosten � 2.–; ab einem Bestellwert von � 20.– liefern wir innerhalb von Deutschland versandkostenfrei.<br />
Steinwasenstraße 6–8 • 73614 Schorndorf • Telefon (0 71 81) 402-125 • Fax (0 71 81) 402-111<br />
Internet: www.hofmann-verlag.de • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.de
Katrin Walter, Maike Grotz, Kristina Holl, Ilka Seidel und Klaus Bös<br />
Sprungbrett<br />
Eine Pilotstudie zur multimodalen ambulanten Beeinflussung<br />
von Lebensstilfaktoren bei adipösen Kindern 1<br />
Weltweit gehen Experten derzeit von 1,3 Milliarden übergewichtigen oder adipösen<br />
Menschen aus. In Deutschland ist bereits die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung<br />
übergewichtig und jeder fünfte Bürger adipös. Auch immer mehr Kinder und<br />
Jugendliche sind von den bereits schon epidemiologischen Ausmaßen von Übergewicht<br />
und Adipositas betroffen. Laut KIGGSStudie (Kurth/Schaffrath Rosario<br />
2007) sind 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3–17 Jahren übergewichtig,<br />
davon sind 6% adipös. So multifaktoriell die Ursachen für die Entstehung von<br />
Übergewicht sind, so umfassend sind auch die Interventionsprogramme. Derzeit<br />
werden vorrangig integrative Interventionsansätze mit den Bausteinen Bewegung,<br />
Ernährung und Verhaltenstherapie für eine Gewichtsreduktion als sinnvoll und<br />
effektiv angesehen. Das FoSS am Karlsruher Institut für Technologie erarbeitete ein<br />
Konzept für die langfristige und effektive Therapie und Prävention von Übergewicht,<br />
und erweiterte die traditionellen Interventionsmaßnahmen um die Bausteine<br />
Hausaufgabenbetreuung, Elternschulung sowie computergestützte Dokumentation<br />
und Analyse. Dem so genannten Projekt „Sprungbrett“ liegt ein quasiexperimenteller<br />
Untersuchungsplan mit insgesamt bis zu 5 Messzeitpunkten über einen Zeitraum<br />
von 6 Monaten zugrunde. An der Studie nahmen zehn übergewichtige Kinder im<br />
Alter zwischen neun und zwölf Jahren teil. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass<br />
sich durch ein gezieltes strukturiertes Betreuungsprogramm am Nachmittag<br />
signifikante Verbesserungen in der motorischen Leistungsfähigkeit und dem BMI<br />
SDS erzielen lassen.<br />
Ausgangssituation<br />
Weltweit gehen Experten derzeit von<br />
1,3 Milliarden übergewichtigen oder<br />
adipösen Menschen aus. Auch immer<br />
mehr Kinder und Jugendliche sind von<br />
den bereits schon epidemiologischen<br />
Ausmaßen von Übergewicht und<br />
Adipositas betroffen (Wabitsch 2007).<br />
Legt man die BMI-Grenzwerte der WHO<br />
zugrunde, so ist in Deutschland die<br />
Hälfte der erwachsenen Bevölkerung<br />
übergewichtig und jeder fünfte Bürger<br />
adipös, bei Kindern und Jugendlichen<br />
sind 15% übergewichtig, davon 6%<br />
adipös (www.kiggs.de).<br />
Mögliche Ursachen für kindliches<br />
Übergewicht finden sich, neben der<br />
Zugehörigkeit zu einer niedrigen<br />
sozialen Schicht, der elterlichen<br />
1 Eine Studie aus dem Forschungszentrum für<br />
den Schulsport und den Sport von Kindern<br />
und Jugendlichen (FoSS) am Institut für Sport<br />
und Sportwissenschaft des Karlsruher Insitut<br />
für Technologie (KIT).<br />
Vorbelastung, ungünstigen Ernährungsgewohnheiten<br />
und einem hohen Maß<br />
an körperlicher Inaktivität, vor allem<br />
auch im Wandel der Lebenswelt und der<br />
Lebensstile von Kindern und Jugendlichen.<br />
Im Gegensatz zu einer Kindheit<br />
in den fünfziger oder sechziger Jahren<br />
lässt die derzeitige Verkehrssituation in<br />
den Städten ein Spielen auf der Straße<br />
nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt<br />
zu. Daraus resultiert, dass die Kindheit<br />
zu großen Teilen im Haus oder in der<br />
Wohnung stattfindet und der Medienkonsum<br />
entsprechend hoch ist. Zu<br />
dieser inaktiven Lebensweise kommt<br />
häufig noch ein energiereiches aber<br />
nährstoffarmes Ernährungsverhalten<br />
hinzu. Eine über einen langen Zeitraum<br />
bestehende positive Energiebilanz führt<br />
zu Übergewicht und damit in vielen<br />
Fällen zu Fett- und Zuckerstoffwechselstörungen,<br />
Erkrankungen des Herz-<br />
Kreislauf-Systems und des Bewegungsapparates.<br />
Die kindliche Adipositas<br />
kann asthmaähnliche Beschwerden bei<br />
körperlicher Anstrengung oder Atem-<br />
Katrin Walter<br />
Sportwissenschaftlerin (M.A.)<br />
Ehemalige Mitarbeiterin am FoSS. Seit<br />
2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
am House of Competence (HoC) in der<br />
Research Group hiper.campus des<br />
Karlsruher Institut für Technologie (KIT).<br />
Forschungsschwerpunkt: körperliche<br />
Aktivität, Gesundheit und kognitive<br />
Leistungsfähigkeit.<br />
Anschrift der Verfasserin:<br />
Fritz-Erler-Str. 1–3, 76131 Karlsruhe<br />
Mobil: 0177 405536<br />
E-Mail: katrin.walter@hoc.kit.edu<br />
Internet: http://www.hiper-campus.de<br />
http://www.sport.kit.edu<br />
Maike Grotz<br />
Geb. am 16.02.1 84 in Villingen-<br />
Schwenningen. 2003-2007 Studium<br />
an der Universität Karlsruhe: Sportwissenschaft<br />
mit Nebenfach Gesundheits-<br />
und Fitnessmanagement,<br />
Bachelor. 2007-200 Studium Sportwissenschaft,<br />
Master
10<br />
Sprungbrett<br />
Kristina Holl<br />
Bachelor of Arts in Sportwissenschaft<br />
und Fitness- und Gesundheitsmanagement<br />
(2007) sowie Master of Arts in<br />
Sportwissenschaft (2009) am Karlsruher<br />
Institut für Technologie (KIT) – zu<br />
diesem Zeitpunkt Universität Karlsruhe<br />
(TH). Seit 09.2009 sportliche Leitung im<br />
Wellness- und Fitnesspark Pfitzenmeier<br />
in Neustadt/W.<br />
Prof. Dr. Klaus Bös,<br />
geb. 1948 ist Universitätsprofessor<br />
für Sportwissenschaft und Leiter des<br />
Institutes für Sport und Sportwissenschaft<br />
am Karlsruher Institut für<br />
Technologie (KIT). Seit 2008 ist Prof.<br />
Dr. Bös auch Dekan der Fakultät für<br />
Geistes- und Sozialwissenschaften am<br />
KIT. Seine Forschungsarbeiten befassen<br />
sich mit dem Schulsport, mit Sport und<br />
Gesundheit sowie mit der Entwicklung<br />
und Evaluation von Diagnoseverfahren<br />
und Sportprogrammen.<br />
Für seine Dissertation zum Thema<br />
„Dimensionen der Motorik“ wurde Klaus<br />
Bös mit dem Carl Diem Preis des Deut-<br />
schen Sportbundes ausgezeichnet.<br />
Wichtigste Publikationen sind „Dimensionen<br />
der Motorik“ (<strong>Hofmann</strong> <strong>Verlag</strong><br />
1983), Handbuch sportmotorischer<br />
Tests (Hogrefe <strong>Verlag</strong> 1987, 20002),<br />
Handbuch „Walking“ (Meyer & Meyer<br />
<strong>Verlag</strong> 1994) sowie das Handbuch<br />
„Gesundheitssport (<strong>Hofmann</strong> <strong>Verlag</strong><br />
1998).<br />
aussetzer während des Schlafes zur<br />
Folge haben. Bei den Mädchen kommt<br />
es zu einer frühzeitigen, bei den Jungen<br />
zu einer verspäteten Pubertätsentwicklung.<br />
Doch neben den physiologischen<br />
Beschwerden leiden übergewichtige<br />
und adipöse Kinder und Jugendliche<br />
ganz besonders psychisch unter ihren<br />
zu vielen Pfunden. Bei den psychiatrischen<br />
– beziehungsweise psychologischen<br />
Erkrankungen – ist es generell<br />
ein Problem zwischen Ursachen und<br />
Folgen der Fettleibigkeit zu unterscheiden.<br />
Britz et al. (2000) konnte in einer<br />
deutschen Populationsstudie mit<br />
extrem adipösen Jugendlichen bei 43%<br />
Depressionen, bei 40% Angststörungen,<br />
bei 17% Essstörungen (Bulimie, binge<br />
eating disorder) und bei 15% Somatisierungsstörungen,<br />
deutlich häufiger als<br />
in einem normalgewichtigen Kontrollkollektiv<br />
nachweisen. In Verbindung mit<br />
Essstörungen ist es auch wichtig darauf<br />
hinzuweisen, dass gerade bei Jugendlichen,<br />
verstärkt bei Mädchen, neben<br />
dem Übergewicht auch das Unterge-<br />
Dr. Ilka Seidel<br />
Sportwissenschaftlerin<br />
Ehemalige Geschäftsführerin des FoSS.<br />
Seit 2009 Nachwuchsgruppenleiterin<br />
am FoSS und Verantwortliche für den<br />
Bereich „Bewegung und Lernen“ am<br />
House of Competence (HoC) des<br />
Karlsruher Institut für Technologie (KIT).<br />
Forschungsschwerpunkte: Diagnose und<br />
Verbesserung motorischer Leistungsfähigkeit<br />
und körperlich-sportlicher<br />
Aktivität; Gesundheitsförderung;<br />
kognitive Leistungsfähigkeit; trainingswissenschaftliche<br />
Talentforschung.<br />
Anschrift der Verfasserin:<br />
Engler-Bunte-Ring 15, Geb. 40.40<br />
76131 Karlsruhe, Germany<br />
E-Mail: seidel@foss-karlsruhe.de<br />
Internet: http://www.foss-karlsruhe.de<br />
wicht („Magersucht“; Anorexia nervosa)<br />
ein Problem darstellt.<br />
In einer weiteren Studie im Rahmen der<br />
WHO-Jugendgesundheitsstudie „Health<br />
behaviour in School-aged Children<br />
(HBSC)” wurden in Deutschland mit<br />
Hilfe eines international standardisierten<br />
Fragebogens Daten zum Gesundheitszustand,<br />
zur Lebenszufriedenheit<br />
und Lebensqualität, zum psychischen<br />
Wohlbefinden, zur körperlichen<br />
Aktivität, zum Freizeitverhalten, zum<br />
Ernährungs- und Essverhalten von<br />
Jugendlichen im Alter von 11, 13 und<br />
15 Jahren erhoben (Ravens-Sieberer<br />
2005, 241). Hier zeigte sich ebenfalls<br />
auffällig, dass übergewichtige und<br />
adipöse Kinder und Jugendliche im<br />
Vergleich zu normalgewichtigen über<br />
Einschränkungen der Lebensqualität in<br />
allen Lebensbereichen berichten (siehe<br />
Abbildung 1).<br />
Das Projekt „Sprungbrett“<br />
Das Forschungszentrum für den<br />
Schulsport und den Sport von Kindern<br />
und Jugendlichen (FoSS) erarbeitete ein<br />
Konzept für die langfristige und<br />
effektive Therapie und Prävention von<br />
Übergewicht. Im Rahmen des Projekts<br />
„Sprungbrett“ wurden vom 24. <strong>April</strong> bis<br />
31. Juli 2006 die Auswirkungen einer<br />
strukturierten Nachmittagsbetreuung<br />
(4x pro Woche) auf den Fitnesszustand,<br />
die gesundheitsbezogene Lebensqualität<br />
und das Ernährungsverhalten<br />
übergewichtiger Kinder im Alter von<br />
9–12 Jahren untersucht. Die Intervention<br />
wollte an den alltäglichen kritischen<br />
Lebenssituationen ansetzen, die<br />
zu einem inaktiven, nicht kontrollierten<br />
Verhalten führen. Die schulfreien<br />
Nachmittage stellen häufig solche<br />
kritischen Situationen dar. Viele Kinder<br />
sind mittags oft alleine zu Hause und<br />
verbringen die freie Zeit beispielsweise<br />
mit Cola und Chips vor dem Fernseher,<br />
dem Computer oder der Playstation,<br />
Hausaufgaben werden gar nicht, oder<br />
nur unzufriedenstellend und nebenbei<br />
erledigt. Deshalb integrierte das FoSS-<br />
Projekt „Sprungbrett“ – im Gegensatz<br />
zu anderen ambulanten Interventionsprogrammen<br />
für übergewichtige<br />
Kinder – den Baustein Hausaufgabenbetreuung<br />
in sein Konzept. Eine weitere<br />
Besonderheit des FoSS-Projekts war<br />
die detaillierte Dokumentation und
Abb. 1: Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 2<br />
Verlaufsdarstellung aller für die Durch-<br />
führung und Ergebnisanalyse relevanten<br />
Daten in der internetbasierten Gesundheitsakte<br />
LifeSensor 3 . „Sprungbrett“ ist<br />
auch sicherlich deshalb eine Ausnahme<br />
unter den geläufigen Adipositasprojekten,<br />
da die Intervention über<br />
einen Zeitraum von drei Monaten vier-<br />
mal die Woche jeweils von 14.30 Uhr<br />
bis 17.30 Uhr stattgefunden hat.<br />
Ergänzt wurden die insgesamt 43<br />
Nachmittagseinheiten von Sonderveranstaltungen<br />
(SV) wie Schwimmbadbesuche,<br />
gemeinsames Einkaufen und<br />
Kochen, sowie drei Elternabenden,<br />
die von Mitarbeitern des Gesundheitsamts<br />
Karlsruhe angeleitet wurden.<br />
Die Pyramide in Abbildung 2 bietet<br />
eine Übersicht über die einzelnen<br />
Programmbausteine des Projekts.<br />
Bewegungsprogramm<br />
Das „Sprungbrett“-Bewegungsprogramm<br />
besteht insgesamt aus<br />
43 Einheiten und lässt sich in zwei<br />
Blöcke unterteilen. Block I, das<br />
„Sprungbrett“ Bewegungs-ABC<br />
umfasst das Kennenlernen der<br />
Teilnehmer, die Einführung in die<br />
Ballsportarten sowie das Erfahren<br />
von Spaß an Bewegung.<br />
2 Entnommen aus Ravens-Sieberer (2005, 241).<br />
WHO-Jugendgesundheitsstudie, ANOVA,<br />
p ≤ 0,01, n = 8123.<br />
3 LifeSensor ist eine elektronische Gesundheitsakte<br />
und Marke der ICW AG vgl.<br />
www.lifesensor.de<br />
Block II, das Bewegungsprogramm-<br />
27 basiert auf dem bereits evaluierten<br />
Programm „Appetit auf Bewegung“<br />
(Bös/Schmidt-Redemann/<br />
Bappert, 2007) welches auf die<br />
„Sprungbrett“-Teilnehmer angepasst<br />
und entsprechend verändert wurde.<br />
Block II knüpft an Block I an und<br />
setzt den Schwerpunkt auf die Ver-<br />
besserung der motorischen Fähigkeiten<br />
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit,<br />
Schnelligkeit, Koordination<br />
sowie zusätzliche Themen wie<br />
Wahrnehmung, Haltungsförderung,<br />
Umgang mit dem Ball, Bewegungslandschaften<br />
und soziale Kompetenz.<br />
Hausaufgabenbetreuung<br />
Die Hausaufgabenbetreuung wurde<br />
als fester Programmbaustein in das<br />
Projekt eingebunden, damit die<br />
Kinder ohne die Ablenkung des<br />
Fernsehers, des Computers und ohne<br />
„Snacking“ lernen, in konzentrierter<br />
Atmosphäre, ihren schulischen Ver-<br />
pflichtungen nachzukommen.<br />
Dabei wurden sie von studentischen<br />
Hilfskräften unterstützt. Ein Student<br />
betreute immer zwei bis drei Kinder<br />
bei den Hausaufgaben.<br />
Ernährungsschulung<br />
In insgesamt 18 Einheiten, die auf<br />
dem Ratgeber der Deutschen<br />
Schulsportstiftung „Fit und gesund<br />
durch Bewegung und richtige<br />
Ernährung“ (Bappert/Osterkamp-<br />
Baerens 2004) basieren, wurden<br />
während des Treatments folgende<br />
inhaltlichen Schwerpunkte behan-<br />
delt: (1) Reflektion des eigenen<br />
Ernährungsstils, (2) Verständigkeit<br />
für eine ausgewogene Energiebilanz,<br />
(3) Führung eines gesunden<br />
Lifestyles, (4) gesunde Pausensnacks/<br />
Pausengestaltung und (5) richtiges<br />
Trinkverhalten.<br />
LifeSensor-Dokumentation<br />
Jegliche, während des Treatments<br />
erhobenen Daten und Testergebnisse,<br />
sowie absolvierte Trainingspläne<br />
wurden für jeden Teilnehmer<br />
in der LifeSensor-Gesundheitsakte<br />
dokumentiert und grafisch dargestellt.<br />
Elternschulung<br />
Um feste Ernährungs- und Bewegungsregeln<br />
bei Kindern zu etablieren,<br />
sollten die Eltern dazu angeregt<br />
werden ein vorbildliches Verhalten<br />
vorzuleben.<br />
Dafür bedarf es der Elternschulung.<br />
Im Rahmen des Projekts „Sprungbrett“<br />
fanden drei Elternabende<br />
statt, die vom Gesundheitsamt<br />
Karlsruhe moderiert wurden.<br />
Unterstützend zur Arbeit mit den<br />
Eltern wurden die Arbeitsblätter von<br />
Eberding et al. (2004) verwendet.<br />
Sonderveranstaltungen (SV)<br />
Im Rahmen des Projekts wurden<br />
drei Sonderveranstaltungen<br />
(gemeinsames Kochen, Freibadbesuch,<br />
Grillfest) realisiert, die die<br />
Motivation der Teilnehmer steigern<br />
sollten.<br />
Untersuchungsplanung<br />
Hypothesen<br />
Es wird angenommen, dass eine<br />
strukturierte Nachmittagsbetreuung die<br />
motorische Leistungsfähigkeit, physiologische<br />
Parameter und die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität übergewichtiger<br />
Kinder beeinflusst. Im<br />
Mittelpunkt des Projekts „Sprungbrett“<br />
steht die Verbesserung der motorischen<br />
Leistungsfähigkeit übergewichtiger<br />
Kinder und Jugendlicher, um eine<br />
Gewichtsreduktion und eine Steigerung<br />
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität<br />
zu erreichen.<br />
Daraus ergeben sich folgende drei<br />
Arbeitshypothesen: Übergewichtige und<br />
adipöse Kinder und Jugendliche, die<br />
11
12<br />
Sprungbrett<br />
Programmbausteine<br />
eine Intervention mit dem Projekt<br />
„Sprungbrett“ erfahren haben, zeigen<br />
nach dem Projekt im Vergleich zu<br />
Beginn der Intervention Verbesserungen<br />
in den Konstrukten<br />
SV<br />
Eltern<br />
LifeSensor-<br />
Dokumentation<br />
Ernährungsschulung<br />
Hausaufgabenbetreuung<br />
Bewegungsprogramm<br />
r Abb. 2: Die „Sprungbrett“-Programmbausteine<br />
• motorische Leistungsfähigkeit,<br />
• anthropometrische Daten und<br />
• gesundheitsbezogene Lebensqualität.<br />
Untersuchungsteilnehmer<br />
Die teilnehmenden Kinder wurden über<br />
Karlsruher Kinderärzte rekrutiert. An der<br />
Untersuchung nahmen insgesamt 10<br />
Kinder (w = 6; m = 4) im Alter von 9 bis<br />
12 Jahren (M = 10.2; SD = 0.9) mit<br />
einem durchschnittlichen BMI von<br />
25.16 (SD = 3.04) teil. Der durchschnittliche<br />
Perzentilwert lag in der Gesamtstichprobe<br />
bei 96.7 (SD = 2.0), der<br />
BMISDS bei 2.0 (SD = 0.4). Es war<br />
geplant eine WarteKontrollgruppe<br />
einzurichten. Die Rekrutierung der<br />
Stichprobe gestaltete sich aber trotz<br />
vielfältiger Werbemaßnahmen als so<br />
schwierig, dass mangels Teilnehmer<br />
darauf verzichtet werden musste.<br />
Untersuchungsplan<br />
Der Feldstudie liegt ein quasiexperimenteller<br />
Untersuchungsplan mit einer<br />
Untersuchungsgruppe (Experimentalgruppe)<br />
und zwei Messzeitpunkten<br />
t1 und t3 (Prä und Postmessung)<br />
zugrunde. Die Experimentalgruppe<br />
4 Bappert/OsterkampBaerens (2004).<br />
nahm an einem dreimonatigen Interventionsprogramm<br />
teil. Zudem erfolgte<br />
nach Hälfte der Intervention eine<br />
Interimsmessung (t2) und zur Überprüfung<br />
der Nachhaltigkeit erfolgte<br />
10 Wochen (t4) und 5 Monate (t5) nach<br />
Beendigung des Projekts eine schriftliche<br />
bzw. telefonische Befragung zur<br />
Nachhaltigkeit. Im Folgenden werden<br />
die Testzeitpunkte t1 (Prä) und t3 (Post)<br />
betrachtet.<br />
Das Treatment umfasste insgesamt<br />
sechs Programmbausteine (s. o., Abbil<br />
dung 2). Die wesentlichen Interventionsmaßnahmen<br />
bestehen in den<br />
Bausteinen Bewegungsprogramm,<br />
Hausaufgabenbetreuung und Ernährungsschulung.<br />
Merkmalsbereiche<br />
Die Auswahl der Merkmalsbereiche<br />
und Messinstrumente orientiert sich<br />
an den Bereichen, in denen Wirkungen<br />
des Treatments erwartet wurden:<br />
(1) motorische Leistungsfähigkeit,<br />
(2) anthropometrische Daten,<br />
(3) gesundheitsbezogene Lebensqualität.<br />
Motorische Leistungsfähigkeit<br />
Zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit<br />
wurde eine Testbatterie<br />
bestehend aus 10 Items eingesetzt.<br />
Anhand der Systematisierung motorischer<br />
Fähigkeiten nach Bös et al.<br />
(2006, 32) lassen sich auf einer ersten<br />
Ebene konditionelle und koordinative<br />
Fähigkeiten unterscheiden, und auf<br />
einer zweiten Ebene Ausdauer, Kraft,<br />
SV = Sonderveranstaltungen (3mal à 5 h)<br />
Eltern = Elternschulung (3 Einheiten à 90 min)<br />
LifeSensor-Dokumentation = regelmäßige<br />
Dokumentation des Ernährungs und Bewegungsverhaltens<br />
in der elektronischen Gesundheitsakte<br />
LifeSensor<br />
Ernährungsschulung = „Fit und gesund<br />
durch Bewegung und richtige Ernährung“ 4<br />
(18 Einh. à 45 min)<br />
Hausaufgabenbetreuung = (43 Einh. à 60–90 min)<br />
Bewegungsprogramm = „Sprungbrett BEWABC“ und<br />
„Sprungbrett BEW27“ (43 Einh. à 60120 min)<br />
Schnelligkeit, Koordination und<br />
Beweglichkeit. Die Auswahl der<br />
Testitems orientierte sich dabei an<br />
dieser Differenzierung motorischer<br />
Fähigkeiten nach Bös mit dem Ziel,<br />
möglichst viele der oben beschriebenen<br />
Dimensionen zu erfassen. In Anlehnung<br />
an die Erhebung der motorischen<br />
Leistungsfähigkeit von luxemburgischen<br />
Kindern und Jugendlichen (vgl. Bös et<br />
al. 2006, 33) wurden die Testaufgaben<br />
6MinutenLauf, Liegestütz, Standweitsprung,<br />
20MeterSprint dem<br />
konditionellen Bereich, die Testaufgabe<br />
Balancieren rückwärts der Ganzkörperkoordination,<br />
MLS Linien nachfahren<br />
und MLS Stifte einstecken der Feinkoordination<br />
und Rumpfbeugen der<br />
Beweglichkeit zugeordnet (vgl. Tab. 1),<br />
und die Testaufgaben Balancieren<br />
rückwärts und MLS Linien nachfahren<br />
und MLS Stifte einstecken dem<br />
koordinativen Bereich zugeordnet.<br />
Auf einer zweiten Ebene erfolgte eine<br />
präzisere Zuordnung in die Motorikbereiche<br />
Kondition, Ganzkörperkoordination,<br />
Feinkoordination und Beweglichkeit<br />
(vgl. Tabelle 1).<br />
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, umfasst<br />
der Bereich Kondition die Ausdauerleistungsfähigkeit<br />
ebenso wie die Kraft und<br />
die Schnelligkeit.<br />
Die Ausdauerleistungsfähigkeit (aerobe<br />
Ausdauer) wurde anhand des 6-Minuten-<br />
Laufs überprüft, bei dem in der vorgegebenen<br />
Zeit (6 Minuten) eine möglichst<br />
große Strecke zurückgelegt<br />
werden soll. Die Testaufgabe Liegestütz<br />
prüft in erster Linie die dynamische
Tab. 1: Die „Sprungbrett“-Testbatterie 5<br />
Bezeichnung der Testbereiche<br />
und Testaufgabe<br />
Kondition (KON)<br />
Ausdauer<br />
Kraftausdauer im Brust- und Schulterbereich,<br />
sowie in den oberen Extremitäten<br />
und die der stabilisierenden<br />
Rumpfmuskulatur. Während der<br />
Testdauer von 40 Sekunden soll der<br />
Proband so viele kindgerecht modifizierte<br />
Liegestütze wie möglich machen.<br />
Die Messung der Schnellkraft, insbesondere<br />
der Sprungkraft erfolgt über<br />
die Testaufgabe Standweitsprung. Die<br />
Testaufgabe 20MeterSprint überprüft<br />
in erster Linie die Aktionsschnelligkeit,<br />
aber auch die Schnellkraft der unteren<br />
Extremitäten.<br />
Die Ganzkörperkoordination wurde<br />
anhand der Testaufgabe Balancieren<br />
rückwärts überprüft. Hier wird das<br />
Testinhalt<br />
(Motorische Fähigkeiten)<br />
Primäre<br />
Beanspruchung<br />
6-Minuten-Lauf<br />
Kraft<br />
Aerobe Ausdauer Untere Extremitäten,<br />
Herz-Kreislauf-System<br />
Liegestütz Dynamische<br />
Kraftausdauer<br />
Obere Extremitäten,<br />
stabilisierende<br />
Rumpfmuskulatur<br />
Standweitsprung<br />
Schnelligkeit<br />
Schnellkraft Untere Extremitäten<br />
20-Meter-Sprint Zyklische<br />
Aktionsschnelligkeit<br />
Untere Extremitäten<br />
Ganzkörperkoordination (GKKO)<br />
Balancieren rückwärts<br />
Feinkoordination (FKO)<br />
Exterozeptiv-geführt/<br />
dynamisch<br />
(sensorische Regulation<br />
bei Präzisionsaufgaben)<br />
Ganzkörper<br />
Linien nachfahren (MLS) Exterozeptiv-geführt<br />
(sensorische Regulation<br />
bei Präzisionsaufgaben)<br />
Auge-Hand-Koordination<br />
Stifte einstecken (MLS)<br />
Beweglichkeit (BEW)<br />
Exterozeptiv-geführt<br />
(Koordination unter<br />
Zeitdruck)<br />
Auge-Hand-Koordination<br />
Stand and Reach Dehnfähigkeit (aktiv) Rückwärtige Muskulatur,<br />
untere Extremitäten, lange<br />
Rückenstrecker<br />
5 Entnommen und modifiziert aus Bös et al.<br />
(2006, 33).<br />
dynamische Ganzkörpergleichgewicht<br />
erfasst, in dem die Probanden die<br />
Aufgabe haben, auf drei unterschiedlich<br />
breiten Balken (6 cm, 4,5 cm, 3 cm) so<br />
viele Schritte wie möglich zu erzielen<br />
(maximal 8).<br />
Die Feinkoordination der Probanden<br />
wurde mit den Testaufgaben aus der<br />
Tab. 2: Messinstrumentarium<br />
motorischen Leistungsserie nach Schoppe<br />
(MLS) erfasst. Die Testaufgabe MLS Linien<br />
nachfahren überprüft die Auge-Hand-<br />
Koordination bei Präzisionsaufgaben.<br />
Beim Liniennachfahren besteht die<br />
Aufgabe darin, mit einem Griffel einer<br />
ausgefrästen Linie in der MLS-Platte zu<br />
folgen ohne die Seiten oder den Boden<br />
der Platte zu berühren. Je höher die<br />
freifahrende Zeit pro Fehler, desto besser<br />
ist die Testleistung.<br />
Die Testaufgabe MLS Stifte einstecken<br />
misst die Auge-Hand-Koordination<br />
unter Zeitdruck. Hierbei gilt es, innerhalb<br />
möglichst kurzer Zeit 25 Metallstifte<br />
aus einem Stifthalter in die<br />
Lochungen der MLS-Platte umzustecken.<br />
Die Beweglichkeit wurde mit der<br />
Testaufgabe Stand and Reach getestet.<br />
Hier wird die Rumpfbeweglichkeit und<br />
statische Dehnfähigkeit der rückwärtigen<br />
Muskulatur (v. a. der unteren<br />
Extremitäten) ermittelt, indem die<br />
Probanden auf einem Kasten stehen<br />
und die Aufgabe haben, bei gestreckten<br />
Beinen den Oberkörper nach vorne zu<br />
beugen.<br />
Anthropometrische Daten<br />
Für die Feststellung von Übergewicht<br />
im Kindes- und Jugendalter stellt der<br />
Body-Mass-Index (BMI) ein geeignetes<br />
Screening-Instrument dar. Der aus dem<br />
BMI der Probanden ermittelte BMI-SDS<br />
ermöglicht eine präzise Ergebnisdarstellung.<br />
Tabelle 2 liefert einen Überblick<br />
über die Messverfahren.<br />
Gesundheitsbezogene Lebensqualität<br />
Zur Untersuchung der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität wurde der<br />
Fragebogen Kidscreen-52 (Bisegger et<br />
al. 2005) eingesetzt. Der Fragebogen<br />
hat 52 Items in den folgenden 10 Skalen:<br />
• Körperliches Wohlbefinden (PHY)<br />
• Psychisches Wohlbefinden (PWB)<br />
• Stimmungen & Emotionen (EMO)<br />
Aufgenommene Daten Messverfahren<br />
Körpergröße in Metern ärztlich geprüfte Messlatte, Marke Actonel<br />
Körpergewicht in Kilogramm Tanita-Waage; Modell TBF-612,<br />
Max. 136 kg, d = 0,2 kg<br />
BMI Quotient aus dem Körpergewicht in kg und dem<br />
Quadrat der Körpergröße in m<br />
BMI-SDS Berechnung nach Kromeyer-Hauschild et al.<br />
(2001)<br />
13
14<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Sprungbrett<br />
Selbstwahrnehmung (SEL)<br />
Autonomie (AUT)<br />
Beziehungen zu Eltern und<br />
Zuhause (PAR)<br />
Beziehungen zu Gleichaltrigen und<br />
soziale Unterstützung (SOC)<br />
Schulisches Umfeld (SCH)<br />
Soziale Akzeptanz (Bullying) (BUL)<br />
Finanzielle Möglichkeiten (FIN)<br />
Der Fragebogen wurde für Kinder<br />
zwischen acht und achtzehn Jahren<br />
konzipiert und dauert zum Bearbeiten<br />
zwischen 15 und 20 Minuten. Der<br />
Fragebogen wurde vor und nach der<br />
Intervention sowohl bei den Kindern,<br />
als auch bei den Eltern eingesetzt. Zur<br />
Skalenberechnung wurden zunächst<br />
die jeweiligen Items aufsummiert und<br />
anschließend weiter in T-Werte<br />
transformiert. In der vorliegenden<br />
Studie wurden alle Werte, die unter<br />
einem Wert von 45 liegen, als kritisch<br />
betrachtet.<br />
Ergebnisse<br />
Ergebnisse zur motorischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Zur Ergebnisbeurteilung wurden die<br />
Rohwerte in Z-Werte transformiert und<br />
Bereichsindizes für Kondition, Ganzkörper-<br />
und Feinkoordination sowie<br />
Beweglichkeit gebildet. Weiter wird<br />
zwischen Jungen und Mädchen unter-<br />
schieden. Die erste Arbeitshypothese<br />
prüft, ob die Sprungbrett-Intervention<br />
zu einer signifikanten Verbesserung der<br />
motorischen Leistungsfähigkeit geführt<br />
hat.<br />
Die Graphiken zeigen den Vergleich der<br />
Sprungbrettkinder mit den Normwerten<br />
der MoMo-Stichprobe (vgl. Bös 2003),<br />
die Veränderung von t1 nach t3 sowie<br />
die differenziellen Unterschiede von Ge-<br />
schlecht und Motorikbereichen.<br />
Die Veränderung der Leistungsfähigkeit<br />
innerhalb des Interventionszeitraumes<br />
von 3 Monaten zeigt ein differenziertes<br />
Bild. In den Bereichen Koordination<br />
und Beweglichkeit zeigen sich keine<br />
Leistungsverbesserungen von t1 nach<br />
t3. Bei den Jungen zeigt sich in der<br />
Gesamtkörperkoordination, bei den<br />
Mädchen in der Beweglichkeit sogar<br />
eine leichte Leistungsverschlechterung.<br />
Es ist durch das Spiel- und Fitnessorientierte<br />
Programm offensichtlich<br />
nicht gelungen, alle Bereiche der<br />
Motorik zu trainieren. Imposante<br />
120<br />
110<br />
100<br />
[Z-Werte]<br />
90<br />
80<br />
70<br />
100,3<br />
99,2<br />
Fortschritte zeigen sich aber im<br />
konditionellen Bereich. In den Testaufgaben<br />
Ausdauerlauf, 20-m-Sprint,<br />
Liegestütz und Standweitsprung<br />
konnten sowohl statistisch signifikante<br />
als auch in der numerischen Höhe<br />
bedeutsame Leistungsverbesserungen<br />
erreicht werden.<br />
Bei den Jungen verbessert sich der<br />
konditionelle Bereich von Z = 0,5 auf<br />
Z = 7,2 (+ 6%) (t = 6,3; p = 0.008),<br />
bei den Mädchen geht die Verbesserung<br />
sogar von Z = 5, auf Z = 104,6 (+ %)<br />
(t = 6,0; p = 0.002). Legt man die<br />
Durchschnittsnorm (Z = 100) an, so<br />
zeigt es sich, dass übergewichtige<br />
Kinder bei guter Förderung durchaus<br />
motorisch leistungsfähig sein können.<br />
In der Feinkoordination (Handgeschicklichkeit)<br />
und in der Beweglichkeit<br />
(Rumpfbeugen) liegen die Leistungen<br />
Veränderung der Bereichsindizes<br />
bei den Jungen von t1 zu t3<br />
89,9<br />
86,0<br />
100,5<br />
99,7<br />
90,5<br />
FKO GKKO BEW KON<br />
t1 t3<br />
r Abb. 3: Motorische Leistungsfähigkeit der Jungen in 4 Bereichen zu t1 und t3<br />
120<br />
110<br />
100<br />
[Z-Werte]<br />
90<br />
80<br />
70<br />
95,2<br />
98,8<br />
Veränderung der Bereichsindizes<br />
bei den Mädchen von t1 zu t3<br />
102,1<br />
103,3<br />
108,7<br />
107,2<br />
95,9<br />
FKO GKKO BEW KON<br />
97,2<br />
t1 t3<br />
104,6<br />
r Abb. 4: Motorische Leistungsfähigkeit der Mädchen in 4 Bereichen zu t1 und t3<br />
der Sprungbrett-Stichprobe im Normbereich.<br />
In der Gesamtkörperkoordination<br />
und bei der Kondition liegen sie<br />
deutlich unter den Durchschnittwerten<br />
aus der MoMo-Stichprobe. Es ist aller-<br />
dings beeindruckend, dass im konditionellen<br />
Bereich dieser Rückstand von<br />
den Mädchen ganz und von den Jungen<br />
fast aufgeholt werden konnte. Für die<br />
Verbesserung der konditionellen Leis-<br />
tungsfähigkeit kann die Arbeitshypo-<br />
these 1 uneingeschränkt angenommen<br />
werden. Koordination und Beweglichkeit<br />
wurden jedoch durch die Sprungbrett-Intervention<br />
nicht verbessert.<br />
Ergebnisse zur Konstitution<br />
Zur Beurteilung der konstitutionellen<br />
Veränderungen wurden Größe und<br />
Gewicht sowie die abgeleiteten Indizes
BMI und BMI-SDS herangezogen.<br />
Ebenfalls wurde der BMI-Prozentrang<br />
betrachtet. Der hohe Anspruch des<br />
Programms (Arbeitshypothese 2) lautet,<br />
dass sich die Konstitution positiv<br />
verändert.<br />
Die Ergebnistabelle zeigt, dass die -<br />
bis 12-jährigen Kinder im Interventionszeitraum<br />
von 3 Monaten um<br />
2,1 cm (1,4%) wachsen und 0, kg<br />
(1,6%) schwerer werden. Der BMI sinkt<br />
im Beobachtungszeitraum geringfügig<br />
von 25,1 auf 24, um 0.2 Punkte<br />
(1%). Auch die relative BMI-Position<br />
verbessert sich geringfügig von<br />
Prozentrang 6,7 auf 6,5, ebenso wie<br />
der BMI-SDS von 2,02 auf 1, 4 (–4%).<br />
Von diesen beobachteten Veränderungen<br />
ist nur der Zuwachs der<br />
Körpergröße sowie die Abnahme des<br />
BMI-SDS signifikant. Es zeigen sich<br />
keine Unterschiede zwischen Jungen<br />
und Mädchen. Die Arbeitshypothese<br />
einer positiven Konstitutionsveränderung<br />
kann nur mit Einschränkungen<br />
angenommen werden.<br />
Was bedeutet dieses Ergebnis in der<br />
Praxis? Die Sprungbrett-Kinder sind zu<br />
Projektbeginn extrem übergewichtig,<br />
die Jungen (BMI Prozentrang 8,3)<br />
sogar noch etwas mehr als die Mädchen<br />
(BMI Prozentrang 8). Legt man den<br />
Arbeitsgrenzwert von BMI-Prozentrang<br />
7 zugrunde, so überschreiten zu<br />
Tab. 3: statistische Werte Anthropometrie t1 ; t3<br />
Variablen<br />
Größe [cm]<br />
Gewicht [kg]<br />
BMI [kg/m²]<br />
Perzentilwert<br />
BMI-SDS<br />
Projektbeginn alle 4 Jungen und 2 der<br />
6 Mädchen diesen Grenzwert. Üblicherweise<br />
nehmen diese Kinder im weiteren<br />
Lebensverlauf nicht nur absolut<br />
(Gewichtszunahme durch Wachstum),<br />
sondern auch relativ (BMI-SDS Zunahme<br />
durch Zunahme des Übergewichts)<br />
immer weiter zu. Diese Adipositaskarriere<br />
zu stoppen ist im Sprungbrett-<br />
Projekt gelungen und ist zunächst<br />
einmal ein bemerkenswerter Erfolg.<br />
Ergebnisse zur gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität<br />
Die dritte Arbeitshypothese prüft, ob die<br />
„Sprungbrett“-Intervention zu einer<br />
Verbesserung der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität (health related quality of<br />
life HRQOL) geführt hat. Derzeit werden<br />
noch die kritischen Werte für Auffälligkeiten<br />
in der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität HRQOL diskutiert. Unter<br />
30 spricht man von einem zweifellos<br />
auffälligen Wert. Erste Hinweise aus<br />
klinischen Stichproben deuten darauf<br />
hin, dass schon Gruppenmittelwerte von<br />
45 und tiefer, in jedem Fall unter 40 als<br />
auffällig betrachtet werden sollten (vgl.<br />
Bisegger et al. 2005). Im Folgenden<br />
wurden T-Werte unter 45 als kritisch<br />
betrachtet.<br />
Wie der Tabelle 4 zu entnehmen ist,<br />
liegen für die Dimension „Stimmungen<br />
T1<br />
MW (SD)<br />
und Emotionen“ (EMO) die Werte für t1<br />
im kritischen Bereich. Die Mädchen<br />
leiden zudem unter einem negativen<br />
Körpergefühl, sie fühlen sich mit ihrem<br />
eigenen Äußeren unwohl, sind unzufrieden<br />
mit sich selbst und haben ein<br />
niedriges Selbstwertgefühl, „Selbstwahrnehmung“<br />
(SEL). Des Weiteren<br />
fühlen sie sich von Gleichaltrigen<br />
gequält und schikaniert und zurückgewiesen<br />
„Bullying“ (BUL) (soziale<br />
Akzeptanz). Die Jungen dagegen finden<br />
ihre finanzielle Situation nicht zufrieden<br />
stellend „Finanzielle Möglichkeiten“<br />
(FIN), und leiden unter der Beziehung<br />
zu Gleichaltrigen und mangelnder<br />
sozialer Unterstützung „Beziehung zu<br />
Gleichaltrigen“ (SOC).<br />
Betrachtet man die Veränderungen zu<br />
t3, so konnten die Werte der Dimension<br />
„Stimmungen und Emotionen“ sich um<br />
13,7% aus dem kritischen Bereich<br />
heraus verbessern. Aus der Tabelle 4<br />
geht hervor, dass sich besonders die<br />
Mädchen vom Zeitpunkt t1 zum<br />
Zeitpunkt t3 um 17,8% steigern<br />
konnten (T = –1.43 ; df = 5; p = .210).<br />
Sie kamen somit aus dem kritischen<br />
Bereich (T-Wert ≤ 45) und konnten sich<br />
auf einen T-Wert von 51 steigern.<br />
Das bedeutet, dass sie sich nun besser<br />
und auch besserer Laune fühlen als<br />
zu Beginn des Projekts. Die Jungen<br />
steigerten ihre Werte im Bereich<br />
T3<br />
MW (SD) Differenz (%) T P<br />
Jungen n = 4 152,8 (7,3) 155,3 (7,3) + 2,5 (1,6%) - 8,660 .003<br />
Mädchen n = 6 146,3 (3,9) 148,2 (3,3) + 1, (1,3%) - 4,568 .006<br />
Gesamt N = 10 148, (8) 151 (6,3) + 2,1 (1,4%) - 7,584 .000<br />
Jungen n = 4 62,7 (8) 64 (5,6) + 1,3 (2,2%) - 1,824 .166<br />
Mädchen n = 6 51,5 (5,6) 52,1 (5,4) + 0,6 (1,2%) - 1,207 .281<br />
Gesamt N = 10 56 (8,6) 56, (8,8) + 0, (1,6%) - 2,178 .057<br />
Jungen n = 4 26,8 (1,7) 26,5 (2,1) – 0,3 (0, %) 0,874 .446<br />
Mädchen n = 6 24,1 (3,0) 23,8 (2,6) – 0,3 (1,4%) 1,0 3 .324<br />
Gesamt N = 10 25,1 (2,9) 24, (2,7) – 0,2 (–1,0%) 1,466 .177<br />
Jungen n = 4 8,3 (0,8) 8,0 (1,2) – 0,3 (0,3%) 1,000 .3 1<br />
Mädchen n = 6 5,7 (1,8) 5,5 (1,9) – 0,2 (0,2%) 0,542 .611<br />
Gesamt N = 10 6,7 (2) 6,5 (2,1) – 0,2 (0,2%) 1,000 .343<br />
Jungen n = 4 2,3 (0,3) 2,2 (0,3) – 0,1 (3,5%) 1,827 .165<br />
Mädchen n = 6 1, (0,4) 1,8 (0,3) – 0,1 (4, %) 2,084 .0 2<br />
Gesamt N = 10 2 (0,4) 1, (0,4) – 0,1 (–4,0%) 2, 05 .017<br />
15
16<br />
Sprungbrett<br />
Tab. 4: statistische Werte health related quality of life (HRQOL) t1; t3<br />
Variablen<br />
[T-Wert]<br />
PHY<br />
(körperliches<br />
Wohlbefinden)<br />
PWB<br />
(psychisches<br />
Wohlbefinden)<br />
EMO<br />
(Stimmungen &<br />
Emotionen)<br />
SEL<br />
(Selbstwahrnehmung)<br />
AUT<br />
(Autonomie)<br />
PAR<br />
(Eltern und<br />
Familie)<br />
FIN<br />
(Finanzielles)<br />
SOC<br />
(Gleichaltrige)<br />
SCH<br />
(Schule)<br />
BUL<br />
(soziale Akzeptanz)<br />
Stimmungen und Emotionen ebenfalls.<br />
Mit einer Verbesserung von 7,2%<br />
von t1 zu t3 allerdings nicht ganz so<br />
deutlich wie die Mädchen (T = –0.2 3;<br />
df = 3; p = .788). Die „Selbstwahrnehmung“<br />
in der Gesamtgruppe verbessert<br />
sich während des Projekts „Sprungbrett“<br />
von t1 zu t3 signifikant um<br />
12,8% (T = –2.523; df = ; p = .033).<br />
Die „Selbstwahrnehmung“ verbessert<br />
sich bei den Jungen um 11, % (T =<br />
–1.181; df = 3; p = .323) und bei den<br />
Mädchen um 13% (T = –2.411; df = 5;<br />
p = .61). Gerade dicke Menschen leiden<br />
T1<br />
MW (SD)<br />
häufig unter mangelndem Selbstwertgefühl.<br />
Während des gesamten Projekts<br />
wurden die Kinder besonders sportlich<br />
gefordert und gefördert. Die Kinder<br />
erlebten bei der sportlichen Betätigung<br />
Misserfolge, jedoch auch viele Erfolge.<br />
Die Projektleitung lobte die Kinder<br />
während des Sports oft, und die Kinder<br />
waren selbst sehr stolz, wenn sie bei<br />
einem Wettkampfspiel gewannen oder<br />
etwas schafften, was ihnen zuvor nicht<br />
gelang (ein Korbwurf, Pritschen oder<br />
Baggern, beim Fangen als letzter noch<br />
übrig sein …). Gerade der Sport kann,<br />
T3<br />
MW (SD) Differenz (%) T P<br />
Jungen n = 4 46,8 (5,3) 47,4 (5,1) + 0,6 (1,5%) - 0,261 .811<br />
Mädchen n = 6 4 ,6 (7,6) 50,6 (8,2) + 0,7 (2%) - 0,1 7 .851<br />
Gesamt N = 10 48,5 (6,6) 4 ,3 (7,0) + 0,8 (1,6%) - 0,271 .7 2<br />
Jungen n = 4 51,5 (4,5) 48,0 (14,1) -3,5 (6,8%) 0,470 .671<br />
Mädchen n = 6 48, (6,3) 50,7 (11,6) + 1,8 (3,7%) - 0,445 .675<br />
Gesamt N = 10 4 , (5,5) 4 ,6 (11,9) - 0,3 (0,6%) 0,0 2 . 28<br />
Jungen n = 4 43,1 (5,1) 46,2 (16,9) + 3,1 (7,2%) -0,2 3 .788<br />
Mädchen n = 6 43,3 (9,9) 51,0 (13,2) + 7,7 (17,8%) - 1,43 .210<br />
Gesamt N = 10 43,2 (7,9) 4 ,1 (14,1) + 5, (13,7%) - 1,174 .271<br />
Jungen n = 4 48,6 (3,2) 54,4 (12,8) + 5,8 (11,9%) - 1,181 .323<br />
Mädchen n = 6 42,2 (8,0) 47,7 (9,6) + 5,5 (13%) - 2,411 .061<br />
Gesamt N = 10 44,7 (7,1) 50,4 (10,8) + 5,7 (12,8%) - 2,523 .033<br />
Jungen n = 4 45, (7,0) 4 ,5 (12,9) + 3,6 (7,8%) - 0,360 .743<br />
Mädchen n = 6 48, (6,4) 47,4 (9,0) - 1,5 (3,1%) 0,6 3 .51<br />
Gesamt N = 10 47,7 (6,4) 48,2 (10,1) + 0,5 (1%) - 0,12 . 00<br />
Jungen n = 4 45,2 (6,3) 40, (4,4) - 4,3 (9,5%) 1,457 .241<br />
Mädchen n = 6 48,7 (11,8) 44,8 (15,2) - 3, (8%) 1,554 .181<br />
Gesamt N = 10 47,3 (9,7) 43,2 (11,8) - 4,1 (8,7%) 2,250 .051<br />
Jungen n = 4 43, (8,5) 38,5 (11,3) - 5,4 (12,3%) 0,808 .478<br />
Mädchen n = 6 53,3 (10,2) 53,8 (11,4) + 0,5 (0,9%) - 0,1 7 .851<br />
Gesamt N = 10 4 ,6 (10,3) 47,7 (13,3) - 1, (3,8%) 0,645 .535<br />
Jungen n = 4 43,5 (9,4) 42,2 (6,3) - 1,3 (3%) 0,848 .45<br />
Mädchen n = 6 4 , (9,5) 46,2 (14,7) - 3,7 (7,4%) 0,1 7 .851<br />
Gesamt N = 10 45,5 (9,1) 44,6 (11,7) - 0, (2%) 0,450 .663<br />
Jungen n = 4 46,5 (16,7) 43,8 (12,3) - 2,7 (5,8%) 2,0 2 .128<br />
Mädchen n = 6 56,2 (13,3) 55,7 (8,6) - 0,5 (0,9%) 0,124 . 06<br />
Gesamt N = 10 56,3 (13,8) 50, (11,4) - 5,4 (9,6%) 1,425 .188<br />
Jungen n = 4 45, (9,8) 38,2 (9,0) - 7,7 (16,8%) 0, 42 .416<br />
Mädchen n = 6 37,2 (14,2) 42,6 (12,8) + 5,4 (14,5%) - 1,565 .178<br />
Gesamt N = 10 40,7 (12,8) 40,8 (11,1) + 0,1 (0,2%) - 0,034 . 74<br />
wenn er in einer ungefähr gleichstarken<br />
Gruppe absolviert wird, eine wichtige<br />
Maßnahme sein, um Selbstwertgefühl<br />
wieder oder neu zu gewinnen.<br />
Bei der „sozialen Akzeptanz“ verbessert<br />
sich der Gesamtwert der Gruppe<br />
minimal um 0,2% (T = 0.034; df = ;<br />
p = . 74), doch es zeigt sich eine sehr<br />
kontroverse Entwicklung zwischen den<br />
Jungen und Mädchen. Die Jungen<br />
befinden sich zu Beginn der Intervention<br />
mit einem T-Wert von 45, nur<br />
knapp über dem kritischen Bereich<br />
fallen jedoch um 16,8% unter die
unumstritten kritische Grenze mit<br />
einem T-Wert < 40 (T = 0, 42; df = 3;<br />
p = .416). Bei den Mädchen hingegen<br />
steigt der T-Wert um 14,5% (T =<br />
–1.565; df = 5; p = .178). Die Mädchen<br />
kommen somit im Laufe der Intervention<br />
aus dem zweifelsohne kritischen<br />
Bereich bezüglich der sozialen Akzeptanz<br />
hinaus. Bei der sozialen Akzeptanz<br />
(Bullying) zeigt sich bei den „Sprungbrett“-Kindern,<br />
dass sie sich von Gleichaltrigen<br />
schikaniert und zurückgewiesen<br />
fühlen.<br />
Ob die Veränderungen besonders im<br />
Verhältnis zu anderen Kindern im<br />
Zusammenhang mit der Studie stehen,<br />
ist nicht unbedingt bestätigt. Es ist<br />
jedoch anzunehmen, dass das „Sprungbrett“-Programm<br />
nur dann positive<br />
soziale Wirkung zeigen kann, wenn<br />
die Gruppenmitglieder miteinander<br />
harmonieren und ein Gruppenzusammenhalt<br />
besteht.<br />
Aus diesem Grund wurde durch die<br />
Anfertigung von Soziogrammen die<br />
Gruppenstruktur der „Sprungbrett“-<br />
Gruppe analysiert. Bei der Auswertung<br />
der Soziogramme wurden erhebliche<br />
soziale Entwicklungen innerhalb der<br />
Gruppe ersichtlich. Es fällt auf, dass<br />
sich zwischen den Mädchen festere<br />
Freundschaften bilden, mit gegenseitiger<br />
Zuneigung, als unter den<br />
Jungen. Dort besteht kaum gegenseitige<br />
Zuneigung. Dies erklärt womöglich die<br />
drastisch absinkenden Werte bei der<br />
sozialen Akzeptanz und der Beziehung<br />
zu Gleichaltrigen.<br />
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in<br />
dem Gesamtwert der gesundheitsbezo-<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
[t-Wert]<br />
47,5<br />
47,1<br />
HRQOL<br />
r Abb. 5: Veränderung Gesamtwert HRQOL<br />
genen Lebensqualität oder auch health<br />
related quality of life (HRQOL) wieder<br />
(vgl. Abb. 5). Hier verschlechtert sich bei<br />
den Jungen der t-Wert von 47,1<br />
Punkten um 4,7% auf 44, Punkte. Bei<br />
den Mädchen verbessert sich die<br />
HRQOL von 47,5 Punkten um 3,2% auf<br />
4 Punkte. Die Gesamtgruppe kann den<br />
t-Wert der HRQOL um 0,2% steigern<br />
(T = –.120; df = ; p = . 07).<br />
Dieses Ergebnis wirft die Frage auf,<br />
ob diese Veränderung aufgrund des<br />
Bewegungsprogramms oder der<br />
Zufriedenheit innerhalb der Gruppe<br />
zustande kommt. Lässt sich bei<br />
Mädchen generell leichter durch ein<br />
Bewegungsprogramm die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität steigern? Für<br />
den Gesamtwert der HRQOL muss die<br />
Arbeitshypothese 3 verworfen werden.<br />
Allerdings lassen die signifikanten<br />
Verbesserungen bei beiden Geschlechtern<br />
in den Bereichen „Stimmungen und<br />
Emotionen“ sowie „Selbstwertgefühl“<br />
jedoch eine positive Wirkung des<br />
Projekts „Sprungbrett“ auf wesentliche<br />
Teilbereiche der psychischen Gesundheit<br />
übergewichtiger Kinder erkennen.<br />
Diskussion<br />
Hinsichtlich der Wirksamkeit des<br />
Interventionsprogramms „Sprungbrett“<br />
lässt sich festhalten, dass sich positive<br />
Veränderungen in den drei Konstrukten<br />
motorische Leistungsfähigkeit, anthropometrische<br />
Daten und gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität zeigen. Diese<br />
44,9<br />
t1 t3<br />
49,0<br />
Jungen<br />
Mädchen<br />
Gesamt<br />
sind allerdings nach 3 Monaten nicht<br />
in allen Parametern so deutlich wie<br />
vielleicht erwartet und müssen vor<br />
allem differenziell betrachtet werden.<br />
Der deutliche Zuwachs bei der konditionellen<br />
Leistungsfähigkeit lässt<br />
sich mit der guten Trainierbarkeit<br />
insbesondere der konditionellen<br />
Fähigkeiten in diesem Lebensalter<br />
und auch der Gestaltung des Bewegungsprogramms<br />
begründen. Die<br />
wünschenswerten Verbesserungen im<br />
koordinativen Bereich bedürfen<br />
spezifischer Übung und werden hier<br />
nicht erreicht.<br />
Die, wenn auch nur sehr geringe,<br />
Gewichtsreduktion der Teilnehmer ist<br />
hinsichtlich des kurzen Interventionszeitraumes<br />
als positiv zu bewerten, vor<br />
allem die relative Gewichtsabnahme,<br />
die sich in der Verringerung des<br />
BMI-SDS zeigt. Dies kann allerdings,<br />
angesichts des dramatischen Übergewichts<br />
der Sprungbrett-Kinder nur ein<br />
allererster Schritt sein, die Adipositaskarriere<br />
zu stoppen. Die Veränderungen<br />
im Bereich der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität weisen bei geschlechtsspezifischer<br />
Betrachtung zum Teil<br />
konträre Entwicklungen auf. Hier ist<br />
nicht eindeutig feststellbar, ob diese<br />
Veränderungen schulische oder private<br />
Ursachen haben, und in wiefern die<br />
einzelnen Bausteine des Projekts<br />
„Sprungbrett“, aber auch Faktoren wie<br />
die Gemeinschaft der „Sprungbrett“-<br />
Gruppe, Freundschaften und Anerkennung<br />
innerhalb dieser, Einfluss auf die<br />
Ergebnisse zur Einschätzung der<br />
gesundheitsbezogenen Lebensqualität<br />
nehmen.<br />
Eventuell spielt auch die Tatsache, dass<br />
das Projektteam überwiegend weiblicher<br />
Besetzung war, eine entscheidende<br />
Rolle für die zum Teil negative<br />
Entwicklung bei den männlichen<br />
Untersuchungsteilnehmern. Die bei<br />
allen Untersuchungsteilnehmern<br />
erfahrene positive Steigerung der<br />
Selbstwahrnehmung ist wahrscheinlich<br />
in Verbindung zu sehen mit der<br />
gesteigerten motorischen Leistungsfähigkeit.<br />
In Zukunft sind neben neuen<br />
und außergewöhnlichen Präventions-,<br />
Interventions- und Therapieansätzen<br />
zur Bekämpfung der Adipositas auch<br />
weitere Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen<br />
körperlicher Aktivität auf die<br />
gesundheitsbezogene Lebensqualität<br />
übergewichtiger Kinder von Interesse.<br />
17
18<br />
Sprungbrett<br />
Literatur<br />
Bappert, S./Osterkamp-Baerens, C.<br />
(2004): Fit und gesund durch<br />
Bewegung und richtige Ernährung.<br />
Ein Ratgeber der Deutschen<br />
Schulsportstiftung.<br />
Weilheim Teck: Bräuer GmbH.<br />
Bisegger, C./Cloetta, B. und die<br />
europäische Kidscreengruppe<br />
(2005): Kidscreen: Fragebogen<br />
zur Erfassung der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität von<br />
Kindern und Jugendlichen.<br />
Manual der deutschsprachigen<br />
Versionen für die Schweiz. Berlin:<br />
Robert Koch-Institut.<br />
Bös, K. (2003): Motorische Leistungsfähigkeit<br />
von Kindern und<br />
Jugendlichen. In: W. Schmidt/ I.<br />
Hartmann-Tews/W.-D. Brettschneider<br />
(Hrsg.), Erster<br />
Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht<br />
(S. 85- 107).<br />
<strong>Hofmann</strong>: Schorndorf.<br />
Bös, K./Eschette, H./Lämmle, L./<br />
Lanners, M./Oberger, J./Opper, E./<br />
Romahn, E./Schorn, A./Wagener,<br />
Y./Wagner, M./Worth, A. (2006):<br />
Gesundheit, motorische Leistungsfähigkeit<br />
und körperlichsportliche<br />
Aktivität von Kindern<br />
und Jugendlichen in Luxemburg.<br />
Untersuchung für die Altersgruppen<br />
9, 14 und 18 Jahre.<br />
Abschlussbericht zum Forschungsprojekt.<br />
MENFP: MS:<br />
DMS: Luxembourg.<br />
Bös, K./Schmidt-Redemann, A./<br />
Bappert, S. (2007): Appetit auf<br />
Bewegung. Bewegungs-/<br />
Ernährungsprogramme für<br />
Grundschulkinder. Aachen:<br />
Meyer & Meyer.<br />
Britz, B./Siegfried, W./Ziegler, A./<br />
Lamertz, C./Herpertz-Dahlmann,<br />
B. M./Remschmidt, H./Wittchen,<br />
H. U./Hebebrand, J. (2000):<br />
Rates of psychiatric disorders in<br />
a clinical study group of<br />
adolescents with extreme<br />
obesity via a popoulation based<br />
study. International Journal of<br />
Obesity (24), 1707–1714.<br />
Eberding, A./Lemme, M./Ernst, M./<br />
van Egmond-Fröhlich, A./<br />
Jaeschke, R./Kühn-Dost, A./<br />
Mannhardt, S./Stübing, K./Lob-<br />
Corzilius, T./Tiedjen, U./Werning,<br />
A./Vahabzadeh, Z./Stachow, R.<br />
(2004): Schulungsbereich Eltern.<br />
In aid infodienst Verbraucherschutz,<br />
Ernährung, Landwirtschaft<br />
e.V./Deutsche Gesellschaft<br />
für Ernährung (DGE) e.V.<br />
(Hrsg.), Trainermanual Leichter,<br />
aktiver, gesünder. Interdisziplinäres<br />
Konzept für die Schulung<br />
übergewichtiger oder adipöser<br />
Kinder und Jugendlicher (S. 617–<br />
730). Köln: Moeker Merkur.<br />
Kromeyer-Hauschild, K./Wabitsch,<br />
M./Kunze, D. et al. (2001):<br />
Perzentile für den Body Mass<br />
Index für das Kindes- und<br />
Jugendalter unter Heranziehung<br />
Prof. Dr. Jürgen Baur / Prof. Dr. Klaus Bös /<br />
Prof. Dr. Achim Conzelmann / Prof. Dr. Roland Singer (Hrsg.)<br />
Handbuch Motorische Entwicklung<br />
2., komplett überarbeitete Auflage 2009<br />
verschiedener deutscher<br />
Stichproben. Monatsschrift<br />
Kinderheilkunde 149, 807–818.<br />
Kurth, B.-M./Schaffrath Rosario, A.<br />
(2007): Die Verbreitung von<br />
Übergewicht und Adipositas bei<br />
Kindern und Jugendlichen in<br />
Deutschland. Ergebnisse des<br />
bundesweiten Kinder- und<br />
Jugendgesundheitssurveys<br />
(KIGGS). Bundesgesundheitsblatt<br />
- Gesundheitsforschung –<br />
Gesundheitsschutz 50, 736–743.<br />
Ravens-Sieberer, U. (2005): Lebensqualität<br />
von Kindern und<br />
Jugendlichen mit Adipositas. In<br />
M. Wabitsch/K. Zwiauer/J.<br />
Hebebrand/W. Kiess (Hrsg.),<br />
Adipositas bei Kindern und<br />
Jugendlichen (S. 240–246).<br />
Heidelberg: Springer.<br />
Wabitsch, M. (2007): Ärzte warnen<br />
immense Folgekosten durch<br />
Adipositas. In AdipositasSpektrum<br />
(2007, 2. Februar). Zugriff<br />
am 5. Februar 2007 unter http://<br />
www.adipositasspektrum.<br />
de/114.0.html?&tx_ttnews[tt_<br />
news]=15&tx_ttnews[backPid]=<br />
121&cHash=4aa37b969.<br />
Internetverzeichnis<br />
• http://www.adipositas-<br />
spektrum.de<br />
• http://www.a-g-a.de<br />
• http://www.foss-karlsruhe.de<br />
• http://www.de.icw-global.com<br />
• http://www.kidscreen.org<br />
In 21 Einzelbeiträgen stellen 22 Autorinnen und Autoren den aktuellen Stand der Forschung zur<br />
motorischen Entwicklung zusammen. Der Band richtet sich v. a. an Sportwissenschaftler/innen,<br />
Studierende der Sportwissenschaft, aber auch an Leserkreise aus den Gebieten der Medizin und<br />
Psychologie.<br />
DIN A5, 464 Seiten, ISBN 978-3-7780-1562-9, Bestell-Nr. 1562 � 34.90<br />
Inhaltsverzeichnis unter www.sportfachbuch.de/1562<br />
Steinwasenstraße 6–8 • 73614 Schorndorf • Telefon (0 71 81) 402-125 • Fax (0 71 81) 402-111<br />
Internet: www.hofmann-verlag.de • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.de
Sabine C. Koch<br />
Entwicklungsdiagnostik mit dem<br />
Kestenberg Movement Profile (KMP)<br />
Zu einer guten Psychomotorik gehört eine differenzierte Diagnostik. Neben der<br />
Erfassung quantitativer Variablen, sind qualitative Aspekte von Bewegung von<br />
zentraler Bedeutung. Ein umfassendes Instrument für die psychomotorische Entwicklungsdiagnostik,<br />
das beide Aspekte einschließt, ist das Kestenberg Movement Profile<br />
(KMP). Dieses hat sich im Rahmen der Tanz- und Bewegungstherapie in Diagnostik<br />
und Interventionsplanung etabliert. Der vorliegende Artikel gibt eine Einführung in<br />
das Kestenberg Movement Profile vor, beschreibt exemplarisch die Entwicklungsdiagnostik<br />
eines normal entwickelten Kindes und stellt klinische Bezüge her.<br />
Das KMP – ein Überblick<br />
Das Kestenberg Movement Profile<br />
(Kestenberg 1995; Kestenberg/Sossin<br />
1973/1979; Kestenberg-Amighi u. a.<br />
1999; Lewis/Loman 1990; Loman 1995)<br />
ist ein Instrument zur Erfassung und<br />
Untersuchung des nonverbalen Bewegungs-<br />
und Ausdrucksverhaltens.<br />
Es erlaubt eine Feinanalyse zwischenmenschlicher<br />
Kommunikation und<br />
Interaktion und gibt Auskunft über<br />
Bedürfnisse, Temperament, Affekt,<br />
Lernstile, Abwehrmechanismen, Gefühle<br />
gegenüber Selbst und Anderen sowie<br />
weitere emotionale und kognitive<br />
Variabeln. In 64 Parametern erfasst es<br />
komplexe Bewegungen qualitativ und<br />
quantitativ und dient zur Analyse des<br />
Entwicklungsstandes, differenzieller<br />
Persönlichkeitsmerkmale und des<br />
interaktiven Kommunikationsverhaltens<br />
einer Person (vgl. Abb. 1). Anwendung<br />
findet es vor allem in der individuellen<br />
Entwicklungsdiagnostik, der Analyse<br />
von Eltern-Kind-Interaktionen sowie<br />
im Bereich der Paar-, Familien- und<br />
Teamkommunikationsanalyse. Das KMP<br />
Abb. 1: Vereinfachte Übersicht des KMP mit deutscher Terminologie (aus: Eberhard., 2007; die Linien<br />
zeigen die Entwicklungsreihenfolge an).<br />
1.2 Bewegungsformen<br />
Bei den Bewegungsformen (System II, rechte Spalte von Abb. 1) handelt es sich um den<br />
Wechsel von wachsenden und schrumpfenden Bewegungen, von Öffnen und Schließen auf<br />
der Formenfluss-Seite. Diese sind selbstbezogen (z.B. Wachsen aufgrund einer emotional angenehmen<br />
Atmosphäre in einer Gruppe, in der ich mich wohlfühle), umwelt- (z.B. Wachsen<br />
aufgrund der Wärme der einstrahlenden Sonne) oder objektbezogen (z.B. Wachsen hin zu<br />
einem geliebten Menschen). Dazu gehören auch Annäherungs- und Vermeidungsbewegungen<br />
als zugleich objekt- und selbstbezogene Bewegungen. „Reifestufen“ sind hier: unbewusster<br />
Formenfluss (Bipolar / Unipolar Shape-Flow) mit zumeist kleinen Torsobewegungen hin zu<br />
oder weg von einem Objekt, vorbewusste Richtungsbewegungen (Shaping in Directions) mit<br />
deutlichen Bewegungen der Extremitäten in einer Bewegungsebene, die entweder affiliative<br />
oder defensive Bedeutung haben können, und bewusste Formen, die mehrere Ebenen einschließen<br />
(Shaping in Planes) und komplexe Objektrelationen widerspiegeln. Wachsen und<br />
Annäherung sind überwiegend im Zusammenhang mit positiven Stimuli zu beobachten,<br />
Schrumpfen und Vermeidung überwiegend in Zusammenhang mit negativen Stimuli.<br />
r Abb. 1: Vereinfachte Übersicht des KMP mit deutscher Terminologie (aus: Eberhard<br />
2007; die Linien zeigen die Entwicklungsreihenfolge an)<br />
geht zum einen auf die psychoanalytische<br />
Entwicklungstheorie von Anna<br />
Freud (1965), zum anderen auf die<br />
Bewegungsanalyse und Bewegungsnotation<br />
nach Laban (1960; Laban/<br />
Lawrence 1974) und Lamb (1965)<br />
zurück. In den letzten Jahren wurde<br />
es überarbeitet und der psychoanalytische<br />
Hintergrund wurde um einen<br />
kognitiv-verhaltenstherapeutischen<br />
PD Dr. Sabine C. Koch<br />
Psychologin und Tanztherapeutin, M.A.,<br />
BC-DMT, Universität Heidelberg,<br />
promovierte im Bereich der Mikroanalyse<br />
von verbaler und nonverbaler<br />
Kommunikation am Arbeitsplatz und<br />
habilitierte zum Thema „Embodiment:<br />
Der Einfluss von Eigenbewegung auf<br />
Affekt, Einstellung und Kognition“.<br />
Derzeit ist sie in Forschung und Lehre<br />
auf der Abteilung für Gender, Persönlichkeits-<br />
und Gesundheitspsychologie<br />
tätig und leitet das nationale Forschungsprojekt<br />
„Körpersprache von<br />
Tanz und Bewegung“ (BMBF) in<br />
Kooperation mit Phänomenologen und<br />
Kognitionslinguisten.<br />
Anschrift der Verfasserin:<br />
Universität Heidelberg<br />
Psychologisches Institut<br />
Hauptstr. 47–51, 69117 Heidelberg<br />
Telefon: +49-62 21-54 72 97<br />
E-Mail: sabine.koch@<br />
urz.uni-heidelberg.de<br />
19
20<br />
Entwicklungsdiagnostik mit dem Kestenberg Movement Profile (KMP)<br />
Hintergrund ergänzt, sowie das gesamte<br />
System auf ein stärker kognitionswissenschaftlich<br />
anschlussfähiges<br />
Fundament gestellt (Kestenberg-Amighi<br />
et al. 1999). Einen deutschsprachigen<br />
Überblick geben Romer (1980), Bender<br />
(2007) und Eberhard (2007).<br />
Bewegungsqualitäten<br />
Das KMP unterscheidet grundsätzlich<br />
zwischen Bewegungsqualitäten und<br />
Bewegungsformen. Bei den Bewegungsqualitäten<br />
(System I; linke Spalte<br />
von Abb. 1) handelt es sich um den<br />
Wechsel von Muskelanspannung und<br />
-entspannung auf der Spannungsfluss-<br />
Seite. Kestenberg spricht mit Bezug auf<br />
Laban (1960) von ankämpfenden<br />
(fighting) vs. hingebenden/erspürenden<br />
(indulgent) Bewegungsqualitäten;<br />
diese treten in mehreren entwicklungspsychologischen<br />
„Reifestufen“ auf: als<br />
unbewusste Spannungsfluss-Rhythmen<br />
und Spannungsfluss-Eigen-<br />
schaften (Rhythms und Attributes), die<br />
Bedürfnisse und Affekt reflektieren,<br />
vorbewusste Antriebsvorläufer (Pre-<br />
Efforts), die Abwehrmechanismen und<br />
Lernstile reflektieren, und bewusste<br />
Antriebe (Efforts), die den intentionalen<br />
Umgang mit Raum, Zeit und Schwerkraft<br />
und das „Environmental Coping“<br />
reflektieren. Hingebende Bewegungen<br />
dienen dazu, in einer Entwicklungsstufe<br />
motorisch aufzugehen (z. B. hüpfen um<br />
des Hüpfens willen), während ankämpfende<br />
Bewegungen dazu dienen, sich<br />
aus einer Entwicklungsstufe zu lösen,<br />
zu verabschieden, zu trennen, um sich<br />
auf ein neues Ziel hinbewegen zu<br />
können.<br />
Bewegungsformen<br />
Bei den Bewegungsformen (System II,<br />
rechte Spalte von Abb. 1) handelt es<br />
sich um den Wechsel von wachsenden<br />
und schrumpfenden Bewegungen, von<br />
Öffnen und Schließen auf der Formenfluss-Seite.<br />
Diese sind selbstbezogen<br />
(z. B. Wachsen aufgrund einer emotional<br />
angenehmen Atmosphäre in einer<br />
Gruppe, in der ich mich wohlfühle),<br />
umweltbezogen (z. B. Wachsen auf-<br />
grund der Wärme der einstrahlenden<br />
Sonne) oder objektbezogen (z. B.<br />
Wachsen hin zu einem geliebten Men-<br />
schen). Dazu gehören auch Annäherungs-<br />
und Vermeidungsbewegungen<br />
als zugleich objekt- und selbstbezogene<br />
Bewegungen. Entwicklungspsychologische<br />
„Reifestufen“ sind hier: unbewusster<br />
Formenfluss (Bipolar/Unipolar<br />
Shape-Flow) mit zumeist kleinen<br />
Torsobewegungen hin zu oder weg von<br />
einem Objekt, vorbewusste Richtungsbewegungen<br />
(Shaping in Directions) mit<br />
deutlichen Bewegungen der Extremitäten<br />
in einer Bewegungsebene, die<br />
entweder affiliative oder defensive<br />
Bedeutung haben können, und bewusste<br />
Formen, die mehrere Ebenen<br />
einschließen (Shaping in Planes) und<br />
komplexe Objektrelationen wider-<br />
spiegeln. Wachsen und Annäherung<br />
sind überwiegend im Zusammenhang<br />
mit positiven Stimuli zu beobachten,<br />
Schrumpfen und Vermeidung überwiegend<br />
in Zusammenhang mit negativen<br />
Stimuli.<br />
Diagnostischer Prozess<br />
und Gütekriterien<br />
Durchführung und Auswertung<br />
Im KMP werden die Bewegungselemente<br />
notiert, quantifiziert und in Häufigkeitsdiagramme<br />
übertragen, aus welchen sich<br />
Entwicklungsverläufe rekonstruieren und<br />
Persönlichkeitsprofile ableiten lassen.<br />
Das KMP unterscheidet sich insofern<br />
von anderen Instrumenten der Verhaltensbeobachtung,<br />
als dass es neben<br />
den Häufigkeitsinformationen auch<br />
Paul (2½ Monate)<br />
Abb. 2: Rhythmennotation von Paul (2 � Monate)<br />
kontinuierliche Daten erfasst (Rhythmennotation;<br />
s. Abb. 2), was grundsätzlich<br />
ermöglicht, über die kategoriale<br />
Information hinaus weitere Aspekte der<br />
Dynamik der sozialen Interaktion zu<br />
untersuchen.<br />
Die Rhythmennotation, handschriftliche<br />
Aufzeichnungen auf einem leeren Blatt<br />
Papier mit lediglich einer Zeitlinie,<br />
benutzt die kinästhetische Empathie<br />
(Kestenberg 1995) als Hauptmethode.<br />
Die Beobachter nehmen die Wechsel<br />
von Anspannung und Entspannung der<br />
beobachteten Person in ihren eigenen<br />
Körper auf (motorische Simulation),<br />
versuchen sie insbesondere in ihrem<br />
Schreibarm, ihren Fingern und im Stift<br />
(als deren Extension) zu spüren und in<br />
Form einer „Spannungsflusslinie“ zu<br />
Papier zu bringen. Der Konvention<br />
folgend wird bei einer Erhöhung der<br />
Muskelspannung der Stift nach unten<br />
geführt und bei einer Entspannung der<br />
Stift nach oben geführt (vgl. Abb. 2).<br />
Nach dem Notieren werden die<br />
Rhythmen kategorisiert und dann<br />
ausgezählt. Die entstehenden Profile<br />
sind demnach häufigkeitsbasiert und<br />
wiesen in Überprüfungsstudien eine<br />
Beobachterübereinstimmung von<br />
Cronbachs Alphas zwischen .74 und .91<br />
auf, wenn mehrere Beobachter Profile<br />
für eine Person erstellen (Koch 2006;<br />
Sossin 1987). Bislang wird nur die<br />
Häufigkeitsinformation in den Bewegungsrhythmen<br />
zur Auswertung<br />
genutzt und die Sequenz- und Muster-<br />
Andererseits hat Paul schon erstaunlich viele Rhythmen aus der analen Phase verfügbar. Das<br />
spielerische, flirtende und schüchterne Sich-Drehen ist sein präferierter Körperrhythmus, der<br />
sogar die generell in seiner Entwicklungsphase am häufigsten zu beobachtenden oralen<br />
Rhythmen übertrifft. Hier zeichnet sich eventuell eine Tendenz zu einer generelle Präferenz der<br />
sich hingebenden Rhythmen vor den ankämpfenden Rhythmen ab. Aber auch der Press- bzw.<br />
Halterhythmus, der bald für die Sauberkeitserziehung wichtig werden wird, wird von Paul<br />
schon weitgehend beherrscht und angewandt, es fehlt ihm jedoch noch an Intensität.<br />
Die anderen Rhythmen sind altersgemäß noch nicht so stark ausgeprägt, allerdings lässt sich<br />
auch bei diesen (mit Ausnahme der urethralen Phase) eine Präferenz der sich hingebenden<br />
Rhythmen beobachten. Insgesamt zeigt Paul bei den puren Rhythmen ein 2:1 Verhältnis von<br />
ankämpfenden zu sich hingebenden Rhythmen, was für potentiell gute Durchsetzungs- und<br />
Abgrenzungsfähigkeit spricht. Bei den gemischten Rhythmen kehrt sich das Verhältnis<br />
erwartungsgemäß um, was auf bedarfsgerechte Bedürfnisbefriedigung und Kompromiss-<br />
r Abb. 2: Rhythmennotation von Paul (2½ Monate)
information in den kontinuierlichen<br />
Rohdaten gehen noch nicht in die<br />
Analysen ein.<br />
Gütekriterien des KMP<br />
Durchführungs- und Auswertungsobjektivität<br />
des KMP lassen sich gut<br />
sicherstellen. Die Interrater-Reliabilität<br />
für das Gesamtprofil liegt für Laien im<br />
einfachen prozentualen Vergleich etwa<br />
bei 70% für Experten etwa bei 75%<br />
(vgl. Koch 2006; Koch u. a. 2002;<br />
Sossin 1987). Die interne Konsistenz<br />
und die Trennschärfen der Items einer<br />
deutschen Übersetzung des KMP-<br />
Fragebogens wurden 1998 mit guten<br />
bis sehr guten Resultaten überprüft<br />
(Cronbachs Alphas der Profile zwischen<br />
.70 und .95). Die Validität wurde z. B.<br />
für hingebende vs. ankämpfende<br />
Rhythmen, für starke vs. leichte Efforts<br />
und für direkte vs. indirekte Efforts<br />
überprüft (Koch 2009; Lotan/Yirmiya<br />
2002). Die Konstruktvalidität wurde<br />
anhand eines Diagnostikvergleichs<br />
zwischen Anna Freud und Judith<br />
Kestenberg (beide blind zur Diagnostik<br />
der jeweils anderen) in den 70er Jahren<br />
überprüft (Kestenberg-Amighi et al.<br />
1999).<br />
Exemplarische Analyse für<br />
ein 2½-monatiges normal<br />
entwickeltes Kind<br />
Mit dem KMP kann man Personen jeden<br />
Alters untersuchen, Teile des Instrumentes<br />
können bereits am Fötus angewandt<br />
werden (vgl. Loman 2007). Es umfasst<br />
neun Kategorien der Bewegung, die<br />
jeweils in Diagrammform dargestellt<br />
werden. Die Diagramme beschreiben die<br />
inneren Bedürfnisse des Kindes und<br />
deren bevorzugte Äußerungsformen,<br />
das Temperament des Kindes, seine<br />
bevorzugten kognitiven Stile, die<br />
bevorzugten Abwehrmechanismen und<br />
Bewältigungsformen, sein Vertrauen<br />
zur Umwelt und zu sich selbst, sein<br />
Annäherungs- und Vermeidungsverhalten<br />
sowie sein ein- und mehrdimensionales<br />
Sich-in-Beziehung-setzen zu<br />
Personen und Objekten. Die Diagramme<br />
werden ausschließlich durch Beobachtung<br />
und zum Teil mithilfe der oben<br />
beschriebenen Freihandmethode, sowie<br />
der von Laban/Lawrence (1974)<br />
entwickelten Bewegungsnotation,<br />
erstellt. Die Auswertung erfolgt auf der<br />
Grundlage beobachteter Häufigkeiten.<br />
Es folgt eine exemplarische Entwicklungsdiagnostik<br />
für Paul (2½ Monate)<br />
in Darstellung und Interpretation.<br />
Allgemeine Körperhaltung<br />
(Body Attitude)<br />
Paul zeigt eine für einen Säugling in<br />
seinem Alter typische Körperhaltung.<br />
Seine Aktivitätsphase verbringt er in<br />
Rückenlage, dabei ist sein Oberkörper<br />
meist weit geöffnet, das aktive bipolare<br />
Verengen des Körpers fällt ihm noch<br />
schwer. Seine untere Körperhälfte<br />
bewegt sich typischerweise eher in der<br />
vertikalen Ebene, sein Oberkörper in der<br />
horizontalen. Die Körperspannung in<br />
den Extremitäten ist bei ihm gewöhnlich<br />
höher als die des Torsos. Seine<br />
bevorzugten Antwortmuster sind<br />
Bewegungen der Arme, wobei der linke<br />
Arm stets aktiver ist als der rechte und<br />
einen Großteil der Bewegung leitet.<br />
Während der Beobachtungszeit war<br />
Paul wach und aktiv, z. T. reagierte er<br />
auf akustische Signale. Gegen Ende des<br />
Videosegments wurde er müde und<br />
schlief schließlich ein, wie es sich in<br />
den beiden letzten Zeilen der Rhythmenkurve<br />
durch die Verwendung vieler,<br />
immer regelmäßig werdender oraler<br />
Rhythmen abbildet (vgl. Abb. 2).<br />
Spannungsfluss-Rhythmen<br />
(Tension-flow rhythms)<br />
Spannungsfluss-Rhythmen sind die<br />
Wechsel im Grad der Körpermuskelspannung.<br />
Man unterscheidet freien<br />
Fluss (nicht-eingeschränkte Bewegung<br />
ohne Beteiligung des Muskelantagonisten)<br />
und gebundenen Fluss (eingeschränkte<br />
Bewegung mit Beteiligung<br />
des Muskelantagonisten). Auf psychologischer<br />
Ebene geht freier Fluss mit<br />
Entspannung und innerer Lockerheit,<br />
gebundener Fluss mit Anspannung und<br />
Ängsten einher. Die Rhythmen sind an<br />
die psychodynamischen Entwicklungsphasen<br />
angelehnt. In jeder Phase gehen<br />
ankämpfende (fighting) Rhythmen sich<br />
hingebenden (indulgent) voraus: das<br />
Aufgehen in einer Entwicklungsphase<br />
wird jeweils gefolgt von der Ablösung<br />
aus dieser Phase (vgl. Erickson 1950).<br />
Die Subphasen gliedern sich in die orale<br />
Phase, die anale Phase, die urethrale<br />
Phase, die innergenitale und die<br />
außergenitale Phase. Kestenberg fand<br />
die dritte Subphase bei ihren Kinderbeobachtungsstudien<br />
und unterteilte<br />
dabei auch die klassische ödipale Phase<br />
in die inner- und außergenitale Phase.<br />
Die Bewegungsrhythmen sind in der<br />
Entwicklungsreihenfolge:<br />
• saugen, beißen<br />
• (ver)drehen, anspannen-loslassen<br />
• laufen lassen, starten-stoppen<br />
• wiegen, gebären<br />
•<br />
hüpfen und stoßen<br />
Der Saugrhythmus ist der erste Rhythmus,<br />
der den Körper des Kindes<br />
organisiert. Er hat eine geringe Intensität,<br />
runde Übergänge und regelmäßige,<br />
fast sinuskurvenförmige Amplituden,<br />
die sich in der Beobachtung und der<br />
Notation der Rhythmen zeigen (vgl.<br />
Abb. 2). Man findet ihn nicht nur im<br />
Mund des Kindes, sondern auch in den<br />
Händen, den Füßen und den Handgelenken,<br />
vermehrt, kurz bevor das Kind<br />
einschläft (Lotan/Yirmiya 2002). Der<br />
Saugrhythmus dient der Selbstberuhigung,<br />
und man findet ihn auch bei<br />
Erwachsenen, die in diesem Rhythmus<br />
z. B. leicht mit dem Torso wippen oder<br />
ihr Haar drehen (auch wenn die Form<br />
Drehen ist, kann der Rhythmus Saugen<br />
sein, da es ja um die Muskelspannungsänderungen<br />
geht). Der darauf folgende<br />
Beißrhythmus hat ebenfalls eine<br />
niedrige Intensität und gleichmäßige<br />
Amplituden, aber eckige Übergänge und<br />
hilft dem Kind, Dinge zu kauen und<br />
voneinander zu trennen, zuerst mit den<br />
Zähnen, dann mit den Händen und dem<br />
ganzen Körper. Auf diese Weise ist es<br />
auch der erste Rhythmus, der dem Kind<br />
hilft, Kategorien und Konzepte zu<br />
trennen, und dadurch analytisches<br />
Denken vorbereitet. Bei Erwachsenen<br />
können wir ihn beobachten, wenn sie<br />
auf einem Bleistift oder an Fingernägeln<br />
kauen. Das Beißen auf einem Bleistift<br />
kann ein Hinweis darauf sein, dass man<br />
versucht sich zu konzentrieren, auf<br />
etwas zu fokussieren und Konzepte zu<br />
unterscheiden, oder, dass man sich aus<br />
der Situation trennen, lösen will, um<br />
zur nächsten Herausforderung – oder<br />
auch zur Entspannung – überzugehen.<br />
Ebenso können die Rhythmen Verwendung<br />
finden, um auf die Bedürfnisse<br />
anderer einzugehen. So kann man<br />
z. B. ein Baby durch Wiegen oder ein<br />
Wiegenlied in einem oralen Rhythmus –<br />
alle Wiegenlieder haben einen oralen<br />
21
22<br />
Entwicklungsdiagnostik mit dem Kestenberg Movement Profile (KMP)<br />
Saugrhythmus – beruhigen, oder man<br />
kann einen Freund mit runden Rhythmen<br />
umarmen und wenn die Umarmung<br />
zu lang wird, mit eckigen<br />
Rhythmen (z. B. durch Klopfen auf den<br />
Rücken) das Bedürfnis nach Trennung<br />
anzeigen. Die Verwendung von Bewegungsrhythmen<br />
ist uns normalerweise<br />
nicht bewusst.<br />
Paul ist altersentsprechend mitten in<br />
der oralen Phase mit einem ausgewogenen<br />
Anteil von sich hingebenden<br />
Saugrhythmen und ankämpfenden<br />
Beißrhythmen. Das Saugen wird von<br />
Kleinkindern nicht nur funktional,<br />
sondern auch zur Selbstberuhigung<br />
benutzt. Das Beißen dient über seine<br />
Funktionalität hinaus der Abgrenzung,<br />
Differenzierung und späteren Analyse<br />
von Sachverhalten, sowie dem Verabschieden<br />
aus dieser ersten Phase. Wir<br />
würden für Pauls Altersgruppe vielleicht<br />
sogar ein wenig mehr von den Beißrhythmen<br />
erwarten, da dies die Phase<br />
ist, an der er gerade arbeiten sollte. Er<br />
wird vermutlich kein sehr ‚orales Kind’<br />
bleiben.<br />
Andererseits hat Paul schon erstaunlich<br />
viele Rhythmen aus der analen Phase<br />
verfügbar. Das spielerische, flirtende und<br />
schüchterne Sich-Drehen ist sein<br />
präferierter Körperrhythmus, der sogar<br />
die generell in seiner Entwicklungsphase<br />
am häufigsten zu beobachtenden oralen<br />
Rhythmen übertrifft. Hier zeichnet sich<br />
eventuell eine Tendenz zu einer generelle<br />
Präferenz der sich hingebenden Rhythmen<br />
vor den ankämpfenden Rhythmen<br />
ab. Aber auch der Drück- bzw. Halterhythmus,<br />
der bald für die Sauberkeitserziehung<br />
wichtig werden wird, wird von<br />
Paul schon weitgehend beherrscht und<br />
angewandt, es fehlt ihm jedoch noch an<br />
Intensität.<br />
Die anderen Rhythmen sind altersgemäß<br />
noch nicht so stark ausgeprägt, aller-<br />
dings lässt sich auch bei diesen (mit<br />
Ausnahme der urethralen Phase)<br />
eine Präferenz der sich hingebenden<br />
Rhythmen beobachten. Insgesamt zeigt<br />
Paul bei den puren Rhythmen ein 2 : 1-<br />
Verhältnis von ankämpfenden zu sich<br />
hingebenden Rhythmen, was für<br />
potenziell gute Durchsetzungs- und<br />
Abgrenzungsfähigkeit spricht. Bei den<br />
gemischten Rhythmen kehrt sich das<br />
Verhältnis erwartungsgemäß um, was<br />
auf bedarfsgerechte Bedürfnisbefriedigung<br />
und Kompromissfähigkeit<br />
schließen lässt (vgl. Abb. 2).<br />
Spannungsfluss-Eigenschaften<br />
(Tension-flow Attributes)<br />
Spannungsfluss-Attribute beschreiben<br />
die Art und Weise wie wir die Rhythmen<br />
verwenden und die Übergänge<br />
zwischen den Rhythmen. Sie sind<br />
Substrate des Temperamentes einer<br />
Person und dienen dem Ausdruck von<br />
Gefühlen. Sie spiegeln wesentliche<br />
Persönlichkeitsmerkmale sowie Erregungs-<br />
und Ruhezustände wieder.<br />
Die sechs erfassten Attribute sind in<br />
der Entwicklungsreihenfolge:<br />
• anpassend, gleichbleibend,<br />
• geringe Intensität, hohe Intensität,<br />
• graduell und abrupt.<br />
Pauls bevorzugte Spannungsflusseigenschaft<br />
ist die geringe Intensität. Damit<br />
gehört er von seinem Temperament her<br />
zu den gemäßigten Personen. Er befindet<br />
sich im oberen Bereich der geringen<br />
Intensität, da er keinen besonders<br />
hohen neutralen Fluss aufweist (das ist<br />
Bewegung die immer sehr nahe an der<br />
Nulllinie, d. h. dem Übergang von<br />
freiem zu gebundenem Fluss, bleibt).<br />
Auch zeigt er uns in dem kurzen<br />
Beobachtungszeitraum, dass er<br />
durchaus hohe Intensität anwenden<br />
kann, diese allerdings nicht bevorzugt.<br />
Des Weiteren bevorzugt Paul die gleich<br />
bleibende und ebenmäßige Art vor der<br />
anpassenden und wechselhaften.<br />
Ebenso bevorzugt er abrupte Veränderungen<br />
vor graduellen. Allerdings bringt<br />
er die Fähigkeit zu allen anderen<br />
Attributen mit. Generell weist Paul<br />
einen hohen Komplexitätsgrad (Load<br />
Factor) der Spannungsflusseigenschaften<br />
auf, was auf einen differenzierten<br />
Charakter schließen lässt.<br />
Antriebsvorläufer (PreEfforts)<br />
Unter Antriebsvorläufern versteht<br />
man die verschiedenen Arten, auf die<br />
eine Person durch Spannungskontrolle<br />
versucht, mit der physikalischen<br />
Umwelt (Raum, Schwerkraft und Zeit)<br />
zurecht zu kommen. Sie vermitteln<br />
zwischen den inneren Bedürfnissen<br />
(sowie dem Charakter) und der äußeren<br />
Realität. Antriebsvorläufer werden in<br />
Lernsituationen verwendet aber auch<br />
als Abwehrmechanismen. Mit der<br />
Reifung des Individuums entwickeln sie<br />
sich zu Antrieben (Efforts/Loman 1995).<br />
Man kann sie als noch nicht hinreichend<br />
gelernte Antriebe (Efforts)<br />
auffassen. Die Antriebsvorläufer sind<br />
in der Entwicklungsreihenfolge:<br />
• kanalisierend, flexibel,<br />
• vehement/angestrengt,<br />
sachte/vorsichtig,<br />
• plötzlich und zögernd.<br />
Paul bevorzugt den flexiblen Antriebsvorläufer.<br />
Dies ist nicht nur altersentsprechend,<br />
sondern koinzidiert auch mit<br />
der hohen Anzahl von Dreh-Rhythmen,<br />
die wir bei ihm beobachten. Dies deutet<br />
darauf hin, dass er später möglicherweise<br />
den Abwehrmechanismus der<br />
Vermeidung präferieren wird. Sein<br />
bevorzugter Lernstil wird möglicherweise<br />
das Lernen über Assoziationen<br />
und Verknüpfungen sein, und er wird<br />
wahrscheinlich keine Schwierigkeiten<br />
haben den Fokus effizient von einer<br />
Aufgabe zur anderen zu wechseln und<br />
unter Umständen sogar gerne mehrere<br />
Dinge auf einmal tun. Das Kanalisieren<br />
ist verhältnismäßig niedrig bei ihm, als<br />
Vorantrieb für das direkte Verhalten<br />
würden wir hier gerne eine höhere Zahl<br />
sehen, es wird benötigt um sich auf<br />
Aufgaben zu fokussieren, die Aufmerksamkeit<br />
und Konzentration verlangen.<br />
Die relativ hohe Anzahl von angespann-<br />
ten und vehementen Antriebsvorläufer<br />
kann nur unter Berücksichtigung der<br />
Situation interpretiert werden. Da Paul<br />
versuchte nach verschiedenen Gegenständen<br />
zu greifen und diese Fähigkeit<br />
noch nicht beherrschte erklärt sich die<br />
hohe Anzahl hier durch den Kontext.<br />
Die Antriebsvorläufer sachte, plötzlich<br />
und zögernd sind altersentsprechend<br />
noch nicht so weit entwickelt.<br />
Antriebe (Efforts)<br />
Antriebe sind Bewegungsqualitäten, die<br />
innere Einstellungen zu den physikalischen<br />
Realitäten Raum, Schwerkraft<br />
und Zeit repräsentieren. Sie werden als<br />
Bewältigungsmechanismen gegenüber<br />
der realen Umwelt benutzt (Laban<br />
1960). Sie sind gut gelernte Verhaltensweisen<br />
und werden vom Individuum oft<br />
bewusst eingesetzt. Die Antriebe sind in<br />
der Entwicklungsreihenfolge:<br />
• direkt, indirekt,<br />
• stark, leicht,<br />
•<br />
schnell/beschleunigend und<br />
langsam/verlangsamend.<br />
Pauls Antriebsdiagramm ist aufgrund<br />
seines Alters nicht interpretierbar, da
Aktuelles aus der Akademie<br />
Pilotprojekt: Fachqualifikation Motogeragogik <strong>dakp</strong><br />
an der Fachschule in Hamm<br />
Angesichts des demographischen Wandels<br />
wird es immer dringender, die psychomotorischen<br />
Angebote nicht nur für<br />
Kinder, sondern auch für alte Menschen<br />
bereitzustellen. Die ständig wachsende<br />
Zahl der pflegebedürftigen und alterskranken<br />
Menschen, die in Einrichtungen<br />
der stationären oder teilstationären Altenhilfe<br />
leben, bedürfen einer Anregung,<br />
die auf ihre Lebenssituation und ihre<br />
Bedürfnisse abgestimmt ist. Hier greift<br />
das Konzept der Motogeragogik, das seit<br />
Bildungsprämie erhöht<br />
Im Programm „Bildungsprämie“ des Bundesministeriums<br />
für Bildung und Forschung<br />
wurden mit Wirkung zum<br />
1. 1. <strong>2010</strong> die Förderkonditionen ver<br />
Neue DozentInnen-<br />
Sprecher gewählt<br />
Die DozentInnen und Dozenten der<br />
Deutschen Akademie für Psychomotorik<br />
haben auf ihrer letzten Konferenz im<br />
November 2009 drei neue SprecherInnen<br />
für die Arbeit im Kuratorium gewählt.<br />
Einstimmig wurden Fiona Martzy,<br />
Silvia Bender und Hubert Bisping in das<br />
Amt berufen.<br />
vielen Jahren die individuelle psychomotorische<br />
Förderung alter Menschen<br />
verfolgt.<br />
Die Verbreitung dieses Konzepts ist trotz<br />
allgemeiner Bekräftigung, wie wichtig<br />
dieses Thema ist, bislang nur mäßig berücksichtigt<br />
worden. Gerade die Arbeit<br />
in Alten und Pflegeeinrichtungen wird<br />
das pädagogische und therapeutische<br />
Feld der Zukunft. Die Akademie versucht<br />
daher neue Wege einzuschlagen und<br />
hat im letzten Jahr in Kooperation mit<br />
bessert. Einen Prämiengutschein in Höhe<br />
von max. 500 Euro können jetzt alle Erwerbstätigen<br />
erhalten, deren zu versteuerndes<br />
Jahreseinkommen 25 600 Euro<br />
(51 200 Euro bei gemeinsam Veranlagten)<br />
nicht übersteigt. Mit dem höheren<br />
der Fachschule für Motopädie am LWL<br />
Berufskolleg in Hamm, erfolgreich den<br />
ersten Basiskurs „Psychomotorik in<br />
Alten und Pflegeheimen“ durchgeführt.<br />
Um die Fachqualifikation Motogeragogik<br />
<strong>dakp</strong> zu erhalten, konnten die TeilnehmerInnen<br />
zusätzlich einen Kurs zum<br />
Thema „Psychomotorik und Demenz“<br />
absolvieren. Aufgrund der überaus positiven<br />
Erfahrungen werden die SchülerInnen<br />
auch im nächsten Schuljahr wieder<br />
die Gelegenheit haben, die Kurse zu belegen.<br />
Zudem ist angedacht, das Angebot<br />
auf andere Schulen auszuweiten.<br />
Gutscheinwert soll interessierten Personen<br />
mit niedrigem und mittlerem<br />
Einkommen die Finanzierung von umfangreichen<br />
und höherwertigen Weiterbildungen<br />
erleichtert werden. Weitere<br />
Infos unter www.bildungspraemie.info.
<strong>Fortbildungsübersicht</strong> <strong>dakp</strong> <strong>April</strong> <strong>2010</strong> – Juli <strong>2010</strong><br />
<strong>April</strong> <strong>2010</strong><br />
Berufsqualifikation Psychomotorik Kurs 1<br />
Entwicklung wahrnehmen – Entwicklung bewegen<br />
Kurs: 10104<br />
Kurstermin: Mi 07.04.–So 11.04.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Förderschule Schloss Schönefeld, Leipzig<br />
Leitung: Michaela Lamy<br />
Hipphopp aufs Pferd – Hippopädagogik in Praxis und Theorie<br />
(eine Einführung)<br />
Kurs: 10504<br />
Kurstermin: 09.04.–11.04.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Günzach<br />
Leitung: Juliane Deppisch<br />
„Einstein turnt …“ – Bewegung und Bildung<br />
im Kindergarten<br />
Kurs: 10505<br />
Kurstermin: 16.04.–18.04.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Marburg<br />
Leitung: Dr. Richard Hammer,<br />
Prof. Dr. Michael Wendler<br />
Mai <strong>2010</strong><br />
Berufsqualifikation Psychomotorik Kurs 1<br />
Entwicklung wahrnehmen – Entwicklung bewegen<br />
Kurs: 10105<br />
Kurstermin: 10.05.–14.05.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Sportschule Hachen, Sundern<br />
Leitung: Michaela Lamy<br />
Fachqualifikation Psychomotorische Diagnostik<strong>dakp</strong> Modul D2: Diagnostische Verfahren in der Anwendung<br />
Kurs: 10D21<br />
Kurstermin: 14.05.–16.05.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Landesturnschule des NTB, Melle<br />
Leitung: Ingrid Schäfer<br />
Bleibt alles anders – Bewegung im Kindergarten<br />
Kurs: 10506<br />
Kurstermin: 28.05.–30.05.<strong>2010</strong><br />
Kursort: HeilpädagogischIntegrative<br />
Kindertagesstätte Düsseldorf<br />
Leitung: Katrin Nowak<br />
Juni <strong>2010</strong><br />
Berufsqualifikation Psychomotorik Kurs 1<br />
Entwicklung wahrnehmen – Entwicklung bewegen<br />
Kurs: 10106<br />
Kurstermin: Di 01.06.–Sa 05.06.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Institut für soziale Berufe, Ravensburg<br />
Leitung: Peter Bentele, Helge Afflerbach<br />
Graphomotorik – von den ersten Spuren bis zum Schreiben<br />
Kurs: 10507<br />
Kurstermin: 11.06.–13.06.<strong>2010</strong><br />
Kursort: PaulMoorSchule Königswinter<br />
Leitung: Ingrid Schäfer<br />
Juli <strong>2010</strong><br />
Berufsqualifikation Psychomotorik Kurs 1<br />
Entwicklung wahrnehmen – Entwicklung bewegen<br />
Kurs: 10107<br />
Kurstermin: 12.07.–16.07.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Landesturnschule des NTB, Melle<br />
Leitung: Jan Schulz, Dr. Jörg Schröder<br />
Fachqualifikation Trampolinspringen in der<br />
Psychomotorik<strong>dakp</strong> Kurs: 10601<br />
Kurstermin: 26.07.–30.07.<strong>2010</strong><br />
Kursort: Landesturnschule des NTB, Melle<br />
Leitung: Gaby Christlieb, Manfred Reuter<br />
Detaillierte Informationen zu den Kursen finden Sie unter<br />
www.<strong>dakp</strong>.de<br />
Möglichkeiten zur Anmeldung und Anforderung des aktuellen<br />
Fortbildungsprogramms:<br />
Deutsche Akademie für Psychomotorik<br />
Kleiner Schratweg 32, 32657 Lemgo<br />
Tel. 05261 970971, Fax. 05261 970972<br />
www.<strong>dakp</strong>.de, info@<strong>dakp</strong>.de
Übersicht regionale Fachveranstaltungen des AKP<br />
<strong>April</strong> <strong>2010</strong><br />
Bewegung von Anfang an –<br />
motorische Kompetenzen im Kleinkindalter erkennen<br />
Veranstaltung: WL0410<br />
Termin: Mo 19.04.<strong>2010</strong>, 9.00–15.30 Uhr<br />
Ort: Dortmund<br />
Referentinnen: Linda Adam und Bianca Zacharias<br />
Vom ersten Schrei zum ersten Schritt – ein Vortrag<br />
Veranstaltung: NR0410<br />
Termin: Mi 21.04.<strong>2010</strong>, 19.00 bis 21.00 Uhr<br />
Ort: Düsseldorf<br />
Referentin: Dr. Stefanie Kuhlenkamp<br />
Geo Caching<br />
Veranstaltung: KB0410<br />
Termin: 24.04.<strong>2010</strong><br />
Ort: Brunnenhaus in Dabringhausen<br />
Referent: Tim Niepalla<br />
Ich lerne das spielend – Gesellschaftsspiele in Bewegung<br />
mit Schul- und Alltagsmaterialien<br />
Veranstaltung: SL0410<br />
Termin: 24.04.<strong>2010</strong><br />
Ort: Neunkirchen<br />
Referentin: Carola Gerstmann<br />
Mai <strong>2010</strong><br />
Gewalt bewegt – Wege aus der Gewalt<br />
Veranstaltung: HEHN0510<br />
Termin: 08.05.<strong>2010</strong><br />
Ort: Marburg<br />
Referent: Dr. Holger Jessel<br />
Schokolade fürs Gehirn<br />
Veranstaltung: SA0510<br />
Termin: 08.05.<strong>2010</strong><br />
Ort: Dresden<br />
Referentin: Dorothea Beigel<br />
Juni <strong>2010</strong><br />
Kindliche Entwicklung spielend erkennen und<br />
spielend fördern<br />
Veranstaltung: NR0610<br />
Termin: 19.06.<strong>2010</strong><br />
Ort: Düsseldorf<br />
Referentin: Fiona Martzy<br />
Das Gleichgewicht – Bildung braucht Bewegung<br />
Veranstaltung: HEHN0610<br />
Termin: 19.06.<strong>2010</strong><br />
Ort: Marburg<br />
Referent: Thorsten Späker<br />
Gewalt bewegt – Wege aus der Gewalt<br />
Veranstaltung: RP0610<br />
Termin: 19.06.<strong>2010</strong><br />
Ort: Landau<br />
Referent: Dr. Holger Jessel<br />
Detaillierte Informationen zu den Inhalten,<br />
Preisen und Anmeldemodalitäten aller<br />
Veranstaltungen finden Sie unter<br />
www.psychomotorik.com<br />
Aktionskreis Psychomotorik<br />
Kleiner Schratweg 32, 32657 Lemgo<br />
Tel. 05261 970970, Fax. 05261 970972<br />
akp@psychomotorik.com
Ideen für die psychomotorische Praxis<br />
Praxis konkret im (Förder-)Schulalltag<br />
Im Förderschulalltag sind zahlreiche<br />
Differenzierungen notwendig, die eine<br />
konkrete Anwendung in der Zusammenarbeit<br />
in heterogenen Gruppen im<br />
schulischen und außerschulischen<br />
Beispiel 1:<br />
Seilschaften auf dem Trampolin<br />
Material: verschiedenfarbige Seile,<br />
Trampolin<br />
Umsetzung: Die Kinder erproben auf<br />
dem Trampolin verschiedene Aufgaben<br />
mit Seilen in Einzel und Kleingruppenerfahrungen.<br />
Differenzierungen:<br />
• Seile über das Trampolintuch spannen.<br />
• Überqueren des Tuches ohne Seile zu<br />
berühren.<br />
• Bei verschiedenfarbigen Seilen: z. B.<br />
springe zwischen das rote und das<br />
grüne Seil; springe, so dass du mit<br />
einem Fuß auf dem gelben und mit<br />
dem anderen Fuß auf dem blauen<br />
Seil landest.<br />
Beispiel 2: Der verlorene Schlüssel<br />
Material: verschiedene Schlüssel, Truhe<br />
Umsetzung: Die Kinder wählen je<br />
weils mit verschlossenen Augen einen<br />
Schlüssel aus einer Truhe aus, befühlen<br />
ihn, legen ihn wieder in die Truhe und<br />
sollen diesen dann mit geöffneten Augen<br />
wieder finden.<br />
Differenzierungen:<br />
• Die Kinder schauen sich einen<br />
Schlüssel an und sammeln gemeinsam<br />
Kriterien, die zur Beschreibung<br />
eines Gegenstandes nützlich erscheinen<br />
(z. B. Größe, Farbe, Gewicht<br />
(Material), Form, …).<br />
• Die Kinder befühlen jeweils einen<br />
Schlüssel. Es werden ihnen verschie<br />
Kontext ermöglichen. Die Praxissequenzen<br />
verdeutlichen, wie bestimmte<br />
Aufgaben zu einem speziellen Thema<br />
für verschiedene Zielgruppen differenziert<br />
werden können und müssen, um<br />
• Seile können von verschiedenen<br />
Personen außen in unterschiedlicher<br />
Höhe gehalten werden; das Kind auf<br />
dem Tuch soll nun über die Seile gehen<br />
oder springen.<br />
• Der Springer springt über ein von<br />
außen gehaltenes Seil verschiedene<br />
„Kunststücke“, z. B. Sitzsprung, halbe<br />
Drehung u. a.<br />
• Zwei Personen halten von außen ein<br />
Seil über die kurze Seite des Trampolintuches;<br />
der Springer springt über<br />
das Seil; Höhen variabel.<br />
dene Fotos mit Schlüsseln vorgelegt<br />
und sie sollen das entsprechende<br />
Foto ihrem Schlüssel zuordnen.<br />
• Ein Kind befühlt einen Schlüssel und<br />
beschreibt dies. Ein anderes Kind<br />
sucht ein entsprechendes Foto heraus,<br />
das zu der Beschreibung des<br />
Schlüssels passt.<br />
• Ein Kind befühlt einen Schlüssel und<br />
versucht sich, dessen Merkmale einzuprägen;<br />
alle Schlüssel kommen in<br />
einen Sack und der geht so lange<br />
herum, bis jedes Kind seinen Schlüssel<br />
wieder gefunden hat.<br />
• Jeweils zwei Kinder bilden ein Paar.<br />
Sie erhalten zwei Schlüssel, die sie<br />
nacheinander befühlen. Anschließend<br />
beschreiben die Kinder die<br />
Merkmale der einzelnen Schlüssel<br />
und beschreiben, worin sich diese<br />
bei den beiden Schlüsseln unterscheiden.<br />
• Die Kinder befühlen jeweils einen<br />
Schlüssel und machen sich selbst ein<br />
Bild von ihrem Schlüssel. Sie beschreiben<br />
die Eigenschaften des<br />
Fördersequenzen in stark heterogenen<br />
Gruppen für alle Beteiligten ansprechend<br />
und gewinnbringend zu gestalten.<br />
• Zwei Kinder schlagen das Seil und<br />
stehen dabei an den kurzen Seiten<br />
des Trampolins; sie singen dazu ein<br />
Lied, das zum Seilchenspringen passt<br />
und der Springer passt seine Sprünge<br />
dem Liedtext an.<br />
• Das Kind schlägt das Seil selbstständig<br />
und führt Seilchenspringen auf<br />
dem Trampolintuch aus; dabei kann<br />
es die Sprünge variieren, z. B.:<br />
– Doppelter oder dreifacher Seilumschlag;<br />
– Überkreuzen der Arme vor dem<br />
Körper während des Springens;<br />
– Seil rückwärts schlagen;<br />
– Sitzsprung während des Seilchenschlagens;<br />
– Drehung während des Seilchenschlagens.<br />
Schlüssels (Form, Größe, Besonderheiten<br />
…).<br />
• Die Kinder befühlen einen Schlüssel<br />
und machen sich selbst ein Bild von<br />
dem Schlüssel. Dabei können sie sich<br />
Fragen stellen, wie z. B.: in welches<br />
Schloss könnte der Schlüssel passen,<br />
eine Tür, ein Tor, eine Schatzkiste, …?<br />
Was ist hinter dem Schloss bzw. was<br />
könnte mich erwarten, wenn ich das<br />
Schloss aufschließe?<br />
Quelle: Lücking, C./Reichenbach, C. (2009):<br />
Praxis konkret im (Förder-)Schulalltag. Förderung<br />
von Kindern mit Förderbedarf in der<br />
körperlich-motorischen, sozial-emotionalen,<br />
sprachlich-kommunikativen und geistigen Entwicklung.<br />
Dortmund: verlag modernes lernen.
Säuglinge in seinem Alter Bewegung in<br />
den meisten Fällen noch nicht bewusst<br />
oder gut gelernt einsetzen. Bei Paul<br />
konnte im analysierten Videoauszug<br />
lediglich zweimal der Antrieb direkt<br />
beobachtet werden. Diese Beobachtung<br />
bezog sich auf sein Blickverhalten, als<br />
er ein Objekt fixierte. Direkt dient der<br />
Aufmerksamkeit z. B. sich lange einer<br />
Aufgabe zuzuwenden, die hohe Konzen-<br />
tration erfordert, wie z. B. später das<br />
wissenschaftliche Arbeiten.<br />
Bipolarer Formfluss<br />
(Bipolar Shape-flow)<br />
Formfluss bezeichnet die kontinuierliche<br />
Veränderung der Form der<br />
Bewegung. Der Formfluss hat seinen<br />
Ausgangspunkt in der Atmung. Mit<br />
jedem Einatmen füllt sich der Körper<br />
und wächst in alle Dimensionen, mit<br />
jedem Ausatmen schrumpft der Körper<br />
in allen Dimensionen. Das Wachsen<br />
erhöht den Körperkontakt zur Umwelt<br />
und das sich Zurückziehen verringert<br />
ihn.<br />
Der Bipolare Formfluss ist die Ausdehnung<br />
oder das Zurückziehen des Körpers<br />
in beide Richtungen vom Körperzentrum<br />
aus oder vom Zentrum eines<br />
Körperteils. Er gibt uns Auskunft über<br />
das Wohlbefinden des Individuums in<br />
seiner derzeitigen Umwelt und über<br />
Gefühle gegenüber sich selbst. Er<br />
bezieht sich auf Reaktionen gegenüber<br />
der generellen äußeren oder inneren<br />
Umwelt. Der Bipolare Formfluss be-<br />
steht in der Entwicklungsreihenfolge<br />
aus:<br />
• sich weiten, sich verengen,<br />
• sich verlängern, sich verkürzen,<br />
• sich auswölben und<br />
sich aushöhlen.<br />
Paul wendet am häufigsten das Sich-<br />
Weiten an. Dies ist jedoch im Lichte<br />
dessen zu sehen, dass er das Sich-<br />
Verengen noch nicht ganz beherrscht.<br />
Beide Formflussqualitäten finden in der<br />
horizontalen Ebene statt. Das Sich-<br />
Weiten steht für Vertrauen und sich<br />
wohl fühlen in seiner Umwelt und für<br />
Gefühle der Omnipotenz und Großzügigkeit<br />
wird es später als präferierte<br />
Haltung beibehalten. Das Sich-Verengen<br />
steht für Gefühle des Misstrauens, der<br />
Selbstkontrolle und des Geizes, es ist<br />
für ein Kind nötig, um der Omnipotenz<br />
entgegenzuwirken und sich abgrenzen<br />
zu lernen. Die vertikale und sagittale<br />
Bewegungsdimensionen sind altersentsprechend<br />
noch wenig ausgebildet und<br />
sollen hier nicht näher behandelt<br />
werden. Insgesamt überwiegen bei Paul<br />
die wachsenden Elemente gegenüber<br />
den sich zurückziehenden im Verhältnis<br />
von 16 : 8. Es ist zwar generell wünschenswert,<br />
dass die wachsenden<br />
Elemente überwiegen, jedoch erwarten<br />
wir bei Paul einen Zuwachs an sich<br />
zurückziehenden Elementen, der ihm<br />
helfen wird, seiner Umwelt (oder sich<br />
selbst) nicht unverhältnismäßig zu<br />
vertrauen.<br />
Unipolarer Formfluss<br />
(Unipolar Shape-flow)<br />
Beim Unipolaren Bewegungsfluss<br />
bewegt sich der Körper ausgehend von<br />
seinem Zentrum (Torso) hin zu oder fort<br />
von einem anziehenden oder zurückstoßenden<br />
Stimulus. Auch hier geht es um<br />
ein sich Ausdehnen oder sich Zurückziehen<br />
(in Abgrenzung zu gezielter<br />
Bewegung) jedoch in Bezug auf einen<br />
diskreten Reiz. Die Komponenten des<br />
Unipolaren Formflusses sind in der<br />
Entwicklungsreihenfolge:<br />
• sich weiten, sich verengen,<br />
• sich nach oben verlängern und sich<br />
nach oben verkürzen, sich nach unten<br />
verlängern und sich nach unten<br />
verkürzen,<br />
• sich nach vorne auswölben (zu etwas<br />
vor mir hin) und sich nach vorne<br />
aushöhlen (von etwas vor mir fort)<br />
und sich nach hinten auswölben und<br />
sich nach hinten aushöhlen.<br />
Paul wendet stärker als seine eigentlich<br />
primäre Ebene (die Horizontale) Sich-<br />
Annähern und Sich-Zurückziehen in der<br />
vertikalen Ebene an. Dies mag zum Teil<br />
kontextspezifische Gründe haben (Reize<br />
von ,oben‘ oder ,unten‘ in der Situation<br />
aus seiner Perspektive betrachtet). Zum<br />
anderen ist es auch möglich, dass er<br />
bereits verstärkt an der Exploration der<br />
beiden Körperhälften arbeitet und obere<br />
und untere Funktionsweisen entdeckt.<br />
Der Anteil der wachsenden Elemente<br />
gegenüber den sich Zurückziehenden ist<br />
hier 29 : 27. Das Sich-Annähern über-<br />
wiegt leicht dem Sich-Zurückziehen.<br />
Der Anteil des Sich-Zurückziehens<br />
mag unter anderem so hoch sein,<br />
weil Paul am Ende des analysierten<br />
Videosegmentes ermüdete und sich<br />
von da an generell stärker von den<br />
auf ihn einströmenden Stimuli zurückzog.<br />
Richtungsbewegungen<br />
(Shaping in Directions)<br />
Beim den Richtungsbewegungen<br />
bewegen sich Körperteile in Vektor-<br />
oder Bogenform in den Raum und<br />
stellen so Brücken zwischen dem Selbst<br />
und Personen/Objekten her. Es spielt<br />
eine wichtige Rolle beim Entstehen von<br />
Objektkonstanz und beim Erkennen von<br />
Selbst und Objekt als zwei unterschiedliche<br />
Entitäten. Richtungsbewegungen<br />
werden zum Selbstschutz und zur<br />
Selbstverteidigung gebraucht, sowie<br />
zum Strukturieren von Lernsituationen.<br />
Ihre Elemente sind in der Entwicklungs-<br />
reihenfolge:<br />
• seitwärts, quer,<br />
• nach oben, nach unten,<br />
• nach vorne und nach hinten.<br />
Paul zeigt auch hier überwiegend offene<br />
Formen mit Präferenzen für seitwärts,<br />
nach oben und vorwärts. Dies lässt<br />
auf eine Tendenz zur aktiven und<br />
offenen Verteidigung schließen. Auch<br />
mag sich hier andeuten, dass sein<br />
Lernstil später neben dem Assoziationslernen<br />
aus erklärungssuchendem<br />
Verhalten (aufblickend, bestätigungssuchend<br />
und hilfesuchend) bestehen<br />
wird. Des Weiteren gibt es einen<br />
Hinweis darauf, dass er später gut in<br />
der Lage zu sequentiellem, deduktiven<br />
Lernen sein wird, und Konsequenzen<br />
gut abschätzen kann.<br />
Formen (Shaping in Planes)<br />
Das Formen in Ebenen ist der Ausdruck<br />
von komplexen Objektbeziehungen. Wie<br />
auch bei den Richtungsbewegungen<br />
bezieht es sich auf die Körperebenen<br />
der Horizontalen (Breite), Vertikalen<br />
(Länge) und der Sagittalen (Tiefe).<br />
Die Elemente des Formens sind in der<br />
Entwicklungsreihenfolge:<br />
• ausbreiten, einschließen,<br />
• steigen/heben, sinken/senken,<br />
•<br />
vordringen und zurückweichen.<br />
Auch hier ist Pauls Diagramm aufgrund<br />
der geringen Beobachtungszahlen (
24<br />
Entwicklungsdiagnostik mit dem Kestenberg Movement Profile (KMP)<br />
dazu dient, kleine Raumareale oder<br />
Einzelobjekte zu explorieren, sich auf<br />
dyadische Beziehungen einzulassen<br />
sowie fokussierte Aufmerksamkeit<br />
herzustellen. Aber auch das Ausbreiten<br />
hat er in seinem Bewegungsrepertoire.<br />
Dieses dient der Exploration von großen<br />
Räumen und der Fähigkeit, sich auf<br />
multiple Beziehungen oder Beziehungen<br />
zu sich bewegenden Objekten<br />
einzulassen. Diese Fähigkeit ist auch<br />
wichtig für das aufmerksame Zuhören.<br />
Die anderen Ebenen sind aufgrund der<br />
geringen Beobachtungsanzahlen nicht<br />
interpretierbar.<br />
Zusammenfassende<br />
Entwicklungsdiagnostik Pauls<br />
Paul zeigt entwicklungs- und altersentsprechend<br />
die stärksten Ausprägungen<br />
zumeist in den ersten beiden Bewegungsparameter<br />
jeden Diagramms.<br />
Bei den Rhythmen verwendet er jedoch<br />
seiner Entwicklung vorgreifend mehr<br />
anale als orale Rhythmen. Insbesondere<br />
der Dreh-Rhythmus mit seinen spielerischen<br />
Bewegungen steht im Vordergrund.<br />
Für diesen hat er auch eine<br />
bereits vorhandene Struktur vonseiten<br />
des Unipolaren Bewegungsflusses zur<br />
Verfügung. Das Verhältnis von ankämpfenden<br />
und sich hingebenden Rhythmen<br />
lässt auf eine gesunde Entwicklung<br />
des Säuglings im Ausdruck der eigenen<br />
Bedürfnisse und in einem späteren<br />
Umgang mit der Ablösungsproblematik<br />
schließen.<br />
Von seinem Temperament steht er eher<br />
auf der gemäßigten Seite: geringe<br />
Gefühlsintensität, Ebenmäßigkeit und<br />
eine Vorliebe für abrupte Veränderungen<br />
(in der Negativausprägung: Impulsivität<br />
und Ungeduld) zeigen sich hier. Die<br />
Antriebsvorläufer zeigen einen hohen<br />
Grad von Flexibilität, was darauf<br />
schließen lässt, dass sein bevorzugter<br />
Abwehrmechanismus später möglicherweise<br />
die Vermeidung sein wird. Als<br />
Lernstil wird er vermutlich Assoziations-<br />
und Verbindungslernen präferieren.<br />
Aufseiten des Formenflusses zeichnet<br />
sich ab, dass sich Paul in seiner Um-<br />
gebung und mit sich selbst sehr wohl<br />
fühlt. Fast ein wenig zu wohl, da er in<br />
einer ihm fremden Umgebung beobachtet<br />
wurde. Allerdings ist Paul noch<br />
mitten in der Entwicklung der geschlossenen<br />
Bewegungsparameter, was den<br />
Überschuss an offenen Bewegungs-<br />
parametern vorläufig erklärt. Sollte sich<br />
dieser jedoch nicht ändern, so muss<br />
weiter nachgedacht werden, wie dem<br />
Kind ein vernünftiges Ausmaß an<br />
Vorsicht vermittelt werden kann. Paul<br />
zeigt ein balanciertes Maß an Annäherungs-<br />
vs. Vermeidungsverhalten gegen-<br />
über diskreten Reizen und ausgewogene<br />
Parameter beim Dimensionalen Formen<br />
sowie Ebenenformen.<br />
Das KMP zeigt, dass Paul altersgemäß<br />
entwickelt ist. Z. T. ist er seiner Entwicklung<br />
sogar voraus und zeigt bereits<br />
Bewegungselemente aus späteren<br />
Stufen. Beim Formenfluss ist er stark<br />
auf der offenen, vertrauenden Seite und<br />
muss noch lernen sich zu schützen.<br />
Er hinterlässt insgesamt einen balancierten<br />
und ausgeglichenen Eindruck,<br />
der sich in einer ausgewogenen Anzahl<br />
hingebender und ankämpfender<br />
Qualitäten und weiteren beobachteten<br />
Bewegungsmerkmalen manifestiert.<br />
Diagnostik bei Entwicklungspathologien,<br />
-verzögerungen<br />
und Traumata<br />
Im Unterschied zu Paul, der ein normal<br />
entwickelter Säugling ist, haben wir es<br />
in der therapeutischen Arbeit mit einer<br />
Vielzahl von Entwicklungspathologien<br />
zu tun: Kinder mit Autismus, Down-<br />
Syndrom, ADHS, und anderen klinischen<br />
und Verhaltensauffälligkeiten gehören<br />
zu unserer zentralen Zielgruppe.<br />
Das KMP eignet sich als diagnostisches<br />
Instrument für alle Kinder von 0–6 und<br />
darüber hinaus für alle weiteren Alters-<br />
gruppen, bei denen frühe Traumata und<br />
Erfahrungen aus der Zeit von 0–6 für<br />
den therapeutischen Prozess relevant<br />
sind. Zudem für alle nonverbalen<br />
Patienten, z. B. autistische Kinder,<br />
behinderte Kinder, etc., da das Assessment<br />
ausschließlich aus nonverbalen<br />
Daten durchgeführt wird. Beobachtet<br />
man Kinder oder auch Erwachsene<br />
im Interview, oder therapeutischen<br />
Gespräch vom Band, so dreht man den<br />
Ton für die Beobachtung komplett ab.<br />
Der Inhalt des Gesagten wird nur<br />
genutzt, um den Kontext des Assessments<br />
darzustellen (im Einbezug des<br />
Verbalen liegen hier in der Tat weitere<br />
Analysemöglichkeiten, die noch nicht<br />
ausgeschöpft sind). Die Kamera sollte<br />
immer von zwei Perspektiven aufneh-<br />
men, um alle Bewegungsebenen gut<br />
beobachtbar abzubilden.<br />
Wie in der Beispielbeschreibung, erstellt<br />
man im diagnostischen Prozess ein<br />
komplettes Profil, welches über Stärken<br />
und Schwächen, persönliche Vorlieben<br />
(z. B. auch Lernstile), Abwehrmechanismen,<br />
Entwicklungsverzögerungen und<br />
-vorsprünge auf der nonverbalen Ebene<br />
differenziert informiert. Von diesem<br />
Assessment ausgehend, plant man die<br />
Interventionen und fördert die schwa-<br />
chen bzw. entwicklungsverzögerten<br />
Bereiche. Von der Leib-Seele-Einheit<br />
ausgehend wird angenommen, dass<br />
Veränderungen auf der motorischen<br />
Ebene auch Veränderungen auf der<br />
affektiven, kognitiven und Verhaltensebene<br />
nach sich ziehen.<br />
Für die Interaktionsanalyse macht man<br />
bspw. Beobachtungen der familiären<br />
Interaktion (am besten im häuslichen<br />
Kontext) und sieht sich dann die Anzahl<br />
von Annäherungs- vs. Vermeidungsverhalten,<br />
von hingebenden und<br />
ankämpfenden Qualitäten in der<br />
Interaktion der Familienmitglieder an.<br />
So lässt sich bspw. bei Verdacht auf<br />
sexuellen oder anders gearteten<br />
Missbrauch durch die Quantifizierung<br />
von Interaktionsmustern zur Klärung<br />
der Situation beitragen.<br />
Fazit<br />
Mit dem Kestenberg Movement Profil<br />
(KMP) bietet sich ein Instrument, das<br />
Bewegung und Bedeutung hochgradig<br />
differenziert und gleichzeitig auf einige<br />
wenige Basisdimensionen reduzierbar<br />
konzeptualisiert. Das KMP unterscheidet<br />
sich substanziell von herkömmlichen<br />
Bewegungsanalysesystemen,<br />
dadurch dass es neben Häufigkeitsinformation<br />
auch kontinuierliche Daten<br />
erfasst (Rhythmen und Attribute).<br />
Theoriebasiert liefert es im diagnostischen<br />
Prozess Anhaltspunkte über die<br />
individualpsychologische Entwicklung,<br />
die präverbale Kommunikation und<br />
Interaktion, deren Barrieren und<br />
Präferenzen, sowie vielfältige Hypothesen<br />
über die Verknüpfung von Bewegung<br />
und Bedeutung, die im Rahmen<br />
der Behandlung und Interventionsplanung<br />
hilfreich sein können. Da viele<br />
Aspekte dieser Bewegungs-Bedeutung-<br />
Theorie bislang noch nicht validiert sind<br />
(Koch 2009), sollte es insbesondere in
der Individualdiagnostik nur in diesem<br />
hypothesengenerierenden und -<br />
überprüfenden Sinn eingesetzt werden.<br />
Durch seinen Reichtum ist das KMP für<br />
die Psychomotorik ein geeignetes<br />
Instrument, das die stärker funktional<br />
orientierte Diagnostik um den psychologisch-psychodynamische<br />
Aspekt<br />
ergänzt und damit eine wichtige<br />
Funktion im diagnostischen Prozess<br />
einer umfassenden Psychomotorik<br />
erfüllt.<br />
Literatur<br />
Bender, S. (2007): Die psychophysische<br />
Bedeutung der Bewegung.<br />
Ein Handbuch der Laban<br />
Bewegungsanalyse und des<br />
Kestenberg Movement Profiles.<br />
Berlin: Logos.<br />
Eberhard, M. (2007): Tabellarische<br />
Arbeitshilfen zur Diagnostik und<br />
Interventionsplanung mit dem<br />
KMP. In: S. C. Koch/S. Bender<br />
(Eds), Movement Analysis –<br />
Bewegungsanalyse. The Legacy<br />
of Laban, Bartenieff, Lamb, and<br />
Kestenberg (pp. 65–86). Berlin:<br />
Logos.<br />
Freud, A. (1965). Normality and<br />
Pathology in Childhood. In The<br />
Writings of Anna Freud, Vol. 6.<br />
New York: International<br />
University Press.<br />
Kestenberg, J. S./Sossin, K. M. (1973/<br />
1979): The role of movement<br />
patterns in development, Vol.<br />
1 + 2. New York: Dance Notation<br />
Bureau Press.<br />
Kestenberg, J. S. (1995): Sexuality,<br />
body movement and rhythms of<br />
development. Northvale: Jason<br />
Aronson (Originally published in<br />
1975 under the title Parents and<br />
Children).<br />
Kestenberg-Amighi, J./Loman, S./<br />
Lewis, P./Sossin, M. (1999): The<br />
Meaning of Movement. Developmental<br />
and Clinical Applications<br />
of the Kestenberg Movement<br />
Profile. Williston, VT: Gordon/<br />
Breach.<br />
Koch, S. C. (2006): Gender at work:<br />
Differences in use of rhythms,<br />
efforts, and preefforts. In: S. C.<br />
Koch/I. Bräuninger (Eds.),<br />
Advances in dance/movement<br />
therapy. Theoretical perspectives<br />
and empirical findings (pp. 116–<br />
127). Berlin: Logos.<br />
Koch, S. C. (2009): Embodiment. Der<br />
Einfluss von Eigenbewegung auf<br />
Affekt, Einstellung und Kognition.<br />
Experimentelle Grundlagen<br />
und klinische Anwendungen.<br />
Universität Heidelberg: Unveröffentlichte<br />
Habilitationsschrift.<br />
Koch, S./Cruz, R./Goodill, S. W.<br />
(2002): The Kestenberg Movement<br />
Profile (KMP): Reliability<br />
of novice raters. American<br />
Journal of Dance Therapy, 23(2),<br />
71–88.<br />
Laban, R. von (1960): The Mastery<br />
of Movement. London: MacDonald/Evans.<br />
Laban, R. von/Lawrence, F. C.<br />
(1974): Effort: Economy in body<br />
movement. Boston, MA: Plays.<br />
(Originally published in 1947).<br />
Lamb, W. (1965): Posture and<br />
Gesture. London: Gerald<br />
Duckworth.<br />
�����������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Claudia Kugelmann, von der<br />
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-<br />
Universität Nürnberg-Erlangen und der Akademie für Psychomotorik<br />
und Motopädie von Dr. Andrzej Majewski erhalten<br />
��������������������<br />
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.<br />
Regionalverband Mittelfranken<br />
Ute Ulsenheimer<br />
Tel. 09171 843788<br />
roth@juh-bayern.de<br />
Lewis, P./Loman, S. T. (1990): The<br />
Kestenberg Movement Profile: Its<br />
past, present applications and<br />
future directions. Keene, NH:<br />
Antioch New England Graduate<br />
School.<br />
Loman, S. T. (Ed.) (1995): Training<br />
Manual for the Kestenberg<br />
Movement Profile. Keene, NH:<br />
Antioch New England Graduate<br />
School.<br />
Loman, S. T. (2007): The KMP and<br />
pregnancy: Developing early<br />
empathy through notating fetal<br />
movement. In: S. C. Koch/S.<br />
Bender (Eds.), Movement<br />
analysis – Bewegungsanalyse.<br />
The legacy of Laban, Bartenieff,<br />
Lamb and Kestenberg (pp. 187–<br />
194). Berlin: Logos.<br />
Lotan, N./Yirmiya, N. (2002): Body<br />
movement, presence of parents,<br />
and the process of falling asleep<br />
in toddlers. International Journal<br />
of Behavioral Development,<br />
26(1), 81–88.<br />
Romer, G. (1980): Choreographie<br />
einer haltenden Umwelt: Die<br />
frühe Mutter-Kind-Beziehung in<br />
Bewegungsmustern. In: K.<br />
Hörmann (Hrsg.), Tanztherapie.<br />
Göttingen: <strong>Verlag</strong> für Angewandte<br />
Psychologie.<br />
Sossin, K. M. (1987): Reliability of<br />
the Kestenberg Movement<br />
Profile. Movement Studies – a<br />
Journal of the Laban Bartenieff<br />
Institute for Movement Studies:<br />
Observer Agreement, 2, 1987.<br />
Sie eine praxisorientierte und fundierte Ausbildung zum Thema<br />
Motopädie und Psychomotorik. Die Ausbildung umfasst 20<br />
Ausbildungstage verteilt auf ein Jahr. Anerkannt vom Bayer.<br />
Kultusministerium als Lehrerfortbildung für alle Schulen.<br />
Dr. Andrzej Majewski<br />
www.majewski-akademie.de<br />
25
26<br />
Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik<br />
Holger Jessel<br />
Im Sinne des Menschen –<br />
Ressourcenorientierung in der<br />
psychomotorischen Diagnostik<br />
Einleitung<br />
„Man muss einfach diesen unerschütterlichen Glauben<br />
an das große Potenzial jedes Menschen haben. (…)<br />
Zweifeln Sie an der Besonderheit eines Menschen,<br />
mit dem Sie arbeiten, dann spürt er das und Sie schränken ihn ein.<br />
Wenn also ein Kind sein Potenzial nicht voll ausschöpfen kann,<br />
dann ist das mein Fehler, nicht der des Kindes.“<br />
(Royston Maldoom)<br />
Der Begriff der Ressourcenorientierung<br />
entfaltet – ähnlich wie der der Lösungsorientierung<br />
– seit geraumer Zeit eine<br />
beeindruckende Suggestivkraft. Er ist<br />
jedoch in der konkreten Beziehungsgestaltung<br />
mit Klienten und im Rahmen<br />
der Theoriebildung mit besonderen<br />
Herausforderungen und Ambivalenzen<br />
verbunden. Die Zustimmung beruht vor<br />
allem auf den zahlreichen Hoffnungen<br />
(u. a. auf gelingende Lebensgestaltung,<br />
gesunde Entwicklung, Zukunftschancen,<br />
Kostenreduzierung), die mit dem Begriff<br />
assoziiert werden. Dies ist ein Aspekt,<br />
der insbesondere im Kontext schwieriger<br />
Entwicklungszusammenhänge und<br />
Sozialisationsbedingungen (vgl. u. a. die<br />
zahlreichen Forschungsergebnisse zu<br />
Desintegrationsprozessen, neuer Armut<br />
oder Bildungsbenachteiligung (u. a.<br />
Armbruster 2006)) eine hohe Relevanz<br />
besitzt.<br />
Die Herausforderung besteht jedoch<br />
darin, dass der Begriff eine nur scheinbar<br />
eindeutige Beschreibung für ein<br />
hochkomplexes Beziehungsphänomen<br />
darstellt, welches eng an die Auseinandersetzung<br />
mit der eigenen Haltung<br />
und dem Menschenbild als Psychomotoriker<br />
gekoppelt ist. Eine solche<br />
Haltung basiert keineswegs auf der<br />
bloßen Anwendung von Techniken und<br />
Methoden, sondern setzt ein hohes<br />
Maß an Eigenerfahrung sowie die<br />
Bereitschaft zur permanenten Selbstreflexion<br />
der Professionellen voraus.<br />
Dies ist nicht zuletzt deshalb entscheidend,<br />
weil Kinder und Jugendliche in<br />
der Art und Weise, wie sie von Eltern<br />
und Professionellen wahrgenommen<br />
werden, nicht nur erkennen, „wer sie<br />
selbst sind, sondern vor allem auch, wer<br />
sie sein könnten, das heißt, worin ihre<br />
Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
bestehen“ (Bauer 2007, 26 f.).<br />
In den Worten von Max Frisch: „Auch<br />
wir sind die Verfasser der anderen; wir<br />
sind auf eine heimliche und unentrinnbare<br />
Weise verantwortlich für das<br />
Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich<br />
nicht für ihre Anlage, aber für die<br />
Ausschöpfung dieser Anlage“ (Frisch<br />
1985, 29).<br />
In diesem Zusammenhang geht es vor<br />
allem um Resonanz sowie um Zuwendung,<br />
Zuversicht und Vertrauen in die<br />
Fähigkeiten, Ressourcen, Stärken und<br />
Kompetenzen der Klienten(systeme),<br />
wobei entscheidend ist, dass all diese<br />
Aspekte in erster Linie implizit bzw.<br />
zwischenleiblich, d. h. vor einer bewussten<br />
Reflexion, kommuniziert werden<br />
(vgl. u. a. MerleauPonty 1966). Dieser<br />
Aspekt hat zahlreiche Konsequenzen<br />
für ressourcenorientiertes Arbeiten im<br />
Rahmen der Psychomotorik, die im<br />
Schlusskapitel diskutiert werden.<br />
Zunächst soll jedoch der Ressourcenbegriff<br />
kurz charakterisiert werden.<br />
Der Begriff der Ressource<br />
Als Ressource kann einerseits jeder<br />
Aspekt des seelischen Geschehens<br />
sowie der gesamten Lebenssituation<br />
eines Klienten aufgefasst werden;<br />
hierzu gehören z. B. „motivationale<br />
Bereitschaften, Ziele, Wünsche, Abnei<br />
gungen, Interessen, Überzeugungen,<br />
Werthaltungen, Geschmack, Einstellungen,<br />
Wissen, Bildung, Fähigkeiten,<br />
Gewohnheiten, Interaktionsstile,<br />
physische Merkmale wie Aussehen,<br />
Kraft, Ausdauer, finanzielle Möglichkeiten<br />
und das gesamte Potenzial der<br />
zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
eines Menschen“ (Grawe 1998, 34).<br />
Andererseits stellt all das zunächst nur<br />
den gegenwärtigen Möglichkeitsraum<br />
eines Klienten dar bzw. dessen positives<br />
Potenzial, das er in den Veränderungsprozess<br />
einbringen kann (vgl. ebd.). Das<br />
Dr. Holger Jessel<br />
Dipl.Motologe, wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter im Masterstudiengang<br />
Motologie an der PhilippsUniversität<br />
Marburg, Promotion zum Thema<br />
„Psychomotorische Gewaltprävention –<br />
ein mehrperspektivischer Ansatz“,<br />
Dozent der Deutschen Akademie für<br />
Psychomotorik, Redaktionsmitglied der<br />
Zeitschrift motorik‘, Vorstandsmitglied<br />
der WVPM<br />
Anschrift des Verfassers:<br />
PhilippsUniversität Marburg<br />
Institut für Sportwissenschaft<br />
und Motologie<br />
Masterstudiengang Motologie<br />
Barfüßerstr. 1<br />
35032 Marburg<br />
EMail: jessel@staff.unimarburg.de
tatsächlich nutzbare Potenzial dieser<br />
Ressourcen wird erst ersichtlich, wenn<br />
man die folgenden drei Elemente des<br />
Ressourcenbegriffs differenziert (vgl.<br />
Willutzki 2003, 91 ff.):<br />
1. Aufgabenabhängigkeit: Ressourcen<br />
besitzen keine verallgemeinerbare<br />
Wirksamkeit, diese zeigt sich erst im<br />
Hinblick auf konkrete Herausforderungen<br />
und Problemsituationen.<br />
2. Funktionalität: Der Nutzwert von<br />
Ressourcen zeigt sich erst im Hin<br />
blick auf die Realisierung individuell<br />
definierter Ziele und Motive.<br />
3. Bewertung und Sinnzuschreibung:<br />
Ressourcen entstehen erst durch<br />
individuelle Bewertungs und<br />
Sinnzuschreibungsprozesse.<br />
Hier wird deutlich, dass man Ressourcen<br />
nicht einfach „hat“, sondern sie<br />
aktiviert, wahrnimmt und entwickelt,<br />
wobei dies von den jeweiligen individuellen<br />
Lebenszielen und emotional<br />
gefärbten Themen abhängig ist (vgl.<br />
Schiepek/Cremer 2003). Ressourcen<br />
sind damit „aktive Konstruktionsleistungen<br />
eines handelnden Subjekts“<br />
(ebd., 183).<br />
Zusammenfassend können Ressourcen<br />
demnach als diejenigen positiven<br />
Personen und Umweltpotenziale<br />
aufgefasst werden, die von Menschen<br />
zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse,<br />
zur Bewältigung altersspezifischer<br />
Entwicklungsaufgaben, zur<br />
gelingenden Bearbeitung von kritischen<br />
Lebenslagen und belastenden Alltagsanforderungen<br />
und zur Verwirklichung<br />
langfristiger Identitätsziele genutzt<br />
werden können (vgl. Herriger 2006b, 2).<br />
Argumente für eine<br />
ressourcenorientierte Haltung<br />
in Diagnostik und<br />
Entwicklungsförderung<br />
Der Begriff der Ressourcenorientierung<br />
ist im psychosozialen Bereich seit gerau<br />
mer Zeit in aller Munde (vgl. Herriger<br />
2006b, 1) und auch im Kontext der<br />
Psychomotorik wird er als ein wesentliches<br />
Charakteristikum der Entwicklungsförderung<br />
betrachtet (vgl. u. a.<br />
Eggert 2000; Fischer 2009; Köckenberger<br />
2007; Zimmer 2006, 37). Da jedoch<br />
die Anerkennung und Umsetzung einer<br />
ressourcenorientierten Haltung nach<br />
wie vor mit bedeutenden Herausforde<br />
rungen (dazu gehören u. a. individuelle,<br />
lebensgeschichtlich geprägte Wahrnehmungs<br />
und Bewertungsmuster, das<br />
eigene Rollenverständnis, die Kommunikation<br />
mit Kostenträgern oder Fragen<br />
der professionellen Legitimation)<br />
verbunden ist, sollen in diesem Kapitel<br />
Argumente für die zwingende Notwendigkeit<br />
ressourcenorientierten Arbeitens<br />
vorgelegt werden. Zur Beantwortung<br />
der Frage nach dem Sinn und Wert<br />
einer ressourcenorientierten Diagnostik<br />
und Entwicklungsförderung werden<br />
fünf Argumentationslinien unterschieden,<br />
die jedoch vielfältig miteinander<br />
vernetzt sind.<br />
1. Das bedürfnistheoretische Argument:<br />
Der Psychotherapieforscher Klaus<br />
Grawe (vgl. 1998) geht in seinem<br />
Bedürfnismodell davon aus, dass<br />
Menschen permanent bestrebt sind,<br />
insgesamt vier grundlegende Bedürfnisse<br />
zu befriedigen: das Bedürfnis nach<br />
positiven zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen (vgl. hierzu auch die<br />
Bindungstheorie (u. a. Grossmann/<br />
Grossmann 2004)), nach Orientierung<br />
und Kontrolle (vgl. Flammer 1990;<br />
Seewald 2007), nach Selbstwerterhöhung<br />
sowie nach Lustgewinn und<br />
Unlustvermeidung. Vor diesem Hintergrund<br />
ist ein großer Teil menschlichen<br />
Erlebens und Handelns darauf ausgerichtet,<br />
Konsistenz herzustellen, d. h.<br />
die verschiedenen nach Bedürfnisbefriedigung<br />
strebenden psychischen<br />
Prozesse miteinander in Einklang zu<br />
bringen (vgl. Grawe 1998). Dieser<br />
Vorgang stellt eine permanente Heraus<br />
forderung dar, die alternativ auch als<br />
Inkonsistenzreduktion bezeichnet<br />
werden kann. Die Bewältigung dieser<br />
Herausforderung findet immer in<br />
Beziehung statt und ist damit auf<br />
Passungsverhältnisse zwischen Individuum<br />
und Umwelt angewiesen. Grawe<br />
entwickelte ein auf diesem Bedürfnismodell<br />
basierendes Wirkkomponentenmodell,<br />
in dem der Ressourcenaktivierung<br />
ein zentraler Stellenwert zukommt.<br />
Ressourcenaktivierung bedeutet, unter<br />
der Vielzahl der oben aufgeführten<br />
Potenziale „solche aufzuspüren, die für<br />
den Patienten motivational stark<br />
besetzt und für sein Selbstwertgefühl<br />
besonders wichtig sind, und diese für<br />
den therapeutischen Veränderungsprozess<br />
zu mobilisieren“ (ebd., 34). Dies<br />
führt einerseits zu positiven Kontrollerfahrungen<br />
und andererseits zu<br />
selbstwerterhöhenden Wahrnehmungen<br />
auf Seiten der Klienten. Die Folge ist<br />
eine Inkonsistenzreduktion, aus der<br />
wiederum eine Verbesserung des<br />
Wohlbefindens und damit eine optimierte<br />
LustUnlustBalance resultiert<br />
(vgl. ebd., 541 f.).<br />
Diese positiven Erfahrungen sind aus<br />
Klientenperspektive unmittelbar mit<br />
der Beziehung zum Psychomotoriker<br />
verbunden und führen in der Regel zu<br />
einem größeren Vertrauen sowie zu<br />
einer veränderten Offenheit und<br />
Aufnahmebereitschaft (vgl. ebd., 542),<br />
nicht zuletzt auch hinsichtlich der<br />
Auseinandersetzung mit schwierigen<br />
Entwicklungskonstellationen (mit denen<br />
wir es in der Psychomotorik in der Regel<br />
zu tun haben). Klienten sollten demnach<br />
grundsätzlich die Gelegenheit<br />
erhalten, den Prozess der psychomotorischen<br />
Entwicklungsförderung<br />
entsprechend ihrer Ziele, Bedürfnisse,<br />
Ressourcen und Kompetenzen aktiv<br />
mitzugestalten. Diese Erfahrungen<br />
können eine Stärkung des Selbstwertgefühls<br />
sowie eine Verbesserung des<br />
Wohlbefindens unterstützen und sie<br />
können über Selbstwirksamkeitserfahrungen<br />
zur Entwicklung positiver<br />
Kontrollüberzeugungen führen, indem<br />
die Beteiligten mit ihrem Verhalten<br />
positive Wirkungen im Hinblick auf<br />
individuell bedeutsame Ziele hervorrufen.<br />
Die Ressourcenaktivierung schafft<br />
damit die wesentlichen Voraussetzungen<br />
für eine Auseinandersetzung<br />
mit problematischen Entwicklungs<br />
und Beziehungsthemen, mehr noch:<br />
„Ohne Ressourcenaktivierung bleiben<br />
störungsspezifische Interventionen<br />
erfolglos“ (ebd., 553). Dies entspricht<br />
auch der Auffassung von Rotthaus, der<br />
es insbesondere für die systemische<br />
Kinder und Jugendlichenpsychotherapie<br />
als wesentlich erachtet, „einen<br />
Kontext des Gelingens, einen Kontext<br />
der Kompetenz zu schaffen“ (Rotthaus<br />
2005, 15).<br />
2. Das neurobiologische Argument:<br />
Für Joachim Bauer lautet die entscheidende<br />
Frage im Hinblick auf kindliche<br />
Entwicklungs und Bildungspotenziale:<br />
„Welches zwischenmenschliche Erleben<br />
(Psychologie) führt im Gehirn und im<br />
Körper des Kindes zu einer optimalen<br />
Biologie bzw. zu einer optimalen<br />
geistigen Entwicklung?“ (Bauer 2007,<br />
127). Seine neurobiologische Antwort<br />
lautet:<br />
27
28<br />
Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik<br />
„Kinder brauchen persönliche Bin<br />
dungen zu Bezugspersonen, um ihre<br />
Motivationssysteme zu entfalten.<br />
Sie brauchen Einfühlung und<br />
Unterstützung, um sich frei von<br />
Angst der Welt zuwenden und<br />
lernen zu können. Kinder und<br />
Jugendliche brauchen Bezugspersonen,<br />
nicht nur um von ihnen<br />
gefordert zu werden und sich an<br />
ihnen als Vorbildern zu orientieren,<br />
sondern auch um von ihnen eine<br />
Vision von der eigenen Entwicklung<br />
und den eigenen Potenzialen<br />
zurückgespiegelt zu bekommen“<br />
(ebd., 128).<br />
Vor diesem Hintergrund lässt sich eine<br />
Vision der eigenen Potenziale offensichtlich<br />
nicht ausschließlich durch<br />
Anforderungen entwickeln, sondern in<br />
erster Linie durch eine Orientierung an<br />
den Ressourcen und positiven Beziehungsaspekten<br />
eines Klienten(systems) 1 ,<br />
die zu einer Aktivierung der neurobiologischen<br />
Motivationssysteme (hierzu<br />
gehören die Botenstoffe Dopamin,<br />
körpereigene Opioide sowie Oxytozin)<br />
führen (vgl. ebd., 19). Dopamin ruft ein<br />
Gefühl des Wohlbefindens hervor „und<br />
versetzt den Organismus psychisch und<br />
physisch in einen Zustand von Konzentration<br />
und Handlungsbereitschaft.<br />
Interessanterweise beeinflusst Dopamin<br />
zugleich auch die muskuläre Bewegungsfähigkeit<br />
des Körpers“ (Bauer<br />
2006, 29). Körpereigene Opioide haben<br />
positive Wirkungen auf das IchGefühl,<br />
die emotionale Gestimmtheit und die<br />
Lebensfreude (vgl. ebd., 31). Oxytozin<br />
schließlich ist „sowohl Ursache als auch<br />
Wirkung von Bindungserfahrungen“<br />
(ebd., 45) und besitzt ebenfalls ein<br />
hohes Glücks und Genusspotenzial.<br />
Die (ausschließliche) Fokussierung auf<br />
Defizite und Entwicklungsschwierigkeiten<br />
kann hingegen – ähnlich wie<br />
Situationen der Überforderung –<br />
Beziehungen belasten und Angst<br />
auslösen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit<br />
einer Daueraktivierung des<br />
1 Eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung<br />
dieser positiven Beziehungsaspekte ist das<br />
System der Spiegelneurone (vgl. Rizzolatti et al.<br />
2002 sowie Bauer 2005). Dieses System ist an<br />
der Entwicklung von Empathiefähigkeit<br />
maßgeblich beteiligt und es macht deutlich,<br />
dass Bindung „ein neurobiologisch verankertes<br />
Geschehen“ ist (Bauer 2007, 129).<br />
neurobiologischen Stresssystems, was<br />
Lernen und Entwicklung geradezu ver<br />
hindert (vgl. Bauer 2007, 36). Aus neuro<br />
biologischer Perspektive werden demnach<br />
„Sicherheit bietende Bindungen zur<br />
entscheidenden Voraussetzung für die<br />
Ausbildung lernfähiger, plastischer<br />
Gehirne“ (Hüther 2004, 141).<br />
3. Das systemisch-konstruktivistische<br />
Argument: Die Vorstellung der Ressourcenorientierung<br />
ist eng mit der Idee<br />
der Lösungsorientierung verbunden,<br />
die maßgeblich von Steve de Shazer<br />
(vgl. 1988) und seiner Arbeitsgruppe<br />
entwickelt wurde und im Kontext<br />
systemischkonstruktivistischen<br />
Denkens eine bedeutende Rolle spielt.<br />
Sie entwickelten die zentrale Annahme,<br />
„daß jedes System bereits über alle<br />
Ressourcen verfügt, die es zur Lösung<br />
seiner Probleme benötigt – es nutzt<br />
sie nur derzeit nicht“ (von Schlippe/<br />
Schweitzer 2000, 124). Entscheidend ist<br />
nun, dass die Entdeckung der Ressourcen<br />
nicht auf eine Auseinandersetzung<br />
mit dem Problem angewiesen ist, es<br />
steht vielmehr von vornherein die<br />
Konstruktion von Lösungen im Rahmen<br />
der aktuell verfügbaren Kompetenzen<br />
im Vordergrund. Rolf Arnold formuliert<br />
den Zusammenhang wie folgt:<br />
„Lösungen werden vielmehr dann<br />
wahrscheinlich, wenn Teufelskreise<br />
des Denkens, Fühlens und Handelns<br />
auf beiden Seiten durchbrochen<br />
werden. Dafür müssen Lehrerinnen<br />
und Lehrer sowie Eltern und andere<br />
Erziehungsverantwortliche zunächst<br />
darin geübt sein, die wirklichkeitsschaffenden<br />
Wirkungen ihrer<br />
eigenen Interpretationen zu<br />
erkennen – und leidenschaftslos<br />
beobachten zu können, wie diese<br />
das Gegenüber festlegen und ihm<br />
immer weniger Möglichkeiten<br />
lassen, aus diesen Wirklichkeitszuschreibungen<br />
auszusteigen“<br />
(Arnold 2007, 104 f.).<br />
Ressourcen und lösungsorientiertes<br />
Denken und Handeln steht damit in<br />
deutlichem Gegensatz zu defizitorientierten<br />
Sichtweisen. Es setzt sich<br />
nicht mit der Frage auseinander, ob es<br />
Störungen oder Defizite tatsächlich<br />
„gibt“, sondern es fragt, welche<br />
Handlungs und Problemlösungsmöglichkeiten<br />
diese dem Betroffenen<br />
eröffnen bzw. verschließen. Die Frage<br />
nach der Nützlichkeit bestimmter<br />
Konzepte und Vorstellungen führt zu<br />
der Annahme, dass es in Beratungs<br />
sowie in psychomotorischen Förderprozessen<br />
häufig hilfreicher ist, von der<br />
Existenz zahlreicher Ressourcen und<br />
Möglichkeiten der Klienten auszugehen,<br />
dass die Klienten jedoch „aus subjektiv<br />
respektablen Gründen – vieles von<br />
dem, was sie tun könnten, zumindest<br />
vorläufig noch nicht (oder nur manchmal)<br />
(…) tun“ (von Schlippe/Schweitzer<br />
2000, 124 f.). Im Hinblick auf das von<br />
ihr vertretene Konzept der lösungsorientierten<br />
Kurztherapie zeigt sich<br />
Therese Steiner vor allem beeindruckt<br />
davon, „wie nachdrücklich es den<br />
Wunsch des Klienten berücksichtigt,<br />
positive Veränderungen im Leben zu<br />
erreichen, und wie sehr es die Annahme<br />
betont, dass der Klient zur Gestaltung<br />
seines Lebens imstande ist“ (Steiner/<br />
Berg 2008, 16). Eine solche Haltung<br />
schafft die Voraussetzungen dafür, dass<br />
der Psychomotoriker den Klienten<br />
fortwährend Möglichkeiten anbietet,<br />
„sich als wirksam zu erleben und eine<br />
positive Identitätsbeschreibung von sich<br />
zu entwickeln“ (Arnold 2007, 105).<br />
Nach Matthias Varga von Kibéd und<br />
Insa Sparrer ist Querdenken dabei<br />
äußerst hilfreich: „Häufig macht nur<br />
unsere Haltung etwas zu einem Hin<br />
dernis, und eine veränderte Einstellung<br />
zeigt uns, daß hier immer schon eine<br />
Ressource vorlag“ (Varga von Kibéd/<br />
Sparrer 2009, 44).<br />
4. Das Argument der Selbstbemächtigung<br />
(Empowerment): Die Haltung der<br />
Ressourcen und Lösungsorientierung<br />
hat deutliche Entsprechungen im<br />
Menschenbild des Empowerment<br />
Konzeptes. Der Begriff steht für solche<br />
Ansätze in der psychosozialen Praxis,<br />
die Menschen zur Entdeckung ihrer<br />
Stärken ermutigen und sie bei der<br />
Aneignung von Selbstbestimmung und<br />
Lebensautonomie unterstützen (vgl.<br />
Herriger 2006a). Das Leitmotiv dieses<br />
Konzeptes ist das Vertrauen in die<br />
Stärken der Menschen, in produktiver<br />
Weise die Belastungen und Herausforderungen<br />
der alltäglichen Lebensrealität<br />
zu verarbeiten. Die zentralen<br />
Charakteristika sind: Abkehr vom<br />
DefizitBlick auf Menschen mit<br />
Entwicklungsschwierigkeiten, Verzicht<br />
auf pädagogische Zuschreibungen von<br />
Hilfebedürftigkeit, Vertrauen in die<br />
Fähigkeit zur Selbstaktualisierung und
zu persönlichem Wachstum, Anerkennung<br />
von Autonomie und EigenSinn,<br />
Verzicht auf enge Zeithorizonte und<br />
standardisierte Hilfepläne, normative<br />
Enthaltsamkeit der Pädagogen, d. h.<br />
Verzicht auf moralisierende, entmündigende<br />
Expertenurteile über Lebensprobleme<br />
und Problemlösungen sowie<br />
eine ausdrückliche Zukunftsorientierung<br />
(vgl. Herriger 2006a, 72 ff.). Die Wirk<br />
samkeit einer solchen Haltung basiert<br />
auf der dialogischen Begegnung „auf<br />
Augenhöhe“ (was nicht nur ein gedul<br />
diges Einlassen auf individuelle Situa<br />
tionsdeutungen der Klienten, sondern<br />
auch kontrastierende Fremdwahrnehmungen<br />
beinhaltet), auf der Eröffnung<br />
von „Testfeldern“ für das Entdecken<br />
eigener Stärken, auf der Erprobung von<br />
Selbstbestimmung und Selbstorganisation<br />
sowie auf einer verstehenden und<br />
mutmachenden Ressourcendiagnostik,<br />
die Hilflosigkeitsunterstellungen und<br />
„Entmündigungsfallen“ vermeidet<br />
(vgl. ebd.).<br />
5. Das gesundheitspsychologische<br />
Argument: Die Gesundheitspsycho<br />
logie thematisiert die Bedeutung von<br />
personalen und sozialen Ressourcen für<br />
Gesundheit und Wohlbefinden. Neben<br />
der Psychologie der Bewältigung (vgl.<br />
u. a. TeschRömer et al. 1997), dem<br />
Konstrukt der seelischen Gesundheit<br />
(vgl. u. a. Becker 1992), der Resilienzforschung<br />
(vgl. u. a. WelterEnderlin/<br />
Hildenbrand 2006) und der Positiven<br />
Psychologie (vgl. u. a. Auhagen 2008)<br />
hat v. a. das Salutogenese-Modell von<br />
Antonovsky (vgl. 1997) einen herausragenden<br />
Stellenwert für eine ressourcenorientierte<br />
Diagnostik.<br />
Das Modell markiert einen grundlegenden<br />
Perspektivenwechsel in der<br />
Medizin, indem es nicht mehr fragt, wie<br />
und warum Menschen krank werden<br />
(Pathogenese) und wie Professionelle<br />
sie wieder gesund machen können,<br />
sondern indem es fragt, was Menschen<br />
trotz zum Teil erheblicher Belastungen<br />
und Krankheitsgefährdungen gesund<br />
erhält (Salutogenese). Antonovsky (vgl.<br />
1997, 92) stellt die entscheidende<br />
(metaphorische) Frage, wie Menschen<br />
in dem durch Stromschnellen, Verschmutzungen,<br />
Abzweigungen etc.<br />
gekennzeichneten Fluss des Lebens zu<br />
guten Schwimmern werden. Ein guter<br />
Schwimmer besitzt für ihn ein ausgeprägtes<br />
Kohärenzgefühl („sense of<br />
coherence“), d. h. ein durchdringendes,<br />
andauerndes, aber dennoch dynamisches<br />
Gefühl des Vertrauens, das sich<br />
aus drei Dimensionen zusammensetzt,<br />
die Antonovsky (vgl. ebd., 34 ff.) als<br />
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und<br />
Sinnhaftigkeit bezeichnet. Verstehbarkeit<br />
bedeutet, dass im Leben auftretende<br />
innere und äußere Reize strukturiert,<br />
vorhersehbar und verstehbar<br />
bzw. erklärbar sind; Handhabbarkeit<br />
meint die Wahrnehmung und Nutzung<br />
von geeigneten (personalen und<br />
sozialen) Ressourcen zur Bewältigung<br />
von Herausforderungen und Sinnhaftigkeit<br />
beschreibt das Ausmaß, in dem<br />
man das Leben emotional als sinnvoll<br />
empfindet.<br />
Antonovsky nimmt an, dass Menschen<br />
zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens mehr<br />
oder weniger (und niemals vollkommen)<br />
gesund bzw. krank sind. Die genannten<br />
drei Dimensionen stellen grundlegende<br />
Ressourcen dar und tragen wesentlich<br />
dazu bei, dass sich ein Mensch auf dem<br />
GesundheitsKrankheitsKontinuum<br />
in Richtung Gesundheit bewegt. Vor<br />
diesem Hintergrund gilt es einerseits<br />
diagnostisch zu ermitteln, welche<br />
Qualität das Kohärenzgefühl eines<br />
Menschen hat (vgl. u. a. den Fragebogen<br />
zur Lebensorientierung von Antonovsky<br />
(1997, 192 ff.)). Andererseits sollte die<br />
Psychomotorik Klienten erstens Erfah<br />
rungen von Struktur und Vorhersehbarkeit<br />
anbieten, zweitens Situationen,<br />
in denen sie Selbstwirksamkeitserfahrungen<br />
machen können, und sie sollte<br />
drittens einen Raum für individuell<br />
bedeutsame und sinnvolle Entscheidungen<br />
und Entwicklungsthemen<br />
eröffnen.<br />
Neben diesen fünf in anderen Disziplinen<br />
entwickelten Argumenten existiert<br />
eine weitere Begründungslinie, die<br />
aufgrund ihrer leibphänomenologischen<br />
Orientierung maßgebliche Berührungspunkte<br />
zur psychomotorischen Fachdiskussion<br />
besitzt.<br />
Ressourcenorientierung in<br />
der Psychomotorik – leibphänomenologische<br />
Argumente<br />
Die Leibphänomenologie geht von der<br />
Idee der leiblichen Subjektivität (vgl.<br />
MerleauPonty 1966) aus, von einem<br />
leiblichen „ZurWeltSein“ des Menschen:<br />
„Was immer wir auch explizit<br />
planen oder bewusst tun – wir leben<br />
aus einem unbewussten, leiblichen<br />
Grund heraus, den wir nie ganz vor uns<br />
selbst zu bringen vermögen. Und dieser<br />
Grund geht ein in alles Wahrnehmen,<br />
Denken, Tun, insofern es eines Mediums<br />
bedarf, durch das es sich vollzieht, und<br />
das selbst transparent bleibt. Dieses<br />
Medium ist der Leib“ (Fuchs 2008, 97).<br />
Der Leib stellt demnach eine Ressource<br />
dar, auf die Psychomotoriker und<br />
Klienten – selbst bei schweren Entwicklungsbeeinträchtigungen<br />
– permanent<br />
zurückgreifen können. Er ist der exis<br />
tenzielle Mittler zur Welt (vgl. Merleau<br />
Ponty 1966, 106) und die permanente<br />
Quelle all unserer Wahrnehmungen,<br />
Bewegungen und Handlungen. Nach<br />
MerleauPonty nimmt der Mensch die<br />
Welt leiblich und damit präreflexiv<br />
wahr, er nimmt „natürlich“, d. h. spürend<br />
und unmittelbar, Stellung zu ihr. Diese<br />
„ursprüngliche Intentionalität“ (ebd.,<br />
166) kann unser Gespür für die (eigenen<br />
und fremden) Themen und Prozesse<br />
erhöhen und ist damit eine elementare<br />
Grundlage für jeden psychomotorischen<br />
bzw. tonischen Dialog (vgl. u. a. Eckert<br />
2004, 63 f.).<br />
Entscheidend ist nun, dass leibliche<br />
Resonanzen in erster Linie implizit, also<br />
zunächst vor einer Bewusstseinsaktivität<br />
entstehen und in den Dialog mit<br />
den Klienten einfließen. Dies ist Chance<br />
und Risiko zugleich, denn unsere<br />
Klienten spüren auf einer vorbewussten,<br />
leiblichen Ebene, was wir ihnen (nicht)<br />
zutrauen, welche Kompetenzen<br />
(Defizite) wir ihnen zuschreiben, welche<br />
Ressourcen (Störungen) wir bei ihnen<br />
wahrnehmen und inwiefern wir mit<br />
ihnen in einen entwicklungsfördernden<br />
Dialog treten. Aus diesem Grund ist es<br />
für ressourcenorientiertes Arbeiten von<br />
grundlegender Bedeutung, dass wir uns<br />
als Psychomotoriker mit unserer<br />
Haltung gegenüber unseren jeweiligen<br />
Klienten bewusst auseinandersetzen.<br />
Denn diese Haltung wird zwischenleiblich<br />
kommuniziert und ist damit spürbar<br />
– ob wir das möchten oder nicht. Dieses<br />
Phänomen ist nicht nur leibphänomenologisch<br />
beschreibbar – MerleauPonty<br />
(vgl. 1966) spricht von leiblicher Inter<br />
subjektivität bzw. Zwischenleiblichkeit,<br />
Schmitz (vgl. 2007) verwendet die<br />
Bezeichnung leibliche Kommunikation –,<br />
sondern hier schließt sich auch der<br />
Kreis zu aktuellen neurobiologischen<br />
Erkenntnissen, die im 2. Argument<br />
29
30<br />
Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik<br />
bereits angeklungen sind und die Bauer<br />
wie folgt beschreibt:<br />
„Die Spiegelaktivität von Nervenzellen<br />
für die Vorstellung von<br />
Empfindungen erzeugt im Beobachter<br />
ein intuitives, unmittelbares<br />
Verstehen der Empfindungen der<br />
wahrgenommenen Person. (…)<br />
Bereits ein kurzer Eindruck von<br />
einer Person kann ausreichen, um<br />
eine intuitive Ahnung zu erzeugen,<br />
wie die körperlichen Empfindungen<br />
der beobachteten Person im<br />
kurzfristigen weiteren Verlauf<br />
aussehen werden. (…) Das Ergebnis<br />
ist eine intuitive Wahrnehmung, wie<br />
sich ein von uns beobachteter<br />
Mensch aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach gerade fühlt“ (Bauer 2005,<br />
44 f.).<br />
Hier wird deutlich, dass wir als Psychomotoriker<br />
in einem fortlaufenden<br />
tonischemotionalen Dialog mit<br />
unseren Klienten stehen. Sie nehmen<br />
intuitiv wahr, wie wir sie erleben und<br />
wahrnehmen (und umgekehrt) und<br />
dafür ist das System der Spiegelneurone<br />
bzw. das Phänomen der Zwischenleiblichkeit<br />
verantwortlich. Dies hat<br />
mehrere Konsequenzen für die psychomotorische<br />
Diagnostik, Entwicklungsbegleitung<br />
und Ausbildung.<br />
Konsequenzen für die<br />
psychomotorische Diagnostik,<br />
Entwicklungsbegleitung und<br />
Ausbildung<br />
Diagnostik als Prozess ist charakterisiert<br />
durch eine Suchhaltung: es geht also<br />
„nicht um das Finden von Wahrheiten,<br />
sondern um das Suchen nach Zusammenhängen“<br />
(Baumann 2009, 19), die<br />
den Psychomotoriker dabei unterstützen,<br />
mit den Klienten in einen entwicklungsfördernden<br />
Dialog zu kommen.<br />
Dabei besteht Diagnostik zu einem<br />
großen Teil aus Beobachtungen und<br />
diese basieren wiederum auf (subjektiven)<br />
Wahrnehmungen: „Alles, was<br />
beobachtet, beschrieben, festgestellt<br />
oder diagnostiziert wird, ist ein<br />
Ausdruck subjektiver Erfahrung und<br />
sozialer Einigung“ (Lindemann 2008,<br />
13). Diese Wahrnehmungen, Erfahrungen<br />
und sozialen Einigungsprozesse<br />
beruhen jedoch keineswegs nur auf<br />
visuellen Informationen, sondern sie<br />
sind generell leiblich fundiert: „Alles<br />
Fühlen, Wahrnehmen, Vorstellen,<br />
Denken und Tun vollzieht sich also auf<br />
der Basis eines leiblichen Hintergrunds,<br />
oder mit anderen Worten: Das Subjekt<br />
dieser Tätigkeiten ist immer leiblich“<br />
(Fuchs 2008, 98). Damit sind Wahrnehmungen<br />
einerseits immer perspektivisch<br />
(vgl. MerleauPonty 1966, 91) und<br />
andererseits ganzheitlich, mit anderen<br />
Worten: Sie finden nicht ausschließlich<br />
bewusst statt, sondern zu einem großen<br />
Teil implizit und intuitiv und sie sind<br />
darüber hinaus biographisch geprägt<br />
und von unseren persönlichen Haltungen<br />
und Wertmaßstäben beeinflusst.<br />
Diagnostisches Arbeiten ist deshalb<br />
zuallererst auf die Bewusstheit des<br />
Psychomotorikers angewiesen. Sie<br />
bezieht sich einerseits auf die Unterscheidungen<br />
(z. B. schuldigunschuldig,<br />
gesundgestört, DefizitProfizit), die wir<br />
als Psychomotoriker (nicht) treffen,<br />
andererseits jedoch auch auf die<br />
Reflexion, inwiefern wir uns um unsere<br />
Klienten umfassend bemühen und<br />
inwiefern wir die Haltung des Verstehenwollens<br />
und der Neugier realisieren<br />
können. Ressourcenorientierung ist<br />
vor diesem Hintergrund eine aktive<br />
Entscheidung und Leistung des Diagnostikers.<br />
Mit Klemenz (vgl. 2003, 131)<br />
wird allerdings davon ausgegangen,<br />
dass für die Entwicklungsbegleitung die<br />
Ressourcen und die Problemperspektive<br />
wieder zusammengeführt werden<br />
müssen, „wenn man sich nicht mit<br />
einem ,halbierten‘ Bild des Klienten<br />
zufrieden geben möchte“ (ebd.).<br />
Für die Ausbildung von Psychomotorikern<br />
bedeutet dies nicht nur eine<br />
differenzierte Auseinandersetzung mit<br />
(ressourcen und problemorientierten)<br />
Methoden und Verfahren der (psychomotorischen)<br />
Diagnostik (zur Erfassung<br />
von Ressourcen u. a. die Ressourcenorientierte<br />
Diagnostik (RODI) von<br />
Köckenberger (vgl. 2007), die multiaxiale<br />
und multimodale Ressourcendiagnostik<br />
von Klemenz (vgl. 2003),<br />
Ressourcenkarten (vgl. Petzold 1997),<br />
Ressourcen und Kompetenzsterne (vgl.<br />
VogtHillmann 2002), der Soziale Beziehungstest<br />
für Kinder (SOBEKI) (vgl.<br />
Berger/Klopfer 2002) sowie zahlreiche<br />
handlungsorientierte, bildhafte und<br />
spielerische Methoden aus der lösungsorientierten<br />
Arbeit mit Kindern (vgl.<br />
Steiner/Berg 2008, 92–140)), sondern in<br />
erster Linie auch eine Thematisierung<br />
und Reflexion subjektiver und leiblich<br />
fundierter Beobachterperspektiven und<br />
Haltungen. Vor diesem Hintergrund<br />
geht es nicht zuletzt um ein hinreichendes<br />
Maß an Selbsterfahrung (im<br />
Sinne eines Erspürens der eigenen<br />
Themen, Wahrnehmungs und Bewertungsmuster<br />
und präferenzen etc.)<br />
sowie um die Erarbeitung von differenzierten<br />
Selbstreflexionskompetenzen im<br />
Sinne einer reflexiven Leiblichkeit,<br />
denn: Psychomotorik ist in erster Linie<br />
eine emotionale Begegnung zwischen<br />
zwei (oder mehr) Menschen und die<br />
dabei ausgetauschten „Fundamentalbotschaften“<br />
(Ciompi 2005, 299) sind<br />
für den Verlauf der Förderung von<br />
entscheidender Bedeutung.<br />
Literatur<br />
Antonovsky, A. (1997): Salutogenese.<br />
Zur Entmystifizierung der<br />
Gesundheit. Dt. erw. Hrsg. von<br />
Alexa Franke. Tübingen.<br />
Armbruster, M. (2006): Eltern-AG.<br />
Das Empowerment-Programm<br />
für mehr Elternkompetenz in<br />
Problemfamilien. Heidelberg.<br />
Arnold, R. (2007): Aberglaube<br />
Disziplin. Antworten der<br />
Pädagogik auf das „Lob der<br />
Disziplin“. Heidelberg.<br />
Auhagen, A. E. (Hg.) (2008): Positive<br />
Psychologie: Anleitung zum<br />
„besseren“ Leben (2. Aufl.).<br />
Weinheim.<br />
Bauer, J. (2005): Warum ich fühle,<br />
was du fühlst. Intuitive Kommunikation<br />
und das Geheimnis der<br />
Spiegelneurone. Hamburg.<br />
Bauer, J. (2006): Prinzip Menschlichkeit.<br />
Warum wir von Natur<br />
aus kooperieren. Hamburg.<br />
Bauer, J. (2007): Lob der Schule.<br />
Sieben Perspektiven für Schüler,<br />
Lehrer und Eltern. Hamburg.<br />
Baumann, M. (2009): Verstehende<br />
Subjektlogische Diagnostik bei<br />
Verhaltensstörungen. Ein<br />
Instrumentarium für Verstehensprozesse<br />
in pädagogischen<br />
Kontexten. Hamburg.<br />
Becker, P. (1992): Seelische Gesundheit<br />
als protektive Persönlichkeitseigenschaft.<br />
In: Zeitschrift<br />
für Klinische Psychologie, 21<br />
(1992), 64–75.
Berger, C./Klopfer, U. (2002): Kinder<br />
zeigen, wo Lösungen langgehen:<br />
ressourcenorientierte Diagnostik<br />
im sozialen Netz. In: M. Vogt<br />
Hillmann, /W. Burr (Hg.) (2002),<br />
Lösungen im Jugendstil.<br />
Systemisch-lösungsorientierte<br />
Kreative Kinder- und Jugendlichentherapie<br />
(S. 93–102).<br />
Dortmund.<br />
Ciompi, L. (2005): Die emotionalen<br />
Grundlagen des Denkens.<br />
Entwurf einer fraktalen Affektlogik<br />
(3. Aufl.). Göttingen.<br />
Eckert, A. R. (2004): Menschen<br />
psychomotorisch verstehen und<br />
begleiten. In: A. R. Eckert/R.<br />
Hammer (Hg.), Der Mensch im<br />
Zentrum. Beiträge zur sinnverstehenden<br />
Psychomotorik und<br />
Motologie (S. 59–73). Lemgo.<br />
Eggert, D. (2000): Von den Stärken<br />
ausgehen … Individuelle Ent-<br />
wicklungspläne in der Lernförderdiagnostik;<br />
ein Plädoyer für<br />
andere Denkgewohnheiten und<br />
eine veränderte Praxis (4. Aufl.).<br />
Dortmund.<br />
Fischer, K. (2009): Einführung in die<br />
Psychomotorik (3. Aufl.).<br />
München, Basel.<br />
Flammer, A. (1990): Erfahrung der<br />
eigenen Wirksamkeit. Einführung<br />
in die Psychologie der<br />
Kontrollmeinung. Bern, Stuttgart,<br />
Toronto.<br />
Frisch, M. (1985): Tagebuch 1946–<br />
1949. Frankfurt a. M.<br />
Fuchs, T. (2008): Das Gehirn – ein<br />
Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische<br />
Konzeption. Stuttgart.<br />
Grawe, K. (1998): Psychologische<br />
Therapie. Göttingen.<br />
Grossmann, K./Grossmann, K. E.<br />
(2004): Bindungen – Das Gefüge<br />
psychischer Sicherheit. Stuttgart.<br />
Herriger, N. (2006a): Empowerment<br />
in der sozialen Arbeit. Eine<br />
Einführung (3. Aufl.). Stuttgart.<br />
Herriger, N. (2006b): Ressourcen<br />
und Ressourcendiagnostik in der<br />
sozialen Arbeit. Unveröffentl.<br />
Manuskript. Düsseldorf. (www.<br />
empowerment.de/materialien_<br />
5.html; Zugriff am 10.11.2008).<br />
Hüther, G. (2004): Destruktives<br />
Verhalten als gebahnte Bewältigungsstrategie<br />
zur Überwindung<br />
emotionaler Verunsicherung: ein<br />
entwicklungsneurobiologisches<br />
Modell. In: A. StreeckFischer<br />
(Hg.), Adoleszenz – Bindung –<br />
Destruktivität. (S. 136–151).<br />
Stuttgart.<br />
Klemenz, B. (2003): Ressourcenorientierte<br />
Diagnostik und<br />
Intervention bei Kindern und<br />
Jugendlichen. Tübingen.<br />
Köckenberger, H. (2007): Kinder<br />
Stärken: Ressourcenorientierte<br />
Diagnostik (RODI) und psychomotorischeEntwicklungsbegleitung<br />
(ROPE). Dortmund.<br />
Lindemann, H. (2008): Systemisch<br />
beobachten – lösungsorientiert<br />
handeln. Münster.<br />
MerleauPonty, M. (1966; im Orig.<br />
1945): Phänomenologie der<br />
Wahrnehmung. Berlin.<br />
Petzold, H. (1997): Das Ressourcenkonzept<br />
in der sozialinterventiven<br />
Praxeologie und Systemberatung.<br />
In: Integrative<br />
Therapie, 4, 359–376.<br />
Rizzolatti, G./Fadiga, L./Fogassi, L./<br />
Gallese, V. (2002): From mirror<br />
neurons to imitation: facts and<br />
speculations. In: A. Meltzoff/W.<br />
Prinz (Hg.), The Imitative Mind.<br />
Cambridge.<br />
Rotthaus, W. (2005): Zur Einführung:<br />
Systemische Kinder und<br />
Jugendlichenpsychotherapie –<br />
eine Erweiterung der therapeutischen<br />
Handlungskompetenz.<br />
In: W. Rotthaus (Hg.), Systemische<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie<br />
(S. 9–17).<br />
(3. Aufl.). Heidelberg.<br />
Schiepek, G./Cremer, S. (2003):<br />
Ressourcenorientierung und<br />
Ressourcendiagnostik in der<br />
Psychotherapie. In: H. Schemmel/J.<br />
Schaller (Hg.), Ressourcen.<br />
Ein Hand- und Lesebuch zur<br />
therapeutischen Arbeit (S. 147–<br />
192). Tübingen.<br />
Schlippe, A. v./ Schweitzer, J. (2000):<br />
Lehrbuch der systemischen The-<br />
rapie und Beratung. (7. Aufl.).<br />
Göttingen.<br />
Schmitz, H. (2007): Der Leib, der<br />
Raum und die Gefühle. Bielefeld,<br />
Locarno.<br />
Seewald, J. (2007): Der Verstehende<br />
Ansatz in Psychomotorik und<br />
Motologie. München, Basel.<br />
Shazer, S. de (2002; im Orig. 1988):<br />
Der Dreh. Überraschende Wen-<br />
dungen und Lösungen in der<br />
Kurzzeittherapie. (7. Aufl.).<br />
Heidelberg.<br />
Steiner, T./Berg, I. K. (2008):<br />
Handbuch Lösungsorientiertes<br />
Arbeiten mit Kindern. (3. Aufl.).<br />
Heidelberg.<br />
TeschRömer, C./Salewski, C./<br />
Schwarz, G. (Hg.) (1997):<br />
Psychologie der Bewältigung.<br />
Weinheim.<br />
Varga von Kibéd, M./Sparrer, I.<br />
(2009): Ganz im Gegenteil.<br />
Tetralemmaarbeit und andere<br />
Grundformen Systemischer<br />
Strukturaufstellungen – für<br />
Querdenker und solche, die es<br />
werden wollen. (6. Aufl.).<br />
Heidelberg.<br />
VogtHillmann, M. (2002): Ressourcen<br />
und Kompetenzsterne<br />
in der Diagnostik von Kindern<br />
und Jugendlichen. In: M. Vogt<br />
Hillmann/W. Burr (Hg.), Lösungen<br />
im Jugendstil. Systemischlösungsorientierte<br />
Kreative<br />
Kinder- und Jugendlichentherapie<br />
(S. 123–149). Dortmund.<br />
WelterEnderlin, R./Hildenbrand, B.<br />
(Hg.) (2006): Resilienz – Gedei-<br />
hen trotz widriger Umstände.<br />
Heidelberg.<br />
Willutzki, U. (2000): Ressourcenorientierung<br />
in der Psychotherapie<br />
– Eine „neue“ Perspektive? In:<br />
M. Hermer (Hg.), Psychotherapeutische<br />
Perspektiven am<br />
Beginn des 21. Jahrhunderts<br />
(S. 193–212). Tübingen.<br />
Willutzki, U. (2003): Ressourcen.<br />
Einige Bemerkungen zur<br />
Begriffsklärung. In: H. Schemmel/J.<br />
Schaller (Hg.), Ressourcen.<br />
Ein Hand- und Lesebuch zur<br />
therapeutischen Arbeit (S. 91–<br />
109). Tübingen.<br />
Zimmer, R. (2006): Handbuch der<br />
Psychomotorik. (9. Aufl.).<br />
Freiburg.<br />
31
32<br />
Mitteilungen des Berufsverbandes der Motologen – Diplom / Master e. V.<br />
Mitteilungen des Berufsverbandes der Motologen – Diplom / Master e. V.<br />
Einblicke in motologische<br />
Arbeitsfelder<br />
Die motologische Arbeit<br />
zeichnet sich durch Vielfältigkeit<br />
in unterschiedlichen<br />
Arbeitsgebieten mit unterschiedlichenAdressatengruppen,<br />
unterschiedlichen<br />
Aufgabenstellungen, unter-<br />
schiedlichen Arbeitsweisen<br />
… aus. An dieser Stelle<br />
werden wir in Zukunft durch<br />
Einblicke in Arbeitsaufgaben<br />
und Arbeitsweisen diese<br />
Vielfältigkeit dokumentieren,<br />
um so vielleicht auch über<br />
kurze Einblicke hinaus den<br />
beruflichen Austausch anzu-<br />
regen, also: Nachfragen<br />
erlaubt!!<br />
Heute berichtet Hubert<br />
Bisping, Diplomjahrgang<br />
1985, seit 1996 als Diplom-<br />
Motologe beim Verein<br />
Beweggründe e. V. in Sendenhorst<br />
tätig und Leiter der<br />
Psychomotorischen Förderstelle,<br />
von einer Facette seiner<br />
motologischen Arbeit: der<br />
Projektentwicklung.<br />
D. Beckmann-Neuhaus<br />
Sprungbrett :<br />
Projektentwicklung und<br />
-begleitung als Herausforderung<br />
motologischen<br />
Arbeitens im Verein<br />
Beweggründe e. V.<br />
Der Verein Beweggründe e. V.<br />
wurde 1996 in Sendenhorst<br />
gegründet. Ich selbst bin<br />
Gründungsmitglied des<br />
Vereins und in unterschiedlichen<br />
Aufgabengebieten<br />
tätig.<br />
Neben der Organisation und<br />
Durchführung unterschiedlicher<br />
psychomotorischer<br />
Förderangebote (hier hat<br />
sich eine nachfrageorientierte<br />
psychomotorische<br />
Angebotsvielfalt entwickelt,<br />
die im Rahmen von Mischfinanzierungsmodellen<br />
über<br />
Mittel der Gesundheits- und<br />
Jugendhilfe sowie Elternbeiträgen<br />
finanziert werden)<br />
bin ich insbesondere für<br />
die konzeptionelle Reflexion<br />
der Vereinstätigkeit und<br />
Angebotspraxis sowie deren<br />
Weiterentwicklung unter<br />
Einbeziehung wichtiger<br />
örtlicher Kooperationspartner<br />
im Sozialraum zuständig<br />
(Ideen- und Konzeptentwicklung).<br />
Ein zukunftsweisender neuer<br />
Akzent hat sich aufgrund<br />
einer Bedarfsanalyse in der<br />
Kooperation mit dem Netz-<br />
werk „FIZ Sendenhorst und<br />
Albersloh e. V. Familien im<br />
Zentrum“ entwickelt: das<br />
Kinder- und Jugendhilfeprojekt<br />
„Sprungbrett“ (2008–<br />
2011).<br />
Der Projektidee lag die<br />
Fragestellung zugrunde, wie<br />
der Verein mit dem entwicklungsstärkendenpsychomotorischen<br />
Ansatz Familien<br />
erreichen kann, die sich<br />
selber aufgrund unterschiedlicher<br />
Zusammenhänge nicht<br />
selber auf den Weg machen.<br />
Sie ist gleichzeitig Ausdruck<br />
einer Entwicklung des<br />
Vereins, die psychomotorische<br />
Angebotsstruktur verstärkt in<br />
die Angebotsstruktur des<br />
pädagogischen Alltags<br />
einzubinden (Kindertagesstätten,<br />
Grundschulen, Offene<br />
Ganztagsangebote, …).<br />
Zielgruppe sind „Kinder mit<br />
besonderem Förderbedarf“<br />
(Störungen der Selbstwertentwicklung,<br />
der Beziehungs-<br />
und Kontaktfähigkeit,<br />
der Konfliktfähigkeit,<br />
Kommunikationsstörungen,<br />
Auffälligkeiten in der Spiel-<br />
und Handlungsfähigkeit,<br />
emotionales Ungleichgewicht,<br />
…) aus den Vorschuleinrichtungen,<br />
deren Eltern<br />
unter „erschwerten bzw.<br />
benachteiligten Lebensbedingungen“<br />
(z. B. durch<br />
Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund,<br />
Erkrankung,<br />
Armut oder soziale Isolation<br />
belastet) leben.<br />
Neben der Entwicklung der<br />
Projektidee sowie ihrer<br />
Vorstellung bei den verschiedenen<br />
Projektpartnern<br />
(Vorschuleinrichtungen, FIZ,<br />
Jugendhilfeträger, Kinder-<br />
und Jugendärztlicher Dienst,<br />
verschiedene Facharbeitskreise,<br />
…) ging es in der<br />
Entscheidungs- und Konkretisierungsphase<br />
zunächst<br />
um Antragsstellung und<br />
Finanzierungsfragen.<br />
„Sprungbrett“ wird in großen<br />
Anteilen als Kinder- und<br />
Jugendhilfeprojekt durch die<br />
Aktion Mensch, die Software<br />
AG sowie weitere Stiftungen<br />
und private Sponsoren<br />
finanziert. Grundlage für diese<br />
Projektförderung war die<br />
Unterstützung und Begleitung<br />
des Projektantrages durch die<br />
Fachberatung des DPWV<br />
NRW sowie dem örtlichen<br />
Jugendhilfeträger.<br />
In der Konkretisierungs- und<br />
Umsetzungsphase ging es<br />
v. a. um die Frage, wie in<br />
allen 7 Vorschuleinrichtungen<br />
des Netzwerkes FIZ ein<br />
differenziertes psychomotorisch-systemischesFörderangebot<br />
eingerichtet werden<br />
kann, das sowohl die Eltern<br />
als auch die pädagogischen<br />
Fachkräfte in den Förderprozess<br />
einbezieht. Die beiden<br />
Projektleiterinnen werden<br />
bez. dieser Thematik von mir<br />
in regelmäßigen Treffen (alle<br />
2 Wochen) begleitet. Dabei<br />
ist die Spannbreite der<br />
Fragen bez. der pragmatischen<br />
Umsetzung der<br />
Projektidee immens: Fragen<br />
wie „Wie kommt das Projekt<br />
an einen Auftrag?“ oder<br />
„Wie kann psychomotorisch-<br />
systemisches Arbeiten im<br />
konkreten Fall aussehen?“<br />
bis hin zu Fragen hinsichtlich<br />
der Wirksamkeit und<br />
Nachhaltigkeit des Projektes<br />
(fachkompetente Begleitung<br />
und Beratung des Dokumentations-<br />
und Evaluationsprozesses).<br />
Über die Einrichtung<br />
und Moderation einer<br />
Projektsteuerungsgruppe<br />
(alle 6 Wochen), an der<br />
neben den beiden Projektleiterinnen<br />
jeweils eine<br />
Vertreterin der beteiligten<br />
Vorschuleinrichtungen sowie<br />
die zuständige Vertreterin<br />
des Jugendamtes (ASD)<br />
teilnehmen, ist es möglich<br />
geworden, die Verantwortlichkeit<br />
für die Projektumsetzung<br />
auf eine breite Basis<br />
zu stellen.<br />
Durch gezielte und differenzierte<br />
Darstellungen wird die<br />
Öffentlichkeit wie auch<br />
Fachöffentlichkeit (Gesundheitsamt,<br />
Jugendamt,<br />
Erziehungsberatungsstelle,<br />
Frühförderstelle, Deutsch-<br />
Ausländischer Freundeskreis,<br />
Gremien des FIZ, …) im
Sozialraum über die Projektidee<br />
und entwicklung<br />
informiert, was zu einer<br />
breiten fachlichen Akzeptanz<br />
durch die pädagogischen<br />
Mitarbeiter sowie die ver<br />
mehrte Aufgeschlossenheit<br />
der Elternschaft gegenüber<br />
den Projektangeboten<br />
geführt hat.<br />
Reihe MOTORIK<br />
Weitere Umsetzungsebenen<br />
der Projektentwicklung<br />
beziehen sich auf die<br />
Integration in bestehende<br />
Strukturen des Netzwerkes<br />
FIZ, auf die Vernetzung mit<br />
örtlichen wie regionalen<br />
Beratungs und Förderstrukturen<br />
sowie auf die Evaluation<br />
und Dokumentation im<br />
Dr. Astrid Krus<br />
Mut zur Entwicklung<br />
Hinblick auf die Fortsetzung<br />
der Projektidee auch über<br />
den Förderzeitraum von<br />
3 Jahren hinaus.<br />
Insgesamt ein Arbeitsauftrag,<br />
der nicht nur durch die<br />
Umsetzung der Projektidee<br />
selbst besticht, sondern v. a.<br />
auch die Frage herausfordert,<br />
auf welche Weise die<br />
Psychomotorik den Prozess<br />
der Projektentwicklung und<br />
begleitung an sich unterstützen<br />
kann.<br />
Kontaktadresse:<br />
Hubert Bisping<br />
beweggruende@tonline.de<br />
H. Bisping<br />
Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie<br />
In dem vorliegenden Band wird erstmalig ein für das Kindesalter differenziertes psychomotorisches<br />
Therapiekonzept vorgelegt, das lehr- und lernbare Verhaltensdimensionen für den<br />
Therapeuten aufzeigt. Das Konzept beinhaltet einen Leitfaden für eine mehrdimensionale<br />
psychomotorische Diagnostik, die als Grundlage für die Therapieplanung und -durchführung<br />
dient. Vielfältige Arbeitsvorlagen sowie konkrete Arbeitsschritte einer begleitenden Elternarbeit<br />
und Hinweise zur Kooperation mit anderen Institutionen ermöglichen eine Übertragung<br />
auf verschiedene therapeutische Arbeitsfelder.<br />
17 x 24 cm, 228 Seiten, ISBN 978-3-7780-7026-0, Bestell-Nr. 7026 � 21.80<br />
Inhaltsverzeichnis unter www.sportfachbuch.de/7026<br />
Dr. Udo Wohnhas-Baggerd<br />
ADHS und Psychomotorik<br />
Systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention<br />
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) gehört mit den aggressiven<br />
Verhaltensstörungen zu den häufigsten diagnostizierten psychischen Störungen im Kindesalter.<br />
Das ADHS ist durch Störungen der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle und der motorischen<br />
Unruhe gekennzeichnet. Ein großes öffentliches Interesse an diesem Phänomen ist aus dem<br />
hohen Leidensdruck der betroffenen Kinder und der tangierten Umwelt entstanden. Das<br />
grundlegende Problem bei der Behandlung dieses Störbildes ist die Effizienz der Behandlungsmethoden,<br />
die im direkten Zusammenhang mit dem Leidensdruck der betroffenen Kinder steht.<br />
17 x 24 cm, 216 Seiten, ISBN 978-3-7780-7029-1, Bestell-Nr. 7029 � 21.80<br />
Inhaltsverzeichnis unter www.sportfachbuch.de/7029<br />
Steinwasenstraße 6–8 • 73614 Schorndorf • Telefon (0 71 81) 402-125 • Fax (0 71 81) 402-111<br />
Internet: www.hofmann-verlag.de • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.de<br />
33
34<br />
Berichte<br />
Berichte<br />
Deutsche Gesellschaft<br />
für Psychomotorik e. V.<br />
(DGfPM), Aktuelles:<br />
Informationen aus der<br />
Delegiertenversammlung<br />
am 19. 9. 2009 in Dortmund<br />
und der Vorstandssitzung<br />
am 7. 11. 2009 in<br />
Bergisch-Gladbach<br />
Die Deutsche Gesellschaft<br />
für Psychomotorik hat am<br />
26. 9. 2006 nach hochengagiertenGründungsvorbereitungen<br />
ihre Arbeit<br />
aufgenommen. Es wurde<br />
festgestellt, dass nach der<br />
Umwandlung des „Deutschen<br />
Forums für Psychomotorik“<br />
in die DGfPM zunächst<br />
eine Phase der Euphorie zu<br />
registrieren war, die aber<br />
angesichts der Vielfältigkeit<br />
der Themen durch Ernüchterung<br />
abgelöst wurde, in der<br />
allerdings seither zunehmend<br />
geeignetere Formen<br />
der Organisations- und<br />
Kommunikationsstrukturen<br />
entwickelt werden.<br />
Die Homepage ist inzwischen<br />
dank des Engagements von<br />
Melanie Behrens und Horst<br />
Göbel soweit fertig gestellt,<br />
so dass nun ein Bild der<br />
DGfPM für die Öffentlichkeit<br />
zunehmend besser erstellt<br />
werden kann. Vermutlich ab<br />
Mitte Februar <strong>2010</strong> können<br />
aktuelle Entwicklungen<br />
(auch) dort eingesehen und<br />
Themen in einem Forum<br />
diskutiert werden.<br />
Zu den Vorständen der 6 Sek-<br />
tionen der DGfPM von AKP,<br />
DBM, BVDM, WVPM, BAM<br />
und den Psychomotorischen<br />
Vereinen bestehen gute,<br />
kontinuierliche und zuneh-<br />
mend perspektivische nicht mit psychomotorischer<br />
Kontakte.<br />
Begrifflichkeit bzw. Wirk-<br />
Auch im Europäischen Forum samkeit in Zusammenhang<br />
(EFP) konnte die Kooperation gebracht werden. Aus der<br />
intensiviert und verbessert gesamten psychomoto-<br />
werden. Nach dem Ausscheirischen Fachliteratur wird<br />
den von Eckhart Knab aus lediglich Renate Zimmer kurz<br />
der Kommission Wissenschaft zitiert; der Kontakt soll<br />
nimmt Melanie Behrens fortgesetzt werden.<br />
seine Stelle ein. Es sind • Erinnert wird an die Fach-<br />
Bemühungen im Gange, für tagung des Berufsverbands<br />
diese Arbeit Zuschüsse von der Motopäden (DBM e. V.)<br />
der EU zu erhalten. Die „bewegt und bewegend“<br />
nächste Studentenakademie vom 5. 3.–7. 3. <strong>2010</strong> in<br />
findet am 23.–25. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> Borken-Gemen; hieran ist<br />
in Genf statt.<br />
die DGfPM als Kooperations-<br />
Aus der Diskussion der partner beteiligt.<br />
weiteren Aktivitäten sind • Zu den derzeitigen Perspekbesonders<br />
folgende Punkte tiven der Psychomotorik in<br />
zu erwähnen:<br />
Deutschland plant die DGfPM<br />
• Die Bemühungen der ein eintägiges Symposium,<br />
Berufsverbände und Vereine voraussichtlich am 26. oder<br />
um Finanzierungsmöglich- 27. 11. <strong>2010</strong>.<br />
keiten psychomotorischer<br />
Gez. Eckhart Knab,<br />
Angebote werden intensiv<br />
mitverfolgt und gefördert;<br />
eine neue Initiative soll<br />
zusammen mit der DGfPM<br />
entwickelt werden.<br />
Horst Göbel<br />
• Die DGfPM unterstützt die 25 Jahre<br />
Initiativen zur „Bachelor-<br />
Psychomotorik“-Ausbildung<br />
auf allen nützlichen Ebenen<br />
und sucht die Kooperation<br />
mit der WVPM. Hierzu<br />
werden 5 Vorstandsmit-<br />
„Verein zur Bewegungsförderung<br />
und<br />
Psychomotorik“ e. V.<br />
Marburg<br />
glieder der DGfPM an einer Am 31. 10. 2009 beging der<br />
Bachelor-Arbeitsgruppe im „Verein zur Bewegungsförde-<br />
Rahmen der Jahrestagung rung und Psychomotorik e.V.<br />
der WVPM im Januar <strong>2010</strong> in Marburg“ sein 25-jähriges<br />
Bochum teilnehmen.<br />
• Eine Stellungnahme zum<br />
Jubiläum.<br />
13. Kinder- und Jugendhilfe- Prof. Dr. Astrid Krus schreibt<br />
bericht wird erörtert; mit in ihrem Grußwort: „Für eine<br />
dem Vorsitzenden der Sach- Institution ist ein Viertel-<br />
verständigenkommission des jahrhundert Ausdruck dafür,<br />
13. Kinder- und Jugendhilfe- dass man sich etabliert<br />
berichtes der Bundesregie- hat und ein angesehenes<br />
rung, Herrn Prof. Dr. Manfred Unternehmen ist … eine<br />
Keupp, hat Horst Göbel in feste Größe in Marburg und<br />
Mainz am Rande eines Umgebung, eine wichtige<br />
Vortrages ein Gespräch Anlaufstelle für viele Eltern,<br />
geführt. Es konnte verdeut- und ein Ort des Erlebens und<br />
licht werden, dass im Bericht der positiven Erfahrungen<br />
bewegungspädagogische für zahlreiche Kinder, Jugend-<br />
Erfolge/Konzepte überhaupt liche und Erwachsene“<br />
Gegründet wurde der Verein<br />
1984 durch eine Elterninitiative<br />
gemeinsam mit Lehrenden<br />
und Studenten des<br />
jungen Studienganges<br />
„Motologie“ der Philipps-<br />
Universität Marburg, zu den<br />
Gründungsvätern zählten u. a.<br />
Ulrich Kerste, Tilo Irmischer<br />
und Prof. Dr. Friedhelm<br />
Schilling.<br />
Startete der Verein 1984 mit<br />
fünf Fördergruppen, so kann<br />
er heute mit 77 Psychomotorikgruppen<br />
und 470<br />
Mitgliedern eine stolze<br />
Bilanz vorweisen. Schon<br />
1986 wurde das dezentrale<br />
wohnortnahe Konzept<br />
entwickelt und Förderangebote<br />
im ländlichen Raum<br />
angesiedelt, heute erstrecken<br />
sich die Aktivitäten des<br />
Vereins in einem Einzugsbereich<br />
von 40 km rund um<br />
Marburg. Das dezentrale<br />
Konzept ermöglicht die<br />
Entwicklungsbegleitung<br />
der Kinder und Jugendlichen<br />
in ihrem unmittelbaren<br />
sozialen Lebensumfeld, z. B.<br />
Kindertagesstätten und<br />
Schulen, für die mobilen<br />
Fachkräfte den Einblick in<br />
die Lebenswelt und die<br />
bessere Vernetzung mit den<br />
Institutionen.<br />
Drei Angestellte, fünfzehn<br />
Honorarkräfte und eine<br />
Sekretärin setzen derzeit das<br />
„Konzept der psychomotorischenEntwicklungsbegleitung“<br />
des Vereins um. Im<br />
Berufsprofil dominiert der/<br />
die Motologe/-in, aber auch<br />
pädagogische Grundqualifikationen<br />
mit psychomotorischer<br />
Zusatzausbildung<br />
stellen eine inhaltliche<br />
Bereicherung dar.<br />
Neben dem Frühförderbereich<br />
(269 Kinder) und dem<br />
Schulbereich (120 Kinder/<br />
Jugendliche) gewinnt der<br />
Seniorenbereich (67 Senioren)<br />
seit der Etablierung und
Ausgestaltung des „motogeragogischen<br />
Konzeptes“<br />
durch Dr. Marianne Eisenburger<br />
an wachsender<br />
Bedeutung. Auch hier findet<br />
der überwiegende Anteil an<br />
psychomotorischer Arbeit in<br />
den Senioreneinrichtungen<br />
statt.<br />
Prof. Dr. Ruth Haas entwickelte<br />
1995 im Rahmen des<br />
Vereins ein psychomotorisches<br />
Nachsorgeangebot als<br />
flankierende Maßnahme zur<br />
ambulanten psychiatrischen<br />
Behandlung und Teil eines<br />
unterstützenden Netzwerks,<br />
was seitdem erfolgreich<br />
fortgeführt wird.<br />
Die Aktivitäten des Vereins<br />
verzweigen sich in zahlreiche<br />
Projekte und sind weitreichend<br />
vernetzt. 1992 ent-<br />
stand unter Federführung<br />
von Michael Müller-Schwarz<br />
das „Projekt Sportförderung“,<br />
ein Programm des Hessischen<br />
Kultusministeriums<br />
und des Landessportbundes<br />
„zur Förderung der Zusammenarbeit<br />
von Schulen und<br />
Vereinen“, kontinuierlich<br />
fortgeführt und erweitert<br />
wurde dieses Projekt im<br />
Dezember 2009 als „Initiative<br />
des Jahres“ bundesweit<br />
in der Kategorie „Inte-<br />
gration durch Bewegung und<br />
Sport“ vom Deutschen<br />
Olympischen Sportbund<br />
ausgezeichnet.<br />
Die differenzierte Angebotsstruktur<br />
des Vereins reicht<br />
von Psychomotorik in<br />
Kindergarten und Schule,<br />
psychomotorischer Intensivförderung<br />
in Kleinstgruppen,<br />
Bewegungsbaustellen im<br />
Nachmittagsschulangebot,<br />
speziellen Angeboten in<br />
benachteiligten Stadtteilen,<br />
„Psychomotorik in der Natur“<br />
bis zu „motopädagogischen<br />
Reiterferien“, auch Eltern-<br />
Kind-Gruppen, Schwimmgruppen,Graphomotorikförderung<br />
und „psychomoto-<br />
rische Bewegungsangebote<br />
nach Krebs“ und hatten ihre<br />
Zeit im Verein.<br />
Das, 1987 erstmals unter der<br />
Leitung von Prof. Dr. Klaus<br />
Fischer durchgeführte,<br />
„Fortbildungskonzept<br />
Psychomotorik“ für Erzieherinnen<br />
der Stadt Marburg<br />
wurde im Laufe der Jahrzehnte<br />
zu einer nachhaltigen<br />
Kooperation zwischen dem<br />
„Fachdienst Kinderbetreuung“<br />
und dem Verein<br />
ausgebaut. Ziel ist die<br />
psychomotorische Entwicklungsbegleitung<br />
von Kindern,<br />
die Fort- und Weiterbildung<br />
sowie die fachliche Begleitung<br />
der pädagogischen<br />
Fachkräfte in städtischen<br />
Kindertagesstätten, wo sich<br />
die Psychomotorik inzwischen<br />
zu einem pädagogischen<br />
Schwerpunkt entwickelt hat.<br />
So konnte die „Kita Höhenweg“,<br />
eine Marburger Ein-<br />
richtung, 2009 das Zertifikat<br />
„Bewegungskindergarten“<br />
des Hessischen Sportbundes<br />
erwerben, wofür sich die<br />
Erzieherinnen in fünfwöchigen<br />
Psychomotorikkursen<br />
des Vereins qualifiziert<br />
hatten. Inzwischen konnten<br />
unter denselben Umständen<br />
zwei weitere Kitas das<br />
Gütesiegel „Bewegungskindergarten“<br />
erlangen.<br />
Unabdingbar für die Ver-<br />
breitung der „psychomotorischen<br />
Idee“ ist die Mitarbeit<br />
in lokalen Gremien und<br />
Arbeitsgruppen zu Themen<br />
der Gesundheitsförderung,<br />
des Sozialen und der Inte-<br />
gration: so war der Verein<br />
beteiligt bei der Erstellung<br />
des „Leitfadens Integration“,<br />
einem Handbuch der Stadt<br />
und des Kreises zur Verbesserung<br />
und Vereinheitlichung<br />
der Förder- und<br />
Betreuungsqualität in der<br />
Integration.<br />
Momentan arbeitet der Verein<br />
gemeinsam mit dem „Fachdienst<br />
Kinderbetreuung“ der<br />
Stadt Marburg an einem<br />
Handbuch zu dem Thema<br />
„Entwicklungs-, Gesundheits-<br />
und Bildungsförderung durch<br />
Bewegung“.<br />
In der Arbeitsgruppe „Kort“,<br />
einem regionalen „Netzwerk<br />
Gesundheit“ arbeitet der<br />
Verein gemeinsam mit<br />
Kinderärzten, Gesundheitsamt,<br />
Staatlichen Schulamt,<br />
Sportkreis Marburg und<br />
anderen gesundheits- und<br />
bewegungsorientierten<br />
Einrichtungen an Maßnahmen<br />
präventiver Gesundheitsförderung<br />
um z. B. dem<br />
Risiko „Übergewicht bei<br />
Kindern“ sinnvoll zu begegnen.<br />
Den jährlichen „Marburger<br />
Gesundheitstagen“ für<br />
Grundschulklassen gestaltet<br />
der Verein gemeinsam mit<br />
vielen anderen Initiativen,<br />
hier werden Kindern viel-<br />
fältige Formen gesunden<br />
Lebens präsentiert u. a. durch<br />
ein ansprechendes Bewegungsangebot.<br />
35
36<br />
Veranstaltungen<br />
Als gegenseitig bereichernd<br />
muss die enge Zusammenarbeit<br />
mit dem Fachbereich<br />
„Motologie“ der Uni Marburg<br />
erwähnt werden: häufig<br />
schon konnten innovative<br />
Ideen und Projektvorhaben<br />
von Dozentinnen und<br />
Student/innen im Verein in<br />
die Praxis umgesetzt werden<br />
und trugen so zur Qualitätsentwicklung<br />
bei, umgekehrt<br />
konnten Studenten durch<br />
Lehraufträge, Praktika und<br />
Hospitationen von den<br />
Fachkräften des Vereins<br />
profitieren.<br />
Seit 1990 besteht die<br />
intensive Kooperation des<br />
Vereins mit der „Deutschen<br />
Akademie für Psychomotorik“<br />
(<strong>dakp</strong>), ehemals akM,<br />
viele Teilnehmer/innen der<br />
Berufsqualifikation der <strong>dakp</strong><br />
erwerben im letzten<br />
Abschnitt ihrer Ausbildung<br />
psychomotorische Praxis<br />
durch die Fördergruppen des<br />
Vereins. Durch Personalunionen,<br />
Beteiligung an<br />
curricularer Weiterentwicklung<br />
in der <strong>dakp</strong>, enger<br />
Verzahnung und Austausch<br />
finden auch immer wieder<br />
aktuelle fachwissenschaftliche<br />
Impulse Eingang in die<br />
inhaltliche Arbeit des<br />
Vereins.<br />
Veranstaltungen<br />
30. <strong>April</strong> – 2. Mai <strong>2010</strong><br />
„Wenn jemand spricht,<br />
wird es heller.“ –<br />
Klang, Geste, Imagination<br />
In jedem Sprechen werden<br />
sowohl die Fähigkeiten zur<br />
Imagination wie auch zur<br />
Symbolisierung entwickelt<br />
und die Befähigung, sich<br />
über die Primärbeziehung<br />
hinaus in das soziale Leben<br />
der Anderen einzufinden.<br />
Das Sprechen erlaubt den<br />
Zugang zur sozialen Welt<br />
und ermöglicht damit einen<br />
Ausgang aus dem symbiotischen<br />
Einschluss mit dem<br />
Primärobjekt. Die Tagung<br />
nähert sich diesem umfassenden<br />
und vielgestaltigen<br />
Thema in Vorträgen und<br />
Arbeitsgruppen zum Umgang<br />
mit klinischem Material.<br />
Ort: Logenhaus,<br />
Emserstr. 12-13,<br />
10719 Berlin<br />
E-Mail: jahrestagung@<br />
vakjp.de<br />
URL: http://www.vakjp.<br />
de/index-veranstalt.<br />
htm<br />
7.–8. Mai <strong>2010</strong><br />
Ein-Blicke in die Tiefe.<br />
Die Methode der psychoanalytischenSäuglingsbeobachtung<br />
und<br />
ihre Anwendungen<br />
Im Zentrum des Symposiums<br />
steht die von Esther Bick in<br />
London entwickelte Infant-<br />
Observation, die seit fünfzig<br />
Jahren eine Schlüsselstellung<br />
innerhalb der psychoanalytischen<br />
Lehre und Forschung<br />
einnimmt. Teilnehmer/innen<br />
an Beobachtungsseminaren<br />
wird die Möglichkeit<br />
eröffnet, ihre Fähigkeiten im<br />
Verstehen von menschlichen<br />
Beziehungen und von<br />
unbewussten Prozessen zu<br />
vertiefen. Das Symposium ist<br />
mit international hochrangigen<br />
Vortragenden aus dem<br />
In- und Ausland besetzt, die<br />
die psychoanalytische Beob-<br />
achtung und ihre Anwendungsformen,<br />
anhand von<br />
Beobachtungsmaterial,<br />
Praxisbeispielen und For-<br />
schungsergebnissen darstellen.<br />
In zwei Workshops<br />
Auf der wirtschaftlichen<br />
Ebene hat der Verein sowohl<br />
die Bergkuppen gesehen<br />
(Übernahme der Psychomotorikkosten<br />
durch die<br />
Krankenkassen) als auch<br />
schon die Talsohle erreicht<br />
(Streichung der Psychomotorik<br />
aus dem Heilmittelkatalog),<br />
durch umsichtige<br />
Geschäftsführung und<br />
Verzichtleistungen der<br />
MitarbeiterInnen sind die<br />
Krisen weitestgehend<br />
überstanden, der Verein<br />
existiert nun überwiegend<br />
aus (erschwinglichen)<br />
Mitglieds-/Elternbeiträgen,<br />
Einnahmen aus dem Reha-<br />
haben die Teilnehmer die<br />
Gelegenheit, mit namhaften<br />
Vertreter/innen der psychoanalytischen<br />
Beobachtung<br />
anhand von Beobachtungsnotizen<br />
oder Falldarstellungen<br />
aus der eigenen Berufs-<br />
praxis die Fruchtbarkeit<br />
dieser Methode zu erleben<br />
und dabei die eigene innere<br />
Haltung zu reflektieren.<br />
Ort: Fakultät für<br />
interdisziplinäre<br />
Forschung und<br />
Fortbildung, Institut<br />
für Unterrichts-<br />
und Schulentwicklung,<br />
Schottenfeld-<br />
gasse 29, 1070 Wien<br />
URL: http://ius.uni-klu.<br />
ac.at/ein-blicke<br />
8. Mai <strong>2010</strong><br />
Bundesweite Fachtagung<br />
für Psychomotorik<br />
„Verspielte Kindheit:<br />
Wie kindliche Entwicklungspotentiale<br />
über Spiel und<br />
Bewegung wirksam werden“<br />
Kindheit gilt gemeinhin als<br />
Zeitraum, der Menschen<br />
Sport, Mitteln der Eingliederungshilfe<br />
und Fortbildungseinnahmen.<br />
In einer Feierstunde mit<br />
Kooperationspartnern,<br />
Förderern und Mitarbeiter/innen<br />
beging der Verein im<br />
Institut für Leibesübungen<br />
(IFL) im Oktober sein 25jähriges<br />
Jubiläum.<br />
Am darauf folgenden Tag<br />
zitierte die örtliche Presse<br />
in einem Leitartikel den<br />
Marburger Bürgermeister<br />
Franz Kahle mit den Worten:<br />
„Für uns ist es ein Glücksfall,<br />
dass wir eine solche Institution<br />
haben“.<br />
Jutta Müller<br />
unbeschwert für ihre<br />
Entwicklung zur Verfügung<br />
steht. Bei der Frage, ob es<br />
trotz eines ständigen<br />
Wandels kindlicher Rahmenbedingungen<br />
Konstanten für<br />
eine gesunde Entwicklung<br />
gibt, rücken neben einer<br />
sicheren Bindung das Spiel,<br />
Raum für Kreativität und die<br />
Bewegung in den Mittelpunkt.<br />
Häufig begrenzen<br />
phantasielos gestaltete<br />
Räume die Spiel- und<br />
Bewegungsfreude der Kinder.<br />
Stattdessen werden schon<br />
kognitive Lernprogramme für<br />
Neugeborene empfohlen und<br />
nicht selten einer selbsttätigen,<br />
spielerischen Auseinandersetzung<br />
mit der Umwelt<br />
vorgezogen. Die Zeit für eine<br />
verspielte Kindheit scheint<br />
zu schrumpfen. Psychomotorik<br />
eröffnet Spielräume,<br />
Psychomotorik begeistert<br />
Kinder und Jugendliche –<br />
sie erhalten Zeit für eine<br />
eigenständige sozial-emo-<br />
tionale Entwicklung, in der<br />
sie ihre Spiel- und Bewe-
gungsfreude ausleben<br />
können. Psychomotorik<br />
stärkt Erwachsene, die für<br />
Kinder sinnvolle räumliche<br />
und zeitliche Rahmenbedingungen<br />
schaffen, so dass<br />
diese „Kind sein“ dürfen.<br />
Die Fachtagung lädt zum<br />
freudvollen Spielen, Denken<br />
und Bewegen ein. Pädagogen,<br />
Therapeuten und Eltern<br />
erhalten Gelegenheit, die<br />
Psychomotorik mit neuen<br />
Ideen und in gewohnter<br />
Verbindung von Theorie und<br />
Praxis zu erleben.<br />
Ort: Rheinische<br />
Akademie im<br />
Förderverein<br />
Psychomotorik,<br />
53113 Bonn<br />
E-Mail: akademie@<br />
psychomotorikbonn.de<br />
URL: http://www.<br />
psychomotorikbonn.de/pages/<br />
fachtagung<strong>2010</strong>.<br />
htm<br />
13.–15. Mai <strong>2010</strong><br />
Was hilft?<br />
Wenn wir anderen<br />
erfolgreich helfen<br />
Diese Frage stellt sich allen,<br />
die in helfenden Berufen<br />
tätig sind.<br />
Eine alle verbindende<br />
Antwort ist: Du musst die<br />
Menschen lieben und das<br />
Richtige tun. Das bedeutet<br />
einerseits Liebe zu den<br />
Menschen, also die gelingende<br />
Beziehung zu den<br />
Betroffenen, den Mitarbeitern<br />
und zu sich selbst, und<br />
andererseits professionelles<br />
Handeln nach den „Regeln<br />
der Kunst = state of the art“.<br />
In Vorträgen werden zentrale<br />
Facetten dieses Kongressmottos<br />
erörtert. Darüber<br />
hinaus werden in Hauptreferaten<br />
wesentliche<br />
Themen unserer Zeit<br />
dargestellt und Hilfestellungen<br />
angeboten aus der<br />
Perspektive von Neurobiologie<br />
und Medizin, Pädagogik,<br />
Heilpädagogik, Psychologie<br />
und Therapie sowie Soziologie<br />
und Ökonomie. An<br />
den beiden Nachmittagen<br />
können in einer Vielzahl von<br />
Seminaren und Symposien<br />
wichtige Aspekte noch<br />
vertieft werden.<br />
Ort: Kultur- und<br />
Kongresshaus<br />
am Dom, Leo-<br />
Neumayerplatz 1,<br />
5600 St. Johann<br />
E-Mail: hpg-salzburg@<br />
drei.at<br />
URL: http://www.hpgsalzburg.at/daten.<br />
htm<br />
3.–5. Juni <strong>2010</strong><br />
Jahrestagung der<br />
dvs-Sektion Sportpädagogik:<br />
Sportpädagogik als<br />
Erfahrungswissenschaft<br />
Ausgangspunkt einer<br />
Pädagogik des Sports ist die<br />
Vorstellung, dass Bildungspotenziale<br />
nicht nur über<br />
das Erlernen bewegungskultureller<br />
Praktiken, sondern –<br />
in gleichem Maße – über die<br />
individuellen Erfahrungen im<br />
Rahmen der ermöglichten<br />
Lernprozesse zu bestimmen<br />
sind. Demnach gibt es keinen<br />
Sport, der nicht zugleich<br />
erzieht – zum Guten oder<br />
zum Schlechten. Der<br />
Sportpädagogik kommt als<br />
Wissenschaft die Funktion<br />
zu, angemessene Bildungserwartungen<br />
an Bewegung,<br />
Spiel und Sport zu formulieren,<br />
sowie diese für schulische<br />
wie auch außerschulische<br />
Vermittlungsfelder zu<br />
spezifizieren und auf ihre<br />
tatsächlichen Wirkungen hin<br />
zu untersuchen. Hierbei soll<br />
die empirische Forschung<br />
ein Gegengewicht zu dem<br />
normativ gehaltenen<br />
Begründungsdiskurs schaffen<br />
und sicherstellen, dass die<br />
erwünschten Erziehungs-<br />
und Bildungsprozesse auch<br />
eingelöst werden können.<br />
Der Begriff der Erfahrung<br />
steht demnach in einem<br />
mehrfachen Sinne zur<br />
Diskussion.<br />
Ort: Haus Neuland,<br />
Senner Hellweg 493,<br />
33689 Bielefeld<br />
E-Mail: Kornelia<br />
Gagelmann@<br />
uni-bielefeld.de<br />
URL: http://www.unibielefeld.de<br />
16.–19. Juni <strong>2010</strong><br />
Weltkongress „Inclusion<br />
International – Inklusion-<br />
Rechte werden Wirklichkeit“<br />
Alle Staaten der Erde gehören<br />
zu den Vereinten Nationen.<br />
Sie haben eine Vereinbarung<br />
beschlossen. Diese „Konvention“<br />
schützt die Rechte<br />
behinderter Menschen.<br />
Sie gilt als Gesetz in allen<br />
Ländern, die sie unterschrieben<br />
haben. Was in dem<br />
Gesetz steht, muss jetzt für<br />
Menschen mit geistiger<br />
Behinderung auch Wirklichkeit<br />
werden. Im Mittelpunkt<br />
des Kongresses stehen junge<br />
und alte Menschen mit<br />
geringer bis hin zu schwerer<br />
geistiger Behinderung, sowie<br />
ihre Familien. Über ihre<br />
Rechte wird gesprochen:<br />
Ihr Recht auf ein Leben in<br />
Würde. Behinderte Menschen<br />
haben gleiche Rechte,<br />
auch das Recht, selbst<br />
Entscheidungen zu treffen.<br />
Sie leben mitten in der<br />
Gemeinschaft. Sie haben das<br />
Recht auf inklusive Bildung<br />
wie alle anderen. Sie haben<br />
das Recht auf ein Leben<br />
ohne Armut. Niemand darf<br />
sie abwertend behandeln<br />
und diskriminieren. Sie<br />
gehören dazu und dürfen<br />
nicht sozial ausgegrenzt<br />
werden.<br />
Ort: Estrel Hotel und<br />
Convention Center,<br />
Sonnenallee 225,<br />
12057 Berlin<br />
E-Mail: inclusion@ctwcongress.de<br />
URL: www.inclusion<strong>2010</strong>.<br />
de<br />
29. Juni – 3. Juli <strong>2010</strong><br />
Infancy in Times<br />
of Transition –<br />
12. Weltkongress für<br />
seelische Gesundheit in<br />
der frühen Kindheit<br />
Hauptvorträge und Master<br />
Class Lectures zu zahlreichen<br />
Themen der kindlichen<br />
Entwicklung in Zeiten des<br />
gesellschaftlichen Umbruchs.<br />
Ort: Congress Center<br />
Leipzig,<br />
Messe-Allee 1,<br />
04356 Leipzig<br />
E-Mail: congress@<br />
waimh.org<br />
URL: http://www.waimhleipzig<strong>2010</strong>.org/<br />
index.htm<br />
37
38<br />
Buchbesprechungen /Neuerscheinungen<br />
Buchbesprechungen /Neuerscheinungen<br />
Lücking, Chr./Reichenbach,<br />
Chr. (2009)<br />
Praxis konkret im<br />
(Förder-)Schulalltag<br />
Förderung von Kindern mit<br />
Förderbedarf in der körperlich-motorischen,<br />
sozial-<br />
emotionalen, sprachlich-<br />
kommunikativen und<br />
geistigen Entwicklung<br />
Dortmund: modernes lernen<br />
ISBN: 978-3-8080-0642-9<br />
€ 19, 95<br />
Der erste Teil des Buches<br />
befasst sich in aller Kürze<br />
mit Bedingungen und<br />
Erfordernissen von Lernen<br />
in heterogenen Gruppen.<br />
Dabei wird auf das mögliche<br />
Verhalten von Pädagogen<br />
sowie den Einsatz und die<br />
Bedeutung von Regeln und<br />
Ritualen vor dem Hintergrund<br />
verschiedener<br />
Verständnisse von Lernen<br />
und individueller Lernwege<br />
eingegangen. Im Weiteren<br />
wird die Bedeutung von<br />
Differenzierungen für sonder-<br />
pädagogische Klientel für<br />
schulische und außerschulischen<br />
Förderangebote<br />
aufgezeigt und exemplarisch<br />
für verschiedene Formen von<br />
Beeinträchtigungen veranschaulicht.<br />
Im Speziellen wird auf die<br />
Förderschwerpunkte<br />
Sprache, geistige Entwicklung,<br />
körperlich-motorische<br />
Entwicklung sowie emotio-<br />
nale und soziale Entwicklung<br />
eingegangen. Für diesen Teil<br />
konnten weitere Fachautoren<br />
gewonnen werden, die die<br />
spezifischen Förderschwerpunkte<br />
und damit verbunden<br />
die individuellen Förderbedürfnisse<br />
dieser heterogenen<br />
Klientel betrachten. Vor dem<br />
Hintergrund der theoretischen<br />
Ausführungen befinden<br />
sich im zweiten umfangreicheren<br />
Teil des Buches<br />
Fördersequenzen zu bestimmten<br />
Themengebieten.<br />
Hierzu zählen Praxisaufgaben<br />
und -situationen wie<br />
z. B. Kooperation, Vertrauen,<br />
Schulhof, Trampolin. Diese<br />
Sammlung von Ideen be-<br />
inhaltet zahlreiche Differenzierungen,<br />
welche eine<br />
konkrete Anwendung in der<br />
Zusammenarbeit in heterogenen<br />
Gruppen im schulischen<br />
und außerschulischen<br />
Kontext veranschaulichen<br />
und ermöglichen. Die Praxis-<br />
sequenzen verdeutlichen,<br />
wie bestimmte Aufgaben zu<br />
einem speziellen Thema für<br />
verschiedene Klientel<br />
differenziert werden können<br />
und müssen, um Fördersequenzen<br />
in stark heterogenen<br />
Gruppen für alle<br />
Beteiligten ansprechend und<br />
gewinnbringend zu gestalten.<br />
Witting, A./Dörken, Y. (2009)<br />
Bewegte<br />
Konzentrationsförderung<br />
100 neue und bewährte<br />
Übungen und Spiele<br />
Praxisbücher Sport<br />
Wiebelsheim: Limpert<br />
ISBN: 978-3-7853-1773-0<br />
€ 14,95<br />
Kinder mit Konzentrationsproblemen<br />
haben nicht nur<br />
in der Schule große Schwierigkeiten,<br />
dem Unterricht zu<br />
folgen, sondern sind auch in<br />
ihrem Spiel- und Freizeitverhalten<br />
beeinträchtigt. Die<br />
Folgen sind meist Frustration<br />
und mangelndes Selbstbewusstsein.<br />
Das neu ent-<br />
wickelte Konzept der<br />
„Bewegten Konzentrationsförderung“<br />
schafft hier einen<br />
wirkungsvollen präventiven<br />
und therapeutischen Lösungs-<br />
ansatz: Durch den Wechsel<br />
von Bewegung und kognitiven<br />
Leistungen lernen<br />
Kinder, sich spielerisch zu<br />
konzentrieren und ihre<br />
Aufmerksamkeit bewusst zu<br />
steuern. Die Autorinnen<br />
stellen in diesem Buch 100<br />
ihrer in der Praxis erfolgreich<br />
eingesetzten Spiele und<br />
Übungen zur Konzentrationsförderung<br />
vor und differenzieren<br />
dabei nach den ver-<br />
schiedenen Wahrnehmungen<br />
und Verhaltensformen. Das<br />
Buch richtet sich auch an<br />
Lehrer, Erzieher, Therapeuten<br />
und Übungsleiter und ist<br />
zudem allen Eltern zu<br />
empfehlen, deren Kinder<br />
Schwierigkeiten haben, sich<br />
zu konzentrieren.<br />
Schoo, M. (<strong>2010</strong>)<br />
Sport für Menschen<br />
mit motorischen<br />
Beeinträchtigungen<br />
München: Ernst Reinhardt<br />
ISBN: 978-3-497-02128-4<br />
€ 29,90<br />
Sport macht Spaß, fordert<br />
heraus und ermöglicht<br />
Gemeinschaftserlebnisse.<br />
Dies gilt auch für Menschen<br />
mit körperlichen Beeinträchtigungen.<br />
Das Buch zeigt in<br />
Theorie und Praxis auf, wie<br />
Sportangebote für Menschen<br />
mit motorischen Beeinträchtigungen<br />
gestaltet werden<br />
können. Es bietet eine<br />
Vielzahl von praxiserprobten<br />
Anregungen für abwechslungsreiche<br />
Sportstunden in<br />
Schulen, Vereinen und<br />
Werkstätten. Das Spektrum<br />
der dargestellten Sportangebote<br />
umfasst bekannte und<br />
weniger bekannte Sportarten,<br />
wie Leichtathletik,<br />
Schwimmen, therapeutisches<br />
Reiten, Turnen und Tanzen,<br />
aber auch Rafroball,<br />
Zonenhockey, Rollstuhlrugby<br />
und Sport Stacking. Die<br />
theoretische Einführung<br />
behandelt ausführlich die<br />
Bedeutung des Sports für<br />
Menschen mit motorischen<br />
Beeinträchtigungen,<br />
grundlegende methodischdidaktische<br />
Überlegungen<br />
und den Aspekt der Heterogenität.<br />
Belz, M./Frey, G. (<strong>2010</strong>)<br />
Doppelstunde Sport 8<br />
Leichtathletik<br />
Band 1. Klasse 5–7 (10- bis<br />
12-Jährige). Unterrichtseinheiten<br />
und Stundenbeispiele<br />
für Schule und Verein<br />
(inkl. CD-ROM)
Schorndorf: <strong>Hofmann</strong><br />
ISBN: 978-3-7780-0581-1<br />
€ 19,90<br />
Leichtathletik ist eine Kern-<br />
sportart. Jede Schülerin und<br />
jeder Schüler begegnet ihr<br />
mehrfach im Laufe des<br />
Schullebens. Die erzielten<br />
Ergebnisse sind transparent<br />
und die gesetzten Ziele meist<br />
nur schwer zu erreichen. In<br />
der Regel bedarf es nicht<br />
unerheblicher koordinativer<br />
und physischer Voraussetzungen.<br />
Zu dieser Leichtathletik<br />
stehen wir. Sie ist<br />
heute pädagogisch genauso<br />
begründbar wie zu Zeiten<br />
der Bildungstheorie: Wich-<br />
tige Elemente sind Anstrengung<br />
und Leistung. Warum<br />
sollten ausgerechnet sie im<br />
Sport keine Rolle mehr<br />
spielen? Doch warum<br />
müssen Schülerinnen und<br />
Schüler, wenn sie zum ersten<br />
Mal mit Laufen, Springen<br />
und Werfen konfrontiert<br />
werden, sofort dieser<br />
„klassischen“ Leichtathletik<br />
begegnen? Das schreckt<br />
vielfach ab, insbesondere<br />
wenn sie nur zur Notenfindung<br />
und ohne jede Vorbereitung<br />
benutzt wird. Leicht-<br />
athletik macht dann Spaß,<br />
wenn durch die richtigen<br />
Inhalte das Neugierdeverhalten<br />
geweckt, durch instrumentelle<br />
Unterstützung beim<br />
Springen „Körperfeeling“<br />
oder durch die richtigen<br />
Wurfgeräte „Freude am<br />
Effekt“ vermittelt wird.<br />
Leichtathletik wird zum<br />
Erlebnis, wenn Spielformen<br />
und das Team eine entscheidende<br />
Rolle spielen und<br />
durch altersgemäß vereinfachte<br />
methodische Reihen<br />
das Lernen zum Erfolg wird.<br />
Das Buch enthält zu den<br />
Bereichen Laufen, Springen<br />
und Werfen jeweils sechs<br />
durchaus sportorientierte<br />
und zugleich entwicklungsgemäße<br />
Unterrichtseinheiten<br />
für die Klassen 5 bis 7.<br />
Haag, H. (2009)<br />
Doppelstunde Sport 7<br />
Alpiner Skilauf<br />
Unterrichtseinheiten und<br />
Stundenbeispiele für Schule<br />
und Verein (inkl. CD-Rom)<br />
Schorndorf: <strong>Hofmann</strong><br />
ISBN: 978-3-7780-0571-2<br />
€ 19,90<br />
Das Buch bietet im Teil I<br />
(„Skilauf unterrichten“) in<br />
sechs Abschnitten eine<br />
Einleitung in das Thema<br />
„Alpiner Skilauf“: Sportart/<br />
Bewegungskompetenzen und<br />
motorisches Anforderungsprofil/Vario-Technik<br />
und<br />
Vario-Methodik/Lehr-und<br />
Lerntheorie/Äußere Bedingungen/Aufbau<br />
des Buches<br />
„Doppelstunde“. Teil II ent-<br />
hält in sechs Doppelstunden<br />
„Einführung und Grundlagen<br />
des Alpines Skilaufs“. Unter-<br />
richtselemente sind hier<br />
Einführung in die Skiausrüstung<br />
und Gehen & Laufen in<br />
der Ebene/Aufsteigen und<br />
Geradeaus-Abfahren/<br />
Liftfahren und Schrägabfahren/Bogenfahren/Beidbeinskifahren/Einbeinskifahren.<br />
In Teil III werden „Impulse<br />
für Richtungsänderungen im<br />
Alpinen Skilauf“ in sechs<br />
Doppelstunden behandelt.<br />
Diese Impulse stellen<br />
Schwungprinzipien dar. Sie<br />
konkretisieren sich in den<br />
folgenden sechs Aspekten,<br />
d. h. als drei jeweils gegensätzliche<br />
Formen-Paare.<br />
Dies sind: Hochentlasten-<br />
Tiefentlasten, Rotieren-<br />
Gegendrehen, Umsteigen-<br />
Carven. Damit erfolgt eine<br />
Analyse und Darstellung des<br />
Alpinen Skilaufs in seiner<br />
ganzen Bandbreite von<br />
technischen Möglichkeiten.<br />
Teil IV enthält sechs Doppelstunden,<br />
die sich auf<br />
„Ganzheitliche Konzepte für<br />
das Erlernen des Alpinen<br />
Skilaufs beziehen“. Ganzheitlich<br />
heißt, dass Zweier- und<br />
Dreierwechsel mit Bezug zu<br />
Aufgabenstellungen gefahren<br />
werden und dass das<br />
Einbeziehen von Musik,<br />
Spielen/Wettkämpfen und<br />
Skirennlauf Teil des Skiunterrichts<br />
ist. Das Buch<br />
enthält zudem reichlich<br />
Bildmaterial, Bewegungsbeispiele<br />
zu den Doppelstunden<br />
auf einer beigefügten CD<br />
sowie einen ausführlichen<br />
Anhang zur Orientierung für<br />
den Skilehrer.<br />
Jungmann, T./Reichenbach,<br />
Chr. (2009)<br />
Bindungstheorie und<br />
pädagogisches Handeln<br />
Ein Praxisleitfaden<br />
Dortmund: borgmann<br />
39
40<br />
Buchbesprechungen /Neuerscheinungen<br />
ISBN: 978-3-938187-56-2<br />
€ 19,95<br />
Pädagogischen Fachkräften<br />
ist die Bedeutung von<br />
Bindung und Beziehung in<br />
Förderkontexten hinreichend<br />
bekannt: Beziehungsgestaltung<br />
ist der Schlüssel zum<br />
Fördererfolg! Eine wesentliche<br />
Grundlage der Auseinandersetzung<br />
mit<br />
beziehungsorientierter<br />
Förderung ist die Bindungstheorie.<br />
Übertragen auf<br />
pädagogische Kontexte kann<br />
die Beziehung zur pädagogischen<br />
Fachkraft als<br />
wichtiger Schutzfaktor und<br />
Ressource betrachtet werden.<br />
Dieses Buch legt dar, welche<br />
Bedeutung gelungene im<br />
Vergleich zu misslungener<br />
Beziehungserfahrungen für<br />
die kindliche Entwicklung in<br />
verschiedenen Förderkontexten,<br />
wie den Frühen Hilfen,<br />
der Frühförderung, der<br />
Tagesbetreuung in Krippen<br />
und Kindergärten sowie der<br />
Schule hat. Dies wird anhand<br />
von Fallbeispielen verdeutlicht.<br />
Ideen für die Beziehungsgestaltung<br />
in pädagogischen<br />
Kontexten werden<br />
abgeleitet und Anregungen<br />
für die Reflexion der eigenen<br />
Beziehungsgestaltung zum<br />
Kind in der pädagogischen<br />
Arbeit gegeben.<br />
Kraus, U. (2009)<br />
Spiel-„Turnen“<br />
Psychomotorische Bewegungsstunden<br />
für Kindergarten,<br />
Schule, integrative<br />
Kleingruppen<br />
Dortmund: modernes lernen<br />
ISBN: 978-3-8080-0652-8<br />
€ 15,80<br />
Dieses Praxisbuch bietet<br />
für ein ganzes Jahr Themen<br />
zur Bewegungsförderung.<br />
Der Begriff „Spiel-Turnen“<br />
entstand auf der Suche nach<br />
einem kindgerechten Namen<br />
für „psychomotorische<br />
Übungsstunden“, vor denen<br />
nach Erfahrung der Autorin<br />
Eltern wie Kinder eine<br />
gewisse Scheu zeigen und<br />
meinten: „Das hört sich so<br />
krank an!“ Nach einer kurzen<br />
Einführung in die Unterschiede<br />
zum „normalen“<br />
Sportunterricht und die Ziele<br />
der Psychomotorik, finden<br />
sowohl Erzieher und Lehrer<br />
für Krabbelgruppen, Kindergarten,<br />
Hort und Grundschulklassen,<br />
als auch<br />
Übungsleiter in Sportvereinen<br />
knapp 100 Stundenvorschläge<br />
für phantasievolle<br />
Bewegungsstunden, die alle<br />
Sinne ansprechen. Die<br />
Angebote sind klar strukturiert,<br />
mit Material-Angaben<br />
und Vorschlägen zum Raum-<br />
bzw. Hallenaufbau. Bei den<br />
verwendeten Materialien<br />
handelt es sich fast ausschließlich<br />
um kostengünstiges<br />
Alltagsmaterial. Die<br />
Gliederung nach Jahreszeiten<br />
entspricht den Förder-<br />
und Lehrplänen in Kindergarten<br />
und Schule und<br />
erleichtert die Suche. Das<br />
Buch ist eine kleine erprobte<br />
„Ideen-Kiste“ für den psycho-<br />
motorischen Alltag in<br />
kleinen und großen Räumen,<br />
für große und kleine<br />
Gruppen oder auch einzelne<br />
Kinder.<br />
Neuber, N. (2009)<br />
Supermann kann<br />
Seilchen springen<br />
Bewegung, Spiel und<br />
Sport mit Jungen<br />
Dortmund: borgmann<br />
ISBN: 978-3-938187-51-7<br />
€ 21,95<br />
Jungen sind die neuen<br />
Problemkinder: Sie sind<br />
unkonzentrierter und lauter,<br />
stören häufiger, fordern<br />
mehr Aufmerksamkeit, sind<br />
unkooperativer und aggres-<br />
siver als Mädchen. In<br />
Kindergarten und Schule<br />
verlangen sie mehr Zeit und<br />
Raum, sind oft aber auch<br />
schneller abgelenkt und<br />
schreiben schlechtere Noten.<br />
Nach Jahren der Mädchenförderung<br />
rücken die Jungen<br />
in den Fokus der Aufmerksamkeit.<br />
Aber sind Jungen<br />
wirklich so auffällig, wie es<br />
auf den ersten Blick scheint?<br />
Wie können wir ihre<br />
Entwicklung fördern? Und<br />
welche Rolle spielen<br />
Bewegung, Spiel und Sport<br />
dabei? Das Buch beschreibt<br />
die Bedingungen des<br />
Aufwachsens von Jungen aus<br />
einer jungenparteilichen<br />
Perspektive. Darauf aufbauend<br />
werden Ansätze der<br />
Entwicklungsförderung von<br />
Jungen vorgestellt. Im<br />
Mittelpunkt steht das so<br />
genannte „Variablenmodell“,<br />
das sowohl aktive, leistungsbezogene,<br />
als auch passive,<br />
reflexive Aspekte integriert.<br />
Es setzt weniger bei den<br />
Defiziten und Problemen von<br />
Jungen an, sondern greift<br />
ihre Wünsche und Bedürfnisse<br />
auf – sowohl nach<br />
wilden Balgereien und<br />
,richtigem‘ Sport als auch<br />
nach sozialen Kontakten und<br />
Entspannung. Im Hauptteil<br />
des Buchs werden vielfältige<br />
Bewegungs- und Spielformen<br />
zur Jungenförderung<br />
durch Bewegung, Spiel und<br />
Sport vorgestellt. Die<br />
Praxisbeispiele eignen sich<br />
für vier- bis zwölfjährige<br />
Jungen in Kindergärten,<br />
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen<br />
und Vereinen. Sie<br />
orientieren sich an verschiedenen<br />
jungenspezifischen<br />
Handlungsfeldern für die<br />
Altersgruppen von 4 bis 12<br />
Jahren. Melanie Behrens
Zeitschriftenspiegel<br />
Die hier aufgeführten<br />
Artikel stellen einen<br />
zusammenfassenden<br />
Überblick aus diversen<br />
Zeitschriften dar, die für<br />
das Fachgebiet Psychomotorik/Motologie<br />
von<br />
Bedeutung sind. Folgende<br />
Zeitschriften sehen wir für<br />
unsere Leser regelmäßig<br />
durch:<br />
• „Behinderte“: Reha-<br />
Druck, Graz<br />
• „Ergotherapie & Reha-<br />
bilitation“: Schulz-<br />
Kirchner, Idstein<br />
• „Geistige Behinderung“:<br />
Lebenshilfe-<strong>Verlag</strong>,<br />
Marburg<br />
Praxis der<br />
Psychomotorik<br />
Jahrgang 2008<br />
Heimberg, D.: Graphomotorik<br />
aus psychomotorischer<br />
Sicht. 2: 68–73.<br />
Rösner, M.: Sportinsel:<br />
Gründung eines Bewegungszentrums<br />
für<br />
Kinder und Jugendliche –<br />
ein Erfahrungsbericht.<br />
2: 74–77.<br />
Schmidt, D.: ganzheitliches<br />
Gehirntraining (GGT) für<br />
Senioren. Theoretische<br />
Überlegungen und prakti-<br />
sche Beispiele. 2: 78–84.<br />
Szugfil, A.: Spannungsregulation<br />
durch Konzentrative<br />
Bewegungstherapie.<br />
2: 85–88.<br />
• „Grundschule“: Westermann,<br />
Braunschweig<br />
• „Haltung und Bewegung“:<br />
BAG, Wiesbaden<br />
• „Heilpädagogik“:<br />
Heilpädagogische<br />
Gesellschaft Österreich,<br />
Siegenfeld<br />
• „Hörgeschädigten<br />
Pädagogik“: Median-<br />
<strong>Verlag</strong>, Heidelberg<br />
• „Kindergarten heute“:<br />
Herder, München<br />
• „Kindheit und Entwicklung“:<br />
Hogrefe <strong>Verlag</strong>,<br />
Göttingen<br />
• „Kinder- und Jugendarzt“:<br />
Hanseatisches <strong>Verlag</strong>skontor<br />
Lübeck<br />
Tschurtschenthaler, B.: Kör-<br />
perbild und Körperschema<br />
– Eine Pilotstudie im<br />
Kindergarten. 2: 89–94.<br />
Sowa, M.: Und sie bewegt<br />
sich doch! Schule für<br />
Menschen mit geistiger<br />
Behinderung als Bewegungsschule.<br />
2: 95–102.<br />
Aucouturier, B.: Die Persönlichkeit<br />
des Therapeuten<br />
und die „Strategie des<br />
Umwegs“. 2: 103–105.<br />
Ellmer, B.: Yoga für Kinder.<br />
2: 106–108.<br />
Bundschuh, C.-M.: Gemeinsam<br />
mit Kindern experi-<br />
mentieren und forschen.<br />
4: 192–196.<br />
Pröger, C.: Lernen an der Uni-<br />
versität mit Kopf, Herz<br />
und Hand. Ein Erfahrungsbericht.<br />
4: 197–202.<br />
Jessel, H.: Gewalt bewegt –<br />
Wege aus der Gewalt.<br />
Zur Bedeutung psychomotorischerÜberlegungen<br />
für die Gewaltprävention.<br />
4: 203–208.<br />
Aucouturier, B.: Therapie und<br />
Heilung. 4: 209–210.<br />
Majewski, A.: PsychomotorischeFörderarrangements<br />
in abenteuerlichen<br />
Szenarien. 4: 211–216.<br />
• „Krankengymnastik“:<br />
Pflaum, München<br />
• „Mit Sprache“: Holzhausen<br />
Druck & Medien<br />
GmbH, Wien<br />
• „Päd Forum“: Schneider,<br />
Hohengehren<br />
• „Prävention“: Deutscher<br />
Bundes-<strong>Verlag</strong> Bonn<br />
• „Praxis Ergotherapie“: Mo-<br />
dernes Lernen, Dortmund<br />
• „Praxis der Psychomotorik/Motopädie“:<br />
modernes<br />
Lernen, Dortmund<br />
• „Schweizerische Zeitschrift<br />
für Heilpädagogik“:<br />
Ediprim AG, Biel<br />
• „sportunterricht“:<br />
<strong>Hofmann</strong>, Schorndorf<br />
Krombholz, H./ Scholz, U./<br />
Jung, E.: Waldkindergarten.<br />
Ein natürliches<br />
Bewegungsangebot.<br />
4: 217–219.<br />
Späker, T.: Begegnung – Das<br />
Herz der Psychomotorik<br />
im Altenpflegeheim. Ein<br />
theoriebezogener Erfah-<br />
rungsbericht. 4: 220–226.<br />
Tille, H./ G.: Sport ab 80:<br />
Training von Geschichtlichkeit<br />
und Gedächtnis<br />
durch Gruppenspiele.<br />
4: 227–230.<br />
Jahrgang 2009<br />
Breithecker, D.: Kinder in der<br />
Balance. Fordern und<br />
fördern in „wackeligen“<br />
Situationen. 1: 4–8.<br />
Amft, S./ Braun, W. G./Kohle,<br />
J./Schneider, K.: Sprechen<br />
als Hochseilakt. Bericht<br />
über ein Kooperationsprojekt<br />
von Psychomotorik<br />
und Logopädie.<br />
1: 10–16.<br />
Tönshoff, U./ Winkelmann, E.:<br />
Eltern-Kind-Gruppe für<br />
Vorschulkinder mit<br />
Entwicklungsrisiken.<br />
1: 17–21.<br />
Schnurnberger, M./Wrobel,<br />
J.: Stockkampfkunst als<br />
• „Sportwissenschaft“:<br />
Springer, Heidelberg<br />
• „Unsere Jugend“:<br />
Reinhardt, München<br />
• „Welt des Kindes“:<br />
Kösel, München<br />
• „Zeitschrift für<br />
Erlebnispädagogik“:<br />
Neubauer, Lüneburg<br />
• „Zeitschrift für<br />
Heilpädagogik“:<br />
Reinhardt, München<br />
• „Zusammen“:<br />
Friedrich, Velber<br />
Zuständige Redakteure: Melanie Behrens, Klaus Fischer<br />
Medium der Kommunikation.<br />
Ein Projekt zur Ge-<br />
sundheitsförderung von<br />
Lehrer/innen am Sophie-<br />
Scholl-Berufskolleg in<br />
Duisburg. 1: 22–27.<br />
Seewald, J.: Wann ist ein<br />
Ansatz ein Ansatz? Über<br />
Kriterien für psychomotorische<br />
Ansätze. 1: 31–34.<br />
Hesse, L.: Spielen löst und<br />
bewegt. Spieltherapie in<br />
der Motopädie. 1: 35–39.<br />
Proßowsky, P.: Yoga in der<br />
schule. 1: 40–44.<br />
Böcker, N.: Psychomotorische<br />
Spielangebote auf kleinem<br />
Raum. 2: 64–68.<br />
Schneising, S.: Große Bau-<br />
werke sind keine fertigen<br />
Bewegungslandschaften.<br />
2: 69–74.<br />
Offergeld-Schnapka, A./<br />
Listmann-Weber, B.:<br />
TEACCH – ein wichtiger<br />
Baustein der speziellen<br />
Autismustherapie. The-<br />
orie und Praxis. 2: 76–81.<br />
Bergmann, T.: Rudern mit<br />
ADHS-Kindern. 2: 84–89.<br />
Vom Bruch, H.: Ausdauer,<br />
Körperbehinderung und<br />
Motivation. Reflexion<br />
und Erfahrungsbericht.<br />
2: 91–92.<br />
41
42<br />
Zeitschriftenspiegel<br />
Jessel, H.: Vom Defizit zum<br />
„Profizit“. Anstöße zur<br />
Ressourcenorientierung<br />
in der psychomotorischen<br />
Diagnostik. 2: 93–98.<br />
Kindergarten heute<br />
Jahrgang 2009<br />
Greine, R.: Spürbar miteinander<br />
in Kontakt kommen.<br />
Spiele zur Entwicklung<br />
von Körperbewusstsein.<br />
1: 18–20.<br />
Muthesius-Schön, M.: „Wenn<br />
wir Räder nehmen, krie-<br />
gen wir’s hin“. Kinder<br />
bringen Unbewegliches<br />
in Bewegung. 1: 36–39.<br />
Henning, M./ Hilmer, U.: Die<br />
„Ball-nach-oben-bring“-<br />
Vorrichtung. Kinder<br />
bauen einen Flaschenzug.<br />
2: 30–33.<br />
Streit, C./ Royar, T.: Setzen<br />
Sie doch mal die „mathe-<br />
matische Brille“ auf!<br />
Mathematik in Alltagssituationen<br />
erkennen und<br />
für die pädagogische<br />
Arbeit nutzen. 3: 8–15.<br />
Zeugner, M.: Zu was große<br />
Mengen alles anregen.<br />
Kinder erschließen sich<br />
Mathematik auf ungewöhnliche<br />
Weise.<br />
3: 16–20.<br />
Nadansky, M.: Falten, rollen,<br />
knüllen. Bauen und kons-<br />
truieren mit Zeitungspapier.<br />
3: 31–34.<br />
Von Gosen, A./ Wettich, N.:<br />
Jedes Kind hat sein<br />
eigenes Zeitmaß.<br />
Zur Kleinkindpädagogik<br />
Emmi Piklers. 5: 8–14.<br />
Stanko, R.: Welche Farben<br />
gibt es an mir? Kinder<br />
nähern sich spielerisch<br />
abstrakter Kunst.<br />
5: 16–17.<br />
Reihe: „Gesundheit!“<br />
Bründel, H.: Voraussetzungen<br />
für Entwicklung, Bildung<br />
und Wohlbefinden.<br />
(1.Teil). 1: 8–15.<br />
Bründel, H.: So kann die KiTa<br />
Gesundheit fördern.<br />
(2.Teil). 2: 8–15.<br />
Reihe: „Schreibwerkstatt“<br />
Müller, S.: Keine Angst vor<br />
dem Leeren Blatt.<br />
Pädagogische Fachkräfte<br />
brauchen verschiedene<br />
Textsorten für verschiedene<br />
Adressaten.<br />
(1. Teil). 1: 24–27.<br />
Müller, S.: Keine Angst vor<br />
dem leeren Blatt.<br />
Beobachtungen kreativ<br />
festhalten. (2. Teil).<br />
2: 24–29.<br />
Müller, S.: Keine Angst vor<br />
dem leeren Blatt.<br />
Schreiben für Eltern.<br />
(3.Teil). 3: 37–39.<br />
Müller, S. / Goers, B.: Keine<br />
Angst vor dem leeren<br />
Blatt. Schreiben für die<br />
Öffentlichkeit. (4. Teil).<br />
5: 31–34.<br />
Reihe: „Kinder unter drei –<br />
Entwicklung verstehen“<br />
Haug-Schnabel, G./ Bensel, J.:<br />
„Ich will auch mit in den<br />
Wald!“ Diesmal im Blick:<br />
Natur und Umwelt.<br />
1: 40–42.<br />
„Beim Wickeln hast du Zeit<br />
nur für mich!“ Diesmal<br />
im Blick: Pflegezeit<br />
ist Beziehungszeit.<br />
2: 42–44.<br />
„Ich gehe schon allein zur<br />
Toilette!“ Diesmal im<br />
Blick: Am Kind orientierteSauberkeitserziehung.<br />
3: 42–44.<br />
„Alle Antennen auf Empfang,<br />
alle Sinne hellwach“.<br />
Diesmal im Blick:<br />
Mit allen Sinnen lernen.<br />
4: 41–43.<br />
„Dann krieg ich eine große<br />
Wut!“ Diesmal im Blick:<br />
Konflikte zwischen<br />
Kindern unter drei.<br />
5: 40–42.<br />
Reihe: „Kinder unter drei –<br />
Entwicklung fördern“<br />
Cantzler, A.:<br />
Die sozial-emotionale<br />
Entwicklung fördern.<br />
Diesmal im Blick: Die<br />
Beziehung zum Kind.<br />
1: 43–46.<br />
Die motorische Entwicklung<br />
fördern. Diesmal im<br />
Blick: Bewegungsimpulse<br />
für das Kind im 1. Lebens-<br />
jahr. 2: 45–48.<br />
Die motorische Entwicklung<br />
fördern. Diesmal im<br />
Blick: Bewegungsangebote<br />
für das Kind im<br />
2. und 3. Lebensjahr.<br />
3: 45–48.<br />
Die feinmotorische Entwicklung<br />
fördern. Diesmal<br />
im Blick: Anregungen für<br />
Finger und Hände.<br />
4: 44–47.<br />
Die Sinne des Kindes unter-<br />
stützen. Diesmal im Blick:<br />
Sinneswahrnehmung und<br />
Sinnesschulung. 5: 43–46.<br />
Reihe: „Bildungsarbeit konkret“<br />
Klages, M.: Täuschen und<br />
tarnen. Faszination<br />
Dschungel – wie Kinder<br />
das Thema durchdringen.<br />
4: 24–28.<br />
Welt des Kindes<br />
Jahrgang 2008<br />
Güntner, D.: Viel mehr als nur<br />
ein Symbol … 5: 9–11.<br />
Ansari, S.: Kitas als Experimentierstuben?<br />
5: 13–18.<br />
Wertfein, M.: Bindung und<br />
Exploration von Anfang<br />
an. 6: 2008.<br />
Otto, J.: Frühkindliche Bil-<br />
dung – der Länderreport.<br />
6: 46–47.<br />
Reihe: „Kinderwelt“<br />
Treiber, I.: „Jedes Lernen ist<br />
gut“. 5: 29–31.<br />
Schuch, K.: Farben des<br />
Lebens – neben der<br />
Müllhalde. 6: 29–31.<br />
Beilage:<br />
Manzke, G.: Computer im<br />
Kindergarten. 5/2008<br />
Nickel, R. M.: das Kinderatelier.<br />
Kleine Künstler auf<br />
den Spuren großer Maler.<br />
6/2008<br />
Themenschwerpunkthefte:<br />
„Ein Naturelement in der<br />
Kita. Aus der Luft<br />
Gegriffen“, 5/2008.<br />
„Krippenspiele. Die Knirpse<br />
kommen!“, 6/2008.<br />
Jahrgang 2009<br />
Ploeger, A.: Entdeckungsreise<br />
für die Sinne. 1: 8–11.<br />
Ilhan-Herkert, S.: Vielfalt er-<br />
lebbar machen. 2: 8–11.<br />
Kieferle, C.: Was heißt<br />
Literacy in der frühen<br />
Kindheit? 3: 9–11.<br />
Reihe: „Kinderwelt“<br />
Messmer, L.: Unvergessliche<br />
Begegnungen! 1: 29–31.<br />
Wiedemann, H.: Montessori<br />
in Mittelamerika. 2: 29–31.<br />
Treiber, I.: An den Bedürfnissen<br />
des Kindes orientiert.<br />
3: 29–31.<br />
Beilage:<br />
Quaas, B.: Haste Töne? Singen<br />
mit Kindern. 1/2009<br />
Von Mirbach, K.: Zen und die<br />
Kunst, einen Irrgarten zu<br />
bauen. 2/2009<br />
Netta, B.: „Architek-Touren“<br />
mit Kindern. 3/2009
Summaries Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Christina Reichenbach<br />
The importance of ethical<br />
aspects of diagnostic<br />
measures for the special<br />
psychomotor discourse<br />
Diagnostic measures, which<br />
are becoming more and<br />
more important for practice,<br />
research and training, are<br />
mostly associated with<br />
knowing and carrying out<br />
special methods and<br />
procedures. Ethical questions<br />
are normally not dealt with.<br />
This article wants to draw<br />
the attention to ethical<br />
questions and problems as<br />
related to diagnostics.<br />
Furthermore, it wants to<br />
stimulate the discussion of<br />
contents, goals, qualifications<br />
and guidelines.<br />
Katrin Walter, Maike Grotz,<br />
Kristina Holl, Ilka Seidel &<br />
Klaus Bös<br />
Springboard – a pilot study<br />
of the multimodal ambulant<br />
influence on the lifestyle<br />
factors of obese children<br />
Experts assume that on a<br />
world wide scale there are<br />
currently 1,300 millions of<br />
overweight or obese people.<br />
In Germany, even half of<br />
the adult population is<br />
overweight and every fifth<br />
person is obese. There is also<br />
an increasing number of<br />
children and youths who<br />
are affected by the already<br />
epidemiological proportions<br />
of overweight or obesity.<br />
According to the KIGGS<br />
study, 15% of the children<br />
and youths at the age of<br />
4–17 years are overweight,<br />
and 6% of these are obese.<br />
As the causes of overweight<br />
are of a multifactorial<br />
character the appropriate<br />
intervention programmes are<br />
also very comprehensive.<br />
Sabine C. Koch<br />
Development diagnostics<br />
using the Kestenberg<br />
Movement Profile (KMP)<br />
A good and differentiated<br />
diagnostics should be a<br />
firmly established part of a<br />
good psychomotor therapy.<br />
Apart from the measurement<br />
of quantitative variables,<br />
the focus should be on<br />
qualitative aspects of<br />
movement. A comprehensive<br />
instrument for psychomotor<br />
development diagnostics,<br />
which includes both aspects,<br />
is the Kestenberg Movement<br />
Profile (KMP). This profile<br />
has delivered good performance<br />
in the diagnostics and<br />
intervention planning within<br />
dance and movement<br />
therapy. In this article, the<br />
Kestenberg Movement<br />
Profile is presented, the<br />
development diagnostics of<br />
a normally developed child is<br />
described as an example, and<br />
clinical relations are<br />
established.<br />
Holger Jessel<br />
For the purpose of man –<br />
resource orientation in<br />
psychomotor diagnostics<br />
In this article, it is discussed<br />
Berufliche Weiterbildung in Vollzeit<br />
(1-jährig) und Teilzeit (2-jährig)<br />
Staatlich anerkannte Motopädin<br />
Staatlich anerkannter Motopäde<br />
Beginn: August <strong>2010</strong><br />
Voraussetzungen:<br />
Fachschulausbildung des Sozialoder<br />
Gesundheitswesens bzw. in<br />
Sport- und Gymnastik<br />
+ 1 Jahr Berufspraxis<br />
sportliche Qualifikation<br />
Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Fachschule für Motopädie<br />
Victor-Toyka-Str. 6<br />
44139 Dortmund<br />
Fon: 0231-103870 Fax: 0231-103903<br />
E-Mail: info@motopaedieschule.de<br />
www.motopaedieschule.de<br />
whether a resource-oriented<br />
diagnostics must be understood<br />
as an alternative<br />
concept or as an addition to<br />
deficit-oriented point of<br />
views. Arguments are listed<br />
that militate in favour of a<br />
resource-oriented attitude as<br />
the basis of every kind of<br />
diagnostics and support and<br />
that describe the consequences<br />
for psychomotor<br />
diagnostics and the training<br />
of psychomotor experts.<br />
Bestellen Sie jetzt unser neues<br />
Gesamtverzeichnis <strong>2010</strong>!<br />
� www.sportfachbuch.de/katalog<br />
� bestellung@hofmann-verlag.de<br />
� Tel. 07181 / 402-125<br />
43
44<br />
Summaries / Résumés<br />
Résumés<br />
Christina Reichenbach<br />
L’importance d’aspects<br />
éthiques dans l’action<br />
diagnostique pour le<br />
discours professionnel<br />
psychomoteur<br />
Le diagnostic jouit, dans le<br />
cadre de la pratique, de la<br />
recherche et de la formation,<br />
de façon continue d’une<br />
grande importance. L’action<br />
diagnostique se rapporte le<br />
plus souvent à la connaissance<br />
et l’application de<br />
méthodes et de procédures<br />
spéciales. Des questions<br />
éthiques ne se posent<br />
généralement pas et ne sont<br />
pas discutées. La contribution<br />
ci-jointe voudrait rendre<br />
attentif à des questions<br />
éthiques et à des problèmes<br />
concernant le diagnostic et<br />
inciter entre autres à la<br />
discussion concernant les<br />
contenus, les objectifs, les<br />
qualifications et les guidelines.<br />
Katrin Walter, Maike Grotz,<br />
Kristina Holl, Ilka Seidel &<br />
Klaus Bös<br />
Tremplin – une étude pilote<br />
sur l’influence multimodale<br />
ambulatoire concernant les<br />
facteurs de style de vie<br />
auprès d’enfants adipeux<br />
De façon universelle les<br />
experts parlent actuellement<br />
de 1,3 milliards d’hommes<br />
obèses ou adipeux. En<br />
Allemagne, la moitié de la<br />
population adulte est déjà<br />
obèse et chaque cinquième<br />
citoyen adipeux. Egalement<br />
de plus en plus d’enfants et<br />
d’adolescents sont touchés<br />
par les dimensions déjà<br />
épidémiologiques d’obésité<br />
et d’adiposité. Suivant l’étude<br />
KIGGS 15% des enfants et<br />
adolescents à l’âge de 4–17<br />
ans sont obèses, de cette<br />
population 6% sont adipeux.<br />
Autant les causes de déve-<br />
loppement d’obésité sont<br />
multifactorielles, autant<br />
complets sont aussi les pro-<br />
grammes d’intervention.<br />
La contribution décrit un<br />
concept efficace pour la<br />
thérapie à long terme et la<br />
prévention d’obésité, qui<br />
complète les mesures<br />
d’intervention traditionnelles<br />
concernant les modules de<br />
surveillance des devoirs à<br />
domicile, de la formation des<br />
parents ainsi que de la<br />
documentation et analyse<br />
assistée par ordinateur.<br />
Sabine C. Koch<br />
Diagnostic de développement<br />
à l’aide du Kestenberg<br />
Movement Profile (KMP)<br />
Un bon diagnostic nuancé<br />
fait partie d’une bonne<br />
psychomotricité. A côté de la<br />
saisie de variables quantitatives<br />
les aspects qualitatifs<br />
du mouvement sont d’une<br />
importance centrale. Un<br />
vaste instrument pour le<br />
diagnostic de développement<br />
psychomoteur, qui englobe<br />
les deux aspects, est le<br />
Kestenberg Movement<br />
Profile (KMP). Celui-ci a fait<br />
réellement ses preuves, dans<br />
le cadre de la thérapie de<br />
danse et de mouvement,<br />
dans le diagnostic et la<br />
planification d’intervention.<br />
Cet article présente le<br />
Kestenberg Movement<br />
Profile, décrit de façon<br />
exemplaire le diagnostic de<br />
développement d’un enfant<br />
normal et établit des<br />
relations cliniques.<br />
Holger Jessel<br />
Orientation humaine –<br />
orientation vers les<br />
ressources dans le<br />
diagnostic psychomoteur<br />
La discussion dans la<br />
contribution porte sur la<br />
question si le diagnostic<br />
orienté vers les ressources<br />
peut être compris en tant<br />
que contre-projet ou en tant<br />
que complément des façons<br />
de voir orientées vers le<br />
déficit. Des arguments en<br />
faveur d’une position<br />
orientée vers les ressources<br />
en tant que fondement de<br />
chaque diagnostic et<br />
développement sont exposés<br />
et les conséquences pour le<br />
diagnostic psychomoteur et<br />
la formation des psychomotriciens<br />
décrites.<br />
Susanne Pape-Kramer / Dr. Ulrike Köhle<br />
Doppelstunde Bewegungsgestaltungen<br />
Unterrichtseinheiten und Stundenbeispiele für Schule und Verein<br />
Im vorliegenden Buch wird ein Vermittlungsweg aufgezeigt, der allen Sportlehrkräften die Möglichkeit<br />
bieten soll, Schüler in diesem Bereich ohne großen Aufwand anzuleiten. Während in der<br />
Unterstufe die spielerische Vermittlung von Fortbewegungsgrundformen im Vordergrund stehen,<br />
werden in der Mittel- und Oberstufe konkrete sportartspezifische Elemente erlernt. Die Übungseinheiten<br />
sind jeweils auf einen Zeitraum von ca. 80 Minuten zugeschnitten. Das Buch ist für alle<br />
Personen interessant, die 10- bis 19-Jährige unterrichten. Jedem Buch liegt eine CD-ROM bei auf der<br />
Techniken und Übungen in Videoclips dargestellt werden.<br />
15 x 24 cm, 144 Seiten + CD-ROM, ISBN 978-3-7780-0541-5, Bestell-Nr. 0541 � 19.90<br />
Inhaltsverzeichnis und Musterseiten unter www.sportfachbuch.de/0541<br />
Versandkosten � 2.–; ab einem Bestellwert von � 20.– liefern wir innerhalb von Deutschland versandkostenfrei.<br />
Steinwasenstraße 6–8 • 73614 Schorndorf • Telefon (0 71 81) 402-125 • Fax (0 71 81) 402-111<br />
Internet: www.hofmann-verlag.de • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.de