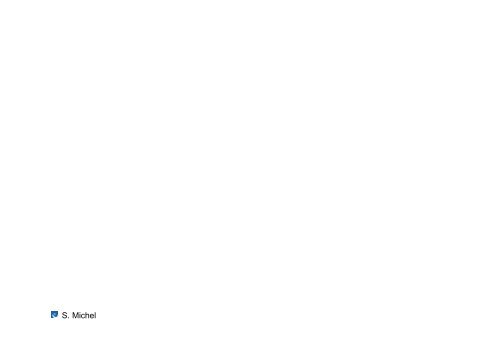S. Michel - Schule Berliner Strasse
S. Michel - Schule Berliner Strasse
S. Michel - Schule Berliner Strasse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S. <strong>Michel</strong>
S. <strong>Michel</strong><br />
Kompetenzregion Köln<br />
Mülheim-Ost<br />
© Theory U, Claus O. Scharmer
S. <strong>Michel</strong><br />
Gliederung<br />
• rechtliche Grundlagen, Ziele, Kennzeichen<br />
• Startprozesse (Erkundungs- und<br />
Handlungsfelder, der regionale Charakter)<br />
• Aufbauorganisation (Steuergruppe,<br />
Kerngruppe, Koordination)<br />
• Zusammenfassung (…)
S. <strong>Michel</strong><br />
„Wie kann es sein, dass wir über<br />
Jahrzehnte in erster Linie die<br />
Überschriften, dessen, was wir<br />
Förderung nennen ändern, aber<br />
im Wesentlichen immer die<br />
gleichen Muster wieder<br />
hervorbringen?“
Die drei Ebenen<br />
organisationaler<br />
Veränderungen<br />
� Struktur, Produkt<br />
� Prozess<br />
� Denken<br />
Presencing<br />
� sensing<br />
� presence<br />
� verbinden mit der<br />
Quelle der höchsten<br />
Zukunftsmöglichkeit<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
© Theory U, Claus O. Scharmer
„Grundschule, GU-<strong>Schule</strong>n und<br />
Sonderschulen, das ist wie beim<br />
Schwimmwettbewerb:<br />
Jeder schwimmt auf seiner Bahn<br />
neben den anderen her.“<br />
S. <strong>Michel</strong>
„… der Auftrag vom Land ist komplett umzusteuern…“<br />
§ 20 Abs. 5 SchG NRW (2005)<br />
„Der Schulträger kann Förderschulen zu Kompetenzzentren für die<br />
sonderpädagogische ausbauen. Sie dienen der schulischen Förderung von<br />
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und<br />
Angeboten zur Diagnose, Beratung und ortsnahen präventiven Förderung.<br />
Das Ministerium wird ermächtigt, die Vorraussetzungen zur Errichtung und<br />
die Aufgaben im Einzelnen durch Rechtsverordnungen näher zu regeln.“<br />
Im Rahmen von §25 Abs. 1<br />
„Schulversuche dienen dazu, das Schulwesen weiterzuentwickeln. Dazu<br />
können insbesondere Abweichungen von Aufbau und Gliederung des<br />
Schulwesens [….] zeitlich und im Umfang begrenzt erprobt werden”<br />
und § 25 Abs. 4:<br />
“Schulversuche, Versuchsschulen und Modellvorhaben bedürfen der<br />
Genehmigung des Ministeriums. Dabei werden Inhalt, Ziel, Durchführung<br />
und Dauer in einem Programm festgelegt.”<br />
S. <strong>Michel</strong>
Eckpunktepapier 2007<br />
Aufgaben und Handlungsfelder eines KSF werden präzisiert:<br />
1. ……wohnortnahe und präventive Unterstützungs- und<br />
Beratungsangebote gestalten,<br />
2. ……frühzeitig, integrativ und präventiv fördern,<br />
3. ……alle Maßnahmen der sonderpädagogischen Förderung bündeln,<br />
4. …… wirkungsvoll im allgemeinen Schulsystem verankern.<br />
5. …….Aufgaben- und Handlungsfelder sind:<br />
Unterricht, Diagnostik, Beratung und Prävention<br />
S. <strong>Michel</strong>
Zielperspektiven:<br />
� Mehr Kinder in Allgemeinbildenden <strong>Schule</strong>n,<br />
� multiprofessionelle integrierte Förderung schaffen,<br />
� Lehrkräfte gehen zum Kind, nicht das Kind zu den<br />
Lehrkräften in den Förderschulen<br />
� Vermeidung der Entwicklung von<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf,<br />
� Qualitative und quantitative Stärkung gemeinsamer<br />
Beschulung,<br />
S. <strong>Michel</strong>
Kennzeichen<br />
• Festgeschriebene Personalausstattung<br />
• Primarstufe und Sekundarstufe,<br />
• Förderschwerpunkte L, ES und Sprache<br />
S. <strong>Michel</strong>
Zeitraum<br />
Im Schuljahr 2007/2008 ist landesweit eine<br />
3jährige Pilotphase in zunächst 20<br />
Pilotregionen (2010 +30) gestartet mit dem Ziel:<br />
Erprobung und Klärungen zur Erstellung einer<br />
Rechtverordnung.<br />
Erfahrungen der Pilotprojekte bieten<br />
Empfehlungen für die Rahmenbedingungen, die<br />
Konstruktion und den Prozess.<br />
S. <strong>Michel</strong>
…. das Umsteuern muss erst mal ein<br />
innerer Perspektivenwechsel sein…“<br />
S. <strong>Michel</strong>
Herausforderung<br />
„Gesamtkonzept sonderpädagogischer Förderung<br />
in den jeweiligen Einzugsgebieten entwickeln.<br />
Dazu gehört ein Netzwerk allgemeiner <strong>Schule</strong>n.<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
(vgl. MSWW 2007).
De Saint Phalle: Volleyball Magrite: Golconde<br />
aus: Wehrli Ursus, Kunst aufräumen, Zürich (Kein&Aber) 2002/ erstellt durch R. Patt<br />
2009, www.schulhorizonte.de (alle weiteren ebenfalls)<br />
S. <strong>Michel</strong>
„… es geht um die Veränderung<br />
des kollektiven Denkmodells:<br />
Integrieren heißt: Die Leute<br />
stehen draußen und müssen<br />
reingeholt werden.<br />
Inklusion heißt: Es gehören alle<br />
dazu, die da sind.“<br />
S. <strong>Michel</strong>
S. <strong>Michel</strong><br />
Beethoven: Für Elise
S. <strong>Michel</strong>
S. <strong>Michel</strong><br />
O-Töne<br />
aus der Steuergruppe<br />
der Kompetenzregion<br />
Köln-Mülheim-Ost
Die Wirklichkeit sonderpädagogischer Förderung in NRW sieht anders aus:<br />
� 7 Förderschwerpunkte<br />
� 7 Förderschultypen<br />
� Festlegung durch das<br />
AOSF-Verfahren<br />
� Gerichturteil<br />
„Ressourcenvorbehalt“<br />
� Kein Wahlrecht für Eltern<br />
� einzige Alternative GU<br />
S. <strong>Michel</strong>
Anspruch an ein KSF<br />
ist hoch:<br />
• Veränderung der Schulkultur, Entwickeln einer „Kultur des<br />
Behaltens“<br />
• Veränderung von Unterrichtskonzepten sowie organisatorischen<br />
und strukturellen Vorraussetzungen<br />
• Arbeitsplätze, Rollen, Zuständigkeiten neu denken<br />
• Schulübergreifende Personaleinsatzplanung (durch den Leiter des<br />
KSF)<br />
• Systematische Integration verschiedenster Professionen, Klärung<br />
GU und KSF<br />
S. <strong>Michel</strong>
S. <strong>Michel</strong><br />
Region Köln<br />
Mülheim-Ost<br />
• fünf Stadtteile<br />
• 81.000 Bewohner<br />
rund 15.100<br />
(19% unter 18<br />
Jahren)<br />
• rund 40 Kindertagesstätten<br />
• 25 <strong>Schule</strong>n<br />
2 Förderschulen<br />
15 Grundschulen<br />
3 Hauptschulen<br />
1 Realschule<br />
3 Gesamtschulen<br />
1 Berufskolleg
Der regionale Charakter<br />
Regionale Bildungslandschaft bedeutet die konkrete Realisierung<br />
kommunaler Verantwortung für die „zukunftsgerichtete<br />
Weiterentwicklung der <strong>Schule</strong>n“<br />
(SchulG § 78 (4))<br />
Aachener Erklärung des Deutschen Städtetages anlässlich des<br />
Kongresses „Bildung in der Stadt“ am 22./23. November 2007:<br />
Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in den verschiedenen<br />
Lebensphasen ist die kommunale Ebene. Hier entscheidet sich<br />
Erfolg oder Misserfolg von Bildung, werden die Grundlagen für<br />
berufliche Perspektiven, gesellschaftliche Teilhabe und gleichzeitig<br />
die Zukunftsfähigkeit einer Region gelegt…“<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Deshalb braucht dieser Prozess<br />
eine regional abgestimmte Planung!
Externe Moderation<br />
� Dialogforen, Steuergruppe, Kerngruppe, Coaching der<br />
Leitung<br />
� nicht vorgesehen im Pilotprojekt<br />
� finanziert in Köln im ersten Jahr durch die Carl-<br />
Richard-Montag-Stiftung für Jugend und Gesellschaft<br />
� finanziert im zweiten Jahr durch die Stadt Köln<br />
� Finanzierung im dritten Jahr ungeklärt<br />
S. <strong>Michel</strong>
Regionale Startprozesse<br />
Das Projekt ist seit Beginn an folgenden Schulstandorten vorgestellt worden:<br />
GGS Buschfeldstraße KGS Am Portzenacker<br />
KGS Neufelderstraße GS Dellbrücker Hauptstraße<br />
KGS Friedlandstraße KGS Thurner Straße<br />
GGS An St. Theresia GGS Leuchterstraße<br />
GGS Alte Wipperfürther Straße FS Lernen Thymianweg<br />
HS Wuppertaler Straße FS Sprache Alter Mühlenweg<br />
HS Rendsburger Platz<br />
GGS Von Bodelschwingh Straße<br />
HS Von Bodelschwingh<br />
KGS Honschaftsstraße<br />
GS Willy Brandt<br />
RS Dellbrücker Mauspfad<br />
HS Dellbrücker Mauspfad<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
2/3 der <strong>Schule</strong>n stimmten per Schulkonferenzbeschluss zu =<br />
Vorraussetzung zur Genehmigung
Startprozesse – Erkundungsfelder - Halbzeitstand<br />
1. Externen Moderation (parntership for developement.- C. B. Pakleppa)<br />
2. Vorstellen des Projekts in der Region<br />
3. Dialogforen mit den Berufsgruppen und in den Stadtteilen<br />
4. Bildung der Steuergruppe, Kerngruppe und Koordinationsteam<br />
5. Koordinationsbüro an der <strong>Berliner</strong> <strong>Strasse</strong><br />
6. Bildung und Besetzung von Stadtteilteams an 11 <strong>Schule</strong>n mit festen Terminen vor Ort<br />
7. Prototyp Schulneulinge und Prototyp Lernreisen<br />
8. Fortbildung Kooperative Beratung, TN aus allen Schulformen<br />
9. Kooperationsvereinbarung <strong>Schule</strong>-Jugendhilfe zu §8a (Vorstellung des GSD)<br />
10. Zusammenarbeit der <strong>Schule</strong>n, Türen öffnen sich, Vetrauen baut sich auf, die<br />
Menschen kommen zusammen<br />
S. <strong>Michel</strong>
Steuergruppe:<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Gesundheitsamt<br />
Jugendhilfe<br />
Frühförder<br />
-zentrum<br />
Schulpsychologischer<br />
Dienst<br />
Jugend<br />
hilfe- u.<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklungsplanung<br />
Förderschulen<br />
Steuergruppe<br />
Mülheim-Ost<br />
Schulamt<br />
GU-<br />
Grundschulen<br />
Grundschulen<br />
KiTa<br />
Real- und<br />
Hauptschulen
Die Steuergruppe<br />
Die Steuergruppe versteht sich als konzeptionelle Entwicklungsgruppe<br />
mit<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
• Steuerungsverantwortung<br />
• Prozesskontrollverantwortung<br />
Aufgaben der Steuergruppe:<br />
• schafft Voraussetzungen für die Arbeit (i. S. von<br />
Ressourcenmanagement, Kooperationsvereinbarungen, Vernetzung)<br />
• ist strategisch aktiv mit Wirkung auf Politik bzw. politische<br />
Verantwortliche<br />
• gibt Ziele vor und kontrolliert deren Einhaltung<br />
• gibt Aufträge an die Kerngruppe<br />
• entwickelt Ideen, Innovationen, Prototypen und Visionen<br />
• stößt Entwicklungen an und trifft Entscheidungen
1. Gemeinsame Intentionsbildung:<br />
Den gemeinsamen Grund entdecken<br />
und freilegen<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
SEEING<br />
SENSING<br />
2. Gemeinsame Wahrnehmung:<br />
„Hinschauen, hinschauen, hinschauen “gehe<br />
zu den Orten und Menschen, die für<br />
deine Situation wichtig sind und höre mit<br />
offenem Denken und Herzen zu.<br />
Theory U nach C.O. Scharmer<br />
PRESENCING<br />
3. Gemeinsame Willensbildung:<br />
Geh zu einem Ort der Stille und lass<br />
das innere Wissen entstehen<br />
PERFORMING<br />
5. Gemeinsame Gestaltung:<br />
Umsetzung des Neuen, so dass<br />
Handeln und Wahrnehmen vom<br />
Ganzen her möglich werden<br />
PROTOTYPING<br />
4. Gemeinsames Experimentieren:<br />
Entwickele Prototypen von Beispielen<br />
des Neuen, um die Zukunft im<br />
Tun zu erkunden<br />
© Theory U, Claus O. Scharmer
Zuhören I:<br />
„Runterladen und bestätigen!“<br />
Zuhören II:<br />
„Debatte und Unterschiede aussprechen“<br />
Zuhören III: „Dialog“<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
•Vom Verteidigen zum Erkunden fremder Standpunkte<br />
•einander zuhören, um zu verstehen,<br />
•auf tiefere Fragen hören, verbindende Muster erspüren<br />
Zuhören IV: „Kreatives Schöpfen und Erschaffen“<br />
•sich mit dem gemeinsamen Neuen verbinden (fühlen, denken, wahrnehmen)<br />
•von der entstehenden Möglichkeit her sprechen<br />
•gemeinsames Schaffen, kollektive Kreativität<br />
Theory U nach C.O. Scharmer<br />
Stimme des Urteiles<br />
behindert die Öffnung des<br />
Denkens<br />
Stimme des Zynismus<br />
behindert die Öffnung<br />
des Fühlens<br />
Stimme der Angst<br />
behindert die Öffnung<br />
des Willens<br />
© Theory U, Claus O. Scharmer
Leitbild<br />
� „bestmögliche Förderung eines jeden Kindes in der Region“<br />
� „es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“<br />
S. <strong>Michel</strong>
Das Leitbild konkretisiert sich in der Praxis auf 4 Ebenen:<br />
Arbeit mit Kind und Familie (Alltag)<br />
Bewusstseinsprozesse (Haltung)<br />
– Teilhabe<br />
– Akzeptanz<br />
– Heterogenität und Vielfalt<br />
autonome <strong>Schule</strong>ntwicklung (lernende Systeme)<br />
in Richtung einer „Bildungslandschaft“<br />
– Transfer und Implementierung der Sonderpädagogik<br />
– Neue Rolle der Sonderpädagogen<br />
– Systemgrenzen aufweichen<br />
Weiterbildung (individuelle Professionalisierung)<br />
der Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden <strong>Schule</strong>n<br />
S. <strong>Michel</strong>
Ziele<br />
Mehr individuelle förderdiagnostische und<br />
förderpädagogische Prozesse vor Ort und die<br />
Durchlässigkeit zwischen den Systemen<br />
erhöhen<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
� weniger Schüler in den Förderschulen<br />
� mehr sonderpädagogische Förderung in den allgemeinen<br />
<strong>Schule</strong>n<br />
� unbürokratischer Zugang zu sonderpädagogischen<br />
Ressourcen<br />
� zeitlich flexible Beschulungsmöglichkeiten an Förderschulen<br />
schaffen (Schulstationen, Clearingstellen)
Ziele<br />
Multiprofessionelle Sicht auf Kinder entwickeln<br />
� Stadtteilteams gemischt besetzen (allgemeine<br />
<strong>Schule</strong>, Sonderpädagogen, ASD, Medizin)<br />
� Fallbesprechungen installieren<br />
• Zusammenarbeit der Institutionen soll für Eltern deutlich und<br />
selbstverständlich werden<br />
• Ressourcen der Stadtteile zusammen zu bringen,<br />
• Ressourcenkartei erstellen,<br />
• aktiv pflegen und leben im Sozialraum/Stadtteil und der<br />
gesamten Region<br />
S. <strong>Michel</strong>
Ziele<br />
Prävention neu organisieren<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
�Bedarfe früh erkennen, mit Jugendhilfe<br />
vernetzen, gemeinsam Schritte erzeugen<br />
�Grundmodell „inklusive <strong>Schule</strong>“ erarbeiten<br />
�Transparenz im Übergang KITA –<strong>Schule</strong><br />
�Arbeitsschwerpunkte der Stadtteilteams von<br />
derzeitigem Schwerpunkt Beratung erweitern<br />
auf präventiven Unterricht
Ziele<br />
Ansatz Kooperative Beratung (nach W.<br />
Mutzeck) durch Fort- und Weiterbildung<br />
ausbauen<br />
� Teilnehmer aus allen Schulformen gewinnen,<br />
� Regelmäßige Übungsgruppen installieren,<br />
S. <strong>Michel</strong>
Ziele<br />
Alle Kinder, die einen frühen Förderbedarf haben,<br />
sollen Förderung bekommen<br />
Die Förderschwerpunkt GE, KME, HK, S in die<br />
Netzwerkarbeit einbeziehen<br />
Dezernentenveranstaltung Bezirksregierung/ Stadt<br />
Köln durchführen<br />
• Evaluationsdesign entwickeln<br />
� Prototyp Schulneulinge<br />
� Konzept Stadtteilteam-Netzwerkschule<br />
S. <strong>Michel</strong>
Kerngruppe<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Bei Bedarf<br />
weitere<br />
Netzwerkpartner<br />
Kinder- und<br />
jugendärztlicher Dienst<br />
des<br />
Gesundheitsamts<br />
Schulleitung<br />
FS Förderschulen<br />
Kerngruppe<br />
Jugendamt:<br />
Leiter GSD<br />
Projektleiter<br />
Projektkoordinator
Kerngruppe<br />
Die Kerngruppe versteht sich als operative Gestaltungsgruppe<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
•Geschäftsführungsverantwortung<br />
•ausführende Prozessverantwortung<br />
•Berichtsverantwortung<br />
Aufgaben der Kerngruppe:<br />
•gibt Fragen, die aus der vernetzten Arbeit in der Region entstehen, an<br />
die Steuergruppe<br />
•holt sich Unterstützung durch die Steuergruppe<br />
•dokumentiert die laufenden Prozesse<br />
•definiert neue Ziele<br />
•berichtet der Steuergruppe regelmäßig über ihre Aktivitäten
Geschäftsführende Koordination<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Projektleiter<br />
Koordinationsteam<br />
Projektkoordinator Verwaltungsfachkraft
Geschäftsführende Koordination<br />
Teil einer erweiterten Schulleitung im KsF mit<br />
•Administrativer Verantwortung<br />
•Koordinations-, Beratungs- und Begleitungsverantwortung für das Projekt<br />
Aufgaben des Koordinators:<br />
•trifft strategische und operative Absprachen mit der Leitung des KsF<br />
•sorgt für entsprechende Entlastung und Unterstützung der Leitung des KsF<br />
•begleitet und koordiniert die Stadtteilteams (leitet Teambesprechungen, begleitet<br />
und berät Team- und Konzeptentwicklung vor Ort)<br />
•hält und pflegt Kontakt zu Netzwerkschulen (Ansatz des management by walking<br />
around, Vermeidung von Strukturen einer Front-line-Organisation)<br />
•koordiniert Prototypen<br />
•plant Fortbildungsangebote, führt diese durch<br />
•bearbeitet Anfragen aus der Region (Beratung, Schulplatzmanagement,<br />
Rückschulungen, Aufnahmen, etc.)<br />
•plant in Absprache mit der Leitung den Personaleinsatz<br />
•koordiniert Rückschulungen nach dem Modell In-Steps (Uni Köln)<br />
•Außendarstellung (Flyer, Homepage, Anfragebögen, etc.)<br />
S. <strong>Michel</strong>
Stadtteilteams<br />
Die Stadtteilteams setzen sich zusammen aus Lehrerinnen und Lehrern aus den<br />
Standorten FS ES <strong>Schule</strong> <strong>Berliner</strong> Str., FS Sprache Alter Mühlenweg, FS Lernen<br />
Thymianweg, GU-Grundschule am Portzenacker, GU-Grundschule Am Rosenmaar<br />
Stadtteilteam Holweide (12 Std. im 2 Wochen-Rhythmus)<br />
GGS Buschfeldstraße<br />
KGS Neufelderstraße<br />
KGS Friedlandstraße<br />
Kontakt Kompetenzregion<br />
Gudrun Stefes g.stefes@schule-berlinerstrasse.de<br />
Cordula Schneider c.schneider@schule-berlinerstrasse.de<br />
Stadtteilteam Höhenhaus (12 Std. – 3 Wochen-Rhythmus)<br />
GGS Von Bodelschwingh Straße<br />
KGS Hohnschaftsstraße<br />
GS Willy Brandt<br />
Kontakt Kompetenzregion<br />
Christina Biedermann ch.biedermann@schule-berlinerstrasse.de<br />
Michael Lorenzen michaellorenzen@web.de<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Stadteilteam Buchheim (12 – 2W-Rhythmus)<br />
GGS An St. Theresia<br />
GGS Alte Wipperfürther Straße<br />
HS Wuppertaler Straße<br />
HS Rendsburger Platz<br />
Kontakte Kompetenzregion<br />
Cordula Schneider c.schneider@schule-berlinerstrasse.de<br />
Barbara Kruse<br />
Stadtteilteam Dellbrück (9 Std. – 1WRhyhmus)<br />
Realschule Dellbrücker Mauspfad<br />
Hauptschule Dellbrücker Mauspfad<br />
KGS Thurner Straße<br />
GGS Dellbrücker Hauptstraße<br />
Ansprechpersonen und Kontakte Kompetenzregion<br />
Ingrid Käsch i.kaesch@schule-berlinerstrasse.de<br />
Kristina Bongard t.bongard@schule-berlinerstrasse.de<br />
Andrea Weyer<br />
Elisabeth Kleine-Flintrop
Aufgaben und Tätigkeiten der Stadtteilteams<br />
� hospitieren zum Kennenlernen der <strong>Schule</strong>, Kolleginnen<br />
und Kollegen, Klassen, Lerngruppen<br />
� unterstützen mit Testdiagnostik,<br />
� führen Beratungsgespräche mit Kollegen/innen, Schüler<br />
und Eltern,<br />
� führen Beratungen zur Lern- und<br />
Entwicklungsprozessbegleitung und Förderplanung<br />
durch,<br />
� entwickeln gemeinsam begleitende und unterstützende<br />
Maßnahmen für einen erfolgreichen Lern- und<br />
Entwicklungsprozess der Schüler und Schülerinnen,<br />
begleiten und dokumentieren diesen Prozess<br />
� führen themenbezogenen Fortbildungen und<br />
pädagogische Ganztage mit Kollegien der Allgemeinen<br />
<strong>Schule</strong>n durch<br />
S. <strong>Michel</strong>
Die Region entwickelt….<br />
� eine Aufbauorganisation mit Rollen-, Funktions-<br />
Kommunikationsklarheit, einfache, unmittelbare und<br />
unbürokratische Wege und Verfahren<br />
� ein kontinuierliches Berichtswesen, quantitative Daten<br />
sowie eine Prozess- und Wirkungsevaluation<br />
� Die scheinbar Außenstehenden wie Jugendhilfe, der GU<br />
(Bestandschutz während der Modellphase) und die Kitas<br />
( Trägervielfalt) sind unmittelbar einzubeziehen<br />
S. <strong>Michel</strong>
Die Region benötigt immer wieder<br />
� Kommunikation und Kooperation<br />
Jede Projektregion braucht den kontinuierlichen regionalen sowie<br />
überregionalen Austausch und Lernreisen<br />
� die regionale Vision des zukünftig Möglichen mit klaren<br />
Zielen<br />
� „den redlichen Start“ = vereinbarte, eindeutig definierte,<br />
wirkungsvolle, verlässlich umsetzbare Leistungen und die<br />
gemeinsame Planung in Etappen<br />
� die Beiträge und Leistungen aller Kooperationspartner im Rahmen<br />
regionaler Vereinbarungen<br />
S. <strong>Michel</strong>
Die Region benötigt…<br />
� Die Überwindung der Zuständigkeitstrennung von Förderschulund<br />
Allgemeinschulaufgaben/-sichtweisen hin zu gemeinsamer<br />
Verantwortung mit systemischem Ansatz, mit dem Blick auf alle<br />
Kinder und Jugendlichen, in kontinuierlicher und methodisch<br />
gestützter Kommunikation und abgestimmter Planung als zentraler<br />
Schlüssel und Energiepool der Projektentwicklung<br />
� Der Start aus bestehenden Ressourcen braucht eine 100% -<br />
Stellenbesetzung in den beteiligten <strong>Schule</strong>n<br />
� Verantwortung, Anstrengung, den Mut und die Lust aller Beteiligten<br />
an Veränderung<br />
� Änderung der Rahmenbedingungen (Schulstrukturreform,<br />
Lehrerausbildung, Klassengrößen)<br />
S. <strong>Michel</strong>
Vision einer guten Zukunft<br />
Jeder Einzelne<br />
pro Inklusion,<br />
Kooperation der<br />
verschiedenen Lehrämter,<br />
Veränderungsbereitschaft<br />
S. <strong>Michel</strong><br />
Region<br />
Nachhaltige Netzwerkarbeit,<br />
Netzwerkintelligenz,<br />
Aufbauorganisation mit beschriebenen Funktionen und Aufgaben<br />
Haltung<br />
Kooperation<br />
Gemeinsame Verantwortung<br />
Netzwerkarbeit<br />
Vision und Ziel<br />
Vereinbarungen<br />
roten Faden<br />
Institution<br />
Gemeinsam Verantwortung<br />
für Kinder übernehmen,<br />
Veränderungsbereitschaft
Bruegel: Dorfplatz<br />
…aufgeräumt<br />
S. <strong>Michel</strong>
S. <strong>Michel</strong><br />
Bruegel: Dorfplatz
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und<br />
einen schönen Abend…….<br />
Kontakt:<br />
Sascha <strong>Michel</strong>/ Christina Biedermann<br />
c/o Förderschule <strong>Berliner</strong> Straße<br />
<strong>Berliner</strong> Straße 975<br />
51069 Köln<br />
www.berlinerstrasse.de<br />
s.michel@schule-berlinerstrasse.de<br />
ch.biedermann@schule-berlinerstrasse.de<br />
S. <strong>Michel</strong>