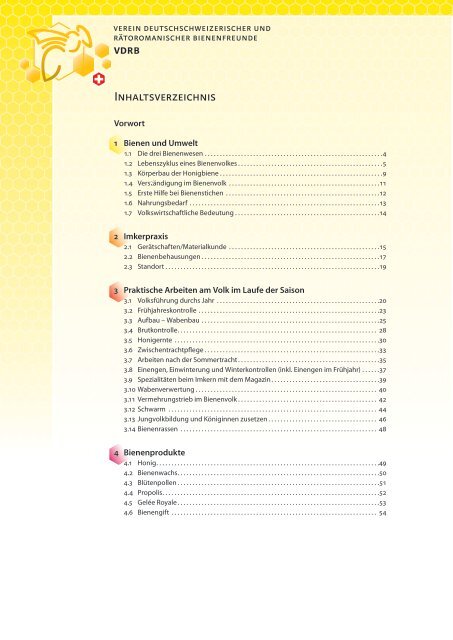VDRB_Inhalt_Lehrerordner_2012_Nachdruck_2014
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Inhalt</strong>sverzeichnis<br />
Vorwort<br />
1 Bienen und Umwelt<br />
1.1 Die drei Bienenwesen ...........................................................4<br />
1.2 Lebenszyklus eines Bienenvolkes ................................................5<br />
1.3 Körperbau der Honigbiene ......................................................9<br />
1.4 Verständigung im Bienenvolk ..................................................11<br />
1.5 Erste Hilfe bei Bienenstichen ...................................................12<br />
1.6 Nahrungsbedarf ...............................................................13<br />
1.7 Volkswirtschaftliche Bedeutung ................................................14<br />
2 Imkerpraxis<br />
2.1 Gerätschaften/Materialkunde ..................................................15<br />
2.2 Bienenbehausungen ...........................................................17<br />
2.3 Standort .......................................................................19<br />
3 Praktische Arbeiten am Volk im Laufe der Saison<br />
3.1 Volksführung durchs Jahr ......................................................20<br />
3.2 Frühjahreskontrolle ............................................................23<br />
3.3 Aufbau – Wabenbau ...........................................................25<br />
3.4 Brutkontrolle .................................................................. 28<br />
3.5 Honigernte ....................................................................30<br />
3.6 Zwischentrachtpflege ..........................................................33<br />
3.7 Arbeiten nach der Sommertracht ...............................................35<br />
3.8 Einengen, Einwinterung und Winterkontrollen (inkl. Einengen im Frühjahr) ......37<br />
3.9 Spezialitäten beim Imkern mit dem Magazin ....................................39<br />
3.10 Wabenverwertung ............................................................ 40<br />
3.11 Vermehrungstrieb im Bienenvolk .............................................. 42<br />
3.12 Schwarm ..................................................................... 44<br />
3.13 Jungvolkbildung und Königinnen zusetzen .................................... 46<br />
3.14 Bienenrassen ................................................................. 48<br />
4 Bienenprodukte<br />
4.1 Honig ..........................................................................49<br />
4.2 Bienenwachs ...................................................................50<br />
4.3 Blütenpollen ...................................................................51<br />
4.4 Propolis ........................................................................52<br />
4.5 Gelée Royale ...................................................................53<br />
4.6 Bienengift .................................................................... 54
<strong>Inhalt</strong>sverzeichnis<br />
5 Bienengesundheit/Bienenkrankheit<br />
5.1 Gesundheits-Diagnose auf den ersten Blick ....................................55<br />
5.2 Varroatose .....................................................................57<br />
5.3 Weitere Bienenkrankheiten ................................................... 60<br />
5.4 Brutkrankheiten ...............................................................62<br />
5.5 Wachsmotten .................................................................65<br />
5.6 Andere Mitbewohner ......................................................... 66<br />
6 Imkerwirtschaft<br />
6.1 Imkerorganisationen ..........................................................67<br />
6.2 Rechte und Pflichten des Imkers ............................................... 68<br />
6.3 Gesetze im Bereich der Imkerei .................................................70<br />
6.4 Anhang ........................................................................72<br />
Kalender des Schweizer Imkers<br />
Stockkarten<br />
Bestandeskontrolle<br />
Selbstkontrolle<br />
Links<br />
Glossar<br />
Feedback
Vorwort<br />
Dieser Ausbildungsordner für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ist konzipiert<br />
zum Einsetzen als Vorbereitung für die folgende Lektion oder als Nachbereitung nach einem<br />
Kurstag. Im Bienenhaus soll er kaum zum Einsatz kommen.<br />
Die Lösungen zu den Fragen im Schülerordner sind einerseits im <strong>Lehrerordner</strong> eingesetzt,<br />
anderseits können sie als PDF heruntergeladen werden (www.vdrb.ch - Login - interner<br />
Bereich für <strong>VDRB</strong>-Funktionäre). Auf diese Weise hat die Kursleiterin/der Kursleiter die grössten<br />
methodischen Freiheiten. Er kann sie abgeben, daraus Folien erstellen oder auch bearbeiten.<br />
Appenzell, im Februar <strong>2012</strong><br />
Das Autorenteam und der Zentralvorstand<br />
© <strong>VDRB</strong><br />
Einfachheitshalber wird nur die männliche Form verwendet, damit<br />
ist selbstverständlich auch das weibliche Geschlecht gemeint.
1.1 Die drei Bienenwesen<br />
Lernziel<br />
– Sie gewinnen einen Überblick über die drei Bienenwesen, deren Entwicklung, die Arbeitsteilung, die<br />
Lebensdauer.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Zeigt am Bienenvolk die drei Bienenwesen und die verschiedenen Brutstadien. PowerPoint<br />
Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 37 – 49. Bestimmen Sie am Bienenvolk die drei<br />
Bienenwesen, beurteilen Sie die Brutstadien.<br />
Königin Arbeiterbiene Drohn<br />
Erkennung<br />
Körperliche Merkmale<br />
Grosser, langer<br />
Hinterleib<br />
Lange Beine,<br />
rötliches Hinterbein<br />
Flügel kürzer als<br />
Hinterleib<br />
Grösser als Arbeiterin,<br />
Massiger Hinterleib<br />
Grosse Augen<br />
Maximales Alter 5 Jahre 6 Wochen im Sommer<br />
8 Monate im Winter<br />
20 – 50 Tage (nur im<br />
Sommer), können<br />
ausnahmsweise<br />
überwintern<br />
Anzahl im Volk 1 8 000 – 40 000 1000 – 2000<br />
(nur im Sommer)<br />
Aufgabe<br />
Fortpflanzung<br />
Führen des Volkes<br />
Brutpflege<br />
Sammeln<br />
Paarung<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie viele Bienen braucht es für ein Kilogramm Bienen?<br />
10 000<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
4
1.2 Lebenszyklus eines Bienenvolkes<br />
Lernziele<br />
– Sie wissen um die unterschiedlichen Lebenszyklen von Königin, Arbeiterinnen, Drohnen.<br />
– Sie können daraus wichtige Rückschlüsse für die Völkerführung ableiten (Frühjahrsaufbau zur<br />
Trachtreife, Massenwechsel, Jungvolkbildung, Neu- und Umweiselungsvorgänge).<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Betrachtung von Brutwaben und Weiselzellen direkt im Volk.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 38 – 44.<br />
Grafik zum Lebensweg der Biene: www.bienenfreund.de/bienenvolk.htm<br />
Die Entwicklung der Biene (Arbeiterin)<br />
1. Tag: Die Königin legt ein Ei in eine sauber<br />
geputzte Zelle.<br />
Nach drei Tagen ist die Larve mit all ihren<br />
Organen fertig ausgebildet.<br />
3. Tag: Das Ei liegt auf dem Zellenboden, die Eihaut<br />
platzt, die Made schlüpft.<br />
4.–6. Tag: Die Made wird sehr häufig gefüttert.<br />
In dieser Zeit häutet sie sich vier mal. Bald füllt sie den<br />
ganzen Zellenboden aus. Man nennt sie jetzt Rundmade.<br />
7. Tag: Die Rundmade ist so dick geworden, dass sie auf<br />
dem Zellenboden nicht mehr genügend Platz hat. Sie richtet<br />
sich in der Zelle auf. Man nennt sie jetzt Streckmade.<br />
8./9. Tag: Die Made ist ausgewachsen.<br />
Die Zelle ist verdeckelt worden.<br />
Die Vorpuppe braucht Ruhe.<br />
Während sie still in der Zelle liegt, häutet sie<br />
sich zum fünften Mal.<br />
Quelle: Honigbienen, Praxishilfe, Naturama Aargau<br />
Während der Verwandlung (=Metamorphose) verändert<br />
sich die Bienenmade in kleinen Entwicklungsschritten<br />
zuerst zur Puppe, dann zur Nymphe, bis sie schliesslich eine<br />
richtige Biene ist.<br />
Nach 20 Tagen ist die Biene fertig entwickelt. Sie ruht noch<br />
etwa einen Tag in der Zelle aus.<br />
Die Biene öffnet am 21. Tag den Zelldeckel und schlüpft.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
5
Die Entwicklung der drei Bienenwesen<br />
Eigenarbeit: Kennzeichnen Sie die Brutstadien der drei Bienenwesen mit verschiedenen Farben.<br />
befruchtetes Ei<br />
unbefruchtetes Ei<br />
Königin<br />
Arbeiterin<br />
Drohn<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Ei<br />
2<br />
2<br />
2<br />
3<br />
3<br />
3<br />
4<br />
4<br />
4<br />
Rundmade<br />
5<br />
5<br />
5<br />
6<br />
6<br />
6<br />
7<br />
7<br />
7<br />
Streckmade<br />
8<br />
8<br />
8<br />
9<br />
9<br />
9<br />
10<br />
10<br />
10<br />
11<br />
11<br />
11<br />
Vorpuppe<br />
12<br />
12<br />
12<br />
13<br />
13<br />
13<br />
14<br />
14<br />
14<br />
15<br />
15<br />
15<br />
16<br />
16<br />
16<br />
17<br />
17<br />
18<br />
18<br />
Puppe<br />
19<br />
19<br />
20<br />
20<br />
21<br />
21<br />
Eizeit<br />
Larvenzeit (offene Brut)<br />
Puppenzeit (geschlossene Brut)<br />
Schlüpftag<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
6
Der Lebenslauf einer Arbeitsbiene<br />
Die Biene schlüpft. In ihrer Zelle bleibt eine feine Haut zurück.<br />
Sofort beginnt sie, ihre eigene Zelle und die Nachbarzellen zu putzen,<br />
denn bevor die Königin das nächste Ei in diese Zelle legt, muss diese<br />
blitzblank sein. Die Putzbienen sind dafür verantwortlich.<br />
Die Futtersaftdrüsen im Kopf der jungen Biene sind nach etwa 5–6<br />
Tagen ausgereift und produzieren einen Futtersaft.Sie ist jetzt eine<br />
Ammenbiene. Mit diesem Futtersaft werden die jungen Maden gefüttert.<br />
Drohnenmaden und Königinnenmaden erhalten einen anderen<br />
Futtersaft als die Bienenmaden. Die Brutpflege ist sehr anstrengend.<br />
Eine Bienenmade wird etwa alle fünf Minuten gefüttert und täglich<br />
etwa 1300 mal besucht.<br />
Wenn die Biene 12 Tage alt ist, entwickeln sich am Bauch ihre Wachsdrüsen.<br />
Darum wird sie als Ammenbiene abgelöst und als Baubiene<br />
eingesetzt. Überall am Bau gibt es etwas zu reparieren oder neu zu<br />
bauen. Zwischendurch unternimmt sie vor dem Flugloch Orientierungsflüge.<br />
Jedesmal wenn sie den Stock verlässt, schleppt sie Abfall weg, der<br />
am Boden des Stockes liegen geblieben ist. So hilft sie, den Bau sauber<br />
zu halten.<br />
In dieser Zeit hilft sie auch, Honig einzulagern und Pollen zu stampfen.<br />
Gefüllte Zellen muss sie verdeckeln.<br />
Bis zum 21. Tag hat sich die Giftblase voll entwickelt und mit Gift gefüllt.<br />
Jetzt wird die Biene als Wächter benötigt. Sie sorgt dafür, dass im Volk<br />
Ruhe herrscht und sich keine Räuber über die Brut oder den Vorrat<br />
hermachen können.<br />
Quelle: Honigbienen, Praxishilfe, Naturama Aargau<br />
Je älter eine Biene wird, um so häufiger lässt sie sich als Wächter<br />
ablösen und fliegt weg. Sie wird zur Sammlerin. Sie schleppt Pollen,<br />
Nektar, Honigtau, Propolis oder Wasser herbei. Bis zu ihrem Tode macht<br />
sie (je nach Wetter) täglich etwa 12 Ausflüge, die jeweils 20 bis 30 Minuten<br />
dauern.<br />
Nach drei bis sechs Wochen stirbt sie. Nur im Winter werden<br />
die Bienen älter. Weil sie weniger arbeiten müssen, können sie<br />
sechs, in strengen Wintern sogar neun Monate alt werden.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
7
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Was heisst «Metamorphose»?<br />
Die Metamorphose ist die Entwicklung eines Lebewesens, die über ein Larvenstadium führt.<br />
Beispiel der vollständigen Entwicklung:<br />
Biene, Schmetterling<br />
Beispiel der unvollständigen Entwicklung: Heuschrecke<br />
2. Wie viele Tage dauert es, bis Königin und Drohnen geschlechtsreif werden?<br />
Königin: nach 5 – 6 Tagen<br />
Drohne: nach 8 – 12 Tagen<br />
3. Ab welchem Lebenstag findet der Begattungsflug einer Jungkönigin statt?<br />
Ab dem 6. Lebenstag<br />
4. Wann beginnt die Königin normalerweise mit der Eilage?<br />
Ca. 14 Tage nach dem Schlüpfen<br />
5. Die alte Königin stirbt oder ein Jungvolk wird mit Brutwaben ohne Weiselzellen gebildet:<br />
a Wie alt könnte eine Arbeiterinnenlarve sein, damit aus ihr noch eine Königin gezogen<br />
werden kann?<br />
b An welchem Tag ab Beginn der Weisellosigkeit schlüpft frühestens die Nachfolgerin?<br />
c An welchem Tag nach dem Tod der alten Königin oder der Bildung des Jungvolkes schlüpfen<br />
die ersten Arbeiterinnen?<br />
a 2 – 3 Tage alt<br />
b Am 11. Tag<br />
c Nach 46 Tagen, wenn es Nachkommen der neuen Königin sind<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
8
1.3 Körperbau der Honigbiene<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Biologie der Honigbiene.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Er vertieft das Wissen der Lernenden über die Biologie der Honigbiene. Insbesondere die<br />
Körperteile und die wichtigsten Drüsen, Innenorgane und Körperglieder. Dazu verwendet er wenn<br />
möglich Modelle der Biene.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 8 – 36.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Beschriften Sie die folgende Grafik: Körpergliederung der Biene.<br />
Kopf Brust Hinterleib<br />
13<br />
1<br />
2<br />
14<br />
3<br />
15<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
18<br />
16<br />
17<br />
8<br />
12<br />
9<br />
10 11<br />
Kopf 1 Facettenauge 4 Kopfschild 7 Unterkiefer<br />
2 Punktaugen 5 Oberlippe 8 Zunge<br />
3 Fühler 6 Oberkiefer 9 Unterlippe<br />
Brust 10 Vorderbein 13 Vorderflügel<br />
11 Mittelbein 14 Hinterflügel<br />
12 Hinter- (Sammelbein)<br />
Hinterleib 15 Stigma (Atemöffnungen) 17 Stachel<br />
16 Rückenschuppen 18 Bauchschuppen<br />
Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 8<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
9
2. Beschriften Sie die folgende Grafik: Blutkreislauf und Nervensystem<br />
13<br />
12<br />
14<br />
11<br />
1<br />
10<br />
9<br />
8<br />
4 5<br />
7<br />
3<br />
6<br />
2<br />
1 Gehirn 6 Bauchmark 11 Mitteldarm<br />
2 Unterschlundganglion 7 Unteres Zwerchfell 12 Honigblase<br />
3 Nervenstränge 8 Oberes Zwerchfell 13 Herzschlingen<br />
4 Speiseröhre 9 Herzöffnungen 14 Schlagader<br />
5 Nervenknoten 10 Herzschlauch<br />
Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 26<br />
3. Beschriften Sie die folgende Grafik: Drüsen der Honigbiene<br />
1<br />
6<br />
5<br />
2<br />
4<br />
3<br />
1 Futtersaftdrüse 3 Brustspeicheldrüse 5 Nassanoffdrüse<br />
2 Oberkieferdrüse 4 Wachsdrüse 6 Kopfspeicheldrüse<br />
Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 30<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
10
1.4 Verständigung im Bienenvolk<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die Tanzsprache der Bienen und erkennen tanzende Bienen.<br />
– Sie wissen Bescheid über die Verständigung mit Pheromonen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Er erklärt mit Bildmaterial die Arbeitsteilung und die Orientierung über Trachtquellen.<br />
Er zeigt die tanzenden Bienen und erläutert die Verständigung im Volk durch Pheromone.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 70, 87 – 88 und 93 – 96. Beobachten Sie die Tanzbewegungen.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie informiert die Spurbiene die Sammlerinnen über die Lage der Trachtquelle?<br />
Durch Tanzbewegungen auf der Wabe sowie über die Orientierung nach dem Sonnenstand.<br />
Gleichzeitig gibt sie eine Kostprobe des Futters ab.<br />
2. Welche verschiedenen Tänze kennen die Bienen?<br />
Rund- und Schwänzeltanz<br />
3. Welchen Zweck erfüllen die Pheromone im Bienenvolk?<br />
Sie wirken als schnelle Kommunikation zwischen den Bienen eines Volkes, zu vergleichen mit den<br />
Hormonen bei Säugetieren. ABER: Hormone steuern nur einen Körper. Pheromone steuern das Verhalten<br />
der verschiedenen Lebewesen im Bienenvolk. Sie steuern unter anderem die Volkszugehörigkeit und das<br />
Verteidigungs verhalten.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
11
1.5 Erste Hilfe bei Bienenstichen<br />
Lernziele<br />
– Sie reagieren richtig, wenn Besucher oder Imker von Bienen gestochen werden (Risiken, Notarzt).<br />
Stoff<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 115 – 117, 72 – 76 und Band 1, Seite 151.<br />
Hilfe beim Bienenstich<br />
Stachel entfernen: Wenn die Biene einen Menschen gestochen hat, bleibt ihr Stachel mit der Giftblase<br />
in der Haut stecken. Er muss als erstes entfernt werden. Dazu wird der Stachel seitlich mit dem<br />
Fingernagel herausgekratzt. Nie mit beiden Fingern anfassen, damit sich die Giftblase nichtvollends<br />
ins Gewebe entleert.<br />
Bei einer allergischen Reaktion (Rötung am ganzen Körper, Juckreiz, Erbrechen, Schüttelfrost, Atembeschwerden,<br />
Schwindel, Kollaps) unverzüglich Notarzt aufsuchen. Nr. 144 anrufen.<br />
Besonders gefährlich sind Stiche in die Zunge oder in den Rachen. Wegen der raschen Schwellung<br />
der Schleimhaut droht in kürzester Zeit der Erstickungstod. Hier kann nur der unverzüglich zu rufende<br />
Notarzt helfen. Telefon 144. Mehrere Stiche in kurzer Zeit muss man ernst nehmen. In diesem Fall muss<br />
der Patient beobachtet werden.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie wird der Stachel aus der Haut entfernt?<br />
Den Stachel seitlich mit dem Fingernagel herauskratzen. Nie mit beiden Fingern anfassen, damit sich die<br />
Giftblase nicht vollends ins Gewebe entleert.<br />
2. Welche Reaktionen zeigt eine Bienengiftallergie auf?<br />
Rötung am ganzen Körper, Juckreiz, Schüttelfrost, Erbrechen, Übelkeit oder Atemnot<br />
3. Ab wann besteht die Gefahr bedrohlicher Reaktionen?<br />
Bereits ein Stich kann allergische Reaktionen auslösen. Mehrere Stiche in kurzer Zeit können gefährlich<br />
sein. Darum muss der Patient genau beobachtet werden. Treten Anzeichen einer Allergie auf, muss sofort<br />
der Notarzt gerufen werden.<br />
4. Bei welchen Körperteilen sind Bienenstiche besonders gefährlich?<br />
Zunge, Rachen, Hals und Kopf<br />
5. Diskutieren Sie, wie Sie unter den konkreten Umständen im Kurs reagieren müssen, wenn eine<br />
Teilnehmerin eine allergische Reaktion entwickelt.<br />
Diskussionsleitung durch den Kursleiter<br />
6. Wie behandeln Sie einen Bienenstich?<br />
– Einstichstelle mit Speichel oder Wasser vom «Stechgeruch» reinigen.<br />
– Bei starker Schwellung mit kalten Umschlägen mit Essigwasser (1 Teil Essig auf 2 Teile Wasser),<br />
Eiswürfeln, einem Kältespray oder Alkohol kühlen.<br />
Möglich wären auch:<br />
– Frische Zwiebelscheiben auflegen<br />
– Propolistinktur auftragen<br />
– Insektensalbe auftragen<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
12
1.6 Nahrungsbedarf<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen den jährlichen Nahrungsbedarf eines Bienenvolkes und dessen Verwendung im<br />
Bienenvolk.<br />
– Sie wissen Bescheid über das Nahrungsangebot in der Natur.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Zusammen mit den Kursteilnehmenden wird das ganze Nahrungsspektrum erarbeitet.<br />
Er gibt praktischen Anschauungsunterricht am Bienenvolk, am Flugloch und in der Natur.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 61 – 64. Beurteilen Sie am Flugloch und im Volk<br />
die verschiedenen Pollenarten. Beobachten Sie am Flugloch die Intensität des Pollen-, Nektar- und<br />
Honigtaueintrages.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Nennen Sie die Herkunft und die Verwendung der verschiedenen Nährstoffe im Bienenvolk.<br />
Nährstoff Benötigte Menge Herkunft Verwendung im<br />
Bienenvolk<br />
Kohlenhydrate<br />
(Zucker) im Nektar<br />
und im Honigtau<br />
60 – 80 kg Von den Blüten (Nektar),<br />
Laub- und Nadelbäumen<br />
(Honigtau)<br />
Eiweiss (Pollen) 30 – 60 kg Von blühenden Pflanzen<br />
(Blütenstaub)<br />
Energieerzeugung,<br />
Futtersaftherstellung,<br />
Wachsproduktion<br />
Hauptaufbaunahrung,<br />
Larvenernährung<br />
Fette – Pollen Futtersaftproduktion<br />
Wachsherstellung<br />
Mineralstoffe – Pollen und Nektar Stoffwechselregulierung<br />
Wasser 30 – 40 l Bienentränke, Wasserläufe,<br />
Kondenswasser im<br />
Volk<br />
Stoffwechsel, Futtersaftherstellung,<br />
Temperaturregulierung<br />
im Volk,<br />
Auflösung von Vorräten<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
13
1.7 Volkswirtschaftliche Bedeutung<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen den direkten und den indirekten Nutzen der Bienen für die Volkswirtschaft.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Er erklärt den volkswirtschaftlichen Nutzen der Bienen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 33– 38.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Nennen Sie den direkten und den indirekten Nutzen der Bienen auf die Volkswirtschaft.<br />
Direkter Nutzen<br />
Bienenprodukte<br />
Honig, Pollen, Wachs, Propolis,<br />
Gelée Royale<br />
Rund 45 – 75 Mio. Fr. / Jahr<br />
Bestäubungsarbeit<br />
keiner<br />
Indirekter Nutzen keiner Obstbau/Beerenkulturen; ca. 80 %<br />
Mehrertrag und vollentwickelte Früchte,<br />
ca. 200 Mio. Fr./Jahr<br />
Raps; ca. 50 % Mehrertrag, bessere Ausbeute,<br />
ca. 100 Mio. Fr. /Jahr<br />
Gartenbau; bedeutende Mehrerträge<br />
Insgesamt rund 300 Mio. Fr. / Jahr<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
14
2.1 Gerätschaften/Materialkunde<br />
Lernziele<br />
– Sie lernen die Grundausstattung einer Kleinimkerei kennen und können die wichtigsten Werkzeuge<br />
benennen.<br />
– Sie lernen weitere nützliche Utensilien kennen. Sie können zwischen nötig und wünschbar<br />
unterscheiden.<br />
– Sie üben den Umgang mit den wichtigsten Werkzeugen und wissen, wie sie korrekt angewendet<br />
werden.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Gerätschaften aufliegend. Vergleichen verschiedener Ausführungen. «Was gibt es?»: Arbeit<br />
mit Imkerkatalogen. Funktionsweise, Qualitätsmerkmale und Unterhalt von Gerätschaften behandeln<br />
bis hin zur Schleuder. Anwendung der Werkzeuge.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 29 – 32.<br />
Imkergeräte für das Kastensystem «Schweizerkasten»<br />
1. Imkerpfeife/Rauchmaschine: Zum Beruhigen und Vertreiben der Bienen<br />
Brennmaterial:<br />
Tabakabfälle, Nussbaumlaub, Brennwürfel<br />
2. Wabenzange: Zum Herausziehen und Halten der Waben<br />
3. Einlauftrichter: Wird hinten an den Kasten gesteckt, fängt abgeklopfte oder<br />
abgewischte Bienen auf<br />
4. Wabenknecht: Dient als Wabenhalter beim Auspacken eines Volkes<br />
5. Reinigungskrücke: Zum Reinigen der Kastenböden<br />
6. Futtergeschirr: Fütterung für den Wintervorrat<br />
Imkergeräte für das Kastensystem «Magazin»<br />
Rauchmaschine:<br />
Zum Beruhigen der Bienen<br />
Imkergeräte für beide Kastensysteme<br />
1. Stockmeissel: Zum Lösen von angekitteten Bauteilen, zum Auskratzen der Kästen<br />
und Reinigen der Rahmen und Tragleisten<br />
2. Bienenbürste/Gänsefeder: Zum Abwischen der Bienen<br />
3. Wabendraht: Zum Drahten der Rahmen<br />
4. Löttrafo: Zum Einlöten der Mittelwände<br />
5. Schleier: Zum Schutz des Gesichts<br />
6. Handschuhe: Zum Schutz der Hände<br />
7. Wasserzerstäuber: Zum Benetzen trockener Honigwaben, Besprühen der Bienen etc.<br />
8. Bienentrichter: Zum Abwischen der Bienen in die Schwarmkiste<br />
9. Kleiner Gasbrenner: Zum Abflammen, Desinfizieren von Kasten, Wachs schmelzen etc.<br />
10. Allgemeines Werkzeug wie Hammer, Zange, Taschenmesser etc. für allgemeine Arbeiten<br />
11. Schreibzeug, Halterung am Kasten für die Stockkarten<br />
Erntegeräte<br />
1. Entdeckelungsgabel: Zum Entfernen der Wachsschicht auf der Honigwabe<br />
2. Entdeckelungsmesser: Zum Entfernen der Wachsschicht auf der Honigwabe<br />
3. Abdeckelungs-/Auffanggefäss: Auffanggefäss für Abdeckelung und Honig<br />
4. Lager und Abfüllkessel: Edelstahl oder Kunststoff (lebensmittelecht)<br />
5. Honigschleuder, tangential: Die Waben stehen tangential in einem Korb. Moderne Schleudern<br />
sind als Selbstwendeschleudern konzipert, bei alten Modellen<br />
müssen die Waben gewendet werden.<br />
6. Honigschleuder, radial: Die Waben stehen radial zum Kessel. Die Waben müssen nicht<br />
gewendet, jedoch muss während des Schleudervorgangs die<br />
Drehrichtung gewechselt werden.<br />
7. Honigsieb: Schleuderhonig enthält viele Wachspartikel,<br />
die ausgesiebt werden müssen.<br />
8. Gefäss für heisses Wasser, evtl. Heizplatte für Warmwasser<br />
9. Klärsieb: Zum Klären des Honigs<br />
10. Abfüllkessel: Zum Abfüllen des Honigs<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
15
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Erstellen Sie eine Stückliste mit den Geräten für eine Grundausstattung zu Ihrem Beutensystem.<br />
Schweizerkasten:<br />
Imkerpfeife, Wabenzange, Einlauftrichter, Wabenknecht, Reinigungskrücke, Futtergeschirr, Stockmeissel,<br />
Bienenbürste/Gänsefeder, Wabendraht, Löttrafo, Schleier, Handschuhe, Wasserzerstäuber, kleiner<br />
Gasbrenner, allgemeines Werkzeug (Hammer, Zange, Taschenmesser etc.), Entdeckelungsgabel, Lagerund<br />
Abfüllkessel, Honigschleuder, Honigsieb, Klärsieb.<br />
Magazin:<br />
Rauchmaschine, Stockmeissel, Bienenbürste/Gänsefeder, Wabendraht, Löttrafo, Schleier, Handschuhe,<br />
Wasserzerstäuber, kleiner Gasbrenner, allgemeines Werkzeug (Hammer, Zange, Universal-Taschenmesser<br />
etc.), Entdeckelungsgabel, Lager- und Abfüllkessel, Honigschleuder, Honigsieb, Klärsieb.<br />
2. Welches Brennmaterial kann für Imkerpfeife und Rauchmaschine verwendet werden?<br />
Rippentabak, Jute, morsches Holz, Nussbaumlaub, Bienenrauch-Briketts u.a.<br />
3. Aus welchem Material müssen Lager- und Abfüllkessel bestehen?<br />
Sie müssen aus Chromnickelstahl oder Kunststoff (lebensmittelecht) bestehen.<br />
4. Füllen Sie die Tabelle aus.<br />
Name Tangentialschleuder Radialschleuder<br />
Anzahl Waben 2–6 9–36<br />
Antrieb<br />
von Hand oder elektrisch, auch mit<br />
vollautomatischer Steuerung<br />
von Hand oder elektrisch, auch mit<br />
vollautomatischer Steuerung<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
16
2.2 Bienenbehausungen<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen gängige Beuten und können diese benennen (Schweizerkasten, Magazinbeute,<br />
Beobachtungskasten).<br />
– Sie wissen Warmbau/Kaltbau zu unterscheiden.<br />
– Vor- und Nachteile der Beutensysteme wissen Sie abzuwägen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Kasten und Gerätschaften im Kursraum aufstellen, Unterlagen zu Kästen, Imkereikataloge,<br />
Theorie und Praxis im Bienenhaus.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 24 – 29.<br />
Info und Tipps<br />
Typ Eigenschaften Zu beachten<br />
Schweizerkasten<br />
Magazin<br />
Beobachtungskasten<br />
Er fasst 12 bis 16 hochformatige<br />
Brut waben.<br />
Er fasst 2 Honigräume.<br />
Die Waben stehen quer zum Flugloch<br />
(«Warmbau») und werden mit Deckbrettchen<br />
abgedeckt und hinten mit Fensterchen<br />
abgeschlossen.<br />
Das Volk wird von hinten bearbeitet,<br />
jede Wabe wird einzeln aus dem Kasten<br />
gehoben.<br />
Die Schweizerkasten werden üblicherweise<br />
im Bienenhaus gestapelt und eng<br />
aneinander geschoben.<br />
Es fasst pro Zarge (je nach System) 9 bis<br />
12 querformatige Brut- oder Honigwaben.<br />
Pro Volk werden je nach Volksstärke 2 bis<br />
5 Zargen aufeinander gestapelt.<br />
Die Waben stehen längs zum Flugloch<br />
(«Kaltbau»).<br />
Der Boden besteht aus einem Holzrahmen<br />
mit bienendichtem Metall- oder<br />
Kunststoffgitter. Unterhalb des Gitters<br />
kann eine Holzplatte als Schiebeboden<br />
eingeschoben werden.<br />
Magazine werden üblicherweise auf<br />
einem Freistand aufgestellt.<br />
Bewährte Magazintypen sind:<br />
Dadant-Blatt (Westschweiz,<br />
Frankreich, Italien)<br />
Zander (Deutschland, Österreich,<br />
für die Schweiz empfehlenswert)<br />
Langstroth (USA, international)<br />
Mit 1 Brut- und Honigwabe<br />
Beidseitig mit Glas- oder Kunststoffscheibe<br />
zur Beobachtung<br />
Aussendeckel wegnehmbar zur Isolation<br />
und Verdunkelung vom Volk<br />
Oberhalb des Kastens Fütterungseinrichtung<br />
Der Kasten sollte Platz für mindestens<br />
14 Brutwaben und 2 Honigräume<br />
aufweisen.<br />
Der Abstand zwischen Boden und<br />
Brutwaben sollte mindestens 2 cm<br />
betragen.<br />
Die Fluglochgrösse sollte mindestens<br />
30 cm breit und 2 cm hoch sein.<br />
Der lose Beutenboden sollte ein<br />
bienendichtes Gitter aufweisen.<br />
Die Beute sollte nach den Originalmassen<br />
gefertigt sein.<br />
Freistände mit Magazinen lassen sich<br />
schnell auf- und abbauen und eignen<br />
sich für die Wanderimkerei.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
17
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Welche Vorteile weist der Schweizerkasten auf, welche das Magazin?<br />
Schweizerkasten:<br />
Die Volksentwicklung kann am Kastenfenster gut beobachtet werden. Dank der schmalen, hochformatigen<br />
Brutwaben wird der Honig schnell in die Honigwaben abgelagert; dadurch kann auch in mageren Honigjahren<br />
etwas Honig geschleudert werden. Im Bienenhaus stapelbar und dadurch weniger Platzbedarf.<br />
Magazin:<br />
Preisgünstig, handlich, beweglich, rationelle Beurteilung und Bearbeitung der Völker, günstig für die<br />
Wanderung<br />
2. Welche Nachteile weisen diese beiden Systeme auf?<br />
Schweizerkasten:<br />
Teurer Neupreis, schwer und unhandlich, zeitaufwändig bei Wabenumstellung, Futterkontrolle, Volkskontrolle<br />
Magazin:<br />
Im Bienenhaus nicht stapelbar, schwere Arbeit beim Abheben voller Zargen, dem Wetter ausgesetzt,<br />
Gefahr von Beschädigungen durch Tier und Mensch, Diebstahl<br />
3. Wie nennt man die Wabenanordnung im Schweizerkasten?<br />
Warmbau<br />
4. Wie viele Honigräume sollte der Schweizerkasten aufweisen?<br />
Zwei Honigräume<br />
5. Wie arbeitet man am Volk in den folgenden Kastensystemen?<br />
Schweizerkasten: von hinten<br />
Magazin:<br />
von oben<br />
6. Wie ist die Wabenanordnung im Magazin üblicherweise?<br />
Kaltbau<br />
7. Welche bewährten Magazintypen gibt es?<br />
– Dadant-Blatt<br />
– Langstroth-Flachzarge<br />
– Zander<br />
– Deutsch Normalmass<br />
– CH-Magazin (Warmbau)<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
18
2.3 Standort<br />
Lernziele<br />
– Sie lernen den Einfluss vom Standort der Bienenbeuten auf die Bienen kennen.<br />
– Sie wissen Elementares um die Bedeutung von Trachtgebieten und -bedingungen, Exposition der<br />
Beuten, mikroklimatische Phänomene, umgebende Landwirtschaft, Flugrichtung, Zugänglichkeit,<br />
Zufahrt für Fahrzeuge, Winterbedingungen, Windschutz, Völkerzahl pro Stand und Saisonalität.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Standorte der Kursteilnehmer vergleichen, Analyse Vor-/Nachteile derselben.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 17 – 24.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Welches ist der sicherste Weg, einen bewährten Standort zu finden?<br />
Die Übernahme eines Standortes, der sich über Jahre bewährt hat.<br />
2. Nach welcher Himmelsrichtung sollen die Fluglöcher ausgerichtet sein?<br />
Südost bis Südwest<br />
3. Wovor soll der Bienenstand im Sommer geschützt werden?<br />
Vor der heissen Mittagssonne<br />
4. Welches sind die Anforderungen ans Trachtgebiet?<br />
Pflanzenvielfalt für Pollen- und Nektarweide<br />
5. Nennen Sie je vier Vor- und Nachteile eines Bienenhauses.<br />
Vorteile: – Ersetzt Lagerraum<br />
– Kann auch bei Regen gearbeitet werden<br />
– Völker und Werkzeug sind vor Wind und Nässe geschützt.<br />
– Schutz vor Diebstahl<br />
Nachteile: – Hohe Anschaffungskosten<br />
– Baubewilligung muss eingeholt werden<br />
– Es bindet den Imker an einen Standort.<br />
– Die Völkerzahl wird durch die Hausgrösse bestimmt.<br />
6. Wie viele Völker sollten an einem Standort platziert werden?<br />
Nicht mehr als 20 Völker<br />
7. Braucht es ein Baugesuch für einen Bienenstand oder Bienenhaus?<br />
Für ein Bienenhaus braucht es ein Baugesuch, Vorschriften gemäss kantonalem und kommunalem Recht.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
19
3.1 Volksführung durchs Jahr<br />
Lernziele<br />
– Sie verschaffen sich einen Überblick über die wichtigsten Arbeiten der Volksführung im Jahreslauf.<br />
– Sie kennen die Arbeitsspitzen und verstehen, wie Völker in Bezug auf ihre Entwicklungszeiten und<br />
die wichtigsten Trachtzeiten geführt werden.<br />
– Sie lernen ein Journal/Stockkarten zu führen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: «Volksführung durchs Jahr» stellt einen Überblick dar. Zu den einzelnen Arbeiten beachten<br />
Sie die weiteren Module zur praktischen Arbeit am Volk im Laufe der Saison. Wichtig ist, diese Arbeiten<br />
in den Zusammenhang des Bienenjahres zu stellen. Ein Vorteil ist die Führung eines Journals. Eingriffe<br />
und Ereignisse mit eigenen Völkern sollten ins Kursgeschehen einbezogen werden.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 40 – 53.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
20
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Nennen Sie die ungefähre Datumsangabe auf dem eigenen Stand.<br />
Hauptsächliche<br />
imkerliche Arbeiten<br />
Ungefähre<br />
Datumsangabe<br />
auf dem eigenen<br />
Stand<br />
Tracht situation<br />
Notwendiges Material,<br />
welches vorbereitet sein muss<br />
Auswinterung mit<br />
Frühjahrskontrolle<br />
Erste Hälfte März<br />
Zur Salweidenblüte<br />
Zeitungen zum Vereinigen von<br />
Völkern<br />
Schwefelschnitten oder<br />
flüssiger Schwefel aus der<br />
Druckgasflasche zur Abtötung<br />
von Schwächlingen<br />
Futterteig zur Notfütterung<br />
Reinigungsutensilien<br />
Aufbau – Wabenbau<br />
Zweite Hälfte<br />
März/Anfang April<br />
Am Besten kurz vor<br />
und beim Einsetzen<br />
der Frühtracht<br />
Drohnenbau an Brutnest<br />
Leitwachsstreifen zum Naturbau<br />
3–5 Mittelwände pro Volk<br />
Aufsatzwaben und Honigwabenmittelwände<br />
evtl. Ergänzungsfütterung<br />
Schwarmzeit<br />
Vermehrungszeit<br />
Mitte April bis<br />
Ende Juni<br />
Beginn: Während<br />
der Frühtracht<br />
Schwarmkisten<br />
Mittelwände für die Schwärme<br />
Zucker und Futtergeschirre für<br />
die Schwarmfütterung<br />
Jungvolkkästen<br />
Frühjahres-Honigernte<br />
Ende April, Mai<br />
und Juni<br />
Beim Einsetzen<br />
einer Läppertracht<br />
oder Beginn der<br />
Trachtpause<br />
Erntegeräte oder Gelegenheit,<br />
diese bei Imkerkollegen mit zu<br />
benutzen<br />
Ordnen des Wabenbaus<br />
Erste Hälfte Juni<br />
bis Ende Juli<br />
Futterwaben (sofern die<br />
verwendete Futterwabe aus<br />
dem betreffenden Volk stammt<br />
und nummeriert ist) und/oder<br />
Futtertaschen für die Zwischentrachtfütterung<br />
Sommer-Honigernte Ende Juli Beim Nachlassen<br />
der Waldtracht<br />
Erntegeräte oder Gelegenheit,<br />
diese bei Imkerkollegen mit zu<br />
benützen<br />
Völkerkontrolle Erste Hälfte August Schwefelschnitten zum Abtöten<br />
von Schwächlingen<br />
Varroabekämpfung Erste Hälfte August Säuren in vorgeschriebener<br />
Menge und Konzentration<br />
zugelassener Applikator gemäss<br />
Empfehlung ZBF<br />
Gittergeschützte Unterlage<br />
Auffütterung<br />
Einwinterung und<br />
Winterarbeiten<br />
Varroa-<br />
Winterbekämpfung<br />
August und erste<br />
Hälfte September<br />
Zweite Hälfte September,<br />
Oktober<br />
November und<br />
Dezember<br />
Kristallzucker 15 kg oder<br />
Flüssigfutter 20 kg<br />
Evtl. einengen<br />
Oxalsäure gemäss<br />
Empfehlung ZBF<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
21
2. Nennen Sie die Zeiten, die Imkerinnen und Imker am meisten herausfordern.<br />
– Aufbau im Frühjahr<br />
– Schwarmzeit<br />
– Honigernte<br />
– Varroabekämpfung<br />
3. Was passiert bei ungenügender Arbeit oder Unterlassung während dieser Zeiten?<br />
Aufbau im Frühjahr:<br />
Schwarmzeit:<br />
Honigernte:<br />
Varroabekämpfung:<br />
Mehr weisellose, schwache oder nicht trachtreife Völker<br />
Verlust eines Teils des Honigs, mehr abgeschwärmte oder weisellose Völker<br />
Finanzieller Verlust<br />
Abgänge von Völkern im Herbst und Winter, schwache Völker im Frühjahr,<br />
Varroafolgekrankheiten: Virenbefall, Sauerbrut. Die Stände der Umgebung werden<br />
in Mitleidenschaft gezogen.<br />
4. Bei welchen Temperaturen im Schatten können Völker (immer möglichst kurz) geöffnet werden?<br />
Wegnahme und Austausch der hintersten Waben oder von Randwaben: 9º C<br />
Blick ins Brutnest: 12º C<br />
Ganzes Volk herausnehmen: 15º C<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
22
3.2 Frühjahreskontrolle<br />
Lernziele<br />
– Sie erkennen, wenn das Volk weisellos ist.<br />
– Sie erkennen, wenn das Volk zu wenig Futter hat.<br />
– Sie erkennen, wenn das Volk Krankheitsanzeichen zeigt.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern, besonders Quervergleich der Völker auf einem<br />
Stand. Beurteilung und Auflösung/Vernichtung von drohnenbrütigen Völkern und Serbelvölkern.<br />
Ergänzungs- und Notfütterungsmöglichkeiten praktisch zeigen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 58 – 62.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Auf welche Fragen muss die Frühjahreskontrolle Antwort geben?<br />
1. Wie stark ist das Volk?<br />
2. Ist es weiselrichtig?<br />
3. Hat es genug Futter?<br />
4. Ist es gesund?<br />
5. Hat es aus eigener Kraft den Boden gesäubert?<br />
2. Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Frühjahreskontrolle, bezogen auf:<br />
a die Temperatur?<br />
b den Trachtkalender?<br />
c das Datum (Halbmonat)?<br />
a Bei mindestens 12º C, an einem Flugtag<br />
b Zur Salweidenblüte<br />
c Zweite Hälfte Februar, erste Hälfte März<br />
3. Woran sehen Sie, dass das Volk eine Königin hat?<br />
An offener Brut<br />
4. Woran erkennen Sie den Futtermangel eines Volkes?<br />
Im Schweizerkasten: Beim Öffnen des Volkes sind die Futterkränze nahezu verschwunden.<br />
Beim Magazin: Blick von oben auf die Waben, es sind keine Futterkränze mehr sichtbar.<br />
5. Wie kann Notfutter gereicht werden?<br />
Futterwaben: An eine mit Bienen besetzte Wabe anschieben, ab 9º C. Nur Futterwaben verwenden,<br />
welche zu einem früheren Zeitpunkt dem betroffenen Volk entnommen wurden und<br />
nummeriert sind.<br />
Zuckerwasser: von oben<br />
Futterteig: von oben<br />
6. Welche Temperaturen müssen bei einer Notfütterung herrschen?<br />
Futterteig ab 5º C<br />
Futterwaben ab 9º C<br />
Zuckerwasser ab 10º C<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
23
7. Was halten Sie von einer Reizfütterung mit Flüssigfutter im frühen Frühling?<br />
Davon ist prinzipiell abzusehen.<br />
8. Nennen Sie die drei Vorteile des Einengens kombiniert mit der Frühjahreskontrolle.<br />
1. Verhinderung verschimmelter Waben: Es sind nur Waben im Volk, die mehr oder weniger mit Bienen<br />
besetzt sind.<br />
2. Wichtig: Es entsteht Raum für neuen Wabenbau, im Schweizerkasten soll der Platz vorbereitet werden<br />
für vier Waben: Eine Drohnenwabe und 3–5 Mittelwände.<br />
3. Entwicklungsfortschritte und -rückschritte sind gut sichtbar.<br />
9. Was tun Sie bei folgenden abnormen Zuständen:<br />
a Keine Eilage, keine Brut?<br />
b Buckelbrut?<br />
c Schwäche, Volk besetzt weniger als vier Waben im Schweizermass?<br />
a Vereinigen oder eine Königin einweiseln, vorausgesetzt, das Volk ist stark genug<br />
(besetzt mindestens 6 Waben).<br />
b Abtöten, oder wenn das Volk noch sehr stark ist, evtl. mit einem anderen starken Volk vereinigen. Nicht<br />
vor dem Stand abwischen (Gefahr von Krankheits- und Parasiten-Verschleppung).<br />
c Abschwefeln<br />
10. Welche Argumente sprechen für oder gegen…<br />
…die Vereinigung mit anderen Völkern?<br />
Pro:<br />
Mit einer Vereinigung kann versucht werden, aus zwei oder drei kleinen, aber gesunden Völkern<br />
ein brauchbares Volk zu machen. Der Erfolg ist aber sehr zweifelhaft.<br />
Achtung: Schwächlinge abschwefeln, nicht vereinigen!<br />
Kontra: Es besteht die Gefahr einer Verschleppung von Krankheiten.<br />
…das Abwischen beim Stand?<br />
Pro: –<br />
Kontra: Es besteht die Gefahr einer Verschleppung von Krankheiten. Die abgewischten, alten Bienen<br />
bringen keine substanzielle Verstärkung der anderen Völker.<br />
…die Abschwefelung?<br />
Pro:<br />
Schwächlinge bringen ausser Arbeit und Kosten nichts. Im Interesse eines gesunden<br />
Bienenbestandes dürfen keine Schwächlinge toleriert werden.<br />
Kontra: Verlust eines Volkes<br />
11. Was tun Sie mit den folgenden Waben, die bei der Frühjahreskontrolle anfallen:<br />
a Futterwaben und Leerwaben gesunder Völker?<br />
b verkotete Waben/graue Waben/Waben aus abgestorbenen oder schwachen Völkern?<br />
c Waben mit Buckelbrut?<br />
a In den Wabenschrank oder in einen Kasten hängen, sortiert nach Alter, immer mit der Volksnummer<br />
angeschrieben. Nur sehr schöne Waben aufbewahren.<br />
b Sofort im Dampfwachsschmelzer oder später im Sonnenwachsschmelzer einschmelzen. Der Dampfwachsschmelzer<br />
verarbeitet auch Waben, die voll mit Futter sind! Achtung: Mit dem Auslecken lassen in<br />
den Völkern oder noch schlimmer im Freien können Krankheiten verbreitet werden. Deshalb wird davor<br />
dringend abgeraten. Zusätzlich kann Räuberei gefördert werden.<br />
c Sofort einschmelzen oder einfrieren, bis der Sonnenwachsschmelzer in Betrieb ist.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
24
3.3 Aufbau – Wabenbau<br />
Lernziele<br />
– Sie können Ihre Völker dem Entwicklungsrhythmus entsprechend im Frühjahrsaufbau unterstützen.<br />
– Sie können Unterschiede in der Volksstärke beurteilen und wissen, wie in Problemsituationen<br />
verfahren werden kann.<br />
– Sie kennen die praktischen Arbeiten für die Wabenbauerneuerung, insbesondere die Umstellung<br />
des Wabenbaus im Schweizerkasten.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Arbeit mit Stockkarten; diese dokumentieren die Entwicklung<br />
der Völker seit dem Herbst des Vorjahres (Beispiel einer Stockkarte im geschützten Bereich<br />
auf www.vdrb.ch). Vergleichende Beurteilung der Volksstärke und Vergleich der unterschiedlichen<br />
Entwicklungsrhythmen. Aussagekräftiges Waagvolk betrachten. Völkerführung bei andauerndem<br />
Schlechtwetter besprechen. Blick auf die Qualität des Wabenbaus und praktisches Üben der Wabenbauerneuerung.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 57 – 68 und Band 2, Seiten 51 – 56.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Füllen Sie die Tabelle zum Volksaufbau aus. *<br />
Name<br />
Drohnenwabe<br />
und Baurahmen<br />
Mittelwände<br />
Honigrahmen<br />
Zeitpunkt Wenn der Bautrieb erwacht Drohnenwabe ausgebaut<br />
und bestiftet<br />
Anzahl 1–2 3–5<br />
Im Magazin, eine Zarge<br />
Bei anstehender Frühtracht.<br />
Wenn bereits Nektar eingetragen<br />
wird<br />
1–2<br />
* Eine bebrütete Honigwabe hat in einem Honigraum nichts zu suchen.<br />
2. Wie viele Mittelwände erhält der 1. Honigraum? Wie ist die Anordnung?<br />
Begründen Sie Ihre Antwort.<br />
Wenn der richtige Zeitpunkt zum Aufsetzen gewährt wird, spielt die Anzahl der Mittelwände und die Anordnung<br />
im Honigraum keine Rolle. Bei guter Tracht ist ein ganzer Aufsatz voll Mittelwände innert Tagen<br />
ausgebaut.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
25
3. Wie viele Mittelwände erhält der 2. Honigraum? Begründen Sie Ihre Antwort.<br />
In der Regel erhält er keine Mittelwände, denn nur bei starker, anhaltender Tracht würden diese ausgebaut.<br />
4. Was ist eine Drohnenwabe und welche Funktion hat sie?<br />
Auf der Drohnenwabe konzentriert sich die Drohnenbrut. Sie steuert die Bienen, dass diese auf den<br />
Brutwaben weniger Drohnenzellen bauen.<br />
Sie dient auch als Schwarmbarometer. Solange die Bienen bauen, ist das Volk nicht in Schwarmstimmung.<br />
Kann als «Wachsquelle» genutzt werden, d.h. zum Aufbau eines Vorrats an unbelastetem eigenem Wachs.<br />
5. Was ist vom Drohnenschnitt zu halten?<br />
Der Drohnenschnitt gehört zu jeder alternativen Varroabekämpfung.<br />
6. In welcher Anordnung zur Brut und zur Fensterwabe wird die Drohnenwabe gesetzt?<br />
Die Drohnenwabe wird immer anschliessend ans Brutnest gesetzt, nach Möglichkeit nicht als<br />
Fenster wabe, da die Drohnenbrut bei Kälterückschlägen am ehesten vernachlässigt wird und so ein<br />
Krankheitsrisiko darstellen würde. Im Mai kann die Drohnenwabe auch ans Fenster gesetzt werden, wo die<br />
Bautätigkeit leicht sichtbar ist.<br />
7. Warum sollte die Umstellung vor dem längsten Tag erfolgen, d.h. frühestens sobald alle<br />
Mittelwände im Brutraum ausgebaut sind?<br />
Das Volk sollte die Mittelwände nicht nur ausgebaut, sondern an zentralerer Stelle im Brutnest soweit<br />
bebrütet und benutzt haben, dass sie für den Wintersitz in Frage kommen.<br />
Rückt man die ausgebauten noch jungen, ehemaligen Mittelwände erst im Herbst um zwei oder drei<br />
Stellen nach vorne, zertrennen sie den Wintersitz, der teils auch auf die nach hinten gezogenen, alten<br />
Waben zu liegen kommt.<br />
Folge: Das Volk sitzt mit getrenntem Wintersitz weit hinten.<br />
8. Wann müssen Waben aussortiert werden?<br />
Faustregel: Wenn der Schatten einer hinter die Wabe gehaltenen Hand nicht mehr durch den Wabenbau<br />
sichtbar ist, normalerweise nach spätestens drei Jahren.<br />
9. Wie bringt man Waben am besten aus dem Sitz des Volkes heraus?<br />
Einengen im Herbst und Frühjahr: Entfernen alter Futterwaben.<br />
Auslecken lassen alter Waben hinter dem Fenster (im Frühjahr).<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
26
10. Was können die Gründe sein, wenn ein Volk wenig baut und nicht stark genug ist?<br />
– Hungerphasen, schlechte Tracht<br />
– Durch Königin bedingtes Problem, Alter, mangelnde Fruchtbarkeit<br />
– Krankheitsdruck<br />
– Mangelnde Vitalität der Bienen<br />
11. Wie verfahren Sie während der Frühtracht mit einem schwachen Volk?<br />
Abschwefeln<br />
12. Was passiert, wenn Sie mit der Entwicklung des Volkes nicht Schritt halten?<br />
«Ich bin zu langsam»: Entwicklungsbegrenzung, oft recht schneller Ausbruch der Schwarmlust.<br />
«Ich bin zu schnell»: Unterkühlung der Brut, Entwicklungsdämpfer.<br />
Fazit: Ich halte in dieser herausfordernden Zeit Schritt mit meinen Völkern. Ich bereite das erforderliche<br />
Material für den Aufbau vorher vor und halte mir so Zeit frei für eine angepasste Völkerführung.<br />
13. Wie verwenden Sie braune oder nur teilweise ausgebaute Mittelwände?<br />
Einschmelzen<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
27
3.4 Brutkontrolle<br />
Lernziele<br />
– Sie wissen, wie Sie bei jedem Eingriff ins Volk die Brut in ihren Stadien beurteilen können.<br />
– Sie können die Eier und die junge Brut erkennen und wissen, wo sie diese am ehesten finden.<br />
– Sie eignen sich ein Bild an hinsichtlich Brutmenge, Geschlossenheit und Gesundheit der Brut.<br />
– Sie lernen aus dem Brutbild Schlüsse zu ziehen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Waben mit Brutbildern und Weiselzellen herumzeigen.<br />
Bilder gesunder, normaler Brut besprechen. Gelegenheit geben, die Brutstadien anzusehen. Gemeinsam<br />
beurteilen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 69, 141– 142, Band 2, Seite 69 und Band 3, Seite 10.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Nennen Sie die drei Brutstadien, die Sie bei jedem raschen Blick ins Brutnest prüfen und wie viele<br />
Tage diese Stadien bei der Arbeiterinnenbrut währen.<br />
Eier:<br />
3 Tage<br />
Offene Brut: 5 Tage<br />
Geschlossene Brut: 13 Tage<br />
2. Was können die folgenden Beobachtungen bedeuten?<br />
Keine Eier: Weisellosigkeit, Königin legt (noch) nicht, Hunger, Winter<br />
Keine offene Brut: Hunger (auch Pollenhunger), königinnenbedingter Brutunterbruch, Ende der Brutsaison<br />
Keine verdeckelte Brut: Jungkönigin bei erster Eilage<br />
Kein geschlossenes Brutnest: Sauerbrutverdacht! Alte Königin/Krankheit/verhonigte Brutwaben<br />
3. Welches Brutstadium wird von den Bienen nicht gepflegt und ist auffallend oft wenig von Bienen<br />
besetzt?<br />
Tipp: Wenn Sie nach diesem Stadium suchen, schauen Sie zuerst auf die bienenfreien Flächen inmitten einer<br />
sonst gut mit Bienen besetzter Wabe!<br />
Eier<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
28
4. Was sagen diese Bilder aus?<br />
a Brut einer Afterkönigin<br />
Das Volk ist schon länger weisellos.<br />
b Löchriges Brutnest<br />
Sauerbrutverdacht! Fehlende Balance im Volk,<br />
Krankheitsdruck, Kalkbrut u.a. Inzuchtschädigung.<br />
c Spielnäpfchen<br />
Der Schwarmtrieb erwacht.<br />
d Brut einer drohnenbrütigen Königin<br />
Die Königin hat eine Legestörung oder ihr<br />
Spermavorrat ist erschöpft.<br />
e Schwarmzellen<br />
Wird die Made gefüttert: Das Volk will schwärmen.<br />
f<br />
Nachschaffungszellen<br />
Das Volk hat die alte Königin verloren und zieht<br />
eine neue nach.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
29
3.5 Honigernte<br />
Lernziele<br />
– Sie können das qualitativ hoch stehende Lebensmittel Honig korrekt ernten.<br />
Stichworte: Reifezustand, verdeckelte Honigwaben, Stossprobe, Honig abdeckeln, schleudern,<br />
sieben, abschäumen, abfüllen, Hygiene.<br />
– Sie erlernen den Gebrauch von Honigerntegeräten und Werkzeugen.<br />
– Sie erarbeiten Basiswissen im Bereich Honigpflege/-verarbeitung (Lagerung, Klärung, Abschäumen,<br />
Cremehonig, Abfüllen), Honigverkauf.<br />
– Sie kennen das Goldsiegelprogramm und wissen um die Qualitätsanforderungen (auch lebensmittelgesetzlich<br />
vorgeschriebene).<br />
– Materialkunde: Gefässe, Kessel und Gebinde.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Schwerpunkt praktische Arbeit im Bienenhaus, auf dem Bienenstand, im Schleuderraum.<br />
Arbeit mit der Checkliste für die Qualitätskontrolle für das Honig-Qualitätssiegel-Programm von<br />
apisuisse.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 83 – 92, 150 und Band 4, Seiten 11 – 21.<br />
Info und Tipps<br />
Ursache<br />
Honigernte während einer Tracht<br />
Unverdeckelte Waben ohne «Stossprobe» oder<br />
Refraktometertest geerntet<br />
Honig zum Abschäumen offen stehen lassen<br />
Honig bei Raumtemperatur und hell lagern<br />
Unhygienischer Schleuderraum mit<br />
Fremdgerüchen<br />
Zu hoher Wassergehalt<br />
Honig beim Schleudern nicht fachgerecht gesiebt<br />
Bei Honigwabenentnahme aus dem Volk zu viel<br />
Rauch verwendet<br />
Auswirkungen<br />
Unreifer Honig mit zu hohem Wassergehalt<br />
beginnt zu gären (Fermentation)<br />
Wassergehalt im Honig steigt rasch<br />
(hygroskopisch) über den empfohlenen Wert<br />
Blütenhonig verfärbt sich bei der Lagerung braun<br />
Honig mit Fremdgeruch (untypischer<br />
Honig geruch)<br />
Honig trennt sich in zwei Schichten,<br />
Gärungs gefahr<br />
Fremd- und Wachsteile im Honig<br />
Honig mit Rauchgeschmack<br />
Info: Honigernte<br />
Vor der Ernte den Wassergehalt prüfen: Stossprobe (Wassergehalt maximal 18,5%).<br />
Behandlung von Honig und die Erhaltung der Qualität:<br />
Je niedriger der Wassergehalt des Honigs ist, desto haltbarer ist er. Qualitätshonig darf höchstens 18,5%<br />
Wasser enthalten. Der Wassergehalt des Honigs wird mit einem geeichten Refraktometer gemessen.<br />
Die Erntefähigkeit kann auch mit Hilfe der Stossprobe abgeschätzt werden.<br />
Der reife Honig wird in einer gereinigten Schleuder ohne zusätzliche Erwärmung geschleudert. Am<br />
besten werden die Waben direkt nach der Entnahme aus den Bienenvölkern geschleudert. Der Honig<br />
fliesst durch ein Sieb in einen sauberen Behälter. Das Sieb hält unerwünschte Fremdpartikel wie<br />
beispielsweise Wachs zurück. Pollen dagegen dürfen nicht entfernt werden. Deshalb darf die Maschenweite<br />
bei mehreren Siebstufen nicht kleiner als 0,2 mm sein.<br />
Info: Richtlinien für das Etikettieren von Honig<br />
www.vdrb.ch – Rubrik Downloads – Honigqualität<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
30
Info: Honig-Qualitätssiegel-Programm<br />
Die Imkerinnen und Imker sind Hersteller von Lebensmitteln. Die Gesetzgebung im<br />
Bereich Lebensmittel überträgt dem Produzenten die Verantwortung für die gute<br />
Herstellungspraxis auf seinem Betrieb und die Qualität seiner Produkte. Um dieser<br />
Verantwortung gerecht zu werden, braucht es eine stetige fachliche Weiterbildung. Die<br />
Selbstkontrolle ist das Qualitätssicherungssystem, das Imkerinnen und Imker auf ihrem<br />
Betrieb durchführen und das hilft, die Herstellung und die Qualität der Erzeugnisse unter<br />
Kontrolle zu halten.<br />
Diese Vorschriften gelten für alle Imker<br />
Was machen Siegelimker mehr?<br />
Honig darf höchstens 21% Wasser enthalten. Wassergehalt des Honigs ist max. 18,5%.<br />
Honig darf nicht übermässig erhitzt werden,<br />
er muss reif gewonnen werden. Die Waben<br />
müssen brutfrei sein. Er muss gesiebt werden,<br />
aber Pollen dürfen nicht entfernt werden<br />
(Sieb > 0,2 mm).<br />
Die «Gute Herstellungs-Praxis» ist ein Begriff<br />
der Produktehaftung und -herstellung.<br />
Produkte sollen nach neuesten Erkenntnissen<br />
hergestellt werden, um die Sicherheit des<br />
Konsumenten sicherzustellen.<br />
Die Pflicht zur Selbstkontrolle ist einer der<br />
wichtigsten Grundsätze des schweizerischen<br />
Lebensmittelrechts. Sie gilt für alle, die<br />
Lebensmittel herstellen, behandeln, abgeben,<br />
einführen oder ausführen.<br />
Die Pflicht zur Selbstkontrolle beinhaltet auch<br />
die Pflicht zur Dokumentation der Herstellung<br />
und der Ernte.<br />
Erlaubt sind nur Arzneimittel, die SwissMedic<br />
zugelassen hat. Das ZBF empfiehlt aber nur<br />
einen Teil der erlaubten Arzneimittel!<br />
Es dürfen nur lebensmittelechte Geräte und<br />
Lagergefässe verwendet werden.<br />
Lagern nur in Chromstahl und spez.<br />
Kunststoffkesseln (oder Gläsern).<br />
Er verpflichtet sich schriftlich, die<br />
Qualitäts vorschriften des Reglements<br />
einzuhalten.<br />
Selbstkontrolle wird mit dem apisuisse-<br />
Formular geführt (www.vdrb.ch –<br />
Rubrik Downloads – Formulare).<br />
Es werden von jedem Warenlos zwei Rückstellmuster<br />
zu 250g bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
gelagert, wovon eines zur <strong>VDRB</strong><br />
Verbandsanalyse gratis einzogen werden<br />
kann.<br />
Für Siegelimker gilt: NUR vom ZBF empfohlene<br />
Arzneimittel sind erlaubt! Varroa und<br />
Wachsmotten werden nur mit empfohlenen<br />
Mitteln bekämpft (www.vdrb.ch – Rubrik<br />
Links – Gesetze und Verordnungen).<br />
Honig wird dunkel und kühl gelagert.<br />
25% der Brutwaben werden jährlich erneuert,<br />
damit sie hell bleiben. Bebrütete Honigwaben<br />
werden im Folgejahr ersetzt.<br />
Bienen werden nur mit eigenem Honig<br />
gefüttert.<br />
Zwischentrachtfütterung nur mit<br />
Futterwaben, Maische oder Teig<br />
(14 Tage Wartezeit bei Flüssigfütterung)<br />
Mindestens zwei Weiterbildungen pro Jahr<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
31
Info: Honiglagerung<br />
Honig mit einem Wassergehalt zwischen 15 % und 18% kristallisiert optimal aus. Honig mit weniger<br />
als 15% Wasser ist sehr zähflüssig und schlecht streichbar. Er kristallisiert sehr hart aus. Bei der Kristallisation<br />
von Honig mit mehr als 18,5% Wassergehalt bilden sich oft zwei Schichten: Eine kandierte und<br />
eine flüssige. Der Wassergehalt in der flüssigen Schicht ist höher als im kristallisierten Bereich, so dass<br />
die Gefahr einer Gärung besteht. Gärender Honig ist nicht handelsfähig, kann aber je nach Zustand zu<br />
Backzwecken verwendet werden. Er darf nicht den Bienen verfüttert werden.<br />
Quelle: Website Zentrum für Bienenforschung www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />
Info: Lagergefässe<br />
Behälter für den Konsum: Glas oder lebensmittelechter Kunststoff<br />
Behälter für Lagerung: Chromnickelstahl oder lebensmittelechter Kunststoff<br />
Die Behälter von Honig müssen vor allem luft- und wasserdicht sein, damit keine Luftfeuchtigkeit<br />
eindringen kann.<br />
Als Behälter für den Konsum eignen sich am besten Gläser mit Twist-off-Deckel, aber auch Behälter<br />
aus lebensmittelechtem Kunststoff sind akzeptabel. Kartondosen mit Paraffinbelag sind vom Lebensmittelgesetz<br />
her verboten, weil Paraffin giftige Substanzen enthält. Für den Handel und die Lagerung<br />
in Grossbehältern sind nur Chromnickelstahl und lebensmittelechter Kunststoff geeignet. Ungeeignet<br />
sind Kessel aus Aluminium, verzinkte Gefässe und solche, die innen mit einer Farbschicht versehen sind.<br />
Die Farbe könnte Giftstoffe abgeben. Behälter aus Weissblech dürfen nur verwendet werden, wenn sie<br />
absolut rostfrei sind. Bei Neuanschaffungen sollten keine Kessel aus Weissblech gekauft werden.<br />
Quelle: Website Zentrum für Bienenforschung www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wann kann in den Flachlandregionen Honig geerntet werden?<br />
Blütenhonig:<br />
Ende Mai bis Mitte Juni<br />
Sommerhonig: Juli bis Anfang August<br />
2. Wann ist Honig reif?<br />
Die Honigwaben sind verdeckelt. Der Honig spritzt bei Stossprobe nicht aus den Waben.<br />
3. Warum darf unreifer Honig nicht geerntet werden?<br />
Unreifer Honig hat zu viel Wasser und gärt schnell.<br />
4. Wann darf kein unverdeckelter Honig geerntet werden?<br />
Während einer guten Tracht, z.B. während der Rapsblüte<br />
5. Nennen Sie geeignete Räume, welche als Schleuderraum benützt werden können.<br />
Raum im Bienenhaus, Waschküche oder ein mit Fliesen ausgekleideter Heizungs- oder Luftschutzraum.<br />
Raum darf keine Fremdgerüche aufweisen.<br />
6. Worauf ist beim Schleuderraum besonders zu achten?<br />
Geruchsfrei, trocken, sauber und bienendicht. Der Raum soll wenn möglich über fliessendes Wasser und<br />
elektrischen Strom verfügen.<br />
7. Wie wird der Honig ohne grosse Qualitätseinbusse mehrere Jahre optimal gelagert?<br />
– Richtiges Gefäss, vorzugsweise Glas, Chromnickelstahl oder lebensmittelechter Kunststoff<br />
(luftdicht verschlossen)<br />
– Kühl: 10° C – max. 16° C, möglichst geringe Temperaturschwankungen während des ganzen Jahres<br />
– Dunkel<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
32
3.6 Zwischentrachtpflege<br />
Wabenbauumstellung – Futtervorrat, Fütterung, Futter- und Brutkontrolle, Räuberei<br />
Lernziele:<br />
– Sie kennen Vor- und Nachteile von Gesamtbauerneuerung oder Umstellung des Wabenbaus.<br />
– Den Futtervorrat eines Volkes können Sie rationell abschätzen<br />
(Futterkontrolle, Futterkranzkontrolle).<br />
– Die verschiedenen Futterarten und Futtergeschirre kennen Sie.<br />
– Sie kennen die Gefahren beim Einsatz von Futterwaben.<br />
– Sie kennen die Gründe für Räuberei und wissen diese zu vermeiden.<br />
– Sie wissen, wann und wie eine Notfütterung durchgeführt werden muss.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Bei der Jungvolkbildung und der Sommerpflege der Leistungsvölker in verschiedenen<br />
Kursteilen auf die Grundversorgung der Völker achten, praktische Arbeit an den Völkern. Verschiedene<br />
Futtergeschirre und Futterarten vor Ort.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch Band 1, Seite 68, 90, 95 – 99, 114.<br />
Methodischer Hinweis<br />
Vom Zeitpunkt her drängt sich die Wabenbauumstellung auf siehe 3.3 Aufbau/Wabenbau, Seite 25.<br />
Infos und Tipps<br />
Ursache<br />
Alte Futterwaben vor dem Bienenhaus<br />
auslecken lassen<br />
Verschüttetes Zuckerwasser nicht sofort<br />
aufputzen<br />
Bienenvolk überwintert auf Waldhonig<br />
Volk ist weisellos oder zu schwach<br />
Nach der Ernte wird zu rasch und zu viel<br />
aufgefüttert<br />
Späte, starke Waldtracht<br />
Nach dem Abräumen des Honigaufsatzes wird<br />
nicht sofort gefüttert<br />
Nach dem Einengen nur verdeckelte Futterwaben<br />
und Pollenwaben im Volk belassen<br />
Auswirkungen<br />
Bewirkt Räuberei, Verschleppen von<br />
Bienenkrankheiten<br />
Räuberei wird gefördert<br />
Ruhrgefahr bei längeren Kälteperioden<br />
Das Bienenvolk nimmt das Futter nicht oder<br />
ungenügend auf<br />
Der Brutraum «verhonigt» und für die Brut ist<br />
kein Platz mehr vorhanden<br />
Kein Platz für Winterbrut, schlechter Wintersitz,<br />
Gefahr von Ruhr bei langer Kälteperiode<br />
Massnahme: Volle, mit Waldhonig gefüllte Brutwaben<br />
werden geschleudert und müssen durch<br />
leere Brutwaben ersetzt werden.<br />
(Achtung Siegelimker!)<br />
Bienen sind hungrig, werden aggressiv und<br />
rauben Nachbarvölker aus<br />
Bienenvolk verhungert im Winter/Frühjahr bei<br />
kalter Witterung<br />
1. Wann ist der beste Zeitpunkt für die Wabenbauumstellung oder die Wabenbauerneuerung?<br />
Nach der Frühjahresernte bis Ende Juni<br />
2. Mit welchen Arbeiten kann die Wabenbauumstellung kombiniert werden?<br />
– Schwarmkontrolle<br />
– Ablegerbildung<br />
– Kontrolle des abgeschwärmten Volkes<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
33
3. Welche Vorteile bringt die Gesamtbauerneuerung?<br />
Neues Wabenmaterial, reduzierter Krankheitsdruck, kontrollierter Wachskreislauf, weniger Störungen<br />
über drei Jahre, evtl. neue Königin<br />
4. Wie gross ist der Nahrungsbedarf eines Bienenvolkes im Frühling pro Woche?<br />
Etwa 1 kg<br />
5. Wie gross muss der Frühjahrshonigvorrat sein, dass sich eine Zwischentrachtfütterung erübrigt?<br />
Mindestens 6 kg. Bei gutem Trachtangebot, z.B. Buntbrache, Waldbeeren.<br />
6. Welche Möglichkeiten haben Sie zur Notfütterung bei andauerndem Schlechtwetter?<br />
– Fütterung mit Futterwaben. Nur Futterwaben verwenden, die aus dem entsprechenden Volk stammen<br />
und nummeriert sind.<br />
– Fütterung mit Futterteig<br />
Bei entferntem Honigraum:<br />
– Futtertasche mit Maische<br />
– Flüssigfütterung<br />
Wartefrist: Zwei Wochen für erneutes Aufsetzen des Honigraumes<br />
7. Wann besteht die Gefahr von Räuberei?<br />
Räuberei wird meist von einem vorausgehenden Fehler des Imkers ausgelöst.<br />
– Nie Waben im Freien zum Auslecken aufhängen<br />
– Flugloch ist nicht der Volksstärke angepasst.<br />
– Honig- und Futterwabenschrank sind nicht bienendicht.<br />
– Weisellose Völker<br />
8. Wie kann man Räuberei bekämpfen?<br />
– Flugloch derart verschliessen, dass jeweils nur eine Biene durchschlüpfen kann.<br />
– Beraubtes Volk an einen mindestens 3 km entfernten Standort verstellen.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
34
3.7 Arbeiten nach der Sommertracht<br />
Lernziele<br />
– Sie können den Zeitpunkt der Sommertrachternte richtig bestimmen.<br />
– Sie wissen, dass sich eine späte Varroabekämpfung negativ auf den Aufbau starker und gesunder<br />
Winterbienengenerationen auswirkt.<br />
– Sie können die Volksstärke abschätzen und entscheiden, ob dieses überwinterungswürdig ist.<br />
– Sie können den Vorrat abschätzen und den Nahrungsbedarf berechnen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Stockkarten, die den Verlauf des Jahres wiedergeben<br />
(Beispiel einer Stockkarte im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch). Aussagekräftiges Waagvolk,<br />
welches das Abflauen der Tracht zeigt. Ergebnisse der apistischen Beobachtungsstationen der letzten<br />
zehn Jahre, die dokumentieren, ob im August noch Tracht erwartet werden kann. Vergleiche zwischen<br />
den Völkern hinsichtlich der Kontrollpunkte.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 91 – 99.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie setzen Sie den Zeitpunkt der Sommertrachternte an:<br />
a Im Bezug auf die Tracht?<br />
b Im Bezug auf den Aufbau starker Winterbienengenerationen?<br />
c Im Bezug auf die Varroabelastung?<br />
a Am besten beim Ausklingen und nicht bei völlig beendeter Tracht, die Ernte und Kontrolle gehen viel<br />
ruhiger, die Völker sind sanfter.<br />
b So früh wie möglich, damit die Winterbienen nicht die Hauptarbeit der Zuckerfutterverarbeitung<br />
übernehmen müssen. Sie brauchen ihre Kräfte für Überwinterung und Frühjahrsaufbau.<br />
c Kein Warten auf den letzten Tropfen Honig und schon gar kein Hungern lassen der Völker. Auf den rasch<br />
sich vermindernden Brutkreisen vermehrt sich sonst die Varroa sehr rasch und die Völker erleiden eine<br />
irre versible Schädigung.<br />
«Ein gesundes, vitales Volk im nächsten Frühjahr ist mindestens ebenso viel wert wie sein gesamter<br />
Jahreshonigertrag.»<br />
2. Welches sind die Arbeitsschritte bei der Sommertracht-Ernte?<br />
– Alle Honigwaben herausnehmen, Bienen abklopfen und abwischen<br />
– Honigwaben in schliessbare Transportkiste einhängen<br />
– Volk möglichst rasch schliessen und sich beruhigen lassen<br />
3. Was ist besser: Eine späte Sommertracht-Ernte oder eine frühzeitige Varroabekämpfung?<br />
An den meisten Orten kann auf diese geringe Menge Honig zu Gunsten einer frühen Varroabekämpfung<br />
verzichtet werden.<br />
4. Nennen Sie die sechs Fragen, welche vor dem Auffüttern beantwortet werden müssen.<br />
1. Ist das Volk weiselrichtig?<br />
2. Ist die Brut gesund?<br />
3. Wie gross ist der Futtervorrat?<br />
4. Können alte oder schlechte Waben entfernt werden?<br />
5. Müssen nach starker, später Waldtracht volle Brutwaben durch leere ersetzt werden<br />
(Platz zum Brüten geben)?<br />
6. Muss ein Volk noch umgeweiselt werden?<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
35
5. Nennen Sie die Arbeitsschritte nach dem Abräumen.<br />
– Teilweise auffüttern<br />
– Varroabekämpfung<br />
– Fertig auffüttern<br />
– Herbstkontrolle<br />
6. Wie viel Zuckerwasser soll pro Volk im Spätsommer gefüttert werden?<br />
15 – 20 kg, abhängig vom Beutentyp, vom Versorgungsgrad und den klimatischen Bedingungen.<br />
7. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem fertigen Futtersirup aus dem Fachhandel oder dem<br />
selbst hergestellten aus Kristallzucker?<br />
Gekaufter Futtersirup ist konzentrierter, teurer, aber es entfällt Arbeit.<br />
8. Nach der Honigernte sind zwei Schritte fällig – die Säurebehandlung und das Auffüttern.<br />
Welcher kommt zuerst?<br />
Zuerst einen Kessel Futter geben, das beruhigt die Bienen.<br />
9. Wann soll aufgefüttert werden?<br />
Sofort nach der Honigernte bis Mitte September. Wegen Räubereigefahr abends und bei allen Völkern<br />
gleichzeitig.<br />
10. Wann soll die erste Behandlung gegen die Varroamilbe durchgeführt werden?<br />
Ende Juli/Anfang August<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
36
3.8 Einengen, Einwinterung und Winterkontrollen (inkl. Einengen im Frühjahr)<br />
Lernziele<br />
– Sie verstehen die Bedeutung des Einengens.<br />
– Sie kennen die Argumente für das Einengen im Herbst und im Frühjahr.<br />
– Sie können die Volksstärke abschätzen und ein Volk bei der Einwinterung einfach bewerten.<br />
– Sie wissen um die umstrittene Frage des Eindeckens von Bienenvölkern.<br />
– Sie kennen Mäuseschutzvorrichtungen.<br />
– Sie kennen die Winterarbeiten, wie Futterwaben sortieren, Waben ausscheiden/verwerten und die<br />
periodische Winterkontrolle an den Völkern.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Arbeit mit Stockkarten (ein Beispiel finden Sie im geschützten<br />
Bereich auf www.vdrb.ch). Wärmehaushalt der Bienenvölker im Winter und Aufbau der<br />
Wintertraube repetieren.<br />
PowerPoint Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 100 – 102 und Band 2, Seiten 74 – 76.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. In welchem Teil des Kastens soll der Wintersitz liegen?<br />
Im fluglochnahen Teil des Kastens<br />
2. Welche Waben bevorzugen die Bienen für den Wintersitz?<br />
Alte Waben<br />
3. Welche Auswirkungen hat ein zu spätes Ordnen des Wabenbaus?<br />
Der Wintersitz kann nach hinten ans Fenster gezogen und getrennt werden.<br />
4. Auf wie vielen Waben überwintert ein Volk?<br />
Auf fünf bis zehn Waben im Schweizerkasten<br />
5. Nennen Sie Gründe für das Einengen<br />
a im Spätherbst.<br />
b im Frühjahr.<br />
a Kein Schimmel auf den Futterwaben<br />
b Platz schaffen für Mittelwände<br />
6. Wie geht das Einengen im Herbst vor sich?<br />
– Unnötige Waben entfernen<br />
– Bienen abwischen<br />
– Volk schliessen<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
37
7. Warum ist es nicht nötig, das Volk einzudecken?<br />
– Die Wintertraube isoliert sich selber ausreichend.<br />
– Wenn weniger lange Brut gepflegt wird, gehen die Bienen mit ihrem Vorrat besser um.<br />
8. Wie hoch und wie breit soll das Flugloch höchstens sein, damit keine Mäuse eindringen können?<br />
7 mm hoch, die Breite den effektiven Flugbewegungen anpassen.<br />
9. Zählen Sie die wichtigen Winterarbeiten auf.<br />
1. Periodische Standkontrollen<br />
2. Rahmen drahten<br />
3. Winterbehandlung mit Oxalsäure<br />
4. Gerätschaften für das nächste Jahr vorbereiten<br />
5. Honig vermarkten<br />
10. Worauf achten Sie bei der Winterkontrolle?<br />
1. Sind die Fluglöcher offen und frei?<br />
2. Stört etwas die Winterruhe der Bienen?<br />
3. Höre ich das Summen der Bienen im Kasten?<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
38
3.9 Spezialitäten beim Imkern mit dem Magazin<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die wichtigsten Unterschiede in der Betriebsweise der beiden Beutentypen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 49 – 53, 75 – 76, 94 (Magazine allgemein),<br />
Seiten 45 – 48 (Dadant).<br />
Methodischer Hinweis<br />
Halbieren Sie die Gruppe der Kursteilnehmenden mit dem Auftrag, alle Argumente für den Schweizerkasten<br />
bzw. das Magazin zusammenzutragen.<br />
Wagen Sie Spielformen – z.B. das Erstellen eines dazugehörigen Prospektes, die Präsentation an der<br />
Pinnwand.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Vergleichen Sie Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzbeuten.<br />
Holz:<br />
langlebiger, besser zu reinigen<br />
Magazin: leichter, billiger<br />
2. Magazinbeuten können in zwei Gruppen eingeteilt werden, jene mit einem und jene mit zwei<br />
Wabenmassen. Welche Vor- und Nachteile bieten diese Beuten?<br />
Ein Wabenmass ist für die Wabenbauerneuerung sehr erwünscht, da ältere oder bebrütete Honigwaben<br />
nach unten wandern. Volle Honigwaben sind sehr schwer.<br />
3. Welches sind die wesentlichen Unterschiede in der Betriebsweise Schweizerkasten/<br />
Magazinbeute?<br />
Im Magazin sind weniger Eingriffe nötig als im Schweizerkasten.<br />
Erweitern heisst meist, eine weitere Zarge aufzusetzen.<br />
4. Beschreiben Sie die Frühjahreskontrolle im Magazin mit einem Wabenmass.<br />
In einem einzigen Eingriff werden vier Schritte gleichzeitig erledigt:<br />
– Brutkontrolle<br />
– Aussondern der Altwaben<br />
– Wabenbauerneuerung<br />
– erste Honigwaben und Drohnenwabe<br />
5. Vergleichen Sie – möglichst unvoreingenommen vom eigenen Beutentyp – Magazine oder<br />
Schweizerkasten miteinander. Welche Schlüsse ziehen Sie?<br />
Eine allgemein gültige Antwort für das eine oder das andere System gibt es nicht.<br />
Einige Punkte müssen abgewogen werden: Standort, vorhandenes Material, Finanzen, Vorlieben...<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
39
3.10 Wabenverwertung<br />
Lernziele<br />
– Sie wissen, wie Altwaben und Altwachs korrekt verwertet werden (einschmelzen, Altwachs/-waben<br />
lagern).<br />
– Sie wissen, wie Waben richtig sortiert, gelagert und behandelt werden.<br />
– Sie wissen um die Bedeutung der Wabenhygiene bezüglich Wachsmottenprophylaxe und Rückstandsproblematik.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Mit diversen Waben (Honig-, Brut-, Futter-, Drohnenwaben, Baurahmen) Verwertung<br />
demonstrieren.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 114 – 128 und Band 4, Seiten 47 – 50.<br />
Info und Tipps<br />
Für die Vorbeugung bzw. Bekämpfung der Wachsmotten in den Wabenlagern und Völkern ist ein<br />
integriertes Vorgehen erforderlich, bei dem je nach Bedarf Kombinationen von technischen, physikalischen,<br />
chemischen und biologischen Massnahmen zu ergreifen sind. Einzelheiten sind in der Broschüre<br />
«Qualität des Bienenwachses – Rückstände» zu finden (www.agroscope.admin.ch/imkerei - Rubrik<br />
Publikationen).<br />
Die wichtigste Massnahme, um Verschmutzungen der Bienenprodukte zu vermeiden, ist die Durchführung<br />
der alternativen Varroabekämpfung mit Produkten, die keine persistent fettlöslichen Wirkstoffe<br />
in die Bienenvölker abgeben (Ameisensäure, Oxalsäure, Thymol).<br />
In der alternativen Varroabekämpfung kommen im Juli – September Ameisensäure oder Thymol und<br />
im November – Dezember Oxalsäure zur Anwendung.<br />
Die aktuellen Empfehlungen für die Durch führung finden Sie<br />
– in Artikeln des Zentrums für Bienenforschung<br />
– in den Bienenzeitungen<br />
– im Kalender des Schweizer Imkers<br />
– auf der Website www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Warum werden Waben aussortiert?<br />
Hygiene, Krankheitskeime eliminieren, Drohnenwildbau entfernen<br />
2. Wann lassen Sie Mittelwände ausbauen?<br />
Bautrieb der Bienen im Frühling nutzen, Honigwabenbau bei guter Tracht<br />
3. Welche Waben ersetzen Sie?<br />
Dunkle Brutwaben und bebrütete Honigwaben<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
40
4. Wie verwerten Sie Altwaben mit Futter?<br />
Alle Altwaben sollen eingeschmolzen werden. Der Verlust pro Altwabe beträgt vielleicht zwei Franken.<br />
Dafür gibt es sicher keine Infektion durch allfällige Krankheitserreger.<br />
Wenig oder nicht bebrütete Waben nummerieren und für Zwischentrachtfütterung in den Wabenschrank<br />
hängen.<br />
5. Wie bekämpfen Sie Wachsmotten?<br />
24 h im Tiefkühler, biologische Mittel (B401, Mellonex), Essigsäure verdampfen, Schwefelbehandlung,<br />
Waben in Kühlzelle mit Temperaturen unter 10°C lagern<br />
6. Wie gewinnen Sie Wachs?<br />
Altwaben einschmelzen (Sonnenwachs-/Dampfschmelzer), im Wachsverarbeitungsbetrieb zum<br />
Umarbeiten in Mittelwände abgeben<br />
7. Welches Hilfsmittel hat sich für das Filtrieren des Wachses bewährt?<br />
Gartenflies<br />
8. Warum dürfen Mottenkugeln zur Wachsmottenbekämpfung nicht verwendet werden?<br />
Paradichlorbenzol (PDCB)-Rückstände im Wachs und im Honig sind eine gesundheitliche Gefährdung von<br />
Imker und Umwelt.<br />
9. Wie werden Vorrats- und Honigwaben gelagert?<br />
Im bienendichten, geruchsneutralen Wabenschrank. Kühl, wachsmottendicht.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
41
3.11 Vermehrungstrieb im Bienenvolk<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die natürliche Vermehrungszeit der Bienenvölker, angepasst an den eigenen<br />
Bienenstand.<br />
– Sie kennen schwarmfördernde Faktoren und wenden schwarmhemmende Massnahmen auf dem<br />
eigenen Stand praktisch an.<br />
– Sie unterscheiden Nachschaffungs- und Schwarmzellen im Bienenvolk und kennen die Hintergründe<br />
von deren Entstehung.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Beurteilt zusammen mit den Kursteilnehmenden die allgemeine Lage bezüglich Schwärmen<br />
zur Zeit des Kurses und dem Schwarmtrieb verschiedener Völker. Zeigt verschiedene Stadien und<br />
Typen von Königinnenzellen. Führt schwarmhemmende Massnahmen an den Völkern durch.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 68 – 76, Band 2, Seiten 65 – 76 und Band 3,<br />
Seiten 9 – 10.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. In welchen beiden Monaten schwärmen auf Ihrem Bienenstand die Völker?<br />
Mai und Juni: Variabel, je nach Lage des Bienenhauses schon ab Mitte April<br />
2. Beurteilen Sie, wie die folgenden Faktoren die Schwarmlust eines<br />
Bienenvolkes beeinflussen.<br />
Viele Waben mit offener, ganz junger Brut<br />
Ein längerer Kälteeinbruch im April nach relativ guten Flug- und<br />
Trachtbedingungen<br />
Flugfront, die der Sonneneinstrahlung lang und stark ausgesetzt ist<br />
Ausbauen lassen von Drohnenwabe und Mittelwänden<br />
Volk mit junger Königin aus dem Vorjahr<br />
Sehr gutes Flugwetter mit starker Blütentracht<br />
Spätes Erweitern des Volkes<br />
Schwarmfördernd<br />
Schwarmhemmend<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
42
3. Erklären Sie, was hier geschehen ist.<br />
Die zuvor geschlüpfte Königin hat die Weiselzelle der jüngeren<br />
Schwesterkönigin seitlich aufgebissen und sie dadurch getötet.<br />
4. Nennen Sie die vier Massnahmen der Schwarmhemmung, die Sie auf Ihrem Bienenstand<br />
praktisch anwenden können.<br />
– Völker im Frühjahr rechtzeitig erweitern<br />
– Drohnenwaben und Mittelwände bauen lassen<br />
– Regelmässiger Ersatz der Königinnen<br />
– Kunstschwarmbildung/Ablegerbildung<br />
Der Schwarmtrieb vererbt sich, Schwarmköniginnen mit Zuchtköniginnen ersetzen.<br />
5. Um welchen Typ von Königinnenzellen handelt es sich bei folgenden Abbildungen?<br />
Name Schwarmzellen Nachschaffungszellen<br />
Grund Schwarmtrieb Königinnenverlust<br />
Ort<br />
Meist unten, aber auch mitten im<br />
Brutnest<br />
Aus Arbeiterinnenei im Brutnest<br />
Königin Schwarmkönigin Nachschaffungskönigin<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
43
3.12 Schwarm<br />
Lernziele<br />
– Sie sind in der Lage, Schwärme an unterschiedlichen Orten einzufangen oder abzuschätzen, ob das<br />
Einfangen ein zu hohes Unfallrisiko birgt.<br />
– Sie können Schwärme korrekt einlogieren und pflegen.<br />
– Sie sind in der Lage, das abgeschwärmte Volk richtig zu pflegen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Demonstriert den Kursteilnehmenden verschiedene Geräte zum Einfangen von<br />
Schwärmen. Zeigt den Ablauf des Einfangens eines Schwarmes, wenn möglich praktisch, sonst<br />
theoretisch. Er macht auf die Unfallgefahren beim Einfangen eines Schwarmes aufmerksam. Zeigt<br />
das praktische Einlogieren eines (Kunst-)Schwarmes und erläutert oder demonstriert die Pflegemassnahmen<br />
beim Schwarm und beim abgeschwärmten Volk.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 77 – 82 und Band 2, Seiten 70 – 72.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. An einem schönen Tag Ende Mai fliegt ein Schwarm aus und setzt sich an einem Ast unten am<br />
Apfelbaum fest. Welche Geräte benötigen Sie zum Einfangen des Schwarmes?<br />
Schwarmkiste, Wasserspritze, Bürste oder Feder, Imkerschleier und Handschuhe, Rauch,<br />
evtl. feuchtes Tuch, Leiter<br />
2. Erstellen Sie eine Skizze, wie der Kasten zum Einlogieren eines 1,7 kg schweren Schwarmes<br />
vorbereitet werden muss (Beutensystem des eigenen Standes).<br />
Mit den Teilnehmern beschriften, je nach Beutesystem anpassen!<br />
3. Der Schwarm ist einlogiert, welche weiteren Pflegemassnahmen sind bei diesem neuen Volk<br />
durchzuführen (mit Zeitangabe ab Einlogieren)?<br />
Zeitpunkt<br />
Am 1. Abend nach<br />
dem Einlogieren<br />
nach 3–5 Tagen<br />
nach 12 – 14 Tagen<br />
Arbeiten<br />
3 – 8 Liter Zuckerwasser füttern<br />
Kontrolle von<br />
– Weiselrichtigkeit<br />
– Wenn nach 3–5 Tagen bereits Eilage, dann Vorschwarm,<br />
wenn nach 12–14 Tagen, dann Nachschwarm<br />
– Wenn Königin in Eilage, Bienen mit Milchsäure und/oder Oxalsäure<br />
besprühen zur Bekämpfung der Varroamilbe<br />
– Futtervorrat kontrollieren<br />
– Wabenzahl der Volksstärke anpassen<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
44
4. Sie haben auf Ihrem Stand gleichzeitig zwei Schwärme erhalten. Bei der ersten Kontrolle stellen<br />
Sie fest, dass beide Schwärme Brut haben. Beim einen ist die älteste bereits verdeckelt, beim andern<br />
hat es viele Eier und wenige sehr junge Mädlein. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?<br />
Der Schwarm mit der verdeckelten Brut ist ein Vorschwarm mit einer alten Königin, im Schwarm mit der<br />
jungen Brut (Nachschwarm) hat die Königin vor kurzem mit der Legetätigkeit begonnen.<br />
5. Welche Pflegemassnahmen sind bei einem abgeschwärmten Volk durchzuführen (mit Zeitangabe<br />
ab Abschwärmen)?<br />
Zeitpunkt<br />
Arbeiten<br />
1. – 5. Tag 2–3 schöne Zellen auf der gleichen Wabe stehen lassen, alle andern ausbrechen.<br />
Vielleicht einengen<br />
14. – 20. Tag Kontrolle ob Jungkönigin in Eilage<br />
Empfehlung: Restvolk auf Mittelwände setzen, auffüttern, alle Waben einschmelzen.<br />
6. Bei einer Kontrolle (Schwarm, der vor zwei Wochen einlogiert wurde oder Volk, das vor 18 Tagen<br />
schwärmte) verhält sich das Volk sehr ruhig. Sie finden jedoch weder eine Königin noch Brut.<br />
Was ist zu tun?<br />
– Wabenstück mit Eiern oder ganz jungen Larven einhängen<br />
– Kontrolle nach 3 – 4 Tagen, ob Weiselzellen nachgezogen werden<br />
– Wenn Weiselzellen nachgezogen werden, lassen wir diese ausschlüpfen<br />
– Besser: Zellen ausbrechen, Zuchtkönigin einsetzen<br />
7. Sie haben beim besten Volk den richtigen Zeitpunkt zum Erweitern verpasst. Die Weiselzellen<br />
stehen kurz vor dem Verdeckeln. Welche Eingriffe sind notwendig, damit das Volk nicht<br />
schwärmt?<br />
Es hängt davon ab, ob Sie einen zweiten Standort haben, wo Sie die Bienen aufstellen können<br />
(Jungvolkstand).<br />
Wenn JA:<br />
Alte Königin heraussuchen, Brutwaben und Bienen aufteilen und einen oder mehrere Brutableger erstellen.<br />
Pro Brutableger eine Weiselzelle stehen lassen und auf den Jungvolkstand transportieren.<br />
Beim Restvolk mit der alten Königin alle Weiselzellen ausbrechen und wieder zurückhängen.<br />
Wenn NEIN:<br />
Ableger mit Königin und 3 Waben mit verdeckelter Brut (ohne Weiselzellen) und einer Futterwabe in eine<br />
neue Beute umhängen. Nach drei Tagen leicht füttern und mit einer Mittelwand erweitern.<br />
Beim Restvolk ziehen die Bienen nochmals neue Weiselzellen nach. Darum: 6 - 7 Tage warten. Dann zwei<br />
Weiselzellen stehen lassen. Alle andern entfernen. Nach frühestens 14 Tagen Kontrolle auf Eilage.<br />
8. Bei einem starken Volk finden Sie verdeckelte Weiselzellen. Welche Massnahmen ergreifen Sie?<br />
Wenn Sie einen Ablegerstand haben, siehe Antwort bei Frage 7.<br />
Wenn Sie keinen Ablegerstand haben, stellen Sie die Schwarmkiste bereit und freuen Sie sich, wenn Sie den<br />
Schwarm ausziehen sehen. Fangen Sie ihn ein.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
45
3.13 Jungvolkbildung und Königinnen zusetzen<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die Vorteile von Jung- und Zuchtköniginnen.<br />
– Sie können Königinnen fachgerecht zeichnen.<br />
– Sie können Königinnen auf zwei verschiedene Arten zusetzen (Kunstschwarm, Standvolk).<br />
– Sie können eine Königin in einem Begattungskästchen verwerten.<br />
– Sie können zwei Methoden der Jungvolkbildung beschreiben und auf dem eigenen Stand fachgerecht<br />
praktisch ausführen (Kunstschwarm, Ableger mit Königin).<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Hält Kurzvortrag zu den Vorteilen von Jung- und Zuchtköniginnen. Demonstriert eine Methode<br />
zum Zeichnen von Königinnen. Zeigt, wie eine Jungkönigin im Kunstschwarm verwertet werden<br />
kann und demonstriert, wie man eine Königin zusetzen kann. Wendet mit den Kursteilnehmenden<br />
eine weitere Methode der Jungvolkbildung praktisch an (Ableger mit Königin). Zeigt die Verwertung<br />
einer Jungkönigin im Begattungskästchen.<br />
PowerPoint Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 71 – 77 und Band 3, Seiten 53 – 61.<br />
Wählen Sie eine Technik zur Jungvolkbildung aus und wenden Sie diese an.<br />
Methodischer Hinweis<br />
Zeichnen Sie zuerst Drohnen, bis Sie die Technik sicher anwenden können.<br />
Jungimker sollten so instruiert werden, dass sie möglichst ohne Ablegerstand auskommen.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie beeinflussen die folgenden Faktoren die<br />
Chance, eine Jungkönigin erfolgreich einem Volk<br />
zuzusetzen?<br />
Zeitpunkt Mai/Juni<br />
Zeitpunkt Juli/August<br />
Zeitpunkt September<br />
Zusetzen in grosses Volk mit einer zweijährigen<br />
Königin in voller Legetätigkeit<br />
Volk, das schon länger weisellos ist und deshalb<br />
viele ältere Bienen hat<br />
Jungkönigin, die eben erst mit dem Legen von<br />
Eiern begonnen hat<br />
Flugfront, die der Sonneneinstrahlung lang und<br />
stark ausgesetzt ist<br />
Volk mit einem guten Futtervorrat<br />
Gutes Flugwetter mit Waldtracht<br />
Durch Fütterung gereiztes Klima, wegen Bienen,<br />
die versuchen, in fremden Völkern Futter zu holen<br />
Chancen<br />
besser<br />
Auflösen,<br />
evtl. abschwefeln<br />
Chancen<br />
schlechter<br />
Auflösen,<br />
evtl. abschwefeln<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
46
2. Nennen Sie fünf Vorteile der Jungvolkbildung.<br />
– Ersatz von Winterverlusten<br />
– Jungvölker ergeben leistungsstarke Völker im Folgejahr<br />
– Selektion bei den Völkern im Frühjahr möglich<br />
– Bei Brutablegerbildung Reduktion der Varroamilben<br />
– Reduktion des Schwarmtriebs<br />
3. Beschreiben Sie in Stichworten die Bildung eines Kunstschwarmes.<br />
Königin im Zusetzer käfigen (fester Verschluss)<br />
Käfig in Schwarmkiste hängen, 1 – 2 kg Bienen dazuwischen<br />
Schwarm füttern<br />
3 Tage in dunklen, kühlen Keller stellen<br />
Oxalsäure-Behandlung<br />
Beim Einlogieren Königin freilassen<br />
4. Beschreiben Sie in Stichworten die Zusetzmethode in einem Standvolk.<br />
Alte Königin suchen, auf dieser Wabe im Zusetzer einsperren<br />
Nach zwei Tagen alte Königin entfernen und neue Königin in Zusetzer mit Futterteigverschluss am gleichen<br />
Ort zusetzen<br />
Etwa eine Woche später Kontrolle auf Eilage<br />
5. Sie erhalten eine Jungkönigin im Begattungskästchen. Wie können Sie diese einem Standvolk<br />
zusetzen?<br />
Alte Königin suchen und entfernen, Volk zurückhängen<br />
Über dem Brutnest bleibt eine Spalte in den Deckbrettchen offen. Die Spalte mit einem Zeitungspapier<br />
abdecken<br />
Mit einem spitzen Gegenstand einige kleine Löcher in die Zeitung machen<br />
Beim Begattungskästchen Boden entfernen und auf die Zeitung stellen<br />
6. Wie bilden Sie einen Ableger mit Königin?<br />
Drei gut besetzte Brutwaben (viel verdeckelte Brut, wenig Eier und ganz junge Mädlein) zwischen zwei<br />
Futterwaben hängen und zusätzlich die Bienen einer Wabe in den Jungvolkkasten geben.<br />
Wenn man einem Ableger die Königin mitgibt, erübrigt sich der Ablegerstand. Sperrgebiete bilden dann<br />
kein Problem mehr.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
47
3.14 Bienenrassen<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die Namen der bei uns häufigsten Bienenrassen: Mellifera, Carnica und Buckfast.<br />
– Sie können mit Hilfe des Bienenbuchs rassentypische Arbeitsbienen der drei oben genannten<br />
Rassen grob unterscheiden.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Zeigt rassentypische Merkmale der Völker auf dem Bienenstand.<br />
PowerPoint Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 3, Seiten 105 – 112.<br />
Bestimmen Sie, zu welcher Rasse Ihre eigenen Bienen gehören.<br />
Lösung Lernkontrolle:<br />
1. Füllen Sie die Tabelle zu den Bienenrassen aus.<br />
Merkmal<br />
Rasse<br />
Mellifera<br />
(schwarze Biene)<br />
Carnica<br />
(graue Biene)<br />
Ligustica<br />
(gelbe Biene)<br />
Buckfast<br />
Sanftmut*<br />
Brutintensität Mittel Gross Gross Gross<br />
Futterbedarf Mittel Gross Gross Gross<br />
Winterhärte Gut Mittel Schlecht Mittel<br />
*Sanftmut: Diese ist nicht rassenabhängig, sondern vom Grad der züchterischen Bearbeitung der<br />
Bienen abhängig. Es gibt bei jeder Rasse sehr sanftmütige Linien, aber auch «wilde Stecher».<br />
Mellifera<br />
Carnica<br />
Ligustica<br />
Buckfast<br />
Anmerkung: Allgemein verbindliche Aussagen zu den Bienenrassen zu machen, ist fast nicht<br />
möglich, da sehr viele Eigenschaften züchterisch bearbeitet werden können. Die oben genannten<br />
Lösungen stellen lediglich eine Tendenz dar.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
48
4.1 Honig<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die beiden Rohstoffquellen für Honig, die Entstehung des Honigs und seine richtige<br />
Lagerung ohne Qualitätseinbusse.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Der Kursleiter zeigt zur Zeit des Kurses, wie der Honig unter sauberen und hygienisch<br />
einwandfreien Bedingungen gewonnen und verarbeitet wird. Er demonstriert, wie der Reifetest<br />
(Stossprobe) des Honigs in offenen Zellen gemacht wird. Im Weiteren zeigt er auch, wie die Honigwaben<br />
mit Gabel oder Messer richtig entdeckelt und in die Schleuder eingefüllt werden, die Bedienung<br />
der Schleuder, richtiges Sieben und Abschäumen des Honigs.<br />
PowerPoint Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 83 – 89 und Band 4, Seiten 11 – 21.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Nennen Sie Sortenhonige.<br />
Löwenzahn, Kirsche, Obst, Ahorn, Raps, Akazie, Linde und Alpenrose.<br />
2. Was ist Nektar?<br />
Aus den Nektardrüsen der Blütenpflanzen ausgeschiedene Zuckerlösung. Hauptzucker sind Saccharose<br />
(«Rübenzucker»), Fructose (Fruchtzucker) und Glucose (Traubenzucker).<br />
3. Was ist Honigtau?<br />
5 – 20 %ige Zuckerlösung. Der Hauptzucker des Honigtaus ist Saccharose («Rübenzucker»).<br />
4. Was ist Waldhonig?<br />
Siebröhrensaft, den die Tannenhoniglaus saugt, aber nicht verwerten kann und deshalb als Honigtau<br />
ausscheidet. Den Honigtau verarbeiten die Bienen zum beliebten Waldhonig.<br />
5. Was ist Zementhonig?<br />
Melizitosereicher Honigtau (Melizitose entsteht aus Saccarose und Glucose), den die schwarze Fichtenrindenlaus<br />
ausscheidet. Er ist aus den Honigwaben schwer oder nicht schleuderbar. Er kann später zur<br />
Fütterung verwendet werden.<br />
6. Wie erklären Sie diese Phasenbildung?<br />
– Der Honig ist unreif geerntet worden. In der oberen Schicht kann es gären.<br />
– Der Honig ist beim Verflüssigen zu stark erhitzt worden.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
49
4.2 Bienenwachs<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Entstehung von Bienenwachs, Bienenwachs als Zutat in Farben, Polituren und<br />
Kosmetik sowie als Überzugsmittel von Nahrungsmitteln und Tabletten.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Der Kursleiter zeigt die Wachsproduktion und die Bautätigkeit im Bienenvolk. Er demonstriert,<br />
wie das Bienenwachs aus den alten Waben im Sonnenwachs- und Dampfwachsschmelzer gewonnen<br />
werden kann und produziert wenn möglich selbst Mittelwände.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 45 – 58 und Band 5, Seiten 74 – 92.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wann sind die Wachsdrüsen der Arbeiterinnen voll entwickelt?<br />
Vom 12. bis zum 18. Tag<br />
2. Wann wird im Bienenvolk am meisten Wachs erzeugt?<br />
Während der Wachstumsphase des Volkes in den Monaten April bis Juni<br />
3. Welches sind die hauptsächlichen Rohstoffe für die Wachsbildung im Bienenkörper?<br />
Kohlenhydrate, also Honig oder Zuckerwasser (Fructose, Glucose und Saccharose) und Pollen<br />
4. Was bestimmt die Wachsproduktion und die Bautätigkeit im Bienenvolk?<br />
Nektareintrag, Brutgeschehen, Vorhandensein der Königin (weisellose Völker bauen nicht),<br />
Tagestemperatur von 15° C und mehr<br />
5. Was muss bei der Wachsgewinnung beachtet werden?<br />
Damit die Bienen die Mittelwände annehmen und zu neuen Waben ausbauen, darf bei der<br />
Wachsgewinnung die Qualität des Wachses nicht beeinträchtigt werden.<br />
6. Nennen Sie mindestens zwei Beispiele, welche die Qualität des Wachses beeinträchtigen<br />
können.<br />
– Eine zu grosse und zu lange Erhitzung kann das Wachs sensorisch wie auch chemisch schädigen.<br />
– Wachs soll nicht in Gefässen aus Eisen, Aluminium, Zink oder Kupfer erhitzt werden.<br />
– Wachs darf nicht mit gärendem Honig in Kontakt kommen, sonst verändert sich sein Geruch.<br />
7. Wie wird Bienenwachs richtig gelagert?<br />
Die Wachsblöcke werden trocken, dunkel und kühl gelagert. Am besten verpackt man sie in Packpapier<br />
und legt sie auf Holzregale oder in Gefässe aus Edelstahl, Glas oder Kunststoff.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
50
4.3 Blütenpollen<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Entstehung und die Verarbeitung des Blütenpollens.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Der Kursleiter zeigt Brutwaben mit «Bienenbrot» und andere eingelagerte Pollen und –<br />
wenn möglich – das Abfangen der Pollenhöschen mit Pollenfallen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 95 – 100.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Was ist nebst Nektar und Honigtau die Hauptnahrung für das Bienenvolk?<br />
Pollen ist die Eiweissnahrung des Bienenvolkes.<br />
2. Wie viel Pollen sammelt ein Bienenvolk pro Jahr?<br />
30 – 60 kg<br />
3. Was ist «Bienenbrot»?<br />
Die Biene streift ihre Pollenhöschen in die Zelle ab. Die Stockbienen vermischen den Pollen mit Drüsensekreten<br />
und Honig, stampfen dieses Gemisch in den Zellen fest. Die mit Pollen angefüllte Zelle wird mit<br />
Honig abgeschlossen. Der Pollen durchläuft einen Gärungsprozess und wird nun «Bienenbrot» genannt.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
51
4.4 Propolis<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Entstehung und Verwendung von Propolis.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Zeigt zur Zeit des Kurses, wie Propolis mit verschiedenen Methoden geerntet werden kann.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 59 – 66.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Woraus gewinnen die Bienen das Propolis?<br />
Aus dem Harz von Knospen, Blättern und Rinde<br />
2. Wofür benützen die Bienen Propolis im Bienenstock?<br />
Um Ritzen abzudichten und um die Innenwände ihrer Beute und Waben zu desinfizieren<br />
3. Wie viel Propolis sammelt ein Bienenvolk pro Jahr?<br />
50 –150 g<br />
4. Wovon hängt die Qualität von Propolis ab?<br />
Die Qualität von Propolis hängt einerseits davon ab, wie sorgfältig Propolis von Rähmchen, Leisten,<br />
Sammelgittern und Innenwänden der Bienenkästen gelöst wird. Andrerseits bestimmen die <strong>Inhalt</strong>sstoffe<br />
die Wirksamkeit und somit dessen Qualität.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
52
4.5 Gelée Royale<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Entstehung von Gelée Royale.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Der Kursleiter zeigt zur Zeit des Kurses verschiedene offene Stadien von Arbeiterinnen- und<br />
Drohnenzellen, wenn möglich auch von Königinnenzellen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 67 – 71.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wo wird Gelée Royale im Bienenvolk eingelagert?<br />
In der Weiselzelle<br />
2. Wie wird Gelée Royale auch noch bezeichnet?<br />
Königinnenfuttersaft<br />
3. Wozu wird Gelée Royale im Bienenvolk verwendet?<br />
Für die Ernährung der Larven. Die Drohnen- und Arbeiterinnenlarven werden während drei Tagen mit<br />
Futtersaft versorgt, danach mit Honig und Pollen.<br />
Königinnen, Arbeiterinnen und Drohnen erhalten den gleichen Futtersaft, doch die Königin 10–12 x mehr.<br />
Dies bewirkt die Königinnenentwicklung.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
53
4.6 Bienengift<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Entstehung von Bienengift. Auch allergische Reaktionen auf Bienengift sind Ihnen<br />
bekannt.<br />
Stoff<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 72 – 76.<br />
Website: www.swisshoney.ch<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Was ist die auffallendste biologische Wirkung des Bienengifts für den Menschen?<br />
– Die schmerzhafte lokale Entzündung<br />
– Die allfällige Auslösung einer allergischen Reaktion<br />
2. Was sind die Unterschiede zwischen einem Bienenstich und einem Wespenstich?<br />
Der Bienenstachel hat Widerhaken und bleibt in der Haut stecken.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
54
5.1 Gesundheits-Diagnose auf den ersten Blick<br />
Lernziel<br />
– Sie sehen auf den ersten Blick, wenn das Hygieneverhalten der Bienen gestört ist und nutzen dieses<br />
Alarmsignal, um dem Problem auf den Grund zu gehen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Beurteilt zusammen mit den Kursteilnehmenden die ersten Eindrücke vor dem Betreten des<br />
Bienenhauses (Bienenflug und Fluglochkontrolle), beim Öffnen des Kastens (Verhalten der Bienen auf<br />
der hintersten Wabe, Wabenbau am Fenster) sowie beim Entfernen des Keils (sauberer Boden).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 102 – 106.<br />
Hinweis:<br />
Nähern Sie sich immer in gleicher Weise Ihrem Bienenhaus. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für<br />
die Fluglochbeobachtung. Vor dem Öffnen des Kastens im Bienenhaus beobachten Sie immer kurz die<br />
hintersten Bienen (Unruhe, Ruhe, Schwänzeltanz usw.). Beim Entfernen des Keils Kontrolle des Kastenbodens.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Bei einem Volk finden Sie im Vorfrühling Kotspuren auf dem Flugbrett und in der Flugnische.<br />
Was ziehen Sie für Schlüsse daraus?<br />
Das Volk leidet unter Ruhr. Das Volk so rasch als möglich kontrollieren, verkotete Waben entfernen und<br />
einschmelzen. Flugloch mit Sodalösung reinigen. Schwache Völker vernichten und Wabenmaterial einschmelzen<br />
oder vernichten.<br />
2. Beim Betreten des Bienenhauses im Frühling liegt ein feiner süsslicher Geruch in der Luft.<br />
Was bedeutet das?<br />
Es blüht und die Bienen bringen Pollen und Nektar.<br />
3. Anfang Mai geht es bei einem Flugloch sehr hektisch zu und her.<br />
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?<br />
Es könnte sich um Räuberei handeln oder das Volk schwärmt.<br />
4. Im Juni finden Sie auf dem Flugbrett Drohnenpuppen und am Fenster viele Drohnen.<br />
Was geht da vor?<br />
Die «Drohnenschlacht» hat begonnen, d.h. die Bienen finden zu wenig Futter, um auch die Drohnen zu<br />
pflegen. Achtung! Finden unsere Bienen zu wenig Nahrung und müssen sie hungern? Sofort Massnahmen<br />
einleiten!<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
55
5. Beim Öffnen des Kastens kommt Ihnen ein säuerlicher Geruch entgegen. Ihnen ist bereits beim<br />
Beobachten des Fluglochs aufgefallen, dass der Flug im Gegensatz zu den andern Völkern<br />
spärlich ist. Was könnte im Volk vorgehen?<br />
Ein Alarmzeichen. Wenn auch noch die Brut sehr ungleich ist (Schrotschuss) und im Brutnest abgestorbene<br />
Zellen sind, sofort den Bieneninspektor anrufen. Das Volk könnte unter Sauerbrut oder starkem<br />
Varroabefall leiden.<br />
6. Die Bienen haben das Fenster total verbaut. Was geht im Volk vor und welche Massnahmen<br />
leiten Sie ein?<br />
Das ist normal und ein sehr gutes Zeichen. Das Volk ist vital und nutzt jeden kleinsten Raum.<br />
Mit Mittelwänden oder Aufsatz mehr Platz geben.<br />
7. Beim Entfernen des Keils entdecken Sie kleine, weissgraue Maden, die sofort ins Kasteninnere<br />
fliehen. Um welche Mitbewohner handelt es sich? Was sagt Ihnen dieses Bild?<br />
Es handelt sich hier um Wachsmotten, ihre Kotspuren und das Gespinnst.<br />
8. Beim Entfernen des Keils stürzen sich mehrere Bienen auf Sie und verhalten sich sehr aggressiv.<br />
Welche Schlüsse können Sie daraus ziehen?<br />
– Das Volk könnte weisellos sein, vielleicht hat es Hunger oder es handelt sich um ein aggressives Volk.<br />
– Der Imker hat den Keil ruckartig gezogen oder gegen den Kasten gestossen.<br />
– Er hat es unterlassen, beim Öffnen des Keils einen Rauchstoss zu geben.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
56
5.2 Varroatose<br />
5.2.1 Varroa-Milbe<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Grundzüge der Biologie und den Vermehrungszyklus der Milbe Varroa destructor.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Zählt zusammen mit den Kursteilnehmenden auf gittergeschützten Unterlagen den<br />
Totenfall der vergangenen Tage aus. Mit der Lupe werden Männchen und Weibchen gesucht. In ausgeschnittener<br />
Drohnenbrut werden Milben gesucht und die Drohnenbrut mit einer Lupe auf Verletzungen<br />
untersucht. Erklärt den Kursteilnehmenden ausführlich den Vermehrungszyklus der Milbe. Sucht<br />
auf dem Flugbrett und am Boden nach Bienen, die durch die Varroa geschädigt wurden.<br />
PowerPoint Präsentationen (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 107 – 110. Führen Sie an Ihren Bienen die gleichen<br />
Untersuchungen, analog dem Kurs, durch. Zählen Sie den Totenfall in einem Volk auf der gittergeschützten<br />
Unterlage im Abstand von einigen Wochen und notieren Sie das Resultat.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Erklären Sie in kurzen Zügen den Vermehrungszyklus der Varroa-Milbe.<br />
Kurz vor dem Verdeckeln dringen Milbenweibchen in Drohnen- und Arbeiterinnenbrut ein und legen<br />
2 – 6 Eier. Aus den Eiern entwickeln sich Varroa-Nymphen. Während der Entwicklung saugen sie Blut von<br />
der Bienenlarve. Das erstgeschlüpfte Männchen begattet seine jüngeren Schwestern und stirbt. Mit der<br />
schlüpfenden Biene verlassen die begatteten Tochtermilben und die Muttermilbe die Brutzelle und steigen<br />
bis zur nächsten Eiablage auf adulte Bienen auf.<br />
2. Beschreiben Sie das Schadensbild in einem mit Varroa-Milben befallenen Volk.<br />
Das Bienenvolk wird schwach und pflegt die Brut nicht mehr. Die Brut wird nicht mehr verdeckelt und<br />
stirbt, die Brut ist daher lückenhaft. Auf den Flugbrettern oder im Volk entdecken wir junge Bienen ohne<br />
Flügel sowie Bienen mit verkürztem Hinterleib. Das Schadensbild ähnelt teilweise dem der Sauerbrut.<br />
3. Wie stellen Sie fest, dass Sie tatsächlich ein Varroaproblem haben und nicht eine andere<br />
Brutkrankheit?<br />
Ich messe den natürlichen Milbenfall mit einer gittergeschützten Unterlage.<br />
Ich suche nach Bienen mit verkürztem Hinterleib oder Krüppelflügeln.<br />
4. Warum wird empfohlen, im Frühling die Drohnenbrut auszuschneiden?<br />
Da Drohnen erst am 24. Tag schlüpfen (Arbeiterinnen am 21. Tag), werden Drohnen für die Eiablage von<br />
der Varroa-Milbe bevorzugt. In der Drohnenbrut entwickeln sich mehr Varroa-Milben.<br />
5. Erklären Sie die Brutentwicklung von Biene und Varroa im Jahreslauf und die daraus folgenden<br />
Probleme.<br />
Im Frühjahr kommen wenig Varroa-Milben auf viel Bienenbrut. Jetzt ist der Schaden gering. Im Spätsommer<br />
kommen viele Varroa-Milben auf wenig Bienenbrut. Nun sind viele der schlüpfenden Bienen befallen.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
57
5.2.2 Varroa-Diagnose<br />
Lernziel<br />
– Sie sind in der Lage, den Varroabefall abzuschätzen, Schäden zu erkennen und rechtzeitig vom ZBF<br />
empfohlene Methoden und Mittel wirksam einzusetzen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt den Kursteilnehmenden ausführlich die verschiedenen Schadensschwellen im Laufe<br />
eines Bienenjahres. Zeigt die diversen Behandlungsmöglichkeiten im Bienenjahr mit den Vor- und<br />
Nachteilen auf. Klärt die Kursteilnehmenden über die Gefährlichkeit der Varroamittel auf und vermittelt<br />
die Erste-Hilfe-Massnahmen bei einem Unfall.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seite 107 – 110. Kontrollieren Sie mit einer geschützten<br />
Unterlage in einem Volk den Milbenfall Ende Mai, Ende Juli und anfangs September.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Warum zählen wir den Totenfall der Varroa-Milbe aus?<br />
Anhand des Totenfalls, der Anzahl Milben, die aus dem Volk auf die geschützte Unterlage fallen, entscheiden<br />
wir uns zu den entsprechenden Bekämpfungsmassnahmen.<br />
2. Was unternehmen Sie, wenn Ende Juli der Totenfall der Milben pro Tag 25 beträgt?<br />
Ich handle sofort:<br />
– Abräumen<br />
– Kurze Futtergabe<br />
– Nach wenigen Tagen erste Varroa-Behandlung<br />
3. Was ist die Ursache dieser verkrüppelten Bienen?<br />
Die Entwicklung im Puppenstadium wurde durch Varroa-Milben massiv gestört.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
58
5.2.3 Varroa-Bekämpfung<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen den Zeitpunkt und die Methoden für die Varroabekämpfung, so dass die Varroa unter<br />
der Schadensschwelle gehalten werden kann.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt den Kursteilnehmenden die vom ZBF empfohlene Bekämpfungsstrategie. Nur<br />
bei Anwendung des gesamten Konzepts kann die Behandlung erfolgreich sein. Führt die Methoden<br />
praktisch im Volk vor und weist auf die Gefährlichkeit der Säuren hin. Milchsäure nicht vergessen.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 134 – 138. Entscheiden Sie sich für eine Methode<br />
und begründen Sie Ihren Entschluss. In der Begründung zeigen Sie Vor- und Nachteile auf.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Zeigen Sie das vom ZBF empfohlene Varroabekämpfungs-Konzept auf.<br />
Organische Säuren und ätherische Öle bilden die Eckpfeiler der Behandlung. Durch das ständige Überwachen<br />
des natürlichen Milbenfalls können die nötigen Massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden.<br />
2. Zählen Sie drei Säuren auf, die für eine erfolgreiche Varroabekämpfung eingesetzt werden.<br />
Ameisensäure, Oxalsäure, Milchsäure<br />
3. Welche Vorteile haben die Säuren gegenüber Thymol?<br />
Die Säuren sind relativ günstig und es gibt keine Rückstände.<br />
4. Wie gehen Sie vor, wenn Ihnen Ameisensäure auf die Hosen tropft?<br />
Hose sofort ausziehen und Spritzer mit Wasser auswaschen. Ist die Haut bereits mit Ameisensäure in<br />
Berührung gekommen, sofort die Stelle mit viel Wasser abwaschen. Ameisensäure ist stark ätzend und<br />
wird bei Hautkontakt nicht sofort als Schmerz empfunden. Wenn es auf der Haut brennt, mit viel Wasser<br />
spülen. Nie abwarten, immer mit bereitstehendem Wasser stark verdünnen.<br />
Achtung: Verätzungen sind Verbrennungen zweiten Grades und bergen eine grosse Infektionsgefahr.<br />
5. Welche Schutzvorrichtungen sehen Sie vor, wenn Sie mit Ameisensäure arbeiten?<br />
Handschuhe, Schutzbrille und Ganzkörperkleidung sind ein Muss. Wasser unbedingt in Griffnähe halten.<br />
6. Welche Behandlungsmöglichkeit haben wir von November – Januar?<br />
Das Sprühen, Verdampfen oder Träufeln von Oxalsäure<br />
7. Wann setzen wir Milchsäure ein?<br />
Milchsäure kann während der Vegetationsperiode jederzeit eingesetzt werden. Milchsäure wirkt nur<br />
gegen die Milben auf den Bienen und dringt nicht in die Brut ein.<br />
8. Welche Applikatoren für Ameisensäure eignen sich?<br />
Liebig-Dispenser, FAM-Dispenser, Apidea, Wyna<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
59
5.3 Weitere Bienenkrankheiten<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die häufigsten Bienenkrankheiten, deren Bekämpfungsmassnahmen und wissen, wie<br />
man einer Ansteckung vorbeugen kann (Tracheenmilbe, Nosematose, Ruhr).<br />
5.3.1 Tracheenmilbe<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Sucht im Frühling, Februar – April bei den Reinigungsausflügen auf dem Flugbrett oder auf<br />
dem Boden nach Krabbelbienen oder Bienen mit abnormal gespreizten Flügeln.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 110 – 112.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wann finden wir von Tracheenmilben befallene Bienen vermehrt vor dem Bienenhaus?<br />
Februar bis April<br />
2. Welche Anzeichen weisen auf die Tracheenmilbe hin?<br />
Krabbelbienen, Bienen mit abnormal gespreizten Flügeln<br />
3. Wie wird die Tracheenmilbe übertragen?<br />
Die Ausbreitung erfolgt durch Räuberei, durch das Verstellen von Völkern. Im Stock bei gegenseitiger<br />
Berührung.<br />
4. Warum tritt die Tracheenmilbe im Sommer nicht auf?<br />
Die Lebensphase einer Tracheenmilbe ist fast gleich lang wie die der Biene. Dadurch entwickeln sich nicht<br />
viele Tracheenmilben zu erwachsenen Milben.<br />
5. Sie vermuten Tracheenmilben bei Ihren Völkern. Welches ist die erste Massnahme?<br />
Die Tracheenmilbe ist nicht anzeigepflichtig. Trotzdem frage ich den Berater oder den Bieneninspektor<br />
um Rat.<br />
6. Wie unterstützen Sie Ihre Bienen, damit der Tracheenmilbenbefall niedrig bleibt?<br />
Sonniger Standort, damit die Bienen im Winter den Reinigungsflug durchführen können. Dabei sterben<br />
befallene Bienen. Standorte mit guten Trachtverhältnissen fördern. Varroabekämpfung mit Ameisensäure<br />
wirken auch gegen die Tracheenmilbe.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
60
5.3.2 Nosematose<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Findet beim Volk braune oder beige Kotflecken auf dem Flugbrett, auf den Waben und in<br />
den Beuten. Sucht nach flugunfähigen Bienen mit aufgedunsenem Hinterleib.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seite 139 und Band 2, Seiten 121 – 123.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wann kommt die Nosematose am häufigsten vor?<br />
Von März bis April<br />
2. Wer ist der Erreger von Nosematose?<br />
Protozoen, ein tierischer Einzeller (Darmparasit)<br />
3. Was können Sie als Bienenhalter tun, um Nosematose vorzubeugen?<br />
Mit Kot verschmutzte Waben einschmelzen. Wabenbau fördern. Verschmutzte Flugbretter und andere<br />
Kastenteile mit Sodawasser abwaschen. Stresssituationen bei den Bienen vermeiden und schwache Völker<br />
abschwefeln.<br />
5.3.3 Ruhr<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt anhand eines Beispiels die Unterschiede zwischen Ruhr und Nosematose.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seite 140. Suchen Sie bei Ihren Bienen nach Spuren der<br />
Ruhr und ergreifen Sie wenn nötig Massnahmen.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wann kommt die Ruhr am häufigsten vor?<br />
Dezember bis März<br />
2. Was ist der Hauptgrund für die Ruhr?<br />
Schwache Völker. Ungeeignetes Winterfutter, z.B. Waldhonig, hoher Anteil an Mineralstoffen und Doppelzuckern.<br />
3. Welche weiteren Gründe gibt es für die Ruhr?<br />
Störung der Winterruhe, Weisellosigkeit, langanhaltendes, kaltes Frühlingswetter<br />
4. Was können wir gegen das Auftreten der Ruhr unternehmen?<br />
Bei Waldtrachten volle Waben gegen leere eintauschen und anschliessend gut füttern. Störungen im<br />
Winter vermeiden.<br />
5. Gibt es auf den ersten Blick Unterschiede zwischen der Ruhr und der Nosematose?<br />
Die Nosematose tritt erst vom März bis Mai auf. Bienen mit Nosematose haben einen aufgedunsenen<br />
Hinterleib.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
61
5.4 Brutkrankheiten<br />
Lernziele<br />
– Sauerbrut, Amerikanische Faulbrut, Kalkbrut und Sackbrut sind Ihnen ein Begriff.<br />
– Sie kennen die Entstehung der Brutkrankheiten und die Schadensbilder.<br />
– Sie wissen über die Gefährlichkeit der Sauerbrut und der Amerikanischen Faulbrut Bescheid und<br />
können beim Auftreten dieser Brutkrankheiten richtig reagieren.<br />
5.4.1 Anzeigepflichtige Krankheiten<br />
Sie wissen Bescheid über das Verhalten bei anzeigepflichtigen Krankheiten.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt den Kursteilnehmenden anhand von Bildern und PowerPoint Präsentation die heimtückischen<br />
Brutkrankheiten.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 130 – 131 und Band 2, Seiten 115 – 120. Lernen Sie<br />
die An zeichen der Brutkrankheiten auswendig. Nehmen Sie an der nächsten Standbegehung Ihrer<br />
Sektion teil, wenn das Thema Brutkrankheiten angekündigt ist.<br />
Website: Merkblatt zur Erkennung von Bienenbrutkrankheiten und Film «Achtung Sauerbrut! –<br />
Symptome frühzeitig erkennen» auf www.vdrb.ch – Rubrik Downloads – Bildung und Beratung<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wissen Sie, wer der Bieneninspektor für Ihre Region ist?<br />
Im Imkerkalender des <strong>VDRB</strong> oder auf Anfrage bei Ihrer Gemeindeverwaltung<br />
2. Welche Brutkrankheiten sind anzeigepflichtig und warum nur diese?<br />
Faul- und Sauerbrut sind anzeigepflichtig. Beide Krankheiten sind sehr ansteckend und werden leicht auf<br />
andere Stände übertragen. Sie sind für die Bienen meistens tödlich.<br />
3. Was heisst «anzeigepflichtig»?<br />
Anzeigepflichtig heisst: Gemäss Tierseuchengesetz muss ich den Fall dem Bieneninspektor melden, damit<br />
er die notwendigen Massnahmen ergreifen kann.<br />
4. Wie gehen Sie bei einer anzeigepflichtigen Krankheit vor?<br />
Massnahmen dürfen erst ergriffen werden, wenn der Inspektor seine Anweisungen gegeben hat.<br />
Diese werden sein: Völker vernichten, tote Bienen und Waben in Kehrichtverbrennung bringen, Kasten<br />
und Gerätschaften mit 6% heisser Sodalösung oder 3–5% heisser Natronlauge reinigen und den Kasten<br />
abflammen. Personenschutz beachten.<br />
Sofern von der Infrastruktur her möglich, Kasten und sämtliche Gerätschaften in Einbrennkabine auf<br />
120 ° C erhitzen.<br />
5. Nach einem Faulbrutfall in Ihrer Nähe befinden Sie sich im Sperrgebiet.<br />
Welche Folgen hat dies auf Ihre Imkerei?<br />
Ich muss jeden Bienenverkehr (Verstellen) unterlassen, bis die Sperre wieder aufgehoben wird.<br />
6. Wie gross ist normalerweise ein Sperrgebiet?<br />
In normalem Gelände (flach) zieht man mit dem Zirkel vom betroffenen Bienenhaus einen Kreis mit 2 km<br />
Radius. Der Durchmesser des Kreises misst also 4 km.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
62
5.4.2 Sauerbrut und Faulbrut<br />
– Sie wissen Bescheid über diese Krankheiten. Sie kennen die Entstehung, das Schadensbild und die<br />
Massnahmen, die dabei ergriffen werden müssen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt den Kursteilnehmenden anhand von Bildern und/oder PowerPoint Präsentation<br />
(online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch) die heimtückische Bienenkrankheit. Lädt den Bieneninspektor<br />
ein.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 130 – 131 und Band 2, Seiten 115 – 120. Lernen Sie<br />
die Anzeichen der Brutkrankheiten auswendig. Nehmen Sie an der nächsten Standbegehung Ihrer<br />
Sektion teil, wenn das Thema Brutkrankheiten angekündigt ist.<br />
Website: Merkblatt zur Erkennung von Bienenbrutkrankheiten und Film «Achtung Sauerbrut! –<br />
Symptome frühzeitig erkennen» auf www.vdrb.ch – Rubrik Downloads – Bildung und Beratung<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Sie kennen den Unterschied zwischen Faulbrut und Sauerbrut. Füllen Sie diese Tabelle aus.<br />
Name Sauerbrut/Europäische Faulbrut Faulbrut/Amerikanische Faulbrut<br />
Schadensbild<br />
offene Brut<br />
Schadensbild<br />
verdeckelte Brut<br />
Lückenhaft<br />
Maden abgestorben<br />
Gelb, verdreht<br />
Gliederung geht verloren<br />
Löchrige Zelldeckel<br />
Lückenhaft<br />
Maden abgestorben<br />
Bräunlich, schleimig<br />
Verlagerung des Brutnestes auf saubere<br />
Waben<br />
Eingefallene Brutdeckel, z.T. löchrig<br />
Streichholzprobe Zieht nur kurze Fäden Fadenziehende, faulige Masse<br />
Schorf Lässt sich leicht entfernen Dunkler Schorf, klebt an der Zelle<br />
Geruch Sauer Faulig<br />
Erreger Bakterium Melissococcus pluton Bakterium Paenibacillus larvae<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
63
5.4.3 Kalk- und Sackbrut<br />
– Sie wissen Bescheid über die Kalk- und Sackbrut. Sie kennen die Entstehung, das Schadensbild und<br />
die Massnahmen, die bei diesen Brutkrankheiten ergriffen werden müssen.<br />
– Sie wissen, dass auch Unterkühlung die Brut schädigen kann und erkennen die Anzeichen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Erklärt den Kursteilnehmenden anhand von Bildern die beiden Bienenkrankheiten.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 132 – 133 und Band 2, Seiten 113 – 115 und 123 – 125.<br />
Lernen Sie die Anzeichen der Brutkrankheiten auswendig. Nehmen Sie an der nächsten Standbegehung<br />
Ihrer Sektion teil, wenn das Thema Brutkrankheiten angekündigt ist.<br />
Website: Merkblatt zur Erkennung von Bienenbrutkrankheiten auf www.vdrb.ch – Rubrik Downloads –<br />
Bildung und Beratung<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. An welcher Krankheit leidet dieses Volk?<br />
Das Volk hat Kalkbrut.<br />
2. Welche Erreger finden wir bei Kalkbrut und Sackbrut?<br />
Kalkbrut: Pilzkrankheit<br />
Sackbrut: Viruserkrankung<br />
3. Im Frühling finden Sie auf dem Flugbrett bei zwei Völkern weisse, braune und schwarze Mumien.<br />
Ein Volk deckt knapp drei Waben, die anderen sechs Waben. Um welche Krankheit handelt es<br />
sich und wie gehen Sie vor?<br />
Es handelt sich um Kalkbrut (Pilzkrankheit). Das schwache Volk wird vernichtet. Dem stärkeren Volk<br />
entnehme ich die befallenen Brutwaben und schmelze sie ein. Königin unbedingt ersetzen. Anschliessend<br />
durch ausgebaute Jungwabe ersetzen und wenn nötig einengen. Für optimale Futterversorgung sorgen.<br />
Bienen eng und warm halten.<br />
4. Wie können Sie erfolgreich präventiv gegen die Kalkbrut vorgehen?<br />
Königin ersetzen und vermehrt auf Hygienemerkmale setzen. Bienen eng und warm halten.<br />
5. Wie unterstützen Sie präventiv Ihre Völker gegen die Sackbrut?<br />
Ich lasse die Mittelwände gut ausbauen. Bienen eng und warm halten.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
64
5.5 Wachsmotten<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen die Wachsmotte, das Schadensbild und die Vorsorge- und Bekämpfungsmöglichkeiten.<br />
– Die anderen Mitbewohner wie Speckkäfer, Silberfischchen, Ameisen, Asseln, Ohrwürmer usw. sind<br />
Ihnen bekannt.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Sucht in den Bienenkasten unter dem Keil nach jungen Wachsmotten. Setzt eine Woche vor<br />
dem Kurstag Wachsmotten auf eine alte Wabe und beobachtet mit den Kursteilnehmenden anhand<br />
dieser Wabe das Schadensbild der Motte. Erklärt, wie man sich vor der Wachsmotte schützen kann und<br />
zeigt die geeigneten Bekämpfungsmöglichkeiten auf. Sucht im Bienenhaus mit den Kursteilnehmenden<br />
nach Mitbewohnern und bestimmt diese.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 120 – 128 und Band 2, Seiten 137 – 140.<br />
Suchen Sie bei Ihren Bienen nach Mitbewohnern und bestimmen Sie diese.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Um die Waben vor Wachsmotten zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten.<br />
Bilden Sie drei Gruppen.<br />
Einfache Vorsorge:<br />
Wabenschrank dicht schliessen, wenig Vorratswaben lagern. Kühl lagern, regelmässige Kontrollen mit<br />
weisser Kunststofffolie, unbebrütete, honigfeuchte Waben sind frei von Wachsmotten.<br />
Säuren und Frassgifte:<br />
Essig- oder Ameisensäure, auf Dosierung achten, Schutzmassnahmen beachten, Behandlungen müssen<br />
wiederholt werden.<br />
Präparate mit dem «Bacillus thuringiensis»: Wirken als Frassgift bei der Nahrungsaufnahme der Wachsmotte.<br />
Schwefelschnitte: Brandgefahr. Schutzmassnahme beachten.<br />
Aufwändige Technik:<br />
Mit Tiefkühlen und einer Wärmebehandlung werden auch die Eier der Motte vernichtet.<br />
2. Sie haben immer mit Wachsmotten zu kämpfen. Ein Kollege empfiehlt Ihnen ein sicheres Mittel,<br />
das dazu noch sehr günstig sein soll. Bereits sein Grossvater und Vater sollen es benutzt haben.<br />
Was denken Sie?<br />
Hände weg von Mitteln, die nicht vom ZBF empfohlen werden und Ihnen unbekannt sind. Beim beschriebenen<br />
Mittel handelt es sich allenfalls um Mottenkugeln. Der Wirkstoff Paradichlorbenzol lagert sich im<br />
Wachs ein und kann auch im Honig nachgewiesen werden.<br />
Ein Tipp: Der Wabenschrank muss dicht sein, damit die Motte keine Chance hat, in den Kasten zu gelangen.<br />
3. Welche Vor- und Nachteile hat das biologische Mittel B401/Mellonex?<br />
B401 ist ein sicheres biologisches Mittel, das im Frühling auf das eingelagerte Wabenmaterial gesprüht wird.<br />
Vorteile: Einfache Anwendung, günstig, sicher<br />
Nachteile: Das Mittel muss gekühlt werden, kein Wabentausch während des Sommers,<br />
aufwändig, da jede Wabe besprüht werden muss<br />
Mellonex, Granulat<br />
Vorteil: Lange haltbar, muss nicht gekühlt werden<br />
Nachteil: Aufwändig, da jede Wabe besprüht werden muss<br />
4. Essig- oder Ameisensäure. Welches Mittel ziehen Sie für einen Dauereinsatz im Wabenschrank<br />
vor? Begründung mit allen Vor- und Nachteilen.<br />
Ich ziehe Essigsäure vor, obwohl diese etwas teurer ist als Ameisensäure. Essigsäure verursacht keine<br />
Korrosion an Drähten und Metallteilen im Wabenschrank und im Bienenkasten.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
65
5.6 Andere Mitbewohner<br />
Lernziel<br />
– Sie kennen die Nützlinge und Schädlinge der Bienen, sowie andere artverwandte Lebewesen.<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Gibt praktischen Anschauungsunterricht in der Natur.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 5, Seiten 49 – 58. Beobachten und bestimmen Sie in der<br />
Natur die entsprechenden Lebewesen.<br />
Info<br />
Lebewesen Nutzen Schaden und<br />
Belästigung<br />
Läuse (Honigtauproduzenten)<br />
auf Laub- und<br />
Nadelbäumen<br />
Waldameise<br />
Sondern Honigtau ab<br />
als Grundstoff für den<br />
Waldhonig<br />
Pflegen die Honigtauproduzenten<br />
Keiner<br />
Keiner<br />
Ameisen Keiner Belästigung im Bienenhaus<br />
und in den Kasten<br />
Mäuse Keiner Im Bienenhaus und im Volk<br />
Frassschäden<br />
(Mäusegitter anbringen)<br />
Spinnen Fangen Wachsmotten Fangen in den Netzen<br />
Bienen<br />
Vögel Keiner Bienenfang<br />
Spechte klopfen im Winter<br />
an Beuten<br />
Auswirkung<br />
Futterquelle im<br />
Sommer<br />
Keine<br />
Keine<br />
Gefahr bei<br />
Störungen<br />
im Winter<br />
Keine<br />
Keine<br />
Ameisenlöwe Keiner Keiner Keine<br />
Hornisse Keiner Können Bienen fangen Keine<br />
Hummeln Keiner Keiner Keine<br />
Wildbienen Keiner Keiner Keine<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Sie finden im Wabenschrank Käfer in der Grösse 8 x 3 mm. Sie sind schwarz gefärbt und tragen in<br />
der vorderen Hälfte eine behaarte, grau bis braungelb gefärbte Querbinde. Um welchen Mitbewohner<br />
handelt es sich und wie können wir verhindern, dass er sich im Wabenschrank einnistet?<br />
Es handelt sich um den Speckkäfer, der sich von Pollen und toten Bienen ernährt.<br />
Massnahmen: Wenig Wabenmaterial, sauberer Wabenkasten.<br />
2. In einem leerstehenden Bienenkasten entwickelt sich ein Hornissenvolk.<br />
Welche Massnahmen treffen Sie?<br />
Hornissen sind sehr friedliche und interessante Mitbewohner. Ich verhindere, dass die Hornissen ins<br />
Bienenhaus kommen und überlasse ihnen den Kasten für den Sommer. Hornissen sind geschützt.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
66
6.1 Imkerorganisationen<br />
Dachverband<br />
– apisuisse<br />
– apiservice gmbh / Das Bienenkompetenzzentrum<br />
Landesverbände<br />
– <strong>VDRB</strong>, Verein deutschschweizerischerund rätoromanischer Bienenfreunde<br />
– SAR, Société d‘Apiculture Romande<br />
– STA, Società Ticinese di Apicoltura<br />
Kantonalverband/Sektion/Verein<br />
– Kantonalverband<br />
– Sektion/Verein<br />
Züchterorganisationen<br />
– Verein Schweizerischer Mellifera Bienenfreunde (VSMB)<br />
– Schweizerische Carnicaimker-Vereinigung (SCIV)<br />
– Buckfastimkerverband Schweiz (BIVS)<br />
Spezielle Fachgruppen<br />
– Schweizerischer Apitherapie Verein (SAV)<br />
– Verein Schweizer Wander-Imker (VSWI)<br />
– Arbeitsgruppe naturgemässe Imkerei (AGNI)<br />
– Schweizerische Pollenimkervereinigung (SPIV)<br />
Zentrum für Bienenforschung (ZBF), Bern, ALP agroscope Liebefeld-Posieux<br />
– Wissenschaft und Beratung<br />
– Honiganalysen (individuell/Verband)<br />
Lernziele<br />
– Sie gewinnen einen Überblick über die Imkerorganisationen.<br />
– Sie wissen, welche Dienstleistungen Ihnen Ihre Sektion/Ihr Verein und der Verband bieten.<br />
Kursleiter: Hat die Statuten des <strong>VDRB</strong> und kennt die Aufgaben von <strong>VDRB</strong>, apisuisse und der apiservice gmbh.<br />
Die Adresse des Sekretariates ist bekannt.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 144 – 148.<br />
Schauen Sie sich die folgenden Internetseiten an:<br />
– <strong>VDRB</strong>, www.vdrb.ch<br />
– ZBF, www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />
Lösung Lernkontrolle:<br />
1. Welche Dienstleistungen bietet Ihnen Ihre Sektion an?<br />
– Regelmässige Beraterabende und individuelle Hilfe bei Problemen<br />
– Honigkontrolle und Siegelimker-Prüfungen<br />
– Kalibrierung von Refraktometern<br />
– Gesellige Anlässe und Imkerbesuche<br />
– Grundausbildungskurse, Königinnenzuchtkurse u.a. Weiterbildung<br />
2. Wie profitieren Sie vom <strong>VDRB</strong>?<br />
Veranstaltung und Unterstützung von Kursen und Vorträgen / Aus- und Weiterbildung von Betriebsberatern,<br />
Zuchtberatern, Betriebsprüfern / Ausbildungsunterlagen für Neuimker / Herausgabe der Schweizerischen<br />
Bienen-Zeitung, des Schweizerischen Bienenbuchs, Broschüren und Flyer / Online-Shop mit div. Artikeln<br />
für die Imker / Organisation und Überwachung einer allgemeinen Honigprüfung, auch im Interesse der<br />
Lebensmittelbehörden / Unterhalt von Waagvölkern inkl. Online-Waagen / Unterhalt eines Bienenmuseums<br />
und einer Fachbibliothek / Wahrung bienenwirtschaftlicher Interessen bei der Ausarbeitung von Gesetzen,<br />
Verordnungen und Richtlinien / Öffentlichkeitsarbeit in den Medien usw.<br />
3. Welche Aufgaben erfüllt die apiservice gmbh mit dem Bienenkompetenzzentrum?<br />
Bitte beachten Sie die Webseite www.vdrb.ch – Rubrik apisuisse und apiservice gmbh.<br />
Januar <strong>2014</strong><br />
67
6.2 Rechte und Pflichten des Imkers<br />
Lernziele<br />
– Sie kennen als Imker die gesetzliche Sorgfaltspflicht.<br />
– Sie kennen die wichtigsten nachbarrechtlichen Bestimmungen.<br />
– Sie kennen die Dokumentationspflichten des Betriebsinhabers.<br />
Imker als Tierhalter<br />
Stoff<br />
Kursleiter: Besorgt den Art. 56 OR.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 149 – 154.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Kann der Imker wegen Stichen seiner Bienen haftbar gemacht werden?<br />
Bienenstiche sind nur unter ganz besonderenUmständen ein Fall für die gesetzliche Haftpflicht. Dem<br />
Imker muss ein Verschulden nachgewiesen werden können. Ohne Rücksprache mit der eigenen Privathaftpflichtversicherung<br />
soll der Bienenhalter keine Haftpflicht anerkennen. Die gesetzliche Haftpflicht und<br />
damit die Zahlungspflicht kann nur durch die Versicherung, bzw. den Richter, festgestelltwerden.<br />
2. Was sollte der Imker bei Besuchen auf seinem Bienenstand beachten?<br />
– Nur bei guten Bedingungen die Völker öffnen, um sie dem Besucher zu zeigen.<br />
– Vorher nachfragen, ob irgendwelche gesundheitlichen oder allergischen Probleme bestehen.<br />
– Die wichtigsten lebenserhaltenden Sofortmassnahmen und die Notfallnummern kennen.<br />
3. Wem gehört ein Bienenschwarm, der auf Ihrem Grundstück am Baum hängt?<br />
Grundsätzlich jenem Imker, von dem der Schwarm stammt. Hat er Kenntnis vom Schwarm und trifft keine<br />
Anstalten, ihn zu fangen, so gilt dieser als herrenlos.<br />
4. Der Nachbar ist hochgradig allergisch gegen Bienenstiche, was kann er verlangen?<br />
– Er darf die Bienenhaltung nicht verbieten lassen, Imkerei ist ein Freiheitsrecht.<br />
– Er darf verlangen, dass die Grenzabstände eingehalten werden und dass die Flugfront nicht zu ihm hin<br />
gerichtet ist.<br />
– Er darf verlangen, dass der Imker dafür sorgt, dass die Bienen friedfertig und sanft sind, denn dies<br />
schränkt das Freiheitsrecht des Hobbies nur unwesentlich ein.<br />
5. Es ist früher Frühling. Im Wetterbericht wird angekündigt, dass morgen der erste richtig schöne<br />
und warme Tag zu erwarten ist, nachdem es nun seit 6 Wochen immer Minustemperaturen hatte.<br />
Welche Informationspflicht haben Sie?<br />
Am ersten Flugtag des Frühlings fliegen viele Bienen aus, um die Kotblase zu leeren. Sie bevorzugen helle<br />
Flächen, um sich zu erleichtern.<br />
Die Gefahr besteht, dass die Nachbarinnen gerade morgen auch die Gelegenheit benützen wollen, ein<br />
erstes Mal die Bettwäsche wieder draussen auslüften zu können. Ich sollte daher meine Nachbarn über die<br />
Gefahr von Kotspuren warnen, diese kann ich als Imker nicht verhindern, da die Bienenkästen offen sein<br />
müssen und die Biene ein Wildtier ist. Die Information ist mir aber zuzumuten.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
68
6. Welche Dokumente müssen Sie als Tierhalter von Bienen und als Lebensmittelhersteller führen?<br />
Bestandeskontrolle und Bestandesmeldung an das kantonale Landwirtschaftsamt und Selbstkontrolle<br />
(Formulare Bestandeskontrolle und Selbstkontrolle im Imkerkalender oder auf www.vdrb.ch – Rubrik<br />
Downloads –Formulare)<br />
Weitere Angaben im Anhang unter 6.4, Seite 72<br />
7. Müssen Sie den Ertrag des Honigverkaufs versteuern?<br />
Grundsätzlich ja. Aber aufgrund allgemeiner Annahmen zur Wirtschaftlichkeit von Imkereien wird<br />
angenommen, dass Imkereien bis zu 30 Wirtschaftsvölkern nicht kostendeckend sind.<br />
Sicherheitshalber sollte jeder Imker aber seine Ausgaben und Einnahmen dokumentieren.<br />
8. Welche Pflichten hat der Imker in Bezug auf die Honigherstellung?<br />
Die Honigherstellung hat nach der guten imkerlichen Praxis zu erfolgen (als Siegelimker ist das gegeben).<br />
Es sind alle diesbezüglichen Gesetze und Verordnungen einzuhalten.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
69
6.3 Gesetze im Bereich der Imkerei<br />
Lebensmittelgesetz<br />
Quelle: LMG SR 817 Art. 1 – 4, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 21<br />
VO tierische Lebensmittel SR 817.022.108 Art. 76 – 83<br />
Schweiz. Lebensmittelhandbuch (SLMB) Bereich Honig<br />
VO über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LGV) SR 817.02 Art. 10<br />
Verordnung über tierische Lebensmittel<br />
– Beschreibung von Honig<br />
– Schweizerisches Lebensmittelbuch<br />
Hygieneverordnung<br />
– Produktion<br />
– Lagerung<br />
– Räumlichkeiten und Geräte<br />
Quelle: HyV, SR 817.024.1, Art. 1 – 8, 14, 17, 20 – 24<br />
Landwirtschaftsgesetz<br />
– Förderung der Bienenzucht<br />
Quelle: LwG SR 910.1 Art. 1 – 3, 7 – 27, 113 – 136, 141 – 147<br />
TierzuchtVO SR 916.310 Art. 1 – 5, 19 – 21<br />
Tierschutzgesetz/-verordnung<br />
Quelle: TSG SR 455 Art. 1 – 2<br />
TSchV SR 455.1 Art. 1 – 4<br />
Tierseuchengesetz/-verordnung<br />
– Faulbrut<br />
– Sauerbrut<br />
Quelle: TSG SR 916.40 Art. 1, 2, 5, 9 – 11, 24, 32 – 34<br />
TSV SR 916.401 Art. 1 – 6, 20, 59 – 64, 269 – 274, 308<br />
Info<br />
In Ihrer Tätigkeit als Imkerin/Imker kommen Sie mit mehreren Gesetzen und Verordnungen in Kontakt,<br />
die Sie erfüllen müssen oder von denen Sie profitieren.<br />
Als Produzent von Honig müssen Sie die Anforderungen vom Lebensmittelgesetz und der Lebensmittelverordnung<br />
erfüllen (gute Herstellungspraxis, korrekte Deklaration...) Weiter muss die Hygieneverordnung<br />
beachtet werden (Produktion, Lagerung, Räumlichkeit). Die Amtsperson für deren Überprüfung<br />
ist der Lebensmittelinspektor. Als Imkerin/Imker profitieren Sie vom Landwirtschaftsgesetz.<br />
Die Förderung der Biene ist darin aufgelistet. Deshalb erhält unsere Dachorganisation apisuisse einen<br />
stattlichen Beitrag für Bildung, Zucht, Bienengesundheitsdienst und Marketing.<br />
Das Tierschutzgesetz verpflichtet den Tierhalter zur artgerechten Tierhaltung.<br />
Das Tierseuchengesetz und die Tierseuchenverordnung regeln die notwendigen Schritte beim Auftreten<br />
einer anzeigepflichtigen Krankheit (Faulbrut und Sauerbrut). Die Amtsperson in diesem Bereich ist<br />
der Bieneninspektor.<br />
Ein Jungimker kann durch die vielen Gesetze und Verordnungen rund um die Bienenhaltung verunsichert<br />
werden. Man braucht aber nicht Jurist zu sein, um imkern zu können. Das korrekte Verhalten<br />
wird im Grundkurs vermittelt. Hält man sich daran, so wird man nicht mit dem Gesetz in Konflikt<br />
geraten.<br />
Sämtliche Gesetzestexte finden Sie auf www.vdrb.ch – Rubrik Links – Gesetze und Verordnungen.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
70
Lernziele<br />
– Sie gewinnen einen Überblick über die wichtigsten für die Imkerei relevanten gesetzlichen<br />
Bestimmungen.<br />
– Sie können diese in der Praxis umsetzen.<br />
Kursleiter: Gibt Überblick über die relevanten Gesetze.<br />
Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 149 – 154.<br />
Lösung Lernkontrolle<br />
1. Wie ist Honig im Gesetz definiert?<br />
Art. 75 in der VO Tierische Lebensmittel: Honig ist der süsse Stoff, den die Bienen erzeugen, indem sie<br />
Nektar und Honigtau oder andere an lebenden Pflanzenteilen zu findende zuckerhaltige Säfte aufnehmen,<br />
durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem Körper verändern, in Waben speichern und reifen<br />
lassen. Er kann flüssig, dickflüssig oder kristallin sein.<br />
2. Wie soll der Schleuderraum aussehen?<br />
Der Raum muss an Boden und Wänden leicht zu reinigen und allenfalls zu desinfizieren sein. Er darf keine<br />
Staubansammlungen aufweisen. Die Decke darf keine Teile verlieren, die in die Lebensmittel kommen<br />
könnten.<br />
3. Was müssen Sie bezüglich Ihrer eigenen Hygiene beachten?<br />
Ich muss auf die persönliche Hygiene achten. Insbesondere meinen Körper, die Hände und die Kleidung<br />
muss ich sauber halten. Für die Reinigung sollte Trinkwasser zur Verfügung stehen.<br />
4. Welche Informationen gehören auf die Etikette?<br />
verein deutschschweizerischer und<br />
rätoromanischer bienenfreunde<br />
<strong>VDRB</strong><br />
www.swisshoney.ch<br />
SCHWEIZER BIENENHONIG<br />
Bündner Blütenhonig<br />
fluors da muntogna Val Müstair<br />
Hans Muster<br />
Chasa Muster<br />
7537 Müstair<br />
Tel. 000 000 00 00<br />
Los Nr. 00 00 00<br />
mindestens haltbar bis<br />
Ende 20XX<br />
500g netto<br />
1. Sachbezeichnung (Art des Lebensmittel) = HONIG oder BIENENHONIG<br />
2. Name und Adresse des Honigproduzenten oder des Honigabfüllers<br />
3. Das Produktionsland (z.B. Schweizer Honig, falls von Produzentenadresse nicht ableitbar)<br />
4. Das Gewicht: 1 kg, 500 g, 250 g netto<br />
5. Das Warenlos nach Art. 27 LGV: z.B. eine Nummer, beginnend mit L. ...... oder eine andere Bezeichnung,<br />
welche die Honigproduktions-Charge bezeichnet<br />
6. Mindesthaltbarkeit wird durch den Produzenten oder Honigabfüller bestimmt. Für Siegelimker wird<br />
3 Jahre ab Erntejahr empfohlen. Das heisst für die Ernte <strong>2012</strong> muss auf der Etikette folgendes stehen:<br />
«Mindestens haltbar bis Ende 2015»<br />
5. Welche Massnahmen kann das Lebensmittelamt verfügen?<br />
Es kann verlangen, dass der Honig aus dem Verkehr gezogen wird.<br />
6. Welche weiteren Gesetze und Verordnungen müssen Sie befolgen?<br />
Lebensmittelgesetz, Lebensmittelhandbuch, Hygieneverordnung, Tierseuchengesetz und -verordnung,<br />
Tierschutzgesetz und -verordnung, Verordnung über tierische Lebensmittel.<br />
Februar <strong>2012</strong><br />
71
6.4 Anhang<br />
6.4.1 Kalender des Schweizer Imkers<br />
Hier finden Sie viele aktuelle Informationen, Adressen, Vorlagen.<br />
6.4.2 Stockkarten<br />
Ein Beispiel einer Stockkarte finden Sie im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch. Diese Vorlage oder<br />
andere Formulare den Kursteilnehmern vorstellen.<br />
6.4.3 Bestandeskontrolle<br />
Die Bestandeskontrolle kann auch auf dem PC geführt werden.<br />
Formulare auf www.vdrb.ch – Rubrik Downloads – Formulare oder im Imkerkalender<br />
6.4.4 Selbstkontrolle<br />
Formular im Imkerkalender oder auf www.vdrb.ch – Rubrik Downloads– Formulare<br />
6.4.5 Links<br />
Unter der Adresse www.vdrb.ch finden Sie weitere Links zu interessanten Bienen-Websites.<br />
6.4.6 Feedback<br />
Gegen Ende des Kurses bitten wir Sie, von Ihren Grundkursteilnehmern eine Kursbeurteilung<br />
zu verlangen. Erklären Sie den Online-Fragebogen kurz in einer Ihrer letzten<br />
Lektionen und bitten Sie Ihre Teilnehmer, dieses Feedback rechtzeitig vor Abschluss des<br />
Kurses abzusenden:<br />
www.vdrb.ch – Rubrik Aktuelles – Kurse – Feedback Imkergrundkurs<br />
Gerne werden wir Ihnen eine Auswertung der eingegangenen Antworten zusammen mit<br />
den bestellten Diplomen zusenden.<br />
Glossar – unsere Bienensprache<br />
abräumen<br />
abschäumen<br />
Afterkönigin<br />
aufsetzen<br />
Beute<br />
Drohn<br />
drohnenbrütig<br />
Mittelwand<br />
Pheromone<br />
Propolis<br />
Weisel<br />
weisellos<br />
weiselrichtig<br />
Zarge<br />
zusetzen<br />
entfernen der Honigwaben<br />
entfernen des Schaumes vom geernteten Honig<br />
unbegattete Arbeiterin legt Eier<br />
Honigwaben werden oberhalb des Brutnestes gegeben<br />
Bienenwohnung<br />
männliche Biene (auch die Drohne)<br />
Königin legt nur noch Drohneneier<br />
Wachsplatte mit Wabenstruktur<br />
Hormon ähnliche Stoffe im Bienenvolk<br />
Kittharz, das Bienen im Volk verwenden<br />
alte Bezeichnung für Bienenkönig<br />
Volk ohne Königin<br />
Volk mit Königin<br />
Stockwerk eines Magazins<br />
beigeben einer Königin in ein bestehendes Volk<br />
Januar <strong>2014</strong><br />
72