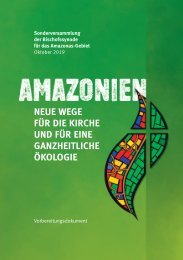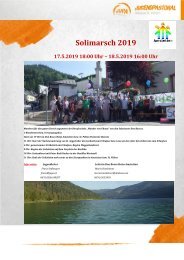Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
≫freitag.de Terror in Afghanistan: Wenn Krieg als Mittel zum Selbsterhalt dient<br />
Julian Assange Lasst den<br />
Wikileaks-Gründer endlich aus<br />
seinem Kerker in London<br />
entkommen! Wochenthema S. 6/7<br />
Partner des Guardian<br />
Spanien Podemos läuft ins<br />
Leere: Der Katalonien-Konflikt<br />
droht die Neoliberalen an<br />
die Macht zu bringen Politik S. 8<br />
Simon Strauß Der junge<br />
Schriftsteller soll ein Rechter<br />
sein. Stimmt das? Fragen<br />
wir ihn doch selbst Kultur S. 17<br />
1. Februar 2018<br />
Ausgabe 5<br />
Deutschland 3,95 €<br />
Ausland 4,25 €<br />
„Kevin for<br />
Kanzler! Das<br />
sage ich als<br />
SPD-Mitglied“<br />
mvolkers<br />
Das Meinungsmedium<br />
Politik Die Community diskutiert<br />
ein sozialdemokratisches Nein<br />
zur GroKo beim Mitgliederentscheid<br />
≫freitag.de/community<br />
Ausgeliefert<br />
Über die Machtverhältnisse beim Film S. 3<br />
FOTO: UNIVERSAL PICTURES/IMAGO<br />
Verraten und verkauft<br />
Afrin Die Welt sieht weiter<br />
zu, wie die türkische Armee<br />
mit deutschen Panzern<br />
die kurdische Demokratie in<br />
Nordsyrien zerstören will<br />
■■David Graeber<br />
Drei Jahre ist es her, dass die<br />
Welt im syrischen Kobanê<br />
Zeuge einer Schlacht wurde,<br />
wie sie dem Kampf des Guten<br />
gegen das Böse nicht näher<br />
hätte kommen können: ein bunter Haufen<br />
von Kämpferinnen und Kämpfern, meist<br />
gerade einmal mit Kalaschnikows bewaffnet,<br />
auf der einen Seite. Mit Panzern und<br />
Artillerie hochgerüstete Islamisten auf der<br />
anderen. Die Verteidiger entschlossen, ihr<br />
revolutionäres, feministisches und demokratisches<br />
Experiment zu verteidigen. Die<br />
Angreifer davon beseelt, ihre Feinde gerade<br />
wegen dieses Experiments zu vernichten.<br />
Als jener bunte Haufen Kobanê und damit<br />
die Region Rojava verteidigt hatte, war der<br />
Jubel in aller Welt groß.<br />
Heute geschieht genau dasselbe. Nur dass<br />
die Weltmächte nun glasklar auf der Seite<br />
der Angreifer stehen.<br />
Jetzt tobt die Schlacht weiter westlich, in<br />
Afrin, bis dahin eine Insel des Friedens und<br />
der Vernunft im syrischen Bürgerkrieg. Afrins<br />
Bevölkerung hat sich im Laufe des Krieges<br />
fast verdoppelt, weil Hunderttausende<br />
meist arabische Flüchtlinge an der Seite der<br />
dort ursprünglichen, überwiegend kurdischen<br />
Bevölkerung Zuflucht gesucht haben.<br />
Frieden und Stabilität, wie es sie derzeit<br />
nirgendwo sonst in Syrien gibt, haben die<br />
Bewohnerinnen und Bewohner der dortigen<br />
Region Rojava genutzt, um einen Modus<br />
lokaler Entscheidungsfindung zu installieren<br />
– Nachbarschaftsversammlungen,<br />
an denen jede und jeder partizipieren kann<br />
und die Delegierte in kommunale Räte entsenden.<br />
Während in anderen Teilen Rojavas<br />
eine strikte Genderparität gilt, bei der jedes<br />
Amt eine weibliche Inhaberin und einen<br />
männlichen Inhaber hat, halten in Afrin<br />
Frauen zwei Drittel der Ämter. Weltweit ist<br />
das wohl einzigartig. Dieses demokratische<br />
Experiment ist die Zielscheibe eines Angriffs,<br />
dem keinerlei Provokation vorausging<br />
– geführt von islamistischen Milizen,<br />
unter ihnen IS- und Al-Qaida-Veteranen,<br />
faschistische türkische Todesschwadronen<br />
wie die Grauen Wölfe –, mit der türkischen<br />
Armee und deutschen Leopard-Panzern,<br />
F-16-Kampflugzeugen und -helikoptern im<br />
Rücken. Unumwunden hat der türkische<br />
Präsident Recep Tayyip Erdoğan sein Ziel<br />
formuliert: Afrin zu erobern, um die ethnische<br />
Säuberung der Region von ihren kurdischen<br />
Bewohnern durchzusetzen.<br />
Erstaunlicherweise haben die kurdischen<br />
Volksbefreiungseinheiten den Invasoren<br />
bis jetzt standgehalten – umgeben von<br />
Feinden auf allen Seiten, ohne auch die nur<br />
moralische Unterstützung einer einzigen<br />
Weltmacht. Westliche Staatschefs, die Regierungen<br />
im Mittleren Osten gern einen<br />
Mangel an Respekt für Demokratie und<br />
Frauenrechte attestieren – und das in vielen<br />
Rojava ist eine<br />
Bedrohung<br />
für Erdoğan.<br />
Aber keine<br />
militärische<br />
Fällen gar zur Rechtfertigung militärischer<br />
Angriffe nutzen –, scheinen beschlossen zu<br />
haben, dass es ebenfalls einen Angriff<br />
rechtfertigt, wenn man sich zu sehr um politische<br />
Alternativen bemüht.<br />
Um zu verstehen, wie das geschehen<br />
konnte, muss man in die 1990er Jahre zurückgehen,<br />
als die Türkei sich in einem Bürgerkrieg<br />
mit dem militärischen Arm der<br />
kurdischen Arbeiterpartei befand. Die PKK<br />
war damals eine marxistisch-leninistische<br />
Organisation, die einen eigenständigen<br />
kurdischen Staat forderte. Sie war nie eine<br />
Terrororganisation, die etwa Bomben auf<br />
Marktplätzen gezündet hätte. Aber Guerillakriege<br />
sind immer blutig. Um die Jahrtausendwende<br />
unterzog sich die PKK einer<br />
tiefgreifenden ideologischen Transformation,<br />
verabschiedete sich von der Forderung<br />
nach einem eigenständigen Staat und altmodischem<br />
Marxismus, um sich von nun<br />
an ganz auf den Kampf gegen das Patriarchat<br />
und für die Einrichtung einer direkten<br />
Basisdemokratie zu konzentrieren. Inspiriert<br />
vom inhaftierten Anführer der Bewegung,<br />
Abdullah Öcalan, ging es um radikale<br />
Dezentralisierung der Macht, um Opposition<br />
zu jeglichem ethnischen Nationalismus,<br />
um Friedensgespräche, um eine regionale<br />
Autonomie für die Kurden, eine breitere<br />
Demokratisierung der türkischen Gesellschaft.<br />
Diese Transformation betraf die kurdische<br />
Bewegung nicht nur in der Türkei,<br />
sondern im gesamten Mittleren Osten.<br />
Die türkische Regierung antwortete mit<br />
einer Lobbykampagne für die Einstufung<br />
der PKK als „terroristische Organisation“.<br />
Bis 2001 hatte sie erreicht, dass die PKK auf<br />
die Terrorliste der EU und der USA kam. Die<br />
türkische Regierung konnte nun Aktivisten,<br />
Journalisten, gewählte kurdische Bürgermeister<br />
und den Vorsitzenden der zweitgrößten<br />
Oppositionspartei des Landes verhaften,<br />
weil sie angeblich alle mit „Terroristen“<br />
sympathisierten.<br />
Es entstand eine Situation Orwell’schen<br />
Irrsinns: Sogar in großen Teilen Europas ist<br />
es praktisch illegal für Mitglieder der PKK zu<br />
behaupten, die PKK sei nicht „terroristisch“,<br />
denn das fällt schon unter den Straftatbestand<br />
„terroristischer Propaganda“.<br />
Als ultimative Absurdität hat das jetzt<br />
den Regierungen dieser Welt ermöglicht,<br />
untätig herumzusitzen, während die Türkei<br />
anlasslos einer der wenigen friedlichen<br />
Winkel, die es in Syrien noch gibt, überfällt.<br />
Die türkische Regierung weiß nur allzu<br />
gut, dass Rojava keine militärische Bedrohung<br />
darstellt. Die Bedrohung, die es darstellt,<br />
besteht darin, eine alternative Realität<br />
davon anzubieten, die das Leben in der<br />
Region prägen könnte. Die Frage ist: Warum<br />
macht der Rest der Welt dabei mit?<br />
David Graeber ist Professor für Anthropologie<br />
an der London School of Economics<br />
Übersetzung: Mladen Gladić<br />
Simone Schmollack über die Affäre Wedel und das Filmgeschäft<br />
Brauchen die Macher von Rosamunde-<br />
Pilcher-Filmen jetzt ein Genderseminar?<br />
Man muss sich das auf der Zunge<br />
zergehen lassen: Nur etwa<br />
zehn Prozent der Film- und<br />
Fernsehproduktionen in den vergangenen<br />
Jahren hatten ausschließlich Frauen<br />
unter sich. Bei gut einem Fünftel führten<br />
Frauen allein Regie. Hinter der Kamera<br />
standen neun Prozent Frauen, die Tontechnik<br />
bedienten drei Prozent. Nur<br />
bei den Kostümen rangierten Frauen<br />
mit 80 Prozent weit vorn.<br />
Diese Zahlen der Filmförderungsanstalt<br />
sind wichtig, um zu verstehen, worüber<br />
sich derzeit viele den Kopf zerbrechen:<br />
Warum konnte das „System Wedel“<br />
funktionieren? Wie kann es sein, dass<br />
ein einzelner Mann massenweise Frauen<br />
anbrüllen, körperlich angreifen, demütigen<br />
und fertigmachen konnte? Und vor<br />
allem: Wenn alle von Wedels Tyrannei<br />
wussten, wieso hat niemand, wirklich<br />
niemand etwas dagegen getan?<br />
In den Zahlen der größten staatlichen<br />
Filmfördereinrichtung Deutschlands<br />
ist eine Antwort zu finden: In einer Branche,<br />
die überwiegend von Männern<br />
beherrscht wird, hat eine einzelne Frau,<br />
die sich gegen unzumutbare Zustände<br />
wehrt, schlichtweg keine Chance. Ihr<br />
Kampf ist noch aussichtsloser als der<br />
Davids gegen Goliath.<br />
Diese Zahlen stellen die Filmbranche<br />
vom Kopf auf die Füße. Gemeinhin<br />
glaubt man, im Filmgeschäft würden<br />
ähnlich viele Frauen mitmischen wie<br />
Männer. Immerhin haben rosenblütenhafte<br />
Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen<br />
im Fernsehen Hochkonjunktur. Journalistinnen<br />
wie Anne Will, Sandra Maischberger<br />
und Maybrit Illner prägen das<br />
Bild seriöser Polittalks. Regisseurinnen<br />
wie Maren Ade (Toni Erdmann) kennt<br />
nahezu die gesamte (Film-)Welt.<br />
Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt<br />
eines Geschäfts, das letztlich nach einem<br />
schlichten Prinzip funktioniert: male<br />
bonding. Männerbünde. Nun sind mitnichten<br />
alle Männer, auch nicht beim<br />
Film, Vergewaltiger, Fieslinge, Rampensäue.<br />
Die meisten sind sogar ziemlich<br />
nette Typen, mit denen Frauen (und<br />
Männer) gern zusammenarbeiten, die<br />
von Frauen (und Männern) geliebt und<br />
begehrt werden. Aber wenn es hart auf<br />
hart kommt – und das kommt es oft im<br />
beruflichen Verteilungskampf, vor allem<br />
in fragilen Jobs, auf dem Weg nach oben<br />
und bei Gehaltsverhandlungen –, halten<br />
Männer eben zusammen. Auch die<br />
guten machen häufig mit. Sei es, dass sie<br />
so tun, als hätten sie nichts bemerkt.<br />
Und was ist mit den Frauen am Set? Sie<br />
haben in der „Affäre Wedel“ ja auch<br />
nicht den Mund aufgemacht, sich nicht<br />
offen für die Opfer eingesetzt. Stimmt.<br />
Aber man kennt das doch: Eine kritisiert,<br />
mahnt, gibt zu bedenken, will helfen.<br />
Und dann sagt der erste Mann: Ich hab’s<br />
gewusst, die ist ’ne Heulsuse, die hält<br />
den ganzen Laden auf. Was das kostet!<br />
Mit der? Nie wieder. Es nickt der erste<br />
Mann, es nickt der zweite Mann. Und so<br />
weiter. Und der, der nicht nickt, schweigt.<br />
Male bonding at its best.<br />
Große Unternehmen und meinungsbildende<br />
Organisationen haben das<br />
schon vor langer Zeit erkannt – und sich<br />
Genderseminare verordnet. Puh, Genderworkshops:<br />
gouvernantenhaftes<br />
Dozieren über Geschlechterklischees,<br />
Rollenspiele, um als Mann eine Frau<br />
zu verstehen, so was. Wer will das schon?<br />
Andererseits verhalten sich Menschen<br />
nicht besser, fairer, weniger diskriminierend,<br />
wenn sie nicht deutlich darauf<br />
aufmerksam gemacht werden, was sie<br />
falsch machen. Vielen Männern – im<br />
Übrigen auch vielen Frauen – ist gar nicht<br />
bewusst, wie stark männerdominiert<br />
weite Teile der Gesellschaft heute noch<br />
sind und welche Wirkung das hat.<br />
So sehr haben wir uns daran gewöhnt.<br />
Kann man das ändern? Man muss.<br />
4 1 9 8 3 8 9 8 0 3 9 5 7<br />
0 5<br />
Hegelplatz 1<br />
10117 Berlin<br />
PVStk. A04188<br />
Entgelt bezahlt
Tagebuch<br />
02 Seite 2<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Inhalt<br />
Die Neue an der Schule<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
es kommt nicht mehr oft vor, dass ein<br />
Gedicht die Gemüter erregt. Wenn ich<br />
mich recht erinnere, war das vor Avenidas<br />
zum letzten Mal der Fall bei Was gesagt<br />
werden muss von Günter Grass. Damals<br />
war es die harsche Kritik an Israels<br />
(Iran-)Politik, die für eine heftige Debatte<br />
sorgte. Nun also das Gedicht Avenidas<br />
des Meisters der konkreten Poesie, Eugen<br />
Gomringer, das viele Menschen in Rage<br />
bringt. Die Alice-Salomon-Hochschule<br />
hat beschlossen, es von ihrer Fassade zu<br />
entfernen und durch einen Beitrag von<br />
Barbara Köhler (siehe nebenstehendes<br />
Porträt) zu ersetzen. Das Frauenbild<br />
im Gedicht sei nicht zeitgemäß, befand<br />
sinngemäß der AStA der Hochschule.<br />
Während sich die einen also über den<br />
„Sexismus“ aufregen, ärgert die ande ren<br />
die „Zensur“. So oder ähnlich verlaufen<br />
die Fronten ja nun immer öfter in unserer<br />
Erregungsgesellschaft. Deprimierend.<br />
So viel Energie, die ins Aufregen geht!<br />
Dabei könnte man zum Beispiel dichten!<br />
In unserem Kultur aufmacher zeigen<br />
wir sechs Adaptionen von Avenidas. Wir<br />
zeigen sie auf sechs Häuserfassaden.<br />
Denn eines ist klar: Der Look unserer<br />
Städte bräuchte dringend eine poetische<br />
Auffrischung.<br />
Ihr Michael Angele<br />
Wochenthema<br />
Julian Assange S. 6/7<br />
Zu Besuch bei dem Exilanten, der nie<br />
ein Linker war und dringend<br />
medizinische Versorgung braucht<br />
Politik<br />
Grüne S. 4<br />
Das Ergebnis des Parteitags bestätigt<br />
den Kurs: Die Ökopartei tut links, träumt<br />
jedoch vom Bündnis mit der Union<br />
Martina Mescher<br />
Österreich S. 10<br />
Waldviertel statt Marienthal: Ein<br />
Programm für Arbeitslose versucht<br />
es mal mit Würde statt mit Druck<br />
Franz Schandl<br />
Zeitgeschichte S. 12<br />
Schock für die Großmacht: Anfang<br />
1968 ist die Tet-Offensive des<br />
Vietcong den USA eine bittere Lehre<br />
Lutz Herden<br />
Barbara Köhler ist für die Alice-Salomon-Hochschule genau die richtige Dichterin<br />
■■Björn Hayer<br />
Wenn die Entfernung des Gedichts<br />
Avenidas von der<br />
Südfassade der Alice-Salomon-Hochschule<br />
ein Gutes<br />
hat, dann wohl wenigstens<br />
den Umstand, dass ein Text der Lyrikerin Barbara<br />
Köhler dafür ein würdiger Ersatz ist. Monatelang<br />
war über vermeintlich frauenfeindliche<br />
Untertöne in Eugen Gomringers Gedicht<br />
gestritten worden, bis man schließlich die<br />
peinlichste aller Entscheidungen fällte, nämlich<br />
es zu ersetzen und ein Neues darüberzuschreiben.<br />
Unterstellen also manche dem<br />
Werk des bolivianisch-schweizerischen<br />
Schriftstellers Sexismus, stellt sich umso mehr<br />
die Frage: Wer ist die Frau, die nun das zweifellos<br />
schwere Erbe an der Wand antreten soll?<br />
Zunächst einmal eine souveräne Frau mit<br />
klaren Überzeugungen. Aufgewachsen in der<br />
DDR, arbeitete Köhler erst als Altenpflegerin<br />
und als Beleuchterin am Theater Chemnitz<br />
und wurde dann zu einer gefragten, sozialkritischen<br />
Lyrikerin. Im Fokus ihrer Arbeiten stehen<br />
veraltete Strukturen und überkommene<br />
Stereotype, insbesondere im Hinblick auf Geschlechterrollen<br />
oder unsere Einstellungen<br />
gegenüber dem Fremden. Ein Gedicht aus ihrem<br />
1991 publizierten Band „Deutsches Roulette“<br />
gibt anschauliche Auskunft über ihre<br />
Vorstellung, wie es mit dem Trennenden umzugehen<br />
gilt. Es beginnt so: „ich nenne mich<br />
du weil der Abstand / so vergeht zwischen<br />
uns wie Haut / an Haut wir sind nicht / zu unterscheiden“<br />
– als würden sich die Konturen<br />
dieser beiden Personen im Wasser auflösen,<br />
gehen ihre Körper sanft ineinander über. Die<br />
kaum mehr merkliche Grenze zwischen dem<br />
Paar versteht sich lediglich noch als Verletzung,<br />
„der Übergang / eine offene Wunde“.<br />
Wer das lyrische Großprojekt der 1959 in<br />
Burgstädt geborenen Dichterin zu bestimmen<br />
sucht, kommt in diesem Liebesgedicht<br />
dem zentralen Wesenspunkt ihres Schaffens<br />
schon sehr nahe: dem Wechselspiel zwischen<br />
Differenz und Verschmelzung, der Verflüssigung<br />
des Festen, Verkrusteten.<br />
Keine Frage: Die Haltung, welche die Autorin<br />
in ihren Gedichten und oftmals unterschiedliche<br />
Medien einbeziehenden Mixed-<br />
Media-Installationen kundtut, ist eine postfeministische.<br />
Statt auf „Er“ und „Sie“ oder „Ich“<br />
und „Du“ setzt sie mitunter auf das „Wir“ oder<br />
wirft Bezeichnungen gleich ganz über Bord.<br />
Und wo männliche Dominanz vorherrscht,<br />
FOTO: PATRICK SEEGER/DPA<br />
Ihre Gedichte<br />
tragen sichtlich<br />
die Spuren einer<br />
akademischen<br />
Komplexität.<br />
Aber ideologisch<br />
verbissen<br />
sind sie nicht<br />
übt sich die Poetin als Zersetzerin. So lässt sie<br />
im Band Niemands Frau. Gesänge zur Odyssee<br />
(2000) vor allem die Frauen, darunter Helena,<br />
Penelope, Kirke oder die Sirenen zu Wort kommen.<br />
Dem Patriarchat des antiken Epos setzt<br />
sie in ihrer lyrischen Be- und Überarbeitung<br />
eine moderne Position entgegen, welche den<br />
Helden Odysseus gleichsam kastriert. Denn<br />
wie der Titel verrät, schrumpft der Übermann<br />
bei Köhler tatsächlich zum No Name.<br />
Ganz im Sinne der Philosophin Judith Butler<br />
weiß die Poetin: Sprache spiegelt Machtverhältnisse<br />
wider. Je mehr man mit ihr spielt,<br />
desto eher brechen die ihr innewohnenden<br />
Ablagerungen auf.<br />
Bevor sie 1985 ein Studium am Literaturinstitut<br />
Leipzig aufnahm, hatte Köhler unter anderem<br />
in der Textilbranche gearbeitet. Offenbar<br />
hat sie dort ein für die Machart ihrer Gedichte<br />
nicht zu unterschätzendes Verfahren<br />
kennengelernt, nämlich das Verweben und<br />
Verknüpfen. Köhlers Schreiben steht im Zeichen<br />
von Zusammenführungen und der<br />
Überwindungen einer einfachen Zweiteilung<br />
der Welt, wobei dies nicht mit der bloßen Verwischung<br />
von Unterschieden gleichzusetzen<br />
ist. Die Autorin negiert weder das Feminine<br />
noch das Maskuline, sie will uns für die verschiedenen<br />
Perspektiven erst sensibilisieren.<br />
Jeder Vereinigung, jeder fließenden Synthese<br />
geht logischerweise ein Unterschied voraus.<br />
Dies betrifft im Übrigen nicht nur den Unterschied<br />
zwischen Mann und Frau, sondern<br />
auch jenen zwischen Landschaften und Kulturen.<br />
In ihrem virtuosen Band Istanbul, zusehends<br />
(2016) bricht sie mit einer eurozentristischen<br />
Position und nähert den Leser behutsam<br />
und mit Faszinationskraft den<br />
morgendländischen Gefilden an, in 36 Ansichten<br />
des Berges Gorwetsch (2013) lässt sie<br />
Gelände und Gefühle ineinander übergehen.<br />
So ist etwa der titelgebende „Berg als Geste zu<br />
sehen: wie eigenar- / tig… – So wird auch das<br />
Erheben zu einer Geste und keine Natur- / gegebenheit.“<br />
Was nach netter Naturlyrik klingt,<br />
liest sich bei genauem Hinschauen als politische<br />
Kampfansage, als Widerrede gegen grobschlächtige<br />
Narrative von den Frauen, den<br />
Abgehängten oder den Geflüchteten. Die so<br />
oft behauptete Natur der Menschen und Dinge<br />
erweist sich demzufolge als reinste Konstruktion.<br />
Köhlers Wirken zielt sicherlich nicht auf das<br />
Mitreißen der Massen. Nach ihrer wissenschaftlichen<br />
Tätigkeit für das Bezirksliteraturzentrum<br />
Karl-Marx-Stadt in der DDR und<br />
zahlreichen Poetik-Dozenturen, zum Beispiel<br />
an der Universität Duisburg-Essen und der<br />
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
Bonn, tragen ihre Werke sichtlich die Spuren<br />
einer akademischen Komplexität, wie sie mit<br />
Leitbegriffen wie den Gender Studies oder<br />
dem Poststrukturalismus verbunden ist.<br />
Da ihre Texte allerdings immer von einem<br />
ironischen Gestus und beschwingten Ton getragen<br />
sind, haftet ihnen keinerlei ideologische<br />
Verbissenheit an. Die Dichterin zeigt<br />
sich politisch, ohne ihr Politischsein (im Gegensatz<br />
etwa zu Julie Zeh oder Ilja Trojanow)<br />
demonstrativ zu Markte zu tragen. Wie ihre<br />
Texte steht auch die Peter-Huchel-Preisträgerin<br />
ganz für den Entwurf einer von Dynamik<br />
und Offenheit geprägten Gesellschaft. Auf der<br />
Fassade der Alice-Salomon-Hochschule dürfte<br />
ihr bis dato noch unbekanntes Gedicht daher<br />
zugleich auch ein Menetekel für all jene<br />
sein, die sich paradoxerweise gegenwärtig<br />
der Zensur bedienen, um einer liberalen Poesie<br />
Raum zu schaffen.<br />
Kultur<br />
Medien S. 14<br />
Die „Huffington Post“ jagt die Blogger<br />
vom Platz. Die Zukunft des Journalismus<br />
wird dadurch auch nicht gerettet<br />
Dorian Baganz<br />
Im Gespräch S. 15<br />
Kommunismus statt Arbeit: Es rettet uns<br />
kein höh’res Wesen, nur die Befreiung<br />
vom Lohnprinzip, meint Franco Berardi<br />
Anna Stiede<br />
Debatte S. 17<br />
Lieber Adorno als „Tumult“? Simon<br />
Strauß mag den Streit, schwieg jedoch<br />
zu dem über ihn selbst. Ein Treffen<br />
Mladen Gladić<br />
Film S. 19<br />
Pochierte Eier: Paul Thomas Anderson<br />
erzählt wieder von der Monomanie<br />
der Männer. Dieses Mal ganz elegant<br />
Karsten Munt<br />
Alltag<br />
Porträt S. 22<br />
Wie eine Seherin: Es wäre zu wünschen,<br />
die Welt würde sich nicht so sehr an<br />
Margaret Atwoods Romanen orientieren<br />
Lisa Allardice<br />
Altern S. 23<br />
Plötzlich fällt das Aufstehen schwer:<br />
fünf Betrachtungen zu einem Prozess,<br />
der wirklich nichts für Feiglinge ist<br />
Magda Geisler<br />
A – Z Männergrippe S. 24<br />
Es ist wieder so weit: Zeit für Klischees<br />
Leserbriefe, Impressum S. 20<br />
Werner Vontobel über Davos und den ruinösen Steuerwettbewerb<br />
Lassen wir uns nicht länger erpressen<br />
So ungeschminkt hat sich<br />
Davos noch nie präsentiert.<br />
Das Weltwirtschaftsforum<br />
war eine einzige Ode an<br />
den Standortwettbewerb: Jobs<br />
gegen Senkung der Steuern und<br />
Löhne, die Topmanager haben<br />
uns ihre Lektion eingebläut:<br />
Wachstum und Beschäftigung<br />
ist, wenn ihr uns dazu bringt,<br />
bei euch statt bei den anderen<br />
zu investieren. Dealmaker<br />
Trump hat es vorgemacht: Er<br />
senkte die Gewinnsteuer von<br />
41 auf 15,5 Prozent, als Dank ließ<br />
er sich vor laufender Kamera<br />
von Konzernchefs sagen, wie<br />
viele Milliarden sie nun in den<br />
USA statt anderswo investieren.<br />
Nun streiten Ökonomen,<br />
ob Deutschland nachziehen und<br />
die Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften<br />
auch senken<br />
müsse. Diese Ökonomen sehen<br />
den Wald vor lauter Bäumen<br />
nicht: Sie haben verinnerlicht,<br />
dass Beschäftigung von der<br />
Wettbewerbsfähigkeit kommt.<br />
Doch diese hängt nicht nur<br />
von der Höhe der Unternehmenssteuer<br />
ab. Verglichen mit<br />
den Löhnen sind die Steuern<br />
Peanuts. Von Lohnsenkungen<br />
spricht man in Davos nicht<br />
so gern, aber man kann dazu ja<br />
„Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“<br />
oder „längt überfällige<br />
Strukturreformen“ sagen. Noch<br />
dazu wollen die Topmanager<br />
steuerlich entlastet werden,<br />
sonst bleiben sie am alten<br />
Standort – runter mit Spitzensätzen<br />
der Einkommensteuer!<br />
Auf diesem abschüssigen Pfad<br />
sind wir schon lange unterwegs.<br />
In der EU wurde der Einkommensteuerspitzensatz<br />
zwischen<br />
2000 und 2010 von knapp 45<br />
auf 39 Prozent, die Körperschaftsteuer<br />
von 32 auf 22 Prozent<br />
gesenkt. Für Kapitalerträge gibt<br />
es Dutzende Schlupflöcher.<br />
Man muss viel Ballast abwerfen,<br />
um im Bieterwettbewerb<br />
der globalen Standorte ab und<br />
zu ein paar tausend Jobs zu<br />
gewinnen oder zu behalten. Das<br />
macht dann Schlagzeilen –<br />
wie Apples Ankündigung, in den<br />
USA 38 Milliarden Dollar zu<br />
investieren. Doch global gesehen<br />
gibt es nicht mehr Jobs,<br />
wenn die Multis ihre Standorte<br />
von hier nach dort verschieben.<br />
Die Deindustrialisierung lässt<br />
sich so nicht aufhalten. Trotz<br />
rekordhoher Handelsbilanzüberschüsse<br />
ist der Anteil der<br />
Industriejobs in Deutschland<br />
seit 2000 von 28,5 auf 24,1 Prozent<br />
gesunken. Und diese 24<br />
Prozent produzieren viel mehr<br />
Industriegüter, als der Konsument<br />
konsumieren, erst recht,<br />
als die Umwelt ertragen kann.<br />
Es mag sein, dass ein Sieg im<br />
Standortwettbewerb diesen<br />
Rückgang verlangsamt. Dafür<br />
aber behindert er die Schaffung<br />
neuer Jobs: Deutschland bezahlt<br />
seinen Sieg mit der Verarmung<br />
der Mittel- und Unterschicht.<br />
14 Prozent der Erwerbsbevölkerung<br />
sind aktuell nicht oder<br />
geringfügig beschäftigt. 2,7 Millionen<br />
verdienen weniger als<br />
den Mindestlohn. Viele Rentner<br />
sind nicht besser dran. Das kostet<br />
Millionen von Jobs.<br />
Denn das, was sich das ärmste<br />
Viertel der Deutschen heute zu<br />
leisten vermag, kann man mit<br />
etwa zehn durchschnittlich produktiven<br />
Arbeitsstunden pro<br />
Woche herstellen. Wäre ganz<br />
Deutschland auf Hartz IV, könnte<br />
man alle Autofabriken, die<br />
Fitnesszentren, die Hotels und<br />
fast alle Gaststätten schließen.<br />
Vergleicht man die Entwicklung<br />
der Binnennachfrage mit<br />
der der Handelsbilanz, dann hat<br />
Deutschland mit jeder Milliar de<br />
Kaufkraft, die es dank der<br />
Exportüberschüsse dem Ausland<br />
abgeluchst hat, mindestens<br />
1,5 Milliarden eigene Nachfrage<br />
in den Sand gesetzt. Für<br />
Topmanager mag der Standortwettbewerb<br />
ein Win-win-<br />
Geschäft sein. Für alle anderen<br />
ist es Lose -lose. Was wir vom<br />
Weltwirtschaftsforum wirklich<br />
lernen können: Beschäftigung<br />
und Wohlstand ist, wenn wir<br />
uns von den Davos-Menschen<br />
nicht länger erpressen lassen.<br />
Leander F. Badura über Stiftungsgremien und die AfD<br />
Resilienz und Gegendruck<br />
Nicole Höchst sorgt sich<br />
um die Reproduktion<br />
des deutschen Volkes.<br />
Außerdem findet sie, Deutschland<br />
habe „weniger ein Problem<br />
mit Fremdenfeindlichkeit als<br />
viel eher ein Problem mit feindlichen<br />
Fremden“. Keine sonderlich<br />
überraschenden Positionen<br />
für eine Abgeordnete der AfD.<br />
Doch nun hat ihre Fraktion sie<br />
in das Kuratorium der Mag nus-<br />
Hirschfeld-Stiftung entsandt.<br />
Eine Provokation sei das, meint<br />
nicht zuletzt der Bundesverband<br />
der Lesben und Schwulen.<br />
Und es ist ja auch absurd: Eine<br />
Politikerin, die die Aufhebung<br />
des Eheverbots für gleichgeschlechtliche<br />
Paare als „Befriedigung<br />
von Kleinstinteressen“<br />
bezeichnet und findet, über<br />
LGBT aufzuklären sei ein „Angriff<br />
auf Kinderseelen“, sitzt<br />
nun bei einer der wichtigsten<br />
Stiftungen, die gegen genau solche<br />
Ansichten kämpfen. Grund<br />
dafür ist die einfache Regel,<br />
dass jede Bundestagsfraktion<br />
ein Mitglied in das 24-köpfige<br />
Gremium der durch den Bund<br />
geförderten Stiftung entsendet.<br />
Es ist keine Überraschung,<br />
dass die AfD eine sogenannte<br />
Hardlinerin schickt. Provokation<br />
ist nicht nur Strategie, sondern<br />
Essenz der Partei. Der Einfluss<br />
von Höchst wird natürlich<br />
marginal bleiben, auch weil<br />
man sich im Beirat der Stiftung<br />
wappnen will.<br />
Der Vorgang ist allerdings eine<br />
Lehre über die Dialektik des<br />
Umgangs mit der AfD. Einerseits<br />
erweisen sich die demokratischen,<br />
liberalen Institutionen<br />
als resilient. Das simple Dazustoßen<br />
der Feinde der Freiheit<br />
zu den Hütern jener Ordnung<br />
schafft diese noch nicht ab. Im<br />
Bundestag spielt sich derzeit<br />
ein erstaunlich gut funktionierender<br />
Modus Operandi ein.<br />
Die anderen Parteien stellen die<br />
AfD mit inhaltlicher Kritik statt<br />
Pauschalisierung.<br />
Andererseits zeigt sich, dass<br />
die AfD auf Dauer das demokratische<br />
Spiel aushöhlen kann, da<br />
es unmöglich ist, sie auszusperren.<br />
Am Ende geht es um Mehrheiten<br />
– und die können sich<br />
ändern. Björn Höckes Fantasien<br />
von einer AfD „an der Macht“<br />
sind also durchaus eine Drohung.<br />
Schwer vorstellbar, dass<br />
Organisationen wie die Magnus-Hirschfeld-Stiftung<br />
dann<br />
noch gefördert würden. Ganz<br />
abgesehen von der diskursiven<br />
Wirkung, die sich längst in allen<br />
Ecken der Gesellschaft entfaltet.<br />
Gegendruck braucht es auch<br />
jenseits institutioneller Resilienz.<br />
Nicht nur der Stiftungsbeirat<br />
muss sich für die Auseinandersetzung<br />
wappnen, sondern<br />
eigentlich – alle.
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Titelthema 03<br />
„Der Sender<br />
hat klar versagt“<br />
Wedel Sexuelle Übergriffe sind möglich,<br />
weil zu wenig Frauen zu wenig Macht haben,<br />
sagt Regisseurin Barbara Rohm<br />
Derzeit Kassenschlager: „Affäre Wedel“ über Macht und Gewalt am Filmset<br />
Als vor Kurzem mehrere<br />
Frauen den Regisseur<br />
Dieter Wedel beschuldigten,<br />
er habe<br />
ihnen Gewalt angetan,<br />
ging ein Aufschrei durch die<br />
Republik: Wieso hat niemand etwas<br />
dagegen getan, obwohl am Set<br />
alle von den Übergriffen gewusst<br />
haben? Ein Gespräch über Einschaltquoten,<br />
die Macht Einzelner<br />
und die Angst vor Ausgrenzung,<br />
wenn man Opfern hilft.<br />
<strong>Freitag</strong>: Frau Rohm, die Enthüllungen<br />
zu den gewalttätigen<br />
Übergriffen auf Schauspielerinnen<br />
durch den Starregisseur<br />
Dieter Wedel scheinen nicht abzureißen.<br />
Was kommt da noch?<br />
Barbara Rohm: Das ist sicher noch<br />
nicht auserzählt. Der „Fall Wedel“<br />
macht Strukturen sichtbar, die<br />
Machtmissbrauch stützen. Das ist<br />
systemimmanent.<br />
Das System war unter anderem<br />
der Saarländische Rundfunk (SR).<br />
Frauen haben dem Sender<br />
bereits in den 80er Jahren von<br />
Wedels physischer und psychischer<br />
Gewalt ihnen gegenüber<br />
berichtet. Die SR-Führungsebene<br />
hat demnach genau gewusst,<br />
was am Set passiert. Wie kann es<br />
sein, dass niemand reagiert?<br />
Einschaltquoten und die Angst,<br />
dass eine Produktion zeitlich und<br />
finanziell aus dem Ruder läuft,<br />
wenn solche Vorwürfe aufgeklärt<br />
und verfolgt werden, waren offensichtlich<br />
zu groß. Solche Vorkommnisse<br />
werden zudem oft als<br />
Privatsache abgetan. Der Sender<br />
hat ganz klar versagt.<br />
Vergewaltigung, Nötigung, körperliche<br />
Übergriffe waren auch<br />
damals Straftaten. Durch Schweigen<br />
macht man sich mitschuldig.<br />
Sich mit Opfern zu solidarisieren,<br />
heißt auch, sich außerhalb einer<br />
Gruppe zu stellen. Das ist unbequem<br />
und birgt die Gefahr, ebenfalls<br />
zu vereinzeln. Ein Risiko<br />
angesichts der kurzzeitigen Verträge,<br />
die im Filmgeschäft üblich<br />
5,6 Mio € (9,4 %)<br />
59,4 Mio €<br />
2013<br />
53,8 Mio € (90,6%)<br />
„Vielleicht<br />
berichten ja<br />
bald auch<br />
Männer, was<br />
ihnen am<br />
Set passierte“<br />
antwortlicher Position, der solche<br />
Zustände nicht duldet. Versagt<br />
haben nicht die Frauen, sondern<br />
die Verantwortlichen, die das<br />
zugelassen haben.<br />
Und die Frauen, die Zeuginnen<br />
wurden? Waren sie allesamt mitleidslos?<br />
Frauen vorzuwerfen, sie hätten<br />
versagt, weil sie sich nicht solidarisiert<br />
haben, greift zu kurz. Das<br />
ist doch keine Angelegenheit unter<br />
Frauen! Diejenigen, die die Macht<br />
haben, müssen das System verändern.<br />
Und das sind nicht die<br />
Frauen.<br />
Wer keine Macht hat, kann keine<br />
Solidarität zeigen?<br />
Was hätte der Protest einer einzelnen<br />
Maskenbildnerin ausrichten<br />
können, wenn die „oberste Etage“<br />
die Taten deckt? Darüber hinaus<br />
Filmförderungen des DFFF<br />
7,2 Mio € (14,2 %)<br />
Männer<br />
43,4 Mio € (85,8%)<br />
7,6 Mio € (15,1 %)<br />
Frauen<br />
50,6 Mio € 50,2 Mio € 49,8 Mio €<br />
42,6 Mio € (84,9%)<br />
8,8 Mio € (17,7 %)<br />
2014 2015 2016<br />
41,0 Mio € (82,3 %)<br />
sind. Beteiligte an einem Film kommen<br />
stets nur für dieses eine zeitlich<br />
begrenzte Projekt zusammen.<br />
Wie es danach weitergeht, weiß<br />
niemand. Aber alle wollen Folgeaufträge,<br />
das ist häufig eine existenzielle<br />
Frage.<br />
In einer „normalen“ Firma wäre<br />
solch ein System nicht möglich?<br />
Zumindest besteht eher die Chance,<br />
dass sich irgendwann doch<br />
jemand solidarisiert. Das System<br />
am Set schließt und öffnet sich<br />
ständig. Und diejenigen, für die es<br />
nicht gut läuft oder die sehen,<br />
wie andere fertiggemacht werden,<br />
wissen: Bald ist der Dreh vorbei,<br />
der Vertrag läuft aus, dann ist das<br />
hier vorbei. Das ist auch ein gewisser<br />
Selbstschutz.<br />
Das verhindert jegliche Solidarität?<br />
Opfer von sexueller Gewalt sind<br />
in der Beweispflicht. Aber beweisen<br />
Sie das mal, wenn alle anderen<br />
sagen: Ich weiß von nichts, ich<br />
habe nichts gesehen, nichts gehört.<br />
Das produziert eher Ohnmacht<br />
und keine Solidarität<br />
Hat der Feminismus an dieser<br />
Stelle versagt?<br />
Eine einzelne Frau kann ein toxisches<br />
System nicht verändern,<br />
dafür braucht es viele mutige Menschen.<br />
Oder jemanden in verhaben<br />
die Frauen am Set offenbar<br />
gefürchtet, ihren Job zu verlieren.<br />
Das hat mit dem harten Verteilungskampf<br />
zu tun, unter dem vor<br />
allem Frauen zu leiden haben.<br />
Das müssen Sie erklären.<br />
Gerade zeigt eine Studie der Filmförderungsanstalt<br />
(FFA), der größten<br />
staatlichen Filmfördereinrichtung<br />
Deutschlands, wie wenig<br />
präsent Frauen in allen Filmbereichen<br />
sind. So werden nicht einmal<br />
ein Viertel der Drehbücher von<br />
Frauen verfilmt, hinter der Kamera<br />
stehen gerade mal 10 Prozent Frauen,<br />
der Ton wird fast ausschließlich<br />
von Männern gemacht. 2016<br />
waren gerade mal 14 Prozent<br />
der ZDF-Produktionen von Frauen,<br />
über 82 Prozent der Fördermittel<br />
flossen an Männer.<br />
Vielleicht sind die Männer einfach<br />
besser?<br />
Nein. Das ist keine Frage der Qualität,<br />
sondern eine der Mittel- und<br />
Auftragsvergabe. Frauen leiden<br />
nicht an einem kollektiven Qualitätsmangel.<br />
Ich gehe davon aus,<br />
dass Talent bei Frauen und Männern<br />
gleichmäßig verteilt ist.<br />
Die FFA bescheinigt sich mit ihrer<br />
Studie das eigene miserable Handeln?<br />
Die Anstalt sagt ganz klar, dass aufgrund<br />
der asymmetrischen<br />
Geschlechterverhältnisse und der<br />
Risikoscheu in der Filmindustrie<br />
immer wieder gern auf bewährte<br />
Formate und Personen zurückgegriffen<br />
wird. Und sie sagt auch,<br />
dass dadurch Stereotype fortgeschrieben<br />
werden. Ganz konkret<br />
bedeutet das: Männer werden<br />
nach wie vor Eigenschaften wie<br />
Durchsetzungskraft, Kreativität,<br />
Stressresistenz zugeschrieben. Sie<br />
sind das Genie und Frauen sind<br />
die Musen, die auf ihren Körper<br />
reduziert werden, nicht selten mit<br />
einem sexuellen Interesse für<br />
den Mann.<br />
Von anderen männerdominierten<br />
Branchen, wie beispielsweise<br />
der Metallindustrie, hört man<br />
nichts von derlei Vorfällen.<br />
FOTOS: EIBNER/IMAGO, ORSINO ROHM (UNTEN)<br />
Es gibt aber Berichte von Versicherungsunternehmen,<br />
deren Führungskräfte<br />
gemeinsam in den Puff<br />
gehen. Was ist mit der Kirche?<br />
Dem Sport? In den sozialen Netzwerken<br />
haben sich im Zuge<br />
von #metoo mittlerweile Millionen<br />
von Frauen geäußert, und<br />
die arbeiten nicht alle in der Medienbranche.<br />
Werden neben dem Saarländischen<br />
Rundfunk demnächst andere<br />
öffentlich-rechtliche Anstalten<br />
ihre Archive öffnen?<br />
Sie werden es müssen, falls noch<br />
weitere Fälle öffentlich werden. Die<br />
#metoo-Debatte in Amerika hat<br />
gezeigt, dass eine Lawine losgetreten<br />
werden kann, wenn nur ein<br />
paar Frauen den Anfang machen<br />
und reden.<br />
Muss sich die Filmbranche<br />
den Vorwurf der institutionellen<br />
Schuld machen lassen?<br />
Das ist eine eigenartige Kultur, die<br />
da vorherrschte. Im Fall Wedel<br />
hieß diese, klar abzuwägen: Der<br />
Mann liefert uns Erfolg. Was<br />
würde es uns kosten, jemanden<br />
nachzubesetzen, Drehtage zu<br />
wiederholen? Das wiegt mehr als<br />
einzelne Frauen, deren Leben<br />
zerstört wird.<br />
Diese „Kultur“ erlaubt es vor<br />
allem Männern, sich an Frauen<br />
zu vergehen.<br />
Warten wir mal, möglicherweise<br />
berichten bald auch Männer,<br />
was ihnen am Set widerfahren ist.<br />
Ist #metoo in Deutschland zu<br />
zahm?<br />
Vielleicht. Mir fehlt vor allem die<br />
Debatte darüber, was sich verändern<br />
muss, um gewaltfreies Arbeiten<br />
zu ermöglichen, nicht nur<br />
am Set.<br />
Was muss sich denn ändern?<br />
Das beste Korrektiv sind ausgeglichene<br />
Geschlechterverhältnisse,<br />
übrigens in jeder Branche. Sowie<br />
ein tief greifender Kulturwandel.<br />
Wie kann man den erreichen?<br />
Der Verein Pro Quote Regie erweitert<br />
sich gerade zu Pro Quote Film.<br />
Gemeinsam mit filmschaffenden<br />
Frauen aller Gewerke und Schauspielerinnen<br />
fordert er für die<br />
Filmbranche eine Quote von 50<br />
Prozent: die Hälfte aller öffentlichen<br />
Aufträge und Fördermittel<br />
muss an Frauen gehen. Frauen<br />
und Männer müssen gleichermaßen<br />
vor und hinter der Kamera<br />
vertreten sein. Auch Frauen über<br />
35 müssen stärker präsent sein.<br />
Kostüm<br />
Frauen über 50 beispielsweise<br />
kommen nur noch zu einem Viertel<br />
in Film- und Fernsehproduktionen<br />
vor. Ab 60 nur noch zu einem<br />
Fünftel. Außerdem empfehlen wir<br />
verpflichtende Genderseminare.<br />
Genderworkshops als Pflicht sind<br />
nicht sonderlich beliebt.<br />
Barbara Rohm,<br />
51, ist Regisseurin,<br />
Fotografin<br />
und Mitbegründerin<br />
sowie<br />
Vorstand des Vereins Pro<br />
Quote Regie und Pro Quote<br />
Film. Sie arbeitete unter<br />
anderem für Pro 7 und als<br />
Regisseurin von Werbespots<br />
und -filmen. Zuletzt<br />
erschien von ihr der Bildband<br />
Menschen in Sanssouci<br />
im h. f. ullmann Verlag.<br />
Wer etwas ändern will, darf nicht<br />
davor zurückschrecken, unbeliebte<br />
Dinge einzufordern. Wenn Genderseminare<br />
erst einmal selbstverständlich<br />
geworden sind, wird<br />
man vergessen haben, dass sie mal<br />
unbeliebt waren. In großen Unternehmen<br />
sind Diversity-Seminare<br />
bereits üblich, da weiß man, dass<br />
Vielfalt ein Erfolgsfaktor ist.<br />
Unabhängig davon hat der Schauspielverband<br />
einen runden Tisch<br />
zur Gründung einer überbetrieblichen<br />
Beschwerdestelle für Filmschaffende<br />
in kurzen Arbeitsverhältnissen<br />
initiiert. Für Menschen<br />
also, die nicht die Chance haben,<br />
sich an einen Betriebs- oder Personalrat<br />
in einem Betrieb zu wenden,<br />
in dem sie täglich arbeiten. Die<br />
Beschwerdestelle muss sich auch<br />
um Aufarbeitung und Prävention<br />
kümmern.<br />
Wie sieht es mit Entschädigungszahlungen<br />
für die Opfer aus?<br />
Auch darüber sollte nachgedacht<br />
werden. Das, was die Opfer schildern,<br />
hat ihre Karrieren und ihre<br />
persönliche Entwicklung stark<br />
beeinflusst. Wünschenswert ist<br />
auch hier, dass die Opfer Unterstützung<br />
finden und nicht allein um<br />
Entschädigung kämpfen müssen.<br />
Das Gespräch führte<br />
Simone Schmollack<br />
Anteil von Frauen und Männern bei der<br />
deutschen Filmproduktion<br />
80%<br />
Szenografie<br />
38% 4% 9% 46% 3%<br />
Schnitt/Montage<br />
30% 3% 10% 48% 9%<br />
Regie<br />
22% 1%5% 67% 5%<br />
Drehbuch<br />
20% 3% 16% 40% 20%<br />
Produktion<br />
10% 4% 28% 28% 30%<br />
Kamera<br />
9% 1%5% 71% 14%<br />
Ton<br />
3%1%5% 68% 23%<br />
Frauen<br />
Männer<br />
Frauenteams<br />
Männerteams<br />
Gemischte Teams<br />
Quellen: Unter der Gender-Lupe, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)<br />
2017. Gender und Film – Rahmenbedingungen und Ursachen der<br />
Geschlechterverteilung von Filmschaffenden in Schlüsselpositionen,<br />
Filmförderungsanstalt (FFA) 2017 (Angaben gerundet)<br />
6% 3% 10%
04 Politik<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Sie nennen es links<br />
Grüne Die Partei hat ein neues Führungsduo gewählt<br />
und dabei eherne Prinzipien über Bord geworfen<br />
■■Martina Mescher<br />
Ein „neuer Joschka“, eine „neue Petra<br />
Kelly“, der mediale Trend zur ikonografischen<br />
Überfrachtung macht<br />
auch vor den Grünen nicht halt. Die Partei<br />
hat mit Robert Habeck und Annalena<br />
Baerbock seit dem Wochenende ein neues<br />
Führungsduo, das nun als politisches<br />
Traumpaar der Republik gefeiert wird. Im<br />
wirklichen Leben verband den regierungsfreudigen<br />
Kosovo-Kriegsbefürworter<br />
Joschka Fischer und die Friedensaktivistin<br />
Petra Kelly, die die Grünen als „Anti-Parteien-Partei“<br />
etablieren wollte, nicht<br />
allzu viel. Fischers Aufstieg in der Partei<br />
begann mit Kellys Abstieg. Die Rückbesinnung<br />
auf die Anfänge der Grünen passt<br />
zwar zu Habecks Plänen, aus ihnen eine<br />
attraktive Bewegungspartei zu machen,<br />
aber ansonsten stand die Bundesdelegiertenkonferenz<br />
in Hannover eher für einen<br />
Abschied von früheren Grundsätzen.<br />
Umverteilung<br />
und doch<br />
noch Jamaika<br />
– so geht<br />
Flexibilität<br />
ANZEIGE<br />
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202 | 50937 Köln<br />
LucIano canfoRa<br />
euRoPa, DeR WeSTen unD<br />
DIe SKLaVeReI DeS KaPITaLS<br />
Der Kapitalismus – einst nur im Westen heimisch – erscheint heute<br />
weltweit auf der Bühne und ruft Formen längst überwunden geglaubter<br />
Sklaverei hervor. Aber ist die Ungleichheit, die sich überall noch verschärft<br />
hat, eine unvermeidliche Zwangslage? Und wird, wer herrscht,<br />
dies immer tun?<br />
ISBN 978-3-89438-663-4 | 107 Seiten | € 9,90<br />
KemaL Bozay / HaSan KaygISIz<br />
DeR neue SuLTan<br />
Die Türkei zwischen Repression und Widerstand<br />
Kemal Bozay und Hasan Kaygısız gehen der Frage nach, wie die<br />
gezielte Eskalation nach dem Putsch und Gegenputsch von 2016<br />
zu erklären ist. Mehr noch: Wie es unter Erdoğan zum Bruch mit<br />
dem Kemalismus bei gleichzeitiger osmanischer Rückbesinnung<br />
kommen konnte.<br />
Bisher galt bei der Besetzung von Führungsposten<br />
die Flügellogik, mit Habeck<br />
und Baerbock bilden nun zwei Realo-Vertreter<br />
die Doppelspitze. Das eherne Prinzip<br />
der Trennung zwischen Amt und<br />
Mandat, das den frühen Grünen nicht nur<br />
als Instrument gegen die Anhäufung von<br />
Ämtern, sondern auch als Waffe gegen<br />
die verachtete Personalisierung von Politik<br />
galt, wurde für Habeck aus dem Weg<br />
geräumt, in Hannover wurde die Satzung<br />
entsprechend geändert. Habeck wird in<br />
den kommenden acht Monaten zwei Jobs<br />
bestreiten, als Bundesvorsitzender der<br />
Grünen und als Umweltminister der Kieler<br />
Jamaika-Koalition. Dass Habeck die<br />
Aufhebung der Trennung von Amt und<br />
Mandat zur Bedingung für seine Kandidatur<br />
um den Chefposten machte und damit<br />
auch offensiv seinen Machtanspruch<br />
zur Schau stellte, sorgte bei Teilen des linken<br />
Flügels durchaus für Unmut.<br />
Der Parteitag hat noch einmal deutlich<br />
vor Augen geführt, wie defensiv die Parteilinke<br />
inzwischen auftritt, wenn es um<br />
den Anspruch auf Führungspositionen<br />
geht. Das war bereits der Fall, als mit Katrin<br />
Göring-Eckardt und Cem Özdemir<br />
zwei Realos als Spitzenkandidaten für den<br />
Bundestagswahlkampf gekürt wurden,<br />
und daran hat auch das magere Ergebnis,<br />
das die beiden mit ihrem Kurs in Richtung<br />
Schwarz-Grün einfuhren, nichts geändert.<br />
Mit der niedersächsischen Fraktionsvorsitzenden<br />
Anja Piel gab es bei diesem<br />
Parteitag nur eine Anwärterin vom<br />
linken Flügel für den Parteivorsitz, sie<br />
unterlag deutlich. Baerbock holte 64,45<br />
Prozent der Stimmen, Piel 34,78, Habeck<br />
erhielt 81,3 Prozent. Im Vorfeld hatten Özdemir<br />
und Winfried Kretschmann geklagt,<br />
der Flügelpoporz verhindere, dass<br />
die Besten sich durchsetzten. Die Medien<br />
passten sich ihrer Lesart, Talente seien<br />
nur in den Reihen der Realos auffindbar,<br />
bereitwillig an.<br />
Mindestlohn, war da was?<br />
Habeck und Baerbock haben die Devise<br />
ausgegeben, die Partei links der Mitte zu<br />
positionieren, angesichts des gegenwärtigen<br />
Rechtsrucks dürfte das keine allzu<br />
große Herausforderung sein. In seiner<br />
eher feuilletonistisch inspirierten Parteitagsrede<br />
sinnierte Habeck über eine zeitgemäße<br />
Definition des Linksseins. Er kritisierte<br />
die Schere zwischen Arm und<br />
Reich und nahm das Wort Umverteilung<br />
in den Mund. Dass die Jamaika-Regierung<br />
in Schleswig-Holstein gerade den höheren<br />
landeseigenen Mindestlohn einkassiert<br />
hat, verträgt sich allerdings nicht so<br />
ganz mit dieser sozialpolitischen Rhetorik.<br />
Die gebürtige Niedersächsin, die sich<br />
als Wahl-Brandenburgerin für die Energiewende<br />
und gegen den Kohleabbau engagiert,<br />
betonte auf dem Parteitag die<br />
Bedeutung der sozialen Frage und hielt<br />
ein leidenschaftliches Plädoyer für eine<br />
humane Flüchtlingspolitik. Habeck und<br />
Baerbock sind Experten für Umweltpolitik<br />
und Klimaschutz, dass die versierteren<br />
Protagonisten für sozialpolitische Positionen<br />
eher im linken Flügel anzutreffen<br />
sind, wissen sie. Entsprechend deutlich<br />
waren die Signale, die sie in dessen Richtung<br />
sendeten; ohne die Einbindung von<br />
Finanzexperten wie Gerhard Schick oder<br />
der Sozialpolitikerin Katja Dörner wird es<br />
schwierig, einen Kurs links der Mitte einzuschlagen.<br />
Als kleinster Oppositionspartei<br />
in einem Parlament, das deutlich nach<br />
rechts gerückt ist, bleibt den Grünen ohnehin<br />
nichts anderes übrig.<br />
Dass bedeutet allerdings nicht, dass die<br />
Partei sich offensiver um linke Bündnisse<br />
im Bund bemühen wird, als das in den<br />
letzten vier Jahren der Fall war. Özdemir<br />
will weiter um die Gunst der FDP-Klientel<br />
buhlen, Habeck gehört einer Jamaika-Regierung<br />
an und Baerbock hat für den Fall,<br />
dass eine schwarz-rote Koalition nicht zustande<br />
kommt, eine erneute Jamaika-Sondierung<br />
in Aussicht gestellt. Die erste<br />
Runde hat wohl noch nicht ausreichend<br />
für Ernüchterung gesorgt, obwohl die<br />
Grünen dabei eine Flexibilität an den Tag<br />
legten, die viele ihrer Anhänger nicht begeistert<br />
haben dürfte. Die Grünen werden<br />
zwar gerade für ihre Erneuerung gefeiert,<br />
aber auch bei der CSU hat eine Personalrochade<br />
begonnen, die deren Schwesterpartei<br />
noch bevorsteht. Angesichts einer<br />
CSU, die AfD-Positionen abräumt und eines<br />
extrem konservativen CDU-Nachwuchses,<br />
fragt man sich, was noch passieren<br />
muss, damit die Ökopartei ihren<br />
Traum von Schwarz-Grün beerdigt.<br />
ISBN 978-3-89438-636-8 | 189 Seiten | € 14,90<br />
Tel. (02 21) 44 85 45 | mail@papyrossa.de | w w w . p a p y r o s s a . d e<br />
Der Genosse im grauen Hemd heißt Kevin Kühnert und ist drei Jahre jünger als Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz<br />
Keine Überlebenden<br />
SPD Warum ein neuer Aufbruch nur von der Parteijugend ausgehen kann<br />
■■Michael Jäger<br />
Tritt ein, sag Nein“, die Kampagne<br />
der Jusos zur Verhinderung<br />
der Großen Koalition scheint<br />
sehr erfolgreich zu sein. Es kann<br />
zwar sein, dass viele Menschen<br />
mehr von der Debattenkultur angezogen<br />
wurden, die sich auf dem jüngsten Parteitag<br />
gezeigt hat, als von der Möglichkeit des<br />
Neinsagens. Aber dann hätten die Jusos das<br />
Verdienst, solche Menschen ermutigt zu<br />
haben. Der Parteivorstand der SPD hat die<br />
Legitimität der Kampagne in Zweifel gezogen.<br />
Verhindern konnte er sie nicht, aber<br />
einen Stichtag setzte er fest: Bis 6. Februar,<br />
18 Uhr, muss eine Aufnahmebestätigung<br />
durch den Ortsverein vorliegen, um am<br />
Entscheid über die Koalition teilnehmen zu<br />
können. Es stellt sich nun die Frage nach<br />
der Legitimität des Stichtags.<br />
Seine Setzung legt nahe, es sei unzumutbar,<br />
jemanden mit abstimmen zu lassen,<br />
der oder die noch während des Abstimmungszeitraums<br />
einträte. Aber was wäre<br />
dagegen einzuwenden? Die Kontroverse,<br />
um die es geht, hat doch ihrerseits einen<br />
Zeitraum von vier Jahren, eine ganze Legislaturperiode,<br />
zum Gegenstand. Warum soll<br />
es dann wichtig sein, wann genau jemand<br />
eintritt im Verlauf des Monats Februar, um<br />
die Große Koalition verneinen oder bejahen<br />
zu können? Welches Bild vom Wesen<br />
einer Partei steht hinter der Stichtagsetzung?<br />
Etwa das Marktmodell von Politik,<br />
das ja ohnehin ständig Boden gewinnt?<br />
In diesem Modell, das bis auf Max Weber<br />
zurückgeht, erscheint eine Partei als ein<br />
Unternehmen, das mit anderen Parteien<br />
gleichsam um Verkaufsanteile ringt, als<br />
welche sich die Stimmanteile dann darstellen.<br />
Der Profitmaximierung der Unternehmen<br />
entspräche die Stimmenmaximierung.<br />
Eine solche Partei sollte eine breite<br />
freiwillige Mitgliedschaft am besten gar<br />
nicht haben, weil sie die Flexibilität und<br />
Schlagkraft des Verkaufskonzerns tendenziell<br />
behindert. Denn Mitglieder stellen<br />
Forderungen und diese greifen in die unternehmerische<br />
Dispositionsfreiheit ein.<br />
Das Leid die SPD-Führung um Martin<br />
Schulz ist tatsächlich von dieser Art. Es<br />
geht darum, ob die Autorität der „flexiblen“<br />
Wendungen des Vorsitzenden erhalten<br />
bleiben kann oder nicht: von der „Großen<br />
Koalition unter meiner Führung“ über das<br />
entschiedene Nein bis zum ebenso entschiedenen<br />
Ja, alles in wenigen Monaten!<br />
Das Problem ist nur: Es geht gar nicht<br />
um Stimmenmaximierung. Denn die hätte<br />
für einen konsequenten, nachhaltigen Kurs<br />
gegen die Große Koalition gesprochen,<br />
seitdem der „Schulz-Hype“ vor einem Jahr<br />
schon einmal eine Eintrittswelle ausgelöst<br />
und auch dazu geführt hatte, dass die SPD<br />
die Union kurzzeitig in der Wählergunst<br />
überholte. Ursache war der Abschied von<br />
der Agenda 2010, der sich damals anzudeuten<br />
schien. Das Kontinuierliche am Zickzackkurs<br />
der Parteiführung ist aber offenbar<br />
das Festhalten an der Agenda. Wenn<br />
man ihre Handlungen im Marktmodell interpretiert,<br />
betreibt sie Stimmenmaximierung<br />
nicht für die SPD, sondern für die Große<br />
Koalition, die schon immer das Subjekt<br />
der Agenda gewesen ist.<br />
Die Jusos handeln nach einem anderen<br />
Modell. Sie halten noch daran fest, dass<br />
Parteien den Willen der Wähler aufnehmen<br />
und in politische Entscheidungen<br />
übersetzen sollen. Das gelingt desto besser,<br />
je mehr wählende Bürger auch Parteimitglieder<br />
werden, denn dann nehmen diese<br />
nicht nur an Abstimmungen teil, sondern<br />
auch daran, wie die Abstimmungsfragen<br />
formuliert werden. Tatsächlich geht darum<br />
in Wahrheit die derzeitige Kontroverse innerhalb<br />
der SPD. „Große Koalition ja oder<br />
nein“ ist nur die Oberfläche der Kontroverse.<br />
Was dahintersteht, hat die Fraktionsvorsitzende<br />
Andrea Nahles in ihrer Parteitagsrede<br />
formuliert: Ist die SPD dazu da, für<br />
„das Kleine“ zu kämpfen? Was unausgesprochen<br />
hieß: für kleine Verbesserungen<br />
innerhalb der fortgesetzten Agenda-Politik,<br />
für welche die Große Koalition steht?<br />
Oder soll die SPD zu dem zurückkehren,<br />
was vor Gerhard Schröder sozialdemokratische<br />
Politik gewesen ist? Dann würde man<br />
„das Kleine“ in einem anderen Rahmen<br />
durchsetzen als dem, den eine Kanzlerin<br />
Angela Merkel absteckt.<br />
Die Partei hat<br />
niemanden<br />
wie Jeremy<br />
Corbyn in<br />
ihren Reihen<br />
In diesem Zusammenhang ist daran zu<br />
erinnern, dass die SPD eine Austrittswelle<br />
erlebte, schon als Gerhard Schröder die<br />
Praxisgebühr bei Arztbesuchen durchgesetzt<br />
hat. Das war noch vor der Agenda,<br />
kündigte sie aber bereits an.<br />
Jetzt kommt Kevin<br />
Dass die Front nun zwischen dem Vorstand<br />
und den Jusos verläuft, hat eine über die<br />
Stichtag-Frage noch weit hinausreichende<br />
Bedeutung. Denn egal wie die Mitgliederabstimmung<br />
ausgehen wird, der Streit wird<br />
nicht enden. Er dreht sich um eine Frage,<br />
die an und für sich mit dem Unterschied<br />
„jung oder alt“ gar nichts zu tun hat. Und<br />
doch ist es kein Zufall, dass er sich mit ihm<br />
verbindet. Man braucht bloß nach England<br />
zu schauen. Dort hat sich eine analoge Kontroverse<br />
mit der Figur Jeremy Corbyns verbunden,<br />
der längst nicht mehr jung ist.<br />
Auch das war kein Zufall: Corbyn war<br />
gleichsam ein Überlebender der Zeit, bevor<br />
die Labour Party von Tony Blair, gegen den<br />
er stets gekämpft hatte, gewendet worden<br />
ist. Dass Einzelne übrig bleiben und eine<br />
Rückkehr zu verdrängten Problemlagen ermöglichen,<br />
ist ein typisches strukturelles<br />
Phänomen politischer, überhaupt gesellschaftlicher<br />
Entwicklung. Aus diesem<br />
Grund hat ein Adorno so große Bedeutung<br />
erlangen können. Er war ja, unfreiwillig<br />
zwar, in der Sache aber nachvollziehbar, ein<br />
wichtiger Stichwortgeber der 68er Revolte<br />
in Westdeutschland. Die SPD hat aber solche<br />
Überlebenden nicht mehr zu bieten.<br />
Deshalb kann ein Aufbruch zur Rückkehr<br />
nur von der Parteijugend ausgehen.<br />
Und wiederum ist das ist kein Zufall.<br />
Man kann es mit dem Unterschied der<br />
Wahlsysteme erklären. In Großbritannien<br />
gilt das Mehrheitswahlrecht. Da hätten<br />
Parteiaustritt und -neugründung Corbyns<br />
Sache nichts genützt. Wenn aber wie in<br />
Deutschland das Verhältniswahlrecht gilt,<br />
liegt es für einen Oskar Lafontaine nahe,<br />
eben das zu tun. Er wäre der politisch Überlebende,<br />
den die SPD jetzt brauchte. Wenn<br />
aber stattdessen „nur“ die Parteijugend für<br />
genuin sozialdemokratische Politik<br />
kämpft, liegen darin vielleicht sogar noch<br />
mehr Chancen. Wie schnell konnte sich Kevin<br />
Kühnert, der erst Ende November 2017<br />
Juso-Vorsitzender wurde, profilieren! Er ist<br />
nur drei Jahre jünger als Österreichs Bundeskanzler<br />
Sebastian Kurz.<br />
FOTO: KAY NIETFELD/DPA
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Politik <strong>05</strong><br />
Verwandte zur Verwendung<br />
Wissenschaft I Das erstmals vollzogene Klonen von Primaten wirft viele forschungsethische Fragen auf<br />
■■Ulrike Baureithel<br />
Wissenschaft ist Wettbewerb.<br />
Das gilt nicht nur<br />
für die einzelnen Forscher<br />
im Rennen, mit<br />
den besten Ideen und<br />
Studien zuerst auf dem Markt zu sein, sondern<br />
auch für Nationen. Maßen sie sich<br />
früher an der modernsten Kriegsflotte<br />
oder am Bau einer „Wunderwaffe“, hat sich<br />
das Feld des Wettstreits ausgeweitet ins Zivile,<br />
insbesondere die Informations- und<br />
Biotechnologie, wo nicht nur das moderne<br />
Gold zu schürfen ist, sondern auch nationales<br />
Prestige winkt. Nicht umsonst heißen<br />
die beiden Javaneräffchen, die von chinesischen<br />
Forschern kürzlich im Labor geklont<br />
worden sind (siehe Text unten),<br />
Zhong Zhong und Hua Hua: Zusammengezogen<br />
ergibt das „Zhonghua“, die Bezeichnung<br />
für „chinesische Nation“.<br />
Und so muss man die wissenschaftliche<br />
Leistung wohl auch lesen: Es geht weniger<br />
um einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel<br />
oder einen der viel beschworenen<br />
„Durchbrüche“ als zunächst einmal um einen<br />
Wechsel der Flaggen. Denn noch bis<br />
ins Jahr 2000, als Craig Venter das menschliche<br />
Genom als entziffert präsentierte, galt<br />
der angelsächsische Raum als führend in<br />
Bezug auf bio- und reproduktionstechnologische<br />
„Sensationen“, nicht zuletzt weil<br />
eine utilitaristische Ethik den Begründungsrahmen<br />
dafür lieferte. Ian Wilmuts<br />
Klonschaf Dolly war die Ikone hybrider<br />
Züchtungsfantasien, sei es, um landwirtschaftliche<br />
Erträge zu steigern oder um genetisch<br />
identische Tiermodelle für die Forschung<br />
zu erzeugen.<br />
Noch im selben Jahr, als Venter die Welt<br />
und den Menschen mittels vier Buchstabenfolgen<br />
erklären wollte, bastelten in Oregon<br />
Wissenschaftler an der Zerteilung der<br />
Zellen eines Schimpansenembryos, um aus<br />
ihnen identische Äffchen zu klonen. Sie<br />
versuchten damit die komplizierte Methode,<br />
die Wilmut bei seinen Schafen angewandt<br />
hatte, zu umgehen: Statt den Zellkern<br />
zu isolieren und anschließend in eine<br />
weibliche Eizelle einzuführen und den<br />
Klon durch ein Muttertier austragen zu lassen,<br />
splitteten sie den Embryo einfach auf,<br />
um Duplikate zu erhalten. Bei den vier bei<br />
dieser Prozedur entstandenen Äffchen<br />
handelte es sich um die ersten genveränderten<br />
Primaten. Gerald Schatten, der da-<br />
Der Name ist Programm: Zhong Zhong und Hua Hua, zusammen Zhonghua, das heißt: „chinesische Nation“<br />
63 Weibchen<br />
wurden zur<br />
Erzeugung der<br />
beiden<br />
Tiere benötigt<br />
malige Leiter der Forschungsabteilung,<br />
pries sie als „Modelle“ für die Aids-Forschung<br />
und rief damit damals schon die<br />
Tierschützer auf den Plan.<br />
Mittlerweile sind Singapur und China<br />
auf diesem Gebiet auf der Überholspur,<br />
und die Laborkünstler des Instituts für<br />
Neurowissenschaften in Schanghai haben<br />
sich wieder auf Wilmuts Methode besonnen.<br />
Die beiden Affenbabys sind das – zahlenmäßig<br />
eher dürftige – Ergebnis eines<br />
erstmals an Primaten durchgeführten somatischen<br />
Zellkerntransfers. Dürftig, wenn<br />
man bedenkt, dass für dieses Experiment<br />
über 400 Eizellen verbraucht und 260 Embryonen<br />
erzeugt wurden, die auf 63 Affenweibchen<br />
übertragen wurden. 28 Schwangerschaften<br />
ergaben sich, aus ihnen gingen<br />
die besagten beiden Äffchen hervor, eine<br />
aus tierethischer Sicht hochproblematische<br />
Materialschlacht, bei der die Ursprungszelle<br />
jedes Mal so reprogrammiert,<br />
die genetische Uhr sozusagen jedes Mal<br />
zurückgestellt werden muss, damit sich<br />
ein Embryo daraus entwickeln kann.<br />
Tierschützer kritisieren die chinesischen<br />
Klonexperimente als einen Dammbruch,<br />
der, so der Bundesverband „Menschen<br />
für Tierrechte“, zu einer erneuten<br />
„Welle von Affenversuchen“ führen könnte.<br />
Javaäffchen werden insbesondere eingesetzt,<br />
um die Toxizität von Medikamenten<br />
und die Qualität medizinischer Produkte<br />
und Geräte zu prüfen. Der Deutsche<br />
Tierschutzbund befürchtet ebenfalls eine<br />
Ausweitung von Affenexperimenten und<br />
macht auf das Leid der sensiblen Tiere<br />
aufmerksam, die häufig kurz nach der Geburt<br />
unter Schmerzen sterben. Er lehnt<br />
jegliches Tierklonen ab und wirft damit<br />
die generelle Frage auf, ob Klontiere im<br />
Dienst des Menschen produziert und vernutzt<br />
werden dürfen.<br />
Paradoxerweise bringen die einschlägigen<br />
Forscher gerade jedoch den Tierschutz<br />
in Anschlag, um ihre Experimente zu legitimieren.<br />
Denn durch die genetisch identischen<br />
Klontiere, behaupten sie, benötige<br />
man weniger Versuchstiere. Je geringer<br />
nämlich deren genetische Variabilität, desto<br />
genauer die Forschungsergebnisse. Der<br />
„Material“verbrauch beim Klonen wird aus<br />
FOTO: PHOTOSHOT/DPA<br />
dieser Perspektive ausgeglichen durch die<br />
Sparsamkeit beim Einsatz von Versuchstieren.<br />
Man wird allerdings den Verdacht<br />
nicht los, dass die Existenzberechtigung<br />
der beim Klonen verbrauchten Tiere anders<br />
bewertet wird als die der auf natürliche<br />
Weise erzeugten.<br />
Nebulöse Therapieversprechen<br />
Die Wissenschaftsgeschichte zeigt indessen<br />
auch, dass das Modellieren von Versuchstieren<br />
und deren (Ver)nutzung in der<br />
vergleichenden Forschung – etwa der Erbpathologie<br />
– eine lange Spur hin zum Menschenexperiment<br />
hinterlassen hat, durchaus<br />
nicht nur im Nationalsozialismus. Von<br />
daher ist es berechtigt, danach zu fragen,<br />
inwieweit der Klonversuch mit Affen technisch<br />
nicht auch mit anderen Primaten –<br />
also den Menschen – möglich ist und damit<br />
erst der Anfang, selbst wenn man dies<br />
den chinesischen Forschern, die das weit<br />
von sich weisen, nicht persönlich unterstellen<br />
muss.<br />
Zwar hat sich der Ansatz in der Stammzellforschung<br />
mittlerweile verändert, und<br />
zumindest in der westlichen Hemisphäre<br />
wird viel mit „erwachsenen“ Körperzellen<br />
gearbeitet. Das heißt aber noch lange nicht,<br />
dass der Weg von der Möglichkeit zur Tatsächlichkeit<br />
nicht irgendwann doch beschritten<br />
werden könnte. Das reproduktive<br />
Klonen von Menschen wird zwar international<br />
geächtet, ist in vielen Ländern aber<br />
auch nicht verboten. Die lange Auseinandersetzung<br />
in den Vereinten Nationen um<br />
das Klonverbot, die 20<strong>05</strong> mit einer unverbindlichen<br />
Deklaration endete, hat nur<br />
dazu geführt, dass das Handwerken mit<br />
menschlichen Föten und Eizellen inzwischen<br />
unter den Radar der öffentlichen<br />
Aufmerksamkeit gerutscht ist.<br />
Mit Blick auf die Versuche in China stellt<br />
sich zunächst aber weniger die Frage, wie<br />
viele Lichtjahre uns noch vom Menschen-<br />
Klon des Science-Fiction trennen, sondern<br />
die nach dem grundsätzlichen Umgang<br />
mit Kreaturen, die sich der Mensch glaubt<br />
dienstbar machen zu können. Die entwicklungsbiologische<br />
Spanne zwischen patentierter<br />
Onco-Maus und geklontem Makaken<br />
schnurrt plötzlich zusammen, wenn es<br />
um nebulöse Therapieversprechen für den<br />
Menschen geht. Im Unterschied zum Embryonensplitting<br />
stünde mit dem Zellkerntransfer<br />
jedenfalls ein ganzes Heer von Versuchsäffchen<br />
bereit.<br />
ANZEIGE<br />
Äffchen für den Nationalstolz<br />
Wissenschaft II Kein Land investiert so viel Geld in die Genforschung wie China<br />
■■Felix Lee<br />
In Deutschland steht Volkswagen derzeit<br />
wegen Diesel-Abgastests mit Affen<br />
in der Kritik. China hingegen feiert seine<br />
Experimente mit dem nächsten Verwandten<br />
der Gattung Mensch. Wie vergangene<br />
Woche bekannt geworden ist, gelang<br />
es chinesischen Wissenschaftlern, kleine<br />
Javaäffchen aus der Gattung der Makaken<br />
zu klonen. Schon bald sollen geklonte Äffchen<br />
für Tierversuche sogar in Serie gehen.<br />
Dass den chinesischen Wissenschaftlern<br />
überhaupt gelungen ist, Primaten zu klonen,<br />
ist eine echte Überraschung. 22 Jahre<br />
ist die Geburt des berühmten Klonschafs<br />
Dolly her, der ein wahrer Zoo aus geklonten<br />
Tieren folgte: Pferde, Schweine, Rinder<br />
– 23 Tierarten werden seitdem weltweit regelmäßig<br />
geklont. Und keineswegs nur für<br />
wissenschaftliche Zwecke: Eine chinesische<br />
Firma wirbt mit geklonten Kühen, die für<br />
besseres Fleisch mit einem speziellen Gen<br />
ausgestattet sind. In den USA wird Sperma<br />
von geklonten Bullen verkauft. Und in Südkorea<br />
können Hundebesitzer sogar Kopien<br />
ihrer verstorbenen Vierbeiner in Auftrag<br />
geben. Obwohl diese Technik also seit<br />
mehr als 20 Jahren bekannt ist – das Klonen<br />
von Affen klappte bislang nicht.<br />
In den meisten westlichen Ländern sind<br />
Experimente mit Affen, dem nächsten Verwandten<br />
der Gattung Mensch, verpönt; in<br />
Deutschland sind sie sogar verboten. Doch<br />
selbst in Ländern, in denen ethische Bedenken<br />
weniger eine Rolle spielen, gelang es<br />
bislang nicht, Affen zu klonen. Die Embryos<br />
der Primaten starben allesamt ab. Nur 1999<br />
schafften es Forscher in den USA, einen Labor-Affen<br />
in die Welt zu setzen, der dieselben<br />
genetischen Erbsubstanzen besaß wie<br />
ein Artgenosse. Das Klontier war jedoch aus<br />
der einfachen Teilung einer befruchteten<br />
Eizelle im Labor entstanden – und war damit<br />
nichts anderes als ein eineiiger Zwilling.<br />
Dass dem chinesischen Forscherteam<br />
um Qiang Sun vom Institut für Neurowissenschaften<br />
in Schanghai von der Akademie<br />
der Naturwissenschaften der Durchbruch<br />
gelungen ist, lässt sich jedoch nicht<br />
nur auf die nicht vorhandenen ethischen<br />
Bedenken zurückführen, sondern vor allem<br />
auch auf die üppige finanzielle Ausstattung.<br />
Mit viel Geld versucht China seit<br />
Jahren an die Spitze der Gen- und Biotechforschung<br />
zu gelangen und lockt weltweit<br />
Forscher an chinesische Unis. Mehr als<br />
eine halbe Milliarde US-Dollar sind allein<br />
im derzeit laufenden Fünfjahresplan für<br />
die Biotechforschung veranschlagt – so<br />
viel wie in keinem anderen Land.<br />
In China steht die Genforschung denn<br />
auch in einer Reihe mit der Weltraumerkundung<br />
oder den Bau von Superrechnern<br />
Aus aller<br />
Welt lockt<br />
das Land<br />
Wissenschaftler<br />
an seine Unis<br />
und wird als „nationale Aufgabe“ bezeichnet.<br />
Für dieses Ziel müssen auch die beiden<br />
geklonten Affen mit ihren Namen herhalten<br />
(siehe Text oben). Es geht hier also keineswegs<br />
nur um Fortschritte in der Wissenschaft,<br />
sondern auch um Prestige und<br />
Nationalstolz.<br />
Tierschutzrechtliche Bedenken gibt es in<br />
China keine. Während etwa in Europa in<br />
den meisten Laboren vorwiegend mit Ratten<br />
und Schweinen experimentiert wird,<br />
befinden sich in den chinesischen Laboren<br />
Hunderttausende Primaten in Gefangenschaft.<br />
Und Chinas Neuromedizin vermeldet<br />
regelmäßig Erfolge. So ist es chinesischen<br />
Wissenschaftlern bereits gelungen,<br />
eine Variante von Autismus bei Affen auszulösen<br />
und auf diese Weise einen Zusammenhang<br />
zwischen Erbinformationen und<br />
der Verhaltensvariante nachzuweisen.<br />
Auch in der Bevölkerung gibt es nur wenig<br />
ethische Bedenken. Gespeist aus einem<br />
großen Maß an Fortschrittsgläubigkeit und<br />
der Hoffnung, aus wirksamer Forschung<br />
auch rasch ökonomischen Nutzen ziehen<br />
zu können, macht es für die meisten Menschen<br />
in China keinen Unterschied, ob nun<br />
ein Affe gequält wird, ein Schwein oder ein<br />
Huhn. Hauptsache, es dient der Sache.<br />
Hundefleisch wird in einigen Regionen des<br />
Landes schließlich auch noch gegessen.<br />
Wobei: Was das Abschlachten von Hunden<br />
betrifft, regt sich inzwischen doch mitunter<br />
auch Widerstand.<br />
Felix Lee arbeitet seit dem Jahr 2012 als<br />
China-Korrespondent in Peking<br />
1968 – was steckte wirklich<br />
hinter der Revolte?<br />
Heinz Bude, einer der besten<br />
Kenner der deutschen<br />
Gesellschaft, zieht fünfzig<br />
Jahre danach Bilanz.<br />
www.hanser-literaturverlage.de<br />
128 Seiten. Gebunden | Foto: © Dawin Meckel
06 Wochenthema<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Wochenthema<br />
07<br />
Frische Luft täte<br />
dem Mann gut<br />
An einem Ort ohne Zeit<br />
Wikileaks Sechs Jahre ohne Sonnenlicht: zu Besuch bei Julian Assange, dessen<br />
Botschaftsexil wohl trotz eines nahen Gerichtstermins Bestand haben wird<br />
■■Srećko Horvat<br />
In den vergangenen Jahren habe ich<br />
einen Freund sehr oft besucht. Auf<br />
dem Weg zur Botschaft Ecuadors<br />
durch die Straßen des Londonder<br />
Viertels Knightsbridge beschlich<br />
mich jedes Mal das gleiche Gefühl: In der<br />
Hans Crescent Street angekommen, wird<br />
man sofort in eine postmoderne Version<br />
von Saudi-Arabien mitten in der britischen<br />
Hauptstadt teleportiert. Goldfarbene Lamborghinis<br />
und Limited-Edition-Ferraris mit<br />
arabischen Nummernschildern parken vor<br />
einem der luxuriösesten Kaufhäuser der<br />
Welt, das an seinem Giebel auf Latein<br />
wirbt: „Omnia Omnibus Ubique“ – Alle<br />
Dinge für alle Menschen, überall.<br />
Nachdem ich an der Gedenkstätte für<br />
Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed – dem<br />
ältesten Sohn des Milliardärs, der dieses<br />
Kaufhaus gegründet hat – vorbeigegangen<br />
bin, betrete ich die berühmte Luxus-Lebensmittelabteilung<br />
von Harrods, um einen<br />
Hummer für meinen Freund zu kaufen,<br />
der seit sieben Jahren das Meer nicht<br />
mehr gesehen hat. 300.000 Kunden besuchen<br />
dieses Kaufhaus an Spitzentagen. Ich<br />
frage mich, wie viele von ihnen wissen,<br />
dass nur ein paar Meter weiter der wohl berühmteste<br />
Dissident der westlichen Welt<br />
schon mehr als 2.500 Tage lang keinen<br />
Himmel und kein Sonnenlicht mehr gesehen<br />
hat? Von einem Sonnenuntergang am<br />
Meer ganz zu schweigen.<br />
Ich nehme die Rolltreppe hoch zum Ausgang<br />
und lande wieder auf der Straße. Ich<br />
sehe Leute mit Einkaufstüten von Luxus-<br />
Marken vorbeigehen. Andere sitzen im<br />
Gran Caffé Londra und essen Tagliata vom<br />
Thunfisch oder frisches schottisches Lachsfilet,<br />
zu dem sie einen sizilianischen Rosé<br />
mit dem Aroma von Frühlingsblumen und<br />
Erdbeeren trinken. Auf der Straße ist viel<br />
los, Londons Taxis halten an und fahren ab,<br />
ich mache mich auf den Weg zur Botschaft.<br />
Bei meinem letzten Besuch im November<br />
2017 war ich direkt von der kroatischen<br />
Küste hierhergeflogen, hatte keinen teuren<br />
Rosé dabei, sondern eine schlichte Flasche<br />
mit frischem Meerwasser. Ich frage mich,<br />
ob die zahlreichen Überwachungskameras<br />
in der Gegend hier etwas damit anfangen<br />
können. Als ich dann, nach der üblichen<br />
peniblen Kontrolle aller Dinge, die ich dabeihatte,<br />
darunter auch die Flasche Meerwasser,<br />
die ecuadorianische Botschaft betreten<br />
hatte, schaltete ich mein Handy aus<br />
und ließ es beim Wachpersonal. Sobald<br />
man das macht – auch das denke ich jedes<br />
Mal wieder –, betritt man eine andere Zeitzone.<br />
Das weiße Rauschen beginnt ...<br />
Jemand, der noch nie hier war, kann sich<br />
die Szenerie am besten vorstellen, indem<br />
er Alfonso Cuaróns Film Gravity ansieht, in<br />
dem zwei Astronauten im Weltraum festhängen.<br />
Totaler Verlust der Zeitlichkeit.<br />
Einmal war ich zwei Stunden lang drinnen<br />
bei Julian, aber es fühlte sich an wie eine<br />
Ewigkeit. Einmal kam ich heraus und dachte,<br />
ich sei nur zwei Stunden dort gewesen.<br />
Dabei stellte ich fest, dass es bereits sechs<br />
Uhr morgens war. Es gibt keine frische Luft.<br />
Nicht das geringste direkte Sonnenlicht. Jeder<br />
Atemzug, den man macht, jeder Schritt<br />
wird auch in der Botschaft überwacht. Jetzt<br />
stelle man sich vor, fünfeinhalb Jahre dadrin<br />
zu verbringen.<br />
Freude über ein Asterix-Heft<br />
„Was würdest du als Erstes machen, wenn<br />
du die Botschaft verlassen könntest?“, fragte<br />
ich bei einem unserer Treffen, bei permanent<br />
künstlichem Licht. „Ich würde in<br />
den Himmel schauen“, sagte Julian Assange.<br />
Ich fragte ihn, was er in all den Jahren<br />
vermisst hat, in denen er sich in „willkürlicher<br />
Haft“ befand, wie die Vereinten Nationen<br />
im Februar 2016 seine Lage nannten.<br />
Julian antwortete ruhig: „Nichts.“ – „Nicht<br />
einmal den Himmel?“ – „Nein.“<br />
Diese scheinbar widersprüchliche Antwort<br />
ist wahrscheinlich die beste Abkürzung<br />
in den Kopf eines Mannes, der ohne<br />
Zweifel der größte Feind der Geheimdienste<br />
auf der ganzen Welt ist. In seiner ersten<br />
Rede im April 2017 bezeichnete der neue<br />
CIA-Chef Mike Pompeo Julian Assanges Organisation<br />
Wikileaks als „nicht staatlichen<br />
feindlichen Geheimdienst“.<br />
Wie passt zusammen, dass er sofort zum<br />
Himmel schauen würde, sobald er die Botschaft<br />
verlässt, aber den Himmel nicht vermisst?<br />
Ich bin mir sicher, dass er ihn vermisst,<br />
ebenso wie er als Australier das Meer<br />
vermisst. Aber Julian hat seine Situation so<br />
beschrieben: „Es ist nicht so, dass ich diesen<br />
Preis bezahle, weil ich nicht wusste, wie<br />
die Welt funktioniert. Ich wusste, dass ich<br />
einen Preis bezahlen muss, nicht exakt<br />
welchen, aber etwas in der Art. Meine Lage<br />
ist schwierig, aber ich glaube, dass man für<br />
seine Überzeugung eintreten und bezahlen<br />
muss.“ Ich bin sicher, dass er diese Worte<br />
heute ganz genau so wiederholen würde.<br />
Drei in der Behandlung Traumatisierter<br />
erfahrene Ärzte haben kürzlich 20 Stunden,<br />
über drei Tage verteilt, bei Julian Assange<br />
verbracht, um seine physische und psychische<br />
Gesundheit zu untersuchen. Hernach<br />
schrieben sie in einem Offenen Brief im Guardian:<br />
Das anhaltende Gefangensein gefährde<br />
ihn „physisch wie mental“ und verletze<br />
ganz klar sein Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung<br />
(siehe Text unten).<br />
Ich kann bestätigen, dass Julian Assange<br />
all diese Jahre nicht einmal das Menschenrecht<br />
auf Gesundheitsversorgung gewährt<br />
wurde. Vor zwei Jahren verweigerten die<br />
britischen Behörden ihm „Schutz vor Verhaftung“,<br />
um im Krankenhaus eine MRT<br />
seiner verletzten Schulter machen zu lassen.<br />
Die Schulter schmerzt heute noch. In<br />
Großbritannien und Deutschland angefragte<br />
Ärzte lehnten trotz anfänglichen Interesses<br />
ab, ihn in der Botschaft zu untersuchen.<br />
Sie fürchteten um ihre Karriere.<br />
„Alle Dinge für alle Menschen, überall“,<br />
wie es das Harrods-Motto verspricht, gilt<br />
nicht für die Gesundheitsversorgung von<br />
Julian Assange. Mit Ausnahme der mutigen<br />
Ärzte, die gerade ihren alarmierenden<br />
Bericht veröffentlicht haben, zählt nicht<br />
einmal der hippokratische Eid, wenn es um<br />
den Wikileaks-Gründer geht.<br />
Gibt es einen<br />
Antrag auf<br />
Auslieferung in<br />
die USA?<br />
Die Behörden<br />
schweigen<br />
Einmal – es muss im Winter 2015 gewesen<br />
sein – flog ich von Paris nach London<br />
und brachte ihm das neueste Asterix-und-<br />
Obelix-Heft Der Papyrus des Cäsar mit. In<br />
dem Band geht es um Zensur und den<br />
Kampf um Informationen. Der Comicautor<br />
schuf daher einen Charakter, der von Assange<br />
inspiriert ist und ihm ähnelt.<br />
Als er das kleine Geschenk entgegennahm,<br />
glänzten Julians Augen. Auf die Frage,<br />
wie er es finde, zum Comic-Charakter<br />
geworden zu sein, antwortete er: „In einem<br />
Asterix-Heft zu erscheinen, das ist besser,<br />
als den Nobelpreis zu erhalten. Es gibt<br />
mehr Nobelpreis-Gewinner als Leute, die in<br />
einem Asterix-Heft vorkommen.“<br />
Genau diese charakteristische Antwort<br />
und Asterix können uns dabei helfen, Wikileaks<br />
besser zu verstehen. In der Comicreihe<br />
wird ganz Gallien vom Römischen<br />
Reich beherrscht, nur nicht ein kleines<br />
Dorf in der heutigen Bretagne, dessen Bewohner<br />
ein Zaubertrank unbesiegbar<br />
macht. Ganz ähnlich ist Wikileaks eine winzige<br />
Organisation, die seit Jahren die<br />
schmutzigen Geheimnisse der führenden<br />
Mächte der Welt von den USA bis Russland,<br />
von Saudi-Arabien bis Syrien, von der EU<br />
bis zu Google veröffentlicht.<br />
Was ist der „Zaubertrank“ von Wikileaks?<br />
„Kryptografie“, sagt Julian Assange, Datenverschlüsselung.<br />
Aber in der Realität läuft<br />
es nicht immer wie im Comic.<br />
Sofort nachdem Wikileaks im November<br />
2010 „Cablegate“ veröffentlicht hatte – zu<br />
diesem Zeitpunkt der größte Satz an vertraulichen<br />
Daten, der je an die Öffentlichkeit<br />
gelangte –, wurde im US-Bundesstaat<br />
Virginia eine geheime Grand Jury eingesetzt:<br />
eine Instanz, die in einem nicht öffentlichen<br />
Verfahren prüft, ob die von der<br />
Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise für<br />
eine Anklage wegen eines Verbrechens reichen.<br />
Die US-Behörden leiteten eine Untersuchung<br />
ein und bereiteten die Anklage<br />
gegen Assange und Wikileaks vor, während<br />
Chelsea Manning im Knast landete.<br />
Genau zu diesem Zeitpunkt wählten Angehörige<br />
des Tiefen Staates in den USA ein<br />
paar Telefonnummern; schnell brachten<br />
sie Visa, Mastercard, Amazon und Paypal<br />
dazu, Spenden an Wikileaks zu blockieren.<br />
Ähnliches geschah in Bezug auf die Freedom<br />
of Press Foundation, eine Stiftung, die<br />
vor allem als Reaktion auf die Bankenblockade<br />
gegen Wikileaks gegründet worden<br />
war und die vor Kurzem aufgehört hat,<br />
Spenden abzuwickeln. Wenn der CIA-Chef<br />
jemanden als „feindliche nicht staatliche<br />
Organisation“ behandelt, nachdem Hillary<br />
Clinton, Joseph Biden und andere ihn als<br />
„Terroristen“ bezeichnet haben und es sogar<br />
Stimmen gibt, die fordern, ihn durch<br />
eine Drohne zu töten, dann ist offensichtlich,<br />
warum Julian Assange nicht einmal<br />
das elementare Recht auf Gesundheitsversorgung<br />
gewährt wird.<br />
Ein bohrender letzter Blick<br />
Seit meinem letzten Besuch in der ecuadorianischen<br />
Botschaft in London im vergangenen<br />
November hat sich viel verändert.<br />
Oder: Es scheint sich viel geändert zu haben,<br />
denn noch immer ist Julians Zukunft<br />
ungeklärt. Er hat die ecuadorianische<br />
Staatsbürgerschaft erhalten, und seine Anwälte<br />
haben vor einem britischen Gericht<br />
die Aufhebung des Haftbefehls beantragt,<br />
der ihn daran hindert, die Botschaft zu verlassen.<br />
Da der sogenannte schwedische Fall<br />
keiner mehr ist, weil die Ermittlungen wegen<br />
des Vorwurfs einer Sexualstraftat in<br />
Schweden eingestellt worden sind, habe<br />
der Haftbefehl seinen Zweck verloren, so<br />
argumentieren die Anwälte.<br />
Aber selbst wenn das zuständige Gericht<br />
am 6. Februar entscheiden sollte, den Haftbefehl<br />
aufzuheben, bleibt das eigentliche<br />
Problem bestehen: Die britischen Behörden<br />
weigern sich, zu beantworten, ob es<br />
einen Auslieferungsantrag der USA gibt.<br />
Als die Journalistin Stefania Maurizi jüngst<br />
beantragte, Dokumente in Zusammenhang<br />
mit Assange und dessen Auslieferung freizugeben,<br />
gab die britische Staatsanwaltschaft<br />
sogar zu, wichtige E-Mails in dieser<br />
Angelegenheit vernichtet zu haben.<br />
Am Ende stehen wir wieder ganz am Anfang.<br />
Nach all den Jahren, inklusive des<br />
schwedischen „Ermittlungsverfahrens“ – es<br />
war niemals eine Anklage – und der Dämonisierung<br />
von Wikileaks, kommen wir auf<br />
den wahren Grund dafür zurück, dass Julian<br />
so lange in der ecuadorianischen Botschaft<br />
ausharren musste. Der Grund ist<br />
ganz einfach: Das Imperium wird diese<br />
kleine Gruppe Gallier niemals tolerieren.<br />
Jedes Mal, wenn ich die Botschaft in London<br />
verließ und Julians bohrenden letzten<br />
Blick spürte, hatte ich die gleichen Gedanken.<br />
War es diesmal mein letzter Besuch<br />
hier, in dieser postmodernen Gefängniszelle<br />
inmitten einer westlichen Metropole?<br />
Oder werde ich wiederkommen, frisches<br />
Meerwasser oder andere Spuren von Freiheit<br />
mitbringen, die er genauso verdient<br />
wie wir, die wir in den Himmel schauen<br />
und die Sonne genießen können?<br />
Ich weiß nicht, was Julian in der Zwischenzeit<br />
mit dieser Flasche mit Meerwasser<br />
gemacht hat. Aber ich hoffe, sie bleibt<br />
– auch nachdem er wieder frei ist – noch<br />
lange dort in der Hans Crescent Street 3,<br />
gegenüber von Harrods. Als Erinnerung daran,<br />
dass Freiheit eine kostbare Sache ist<br />
und dass es Dinge gibt, die es wert sind, sie<br />
mit ihrem Verlust zu bezahlen: Denn was<br />
bringt die Freiheit, im Meer zu schwimmen,<br />
wenn man an rein gar nichts glaubt?<br />
Srećko Horvat ist Philosoph, Autor und<br />
Mitbegründer der Bewegung DiEM25<br />
Übersetzung: Carola Torti<br />
Er braucht dringend ärztliche Behandlung<br />
Traumata Drei Mediziner fordern in einem offenen Brief, Julian Assange das Menschenrecht auf Gesundheit nicht länger zu verwehren<br />
■■S. Crosby, B. Chisholm, S. Love<br />
Seit fast sechs Jahren hat der Gründer<br />
von Wikileaks, Julian Assange, keinen<br />
Schritt aus dem stark überwachten<br />
Gebäude der ecuadorianischen<br />
Botschaft in London getan, in die er sich<br />
geflüchtet hat. Die Medien haben sich natürlich<br />
in erster Linie für das internationale<br />
juristische Drama rund um seine<br />
Person und um die Bedrohung seiner Sicherheit<br />
interessiert, vor allem um seine<br />
mögliche Verhaftung und Auslieferung<br />
an die USA. Über die laufende Verletzung<br />
seiner Menschenrechte, wie etwa das<br />
Grundrecht auf Gesundheitsversorgung,<br />
wurde dagegen weniger berichtet.<br />
Als Klinikärzte, die zusammen über 40<br />
Jahre Erfahrung mit der Behandlung von<br />
Flüchtlingen und anderen traumatisierten<br />
Bevölkerungsgruppen verfügen, haben<br />
wir Julian Assange im vergangenen<br />
Oktober innerhalb von drei Tagen 20<br />
Stunden lang umfassend körperlich und<br />
psychologisch untersucht. Die Ergebnisse<br />
unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.<br />
Aber unserer Meinung nach gefährdet<br />
Julian Assanges anhaltende Gefangenschaft<br />
seine körperliche und geistige<br />
Gesundheit und stellt einen klaren<br />
Verstoß gegen sein Menschenrecht auf<br />
Gesundheit und damit auf den Zugang zu<br />
Gesundheitsversorgung dar.<br />
Nachdem wir unübersehbar dabei fotografiert<br />
worden waren, wie wir die Botschaft<br />
mit Stethoskop und Blutdruckmessgerät<br />
ausgestattet betraten, führten<br />
wir unsere Untersuchung in einem<br />
schlecht belüfteten Konferenzsaal durch.<br />
Wir untersuchten Julian Assange unter<br />
diesen Bedingungen, weil er keinen Zugang<br />
zu ordentlichen medizinischen Einrichtungen<br />
hat. Zwar können Mediziner<br />
ihn in der Botschaft aufsuchen, aber die<br />
meisten Ärzte zögern. Zudem sind die Behandlungsmöglichkeiten<br />
begrenzt. All die<br />
Diagnoseprogramme, Behandlungen und<br />
Verfahren, die er unserem Befund nach<br />
dringend bräuchte, stehen in der Botschaft<br />
nicht zur Verfügung.<br />
Als Flüchtling anerkannt<br />
Als Krankenhausärzte haben wir die ethische<br />
Pflicht, uns für die Gesundheit und<br />
Menschenrechte aller Menschen einzusetzen,<br />
wie sie das internationale Recht<br />
vorsieht, und unsere Kolleginnen und<br />
Kollegen aufzufordern, von unseren Berufsverbänden,<br />
Institutionen und Regierungen<br />
Rechenschaft einzufordern.<br />
Im Jahr 2012 hat Ecuador in Einklang<br />
mit seinem Recht als souveräner Staat Julian<br />
Assange formal als Flüchtling anerkannt.<br />
Er erfüllt demnach die in der Genfer<br />
Flüchtlingskonvention von 1951 und<br />
im dazugehörenden Protokoll von 1967<br />
festgeschriebenen Voraussetzungen. Unabhängig<br />
von den Vorwürfen gegen ihn<br />
ist er australischer Staatsbürger und<br />
Flüchtling, und mittlerweile auch Staatsbürger<br />
von Ecuador.<br />
2016 befand die Arbeitsgruppe der UN<br />
für willkürliche Inhaftierung, dass Julian<br />
Assanges Situation in der ecuadorianischen<br />
Botschaft zu einem „willkürlichen<br />
Freiheitsentzug“ geworden ist. Nach ihrer<br />
Ansicht ist die Botschaft nicht für längere<br />
Inhaftierungen ausgestattet, es mangelt<br />
an der notwendigen medizinischen Ausstattung<br />
– eine Einschätzung, die wir teilen.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass die anhaltende<br />
Unsicherheit unbefristeter Gefangenschaft<br />
tiefe psychologische und<br />
physische Traumata auslöst, die über die<br />
absehbaren Stressfaktoren von Inhaftierung<br />
hinausgehen. Dazu gehören große<br />
Anspannung, krankhaftes Stressempfinden,<br />
dissoziative Störungen, Depression,<br />
Selbstmordgedanken, posttraumatische<br />
Belastungsstörung und chronische<br />
Schmerzen.<br />
Julian Assange sieht sich glaubhaften<br />
Drohungen gegen seine Person seitens<br />
verschiedener Regierungen und Einzelpersonen<br />
gegenüber. Wegen der Bedrohung,<br />
bei Verlassen der Botschaft sofort<br />
verhaftet zu werden, ist er zudem nicht<br />
einmal bei einem medizinischen Notfall<br />
in der Lage, sein Recht auf Zugang zu medizinischen<br />
Einrichtungen wahrzunehmen.<br />
Es ist unzumutbar, dass er sich entscheiden<br />
muss, ob er um eine Verhaftung<br />
zu vermeiden, mögliche Gesundheitsfolgen<br />
bis hin zum Tod in Kauf nimmt, etwa<br />
im Fall eines Herzinfarkts.<br />
Verletzung der UN-Norm<br />
Zudem haben unsere Untersuchungen gezeigt,<br />
dass er seit fünfeinhalb Jahren ohne<br />
Sonnenlicht, adäquate Belüftung oder<br />
Aufenthalt an der frischen Luft leben<br />
muss. Das hat deutlichen Tribut gefordert.<br />
Unserer professionellen Ansicht nach<br />
sind die physischen und psychologischen<br />
Bedingungen, unter denen Julian Assange<br />
lebt, eine Verletzung der UN-Mindestanforderungen<br />
für die Behandlung von Gefängnisinsassen.<br />
Wir müssen fragen: Wieso bleibt Julian<br />
Assange sein Menschenrecht auf medizinische<br />
Versorgung verwehrt? Dürfen Staaten<br />
entscheiden, wer dieses Grundrecht<br />
hat und wer nicht?<br />
Wir appellieren an die British Medical<br />
Association und alle Kollegen in Großbritannien,<br />
sicheren Zugang zu medizinischer<br />
Versorgung für Assange zu fordern<br />
und sich offen gegen die Verletzung seines<br />
Menschenrechts auf Gesundheit auszusprechen.<br />
Angesichts der Spannungen<br />
zwischen Großbritannien und Ecuador<br />
über Julian Assanges unhaltbare Situation,<br />
haben Medien von neuen Plänen zur<br />
diplomatischen Lösung des Problems mithilfe<br />
eines Mediators berichtet. Solche Gespräche<br />
müssen eine faire und transparente<br />
Diskussion über den Zugang zu Gesundheitsversorgung<br />
enthalten. Das ist<br />
unserer Ansicht nach der einzige Weg,<br />
richtig und ethisch zu handeln. Wir unterstützen<br />
die wenigen Ärzte, die versucht<br />
haben, unter diesen schwierigen Bedingungen<br />
Julian Assange zu versorgen.<br />
Sondra S Crosby ist Ärztin und Professorin an<br />
der School of Medicine der Boston University.<br />
Brock Chisholm ist Psychologe und Mitglied<br />
des Vorstands der britischen Gesellschaft<br />
für Psychotraumatologie. Sean Love arbeitet<br />
in Boston als Arzt in Ausbildung<br />
Übersetzung: Carola Torti<br />
FOTO: JUSTIN TALLIS/AFP/GETTY IMAGES<br />
Anarchie Gegen den Staat<br />
oder nicht? Das ist<br />
Assanges einziger Maßstab.<br />
Ein Linker war er nie<br />
■■Wolfgang Michal<br />
Am 25. Dezember tauchte dieser seltsame<br />
Tweet auf: „Julian Assange“.<br />
Nur der Name. In Anführungszeichen.<br />
Absender: die Kriegsmarine der Vereinigten<br />
Staaten. Was bedeutete das? War<br />
es ein Codewort für eine verdeckte Operation<br />
der Navy Seals? Oder ein Weihnachtsscherz?<br />
In der Silvesternacht dann eine<br />
neue Botschaft. Diesmal von Julian Assange.<br />
Einem Verschlüsselungscode folgte der<br />
Hinweis auf das Lied Paper Planes der britischen<br />
Sängerin M.I.A. War Assange tot?<br />
Oder gekidnappt? Seine Follower gerieten<br />
in helle Aufregung.<br />
Julian Assange liebt solche Versteckspiele.<br />
Was sollte er auch sonst tun in seinem<br />
„Gefängnis“ in London? Früher war er ein<br />
Held, ein unerschrockener Kämpfer gegen<br />
korrupte Diktatoren und kriegslüsterne Regierungen.<br />
Er entriss ihnen Geheimnisse<br />
und publizierte sie auf seiner Plattform<br />
Wiki leaks. Die Medien rissen sich um ihn,<br />
die New York Times, der Guardian und die<br />
Washington Post. Von Le Monde wurde er<br />
zum „Mann des Jahres“ gewählt, von Amnesty<br />
International mit einem Preis geehrt.<br />
Er nannte sich Chefredakteur und gab dem<br />
zahnlosen Journalismus den Kampfgeist<br />
zurück. Als er sich im Dezember 2010 der<br />
britischen Polizei stellte, zahlten Prominente<br />
für ihn die Kaution, darunter die Filmemacher<br />
Michael Moore und Ken Loach.<br />
Auch Bianca Jagger, Yanis Varoufakis, Roberto<br />
Saviano, Glenn Greenwald und Noam<br />
Chomsky unterstützten ihn. Der spanische<br />
Staranwalt Baltasar Garzon übernahm kostenlos<br />
seine Verteidigung.<br />
Gegen die<br />
NATO, gegen<br />
Drohnen,<br />
für WikiLeaks<br />
– er mag<br />
die Libertären<br />
Doch die Ermittlungen der schwedischen<br />
Justiz wegen sexueller Übergriffe an zwei<br />
Frauen im August 2010 machten aus dem<br />
Helden ein „Sex-Monster“ und drängten<br />
die Enthüllungen von Wikileaks in den<br />
Hintergrund. Fast sieben Jahre wanderten<br />
die Vorwürfe durch die Medien, ohne dass<br />
jemals Anklage erhoben wurde, dann stellte<br />
Schweden die Ermittlungen ein.<br />
Der Haftbefehl sei damit hinfällig, argumentierten<br />
die Anwälte, doch die britische<br />
Polizei kündigte an, sie werde Assange festnehmen,<br />
sobald er die Botschaft verlasse.<br />
Mit seiner Flucht in die Botschaft habe er<br />
gegen die Kautionsauflagen verstoßen. Am<br />
6. Februar soll ein Gericht entscheiden, ob<br />
der Haftbefehl wegen der angegriffenen<br />
Gesundheit Assanges aufgehoben wird.<br />
Der siebenjährige Kampf durch alle Instanzen<br />
hat Spuren hinterlassen. Er habe<br />
depressive Zustände, schlechte Zähne und<br />
Herzprobleme, hieß es im Rahmen der Verhandlung<br />
seines Antrags auf Aufhebung<br />
des Haftbefehls. Assange selber inszeniert<br />
sich weiterhin als Kämpfer. Was bleibt ihm<br />
auch übrig? Würde er in die USA ausgeliefert,<br />
müsste er mit der Todesstrafe rechnen.<br />
Denn CIA-Chef Mike Pompeo hält<br />
Wiki leaks nicht für ein Nachrichtenmedium,<br />
sondern für einen „feindlichen Geheimdienst“.<br />
Justizminister Jeff Sessions<br />
nennt die Überstellung von Julian Assange<br />
deshalb ein vordringliches Anliegen der<br />
US-amerikanischen Politik.<br />
Problematisch ist, dass viele Menschen<br />
der offiziellen US-Version inzwischen Glauben<br />
schenken. Sie meinen, Assange sei auf<br />
Abwege geraten. Er sei politisch nach<br />
rechts gerückt und verhalte sich wie ein<br />
Verschwörungstheoretiker. Sein egozentrischer<br />
Kampf gegen alle, die nicht seiner<br />
Meinung sind, habe das Anliegen von Wiki-<br />
leaks verraten. Auf den ersten Blick ist die<br />
Distanzierung verständlich.<br />
Seit Assange in der Botschaft festsitzt,<br />
scheint er sich immer weiter von seinen<br />
ursprünglichen Zielen zu entfernen. Er<br />
nennt sich jetzt „Analytiker der Geopolitik“<br />
und nicht mehr „Chefredakteur“. Er hat den<br />
Job des bedingungslosen Aufklärers mit<br />
dem des selbst ernannten Politikberaters<br />
und Nachrichtenhändlers vertauscht. Viele<br />
verübeln ihm, dass er seine Interview-Serie<br />
The World Tomorrow ausgerechnet beim<br />
russischen Staatssender Russia Today unterbrachte,<br />
dass er im US-Wahlkampf mit<br />
der gezielten Veröffentlichung der Mail-<br />
Kommunikation der Demokratischen Partei<br />
die Kampagne von Donald Trump unterstützte,<br />
dass er einem Sohn Trumps liebedienerische<br />
Vorschläge unterbreitete,<br />
wie man Hillary Clinton weiter schaden<br />
könne und dass er dem ultrarechten Sender<br />
Fox News ein einstündiges Interview<br />
gewährte, in dem er über die geleakten E-<br />
Mails der US-Demokraten sagte: „Es gibt<br />
nur einen in der Welt, der genau weiß, wie<br />
das gelaufen ist. Und das bin ich.“ Statt den<br />
Sachverhalt aber aufzuklären, ergötzte er<br />
sich an den Mutmaßungen, Hacker des<br />
russischen Geheimdienstes hätten die<br />
Mails besorgt und dann an Wikileaks weitergeleitet.<br />
Er will der große Undurchschaubare<br />
bleiben.<br />
Kurz hoffte er auf Trump<br />
Das aber ist er nicht. Betrachtet man sein<br />
Verhalten einmal von seiner Warte, wird<br />
schnell klar, dass er sich gar nicht so sehr<br />
verändert hat. Assange war nie ein Linker.<br />
Das Leaken von Dokumenten betrachtet er<br />
als „anarchistische Tat“. Jede Regierung, die<br />
Geheimnisse hat, ist für ihn eine Verschwörung,<br />
die zerstört werden muss. Gegenüber<br />
Fox News betonte er, er hätte „die Mails<br />
auch veröffentlicht, wenn sie das Trump-<br />
Lager getroffen hätten“. Julian Assange<br />
handelt treu nach den anarchistischen<br />
Grundsätzen, die er 2006 in seiner Schrift<br />
„Conspiracy as Governance“ entwickelt hat.<br />
Er will die Kommunikationsflüsse der<br />
Mächtigen behindern. Sein Motto: „Lasst<br />
uns Ärger machen.“<br />
Dass er in seiner „Gefängniszelle“ auch<br />
nach jedem Strohhalm greift, der ihm die<br />
Freiheit verspricht, kann man ihm nicht<br />
verdenken. Barack Obama und Hillary Clinton<br />
haben ihn – wegen der Veröffentlichung<br />
des „Collateral Murder“-Videos und<br />
der peinlichen US-Depeschen – in seine<br />
jetzige Lage gebracht, von den US-Demokraten<br />
war nichts zu erwarten. Auch nicht<br />
von Bernie Sanders. Also suchte er sich Hilfe<br />
woanders.<br />
Im August 2013 bekannte er erstmals seine<br />
Bewunderung für den libertären Flügel<br />
der US-Republikaner. Dessen Repräsentanten,<br />
Ron und Rand Paul, hatten 2008 die<br />
„Campaign for Liberty“ ins Leben gerufen,<br />
eine direkte Vorläuferorganisation der Tea-<br />
Party-Bewegung. Die Libertären verbinden<br />
ihren Kampf für die Freiheit mit einer radikalen<br />
Kritik am übermächtigen Staat. So<br />
verteidigte Ron Paul nicht nur die Freiheit<br />
von Wikileaks, er verurteilte auch den Patriot<br />
Act, der nach den Terroranschlägen<br />
von 2001 die Bürgerrechte beschnitt. Er<br />
lehnte die US-Militärinterventionen im Kosovo,<br />
in Afghanistan, im Irak und in Libyen<br />
ab, er wandte sich gegen den Drohnenkrieg<br />
und gegen die NATO, gegen die Militarisierung<br />
der Polizei und die Datensammelwut<br />
der NSA. Das gefiel Assange. Allerdings fordern<br />
die Libertären auch die Abschaffung<br />
der staatlichen Sozialversicherungssysteme.<br />
Ökonomisch stehen sie den Marktradikalen<br />
August von Hayek und Ludwig von<br />
Mises nahe. Für Assange spielte das keine<br />
Rolle. Wirtschaft und Soziales interessieren<br />
ihn nicht. Er ist, wie gesagt, kein Linker.<br />
Auch in Donald Trump erkannte Assange<br />
einen Verbündeten. Wie Ron Paul hasst<br />
Trump die demokratische Elite in Washington.<br />
Trump kritisierte die Geheimdienste<br />
und lobte das Wirken von Wikileaks. „I love<br />
Wikileaks“, tönte er auf seiner Wahlkampftour<br />
im Oktober 2016. Das schmeichelte<br />
dem in London schmorenden Wikileaks-<br />
Gründer und vernebelte ihm jeden Realitätssinn.<br />
Er dachte, er könne auf dem Ticket<br />
von Trump seine Freiheit wiedererlangen.<br />
Diese Selbsttäuschung „enthüllt“, was<br />
Assange in Wahrheit ist: ein unpolitischer<br />
Anarchist, der sich überschätzt und die Politik<br />
allein danach bewertet, ob sie gegen<br />
den Staat ist oder nicht. Es wird Zeit, dass<br />
ihm viel frische Luft die Gedanken durchpusten<br />
kann.
08<br />
Politik<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Der gemeine Wahlbürger wünscht sich meist eine verlässliche Macht, die ihn trägt<br />
FOTO: SUSANA VERA/REUTERS<br />
Podemos von rechts<br />
Spanien Der Katalonien-Konflikt hat eine konservative Wende begünstigt,<br />
die von der Partei Ciudadanos angeführt wird<br />
■■Conrad Lluis Martell<br />
Für die Bürger ist 2017 ein negatives,<br />
beunruhigendes Jahr gewesen.<br />
Die Minderheitsregierung<br />
Mariano Rajoys übte sich im Stillstand<br />
… Sie betrieb keine Politik,<br />
es ging ihr nur noch um Machterhalt. Doch<br />
auch der Opposition gelang es nicht, eine<br />
Alternative aufzubieten. Das Land ist wie<br />
gelähmt. Und das schon seit Jahren.“ Das<br />
Urteil der Journalistin Lucia Méndez legt<br />
offen, was jenseits des Krisenherdes Katalonien<br />
in Spanien geschieht. So gut wie<br />
nichts. Die Fanfaren der nationalen Einheit,<br />
des Verfassungspatriotismus und der<br />
wehrhaften Demokratie verbergen mehr<br />
schlecht als recht, dass Premierminister<br />
Rajoy und sein konservativer Partido Popular<br />
(PP) auf die katalanische Frage eine Antwort<br />
schuldig bleiben. Tatsächlich ist Katalonien<br />
ein Symptom. Rajoy und seiner Partei<br />
fehlt grundsätzlich ein zukunftsfähiges,<br />
Hoffnung stiftendes Projekt.<br />
Der schon von seiner Persönlichkeit her<br />
träge und abwartende Regierungschef<br />
geht davon aus, positive Wirtschaftsindikatoren<br />
seien Empfehlung genug. Die sinkenden<br />
Erwerbslosenzahlen würden von<br />
selbst dafür sorgen, das Vertrauen der Bürger<br />
zu gewinnen. Womit er sich getäuscht<br />
hat. Der Partido Popular hat den Jahresauftakt<br />
vor Gericht begangen. Im „Fall Gürtel“<br />
sieht sich die Partei in Regionen wie Madrid<br />
und Valencia beschuldigt, gegen Bestechungsgeld<br />
und Parteispenden für Jahrzehnte<br />
öffentliche Gelder an Unternehmen<br />
umgelenkt zu haben. Lange gelang es<br />
dem PP, sich trotz aller unlauteren Machenschaften<br />
als Fels in der Brandung darzustellen,<br />
der Wirtschaftsflaute, Linkspopulismus<br />
und Separatismus trotzt.<br />
Aber gerade jetzt, nach dem „heißen<br />
Herbst“, da in Spanien wieder Rojigualdas,<br />
die Nationalfahnen, von Balkonen und aus<br />
Fenstern hingen, dazu bei Aufmärschen gegen<br />
die katalanische Autonomie Gruppen<br />
von Franquisten geduldet wurden, müsste<br />
Rajoy eigentlich stärker dastehen – das Gegenteil<br />
ist der Fall. Der Premier räumte Mitte<br />
Januar vor der Parteiführung gewohnt<br />
verdruckst ein: „Die Antwort der Regierung<br />
auf die katalanische Situation war gut für<br />
Spanien, womöglich aber nicht für den Partido<br />
Popular.“<br />
Ende des Linkstrends<br />
Derzeit treffen in Spanien zwei Tendenzen<br />
aufeinander, die eine alt, die andere jung.<br />
Ersterer lässt sich entnehmen: Der Konflikt<br />
um Katalonien hat endgültig eine linke<br />
Wendestimmung beendet, die schon seit<br />
geraumer Zeit erschöpft schien. Seit dem<br />
Frühjahr 2011, als die Proteste der Empörten<br />
(„Indignados“) nicht zu überhören waren,<br />
zog eine Welle des Aufbruchs durch das<br />
Land. Als bei den Kommunalwahlen vom<br />
Mai 2015 in Madrid, Barcelona und anderen<br />
Großstädten die Partei Podemos siegte, sahen<br />
manche diese neue Linke schon an der<br />
Macht. Es entstand der Eindruck, auch anderswo<br />
in Südeuropa wie in Griechenland<br />
und Portugal sei eine linke Gegenhegemonie<br />
im Anmarsch. Nur erwies sich Podemos<br />
bei den Generalwahlen Ende Dezember<br />
2015 mit 20,7 Prozent als nicht stark genug.<br />
Mit den geschrumpften Sozialisten – sie<br />
verloren fast sieben Prozent – wäre zwar<br />
eine linke Regierung möglich gewesen. Nur<br />
leider schaute der Partido Socialista Obrero<br />
Español (PSOE) nicht nach links, sondern<br />
nach rechts, zu den rechtsliberalen Newcomern<br />
der Partei Ciudadanos.<br />
Wie Podemos war Ciudadanos 2015 erstmals<br />
zu einer Parlamentswahl angetreten.<br />
Wie die radikale Linke galt die Partei als Herold<br />
einer „neuen Politik“, die versprach,<br />
den verkrusteten Volksparteien endlich<br />
Grenzen aufzuzeigen. Ciudadanos schnitt<br />
seinerzeit mit 14 Prozent zwar nur mäßig<br />
ab, dennoch reichte dieses Quorum aus,<br />
um den Podemos-Aufstieg zu neutralisieren<br />
und in der Abgeordnetenkammer einen<br />
starken rechten Block zu etablieren.<br />
Der linke Aufbruch lief ins Leere.<br />
Die Partei Ciudadanos – 2006 in Barcelona<br />
von konservativen Intellektuellen als<br />
antikatalanistische Kraft gegründet und<br />
Anfang 2015 mit einer groß angelegten Medienkampagne<br />
spanienweit expandiert –<br />
fungierte als „Podemos von rechts“ und<br />
idealer Prellbock gegen die Linke. Die<br />
Rechtsliberalen schienen das Scharnier zu<br />
sein, um den Altparteien Mehrheiten zu<br />
sichern. Erst versuchte es Ciudadanos nach<br />
den Wahlen von 2015 mit den Sozialisten<br />
von Parteichef Pedro Sánchez. Nachdem<br />
die sozialliberale Achse jedoch keine Mehrheit<br />
fand und im Juni 2016 nochmals Parlamentswahlen<br />
anberaumt waren, hielten<br />
sich die Rechtsliberalen an die wiedererstarkten<br />
Konservativen von Rajoy.<br />
War es vernünftiger Zentrismus oder reiner<br />
Opportunismus, wie Kritiker monierten?<br />
Parteichef Albert Rivera sei – so meinte<br />
der Politologe Jorge Verstrynge polemisch<br />
– „weniger ein Politiker als ein<br />
Politikverkäufer, ein geleckter Schnösel,<br />
der gut kommuniziert und ein Programm<br />
voller Mehrdeutigkeiten offeriert, das nur<br />
dann seine stockkonservative Ausrichtung<br />
offenbart, wenn es um harte Fragen geht:<br />
Steuern, Religion in der Schule, Rolle des<br />
Staates, das Territorialmodell … Ciudadanos<br />
bleibt für mich ein soziologisches Rätsel.“<br />
Parteichef<br />
Rivera ist<br />
weniger ein<br />
Politiker<br />
als ein guter<br />
Verkäufer<br />
Mittlerweile wurde Ciudadanos vom „soziologischen<br />
Rätsel“ zum politischen Tatbestand,<br />
von dem mehr Macht ausgeht, als<br />
sich das die neue Linke und die alte Rechte<br />
wünschen. Spanien Anfang 2018: Schwung<br />
und Sympathien für eine Linkswende sind<br />
versiegt, das Land steuert nach rechts – und<br />
nicht der Partido Popular, sondern Ciudadanos<br />
führt diese konservative Trendwende<br />
an. Das ist die neue Tendenz, zu deren<br />
Katalysator der katalanische Konflikt<br />
wurde. Für viele Spanier war und bleibt die<br />
Unabhängigkeits- eine Identitätsfrage: Der<br />
Separatismus bedroht, was man ist, zu wem<br />
und wozu man sich zugehörig fühlt.<br />
In dieser Situation avanciert Ciudadanos<br />
zum Vorreiter der „identitären Offensive“<br />
gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens. Ob<br />
sie die Rajoy-Regierung dazu ermahnt, härter<br />
durchzugreifen, die Nation und die Monarchie<br />
preist oder mit der ungeschriebenen<br />
Regel der katalanischen Politik bricht,<br />
in Ansprachen Katalanisch und Spanisch<br />
gleichermaßen zu gebrauchen – es dient<br />
immer einer Selbstvergewisserung der Mitte.<br />
Ciudadanos droht sogar halb ironisch, im<br />
Ernstfall müsse sich das antiseparatistische<br />
vom separatistischen Katalonien abspalten.<br />
Ende 2017 haben sich die geschürten Ressentiments<br />
schon einmal ausgezahlt, als<br />
Ciudadanos bei der katalanischen Regionalwahl<br />
mit 25 Prozent stärkste Kraft wurde.<br />
Der Höhenflug hinterlässt Wirkung, bestätigen<br />
doch etliche Umfragen, dass die<br />
Partei die Konservativen Rajoys überrunden<br />
und weiter aufsteigen könnte, weil sie<br />
in allen Bevölkerungsschichten Sympathien<br />
weckt. Der charismatische Ex-Premier<br />
Felipe González (PSOE) betont, dass er weder<br />
mit Rajoy noch mit Sozialistenchef<br />
Sánchez, sondern nur mit Albert Rivera<br />
Kontakt pflege. Ob er im 38-jährigen Rivera<br />
einen spanischen Macron erblickt? Zweifellos<br />
steht Ciudadanos für die alte Sehnsucht<br />
nach einer Modernisierungspartei, die weder<br />
im Geruch der Restauration noch der<br />
Revolution steht. Den Konservativen stand<br />
ihre franquistische Vergangenheit im Weg,<br />
wenn sie das Muster bedienen wollten. Den<br />
Sozialisten ist dieses Label wegen ihres<br />
Überlebenskampfes mit Podemos verwehrt.<br />
„Wir möchten keinen Stillstand, keine<br />
Dekadenz, aber auch keinen Populismus<br />
und keine Rache (…) Echter Wandel<br />
heißt nicht umkrempeln, was funktioniert,<br />
sondern infrage stellen, was nicht funktioniert“,<br />
so jüngst Rivera bei einem Interview<br />
mit der Zeitung El País. Unter diesen Umständen<br />
bietet Ciudadanos der ramponierten<br />
Mittelschicht die vollendete Identifikationsfolie.<br />
Der Kleinunternehmer, dem die<br />
Konservativen zu korrupt, die Sozialisten<br />
zu verstaubt und die Podemos-Führer zu<br />
revoluzzerhaft sind, darf mit einer Partei<br />
fraternisieren, die unternehmerfreundliche<br />
Politik verspricht. Schließlich wird sie<br />
selbst wie ein Unternehmen geführt. Auch<br />
auf die junge Mittelstandsfamilie, die sich<br />
wünscht, dass Spaniens soziale Standards<br />
westeuropäisches Niveaus erreichen, kann<br />
Rivera wohl zählen. Kurzum: Ciudadanos<br />
steht für die Vision der Mitte, Ordnung<br />
und Wandel seien im Paket zu haben.<br />
Neoliberales Programm<br />
„Der ruhige Wandel“ – es wäre der beste<br />
Slogan für Ciudadanos, hätte ihn nicht bereits<br />
der Zentrumspolitiker Adolfo Suárez<br />
im Wahljahr 1977 geprägt. Suárez, der junge,<br />
energiegeladene Ministerpräsident, der<br />
das Land von der Diktatur Francos in die<br />
Demokratie führte, pragmatisch Kommunisten<br />
und Franquisten an einen Tisch<br />
setzte, ist Riveras großes Vorbild. Beflissen<br />
ahmt er dessen Wendungen oder Gesten<br />
nach und würde gern die Geschichte wiederholen:<br />
Wie einst Suárez das Land nach<br />
Franco in eine neue Ära führte, will Rivera<br />
Spaniens ewig unvollendete Modernisierung<br />
zum Abschluss bringen.<br />
Noch bleibt dies der Anspruch einer Partei,<br />
die nirgends, in keiner Region, regiert.<br />
Wie Ciudadanos, wenn es einmal so weit<br />
sein sollte, Realpolitik betreibt, bleibt ungewiss.<br />
Ihr Programm deutet auf harte<br />
neoliberale Reformen hin. Würde der „einheitliche<br />
Arbeitsvertrag“, den Rivera vorschlägt,<br />
die Prekarität des Arbeitnehmerdaseins<br />
eindämmen oder vertiefen? Politik<br />
in aufwühlenden Zeiten wie diesen<br />
beruht nicht auf Programmen, sondern<br />
Sehnsüchten und Ängsten. Beides weiß die<br />
Führung von Ciudadanos zu wecken. Ihr<br />
Liberalismus zielt nur noch auf das Wesentliche:<br />
die Macht.
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Politik 09<br />
Wir sind dann mal da<br />
Syrien I Plötzlich wollen die<br />
USA wieder mitmischen und<br />
über das Nachkriegsregime<br />
entscheiden. Dabei gestört<br />
werden sie von der Türkei<br />
■■Julian Borger, Kareem Shaheen<br />
Zuletzt hatte es den Anschein, als<br />
wollten sich die USA auf einen<br />
defensiven Part in Syrien beschränken,<br />
zwar weiter Einfluss<br />
auf die Nachkriegsordnung nehmen,<br />
dazu aber kein überbordendes militärisches<br />
Engagement riskieren. Donald<br />
Trump hatte das Bürgerkriegsland als<br />
„Treibsand“ tituliert, den man nicht brauche.<br />
Doch fiel auf, dass weder Außenminister<br />
Tillerson noch Verteidigungsminister<br />
Mattis diese Sicht je geteilt haben. Sie ließen<br />
keinen Zweifel daran, nach Kräften<br />
verhindern zu wollen, dass der Iran einen<br />
breiten Landkorridor von seinem eigenen<br />
Territorium über den Irak durch Syrien bis<br />
in den Libanon und damit hin zur Mittelmeerküste<br />
kontrolliert. Dabei wollte man<br />
sich auch auf die weitgehend aus Kurdenmilizen<br />
rekrutierten und von den USA ausgerüsteten<br />
Demokratischen Kräfte Syriens<br />
(DKS) stützen, die angehalten waren, aus<br />
dem Norden nach Südosten vorzustoßen.<br />
Unter anderem galt das Gebiet rings um<br />
Rakka, mit dem der Islamische Staat (IS) im<br />
September seine syrische Bastion verlor,<br />
als potenzielle Domäne. Wer sich dort etabliert<br />
– so offenbar die Überlegung in Washington<br />
–, kann die iranischen Revolutionsgarden<br />
in die Schranken weisen.<br />
Soll Assad gehen?<br />
Welchen Sinn die Zerstörung gehabt haben soll, wird anderswo entschieden: syrischer DKS-Kämpfer in Rakka<br />
Wenn es um die geostrategische Aufteilung<br />
Syriens geht, die der Preis für einen landesweiten<br />
Waffenstillstand sein dürfte, stürzen<br />
sich die USA notgedrungen auf den<br />
Osten des Landes vom Euphrat-Tal bis zur<br />
irakischen Grenze. Der Küstenstreifen wie<br />
die Metropolenregion um Damaskus, dazu<br />
die großen Städte Homs, Hama und Latakia<br />
bis Aleppo im Norden sind fest in der<br />
Hand der Assad-Streitkräfte, die inzwischen<br />
auch die Nordprovinz Idlib vollständig<br />
unter ihre Kontrolle bringen wollen. Sie<br />
aus den genannten Zonen zu verdrängen,<br />
würde Russland als Schutzmacht auf den<br />
Plan rufen. Mit den noch von Rebellen gehaltenen<br />
Territorien im Süden an der Grenze<br />
zu Jordanien wie der Euphrat-Senke im<br />
Südosten bleiben jedoch Spielräume, die<br />
sich ausschöpfen ließen. Wäre da nicht Recep<br />
Tayyip Erdoğans Aufmarsch in der Enklave<br />
Afrin, der kurdische Verbündete der<br />
USA aus dem Spiel zu nehmen droht oder<br />
zumindest so weit schwächt, dass sich die<br />
USA selbst mehr exponieren müssen.<br />
Man habe vor, die eigene Präsenz in Syrien<br />
unbefristet fortzusetzen, egal wie Russland<br />
darauf reagiere, so Rex Tillerson vor<br />
Tagen bei einer Rede an der Stanford University<br />
in Kalifornien. Es sei die neue Syrienpolitik<br />
der Vereinigten Staaten, die bisherigen<br />
Ziele auszuweiten und sich nicht<br />
länger auf Terrorismusbekämpfung zu beschränken,<br />
wie das die Trump-Administration<br />
während ihres gesamten ersten Jahres<br />
getan habe. Im Augenblick komme es vor<br />
allem darauf an, sich darum zu kümmern,<br />
dass Präsident Assad abdanke, und „die<br />
notwendigen Bedingungen herzustellen“,<br />
damit das Gros der Flüchtlinge zurückkehren<br />
könne.<br />
Tillerson hat nicht ausdrücklich gesagt,<br />
wie man zu verfahren gedenke. Soll es über<br />
die 1.500 bis 2.000 Mann Spezialkräfte hinaus<br />
mehr US-Soldaten in Syrien geben?<br />
Werden deutlich größere Ressourcen investiert?<br />
Wie sonst kann der iranische Einfluss<br />
eingedämmt und Einfluss auf Verhandlungen<br />
über die politische Zukunft<br />
Syriens genommen werden, die es derzeit<br />
in Genf, Wien und Sotschi gibt?<br />
Tillersons Einlassungen erfolgten vor<br />
dem Hintergrund, dass sich die Zahl der<br />
Binnenflüchtlinge, die vor den Kämpfen in<br />
der Provinz Idlib fliehen, in den vergangenen<br />
Wochen von etwa 99.000 auf 212.000<br />
mehr als verdoppelt hat. Das UN-Flüchtlingshilfswerk<br />
hatte gewarnt, dass die eskalierende<br />
humanitäre Krise eine neue Migrationswelle<br />
auslösen werde. Und das ist<br />
prompt geschehen.<br />
FOTO: BULENT KILIC/AFP/GETTY IMAGES<br />
Russland<br />
wird als<br />
Schutzmacht<br />
auf seine<br />
Mission nicht<br />
verzichten<br />
In seiner Stanford-Rede formulierte Tillerson<br />
fünf Ziele, denen man sich in Syrien zu<br />
verschreiben gedenke: die Zerschlagung des<br />
IS und aller Al-Qaida-Filialen, eine von den<br />
UN vermittelte und verbindliche Resolution<br />
für Syrien, die den Rücktritt Baschar al-Assads<br />
vorsieht, eine Disziplinierung des Iran,<br />
eine sichere Rückkehr von Flüchtlingen und<br />
eine völlige Vernichtung verbliebener Chemiewaffen.<br />
Es fiel auf, dass Tillerson den IS<br />
und al-Qaida auf eine Stufe stellte: „Al-Qaida<br />
stellt eine schwerwiegende Bedrohung dar,<br />
weil diese Organisation gerade versucht,<br />
sich neu zu organisieren.“<br />
Bisher zögerte die Trump-Administration<br />
mit der Aussage, ob ein Regimewechsel<br />
in Damaskus Teil eines politischen Prozesses<br />
sein müsse. An der Stanford University<br />
signalisierte Tillerson, die USA würden auf<br />
einer Demission Assads bestehen. „Ein stabiles,<br />
vereintes und unabhängiges Syrien<br />
bedarf letzten Endes einer Post-Assad-Regierung,<br />
um erfolgreich zu sein.“ Offenbar<br />
haben die jüngsten Konsultationen mit Israel<br />
– man denke an die Gespräche von Vizepräsident<br />
Mike Pence mit Premierminister<br />
Netanjahu – die Amerikaner in der<br />
Überzeugung bestärkt, es als Strategie des<br />
Iran zu betrachten, eine große Landbrücke<br />
zu beherrschen, die sich quer durch den<br />
Mittleren Osten von Afghanistan bis zum<br />
Libanon zieht. Ohne Syrien wird das kaum<br />
möglich sein. Wollte man dort die Segel<br />
streichen, so Tillerson, würde das die Position<br />
Teherans weiter stärken. „Eine destabilisierte<br />
Nation wie Syrien, die an Israel<br />
grenzt, bietet für den Iran Gelegenheiten,<br />
die zweifellos gern genutzt werden.“ Bisher<br />
freilich wird im State Department bestritten,<br />
dass erneut – nach dem gescheiterten<br />
Versuch im Irak – in Syrien eine Art Nation<br />
Building betrieben werden soll.<br />
Über die US-Planungen ist der russische<br />
Außenminister Sergej Lawrow Mitte letzter<br />
Woche während einer Chemiewaffen-Konferenz<br />
in Paris informiert worden, verbunden<br />
mit der Ankündigung, die USA wollten<br />
sich bei allen derzeit stattfindenden Syrien-<br />
Verhandlungen wieder Geltung verschaffen.<br />
Man wolle die Bereitschaft der Regierung<br />
Assad prüfen, auf substanzielle Gespräche<br />
Wert zu legen. Die unter dem<br />
UN-Syrienvermittler Staffan de Mistura geführten<br />
Gespräche genießen für Washington<br />
absoluten Vorrang, Russland solle nicht<br />
dem Irrtum aufsitzen, es könne durch seine<br />
Konferenz des Nationalen Syrischen Dialogs<br />
in Sotschi alternative Friedensverhandlungen<br />
führen, heißt es.<br />
Julian Borger ist „World Affairs“-Kolumnist des<br />
Guardian<br />
Kareem Shaheen ist Korrespondent in Kairo<br />
Übersetzung: Holger Hutt<br />
ANZEIGE<br />
Pakt schlägt sich<br />
Syrien II US-Truppen könnten mit der Armee Erdoğans aneinandergeraten<br />
■■Konrad Ege<br />
Die Sache mit Erdoğan und Trump<br />
war früher weniger komplex und<br />
folgenschwer. Da hatten sich noch<br />
keine Außen- und Verteidigungsminister<br />
eingemischt. „Danke, Ministerpräsident<br />
Erdoğan, dass Sie bei uns waren, um die Eröffnung<br />
der #Trump Towers Istanbul zu<br />
feiern“, schrieb Trump-Tochter Ivanka im<br />
April 2012 auf Twitter. Ihr Vater war offenbar<br />
auch begeistert. „Gerade abgereist aus<br />
Istanbul, Türkei, gestern, wo #Trump Towers<br />
gerade eröffnet wurden – großartig!“<br />
Heute dagegen streiten sich amerikanische<br />
und türkische Regierungsvertreter<br />
über den Inhalt eines Gespräches beider<br />
Präsidenten zur türkischen Syrien-Offensive.<br />
Nach Telefonaten des Präsidenten mit<br />
Amtskollegen veröffentlicht die Pressestelle<br />
des Weißen Hauses sogenannte Readouts,<br />
kurze, oft wenig informative Zusammenfassungen.<br />
Die zwei Absätze zum Gespräch mit<br />
Erdoğan am 24. Januar allerdings waren relativ<br />
gewichtig. Unstimmigkeit wurde offenbar.<br />
Trump habe „Besorgnis“ geäußert über<br />
die „eskalierende Gewalt in Afrin, Syrien“.<br />
Dort, im syrisch-türkischen Grenzgebiet, gehen<br />
türkische Einheiten gegen von den USA<br />
bewaffnete Kurdenmilizen vor. Die Türkei<br />
solle deeskalieren, hat Trump nach Angabe<br />
seines Pressebüros gemahnt, und „Handlungen<br />
vermeiden, die Konflikte riskieren<br />
könnten zwischen türkischen und amerikanischen<br />
Streitkräften“. Sofort konterte die<br />
türkische Regierung: Trump habe sich gar<br />
nicht besorgt geäußert über die Gewalt. Die<br />
beiden Staatschefs hätten lediglich Ansichten<br />
ausgetauscht.<br />
US-Verteidigungsminister James Mattis<br />
sagte bei einer Pressekonferenz, Ankara<br />
habe die USA vor den ersten Luftangriffen<br />
im Voraus in Kenntnis gesetzt. Die Regierung<br />
Trump versucht den Balanceakt: „Türkische<br />
Sicherheitsinteressen“ (Mattis) respektieren,<br />
doch auch Verbündete beim erfolgreichen<br />
Kampf gegen den Islamischen<br />
Staat nicht fallen lassen und den Handlungsspielraum<br />
vergrößern für das Syrien nach<br />
dem Krieg. Das birgt Gefahren. CNN zitierte<br />
Ende Januar Joseph Votel, Kommandierender<br />
General des für den Nahen Osten zuständigen<br />
Central Command: Er denke nicht daran,<br />
seine Streitkräfte trotz türkischer Warnungen<br />
aus dem nordsyrischen Ort<br />
Manbidsch abzuziehen. Das bedeute, so<br />
CNN, dass US-Einheiten in den Vormarsch<br />
der Türkei hineingeraten könnten. An die<br />
2.000 US-Soldaten sollen in Syrien im Einsatz<br />
sein. Details sind kaum bekannt. Das<br />
Central Command beschränkt sich auf Statements<br />
wie dieses vom 25. Januar: Die Combined<br />
Joint Task Force – Operation Inherent<br />
Resolve („Inhärente Entschlossenheit“), wie<br />
die US-Militärkampagne gegen den IS in Syrien<br />
und im Irak heißt, bleibe bei ihrem Plan,<br />
„2018 zusammen mit unseren Partnern eine<br />
dauerhafte Niederlage des Daesh herbeizuführen<br />
und nicht militärische Stabilisierungsoperationen<br />
zu ermöglichen“.<br />
Stabilisierung war auch Thema in den Interviews,<br />
die Minister Mattis zum Jahreswechsel<br />
gab. Tenor: Die USA und ihre Alliierten<br />
seien dabei, den Islamischen Staat zu<br />
zerstören („crushing the life out of ISIS“).<br />
Jetzt würden zunehmend „Contractors“ –<br />
Zivilisten und Diplomaten – gebraucht.<br />
Keine Frage, Erdoğan dürfte sich mehr<br />
erhofft haben von Trump. Dessen außenpolitischer<br />
Berater Michael Flynn hatte<br />
doch hervorgehoben, die Türkei sei von „lebenswichtiger<br />
Bedeutung“ für die USA.<br />
Flynn, der Nationaler Sicherheitsberater<br />
wurde (und wegen der „Russlandsache“ gehen<br />
musste), äußerte sich selbst zu Fethullah<br />
Gülen, dem in den USA lebenden türkischen<br />
Geistlichen und aus Erdoğans Sicht<br />
Drahtzieher des Terrorismus. Die USA sollten,<br />
so Flynn, Gülen „keinen sicheren Hafen“<br />
gewähren.<br />
So ein toller Trump-Turm<br />
Nach dem türkischen Verfassungsreferendum<br />
im April 2017, moniert vielerorts als<br />
Schritt weg von der Demokratie, gratulierte<br />
Trump Präsident Erdoğan und dankte ihm<br />
für dessen Zustimmung zur „Antwort auf<br />
den Einsatz chemischer Waffen durch das<br />
syrische Regime“ am 4. April 2017. Trump<br />
hatte zwei Tage später 59 Marschflugkörper<br />
auf einen syrischen Luftstützpunkt schießen<br />
lassen.<br />
Den rechten Breitbart News erklärte<br />
Trump Ende 2015, die Türkei habe einen<br />
„starken Führer“ und sei „ein guter Partner“.<br />
Dass Ankara damals vorgeworfen wurde,<br />
von den Ölgeschäften des IS zu profitieren,<br />
störte nicht weiter. Freilich räumte Trump<br />
ein, er habe „einen kleinen Interessenkonflikt“<br />
beim Thema Türkei, „weil ich ein großes,<br />
großes Gebäude in Istanbul habe, ein<br />
außerordentlich erfolgreicher Job“.<br />
ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie<br />
sucht<br />
eine/n GeschäftsführerIn<br />
Sie sind verantwortlich für alle administrativen, inhaltlichen und kommunikativen<br />
Aktivitäten unserer spendenfinanzierten konzern- und kapitalismuskritischen<br />
Stiftung. Als einzige hauptamtliche Kraft werden Sie durch Ehrenamtliche aus<br />
Stiftungsgremien, Team und externen Dienstleistern unterstützt.<br />
Aufgaben<br />
Management bzw. Geschäftsführung der Stiftung<br />
(Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, ggfl. Personal)<br />
Fähigkeiten/Kenntnisse (professionelles Niveau)<br />
• Praxis und Erfahrung in kapitalismus- und gesellschaftskritischer Politik<br />
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Leitungs – Erfahrungen<br />
• Gute Deutschkenntnisse und sichere Kommunikation<br />
• Englisch verhandlungssicher, ideal Spanisch<br />
• Office-Programme, elektronische Medien<br />
• Führerschein und Fahrpraxis<br />
Anforderungen<br />
• Aktive Vertretung der politischen Grundsätze der Stiftung<br />
• Belastbarkeit, Eigenverantwortlichkeit, Zuverlässigkeit<br />
• Kreativität, Flexibilität und Eigeninitiative<br />
• Wohnen in und um Düsseldorf<br />
Angebot<br />
• Ausfüllende Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum<br />
• Unbefristeter Vollzeit-Vertrag<br />
Vollständige Ausschreibung bei www.ethecon.org<br />
Bewerbungen bis zum 17.03.18 an<br />
Brigitte Hincha, Bachstr. 10, 53773 Hennef<br />
(auch per Mail (pdf) b.hincha@web.de).<br />
Bitte teilen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellungen mit,<br />
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sie sich<br />
bei einer Non Profit Organisation bewerben.<br />
ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie<br />
Schweidnitzer Str. 41, 40231 Düsseldorf<br />
Stiftung<br />
Ethik & Ökonomie
10 Politik<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Das Ende der Angst<br />
Österreich Ein Experiment im Oberen Waldviertel befreit Arbeitslose von ständiger Drangsalierung und Depression<br />
■■Franz Schandl<br />
Heidenreichstein mit etwa<br />
4.100 Einwohnern ist eine<br />
verletzte Kleinstadt. Vor allem<br />
nach dem Kollaps der<br />
Industrie Ende der 1970er,<br />
Anfang der 1980er Jahre hat sich der Ort im<br />
Oberen Waldviertel in Niederösterreich nie<br />
mehr richtig erholt. Die Arbeitslosenrate<br />
ist entsprechend hoch. Seit einigen Monaten<br />
läuft hier nun das Projekt „Sinnvoll tätig<br />
sein“ (STS), das jenseits gängiger Disziplinierungsmuster<br />
versucht, über 40 Langzeitarbeitslosen<br />
(in etwa ein Prozent der<br />
Bevölkerung) Perspektiven zu eröffnen, die<br />
sich doch von obligaten Erwartungshaltungen<br />
unterscheiden. Geleitet wird dieses<br />
Projekt, das offiziell als Kurs des AMS (Arbeitsmarktservice,<br />
das österreichische Pendant<br />
zur Bundesagentur für Arbeit) firmiert,<br />
von Karl Immervoll und der „Betriebsseelsorge<br />
Oberes Waldviertel“, die<br />
mit ähnlichen Initiativen schon einschlägige<br />
Erfahrungen sammeln konnten. Arbeitslose<br />
sollen nicht als Fälle oder gar Problemfälle<br />
wahrgenommenen werden, sondern<br />
als Menschen. Natürlich geht es auch<br />
um Arbeit und Arbeitsplatz – vorrangig jedoch<br />
um die Personen selbst. Nicht Was<br />
sollen wir? ist die entscheidende Frage, sondern<br />
Was wollen wir? Was will ich?<br />
Es ist in Ordnung, wie du bist<br />
Man hat mir oft gesagt, ich solle tun, was ich gut kann, und das ist: ich selber sein<br />
In einem ersten Bericht darüber schreibt<br />
Immervoll: „Die Befreiung von Ängsten<br />
und Druck ist ein Prozess. Trotzdem: 18<br />
Monate von den Vorgängen rund um die<br />
Arbeitssuche befreit zu sein, Zeit zu haben,<br />
sich auf sich selbst zu konzentrieren. Für<br />
manche bedeutet das, sich zum ersten Mal<br />
in ihrem Leben die Frage zu stellen: Was ist<br />
mein Weg? Generell ist das für alle eine<br />
neue Lebenssituation. Die Frage, was denn<br />
jetzt wirklich zu tun ist, verunsichert. Denn<br />
es stellt den Arbeitsbegriff auf den Kopf:<br />
Arbeit war bisher etwas, was jemand aus<br />
einem ökonomischen Interesse heraus von<br />
mir verlangt, und ich, indem ich es tue, dafür<br />
entlohnt werde. Nun heißt es: Entwickle<br />
deine Fähigkeiten und teile sie mit anderen,<br />
indem du sie in die Gesellschaft einbringst!“<br />
Und Immervoll weiter: „Hier<br />
brauchst du dich nicht zu rechtfertigen. Es<br />
ist in Ordnung, so wie du bist. Dein Bemühen,<br />
dein Tun wird von uns keiner Wertung<br />
unterzogen. Hier bist du als Mensch<br />
geschätzt, und wir haben die Zeit, zu schauen,<br />
was du brauchst, und machen uns gemeinsam<br />
auf den Weg. Wir nehmen uns<br />
Zeit und hören zu. Unser Gegenüber spürt<br />
und schätzt, dass sie/er für uns keine Nummer<br />
ist.“<br />
So fungiert der Bezug von Arbeitslosengeld<br />
für anderthalb Jahre ähnlich einem<br />
garantierten Grundeinkommen. An den<br />
finanziellen Begrenzungen für die Betroffenen<br />
ändert sich zwar nichts, was sich aber<br />
fundamental ändert, ist das restriktive<br />
Rundherum. Der Charme besteht darin,<br />
nicht ständig Angst haben zu müssen, dass<br />
die soziale Absicherung auszufallen droht<br />
– der Punkt, der von den Teilnehmern am<br />
meisten geschätzt wird. Verbindlich erwartet<br />
werden lediglich Tagebücher über den<br />
Umgang mit vorhandener Zeit.<br />
Ziemlich unterschiedliche Typen frequentieren<br />
diesen Kurs, da tummeln sich<br />
Frauen und Männer im Alter von 20 bis 60,<br />
Personen, die einen akademischen Abschluss<br />
haben, bis hin zu solchen, die kaum<br />
lesen können. Manche haben 40 Jahre<br />
Lohnarbeit hinter sich, andere sind aus diversen<br />
Gründen zwischenzeitlich ausgestiegen.<br />
Da finden sich Jugendliche, die<br />
noch nie so richtig in einem Arbeitsverhältnis<br />
angekommen sind, oder Menschen, die<br />
wegen schwerer körperlicher Beeinträchtigungen<br />
(durch Unfälle oder chronische Erkrankungen)<br />
keine Chance auf dem Arbeitsmarkt<br />
haben. Physisch und psychisch<br />
geschwächt sind freilich die meisten.<br />
Im Zwischenbericht des Projekts heißt<br />
es: „Arbeitslosigkeit erzeugt Druck, am<br />
größten seitens der Gesellschaft. Die obligate<br />
Frage bei Begegnungen, was man<br />
denn jetzt beruflich mache, drängt in die<br />
Isolation. Niemand will als Versager dastehen,<br />
vor allem wenn der Zustand der Arbeitslosigkeit<br />
schon länger andauert. Dazu<br />
kommen die Termine beim Arbeitsmarktservice<br />
(AMS). Allzu oft erleben wir, dass<br />
Menschen schon Tage zuvor in ‚alle Umstände‘<br />
verfallen, wenn sie die Notstandshilfe<br />
verlängern müssen, aber auch jeder<br />
Kontrolltermin verunsichert: Werde ich wo<br />
angewiesen, muss ich in eine Schulung …?“<br />
Vorstellungsgespräche seien in der Regel<br />
mühsam, weil die meisten Betriebe niemand<br />
brauchen. Man gehe halt hin, weil<br />
man muss, weil man Bewerbungen vorweisen<br />
soll. „Gleichzeitig“ – so der Bericht –<br />
„sind die Verweigerung von Erwerbsarbeit<br />
und lang anhaltende Arbeitslosigkeit ein<br />
Ausschluss aus der Gesellschaft und damit<br />
Verweigerung von Anerkennung.“<br />
Ein Widerspruch ist offensichtlich. Arbeit<br />
wird eingefordert, kann aber nicht<br />
ausreichend angeboten werden. Ist man<br />
erwerbslos und auf sozialen Beistand angewiesen,<br />
wird man unter Kuratel gestellt<br />
und verwaltet. Die Vormundschaft durch<br />
das AMS ist anstrengend und demütigend,<br />
man darf dies und jenes nicht, vor allem<br />
hat man Arbeitsbereitschaft zu demonstrieren<br />
und zu vorgegebenen Zeitpunkten<br />
(Vorstellungsgespräche, AMS-Kontrolltermine)<br />
zur Verfügung zu stehen. Widrigenfalls<br />
drohen Sanktionen. Das heißt, man<br />
disponiert nicht mehr, sondern wird disponiert.<br />
Man hat sich nicht mehr selbst, ist<br />
angewiesen und aufgrund der Abhängigkeit<br />
von Zahlungen (Arbeitslosengeld,<br />
Mindestsicherung) auch entsprechend erbötig.<br />
Das prägt.<br />
Diese Zumutungen nerven nicht bloß,<br />
sie beschädigen und verletzen merklich.<br />
Nicht nur mental. Nicht einmal die Freizeit<br />
bleibt „frei“, da die Gedanken anderswo<br />
Viele verlieren<br />
allen Mut,<br />
andere geraten<br />
in den Zwang,<br />
positiv denken<br />
zu müssen<br />
kreisen, in der Drangsalierung hängen, sich<br />
nicht von ihr lösen können. Man ist unter<br />
Druck, selbst wenn da niemand direkten<br />
Druck ausübt. Die Lage ist hochgradig<br />
amorph: gestaltlos, unbegreifbar, weil ungreifbar,<br />
unfassbar und daher irgendwie<br />
bedrohlich. Drangsalierung ist etwas, das<br />
man nicht einfach abschütteln kann, da sie<br />
sich in einem festgesetzt hat. Sie produziert<br />
Stress und Ohnmacht. Leute, die in<br />
einer Notlage sind, werden zusätzlich belastet.<br />
Vor allem das Training von Bewerbungen<br />
gleicht zumeist einem Leerlauf mit<br />
frustrierendem Ausgang.<br />
In drangsalierten Zeiten ist Selbstbestimmung<br />
aufgrund der psychischen Konstellation<br />
aufgehoben. Man fühlt sich geknechtet,<br />
geplagt, gepeinigt, da muss unmittelbar<br />
gar nichts geschehen. Oft reicht ein<br />
Blick, eine Geste, eine Handbewegung, ein<br />
Wort, eine Ladung, ein Bescheid, ein Gerücht.<br />
Drangsalierung erscheint nicht als<br />
Konfrontation oder Kampf, sondern als ein<br />
Verhältnis, bei dem man apathisch wird,<br />
aber nicht aussteigen kann. Drangsalierung<br />
ist eine chronische Belastung, nicht<br />
bloß eine akute Herausforderung. Stets<br />
wird am Selbstbewusstsein gekratzt.<br />
Wer isoliert wird, isoliert sich<br />
Mehr Muße<br />
zum Abhängen<br />
würde<br />
den Leuten<br />
sowieso<br />
nicht schaden<br />
Für Arbeitslose ist dieser Zustand – selbst<br />
wenn er sich nicht unmittelbar manifestiert<br />
– latent vorhanden. Das heißt, er ist<br />
immer da, manchmal aber gut verborgen,<br />
weil verdrängt. In solchen Lagen hat man<br />
den Kopf nicht frei. Drangsalierte Zeit ist<br />
also schwer zu ermitteln, und es ist auch<br />
schwierig, derlei anderen zu vermitteln. Sie<br />
ist keine abgrenzbare Erscheinung, sondern<br />
eine übergreifende. Man kann nie genau<br />
sagen, wann und wie lange man unter<br />
welchem Druck steht. Aber es lässt sich darüber<br />
reden. Das Wechselspiel des Ausschlusses<br />
besagt: Wer isoliert wird, isoliert<br />
sich. So gesehen leistet das Heidenreichsteiner<br />
Experiment auch Dienste an alternativer<br />
Vergemeinschaftung. Bekanntschaften<br />
werden geschlossen, Freundschaften<br />
entstehen. Es gibt sogar gemeinsame<br />
Ausflüge. Menschen lernen sich kennen,<br />
die sich sonst nie kennengelernt hätten. Da<br />
geht es auch um eine Rückholung in die<br />
Kommune, ohne Muster aufzuerlegen.<br />
Eine Menge von zusätzlichen Kursangeboten<br />
steht den Arbeitslosen parallel zur<br />
Verfügung: gesundes Essen, Erste Hilfe,<br />
Männerseminar, Schönheitsseminar, Rückenfit,<br />
Suchtprävention, Tanzen, Move<br />
your Ass etc. – Die Leute sollen fitter werden.<br />
Geistig und körperlich. In erster Linie<br />
handelt es sich dabei nicht um die Erfüllung<br />
eines äußeren Anspruchs. Aktiviert<br />
werden ist zweifellos wichtig, aber es ist<br />
wichtig als Selbstzweck, nicht als Zweck.<br />
Die befreiende Potenz des Projektes<br />
„Sinnvoll tätig sein“ (STS) ist auf jeden Fall<br />
größer, als das bei Erfahrungen der Fall ist,<br />
mit der Arbeitslose in der Regel zu tun haben:<br />
Schalterkonfrontationen, Vorstellungen,<br />
Zuweisungen und Abweisungen. Wer<br />
je in einer solchen Situation gewesen ist,<br />
kann das nachvollziehen. Umso mehr werden<br />
die STS-Kursteilnehmer psychisch entlastet.<br />
Fast alle geben an, dass ihr Wohlbefinden<br />
in den zurückliegenden Monaten<br />
gestiegen sei.<br />
Die Arbeitslosen sind natürlich nicht von<br />
Kritik ausgenommen. Feststellbar ist einerseits<br />
der Hang zu Distanz und zum Abtauchen,<br />
zum Noch-kleiner-Machen, zum Fatalismus.<br />
Auffällig sind andererseits aber<br />
auch notorisch positives Denken und ex<br />
plizit esoterische Muster, allesamt dazu da,<br />
persönliche Krisen umzudeuten, ihnen<br />
Sinn zu verordnen, anstatt Kritik angedeihen<br />
zu lassen. Gelegentlich hindern einige<br />
Vielredner die Schweigsamen an der Artikulation.<br />
Nicht vorsätzlich, aber doch effektiv.<br />
Unterschiedliche intellektuelle Standards<br />
sind hingegen kaum ein Problem.<br />
Persönliche Konflikte in der zusammengewürfelten<br />
Gruppe sind bisher selten aufgetreten,<br />
im Gegenteil, man lernt sich kennen<br />
und schätzen, von neuen sozialen<br />
Kontakten ganz abgesehen.<br />
Das gemeine Volksvorurteil, wonach Arbeitslose<br />
Schmarotzer sind und es sich auf<br />
Kosten der Allgemeinheit gut gehen lassen,<br />
heißt im Prinzip nichts weiter, als dass es<br />
allen Arbeitslosen gefälligst schlecht zu gehen<br />
habe. Die Abgehängten hängen freilich<br />
weniger in den Hängematten als in den<br />
Seilen. Nicht nur vor diesem Hintergrund<br />
stellt sich heute tatsächlich die Frage, ob es<br />
nicht gesamtgesellschaftlich sinnvoller<br />
wäre, statt des illusorischen „Arbeit für<br />
alle!“ das machbare „Hängematten für<br />
alle!“ zu fordern. Etwas mehr Abhängen<br />
würde den Leuten sowieso nicht schaden,<br />
kämen sie doch dann auf Gedanken, die ihnen<br />
in ihrem Alltagstrott nie einfielen.<br />
Mehr Muße würde allen guttun.<br />
Arbeitslosigkeit ist als gesellschaftliches<br />
Phänomen zu denken, nicht als individuelles<br />
Manko. Sorge und Hilfe und Verständnis<br />
prägen jedenfalls das Heidenreichsteiner<br />
Experiment, es ist somit keine Variante<br />
eines alternativen Zucht- und Ordnungsprogramms.<br />
Druck soll genommen, nicht<br />
entfacht werden. Ob derartige Versuche<br />
unter der ÖVP-FPÖ-Regierung und Kanzler<br />
Sebastian Kurz weiter möglich sind, darf<br />
bezweifelt werden.<br />
Franz Schandl arbeitet für das wissenschaftliche<br />
Begleitprogramm von STS. Von 1985 – 1995 war er<br />
zudem Gemeinderat der Alternativen Liste in<br />
Heidenreichstein. Mehr Informationen, siehe:<br />
www.bsowv.at/sites/default/files/sts_folder.pdf<br />
FOTO: PRESSE
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Gender 11<br />
■■Björn Hayer<br />
Männersache<br />
Frauensache<br />
Das Bild erscheint vielversprechend:<br />
ein schönes Lächeln<br />
und ein leichtes Sommerkleid.<br />
Urlaubskulisse im Hintergrund.<br />
Als sie auf seine<br />
Anfrage antwortet und einem Date zustimmt,<br />
ist bei ihm die Freude groß. Die<br />
beiden treffen sich, trinken Wein in einer<br />
schicken Szenekneipe, sie sind um Sympathie<br />
bemüht. Am Ende eine offenherzige<br />
Umarmung: Wann wollen wir uns wiedersehen?<br />
Auf seine Frage per Whatsapp antwortet<br />
sie nicht. Er ist betrübt. Aber was soll’s? Es<br />
gibt da ja noch zahlreiche andere „Kandidatinnen“.<br />
Auf geht’s zum nächsten Treffen.<br />
Diesmal eine Kosmetikerin, die schon<br />
nach den ersten Minuten mit der Tür ins<br />
Haus fällt: Kinder? Heiraten? Puh, das<br />
geht ihm dann doch zu schnell. Wieder<br />
nicht die Richtige.<br />
Wie kann das sein? Die Algorithmen der<br />
Dating-Apps sollen doch Erfolg bringen?<br />
Die eine Echte, den einen Besonderen. Diese<br />
Algorithmen sollen derartig trainiert<br />
sein, so heißt es jedenfalls immer, dass sie<br />
die geeigneten Konstellationen finden. Was<br />
machen die Apps falsch?<br />
Aber vor allem: Wo ist die Romantik geblieben?<br />
Wo die Leidenschaft des gegenseitigen<br />
Entdeckens? Um den Idealisten auf<br />
dem „Markt“ der Liebe ist es ganz offensichtlich<br />
derzeit schlecht bestellt. Die Dating-App<br />
Tinder hat sogar schon ein eigenes<br />
Verb hervorgebracht. Allein das dürfte<br />
wohl als Indiz einer gewandelten Kultur<br />
verstanden werden. Täglich wischen die<br />
zahlreicher werdenden Singles der westlichen,<br />
urbanen Wohlstandsgesellschaften<br />
Profilfotos hin und her: nee, nee, nee, ja,<br />
vielleicht.<br />
Posen musst du – und posten<br />
Wer so rasch die Regale des Angebots<br />
durchschaut, dem fehlen am Ende Zeit und<br />
Muße für die ach so viel gepriesenen inneren<br />
Werte. Die kann man im „Tinderzeitalter“<br />
allenfalls aus einer Chat-Kommunikation<br />
infolge eines Matches erfahren, durch<br />
die von beiden Seiten durch das Liken hergestellte<br />
Übereinstimmung.<br />
Selbst dann ereignen sich allzu oft standardisierte<br />
Gespräche: Hobbys, Beruf, Vorlieben,<br />
Haustiere, vermeintlich individuelle<br />
Charakterzüge. Das ganze Programm<br />
wird durchgezogen, um Gemeinsamkeiten<br />
abzuklopfen – sofern es sich nicht um „eine<br />
schnelle Nummer“ handelt.<br />
Besonders deutlich wird bei all dem die<br />
sogenannte Transparenzgesellschaft, wie<br />
sie der aus Korea stammende Philosoph<br />
Byung-Chul Han beschreibt: Ihm zufolge<br />
findet gegenwärtig überall eine pornoide<br />
Ausstellung des Ich statt. Damit man gerade<br />
in den virtuellen Universen des Internets<br />
bestehen kann, bildet dauerhaftes<br />
Posten und Posen die zentrale Voraussetzung.<br />
Ganz nach dem Motto: Ich twittere,<br />
also bin ich! Man sollte meinen, unsere<br />
Epoche sei so etwas wie eine Hochphase<br />
des Subjekts.<br />
Bezogen auf die Findung eines geeigneten<br />
Partners trifft dies allerdings nur bedingt<br />
zu. Oftmals schwindet im ersten Austausch<br />
zweier Menschen paradoxerweise<br />
das Persönliche. Zwar verspricht der<br />
Schutzraum der Anonymität ein „Alles ist<br />
möglich“. Vor allem um mit jenen Menschen<br />
in Kontakt zu kommen, die man in<br />
der Realität nicht anspricht, weil man sich<br />
das nicht traut. Zugleich versucht man ein<br />
Bild von sich zu zeichnen, dem man möglicherweise<br />
gar nicht entspricht. Aber man<br />
will ja gefallen. Viele Männer immer noch<br />
als Athleten, Abenteurer, Helden. Viele<br />
Frauen nach wie vor als Verführerinnen.<br />
Oder mütterliche Gefährtinnen.<br />
Sobald dann ein reales Treffen zustande<br />
kommt, stellt sich häufig recht schnell<br />
große Ernüchterung ein. Aber halb so<br />
wild, werden die vollen Erwartungen nicht<br />
erfüllt, macht das nichts. Das nächste<br />
Match wartet schon.<br />
Zweifelsohne ist das vielfältige virtuelle<br />
Potenzial, jemanden kennenzulernen,<br />
wunderbar. Die Chance darauf ist so groß<br />
wie nie zuvor. Doch die Vielfalt geht mit einem<br />
unermüdlich-selbstzirkulären Prozess<br />
des Vergleichens einher. Immer seltener<br />
gehen die suchenden Menschen Risiken<br />
ein. Warum? Viele wollen sich nicht festlegen.<br />
Das Stichwort der Stunde lautet:<br />
warmhalten.<br />
Auf der anderen Seite beklagen nicht<br />
wenige die mangelnde Verbindlichkeit –<br />
und bewundern fassungslos die Ehen ihrer<br />
Großeltern, die allen Gezeiten und<br />
Widrigkeiten zum Trotz ein Leben lang<br />
gehalten haben.<br />
Wo liegen die Ursachen für den Hype loser<br />
und dynamischer Beziehungen? Soziale<br />
Netzwerke und die neuen Anforderungen<br />
einer Kommunikationsgesellschaft allein<br />
können es ja nicht sein. Was also dann? Es<br />
ist ebenso der liberale Kapitalismus. In allen<br />
Werte-Indizes der vergangenen Jahre<br />
rangiert die Kategorie Freiheit bei den Befragten<br />
ständig ganz oben. Wiederum steht<br />
das Ego im Zen trum aller Bestrebungen<br />
nach Partnerschaft. Es profiliert sich in den<br />
sozialen Netzwerken und bindet sich ungern<br />
an Institutionen. Die Suche nach dem<br />
passenden Pendant gleicht einem marktwirtschaftlichen<br />
Verfahren.<br />
In dem Band „Wa(h)re Gefühle“ legt Eva<br />
Illouz, die moderne Soziologin der Liebe<br />
schlechthin, dar, dass Emotionen und deren<br />
Lenkung einem ökonomischen Handlunsplan<br />
entspringen. „Die kapitalistische<br />
Kultur hat durchaus keinen Verlust an<br />
Emotionalität eingeläutet“, konstatiert Illouz:<br />
„Sie ist vielmehr mit einer beispiellosen<br />
Intensivierung des Gefühlslebens einhergegangen,<br />
in dessen Rahmen Akteure<br />
ihre emotionalen Erfahrungen bewusst<br />
Tinder-Dates<br />
stumpfen uns<br />
ab. Das<br />
Gegenüber ist<br />
heutzutage<br />
austauschbar<br />
Halt mich warm<br />
Liebe Tindern, berechnen und Risiken abmildern,<br />
so datet die Spätmoderne<br />
um ihrer selbst willen gestalten.“ Eine solche<br />
Intensivierung des Gefühlslebens manifestiert<br />
sich in vielfältiger Weise. Das<br />
Privatleben zum Beispiel sei auf das Verfolgen<br />
„emotionaler Projekte“ ausgerichtet:<br />
eine romantische Liebe zu erleben,<br />
eine Depression zu überwinden, seinen<br />
inneren Frieden zu finden, ein mitfühlender<br />
Mensch zu werden.<br />
Liebe als Modulsystem<br />
Die Suche nach dem Anderen entpuppt<br />
sich somit als eine narzisstische Arbeit am<br />
Projekt Ich-AG.<br />
Das Gegenüber ist austauschbar geworden<br />
und seines Reizes beraubt. Da ohnehin<br />
eine Unmenge potenzieller Partner<br />
zur Verfügung steht, lohnt es nicht, sonderlich<br />
in die Tiefe zu gehen. Tinder-Dates<br />
stumpfen ab und machen kaum mehr<br />
neugierig auf das Geheimnis, ja die Schattenseiten<br />
eines anderen.<br />
Es scheint zu einfach zu sein: Wir schreiben<br />
uns, also kennen wir uns. Da wird der<br />
Rest schon stimmen. Oder eben nicht. Im<br />
Gegensatz zu diesem Trend behaupten sich<br />
Liebe und Erotik seit jeher vor allem dort,<br />
wo Verschleierung im Spiel ist. Denn erst<br />
das Unbekannte erzeugt Faszination, die<br />
durch den regen Austausch von Daten mitunter<br />
verschwindet, bevor das erste Treffen<br />
überhaupt vonstattengegangen ist.<br />
Offenbar gibt es bei aller Unverbindlichkeit<br />
eben auch ein deutliches Sicherheitsbedürfnis.<br />
So werden im Vorfeld eines<br />
Dates alle denkbaren No-Gos abgeklärt.<br />
Schließlich gilt es, peinliche Momente zu<br />
vermeiden. Und so geriert das idealerweise<br />
verzaubernde Jeux d’Amour zur Taktik aus<br />
Kalkül, bei der Risiken abgewogen und am<br />
liebsten ganz ausgeschaltet werden. Die<br />
Crux: Ein unbändiger Drang zur Autonomie<br />
und zugleich die Sehnsucht nach dem<br />
einen Prinzen oder der Prinzessin ergeben<br />
eine unheilvolle Melange. Am Ende kann<br />
die Realität in den meisten Fällen den Erwartungen<br />
nicht standhalten.<br />
Dass Menschen in der Gegenwart an den<br />
eigenen Maßstäben verzweifeln, hängt<br />
wohl nicht zuletzt mit der Emanzipation<br />
des Liebeskonzepts als solchem zusammen.<br />
Nachdem die Vormoderne die Liebe<br />
primär als eine Komposition an Werten<br />
und Tugenden, beispielhaft in der Institutionalisierung<br />
der Ehe, betrachtete, bricht<br />
die Romantik mit diesem Konzept. Wie die<br />
Germanistin Elke Reinhardt-Becker in ihrer<br />
Studie „Seelenbund oder Partnerschaft?“<br />
dokumentiert, tritt im 20. Jahrhundert<br />
eine Art Entzauberung ein. Diesbezüglich<br />
spricht Reinhardt-Becker vom<br />
partnerschaftlichen Konzept: Man teilt<br />
den Alltag und die Freizeit. Liebe erinnert<br />
zunehmend an ein Modulsystem einer<br />
nützlichen Zusammenstellung.<br />
All den Suchenden stehen die neuen Biedermeier<br />
entgegen, die schon früh Häuser<br />
bauen, Kinder bekommen und heiraten.<br />
Im Werte-Index 2016 jedoch sinkt erstmals<br />
wieder die Zustimmung zur Idee fester Familienbünde:<br />
zurück zur einer Offenheit,<br />
die gleichermaßen Neues und Angst vor<br />
der Ungewissheit zulässt.<br />
Obwohl sich der Liebesbegriff in einer<br />
„Gesellschaft der Singularitäten“ ändert,<br />
wie der Soziologe Andreas Reckwitz meint,<br />
bleibt eines zeitlos gültig: die Notwendigkeit<br />
von Vertrauen und Mut. Jede Beziehung<br />
braucht einen Vorschuss an Hoffnung.<br />
Und sicher Wagemut. Nur wenn Liebe<br />
bar jeder Berechenbarkeit die Gefahr<br />
des Scheiterns birgt, wird ihr wohl unerschöpflicher<br />
Reichtum offenbar.<br />
ILLUSTRATION: JONAS HASSELMANN FÜR DER FREITAG; MATERIAL: GETTY IMAGES, ISTOCK<br />
Streik bei der BBC!<br />
Leider nicht.<br />
Aber schön wär’s<br />
Es war einmal eine Zeit, da setzten<br />
sich Arbeitnehmer gemeinsam<br />
dafür ein, dass alle mehr verdienten.<br />
Dafür wandten sie sich in der Regel<br />
an diejenigen, die für Ungerechtigkeit<br />
in der Bezahlung zuständig waren – die<br />
Arbeitgeber. Wenn die nicht spurten,<br />
drohten sie mit Streik. Und wenn das<br />
auch nichts half, machten sie die Drohung<br />
wahr. Manchmal etwas rabiater,<br />
oft jedoch eher konziliant, manchmal<br />
sehr erfolgreich, oft jedoch eher weniger<br />
– am Ende hatten alle mehr in<br />
der Tasche (außer natürlich der Arbeitgeber).<br />
So ganz „Es war einmal“ ist das<br />
zugegebenermaßen nicht, wie derzeit<br />
die IG Metall versucht unter Beweis zu<br />
stellen. Dennoch gibt es eine merkwürdige<br />
Tendenz dazu, den Lohn nicht als<br />
solchen für geleistete Arbeit zu werten,<br />
sondern als freundliche Spende. Und<br />
wenn jemand anders weniger gespendet<br />
bekommt, dann ist es kein Problem,<br />
selbst auf einen Teil der Spende zu verzichten<br />
– als Akt des Großmuts.<br />
Geschehen zuletzt bei der BBC. Der<br />
britische Rundfunkgigant wird von einer<br />
mittelschweren Krise geplagt, seit<br />
Anfang Januar die China-Korrespondentin<br />
Carrie Gracie ihren Job hingeworfen<br />
hatte. Begründung: Männer in ähnlichen<br />
Positionen verdienen mitunter bis<br />
zu 50 Prozent mehr.<br />
Das brachte das Unternehmen in<br />
Erklärungsnot, nun will es mit dieser<br />
Praxis aufräumen. Dazu gehört, dass<br />
sechs der prominentesten – männlichen<br />
– Flaggschiffe nun auf einen Teil<br />
ihres Gehalts (pardon: ihrer Spende)<br />
verzichten. John Humphrys, Jeremy<br />
Vine, Huw Edwards, Nicky Campbell,<br />
Nick Robinson und Jon Sopel sind<br />
allesamt Moderatoren bekannter Live-<br />
Sendungen in Radio und Fernsehen<br />
und haben eingewilligt, ihren Salär<br />
um teilweise die Hälfte zu reduzieren.<br />
Welch noble Geste! Gewiss, sie verdienen<br />
verdammt gut. Statt 500.ooo<br />
oder 600.000 Pfund pro Jahr nur die<br />
Hälfte zu bekommen, dürfte sie nicht in<br />
die Sphäre des verelendeten Proletariats<br />
herabstoßen.<br />
Zur Begründung erklärten sie wahlweise,<br />
dass sie es eben als ungerecht<br />
empfänden, als Einzige in einer Sendung<br />
so gut zu verdienen. Oder dass<br />
ihre Gehälter aus einer Zeit stammten,<br />
in der die BBC jene, die ihr Gesicht<br />
und ihre Stimme waren, mit Geld überschüttete.<br />
Dass das fast nur Männer<br />
betraf – ja, okay. Als treu ergebene<br />
Arbeitnehmer fügten sie hinzu, dass es<br />
dieses Geld nun eben nicht mehr gebe.<br />
Doch damit sind sie in genau jene<br />
Falle marschiert, die der ideologisch<br />
postmoderne Kapitalismus den Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern<br />
stellt. Es sollte nicht darum gehen, dass<br />
alle weniger verdienen. Ziel muss sein,<br />
dass alle in Wohlstand leben. Und ja, in<br />
diesem Falle mag das müßig sein, da<br />
weder die Frauen durch die Ungerechtigkeit<br />
noch die Männer durch den Verzicht<br />
an den Rand des Hungertuchs<br />
befördert werden. Dann wäre allerdings<br />
die Debatte ohnehin hinfällig. Es geht<br />
ums Prinzip! Denn es darf sich nicht<br />
durchsetzen, dass Fragen der gerechten<br />
Bezahlung nach unten geregelt werden.<br />
Auch beim Gender Pay Gap geht es ja in<br />
der Regel nicht darum, wie groß nun<br />
die Penthousewohnung in London ist,<br />
die man sich leisten kann, sondern<br />
um waschechte Armut. Sollen bald auch<br />
männliche Facharbeiter wieder Armutslöhne<br />
bekommen, weil Frauen ja auch<br />
nicht besser bezahlt werden?<br />
Was für ein Zeichen wäre es gewesen,<br />
wären die sechs prominenten BBC-<br />
Moderatoren einfach in den Streik getreten<br />
– und zwar so lange, bis ihre Kolleginnen<br />
eine saftige, angleichende Gehaltserhöhung<br />
bekommen hätten. Und<br />
dann gemeinsam weiter, bis auch jene,<br />
die nicht im Rampenlicht stehen, aber<br />
den Laden BBC am Laufen halten, mehr<br />
Geld bekommen hätten. Und dann<br />
mit denen weiter, bis auch im privaten<br />
Sektor ... und so weiter. Bis zum Ende<br />
des Kapitalismus. Leander F. Badura
12 Chronik<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Die Woche vom 25. bis 31. Januar 2018<br />
FOTOS: AFP/GETTY IMAGES (4), IMAGO<br />
Trojaner<br />
Im Einsatz<br />
Vergangenen Sommer wurde vom<br />
Bundestag das passende Gesetz verabschiedet,<br />
nun ist er schon eifrig im<br />
Einsatz: der Staatstrojaner für Smartphones,<br />
oder, wie Strafverfolger<br />
sagen: die Quellen-Telekommunikationsüberwachung<br />
(Quellen-TKÜ). Das<br />
ergaben Recherchen von SZ, NDR und<br />
WDR. Mit dem neuen Werkzeug nutzen<br />
Ermittler Sicherheitslücken aus –<br />
oder suchen gar gezielt nach ihnen –,<br />
um Verschlüsselungen von Messenger-<br />
Diensten wie WhatsApp oder Signal<br />
zu umgehen. Nötig sei dies, da sich ein<br />
Großteil der Kommunikation in solche<br />
Dienste verschoben hat. Kritiker<br />
planen nun eine Verfassungsbeschwerde,<br />
da die digitale Sicherheit<br />
der Bürger auf dem Spiel stehe. LFB<br />
Mazedonien/Griechenland<br />
Im Streit<br />
Die Nationalisten in Griechenland lassen<br />
sich nicht erweichen. Für sie gibt es<br />
im Namensstreit mit der Regierung in<br />
Skopje weiter keine Kompromisse. Die<br />
einstige jugoslawische Teilrepu blik<br />
dürfe nicht länger Mazedonien heißen,<br />
weil das irgendwann dazu führen<br />
werde, die gleichnamige nordgriechische<br />
Provinz zu beanspruchen. Zuletzt<br />
hatte ein UN-Vermittler in New York<br />
Vorschläge repräsentiert, wie der 1991<br />
ausgerufene Staat künftig heißen<br />
könnte: Neu- oder Nordmazedonien,<br />
Obermazedonien oder Repu blik<br />
Mazedonien-Skopje. Premier Tsipras<br />
könnte damit leben, nicht so rechtskonservative<br />
Hardliner, die allein in<br />
Thessaloniki 90.000 Menschen zu<br />
einem Protestzug mobilisierten. LH<br />
Tschechien<br />
Im Stechen<br />
Zwar konnte Jiří Drahoš (Foto) einen<br />
Achtungserfolg landen und die 26,6<br />
Prozent aus dem ersten Wahlgang auf<br />
den Wert 48,6 steigern, doch das reichte<br />
nicht. Der bisherige Präsident Miloš<br />
Zeman hat mit 51,4 Prozent gesiegt und<br />
bleibt bis 2023 Staatsoberhaupt des<br />
NATO- und EU-Landes. Vor dem Stechen<br />
hatte Zeman dafür gesorgt, dass<br />
die Minderheitsregierung der Partei<br />
ANO unter Andrej Babiš zunächst die<br />
Amtsgeschäfte ohne parlamentarische<br />
Mehrheit übernehmen konnte. Ob<br />
sich das Kabinett behauptet, ist offen.<br />
Gegen den Premier wird ermittelt,<br />
weil er sich als Unternehmer EU-Subventionen<br />
erschlichen haben soll.<br />
Für Babiš ein Komplott, wie er immer<br />
wieder betont. <br />
LH<br />
Banken<br />
Im Unrecht<br />
Seitdem die EZB von den Banken Negativzinsen<br />
verlangt, wollen diese sie<br />
an ihre Kunden durchreichen. Sparer<br />
bekommen so für ihre Einlagen nicht<br />
nur keine Zinsen, sondern zahlen<br />
auch noch drauf. Während viele Banken<br />
bei Einlagen ab 100.000 Euro<br />
oder gar noch mehr zugreifen, wollte<br />
die Volksbank Reutlingen schon ab<br />
10.000 Euro Geld von ihren Kunden.<br />
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg<br />
klagte und das Landgericht<br />
Tübingen entschied nun, dass die Praxis<br />
rechtswidrig ist. Weil die Bank die<br />
Zinsen nicht nur bei neuen Verträgen,<br />
sondern auch nachträglich für Altkunden<br />
eingeführt hatte, kippte das<br />
Gericht das ganze Modell. Das Urteil<br />
könnte wegweisend sein. LFB<br />
Bolivien<br />
Im Rückwärtsgang<br />
Staatschef Evo Morales gibt wachsendem<br />
politischen Druck nach und will<br />
das Parlament ersuchen, die jüngsten<br />
Neuerungen des Strafgesetzbuches<br />
zurückzunehmen. Dies sei eine Reaktion<br />
auf Proteste und Streiks von<br />
Berufsverbänden, schreibt das Nachrichtenportal<br />
Amerika 21. Die Regierung<br />
sah sich dabei auch aufgefordert,<br />
das Ergebnis des Plebiszits vom 21. Februar<br />
2016 zu respektieren, bei dem<br />
eine Mehrheit die unbegrenzte Wiederwahl<br />
von Politikern verwarf. Dies galt<br />
nicht zuletzt der Absicht von Morales,<br />
beim Präsidentenvotum im nächsten<br />
Jahr wieder anzutreten und um die<br />
vierte Amtszeit zu kämpfen. Die Opposition<br />
hatte das als „Staatsstreich<br />
gegen die Demokratie“ bezeichnet. LH<br />
1968 Krieg ohne Ende<br />
Zeitgeschichte Die Tet-Offensive des Vietcong führt den USA<br />
vor Augen, dass ihre Streitmacht in Südvietnam den Kampf um<br />
Indochina nicht verlieren, aber auch nicht gewinnen kann<br />
■■Lutz Herden<br />
Durchsichtig wird die Luft von<br />
Hue gegen Mittag, dunstig ist sie<br />
am Morgen, wenn noch die Nebel<br />
der Nacht auf der Stadt liegen<br />
und im Wasser des Parfümflusses<br />
das zitternde Nachbild des Mondes<br />
schwimmt. Fallen werden die Schleier erst mit<br />
dem Zenit der Sonne, wenn in Vietnams einstiger<br />
Kaiserresidenz die Zitadelle keinen<br />
Schatten mehr wirft. Hinter den Wällen und<br />
Mauern der „Verbotenen Purpurstadt“ haben<br />
sich einst die Herrscher der Nguyen-Dynastie<br />
das Volk verbeten, weil sie glaubten, als Gottkönige<br />
mit der Ewigkeit verschworen zu sein.<br />
Die mutmaßlich Erwählten fanden ein jähes<br />
Ende, als am 30. August 1945 der Monarchie<br />
die letzte Stunde schlug und Bao Đai, der<br />
13. Thronfolger des Nguyen-Geschlechts, am<br />
Ngo-Mon-Tor mit den Worten abdankte: „Mit<br />
Bedauern denken Wir an die Jahre Unserer Regierung,<br />
in denen Wir es nicht vermochten,<br />
etwas von Belang für Unser Land zu tun.“ Am<br />
Abend jenes Tages schirmte nicht mehr das<br />
Gelbe Tuch des Kaisers die Zitadelle, stattdessen<br />
hatte die Demokratische Republik des<br />
Staatsgründers Ho Chi Minh ihr Banner aufgezogen,<br />
sollte es aber noch zweimal fallen<br />
sehen, bevor es unangefochten wehte über<br />
den Lotus-Teichen.<br />
Mitte der 1950er Jahre, nach der Genfer Indochina-Konferenz,<br />
die das Ende der französischen<br />
Kolonialära in Vietnam besiegelte, hatte<br />
sich Vietnam in zwei Staaten geteilt. Die<br />
sozialistische Volksrepublik im Norden, verbündet<br />
mit der Sowjetunion und China, stand<br />
in einem erklärten Krieg mit der prowestlichen<br />
Republik im Süden, unterstützt seit den<br />
frühen 1960er Jahren von US-Militärberatern,<br />
den Vorboten eines Besatzungskorps, das eines<br />
baldigen Tages mehr als eine halbe Million<br />
Soldaten zählen sollte.<br />
Der britische Schriftsteller Graham Greene<br />
hatte in seinem 1955 erschienenen Roman<br />
Der stille Amerikaner, den er in wenigen Wochen<br />
auf der Terrasse des Hotels Continental<br />
in Saigon schrieb, das Unheil des amerikanischen<br />
Krieges in Vietnam erahnt, bevor es tatsächlich<br />
dazu kam. Die Geschichte spielt 1952<br />
in Südvietnam – der junge, sendungsbewusste<br />
CIA-Agent Pyle spannt dem englischen Korrespondenten<br />
Thomas Fowler die einheimische<br />
Geliebte aus, geht ansonsten über Leichen<br />
und trüben Geschäften nach. Er<br />
ermuntert eine den USA genehme „Dritte<br />
Kraft“, durch Terroranschläge die französische<br />
Kolonialverwaltung zu erschüttern, und verklärt<br />
dies zur Katharsis im Namen von Freiheit<br />
und Democracy. Der „hinterhältige Anschlag“,<br />
dem Pyle schließlich zum Opfer fällt<br />
und den Fowler durch einen Hilfsdienst für<br />
den nationalkommunistischen Untergrund<br />
der Viet Minh ermöglicht, wird zur Metapher.<br />
Amerika vergreift sich an Vietnam, scheitert<br />
und geht zugrunde. Der tote Pyle wird zum<br />
Propheten des großen Sterbens Zehntausender<br />
GIs, der Leichensäcke, der abgerissenen<br />
Beine und Gesichter.<br />
Anfang 1968 stehen unter Führung von General<br />
Westmoreland 485.600 US-Soldaten in<br />
Südvietnam und hören von Präsident Lyndon<br />
B. Johnson, der Sieg sei in Sicht. Keine drei<br />
Jahre ist es her, dass am 8. März 1965 die ersten<br />
zwei Bataillone Marines als Kampfverband<br />
am Strand von Da Nang gelandet sind.<br />
Danach wächst die Präsenz von Woche zu Woche.<br />
Immer mehr reguläre US-Truppen ziehen<br />
in den Krieg gegen die Soldaten aus Nordvietnam<br />
und der Befreiungsfront im Süden, die<br />
im Westen Vietcong („vietnamesische Kommunisten“)<br />
genannt werden. Die Amerikaner<br />
schleppen sich durch die Regenwälder Annams,<br />
kriechen in die feindlichen Tunnel im<br />
Gebiet Cu Chi, sitzen im Zentralen Hochland<br />
fest, hoffen auf Entsatz und denken an nichts<br />
mehr. Sie errichten monströse Stützpunkte in<br />
Đa Nang und Cam Ranh oder Khe Sanh, ein<br />
paar Kilometer südlich des 17. Breitengrades,<br />
der Grenze zwischen Nord- und Südvietnam.<br />
Am 30. Januar 1968 feiert der Süden das<br />
buddhistische Tet-Fest mit Maskentanz und<br />
Feuerwerk, um das beginnende „Jahr des Affen“<br />
zu empfangen. Noch in der Neujahrsnacht<br />
stürmen 85.000 Vietcong 36 der 44 Provinzhauptstädte<br />
im Süden. Auch in Hue droht<br />
der Himmel zu zerspringen. Guerilla-Einheiten<br />
erobern die Stadt auf beiden Seiten des<br />
Parfümflusses und setzen eine eigene Regierung<br />
ein, die sich darauf stützt, dass die Befreiungsfront<br />
in Hue seit Jahren verankert ist.<br />
Saigon: Einer der Angreifer wird von US-Militärpolizisten abgeführt<br />
Soldaten mit<br />
starrem<br />
Kiefer warten<br />
auf den<br />
Angriff oder<br />
den Abflug<br />
ins Lazarett<br />
FOTO: ROLLS PRESS/POPPERFOTO/GETTY IMAGES<br />
Über der Zitadelle hissen junge Vietnamesen<br />
die blau-rote Fahne mit dem gelben Stern ihrer<br />
Revolution. Es dauert eine ganze Woche,<br />
bis es US-Marines über den Fluss schaffen, um<br />
einzugreifen. In den USA sehen Millionen<br />
Fernsehschauer bei Live-Übertragungen vom<br />
Kriegsschauplatz, wie die Männer unter Beschuss<br />
geraten, sich zurückziehen, wieder vorgehen<br />
und wieder festsitzen. Sie sehen, wie<br />
verkohlte Leichen und ausgebrannte Humvees<br />
die Straßen blockieren, Soldaten mit<br />
starrem Kiefer auf den Angriff oder den Abflug<br />
mit dem Sanitätshubschrauber warten.<br />
Vielen wird bewusst, es sind nicht die<br />
475.000 Mann des Generals Westmoreland,<br />
die irgendwo in Indochina eine Schlacht gegen<br />
den Kommunismus schlagen. Wir sind es,<br />
die Vereinigten Staaten, die einen so aussichtslosen<br />
wie barbarischen Krieg führen.<br />
Auch die Hauptstadt Saigon wird von der<br />
Tet-Offensive erfasst. Vietcong tauchen im<br />
Viertel um den Großmarkt Ben Thanh mit<br />
den vielen Schleichwegen auf, die in Greenes<br />
Roman ein Thomas Fowler nahm, um Kontaktleute<br />
zu treffen. Es geschieht das bis dahin<br />
Unfassbare. Einem Trupp aus dem Vietcong-<br />
Bataillon C-10, das normalerweise für Subversion<br />
und Sabotage zuständig ist, gelingt es, im<br />
sichersten Distrikt das am besten gesicherte<br />
Gebäude Südvietnams anzugreifen. Am 31. Januar<br />
1968 gegen acht Uhr Ortszeit wird das<br />
„Weiße Haus von Saigon“, wie die US-Botschaft<br />
heißt, zum Schlachtfeld. Die 19 Kämpfer des<br />
Kommandos dringen nicht nur auf das Gelände<br />
der Mission vor, sie verschanzen sich im<br />
Erdgeschoss der Residenz. Der Vietnamkrieg<br />
tobt erstmals auf US-Territorium und dauert<br />
zwei Stunden. Als die Angreifer erschossen<br />
oder gefangen genommen sind, entern Kamerateams<br />
von ABC und CBS das Gelände, um<br />
die Toten aufzunehmen. 16 Vietnamesen, ein<br />
US-Marine, vier Militärpolizisten der Army.<br />
Die Botschaft des Horrors: Wir sind ihnen<br />
trotz allem überlegen. In diesem Krieg kann<br />
viel passieren, aber er wird noch in hundert<br />
Jahren nicht verloren gehen. Keiner fragt:<br />
Lohnt es sich, einen Krieg nur deshalb zu führen,<br />
weil man ihn nie verlieren kann?<br />
In Hue wird 26 Tage lang erbittert gekämpft.<br />
Die Walzen der Explosionen rollen durch die<br />
Stadt und pulverisieren Mauern und Menschen.<br />
Wenn sich die Rauchschwaden lichten,<br />
tauchen Panzer der südvietnamesischen Armee<br />
auf, um Quartiere zurückzuerobern, die<br />
keine mehr sind. Wer von den Vietcong überlebt<br />
hat, zieht sich zurück. Von den 135.000<br />
Bewohnern sind 110.000 obdachlos, als am 27.<br />
Februar 1968 wieder die gelb-rote Flagge Südvietnams<br />
über der Zitadelle weht.<br />
Auch wenn die Tet-Offensive für die Angreifer<br />
nicht den erhofften Durchbruch bringt,<br />
weil der erwartete Aufstand in den südvietnamesischen<br />
Städten ausbleibt, hinterlässt allein<br />
die Schlacht um Hue in den USA eine tiefe<br />
Wirkung. Es ist schwer zu glauben, was dieser<br />
Gegner, den Napalmteppiche und entlaubte<br />
Wälder zermürben sollen, noch fertigbringt,<br />
weil ihn die Entschlossenheit nie verlässt. Die<br />
Falken unter den US-Generälen behaupten,<br />
Tet war der letzte Atemzug des Vietcong. Doch<br />
glaubt das Oberkommando nicht daran.<br />
Schon Anfang März 1968, keine Woche nachdem<br />
die Gefechte abgeflaut sind, verlangt<br />
Westmoreland intern 206.000 zusätzliche<br />
Soldaten für Vietnam, womit die Truppenstärke<br />
bei fast 700.000 Mann läge. Selbst wenn er<br />
sie bekäme, was nicht geschieht, wäre damit<br />
noch nichts gewonnen.<br />
Walter Cronkite, Anchorman bei CBS News,<br />
kommentiert nach der Tet-Offensive: „Wer<br />
sagt, wir näherten uns einem Sieg, der glaubt<br />
nicht den Tatsachen, sondern den Optimisten,<br />
die sich schon so oft irrten. Von eine Pattsituation<br />
zu sprechen, ist der allein richtige,<br />
wenn auch unbefriedigende Schluss. Es wird<br />
immer klarer, dass wir verhandeln sollten –<br />
nicht als Sieger, sondern als ehrbares Volk.“
13<br />
Arbeit Franco Berardi erotisiert den General intellect S. 15<br />
Kunst Simon Strauß provoziert die Engagierten S. 17<br />
Lohn Das bedingungslose Grundeinkommen kommt ins Kino S. 19<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Hex Hex? Nö.<br />
Eine Ausstellung<br />
zeigt, dass gute<br />
Fantasy kein<br />
Hokuspokus,<br />
sondern harte<br />
Arbeit ist S. 16<br />
Betonblumen<br />
Stadtraum Der Streit über das „Avenidas“-Gedicht an der Fassade der Berliner<br />
Alice-Salomon-Hochschule ist entschieden. Es muss da weg. Wenn dieser Streit<br />
etwas Gutes hatte, dann dies: Selbst ein Jens Spahn interessierte sich (kurz) für Dichtkunst.<br />
Hier sechs Pastiches von Eugen Gomringers umstrittenem Gedicht<br />
FOTOS [M]: IMAGO, FOTO OBEN: LISA MAREE WILLIAMS/GETTY IMAGES
14 Kultur<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Medientagebuch<br />
Die „Huffington<br />
Post“ jagt ihre<br />
Blogger vom Hof<br />
Süße Frucht der Revolution! Vor<br />
ein paar Jahren schien die Medienwelt<br />
sich im Umbruch zu befinden.<br />
Damals schickten sich Blogs an,<br />
unsere publizistischen Gewohnheiten<br />
durcheinanderzuwirbeln. Als Bereicherung,<br />
vielleicht sogar als Surrogat, zum<br />
Angebot der großen Verlagshäuser.<br />
Die Huffington Post schwang sich schon<br />
20<strong>05</strong> zur tonangebenden Plattform in<br />
dieser mutmaßlichen Zeitenwende auf.<br />
Mit einer erheblichen Anzahl von<br />
unbezahlten Bloggern und ohne redaktionellen<br />
Filter wollte sie den Journalismus<br />
umkrempeln. Bürgerjournalismus<br />
als Vorstufe der deliberativen<br />
Demokratie; Jürgen Habermas wird sich<br />
gefreut haben! Doch die Revolution<br />
scheiterte, bevor sie überhaupt richtig<br />
Fahrt aufgenommen hatte. Blogs spielen<br />
heute politisch und ökonomisch so<br />
gut wie keine Rolle mehr. Aber wieso<br />
sollten Voluntaristen den medialen<br />
Betrieb nicht trotzdem ergänzen und<br />
von außen stimulieren?<br />
Doch auch die Huffington Post frisst<br />
ihre Kinder. Hier wurden die Blogger<br />
jetzt vom Hof gejagt und ab sofort wird<br />
– aus Qualitätsgründen – alleine der<br />
professionelle Journalismus den Ton<br />
angeben. Die Sphären des nicht gefilterten<br />
Meinungsaustausches seien zu<br />
„schmutzigen Orten geworden, wo<br />
sich nur der Lauteste durchsetzt“, sagte<br />
Chefredakteurin Lydia Polgreen.<br />
Schmutzig? Laut? So ist das Internet<br />
wohl manchmal. Aber es fragt sich, wieso<br />
die Kollegen nicht etwas mehr Aufwand<br />
betrieben haben, um ihr Medium<br />
zu moderieren, und stattdessen das<br />
grundsätzlich richtige Prinzip der Lesereinbindung<br />
komplett über Bord geworfen<br />
haben. Reicht es nicht, die Irren in<br />
die Untiefen der Website zu verbannen?<br />
Wieso müssen direkt alle Leine<br />
ziehen?<br />
Als ich 2013 anfing, für den <strong>Freitag</strong><br />
zu bloggen, war ich noch Schüler. Ich<br />
schrieb meine Enttäuschung über<br />
Barack Obama auf, nahm Oskar Lafontaine<br />
gegen Günter Grass in Schutz<br />
und beschimpfte die CSU als rechtspopulistisch<br />
und unsozial. Das hat Spaß<br />
gemacht! Und es war kein reiner Selbstzweck<br />
– ich wollte gelesen werden. Hier<br />
gewinnen alle: die Leser, weil ihnen<br />
eine zusätzliche Stimme gegeben wird,<br />
die Medien, weil sie dadurch die Menschen<br />
an ihr Produkt binden, und die<br />
Demokratie, weil Streit sie wachhält.<br />
Wenn die Huffington Post die Professionalisierung<br />
will, wird sie sie bekommen.<br />
Das Rad der Geschichte wird<br />
sie damit aber nicht zurückdrehen. Die<br />
allermeisten Menschen haben nach<br />
der Schule genug von Lehrern und wollen<br />
nicht mehr nur belehrt und informiert,<br />
sondern ernst genommen werden.<br />
Deswegen funktioniert moderner<br />
Journalismus nur als reziproke Verständigung,<br />
als Dialog zwischen Autor<br />
und Leser. Medien, die das nicht<br />
begreifen, wird es bald nicht mehr<br />
geben.<br />
Dorian Baganz<br />
KLEINANZEIGE<br />
Buchungen ab sofort unter:<br />
weber-herzog@freenet.de<br />
Oder Telefon 030 - 229 75 91<br />
Infos: www.christa-weber.de<br />
Kur an der polnischen Ostseeküste<br />
in Bad Kolberg! 14 Tage ab 299 €!<br />
Mit Hausabholung 70 € Tel.: 00489 43 55 62 10<br />
In Brett Baileys „Sanctuary“ ist keiner willkommen<br />
Hölle Europa<br />
Flucht Das Frankfurter Theaterfestival „Displacements“ entwirft unseren Kontinent<br />
als Ort der Herzlosigkeit und teilt dabei nicht zu knapp mit der Moralkeule aus<br />
■■Alexander Jürgs<br />
Ein dunkler Raum, eine weiße<br />
Wand. Durch ein Loch in dieser<br />
Wand steckt man den linken<br />
Arm. Er wird gegriffen, wird bewegt.<br />
Nur ab und zu erblickt man<br />
die Hände, die Finger, die dies tun. Dann<br />
spürt man einen Stift auf der Haut. Kleine<br />
Figuren entstehen, eine Zeichnung, die einen<br />
Treck von Geflüchteten darstellt. Über<br />
Kopfhörer lauscht man der Geschichte des<br />
Zeichners: ein Palästinenser, aufgewachsen<br />
in einem Flüchtlingslager in Damaskus, geflohen<br />
in die Türkei, in Deutschland für<br />
kurze Zeit inhaftiert. Und er singt, auf Arabisch,<br />
einen Rap. Der übersetzte Text steht<br />
auf der weißen Wand. „In den Booten sind<br />
alle Gesichter gestresst / Halten den Atem<br />
an / Pressen ihre Wunden ab / Sie haben<br />
viel Gewehrfeuer gehört / Sie fühlen nichts<br />
mehr“, heißt es darin. Ein Stück über die<br />
Sehnsucht nach Sicherheit und Freiheit,<br />
ein Aufbegehren gegen die Angst.<br />
As Far As My Fingertips Take Me hat die<br />
zwischen Beirut und London pendelnde<br />
Künstlerin Tania El Khoury ihre Performance<br />
genannt, bei der jeweils ein einzelner<br />
Zuschauer auf den Darsteller Basel<br />
Zaraa trifft. Sie dauert kaum länger als<br />
zehn Minuten und hinterlässt doch einen<br />
starken Eindruck. Auf einem Festival mit<br />
dem Titel Displacements im Frankfurter<br />
Künstlerhaus Mousonturm wurde das<br />
Stück nun zum ersten Mal im deutschsprachigen<br />
Raum gezeigt.<br />
Kitschpostkarten und Draht<br />
Die Werkschau, die Inszenierungen aus<br />
den vergangenen drei Jahren zusammenfasst,<br />
will ein Gegenentwurf zum aktuellen<br />
Status quo sein, der Geflüchtete nur noch<br />
als Abzuwehrende wahrnimmt. Gezeigt<br />
werden Arbeiten aus den Grenzbereichen<br />
des Theaters, vom Berliner Performance-<br />
Kollektiv Rimini Protokoll, von dem brasilianischen<br />
Regisseur Marcio Abreu oder<br />
dem japanischen Künstler Akira Takayama,<br />
Thomas Irmer über die zehn Inszenierungen, die zum 55. Theatertreffen eingeladen sind<br />
Revolution nur ohne Brecht<br />
Die Wette wäre ohne Risiko<br />
gewesen: An Frank Castorfs<br />
Faust war für die siebenköpfige<br />
Jury kein Vorbeikommen<br />
als fundamentale Neudeutung<br />
im derzeit sogar auf der<br />
höchsten politischen Agenda stehenden<br />
Kolonialkontext. Wenn<br />
die Volksbühnen-Inszenierung<br />
im Mai im Haus der Berliner<br />
Festspiele gezeigt wird, wird die<br />
Welt noch einmal erkennen,<br />
was diesem Theater und seinen<br />
Schauspielern angetan wurde.<br />
Gleich daneben eine weitere<br />
Großproduktion, die ohne ihre<br />
Vorgeschichte in der Volksbühne<br />
nicht denkbar ist: das Nationaltheater<br />
Reinickendorf von Vegard<br />
Vinge und Ida Müller. Die bislang<br />
nur zehn Mal gezeigte Performance<br />
kreist in Variationen bis<br />
zu 12 Stunden lang um Ibsens<br />
Baumeister Solness, womit Vinge<br />
sich auch an Castorf abarbeitet.<br />
Die Zehner-Auswahl aus über<br />
400 Inszenierungen in rund 50<br />
Städten zeugt von unserer unruhigen<br />
Zeit mit bohrenden Fragen<br />
ohne Antwort. Da steht Elfriede<br />
Jelineks Trump-Stück Am Königsweg<br />
(Schauspielhaus Hamburg,<br />
Regie Falk Richter) neben Rückkehr<br />
nach Reims (Berliner Schaubühne),<br />
in der Thomas Ostermeier<br />
mit Didier Eribons Buch<br />
und Nina Hoss als Protagonistin<br />
nach dem Verdampfen sozialer<br />
Grundsätze der Linken fragt. Dieser<br />
Inszenierung steht wiederum<br />
ein anderes Erfahrungsbuch zur<br />
Seite. Die Einladung von Die Welt<br />
im Rücken von Thomas Melle in<br />
der Regie von Jan Bosse (Burgtheater<br />
Wien) meint auch Joachim<br />
Meyerhoff als höchst begnadeten<br />
Darsteller der bipolaren Krankheit<br />
des Autors.<br />
Und aus dem Klassiker-Repertoire?<br />
Ein Woyzeck, bei dem<br />
Ulrich Rasche am Theater Basel<br />
in einer radikal künstlichen<br />
Inszenierung Büchners Text zum<br />
Vorschein bringt. Zweimal geht<br />
es an die Antike: In der Odyssee<br />
(Thalia Theater Hamburg) begibt<br />
sich Antú Romero Nunes an den<br />
Anfang des Erzählens und füttert<br />
zugleich die postdramatische<br />
Theatermaschine. Diese eher verspielte<br />
Variante kontrastiert mit<br />
der feministischen Ernsthaftigkeit<br />
von BEUTE FRAUEN KRIEG in<br />
der Regie von Karin Henkel.<br />
Neu ist das Phänomen der<br />
Rekon struktion mit veränderten<br />
Vorzeichen, ein Verfahren, das<br />
in der bildenden Kunst wie auch<br />
im Tanz gängig ist und nun das<br />
die Gruppe Mobile Albania organisiert Interventionen<br />
im Stadtraum. Die zentralen<br />
Fragen des Festivals werden schon seit einiger<br />
Zeit heftig diskutiert: Welche Rolle<br />
können Geflüchtete im Gegenwartstheater<br />
spielen? Wie können Projekte auf Augenhöhe<br />
entstehen? Wo werden Flüchtlinge<br />
zum Material, zur Projektionsfläche verdammt?<br />
Wo verläuft die Grenze zwischen<br />
Kunst und Sozialarbeit?<br />
Die aus Syrien stammende und heute in<br />
Paris lebende Künstlerin Bissane Al Charif<br />
zeigt im Foyer ihre Videoinstallation<br />
Women’s Memories. Das Werk ist sehr sachlich,<br />
sehr unaufgeregt – obwohl die syrischen<br />
Frauen, die darin zur Wort kommen<br />
und ihre Fluchtgeschichten minutiös nacherzählen,<br />
von unerhörten Grausamkeiten<br />
berichten. Bissane Al Charif hat die Interviews<br />
mit den Frauen großteils bereits 2013<br />
und 2014 geführt, ihre Arbeitsweise entspricht<br />
viel eher der einer Journalistin als<br />
der einer Dramaturgin oder Regisseurin.<br />
Aus ihren Recherchen erschafft sie kein<br />
Stück, sondern eine Dokumentation.<br />
Thea tertreffen mit zwei bemerkenswerten<br />
Beispielen erreicht.<br />
Für Brechts Trommeln in der<br />
Nacht hat Christopher Rüping an<br />
den Münchner Kammerspielen<br />
Otto Falckenbergs Uraufführung<br />
von 1922 im Bühnenbild sowie<br />
in den expressionistischen Spielund<br />
Sprechhaltungen von damals<br />
rekonstruiert – Komik und Hommage<br />
zugleich. Wichtig dabei<br />
auch: Es gibt den Schluss des<br />
Stücks in zwei Versionen, die von<br />
Brecht und eine, in der sich der<br />
Held für die Revolution entscheidet.<br />
Auf jeden Fall bereitet Rüping<br />
mit dieser Volte schon mal die<br />
kommende Brecht-Freiheit mit<br />
vor. Ebenfalls an den Münchner<br />
Kammerspielen hat Anta Helena<br />
Recke eine Inszenierung von<br />
Mittelreich (nach dem Roman von<br />
Josef Bierbichler) als Kopie einer<br />
FOTO: JÖRG BAUMANN<br />
Stumm starren<br />
Geflüchtete<br />
die Besucher<br />
an, wirken<br />
ausgestellt wie<br />
Zootiere<br />
Mit viel Wucht und großer Geste arbeitet<br />
hingegen der südafrikanische Regisseur<br />
Brett Bailey. Sanctuary hat er seine Inszenierung<br />
getauft. Es ist die Weiterentwicklung<br />
einer Installation, die der Künstler<br />
bereits in Athen, auf Lesbos und im vergangenen<br />
Jahr in Hamburg beim Festival Theater<br />
der Welt gezeigt hat. Bailey hat dafür<br />
eine große Halle am Stadtrand von Frankfurt<br />
in ein Labyrinth verwandelt, hat aus<br />
viel schwarzem Stoff und Nato-Stacheldraht<br />
einen eindrucksvoll-beängstigenden<br />
Parcours erschaffen. Einzeln werden die<br />
Besucher in dieses Anti-Paradies eingelassen.<br />
Auf der ersten Station bekommen sie<br />
noch postkartenkitschige Europa-Impressionen<br />
– das Brandenburger Tor, das idyllische<br />
Vernazza an der ligurischen Küste,<br />
österreichische Wiesen – vorgeführt, doch<br />
je weiter sie in Baileys Irrgärten vordrängen,<br />
umso bedrückender werden die Szenen.<br />
Auf weißen Zetteln, mit roter Schnur<br />
verbunden, stehen die Namen von Geflüchteten<br />
und die typischen Stationen ihrer<br />
Wege: Istanbul, die serbische Grenze,<br />
Sofia, der „Dschungel“ von Calais. Drei Jahre<br />
lang hat der Südafrikaner Bailey auf den<br />
Flüchtlingsrouten und in den Camps für<br />
seine Installation recherchiert.<br />
Auch seine Darsteller sind Geflüchtete<br />
oder Aktivisten. Die Figuren aber, die sie<br />
repräsentieren, sind nicht sie selbst, sondern<br />
fiktiv. Man stößt auf eine Frau, die<br />
sich prostituiert, um die Schulden bei den<br />
Schleppern zu begleichen, man sieht einen<br />
Mann in Abschiebehaft, man erblickt eine<br />
griesgrämige Alte mit Strickzeug auf dem<br />
Sofa, auf ihrem Fernseher erscheint das<br />
Konterfei von Marine Le Pen. Der Theatermacher<br />
inszeniert all diese Figuren als Tableaux<br />
vivants. Sie bleiben stumm, sie starren<br />
die Besucher an, sie wirken ausgestellt<br />
wie Zootiere. Es fällt schwer, ihre fordernden<br />
Blicke zu erwidern, genauso schwer<br />
fällt es, diesen Blicken auszuweichen.<br />
Baileys Installation baut darauf, dass<br />
man sich in ihr unwohl fühlt, Europa zeichnet<br />
der Regisseur als unbarmherzigen Ort.<br />
Sanctuary wirkt dabei plakativ, man fühlt<br />
sich wie von einer Moralkeule erschlagen,<br />
die Inszenierung ist alles andere als subtil.<br />
Vielleicht aber, denkt man, ist es ja genau<br />
das, was gerade jetzt benötigt wird: ein<br />
Theater, das den Ist-Zustand schonungslos<br />
nachzeichnet, das angreift, das aus seinem<br />
aktivistischen Impetus kein Geheimnis<br />
macht.<br />
Displacements. Andere Erzählungen von<br />
Flucht, Migration und Stadt, Künstlerhaus<br />
Mousonturm, Frankfurt am Main, bis 4. Februar<br />
früheren Inszenierung mit<br />
schwarzen Schauspielern angelegt,<br />
auch um die Normen des<br />
Theaterbetriebs mit seinem eigenen<br />
Rezeptionsverhalten infrage<br />
zu stellen (siehe der <strong>Freitag</strong><br />
41/2017). Wenn man will, kann<br />
man das sogar mit dem kolonialen<br />
Castorf-Faust in Verbindung<br />
bringen und das Ganze als Theatergeschichte<br />
heutigen Bewusstseins<br />
lesen. Dazu passt die Mitteilung<br />
von Festspiele-Chef Thomas<br />
Oberender, dass sich zum<br />
Treffen im Mai so viele Chinesen<br />
akkreditieren wollen wie nie.<br />
Vielleicht wollte er auch einfach<br />
nur sagen, dass es wieder knapp<br />
wird mit den Karten.<br />
Das 55. Theatertreffen findet vom<br />
4. bis 21. Mai in Berlin statt
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Kultur<br />
15<br />
Für den italienischen Philosophen<br />
und Medientheoretiker<br />
Franco<br />
Berardi ist das Jahr 1977<br />
ein epochaler Wendepunkt,<br />
der das Ende der Moderne,<br />
den Beginn der Postmoderne und<br />
einer neoliberalen Sozialphilosophie<br />
markiert. In dem Fotoband<br />
Malgrado voi über die sozialen<br />
Kämpfe in Bologna plädierte er<br />
schon damals für die Erkundung<br />
der neuen Verbindungen zwischen<br />
Wissen, Technologie und<br />
Arbeit. Um soziale Autonomie<br />
Franco „Bifo“ Berardi, 68,<br />
studierte Ästhetik an<br />
der Universität Bologna und<br />
schloss sich 1969 der<br />
außerparlamentarischen<br />
Potere Operaio an. Er ist<br />
Mitgründer von Radio Alice,<br />
dem ersten freien Radio in<br />
Italien. Im Mai erscheint sein<br />
neues Buch Die Seele bei<br />
der Arbeit bei Matthes & Seitz<br />
aufzubauen, schrieb er, sei ein<br />
Verständnis der ökonomischen<br />
Entwicklungen und der Mikroelektronik<br />
nötig. Gut 40 Jahre später<br />
wird Berardi nicht müde, zu<br />
kritisieren, dass wir die Potenziale<br />
neuer Technologien längst nicht<br />
ausschöpfen, solange diese den<br />
Zweckvorstellungen des Kapitals<br />
unterworfen sind.<br />
der <strong>Freitag</strong>: Herr Berardi, Sie<br />
waren während der Arbeitskämpfe,<br />
die in Italien 1969 begannen,<br />
Mitglied von Potere Operaio. Für<br />
die außerparlamentarische Linke<br />
war schon damals das Verhältnis<br />
von Arbeit und Technologie<br />
zen tral. Wie sehen Sie vor diesem<br />
Hintergrund die aktuellen Entwicklungen?<br />
Franco Berardi: Wichtig ist<br />
dabei der Bezug auf den Marx des<br />
Maschinenfragments aus den<br />
Grundrissen der Politik der Kritischen<br />
Ökonomie. Uns interessierte<br />
die technologische Frage als Voraussetzung<br />
für die Verweigerung<br />
der Arbeit. Wenn einer fragt „Was<br />
ist der tiefe Sinn all dessen, was in<br />
der Welt zwischen 1968 und 1977<br />
passierte?“, dann würde ich antworten:<br />
dass einer Minderheit bewusst<br />
geworden ist, dass sich der Kommunismus<br />
erst durch die Befreiung<br />
von der Arbeit vollendet. Aber<br />
wir waren nicht in der Lage, das<br />
in eine echte Bewegung zu überführen,<br />
weil Parteien wie die italienische<br />
kommunistische Partei<br />
und die deutsche Sozialdemokratie,<br />
ja überhaupt die Linke allgemein<br />
daran festhielt, den Arbeitsplatz<br />
zu verteidigen. Eben weil<br />
die alte Arbeiterbewegung nicht<br />
das Maschinenfragment las und<br />
nicht fähig war, die junge studentische<br />
Revolte mit dem möglichen<br />
Befreiungsprozess von der Lohnarbeit<br />
zu verbinden. Dieses Problem<br />
bleibt heute mehr denn je bestehen.<br />
Die technologische Entwicklung<br />
hat uns nicht von der Arbeit<br />
befreit. Im Gegenteil, wir sind<br />
gestresster und prekärer als zuvor.<br />
Genau, denn die Arbeitsbedingungen<br />
haben sich verschlechtert.<br />
Der Lohn ist geringer und die<br />
Prekarität gestiegen. Und wir haben<br />
Angst, dass die Roboter uns die<br />
Arbeit wegnehmen. Das Problem<br />
steckt im Lohn, in den Bedingungen<br />
der Entlohnung. Wir müssen<br />
die Voraussetzungen dafür schaf<br />
Technologische Bedingung für einen Ausbruch ist hier die Klinke. Aufs Handy gucken geht aber auch<br />
„Unser<br />
Hirn leidet“<br />
Im Gespräch Der Philosoph Franco Berardi erklärt,<br />
warum wir uns von der Arbeit befreien müssen und<br />
weshalb die Zeit im Cyberspace aus dem Takt ist<br />
fen, dass wir weniger in kollektiven<br />
Zusammenhängen arbeiten<br />
müssen und allen eine Form der<br />
Grundsicherung, eine ökonomische<br />
Form des Überlebens, garantiert<br />
wird.<br />
In Deutschland wird das Grundeinkommen<br />
kontrovers diskutiert.<br />
Führende Gewerkschafter<br />
sind eher dagegen.<br />
Ja klar, das kann ich mir schon denken,<br />
weil es ihre Macht angreift.<br />
Die Macht der Gewerkschaften<br />
basiert auf dem Unterschied zwischen<br />
jenen, die arbeiten, und<br />
denen, die nicht arbeiten. Meiner<br />
Meinung nach ist das vor allem<br />
eine kulturelle Schlacht. Verweigerung<br />
der Lohnarbeit heißt aber<br />
nicht, nichts zu tun. Es bedeutet,<br />
jene Formen der Betätigungen<br />
maximal zu entwickeln, die nicht<br />
auf den Lohn zu reduzieren<br />
sind. Die Sorge oder Bildung sind<br />
im Wesentlichen freudvolle Tätigkeiten,<br />
die der Kapitalismus in entlohnte<br />
Leistungen verwandelt hat.<br />
In Ihrem Buch „Aufstand der<br />
Emotionen“ beschreiben Sie eine<br />
neue „Semisphäre“. Das erinnert<br />
an die alten feministischen Theorien<br />
zur Rolle der Reproduktionsarbeit,<br />
die Gebrauchswert<br />
schafft, aber keinen Tauschwert<br />
hat. Besteht da eine Analogie?<br />
„Die Linke<br />
kämpft stets<br />
für die<br />
Lohnarbeit,<br />
das ist<br />
das Problem“<br />
FOTO: JENS GYARMATY<br />
Ja, absolut. Dem industriellen<br />
Kapitalismus gelingt es, Arbeit zu<br />
semiotisieren, die in Zeiteinheiten<br />
quantifizierbar ist. Nehmen Sie<br />
etwa die Muskelarbeit der Arme.<br />
Welche Arbeit in einer Stunde verrichtet<br />
werden kann, lässt sich<br />
bemessen. Wenn es aber darum<br />
geht, die Arbeit zu definieren, die<br />
es braucht, um ein Kind zu erziehen,<br />
einen alten Menschen zu pflegen<br />
oder eine geniale, architektonische<br />
Idee zu haben, wie macht<br />
man das? Benötigt man eine<br />
Minute oder zehn Jahre dafür? Das<br />
ist eine Tätigkeit, die nicht messbar<br />
ist. Wir haben die Sphäre der<br />
quantifizierbaren industriellen<br />
Arbeit verlassen. Daher funktioniert<br />
die kapitalistische Semiotisierung,<br />
die in Lohn übersetzt, nicht mehr.<br />
Das Allerwichtigste für mich heutzutage<br />
ist die Anerkennung des<br />
kognitiven und affektiven Reichtums<br />
menschlicher Tätigkeit.<br />
Diese ist nicht mehr auf Kapitalformen<br />
zu reduzieren.<br />
Wird das Kapital nicht irgendwann<br />
auch in der Lage sein, diesen<br />
Reichtum verwertbar zu<br />
machen?<br />
Dem Kapital gelingt es, kognitive<br />
und affektive Tätigkeit in einen<br />
ökonomischen Wert zu verwandeln<br />
und erlaubt ihr nicht, ihr volles<br />
Potenzial zu verwirklichen.<br />
Wenn das Kapital eine Tätigkeit<br />
ausbeuten will, die sich nicht auf<br />
das Modell der Lohnarbeit reduzieren<br />
lässt, muss es diese pervertieren.<br />
Das Kapital unterwirft sich<br />
die kognitive Arbeit durch eine<br />
Veränderung des Zwecks. Der<br />
eigentliche Zweck der kognitiven<br />
Arbeit wäre es, das menschliche<br />
Leben zu bereichern. Die Funktion,<br />
die das Kapital der kognitiven Arbeit<br />
zuweist, lässt es verkümmern.<br />
Müssen wir also die körperliche<br />
und mentale Ebene in die Erforschung<br />
der digitalen Entwicklung<br />
einschließen?<br />
Das Kapital braucht das kollektive<br />
Gehirn bei der Arbeit. Unser Hirn<br />
bereichert sich stetig, während es<br />
vom Körper zunehmend entbunden<br />
ist, weshalb es zu einem leidenden<br />
Hirn wird. Die Folge sind Einsamkeit,<br />
Depression, Angstzustände,<br />
eine steigende Zahl an<br />
Selbstmorden. Umgekehrt ist der<br />
Körper zunehmend vom Gehirn<br />
getrennt, weshalb er ausflippt, ein<br />
dementer Körper, ein rassistischer<br />
Körper, ein faschistischer Körper,<br />
ein sexistischer Körper wird. Ein<br />
Körper, der nicht mehr in der Lage<br />
ist, sich intellektuell und affektiv<br />
mit anderen Körpern zu verbinden.<br />
Er reagiert auf Grundlage der<br />
einzigen Sache, die ihm geblieben<br />
ist: der Identität. Die Hautfarbe zu<br />
erkennen, die Sexualität zu erkennen<br />
und vieles mehr. Ich glaube,<br />
der gegenwärtige Identitarismus<br />
ist ein Resultat dieser Demenz.<br />
Was heißt das politisch?<br />
Die kognitive Arbeit hat die technologischen<br />
Bedingungen für die<br />
Befreiung geschaffen. Anstatt<br />
einer Befreiung schafft der Kapitalismus<br />
aber eine Trennung zwischen<br />
der Körperlichkeit der Masse.<br />
Sieben Milliarden Körper, die<br />
immer verzweifelter sind, immer<br />
einsamer und immer enthirnter.<br />
Andererseits gibt es ein kollektives<br />
Gehirn, das perfekt funktioniert,<br />
jedoch gegen den Menschen.<br />
Für den gegenwärtigen Cyberspace<br />
scheinen Körper, Zeit,<br />
Raum und soziale Verhältnisse<br />
hingegen irrelevant zu sein.<br />
Nun ja, du kannst Amphetamine<br />
nehmen, um schneller zu laufen,<br />
aber du kannst die Schnelligkeit<br />
des Cyberspace nicht einholen.<br />
Daher befindet sich die Cybertime<br />
ständig in einem Zustand des<br />
Nicht-in-Takt-Seins. Das bewirkt<br />
ein konstantes Angstgefühl. Meiner<br />
Ansicht nach ist es genau dieses<br />
Leiden, das zu Energie werden und<br />
Neues in Bewegung setzen kann.<br />
Die Lebendigkeit von Bewegungen<br />
war immer ein Ergebnis des<br />
Zusammenseins. Wie kann dieser<br />
Entwicklung politisch begegnet<br />
werden, wenn körperlicher Kontakt<br />
immer weniger erlebt wird?<br />
Mit Occupy haben wir 2011 gesehen,<br />
dass die Frage um die Körper<br />
zentral wird, als etwas, das dir<br />
entflieht. Was war diese Bewegung,<br />
die nicht gewonnen, die überall<br />
verloren hat? Der tiefere Sinn war<br />
das Anliegen, den kollektiven Körper<br />
wiederzubeleben, der gelähmt<br />
ist. Occupy war der Beginn eines<br />
neuen Zyklus, der vielleicht 50 Jah<br />
re andauern wird und der die neue<br />
Frage der Wiederaktivierung<br />
des erotischen Körpers des „General<br />
Intellect“ hervorbringt.<br />
In Deutschland würde die Kritik<br />
folgen, solch eine Politik sei identitär,<br />
da der Kampf um Körper<br />
kein sozialer, sondern ein identitärer<br />
Kampf sei.<br />
„Sieben<br />
Milliarden<br />
Körper<br />
verzweifeln<br />
jeden<br />
Tag mehr“<br />
Das verstehe ich nicht, denn Identitätspolitiken<br />
sind wichtig. Gerade<br />
weil wir Körper ohne universalistische<br />
Bezugspunkte sind, erkennen<br />
wir uns als Identitäten: Weiß<br />
gegen Schwarz, die Frau als identitäre<br />
Figur gegen den Mann als<br />
identitäre Figur. Mir scheint, dass<br />
wir nur aus dem Identitarismus<br />
herauskommen, wenn wir die<br />
Beziehung zwischen Körper und<br />
Gehirn, also zwischen der affektiven,<br />
gesellschaftlichen Dimension<br />
und jener der kognitiven Arbeit<br />
wieder in Beziehung setzen. Sich<br />
zum Körper zu bekennen, heißt<br />
nicht, die Identität des Körpers zu<br />
fordern.<br />
Wie aber ließe sich die Trennung<br />
von Gehirn und Körper überwinden?<br />
Der Kern ist die Marx’sche Idee des<br />
„General Intellect“. Er beschreibt<br />
etwas, das wir heute mit dem Internet<br />
kennen. Nämlich das Hirn,<br />
das sich über den gesamten Planeten<br />
verbinden und selbstverständlich<br />
interagieren kann. Die<br />
Programmierung der Technologie<br />
könnte neu ausgerichtet werden,<br />
wenn das Subjekt nicht das Finanzkapital,<br />
sondern die kollektive<br />
Leiblichkeit wäre.<br />
Sie rufen zur Benutzung der Ironie<br />
in der politischen Praxis auf.<br />
Manchmal haben wir den Eindruck,<br />
dass der Kapitalismus gewonnen<br />
hat, weil er sich unsere Sprache<br />
einverleibt hat. Ironie hingegen ist<br />
die unendliche Doppeldeutigkeit<br />
von Sprache.<br />
Was bedeutet das im Hinblick auf<br />
die Digitalisierung?<br />
Die kräftigsten Formen der politischen<br />
Beziehung sind jene, die sich<br />
in einer Neukodierung von Zeichen<br />
ausdrücken. Das ist Wikileaks,<br />
das sind die tausend Figuren aus<br />
Hamburg, die bleich und grau<br />
angemalt durch die Stadt gehen<br />
und es schaffen, etwas zu kommunizieren,<br />
das alle sehen. Die Aufgabe<br />
der Bewegungen ist das singuläre,<br />
individuelle Begehren, aufzuschnappen<br />
und auszubrechen.<br />
Die technischen Modalitäten, um<br />
aus dieser Hölle auszubrechen,<br />
werden zu schaffen sein. Wissentlich,<br />
dass wir für die nächsten zehn<br />
Jahre in einer Falle stecken. Ich<br />
glaube nicht, dass wir schnell da<br />
rauskommen. Wir müssen dranbleiben,<br />
den erotischen Körper der<br />
kognitiven Arbeit wiederzubeleben,<br />
um das Potenzial zu befreien,<br />
das die Technik bereithält.<br />
Das Gespräch führte Anna Stiede
16 Literatur<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Hermines Welt<br />
Potter Die British Library<br />
korrigiert einige hartnäckige<br />
Mythen über J.K. Rowling,<br />
die erfolgreichste Autorin, die<br />
die Welt je gesehen hat<br />
■■Teresa Mallt<br />
Als J.K. Rowling begann, den<br />
ersten Harry Potter zu schreiben,<br />
lagen bereits Jahre der<br />
Arbeit hinter ihr. Fünf Jahre<br />
hatte sie sich Zeit genommen,<br />
um die Welt und Geschichte Harry Potters<br />
akribisch vorzubereiten. Dann, nachdem<br />
sie alles entworfen hatte, die Handlung bis<br />
zum siebten und letzten Band, begann sie<br />
den Stein der Weisen. Sie verfasste außerdem<br />
das letzte Kapitel der Serie und<br />
schloss es weg. Die Komplexität Harry Potters<br />
kann sich nicht zuletzt aus dieser Systematik<br />
entfalten – und mit ihr sein gigantischer<br />
Erfolg: 450 Millionen verkaufte Bücher,<br />
Übersetzungen in 79 Sprachen, 8<br />
Blockbuster, die größte (und treueste) Fangemeinde<br />
überhaupt. Es ist das erfolgreichste<br />
Buch aller Zeiten. Seit bald 30 Jahren<br />
arbeitet Rowling nun daran. Rowling<br />
versteht sich nicht primär als Autorin mit<br />
der großen Fantasie. Eigentlich missfällt<br />
ihr dieses Bild sogar, das wohl am prominentesten<br />
von ihr gezeichnet wurde.<br />
Die Vorbereitung: fünf Jahre<br />
Kommt aus der<br />
Asche. Bringt auch<br />
ganz schön viel<br />
Asche: In London<br />
boomt die Magie<br />
Da wird eine aschenputtelartige Geschichte<br />
von einer ehemals armen, unglücklichen<br />
Frau, die zu ihrem Glück aber begabt ist<br />
mit starker Einbildungskraft, erzählt. Von<br />
einer alleinerziehenden Mutter, die, wenn<br />
ihr Baby schlief, in Cafés (weil beheizt) eilte<br />
und dort auf Servietten (weil kostenlos)<br />
schrieb. Sie musste nie auf Servietten<br />
schrei ben, hat sie längst versucht klarzustellen.<br />
Außerdem sei sie nicht so blöd,<br />
mitten im Winter eine unbeheizte Wohnung<br />
in Edinburgh zu mieten. Sozialhilfeempfängerin<br />
war sie auch bloß einige Monate<br />
lang. Und so weiter – die Geschichte<br />
Rowlings besteht aus einer ganzen Reihe<br />
von vermarktbaren Details, die mit ihr als<br />
Schriftstellerin nichts zu tun haben.<br />
In der ersten TV-Dokumentation über sie<br />
von 2001 wollte sie stattdessen über die Arbeit<br />
an Harry Potter sprechen. Man sieht<br />
sie auf dem Boden ihres Arbeitszimmers<br />
sitzen, um sie herum liegen überall eng beschriebene<br />
Blätter Papier, Notizbücher,<br />
Zeichnungen von Szenen und Figuren. Im<br />
Durchgang zu einem weiteren Zimmer stapeln<br />
sich weitere Kisten, im Hintergrund<br />
stehen noch ein paar. Rowling spricht darüber,<br />
wie es zu Beginn des Schreibprozesses<br />
darum ging, diese gewaltige Ansammlung<br />
an Material zu verdichten. Daraus<br />
Stück für Stück ein Buch „herauszumeißeln“.<br />
Was stellt sie selbst für Erwartungen<br />
an einen Autor? Grundsätzlich, dass er allwissender<br />
Gott seiner Schöpfung ist. Vertraut<br />
ist mit seiner Welt und ihrer internen<br />
Logik weit über das hinaus, was letztlich im<br />
Buch stehen wird. Wenn es dabei um ein so<br />
gewaltiges Epos wie Harry Potter geht, ist<br />
das ein hoher Anspruch. Rowling wird ihm<br />
ganz und gar gerecht: Verwoben mit dem<br />
Fantasy-Stoff ziehen sich Rückgriffe auf<br />
klassische Literatur, Mythologie, Wissenschaft,<br />
Folklore und Historie wie feine Fäden<br />
durch die Bücher.<br />
Von der British Library in London wurden<br />
sie nun in etwas hautnah Erlebbares<br />
verwandelt: A History of Magic stellt die<br />
Recherchen und Inspirationen Rowlings<br />
aus. Organisiert nach den Fächern, die in<br />
Hogwarts unterrichtet werden, lässt sich<br />
hier von Alchemie zu Astronomie gehen,<br />
von Kräuterkunde zu Geschichte von Fabelwesen,<br />
Hexen und Okkultismus, und<br />
immer weiter. Man erfährt: Informationen<br />
über Pflanzen und Tränke bezog Rowling<br />
unter anderem aus The English Physician,<br />
dem ersten Medizinbuch Nordamerikas<br />
von 1652 (dessen Autor wurde später der<br />
Hexerei angeklagt). Hagrid steht, klar, in<br />
Damit das mal<br />
klar ist: Sie<br />
musste niemals<br />
Servietten<br />
vollschreiben<br />
der langen Tradition des Giganten mit riesigem<br />
Herzen. Nicholas Flamel, der Macher<br />
des Steins der Weisen, beruht auf einem<br />
gewissen Nicholas Flamel, der 1418 in Paris<br />
verstarb. Hinter beinahe allen Namen, Gegenständen<br />
und Pflanzen gibt es eine alte<br />
Tradition, einen Jux, eine Heldensage, eine<br />
historische Figur zu entdecken. Daneben<br />
tauchen auch viele der schon erwähnten<br />
Zeichnungen und Zettel wieder auf: handschriftliche<br />
Manuskripte, organisatorische<br />
Notizen und detaillierte Plotpläne, auf denen<br />
die einzelnen Tage im Buch ausgeführt<br />
werden. So lässt sich in der Ausstellung<br />
F O T O : Z U M A P R E S S / I M A G O<br />
eine Seite der Harry-Potter-Autorin in Augenschein<br />
nehmen, die sonst nahezu unsichtbar<br />
bleibt – zugunsten des Märchens<br />
von der frierenden, alleinerziehenden<br />
Mutter Joanne Rowling – und am Ende<br />
fragt man sich, warum das eigentlich so ist.<br />
Je mehr man über andere Fantasy-Autoren<br />
liest, umso drängender wird die Frage. Ob<br />
es einem Joseph K. Rowling vielleicht anders<br />
ergehen würde.<br />
Hätte man sich längst fasziniert Joseph<br />
K. Rowlings Denken zugewendet? So wie<br />
dem des ebenfalls britischen Fantasy-Autors<br />
Philip Pullman? Sich längst aufgemacht,<br />
den Geist dieses Großmeisters zu<br />
ergründen, was ihn umtreibt, von welchen<br />
politischen Ansichten und metaphysischen<br />
Wahrheiten sein Werk durchwirkt<br />
ist? Rowling jedenfalls wird meist zu ihrer<br />
Familie befragt, ihrer Kindheit, ihren Fans,<br />
was sie davon hält, reicher als die Queen zu<br />
sein. Und dann ist da immer diese Frage<br />
nach den Schuhen. Bei Pullman würden<br />
solche Fragen statt als Interesse an seiner<br />
Arbeit wohl als beleidigend durchgehen.<br />
Eine Frau fragt<br />
man nach<br />
Kindheit, Fans,<br />
Familie –<br />
und Schuhen<br />
Popularität ist die eine Sache, als kultureller<br />
Beitrag ernst genommen zu werden,<br />
eine andere. Dieses Problem ist natürlich<br />
alt: Frauen schreiben Bücher, Frauen verkaufen<br />
Bücher. Aber was die Anerkennung<br />
angeht, messbar etwa an Literaturkritik<br />
und, noch besser, in Literaturpreisen, da<br />
dominieren Männer – auch aktuell noch.<br />
Wenn ein Mann Fantasy schreibt, ist es<br />
ein episches Triologie-Meisterwerk über<br />
den Kampf gegen Ideologie und Totalitarismus.<br />
Wenn eine Frau Fantasy schreibt, ist<br />
es eine magische Romanreihe über den<br />
Zauberer-Jungen Harry. Schön, muss man<br />
aber nicht so ernst nehmen. (Die Ausnahme<br />
bildet die berüchtigte Ex-Chef-Kritikerin<br />
der New York Times, Michiko Kakutani,<br />
die Harry Potter durchaus ernst nahm).<br />
Unterschieden werden sollte einzig nach<br />
gutem und schlechtem Schreiben, nicht<br />
nach Geschlecht. Aber gelesen wird noch<br />
immer, mit Vorstellungen davon hinter<br />
den Brillengläsern, was vermeintlich ureigenes<br />
Metier der Autorin, was Metier des<br />
Autors ist. Metiers von Frauen sind dabei<br />
tendenziell Beziehungen, das Psychologische,<br />
Familiäre, der kleinere Rahmen. Vertrautes<br />
männliches Metier ist der Krieg, die<br />
Politik, Macht, der große Rahmen. Ja, das<br />
ist sehr antiquiert und absurd. Und gefiltert<br />
durch diese antiquierten Stereotype<br />
wird das Buch des männlichen Autors anders<br />
gelesen als das einer Autorin. Was sich<br />
wiederum darin widerspiegelt, was in diesen<br />
Büchern gesehen wird, auch oder insbesondere<br />
bei fantastischer Literatur.<br />
Man fragt sich, wie anders Rowling hätte<br />
porträtiert werden können. Als der Typ des<br />
grandios-obsessiven Autors? Man wäre ihr<br />
damit gerechter geworden. Oder schlicht<br />
als Nerd? Die Figur der Hermine basiert<br />
nicht umsonst gänzlich auf der jungen<br />
Rowling. Und eine älter gewordene Hermine<br />
könnte exakt so aussehen wie Rowling<br />
in ihrem Arbeitszimmer. Nichtsdestotrotz,<br />
Tolkiens Herr der Ringe wurde anfangs als<br />
„Mischung aus Richard Wagner und Pu der<br />
Bär“ verspottet. Abwarten also, was die literarische<br />
Achtung vor Rowling angeht. Die<br />
Ausstellung in der British Library wenigstens<br />
würde einer Hermine schon einmal<br />
gefallen.<br />
Harry Potter. A History of Magic The British<br />
Library, London, noch bis zum 28. Februar 2018<br />
Huch! Schluss?<br />
Lyrik Wenn Marco Tschirpke singt oder einen Witz erzählt, kann alles ganz schnell vorbei sein<br />
■■Ben Mendelsohn<br />
Trifft man ihn abseits seiner Auftritte,<br />
hat man einen aufgeräumten, ruhigen<br />
Zeitgenossen vor sich. Auf der<br />
Bühne ist Marco Tschirpke ein Ausbund an<br />
Fahrigkeit, gibt sich spontan bis planlos –<br />
alles nur Show. Diese Show zieht Tschirpke<br />
als Klavierkabarettist seit 15 Jahren ab. Und<br />
obwohl es viele Pianisten gibt in der Kabarettszene:<br />
Tschirpkes Werk sticht hervor<br />
und sucht bislang seinesgleichen.<br />
Denn der Musiker und Lyriker legt größten<br />
Wert darauf, sich in aller Kürze auszudrücken.<br />
Deshalb dauern seine „Lapsuslieder“,<br />
wie er diese selbst geschaffene Kurzgattung<br />
nennt, in den seltensten Fällen<br />
länger als eine Minute. Das gilt auch für<br />
die Gedichte Tschirpkes, die Mitte Januar<br />
im Band Empirisch belegte Brötchen erschienen<br />
sind. Es ist nach dem Spiegel-<br />
Bestseller Frühling, Sommer, Herbst und<br />
Günther (2015) seine zweite Gedichtsammlung,<br />
die bei den Ullstein-Buchverlagen<br />
erscheint. Bücher bei Verlagen zu<br />
veröffentlichen, bedeute immer, Kompromisse<br />
eingehen zu müssen, gibt der<br />
Künstler zu. Er müsse sich erst einmal daran<br />
gewöhnen, sie nicht ganz alleine zu<br />
machen. Bei seinen ersten Lyrikbänden<br />
hatte er noch vom Artwork bis zur letzten<br />
Abnahme alles selbst organisiert.<br />
Tschirpkes Gedichte sind prägnant, pointiert<br />
und gerne stichelnd, ohne dabei<br />
grundlos fies zu sein. Er beschreibt versiert<br />
vermeintlich uninteressante Geschehnisse<br />
des Alltags, die er witzelnd kommentiert<br />
und ad absurdum führt. Und vereinzelt<br />
streut der Autor auch berührend schöne<br />
Gedichte ein. Zum Beispiel beschreibt<br />
Tschirpke, wie er mit jedem Ärger, den er<br />
hat, im Park Gassi geht – um den Ärger<br />
dort von der Leine zu lassen und alleine zurückzukehren.<br />
Daneben versammelt der<br />
Band auch bissige Kommentare und Sehr-<br />
kurzgeschichten. Tschirpke, 1975 in Rathenow<br />
geboren, rechnet darin unter anderem<br />
mit der Generation der 68er ab: „Sie wollten<br />
die Vereinigung aller Proletarier. Sie<br />
erreichten die Mülltrennung.“ Daneben<br />
stehen Gedichte zum alten China oder bislang<br />
eher unbeleuchteten historischen Ereignissen.<br />
Sein Verständnis von und großes<br />
Interesse an Geschichte sind auch im<br />
neuen Lyrikband unverkennbar. Doch insgesamt<br />
überzeugt der Band nicht nur<br />
durch den Tschirpke-eigenen Tonfall, der<br />
läppisch und bildungssprachlich zugleich<br />
wirkt. Es wird zudem eine thematische<br />
Bandbreite bespielt, die die jedes Generalisten<br />
in einer Lokalredaktion übersteigt:<br />
Tschirpke liefert Gedichte über Tiere<br />
(und tierähnliches Verhalten bei Menschen),<br />
„Brut und Pflege“, Natur, Politik<br />
und natürlich über die Kunst – sein Herzensthema.<br />
Allein Tschirpkes Texte und<br />
Lieder über die Malerei könnten über eine<br />
Stunde Programm füllen. Wer Marco<br />
Tschirpke auf der Bühne erlebt, merkt spätestens<br />
nach zehn Minuten, dass es ihm<br />
darum geht, mit den Erwartungen seines<br />
Publikums zu spielen und mit diesen zu<br />
brechen. Er legt ein irres Tempo hin, wenn<br />
er in die Tasten des Klaviers haut – um<br />
dann ruhig zu warten, nachdem sein Kurzlied<br />
ein überraschend abruptes Ende genommen<br />
hat.<br />
Mal flach, aber mit Steigung<br />
Marco Tschirpke bespielt kleine Kabarettbühnen<br />
genauso wie den Quatsch Comedy<br />
Club, er hat großen Respekt vor der so oft<br />
kritisierten Comedy. Schließlich kann er<br />
selbst auch mal flache Witze reißen und<br />
bastelt manches Gedicht scheinbar nur,<br />
um es im letzten Vers durch ein Wortspiel<br />
in einen Kalauer zu verwandeln. Einige dieser<br />
Gags haben es jetzt auch in den neuen<br />
Lyrikband Empirisch belegte Brötchen geschafft.<br />
Das gleichnamige Kabarettpro-<br />
gramm hat an diesem Wochenende in Berlin<br />
Premiere. Mitte des Monats erhält<br />
Tschirpke dann in Mainz den Deutschen<br />
Kleinkunstpreis in der Sparte „Chanson/<br />
Lied/ Musik“.<br />
Manchmal macht der Brandenburger auf<br />
der Bühne so verstiegene und um drei<br />
Ecken gedachte Witze, dass die meisten Zuschauer<br />
im Saal erst mal verwirrt zurückbleiben.<br />
Dann sagt Marco Tschirpke selbstironisch,<br />
er mache „gerne eine Handvoll<br />
Scherze nur für mich.“ Dabei guckt er verschmitzt<br />
in den dunklen Raum, so als mache<br />
ihm ein stilles Publikum fast so viel<br />
Spaß wie ein laut lachendes. Und dann<br />
geht der Abend weiter. Wie üblich bei<br />
Tschirpke: in einem rasanten Tempo.<br />
Empirisch belegte Brötchen:<br />
Gedichte und Geschichten (in überwiegend<br />
komischer Manier) Marco Tschirpke<br />
Ullstein Taschenbuch € 21,99
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Literatur 17<br />
■■Mladen Gladić<br />
Der Schriftsteller und FAZ-Theaterkritiker<br />
Simon Strauß steht<br />
im Casino des Berliner Abgeordnetenhauses<br />
und sagt,<br />
dass eigentlich alles gesagt sei<br />
in der Debatte um seine Person. Strauß<br />
meint den Streit darüber, ob er, Sohn der<br />
Journalistin Manuela Reichart und des<br />
Büchner-Preisträgers Botho Strauß,<br />
„rechts“ sei. Ob er „im Gewand der Romantik<br />
Pamphlete für die AfD“ schreibe.<br />
So stand es jedenfalls in einem Artikel,<br />
den Alem Grabovac in der taz veröffentlichte:<br />
Strauß stilisiere sich als Nachfahre<br />
Ernst Jüngers, habe die AfD dafür gelobt,<br />
Merkels Flüchtlingspolitik „vernünftig“ zu<br />
kritisieren und Künstler dafür gegeißelt,<br />
„nur noch jämmerliche Untergebene des<br />
Konsums und der Moralpolitik“ zu sein.<br />
Dabei habe er sich nicht nur auf die<br />
„rechtsradikale“ Zeitschrift Tumult berufen,<br />
er habe auch – in anderem Zusammenhang<br />
– den Neurechten Götz Kubitschek<br />
in den Salon, den er mit anderen in<br />
Berlin betrieb, eingeladen – kein Wunder,<br />
denn Strauß’ Ästhetik sei „die Verwirklichung<br />
der Kubitschek’schen Visionen“.<br />
Kein Tag ohne Wortmeldung<br />
Nichts ist zu blumig, als dass sich keine Debatte drumherumbasteln ließe<br />
Seitdem ist kein Tag ohne Wortmeldung in<br />
diesem Streit vergangen. Da sind die Stimmen,<br />
die die Vorwürfe teilen: Strauß gehöre<br />
zu jenen, „denen die AfD zwar zu vulgär<br />
ist, deren Anliegen aber scheinbar doch<br />
nicht so fern sind“, er träume von „Auswegen<br />
für den bedrohten Mann“, schrieb<br />
etwa Antonia Baum in der Zeit. Andere<br />
stellen sich vor Strauß, sprechen von „Hexenjagd“<br />
(Nora Bossong in der taz) oder<br />
„Rufmord“ (Ijoma Mangold in der Zeit).<br />
Und dann gibt es Stimmen, welche die Debatte<br />
für müßig halten.<br />
Ob überflüssig oder nicht, „Debatten“<br />
sind immer auch „Ausdruck des aktuellen<br />
Stands der Struktur von Öffentlichkeit“,<br />
wie die Merkur-Herausgeber Ekkehard<br />
Knoerer und Christian Demand einmal geschrieben<br />
haben. So gesehen, wundert<br />
dann schon, wie leichtfertig der Vorwurf,<br />
jemand sei ein Wegbereiter des Faschismus,<br />
über die Lippen geht. Es verwundert<br />
allerdings auch, dass einer recht still geblieben<br />
ist: Simon Strauß selbst. Abgesehen<br />
von einem offenen Brief an das besonders<br />
harsche Wetter-Magazin (ein Magazin<br />
für Text und Musik) auf Facebook, in dem<br />
er persönlicher Enttäuschung Ausdruck<br />
verlieh und die Kritiker etwas paternalistisch<br />
dafür tadelte, weder von Jünger noch<br />
von Romantik einen Schimmer zu haben,<br />
zog Strauß es vor, zu schweigen.<br />
Er wolle kein Interview geben, doch ich<br />
könne ihn bei den Jewish History Awards<br />
treffen, hatte mir Strauß nun auf eine Anfrage<br />
geschrieben. Die Auszeichnung, die<br />
eine amerikanische Stiftung an Deutsche<br />
vergibt, die sich um die Erinnerung an jüdisches<br />
Leben verdient gemacht haben, geht<br />
heute auch an die Joseph-Gruppe. Benannt<br />
ist sie nach dem Holocaust-Überlebenden<br />
Rolf Joseph. Den hatte Strauß noch zu<br />
Schulzeiten kennengelernt und mit Mitschülern<br />
sein Leben aufgeschrieben.<br />
Strauß spricht in seiner Preisrede souverän,<br />
wie einer, der Öffentlichkeit gewohnt<br />
ist. Er spricht von Lethe, dem Fluss des Vergessens<br />
in der griechischen Mythologie.<br />
Strauß ist promovierter Althistoriker. Er<br />
nennt Joseph seinen Großvater, sich und<br />
die Mitstreiter dessen Enkel. Keine Hollywoodproduktion,<br />
keine Seminarstunde<br />
werde einem den Holocaust vergegenwärtigen,<br />
sagt er, aber wer in der Erinnerung<br />
lebt, sei niemals tot. Der Preis wird von<br />
nun an zusammen in der FAZ ausgelobt,<br />
die besten Beiträge veröffentlicht.<br />
Er glaube, es sei falsch, die Rechten zu<br />
isolieren, nicht mit ihnen zu sprechen,<br />
denn das würde sie nur stärken, sagt<br />
Strauß später zu mir. Kubitschek nennt er<br />
nicht. Ich erwähne die Diskussionen um<br />
Mit Rechten reden, die Krawalle auf der<br />
Buchmesse, mein Befremden über die aggressive<br />
Ablehnung, die das Buch erfahren<br />
hat. Auf der Messe habe ich Strauß zuletzt<br />
getroffen, beim Empfang des Rowohlt-Verlags.<br />
Wir kennen uns: Im Frühjahr 2017 haben<br />
wir über Europa als Heimat diskutiert,<br />
bei einem Treffen der Gruppe Arbeit an<br />
Europa, auf einer Burg in Südthüringen.<br />
Strauß sagt, er müsse sich die Aufmerksamkeit,<br />
die ihm jetzt gezollt werde, erst<br />
verdienen. Erst einmal mehr schreiben.<br />
Die Denunziationen, wie er sie heute<br />
Abend noch zweimal nennen wird, dienten<br />
nur dazu, der Debatte einen „Dreh“ zu<br />
geben. Ich verstehe nicht gleich, frage<br />
nach. Der Faschismusvorwurf sei einfach<br />
nur eine weitere Drehung, sagt Strauß. Dafür<br />
sei das hier aber zu wichtig. Das meint<br />
die Erinnerungsarbeit, für die er gerade<br />
ausgezeichnet wurde.<br />
Was ihn wirklich interessiere sei, ob – frei<br />
nach Brecht – in finsteren Zeiten ein Gespräch<br />
über die blaue Blume tatsächlich<br />
ein Verbrechen sei – das hatte Das Wetter<br />
behauptet. Ob Kunst also eine Eigenlogik<br />
fernab des Politischen habe und ob es<br />
falsch sei, diese zu betonen. Er erwähnt einen<br />
Artikel von 2014: „Ich sehne mich nach<br />
Streit“ heißt er, das gelte immer noch. 2014<br />
war Strauß 26, noch nicht Redakteur und<br />
Sartre<br />
gegen Adorno,<br />
sage ich.<br />
Bohrer gegen<br />
Habermas,<br />
sagt Strauß<br />
Im heißen<br />
Brei<br />
Debatte Der Schriftsteller Simon Strauß steht unter Verdacht,<br />
ein Rechter zu sein. Wir haben bei ihm nachgefragt<br />
Autor. Jetzt ist in seinem „dreißigsten Jahr“,<br />
Romancier, Theaterkritiker. Die rechte Publizistin<br />
Ellen Kositza hat den Bogen von<br />
Strauß’ Sieben Nächten zu Bachmanns Erzählung<br />
von 1961 gespannt.<br />
Strauß sagt, er wolle ernste Auseinandersetzungen.<br />
„Auch über Männlichkeit?“, frage<br />
ich ihn, denke an Antonia Baum, die in<br />
ihrem „Contra“ in der Zeit zweimal<br />
schreibt, Strauß’ Alter Ego in Sieben Nächte<br />
esse Fleisch. Der Karnivore: kein Mann von<br />
heute. „Auch über Männlichkeit“, sagt<br />
Strauß. Aber er sei Theaterkritiker. Im Theater<br />
sei ihm aufgefallen, wie oft Kunst für<br />
moralische und politische Ziele verwertet<br />
werde. Ist man unschuldig, wo man etwas<br />
sagt? Strauß hätte nicht unbedingt Tumult<br />
zitieren müssen, hat Nora Bossong geschrieben.<br />
„Irony is over“<br />
Vielleicht ein Fehler, Adorno wäre besser<br />
gewesen, sagt Strauß jetzt. Er plane eine<br />
Podiumsveranstaltung mit einem Ästhetikphilosophen.<br />
Und vielleicht auch einem<br />
Verfechter politischer Literatur. Ende<br />
Februar, das hat Strauß’ Lektor beim Aufbau<br />
Verlag, Tom Müller, gerade angekündigt,<br />
werde es einen Abend zum Thema<br />
geben, wie politisch Literatur sein müsse.<br />
Ein junger Mann kommt auf uns zu,<br />
Strauß wird gebraucht, es wird gefilmt.<br />
Kurz scheint er zu überlegen, ob unser Gespräch<br />
hier schon beendet ist.<br />
Aber Strauß kommt wieder, wir spazieren<br />
durch die Gänge des Abgeordnetenhauses,<br />
an Gemälden, die Genscher oder<br />
Karajan zeigen, vorbei, sprechen, worüber<br />
Simon Strauß sprechen möchte, über den<br />
<br />
TEXT+KRITIK<br />
Die Zeitschrift für Literatur<br />
Zeitschrift für Literatur · Begründet von Heinz Ludwig Arnold · I/18<br />
217<br />
Navid Kermani<br />
ABB.: BARBARA REGINA DIETZSCH „GEFÜLLTE BLAUE HYAZINTHE MIT ROTEM KÄFER“; VOLKER-H. SCHNEIDER/KUPFERSTICHKABINETT/BPK<br />
alten Konflikt zwischen engagierter Literatur<br />
und autonomer Ästhetik. Sartre gegen<br />
Adorno, sage ich. Bohrer gegen Habermas,<br />
sagt Strauß. Was denn an Mallarmé rechts<br />
sei, will er wissen, und ich spekuliere, ob<br />
der Vorwurf des politischen Konservatismus,<br />
der Vertretern einer weltabgewandten<br />
Ästhetik gemacht werde, etwas mit Sippenhaft<br />
zu tun habe. Kurzes Aufflackern in<br />
Strauß’ Augen: Wahrscheinlich denkt er,<br />
dass ich jetzt über seinen Vater sprechen<br />
will. Will ich nicht – ich überlasse das Maxim<br />
Biller – und sage Stefan George.<br />
Was denn mit Beckett sei, fragt Strauß,<br />
den könne man doch nicht rechts nennen.<br />
Dass er nicht verstehen könne, dass es<br />
manchen reiche, Kunst in Kategorien des<br />
Politischen zu fassen, wie man das intellektuell<br />
befriedigend finden könne. In seiner<br />
Redaktion sei Dietmar Dath derjenige gewesen,<br />
der sein ästhetisches Anliegen am<br />
besten verstanden habe.<br />
Wir sprechen über Jünger- und Schmitt-<br />
Zitate in seinem Buch. Die seien doch ironisch<br />
gebrochen, sagt er, obwohl er ein<br />
schwieriges Verhältnis zur Ironie habe. Irgendjemand<br />
hat Strauß in die Tradition<br />
der deutschen Popliteratur gestellt,<br />
Kracht, Illies. Auch die glaubten an Jarvis<br />
Cockers Dekaden-Spruch „Irony is over“. In<br />
einem Artikel hat Strauß Jünger gegen die<br />
Vereinnahmung durch Martin Schulz verteidigt.<br />
Wahrscheinlich hat er den Buchhändler<br />
Schulz unterschätzt. Das sage ich<br />
nicht, erlaube mir aber die Bemerkung,<br />
dass es nicht Strauß’ stärkster Artikel war.<br />
Er ist kurz irritiert. Gekränkte Eitelkeit?<br />
Wenn, dann ist sie nach einer Sekunde<br />
verflogen: Das sei witzig gemeint gewesen,<br />
sagt er.<br />
Es wird Zeit zu gehen. In der Tasche meines<br />
Jacketts steckt Arthur Millers Theaterstück<br />
Hexenjagd von 1953, in dem eine historische<br />
Begebenheit zur Allegorie der<br />
Kommunistenjagd unter McCarthy wird.<br />
Ich zeige Strauß das Buch, vielleicht kann<br />
ich ihm ja noch etwas zum aktuellen Streit<br />
entlocken. Kein Erfolg. Ich sage, er hätte<br />
das sicher gelesen. Seine Augen glänzen:<br />
nicht nur gelesen, sondern auch oft auf<br />
der Bühne gesehen.<br />
Als wir zum Casino zurückgehen, versuche<br />
ich es direkter: Beleidigt es Strauß,<br />
„rechts“ genannt zu werden? Kurzes Nachdenken.<br />
Wenn rechts sei, zu sagen, dass<br />
Kunst einen Wert habe, eine Eigenlogik,<br />
jenseits der Tagespolitik, dann sei er ein<br />
Rechter. Aber nur dann, sagt Strauß.<br />
auch als<br />
eBook<br />
Heft 217<br />
Navid Kermani<br />
Er spricht vom<br />
Fluss des<br />
Vergessens.<br />
Strauß ist<br />
promovierter<br />
Althistoriker<br />
Herausgeber: Torsten Hoffmann<br />
96 Seiten, € 24,–<br />
ISBN 978-3-86916-668-1<br />
Navid Kermani experimentiert mit den ganz großen Themen: Liebe,<br />
Tod und – Fußball! Er ist einer der wichtigsten Intellektuellen der<br />
deutschsprachigen Literatur des 21. Jahrhunderts. Die BeiträgerInnen<br />
aus Wissenschaft, Feuilleton, Literaturbetrieb und Politik loten die<br />
unterschiedlichen Dimensionen von Kermanis Schreiben aus.<br />
ANZEIGE
18 Film<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Etwas<br />
klemmt<br />
Retrospektive Ula Stöckl wird 80. Das Berliner Arsenal<br />
zeigt ihre Filme. Eine kleine Auswahl<br />
Skeptisch gegenüber konventionellen Lebensentwürfen: Kristine de Loup in „Neun Leben hat die Katze“<br />
FOTO: DEUTSCHE KINEMATHEK<br />
Sonnabend, 17 Uhr<br />
Neun Leben hat die Katze<br />
Erikas Leidenschaften<br />
Das alte Lied<br />
1966 Zwei Jahre vor den großen gesellschaftlichen<br />
Aufbrüchen stellt die Filmstudentin<br />
Ula Stöckl eine Frage, die mehr will,<br />
als sie vorgibt: Was machen junge Leute<br />
Samstag 17 Uhr in ihrem Land? Stöckl ist in<br />
München unterwegs, filmt an der Isar, auf<br />
der Leopoldstraße, in Vorstadtgärten und<br />
typisch bundesdeutschen Wohnzimmern.<br />
Hier klemmt es besonders. Die jungen Leute<br />
(Abiturientinnen) blicken scheu, sie sagen<br />
Sachen wie: Nachmittagskaffee, Bummeln,<br />
vorwiegend Tanzlokale besuchen –<br />
„oder ich hab auch mal ein Rendezvous“.<br />
Der Film ist auch eine Chronik der Gesten,<br />
Körperhaltungen und Sprechweisen.<br />
Stöckl streift unterschiedliche gesellschaftliche<br />
Schichten und Stile (Starnberger Perlenkettenträgerinnen,<br />
Zünftige in bayerischer<br />
Tracht, Kleinbürgerinnen mit Swing),<br />
es geht ihr aber mehr um die Geschlechterals<br />
um die Milieustudie. Für Carola, eine toll<br />
verhuschte Abiturientin, interessiert sich<br />
der Film am meisten. Die Eltern haben Pläne<br />
für sie (vor dem Studium die Hauswirtschaftsschule),<br />
Carola wehrt sich zaghaft,<br />
weicht aus, guckt in die Luft. In der jungen<br />
Frau wird vage etwas erkennbar, das mit<br />
der Zukunft zu tun hat. Esther Buss<br />
1968 Die Trennung eines Paares im Bild:<br />
zwei Menschen getrennt durch einen Fluss.<br />
Das Gemeinsame rinnt davon, was bleibt,<br />
ist jeder Einzelne. Es ist Sommer, und Ula<br />
Stöckl entwirft in der lichtdurchfluteten<br />
Szenerie Münchens eine Ode an die Freiheit.<br />
Die Freundin ist zu Besuch in der<br />
Stadt und gemeinsam laben sich die Protagonistinnen<br />
an der Gesellschaft der anderen,<br />
durchstreifen Gärten, verharren in<br />
Wohnungen, auf Betten: Müßiggang am<br />
Kaffeetisch. Beziehungs- und Liebesmodelle,<br />
Arbeitsstrukturen – ganz grundsätzlich<br />
werden hier Konventionen infrage gestellt.<br />
Ein Leben wird als Entwurf skizziert, als<br />
Möglichkeit und Variation.<br />
Ein Leben sind demnach mehrere Leben,<br />
und die Lebensweisen frei: „Heute ist heute<br />
und morgen ist morgen.“ Die Probe und<br />
das melancholische Scheitern eines solchen<br />
freien Lebens sind es, die hier von einer<br />
dokumentarisch anmutenden Kamera<br />
beobachtet werden. Vieles ist dabei Spiel<br />
und Provokation als Machtverhandlung<br />
zwischen den Geschlechtern und den Frauen<br />
selbst. Es sind diese Frauenleben, die<br />
der Film an ihre eigene Handlungskraft erinnern<br />
will. Vivien Kristin Buchhorn<br />
1976 Zwischen Küche und Badezimmer resümieren<br />
zwei Frauen ihre Beziehung, vier<br />
Jahre nach der Trennung. Thomas Mauchs<br />
aufgeräumte 16mm-Schwarz-Weiß-Bilder<br />
arbeiten am Kontrast weiblicher Lebensentwürfe,<br />
die einander Tiefe geben und<br />
sich im Verlauf einer Nacht reflexiv entfalten.<br />
In Härte und Konzentration erinnert<br />
Stöckls Versuchsanordnung an Bergman.<br />
Auch in der Souveränität des Tons: Die<br />
zwischen Komödie (diverse Haushaltsunfälle,<br />
eine klemmende Badezimmertür)<br />
und offenem Schlagabtausch wechselnde<br />
Dramaturgie betont das Experimentelle der<br />
Situation, in der die bürgerliche Privatsphäre<br />
zum feindlichen (männlichen) Agenten<br />
im weiblichen Selbstbewusstsein wird. Der<br />
visuelle Reichtum des Zweipersonenstücks<br />
entsteht deshalb gerade durch die eigensinnigen<br />
Bewegungen in einer heteronormativen<br />
Wohnungsarchitektur, als leidenschaftliche<br />
Choreografie der Missverständnisse.<br />
Dass hier 60 Minuten Frauen über sich reden,<br />
hat einen spürbaren Effekt auf die allgemeingültige<br />
Beziehungsmusterstudie,<br />
die man damals darin sehen wollte. In zeitgenössischen<br />
Texten liest man das böse<br />
Wort „bissig“. <br />
Jan Künemund<br />
Ula-Stöckl-Werkschau<br />
Am 5. Februar wird die in Ulm<br />
geborene Filmemacherin Ula Stöckl<br />
80 Jahre alt. Aus diesem Anlass<br />
zeigt das Berliner Arsenal vom 9. bis<br />
14. Februar eine Retrospektive mit<br />
17 Filmen von Stöckl, die seit Mitte der<br />
sechziger Jahren entstanden. Ein<br />
Großteil der Filme liegt im Bestand<br />
der Deutschen Kinemathek – als<br />
klassische Kopie, was das Abspielen in<br />
den zumeist auf digitale Projektion<br />
umgestellten Kinos im Land erschwert.<br />
2015 kam der bislang letzte Film<br />
von Stöckl heraus: Die Widerständigen<br />
... also machen wir das weiter,<br />
eine beeindruckende Oral History aus<br />
dem Umfeld der Weißen Rose, die<br />
Stöckl für die verstorbene Freundin<br />
Katrin Seybold zu Ende brachte. MD<br />
1991/92 Der Film ist ein Beleg der Ratlosigkeit.<br />
Er ist nicht der Film über das deutsche<br />
1989/90, er ist nur ein Film aus dieser Zeit,<br />
der wie die anderen versucht, der historischen<br />
Situation eine Geschichte zu erfinden.<br />
Etwa durch Fallerslebens Deutschland-Lied,<br />
das, in allen drei Strophen gesungen,<br />
den Film strukturiert. Die Art und<br />
Weise, wie gesungen wird – sprechend, zögernd,<br />
stockend, gegen die von sich selbst<br />
besoffene Hybris an, die das „Über alles“<br />
spätestens ab 1933 unmöglich gemacht hat<br />
–, diese Art und Weise formuliert die Frage,<br />
die der Film zu erkunden versucht: Was<br />
wird das Deutsche, da es wiedervereint ist?<br />
Eine Antwort findet der Film darauf<br />
nicht. Auf der Handlungsebene erzählt er<br />
in gewollter Künstlichkeit von einer Familie,<br />
die sich in Dresden wiedertrifft. Es geht<br />
um Lügen, die aus Anpassung geschehen<br />
sind. Interessant macht den Film, was an<br />
quasi dokumentarischem Material in ihn<br />
reinreicht: die Unfähigkeit, dass West und<br />
Ost sich verstehen. Die Stöckl zulässt. Die<br />
bis heute dauert. Genauso wie die Faszination<br />
für Dresden, das hier elegisch-zart als<br />
eine viel offenere Projektionsfläche erscheint<br />
als heute. <br />
Matthias Dell<br />
ANZEIGE<br />
Jetzt lesen und genießen<br />
Kritischer Journalismus &<br />
Fairer Handel<br />
Coupon bitte hier ausschneiden, ausfüllen und an den <strong>Freitag</strong>, PF 11 04 67 in 20404 Hamburg senden<br />
✓ Ja, ich lese den <strong>Freitag</strong><br />
– 10 Wochen für € 27,90.<br />
Zudem erhalte ich meine gewünschte Prämie, den fair gehandelten Kaffee oder Tee von GEPA. Hat mich der <strong>Freitag</strong> überzeugt und möchte<br />
ich nach 10 Ausgaben weiterlesen, brauche ich nichts zu tun. Ich erhalte den <strong>Freitag</strong> dann jeweils donnerstags zum Vorzugspreis von € 3,60<br />
pro Ausgabe statt € 3,95 am Kiosk und spare rund 9%. Außerdem erhalte ich kostenlos den <strong>Freitag</strong>-Newsletter an meine E-Mail-Adresse.<br />
Möchte ich den <strong>Freitag</strong> nicht weiterlesen, schicke ich eine E-Mail an service@abo.freitag.de oder rufe an (Telefon: 040 3007-351 0). Ich habe<br />
das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Mehr unter www.freitag.de/agb.<br />
Meine Adresse:<br />
Vor- / Nachname<br />
Straße / Hausnummer<br />
PLZ<br />
E-Mail<br />
Ort<br />
Als Prämie wähle ich:<br />
Bio-Café Guatemala Bio-Espresso Italia Bio-Tee Subarna Gold Bio-Tee Indischer Chai<br />
Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000815700):<br />
Kontonummer oder IBAN<br />
Bankleitzahl (bei IBAN nicht erforderlich)<br />
Ich ermächtige den Verlag, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.<br />
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften<br />
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem<br />
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit<br />
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br />
Ja, ich möchte weitere Informationen und Angebote per E-Mail oder Telefon<br />
vom <strong>Freitag</strong> erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Ich möchte per Rechnung zahlen.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
✗<br />
Telefon<br />
Geburtsdatum<br />
Ihre Abovorteile:<br />
- linker<br />
Qualitätsjournalismus<br />
- pünktlich, portofrei<br />
und bequem<br />
- fast 30% Preisvorteil<br />
- fair gehandelter Tee oder<br />
Kaffee als Prämie<br />
Coupon bitte senden an:<br />
der <strong>Freitag</strong><br />
PF 11 04 67<br />
20404 Hamburg<br />
Jetzt sofort online sichern!<br />
www.freitag.de/fair<br />
Telefon: 040 3007-3510<br />
DF18-533
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Film<br />
19<br />
Flucht ins Feine<br />
Kino In „Der seidene Faden“<br />
erzählt Paul Thomas<br />
Anderson einmal mehr von<br />
männlicher Monomanie,<br />
diesmal ganz ohne Geballer<br />
■■Karsten Munt<br />
Erhaben stolpert Alma (Vicky<br />
Krieps) durch den Frühstückssaal.<br />
Sie fällt auf unter den uniform<br />
gekleideten Kellnerinnen.<br />
Kantig und ungeschickt stolziert<br />
sie zwischen ihnen mit der Kaffeekanne<br />
umher. Durch die Augen des Modedesigners<br />
Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis)<br />
enthüllt Paul Thomas Anderson die<br />
Schönheit, die sich hinter Almas charmanter<br />
Unvollkommenheit verbirgt. Er ist fasziniert<br />
von ihrem Gesicht, das elegant und<br />
doch gewöhnlich scheint – bis ihr Lachen<br />
es vollkommen macht. Woodcock provoziert<br />
es und bringt so zum Vorschein, was<br />
sie makellos macht – nicht in seinen, sondern<br />
in ihren eigenen Augen. In seiner Zuneigung<br />
spürt sie eine Schönheit, die sie<br />
sich selbst nie zugestanden hat.<br />
Noch im Frühstückssaal beginnt die spielerische<br />
Inszenierung der Obsession, die<br />
die Beziehung von Couturier und Muse –<br />
die hier bereits ausgemachte Sache zu sein<br />
scheint – prägen wird. Woodcock bestellt<br />
und klaut Alma sogleich den Zettel, auf<br />
dem sie seinen gewaltigen Appetit aufgelistet<br />
hat: Rahm, Speck, Marmelade, Croissants<br />
und pochierte Eier. Doch auch ohne<br />
ihre Notizen merkt sie sich jede Zutat, jede<br />
Zubereitungsart und bringt alles mit einem<br />
neuen Zettel, der dem „hungrigen<br />
Jungen“ guten Appetit wünscht – Reynolds<br />
Woodcock hat seine Muse gefunden.<br />
Bald lädt er sie auf sein Landhaus ein, erzählt<br />
ihr von seiner Mutter, die er geliebt<br />
und begehrt hat. Dann nimmt er ihre<br />
Maße, schmeichelt ihr, konzentriert sich<br />
ganz auf sie, gibt sich ein weiteres Mal ihrer<br />
Schönheit hin. Sie legt ihr Kleid ab, bis sie<br />
halb nackt vor seiner Schwester Cyril (Leslie<br />
Manville) steht, die unerwartet das Atelier<br />
betreten hat und beiden fortan nur in<br />
Ausnahmen von der Seite weichen wird.<br />
Gedemütigt hält Alma die Pose, doch<br />
ihre Schönheit geht mit ihrem Lächeln.<br />
Dann ist Woodcock wieder ganz bei ihr:<br />
There will be pochierte Eier<br />
Eine perfekt gesteckte Nadel lässt sie Cyril<br />
vergessen und holt Almas Lächeln zurück.<br />
Fortan ist sie Teil seiner Rituale und Routinen.<br />
Er entwirft Kleider für sie, schickt sie<br />
auf Modenschauen und beobachtet mit lächelnden<br />
Augen, wie die Welt sie in seinen<br />
Stoffen bewundert. Der Glanz, den die Kleider<br />
ausstrahlen, entspringt dem so rigiden<br />
wie fragilen Lebensstil, den der Modeschöpfer<br />
führt.<br />
Man könnte sich kaum ein besseres<br />
Sinnbild für den Stil Andersons vorstellen<br />
als diese Welt, die von absoluter Kontrolle<br />
besessen ist und zugleich elegant erscheint.<br />
So sucht Anderson, der erstmals<br />
auch die Kameraarbeit übernahm, in Der<br />
seidene Faden zu jeder Zeit nach genau jener<br />
filigranen Geste, die seine perfekt geschneiderte<br />
Liebesgeschichte passgenau<br />
Gedemütigt<br />
hält Alma<br />
die Pose. Dann<br />
wird sie<br />
zum Teil seiner<br />
Rituale<br />
abrundet. Etwa die Schleife, die Woodcock<br />
mit seinem Sportwagen zieht, als er Alma<br />
das erste Mal abholt, und die sie auf ähnliche<br />
Weise mit ihrer Hand vollführt, als sie<br />
ihm das erste Mal eine Tasse Tee einschenkt.<br />
An diesem wiederkehrenden<br />
Schlenker demonstriert der Film die ersten<br />
Reflexe eines Kontrollwahns.<br />
Beim gemeinsamen Frühstück wird die<br />
Gewandtheit der Handbewegung für<br />
Woodcock plötzlich zu einer nervigen Manier,<br />
die ihm fast körperliche Schmerzen<br />
bereitet – denn alles, was in der Stadtvilla<br />
passiert, hat seinen Vorgaben zu entsprechen<br />
oder muss entfernt werden. Der seidene<br />
Faden überhöht genüsslich diese Einbrüche<br />
in die Welt Woodcocks. Das Reiben<br />
eines Messers auf der Scheibe Toastbrot<br />
klingt plötzlich wie ein Winkelschleifer auf<br />
Asphalt, um dann, als der Couturier wieder<br />
inspiriert ist, durch die Klänge von Jonny<br />
Greenwoods Piano wieder in den Hintergrund<br />
geschoben zu werden.<br />
Nicht nur stilistisch scheint die Schilderung<br />
des Alltags in der viktorianischen<br />
FOTO: FOCUS FEATURES<br />
Wohnung Woodcocks eine logische Fortsetzung<br />
im Œuvre von Anderson darzustellen.<br />
Der Film setzt die so häufig von der<br />
Monomanie eines Mannes dominierten<br />
Motive der Machtdynamik fort, die Anderson<br />
so oft in seinen Filmen aufgreift.<br />
Statt der permanent offen ausgetragenen<br />
Konfrontation, sei es in der blut- und<br />
ölverschmierten Gründerzeit (There Will Be<br />
Blood, 2007) oder im traumatisiert-sinnsuchenden<br />
Nachkriegsamerika (The Master,<br />
2012), inszeniert er hier die Flucht eines<br />
Mannes in seine eben nicht archaische und<br />
brutale, sondern feine und geschmeidige<br />
Welt. Anderson verlässt mit Der seidene Faden<br />
das erste Mal seine amerikanische Heimat,<br />
um seine filmischen Motive in das<br />
Großbritannien der 1950er zu exportieren.<br />
Erhabene Perversion<br />
Im stets abgeschotteten Reich der britischen<br />
Stadtvilla ist alles eine Inszenierung<br />
Woodcocks. Daniel Day-Lewis lässt in ihm<br />
den spröden Greis und den lebhaften Dandy<br />
spielerisch zusammenfließen. Doch<br />
Woodcocks pathologischer Habitus droht<br />
sein Umfeld, insbesondere seine Partnerinnen<br />
zu zerstören. Was nicht in seine Welt<br />
passt, wird abgeblockt mit dem bockigen<br />
Gestus eines Kleinkinds und dem Nachdruck<br />
eines verehrten Modemoguls. Was er<br />
nicht selbst entwirft, kann er nicht lieben.<br />
Doch Alma – Vicky Krieps lässt sie hier ansatzlos,<br />
mit kleinsten Gesten Sprünge zwischen<br />
aufopfernd und einfordernd, verschüchtert<br />
und bedrohlich vollführen –<br />
sucht die Liebe eben nicht in der<br />
Selbstaufgabe.<br />
Um die Barriere von Woodcocks ödipaler<br />
Bockigkeit zu überwinden, legt sich Alma<br />
eine Strategie zurecht: Sie vergiftet ihn,<br />
pflegt ihn wieder gesund und verführt ihn.<br />
Sie reißt das Liebesspiel wieder an sich,<br />
durchdringt die Zwanghaftigkeit mit einer<br />
mütterlichen Fürsorglichkeit, die stets ein<br />
tödlicher Hauch umweht. Sie liebt Reynolds<br />
auf ihre Art. Der Film erkundet diese<br />
Zuneigung nicht als etwas Abgründiges,<br />
Alma und Reynolds vollführen nunmehr<br />
das gleiche Spiel, das sie schon bei ihrer<br />
ersten Begegnung gespielt haben: das Spiel<br />
einer zwanghaften Liebe und einer erhabenen<br />
Perversion.<br />
Der seidene Faden Paul Thomas Anderson<br />
USA 2017, 130 Minuten<br />
Verrückte Idee<br />
Dokumentarfilm Christian Tod wirbt für das Grundeinkommen: „Free Lunch Society“<br />
ANZEIGE<br />
■■Silvia Hallensleben<br />
Gern zitieren Neoliberale die Pseudo-<br />
Weisheit: „There’s no such thing as<br />
a free lunch.“ Dass sich menschliches<br />
Wirtschaften auch anders als in den<br />
Kategorien von Knappheit und Eigeninteresse<br />
denken lässt, wurde schon vor Karl<br />
Marx diskutiert. Fast so lange gibt es die<br />
Idee, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln<br />
und jedem Menschen vom Staat her<br />
den Lebensunterhalt zu stellen.<br />
Bedingungsloses Grundeinkommen<br />
heißt diese Idee in Deutschland oder Österreich,<br />
woher der Film Free Lunch Society<br />
kommt. Der macht in einem klassischen dokumentarischen<br />
Rundgang Experten und<br />
Projekten von den USA über Zentraleuropa<br />
bis nach Namibia seine Aufwartung. Dabei<br />
stehen neben Talkshow-Gesichtern wie dm-<br />
Chef Götz Werner und Michael Bohmeyer,<br />
dem Gründer der Grundeinkommen-Lotterie,<br />
auch Überraschungskandidaten parat.<br />
Martin Luther King etwa, der in den<br />
1960er Jahren dafür eintrat, die kommende<br />
Umwälzung der Arbeit durch die Digitalisierung<br />
mit einem Grundeinkommen zu bekämpfen.<br />
Oder der libertäre US-Politologe<br />
Charles Murray (In Our Hands, 2006) vom<br />
American Enterprise Institute, der in Statements<br />
vorführt, wie die Idee unter dem Etikett<br />
„negative Einkommensteuer“ gerade<br />
von neoliberalen Ökonomen wie Friedrich<br />
Hayek und Milton Friedman unterstützt<br />
werden kann: Die garantierte Alimentation<br />
stärkt paradoxerweise die individuelle Autonomie<br />
gegen staatliche Institutionen.<br />
In Namibia<br />
hat es<br />
funktioniert.<br />
Zumindest<br />
in einem Dorf<br />
Es ist dieser Aspekt der persönlichen und<br />
gesellschaftlichen Ermächtigung, der den<br />
Regisseur und studierten Ökonomen<br />
Christian Tod mehr als Rechenexempel interessiert.<br />
Dass die „crazy idea“ (so Fox<br />
Business in einem der vielen illustrierenden<br />
TV-Schnipsel) finanziell machbar ist,<br />
wird eher nebenbei abgehandelt. Das von<br />
Gegnern des Grundeinkommens gern vorgebrachte<br />
Argument drohender kollektiver<br />
Arbeitsverweigerung bekommt mehr<br />
Raum, wird aber vielfach widerlegt. Werner<br />
argumentiert, dahinter verberge sich die<br />
Angst, abhängig Beschäftigte verdingten<br />
sich mit Grundsicherung im Rücken nicht<br />
mehr zu ganz erbärmlichen Bedingungen.<br />
Die narrative Idee, die Geschichte rückblickend<br />
aus einer utopisch verwandelten Zukunft<br />
zu erzählen, ist charmant und zeigt<br />
wie der suggestive Titel, dass die Filmemacher<br />
keine Neutralität anstreben, sondern<br />
wie ihre Protagonisten das Grundeinkommen<br />
als probates Mittel zur Befreiung aus<br />
dem Zwang zur Niedriglohnarbeit etwa bei<br />
Walmart sehen.<br />
Interessanter aber sind die Ausflüge zu<br />
weniger bekannten historischen Exempeln.<br />
Nach Alaska, wo seit riesigen Ölfunden<br />
1969 im Sparfonds Alaska Savings Account<br />
gesicherte 900 Millionen Dollar bis<br />
heute jährliche Dividenden für die Bürger<br />
bringen. Oder in die kanadische Kleinstadt<br />
Dauphin, wo Ökonomen im Mincome-Experiment<br />
zwischen 1974 und 1978 die sozialen<br />
Auswirkungen eines Grundeinkommens<br />
untersuchten. 1978 wurde das Projekt<br />
wegen Geldmangels ohne Auswertung<br />
eingestellt. In den USA gab es in den<br />
1960er Jahren ähnliche Forschungen, Präsident<br />
Johnson (wie später Nixon) plante<br />
die Einführung eines Family-Assistance-<br />
Programms – mit dem jungen Donald<br />
Rumsfeld an der Spitze. Auch hier blieben<br />
Umsetzung und Auswertung ob der Gegenwehr<br />
des damaligen kalifornischen<br />
Gouverneurs Reagan 1970 stecken.<br />
Sichtbare Erfolge dagegen zeigte ein Versuchsprogramm<br />
des namibischen Ministers<br />
für Armutsbekämpfung und Wohlfahrt<br />
2008 bis 2012 in dem Dorf Otjivero:.<br />
Auch deswegen, weil schon eine kleine monatliche<br />
Summe ausreicht, um den Bewohnern<br />
mit eigener Nähmaschine oder eigenem<br />
Werkzeug den ersten Schritt aus der<br />
Armut zu ermöglichen. Die geplante Ausweitung<br />
des Projekt hat aber trotzdem<br />
nicht stattgefunden, auch hier wurden notwendige<br />
begleitende Nachuntersuchungen<br />
nicht durchgeführt. So zeigt Tods Film vor<br />
allem: Den Bedarf nach langfristiger Praxis<br />
mit dem Grundeinkommen.<br />
Free Lunch Society Christian Tod<br />
Deutschland/Österreich 2017, 95 Minuten<br />
www.spiegel-geschichte.de<br />
Auch als App für iPad, Android<br />
sowie für PC/Mac. Hier testen:<br />
spiegel-geschichte.de/digital<br />
Lesen Sie in diesem Heft:<br />
Wiederaufbau Die wahre Geschichte<br />
der Trümmerfrauen<br />
Zeitzeugen Erinnerungen an die „Stunde null“<br />
Staatsgründung Warum die deutsche<br />
Teilung nicht geplant war<br />
Jetzt im<br />
Handel<br />
SPG_0118_Der<strong>Freitag</strong>_122x173_ISOnewspaper.indd 1 23.01.18 10:37
20 Post<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Immer noch aktuell<br />
Bernd Mansel<br />
1958: Christ und Antichrist<br />
Unerwartet wird eine Debatte im<br />
Bundestag zur Kampfansage gegen<br />
Adenauers polemische Rhetorik<br />
und seine Politik der Ost-West-Spaltung<br />
nach dem Wahlsieg 1957<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
Gerne gelesen. Ich meine, dass wir<br />
von diesen alten Geschichten auch<br />
heute noch mehr lernen können,<br />
als man gemeinhin denkt. Insofern<br />
sind diese Storys immer noch<br />
hochaktuell. „Der Russe“, der seine<br />
Rohstoffe nicht an den Neoliberalismus<br />
verramschen will, ist ja als<br />
„Antichrist“ erhalten geblieben.<br />
Alle Kritiker des Neoliberalismus<br />
werden auch heute in den Medien<br />
gerne dazugezählt – man denke nur<br />
an Varoufakis, Tsipras.<br />
Poor on Ruhr, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Ersichtliche Folgen<br />
Kathrin Hartmann<br />
Abschotten und wegessen<br />
Die verheerenden Folgen deutscher<br />
Landwirtschaftspolitik sind hierzulande<br />
kaum zu spüren<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
Präzis und ausgezeichnet! Man<br />
kann kaum erwarten, dass das<br />
Bewusstsein der Endverbraucher<br />
für unsere Umwelt sich je ändern<br />
wird, und auch wenn dies möglich<br />
wäre: bleibt die Machtposition<br />
der Supermarktketten ungebrochen.<br />
Die einzige Möglichkeit ist eine<br />
Änderung der Politik der BRD.<br />
PierP, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Die deutsche und EU-Landwirtschaftspolitik<br />
privilegiert genauso<br />
wie in der allgemeinen Wirtschaftspolitik<br />
die großen Konzerne.<br />
Sie ist ein Spiegelbild der<br />
Machtverhältnisse. Was bleibt da<br />
anderes, als sich selbst aus<br />
diesem Wahnsinn zu befreien.<br />
Frank Linnhoff, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Vielen Dank für den Artikel. Die<br />
Folgen werden auch bei uns immer<br />
offensichtlicher. Ob Biobauer<br />
oder konventioneller Landwirt,<br />
sind diese auch hier von Landverkäufen<br />
– quasi Enteignungen<br />
bei Pachtflächen und der damit<br />
veränderten Interessenstruktur<br />
betroffen. Der Filz geht so weit, wie<br />
ich selbst in persönlichen Gesprächen<br />
erlebt habe, dass Landwirte<br />
auf keinen Fall öffentlich mit<br />
kritischer Haltung in Erscheinung<br />
treten wollen – sonst bekämen<br />
sie gar keine Flächen mehr!<br />
Artur Schmidt, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Die besten Zitate aus den Kommentaren auf freitag.de/community<br />
„Es ist ein typisch<br />
deutsches Weiter-so“<br />
Miauxx<br />
freitag.de/community<br />
Balsam für Ratlose<br />
Bernie Sanders<br />
Das Gesetz des Schwächeren<br />
Die Milliardäre verprassen ihren Luxus,<br />
während Tausende Kinder sterben.<br />
Warum sich alles radikal ändern muss<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
Sehr geehrte Redaktion, mit Begeisterung<br />
habe ich den Text von<br />
Bernie Sanders gelesen. Danke an<br />
Herrn Sanders für diese Worte und<br />
an Sie für das Abdrucken. Der Text<br />
ist einfach nur überragend und ist-<br />
Balsam für die Ratlosen und Kraft<br />
für mich als SPD-Mitglied auf der<br />
Suche nach dem richtigen Weg.<br />
Bitte mehr davon.<br />
Eigentlich ist doch das, was Herr<br />
Sanders schreibt, nicht einmal<br />
linke Politik, sondern die Formulierung,<br />
wie Mitmenschlichkeit und<br />
Gerechtigkeit umgesetzt werden<br />
können – eine Selbstverständlichkeit.<br />
Denn der vermeidbare tägliche<br />
Tod von 29.000 Kindern zeigt,<br />
dass unser gesunder Menschenverstand<br />
abhandengekommen ist.<br />
Unseren gesunden Menschenverstand<br />
am Leben zu erhalten, ist aus<br />
meiner Erfahrung bisweilen mühsame<br />
Arbeit. Diese Arbeit möchten<br />
sich nicht alle Menschen machen<br />
und wählen stattdessen rechts.<br />
Auch dazu sagt Sanders treffend:<br />
„Aber es ist ein Kampf, den wir<br />
nicht vermeiden können. Es steht<br />
zu viel auf dem Spiel.“<br />
Richard Grossmann, per Mail<br />
„Die SPD steckt in einer Krise,<br />
und sie ist dabei,<br />
viele Fehler zu wiederholen“<br />
Die angedachte Sammlungsbewegung<br />
hat wahrscheinlich den<br />
Gründungsfehler, dass sie „von<br />
oben“ gedacht wird. Und es wird<br />
endlose Streitereien geben, ob<br />
denn die SPD (da eher rechts) dazugehören<br />
solle oder die DKP und<br />
die MLPD. Allein die Kriegsfrage<br />
trennt sofort. Und die Bewegung<br />
käme eben nicht „aus dem Volk“.<br />
Die linke Bewegung kann der<br />
Bevölkerung, insbesondere den<br />
Abgehängten, kein überschaubares<br />
alternatives Konzept zum Kapitalismus<br />
anbieten. Wut und Protest<br />
wenden sich dann eher nach<br />
rechts, wobei die Rechte nur<br />
falsche Lösungen anbietet.<br />
Wäre der<br />
„Boden“ ein<br />
öffentliches<br />
Gut, dann<br />
würde den<br />
Spekulanten<br />
der Boden<br />
unter ihren<br />
Kapitalfüßen<br />
entzogen<br />
werden<br />
Und es geht eben nicht nur, wie<br />
Lafontaine vielleicht meint, ums<br />
Geld und ums Vermögen, es geht<br />
um die Eigentumsfrage und die<br />
entsprechenden Machtverhältnisse<br />
schlechthin.<br />
Ulrich Straeter, per Mail<br />
Auf halber Strecke<br />
Henry Wilke<br />
Bodenwertsteuer jetzt!<br />
Eine Reform der Grundsteuer ist<br />
längst überfällig. Doch die beste Alternative<br />
wird von der Politik ignoriert<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
KARIKATUR: AMELIE GLIENKE FÜR DER FREITAG<br />
Jan Bühlbecker<br />
Die von der Autorin geforderte<br />
Bodenwertsteuer wäre zwar ein<br />
Fortschritt. Allerdings bleibt sie<br />
auf halbem Weg stehen. Der Boden<br />
(Natur) ist einer der Produktionsfaktoren.<br />
Er ist jedoch das knappste<br />
Gut und lässt sich so gut wie nicht<br />
vermehren. Andere Faktoren schon,<br />
wie etwa Kapital und Arbeit. Wäre<br />
dieser Produktionsfaktor ein rein<br />
öffentliches Gut, könnte weitaus<br />
effizienter zugunsten der Bedürfnisse<br />
der Allgemeinheit gesteuert<br />
werden.<br />
Bodenspekulanten mit ihrer<br />
Spielkasino-Mentalität würde der<br />
Boden unter ihren Kapitalfüßen<br />
entzogen. Die Mietpreise sind ja<br />
gerade deshalb in die Höhe geschossen,<br />
weil die Politiker, dem<br />
Ruf nach Verschlankung des<br />
Staates folgend, öffentliches Wohneigentum<br />
und damit auch Grund<br />
und Boden an Spekulanten verscherbelt<br />
haben. Ihnen war und ist<br />
die Abschaffung des staatlichen<br />
Einflusses weitaus näher als die<br />
Vorstellung, dass Wohnen ein<br />
Grundbedürfnis ist.<br />
Achtermann, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Juristisch gesehen<br />
Johanna Montanari<br />
Fragwürdige Verknüpfung<br />
Schlechter Sex ist doof. Übergriffe<br />
sind doofer, findet unsere Autorin<br />
der <strong>Freitag</strong> 4 vom 25. Januar 2018<br />
Die öffentliche Beschuldigung,<br />
und umso mehr die öffentliche<br />
Beschuldigung ohne Beweise,<br />
gebiert bereits aus sich selbst heraus<br />
Konsequenzen für den Beschuldigten,<br />
in der Regel die soziale<br />
Vernichtung.<br />
Wenn Sie mit Verjährungsfristen<br />
argumentieren wollen, gibt es<br />
außer bei Mord nach deutschem<br />
Recht bei allen Straftaten Verjährungsfristen.<br />
Verjährung ist also<br />
keine besondere Zumutung, die<br />
speziell für vergewaltigte Frauen<br />
erfunden wurde. Man könnte<br />
also mit sehr viel mehr Sinn eine<br />
Kampagne starten, die das Ziel<br />
verfolgt, Vergewaltigung zu einem<br />
Verbrechen zu erklären, für das<br />
keine Verjährung gewährt wird. Als<br />
Teil einer derartigen Änderung<br />
müsste allerdings gleichzeitig eine<br />
belastbare Differenzierung zwischen<br />
strafbaren und nicht strafbaren<br />
Sachverhalten erfolgen. Im<br />
Moment erweckt #metoo eher den<br />
Eindruck, derartige Differenzierungen<br />
zu vermeiden.<br />
Ich habe nichts dagegen, wenn<br />
im Rahmen von #metoo frühere<br />
oder aktuelle Sexualdelikte öffentlich<br />
gemacht werden. Wenn dabei<br />
aber Namen genannt werden, muss<br />
der Weg über eine vorher erfolgte<br />
Anzeige der Straftat bei einer Strafverfolgungsbehörde<br />
führen, alles<br />
andere ist nichts als Selbst- und<br />
Lynchjustiz.<br />
Lethe, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Finger in die Wunde<br />
Katharina Schmitz, Timon Karl Kaleyta<br />
„Die Armen sind Gegner“<br />
Guillaume Paoli fordert in „Die lange<br />
Nacht der Metamorphose. Über die<br />
Gentrifizierung der Kultur“ die Rückkehr<br />
des Elends im Erzählten<br />
der <strong>Freitag</strong> 1 vom 4. Januar 2018<br />
Interessantes Interview. Der Mann<br />
hat den Finger in der Wunde. Er<br />
sagt nichts wirklich Neues, aber er<br />
sagt es wenigstens wieder einmal.<br />
„Anthropologische Mutation“, hübsch<br />
metaphorisch, das ist der gute<br />
alte mentalitätshistorische Prozess,<br />
den Norbert Elias schon vor gut<br />
70 Jahren sichtbar machte. Auch<br />
der Hinweis auf Marx’ These von<br />
der „zivilisatorischen Wirkung des<br />
Kapitals“ zeigt uns nichts Neues,<br />
aber seit Langem Unbeachtetes.<br />
Goedzak, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Tunesier macht was<br />
Sabine Kebir<br />
Das verflixte siebte Jahr<br />
Politisch hat sich der Arabische<br />
Frühling hier als einziges durchsetzen<br />
können. Doch wirtschaftlich geht es<br />
den Tunesiern schlechter als vorher<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
Die tunesische Regierung sollte sich<br />
Gedanken machen, wie das Land<br />
nicht nur durch den Abbau natürlicher<br />
Ressourcen oder den in<br />
Misskredit geratenen Tourismus<br />
zu Geld kommt, sondern durch<br />
intelligenteren Einsatz der Ressource<br />
Mensch. Eine kluge Industriepolitik<br />
muss Schwerpunkte setzen,<br />
um sich auf dem Weltmarkt zu<br />
etablieren.<br />
Querlenker, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Stagnieren geht nicht<br />
Georg Seeßlen<br />
Geh, Gespenst!<br />
1968 glaubte man an einen Fortschritt,<br />
der heute fragwürdig erscheint. Ein<br />
neuer Aufbruch muss einen anderen<br />
Weg nehmen<br />
der <strong>Freitag</strong> 3 vom 18. Januar 2018<br />
„Solange es Fortschritt gibt, gibt es<br />
Ungleichheit, Kampf und Ausbeutung,<br />
es geht nicht anders.“ Mag sein.<br />
Aber wo es keinen Fortschritt<br />
mehr gibt, gibt es bald Rückschritt.<br />
Perioden der Stagnation halten<br />
nie lange an, weil der aus sich selbst<br />
heraus produktive Mensch sie<br />
nicht aushält. Man kann das Leben<br />
grundsätzlich nicht am schönsten<br />
Punkt anhalten. Dieser Punkt, auf<br />
die Ewigkeit ausgedehnt, würde<br />
nicht mehr als schön empfunden.<br />
Gunnar Jeschke, <strong>Freitag</strong>-Community<br />
Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe zu kürzen<br />
Impressum<br />
Verleger Jakob Augstein<br />
Chefredaktion Jakob Augstein (V.i.S.d.P.),<br />
Michael Angele, Simone Schmollack<br />
Verantwortliche Redakteure<br />
Jan J. Kosok (Online), Sebastian Puschner<br />
(Politik)<br />
Textchef Klaus Ungerer (FM*)<br />
CvD Marco Rüscher<br />
Redaktion Leander Badura, Ulrike Baureithel<br />
(FM), Matthias Dell (FM), Pepe Egger (FM),<br />
Mladen Gladić, Lutz Herden, Michael Jäger<br />
(FM), Christine Käppeler, Benjamin Knödler,<br />
Maxi Leinkauf, Martina Mescher, Katharina<br />
Schmitz (FM)<br />
Gestaltung Lisa Kolbe (Art Direktion),<br />
Felix Velasco (Titel), Gabor Farkasch,<br />
Niklas Rock (Bild)<br />
Redaktionelle Übersetzer<br />
Holger Hutt, Carola Torti<br />
Redaktionsassistenz Jutta Zeise<br />
Hospitanz Rebekka Gottl<br />
Verlag und Redaktion<br />
der <strong>Freitag</strong> Mediengesellschaft mbH &<br />
Co KG, Hegelplatz 1, 10117 Berlin,<br />
Tel.: (030) 250 087-0<br />
www.freitag.de<br />
Geschäftsführung Jakob Augstein,<br />
Dr. Christiane Düts<br />
Beratung Prof. Christoph Meier-Siem<br />
Verlagsleitung Nina Mayrhofer<br />
Anzeigen Johann Plank (Leitung)<br />
(johann.plank@freitag.de), Elke Allenstein<br />
(elke.allenstein@freitag.de), Isabell Schröder<br />
(isabell.schroeder@freitag.de)<br />
Marketing & Vertrieb<br />
Franziska Liebchen (Leitung)<br />
(franziska.liebchen@freitag.de)<br />
Oda Hassepaß (oda.hassepass@freitag.de)<br />
Johannes Heim (johannes.heim@freitag.de)<br />
Barbara Herzog (barbara.herzog@freitag.de)<br />
Madeleine Richter<br />
(madeleine.richter@freitag.de)<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Nina Mayrhofer<br />
presse@freitag.de<br />
*= Freie/r Mitarbeiter/in<br />
Der <strong>Freitag</strong> verpflichtet sich dem<br />
Code of Fairness der Freischreiber –<br />
Berufsverband freier Journalistinnen<br />
und Journalisten<br />
Jahresbezugspreis € 183,60<br />
Ermäßigter Bezugspreis für Schüler,<br />
Studenten, Auszubildende und Rentner:<br />
€ 132,60 jeweils inkl. Zustellung Inland.<br />
Im Ausland: € 214,20 (Europa) bzw. € 224,40<br />
(Übersee)<br />
Aboverwaltung QS Quality Service GmbH<br />
Telefon Kundenservice (040) 3007-3510<br />
Fax Kundenservice (040) 3007 85 7044<br />
E-Mail: service@abo.freitag.de<br />
Service-Zeiten<br />
Mo – Fr 8 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr<br />
Der <strong>Freitag</strong>, Postfach 11 04 67,<br />
20404 Hamburg<br />
Konto für Abozahlungen:<br />
Der <strong>Freitag</strong> Mediengesellschaft mbH & Co KG,<br />
IBAN DE39 10<strong>05</strong> 0000 0013 5<strong>05</strong>0 50<br />
Nationalvertrieb<br />
Newspaper Impact GmbH<br />
Süderstraße 79 a, 20097 Hamburg<br />
IT- und Redaktionstechnik<br />
Heldisch networx GmbH<br />
Druck BVZ Berliner Zeitungsdruck,<br />
Am Wasserwerk 11, 10365 Berlin,<br />
www.berliner-zeitungsdruck.de<br />
Papier 100 % Recycling, trägt den Blauen<br />
Engel, produziert in Schwedt an der Oder,<br />
gedruckt in Berlin<br />
Gesetzt in TheAntiquaF von Lucas de Groot,<br />
www.lucasfonts.com<br />
ISSN 0945-2095
21<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Marotte,<br />
Mimose, Mann:<br />
Unser Lexikon<br />
der Woche enthält<br />
eingebildete<br />
Kranke sowie auch<br />
zerknirschte<br />
Gemüter S. 24<br />
Der Koch<br />
Jörn Kabisch<br />
Mach es wie Obelix:<br />
Iss Wildschweine –<br />
und rette den Export<br />
FOTOS: LINDA NYLIND/EYEVINE/LAIF, MALERAPASO/ISTOCK (OBEN)<br />
Hart<br />
am<br />
Nerv<br />
Margaret Atwood ist ein Kind des<br />
Krieges. Ihre Bestseller und die<br />
Verfilmungen leben davon. Dass jetzt<br />
alle entsetzt über Donald Trump<br />
sind, kann sie nicht verstehen S. 22<br />
In diesen Tagen ist es geradezu<br />
Bürgerpflicht, Wildschwein zu konsumieren.<br />
Denn die afrikanische<br />
Schweinepest nähert sich, von Osten<br />
also, eine Himmelsrichtung, die – wie<br />
wir wissen – noch nie Gutes versprach.<br />
Das Virus, das gerade im Baltikum grassiert,<br />
ist hoch ansteckend. Schwarzwild<br />
wie Haustier verenden in wenigen<br />
Tagen. Die Zeitungen sprechen schon<br />
von der „Schweine-Ebola“, weil es kein<br />
Gegenmittel gibt. Es geht um den<br />
Bestand von Millionen von Tieren, die<br />
hinter Hochsicherheitsmauern in Massenställen<br />
heranwachsen, um die Deutschen<br />
mit einem ihrer wichtigsten<br />
Kulturgüter, nämlich der Wurst, zu versorgen.<br />
Und nebenbei auch die Exportwirtschaft:<br />
Deutsches Fleisch geht<br />
in die ganze Welt. Nicht auszudenken,<br />
würde nur ein Schwein in Deutschland<br />
erkranken. Importstopp auf dem ganzen<br />
Globus, Massentierhalter würden<br />
massenhaft um die Existenz gebracht.<br />
Gutes deutsches Fleisch, es wäre nichts<br />
mehr wert. Und was würde erst der<br />
Verbraucher hierzulande sagen, auch<br />
wenn Veterinäre immerzu betonen,<br />
für den Menschen sei die Schweinepest<br />
ganz ungefährlich?<br />
Die Jäger legen gerade auf Eber komm<br />
raus auf die Schwarzkittel an. Denn das<br />
Wildschwein gilt als Hauptrisikofaktor,<br />
dass die Seuche Deutschland erreicht.<br />
Vor allem an der ostdeutschen Grenze<br />
sind die Schweinezüchter gerade hoch<br />
alarmiert. Da werden ja tonnenweise<br />
Wurstbrotreste weggeworfen Wenn nur<br />
ein Zipfel infiziert ist und ein Wildschwein<br />
fischt sich das aus einer Mülltonne,<br />
dann ist Holland in Not. Das<br />
Wildschwein ist vogelfrei. Der Effekt: In<br />
meinem Biomarkt ist Wildschwein<br />
inzwischen seit Dezember im Sortiment,<br />
billiger als normales Schwein, und<br />
nun gibt es bereits die ersten Sonderangebote.<br />
Das Zeug muss weg. Also,<br />
machen Sie endlich Wildschwein! Stellen<br />
Sie sich gleichzeitig auf eine Herausforderung<br />
ein – es gibt kein komplizierteres<br />
Fleisch. Vielleicht haben Sie<br />
ja auch schon mal ein Wildschweingulasch<br />
gemacht und fanden es etwas<br />
hart und trocken. Das war nicht unbedingt<br />
ihre Schuld. Und überlegen Sie<br />
mal: Der größte Wildschwein-Fan, den<br />
wir kennen, ist als Kind in den Zaubertrank<br />
gefallen. Obelix hat auch in<br />
den Kiefern Riesenkräfte. Für uns Normalos<br />
reicht kein Grillspieß, den man<br />
durch das ganze Schwein steckt. Das<br />
Fleisch braucht eine Extrabehandlung,<br />
damit es richtig zart und schmackhaft<br />
wird. Ich habe da einen kleinen Leidensweg<br />
hinter mir. Wildschweinsteaks<br />
etwa verwandelten sich trotz des<br />
24-stündigen Aufenthalts in Buttermilch<br />
in der Pfanne zu Schuhsohlen. Buttermilch<br />
ist eine milde Marinade, sie<br />
dient vor allem dazu, den ranzigen<br />
Hautgout, den Wild manchmal hat,<br />
abzuschwächen. Ich setze inzwischen<br />
auf stärkere Mittel: eine Marinade aus<br />
Apfelessig beispielsweise, das korrespondiert<br />
72 Stunden später geschmacklich<br />
mit dem Apfel-Zwiebel-Confit,<br />
das die Steaks begleitet. Für ein Gulasch<br />
hilft ebenfalls marinieren, zusätzlich<br />
aber kommt der Schmortopf einen halben<br />
Tag in den Ofen. Die Zubereitung<br />
im Slow Cooker ist auch eine gute Wahl.<br />
Habe ich keine Zeit und soll es mit dem<br />
Wildschwein schneller gehen, mache<br />
ich Buletten. Die sind derzeit überhaupt<br />
mein Favorit. Aber man braucht einen<br />
Fleischwolf zu Hause oder einen Metzger,<br />
der noch einen hat. Es gibt sicher<br />
noch mehr gute Ideen. Haben Sie Tipps?<br />
Noch eine Bitte, wenn Wildschwein<br />
bei Ihnen auf den Tisch kommt. Essen<br />
Sie alles auf, egal wie gelungen das<br />
Gericht ist. Schwarzwild im Müll, das<br />
geht in diesen Zeiten natürlich gar<br />
nicht.
22 Porträt<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
„Prophezeiungen<br />
erzählen von heute“<br />
Margaret Atwood kam in ihren dystopischen Romanen der Wirklichkeit zuvor: Es geht um Macht und Sexismus<br />
■■Lisa Allardice<br />
Im März vergangenen Jahres krönte<br />
sie der New Yorker zur „Prophetin<br />
der Dystopie“. Die Adaptionen fürs<br />
Fernsehen von Der Report der Magd<br />
(The Handmaid’s Tale) und Alias<br />
Grace haben ihr zu internationaler Berühmtheit<br />
verholfen, die Romanautoren<br />
sonst selten zuteilwird. Margaret Atwood<br />
war bei beiden Produktionen beratend tätig,<br />
bald wird sie in Toronto am Set sein,<br />
wieder als Beraterin. „Manchmal tue ich so,<br />
als wäre ich eine unheimliche alte Dame“,<br />
bekennt sie über einer Tasse Kaffee, mit<br />
lang gezogener mechanischer Stimme. Es<br />
sei reiner Zufall, dass ihre in der nahen Zukunft<br />
angesiedelte Dystopie und ihr historischer<br />
Roman, der von einem realen Mord<br />
im 19. Jahrhundert inspiriert wurde, zur<br />
selben Zeit auf die Bildschirme kommen.<br />
Aber sie haben etwas gemeinsam: Hauben.<br />
So viele Hauben.<br />
Alles dreht sich um Macht<br />
„Ich bin keine Prophetin“, sagt sie. „Lassen<br />
Sie uns diese Vorstellung gleich einmal<br />
aus der Welt schaffen. Prophezeiungen erzählen<br />
in Wirklichkeit von heute. In der<br />
Science-Fiction geht es immer ums Jetzt.<br />
Worum könnte es sonst gehen? Es gibt<br />
nicht die eine Zukunft. Es gibt viele Möglichkeiten,<br />
aber wir wissen nicht, welche<br />
wir erleben werden.“ Sie bedauert aber,<br />
dass die heutige Realität ihren Roman so<br />
aktuell erscheinen lässt. Mit ihrer hohen<br />
Stirn und ihrem lockenumkränzten Gesicht<br />
hat Atwood etwas Jenseitiges an sich.<br />
Sie trägt einen der bestickten Schals, die zu<br />
ihrem Markenzeichen geworden sind, und<br />
eine Halskette aus kleinen Totenköpfen –<br />
so gibt sie vor dem Café in Piccadilly, in<br />
dem wir uns treffen, eine markante Figur<br />
ab. Wir reden über hermaphroditischen<br />
Baramundi-Fisch und Game of Thrones.<br />
Sie ist voller vogelgleicher Neugier und<br />
tödlicher intellektueller Agilität: Elster<br />
und Falke (sie ist eine begeisterte Ornithologin).<br />
Atwood spricht mit einer markanten,<br />
leisen und monotonen Stimme und<br />
neigt zu zweifelnden rhetorischen Fragen<br />
wie: „Und warum ist das so?“<br />
Der Report der Magd wurde 1984 in<br />
West-Berlin geschrieben. Nach der Trump-<br />
Wahl ist der Roman wieder auf den Bestsellerlisten.<br />
Plakate mit der Aufschrift<br />
Make Atwood fiction again – „Atwood soll<br />
wieder Literatur werden“ – tauchen auf<br />
den Straßen auf und Frauen haben die roten<br />
Gewänder aus der Serie in stillem Protest<br />
gegen das drohende Abtreibungsverbot<br />
übernommen. Die Serie traf einen<br />
Nerv. Die Netflix-Produktion von Alias<br />
Grace, einer Meditation über Wahrheit, Erinnerung<br />
und Mitschuld und die Frage<br />
nach der Glaubwürdigkeit der Aussage einer<br />
Frau, wurde ausgestrahlt, als die Vorwürfe<br />
gegen Weinstein gerade öffentlich<br />
geworden waren.<br />
Sogar Payback, das Buch aus dem Jahr<br />
2008, in Eile geschrieben (siehe Kasten), erschien<br />
rechtzeitig zum Finanzcrash: „Alle<br />
dachten, ich würde etwas wissen. Dabei<br />
dachte ich, ich schreibe ein Buch über den<br />
viktorianischen Roman.“ Ihre gewonnene<br />
Berühmtheit (Sie sei gern in London, sagt<br />
sie, denn hier werde sie nicht so oft angehalten,<br />
um Selfies zu machen) habe sich<br />
völlig ohne ihr eigenes Zutun eingestellt,<br />
erzählt sie. „Das war nicht wirklich mein<br />
Verdienst, sondern das all der anderen Leute,<br />
die die Folgen gespielt, sie entworfen<br />
und geschrieben haben.“<br />
Sie sei beeindruckt gewesen, wie vollständig<br />
die Schauspielerinnen am Set in<br />
ihre nahezu unerträgliche Welt eingetaucht<br />
seien. „Sie machten die ganze Sache<br />
ohne Make-up. Alle. Das ist wahre Hingabe!“<br />
Warmherzig spricht Atwood auch<br />
über Sarah Polley, die Schauspielerin,<br />
Drehbuchautorin und Produzentin des<br />
fast ausschließlich aus Frauen bestehenden<br />
Teams hinter Alias Grace. Polley war<br />
gerade mal 17, als sie Atwood zum ersten<br />
Mal schrieb und fragte, ob sie den Roman<br />
adaptieren dürfe. Es dauerte 20 Jahre –<br />
während derer Polley zwei Kinder bekam<br />
–, bis sie so weit war, den Film zu machen.<br />
„Das wird ihr Durchbruch“, prophezeite<br />
die Autorin. Während sie Gilead – so der<br />
Name des Staates, in dem Der Report der<br />
Magd spielt, in eine wiedererkennbare Gegenwart<br />
verfrachtete („1985 trank man in<br />
Nordamerika noch keinen Latte macchiato“),<br />
beherzigt die Serie Atwoods Regel,<br />
nichts zu verwenden, was nicht schon irgendwann<br />
einmal in der Welt passiert ist;<br />
die Ergänzung durch die modernen Schrecken<br />
macht die Geschichte noch erschreckend<br />
plausibler. Weibliche Genitalverstümmelung<br />
habe es zwar bereits gegeben,<br />
„aber wenn ich das 1985 eingebaut<br />
hätte, hätten die Menschen wahrscheinlich<br />
nicht gewusst, wovon ich rede. Heute<br />
wissen sie es.“<br />
Im Gegensatz zu anderen Dystopien ist<br />
die aus der Serie gespenstisch schön: die<br />
Üppigkeit, die Stille (schallgedämpfte Autos,<br />
gruselig verstärktes Vogelzwitschern),<br />
die satte Farbe des Lichts. Sieht es so aus,<br />
wie sie es sich vorgestellt hatte? „Es kommt<br />
dem sehr nahe. Natürlich kann ich mich<br />
nicht genau an das Bild erinnern, das ich<br />
hatte. Aber ich wusste, wie der Ort aussah,<br />
denn es war ein realer Ort: Cambridge Massachusetts.<br />
Er hat sich seitdem etwas verändert,<br />
aber im Wesentlichen sehen diese<br />
Wohnstraßen noch immer gleich aus.“ Eine<br />
andere Frage hinter dem Roman lautete:<br />
„#metoo ist<br />
Symptom eines<br />
kaputten<br />
Systems, das<br />
ersetzt<br />
werden sollte“<br />
„Jetzt, wo die Büchse geöffnet wurde und<br />
die Schmetterlinge umherfliegen“, könnte<br />
man Frauen da immer noch dazu bringen,<br />
an Heim und Herd zurückzukehren, was<br />
manche von der christlichen Rechten in<br />
den Achtzigern forderten? Mit welcher Methode?<br />
Ihre Antwort: reproduktive Sklaverei.<br />
Das unvermeidliche F-Wort in Atwoods<br />
Gegenwart auszusprechen, kann gefährlich<br />
werden. „Es ist immer die Frage, was man<br />
darunter versteht. Zum Beispiel waren<br />
manche historischen Feministinnen gegen<br />
Lippenstift und wollten Transgender-Frauen<br />
nicht in die Waschräume für Frauen lassen.<br />
Mit diesen Positionen stimme ich<br />
nicht überein.“<br />
Am vergangenen Wochenende provozierte<br />
Atwood einen Twitter-Sturm mit<br />
einem Kommentar in der kanadischen<br />
Globe and Mail (Überschrift „Bin ich eine<br />
schlechte Feministin?“), in dem sie die<br />
#metoo-Bewegung als Symptom eines kaputten<br />
Systems bezeichnet. Weiter heißt<br />
es dort: „Man hat die Wahl: das System zu<br />
reparieren, es zu umgehen oder es niederzubrennen<br />
und durch etwas völlig anderes<br />
zu ersetzen. In Ländern mit einem geringeren<br />
Wohlstandsgefälle gibt es weniger<br />
sexuelle Übergriffe. Also warum<br />
Frauen unter Hauben: „The Handmaid’s Tale“<br />
fangen wir nicht da an?“ Und sie redet<br />
schnell weiter: „Frauen Informationen<br />
über Verhütung, Reproduktionsrechte, einen<br />
Lohn, der zum Leben reicht, sowie<br />
Schwangerschaftsvorsorge und Mütterbetreuung<br />
vorzuenthalten – wie einige Bundesstaaten<br />
der USA dies tun wollen –,<br />
kommt praktisch einem Todesurteil gleich<br />
und stellt einen Verstoß gegen grundlegende<br />
Menschenrechte dar. Doch Gilead<br />
ist totalitär und respektiert keine universellen<br />
Menschenrechte.“<br />
Das große Thema in Atwoods Literatur<br />
ist Macht, Machtungleichheit oder -missbrauch<br />
Frauen oder anderen Gruppen gegenüber.<br />
„Ich fürchte, bei vielen Menschen<br />
dreht sich alles um Macht“, sagt sie.<br />
„Aber das entsteht nicht aus dem Wunsch<br />
nach Macht, sondern aus Angst, nicht derjenige<br />
zu sein, den es trifft. Denken Sie an<br />
Julia in George Orwells 1984: ,Tut es Julia<br />
an! Nicht mir!‘ “ Bei sozialem Mobbing auf<br />
Twitter geht es darum, „auf der Seite derjenigen<br />
zu stehen, die es machen, um<br />
nicht auf der Seite derer zu sein, mit denen<br />
es gemacht wird“. Ihr Roman Katzenauge<br />
von 1988 ist eine äußerst realistische<br />
Geschichte über das Mobbing unter Schülerinnen.<br />
Die Machtstrukturen unter<br />
Jungs seien „recht einfach und offenkundig<br />
hierarchisch und stabil“, sagt Atwood<br />
heute. Bei Mädchen sei es hingegen<br />
„mehr wie in der Serie Wolf Hall: kompliziert,<br />
verdeckt. Man versteht nie ganz, warum<br />
eine Person beliebt ist und dann<br />
plötzlich wieder nicht.“<br />
Dunkle, tiefe Psyche? Pah!<br />
„Bei Mobbing<br />
auf Twitter will<br />
man auf<br />
der Seite derer<br />
stehen,<br />
die es machen“<br />
Auch wenn Katzenauge eindeutig auf die<br />
Erfahrungen zurückgreift, die Atwood bei<br />
ihrem Umzug aus der kanadischen Wildnis<br />
nach Toronto machte, wo sie die Schule<br />
besuchte, haben Memoiren sie nie gereizt.<br />
„Mich beschäftigt mehr, was in der Welt<br />
vor sich geht. Ich interessiere mich nicht<br />
besonders für meine tiefe, dunkle Psyche,<br />
so faszinierend sie auch sein mag.“ Sie sei<br />
keine Perfektionistin, und es sei ihr auch<br />
egal, wann oder wo sie schreibe. „Ich bin<br />
eine Abfahrtsskiläuferin. Ich komme unten<br />
an. Wenn ich einmal am Ende angekommen<br />
bin, schreibe ich viel um. Ich fange<br />
sogar schon vorne an umzuschreiben,<br />
während ich hinten noch gar nicht fertig<br />
bin, nur um mich zu erinnern, was ich geschrieben<br />
habe.“ Das lässt den Prozess<br />
spontaner klingen, als er ist: Tatsächlich<br />
erstellt sie für jeden Charakter Diagramme,<br />
von dem Jahr an, in dem sie geboren<br />
sind. „Ich will genau wissen, wie alt die Figuren<br />
sind – so bringe ich da nichts durcheinander.“<br />
Margaret Atwood wurde 1939 geboren,<br />
in einer dunklen Zeit, die sie grundlegend<br />
geprägt hat, „keine Frage!“. Von all den Bezügen,<br />
die den Report der Magd inspiriert<br />
haben, stelle Nazi-Deutschland den verfaulten<br />
Kern dar: die Vorstellung, dass die<br />
Stabilität über Nacht über den Haufen geworfen<br />
werden kann. Die Demokratie in<br />
den USA sei noch nie so sehr herausgefordert<br />
gewesen wie heute. „Aber warum<br />
Dunkle Helden, Moden und Geld<br />
Sie hat George Orwell<br />
„meinen Helden“ genannt.<br />
Dessen Roman Animal<br />
Farm habe sie verschlungen<br />
und als literarisches Vorbild<br />
genutzt. Margaret Atwood hat<br />
ihre Kindheit in Ottawa<br />
und Quebec verbracht. Sie<br />
studierte in Harvard englische<br />
Sprache und Literatur und<br />
lehrte als Literaturwissenschaftlerin<br />
an verschiedenen<br />
Universitäten.<br />
Daneben veröffentlichte sie<br />
Kurzgeschichten, Gedichte,<br />
Kinderbücher und Romane.<br />
Bekannt geworden ist sie<br />
mit Der Report der Magd (The<br />
Handmaid’s Tale), entstanden<br />
während eines Stipendiums<br />
in West-Berlin und einer Reise<br />
in den Ostblock (1984). Darin<br />
beschreibt sie ein theokratisches,<br />
patriarchales System,<br />
in dem die noch verbliebenen<br />
fruchtbaren Frauen als<br />
sind die Leute denn so schockiert von all<br />
dem?“, fragt sie. „Sehen Sie sich doch die<br />
Geschichte der USA an. Der eigentliche<br />
Grund, warum die Leute in der Neuzeit so<br />
viel von Amerika erwarten, besteht darin,<br />
dass es anfänglich für das gelobte Land gehalten<br />
wurde. Das hat nicht lange gedauert.<br />
Als die Menschen nach Amerika kamen,<br />
haben sie als Erstes ein Schafott und<br />
ein Gefängnis gebaut.“ Es sei im Moment<br />
vielleicht beängstigend, aber „können wir<br />
uns mal für eine Minute an den Ersten<br />
und Zweiten Weltkrieg erinnern? Und in<br />
den Fünfzigern dachten wir alle, wir würden<br />
von Atombomben in die Luft gesprengt.<br />
Es gibt also verschiedene Formen<br />
von ‚beängstigend‘.“<br />
Als engagierte Umweltschützerin sieht<br />
Atwood im Zustand des Planeten einen<br />
Grund für „soziale Unruhen, Kriege und<br />
Revolutionen. Dazu kommt es, wenn die<br />
Menschen das Gefühl haben, dass ihnen<br />
das Holz ausgeht.“<br />
Lisa Allardice ist Redakteurin des Guardian<br />
Übersetzung: Holger Hutt<br />
Gebärmaschinen an die<br />
Herrschenden vermietet<br />
werden. Die Stellung der Frau<br />
in der Gesellschaft wird in<br />
ihren Romanen oft in Form<br />
von dystopischen Science-<br />
Fiction-Erzählungen thematisiert.<br />
Bereits 1990 hatte<br />
Volker Schlöndorff ihren<br />
Roman Die Geschichte der<br />
Dienerin verfilmt. Die<br />
Adaption des amerikanischen<br />
Streamingdienstes Hulu<br />
wurde bei den Golden Globes<br />
2018 als Beste Dramaserie<br />
ausgezeichnet (in Deutschland<br />
läuft sie auf EntertainTV).<br />
Für ihre Rolle als<br />
Magd Desfred erhielt die<br />
Hauptdarstellerin Elisabeth<br />
Moss den Emmy. Die 2.<br />
Staffel der Serie wird ab Ende<br />
April ausgestrahlt.<br />
Im Jahr 2008, inmitten der<br />
Finanzkrise, erschien Payback.<br />
Darin durchstreift Atwood<br />
die Ideen- und Literaturgeschichte<br />
von der Antike bis<br />
heute. Nicht Liebe, sondern<br />
Geld scheint demnach das<br />
Hauptmotiv der Erzählungen<br />
zu sein. Die kulturhistorische<br />
Betrachtung von Schuld(en)<br />
und Wohlstand steigert sich<br />
bis hin zu apokalyptischen<br />
Szenarien und einer ökologischen<br />
Weltkrise. Mit bissigen<br />
Seitenhieben auf den<br />
Literaturbetrieb wird auch<br />
in Hexensaat (2016), einer<br />
zeitgenössischen Umschreibung<br />
von Shakespeares Der<br />
Sturm, nicht gespart.<br />
Von Eva Menasse als „boshaft<br />
kichernde, weise Frau“<br />
bezeichnet, schaffe sie es<br />
stets, die Macht totalitärer<br />
Systeme literarisch greifbar zu<br />
machen und politische<br />
Moral ironisch auszudrücken.<br />
Margaret Atwood erhielt<br />
2017 den Friedenspreis des<br />
Deutschen Buchhandels. RG<br />
FOTO: GEORGE KRAYCHYK/EVERETT COLLECTION/DPA
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
Alltag<br />
23<br />
Jetzt die Kür<br />
Altern Wenn Menschen in die Jahre kommen, wird das meist<br />
klischeehaft wahrgenommen – vor allem bei Frauen.<br />
Wie ist es wirklich? Fünf Betrachtungen von Magda Geisler<br />
Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, hat stets einen wachsenden Schatten im Blick<br />
FOTO: BILDAGENTUR-ONLINE/DPA<br />
Warum Beschönigen<br />
gar nichts bringt<br />
Womit kann man<br />
noch so rechnen<br />
In der Liebe werden<br />
wir nachsichtiger<br />
Ich hatte den Befund, der in meiner<br />
Tasche steckte, schon gelesen, als<br />
ich einer 20 Jahre jüngeren Freundin<br />
in unserer Stammkneipe verkündete:<br />
„Es ist nie gut, sich über<br />
sein Alter was vorzumachen.“<br />
Dabei war mir selbst gar nicht nach<br />
kühlem Realismus zumute, sondern<br />
nach Trost. Da waren sie,<br />
all die Fachtermini über die Beanspruchung<br />
und Abnützung der<br />
Apparatur, die uns zum aufrechten<br />
Gang befähigt. Da traten zum<br />
Beispiel auf: ein Cervicocephalsyndrom<br />
mit Myogelosen, das sind<br />
Muskelverhärtungen. Eine abgeflachte<br />
Lordose, eine Verkrümmung,<br />
an der Halswirbelsäule kann<br />
ich ebenfalls vorweisen.<br />
Man altert nicht gemütlich vor<br />
sich hin. Ganz plötzlich fühlt man<br />
sich mit einem Schlag um Jahre<br />
gealtert, manchmal ist es ein Blick<br />
in den Spiegel, oder das Aufstehen<br />
vom Sessel fällt – mit einem Mal –<br />
schwerer als gestern.<br />
Leben ist Verschleiß. Mir geht es<br />
besser, seit ich mich dieser Erkenntnis<br />
stelle. Das Alter ist keine Krankheit,<br />
aber die ständige Altersbedrohung<br />
ist eine. „Das Alter ist nichts<br />
für Feiglinge“, erklärte einmal die<br />
Hollywood-Schauspielerin Mae<br />
West. Mittlerweile ein geflügeltes<br />
Wort. Andere, wie die gerade 75<br />
Jahre alt gewordene Schauspielerin<br />
Senta Berger, charakterisieren<br />
das Älterwerden unverhüllter als<br />
„Zumutung“.<br />
Wir sind schlichtweg länger alt.<br />
Im Jahr 2030 soll die durchschnittliche<br />
Lebenserwartung 90 Jahre<br />
betragen – und so kommt das Phänomen<br />
länger und deutlicher in<br />
der Öffentlichkeit vor.<br />
Wenn wir auf der Straße<br />
verschwinden<br />
Das Nicht-mehr-wahrgenommen-<br />
Werden - es macht älteren Frauen<br />
zu schaffen. Eine Freundin, eine<br />
schöne Frau in den 50ern, erzählte,<br />
dass sie manche Blicke vermisst.<br />
Dass sie dieses „Verschwinden“<br />
schmerzvoll erlebt.<br />
Aber das geht auch Männern so:<br />
Kürzlich beklagte sich der Schauspieler<br />
Winfried Glatzeder über<br />
dieses Übersehenwerden. Er fühle<br />
sich ausgesondert. Wenn er die<br />
Straße entlanggehe, gucke man an<br />
ihm vorbei. Er werde nicht mehr<br />
wahrgenommen. Das sei im Beruf<br />
ähnlich. Glatzeder ist jetzt über<br />
70 – so wie ich.<br />
Mir selber macht das Übersehen<br />
wenig aus, weil ich nie eine sehr<br />
auffällige Erscheinung war und eher<br />
unter „ganz nett“ fiel. Und noch<br />
falle. Aber ich mache mich – auch<br />
als Bloggerin – gern kenntlich und<br />
erlebe, dass ich mit meiner Altersangabe<br />
und einem halbwegs realistischen<br />
Foto im Internet und in<br />
sozialen Medien manchen Kontrahenten<br />
Argumente lieferte. Es<br />
gibt Leute, die mit Begriffen wie<br />
„senil“ oder „arme alte Frau“ einen<br />
Punkt machen wollen.<br />
Alte Menschen gelten als gesundheitspolitisches<br />
Problem und<br />
eher konservatives WählerInnen-<br />
Potenzial – so wird das öffentlich<br />
diskutiert. Aber als Subjekte, als<br />
einzelne Menschen verschwinden<br />
sie. Vor allem Frauen. Wenn in<br />
Talkshows sowieso schon wenige<br />
sitzen, dann noch weniger ältere.<br />
Und wenn doch einmal, dann sollen<br />
sie über Probleme reden, die<br />
mit ihrem Alter zu tun haben. Die<br />
Lebensaussagen älterer Menschen<br />
sollen die jüngeren eher ermutigen,<br />
statt sie an Endlichkeiten des<br />
Lebens zu erinnern.<br />
Manchmal möchte man appellieren:<br />
Redet darüber, dass das Alter<br />
beschwerlich ist. Redet über die<br />
Angst vor der Gebrechlichkeit.<br />
Über die Furcht vor dem Ende. „Ich<br />
werde mir doch sehr fehlen“,<br />
diesen ironischen Satz hat Kurt<br />
Tucholsky einmal geschrieben.<br />
Aus der Welt zu verschwinden,<br />
da ist ja auch eine Ungeheuerlichkeit,<br />
die nicht nur im Alter das<br />
Denken überfällt. Selbst bei so<br />
einem trivialen Skandal wie dem<br />
verzögerten Bau des monströsen<br />
Berliner Flughafens, denke ich<br />
manchmal darüber nach, ob ich<br />
seine Eröffnung noch erleben<br />
werde. Manche Männer rechnen<br />
sich aus, wie viele Fußballweltmeisterschaften<br />
sie noch sehen werden.<br />
Ja, es stellt sich ein, dieses<br />
Rechnen, wenn über zukünftige<br />
Projekte berichtet wird. Ich erinnere<br />
mich gern an meine Mutter,<br />
die mir einmal freudvoll sagte: Du<br />
wirst es erleben, das neue Jahrtausend,<br />
du bist dann gerade mal<br />
54 Jahre alt. Sie war damals über<br />
70, und so alt bin ich heute.<br />
Alles ist unsicher, wenn man älter<br />
wird und immer noch älter.<br />
Man muss das richtige Maß finden.<br />
Wo nur sind die<br />
zornigen alten Weiber<br />
Das öffentliche Reden übers Alter<br />
benutzt gefällige Klischees, zum<br />
Beispiel „Unruhestände“. Als<br />
Zuschreibung für einen noch aktiven<br />
Pensionär im Ruhestand.<br />
Ich kenne das nur als zunehmende<br />
Ungeduld: an der Kasse, bei<br />
Ämtern.<br />
Die wird sonst eher jungen Leuten<br />
zugeschrieben. Aber die gucken<br />
geduldiger auf ihr Handy als ich.<br />
Es heißt immer, ältere Menschen<br />
sind gelassener, aber das stimmt<br />
nicht immer. Oder man sagt: Menschen<br />
sind glücklich, wenn sie<br />
„noch gebraucht“ werden. Auch das<br />
ist mir ein bisschen verdächtig.<br />
„Gebraucht“, das sind alte Menschen<br />
sowieso, das Leben hat dafür<br />
gesorgt. Das ist ein Zustand, keine<br />
Anforderung. Übrigens wird dies<br />
oft im Zusammenhang mit Frauen<br />
verwendet, Männern steht die<br />
noch immer kraftvolle, zornige<br />
Wortmeldung im Vordergrund.<br />
Die Putzfrau Susanne Neumann,<br />
Gewerkschafterin und SPD-Mitglied,<br />
die manchmal öffentlichkeitswirksam<br />
ins Rennen geschickt<br />
wird, um ihrer Partei ins Gewissen<br />
zu reden, ist eine Einzelerscheinung.<br />
Die zudem stets etwas inszeniert<br />
wirkt. Zornige ältere Männer<br />
hingegen gibt es fast schon als<br />
Label. Zornige alte Weiber kaum,<br />
Treten sie zu lebhaft in der Öffentlichkeit<br />
auf, werden sie mit Spott<br />
bedacht - wie im Moment SPD-<br />
Fraktions chefin Andrea Nahles.<br />
Bei alten Frauen geht das nur,<br />
wenn sie sich ganz bewusst stilisieren<br />
oder künstlerisch unterwegs<br />
sind. Wie „Die drei alten Schachteln“,<br />
die in den Nullerjahren<br />
auf der Bühne standen. Eine von<br />
ihnen war Brigitte Mira. Damals<br />
war sie 85.<br />
Zu zweit ist es leichter, zumindest<br />
wenn beide voll erwerbstätig waren.<br />
Was ja noch immer ein Vorzug<br />
des Ostens ist. Viele ältere Menschen<br />
müssen nach dem Prinzip leben:<br />
„Ich bin alt und brauche das Geld“.<br />
Meist geht es Alleinstehenden so, in<br />
der Mehrzahl Frauen. Sie sind<br />
häufig Missbrauchsopfer der nach<br />
unten definierten Rentenformeln.<br />
Ich jedenfalls bin erleichtert, dass ich<br />
nichts mehr wirklich tun muss.<br />
Und wenig Sinnsuche betreibe. Übrigens:<br />
Auch nicht nach rückwärts,<br />
auch nicht als Bilanz. Wenn ich<br />
zurückschaue, dann als Erinnerung,<br />
die nicht Versäumnisse abrechnet.<br />
Mein Mann und ich unterhalten<br />
uns oft über die auf einmal so lang<br />
schon zurückliegende Zeit der täglichen<br />
Pflichten und 8-Stunden-Tage.<br />
Und sind froh, dass es jetzt vorbei<br />
ist. So gut und wichtig es ist, sich im<br />
Alter zu betätigen, so sehr von<br />
Belang sind auch die schönen Rituale<br />
der Beschaulichkeit, des Gleichmaßes<br />
der Alltagsverrichtungen und<br />
der Ruhe. Altersweisheit ist mir<br />
allerdings ziemlich fremd. Milde,<br />
„altersmilde“ und nachsichtig bin<br />
ich mit dem Menschen, der mir<br />
am nächsten ist.<br />
Mein Mann ist einige Jahre älter als<br />
ich, und ich habe gerade in den letzten<br />
Jahren erlebt, dass Älterwerden<br />
nicht ein ständiges „Abwärts“<br />
bedeutet. Krank heiten kommen und<br />
vergehen. Das macht mir, die mein<br />
Mann mit den Worten verspottet,<br />
ich sei noch so „herrlich jung“, doch<br />
Mut. Das Alter zeigt, worauf es<br />
ankommt. Es braucht Wohlwollen<br />
füreinander. Nachsicht. Im Alter<br />
zeigt sich für uns deutlicher, warum<br />
wir einst zusammenbleiben wollten.<br />
Wir passen jetzt vielleicht sogar<br />
besser zusammen als früher.<br />
Magda bloggt seit 2009 in der <strong>Freitag</strong>-<br />
Community – auch zu diesem Thema
24 A – Z<br />
der <strong>Freitag</strong> | Nr. 5 | 1. Februar 2018<br />
A–Z Männergrippe<br />
Maskulinität Nasskalt, sonnig, frühlingshaft – Zeit, einige lieb gewonnene<br />
Männerklischees zu zementieren. Ist es eine Hochzeitsangina, wenn sein Hals<br />
kratzt? Beweist Niesen Potenz? Ach je, und es tut doch alles so weh! Noch<br />
mehr sogar, wenn man zur Grippe Grönemeyer hört. Unser Wochenlexikon<br />
AAbgrenzung Potenzieller Männlichkeitsverlust<br />
erschütterte schon frühere Generationen.<br />
Martialisch (➝ Kita) gerät mitunter<br />
die Inszenierung der selbstvergewissernden<br />
Abgrenzung.<br />
Die neue Aesthetik der musikalischen<br />
Impotenz heißt ein Manifest gegen die<br />
Neue Musik von 1920. Männlichkeit wird<br />
als von außen durch das weibliche Andere<br />
gefährdet erfahren, oder durch sich selbst.<br />
Könnte nicht jederzeit homoerotisches<br />
Begehren ins Bewusstsein schießen? Darum<br />
halten sich verunsicherte Männer<br />
an fixen Rollen und sexuellen Orientierungen<br />
fest. Bernd Höcke erntete heftigen<br />
Applaus, als er zeterte, Deutschland<br />
habe seine „Männlichkeit verloren“. Es<br />
müsse „mannhaft“ werden, um „wehrhaft“<br />
zu sein. In seiner Dankesrede zum<br />
Schirrmacherpreis beklagte der Autor Michel<br />
Houellebecq die Rückkehr des Matriarchats.<br />
Der „erste Feind, den unsere westliche<br />
Gesellschaft versucht auszurotten,<br />
ist das männliche Zeitalter, ist die Männlichkeit<br />
selbst“. <br />
Tobias Prüwer<br />
BBericht Männer leben durchschnittlich<br />
fünf Jahre kürzer als Frauen. Sie bekommen<br />
öfter als Frauen einen Herzinfarkt,<br />
und das schon in einem Alter, in dem sie<br />
sich noch voll fit und voll jung fühlen, so<br />
mit 50 also. In diesem Alter begehen drei<br />
Mal mehr Männer als Frauen Suizid. Dass<br />
das so ist, weiß die Wissenschaft schon<br />
lange. Aber warum das so ist, erst seit<br />
Kurzem. Das hat viel mit dem Männergesundheitsbericht<br />
der 20<strong>05</strong> gegründeten<br />
Stiftung Männergesundheit zu tun. Der<br />
Bericht beleuchtet die Zusammenhänge<br />
von Biologie, Gesellschaft und Männlichkeitsbildern.<br />
Der erste Bericht 2010 war<br />
damals sensationell, weil er auf unaufgeregte<br />
Weise sagte: Männer, kümmert<br />
euch um euch. Hustet dem Erwartungsdruck<br />
eurer Chefs, Frauen und Fußballkumpels<br />
was. Und lebt lieber wild, aber<br />
nicht so gefährlich wie früher (➝ Grönemeyer).<br />
<br />
Simone Schmollack<br />
GGrönemeyer Sein Superhit aus dem Jahr<br />
1984 ist ein Song, der Männer versteht,<br />
aber ihre Unzulänglichkeiten auch voller<br />
Genuss und Ironie markiert. Der Mann,<br />
das wehleidige Wesen: Das ist eine Botschaft<br />
des Liedes. „Allzeit bereit“, „ständig<br />
unter Strom“, bekommen Männer leider<br />
viel zu früh nicht nur eine Männergrippe,<br />
sondern nicht selten einen Herzinfarkt<br />
(➝ Bericht). Und so hyperventiliert singt<br />
Grönemeyer das Lied auch: als stünde er<br />
selbst kurz davor.<br />
Männer mögen das Lied. Vielleicht,<br />
weil sie sich erkennen – und weil es keine<br />
Frau geschrieben hat. Vielleicht, weil<br />
es gut ist, wenn ein Mann von den Fehlern<br />
der Männer singt. In jedem Fall war<br />
die Platte 4630 Bochum ein Riesenerfolg<br />
und verkaufte sich in Deutschland besser<br />
als Michael Jacksons Thriller. Außen hart<br />
und innen ganz weich: War Grönemeyer<br />
selbst der Mann, den er mit so viel Furor<br />
besang? Männer ist ein guter Song, auch<br />
weil er sich in viele Richtungen interpretieren<br />
lässt. Eben auch in jene: Die Verletzlichkeit<br />
der Männer, ihre Zartheit, ihr<br />
Hang zum Leiden, ist groß. Größer, als es<br />
der Mainstreampop in Deutschland zuvor<br />
erzählt hat. <br />
Marc Peschke<br />
B<br />
Hochzeitsangina nannte ein schon etwas<br />
älterer Ratgeber für Paare ein Phänomen,<br />
das vor allem junge Männer signifikant<br />
heimgesucht haben soll. Einen Tag vor<br />
der Trauung kriegten die einen dicken<br />
Hals und hohes Fieber, das Ereignis musste<br />
ausfallen. Wahrscheinlich betraf es<br />
solche Ehekandidaten (➝ Molière), die<br />
beim Gedanken an eine Bindung sowieso<br />
schon schwer schlucken mussten –<br />
statt der Hochzeit entgegen zu fiebern.<br />
Ein Grund kann das einstmals in Ost und<br />
West recht niedrige Alter bei Eheschließungen<br />
gewesen sein. In der DDR wurde<br />
oft mit 18 Jahren schon geheiratet. Auch<br />
aus Zwängen. Ein ungeplantes Kind oder<br />
ein Trauschein als Berechtigungsnachweis<br />
für eine Wohnung. Magda Geisler<br />
I<br />
Immunsystem Gibt es bei der Immunabwehr<br />
geschlechtsspezifische Unterschiede?<br />
Die Forschung geht der Frage schon<br />
länger auf den Grund. Siehe da: Während<br />
Östrogene, die im Falle von Bakterien und<br />
Viren notwendig spezifische Immunantwort<br />
fördern, wird sie durch Testosteron<br />
eher gehemmt. Siehste! Aber: wenn die<br />
Immunantwort bei Frauen viel heftiger<br />
ausfällt als bei Männern, müssten die<br />
sich dann nicht elender fühlen? Tatsächlich<br />
kommen andere Studien zu dem Ergebnis,<br />
dass Männer und Frauen gleichermaßen<br />
unter Erkältungen leiden. Die<br />
Wissenschaft bleibt unserer Alltagswahrnehmung<br />
den Realitätscheck (➝ Kita)<br />
also vorerst schuldig. Sophie Elmenthaler<br />
FOTO: DENVER POST/GETTY IMAGES<br />
K<br />
Kita Wann immer meine Frau krank ist,<br />
bin ich kränker – das sagt zumindest meine<br />
Frau. Ich kann dem natürlich so nicht<br />
zustimmen, vor allem wenn sie sagt, dass<br />
ich besonders leiden würde. Fakt ist aber,<br />
dass wir uns, seitdem wir zwei Söhne haben,<br />
von Krankheit zu Krankheit hangeln.<br />
Es liegt am Wetter und vor allem an der<br />
Kita. Da können sich die Kinder richtig<br />
austoben, lernen mit Gleichaltrigen umzugehen<br />
und lernen zu teilen – leider<br />
auch alle Arten von Krankheiten. So ist<br />
unser Alltag abwechslungsreich (➝ Mansplaining)<br />
und immer voller Überraschungen.<br />
Sie heißen Hand-Fuß-Mund, Dreitagefieber,<br />
Hüftschnupfen, Bindehautentzündung,<br />
Pseudo-Krupp, Magen-Darm,<br />
Blasenentzündung, Bronchitis. Nicht zu<br />
vergessen ist die gemeine Erkältung.<br />
Und wenn unsere Söhne mal nichts haben,<br />
aber es uns Eltern getroffen hat, geht<br />
der Alltag unerbittlich weiter – und die<br />
Debatte, wer denn kränker ist und liegen<br />
bleiben darf. Behrang Samsami<br />
M<br />
Mansplaining Zumindest den Leserinnen<br />
unter Ihnen muss das Phänomen<br />
nicht erst dargelegt werden. Und sollte<br />
ausgerechnet ein Mann Ihnen erklären,<br />
was Mansplaining ist? Nun denn, die Redakteurin<br />
hat entschieden: Die Publizistin<br />
Rebecca Solnit erfand das Kofferwort<br />
(Man=Mann, Explaining=Erklären) vor<br />
genau zehn Jahren in einem Blogbeitrag<br />
und gab einem alten Problem (➝ Präsentismus)<br />
den passenden Namen.<br />
Übersetzt heißt der Beitrag: „Männer<br />
erklären mir Dinge; Fakten stören sie dabei<br />
nicht.“ Solnit schildert eine legendäre<br />
Partybegegnung. „Sie schreiben also Bücher,<br />
worüber?“, fragte er. Sie antwortete,<br />
dass ihr letztes Werk die Industrialisierung<br />
des Alltags und den Fotopionier Eadweard<br />
Muybridge behandelte. Sobald dessen<br />
Name fiel, unterbrach der Mann:<br />
„Wissen Sie, dass über Muybridge gerade<br />
ein wichtiges Buch erschien?“ Er plapperte<br />
einfach weiter, bis er verstand, dass er<br />
Solnits Buch referierte. Kurz wurde der<br />
Mann bleich, dann ging der Redeschwall<br />
weiter. Ein klassisches Beispiel für eine<br />
Machtasymmetrie in Kommunikationssituationen<br />
– zahlreiche Studien belegen<br />
die kürzere Redezeit von Frauen. TP<br />
Molière Der eingebildete Kranke, 1673 uraufgeführt,<br />
ist ein Stück, über das man<br />
sich nur wundern kann. Warum wird es<br />
heutzutage so viel gespielt? Warum steht<br />
es bis heute auf den Spielplänen von Provinztheatern<br />
und den ganz großen Häusern?<br />
Es gibt nur eine Erklärung: Das Thema<br />
der eingebildeten Krankheiten ist<br />
ein zeitgenössisches Phänomen. Die<br />
Krankheiten, das Selbstmitleid – sie halten<br />
am Leben. Das Leiden (➝ zartbesaitet)<br />
schafft Leidenschaft. Die Hypochondrie<br />
macht zum Tyrannen, aber: Sie hält fit.<br />
Die Krankheit, natürlich, ist eine Metapher<br />
für das, was uns umgibt: Erschöpfungszustände,<br />
Angst, Kontrollwahn. Molières<br />
Komödie ist reine Gegenwart. Die<br />
tragische Komponente des Ganzen ist<br />
bekannt: Molière starb 1673 während der<br />
vierten Vorstellung des Stücks, in dem er<br />
selbst die Hauptrolle gespielt hatte. MP<br />
PPräsentismus ist gewissermaßen das Gegenteil<br />
der Männergrippe. Arbeitspsychologen<br />
bezeichnen so das Verhalten von<br />
Arbeitnehmern, trotz Krankheit am Arbeitsplatz<br />
zu erscheinen. Der Präsentismus<br />
greift besonders stark in Zeiten ho-<br />
her Arbeitslosigkeit um sich. In Deutschland<br />
scheint er sogar eine Art<br />
Volkskrankheit zu sein. Zwei Drittel<br />
(➝ Statistik) gehen krank zur Arbeit, ermittelt<br />
der Deutsche Gewerkschaftsbund.<br />
Denn im neoliberalen Zeitalter gelten<br />
Krankheiten als Zeichen der Schwäche.<br />
Dabei rechnen Wirtschaftswissenschaftler<br />
vor, dass die ökonomischen Einbußen<br />
durch Präsentismus höher sind, als wenn<br />
Kranke sich einfach auskurieren.<br />
Der Kranke kann sein Kranksein also so<br />
ökonomisch legitimieren – dem einzigen<br />
Kriterium, das zählt. Marlene Brey<br />
RRothaarige „Der Schmerz ist aber überhaupt<br />
der Verlauf der Endlichkeit und<br />
subjektiv die Zerknirschung des Gemüths“,<br />
spekulierte G.W.F. Hegel und ging<br />
munter darüber hinweg, welch haarige<br />
Angelegenheit eben diese Subjektivität<br />
des Schmerzes in Wirklichkeit ist.<br />
Menschen mit rotem Haar seien<br />
schmerzempfindlicher, so eine Studie<br />
der International Association for the<br />
Study of Pain, sie brauchen eine stärkere<br />
Narkose-Dosis. Zudem seien sie empfindlicher<br />
gegenüber Wärme und Kälte. Eine<br />
Extremerfahrung ist die Erkältung für den<br />
rothaarigen Mann: Er leidet doppelt an<br />
„man flu“, was Fieber und Schüttelfrost<br />
(➝ Immunsystem) angeht. Und dann<br />
noch diese Gliederschmerzen! Pepe Egger<br />
SStatistik „Diskriminierung!“, rufen männerbewegte<br />
Aktivisten – auch Maskulisten<br />
genannt –, weil Männer statistisch<br />
öfter Opfer von Gewalt werden als Frauen.<br />
Es ist in der Tat beunruhigend, dass Männer<br />
gerade in der Öffentlichkeit viel stärker<br />
durch körperliche Gewalt bedroht<br />
sind. Es sind aber in der Regel andere<br />
Männer, die die Täter sind. Circa sechsmal<br />
häufiger verursachen sie schwere Körperverletzungen.<br />
Also macht die Geschlechtskategorie<br />
hier wenig Sinn, von<br />
Diskriminierung zu sprechen sowieso<br />
nicht. Laut der Pilotstudie Gewalt gegen<br />
Männer hat ein Viertel der Befragten körperliche<br />
Gewalt innerhalb der heterosexuellen<br />
Partnerschaft erfahren. Problematisch<br />
ist, dass Männergewalt noch<br />
immer als normal gilt. Vielleicht sollten<br />
wir weniger Männlichkeit (➝ Hochzeitsangina)<br />
wagen. Dann können sich<br />
alle sicherer fühlen und eine Gesellschaft<br />
ohne Gefängnisse wird realistischer.<br />
Denn in deutschen Haftanstalten standen<br />
2016 rund 3.125 Frauen 47.733 inhaftierten<br />
Männern gegenüber. <br />
TP<br />
ZZartbesaitet Klar, es gibt sie, die Weicheier<br />
und Mimosen. Lappen, die nicht mal<br />
einen Hocker ins Dachgeschoss schleppen<br />
können und Angst vorm Flaschenteilen<br />
oder Löcher-in-Wände-Bohren haben.<br />
Ich beobachte verweichlichte Unter-dem-<br />
Schirm-Steher statt fröhlicher Durch-den-<br />
Regen-Renner in den Straßen, erlebe<br />
Menschen, die mit Schnupfen sofort daheimbleiben.<br />
Ein typisches Mann/Frau-Phänomen?<br />
Nicht auszumachen. Meine Mutter setzt<br />
riesige Spinnen mit bloßen Händen nach<br />
draußen, eine Freundin geht 640 Kilometer<br />
St. Olavsweg bei Regen und Sturm, ein<br />
Freund klebt seine abgesägte Fingerkuppe<br />
einfach mit Gaffa-Tape wieder an und<br />
ein anderer spielt noch Fußball – trotz<br />
Schlüsselbeinbruchs. Es scheint, trotz<br />
Achtsamkeitsdiktats – es gibt sie noch, die<br />
harten Kerle (➝ Grönemeyer) und die taffen<br />
Deerns. <br />
Oda Hassepass