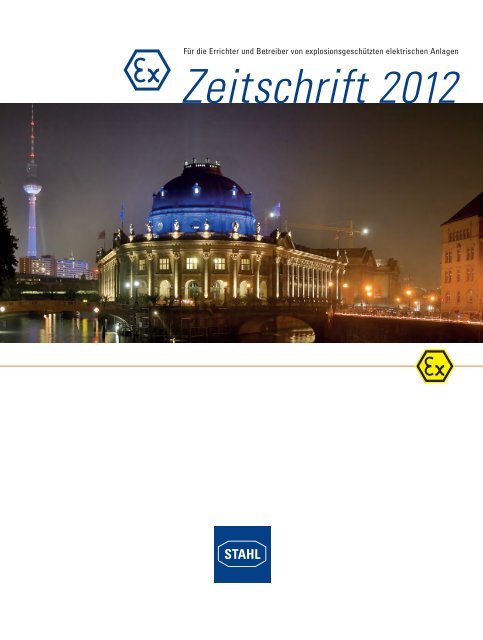Zeitschrift 2012
Zeitschrift 2012
Zeitschrift 2012
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Für die Errichter und Betreiber von explosionsgeschützten elektrischen Anlagen<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong>
Titelbild: Berlin – Hauptstadt vom wiedervereinigten<br />
Deutschland. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts Sitz staatlicher<br />
Institute, u.a. für die Forschung und Untersuchungen<br />
zur Sicherheitstechnik in Industrie und Gewerbe (siehe Berichte<br />
auf Seite 18 und 26).<br />
Impressum<br />
Die Ex-<strong>Zeitschrift</strong> 44/<strong>2012</strong> (ISSN 0176-2419)<br />
erscheint im Auftrag von:<br />
R. STAHL<br />
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany<br />
Telefon: + 49 7942 943-0<br />
Telefax: + 49 7942 943-4333<br />
exzeitschrift@stahl.de<br />
www.stahl.de<br />
Herausgeber<br />
R. STAHL Schaltgeräte GmbH<br />
Redaktion<br />
Dr.-Ing. Thorsten Arnhold<br />
Dr.-Ing. Peter Völker<br />
Ingénieur Industriel Roger Peters<br />
Anja Kircher<br />
Kerstin Wolf<br />
Peter Krapf<br />
Organisation und Gestaltung<br />
Anja Kircher, Yasemin Serttürk<br />
Druck<br />
f&w Mediencenter, 83361 Kienberg<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine<br />
Gewähr übernommen. Einsender von Manuskripten,<br />
Briefen u.a. erklären sich mit redaktioneller Bearbeitung<br />
einverstanden.<br />
Nachdruck nur mit Genehmigung des<br />
Herausgebers!<br />
Seite 2 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Editorial<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />
Vom 18. – 22. Juni <strong>2012</strong> wird in Frankfurt/Main zum dreißigsten Mal<br />
mit der ACHEMA das Weltforum der Prozessindustrie und die weltgrößte<br />
Fachmesse für Chemische Technik, Umweltschutz und Biotechnologie<br />
ihre Pforten öffnen. Neben zahllosen anderen technischen<br />
und technologischen Themen rund um die Prozessindustrie<br />
wird auch der Explosionsschutz hier eine gewichtige Rolle spielen.<br />
Der durch die begonnene Energiewende ausgelöste Trend zur verstärkten<br />
Nutzung erneuerbarer Energien und zur deutlichen Erhöhung<br />
der Energieeffizienz in allen Bereichen der Prozesstechnik wird<br />
sich auch an den auf der Messe ausgestellten Produktneuheiten widerspiegeln.<br />
Dies ist nicht verwunderlich, immerhin gehören die chemische, die<br />
petrochemische und pharmazeutische Industrie zu den größten Energieverbrauchern.<br />
So beträgt z. B. der Anteil der Energiekosten in<br />
der chemischen Industrie an der Bruttowertschöpfung etwa 3% (im<br />
Vergleich beträgt der Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes<br />
etwa 1,7%). Smarte energiesparende Lösungen für die gesamte Prozessanlage<br />
einschließlich der explosionsgefährdeten Bereiche bieten<br />
große Potenziale zur Senkung der Herstellkosten. Aus der Vielzahl<br />
der sich ergebenden Lösungen sei hier stellvertretend die<br />
LED – Technik hervorgehoben, auf die wir in dieser Ausgabe unserer<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> besonders eingehen werden. Neben der erstaunlich<br />
langen Lebensdauer der LEDs, die teure Wartungs- und Austauschkosten<br />
vergessen macht, sind die Kompaktheit und die hohe Energieeffizienz<br />
ihre wichtigsten Merkmale. Bei den explosionsgeschützten<br />
Handscheinwerfern, den Signalleuchten sowie bei<br />
Serviceleuchten hat die LED bereits die herkömmlichen Leuchtmittel<br />
abgelöst, jetzt setzt sie ihren Siegeszug bei der Allgemein-beleuchtung<br />
fort.<br />
Zahlreiche weitere Neuentwicklungen auch für explosionsgefährdete<br />
Bereiche zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung<br />
autarker Energiequellen sowie zur Energiespeicherung und –umwandlung<br />
werden in Frankfurt ausgestellt.<br />
Das Redaktionsteam der Ex-<strong>Zeitschrift</strong> wünscht Ihnen viel Spaß bei<br />
Ihrer Entdeckungstour auf der Messe!<br />
Ihre Redaktion
Die Autoren<br />
Seite<br />
04 Dr.-Ing. Thorsten Arnhold<br />
Bereichsleiter Produktmanagement<br />
und Marketing,<br />
R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Waldenburg<br />
37 Jos Abbing<br />
Product Manager Ex Solutions,<br />
Electromach BV, Hengelo/NL<br />
10 Philipp Baldermann<br />
Leitung Organisation und Kommunikation,<br />
Franz Schuck GmbH, Steinheim<br />
18 Dr.-Ing. Michael Beyer<br />
Leiter des PTB-Fachbereichs ›Zündquellensicherheit‹,<br />
PTB, Braunschweig<br />
18 Dr. Heino Bothe<br />
Leiter des PTB-Fachbereichs ›Grundlagen des<br />
Explosionsschutzes‹, PTB, Braunschweig<br />
34 Marcel Franowski<br />
Projektingenieur Anlagenbau, Andreas Junghans<br />
Anlagenbau und Edelstahlbearbeitung,<br />
Frankenberg<br />
26 Dr. Rainer Grätz<br />
Fachbereich 2.1 ›Gase, Gasanlagen‹,<br />
BAM Bundesanstalt für Materialforschung, Berlin<br />
56 Rudolf Hauke<br />
Laborleiter, DEKRA EXAM GmbH, Bochum<br />
und -prüfung, Berlin, Obmann AK 764.01.1<br />
und Sachverständiger BVS<br />
13 Dr.-Ing. Ulrich Johannsmeyer<br />
Leiter des Zertifizierungssektors<br />
Explosionsschutz, PTB, Braunschweig<br />
13 Dr.-Ing. Uwe Klausmeyer<br />
Leiter des PTB-Fachbereichs ›Zünddurchschlags-<br />
prozesse‹, PTB, Braunschweig<br />
23 Karl-Heinz Kolodziej<br />
Geschäftsführer, Blitzschutz Graff GmbH,<br />
Bergisch Gladbach<br />
42 Frank Merkel<br />
Leiter Technische Administration & Qualitäts-<br />
management und Produktleiter Ex-Produkte,<br />
Winkler GmbH, Heidelberg<br />
34 Wolfgang Moeller<br />
Sales Manager System Solution,<br />
R.STAHL Schaltgeräte GmbH, Waldenburg<br />
50 Prof. Dr. Cornelius Neumann,<br />
Karlsruher Institut für Technologie (KIT),<br />
Kollegiale Institutsleitung, Karlsruhe<br />
10 Tobias Popp<br />
Vertriebsspezialist für Systemlösungen,<br />
R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Waldenburg<br />
18 Dr. Thomas Schendler<br />
Leiter der BAM-Abteilung ›Chemische Sicherheit‹,<br />
Bundesanstalt für Materialforschung und-<br />
prüfung, Berlin<br />
26 Dr. Volkmar Schröder<br />
Leiter des Fachbereichs 2.1 ›Gase, Gasanlagen‹,<br />
BAM Bundesanstalt für Materialforschung, Berlin<br />
56 Stephan Schultz<br />
Produktmanager Automatisierungstechnik,<br />
Wireless und Trennstufen,<br />
R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Waldenburg<br />
§<br />
Inhalt<br />
Recht, Normen und Technik<br />
04 Ex-Nachrichten<br />
Informationen rund um den Explosionsschutz<br />
13 Anforderungen an Dienstleistungen<br />
im Explosionsschutz<br />
18 Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik<br />
und Explosionsschutz in PTB und BAM<br />
26 Geschichte und Gegenwart<br />
des Explosionsschutzes in der Bundesanstalt für<br />
Materialforschung- und prüfung<br />
50 Die Licht emittierende Diode<br />
– eine Erfolgsgeschichte<br />
> Anwendungsberichte<br />
10 Explosionsgeschützter Kugelhahn<br />
mit netzunabhängiger Antriebssteuerung für Ferngasleitungen<br />
23 Blitz- und Überspannungsschutz<br />
schafft Sicherheit<br />
34 Mobile Anlage<br />
zur organophilen Nanofiltration<br />
37 Containersysteme Ex p<br />
– optimierte Lösung für Öl- und Gasanlagen<br />
42 Flexible elektrische Heizungen<br />
für explosionsgefährdete Bereiche<br />
56 Funkanwendungen im Ex-Bereich<br />
Status quo und Neuigkeiten<br />
Produktvorstellungen<br />
i 63 Produkt-Neuheiten<br />
Nachgefragt<br />
? 61 Eine Frage bitte...<br />
Kunden fragen – wir antworten<br />
69 Druckschriften<br />
70 Ex-Seminarkalender <strong>2012</strong><br />
Termine, Themen und Veranstaltungsorte<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 3
Seite 4 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
§<br />
Ex-Nachrichten<br />
Informationen rund um den Explosionsschutz<br />
von Thorsten Arnhold (Redaktion)<br />
Recht, Normen und Technik<br />
IEC TC 31 Explosionsschutz elektrischer<br />
Betriebsmittel<br />
Die jährliche Sitzung des IEC TC 31 fand<br />
im Oktober 2011 in Melbourne statt. Wie üblich<br />
wurde dieses jährliche Treffen auch für<br />
die Zusammenkunft der folgenden Arbeitsgruppen<br />
genutzt:<br />
WG 31: Hybridgemische<br />
Die Gruppe beendete ihre Aktivitäten mit<br />
der Empfehlung an die Überarbeitungsteams<br />
der IEC-Richtlinien 60079, Teil 0 (Allgemeine<br />
Anforderungen), Teil 10 (Zoneneinteilung)<br />
und Teil 14 (Auswahl und Installation) ihre<br />
Anwendungsbereiche zu überarbeiten.<br />
WG 32: Kriech- und Luftstrecken<br />
Unter dem Sprecher, Herrn Coppler, wurde<br />
eine erste Grundlage für interne Diskussionen<br />
in der Arbeitsgruppe erstellt. Dieses<br />
Papier ist eng an die IEC-Grundnorm IEC<br />
60664 ›Isolationskoordination für elektrische<br />
Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen‹<br />
angelehnt.<br />
Ad hoc Arbeitsgruppe (AHG) 33:<br />
Sicherheitseinrichtungen<br />
Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es,<br />
die Europäische Norm EN 50495 in eine IEC-<br />
Norm zu transferieren. Der Sprecher ist Herr<br />
Hilgers aus Deutschland. Ein erster Bericht<br />
wurde erstellt.<br />
AHG 34: Sehr niedrige Temperaturen<br />
Eine IEC-Richtlinie hinsichtlich der korrekten<br />
Installation und Wartung und der<br />
speziellen Anforderungen für gewisse Explosionsschutzmethoden<br />
wurde entwickelt.<br />
Wie erwartet, richtete sich ein Großteil der<br />
Empfehlungen an funktionelle Aspekte.<br />
AHG 37: Elektrochemische Zellen und<br />
Batterien in Betriebsmitteln für explosionsfähige<br />
Atmosphären<br />
Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, Anforderungen<br />
zu entwickeln für primäre und<br />
sekundäre Zellen, die als Batterien zur Versorgung<br />
von Schaltkreisen mit elektrischem<br />
Strom verwendet werden.<br />
Dr. Johannsmeyer von der Physikalisch-<br />
Technischen Bundesanstalt (PTB) wurde als<br />
Sprecher vorgeschlagen. Ein Aufruf an internationale<br />
Experten wurde an die nationalen<br />
Komitees gesandt.<br />
Um die Häufigkeit der Herausgabe neuer<br />
Normen in einen vernünftigen Rahmen zu<br />
bringen, wurde entschieden, Eckdaten für<br />
jede Norm einzuführen, die den Zeitraum definiert,<br />
in welchem keine wesentliche neue<br />
Überarbeitungsaktivität erlaubt ist.<br />
Eine weitere hilfreiche Entscheidung<br />
wurde hinsichtlich der Bewertung der Bedeutung<br />
von Änderungen in neuen Normen<br />
getroffen. Dafür wurde in jeder neuen Norm<br />
ein spezieller Anhang eingeführt.<br />
IEC 60079-0: Allgemeine Anforderungen<br />
Die 6. Ausgabe der Grundnorm wurde<br />
2011 veröffentlicht. Die entscheidenden Änderungen<br />
in dieser Ausgabe sind:<br />
> Ergänzung von Grenzwerten für die<br />
Durchbruchspannung von nicht-<br />
metallischen Beschichtungen auf<br />
Metallgehäusen,<br />
> Erweiterung der Möglichkeiten zur Markierung<br />
mit dem Kennbuchstaben ›X‹ für<br />
solche nichtmetallische Gehäusematerialien,<br />
die die Grundvoraussetzungen hinsichtlich<br />
elektrostatischer Eigenschaften<br />
nicht erfüllen.
Klarstellung, dass die Anforderungen an<br />
nichtmetallische Gehäusewerkstoffe auch<br />
für lackierte oder beschichtete Metallgehäuse<br />
gelten,<br />
> Ergänzung von Grenzwerten für den Zirkonium-Anteil<br />
für Gehäuse der Gruppen III<br />
und II (nur Gb),<br />
> Einführung des Kennbuchstabens ›X‹ zur<br />
Markierung von Gehäusen der Gruppe III,<br />
die nicht mit den Grundanforderungen<br />
hinsichtlich des Materials übereinstimmen<br />
(analog zu Gruppe II),<br />
> Ergänzung der Anforderungen an Ventilatoren,<br />
> Änderung des Schlagtests zur Berücksichtigung<br />
von Prelleffekten des Schlagstücks,<br />
> Ergänzung von Anforderungen an<br />
Kabeleinführungssysteme.<br />
Das Eckdatum zur Überprüfung ist das<br />
Jahr 2015, was bedeutet, dass in diesem<br />
Jahr das Überarbeitungsteam entscheiden<br />
wird, ob ein Projekt zur Erstellung der 7.<br />
Auflage gestartet wird.<br />
Ein Harmonisierungsprozess zur Erstellung<br />
einer Europäischen Norm wird im Sommer<br />
<strong>2012</strong> gestartet.<br />
IEC 60079-1: Druckfeste Kapselung<br />
In der Sitzung der entsprechenden Überarbeitungsteams<br />
in Melbourne wurden die<br />
Kommentare zu den Normentwürfen der<br />
7. Ausgabe diskutiert. Es ist geplant, den<br />
Schlussentwurf (FDIS) bis Mitte <strong>2012</strong> zu<br />
veröffentlichen. Die hauptsächlichen Änderungen,<br />
verglichen mit der 5. Ausgabe sind<br />
folgende:<br />
> Einführung der Geräteschutzniveaus<br />
(EPL) ›da‹, ›db‹ und ›dc‹,<br />
> Neue Möglichkeiten für verklebte Spalte,<br />
> Um Missbrauch zu verhindern, dürfen U-<br />
Gehäuse künftig nur noch im Inneren des<br />
Gehäuses markiert sein,<br />
> Gehäuse, deren Spaltabmessungen von<br />
den Standardwerten abweichen, müssen<br />
gekennzeichnet sein,<br />
> Neuartige Mäanderspalte (multi step<br />
joints) sind jetzt zulässig. Dabei müssen<br />
mindestens zwei Umkehrungen der<br />
Spaltrichtung vorliegen,<br />
> Anstelle einer Stückprüfung ist auch eine<br />
Stichprobenprüfung der Druckfestigkeit<br />
möglich, wenn im Rahmen der Typprüfung<br />
ein Test mit dem dreifachen Referenzdruck<br />
bestanden wurde.<br />
Der Ursprung des neuen Schutzniveaus<br />
›da‹ ist eine australische Norm, die in den<br />
Entwurf von IEC 60079-33 übernommen wurde<br />
und die sehr kleine druckfeste Kapselungen<br />
definiert, die für Anwendungen in Zone<br />
0 geeignet sind. Für das Schutzniveau<br />
›dc‹ wurden die Anforderungen an die Zündschutzart<br />
›umschlossene Schalteinrichtung‹<br />
aus der IEC 60079-15 übernommen.<br />
Es wurde festgestellt, dass die neue Prüfung<br />
der Druckfestigkeit, die im Hauptteil der<br />
Norm beschrieben wurde, im Anhang D für<br />
leere Gehäuse vergessen wurde. Gemäß<br />
dem Sprecher des Überarbeitungsteams UL<br />
(USA), Paul Kelly, kann dies aufgrund des<br />
Status innerhalb des Überarbeitungszyklus<br />
nicht im Text korrigiert werden, aber es ist<br />
klar, dass diese Feststellung auch für leere<br />
Gehäuse gilt.<br />
IEC 60079-2: Überdruckkapselung<br />
Im November 2011 wurde der Entwurf der<br />
6. Ausgabe der Norm IEC 60079-2 veröffentlicht.<br />
Wesentliche Neuerungen, verglichen<br />
mit der 5. Ausgabe der Norm, sind:<br />
> Aufnahme der Anforderungen an Staubexplosionsschutzanwendungen,<br />
> Neue Definitionen für px, py, pz,<br />
> Zusätzliche Anforderungen an Batterien,<br />
> Zusätzliche Anforderungen an überdruckgekapselte<br />
Systeme,<br />
> Überarbeitete Prüfanforderungen an ausfallsichere<br />
Containments,<br />
> Überarbeitete Prüfanforderungen zur Begrenzung<br />
des Innendrucks durch das Gehäuse,<br />
> Zusätzliche zweite Quelle zur Schutzgaszuführung.<br />
Es wird damit gerechnet, dass einige Länder<br />
diesen Entwurf aufgrund der schwachen<br />
Anforderungen hinsichtlich Festigkeit und<br />
Stabilität der Gehäuse in Artikel 5.1 ablehnen.<br />
Ein weiterer Streitpunkt sind die Batterien<br />
innerhalb der Kapselung. In früheren<br />
Normen gab es keine Einschränkungen für<br />
Batterien. Im momentanen Entwurf wurde<br />
die Tatsache, dass beim Laden brennbare<br />
Gase, wie Wasserstoff, entstehen können, in<br />
Betracht gezogen und daher wurden ähnliche<br />
Anforderungen wie an die druckfeste<br />
Kapselung hinzugefügt. Dies könnte eine<br />
große Anzahl von üblichen Anwendungen in<br />
der Zündschutzart Ex p künftig einschränken.<br />
Die Norm 60079-13 ›Geräteschutz durch<br />
überdruckgekapselte Räume‹ wurde im Oktober<br />
2010 erstmals veröffentlicht. Nun wurde<br />
das Eckdatum zur Überprüfung der ersten<br />
Ausgabe für 2014 festgesetzt.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 5
Ex-Nachrichten<br />
IEC 60079-5:<br />
Geräteschutz durch Sandkapselung<br />
Die Kommentare der nationalen Komitees<br />
zum ersten Arbeitspapier (DC = Draft for<br />
comments) der 4. Ausgabe wurden während<br />
der Zusammenkunft des Überarbeitungsteams<br />
2011 in Melbourne diskutiert. Eine<br />
Veröffentlichung des Entwurfs bis Frühjahr<br />
<strong>2012</strong> ist geplant. In dieser Norm wird zum ersten<br />
Mal die Bewertung der Änderungen in<br />
einem speziellen Anhang dokumentiert.<br />
IEC 60079-6:<br />
Geräteschutz durch Ölkapselung<br />
Der Entwurf der 4. Ausgabe wurde 2011<br />
veröffentlicht. Darin wurden die Geräteschutzniveaus<br />
ob und oc zum ersten Mal<br />
eingeführt. Die maximale Spannung für ob<br />
beträgt 11 kV, für oc sind es 15 kV. Es gibt einen<br />
neuen Paragraphen über Kurzschlusskontakte.<br />
IEC 60079-7: Erhöhte Sicherheit:<br />
Der Entwurf der 5. Ausgabe wurde im Dezember<br />
2011 veröffentlicht. Es gab 182 Kommentare<br />
zu diesem Entwurf, was das bemerkenswerte<br />
öffentliche Interesse und die<br />
Tatsache verdeutlicht, dass diese wichtige<br />
Norm nicht sehr lange Bestand hatte. Die<br />
hauptsächlichen Änderungen, verglichen<br />
mit der 4. Ausgabe, sind folgende:<br />
> Einführung der Schutzniveaus eb und ec,<br />
> sofern möglich, werden die Anforderungen<br />
der Richtlinie IEC 60079-15 für nA unter<br />
dem Schutzniveau ec in diese Norm<br />
übernommen (einige Anforderungen, wie<br />
z.B. die Vergusstechnik, konnten nicht in<br />
die Erhöhte Sicherheit übernommen werden<br />
und müssen in Teil 15 bleiben),<br />
> Neue Anforderungen an den Umrichterbetrieb<br />
wurden an das entsprechende<br />
Schutzniveau angepasst,<br />
Seite 6 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
> Spezifikation, dass U-Gehäuse nur noch<br />
innen gekennzeichnet werden dürfen.<br />
Hinsichtlich der Geräteschutzniveaus gibt es<br />
eine ausgeklügeltere Klassifizierung, die auf<br />
dem Verschmutzungsgrad basiert:<br />
> eb Standard,<br />
> eb Spezial,<br />
> ec Standard,<br />
> ec Spezial,<br />
> ec extra.<br />
Viele Experten denken jedoch, dass dies bedeutungslos<br />
ist und es die Anwendung nur<br />
verkompliziert. Die Anwendung von LEDs<br />
wird mit dem Geräteschutzniveau ec möglich.<br />
IEC SC 31 G Eigensicherheit<br />
Die Sitzung des Unterkomitees SC31 J Eigensicherheit<br />
vereinte 25 Delegierte aus 12<br />
Ländern.<br />
IEC 60079-11: Eigensicherheit<br />
Aufgrund der Tatsache, dass die 6. Ausgabe<br />
dieser IEC-Richtlinie 2011 veröffentlicht<br />
wurde, gab es in diesem Überarbeitungsteam<br />
nur geringe Aktivitäten. Die<br />
Veröffentlichung der entsprechenden europäischen<br />
Norm ist für Anfang des Jahres<br />
<strong>2012</strong> geplant. Der Anhang ZY wurde fertiggestellt,<br />
und es gibt keinen Eintrag in Spalte<br />
3 ›Signifikante technische Änderungen‹. Der<br />
Start der 7. Ausgabe ist für die Zusammenkunft<br />
in Oslo im Herbst <strong>2012</strong> geplant.<br />
IEC 60079-25: Eigensichere Systeme<br />
Die Arbeit an der 3. Ausgabe der IEC-<br />
Richtlinie wurde in Melbourne begonnen.<br />
Maßgebliche neue Punkte in der Ausgabe<br />
werden sein:<br />
> die Betrachtung von sehr niedrigen Temperaturen,<br />
> die Anwendung in einer Hybridgas-<br />
Staubatmosphäre,<br />
> und die Verwendung einer neuen Funkenprüfeinrichung<br />
(siehe unten).<br />
Die AHG 3 des Unterkomitees SC31G, die die<br />
Änderungen der Funkenprüfgeräte behandelt,<br />
setzte ihre Arbeit fort. Der Sprecher<br />
dieser Gruppe ist Herr Gabriel (Deutschland).<br />
Bis jetzt gab es nur kleine Erfolge bei<br />
der Ersetzung der Kadmiumscheibe, und es<br />
gibt eine Empfehlung der Gruppe, die herkömmliche<br />
Testeinrichtung so selten wie<br />
möglich einzusetzen. Die PTB startete ein<br />
gemeinsames Forschungsprojekt mit Australian<br />
Coal, um alternative Testmethoden zu<br />
entwickeln. Zudem wurde der Vorschlag gemacht,<br />
einen weiteren Arbeitspunkt aufzunehmen,<br />
der die neue ›Power I‹ -Technologie<br />
abdeckt. Daraufhin nahm das neue<br />
Projektteam 60079-39 die Arbeit am Entwurf<br />
der ersten Ausgabe im September 2011 unter<br />
seinem Sprecher Dr. Gerlach (Deutschland)<br />
auf.<br />
IEC 60079-15 Betriebsmittel für die Zone 2:<br />
Die 4. Ausgabe der Norm wurde veröffentlicht.<br />
Das Überprüfungsdatum wurde auf<br />
2014 festgelegt.<br />
IEC 60079-18: Schutz durch Gehäuse<br />
Die Arbeit an der 4. Ausgabe der IEC-<br />
Richtlinie wurde in Melbourne begonnen.<br />
Ein CD wird voraussichtlich Anfang <strong>2012</strong><br />
veröffentlicht werden.
Die Anmerkungen der nationalen Komitees<br />
werden in der nächsten Sitzung des<br />
Überarbeitungsteams im April <strong>2012</strong> in Northbrook<br />
(USA) diskutiert werden. Die maßgeblichen<br />
Änderungen in der neuen Ausgabe<br />
sind:<br />
> Schutzeinrichtungen werden nur noch<br />
die maximalen Oberflächentemperaturen<br />
sicherstellen müssen,<br />
> Lagertemperaturen für thermische Beständigkeitstests<br />
sind besser definiert<br />
und vereinfacht,<br />
> Der Drucktest, um Lufteinschlüsse im<br />
Formteil zu erkennen, wird in Frage gestellt<br />
und soll später diskutiert werden.<br />
Das Überprüfungsdatum für die 3. Ausgabe<br />
ist das Jahr 2013.<br />
IEC 60079-26: Betriebsmittel mit dem Geräteschutzniveau<br />
(EPL) Ga<br />
Der Entwurf (CD) der 3. Ausgabe wurde<br />
Ende 2011 veröffentlicht. In der nächsten<br />
Sitzung des Überarbeitungsteams wird der<br />
Entwurf zur ersten Abstimmung (CDV) zur<br />
Verteilung an die nationalen Komitees vorbereitet.<br />
Das Überprüfungsdatum ist das<br />
Jahr 2014.<br />
IEC 60079-31: Schutz durch Gehäuse<br />
Der IEC-Richtlinienentwurf der zweiten<br />
Ausgabe wird voraussichtlich im Oktober<br />
<strong>2012</strong> veröffentlicht.<br />
Die hauptsächlichen Änderungen, verglichen<br />
mit der ersten Ausgabe, sind:<br />
> Verringerte Anforderungen an die IP<br />
Schutzart für ›ta‹ mit zusätzlichen Anforderungen<br />
an funkende Teile und heiße<br />
Oberflächen. In diesem Fall ist ein zusätzliches<br />
Gehäuse erforderlich.<br />
Bei nicht-funkenden Betriebsmitteln mit<br />
dem Schutzniveau ›ta‹, definiert die innere<br />
Temperatur und die maximale Oberflächentemperatur<br />
des Produkts, das für eine<br />
bestimmte Staubart freigegeben ist.<br />
Für ›ta‹ ist der Drucktest vorgeschrieben,<br />
für ›tb‹ und ›tc‹ ist er nur vorgeschrieben,<br />
wenn die Dichtungen nicht am Gehäuse<br />
befestigt sind,<br />
> Verringerung der Staubschichtdicke<br />
beim Temperaturtest für ›ta‹,<br />
> Zusätzliche Bauformen der Gewindeeinführungen,<br />
> Wegfall der Einschränkungen des prospektiven<br />
Kurzschlusswertes für ›ta‹.<br />
IEC 60079-33: Sonderzündschutzart ›s‹<br />
Es kamen nur wenige Kommentare zum<br />
Entwurf der ersten Veröffentlichung der-<br />
Norm (CDV), der im April 2011 verteilt wurde,<br />
zurück. Der Schlussentwurf FDIS wird voraussichtlich<br />
Anfang <strong>2012</strong> veröffentlicht<br />
werden, und es wird erwartet, dass die<br />
Norm bis Ende <strong>2012</strong> verabschiedet wird.<br />
Der Zweck und das Ziel der Norm sind je-<br />
doch nach wie vor umstritten, da damit keine<br />
Anforderungen an die Bauform festgelegt<br />
werden. In allen anderen Produktnormen<br />
der IEC-Normenreihe 60079 werden solche<br />
Bauformänderungen spezifiziert. Das Konzept<br />
eines unabhängigen Gutachters, der<br />
die Einhaltung der Normanforderung subjektiv<br />
bewertet, deckt sich nicht mit der ATEX-<br />
Richtlinie, so dass eine Übernahme in eine<br />
EN-Norm nur schwer möglich sein wird.<br />
Zwischenzeitlich wurde der Explosionsschutz<br />
mechanischer Betriebsmittel aus<br />
dem Anwendungsbereich gestrichen und<br />
seine Aufnahme in die Norm wurde bis zur<br />
zweiten Auflage verschoben.<br />
TC31 SC31 J Einteilung und Installation<br />
IEC 60079-10-1: Einteilung der Bereiche –<br />
Gasexplosionsgefährdete Bereiche<br />
Die Tendenz zur Quantifizierung der Zoneneinteilung<br />
setzt sich fort. Es gibt jetzt sogar<br />
starke Bestrebungen, die Zoneneinteilung<br />
durch Anwendung mathematischer<br />
Gleichungssysteme vorzunehmen. Andererseits<br />
ist die deutsche Delegation mit der<br />
Übernahme der seit vielen Jahren bewährten<br />
und praxisnahen Beispielsammlung der BG<br />
Chemie gescheitert. Die Fachleute, die in<br />
diesem Bereich arbeiten, müssen dieser<br />
erzwungenen ›Verwissenschaftlichung‹<br />
eines sehr sicherheitssensiblen Themas<br />
skeptisch gegenüberstehen. Um zuverlässige<br />
und tragfähige Schlussfolgerungen zu<br />
erreichen, müssen zahlreiche Bedingungen<br />
für die Berechnung berücksichtigt werden,<br />
und diese Bedingungen können in der Regel<br />
nicht exakt ermittelt werden. In der Sitzung<br />
der Normenorganisation CENELEC TC im<br />
November 2011 in Mailand wurde die Gründung<br />
einer AHWG beschlossen, mit dem<br />
Ziel, einen Vorschlag hinsichtlich alternativer<br />
Methoden zur Zoneneinteilung vorzubereiten,<br />
der auf praktischer Erfahrung beruht.<br />
Dies ist seit Jahrzehnten eine bewährte<br />
Vorgehensweise; sie sollte daher nicht<br />
durch rein theoretische Methoden ersetzt<br />
werden.<br />
IEC 60079-14: Projektierung, Auswahl und<br />
Errichtung elektrischer Anlagen<br />
Der erste Entwurf (CD) der 5. Auflage der<br />
Norm wurde 2011 an die nationalen Komi<br />
tees verteilt. Die Anmerkungen werden in<br />
der nächsten Sitzung des Überarbeitungsteams<br />
im Februar <strong>2012</strong> in Singapur diskutiert<br />
werden. Erstmalig werden die Anforderungen<br />
an die Qualifikation und die Kompetenz<br />
der Mitarbeiter, die mit Installationsar-<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 7
Ex-Nachrichten<br />
beiten in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
betraut sind, im Anhang beschrieben.<br />
Außerdem werden die folgenden Zusätze<br />
und Änderungen eingeführt:<br />
> Übernahme der Anforderungen an Anlagen<br />
in staubexplosionsgefährdeten Bereichen<br />
aus IEC 61241-14,<br />
> Festlegung der Spannungstoleranzen für<br />
Geräte auf +/- 10%,<br />
> Festlegung der Mindestanforderungen an<br />
Betriebsanleitungen (Anmerkung des<br />
Verfassers: Dieses Thema sollte eher in<br />
die Produktnorm IEC 60079-0 aufgenommen<br />
werden),<br />
> Stärkere Beachtung von Anlagen in extremen<br />
Umgebungsbedingungen,<br />
> Festlegung von Temperaturklassen für<br />
den Einsatz von unzertifizierten passiven<br />
RFID-Tags: hier wurde T6 für Temperaturen<br />
bis 40 °C und T5 für Temperaturen<br />
bis 60 °C festgelegt.<br />
In der neuen Ausgabe definieren eine Reihe<br />
von Anhängen die speziellen Anforderungen<br />
an<br />
> Gaserkennungssysteme,<br />
> Hybride Gemische,<br />
> Methoden zur Vermeidung des Gaseintritts<br />
über die Kabel in die Gehäuse ›d‹<br />
und ›nr‹.<br />
Das Überprüfungsdatum der Norm wurde<br />
für das Jahr 2013 festgelegt.<br />
Seite 8 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
SC 31 M<br />
IEC 60079-20-1: Stoffliche Eigenschaften zur<br />
Klassifizierung von Gasen und Dämpfen –<br />
Prüfmethoden und Daten<br />
Die Norm, die erstmals im Jahr 2011 publiziert<br />
wurde, soll im Jahr 2014 überprüft<br />
werden.<br />
IEC 60079-20-2: Untersuchungsverfahren –<br />
Verfahren zur Bestimmung der Mindestzündtemperatur<br />
von Staub<br />
Das Überprüfungsteam gibt unter der<br />
Führung des neuen Sprechers D. Enkele<br />
(USA) einen ersten Entwurf zur Veröffentlichung<br />
(CD) heraus.<br />
Beide Normen werden nun in SC 31 M<br />
überprüft.<br />
Es gibt einige Tendenzen zur Verkürzung<br />
der Überprüfungsintervalle der Normen in<br />
SC 31 M auf 2 Jahre. Dies wird nicht von allen<br />
nationalen Komitees begrüßt, da es nicht<br />
als eine Vorgehensweise angesehen wird,<br />
die die Sicherheit des Betriebsmittels steigert.<br />
CENELEC TC31<br />
Sitzung in Mailand, November 2011<br />
Ein hauptsächliches Thema dieser Sitzung<br />
war die Gültigkeit von Zertifikaten nach<br />
der Veröffentlichung von neuen Normenausgaben.<br />
Die Grundlage für die richtige<br />
Methode, die auf die Betriebsmittel und die<br />
entsprechenden Zertifikate angewendet<br />
werden kann, sollte sich nach der Klassifizierung<br />
in Anhang ZY richten, die ein wesentlicher<br />
Bestandteil der Arbeit der Überarbeitungsteams<br />
ist. Es wird dazu tendiert,<br />
dass ein neues Zertifikat nur dann nötig ist,<br />
wenn die Normänderung als signifikant<br />
klassifiziert wird (Spalte 3 von Anhang ZY).<br />
Um zu vermeiden, dass immer mehr Zertifikate<br />
aktualisiert werden müssen, sollten die<br />
Hersteller bei der Normenfestlegung in den<br />
Teams eine aktive Rolle übernehmen. Nur<br />
dadurch können die Hersteller verhindern,<br />
dass Normenänderungen unnötigerweise<br />
als signifikant eingestuft werden.
IECEx-System<br />
Die Sitzung des Management Committees<br />
(MC) von der Gruppe der Prüfstellen IECEx-<br />
Tag und verschiedener Arbeitsgruppen fand<br />
Anfang September 2011 in Split, (Kroatien)<br />
statt. Insgesamt nahmen 110 Delegierte aus<br />
30 Ländern teil. Aus der Vielzahl von Diskussionspunkten<br />
und Beschlüssen, sollten folgende<br />
besonders erwähnt werden:<br />
> Die IECEx-Verantwortlichen Kerry Mc-<br />
Manama (Vorsitzender), Chris Agius (Geschäftsführer)<br />
und Heinz Berger (Finanzleiter)<br />
wurden vom Management<br />
Committee des IECEx erneut benannt,<br />
> Dr. Alexander Zalogin wurde zum neuen<br />
stellvertretenden Vorsitzenden ernannt,<br />
> Der Vorsitzende gab in der Sitzung bekannt,<br />
dass die zweite Amtszeit von Liu<br />
Weijun als stellvertretender Vorsitzender<br />
des IEC-Ex-Systems Ende des Jahres endet<br />
und dankte ihm für die großartige Unterstützung<br />
und die geleisteten<br />
Dienste für das IECEx-System,<br />
> Ein neues Komitee mit dem Namen ›Certificate<br />
of Personnel Competence Certification<br />
Committee‹ (ExPCC) wurde von<br />
den Mitgliedern des IECEx-Systems gegründet.<br />
Abkürzungen<br />
EPL Equipment protection level<br />
Geräteschutzniveau<br />
DC Document for Comments<br />
Umfrage zum Beginn eines Neuentwurfes<br />
CD Committee Draft<br />
1. Stufe: Veröffentlichung eines<br />
Normen entwurfes<br />
CDV Committee Draft for Voting<br />
2. Stufe: Erste Abstimmung über den<br />
Normen entwurf<br />
FDIS Final Draft International Standard<br />
3. Stufe: Schlussabstimmung über den<br />
Normen entwurf<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 9
Seite 10 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
mit netzunabhängiger Antriebssteuerung für Ferngasleitungen<br />
von Philipp Baldermann und Tobias Popp<br />
>> Anwendungsberichte<br />
Explosionsgeschützter<br />
Kugelhahn<br />
Bild 1: Der Schuck Antrieb für Kugelhähne an der Asia Gas Pipeline inkl. Steuerung und allen Anbauten<br />
Die Schuck Group wurde 1972 von Franz Schuck gegründet und fertigt<br />
und vertreibt Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen,<br />
wie Armaturen, Antriebe, Hauseinführungen, Isolierstücke und Formstücke.<br />
Mit 5 internationalen Niederlassungen, einem Vertriebsnetz in<br />
über 50 Ländern und 40 Jahre Erfahrung hat sich die Schuck Group als<br />
internationaler Spezialist für die sichere Verbindung von Rohrleitungen<br />
und die Steuerung von Armaturen einen festen Platz erarbeitet. Namhafte<br />
und auch für unsere Regionen wichtige Projekte, wie z.B. die<br />
North Stream Pipeline rund um den russischen Energiegiganten Gazprom,<br />
oder international bedeutende Projekte, sowie die East West<br />
Pipeline in Indien, sind mit Schuck Armaturen und Steuerungen ausgestattet.<br />
Der wachsende und innovative Unternehmensbereich Schuck<br />
Antriebe spielt dabei eine immer wichtiger werdende Rolle. Komplexe,<br />
wartungsfreundliche und ausfallsichere Steuerungen bilden dabei das<br />
Gehirn des Gesamtproduktes. Ohne sie sind die Armaturen-Kolosse<br />
aus bis zu 30 Tonnen Stahl und für Leitungen mit bis zu 60 Zoll Innendurchmesser<br />
über tausende von Kilometern nicht zu steuern.
Aufgabenstellung<br />
Die in der internationalen Ausschreibung geforderten Antriebe<br />
und Steuerungen für die Asia Gas Pipeline von Usbekistan nach China<br />
sollten vor allem einen Zweck erfüllen: Im Ernstfall die rund 1.818 km<br />
lange Gas-Fernleitung mit insgesamt 130 Kugelhähnen sicher und<br />
schnell absperren. Dies geschieht über Schaltungsabschnitte, die im<br />
Schadensfall durch zwei Absperrarmaturen abgeschottet werden<br />
können.<br />
Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt war, die sichere<br />
Betätigung der Armaturen über die großen Entfernungen und das zum<br />
Teil schwer zugängliche Gelände zu garantieren. Im Bedarfsfall ist eine<br />
manuelle Steuerung vor Ort nur schwer realisierbar, da es selbst<br />
mit dem Hubschrauber mehrere Stunden dauern würde bis die Einsatzstelle<br />
erreicht ist.<br />
Durch den Betrieb der Steuerung in dem explosionsgefährdeten<br />
Bereich der Gasarmatur ist eine explosionsgeschützte Ausführung<br />
selbstverständlich Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb.<br />
Realisierung<br />
Die Schuck Group bekam sowohl für die benötigten 130 Absperrarmaturen<br />
als auch für die dazugehörigen Antriebe und Steuerungen<br />
den Zuschlag. Dadurch war von Anfang an eine perfekte Abstimmung<br />
der beiden Baugruppen möglich.<br />
Kern der Antriebseinheit bildet die elektronische Steuerung.<br />
Diese wurde durch die Firma R. STAHL mittels druckfester Kapselung<br />
explosionsgeschützt ausgeführt (Bild 5). Das Grundprinzip der damit<br />
gesteuerten mechanischen Antriebselemente ist so einfach wie genial:<br />
Der Leitungsdruck aus der Gas-Pipeline wird über eine Verrohrung<br />
abgenommen und als Antriebsenergie zur Betätigung der Armatur genutzt.<br />
Hierzu wird aus Sicherheitsgründen zunächst in einem Gasüber-Ölbehälter<br />
der Gasdruck in einen Öldruck transferiert. Dieser<br />
betätigt schließlich nach dem bewährten Scotch-Yoke-Prinzip den<br />
Grundantrieb und darüber die Armatur. Für den Fall eines totalen<br />
Druckverlusts in der Pipeline wurde das System mit einem Energiespeicher<br />
ausgestattet, welcher den höchsten zuletzt erreichten Pipelinedruck<br />
speichert. Damit sind dann noch bis zu drei Speicherfahrten<br />
möglich.<br />
Drehmoment<br />
zu<br />
Eingang<br />
Antrieb<br />
Kugelhahn<br />
Kugelhahnstellung<br />
Druck = konstant<br />
Drehmoment = konstant<br />
Bild 2: Das Scotch-Yoke-Prinzip<br />
auf<br />
Typ Drehmoment<br />
VG 2.000 Nm<br />
WG 4.000 Nm<br />
AG 8.000 Nm<br />
BG 20.000 Nm<br />
CG 40.000 Nm<br />
DG 85.000 Nm<br />
EG 150.000 Nm<br />
FG 350.000 Nm<br />
GG 600.000 Nm<br />
Bild 3: Verfügbare Grundantriebe<br />
mit bis zu 600.000Nm<br />
Bild 4: Ein vollverschweißter 56 Zoll Schuck<br />
Kugelhahn inkl. Gas-über-Öl Antrieb<br />
Um im Fall einer Leckage schnell reagieren zu können, wurden<br />
zwei Sicherheitskonzepte geplant und realisiert: Zum einen wurde in<br />
der Steuerung eine ›Line-Guard Komponente‹ mit integriert. Diese hat<br />
die Aufgabe, den Leitungsdruck zu überwachen und im Fall eines definierten<br />
Abfalles den Kugelhahn selbstständig zu schließen. Dadurch<br />
wird schnellstmöglich auf relevante Schwankungen reagiert. Zum anderen<br />
musste das Risiko eines Stromausfalles ausgeschlossen werden.<br />
Da die verwendete elektronische Steuereinheit SEC-200 eine<br />
Stromversorgung benötigt, hängt die Ausfallsicherheit des Systems<br />
maßgeblich von der elektrischen Versorgung der 130 Antriebe ab. Zu<br />
diesem Zweck wurde ein Solarpanel auf dem Antrieb installiert, das<br />
die im exgeschützten Batterieschrank befindlichen Akkus auflädt. Dieses<br />
System zur Notstromversorgung garantiert selbst bei völliger Dunkelheit<br />
und unter Verlust der Hauptstromversorgung eine mehrfache<br />
und sichere Betätigung der Armatur. Hier kam das für Zone 2 zugelassene,<br />
gemeinsam mit der R. STAHL entwickelte Batteriepaket mit Solarstromversorgung<br />
zum Einsatz. Um dies nun auch über große Entfernungen<br />
zu ermöglichen, bildet das integrierte GSM-Modul die<br />
Schnittstelle zur Fernbedienung aus der Schaltzentrale oder direkt<br />
über ein Smart-Phone bzw. einen Laptop.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 11
Explosionsgeschützter Kugelhahn<br />
Die elektronische Steuerung SEC-200 in explosionsgeschützter Ausführung<br />
Das Gehirn dieses Gesamtkonzeptes bildet die elektronische<br />
Steuerung Line Guard SEC-200 in druckfest gekapselter Ausführung<br />
nach EN 60079 ff. Die SEC ist eine Entwicklung des Unternehmensbereiches<br />
Schuck Antriebe und besticht durch umfangreiche projektspezifische<br />
Anpassungsmöglichkeiten und zahlreiche nützliche Produkteigenschaften.<br />
Besonders zu erwähnen sind die hohen<br />
Sicherheitsattribute, wie die Rohrleitungsdrucküberwachung, die<br />
Überwachung des Batteriesystems, die Kurzschluss- und Kabelbruchüberwachung<br />
der Druckmesskreise, sowie die Laufzeitüberwachung.<br />
Zur Umsetzung des Explosionsschutzkonzeptes durch R. STAHL<br />
wurden neben den Zündschutzarten ›e‹ (erhöhte Sicherheit) und ›i‹ (Eigensicherheit)<br />
im Wesentlichen Ex d Gehäuse (druckfeste Kapselung)<br />
angewendet. Aufgrund des begrenzten Einbauraumes wurde der Anschluss<br />
mittels Direkteinführung durch spezielle Ex-Kabelverschraubungen<br />
in druckfester Kapselung ›d‹ realisiert.<br />
Bild 5: Elektronische Steuerung SEC-200 mit ›Gas-über-Öl Steuerung-Prinzip‹ in<br />
einem Gehäuse von R. STAHL<br />
Seite 12 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Im Bereich der Benutzerinteraktion punktet die SEC-200 vor<br />
allem durch das einfache und klare Bedienkonzept, die funktionalen<br />
Bus- und Bluetooth-Schnittstellen für den einfachen Datenaustausch<br />
und für Systemupdates, sowie die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten<br />
auf individuelle Kundenwünsche. Das integrierte EPROM<br />
speichert alle benutzerspezifischen Einstellungen auch im Falle eines<br />
kurzfristigen Spannungsausfalles ab, bis die Notstromversorgung eingreifen<br />
kann. Diese wurde von R. STAHL mittels eines in Ex e ausgeführten<br />
Batteriekastens hergestellt (Bild 6). Die Batterien werden<br />
durch ein auf dem Skid montierten Fotovoltaikmodul geladen. Der Controller<br />
ist dabei mit in der druckfesten Steuerung eingebaut.<br />
Fazit<br />
Durch die Zusammenarbeit der Schuck- und der Explosionsschutzexperten<br />
von R. STAHL konnte die anspruchsvolle Aufgabenstellung<br />
ganzheitlich angepackt und zur vollen Zufriedenheit des Betreibers<br />
in eine sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung<br />
umgesetzt werden.<br />
Bild 6: Ex e Batteriekasten von R. STAHL
§<br />
Anforderungen<br />
an Dienstleistungen im Explosionsschutz<br />
von Ulrich Johannsmeyer und Uwe Klausmeyer<br />
Einleitung<br />
Recht, Normen und Technik<br />
In vielen industriellen und gewerblichen<br />
Anlagen, in denen mit brennbaren Stoffen<br />
gearbeitet wird, treten explosionsgefährdete<br />
Bereiche auf. In diesen Bereichen treiben<br />
Elektromotoren Pumpen, Ventilatoren und<br />
Förderanlagen an, Thermostate und Druckwächter<br />
regeln Prozesse, elektrische Heizungen<br />
erwärmen Produkte. Da nichtexplosionsgeschützte<br />
Geräte (elektrische als auch<br />
nichtelektrische) zu einer Zündquelle werden<br />
können, würde ihr Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen zu einer erheblichen<br />
Gefahr für die Beschäftigen, die Produktionsanlagen<br />
und die Umwelt werden. Über die<br />
Europäischen Richtlinien 94/9/EG und<br />
1999/92/ EG wird der Explosionsschutz europaweit<br />
seit geraumer Zeit auf eine einheitliche<br />
Grundlage gestellt. Zusätzlich wurden<br />
und werden mandatierte Europäische Normen<br />
geschaffen, um die ›grundlegenden Sicherheits-<br />
und Gesundheitsanforderungen‹<br />
der ATEX-Richtlinie 94/9/EG erfüllen zu können<br />
und mit diesen harmonisierten Normen<br />
die so genannte Vermutungswirkung auf Erfüllung<br />
der Anforderungen in Anspruch zu<br />
nehmen.<br />
Die Einteilung der explosionsgefährdeten<br />
Bereiche in Zonen ist für Gase/Dämpfe und<br />
auch für Stäube Teil der Anforderungen zum<br />
betrieblichen Explosionsschutz für den Arbeitsplatz<br />
nach Richtlinie 1999/92/EG. Auf der<br />
Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung hat<br />
der Arbeitgeber Maßnahmen zu ergreifen,<br />
die die Sicherheit der Beschäftigten und der<br />
Umwelt gewährleisten. Die Gefährdungsbeurteilung<br />
sowie die daraus abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen<br />
sind in einem Explosionsschutzdokument<br />
festzuhalten. Mit den<br />
getroffenen Maßnahmen (technisch, personell,<br />
organisatorisch) wird sichergestellt,<br />
dass die minimalen Sicherheitsanforde-<br />
rungen an den Arbeitsplatz bezüglich Ausrüstung<br />
und Installation sowie personell und<br />
organisatorisch nach den Vorgaben der<br />
Richtlinie 1999/92/EG erfüllt sind.<br />
Richtlinie 94/9/EG (ATEX-Richtlinie)<br />
Für das in Verkehr bringen von Geräten<br />
und Schutzsystemen gilt die Richtlinie 94/9/<br />
EG; sie wurde in Deutschland umgesetzt<br />
durch das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
(GPSG). Seit dem 1. Juli 2003 können relevante<br />
Produkte nur dann entwurfs- und bestimmungsgemäß<br />
innerhalb der EU in Verkehr<br />
gebracht, unbehindert gehandelt und<br />
betrieben werden, wenn sie der Richtlinie<br />
94/9/EG (und anderen relevanten Rechtsvorschriften)<br />
entsprechen. In der Richtlinie wird<br />
darauf hingewiesen, dass zur Beseitigung<br />
von Handelshemmnissen durch den ›neuen<br />
Ansatz‹, den der Rat in seiner Entschließung<br />
vom 7. Mai 1985 beschlossen hat, grundlegende<br />
Anforderungen an die Sicherheit und<br />
andere relevante Attribute festgelegt werden<br />
müssen, durch die ein hoher Schutzgrad sichergestellt<br />
wird. Diese ›Grundlegenden Sicherheits-<br />
und Gesundheitsanforderungen‹<br />
sind in Anhang II der Richtlinie 94/9/EG aufgeführt.<br />
Sie nehmen Bezug auf:<br />
> potentielle Zündquellen von Geräten zur<br />
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen,<br />
> autonome Schutzsysteme, deren wesentliche<br />
Aufgabe darin besteht, nach dem<br />
Beginn einer Explosion diese umgehend<br />
zu stoppen und/oder die Auswirkungen<br />
der Explosionsflammen und -drücke zu<br />
begrenzen,<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 13
Herausforderungen an Dienstleistungen im Explosionsschutz<br />
> Sicherheitsvorrichtungen, die dafür vorgesehen<br />
sind, zum sicheren Betrieb der<br />
genannten Geräte im Hinblick auf deren<br />
Zündquellen und zum sicheren Betrieb<br />
autonomer Schutzsysteme beizutragen,<br />
> Komponenten ohne autonome Funkti-<br />
on, die für den sicheren Betrieb der ge-<br />
nannten Geräte oder autonomen<br />
Schutzsysteme von grundlegender Be-<br />
deutung sind.<br />
Die Richtlinie 94/9/EG enthält erstmals harmonisierte<br />
Anforderungen auch an nichtelektrische<br />
Geräte, die für den Einsatz in Bereichen<br />
bestimmt sind, in denen auf Grund<br />
von Staubbildung Explosionsgefahr besteht,<br />
sowie für Schutzsysteme. Sicherheitsvorrichtungen,<br />
die für den Einsatz außerhalb von explosionsfähigen<br />
Atmosphären bestimmt sind,<br />
aber in Bezug auf Explosionsrisiken zum sicheren<br />
Betrieb von Geräten oder Schutzsystemen<br />
erforderlich sind, beziehungsweise<br />
dazu beitragen. Dies ist im Vergleich zu früheren<br />
nationalen Vorschriften zu Geräten und<br />
Systemen für die bestimmungsgemäße Verwendung<br />
in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
eine deutliche Ausweitung des Anwendungsbereichs.<br />
Ausstellung von EG Konformitätserklärungen<br />
nach EU-Richtlinie 94/9/EG nach dem Erscheinen<br />
neuer Normenausgaben<br />
Der Gesetzgeber verlangt durch die Elfte<br />
Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
(Explosionsschutzverordnung)<br />
auf der Basis der EU-Richtlinie 94/9/EG, Anhang<br />
II, dass der technische Erkenntnisstand,<br />
der sich schnell ändert, unverzüglich<br />
und soweit wie möglich angewandt werden<br />
muss.<br />
Seite 14 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Die Normungsorganisationen CENELEC<br />
und künftig auch CEN ziehen auch aus diesem<br />
Grund nach einer meist 3 jährigen Übergangsfrist<br />
Normen wieder zurück, wenn eine<br />
neue Ausgabe erschienen ist. Neue EG-<br />
Baumusterprüfbescheinigungen werden<br />
nach dieser Frist in jedem Fall auf der Basis<br />
der neuesten Ausgaben der Normen ausgestellt.<br />
Es wird davon ausgegangen, dass in<br />
diesen neuesten Ausgaben auch der neueste<br />
(sicherheits) technische Erkenntnisstand abgebildet<br />
ist. Die Änderungen sollen im Vorwort<br />
einer neuen Normenausgabe aufgelistet<br />
und bewertet werden. Erfolgt die Bewertung:<br />
›Der sicherheitstechnische Erkenntnisstand<br />
hat sich durch Erscheinen dieser neuen Ausgabe<br />
wesentlich geändert‹, müssen die betroffenen<br />
Produkte innerhalb der Übergangsfrist<br />
(bis zum Zurückziehen der alten<br />
Ausgabe) einem Review und ggf. einer Re-<br />
Zertifizierung (Ergänzung zur bestehenden<br />
bzw. Ausstellung einer neuen EG-Baumusterprüfbescheinigung)<br />
unterzogen werden.<br />
Für die Durchführung und Bewertung, ob ein<br />
bestimmtes Produkt von einer Normenänderung<br />
betroffen ist, ist allein der Hersteller<br />
verantwortlich. Der Grund liegt im so genannten<br />
›Neuen Ansatz‹ (New Approach) der<br />
Europäischen Union, der die Verantwortung<br />
des Herstellers für sein Produkt in den Mittelpunkt<br />
gestellt hat. Das verbindliche Dokument<br />
ist die EG-Konformitätserklärung, in der<br />
der Hersteller die Übereinstimmung mit den<br />
Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen<br />
der Richtlinie 94/9/EG<br />
und ggf. mit anderen betroffenen EU-Richtlinien<br />
bestätigt.<br />
Der Hersteller prüft also nach Erscheinen<br />
einer neuen Normenausgabe, ob sein Produkt<br />
von den Änderungen betroffen ist. Dieser<br />
Vorgang wird durch die Auflistung der<br />
Änderungen im Vorwort der neuen Ausgabe<br />
erleichtert. Es kann nun das Problem entste-<br />
hen, dass sich die vorhandene EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
auf die alte Norm abstützt,<br />
die EG-Konformitätserklärung jedoch<br />
mit Bezug auf die neue Normenausgabe ausgestellt<br />
werden soll. Die Lösung des Problems<br />
kann über eines der folgenden Szenarien,<br />
bei denen die PTB auch unterstützend<br />
tätig wird, erfolgen:<br />
Szenario 1:<br />
Der Hersteller befindet, dass sein Produkt<br />
von den Änderungen in der neuen Ausgabe<br />
der Norm nicht betroffen ist. Dies umfasst<br />
Fälle, in denen die geänderten Anforderungen<br />
für das jeweilige Produkt nicht relevant<br />
sind oder es sich um Erweiterungen handelt.<br />
Konsequenzen:<br />
> Der Hersteller ändert die EG-Konformitätserklärung<br />
und legt die neuen Normenausgaben<br />
zu Grunde.<br />
> Gleichzeitig verweist er weiter auf die EG-<br />
Baumusterprüfbescheinigung nach den<br />
alten Ausgaben. Sollten sich Akzeptanzprobleme<br />
beim Endanwender ergeben,<br />
kann der Hersteller die Aussage von einer<br />
›Benannten Stelle‹ mit Bezug auf sein<br />
spezifisches Produkt anbieten (bis hin zur<br />
Ergänzung der EG-Baumusterprüfbescheinigung).<br />
Szenario 2:<br />
Der Hersteller befindet, dass sein Produkt<br />
nur minimal (z. B. formal) von den Änderungen<br />
betroffen ist.<br />
Konsequenzen:<br />
> Die geforderten Änderungen führen nicht<br />
zu einer Änderung der Konstruktion des<br />
Produkts. So könnte eine Prüfung hinzu<br />
gekommen sein, die leicht nachgewiesen<br />
werden kann. Die Erfüllung der neuen Kriterien<br />
ist also evident.
Der Hersteller dokumentiert die Erfüllung<br />
der Anforderungen und fügt sie der Dokumentation<br />
zu seiner EG-Konformitätserklärung<br />
bei Konsequenzen:<br />
> Er ändert die EG-Konformitätserklärung<br />
und legt die neuen Normenausgaben zu<br />
Grunde. Gleichzeitig verweist er weiter<br />
auf die EG-Baumusterprüfbescheingung<br />
nach den alten Ausgaben.<br />
> Die PTB gibt (in Abstimmung mit dem AK<br />
Ex des ZVEI) für einige Standard-Fälle Informationsblätter<br />
und Checklisten heraus,<br />
die die Hersteller bei diesem Szenario unterstützen.<br />
> Die PTB gestattet dem Hersteller, dass<br />
Produkte auch ohne neue EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
die neue Kennzeichnung<br />
erhalten dürfen, wenn der Hersteller<br />
die PTB darüber schriftlich informiert. Die<br />
PTB kann nach formaler Prüfung der<br />
Kennzeichnungsänderung ggf. widersprechen.<br />
Eine technische Bewertung findet<br />
dabei nicht statt.<br />
Szenario 3:<br />
Der Hersteller befindet, dass sein Produkt<br />
von den Änderungen betroffen ist. Er muss<br />
z. B. eine neue Anforderung bzw. Prüfung<br />
nachweisen, wodurch sich ggf. die Konstruktion<br />
des Produkts geringfügig verändert.<br />
Konsequenzen:<br />
> Der Hersteller schickt die Dokumentation<br />
zu den durchgeführten bzw. den in der<br />
PTB durchzuführenden Prüfungen sowie<br />
die technischen Unterlagen mit den geringfügigen<br />
Änderungen an die PTB mit<br />
der Bitte um Stellungnahme bzw. Ausführung.<br />
> Die PTB wird nach positiver Begutachtung<br />
der Prüfungen und Unterlagen einen<br />
Brief verfassen, in dem die Unbedenklichkeit<br />
bestätigt wird oder auf Wunsch auch<br />
eine Ergänzung zu der jeweiligen EG-<br />
Baumusterprüfbescheinigung (bei Akzeptanzproblemen)<br />
ausstellen.<br />
> Gleichzeitig verweist der Hersteller weiter<br />
auf die EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
nach den alten Ausgaben.<br />
Szenario 4:<br />
Der Hersteller befindet, dass sein Produkt<br />
betroffen ist, und dass die Änderungen wesentlich<br />
sind (siehe Annex ZY der neuen Europäischen<br />
Norm).<br />
Konsequenzen:<br />
> Der Hersteller beantragt eine Ergänzung<br />
zur bestehenden EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
unter Zugrundelegung der<br />
neuen Ausgaben der Normen oder eine<br />
neue EG-Baumusterprüfbescheinigung.<br />
> Er ändert die EG-Konformitätserklärung<br />
und legt die neuen Normenausgaben zu<br />
Grunde. Gleichzeitig verweist er auf die<br />
geänderte oder neue EG-Baumusterprüfbescheinigung.<br />
Der internationale Markt<br />
im Explosionsschutz<br />
Auch im Explosionsschutz nimmt die Bedeutung<br />
des internationalen Marktes immer<br />
mehr zu. Besonders die deutsche Industrie<br />
ist überdurchschnittlich abhängig vom weltweiten<br />
Handel mit Geräten und Ingenieurdienstleistungen,<br />
dessen Grundlage möglichst<br />
vollständig harmonisierte IEC/<br />
ISO-Normen, Zertifizierungsverfahren und<br />
staatliche Verordnungen sein sollten. Die<br />
Kunden für explosionsgeschützte Geräte sind<br />
überwiegend in den Bereichen der chemischen<br />
Industrie, Öl- und Gasindustrie sowie<br />
in der Pharmaindustrie und deren Zulieferern<br />
angesiedelt. Für den globalen Markt<br />
benötigen Herstellerfirmen neben den Europäischen<br />
Zertifikaten (EG-Baumusterprüfbe-<br />
scheinigung, QS-Mitteilung für die Anerkennung<br />
der Qualitätssicherung bei der<br />
Herstellung) auch ein Zertifikat nach dem<br />
IECEx-System sowie für den nordamerikanischen<br />
Markt eine UL (Underwriters Laboratories)<br />
oder FM (Factory Mutual)- Zulassung.<br />
Die Realisierung der Vision vom weltweit gültigen<br />
Zertifikat wird wohl noch etwas Zeit<br />
brauchen. Die PTB hat sich deshalb für die<br />
Ausstellung von ATEX-Zertifikaten und von<br />
IECEx-Zertifikaten qualifiziert. Für Hersteller<br />
bietet die PTB weiterhin durch die Partnerschaft<br />
mit UL und deren Fachexperten auf<br />
dem Gelände der PTB einen erleichterten<br />
Einstieg in den US-Markt an (siehe auch<br />
›Neue Entwicklungen in der Zusammenarbeit<br />
der PTB mit anderen Zertifizierungsstellen‹).<br />
Die Rolle der PTB im Explosionsschutz<br />
Fragen der öffentlich-technischen Sicherheit<br />
− wozu auch der Explosionsschutz gehört<br />
– sind als Teil der Daseinsvorsorge weitgehend<br />
in die Zuständigkeit des Staates<br />
gelegt. Ihm ist damit für die ordnungsgemäße<br />
Durchführung dieses Auftrages Verantwortung<br />
übertragen. Im Bereich des Explosionsschutzes<br />
nehmen diese Verantwortung die<br />
Physikalisch-Technische Bundesanstalt<br />
(PTB) und die Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM) in abgestimmter<br />
Arbeitsteilung wahr.<br />
Ein gemeinsames Gremium von BAM und<br />
PTB in der Form des heutigen Lenkungsgremiums<br />
›Physikalisch − Chemische Sicherheitstechnik‹<br />
hat sich als eine sehr effiziente<br />
Lösung für die Wahrnehmung der Aufgaben<br />
des Staates im Explosionsschutz erwiesen.<br />
Das Aufgabengebiet erstreckt sich hier von<br />
der Beratung der Bundesregierung, der<br />
Wahrnehmung deutscher Interessen in internationalen<br />
und europäischen �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 15
Herausforderungen an Dienstleistungen im Explosionsschutz<br />
Normungs- und sonstigen Fachorganisationen,<br />
der Dienstleistung bis hin zur Forschung.<br />
PTB und BAM betreiben anwendungsorientierte<br />
und pränormative Grundlagenforschung;<br />
sie entwickeln Normen zum Nutzen<br />
der deutschen Industrie und zur Aufrechterhaltung<br />
des Sicherheitsniveaus im Explosionsschutz.<br />
Zur Erzielung von Exporterleichterungen<br />
der Hersteller trifft die PTB inter-<br />
nationale Vereinbarungen mit anderen Prüfstellen<br />
(u. a. in der USA, in Japan und China),<br />
fördert maßgeblich das internationale IECEx-<br />
System (Prüf- und Zertifizierungsschema)<br />
und trägt darüber hinaus durch Vorträge und<br />
Gremienarbeit entscheidend zum internationalen<br />
Wissenstransfer bei. Zur Wahrnehmung<br />
dieser Aufgaben gehört, dass die PTB<br />
zum Kompetenzerhalt eigene Prüfkapazitäten<br />
für Dienstleistungsaufgaben vorhält. Das<br />
zieht nach sich, dass sie auf der Grundlage<br />
der europäischen Richtlinien auch als ›Benannte<br />
Stelle‹ agieren muss.<br />
Die prüftechnische Kompetenz der PTB im<br />
Bereich des Explosionsschutzes ist deshalb<br />
die Voraussetzung dafür, dass sie durch entsprechendes<br />
Ansehen international agieren<br />
und die Interessen der deutschen Wirtschaft<br />
vertreten kann. Gleichwohl ist es die Strategie<br />
der Bundesanstalt, nur solche Prüfungen<br />
durchzuführen, die keinen Routinecharakter<br />
haben und für die keine Voraussetzungen für<br />
eine gleichwertige Aufgabenerfüllung bei anderen<br />
Prüfstellen gegeben sind. Der Regelfall<br />
ist die Prüfung und Bewertung komplexer<br />
Systeme, bei denen das Forschungsumfeld<br />
der PTB von Nutzen ist und die Zusammenarbeit<br />
mit der BAM positiv einfließt.<br />
Die PTB steht als ›Benannte Stelle‹ im europäischen<br />
Binnenmarkt im Wettbewerb mit<br />
Prüfstellen anderer Mitgliedstaaten. Die von<br />
der PTB erhobenen Gebührensätze sind Ergebnis<br />
einer internen Kosten- und Leistungs-<br />
Seite 16 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
rechnung; sie haben eine Größenordnung,<br />
die einen hohen Grad an Kostendeckung ermöglicht.<br />
Diese Kostenhöhe ist Gewähr dafür,<br />
dass die PTB nicht über den Preis Vorteile<br />
am Markt erzielt. Die hohe Nachfrage nach<br />
Prüfdienstleistungen der PTB ist überwiegend<br />
darin begründet, dass ihren Zertifikaten<br />
ein hohes Vertrauenspotential<br />
entgegengebracht wird - nicht zuletzt<br />
durch ihre hohe Sachkompetenz und<br />
wirtschaftliche Unabhängigkeit.<br />
Auch die Arbeit der PTB in wichtigen nationalen<br />
und internationalen regelsetzenden<br />
Gremien ist unter Berücksichtigung des aufgezeigten<br />
Aufgabenspektrums unerlässlich;<br />
die PTB kann hier neutral und als unabhängiger<br />
Partner agieren. So werden bevorzugt<br />
koordinierende Funktionen angestrebt, wie z.<br />
B. die Planung und Organisation von Ringvergleichen<br />
oder die Einrichtung von Wissens-<br />
spools (Ex-Dienst, etc.).<br />
Der Trend geht zu immer mehr Eigenverantwortung<br />
der Industrie, aber in Fragen der<br />
industriellen Sicherheitstechnik funktioniert<br />
die Deregulierung nur, wenn zwischen Staat<br />
und Industrie eine neutrale und fachlich kompetente<br />
Stelle mitwirkt. Sowohl Industrie als<br />
auch die betroffenen Ministerien BMWi/<br />
BMAS bewerten diese Funktion der PTB als<br />
sehr hilfreich.<br />
Anerkennung von Hersteller-<br />
QM-Systemen<br />
Bei der Konformitätsbewertung sind die<br />
Module der Qualitätssicherung in der Produktionsphase<br />
ein Kernelement der neuen<br />
Konzeption. In den Fällen, wo in der Richtlinie<br />
94/9/EG eine Baumusterprüfung gefordert<br />
wird, ist auch ergänzend ein Qualitätssicherungs-Modul<br />
notwendig, abgestuft nach den<br />
Kategorien, d. h. dem Sicherheitsniveau des<br />
Produktes. Für Geräte der Kategorie 1 (Zone<br />
0 oder 20) und für Schutzsysteme ist das Modul<br />
›QS-Produktion‹ erforderlich; alternativ<br />
kann eine Prüfung des Produktes selbst<br />
durch die ›Benannte Stelle‹ erfolgen, was allein<br />
aus Kostengründen eine seltene Ausnahme<br />
bleiben wird. Das Gleiche gilt für die<br />
EG-Einzelprüfung, die für alle Kategorien anwendbar<br />
wäre und wohl eher für komplexe<br />
Einzelanfertigungen gedacht ist. In den Anhängen<br />
IV und VII der Richtlinie wird in gleicher<br />
Weise für die QM-Anerkennung gefordert,<br />
dass die ›Benannte Stelle‹ das<br />
QM-System bewertet.<br />
Diese und weitere Anforderungen werden<br />
so ausgelegt, dass ein allgemeines QM-System-<br />
Zertifikat nach ISO 9000 nicht ausreichend<br />
ist, sondern eine produktspezifische<br />
bzw. richtlinienspezifische Bewertung nach<br />
EN 13980 bzw. künftig IEC/ISO 80079-34 erforderlich<br />
ist. In der PTB gilt dabei der folgende<br />
Grundsatz:<br />
Der Ex-Auditor ist ein Fachmann des Explosionsschutzes<br />
für bestimmte Zündschutzarten<br />
oder Produktgruppen und hat eine Ausbildung<br />
zur Bewertung von QS-Systemen<br />
erhalten. Grundsätzlich kann ein QS-System<br />
allein durch Experten der PTB bewertet werden;<br />
eine Ausweitung der Aktivitäten ist im<br />
Sinne der Deregulierung aber nicht gewollt in<br />
einem Markt, der bereits viele kompetente<br />
Anbieter hat. Deshalb wird ein aktuelles ISO<br />
9000-Zertifikat einer anerkannten Stelle vorausgesetzt.<br />
Über die richtlinienspezifische Anerkennung<br />
des QS-Systems erhält der Hersteller<br />
eine entsprechende Mitteilung (Notification).<br />
Die Befristung der Anerkennung auf drei<br />
Jahre entspricht der üblichen Vorgehensweise<br />
bei QM-System-Zertifizierungen. Innerhalb<br />
der drei Jahre wird ein Überwachungsaudit<br />
durchgeführt. Die richtlinienspezifische<br />
QM-Anerkennung dient auch als Grundlage
für das IECEx-System, das einen QAR (Quality<br />
Assessment Report) erfordert, der mit seinen<br />
wichtigsten Daten im Internet eingestellt<br />
wird.<br />
Der Trend bei den Herstellerfirmen geht<br />
zunehmend zu außerdeutschen Fertigungsstandorten.<br />
Auch die Fertigung wesentlicher<br />
Teile von Geräten bei anderen Firmen (verlängerte<br />
Werkbank) ist immer häufiger zu finden.<br />
Die PTB stellt sich darauf durch verschiedene<br />
Strategien ein:<br />
> Nutzung externer Auditoren (z. B. in China)<br />
mit gleichem Anspruch wie an PTB-<br />
Mitarbeiter,<br />
> Matrix-Zertifizierung bei Herstellern mit<br />
mehreren Fertigungsstandorten, aber einheitlichem<br />
QM-System,<br />
> Auditierung von Zulieferern, die für den<br />
Explosionsschutz wichtige Baugruppen<br />
bzw. Komponenten fertigen.<br />
Vergleichsmessungen zwischen den nach<br />
ATEX ›Benannten Stellen‹ und IECEx-Prüflaboratorien<br />
Der Konvergenzprozess innerhalb der<br />
Normung muss hinsichtlich der nachhaltigen<br />
Umsetzung in die Praxis der Mess-, Prüf- und<br />
Bewertungstätigkeiten durch eine enge Kommunikation<br />
zwischen den ›Benannten Stellen‹<br />
begleitet werden. Deswegen wurde unter<br />
Leitung der PTB im Jahr 2008 weltweit erstmalig<br />
damit begonnen, ein umfangreiches systematisches<br />
Programm mit Vergleichsmessungen<br />
zwischen den ›Benannten Stellen‹ zu<br />
planen und umzusetzen. Gleichzeitig soll dabei<br />
ein Referenz-QM-Handbuch (ISO/IEC<br />
17025, 17065) entstehen, so dass in Zukunft<br />
alle ›Benannten Stellen‹ möglichst nach<br />
denselben Regeln Geräte prüfen und zertifizieren<br />
können.<br />
Auf die Fachbereiche des Explosionsschutzes<br />
in der PTB kommt dabei mehr und<br />
mehr die Rolle des weltweiten Koordinators<br />
bzw. die Funktion eines Referenzlaboratoriums<br />
zu. Das Programm für Vergleichsmessungen<br />
beginnt mit den Messgrößen für Explosionsdruck<br />
(Zündschutzart Druckfeste<br />
Kapselung) und Funkenzündung (Zündschutzart<br />
Eigensicherheit). Hier werden speziell<br />
präparierte Prüflinge zeitgleich an weltweit<br />
41 Prüfstellen gesandt. Dabei sind auch unter<br />
Anwendung der ISO/IEC 17043 ›Proficiency<br />
Testing‹ auf die Programme des Explosionsschutzes<br />
sowie die Entwicklung von Labornormalen<br />
zur Rückführung der Messgrößen<br />
für Explosionsdruck und Zündgrenzwerte der<br />
Eigensicherheit Regeln zu erarbeiten. Mittelfristiges<br />
Ziel ist es, die Teilnahme an den Proficiency<br />
Testing Programmen zumindest im<br />
IECEx-System als verpflichtende Bedingung<br />
für die Ausstellung von IECEx-Zertifikaten<br />
festzuschreiben. Erste Ergebnisse aus den<br />
bereits laufenden Vergleichsmessungen waren<br />
für den Beginn des Jahres 2011 erwartet<br />
worden.<br />
Neue Entwicklungen in der Zusammenarbeit<br />
der PTB mit anderen Zertifizierungsstellen<br />
Insbesondere in Fragen der Sicherheit arbeiten<br />
Kompetenzstellen mit höchster Motivation<br />
international zusammen, um ihre Erfahrungen<br />
im Sinne des optimalen Schutzes<br />
der Bevölkerung auszutauschen. Der wissenschaftlich-technische<br />
Erkenntnisstand im<br />
Fachgebiet des Explosionsschutzes wird daher<br />
auch nicht mehr in nationalen, sondern in<br />
internationalen ISO- und IEC-Normen niedergeschrieben.<br />
Die Regelwerke werden weltweit,<br />
u. a. zur Durchführung von Konformitätsbewertungen<br />
an explosionsgeschützten<br />
Geräten angewendet. Um die Gleichförmig-<br />
keit der alltäglichen Anwendung in den weltweit<br />
über 50 Laboratorien sicherzustellen,<br />
haben alle Laboratorien ein Interesse an einer<br />
möglichst engen Zusammenarbeit. Underwriters<br />
Laboratories Inc. (UL) und die<br />
Physikalisch Technische Bundesanstalt haben<br />
sich daher entschlossen, einige ihrer<br />
Fachexperten auf dem Gelände der PTB in einer<br />
Arbeitsgruppe zusammenarbeiten zu lassen.<br />
Hauptsächlich die Konformitätsbewertungen<br />
auf der Basis der Normengruppe der<br />
IEC 60079-0 werden in gemeinsamen Teams<br />
durchgeführt.<br />
Die Fachexperten von UL bearbeiten auch<br />
Konformitätsbewertungen nach US-amerikanischen<br />
Standards (NEC-Artikel 500/Divison 1<br />
und 2, NEC-Artikel 505/Zone, Class I, II und<br />
III). Die deutschen Hersteller können durch<br />
die enge Zusammenarbeit von UL und PTB<br />
nun in Braunschweig sowohl Zulassungen<br />
für den nordamerikanischen Markt als auch<br />
für den EU-Binnenmarkt erhalten. Dieses<br />
stellt eine erhebliche Vereinfachung für den<br />
Zulassungsprozess zu den wichtigsten Märkten<br />
dar. UL und PTB werden den Erfolg der<br />
engen Zusammenarbeit anhand von Kundenbefragungen<br />
überprüfen und bei positiver<br />
Rückmeldung weiter ausbauen. Auch andere<br />
Kompetenzstellen des Explosionsschutzes<br />
sind eingeladen, sich diesem Organisationsmodell<br />
anzuschließen.<br />
Unveränderter Nachdruck<br />
aus PTB-Mitteilungen 121 (2011, Heft 1)<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 17
Seite 18 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
§ Recht, Normen und Technik<br />
Physikalisch-Chemische Sicher-<br />
heitstechnik und Explosionsschutz<br />
in PTB und BAM<br />
von Michael Beyer, Heino Bothe und Thomas Schendler<br />
BAM und PTB – gemeinsam für die Physikalisch-Chemische<br />
Sicherheitstechnik<br />
Unter diesem Motto arbeiten die BAM<br />
Bundesanstalt für Materialforschung und<br />
-prüfung und die PTB abgestimmt, aber mit<br />
eigenen Schwerpunkten, eng auf dem Gebiet<br />
des Brand- und Explosionsschutzes zusammen.<br />
Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die<br />
Gewährleistung sicherer Prozesse und Technik<br />
in einem sich ständig verändernden technischen<br />
und industriellen Umfeld. Das vorliegende<br />
Themenheft der PTB-Mitteilungen<br />
zeigt einen Ausschnitt aus dem gemeinsamen<br />
Aufgabengebiet mit dem Schwerpunkt<br />
des klassischen Explosionsschutzes.<br />
Ein augenfälliges Beispiel für diese Zusammenarbeit<br />
sind die seit 30 Jahren gemeinsam<br />
veranstalteten Kolloquien zu Fragen<br />
der chemischen und physikalischen Sicherheitstechnik.<br />
Auch beim 12. Kolloquium dieser<br />
Reihe präsentierten beide Bundesanstalten<br />
am 15. und 16. Juni 2010 wieder ihre<br />
aktuellen Entwicklungen und Forschungsergebnisse.<br />
Teilnehmer aus wissenschaftlichen<br />
und sicherheitstechnischen Institutionen,<br />
aus Behörden, aber auch Hersteller explosionsgeschützter<br />
Geräte und sicherheitsrelevanter<br />
Ausrüstung sowie Betreiber von Anlagen<br />
mit Explosionsgefährdungen nutzten<br />
diese Gelegenheit, sich über den Stand von<br />
Wissenschaft und Sicherheitstechnik zu informieren<br />
und mit den Mitarbeitern von BAM<br />
und PTB sicherheitstechnische Praxisfragen<br />
zu diskutieren. In zwei Tagen intensiver wissenschaftlicher<br />
und sicherheitstechnischer<br />
Diskussion wurde die große Bandbreite und<br />
die damit verbundene technisch-wissenschaftliche<br />
Expertise von BAM und PTB auf<br />
dem Gebiet der physikalisch-chemischen Sicherheitstechnik<br />
deutlich.<br />
Aufgabenteilung zwischen PTB und BAM<br />
Die Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik<br />
im Aufgabenbereich von PTB und<br />
BAM umfasst im Wesentlichen die Untersuchung<br />
und Bewertung von<br />
> gefährlichen Stoffen und Gütern,<br />
> gefährlichen chemischen Reaktionen,<br />
> Verfahren, Anlagen, Anlagenteilen und<br />
Sicherheitseinrichtungen für den Umgang<br />
mit gefährlichen Stoffen und Stoffsystemen.<br />
Der Explosionsschutz als Teilgebiet der Physikalisch-Chemischen<br />
Sicherheitstechnik ist<br />
zu verstehen als Summe der Schutzmaßnahmen<br />
bei ungewollten Oxidationsreaktionen in<br />
der Gasphase unter atmosphärischen Bedingungen<br />
mit nachfolgendem Anstieg von Temperatur<br />
und Druck in geschlossenen Systemen<br />
auch außerhalb atmosphärischer<br />
Bedingungen. Dieses Gebiet erstreckt sich<br />
daher von den stofflichen Eigenschaften über<br />
die Gemischausbreitung, die Zündquellenbeherrschung<br />
und Begrenzung der Explosionsauswirkungen,<br />
die Beschaffenheitsanforderungen<br />
an Geräte, Schutzsysteme und<br />
Anlagen bis hin zu den Betriebsvorschriften<br />
der Anlagensicherheit und des Transports<br />
gefährlicher Güter.<br />
In der PTB werden ausschließlich Fragen<br />
des Explosionsschutzes bearbeitet. Dazu gehören<br />
die oben genannten apparativen Fragestellungen<br />
mit dem Schwerpunkt der Vermeidung<br />
von elektrischen und mechanischen<br />
Zündquellen sowie Fragen zum Umgang mit<br />
brennbaren Flüssigkeiten. In der BAM hingegen<br />
ist die Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik<br />
als Ganzes Schwerpunktaufgabe.<br />
Dazu gehören neben den in diesem Heft<br />
behandelten Themen generell die Ermittlung
und Bewertung gefährlicher Stoffeigenschaften<br />
sowie die Sicherheit z. B. von Druckbehältern<br />
und Lageranlagen und Festlegungen<br />
für den Transport gefährlicher Güter. Im engeren<br />
Bereich des Explosionsschutzes ist die<br />
BAM stofflich für den Umgang mit brennbaren<br />
Gasen und Stäuben zuständig, befasst<br />
sich aber − anders als die PTB − nicht mit<br />
Fragen des elektrischen Explosionsschutzes.<br />
Die beschriebene Aufgabenteilung für Standardaufgaben<br />
besteht im Wesentlichen<br />
schon seit Jahrzehnten und hat sich gut bewährt.<br />
Im Falle neuer oder komplexer, übergreifender<br />
Fragestellungen werden die Aufgaben<br />
gemeinsam in enger Absprache<br />
geklärt. Darüber hinaus gibt es seit 2005 ein<br />
gemeinsames Lenkungsgremium für den Bereich<br />
der Physikalisch-Chemischen Sicherheitstechnik,<br />
in dem mittel- bis langfristige<br />
fachliche und strukturelle Planungen, große<br />
Investitionen und Maßnahmen zur gemeinsamen<br />
Außendarstellung des Fachgebietes<br />
abgestimmt werden. Ziel ist eine gemeinsame<br />
effiziente und effektive Bearbeitung der<br />
Kernaufgaben Politikberatung, Industrieberatung<br />
(Gutachten, Normung etc.), Förderung<br />
der Wirtschaft durch wissenschaftsbasierte<br />
Dienstleistungen (Prüfung und Zulassung)<br />
und Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
im vorhandenen Netzwerk der Sicherheitsforschung.<br />
Der nachfolgende Beitrag<br />
dieses Heftes ›Herausforderungen an Dienstleistungen<br />
im Explosionsschutz‹ beleuchtet,<br />
dass nicht nur in der Forschung erhebliche<br />
Neuerungen auf das Fachgebiet einwirken.<br />
Bild 1: Im Dezember 2005 kam es im englischen Tanklager Buncefield nach Freisetzung einer großen Ottokraftstoffdampfwolke<br />
zu mehreren Explosionen und einem verheerenden Folgebrand<br />
(Quelle: www.buncefieldinvestigation.gov.uk).<br />
Politikberatung und Wissenstransfer in die<br />
Industrie<br />
Als Ressortforschungseinrichtungen der<br />
Bundesregierung kommen BAM und PTB<br />
spezifische Aufgabenstellungen zu, damit sie<br />
ihrer Scharnierfunktion zwischen den Interessen<br />
der Wirtschaft und der Gesellschaft<br />
gerecht werden können. Ein wesentlicher<br />
Bestandteil dieser Funktion ist die Beratung<br />
der Bundesregierung in den sicherheitstechnischen<br />
Gremien verschiedener Bundesministerien,<br />
die sich u. a. mit dem Anpassungsbedarf<br />
des Regelwerkes nach großen<br />
Explosionsunfällen befassen (Bild 1). Dazu<br />
gehören u. a. der Ausschuss für Betriebssicherheit<br />
(ABS) und der Ausschuss für Gefahrstoffe<br />
(AGS) des Bundesministeriums für<br />
Arbeit und Soziales (BMAS), der Ausschuss<br />
Gefahrgutbeförderung (AGGB) und der Gefahrgut-Verkehrs-Beirat<br />
beim Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwick-<br />
lung (BMVBS) sowie die Kommission für<br />
Anlagensicherheit (KAS) des Bundesministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
(BMU) mit diversen Untergremien.<br />
Vertreter von BAM und PTB arbeiten weiterhin<br />
in den regelsetzenden Gremien der Berufsgenossenschaften<br />
mit und beraten darüber<br />
hinaus auch die Gewerbe- und<br />
Marktaufsicht der Bundesländer sowie andere<br />
Behörden, aber auch die Industrie (u. a.<br />
Hersteller explosionsgeschützter Geräte und<br />
Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen).<br />
Wie in vielen anderen Branchen nimmt<br />
auch im Explosionsschutz die Bedeutung des<br />
internationalen Marktes immer mehr zu. Insbesondere<br />
die deutschen Unternehmen sind<br />
sehr stark vom globalen Handel mit technischen<br />
Produkten und Ingenieurdienstleistungen<br />
abhängig. Für die Industrie (Hersteller<br />
wie auch Betreiber von überwachungsbedürftigen<br />
Anlagen) spielt daher die �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 19
Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik und Explosionsschutz in PTB und BAM<br />
Vermeiden<br />
explosionsfähiger<br />
Atmosphäre<br />
Reduzieren der<br />
Auswirkungen<br />
von Explosionen<br />
Vermeiden<br />
von Zündquellen<br />
Bild 2: Die Maßnahmen des Explosionsschutzes werden<br />
in drei Teilaspekte gegliedert: Das Vermeiden explosionsfähiger<br />
Atmosphäre, das Vermeiden von<br />
Zündquellen und das Begrenzen der Auswirkungen<br />
von Explosionen auf ein unbedenkliches Maß<br />
Seite 20 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
europäische und internationale Normung eine<br />
immer größere Rolle. Wesentlich sind dabei<br />
die harmonisierten europäischen Normen,<br />
die die Vermutung der Konformität mit<br />
europäischen Richtlinien auslösen, hier insbesondere<br />
die Normen von CENELEC/TC 31<br />
›Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete<br />
Bereiche‹ und CEN/TC 305 ›Explosionsfähige<br />
Atmosphären – Explosionsschutz‹<br />
mit der Vermutungswirkung in Bezug auf die<br />
Richtlinie 94/9/EG. Die Normen des elektrischen<br />
Explosionsschutzes werden inzwischen<br />
nahezu ausschließlich auf IEC-Ebene<br />
erarbeitet (im IEC/TC 31 ‹Equipment for explosive<br />
atmospheres‹) und dann als harmonisierte<br />
europäische Normen übernommen.<br />
Bei den Normen des CEN/TC 305 für nichtelektrische<br />
Geräte, Schutzsysteme und sicherheitstechnische<br />
Kenngrößen, die bisher<br />
ausschließlich auf europäischer Ebene entwickelt<br />
wurden, beginnt dieser Prozess gerade<br />
im IEC/SC 31M ›Non-electrical equipment<br />
and protective systems for explosive atmospheres‹,<br />
das ISO-Normen auf diesem Gebiet<br />
erarbeitet.<br />
Mitarbeiter der vier PTB-Fachbereiche des<br />
Explosionsschutzes und der Abteilung ›Chemische<br />
Sicherheitstechnik‹ der BAM arbeiten<br />
auf allen Ebenen dieses Normungsprozesses<br />
in fachlichen und leitenden<br />
Funktionen mit. Sie vertreten dabei sicherheitstechnische<br />
und technologische Grundsätze,<br />
wie sie in Deutschland und Europa<br />
über Jahre entwickelt wurden und unterstützen<br />
damit auch die vielen KMU, die sich selber<br />
nicht an der internationalen Normung beteiligen<br />
können. Für den außergewöhnlichen<br />
Einsatz in diesem Normungssektor ist Dr.<br />
Uwe Klausmeyer 2009 mit dem Lord Kelvin<br />
Award der Internationalen Elektrotechnischen<br />
Kommission (IEC) ausgezeichnet<br />
worden.<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in<br />
PTB und BAM zu den Eigenschaften explosionsfähiger<br />
Atmosphären, über elektrische<br />
und nichtelektrische Zündquellen sowie zum<br />
Ablauf von Explosions- und Detonationsvorgängen<br />
unterstützen als pränormative Forschung<br />
die Normungs- oder Regelwerksarbeiten<br />
oder bilden Grundlagen für technische<br />
Entwicklungen.<br />
Grundzüge des Explosionsschutzes<br />
Die Grundzüge des Explosionsschutzes,<br />
die im Folgenden skizziert werden, bilden<br />
sich auch in der Arbeitsstruktur von BAM<br />
und PTB ab. Nähere Erläuterungen zu den<br />
Arbeiten beider Bundesanstalten geben dann<br />
die weiteren Fachbeiträge dieses Heftes.<br />
Die sicherheitstechnische Beurteilung von<br />
Explosionsgefährdungen ist von entscheidender<br />
Bedeutung für viele technische Prozesse.<br />
Die Maßnahmen des Explosionsschutzes<br />
gliedern sich klassisch in drei verschiedene<br />
Teilgebiete (Bild 2). Zunächst wird<br />
die Vermeidung explosionsfähiger Atmosphären<br />
betrachtet. Gelingt dies sicher, z. B.<br />
durch Verwendung nichtbrennbarer Ersatzstoffe<br />
oder Prozessführung außerhalb der<br />
Explosionsgrenzen, sind keine weiteren Explosionsschutzmaßnahmen<br />
mehr nötig. Kann<br />
aber explosionsfähige Atmosphäre nicht sicher<br />
vermieden werden, steht die Beherrschung<br />
von Zündquellen im Vordergrund. Für<br />
den Fall, dass Prozesse nicht vollständig<br />
zündquellenfrei betrieben werden können<br />
oder das Versagen von technischen Schutzmaßnahmen<br />
nicht ausgeschlossen werden<br />
kann, müssen dann im nächsten Schritt die<br />
Auswirkungen von Explosionen auf ein unbedenkliches<br />
Maß begrenzt werden.
Basisinformationen für die Beurteilung von<br />
Explosionsgefahren<br />
Eine wichtige Basis für die Beurteilung<br />
von Explosionsgefahren sind die sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen von brennbaren<br />
Gasen, Dämpfen und Stäuben. Diese Kenngrößen<br />
erlauben die Beurteilung, ob explosionsfähige<br />
Atmosphäre vorliegt (z. B. an Hand<br />
der Kenngrößen Explosionsgrenzen, Sauerstoffgrenzkonzentration,<br />
Explosionspunkt,<br />
Flammpunkt), ob die brennbaren Stoffe sich<br />
entzünden können (z. B. an Hand der Zündtemperatur<br />
und Mindestzündenergie), aber<br />
auch eine Aussage über Ausbreitung und<br />
Auswirkung einer Explosion (Normspaltweite,<br />
Explosionsdruck und Explosionsdruckanstiegsgeschwindigkeit).<br />
In der gemeinsam<br />
von BAM, PTB und DECHEMA betriebenen<br />
Datenbank CHEMSAFE werden die Kenngrößen<br />
erfasst und auf einfache Art für Anwender<br />
verfügbar gemacht. Ein wesentliches<br />
Merkmal von CHEMSAFE ist dabei, dass vor<br />
der Aufnahme der Stoffe in die Datenbank<br />
ein Bewertungsprozess durchgeführt wird,<br />
der für eine besondere Verlässlichkeit der<br />
abrufbaren Daten sorgt. Dies ist Grund genug,<br />
die Erfolgsgeschichte in dem Beitrag<br />
›CHEMSAFE 2011‹ etwas näher zu beleuchten.<br />
Aufgrund der Komplexität des Explosionsprozesses<br />
werden für eine praxisnahe sicherheitstechnische<br />
Beurteilung verschiedene<br />
empirisch ermittelte<br />
sicherheitstechnische Kenngrößen wie<br />
Zündtemperatur oder Mindestzündenergie<br />
verwendet. Diese hängen jedoch von der Art<br />
und Weise ihrer Bestimmung ab und sind daher<br />
nur für einen definierten Anwendungsbereich<br />
verwendbar. Wird der ursprüngliche<br />
Anwendungsbereich erweitert, müssen auch<br />
die Bestimmungsverfahren weiter entwickelt<br />
werden. Ein Beispiel dafür ist der Beitrag<br />
›Schwerentzündbare Gase und Dämpfe – Erweiterung<br />
der europäischen Norm EN 1839<br />
zur Bestimmung der Explosionsgrenzen‹.<br />
Vermeidung explosionsfähiger Gemische<br />
Der erste gedankliche Schritt bei der Abwägung<br />
von Explosionsschutzmaßnahmen<br />
ist immer die Überlegung, ob sich explosionsfähige<br />
Atmosphäre ganz vermeiden oder<br />
zumindest einschränken lässt. Wenn sich<br />
keine unbrennbaren Ersatzstoffe einsetzen<br />
lassen, lässt sich häufig durch die Betriebsbedingungen<br />
einer Anlage explosionsfähige<br />
Atmosphäre vermeiden, in dem z. B. die Temperatur<br />
einer brennbaren Flüssigkeit genügend<br />
weit unterhalb des Flammpunktes gehalten<br />
wird, oder aber der Anteil des<br />
brennbaren Gases oder Staubes unter der<br />
unteren Explosionsgrenze gehalten wird.<br />
BAM und PTB liefern hierzu einerseits die<br />
notwendigen Stoffkennwerte in Form der sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen, führen<br />
andererseits aber auch (oft in Form von Forschungsvorhaben)<br />
experimentelle und rechnerische<br />
Untersuchungen exemplarischer<br />
betrieblicher Situationen durch, die dann<br />
verallgemeinert die Basis für Zonenfestlegungen<br />
in den Explosionsschutzdokumenten<br />
von Betreibern explosionsgefährdeter Anlagen<br />
oder auch für Regelungen von Staat<br />
oder Berufsgenossenschaften bilden können.<br />
Der Beitrag ›Messung und Festlegung<br />
explosionsgefährdeter Bereiche – Erfahrungen<br />
aus praxisnahen Untersuchungen an<br />
Tankfahrzeugen für brennbare Flüssigkeiten‹<br />
ist ein solches Beispiel für die Untersuchung<br />
der Bildung und Ausbreitung explosionsfähiger<br />
Atmosphäre in einer typischen betrieblichen<br />
Situation.<br />
In manchen Fällen lässt sich die zeitliche und<br />
räumliche Begrenzung der explosionsfähigen<br />
Atmosphäre nicht ausreichend sicherstellen.<br />
Dann können auf Basis eines Explosionsschutzdokuments<br />
zusätzliche Schutzmaßnahmen<br />
durch besonders geeignete Gaskonzentrationsmessgeräte,<br />
die ›Gaswarngeräte‹,<br />
das Mittel der Wahl sein. Ergibt die Überwachung<br />
des betroffenen Bereiches mit Gaswarngeräten,<br />
dass bestimmte Grenzkonzentrationen<br />
der brennbaren Substanz<br />
überschritten werden, können z. B. Lüftungsmaßnahmen<br />
zur Reduzierung der Konzentration<br />
ergriffen oder Geräte mit Zündquellen<br />
abgeschaltet werden. Diese Vorgehensweise<br />
ist nur in geeigneten Situationen anwendbar,<br />
und die Gaswarngeräte müssen dafür bestimmte<br />
Qualifikationen mitbringen, die im<br />
Beitrag ›Gaswarnsysteme in der Sicherheitstechnik<br />
– Anforderungen an Messfunktion<br />
und funktionale Sicherheit‹ dargestellt werden.<br />
Vermeidung von Zündquellen<br />
In explosionsgefährdeten Bereichen sind<br />
vielfältige Zündgefahren zu beachten (z. B.<br />
heiße Oberflächen, elektrostatischen Aufladungen,<br />
elektrische und mechanische Funken,<br />
optische Strahlung oder Ultraschall; Bild<br />
3). Elektrische Zündquellen sind dabei allein<br />
auf Grund der Menge und Vielfalt der eingesetzten<br />
elektrischen Geräte die häufigste<br />
Zündquellenart. Transiente Überspannungen<br />
in elektrischen Netzen oder bei Verwendung<br />
von umrichtergespeisten drehenden elektrischen<br />
Maschinen können zu unvollständigen<br />
elektrischen Entladungen (Teil- und Vorentladungen)<br />
führen. Sie galten lange als ungefährlich,<br />
da die einzelnen Entladungen zu wenig<br />
Energie freisetzen. Inzwischen konnte<br />
gezeigt werden, dass durch mehrfache �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 21
Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik und Explosionsschutz in PTB und BAM<br />
Wiederholung solcher Entladungen mit hoher<br />
Frequenz die freigesetzte Energie akkumulieren<br />
und zündwirksam werden kann. Im Beitrag<br />
›Zündung durch elektrische Entladungen‹<br />
wird u. a. auf das Zündverhalten solcher Entladungsformen<br />
eingegangen.<br />
Im Fall von technischen Defekten können in<br />
mechanischen Geräten wie Getrieben, Pumpen,<br />
Rührwerken oder dynamischen Dichtungen<br />
durch Schlagvorgänge oder durch<br />
kontinuierliche metallische Reibung wirksame<br />
Zündquellen entstehen. Dies sind einerseits<br />
abgetrennte Partikel hoher Temperatur<br />
(mechanische Funken) und bei Reibvorgängen<br />
zusätzlich entstehende heiße<br />
Oberflächen. Der Beitrag ›Mechanisch erzeugte<br />
Reib- und Schlagfunken im Vergleich‹<br />
greift dieses Thema auf und verdeutlicht Gemeinsamkeiten<br />
und Unterschiede bei der<br />
Funkenentstehung sowie insbesondere in der<br />
Zündwirksamkeit.<br />
Neben Untersuchungen der Zündvorgänge<br />
ist die adäquate Vermeidung von Zündquellen<br />
in neuartigen elektrotechnischen Anwendungen<br />
ein wichtiges Aufgabenfeld.<br />
Durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit<br />
in diesem Bereich ergibt sich ein entsprechender<br />
Forschungs- und Entwicklungsbedarf<br />
für neue Explosionsschutzkonzepte, die<br />
dieser technischen Entwicklung angepasst<br />
sein müssen. An der Entwicklung neuer Lösungen<br />
sind PTB-Mitarbeiter wesentlich beteiligt,<br />
was kürzlich mit dem Technologietransferpreis<br />
2010 der Industrie- und<br />
Handelskammer Braunschweig für Dr. Udo<br />
Gerlach, Dr. Ulrich Johannsmeyer und Dipl.-<br />
Ing. Thomas Uehlken und ihren Transfer ›Eigensicheres<br />
Energieversorgungssystem mit<br />
hoher elektrischer Leistung im Explosionsschutz–<br />
›Power-i‹/DART‹ gewürdigt wurde.<br />
Ein weiteres Beispiel sind die Brennstoffzellen.<br />
Um solche innovativen Technologien für<br />
den Betrieb innerhalb explosionsgefährdeter<br />
Seite 22 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Bereiche zu qualifizieren, musste ein Explosionsschutzkonzept<br />
auf Grundlage einer Zündgefahrenbewertung<br />
entwickelt werden. Dies<br />
wird im Beitrag ›Zündgefahren einer PEM-<br />
Brennstoffzelle hinsichtlich innerer explosionsartiger<br />
Verbrennungsreaktionen‹ behandelt.<br />
Begrenzung der Auswirkungen einer Explosion<br />
Oft werden durch relativ kleine Explosionen<br />
große Schäden durch nachfolgende<br />
Brände und Versagen von Gebäudestrukturen<br />
ausgelöst. Solche Ereignisketten und<br />
Folgeschäden sind vermeidbar, wenn die beginnende<br />
Explosionsausbreitung innerhalb<br />
von Behältern und anderen Umschließungen<br />
beherrscht werden kann. Technische Maßnahmen,<br />
die anlaufende Explosionen auf ein<br />
unbedenkliches Maß begrenzen,sind zum<br />
Beispiel:<br />
> Entkopplungsmaßnahmen wie<br />
Flammensperren,<br />
> explosionsdruckfeste Bauweise,<br />
> Explosionsdruckentlastung,<br />
> Explosionsunterdrückung.<br />
Mit Explosionsdruckentlastungseinrichtungen<br />
kann das Bersten von Apparaten, Behältern<br />
und Rohrleitungen im Falle einer Explosion<br />
verhindert werden. Ein Kernproblem<br />
für die Auslegung von Druckentlastungsflächen<br />
ist die Berücksichtigung von Turbulenz<br />
erzeugenden Einbauten. Dies ist das Thema<br />
des Beitrages ›Auswirkungen von Turbulenzen<br />
auf die Druckentlastung von Gasexplosionen‹.<br />
In der industriellen chemischen Reaktionstechnik<br />
werden in den letzten Jahren in zunehmendem<br />
Maße Methoden der Mikroverfahrenstechnik<br />
eingesetzt. So bezeichnet<br />
man Apparate mit typischen Rohrdurchmessern<br />
oder Strukturen innerer Anlagenteile<br />
Bild 3: Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre<br />
durch eine kleine heiße Oberfläche (›hot spot‹).<br />
kleiner als 1 mm. Mit Hilfe der Mikroverfahrenstechnik<br />
lassen sich bei geringeren<br />
Durchsätzen höhere Ausbeuten oder reinere<br />
Produkte erzielen als mit den üblichen Reaktionsverfahren.<br />
Zu Beginn des Einsatzes dieser<br />
Technik wurde angenommen, dass mikroverfahrenstechnische<br />
Apparaturen wegen<br />
ihrer geringen inneren charakteristischen<br />
Abmessungen ›inhärent sicher‹ gegenüber<br />
Zünddurchschlagsvorgängen (Deflagrations-<br />
und Detonationsvorgängen) seien. Diese Fragestellung<br />
wird im abschließenden Beitrag<br />
dieses Heftes ›Sicherheit bei mikrostrukturierten<br />
Reaktoren‹ näher untersucht.<br />
Redaktionell korrigierter Nachdruck<br />
aus PTB-Mitteilungen 121 (2011, Heft 1)<br />
Die Fachbeiträge, auf die in dieser Publikation<br />
verwiesen wird, sind ebenfalls in den<br />
PTB-Mitteilungen 121 (2011, Heft 1) erschienen<br />
(http://www.ptb.de/cms/publikationen/<br />
zeitschriften/ptb-mitteilungen.html).
Blitz- und Überspannungsschutz<br />
schafft Sicherheit<br />
von Karl-Heinz Kolodziej<br />
>> Anwendungsberichte<br />
Die Notwendigkeit von Blitzschutzsystemen für sowohl private<br />
als auch öffentliche und nicht zuletzt industrielle Bauten und Anlagen<br />
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Große Schadensereignisse<br />
in jüngster Vergangenheit sowie die Zunahme der Gewitterhäufigkeit<br />
und Gewitterheftigkeit sind ein Beleg für den Bedarf von geeigneten<br />
Schutzmaßnahmen.<br />
Insofern ist festzustellen, dass gerade in industriellen Bereichen,<br />
dort wo kostenintensive Anlagen oder lebensrettende Einrichtungen<br />
betrieben werden, deren Verfügbarkeit höchste Priorität haben<br />
muss. Dafür sind entsprechende Informations- und Kommunikationsstrukturen<br />
zwingend erforderlich, die in diesem Zusammenhang den<br />
betrieblichen Ablauf sicherstellen. In diesem Zusammenhang hat<br />
auch die Nachfrage nach geeigneten Blitz- und Überspannungsschutzsystemen<br />
stark zugenommen.<br />
Die Firma Blitzschutz Graff GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach<br />
versteht sich mit seinen mehr als 80 Mitarbeitern als exzellente<br />
Fachfirma auf dem Gebiet der Planung und Montage von komplexen<br />
Blitzschutzsystemen. Es ist ein seit 150 Jahren im Markt etabliertes<br />
Fachunternehmen für Erdungs-, Blitzschutz- und Potentialausgleichssysteme<br />
und gehört zum Unternehmensverbund der Griesemann-Gruppe,<br />
die mit ihren Unternehmen Indurest GmbH, GMR<br />
GmbH und John Brown Voest GmbH die Planung, Fertigung, �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 23
Blitz- und Überspannungsschutz schafft Sicherheit<br />
Montage und Instandhaltung von insbesondere chemischen und petrochemischen<br />
Industrieanlagen professionell betreibt.<br />
In enger Absprache mit Architekten, öffentlichen Einrichtungen,<br />
Hausbesitzern und nicht zuletzt mit der Industrie, werden individuelle<br />
Schutzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt, die den Anforderungen<br />
an einen hinreichenden Blitz- und Überspannungsschutz<br />
genügen.<br />
Durch die großflächige Ausdehnung verfahrenstechnischer<br />
Anlagen und durch den Einsatz moderner MSR-Technik ist deren<br />
Funktion in starkem Maße durch Blitz- und Schaltüberspannungen<br />
gefährdet.<br />
Bei einem Blitzeinschlag in eine ungeschützte Anlage treten in<br />
elektrisch leitenden Systemen hohe Stoßströme und -spannungen<br />
auf, wodurch wichtige elektrische Verbraucher zerstört werden können.<br />
Neben der dynamischen und thermischen Zerstörung löst der<br />
Blitzstoßstrom einen elektromagnetischen Feldimpuls aus, der tief in<br />
die bauliche Anlage, ihre Systeme und Endgeräte eindringt und dort<br />
durch Induktion in Leiterschleifen und Schaltkreisen Überspannungen<br />
von mehreren 1.000 Volt erzeugt.<br />
Deshalb ist ein anlagenspezifisches Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept<br />
notwendig. Eine Blitzschutzanlage soll Gebäude<br />
und Anlagen vor direkten Blitzeinschlägen und möglichem Brand<br />
und vor den Auswirkungen des eingeprägten Blitzstromes (nicht zündender<br />
Blitz) schützen.<br />
Die Kosten für individuell zugeschnittene Blitzschutzsysteme –<br />
von der richtigen Erdung bis hin zu einem funktionierenden Potentialausgleich<br />
und der Einbindung anforderungsgerechter Überspannungsschutzsysteme<br />
sind nicht annähernd mit den Kosten zu<br />
vergleichen, die durch Blitzeinschläge verursacht werden, sowohl<br />
durch direkte Schadenwirkung als auch durch kostenintensive Ausfallzeiten<br />
in Produktionsprozessen.<br />
Neben der reinen Kostenbetrachtung, die eine hohe Priorität<br />
Ex Zone 22<br />
Ex Zone 21<br />
Ex Zone 20<br />
Deckenprofil<br />
Ausblasöffnung<br />
Silodach<br />
Endverschluss<br />
Stützrohr mit HVI ®-Leitung<br />
an Mobilfunkmast<br />
Freistehende Fangstange<br />
im Dreibeinstativ<br />
DEHNiso-<br />
Distanzhalter<br />
DEHNiso-Combi<br />
Blitzschutzsysteme – Sichere Bereiche und Ex-Bereiche<br />
In allen Bereichen der Industrie, wo während der Verarbeitung<br />
oder dem Transport brennbare Stoffe, Gase, Dämpfe, Nebel oder<br />
Stäube entstehen, die im Gemisch mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre<br />
bilden, müssen zum Schutz gegen Explosionen besondere<br />
Maßnahmen getroffen werden.<br />
Abhängig von der Möglichkeit und der zeitlichen Dauer des Auftretens<br />
einer explosionsfähigen Atmosphäre werden die Bereiche der<br />
Ex-Anlage in Zonen eingeteilt, in so genannte Ex-Zonen. Dabei werden<br />
darin die Gefährdung durch direkte und indirekte Blitzschläge,<br />
die Schadensursachen, die zu schützenden Objekte und die anzuwendenden<br />
Schutzmaßnahmen berücksichtigt.<br />
Durch die steigende Komplexität der Anlagen nimmt auch die Notwendigkeit<br />
eines wirksamen Schutzes bei Blitzschlägen und Überspannungen<br />
zu.<br />
Eine Forderung nach Blitzschutzmaßnahmen von öffentlicher Seite,<br />
wie z. B. durch die Landesbauordnungen und die Betriebssicherheitsverordnungen,<br />
besteht für bauliche Anlagen mit explosionsgefährdeten<br />
Betriebsstätten, wie Lack- u. Farbfabriken, chemische Betriebe,<br />
größere Lager mit brennbaren Flüssigkeiten und größere<br />
Gasbehälter mit besonderer Brandgefährdung.<br />
Mit dem HVI ®-System ist es möglich, in den Ex-Zonen 1 und 2<br />
sowie auch in Zone 21 und 22 einen äußeren Blitzschutz zu errichten.<br />
Hohe Impulsspannungen verursachen ohne zusätzliche<br />
Schutzmaßnahmen Überschläge an Isolierstoffoberflächen. Dieser<br />
Effekt ist als Gleitüberschlag bekannt. Bei Überschreitung der Gleitentladungs-Einsatzspannung<br />
wird eine Oberflächenentladung initiiert,<br />
die problemlos eine Strecke von einigen Metern überschlagen<br />
kann. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI ®-Leitung mit<br />
einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe<br />
Stützrohr mit HVI ®-Leitung<br />
im Ex-Bereich<br />
HVI ®-Leitung<br />
Tele-Blitzschutzmast<br />
Freistehende Fangstange<br />
im Betonsockel<br />
Bild 3: Schutz der baulichen Anlage mit ausgewiesenen Ex-Zonen mittels HVI-Leitung zur Einhaltung von Trennungsabständen und Vermeidung von gefährlicher Funkenbildung<br />
in den Ex-Zonen 1 oder 2 bzw. 21 oder 22 (Dehn Conductor System)<br />
›Blitzimpulsspannungen gegen ein Bezugspotential‹ abzuleiten.<br />
Funktionsbedingt wird dazu im Bereich des Endverschlusses eine<br />
Verbindung des äußeren Spezialmantels mit dem Potentialausgleich<br />
des Gebäudes, der nicht von Teilen des Blitzstromes durchflossen<br />
ist, geschaffen.<br />
Dieser Anschluss an den Potentialausgleich kann z. B. an metallene,<br />
geerdete Dachaufbauten, die im Schutzbereich der Blitzschutzanlage<br />
liegen, an geerdete Teile der Gebäudekonstruktion,<br />
die nicht von Blitzströmen durchflossen werden, oder an den Schutzleiter<br />
des Niederspannungssystems erfolgen. Eine Verbindung des<br />
Spezialmantels mit Teilen des Blitzschutzsystems, wie Fangeinrichtung<br />
und anderen Ableitungen im Leitungsverlauf, ist unter bestimmten<br />
Voraussetzungen zulässig. Dabei ist zu beachten, dass der errechnete<br />
Trennungsabstand an der Kontaktstelle nicht größer als 35<br />
cm in Luft ist. Sonst muss der äußere Spezialmantel nochmals direkt<br />
mit dem blitzpotentialbehafteten Gegenstand über ein Potentialausgleichs-Anschlusselement<br />
verbunden werden. Die koaxial aufgebaute<br />
HVI ®-Leitung mit 20 mm Außendurchmesser in schwarzer<br />
Ausführung und 23 mm Außendurchmesser in grauer Ausführung<br />
besteht aus einem 19 mm 2 Kupferdraht, einer dickwandigen, hochspannungsfesten<br />
Isolierung und einem äußeren, witterungsbeständigen<br />
Spezialmantel. Um energieschwache Überschläge auf Grund<br />
von kapazitiven Verschiebeströmen zu vermeiden, kann die HVI ®-<br />
Leitung im Verlauf der Leitungsverlegung zusätzlich an den Potentialausgleich<br />
angeschlossen werden. Diese Anschlüsse müssen nicht<br />
blitzstromtragfähig ausgebildet werden, da die kapazitiven Verschiebeströme<br />
energiearm sind und nicht zu gefährlichen Funkenbildungen<br />
führen. Umfangreiche Messungen zeigen, dass die HVI ®-<br />
Leitung mit ihrer hohen Spannungsfestigkeit einem äquivalenten<br />
Trennungsabstand von s = 0,75 m (Luft) gleichgesetzt werden kann.<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 25
Seite 26 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
§<br />
Geschichte und Gegenwart<br />
des Explosionsschutzes in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung<br />
von Rainer Grätz und Volkmar Schröder<br />
Recht, Normen und Technik<br />
Bild 1: Hauptgebäude der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin<br />
Explosionsschutz in der Chemisch-<br />
Technischen Reichsanstalt<br />
Die Entwicklung der Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM), einer<br />
Bundesbehörde unter dem Dach des Bundeswirtschaftsministeriums,<br />
ist eng mit dem<br />
Explosionsschutz verbunden. Die Wurzeln<br />
des Explosionsschutzes in Deutschland liegen,<br />
wie auch in vielen anderen europäischen<br />
Ländern, im Bergbau. Grubenexplosionen,<br />
verursacht durch Methangas und<br />
Kohlenstaub, führten dazu, dass man sich der<br />
systematischen Erforschung von Explosionsgefahren<br />
zuwandte. Mit dem Einsatz neuer<br />
Sprengstoffe zum Ende des 19. Jahrhunderts<br />
häuften sich die Schlagwetterexplosionen,<br />
und in Preußen wurde eine staatliche<br />
›Schlagwetterkommission‹ [1] berufen.<br />
Erste Bergbauversuchsstrecken zur Tauglichkeitsprüfung<br />
von Sprengstoffen entstanden.<br />
So wurde bereits 1894 für den Steinkohlenbergbau<br />
im Ruhrgebiet in Dortmund-Derne<br />
eine größere Bergbauversuchsstrecke unter<br />
Leitung des Bergassessors CARL BEYLING<br />
eingerichtet. Eine weitere Bergbauversuchsstrecke<br />
mit dem Schwerpunkt ›Braunkohle‹<br />
wurde 1928 an der Bergakademie Freiberg/<br />
Sachsen in Betrieb genommen. Mit der zunehmenden<br />
wirtschaftlichen Bedeutung des<br />
Braunkohlenbergbaus und den Explosionsgefahren,<br />
die z.B. auch bei der Kohleverarbeitung<br />
in den Brikettfabriken vorkommen, entstand<br />
hier die Notwendigkeit, sich mit<br />
Maschinen und Einrichtungen für den Einsatz<br />
in explosionsgefährdeten Bereichen speziell<br />
zu beschäftigen [2].
Parallel zu den Aktivitäten im Bergbau gab<br />
es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in<br />
Deutschland auch Bemühungen zur Gewährleistung<br />
der Sicherheit in der sich schnell<br />
entwickelnden jungen chemischen Industrie.<br />
So gab es bereits seit 1880 Bemühungen zur<br />
Schaffung einer Reichsbehörde, die nach<br />
dem Vorbild der Physikalisch-Technischen<br />
Reichsanstalt (PTR) einerseits Aufgaben zur<br />
wissenschaftlichen Förderung der Chemie<br />
haben sollte, andererseits aber auch Regeln<br />
in der chemischen Sicherheitstechnik setzen<br />
konnte. Während EMIL FISCHER, WALTHER<br />
NERNST und WILHELM OSTWALD eine chemische<br />
Reichsanstalt zur Förderung ›nur mit<br />
großem Aufwand bestreitbarer wissenschaftlicher<br />
Aufgaben‹ forderten, empfahl im<br />
Jahr 1908 CARL ALEXANDER VON MARTIUS,<br />
Gründer der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation<br />
(AGFA), die Einrichtung einer gewerblich<br />
technischen Reichsbehörde: ›Je<br />
mehr Wissenschaft und Technik im sozialen<br />
Leben an Bedeutung gewinne, um so mehr<br />
tritt das Bedürfnis hervor, Normen zu schaffen,<br />
die die gewerbliche Tätigkeit zur vollen<br />
Entfaltung bringen, andererseits aber die berechtigten<br />
Interessen des Publikums und der<br />
Individuen vor Beeinträchtigung bewahren‹<br />
[3]. VON MARTIUS erkannte, bahnbrechend<br />
für die damalige Zeit, dass die Akzeptanz<br />
neuer Techniken in der Bevölkerung entscheidend<br />
vom sicheren Betrieb der Anlagen<br />
abhängt.<br />
So wurde für die Förderung der Forschung<br />
1911 in Berlin-Dahlem das Kaiser-Wilhelm-Institut<br />
für Chemie gebaut. Im Jahre 1920 folgte<br />
dann mit der Umwandlung des Militärversuchsamtes<br />
die Gründung der Chemisch-<br />
Technischen Reichsanstalt (CTR) in Berlin-<br />
Plötzensee. Die CTR war eine nachgeordnete<br />
Behörde des Reichsinnenministeriums und<br />
führte u.a. chemisch-technische Untersuchungen<br />
zur Unfallverhütung durch.<br />
Die damaligen Aufgaben der Reichsanstalt<br />
spiegelten sich im Arbeitsplan von 1921<br />
[3] wieder. Hier heißt es im Teil 1 ›Untersuchungen<br />
auf dem Gebiet der Unfallverhütung<br />
und des Arbeitsschutzes‹ u.a.:<br />
> Grundlegende experimentelle<br />
chemische Untersuchungen,<br />
> Versuche für die Ausarbeitung reichsgesetzlicher<br />
Vorschriften für Herstellung,<br />
Lagerung, Beförderung und Verwendung<br />
feuer- und explosionsgefährlicher Stoffe,<br />
> Prüfung der Handhabungs- und Transportsicherheit<br />
sowie der chemischen Beständigkeit<br />
von Bergwerkssprengstoffen,<br />
Treibmitteln, Zündmitteln und feuergefährlichen<br />
Stoffen, auch Flaschen mit komprimierten<br />
Gasen,<br />
> Untersuchung von Zelluloid im Hinblick<br />
auf die Brand- und Explosionsgefahr,<br />
> Überwachung explosionsgefährlicher Betriebe,<br />
> Aufklärung von Unfällen, die durch Brände<br />
und Explosionen entstanden.<br />
Im Jahr 1921, kurz nach ihrer Gründung, wurde<br />
die CTR mit der Aufklärung eines der<br />
größten Explosionsunfälle der bisherigen Industriegeschichte<br />
betraut. Am 21. September<br />
1921 wird das neue Oppauer Werk der Badischen<br />
Anilin- und Sodafabriken (BASF) von<br />
einer verheerenden Explosion verwüstet.<br />
Über 500 Menschenleben sind zu beklagen,<br />
Werk und Umgebung werden schwer zerstört.<br />
Bei Lockerungssprengungen in einem<br />
Lagerhaus mit zusammengebacktem Ammonsalpeter<br />
ist das Düngemittel explodiert.<br />
HERRMANN KAST, Leiter der Abteilung S<br />
›Sprengstoffe‹ der CTR, übernahm die Leitung<br />
bei der Aufklärung des Unfalls und veröffentlichte<br />
1924 in der Chemiker-Zeitung den Abschlussbericht.<br />
Bild 2: Walther Rimarski<br />
(1874 – 1963), Präsident<br />
der Chemisch-Technischen<br />
Reichsanstalt<br />
1937-1945<br />
Fragen zur Sicherheitstechnik und zum<br />
Explosionsschutz wurden in der Zeit vor dem<br />
zweiten Weltkrieg vorrangig in der Abteilung<br />
C für allgemeine Chemie bearbeitet. Hier war<br />
es vor allem WALTHER RIMARSKI, der, als<br />
Abteilungsleiter und Vorsitzender des Deutschen<br />
Acetylenvereins, das sich schnell entwickelnde<br />
neue Gebiet ›Acetylen, technische<br />
Gase und Schweißtechnik‹ integrierte [3].<br />
1937 wurde RIMARSKI Präsident der CTR und<br />
leitete die Reichsanstalt bis zu ihrer Auflösung<br />
1945.<br />
In der CTR wurden erstmals die im Explosionsschutz<br />
wichtigen sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen von brennbaren Gasen<br />
und Flüssigkeiten, wie Explosionsgrenzen,<br />
Flammpunkte, Zündtemperaturen usw., systematisch<br />
untersucht und in Form einer Datei<br />
archiviert. Vor dem 2. Weltkrieg wurde auch<br />
die CTR auf die Kriegswirtschaft ausgerichtet<br />
und war als Nachfolgerin des Militärversuchsamtes<br />
während des Krieges vorrangig<br />
für die Wehrmacht tätig. Wegen dieser Aufgaben<br />
musste die CTR auf Befehl der sowjetischen<br />
Besatzungsmacht 1945 ihre Tätigkeiten<br />
einstellen. Am 1. August 1945 erfolgte<br />
dann der vom Magistrat in Berlin bestätigte<br />
Zusammenschluss des Materialprüfungsamtes<br />
mit der Chemisch-Technischen<br />
Reichsanstalt in den Gebäuden des Materialprüfungsamtes<br />
in Berlin-Dahlem. �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 27
Geschichte und Gegenwart des Explosionsschutzes in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung<br />
Bild 3: Das ›Oppauer Loch‹. Verwüstetes Werk der BASF nach der Explosion von Düngemitteln im<br />
Jahr 1921 (Quelle: www.chemieonline.de/forum)<br />
Während des Krieges ging die Datei mit den<br />
für den Explosionsschutz erforderlichen sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen brennbarer<br />
Gase und Dämpfe in der CTR verloren.<br />
Der ehemalige Mitarbeiter der CTR, KARL<br />
NABERT, begann in der aus Berlin nach<br />
Braunschweig umgezogenen Physikalisch-<br />
Technischen Reichsanstalt die Daten erneut<br />
zusammenzustellen. Bereits 1950 war ein<br />
Vorentwurf des Tabellenwerkes fertiggestellt<br />
und 1953 erschien die erste Auflage der ›Sicherheitstechnischen<br />
Kennzahlen brennbarer<br />
Gase und Dämpfe‹ [4]. Das Tabellenwerk<br />
ermöglichte mit den sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen eine einheitliche<br />
Bewertung von Explosionsgefahren und bildete<br />
die stoffliche Grundlage für den Explosionsschutz<br />
in Regelwerken und Normen.<br />
Seite 28 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Explosionsschutz in der BAM<br />
Heute ist die BAM ein Wissenschaftsinstitut<br />
mit knapp 1800 Mitarbeitern und einem Etat<br />
von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Die<br />
Arbeitsinhalte sind bestimmt vom gesellschaftlichen<br />
Auftrag der Gewährleistung von<br />
Sicherheit in Technik und Chemie. Der Explosionsschutz<br />
ist seit langem ein Schwerpunkt<br />
in der Abteilung 2 ›Chemische Sicherheitstechnik‹<br />
der BAM. Dieser umfasst im Wesentlichen<br />
die Untersuchung und Bewertung<br />
> von gefährlichen Stoffen und Gütern,<br />
> von gefährlichen chemischen<br />
Reaktionen,<br />
> von Verfahren, Anlagen, Anlagenteilen<br />
und Sicherheitseinrichtungen für den Umgang<br />
mit gefährlichen Stoffen und Stoffsystemen.<br />
Als ein Teilgebiet der physikalischchemischen<br />
Sicherheitstechnik kann man<br />
den Explosionsschutz als die Summe der<br />
Schutzmaßnahmen bei ungewollten Oxidationsreaktionen<br />
mit nachfolgendem Anstieg<br />
von Temperatur und Druck betrachten. Im<br />
klassischen Sinn werden dabei atmosphärische<br />
Bedingungen mit dem Oxidationsmittel<br />
›Luft‹ betrachtet, im erweiterten Sinn aber<br />
auch Bedingungen in geschlossenen Systemen<br />
bei nicht-atmosphärischen Bedingungen.<br />
Explosionsschutz erstreckt sich daher<br />
von den stofflichen Eigenschaften über<br />
die Gemischausbreitung, die Zündquellenbeherrschung<br />
und Begrenzung der Explosionsauswirkungen,<br />
die Beschaffenheitsanforderungen<br />
an Geräte, Schutzsysteme und<br />
Anlagen bis hin zu den Betriebsvorschriften<br />
der Anlagensicherheit und des Transports<br />
gefährlicher Güter.
Arbeitsteilung mit der Physikalisch-<br />
Technischen Bundesanstalt<br />
Aufgrund der historischen Entwicklung<br />
werden die Grundlagen des Explosionsschutzes<br />
heute mit einer sinnvollen Aufgabenteilung<br />
in beiden Bundesanstalten bearbeitet.<br />
Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung<br />
im Rahmen des gemeinsamen Arbeitsschwerpunktes<br />
›Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik‹.<br />
In der PTB werden<br />
schwerpunktmäßig Fragen des Explosionsschutzes<br />
elektrischer Betriebsmittel, elektrische<br />
und mechanische Zündquellen sowie<br />
Fragen zum Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten<br />
bearbeitet, in der BAM brennbare<br />
Gase und Stäube. Darüber hinaus ist die physikalisch-chemische<br />
Sicherheitstechnik als<br />
Ganzes, also auch gefährliche chemische<br />
Reaktionen und Sprengstoffe, Schwerpunktaufgabe<br />
der BAM. Diese Aufgabenteilung<br />
wird über ein gemeinsames Lenkungsgremium<br />
von BAM und PTB koordiniert und hat<br />
sich seit vielen Jahren gut bewährt.<br />
Sicherheitstechnische Kenngrößen<br />
Wichtige Grundlage für die Ermittlung und<br />
Bewertung des Risikos von Explosionen sowie<br />
die Auswahl und Auslegung von Explosionsschutzmaßnahmen<br />
sind Kenntnisse relevanter<br />
sicherheitstechnischer Kenngrößen<br />
sowie ihrer Abhängigkeiten, insbesondere<br />
von Druck und Temperatur. Die Ermittlung sicherheitstechnischer<br />
Kenngrößen erfolgt in<br />
BAM und PTB ebenfalls arbeitsteilig. Die PTB<br />
konzentriert sich dabei auf die Ermittlung von<br />
Kenngrößen für brennbare Flüssigkeiten und<br />
Dämpfe, die BAM auf die Ermittlung von<br />
Kenngrößen für brennbare Gase und Stäube.<br />
1871<br />
1889<br />
1904<br />
1919<br />
1920<br />
1945<br />
1954<br />
1990<br />
Preußische Königliche<br />
Mechanisch-Technische<br />
Versuchsanstalt<br />
Königlich-preußisches<br />
Materialprüfungsamt<br />
Preußisches Staatliches<br />
Materialprüfungsamt<br />
Bild 4: Historische Wurzeln der BAM [5]<br />
Vereinigte Anstalten<br />
Preußische Zentralstelle<br />
für Explosivstoffe;<br />
Militärversuchsamt<br />
Chemisch-Technische<br />
Reichsanstalt (CTR)<br />
Bundesanstalt für mechanische und chemische Materialprüfung (BAM)<br />
Im Fachbereich 2.1 ›Gase, Gasanlagen‹<br />
der BAM werden folgende sicherheitstechnische<br />
Kenngrößen für brennbare Gase ermittelt:<br />
> Explosionsgrenzen,<br />
> Sauerstoffgrenzkonzentration,<br />
> Zündtemperatur,<br />
> Mindestzündenergie,<br />
> Normspaltweite,<br />
> Explosionsdruck und<br />
> Explosionsdruckanstiegsgeschwindigkeit.<br />
Deutsche Vereinigung, Restrukturierung der BAM<br />
Leitlinie: ›Sicherheit in Chemie- und Materialtechnik‹<br />
Für diese Untersuchungen stehen verschiedene<br />
Apparaturen zur Verfügung, die es ermöglichen,<br />
diese Kenngrößen sowohl für atmosphärische<br />
Bedingungen als auch für<br />
erhöhte Anfangsbedingungen (Drücke bis<br />
500 bar und Temperaturen bis 300 °C) zu bestimmen.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 29
Geschichte und Gegenwart des Explosionsschutzes in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung<br />
Für brennbare Stäube in abgelagerter und<br />
aufgewirbelter Form werden im Fachbereich<br />
2.2 die sicherheitstechnischen Kenngrößen<br />
bestimmt. Es handelt sich dabei um die<br />
> Selbstentzündungstemperatur und<br />
> die Mindestzündtemperatur des abgela-<br />
gerten Staubes (Glimmtemperatur)<br />
sowie um die<br />
> untere Explosionsgrenze,<br />
> die Sauerstoffgrenzkonzentration,<br />
> die Mindestzündenergie,<br />
> die Zündtemperatur,<br />
> den maximalen Explosionsdruck und<br />
> den maximalen zeitlichen Druckanstieg<br />
bzw. KSt-Wert für aufgewirbelte Stäube.<br />
Für die Bestimmung dieser Größen sind verschiedene<br />
Explosionsapparaturen (20 Liter<br />
und 1 m³), sowie eine modifizierte Hartmann-<br />
Apparatur, der BAM-Ofen und ein Godbert-<br />
Greenwald-Ofen verfügbar.<br />
In der gemeinsam von BAM, PTB und DE-<br />
CHEMA gepflegten Datenbank CHEMSAFE<br />
[6] werden die Kenngrößen erfasst und auf<br />
einfache Art für Anwender verfügbar gemacht.<br />
Ein wesentliches Merkmal von<br />
CHEMSAFE ist dabei, dass vor der Aufnahme<br />
der Stoffe in die Datenbank ein Bewertungsprozess<br />
durchgeführt wird, der für eine besondere<br />
Verlässlichkeit der abrufbaren Daten<br />
sorgt. Die Datenbank enthält bewertete sicherheitstechnische<br />
Kenngrößen von zurzeit<br />
3.600 brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und<br />
Stäuben und 810 Gemischen. Diese Daten liegen<br />
nicht nur für atmosphärische, sondern<br />
auch für nichtatmosphärische Bedingungen<br />
vor. In einem Tabellenbuch von BAM und<br />
PTB [7, 8], das an die Arbeiten von NABERT,<br />
SCHÖN und REDEKER [9] anknüpft, sind die<br />
wichtigsten Kenngrößen des Explosionsschutzes<br />
in Buchform zusammengefasst<br />
Seite 30 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
worden. Darüber hinaus stehen hier im Band<br />
2 ›Explosion Regions of Gas Mixtures‹ Explosionsdiagramme<br />
von Stoffsystemen vom Typ<br />
Brenngas/Inertgas/Oxidator zur Verfügung,<br />
die erweiterte Aussagen zur Inertisierung<br />
von explosionsfähigen Gemischen gestatten.<br />
Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre<br />
Eine wichtige Maßnahme zur Überwachung<br />
im primären Explosionsschutz ist der<br />
Einsatz von Gaswarngeräten. Der Fachbereich<br />
2.1 ›Gase, Gasanlagen‹ ist akkreditiertes<br />
Prüflaboratorium für die Prüfung der<br />
Messfunktion und der funktionalen Sicherheit<br />
von Gaswarngeräten zur Warnung vor<br />
gefährlichen Konzentrationen von brennbaren<br />
und/oder giftigen Gasen sowie Sauerstoff.<br />
Die vollständige Prüfung der Gaswarngeräte,<br />
die sowohl die Messfunktion als ihre<br />
Eigenschaft als elektrisches Gerät betrifft, erfolgt<br />
in Kooperation mit der PTB. Dort finden<br />
alle Prüfungen zur elektrischen Zündquellensicherheit<br />
an diesen Geräten statt.<br />
Vermeidung von Zündquellen an<br />
nichtelektrischen Geräten<br />
In mechanischen Geräten, wie Getrieben,<br />
Pumpen, Rührwerken oder dynamischen<br />
Dichtungen können im Fall von technischen<br />
Defekten durch Schlagvorgänge oder durch<br />
kontinuierliche metallische Reibung wirksame<br />
Zündquellen entstehen. Die Zündfähigkeit<br />
mechanisch erzeugter Funken hängt von<br />
einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab, wie<br />
z. B. von der kinetischen Schlagenergie bzw.<br />
der Schleifgeschwindigkeit, der Geometrie<br />
der Schlag- bzw. Schleifpartner, dem An-<br />
pressdruck der Schleifpartner, der Kinematik,<br />
den Werkstoffen, der Oberflächenbeschaffenheit,<br />
ggf. dem Grad der Verrostung und<br />
der Zusammensetzung des explosionsfähigen<br />
Gemisches, auch innerhalb einer Gasgruppe.<br />
Im Fachbereich 2.1 ›Gase, Gasanlagen‹<br />
werden in enger Abstimmung mit der<br />
PTB seit langem Untersuchungen mit Schlag-<br />
und Schleiffunkenapparaturen unter unterschiedlichen<br />
explosionsfähigen Brennstoff/<br />
Luft-Gemischen durchgeführt. In der BAM<br />
werden dabei überwiegend wissenschaftliche<br />
Untersuchungen zu Schlagfunken, in<br />
der PTB zu Reib- und Schleiffunken durchgeführt.<br />
Folgende Parameter können an den<br />
Anlagen in der BAM variiert werden:<br />
> Werkstoffpaarung,<br />
> Schlagenergie,<br />
> Schleifgeschwindigkeit und<br />
Anpressdruck,<br />
> Brenngas/Luft-Gemisch.<br />
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden<br />
die Grundlage für die Beurteilung mechanischer<br />
Zündgefahren an Geräten, Gerätebaugruppen,<br />
Anlagen und Anlagenteilen.<br />
Ferner fließen die Ergebnisse in die europäische<br />
und internationale Normung ein (z.B.<br />
EN 1127-1 [10], EN 13463-1 [11], EN 14986<br />
[12]). Die vorhandenen Versuchsapparaturen<br />
erlauben weiterhin die Untersuchung von<br />
kundenspezifischen Materialpaarungen auf<br />
die Wahrscheinlichkeit der Entstehung mechanisch<br />
erzeugter Funken und deren Zündwahrscheinlichkeit<br />
unter vom Kunden vorgegebenen<br />
Randbedingungen.
Konstruktiver Explosionsschutz<br />
Relativ kleine Explosionen können oft<br />
durch nachfolgende Brände und Versagen<br />
von Gebäudestrukturen zu großen Schäden<br />
führen. Solche Ereignisketten und Folgeschäden<br />
sind vermeidbar, wenn die beginnende<br />
Explosionsausbreitung innerhalb von Behältern<br />
und anderen Umschließungen beherrscht<br />
werden kann. Technische Maßnahmen,<br />
die anlaufende Explosionen auf ein<br />
unbedenkliches Maß begrenzen, sind zum<br />
Beispiel:<br />
> Entkopplungsmaßnahmen wie<br />
Flammensperren,<br />
> explosionsdruckfeste Bauweise,<br />
> Explosionsdruckentlastung,<br />
> Explosionsunterdrückung.<br />
Die BAM beschäftigt sich in diesem Zusammenhang<br />
speziell mit Fragen der Ausbreitung<br />
von Deflagrationen und Detonationen in<br />
Rohrleitungen, der Druckentlastung von Gasexplosionen<br />
und der Untersuchung von<br />
Staubexplosionen und der Staubexplosionsentlastung.<br />
Die Untersuchung der Ausbreitung von Deflagrationen<br />
und Detonationen in Rohrleitungen<br />
erfolgt mit der Zielrichtung der Verbesserung<br />
der Grundlagen für die Auslegung<br />
und Prüfung von Flammendurchschlagsicherungen.<br />
Schwerpunkt dieser Arbeiten sind einerseits<br />
Untersuchungen zum Umschlag von<br />
Deflagrationen zu Detonationen und andererseits<br />
zum Einfluss von Einbauten auf die Ausbreitung<br />
von Explosionen in Rohrleitungen.<br />
Die Entlastung von Gasexplosionen ist ein<br />
Untersuchungsgegenstand, dem sich die<br />
BAM seit einigen Jahren widmet. Mit Explosionsdruckentlastungseinrichtungen<br />
kann<br />
das Bersten von Apparaten, Behältern und<br />
Rohrleitungen im Falle einer Explosion ver-<br />
Bild 5: Freifläche für Deflagrations- und Detonationsversuche in Rohren<br />
hindert werden. Ein Kernproblem für die Auslegung<br />
von Druckentlastungsflächen ist die<br />
Berücksichtigung von Turbulenz erzeugenden<br />
Einbauten.<br />
Weitere wichtige Schwerpunkte sind die<br />
Untersuchung von Staubexplosionen und die<br />
Staubexplosionsentlastung. Etwa 80 % aller<br />
Schüttgüter sind brennbar. Schüttgutbrände<br />
sowie Staubexplosionen treten deshalb in<br />
nahezu allen Industriezweigen sowie bei<br />
Transport, Umschlag und Lagerung von<br />
Schüttgütern auf. Die Untersuchung der sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen brennbarer<br />
Stäube sowie – darauf aufbauend – die<br />
Anwendung von Maßnahmen des Explosionsschutzes<br />
in Industrieanlagen dienen dem<br />
Schutz von Menschen, Sachwerten und der<br />
Umwelt. Zur Untersuchung dieser Themen<br />
stehen in der BAM neben Anlagen auf dem<br />
Stammgelände in Berlin-Lichterfelde auch<br />
Großversuchseinrichtungen auf dem ›Testgelände<br />
Technische Sicherheit (TTS)‹ in Horstwalde<br />
(60 km südlich von Berlin) zur Verfügung.<br />
Dort befindet sich ein Prüffeld zur Untersuchung<br />
von Brand- und Explosionsgefahren.<br />
Die Versuchseinrichtungen auf dem Prüffeld<br />
umfassen im Einzelnen:<br />
> Gebäude für Versuche mit Sauerstoff,<br />
> Technikgebäude,<br />
> Versuchsbunker mit Detonationsrohrstrecke,<br />
> Freifläche für Versuche mit Sauerstoff<br />
unter hohem Druck,<br />
> Betonplatte für Explosionsversuche,<br />
> Versuchsbunker,<br />
> Beobachtungsturm,<br />
> Siloversuchsstand,<br />
> Rohrstreckenprüfstand.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 31
Geschichte und Gegenwart des Explosionsschutzes in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung<br />
Bild 6: Silo zur Untersuchung von<br />
Staubexplosionen<br />
Seite 32 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Tätigkeiten der BAM als ›Benannte Stelle‹<br />
nach Richtlinie 94/9/EG<br />
Beschaffenheitsanforderungen an Produkte,<br />
die Explosionsschutzanforderungen zu<br />
erfüllen haben, werden durch die Europäische<br />
Richtlinie 94/9/EG [13] geregelt. Diese<br />
Europäische Richtlinie erfasst sowohl elektrische<br />
als auch nichtelektrische Geräte. Die<br />
Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland<br />
erfolgte durch die 11. Verordnung zum Geräte-<br />
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung)<br />
vom 12. Dezember<br />
1996 (BGB1.I S. 1914), die zuletzt durch Artikel<br />
21 des Gesetzes vom 8. November 2011<br />
(BGB1. A S. 2178) geändert worden ist [14].<br />
Wesentlicher Inhalt dieser Verordnungen<br />
und der Europäischen Richtlinie 94/9/EG sind<br />
die Begriffsdefinitionen für Geräte, Schutzsysteme<br />
und Komponenten, das System der<br />
Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung,<br />
sowie die grundlegenden Sicherheits-<br />
und Gesundheitsanforderungen.<br />
Seit 1997 ist die BAM als ›Benannte Stelle‹<br />
mit der Kennnummer 0589 im System der<br />
Konformitätsbewertung von Produkten im<br />
Geltungsbereich der Richtlinie 94/9/EG tätig.<br />
Die BAM ist notifiziert für die entsprechenden<br />
Konformitätsbewertungsverfahren<br />
(EG-Baumusterprüfung, Qualitätssicherung<br />
Produktion, Qualitätssicherung Produkte) für<br />
nichtelektrische Geräte, Gaswarngeräte und<br />
Flammendurchschlagsicherungen. Weiterhin<br />
bietet die BAM als ›Benannte Stelle‹ Herstellern<br />
nichtelektrischer Geräte der Gerätegruppen<br />
I und II, Gerätekategorie M2 und 2 eine<br />
Annahme und Aufbewahrung der Unterlagen<br />
im Rahmen des Moduls der internen Fertigungskontrolle<br />
an.<br />
Mitarbeit in nationalen und internationalen<br />
Gremien des Explosionsschutzes<br />
Als Ressortforschungseinrichtung der<br />
Bundesregierung hat die BAM, wie auch die<br />
PTB, die spezifische Aufgabenstellung zwischen<br />
den Interessen der Wirtschaft und der<br />
Gesellschaft zu vermitteln. Ein wesentlicher<br />
Bestandteil dieser Funktion ist die Beratung<br />
der Bundesregierung in sicherheitstechnischen<br />
Gremien.<br />
Dazu gehören u. a. der Ausschuss für Betriebssicherheit<br />
(ABS) und der Ausschuss für<br />
Gefahrstoffe (AGS) des Bundesministeriums<br />
für Arbeit und Soziales (BMAS), der Ausschuss<br />
Gefahrgutbeförderung (AGGB) und<br />
der Gefahrgut-Verkehrs-Beirat beim Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
(BMVBS) sowie die Kommission für<br />
Anlagensicherheit (KAS) des Bundesministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
(BMU) mit diversen Untergremien.<br />
Vertreter der BAM arbeiten weiterhin in regelsetzenden<br />
Gremien der Berufsgenossenschaften<br />
mit und beraten darüber hinaus<br />
auch die Gewerbe- und Marktaufsicht der<br />
Bundesländer sowie andere Behörden, aber<br />
auch Hersteller explosionsgeschützter Geräte<br />
und Betreiber überwachungsbedürftiger<br />
Anlagen. Auch im Explosionsschutz nimmt,<br />
wie in vielen anderen Branchen, die Bedeutung<br />
des internationalen Marktes immer<br />
mehr zu. Auf Grund ihres großen Exportanteils<br />
sind insbesondere die deutschen Unternehmen<br />
des Maschinen- und Anlagenbaus<br />
sehr stark vom globalen Handel mit technischen<br />
Produkten und Ingenieurdienstleistungen<br />
abhängig. Daher spielt die europäische<br />
und internationale Normung eine<br />
immer größere Rolle. Wesentlich sind dabei
die harmonisierten Europäischen Normen,<br />
die die Vermutung der Erfüllung bezüglich<br />
europäischer Richtlinien auslösen. Das betrifft<br />
für nichtelektrische Geräte, Schutzsysteme<br />
und sicherheitstechnische Kenngrößen<br />
insbesondere die Normen von CEN/TC<br />
305 ›Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz‹<br />
mit ihrer Vermutungswirkung in<br />
Bezug auf die Richtlinie 94/9/EG. Während<br />
die Normen des Explosionsschutzes elektrischer<br />
Betriebsmittel inzwischen nahezu ausschließlich<br />
auf IEC-Ebene erarbeitet werden,<br />
beginnt dieser Prozess gerade im IEC/SC<br />
31M ›Non-electrical equipment and protective<br />
systems for explosive atmospheres‹, das<br />
ISO Normen auf diesem Gebiet erarbeitet<br />
[15]. Mitarbeiter der Abteilung ›Chemische<br />
Sicherheitstechnik‹ der BAM arbeiten in Zusammenarbeit<br />
mit Mitarbeitern der PTB auf<br />
allen Ebenen des Normungsprozesses in<br />
fachlichen und leitenden Funktionen mit. Dabei<br />
werden von ihnen sicherheitstechnische<br />
und technologische Grundsätze vertreten,<br />
wie sie in Deutschland und Europa über Jahre<br />
entwickelt wurden. Damit werden auch<br />
die vielen klein- und mittelständischen Betriebe,<br />
die sich selber nicht an der internationalen<br />
Normung beteiligen können, unterstützt.<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />
in PTB und BAM zu den Eigenschaften explosionsfähiger<br />
Atmosphären, über Zündquellen<br />
sowie zum Ablauf von Explosions- und Detonationsvorgängen<br />
unterstützen als pränormative<br />
Forschung die Normungs-und Regelwerksarbeiten<br />
oder bilden Grundlagen für<br />
technische Entwicklungen.<br />
Literatur<br />
[1] Archive in Nordrheinwestfalen, http://www.archive.nrw.de<br />
[2] A. Pärnt ›IBExU – 80 Jahre Tradition im Explosionsschutz für Industrieanlagen‹,<br />
R.STAHL Ex-<strong>Zeitschrift</strong> 2009, S. 13 – 19<br />
[3] Walter Ruske: 100 Jahre Materialprüfung in Berlin, Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin, 1971<br />
[4] K. Nabert und G. Schön: Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe, Deutscher<br />
Eichverlag Braunschweig, 1953<br />
[5] W. Ruske, G. Becker, H.Czichos: Die Chronik 1871 – 1996, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven, 1996<br />
[6] DECHEMA, BAM und PTB: CHEMSAFE, eine Datenbank mit bewerteten sicherheitstechnischen<br />
Kenngrößen, Frankfurt/a.M., Update 2011<br />
[7] E. Brandes und W. Möller: Safety Characteristic Data,<br />
Volume 1: Flammable Liquids and Gases, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven, 2008<br />
[8] M. Molnarne, Th. Schendler und V. Schröder: Safety Characteristic Data,<br />
Volume 2: Explosion Regions of Gas Mixtures, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven, 2008<br />
[9] T. Redeker und G. Schön: 6. Nachtrag zu Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und<br />
Dämpfe, Deutscher Eichverlag Braunschweig, 1990<br />
[10] DIN EN 1127-1 Explosionsfähige Atmosphären –<br />
Explosionsschutz Teil 1: Grundlagen und Methodik, Deutsche Fassung EN 1127-1:2011<br />
[11] DIN EN 13463-1 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
Teil 1: Grundlagen und Anforderungen; deutsche Fassung EN 13463-1:2009<br />
[12] DIN EN 14986 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen;<br />
deutsche Fassung EN 14986:2007<br />
[13] Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften<br />
der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in<br />
explosionsgefährdeten Bereichen vom 23. März 1994 (ABl. EG vom 19.04.1994 Nr. L 100 S. 1;<br />
ABl. EG vom 10.10.1996 Nr. L 257 S. 44; ABl. EG vom 26.01.2000 Nr. L 21 S. 42) zuletzt geändert am<br />
29. September 2003 durch Anhang I Nr. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003<br />
(ABl. EU vom 31.10.2003 Nr. L 284 S. 1)<br />
[14] Elfte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (11. GPSGV) vom 12. Dezember 1996<br />
(BGBl. I Nr. 65 vom 19.12.1996 S. 1914) zuletzt geändert am 6. Januar 2004 durch Artikel 18 des<br />
Gesetzes zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten<br />
(BGBl. I Nr. 1 vom 09.01.2004 S. 2)<br />
[15] M. Beyer, H. Bothe und T.Schendler ›Physikalisch-Chemische Sicherheitstechnik und Explosionsschutz<br />
in PTB und BAM‹, PTB-Mitteilungen 1/2011<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 33
Seite 34 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
>><br />
Mobile Anlage<br />
zur organophilen Nanofiltration<br />
von Marcel Franowski und Wolfgang Möller<br />
Anwendungsberichte<br />
Bild 1: Vereinfachtes R&I Fließbild der organophilen Nanofiltrationstestanlage<br />
Die Nanofiltration ist ein druckgetriebenes Membrantrennverfahren,<br />
angesiedelt zwischen Ultrafiltration und Umkehrosmose, das<br />
für wässrige Medien bereits industriell im Einsatz ist. Dabei werden<br />
Partikel (feindisperse Gemische oder echte Lösungen) aufgrund ihrer<br />
Größe oder Ladungseigenschaften abgetrennt. In der Vergangenheit<br />
realisierte das Unternehmen Andreas Junghans, Anlagenbau und<br />
Edelstahlbearbeitung in Frankenberg/Sachsen bereits eine Reihe von<br />
Nanofiltrationsanlagen zur Aufbereitung von speziellen Industrieabwässern<br />
mittels Membranen aus keramischen Werkstoffen. Dabei<br />
nutzte man die Vorteile des Keramikwerkstoffes für die Aufbereitung<br />
von stark alkalischen Waschbädern, wie auch von heißen Abwässern.<br />
Ein bis dahin noch weitgehend ungenutztes Potential, die Beständigkeit<br />
gegenüber organischen Lösemitteln, wurde mit der Substratgewinnung<br />
durch Diafiltration aus N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) erstmalig<br />
tangiert.
Anwendung<br />
Die Stofftrennung im nicht-wässrigen Bereich mittels Nanofiltration<br />
stellt derzeit nur einen vernachlässigbaren Anteil dar gegenüber<br />
anderen Trennverfahren, wie Destillation, Rektifikation oder Adsorption.<br />
Jedoch bestechen die Vorteile dieses Verfahrens. Da<br />
während der Filtration kein Phasenübergang stattfindet, benötigt man<br />
weniger Energie. Zudem ist es aufgrund geringer Temperaturen schonender<br />
für die abzutrennenden Partikel, speziell wenn es sich um empfindliche<br />
Substrate handelt.<br />
Diese Eigenschaften spielen eine wichtige Rolle in der chemischen<br />
Prozessindustrie, wo der Einsatz für das Recycling von organischen<br />
Lösemitteln, der Rückgewinnung von teuren Katalysatoren,<br />
der Fraktionierung von Stoffgemischen, der Aufkonzentrierung bestimmter<br />
Substanzen und eventuell anschließender Lösemittelsubstitution,<br />
durchaus denkbar wäre.<br />
In der pharmazeutischen Industrie können mit Hilfe der organophilen<br />
Nanofiltration bestimmte Proteine, Antibiotika, Vitamine oder<br />
Polysaccharide ›sanft‹ separiert werden.<br />
Somit ist neben der Verminderung des Abfallstromes ein hohes<br />
Wertschöpfungspotential mit dieser Technologie verbunden.<br />
Ausführung<br />
Die Aufgabenstellung eines belgischen Forschungsinstitutes,<br />
den Bau einer Filtrationstestanlage für den Betrieb mit organischen<br />
Lösemitteln, konnte von der Firma Andreas Junghans mit Unterstützung<br />
für den Explosionsschutz durch R. STAHL erfolgreich umgesetzt<br />
werden.<br />
Neben der Ex-Schutz Problematik (Ex II 2/3G IIB T4) musste die<br />
Anlage den GMP Regularien entsprechen, einen maximalen Betriebsdruck<br />
von 60 bar aufweisen und zudem ortsveränderlich sein, um an<br />
unterschiedlichen Einsatzorten arbeiten zu können. Folglich entschied<br />
man sich, die Anlage so kompakt wie möglich zu gestalten, wobei auch<br />
der Schaltschrank auf dem mobilen Rahmen installiert ist.<br />
Zur Realisierung des Explosionsschutzes wurden unterschiedliche<br />
Zündschutzarten eingesetzt. Da es sich bei der benötigten Anlage<br />
um eine Einzelanfertigung für den Einsatz im explosionsgefährdeten<br />
Bereich handelt und der Aufbau der Steuerung adäquat zu einer Steuerung<br />
im sicheren Bereich erfolgen sollte, wurde die Zündschutzart<br />
Überdruckkapselung Ex p für den Schaltschrank gewählt. Als zusätzliche<br />
Vorteile der Zündschutzart Ex p sind in dieser Anwendung das<br />
geringere Gewicht, sowie die Möglichkeit einer zusätzlichen Abfuhr<br />
von Verlustwärme durch den Einsatz eines Vortex-Kühlers zu sehen.<br />
Bei der Überdruckkapselung kann die gesamte Steuerung mit<br />
normalen Industriekomponenten aufgebaut werden. Im Inneren des<br />
Ex p-Gehäuses wird mit Hilfe eines inerten Gases ein ex-freier Raum<br />
geschaffen. Hierfür wird ein innerer Überdruck im mbar-Bereich erzeugt,<br />
der das Eindringen von explosionsfähiger Atmosphäre in das<br />
Gehäuse verhindert. Dieser Überdruck wird permanent von dem eingesetzten<br />
Steuergerät aufrechterhalten und überwacht. Die Zufuhr<br />
des Inertgases erfolgt über ein am Gehäuse befindliches Digitalventil.<br />
Bei einer Unterschreitung des eingestellten Schwellwertes wird zu-<br />
Bild 2: Vorderansicht der Nanofiltrationsanlage<br />
erst das Lufteinlassventil geöffnet, um den Druckverlust wieder auszugleichen.<br />
Sollte der gemessene Druckwert weiterhin unter dem<br />
Schwellwert liegen, so erfolgt abhängig von der definierten Ex-Zone<br />
entweder eine sofortige Abschaltung (Zone 1) oder mindestens eine<br />
Alarmierung des Betreibers (Zone 2).<br />
Vor der Inbetriebnahme eines Ex p geschützten Schaltschrankes<br />
muss dieser zusätzlich mittels Inertgas gespült werden, um eine<br />
eventuell vorhandene explosionsfähige Atmosphäre im Schrankinneren<br />
zu entfernen. Das benötigte Spülvolumen beträgt ein Mehrfaches<br />
des Schrankvolumens und wird über ein Messverfahren, gemäß den<br />
Vorgaben der DIN EN 60079-2, ermittelt und dokumentiert.<br />
Konzipiert wurde die Anlage für Keramik- und Polymermembranen<br />
gleichermaßen. Die unterschiedlichen Filtrationsmodule<br />
können durch zwei Kreisläufe separat voneinander betrieben werden.<br />
Der Druck in der Anlage wird durch eine Verdrängerpumpe erzeugt,<br />
wobei ein Regelventil einen Teil des Retentatstroms zurück in den Vorlagebehälter<br />
überführt. Über dieses Regelventil kann der genaue Betriebsdruck<br />
der Anlage eingestellt werden. Um Ablagerungen auf der<br />
Membran zu vermeiden, wird durch eine zweite Pumpe ein Volumenstrom<br />
quer zur Filtrationsrichtung erzeugt, der einerseits eine Scherwirkung<br />
erzielen soll und anderseits eine Umwälzung des Stoffgemisches<br />
bewirkt, die eine Aufkonzentrierung an der<br />
Membranoberfläche verhindert. Mit der Erfassung des Volumenstromes<br />
durch einen Coriolis-Massedurchflussmesser wird die Drehzahl<br />
des Pumpenmotors geregelt, um den einstellbaren Sollwert zu<br />
erreichen. Die durch die Membran permeierende Flüssigkeit (Permeat)<br />
gelangt nach der Messung des Durchflusses in einen externen Behälter<br />
oder kann zurück in den Vorlagetank geführt werden, um im Kreislaufbetrieb<br />
zu fahren.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 35
Mobile Anlage zur organophilen Nanofiltration<br />
Bild 3: Überdruckgekapselter Schaltschrank in Zündschutzart Ex p<br />
Die Bedienung der Anlage ist halbautomatisch und erfolgt mittels<br />
eines berührungssensitiven Bildschirms von R. STAHL HMI Systems,<br />
welcher direkt in den Schaltschrank integriert ist. Die Visualisierung<br />
des Prozesses basiert auf WinCC flexible, das von der<br />
verwendeten Siemens SPS und auch dem R. STAHL HMI MT436 genutzt<br />
wird.<br />
Der innere Aufbau dieser HMI-Terminals der Serien ET und MT<br />
ist so ausgeführt, dass diese Geräte ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen<br />
in überdruckgekapselten Gehäusen für die Ex-Zone 1<br />
(Serie ET) bzw. die Ex-Zone 2 (Serie MT) eingesetzt werden können.<br />
Hierbei ist natürlich auch die volle Funktionalität des Touchscreens<br />
weiterhin gegeben.<br />
Alle regelbaren Betriebs- und Alarmparameter können über den<br />
Bildschirm eingegeben werden. Dabei unterscheidet die Steuerung<br />
vier unterschiedliche Berechtigungslevel der Bediener, um eine maximale<br />
Sicherheit zu gewährleisten. Der Betrieb erfolgt in Schritten, die<br />
nacheinander ausgeführt werden müssen. Die Filtration kann entweder<br />
als batchweises Aufkonzentrieren der Flüssigkeit im Vorlagetank<br />
oder mit kontinuierlicher Nachförderung (Option der Diafiltration)<br />
durchgeführt werden.<br />
Den hohen Anforderungen der GMP Richtlinie bezüglich der<br />
Totraumfreiheit und Oberflächengüte der produktberührenden Teile<br />
wurde durch die Verwendung von speziellen Verbindungsfittings, automatisierten<br />
Schweißverfahren und einer hohen Fertigungsqualität<br />
Rechnung getragen. Sämtliche produktberührende Teile der Anlage<br />
sind aus Edelstahl 1.4404 / 1.4435 gefertigt, als Dichtungswerkstoffe<br />
wurden FFKM und FEP-ummantelte O-Ringe eingesetzt (FFKM: Perfluorkautschuk;<br />
FEP: Perfluorethylenpropylen-Copolymer).<br />
Die besonders in der Pharmaindustrie wichtige validierbare<br />
Archivierung der Betriebsparameter war ein weiteres Kriterium. Die<br />
Daten (Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand) werden fortdauernd<br />
an mehreren Stellen erfasst und in einer Datenbank gespeichert, die<br />
nur autorisiertem Personal zur Verfügung steht.<br />
Um bei externem Ausfall des Stromversorgungsnetzes diese Daten<br />
nicht zu verlieren, sollte eine Spannungsversorgung implementiert<br />
werden, die im Notfall zumindest die Versorgung des Panel PCs sicherstellt,<br />
um die gewonnenen Daten nicht zu verlieren.<br />
Seite 36 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Die Forderungen an die USV-Anlage waren:<br />
Während des normalen Betriebs in Ex-Atmosphäre werden die<br />
notwendigen Batterien geladen, um bei einem Spannungsausfall für<br />
einen Zeitraum von ca. 60 Minuten die Versorgung des Panel PCs sicherzustellen.<br />
Eine Integration in den überdruckgekapselten Schrank<br />
ist nicht möglich, da Batterien weder in Ex p noch in Ex d Gehäusen<br />
eingebaut werden dürfen. Es sind spezielle zugelassene Batteriegehäuse<br />
notwendig.<br />
Abschließend ist festzustellen, dass durch die Zusammenführung<br />
der Fachkompetenzen der Firmen Andreas Junghans und<br />
R. STAHL eine für den Betreiber optimal angepasste Anlage realisiert<br />
werden konnte.<br />
Derzeit werden unterschiedliche Anwendungen durch den Betreiber<br />
intensiv getestet und sollen, nach einem erfolgreichen Abschluss<br />
der Testreihen, in der Industrie etabliert werden.<br />
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Filtrationstechnik<br />
erschließen der chemischen und pharmazeutischen Industrie<br />
neue, sehr wirtschaftliche und umweltschonende Produktionsmöglichkeiten,<br />
für die es nun auch eine Bauform für explosionsgefährdete<br />
Bereiche gibt.<br />
Literatur<br />
Klaus Ohlrogge: Membranen: Grundlagen, Verfahren und industrielle<br />
Anwendungen<br />
DIN EN 60079-2: Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 2: Geräteschutz durch<br />
Überdruckkapselung ›p‹<br />
DIN IEC 62 040-1-1,1-2 / VDE 0558 Teil 511, 512: Unterbrechungsfreie<br />
Stromversorgung (USV) Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen
Anwendungsberichte<br />
Containersystem Ex p<br />
– optimierte Lösung für die Öl- und Gasindustrie<br />
von Jos Abbing<br />
Bild 1: Transport von zwei Containern für eine Ölförderungsanlage<br />
Die aktuelle Situation in der Öl- und Gasindustrie<br />
Die Weltbevölkerung wächst ständig und wird von heute 6,5<br />
Milliarden auf 9 Milliarden Menschen in 2050 ansteigen. Das bringt<br />
ein ähnliches Wachstum unseres Energiebedarfs mit sich. Sicherlich<br />
werden energiesparende Techniken einen gewissen Einfluss haben,<br />
dennoch wird geschätzt, dass der Energiebedarf von etwa 550 EJ<br />
heute bis auf mehr als 700 EJ im Jahr 2030 steigen wird.<br />
Globale, europaweite und nationale Planungen zeigen einen Anteil<br />
von 10% bis 25% Primärenergie aus erneuerbaren Energien bis 2030.<br />
Die Anteile von traditionellen Energiequellen aus nicht erneuerbaren<br />
Ressourcen, wie Kohle, Öl und Gas, werden stabil bleiben oder sogar<br />
noch leicht steigen. Besonders bei Erdgas wird noch eine Steigerung<br />
erwartet.<br />
Werfen wir einen Blick auf diese konventionellen Energiequellen<br />
mit dem Schwerpunkt auf Öl und Gas. Es ist eine Tatsache, dass<br />
die größten Öl- und Gasreserven in den letzten 40 Jahren bereits<br />
entdeckt wurden. Die Hauptreserven sind auf kleinere und mittlere<br />
Vorkommen verteilt. Abbaubare Öl- und Gasreserven liegen in Nordeuropa,<br />
Nordwesteuropa, im Nahen Osten, in Afrika, Nordamerika<br />
und Asien.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 37
Containersystem Ex p – optimierte Lösung für Öl- und Gasanlagen<br />
Bild 2: Anteile der Rohölsorten an den Fundstellen<br />
Bild 3: Erdölbohrturm in einer rauen Gegend in Sibirien<br />
Seite 38 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Ein Blick auf die Art der Ölreserven zeigt:<br />
> 30% Konventionelles Öl,<br />
> 30 % Ölsand (Bitumen),<br />
> 25% Extraschweres Öl,<br />
> 15% Schweröl.<br />
Der Aufwand und der Einsatz von besonderen Techniken sowie<br />
die Schwierigkeiten beim Abbau des nicht-konventionellen Teils<br />
der Öl- und Gasreserven steigen und erfordern spezielle, z.B. zielgenaue<br />
Bohrverfahren und Tiefseebohrungen.<br />
Die örtliche Lage der Bohrlöcher wird immer extremer: kältere,<br />
wärmere und abgelegenere Orte lassen die Produktionskosten weiter<br />
steigen. Dies wird durch die Anzahl aller Bohrplattformen und<br />
Bohrinseln zwischen 1996 und 2011 veranschaulicht. Sie lag in den<br />
neunziger Jahren bei etwa 2000. Bis November 2011 stieg sie bis auf<br />
über 3.500.<br />
Wir können daher erwarten, dass die Anzahl der Bohrlöcher in<br />
den nächsten 20 Jahren steigen wird, da erneuerbare Energien noch<br />
keine hundertprozentige Alternative darstellen.<br />
Gemeinsam finden wir eine Lösung!<br />
In allen Bereichen braucht die Öl- und Gasindustrie qualifizierte<br />
und erfahrene Mitarbeiter. Der Öl- und Gasverbrauch wird also<br />
weiterhin wachsen und immer anspruchsvollere Fördertechniken erfordern.<br />
Die Industrie muss für diese Fördertechniken erhebliche<br />
Mittel investieren, um die momentane Produktionsmenge aufrechtzuerhalten<br />
und sogar noch zu steigern. Das Durchschnittsalter der<br />
Mitarbeiter in diesem Sektor liegt bei etwa 55 Jahren. Das bedeutet,<br />
dass ein Großteil davon in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den Ruhestand<br />
gehen wird. Dazu kommt die Tatsache, dass der Öl- und<br />
Gassektor bekannt ist für die raue Arbeitsumgebung, was es noch<br />
schwieriger macht, junge Fachkräfte anzuwerben.<br />
Der Öl- und Gassektor braucht erfahrene, qualifizierte und verantwortungsvolle<br />
Lieferanten. R. STAHL und Electromach werden innerhalb<br />
der R. STAHL-Gruppe diesen wachsenden Anforderungen<br />
für Ex-, NEC-, ATEX- und IEC Ex-Geräte und -Lösungen tagtäglich gerecht.<br />
Auf Erfahrung beruhende Systemlösungen, Systemfähigkeit<br />
und Verantwortungsbewusstsein werden immer wichtiger, eine Rolle,<br />
die wir seit über 50 Jahren mit Begeisterung angenommen haben<br />
und ausfüllen.<br />
Historischer Ansatz für Schutzräume und abgesetzte Instrumenten-<br />
Gebäude<br />
Der historische Ansatz für auf verschiedene Beteiligte verteilte<br />
Schutzräume für Betriebsmittel, wie z.B. örtliche Unternehmen<br />
für Energieversorgungsgebäude, elektrische Anlagen, Steuerungshersteller,<br />
Systemintegratoren und nicht zuletzt Zertifizierungsprüfung,<br />
trägt dazu bei, autonome, vormontierte oder Einzelgeräteanlagen<br />
zur anspruchsvollen Projektmanagementaufgabe zu machen,<br />
ungeachtet der verteilten Verantwortung für den Explosionsschutz<br />
der Anlage.
A B C<br />
Explosionsgefährdeter<br />
Bereich<br />
Sicherer Bereich<br />
Geprüfter<br />
Bereich<br />
Explosionsgefährdeter<br />
Bereich<br />
Sicherer Bereich<br />
Bild 4: Die 3 Funktionseinheiten A, B und C des Ex p Containersystems von R. STAHL / Electromach<br />
Der transportable, belüftete Container (TVC)<br />
Die Form der Container richtet sich nach der Funktion der eingebauten<br />
Anlagenteile, ein Konstruktionskonzept, das in unserer Organisation<br />
tief verwurzelt ist. Nach über 50 Jahren Erfahrung mit<br />
dem Umgang z.B. mit Bedienpulten in explosionsgefährdeter Umgebung<br />
haben wir erkannt, dass der Zweck und die Funktion der transportablen<br />
und belüfteten Container wichtiger ist als die Form der Einheit.<br />
Das Prinzip der transportablen und belüfteten Container in ›Ex p‹<br />
orientiert sich am neuesten, modularen und funktionsorientierten<br />
Trend der Industrie, kombiniert mit zertifiziertem Explosionsschutz,<br />
als ein logischer, aber wichtiger Faktor. Ein transportabler und belüfteter<br />
Container ist so konstruiert, dass die innere Atmosphäre garantiert<br />
frei von explosionsfähiger Atmosphäre ist und damit den Einsatz<br />
von allgemein üblichen elektrischen Instrumenten, Antrieben, kompletten<br />
Ausrüstungspaketen und sogar von Werkstätten ermöglicht,<br />
die nicht alle explosionsgeschützt ausgeführt werden müssen.<br />
Ein empfindliches Gerät wird im Container platziert, die Funktion<br />
dieser Einheit ist kritisch für die Sicherung der Qualität der Produktionsprozesse.<br />
Außerdem darf ein Zwischenfall nicht in eine Katastrophe<br />
münden. Es ist daher selbstverständlich, dass wir im<br />
Bereich der Sicherheit und Qualtität unserer Container keine Kompromisse<br />
machen. Wir glauben nicht nur an den momentanen Trend<br />
der steigenden Sicherheitsstandards in der Industrie, wir unterstützen<br />
ihn auch. Wir produzieren gemäß den ATEX, IECEx und NEC<br />
Richtlinien und deren Normen.<br />
Funktionsprinzipien<br />
Unsere Funktionseinheiten entsprechen einem der folgenden<br />
Kriterien:<br />
> Typ TVC-ev, positive Druckdifferenz für Umweltschutz (siehe A),<br />
> Typ TVP-op, positive Druckdifferenz, um eine sichere<br />
Betriebsumgebung herzustellen (siehe B),<br />
> Typ TVC-up, negative Druckdifferenz, um eine Gasansammlung<br />
im Innenraum zu vermeiden (siehe C).<br />
Bild 5: Transportabler Ex p Container mit Schutzdach<br />
Sicherer Bereich<br />
Potentiell explosionsgefährdeter<br />
Bereich<br />
Das Herz des transportablen, belüfteten Containers<br />
Die Druckregelung der Belüftung wird durch integrierte, explosionsgeschützte<br />
und modulare Komponenten der Heizungs-, Klimaund<br />
Lüftungstechnik ermöglicht. Die doppelte Funktion dieser Heizungs-,<br />
Lüftungs- und Klimakomponenten ermöglicht eine<br />
IECEx-zertifizierte Druckregelung, angepasst an die Funktionen einer<br />
Heizungs- und Klimaanlage.<br />
Die Kühlleistung der Klimakomponenten reicht von 2 KW bis zu 140<br />
KW und ermöglicht somit den Betrieb von kleineren Containern mit<br />
10 ft bis zu Containern mit 60 ft, ausgerüstet mit sowohl schweren,<br />
als auch wärmeproduzierenden Geräten.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 39
Containersystem Ex p – optimierte Lösung für Öl- und Gasanlagen<br />
Bild 6: Ex p Container mit Klimatisierungseinheit<br />
Seite 40 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Zusammenfassung der Beschreibung der TVC Funktionseinheiten<br />
Die Einheiten sind komplett auf ihre Funktionalität und den Explosionsschutz<br />
getestet, da wir unseren Kunden sofort betriebsbereite<br />
Lösungen anbieten möchten, die im Hinblick auf alle Zertifikatsanforderungen<br />
ohne weitere Prüfungen selbst installiert werden<br />
können. Neben der Einhaltung der geltenden Richtlinien garantiert<br />
dies auch eine Reduzierung der Montage- und Abnahmekosten am<br />
Einbauort.<br />
Die Einheiten sind so konstruiert, dass die Betriebskosten niedrig gehalten<br />
werden und der Arbeitsplatz ergonomisch und energieeffizient<br />
gestaltet werden kann.<br />
Unsere langjährige Erfahrung als Systemplaner und -Hersteller<br />
ermöglicht es uns, das komplette System einschließlich Projektmanagement,<br />
Programmierung, Elektrik, Hardware/Software, mechanischer<br />
Konstruktion und Transport anzubieten.<br />
Aufbau und Betriebsarten<br />
> Ein explosionsgeschütztes, autonomes, elektrisches System<br />
in einem Container<br />
> Transportabel, zur zeitweiligen oder dauerhaften Nutzung<br />
> Container ohne Personalbegehung unter normalen<br />
Betriebsbedingungen<br />
> Container für Personalbegehung unter normalen<br />
Betriebsbedingungen<br />
Mögliche Inhalte:<br />
> Steuerungssysteme, Energieverteilungen, Kommunikationseinheiten<br />
auch drahtlose, Notstromanlagen, Alarmsysteme,<br />
Werkstatt, Büro,<br />
> Elektrische Konsolen einschließlich Prozessleitsystemen,<br />
SPS, ESD, MCC, UPS oder Batterien, VSD, PC und PA,<br />
> Diagnoseschnittstellen, basierend auf GSM/GPRS oder Fieldbus,<br />
> Geeignet für die Installation in Zone 1 und Zone 2,<br />
> ATEX-Einstufung Gas IIB T4,<br />
> Normen-Ausführungen für NEC-, GOST-, Norsok- und für<br />
weitere Normen,<br />
> Umgebungstemperatur -50 bis +50 °C (projektabhängig).<br />
Die Dienstleistungen<br />
Wir übernehmen die Projektplanung einschließlich:<br />
> mechanischer und elektrischer Konstruktion (3D),<br />
> Software und Programmierung,<br />
> Materialbeschaffung,<br />
> Service,<br />
> Erweiterte Abnahmeprüfung,<br />
> Zertifizierung des Systems,<br />
> Dokumentenlieferung, Transport und Versicherung,<br />
> Inbetriebnahmeunterstützung.<br />
Mit diesen Dienstleistungen werden die gesamten Projektkosten und<br />
der Zeitaufwand minimiert. Alles kommt aus einer Hand, schnell betriebsbereit,<br />
was die Inbetriebnahmezeit verkürzt und die Verantwortung<br />
für den Explosionsschutz klar zuordnet.
Bild 7: Die Innenansicht eines Ex p Containers mit den eingebauten elektrischen<br />
Steuerungseinheiten<br />
Bild 8: Belüfteter Container mit Sicherheitsanzeigen<br />
Bild 9: Transportvorbereitung der Container<br />
Bild 10: Electromach Container Workshop<br />
Literatur<br />
Broschüre von R. STAHL ›Gemeinsam finden wir eine Lösung‹<br />
Broschüre von Electromach BV ›HVAC pressurization & ventilation‹<br />
Shell Energieplanung 2005<br />
USGS BP Statistik 2005 und Öl- und Gasjournal Dezember 2005<br />
Baker Hughes Energy, WTRG economics 2011<br />
Weltenergie 10/2007<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 41
Korrekturen Dr. Völker erl.<br />
Schick erl. 03.04.<br />
Grafiken bei Visuell zur Überarbeitung/20.03.<br />
03.05. Korrektur Schick/Autor erl.<br />
engl. Text bei Autor und Alyson Flexible elektrische Beheizungen<br />
für explosionsgefährdete Bereiche<br />
von Frank Merkel<br />
Seite 42 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> 2011<br />
>> Anwendungsberichte<br />
Bild 1: Industrieanlage mit nächtlicher Beleuchtung<br />
Wie wichtig Wärme ist, weiß jeder aus eigener Erfahrung oder besser<br />
gesagt: auf die richtige Temperatur kommt es an. Was für uns<br />
Menschen gilt, trifft auch auf die Technik zu. Dabei liegen die Vorteile,<br />
umgewandelten Strom als Wärmelieferanten zu wählen, auf<br />
der Hand: Strom ist wirtschaftlich. Strom ist sauber. Strom ist sicher.<br />
Deshalb verlassen sich auch in explosionsgeschützten Bereichen<br />
immer mehr Anlagenbetreiber auf flexible elektrische Beheizungen.<br />
Elektrische Beheizungen sind nicht auf gewisse Industriebereiche<br />
oder spezielle Anwendungen beschränkt, sondern universell<br />
einsetzbar. Durch die physikalische Grundeigenschaft der Widerstandserwärmung<br />
ist es möglich, elektrische Beheizungen gezielt<br />
anzuwenden: genau dort, wo Wärme gebraucht wird und nur dann,<br />
wenn Erwärmung notwendig ist. Diese flexible Handhabung ermöglicht<br />
ein wirtschaftliches Beheizen von großen wie kleinen Anlagen.<br />
Der größte Vorteil elektrischer Beheizungslösungen liegt jedoch darin,<br />
dass sie passgenau gefertigt werden, egal ob zum Nachrüsten<br />
bereits vorhandener Systeme oder in der Planungsphase entstehender<br />
Projekte.
Neben den klassischen Einsatzgebieten im Bereich Frostschutz,<br />
Temperaturerhaltung und Temperaturerhöhung sind auch<br />
viele weitere Anwendungsmöglichkeiten gegeben und heutzutage in<br />
den Industriebetrieben allgegenwärtig. Die Vermeidung einer Taupunktunterschreitung<br />
durch eine elektrische Beheizung ist zum Beispiel<br />
bei vielen Analysenanwendungen wichtig, um keine falschen<br />
Messergebnisse zu erhalten.<br />
Die meistverbreitete und wohl konventionellste Form einer<br />
elektrischen Beheizung ist die Widerstandserwärmung durch Verwendung<br />
von Heizleitern auf Rohren oder Schläuchen mit einer darüber<br />
liegenden thermischen Isolation aus entsprechend der Anwendung<br />
geeigneten Werkstoffen.<br />
Über eingebaute Sensoren direkt am zu beheizenden Objekt<br />
werden die Temperaturen erfasst und in einem Temperaturregelgerät<br />
ausgewertet. Entsprechend der Einstellung am Temperaturregelgerät<br />
und den gewünschten Prozesstemperaturen wird der Heizleiter<br />
mit Spannung versorgt. Die durch den Spannungsfall am<br />
Widerstand des Heizleiters erzeugte Wärmeenergie wird direkt auf<br />
das zu beheizende Objekt übertragen und erwärmt dies bis zur gewünschten<br />
Prozesstemperatur.<br />
Eine solche Widerstandserwärmung kommt auch in Bereichen<br />
zum Einsatz, wo entzündliche Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder<br />
Stäube entstehen, gelagert oder transportiert werden. Hier ist besondere<br />
Vorsicht geboten, da mögliche Explosionen eine permanente<br />
und nicht unerhebliche Gefahr darstellen. Unter bestimmten<br />
Voraussetzungen bildet sich in Verbindung mit dem vorhandenen<br />
Sauerstoff in der Umgebungsluft ein zündfähiges Gemisch, welches<br />
durch einen entsprechenden Zündfunken zu einer Explosion führen<br />
kann. Diese sogenannten Ex-Bereiche finden sich in vielen Industrien,<br />
z.B. der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in Raffinerien<br />
und Tanklagern oder Lackfabriken, aber auch in holz- oder lebensmittelverarbeitenden<br />
Betrieben, wie Mühlen und Getreidesilos,<br />
in denen ausgasende oder staubbildende Güter verarbeitet, gelagert<br />
oder transportiert werden.<br />
Besondere Vorkehrungen bei Planung, Konstruktion und Bau von<br />
elektrischen Begleitheizungen für diese explosionsgefährdeten Bereiche<br />
sowie besondere und umfangreiche Montage- und Betriebsbedingungen<br />
sind Grundvoraussetzung für einen sicheren und bestimmungsgemäßen<br />
Betrieb gemäß der Europäischen Richtlinie<br />
94/9/EG [1].<br />
Die Winkler GmbH in Heidelberg entwickelt seit über 33 Jahren<br />
flexible elektrische Beheizungen, auch für explosionsgefährdete<br />
Bereiche. Das besondere an Winkler ist, dass die jeweilige Fachabteilung<br />
gemeinsam mit dem Kunden nach der besten Lösung für das<br />
spezifische Beheizungsproblem sucht. So ist fast jede Beheizungslösung<br />
ein Unikat und speziell auf die Anforderungen des Kunden oder<br />
des Prozesses abgestimmt.<br />
Im Laufe der Jahre stellten die Kunden immer speziellere Anforderungen,<br />
besonders für explosionsgefährdete Bereiche wurden<br />
flexible und breite Anwendungsmöglichkeiten gefordert, welche<br />
aber keinesfalls zulasten der Sicherheit gehen dürfen. Vorhersehbare<br />
Fehlerquellen beim Betrieb oder falscher Umgang mit den elektrischen<br />
Beheizungen müssen ausgeschlossen werden. Dies ist<br />
durch eine mitzuliefernde umfangreiche und vor allem aussagekräf-<br />
Das Thema Sicherheit war und ist eine der großen Herausforderungen,<br />
welchen sich Winkler in den letzten Jahren erfolgreich<br />
gestellt hat. Dies zeigt sich in der breiten Produktpalette systemzertifizierter<br />
explosionsgeschützter elektrischer Beheizungen vom Typ<br />
WEX… (Heizschläuche, Analysenleitungen, Heizmanschetten und<br />
Temperaturregler). Der große Vorteil der Winkler WEX-Produkte besteht<br />
darin, dass sie nicht, wie bisher üblich, aus mehreren einzeln<br />
zertifizierten Komponenten (z.B. Heizleiter, Anschlussmuffe, Temperatursensoren,<br />
usw.) bestehen, die nach der Montage eine Abnahme<br />
beim Kunden vor Ort durch speziell befähigte Personen oder Sachverständige<br />
erforderlich machen. Systemzertifiziert von Winkler<br />
heißt, dass nur eine EG-Baumusterprüfbescheinigung und eine umfangreiche<br />
Dokumentation für den bestimmungsgemäßen Betrieb im<br />
Ex-Bereich notwendig ist. Das ist eine wesentliche Vereinfachung<br />
für den Betreiber der Anlage, der nach der Gefährdungsbeurteilung<br />
nach §3 der Betriebssicherheitsverordnung -BetrSichV [2] die notwendige<br />
Dokumentation (§6 BetrSichV) erstellen muss. Die zusätzliche<br />
Abnahme des Ex-Produktes vor Ort entfällt damit.<br />
Rechtliche Grundlagen systemzertifizierter elektrischer Ex-Beheizungen<br />
Die Einführung der EU-Richtlinie 94/9/EG [1] im Jahr 1996, welche<br />
speziell die Hersteller betrifft, machte es schwieriger, entsprechend<br />
geeignete Produkte und Bauteilkomponenten für elektrische<br />
explosionsgeschützte Beheizungen am Markt zu bekommen.<br />
Auszug aus der Richtlinie 94/9/EG Artikel 2 Abs.1 [1]:<br />
›Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit<br />
von dieser Richtlinie erfasste Geräte, Schutzsysteme und Vorrichtungen<br />
im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 nur dann in den Verkehr gebracht<br />
und in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie die Sicherheit<br />
und die Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von<br />
Haustieren oder Gütern bei angemessener Installierung und Wartung<br />
und bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gefährden‹.<br />
Diese Aussage in der Richtlinie bringt alle Anforderungen, Richtlinien<br />
und Normen auf einen Punkt: ›Sicherheit steht an erster Stelle‹. �<br />
tige Montage- und Betriebsanleitung sicherzustellen. Bild 2: Winkler bringt die Wärme auf den Punkt<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 43
Flexible elektrische Heizungen für explosionsgefährdete Bereiche<br />
Hersteller<br />
RL 94/9/EG<br />
ATEX 95 (100a)<br />
GPSG<br />
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
ExVo<br />
Explosionsschutzverordnung<br />
EU-Richtlinie ATEX<br />
Bild 3: EU Richtlinien ATEX für Hersteller und Betreiber<br />
Betreiber<br />
RL 1999/92/EG<br />
ATEX 137 (118a)<br />
BetrSichV<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
ArbSch<br />
Arbeitsschutzgesetz<br />
Darüber hinaus gelten weitere nationale Vorschriften, Verordnungen<br />
und Gesetze, die Hersteller von explosionsgeschützten elektrischen<br />
Beheizungen sowie die Betreiber von explosionsgefährdeten<br />
Anlagen einhalten müssen (Bild 3).<br />
Die Richtlinie 94/9/EG [1] enthält erstmals konkrete und harmonisierte<br />
Aussagen zu Anforderungen an nichtelektrische Bauteile.<br />
Produkte, die für den Einsatz in Bereichen bestimmt sind, in denen<br />
aufgrund von Staubbildung eine Explosionsgefahr besteht, sowie für<br />
Schutzsysteme und Sicherheitsvorrichtungen, die für den Einsatz<br />
außerhalb von explosionsgefährdeten Atmosphären bestimmt sind<br />
und in Bezug auf Explosionsrisiken zum sicheren Betrieb der Produkte<br />
beitragen.<br />
Dies ist im Vergleich zu früheren nationalen Vorschriften für den bestimmungsgemäßen<br />
Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen eine<br />
Ausweitung des Verantwortungsbereiches auf Seiten des Herstellers<br />
und des Betreibers.<br />
Der Hersteller muss jetzt bei Auswahl und Verwendung von Komponenten,<br />
welche nicht unmittelbar mit den elektrischen Komponenten<br />
zu tun haben, eine Zündgefahrenanalyse nach EN 13463 [3] durchführen,<br />
um sicherzustellen, dass keine Gefahr von seinem Produkt<br />
ausgehen kann. Diese Sicherheit muss auch in einem vorhersehbaren<br />
Fehlerfall gewährleistet sein, und hierfür müssen Vorkehrungen<br />
geschaffen werden, welche in erster Linie im Bereich der<br />
technischen Ausstattung liegen.<br />
Standen vor Einführung der Richtlinie 94/9/EG [1] ausschließlich die<br />
elektrischen Komponenten einer Beheizung im Fokus, so sind nun<br />
auch die nichtelektrischen Komponenten und hierbei besonders<br />
Kunststoffe zu betrachten. Kunststoffe besitzen die Eigenschaft,<br />
elektrostatische Ladungen zu speichern und diese schlagartig in<br />
Form eines Überschlages mit Zündfunken gegenüber benachbarten<br />
Bauteilen mit anderen Potentialen abzugeben (Zündgefahr ›elektrostatische<br />
Aufladung‹). Diese Gefahrenquelle gilt es durch konstruktive<br />
Maßnahmen auszuschließen.<br />
Seite 44 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> 2011<br />
Das Inverkehrbringen von elektrischen Beheizungen für den<br />
Einsatz im Ex-Bereich unterliegt einem festgelegten Zertifizierungsprozess.<br />
Dieser wird durch ›Benannte Stellen‹ (sog. Notified Bodys)<br />
durchgeführt, welche gemäß der Richtlinie 94/9/EG [1] die Ex-Produkte<br />
exemplarisch an einem eingereichten Musterprodukt prüfen<br />
und bei Bestehen der in den für das Produkt gültigen Normen (DIN<br />
EN 60079-ff [8]) festgelegten Prüfanforderungen ihre Zertifikate in<br />
Form einer EG-Baumusterprüfbescheinigung ausstellen.<br />
Neben dem aufwendigen Prüf- und Zertifizierungsprozess<br />
muss der Hersteller ein durch eine ›Benannte Stelle‹ zertifiziertes<br />
und regelmäßig überwachtes Qualitätsmanagementsystem unterhalten<br />
sowie die Fertigung der Ex-Produkte nach den in der DIN EN<br />
13980 [5] festgelegten Kriterien jährlich überprüfen lassen.<br />
Systemzertifizierte Ex-Produkte<br />
Wie alle anderen Hersteller fertigte die Winkler GmbH bis dato<br />
seine Ex-Beheizungen aus Einzelkomponenten ohne Zertifizierung<br />
des gesamten Systems. Doch das Heidelberger Unternehmen reagierte<br />
auf die gestiegenen Anforderungen des Marktes. Im Jahr 2006<br />
entwickelte Winkler den ersten komplett systemzertifizierten explosionsgeschützten<br />
Heizschlauch bzw. die erste Ex-Analysenleitung<br />
des Typs WEX8000. Damit war Winkler der erste Hersteller in der<br />
Branche, der mit dieser Art der Zertifizierung kundenspezifische Anforderungen<br />
mit in seine Ex-Produkte integrierte.<br />
Durch den modularen Aufbau des Winkler Ex-Heizschlauchs<br />
bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, für jeden Anwendungsfall<br />
den passenden Schlauch zu erhalten. So sind z. B. Längen bis zu 50<br />
m und unterschiedliche Grundschläuche mit verschiedenen Innendurchmessern<br />
je nach Anwendungsfall möglich. Eine vielfältige Armaturenpalette<br />
bietet unterschiedlichste Anschlussmöglichkeiten.<br />
Auswechselbare Innenleitungen aus unterschiedlichen Materialien<br />
eignen sich für die vielseitigen Anwendungen industrieller Prozesse.<br />
Über optional wählbare Sensorpositionen kann die Temperatur<br />
punktgenau erfasst und entsprechend dem Prozessverlauf optimal<br />
angepasst und geregelt werden (Bild 4; siehe rechts).<br />
Eine weitere Besonderheit an den explosionsgeschützten Beheizungen<br />
ist der komplett elektrostatisch ableitende Aufbau, welcher<br />
den Betrieb in Ex-Bereichen uneingeschränkt und ohne eine zusätzliche<br />
Erdungsanschlussleitung möglich macht. Da die Beheizungen<br />
auch oft im mobilen Betrieb eingesetzt werden und somit einer erhöhten<br />
mechanischen Belastung ausgesetzt werden, ist es wichtig,<br />
dass alle verwendeten Materialkomponenten robust, einfach und<br />
doch effektiv miteinander verbaut werden.<br />
Nach Einführung der Analysenleitung des Typs WEX8000<br />
folgten weitere Ausführungen, so dass heute über tausend anwendungs-<br />
oder kundenspezifische Versionen gefertigt werden können.<br />
Im Jahr 2011 erfolgte die komplette Systemzertifizierung von Ex-<br />
Heizmanschetten und Ex-Fassheizern, die nach dem gleichen Grundprinzip<br />
wie die Ex- Heizschläuche und Ex-Analysenleitungen aufgebaut<br />
sind.
Alle explosionsgeschützten elektrischen Beheizungen des<br />
Typs WEX… sind geeignet für den Einsatz im gasexplosionsgefährdeten<br />
Bereich der Zonen 1 und 2 sowie im staubexplosionsgefährdeten<br />
Bereich der Zonen 21 und 22. Somit sind sie auch in den verschiedensten<br />
Branchen und industriellen Anwendungen mit den<br />
Explosionsgruppen IIC (z.B. Wasserstoff) und IIIC, leitfähige Stäube<br />
(z.B. Kohlestaub), bei prozessbedingter Erwärmung universell einsetzbar.<br />
Der erweiterte Temperatureinsatzbereich gegenüber der EN<br />
60079-0: 2006 Kap.5.1.1 [9] ist bei WEX-Heizschläuchen von - 40°C bis<br />
+85°C und bei WEX-Heizmanschetten von -40°C bis +60°C möglich<br />
und weitet somit das Einsatzgebiet, selbst unter extremen Umgebungsbedingungen<br />
aus.<br />
Bauliche Grundlagen explosionsgeschützter elektrischer Beheizungen<br />
Beim Transport von Gasen, flüssigen oder festen Medien von<br />
A nach B spielt die Beheizung eine wichtige Rolle. So dienen elektrisch<br />
beheizte Schläuche zum Beispiel dazu, die Eigenschaften<br />
des Mediums an der Entnahmestelle bis zur Abgabestelle durch<br />
Temperaturunterstützung zu erhalten. Viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten<br />
im Bereich des Frostschutzes, der<br />
Temperaturerhaltung und der Temperaturerhöhung können damit gewährleistet<br />
werden.<br />
Als Beispiel kann die Vermeidung einer Taupunktunterschreitung<br />
herangezogen werden. Dabei wird das Medium auf seiner idealen<br />
stoffspezifischen Temperatur während des Transports gehalten,<br />
um eventuelle Absonderungen (z.B. Wasser) aufgrund seiner chemischen<br />
Zusammensetzung zu vermeiden, welche unweigerlich zu<br />
einem verfälschten Messergebnis in der nachgeschalteten Analyse<br />
führen würde. Auch beim Transport oder Abfüllen von flüssigen oder<br />
festen Medien ist eine Begleitbeheizung oft unerlässlich, um deren<br />
Fließfähigkeit gewährleisten zu können. Es kann auch vorkommen,<br />
dass bei unbeheiztem Transport das Medium sich an der Innenwand<br />
des Schlauches festsetzt und ihn so unweigerlich verstopft. Dies<br />
kann je nach den Eigenschaften des Mediums durch eine Beheizung<br />
verhindert werden. Auch das Erreichen von besseren Ergebnissen<br />
bei Produktionsabläufen oder beim Abfüllen und Einbringen von erwärmten<br />
Medien in nachgelagerte Fertigungs- und Bearbeitungsprozesse<br />
ist ein großes Einsatzgebiet für elektrische Beheizungen.<br />
Als Beispiel stehen dafür die Fass- oder Containerheizer, welche<br />
überwiegend im mobilen Betrieb eingesetzt werden. Hier werden<br />
zum sicheren elektrischen Anschluss der Zuleitungen oder Verbindungsleitungen<br />
vormontierte Ex-Klemmkästen von R. STAHL eingesetzt<br />
(Bild 5).<br />
Da solche Anwendungen auch oft innerhalb explosionsgefährdeter<br />
Bereiche vorkommen, sind besondere Vorkehrungen bei deren<br />
Konstruktion und Fertigung zu berücksichtigen.<br />
Überwiegend ist das zu beheizende Medium selbst Ursache für einen<br />
explosionsgefährdeten Bereich, da es aufgrund seiner Stoffeigenschaften<br />
als Gefahrstoff eingeteilt wurde und nur unter entsprechenden<br />
Sicherheitsbestimmungen gelagert, transportiert und<br />
verarbeitet werden darf.<br />
�<br />
Bild 5: WEXH…-Heizmanschetten (IBC Containerheizer/200 l Fassheizer),<br />
Klemmenkästen von R. STAHL für Zuleitungsanschlüsse (Netz/Sensor)<br />
Bild 4: WEX8000 Ex-Heizschlauch / Ex-Analysenleitung<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 45
Flexible elektrische Heizungen für explosionsgefährdete Bereiche<br />
Außen- und Innenmantel<br />
(elektrostatisch ableitfähig<br />
intern auf Schutzleiterpotential)<br />
Isolierung<br />
Glasnadelmatte<br />
Grundträger für HL<br />
elektrostatische Aufladung möglich<br />
Wärmeableitung<br />
Wärmeableitung<br />
zu beheizendes Objekt<br />
Bild 6: Prinzipquerschnitt einer WEX-Heizmanschette<br />
PTFE Heizleiter<br />
doppelt isoliert<br />
Trennung<br />
PTFE Heizleiter in Taschen<br />
eingezogen und fixiert<br />
Bei der Gefahrenbetrachtung sind vorgegebene Betriebs- und Umgebungsbedingungen<br />
genauso zu beachten, wie eventuelle Fehlbedienungen<br />
aufgrund von Unachtsamkeit beim Umgang oder Informationsdefizite<br />
durch fehlende Montage- und Betriebskenntnisse.<br />
Es ist die Aufgabe des Herstellers, die Produktsicherheit in erster<br />
Linie durch technische und konstruktive Lösungen zu gewährleisten.<br />
Einschränkungen für den Betrieb sind in der Montage- oder<br />
Betriebsanleitung möglichst zu vermeiden.<br />
Elektrische Komponenten<br />
Die elektrischen Komponenten bestehen aus dem Heizleiter,<br />
der Anschlussmuffe und den Temperatursensoren.<br />
Diese elektrischen Komponenten sind aufgrund ihrer physikalischen<br />
Eigenschaften auch schon im Normalbetrieb als primäre Zündquellen<br />
anzusehen. Es ist hier besonders wichtig, dass diese Komponenten<br />
nicht als Zündquelle wirken oder bei ständig vorkommenden<br />
Schaltvorgängen keinen Zündfunken erzeugen, der nach außen dringen<br />
kann (Bild 7).<br />
Der Heizleiter (1) besitzt neben einer Basisisolierung (2), welche<br />
gleichzeitig die Temperaturen direkt am Heizleiter aushalten<br />
muss, eine zusätzliche Ummantelung (4), die gegen mechanische<br />
Einflüsse von außen schützt. So ist eine Kombination von elektrischer<br />
Sicherheit (Isolierung) und mechanischer Ummantelung unerlässlich<br />
und Grundvoraussetzung für eine Verwendung in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen. Das zwischen den beiden Um-<br />
Bild 7: Ex-Heizleiter mit doppelter PTFE Isolation und Schutzgeflecht<br />
Seite 46 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
mantelungen befindliche Schutzgeflecht (3) ist eine weitere Schutzmaßnahme,<br />
die bei Zerstörung der Basisisolierung zum Tragen<br />
kommt und vorgeschaltete Schutzeinrichtungen (Sicherung, FI-<br />
Schutzschalter) zum Auslösen bringt. Dazu gehört ein Kaltleiter, dessen<br />
Verbindung mit dem Heizleiter innerhalb der Anschlußmuffe mit<br />
Silikonmasse vergossen ist. Damit ist die Übergangsstelle luft- und<br />
gasdicht abgeschlossen.<br />
Weitere wichtige elektrischen Komponenten sind zwei Temperatursensoren,<br />
welche zur Regelung der Temperatur (Reglersensor)<br />
und zum Gewährleisten der maximal zulässigen Temperatur (Begrenzersensor)<br />
dienen.<br />
Für den externen Anschluss der Heizleiter und der Temperatursensoren<br />
werden die Klemmenkästen Ex e (Netz) und Ex i (Sensoren)<br />
von R. STAHL eingesetzt (Bild 8, 9, 10; siehe rechts).<br />
Nichtelektrische Komponenten<br />
Seit Einführung der Richtlinie 94/9/EG [1] müssen auch diese<br />
gesonderten Gefahrenbetrachtungen unterzogen werden. Dabei<br />
sind mögliche Gefahren, die beim bestimmungsgemäßen Betrieb<br />
entstehen können, im Vorfeld zu berücksichtigen. Eine Zündgefahrenanalyse<br />
nach EN 13463 [3] ist für alle relevanten Teile durchzuführen.<br />
Hierbei ist der Zündgefahr durch eine elektrostatische Aufladung<br />
des Außenmantels einer Heizmanschette oder des Wellrohres<br />
eines Heizschlauchens besondere Bedeutung zukommen zu lassen.<br />
Vermeidung von elektrostatischer Aufladung des Außenmantels<br />
Im Rahmen der Zündgefahrenanalyse nach EN 13463 [2] wurde<br />
ein besonderer Schwerpunkt auf die elektrostatische Ableitfähigkeit<br />
der Ex-Beheizungen gelegt. Bei mobilem Betrieb kommt diese Zündgefahr<br />
aufgrund der vielfältigen Materialberührungen sehr häufig<br />
vor.<br />
In der TRBS 2153 [6] und der BGR 132 [7], die sich mit der Vermeidung<br />
von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen<br />
beschäftigen, sind grundlegende Maßnahmen festgelegt, welche<br />
dem Anwender als Hilfestellung dienen können und ihn bei der Gefährdungsbeurteilung<br />
nach der Betriebssicherheitsverordnung unterstützen.<br />
Sie sind auch Grundlage der Konstruktion.<br />
Dabei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen:<br />
> Gegenstände oder Einrichtungen dürfen in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen nicht gefährlich aufgeladen werden.<br />
> Der Einsatz von Gegenständen oder Einrichtungen aus isolierenden<br />
Materialien in explosionsgefährdeten Bereichen ist zu<br />
vermeiden oder es müssen entsprechende Maßnahmen gegen<br />
gefährliche elektrostatische Aufladungen getroffen werden.
Bild 8: Glasseidenmatte mit PTFE Heizleiter Bild 9: PTFE Anschlussmuffe Bild 10: Klemmenkästen Ex e / Ex i von R. STAHL für<br />
die Anschlüsse von Heizung und Temperatursensoren<br />
> In explosionsgefährdeten Bereichen sollten grundsätzlich nur<br />
leitfähige oder ableitfähige Gegenstände oder Einrichtungen verwendet<br />
werden. Eine Miteinbeziehung in den Potentialausgleich<br />
der Anlage oder des Gesamtsystems ist notwendig.<br />
Man unterscheidet nach ihrer elektrischen Leitfähigkeit drei Arten<br />
von Materialien:<br />
leitfähige Materialien<br />
ableitfähige Materialien isolierende Materialien<br />
10<br />
Oberflächenwiderstand Ro in Ω/m<br />
1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12<br />
Bild 11: Definition der Materialien hinsichtlich elektrostatischer Aufladung<br />
Ableitfähig ist ein Stoff oder Material mit einem spezifischen<br />
Widerstand von mehr als 10 4 Ω/m und weniger als 10 9 Ω/m. Hierbei<br />
spielen auch die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit<br />
eine Rolle (z.B. je höher die relativer Luftfeuchtigkeit ist, desto<br />
besser sind die Ableiteigenschaften des Materials).<br />
Zitat BGR 132 Abschnitt 3.1.1: ›Nach Maßgabe der Zündwahrscheinlichkeit<br />
sind alle Gegenstände oder Einrichtungen aus leitfähigen<br />
Materialien zu erden und solche aus ableitfähigen Materialien<br />
mit Erdkontakt zu versehen. Geerdete leitfähige Gegenstände können<br />
nicht gefährlich aufgeladen werden. Sind sie jedoch von Erde<br />
isoliert, können Funkenentladungen auftreten‹. In den Technischen<br />
Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2153, ›Vermeidung von Zündgefahren<br />
infolge elektrostatischer Aufladungen‹, findet man konkrete<br />
Forderungen und wichtige Hinweise für den Einsatz von elektrostatisch<br />
ableitfähigen oder leitfähigen Materialien.<br />
Laut DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) [8] Kapitel 6.4 müssen bei<br />
den verwendeten nichtmetallischen Materialien des elektrischen<br />
Betriebsmittels Schritte unternommen werden, um die Auswirkungen<br />
statischer Elektrizität auf ein ungefährliches Maß zu beschränken,<br />
d.h. der Isolationswiderstand bzw. Oberflächenwiderstand<br />
darf nicht größer 1 GΩ/m (10 9 Ω/m) sein, um entsprechende<br />
Aufladungen zu verhindern.<br />
Bringt man zwei unterschiedliche Materialien in engen Kontakt,<br />
so treten Ladungen von dem Stoff mit der geringeren Elektronenaustrittsenergie<br />
in den Stoff mit der höheren Elektronenaustrittsenergie<br />
über. Ist einer der beiden Stoffe elektrisch isolierend, so<br />
können bei abrupter Trennung der Materialien die Elektronen nicht<br />
schnell genug zurückfließen und verbleiben als Überschuss auf dem<br />
anderen Material. So werden unterschiedliche Potentiale aufsummiert.<br />
Aber auch durch Influenz (auch Induktion genannt) erfolgen<br />
Aufladungen, die besonders gefährlich sind, da sie auf den ersten<br />
Blick nicht erkennbar sind und sich über längere Zeit zu einer ausreichenden<br />
Zündenergie ansammeln können (Bild 12).<br />
�<br />
Bild 12: Elektrostatische Aufladung an einem Heizschlauch<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 47
Flexible elektrische Heizungen für explosionsgefährdete Bereiche<br />
Bild 13: Elektrostatische Entladung an einem Heizschlauch<br />
Diese aufgeladenen Zustände sind thermodynamisch sehr instabil<br />
und bemüht, diesen Zustand innerhalb einer elektrostatischen<br />
Entladung wieder auszugleichen. Dabei spielt die Art und Form des<br />
Energieausgleiches (z.B. Funkenentladung) eine wichtige Rolle.<br />
Sind bei diesen Entladungsvorgängen Personen beteiligt, so<br />
sind Körperteile als wirksame Zündelektroden anzusehen, die gegen<br />
Erdpotential ableitend wirken. Aber auch im umgekehrten Fall kann<br />
eine Person sich mit mehreren tausend Volt aufladen.<br />
Diese Ladungsenergien reichen aus, um brennbare Flüssigkeiten,<br />
Gase, Dämpfe und Stäube mit der entstehenden Funkenentladung zu<br />
zünden (Bild 13).<br />
Es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar und kompliziert zu<br />
beurteilen, wo eine solche elektrische Aufladung auftreten kann.<br />
Aus diesem Grund wird in einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften<br />
der Einsatz von leitenden bzw. ableitenden Materialien gefordert.<br />
Analysenleitungen und Heizschläuche, die mit verschiedenen<br />
für den Ex-Bereich zugelassenen Komponenten aufgebaut<br />
sind, aber keine komplette Systemzulassung des Herstellers besitzen,<br />
müssen vor Ort geprüft und einer internen Gefahrenbetrachtung<br />
unterzogen werden. Dies kann nur erfolgen, sofern der Hersteller alle<br />
entsprechenden Materialdatenblätter beigefügt hat und der Betreiber<br />
der explosionsgeschützten Anlage in der Lage ist, dies zu beurteilen.<br />
Hierzu sind umfassende Kenntnisse der Materie notwendig,<br />
welche eine fachspezifische Ausbildung erfordern. Aus diesem<br />
Grund kommt einer kompletten Systemzulassung durch eine ›benannte‹<br />
Zertifizierungsstelle eine immer größere Bedeutung zu.<br />
Bei diesen Prüfungen spielt der äußere Aufbau, das Schutzrohr<br />
(Wellrohr), sowie die Anschlussstellen (Anschlusskappen) eine<br />
große Rolle. Der Aufbau ist nicht nur als reiner mechanischer Schutz<br />
anzusehen, sondern muss in eine Gefährdungsbeurteilung des Gesamtsystems<br />
einbezogen werden. Prüfungen, die neben den üblichen<br />
Umwelteinflüssen die Materialalterung, die Hydrolyse und<br />
Tests zur Schlagfestigkeit beinhalten, sind Grundvoraussetzungen<br />
für eine erfolgreiche Zertifizierung und sichere Verwendung in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen.<br />
Seite 48 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Bild 14: Mögliche elektrostatische Aufladungen<br />
Auch Entladungsvorgänge, an denen Personen beteiligt sind,<br />
können im Vorfeld nur schwierig beurteilt werden. Deshalb sind klare<br />
und unmissverständliche Arbeits- und Betriebsanweisungen notwendig,<br />
in denen Regelungen getroffen werden, wie bei Umgang bei<br />
Betrieb von Analysenleitungen und Heizschläuchen in den explosionsgefährdeten<br />
Bereichen zu verfahren ist.<br />
Die Gefährlichkeit der elektrostatischen Entladung kann an<br />
einem einfachen Beispiel deutlich gemacht werden:<br />
Wenn sich eine Person auf eine Spannung von ca. 2 kV auflädt<br />
(diese Spannung ist bei einer Entladung für die Person fühlbar), so<br />
geht in die Funkenentladung die gesamte auf der Person gespeicherte<br />
Energie mit ein (wie bei einem Kondensator). Da die Person als<br />
Leiter aufzufassen ist, hat sie eine messbare Kapazität gegen Erde<br />
von ca. 100 bis 200 pF, was eine gespeicherte Energie ergibt, welche<br />
fast alle brennbaren Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe und Stäube mit einer<br />
etwaigen Funkenentladung zündet.<br />
Die explosionsgeschützten Analysenleitungen und Heizschläuche<br />
von Winkler sind prinzipiell mit elektrisch ableitenden Materialien<br />
aufgebaut (Außenmantel und An- / Abschlusskappen), welche<br />
eine gefährliche elektrostatische Aufladung erst gar nicht entstehen<br />
lassen.<br />
Bild 14 verdeutlicht die maßgeblichen Bereiche, an denen eine<br />
elektrostatische Aufladung an Analysenleitungen oder Heizschläuchen<br />
entstehen kann, und welche Ableitungsmöglichkeiten vorhanden<br />
sind:<br />
A Der umklöppelte PTFE Grundschlauch ist durch sein<br />
Stahlgeflecht geerdet,<br />
B Der PTFE isolierte Heizleiter ist über sein Schutzgeflecht<br />
(Metall) geerdet,<br />
C Der Außenmantel (Wellrohr) ist elektrostatisch ableitend<br />
mit Verbindung zu den Silikonkappen oder Verschraubungen, die<br />
Verbindung mit dem Schutzleitungssystem erfolgt über ein großflächig<br />
anliegendes Cu-Geflecht,<br />
D Die Silikonkappen oder Verschraubungen sind elektrostatisch Ableitend<br />
mit Verbindung zum Wellrohr,<br />
E Die Armaturen sind mit dem umklöppelten PTFE Grundschlauch<br />
verbunden und werden zusätzlich in die Schutzmaßnahme der<br />
Gesamtanlage mit einbezogen,<br />
F Schutzleiteranschluss (PE / 2,5 mm²) in Netzzuleitung.
Bild 15: Vermeidung elektrostatischer Aufladung<br />
Durch den elektrischen Anschluss (Schutzleiter in Netzzuleitung)<br />
und die Anschlussarmaturen wird der Ex-Heizschlauch an den<br />
örtlichen Potentialausgleich angeschlossen und ist somit geerdet.<br />
Bei Ex-Analysenleitungen und Ex-Heizschläuchen von Winkler wird<br />
durch die Miteinbeziehung elektrostatisch ableitender Eigenschaften<br />
der verwendeten Bauteilkomponenten jede Zündgefahr verhindert<br />
(Bild 15).<br />
Die sich eventuell durch Reibung oder Influenz bildende Ladungstrennung<br />
/ -häufung, welche einen energiereichen und thermo-dynamischen<br />
Zustand erzeugt, wird durch den kontinuierlichen<br />
Abfluss der Elektronen über das Schutzleitersystem gegen Erdpotential<br />
neutralisiert, so dass keine gefährliche Ladungsansammlung<br />
stattfinden kann. Es kommt somit bei sich nähernden Objekten auch<br />
zu keiner Ladungstrennung und zu keinem Funken durch eventuellen<br />
Ladungsausgleich.<br />
Bei der Gefährdungsbetrachtung im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens<br />
müssen alle Materialien und Komponenten<br />
überprüft und auf ihr Zusammenspiel mit den anderen Bauteilkomponenten<br />
getestet werden. Dabei spielen folgende Faktoren eine<br />
wichtige und entscheidende Rolle:<br />
Neben der sicheren, mittels Verwendung spezieller Zündschutzarten<br />
aufgebauten elektrischen Beheizung im Schlauchinneren<br />
müssen auch die in unmittelbarer Umgebung befindlichen Bauteilkomponenten<br />
eine entsprechende Schutzfunktion aufweisen, um<br />
die elektrische Beheizung gegen schädigende Umwelteinflüsse zu<br />
sichern. Dabei spielt der Außenmantel als nichtelektrisches Bauteil<br />
eine entscheidende Rolle.<br />
Die Anforderungen sind mit einer Schutzartprüfung nach<br />
IP66/IP68, auch einem Alterungstest gegen Versprödung durch ungünstige<br />
Umwelteinflüsse (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und einer<br />
Schlagprüfung mit 7J ohne Bruch sehr hoch angesetzt. Auch der<br />
Oberflächenwiderstand aller Teile (Wellrohr, Silikonendkappen oder<br />
Verschraubungen) muss < 10 9 Ohm (elektrostatisch ableitend) sein.<br />
All diese Anforderungen erfüllen die Winkler Ex-Analysenleitungen<br />
und Ex-Heizschläuche. Auch ein entsprechender Schutz gegen chemische<br />
Einflüsse auf den Außenmantel, abhängig von der Temperatur,<br />
der Einwirkzeit (dauerndes Berühren oder nur gelegentlicher<br />
Kontakt) des chemischen Stoffes, sowie dessen Konzentration, ist<br />
maßgebend für einen sicheren und bestimmungsgemäßen Einsatz.<br />
Fazit<br />
Die sicherheitstechnischen Anforderungen an elektrische Beheizungen<br />
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind<br />
sehr vielfältig und umfangreich. Deshalb ist es bei der Entwicklung<br />
einer prozessspezifischen Beheizung wichtig, dass man sich intensiv<br />
mit der entsprechenden Anwendung auseinandersetzt und eventuell<br />
vorhersehbare Fehler im Vorfeld mittels konstruktiver Maßnahmen<br />
verhindert oder vorneweg ausschließt. Einschränkungen in Montage-<br />
und Bedienungsanleitungen sollten vermieden werden. Somit<br />
kommt einer anwendungsunabhängigen Konstruktionsweise immer<br />
größere Bedeutung zu. Ein sicheres und effektiv einsetzbares Produkt<br />
erhält man nur, wenn es einer kompletten Systemprüfung unterzogen<br />
wird. Dies ist von besonderer Bedeutung bei wechselnden<br />
Betriebs- und Einsatzbedingungen, insbesondere auch beim Einsatz<br />
in explosionsgefährdeten Bereichen.<br />
Literatur<br />
[1] Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom<br />
23.März1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten<br />
für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen.<br />
[2] Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777),<br />
die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S.<br />
2178) geändert worden ist<br />
[3] DIN EN 13463-1 : Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen – Teil 1: Grundlegende Methodik und Anforderungen<br />
(Beuth Verlag, Berlin).<br />
[4] DIN EN ISO 9001 : Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen<br />
Aktuelle Ausgabe 2008 (Beuth Verlag, Berlin)<br />
[5] DIN EN 13980:2003-02 Explosionsgefährdete Bereiche –<br />
Anwendungen von Qualitätsmanagementsystemen (Beuth Verlag, Berlin)<br />
[6] TRBS 2153 – Technische Regeln für Betriebssicherheit – Vermeidung von<br />
Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung, T033 BG RCI)<br />
[7] BGR 132 – Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer<br />
Aufladung – Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und<br />
Gesundheit bei der Arbeit<br />
[8] DIN EN 60079-..ff - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil ...<br />
[9] DIN EN 60079-0 (VDE0170-1) – Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 0:<br />
Geräte - Allgemeine Anforderungen (Beuth Verlag, Berlin)<br />
[10] DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) – Explosionsfähige Atmosphäre,<br />
Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen<br />
(Beuth Verlag, Berlin)<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 49
Seite 50 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
§<br />
Die Licht emittierende Diode<br />
– eine Erfolgsgeschichte<br />
von Cornelius Neumann<br />
Recht, Normen und Technik<br />
Bild 1: Die Original-Notiz von H. J. Round in der Electrical<br />
World Vol 49, 1907<br />
Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts die<br />
großen Städte der Welt erstmals im elektrischen<br />
Licht der neuartigen Glühlampen erstrahlten,<br />
wurde – fast unbeachtet – der<br />
Grundstein für eine Lichtquelle gelegt, welche<br />
heute, über 100 Jahre später, als Innovationsträger<br />
in der Öffentlichkeit gefeiert<br />
wird, die LED.<br />
Im Jahre 1907 berichtete H.J Round in der<br />
Electrical World Vol. 49 über ›a curious phenomenon‹<br />
beim Material Carborundum, heute<br />
besser bekannt als Siliziumkarbit (Abbildung<br />
1). Beim Anlegen einer elektrischen<br />
Spannung konnte Round an einigen Kristallen<br />
ein sichtbares ›Glühen‹ in verschiedenen<br />
Farben beobachten und vermutete einen<br />
thermoelektrischen Effekt, welcher auch<br />
Glühlampen zum Leuchten bringt.<br />
Wie falsch er mit dieser Vermutung lag,<br />
wurde erst viel später klar, als die Entwicklung<br />
des Transistors im Jahre 1951 die Ent-<br />
wicklung der Halbleiterphysik beflügelte, mit<br />
deren Hilfe sich die Lichtentstehung in Halbleiterkristallen,<br />
wie beispielsweise Siliziumkarbit,<br />
erstmals erklärt werden konnte.<br />
Etwa zehn Jahre später, 1962, entwickelte<br />
Nick Holonyak bei General Electric die erste<br />
Leuchtdiode.<br />
In den folgenden Jahren fristete die LED<br />
trotz rasanter technischer Fortschritte ein<br />
Randdasein als ›Glühwürmchen‹ und fand<br />
Anwendung bestenfalls als Anzeigefunktion<br />
in elektronischen Geräten. Für den Laien war<br />
nicht abzusehen, dass die LED zukünftig als<br />
Wettbewerber für Glüh- und Gasentladungslampen<br />
auftreten würde.<br />
Über die Entwicklung der letzten Jahre<br />
wird im weiteren Verlauf noch berichtet werden,<br />
zuerst jedoch gilt es, die Lichterzeugung<br />
der Licht emittierenden Diode zu verstehen.
Eine neue Art der Lichterzeugung<br />
Die LED ist zunächst einmal eine elektrische<br />
Diode. Ein positiv dotierter Halbleiter (mit<br />
›positiven Löchern‹ im Bindungsband) und<br />
ein negativ dotierter Halbleiter (mit Elektronen<br />
im Leitungsband) werden stoffschlüssig<br />
verbunden. Bei der richtigen Polung senkt<br />
eine angelegte Spannung die Potentialdifferenz<br />
zwischen den jeweiligen Leitungs- und<br />
Bindungsbändern der Materialien herab und<br />
ein elektrischer Strom aus Elektronen und<br />
Löchern fließt durch die Diode. Umgekehrt<br />
sperrt die Diode, wenn der positive Pol am ndotierten<br />
und der negative am p-dotierten<br />
Material angeschlossen wird.<br />
Im Gegensatz zu einer normalen Diode,<br />
welche den elektrischen Strom möglichst<br />
verlustfrei weiter leiten soll, ist die Funktion<br />
der Licht emittierende Diode gerade auf<br />
sonst störende Verlustprozesse angewiesen<br />
(Bild 2).<br />
Der für die LED unerlässliche interne Verlustprozess<br />
lässt sich durch eine Vereinigung<br />
der unterschiedlichen Ladungsträger<br />
innerhalb des LED Chips beschreiben. Hierbei<br />
rekombiniert ein Elektron aus dem Leitungsband<br />
mit einem positiven Loch aus dem<br />
Bindungsband. Die dabei abgegebene Ener-<br />
E<br />
Leitungsband<br />
Lichtabstrahlung<br />
Bindungsband<br />
Bild 2: Vereinfachtes Funktionsprinzip der LED<br />
Defekt<br />
gie wird in Form elektromagnetischer Strahlung<br />
emittiert. Wenn der Energieabstand<br />
zwischen den beiden Bändern, ∆E, so groß<br />
ist, dass die abgegebene Strahlung im für<br />
den Menschen sichtbaren Bereich liegt,<br />
strahlt die Diode Licht ab.<br />
Durch den Stromfluss der Diode werden<br />
ständig Ladungsträger nachgeliefert, so<br />
dass der Prozess kontinuierlich ablaufen<br />
kann.<br />
Eine unterschiedliche Dotierung mit<br />
Fremdatomen verändert den energetischen<br />
Abstand der Bänder und damit auch die<br />
Wellenlänge des abgestrahlten Lichtes.<br />
Defekte in der Struktur des Halbleiters<br />
führen als Konkurrenzprozess zu nicht sichtbaren<br />
Emissionen, welche die Effizienz und<br />
auf Dauer die Lebensdauer der LED herabsetzen,<br />
da solche Defekte die Eigenschaft<br />
besitzen, nach und nach in die aktive Schicht<br />
der LED einzuwandern.<br />
Weil die energetischen Abstände zwischen<br />
Leitungs- und Bindungsband relativ<br />
scharf definiert sind, ist das von der LED abgegebene<br />
Licht zwar nicht monochromatisch,<br />
wie beispielsweise beim Laser, jedoch<br />
mit einer Halbwertsbreite von ca. 30 nm bis<br />
40 nm monochrom, d.h. einfarbig – eine LED<br />
ist also immer farbig!<br />
Die LED Farben sind sehr gesättigt und liegen<br />
nahe an den reinen Spektralfarben.<br />
Diese Eigenschaft der LED hat natürlich zuerst<br />
farbige Anwendungen gefördert, beispielsweise<br />
bei den roten und gelben Signalfunktionen<br />
im Automobil.<br />
Für verschiedene Farbbereiche haben<br />
sich auf dem Markt inzwischen zwei unterschiedliche<br />
LED Materialien durchgesetzt.<br />
Für den Bereich Rot und Gelb nutzt man Aluminium<br />
Indium Gallium Phosphit (kurz: AlIn-<br />
GaP), im Farbbereich Grün bis Blau (bis hin<br />
zum nahen Ultraviolett) Indium Gallium Nitrit<br />
(kurz: InGaN).<br />
Wenn aber das Licht der LED immer gesättigt<br />
farbig ist, stellt sich natürlich die Frage,<br />
wie man die ungesättigte Farbe Weiß mit<br />
LEDs erzeugt, da ansonsten diese Lichtquelle<br />
für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung<br />
nur bedingt einsetzbar wäre.<br />
Weißes Licht mit LEDs<br />
Um weißes Licht zu erzeugen, kann man<br />
verschiedene Wege beschreiten, welche alle<br />
auf dem Prinzip der additiven Farbmischung<br />
beruhen (Bild 3):<br />
RGB Mischung<br />
Das Licht einer roten, einer grünen und<br />
einer blauen LED wird – analog dem Prinzip<br />
des Farbfernsehers – miteinander vermischt.<br />
Durch verschiedene Anteile der einzelnen<br />
Primärfarben kann man kontinuierlich verschiedenste<br />
Farbtöne innerhalb des von den<br />
Primärfarben definierten Farbraumes darstellen,<br />
unter anderem auch die Farbe Weiß.<br />
Dieses an sich sehr elegante Verfahren<br />
hat allerdings zwei Nachteile, welche die<br />
Nutzbarkeit einschränken. Zum einen sind<br />
die drei Lichtquellen räumlich voneinander<br />
getrennt, so dass das Licht erst vermischt<br />
werden muss. Dies geschieht entweder<br />
durch diffus streuende Materialien oder mittels<br />
Lichtleitern, in denen das Licht durch<br />
Vielfachreflexionen an den Grenzflächen des<br />
Lichtleiters vermischt wird. Zum anderen reagieren<br />
die verschiedenen LED Chips unterschiedlich<br />
auf Bestromung und Erwärmung,<br />
so dass man, um eine bestimmte Farbe stabil<br />
darstellen zu können, während des Betriebes<br />
die einzelnen LEDs jeweils unterschiedlich<br />
nachregeln muss. Dies stellt natürlich<br />
in vielen Anwendungen einen<br />
höheren technischen Aufwand dar.<br />
�<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 51
Die Licht emittierende Diode – eine Erfolgsgeschichte<br />
Blue Peak<br />
Green Peak<br />
Red Peak<br />
470 525 590 630 (nm)<br />
Kombination UV-Diode und Leuchtstoffe<br />
Diese Umwandlungsmethode ähnelt der<br />
Weißlichterzeugung in Leuchtstofflampen.<br />
Statt sichtbarer Strahlung wird die Strahlung<br />
einer UV-Diode verwendet. Die UV-Strahlung<br />
wird von über der Diode befindlichen<br />
Leuchtstoffen absorbiert und als sichtbare<br />
Strahlung wieder abgestrahlt. Durch die<br />
Kombination von Leuchtstoffen, welche in<br />
unterschiedlichen Spektralbereichen emittieren,<br />
kann man mit dieser Methode Weiß<br />
von vorzüglicher Qualität erzeugen. Leider<br />
ist die Effizienz von UV-Strahlung erzeugenden<br />
Dioden bislang deutlich schlechter,<br />
als der von Dioden im sichtbaren Bereich.<br />
Deshalb gibt es für diese Technik bislang nur<br />
wenige industrielle Anwendungen.<br />
Kombination blaue LED mit Leuchtstoff<br />
Statt einer UV-Diode nutzt man eine blaue<br />
Diode und konvertiert einen Teil des blauen<br />
Lichtes mittels eines Leuchtstoffes in den<br />
grün/gelben Spektralbereich.<br />
Die Kombination dieser Lichtfarben erscheint<br />
dem Beobachter als weiß. Diese<br />
recht einfache Technologie hat sich inzwischen<br />
auf dem Markt durchgesetzt und stellt<br />
momentan den Stand der Technik dar. Die<br />
UV LED<br />
Spectrum<br />
Combined<br />
Spectrum<br />
Phosphor<br />
Emmission<br />
410 470 525 590 630 (nm)<br />
Phosphor<br />
Emission<br />
Combined<br />
Spectrum<br />
470 525 590 630 (nm)<br />
Blue LED<br />
Spectrum<br />
Bild 3: Erzeugung von weißem Licht (von links) über RGB Mischung, Umwandlung von UV Strahlung durch mehrere Leuchtstoffe und partieller Umwandlung von blauem<br />
Licht mittels Leuchtstoff. Oben: Funktionsprinzip, unten: entstehendes Lichtspektrum (Quelle: Zukaukas et al.)<br />
Seite 52 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Farbtemperatur des Lichtes kann durch die<br />
Menge und Zusammensetzung des Leuchtstoffes<br />
zwischen kalt und warm wirkendem<br />
Weiß variiert werden. Dadurch, dass man<br />
inzwischen sehr effizient weißes Licht mit<br />
LEDs erzeugen kann, ist die LED zur sehr interessanten<br />
Lichtquelle für die allgemeine<br />
Lichttechnik geworden. Zudem ist die lichttechnische<br />
Effizienz der LED selbst in den<br />
letzten Jahren um mehrere Größenordnungen<br />
angestiegen, so dass sie die einer<br />
Glühlampe um fast den Faktor 10 übersteigt!<br />
LED-Effizienz<br />
Diese rasante Entwicklung wurde von Ronald<br />
Heitz, einem Mitarbeiter der Firma Hewlett<br />
Packard, schon in den neunziger Jahren<br />
des vergangenen Jahrhunderts vorausgesagt.<br />
Ähnlich dem Moorschen Gesetz in der<br />
Computertechnik, sagt das sogenannte<br />
Heitz´sche Gesetz die Steigerung der Lichtmenge<br />
für LED-Lampen und die Entwicklung<br />
der Herstellungskosten voraus. Seine Prognose<br />
lautet, dass der Lichtstrom einer gehäusten<br />
LED (englisch Package) – unter Umständen<br />
mit mehr als einem LED Chip – pro<br />
Jahrzehnt um einen Faktor 20 bis 30 ansteigt,<br />
während die Herstellungskosten um einen<br />
Faktor 10 pro Dekade sinken. Diese Voraussage<br />
wurde in den letzten Jahren durch die<br />
Marktenwicklung immer wieder bestätigt<br />
(Bild 4). Inzwischen gibt es LEDs mit vier<br />
Chips, welche bei einer Größe von nur wenigen<br />
Quadratmillimetern eine 100 W Standardglühlampe<br />
ersetzen können.<br />
Während die Kostenentwicklung von der<br />
Steigerung der Stückzahl und vielen Fertigungsinnovationen<br />
abhängt, ist die Effizienzentwicklung<br />
sowohl vom Chipaufbau und<br />
von der Effizienz der Lichtextraktion aus dem<br />
Chip als auch der Erwärmung der LED bestimmt.<br />
Da die LED (im Gegensatz zu Glühlampen<br />
und Gasentladungslampen) bei Erwärmung<br />
weniger Licht erzeugen, ist es für ein gutes<br />
LED System notwendig, für einen geringen<br />
Wärmewiderstand des Systems und damit<br />
für eine gute Ableitung der bei der Lichterzeugung<br />
produzierten Wärme zu sorgen – eine<br />
gute LED Leuchte braucht einen ›kühlen<br />
Kopf‹.
Die Steigerung der Leistungsfähigkeit von<br />
LEDs sieht man daher auch am Rückgang<br />
des thermischen Widerstands; während ältere<br />
Bauformen, wie beispielsweise 3 mm<br />
LEDs, noch eine Erwärmung von mehr als<br />
200 °C/W haben, zeichnen sich neue Hochleistungs-LEDs<br />
durch die Erwärmung von<br />
10 °C/W und weniger aus. Bei einer Verlustleistung<br />
von einem Watt erwärmt sich der<br />
Chip einer Hochleistungs-LED demnach um<br />
nur ca. 10 °C gegenüber der Umgebung.<br />
Allerdings, auch wenn die LED einen geringen<br />
Wärmewiderstand hat, ergibt sich nicht<br />
automatisch eine effiziente LED-Leuchte,<br />
denn wenn der Wärmewiderstand des gesamten<br />
Leuchten-Systems groß ist, bestimmt<br />
dieser dessen Leistungsfähigkeit.<br />
Hier liegt ein Stolperstein der LED-Technik,<br />
welche bei der Entwicklung von kompletten<br />
Systemen immer Beachtung finden muss.<br />
Wie wir im Folgenden sehen werden,<br />
spiegelt die Entwicklung der LED-Anwendungen<br />
die prognostizierte Effizienzsteigerung<br />
wider.<br />
LED Anwendungen im Automobil<br />
Dass die LED im Automobil in den letzten<br />
Jahren zur Lichtquelle für energiesparende,<br />
innovative und stilistisch anspruchsvolle Signalfunktionen<br />
wurde, liegt sicherlich an der<br />
hier verlangten Farbigkeit: Rot für Bremsund<br />
Schlusslicht, Gelb für Blinklicht und Blau<br />
für Kennleuchten.<br />
Zudem wurde Mitte der neunziger Jahre<br />
die zusätzliche mittige Bremsleuchte (Bild 5)<br />
für Neuwagen in den europäischen Regelungen<br />
zum Straßenverkehr, den sogenannten<br />
ECE Regeln vorgeschrieben. Diese Gesetzgebung<br />
kam genau zur richtigen Zeit, als<br />
die für solche Funktionen benötigten roten<br />
LEDs mit einem Lichtstrom zwischen �<br />
Lumen/Package<br />
~30x Increase/Decade<br />
10,000.0<br />
1,000.0<br />
100.0<br />
10.0<br />
1.0<br />
0.1<br />
0.01<br />
100W Tungsten<br />
0.001<br />
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 Year<br />
Bild 4: Das Haitzsche Gesetz sagt die Entwicklung der Lichtmenge/Lichtstrom in Lumen pro Package voraus<br />
(Quelle: LumiLeds)<br />
Bild 5: Typische Zusatzbremsleuchten der ersten Generation (Quelle: Hella)<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 53
Die Licht emittierende Diode – eine Erfolgsgeschichte<br />
einem und drei Lumen auf dem Markt erhältlich<br />
waren und man mit ca. 20 bis 30 solcher<br />
Lichtquellen sowohl die gesetzlichen Forderungen<br />
für die Lichtverteilung als auch für<br />
die geforderte Mindestfläche erfüllen konnte.<br />
Schnell konnte sich diese Applikation in<br />
Europa einen beträchtlichen Marktanteil sichern.<br />
In den USA, wo die dritte Bremsleuchte<br />
schon deutlich früher vorgeschrieben<br />
wurde, haben sich Glühlampenlösungen<br />
bis heute auf dem Markt gehalten, während<br />
sie hierzulande nur noch ein Randdasein<br />
führen.<br />
Dem Anstieg der Leistungsfähigkeit folgend,<br />
wurden dann Schluss-, Brems- und<br />
Blinklichter in LED-Technik eingeführt, wobei<br />
die erhöhten Kosten für diese neue Lichtquelle<br />
gegenüber der altbewährten Glühlampe<br />
als einziges Innovationshemmnis deren<br />
Siegeszug verzögerten.<br />
Da sich mit den Dioden und entsprechend<br />
neuartigen Optiksystemen, wie Lichtleitern,<br />
vollkommen neue Designlösungen erschlossen,<br />
wurden LED-Signalfunktionen schnell<br />
beliebt bei den Fahrzeugdesignern. Wenn<br />
man neue Leuchten und Scheinwerfer betrachtet,<br />
stellen diese häufig ein prägendes<br />
Element des Fahrzeugdesigns dar, welches<br />
zudem für ein eindeutiges Nachterscheinungsbild<br />
sorgen kann (Bild 6, oben). Dabei<br />
sind die wesentlichen Stylinginnovationen<br />
auf die Kombinationen von Lichtquelle und<br />
neuartigen Optiksystemen zurück zu führen.<br />
Dies gilt auch für Signalfunktionen im<br />
Scheinwerfer und schließlich dem Scheinwerfer<br />
selbst (Bild 6, unten).<br />
Bei der Umsetzung von LED Positions-<br />
und -Tagfahrlicht, sowie Abblend- und Fernscheinwerfern<br />
wurden erstmals weiße Dioden<br />
als Lichtquellen im Automobil<br />
verwendet.<br />
Seite 54 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Bild 6: Beispiele für Stylinginnovationen bei Signalleuchten und Scheinwerfern mit LED Technik. Links: Peugeot<br />
308 CC mit Lichtvorhang, rechts: Ford S-Max mit Edge Light, unten Audi A8 mit Voll-LED AFS Scheinwerfer<br />
(Quellen: Hella, netcarshow.com)<br />
Das erste Tagfahrlicht mit LEDs ging 2002<br />
in Serie, den ersten Voll-LED Scheinwerfer<br />
bot Audi 2007 im Sportwagen R8 an.<br />
Im Gegensatz zu den üblichen Scheinwerferlichtquellen,<br />
Halogen und Xenon, reicht aber<br />
die Lichtmenge einer einzelnen LED nicht<br />
aus, eine ausreichend helle Lichtverteilung<br />
zu erzeugen. Aus diesem Grunde werden einerseits<br />
mehrere Chips zu einer Lichtquelle<br />
kombiniert und andererseits die Lichtverteilung<br />
auf der Straße aus der Abbildung mehrerer<br />
solcher Multichip LEDs zusammengesetzt.<br />
Inzwischen erzielen LED-Lösungen die<br />
gleiche Helligkeit wie Xenon Scheinwerfer<br />
und werden auch mit variablen Lichtverteilungen<br />
(sogenannten adaptiven Frontlicht<br />
Systemen – AFS) ausgestattet, welche (anders<br />
als bei adaptiven Xenon Scheinwerfern)<br />
ohne Mechatronik, allein durch Zu- und<br />
Abschalten einzelner Optikkomponenten der<br />
Fahrsituation angepasste Lichtverteilungen<br />
erzeugen können.<br />
Es ist zu erwarten, dass die LED in der<br />
Automobilbeleuchtung – sowohl bei Leuchten<br />
und Scheinwerfern, als auch im Fahzeuginnenraum<br />
– noch für viele neue Licht- und<br />
Designinnovationen sorgen wird.
LED in der Allgemeinbeleuchtung<br />
Natürlich hat die LED in vielen anderen<br />
Bereichen der Lichttechnik Fuß gefasst, beispielsweise<br />
in der Luftfahrt oder bei Signallichtern<br />
auf Straßen- und Schienenwegen,<br />
aber erst in den letzten drei Jahren ist ein<br />
enormer Entwicklungsschub bei der Allgemeinbeleuchtung<br />
zu beobachten, welcher<br />
wiederum der Leistungsentwicklung der<br />
Lichtquellen folgt.<br />
Auf den einschlägigen Messen werden<br />
immer mehr LED-Produkte vorgestellt. Zum<br />
Teil wird der Eindruck erweckt, dass andere<br />
Lichtquellen gar nicht mehr existieren, obwohl<br />
der Marktanteil bislang noch einstellig<br />
ist. Das kontrovers diskutierte Glühlampenverbot<br />
wird, neben der technologischen Entwicklung,<br />
allerdings für einen baldigen Anstieg<br />
des Marktanteils von LED-Produkten<br />
sorgen.<br />
Aus dem Glühlampenverbot folgt auch die<br />
erste wichtige Anwendung von LED-Leuchten,<br />
nämlich der Glühlampenersatz, auch Retrofit<br />
genannt (Bild 7).<br />
Neben Kompaktleuchtstofflampen dienen<br />
auch LED-Retrofits dem Ziel der energieeffizienteren<br />
Beleuchtung.<br />
Retrofits kombinieren Lichtquelle, elektronische<br />
Ansteuerung und Kühlung in einem<br />
Volumen, welches in etwa dem der Glühlampe<br />
entspricht.<br />
Der Vielzahl von (qualitativ sehr unterschiedlichen)<br />
Lösungen ist gemein, dass die<br />
üblichen Sockel der Glühlampe als Anschluss<br />
dienen müssen. Man steckt also eine<br />
neue Technik sozusagen in altes Schuhwerk.<br />
Vielfach wird diese Anwendung als Übergangslösung<br />
aufgefasst, welche sich in etwa<br />
15 Jahren langsam vom Markt zurückziehen<br />
wird.<br />
Bild 7: LED Retrofits in einem Langzeitmessstand des Lichttechnischen Instituts in Karlsruhe<br />
Die zweite Anwendung von LEDs stellen<br />
Leuchten dar, welche für diese Lichtquelle<br />
speziell entworfen sind. Diese werden mehr<br />
und mehr Einfluss auf unser tägliches Leben<br />
haben, indem sie sowohl gutes Licht, als<br />
auch neue Ideen in unser Heim, ins Büro, an<br />
öffentliche Orte und andere Lebensräume<br />
bringen werden.<br />
Neues Design, Farbigkeit und Weiß, sowie<br />
die geringe Größe der Lichtquelle, geben<br />
neue Impulse in der Beleuchtung.<br />
Bild 8 zeigt stellvertretend ein Beispiel für<br />
neues und vielfach ausgezeichnetes Design<br />
mit LEDs.<br />
In der allgemeinen Lichttechnik sind momentan<br />
Forschung und Entwicklung an Instituten<br />
und in der Industrie dabei, die noch offenen<br />
Fragestellungen der LED-<br />
Anwendungen, wie beispielsweise Lebensdauer,<br />
Lichtqualität und Blendungspotentiale<br />
zu beantworten.<br />
Die Grenzen der LED-Technik sind noch lange<br />
nicht erreicht. Wenn es uns gelingt, die<br />
Potentiale dieser Lichtquelle weiter zu erforschen,<br />
sinnvoll zu nutzen und in ansprechende<br />
Produkte umzusetzen, steht einer<br />
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte nichts im<br />
Wege.<br />
Bild 8: Beispiel für neues Design mit LEDs in der Allgemeinbeleuchtung;<br />
die preisgekrönte Leuchte Circolo<br />
(Quelle: Sattler)<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 55
Seite 56 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
>> Anwendungsberichte<br />
Funkanwendungen im Ex-Bereich<br />
Status quo und Neuigkeiten<br />
von Rudolph Hauke und Stephan Schultz<br />
Bild 1: Typisches Umfeld für den Einsatz von Wireless Lösungen<br />
in der Prozessindustrie<br />
Es ist ein knappes Jahrzehnt her, da startete eine neue Technologie<br />
ihren Einzug in die industrielle Kommunikation der Prozessautomatisierung.<br />
Es wurde schnell zu einem neuen Trendthema, und<br />
man kann heute feststellen, dass die Funktechnik ihren Weg in die<br />
Prozessindustrie gefunden hat.<br />
Die Anwendungen erstrecken sich heutzutage von der Datenübertragung<br />
für mobile Geräte über die drahtlose Anbindung von<br />
Sensoren und Aktoren der Automatisierungstechnik bis hin zu Lokalisierungssystemen.<br />
Funktechnik findet in erster Linie dort Anwendung,<br />
wo der Einsatz von drahtgebundener Technik einen deutlich<br />
höheren technischen und finanziellen Aufwand bedeutet. Mit den<br />
ersten Erfahrungen im Einsatz dieser Technologie wurden neue Anforderungen<br />
und Ideen für weitere Anwendungen auf den Weg gebracht.<br />
Es bleibt festzustellen, dass das Potential der Technologie<br />
heute bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.<br />
Wie jede neue Technologie, musste auch die Funktechnik beweisen,<br />
dass sie in der anspruchsvollen und rauen industriellen Umgebung<br />
zuverlässig funktioniert. Dazu zählt neben einer robusten<br />
und hoch verfügbaren Auslegung für den Bereich der Prozessindustrie<br />
und viele andere Einsatzfälle das Thema Explosionsschutz.
Anforderungen auch beim Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen<br />
Der Betrieb von elektrischen Geräten in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen wirft zuerst einmal ganz unabhängig von der individuellen<br />
Funktion die Frage auf: Was muss beachtet werden, um die<br />
Sicherheit im Sinne des Explosionsschutzes zu gewährleiten? Betrachtet<br />
man das Thema Wireless im Speziellen, dann gilt, es die Frage<br />
zu beantworten: Stellen Funksignale eine Zündgefahr dar, und<br />
wenn ja, was sind die Maßnahmen, um mögliche Gefahren abzuwenden?<br />
Die Frage nach der Zündquelle ›Funksignal‹ ist schnell beantwortet:<br />
Funkgeräte strahlen elektromagnetische Strahlung ab, und<br />
diese gehört eindeutig zu den möglichen Zündquellen in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen. Dies wird durch die ATEX Richtlinie (Richtlinie<br />
94/9/EG) dokumentiert. Dort findet sich in der Liste der möglichen<br />
Zündquellen auch die elektromagnetische Welle.<br />
Die Zündung erfordert in diesem Fall drei Faktoren: Neben einer<br />
explosionsfähigen Atmosphäre und einer Zündquelle in Form von<br />
elektromagnetischer Strahlung, ist ein metallisches Gebilde erforderlich,<br />
das ungewollt als Empfangsantenne fungiert. Um letztendlich<br />
einen zündfähigen Funken zu erzeugen, muss dieses metallische<br />
Gebilde in einer ringförmigen Struktur über eine isolierende Unterbrechung<br />
verfügen, die wie eine Funkenstrecke wirkt. Dabei kann es<br />
sich zum Beispiel um eine Dichtung an einem Rohrleitungsflansch<br />
handeln. Bei dem Blick in eine Prozessanlage lassen sich sehr einfach<br />
genügend Beispiele für solche Gebilde und Strukturen finden.<br />
Mit dem Erscheinen der Norm IEC 60079-0 (Stand März 2006) bekamen<br />
Hersteller und Anwender die ersten Grenzwerte für den Einsatz<br />
von Funkgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen an die Hand.<br />
Die Grenzwerte sind in Tabelle 1 aufgeführt.<br />
Die Grenzwerte beziehen sich auf die Explosionsgruppe,<br />
sprich die Gase. Je zündwilliger das explosionsfähige Gemisch ist,<br />
umso geringer ist die eingebrachte Energie, die für eine Zündung erforderlich<br />
ist. Dies entspricht der Einteilung, wie sie bereits von der<br />
Zündschutzart Eigensicherheit (Ex i) bekannt ist. Die Zündgrenzkurven<br />
der Eigensicherheit aus der IEC 60079-11 unterscheiden sich<br />
ebenfalls entsprechend den Explosionsgruppen I, IIA, IIB und IIC.<br />
Der Einfluss des Geräteschutzniveaus nach IEC 60079 (EPL<br />
Equipment Protection Level) kommt bei den Funksignalen dann ins<br />
Spiel, wenn es um die Fehlerbetrachtungen geht. In der Zone 2 entsprechend<br />
EPL 3 wird der normale Betrieb betrachtet, in Zone 1 entsprechend<br />
EPL 2 muss ein Fehler betrachtet werden, bei dem die<br />
oben erwähnten Grenzwerte nicht überschritten werden dürfen. Für<br />
den Einsatz in Zone 0 entsprechend EPL 1 werden die Anforderungen<br />
auf zwei mögliche Fehler erhöht. Hierbei wird vorausgesetzt, dass<br />
die entsprechenden Funksignale nur innerhalb des betrachteten Zonenbereiches<br />
verbleiben. Ein Signal, dass nach EPL3 eingestuft wurde,<br />
darf sich nur in der Zone 2 ausbreiten. Sollte das Signal auch in<br />
die Zone 1 einstrahlen, so sind die Kriterien des Schutzniveaus EPL2<br />
anzuwenden.<br />
Dies ist in der Praxis kaum zu realisieren, da insbesondere<br />
Rundstrahlantennen das Funksignal weiträumig verteilen. �<br />
Explosionsgruppe IIC IIB IIA I oder III<br />
Zündgrenzwert der Wirkleistung (W) 2 W<br />
gemittelt über 20 µs<br />
3,5 W<br />
gemittelt über 80 µs<br />
Tabelle 1: Grenzwerte für kontinuierliche Strahlung von Funksignalen in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
Bild 2: Wireless HART Gateway mit Funkschnittstelle in<br />
Zündschutzart Eigensicherheit ›i‹<br />
6 W<br />
gemittelt über 100 µs<br />
Explosionsgruppe IIC IIB IIA I oder III<br />
Zündgrenzwert der Energie Pzg 50 µJ 250 µJ 950 µJ 1.500 µJ<br />
Tabelle 2: Grenzwerte für gepulste Strahlung z.B. gepulste Radarsignale in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
6 W<br />
gemittelt über 200 µs<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 57
Funkanwendungen im Ex-Bereich – Status quo und Neuigkeiten<br />
Die im weiteren Verlauf des Artikels beschriebene vereinfachte Fehlerfallbetrachtung<br />
der Signalstärke relativiert diese Einschränkung<br />
für Signale mit geringer Sendeleistung. Beim Einsatz von Geräten mit<br />
hoher Sendeleistung muss jedoch auf die Ausbreitungsrichtung geachtet<br />
werden. So sollten Richtfunkstrecken wie sie zum Beispiel auf<br />
Offshore Plattformen üblich sind, nicht durch eine Zone 1 oder 0 verlaufen,<br />
wenn die Sendeeinheiten nur für die Zone 2 zugelassen sind.<br />
Es versteht sich von selbst, dass auch Sendeeinrichtungen, die aus<br />
dem sicheren Bereich in explosionsgefährdete Bereiche einstrahlen,<br />
betrachtet werden müssen. Hinweise zu diesen Betrachtungen können<br />
dem CENELEC Technical Report CLC/TR 50427 und der DIN VDE<br />
0848 Teil 5 entnommen werden.<br />
Bei der Entwicklung von Geräten, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen vorgesehen sind, werden mögliche<br />
Fehlerfälle vom Hersteller entsprechend berücksichtigt. Durch die<br />
Zertifizierung nach ATEX, IECEx, FM, UL, usw. erhält der Kunde ein<br />
Betriebsmittel, das er praktisch weltweit entsprechend den angegebenen<br />
Bedingungen einsetzen kann. Komplett zertifizierte Geräte<br />
sind bereits heute, z.B. für die drahtlose Steuerung von Kränen, als<br />
aktive RFID Tags oder als WirelessHART Gateways in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen im Einsatz.<br />
Etwas schwieriger ist der Fall von individuellen gekapselten<br />
Lösungen: Der Nachweis für das Fehlerverhalten ist hier nicht nur<br />
für den Projektierer so gut wie nicht möglich, sondern auch für viele<br />
Hersteller von derartigen Geräte eine kaum zu lösende Aufgabe, da<br />
ganze Schaltungsteile oft zugekauft werden. Die Aufgabe besteht<br />
darin, eine klare und belastbare Aussage über das Fehlerverhalten<br />
zu bekommen, die der Begutachtung durch den verantwortlichen<br />
Hersteller und der Zertifizierungsstelle standhält.<br />
Verbinder Connector<br />
Koaxialkabel<br />
Funkenergie<br />
ERP:<br />
Funkgerät Antenne<br />
Abgegebene<br />
Funkleistung<br />
Verbinder Koaxialkabel<br />
5 m<br />
Verbinder<br />
20 dBm 0,1 dB 5 dB 0,1 dB<br />
20 dBm<br />
100 mW<br />
19,9 dBm 14,9 dBm 14,8 dBm<br />
EIRP:<br />
Bild 3: Schematische Darstellung von ERP- bzw. EIRP-Werten<br />
Seite 58 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Antenne<br />
8 dBi<br />
22,8<br />
191 mW<br />
Vereinfachte Fehlerfallbetrachtung gemäß der neuen Ausgabe von<br />
IEC 60079-0<br />
Die neue Ausgabe der IEC 60079-0 enthält im Abschnitt zu den<br />
Grenzwerten für Funksignale eine Anmerkung, die den Anwendern<br />
und auch Herstellern das Leben erleichtern kann. Es heißt hier sinngemäß,<br />
dass bei Funksignalen, die im Normalbetrieb deutlich unter<br />
den oben genannten Grenzwerten liegen, der Fehlerfall einer überhöhten<br />
Leistung nicht betrachtet werden muss. Diese Formulierung<br />
hilft insbesondere, wenn normale Industriefunklösungen durch eine<br />
Gehäusekapselung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
ertüchtigt werden sollen. Nehmen wir einmal folgenden Fall<br />
an: Ein WLAN Access Point soll in der Zone 1 zum Einsatz kommen.<br />
Die flexibelste und am schnellsten umsetzbare Lösung ist der Einbau<br />
in ein druckfestes Gehäuse, wobei die Antenne in der Zündschutzart<br />
›Ex e‹ außerhalb des Gehäuses installiert wird. Die Antennen sind für<br />
den Einsatz in der Zone 1 bescheinigt, können jedoch einen Fehlerfall<br />
des WLAN Access Points nicht abfangen. Sollte dabei der WLAN<br />
Access Point plötzlich deutlich mehr Funkleistung abgeben, kann<br />
diese durch die Antenne nicht begrenzt werden. Die neue Anmerkung<br />
in der IEC 60079-0 weist dazu einen pragmatischen Weg aus<br />
dem Dilemma. Dies trifft insbesondere für Anwendungen, wie WLAN,<br />
Bluetooth, ZigBee, WirelessHART, ISA 100.11a und alle weiteren<br />
Technologien zu, die das ISM Band zur Übertragung nutzen. Die abgestrahlte<br />
Leistung liegt im Normalbetrieb bei Werten von 10…100<br />
mW. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass es sehr unwahrscheinlich<br />
ist, dass diese Geräte in einem Fehlerfall die elektromagnetischen<br />
Grenzwerte überschreiten.<br />
Auf Basis dieser Anmerkung können mit Hilfe einer geeigneten<br />
Zündschutzart für die Kapselung des Sendemoduls (z.B. in Ex d) und<br />
Ex-zertifizierten Antennen (meistens in der Zündschutzart Erhöhte<br />
Sicherheit ›Ex e‹), schnell und flexibel Funklösungen für den Einsatz<br />
in explosionsgefährdeten Bereichen ertüchtigt werden.<br />
Der Unterschied zwischen den Strahlungsleistungen EIRP und ERP<br />
Die in den Tabellen aufgelisteten Grenzwerte beziehen sich<br />
auf die an der Antenne abgestrahlte Leistung (EIRP Abkürzung für:<br />
equivalent isotropically radiated power). In diesem Zusammenhang<br />
ist es wichtig, die Begriffe ERP (Abkürzung für: effective radiated power)<br />
und EIRP näher zu erläutern.<br />
Die Leistungsfähigkeit einer Funkverbindung hängt in einem ganz<br />
entscheidenden Maße von der Ausführung der Antenne ab. Punktzu-Punkt<br />
Verbindungen erfordern Antennen, die den Großteil des<br />
Sendesignals in eine bestimmte Richtung abgeben und damit eine<br />
größere Entfernung überbrücken können. Für die Abdeckung eines<br />
Industriegeländes sind im Gegensatz dazu Rundstrahlantennen geeignet,<br />
die großflächig das Signal an die Umgebung abgeben. Die<br />
Fähigkeit der Antenne, das Signal in eine bestimmte Richtung zu<br />
bündeln, wird als Antennengewinn bezeichnet. Dieser Antennengewinn<br />
und andererseits die Dämpfung durch die Antennenkabel/<br />
Steckverbinder zwischen Funkmodul und Antenne machen den Unterschied<br />
zwischen ERP- und EIRP-Wert aus.
Vereinfacht gesagt, handelt es sich beim ERP-Wert um die abgegebene<br />
Leistung am Funkgerät selbst, z.B. an der Koaxialschnittstelle.<br />
Diese Angabe ist jedoch nicht maßgeblich für die Bewertung<br />
des Grenzwertes; sie ist lediglich die Basis der Betrachtung. Die<br />
Dämpfung des Verbindungskabels geht über die Länge und den<br />
Dämpfungsbelag in die Berechnung für den EIRP-Wert ein. Dieser<br />
Belag hängt vom Kabeltyp und der Frequenz des Signals ab. Für Antennenkabelverbinder<br />
wird oft ein Wert von 0,1 dB angegeben. Am<br />
Ende dieses Pegelplans zeigt sich der Einfluss des Antennengewinns.<br />
Der Pegelwert erhöht sich entsprechend des Antennengewinns.<br />
Es ergibt sich dann der EIRP-Wert, für den die Grenzwerte zu<br />
berücksichtigen sind.<br />
RFID – Funketiketten mit vielfältigen Einsatzbereichen<br />
Neben den Funk-/Wirelesseinrichtungen sollen nun auch die<br />
sogenannten RFID Etiketten - auch RFID Tag genannt- betrachtet<br />
werden. Man kennt sie aus der Materialverfolgung in der Lagerhaltung<br />
und auch als Warenhausetiketten. Im einfachsten Fall eines<br />
passiven RFID Tags bestehen sie aus einer kleinen Antenne, einem<br />
Energiespeicher und einem Mikrocontroller. Das Lesegerät sendet<br />
ein Signal aus, das von der Antenne des betreffenden RFID Tag aufgenommen<br />
und in Energie umgesetzt wird. Die Energie wird zwischengespeichert<br />
und betreibt damit den Mikrocontroller. Dieser<br />
sendet dann z.B. eine Inventarnummer zurück an das<br />
Lesegerät.<br />
Wenn es sich um den gezielten Einsatz eines RFID Tags im explosionsgefährdeten<br />
Bereich handelt, sollte dieser bescheinigt sein.<br />
Dies ist der Fall, wenn z. B. der Tag mit der Kennzeichnung eines Betriebsmittels<br />
im Ex-Bereich kommuniziert. Ein gezielter Einsatz besteht<br />
unter folgenden Kriterien:<br />
> Der RFID Tag ist sowohl Empfänger als auch als Sender zu betrachten.<br />
> Die Antenne nimmt die Energie eines umgebenden elektromagnetischen<br />
Feldes auf. Als Folge erwärmt sich die Antenne und muss<br />
im Sinne des Explosionsschutzes einer Zündtemperaturklasse<br />
entsprechen. Hierbei muss sowohl das durch ein Lesegerät gezielt<br />
ausgestrahlte Feld als auch die elektromagnetische Umgebung<br />
am Einsatzort des Tags berücksichtigt werden.<br />
> Das Kunststoffgehäuse eines Tags darf weder selbst noch durch<br />
seinen Einbau/Anbau an ein elektrisches Betriebsmittel eine elektrostatische<br />
Gefahr darstellen.<br />
�<br />
Bild 4: ›WLAN access point‹ gekapselt durch ein Ex d Gehäuse<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 59
Funkanwendungen im Ex-Bereich – Status quo und Neuigkeiten<br />
Bild 5: Aktiver RFID Tag für ein Lokalisierungssystem<br />
In der betrieblichen Praxis gibt es aber auch Fälle, bei denen<br />
RFID Tags in explosionsgefährdete Bereiche verbracht werden,<br />
ohne dass diese dort zum Einsatz kommen sollen. So können<br />
zum Beispiel Verpackungsetiketten auf angelieferten Waren passive<br />
RFID Tags enthalten, die im Ex-Bereich nicht ausgelesen werden.<br />
Ein weiteres Beispiel sind Betriebsausweise, die lediglich<br />
außerhalb des Ex-Bereiches für die Zugangskontrolle eingesetzt<br />
werden, vom Personal jedoch unbewusst in einen Ex-Bereich verbracht<br />
werden. Der passive RFID-Tag kann dort einer<br />
elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt werden, sodass dabei<br />
folgenden Zündquellen zu betrachten sind:<br />
> elektrische Zündenergie,<br />
> Erwärmung und<br />
> elektrostatische Aufladung.<br />
Für diese Art der Benutzung von passiven RFID-Tags wurden hilfreiche<br />
Anforderungen beschrieben, so dass unter gewissen Randbedingungen<br />
nicht nach 94/9/EG zertifizierte Tags eingesetzt werden<br />
können. Diese Randbedingungen werden u.a. in der aktuellen<br />
Ausgabe der IEC 60079-14 beschrieben.<br />
Für den Einsatz in der Zone 1 (21) oder Zone 2 (22) wird die Temperaturklasse<br />
T6 eingehalten, wenn die Umgebungsfeldstärke die<br />
Werte von 1 A/m oder 3 V/m nicht überschreitet und die Umgebungstemperatur<br />
?<br />
Nachgefragt<br />
Eine Frage bitte ...<br />
Kunden fragen – wir antworten<br />
›Wie werden einfache elektrische Betriebsmittel<br />
in eigensicheren Stromkreisen beurteilt<br />
und warum gibt es diese auch manchmal<br />
mit einer EG-Baumusterprüfbescheinigung?‹<br />
Das sogenannte ›einfache elektrische Betriebsmittel‹<br />
wird in DIN EN 60079-14:2008 im<br />
Abschnitt 3.5.2 definiert: ›…elektrisches<br />
Bauelement oder Kombination von Bauelementen<br />
einfacher Bauart mit genau bekannten<br />
elektrischen Parametern, das (die) die<br />
Eigensicherheit des Stromkreises, in dem es<br />
(sie) eingesetzt wird, nicht beeinträchtigt…‹.<br />
Eine identisch lautende Definition findet sich<br />
auch in der DIN EN 60079-11:2007.<br />
Als Beispiel werden die folgenden Betriebsmittel<br />
angeführt:<br />
> passive Bauelemente, z. B. Schalter, Anschlusskästen,<br />
Widerstände und einfache<br />
Halbleiterbauelemente;<br />
> Quellen gespeicherter Energie mit genau<br />
bekannten Parametern, z. B. Kondensatoren<br />
oder Induktivitäten, deren Werte berücksichtigt<br />
werden, wenn die Gesamtsicherheit<br />
des Systems beurteilt wird;<br />
> Energiequellen, z. B. Thermoelemente<br />
und Fotozellen, die nicht mehr als 1,5 V,<br />
100 mA und 25 mW erzeugen. Jede Induktivität<br />
oder Kapazität, die in diesen<br />
Quellen enthalten ist, muss wie in b) berücksichtigt<br />
werden.<br />
Da ein ›einfaches elektrisches Betriebsmittel‹<br />
keine Zündquelle aufweist und bei Einsatz<br />
in einem (zertifizierten) eigensicheren<br />
Stromkreis auch nur mit sehr niedriger Energie<br />
versorgt wird, ist keine EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
erforderlich.<br />
Die Beurteilung, ob es sich um ein einfaches<br />
elektrisches Betriebsmittel handelt,<br />
kann sowohl vom Hersteller als auch vom<br />
Betreiber durchgeführt werden. Hierbei ist<br />
nachzuweisen, ob das Betriebsmittel den<br />
zutreffenden Anforderungen der DIN EN<br />
60079-0 und -11 genügt, insbesondere den<br />
Aspekten unter DIN EN 60079-11, Abschnitt<br />
5.7. Hierzu gehören z.B. geforderte Abstände<br />
von Ex i- zu nicht-Ex i Stromkreisen, IP-<br />
Schutz, Elektrostatik usw.<br />
Der Hersteller sollte diesen Nachweis<br />
sinnvollerweise in der Betriebsanleitung unter<br />
Angabe der relevanten Grenzwerte des<br />
anschließbaren eigensicheren Stromkreises<br />
aufnehmen. Eine ATEX Kennzeichnung darf<br />
nicht aufgebracht werden.<br />
Auch der Betreiber kann den Nachweis führen:<br />
hier muss die Übereinstimmung mit entsprechenden<br />
Unterlagen, wie Werkstoffdatenblättern<br />
oder Prüfberichten dokumentiert<br />
werden. Diese geschieht vorzugsweise im<br />
Explosionsschutzdokument. Bei Einsatz in<br />
gasexplosionsgefährdeten Bereichen muss<br />
auch eine Zuordnung zu einer Temperaturklasse<br />
(T1…T6) gemäß DIN EN 60079-11 Abschnitt<br />
4 erfolgen<br />
Auch hier darf eine ATEX-Kennzeichnung<br />
im Sinne der Richtlinien nicht angebracht<br />
werden, allerdings muss das einfache elektrische<br />
Betriebsmittel als solches gekennzeichnet<br />
sein.<br />
Häufig entscheidet ein Hersteller, dass er<br />
für ein einfaches elektrisches Betriebsmittel<br />
eine EG-Baumusterprüfbescheinigung beantragt.<br />
Hier sind alle relevanten Bedingungen<br />
der ATEX-Richtlinien zu erfüllen, inklusive<br />
�<br />
des Moduls zur Qualitätssicherung.<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 61
Eine Frage bitte...<br />
Ein ›einfaches elektrisches Betriebsmittel‹<br />
mit einer EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
wird dadurch zu einem ›echten‹ eigensicheren<br />
Betriebsmittel mit den daraus sich<br />
ergebenden Konsequenzen. So muss eine<br />
ATEX-Kennzeichnung erfolgen und der<br />
Nachweis der Eigensicherheit mit den vorliegenden<br />
sicherheitstechnischen Daten<br />
durchgeführt werden und im Explosionsschutzdokument<br />
enthalten sein.<br />
Der Einsatz von ›einfachen elektrischen<br />
Betriebsmitteln‹ in der Zone 0 als Kategorie 1<br />
Geräte ist zulässig. Allerdings sind hier zusätzlich<br />
die Anforderungen der EN 60079-26<br />
(z.B. für Gehäuse) und EN 1127-1 anzuwenden.<br />
So darf die Oberflächentemperatur des<br />
einfachen elektrischen Betriebsmittels max.<br />
80 % der Zündtemperatur der Gase/Dämpfe<br />
erreichen (also z.B. bei T4 statt 135 °C nur<br />
max. 108 °C). Üblicherweise werden in der<br />
Zone 0 allerdings meistens Betriebsmittel<br />
mit einer EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
eingesetzt.<br />
Seite 62 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
›Kann eine elektrische Zigarette in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen verwendet werden?‹<br />
Die elektrische Zigarette sieht oftmals aus<br />
wie eine herkömmliche Zigarette und besteht<br />
aus mehreren Komponenten: Akku,<br />
Kartusche, Verdampfer und Mundstück.<br />
Durch das Vorhandensein elektrischer Bauteile<br />
muss davon ausgegangen werden,<br />
dass die elektrische Zigarette wirksame<br />
Zündquellen aufweisen kann. Damit diese<br />
Zigarette bei Vorhandensein explosionsfähiger<br />
Atmosphäre nicht zur Zündquelle wird,<br />
müssen analog zu elektrischen Betriebsmitteln<br />
alle wirksamen Zündquellen ausgeschlossen<br />
werden. Auch wenn rein formal<br />
die elektrische Zigarette kein Arbeitsmittel<br />
ist, muss der Hersteller für elektrische Zigaretten<br />
zum Einsatz in Zone 2 eine quasi EG-<br />
Konformitätserklärung in Analogie zu elektrischen<br />
Geräten zum Einsatz in explosions-<br />
gefährdeten Bereichen der Zone 2 erstellen.<br />
Aus dieser muss eindeutig hervorgehen,<br />
dass alle wirksamen Zündquellen beseitigt<br />
sind und diese Zigarette in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen der Zone 2 eingesetzt<br />
werden kann. Ist vorgesehen, die Zigarette<br />
sogar in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
der Zone 1 zu verwenden, sollte in Analogie<br />
zu elektrischen Geräten der Kategorie 2<br />
(Einsatz in Zone 1) gegebenenfalls auf der<br />
Basis einer EG-Baumusterprüfbescheinigung<br />
eine EG-Konformitätserklärung vom<br />
Hersteller vorhanden sein. Bisher liegen keine<br />
Erkenntnisse vor, dass Hersteller explosionsgeschützte<br />
elektrische Zigaretten anbieten.<br />
Insofern kann dem Einsatz elektrischer<br />
Zigaretten in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
aus Sicht des Explosionsschutzes<br />
nicht zugestimmt werden.<br />
(Dr. Berthold Dyrba / BG RCI, Heidelberg)
Page 63 | Ex-Magazine 2009<br />
i Produkt-Neuheiten<br />
Produkt-Neuheiten<br />
Handscheinwerfer im Einsatz bei der Feuerwehr<br />
– Interview mit Klaus Walter<br />
Herr Walter, welche Rolle spielen Handscheinwerfer<br />
für Feuerwehrleute? Was ist<br />
Ihnen bei diesen Geräten besonders wichtig?<br />
Klaus Walter: Handscheinwerfer sind bei<br />
der Feuerwehr in jedem Fahrzeug ein Muss.<br />
Das schreiben die DIN-Normen vor. Das<br />
Wichtigste für uns ist – wie bei all unseren<br />
Geräten – Zuverlässigkeit. Immer wieder<br />
schicken wir unsere Leute mit Atemschutz<br />
direkt zu dem Brandherd in einem geschlossenen<br />
Gebäude. Auch wenn das tagsüber<br />
geschieht, ist in den meisten Fällen mit<br />
Rauch zu rechnen, der enorm viel Licht<br />
schluckt. Es gibt nichts Schlimmeres – und<br />
das habe ich am eigenen Leib erlebt – als in<br />
einen solchen Einsatz mit einem Scheinwerfer<br />
zu gehen, der mitten im Brandherd plötzlich<br />
versagt.<br />
Wie beurteilen Sie die Lichtqualität und<br />
-stärke des LED-Handscheinwerfers von<br />
R. STAHL gegenüber bisher üblichen Geräten<br />
mit Halogenlampen, und was hat für Ihre<br />
Zwecke Vorrang – eher eine große Reichweite<br />
oder eher besonders gute Helligkeit<br />
im Nahbereich?<br />
Klaus Walter: Die LED-Handscheinwerfer<br />
von R. STAHL geben das beste Licht ab, das<br />
ich bis jetzt bei einem Handscheinwerfer gesehen<br />
habe, mit sehr hoher Leuchtkraft. Das<br />
Allerwichtigste ist für Feuerwehrleute, dass<br />
das Scheinwerferlicht sehr gut das Medium<br />
durchdringt, mit dem wir es bei Bränden<br />
ständig zu tun haben – also den Rauch. Der<br />
ist ziemlich unterschiedlich beschaffen. Er<br />
kann weiß sein, ebenso gut auch tiefschwarz,<br />
und er enthält, je nachdem, welche<br />
Materialien gerade verbrennen, die verschiedensten<br />
Partikel. PVC zum Beispiel erzeugt<br />
Flocken. Das LED-Licht kommt damit<br />
gut klar. Bestmögliche Unempfindlichkeit gegenüber<br />
raschen Temperaturwechseln ist<br />
ebenfalls enorm wichtig. Es kann sein, dass<br />
Bild 1: Klaus Walter, langjähriger Kommandant der<br />
Freiwilligen Feuerwehr Ingelfingen<br />
man bei -15 °C Außentemperatur ein Gebäude<br />
betritt und innerhalb kürzester Zeit einen<br />
Bereich mit +80 °C Innentemperatur erreicht.<br />
Die LED-Technologie ist außerdem besonders<br />
sparsam: Diese Geräte leuchten deshalb<br />
bis zu acht Stunden lang, bevor der Akku<br />
leer ist. Ist das für Sie auch von<br />
Bedeutung?<br />
Klaus Walter: Eine lange Betriebszeit kann<br />
ausgesprochen hilfreich sein, zum Beispiel<br />
bei Suchen draußen im Gelände. Und bei<br />
langwierigen Sicherungs- und Bergungseinsätzen<br />
ist eine langlebige Batterie natürlich<br />
vorteilhaft. Nützlich ist sie auch, wenn wir<br />
solche Scheinwerfer im Blinkmodus als Signal<br />
verwenden können. Manchmal markieren<br />
wir damit zum Beispiel einen Hydranten,<br />
den wir gerade benutzen. Aus dem schaut<br />
dann ein Rohr heraus – herannahende Autos<br />
müssen gewarnt werden, damit sie diesen<br />
Bereich besonders vorsichtig umfahren.<br />
Dass LED-Geräte mit acht Stunden Betriebsdauer<br />
auch einmal eine ganze Nacht durchhalten,<br />
erspart uns, bei einem langen Einsatz<br />
an den Austausch solcher Warnsignale alle<br />
paar Stunden denken zu müssen. �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 63
Produkt-Neuheiten<br />
Die Scheinwerfer bieten ja auch Gas- und<br />
Staub-Explosionsschutz. Wie beurteilen Sie<br />
eigentlich eventuelle Explosionsgefahren<br />
im Einsatz, und wie gehen Sie damit um?<br />
Klaus Walter: Wir dürfen prinzipiell nur explosionsgeschützte<br />
Handscheinwerfer einsetzen,<br />
denn wir können nie wissen, was uns<br />
genau erwartet. Manchmal können Sie die<br />
Situation zwar einigermaßen genau einschätzen,<br />
zum Beispiel wenn wir es mit Gefahrguttransportern<br />
zu tun haben. Und es<br />
gibt natürlich Schulungen zur Gefahrenbeurteilung<br />
bei unseren Übungen. Aber mit versteckten<br />
Gefahren ist überall zu rechnen.<br />
Die größten Überraschungen erlebt man bei<br />
Einsätzen in Wohn- und anderen Privatgebäuden.<br />
Jederzeit können in einer Garage<br />
große Gasflaschen kurz vorm Bersten stehen.<br />
Benzinkanister explodieren plötzlich.<br />
Explosionsgefahren müssen Sie als ständige<br />
Bedrohung voraussetzen. Maximaler Schutz<br />
dagegen und Risikominimierung ist deshalb<br />
Pflicht für alle technischen Geräte, die zur<br />
Ausrüstung gehören.<br />
Herr Walter, wir danken Ihnen für dieses<br />
Gespräch.<br />
Leichter LED-Handscheinwerfer für den Ex-<br />
Bereich leuchtet acht Stunden<br />
Mit rund 24.000 Candela maximaler Lichtstärke<br />
und einer Reichweite bis 155 m bei<br />
einer Beleuchtungsstärke von 1 lx stellt der<br />
tragbare explosionsgeschützte LED-Handscheinwerfer<br />
von R. STAHL konventionelle<br />
Leuchten dieser Bauart sprichwörtlich in den<br />
Schatten. Nur knapp 1,5 kg Gewicht machen<br />
die von Grund auf neu entwickelte Typreihe<br />
6148 außerdem leichter als die bisher üblichen<br />
Scheinwerfer. Nach bis zu acht Stunden<br />
Betrieb ist der Blei-Vlies-Akku des<br />
Scheinwerfers in höchstens zwölf Stunden<br />
wieder voll aufgeladen. Auch bei intensivem<br />
Gebrauch hält die 4,5 Ah starke Batterie bis<br />
zu vier Jahre. Die lange Leuchtdauer pro Akkuladung<br />
erreicht der Scheinwerfer dank der<br />
eingesetzten LED-Technologie: Die Haupt-<br />
LED, die kaltweißes Licht mit einer Farbtemperatur<br />
von 6000 K erzeugt, benötigt nur 3 W<br />
Leistung.<br />
Der ergonomisch gestaltete Scheinwerfer<br />
liegt perfekt in der Hand und kann gut mit<br />
einer Hand bedient werden. Der Scheinwer-<br />
Seite 64 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
fer eignet sich auch für raue Einsatzbedingungen<br />
und Umgebungstemperaturen von<br />
-20 °C bis +50 °C. Die Leuchte erreicht<br />
Schutzart IP66. Neben IEC Ex- und ATEX-<br />
Bescheinigungen liegt auch eine E1-Zertifizierung<br />
für den Automotive-Sektor vor. Per<br />
Dimmregler kann die benötigte Lichtstärke<br />
am Scheinwerfer schnell und komfortabel<br />
eingestellt werden. Auch einen Blinkmodus<br />
– bei Bedarf ebenfalls mit dimmbarem Licht<br />
– sowie eine Notlichtfunktion bieten diese<br />
Scheinwerfer. Zur Ausstattung gehört ein Ladegerät,<br />
für Eingangsspannungen von sowohl<br />
12 V bis 30 V DC als auch von 100 V bis<br />
240 V AC. Als Zubehör ist neben einem Anschlusskabel<br />
zum Betrieb der Ladeeinheit in<br />
einem Kraftfahrzeug auch ein Adapter für<br />
andere Ladegeräte verfügbar, um eine Umstellung<br />
auf moderne LED-Technik zu erleichtern.<br />
Wird der Akku an einem Bordnetz<br />
geladen, überwacht das Gerät die Eingangsspannung<br />
und schaltet den Ladevorgang ab,<br />
sobald die Fahrzeugbatterie zu stark beansprucht<br />
wird. Optional kann der neue Scheinwerfer<br />
mit gelben und roten Farbfiltern oder<br />
mit einer Streuscheibe ausgerüstet werden.<br />
Bild 2: Der neue LED-Handscheinwerfer von R. STAHL<br />
erreicht bis zu acht Stunden Leuchtdauer mit einer<br />
Akkuladung; farbige Filter können bequem mitgeführt<br />
werden<br />
Zum bequemen Tragen sind außerdem Gürtelhaken<br />
sowie ein Schultergurt erhältlich.<br />
Umfassende Lösungen für den Gefahrenschutz:<br />
Akustische und visuelle Signalgeräte<br />
von R. STAHL<br />
R. STAHL, ein international führender Anbieter<br />
von Sicherheitstechnik, bietet ein<br />
breites Sortiment an Warnsystemen für den<br />
weltweiten Einsatz, die Bediener durch akustische<br />
oder visuelle Signale rechtzeitig auf<br />
Fehlfunktionen aufmerksam machen und so<br />
z.B. in Brandschutzsystemen oder anderen<br />
Überwachungsanlagen optimale Sicherheit<br />
gewährleisten. Das Programm umfasst Geräte<br />
für den industriellen Einsatz sowie für<br />
explosionsgefährdete Bereiche, die beispielsweise<br />
im Schiffbau, in der Prozessindustrie,<br />
in der Fördertechnik und Logistik, in<br />
Kranen und Eisenbahnen und in Lagern und<br />
Fabrikgebäuden, aber auch in Hotels, Bürogebäuden,<br />
öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern<br />
und Flughäfen eingesetzt werden<br />
können. Für den Ex-Bereich bietet das<br />
Produktprogramm neben druckfest gekapselten<br />
Xenon- und LED-Signalleuchten, eigensicheren<br />
LED-Statusleuchten und Verkehrsampeln<br />
auch Warnblinkleuchten,<br />
Warnhupen und robuste Alarm- und Feuermelder.<br />
Zur Yodalex-Baureihe beispielsweise<br />
gehören die Warnhupe YA60, die Warnblinkleuchte<br />
FL60 und das innovative<br />
Kombigerät YL60, das Warnhupe und Warnblinkleuchte<br />
in einem gemeinsamen Gehäuse<br />
kombiniert. Die YA60-Hupe erreicht eine<br />
maximale Lautstärke von 110 dB auf 1 m und<br />
spielt zwei ansteuerbare Signalfolgen ab, die<br />
aus einer Auswahl von 32 Warntönen ausgewählt<br />
werden können.<br />
Bild 3: Warnhupe und Warnblinkleuchten der Yodalex-Baureihe (links), akustisches und<br />
visuelles Kombigerät der Serie Yodalarm/Yodalight (rechts)
Bild 4: Drucker in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
sicher betreiben: Neue Ex p-Lösung von R. STAHL<br />
Dank einer patentierten Schallhaube bei<br />
YA60 und YL60 ist eine gleichmäßige Rundum-Schallabstrahlung<br />
gewährleistet. Die<br />
Warnblinkleuchte FL60 aktiviert bei Gefahr<br />
einmal pro Sekunde einen hochintensiven 5-<br />
bis 20-Joule Blitz. Ihre aus schwer entflammbarem<br />
Polycarbonat gefertigten Kalotten<br />
sind in sieben verschiedenen Farben verfügbar<br />
und werden standardmäßig mit einem<br />
Schutzgitter geliefert. Im Angebot für den<br />
Nicht-Ex-Bereich findet man beispielsweise<br />
die Clifford & Snell-Produktpalette von elektronischen<br />
Tongebern und Signalleuchten,<br />
wie z.B. die FL40-Xenon-Warnblitzleuchten<br />
und LED-Leuchten für Status- oder Alarmanzeigen,<br />
sowie die Yodalarm- und Yodalight-Tongeber,<br />
Leuchten und Kombigeräte.<br />
Letztere kombinieren einen Tongeber mit einer<br />
maximalen Lautstärke von 120 dB auf 1 m<br />
mit Warnblitzleuchten, die mit verschiedenen<br />
Joule-Leistungen, Spannungsvarianten und<br />
Kalottenfarben erhältlich sind.<br />
Taghelles Licht in jeder Umgebung<br />
Robuste tragbare LED-Leuchten für Inspektionsaufgaben<br />
im Ex-Bereich<br />
Mit LED statt wie bisher mit Kaltkathoden-<br />
Röhren (CCFL) stattet R. STAHL Inspektionsleuchten<br />
des neuen Typs 6149/2 aus. Das<br />
weiterentwickelte Design bietet im Vergleich<br />
zur Vorgängergeneration einen erheblich geringeren<br />
Energieverbrauch. Zusätzlich weisen<br />
die LED-Geräte eine höhere Lichtstärke<br />
auf. Die neuen Handleuchten eignen sich für<br />
explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1,<br />
2, 21 und 22. Verfügbar sind die Geräte als<br />
T4-Varianten, die einen Einsatz selbst bei extremen<br />
Umgebungstemperaturen zwischen<br />
-40 °C und +60 °C gestatten. Zudem sind<br />
T6-Versionen lieferbar. Mit einer tageslicht-<br />
nahen Farbtemperatur von 6000 K stellen die<br />
LED beste Sichtverhältnisse auf Maschinenteile<br />
oder andere Arbeitsbereiche her. Eine<br />
Diffusor-Optik sorgt dafür, dass das Licht<br />
nicht blendet. Das Modellspektrum für Nennspannungen<br />
von 24-48 V AC/DC und 110-240<br />
V AC/DC wird mit einer neuen Ausführung für<br />
12 V DC Eingangsspannung nach unten ergänzt.<br />
Alle Geräte bieten Schutzart IP 66/67<br />
und erreichen bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer.<br />
Der ergonomisch geformte Griff ist so<br />
gestaltet, dass eine am Einsatzort abgelegte<br />
Leuchte nicht versehentlich wegrollen kann.<br />
Ein arretierbarer Haken erlaubt außerdem<br />
das Aufhängen. Als optionales Zubehör ist<br />
unter anderem ein Schlagschutzkorb erhältlich,<br />
um das Leuchtenrohr in besonders rauen<br />
Einsatzbedingungen zusätzlich zu schützen.<br />
Ausdruck dank Überdruck:<br />
R. STAHL liefert Ex p-Lösung für Drucker<br />
Ein schneller Ausdruck von Etiketten kam<br />
bislang in explosionsgefährdeten Anlagenbereichen<br />
kaum in Frage: Es fehlte an der<br />
nötigen explosionsgeschützten Hardware<br />
oder geeigneten Schutzkonzepten für Standardgeräte.<br />
Mit einem herkömmlichen Drucker<br />
in einem Gehäuse der Zündschutzart ›Ex<br />
p‹ (Überdruckkapselung) schafft R. STAHL<br />
hier Abhilfe. Diese Lösung setzt sich aus<br />
einem Standarddrucker und einem neu entwickelten<br />
Gehäuse zusammen. Nutzer können<br />
hiermit nun problemlos Druckaufträge in<br />
Ex-Bereichen abwickeln. Die gedruckten<br />
Etiketten lassen sich einfach durch eine<br />
frontseitige Tür entnehmen, ohne dass dafür<br />
der Drucker abgeschaltet werden muss. Zudem<br />
ist das Gehäuse mit einer seitlichen Tür<br />
und einem ausziehbaren Boden mit Griff aus-<br />
Bild 5: Die energieeffizienten und lichtstarken LED-Inspektionsleuchten<br />
sind mit einer Diffusor-Optik ausgestattet,<br />
die die Blendwirkung minimiert<br />
gestattet, die einen leichten Zugriff für Wartungsarbeiten<br />
gewährleisten.<br />
Die Zündschutzart Ex p wird erreicht, indem<br />
erstens in einem geschlossenen Gehäuse<br />
vorhandene explosionsfähige Gase ausgespült<br />
werden und zweitens anschließend ein<br />
Überdruck gegenüber der umgebenden Atmosphäre<br />
erzeugt und gehalten wird. Bedingt<br />
durch den höheren Druck im Gehäuseinneren<br />
gegenüber der Atmosphäre<br />
können zu keinem Zeitpunkt explosionsfähige<br />
Gase aus der Umgebung ins Innere vordringen.<br />
Dies wird durch die korrekte Kombination<br />
von Spülgasdurchfluss, Gehäuseabmessungen<br />
und Größe der frontseitigen Tür<br />
erzielt. Rund um den eingebauten herkömmlichen<br />
Drucker, der eine elektrische und<br />
thermische Zündquelle darstellt, wird im Gehäuse<br />
damit ein gefahrloser Bereich geschaffen.<br />
Es ist dank dieser Schutzart also<br />
nicht erforderlich, beim Drucker zwingend<br />
auf eine Begrenzung des Energiebedarfs<br />
oder auf sonstige für den Ex-Schutz wichtige<br />
Aspekte zu achten. Zudem bietet dieses<br />
Überdruckgehäuse Vorteile hinsichtlich der<br />
Benutzerfreundlichkeit: Ohne Schwierigkeiten<br />
lassen sich beispielsweise größere<br />
Fenster einsetzen, die einen besonders guten<br />
Durchblick auf Anzeigen am Drucker im<br />
Schrankinneren erlauben. Ein weiterer Vorteil<br />
sind die variablen Gehäuseabmessungen<br />
der Lösung, die den Einsatz von größeren<br />
Druckern bzw. die Verwendung von größeren<br />
Etiketten ermöglichen.<br />
Nachrüstbarer Wischerarm reinigt PTZ-Kamera<br />
im Ex-Bereich<br />
Zur effizienten Reinigung der Kameraoptik<br />
direkt aus der Warte heraus hat R. STAHL für<br />
die Ex-Kameraserie EC-740-PTZ einen patentierten,<br />
rein mechanischen, Wischerarm entwickelt.<br />
Die Konstruktion kommt ohne eigenen<br />
Elektromotor aus, da sie einfach über die<br />
Bewegung der PTZ-Kamera betätigt wird.<br />
Anders als bisher schon erhältliche Wischsysteme<br />
eignet sich diese Lösung auch sehr<br />
gut zur nachträglichen Anbringung an vorhandenen<br />
PTZ-Kameras von R. STAHL. Behindern<br />
Verschmutzungen den Durchblick,<br />
wird vom Leitstand aus über die Video-Software<br />
der Kopf der betroffenen Kamera automatisch<br />
in die Reinigungsposition nach unten<br />
gefahren. Kurz vor der Betätigung �<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 65
Produkt-Neuheiten<br />
Bild 6: Der patentierte neue Wischerarm reinigt bei<br />
Bedarf die Optik der Kamera EC-740-PTZ von<br />
R.STAHL; das Reinigungssystem lässt sich auch gut<br />
nachrüsten<br />
Bild 7: YA11-Signalhupen von R. STAHL erzeugen<br />
Alarmsignale mit 100 dB<br />
des Wischers löst die Kamera in der Abwärtsbewegung<br />
ebenfalls mechanisch eine<br />
Düse aus, die das Glas aus einem Drucktank<br />
mit Reinigungslösung besprüht. Das Schutzglas,<br />
über das gewischt wird, ist etwa fünfmal<br />
härter als herkömmliches Fensterglas,<br />
womit Kratzer praktisch ausgeschlossen<br />
sind.<br />
Die dreh- und schwenkbare Zoom-Kamera<br />
EC-740-PTZ für den Ex-Bereich ist in Aluminium-<br />
oder Edelstahlgehäuse lieferbar. Beide<br />
Varianten gewährleisten den erforderlichen<br />
Explosionsschutz durch Überdruckkapselung<br />
(Ex p) statt durch massive druckfeste<br />
Kapselung (Ex d). So bleibt selbst die Edelstahlausführung<br />
mit nur 15 kg Gewicht für<br />
den Monteur gut handhabbar. Die Kameras<br />
eignen sich für CCTV-Systeme zum Einsatz in<br />
der Öl- und Gasindustrie ebenso wie für unterschiedlichste<br />
Überwachungsaufgaben in<br />
Prozessanlagen. Sie erreichen Schutzart<br />
IP69K und trotzen selbst äußerst widrigen<br />
Bedingungen an Einsatzorten von der Wüste<br />
bis zur Hochsee. Der Betrieb ist bei extremen<br />
Umgebungstemperaturen von - 40 °C bis<br />
+75 °C möglich. Bei tiefen Temperaturen<br />
kann durch Beheizung des Linsenglases von<br />
innen auch einer Eisbildung an der Scheibe<br />
vorgebeugt werden. Der zum Wischersystem<br />
Seite 66 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
gehörige Edelstahltank mit Reinigungsflüssigkeit<br />
bietet ein Fassungsvermögen von bis<br />
zu 5 Litern. Der Behälter lässt sich in Zone 1<br />
oder 2 in bis zu 20 m Entfernung von der versorgten<br />
Kamera platzieren. Er wird entweder<br />
manuell oder optional per Kompressor (max.<br />
6 bar) gespeist.<br />
Akustische Signalgeräte für Ex-Atmosphären<br />
und raue Umgebungen: YA11-Signalhupen<br />
für Schalttafeleinbau von R. STAHL<br />
R. STAHL präsentiert mit den neuen YA11-<br />
Signalhupen für den Schalttafeleinbau eine<br />
Erweiterung der Yodalex-Signalgeräteserie.<br />
YA11-Geräte sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Umgebungen der Zonen 2<br />
und 22 konzipiert. Mit Hilfe der von der YA11-<br />
Signalhupe erzeugten akustischen Signale<br />
können Bediener, z.B. bei Fehlfunktionen<br />
oder Prozessabbrüchen gewarnt oder auf<br />
Anzeigen eines Bedientableaus aufmerksam<br />
gemacht werden. Die leichten, flachen Aluminiumgehäuse<br />
der YA11-Reihe lassen sich<br />
auf Schalttafeln, an Gehäusewänden sowie<br />
allen geeigneten Oberflächen an Schaltschränken<br />
oder Bedienständen installieren.<br />
Mit einer Höhe von lediglich 28 mm benötigen<br />
sie nur wenig Platz. Die innenliegende<br />
Elektronik ist gekapselt und dadurch bestens<br />
geschützt, und eine manipulationssichere<br />
Abdeckung bietet Schutz vor Stößen und unbefugtem<br />
Zugang. Ein vorkonfektioniertes,<br />
3m langes Kabel vereinfacht die Installation<br />
und minimiert den Kostenaufwand. Die Geräte<br />
sind gemäß IP66 / NEMA 4X zertifiziert.<br />
Dank einer Schaumdichtung und Edelstahlbefestigungen,<br />
die im Lieferumfang enthalten<br />
sind, wird die Schutzklasse bei der Installation<br />
der Signalhupe sichergestellt.<br />
Montagesätze können auch nachträglich<br />
von R. STAHL bezogen werden, falls die Hupe<br />
ersetzt oder neu installiert werden muss.<br />
YA11-Signalhupen sind mit einem werkseitig<br />
einstellbaren Signalgenerator ausgestattet:.<br />
Nutzer können bei der Bestellung aus einer<br />
Auswahl von 32 international anerkannten<br />
Warntönen den für sie zutreffenden Signalton<br />
festlegen. Die Geräte werden mit einer<br />
Nennversorgungsspannung von 24 V DC<br />
(18 bis 32 V DC) betrieben und erreichen bei<br />
einem Nennstromverbrauch von nur 70 mA<br />
eine Lautstärke von 110 dB auf 1 m. Sie eignen<br />
sich für einen Temperaturbereich von<br />
-40 bis +70 °C und verfügen über Zertifizierungen<br />
für den globalen Einsatz (ATEX,<br />
IECEx, UL und ULC), sodass sie besonders für<br />
OEMs, Schalttafelbauer und Planer eine<br />
wirtschaftlich und technisch attraktive Lösung<br />
darstellen.<br />
Komfortabler Umstieg: Breitbild-HMIs für<br />
Ex-Prozessanlagen<br />
Hellere, effiziente 22‘‘-/24‘‘-Widescreens für<br />
aktuelle und kommende PLS<br />
Zur Umrüstung bisheriger 15‘‘- und 19‘‘-<br />
Bedienstationen im Ex-Bereich bietet<br />
R. STAHL mit großformatigen aktuellen Widescreen-HMIs<br />
eine zukunftssichere Lösung<br />
an. Die Umstellung auf neue Betriebs- oder<br />
Prozessleitsysteme ist nicht das einzige<br />
sinnvolle Umstiegsszenario: Durch die modernen<br />
22‘‘- und 24‘‘-HMIs erhöht sich durchweg<br />
der Bedien- und Visualisierungskomfort,<br />
da sie mit LED-Backlights für eine brillantere<br />
Anzeige und besser ablesbare Bilder sorgen.<br />
Auch im Zusammenspiel mit Leitsystemen<br />
älterer Generationen macht sich dies bereits<br />
deutlich positiv bemerkbar. Für jüngere Versionen<br />
und anstehende Upgrades üblicher<br />
PLS stellen die Widescreen-HMIs zudem die<br />
nötigen höheren Breitformat-Auflösungen<br />
bereit. Die leistungsfähigen Stationen bieten<br />
damit vorab volle Unterstützung für noch offene<br />
eventuelle Aufrüstungen auf der Leitebene<br />
– doch auch Prozessbilder laufender<br />
Systeme werden wie gewohnt angezeigt,<br />
ohne dass neu projektiert oder konfiguriert<br />
werden muss. In Chemieanlagen, pharmazeutischen<br />
Prozessen und verwandten Bereichen<br />
der Industrie ist ein Upgrade von<br />
Vorgänger-HMIs gängiger Hersteller so gut<br />
wie immer schnell, bequem und mit geringem<br />
Aufwand möglich. Getauscht werden müssen<br />
jeweils nur Stecker und das Ex-Terminal.<br />
Sonstige vorhandene Installationen, zum<br />
Beispiel Standfüße und insbesondere die<br />
existierende Verkabelung, können einfach<br />
übernommen und weiterverwendet werden.<br />
Dank der LED-Hinterleuchtung verbrauchen<br />
die aktuellen HMIs trotz ihrer größeren Displays<br />
rund 50% weniger Energie als die gewohnten<br />
TFT-Monitore mit konventionellen<br />
Backlights. Zudem sind die neuen Geräte frei<br />
von Schadstoffen, wie z.B. Quecksilber und<br />
Blei.
Bild 8: Die Umrüstung älterer Ex-Bedienstationen in<br />
Prozessanlagen auf 22‘‘-/24‘‘-Breitbild-HMIs bringt<br />
bessere Anzeigen und ebnet späteren PLS-Upgrads<br />
den Weg<br />
Neue Ex i-Trennstufen für Vibrationssensoren:<br />
Sichere Vibrationserfassung im Ex-<br />
Bereich erhöht Anlagenverfügbarkeit<br />
R. STAHL hat das Spektrum seiner Ex i-<br />
Trennstufenreihe ISpac mit der neuen Reihe<br />
9147 um eine weitere wichtige Funktion erweitert:<br />
Die Messumformerspeisegeräte ermöglichen<br />
den Einsatz von Vibrationssensoren<br />
in explosionsgefährdeten Umgebungen.<br />
Diese Sensoren zur Zustandsüberwachung<br />
von Maschinen und Anlagen erlauben<br />
es Nutzern, entstehende Schäden<br />
frühzeitig zu erkennen. Die meisten Vibrationssensoren<br />
für explosionsgefährdete Bereiche<br />
sind in der Zündschutzart Eigensicherheit<br />
(Ex i) ausgeführt und erfordern den<br />
Einsatz von Trennstufen. Die neuen Speisegeräte<br />
des Typs 9147 erlauben es, eine sehr<br />
breite Auswahl solcher Sensoren und Messumformer<br />
anzuschließen. Die Parametrierung<br />
erfolgt schnell und komfortabel mithilfe<br />
eines leicht zugänglichen Drehschalters. Mit<br />
einer ein- und einer zweikanaligen Version<br />
der Geräte bietet R. STAHL Anwendern flexible<br />
Möglichkeiten. Der Einsatz der zweikanaligen<br />
Version erlaubt es, 50% Platz im<br />
Schaltschrank einzusparen und so die indirekten<br />
Installationskosten zu reduzieren.<br />
Dank optimalem Signal-Rausch-Abstand ist<br />
eine hochpräzise Signalübermittlung gewährleistet.<br />
Die Module sind wie alle ISpac-<br />
Trennstufen wahlweise als Einzelgeräte auf<br />
DIN-Schiene, mit Gruppenversorgung und<br />
Sammelfehlermeldung über den kostensparenden<br />
pac-Bus oder in pac-Trägern verfügbar.<br />
Die pac-Träger ermöglichen die werksseitige<br />
Vorverkabelung von Anlagen. Dies<br />
vereinfacht den endgültigen Einbau oder<br />
auch eine spätere Nachrüstung und sorgt für<br />
eine fehlerfreie Installation der Trennstufen.<br />
Die frühzeitige Erkennung problematischer<br />
Vibrationen ist bei der Zustandsüberwachung<br />
von prozesstechnischen Anlagen mit<br />
rotierenden Teilen nahezu unverzichtbar.<br />
Sie trägt dazu bei, kostspielige Anlagenstillstände<br />
zu verhindern, indem Gefahren bereits<br />
lange vor einem drohenden Ausfall diagnostiziert<br />
werden – zumeist deutlich früher,<br />
als es durch Temperatur-, Drehzahl- oder<br />
akustische Messungen möglich wäre. Eine<br />
komplette Zustandsüberwachung von Maschinen<br />
umfasst jedoch auch Temperatursensorik,<br />
diskrete Signale und 4...20 mA-<br />
Signale. Die Trennstufenreihe ISpac von<br />
R. STAHL bietet Anwendern Lösungen für alle<br />
denkbaren Signalmischungen.<br />
Reaktionsschnell und optimiert für SIL-Anwendungen:<br />
R. STAHL führt neue Generation<br />
von Messumformerspeisegeräten ein<br />
Die Messumformerspeisegeräte des Typs<br />
9160 aus der ISpac-Serie von R. STAHL sind<br />
nun in einer komplett überarbeiteten Version<br />
erhältlich. Die Geräte sind mit zahlreichen<br />
neuen und verbesserten Funktionen ausgestattet<br />
und eignen sich daher für erweiterte<br />
Anwendungsbereiche. Hinzu gekommen ist<br />
neben einer neuen Variante mit einer eigensicheren<br />
Schnittstelle für Spannungsnormsignale<br />
auch eine SIL 3-Ausführung für Anwendungen<br />
mit funktionaler Sicherheit nach<br />
IEC EN 61508. Anwender können den Sensorteil<br />
einer Sicherheitsfunktion entsprechend<br />
SIL 3 einkanalig aufbauen oder bei einem<br />
zweikanaligen Aufbau die erforderlichen<br />
Prüfzyklen verlängern. Daneben wurde eine<br />
Bild 9: Die neuen Ex i-Trennstufen des Typs 9147 ermöglichen<br />
den Einsatz von Vibrationssensoren in explosionsgefährdeten<br />
Umgebungen<br />
Reihe von Merkmalen bei allen Geräten der<br />
Produktreihen 9160 und 9163 verbessert. Dazu<br />
zählen eine reduzierte Leistungsaufnahme,<br />
reduzierte Dämpfung für die Übertragung<br />
des HART-Signals, durchweg bessere<br />
Werte für SIL-Anwendungen, die eine flexiblere<br />
Planung ermöglichen, sowie eine reduzierte<br />
Signallaufzeit, d.h. eine schnellere<br />
Reaktion des Ausgangssignals auf Änderungen<br />
am Eingang.<br />
Die Messumformerspeisegeräte des Typs<br />
9160 sind ein- und zweikanalig erhältlich und<br />
ermöglichen daher eine platzsparende Montage<br />
im Schaltschrank. Neben dem Anschluss<br />
von 2-Leiter-Messumformern erlauben<br />
die Geräte auch den Betrieb von<br />
3-Leiter-Ausführungen und die Übertragung<br />
der Signale von 4-Leiter-Messumformern.<br />
HART-Signale werden bidirektional übertragen.<br />
Wie alle Ex i-Trennstufen der ISpac-<br />
Produktfamilie lassen sich die Geräte sowohl<br />
einfach auf der Hutschiene als auch über<br />
das pac-Bus-System installieren. Mithilfe<br />
des ohne Werkzeug installierbaren pac-Bus-<br />
Systems werden alle Geräte sofort mit Strom<br />
versorgt, und die Leitungsfehlermeldung<br />
wird als Sammelmeldung ausgelesen. Zudem<br />
lassen sich die neuen Messumformerspeisegeräte<br />
auch im pac-Träger installieren,<br />
einem Baugruppenträger, der den Anschluss<br />
an Prozessleitsysteme vereinfacht. Die Geräte<br />
der neuen Generation sind funktional<br />
und bezüglich der sicherheitstechnischen<br />
Daten voll kompatibel zu den bisher verfügbaren<br />
Versionen. Ein Umstieg ist nahtlos<br />
möglich, Schaltpläne und Nachweise der Eigensicherheit<br />
müssen nicht geändert werden.<br />
�<br />
Bild 10: Die überarbeiteten Messumformerspeisegeräte<br />
des Typs 9160 bieten zahlreiche neue und optimierte<br />
Features und sind u.a. in einer SIL 3-Variante<br />
verfügbar<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 67
Produkt-Neuheiten<br />
Pipeline-Überwachung im Ex-Bereich:<br />
Innovative Lösung von R. STAHL Camera<br />
Systems<br />
Die Überwachung von Pipelines, die sich oft<br />
über große Distanzen fernab der Zivilisation<br />
erstrecken, ist eine anspruchsvolle Aufgabe:<br />
Die hierfür eingesetzte Technik muss überaus<br />
harten Umgebungsbedingungen, wie etwa<br />
Staub, extremer Hitze oder Kälte sowie<br />
Schnee und Regen standhalten und sie muss<br />
darüber hinaus tauglich für den Einsatz in<br />
explosionsgefährdeten Bereichen sein. Ein<br />
zusätzliches Problem ist, dass für Pipeline-<br />
Überwachungstechnik in vielen Fällen keine<br />
Netzstromversorgung bereitgestellt werden<br />
kann. Für solche Anwendungen hat die<br />
R. STAHL Camera Systems GmbH eine Kameralösung<br />
entwickelt, die mit einer autarken<br />
Stromversorgung ausgestattet ist und dank<br />
stickstoffbefüllter Gehäuse überaus leicht<br />
und robust ist.<br />
Sensorüberwachte Stickstoff-Füllung statt<br />
druckfester Kapselung:<br />
Die SNF-Technologie<br />
In explosionsgefährdeten Bereichen darf<br />
Überwachungstechnik grundsätzlich nur in<br />
explosionsgeschützter Ausführung eingesetzt<br />
werden. Anwender, die Kameras für die<br />
Anlagenbeobachtung installieren wollten,<br />
standen daher bislang vor dem Problem,<br />
schwere druckfest gekapselte Gehäuse<br />
(Zündschutzart Ex d) integrieren zu müssen.<br />
Um die Nachteile dieser Systeme zu beseitigen,<br />
hat R. STAHL eine Alternative entwickelt:<br />
überdruckgekapselte Gehäuse (Zündschutzart<br />
Ex p), die mit Stickstoff befüllt<br />
werden. Im Kamerainneren herrscht ein permanenter<br />
Überdruck, durch den das Eindringen<br />
gefährlicher brennbarer Gase aus der<br />
Umgebungsatmosphäre ausgeschlossen ist.<br />
Die Kameras mit SNF-Technologie (sensorcontrolled<br />
nitrogen filling) sind so präzise<br />
und dicht konstruiert, dass eine einmalige<br />
Stickstoffbefüllung lebenslang einen sicheren<br />
Betrieb erlaubt. Feste Zuleitungen<br />
oder Ventile zum Nachführen von Gas, wie<br />
sie bei der Schutzart Ex p sonst notwendig<br />
sind, sind bei SNF-Systemen also nicht erforderlich.<br />
Nur eine massive mechanische Beschädigung<br />
könnte zu einem Ausfall führen.<br />
In einem solchen Fall sorgt ein in das Gehäuse<br />
integrierter Drucksensor dafür, dass das<br />
betroffene Gerät umgehend stromlos ge-<br />
Seite 68 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
Bild 11: SNF-Kameragehäuse von R. STAHL werden<br />
einmalig mit Stickstoff befüllt und von einem Drucksensor<br />
überwacht<br />
schaltet wird und damit eine Explosionsgefahr<br />
ausgeschlossen wird.<br />
Vorteile der SNF-Technologie<br />
Die SNF-Kameras von R.STAHL Camera<br />
Systems sind leicht, robust und explosionsgeschützt.<br />
Sie sind extrem temperaturresistent<br />
und zudem gas-, dampf- und wasserdicht.<br />
Ihr Gewicht liegt je nach verwendetem<br />
Kameratyp lediglich zwischen 0,6 und 15 kg.<br />
Selbst die schwerste Variante bleibt daher<br />
handlich genug, um problemlos von einer<br />
Person montiert zu werden. Eine weitere<br />
Extrem-Eigenschaft ist die hohe Temperaturresistenz.<br />
Der gute Wärmeaustausch über<br />
die robusten, mechanisch äußerst unempfindlichen<br />
Gehäuse (Werkstoff 316) erlaubt<br />
Einsätze von -40 °C bis +75 °C. Lebensdauer<br />
und Betriebszeit bleiben dank Schutzart IP68<br />
bzw. IP69K auch bei dauerhaft rauen Witterungsbedingungen<br />
unbeeinträchtigt, ob im<br />
Wüstenklima mit Sandstürmen oder in maritimer<br />
Umgebung mit aggressiver, salzhaltiger<br />
Atmosphäre. Die Stickstofffüllung sorgt<br />
dafür, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse<br />
eindringt und gewährleistet stets eine klare<br />
Sicht der Kamera, da eine Betauung des<br />
Glases von innen ausgeschlossen ist. Für<br />
den Einsatz in der Pipeline-Überwachung<br />
sind sie somit optimal geeignet.<br />
Lösung für die Pipeline-Überwachung im<br />
Ex-Bereich<br />
Um im Falle einer Leckage oder Störungen<br />
von Pipelines den Überblick und die Kontrolle<br />
zu behalten, hat R. STAHL Camera Systems<br />
eine Komplettlösung für explosionsgefährdete<br />
Bereiche entwickelt. Diese besteht<br />
im Wesentlichen aus einem explosionsgeschützten<br />
Solarpanel, einer explosionsge-<br />
Bild 12: Die Wärmebildkamera EC-800 gewährleistet eine<br />
hundertprozentige Tag-und-Nacht-Überwachung<br />
schützten Batterie und der Wärmebildkamera<br />
EC-800. Das Solarpanel und die Batterie<br />
sichern eine autarke Stromversorgung mit<br />
hohen Reserven. Selbst ohne Sonneneinstrahlung<br />
kann die Kamera bis zu fünf Tagen<br />
lang betrieben werden. Der explosionsgeschützte<br />
Batteriepack ist zuverlässig vor<br />
dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt<br />
und eignet sich somit auch für den<br />
Einsatz in Wüstenklimaten. Eine hundertprozentige<br />
Tag-und-Nacht-Überwachung wird<br />
durch den Einsatz der Wärmebildkamera sichergestellt,<br />
die keine externe Lichtquelle<br />
benötigt. Die Kamera als Ausführung mit<br />
Schwenk-/Neigefunktion ermöglicht zusätzlich<br />
einen Rundumblick und ist darauf ausgelegt,<br />
die Pipeline umfassend und zuverlässig<br />
zu überwachen.<br />
Mit vielfältigen unterschiedlichen Kameratypen<br />
in explosionsgeschützter Ausführung<br />
sowie skalierbaren Video-Management-Systemen<br />
stellt die 2011 als Tochter von<br />
R. STAHL gegründete R. STAHL Camera Systems<br />
GmbH ein breites Hard- und Softwareportfolio<br />
samt Know-how für maßgeschneiderte<br />
CCTV-Lösungen zur Verfügung. Das<br />
Kamera-Produktspektrum reicht von äußerst<br />
kompakten Modellen für die Überwachung<br />
kleinster Nischen über Dome-Kameras bis<br />
hin zu Wärmebildkameras, die eine Rundum-die-Uhr-Überwachung<br />
sichern. Dieses<br />
breite Produktspektrum und die Systemkompetenz<br />
gewährleisten zuverlässig die Überwachung<br />
unter härtesten Bedingungen und<br />
in verschiedensten Einsatzfeldern, beispielsweise<br />
in Offshore-/Onshore-, Chemie- oder<br />
auch Pharma-Anwendungen.
Druckschriften<br />
Geschäftsbericht 2011<br />
Einfach kopieren, ausfüllen und per Fax oder Post an uns schicken<br />
Firma<br />
Name<br />
Abteilung<br />
Straße<br />
PLZ und Ort<br />
Telefon Fax<br />
E-Mail<br />
Grundlagen<br />
Explosionsschutz<br />
Einführung in den<br />
Explosionsschutz<br />
elektr. Betriebsmittel<br />
und Anlagen<br />
Safety around<br />
the world<br />
Geschäftsbericht 2011<br />
Geschäftsbericht<br />
der R. STAHL AG<br />
Betreiber elektrischer Anlagen in Ex-gefährdeten Bereichen<br />
pflichten und aufgaben<br />
R. STAHL Pflichten und Aufgaben<br />
Pflichten und Aufgaben<br />
Betreiber elektrischer<br />
Anlagen in<br />
Ex-gefährdeten<br />
Bereichen<br />
Steuern & Verteilen<br />
Systemlösungen<br />
Einblicke<br />
Wo Sicherheit keine<br />
Kompromisse kennt:<br />
System lösungen,<br />
Ex-Zertifizierungen,<br />
Service u. Seminare<br />
Camera Systems<br />
Innovative Prozess- & Sicherheitsüberwachung<br />
Kamera-Systeme<br />
Innovative ProzessundSicherheitsüberwachung<br />
+49 7942 943 40 4301<br />
Ex-Plakat<br />
HMI Solutions<br />
Innovationen für alle Branchen<br />
HMI Solutions<br />
Systemlösungen für<br />
alle Bereiche<br />
Ich möchte gerne persönlich beraten werden<br />
Ich möchte gerne in den Verteiler der<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> aufgenommen werden<br />
(erscheint 1x jährlich in Deutsch und Englisch)<br />
Ich möchte gerne Informationen zu folgenden<br />
Produkten und Themen erhalten<br />
Contents<br />
> Product Information<br />
System Solutions and Services, Safety Barriers,<br />
I.S. Isolators, Remote I/O System, Fieldbus<br />
Technology, Operating and Monitoring Systems,<br />
Lighting, Installation Equipment, Control Stations<br />
and Control Devices, Signalling Devices, Components<br />
for Heating Systems, Load Disconnect<br />
Switches and Motor Starters, Applications Low<br />
Voltage Systems, Components for System Solutions,<br />
Instalation Equipment and Accessories<br />
System requirements<br />
> PC with Windows 95 ® or higher<br />
> Acrobat Reader 6.0 or higher<br />
(download for free at www.adobe.com)<br />
Installation<br />
Not required<br />
To start the CD-ROM<br />
> Activation automatically:<br />
Put the CD into the drive unit.<br />
> Manual start: If you have installed a browser,<br />
(Netscape or Explorer), start with the date file<br />
„0000_STAHL_HOME.pdf“, in the top path of the CD<br />
(example R_STAHL (D):)\0000_STAHL_HOME.pdf).<br />
Ex-Stehsammler<br />
Ihr praktischer<br />
Sammler für unsere<br />
<strong>Zeitschrift</strong>en<br />
Automatisierungskatalog<br />
Komponenten und<br />
Systeme für<br />
die Automatisierung<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 69<br />
Inhalt<br />
Produktinformationen Systemtechnik, Sicherheitsbarrieren,<br />
Ex i Trennstufen, Remote I/O System,<br />
Feldbustechnik, Bedien- und Beobachtungssysteme,<br />
Beleuchtung, Installationsgeräte, Befehls- und<br />
Meldegeräte, Signalgeräte, Heizungskomponenten,<br />
Lasttrennschalter und Motorstarter, Applikationen<br />
Niederspannungssysteme, Komponenten für die<br />
Systemtechnik, Installationsmaterial und Zubehör<br />
Systemvoraussetzungen<br />
> PC mit Windows 95 ® oder höher<br />
> Acrobat Reader 6.0 oder höher<br />
(gratis herunterladen unter www.adobe.de)<br />
Installation<br />
Nicht erforderlich<br />
Die CD starten<br />
> Automatisch:<br />
Legen Sie die CD in Ihr Laufwerk ein.<br />
> Manuell: Falls Sie einen Browser (Netscape<br />
oder Explorer) installiert haben, starten Sie mit<br />
der Datei „0000_STAHL_HOME.pdf“, direkt unter<br />
dem Verzeichnis Ihres CD-ROM Laufwerkes (zum<br />
Beispiel: R_STAHL (D:)\0000_STAHL_HOME.pdf).<br />
R. STAHL<br />
Am Bahnhof 30<br />
74638 Waldenburg<br />
Telefon +49 7942 943-0 www.stahl.de<br />
Gedruckt in Deutschland | ID 102661<br />
R. STAHL, Abteilung Marketing, Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg<br />
Tel. +49 7942 943 4301, Fax +49 7942 943 40 4301, info.ex@stahl.de www.stahl.de<br />
2011/02<br />
gesamtkatalog<br />
general catalogue<br />
Explosionsschutz von R. STAHL<br />
Automatisieren | Schalten und Verteilen | Installieren | Bedienen und Beobachten | Beleuchten | Signalisieren und Alarmieren<br />
Explosion protection by R. STAHL<br />
Automation | Control and Distribution | Installation Equipment | Operating and Monitoring | Lighting | Signalling<br />
cd_huelle_28.02.2011 28.02.2011 10:36:04<br />
Gesamtkatalog auf<br />
CD-ROM<br />
Explosionsschutz<br />
von R. STAHL<br />
Gesamtkatalog<br />
SG/SL
Ex-Seminarkalender <strong>2012</strong>/2013<br />
Termine, Themen und Veranstaltungsorte<br />
<strong>2012</strong><br />
Termin Seminarnummer Ort Thema Veranstalter<br />
18./19.06.<strong>2012</strong> 05FO008003 Karlsruhe SIL der Prozessindustrie VDI Wissensforum GmbH<br />
25./26.06.<strong>2012</strong> 05SE061014 Düsseldorf Betrieblicher Explosionsschutz VDI Wissensforum GmbH<br />
03.07.<strong>2012</strong> 110-121-12 Herzogenaurach Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
04.07.<strong>2012</strong> 110-121-13 München Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
05.07.<strong>2012</strong> 110-121-14 Frankenthal Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
09./10.07.<strong>2012</strong> 05SE028033 Düsseldorf Methoden der Sicherheitsanalyse für verfahrenstechnische Anlagen VDI Wissensforum GmbH<br />
10.07.<strong>2012</strong> 110-121-15 Rust Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
11.07.<strong>2012</strong> 110-121-16 Stuttgart Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
24./25.07.<strong>2012</strong> 05SE066008 München Sicherer Betrieb von Druckbehälteranlagen und Rohrleitungen VDI Wissensforum GmbH<br />
20./21.08.<strong>2012</strong> 05SE070003 Frankfurt Sichere dichte Rohrleitungen nach DGRL, BetrSichV und BlmSchG VDI Wissensforum GmbH<br />
21./22.08.<strong>2012</strong> 05SE065006 Düsseldorf Sicherheitstechnik bei verfahrenstechnischen Anlagen VDI Wissensforum GmbH<br />
20.09.<strong>2012</strong> 104-121-3 Waldenburg Betriebssicherheitsverordnung: Rechtliche Aspekte und praktische Umsetzung R. STAHL<br />
25.09.<strong>2012</strong> 101-121-5 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
26./27.09.<strong>2012</strong> 106-121-4 Waldenburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
09./10.10.<strong>2012</strong> 106-121-5 Hamburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
11.10.<strong>2012</strong> 104-121-4 Hamburg Betriebssicherheitsverordnung: Rechtliche Aspekte und praktische Umsetzung R. STAHL<br />
16.10.<strong>2012</strong> 101-125-3 Wien/AT Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
17.10.<strong>2012</strong> 106-125-3 Wien/AT Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
18.10.<strong>2012</strong> 109-125-3 Köln Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
23.10.<strong>2012</strong> 104-121-5 Waldenburg Betriebssicherheitsverordnung. Rechtliche Aspekte und praktische Umsetzung R. STAHL<br />
05./06.11.<strong>2012</strong> 8112200912 Altdorf bei Nürnberg Eigensicherheit in explosionsgeschützten elektrischen Anlagen TA Wuppertal e.V.<br />
06.11.<strong>2012</strong> 101-121-6 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
07./08.11.<strong>2012</strong> 109-121-2 Waldenburg Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
13.11.<strong>2012</strong> 101-125-4 Rheinfelden/CH Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
14.11.<strong>2012</strong> 111-121-2 Waldenburg Funktionale Sicherheit – Safety integrity Level/SIL R. STAHL<br />
14.11.<strong>2012</strong> 109-125-4 Rheinfelden/CH Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
15.11.<strong>2012</strong> 106-125-4 Rheinfelden/CH Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
20.11.<strong>2012</strong> 101-121-7 Hamburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
22.11.<strong>2012</strong> 101-121-8 Leipzig Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
27.11.<strong>2012</strong> 107-121-2 Waldenburg Mechanischer Explosionsschutz R. STAHL<br />
27./28.11.<strong>2012</strong> 05FO009054 Stuttgart Allgemeiner Explosionsschutz VDI Wissensforum GmbH<br />
28./29.11.<strong>2012</strong> 106-121-6 Waldenburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
Anschriften der Veranstalter<br />
R. TAHL<br />
Am Bahnhof 30<br />
74638 Waldenburg<br />
Telefon +49 7942 943 4165<br />
Fax +49 7942 943 40 4165<br />
www.stahl.de; seminare@stahl.de<br />
Technische Akademie Heilbronn e.V.<br />
Max-Planck-Straße 39<br />
74081 Heilbronn<br />
Telefon +49 7131 56 80 63<br />
Fax +49 7131 56 80 65<br />
http://intra.fh-heilbronn.de/tah<br />
tah@hs-heilbronn.de<br />
Seite 70 | Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong><br />
VDI Wissensforum GmbH<br />
VDI Platz 1<br />
40468 Düsseldorf<br />
Telefon +49 211 6214 201<br />
Fax +49 211 6214 154<br />
www.vdi-wissensforum.de; wissensforum@vdi.de<br />
Technische Akademie Wuppertal e.V.<br />
Hubertusallee 18<br />
42117 Wuppertal<br />
Telefon +49 0202 7495-298<br />
Fax +49 0202 7495-216<br />
anmeldung@taw.de; www.taw.de
2013<br />
Termin Seminarnummer Ort Thema Veranstalter<br />
29.+30.01.2013 Köln Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
05.02.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
06./07.02.2013 Waldenburg Installtion und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
12.02.2013 Österreich Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
19.02.2013 Hamburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
21.02.2013 Leipzig Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
26.-28.02.2013 Heilbronn Heilbronner Ex-Vorträge TAH Heilbronn<br />
05.03.2013 Düsseldorf Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
06.03.2013 Köln Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
07.03.2013 Frankfurt Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
12.03.2013 Hannover Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
13.03.2013 Berlin Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
14.03.2013 Leipzig Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
19.03.2013 Osnabrück Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
20.03.2013 Dortmund Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
09.04.2013 Rheinfelden/CH Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
10.04.2013 Rheinfelden/CH Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
11.04.2013 Rheinfelden/CH Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
16.04.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
17./18.04.2013 Waldenburg Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
23.04.2013 Hamburg Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
24.04.2013 Hamburg Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
24.04.2013 Waldenburg Funktionale Sicherheit – Safety Integrity Level/SIL R. STAHL<br />
25.04.2013 Bremen Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
04.06.2013 Herzogenaurach Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
05.06.2013 München Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
06.06.2013 Stuttgart Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
11./12.06.2013 Hamburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
18.06.2013 Frankenthal Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
19.06.2013 Rust Tag des Explosionsschutzes R. STAHL<br />
25.06.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
26./27.06.2013 Waldenburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
02.07.2013 Waldenburg Mechanischer Explosionsschutz R. STAHL<br />
24.09.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
25./26.09.2013 Waldenburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
08./09.10.2013 Köln Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
15.10.2013 Hamburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
17.10.2013 Leipzig Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
22.10.2013 Waldenburg Mechanischer Explosionsschutz R. STAHL<br />
23./24.10.2013 Waldenburg Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
05.11.2013 Rheinfelden/CH Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
06.11.2013 Rheinfelden/CH Explosionsschutz durch Eigensicherheit R. STAHL<br />
07.11.2013 Rheinfelden/CH Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
12.11.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. SAHL<br />
13.11.2013 Waldenburg Funktionale Sicherheit – Safety Integrity Level/SIL R. STAHL<br />
26./27.11.2013 Hamburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
03.12.2013 Waldenburg Grundlagen Explosionsschutz R. STAHL<br />
04./05.12.2013 Waldenburg Installation und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen R. STAHL<br />
Weitere Termine auf Anfrage bei den Veranstaltern.<br />
Ex-<strong>Zeitschrift</strong> <strong>2012</strong> | Seite 71
R. STAHL<br />
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg<br />
Telefon + 49 7942 943 -0<br />
Telefax + 49 7942 943 -4333<br />
www.stahl.de<br />
ID 215395<br />
S-Ex<strong>Zeitschrift</strong> 44/<strong>2012</strong>-00-DE-06/<strong>2012</strong> · Gedruckt in Deutschland