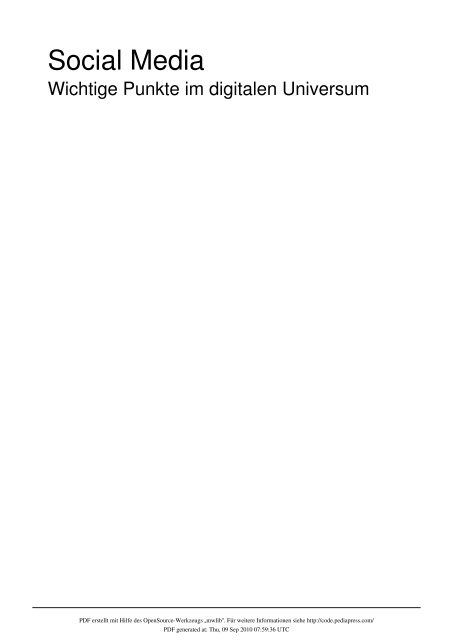Social Media - Jan A. Poczynek
Social Media - Jan A. Poczynek
Social Media - Jan A. Poczynek
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Wichtige Punkte im digitalen Universum<br />
PDF erstellt mit Hilfe des OpenSource-Werkzeugs „mwlib“. Für weitere Informationen siehe http://code.pediapress.com/<br />
PDF generated at: Thu, 09 Sep 2010 07:59:36 UTC
Inhalt<br />
Artikel<br />
Die Digitalisierung 1<br />
Internet 1<br />
World Wide Web 11<br />
Web 2.0 16<br />
Soziales Netzwerk (Internet) 23<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> 29<br />
Soziale Software 32<br />
Channels & Platforms 36<br />
Facebook 36<br />
Blog 48<br />
Mikroblogging 56<br />
Twitter 57<br />
XING 69<br />
LinkedIn 73<br />
MySpace 74<br />
studiVZ 77<br />
Flickr 82<br />
YouTube 86<br />
Wiki 94<br />
Methoden, Konzepte, Technologien 102<br />
Hypertext 102<br />
Posting 104<br />
Instant Messaging 106<br />
Chat 108<br />
Streaming <strong>Media</strong> 112<br />
RSS 116<br />
<strong>Social</strong> Tagging 121<br />
<strong>Social</strong> Bookmarks 124<br />
Cloud Computing 126<br />
Mashup (Internet) 133<br />
Kollaboratives Schreiben 135
High Speed Downlink Packet Access 138<br />
Global Positioning System 142<br />
Open Source 162<br />
Suchmaschinenoptimierung 167<br />
Breitband-Internetzugang 170<br />
Smartphone 174<br />
WordPress 179<br />
Der Hinterhof des digitalen Universums 186<br />
Google 186<br />
Apple 197<br />
Cisco Systems 215<br />
Die Kulturelle Dimension 219<br />
Cluetrain-Manifest 219<br />
Online-Community 220<br />
Verbundenheit 224<br />
Globales Dorf 225<br />
Computer Supported Cooperative Work 226<br />
Millennials 229<br />
Digital Native 230<br />
Netzkultur 233<br />
Netiquette 235<br />
Flame 237<br />
Neue Erscheinungen ...Emergenz 239<br />
Emergenz 239<br />
Prosument 248<br />
BarCamp 249<br />
Flashmob 253<br />
Crowdsourcing 256<br />
Kollektive Intelligenz 257<br />
Die Weisheit der Vielen 262<br />
Managing <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> 266<br />
Enterprise 2.0 266<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 268<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing 272<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations 276
The Long Tail 277<br />
Creative Commons 281<br />
Organisation qua Internet 289<br />
Komplexes System 289<br />
Systemtheorie (Luhmann) 292<br />
Kommunikation (soziologische Systemtheorie) 298<br />
Soziale Systeme (1984) 301<br />
Massenpsychologie 304<br />
Organisationstheorie 307<br />
Netzwerkorganisation 311<br />
Organisationssoziologie 314<br />
Dirk Baecker 316<br />
Niklas Luhmann 318<br />
Protagonisten, Literatur & Quellen 324<br />
Tim Berners-Lee 324<br />
Tim O’Reilly 327<br />
Massachusetts Institute of Technology 329<br />
Jimmy Wales 339<br />
Wikipedia 343<br />
Clay Shirky 363<br />
Chris Anderson (Journalist) 364<br />
Don Tapscott 365<br />
Wikinomics 366<br />
James Surowiecki 367<br />
Peter Kruse 368<br />
TED (Konferenz) 371<br />
Referenzen<br />
Quellen und Bearbeiter der Artikel 373<br />
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder 383<br />
Artikellizenzen<br />
Lizenz 387
Internet<br />
Die Digitalisierung<br />
Das Internet (von engl. interconnected network) ist ein weltweites Netzwerk bestehend aus vielen<br />
Rechnernetzwerken, durch das Daten ausgetauscht werden. Es ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten wie<br />
E-Mail, Telnet, Usenet, Dateiübertragung, WWW und in letzter Zeit zunehmend auch Telefonie, Radio und<br />
Fernsehen. Im Prinzip kann dabei jeder Rechner weltweit mit jedem anderen Rechner verbunden werden. Der<br />
Datenaustausch zwischen den einzelnen Internet-Rechnern erfolgt über die technisch normierten Internetprotokolle.<br />
Die Technik des Internet wird durch die RFCs der Internet Engineering Task Force (IETF) beschrieben.<br />
Umgangssprachlich wird „Internet“ häufig synonym zum World Wide Web verwendet, da dieses einer der<br />
meistgenutzten Internetdienste ist und wesentlich zum Wachstum und der Popularität des Mediums beigetragen hat.<br />
Im Gegensatz dazu sind andere Mediendienste, wie Telefonie, Fernsehen und Radio erst kürzlich über das Internet<br />
erreichbar und haben parallel dazu ihre ursprüngliche Verbreitungstechnik. [1]<br />
Begriff<br />
Herkunft<br />
Der Begriff „Internet“ ist ein Anglizismus, der sich aus der<br />
ursprünglich rein fachbezogenen Benutzung im Rahmen der<br />
gesellschaftlichen Durchdringung unverändert in der Alltagssprache<br />
als Eigenname etabliert hat. Er wurde aus der Beschreibung<br />
„Interconnected Networks“, also „mit-/untereinander verbundene<br />
Netzwerke“, auch „Zusammengeschaltete Netzwerke“, gebildet, da das<br />
Internet aus einem Zusammenschluss zahlreicher Teilnetze mittels der<br />
technischen Standards des sehr dezentral strukturierten ARPANETs<br />
entstand.<br />
Deutsche Bezeichnungen<br />
Visualisierung der verschiedenen Routen durch<br />
Teile des Internets.<br />
In der deutschen Sprache gibt es, teils aus Eindeutschungsbemühungen von Sprachpflegevereinen, verschiedene<br />
Synonyme wie „Weltnetz“, „Zwischennetz“ oder „Internetz“. Einige davon sind zwar seit Mitte der 1990er Jahre<br />
bekannt und in diversen sprachkritischen Publikationen zu finden, haben aber in der Alltagssprache keine praktische<br />
Bedeutung erlangt. [2] Weder „Weltnetz“ [3] noch „Zwischennetz“ [4] sind – im Gegensatz zu „Internet“ – bis heute in<br />
den Duden (24. Auflage) aufgenommen worden. In der Alltagssprache wird der Begriff „Internet“ oft schlicht mit<br />
dem Wort „Netz“ abgekürzt. Der Begriff "Weltnetz" konnte sich in rechtsextremen Kreisen etablieren.<br />
1
Internet 2<br />
Geschichte<br />
Das Internet ging aus dem im Jahr 1969 entstandenen ARPANET hervor, einem Projekt der Advanced Research<br />
Project Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums. Es wurde zur Vernetzung von Universitäten und<br />
Forschungseinrichtungen benutzt. Ziel des Projekts war zunächst, die knappen Rechenkapazitäten sinnvoll zu<br />
nutzen, erst in den USA, später weltweit. Die anfängliche Verbreitung des Internets ist eng mit der Entwicklung des<br />
Betriebssystems Unix verbunden. Nachdem das Arpanet im Jahr 1982 TCP/IP adaptierte, begann sich auch der<br />
Name Internet durchzusetzen.<br />
Nach einer weit verbreiteten Legende bestand das ursprüngliche Ziel des Projektes vor dem Hintergrund des Kalten<br />
Krieges in der Schaffung eines verteilten Kommunikationssystems, um im Falle eines Atomkrieges eine<br />
störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. [5] [6] In Wirklichkeit wurden vorwiegend zivile Projekte gefördert,<br />
auch wenn die ersten Knoten von der ARPA finanziert wurden.<br />
Die wichtigste Applikation in den Anfängen war die E-Mail. Bereits im Jahr 1971 überstieg das Gesamtvolumen des<br />
E-Mail-Verkehrs das Datenvolumen, das über die anderen Protokolle des Arpanet, Telnet und FTP, abgewickelt<br />
wurde.<br />
Rasanten Auftrieb erhielt das Internet seit dem Jahr 1993 durch das World Wide Web, kurz WWW, als der erste<br />
grafikfähige Webbrowser namens Mosaic veröffentlicht und zum kostenlosen Download angeboten wurde. Das<br />
WWW wurde im Jahr 1989 im CERN (bei Genf) von Tim Berners-Lee entwickelt. Schließlich konnten auch Laien<br />
auf das Netz zugreifen, was mit der wachsenden Zahl von Nutzern zu vielen kommerziellen Angeboten im Netz<br />
führte. Der Webbrowser wird deswegen auch als die „Killerapplikation“ des Internet bezeichnet. Das Internet ist ein<br />
wesentlicher Katalysator der Digitalen Revolution.<br />
Im Jahr 1990 beschloss die US-amerikanische National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke<br />
nutzbar zu machen, wodurch es über die Universitäten hinaus öffentlich zugänglich wurde.<br />
Neue Techniken verändern das Internet und ziehen neue Benutzerkreise an: IP-Telefonie, Groupware wie Wikis,<br />
Blogs, Breitbandzugänge (zum Beispiel für Vlogs und Video-on-Demand), Peer-to-Peer-Vernetzung (vor allem für<br />
File Sharing) und Online-Spiele (z. B. Rollenspiele, Taktikshooter, …).<br />
Das rasante Wachstum des Internets sowie Unzulänglichkeiten [7] für immer anspruchsvollere Anwendungen bringen<br />
es jedoch möglicherweise in Zukunft an seine Grenzen [8] , so dass inzwischen Forschungsinitiativen begonnen<br />
haben, das Internet der Zukunft zu entwickeln.
Internet 3<br />
Gesellschaftliche Aspekte<br />
Das Internet gilt bei vielen Experten als eine<br />
der größten Veränderungen des<br />
Informationswesens seit der Erfindung des<br />
Buchdruckes mit großen Auswirkungen auf<br />
diverse Bereiche des alltäglichen Lebens.<br />
Schon Anfang der 1980er Jahre waren<br />
Mailbox-Netze entstanden, basierend auf<br />
Datenfernübertragung über das Telefonnetz<br />
oder auf Netzen wie Datex-P. Diese Technik<br />
blieb aber Experten vorbehalten, wie auch<br />
der Zugang zu weltweiten TCP/IP-Netzen<br />
lange Zeit nur über Universitäten möglich<br />
war. Erst mit kommerziellen Verbreitung<br />
der Internet E-Mail Anfang der 1990er und<br />
durchgreifend dann mit dem World Wide<br />
Ein kleiner Ausschnitt des World Wide Web, dargestellt durch Hyperlinks.<br />
Web etablierte sich das Internet seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend als Standard für die Verbreitung von<br />
Informationen jeder Art.<br />
Waren dies in der Anfangszeit vor allem Kommunikation per E-Mail und der Selbstdarstellung von Personen und<br />
Firmen, folgte im Zuge der New Economy zum Ende des letzten Jahrtausends der Online-Handel. Mit steigenden<br />
Datenübertragungsraten und sinkenden Preisen und nicht zuletzt durch die Verfügbarkeit von DSL-Flatrates dient es<br />
auch der Verbreitung größerer Datenmengen. Hiermit verbunden sind vor allem massenhafte<br />
Urheberrechtsverletzungen, deren Bekämpfung heute einen Großteil der Internet-Gesetzgebung ausmachen.<br />
Eine zunehmende Bedeutung erhält auch der Online-Journalismus, der heute zu einem großen Konkurrenten der<br />
klassischen Medienlandschaft geworden ist. Aktuell sehen Beobachter zudem einen Wandel des Nutzers vom<br />
„surfenden“ (passiven) Medienkonsumenten zum aktiven Web 2.0-Autor, der sich zu vielerlei Themen in<br />
Online-Communitys mit Gleichgesinnten vernetzt, die die klassische, bisher eher techniklastige Netzkultur ergänzt.<br />
Örtlich bedingte Grenzen sind im Internet völlig aufgehoben und werden durch themenbezogene Gruppen ersetzt.<br />
Durch die Vielzahl der Informationsquellen stellt der sinnvolle Umgang mit dem Internet größere Anforderungen an<br />
die Medienkompetenz der Benutzer als klassische Medien.<br />
Das Internet wird häufig in politischen Kontexten als rechtsfreier Raum bezeichnet, da nationale Gesetze durch die<br />
internationale Struktur des Netzes und durch Anonymität als schwer durchsetzbar angesehen werden.<br />
Bei Anwendungen wie E-Mail zeigt sich, dass die Technik auf das Phänomen des Spam überhaupt nicht vorbereitet<br />
ist.<br />
Dienste wie MySpace oder Facebook sollen den Aufbau Sozialer Netzwerke ermöglichen; Funktionen wie Instant<br />
Messaging erlauben auch online beinahe spontane Kommunikation.<br />
Mit der steigenden Verbreitung des Internets wird in den Medien der Begriff Internetsucht immer wieder<br />
thematisiert, der wissenschaftlich jedoch umstritten ist. Ob und wann die exzessive Nutzung des Internets einen<br />
„schädlichen Gebrauch“ oder Missbrauch darstellt und zur Abhängigkeit führt, wird in verschiedenen Studien aktuell<br />
untersucht.<br />
Staatliche Stellen hatten lange Zeit von der Funktion des Internet wenig Kenntnisse und wenig Erfahrung mit der<br />
Anwendung der Gesetze. Bis zur New Economy-Entwicklung ab dem Jahr 1998 war zudem die Bedeutung des<br />
Internet seitens der Politik unterschätzt worden. Dies änderte sich erst danach, Gesetze wurden angepasst und die<br />
Rechtsprechung hat eine Reihe von Unsicherheiten zumindest de jure beseitigt. Der zunehmende Einfluss des Staates<br />
wird dabei teils als Steigerung der Rechtssicherheit begrüßt, teils als Fortschreiten in Richtung auf einen
Internet 4<br />
Überwachungsstaat kritisiert, etwa durch das am 1. <strong>Jan</strong>uar 2008 in Kraft getretene Gesetz zur<br />
Vorratsdatenspeicherung, das am 3. März 2010 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft<br />
wurde. Auch international wird die Kontrolle des Internet durch den Staat aufmerksam beobachtet, etwa beim<br />
Internet in der Volksrepublik China.<br />
Technik<br />
Infrastruktur<br />
Das Internet besteht aus Netzwerken unterschiedlicher administrativer Verwaltung, welche zusammengeschaltet<br />
werden. Darunter sind hauptsächlich:<br />
• Providernetzwerke, an die die Rechner der Kunden eines Internetproviders angeschlossen sind,<br />
• Firmennetzwerke (Intranets), über welche die Computer einer Firma verbunden sind, sowie<br />
• Universitäts- und Forschungsnetzwerke.<br />
Physikalisch besteht das Internet im Kernbereich (in den<br />
Backbone-Netzwerken) sowohl kontinental als auch<br />
interkontinental hauptsächlich aus Glasfaserkabeln, die durch<br />
Router zu einem Netz verbunden sind. Glasfaserkabel bieten eine<br />
enorme Übertragungskapazität und wurden vor einigen Jahren<br />
zahlreich sowohl als Land- als auch als Seekabel in Erwartung<br />
sehr großen Datenverkehr-Wachstums verlegt. Da sich die<br />
physikalisch mögliche Übertragungsrate pro Faserpaar mit<br />
fortschrittlicher Lichteinspeisetechnik (DWDM) aber immens<br />
vergrößerte, besitzt das Internet hier zur Zeit teilweise<br />
Überkapazitäten. Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2005 nur<br />
etwa 3 % der zwischen europäischen oder US-amerikanischen<br />
Städten verlegten Glasfasern benutzt [9] . Auch Satelliten und<br />
Richtfunkstrecken sind in die globale Internet-Struktur<br />
eingebunden, haben jedoch einen geringen Anteil.<br />
Auf der sogenannten letzten Meile, also bei den Hausanschlüssen,<br />
werden die Daten oft auf Kupferleitungen von Telefon- oder<br />
Fernsehanschlüssen und vermehrt auch über Funk, mittels WLAN<br />
oder UMTS, übertragen. Glasfasern bis zum Haus (FTTH) sind in<br />
Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Privatpersonen<br />
greifen auf das Internet entweder über einen<br />
Schmalbandanschluss, zum Beispiel per Modem oder ISDN (siehe<br />
Typische Verbindung zum Internet bei<br />
Heimanwendern<br />
Typische Verbindung zum Internet bei Firmen<br />
auch Internet by Call), oder über einen Breitbandzugang, zum Beispiel mit DSL, Kabelmodem oder UMTS, eines<br />
Internetproviders zu. Firmen oder staatliche Einrichtungen sind häufig per Standleitung auf Kupfer- oder<br />
Glasfaserbasis mit dem Internet verbunden, wobei Techniken wie Kanalbündelung, ATM, SDH oder - immer<br />
häufiger - Ethernet in allen Geschwindigkeitsvarianten zum Einsatz kommen.<br />
In privaten Haushalten werden oft Computer zum Abrufen von Diensten ans Internet angeschlossen, die selbst<br />
wenige oder keine solche Dienste für andere Teilnehmer bereitstellen und welche nicht dauerhaft erreichbar sind.<br />
Solche Rechner werden als Client-Rechner bezeichnet. Server dagegen sind Rechner, welche in erster Linie<br />
Internetdienste bereitstellen. Sie stehen meistens in sogenannten Rechenzentren, sind dort schnell angebunden und<br />
die klimatisierten Räumlichkeiten sind gegen Strom- und Netzwerkausfall sowie Einbruch und Brand gesichert.<br />
Peer-to-Peer-Anwendungen versetzen auch obige Client-Rechner in die Lage zeitweilig selbst Dienste anzubieten,
Internet 5<br />
die sie bei anderen Rechnern dieses Verbunds abrufen und so wird hier die strenge Unterscheidung des<br />
Client-Server-Modells aufgelöst.<br />
An Internet-Knoten werden viele verschiedene Backbone-Netzwerke über leistungsstarke Verbindungen und Geräte<br />
(Router und Switches) miteinander verbunden. Darauf wird der Austausch von Erreichbarkeitsinformationen<br />
zwischen jeweils zwei Netzen vertraglich und technisch als Peering, also auf der Basis von Gegenseitigkeit<br />
organisiert und somit der Datenaustausch ermöglicht. Am DE-CIX in Frankfurt am Main, dem größten deutschen<br />
Austauschpunkt dieser Art, sind beispielsweise mehr als hundert Netzwerke zusammengeschaltet. Eine solche<br />
Übergabe von Datenverkehr zwischen getrennten administrativen Bereichen, sogenannten autonomen Systemen,<br />
kann auch an jedem anderen Ort geschaltet werden, es ist meist jedoch wirtschaftlich sinnvoller, dies gebündelt an<br />
Internet-Knoten vorzunehmen. Da in der Regel ein autonomes System, wie z. B. ein Internetprovider, nicht alle<br />
anderen auf diese Art erreichen kann, benötigt es selbst mindestens einen Provider, der den verbleibenden<br />
Datenverkehr gegen Bezahlung zustellt. Dieser Vorgang ist technisch dem Peering ähnlich, nur stellt der sog.<br />
Upstream- oder Transitprovider dem Kunden alle im Internet verfügbaren Erreichbarkeitsinformationen zur<br />
Verfügung, auch diejenigen, bei denen er selbst für die Zustellung des zu ihnen führenden Datenverkehrs bezahlen<br />
muss. Es gibt derzeit neun sehr große, sogenannte Tier-1-Provider, die ihren gesamten Datenverkehr auf<br />
Gegenseitigkeit abwickeln oder an ihre Kunden zustellen können, ohne einen Upstreamprovider zu benötigen.<br />
Da das Arpanet als dezentrales Netzwerk möglichst ausfallsicher sein sollte, wurde schon bei der Planung beachtet,<br />
dass es keinen Zentralrechner sowie keinen Ort geben sollte, an dem alle Verbindungen zusammenlaufen. Diese<br />
Dezentralität wurde jedoch auf der politischen Ebene des Internets nicht eingehalten. Die Internet Corporation for<br />
Assigned Names and Numbers (ICANN), ist die hierarchisch höchste Organisation zuständig für die Vergabe von<br />
IP-Adressen, die Koordination des Domain Name Systems (DNS) und der dafür nötigen<br />
Root-Nameserver-Infrastruktur, sowie die Festlegung anderer Parameter der Internetprotokollfamilie, welche<br />
weltweite Eindeutigkeit verlangen. Sie untersteht wenigstens indirekt dem Einfluss des US-Wirtschaftsministeriums.<br />
Um diesen Einfluss zumindest auf das DNS einzugrenzen, wurde das in erster Linie europäische Open Root Server<br />
Network aufgebaut, das jedoch mit dem Jahresende 2008 aus nachlassendem Interesse wieder abgeschaltet<br />
[10] [11]<br />
wurde.<br />
Die netzartige Struktur sowie die Heterogenität des Internets tragen zu einer hohen Ausfallsicherheit bei. Für die<br />
Kommunikation zwischen zwei Nutzern existieren meistens mehrere mögliche Wege über Router mit verschiedenen<br />
Betriebssystemen und erst bei der tatsächlichen Datenübertragung wird entschieden, welcher benutzt wird. Dabei<br />
können zwei hintereinander versandte Datenpakete, beziehungsweise eine Anfrage und die Antwort, je nach<br />
Auslastung und Verfügbarkeit verschiedene Pfade durchlaufen. Deshalb hat der Ausfall einer physikalischen<br />
Verbindung im Kernbereich des Internets meistens keine schwerwiegenden Auswirkungen, ein Ausfall der einzigen<br />
Verbindung auf der letzten Meile lässt sich jedoch nicht ausgleichen. Im Bereich der Katastrophenforschung werden<br />
flächendeckende Missbräuche oder Ausfälle des Internets, sog. D-Gefahren, sehr ernst genommen.<br />
Internetprotokoll und Domain Name System<br />
Das Internet basiert auf der Internetprotokollfamilie, welche die Adressierung und den Datenaustausch zwischen<br />
verschiedenen Computern und Netzwerken in Form von offenen Standards regelt. Das Protokoll in welchem die<br />
weltweit eindeutige Adressierung von angebundenen Rechnern festgelegt und benutzt wird heißt Internetprotokoll<br />
(IP). Die Kommunikation damit geschieht nicht verbindungsorientiert, wie ein Telefonat, sondern paketorientiert.<br />
Das heißt, dass die zu übertragenden Daten in IP-Paketen einer Größe von bis zu ca. 65.000 Byte, meist aber nur<br />
1500 Byte, übermittelt werden, welche jeweils IP-Adressen als Absende- und Zielinformation beinhalten. Der<br />
Empfänger setzt die Daten aus den Paketinhalten, auch Nutzdaten genannt, in festgelegter Reihenfolge wieder<br />
zusammen.<br />
Die Netzwerkprotokolle sind je nach Aufgabe verschiedenen Schichten zugeordnet, wobei Protokolle höherer<br />
Schicht samt Nutzdaten in den Nutzdaten niederer Schichten transportiert werden. Die Standards und Protokolle des
Internet 6<br />
Internets werden in RFCs beschrieben und festgelegt. Ein großer Vorteil des Internetprotokolls ist, dass die<br />
Paketübertragung unabhängig von der Wahl der verwendeten Betriebssysteme und unabhängig von den<br />
Netzwerktechniken der Protokollschichten unterhalb von IP geschehen kann, so wie ein 40-Fuß-ISO-Container im<br />
Güterverkehr nacheinander per Schiff, Bahn oder Lastwagen transportiert werden kann, um an sein Ziel zu gelangen.<br />
Um einen bestimmten Computer ansprechen zu können, identifiziert ihn das Internetprotokoll mit einer eindeutigen<br />
IP-Adresse. Dabei handelt es sich bei der heute üblichen Version IPv4 um 4 Byte (32 Bit), die als 4 Dezimalzahlen<br />
im Bereich von 0 bis 255 durch einen Punkt getrennt angegeben werden, beispielsweise 66.230.200.100. Bei<br />
der neuen Version IPv6 sind dies 16 Byte (128 Bit), die als 8 durch Doppelpunkt getrennte Blöcke aus je 4<br />
hexadezimalen Ziffern angegeben werden, z. B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344. Man<br />
kann sich diese Adressen wie Telefonnummern für Computer mit dem Domain Name System (DNS) als<br />
automatischem Telefonbuch vorstellen.<br />
Das DNS ist ein wichtiger Teil der Internet-Infrastruktur. Es ist eine über viele administrative Bereiche verteilte,<br />
hierarchisch strukturierte Datenbank, die einen Übersetzungsmechanismus zur Verfügung stellt: Ein für Menschen<br />
gut merkbarer Domänenname (zum Beispiel „wikipedia.de“) kann in eine IP-Adresse übersetzt werden und<br />
umgekehrt. Dies geschieht – vom Nutzer unbemerkt – immer dann, wenn er etwa im Webbrowser auf einen neuen<br />
Link klickt oder direkt eine Webadresse eingibt. Der Browser fragt dann zuerst mittels IP-Paket einen ihm bekannten<br />
DNS-Server nach der IP-Adresse des fremden Namens und tauscht dann IP-Pakete mit dieser Adresse aus, um die<br />
Inhalte der dort angebotenen Dienste wie beispielsweise Webseiten abzurufen. Zum Ermitteln der IP-Adresse befragt<br />
oft der DNS-Server selbst der Hierarchie folgend andere DNS-Server. Die Wurzel der Hierarchie, welche in den<br />
Namen durch die Punkte erkennbar wird, bilden die Root-Nameserver. So wird also das Erreichen der erwähnten<br />
Dienste mit IP-Paketen ermöglicht, durch die den Anwendern erst ein Nutzen aus dem Internet entsteht. Auch das<br />
DNS selbst ist genau genommen schon ein solcher, wenn auch sehr grundlegender Dienst, ohne den die Nutzer zum<br />
Verbinden mit anderen Rechnern IP-Adressen statt Namen angeben müssten.<br />
Im Kernbereich des Internets müssen die IP-Pakete durch ein weit verzweigtes Netz. Die Verzweigungsstellen sind<br />
Router, welche über den kürzesten Weg zur Ziel-IP-Adresse des Paketes entscheiden. Sie verwenden dazu<br />
Routingtabellen, die über Routingprotokolle automatisch erstellt und aktuell gehalten werden, so wird automatisch<br />
auf ausgefallene Verbindungen reagiert. In Routingtabellen werden mehrere mögliche Ziel-IP-Adressen mit Hilfe<br />
von Netzmasken, bei IPv6 spricht man von Präfixlängen, zu Zielnetzen zusammengefasst und diesen wird jeweils<br />
ein Ausgang des Routers, zum Beispiel in Form der Sprungadresse zum nächsten Router (Next Hop IP Address),<br />
zum Weiterleiten zugeordnet. Zwischen autonomen Systemen geschieht der Austausch dieser<br />
Erreichbarkeitsinformationen heute ausschließlich über das Border Gateway Protocol, innerhalb eines autonomen<br />
Systems stehen viele andere Routingprotokolle zu Verfügung. Für Computer und Router, die nicht im Kernbereich<br />
des Internets stehen, reicht eine statische, nicht durch Routingprotokolle erzeugte, Routingtabelle aus. Diese enthält<br />
dann eine Default-Route, oft auch Standard- oder Default-Gateway genannt, welche für alle Zielnetze, die nicht<br />
anders eingetragen sind, in Richtung des Kernbereichs des Internets weist, ähnlich dem französischen Wegweiser<br />
„Toutes Directions“ (Alle Richtungen) im Straßenverkehr. Die Router im Kernbereich verwalten zurzeit<br />
Routingtabellen mit bis zu 300.000 Zielnetzen für IPv4 und 2500 für IPv6. [12]<br />
In den Nutzdaten des Internetprotokolls werden abhängig vom verwendeten Dienst immer noch Protokolle höherer<br />
Schichten (z. B. TCP oder UDP) übertragen, so wie ein ISO-Container im Güterverkehr z. B. Postpakete beinhalten<br />
kann, in denen wiederum Güter eingepackt sind. Die meisten Webseiten benutzen, aufbauend auf TCP, das<br />
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), bzw. das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) für verschlüsselte<br />
Seiten. E-Mails benutzen das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), ebenfalls aufbauend auf TCP, das DNS wird<br />
dagegen weitgehend mittels UDP abgewickelt.<br />
Bei IPv4 erhalten oft viele Arbeitsplatzrechner in dem Netzwerk einer Firma oder Organisation private IP-Adressen,<br />
die bei nach außen gerichteter Kommunikation per Network Address Translation (NAT) auf wenige öffentliche,<br />
global eindeutige, IP-Adressen übersetzt werden. Auf diese Rechner kann aus dem Internet nicht direkt zugegriffen
Internet 7<br />
werden, was meistens zwar aus Sicherheitsgründen erwünscht ist (siehe auch: Firewall), aber auch offensichtliche<br />
Nachteile hat. Für IPv6 stehen erheblich mehr öffentliche Adressen zur Verfügung, so kann laut RFC 4864 auf NAT<br />
verzichtet werden und es ist freier wählbar, wie die Filterung des Datenverkehrs erfolgen soll.<br />
Energieverbrauch<br />
Der Strombedarf in den Privathaushalten für die Nutzung des Internets ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen<br />
und wird seriösen Schätzungen zu Folge auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Im Jahr 2003 wurden in<br />
Deutschland etwa 6,8 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Strom für den Betrieb des Internets benötigt, für das<br />
Jahr 2010 gehen Schätzungen von einem Energiebedarf des Internets von 31,3 Milliarden Kilowattstunden nur in<br />
Deutschland aus. Berücksichtigt wurden sowohl die Endgeräte von Privathaushalt und Gewerbe sowie der<br />
Energieaufwand zur Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur des Internets an Serverstandorten. Nicht in diese<br />
Rechnung eingegangen ist der Energiebedarf von Serverstandorten im Ausland. [13] Am Stromverbrauch eines<br />
Privathaushaltes ist die Nutzung des Internets zu einem großen Teil beteiligt. [14]<br />
Für das Jahr 2005 wird weltweit von einem Energieverbrauch von 123 Milliarden Kilowattstunden nur für den<br />
Betrieb der Infrastruktur für das Internet ausgegangen. Unberücksichtigt bleiben nach dieser Studie die Geräte der<br />
Endverbraucher. [15] Aufgrund der stetigen Vergrößerung des Netzes auch in den Entwicklungsländern ist mit einem<br />
weiteren Anstieg des Verbrauches zu rechnen, derzeit werden etwa 0,8 % der weltweiten Stromerzeugung für den<br />
Betrieb des Internets benötigt. [16]<br />
Datenaufkommen<br />
Im Jahr 2009 wurden durchschnittlich 11.627 Petabyte Daten pro Monat über das (öffentlich zugängliche) Internet<br />
transportiert, was einem täglichen Datenaufkommen von mehr als 415 Petabyte entspricht (415 Petabyte entsprechen<br />
der tausendfachen Datenmenge aller Bücher, die jemals in jeder Sprache auf der Welt geschrieben wurden [17] ).<br />
Bis zum Jahr 2014 wird die Menge der global übertragenden Daten voraussichtlich auf mehr als 40.401 Petabyte pro<br />
Monat wachsen (was über 1400 Petabytes pro Tag entspricht oder täglich der 3500 fachen Information aller Bücher<br />
die je geschrieben wurden).<br />
Der Löwenanteil der übertragenden Daten wird hierbei von Video-Übertragungen (Video on Demand) ausgemacht<br />
[18] .<br />
Nutzerzahlen<br />
Verbreitung des Internets in Europa<br />
Land Anteil der<br />
Niederlande 81 %<br />
Dänemark 76 %<br />
Finnland 75 %<br />
Schweden 75 %<br />
Island 86 %<br />
Norwegen 81 %<br />
Deutschland 72 %<br />
Italien 34 %<br />
Bulgarien 28 %<br />
Internetnutzer
Internet 8<br />
Griechenland 28 %<br />
Rumänien 22 %<br />
Spanien 40 %<br />
Estland 60 %<br />
Österreich 72 %<br />
Dieser Abschnitt behandelt den Zugang zum Internet unter demographischen Aspekten; ein separater Artikel<br />
behandelt technische Prinzipien und Varianten des Internetzugangs.<br />
Die Anzahl der Teilnehmer oder angeschlossenen Geräte im Internet ist nicht exakt bestimmbar, da Nutzer mit<br />
unterschiedlichen technischen Geräten (PCs, Mobilgeräten, …) über verschiedene Anschlusstechniken kurzfristig<br />
Teil des Internets werden und dieses auch wieder verlassen. Laut IWS hatten im März 2007 etwa 16,9 Prozent der<br />
Weltbevölkerung Zugang zum Internet. [19] Laut EITO nutzen Anfang 2008 1,23 Milliarden Menschen das<br />
Internet. [20] In der EU nutzen Anfang 2008 mehr als die Hälfte (51 Prozent) der 500 Millionen EU-Bürger<br />
regelmäßig das Internet, wobei 40 Prozent das Internet gar nicht benutzen. In den EU-Ländern gibt es starke<br />
Unterschiede bei den regelmäßigen Internetbenutzern: siehe Tabelle. 80 Prozent der Haushalte mit Internetanschluss<br />
verfügen über einen Breitbandzugang. [21] In den USA sind es bereits 75 Prozent, skandinavische Länder 70 Prozent,<br />
osteuropäische Staaten teilweise bei 14 Prozent. Besonders verbreitet ist das Internet in Estland, da Estland per<br />
Gesetz den kostenlosen Zugang ins Internet garantiert.<br />
In China hatten nach dem Report über die Entwicklung des Internets Mitte 2007 162 Millionen Menschen einen<br />
Internetzugang, davon besaßen 122 Millionen einen Breitbandanschluss. [22] Bei jungen Europäern verdrängt das<br />
Internet das Fernsehen und andere traditionelle Medien. [23] US-Amerikaner nutzen als Nachrichtenquellen<br />
vorwiegend (48 Prozent) das Internet. [24]<br />
In Deutschland<br />
Etwa 60 Prozent aller Deutschen nutzen regelmäßig das Internet, Tendenz steigend um 2 bis 3 Prozent jährlich. In<br />
etwa 75 Prozent der deutschen Haushalte stehen PCs mit Internetanschluss, die jedoch mehr von jungen Menschen<br />
als von alten Menschen genutzt werden. In Deutschland verfügen ungefähr 68 Prozent der Erwachsenen über einen<br />
Internetanschluss. [25] Etwa 80 Prozent der deutschen Jugendlichen (10-13 Jahre) nutzen das Internet. [26] Neben alten<br />
Menschen nutzen in Deutschland auch sozial Schwache und Arbeitslose das Internet weniger [27] [28] (siehe auch<br />
Digitale Kluft). In Deutschland verfügen ca. 60 Prozent der Internetnutzer über einen Breitbandzugang. [29] In der<br />
Schweiz verfügen im Jahr 2006 67 Prozent der Bevölkerung über einen privaten Internetzugang. [30]<br />
Deutsche besuchen statistisch gesehen regelmäßig acht Internet-Seiten. (Männer: durchschnittlich 9,4; Frauen: 6,4<br />
Seiten / 14- bis 19-jährige: 5,8; 30 bis 39 Jahre alte: 9,1 Seiten). Die Jungen nutzen bevorzugt<br />
Unterhaltungsangebote. [31] Die deutschen Männer sind im Durchschnitt 1,3 Stunden am Tag online, bei den<br />
deutschen Frauen sind es durchschnittlich 0,8 Stunden. [32]<br />
Nutzerverhalten<br />
Dieser Abschnitt behandelt die parallele Nutzung von Internet und Fernsehen<br />
Inzwischen nutzen immer mehr Europäer Fernsehen und Internet gleichzeitig. Eine Studie von Anfang 2010,<br />
basierend auf der Forschung der EIAA <strong>Media</strong>scope Studie, besagt, dass bereits 70 Prozent der Fernsehzuschauer<br />
gleichzeitig surfen. 75 Prozent der Briten und Dänen sowie 73 Prozent der Deutschen und 71 Prozent der Belgier<br />
nutzen mindestens einmal pro Woche beide Medien gleichzeitig. Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass jeder<br />
Zweite nach Kontakt mit einer TV-Werbung, im Internet danach surft. [33]
Internet 9<br />
Literatur<br />
• Holger Bleich: Bosse der Fasern. Die Infrastruktur des Internet [34] . In: c't 7/2005, S. 88–93 (21. März 2005)<br />
• Manuel Castells: Die Internet-Galaxie - Internet, Wirtschaft und Gesellschaft. Wiesbaden 2005, ISBN<br />
3-8100-3593-9.<br />
• Ch. Meinel und H. Sack: WWW - Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien [35] . Springer-Verlag,<br />
Berlin Heidelberg New York 2004.<br />
• Andreas Metzner-Szigeth: Internet & Gesellschaft: Ein Humanes Projekt? [36] . In: Sic et Non – Zeitschrift für<br />
Philosophie und Kultur – im Netz, No. 8, 2007<br />
• Stefan Scholz: Internet-Politik in Deutschland. Vom Mythos der Unregulierbarkeit. Münster 2004, ISBN<br />
3-8258-7698-5.<br />
• Andreas Schelske: Soziologie vernetzter Medien. Grundlagen computervermittelter Vergesellschaftung.<br />
Oldenbourg Verlag, München 2006, ISBN 3-486-27396-5 (Reihe: Interaktive Medien. Herausgeber: Michael<br />
Herczeg).<br />
• Philip Kiefer: Internet & Web 2.0 von A bis Z einfach erklärt. Data Becker, Düsseldorf 2008, ISBN<br />
978-3-8158-2947-9.<br />
• Bridgette Wessels: Understanding the Internet : a socio-cultural perspective, Basingstoke [u.a.] : Palgrave<br />
Macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-51733-2<br />
Siehe auch<br />
• Anonymität im Internet<br />
• Internetrecht<br />
• Internet Archive<br />
• Internet-Backbone<br />
• Internetkriminalität<br />
• Internetworking<br />
• Internet2<br />
• Internet Society<br />
• Netzneutralität<br />
• Zensur im Internet<br />
Weblinks<br />
• Die Sendung mit der Maus: Der Datenweg durchs Internet [37]<br />
• Modul "Wissen, wie's geht" [38] soll Eltern und Kinder unterstützen, das Internet sicher zu nutzen<br />
• Internetsicherheit: Aktion u. a. des Wirtschaftsministeriums [39]<br />
• Internet Explained [40] – Eingehender Überblick und Erklärung über den Ursprung des Internets (englisch)<br />
• Linkkatalog [41] zum Thema Internet im ODP (Open Directory Project)<br />
• ARD/ZDF Online-Studie 1997–2007, Strukturdaten zur deutschen Internetnutzung [42] – jährliche,<br />
bevölkerungsrepräsentative Online-Studie von ARD und ZDF<br />
• (N)ONLINER Atlas, Deutschlands größte Studie zur Nutzung und Nicht-Nutzung des Internets [43]<br />
• Internet Traffic Report – Globale Statistik des Internets [44] (englisch)<br />
• Internet World Stats [45] (englisch)
Internet 10<br />
Referenzen<br />
[1] Vinton Cerf, Yogen Dalal, Carl Sunshine: RFC 675: (Internet Transmission Control Program, December 1974)<br />
[2] Siehe Leipziger Wortschatz (http:/ / wortschatz. uni-leipzig. de/ ) zu den Häufigkeitsklassen von Internet (http:/ / wortschatz. uni-leipzig. de/<br />
cgi-portal/ de/ wort_www?site=208& Wort_id=38320) (HK 8), Weltnetz (http:/ / wortschatz. uni-leipzig. de/ cgi-portal/ de/<br />
wort_www?site=208& Wort_id=106809523) (HK 21), Zwischennetz (http:/ / wortschatz. uni-leipzig. de/ cgi-portal/ de/<br />
wort_www?site=208& Wort_id=54094398) (HK21); beide Ersatzbegriffe liegen 13 Häufigkeitsklassen unterhalb von „Internet“, was bedeutet,<br />
dass „Internet“ etwa 10000 Mal häufiger als diese Ersatzbegriffe verwendet wird.<br />
[3] http:/ / www. duden. de/ suche/ index. php?begriff=Weltnetz& bereich=mixed<br />
[4] http:/ / www. duden. de/ suche/ index. php?begriff=Zwischennetz& bereich=mixed<br />
[5] Stimmt's - Eine bombige Legende, Die Zeit, Drösser (http:/ / www. zeit. de/ 2001/ 28/ 200128_stimmts_internet_xml)<br />
[6] A Brief History of the Internet bei e-OnTheInternet (http:/ / www. isoc. org/ oti/ articles/ 0597/ leiner. html) von Barry Leiner, David D.<br />
Clark, Robert E. Kahn, Jonathan Postel, u.a.<br />
[7] M. Handley: Why the Internet only just works (http:/ / www. cs. ucl. ac. uk/ staff/ M. Handley/ papers/ only-just-works. pdf) BT Technology<br />
Journal, Vol 24, No 3, July 2006.<br />
[8] RFC 4984 Report from the IAB Workshop on Routing and Addressing (http:/ / www. ietf. org/ rfc/ rfc4984. txt), September 2007<br />
[9] Glasfasern sind nur zu 3% beleuchtet (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Glasfasern-sind-ein-Reich-der-Finsternis--/ meldung/ 58930)<br />
[10] Alternative DNS-Root-Server vor der Abschaltung (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Alternative-DNS-Root-Server-vor-der-Abschaltung--/ meldung/ 117863)<br />
[11] https:/ / lists. dns-oarc. net/ pipermail/ dns-operations/ 2008-October/ 003339. html<br />
[12] BGP Analysis Reports (http:/ / bgp. potaroo. net/ index-bgp. html)<br />
[13] http:/ / winfuture. de/ news,7539. html Internet Grund für hohen Stromverbrauch, WinFuture.de, Benedikt Ziegenfuss, 27. <strong>Jan</strong>uar 2003]<br />
[14] Bild:Haushaltsgeraete.png<br />
[15] Schadet Surfen dem Klima?, WDR.de, Jörg Schieb, 19. Februar 2007 (http:/ / www. wdr. de/ themen/ computer/ schiebwoche/ 2007/<br />
index_08. jhtml?rubrikenstyle=computer)<br />
[16] U.S. servers slurp more power than Mississippi, c|net news.com, Stephen Shankland, 14. Februar 2007 (http:/ / news. com. com/ U. S. +<br />
servers+ slurp+ more+ power+ than+ Mississippi/ 2100-1010_3-6159583. html)<br />
[17] Cisco Visual Networking Index - What is a Zettabyte? (http:/ / www. cisco. com/ en/ US/ netsol/ ns827/ networking_solutions_sub_solution.<br />
html)<br />
[18] Cisco Visual Networking Index (http:/ / www. cisco. com/ en/ US/ solutions/ collateral/ ns341/ ns525/ ns537/ ns705/ ns827/<br />
white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper. html)<br />
[19] World Internet Users and Population Stats (http:/ / www. internetworldstats. com/ stats. htm)<br />
[20] bitkom.de: (http:/ / www. bitkom. org/ 46074_46069. aspx) Fast jeder fünfte Mensch auf der Welt ist online: 2010 werden voraussichtlich<br />
1,5 Milliarden Menschen online sein<br />
[21] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0804/ 59130. html) EU: Mehr als die Hälfte der EU-Bürger nutzt das Internet<br />
[22] heise.de: China hat 162 Millionen Internetnutzer, 19. Juli 2007 (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 92980). Originalbericht<br />
(chinesisch) (http:/ / www. cnnic. net. cn/ uploadfiles/ pdf/ 2007/ 7/ 18/ 113918. pdf)<br />
[23] heise.de: (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 101120) Bei den jungen Europäern verdrängt das Internet das Fernsehen und andere<br />
Medien<br />
[24] heise.de: (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 104320) Internet ist für die Hälfte der Amerikaner primäre Nachrichtenquelle<br />
[25] heise.de: (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 83774) Studie: 68 Prozent der erwachsenen Deutschen sind online<br />
[26] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0708/ 53966. html) Klassisches wird von elektronischem Spielzeug verdrängt: „Während schon<br />
80 Prozent der 10- bis 13-jährigen mindestens ab und zu im Netz unterwegs sind, ist es bei den 6- bis 9-jährigen jeder Dritte.“<br />
[27] spiegel.de: (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,474402,00. html) 60 Prozent der Deutschen sind online<br />
[28] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0705/ 52216. html) Studie: Mehr als 40 Millionen Deutsche sind im Netz<br />
[29] heise.de: (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 90364) Zahl der deutschen Internetnutzer wuchs um 5 Prozent<br />
[30] heise.de: (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 88382) „… im Jahr 2006 verfügen 67 Prozent der Schweizer Bevölkerung über<br />
einen privaten Internetzugang.“<br />
[31] http:/ / www. sevenoneinteractive. net/ downloads/ presse/ 08-04-02_relevant-set_PPT. pdf<br />
[32] Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2007: Durchschnittliche Internetnutzung am Tag (http:/ / de. statista. org/ statistik/<br />
stats_graph_average/ studie/ 22639/ filter/ 20003/ fcode/ 1,2/ umfrage/ nutzungsdauer-des-internets-(stunden-pro-tag)/ ), angeboten durch:<br />
statista.org (http:/ / www. statista. org/ )<br />
[33] wuv.de (http:/ / www. wuv. de/ nachrichten/ media_marktforschung/ parallele_nutzung_von_tv_und_internet_in_europa_weit_verbreitet)<br />
[34] http:/ / www. heise. de/ ct/ 05/ 07/ 088/<br />
[35] http:/ / www. minet. uni-jena. de/ ~sack/ WWWBuch/<br />
[36] http:/ / www. sicetnon. org/ content/ pdf/ internet& gesellschaft. pdf<br />
[37] http:/ / www. wdrmaus. de/ sachgeschichten/ sachgeschichten/ sachgeschichte. php5?id=84<br />
[38] http:/ / www. internet-abc. de<br />
[39] https:/ / www. sicher-im-netz. de
Internet 11<br />
[40] http:/ / www. searchandgo. com/ articles/ internet/ net-explained-1. php<br />
[41] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/<br />
[42] http:/ / www. ard-zdf-onlinestudie. de/<br />
[43] http:/ / www. nonliner-atlas. de/<br />
[44] http:/ / www. internettrafficreport. com<br />
[45] http:/ / www. internetworldstats. com/ stats. htm<br />
World Wide Web<br />
Das World Wide Web [ˌwɜːldˌwaɪdˈwɛb] (kurz Web oder WWW aus<br />
dem Englischen für: „Weltweites Netz“) ist ein über das Internet<br />
abrufbares Hypertext-System, bestehend aus elektronischen<br />
Dokumenten, die durch Hyperlinks miteinander verknüpft sind. Es<br />
wurde am 6. August 1991 weltweit zur allgemeinen Benutzung<br />
[1] [2]<br />
freigegeben.<br />
Zur Nutzung des World Wide Web wird ein Webbrowser benötigt,<br />
welcher die Daten vom Webserver holt und zum Beispiel auf dem<br />
Bildschirm anzeigt. Der Benutzer kann den Hyperlinks im Dokument<br />
folgen, die auf andere Dokumente verweisen, gleichgültig ob sie auf<br />
demselben Webserver oder einem anderen gespeichert sind. Dadurch<br />
Das historische WWW-Logo, entworfen von<br />
Robert Cailliau<br />
ergibt sich ein weltweites Netz aus Webseiten. Das Verfolgen der Hyperlinks wird oft als Internetsurfen bezeichnet.<br />
Das WWW wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit dem Internet<br />
gleichgesetzt, obwohl es jünger ist und nur eine mögliche Nutzung des<br />
Internets darstellt (so wie wiederum das Internet nur einer von<br />
verschiedenen möglichen Serververbünden ist). Es gibt durchaus<br />
Internet-Dienste, die nicht in das WWW integriert sind (am<br />
bekanntesten ist E-Mail, aber z. B. auch IRC und Telnet). Zu dieser<br />
Verwirrung haben nicht zuletzt die Webbrowser beigetragen, die nicht<br />
nur das eigentliche HTTP-Protokoll (siehe unten) benutzen können,<br />
sondern dem Nutzer auch noch andere Dienste wie Mail und FTP<br />
zugänglich machen.<br />
Geschichte<br />
Entwicklung<br />
Grafische Darstellung einiger weniger Seiten im<br />
World Wide Web um en.wikipedia.org am 18.<br />
Juli 2004
World Wide Web 12<br />
Das Web entstand 1989 als Projekt am CERN bei Genf (Schweiz), an<br />
dem Tim Berners-Lee ein Hypertext-System aufbaute. Das<br />
ursprüngliche Ziel des Systems war es, Forschungsergebnisse auf<br />
einfache Art und Weise mit Kollegen auszutauschen. Eine Methode<br />
dafür war das „Verflechten“ von wissenschaftlichen Artikeln – also das<br />
Erstellen eines Webs. In Berners-Lees eigenen Worten: The<br />
WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval<br />
initiative aiming to give universal access to a large universe of<br />
documents.<br />
Erster Webserver von Tim Berners-Lee<br />
Das dem Hypertext zugrunde liegende Konzept stammt von früheren Entwicklungen ab, wie Ted Nelsons Projekt<br />
Xanadu, Vannevar Bushs „memex“ Maschinenidee und dem Note Code Project.<br />
Das World Wide Web unterscheidet sich von damaligen Hypertext-Systemen (Note Code benutzte beispielsweise<br />
eine einfache und lesbare Syntax und sogar semantische Deskriptoren). Das WWW benötigt nur unidirektionale<br />
Links statt bidirektionaler, was es ermöglicht, einen Link auf eine Ressource zu setzen, ohne dass deren Besitzer<br />
eingreifen muss. Zudem, anders als andere Protokolle wie HyperCard oder Gopher, baut das World Wide Web auf<br />
einem freien Protokoll auf, was die Entwicklung von Servern und Clients ohne Beschränkungen durch Lizenzen<br />
möglich machte.<br />
Tim Berners-Lee nannte das erste Web-Anzeigeprogramm (das er im Herbst 1990 auf einem NeXT-Computer<br />
schrieb und das eher ein Browser-Editor-Hybrid war), einfach „WorldWideWeb“. Später benannte er es – um<br />
Verwechslungen mit dem World Wide Web (mit Leerzeichen) zu vermeiden – in „Nexus“ um. Es konnte damals nur<br />
Text anzeigen, aber spätere Browser wie Pei Weis Viola (1992) fügten die Fähigkeit Grafiken anzuzeigen dazu.<br />
Marc Andreessen vom NCSA veröffentlichte im Jahre 1993 einen Browser namens „Mosaic für X“, der bald dem<br />
Web und auch dem gesamten Internet ungekannte Popularität jenseits der bisherigen Nutzerkreise und ein<br />
explosionsartiges Wachstum bescherte. Marc Andreessen gründete die Firma „Mosaic Communications<br />
Corporation“, später „Netscape Communication“. Mittlerweile können moderne Browser auch zusätzliche Merkmale<br />
wie dynamische Inhalte, Musik und Animationen wiedergeben. [3]<br />
Name<br />
In Berners-Lees erstem Projektentwurf vom März 1989 hieß das Web noch "Mesh" (engl. Geflecht) [4] . Der Name<br />
wurde aber schnell verworfen, da er zu sehr an "Mess" (engl. Unordnung) erinnert. Die folgenden<br />
Benennungsversuche "Mine of Information" (engl: Informations-Mine) resp. "The Information Mine" hatten keinen<br />
Bestand, da die Abkürzungen MOI (frz. ich) resp. TIM zu egozentrisch wirkten; außerdem war eine Mine ein nur<br />
teilweise geeignetes Bild, da man aus ihr bloß etwas herausholen kann, das Web dagegen sowohl Informationen<br />
liefern als auch mit ihnen befüllt werden sollte.<br />
Schließlich legte Berners-Lee sich auf "Web" resp. "World Wide Web" fest, obwohl er von Kollegen gewarnt wurde,<br />
dass die im Englischen und Französischen zungenbrecherische Abkürzung "WWW" den Projekterfolg gefährden<br />
würde. "Web" erschien ihm als Bild besonders passend, da es in der Mathematik ein Netz von Knoten (engl. Nodes)<br />
bezeichnet, von denen jeder mit jedem verbunden sein kann [5] .
World Wide Web 13<br />
Funktionsweise<br />
Das WWW basiert auf drei Kernstandards:<br />
• HTTP als Protokoll, mit dem der Browser Informationen vom Webserver anfordern kann.<br />
• HTML als Dokumentenbeschreibungssprache, die festlegt, wie die Information gegliedert ist und wie die<br />
Dokumente verknüpft sind (Hyperlinks).<br />
• URLs als eindeutige Adresse bzw. Bezeichnung einer Ressource (z. B. einer Webseite), die in Hyperlinks<br />
verwendet wird.<br />
Folgende Standards kamen später dazu:<br />
• Cascading Style Sheets (CSS) legen das Aussehen der Elemente einer Webseite fest, wobei Darstellung und<br />
Inhalt getrennt werden.<br />
• Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ist eine Weiterentwicklung von HTTP, bei dem das Protokoll SSL<br />
zwischen TCP und HTTP geschoben wird und in der Folge der Datentransfer komplett verschlüsselt wird.<br />
• Document Object Model (DOM) als Programmierschnittstelle für externe Programme oder Skriptsprachen von<br />
Webbrowsern.<br />
Nicht vom W3-Konsortium standardisiert ist die am weitesten verbreitete Skript- bzw. Makrosprache von<br />
Webbrowsern:<br />
• JavaScript ist eine Skriptsprache mit Anweisungen für den Browser, mit der Programme (Skripte) eingebettet<br />
werden können. Dadurch können Webseiten mit Hilfe des Document Object Models (DOM) dynamisch geändert<br />
werden. Skripte sind üblicherweise kleine Programmschnipsel, können aber auch als Client Manager mit Hilfe<br />
des DOM die vollständige Kontrolle über die Anzeige übernehmen. Eine von Microsoft entwickelte Variante von<br />
JavaScript heißt JScript. Beide Sprachen sind sich ähnlich, allerdings nicht kompatibel zueinander. Diese<br />
Inkompatibilität der beiden Sprachen war ein entscheidender Teil des sogenannten Browserkriegs.<br />
Das World Wide Web Consortium (auch W3C genannt), das heute vom Erfinder des WWW, Tim Berners-Lee,<br />
geleitet wird, entwickelt den HTML- und CSS-Standard; andere Standards stammen von der Internet Engineering<br />
Task Force, der ECMA oder Herstellern wie Sun Microsystems.<br />
Das WWW wurde und wird durch andere Technologien ergänzt. Schon sehr früh wurden Bilder zur Illustration<br />
benutzt; die Formate GIF, PNG und JPEG herrschen vor.<br />
Außerdem können mit HTML nahezu alle Dateitypen eingebettet oder verlinkt werden, die der Browser durch<br />
Ergänzungsmodule darstellen kann. Dadurch lassen sich Multimediainhalte von Animationen bis hin zu Musik und<br />
Videos oder ganze Anwendungen wie zum Beispiel Versicherungsrechner oder Navigationsoberflächen darstellen.<br />
Ferner ermöglichen Java-Applets das Einbetten von Programmen, die auf dem Computer des WWW-Benutzers<br />
ablaufen.<br />
Weitere beliebte Formate sind PDF zum Anzeigen von Dokumenten bzw. Flash für interaktive Inhalte oder<br />
Animationen.<br />
Dynamische Webseiten und Webanwendungen<br />
→ Hauptartikel: Webanwendung<br />
Mit Hilfe der dynamischen WWW-Seiten kann das WWW als Oberfläche für verteilte Programme dienen: Ein<br />
Programm wird nicht mehr konventionell lokal auf dem Rechner gestartet, sondern ist eine Menge von dynamischen<br />
WWW-Seiten, die durch einen Webbrowser betrachtet und bedient werden können. Vorteilhaft ist hier, dass die<br />
Programme nicht mehr auf den einzelnen Rechnern verteilt sind und dort (dezentral) administriert werden müssen.<br />
Dynamische Webanwendungen werden entweder am Webserver oder direkt im Browser ausgeführt.<br />
• Ausführen von Webanwendungen am Webserver: Der Inhalt wird durch in Skriptsprachen (wie PHP oder<br />
Perl) oder kompilierte Anwendungen (wie JSP, Servlets oder ASP.NET) geschriebene Webanwendungen erzeugt
World Wide Web 14<br />
und an den Browser geliefert.<br />
• Dynamische Websites am Client: Der Browser erzeugt oder ändert Inhalt mittels JavaScript.<br />
• Gemischte Ausführung: Eine gemischte Ausführung stellt AJAX dar – hier sendet der Browser mittels<br />
JavaScript einen Request, der vom Webserver bearbeitet wird und so dynamisch Teile der HTML-Struktur<br />
erneuert.<br />
Nachteilig sind die begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten von WWW-Seiten, so dass Programme in Form von<br />
Internetseiten im Allgemeinen nicht so einfach bedient werden können wie konventionelle Programme. Ein Trend,<br />
der versucht, beides in Einklang zu bekommen, sind Rich Internet Applications.<br />
Zur Zeit ist zu beobachten, dass immer mehr Dienste, die ursprünglich vom WWW getrennt waren und als eigenes<br />
Programm liefen, über das WWW angeboten werden und mittels eines Browsers genutzt werden können:<br />
So wird Webmail oft als E-Mail-Client oder WebFTP als FTP-Client genutzt; Webforen ersetzen das Usenet und<br />
Webchats den IRC.<br />
Kompatibilität und Zugänglichkeit<br />
Oft führten Browser-Hersteller neue Möglichkeiten ein, ohne auf eine Standardisierung zu warten. Umgekehrt<br />
werden jedoch immer noch nicht alle Teile von Standards wie HTML oder CSS korrekt implementiert. Das führt zu<br />
Inkompatibilitäten zwischen bestimmten Webseiten und manchen Browsern. Besonders „hervorgetan“ durch solche<br />
Inkompatibilitäten hatte sich zu Beginn des Internet-Booms die Firma Netscape, heute vor allem das Unternehmen<br />
Microsoft mit seinem Internet Explorer.<br />
Außerdem ging durch die Vielzahl der Ad-Hoc-Erweiterungen von HTML ein wesentlicher Vorteil dieser Sprache<br />
verloren – die Trennung von Inhalt und Darstellung. Durch diese Trennung können die in HTML ausgezeichneten<br />
Inhalte optimal für das jeweilige Ausgabegerät – ob Bildschirm, Display des Mobiltelefons oder Sprachausgabe (für<br />
Benutzer mit Sehschwierigkeiten) – aufbereitet werden.<br />
Das W3C und andere Initiativen treiben daher die Entwicklung in die Richtung XHTML/XML und CSS voran, um<br />
diese Vorteile von HTML wiederzuerlangen. Die fortschreitenden Bemühungen um die Barrierefreiheit von<br />
Internetseiten unterstützen diesen Trend.<br />
Literatur<br />
• Tim Berners-Lee, Mark Fischetti: Der Web-Report. Der Schöpfer des World Wide Webs über das grenzenlose<br />
Potential des Internets. Econ, München 1999 (Originaltitel: Weaving the Web: The Original Design and Ultimate<br />
Destiny of the World Wide Web (Paperback: 2000)), ISBN 3-430-11468-3.<br />
• Christoph Meinel, Harald Sack: WWW – Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien [35] . Springer,<br />
Berlin, Heidelberg, New York 2004, ISBN 3-540-44276-6.<br />
Siehe auch<br />
• Transformation des World Wide Web: Web 2.0, Semantisches Web, Linked Open Data<br />
• verwendete Protokolle: HTTP, HTTPS, WebDAV<br />
• verwendete Dokumentformate und Dokumentsprachen: HTML, XHTML, DHTML, SGML, XML, SVG, PDF,<br />
Curl, CSS, XSL<br />
• Serverseitige Techniken: CGI, Perl, PHP, Python, ASP, JSP/Servlet, Apache Wicket, JSF, ColdFusion, Ruby, SSI<br />
• Clientseitige Techniken: Java (Java-Applet), JavaScript, Flash<br />
• Auswertung: Logdatei, Logdateianalyse<br />
• Web-Bildformate: PNG, JFIF, GIF<br />
• Berufe: Webdesigner, <strong>Media</strong>matiker<br />
• wissenschaftliche Auseinandersetzung: Webwissenschaft
World Wide Web 15<br />
• Personal Computer<br />
• Suchmaschine<br />
• Webverzeichnis<br />
Weblinks<br />
• Tim Berners-Lee: Information Management: A Proposal [6] , März 1989.<br />
• Die Geschichte des World Wide Web [7]<br />
• Zeitleiste der Geschichte des WWW mit Emulationen alter Dienste und Browser [8] (englisch)<br />
• World Wide Web Consortium [9] (englisch)<br />
• Erste WWW-Seite (Archiv) [10] (englisch)<br />
• Matthias Gräbner, Das Internet ist keine Zwiebel [11] (Telepolis, 23. Juni 2007 – über eine aktuelle Studie; vgl.<br />
[12] – PDF)<br />
Referenzen<br />
[1] History to date (http:/ / www. w3. org/ History/ 19921103-hypertext/ hypertext/ WWW/ History. html). World Wide Web Consortium.<br />
Abgerufen am 13. April 2009.<br />
[2] Tim Berners-Lee. WorldWideWeb: Summary (http:/ / groups. google. com/ group/ alt. hypertext/ msg/ 395f282a67a1916c). Abgerufen am<br />
13. April 2009.<br />
[3] Detlef Borchers: Vor 20 Jahren: Ein schwer vermittelbarer Vorschlag - und der Anfang des Web (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
meldung/ Vor-20-Jahren-Ein-schwer-vermittelbarer-Vorschlag-und-der-Anfang-des-Web-205966. html). heise online, 13. März 2009,<br />
abgerufen am 23. Juli 2010 (Deutsch).<br />
[4] Tim Berners-Lee: Information Management: A Proposal (http:/ / www. w3. org/ History/ 1989/ proposal. html). CERN/W3C, 1989,<br />
abgerufen am 1. August 2010 (siehe "Mesh" auf der Grafik).<br />
[5] Berners-Lee, Fischetti 2000, S. 23<br />
[6] http:/ / www. w3. org/ History/ 1989/ proposal. html<br />
[7] http:/ / www. netplanet. org/ geschichte/ worldwideweb. shtml<br />
[8] http:/ / www. dejavu. org<br />
[9] http:/ / www. w3. org<br />
[10] http:/ / www. w3. org/ History/ 19921103-hypertext/ hypertext/ WWW/ TheProject. html<br />
[11] http:/ / www. heise. de/ bin/ tp/ issue/ r4/ dl-artikel2. cgi?artikelnr=25553& mode=print<br />
[12] http:/ / arxiv. org/ PS_cache/ cs/ pdf/ 0607/ 0607080v1. pdf
Web 2.0 16<br />
Web 2.0<br />
Web 2.0 ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des<br />
World Wide Webs, verwendet wird. Der Begriff postuliert in Anlehnung an die Versionsnummern von<br />
Softwareprodukten eine neue Generation des Webs und grenzt diese von früheren Nutzungsarten ab. Die Bedeutung<br />
des Begriffs nimmt jedoch zugunsten des Begriffs <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> ab. [1]<br />
Herkunft<br />
Der Begriff Web 2.0 wurde im Dezember 2003 in der US-Ausgabe „Fast-Forward 2010 – The Fate of IT“ des CIO<br />
Magazin, eines Fachmagazins für IT-Manager, in dem Artikel „2004 – The Year of Web Services“ von Eric Knorr,<br />
Chefredakteur des IDG Magazins InfoWorld, erstmals gegenüber einer breiten Öffentlichkeit erwähnt.<br />
“An increase of outsourcing with web services is nothing less than the start of what Scott Dietzen, CTO of<br />
BEA Systems, calls the Web 2.0, where the Web becomes a universal, standards-based integration platform.<br />
Web 1.0 (HTTP, TCP/IP and HTML) is the core of enterprise infrastructure.”<br />
„Eine vermehrte Ausgliederung mit Webservices ist nicht weniger als der Anfang davon, was Scott Dietzen,<br />
Technischer Direktor von BEA Systems, das Web 2.0 nennt, wodurch das Netz eine universelle,<br />
standardbasierte Plattform wird. Das Web 1.0 (HTTP, TCP/IP und HTML) ist der Kern geschäftlicher<br />
Infrastruktur.“<br />
– Eric Knorr [2]<br />
Eric Knorr zitierte in seinem Artikel Scott Dietzen, welcher zu diesem Zeitpunkt CTO bei BEA Systems war (einer<br />
Tochtergesellschaft von Oracle). Dietzen ist heute „President and CTO“ [3] bei Zimbra, Inc., einem<br />
Web-2.0-Unternehmen, welches im September 2007 von Yahoo! für 350 Millionen US-Dollar [4] gekauft wurde und<br />
sich seit <strong>Jan</strong>uar 2010 im Besitz von VMware [5] befindet. 2004 wurde der Begriff auch von Dale Dougherty und<br />
Craig Cline verwendet und erhielt nach dem Artikel „What is Web 2.0“ von Tim O'Reilly vom 30. September 2005 [6]<br />
erhebliches Medienecho, auch außerhalb des englischen Sprachraumes. Der Begriff ist jedoch umstritten und wird<br />
beispielsweise von Tim Berners-Lee, dem Begründer des World Wide Web, kritisch gesehen. Tim O'Reilly<br />
definierte den Begriff Web 2.0 im Jahr 2006 ähnlich Eric Knorr oder Scott Dietzen. O'Reilly beschrieb Web 2.0 als<br />
eine Veränderung in der Geschäftswelt und als eine neue Bewegung in der Computerindustrie hin zum Internet als<br />
Plattform.<br />
“Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as a platform,<br />
and an attempt to understand the rules for success on that new platform.”<br />
„Das Web 2.0 ist die Geschäftsrevolution in der Computerindustrie, hervorgerufen durch die Verlagerung ins<br />
Internet als Plattform, und ein Versuch, die Regeln für den Erfolg auf dieser neuen Plattform zu verstehen.“<br />
– Tim O'Reilly [7]<br />
Bedeutung<br />
Der Begriff Web 2.0 bezieht sich neben spezifischen Technologien oder Innovationen wie Cloud Computing primär<br />
auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets. [8] Die Benutzer erstellen, bearbeiten und verteilen<br />
Inhalte in quantitativ und qualitativ entscheidendem Maße selbst, unterstützt von interaktiven Anwendungen. Um die<br />
neue Rolle des Nutzers zu definieren, hat sich mittlerweile der Begriff Prosumer durchgesetzt. Die Inhalte werden<br />
nicht mehr nur zentralisiert von großen Medienunternehmen erstellt und über das Internet verbreitet, sondern auch<br />
von einer Vielzahl von Nutzern, die sich mit Hilfe sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen. [9] Im<br />
Marketing wird versucht, vom Push-Prinzip (Stoßen: aktive Verteilung) zum Pull-Prinzip (Ziehen: aktive<br />
Sammlung) zu gelangen und Nutzer zu motivieren, Webseiten von sich aus mit zu gestalten.
Web 2.0 17<br />
Hintergrund<br />
Der Begriff grenzt die interaktiven Nutzungsarten von einem angeblichen Web 1.0 ab, in dem es nur wenige<br />
„Bearbeiter“ (Personen und Organisationen, die Inhalte für das Web erstellten oder Informationen bereitstellten), aber<br />
zahlreiche „Benutzer“ (Konsumenten, welche die bereitgestellten Inhalte passiv nutzten) gegeben habe.<br />
Ebenfalls wird angeführt, dass das Web zu Beginn vor allem aus statischen HTML-Seiten bestanden habe, von<br />
denen viele für längere Zeit unverändert ins Netz gestellt und nur gelegentlich überarbeitet oder in größeren<br />
Zeitabständen ausgetauscht wurden. Damit sich Seiten auch von mehreren Menschen effizient bearbeiten und<br />
verwalten lassen, seien Content-Management-Systeme und aus Datenbanken gespeiste Systeme entwickelt worden,<br />
die während der Laufzeit die Inhalte von Seiten dynamisch (nicht zu verwechseln mit Dynamic HTML) austauschen<br />
oder neue Inhalte einzusetzen helfen.<br />
Folgende Entwicklungen haben ab etwa 2005 aus Sicht der Befürworter des Begriffs zur veränderten Nutzung des<br />
Internets beigetragen:<br />
• Die Trennung von lokal verteilter und zentraler Datenhaltung schwindet: Auch Anwender ohne<br />
überdurchschnittliche technische Kenntnis oder Anwendungserfahrung benutzen Datenspeicher im Internet (etwa<br />
für Fotos). Lokale Anwendungen greifen auf Anwendungen im Netz zu; Suchmaschinen greifen auf lokale Daten<br />
zu.<br />
• Die Trennung lokaler und netzbasierter Anwendungen schwindet: Programme aktualisieren sich selbstständig<br />
über das Internet, laden Module bei Bedarf nach und immer mehr Anwendungen benutzen einen Internet-Browser<br />
als Benutzerschnittstelle.<br />
• Neben einer strengen Rollenverteilung zwischen Bearbeitern oder Informationsanbietern auf der einen Seite und<br />
reinen Benutzern oder Informationskonsumenten auf der anderen Seite sind einfache Angebote zu teil- oder<br />
zeitweise stattfindendem Rollentausch getreten: Anwender mit kaum mehr als durchschnittlicher EDV-Kenntnis<br />
stellen eigene Beiträge auf Server (siehe User Generated Content), pflegen Weblogs und verlagern auch private<br />
Daten ins öffentliche Netzwerk.<br />
• Es ist nicht mehr die Regel, die einzelnen Dienste getrennt zu nutzen, sondern die Webinhalte verschiedener<br />
Dienste werden über offene Programmierschnittstellen nahtlos zu neuen Diensten verbunden (siehe Mashups).<br />
• Durch Neuerungen beim Programmieren browsergestützter Anwendungen kann ein Benutzer auch ohne<br />
Programmierkenntnisse viel leichter als bisher aktiv an der Informations- und Meinungsverbreitung teilnehmen.<br />
Entstehung des Begriffs
Web 2.0 18<br />
Der Begriff Web 2.0 wird Dale Dougherty<br />
(O'Reilly-Verlag) und Craig Cline (<strong>Media</strong>Live)<br />
zugeschrieben, die gemeinsam eine Konferenz<br />
planten. Dougherty meinte, das Web sei in einer<br />
Renaissance, bei der sich die Regeln und<br />
Geschäftsmodelle verändern. Er stellte eine Reihe<br />
von Vergleichen an: „DoubleClick war Web 1.0;<br />
Google AdSense ist Web 2.0. Ofoto war Web 1.0;<br />
Flickr ist Web 2.0.“. Dougherty bezog John<br />
Battelle ein, um eine geschäftliche Perspektive zu<br />
erarbeiten. Daraufhin veranstalteten O’Reilly<br />
<strong>Media</strong>, Battelle und <strong>Media</strong>Live die erste<br />
Web-2.0-Konferenz im Oktober 2004. Die<br />
Konferenz findet seitdem jährlich im Oktober statt.<br />
CMP Technology (heutiger Eigentümer von<br />
Am 30. September 2005 schrieb Tim O'Reilly einen Artikel [10] , der das<br />
Thema grundlegend erklärt. Die hier abgebildete Tagcloud zeigt die<br />
Prinzipien des Web 2.0. Sie wurde von Markus Angermeier am 11.<br />
November 2005 veröffentlicht. [11]<br />
<strong>Media</strong>Live) hat den Begriff Web 2.0 in Verbindung mit Konferenzen [12] in den USA als sogenannte Service Mark<br />
(Dienstleistungsmarke) angemeldet. In diesem Zusammenhang erregte der Begriff im Frühjahr 2006<br />
Aufmerksamkeit, als eine nichtkommerzielle Organisation den Begriff für eine eigene Konferenz verwendete und<br />
von CMP anwaltlich abgemahnt wurde. Insbesondere in Weblogs wurde diese Maßnahme zum Teil scharf kritisiert.<br />
O’Reilly und Battelle fassten Schlüsselprinzipien zur Charakterisierung von Anwendungen zusammen, die dem<br />
Begriff Web 2.0 zugeordnet werden können:<br />
• das Web als Plattform (anstatt des lokalen Rechners)<br />
• datengetriebene Anwendungen (Inhalte sind wichtiger als das Aussehen)<br />
• die Vernetzung wird verstärkt durch eine „Architektur des Mitwirkens“ (jeder kann mitmachen)<br />
• Innovationen beim Aufbau von Systemen und Seiten durch die Verwendung von Komponenten, welche von<br />
verschiedenen Entwicklern erstellt worden sind und beliebig miteinander kombiniert werden können (ähnlich dem<br />
Open-Source-Entwicklungsmodell)<br />
• einfache Geschäftsmodelle durch das verteilte, gemeinsame Nutzen von Inhalten und technischen Diensten<br />
• das Ende des klassischen Softwarelebenszyklus; die Projekte befinden sich immerwährend im Beta-Stadium<br />
• die Software geht über die Fähigkeiten eines einzelnen Verwendungszwecks hinaus<br />
• es wird nicht nur auf die Vorhut von Web-Anwendungen abgezielt, sondern auf die breite Masse der<br />
Anwendungen<br />
Tim O'Reilly hat den Unterschied auch anhand einiger Anwendungen dargestellt, von denen manche allerdings nicht<br />
Teil des Webs sind. (Verweis zur Liste siehe [10] )<br />
Aufkommen gängiger Begriffe, die dem Begriff<br />
Web 2.0 zugeordnet werden, im Zeitverlauf. [13]<br />
Technik<br />
Informationen zwischen Websites ausgetauscht werden<br />
Aus technischer Sicht bezeichnet Web 2.0 auch eine Anzahl von bereits<br />
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entwickelten Methoden, von<br />
denen viele erst mit dem Aufkommen einer großen Zahl breitbandiger<br />
Internetzugänge weltweit und allgemein verfügbar wurden. Typische<br />
Techniken und Leistungen sind:<br />
• Abonnementdienste mit RSS/Atom oder ähnlichem, bei denen<br />
• Techniken, die es ermöglichen, Web-Anwendungen wie herkömmliche Desktop-Anwendungen zu bedienen (zum<br />
Beispiel AJAX)
Web 2.0 19<br />
• Webservices<br />
Abonnementdienste<br />
Manche Betreiber von Websites, beispielsweise Zeitungen, stellen Inhalte der Website in einer Form zur Verfügung,<br />
die der Benutzer abonnieren kann. Neue Inhalte werden automatisch heruntergeladen und dem Benutzer durch ein<br />
geeignetes Programm angezeigt. Populäre Anwendungen hierfür sind unter anderem das Anzeigen der neuesten<br />
Schlagzeilen der bevorzugten Zeitung auf dem Desktop oder Information über neu eingetroffene E-Mails in einem<br />
Webmail-Postfach. Solche Abonnementdienste heißen üblicherweise Feed, die zu Grunde liegenden Formate sind in<br />
der Regel RSS oder Atom.<br />
Web-Service<br />
Als Webservice wird ein über das Web abrufbares Daten- oder Datenauswertungsangebot bezeichnet, das<br />
Programmen standardisierte Abfrage- oder Datenaustauschwege bietet. Ein Web-Service ist nicht darauf ausgelegt,<br />
unmittelbar durch Menschen benutzt zu werden. Im Zusammenhang mit dem so genannten Web 2.0 meint man mit<br />
Web-Services Zusammenfassungen von Diensten verschiedener Anbieter zu einem neuen, leistungsfähigeren oder<br />
umfassenderen Dienst für Internetnutzer.<br />
Beispielanwendungen:<br />
• Verschiedene Suchmaschinen ermöglichen den Internet-Benutzern, von ihrer eigenen Website aus eine<br />
Suchanfrage an den Suchdienst abzuschicken. Selbstverständlich können auch Programme solche Web-Services<br />
von Internet-Suchmaschinen verwerten.<br />
• Websites, mit deren Hilfe man seine Bibliothek (beispielsweise LibraryThing) verwalten kann, nutzen<br />
Web-Services von Internetbuchhändlern, für die Suche nach Büchern, Autoren etc. Der Web-Service-Anbieter<br />
liefert Datensätze mit Angaben zu den gefundenen Büchern, teilweise mit einer Abbildung des Titelbildes.<br />
Semantisches Web<br />
Der Begriff Web 2.0 wird auch mit dem Semantischen Web in Verbindung gebracht. Dies betrifft etwa die<br />
Verwendung von Elementen wie FOAF und XFN zur Beschreibung sozialer Netzwerke, die Entwicklung von<br />
Folksonomies als vereinfachte Variante der Ontologien, der Verwendung von Geotagging oder RDF-basierten RSS-<br />
oder Atom-Feeds, die Verwendung von Mikroformaten bis hin zur Erstellung von Ontologien mit Hilfe von Wikis.<br />
Das Semantic Web beschreibt eine Technologieentwicklung hin zu einer höheren Interoperabilität durch den Einsatz<br />
von Standards wie etwa XML, RDF und OWL. Die Verarbeitung der Information durch Maschinen soll damit erhöht<br />
werden.<br />
Anwendungen<br />
Aus praktischer Sicht werden einige Internet-Anwendungen direkt zum Begriff Web 2.0 zugeordnet:<br />
• Wiki: eine Ansammlung von Webseiten, die von Benutzern frei erstellt und überarbeitet werden kann [14]<br />
• Weblog: Wird oftmals als Tagebuch im Internet bezeichnet. Ein festgelegter Autorenkreis verfasst Einträge, die in<br />
chronologisch umgekehrter Reihenfolge aufgelistet werden. Der Leser kann Kommentare zu den Einträgen<br />
verfassen. [15]<br />
• Podcast: bezeichnet das Veröffentlichen von Audio- und Videodateien im Internet [16]<br />
• soziale Netzwerke: stellen soziale Beziehungen im Internet dar. Sie ermöglichen es dem Nutzer ein Profil zu<br />
erstellen und Kontakte zu verwalten. Meist können sich die Mitglieder in Gruppen oder Communities<br />
untereinander austauschen. [17]<br />
• virtuelle Welt: dreidimensionale Plattform im Internet
Web 2.0 20<br />
• <strong>Social</strong>-Bookmarks: Sie bieten dem Nutzer die Möglichkeit zur Speicherung und Kategorisierung von<br />
persönlichen Links.<br />
• <strong>Social</strong> News: Nachrichteneinreichung, -bewertung und -kommentierung durch Nutzer.<br />
• <strong>Media</strong>-Sharing-Plattformen: Interessierten Benutzern bieten die Plattformen die Möglichkeit ein Profil anzulegen,<br />
Mediendaten wie Fotos und Videos zu speichern und Inhalte anderer Nutzer zu konsumieren sowie zu<br />
bewerten [18]<br />
Begriffsübertragung<br />
Der Begriff Web 2.0 erlangte eine derartig hohe Popularität, dass das Begriffsschema inzwischen auf vielfältige<br />
Bereiche angewendet wird, wie Health 2.0, Bibliothek 2.0, Fernsehen 2.0, Politik 2.0, Beziehung 2.0 [19] , Porn 2.0,<br />
Lernen 2.0, Enterprise 2.0 oder auch Wirtschaft 2.0. Ihnen gemeinsam ist die Absicht, die Beteiligungsmöglichkeiten<br />
beziehungsweise die Interaktivität der Nutzer oder Konsumenten in bestimmten Bereichen deutlich zu machen.<br />
Des Weiteren wird 2.0 im Sinne eines Déjà-vu, also einer Wiederholung auf neuer Ebene verwendet, etwa bei Stasi<br />
2.0.<br />
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung<br />
Die gesellschaftliche Bedeutung der Web-2.0-Anwendungen lässt sich anhand ihrer Mitgliederzahlen, ihrer<br />
Popularität und der Häufigkeit der Nutzung belegen. Facebook ist das größte soziale Netzwerk mit 400 Millionen<br />
registrierten Nutzern im Februar 2010; [20] unter den zehn meistbesuchten Websites im gleichen Zeitraum befanden<br />
sich laut Alexa mit Facebook, YouTube, Wikipedia und Blogger.com vier Anwendungen des Web 2.0. Die<br />
Anwendungen werden besonders häufig von jungen Besuchern (14 bis 29 Jahre) genutzt. [21] Der ökonomische<br />
Erfolg der Anwendungen hat sich trotz hoher Erwartungen noch nicht eingestellt. [22] Die Umsätze hinken den<br />
theoretischen Marktbewertungen hinterher, die sich auf der Basis der jeweiligen Finanzierungsrunden der meist noch<br />
nicht am Aktienmarkt notierten Firmen berechnen lassen. Die Unternehmenslenker sind teilweise noch auf der Suche<br />
nach dem richtigen Geschäftsmodell. [23]<br />
Kritik<br />
Kritik am Begriff<br />
Tim Berners-Lee, der Begründer des WWW, sagte 2006 über den Begriff Web 2.0 in einem<br />
IBM-Developer-Works-Podcast, er halte Web 2.0 für einen „Jargonausdruck, von dem niemand weiß, was er<br />
wirklich bedeutet.“ (Originalzitat: „I think Web 2.0 is of course a piece of jargon, nobody even knows what it<br />
means“) [24] . Er vertritt die Ansicht, dass das angeblich „neue Netzverständnis“ des Web 2.0 in Wahrheit nichts<br />
anderes als das ursprüngliche Netzverständnis ist, das bereits dem Web 1.0 zugrunde lag („Web 1.0 was all about<br />
connecting people“). [25]<br />
Berners-Lee konzipierte das Web von Anfang im gleichen Maße zum Publizieren wie zum Konsumieren der<br />
Inhalte. [26] Tatsächlich war auch der erste von ihm entwickelte Webbrowser bereits Editor und Browser zugleich. [27]<br />
Zudem wird von Kritikern angeführt, dass der Begriff Web 2.0 lediglich normale, konsequente Weiterentwicklungen<br />
im WWW verallgemeinert. So ist nach Meinung vieler Kritiker der Begriff Web 2.0 eine Marketingblase, welche<br />
vermeidet, Neuerungen genau zu beschreiben, indem viele Neuentwicklungen ohne genaue Unterscheidung dem<br />
Web 2.0 zugeschlagen werden, auch wenn sie von anderen Technologien oder Zielsetzungen ausgehen.<br />
Beispielsweise fasst man unter dem Oberbegriff Web 2.0 so Unterschiedliches zusammen wie netzwerkgestützte<br />
Anwendungen, die lokale Anwendungen ersetzen (Client-Server-Anwendungen), und soziale<br />
Netzwerkanwendungen. Des Weiteren lege der Begriff Web 2.0 vereinfachend nahe, das Internet sei interaktiver<br />
geworden – obwohl es schon seit den Anfängen des Internet rege Usenet-Gemeinden gegeben habe; genau wie
Web 2.0 21<br />
später im WWW auch viele Forengemeinschaften. Daher beinhalte Web 2.0 nichts Neues. Auch seien die<br />
verwendeten Techniken schon lange, bevor sie unter diesem Begriff verwendet wurden, vorhanden gewesen.<br />
Kritik an den mit dem Begriff verbundenen Techniken<br />
Kritikern zufolge könnten viele der mit dem Begriff verbundenen interaktiven Konzepte dem Benutzer einen Teil<br />
seiner Autonomie nehmen und damit zum Kern neuer Strategien werden, in denen allein eine stete Bindung an den<br />
Anbieter die Aktualität und die Vollständigkeit einzelner Angebote sichere. So sei eine neue Orientierung des<br />
Nutzerverhaltens entstanden, die mit spezialisierten Anwendungen unter dem Schlagwort Soziale Software<br />
unterstützt werde.<br />
Siehe auch<br />
• Online-Journalismus<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
• New Economy<br />
Literatur<br />
• Tom Alby: Web 2.0. Konzepte, Anwendungen, Technologien; Hanser Verlag, 2007, ISBN 978-3-446-40931-6.<br />
• Paul Alpar, Steffen Blaschke (Hrsg.): Web 2.0: Eine empirische Bestandsaufnahme; Vieweg+Teubner, 2008,<br />
ISBN 978-3-8348-0450-1.<br />
• Tim Berners-Lee und Mark Fischetti: Weaving the Web: The Past, Present and Future of the World Wide Web by<br />
its inventor; 1999.<br />
• Blumauer, Andreas; Pellegrini, Tassilo (Hrsg.): <strong>Social</strong> Semantic Web. Web 2.0 – Was nun?; Springer-Verlag;<br />
Berlin, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-540-72215-1.<br />
• Graham Cormode, Balachander Krishnamurthy: Key Differences between Web 1.0 and Web 2.0 [28] , First Monday<br />
[29] , Bd. 13, Nr. 6<br />
• Vitaly Friedman: Praxisbuch Web 2.0: Moderne Webseiten programmieren und gestalten; Galileo Press, 2007,<br />
ISBN 978-3-8362-1087-4.<br />
• Gernot Gehrke, Lars Gräßer: Web 2.0 – Schlagwort oder Megatrend? Fakten, Analysen, Prognosen; kopaed<br />
verlagsgmbh, 2007, ISBN 978-3-86736-206-1<br />
• Erik Möller: Die heimliche Medienrevolution – Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern;<br />
Verlag Heinz Heise, 2006, ISBN 3-936931-36-4, 1. Auflage als freier Download (PDF) [30] .<br />
• Shapiro, Andrew L.: The Control Revolution. How the Internet is Putting Individuals in Charge and Changing the<br />
World We Know, Public Affairs, 1999, ISBN 978-1-891620-19-5<br />
• Graham Vickery, Sacha Wunsch-Vincent: Participative Web and User-Created Content: Web 2.0, Wikis and<br />
<strong>Social</strong> Networking [31] ; OECD, 2007, ISBN 978-92-64-03746-5<br />
• Keen, Andrew: Die Stunde der Stümper. Wie wir im Internet unsere Kultur zerstören; München : Hanser, 2008,<br />
ISBN 978-3-446-41566-9<br />
• Mark Briggs: Journalism 2.0: How to Survive and Thrive [32] , PDF [33] (2.0MB, 132 S.), J-Lab: The Institute for<br />
Interactive Journalism, University of Maryland Philip Merrill College of Journalism, 2007
Web 2.0 22<br />
Zeitschriftenartikel und Whitepapers<br />
• Websense Security Labs: State of Internet Security, Q1 – Q2, 2009. [34] Whitepaper, September 2009 – PDF, 12<br />
S., 888 kB; vgl. Vivian Yeo, Stefan Beiersmann: Studie: 95 Prozent aller Web-2.0-Inhalte enthalten Spam oder<br />
gefährliche Links [35] (ZDNet.de, 17. September 2009)<br />
Weblinks<br />
• Jugendliche und Web 2.0 [36] . Ergebnisse und Übersicht der bisherigen Veröffentlichungen und Vorträge eines<br />
Projekts des Hans-Bredow-Instituts, April 2009 ff.<br />
• PricewaterhouseCoopers (Hrsg.): Web 2.0 – Soziale Netzwerke: Modeerscheinung oder nachhaltiges<br />
Geschäftsmodell? [37] – Studie über die Einstellungen und das Verhalten von 1004 Nutzern Sozialer Netzwerke<br />
(April 2008 – PDF, 55 S., 547 kB)<br />
• Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2008- Mitmachnetz Web 2.0:Rege Beteiligung nur in Communitys [38]<br />
Daten zur Nutzung von Web 2.0 Angeboten aus der bevölkerungsrepräsentativen ARD/ZDF-Online-Studie 2008<br />
(PDF; 150 kB)<br />
Referenzen<br />
[1] Henning Schürig: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> statt Web 2.0 (http:/ / www. henningschuerig. de/ blog/ 2010/ 03/ 31/ social-media-statt-web-20/ )<br />
[2] CIO (15. Dezember 2003): CIO: Fast Forward 2010 – The Fate of IT, 2004 – The Year of Web Services (http:/ / books. google. com/<br />
books?id=1QwAAAAAMBAJ& printsec=frontcover& source=gbs_summary_r& cad=0_0#PPA90,M1)<br />
[3] Zimbra Management Team (http:/ / www. zimbra. com/ about/ management_team. html)<br />
[4] Yahoo! Announces Agreement to Acquire Zimbra (http:/ / www. zimbra. com/ about/ zimbra_pr_2007-09-17. html)<br />
[5] VMware kauft Zimbra (http:/ / www. linux-magazin. de/ NEWS/ VMware-kauft-Zimbra)<br />
[6] Deutsche Übersetzung (http:/ / www. pytheway. de/ index. php/ web-20) des Artikels „What is Web 2.0“ von Tim O'Reilly<br />
[7] Tim O'Reilly: Web 2.0 Compact Definition: Trying Again (http:/ / radar. oreilly. com/ archives/ 2006/ 12/ web_20_compact. html). 10.<br />
Dezember 2006, abgerufen am 7. Mai 2009.<br />
[8] Competence Site (1. März 2007): E-Interview mit Prof. Wolfgang Prinz - Web 2.0 - Bedeutung, Chancen und Risiken (http:/ / www.<br />
competence-site. de/ ebusiness. nsf/ fbfca92242324208c12569e4003b2580/ 9294cb27b87aefd1c12572950047ff87!OpenDocument)<br />
[9] Neue Zürcher Zeitung (18. Mai 2007): Präventivschlag gegen journalistische Neugier (http:/ / www. nzz. ch/ 2007/ 05/ 18/ em/<br />
articleF6QGW. html)<br />
[10] Tim O'Reilly: What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software (http:/ / www. oreillynet. com/<br />
pub/ a/ oreilly/ tim/ news/ 2005/ 09/ 30/ what-is-web-20. html). ( deutsche Übersetzung (http:/ / www. pytheway. de/ index. php/ web-20))<br />
[11] Markus Angermeier: Web 2.0 Mindmap. (http:/ / kosmar. de/ archives/ 2005/ 11/ 11/ the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/ ) Deutsche<br />
Version (http:/ / kosmar. de/ archives/ 2005/ 11/ 24/ netz20-gedankenkarte/ )<br />
[12] Artikel über die Kontroverse rund um den als Marke geschützten Begriff (http:/ / radar. oreilly. com/ archives/ 2006/ 05/<br />
controversy_about_our_web_20_s. html), oreilly.com<br />
[13] Jürgen Schiller García: Web 2.0 Buzz Time bar (http:/ / www. scill. de/ content/ 2006/ 09/ 21/ web-20-buzz-zeitstrahl/ ). 21. September 2006,<br />
abgerufen am 29. Oktober 2006.<br />
[14] Orth, R., Wissensmanagement mit Wiki-Systemen, in: Mertins, K., Seidel, H., (Hrsg.) Wissensmanagement im Mittelstand, Berlin,<br />
Heidelberg 2009<br />
[15] Zerfaß, A., Boelter, D., Die neuen Meinungsmacher; Weblogs als Herausforderung für Kampagnen, Marketing, PR und Medien, Graz 2005<br />
[16] Gheogegan, M., Hlass, D., Podcast Solutions; the complete Guide to Audio and Video Podcasting, New York 2007<br />
[17] Koch, M., Richter, A., Schlosser A., Produkte zum IT-<strong>Social</strong> Networking in Unternehmen, in: Wirtschaftsinformatik<br />
[18] Stanoevska-Slabeva, K., Die Potentiale des Web 2.0 für das Interaktive Marketing; in: Belz, C., Schögel, M., Arndt, O., Walter, V., (Hrsg.):<br />
Interaktives Marketing, Neue Wege zum Dialog mit Kunden. Gabler (2008) ISBN 978-3834907400<br />
[19] http:/ / www. faz. net/ s/ Rub8D05117E1AC946F5BB438374CCC294CC/<br />
Doc~E603B81C9557A455DB616ABFB91FE095F~ATpl~Ecommon~Scontent. html<br />
[20] TechCrunch (4. Februar 2010): As It Celebrates Its Sixth Birthday, Facebook Surges To 400 Million Users (http:/ / techcrunch. com/ 2010/<br />
02/ 04/ as-it-celebrates-its-sixth-birthday-facebook-surges-to-400-million-users/ )<br />
[21] Busemann, Katrin, Gscheidle, Christoph: Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern beliebt (http:/ / www. ard-zdf-onlinestudie. de/<br />
fileadmin/ Online09/ Busemann_7_09. pdf). In: <strong>Media</strong> Perspektiven, 7/2009. Abgerufen am 11. Februar 2010.<br />
[22] Berechnungen und Quellen zum Vortrag von Prof. Alpar im Rahmen des ersten Cologne Web Content Forum. (http:/ / www. uni-marburg.<br />
de/ fb02/ bwl09/ forschung/ web2. 0/ webcontentforum)
Web 2.0 23<br />
[23] Seeking Alpha (22. <strong>Jan</strong>uar 2009): Google Inc. Q4 2008 Earnings Call Transcript (http:/ / seekingalpha. com/ article/<br />
116046-google-inc-q4-2008-earnings-call-transcript?source=bnet)<br />
[24] developerWorks Interviews: Tim Berners-Lee (http:/ / www-128. ibm. com/ developerworks/ podcast/ dwi/ cm-int082206. txt) (Transkript<br />
als Textdatei, englisch)<br />
[25] Telepolis: „Web 2.0 ist nutzloses Blabla, das niemand erklären kann“ (http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 23/ 23472/ 1. html) von<br />
Wolf-Dieter Roth<br />
[26] Berners-Lee, Tim und Fischetti, Mark, Weaving the Web : The Past, Present and Future of the World Wide Web by its inventor (1999)<br />
[27] Tim Berners-Lee's original World Wide Web browser (http:/ / info. cern. ch/ NextBrowser. html) (CERN)<br />
[28] http:/ / www. uic. edu/ htbin/ cgiwrap/ bin/ ojs/ index. php/ fm/ article/ view/ 2125/ 1972<br />
[29] http:/ / www. uic. edu/ htbin/ cgiwrap/ bin/ ojs/ index. php/ fm/ index<br />
[30] http:/ / medienrevolution. dpunkt. de/ files/ Medienrevolution-1. pdf<br />
[31] http:/ / www. oecd. org/ document/ 40/ 0,3343,en_2649_201185_39428648_1_1_1_1,00. html<br />
[32] http:/ / www. kcnn. org/ resources/ journalism_20/<br />
[33] http:/ / www. j-lab. org/ Journalism_20. pdf<br />
[34] http:/ / www. websense. com/ site/ docs/ whitepapers/ en/ WSL_Q1_Q2_2009_FNL. PDF<br />
[35] http:/ / www. zdnet. de/ news/<br />
wirtschaft_sicherheit_security_studie_95_prozent_aller_web_2_0_inhalte_enthalten_spam_oder_gefaehrliche_links_story-39001024-41502826-1.<br />
htm<br />
[36] http:/ / www. hans-bredow-institut. de/ de/ forschung/ jugendliche-web-20<br />
[37] http:/ / www. swr. de/ daserste/ quoten-klicks-und-kohle/ -/ id=3444452/ property=download/ nid=3436570/ 1r75xrg/ index. pdf<br />
[38] http:/ / www. ard-zdf-onlinestudie. de/ fileadmin/ Online08/ Fisch_II. pdf<br />
Soziales Netzwerk (Internet)<br />
Soziale Netzwerke im Sinne der Informatik sind Netzgemeinschaften bzw. Webdienste, die Netzgemeinschaften<br />
beherbergen. Handelt es sich um Netzwerke, bei denen die Benutzer gemeinsam eigene Inhalte erstellen (User<br />
Generated Content), bezeichnet man diese auch als soziale Medien.<br />
Dienste<br />
Soziale Netzwerke stehen umgangssprachlich für eine Form von Netzgemeinschaften, welche technisch durch<br />
Web-2.0-Anwendungen oder Portale beherbergt werden. Im Englischen existiert der präzisere Begriff des social<br />
network service. Die deutschen Begriffe „Gemeinschaftsportal“ oder „Online-Kontaktnetzwerk“ sind eher weniger<br />
gebräuchlich.<br />
Typische Funktionen<br />
Die Webportale bieten ihren Nutzern üblicherweise folgende Funktionen an: [1]<br />
• Persönliches Profil, mit diversen Sichtbarkeitseinstellungen für Mitglieder der Netzgemeinschaft oder generell<br />
der Öffentlichkeit des Netzes<br />
• Kontaktliste oder Adressbuch, samt Funktionen, mit denen die Verweise auf diese anderen Mitglieder der<br />
Netzgemeinschaft (etwa Freunde, Bekannte, Kollegen usw.) verwaltet werden können (etwa Datenimport aus<br />
E-Mail-Konto oder anderen Portalen)<br />
• Empfang und Versand von Nachrichten an andere Mitglieder (einzeln, an alle usw.)<br />
• Empfang und Versand von Benachrichtigungen über diverse Ereignisse (Profiländerungen, eingestellte Bilder,<br />
Videos, Kritiken, Anklopfen usw.)<br />
• Blogs<br />
• Suche<br />
Es sind Funktionen, die sich auch in CSCW Anwendungen finden, allerdings hier für potentiell große Nutzergruppen<br />
(weltweit, landesweit, regional, stadtweit) ausgelegt.
Soziales Netzwerk (Internet) 24<br />
Soziale Netzwerke als Anwendungsplattform<br />
Einige soziale Netzwerke fungieren auch als Plattform für neue Programmfunktionen.<br />
Softwareentwickler können die Portalseiten um eigene Programmanwendungen ergänzen, d.h. ihre<br />
Benutzerschnittstellen werden in das Portal eingebettet.<br />
Die dazu nötigen Programmierschnittstellen und Entwicklungsumgebungen werden von den Entwicklern zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Beispiele sind:<br />
• Facebook Connect, eine Programmierschnittstelle für Facebook [2]<br />
• MySpace Developer Plattform (MDP), eine Entwicklungsumgebung für MySpace [3]<br />
• Open<strong>Social</strong>, ein API, welches mehrere soziale Netzwerke umspannt [4]<br />
Plattformübergreifend ist die Föderation durch B2B-APIs zu nennen.<br />
Untersuchung sozialer Netzwerke<br />
Unter anderem erforschen Betriebswirtschaftslehre, Ethnologie, Sozialpsychologie, Kommunikationswissenschaft,<br />
Computerphysik und Spieltheorie soziale Netzwerke. Dabei spielt unter anderem Multiplexität und Netzwerkdichte<br />
eine Rolle. Die dort entwickelten Verfahren lassen sich auch zur webometrischen Untersuchung des Internets<br />
einsetzen.<br />
Es zeigt sich, dass soziale Netzwerke von ihrer Struktur oft Kleine-Welt-Netzwerke bilden, in denen die maximale<br />
Distanz zwischen einzelnen Einheiten überraschend gering ist („six degrees of separation“).<br />
Geschäftsmodell<br />
Soziale Netzwerke finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge sowie verschiedene Formen von Werbung und<br />
Sponsoring. Da die Zahlungsbereitschaft der Nutzer zumeist gering ist [5] , setzen die meisten Betreiber auf<br />
Anzeigenerlöse.<br />
Da die Dienstbetreiber Zugriff auf den sozialen Graphen der beherbergten Netzgemeinschaft haben, also wissen,<br />
welches Mitglied mit welchen anderen Mitgliedern in Relation steht, verfügen diese über eine kommerziell<br />
interessante Informationsbasis, etwa für zielgruppengerichtete Werbung.<br />
Nutzung<br />
Im Frühjahr 2008 nutzten in Europa die Briten mit 9,6 Millionen am meisten die für das Web 2.0 typischen<br />
<strong>Social</strong>-Networking-Websites. Bis 2012 werden nach einer Schätzung des Informationsanbieters Datamonitor mit<br />
über 27 Millionen fast die Hälfte der Briten Dienste wie etwa Facebook oder MySpace in Anspruch nehmen. Dass<br />
die Briten bislang vorn liegen, führt Datamonitor auch darauf zurück, dass die Angebote in der Regel mit englischen<br />
Versionen gestartet sind. Die Menschen begrüßen es laut Datamonitor offenbar besonders, von zu Hause aus<br />
Kontakte knüpfen und Beziehungen aufrecht erhalten zu können. Zwar stünden hinter den wachsenden<br />
Nutzungszahlen vor allem jüngeren Leute, aber auch viele ältere Nutzer kämen künftig hinzu.<br />
Die Franzosen stellten mit 8,9 Millionen die zweitgrößte Nutzergruppe der <strong>Social</strong>-Networking-Angebote, die<br />
Deutschen folgten demnach mit 8,6 Millionen auf Platz drei. Die Studie prognostiziert in Deutschland bis zum Jahr<br />
2012 21,7 Millionen Nutzer. Das an vierter Stelle stehende Spanien wies lediglich 2,9 Millionen Nutzer auf. 41,7<br />
Millionen Europäer insgesamt seien bei <strong>Social</strong>-Networking-Websites registriert, vier Jahre später sollen es laut<br />
Datamonitor 107 Millionen sein. [6]<br />
Zu einem das Sprachproblem hervorhebenden Ergebnis kommt auch die zweite weltweite vom<br />
Community-Betreiber Habbo erstellte Studie zur Markentreue von Jugendlichen. Das Ergebnis: 40 Prozent der rund
Soziales Netzwerk (Internet) 25<br />
60.000 befragten Jugendlichen aus 31 Ländern sehen soziale Netzwerke nicht als wichtigen Teil ihrer<br />
Onlineaktivitäten an. Dem Global Habbo Youth Survey zufolge ist eine der Hauptursachen hierfür, dass sich viele<br />
der Communitys an der englischen Sprache orientieren. [7]<br />
Auch größere soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Facebook hatten Probleme, auf dem deutschen Markt Fuß zu<br />
fassen, wobei Facebook diese Probleme aber überwinden konnte und zum größten sozialen Netzwerk Deutschlands<br />
angewachsen ist. [8]<br />
Kritik<br />
Kritik an den Diensten richtet sich in erster Linie auf:<br />
• Die Veröffentlichung privater Informationen im Internet, die zu persönlichen Nachteilen führen kann [9] , sei es<br />
durch eigene Unvorsichtigkeit oder Sicherheitslücken beim Dienst oder Nutzer.<br />
• Die Nutzung des sozialen Graphen und anderer persönlicher Daten seitens der Dienstbetreiber für kommerzielle<br />
Zwecke. [10]<br />
Diese Probleme bestanden bereits vor Einführung der sozialen Netzwerke, so haben etwa Microsoft und IBM bereits<br />
2003 Newsgroups und Mailinglisten unter sozialen Gesichtspunkten ausgewertet. [11] Auch konnte man sich schon<br />
immer durch unbedachte Veröffentlichung im Internet Nachteile einhandeln.<br />
Allerdings wurden noch nie zuvor so detailliert, kategorisiert persönliche Informationen von Nutzern abgefragt und<br />
veröffentlicht, wie es bei den umfangreichen Webformularen der heutigen Sozialen Netzwerke üblich ist. Die<br />
automatisierte Analyse dieser Daten wurde dadurch enorm vereinfacht und die oben genannten Probleme verschärft.<br />
Beispiele:<br />
• 1.074.574 StudiVZ-Profile (davon 1.035.890 öffentliche) wurden am 9. Dezember 2006 von dritten systematisch<br />
ausgewertet. [12]<br />
• Journalisten und Mediendienste besorgen sich in sozialen Netzwerken Bilder und Informationen. [13]<br />
• In den USA werden regelmäßig die auf sozialen Netzwerken verfügbaren Informationen bei polizeilichen<br />
Ermittlungen herangezogen. [14]<br />
Betrachtet man die sozialen Netzwerke in ihrer Rolle als Anwendungsplattform, so stand hier bisher die Entwicklung<br />
von Funktionalität im Vordergrund. Inzwischen beginnt man, sich auch mit Sicherheitsaspekten der Anwendungen<br />
dort zu beschäftigen. [15]<br />
Datenschutzrechtliche Bewertung<br />
Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten bedarf immer einer Rechtsgrundlage (so<br />
§ 4 [16] BDSG, beispielsweise § 28 [17] BDSG) oder einer Einwilligung nach § 4a [18] BDSG. [19]<br />
Eine Einwilligung nach § 4a BDSG kann nach den Datenschutzgesetzen nur dann wirksam erteilt werden, wenn sie<br />
auf der freien Entscheidung eines informierten Nutzers beruht. Das Problem bei sozialen Netzwerken besteht aber<br />
vorwiegend darin, dass die Nutzer formal eingewilligt haben und sich zumeist keine Gedanken über die Gefahren<br />
machen und den Netzwerken ein blindes Vertrauen entgegenbringen.<br />
Für eine zulässige Datenverarbeitung nach § 28 BDSG gilt folgendes: Die datenschutzrechtliche Bewertung und<br />
Einordnung steht erst am Anfang. Da die sozialen Netzwerke und Communitys am ehesten mit Vereinen zu<br />
vergleichen sind und häufig von Mitgliedern gesprochen wird, stufen Bergmann/Möhrle/Herb [20] das<br />
Rechtsverhältnis zwischen einem Betroffenen und der jeweils verantwortlichen Stelle als vertragsähnliches<br />
Vertrauensverhältnis im Sinne von § 28 [17] Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG ein. Entsprechend dem Phasenmodell der<br />
Datenverarbeitung müsste bereits bei der Erhebung und Speicherung untersucht werden, ob die Daten über den<br />
Betroffenen dem vertragsähnlichen Vertrauensverhältnis dienen. Hierbei ist ein strenger Maßstab an die Frage der<br />
Erforderlichkeit anzulegen. Aufgrund der Zweckbindung ist eine Übermittlung regelmäßig problematisch, denn ein
Soziales Netzwerk (Internet) 26<br />
Netzwerk, welches z. B. für Freizeitzwecke genutzt wird, darf nicht für berufliche Zwecke (Suchanfragen von<br />
Arbeitgebern bei Bewerbungen) missbraucht werden. Generell wird man auch die Nutzung durch Suchmaschinen als<br />
nicht vom Vertragszweck umfasst ansehen müssen.<br />
Geschichte<br />
Soziale Netzwerke, deren Funktionen über die von reinen Webforen und Chats hinausgehen, existieren seit Mitte der<br />
1990er Jahre, eines der ersten Beispiele ist die 1995 gegründete US-amerikanische Schulfreunde-Community<br />
Classmates.com. Derartige Websites blieben jedoch weitgehend eine Randerscheinung. 2003 setzte dann auf dem<br />
Sektor ein Boom ein.<br />
Im <strong>Jan</strong>uar 2004 wurde Orkut gestartet.<br />
Im Juli 2005 wurde MySpace für 580 Millionen US-Dollar von der News Corporation gekauft.<br />
Im Oktober 2007 kündigte Google die Open<strong>Social</strong>-Initiative an. Dadurch wurde es möglich, Inhalte verschiedener<br />
Sozialer Netzwerke durch eine einheitliche Methode zusammenzuführen.<br />
Microsoft kaufte am 25. Oktober 2007 einen Anteil von 1,6 Prozent an Facebook und bezahlte dafür 240 Millionen<br />
US-Dollar. Durch diese Transaktion wurde Facebook auf dem Papier 15 Milliarden US-Dollar wert. Vorher wurde<br />
ein ähnliches Angebot seitens Google abgelehnt und ein Betrag von einer Milliarde US-Dollar, den Yahoo! bezahlen<br />
wollte, um Facebook zu übernehmen, nicht angenommen.<br />
Im März 2008 hat AOL, die Internettochter des amerikanischen Medienkonzerns Time Warner, das 2005 gegründete<br />
Soziale Netzwerk Bebo für 850 Millionen US-Dollar (ca. 545 Millionen Euro) gekauft. Bebo hatte zur Zeit der<br />
Übernahme nach eigener Aussage etwa 40 Millionen Nutzer und ist vor allem in Großbritannien populär.<br />
Im August 2008 meldete Facebook 100 Millionen Nutzer, [21] im Februar 2010 400 Millionen Nutzer, [22] am 21. Juli<br />
2010 eine halbe Milliarde Nutzer. [23]<br />
Siehe auch<br />
• Computer Supported Cooperative Work<br />
• Graphentheorie<br />
• Netzwerktheorie<br />
• Netzwerkdichte<br />
• Soziale Software<br />
• Soziales Netzwerk (Soziologie)<br />
• Webometrie<br />
Film<br />
Us Now – A film project about the power of mass collaboration, government and the internet [24] . [25] (Flash-Video;<br />
60 min; englisch mit deutschen Untertiteln. Creative Commons Lizenz)<br />
Literatur<br />
• Jono Bacon (2009): The Art of Community - Building the New Age of Participation, O'Reilly, (PDF; 2,3 MB) [26]<br />
• Danah Boyd & Nicole Ellison (2007): <strong>Social</strong> Network Sites: Definition, History, and Scholarship in: Journal of<br />
Computer-<strong>Media</strong>ted Communication, 13(1), article 11. [27]<br />
• Sascha Häusler (2007): Soziale Netzwerke im Internet. Entwicklung, Formen und Potenziale zu kommerzieller<br />
Nutzung, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ISBN 3-8364-5264-2.<br />
• Torsten Kleinz: Netzbekanntschaften. Neue Internet-Dienste helfen, soziale Netzwerke zu flechten, in: c't 18/2004,<br />
S. 84, ISSN 0724-8679 [28]
Soziales Netzwerk (Internet) 27<br />
• Sicherer in <strong>Social</strong> Communities: Tipps für Eltern [29] , Flyer von klicksafe.de (Landeszentrale für Medien und<br />
Kommunikation Rheinland-Pfalz) 2008<br />
• Holger Bleich, Herbert Braun: Soziale Sicherheit. Datenschutz-Schwachpunkte der <strong>Social</strong> Networks, in: c't<br />
7/2010, S. 114 - 118<br />
Weblinks<br />
• Chaosradio CR134 (2008): Soziale Netzwerke – Fluch oder Segen? [30]<br />
• Stephanie Rosenbloom: Status: Looking for Work on Facebook [31] („New York Times”, 1. Mai 2008 – Soziale<br />
Netzwerke spielen zunehmend ein Rolle bei der Arbeitsplatzsuche und beim Headhunting)<br />
• Gerhard W. Loub / Lukas Weber: SNS – mehr als nur virtuell? Projekt der Universität Wien [32] (Vergleich von<br />
Sozialen Netzwerken On- und Offline)<br />
• <strong>Social</strong> Networks und Privatsphäre [33]<br />
• Liste: 175 Soziale Netzwerke aus aller Welt [34]<br />
• Lebenslang abrufbar [35] – Sonderthema im Tagesspiegel vom 4. Mai 2008<br />
• nielsen wire: <strong>Social</strong> Networking’s New Global Footprint [36] . 9. März 2009<br />
• Liste: 149 <strong>Social</strong> Networks aus Deutschland [37]<br />
• Trend: <strong>Social</strong> Network Trends – Mitte 2010 [38]<br />
Ratgeber<br />
• Facebook, Zimmer, Daniela: MySpace & Co – KonsumentInnen-Tipps für Soziale Netzwerke, Österreichisches<br />
Institut für angewandte Telekommunikation, PDF-Download 29 S. [39]<br />
• FraunhoferInstitut für Sichere Informationstechnologie SIT: Privatsphärenschutz in<br />
Soziale-Netzwerke-Plattformen, PDF-Download 124 S. [40]<br />
• scip AG: Schutzmassnahmen in Sozialen Netzen [41]<br />
• Schaumann, Philipp: Verlust an Privatsphäre durch die <strong>Social</strong> Network Sites [42]<br />
Referenzen<br />
[1] Facebook features (http:/ / en. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Facebook_features& oldid=234058252) Artikel der englischsprachigen<br />
Wikipedia über Funktionen von Facebook<br />
[2] Facebook Developers (http:/ / developers. facebook. com/ ) Facebook Entwicklerseiten<br />
[3] MySpace Developer Plattform (http:/ / developer. myspace. com/ community/ )<br />
[4] Open<strong>Social</strong> Entwicklerseiten (http:/ / code. google. com/ apis/ opensocial/ )<br />
[5] Nutzer Sozialer Netzwerke sind treu – doch beim Geld hört die Freundschaft auf (http:/ / www. pwc. de/ portal/ pub/ !ut/ p/ kcxml/<br />
04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4p3tggDSZnFG8Q76kfCRHw98nNT9YP0vfUD9AtyI8odHRUVAdWI3wg!/ delta/ base64xml/<br />
L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0JfQzlF?siteArea=49cbd5c0e668d282& content=e52522060b1069f&<br />
topNavNode=49c411a4006ba50c)<br />
[6] Ein Drittel der Deutschen soll bis 2012 <strong>Social</strong>-Networking-Dienste nutzen (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Ein-Drittel-der-Deutschen-soll-bis-2012-<strong>Social</strong>-Networking-Dienste-nutzen-204644. html) (heise online, 2. Mai 2008)<br />
[7] <strong>Social</strong> Networks von Jugendlichen selten genutzt (http:/ / www. horizont. net/ aktuell/ digital/ pages/ protected/<br />
<strong>Social</strong>-Networks-von-Jugendlichen-selten-genutzt_75761. html) (Horizont.net, abgerufen am 16. April 2008)<br />
[8] Statistics (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Facebook-groesstes-deutsches-<strong>Social</strong>-Network--/ meldung/ 144203). heise.de. Abgerufen am 7.<br />
September 2009.<br />
[9] Soziale Netzwerke Teil 1: Definition (http:/ / fieser-admin. de/ wissenswert/ soziale-netzwerke-teil-1-definition/ ), Kritik an den sozialen<br />
Netzwerken, in der Tradition des BOFH (sprachlich ordinär, aber in der Sache ernstzunehmend)<br />
[10] Heinz Wittenbrink Blog: Sozialer Graph, Soziale Graphen (http:/ / community. fh-joanneum. at/ elgg/ witte/ weblog/ 455. html)<br />
[11] Mining newsgroups using networks arising from social behavior (http:/ / citeseerx. ist. psu. edu/ viewdoc/ summary?doi=10. 1. 1. 14. 6668)<br />
[12] Andreas Dittes: StudiVZ gecrawlt – Analyse der Daten online (http:/ / dittes. info/ blog/ 2007/ 01/ 04/<br />
studivz-gecrawlt-analyse-der-daten-online/ )<br />
[13] Thomas Mrazek: Deckname Moser (http:/ / www. onlinejournalismus. de/ 2008/ 08/ 18/ deckname-moser/ )<br />
[14] Use of social network websites in investigations (http:/ / en. wikipedia. org/ w/ index.<br />
php?title=Use_of_social_network_websites_in_investigations& oldid=231305940) Artikel der englischsprachigen Wikipedia über die<br />
Nutzung von sozialen Netzwerken bei Ermittlungen
Soziales Netzwerk (Internet) 28<br />
[15] Erica Naone: Wenn soziale Netze sich gegen ihre Nutzer wenden (http:/ / www. heise. de/ tr/<br />
Wenn-soziale-Netze-sich-gegen-ihre-Nutzer-wenden--/ artikel/ 117336), Technology Review<br />
[16] http:/ / dejure. org/ gesetze/ BDSG/ 4. html<br />
[17] http:/ / dejure. org/ gesetze/ BDSG/ 28. html<br />
[18] http:/ / dejure. org/ gesetze/ BDSG/ 4a. html<br />
[19] Quelle: Bergmann/Möhrle/Herb (http:/ / www. datenschutz-kommentar. de) Teil VI Multimedia und Datenschutz Ziffer 1.6<br />
[20] (http:/ / www. datenschutz-kommentar. de) (derzeit die einzigen, die sich konkret dazu äußern)<br />
[21] Our First 100 Million (http:/ / blog. facebook. com/ blog. php?post=28111272130) Blogeintrag von Mark Zuckerberg<br />
[22] (http:/ / facebookmarketing. de/ news/ 6-jahre-facebook-400-mio-user) Meldung zum 400 Mio. Nutzer<br />
[23] (http:/ / www. facebook. com/ ?ref=logo#!/ video/ video. php?v=10150238694155484& ref=mf) Meldung: 500.000.000 Nutzer bei<br />
Facebook<br />
[24] http:/ / dotsub. com/ view/ 34591ca8-0ef5-48fb-82e6-163a9f21298d<br />
[25] http:/ / usnowfilm. com/<br />
[26] http:/ / www. artofcommunityonline. org/ downloads/ jonobacon-theartofcommunity-1ed. pdf<br />
[27] http:/ / jcmc. indiana. edu/ vol13/ issue1/ boyd. ellison. html<br />
[28] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0724-8679<br />
[29] https:/ / www. klicksafe. de/ service/ familie/ alle-klicksafe-tipps/ sicherer-in-social-networks-tipps-fuer-eltern. html<br />
[30] http:/ / chaosradio. ccc. de/ cr134. html<br />
[31] http:/ / www. nytimes. com/ 2008/ 05/ 01/ fashion/ 01networking. html?ref=technology<br />
[32] http:/ / www. unet. univie. ac. at/ ~a9000165/ php/ mume_bobrowsky/<br />
[33] http:/ / sicherheitskultur. at/ privacy_soc_networking. htm<br />
[34] http:/ / fudder. de/ artikel/ 2008/ 04/ 09/ 175-internet-communitys/<br />
[35] http:/ / www. tagesspiegel. de/ zeitung/ Sonderthemen;art893,2524269<br />
[36] http:/ / blog. nielsen. com/ nielsenwire/ global/ social-networking-new-global-footprint/<br />
[37] http:/ / netzwertig. com/ 2008/ 04/ 15/ zn-aktuelles-ranking-149-social-networks-aus-deutschland/<br />
[38] http:/ / www. revengeday. de/ 2010/ 09/ social-network-trends/<br />
[39] http:/ / wien. arbeiterkammer. at/ bilder/ d101/ RatgeberSozialeNetzwerke. pdf<br />
[40] http:/ / www. sit. fraunhofer. de/ fhg/ Images/ SocNetStudie_Deu_Final_tcm105-132111. pdf<br />
[41] http:/ / www. scip. ch/ ?labs. 20100423<br />
[42] http:/ / www. sicherheitskultur. at/ privacy_soc_networking. htm#indu
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> 29<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Als <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> (auch Soziale Medien) werden Soziale Netzwerke und Netzgemeinschaften verstanden, die als<br />
Plattformen zum gegenseitigen Austausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen dienen. Kaplan und<br />
Michael Haenlein definieren <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> als „eine Gruppe von Internetanwendungen, die auf den ideologischen<br />
und technologischen Grundlagen des Web 2.0 aufbauen und die Herstellung und den Austausch von User Generated<br />
Content ermöglichen“ [1] .<br />
Begriff<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> sind eine Vielfalt digitaler Medien und Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander<br />
auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten (User Generated Content). Die<br />
Ermöglichung sozialer Interaktionen und Kollaboration in Sozialen Netzwerken gewinnen zunehmend an Bedeutung<br />
und wandeln mediale Monologe (one to many) in social-mediale Dialoge (many to many) [2] . Zudem unterstützt es<br />
die Demokratisierung von Wissen und Information und entwickelt den Benutzer von einem Konsumenten zu einem<br />
Produzenten. Die Nutzer nehmen durch Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen aktiv auf die Inhalte Bezug<br />
und bauen auf diese Weise eine soziale Beziehung untereinander auf. Es besteht kein Gefälle mehr zwischen Sender<br />
und Rezipienten (Sender-Empfänger-Modell). Als Kommunikationsmittel werden dabei Text, Bild, Audio oder<br />
Video verwendet. Das gemeinsame Erstellen, Bearbeiten und Verteilen der Inhalte, unterstützt von interaktiven<br />
Anwendungen betont auch der Begriff Web 2.0.<br />
Es wird angenommen, dass der Begriff <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> erstmals auf der BlogOn 2004 Conference, welche am 22. und<br />
23. Juli 2004 stattfand, vom US-Unternehmen Guidewire Group verwendet wurde.<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> vs. Massenmedien<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> sind von den traditionellen Massenmedien, wie z. B. Zeitungen, Radio, Fernsehen und Film zu<br />
unterscheiden. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> stützt sich ausschließlich auf online-basierte Kommunikationskanäle und<br />
Anwendungen. Des Weiteren weist sie relativ geringe Eintrittsbarrieren, wie z.B. geringe Kosten, unkomplizierte<br />
Produktionsprozesse und einfache Zugänglichkeit der Werkzeuge, für die Veröffentlichung und Verbreitung von<br />
Inhalten jeder Art auf, die sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen einsetzbar sind. Hingegen erfordern<br />
Massenmedien umfängliche Ressourcen und Produktionsprozesse, um Veröffentlichungen zu realisieren.<br />
Ein gemeinsames Charakteristikum, welches <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> und Massenmedien besitzen, ist die Möglichkeit große<br />
wie auch kleine Rezipientengruppen zu erreichen. So kann beispielsweise ein Blogpost wie auch eine TV-Sendung<br />
Millionen Leser bzw. Zuschauer auf sich vereinnahmen; gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, dass kein Leser<br />
bzw. Zuschauer animiert werden kann, sich mit dem Beitrag auseinander zu setzen. Während Massenmedien wie das<br />
Fernsehen zunehmend auf die lineare Kommunikation eines Broadcast setzen, unterliegt die Kommunikation von<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> neben einem hohen Echtzeit-Faktor auch dem Prinzip des Long Tail zur Generierung von<br />
Aufmerksamkeit und Reichweite.<br />
Einige Eigenschaften, die bei der Differenzierung helfen, sind beispielsweise:<br />
1. Reichweite<br />
• Beide, <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> und Massenmedien, ermöglichen es jedem, global präsent zu sein.<br />
2. Zugänglichkeit<br />
• Die Produktion von Massenmedien obliegt i. d. R. privaten oder regierungseigenen Unternehmen. <strong>Social</strong><br />
<strong>Media</strong> Werkzeuge sind für jedermann zu geringen oder gar keinen Kosten zugänglich.<br />
3. Benutzerfreundlichkeit (engl. usability)
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> 30<br />
• Die Produktion von Massenmedien setzt Spezialkenntnisse und eine umfassende Ausbildung voraus. Diese<br />
4. Neuheit<br />
Ausprägung der Kenntnisse ist im Rahmen von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> deutlich geringer.<br />
• Der Zeitraum zwischen einem Ereignis und der Veröffentlichung über Massenmedien, insbesondere von<br />
periodischen, beansprucht einen langen Zeitraum (Tage, Wochen, Monate). <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> ermöglicht es<br />
unmittelbar und ohne Zeitverzug zu veröffentlichen.<br />
5. Beständigkeit<br />
• Ein Beitrag in einem Massenmedium (z. B. Zeitungsartikel) kann nach Erstellung und Veröffentlichung nicht<br />
mehr verändert werden. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> ermöglichen es nahezu ohne Zeitverzug Änderungen an<br />
Veröffentlichungen vorzunehmen.<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing (SMM) ist eine Form des Onlinemarketings, die Branding- und<br />
Marketingkommunikations-Ziele durch die Beteiligung in verschiedenen <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Angeboten erreichen will.<br />
Zudem ist es eine Komponente der integrierten Marketingkommunikation eines Unternehmens. Integrierte<br />
Marketingkommunikation ist ein Prinzip nachdem ein Unternehmen innerhalb seines Zielmarktes mit der Zielgruppe<br />
in Kontakt tritt. Es koordiniert die Elemente des Promotions-Mixes—Werbung, Direktvertrieb, Direktmarketing,<br />
Public Relations und Verkaufsförderung—mit der Zielsetzung kundenorientiert zu kommunizieren. [3]<br />
In der traditionellen Marketingkommunikation werden Inhalt, Frequenz, Timing und Kommunikationsmedium in<br />
Abstimmung mit externen Agents, wie beispielsweise Agenturen, Marktforschunginstituten und/oder PR-Firmen,<br />
festgelegt. [4] Das Wachtum von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> hat einen großen Einfluss auf die Kommunikationsweise der<br />
Unternehmen mit ihren (potenziellen) Kunden. Seit der Entstehung des Web 2.0, bietet das Internet eine Reihe<br />
diverse Werkzeuge um soziale und wirtschaftliche Kontakte auf- und auszubauen. Zudem bietet es zahlreiche<br />
Möglichkeiten Informationen zu teilen und kollaborativ zusammenzuarbeiten. [5]<br />
Im Fokus des <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketings stehen gewöhnlich drei Bemühungen<br />
1. Aufmerksamkeit für die Marke bzw. das Produkt generieren<br />
2. Generierung von Online-Unterhaltungen zu Unternehmensinhalten<br />
3. Animierung der Nutzer zum Teilen von Unternehmensinhalten mit ihrem Netzwerk<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit mittels <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> wird <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations genannt und ist von den<br />
Werbeaktivitäten abzugrenzen. Ein Instrument sind beispielsweise <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Releases. Gebündelt werden diese<br />
Maßnahmen häufig in einem <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Newsroom.<br />
Beispiele<br />
Beispiele für <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Anwendungen:<br />
• Kommunikation: Weblogs, Mikro-Blogging, Soziale Netzwerke, <strong>Social</strong> Network-Aggregatoren, Event-Portale<br />
• Kollaboration: Wikis, <strong>Social</strong> Bookmarks / <strong>Social</strong> Tagging, Bewertungsportale, Auskunftsportale<br />
• Multimedia: Foto-Sharing, Video-Sharing, Livecasting, Audio-/Musik-Sharing<br />
Verschiedene dieser Anwendungen können mittels <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Aggregation vereint werden.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> 31<br />
Siehe auch<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Optimization<br />
Literatur<br />
• Wolfgang Hünnekens: Die Ich-Sender - Das <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Prinzip. Göttingen, BusinessVillage, 2009, ISBN<br />
9783869800059.<br />
Weblinks<br />
• Leitfäden des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) zu <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> [6]<br />
• Facebook, Twitter & Co „So wird die Zukunft von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> aussehen“ [7] , Welt Online, 5. November 2009<br />
• Fachaufsatz „<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Guidelines für Unternehmen - Regeln für das digitale Miteinander“ [8] aus<br />
kommunikationswissenschaftlicher als auch juristischer Perspektive<br />
Referenzen<br />
[1] Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business<br />
Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 59-68.<br />
[2] Brennan Valerie, (2010), Navigating <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> in the Business World, Licensing Journal, Vol.1, p.8-12.<br />
[3] W. Glynn Mangold, David J. Faulds. <strong>Social</strong> media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, The Journal of the<br />
Kelley School of Business, Indiana University<br />
[4] W. Glynn Mangold, David J. Faulds. <strong>Social</strong> media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, The Journal of the<br />
Kelley School of Business, Indiana University<br />
[5] (http:/ / online. wsj. com/ article/ SB122884677205091919. html)<br />
[6] http:/ / www. bvdw. org/ medien?topic=37& type=1& year=& search=<br />
[7] http:/ / www. welt. de/ webwelt/ article5092278/ So-wird-die-Zukunft-von-<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-aussehen. html?page=2#vote_4982783<br />
[8] http:/ / www. rechtzweinull. de/ uploads/ <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Guidelines-RegelnfrdasdigitaleMiteinander. pdf
Soziale Software 32<br />
Soziale Software<br />
Soziale Software (englisch <strong>Social</strong> (Networking) Software) ist ein Modewort für Software, die der menschlichen<br />
Kommunikation und der Zusammenarbeit dient. Das Schlagwort „<strong>Social</strong> Software“ ist um 2002 in Zusammenhang<br />
mit neuen Anwendungen wie Wikis und Blogs aufgekommen; kann aber auch ältere Dienste bezeichnen. Den<br />
Systemen ist gemein, dass sie dazu dienen, Gemeinschaften aufzubauen und zu pflegen, und zwar in aller Regel über<br />
das Internet; zudem entwickeln sie sich teilweise selbstorganisiert. Eine einheitliche Definition existiert nicht, je<br />
nach Auslegung wird die soziale Software enger oder breiter gefasst.<br />
Definition<br />
Coates beschreibt <strong>Social</strong> Software als "Software that supports, extends, or derives added value from human social<br />
behaviour". [1]<br />
Das breite Spektrum von Anwendungen Sozialer Software lässt sich auf verschiedene Weise strukturieren. Schmidt<br />
[2] (S. 5) führt zur Strukturierung beispielsweise drei Basis-Funktionen des Einsatzes von <strong>Social</strong> Software an:<br />
• Informationsmanagement: Ermöglichung des Findens, Bewertens und Verwaltens von (online verfügbarer)<br />
Information.<br />
• Identitätsmanagement: Ermöglichung der Darstellung von Aspekten seiner selbst im Internet.<br />
• Beziehungsmanagement: Ermöglichung Kontakte abzubilden, zu pflegen und neu zu knüpfen.<br />
Auf dieser Betrachtung der Einsatzbereiche baut er auch eine Definition für den Begriff <strong>Social</strong> Software auf: "<strong>Social</strong><br />
Software sind solche internetbasierten Anwendungen, die Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement in<br />
den (Teil-) Öffentlichkeiten hypertextueller und sozialer Netzwerke unterstützen." (Schmidt [2] S. 2).<br />
Ehms [3] unterscheidet vier übergeordnete Ausrichtungen zum Einsatz<br />
von Sozialer Software. Diese Ausrichtungen spiegeln sich in den<br />
technischen Funktionalitäten typischer Plattformen wider.<br />
Üblicherweise ergeben sich beim längeren Einsatz Mischformen der<br />
Hauptrichtungen:<br />
• Informationsmanagement<br />
• Kollaboration (verstanden als enge Zusammenarbeit)<br />
• Kommunikation<br />
• Vernetzung und Identitätsmanagement<br />
Bei der Nutzung sozialer Software kam es wie bei anderen gemeinschaftlichen Kommunikationsformen zu<br />
Konventionen (z. B. sprachlichen Codes wie die Emoticons, formalen Empfehlungen und technischen Normen), zu<br />
Untergruppenbildung mit gruppeneigenen Normen (z. B. der Netiquette) und politischen bzw. gesetzlichen Kontroll-<br />
und Überwachungsversuchen.
Soziale Software 33<br />
Formen sozialer Software<br />
Soziale Software lässt sich in folgende Anwendungsklassen gliedern:<br />
• Gemeinschaftliches Indexieren (engl. social tagging)<br />
• Instant Messaging<br />
• Kollaboratives Schreiben<br />
• Mashups<br />
• Personensuchmaschine<br />
• <strong>Social</strong> Commerce<br />
• Soziale Netzwerke<br />
• Virtuelle Welt (virtual worlds) und Massive Multiplayer Online Game (MMOG)<br />
• Webforen<br />
• Weblogs<br />
• Wikis<br />
Bedeutungen<br />
Politik<br />
Der Politik bietet Soziale Software Kommunikationswerkzeuge um mit den Bürgern in einen direkten Dialog zu<br />
treten, Kampagnen durchzuführenen und Wähler zu mobilisieren. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sieht<br />
in den neuen Partizipationsmöglichkeiten eine große Chance, die politische Willensbildung in der Demokratie und<br />
die Legitimation von Parteien und Politikern grundlegend zu verändern. [4]<br />
Sicherheit<br />
Da Soziale Software nach Ansicht der Bundesregierung ideale Plattformen für die Kommunikation islamistischer<br />
und terroristischer Netzwerke bieten, wurde Anfang 2007 das Gemeinsame Informationszentrum (vormals „Internet<br />
Monitoring und Analysestelle“) der Sicherheitsbehörden gegründet, um den Gefahren für die Öffentliche Sicherheit<br />
zu begegnen. Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), des Bundeskriminalamtes (BKA), des<br />
Bundesnachrichtendienstes (BND), des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) und der Generalbundesanwaltschaft<br />
(GBA) tragen Indizien, die für eine Vorbereitung von Anschlägen sprechen, gezielt zusammen und werten diese<br />
unter Hinzuziehung weiterer Daten aus. [5]<br />
Auf dem Ministertreffen der G8 Innen- und Justizminister Ende Mai 2009 wurde angeregt, die Zusammenarbeit der<br />
Länder mit der Vereinten Nationen und Interpol zur Kontrolle Sozialer Netzwerke zu verstärken. [6]<br />
Unternehmen<br />
<strong>Social</strong> Software spielt heute auch zunehmend in Unternehmen (unter dem Stichwort Enterprise 2.0) eine wichtige<br />
Rolle für eine moderne dezentrale und flexible Unternehmensstruktur, die Organisation des unternehmensinternen<br />
Wissensmanagements und der Expertenverortung.<br />
Siehe auch<br />
• Online-Community<br />
• Computervermittelte Kommunikation<br />
• Rechnergestützte Gruppenarbeit (CSCW)<br />
• Cybergesellschaft<br />
• Web 2.0<br />
• Enterprise 2.0
Soziale Software 34<br />
Literatur<br />
• Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl: <strong>Social</strong> Web. UTB/UVK, Konstanz 2008.<br />
• Manfred Leisenberg: "Web 2.0: Soziale Prozesse bringen Geld - Effektiver Einsatz Sozialer Software".<br />
In:Computerwoche, Bd. 34, Nr. 11, 2007 [7]<br />
• Pferdt, F. G. (2007): Wird Lernen sozial oder wird sozial gelernt? Lernprozesse mit <strong>Social</strong> Software gestalten. In:<br />
Kremer, H.-H. (Hrsg.): Lernen in medienbasierten kooperativen Lernumgebungen - Modellversuch KooL (S.<br />
140-168). Paderborn: Eusl.<br />
• Michael Bächle: <strong>Social</strong> Software. In: Informatik Spektrum. Bd. 29, Nr. 2, 2006, S. 121-124<br />
• Willms Buhse, Sören Stamer (Hg.): Enterprise 2.0: Die Kunst, loszulassen. Rhombos-Verlag, Berlin 2008, ISBN<br />
3-938807-68-7.<br />
• Jochen Dudeck, Jakob Voß: Kooperation als wichtigster Bestandteil des Konzepts / Weblogs, Wikis & Co.: <strong>Social</strong><br />
Software in Bibliotheken. In: Buch und Bibliothek. Nr. 3, 2005, S. 221-225<br />
• Sascha Häusler (2007): Soziale Netzwerke im Internet. Entwicklung, Formen und Potenziale zu kommerzieller<br />
Nutzung, VDM Verlag Dr. Müller, München, 2007, ISBN 3-8364-5264-2.<br />
• Knut Hildebrand, Josephine Hofmann: <strong>Social</strong> Software: Weblogs, Wikis & Co. Dpunkt Verlag, Heidelberg 2006,<br />
ISBN 3-89864-384-0.<br />
• Hajo Hippner, Thomas Wilde: <strong>Social</strong> Software. In: Wirtschaftsinformatik. 47, Nr. 6, 2005, S. 441-444 ISBN<br />
3-8364-1243-8<br />
• Michael Koch, Alexander Richter: Enterprise 2.0 - Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz von <strong>Social</strong><br />
Software in Unternehmen, Oldenburg Verlag, München, 2007, ISBN 3-486-58578-9.<br />
• Ayelt Komus, Franziska Wauch: Wikimanagement - Was Unternehmen von <strong>Social</strong> Software und Web 2.0 lernen<br />
können, Oldenburg Verlag, München, 2008, ISBN 3-486-58324-7.<br />
• Alexander Raabe: <strong>Social</strong> Software im Unternehmen. Wikis und Weblogs für Wissensmanagement und<br />
Kommunikation. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ISBN 3-8364-1243-8.<br />
• Martin Szugat, <strong>Jan</strong> Gewehr, Cordula Lochmann: <strong>Social</strong> Software. Entwickler.Press, Frankfurt am Main 2006,<br />
ISBN 3-939084-09-3.<br />
• Essay von Vannevar Bush: As We May Think [8] (dt.: Wie wir denken werden) veröffentlicht 1945 in der<br />
Zeitschrift Atlantic Monthly<br />
Weblinks<br />
• Competence Network <strong>Social</strong> Software [9] : Ein Zusammenschluss von Münchner Forschungsgruppen rund um<br />
<strong>Social</strong> Software (aus Informatik- und Wirtschaftsinformatik-Sicht)<br />
• Gut vernetzt ist halb geschafft [10] : Handelsblatt-Artikel über die ökonomischen Wirkungen sozialer Software und<br />
"digitaler Cliquenfabriken"<br />
• Soziale Software schreiben [11] : TELEPOLIS-Artikel; eine frühe Begriffsbestimmung (2001)<br />
• Die Humanisierung des Netzes [12] : Artikel aus der ZEIT<br />
• Das Web sind wir [13] : Artikel aus Technology Review<br />
• Chaosradio Folge 89 [14] : Chaosradio Sendung zu <strong>Social</strong> Software<br />
• Christopher Allen: Tracing the Evolution of <strong>Social</strong> Software [15] . (Über Vorläufer und Entwicklung sozialer<br />
Software)<br />
• Harald Taglinger, <strong>Social</strong> Phishing: Die dunklen Möglichkeiten der <strong>Social</strong> Software – ein Szenario [16] (Telepolis,<br />
5. April 2006)<br />
• Seminar zu <strong>Social</strong> Software [17] am FB Design der FH Aachen<br />
• Wikimanagement [18] Wiki und Weblog zu <strong>Social</strong> Software und Management<br />
• Web 2.0 – <strong>Social</strong> Software der neuen Generation [19] (sciencegarden, Februar 2007)<br />
• FAZIT-Forschungsband "Potenziale von <strong>Social</strong> Software" [20]
Soziale Software 35<br />
• Alexander Richter und Michael Koch: <strong>Social</strong> Software – Status quo und Zukunft [21] , Technischer Bericht Nr.<br />
2007-01, Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München, 2007 (PDF)<br />
• Publikation "a digital lifestyle. leben und arbeiten mit social software" [22] von Klaus Haasis und Nadia Zaboura,<br />
2008 (MFG Verlag: Stuttgart)<br />
Referenzen<br />
[1] Tom Coates: "An addendum to a definition of <strong>Social</strong> Software", Blog post, http:/ / www. plasticbag. org/ archives/ 2005/ 01/<br />
an_addendum_to_a_definition_of_social_software<br />
[2] <strong>Jan</strong> Schmidt: <strong>Social</strong> Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement. In: Forschungsjournal Neue Soziale<br />
Bewegungen, Nr 2/2006<br />
[3] Karsten Ehms: Persönliche Weblogs in Organisationen. Spielzeug oder Werkzeug für ein zeitgemäßes Wissensmanagement?. Dissertation,<br />
Universität Augsburg, Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb). April 2010 online (http:/ / opus. bibliothek. uni-augsburg. de/<br />
volltexte/ 2010/ 1542/ ).<br />
[4] Panel über das Thema Politik 2.0 auf der CeBit 2009 (http:/ / www. zaplive. tv/ web/ webciety?streamId=webciety/<br />
84679c59-fdc2-495a-ab08-3a0de43f447e& start=4224). Webcast, abgerufen am 9. März 2009.<br />
[5] heise online: Bundesregierung: Web 2.0 hat hohe Bedeutung für islamistische Propaganda (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Bundesregierung-Web-2-0-hat-hohe-Bedeutung-fuer-islamistische-Propaganda--/ meldung/ 133881). 3. März 2009.<br />
[6] futurezone.at: G-8 für mehr Kontrolle Sozialer Netzwerke (http:/ / futurezone. orf. at/ stories/ 1603830/ ). 29. Mai 2009.<br />
[7] http:/ / www. computerwoche. de/ heftarchiv/ 2007/ 11/ 1218263/<br />
[8] http:/ / www. theatlantic. com/ doc/ 194507/ bush<br />
[9] http:/ / www. cnss. de/<br />
[10] http:/ / www. handelsblatt. com/ news/ Konjunktur-%D6konomie/ %D6konomische-Nachrichten/ _pv/ _p/ 302030/ _t/ ft/ _b/ 1310908/<br />
default. aspx/ gut-vernetzt-ist-halb-geschafft. html<br />
[11] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 4/ 4893/ 1. html<br />
[12] http:/ / www. sixtus. net/ article/ 613_0_2_0_C/<br />
[13] http:/ / www. sixtus. net/ article/ 614_0_2_0_C/<br />
[14] http:/ / chaosradio. de/ cr89. html<br />
[15] http:/ / www. lifewithalacrity. com/ 2004/ 10/ tracing_the_evo. html<br />
[16] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 22/ 22342/ 1. html<br />
[17] http:/ / seminare. design. fh-aachen. de/ ssw/<br />
[18] http:/ / www. wikimanagement. de<br />
[19] http:/ / www. sciencegarden. de/ berichte/ 200702/ web20/ web20. php<br />
[20] http:/ / www. fazit-forschung. de/ fazit-ssw. html<br />
[21] http:/ / www. kooperationssysteme. de/ wordpress/ uploads/ RichterKoch2007. pdf<br />
[22] http:/ / www. digital-lifestyle. mfg-innovation. de/
Facebook<br />
URL<br />
Kommerziell ja<br />
Channels & Platforms<br />
www.facebook.com [1]<br />
Facebook<br />
Beschreibung Gemeinschaftsportal bzw. Online-Kontaktnetzwerk (siehe Soziale Software)<br />
Sprachen 74 Sprachversionen (darunter Deutsch)<br />
(Stand: 28. Juli 2010)<br />
Eigentümer Facebook Inc.<br />
Urheber Mark Zuckerberg,<br />
Dustin Moskovitz (Mitgründer),<br />
Chris Hughes (Mitgründer), Eduardo Saverin (Mitgründer)<br />
Erschienen Februar 2004<br />
Jahreseinnahmen 150 Millionen US-Dollar (Schätzung)<br />
36
Facebook 37<br />
Facebook ist eine Website zur Bildung und Unterhaltung sozialer<br />
Netzwerke, die der Firma Facebook Inc. mit Sitz im kalifornischen<br />
Palo Alto gehört. Größte Anteilseigner sind Mark Zuckerberg<br />
(24 Prozent), Peter Thiel (7 Prozent), Digital Sky Technologies<br />
(6,9 Prozent) [2] und Microsoft (1,6 Prozent). Am 21. Juli 2010 hatte<br />
die Plattform nach eigenen Angaben 500 Millionen aktive Nutzer<br />
weltweit. [3]<br />
Geschichte<br />
Mark Zuckerberg entwickelte Facebook gemeinsam mit den Studenten<br />
Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz und Chris Hughes im Februar<br />
2004 an der Harvard University ursprünglich nur für die dortigen<br />
Studenten. Später wurde die Website für Studenten in den Vereinigten<br />
Staaten freigegeben. Weitere Expansionsschritte dehnten die<br />
Anmeldemöglichkeit auch auf High Schools und auf Firmenmitarbeiter<br />
aus. Im September 2006 konnten sich auch Studenten an ausländischen<br />
Der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg<br />
Hochschulen anmelden, später wurde die Seite für beliebige Nutzer freigegeben. Im Frühjahr 2008 wurde die<br />
Website in den Sprachen Deutsch, Spanisch und Französisch angeboten, [4] ab zweitem Quartal 2008 folgten weitere<br />
Sprachen, so dass heute 70 Lokalisierungen angeboten werden.<br />
Funktionen<br />
Jeder Benutzer verfügt über eine Profilseite, auf der er sich vorstellen und Fotos oder Videos hochladen kann. Auf<br />
der Pinnwand des Profils können Besucher öffentlich sichtbare Nachrichten hinterlassen oder Notizen/Blogs<br />
veröffentlichen. Alternativ zu öffentlichen Nachrichten können sich Benutzer persönliche Nachrichten schicken oder<br />
chatten. Freunde können zu Gruppen und Events eingeladen werden. Facebook verfügt zudem über einen<br />
Marktplatz, auf dem Benutzer Kleinanzeigen aufgeben und einsehen können. Durch eine Beobachtungsliste wird<br />
man über Neuigkeiten, z. B. neue Pinnwandeinträge auf den Profilseiten von Freunden informiert. Die Benutzer auf<br />
Facebook sind in Universitäts-, Schul-, Arbeitsplatz- und Regionsnetzwerke eingeteilt.<br />
Applikationen<br />
Das Unternehmen öffnete im Mai 2007 seine Plattform für Anwendungen von Drittanbietern. Entwicklern steht über<br />
die Facebook Platform eine Programmierschnittstelle (API) zur Verfügung, mit der sie Programme schreiben<br />
können, die sich dem Design von Facebook anpassen und nach Erlaubnis der Nutzer auf deren Daten zugreifen<br />
können. [5] Facebook-Mitglieder können die angebotenen Programme in ihre Profilseiten integrieren. Die Bandbreite<br />
umfasst Spiele und andere Kommunikationsanwendungen. Nach Unternehmensangaben waren im Oktober 2009<br />
mehr als 350.000 Applikationen verfügbar. [6] Allerdings erreicht nur ein kleiner Teil davon mehr als 100.000 Nutzer<br />
im Monat. Mit über 75 Mio. aktiven Nutzern [7] ist das Onlinespiel FarmVille die derzeit beliebteste<br />
Facebook-Applikation.<br />
Beobachter bewerten die Öffnung der Plattform als wichtigen Schritt, um die Attraktivität von Facebook zu erhöhen<br />
und damit die Nutzerzahl zu steigern. [8] Allerdings wuchs das Angebot derart rasant, dass Nutzer über die<br />
Unübersichtlichkeit klagten. Einige Applikationen sind vor allem darauf ausgelegt, sich möglichst schnell zu<br />
verbreiten. Das Unternehmen geht mittlerweile gegen Application Spam vor, indem es im Rahmen eines<br />
sogenannten Verification Program vertrauenswürdige und sichere Anwendungen besser platziert und ihnen ein<br />
entsprechendes Logo verleiht. [9]
Facebook 38<br />
Connect<br />
Mit Facebook Connect bietet das Unternehmen eine Einmalanmeldung-Lösung an. Registrierte Nutzer können über<br />
diese Funktion ihre Anmeldedaten auf anderen Websites verwenden, ohne sich dort registrieren zu müssen. In<br />
bestimmten Fällen ist zudem möglich, Inhalte wie das Profil, Fotos, Kontaktlisten und Kommentare mitzunehmen.<br />
Im Gegenzug zeigt Facebook Aktivitäten in den jeweiligen Portalen in seinem eigenen Angebot an, so dass die<br />
Freunde eines Mitglieds diese sehen können. [10]<br />
Nach einer Testphase ging der Anmeldedienst im Dezember 2008 an den Start. Mittlerweile unterstützen ihn nach<br />
Unternehmensangaben mehr als 240.000 Websites und Geräte, mehr als 60 Millionen Nutzer greifen jeden Monat<br />
darauf zu. [11] Unter den Kooperationspartnern sind namhafte Unternehmen wie Yahoo!, Lufthansa, die Washington<br />
Post oder in Deutschland das Online-Portal Bild.de. [12]<br />
Auch mehrere Spielkonsolen verwenden den Anmeldedienst. Nutzer der mobilen Konsole Nintendo DSi können<br />
beispielsweise mit der integrierten Kamera gemachte Bilder auf Facebook hochladen. Die Xbox 360 erlaubt seit<br />
einer Aktualisierung den direkten Zugriff auf das Netzwerk. Mit der PlayStation 3 können Spieler Transaktionen im<br />
PlayStation-Store und neu erhaltene Trophäen auf der persönlichen Facebook-Seite anzeigen lassen.<br />
Der Facebook-Connect-Nachfolger „Open Graph“ wurde 2010 auf der f8-Entwicklerkonferenz vorgestellt. [13]<br />
Open Graph<br />
Facebook Open Graph ist der Nachfolger der beliebten Schnittstelle Facebook Connect und bietet Entwicklern<br />
Zugang zur Facebook-Plattform. Über die API können Entwickler auf einfache Weise auf die Daten des sozialen<br />
Netzwerks zugreifen und eigene Applikationen programmieren. Im Rahmen der f8-Entwicklerkonferenz 2010 [14] hat<br />
Facebook verschiedene vorprogrammierte Lösungen für externe Webseiten vorgestellt, die sogenannten „<strong>Social</strong><br />
Plugins“ (soziale Erweiterungsmodule). Über diese Plugins können Webseitenbetreiber einfach kleine Anwendungen<br />
mit minimalstem Programmieraufwand im eigenen Portal integrieren. [15] Die beliebtesten Plugins sind der Like<br />
Button, die Like Box und die Facebook Comment Box. Des Weiteren existieren Anwendungen für Empfehlungen,<br />
einen Activity Stream oder die Anmeldung mit Facebook. [16]<br />
Abgesehen von diesen vorprogrammierten Lösungen kann jeder Entwickler selbst mit dem Open Graph seinen<br />
Webauftritt erweitern und mit Facebook verbinden. Die Daten des Nutzers erhält eine Webseite allerdings erst dann,<br />
wenn der Nutzer dies ausdrücklich selbst autorisiert hat. So ist z. B. Einmalanmeldung über Facebook ohne Weiteres<br />
möglich. Die konkreten Anwendungsfälle des Open Graphs können sehr unterschiedlich sein, da jeder Entwickler<br />
selbst entscheidet, wie er konkret mit den Daten umgeht.<br />
Bereits wenige Tage nach der Vorstellung des Open Graphs wurden die Funktionen auf über 100.000 Webseiten<br />
eingebunden. [17] Mittlerweile nutzen über eine Million Webseiten die verschiedenen Funktionen des Open<br />
Graphs. [18]<br />
Mobil<br />
Spezielle Facebook-Clients sind mittlerweile für verschiedene mobile Plattformen verfügbar (BlackBerry, Apple<br />
iPhone/iPod touch, das Nokia-Smartphone-Betriebssystem S60, Android, Palm Pre, bada etc.). Außerdem gibt es<br />
zwei mobile Portale für mobile Browser mit und ohne Sensorbildschirm-Unterstützung. [19]<br />
Des Weiteren gibt es ein Angebot zur Statusaktualisierung und verschiedenen anderen Funktionen per SMS. Der<br />
Versand der SMS an die Nummer 2665 (BOOK) kostet den normalen SMS-Tarif. Für O2-Kunden ist der Empfang<br />
der Nachrichten von Facebook (z. B. Statusmeldungen, neue Nachrichten usw.) kostenlos. Zum Freischalten muss<br />
eine SMS mit dem Buchstaben „f“ an die 2665 gesendet werden, anschließend erhält der Nutzer einen Code auf dem<br />
Mobiltelefon, den er bei Facebook angeben muss und die Nummer daraufhin freigeschaltet wird.
Facebook 39<br />
Technik<br />
Facebook betreibt in seinen Rechenzentren CentOS-Server – früher mit Apache, heute mit einer eigenen<br />
HTTP-Server-Software –, sowie mit PHP und einem selbstentwickelten Datenbanksystem namens Cassandra.<br />
Zahlreiche Eigenentwicklungen aus der Installation werden als freie Software veröffentlicht: die Datenbank<br />
Cassandra, HipHop, Tornado, Thrift, Scribe … [20] Als „Gold“-Sponsor des Apache-Projektes fördert Facebook die<br />
freie Software auch finanziell mit 40.000 US-Dollar jährlich.<br />
Statistik<br />
Facebook hat am 21. Juli 2010 nach eigenen Angaben die 500-Millionen-Benutzer-Grenze überschritten [21] und ist<br />
laut comScore die am häufigsten besuchte Kontaktwebsite. [22] 2008 wurde Facebook in über 70 Sprachen angeboten.<br />
Monatlich werden drei Milliarden Bilder und zehn Millionen Videos hochgeladen. Die meisten Nutzer stammen<br />
dabei aus den Vereinigten Staaten und sind jünger als 25 Jahre. [23] In Deutschland hat Facebook im Juli 2010<br />
erstmals die 10 Millionen Mitglieder-Marke übertroffen, und per 31. Juli 2010 insgesamt 10'276'100 Nutzer<br />
ausgewiesen. (. [24] 94.0 Prozent der deutschen Nutzer sind zwischen 14 und 49 Jahre alt (werberelevante<br />
Zielgruppe), die Männer sind mit 49.8 Prozent nahezug gleich vertreten wie die Frauen mit einem Anteil von<br />
50.2 Prozent. [25] In der Schweiz hat Facebook derzeit 2.252 Millionen aktive Nutzer (Stand 31. August 2010), die<br />
Männer sind mit 51.7 Prozent stärker vertreten gegenüber den Frauen mit 48.3 Prozent. Der Anteil der<br />
werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Benutzer liegt bei rund 91 Prozent. [26] In Österreich liegt die<br />
Nutzerzahl bei 2,108 Millionen, der Frauenanteil beträgt 49.5 Prozent zu 50.5 Prozent Männeranteil, die<br />
Altersgruppe 14 bis 49 Jahre (werberelevante Zielgruppe) beträgt 91.9 Prozent. [27] Damit nutzen in Deutschland<br />
13.3, in der Schweiz 29.2 und in Österreich 25.2 Prozent der Bevölkerung die Plattform (Stand 31. August 2010).<br />
Zum Vergleich: Die Marktdurchdringung in den USA beträgt 43.1 Prozent, in Grossbritannien 45.8 Prozent und in<br />
Frankreich 29.7 Prozent. Mit 61.4 Prozent weist Island die höchste Markterschliessung aller G8-, EU27 und<br />
EFTA-Staaten aus. [28] Große Wachstumsmärkte liegen für Facebook vor allem in Asien. Im Februar 2010 war das<br />
soziale Netzwerk laut einer comScore-Statistik z. B. in Malaysia (77,5 Prozent), Singapur (72,1 Prozent) und<br />
Hongkong (62,5 Prozent) bereits Marktführer. In Malaysia betrug die Steigerung von März 2009 bis März 2010<br />
364 Prozent auf fast sechs Millionen Nutzer. Durch die kontinuierliche Weiterverbreitung des Internets, vor allem<br />
des mobilen Internets über Smartphones, wird sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen. [29] Jeff Rothschild gab in<br />
einer Präsentation Anfang Oktober 2009 bekannt, dass die Infrastruktur von Facebook aus 30.000 Servern<br />
bestehe. [30] Anhand einer im Juni an der Velocity Conference von Tom Cook (Facebook) veröffentlichten<br />
Präsentation dürfte die Anzahl der in der Infrastruktur genutzten Server sich innerhalb von neun Monaten auf rund<br />
60.000 verdoppelt haben. [31]<br />
Aktuelle Entwicklung August 2010: Mit Ausnahme von Luxemburg wiesen im August 2010 sämtliche Länder der<br />
EU27, G8 und EFTA einen Anstieg der aktiven Nutzerzahlen aus. Die grössten Wachstumsraten verzeichneten<br />
Lettland (21.3 Prozent), Russland (16.7 Prozent), Ungarn (14.0 Prozent) und Polen (13.0 Prozent). Den grössten<br />
absoluten Zuwachs verzeichneten die USA mit 3.9 Millionen neuen Mitgliedern, gefolgt von Grossbritannien (0.9<br />
Millionen) und Deutschland (0.6 Millionen). Deutschland weist, innerhalb der zehn Nationen mit der grössten<br />
Anzahl an aktiven Nutzern, das stärkste Wachstum (6.0 Prozent) aus. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird<br />
Deutschland im Verlauf des September 2010 Spanien hinsichtlich der Gesamtzahl aktiver Nutzer überholen. Die<br />
Schweiz konnte das Wachstum gegenüber dem Monat Juli 2010 von 0.3 Prozent auf 0.7 Prozent erhöhen, was<br />
jedoch im Vergleich zu den übrigen Ländern der EU27, G8 und EFTA ein ausgesprochen tiefer Wert ist. Die<br />
Schweiz liegt im Vergleich lediglich auf Platz 31 (35 Länder; Deutschland: Rang 11 [6.0 Prozent], Österreich: Rang<br />
34 [0.1%]). Das kumulierte Wachstum seit anfangs 2010 beträgt in der Schweiz 25.0 Prozent. Das Wachstum bei<br />
den Männern (alle 35 Länder der EU27, G8 und EFTA) wie bei den Frauen betrug 4.4 Millionen. Aufgrund der<br />
geringeren Grundgesamtheit wiesen die Männer (3.6 Prozent) jedoch eine höhere Zuwachsrate aus als die Frauen<br />
(3.1 Prozent). Die Wachstumsrate bei den Silver Surfern war massgeblich höher als bei den jungen Altersgruppen.
Facebook 40<br />
Die erhöhte Wachstumszunahme bei den Silver Surfern ist primär auf einen statistischen Effekt zurückzuführen: Da<br />
die älteren Alterssegmente klar weniger Mitglieder ausweisen, führten bereits geringere absolute Zunahmen zu einer<br />
höheren Zuwachsrate. Das Alterssegment mit den meisten Mitglieder stellen unverändert die 20- bis 29-jährigen<br />
Nutzer (91.8 Millionen), gefolgt von den 30. bis 39. Jahre alten Mitglieder (knapp 60 Millionen). Die kleinste<br />
Gruppe stellen die über 60-jährigen Mitglieder mit 14.3 Millionen. Den grössten absoluten Zuwachs erzielte trotz<br />
einer knapp unterdurchschnittlichen Zuwachsrate von 3.0 Prozent (Durchschnitt: 3.1 Prozent), das nutzerbezogen<br />
grösste Alterssegment der 20- bis 29-jährigen Mitglieder mit einem Plus von 2.7 Millionen. [32]<br />
Wirtschaftliche Lage<br />
Facebook hat nach der Gründung im Jahr 2004 in mehreren Runden rund 740 Millionen Dollar Kapital zur<br />
Finanzierung erhalten. 2009 erzielte das Unternehmen einen geschätzten Umsatz zwischen 700 und 800 Mio.<br />
Dollar. [33] Der Marktwert wird sehr unterschiedlich zwischen 2 und 15 Milliarden Dollar angesetzt. [34] [35] 2009<br />
wurde in Hamburg die erste Deutschland-Filiale eröffnet, um die Zusammenarbeit von Marken und Unternehmen<br />
mit Kunden oder Fans auf Facebook zu verbessern.<br />
Geschäftsmodell<br />
Facebook hat noch kein kostendeckendes Geschäftsmodell entwickelt und legt nach eigenen Angaben derzeit<br />
Priorität auf Wachstum. Die Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, Einnahmen soll vor allem das Werbegeschäft<br />
bringen. Derzeit experimentiere man mit verschiedenen Modellen, beispielsweise personalisierter Werbung<br />
(Targeting) und Empfehlungsmarketing, sagte Firmenchef Mark Zuckerberg im Oktober 2008. Erst in drei Jahren<br />
müsse man das „optimale Modell“ gefunden haben. [36]<br />
Kennzahlen<br />
Da das Unternehmen nicht börsennotiert ist und nur eingeschränkten Publikationspflichten unterliegt, sind keine<br />
genauen Geschäftszahlen bekannt. 2008 lag der Umsatz laut dem amerikanischen Fachblog TechCrunch bei 280<br />
Millionen Dollar, 2009 waren es laut dem Blog Inside Facebook zwischen 1 und 1,1 Milliarden Dollar. [37] Dem<br />
stehen hohe Ausgaben gegenüber, nicht zuletzt durch den enormen Zustrom an neuen Benutzern, der einen massiven<br />
Ausbau der Infrastruktur erfordert. TechCrunch schätzt die Ausgaben auf „mehrere hundert Millionen Dollar“ pro<br />
Jahr, um allein den Betrieb aufrechtzuerhalten. [38]<br />
Finanzierung<br />
Facebook hat in mehreren Runden rund 740 Millionen Dollar Kapital eingesammelt. Der erste Investor war der<br />
Internet-Unternehmer Peter Thiel. Auch der Softwarekonzern Microsoft hat sich an dem Unternehmen beteiligt, die<br />
russische Investment-Firma Digital Sky Technologies schoss rund 400 Millionen Dollar hinzu. Mehrere Konzerne,<br />
darunter Yahoo! und Viacom, versuchten, Facebook vollständig zu übernehmen, die Gründer lehnten jedoch alle<br />
Angebote ab. [39]
Facebook 41<br />
Finanzierungsrunden<br />
Datum Investor Summe<br />
2004 Eduardo Saverin 18.000 Dollar<br />
Juni 2004 Peter Thiel 500.000 Dollar<br />
Mai 2005 Accel Partners (Investmentfirma) 12,7 Mio. Dollar<br />
April 2006 Konsortium geführt von Greylock Partners (Investmentfirma) 27,5 Mio. Dollar [40]<br />
Oktober 2007 Microsoft 240 Mio. Dollar<br />
November 2007 Li-ka Shing (Geschäftsmann aus Hongkong) 60 Mio. Dollar<br />
Mai bis Dezember 2009 Digital Sky Technologies<br />
[41] [42]<br />
400 Mio. Dollar<br />
Mit der Einführung einer neuen Aktienstruktur – die den bisherigen Anteilseignern mehr Kontrolle sichert – hat das<br />
Unternehmen einen möglichen Börsengang vorbereitet. [43] Investoren schlossen den Gang an die Börse aber für das<br />
Jahr 2010 aus. [44]<br />
Im April 2009 hatte Facebook-Vorstand Sheryl Sandberg angegeben, dass Facebook keinerlei Nutzungsgebühren für<br />
die Standarddienste plane. Die Internetseite snopes.com gab an, die im Dezember 2009 aufgekommene gegenteilige<br />
Behauptung, Facebook wolle ab Juni 2010 eine monatliche Gebühr in Höhe von 4,99 US-Dollar von jedem Nutzer<br />
verlangen, sei ein Hoax und von Cyber-Kriminellen zur Verbreitung von Schadprogrammen durch eine angebliche<br />
Protestseite erfunden worden. [45]<br />
Marktwert<br />
Da Facebook nicht börsennotiert ist, kann der Marktwert nur grob anhand mehrerer Faktoren wie Investitionen in die<br />
Firma und Umsatz ermittelt werden. Die Bewertung schwankt zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar. Am<br />
24. Oktober 2007 erwarb Microsoft für 240 Millionen US-Dollar einen Anteil von 1,6 Prozent. Den daraus<br />
resultierenden Wert von 15 Milliarden Dollar hält die New York Times allerdings für zu hoch gegriffen, da Microsoft<br />
darüber hinaus Sonderrechte erworben und zudem den Rivalen Google von einer Beteiligung bei Facebook<br />
abgehalten habe. [46] [47] Bei einer Finanzierungsrunde im Mai 2009 kaufte die russische Firma Digital Sky<br />
Technologies für 200 Millionen Dollar 1,96 Prozent der Firma. Daraus resultiert eine Bewertung von 10 Milliarden<br />
Dollar. [48]<br />
Kontroversen<br />
Anonyme Registrierung<br />
Auf Facebook ist es möglich, sich mit einer fiktiven Identität anzumelden. Der Nutzer wird jedoch ausdrücklich dazu<br />
aufgefordert, sich mit seinem echten Vor- und Nachnamen sowie seinem Geburtsdatum anzumelden. Die Eingabe<br />
von zwei Namen (also Vor- und Nachname) ist erforderlich. Zwar findet keine Überprüfung der realen Identität<br />
eines Benutzers statt, jedoch löschte Facebook schon mehrmals in automatisierter Form ohne Vorwarnung Profile<br />
mit ungewöhnlichen Namen, hinter denen ohne Einzelrecherche unechte Identitäten vermutet wurden. [49] Dadurch<br />
wurden auch Profile real existierender Personen gelöscht. Die Veröffentlichung von persönlichen Daten ist den<br />
Nutzern freigestellt.
Facebook 42<br />
Personalisierte Werbung<br />
Am 7. Oktober 2007 kündigte Facebook an, in allen vorhandenen Nutzerprofilen von mehr als 50 Millionen<br />
registrierten Nutzern personalisierte Werbung zuzulassen. Dabei sollen den bislang interessierten 60 Konzernen und<br />
Unternehmen persönliche Daten der Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Neben Alter, Geschlecht,<br />
Lieblingsbeschäftigungen, Wohnort, politischer Überzeugung, Lieblingsbüchern und -filmen umfassen die<br />
bereitgestellten Informationen auch den Bildungsstand und Hinweise auf persönliche Beziehungen.<br />
Dagegen wendet sich in den Vereinigten Staaten erste Kritik, wie von Facebook-Nutzer Nate Weiner im Gespräch<br />
mit AP: „Was wäre, wenn du ein Buch bei Amazon kaufst, das ‚Der Umgang mit Aids‘ heißt, und jeder einzelne<br />
deiner Freunde erfährt davon?“ Denn das Problem ist, dass nun ein Unternehmen immer mehr persönliche, schlecht<br />
zu kontrollierende Angaben seiner Kunden (mit deren formeller Erlaubnis) speichert, das aber im Alltag nicht<br />
bewusst macht. [50]<br />
Ein Artikel im Guardian vom 14. <strong>Jan</strong>uar 2008 kritisierte die Gründer und Besitzer des Unternehmens in zahlreichen<br />
Punkten. Unter anderem zeigte er auf, wie die libertäre Gesinnung des Investors Peter Thiel, eines aus Deutschland<br />
stammenden Hedgefonds-Managers, einen Einfluss auf die Funktionsweise und Ausrichtung des Unternehmens<br />
haben könnte. [51]<br />
Verwertung von Nutzerdaten<br />
Facebook änderte im Februar 2009 die Nutzungsbedingungen (Terms of Service) dahingehend, dass das<br />
Unternehmen die Daten von Mitgliedern zeitlich unbegrenzt verwenden durfte – auch nach Löschung bzw.<br />
Deaktivierung eines Nutzerkontos. Die Regelung betraf beispielsweise Kommentare, Fotos und Videos. [52] Nach<br />
massiven Protesten von Nutzern, Daten- und Verbraucherschützern wurden die Regeln zunächst wieder auf den<br />
Stand vor den Änderungen zurückgesetzt. [53] Zudem kündigte das Unternehmen an, in bestimmten Fällen seine<br />
Nutzer künftig über Regeländerungen abstimmen zu lassen. [54] Im April 2009 stellte Facebook modifizierte<br />
Nutzungsbedingungen zur Abstimmung, in denen Nutzern der Besitz ihrer Informationen zugesichert wird. Eine<br />
Mehrheit der Teilnehmer befürwortete die neuen Regeln. [55] Obwohl die Inhalte (z. B. Fotos) im Besitz der Nutzer<br />
bleiben, erhält Facebook das Recht, alle Inhalte kommerziell zu nutzen und die Nutzungsrechte an Dritte<br />
weiterzugeben. [56] Auch nach der Änderung der Nutzungsbedingungen kommt Facebook immer wieder wegen<br />
seiner lockeren Datenverwertung in die Schlagzeilen. So speichert das Unternehmen nach einem Update auf dem<br />
Handy Kontaktdaten. Aber auch über eine Suchfunktion, über die Mitglieder die noch nicht gefundenen Freunde auf<br />
Facebook mit den Daten aus der E-Mail-Kontaktliste des Mailproviders abgleichen und finden können, werden<br />
Daten von Nicht-Mitgliedern dauerhaft und ungefragt gespeichert. [57] Zuletzt wurden die Nutzungsbedingungen von<br />
Facebook indirekt durch ein Urteil des Oberlandesgerichtes Köln bestätigt. Ein Nutzer hat ein Foto von sich in<br />
seinem Nutzerprofil veröffentlicht. Eine Personensuchmaschine hatte dieses übernommen. Das Oberlandesgericht<br />
Köln wies die auf Unterlassung gerichtete Klage des Nutzers mit der Begründung zurück, dass dieser mit der<br />
Einstellung seines Fotos seine Einwilligung in einen Zugriff durch die Personensuchmaschine zumindest konkludent<br />
erklärt hätte. Zudem hätte er von der ihm von Facebook in den Nutzungsbedingungen eingeräumten Möglichkeit der<br />
Sperre gegenüber Suchmaschinen keinen Gebrauch gemacht, auf die das Gericht ausdrücklich verwiesen hat. [58]
Facebook 43<br />
Auswertung/Nutzung durch Nachrichtendienste und Polizei<br />
Mitte 2009 wurde bekannt, dass die iranische Polizei Facebook-Profile benutzt, um bei Verhören den Freundeskreis<br />
von Regimegegnern und Demonstranten auszumachen und namentlich zu identifizieren. [59]<br />
Zwangsweise Veröffentlichung von zuvor privaten Nutzerdaten<br />
Im November 2009 veränderte Facebook die Standardeinstellungen zur Privatsphäre. Die Voreinstellungen sind nun<br />
so, dass möglichst viele Informationen öffentlich sichtbar sind. Darüber hinaus sind bestimmte Informationen,<br />
darunter Name, Profilfoto, Freunde und Gruppenzugehörigkeiten, seitdem immer öffentlich sichtbar, auch wenn<br />
Nutzer zuvor andere Einstellungen vorgenommen hatten – die früheren Schutzmöglichkeiten sind bei diesen<br />
Punkten entfallen.<br />
Extremistische Einträge<br />
Auf Facebook werden links- und rechtsextreme Persönlichkeiten und Gewaltverbrecher in positiver, unkritischer<br />
oder vermeintlich amüsanter Weise dargestellt. Es gibt laut einer Recherche des Schweizer Tagesanzeigers [60] Seiten<br />
über Hitler, Stalin, Pol Pot etc. Im April 2009 hatte eine Benutzerin über 200 Nazi-Seiten entdeckt, mit<br />
beispielsweise Namen wie Großdeutschland, Erwin Rommel Fan Club oder Holocaust Party, mit meist<br />
NS-Propaganda. Es kam zu einem offenen Brief an Facebook mit der Aufforderung, die Profile der Neonazis zu<br />
löschen, oder es komme zu einer Anzeige wegen Volksverhetzung. Am 17. April 2009 stoppte die Deutsche<br />
Telekom ihre Werbung auf Facebook mit Hinweis auf „rechtsextreme“ Webseiten auf dem Portal. [61] Auch die<br />
[62] [63] [64]<br />
Bundeszentrale für politische Bildung beobachtete Facebook.<br />
Rechtsstreitigkeiten<br />
studiVZ<br />
Das Konzept von Facebook hat zahlreiche Nachahmer wie studiVZ und wer-kennt-wen gefunden. So wurde der im<br />
deutschsprachigen Raum verbreitete Konkurrent studiVZ dafür kritisiert, ein bis in die Details von Funktion, Aufbau<br />
und Aussehen gehender Nachbau von Facebook zu sein. Am 19. Juli 2008 reichte Facebook beim US-Bezirksgericht<br />
in San José (Kalifornien) Klage gegen die Betreiber des studiVZ ein, der Vorwurf lautet Diebstahl geistigen<br />
Eigentums. [65] Jedoch ist Facebook mit dieser Klage gescheitert. [66] Im September 2009 teilten beide Unternehmen<br />
mit, man habe sich geeinigt, und studiVZ werde einen Geldbetrag an Facebook zahlen. [67]<br />
ConnectU<br />
2004 wurde Facebook von Klassenkameraden Mark Zuckerbergs und ihrem Unternehmen ConnectU verklagt. Er<br />
wurde beschuldigt, einen mündlichen Vertrag gebrochen zu haben. In dieser Vereinbarung soll es sich um die<br />
Nutzung des Quellcodes von Facebook gehandelt haben, der angeblich durch die Kläger erstellt worden war. [68] Das<br />
Unternehmen Facebook teilte der Öffentlichkeit mit, Einigungen mit ConnectU durch eine Zahlung von 65<br />
Millionen US-Dollar erbracht zu haben. [69] [70] ConnectU bestreitet eine solche Einigung bis heute.<br />
Grant Raphael<br />
Am 24. Juli 2008 verurteilte ein Gericht in London Grant Raphael zu einer Zahlung von 22.000 GBP wegen<br />
Persönlichkeitsverletzungen und falscher Beschuldigungen. Raphael hatte eine falsche Facebookseite über einen<br />
ehemaligen Klassenkameraden und Geschäftspartner erstellt. Auf ihr behauptete Raphael unter dem Namen von<br />
diesem, dass er homosexuell und nicht vertrauenswürdig sei. Dieser Fall wird als erster Fall von<br />
Persönlichkeitsverletzungen und Diffamierung über ein Soziales Netzwerk gesehen. [71]
Facebook 44<br />
Jugendschutz<br />
Im Dezember 2009 gründete Facebook einen Sicherheitsbeirat, um regelmäßig die Sicherheitsvorkehrungen für die<br />
Nutzer prüfen zu können. Dieser Beirat besteht aus Vertretern der folgenden fünf Organisationen: Common Sense<br />
<strong>Media</strong>, ConnectSafely, WiredSafety, Childnet International und The Family Online Safety Institute (FOSI). Damit<br />
setzt Facebook eine weitere Maßnahme, um eine sichere Umgebung für Jugendliche im Internet zu schaffen,<br />
nachdem Facebook sich bereits an der Internet Safety Technical Task Force (ISTTF) beteiligt und 2008 mit 49<br />
Generalstaatsanwälten der Vereinigten Staaten und dem Generalstaatsanwalt des District of Columbia<br />
Vereinbarungen zum besseren Jugendschutz unterzeichnete. In diesen Vereinbarungen verpflichtet sich Facebook<br />
dazu:<br />
• Minderjährige vor dem Austausch persönlicher Daten speziell zu warnen;<br />
• es Erwachsenen nicht zu ermöglichen, in Suchmaschinen Profile von minderjährigen Personen zu finden;<br />
• Änderungen des Alters im Profil zu erschweren und zu protokollieren;<br />
• Inhalte besser zu filtern und eine Liste pornographischer Angebote zu führen sowie Links auf diese zu löschen.<br />
Außerdem kooperiert Facebook noch mit MTV und dem BBC gegen digitalen Missbrauch und Cyber-Mobbing. [72]<br />
[73]<br />
Ebenso überarbeitete Facebook im Dezember 2009 die Kontrolle über die Privatsphäre. Nun kann jeder Nutzer bei<br />
der Veröffentlichung von Statusmeldungen, Medien oder Links differenziert festlegen, wer diese sehen darf und wer<br />
nicht. Des Weiteren wurden die Einstellungen zum Datenschutz modifiziert und es wurde jeder Facebook-Nutzer<br />
dazu aufgefordert, diese zu prüfen. Es kann jetzt zwischen eigenen Kontakten, Freunden der Freunde sowie dem<br />
gesamten Facebook-Netzwerk unterschieden werden. Hier wurde wiederum am Jugendschutz gearbeitet: Die Inhalte<br />
von minderjährigen Nutzern sollen nur für Freunde, Kontakte und Klassenkameraden sichtbar sein. [74]<br />
Sonstiges<br />
• Der Name Facebook bezieht sich auf die sogenannten Facebooks, die die Studenten an manchen amerikanischen<br />
Colleges zur Orientierung auf dem Campus erhalten. In diesen Facebooks sind andere Kommilitonen abgebildet<br />
(Face, englisch für Gesicht; book englisch für Buch).<br />
• Wie andere soziale Netzwerke steht auch Facebook im Verdacht, von Arbeitgebern verwendet zu werden, um<br />
Angestellte zu überwachen. Bestätigt werden diese Eindrücke durch einen Fall im November 2008 aus der<br />
Schweiz, wo eine krankgeschriebene Versicherungsangestellte ihre Stelle verlor, weil der Arbeitgeber ihre<br />
Aktivität auf Facebook verfolgen konnte, während der Frau offiziell Bettruhe verordnet war. [75] Fälle, in denen<br />
Arbeitnehmer die Stelle verloren, weil sie sich auf Facebook abschätzig über ihre Arbeitgeber geäußert haben,<br />
sind aus Australien bekannt. [76] Im März 2010 wurde ein Fall aus der Region Manchester publik, in dem einer<br />
Aushilfskellnerin eines Cafés gekündigt wurde, indem der Arbeitgeber die Kündigung unter Angabe des<br />
Kündigungsgrundes auf der Pinnwand der 16-Jährigen veröffentlichte. [77]<br />
• Der Regisseur David Fincher arbeitet zurzeit an einer Verfilmung der Entstehungsgeschichte von Facebook. Das<br />
Drehbuch basiert auf einem Buch von Ben Mezrich mit dem Titel The Accidental Billionaires: The Founding of<br />
Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. Am 7. Oktober 2010 startet der Film unter dem Namen<br />
The <strong>Social</strong> Network in Deutschland. Im Film spielen u. a. Justin Timberlake, Brenda Song und Andrew Garfield<br />
mit. [78]<br />
• Am 31. Mai 2010 wurde der erste „Quit Facebook Day“ veranstaltet. [79]
Facebook 45<br />
Literatur<br />
• The Economist (2010): A world of connections. A special report on social networking. Erschienen am 30. <strong>Jan</strong>uar<br />
2010. URL (kostenpflichtig): http:/ / www. economist. com/ specialreports/ displayStory. cfm?story_id=9032088<br />
• Wolfgang Hünnekens: Die Ich-Sender: Das <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Prinzip – TWITTER, FACEBOOK & COMMUNITYS<br />
ERFOLGREICH EINSETZEN, BusinessVillage, Göttingen 2010, ISBN 978-3-86980-005-9<br />
• Felix Holzapfel, Klaus Holzapfel: facebook - marketing unter freunden Dialog statt plumpe Werbung,<br />
BusinessVillage, Göttingen 2010, ISBN 978-3-86980-053-0<br />
• Ben Mezrich: The Accidental Billionaires - The Founding of Facebook - A Tale of Sex, Money, Genius and<br />
Betrayal, Doubleday, New York 2009 ISBN 978-0-385-52937-2<br />
• Clara Shih: The Facebook Era: Tapping Online <strong>Social</strong> Networks to Market, Sell, and Innovate, Prentice Hall,<br />
New Jersey, Auflage: 0002 (29. Juli 2010), ISBN 978-0-137-08512-5<br />
Weblinks<br />
• www.facebook.com – Offizielle Website von Facebook [80]<br />
• Felix Knoke: Spähwerbung empört Facebook-Nutzer [81] . In: Spiegel Online vom 23. November 2007.<br />
• With friends like these… – The ugly truth about the founders of Facebook [82] In The Guardian vom 14. <strong>Jan</strong>uar<br />
2008.<br />
• Adam Soboczynski: "Wer schweigt, zählt nicht: Soziale Netzwerke wie Facebook erzeugen einen neuen<br />
Menschentypus. Ein Kommentar [83] ". In: DIE ZEIT 44/2009 v. 23. Oktober 2009, Seite 47 8Feuilleton).<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. facebook. com<br />
[2] Russische Firma erhöht Anteil an Facebook (http:/ / www. wallstreet-online. de/ nachrichten/ nachricht/ 2867336. html). wallstreet online,<br />
17.12.2009, abgerufen am 18. Dezember 2009.<br />
[3] Facebook Infografik – 500 Millionen Nutzer & Facebook Nutzung in Deutschland (http:/ / facebookmarketing. de/ zahlen_fakten/<br />
infografik-500-millionen-nutzer). facebookmarketing.de. Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[4] Facebook around the world. (http:/ / blog. facebook. com/ blog. php?post=10056937130). Facebook. Abgerufen am 13. Februar 2008.<br />
[5] Facebook Platform Launches (http:/ / developers. facebook. com/ news. php?blog=1& story=21). facebook developers (27. Mai 2007).<br />
Abgerufen am 20. Juni 2009.<br />
[6] New Ways to Find and Engage With Your Favorite Applications (http:/ / blog. facebook. com/ blog. php?topic_id=222173789127). facebook.<br />
Abgerufen am 10. Februar 2010.<br />
[7] Facebook's FarmVille Seite (http:/ / www. facebook. com/ apps/ application. php?id=102452128776). Facebook (25. <strong>Jan</strong>uar 2010).<br />
Abgerufen am 25. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[8] Die Ära der Facebook-Applikationen ist vorbei (http:/ / netzwertig. com/ 2008/ 12/ 14/ die-aera-der-facebook-applikationen-ist-vorbei/ ).<br />
Netzwertig.com (14. Dezember 2008). Abgerufen am 20. Juni 2009.<br />
[9] Facebook cracks down on developer spam (http:/ / www. washingtonpost. com/ wp-dyn/ content/ article/ 2007/ 08/ 29/<br />
AR2007082900041_pf. html). Washington Post (29. August 2007). Abgerufen am 20. Juni 2009.<br />
Brad Stone (24. Juli 2008). New Tool From Facebook Extends Its Web Presence (http:/ / www. nytimes. com/ 2008/ 07/ 24/ technology/<br />
24facebook. html?partner=rssnyt). New York Times. Abgerufen am 20. Juni 2009.<br />
[10] Facebook Across The Web (http:/ / blog. facebook. com/ blog. php?post=41735647130). Abgerufen am 7. Februar 2010.<br />
[11] 60 Million People A Month Use Facebook Connect (http:/ / www. techcrunch. com/ 2009/ 12/ 09/<br />
60-million-people-a-month-use-facebook-connect/ ). TechCrunch (9. Dezember 2009). Abgerufen am 6. Februar 2010.<br />
[12] Bild.de vernetzt sich mit Facebook (http:/ / meedia. de/ nc/ details/ article/ bildde-vernetzt-sich-mit-facebook_100019528. html). Abgerufen<br />
am 7. Februar 2010.<br />
[13] After f8 - Resources for Building the Personalized Web (http:/ / developers. facebook. com/ blog/ post/ 379). Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[14] After f8 - Resources for Building the Personalized Web (http:/ / developers. facebook. com/ blog/ post/ 379). Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[15] <strong>Social</strong> plugins (http:/ / developers. facebook. com/ plugins). Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[16] Facebook <strong>Social</strong> Plugins: Like Button, Recommendations, Activity Feed, Like Box usw. – Die neuen und alten Plugins im Überblick (http:/ /<br />
facebookmarketing. de/ connect/<br />
facebook-social-plugins-like-button-recommendations-activity-feed-like-box-usw-die-neuen-und-alten-plugins-im-uberblick). Abgerufen am<br />
22. Juli 2010.
Facebook 46<br />
[17] After f8: Personalized <strong>Social</strong> Plugins Now on 100,000+ Sites (http:/ / developers. facebook. com/ blog/ post/ 382). Abgerufen am 22. Juli<br />
2010.<br />
[18] Facebook Infografik – 500 Millionen Nutzer & Facebook Nutzung in Deutschland (http:/ / facebookmarketing. de/ zahlen_fakten/<br />
infografik-500-millionen-nutzer). Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[19] More Facebook Mobile Products (http:/ / www. facebook. com/ mobile/ ). Abgerufen am 24. Oktober 2009.<br />
[20] developers.facebook.com/opensource.php (http:/ / developers. facebook. com/ opensource. php)<br />
[21] Facebook Infografik – 500 Millionen Nutzer & Facebook Nutzung in Deutschland (http:/ / facebookmarketing. de/ zahlen_fakten/<br />
infografik-500-millionen-nutzer). facebookmarketing.de. Abgerufen am 22. Juli 2010.<br />
[22] Facebook, at 400 million users, marks its 6th year (http:/ / www. sfgate. com/ cgi-bin/ article. cgi?f=/ c/ a/ 2010/ 02/ 05/ BUTL1BTB2B.<br />
DTL). San Francisco Chronicle. Abgerufen am 6. Februar 2010.<br />
[23] Statistics (http:/ / www. facebook. com/ press/ info. php?statistics). Facebook. Abgerufen am März 2010.<br />
[24] Facebook: 35 Länder und 4 Wirtschafträume (EU27, EU15, G8 und EFTA) im Vergleich (Update 31. Juli 2010) (http:/ / www.<br />
socialmediaschweiz. ch/ html/ studien. html/ ). <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Schweiz. Abgerufen am 8. August 2010.<br />
[25] Facebook: 35 Länder und 4 Wirtschafträume (EU27, EU15, G8 und EFTA) im Vergleich (Update 31. Juli 2010) (http:/ / www.<br />
socialmediaschweiz. ch/ html/ studien. html/ ). <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Schweiz. Abgerufen am 8. August 2010.<br />
[26] Facebook - Die Schweiz in Zahlen (http:/ / www. socialmediaschweiz. ch/ html/ studien. html) (31. August 2010).]. <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Schweiz.<br />
Abgerufen am 8. September 2010.<br />
[27] Facebook: 35 Länder und 4 Wirtschafträume (EU27, EU15, G8 und EFTA) im Vergleich (Update 31. Juli 2010) (http:/ / www.<br />
socialmediaschweiz. ch/ html/ studien. html/ ). <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Schweiz. Abgerufen am 8. August 2010.<br />
[28] Facebook: 35 Länder und 4 Wirtschaftsräume im Vergleich (Update 31. August 2010). (http:/ / www. socialmediaschweiz. ch/ html/ studien.<br />
html). <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Schweiz. Abgerufen am 8. September 2010.<br />
[29] Linnarz, Paul: „Wie es euch gefällt – Nach den USA erliegen auch asiatische Politiker dem Charme von Facebook und Twitter“.<br />
KAS-Auslandsinformationen 6/2010, S. 9–17. (http:/ / www. kas. de/ wf/ de/ 33. 19700/ )<br />
[30] Rich Miller: Facebook Now Has 30,000 Servers (http:/ / www. datacenterknowledge. com/ archives/ 2009/ 10/ 13/<br />
facebook-now-has-30000-servers/ ). Data Center Knowledge, 13. Oktober 2009, abgerufen am 15. Oktober 2009 (Englisch).<br />
[31] Zahlen zu Facebook (Juni 2010). (http:/ / www. thomashutter. com/ index. php/ 2010/ 06/ facebook-aktuelle-zahlen-im-hintergrund/ ).<br />
thomashutter.com. Abgerufen am 8. Juli 2010.<br />
[32] Facebook: 35 Länder und 4 Wirtschaftsräume (EU27, EU15, EFTA und G8) im Vergleich (Update 31. August 2010) (http:/ / www.<br />
socialmediaschweiz. ch/ html/ studien. html). socialmediaschweiz.ch. Abgerufen am 8. September 2010.<br />
[33] Eric Eldon (March 2, 2010). Facebook Revenues Up to $700 Million in 2009, On Track Towards $1.1 Billion in 2010 (http:/ / www.<br />
insidefacebook. com/ 2010/ 03/ 02/ facebook-made-up-to-700-million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/ ). Inside Facebook.<br />
Abgerufen am 2. Juni 2010. welt.de vom 18. Juni 2010 (http:/ / generationengerechtigkeit. de/ index. php?option=com_content& task=view&<br />
id=101& Itemid=143)<br />
[34] Katrina Chan (February 14, 2008). How Much Is Facebook Really Worth? (http:/ / www. fool. com/ investing/ high-growth/ 2008/ 02/ 14/<br />
how-much-is-facebook-really-worth. aspx). Motley Fool. Abgerufen am 8. Juni 2009.<br />
[35] Erick Schonfeld (May 26, 2009). Facebook Takes That $200 Million Investment From The Russians At A $10 Billion Valuation (http:/ /<br />
www. techcrunch. com/ 2009/ 05/ 26/ facebook-takes-that-200-million-investment-from-the-russians-at-a-10-billion-valuation). TechCrunch.<br />
Abgerufen am 8. Juni 2009.<br />
[36] FAZ.net: (http:/ / faz-community. faz. net/ blogs/ netzkonom/ archive/ 2008/ 10/ 08/ mark-zuckerberg. aspx) „Facebook CEO Mark<br />
Zuckerberg: Our focus is growth, not revenue“ (Artikel vom 8. Oktober 2008)<br />
[37] Eric Eldon (March 2, 2010). Facebook Revenues Up to $700 Million in 2009, On Track Towards $1.1 Billion in 2010 (http:/ / www.<br />
insidefacebook. com/ 2010/ 03/ 02/ facebook-made-up-to-700-million-in-2009-on-track-towards-1-1-billion-in-2010/ ). Inside Facebook.<br />
Abgerufen am 2. Juni 2010.<br />
[38] Techcrunch: „Facebook May Be Growing Too Fast“ (http:/ / www. techcrunch. com/ 2008/ 10/ 31/ facebooks-growing-problem/ ) (Artikel<br />
vom 31. Oktober 2008)<br />
[39] Crunchbase (http:/ / www. crunchbase. com/ company/ facebook)<br />
[40] Facebook-Fakten (http:/ / www. facebook. com/ press/ info. php?factsheet). Abgerufen am <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[41] Facebook Receives Investment From Digital Sky Technologies (http:/ / www. facebook. com/ press/ releases. php?p=103711). Abgerufen am<br />
9. Februar 2010.<br />
[42] Zeitung: DST erhöht erneut Anteil an Facebook (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Zeitung-DST-erhoeht-erneut-Anteil-an-Facebook-889327. html). Abgerufen am 9. Februar 2010.<br />
[43] Neue Aktienstruktur: Facebook fädelt Börsengang ein (http:/ / www. spiegel. de/ wirtschaft/ unternehmen/ 0,1518,663375,00. html).<br />
Abgerufen am 9. Februar 2010.<br />
[44] Die Nicht-Nachrichten vom DLD (http:/ / meedia. de/ nc/ details-topstory/ article/ die-nicht-nachrichten-vom-dld_100025851. html).<br />
Abgerufen am 9. Februar 2010.<br />
[45] snopes.com: Facebook Charge (http:/ / www. snopes. com/ computer/ internet/ fbcharge. asp). 31. Dezember 2009<br />
[46] „Microsoft kauft sich bei <strong>Social</strong>-Networking-Site Facebook ein“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 97934) auf heise online<br />
[47] New York Times: „What is Facebook Worth? (Part 37)“ (http:/ / bits. blogs. nytimes. com/ 2008/ 07/ 03/ what-is-facebook-worth-part-37/ )<br />
(Artikel vom 3. Juli 2008)
Facebook 47<br />
[48] New York Times: Russians Spend Big for a Piece of Facebook (http:/ / www. nytimes. com/ 2009/ 05/ 27/ technology/ internet/ 27facebook.<br />
html?_r=1& ref=technology) (Artikel vom 26. Mai 2009)<br />
[49] The Sydney Morning Herald: Banned for keeps on Facebook for odd name (http:/ / www. smh. com. au/ news/ technology/ biztech/<br />
banned-for-keeps-on-facebook-for-odd-name/ 2008/ 09/ 25/ 1222217399252. html)<br />
[50] Spähwerbung empört Facebook-Nutzer (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,druck-519295,00. html), in spiegel online vom 23.<br />
November 2007<br />
[51] Tom Hodgkinson: With friends like these ... (http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2008/ jan/ 14/ facebook). Guardian, 14. <strong>Jan</strong>uar<br />
2008, abgerufen am 3. Mai 2010 (Englisch).<br />
[52] Änderung der TOS (http:/ / consumerist. com/ 5150175/<br />
facebooks-new-terms-of-service-we-can-do-anything-we-want-with-your-content-forever)<br />
[53] Update on terms: http:/ / blog. facebook. com/ blog. php?post=54746167130. 17. Februar 2009. Abgerufen am 18. Februar 2007.<br />
[54] Heise.de: Facebook will basisdemokratisch werden (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Facebook-will-basisdemokratisch-werden--/<br />
meldung/ 133646) (Artikel vom 27. Februar 2009)<br />
[55] Der Standard: Facebook gibt sich trotz missglückter Abstimmung neue Regeln (http:/ / derstandard. at/ ?url=/ ?id=1240549828177) (Artikel<br />
vom 25. April 2009)<br />
[56] http:/ / www. facebook. com/ terms. php?ref=pf<br />
[57] heute.de: Facebook sammelt Kontaktdaten von Nicht-Mitgliedern (http:/ / www. heute. de/ ZDFheute/ inhalt/ 21/ 0,3672,8037973,00. html)<br />
(Artikel vom 20. Februar 2010)<br />
[58] Rechtsfreund.at: Foto bei Facebook - Einwilligung für Personensuchmaschine (http:/ / www. rechtsfreund. at/ news/ index. php?/ archives/<br />
485-Foto-bei-Facebook-Einwilligung-fuer-Personensuchmaschine-123people. html) (Artikel vom 13. August 2010)<br />
[59] tagesschau.de: Bericht eines iranischen Bloggers - „Markiere die Gesichter deiner Freunde!“ (http:/ / www. tagesschau. de/ ausland/ iran638.<br />
html)<br />
[60] http:/ / www. tagesanzeiger. ch/ digital/ internet/ Stalin-20-Auf-Facebook-leben-Nazis-und-Kommunisten-weiter/ story/ 26174046<br />
[61] N., N.. Wegen rechtsextremer Einträge - Telekom stoppt Facebook (http:/ / www. sueddeutsche. de/ computer/ 812/ 465403/ text/ ).<br />
Abgerufen am 10. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[62] http:/ / www. tagesanzeiger. ch/ digital/ internet/ Facebook-droht-Anzeige-wegen-NaziProfilen/ story/ 19565267<br />
[63] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Telekom-stoppt-wegen-Neonazi-Profilen-Werbung-auf-Facebook--/ meldung/ 136346<br />
[64] http:/ / www. n-tv. de/ technik/ internet/ Neonazis-nutzen-Facebook-article80847. html<br />
[65] Facebook verklagt StudiVZ (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,566904,00. html) – Spiegel Online<br />
[66] Facebook scheitert mit Klage gegen StudiVZ (http:/ / www. tagesschau. de/ wirtschaft/ facebookstudivz100. html) - tagesschau.de<br />
[67] Zeit Online, 10. September 2009: Facebook und StudiVZ legen Rechtsstreit bei (http:/ / www. zeit. de/ digital/ internet/ 2009-09/<br />
soziale-netwerke-facebook-studivz-einigung) Abgerufen am 16. September 2009.<br />
[68] Timothy J. McGinn (13. September, 2004). Lawsuit Threatens To Close Facebook (http:/ / bits. blogs. nytimes. com/ 2008/ 06/ 26/<br />
judge-ends-facebooks-feud-with-connectu/ index. html). Harvard Crimson. Abgerufen am 8. März 2008.<br />
[69] Brad Stone (28. Juni 2008). Judge Ends Facebook’s Feud With ConnectU (http:/ / web. archive. org/ web/ 20070815192011/ http:/ / www.<br />
thecrimson. com/ article. aspx?ref=513007). New York Times. Abgerufen am 23. März 2008.<br />
[70] Zusha Elinson (10. Februar 2009). Quinn Spills Value of Facebook Deal (http:/ / www. law. com/ jsp/ ca/ PubArticleCA.<br />
jsp?id=1202428139731& slreturn=1& hbxlogin=1). The Recorder. Abgerufen am 10. Februar 2009.<br />
[71] Amy Fallon (25. Juli 2008). Libel: Ex-friend's Facebook revenge costs £22,000 in damages at high court (http:/ / www. guardian. co. uk/ uk/<br />
2008/ jul/ 25/ law. facebook). The Guardian. Abgerufen am 3. August 2009.<br />
[72] „Facebook gründet Sicherheitsbeirat“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ Facebook-gruendet-Sicherheitsbeirat-878471. html) auf<br />
heise online<br />
[73] „Facebook verschreibt sich besserem Jugendschutz“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Facebook-verschreibt-sich-besserem-Jugendschutz-206824. html) auf heise online<br />
[74] „Facebook verändert Kontrolle über Privatsphäre“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Facebook-veraendert-Kontrolle-ueber-Privatsphaere-881817. html) auf heise online<br />
[75] http:/ / www. 20min. ch/ news/ schweiz/ story/ 20139035<br />
[76] http:/ / www. 20min. ch/ digital/ webpage/ story/ 10992690<br />
[77] telegraph.co.uk, 22. März 2010: Schoolgirl sacked from cafe job on Facebook (http:/ / www. telegraph. co. uk/ technology/ facebook/<br />
7496740/ Schoolgirl-sacked-from-cafe-job-on-Facebook. html) abgerufen am 25. März 2010<br />
[78] http:/ / www. moviepilot. de/ movies/ the-social-network<br />
[79] Quit Facebook Day (http:/ / www. quitfacebookday. com/ ), offizielle Website der Aktion. 26000 wollen Facebook verlassen (http:/ / www.<br />
focus. de/ digital/ internet/ quit-facebook-day-26000-wollen-facebook-verlassen_aid_514128. html), Focus, 31. Mai 2010.<br />
[80] http:/ / www. facebook. com/<br />
[81] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,519295,00. html<br />
[82] http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2008/ jan/ 14/ facebook<br />
[83] http:/ / www. zeit. de/ 2009/ 44/ Gesellschaft-Soziale-Netzwerke?page=all
Blog 48<br />
Blog<br />
Ein Blog [blɔg] oder auch Web-Log [ˈwɛb.lɔg], engl. [ˈwɛblɒg], Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log<br />
für Logbuch, ist ein auf einer Website geführtes und damit – meist öffentlich – einsehbares Tagebuch oder Journal,<br />
in dem mindestens eine Person, der Web-Logger, kurz Blogger, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte protokolliert<br />
oder Gedanken niederschreibt.<br />
Häufig ist ein Blog „endlos“, d. h. eine lange, abwärts chronologisch sortierte Liste von Einträgen, die in bestimmten<br />
Abständen umgebrochen wird. Der Herausgeber oder Blogger steht, anders als etwa bei Netzzeitungen, als<br />
wesentlicher Autor über dem Inhalt, und häufig sind die Beiträge aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das Blog<br />
bildet ein für Autor und Leser einfach zu handhabendes Medium zur Darstellung von Aspekten des eigenen Lebens<br />
und von Meinungen zu spezifischen Themen. Meist sind aber auch Kommentare oder Diskussionen der Leser über<br />
einen Artikel zulässig. Damit kann das Medium sowohl dem Ablegen von Notizen in einem Zettelkasten, dem<br />
Austausch von Informationen, Gedanken und Erfahrungen als auch der Kommunikation dienen. Insofern ähnelt es<br />
einem Internetforum, je nach Inhalt aber auch einer Internet-Zeitung.<br />
Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als bloggen bezeichnet. Die Deutsche Nationalbibliothek<br />
bezeichnet Blogs als Internetpublikationen. An Weblogs werden jedoch, mit Beschluss von 2002, keine ISSN<br />
Nummern vergeben. [1] Die Begriffe „Blog“, „Blogger“, „Bloggerin“ und „bloggen“ haben in den allgemeinen<br />
Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind in Duden und Wahrig eingetragen. Die sächliche Form (‚das Blog‘) wird<br />
dort als Hauptvariante und die maskuline Form (‚der Blog‘) als zulässige Nebenvariante genannt.<br />
Speziell in Österreich verwendet man meist die maskuline Form (‚der Blog‘). [2]<br />
Geschichte<br />
Die ersten Weblogs tauchten Mitte der 1990er Jahre auf. Sie wurden Online-Tagebücher genannt und waren<br />
Webseiten, auf denen Internetnutzer periodisch Einträge über ihr eigenes Leben machten. Die ersten<br />
deutschsprachigen Weblogs waren Robert Brauns Weblog, Moving Target und die Cybertagebücher, die später dann<br />
von Aktion Sorgenkind übernommen wurden. [3] Über das CL-Netz wurde das Zagreb Diary des niederländischen<br />
Journalisten Wam Kat verbreitet. [4]<br />
Ab 1996 wurden Dienste wie Xanga eingerichtet, die Internetnutzern auf einfache Weise das Einrichten eines<br />
eigenen Weblogs ermöglichten. 1997 wurde eines der ersten Blogs gestartet, das bis heute existiert, namens<br />
Scripting News von Dave Winer. Ein weiteres frühes Blog war Robot Wisdom von Jorn Barger, welches als erstes<br />
mit dem Begriff 'Weblog' [5] bezeichnet wurde. Nach einem langsamen Start wiesen solche Seiten ab Ende der 1990er<br />
Jahre ein schnelles Wachstum auf. So wuchs Xanga von 100 Blogs im Jahr 1997 auf 20 Millionen im Jahr 2005. Seit<br />
einigen Jahren wird das „Bloggen“ auch geschäftlich in sogenannten Corporate Blogs oder Unternehmensblogs<br />
genutzt. So betreiben viele Medien inzwischen eigene Blogs, um ihren Leserkreis zu erweitern und Feedback von<br />
ihren Lesern zu bekommen. Der US-amerikanische Wörterbuchverlag Merriam-Webster wählte die Kurzform „Blog“<br />
sogar zum Wort des Jahres 2004.<br />
In Deutschland betreiben laut der Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 8,4 % der Internetnutzer ein<br />
eigenes Blog [6] . Weltweit soll es (Stand: Anfang 2010) insgesamt etwa 200 Millionen Blogs geben [7] .
Blog 49<br />
Begriffsherkunft<br />
Der Begriff Weblog tauchte 1997 erstmals auf der Website von Jorn Barger auf, 1999 wurde die Abkürzung „Blog“<br />
vom Webdesigner Peter Merholz geprägt – in dem Jahr, in dem allgemein der Aufstieg dieser Art von Webseiten<br />
begann. Nach 2001 wurden auch die traditionellen Massenmedien auf die neue Darstellungsform aufmerksam. Erste<br />
Forschungsarbeiten aus der Journalistik über das Phänomen erschienen, und immer mehr Privatnutzer begannen, sich<br />
ein eigenes Weblog einzurichten. [8] Gleichzeitig etablierten sich einige Blogs als angesehene Medien.<br />
Technische Merkmale von Weblogs<br />
Grundsätzlich lässt sich die Menge der Weblogs in zwei Kategorien unterteilen, nämlich in<br />
• solche, die ähnlich dem Software-as-a-Service-Prinzip von einem meist kommerziellen Anbieter betrieben und<br />
beliebigen Nutzern nach einfacher Registrierung zur Verfügung gestellt werden und<br />
• solche die von den jeweiligen Inhabern auf ihrem individuellen Server oder Webspace meist unter eigener<br />
Domain betrieben werden.<br />
Bekannte Anbieter für Blog-Communitys' sind Googles Blogger.com, WordPress.com und antville.org; daneben<br />
bieten auch einige soziale Netzwerke wie MySpace ihren Mitgliedern Blog-Funktionalitäten an.<br />
Für den Betrieb eines individuellen Weblogs auf eigenem Webspace benötigt man eine entsprechende<br />
Weblog-Software und zumindest rudimentäre Kenntnisse in HTML und der jeweils verwendeten Servertechnologie.<br />
Da sich individuelle Weblogs sehr flexibel an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen, werden diese oft auch als<br />
reine Content-Management-Systeme eingesetzt, was sie rein technisch gesehen auch sind. Unter Umständen kann<br />
eine solche Konfiguration dazu führen, dass die entsprechende Webseite überhaupt nicht als Blog wahrgenommen<br />
wird.<br />
Während viele Blogs in den Blogcommunitys naturgemäß sehr stark auf den sozialen und kommunikativen Aspekt<br />
abzielen, finden sich unter den individuell gehosteten Blogs auch viele, die der publizistischen Meinungsäußerung<br />
oder dem Bereich der Kundenkommunikation zuzuordnen sind und dementsprechend unter die Regelungen des<br />
Telemediengesetzes (unter anderem die Impressumspflicht – siehe unten) fallen.<br />
Kommunikationswissenschaftliche Merkmale von Weblogs<br />
Charakteristische Merkmale dieser Kommunikationsform sind die Individualisierung der Kommunikation, die<br />
Reflexivität hinsichtlich der Medienkommunikation, die Verlinkung und Vernetzung der Webkommunikation bis hin<br />
zur Blogosphäre, die Filterung und Selektion der Medienkommunikation durch die Blogger als eine Art neue<br />
Gatekeeper, die Interaktivität aller Beteiligten, die Aufhebung der Grenze zwischen Rezipient und Produzent und<br />
damit auch zwischen Profis und Laien (was allerdings nicht das Bloggen durch "Kommunikationsprofis" wie<br />
Journalisten ausschließt). [9]<br />
Merkmale der Blogger<br />
Eine Reihe von Studien untersuchen die Autoren von Weblogs, beispielsweise in Hinblick auf soziodemografische<br />
Merkmale oder Nutzungsmotive. Problematisch ist dabei, dass viele dieser Untersuchungen nicht beanspruchen<br />
können, für die Blogosphäre weltweit oder in einem Sprachraum repräsentativ zu sein, weil keine Informationen<br />
über die Grundgesamtheit vorliegen. Eine vergleichende Gegenüberstellung von 29 Studien (deutsch- und<br />
englischsprachige Blogger) haben Neuberger/Nuernbergk/Rischke [10] im Frühjahr 2007 veröffentlicht.<br />
Eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchungen ist, dass die Mehrzahl der Blogger persönliche Erfahrungen und<br />
Erlebnisse veröffentlicht, das Weblog also als eine Variante des Online-Journals verwendet.<br />
• Eine Studie des Singapore Internet Research Centre unter etwa 1.200 englischsprachigen Bloggern (Koh et al.<br />
2005, S. 2ff) teilte die Blogs in zwei Kategorien ein: 73 Prozent der Befragten führten ein sogenanntes personal
Blog 50<br />
Blog, 27 Prozent ein non-personal Blog. Die Blogger der zweiten Gruppe schreiben vor allem, um „zu<br />
kommentieren“ und „Informationen zu liefern“. Ihr Ziel ist zudem, ein möglichst großes Publikum zu erreichen.<br />
Auch soziodemografisch unterscheiden sich die beiden Gruppen: Non-personal-Blogger sind zum Großteil<br />
Männer, die eine höhere formale Bildung als Personal-Blogger haben. Außerdem haben sie im Schnitt mehr<br />
Leser, aktualisieren ihr Blog häufiger und verbringen mehr Zeit damit.<br />
• Ähnliche Ergebnisse erbrachte im Jahr 2005 eine Umfrage unter mehr als 4.000 deutschsprachigen Bloggern. 71<br />
Prozent der befragten Blogger gaben an, „zum Spaß“ zu schreiben; 62 Prozent wollen in ihrem Blog „eigene Ideen<br />
und Erlebnisse für sich selbst festhalten“. Demgegenüber bloggen 33 Prozent, weil sie ihr „Wissen in einem<br />
Themengebiet anderen zugänglich machen wollen“, und 13 Prozent „aus beruflichen Gründen“ (Schmidt 2006,<br />
S. 43).<br />
Technik<br />
Software<br />
Charakteristisch für Weblog-Publishing-Systeme ist, dass es mit ihnen sehr einfach ist, Webseiten zu publizieren. Es<br />
sind Content-Management-Systeme, die das Anlegen neuer Inhalte sowie die Veränderung und Kommentierung<br />
auch für ungeübte Nutzer ermöglichen, dabei jedoch wenig Variationen im Webdesign zulassen. Die gestalterische<br />
Anpassung erfolgt meist einmalig bei der Installation durch die Auswahl einer von mehreren verfügbaren<br />
Design-Schablonen (Templates). Bei vielen Blogsystemen (zum Beispiel WordPress) lässt sich das Aussehen durch<br />
Wechsel des Templates (oder gar Einspielen eigener Templates) auch im Nachhinein ändern.<br />
Weblog-Software kann auf eigenem Webspace installiert oder als ASP-Dienst bei kostenlosen oder kostenpflichtigen<br />
Anbietern genutzt werden. Zu den bekanntesten Blog-Softwaresystemen gehören Serendipity, WordPress, Movable<br />
Type und Textpattern, die meist auf PHP basieren. Mietangebote (Application Service Provider) im<br />
deutschsprachigen Raum sind zum Beispiel Livejournal, Twoday.net, Blog.de oder Blogger.de.<br />
Die veröffentlichten Beiträge und Kommentare sind meist auch per RSS-Newsfeed lesbar. Dafür erscheint in<br />
modernen Browsern ein Icon (meist in der Adressleiste) oder es wird ein Hyperlink bereitgestellt, der mit dem zu<br />
abonnierenden Datenstrom verbunden ist.<br />
Elemente<br />
Einträge / Posts<br />
Die Einträge, auch Postings oder Posts genannt, sind die Artikel, welche die Hauptbestandteile eines Weblogs<br />
darstellen. Sie werden üblicherweise umgekehrt chronologisch aufgelistet, die neuesten Beiträge findet man also<br />
zuoberst im Weblog. Ältere Beiträge werden zum Teil auf weiteren Seiten angezeigt oder in Archiven aufgelistet.<br />
Thread<br />
Als Thread wird hier die Gesamtheit der aufeinander folgenden Beiträge zu einem bestimmten Thema innerhalb<br />
eines Blogs bezeichnet.
Blog 51<br />
Permalinks<br />
Jeder Eintrag, bei manchen Weblog-Systemen auch jeder Kommentar, besitzt eine eindeutige und sich nicht<br />
verändernde, permanente Webadresse (URL). So können andere Nutzer oder andere Blogs direkt einzelne Texte<br />
anstatt des gesamten Weblogs verlinken. Diese permanenten Links ("Permalinks") werden z. B. genutzt, wenn man<br />
einen einzelnen Artikel aus einem RSS-Feed heraus aufruft.<br />
Kommentare<br />
Bei vielen Weblogs ist es möglich, eine eigene Meinung zu einem Eintrag zu veröffentlichen. Ein solcher<br />
Kommentar wird dann auf der gleichen Seite wie der Eintrag selbst oder als Popup angezeigt. Bei vielen Weblogs<br />
kann man jedoch festlegen, ob der Kommentar sofort angezeigt wird oder moderiert, also vom Inhaber geprüft und<br />
dann freigeschaltet werden muss. Dies wird häufig angewandt, um Vandalismus und Spam in den Blogs zu<br />
verhindern.<br />
Trackback und Pingback<br />
Wenn der Blogger A auf einen Beitrag von Blogger B verlinkt, wird dies über die Trackback-Funktion automatisch<br />
auf der verlinkten Seite angezeigt, ähnlich wie ein Kommentar. So weiß der verlinkte Blogger B oder einer seiner<br />
Leser, dass ein anderer Blogger auf diesen Beitrag verwiesen hat. Nicht jede Weblog-Software unterstützt diese<br />
Funktion.<br />
Siehe auch: Trackback, Pingback.<br />
Feed<br />
Ein Feed enthält die Inhalte eines Weblogs in vereinheitlichter Form. Ein Feed kann mittels Feedreader von einem<br />
interessierten Leser abonniert werden. Mit dem Feedreader kann der Leser mehrere Blogs auf einen Blick<br />
überschauen und erkennen, in welchem abonnierten Weblog es neue Beiträge gibt. Diese Beiträge können auch im<br />
Feedreader gelesen werden. Es gibt mehrere technische Formate für Feeds, die gängigsten sind RSS und Atom.<br />
Blogroll<br />
Eine Blogroll (deutschsprachig auch "Blogrolle") ist eine öffentliche Linksammlung zu anderen Weblogs, die meist<br />
gut sichtbar auf der Startseite und allen Unterseiten platziert ist. Autoren von Weblogs haben unterschiedliche<br />
Kriterien für die Aufnahme eines fremden Weblogs in ihre Blogroll. Diese reichen von ähnlichen Interessen über die<br />
Frequenz neuer Artikel oder Kommentare und geografischen Kriterien bis zu Linktausch. Manche Blogrolls<br />
bestehen einfach aus einer Liste von Blogs, die der Autor selbst liest.<br />
Asides<br />
Asides (auch Clippings oder Snippets) sind kleinere Einträge, die häufig nur aus wenigen Wörtern oder Zeilen<br />
bestehen und dazu verwendet werden, um mit einer kurzen Erklärung auf interessante Themen auf anderen Seiten<br />
oder Weblogs zu verweisen.<br />
Blog-Aktionen<br />
Auf Blogs werden diverse Aktionen durchgeführt, die unter anderem dem Informationsaustausch dienen. Auch der<br />
Bekanntheitsgrad eines Blogs hängt von solchen Aktionen ab. Bekannte Blog-Aktionen sind koordiniert, etwa<br />
Blogtouren.
Blog 52<br />
Schlagwortwolken<br />
Schlagwortwolken (Tag Clouds) listen und gewichten die im Blog verwendeten Schlagwörter auf visuell<br />
eindringliche Weise. Sie helfen zum Beispiel beim Indizieren.<br />
Auswirkungen<br />
Politik<br />
Viele Menschenrechtler, insbesondere in Ländern wie Iran oder China, benutzen Blogs, um ohne jegliche<br />
Zensurmaßnahmen der Regierungen Berichte über Menschenrechtsverletzungen, Zensur und aktuelle politische und<br />
soziale Lage etc. zu veröffentlichen. So bloggten viele Journalisten während der gewaltsamen Proteste zu den<br />
Präsidentenwahlen im Iran 2009 ihre Berichte für ausländische Medien. Diese Blogs waren eine wichtige<br />
Nachrichtenquelle westlicher Medien. [11]<br />
Einige vielgelesene Blogger haben in ihren Heimatländern Kultstatus und können sich aufgrund dieser Prominenz<br />
Meinungsäußerungen erlauben, die unbekannte Blogger ins Gefängnis bringen würden. Auch im Westen bekannt ist<br />
z.B. der chinesische Blogger Han Han. [12] 2009 bloggten schon 150 Millionen Chinesen. [13]<br />
Viele Politiker benutzen heutzutage Blogs und ähnliche Formate als PR-Mittel, beispielsweise Twitter während<br />
Wahlkampfreisen oder -veranstaltungen. Bekanntgeworden sind dabei einige Fälle, in denen Abgeordnete des<br />
deutschen Bundestages während geheimer Abstimmungen Vorab-Ergebnisse an die Öffentlichkeit "twitterten". [14]<br />
[15] [16] [17]<br />
Tendenzen<br />
Manche sehen im Aufkommen von Weblogs und deren starker Verbreitung insbesondere in den USA eine neue<br />
Form von Graswurzel-Journalismus, die in Europa leicht in die Tradition des Herstellens von Gegenöffentlichkeit<br />
gestellt werden kann.<br />
Folgen der immer größer werdenden Verbreitung von Weblogs sind unter anderem:<br />
• Die etablierte Presse übernimmt mittlerweile in Blogs aufgebrachte Themen und erkennt sie teilweise als<br />
Meinungsmacher an. Beispiele sind unter Anderem in Deutschland das Unternehmen Jamba! oder die Kampagne<br />
Du bist Deutschland, die sich auf Blogs heftiger Kritik ausgesetzt sahen.<br />
• Die Popularität der als unabhängig geltenden Blogs versuchen Unternehmen zu nutzen, indem sie Blogger zu<br />
positiven Äußerungen über Produkte animieren. Bestechlichkeit gilt unter Bloggern als einer der schlimmsten<br />
Vorwürfe überhaupt. [18] Deshalb setzen innovative Unternehmen und Organisationen auf den so genannten <strong>Social</strong><br />
<strong>Media</strong> Newsroom, in dem Blogger nach dem Pull-Verfahren auf eigene Initiative mediengerechte Informationen<br />
beziehen können.<br />
• Auf Grund der Natur und Anwendung von Weblogs sind gegebenenfalls Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des<br />
Bloggers möglich. Blogger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass Weblog-Einträge stark verbreitet und<br />
langfristig archiviert werden. Blogger sollten sich daher sehr genau überlegen, was und wie sie formulieren und<br />
den Selbstdatenschutz beachten.<br />
• Weblogs haben mit dem Problem des Blogspams zu kämpfen.
Blog 53<br />
Deutsches Telemediengesetz<br />
In Deutschland fallen Blogs in den Regelungsbereich des Telemediengesetzes (in Kraft seit März 2007). Da nach<br />
dem Gesetzestext auch Weblogs als Telemedien anzusehen sind, sind Weblog-Betreibern damit bestimmte<br />
Kennzeichnungspflichten auferlegt. Dazu zählen unter anderem die Notwendigkeit eines Impressums, sofern es sich<br />
um ein geschäftsmäßiges Weblog handelt.<br />
Kritiker bemängeln die Unschärfe des Gesetzestextes, der nicht explizit die Kriterien nennt, ab wann genau ein<br />
Weblog als geschäftsmäßig gilt. [19]<br />
Blog-Typologie<br />
Nach Inhalt<br />
• Artblogs: Kunst und Kultur<br />
• Audioblog: Podcasts werden gelegentlich so bezeichnet, da diese auch oft in Blogform im Internet vertreten sind<br />
• Blawgs: Blogs von Juristen (meist Rechtsanwälte) über juristische Themen<br />
• Berufsblogs: Blogs von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen, die zumeist Erlebnisse aus ihrem beruflichen<br />
Alltag schildern.<br />
• Blogromane: in Form eines Blogs im Internet publizierte Romantexte<br />
• Edublogs: Erziehung, Lehren, Lernen und Bildung<br />
• Corporate Blogs: offizielle Unternehmensblogs<br />
• Fachblogs: auf ein spezielles Thema ausgerichtete Informationen, Thesen oder Beiträge beruflicher oder<br />
wissenschaftlicher Art (Heteronym zu Fachliteratur oder Fachaufsatz)<br />
• Funblogs: Witze und Humor<br />
• Joblogs: Job und Personalwesen<br />
• Knowledge-Blogs: Weblogs für das unternehmensinterne Wissensmanagement – entweder kollektive Blogs zu<br />
Spezialthemen oder persönliche Weblogs von Spezialisten für bestimmte Themen.<br />
• Krimiblogs: Kriminalromane<br />
• Linkblogs: kommentierte Linksammlungen<br />
• Litblogs: Quellen, Kommentare, Empfehlungen und Interpretationen literarischer Texte<br />
• Metablogs: Sammlungen von Beiträgen anderer Logs und Webseiten<br />
• Mikroblogging: in der Zeichenanzahl begrenzte Blogs, bekanntester Anbieter ist Twitter.<br />
• Moblogs (Mobile Weblogs): ist ein Blog, das von einem mobilen Telekommunikationsgerät, normalerweise<br />
einem Mobiltelefon oder PDA mit Inhalten gefüllt wird.<br />
• Placeblogs: Berichte aus Städten, Stadtteilen, Dörfern und Regionen<br />
• Reise-Blogs: Reise-Berichte<br />
• Schnäppchenblogs: Affiliate Blogs mit aktuellen Angeboten vom Online-Shopping, siehe Affiliate<br />
(Partnerprogramm)<br />
• Tumblelogs: es werden u.a. kurze Texte, Links, Bilder, Kurzvideos und Zitate veröffentlicht, die dem Autor beim<br />
Surfen im Internet aufgefallen sind (siehe Tumblr)<br />
• Videoblog: auch als Vlog bezeichnet, z. B. als Videopodcast<br />
• Wahlblogs: Beiträge zu einzelnen Wahlen und zum Thema allgemein<br />
• Warblogs: von engl. war: Krieg, Berichte aus Kriegs- und Krisengebieten<br />
• Watchblogs: kritische Begleitung einzelner Unternehmen, Organisationen oder Medien<br />
• Wissenschaftsblogs: Forscher über Wissenschaft, Forschungsgelder, Forschungspolitik
Blog 54<br />
Nach Betreiber<br />
• Individuen<br />
• Privatpersonen, die private Interessen kommunizieren, in eigener Sache und ohne institutionellen Auftrag<br />
• Personen, die in institutionellem Auftrag agieren, oft mit sehr engem thematischem Fokus oder einem<br />
speziellen Ziel (Kundenbindung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)<br />
• Körperschaften<br />
• so genannte Corporate Blogs, die von Unternehmen betrieben werden<br />
• Blogs von nicht förmlich organisierten Personengruppen, oftmals Interessengruppen<br />
• Blogs von Verbänden, Vereinen und anderen nicht-kommerziell organisierten Körperschaften [20]<br />
Siehe auch<br />
• A-Blogger<br />
• Netzkultur<br />
• Blook<br />
Literatur<br />
• Christian Eigner, Helmut Leitner, Peter Nausner, Ursula Schneider: Online-Communities, Weblogs und die<br />
soziale Rückeroberung des Netzes. Graz 2003. ISBN 978-3-901402-37-1.<br />
• Alban Nikolai Herbst: Das Weblog als Dichtung [21] . Vortrag 2005. (PDF-Download).<br />
• Arnold Picot, Tim Fischer (Hrsg.): Weblogs professionell. Grundlagen, Konzepte und Praxis im<br />
unternehmerischen Umfeld. 2006. ISBN 3-89864-375-1<br />
• Ansgar Zerfaß, Dietrich Boelter: Die neuen Meinungsmacher. 2005. ISBN 3-901402-45-4<br />
• Ramón Reichert: Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im Web 2.0; Bielefeld: transcript,<br />
Oktober 2008, ISBN 978-3-89942-861-2<br />
• Karin Bruns: Archive erzählen: Weblogs, V-Blogs und Online-Tagebücher als dokumentar-fiktionale Formate. In:<br />
Harro Segeberg (Hg.): Referenzen. Zur Theorie und Geschichte des Realen in den Medien. Marburg: Schüren<br />
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Medienwissenschaft Bd. 16) 2009, ISBN 978-3-89472-673-7, S. 314-333.<br />
• Noogie C. Kaufmann: Weblogs - Rechtliche Analyse einer neuen Kommunikationsform [22] (PDF, 8,5MB, 474 S.),<br />
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2009, ISBN 978-3-8300-4586-1<br />
Weblinks<br />
• Linkkatalog [23] zum Thema Weblog im ODP (Open Directory Project)<br />
• Karin Harrasser, Was aus der Mitte flüchtet: Sind Weblogs Archive des „Schwebenden Urteils“? (2006) [24]<br />
(PDF-Datei; 79 kB)<br />
• Gerald Heidegger, Karl Kraus und die Blogger: Die Rückkehr des Autors im Netz [25] (Telepolis, 6. November<br />
2003 – vgl. Karl Kraus)<br />
• „Digitale Mundpropaganda“ Deutsche Unternehmen entdecken Weblogs. [26] DIE ZEIT, 20. Juli 2006.<br />
• „Weblogs. Jetzt kommen die Wir-Medien“ [27] , Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. <strong>Jan</strong>uar 2006, mit<br />
Artikeldossier über Weblogs<br />
• <strong>Jan</strong> Schmidt, „Wie ich blogge?!“ – eine Online-Befragung [28] (Politik-digital.de, 16. Februar 2006 –<br />
PDF-Download: [29], 409 kB)<br />
• Grundstrukturen der Haftung im Netz am Beispiel von Weblogs von Prof. Dr. Kay-Uwe Martens [30]<br />
• Welche Bedeutung haben Weblogs in Deutschland? Analyse der deutschen Netzgemeinde [31]<br />
• ChaosRadio-Podcast, Folge 87: Die Blogosphäre - Weblogs erzeugen ein Metanetzwerk der Kommunikation auf<br />
dem Internet [32] , Chaos Computer Club, 26.November 2003
Blog 55<br />
Referenzen<br />
[1] Werden ISSN auch für Netzpublikationen vergeben? (http:/ / www. d-nb. de/ wir/ kooperation/ issn_faq. htm#issn_vergeben), vom 6. Februar<br />
2010 bei d-nb.de, abgerufen am 6. Februar 2010<br />
[2] Der Blog oder das Blog? (http:/ / www. neue-rechtschreibung. net/ 2010/ 03/ 06/ der-blog-oder-das-blog/ ), vom 6. März 2010 bei<br />
neue-rechtschreibung.net, abgerufen am 9. März 2010<br />
[3] Zeitstrahl der Entwicklung der deutschsprachigen Weblogs des „Bloghistory-Projekts“ (http:/ / www. metaroll. de/ bloghistory. html)<br />
[4] vgl. Inhalte des CL-Netzes<br />
[5] New <strong>Media</strong> Timeline 1997, von David Shedden, Library Director, Poynter Institute (http:/ / www. poynter. org/ content/ content_view.<br />
asp?id=75929)<br />
[6] Betreiben eines eigenen Web-Blogs (http:/ / de. statista. org/ statistik/ diagramm/ studie/ 22662/ umfrage/<br />
betreiben-eines-eigenen-web-blogs-(online-tagebuch)/ ), Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2007<br />
[7] Medienexperte: Zeitungen werden verschwinden (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Medienexperte-Zeitungen-werden-verschwinden-908468. html), vom 19. <strong>Jan</strong>uar 2010 auf heise-online.de, abgerufen am 19. <strong>Jan</strong>uar 2010<br />
[8] Stieglitz, Stefan: Steuerung Virtueller Communities. Instrumente, Mechanismen, Wirkungszusammenhänge. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2008.<br />
S. 99.<br />
[9] • Bucher, Hans Jürgen/Büffel, Steffen (2005): Vom Gatekeeper-Journalismus zum Netzwerk-Journalismus. Weblogs als Beispiel<br />
journalistischen Wandels unter den Bedingungen globaler Medienkommunikation. In: Behmer, Markus/Blöbaum, Bernd/Scholl,<br />
Armin/Stöber, Rudolf (Hrsg.): Journalismus im Wandel. Analysedimen-sionen, Konzepte, Fallstudien. Wiesbaden: VS Verlag für<br />
Sozialwissenschaften.<br />
[10] Neuberger, Christoph/Christian Nuernbergk/Melanie Rischke: Weblogs und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? In:<br />
<strong>Media</strong>-Perspektiven, 2/2007, S. 96–122. Online: http:/ / www. media-perspektiven. de/ uploads/ tx_mppublications/ 02-2007_Neuberger. pdf<br />
[11] http:/ / www. tagesschau. de/ ausland/ iranlinkliste114. html<br />
[12] [Kölner Stadtanziger vom 1. Mai 2010, Seite "Expo 2010 - 09"]<br />
[13] ksta.de 1. Juni 2009. Interview mit Wolfgang Kleinwächter, Professor am Department for <strong>Media</strong> and Information Sciences der Universität<br />
Aarhus in Dänemark und Direktor des NETCOM Instituts der Medienstadt Leipzig e.V. (http:/ / www. ksta. de/ html/ artikel/ 1243453917705.<br />
shtml)<br />
[14] http:/ / www. tagesschau. de/ wahl/ wahlimweb/ netzrauschen168. html<br />
[15] http:/ / www. tagesschau. de/ multimedia/ video/ sendungsbeitrag8900. html<br />
[16] http:/ / www. derwesten. de/ nachrichten/ politik/ Bundestag-Jeder-zehnte-Abgeordnete-nutzt-Twitter-id320794. html<br />
[17] http:/ / www. pottblog. de/ 2009/ 05/ 28/ twitter-verbot-bei-der-spd-bundestagsfraktion/<br />
[18] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Gratis-Ferraris-fuer-aktive-Blogger--/ meldung/ 83032<br />
[19] Artikel auf tagesschau.de vom 18. <strong>Jan</strong>uar 2007 (http:/ / www. tagesschau. de/ aktuell/ meldungen/<br />
0,1185,OID6310346_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00. html)<br />
[20] Christian Hauschke, Sarah Lohre und Nadine Ullmann: Libworld. Biblioblogs global. In: LIBREAS Nummer 10/11 (3/4 – 2007). S. 3 (http:/<br />
/ opus. bsz-bw. de/ fhhv/ volltexte/ 2008/ 8/ pdf/ 002hau. pdf, abgerufen am 23.03.2008).<br />
[21] http:/ / www. die-dschungel. de/ ANH/ download/ download. php?URL=. . / txt/ pdf/ weblog_dichtung. pdf<br />
[22] http:/ / www. dr-bahr. com/ infos/ veroeffentlichungen/ buecher/ promotion-dr-kaufmann-weblogs-rechtliche-analyse. html<br />
[23] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/ WWW/ Weblogs/<br />
[24] http:/ / www. kakanien. ac. at/ beitr/ emerg/ KHarrasser1. pdf<br />
[25] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 15/ 15906/ 1. html<br />
[26] http:/ / www. zeit. de/ 2006/ 30/ Blogs<br />
[27] http:/ / www. faz. net/ s/ Rub8A25A66CA9514B9892E0074EDE4E5AFA/<br />
Doc~E6BE39C33013C4D42B71AC90AFF08EC51~ATpl~Ecommon~Scontent. html<br />
[28] http:/ / www. politik-digital. de/ edemocracy/ netzkultur/ blogger/ jschmidtBlogger-Studie060214. shtml<br />
[29] http:/ / www. fonk-bamberg. de/ pdf/ fonkbericht0601. pdf<br />
[30] http:/ / www. verwaltungmodern. de/ index. php/ grundstrukturen-der-haftung-im-netz-am-beispiel-sogenannter-weblogs/<br />
[31] http:/ / www. hingesehen. net/ welche-bedeutung-haben-blogs-in-deutschland/<br />
[32] http:/ / chaosradio. ccc. de/ cr87. html
Mikroblogging 56<br />
Mikroblogging<br />
Mikroblogging ist eine Form des Bloggens, bei der die Benutzer kurze, SMS-ähnliche Textnachrichten<br />
veröffentlichen können. Die Länge dieser Nachrichten beträgt meist weniger als 200 Zeichen. Die einzelnen Postings<br />
sind entweder privat oder öffentlich zugänglich und werden wie in einem Blog chronologisch dargestellt. Die<br />
Nachrichten können meist über verschiedene Kanäle wie SMS, E-Mail, Instant Messaging oder das Web erstellt und<br />
abonniert werden.<br />
Formen<br />
Mikrovideoblogging ist eine erweiterte Form des Mikrobloggings mit dem Unterschied, dass der Benutzer die<br />
Möglichkeit hat, kurze Videos (ohne Ton) aufzunehmen und diese dann auf die Webseite zu stellen. Vernetzen lässt<br />
sich das Ganze dann mit Facebook, Twitter und Co., bei denen man die einzelnen Statusmeldungen um die<br />
Videoanwendung erweitern und veröffentlichen kann.<br />
Dienste<br />
Der bekannteste Mikroblogging-Dienst ist Twitter, das im März 2006 startete und 2007 den „South by Southwest<br />
Web Award“ in der Kategorie „Blogs“ gewann. [1] Der größte Konkurrent von Twitter war Jaiku aus Finnland, das am<br />
9. Oktober 2007 von Google übernommen wurde [2] . Die Entwicklung soll jedoch eingestellt werden, sobald die<br />
Software auf die Google App Engine portiert und als Open Source Software unter der Apache Lizenz veröffentlicht<br />
ist. [3] Mikroblogging fand auch in Deutschland schnell Nachahmer und es entstanden viele ähnliche Dienste. Auch<br />
in sozialen Netzwerken wie Xing oder Facebook können Microblogs – dann oft Statusmeldung genannt – erstellt<br />
werden. Eine weitere Plattform, die neben Texten beispielsweise auch die Veröffentlichung von Bildern, Videos und<br />
Chatlogs zulässt, ist Tumblr.<br />
Die freie Software StatusNet mit Identi.ca als Dienst benutzt die OStatus-Spezifikation (früherer Name:<br />
OpenMicroBlogging), welche die Kommunikation zwischen Benutzern auf unterschiedlichen Servern ermöglicht.<br />
Weblinks<br />
• openmicroblogging.org [4] - OpenMicroBlogging specification<br />
Referenzen<br />
[1] „We Won!“ (http:/ / twitter. com/ blog/ 2007/ 03/ we-won. html) Twitter Official Blog<br />
[2] „We're joining Google“ (http:/ / www. jaiku. com/ blog/ 2007/ 10/ 09/ were-joining-google/ ) Jaiku Official Blog<br />
[3] ic Gundotra: Changes for Jaiku and Farewell to Dodgeball and Mashup Editor. (http:/ / google-code-updates. blogspot. com/ 2009/ 01/<br />
changes-for-jaiku-and-farewell-to. html) Google Code Blog, 14. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[4] http:/ / openmicroblogging. org/
Twitter 57<br />
Twitter<br />
Twitter, Inc.<br />
Unternehmensform Kapitalgesellschaft<br />
Gründung 2006<br />
Unternehmenssitz San Francisco, Vereinigte Staaten<br />
Unternehmensleitung Jack Dorsey,<br />
Evan Williams,<br />
Biz Stone<br />
Mitarbeiter<br />
Umsatz<br />
etwa 200 [1]<br />
Branche Softwareentwicklung<br />
Produkte Software<br />
Website http:/ / twitter. com [3]<br />
400 Tsd. US-Dollar (Erwartung drittes Quartal 2009) [2]<br />
Twitter ist eine Anwendung zum Mikroblogging. Es wird auch als<br />
soziales Netzwerk oder ein meist öffentlich einsehbares Tagebuch im<br />
Internet definiert. Unternehmen und Pressemedien nutzen Twitter als<br />
Plattform zur Verbreitung von Nachrichten. Twitter wurde im März<br />
2006 der Öffentlichkeit vorgestellt und gewann schnell international an<br />
Beliebtheit.<br />
Funktionen<br />
Angemeldete Benutzer können eigene Textnachrichten mit maximal<br />
140 Zeichen eingeben. Diese Textnachrichten werden allen Benutzern<br />
angezeigt, die diesem Benutzer folgen. Der Herausgeber der Nachricht<br />
steht auf der Webseite des Dienstes mit einer Abbildung als alleiniger<br />
Autor über seinem Inhalt. Die Beiträge sind häufig in der<br />
Ich-Perspektive geschrieben. Das Mikro-Blog bildet ein für Autor und<br />
Leser einfach zu handhabendes Echtzeit-Medium zur Darstellung von<br />
Aspekten des eigenen Lebens und von Meinungen zu spezifischen<br />
Themen. Kommentare oder Diskussionen der Leser zu einem Beitrag<br />
sind möglich. Damit kann das Medium sowohl dem Austausch von<br />
Informationen, Gedanken und Erfahrungen als auch der<br />
Kommunikation dienen. Die Tätigkeit des Schreibens auf Twitter wird<br />
Markenzeichen von Twitter: der blaue Vogel<br />
Softwareentwickler und Twitter-Erfinder Jack<br />
umgangssprachlich als „twittern“ bezeichnet. Die Liste der abonnierten Beiträge wird häufig als „Timeline“ oder kurz<br />
„TL“ bezeichnet.<br />
Dorsey
Twitter 58<br />
Die Beiträge selbst werden als „Tweets“ (engl. to tweet = zwitschern)<br />
oder „Updates“ bezeichnet. Das referenzierte Wiederholen eines<br />
Beitrages einer anderen Person, um beispielsweise eine Eilmeldung im<br />
Netzwerk schnell weiterzuverbreiten, wird als „ReTweet“ bezeichnet.<br />
Das soziale Netzwerk beruht darauf, dass man die Nachrichten anderer<br />
Benutzer abonnieren kann. Autoren werden als „Twitterer“, seltener als<br />
„Tweeps“ bezeichnet; Leser, die die Beiträge eines Autoren abonniert<br />
haben, werden als „Follower“ (engl. to follow = folgen) bezeichnet. Die<br />
Beiträge der Personen, denen man folgt, werden in einem Log, einer<br />
abwärts chronologisch sortierten Liste von Einträgen dargestellt. Der<br />
Absender kann entscheiden, ob er seine Nachrichten allen zur<br />
Verfügung stellen oder den Zugang auf eine Freundesgruppe<br />
beschränken will.<br />
Über eine Programmierschnittstelle (API) stellen Komplementoren die<br />
über Twitter veröffentlichten Nachrichten zur Verfügung, so dass die<br />
Updates auf verschiedenen Kanälen von vielen Diensten abgerufen und<br />
von dort auch wieder eingespeist werden können. Dem Benutzer<br />
stehen unter anderem Kommunikationsstrukturen wie SMS (nur<br />
Vereinigte Staaten, Kanada und Indien) [4] oder einfache Eingabehilfen<br />
über die Twitter-Website (RSS) oder Desktop-Software zur<br />
Verfügung.<br />
Am 8. <strong>Jan</strong>uar 2010 hat die American Dialect Society den Begriff tweet<br />
zum Word of the Year 2009 gewählt.<br />
Unternehmen<br />
Geschichte<br />
Gegründet von Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams, begann<br />
Twitter im März 2006 als ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt<br />
innerhalb der San Franciscoer Podcasting-Firma Odeo. [5] Twitter<br />
wurde ursprünglich intern von den Odeo-Mitarbeitern genutzt. Im<br />
Der Internetunternehmer Evan Williams ist auch<br />
der Gründer von Blogger.com.<br />
Grafiker Biz Stone<br />
Die Twitter-Gründer Biz Stone und Jack Dorsey<br />
2008, einen TechCrunch-Preis für das beste<br />
mobile StartUp entgegennehmend<br />
November 2009 sagte Biz Stone während einer Veranstaltung an der Universität von Oxford, dass ein Börsengang<br />
als eine Möglichkeit betrachtet wird, um Twitter zu einem Unternehmen auszubauen, das es lange Zeit geben wird. [6]<br />
Eigenständigkeit<br />
2006 wurde Twitter ein Produkt der Firma Obvious. [7] Der Dienst gewann sehr schnell an Popularität. Im März 2007<br />
gewann er den South by Southwest Web Award in der Kategorie „Blogs“. [8] Dorsey, der Mann hinter dem Konzept<br />
von Twitter, [9] hielt bei der Verleihung des South by Southwest Web Award folgende humorvolle Rede: „Wir
Twitter 59<br />
würden uns gern mit 140 Zeichen oder weniger bedanken. Was wir<br />
hiermit getan haben!“ [10] Im April 2007 gliederte Obvious Twitter als<br />
eigenständige Firma aus. [11] Dorsey war CEO, bis er 2008 von<br />
Williams ersetzt wurde. [12]<br />
Akquisition von Summize<br />
Summize war ein Internet-StartUp, das den Twitter-XMPP-Stream<br />
verwendete, um Benutzern zu ermöglichen, Twitter-Konversationen<br />
nahezu in Echtzeit zu durchsuchen. Am 15. Juli 2008 akquirierte<br />
Twitter Summize und integrierte es in seine Website unter der<br />
Subdomain search.twitter.com. Zum Zeitpunkt des Verkaufs hatte<br />
Summize sechs Mitarbeiter, von denen fünf zu Twitter wechselten. Der<br />
CEO Jay Verday wechselte in ein anderes Projekt. [13]<br />
Sprachversionen<br />
Deutsche Version<br />
Japanische Version<br />
Am 22. April 2008 gab Twitter in seinem Blog bekannt, dass es eine<br />
Version für japanische Benutzer geschaffen habe, weil diese wichtige<br />
Anwender des Dienstes seien. Die Benutzeroberfläche blieb jedoch<br />
vollständig in Englisch. [14] Eine Woche nach dem Start wurde<br />
berichtet, dass die japanische Version von Twitter an Fahrt<br />
gewinne; [15] Japanisch ist heute nach Englisch die am zweithäufigsten<br />
verwendete Sprache bei Twitter. [16] Anders als beim US-Dienst wird<br />
beim japanischen Dienst Werbung angezeigt. [17]<br />
Weitere Sprachversionen<br />
Anfangs hieß Twitter „Twttr“. Das<br />
Foto zeigt die ersten Notizen und<br />
Ideen vom Erfinder Jack Dorsey von<br />
März 2006.<br />
Das Bürogebäude in San Francisco, in dessen<br />
vierter Etage sich das Büro von Twitter befindet.<br />
Im November/Dezember 2009 wurde das Benutzerinterface von Twitter nacheinander in den Sprachen Spanisch,<br />
Französisch, Italienisch, und Deutsch verfügbar gemacht. [18] Die Übersetzungen wurden durch die Mithilfe<br />
freiwilliger Übersetzer erstellt. [19]<br />
Einnahmen<br />
Der Gründer Evan Williams sammelte etwa 22 Millionen US-Dollar Risikokapital zum Betrieb und Ausbau seines<br />
Dienstes ein. [20] Twitter ist durch Fred Wilsons Union Square Ventures, Digital Garage, Spark Capital und Jeff<br />
Bezos' Bezos Expeditions finanziell abgesichert. [21] The Industry Standard verwies auf das Fehlen von Einnahmen<br />
als Gefahr für die langfristige Lebensfähigkeit. [22] 2008 verkaufte Twitter keine Werbung und erzielte keinerlei<br />
Einnahmen. [12]<br />
Datenschutz<br />
Twitter sammelt personenbezogene Daten seiner Benutzer und teilt sie Dritten mit. Twitter sieht diese Informationen<br />
als einen Aktivposten und behält sich das Recht vor, sie zu verkaufen, wenn die Firma den Besitzer wechselt. [23]
Twitter 60<br />
Technologie<br />
Twitter setzt Ruby on Rails für die Erzeugung von Webseiten ein. Ursprünglich war auch die kritische Infrastruktur<br />
des Backends mit Ruby on Rails geschrieben. Diese musste jedoch aufgrund von Skalierungsproblemen neu<br />
geschrieben werden, was in der Programmiersprache Scala erfolgte. [24]<br />
Komplementoren<br />
Die Twitter-API erlaubt die Integration von Twitter in andere Web Services und Anwendungen. [25] Twitter kann<br />
neben spezialisierten Clients wie Seesmic Desktop auch in verschiedenen anderen Programmen verwendet werden,<br />
beispielsweise im Kundenbeziehungsmanagement Dienst Salesforce.com, den Instant-Messaging-Client Diensten<br />
Adium, Digsby oder im Flock Browser. T-Mobile USA hat in sein Sidekick Mobiltelefon neben Facebook auch<br />
Twitter integriert.<br />
Mittels Erweiterungen lassen sich zusätzliche Informationen über den Absender und die Empfängergruppe anzeigen,<br />
wie etwa den jeweiligen Standort auf dem Kartendienst Google Maps.<br />
Mit spezialisierten Clients, wie TweetDeck lassen sich Nachrichten übersichtlicher darstellen. So kann auch bei<br />
mehreren Twitter-Kontos die Übersicht behalten werden. [26]<br />
Am 9. April 2010 wurde bekannt, dass Twitter die Entwicklerschmiede des mobilen Clients Tweetie übernommen<br />
hat und zukünftig eine Applikation für das Apple iPhone kostenlos anbieten möchte. Die offizielle<br />
Twitter-Applikation erschien am 19. Mai 2010 im App Store. [27]<br />
Sicherheit<br />
Die erste Sicherheitslücke bei Twitter wurde am 7. April 2007 von Nitesh Dhanjani gemeldet. Das Problem entstand<br />
dadurch, dass Twitter die Absenderangabe einer SMS als Authentifizierung für ein Benutzerkonto nutzte. Nitesh<br />
verwendete einen Free-SMS-Dienst um eine SMS zu manipulieren, woraufhin Twitter die Nachricht im Namen des<br />
Opfers verbreitete. Diese Sicherheitslücke kann nur ausgenutzt werden, wenn die Telefonnummer des Opfers<br />
bekannt ist. [28] Wenige Wochen nach dieser Entdeckung führte Twitter eine optionale PIN ein, um SMS<br />
authentifizieren zu können. Am 20. März 2009 wurde eine weitere Sicherheitslücke entdeckt, nachdem Twitter kurz<br />
zuvor ein Problem mit fälschbaren SMS-Updates zumindest provisorisch hatte lösen können. [29] Bei der neuen<br />
Lücke handelt es sich um eine Cross-Site-Scripting-Lücke, die prinzipiell sogar ein Wurm ausnutzen könnte.<br />
Ausfallzeiten<br />
Twitter war 2007 ungefähr zu 98 Prozent erreichbar, das heißt, es war etwa sieben volle Tage nicht erreichbar. [30]<br />
[31] Twitters Ausfallzeiten fielen insbesondere während gut besuchter Veranstaltungen der Technologie-Industrie<br />
auf, wie der 2008er Macworld-Conference-&-Expo-Eröffnungsansprache. [32] [33] Wenn Twitter abstürzt, sehen die<br />
Benutzer als Fehlermeldung den „Ausfall-Wal“ (engl. fail whale) – eine Karikatur von roten Vögeln, die einen<br />
Weißwal aus dem Ozean hieven. [34] Die Grafik wurde von Yiying Lu gestaltet. [35]<br />
Im Mai 2008 hat Twitters neues Entwicklungsteam die notwendigen Architekturänderungen implementiert, um dem<br />
Wachstum gerecht zu werden. Stabilitätsprobleme führten zu Ausfallzeiten oder zum zeitweisen Entfernen von<br />
Funktionen.<br />
Im August 2008 zog Twitter die freien SMS-Dienste für den größten Teil der Welt zurück. [36]<br />
Seit September 2008 ist die Unterstützung von Instant Messaging „zeitweilig nicht verfügbar“. [37] Wann diese<br />
Funktion wieder bereitgestellt wird ist unklar. [38]
Twitter 61<br />
Nutzung und Verbreitung<br />
Laut einer Nutzerstatistik des Marktforschungsunternehmens Nielsen hatte Twitter im Juni 2009 in Deutschland 1,8<br />
Millionen Nettonutzer (Unique Audience). [39] Damit habe sich die Nutzerzahl von Twitter in Deutschland laut dieser<br />
Nielsen-Studie von April 2009 bis Juni 2009 fast verdoppelt. Allerdings zeigt die „Loyalitätsanalyse“ von Nielsen,<br />
dass lediglich „35,7 Prozent der Nutzer des Vormonats im Juni erneut Twitter besucht haben.“ Die Studie fand<br />
weiterhin heraus, dass der Großteil der Twitter-Nutzer im Juni 2009 nur einmal (71,1 Prozent) und nur 14,8 Prozent<br />
der Nutzer mindestens dreimal auf der Webseite waren. Und nur 6,5 Prozent der Twitter-Nutzer hätten im Juni 2009<br />
mehr als 30 Minuten auf der Seite verbracht. Das Fazit von Nielsen zum Nutzerverhalten der Twitter-Nutzer aus<br />
dieser Studie lautet: „Auf der einen Seite steht das enorme Interesse und der Zuwachs der Nutzerzahlen. Auf der<br />
anderen Seite statteten die Nutzer Twitter nur wenige Besuche ab und viele Nutzer des Vormonats sind nicht wieder<br />
zurückgekehrt.“ [40]<br />
Zahlen für Österreich wurden im Zuge einer Studie der österreichischen Agentur Digital Affairs erhoben. Demnach<br />
hatte Twitter im Mai 2010 25.199 österreichische Nutzer, wovon allerdings nur 13.536 aktive Konten waren. [41]<br />
Demographische Informationen über die Twitter-Nutzer: Laut einer Online-Twitterumfrage vom März 2009, in der<br />
2779 brauchbare Datensätze ausgewertet wurden, war das Durchschnittsalter der deutschen Twitter-Nutzer 32 Jahre,<br />
74 Prozent der Nutzer waren männlich und 78 Prozent hatten Abitur. Laut dieser Umfrage würden zudem zwei von<br />
drei Twitter-Nutzern selbst einen eigenen Blog betreiben und unter anderem über Technik, Web-2.0-Themen oder<br />
Privates schreiben. 50 Prozent der Nutzer würden aus der Medien- oder Marketingbranche stammen und jeder Vierte<br />
sei Führungskraft oder Unternehmer. [42]<br />
Twitter-Nutzer geben in ihren Beiträgen üblicherweise Links als Kurz-URLs an, um Zeichen zu sparen.<br />
Auf twitter.com selbst erfolgt das Schreiben der Beiträge über das Eingabefenster und ist auf 140 Zeichen<br />
beschränkt. Zahlreiche Drittanbieter ermöglichen das Twittern über Desktop-Applikationen, Mobiltelefon oder Mail.<br />
Auch Beiträge mit mehr als 140 Zeichen sind so möglich; der restliche Text wird über einen weiterführenden Link<br />
angezeigt. Auch Bilder können über Drittanbieter in die Beiträge eingebunden und mit Bildunterschriften versehen<br />
werden.<br />
Twitterwall<br />
Bei Veranstaltungen kann ein so genannter Twitterwall eingesetzt werden – eine „Wand“ mit Tweets zu einem<br />
vorher bestimmten einheitlichen Hashtag.<br />
Hashtag<br />
Ein Hashtag ist ein Schlagwort in Form eines Tags, welches insbesondere bei Twitter Verwendung findet. Die<br />
Bezeichnung stammt vom Rautenzeichen „#“ (engl. „hash“, dt. „Raute“), mit dem ein solches Tag eingeleitet und<br />
durch ein Leerzeichen beendet wird. Beispiel: „#hashtag “.<br />
Im Gegensatz zu anderen Tag-Konzepten werden Hashtags direkt in die eigentliche Nachricht eingefügt; jedes Wort,<br />
vor dem ein Rautenzeichen steht, wird als Tag verwendet.<br />
Hashtags wurden im August 2007 von Chris Messina (Twitter-Nickname „FactoryJoe“) vorgeschlagen. Seitdem<br />
Twitter selbst eine Suchfunktion anbietet, ist der Nutzen von Hashtags umstritten, [43] jedoch ist eine höhere Qualität<br />
bei expliziter Verwendung des Hash-Zeichens anzunehmen als bei automatischer Suche. Alternative Twitter-Clients<br />
verlinken Hashtags automatisch auf eine entsprechende Trefferliste.<br />
Durch eine Analyse der Hashtags kann festgestellt werden, welche Twitter-Themen besonders beliebt sind. [44] Diese<br />
werden in den Trending Topics auf der Startseite angezeigt.<br />
Hashtags sind auch zum Teil eine ironische Form des Kommentierens eines Tweets, indem man ihn in einen<br />
Zusammenhang stellt, der unerwartet ist und als Einordnung dem Tweet eine neue Konnotation beigibt.
Twitter 62<br />
Nutzung durch öffentliche Institutionen und Gruppen<br />
Die Zwecke, für die Twitter über die individuelle Kommunikation hinaus genutzt wird, sind vielfältig. Öffentliche<br />
Einrichtungen stellen Informationen bereit; z. B. unterhält die US-Weltraumbehörde NASA Twitter-Feeds zu<br />
diversen Projekten; es wurden auch Feeds vom Weltraum aus bedient. [45] [46] Das Los Angeles Fire Department<br />
[47] [48]<br />
verwendete den Service zur Informationsverbreitung während der Waldbrände in Südkalifornien 2007.<br />
[49] [50]<br />
Einzelne Universitäten verteilen Informationen an ihre Studenten und nutzen Twitter zur Lehrevaluation.<br />
[51] [52]<br />
Auch Wissenschaftler nutzen Twitter während Konferenzen, um abwesende Kollegen zu informieren.<br />
Nutzung in der Privatwirtschaft<br />
Unternehmen nutzen Twitter, um Produktinformationen bereitzustellen und mit ihren Kunden zu kommunizieren.<br />
Das Mikro-Blogging dient dabei auch als Marketing- und Marktforschungsinstrument zur Produkt- und<br />
Unternehmensentwicklung. [53]<br />
Nutzung durch Massenmedien<br />
Nachrichtenagenturen sowie renommierte Medien wie die BBC haben ebenfalls begonnen, Twitter zu benutzen.<br />
Durch seinen Kurznachrichten-Charakter sind Hinweise auf aktuelle Ereignisse bei Twitter oft sogar schneller zu<br />
finden, als redaktionell bearbeitete Medien dies leisten könnten. Beispiele sind die Notwasserung von<br />
US-Airways-Flug 1549 oder der Amoklauf von Winnenden. An letzterem zeigte sich jedoch auch, dass die<br />
Unmittelbarkeit der Nachrichtenübertragung per Twitter dazu führen kann, dass unüberprüfbare Falschmeldungen<br />
und Gerüchte multipliziert werden. [54]<br />
Google News hat bestimmten Twitter-Benutzern dieselbe News-Priorität wie kleineren Zeitungen zugeteilt und<br />
deren „Updates“ erscheinen gelegentlich auf der amerikanischen Version von Google News. Auch Technorati<br />
durchsucht die aktuellen Einträge nach Auswertbarem.<br />
Nutzung in der Politik<br />
Im politischen Raum wird Twitter ebenso eingesetzt; so hatte z. B. das Wahlkampfteam von Barack Obama im Jahre<br />
2008 alle Helfergruppen mit Kurznachrichten „online“. So kommunizierten die Wahlkampfteams des<br />
US-Präsidentschaftskandidaten Barack Obama per Twitter. [55] Auf dem Parteikonvent 2008 der Demokraten kam<br />
Twitter verstärkt zum Einsatz.<br />
Politische Aktivisten koordinierten Straßenproteste gegen einen Parteitag der US-Republikaner in Minneapolis/St.<br />
Paul. [56]<br />
Im Rahmen der Wahlen im Iran 2009 erwies sich Twitter als wichtiges Instrument der Opposition. So konnten<br />
Anhänger von Hussein Mussawi trotz Internet-Zensur der iranischen Regierung Informationen weltweit verbreiten,<br />
die Sender wie die ARD, das ZDF oder verstärkt der US-Sender CNN ihrerseits für Berichte nutzten. Es wurde<br />
jedoch kritisiert, dass Nachrichtendienste zunehmend die Berichterstattung via Twitter beeinflussen wollten. [57]<br />
Nutzung in der Politik in Deutschland<br />
Anlässlich der Bundesversammlung 2009 wurden verschiedene Textnachrichtendienste genutzt, um vorab das<br />
Ergebnis der Wahl des Bundespräsidenten zu streuen. So wurden bereits ab 14:00 Uhr SMS mit dem<br />
Auszählungsergebnis versendet, um 14:15 Uhr twitterte dann der SPD-Abgeordnete Ulrich Kelber das Ergebnis.<br />
Gegen 14:18 Uhr veröffentlichte die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner, die überdies in der<br />
Stimmauszählungskommission saß, das Resultat der Wahl. Die frühzeitige Bekanntgabe des Wahlergebnisses über<br />
Twitter führte zu heftigen Diskussionen in Kreisen des Bundestages. [58] Die SPD verlangt deshalb, im Bundestag die<br />
Einrichtung von Störsendern zu prüfen. [59]
Twitter 63<br />
Auch bei Wahlen für die Landtage Saarland, Sachsen und Thüringen gelangten Wahlprognosen vor der Schließung<br />
der Wahllokale mittels Twitter an die Öffentlichkeit. Die veröffentlichten Zahlen unterschieden sich nicht<br />
maßgeblich von denen, die um 18 Uhr in der ARD und im ZDF veröffentlicht wurden. Durch diesen Sachverhalt<br />
entstand die Diskussion um eine mögliche Beeinflussung und entsprechende Ungültigkeit der Wahlen. [60]<br />
Wahlkampf in Deutschland<br />
Der ehemalige Generalsekretär der SPD, Hubertus Heil, hatte als Gast auf dem Kongress der US-Demokraten die<br />
Twitter-Technik kennengelernt und für die SPD-Gremien und die Fraktion nutzbar gemacht.<br />
In Deutschland unterhielten verschiedene Politiker im Wahlkampf zur Landtagswahl in Hessen 2009 Twitter-Feeds.<br />
Mindestens ein Kanal wurde dabei vom Satire-Magazin Titanic persifliert, das einen eigenen Kanal eröffnete und<br />
sich für den betroffenen Politiker ausgab. [61]<br />
Der erste Wahlkampf in Deutschland, in dem Twitter seinen Einsatz fand, war die hessische Landtagswahl 2009, in<br />
der alle großen Parteien eigene Twitter-Seiten hatten, etwa die CDU mit einem Internet-Blog sowie der<br />
[62] [63]<br />
SPD-Spitzenkandidat mit einem personalisierten Twitter-Konto.<br />
Politiker<br />
In der CDU twittern neben einigen Bundestagsabgeordneten beispielsweise die Bundesfamilienministerin, Kristina<br />
Schröder. [64] Von den Spitzengrünen twittert Volker Beck, der allerdings die Spezifität des Mikro-Bloggings als<br />
Kommentarmöglichkeit versteht. Er wird laut FAS „in der sog. Internetgemeinde allseits als sachverständigster<br />
Twitterer gelobt. Er verzichtet völlig auf private Anekdoten und glaubt offensichtlich tatsächlich an den Dialog mit<br />
seinen Anhängern.“ [65] Auch der ehemalige Parteivorsitzende Reinhard Bütikofer hat nach anfänglicher Skepsis<br />
Twitter als intensiven Kommunikations- und Dialogkanal entdeckt. [66] Die stellvertretende Parteivorsitzende der<br />
Linken Halina Wawzyniak twittert seit <strong>Jan</strong>uar 2009. Inzwischen setzt auch die FDP-Fraktion im Deutschen<br />
Bundestag diese Kommunikationstechnik ein, um auf ihre Pressemitteilungen aufmerksam zu machen. [67] Die<br />
Bundespartei und einige Landesverbände der Grünen twittern und berichten dabei über ihre Parteitage und<br />
[68] [69] [70]<br />
Veranstaltungen.<br />
Wahlforschung<br />
Aufgrund der Diskussion über den Obama-Wahlkampf versuchen auch Medien-Institute, im Vorfeld des<br />
Bundestagswahlkampfes 2009 auf sich aufmerksam zu machen. So hat eine Studie von Nielsen <strong>Media</strong> Research [71]<br />
die gefälschten Konten und tote Konten für voll genommen und danach die Twitter-Power der Parteien bewertet. [72]<br />
Durch die Auswertung von Hashtags kann ein politisches Stimmungsbild der Benutzer von Twitter wiedergegeben<br />
[73] [74]<br />
werden.<br />
Nutzung im Kulturbereich<br />
Auch Museen, Theater, Orchester und soziokulturelle Zentren nutzen immer häufiger aktiv Twitter. In einer im<br />
Herbst 2009 durchgeführten Umfrage [75] unter Twitter-Nutzern, die im Kulturbereich tätig sind, meinten 84 Prozent,<br />
dass Kultureinrichtungen Twitter erfolgreich für Marketing und Werbung einsetzen können, jedoch nur 45 Prozent,<br />
dass Twitter verstärkt Teil des Kulturschaffens werden sollte, also z. B. in Form einer Twitter-Oper (wie in der<br />
Londoner Royal Opera aufgeführt). Als Hauptgründe für die Twitter-Nutzung wurde angegeben, dass man durch<br />
Twitter zu kulturellen Ereignissen besser informiert ist und neue Kontakte zu Kulturschaffenden gewonnen habe.<br />
Über 40 Prozent der Befragten gaben an, dass zur Pflege ihrer kulturellen Interessen Twitter unverzichtbar geworden<br />
sei.<br />
Zudem kann Twitter als Analyseinstrument für Kinoerfolge dienen. Wissenschaftler des HP-Laps in Palo Alto haben<br />
verschiedene Algorithmen entwickelt, mithilfe derer man mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent die<br />
Besucherzahlen am Startwochenende eines neuen Kinofilms berechnen kann. [76]
Twitter 64<br />
In der Literatur ist im Jahr 2009 bei Penguin Books in London von Alexander Aciman & Ement Rensin das Buch<br />
„Twitterature . The World’s Greatest Books Retold Through Twitter“ erschienen. In dem 146-seitigen Bändchen<br />
werden sechzig Bücher mit jeweils maximal 20 Tweets dargestellt.<br />
Missbrauch und Spamming<br />
Twitter kann für Spamming missbraucht werden. Darunter fallen u. a. die Publikation einer großen Anzahl von Links<br />
sowie das Folgen von Tweets unbekannter Personen mit dem Zweck, dass diese auch den Tweets des Spammers<br />
folgen (Aggressive Following). [77] Auch die Trending Topics werden von Spammern missbraucht, indem sie ihre<br />
Meldungen automatisch mit Begriffen aus den aktuellen Trending Topics versehen. [78]<br />
Mutmaßungen über psychologische Effekte<br />
Die Psychologin Tracy Alloway von der University of Stirling in Schottland stellte im September 2009 die These<br />
auf, das soziale Netzwerk Facebook mache seine Nutzer klüger, der Mikroblogging-Dienst Twitter hingegen<br />
dümmer. [79] Während Facebook das Arbeitsgedächtnis erweitere und deshalb auch die Intelligenz fördere, bewirke<br />
Twitter das Gegenteil. Die These wurde nicht durch Studien bestätigt.<br />
Medienberichte, nach denen Forscher der University of Southern California einen Verfall von Moral und Empathie<br />
[80] [81]<br />
der Nutzer von Twitter und Facebook festgestellt hätten, stellten sich als falsch heraus.<br />
Siehe auch<br />
• Identi.ca, StatusNet, OpenMicroBlogging<br />
• OneRiot (Echtzeit-Suchmaschine für Twitter)<br />
• Twhirl<br />
Literatur<br />
Deutschsprachige Literatur<br />
• Tim O’Reilly, Sarah Milstein: (10/2009) Das Twitter-Buch – O'Reilly <strong>Media</strong> ISBN 978-3-89721-942-7<br />
• Stefan Ziegler: (04/2009) TwitterSweet: 140 Zeichen für den Geschäftsalltag – Books on Demand ISBN<br />
978-3-8370-3781-4<br />
• Nicole Simon, Nikolaus Bernhardt: (01/2010) Twitter – Mit 140 Zeichen zum Web 2.0 - 2. Aufl. – open source<br />
PRESS ISBN 978-3-937514-98-7<br />
• Stefan Berns, Dirk Henningsen: (10/2009) Der Twitter Faktor – Kommunikation auf den Punkt gebracht! –<br />
Business Village ISBN 978-3-86980-000-4<br />
• Wolfgang Hünnekens: (09/2009) Die Ich-Sender: Das <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Prinzip – Twitter, Facebook & Communitys<br />
erfolgreich einsetzen – Business Village ISBN 978-3-86980-005-9<br />
Englischsprachige Literatur<br />
• Shel Israel: (09/2009) Twitterville: How Businesses Can Thrive in the New Global Neighborhoods – Portfolio<br />
ISBN 978-1-59184-279-8<br />
• Tim O’Reilly, Sarah Milstein: (05/2009) The Twitter Book – O'Reilly <strong>Media</strong> ISBN 978-0-596-80281-3<br />
• Kevin Makice: (04/2009) Programming Twitter: Learn How to Build Applications with the Twitter API –<br />
O'Reilly <strong>Media</strong> ISBN 978-0-596-15461-5<br />
• Joel Comm, Anthony Robbins, Ken Burge: (03/2009) Twitter Power: How to Dominate Your Market One Tweet<br />
at a Time – John Wiley & Sons ISBN 978-0-470-45842-6
Twitter 65<br />
• Julio Ojeda-Zapata: (11/2008) Twitter Means Business: How Microblogging Can Help or Hurt Your Company –<br />
Happy About ISBN 978-1-60005-118-0<br />
• Deborah Micek, Warren Whitlock: (10/2008) Twitter Revolution: How <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> and Mobile Marketing Is<br />
Changing the Way We Do Business & Market Online – Xeno Press ISBN 978-1-934275-07-8<br />
Weblinks<br />
• Offizielle Website von Twitter [3]<br />
• Offizielle Twitter-Suchmaschine [82]<br />
• Die komplette Public Time Line [83] , die alle Tweets enthält, die fortlaufend über Twitter versandt werden und<br />
Public Time Line RSS [84]<br />
• Spiegel Online: Mobile Communitys – Mit 140 Zeichen um die Welt [85] 27. März 2007<br />
• Größtes Verzeichnis deutschsprachiger Marken auf Twitter [86]<br />
• Forscher lüften das Twitter-Geheimnis [87] . In: Handelsblatt.com<br />
• Jens Schröder: Spiegel, heise, Welt und Zeit führen Ranking an. Die Leitmedien der deutschen Twitternutzer [88] .<br />
In: Meedia.de, 24. August 2010. Vgl. Die völlig neuen, anderen Twittercharts [89] . In: Popkulturjunkie.de, 24.<br />
August 2010.<br />
Video-Berichte<br />
• Elektrischer Reporter: Interview mit Twitter-Mitgründer Biz Stone [90] 8. Oktober 2007<br />
• Tagesschau.de: Twitter im Trend: Internetdienst Twitter macht SMS und Email Konkurrenz [91] 24. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
• „Twitter-Affäre“ beschäftigt Bundestags-Präsidium [92] 26. Mai 2009<br />
• Planet Interview: Montagsfrage: „Warum eigentlich Twitter?“ [93] 22. Juni 2009<br />
• Planetopia: Twitter, das Medium der Zukunft? / Einfache Erklärung für jedermann [94] 27. September 2009<br />
Referenzen<br />
[1] Website des Unternehmens (http:/ / twitter. com/ about/ employees)<br />
[2] Hacker Exposes Private Twitter Documents (http:/ / bits. blogs. nytimes. com/ 2009/ 07/ 15/ hacker-exposes-private-twitter-documents/ ?hpw.<br />
), The New York Times, 15. Juli 2009.<br />
[3] http:/ / twitter. com/<br />
[4] Im August 2008 hat Twitter den Versand von SMS-Kurznachrichten außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas und Indiens eingestellt.<br />
Pressemitteilung zur Einstellung des SMS-Versandes (http:/ / blog. twitter. com/ 2008/ 08/ changes-for-some-sms-usersgood-and-bad. html)<br />
[5] Glaser, Mark. “ Twitter Founders Thrive on Micro-Blogging Constraints (http:/ / www. pbs. org/ mediashift/ 2007/ 05/<br />
twitter-founders-thrive-on-micro-blogging-constraints137. html) ” (Englisch) , Public Broadcasting Service (PBS), 17. Mai 2007. Abgerufen<br />
am 5. November 2008.<br />
[6] Twitter: Börsengang nicht ausgeschlossen (http:/ / www. gevestor. de/ wissen-praxis/ details/ article/<br />
twitter-boersengang-nicht-ausgeschlossen. html)<br />
[7] Williams, Evan (16. April 2007). Twitter, Inc. (http:/ / blog. obvious. com/ 2007/ 04/ twitter-inc. html) (Englisch). Obvious. Abgerufen am<br />
7. Mai 2008.<br />
[8] Stone, Biz (14. März 2007). We Won (http:/ / blog. twitter. com/ 2007/ 03/ we-won. html) (Englisch). Twitter. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[9] Strange, Adario. “ Flickr Document Reveals Origin Of Twitter (http:/ / blog. wired. com/ business/ 2007/ 04/ flickr_document. html) ”<br />
(Englisch) , Wired News, CondéNet, 20. April 2007. Abgerufen am 5. November 2008.<br />
[10] engl. „We'd like to thank you in 140 characters or less. And we just did!“<br />
[11] Stone, Biz (18. April 2007). Incorporating Twitter (http:/ / blog. twitter. com/ 2007/ 04/ incorporating-twitter. html) (Englisch). Twitter.<br />
[12] Miller, Claire Cain. Popularity or Income? Two Sites Fight It Out (http:/ / www. nytimes. com/ 2008/ 10/ 21/ technology/ start-ups/<br />
21twitter. html) (Englisch) , The New York Times, 20. Oktober 2008. Abgerufen am 5. November 2008.<br />
[13] Arrington, Michael (15. Juli 2008). Confirmed: Twitter Acquires Summize Search Engine (http:/ / www. techcrunch. com/ 2008/ 07/ 15/<br />
confirmed-twitter-acquires-summize-search-engine/ ) (Englisch). TechCrunch. Abgerufen am 17. November 2008.<br />
[14] Stone, Biz (22. April 2008). Twitter for Japan (http:/ / blog. twitter. com/ 2008/ 04/ twitter-for-japan. html) (Englisch). Twitter. Abgerufen<br />
am 7. Mai 2008.<br />
[15] MacManus, Richard (28. April 2008). Early Stats Show Twitter Taking Off in Japan (http:/ / www. readwriteweb. com/ archives/<br />
twitter_japan. php) (Englisch). ReadWriteWeb. Abgerufen am 7. Mai 2008.
Twitter 66<br />
[16] Niederberger Cabral, Ricardo (10. September 2008). Language most spoken on Twitter (http:/ / blog. isnotworking. com/ 2008/ 09/<br />
language-most-spoken-on-twitter. html) (Englisch). isnotworking.com. Abgerufen am 11. September 2008.<br />
[17] Crampton, Thomas (23. Mai 2008). Joi Ito: Twitter makes money in Japan (http:/ / www. thomascrampton. com/ media/<br />
joi-ito-twitter-makes-money-in-japan/ ). ThomasCrampton.com. Abgerufen am 23. Mai 2008.<br />
[18] Dawn, Jenna (16. Dezember 2009). Was gibt's Neues? (http:/ / blog. twitter. com/ 2009/ 12/ was-gibts-neues. html). blog.twitter.com.<br />
Abgerufen am 19. Dezember 2009.<br />
[19] Stone, Biz (8. Oktober 2009). Coming Soon: Twitter in More Languages (http:/ / blog. twitter. com/ 2009/ 10/<br />
coming-soon-twitter-in-more-languages. html) (Englisch). blog.twitter.com. Abgerufen am 12. Dezember 2009.<br />
[20] Womack, Brian (12. November 2008). Twitter Shuns Venture-Capital Money as Startup Values Plunge (http:/ / www. bloomberg. com/<br />
apps/ news?pid=20601109& sid=afu06n0L7LZ4) (Englisch). Bloomberg. Abgerufen am 12. November 2008.<br />
[21] Miller, Claire Cain (16. Oktober 2008). Twitter Sidelines One Founder and Promotes Another (http:/ / bits. blogs. nytimes. com/ 2008/ 10/<br />
16/ ttwitter-sidelines-one-founder-and-promotes-another/ #more-1642) (Englisch). The New York Times. Abgerufen am 5. November 2008.<br />
[22] Snyder, Bill (31. März 2008). Twitter: Fanatical users help build the brand, but not revenue (http:/ / www. thestandard. com/ news/ 2008/<br />
03/ 28/ twitter-fanatical-users-help-build-brand-not-revenue) (Englisch). The Industry Standard. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[23] Twitter Privacy Policy (http:/ / twitter. com/ privacy) (Englisch). Twitter (14. Mai 2007). Abgerufen am 5. November 2008.<br />
[24] Venners, Bill (3. April 2009). Twitter on Scala (http:/ / www. artima. com/ scalazine/ articles/ twitter_on_scala. html) (Englisch). Artima,<br />
Inc.. Abgerufen am 17. April 2009.<br />
[25] Twitter API Dokumentation (http:/ / apiwiki. twitter. com/ Twitter-API-Documentation) (Englisch). Twitter. Abgerufen am 8. Mai 2008.<br />
[26] Mit TweetDeck den Überblick bei Twitter behalten (http:/ / datenschaetze. de/ kontakte/<br />
tweetdeck-den-uberblick-uber-tweets-bei-twitter-behalten-t849. html) (Deutsch). DatenSchaetze. Abgerufen am 24. November 2009.<br />
[27] Offizielle Twitter Applikation im App Store (http:/ / www. appblogger. de/ 2010/ 05/ 19/ offizielle-twitter-applikation-im-app-store/ )<br />
(Deutsch). Appblogger. Abgerufen am 24. Mai 2010.<br />
[28] Nitesh Dhanjani (7. April 2007). Twitter and Jott Vulnerable to SMS and Caller ID Spoofing (http:/ / www. dhanjani. com/ archives/ 2007/<br />
04/ twitter_and_jott_vulnerable_to. html) (Englisch). Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[29] Twitter schließt eine Lücke und die nächste taucht auf (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Twitter-schliesst-eine-Luecke-und-die-naechste-taucht-auf--/ meldung/ 134922) (Deutsch) (20. März 2009).<br />
[30] Caverly, Doug (20. Dezember 2007). Twitter Downtime Revealed, Ridiculed (http:/ / www. webpronews. com/ topnews/ 2007/ 12/ 20/<br />
twitter-downtime-revealed-ridiculed) (Englisch). WebProNews. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[31] Schonfeld, Erick (20. Dezember 2007). Twitter Downtime On the Upswing (http:/ / www. techcrunch. com/ 2007/ 12/ 20/<br />
twitter-downtime-on-the-upswing/ ) (Englisch). TechCrunch. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[32] Dorsey, Jack (15. <strong>Jan</strong>uar 2008). MacWorld (http:/ / blog. twitter. com/ 2008/ 01/ macworld. html). Twitter. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[33] Kuramoto, Jake (15. <strong>Jan</strong>uar 2008). MacWorld Brings Twitter to its Knees (http:/ / oracleappslab. com/ 2008/ 01/ 15/<br />
macworld-brings-twitter-to-its-knees/ ) (Englisch). Oracle AppsLab. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[34] Whyte, Murray. (June 1, 2008) Toronto Star Tweet, tweet there's been an earthquake (http:/ / www. thestar. com/ News/ Ideas/ article/<br />
434826) 1. Juni 2008<br />
[35] Walker, Rob. Fail Whale (http:/ / www. nytimes. com/ 2009/ 02/ 15/ magazine/ 15wwln_consumed-t. html?_r=2) , Consumed, New York<br />
Times Magazine, February 15, 2009, Seite 17.<br />
[36] Stride, Jake (14. August 2008). A World without Twitter SMS (http:/ / www. senokian. com/ barking/ 2008/ 08/ 14/<br />
a-world-without-twitter-sms/ ) (Englisch). Barking. the Senokian blog. Abgerufen am 15. August 2008.<br />
[37] Dorsey, Jack (05 2008). Twitter IM down May 23rd-May24th (http:/ / getsatisfaction. com/ twitter/ topics/<br />
twitter_im_down_may_23rd_may24th?utm_content=topic_link& utm_medium=email& utm_source=new_user_welcome) (Englisch). Get<br />
Satisfaction. Abgerufen am 29. Juli 2008.<br />
[38] IM: Not coming soon (http:/ / status. twitter. com/ post/ 53978711/ im-not-coming-soon) (Englisch). Twitter. Abgerufen am 22. <strong>Jan</strong>uar<br />
2009.<br />
[39] Nielsen Nutzerstatistik von Twitter im Juni 2009<br />
[40] Nielsen Online (4. August 2009). Das Phänomen Twitter: Nielsen ermittelt Verdopplung der Nutzerzahlen in Deutschland seit April (http:/ /<br />
www. nielsen-media. de/ pages/ download. aspx?mode=0& doc=645/ 090804_Twitter. pdf) (Deutsch).<br />
[41] Digital Affairs (7. Juni 2010). 25.000 ÖsterreicherInnen nutzen Twitter (http:/ / digitalaffairs. at/ 2010/ 06/ 07/<br />
25-000-oesterreicherinnen-nutzen-twitter/ ) (Deutsch).<br />
[42] deutsche Twitterumfrage 2.0 (http:/ / twitterumfrage. de/ dtu1. php), Autor: Thomas Pfeiffer, Webevangelist, März 2009<br />
[43] http:/ / mattbrowne. com/ the-death-of-on-twitter<br />
[44] http:/ / www. twitter-trends. de<br />
[45] Tariq Malik (11. Mai 2009). NASA astronaut trains and tweets for journey (http:/ / www. msnbc. msn. com/ id/ 30078050/ ). MSNBC.<br />
Abgerufen am 25. Mai 2009.<br />
[46] Bates, Claire (13. Mai 2009). Hubble astronaut sends first ever Twitter message from space to say he is 'enjoying the view' (http:/ / www.<br />
dailymail. co. uk/ sciencetech/ article-1180755/ Hubble-astronaut-sends-Twitter-message-space-say-enjoying-view. html). Daily Mail.<br />
Abgerufen am 14. Mai 2009.<br />
[47] Madrigal, Alexis (19. Juni 2008). Mars Phoenix Tweets: „We Have ICE!“ (http:/ / blog. wired. com/ wiredscience/ 2008/ 06/<br />
mars-phoenix-tw. html) (Englisch). Wired News. Abgerufen am 1. Juni 2008.
Twitter 67<br />
[48] Spiegel Online: Live-Berichte aus dem Orbit – „Hubble“-Reparatur wird Web-Ereignis (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/<br />
0,1518,624299,00. html)<br />
[49] Christoph Burger; Stefan Stieger (18. Februar 2009). Using Web 2.0 application Twitter for formative course evaluation: a case study.<br />
(http:/ / www. mobileresearch09. com/ index. php/ page/ the-schedule#postertitles) (Englisch). 1st Mobile phone conference, London (UK).<br />
Abgerufen am 18. Februar 2009.<br />
[50] Christoph Burger; Stefan Stieger (8. April 2009). Let's go formative: Continuous student ratings with Web 2.0 application Twitter (http:/ /<br />
wp1101040. wp137. webpack. hosteurope. de/ conftool09/ index. php?page=browseSessions& abstracts=show& presentations=show&<br />
form_session=44). GOR09. Abgerufen am 7. <strong>Jan</strong>uar 2009.<br />
[51] Wolfgang Reinhardt; Martin Ebner, Günter Beham, Cristina Costa (5. Juni 2009). How People are using Twitter during Conferences (http:/ /<br />
lamp. tu-graz. ac. at/ ~i203/ ebner/ publication/ 09_edumedia. pdf). Graz University of Technology. Abgerufen am 8. März 2010.<br />
[52] 7 Things You Should Know About Backchannel Communication (http:/ / www. educause. edu/ Resources/<br />
7ThingsYouShouldKnowAboutBackc/ 198305). Educause (9. Februar 2010). Abgerufen am 9. März 2010.<br />
[53] Mardesich, Jodi (2008). Business Uses for Twitter (http:/ / technology. inc. com/ networking/ articles/ 200809/ twitter. html) (Englisch).<br />
inc.technology.com. Abgerufen am 17. November 2008.<br />
[54] Mitteldeutsche Zeitung (http:/ / www. mz-web. de/ servlet/ ContentServer?pagename=ksta/ page& atype=ksArtikel& aid=1229853066053&<br />
calledPageId=987490165154), 12. März 2009<br />
[55] Obama, Barack (7. Mai 2008). Twitter / BarackObama (http:/ / twitter. com/ BarackObama). Twitter. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
[56] Twin Cities IMC (21. September 2008). Organizing Resistance (http:/ / twincities. indymedia. org/ 2008/ sep/<br />
organizing-resistance-retrospective-2008-republican-national-convention?t=1221977945). Twin Cities IMC. Abgerufen am 21. September<br />
2008.<br />
[57] Christian Stöcker (16. Juni 2009). Propagandakrieg um Twitter (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,630845,00. html). Spiegel<br />
Online. Abgerufen am 17. Juni 2009.<br />
[58] Süddeutsche Zeitung: Das Zwitschern der Weinkönigin 26. Mai 2009 (http:/ / www. sueddeutsche. de/ politik/ 316/ 469868/ text/ )<br />
[59] Spiegel 29. Mai 2009 Twitter-Ärger im Reichstag – SPD prüft Einrichtung von Handy-Störsendern (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/<br />
tech/ 0,1518,627624,00. html)<br />
[60] Zeit 31. August 2009 Landtagswahlen: Wahlprognosen auf Twitter ausgeplaudert (http:/ / www. zeit. de/ online/ 2009/ 36/<br />
twitter-prognose?page=1)<br />
[61] Whitney, Daisy. “ CNN, MSNBC Web Sites Most Popular on Election Day (http:/ / www. tvweek. com/ news/ 2008/ 11/<br />
cnn_msnbc_web_sites_most_popul. php) ” (Englisch) , TV Week, Crain Communications, 5. November 2008. Abgerufen am 6. November<br />
2008.<br />
[62] Wahlkampf-Twitter der CDU Hessen (http:/ / twitter. com/ webcamp09)<br />
[63] SPD-Sitzenkandidat bei Twitter (http:/ / twitter. com/ tsghessen)<br />
[64] Kristina Schröder bei Twitter (http:/ / twitter. com/ kristinakoehler)<br />
[65] [Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Harald Staun: 140 Zeichen heiße Luft FAS 17. Mai 2009]<br />
[66] Twitter-Konto von Reinhard Bütikofer (http:/ / twitter. com/ bueti)<br />
[67] Viralmythen: Volker Beck, Hubertus Heil und die FDP – die Politik entdeckt die Macht des Mikrobloggens (http:/ / blog. metaroll. de/<br />
2008/ 09/ 30/ volker-beck-hubertus-heil-und-die-fdp-die-politik-entdeckt-die-macht-des-mikrobloggens/ )<br />
[68] Henning Schürig: Bundestags-Listenaufstellung live auf Twitter (http:/ / www. henningschuerig. de/ blog/ 2008/ 10/ 09/<br />
bundestags-listenaufstellung-live-auf-twitter/ )<br />
[69] Der Westen: Politgetwitter Liste der politischen Twitter-accounts. (http:/ / www. derwesten. de/ community/ katrin. scheib/ stories/ 387358/<br />
)<br />
[70] Twitter kommt: Was zwitscherst Du gerade? Oberhessische Presse 13. November 2008 (http:/ / www. op-marburg. de/ newsroom/ medien/<br />
art663,731179)<br />
[71] Trost, Silke (11. Februar 2009). Twitter als Sprachrohr von Bundestagsabgeordneten (http:/ / www. marketing-boerse. de/ News/ details/<br />
Twitter-als-Sprachrohr-von-Bundestagsabgeordneten). Marketing Börse. Abgerufen am 20. August 2009.<br />
[72] Beckedahl, Markus (11. Februar 2009). 68 twitternde Bundestagsabgeordnete? (http:/ / netzpolitik. org/ 2009/<br />
68-twitternde-bundestagsabgeordnete/ ). Netzpolitik.org. Abgerufen am 20. August 2009.<br />
[73] wahlgetwitter.de – Dienst zur Auswertung des politischen Stimmungsbilds (http:/ / www. wahlgetwitter. de)<br />
[74] Parteigezwitscher – Die politische Stimmung auf twitter (http:/ / parteigezwitscher. de/ )<br />
[75] Simon A. Frank (19. <strong>Jan</strong>uar 2010). Warum nutzen Kulturschaffende Twitter? (http:/ / kulturgezwitscher. wordpress. com/ 2010/ 01/ 19/<br />
warum-nutzen-kulturschaffende-twitter/ ). Kulturgezwitscher. Abgerufen am 15. März 2010.<br />
[76] Twitter prophezeit Kinoerfolge (http:/ / www. beyond-print. de/ 2010/ 04/ 08/ twitter-prophezeit-kinoerfolg/ ). Beyond-Print (8. April 2010).<br />
Abgerufen am 11. April 2010.<br />
[77] Artikel im Twitter-Blog vom 21. Juli 2008 (http:/ / blog. twitter. com/ 2008/ 07/ ongoing-battle. html), abgerufen am 5. August 2009<br />
[78] Techcrunch, 3. Juli 2009: Once Again, Twitter Trending Topics Polluted By Spam (http:/ / techcrunch. com/ 2009/ 07/ 02/<br />
once-again-twitter-trending-topics-polluted-by-spam/ ), abgerufen am 1. April 2010<br />
[79] Psychologin: Twitter macht dumm, Facebook klug (http:/ / pressetext. de/ news/ 090908022/<br />
psychologin-twitter-macht-dumm-facebook-klug/ )<br />
[80] Pressetext: Twitter schadet der Moral seiner Nutzer (http:/ / pressetext. de/ news/ 090416019/ twitter-schadet-der-moral-seiner-nutzer/ )
Twitter 68<br />
[81] Twitter macht Journalisten dumm (http:/ / www. bildblog. de/ 7352/ twitter-macht-journalisten-dumm/ )<br />
[82] http:/ / search. twitter. com/<br />
[83] http:/ / twitter. com/ public_timeline<br />
[84] http:/ / twitter. com/ statuses/ public_timeline. rss<br />
[85] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,474047,00. html<br />
[86] http:/ / www. stefan-borchert. de/ index. php?section=service_twittermarken<br />
[87] http:/ / www. handelsblatt. com/ technologie/ it-internet/ kurznachrichten-forscher-lueften-das-twitter-geheimnis;2584497<br />
[88] http:/ / meedia. de/ nc/ details-topstory/ article/ die-leitmedien-der-deutschen-twitternutzer_100029821. html<br />
[89] http:/ / www. popkulturjunkie. de/ wp/ ?p=4661<br />
[90] http:/ / www. elektrischer-reporter. de/ index. php/ site/ film/ 52/<br />
[91] http:/ / www. tagesschau. de/ multimedia/ video/ video440450. html<br />
[92] http:/ / www. tagesschau. de/ inland/ twitteraffaere100. html<br />
[93] http:/ / planet-interview. de/ montagsfrage-twitter-22062009. html<br />
[94] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=pHsJICVo5dY
XING 69<br />
XING<br />
XING AG<br />
Unternehmensform Aktiengesellschaft<br />
ISIN DE000XNG8888<br />
Gründung 2003<br />
Unternehmenssitz Hamburg, Deutschland<br />
Unternehmensleitung • Dr. Stefan Groß-Selbeck (Vorstandsvorsitzender)<br />
• Dr. Neil Sunderland (Aufsichtsratsvorsitzender)<br />
Mitarbeiter<br />
265 (31. Dezember 2009) [1]<br />
Umsatz 45,1 Mio. € (2009)<br />
Website<br />
xing.com [2]<br />
XING (bis Ende 2006: openBC) ist eine webbasierte Plattform, in der natürliche Personen vorrangig ihre<br />
geschäftlichen (aber auch privaten) Kontakte zu anderen Personen verwalten können.<br />
Die Bezeichnung „XING“ wurde aus Gründen der Internationalisierung gewählt, da der alte Name das englische<br />
Kürzel für "v. Chr." enthielt. [3] Der neue Name XING ist zwar ebenfalls mehrdeutig, soll aber zumindest negative<br />
Assoziationen vermeiden. So bedeutet das Wort auf Chinesisch „es funktioniert“, „es klappt“ (行 [行] xíng). Auf<br />
Englisch steht es als Abkürzung für Crossing, Kreuzung, was als Begegnung von Geschäftskontakten gesehen<br />
werden kann. [4] In einem Interview erklärte der openBC-Gründer Lars Hinrichs, die Aussprache nicht vorgeben zu<br />
wollen. [5]<br />
Das System zählt zur sogenannten sozialen Software und ist eines von mehreren webbasierten sozialen Netzwerken.<br />
Kernfunktion ist das Sichtbarmachen des Kontaktnetzes; beispielsweise kann ein Benutzer abfragen, über „wie viele<br />
Ecken“ – also über welche anderen Mitglieder – er einen anderen kennt, dabei wird das sogenannte<br />
Kleine-Welt-Phänomen sichtbar. Daneben bietet das System zahlreiche Community-Funktionen wie Kontaktseite,<br />
Suche nach Interessengebieten, Foren, Unternehmenswebseiten und 26.000 Fachgruppen.<br />
Unternehmen
XING 70<br />
Kennzahlen<br />
Jahr Umsatz in Mio. € Mitarbeiter<br />
2009 45,1 265<br />
2008 35,3 174<br />
XING wurde 2003 unter dem Namen OpenBC (Open Business Club) durch Lars Hinrichs und Bill Liao gegründet<br />
und zählte laut Geschäftsbericht Ende des 1. Quartals 2010 gut 9 Millionen Benutzer, davon 700.000 mit Premium<br />
Account [6] . 43 % der Basis-Mitglieder (3,74 Mio.) stammten 2009 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz<br />
(DACH), davon geschätzte 3 Mio. allein aus Deutschland [7] . Betrieben wird die Plattform von der Hamburger Xing<br />
AG (bis 9. Juli 2007 unter dem Namen OPEN Business Club AG), die seit 2004 Risikokapital der Econa AG<br />
besitzt [8] und in einer ersten Finanzierungsrunde im Jahre 2005 unter Führung von Wellington Partners 5,7 Millionen<br />
Euro Risikokapital erhalten hat. [3] Eine vorherige Runde mit Business Angels wurde von BrainsToVentures im Mai<br />
2004 organisiert. Die Aktien werden seit dem 7. Dezember 2006 an der Börse gehandelt. [9]<br />
Im Geschäftsjahr 2009 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 45,1 Millionen Euro und lag damit 28 % über<br />
dem Umsatz des Geschäftsjahres 2008. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende ist Dr. Stefan Groß-Selbeck.<br />
Im November 2009 gab das Medienhaus Hubert Burda <strong>Media</strong> bekannt, über sein Tochterunternehmen Burda Digital<br />
insgesamt 1.323.041 Aktien von der Cinco Capital GmbH erworben zu haben. Der Geschäftsführer der Cinco<br />
[10] [11]<br />
Capital GmbH ist Lars Hinrichs. Burda hält damit 25,1% der Aktien von Xing und ist somit Hauptaktionär.<br />
Rund 35% der Aktien befinden sich im Streubesitz.<br />
Funktionsweise<br />
Angemeldete Benutzer können sowohl berufliche als auch private Daten in ein Profil eintragen. Es ist möglich,<br />
Studium, Ausbildung und beruflichen Werdegang in tabellarischer Form darzustellen, eingescannte Zeugnisse und<br />
Referenzen hochzuladen sowie ein Profilbild (z. B. Passfoto) einzustellen. Eine Verpflichtung zum vollständigen<br />
Ausfüllen des Profils mit allen Feldern besteht jedoch nicht. Über diese Informationen hinaus können<br />
Kontaktwünsche als Gesuche und Angebote formuliert werden. Zur Kontaktaufnahme ist es notwendig, dass ein<br />
Kontaktwunsch von der Gegenseite bestätigt wird. Der Benutzer entscheidet selbst, wer welche Informationen (z. B.<br />
Rufnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum) aus seinem Profil zu sehen bekommt.<br />
Die Mitgliedschaft bedingt eine Registrierung. Die kostenlose Mitgliedschaft hat im Gegensatz zur kostenpflichtigen<br />
eingeschränkte Funktionalitäten. Beispielsweise steht die Nachrichtenfunktion nicht in vollem Umfang zur<br />
Verfügung (privater Erhalt ist möglich, man kann die Nachricht auch beantworten, soweit es der Adressat es erlaubt,<br />
initiativ Senden kann man jedoch nicht). Auch die Suchfunktion ist nur mit einem Premium-Zugang vollständig zu<br />
nutzen.<br />
Die Kündigung der kostenlosen Xing-Mitgliedschaft ist nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit<br />
möglich. Sie ist gegenüber Xing zu erklären; dazu kann das Kontaktformular des Supports verwendet werden. Das<br />
Konto wird mit allen eingegebenen Daten vollständig gelöscht.
XING 71<br />
Benutzerfunktionen<br />
Die Benutzerschnittstelle von XING ist mehrsprachig und berücksichtigt in der Suchfunktion Mitglieder mit<br />
gemeinsam gesprochenen Sprachen. Zur Zeit werden folgende Systemsprachen unterstützt: Deutsch, Englisch,<br />
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Chinesisch, Japanisch,<br />
Koreanisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch und Türkisch.<br />
Neben der datenbankorientierten Kontaktpflege bietet XING öffentliche Veranstaltungskalender, die dem Benutzer<br />
thematisch und regional aufbereitet dargestellt werden. Darüber hinaus kann die Terminfunktion auch zur<br />
Organisation privater Termine genutzt werden. Aktuell 32.494 Diskussionsforen (Stand: 3. Juni 2010), die teils<br />
öffentlich, teils nur für einen bestimmten Kreis von Benutzern zugänglich sind, sowie geschlossene Benutzergruppen<br />
mit erweiterten Funktionen für Organisationen und Firmen ergänzen das Angebot.<br />
Ergänzend zum Online-Angebot gibt es zahlreiche Regionalgruppen, die lokale Treffen veranstalten, auf denen<br />
persönliche Kontakte geknüpft werden können. So veranstalteten Mitglieder im Jahr 2009 mehr als 150.000 Events.<br />
XING hat aktuell 155 Ambassadoren (Stand: 3. Juni 2010), die eine herausgehobene Stellung auf der Plattform<br />
einnehmen und als aktive Moderatoren jeweils ihre regionale XING-Gruppe betreuen und regelmäßig offizielle<br />
XING-Events in ihrer Region veranstalten. Eine besondere Stellung haben darüber hinaus 38 Xpert Ambassadoren,<br />
die eine branchenspezifische XING-Gruppe moderieren. Diese Personen müssen explizit über Fachwissen verfügen<br />
und in ihrem Bereich anerkannt sein. Auch sie veranstalten offizielle XING-Events für ihre Branche.<br />
Jeder angemeldete Benutzer von XING hat auch ein eigenes Postfach. Dieses ist allerdings nur über das Xing-Portal<br />
zugänglich. Nutzer können auch direkt Funktionen der Instant-Messaging- und VoIP-Software Skype aufrufen.<br />
Seit dem 12. Oktober 2007 bietet Xing außerdem (bis März 2009 unter dem Label Marketplace) eine Jobbörse an.<br />
Mitglieder der Plattform können dort sowohl selbst Stellenangebote einstellen als auch nach freien Stellen suchen.<br />
Dabei setzt XING als eine der ersten deutschen Jobbörsen auf ein Pay-per-Click-Abrechnungsverfahren. Die Kosten<br />
von Stellenanzeigen werden nicht nach Pauschalen berechnet, sondern danach, wie häufig sie von anderen Nutzern<br />
aufgerufen wurden. Zwischenzeitlich hat XING alternativ auch das branchenübliche Festpreismodell eingeführt.<br />
Die Anmeldung und Nutzung der Grundfunktionen ist kostenlos. Zahlende Mitglieder erhalten unter anderem<br />
erweiterte Such- und Statistik-Funktionen; z. B. kann eingesehen werden, welche anderen Mitglieder die eigene<br />
Kontaktseite aufgerufen haben und welche der eigenen Kontakte innerhalb der letzten zwei Monate eine Änderung<br />
ihrer beruflichen Position zu verzeichnen haben. Premium-Mitglieder können Nachrichten an andere<br />
Xing-Mitglieder versenden, während Basis-Mitglieder nur auf Nachrichten antworten können. Seit April 2010<br />
können auch Basis-Mitglieder eine Statusmeldung auf ihrem Profil anzeigen lassen. Darüber hinaus sind<br />
Premium-Profile werbefrei.<br />
Zielgruppe dieser Plattform sozialer Software sind berufstätige Personen, die ihr Kontaktnetzwerk (Partner, Kunden,<br />
Freunde, Interessenten, Ex-Kollegen, Ex-Kommilitonen etc.) online pflegen. Um Mitglied zu werden, müssen<br />
Internetnutzer das 18. Lebensjahr vollendet haben.<br />
Kritik<br />
Datenschützer bemängeln, dass Teilnehmer in Unkenntnis der Schutzeinstellungsmöglichkeiten ihre eigenen<br />
Kontaktbeziehungen ungeschützt der breiten Öffentlichkeit preisgeben. [12] Es gibt eine Reihe von Webseiten, die<br />
Nutzern Hilfestellungen geben, damit sie die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten behalten. [13]<br />
Durch die Funktion „Mitglieder, die meine Kontaktseite kürzlich aufgerufen haben“, die nur für Premium-User<br />
uneingeschränkt nutzbar ist, wird die eigene Nutzungsweise der Plattform für andere Nutzer bewusst oder unbewusst<br />
sichtbar. Auch die Funktion „Neues aus meinem Netzwerk“ hat unter Mitgliedern heftige Diskussionen ausgelöst. [14]<br />
Weitere Kritik gab es Anfang <strong>Jan</strong>uar 2008, als bekannt wurde, dass auf den Profilseiten Werbung eingeblendet wird,<br />
wenn nicht-zahlende Mitglieder diese aufrufen. Über diese Neuerung fühlten sich die zahlenden Mitglieder nur
XING 72<br />
unzureichend informiert. Aufgrund der zahlreichen Kritik wurde zunächst eine Funktion eingebaut, mit der zahlende<br />
Mitglieder die Werbung auf ihren Profilen unterbinden können. Kurz darauf wurden die Werbeeinblendungen wieder<br />
vollständig abgeschaltet. [15]<br />
Im Mai 2009 ist eine weitere Funktion hinzugekommen, die sich derzeit noch in Entwicklung befindet: Auf der<br />
persönlichen Startseite werden andere XING-Mitglieder angezeigt, die der Nutzer „kennen könnte“. Diese Liste<br />
entsteht automatisch durch einen Vergleich von Profilen anhand von Gemeinsamkeiten wie Beruf, Branche,<br />
Geschäftssitz usw.<br />
Beiträge von Nutzern in Gruppen, deren Sichtbarkeit nicht auf Gruppenmitglieder oder andere Xing-Mitglieder<br />
beschränkt ist, werden in den Suchmaschinen gelistet, wenn das Mitglied sein Profil für Suchmaschinen und<br />
RSS-Feeds freigegeben hat. [16]<br />
Siehe auch<br />
• LinkedIn<br />
Literatur<br />
• Stephan Lamprecht: XING - Networking im Internet. 3. erweiterte Auflage, Heise, Hannover 2008, ISBN<br />
978-3-936931-55-6<br />
• Monika Zehmisch: Cleveres Business Networking mit XING. Data Becker, Düsseldorf 2008, ISBN<br />
978-3-815829-13-4<br />
• Andreas Lutz/Joachim Rumohr: XING optimal nutzen - Geschäftskontakte, Aufträge, Jobs. 2. erweiterte Auflage,<br />
Linde, Wien 2008, ISBN 9783709302804<br />
Weblinks<br />
• xing.com [2] – Offizielles Webangebot<br />
Referenzen<br />
[1] Geschäftsberichte der XING AG (http:/ / corporate. xing. com/ deutsch/ investor-relations/ berichtepraesentationen/ geschaeftsberichte/ )<br />
[2] http:/ / www. xing. com/<br />
[3] Anja Tiedge: " Die Vitamin-B-Maschine (http:/ / www. sueddeutsche. de/ wirtschaft/ -millionen-kontakte-die-vitamin-b-maschine-1.<br />
901800-2/ )" - Artikel in der Süddeutschen Zeitung Online vom 12. Juli 2006<br />
[4] Warum der Name XING? (http:/ / www. xing. com/ cgi-bin/ forum. fpl?op=showarticles& id=2458994) Offizielle Stellungnahme von Lars<br />
Hinrichs<br />
[5] Anja Tiedge: Open BC wird XING- Die gewagte Wandlung (http:/ / www. manager-magazin. de/ it/ artikel/ 0,2828,441067,00. html).<br />
manager-magazin.de, 9. Oktober 2006, abgerufen am 26. Mai 2009: „Wir wollen die Aussprache nicht vorgeben.“<br />
[6] Geschäftsberichte der XING AG (http:/ / corporate. xing. com/ deutsch/ investor-relations/ basisinformationen/ )<br />
[7] gruendungszuschuss.de-Blog, 31. März 2010, XING hat jetzt fast neun Millionen Mitglieder – die interessantesten Zahlen aus dem<br />
Geschäftsbericht (http:/ / www. gruendungszuschuss. de/ ?id=15& showblog=2787)<br />
[8] www.econa.com/portfolio<br />
[9] boerse.ard.de (7. Dezember 2006): OpenBC-Chef ist zufrieden (http:/ / boerse. ard. de/ content. jsp?go=meldung& key=dokument_201170)<br />
[10] Burda wird Hauptaktionär von Xing (http:/ / www. kress. de/ cont/ story. php?id=131394) auf kress.de vom 18. November 2009<br />
[11] XING: Hubert Burda <strong>Media</strong> neuer Hauptaktionär der XING AG (http:/ / www. onlinepresse. info/ node/ 4214) , OnlinePresse.info, 19.<br />
November 2009.<br />
[12] http:/ / www. sicherheitskultur. at/ privacy_soc_networking. htm<br />
[13] http:/ / www. rumohr. de/ blog/ 2007/ die-100ige-privatsphaere-im-xing/<br />
[14] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Neue-Xing-Funktion-weckt-Datenschutzbedenken--/ meldung/ 100149<br />
[15] http:/ / www. werbeblogger. de/ 2008/ 01/ 06/ xing-keine-werbung-auf-den-premium-profilseiten/<br />
[16] http:/ / www. xing. com/ app/ network?op=topic
LinkedIn 73<br />
LinkedIn<br />
Unternehmensform Inc.<br />
Gründung Mai 2003<br />
LinkedIn<br />
Unternehmenssitz Mountain View, CA<br />
Unternehmensleitung Jeff Weiner (CEO) und<br />
Reid Hoffman (Gründer und Chairman of the Board)<br />
Website<br />
linkedin.com [1]<br />
LinkedIn ist ein webbasiertes soziales Netzwerk zur Pflege bestehender Geschäftskontakte und zum Knüpfen von<br />
neuen Verbindungen.<br />
Unternehmen<br />
LinkedIn wurde 2003 in Kalifornien, USA gegründet. Es ist mit über 70 Millionen [2] registrierten Nutzern die<br />
derzeit größte Plattform dieser Art, und gehört laut Alexa zu den 500 weltweit meistbesuchten Websites. Per März<br />
2009 lag LinkedIn in den USA auf Rang 43 der meistbesuchten Websites, [3] weltweit auf Rang 146. [4] Seit dem 4.<br />
Februar 2009 ist das Netzwerk auch in deutscher Sprache verfügbar. [5] Bis dato hat der Anbieter in Deutschland nach<br />
eigenen Angaben rund 500.000 Mitglieder.<br />
Funktionen<br />
• Verlinkung auf eine eigene Website<br />
• Ein Lebenslauf kann hinterlassen werden<br />
• Neue Kontakte können geknüpft werden<br />
• Möglichkeiten andere Mitglieder zu empfehlen<br />
Siehe auch<br />
• XING<br />
Weblinks<br />
• Offizielle Website von LinkedIn [1]<br />
• LinkedIn, Inc. [6] Private Company Valuation mit Listung der Rechtsformen und Aktiensplits<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. linkedin. com/<br />
[2] Latest LinkedIn Facts (http:/ / press. linkedin. com/ about). LinkedIn. Abgerufen am 17. März 2010.<br />
[3] Alexa Country Top 100 - USA (http:/ / www. alexa. com/ site/ ds/ top_sites?cc=US& ts_mode=country& lang=none) (Abgerufen am 8. März<br />
2009)<br />
[4] Alexa Site Info - LinkedIn (http:/ / www. alexa. com/ data/ details/ main/ linkedin. com) (Abgerufen am 8. März 2009)<br />
[5] LinkedIn startet deutschsprachiges Angebot (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ LinkedIn-startet-deutschsprachiges-Angebot--/ meldung/<br />
126845), heise online newsticker, 4. Februar 2009.<br />
[6] http:/ / pedatacenter. com/ pedc/ blog/ view/ 11
MySpace 74<br />
MySpace<br />
URL<br />
MySpace<br />
www.myspace.com [1]<br />
Motto „A Place for Friends“<br />
Kommerziell Ja<br />
Beschreibung Kleine-Welt-Netzwerk<br />
Registrierung für die meisten Dienste erforderlich<br />
Sprachen mehrsprachig<br />
Eigentümer News Corporation<br />
Urheber Thomas Anderson, Chris DeWolfe<br />
MySpace (von englisch „my space“, „mein Raum/Platz“) ist eine<br />
mehrsprachige, werbefinanzierte Website, die ihren Nutzern<br />
ermöglicht, kostenlose Benutzerprofile mit Fotos, Videos, Blogs,<br />
Gruppen usw. einzurichten. Lange Zeit galt MySpace als der<br />
beliebteste Vertreter eines als Website realisierten Sozialen Netzwerks<br />
(Web 2.0). Seit 2008 jedoch zählt einer der Hauptwettbewerber von<br />
Logo der Betaversion<br />
MySpace, das ehemals eher businessnetzwerkorientierte Facebook, mehr Mitglieder. Anfang 2010 hatte MySpace 4<br />
Millionen Mitglieder in Deutschland, während die Zahl der User bei Facebook schon auf 13 Millionen gestiegen<br />
war. [2]<br />
Entstehung und Entwicklung<br />
Ursprünglich war MySpace.com ein Anbieter für kostenlose Datenspeicherung im Internet. Erst im Juli 2003<br />
gründete Tom Anderson die Community unter der gleichen Internetadresse. Das Unternehmen wurde im Juli 2005<br />
vom Medienkonzern News Corporation für 580 Millionen US-Dollar gekauft. MySpace hat laut Angaben in Vanity<br />
Fair vom 12. Juli 2007 etwa 180 Millionen Mitglieder. [3] Das 100-millionste Mitglied hat sich am 9. August 2006<br />
angemeldet. Die Website verzeichnet täglich bis zu 230.000 neue Mitglieder. [4] Im sog. Control Panel findet sich<br />
eine Anzeige der aktuellen Statistiken. Demnach sind momentan etwa 267.794.915 (19. September 2009) Mitglieder<br />
registriert. Die öffentliche Präsentation und soziale Verknüpfung hat laut New Scientist auch schon den<br />
US-amerikanischen Geheimdienst NSA aufmerksam gemacht. [5]<br />
Das Besondere an MySpace war seit Gründung durch Tom Anderson der Schwerpunkt Musik. Anderson nutzte<br />
seine Kontakte zu Künstlern und Bands und überzeugte sie davon, sich „ihren MySpace“ einzurichten. Damit wurde<br />
es möglich, dass Bands und Fans miteinander in Kontakt treten konnten – und das war zu Beginn der größte<br />
Erfolgsfaktor der Website.<br />
Heute werden viele Band-Spaces nicht mehr von den Musikern selbst, sondern von Fanclubs oder dem Management<br />
gepflegt. Dies ist natürlich vor allem bei bekannten Künstlern der Fall. Weniger bekannte Künstler pflegen ihren<br />
Space weiterhin selbst. Sie informieren über das Erscheinen von neuen Alben und Tourneedaten. Auch bieten die<br />
meisten Bands Hörproben einzelner Musikstücke an, manche sogar zum Download. Zusätzlich können sich die<br />
Nutzer eigene Seiten individuell einrichten, um damit etwas von sich preiszugeben, ganz getreu dem Motto „Sehen<br />
und Gesehen werden“. Für viele zählt, möglichst viele „Freundschaften“ zu schließen.
MySpace 75<br />
Durch den Schwerpunkt Musik bildeten sich im Laufe der ansteigenden Popularität auch Szenen in der<br />
MySpace-Community. Da Musiker aus verschiedenen Staaten über MySpace miteinander kommunizieren können,<br />
ist eine länderübergreifende Szeneentwicklung online möglich. Die Musiker, die ähnliche Musik machen, „freunden“<br />
sich an und werben für den jeweils anderen durch Bulletins, Kommentare oder Blogeinträge. [6] Auch ist durch die<br />
Bildung von Szenen eine Möglichkeit für Musiker entstanden, Plattenlabels auf sich aufmerksam zu machen.<br />
Seit dem Kauf der Domain myspace.com durch News Corp. zeichnet sich ein (von Rupert Murdoch auch<br />
angekündigter) Trend dahingehend ab, die Website für andere multimediale Inhalte, vor allem für Filme zu öffnen.<br />
Während Anderson ursprünglich allerdings vorwiegend kleine, unbekannte Künstler für MySpace gewinnen wollte,<br />
zielt Murdochs Strategie auf große, kommerzielle Filmprojekte ab. Inzwischen ist auch eine Compilation-CD<br />
erschienen, auf der ausschließlich Künstler zu hören sind, die über MySpace bekannt geworden sind und bei<br />
MySpace Records unter Vertrag stehen.<br />
Im August 2006 wurde eine Kooperation mit Google vereinbart, die vorsieht, dass die Google-Suche sowie Google<br />
AdSense in MySpace integriert wird. MySpace erhält dafür zwischen 2007 und 2010 mindestens 900 Millionen<br />
Dollar.<br />
Die eindeutige Ausrichtung auf den nordamerikanischen bzw. englischsprachigen Raum hat sich bisher jedoch noch<br />
nicht sichtbar verändert. Daher war MySpace, die laut Alexa Internet sechst-beliebteste englischsprachige und<br />
sechst-beliebteste multilinguale Website, in Kontinentaleuropa eher weniger bekannt. Ende 2006 startete MySpace<br />
eine deutsche Betaversion, die im <strong>Jan</strong>uar 2007 bereits 2,5 Millionen Mitglieder hatte. Im Sommer 2007 wurde eine<br />
separate Österreich-Version bereitgestellt. [7]<br />
Im November 2007 berichteten die Medien über MySpace in Verbindung mit dem Selbstmord von Megan Meier. [8]<br />
Seitdem MySpace 2008 von seinem Hauptkonkurrenten Facebook in Bezug auf die Mitgliederzahl überholt worden<br />
ist, arbeitet das Unternehmen daran, sich stärker von Facebook abzugrenzen. Folgende Aspekte zählen zu den neuen<br />
Alleinstellungsmerkmalen: Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Pflege von bestehenden Kontakten, sondern auf dem<br />
Schließen neuer Bekanntschaften. Weiterhin soll bei MySpace laut Co-Präsident Mike Jones für die User das<br />
kreative Schaffen einer neuen Identität im Vordergrund stehen, da es bei MySpace weniger um das reale Leben geht.<br />
Passend dazu soll das multimediale Image des Netzwerks aufrecht erhalten und weiter ausgebaut werden. Priorität<br />
haben Optionen wie Musik hören, Spiele spielen und Videos schauen. [9]<br />
Kritik<br />
Kritik an MySpace gibt es aufgrund verschiedener Probleme mit Barrierefreiheit, Sicherheitslücken, gefälschten<br />
Profil-Seiten von Prominenten (Fakes), Verbreitung von Drohungen, Rassismus, Spam-Freundschaftsanfragen zu<br />
Werbezwecken und anderem. Ende Februar 2006 gab es Meldungen, dass über 7.000 Account-Daten im Internet<br />
kursieren sollten, da eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde und die Zugangsdaten dadurch ausgespäht werden<br />
konnten. [10]<br />
In Internet-Marketing-Foren werden MySpace-Profile mit tausenden Kontakten verkauft, um es Spammern zu<br />
ermöglichen, kostengünstig sogenannte Bulletins, also Mitteilungen, an alle „Freunde“ zur selben Zeit zu<br />
verschicken. Auch sind bereits Programme (umgangssprachlich: Bots) entwickelt worden, um bis zu 500 Freunde<br />
pro Tag automatisiert einzuladen.<br />
Ende März 2006 wurden rund 200.000 Benutzerseiten aufgrund allzu freizügiger Darstellungen und anderer Gründe<br />
gelöscht. Kritik äußerte sich nach einem Fall von sexuellem Missbrauch nach Kontaktanbahnung über das Portal, so<br />
wurde MySpace als ein „Jagdgrund für Pädophile“ bezeichnet. Aber auch von potenziellen jugendlichen<br />
Amokläufern, die zum Beispiel ihr Waffenarsenal präsentierten, sowie von Drohungen gegen Lehrer, Mitschüler und<br />
Schulen wurde berichtet. [11]<br />
Anfang Dezember 2006 wurden alle vorhandenen Profile mit einer amerikanischen Sexualstraftäter-Datenbank<br />
abgeglichen. Als Grund für dieses Vorgehen wurde genannt, die Benutzer vor Belästigung zu beschützen. Dieses
MySpace 76<br />
Vorgehen hat Kritik bei Datenschützern hervorgerufen. [12]<br />
Ende <strong>Jan</strong>uar 2008 gelang es Unbekannten des Online-Forums TribalWar.com durch eine Sicherheitslücke bei<br />
MySpace Fotos herunterzuladen, die von den jeweiligen Benutzern eigentlich als privat deklariert wurden und nur<br />
von befreundeten Profilen aus zugänglich sein sollten. Über ein Programm wurden rund 44.000 Profile durchlaufen<br />
und etwa 500.000 private Bilder heruntergeladen, welche dann später als 17 Gigabyte große BitTorrent-Datei im<br />
Internet angeboten wurden.<br />
Bei Löschungen von Accounts wird in der Regel lediglich eine Standard-E-Mail verschickt und den Benutzern keine<br />
konkreten Gründe genannt, weshalb dem Unternehmen vorgeworfen wird, willkürlich oder aus weltanschaulichen<br />
Gründen Accounts zu löschen. [13] Auch ein Forum zum Austausch von betroffenen Nutzern wurde inzwischen von<br />
MySpace entfernt. [14] Beispielsweise wurde die religionskritische Atheist and Agnostic Group, die zu einer der<br />
größten Nutzergruppen bei MySpace im weltanschaulichen Bereich angewachsen war, plötzlich und ohne<br />
Vorwarnung entfernt. Zehntausende Benutzer waren betroffen.<br />
Sonstiges<br />
In einer vom Pew Internet & American Life Project [15] am 8. <strong>Jan</strong>uar 2007 veröffentlichten Studie wird deutlich, dass<br />
55 Prozent der amerikanischen Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren sich an sozialen Netzwerken im Internet<br />
beteiligen. Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren nutzen mit 70 Prozent Seiten wie MySpace am meisten. Für sie<br />
sind diese Seiten vor allem Orte, an denen sie bereits bestehende Freundschaften pflegen, während Jungen sie auch<br />
als gute Gelegenheit zum Flirten betrachten. [16]<br />
Einige nordamerikanische und europäische Schulen haben MySpace auf Schulrechnern gesperrt, da viele Schüler<br />
dank Notebooks und WLAN ihre Unterrichtszeit gerne bei MySpace verbringen.<br />
Weblinks<br />
• Offizielle MySpace-Website [1]<br />
• MySpace-Deutschland [17]<br />
• Anleitung zum Aussteigen aus myspace [18]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. myspace. com/<br />
[2] http:/ / www. taz. de/ 1/ netz/ netzoekonomie/ artikel/ 1/ meinraum-wird-kleiner/<br />
[3] Vanity Fair: Wer auf MySpace versagt, wird nicht ins Oval Office kommen. 180 Millionen können nicht irren. (http:/ / www. presseportal. de/<br />
meldung/ 1015092/ ), 11. Juli 2007<br />
[4] CNN: MySpace cowboys (http:/ / money. cnn. com/ magazines/ fortune/ fortune_archive/ 2006/ 09/ 04/ 8384727/ index. htm), 29. August<br />
2006<br />
[5] Spiegel Online: Datenmine der Geheimdienste? (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,420514,00. html), 9. Juni 2006<br />
[6] http:/ / www. simplewelt. com/ 2008/ 01/ myspace-szenen/<br />
[7] Spiegel Online: Spiegel-Gespräch: "Jetzt geht's erst richtig los" (http:/ / www. spiegel. de/ spiegel/ 0,1518,458273,00. html), 12. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[8] Spiegel Online: Spiegel-Bericht: "Cyber-Mobbing: Tod eines Teenagers" (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,518042,00. html),<br />
18. November 2007<br />
[9] http:/ / www. faz. net/ s/ Rub2F3F4B59BC1F4E6F8AD8A246962CEBCD/<br />
Doc~E1A574BE2E40A44E8ACC3AD0EF29564EE~ATpl~Ecommon~Scontent. html<br />
[10] heise online: Myspace-Account-Daten kursieren im Web (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 69872), 21. Februar 2006<br />
[11] Financial Times: MySpace acts to calm teen safety fears (http:/ / www. ft. com/ cms/ s/ 3f8a53d4-c01c-11da-939f-0000779e2340. html)<br />
(englisch), 30. März 2006<br />
[12] Myspace gleicht Nutzerprofile mit Sexualtäter-Datenbank ab (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 82127), 12. Dezember 2006<br />
[13] Peter Mühlbauer: "Bart Simpson Child Fucker". In: Telepolis. Heise, 10. März 2007 ( HTML (http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 24/<br />
24809/ 1. html), abgerufen am 10. März 2007).<br />
[14] http:/ / www. myspace. com/ myspaceprofiledeletions (Zugriff über Google-Cache möglich)
MySpace 77<br />
[15] Pew Research Center: Pew Internet & American Life Project: <strong>Social</strong> Networking Websites and Teens (http:/ / www. pewinternet. org/ PPF/<br />
r/ 198/ report_display. asp)(englisch), 8. <strong>Jan</strong>uar 2006<br />
[16] Financial Times, Aline van Duyn, Teenagers love social networking sites, 8. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[17] http:/ / de. myspace. com/<br />
[18] http:/ / www. ausgestiegen. com/ anleitung-zum-aussteigen-aus-myspace<br />
studiVZ<br />
URL<br />
studiVZ<br />
www.studivz.net [1]<br />
Motto das Studiverzeichnis<br />
Kommerziell Ja<br />
Beschreibung Online-Community für Studenten<br />
Sprachen Deutsch<br />
Eigentümer VZnet Netzwerke Ltd.<br />
Urheber Ehssan Dariani, Dennis Bemmann<br />
Erschienen 11. November 2005<br />
Mitglieder 6,2 Millionen (Stand: November 2009)<br />
studiVZ (kurz für Studiverzeichnis) ist eine Online-Community für Studenten und neben meinVZ und schülerVZ ein<br />
Projekt der VZnet Netzwerke. Das soziale Netzwerk wurde im November 2005 gegründet und war das erste der drei<br />
Projekte. Bis 2009 wurde studiVZ in verschiedenen Sprachen mit separaten Plattformen angeboten, konzentrierte<br />
sich seitdem jedoch ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum.<br />
Geschichte<br />
studiVZ wurde am 11. November 2005 als Projekt der studiVZ Ltd. gegründet. Es war eine Idee von Ehssan Dariani<br />
(CEO). Dennis Bemmann war CTO. Die Seite ähnelte dem englischsprachigen Pendant Facebook sowohl optisch als<br />
auch inhaltlich – einziges Erkennungsmerkmal war die gewählte rote Farbe und das gruscheln.<br />
Das Projekt entwickelte sich als soziales Netzwerk sehr schnell und war ursprünglich für die 2,3 Millionen Studenten<br />
in Deutschland, Österreich und der Schweiz konzipiert. Im Herbst 2006 starteten Ableger von studiVZ für Studenten<br />
in Frankreich (studiQG), Italien (studiLN), Spanien (estudiLN) und Polen (studentIX). Für Schüler wurde im Februar<br />
2007 eigens das schülerVZ gegründet, in dem Schüler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und<br />
Südtirol vernetzt sind. Für Benutzer, welche ihr Studium bereits absolviert haben oder gar nicht studieren, wurde am<br />
28. Februar 2008 eine dritte Plattform namens meinVZ in englischer und deutscher Sprache eröffnet. [2]<br />
Aufgrund des großen Erfolges in den deutschsprachigen Ländern und dem immer größeren Zuwachs an<br />
Nicht-Studenten, wurden mit schülerVZ und meinVZ fast identische Projekte mit einer anderen Zielgruppe gestartet.<br />
Zum 20. <strong>Jan</strong>uar 2009 wurden die Plattformen für Spanien, Italien, Frankreich und Polen eingestellt. [3] Die VZnet<br />
Netzwerke konzentrieren sich seitdem ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum.
studiVZ 78<br />
Das Projekt für Studenten zählte im November 2009 allein 6,2 Mio. registrierte Nutzer. Im ersten Quartal 2008 hatte<br />
studiVZ rund 5,5 Millionen Unique User und gehört damit zu den erfolgreichsten Onlinemedien in Deutschland [4]<br />
und hat einen weltweiten Alexa Rank von 173, in Deutschland von 11 und in Österreich Rang 24 [5] (Stand 7.Oktober<br />
2009).<br />
Entwicklung<br />
Mit studiVZ und meinVZ wurden erstmals zwei Plattformen durch eine Schnittstelle verbunden, so dass – sofern<br />
vom einzelnen Mitglied gestattet – auf Profile von beiden Seiten zugegriffen werden kann. Mit der Plattform<br />
schülerVZ besteht eine solche Verbindung aus Jugendschutzgründen nicht. [6] Auch Verbindungen zwischen den<br />
verschiedensprachigen Plattformen gab es nicht. meinVZ erreichte nach Angabe der FAZ im Juni 2009<br />
3,17 Millionen Mitglieder [7] , von denen jedoch viele nach einer großangelegten „Umzug“-Aktion hierher<br />
gewechselte ehemalige studiVZ-Nutzer sind.<br />
In der Vergangenheit wurde insbesondere in Blogs und Onlinemagazinen, aber auch von verschiedenen größeren<br />
Zeitungen, Kritik am Verhalten der Betreiber geübt. Dies ging soweit, dass Ende 2006 sogar Studentenvertreter vor<br />
der Benutzung von studiVZ warnten. [8] [9] [10] [11] [12] Das schülerVZ wird aufgrund der minderjährigen Klientel<br />
noch kritischer gesehen.<br />
Daraufhin begann studiVZ Anfang 2007 mit der Diskussion eines Verhaltenskodex, dem eine Änderung der<br />
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und technische Verbesserungen folgten. Seit Mai 2007 ist studiVZ<br />
zudem Mitglied der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. (FSM).<br />
Um Phänomenen wie Stalking und Mobbing vorzubeugen, hat der Betreiber ein rund hundertköpfiges Supportteam<br />
eingerichtet, das Verstöße gegen den Verhaltenskodex ahndet.<br />
Funktionen<br />
Das System zählt zur sogenannten Sozialen Software. Es bietet unter anderem die folgenden Funktionen:<br />
• Die Wahl einer Hochschule, an der der Nutzer bzw. die Nutzerin aktuell studiert. Die Auswahl ist nicht optional<br />
und auch bei ausgeblendeten Profilen sichtbar.<br />
• Erstellung eines Profils mit der Möglichkeit, vielfältige Angaben zu machen (Kontaktdaten, Interessen, Hobbys,<br />
gerade besuchte Lehrveranstaltungen usw.).<br />
• Funktion zur Suche nach anderen Studenten, auch über die in Profilen hinterlegten Interessen und<br />
Lehrveranstaltungen (hier unterscheidet man allgemeine Suche, Profilsuche und Gruppensuche).<br />
• Die Projektübergreifende Suche im meinVZ-Projekt<br />
• Anzeige von Verbindungen (Kontakte) zwischen im System registrierten Mitgliedern.<br />
• Bildung von Gruppen mit Gruppen-Diskussionsforen, inzwischen über eine Million. Jedes Mitglied kann bis zu<br />
125 Gruppen betreten. Die Themen der Gruppe sind vollkommen frei wählbar, und variieren von konkreten<br />
Problemstellungen bis zu reinen über den Namen formulierten witzigen Statements.<br />
• Erstellen von Fotoalben und Hochladen von Fotos.<br />
• Foto-Tagging: Einzelne Personen auf Fotos können mit deren Benutzerkonten verlinkt werden.<br />
• Melden: Links an verschiedenen Stellen der Seite, mit denen man die Betreiber auf Regelverstöße durch andere<br />
Nutzer oder Gruppen hinweisen kann.<br />
• Ignorieren: Bestimmte Personen können auf eine Ignorierliste gesetzt werden. Eine anschließende<br />
Kontaktaufnahme bzw. Ansicht des Profils ist dann nicht mehr möglich.<br />
• Plauderkasten: Mit Kontakten, die zur selben Zeit online sind, kann man wie in einem Instant Messenger<br />
chatten. [13]<br />
• Video-Serie „Pietshow“: StudiVZ stellte erstmals von Oktober bis Dezember 2008 insgesamt 15 vierminütige<br />
Folgen (Webisodes) einer fiktionalen Geschichte um den Berliner Filmstudenten Piet online. Die Firma Grundy
studiVZ 79<br />
UFA produzierte die ausschließlich im Internet veröffentlichte Serie. [14] [15] Im März 2009 wurde die Serie für<br />
den International Digital Emmy nominiert, gewann ihn jedoch nicht. [16] Aufgrund des großen Erfolgs der<br />
Webserie bei den VZ-Mitgliedern entschlossen sich die VZnet Netzwerke und Grundy UFA, weitere Folgen zu<br />
produzieren. Seit dem 20. Oktober ist die Pietshow im bewährten Format jeweils dienstags und donnerstags in<br />
neuen Episoden zu sehen. [17]<br />
• Buschfunk ist ein Twitter-ähnlicher Dienst, der ein Versenden von Nachrichten mit einer maximalen Länge von<br />
140 Zeichen erlaubt. Diese Nachrichten werden bei allen "Freunden" auf der Startseite angezeigt. Die Funktion<br />
kann mit Twitter gekoppelt werden, so dass Nachrichten aus dem Buschfunk bei Twitter erscheinen und<br />
umgekehrt.<br />
• Die Partnerfunktion hat den Zweck, das Profil von seinem Partner und sich selbst zu verbinden.<br />
Gruscheln<br />
Ein prägender Begriff für studiVZ ist die Funktion des Gruschelns, der von Ehssan Dariani ersonnen wurde, und<br />
welcher ebenso in die Ableger meinVZ und schülerVZ übertragen wurde. Hierbei handelt es sich um eine Funktion<br />
zur Kontaktaufnahme mit anderen Mitgliedern. Gruscheln hat keine offizielle Definition, es wird jedoch oft durch<br />
Presse und Nutzer als Verbindung der Wörter grüßen und kuscheln interpretiert. Jedem Nutzer steht eine eigene<br />
Interpretation frei. [18] Im Raum der fränkischen Dialekte bedeutet das Wort in der Umgangssprache etwa so viel wie<br />
[19] [20] [21] [22] [23]<br />
kramen oder wühlen im Sinne von suchen.<br />
Datenschutz<br />
Missbrauchsgefahr durch Dritte<br />
Websites mit vielen persönlichen Benutzerdaten wie studiVZ bergen<br />
grundsätzlich die Gefahr, dass unberechtigte Dritte Data-Mining<br />
betreiben. So war es beispielsweise zwei Studenten am<br />
US-amerikanischen MIT-College möglich, mithilfe eines<br />
automatischen Skripts über 70.000 Facebook-Benutzerprofile<br />
herunterzuladen. [24] Auch für studiVZ wird Identitätendiebstahl durch<br />
Kombination der Daten mit anderen sozialen Netzwerken<br />
befürchtet. [25] Tatsächlich gelang es am 9. Dezember 2006, insgesamt<br />
1.074.574 studiVZ-Profile herunterzuladen und damit anschließend<br />
eine Analyse der Profilinformationen zu erstellen. [26] Des Weiteren<br />
wurde ein Programm veröffentlicht, [27] welches es ermöglichte, alle<br />
Logo der Datenschutzkampagne der VZnet<br />
Netzwerke Ltd.<br />
nach der Anmeldung auf studiVZ frei zugänglichen Daten zu speichern und Freundschaftsverbindungen grafisch<br />
darzustellen. Solch ein automatisierter Zugriff auf die Seite wird mithilfe sogenannter Captchas seit dem Dezember<br />
2006 erschwert.<br />
Im Februar 2007 gab es erneut einen Angriff auf die Website, bei dem es dem Angreifer gelungen sein soll,<br />
unmittelbaren Zugriff auf die Datenbank des Systems zu erhalten und so auch an nicht veröffentlichte Daten wie<br />
Passwörter und E-Mail-Adressen der Nutzer zu gelangen. studiVZ hat daraufhin die Passwörter aller Mitglieder<br />
zurückgesetzt und musste die Seite erneut mehrere Stunden vom Netz nehmen. [28]<br />
Im Laufe des Jahres 2009 wurde im Internet ein Programm veröffentlicht, mit dem man die von den VZ-Netzwerken<br />
benutzten Captchas automatisch lösen konnte; dies führte jedoch zu keiner nach Außen hin erkennbaren Änderung<br />
der Sicherheitsmaßnahmen. Bekannt wurden drei Fälle aus dem Oktober 2009, bei denen insgesamt mehrere<br />
Millionen Profile der verschiedenen VZ-Netzwerke [29] , insbesondere des SchülerVZ, mithilfe eines Skriptes<br />
heruntergeladen worden sein sollen. [30] [31] [32] Durch das Ausnutzen verschiedener Sicherheitslücken in den
studiVZ 80<br />
VZ-Netzwerken, war es bis Juli 2009 auch möglich als “privat und nur für Freunde sichtbar″ gekennzeichnete Daten<br />
abzugreifen. [32] Eine entsprechende Datensammlung mit über 100.000 Datensätzen ist im Oktober 2009<br />
aufgetaucht. [33] Die genauen Umstände und Inhalte der Kontakte zwischen den VZnet Netzwerken und dem<br />
Datensammler, sowie den Umständen und Gründen seiner Festnahme und seines Selbstmords in Haft sind unklar. [34]<br />
[35] [36]<br />
Privatsphäre<br />
Dem Nutzer werden Optionen angeboten, die es erlauben, den Zugriff auf sensible Informationen einzuschränken,<br />
allerdings sind diese standardmäßig deaktiviert. Infolgedessen geben viele Benutzer ihr volles Profil der<br />
Öffentlichkeit preis. Je nach Einstellungsoptionen für die Privatsphäre bleiben nur bestimmte Informationen (bspw.<br />
der Name) für Betrachter des Profils sichtbar; für Freunde können weitere Details zugänglich gemacht werden (wie<br />
beispielsweise Verlinkungen auf Fotos). Anmelden kann sich jeder, der über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt.<br />
Beim Anlegen eines eigenen Fotoalbums kann der Benutzer wählen, ob dieses Album nur für ihn, für alle Personen<br />
mit denen er befreundet ist, oder für alle Benutzer sichtbar gemacht werden soll.<br />
Gespeicherte Bilder<br />
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Verwaltung der von Benutzern in Fotoalben hochgeladenen Bilder: studiVZ<br />
speichert diese Bilder in Verzeichnissen auf einem Webserver, wobei ein Teil der Bild-URL mithilfe eines<br />
Hash-Algorithmus bestimmt wird. Da die Bilder ansonsten ungeschützt sind, können sämtliche Bilder, auch die als<br />
privat markierten, von jedem Internetnutzer angesehen werden, dem die URL bekannt ist. Die URLs könnten<br />
beispielsweise im Freundeskreis weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden. Das Verlinken der Bilder auf<br />
anderen Internetseiten wird seit Februar 2009 durch sogenanntes Referrer-Checking erschwert. [37]<br />
Literatur<br />
• Jo Bager: Dabei sein ist alles. Das Phänomen SchülerVZ. In: c't. Nr. 5/2008, Heise, 2008, Report, S. 92 ff<br />
(c't-Archiv [38] , heise kiosk).<br />
Weblinks<br />
• Offizielle Webpräsenz von studiVZ [1]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. studivz. net/<br />
[2] Startschuss für meinVZ – Das neue Netzwerk für alle, die nicht (mehr) studieren (http:/ / www. meinvz. net/ l/ press/ 6). In: meinvz.net.<br />
Abgerufen am 2009.<br />
[3] StudiVZ schließt fremdsprachige Ableger (http:/ / www. chip. de/ news/ StudiVZ-schliesst-fremdsprachige-Ableger_34078550. html). Chip,<br />
17. Dezember 2008, abgerufen am 2009.<br />
[4] Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V.: Ranking der größten Online-Medien (http:/ / de. statista. org/ statistik/ daten/ studie/ 1553/<br />
umfrage/ ranking-der-goeßten-online-medien/ )<br />
[5] Alexa Site Information (http:/ / www. alexa. com/ data/ details/ main/ studiverzeichnis. com)<br />
[6] FAQ zu meinVZ (http:/ / www. studivz. net/ l/ meinvz_faq). In: studivz.net<br />
[7] Stefan Herber: Soziale Netzwerke. Wiedersehen mit alten Bekannten (http:/ / www. faz. net/ s/<br />
Rub2F3F4B59BC1F4E6F8AD8A246962CEBCD/ Doc~E82F9190E67BB4367A9C83251DCE815A5~ATpl~Ecommon~Scontent. html).<br />
FAZ online, 23. Juni 2009, abgerufen am 2009.<br />
[8] AStA FU: http:/ / www. astafu. de/ aktuelles/ archiv/ a_2006/ presse_11-29 FU warnt vor StudiVZ-Nutzung]. Presseerklärung vom<br />
29. November 2006.<br />
[9] AStA Uni-Frankfurt a. M.: Achtung! Datenschutzproblem bei studiVZ! 7. Dezember 2006: AStA mahnt zu vorsichtigem Umgang mit Daten.<br />
(http:/ / www. asta. uni-frankfurt. de/ aktuell/ news/ 340961. html)<br />
[10] AStA Hochschule Vechta: Ist das StudiVZ gefährlich? (http:/ / www. asta-uni-vechta. de/ home/ aktuell/ neuigkeiten/ studivz. html)<br />
[11] AStA FH Münster/Steinfurt: Ärger ohne Ende?! (http:/ / www. astafh. de/ ?p=353''StudiVZ& nbsp;-)
studiVZ 81<br />
[12] RefRat Hu-Berlin: Der ReferentInnenrat warnt vor dem „StudiVZ“ (http:/ / www. refrat. de/ alt/ presse/ pe061124. html). Presseerklärung<br />
des Referentenrat der HU vom 24. November 2006.<br />
[13] Peter, Annette: in Echtzeit mit Freunden quatschen: Der studiVZ Plauderkasten (http:/ / www. studivz. net/ Newsroom/ Detail/<br />
3c106cca66a0e223). In: Newsroom. studivz.net, 23. Oktober 2008, abgerufen am 2009.<br />
[14] Pietshow geht online (http:/ / www. ufa. de/ index. php/ Presse/ PressemitteilungDetail/ myid/ 1015262). Pressemitteilung von Grundy UFA<br />
[15] Web-TV: Pietshow - Gezielt und preiswert (http:/ / www. sueddeutsche. de/ computer/ 327/ 316213/ text/ 5/ ). www.sueddeutsche.de<br />
[16] MIPTV 2009 International Digital Emmy Awards. (http:/ / www. mipworld. com/ en/ MIPTV/ Conferences-events/ Emmy-awards/ )<br />
www.mipworld.com<br />
[17] Blog der VZnet Netzwerke Ltd.: „Ein Blick hinter die Kulissen der PIETSHOW Vol. 2“ (http:/ / blog. studivz. net/ 2009/ 10/ 16/<br />
ein-blick-hinter-die-kulissen-der-pietshow-vol-2/ )<br />
[18] Michel: Antworten von Oliver Skopec auf eure Fragen (http:/ / www. vzlog. de/ 2008/ 08/ antworten-von-oliver-skopec/ ). In: vzlog.de – das<br />
Blog über studiVZ, schülerVZ und meinVZ. 18. August 2008, abgerufen am 3. Februar 2010.<br />
[19] Synonyme bei OpenThesaurus (http:/ / www. openthesaurus. de/ synset/ search?q=gruscheln). 5. September 2009, abgerufen am 2009.<br />
[20] Mundart bei MundMische.de (http:/ / www. mundmische. de/ entry/ show/ 15958-kruscheln). 5. September 2009, abgerufen am 2009.<br />
[21] Abschnitt in Artikel bei kurzreporter.de (http:/ / www. kurzreporter. de/ gruscheln-und-andere-nettigkeiten-des-webs/ ). 5. September 2009,<br />
abgerufen am 2009.<br />
[22] Texte von Walter Rupp verwendet das zugehörige Nomen Gruschel (http:/ / www. keramik-elwedritsche. de/ paelzisch. html). 5. September<br />
2009, abgerufen am 2009.<br />
[23] Ernst Christmann, Julius Krämer, Josef Schwing: Pfälzisches Wörterbuch Band 3, 1998, S. 490, Akademie der Wissenschaften und der<br />
Literatur<br />
[24] Harvey Jones, José Hiram Soltren: Facebook: Threats to Privacy (http:/ / www. swiss. ai. mit. edu/ 6095/ student-papers/ fall05-papers/<br />
facebook. pdf) (2005, PDF-Datei, 1,3 MB)<br />
[25] Dominik Birk, Felix Gröbert: Analyse Sozialer Netzwerke (https:/ / roulette. das-labor. org/ trac/ browser/ labor-talks/ Web_2. 0_Sicherheit/<br />
web-sec-final-ohne-notizen. pdf?format=raw) (2006, PDF-Datei, 4,9 MB)<br />
[26] Hagen Fritsch: studiVZ – inoffizielle Statistikpräsentation (http:/ / studivz. irgendwo. org)<br />
[27] IcePic zum Thema: Mit java bei studiVZ einloggen (http:/ / www. buha. info/ board/ showpost. php?p=374118& postcount=44)<br />
(6. Dezember 2006)<br />
[28] www.focus.de: Daten-GAU bei StudiVZ (http:/ / www. focus. de/ digital/ internet/ online-community_nid_45470. html) (28. Februar 2007)<br />
[29] onlinekosten.de (http:/ / www. onlinekosten. de/ news/ artikel/ 36489/ 0/ SchuelerVZ-Datenklau-Script-Kiddie-am-Werk) Artikel vom 20.<br />
Oktober 2009<br />
[30] heise.de (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ SchuelerVZ-Daten-Der-florierende-Markt-fuer-Datensammelprogramme-833215.<br />
html) Meldung vom 19. Oktober 2009<br />
[31] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,656066,00. html spiegel.de] Meldung vom 19. Oktober 2009<br />
[32] netzpolitik.de (http:/ / www. netzpolitik. org/ 2009/ netzpolitik-interview-sicherheitsluecken-bei-der-vz-gruppe/ ) Meldung vom 20. Oktober<br />
2009]<br />
[33] heise.de (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ SchuelerVZ-Datenlecks-auch-geschuetzte-Informationen-ausgespaeht-843963. html)<br />
Meldung vom 28. Oktober 2009]<br />
[34] SchülerVZ-Datenklau: Verdächtiger begeht Selbstmord (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
SchuelerVZ-Datenklau-Verdaechtiger-begeht-Selbstmord-847178. html)<br />
[35] Anwalt weist Erpressungsversuch gegen SchülerVZ zurück (http:/ / www. dernewsticker. de/ news. php?id=150014& i=iqrqet)<br />
[36] CCC-Jahresrückblick 2009 (http:/ / bat-country. de/ 26C3/ mp4/ 26c3-3690-de-ccc-jahresrckblick. mp4), mp4-Video (1.0 GB), 1:02:50 -<br />
1:10:00<br />
[37] martin: Auf der Suche nach den verschwundenen Fotos (http:/ / developer. studivz. net/ 2009/ 02/ 19/<br />
auf-der-suche-nach-den-verschwundenen-fotos). In: developer.studivz.net where the studiVZ developers blog. 19. Februar 2009, abgerufen am<br />
2009.<br />
[38] http:/ / www. heise. de/ kiosk/ archiv/ ct/ 2008/ 05/ 92_Das-Phaenomen-SchuelerVZ
Flickr 82<br />
Flickr<br />
URL http:/ / www. flickr. com<br />
Kommerziell teilweise<br />
Beschreibung Online-Community, Imagehoster<br />
Flickr<br />
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch, Kantonesisch<br />
Eigentümer Yahoo<br />
Urheber Ludicorp<br />
Erschienen Februar 2004<br />
Flickr (von englisch to flick through something, „etwas durchblättern“, also etwa „Vorrichtung zum Durchblättern“<br />
bzw. „Durchblätterer“ oder von englisch to flicker, „flimmern“) ist ein kommerzielles Web-Dienstleistungsportal mit<br />
Community-Elementen, das es Benutzern erlaubt, digitale und digitalisierte Bilder sowie Videos mit Kommentaren<br />
und Notizen auf die Website zu laden und so anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Neben dem herkömmlichen<br />
Hochladen über die Website können die Bilder auch per E-Mail oder vom Fotohandy aus übertragen und später von<br />
anderen Webauftritten aus verlinkt werden.<br />
Geschichte<br />
Flickr wurde von Ludicorp entwickelt, einem 2002 in Kanada gegründeten Unternehmen mit Sitz in Vancouver.<br />
Ursprünglich war das Hochladen von Bildern nur ein Aspekt des Online-Spiels Game Neverending, [1] das Caterina<br />
Fake und ihr Ehemann Stewart Butterfield programmiert hatten. Diese Komponente kam jedoch besonders gut bei<br />
den Benutzern an, was dazu führte, dass die Arbeiten an dem Online-Spiel eingestellt wurden und Flickr in seiner<br />
heutigen Form entstand. Im März 2005 wurden Flickr und Ludicorp von Yahoo gekauft.<br />
Flickr hat nach eigenen Angaben ca. 5000 Uploads pro Minute und weltweit über 40 Millionen registrierte Benutzer.<br />
Laut der Suchmaschine Alexa gehört Flickr damit zu den 50 am stärksten frequentierten Seiten im Internet. [2]<br />
Seit dem 12. Juni 2007 ist Flickr in verschiedenen Sprachen (auch auf Deutsch) verfügbar.<br />
Am 12. November 2007 wurde das zweimilliardste Foto auf Flickr hochgeladen. Knapp ein Jahr später, am 3.<br />
November 2008, wurde das dreimilliardste Foto online gestellt. [3] Aktuell befinden sich mehr als vier Milliarden<br />
Fotos und Videos im Austausch.<br />
Funktionen<br />
Flickr bietet die Möglichkeit, Fotos in Kategorien (auch Tags genannt) zu sortieren, in sogenannte Pools<br />
aufzunehmen, nach Stichworten zu suchen, sogenannte Fotostreams (Fotoblogs) anderer Benutzer anzuschauen und<br />
Bilder mit Bildausschnitten zu kommentieren.<br />
Darüber hinaus stehen eine Vielzahl von RSS-Feeds zur Verfügung, die die Darstellung der Bilder auf beliebigen<br />
Webseiten oder das Finden neuer Bilder zu einem bestimmten Thema vereinfachen sollen.<br />
Flickr bietet eine spezielle Suchfunktion, um gemeinfreie Bilder und Bilder mit Creative-Commons-Lizenzen zu<br />
finden, die dem Benutzer eine Weiterverarbeitung gestatten.
Flickr 83<br />
Der Entwicklungsstand der zugrundeliegenden Software wurde am 16. Mai 2006 von einer Beta- auf eine<br />
Gamma-Version umgestellt. Am 12. Juni 2007 wurde eine stärkere Lokalisierung, auf Deutsch und sechs weiteren<br />
Sprachen, bekanntgegeben.<br />
Kooperationen<br />
Im November 2009 ging Flickr eine Kooperation mit Snapfish by HP ein. Damit haben Nutzer die Möglichkeit,<br />
Fotoabzüge zu bestellen, Bilder auszudrucken oder Fotoprodukte wie Bücher, Kalender, Grußkarten zu gestalten.<br />
Im Rahmen einer Kooperation mit Getty Images können Flickr-Mitglieder ihre Bilder kommerziell lizenzieren. Über<br />
die in Frage kommenden Bilder entscheiden im ersten Schritt die Bildredakteure von Getty Images. Außerdem hostet<br />
Getty Images die Flickr-Gruppe "Getty Images Call for Artists" [4] , deren Mitglieder ein Portfolio von zehn Bildern<br />
pro Monat einreichen können, um sie für eine Einladung in die Flickr-Sammlung in Erwägung ziehen zu lassen.<br />
Datenschutz und Zugriffsbeschränkungen<br />
Die Benutzer können die Bilder für jeden sichtbar veröffentlichen oder so hochladen, dass nur sie selbst auf die<br />
Bilder zugreifen können. Die Erlaubnis zum Betrachten lässt sich auch auf eine Gruppe anderer Flickr-Benutzer<br />
einschränken. 82 % der Nutzer stellen ihre Bilder aber jedermann zu Verfügung. [5] Die Bilder können unter einer frei<br />
wählbaren Lizenz veröffentlicht werden, darunter auch unter denen der Creative Commons.<br />
Für Benutzer, die sich gratis registriert haben, gelten unter anderem folgende Einschränkungen:<br />
• Hochladevolumen von 100 MB pro Monat<br />
• maximale Fotogröße von 10 MB<br />
• öffentlich im Fotostream angezeigt werden nur die 200 neuesten Fotos<br />
• es besteht kein Zugriff auf die Originaldatei<br />
• maximal 2 Videos pro Monat mit einer Größe von jeweils 150 MB und maximal 90 Sekunden Länge<br />
• Flickr behält sich die Option vor, Zugänge, die mehr als 90 Tage inaktiv waren, zu löschen<br />
• Bilder können maximal in zehn Fotogruppen gleichzeitig eingetragen werden.<br />
Mit dem käuflichen sogenannten Pro Account fallen die genannten Einschränkungen weg, und die maximale<br />
Dateigröße erhöht sich auf 20 MB bei Fotos bzw. 500 MB für Videos. Außerdem kann auf die Originalbilder in<br />
hoher Auflösung zugegriffen werden. Pro-Benutzer können des Weiteren eine unbegrenzte Anzahl Videos auch in<br />
HD-Qualität hochladen und anderen präsentieren.<br />
Tags und Kategorien<br />
Die Möglichkeit, jedes Bild frei zu kategorisieren, mit einer Beschreibung zu versehen und von anderen<br />
kommentieren zu lassen, unterstützt den Anwender beim schnellen Aufbau von Metadaten.<br />
Mit Hilfe von Suchmaschinen, die diese Daten gezielt auswerten können, erhält man ein organisierteres Web, das<br />
von vielen gemeinsam klassifiziert und bewertet wurde. Im Englischen nennt man dieses Phänomen Folksonomy, im<br />
Deutschen passt am besten der Begriff „kollaborative Klassifikation aus Informationswiedergewinnung“.<br />
Flickr bietet Suchfunktionen nach Kategorien. Damit kann man sich z. B. die neuesten Bilder, Weblinks und<br />
Weblog-Artikel zu einem beliebigen Suchbegriff ansehen.<br />
Die Funktion "People in Photos" ermöglicht es außerdem - sofern die Nutzer es in ihren Einstellungen erlauben -<br />
sich gegenseitig auf Fotos zu markieren und mit Namen zu versehen.
Flickr 84<br />
Interaktion und Schnittstellen<br />
Flickr setzt stark auf Ajax, um seine Seiten dynamisch aufzubauen; für die Dia-Shows und andere Anwendungen<br />
wird weiterhin durch Open-Source-Software generiertes Flash benutzt. Die externe Anbindung verschiedener<br />
Anwendungen wie zum Beispiel Weblogs unterstützt Flickr durch offene Schnittstellen. IPTC-Kommentare und<br />
Stichwörter der Bilddaten werden automatisch als "Tags" und Beschreibung übernommen. Flickr-Benutzerseiten und<br />
Kategorien können per RSS und Atom abonniert werden. In den Fotodaten enthaltene GPS-Daten werden von Flickr<br />
automatisch ausgelesen oder können als „Machine-Tags“ vom Benutzer nachträglich angefügt werden. Die<br />
Aufnahmepositionen der Fotos werden auf Karten weltweit dargestellt.<br />
Flickr setzt in diesem Zusammenhang konsequent auf die Verwendung von offenen Standards, so dass viele<br />
Weiterentwicklungen und Verwendungen von Flickr-Bildern oder -Metadaten erst dadurch entstehen, dass die dazu<br />
benötigten Daten an offenen, gut dokumentierten Schnittstellen zur Verfügung stehen.<br />
Kritik<br />
Am 12. Juni 2007 wurde Flickr aktualisiert. Seit diesem Tag werden einige Länder (Deutschland, Hong Kong,<br />
Singapur und Südkorea) in der Suche beschränkt. Maßgebend dafür ist die Yahoo-ID.<br />
„Bitte beachten Sie, dass Sie mit einer Yahoo!-ID aus Deutschland die Suche aus rechtlichen Gründen<br />
lediglich auf die Kategorie „Mittel“ ausweiten können. Eine Suche innerhalb der Kategorie „Eingeschränkt“ ist<br />
daher leider nicht möglich. [...] Die Filter für die sichere Suche greifen auch dann, wenn Sie sich auf Flickr<br />
bewegen. Wenn Sie beispielsweise auf ein Foto stoßen, das nicht in Ihre Einstellungen passt, werden Sie<br />
dieses Foto nicht sehen. (Wenn Sie angemeldet sind, werden Sie nach einer Warnung trotzdem das Foto sehen<br />
können, außer, wenn der Inhalt 'eingeschränkt' ist und Sie unter 18 Jahre alt sind).“<br />
– Flickr Hilfe [6]<br />
Dies stößt vor allem bei der deutschen Community auf starke Ablehnung. Inzwischen haben sich einige Gruppen und<br />
Foren gebildet, die versuchen, Yahoo! zu einer Umkehr zu bewegen.<br />
Eine Stellungnahme von Yahoo Deutschland, was der genaue Grund für die Beschränkungen sei, war bisher nicht zu<br />
erhalten. Es wird vermutet, dass das schwammige deutsche Telemediengesetz – zumindest für Flickr-Nutzer mit<br />
[7] [8]<br />
deutscher Yahoo-ID – der Grund für die restriktive Filterung der Inhalte ist.<br />
Seit dem 9. April 2008 ist es möglich, neben Bildern auch kurze Videosequenzen auf Flickr zu veröffentlichen. Dies<br />
ist auf starken Widerstand bei der Community gestoßen, die eine Abgrenzung von Videoportalen, wie beispielsweise<br />
YouTube, fordert. [9]<br />
Mit dem Hochladen eines Bildes übergibt der Urheber «Yahoo! damit das gebührenfreie, unbefristete,<br />
unwiderrufliche und nicht ausschließliche Recht, einschließlich des Rechts zur Gewährung von Unterlizenzen, diese<br />
Inhalte (ganz oder teilweise) weltweit zu nutzen, zu vervielfältigen, zu modifizieren, anzupassen, zu<br />
veröffentlichen[...]». [10]
Flickr 85<br />
Ähnliche Dienste<br />
Neben Flickr gibt es im Internet noch weitere Imagehoster, die sich im Angebot ähneln. Hier sind beispielsweise<br />
Panoramio, Picasa-Webalben, PBase.com, locr, Ipernity, 23hq oder Fotocommunity zu nennen. [11]<br />
Weblinks<br />
• Flickr.com [12]<br />
• Offizieller Flickr-Blog auf Deutsch [13]<br />
• Unabhängiger Flickr-Blog [14] mit vielen Zusatzinformationen in Deutsch<br />
Referenzen<br />
[1] gnespy.com „Screenshots der originalen Webseite von Game Neverending“ (http:/ / www. gnespy. com/ museum)<br />
[2] alexa.com: „flickr.com - Traffic Details from Alexa“ (http:/ / www. alexa. com/ data/ details/ traffic_details/ flickr. com), abgerufen am 10.<br />
März 2009.<br />
[3] Heather Champ: 3 Billion! (http:/ / blog. flickr. net/ en/ 2008/ 11/ 03/ 3-billion/ ). 3. November 2008, abgerufen am 3. November 2008<br />
(englisch).<br />
[4] http:/ / www. flickr. com/ groups/ callforartists/<br />
[5] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 19/ 19556/ 1. html Artikel vom 28. Februar 2005<br />
[6] http:/ / www. flickr. com/ help/ filters/ #249<br />
[7] http:/ / www. gesetze-im-internet. de/ tmg/ __10. html<br />
[8] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,490006,00. html<br />
[9] http:/ / www. heise. de/ foto/ Viele-Flickr-Nutzer-lehnen-neue-Videounterstuetzung-ab--/ news/ meldung/ 106305<br />
[10] http:/ / info. yahoo. com/ legal/ de/ yahoo/ tos. html<br />
[11] Flickr-Alternativen (http:/ / www. internet-professionell. de/ / praxis/ netzwerke/ article20070704018. aspx)<br />
[12] http:/ / www. flickr. com/<br />
[13] http:/ / blog. flickr. net/ de<br />
[14] http:/ / flickrbuch. wordpress. com
YouTube 86<br />
YouTube<br />
URL<br />
YouTube<br />
www.youtube.com [1]<br />
(Internationale Internetpräsenz)<br />
de.youtube.com [2]<br />
(Deutsche Internetpräsenz)<br />
Motto Broadcast Yourself<br />
Kommerziell Ja<br />
Beschreibung Videoportal<br />
Sprachen 12 Sprachversionen (darunter Deutsch)<br />
Eigentümer Google Inc.<br />
Urheber Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim<br />
Erschienen 14. Februar 2005<br />
YouTube [ˈjuːtuːb oder ˈjuːtjuːb] ist ein am 14. Februar 2005 von den<br />
drei ehemaligen PayPal-Mitarbeitern Chad Hurley, Steve Chen und<br />
Jawed Karim gegründetes Internet-Videoportal mit Sitz in San Bruno,<br />
Kalifornien, auf dem die Benutzer kostenlos Video-Clips ansehen und<br />
hochladen können. Am 9. Oktober 2006 gab Google die Übernahme<br />
von YouTube bekannt.<br />
Auf der Internetpräsenz befinden sich Film- und Fernsehausschnitte,<br />
Musikvideos sowie selbstgedrehte Filme. Sogenannte „Video-Feeds“<br />
können in Blogs gepostet oder auch einfach auf Webseiten über eine<br />
Programmierschnittstelle (API) eingebunden werden. Eine Studie des<br />
Marktforschungsinstituts Hitwise von März 2008 ordnet YouTube 73<br />
Prozent aller Besuche von US-Videoportal-Seiten zu. [3] Das eigene<br />
Videoangebot der Muttergesellschaft Google kommt in dieser Zeit auf<br />
8,4 Prozent.<br />
Seit 2007 führt YouTube jährlich einen Wettbewerb zur Förderung der<br />
Talente auf der Plattform durch. Mit dem Namen „Secret Talents“<br />
(Secret Talents Award) versucht YouTube den großen Castingshows<br />
mit einem Onlinecasting entgegen zu treten. Dem Gewinner winkten<br />
bisher Förderungsbudgets und ein professioneller YouTube-Kanal.<br />
Name<br />
YouTube-Zentrale 2006 in San Mateo,<br />
Kalifornien (1. Etage)<br />
YouTube-Zentrale 2007 in San Bruno,<br />
Kalifornien
YouTube 87<br />
Der Begriffsteil „Tube“ (eigentlich: Röhre) bezeichnet umgangssprachlich einen Fernseher, abgeleitet von der darin<br />
traditionell verwendeten „cathode ray tube“ (dt. Kathodenstrahlröhre). Der Name im Ganzen (wörtlich: DuRöhre)<br />
lässt sich auf Deutsch mit „Du sendest“ wiedergeben.<br />
Verkauf<br />
Das offizielle YouTube-Logo vor der Übernahme durch Google<br />
weiterführen. [4]<br />
Technik<br />
Am 9. Oktober 2006 wurde YouTube vom<br />
Suchmaschinenbetreiber Google für umgerechnet 1,31<br />
Milliarden Euro (in Aktien) gekauft. Die Marke<br />
YouTube soll bestehen bleiben; der Betrieb mit 67<br />
Mitarbeitern – darunter die Gründer Chad Hurley und<br />
Steve Chen – wird die Geschäfte vorerst unabhängig<br />
YouTube verwendet als Webserver Apache, für Bilder und andere statische Inhalte wird eine modifizierte Version<br />
von Lighttpd mit verbesserter Lastverteilung [5] genutzt. Zum Speichern der publizierten Videofilme kommt das<br />
Flash-Video-Format (Dateinamenserweiterung .flv) zum Einsatz. Später begann das Unternehmen allerdings, seine<br />
Videos auch in das H.264-Format zu konvertieren, welches auch Apple nutzt, um auf dem iPhone YouTube-Videos<br />
abspielen zu können. [6] Die entsprechenden Video-Versionen können über einen Link unterhalb der normalen<br />
Version oder durch Anhängen des Parameters &fmt=18 an die Video-URL [7] aufgerufen werden. Seit dem 25.<br />
November 2008 werden geeignete Videos zudem im 16:9-Breitbildformat angezeigt.<br />
Seit Anfang 2010 ist es auch möglich, die Videos nicht mehr im Flash-Format, sondern als HTML5-Video und damit<br />
mit Browser-Bordmitteln anzusehen. Dies kann in den Optionen aktiviert werden. Derzeit unterstützen nur die<br />
Browser Google Chrome und Apples Safari dieses Format. Aber Mozilla Firefox und der Internet Explorer<br />
unterstützen HTML5 schon eingeschränkt. Der Internet Explorer benötigt zusätzlich das Google Chrome-Plugin.<br />
YouTube ist komplett in der Programmiersprache Python realisiert. [8]<br />
Videos ansehen und archivieren<br />
Die Videos lassen sich online als Stream im Webbrowser betrachten. Hierfür ist die Installation des für alle gängigen<br />
Browser kostenlos verfügbaren Adobe-Flash-Plug-ins erforderlich. Seit Anfang 2010 ist es auch möglich Videos<br />
durch den Video und Audio Tag von HTML5 ohne Plugin abzuspielen.<br />
Das dauerhafte Speichern der Videos hatte YouTube weder vorgesehen noch implementiert. Jedoch können zum<br />
lokalen Speichern client-basierte Lösungen wie Bookmarklets [9] und Greasemonkey-Skripte [9] oder server-basierte<br />
Dienste [10] verwendet werden. Auch einfaches Sichern der Videos durch das Kopieren temporärer Dateien ist<br />
möglich. Eine weitere populäre Möglichkeit ist das Herunterladen mithilfe spezieller Software, die die Videos<br />
teilweise auch in andere Dateiformate umwandeln kann. [11]<br />
Beispiele für Flash-Video-kompatible <strong>Media</strong> Player unter Windows sind der <strong>Media</strong> Player Classic (mit FFDShow<br />
Filter [12] ), der VLC media player, der MPlayer und der ausschließlich für .flv-Dateien ausgelegte FLV-<strong>Media</strong><br />
Player. [13] Durch Installation von speziellen Codecs ist die Wiedergabe auch mit den weit verbreiteten Programmen<br />
Windows <strong>Media</strong> Player und Winamp möglich.<br />
Auf YouTube kann jeder Nutzer ein kostenloses Konto anlegen und Videos als Favoriten speichern. Die<br />
Favoritenliste können wiederum andere Nutzer einsehen. Wenn man dies nicht möchte dass andere die eigene<br />
Favoritenliste durchsehen können, lässt sie sich für andere die die Seite besuchen, verbergen.
YouTube 88<br />
Videos publizieren<br />
Videos können zu YouTube in verschiedenen Formaten (wie beispielsweise AVI, MPEG, WMV oder Quicktime)<br />
hochgeladen werden. Empfohlen wird eine Videoauflösung von 480×360 Pixeln oder höher. [14] Die Videos werden<br />
bei der Konvertierung in das Flash-Video-Format (320×240 Pixel) bzw. das H.264-Format (352×244 Pixel)<br />
überführt. Die Skalierung eliminiert eventuelle Qualitätsverluste, die durch eine verlustbehaftete<br />
Formatkonvertierung entstehen können.<br />
Bis Juli 2010 durften die Clips eine Größe von 2 GB haben und mussten kürzer als elf Minuten sein. [15] [16] Mit<br />
einem Director-Konto war es möglich, längere Videos zu publizieren, diese Regelung wurde allerdings aufgehoben.<br />
Nur noch Alt-Director-Kontos und Premium-Partner können längere Videos hochladen. Im Juli 2010 wurde die<br />
maximale Länge auf 15 Minuten angehoben. [17]<br />
Seit Dezember 2008 ist es möglich, Videos in HD hochzuladen und anzusehen. Diese werden in der Auflösung<br />
1280×720 Pixel wiedergegeben, also 720p. Seit Mitte November 2009 wird 1080p unterstützt. [18] Weiterhin ist seit<br />
Juli 2009 das Hochladen in 3D möglich. [19]<br />
Seit Juli 2010 werden von YouTube auch Videos in 4K-Auflösung akzeptiert. Diese sind vier-mal so groß wie<br />
HD-Videos und haben eine Auflösung von 4.096×2.304 Pixel.<br />
Nutzung<br />
Die Popularität von YouTube lässt sich aus der großen Gemeinschaft erklären, die Video-Dateien hochladen,<br />
bewerten und kommentieren kann.<br />
YouTube ist seit seiner Gründung rasant zum führenden Videoportal im Internet aufgestiegen. Im März 2008 ging<br />
man von einem Marktanteil in den USA von etwa 73 Prozent aus.<br />
Nach dem Erfolg von YouTube versuchen in Deutschland die privaten Fernsehsender, auf den Zug aufzuspringen.<br />
Im August 2006 bekannte sich RTL als Initiator der Video-Community Clipfish, nur wenige Wochen später<br />
beteiligte sich ProSiebenSat.1 <strong>Media</strong> mit 30 Prozent am Konkurrenten MyVideo. Dennoch ist YouTube auch in<br />
Deutschland weiterhin Marktführer.<br />
Sprachen und lokale Partner<br />
Das Interface von YouTube ist in zwölf verschiedenen Sprachversionen verfügbar: Chinesisch, Deutsch, Englisch,<br />
Französisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Italienisch,<br />
Tschechisch und Spanisch.<br />
YouTube arbeitet mit nationalen Partnern zusammen, die Material für das Portal bereitstellen. Wer z. B. die deutsche<br />
Version von YouTube ansteuert (de.youtube.com), dem wird auf der Startseite in der Kategorie „Promotete Videos“<br />
Filmmaterial von Partnern wie dem Sender ZDF, dem Fußballverein FC Bayern München oder der Zeitung Financial<br />
Times Deutschland angeboten.<br />
Statistik<br />
Täglich werden etwa 65.000 neue Videos hochgeladen und 100 Millionen Clips angesehen, das entspricht 3 neue<br />
Videos alle 4 Sekunden (Stand: Oktober 2006). [20] Im Oktober 2009 gab das Unternehmen bekannt, über eine<br />
Milliarde Videoabrufe pro Tag zu verzeichnen. [20] [21] Am 17. Mai 2010 berichtete YouTube von mehr als 2<br />
Milliarden Aufrufen pro Tag. [22] Von Nutzern beanstandete oder als anstößig gemeldete Videos werden von<br />
YouTube-Mitarbeitern überprüft und gegebenenfalls gelöscht.<br />
Nach Berechnungen des US-Unternehmens Ellacoya Networks [23] ist YouTube verantwortlich für 10 Prozent des<br />
gesamten Internet-Datenverkehrs und 20 Prozent des HTTP-Aufkommens. [24]
YouTube 89<br />
Sperre in der Türkei<br />
YouTube ist in der Türkei seit dem 5. Mai 2008 gesperrt, weil auf dem Portal ein Video erschien, auf dem sich über<br />
den Staatsgründer der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, lustig gemacht wurde, was nach türkischem Recht seit den<br />
1950er Jahren unter Androhung von Haftstrafe verboten ist (Gesetz Nr. 5816). [25] In der Türkei besteht seit Mai<br />
2007 ein Gesetz, das Gerichten auf Antrag von Staatsanwaltschaften die Sperrung von Internetseiten im<br />
24-stündigen Eilverfahren ohne Verhandlung erlaubt.<br />
Lizenzübertragung an YouTube<br />
In den Geschäftsbedingungen [26] behält sich YouTube vor, hochgeladene Inhalte (Videos) weiterzuverkaufen oder<br />
zu lizenzieren, ohne den Autor vorher fragen zu müssen.<br />
Finanzierung<br />
Im November 2005 erhielt YouTube 3,5 Millionen US-Dollar vom Silicon-Valley-Risikokapitalgeber Sequoia<br />
Capital, der auch Google bei der Anfangsfinanzierung geholfen hatte. Im April 2006 bekam die junge Firma weitere<br />
8 Millionen US-Dollar von Sequoia.<br />
Die Bewertung von YouTube stieg von 600 Millionen US-Dollar im Frühjahr 2006 auf 1,5 Milliarden US-Dollar<br />
bereits im Herbst desselben Jahres, als es von Google für diese Summe übernommen wurde. Laut einem Bericht der<br />
Zeitung New York Post waren Gesellschaften wie Viacom, Disney, AOL, eBay und Rupert Murdochs News Corp. –<br />
die Muttergesellschaft der New York Post – an einem Kauf von YouTube interessiert. Murdochs Medienimperium<br />
hat im Jahre 2005 durch den Kauf des Portals MySpace für 580 Millionen US-Dollar einen neuen<br />
Internet-Kaufrausch eingeläutet. [27]<br />
Nach anfänglicher Zurückhaltung begann YouTube im August 2007 mit Werbeeinblendungen bei Videos<br />
ausgewählter Partner. Videos, die von Privatpersonen hochgeladen wurden, sollen vorerst nicht mit Werbung<br />
gekoppelt werden. [28]<br />
Das Partnerprogramm ist mittlerweile neben den USA auch in Kanada, Großbritannien, Japan, Australien und Irland<br />
verfügbar. Die Voraussetzungen für eine Teilnahme am Partnerprogramm sind das regelmäßige Hochladen von<br />
Originalvideos über deren Rechte man komplett verfügt. Außerdem müssen die Videos laut YouTube von<br />
Tausenden Benutzern geschaut werden. [29]<br />
Am 26. Juni 2008 gab Google Deutschland bekannt, dass das Partnerprogramm nun auch in Frankreich und<br />
Deutschland verfügbar ist. [30]<br />
Bedeutung<br />
In jüngster Zeit lässt sich beobachten, dass sich ein Teil des politischen Diskurses vom klassischen TV-Talkformaten<br />
zu YouTube verlagert. Dort haben die Zuschauer durch die Möglichkeit der Kommentarfunktion die Möglichkeit,<br />
direktes Feedback zu geben. Durch Häufung von Sichtweisen und deren Bewertung durch andere Benutzer lassen<br />
sich auch Mehrheiten zu Themen herauslesen. Ein weiterer Punkt ist die Archivierung von TV-Inhalten als<br />
Quellenreferenz, da diese stets abrufbar bleiben.<br />
Darüber hinaus löste YouTube das in den 90er Jahren boomende Musikfernsehen fast vollkommen ab, welches bis<br />
dahin beinahe exklusiv für die Verbreitung einer globalen Popkultur verantwortlich war.
YouTube 90<br />
Kritik<br />
Video-Qualität<br />
Wie auch beim vergleichbaren Portal Google Video wurde in der<br />
Anfangszeit die meist geringe Qualität der Filme bemängelt.<br />
Mittlerweile ist es jedoch möglich, auf eine höhere Audio- und<br />
Bildqualität (HQ) umzuschalten. Videos werden außerdem im<br />
HD-Format (720p oder 1080p) und seit Juli 2010 auch in der<br />
Auflösung von 4096 × 2304 Pixel (4K2K) unterstützt. [31]<br />
Videos mit fragwürdigem Inhalt<br />
Obwohl es laut den Nutzungsbedingungen [26] von YouTube nicht<br />
erlaubt ist, Videos mit rassistischem und/oder hetzerischem Inhalt<br />
hochzuladen, werden diese Clips, nachdem sie von Zuschauern als<br />
unangebracht deklariert wurden, bisweilen nicht gelöscht, sondern<br />
lediglich nur noch für registrierte Nutzer zugänglich gemacht.<br />
Da bei einer Registrierung keine Altersverifizierung durchgeführt wird,<br />
stößt YouTube vor allem bei Jugendschützern und deutschen Medien<br />
[32] [33]<br />
auf Kritik.<br />
Ein Beitrag von Report Mainz im August 2007 berichtete, dass bei<br />
YouTube diverse rassistische und volksverhetzende Videoclips<br />
verfügbar seien, die trotz mehrerer Hinweise seitens des Reporterteams<br />
und der Jugendmedienschutz-Einrichtung jugendschutz.net nicht<br />
gelöscht wurden. Daraufhin kündigte der Zentralrat der Juden<br />
strafrechtliches Vorgehen gegen YouTube an. [34]<br />
Urheberrechtsverletzungen<br />
Vergleich der Standardqualität mit HQ und HD in<br />
Player- und Originalgröße<br />
Ein weiterer Kritikpunkt liegt darin, dass die Nutzer beim Hochladen von Videos vielfach das Urheberrecht<br />
verletzen. Nach der geltenden amerikanischen Rechtsprechung muss YouTube urheberrechtlich geschützte Inhalte<br />
erst nach einer Abmahnung durch die Rechteinhaber löschen (Opt-Out-Verfahren).<br />
Am 14. Juli 2006 verklagte US-Journalist Robert Tur YouTube auf 150.000 US-Dollar, weil ein von ihm<br />
aufgezeichnetes Video ohne seine Zustimmung veröffentlicht wurde. [35] Im Dezember 2006 forderte ein Konsortium<br />
der japanischen Unterhaltungsindustrie das Videoportal auf, durch japanisches Copyright geschütztes Bild- und<br />
Filmmaterial von der Seite zu entfernen. [36] Im März 2007 kündigte der US-amerikanische Medienkonzern Viacom<br />
eine Schadensersatzklage gegen Google wegen Urheberrechtsverletzungen auf YouTube an. Es gehe dabei um eine<br />
Schadenersatzsumme von einer Milliarde US-Dollar. Zuvor hatte Viacom, zu dem Fernsehsender wie MTV oder<br />
Comedy Central gehören, gefordert, dass mehr als 100.000 Videos von den YouTube-Seiten entfernt werden. [37] Die<br />
Forderungen wurden in erster Instanz zurückgewiesen. [38]<br />
Die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA hatte sich laut einer Pressemitteilung vom 9. November 2007 mit<br />
YouTube LLC auf eine Vereinbarung geeinigt, die zur Nutzung des Weltrepertoires musikalischer Werke auf der<br />
YouTube-Plattform berechtige. Laut dieser Mitteilung ermögliche diese Einigung die Musiknutzung sowohl in<br />
Musikvideos als auch in den von Nutzern erstellten Videos. [39] Diese Vereinbarung ist allerdings zum 31. März 2009<br />
abgelaufen. YouTube-Nutzern aus Deutschland soll seitdem der Zugriff auf Musikvideos von Künstlern, die von der
YouTube 91<br />
GEMA vertreten werden, weitgehend verwehrt bleiben. [40] Im Mai 2010 brach die GEMA die Verhandlungen mit<br />
YouTube ab. [41]<br />
Ende Dezember 2008 hat die Warner Music Group YouTube aufgefordert, alle illegal hochgeladenen Videos zu<br />
löschen. Begründet wird diese Forderung damit, dass man sich mit dem Portalbetreiber Google nicht über ein<br />
Lizenzabkommen habe einigen können. Einige Songs von Warner-Künstlern wurden daraufhin zunächst von der<br />
Seite zurückgezogen. [42] Allerdings stehen beide Parteien in engen Verhandlungen, so dass mit einer baldigen<br />
Rückkehr der Videos auf die Seite gerechnet werden kann. [43]<br />
Authentizität der Inhalte<br />
Ebenso wie andere Online-Dienste mit <strong>Social</strong>-Networking-Charakter wird YouTube zunehmend als Plattform für<br />
Guerilla-Marketing genutzt. Die Authentizität von Inhalten ist häufig nur schwierig zu beurteilen.<br />
Besondere Aufmerksamkeit erregten in der Vergangenheit unter anderem ein politisches Video, das sich kritisch mit<br />
dem ehemaligen US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore und seinem Engagement für eine<br />
Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen beschäftigte, sowie die tagebuchartigen Veröffentlichungen einer<br />
Video-Bloggerin mit Pseudonym lonelygirl15, welche den vermeintlichen Alltag eines vorgeblich streng religiös<br />
erzogenen 16-jährigen US-Teenagers namens „Bree“ zum Inhalt hatten.<br />
In beiden Fällen wurden Videos gezielt von Medienagenturen produziert, jedoch mit dem Anschein verbreitet, von<br />
Privatpersonen hergestellt und veröffentlicht worden zu sein. Kritische Stimmen, die bereits frühzeitig die<br />
Glaubhaftigkeit und den Ursprung der Videos in Frage stellten, hatten zunächst keinen negativen Einfluss auf die<br />
große Aufmerksamkeit und Beliebtheit, die die Veröffentlichungen jeweils erlangten.<br />
Im Falle des Al-Gore-Videos konnten Beziehungen der produzierenden Werbeagentur zum Mineralölkonzern Exxon<br />
und zum Automobilhersteller General Motors aufgezeigt werden. [44] Im Falle lonelygirl15 handelte es sich nach<br />
Auskunft der Produzenten um ein Experiment im Geschichtenerzählen („an experiment in storytelling“). [45] Die<br />
Rolle der „Bree“ wurde von der neuseeländischen Schauspielerin Jessica Lee Rose gespielt.<br />
Auch ein im deutschsprachigen Raum bekanntes Video eines Beifahrers, der 2006 WM-Karten auf der Autobahn<br />
verliert, war gestellt. Solche Videos werden im Netzjargon als Fake oder auch Hoax bezeichnet.<br />
YouTube Secret Talents Award<br />
Der YouTube Award wurde 2007 ins Leben gerufen. Er wurde parallel mit der YouTube-Aktion „Deutschland-Star“<br />
gestartet. Der Wettbewerb dient zur Förderung der Kreativen der Plattform. Nutzer sollen ihr Talent unter Beweis<br />
stellen und laden diese auf die entsprechende Seite hoch. Eine prominente Jury nominiert dann aus den<br />
eingesendeten Videos die Top 25. Die Videos dieser Top 25 werden dann von der YouTube-Gemeinschaft bewertet.<br />
Der Wettbewerb endet mit einer Gala, zu der alle 25 Nominierten eingeladen sind. Hier wird verkündet, wer die<br />
Auszeichnung erhält und somit die meisten Stimmen der Gemeinschaft erhalten hat. Neben dem Secret Talents<br />
Award selbst werden auch die Platzierungen 2 und 3 mit einer Auszeichnung geehrt.
YouTube 92<br />
Auszeichnungen<br />
2007 wurden die Gründer Steve Chen und Chad Hurley von der International Academy of Digital Arts and Sciences<br />
bei der elften Verleihung des Webby Awards als Personen des Jahres mit einem Preis ausgezeichnet. [46]<br />
Literatur<br />
• Jean Burgess and Joshua Green: YouTube : online video and participatory culture, Cambridge [u.a.] : Polity<br />
Press, 2009, ISBN 978-0-7456-4479-0<br />
• Pelle Snickars: The YouTube reader, Stockholm : National Library of Sweden, 2009, ISBN 978-91-88468-11-6<br />
Weblinks<br />
• Deutsche Internetpräsenz von YouTube [47]<br />
• Internationale Internetpräsenz von YouTube [48] (englisch)<br />
• Berichte über Trends und Videos auf YouTube aus Sicht der Medienkunst [49]<br />
• YouTube – Kreativlabor oder Konkurrenz für „alte Medien“? [50] , Tagesschau.de<br />
• Deutsches Interview mit Hurley vom Dezember 2007 auf WELT ONLINE [51]<br />
• Übersicht über Online-Dienste zum Herunterladen von YouTube-Videos [52] (englisch)<br />
• Mächtige Videokonvertierung [53]<br />
• YouTube Secret Talents Award, aktuelle Infos [54]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. youtube. com/ index?gl=EN<br />
[2] http:/ / www. youtube. com/ ?gl=DE<br />
[3] heise.de (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ YouTube-boomt-weiter--/ meldung/ 106537) YouTube boomt weiter, aufgerufen am 15. April<br />
2008<br />
[4] Pressemitteilung von Google zur Übernahme von YouTube (http:/ / www. google. com/ press/ pressrel/ google_youtube. html)<br />
[5] Lighttpd powers 5 Alexa Top 250 sites (http:/ / blog. lighttpd. net/ articles/ 2006/ 12/ 28/ lighttpd-powers-5-alexa-top-250-sites)<br />
[6] iPhone und YouTube (http:/ / www. apple. com/ iphone/ pr/ 20070620youtube. html)<br />
[7] Höhere Videoqualität per URL-Parameter (http:/ / perpetuum-immobile. blogspot. com/ 2008/ 07/ tipp-youtube-videos-in-hoher-qualitt. html)<br />
[8] Folien zu "Unladen Swallow - Python on LLVM" (http:/ / llvm. org/ devmtg/ 2009-10/ Winter_UnladenSwallowLLVM. pdf), einer<br />
Präsentation auf dem LLVM Developer Meeting 2009 (http:/ / llvm. org/ devmtg/ 2009-10/ )<br />
[9] 1024k.de, Video-Bookmarklets (http:/ / 1024k. de/ bookmarklets/ video-bookmarklets. html) Video-Bookmarklets und<br />
Greasemonkey-Skripte (englisch)<br />
[10] FlashLoad.net (http:/ / flashload. net/ ), keepvid.com (http:/ / keepvid. com/ ) und Javimoya.com (http:/ / javimoya. com/ blog/ youtube_en.<br />
php) (englisch)<br />
[11] ClipGrab (http:/ / clipgrab. de/ ), TubeBox (http:/ / tubebox. org/ )<br />
[12] FFDShow (http:/ / ffdshow. sourceforge. net/ tikiwiki/ tiki-index. php?page=Getting+ ffdshow), sourceforge.net<br />
[13] FLV-Player (http:/ / www. download. com/ FLV-Player/ 3000-2139_4-10467081. html), download.com<br />
[14] YouTube-Hilfe über Qualitätsempfehlungen: http:/ / help. youtube. com/ support/ youtube/ bin/ answer. py?answer=91450& topic=10526<br />
(Link nicht mehr aufrufbar)<br />
[15] http:/ / help. youtube. com/ support/ youtube/ bin/ answer. py?answer=55743& topic=10527<br />
[16] YouTube-Blog: Upload Size Doubles + HD Tips (http:/ / youtube-global. blogspot. com/ 2009/ 07/ upload-size-doubles-hd-tips_8074. html)<br />
[17] http:/ / www. chip. de/ news/ YouTube-Videos-duerfen-nun-15-Minuten-lang-sein_44068282. html<br />
[18] http:/ / youtube-global. blogspot. com/ 2009/ 11/ 1080p-hd-comes-to-youtube. html<br />
[19] http:/ / blogoscoped. com/ archive/ 2009-07-20-n37. html<br />
[20] heise.de: YouTube: Über 1 Milliarde Videoabrufe pro Tag (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
YouTube-Ueber-1-Milliarde-Videoabrufe-pro-Tag-821259. html) (abgerufen am 11. Oktober 2009)<br />
[21] YouTube Blog: Y,000,000,000uTube (http:/ / youtube-global. blogspot. com/ 2009/ 10/ y000000000utube. html) (englisch, abgerufen am 11.<br />
Oktober 2009)<br />
[22] YouTube Blog: 2 Milliarden aufrufe pro Tag (http:/ / youtube-global. blogspot. com/ 2010/ 05/ at-five-years-two-billion-views-per-day.<br />
html) (englisch, abgerufen am 17. Mai 2010)<br />
[23] Ellacoya Data Shows Web Traffic Overtakes Peer-to-Peer (P2P) as Largest Percentage of Bandwidth on the Network (http:/ / www.<br />
ellacoya. com/ news/ pdf/ 2007/ NXTcommEllacoya<strong>Media</strong>Alert. pdf) (PDF), ellacoya.com, aufgerufen am 18. Juni 2007
YouTube 93<br />
[24] YouTube beansprucht ein Zehntel der Web-Bandbreite (http:/ / www. zdnet. de/ news/ tkomm/ 0,39023151,39155501,00. htm), zdnet.de,<br />
aufgerufen am 21. Juni 2007<br />
[25] „YouTube completes a year of being blocked in Turkey“ (http:/ / www. unhcr. org/ refworld/ publisher,RSF,,TUR,4a07cce619,0. html)<br />
[26] Nutzungsbedingungen von YouTube (http:/ / www. youtube. com/ t/ terms)<br />
[27] Kaufinteressen von YouTube (http:/ / search. nypost. com/ search?q=YouTube+ Google+ AND+ daterange:2006-01-01. . 2006-12-01&<br />
partialfields=section:. webtype:& sort=date:D:S:d1& getfields=*& filter=0& client=redesign_frontend& proxystylesheet=redesign_frontend&<br />
output=xml_no_dtd) (englisch)<br />
[28] Werbung soll YouTube profitabel machen (http:/ / www. faz. net/ s/ RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/<br />
Doc~EED8B834A359F4072A82E56C570D02C46~ATpl~Ecommon~Scontent. html?rss_googlefeed)<br />
[29] http:/ / www. google. com/ support/ youtube/ bin/ answer. py?hl=de& answer=82839<br />
[30] http:/ / www. lifepr. de/ pressemeldungen/ google-germany-gmbh/ boxid-51790. html<br />
[31] YouTube-Videos nun auch in Über-Full-HD (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
YouTube-Videos-nun-auch-in-Ueber-Full-HD-1036192. html) bei Heise-Online, vom 10. Juli 2010<br />
[32] jugendschutz.net: Nazi-Musikvideos auf einer der beliebtesten Internetseiten (http:/ / www. jugendschutz. net/ news/ 200607/<br />
news_06-07-09_18-44-28_fs. html)<br />
[33] Spiegel.de: YouTube zeigt Nazi-Videos (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ politik/ 0,1518,426030,00. html)<br />
[34] Spiegel Online: Zentralrat der Juden droht YouTube mit Anzeige (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,502093,00. html)<br />
[35] heise.de Newsticker Meldung (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 75673)<br />
[36] Presseerklärung der JASRAC (http:/ / www. jasrac. or. jp/ release/ 06/ 12_2. html) vom 4. Dezember 2006<br />
[37] Die Welt: Milliarden-Klage gegen YouTube (http:/ / www. welt. de/ webwelt/ article759693/ Milliarden-Klage_gegen_YouTube. html),<br />
aufgerufen am 13. März 2007<br />
[38] Urheberrechtsklage: Viacom verliert vor Gericht gegen Google (http:/ / www. golem. de/ 1006/ 75986. html)<br />
[39] gema.de (http:/ / www. gema. de/ presse/ pressemitteilungen/ archive/ 2007/ / select_category/ 13/ ) GEMA und YouTube erzielen<br />
entscheidende Einigung, aufgerufen am 5. Juli 2008<br />
[40] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 135532<br />
[41] http:/ / www. tagesschau. de/ wirtschaft/ youtube124. html<br />
[42] http:/ / www. digitalfernsehen. de/ news/ news_697747. html<br />
[43] (http:/ / www. boersennews. de/ nachrichten/ artikel/ presse-musikvideos-von-warner-music-bald-wieder-bei-youtube/ 120218209/ 1000)<br />
Musikvideos von Warner Music bald wieder bei YouTube<br />
[44] Slick lobbying is behind penguin spoof of Al Gore (Times Online) (http:/ / www. timesonline. co. uk/ article/ 0,,11069-2299550,00. html),<br />
aufgerufen am 5. August 2006<br />
[45] „Lonelygirl15: Just Another Web Scam“ (TheFirstPost.co.uk) (http:/ / www. thefirstpost. co. uk/ index. php?menuID=2& subID=903& p=2),<br />
aufgerufen am 19. September 2006<br />
[46] Heise.de: David Bowie bekommt „Internet-Oscar“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 89106), aufgerufen am 1. Mai 2007<br />
[47] http:/ / www. youtube. com/ ?gl=DE& hl=de<br />
[48] http:/ / www. youtube. com/ index?gl=EN& hl=en<br />
[49] http:/ / www. bittekunst. de/ category/ bewegtes/ videokunst/ youtube-und-co/<br />
[50] http:/ / www. tagesschau. de/ ausland/ meldung105482. html<br />
[51] http:/ / www. welt. de/ webwelt/ article1444299/ Wir_wollen_auf_jeden_Bildschirm. html<br />
[52] http:/ / robertpeloschek. blogspot. com/ 2006/ 11/ downloading-and-converting-youtube. html<br />
[53] http:/ / www. dvdvideosoft. com/ de/<br />
[54] http:/ / Youtube. com/ secrettalents
Wiki 94<br />
Wiki<br />
Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“ [1] ), seltener auch WikiWiki oder WikiWeb genannt, ist ein Hypertext-System für<br />
Webseiten, dessen Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt im Browser geändert<br />
werden können. Diese Eigenschaft wird durch ein vereinfachtes Content-Management-System, die sogenannte<br />
Wiki-Software oder Wiki-Engine, bereitgestellt. Zum Bearbeiten der Inhalte wird meist eine einfach zu erlernende<br />
Auszeichnungssprache verwendet. Die bekannteste Anwendung ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, welche die<br />
Wiki-Software <strong>Media</strong>Wiki einsetzt und teilweise umgangssprachlich auch kurz als „Wiki“ bezeichnet wird.<br />
Konzeption<br />
Wikis ermöglichen das gemeinschaftliche Arbeiten an Texten. Ziel eines Wikis ist es im Allgemeinen, die Erfahrung<br />
und den Wissensschatz der Autoren kollaborativ auszudrücken (Kollektive Intelligenz). Sie können sowohl auf<br />
einem einzelnen Rechner (beispielsweise in Form eines sogenannten Desktop-Wiki) als auch in lokalen Netzwerken<br />
oder im Internet eingesetzt werden. Auch wenn das Konzept vor allem in Verbindung mit der<br />
Freie-Inhalte-Bewegung bekannt wurde und in dieser ein zentrales Medium zur Inhaltserstellung darstellt, nutzen<br />
auch Hersteller proprietärer Inhalte Wikis als Arbeits- und Präsentationssystem.<br />
Eine wesentliche Funktion der meisten Wiki-Softwares (darunter <strong>Media</strong>Wiki und das oft innerhalb von<br />
Unternehmen verwendete TWiki) ist die Versionsverwaltung, die es den Benutzern im Fall von Fehlern oder<br />
Vandalismus erlaubt, eine frühere Version einer Seite wiederherzustellen. Wie bei Hypertexten üblich, sind die<br />
einzelnen Seiten eines Wikis durch Querverweise (Hyperlinks) miteinander verbunden; zur Vernetzung<br />
verschiedener Wikis dient das Verfahren der InterWiki-Verweise.<br />
Wikis gehören zu den Content-Management-Systemen (CMS), setzen aber – im Unterschied zu teils genau<br />
geregelten Arbeitsabläufen (engl. workflow) in Redaktionssystemen – auf die Philosophie des offenen Zugriffs. [2]<br />
Die Änderbarkeit der Seiten durch jedermann setzt eine ursprüngliche Idee des World Wide Web konsequent um.<br />
Jedoch nicht jedes Wiki ist öffentlich lesbar oder schreibbar, es gibt auch Systeme, die eine Zugriffssteuerung für<br />
bestimmte Seiten und Benutzergruppen erlauben.<br />
Ein wesentlicher Unterschied zu typischen<br />
Content-Management-Systemen ist, dass bei Wiki-Software weniger<br />
Wert auf ein differenziertes Layout der Webseiten, als vielmehr auf<br />
eine auch für Laien möglichst einfache Formatierbarkeit gelegt wird.<br />
Dazu dient oft die Verwendung einer speziellen einfachen<br />
Auszeichnungssprache, der sogenannte Wikitext.<br />
Wikis sind im Gegensatz zu klassischen CMS dann sinnvoll, wenn eine<br />
hohe Anzahl an Nutzern Informationen einstellt. Ein Wiki entfaltet<br />
seine volle Wirkung meistens erst dann, wenn eine kritische Masse<br />
erreicht ist. In diesem Fall kann ein Wiki zu einem „Selbstläufer“<br />
werden.<br />
Einfache Wikitext-Beispiele im<br />
Bearbeiten-Modus von TiddlyWiki<br />
Die meisten Systeme sind als Freie Software veröffentlicht, oft unter einer Version der gebräuchlichen GNU General<br />
Public License (GPL). Viele Wiki-Software Systeme sind modular aufgebaut und bieten eine eigene<br />
Programmierschnittstelle, welche dem Benutzer ermöglicht, eigene Erweiterungen zu schreiben, ohne den gesamten<br />
Quellcode zu kennen.
Wiki 95<br />
Anwendungen<br />
Die ersten Wikis wurden Mitte der 1990er Jahre von Software-Designern zur Produktverwaltung in IT-Projekten<br />
entwickelt. Heute kommen Wikis in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, bei denen inhaltliche Flexibilität<br />
mehr als Repräsentanz zählt. Dazu gehören Dokumentationen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.<br />
Wissensmanagement<br />
Siehe auch im speziellen Artikel Enterprise Wiki.<br />
In der Wirtschaft dienen Wikis häufig zum Wissensmanagement, mit den Zielen, erhöhte Transparenz des<br />
vorhandenen Wissens herzustellen, Prozesse zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Hierbei ist gegebenenfalls das<br />
Engagement der Mitarbeiter unverzichtbar. Der finanzielle Aufwand ist dagegen meist niedriger als bei<br />
herkömmlichen Systemen der Wissenskonservierung.<br />
Ein Haupteinsatzgebiet für Wikis im Wissensmanagement ist die Softwareentwicklung, was auf die thematische<br />
Nähe zurückzuführen ist. [3] Hier werden die Systeme etwa zur kollaborativen Erstellung von Dokumentationen, zur<br />
Verwaltung von Softwarefehlern oder zum Austausch der Mitarbeiter eingesetzt. Insbesondere in<br />
Open-Source-Entwicklungsprojekten werden Wikis zur Koordination der Entwickler verwendet, etwa bei Apache<br />
oder OpenOffice.org.<br />
Klassifizierung<br />
Grundsätzlich können unternehmensinterne Wikis in zwei Gruppen eingeteilt werden:<br />
• Unternehmens- bzw. Abteilungswikis versuchen das Wissen eines Unternehmens bzw. einer Abteilung zu<br />
erfassen.<br />
• Projektbezogene Wikis dagegen sind speziell auf ein einzelnes Projekt zugeschnitten.<br />
Einige Wikis kombinieren beide Typen und ermöglichen die Einrichtung von sogenannten Spaces, um Projekte<br />
voneinander inhaltlich und benutzerrechtlich zu trennen. [4] Welche dieser Formen zum Einsatz kommt, hängt von<br />
verschiedenen Kriterien ab:<br />
Dauerhaftigkeit<br />
Interesse<br />
Unternehmens- und Abteilungswikis bieten sich vor allem an, wenn es um Wissen geht, das langfristig<br />
konserviert werden soll. Projekte dagegen haben oft nur eine begrenzte Lebensdauer.<br />
Informationen aus einzelnen Projekten oder Abteilungen sind längst nicht für jeden Mitarbeiter interessant.<br />
Geheimhaltung<br />
Informationen sollen aus Geheimhaltungsgründen nur bestimmten Personen zugänglich gemacht werden (z. B.<br />
den Beteiligten an einem Projekt).
Wiki 96<br />
Desktop-Wikis<br />
Einige Wiki-Engines sind nicht als Groupware zur Bedienung über das WWW, sondern zur persönlichen<br />
Informationsorganisation gedacht. Beispiele dafür sind org-mode für Emacs, AcroWiki für Palm OS, Tomboy und<br />
Zim Wiki für Linux, VoodooPad für Mac OS X, Gluebox plattformunabhängig, ConnectedText und WikidPad für<br />
Windows, sowie TiddlyWiki, das client-seitig (ohne Server) als JavaScript in jedem Browser läuft.<br />
Geschichte<br />
Die Entwicklung des Wikis als Medium ist eng mit dem World Wide Web verbunden. Es wurde erst durch dieses zu<br />
einem Erfolgsmodell, auch wenn seine Vorläufer bis in die 1970er Jahre zurückgehen.<br />
Vorläufer<br />
Einer der ersten Vorläufer des Wikis war das in der Carnegie-Mellon University 1972 entwickelte<br />
ZOG-Datenbanksystem, das für mehrere Nutzer ausgelegt war und die Daten in strukturierten Textrahmen darstellte,<br />
verbunden waren sie durch Hyperlinks. Dieses System wurde 1981 von Donald McCracken und Robert Akscyn zum<br />
Knowledge Management System (KMS) erweitert, bei dem Änderungen an den Datenblättern im gesamten<br />
Netzwerk sofort sichtbar wurden. In diesem System waren bereits Grafiken und Bilder integrierbar, auch sie konnten<br />
mit Hyperlinks versehen werden.<br />
Ebenfalls auf ZOG basierte der Document Examiner von <strong>Jan</strong>et Walker, der ab 1985 zur Darstellung von<br />
Computer-Anleitungen verwendet wurde. Dieses Hypertextsystem, bei dem die Texte in einem scrollbaren<br />
Bildschirmfenster dargestellt wurden, wurde im selben Jahr von Xerox zum Note Cards-System weiterentwickelt,<br />
aus dem schließlich 1987 das HyperCard-System von Apple (zunächst unter dem Namen WildCard) hervorging.<br />
Dieses System beeinflusste Ward Cunningham bei seinem WikiWikiWeb entscheidend, da es beispielsweise bereits<br />
verschiedene Typen von Cards ermöglichte, von denen eine Gruppe für Benutzer, eine für Projekte und eine für die<br />
Ideen selbst stehen konnte. Ebenfalls war in Cunninghams Weiterentwicklung des Systems das Anlegen neuer<br />
Karten durch das Klicken auf Links auf nichtvorhandene Inhalte möglich. [5]<br />
Tim Berners-Lee, der ab 1989 entscheidende Beiträge zu HTML und zum World Wide Web leistete, hatte zu Beginn<br />
seiner Arbeiten an Hypertextsystemen ähnliche Ideen verfolgt, da seiner Meinung nach dieses Instrument vor allem<br />
zur kollaborativen Erstellung von Texten in der Wissenschaftsgemeinde verwendet werden sollte.<br />
Konsequenterweise war Berners-Lees erster Browser WorldWideWeb (1990/91) sowohl zum Darstellen als auch<br />
zum Bearbeiten von Websites geeignet. In historischer Perspektive beschreibt er seine Ideen in seinem Buch<br />
„Weaving The Web“ (deutsche Lehnübertragung „Der Web-Report“). [6] Dennoch setzte sich im Web zunächst die<br />
nichtkollaborative Erstellung von Websites durch, die durch restriktive Benutzerrechte für die Seiten auf den Servern<br />
erreicht wurde.
Wiki 97<br />
Das WikiWikiWeb<br />
Das erste im Web gehostete wirkliche Wiki, WikiWikiWeb, wurde vom US-amerikanischen Softwareautor Ward<br />
Cunningham als Wissensverwaltungswerkzeug im Rahmen der Entwurfsmuster-Theorie 1994 auf Basis der<br />
HyperCard-Systeme konzipiert. Es befasste sich mit Softwaredesign im Rahmen der objektorientierten<br />
[7] [8] [9]<br />
Programmierung. Am 25. März 1995 wurde es über das Internet der Öffentlichkeit verfügbar gemacht.<br />
Den Namen wählte Cunningham, da er bei der Ankunft am Flughafen<br />
auf Hawaii die Bezeichnung Wiki Wiki für den dortigen Schnellbus<br />
kennengelernt hatte. Dabei übernahm er die Verdoppelung, die im<br />
Hawaiischen für eine Steigerung („sehr schnell“) steht. Cunningham<br />
betrachtet Wiki weiterhin als eine Abkürzung für den eigentlichen<br />
Namen WikiWikiWeb. [10]<br />
Cunninghams Konzept stieß in der Software-Entwicklergemeinde auf<br />
reges Interesse, das schnell anwuchs. So umfassten die Seiten des<br />
WikiWikiWeb im Dezember 1995 bereits 2,4 MB Speicherplatz, Ende<br />
1997 waren es 10 MB und Ende 2000 62 MB. [11]<br />
Wikis in den späten 1990er Jahren<br />
Wiki-Wiki-Bus am Flughafen Honolulu<br />
Bereits kurze Zeit nach der Inbetriebnahme des WikiWikiWeb entstanden erste Klone der Software. Wikis<br />
entwickelten sich schnell zu einem beliebten Instrument in der Szene rund um die Freie Software, in der sie als<br />
Instrument zur Unterstützung der Kommunikation und der Ideenorganisation unter den Entwicklern genutzt wurden.<br />
Auch Cunningham unterstützte diese Entwicklung, indem er einen eigenen Klon seiner Software, Wiki Base genannt,<br />
veröffentlichte. Dennoch kam es bald zu Spannungen zwischen WikiWikiWeb und einigen Klonen, da Cunningham<br />
erwartete, dass die Nutzer von Wiki Base eigene Verbesserungen in den Quellcode seines eigenen Wikis einfügen,<br />
was aber nur selten geschah. [11]<br />
Einer der bedeutendsten Klone von Wiki Base war das 1997 von Peter Merel geschriebene CvWiki, aus dem 1999<br />
das UseModWiki hervorging, das bis heute im MeatballWiki, einem der populärsten Software-Wikis verwendet<br />
wird. UseModWiki war auch in der Anfangszeit der Wikipedia deren Wiki-Engine, bis es 2002 von <strong>Media</strong>Wiki<br />
abgelöst wurde. 1998 wurde mit TWiki die erste Wiki-Software auf Basis von Textdateien veröffentlicht, dieses<br />
System eignet sich vor allem für kleinere Wikis (z. B. Desktop- und Firmenwikis), in denen so eine höhere<br />
Performance erreicht werden kann. 1999 erschien mit PhpWiki die erste Wiki-Engine auf Basis der<br />
Programmiersprache PHP.<br />
Bis 2001 waren Wikis als Medium weitgehend auf die Software-Entwicklerszene beschränkt, weshalb das<br />
öffentliche Interesse an ihnen außerhalb dieser spezialisierten Szene begrenzt war. [12] Dennoch wurden mit anderen<br />
Softwarekonzepten bereits kollaborative Webportale mit ähnlichen Zielen, wie Everything2, entwickelt. Das erste<br />
echte Wiki-Portal, das zu einem anderen Thema als Software entwickelt wurde, war der Online-Reiseführer<br />
World66, gegründet im Jahr 1999 von einem niederländischen Unternehmen, das als eines der ersten das Konzept<br />
der Freien Inhalte in ein profitables Geschäftsmodell zu integrieren versuchte.<br />
Zwischen 1998 und 2000 kam es im WikiWikiWeb selbst zu Spannungen, als sich die Beiträge immer weiter vom<br />
ursprünglichen Thema des Wikis entfernten. Es kam so zu einer Konfrontation zwischen zwei Gruppen: Während<br />
die WikiReductionists den Schwerpunkt des Wikis weiterhin auf der objektorientierten Softwareprogrammierung<br />
sehen wollten, sollte nach der Meinung der WikiConstructionists auch Platz für andere, allgemeinere Themen im<br />
WikiWikiWeb sein, insbesondere für solche, die das Wiki-Konzept als solches betrafen (sogenannte<br />
WikiOnWiki-Themen). [13] Dies führte im Jahr 2000 zur Spaltung und zur Gründung des MeatballWiki, das sich<br />
neben der Diskussion der Wiki-Idee selbst auch mit allgemeineren Themen wie dem Urheberrecht oder der<br />
Cyberpunk-Bewegung befasste. Das MeatballWiki und einige andere in diesem Streit entstandenen Websites wurden
Wiki 98<br />
als SisterSites bezeichnet und vom WikiWikiWeb aus direkt verlinkt. Aus diesem Wiki stammen zahlreiche Ideen,<br />
die die Popularisierung der Wiki-Idee fördern sollten, wie der TourBusStop, eine Tour durch verschiedene Wikis,<br />
der WikiNode als Knotenpunkt eines Wikis und der WikiIndex als Datenbank möglichst aller Wikis.<br />
Wikipedia und die Popularisierung des Konzeptes: 2001 bis 2005<br />
Die Popularisierung des Wiki-Konzeptes geht auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia zurück. Zwischen 1999 und<br />
2000 hatte das US-amerikanische Unternehmen Bomis die Idee einer im Internet erstellten Enzyklopädie entwickelt.<br />
Dem Nupedia-Projekt, das 2000 gestartet wurde, war jedoch zunächst kein Erfolg beschieden, da der Prozess der<br />
Erstellung der Einträge auf dem Peer-Review-Prozess fußte und damit sehr langwierig war. Gegen Ende des Jahres<br />
wurde daher von den Bomis-Gründern Jimmy Wales und Larry Sanger eine Wiki-Erweiterung entwickelt, die am 15.<br />
<strong>Jan</strong>uar 2001 auf der separaten Domain wikipedia.com online ging und sich noch im Laufe des Jahres, besonders nach<br />
einer Meldung im Onlinemagazin Slashdot zu einem großen Erfolg entwickelte. Im selben Jahr wurden andere<br />
Sprachversionen gestartet. Bis 2005 wuchs die Zahl der Seiten auf über eine Million an und Wikipedia wurde zu<br />
einer der meistbesuchten Websites überhaupt.<br />
Um die wachsenden Ansprüche der Wikipedia erfüllen zu können, wurde 2002 die <strong>Media</strong>Wiki-Software entwickelt.<br />
Diese führte als Neuerung ein, dass die Links erstmals freien Text erhalten konnten, davor war die sogenannte<br />
CamelCase-Schreibweise üblich, in der die Wörter nicht durch Leerzeichen getrennt wurden. <strong>Media</strong>Wiki war<br />
besonders auf Skalierbarkeit angelegt, um die schnell steigenden Nutzerzahlen bewältigen zu können.<br />
In den Folgejahren wurden, zum Teil aus der Wikipedia-, zum Teil aber auch aus der Meatball-Community heraus,<br />
neue Webportale auf Wiki-Basis gegründet. Darunter fiel die Enciclopedia Libre, eine bereits 2002 gegründete<br />
spanischsprachige Wikipedia-Abspaltung, Susning.nu, eine schwedischsprachige Mischung aus Enzyklopädie und<br />
Webforum, der 2003 gegründete Online-Reiseführer Wikitravel, das SourceWatch-Projekt zur Dokumentation von<br />
Lobby-Organisationen sowie die als Schwesterprojekte der Wikipedia bezeichneten Wikis Wikinews, Wiktionary,<br />
Wikibooks, Wikisource, Wikiquote und Wikispecies. Das Wiki-Konzept wurde so an verschiedene Arten von Texten<br />
angepasst, mit unterschiedlichem Erfolg. Eine erste nennenswerte Abwandlung des Wikipedia-Konzeptes wurde ab<br />
2003 mit Wikinfo entwickelt, in dem verschiedene Sichtweisen auf die verschiedenen Themen zugelassen waren, der<br />
Erfolg blieb aber hinter dem der Wikipedia deutlich zurück.<br />
Kommerzielle Wikifarmen, die ihre Dienste oft kostenlos anbieten, führten dazu, dass es nach und nach nahezu zu<br />
jedem möglichen Thema ein eigenes Wiki gibt. Ein besonders großer Erfolg wurden die sogenannten Fanwikis, die<br />
− neben der lexikalischen Abhandlung − eine neue Form der kollaborativ erstellten Fan-Fiction ermöglichten.<br />
Insbesondere im Science-Fiction- (z. B. Memory Alpha), Fantasy- und Comicbereich konnten einige Wikis hohe<br />
Artikel- und Teilnehmerzahlen erreichen. Auch im Bereich Humor haben sich Wikis wie Uncyclopedia, Stupidedia<br />
und Kamelopedia etabliert.<br />
Wikis als Massenmedien: Entwicklung ab 2005<br />
Der Erfolg von Wikipedia führte zu verschiedenen Bestrebungen, das Wiki-Konzept zu verbessern. Im Bereich der<br />
als Enzyklopädie konzipierten Wikis entwickelten Ulrich Fuchs und Larry Sanger unabhängig voneinander die<br />
Projekte Wikiweise [14] und Citizendium, bei denen das Wiki-Konzept eingeschränkt wird und stattdessen durch ein<br />
näher an der traditionellen redaktionellen Arbeitsweise orientiertes System eine Qualitätssteigerung erzielt werden<br />
soll. So hat bei Citizendium jeder Artikel einen eigenen verantwortlichen Betreuer, der mit Klarnamen bekannt ist.<br />
Beiden Projekten blieb jedoch bisher ein durchschlagender Erfolg verwehrt.<br />
Eine weitere Entwicklung ist die Erweiterung von traditionellen Web-Portalen verschiedenster Art durch<br />
Wiki-Funktionen. So kann im Wissensportal Google Knol jeder Interessierte Texte einstellen und bestimmen, ob er<br />
seine Inhalte zur kollaborativen Bearbeitung nach Wiki-Art freigibt oder nicht. Auf einem ähnlichen Konzept basiert<br />
das wissenschaftliche Wiki Scholarpedia, das auf wenige Spezialthemen beschränkt ist und die<br />
Teilnahmemöglichkeiten Fachfremder stark einschränkt.
Wiki 99<br />
Auf Wiki-Basis wurden weiterhin etwa seit 2005 computergenerierte Datenbanken erstellt, die von den<br />
Web-Benutzern bearbeitet und so verbessert werden können. Diese Wikis sind meist stark strukturiert und nutzen in<br />
hohem Maße Vorlagen. Bekannte Vertreter dieser Wiki-Form sind das Web-Verzeichnis AboutUs.org, die Open<br />
Directory Project-Erweiterung Chainki und die proprietäre Musikdatenbank CDWiki. Selbst zur Vermarktung von<br />
Internetwerbung wurden Wikis verwendet, wie bei WikiFox (inzwischen eingestellt) und ShoppiWiki [15] .<br />
Durch Softwareerweiterungen wurde das Wiki-Konzept um die Darstellung von ab 2005 populären Inhalten wie<br />
Web-Videos erweitert sowie auf zukünftig erwartete Internetphänomene wie das Semantische Web vorbereitet.<br />
Im März 2007 wurde das Wort wiki in das Oxford English Dictionary aufgenommen. [16]<br />
Inzwischen sind Wikis als Kollaborationswerkzeuge auch im Unternehmenseinsatz etabliert. Im Jahr 2008 nutzten<br />
oder testeten beispielsweise 41 % der finnischen Top-50-Unternehmen Wikis, weitere 18 % standen einem<br />
Wiki-Einsatz offen gegenüber. [17]<br />
Wikis in Organisationen: Entwicklung ab 2007<br />
Durch den Erfolg von Wikipedia beflügelt, haben viele Unternehmen intern mit dem Einsatz von <strong>Media</strong>Wiki und<br />
anderen Unternehmenswikis begonnen, um das Wissen ihrer Mitarbeiter zu sammeln und zu konservieren. Laut<br />
einer Studie von Forrester Research [18] wird sich der Einsatz von Unternehmenswikis im Rahmen von Enterprise 2.0<br />
von 2007 bis 2013 in etwa verzehnfachen. Die Unternehmensberatung Gartner schätzte, dass 2009 ungefähr die<br />
Hälfte der Unternehmen ein Wiki installiert haben. [19]<br />
Mittlerweile sind Wikis in verschiedensten Verwendungskontexten an Hochschulen zu finden. In Deutschland gibt<br />
es WikiWebs an mehr als 34 % aller Hochschulen. [20]<br />
Siehe auch<br />
• Liste von Wiki-Software<br />
• Liste von Fan-Wikis<br />
Literatur<br />
• Jérome Delacroix: Les wikis: espaces de l’intelligence collective. M2 Editions, Paris 2005. ISBN 2-9520514-4-5<br />
• Anja Ebersbach, Markus Glaser,d Richard Heigl: WikiTools. Kooperation im Web. Springer, Berlin 2005. ISBN<br />
3-540-22939-6<br />
• Christian Eigner, Helmut Leitner, Peter Nauser: Online-Communities, Weblogs und die soziale Rückeroberung<br />
des Netzes, Nausser & Nausser, Graz 2003. ISBN 3-901402-37-3<br />
• Dave Johnson: Blogs, wikis and feeds in action. Manninng 2005. ISBN 1-932394-49-4<br />
• <strong>Jan</strong>e Klobas: Wikis – Tools for Information Work and Collaboration. Chandos Publishing, Oxford 2006. ISBN<br />
1-84334-178-6<br />
• Christoph Lange (Hrsg.): Wikis und Blogs – Planen, Einrichten, Verwalten. Computer- und Literaturverlag,<br />
Böblingen 2007. ISBN 3-936546-44-4<br />
• Bo Leuf, Ward Cunningham: The Wiki Way – Quick Collaboration on the Web. Addison-Wesley,<br />
Harlow/München 2001. ISBN 0-201-71499-X<br />
• Erik Möller: Die heimliche Medienrevolution – Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern.<br />
Heise, Hannover 2004. ISBN 3-936931-16-X<br />
• Monika Neumayer: Weblogs & Wikis – Aus dem Nähkastchen virtueller Vernetzung. In: Christina Schachtner<br />
(Hrsg.): Erfolgreich im Cyberspace. Handbuch virtuelle Frauen- und Mädchennetzwerke. Budrich, Opladen 2005.<br />
ISBN 3-938094-40-0<br />
• Alexander Raabe: <strong>Social</strong> Software im Unternehmen. Wikis und Weblogs für Wissensmanagement und<br />
Kommunikation. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007. ISBN 3-8364-1243-8
Wiki 100<br />
• Andres Streiff: Wiki – Zusammenarbeit im Netz. Streiff, Norderstedt 2005. ISBN 3-8334-2641-1<br />
• Konstantin Zurawski: Bieten an der Wissensbörse. in: Bild der Wissenschaft.Leinefelden-Echterdingen 2007,11,<br />
Seiten 104ff. ISSN 0006-2375 [21]<br />
• Johannes Moskaliuk (Hrsg.): Konstruktion und Kommunikation von Wissen mit Wikis. Hülsbusch, Boizenburg<br />
2008. ISBN 3-940317-29-2<br />
• Steward Mader: Wikipatterns. In: Wiley (Hrsg.): {{{Sammelwerk}}}. 10. Dezember 2007, ISBN 978-0470223628<br />
(http:/ / www. wikipatterns. com/ display/ wikipatterns/ Wikipatterns).<br />
Weblinks<br />
• Literatur über Wiki in Bibliothekskatalogen: DNB [22] , GBV [23] (Wiki)<br />
• Literatur über Wiki in Bibliothekskatalogen: DNB [24] , GBV [25] (WikiTools)<br />
• Linkkatalog [26] zum Thema Wiki im ODP (Open Directory Project)<br />
• <strong>Media</strong>wiki-Handbuch [27]<br />
• WikiMatrix [28] , ein Tabellarischer Vergleich der Eigenschaften vieler Produkte (englisch)<br />
• Wikiengines [29] – Liste von Wiki-Software (englisch)<br />
• WikiIndex.org [30] – Wiki-Verzeichnis (englisch)<br />
• wikiservice.at – Wiki-Verzeichnis [31]<br />
• Tanz der Gehirne [32] , Erik Möller, Telepolis<br />
Referenzen<br />
[1] wiki in Hawaiian Dictionaries (http:/ / wehewehe. org/ gsdl2. 5/ cgi-bin/ hdict?d=D21021), wikiwiki in Hawaiian Dictionaries (http:/ /<br />
wehewehe. org/ gsdl2. 5/ cgi-bin/ hdict?q=wikiwiki)<br />
[2] vergleiche Richard Cyganiak: Wiki und WCMS: Ein Vergleich (http:/ / richard. cyganiak. de/ 2002/ wiki_und_wcms/ wiki_und_wcms. pdf)<br />
(PDF), Seite 3<br />
[3] Ebersbach, Anja; Glaser, Markus; Heigl, Richard: WikiTools. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005, ISBN 3-540-22939-6<br />
[4] Das kommerzielle Wiki-Tool „Confluence“ von Atlassian (Einstufung des Anbieters als „Enterprise Wiki“) kombiniert Unternehmens- bzw.<br />
Abteilungswikis und projektbezogene Wikis: es ermöglicht die Einrichtung von sog. Spaces, um Projekte voneinander inhaltlich und<br />
benutzerrechtlich zu trennen. Der Zugriff ist auf Anonymous, Named User und User Groups mittels verschiedener Benutzerrechte steuerbar.<br />
[5] WikiWikiHypercard (http:/ / c2. com/ cgi/ wiki?WikiWikiHypercard)<br />
[6] Tim Berners-Lee, Mark Fischetti: Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web (dt. Der Web-Report.<br />
Der Schöpfer des World Wide Webs über das grenzenlose Potential des Internets. Aus dem Amerikanischen von Beate Majetschak. Econ,<br />
München 1999. ISBN 3-430-11468-3). Kapitel 1<br />
[7] WikiHistory (http:/ / c2. com/ cgi/ wiki?WikiHistory) on c2.com<br />
[8] Interview mit Kim Bruning bei Wikimania (http:/ / en. wikinews. org/ wiki/ Interview:_Wikinewsie_Kim_Bruning_discusses_Wikimania)<br />
auf WikiNews<br />
[9] Interview mit Ward Cunningham (http:/ / video. google. com/ videoplay?docid=-7739076742312910146) bei Google Video<br />
[10] Correspondence on the Etymology of Wiki (http:/ / c2. com/ doc/ etymology. html) von Ward Cunningham<br />
[11] Wiki History (http:/ / c2. com/ cgi/ wiki?WikiHistory) bei c2.org<br />
[12] Andy Szybalski, Why it’s not a wiki world (yet) (http:/ / andy. bigwhitebox. org/ papers/ wiki_world. pdf), 14 März 2005 (PDF)<br />
[13] WikiReductionists (http:/ / c2. com/ cgi/ wiki?WikiReductionists) bei c2.org<br />
[14] Projekt Wikiweise (http:/ / www. wikiweise. de/ )<br />
[15] ShoppiWiki (http:/ / www. shoppiwiki. de)<br />
[16] New Words March 2007 (http:/ / dictionary. oed. com/ news/ newwords. html), Oxford English Dictionary<br />
[17] Wer nutzt Wikis und warum. (http:/ / blog. seibert-media. net/ 2009/ 07/ arbeitstechniken/ wiki-studie-1-wer-nutzt-wikis-und-warum)<br />
[18] Young, O. (2008) Global Enterprise Web 2.0 Market Forecast: 2007 To 2013. Zitiert nach Computerwoche online vom 21. April 2008:<br />
„Forrester: In fünf Jahren zahlen Unternehmen zehnmal mehr für Web 2.0 als heute“, online unter http:/ / www. computerwoche. de/ software/<br />
office-collaboration/ 1861436/ index. html, zuletzt geprüft am 8. Februar 2010<br />
[19] Leitl, Michael (2008): Bedrohen Wikis die Macht von Managern?, Interview mit Jimbo Wales, Harvard Business Manager, Juni 2008, Seite<br />
12<br />
[20] | Über Wikis an Hochschulen in Deutschland – Versuch einer Systematisierung der Wikinutzung (http:/ / www. eony. org/<br />
WikisAnHochschulen/ files?get=seminararbeit_wikis_an_hochschulen_final. pdf), zuletzt geprüft am 8. März 2010<br />
[21] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0006-2375<br />
[22] http:/ / d-nb. info/ gnd/ 4806885-8
Wiki 101<br />
[23] http:/ / gso. gbv. de/ DB=2. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=1016& SRT=YOP& TRM=4806885-8<br />
[24] http:/ / d-nb. info/ gnd/ 4831094-3<br />
[25] http:/ / gso. gbv. de/ DB=2. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=1016& SRT=YOP& TRM=4831094-3<br />
[26] http:/ / www. dmoz. org/ Computers/ Software/ Groupware/ Wiki/<br />
[27] http:/ / meta. wikimedia. org/ wiki/ Wikitext_standard<br />
[28] http:/ / www. wikimatrix. org<br />
[29] http:/ / c2. com/ cgi/ wiki?WikiEngines<br />
[30] http:/ / wikiindex. org/<br />
[31] http:/ / www. wikiservice. at/ gruender/ wiki. cgi?WikiVerzeichnis<br />
[32] http:/ / humanist. de/ erik/ tdg/
Hypertext<br />
Methoden, Konzepte, Technologien<br />
Als Hypertext [ˈhaipɐtɛkst] bezeichnet man Texte, die mit Hilfe einer netzartigen Struktur von Objekten<br />
Informationen durch Hyperlinks zwischen Knoten (Wissenseinheiten) verknüpfen. Ein Beispiel für den Einsatz von<br />
Hypertext ist dieser Wikipedia-Artikel.<br />
Nutzen<br />
Hypertexte bieten gegenüber der linearen Informationsdarstellung den Vorteil, komplexe Informationen<br />
vergleichsweise redundanzarm vermitteln zu können. Redundanzfreiheit spart nicht nur Speicher, sondern<br />
vereinfacht gleichzeitig die Wartung, da ein hinterlegter Wert zentral nur einmal geändert werden muss, um überall<br />
aktuell angezeigt zu werden, wo der Wert verknüpft ist.<br />
Die assoziative Struktur eines Hypertextes entspricht dabei eher der Funktionsweise des menschlichen Denkens als<br />
lineare Texte, da unser vernetztes Denken ähnlich abläuft wie die Strukturen eines Hypertextes aufgebaut sind.<br />
Schulmeister verwendet dafür in diesem Zusammenhang den Verweis auf die „kognitive Plausibilitätshypothese“. [1]<br />
Probleme<br />
Ein Problem beim Arbeiten mit Hypertext ist das gezielte Auffinden von Informationen. Während literate Menschen<br />
über Jahrhunderte in der Rezeption von linearen Texten geschult worden sind, begann man erst mit der<br />
zunehmenden Verbreitung des World Wide Web seit Mitte der 1990er Jahre den Umgang mit komplexen<br />
Hypertexten zu erlernen. Hilfsmittel wie Suchmaschinen und Suchfunktionen auf den Webseiten unterstützen den<br />
Nutzer.<br />
Ein weiteres Problem ist das Navigieren in Hypertexten, da vor allem in den Anfangsjahren häufig eine vom Autor<br />
vorgegebene Lesestruktur (z. B. Guided Tour) fehlte. Heute verfügen Hypertexte in der Regel über eine ausgefeilte<br />
Navigation. Als Folge eines Übermaßes an Querverweisen kann ein sogenannter Information Overload, die<br />
Überflutung mit ungeordneten Informationen und eine Desorientiertheit im weit verzweigten Netz von Texten (Lost<br />
in Hyperspace) entstehen. Die Lesegewohnheiten spielen hier dabei eine wichtige Rolle. So haben online-affine<br />
Nutzer weniger Schwierigkeiten damit, das Lesen eines Textes zu unterbrechen, um einem Querverweis zu folgen.<br />
Problemlösungsansätze bieten virtuelle Mindmaps und Web-Ontologien. Erst in Ansätzen gelöst ist das Problem der<br />
Visualisierung von Hypertexten, also die grafisch aufbereitete Darstellung der typischerweise netzwerkförmigen und<br />
daher nicht hierarchisch präsentierbaren Struktur eines Hypertextes (siehe auch Hyperbolic Tree).<br />
Geschichte und Entwicklung<br />
Hypertextuelle Strukturen sind seit Jahrhunderten bekannt; die im Aufschreibesystem der Neuzeit ausdifferenzierten<br />
Erschließungshilfen für lineare Texte wie Inhaltsverzeichnisse, Indizes, Querverweise und Fußnoten sowie jegliche<br />
Verweissysteme entsprechen funktional einem Hypertext. Der Unterschied besteht darin, dass zum einen die<br />
Verweisziele nicht vor Ort präsent sein müssen, und zum anderen, dass das Verfolgen der Verweise nicht<br />
mechanisiert bzw. automatisiert ist. Als Vorläufer heutiger digitalisierter Hypertexte gilt daher beispielsweise<br />
Agostino Ramellis Bücherrad aus dem 16. Jahrhundert und Roussels Lesemaschine, eine Art Wechselrad für<br />
Notizzettel, siehe Zettels Traum von Arno Schmidt. Literaturgeschichtlich prominent ist James Joyce’ vertracktes<br />
Werk Finnegans Wake, das an semantische Netze des Hypertext erinnert.<br />
102
Hypertext 103<br />
Das moderne Hypertext-Konzept wurde von Vannevar Bush im Jahr 1945 in einem Artikel As We May Think im<br />
Journal The Atlantic Monthly erwähnt. Er sprach darin über ein zukünftiges System Memex (für Memory Extender),<br />
das das Wissen eines bestimmten Gebietes elektronisch aufbereitet leicht zugänglich darstellen kann. Diese Idee lag<br />
bereits der 1931 in den USA patentierten "Statistischen Maschine" von Emanuel Goldberg zugrunde. [2] Die Kernidee<br />
des Konzepts ist zum einen, dass das Verfolgen von Verweisen mit elektronischer Hilfe erleichtert wird und zum<br />
anderen, dass Bücher und Filme aus einer Bibliothek verfügbar gemacht und angezeigt werden können. Die Idee von<br />
Hypertext ist also von Anfang an mit alten Utopien von der „universellen Bibliothek“ verbunden (siehe auch<br />
Bibliotheksutopie). Daher ist es kein Zufall, dass der Herausgeber der Universalklassifikation Paul Otlet als frühester<br />
Pionier des Hypertext gilt und diese Universalsprache völkerverbindend einsetzen wollte. Er gilt nicht von ungefähr<br />
als Mitbegründer des Völkerbunds, aus dem die UNO hervorging.<br />
Ein Beispiel für ein hypertext-artiges Gedicht sind die Hunderttausend Milliarden Gedichte von Raymond Queneau<br />
(1961). Der Gesellschaftswissenschaftler Ted Nelson (Projekt Xanadu) prägte den Begriff „Hypertext“ im Jahr 1965.<br />
Eines der ersten Hypertextsysteme, das einer größeren Gruppe zugänglich war, war HyperCard der Firma Apple, das<br />
mit den Apple-Macintosh-Computern ausgeliefert wurde.<br />
Das heute am weitesten verbreitete Hypertext-System ist der Internet-Dienst World Wide Web (WWW), obwohl ihm<br />
einige wichtige Funktionen früherer Hypertextsysteme fehlen. So ist zum Beispiel das Problem der so genannten<br />
toten Links im WWW ungelöst, die nicht oder nicht mehr zum gewünschten Ziel führen. Auch die Einführung der<br />
Uniform Resource Identifiers (URIs) ist über die im Web gebräuchlichen URLs nur unvollständig erfüllt. Im<br />
Gegenzug erlaubt das WWW aber auch das Einbinden von nichtsprachlichen Datentypen wie Bildern was als<br />
Hypermedia bezeichnet wird. Dadurch ist das WWW, obwohl auf Hypertext beruhend, streng genommen ein<br />
Hypermedia-System. Die Sprache, in der die Texte des World Wide Web beschrieben werden, heißt Hypertext<br />
Markup Language; Web-Dokumente werden von Webtextern und Webdesignern konzipiert und erstellt.<br />
Siehe auch<br />
• Chronologie der Hypertext-Technologien<br />
• Hypertextualität<br />
• E-Text<br />
Literatur<br />
• Stephan Porombka: Hypertext. Zur Kritik eines digitalen Mythos. Fink, München 2001. ISBN 3-7705-3573-1<br />
• Peter Schnupp: Hypertext. Oldenburg, München 1992. ISBN 3-486-21740-2<br />
• Stefan Iske: Vernetztes Wissen. Hypertext-Strategien im Internet.Bertelsmann, Bielefeld 2002. ISBN<br />
3-7639-0151-5<br />
• George P. Landow: Hypertext 3.0. Critical Theory and New <strong>Media</strong> in a Era of Globalization. 3. Auflage. Johns<br />
Hopkins Univ. Press, Baltimore Md 2005. ISBN 0-8018-8257-5<br />
• Jakob Krameritsch: Geschichte(n) im Netzwerk. Hypertext und dessen Potenziale für die Produktion,<br />
Repräsentation und Rezeption der historischen Erzählung. Medien in der Wissenschaft. Bd 43. Waxmann,<br />
Münster 2007. ISBN 3-8309-1835-6<br />
• Rainer Kuhlen: Hypertext. Ein nicht-lineares Medium zwischen Buch und Wissensbank. Springer, Berlin 1991.<br />
ISBN 3-87940-509-3<br />
• Beat Sutter: Der Hyperlink in der Lektüre. Pause, Leerstelle oder Flucht? [3] . In: dichtung-digital.de. Abgerufen<br />
am 22. Aug.2009.
Hypertext 104<br />
Weblinks<br />
• Bee-Hive the Hypertext/Hypermedia Literary Journal [4]<br />
• Cyberfiction [5] – Schweizer Magazin, das sich mit Hypertext/-fictions beschäftigt<br />
• Kurt Ludwigs: Die Eignung von Ausgangstexten für Hypertexte [6]<br />
• Neue Medien in der linguistischen Lehre [7]<br />
• Hypertext und Sprachwissenschaft - Dissertation von Oliver Huber [8]<br />
• Hypertext als Technologie des Umgangs mit Information, Stefan Iske [9]<br />
• 'Der Looppool' - Ein Hypertext Beispiel zum Hören, Lesen und Selbersteuern, Bas Böttcher [10]<br />
Referenzen<br />
[1] Schulmeister: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Wessley, Bonn 1996, S.257. ISBN 3-89319-923-3<br />
[2] Michael Buckland: Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, And Vannevar Bush's Memex. (http:/ / people. ischool. berkeley. edu/<br />
~buckland/ goldbush. html) in: Journal of the American Society for Information Science. New York 43.1992,4 (May), 284-294. ISSN<br />
0002-8231 (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0002-8231)<br />
[3] http:/ / www. brown. edu/ Research/ dichtung-digital/ 2005/ 2/ Suter/ index. htm<br />
[4] http:/ / beehive. temporalimage. com/ index. html<br />
[5] http:/ / www. cyberfiction. ch/<br />
[6] http:/ / www. lehrer-online. de/ dyn/ 421349. htm<br />
[7] http:/ / www. uni-pannon. hu/ german/ media. html<br />
[8] http:/ / edoc. ub. uni-muenchen. de/ archive/ 00000921/<br />
[9] http:/ / www. gkel. tu-darmstadt. de/ sites/ gkel. tu-darmstadt. de/ files/ 2001_iske_ht. pdf<br />
[10] http:/ / www. looppool. de<br />
Posting<br />
Posting bezeichnet ursprünglich eine Mitteilung innerhalb einer Newsgroup im Usenet. Mittlerweile werden auch<br />
Beiträge in Webforen oder Blogs unter diesem Begriff eingeordnet, allerdings sind die Mechanismen dort anders, als<br />
sie hier für Usenet-Postings dargestellt werden. Eine Folge von Postings, die in Form von Diskussionsbeiträgen<br />
hierarchisch organisiert sind, werden als Thread bezeichnet.<br />
Im Prinzip kann man den Vorgang so verstehen, dass eine E-Mail geschrieben wird, die mehreren Benutzern<br />
gleichzeitig zugänglich ist. Das könnte man auch mit den berühmten schwarzen Brettern vergleichen. Jemand setzt<br />
eine Nachricht ab, und jeder, der das will, kann diese Nachricht lesen und darauf antworten.<br />
Im Usenet sind Posting und Artikel synonym. Ein Posting oder Artikel ist dort ähnlich wie eine E-Mail aufgebaut,<br />
beginnt also mit einem Header, der vom Inhalt durch eine Leerzeile abgetrennt ist. Jede Headerzeile beginnt mit<br />
einem genormten Schlüsselwort, gefolgt von Doppelpunkt, Leerzeichen und Parametern, wobei ein solcher Eintrag<br />
in mehrere Zeilen umbrochen sein kann, die Folgezeilen beginnen dann mit Leer- oder Tabulatorzeichen. Der ganze<br />
Artikel endet mit zwei aufeinanderfolgenden Punkten als einzige Zeichen in einer Zeile. Die wichtigsten<br />
Schlüsselwörter bedeuten:<br />
• Message-ID: eine Kennzeichnung, die kein anderer Usenet-Artikel trägt (ähnlich wie bei E-Mail). Weil man auch<br />
sogenannte Followups (Antworten; Erwiderungen) posten kann, stehen hier in der Reihenfolge (durch eckige<br />
Klammern getrennt) die Nummern aller bezugnehmenden Nachrichten in der absteigenden Reihenfolge des<br />
Thread.<br />
• Subject: die vom Verfasser geschriebene Betreffzeile (genau wie bei E-Mail).<br />
• Newsgroups: Namen der Newsgroups, in denen der Artikel erscheinen soll. Bei mehreren Newsgroups<br />
(Crossposting) sind diese durch Kommata und ohne Leerzeichen getrennt.<br />
• From: E-Mail-Adresse und Name des Urhebers (genau wie bei E-Mail, gleiche Syntax). Beispiel: Mein Name<br />
; der Term vor der Adresse wird dabei in einem Browser angezeigt, der Rest
Posting 105<br />
dient nur dazu, mit einer E-Mail-Software Kontakt zum Autor aufzunehmen. Ebenso gibt es die (mittlerweile<br />
allerdings weniger verbreitete) Schreibweise meinname@meineemailadresse.de (Mein Name).<br />
• Reply-To: Eigentlich dasselbe wie From, aber hier hat man die Möglichkeit, eine davon abweichende Adresse<br />
einzutragen, an die Antworten per E-Mail adressiert werden sollen.<br />
• Path: Liste der Newsserver, die das Posting weitergeleitet haben, mit ! getrennt. Entspricht in etwa den vielen<br />
Received:-Headern in E-Mails. Vom Absender nur teilweise fälschbar, weil sich jeder weiterleitende Newsserver<br />
dort selbst einträgt.<br />
• NNTP-Posting-Host: Hostname oder IP-Adresse des Rechners, der das Posting in einen Newsserver eingespeist<br />
hat. Vom Absender meist nicht fälschbar, weil gängige Newsserver Postings mit einem solchen Eintrag<br />
zurückweisen und stattdessen diesen Eintrag selbst einfügen.<br />
• Organization: Wird eventuell von einem Werbespruch der Firma ersetzt, über welche man posted, aber der<br />
eigene Eintrag hat dabei Priorität.<br />
• X-No-Archive: yes Damit bittet ein Artikelautor darum, den Artikel nicht in ein Archiv wie etwa Google Groups<br />
oder Deja News aufzunehmen.<br />
• References: Wenn das Posting als Antwort auf ein schon vorhandenes Posting geschrieben wird, wird hier die<br />
Message-ID (s. o.) dieses vorangehenden Postings und ggf. die ganze Kette der vorangehenden Postings<br />
eingetragen.<br />
• Followup-To: Newsgroups, in welche Antworten umgeleitet werden sollen. Üblich ist eine Gruppe, um die<br />
Diskussion an einer Stelle fortsetzen zu können. Ein weiterer gültiger Wert ist poster, was darauf hinweist, dass<br />
die Diskussion per E-Mail an den Verfasser fortgesetzt werden soll. Es gilt als höflich, im Text nochmal auf<br />
diesen Header hinzuweisen, damit niemand übersieht, wohin eine Antwort gesendet wird.<br />
Viele Newsreader verstecken den Header, wenn man ein Posting liest, und ermöglichen nicht, ihn direkt zu editieren,<br />
wenn man ein Posting schreibt, so dass es für den Benutzer gar nicht sichtbar wird, dass die Postings Header<br />
enthalten. Generell enthalten aber alle Postings Header. Die hauptsächliche Funktion dieser Header ist die, dass die<br />
Server die Nachrichten besser zuordnen können. Meistens wird deklariert, dass die Header für den Benutzer<br />
eigentlich uninteressant sind, aber das muss nicht immer wirklich auch der Fall sein.<br />
Wie bei einer E-Mail steht der eigentliche Inhalt im Body der Nachricht. Binärinhalte können auch wie bei E-Mails<br />
in Form von MIME-Attachments eingefügt werden.<br />
Ein Posting wird – wiederum wie eine E-Mail – in der Regel mit sogenannten Signaturen unterschrieben. Gerade im<br />
eher textorientierten Usenet wird darauf geachtet, dass Regeln wie die maximale Länge von vier Zeilen bei der<br />
Signature eingehalten werden.<br />
Siehe auch<br />
• NNTP<br />
• ROT13<br />
• Newsreader<br />
• Autoposter<br />
• PGP
Posting 106<br />
Weblinks<br />
• RFC 1036 – Standard zum Austausch von USENET-Nachrichten (englisch)<br />
• Wie zitiere ich im Usenet? [1] - Anleitung zum Zitieren<br />
• Netiquette für de.* [2] - Sitten und Gebräuche im deutschsprachigen Usenet<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. afaik. de/ usenet/ faq/ zitieren/<br />
[2] http:/ / www. kirchwitz. de/ ~amk/ dni/ netiquette<br />
Instant Messaging<br />
Instant Messaging [ˌɪnstənt ˈmɛsɪdʒɪŋ] (kurz IM) (englisch für<br />
„sofortige Nachrichtenübermittlung“) oder Nachrichtensofortversand<br />
ist eine Kommunikationsmethode, bei der sich zwei oder mehr<br />
Teilnehmer per Textnachrichten unterhalten (genannt chatten). Dabei<br />
geschieht die Übertragung im Push-Verfahren, so dass die Nachrichten<br />
unmittelbar beim Empfänger ankommen. Die Teilnehmer müssen dazu<br />
mit einem Computerprogramm (genannt Client) über ein Netzwerk wie<br />
das Internet direkt oder über einen Server miteinander verbunden sein.<br />
Viele Clients unterstützen zusätzlich die Übertragung von Dateien und<br />
Audio- und Video-Streams.<br />
Benutzer können sich gegenseitig in ihrer Kontaktliste führen und<br />
sehen dann an der Präsenzinformation, ob der andere zu einem<br />
Gespräch bereit ist.<br />
Protokolle<br />
Die meisten IM-Dienste sind aufgrund verschiedener, zum Teil<br />
proprietärer Protokolle untereinander inkompatibel. Folgende<br />
Protokolle sind weit verbreitet:<br />
• OSCAR – Protokoll für den AIM- und den ICQ-Dienst sowie die<br />
dazugehörigen Clients<br />
• SIMPLE – gibt dem SIP-Standard IM-Funktion<br />
• Skype – Protokoll und Client<br />
• Tencent QQ – Protokoll und Client<br />
• Windows Live Messenger – Protokoll und Client<br />
• XMPP<br />
• Yahoo Messenger – Protokoll und Client<br />
• IRC<br />
Die Kontaktliste (hier am Beispiel von Gajim) ist<br />
ein typisches Merkmal von Instant Messengern.
Instant Messaging 107<br />
Begriff<br />
Der Ausdruck „Instant Message“ wurde von Paul A. Linebarger geprägt. Er beschrieb damit in seinen<br />
Science-Fiction-Geschichten aus den 1960er Jahren Nachrichten, die mit Überlichtgeschwindigkeit über interstellare<br />
Distanzen hinweg verschickt werden konnten. Seine „sofortigen Nachrichten“ galten als extrem teuer, und er schrieb<br />
einige Episoden, die die Unerschwinglichkeit dieser Nachrichten zum Thema hatten.<br />
Die Mitglieder der New England Science Fiction Association (davon die meisten Computerexperten) haben den<br />
Ausdruck aufgenommen und ihren wöchentlichen Newsletter so genannt. Der heutige Gebrauch des Begriffs dürfte<br />
dort seinen Ursprung haben.<br />
Siehe auch<br />
• LAN Messenger<br />
• Liste von Instant-Messaging-Protokollen<br />
• Multi-Protokoll-Client<br />
• Microblogging<br />
Weblinks<br />
• Sicheres Instant Messaging im Unternehmen [1]<br />
• Chaosradio 119 zum Thema Instant Messaging [2]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. searchsecurity. de/ themenbereiche/ applikationssicherheit/ kommunikations-sicherheit/ articles/ 118599/<br />
[2] http:/ / chaosradio. ccc. de/ cr119. html
Chat 108<br />
Chat<br />
Chat (von engl. to chat [tʃæt] „plaudern, sich unterhalten“) bezeichnet elektronische Kommunikation in Echtzeit,<br />
meist über das Internet. Eine frühere Form des Chats gab es in den 80er Jahren über den CB-Funk.<br />
Formen<br />
Die ursprünglichste Form des Internet-Chats ist der reine Textchat, bei dem nur Zeichen ausgetauscht werden<br />
können. Mittlerweile kann – je nach System – eine Ton- und/oder Videospur dazukommen bzw. den Textchat<br />
ersetzen. Man spricht dann von „Audio-“ bzw. „Videochat“.<br />
Heute werden, technisch gesehen, hauptsächlich drei Chatformen unterschieden:<br />
• Der Internet Relay Chat (IRC) wurde in den 80er Jahren von dem finnischen Studenten Jarkko Oikarinen<br />
entwickelt. Er benötigt eigene Chat-Server; diese Server sind meistens untereinander vernetzt. Zudem wird eine<br />
Client-Software benötigt, die entweder auf den Rechnern der chattenden Personen installiert ist oder aber über<br />
einen Browser gestartet wird, z. B. ein Java-Web-Client. Für die Steuerung des Clients werden spezielle<br />
IRC-Kommandos verwendet.<br />
• Der Webchat bei dem man direkt im Webbrowser chatten kann, es wird meist keine weitere Software benötigt.<br />
Webchats sind meistens auf die jeweilige Webseite beschränkt. Diese Form wird auch in Live Support Systemen<br />
genutzt, die zum Teil weitere Dienste wie IP-Telefonie oder Funktionen zur Fernwartung beinhalten.<br />
• Bei Instant Messaging wird der Chat in der Regel nicht in einem öffentlichen Chatraum geführt, sondern nur<br />
zwischen denjenigen, die die entsprechende Software auf ihrem Rechner installiert haben.<br />
IRC und Instant Messaging beinhaltet meistens weitere Funktionalitäten wie das Erstellen von Gesprächsprotokollen<br />
("chat logs") oder das Übermitteln von Dateien und Hyperlinks. Allen drei Varianten ist gemeinsam, dass meistens<br />
nicht unter bürgerlichem Namen gechattet wird, sondern unter einem Pseudonym (Nickname). Im IRC und in<br />
Web-Chats ist der Austausch meistens in Chaträumen bzw. Channels organisiert, die sich speziellen Themen<br />
widmen. Chats mit mehr als zwei Chattern finden in Chaträumen statt.<br />
Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes nutzten 2009 46 Prozent der 10- bis 15-jährigen Internetnutzer<br />
Chats, Blogs oder Internetforen als Kommunikationsmittel. Bei Studenten und Schülern beträgt dieser Anteil<br />
89 Prozent. [1]<br />
Chatiquette<br />
Zu beachten ist die Chatiquette. Hierbei handelt es sich um spezielle Regeln für die Umgangsformen in einem Chat.<br />
Um Missverständnisse aufgrund der fehlenden visuellen Kommunikation zwischen den Teilnehmern zu vermeiden,<br />
sollten diese Regeln eingehalten werden.<br />
Allgemeine Regeln für die Umgangsformen im Internet beschreibt die Netiquette.<br />
Chatter-Treffen<br />
Da man sich in einem Chat nur „virtuell“ unterhalten kann, werden von manchen Chat-Communitys oder auch<br />
Privatpersonen sogenannte Chatter-Treffen (CT) organisiert. Hier treffen sich die Chatter dann auch im wirklichen<br />
Leben, um sich auszutauschen oder organisatorische Dinge zu besprechen. Treffen, bei denen sich Mitglieder eines<br />
Chat-Kanals (z. B. IRC-Channel) treffen, nennt man Channelparty.<br />
Die ersten Chatter-Treffen Europas fanden schon 1987 statt und nannten sich Relay-Partys entsprechend dem<br />
Vorläufer von IRC, Bitnet Relay.
Chat 109<br />
Gefahren und Probleme<br />
Es liegt in der Natur der Sache, dass man sich in Chats nie sicher sein kann, ob das Gegenüber auch wirklich das ist,<br />
wofür er oder sie sich ausgibt. Dies gilt auch für Chats, in denen die Benutzer Steckbriefe besitzen. Scheinbar<br />
persönliche Informationen und Fotos brauchen nicht unbedingt mit der realen Person übereinzustimmen, da die<br />
Registrierungsdaten üblicherweise nicht verifiziert werden. Chatter, die sich für etwas ausgeben, was sie nicht sind,<br />
nennt man Fakes. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass man mit einem Mann spricht, der sich für eine Frau<br />
ausgibt etc. Selbst wenn eine Verifizierung stattfindet, braucht diese nicht zuverlässig zu sein. Gerade Kinder und<br />
Jugendliche sollten auf diesen möglichen Unterschied zwischen „Online-Persönlichkeit“ und Realität hingewiesen<br />
werden, insbesondere in Bezug auf die Gefahr durch Sexualstraftäter („Online predator“). [2]<br />
Chatsucht<br />
Der Spaß am Chatten kann für Kinder und Jugendliche – aber auch für Erwachsene – zu einer Chatsucht werden.<br />
Dies wird häufig bei Personen beobachtet, die gerade begonnen haben zu chatten. Vor allem bei Personen mit einem<br />
gestörten sozialen Umfeld kann sich dieses Problem verfestigen. Die Chatsucht kann in Verbindung mit einer<br />
Onlinesucht auftreten. Begünstigt wird dies dadurch, dass man sich anderen Teilnehmern gegenüber als<br />
Persönlichkeit ausgeben kann, die man im tatsächlichen Leben nicht ist. Dies kann zu Realitätsverlust führen, da<br />
man sich auch außerhalb des Chatrooms für die im Chat erstellte Person halten kann.<br />
Kommunikation im Chat<br />
Die Kommunikation im Chat findet fast zeitgleich (synchron) statt und nicht über eine lange Zeit versetzt<br />
(asynchron), wie z. B. in der E-Mail-Kommunikation. Die teilnehmenden Chatter tippen ihre Gesprächsbeiträge in<br />
ein Eingabefeld und schicken sie durch eine Eingabe ab. Ab dem Zeitpunkt seiner Zustellung an die<br />
Adressatenrechner ist der Beitrag für alle im selben Chatraum präsenten Chat-Beteiligten fast sofort sichtbar; bis<br />
zum Zeitpunkt seiner Verschickung ist bei den meisten Chat-Systemen aber die Aktivität des Tippens für die Partner<br />
ersichtlich. Ferner können sich Beiträge überlappen. Wegen der kommunikativen Rahmenbedingungen ist trotz der<br />
synchronen Präsenz der Kommunikationsbeteiligten vor ihren Rechnern keine simultane Verarbeitung von<br />
Verhaltensäußerungen zur Laufzeit ihrer Hervorbringung möglich; in diesem Punkt unterscheidet sich die<br />
Chat-Kommunikation ganz erheblich vom mündlichen Gespräch (vgl. z. B. Beißwenger 2007). Die Kommunikation<br />
im Chat teilt somit – trotz ihrer medial schriftlichen Realisierung – mehr Merkmale mit dem mündlichen Gespräch<br />
als mit Texten, ihre charakteristischen Unterschiede zum mündlichen Gespräch bestehen aber in mehr als lediglich<br />
der Tatsache, dass Chat-Beiträge im Gegensatz zu Gesprächsbeiträgen getippt werden.<br />
Sprache im Chat<br />
Im Chat steht eine korrekte Verwendung der Sprache auf syntaktischer und orthographischer Ebene nicht im<br />
Vordergrund. Anakoluthe (Konstruktionsbrüche), Aposiopesen (Satzbrüche) sowie umgangssprachliche<br />
Kontraktionen, Ellipsen, Interjektionen, dialektale und soziolektale Ausdrücke verleihen der Sprache im Chat einen<br />
Slang-Charakter. Tippfehler und grammatikalische Fehler sind häufig, Satzzeichen spielen fast keine Rolle, und oft<br />
wird konsequent klein geschrieben. „Das Ökonomieprinzip steht […] eindeutig als Maxime der<br />
Äußerungsproduktion im Vordergrund.“ (Geers 1999, 5). Die fehlenden parasprachlichen Mittel werden durch<br />
Emoticons (z. B. :-), ;-) oder :-o) und Akronyme (z. B. lol = laugh(ing) out loud; dt. "Lautes Lachen") oder<br />
Abkürzungen ersetzt.
Chat 110<br />
Fremdsprachen lernen im Chat<br />
Möchte man als Lernender das Medium Chat nutzen, um seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, sollte man<br />
aufgrund der besonderen Kommunikations- und Sprachmerkmale von Chats Räume wählen, die extra dafür<br />
eingerichtet wurden, sogenannte Lernchats oder didaktische Chat-Räume.<br />
Software und Protokolle<br />
Bekannte Chatsoftware und Protokolle sind:<br />
• AOL Instant Messenger (AIM)<br />
• Gadu-Gadu<br />
• Google Talk<br />
• ICQ (OSCAR)<br />
• Internet Relay Chat (IRC)<br />
• XMPP<br />
• Multi User Dungeon<br />
• Pichat<br />
• PSYC<br />
• SILC<br />
• Skype<br />
• TeamSpeak (TS)<br />
• Windows Live Messenger (früher MSN)<br />
• Xfire<br />
• Yahoo Messenger<br />
Chatprogramme, die mehrere Protokolle unterstützen:<br />
• Adium<br />
• Digsby<br />
• GMX/Web.de Multimessenger<br />
• Kopete<br />
• Miranda IM<br />
• Pidgin<br />
• Trillian<br />
• QIP<br />
Siehe auch<br />
• Chat-Animateur<br />
• Chatbot<br />
• Groupware<br />
• Leetspeak<br />
• Singlebörse<br />
• Shoutbox<br />
• Mikro-Blogging
Chat 111<br />
Literatur<br />
• M. Beißwenger: Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation. Berlin/New York 2007: de Gruyter<br />
(Linguistik – Impulse & Tendenzen 26).<br />
• R. Geers: Der Faktor Sprache im unendlichen Daten(t)raum. Eine linguistische Betrachtung von Dialogen im<br />
Internet Relay Chat. In: Naumann, Bern 1999. Dialogue analysis and the Mass <strong>Media</strong>. Proceedings of the<br />
International Conference, Erlangen 1998. Tübingen. S. 83–100. (Beiträge zur Dialogforschung 20)<br />
• Gerit Götzenbrucker, Roman Hummel: Zwischen Vertrautheit und Flüchtigkeit. Beziehungsdimensionen in<br />
computervermittelten Konversationen am Beispiel von Chats, MUDs und Newsgroups. In: Beißwenger, Michael<br />
(Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter<br />
Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Ibidem-Verlag, Stuttgart 2001, S.<br />
201–224<br />
• M. Haase et al.: Internetkommunikation und Sprachwandel. In: Weingarten, R. (Hg.). Sprachwandel durch<br />
Computer. S. 51–85. Opladen 1997: Westdeutscher Verlag.<br />
• Eva Platten: Die Bedeutung von Chats für das Fremdsprachenlernen. Uni Gießen 2001, Diplomarbeit Online [3]<br />
Weblinks<br />
• Linkkatalog [4] zum Thema Chat im ODP (Open Directory Project)<br />
• Linkkatalog [5] zum Thema Chats und Foren im ODP (Open Directory Project)<br />
• Linkkatalog [6] zum Thema Webchat im ODP (Open Directory Project)<br />
• Website zur sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Chat-Forschung [7]<br />
• „Bibliography on Chat Communication“ (Bibliographie zur internationalen Chat-Forschung) [8]<br />
• Lehrerhandbuch Chatten im Fremdsprachenunterricht [9]<br />
• Chat-Info Webseite [10]<br />
Referenzen<br />
[1] Private Haushalte in der Informationsgesellschaft (IKT) (https:/ / www-ec. destatis. de/ csp/ shop/ sfg/ bpm. html. cms. cBroker.<br />
cls?cmspath=struktur,vollanzeige. csp& ID=1025074). In: Fachserie 15 Reihe 4. Statistisches Bundesamt, 2009, abgerufen am 16. Februar<br />
2010.<br />
[2] <strong>Jan</strong>is Wolak, David Finkelhor, Kimberly J. Mitchell, Michele L. Ybarra: Online "predators" and their victims: Myths, realities, and<br />
implications for prevention and treatment. (http:/ / www. unh. edu/ news/ cj_nr/ 2008/ feb/ lw18internet. cfm), In: American Psychologist,<br />
2008, Bd. 63, Nr. 2 (Feb-Mär); Crimes Against Children Research Center, University of New Hampshire<br />
[3] http:/ / www. uni-giessen. de/ ~ga1040/ chatfors/ index. htm<br />
[4] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Gesellschaft/ Beziehungen/ Kontakte/ Chats_und_Foren/<br />
[5] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/ Chats_und_Foren/<br />
[6] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/ WWW/ Webchat/<br />
[7] http:/ / www. chat-kommunikation. de/<br />
[8] http:/ / www. chat-bibliography. de/<br />
[9] http:/ / www. goethe. de/ z/ jetzt/ dejchat/ dejlehrh. htm<br />
[10] http:/ / www. chat-surium. com/
Streaming <strong>Media</strong> 112<br />
Streaming <strong>Media</strong><br />
Streaming <strong>Media</strong> ist der Oberbegriff für Streaming Audio und Streaming Video (auch bekannt als Web-Radio und<br />
Web-TV) und bezeichnet aus einem Rechnernetz empfangene und gleichzeitig wiedergegebene Audio- und<br />
Videodaten. Den Vorgang der Datenübertragung selbst nennt man Streaming, und gestreamte Programme werden als<br />
Livestream bezeichnet.<br />
Beim Livestream handelt es sich nicht um Rundfunk. Während beim Rundfunk ein Sender von einer Vielzahl von<br />
Empfängern empfangen werden kann, wird Streaming für jeden Benutzer gesondert auf dessen Anforderung hin als<br />
Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Medienserver des Senders und dem Rechner des Benutzers realisiert,<br />
was dem Gedanken des Rundfunks widerspricht (siehe auch Abschnitt Probleme). Streaming <strong>Media</strong> bildet jedoch<br />
das Internet-Äquivalent zu Broadcasting-Techniken wie Hörfunk oder Fernsehen und wird vom Nutzer meist ebenso<br />
als Rundfunk wahrgenommen.<br />
Geschichte<br />
Streaming <strong>Media</strong> gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Während der ersten Jahrzehnte wurden wenige Fortschritte<br />
gemacht, da die Technik teuer und die Kapazitäten der Computerhardware beschränkt waren.<br />
Während der späten 80er wurden PCs leistungsfähig genug, um verschiedenste Medien anzuzeigen. Die vorrangigen<br />
Voraussetzungen, um Streams zu empfangen, waren eine starke CPU und eine ausreichende BUS- (Netzwerk-)<br />
Bandbreite für die erforderlichen Datenraten.<br />
In den späten 1990ern waren größere Datenraten verfügbar, auch wurde der Zugang zum Internet erleichtert.<br />
Außerdem gab es Standard-Protokolle und -Formate, wie die Internetprotokollfamilie und HTML. Das Internet<br />
wurde kommerzialisiert. Diese Fortschritte in Computernetzwerken kombiniert mit leistungsfähigen PCs und<br />
modernen Betriebssystemen machten Streaming <strong>Media</strong> für normale Nutzer möglich. Inzwischen gibt es immer mehr<br />
Angebote und neue Streamingformate wie MMS:// und RTSP://, außerdem sind Bild- und Tonqualität verbessert<br />
worden.<br />
Software<br />
Um Streaming-<strong>Media</strong>-Angebote nutzen zu können, ist auf der Empfängerseite eine spezielle Software erforderlich.<br />
Dies kann ein Plug-in sein, das in einen Web-Browser integriert ist, aber auch ein eigenständiges<br />
Wiedergabeprogramm. Ersteres wird automatisch aufgerufen, sobald eine angeforderte Seite<br />
Streaming-<strong>Media</strong>-Daten enthält. Diese Plug-ins und Wiedergabeprogramme (engl. Player) werden in der Regel<br />
kostenlos angeboten, im Gegensatz zu den Servern, die dazugehören und die Daten senden.<br />
Es existiert eine Vielzahl verschiedener konkurrierender Streaming-<strong>Media</strong>-Techniken. Die bekanntesten Vertreter<br />
sind:<br />
Audio- und Video-Containerformate:<br />
• Flash Video Streaming<br />
• MP3<br />
• MP4<br />
• Nullsoft Streaming Video<br />
• Ogg (Vorbis, Theora)<br />
• Quicktime<br />
• Real <strong>Media</strong><br />
• Windows <strong>Media</strong><br />
• FLAC
Streaming <strong>Media</strong> 113<br />
Streaming-Software und -Server:<br />
• Catra Streaming Platform<br />
• Darwin Streaming Server/ QuickTime Streaming Server<br />
• FFserver<br />
• Helix Server<br />
• Icecast (Open Source, nur Audio)<br />
• Icecast2 (Freie Software)<br />
• Jinzora Broadcast Server-Software (Freie Software)<br />
• LSCube/Feng (Freie Software), RTSP-fähig, beherrscht auch neuere freie Audio- und Videoformate<br />
• <strong>Media</strong>Tomb (Open Source), UPnP-fähig, Streaming Server fürs Heimnetz (PC und Standalone-Geräte),<br />
Unterstützt Echtzeit-Enkodierung<br />
• No23Live (Freeware, nur Audio)<br />
• PeerStream Broadcast Server<br />
• SHOUTcast<br />
• VideoLAN Server (Freie Software)<br />
• Wirecast<br />
Datenübertragungsrate<br />
Typische Datenübertragungsraten der Ausgangsdaten sind:<br />
• Audio: meist im Bereich zweistellige kBit/s<br />
• Video: einige hundert kBit/s bis einige MBit/s (bei Triple-Play-Angeboten)<br />
Typische zur Verfügung stehende Datenübertragungsraten sind:<br />
• analoges Modem: bis 56 kBit/s<br />
• ISDN: 64 oder 128 kBit/s<br />
• DSL und Kabelmodems: 0,7–50 MBit/s<br />
• FTTH: 10 MBit/s bis 1 GBit/s<br />
• Ethernet: 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1 GBit/s oder 10 GBit/s<br />
Da die Wiedergabe der Daten gleichzeitig mit dem Empfang stattfinden soll, muss eine ausreichende<br />
Datenübertragungsrate zur Verfügung stehen. Es ist notwendig, dass die Datenübertragungsrate, die für die<br />
Übertragung zur Verfügung steht, größer ist als die für das Streaming verwendete Datenübertragungsrate. Die zu<br />
sendenden Audio- und Videodaten müssen deshalb vor der Übertragung komprimiert werden. In den meisten Fällen<br />
geschieht dies verlustbehaftet, da nur so eine handhabbare Datenmenge pro Zeiteinheit erreicht werden kann.<br />
Um unterschiedliche Laufzeiten der Datenpakete im Netz auszugleichen und damit verbundene Stockungen zu<br />
verhindern, wird im Medienplayer ein Puffer verwendet. Deshalb erfolgt die Wiedergabe auch leicht verzögert,<br />
typischerweise um 2 bis 6 Sekunden. Reicht dieser Puffer nicht aus, wird er von manchen Medienplayern dynamisch<br />
vergrößert.<br />
Da Videodaten in aller Regel eine höhere Datenrate als Audiodaten haben, ist hier auch eine wesentlich stärkere<br />
Komprimierung erforderlich. Diese ist bezüglich der verwendeten Algorithmen ausgefeilter und bezüglich der<br />
benötigten Rechenleistung aufwendiger.<br />
Bei gleicher Komprimierungsart sinkt dabei die Qualität mit der Datenübertragungsrate, auf die der Datenstrom<br />
verkleinert werden soll. Die sicht- und hörbare Qualität eines Streams hängt deshalb wesentlich von den folgenden<br />
Faktoren ab:<br />
• der Art und Qualität des Ausgangsmaterials<br />
• der verwendeten Komprimierungsmethode<br />
• der für die Übertragung nutzbaren Datenübertragungsrate, welche meist durch den Internetzugang begrenzt wird.
Streaming <strong>Media</strong> 114<br />
Arten<br />
„On-demand-Streaming“<br />
• Daten werden vom Server über das Netz an den Client übertragen<br />
• die Wiedergabe erfolgt bereits während der Übertragung<br />
• Zwischenpufferung für lückenlose Wiedergabe<br />
• Vor- Zurückspulen und Pausieren möglich<br />
• Protokolle: HTTP, FTP<br />
„Live-Streaming“<br />
• Bereitstellung des Angebotes in Echtzeit<br />
• Protokolle: RTP, RTCP, RTSP<br />
Streaming <strong>Media</strong> in der Bildung<br />
In den letzten Jahren setzten sich zunehmend Systeme zum Aufzeichnen von Vorlesungen in Europa durch. In Delft<br />
werden beispielsweise alle Vorlesungen aufgezeichnet, um sie den Studenten zu Hause zur Verfügung zu stellen.<br />
Besonders seit der Studentenproteste 2009 haben sehr viele Universitäten begonnen, eigene Systeme zu entwickeln<br />
oder Systeme eingerichtet, die bereits existieren (Sonic Foundry, Camtasia, Lecture2Go, u. a.).<br />
Hierbei werden zwei verschiedene Arten von Aufzeichnungen unterschieden:<br />
• Hardwareaufzeichnung (Sonic Foundry): Es gibt einen Hardwarestreamer, über welchen Quellen angeschlossen<br />
werden und aufgezeichnet werden. Diese Möglichkeit ist einfach aber kostenintensiv.<br />
• Softwarelösungen (Camtasia, Lecturnity, u. a.): Eine Software wird auf den Präsentationsrechner installiert und so<br />
die Präsentation aufgezeichnet. Diese Möglichkeit ist kostengünstig, Nachbearbeitung ist jedoch notwendig.<br />
Probleme<br />
Während klassische Broadcasting-Angebote (Rundfunk, Radio usw.) aus ökonomischer Sicht eine möglichst große<br />
Reichweite anstreben, werden Streaming-<strong>Media</strong>-Angebote mit wachsender Teilnehmerzahl teurer, denn die Daten<br />
müssen an jeden Empfänger einzeln versandt werden. In der Netzwerktechnik ist zwar der Multicast-Modus bekannt,<br />
bei dem ein vom Streaming-Server ausgehender Datenstrom bei geringer Netzbelastung gleichzeitig an verschiedene<br />
Empfänger gesendet werden kann; dieser wird jedoch bis heute praktisch nicht benutzt, weil ihn viele Router im<br />
Internet nicht unterstützen. Stattdessen werden für Streaming-Angebote mit einem Massenpublikum (etwa<br />
Übertragungen der Fußballbundesliga oder Popkonzerte), sogenannte Overlay-Netze genutzt, welche die zu<br />
übertragenden Daten netztopologisch betrachtet an vielen Orten gleichzeitig zur Verfügung stellen.<br />
Da „Streaming <strong>Media</strong>“ besondere Stärken in der Echtzeitübertragung besitzen und diese Übertragung nicht in jedem<br />
Fall ebenso für die dauerhafte Speicherung konzipiert wird, kann die Qualität oftmals eher niedrig ausfallen, um bei<br />
den heute üblichen Datenübertragungsraten eine flüssige Übertragung zu gewährleisten. Aus dieser Perspektive<br />
erscheint die Verwendung der Streaming-Technik bei Inhalten, bei denen es nicht auf eine Echtzeitübertragung<br />
ankommt (etwa bei Film-Trailern) eher fraglich. Viele große Anbieter setzen die Übertragung per Streaming aber<br />
dennoch ein, um von weiteren Vorteilen Gebrauch machen zu können. Bspw. erlauben aktuelle<br />
Internetvideotechnologien das freie Spulen innerhalb von Videos (ohne Vorladezeiten) nur über Streaming Server.<br />
Diverse Inhalte-Anbieter setzen die Streaming-Technik auch mit dem Ziel ein, es den Endbenutzern zu erschweren,<br />
die empfangenen Daten dauerhaft zu speichern. Dies ist nämlich nur mit spezieller Software (etwa MPlayer) möglich<br />
und kann durch weitere Maßnahmen erschwert werden. Dadurch muss der Stream ständig neu geladen werden, was<br />
wiederum unnötigen Datentransfer auf Seiten des Servers und auch des Benutzers verursacht.<br />
Ob die Praxis, dem Endbenutzer das dauerhafte Speichern von Daten zu erschweren, allerdings einen Missbrauch der<br />
Streaming-Technik darstellt, ist strittig: wenn die Daten etwa aus GEMA-Musikrepertoire bestehen, ist der Anbieter
Streaming <strong>Media</strong> 115<br />
dazu sogar verpflichtet. Aus der Perspektive des Urhebers kann das Streamen als ein Mittel gesehen werden, seine<br />
Werke zu präsentieren und trotzdem technisch die Möglichkeit zu behalten, die Verwertung zu kontrollieren und an<br />
der Nutzung seiner Werke zu verdienen.<br />
Noch ist es aber kaum zu kontrollieren, ob etwa die Nutzung eines über das Internet verbreiteten Musik-Senders nur<br />
in dem Land erfolgt, in dem der Betreiber die Rechte gekauft hat. Die daraus resultierenden rechtlichen Probleme<br />
sind noch nicht einmal ansatzweise diskutiert worden, und es gibt erst recht keine Erfahrungswerte in Form von<br />
Urteilen oder Gesetzen.<br />
Im Dezember 2005 hatte die GEMA für WebTV (StreamingTV) noch keinen Vergütungsplan. Provisorisch wurde<br />
daher eine Pauschale von 30 Euro pro Monat erhoben.<br />
Inzwischen hat die GEMA ein Vergütungsmodell für „WebTV-Anbieter“ verabschiedet, das eine Staffelung je nach<br />
Musikanteil vorsieht. Wie in dem Formular beschrieben, ist WebTV aus Sicht der GEMA die Übertragung von<br />
Bewegtbildern in einem vom Betreiber zusammengestellten Ablauf, auf den der Nutzer keinen Einfluss hat. Damit<br />
fallen fast alle WebTV-Sender aus dem mit dieser Vereinbarung abgedeckten Bereich, da ein Archiv zum Abrufen<br />
von „Videos on Demand“ den Sender schon aus der GEMA-Definition herausmanövriert.<br />
Siehe auch<br />
• Geschichte und Entwicklung des Streaming <strong>Media</strong><br />
• Push-Dienst<br />
• Streaming-Server<br />
Weblinks<br />
• AV Streaming Echtzeitübertragung von Bild und Ton im Internet [1] , chaosradio.ccc.de, Chaos Computer Club<br />
Berlin e. V.<br />
• Technische Beschreibung des Streamings von Apple [2] (englisch)<br />
• Technische Informationen zum Einbetten von Streaming <strong>Media</strong> [3]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / chaosradio. ccc. de/ cre137. html<br />
[2] http:/ / developer. apple. com/ documentation/ QuickTime/ RM/ Streaming/ StreamingClient/ index. html<br />
[3] http:/ / aktuell. de. selfhtml. org/ artikel/ grafik/ streaming/ index. htm
RSS 116<br />
RSS<br />
RSS (diverse Bedeutungen, siehe Artikel)<br />
Dateiendung: .rss, .xml<br />
MIME-Type:<br />
Erweitert von: XML<br />
application/rss+xml (Registrierung in Vorbereitung) [1]<br />
RSS (zur Bedeutung der Abkürzung siehe unten) ist eine seit dem Anfang des Jahres 2000 kontinuierlich<br />
weiterentwickelte Familie von Formaten für die einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf<br />
Websites (z. B. News-Seiten, Blogs, Audio-/Video-Logs etc.) in einem standardisierten Format (XML). RSS-Dienste<br />
werden in der Regel in Form spezieller Service-Websites (sogenannter RSS-Channels) angeboten. Ein RSS-Channel<br />
versorgt den Adressaten oft, ähnlich einem Nachrichtenticker, mit kurzen Informationsblöcken, die aus einer<br />
Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen. Zunehmend werden aber auch<br />
komplette Inhalte klassischer Webangebote ergänzend als Volltext-RSS bereitgestellt. Die Bereitstellung von Daten<br />
im RSS-Format bezeichnet man auch als RSS-Feed (englisch to feed – im Sinne von füttern, einspeisen, zuführen).<br />
Wenn ein Benutzer einen RSS-Channel abonniert hat, so sucht der Client in regelmäßigen Abständen beim Server<br />
nach Aktualisierungen im RSS-Feed.<br />
Funktionsweise<br />
Nachdem der RSS-Feed abonniert wurde, kann der Abonnent die Nachrichten im Feedreader einlesen. Der Abonnent<br />
des RSS-Feeds kann dann direkt den angebotenen Links folgen und dort die vollständige Meldung lesen. Die<br />
Adresse eines RSS-Feeds sieht der einer „normalen“ Webseite sehr ähnlich.<br />
Zum Lesen eines RSS-Feeds dienen herkömmliche Webbrowser oder spezielle Programme, die auf die Ähnlichkeit<br />
zum Nachrichtenticker angepasst sind. Letztere nennt man (synonym) RSS-Aggregatoren, RSS-Reader oder<br />
Feedreader. Auch einige aktuelle E-Mail-Programme bieten bereits RSS-Lesefunktionen, ältere können durch<br />
Plugins erweitert werden. Daneben gibt es auch Anwendungen wie Bildschirmschoner.<br />
Im Unterschied zur Benachrichtigung per E-Mail geht die Initiative bei RSS vom Empfänger aus, der den Feed<br />
abonniert hat. Das bedeutet, dass der Anbieter die Leser nicht auswählen kann, sich im Gegenzug aber auch nicht um<br />
eine Verwaltung des Leserstammes (zum Beispiel mit einer Mailinglisten-Software) kümmern muss. Der Leser muss<br />
nicht offenlegen, dass er die Quelle beobachtet und kann Quellen wesentlich leichter abonnieren bzw. das<br />
Abonnement widerrufen, indem er einfach die Einstellung in seinem RSS-Aggregator vornimmt.<br />
RSS vereinfacht insbesondere die Beobachtung einer großen Menge von Quellen wie z. B. Blogs, in denen es eher<br />
selten zu Änderungen kommt, deren Aktualisierung der Leser aber ggfs. nicht verpassen möchte.
RSS 117<br />
Syndikation<br />
Weil die Inhalte via RSS in einem standardisierten Format vorliegen, eignen sie sich auch für die maschinelle<br />
Weiterverarbeitung. So lassen sich mittels RSS beispielsweise Texte einer Webseite automatisch mit Hilfe eines<br />
RSS-Parsers in eine andere Webseite integrieren oder sehr einfach auf verschiedenen Endgeräten speziell aufbereitet<br />
darstellen.<br />
Das Aufbereiten von Informationen in ein standardisiertes Austauschformat/-objekt nennt man auch Aggregation,<br />
das Veröffentlichen auf anderen Seiten Content-Syndication. Webseiten können damit automatisch mit neuesten<br />
Nachrichten aktualisiert werden, ohne dass der Seitenbetreiber jeweils eine Aktualisierung vornehmen muss. Eine<br />
Reihe von Content-Management-Systemen unterstützen diese Funktionalität.<br />
Verwendung<br />
RSS wird verwendet, um Artikel einer Website oder deren Kurzbeschreibungen (insbesondere<br />
Nachrichtenmeldungen) zu speichern und in maschinenlesbarer Form bereitzustellen. Ein sogenannter RSS-Feed<br />
oder Newsfeed (engl. etwa Nachrichteneinspeisung) besteht aus einer XML-Datei, die den reinen strukturierten<br />
Inhalt – beispielsweise einer Nachrichtenseite – bereithält, aber keinerlei Layout, keine Navigation oder sonstige<br />
Zusatzinformationen beinhaltet. Zahlreiche Webangebote, die regelmäßig Artikel publizieren, stellen eine<br />
automatisch generierte RSS-Datei mit den neuesten Artikeln zur Verfügung.<br />
Ursprünglich wurden RSS-Feeds von Nachrichtenseiten (zu Beginn auf dem Netscape.com-Portal) zur<br />
Content-Syndication verwendet. Das Format erlangte seine heutige Popularität vor allem durch den Einsatz in Blogs.<br />
Mittlerweile haben auch MP3-Portale begonnen, RSS-Feeds zusammen mit Podcasting-Funktionalität einzusetzen.<br />
Ein Benutzer kann nun ein sogenanntes Aggregatorprogramm bzw. einen sogenannten Feedreader benutzen, um die<br />
für ihn wichtigsten Schlagzeilen und Kurzbeschreibungen automatisch herunterzuladen und die gesammelten Artikel<br />
geordnet anzeigen zu lassen. Hierfür benötigt der Aggregator lediglich einen Link auf den RSS-Feed.<br />
RSS-Feeds eignen sich auch zur Verarbeitung durch spezialisierte Suchmaschinen und Alert-Dienste. Beispielsweise<br />
können die Artikel innerhalb eines RSS-Feeds durch einschlägige Dienste nach Quellen oder Stichworten gefiltert<br />
und zu einem neuen RSS-Feed zusammengesetzt werden.<br />
RSS zählt zu den ersten Anwendungsgebieten des semantischen Webs.<br />
Zunehmend werden RSS-Feeds auch zur Bekanntmachung von Links zu Dateien (z. B. Torrent-Dateien) verwendet.<br />
Diverse Torrent-Programme besitzen die Möglichkeit zum Abonnement von RSS-Feeds mit entsprechenden<br />
Filtereinstellungen zum automatisierten Herunterladen.<br />
Entwicklung<br />
RSS hat sich vor allem durch Weblogs durchgesetzt, da die meisten Autoren sehr früh RSS-Feeds für ihre Artikel<br />
anboten und viele Weblog-Systeme diese automatisch generieren und in die Webseite einbinden.<br />
Ursprünglich ging es dabei vor allem um Text. Dies hat sich inzwischen geändert: Podcasts etwa zeigen, dass man<br />
auch Audio- oder Video-Inhalte gut via RSS verbreiten kann, die dann z. B. auf tragbare Abspielgeräte ladbar sind.<br />
Technisch gesehen ist RSS eine Familie von XML-basierten Dateiformaten. Die Abkürzung RSS hat in den<br />
verschiedenen technischen Spezifikationen eine unterschiedliche Bedeutung:<br />
• Rich Site Summary in den RSS-Versionen 0.9x<br />
• RDF Site Summary in den RSS-Versionen 0.9 und 1.0<br />
• Really Simple Syndication in RSS 2.0 [2]
RSS 118<br />
Historie der Versionen, Alternativen und Ergänzungen<br />
Derzeit gibt es mehrere Versionen von RSS, deren Versionsnummern zwar aufeinander Bezug nehmen, die aber von<br />
verschiedenen Firmen bzw. Entwicklergruppen zum Teil unabhängig voneinander herausgegeben wurden.<br />
• 1999: RSS 0.90 ist das älteste dieser Formate und stammt von dem My Netscape Network, einer<br />
individualisierbaren Nachrichtenseite von Netscape, aus dem Jahr 1999. Es basiert auf RDF, wurde aber schnell<br />
durch RSS 0.91 abgelöst, welches nicht mehr auf RDF, sondern auf einer einfachen XML-Dokumenttypdefinition<br />
basiert.<br />
• 2000: RSS 0.91 und die weitere Versionslinie 0.9x wurde von UserLand Software inoffiziell weiterentwickelt und<br />
Mitte 2000 erstmals mit RSS 0.91 veröffentlicht. Später wurden noch 0.92 sowie Entwürfe zu 0.93 und 0.94<br />
herausgegeben.<br />
• 2000: RSS 1.0 wurde parallel von einer unabhängigen Entwicklergruppe im Jahr 2000 entwickelt und<br />
veröffentlicht. RSS steht hier für RDF Site Summary, basiert also wieder auf RDF.<br />
• 2002: RSS 2.0 war die von UserLand bekannt gemachte Weiterentwicklung. Es erweitert die älteren<br />
RSS-0.9x-Spezifikationen, macht aber keinen Gebrauch von RDF. RSS 2.0 ist umstritten, da es entgegen den<br />
Aussagen von UserLand nicht vollständig abwärtskompatibel zu den 0.9x-Versionen ist, setzt sich als<br />
Quasi-Standard gleichwohl immer mehr durch. Diese Version wird auch als Really Simple Syndication übersetzt.<br />
In Konkurrenz dazu steht das ebenfalls auf XML basierende Format Atom. RSS und Atom sind nicht miteinander<br />
kompatibel, die beiden Formate können jedoch ineinander umgewandelt werden.<br />
Technik<br />
Aufbau einer RSS-Datei (Version RSS 2.0)<br />
Das folgende Beispiel zeigt den Quelltext eines einfachen RSS-Feeds, welcher dem Dokumenttyp RSS 2.0<br />
entspricht. Der Feed enthält einen Channel mit zwei Beispieleinträgen (item).<br />
<br />
<br />
<br />
Titel des Feeds<br />
URL der Webpräsenz<br />
Kurze Beschreibung des Feeds<br />
Sprache des Feeds (z. B. "de-de")<br />
Autor des Feeds<br />
Erstellungsdatum("Tue, 8 Jul 2008 2:43:19")<br />
<br />
URL einer einzubindenden Grafik<br />
Bildtitel<br />
URL, mit der das Bild verknüpft ist<br />
<br />
<br />
Titel des Eintrags<br />
Kurze Zusammenfassung des Eintrags<br />
Link zum vollständigen Eintrag<br />
Autor des Artikels, E-Mail-Adresse
RSS 119<br />
Eindeutige Identifikation des Eintrages<br />
Datum des Items<br />
<br />
<br />
...<br />
<br />
<br />
<br />
Der Autor des Eintrags sollte in der Form „Vollständiger Name, E-Mail-Adresse“ eingegeben werden. Dies<br />
entspricht einer nach RFC 822 (Sektion 6 ADDRESS SPECIFICATION) geformten Adresse, die mit<br />
SGML-Entitäten codiert wurde. Das Datum entspricht auch der RFC 822 (Beispiel: Sat, 15 Nov 2003 09:59:01<br />
+0200). Das Datum der RFC 2822 wird aber von den meisten RSS-Readern auch verstanden.<br />
Verlinkung einer RSS-Datei<br />
Man kann eine RSS-Datei in der HTML-Seite, deren Inhalte sie maschinenlesbar enthält, verlinken. Dieses<br />
Verfahren wurde für RSS nie spezifiziert, allerdings können fast alle Aggregatorprogramme dadurch selbständig die<br />
Adresse des RSS-Feeds eines Webangebots herausfinden (genannt auto-discovery). Moderne Browser ermöglichen<br />
es dem Seitenbesucher, den so verlinkten RSS-Feed zu abonnieren. Beispielsweise wird in der Adress- oder<br />
Statusleiste des Browser-Fensters eine RSS-Schaltfläche angezeigt.<br />
Dazu wird im head-Bereich ein link-Element eingefügt:<br />
<br />
Es ist ebenfalls möglich, mehrere dieser Links zu verwenden.<br />
Siehe auch<br />
• OPML – ein XML-Format u. a. zur Auflistung mehrerer RSS-Feeds, um diese leicht zwischen Newsreadern<br />
austauschen zu können<br />
• RSS-Parser – Programm, welches RSS-Feeds für Webseiten und andere Medien ausliest<br />
• RSS-Editor – Programm, welches zur (Offline-)Erstellung von RSS Feeds verwendet wird<br />
• OpenSearch – Format, das teilweise auf RSS aufbaut und einen Standard für Ausgaben von Suchmaschinen<br />
definiert<br />
• PubSubHubbub - Protokoll, das die "Polling-Situation" von Feeds umgeht RSS und Atom um eine<br />
Echtzeit-Komponente erweitert
RSS 120<br />
Literatur<br />
• Joshua Grossnickle, Todd Board, et al.: RSS—Crossing into the Mainstream, Oktober 2005, Studie der<br />
Marktforschungsagentur Ipsos Insight im Auftrag von Yahoo!, PDF [3]<br />
• Jörg Kantel: „RSS und Atom kurz und gut“, O’Reilly Deutschland, Köln 2007, ISBN 978-3-89721-527-6<br />
• Heinz Wittenbrink: Newsfeeds mit RSS und Atom, Galileo Press GmbH, Bonn 2005. ISBN 978-3-89842-562-9<br />
• Stephan Schmatz: RSS. Das kleine orange Buch über das kleine orange Icon, kostenloses E-Book [4]<br />
Weblinks<br />
• Linkkatalog [5] zum Thema RSS, Werkzeuge und Artikel im ODP (Open Directory Project)<br />
• Linkkatalog [6] zum Thema RSS-Verzeichnisse im ODP (Open Directory Project)<br />
• Feed-Validator [7] für RSS 2.0, RSS 1.0 und Atom<br />
• RSS - was genau ist das eigentlich? [8]<br />
Spezifikationen<br />
• RSS 0.90 [9] (Netscape)<br />
• RSS 0.91 [10] (Netscape)<br />
• RSS 0.91 [11] (UserLand Software)<br />
• RSS 0.92 [12] (UserLand Software)<br />
• RSS 1.0 [13] (freie Entwicklergruppe mit Unterstützung des W3C)<br />
• RSS 1.1 [14] , inoffizielle Weiterentwicklung der Version 1.0<br />
• RSS 2.0.11 [15] (Aktuelle Version, RSS Advisory Board)<br />
Referenzen<br />
[1] Der application/rss+xml Medien Typ (http:/ / www. rssboard. org/ rss-mime-type-application. txt). Network Working Group, 22. Mai 2006,<br />
abgerufen am 16. August 2007.<br />
[2] http:/ / cyber. law. harvard. edu/ rss/ rss. html<br />
[3] http:/ / publisher. yahoo. com/ rss/ RSS_whitePaper1004. pdf<br />
[4] http:/ / schmatz. cc/ index. php?option=com_content& view=article& id=83:kostenloses-e-book-zum-thema-rss& catid=35:aktuell&<br />
Itemid=55<br />
[5] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Datenformate/ Markup_Languages/ XML/ RSS/<br />
[6] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Datenformate/ Markup_Languages/ XML/ RSS/ Verzeichnisse/<br />
[7] http:/ / feedvalidator. org/<br />
[8] http:/ / www. techfacts. net/ rss-was-genau-ist-das-eigentlich/<br />
[9] http:/ / www. rssboard. org/ rss-0-9-0<br />
[10] http:/ / www. rssboard. org/ rss-0-9-1-netscape<br />
[11] http:/ / backend. userland. com/ rss091<br />
[12] http:/ / backend. userland. com/ rss092<br />
[13] http:/ / web. resource. org/ rss/ 1. 0/ spec<br />
[14] http:/ / inamidst. com/ rss1. 1/<br />
[15] http:/ / www. rssboard. org/ rss-specification
<strong>Social</strong> Tagging 121<br />
<strong>Social</strong> Tagging<br />
<strong>Social</strong> Tagging ist eine Form der freien Verschlagwortung<br />
(Indexierung), bei der Nutzer von Inhalten die Deskriptoren<br />
(Schlagwörter) mit Hilfe verschiedener Arten von Sozialer Software<br />
ohne Regeln zuordnen. Die bei diesem Prozess erstellten Sammlungen<br />
von Schlagwörtern werden zu Deutsch Folksonomien genannt.<br />
Derzeit beherbergt die deutsche Sprache keine sinnvolle Entsprechung<br />
des Begriffs. Die bekannten englischsprachigen Begriffe für diese Art<br />
der Erschließung lauten collaborative tagging bzw. social tagging. Die<br />
hierbei vergebenen freien Schlagwörter werden als Tags bezeichnet,<br />
welche gesammelt eine folksonomy bilden. Mehrere Tags können<br />
zusammen als Tag Cloud (Wortwolke) visualisiert werden.<br />
Anwendung<br />
Die Folksonomy findet ihre Anwendung hauptsächlich auf<br />
Internetseiten beziehungsweise in den von ihnen angebotenen<br />
Gemeinschaften, um deren Inhalte zu verschlagworten. Andere<br />
Benutzer finden diese Informationen dann durch die Suche nach einem<br />
Auszug einer Tag Cloud des Internet Tagebuchs<br />
Schlagwort. Populäre, auf diese Art und Weise von vielen Personen indexierte Objekte sind Blogeinträge, Fotos oder<br />
Soziale Lesezeichen. Die Nutzer agieren dabei in offenen Gemeinschaften ohne festgelegte Indexierungsregeln. Das<br />
gemeinschaftliche Indexieren dient dabei vor allem der Sacherschließung.<br />
Gern bedient man sich der grafischen Darstellung einer Tag Cloud bei der die populärsten Schlagwörter<br />
typographisch am größten dargestellt werden.<br />
Entstehung und Ursprung<br />
Die Entstehung des Kofferwortes Folksonomy aus „folk taxonomies“, also Laien-Taxonomien, wird auf Thomas<br />
Vander Wal zurückgeführt. Folksonomy wurde im Jahre 2003 zuerst auf der Internetseite del.icio.us angewandt.<br />
Jon Udell führte im Jahr 2004 aus, dass diese Art der Indexierung schon bekannt sei, neu sei allerdings die<br />
Möglichkeit der Rückkopplung durch einzelne Nutzer.<br />
Eine umfassende Studie über Folksonomies hinsichtlich Wissensrepräsentation und Information Retrieval legt 2009<br />
Isabella Peters vor.<br />
Vorteile gegenüber kontrollierter Erschließung<br />
Durch eine Folksonomie kann jeder Benutzer etwas zur Verschlagwortung beitragen. So verteilt sich zum einen der<br />
Kategorisierungsaufwand auf viele Schultern, zum anderen werden bessere Such-Ergebnisse erzielt, wenn die<br />
Informationsobjekte auch von denjenigen kategorisiert werden, die sie auch benutzen. Durch die zumeist große Zahl<br />
von Benutzern sollen Informationen und Zusammenhänge, die dem einzelnen nicht aufgefallen sind, sichtbar<br />
gemacht werden.<br />
Neben individuellen Nutzen für die Selbstorganisation des einzelnen Nutzers hat dieser die Möglichkeit, seine<br />
Schlagwortsammlung der Allgemeinheit zugänglich zu machen. So können zum Beispiel Dokumente mit identischen<br />
Schlagwörtern oder Nutzer mit ähnlichen Interessen (welche anhand ihrer Schlagwörter identifiziert werden) in<br />
Verbindung gebracht werden. Das offene Teilen der Schlagwörterzuordnungen der Einzelnen mit Anderen bietet der<br />
Netbib
<strong>Social</strong> Tagging 122<br />
Gemeinschaft einerseits eine gute Suchmöglichkeit (gemeinsames Erschließen eines Informationsraumes), erlaubt es<br />
einzelnen Benutzern aber auch, über die Zuordnung der Schlagwörter zu Benutzern auf andere Objekte oder andere<br />
Sichtweisen aufmerksam zu werden.<br />
Nachteile gegenüber kontrollierter Erschließung<br />
Bei der herkömmlichen manuellen Erschließung, beispielsweise durch Bibliothekare, werden meist Klassifikationen<br />
oder andere zentral verwaltete kontrollierte Vokabulare eingesetzt.<br />
Aufgrund der Neuheit der Technik, fehlt bei der Folksonomy eine etablierte Methode des gemeinschaftlichen<br />
Indexierens. Es gibt keine Instanz, die festlegt, welche Schlagwörter zu verwenden sind und welche nicht. Durch die<br />
freie Auswahl der Schlagwörter kommt es zu einer Zersplitterung der Kategorien z. B. wird etwa die gleiche Sache<br />
von einigen Benutzern im Singular (Beispiel: Buch) und von anderen im Plural (Bücher) bezeichnet. Hinzu kommt<br />
bei internationalen Gemeinschaften eine Folksonomy in verschiedenen Sprachen (Buch, Bücher, Book, Books usw.).<br />
Bei zusammengesetzten Begriffen kann man sich, falls nur ein Wort und nicht mehrere technisch zugelassen sind,<br />
für ein Trennzeichen (open_access) oder die Zusammenschreibung entscheiden (openaccess).<br />
Ein weiterer Nachteil der freien Verschlagwortung ist eine Problematik, die durch Synonyme und Homonyme<br />
entsteht: Begriffe können für völlig verschiedene Konzepte stehen und die genaue Bedeutung eines Schlagwortes ist<br />
oft nur im Kontext eindeutig zu verstehen. So steht zum Beispiel das englische Wort „apple“ im allgemeinen<br />
Sprachgebrauch für die Frucht Apfel, während in der Elektronikindustrie die Firma Apple Inc. und in der<br />
Musikbranche das Plattenlabel Apple Records gemeint sein kann, oder die Stadt New York als Big Apple damit<br />
verkürzt bezeichnet sein kann. Ein weiteres Beispiel: Versieht ein Nutzer seine Fotos eines internationalen<br />
Politikgipfels mit den Rednern Kohl und Bush auf einer Webanwendung wie Flickr mit den Schlagwörtern Kohl,<br />
Bush, Gipfel - ermöglicht dies anderen Nutzern gezielt Fotos zu finden, die mit diesen Schlagwörtern<br />
übereinstimmen. Wie dieses Beispiel zeigt, ist das Vorgehen der freien Verschlagwortung, aber mitunter<br />
problematisch, da es zu Doppeldeutigkeiten kommen kann. In diesem Fall mit den Gewächsen Kohl und Bush (deu.<br />
Strauch), sowie Gipfel, einer geomorphologischen Bezeichnung.<br />
Um dieser Problematik entgegenzuwirken können verwandte Schlagwörter angezeigt werden und Methoden der<br />
halbautomatischen Indexierung (Vorschlagen von passenden Tags bei der Tagvergabe) benutzt werden. Als weiteres<br />
Korrektiv wird die Masse an Benutzern angesehen, die Nutzer dazu bringen könnte, sich an dem jeweils populärsten<br />
Schlagwort zu orientieren. Zudem können Data-Mining-Methoden, wie zum Beispiel Clustering eingesetzt werden.<br />
Hierdurch können Gruppen von gleichartigen Ressourcen voneinander unterschieden werden. Zudem sollten immer<br />
mehrere Schlagwörter zur Beschreibung des Inhalts vergeben werden.<br />
Gemeinschaftliches Indexieren mit kontrolliertem Vokabular<br />
Neue Internetprojekte kombinieren das gemeinschaftliche Indexieren mit lexikalischen oder semantischen<br />
Datenbanken, wie der Wikipedia oder der semantischen DBpedia um eine spezielle Form eines kontrollierten<br />
[1] [2] [3]<br />
Vokabulars anzubieten.<br />
Siehe auch<br />
• Metadaten<br />
• Annotation<br />
• Thesaurus<br />
• Informationswissenschaft<br />
• <strong>Social</strong> Cataloging (LibraryThing, CiteULike, …)
<strong>Social</strong> Tagging 123<br />
Literatur<br />
• Sascha A. Carlin: Schlagwortvergabe durch Nutzende (Tagging) als Hilfsmittel zur Suche im Web. Ansatz,<br />
Modelle, Realisierungen. August 2006 ([4])<br />
• Scott Golder, Bernardo A. Huberman: The Structure of Collaborative Tagging Systems. August 2005. [5]<br />
• Marieke Guy, Emma Tonkin: Folksonomies – Tidying up Tags?. D-Lib Magazine 12, 1, 2006 [6]<br />
• Markus Heckner, Susanne Mühlbacher, Christian Wolff: "Tagging tagging. Analysing user keywords in scientific<br />
bibliography management systems". Journal of Digital Information 27, 9, 2008 [7]<br />
• George Macgregor, Emma McCulloch: Collaborative Tagging as a Knowledge Organisation and Resource<br />
Discovery Tool. In: Library Review, Band 55, Nummer 5, 2006. [8]<br />
• Isabella Peters: Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter Saur, 2009.<br />
• Isabella Peters, Wolfgang G. Stock: Folksonomies in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. März<br />
2008 ([9])<br />
• Wolfgang G. Stock (Autor), Mechtild Stock: Folksonomie, Kapitel 9: Kollaborative Inhaltserschließung, Kapitel<br />
10: Bearbeitung von Tags, In: Wissensrepräsentation: Auswerten und Bereitstellen von Informationen,<br />
Oldenbourg, 2008, ISBN 978-3-486-58439-4<br />
• Clay Shirky: Ontology is Overrated: Categories, Links, and Tags. Mai 2005. [10]<br />
• Jakob Voss: Tagging, Folksonomy & Co - Renaissance of Manual Indexing?. <strong>Jan</strong>uar 2007 [11]<br />
• Jakob Voss: Collaborative thesaurus tagging the Wikipedia way. April 2006 [12]<br />
• Birgit Gaiser, Thorsten Hampel, Stefanie Panke: Good Tags - Bad Tags: <strong>Social</strong> Tagging in der<br />
Wissensorganisation, Waxmann, 2008, Tagungsband, Workshop der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft<br />
(GMW) im Tübinger Institut für Wissensmedien (IWM), [13]<br />
• Jutta Bertram: <strong>Social</strong> Tagging - Zum Potential einer neuen Indexiermethode., In: Information: Wissenschaft und<br />
Praxis, Bd. 60 (2009) Nr. 1, S. 19-26.<br />
• Herbert Frohner: <strong>Social</strong> Tagging. Grundlagen, Anwendungen, Auswirkungen auf Wissensorganisation und soziale<br />
Strukturen der User, Hülsbusch, 2010, ISBN 978-3-940317-03-2<br />
Weblinks<br />
• Eintrag zu „Folksonomy“ [14] im Computerwoche-Wiki (deutsch)<br />
• Folksonomies – Cooperative Classification and Communication Through Shared Metadata, englisch [15]<br />
Referenzen<br />
[1] Faviki (http:/ / www. faviki. com)<br />
[2] Semantic Tagging with Faviki - ReadWriteWeb (http:/ / www. readwriteweb. com/ archives/ semantic_tagging_with_faviki. php)<br />
[3] Zigtag (http:/ / www. zigtag. com)<br />
[4] http:/ / itst. net/ 760-diplomarbeit-tagging-schlagwortvergabe-durch-nutzende<br />
[5] http:/ / arxiv. org/ abs/ cs. DL/ 0508082<br />
[6] http:/ / www. dlib. org/ dlib/ january06/ guy/ 01guy. html<br />
[7] http:/ / journals. tdl. org/ jodi/ article/ view/ 246<br />
[8] http:/ / eprints. rclis. org/ archive/ 00005703/<br />
[9] http:/ / wwwalt. phil-fak. uni-duesseldorf. de/ infowiss/ admin/ public_dateien/ files/ 1/ 1204545101folksonomi. pdf<br />
[10] http:/ / shirky. com/ writings/ ontology_overrated. html<br />
[11] http:/ / arxiv. org/ abs/ cs/ 0701072<br />
[12] http:/ / arxiv. org/ abs/ cs/ 0604036<br />
[13] http:/ / www. waxmann. com/ kat/ inhalt/ 2039Volltext. pdf<br />
[14] http:/ / wiki. computerwoche. de/ doku. php/ web_2. 0/ folksonomy<br />
[15] http:/ / www. adammathes. com/ academic/ computer-mediated-communication/ folksonomies. html
<strong>Social</strong> Bookmarks 124<br />
<strong>Social</strong> Bookmarks<br />
<strong>Social</strong> Bookmarks (selten auch in der übersetzten Form: „Soziale Lesezeichen“) sind Internet-Lesezeichen, die von<br />
mehreren Nutzern gemeinsam auf einem Server im Internet oder im Intranet abgelegt werden, so dass sie gemeinsam<br />
darauf zugreifen können, um die Lesezeichen untereinander auszutauschen. Der Zugriff auf den Dienst erfolgt<br />
standardmäßig über einen Webbrowser; für manche Dienste gibt es auch spezielle Browser-Erweiterungen, um die<br />
Bedienung zu erleichtern.<br />
Man spricht insoweit auch vom gemeinschaftlichen Indexieren von Internet-Quellen. Dazu werden üblicherweise<br />
sogenannte <strong>Social</strong>-Bookmark-Netzwerke genutzt, vor allem, um Links und Nachrichtenmeldungen zu sammeln.<br />
Anbieter und Funktionen<br />
Zu den größten Anbietern im englischsprachigen Bereich zählen Delicious (ehemals "del.icio.us"), Digg,<br />
StumbleUpon und Microsoft. Es gibt auch rein deutschsprachige Dienste, wie z. B. Linkarena und Oneview. Mister<br />
Wong bietet neben der deutschsprachigen Oberfläche auch einen Dienst auf Englisch an. Zu den deutschen<br />
Vertretern, die sich auf das „bookmarken“ von Nachrichten spezialisiert haben, gehören unter anderem ShortNews,<br />
Webnews oder YiGG. Darüber hinaus haben sich im deutschsprachigen Raum auch kleinere Portale wie<br />
beispielsweise scoop.at in Österreich entwickelt, die bewusst einen länderspezifischen Nachrichtenbezug in den<br />
Vordergrund stellen.<br />
Nutzer können eigene Lesezeichen hinzufügen, löschen, bewerten, kommentieren beziehungsweise mit Kategorien<br />
oder Schlagwörtern (engl. Tags) versehen. Ebenso haben sie Einblick in die Lesezeichen anderer Nutzer, die in die<br />
eigene Sammlung übernommen werden können. <strong>Social</strong> Bookmarks lassen sich je nach Dienst nach Schlagwörtern,<br />
Schlagwörter-Kombinationen, Kategorien oder Benutzern auflisten und durchsuchen. Zudem gibt es in vielen Fällen<br />
eine Auflistung der von allen Nutzern zuletzt gespeicherten Lesezeichen auf der Startseite sowie eine Liste der<br />
beliebtesten Links. Jede dieser Listen lässt sich mit Hilfe eines RSS-Feeds verfolgen. Die meisten Anbieter von<br />
<strong>Social</strong> Bookmarks bieten eine Auflistung thematisch verwandter Links bzw. verwandter Tags an. Weitere<br />
Funktionen, die es allerdings nicht bei allen Anbietern gibt, sind Gruppenfunktionen, E-Mail- und<br />
Netzwerkfunktionen zwischen einzelnen Nutzern, Im- und Export der Lesezeichen-Dateien sowie Toolbars und<br />
Such-Erweiterungen für diverse Browser.<br />
Suchmaschinenoptimierung<br />
Auch in Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung können <strong>Social</strong> Bookmarks interessant sein. Sie ermöglichen es<br />
nicht nur, eine Webseite bekannter zu machen, sondern können auch zu zusätzlichen Backlinks beitragen. Das<br />
Verlinken verschiedener <strong>Social</strong> Bookmarking-Dienste auf der eigenen Webseite andererseits bietet Besuchern die<br />
Möglichkeit, diese Webseite mit wenigen Klicks bei ihrem bevorzugten <strong>Social</strong> Bookmark-Dienst als Lesezeichen<br />
ablegen zu können und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Webseite gebookmarkt wird. Allerdings<br />
ist übertriebenes Eintragen der eigenen Webseite in verschiedene <strong>Social</strong> Bookmarking-Dienste unerwünscht und<br />
wird als Spam gewertet. Viele solcher „Eigenwerber“ glauben fälschlicherweise, dass sie<br />
<strong>Social</strong>-Bookmarking-Dienste für die kostenlose Steigerung der Linkpopularität nutzen dürfen. In den Augen der<br />
Betreiber von <strong>Social</strong>-Bookmarking-Diensten soll jedoch ein solcher nicht als Werbeplattform für benutzer-eigene<br />
Websites dienen. So verhindern viele Dienste das Weiterverfolgen von Weblinks, indem diese mit dem<br />
nofollow-Attribut versehen oder durch das Robots-Exclusion-Standard-Protokoll geblockt werden. [1]<br />
Andererseits führt diese Möglichkeit der Suchmaschinenoptimierung dazu, dass einige dieser Bookmarking-Dienste<br />
einzig als Optimierungsprojekt des Betreibers aufgebaut werden. In diesem Fall werden die eingetragenen<br />
Bookmarks nur von extrem wenigen Usern gesehen und dienen nur dem Linkaufbau. Zu erkennen sind diese reinen<br />
SEO-Projekte an vielen Einträgen, die auf dieselben Webseiten zeigen, an geringen Bewertungszahlen und an einer
<strong>Social</strong> Bookmarks 125<br />
"trägen" Community.<br />
Open-Source-Lösungen<br />
Es gibt eine Reihe von Open-Source-Lösungen für <strong>Social</strong> Bookmarks, die auf dem eigenen Server installiert werden<br />
können, z. B. Unalog, Connotea, Scuttle oder Pligg. Mit dem CMS Joomla kann ebenfalls ein Bookmark Dienst<br />
erstellt werden.<br />
Literatur<br />
• Christian Maaß, Gernot Gräfe, Andreas Heß (2007): Alternative Searching Services: Seven Theses on the<br />
Importance of <strong>Social</strong> Bookmarking, SABRE Conference, Leipzig 2007.<br />
• Tony Hammond, Timo Hannay, Ben Lund und Joanna Scott: <strong>Social</strong> Bookmarking Tools (I): A General Review<br />
[2] . In: D-Lib Magazine 11, Nr. 4, 2005.<br />
• Ben Lund, Tony Hammond, Martin Flack und Timo Hannay: <strong>Social</strong> Bookmarking Tools (II): A Case Study –<br />
Connotea [3] . In: D-Lib Magazine 11, Nr. 4, 2005.<br />
Quellen<br />
Siehe auch<br />
• <strong>Social</strong> Cataloging<br />
Weblinks<br />
• Linkkatalog (http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/ WWW/ Web-Anwendungen/<br />
Bookmarkverwaltung/ <strong>Social</strong>_Bookmarks/ ) zum Thema <strong>Social</strong> Bookmarks im ODP (Open Directory Project)<br />
• Linkkatalog (http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Medien/ Aktuelle_Nachrichten/ Communitys/ ) zum<br />
Thema News Communitys im ODP (Open Directory Project)
Cloud Computing 126<br />
Cloud Computing<br />
„Cloud Computing“ (deutsch etwa Rechnen in der Wolke) ist ein Begriff aus der Informationstechnik (IT). Er<br />
bezeichnet primär den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher - siehe IaaS),<br />
fertige Programmpakete (siehe SaaS) und Programmierumgebungen (siehe PaaS) dynamisch an den Bedarf<br />
angepasst über Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Die Abrechnung erfolgt dabei nutzungsabhängig, da nur<br />
tatsächlich genutzte Dienste bezahlt werden müssen. Ein weiterer zentraler Punkt des Konzeptes ist, dass die<br />
Bereitstellung basierend auf der Kombination aus virtualisierten Rechenzentren und modernen Webtechnologien wie<br />
Webservices vollautomatisch erfolgen kann und somit keinerlei Mensch-Maschine-Interaktion mehr erfordert.<br />
Sekundär geht es bei „Cloud Computing“ auch darum, alles als dynamisch nutzbaren Dienst zur Verfügung zu<br />
stellen, sei es nun Rechenkapazität, Buchhaltung, einfachste von Menschen verrichtete Arbeit, eine fertige<br />
Softwarelösung oder beliebige andere Dienste (siehe auch XaaS). Im Zentrum steht dabei die Illusion der<br />
unendlichen Ressourcen, die völlig frei ohne jegliche Verzögerung an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden<br />
können (siehe auch Skalierbarkeit) [1] .<br />
Vereinfacht kann das Konzept wie folgt beschrieben werden: Die<br />
IT-Landschaft (in diesem Zusammenhang z. B. Rechenzentrum,<br />
Datenspeicher, Mail- oder Kollaborationssoftware,<br />
Entwicklungsumgebungen, aber auch Spezialsoftware wie<br />
Customer-Relationship-Management (CRM) oder<br />
Business-Intelligence (BI)) wird durch den Anwender nicht mehr<br />
selbst betrieben oder bereitgestellt, sondern von einem oder mehreren<br />
Anbietern als Dienst gemietet. Die Anwendungen und Daten befinden<br />
sich nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder im<br />
Firmenrechenzentrum, sondern in der (metaphorischen) Wolke (engl.<br />
„cloud“), die üblicherweise das Internet in gängigen<br />
Einige Anbieter von Dienstleistungen zu Cloud<br />
Computing<br />
Netzwerkdiagrammen repräsentiert. Der Zugriff auf die entfernten Systeme erfolgt über ein Netzwerk,<br />
beispielsweise das Internet. Es gibt aber im Kontext von Firmen auch sogenannte „Private Clouds“, bei denen die<br />
Bereitstellung firmenintern und somit nur bedingt über das Internet erfolgt. Die meisten Anbieter von Cloudlösungen<br />
nutzen die Poolingeffekte, die aus der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen entstehen, für ihr Geschäftsmodell.<br />
Definition<br />
Der Begriff „Cloud Computing“ stammt aus dem IT-Management und wird dem Wirtschafts-Professor Ramnath K.<br />
Chellappa zugeordnet. Der Name leitet sich von dem in Strukturplänen verwendeten Wolkensymbol für das Internet<br />
ab. [2]<br />
Es existieren eine Reihe von pragmatischen Definitionsansätzen:<br />
• „Cloud Computing“ steht für einen Pool aus abstrahierter, hochskalierbarer und verwalteter IT-Infrastruktur, die<br />
Kundenanwendungen vorhält und falls erforderlich nach Gebrauch abgerechnet werden kann. (Quelle: Forrester<br />
Research)<br />
• „Cloud Computing“ umfasst On-Demand-Infrastruktur (Rechner, Speicher, Netze) und On-Demand-Software<br />
(Betriebssysteme, Anwendungen, Middleware, Management- und Entwicklungs-Tools), die jeweils dynamisch an<br />
die Erfordernisse von Geschäftsprozessen angepasst werden. Dazu gehört auch die Fähigkeit, komplette Prozesse<br />
zu betreiben und zu managen. (Quelle: Saugatuck Technology)<br />
• 2009 veröffentlichte das National Institute for Standards and Technology (NIST) eine Definition [3] , die auf<br />
weitgehende Akzeptanz stieß und verschiedene Definitionsansätze bündelt. Sie enthält die drei verschiedenen<br />
Servicemodelle (IaaS, PaaS und SaaS), vier Liefermodelle (private clouds, public clouds, hybrid clouds und
Cloud Computing 127<br />
community clouds) und listet fünf essenzielle Charakteristika für Cloud Computing.<br />
Demzufolge geht „Cloud Computing“ über andere gegenwärtig diskutierte Ansätze (Software-as-a-Service (SaaS),<br />
„Organic Computing“) und Konzepte (Virtualisierung) hinaus. Unter der Bedingung einer öffentlichen<br />
Verfügbarkeit, ähnlich beispielsweise dem öffentlichen Telefonnetz, kann man „Cloud Computing“ je nach<br />
Architektur auch als Summe von SaaS und „Utility Computing“ ansehen. [4]<br />
Architektur<br />
Aufgrund der noch sehr kurzen Geschichte von „Cloud Computing“ gibt es noch keine eindeutige Definition des<br />
Begriffes. Ebenso finden sich in diversen Artikeln immer wieder unterschiedliche Skizzen der Architektur.<br />
Eine gebräuchliche Darstellungsform ist die Pyramidendarstellung in der es 3 Schichten gibt: [5]<br />
• Infrastruktur,<br />
• Plattform und<br />
• Anwendung.<br />
Auf diese Art können auch die<br />
unterschiedlichen Typen von „Clouds“<br />
klassifiziert werden.<br />
Infrastruktur<br />
Die Infrastruktur oder „Cloud Foundation“<br />
stellt die unterste Schicht im „Cloud<br />
Computing“ dar. Sie wird oft mit dem<br />
Begriff „Cloud Hosting“ assoziiert, obwohl<br />
dieser oft auch die darüberliegende<br />
Cloud Computing Architektur<br />
PaaS-Schicht mit umfasst [6] . Meist spricht man aber von Infrastructure-as-a-Service“ (IaaS). Die Elastic Compute<br />
Cloud (EC2) von Amazon kann beispielsweise in diese Kategorie eingeordnet werden. Der Service stellt eine<br />
Umgebung von virtuellen Servern zur Verfügung.<br />
Der große Vorteil gegenüber traditionellen Datencentern ist die Skalierbarkeit: Die Hardware kann je nach<br />
Anforderungen beliebig um weitere Instanzen erweitert oder verkleinert werden. Der Benutzer hat vollen Zugriff auf<br />
die virtuelle Hardware und kann auch selbst Anwendungen installieren. Dafür muss er die Server aber auch selbst<br />
administrieren und OS-Patches einspielen.<br />
Weitere Beispiele sind Amazon S3, GoGrid und Linode.<br />
Plattform<br />
Im Vergleich dazu können die Services Windows Azure von Microsoft, „App Engine“ von Google oder „force.com“<br />
von Salesforce.com der Plattform-Schicht zugeordnet werden. Dieses Modell wird auch als Platform-as-a-Service<br />
(PaaS) bezeichnet. Hier steht die Anwendung im Vordergrund. Der Entwickler erstellt die Anwendung und lädt diese<br />
auf den Server. Dieser kümmert sich dann selbst um die Aufteilung auf die physischen Server.<br />
Auf der anderen Seite hat der Benutzer kaum oder keine Möglichkeit, den Server selbst zu konfigurieren, da er<br />
keinen direkten Zugriff darauf hat. Er muss also die Server nicht administrieren, sondern die Administration wird<br />
hier komplett vom Anbieter übernommen, wodurch potentiell Kosten der Administration eingespart werden können.
Cloud Computing 128<br />
Anwendung<br />
Die Anwendung stellt die oberste Schicht dar. Bei der Erstellung von Anwendungen in der „Cloud“ muss vermehrt<br />
auf folgende Probleme geachtet werden:<br />
• Das Design soll modular und serviceorientiert sein.<br />
• Die Last ist unberechenbar, denn über den Erfolg einer Anwendung kann selten eine zuverlässige Aussage<br />
gemacht werden.<br />
• Die Anwendung soll dynamisch, verteilt und mandantenfähig sein.<br />
Das anwendungsbasierte Cloud-Konzept wird auch Software-as-a-Service (SaaS) genannt. Bekannte Beispiele für<br />
eine Cloud-Anwendung sind Google Docs, Microsoft Skydrive Office Web Apps und Exchange Online, Sharepoint<br />
Online, Livemeeting, Office Communications Online.<br />
Arten von Clouds<br />
Man kann zwischen verschiedenen Arten von „Clouds“ unterscheiden, die je nach Anwendungsfall ihre Berechtigung<br />
haben:<br />
• Private Cloud: Bei „Private Clouds“ steht im Vordergrund, dass sich sowohl Anbieter als auch Nutzer im selben<br />
Unternehmen befinden, wodurch beispielsweise sämtliche Probleme aus dem Bereich Datensicherheit mehr oder<br />
minder hinfällig werden. Man unterscheidet dabei folgende Evolutionsstufen:<br />
• Exploratory Cloud: Hier steht das Ausprobieren von Cloudfunktionalität innerhalb eines Unternehmens im<br />
Vordergrund. Dabei geht es insbesondere darum, Potential und Nachteile für konkrete Anwendungen<br />
herauszufinden.<br />
• „Departmental Cloud“: Hierbei handelt es sich um eine Cloud, die sich innerhalb eines Unternehmens auch<br />
lediglich innerhalb einer Abteilung befindet. Dies bedeutet insbesondere, dass Anbieter und Nutzer innerhalb<br />
der gleichen Abteilung zu finden sind. Diese Cloudart dient nicht mehr nur Testzwecken.<br />
• Enterprise Cloud: Im Gegensatz zur „Departmental Cloud“ stammen hier Anbieter und Nutzer aus<br />
unterschiedlichen Unternehmensabteilungen.<br />
• Public Cloud: Eine „Public Cloud“ ist eine „Cloud“, die öffentlich ist, d. h. von beliebigen Personen und<br />
Unternehmen genutzt werden kann und nicht mehr auf interne Anwendungen einer einzelnen Institution/eines<br />
Unternehmens beschränkt ist. Hierbei greifen dann auch vor allem Probleme, die mit Datensicherheit zu tun<br />
haben und jeder Akteur muss sich selbst überlegen, wie viele und welche Daten er außerhalb seiner unmittelbaren<br />
Kontrolle halten möchte. Auch hier gibt es Unterformen:<br />
• Exclusive Cloud: „Exclusive Clouds“ setzen voraus, dass sich sowohl Anbieter als auch Nutzer kennen. Sie<br />
handeln feste Konditionen aus und schließen einen Vertrag darüber ab. Es gibt keine Unbekannten.<br />
• Open Cloud: Bei „Open Clouds“ kennen sich Anbieter und Nutzer vorher nicht. Dies hat zur Folge, dass der<br />
Anbieter sein Angebot ohne direkten Input vom Kunden entwickeln und in Form von SLAs festschreiben<br />
muss. Auf Grund der Vielzahl an potentiellen Nutzern müssen auch der gesamte Geschäftsabschluss sowie die<br />
Nutzung von Instanzen anbieterseitig vollautomatisch ablaufen. Als Beispiel hierfür wären die Amazon Web<br />
Services zu nennen oder auch das Marktplatzmodell von Zimory.<br />
• Hybrid Cloud: Ein Unternehmen betreibt eine eigene „Private Cloud“ und nutzt zusätzlich als Failoverstrategie<br />
oder für Belastungsspitzen eine „Public Cloud“.
Cloud Computing 129<br />
Vorteile und Probleme<br />
Ebenso wie die Virtualisierung ermöglicht „Cloud Computing“ Kostenvorteile [7] gegenüber konventionellen<br />
Systemen. Dies ist der Fall, wenn sich z. B. die Bezahlung nach der Dauer der Nutzung des Dienstes richtet und der<br />
Dienst nur gelegentlich genutzt wird. Lokale Ressourcen (Software und Hardware) lassen sich einsparen.<br />
Zunehmend wird diese Ressourceneffizienz auch in Verbindung mit der nachhaltigen Nutzung von IKT-Systemen<br />
gebracht, wobei entsprechende Überlegungen keineswegs neu sind. Ein häufig zitiertes Beispiel ist die Realisierung<br />
von E-Mail-Systemen auf Basis von „Cloud Computing“, denn hier nimmt die Komplexität der Anwendung durch<br />
Maßnahmen zur Unterbindung von Kompromittierungsversuchen kontinuierlich zu, so dass kleinere Unternehmen<br />
von einer Auslagerung profitieren können. Vorteile ergeben sich auch im Fall von stark schwankender Nachfrage:<br />
Normalerweise müsste man genug Kapazität vorhalten, um die Belastungsspitzen bedienen zu können. Bei Nutzung<br />
von „Cloud Computing“ lässt sich die genutzte Kapazität variabel an den tatsächlichen Bedarf kurzfristig anpassen.<br />
Das Grundproblem, nämlich die Absicherung des Zugriffs auf die Anwendungsdaten beim Transfer zwischen<br />
lokalem Client und entferntem Server, konnte bis heute nicht befriedigend gelöst werden. Es existieren allerdings<br />
zahlreiche Entwicklungen im Bereich der Datensicherheit, wie beispielsweise SSL/TLS-Verschlüsselung.<br />
Kritiker befürchten, dass die Kontrolle der privaten Daten von Benutzern durch die marktdominanten Anbieter, wie<br />
etwa Google, hierdurch überhandnehme. [8] Allerdings gibt es mittlerweile Algorithmen, die Berechnungen so auf<br />
einzelne Instanzen aufteilen können, dass es selbst allen Instanzen gemeinsam nicht möglich ist, Rückschlüsse auf<br />
die verarbeiteten Daten zu ziehen. Dies ist lediglich der ausführenden Instanz möglich, da nur sie den genauen<br />
Algorithmus kennt, mit dem die Teilergebnisse wieder zusammengeführt werden. Der kommerziellen Nutzung<br />
solcher Verfahren stehen heute allerdings noch Performanceprobleme im Weg. Ein weiterer Ansatz, der sich zur<br />
Behebung dieses Problems eignet, ist die Anwendung einer voll homomorphen Verschlüsselung. Dabei wird<br />
innerhalb der Cloud ausschließlich auf verschlüsselten Daten gerechnet, die im privaten Bereich dann wieder<br />
entschlüsselt werden können. Die Herausforderung liegt hier jedoch momentan darin, eine solche Verschlüsselung<br />
zu finden, die noch dazu performant genug für einen massiven, großflächigen Einsatz, wie er in der Cloud nötig<br />
wäre, ist. Eine weitere Herausforderung in der Cloud ist die Abhängigkeit (Lock-in-Effekt) vom jeweiligen<br />
Cloud-Anbieter, da die angebotenen Schnittstellen meist sehr herstellerspezifisch sind.<br />
Abgrenzung zu „Grid Computing“<br />
Bei „Grid Computing“ geht es um die gemeinschaftliche Nutzung der gemeinsamen Ressourcen und es gibt keine<br />
zentrale Steuerung. Im Fall von „Cloud Computing“ hat man einen Anbieter der Ressourcen und einen Nutzer, die<br />
Steuerung der Ressourcen erfolgt ebenfalls zentral.<br />
Abgrenzung zu Peer-to-Peer<br />
Auch wenn das Konzept der Clouds dem eines Peer-to-Peer Netzwerkes nicht unähnlich erscheint und beide Ansätze<br />
auch oftmals miteinander verwechselt werden, ist das Ziel des „Cloud Computings“ ein anderes. In<br />
Peer-to-Peer-Netzwerken geht es darum, Rechenlast auf möglichst viele Rechner zu verteilen und somit die Last von<br />
einem Server wegzunehmen. Beim „Cloud Computing“ geht es nicht um Verteilung, sondern um Auslagerung von<br />
Rechenlasten. Anstatt eigene Rechner-, Server- oder Softwareressourcen zu nutzen oder die Last im Netzwerk zu<br />
verteilen, werden die Ressourcen von Anbietern von „Clouds“ genutzt.
Cloud Computing 130<br />
Rechtliche Fragen<br />
Bei der rechtlichen Betrachtung muss grundsätzlich zwischen der Beziehung zwischen Endkunde und<br />
Cloud-Anbieter und den rechtlichen Beziehungen innerhalb der „Clouds“ unterschieden werden. Diese Beziehungen<br />
müssen grundsätzlich vertraglich geregelt werden.<br />
Bei den Cloud-spezifischen Leistungen werden in der Regel Web- oder Filespace, Datenbanken, Applikationen und<br />
Hostingservices zur Verfügung gestellt. Beim Webhosting (ggf. auch für das Storage-Management), bei dem Daten<br />
auf den Host des Hosting-Providers gespeichert werden, wird vertreten, dass es sich hierbei nicht um einen<br />
Mietvertrag nach §§ 535 ff. BGB handelt, sondern um einen Werkvertrag nach §§ 631 ff. BGB. Der<br />
Hosting-Provider schuldet als Leistung lediglich, dass die Website des Kunden bei ihm irgendwo gespeichert wird<br />
und dass sie im Internet aufgerufen werden kann. Eigentliche Leistung ist daher die Aufbewahrung der Information<br />
und ihr Zurverfügunghalten für den Abruf im Internet. Für den Kunden ist vor allem wichtig, dass die Inhalte<br />
dauernd abrufbar sind. Wie der Hosting-Provider oder Cloudanbieter diese Leistung erbringt, ist dem Kunden<br />
gleichgültig. Damit wird nicht primär Speicherplatz überlassen, sondern primär ein Erfolg, nämlich die Abrufbarkeit<br />
im Internet geschuldet. Das Einspeichern der Website ist nur technische Voraussetzung des geschuldeten Erfolgs.<br />
Bei der zur Verfügungstellung von Applikationen wird in der Regel ein Software-as-a-Service (SaaS) oder<br />
„Application Service Providing“-Modell (ASP) gewählt. Hierbei wird vom ASP-Anbieter einem Kunden die<br />
temporäre Nutzung von Applikationen zur Verfügung gestellt. Der BGH (Urt. v. 15. November 2006 - Az.: XII ZR<br />
120/04) hat entschieden, dass auf Application-Service-Providing-Verträge grundsätzlich die mietrechtlichen<br />
Vorschriften Anwendung finden. Auch wenn diese Entscheidung sicherlich bedeutsam gewesen ist, bedarf es doch<br />
einer erheblichen vertraglichen Gestaltung, insbesondere bei der Gestaltung der Service-Levels, da hier die<br />
mietrechtlichen Regelungen des §§ 535 ff. BGB allein nicht ausreichend sein dürften.<br />
Die Einordnung von Hosting-Verträgen für Datenbanken in die vertragstypologische Einordnung des BGB richtet<br />
sich nach der vertraglich geschuldeten Leistung. Hierbei ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob wie in c) beschrieben<br />
Filespace zur Speicherung der Datenbank vom Provider zur Verfügung gestellt wird (sogenanntes<br />
Datenbank-Hosting) oder eine Applikation wie eine Oracle-Datenbank zur (zeitweisen Nutzung) zur Verfügung<br />
gestellt wird d). Schuldet der Cloud-IT-Anbieter über die Hosting-Leistung hinaus Leistungen, wie z. B. bei der<br />
Gestaltung der Datenbanken, sind ggf. die Regelungen von § 87 a–e UrhG zu berücksichtigen.<br />
In der Praxis soll es zuweilen durch die Virtualisierung von Serverfarmen bei Cloudanbietern vorkommen, dass ein<br />
Cloudanbieter nicht weiß, auf welchem Server in welchem Land gerade eine ganz bestimmte Datei eines Kunden<br />
liegt. Dies stellt aus der Sicht des Datenschutzrechts als problematisch dar, insbesondere wenn unklar ist, welche<br />
Drittunternehmen Zugriff auf die Daten haben oder Daten in Staaten außerhalb der EU verarbeitet werden.<br />
Abgesehen von diesen Fragen bietet das deutsche BDSG für die weiteren Fragen jeweils entsprechende Lösungen.<br />
Für die Auftragsdatenverarbeitung greifen die im § 11 BDGS in Verbindung mit § 9 BDSG und Anlage 1 zum<br />
BDGS geforderten organisatorischen und technischen Maßnahmen. Für eine Übertragung personenbezogener Daten<br />
ins Ausland greift der Grundsatz des angemessen Datenschutzniveaus des Empfängerlandes und der damit<br />
verbundenen Regelungen nach § 4 b–c BDSG.<br />
In einer Stellungnahme hat jüngst die Datenschutzaufsichtsbehörde von Schleswig-Holstein zu den<br />
datenschutzrechtlichen Fragen bei Cloud Computing Position bezogen. [9]
Cloud Computing 131<br />
Umsetzungen<br />
• 3tera Applogic (virtuelles Betriebssystem auf Cloudbasis, Herstellerneutral: Linux, in Entwicklung: Solaris,<br />
Windows)<br />
• Adobe Unternehmensanwendung: Adobe® LiveCycle® ES-Lösungen auf Amazon Web Services Plattform.<br />
• Amazon Elastic Compute Cloud<br />
• Apple iWork.com/MobileMe<br />
• AtosOrigin - Atos Sphere<br />
• Covisint - AppCloud<br />
[10] [11]<br />
• Fabasoft Folio Cloud<br />
• Filespots - Dateiaustausch mit Vorschau<br />
• Google App Engine<br />
• iCloud (virtuelles Betriebssystem auf Cloudbasis, welches per Webbrowser global erreichbar ist)<br />
• Windows Azure<br />
• OnLive: Kompressionsmethode für Computergrafik zur Realisierung von Cloud Gaming.<br />
• Salesforce force.com-Plattform<br />
• Ubuntu One<br />
• VMware vSphere Herstellerneutral: AMD/Intel CPU; 32- und 64‐Bit; Clients: FreeBSD, Linux, MS-DOS,<br />
Netware, OS/2, Windows, Solaris. VMware vSphere ist in verschiedenen Editions (small, medium, enterprise)<br />
erhältlich.<br />
• Ubuntu Enterprise Cloud<br />
• Lisog Open Source Cloud Referenz Stack<br />
• T-Systems Dynamic Services; private Cloud-Ansatz zum dynamischen Betrieb von beispielsweise<br />
SAP-Anwendungen<br />
• cloudControl Platform as a Service aus Deutschland<br />
• VERPURA(eine komplette Online-Software für Kleinbetriebe, welches einfach per Webbrowser zu erreichen ist)<br />
Siehe auch<br />
• Ambient Intelligence<br />
• Internet der Dinge<br />
• Machine-to-Machine (M2M)<br />
• Pervasive Computing<br />
• Simple Knowledge Organisation System<br />
• Ubiquitous Computing<br />
• Verteiltes Rechnen<br />
Weblinks<br />
• Aktueller Begriff: Cloud Computing, Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste Nr. 15/10 ( 12. März 2010<br />
), 2 S., 64 KB [12]<br />
• Handelsblatt.com | Cloud Computing: Unternehmer geben Server nicht her [13]<br />
• Cloud Computing Risk Assessment (including recommendations) [14] - November 2009, ENISA (mit PDF-Datei;<br />
2 MB) (englisch)<br />
• Internetgiganten kämpfen um die Wolke [15] – FAZ<br />
• Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing [16] – ausführliche Darstellung über Möglichkeiten des<br />
Cloud Computing (englisch)<br />
• 10 sicherheitsrelevante Gründe gegen Cloud Computing [17] - scip AG<br />
• Chaosradio 153 - Cloud Computing [18]
Cloud Computing 132<br />
Referenzen<br />
[1] S.Tai, M.Kunze, J.Nimis, C.Baun: Cloud Computing - Web-basierte dynamische IT-Services, Reihe Informatik im Fokus, Springer, Berlin<br />
Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-01593-9<br />
[2] Wolfgang Adis, Cloud Computing und Cloud IT, internettechnik (http:/ / internettechnik-netzwerktechnik. suite101. de/ article. cfm/<br />
cloud_computing_und_cloud_it)<br />
[3] NIST Definition of Cloud Computing (http:/ / www. slideshare. net/ crossgov/ nist-definition-of-cloud-computing-v15)<br />
[4] Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing (http:/ / d1smfj0g31qzek. cloudfront. net/ abovetheclouds. pdf).<br />
[5] Sam Charrington: Cloud Taxonomy: Applications, Platform, Infrastructure. (http:/ / www. appistry. com/ blogs/ sam/<br />
cloud-taxonomy-applications-platform-infrastructure)<br />
[6] Philipp Strube: Abgrenzung Cloud Hosting und PaaS (http:/ / serverwolken. de/<br />
cloud-hosting-was-ist-das-eigentlich-und-wie-unterscheidet-es-sich-von-den-alternativen-997/ )<br />
[7] Charles Arthur: Government to set up own cloud computing system. (http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2010/ jan/ 27/<br />
cloud-computing-government-uk) The Guardian, 27. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[8] David Smith: Google plans to make PCs history. (http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2009/ jan/ 25/ google-drive-gdrive-internet) The<br />
Observer 25. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[9] "Cloud Computing und Datenschutz" vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein (https:/ / www.<br />
datenschutzzentrum. de/ cloud-computing/ )<br />
[10] Fabasoft Folio weltweit erstes Produkt mit bestandener MoReq2 Zertifizierung - Medienecho (http:/ / www. moreq2. eu/ press-a-web/<br />
fabasoft)(abgerufen am 7. April 2010)<br />
[11] Bericht im [[Format (Zeitschrift)|Format (http:/ / www. format. at/ articles/ 1013/ 528/ 265778/<br />
himmlische-angebote-it-dienstleistungen-internet-modell)]] (abgerufen am 7. April 2010)<br />
[12] http:/ / www. bundestag. de/ dokumente/ analysen/ 2010/ cloud_computing. pdf<br />
[13] http:/ / www. handelsblatt. com/ technologie/ it-internet/ cloud-computing-unternehmer-geben-server-nicht-her;2471877;0<br />
[14] http:/ / www. enisa. europa. eu/ act/ rm/ files/ deliverables/ cloud-computing-risk-assessment<br />
[15] http:/ / www. faz. net/ s/ RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/<br />
Doc~E1F5DC58852F24B3F9DC6AA81B0DF3977~ATpl~Ecommon~Scontent. html?rss_googlefeed<br />
[16] http:/ / d1smfj0g31qzek. cloudfront. net/ abovetheclouds. pdf<br />
[17] http:/ / www. scip. ch/ ?labs. 20091127<br />
[18] http:/ / chaosradio. ccc. de/ cr153. html
Mashup (Internet) 133<br />
Mashup (Internet)<br />
Mashup (von engl. to mash für vermischen) bezeichnet die Erstellung neuer Medieninhalte durch die nahtlose<br />
(Re-)Kombination bereits bestehender Inhalte. Der Begriff stammt aus der Welt der Musik und bedeutet dort im<br />
Englischen so viel wie Remix (vgl. Bastard Pop). In den deutschen Sprachraum wurde der Begriff rund um das<br />
Schlagwort Web 2.0 importiert, da Mashups als ein wesentliches Beispiel für das Neue an Web 2.0 angeführt<br />
werden: Inhalte des Webs, wie Text, Daten, Bilder, Töne oder Videos, werden z. B. collagenartig neu kombiniert.<br />
Dabei nutzen die Mashups die offenen Programmierschnittstellen (APIs), die andere Webanwendungen zur<br />
Verfügung stellen.<br />
So können z. B. Anbieter von Webseiten über die API von Google Maps Landkarten und Satellitenfotos auf der<br />
eigenen Webseite einbinden und zusätzlich mit individuellen Markierungen versehen. Auch die API von Flickr wird<br />
oft genutzt, um Fotos in neue Anwendungen einzubinden.<br />
Während Mashups zunächst als Spielzeug abgestempelt wurden, machen sich in der Zwischenzeit auch einige<br />
kommerzielle Anbieter, z. B. Immobilienanbieter, die oben genannten Möglichkeiten zu Nutze, aber auch im<br />
sonstigen geschäftlichen Umfeld stellen sie im Rahmen von situativen Anwendungen eine Option dar. Dies ist<br />
speziell für den sogenannten Long Tail of Business interessant.<br />
Eine besonders große Anzahl an Mashups verknüpft dabei geografische Daten, beispielsweise von Google Maps<br />
oder von Bing Maps, mit anderen Inhalten wie Fotos oder Kleinanzeigen. Es werden auch in Internetseiten<br />
eingebettete Videos, wie etwa von YouTube genutzt.<br />
Genutzte Technologien<br />
Mashups nutzen überwiegend moderne leichtgewichtige Webarchitekturen und -technologien. Meistens laufen sie<br />
im Browser, der dann mittels JSON, AJAX, REST, SOAP, RSS oder ATOM mit einem Server kommuniziert. All<br />
dies ist relativ unkompliziert bereits großteils mit JavaScript möglich, allerdings gibt es auch Mashup-Umgebungen,<br />
die auf eine bestimmte Technologie setzen, die dann beim Endanwender erst installiert werden muss. Beispiele dafür<br />
wären Adobe Flash, JavaFX oder Silverlight.<br />
Anbieter von Mashuptechnologien<br />
Es gibt diverse Anbieter von Mashup-Umgebungen. Oft können Benutzer hier durch grafische Benutzeroberflächen<br />
ein Mashup erstellen oder bearbeiten. Beispiele sind:<br />
• Yahoo Pipes ([1])<br />
• Microsoft Popfly (seit Ende August 2009 eingestellt)<br />
• IBM Mashup Center ([2])<br />
• Google Mashup Editor (seit <strong>Jan</strong>uar 2009 eingestellt)<br />
• JackBe Presto<br />
• Mozilla Ubiquity<br />
• Serena Business Mashups ([3])<br />
• ARIS MashZone, Anbieter: IDS Scheer ([4])<br />
Die einzelnen Umgebungen unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Zielgruppe. Einzelne Umgebungen richten sich<br />
an Softwareentwickler, andere an Konsumenten oder an Mitarbeiter von Fachabteilungen in Unternehmen.
Mashup (Internet) 134<br />
Kriterien zur Kategorisierung von Mashups<br />
1. Handelt es sich um ein client- oder serverseitiges Mashup? Werden Daten in einem Application Server aggregiert<br />
und aufbereitet, bevor sie „verschickt“ werden, oder passiert alles auf Clientseite mit Hilfe von JavaScript?<br />
2. Wie wird die Orchestrierung realisiert? Werden die einzelnen Komponenten in Form eines Flows verbunden<br />
(Daten fließen von einer Komponente zur nächsten) oder ist es eventbasiert, so dass die einzelnen Komponenten<br />
durch das Event-Listener-Entwurfsmodell verbunden sind?<br />
3. Wie werden Daten transportiert? Gibt es globale Variablen, in denen die Daten abgelegt und mit denen alle<br />
Komponenten arbeiten dürfen, oder werden die Daten als formale Parameter an die nächste Komponente<br />
übergeben?<br />
4. Wird bei jedem Seitenaufruf eine neue Instanz erzeugt? Oder sehen alle Nutzer die gleiche Instanz, was zur Folge<br />
hätte, dass Aktionen dass Nutzer A beeinflussen könnte, was Nutzer B sieht.<br />
5. An wen richtet sich die Entwicklungsumgebung: Sind es erfahrende Webnutzer, jeder oder Programmierer? Und<br />
verbunden damit:<br />
6. Wie sieht die Entwicklungsumgebung aus: Werden Drag and Drop, Bearbeitung von Quelltext oder eine<br />
Kombination aus beidem angeboten?<br />
7. Sind Browsererweiterungen (z. B. Adobe Flash) erforderlich?<br />
• zum Ausführen des Mashups<br />
• zum Ausführen der Entwicklungsumgebung<br />
8. Kann man das Mashup nach Erzeugung selbst hosten und beliebig kopieren oder ist man an bestimmte Anbieter<br />
gebunden (wie im Falle von Yahoo Pipes an Yahoo)?<br />
Literatur<br />
• Tom Alby: Web 2.0 – Konzepte, Anwendungen, Technologie. 3. überarbeitete Auflage. Hanser Verlag, München<br />
2008, ISBN 3-446-41449-5 (Erstauflage: 2007, ISBN 3-446-40931-9).<br />
• Michael Koch, Alexander Richter: Enterprise 2.0. Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz von <strong>Social</strong><br />
Software in Unternehmen. Oldenburg Verlag, München 2007, ISBN 3-486-58578-9.<br />
• Alexander Richter, Michael Koch: <strong>Social</strong> Software. Status quo und Zukunft. 2007 (frei verfügbar). Download: [5]<br />
• Volker Hoyer, Katarina Stanoveska-Slabeva: Enterprise Mashups: Neue Herausforderung für das<br />
Projektmanagement. dpunkt.verlag, 2008, ISSN 1436-3011 [6] (HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft<br />
260). Download: [7]<br />
• Volker Hoyer: Zusammengerührt. Ad-hoc-Software aus der Fachabteilung. Heise Verlag, 2008 (ix - Magazin für<br />
Professionelle Informationstechnik, 10/2008, 98-102). Download: [8]<br />
• Denny Carl, Jörn Clausen, Marco Hassler, Anatol Zund: Mashups programmieren. O'Reilly, 2008, ISBN<br />
978-3-89721-758-4.
Mashup (Internet) 135<br />
Weblinks<br />
• Takethisdance.com [9] – das erste Mashup-Musicvideo<br />
• dapper.net [10] – Mashup-Service<br />
• Mashup Zürich [11] – Mashup am Beispiel von Flugbewegungen mit Google Maps<br />
• (Enterprise) Mashup [12] – diverse Artikel und kommentierte Links<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / pipes. yahoo. com/ pipes/<br />
[2] http:/ / www-01. ibm. com/ software/ info/ mashup-center/<br />
[3] http:/ / www. serena. com/ products/ business-mashups/<br />
[4] http:/ / www. mashzone. com/<br />
[5] http:/ / www. kooperationssysteme. de/ docs/ pubs/ RichterKoch2007-bericht-socialsoftware. pdf<br />
[6] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1436-3011<br />
[7] http:/ / www. alexandria. unisg. ch/ publications/ 44173<br />
[8] http:/ / www. alexandria. unisg. ch/ publications/ 47250<br />
[9] http:/ / www. takethisdance. com<br />
[10] http:/ / www. dapper. net<br />
[11] http:/ / radar. zhaw. ch/<br />
[12] http:/ / workflow-tool. de/ soa/ mashup/<br />
Kollaboratives Schreiben<br />
Der Begriff Kollaboratives Schreiben bezeichnet Projekte mit Mehrautorenschaft, bei denen Texte in<br />
Zusammenarbeit von mehreren Personen entstehen. Hierarchische Projekte werden von einem Editor überwacht,<br />
während andere Projekte ohne Hierarchien auskommen. Es ist sogar möglich, dass Unbekannte zusammen an einem<br />
Text arbeiten, wie dies beispielsweise bei Wikipedia der Fall ist.<br />
Praktische Anwendung<br />
In einer kollaborativen Gemeinschaft verfügt jeder Mitwirkende über die gleichen Möglichkeiten, Text<br />
hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen (egalitärer Ansatz). Der Prozess des Schreibens wird zu einer<br />
rekursiven Funktion, bei der jede Änderung des Textes Änderungen von den Mitgliedern der kollaborativen<br />
Gemeinschaft nach sich zieht.<br />
Das kollaborative Schreiben setzt voraus, dass die Beteiligten einen regen Diskurs führen und sich über die<br />
Zielsetzung ihres Textes im Klaren sind.<br />
Kollaborative Textbearbeitung in Echtzeit<br />
Kollaboratives Schreiben ermöglicht das gleichzeitige Bearbeiten eines Texts durch mehrere Teilnehmer. Hierfür<br />
bedarf es eines Programms zur kollaborativen Textbearbeitung in Echtzeit, welches insbesondere die Aufgabe<br />
übernimmt die Änderungen der einzelnen Teilnehmer zu einem konsistenten Ganzen zusammenzufügen. Hierzu<br />
werden Algorithmen zur Nebenläufigkeitskontrolle wie z. B. die Operationelle Transformation eingesetzt.<br />
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Programmen mit denen man kollaborativ an Texten arbeiten kann. Bekannte<br />
Beispiele von Programmen, die jeder der Teilnehmer bei sich installiert und welche über einen Server synchronisiert<br />
werden, sind:<br />
• Gobby ist ein plattformübergreifendes Open Source-Projekt, welches als Freie Software freigegeben wurde<br />
• SubEthaEdit (Mac OS X und kommerziell)<br />
• ACE – plattformunabhängiger, kollaborativer Texteditor
Kollaboratives Schreiben 136<br />
• MoonEdit (Linux, Windows, FreeBSD) bietet grundlegende Funktionen kollaborativen Bearbeitens<br />
Von diesen "stand-alone" Programmen unterscheiden kann man browser- bzw. web-basierten Programme, welche<br />
keine Installation erfordern. Hierzu gehören insbesondere die online Textverarbeitungprogramme wie Google Docs,<br />
Adobe Buzzword [1] , Microsoft Office Live oder ThinkFree Office [2] . Viele kleinere Firmen versuchen sich auch<br />
mit Online-Texteditoren wie z.B. EtherPad.com [3] (Website schließt nach Übernahme des Betreibers AppJet durch<br />
Google zum 14. Mai 2010), Liste mit Etherpad Klonen [4] (Wird von der Etherpad Foundation geführt), SynchroEdit<br />
[5] , Writeboard [6] .<br />
Für spezialisierte Anwendungszwecke gibt es auch mittlerweile einige Versuche kollaboratives Editieren zu<br />
ermöglichen:<br />
• GNU Screen gestattet mehreren Benutzern, ein Konsolenfenster zu teilen; allerdings muss auch der Cursor geteilt<br />
werden.<br />
• Mind42 [7] Erlaubt das gemeinsame Editieren von MindMaps<br />
• Eclipse Communication Framework [8] und Saros [9] ermöglichen das kollaborative Programmieren in der Eclipse<br />
(IDE).<br />
• Mozilla Bespin [10] Ein früher experimenteller Prototyp eines kollaborativen Editors, insbesondere für das<br />
kollaborative Programmieren von Webseiten in PHP oder HTML<br />
• Instant Review for Visual Studio [11] ermöglicht das kollaborative Programmieren in Echtzeit für Visual Studio<br />
Synonyme und verwandte Konzepte<br />
• Collaborative Authoring<br />
• Collaborative Fiction<br />
• Collaborative Learning<br />
• Cooperative Writing<br />
• Group Writing<br />
• Joint Authoring<br />
• Massively Distributed Collaboration<br />
• Shared Document Collaboration<br />
• Team Writing<br />
Literatur<br />
• Lisa Ede, Andrea Lunsford: Singular texts/plural authors. Perspectives on collaborative writing. Nachdruck.<br />
Southern Illinois University Press, Carbondale, 1992, ISBN 978-0809317936.<br />
• Michael Koch, Alexander Richter: Enterprise 2.0 – Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz von <strong>Social</strong><br />
Software in Unternehmen. Oldenburg Verlag, München, 2007, ISBN 3-486-58578-9.<br />
• Rainer Kuhlen: Kollaboratives Schreiben. In: Christoph Bieber, Claus Leggewie (Hg.): Interaktivität: ein<br />
transdisziplinärer Schlüsselbegriff. Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2004, ISBN 978-3593376035, Seiten<br />
216–239, PDF-Datei [12] .
Kollaboratives Schreiben 137<br />
Weblinks<br />
• Stanford – Collaborative Writing and Research in Higher Education [13] (englisch)<br />
• Infolab thesis: Computer Supported Collaborative Writing [14] (englisch)<br />
• Analysing interactions during collaborative writing with the computer: an innovative methodology [15] (englisch)<br />
• SAC98 – Ceilidh: Collaborative Writing on the Web [16] (englisch)<br />
• Building a Taxonomy and Nomenclature of Collaborative Writing to Improve Interdisciplinary Research and<br />
Practice [17] (englisch; PDF-Datei; 3,79 MB)<br />
• Wikiroman - Roman collectif en ligne [18] Collaborative fiction (französisch)<br />
• Kooperatives Schreiben im Unterricht (im ZUM-Wiki)<br />
• Die letzte Version [19] Roman<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. adobe. com/ acom/ buzzword/<br />
[2] http:/ / www. thinkfree. com/<br />
[3] http:/ / etherpad. com/<br />
[4] http:/ / doc. etherpad. org/ etherpadsites<br />
[5] http:/ / www. synchroedit. com/<br />
[6] http:/ / writeboard. com/<br />
[7] http:/ / mind42. com/<br />
[8] http:/ / www. eclipse. org/ ecf/<br />
[9] http:/ / dpp. sf. net<br />
[10] https:/ / bespin. mozilla. com/<br />
[11] http:/ / www. nextiteration. de/ instantreview/<br />
[12] http:/ / www. kuhlen. name/ MATERIALIEN/ Publikationen2004/ 20040706_autoren_kollaborateure. pdf<br />
[13] http:/ / www. stanford. edu/ group/ collaborate/<br />
[14] http:/ / infolab. kub. nl/ pub/ theses/ w3thesis/ Groupwork/ collaborative_writing. html<br />
[15] http:/ / www. warwick. ac. uk/ staff/ D. J. Wray/ Articles/ facct. html<br />
[16] http:/ / www. lilikoi. com/ sac98_frame. html<br />
[17] http:/ / job. sagepub. com/ cgi/ reprint/ 41/ 1/ 66. pdf<br />
[18] http:/ / www. wikiroman. fr/<br />
[19] http:/ / dieletzteversion. blogspot. com/
High Speed Downlink Packet Access 138<br />
High Speed Downlink Packet Access<br />
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA, 3.5G, 3G+ oder UMTS-Broadband) ist ein<br />
Datenübertragungsverfahren des Mobilfunkstandards UMTS, das vom 3rd Generation Partnership Project definiert<br />
wurde. Das Verfahren ermöglicht DSL-ähnliche Datenübertragungsraten im Mobilfunknetz.<br />
HSDPA wird in Deutschland unter anderem von den Netzbetreibern Vodafone, E-Plus, Telekom und O 2 und in der<br />
Schweiz von Swisscom, Sunrise und Orange angeboten. In Österreich betreiben die Mobilkom Austria, T-Mobile,<br />
Orange und Drei HSDPA-Netze.<br />
Technik<br />
Die maximale Datenrate ist durch die so genannte Kategorie des Empfängers beschränkt. Typisch sind 3,6 Mbit/s<br />
(Kategorie 6) und 7,2 Mbit/s (Kategorie 8). Für die Kategorie 10 sind maximal 13,98 MBit/s möglich, die aber in der<br />
Praxis kaum erreichbar ist, da sie eine Koderate R von nahezu 1 voraussetzen würde. Wesentliche Merkmale von<br />
HSDPA sind schnelle und flexible Datenlastverteilung, sowie Anpassung an die Kanalqualität mittels „Adaptiver<br />
Modulation und Kodierung“ (AMC).<br />
Die Nutzdaten werden in Intervallen (Transmission Time Interval, TTI) von drei UMTS-Zeitschlitzen (slots) auf dem<br />
sogenannten HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) übertragen. Ein TTI hat eine Länge von 2 ms. Es<br />
können bis zu 15 Kanäle gleichzeitig zugewiesen werden.<br />
Ein Endgerät sendet im Gegenzug alle 2 ms eine Information über die Kanalqualität (Channel Quality Indicator,<br />
CQI). Anhand der empfangenen CQI-Werte verschiedener Endgeräte und unter Berücksichtigung anderer Daten<br />
(Pufferfüllstand, Prioritäten etc.) entscheidet die UMTS-Basisstation (der Node B) darüber, welche Endgeräte mit<br />
wie vielen Kanälen parallel bedient werden sollen. Weiterhin wird die CQI-Information dazu verwendet, die<br />
Kanalkodierung, das Modulationsverfahren und die Node-B-Ausgangsleistung auszuwählen.<br />
HSDPA-Modems werden als USB-Sticks und Datenkarten angeboten, die den HSDPA-Standard mit 3,6 bzw. 7,2<br />
Mbit/s unterstützen. Die neuesten Produkte unterstützen auch HSUPA für ein schnelleres Hochladen mit derzeit bis<br />
zu 5,76 Mbit/s. HSDPA ist in vielen aktuellen Mobiltelefonen integriert. Diese können als HSDPA-Modem<br />
verwendet werden.<br />
Im Gegensatz zu anderen UMTS-Datenübertragungsverfahren gibt es bei HSDPA keinen Soft Handover. Jedes<br />
Endgerät empfängt die HSDPA-Kanäle zu jedem Zeitpunkt immer nur von einer einzigen Basisstation. Ein Wechsel<br />
von Zellen wird mittels der Prozedur HSDPA serving cell change durchgeführt, welches einem Handover mit kurzer<br />
Unterbrechung gleichkommt.<br />
Durch die im Vergleich zu UMTS bei HSDPA (idealerweise mit HSUPA kombiniert) geringeren Round-Trip-Zeiten<br />
sind mit HSDPA viele interaktive Anwendungen möglich geworden.<br />
HSDPA Endgeräte-Kategorien<br />
Die folgende Tabelle ergibt sich aus Tabelle 5.1a aus 3GPP TS 25.306 Release 9 [1] und zeigt die maximalen<br />
Datenraten des Physical Layers verschiedener HSDPA Kategorien.
High Speed Downlink Packet Access 139<br />
Kategorie Max. Anzahl<br />
HS-DSCH Codes<br />
Modulationsverfahren Max.<br />
Datenrate<br />
[Mbit/s]<br />
1 5 QPSK, 16-QAM 1,2<br />
2 5 QPSK, 16-QAM 1,2<br />
3 5 QPSK, 16-QAM 1,8<br />
4 5 QPSK, 16-QAM 1,8<br />
5 5 QPSK, 16-QAM 3,6<br />
6 5 QPSK, 16-QAM 3,6<br />
7 10 QPSK, 16-QAM 7,2<br />
8 10 QPSK, 16-QAM 7,2<br />
9 15 QPSK, 16-QAM 10,1<br />
10 15 QPSK, 16-QAM 14,0<br />
11 5 nur QPSK 0,9<br />
12 5 nur QPSK 1,8<br />
13 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
14 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
17,6<br />
21,1<br />
15 15 QPSK, 16-QAM 23,4<br />
16 15 QPSK, 16-QAM 28,0<br />
19 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
20 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
35,3<br />
42,2<br />
21 15 QPSK, 16-QAM 23,4<br />
22 15 QPSK, 16-QAM 28,0<br />
23 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
24 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
35,3<br />
42,2<br />
25 15 QPSK, 16-QAM 46,7<br />
26 15 QPSK, 16-QAM 55,9<br />
27 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
28 15 QPSK, 16-QAM,<br />
64-QAM<br />
70,6<br />
84,4
High Speed Downlink Packet Access 140<br />
Verbreitung<br />
Seit Ende 2008 herrscht ein verschärfter Wettbewerb durch den Markteintritt von Wiederverkäufern, die den Preis<br />
für reine Datentarife verglichen mit dem Vorjahr um bis zu 50 % unterbieten.<br />
Deutschland<br />
• T-Mobile Deutschland hat laut eigenen Angaben das gesamte UMTS-Netz mit 3,6 Mbit/s HSDPA ausgerüstet<br />
und deckte damit im Februar 2007 über 60 % der Bevölkerung ab. Außerdem werden mittlerweile einzelne<br />
Gebiete mit 7,2 Mbit/s HSDPA versorgt.(Stand 03/2008)<br />
• Vodafone vermarktet HSDPA als UMTS-Broadband. Es war im November 2007 für 80 % der Bevölkerung<br />
verfügbar. An ausgewählten Orten bietet Vodafone 7,2 Mbit/s HSDPA an, im restlichen Netz 3,6 Mbit/s. [2]<br />
• O₂ bietet HSDPA seit Ende 2006 in Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München<br />
an. [3] Der bundesweite Ausbau erfolgte seit Ende 2007 und ist seit Ende 2009 abgeschlossen. Weite Teile in<br />
Deutschland seien mit HSDPA und Geschwindigkeiten bis zu 7,2 Mbit/s im Downstream versorgt. [4] Seit dem 3.<br />
November testet O2 frei für alle Bestandskunden HSDPA in der Kategorie 16 mit 28 Mbit/s in München. [5]<br />
• E-Plus hat in Ballungsgebieten und an Knotenpunkten schon HSDPA mit einer Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s<br />
in Betrieb, in regionalen Gebieten hingegen nur eine Geschwindigkeit von 384 Kbit/s. [6] [7] Laut E-Plus soll<br />
HSDPA in absehbarer Zeit flächendeckend ausgebaut werden, sodass theoretische Bandbreiten von bis zu 21,6<br />
Mbit/s möglich sein werden. [8]<br />
Österreich<br />
• T-Mobile Österreich hatte bereits im März 2006 das gesamte UMTS-Netz mit HSDPA ausgerüstet, und erreicht<br />
[9] [10]<br />
damit im Dezember 2007 über 75 % der Bevölkerung.<br />
• 3 hat Mitte 2008 eine Bevölkerungsabdeckung mit HSDPA von über 94 % und seit Ende Oktober 2009 eine echte<br />
Flatrate. [11]<br />
• Mobilkom Austria (A1) plante bis Ende 2007 eine Abdeckung von 85 % der Bevölkerung mit HSDPA und<br />
HSUPA. [12]<br />
• bob bietet seit August 2009 neben UMTS und EDGE nun auch HSDPA an. [13]<br />
• Orange deckt mit HSDPA rund 70 % der österreichischen Bevölkerung ab. [14]<br />
Schweiz<br />
• Sunrise hat bereits das gesamte UMTS-Netz mit HSDPA ausgerüstet. Dieses deckt momentan 67 % der<br />
Bevölkerung ab.<br />
• Swisscom hat HSDPA-Netze in den größten Städten in Betrieb und plant das gesamte UMTS-Netz (90 %<br />
Abdeckung) mittelfristig mit HSDPA zu erweitern.<br />
• Orange hat in den 7 größten Städten der Schweiz HSDPA-Netze in Betrieb.<br />
Weltweit gab es im Dezember 2007 insgesamt 150 HSDPA-Netze in 72 Ländern. Auf die Europäische Union<br />
entfielen davon 34 Netze. [15]
High Speed Downlink Packet Access 141<br />
Siehe auch<br />
• High Speed OFDM Packet Access (HSOPA)<br />
Literatur<br />
• Martin Sauter: Grundkurs Mobile Kommunikationssysteme. Vieweg, 2008, ISBN 978-3-8348-0397-9, http:/ /<br />
www. cm-networks. de/<br />
• Holma/Toskala: HSDPA /HSUPA for UMTS. John Wiley & Sons, Mai 2006, ISBN 978-0-470-01884-2<br />
• Holma/Toskala: WCDMA for UMTS Fourth Edition. John Wiley & Sons, September 2007, ISBN<br />
978-0-470-31933-8<br />
Weblinks<br />
• UMTSlink.at-Seite: HSDPA-Grundlagen, Tutorial [16]<br />
• Informationen zu HSDPA und HSUPA [17]<br />
Referenzen<br />
[1] 3GPP TS 25.306 v9.0.0 http:/ / www. 3gpp. org/ ftp/ Specs/ html-info/ 25306. htm<br />
[2] Vodafone Deutschland: Vodafone startet HSUPA und beschleunigt den mobilen Versand großer Datenmengen auf bis zu 1,45 Mbit/s (http:/ /<br />
www. vodafone. de/ unternehmen/ presse/ 97943_123757. html), 21. November 2007<br />
[3] o2_Germany: http:/ / www. de. o2. com/ ext/ standard/ index?page_id=11194'', 1. Dezember 2006<br />
[4] o2_Germany: http:/ / www. de. o2. com/ ext/ portal/ online/ 2401/ index'', 8. Mai 2009<br />
[5] heise.de: O2 startet HSPA+-Netz in München (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ O2-startet-HSPA-Netz-in-Muenchen-847974.<br />
html), 3. November 2009<br />
[6] Billig-Tarife.de: E-Plus: Mobil surfen mit HSDPA (http:/ / www. billig-tarife. de/ partner/ koop/ news/ zeige. php?news=2335& partner=bt),<br />
14. September 2009<br />
[7] telespiegel.de: (http:/ / www. telespiegel. de/ handy/ umts-geschwindigkeit. html), 19. April 2010<br />
[8] Billig-Tarife.de: E-Plus: Mit 21,6 Mbit/s surfen? (http:/ / www. billig-tarife. de/ partner/ koop/ news/ zeige. php?news=2435& partner=bt),<br />
23. Dezember 2009<br />
[9] T-Mobile Österreich Presseaussendung: T-Mobile - T-Mobile Austria bringt HSDPA ab sofort in ganz Österreich (http:/ / www. t-mobile. at/<br />
unternehmen/ first_presse/ PA/ pressemitteilungen_2006/ 2006_03_02a/ index. html), 2. März 2006<br />
[10] heise.de: Netzzusammenlegung von T-Mobile Austria und tele.ring abgeschlossen (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 100869),<br />
19. Dezember 2007<br />
[11] Drei Presseaussendung: 3 auf der Futura 2007 (http:/ / www. drei. at/ portal/ de/ privat/ unternehmen/ presse/ presseaussendungen/<br />
Presse_Presseaussendungen_Detail_59747. html), 7. August 2007<br />
[12] A1 Presseaussendung: Auftakt ins Jahr der Netzinnovationen - mobilkom austria gibt Startschuss für HSDPA 7,2 und HSUPA (http:/ / www.<br />
mobilkomaustria. com/ CDA/ frameset/ start_frame/ 0,3149,892-988-181618-1-html-de,00. html), 30. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[13] bob Homepage: Tarif: bob Breitband (http:/ / www. bob. at/ breitband)<br />
[14] Orange Austria Homepage: (http:/ / www. orange. at/ Content. Node/ unternehmen/ zahlen_und_fakten/ ), 7. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[15] GSM Association: HSPA - Networks (http:/ / hspa. gsmworld. com/ networks/ default. asp)<br />
[16] http:/ / www. umtslink. at/ index. php?pageid=hsdpa_grundlagen1<br />
[17] http:/ / www. elektronik-kompendium. de/ sites/ kom/ 0910251. htm
Global Positioning System 142<br />
Global Positioning System<br />
Global Positioning System (GPS), offiziell NAVSTAR<br />
GPS, ist ein globales Navigationssatellitensystem zur<br />
Positionsbestimmung und Zeitmessung. Es wurde seit<br />
den 1970er-Jahren vom US-Verteidigungsministerium<br />
entwickelt und löste ab etwa 1985 das alte<br />
Satellitennavigationssystem NNSS (Transit) der<br />
US-Marine ab, ebenso die Vela-Satelliten zur Ortung von<br />
Atombombenexplosionen. GPS ist seit Mitte der<br />
1990er-Jahre voll funktionsfähig und stellt seit der<br />
Abschaltung der künstlichen Signalverschlechterung<br />
(Selective Availability) im Mai 2000 auch für zivile<br />
Zwecke eine Ortungsgenauigkeit in der Größenordnung<br />
von oft besser als 10 Meter sicher. Die Genauigkeit lässt<br />
sich durch Differenzmethoden (dGPS) auf Zentimeter<br />
steigern, für spezielle Anwendungen in der Geodäsie<br />
lassen sich auch noch genauere Messungen erzielen. GPS<br />
hat sich als das weltweit wichtigste Ortungsverfahren<br />
etabliert und wird in Navigationssystemen weitverbreitet<br />
genutzt.<br />
Die offizielle Bezeichnung ist „Navigational Satellite<br />
Timing and Ranging - Global Positioning System“<br />
(NAVSTAR GPS). NAVSTAR wird manchmal auch als<br />
Abkürzung für „Navigation System using Timing and<br />
Ranging“ genutzt. GPS wurde am 17. Juli 1995 offiziell<br />
in Betrieb genommen.<br />
Einsatzgebiete<br />
NAVSTAR-Satellit der zweiten Generation<br />
Bewegung der Satelliten über der Erde<br />
GPS war ursprünglich zur Positionsbestimmung und Navigation im militärischen Bereich (in Waffensystemen,<br />
Kriegsschiffen, Flugzeugen) usw. vorgesehen. Ein Vorteil ist dabei, dass GPS-Empfänger nur Signale empfangen<br />
und nicht senden. So kann navigiert werden ohne dass der Feind Informationen über den eigenen Standort erhält.<br />
Heute wird es jedoch vermehrt auch im zivilen Bereich genutzt: in der Seefahrt, Luftfahrt, durch Navigationssysteme<br />
im Auto, zur Positionsbestimmung und -verfolgung im ÖPNV, zur Orientierung im Outdoor-Bereich, im<br />
Vermessungswesen etc. In der Landwirtschaft wird es beim so genannten Precision Farming zur<br />
Positionsbestimmung der Maschinen auf dem Acker genutzt. Ebenso wird GPS nun auch im Leistungssport<br />
verwendet. Speziell für den Einsatz in Mobiltelefonen wurde das Assisted GPS (A-GPS) entwickelt.
Global Positioning System 143<br />
Aufbau und Funktionsweise der Ortungsfunktion<br />
Das Prinzip der Satellitenortung beschreibt der Artikel Globales<br />
Navigationssatellitensystem.<br />
GPS basiert auf Satelliten, die mit kodierten Radiosignalen ständig ihre<br />
aktuelle Position und die genaue Uhrzeit ausstrahlen. Aus den<br />
Signallaufzeiten können spezielle GPS-Empfänger dann ihre eigene<br />
Position und Geschwindigkeit berechnen. Theoretisch reichen dazu die<br />
Signale von drei Satelliten aus, welche sich oberhalb ihres<br />
Abschaltwinkels befinden müssen, da daraus die genaue Position und<br />
Höhe bestimmt werden kann. In der Praxis haben aber GPS-Empfänger<br />
keine Uhr, die genau genug ist, um die Laufzeiten korrekt messen zu<br />
können. Deshalb wird das Signal eines vierten Satelliten benötigt, mit<br />
dem dann auch die genaue Zeit im Empfänger bestimmt werden kann.<br />
Zur Mindestanzahl der benötigten Satelliten siehe Artikel<br />
GPS-Technik.<br />
Mit den GPS-Signalen lässt sich aber nicht nur die Position, sondern<br />
auch die Geschwindigkeit des Empfängers bestimmen. Dieses erfolgt<br />
im Allgemeinen über Messung des Dopplereffektes oder die<br />
numerische Differenzierung des Ortes nach der Zeit. Die<br />
Bewegungsrichtung des Empfängers kann ebenfalls ermittelt werden<br />
und als künstlicher Kompass oder zur Ausrichtung von elektronischen<br />
Karten dienen.<br />
Stationäre GPS-Empfangsantenne<br />
Damit ein GPS-Empfänger immer zu mindestens vier Satelliten Kontakt hat, werden insgesamt mindestens 24<br />
Satelliten eingesetzt, die die Erde jeden Sterntag zweimal in einer Höhe von 20 183 km umkreisen. Jeweils<br />
mindestens vier Satelliten bewegen sich dabei auf jeweils einer der sechs Bahnebenen, die 55° gegen die<br />
Äquatorebene inkliniert (geneigt) sind und gegeneinander um jeweils 60° verdreht sind. Ein Satellit ist damit alle<br />
23 Stunden 55 Minuten und 56,6 Sekunden über demselben Punkt der Erde.<br />
Ein Satellit hat eine erwartete Lebensdauer von 7,5 Jahren, doch funktionieren die Satelliten häufig deutlich länger.<br />
Um Ausfälle problemlos zu verkraften, wurden daher bis zu 31 Satelliten in den Orbit gebracht, sodass man auch bei<br />
schlechten Bedingungen fünf oder mehr Satelliten verwenden kann. Aktuell benötigt man 60 Tage für das<br />
Austauschen eines Satelliten; aus Kostengründen versucht man, diesen Zeitraum auf zehn Tage zu senken und somit<br />
die Satellitenanzahl auf 25 zu reduzieren. [1]<br />
Gesendete Daten<br />
Das Datensignal mit einer Datenrate von 50 bit/s und einer Rahmenperiode von 30 s wird parallel mittels Spread<br />
Spectrum Verfahren auf zwei Frequenzen ausgesendet:<br />
• Auf der L1-Frequenz (1575,42 MHz) werden der C/A-Code („Coarse/Acquisition“) für die zivile Nutzung, und<br />
orthogonal dazu der nicht öffentlich bekannte P/Y-Code („Precision/encrypted“) für die militärische Nutzung<br />
eingesetzt. Das übertragene Datensignal ist bei beiden Codefolgen identisch und stellt die 1500 Bit lange<br />
Navigationsnachricht dar. Sie enthält alle wichtigen Informationen zum Satelliten, Datum,<br />
Identifikationsnummer, Korrekturen, Bahnen, aber auch den Zustand, und benötigt zur Übertragung eine halbe<br />
Minute. GPS-Empfänger speichern diese Daten normalerweise zwischen. Zur Initialisierung der Geräte werden<br />
des Weiteren auch die so genannten Almanach-Daten übertragen, die die groben Bahndaten aller Satelliten<br />
enthalten und zur Übertragung über zwölf Minuten benötigen.
Global Positioning System 144<br />
• Die zweite Frequenz L2-Frequenz (1227,60 MHz) überträgt nur den P/Y-Code. Wahlweise kann auf der zweiten<br />
Frequenz auch der C/A-Code übertragen werden. Durch die Übertragung auf zwei Frequenzen können<br />
ionosphärische Effekte, die zur Erhöhung der Laufzeit führen, herausgerechnet werden, was die Genauigkeit<br />
steigert.<br />
• Momentan ist eine dritte L5-Frequenz (1176,45 MHz) im Aufbau. Sie soll die Robustheit des Empfangs weiter<br />
verbessern und ist vor allem für die Luftfahrt und Safety-of-Life-Anwendungen vorgesehen. Bei der derzeitigen<br />
Geschwindigkeit des Ausbaus ist mit einer Fertigstellung ab 2010 und einem Regelbetrieb ab 2013 zu rechnen.<br />
Der Satellit besitzt einen Empfänger für den Uplink im S-Band (1783,74 MHz up, 2227,5 MHz down).<br />
C/A-Code<br />
Der für die Modulation des Datensignals im zivilen Bereich eingesetzte C/A-Code ist eine so genannte<br />
pseudozufällige Codefolge mit einer Länge von 1023 Bits. Die Sendebits einer Codefolge werden bei Spread<br />
Spectrum Modulationen als so genannte „Chips“ bezeichnet und tragen keine Nutzdateninformation, sondern dienen<br />
nur zum Empfang mittels Kreuzkorrelation. Diese 1023 Chips lange Folge hat eine Periodenlänge von 1 ms und die<br />
Chips-Rate beträgt 1,023 Mcps. Die beiden Codegeneratoren für die Gold-Folge bestehen aus jeweils 10 Bit langen<br />
Schieberegistern und sind vergleichbar mit linear rückgekoppelten Schieberegistern, wenngleich sie für sich einzeln<br />
nicht die maximale Folge ergeben. Die beim C/A-Code eingesetzten Generatorpolynome G 1 und G 2 lauten:<br />
Die endgültige Gold-Folge (C/A-Codefolge) wird durch eine Codephasenverschiebung zwischen den beiden<br />
Generatoren erreicht. Die Phasenverschiebung wird bei jedem GPS-Satelliten unterschiedlich gewählt, so dass die<br />
dabei entstehenden Sendefolgen (Chips-Signalfolgen) orthogonal zueinander stehen – damit ist ein unabhängiger<br />
Empfang der einzelnen Satellitensignale möglich, obwohl alle GPS-Satelliten auf den gleichen Nominalfrequenzen<br />
L 1 und L 2 senden (so genanntes Codemultiplex, CDMA-Verfahren).<br />
Im Gegensatz zu den pseudozufälligen Rauschfolgen aus linear rückgekoppelten Schieberegistern (LFSR) haben die<br />
zwar ebenfalls pseudozufälligen Rauschfolgen aus Gold-Codegeneratoren wesentlich bessere Eigenschaften der<br />
Kreuzkorrelation, wenn man die zugrundeliegenden Generatorpolynome entsprechend auswählt. Dies bedeutet, dass<br />
durch die Codephasenverschiebung eingestellten unterschiedlichen Gold-Folgen mit gleichen Generatorpolynomen<br />
zueinander fast orthogonal im Coderaum stehen und sich damit kaum gegenseitig beeinflussen. Die beim C/A-Code<br />
eingesetzten LFSR-Generatorpolynome G1 und G2 erlauben maximal 1023 Codephasenverschiebungen, wovon<br />
ungefähr 25 % zueinander eine in der GPS-Anwendung hinreichend kleine Kreuzkorrelation für den<br />
CDMA-Empfang aufweisen. Damit können neben den maximal 32 GPS-Satelliten und deren Navigationssignale<br />
weitere rund 200 Satelliten zusätzlich Daten auf der gleichen Sendefrequenz zu den GPS-Empfängern übertragen –<br />
dieser Umstand wird beispielsweise im Rahmen von EGNOS zur Übermittlung von atmosphärischen<br />
Korrekturdaten, Wetterdaten und Daten für die zivile Luftfahrt ausgenutzt.<br />
Da die Datenrate der damit übertragenen Nutzdaten 50 bit/s beträgt und ein Nutzdatenbit genau 20 ms lang ist, wird<br />
ein einzelnes Nutzdatenbit immer durch exakt 20-malige Wiederholung einer Gold-Folge übertragen.<br />
Der zuschaltbare künstliche Fehler Selective Availability, der seit dem Jahr 2000 nicht mehr eingesetzt wird, wurde<br />
bei dem C/A-Code dadurch erreicht, dass die zeitliche Ausrichtung (Taktsignal) der Chips einer geringen zeitlichen<br />
Schwankung (Jitter) unterworfen wurde. Die regionale Störung von GPS-Signalen wird durch das US-Militär durch<br />
Jammer erreicht und macht damit GPS nicht in jedem Fall zu einem verlässlichen Orientierungsmittel, da nicht<br />
verlässlich feststellbar ist ob und wie weit GPS-Signale von den tatsächlichen UTM/MGRS-Koordinaten abweichen.
Global Positioning System 145<br />
P/Y-Code<br />
Der längere und meist militärisch verwendete P-Code verwendet als<br />
Codegenerator so genannte JPL-Folgen. Er unterteilt sich in den<br />
öffentlich dokumentierten P-Code [2] und den zur Verschlüsselung auf<br />
der Funkschnittstelle eingesetzten und geheimen Y-Code, welcher<br />
bedarfsmäßig zu- bzw. abgeschaltet werden kann. Die Kombination<br />
daraus wird als P/Y-Code bezeichnet. Die Verschlüsselung mit dem<br />
Y-Code soll einen möglichst manipulationssicheren Betrieb (engl.<br />
Anti-Spoofing oder AS-Mode) ermöglichen. Seit 31. <strong>Jan</strong>uar 1994 ist<br />
der AS-Modus permanent aktiviert und es wird nicht mehr der<br />
öffentlich bekannte P-Code direkt übertragen.<br />
Der P-Code wird aus vier linearen Schieberegistern (LFSR) der Länge<br />
10 gebildet. Zwei davon bilden den so genannten X1-Code, die<br />
Eine US-Luftwaffensoldatin geht in einem<br />
Satellitenkontrollraum der Schriever Air Force<br />
Base in Colorado (USA) eine Checkliste zur<br />
Steuerung von GPS-Satelliten durch.<br />
anderen beiden den X2-Code. Der X1-Code wird mit dem X2-Code so über XOR-Verknüpfungen kombiniert, dass<br />
insgesamt 37 verschiedene Phasenverschiebungen 27 verschiedene Wochensegmente des P-Codes ergeben. Die<br />
Längen sind bei diesem Code wesentlich länger als beim C/A-Code. So liefert der X1-Codegenerator eine Länge<br />
15 345 000 Chips und X2 eine Codefolge, die exakt um 37 Chips länger ist. Die Dauer, bis sich der P-Code<br />
wiederholt, ergibt sich daraus zu 266 Tagen (38 Wochen). Der P/Y-Code wird mit einer Chiprate von 10,23 Mcps<br />
gesendet, das entspricht der zehnfachen Chiprate des C/A-Codes. Er benötigt daher ein breiteres Frequenzspektrum<br />
als der C/A-Code.<br />
Zur Unterscheidung der einzelnen GPS-Satelliten im P/Y-Code wird die sehr lange Codefolge von rund 38 Wochen<br />
Dauer in einzelne Wochensegmente aufgeteilt. Jeder GPS-Satellit hat einen genau eine Woche lang dauernden<br />
Codeabschnitt zugewiesen, und am Anfang jeder Woche (Sonntag 00:00 Uhr) werden alle P-Codegeneratoren<br />
wieder auf den Startwert zurückgesetzt. Damit wiederholt sich pro GPS-Satellit der P/Y-Code einmal pro Woche.<br />
Die Bodenstationen benötigen fünf Wochensegmente des in Summe 38 Wochen langen P-Codes für Steueraufgaben,<br />
32 Wochensegmente sind für die Unterscheidung der einzelnen GPS-Satelliten vorgesehen.<br />
Der C/A-Code dient dabei auch zur Umschaltung (so genanntes Hand Over) auf den P/Y-Code. Da die P-Codefolge<br />
pro GPS-Satellit eine Woche umfasst, wäre das direkte Synchronisieren einfacher Empfänger auf die P-Codefolge<br />
ohne Kenntnis der genauen GPS-Uhrzeit praktisch unmöglich. Einfache GPS-Empfänger, die den P/Y-Code<br />
verwenden, synchronisierten sich zuerst auf den C/A-Code, gewinnen aus den übertragenen Daten die notwendige<br />
Umschaltinformationen wie Uhrzeit, Wochentag und andere Informationen, stellten damit ihre P-Codegeneratoren<br />
entsprechend ein und schalteten dann auf den Empfang des P/Y-Code um.<br />
Moderne militärische GPS-Empfänger werden heute mit einer sehr viel größeren Anzahl von Korrelatoren<br />
ausgestattet, ähnlich wie der im zivilen Bereich eingesetzte SiRFstar-III-Chipsatz, wodurch es möglich ist, den<br />
P/Y-Code direkt auszuwerten. Diese Empfänger werden bei den Herstellern als „direct-Y-code“-Empfänger<br />
bezeichnet. Diese Empfängergeneration macht es möglich, den C/A-Code zu stören, um die Nutzung von zivilen<br />
GPS-Empfängern durch gegnerische Kräfte beispielsweise zum Vermessen von Feuerstellungen zu verhindern. Da<br />
die Bandbreite des militärischen Signals ca. 20 MHz ist, können die 1-2 MHz Bandbreite des C/A-Codes, die zivil<br />
genutzt werden, gestört werden, ohne dass militärische Empfänger wesentlich beeinträchtigt werden. Das und die<br />
Annahme, dass heutige Konflikte regional begrenzt sind, führten zur Entscheidung, die künstliche Verschlechterung<br />
abzuschalten.<br />
Die genauen Parameter für die Y-Verschlüsselung des P-Codes sind nicht öffentlich bekannt. Die Parameter der<br />
Navigationsdaten (Nutzdaten, Rahmenaufbau, Bitrate), die mittels P/Y-Code übertragen werden, sind allerdings<br />
exakt gleich zu den Daten, die mittels der öffentlich bekannten C/A-Codefolge übertragen werden. Der wesentliche<br />
Unterschied besteht darin, dass der Takt der P/Y-Codefolge im Satelliten grundsätzlich keinem künstlichen
Global Positioning System 146<br />
Taktfehler unterworfen wird und der P-Code auch die 10-fache Taktrate zum C/A-Code aufweist. Damit können<br />
P/Y-Empfänger die für die Positionsbestimmung wesentliche Information der Übertragungszeiten genauer gewinnen.<br />
Ausbreitungseigenschaften des Signals<br />
In den verwendeten Frequenzbereichen breitet sich die elektromagnetische Strahlung ähnlich wie sichtbares Licht<br />
fast geradlinig aus, wird dabei aber durch Bewölkung oder Niederschlag nur wenig beeinflusst. Dennoch ist auch<br />
aufgrund der geringen Sendeleistung der GPS-Satelliten für den besten Empfang der Signale eine direkte<br />
Sichtverbindung zum Satelliten erforderlich. In Gebäuden war ein GPS-Empfang bis vor kurzem nicht möglich.<br />
Neue Empfängertechnik ermöglicht jedoch nun unter günstigen Bedingungen auch Anwendungen in Gebäuden.<br />
Auch zwischen hohen Gebäuden kann es durch mehrfach reflektierte Signale (Mehrwege-Effekt) zu<br />
Ungenauigkeiten kommen. Zudem ergeben sich z. T. große Ungenauigkeiten bei ungünstigen<br />
Satellitenkonstellationen, zum Beispiel wenn nur drei dicht beieinander stehende Satelliten aus einer Richtung zur<br />
Positionsberechnung zur Verfügung stehen. Für eine exakte Positionsermittlung sollten möglichst 4 Satellitensignale<br />
aus verschiedenen Himmelsrichtungen empfangbar sein.<br />
Für die zentrale Kontrolle des GPS ist die 50th Space Wing des Air Force Space Command (AFSPC) der US Air<br />
Force auf der Schriever AFB, Colorado zuständig.<br />
Die technische Realisierung einschließlich ihrer mathematischen Grundlagen wird im Artikel GPS-Technik<br />
beschrieben.<br />
Weitere Aufgaben<br />
Die GPS-Satelliten sind Teil des US-Programms Nuclear Detection System (NDS), früher Integrated Operational<br />
Nuclear Detection System (IONDS) genannt, eingebunden in das Verteidigungsprogramm DSP (Defense Support<br />
Program). Sie verfügen über Sensoren für Infrarot- und Gammastrahlung (s. a. en:Bhangmeter) und ebenso<br />
Detektoren für EMP. Damit sollen sie Atombombenexplosionen und Starts von Interkontinentalraketen mit einer<br />
Ortsauflösung von 100 m registrieren. [3] Das GPS hat dabei das Vela-System abgelöst.<br />
Eine weitere Aufgabe des GPS Systems besteht in der Bereitstellung eines einheitlichen Zeitsystems. Die von<br />
einem GPS-Empfänger empfangene Zeit ist zunächst die GPS-Zeit. In der Satellitennachricht ist aber auch die<br />
Abweichung zwischen GPS-Zeit und Koordinierter Weltzeit (UTC) angegeben. Mit der Genauigkeit der GPS-Zeit<br />
und der Angabe der Abweichung garantiert das System eine Abweichung von UTC um maximal eine Mikrosekunde,<br />
wenn die Laufzeit auch so genau bestimmt wird.
Global Positioning System 147<br />
Geschichte<br />
Die Grundidee, mittels Satelliten ein Navigationssystem aufzubauen,<br />
gab es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg: Am 11. Mai 1939 meldete<br />
der deutsche Ingenieur Karl Hans <strong>Jan</strong>ke in Berlin ein Patent für einen<br />
„Standortanzeiger, insbesondere für Luftfahrzeuge“ [4] an, welches am<br />
11. November 1943 erteilt wurde. Im Patent geht er von zwei<br />
entfernten Körpern (Satelliten) aus, die permanent elektromagnetische<br />
Signale senden. Die Signale können empfangen werden und als Vektor<br />
auf einem Bildschirm angezeigt werden. Legt man nun eine Karte über<br />
den Bildschirm, könne man sogar die Herkunft und Richtung eines<br />
Objektes bestimmen. Karl Hans <strong>Jan</strong>ke wurde in der DDR aufgrund<br />
einer chronisch paranoiden Schizophrenie in eine Nervenklinik<br />
eingeliefert und verstarb 1988 in der Psychiatrie Hubertusburg. [5]<br />
Neben bodengestützten Funknavigationssystemen wie dem während<br />
des Zweiten Weltkriegs entwickelten Decca Navigation System,<br />
welches später vor allem der Seeschifffahrtsnavigation diente und<br />
prinzipbedingt nur lokal verfügbar war, wurde ab 1958 von der<br />
US-Marine das erste Satellitennavigationssystem Transit entwickelt.<br />
Transit-O-Satellit (Operationelle Generation)<br />
Zunächst unter der Bezeichnung Navy Navigation Satellite System (NNSS) wurde es ab 1964 militärisch zur<br />
Zielführung ballistischer Raketen auf U-Booten und Flugzeugträgern der US-Marine und ab 1967 auch zivil genutzt<br />
und ist seit dem 31. Dezember 1996 außer Betrieb. Seine Sendefrequenzen lagen bei 150 und 400 MHz und es<br />
erreichte eine Genauigkeit zwischen 500 und 15 m.<br />
Das GPS-Programm wurde mit der Gründung des JPO (Joint Program Office) im<br />
Jahre 1973 gestartet. Der erste GPS-Satellit wurde 1978 [6] vom<br />
Vandenberg-Startplatz SLC-3E mit einer Atlas F Rakete in eine Umlaufbahn in<br />
20.200 km Höhe und 63° Bahnneigung geschossen. 1985 startete der letzte<br />
Satellit dieser Generation mit einer Atlas E Rakete von der<br />
Vandenberg-Startrampe SLC-3W. [7] Mit Einführung der GPS II Serie (1989)<br />
wechselte man nach Cape Canaveral und startete von der Startrampe LC-17 mit<br />
Delta-6925-Raketen. Die Serien GPS IIA - GPS IIR-M folgten mit<br />
Delta-7925-Raketen. Die Inklination wurde bei Starts von Cap Canaveral unter<br />
Beibehaltung der Bahnhöhe auf 55° verringert. [8] Im Dezember 1993 wurde die<br />
anfängliche Funktionsbereitschaft (Initial Operational Capability) festgestellt. Zu<br />
diesem Zeitpunkt waren 24 Satelliten im Einsatz. Die volle Funktionsbereitschaft<br />
(Full Operational Capability) wurde im April 1995 erreicht und am 17. Juli 1995<br />
bekanntgegeben. Die GPS IIF-Serie, deren erster Satellit GPS IIF-1 2010<br />
Start eines GPS-Satelliten am 25.<br />
September 2005 an Bord einer<br />
Delta-II-7925-9.5-Rakete<br />
startete) besitzt keinen Feststoff-Apogäumsmotor mehr sondern wird von ihren Delta IV oder Atlas V Trägerraketen<br />
direkt im GPS-Orbit ausgesetzt statt auf einer Transferbahn, wie es bis zu GPS IIR-M Serie üblich war. [9]<br />
Um nicht-autorisierte Benutzer (potentielle militärische Gegner) von einer genauen Positionsbestimmung<br />
auszuschließen, wurde die Genauigkeit für Benutzer, die nicht über einen Schlüssel verfügen, künstlich<br />
verschlechtert (Selective Availability = SA, mit einem Fehler von größer 100 m). SA musste in den<br />
Block-II-Satelliten implementiert werden, weil der C/A-Dienst deutlich besser als ursprünglich erwartet war. Es gab<br />
aber fast immer vereinzelte Satelliten, bei welchen SA nicht aktiviert war, sodass genaue Zeitübertragungen möglich<br />
waren.
Global Positioning System 148<br />
Am 2. Mai 2000 wurde diese künstliche Ungenauigkeit der Satelliten abgeschaltet, ab ca. 4:05 Uhr UTC sendeten<br />
alle Satelliten ein SA-freies Signal. [10] Seitdem kann das System auch außerhalb des bisherigen exklusiven<br />
Anwendungsbereichs zur präzisen Positionsbestimmung genutzt werden. Dies führte unter anderem zum<br />
Aufschwung der Navigationssysteme in Fahrzeugen und im Außenbereich, da der Messfehler nun in mindestens 90<br />
% der Messungen geringer als 10 m ist.<br />
Am 25. September 2005 brachte eine Delta-II-Rakete den ersten GPS-Satelliten der Baureihe GPS 2R-M<br />
(Modernized) in den Weltraum. Die Antenne wurde verbessert und das Sendespektrum um eine zweite zivile<br />
Frequenz und zwei neue militärische Signale erweitert. Seit Dezember 2005 im Einsatz, erweiterte der neue Satellit<br />
die Flotte der funktionstüchtigen Satelliten auf 28. Momentan sind 32 Satelliten aktiv (Stand Juni 2008). Am 17.<br />
August 2009 startete mit GPS 2R-M8 der letzte GPS Satellit dieser Serie mit einer Delta II-Rakete erfolgreich in<br />
seine Transferbahn.<br />
Am 28. Mai 2010 setzte eine Delta IV Medium+ (4,2) den ersten GPS IIF Satelliten im GPS Orbit ab. Diese Serie ist<br />
weiter verbessert (u.a. genauere Atomuhren) [11] .<br />
Das Pentagon autorisierte die United States Air Force am 9. Mai 2008, die ersten acht Satelliten der dritten Baureihe<br />
zu bestellen. Für Entwicklung und Bau wurden 2 Mrd. US-Dollar bereitgestellt. Die dritte Generation wird aus<br />
insgesamt 32 Satelliten bestehen und soll ab 2014 das GPS-II-System ersetzen. Sie unterscheiden sich durch eine<br />
erhöhte Signalstärke und weitere Maßnahmen, um eine Störung der Signale zu erschweren. Lockheed Martin und<br />
Boeing konkurrierten um den Auftrag, mit dem automatisch auch die nachfolgenden 24 Satelliten verbunden sein<br />
sollte. [12] Am 15. Mai 2008 gewann Lockheed-Martin den Auftrag zum Bau der ersten zwei GPS IIIA Satelliten. [13]<br />
Inzwischen soll der Auftrag auf acht Satelliten aufgestockt worden sein. [14]<br />
Satelliten<br />
Die GPS-Satelliten sind auf mehrere Arten nummeriert:<br />
• Fortlaufende Navstar-Nummer des Satelliten: Unter dieser<br />
Bezeichnung wird der Satellit in internationalen Registern geführt.<br />
• USA-Nummer: damit werden seit 1984 US-Militärsatelliten<br />
nummeriert.<br />
• fortlaufende SVN-Nummer (space vehicle number) für<br />
GPS-Satelliten.<br />
• PRN-Nummer, welche die Signalkodierung (nicht den Satelliten)<br />
bezeichnet und auf dem GPS-Empfänger angezeigt wird. Wenn ein<br />
Satellit ausfällt, kann ein anderer sein Signal mit dem PRN-Kode<br />
aussenden.<br />
Aktuelle Konstellation<br />
Skaladiagramm, Erde und GPS-Satellitenbahn<br />
(grüne Linie)<br />
Der Satellit NAVSTAR 22 (ein eigentlich ausrangierter Satellit) ist permanent auf „Unhealthy“ gesetzt und dient<br />
zum Test der PRN 32 in Endgeräten.
Global Positioning System 149<br />
GPS-Konstellation 14. September 2009<br />
Satellit Position Start SVN PRN Katalog-Nr.<br />
(AFSC)<br />
internat.<br />
Bezeichnung<br />
(COSPAR)<br />
NAVSTAR 22 (USA 66) E5 26.11.1990 23 32 20959 1990-103A IIA<br />
NAVSTAR 23 (USA 71) D5 04.07.1991 24 24 21552 1991-047A IIA<br />
NAVSTAR 24 (USA 79) A5 23.02.1992 25 25 21890 1992-009A IIA<br />
NAVSTAR 26 (USA 83) F5 07.07.1992 26 26 22014 1992-039A IIA<br />
NAVSTAR 27 (USA 84) A4 09.09.1992 27 27 22108 1992-058A IIA<br />
NAVSTAR 33 (USA 92) A1 26.06.1993 39 9 22700 1993-042A IIA<br />
NAVSTAR 35 (USA 96) D4 26.10.1993 34 4 22877 1993-068A IIA<br />
NAVSTAR 36 (USA<br />
100)<br />
NAVSTAR 37 (USA<br />
117)<br />
NAVSTAR 38 (USA<br />
126)<br />
NAVSTAR 39 (USA<br />
128)<br />
NAVSTAR 43 (USA<br />
132)<br />
NAVSTAR 44 (USA<br />
134)<br />
NAVSTAR 46 (USA<br />
145)<br />
NAVSTAR 47 (USA<br />
150)<br />
NAVSTAR 48 (USA<br />
151)<br />
NAVSTAR 49 (USA<br />
154)<br />
NAVSTAR 50 (USA<br />
156)<br />
NAVSTAR 51 (USA<br />
166)<br />
NAVSTAR 52 (USA<br />
168)<br />
NAVSTAR 53 (USA<br />
175)<br />
NAVSTAR 54 (USA<br />
177)<br />
NAVSTAR 55 (USA<br />
178)<br />
NAVSTAR 56 (USA<br />
180)<br />
C1 10.03.1994 36 6 23027 1994-016A IIA<br />
C2 28.03.1996 33 3 23833 1996-019A IIA<br />
E3 16.07.1996 40 10 23953 1996-041A IIA<br />
B2 12.09.1996 30 30 24320 1996-056A IIA<br />
F3 23.07.1997 43 13 24876 1997-035A IIR<br />
A3 06.11.1997 38 8 25030 1997-067A IIA<br />
D2 07.10.1999 46 11 25933 1999-055A IIR<br />
E1 11.05.2000 51 20 26360 2000-025A IIR<br />
B3 16.07.2000 44 28 26407 2000-040A IIR<br />
F1 10.11.2000 41 14 26605 2000-071A IIR<br />
E4 30.01.2001 54 18 26690 2001-004A IIR<br />
B1 29.01.2003 56 16 27663 2003-005A IIR<br />
D3 31.03.2003 45 21 27704 2003-010A IIR<br />
E2 21.12.2003 47 22 28129 2003-058A IIR<br />
C3 20.03.2004 59 19 28190 2004-009A IIR<br />
F4 23.06.2004 60 23 28361 2004-023A IIR<br />
D1 06.11.2004 61 2 28474 2004-045A IIR<br />
Typ
Global Positioning System 150<br />
NAVSTAR 57 (USA<br />
183)<br />
NAVSTAR 58 (USA<br />
190)<br />
NAVSTAR 59 (USA<br />
192)<br />
NAVSTAR 60 (USA<br />
196)<br />
NAVSTAR 61 (USA<br />
199)<br />
NAVSTAR 62 (USA<br />
201)<br />
NAVSTAR 63 (USA<br />
203)<br />
NAVSTAR 64 (USA<br />
206)<br />
Übersicht über die GPS-Satellitenmodelle<br />
GPS I<br />
GPS II/IIA<br />
GPS IIR<br />
Von dieser Baureihe ist kein Satellit mehr aktiv.<br />
Hersteller: Rockwell<br />
C4 26.09.2005 53 17 28874 2005-038A IIR-M<br />
A2 25.09.2006 52 31 29486 2006-042A IIR-M<br />
B4 17.11.2006 58 12 29601 2006-052A IIR-M<br />
F2 17.10.2007 55 15 32260 2007-047A IIR-M<br />
C6 20.12.2007 57 29 32384 2007-062A IIR-M<br />
A6 15.03.2008 48 7 32711 2008-012A IIR-M<br />
B2 24.03.2009 49 1 34661 2009-014A IIR-M<br />
E6 17.08.2009 50 5 35752 2009-043A IIR-M<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 63° Inklination. [7]<br />
Hersteller: Rockwell<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 55° Inklination. [8]<br />
Masse: 2032 kg<br />
Dimensionen: 152 × 193 × 191 cm<br />
Elektrische Leistung: 1,136 kW<br />
Geschätzte Lebensdauer: Konstruiert für 6 bis 7,5 Jahre, durchschnittliche tatsächliche Einsatzdauer: 10 Jahre,<br />
längste Einsatzzeit: 16 Jahre.<br />
Transponder: 2× L-Band, 1× S-Band<br />
Kosten: 40 Mio. US-Dollar<br />
Hersteller: Lockheed Martin<br />
Nutzlast: 2 Cs-Atomuhren, 2 Rb-Atomuhren<br />
Verbreitung: 21 hergestellt, 13 gestartet, 12 sind im Einsatz, die restlichen 8 wurden zu GPS IIR-M<br />
umgerüstet.<br />
Basiert auf: Lockheed-Martins AS 4000 Satellitenbus<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 55° Inklination. [15]
Global Positioning System 151<br />
GPS IIR-M<br />
GPS IIF<br />
GPS III<br />
Start von Navstar 57 (andere Bezeichnungen: USA 183, GPS IIR-M1, GPS IIR-14M): 25. Sept. 2005<br />
Letzter Start: 17. August 2009 [16]<br />
Masse: 2060 kg<br />
Geschätzte Lebensdauer: 13 Jahre<br />
Kosten: 60 Mio. Euro<br />
Hersteller: Lockheed Martin<br />
Verbreitung: 8 aus GPS IIR umgerüstet, alle 8 gestartet<br />
Signal: L2C (zweites ziviles Signal auf L2); L2M (weiteres militärisches Signal, ab 2008). Voraussichtlich<br />
L5-Testsignal ab 2008<br />
Nutzlast: 3 Rb-Atomuhren; Sendeleistung regelbar.<br />
Basiert auf: Lockheed-Martins AS 4000 Satellitenbus<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 55° Inklination. [17]<br />
Start: erster Start zunächst für 2002 geplant, dann 2007, über 2009, schließlich am 28. Mai 2010.<br />
Signal: L5 (drittes ziviles Signal)<br />
Kosten: 121 Mio. US-Dollar [18]<br />
Nutzlast: 2 Cs-Atomuhren, 1 Rb-Atomuhr;<br />
Hersteller: Boeing<br />
Verbreitung: 12<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 55° Inklination. [9]<br />
Start geplant für 2014, die ersten acht Satelliten GPS IIIA wurden 2008 autorisiert. [19] Die Indienststellung<br />
war ursprünglich für 2012 geplant, hat sich aber verzögert. [12]<br />
Basiert auf: Lockheed-Martins: A2100A Satellitenbus [9]<br />
Umlaufbahnen: kreisförmig in 20.200 km Höhe mit 55° Inklination. [14]<br />
Genauigkeit der Positionsbestimmung<br />
Kategorisierung<br />
Es gibt zwei Dienstklassen:<br />
• Standard Positioning Service (SPS) ist für jedermann verfügbar und erreicht eine Genauigkeit (engl. accuracy)<br />
von ca. 15 m horizontal (in 95 % der Messungen). Nach stetigen Verbesserungen vor allem durch den<br />
sukzessiven Ersatz älterer Satelliten durch Nachfolgemodelle wird aktuell eine Genauigkeit von 7,8 m horizontal<br />
garantiert (in 95 % der Messungen).<br />
Im Mai 2000 wurde eine künstliche Ungenauigkeit vom US-Militär abgeschaltet; davor betrug die Genauigkeit<br />
100 m. Mit der vierten Ausbaustufe soll in Krisen- bzw. Kriegsgebieten eine künstliche Verschlechterung<br />
(Selective Availability) durch lokale Störung des Empfangs verwirklicht werden.<br />
• Precise Positioning Service (PPS) ist der militärischen Nutzung vorbehalten und ursprünglich auf eine<br />
Richtigkeit von 22 m (in 95 % der Messungen; die aktuelle Richtigkeit ist unbekannt) ausgelegt worden. Diese<br />
Signale werden verschlüsselt ausgestrahlt.
Global Positioning System 152<br />
Eine Erhöhung der Genauigkeit (0,01–5 m) kann durch Einsatz von DGPS (Differential-GPS) erreicht werden.<br />
Zur Verbesserung der Genauigkeit dienen satellitengestützte Erweiterungssysteme (Satellite-Based Augmentation<br />
Systems, SBAS): EGNOS in Europa, WAAS in den USA, MSAS in Japan und GAGAN in Indien.<br />
GPS nutzt eine eigene kontinuierliche Atomzeitskala, welche keine Schaltsekunden berücksichtigt. Seit Einführung<br />
von GPS im Jahr 1980 hat sich deshalb die Differenz zwischen der GPS-Zeit und der UTC aktuell (2009) auf 15<br />
Sekunden aufsummiert (UTC-Zeit + 15 Sekunden = GPS-Zeit). Der aktuelle Wert dieser Differenz wird im<br />
Nutzdatensignal des Systems übertragen.<br />
Es gibt die folgenden zwei Verfahren, um mittels GPS eine Position zu bestimmen:<br />
• Code: Dieses Verfahren ermöglicht eine recht robuste Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von weniger<br />
als 10 m. Alle preiswerten Empfänger verwenden dieses Verfahren. Mittels DGPS sind Genauigkeiten unter<br />
einem Meter möglich.<br />
• Code + Trägerphase: Unter guten Empfangsbedingungen und mit präzisen Empfängern ist mit diesem<br />
Verfahren eine Genauigkeit von unter 5 m möglich. Die Genauigkeitssteigerung rührt aber nicht nur vom<br />
geringeren Rauschen der Trägerphasenmessung her, sondern auch von der Verwendung der zweiten Frequenz zur<br />
Ionosphärenmessung. Soll der Millimeter-Bereich erreicht werden, so ist dies bisher nur im DGPS-Betrieb<br />
möglich, weil auch die lokalen Effekte der Troposphäre berücksichtigt werden müssen.<br />
In Fahrzeugen können zusätzlich Odometrie-Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie Richtungsdaten<br />
(z. B. Differential-Odometer, Drehratensensor) verwertet werden, um die Position präziser zu bestimmen oder auch<br />
noch in Funklöchern wie z. B. Tunneln eine Position ermitteln zu können. Da diese Daten nur von den in der<br />
Fahrzeugelektronik implementierten Sensoren gemessen und an das Navigationssystem übermittelt werden können,<br />
ist diese höhere Präzision derzeit nur von festeingebauten Navigationssystemen zu erreichen.<br />
Relativistische Effekte<br />
Die Zeit, die die Atomuhren auf den GPS-Satelliten anzeigen, unterliegt den Effekten der relativistischen<br />
Zeitdilatation. [20] Dabei hängt nach der allgemeinen Relativitätstheorie die Ganggeschwindigkeit einer Uhr vom Ort<br />
im Gravitationsfeld ab und nach der speziellen auch von ihrer Geschwindigkeit. Das höhere Gravitationspotenzial in<br />
der Satellitenbahn lässt die Zeit schneller vergehen, die Bahnbewegung der Satelliten relativ zu einem ruhenden<br />
Beobachter auf der Erde verzögert sie. In einer Flughöhe von ca. 3.000 km heben sich beide Effekte gerade auf, in<br />
der GPS-Satellitenbahn überwiegt der gravitative Effekt um mehr als das 6-fache. Auf den Satelliten geht damit die<br />
Zeit vor. Der relative Gangunterschied (= Δt/t) zu einer irdischen Uhr liegt zwar bei nur 4,4·10 −10 , er ist jedoch<br />
deutlich größer als die relative Ganggenauigkeit von Rubidium-Atomuhren, die besser als 10 −14 sind.<br />
Oft wird irrtümlich darauf hingewiesen, dass diese Gangunterschiede zu einem Positionsbestimmungsfehler von<br />
mehreren Kilometern pro Tag führten, wenn sie nicht korrigiert würden. Ein solcher Fehler würde aber nur dann<br />
auftreten, wenn die Positionsbestimmung über die Ermittlung der Abstände des GPS-Empfängers zu drei Satelliten<br />
anhand eines Uhrenvergleichs mit einer Uhr im Empfänger erfolgte. In diesem Fall würde sich bei jeder dieser<br />
Abstandsbestimmungen ein Fehler von ca. 12 km pro Tag anhäufen. Gewöhnliche GPS-Empfänger sind aber nicht<br />
mit einer Atomuhr ausgestattet. Stattdessen wird die präzise Zeit am Empfangsort auch aus dem C/A-Code der<br />
empfangenen Satelliten bestimmt. Aus diesem Grund sind für eine 3D-Positionsbestimmung mindestens vier<br />
Satelliten erforderlich (vier Laufzeitsignale zur Bestimmung von vier Parametern, nämlich drei Ortsparametern und<br />
der Zeit). Weil alle Satelliten den gleichen relativistischen Effekten ausgesetzt sind, entsteht hierdurch ein<br />
vernachlässigbarer Fehler bei der Positionsbestimmung, weil sich dieser Fehler nur über den Laufzeitunterschied<br />
auswirkt.<br />
Damit die Satellitensignale des GPS außer zur Positionsbestimmung auch als Zeitstandard verwendet werden<br />
können, wird der relativistische Gangunterschied der Uhren allerdings kompensiert. Dazu wird die<br />
Schwingungsfrequenz der Satelliten-Uhren auf 10,229999995453 MHz verstimmt, so dass trotz der relativistischen
Global Positioning System 153<br />
Effekte ein synchroner Gang mit einer irdischen Uhr mit 10,23 MHz gewährleistet ist. Weitere relativistische<br />
Effekte, wie zum Beispiel der Sagnac-Effekt sind so klein, dass sie bei stationären Empfängern nicht gesondert<br />
berücksichtigt werden müssen.<br />
Differential-GPS<br />
Differential Global Positioning System (DGPS, auch dGPS) ist eine Sammelbezeichnung für Verfahren, die simultan<br />
mehrere GPS-Empfänger einsetzen, um die Genauigkeit zu erhöhen. DGPS macht sich das Faktum zunutze, dass die<br />
zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksamen Fehler des GPS-Systems auf nahegelegenen Messpunkten fast dieselben<br />
sind, sodass sie in der Differenz herausfallen.<br />
Man verwendet einen oder mehrere Empfänger, deren Position bestimmt werden soll (Rover), und mindestens einen<br />
weiteren Empfänger, der auf einem genau bekannten Vermessungspunkt aufgestellt wird (GPS-Basisstation oder<br />
Referenzstation). Auf der Basisstation werden die momentan wirksamen Messfehler des Systems ermittelt, die vor<br />
allem auf Uhr- und Bahnfehler der Satelliten und Einflüsse der Ionosphäre entfallen. Mit diesen Informationen<br />
(Korrekturdaten) der Basisstation kann ein Rover-Empfänger seine Genauigkeit erhöhen, da er praktisch denselben<br />
Messabweichungen unterliegt.<br />
Die erreichbare Genauigkeit hängt vor allem vom Abstand zwischen Rover und Basisstation ab, aber auch von der<br />
Satellitenkonstellation.<br />
Offline-Methode (Postprocessing)<br />
Man kann die Messdaten (die empfangenen Satellitensignale) entweder für eine nachträgliche Auswertung aller<br />
Messpunkte aufzeichnen (offline) oder die Positionskorrekturen der Basisstation online an alle Rover übermitteln.<br />
Erstere Methode wurde vor allem in der Anfangszeit von GPS verwendet, ist aber bis heute für genaue<br />
Vermessungsnetze in Gebrauch. Die Berechnung erfolgt durch einen räumlichen Netzausgleich, der entweder auf<br />
den Signal-Laufzeiten oder auf ihrer Phasenmessung beruht. Wenn Genauigkeiten von dm...m ausreichen, genügt<br />
auch die Ausgleichung der von den Empfängern direkt berechneten Positionen.<br />
Für weit ausgedehnte Vermessungsnetze kann es notwendig sein, diese in überlappende Abschnitte zu unterteilen,<br />
die sogenannten Sessionen. Mit den vorhandenen Empfängern wird ein Teil der Punkte und ein bis drei<br />
Referenzpunkte gleichzeitig eingemessen; mittels letzteren kann das gesamte Netz a posteriori einheitlich<br />
ausgeglichen werden. Auch eine nachträgliche „Anfelderung“ einzelner Netzteile ist möglich.<br />
Im ersten GPS-Jahrzehnt, als die Empfänger noch sehr teuer waren, wurden auch Verfahren zur<br />
Genauigkeitssteigerung mit nur einem Empfänger entwickelt ("single receiver methods"), u. a. das qGPS<br />
(Quasidifferenz-GPS) der TU Wien, das die einzelnen Messpunkte durch wiederholtes Aufsuchen eines zentral<br />
gelegenen Bezugspunktes gegeneinander versteift. Die Messungen auf solchen Knotenpunkten ermöglichen durch<br />
geeignete Ausgleichung nicht nur eine genauere Vernetzung, sondern auch die Bereinigung eines eventuellen<br />
zeitlichen Trends in den ermittelten GPS- Koordinaten.<br />
Online-Methoden (Korrektursignale)<br />
Im Allgemeinen werden jedoch die Korrekturdaten der Referenzstation(en) direkt an alle Empfänger gefunkt oder –<br />
im Falle regionaler Permanentstationen – auch über das Internet verbreitet.<br />
Durch telefonische oder Funkübertragung der Korrekturdaten einer Basisstation kann jeder Rover sofort seine<br />
Ortungsgenauigkeit erhöhen. Eine feinere Korrektur kann auch im Nachhinein erfolgen, wenn Rover und<br />
Basisstation alle Daten zur Positionsbestimmung aufzeichnen (Postprocessing).<br />
Die Korrekturdaten können vom Anwender selbst erzeugt werden, wenn ein zweiter GPS-Empfänger vorhanden ist.<br />
Um aber auf Zweitgeräte verzichten zu können, haben viele Länder permanente Referenzstationen eingerichtet, die<br />
von Anwendergruppen oder der amtlichen Landesvermessung betrieben werden (z. B. das SAPOS-Netz der
Global Positioning System 154<br />
deutschen Bundesländer). Dadurch sind auch mit nur einem Empfänger hochgenaue Positionsbestimmungen<br />
möglich, bei entsprechender Hardware sogar praktisch in Echtzeit.<br />
• Für Deutschland wurde SAPOS-HEPS (Hochpräziser Echtzeit Positionierungs-Service) entwickelt. Er bietet eine<br />
Lagegenauigkeit von ca. 1–2 cm und eine Höhengenauigkeit von ca. 2–3 cm.<br />
Für Messungen im SAPOS-System benötigt man Roverausrüstung mit einem geodätischen, RTK fähigen<br />
GNSS-Empfänger, sowie ein Modem / Handy für den Empfang der SAPOS-Daten. Man kann sich dabei (unter<br />
Beibehaltung von Satellitenkontakt und Handyverbindung) von Punkt zu Punkt bewegen, ohne den Empfänger jedes<br />
Mal neu initialisieren zu müssen. Dies ermöglicht flexibles Arbeiten und man erhält sofort die Koordinate eines<br />
Punktes im ETRS-Koordinatensystem. Als Beobachtungszeit pro Punkt genügen 5–20 Sekunden.<br />
Vorteil: Wirtschaftlichkeit durch geringen Zeit- und Personalaufwand. Koordinaten direkt erhältlich ohne<br />
innendienstliche Nachbearbeitung. Keine Abhängigkeit von Tageszeit oder Wetter.<br />
Nachteil: Koordinatenbestimmung in Pr.La nur durch Koordinaten-Transformation.<br />
• In anderen Ländern wurden ähnliche Datendienste aufgebaut, die entweder amtlich, von Vermessungsdiensten<br />
oder von EVUs betrieben werden. In Österreich sind es v.a. Kraftwerksbetreiber und das dGPS der<br />
Ingenieurbüros, in der Schweiz das swipos der Landestopografie, in Deutschland neben Sapos Anbieter wie ALF,<br />
AMDS oder ascos.<br />
• Bei der Methode der Pseudorange-Korrektur berechnet die Basisstation die Fehler der Strecken zu den Satelliten<br />
und übermittelt diese an den Rover. So ist auch eine Korrektur möglich, wenn von der Basisstation und dem<br />
Rover unterschiedliche Satelliten empfangen werden. Es sind Genauigkeiten
Global Positioning System 155<br />
Datenformate<br />
Als Standardformat von GPS-Daten dient das RINEX-Format, eine<br />
Standard- und Formatdefinition, die einen freien Austausch von<br />
GPS-Rohdaten ermöglichen soll. Für den Austausch von GPS-Daten in<br />
Echtzeitanwendungen ist das RTCM-Format von Bedeutung.<br />
Siehe auch: NMEA 0183<br />
Neben diesen Basisformaten speichern die GPS-Geräte<br />
unterschiedlicher Hersteller die GPS-Ergebnisse (Routen, Track Logs<br />
und Wegpunkte) häufig in eigenen proprietären Dateiformaten. Als<br />
allgemeine Austauschformate bieten sich das gpx-Format und das<br />
Google Earth eigene .kml-Format an. Eine Konvertierung zwischen<br />
verschiedenen Formaten erlaubt die freie Software GPSBabel.<br />
Störsender<br />
Um das System zu stören, gibt es zum einen die Möglichkeit des<br />
Jammings (Jammer = engl. für Störsender), siehe GPS-Jammer,<br />
weiterhin des GPS-Spoofing.<br />
Alternativen<br />
GLONASS<br />
Euteltracs<br />
Galileo<br />
Das russische Pendant zum amerikanischen NAVSTAR GPS.<br />
Holux Datenlogger zur Aufzeichnung von<br />
GPS-Daten<br />
Europäisches Positionssystem für Fernverkehr (sehr ungenau). Es sendet auf einer Frequenz von 10–14 GHz<br />
und ist seit 1991 in Betrieb.<br />
EU und ESA haben gemeinsam die Entwicklung eines europäischen Systems zur Satellitennavigation für<br />
überwiegend zivile Anwendungen mit dem Namen Galileo vorangetrieben. Die Entwicklungs- und Testphase<br />
wurde im Dezember 2004 in einem 4-Jahresvertrag an die Industrie vergeben. Nach Ablauf dieses Vertrages<br />
sollen 32 Galileo-Satelliten im All und der Großteil des Bodensegments installiert sein. Der ursprüngliche<br />
Zeitplan sieht wie folgt aus: Bis 2005 Entwicklungs- und Testphase, Aufbau des Satellitennetzes ab 2006,<br />
Testphase ab 2008. Bis Ende 2008 waren allerdings erst die beiden Testsatelliten Giove-A1 und Giove-B im<br />
All.<br />
MTSAT<br />
Es wird mindestens vier Dienste (OS, CS, SoL, PRS) geben. Die zivile und kostenlose Positionsbestimmung<br />
(OS) wird eine Genauigkeit von 5–8 m bereitstellen. Beim SoL-Dienst wird zusätzlich noch Integrität, also die<br />
rechtzeitige Warnung des Nutzers, wenn der Positionierungsfehler größer als eine vorgegeben Schranke (12 m<br />
horizontal, 20 m vertikal) ist, bereitgestellt. Der PRS-Dienst wird die Bedürfnisse staatlicher Organisationen<br />
befriedigen, z. B. Polizei und Luftfahrt. Im CS-Dienst können noch zusätzlich Informationen mit geringer<br />
Datenrate an Abonnenten übertragen werden.<br />
Das Multifunction Transport Satellite System ist eine Entwicklung Japans (Frequenz 1,2 GHz). Noch in der<br />
Experimentierphase. (Stand 2003)
Global Positioning System 156<br />
Compass<br />
Das Navigationssystem der Volksrepublik China (Sendefrequenz 1,4 GHz). Seit 2004 in Betrieb, allerdings<br />
beschränkt sich die Nutzung auf den asiatischen Bereich.<br />
GPS und Datenschutz<br />
Der Aufenthaltsort des Trägers eines GPS-Empfängers lässt sich, da die Geräte momentan nur passiv arbeiten und<br />
keine Signale senden, nicht verfolgen. Für eine GPS-Überwachung benötigt man eine Kombination aus einem<br />
passiven GPS-Empfänger mit einem aktiven Sender, der die ermittelten Positionsdaten an Dritte weitergibt.<br />
GPS wird von der deutschen Polizei für Ermittlungen eingesetzt. Es dient zur Überwachung bestimmter Fahrzeuge<br />
und Fahrer. Im April 2005 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Einsatz des satellitengestützten Systems<br />
zur Überwachung in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nicht gegen das Grundgesetz verstoße. Der Zweite<br />
Senat wies mit diesem Urteil eine Verfassungsklage eines Ex-Mitglieds der Antiimperialistischen Zellen (AIZ)<br />
zurück, das beanstandet hatte, eine zweieinhalb Monate andauernde Überwachung seines Fahrzeugs und dessen<br />
verschiedener Benutzer habe in übertriebener Weise in Grundrechte der Überwachten eingegriffen.<br />
GPS in der Praxis<br />
Der Einsatz von GPS-Geräten hat in den letzten Jahren durch die preiswerte Technik erheblich zugenommen und ist<br />
kaum noch überschaubar. Ein verbreitetes Einsatzgebiet ist das Flottenmanagement von Verkehrsbetrieben und des<br />
Transportwesens zu Land und auf Wasser/See. Wenn die Fahrzeuge mit GPS und einem Transponder ausgerüstet<br />
sind, hat die Zentrale jederzeit einen Überblick über den Standort der Fahrzeuge und kann bei Störungen sofort<br />
eingreifen.<br />
Handelsübliche zivile GPS-Geräte für Verbraucher eignen sich vor<br />
allem für den Einsatz im Auto und im „Outdoor“-Bereich.<br />
Handelsübliche GPS-Empfänger (GPS-Mäuse) verwenden meist das<br />
NMEA 0183-Datenformat zur Ausgabe der Positionsdaten.<br />
Zu den Herstellern von GPS-Empfängern zählen Garmin, Magellan,<br />
TomTom, HAiCOM, Globalsat und RoyalTek sowie die Hersteller von<br />
Smartphones.<br />
Kritik<br />
In der Berufsschifffahrt wie in anderen Gewerben galt früher rechtlich<br />
Gebrauch eines GPS-Empfängers bei der<br />
Geländearbeit (Hochanden, 1993)<br />
die Standortermittlung mittels GPS lediglich als ergänzendes Hilfsmittel zur terrestrischen und astronomischen<br />
Standortbestimmung. Der Grund war die damals nicht ausreichend gesicherte Zuverlässigkeit und der künstliche<br />
Fehler.<br />
2006 entdeckte Alessandro Cerruti von der amerikanischen Cornell University, dass GPS durch Sonneneruptionen<br />
gestört werden kann. In den vergangenen Jahren waren diese – und die damit verbundenen geomagnetischen<br />
Stürme – wenig ausgeprägt, sie sollen jedoch bis 2011 wieder zunehmen.<br />
Auch kann der GPS-Empfang durch starke Schneefälle gestört werden. Sonstige Wetterverhältnisse, wie Regen und<br />
Nebel, beeinträchtigen den Empfang normalerweise jedoch nicht – allerdings ist der Empfang unter regennassem<br />
Laub im Wald deutlich schlechter als bei trockener Witterung.
Global Positioning System 157<br />
Im geschäftlichen, sicherheitstechnischen und medizinischen Einsatz<br />
Einsatzmöglichkeiten im geschäftlichen, sicherheitstechnischen und medizinischen Umfeld sind zum Beispiel:<br />
• Trace und Tracking zur Ermittlung und Speicherung von Routen und deren Zeit wie für ein elektronisches<br />
Fahrtenbuch.<br />
• Lokalisation der Standorte von Mitarbeitern, Produkten oder Schutzbefohlenen wie Kinder, Kranke und ältere<br />
Menschen.<br />
• Geofencing zur Verfolgung von Standorten und Geschehnissen in Echtzeit wie für den Personen- und<br />
Fahrzeugschutz bei Werttransporten.<br />
• automatische Steuerung, Überwachung und Aufzeichnung von landwirtschaftlichen Geräten bei der Bestellung<br />
von großen Flächen, wobei heute viele Mähdrescher und ähnliche Fahrzeuge mit dieser Technik ausgerüstet sind.<br />
• Auch die modernen Ausführungen der Elektronischen Fußfessel sind mit GPS ausgerüstet.<br />
GPS beim Sport<br />
GPS-Datenlogger (zur Erstellung von Tracks) und kleine<br />
Navigationsgeräte werden für Individualsport (Jogging, Radfahren, …)<br />
z. B. zur persönlichen Trainingsplanung und -überwachung zunehmend<br />
eingesetzt.<br />
Für Sportwettkämpfe gilt, dass eine GPS-Kontrolle jedes<br />
Wettkämpfers (ähnlich dem auf Transpondertechnik basierenden<br />
ChampionChip-System) grundsätzlich technisch möglich ist, aber die<br />
breite Anwendung auf klassische Wettkampfformate<br />
(Breitensportveranstaltung) noch auf sich warten lässt. Am 1. Mai<br />
2010 wurde der Dresdner 100km-Duathlon als erste<br />
Breitensportveranstaltung vollständig und systemidentisch<br />
GPS-aufgezeichnet. [21] Bei Sportartexoten wie Geocaching,<br />
Kitesurfen, Paragleiten und Segelfliegen hingegen wird eine<br />
GPS-Überwachung heutzutage schon durchgeführt.<br />
Eine GPS-gestützte Wettkampfüberwachung bietet Vorteile, wie:<br />
• Kontrollfunktion: Streckenkonformität (Kürzen die Sportler die<br />
vorgegebene Wettkampfstrecke ab?) Dieser Vorteil ist vor allem für<br />
den Veranstalter des Wettkampfes relevant.<br />
• Erlebniswert: Nachvollziehbarkeit des Wettkampfgeschehens im<br />
Detail, schafft für die Sportler einen Mehrwert an der<br />
Sportveranstaltung.<br />
GPS-Datenlogger<br />
GPS-Empfänger im Armbanduhrformat<br />
• Live-Übertragung: Voraussetzung dafür ist die direkte Übertragung der Geodaten und die Darstellung des<br />
Wettkampfes. Damit kann z.B. über das Internet eine breite Öffentlichkeit erreicht werden.
Global Positioning System 158<br />
In der Luftfahrt<br />
Größter Profiteur des GPS ist die zivile Luftfahrt. Alle modernen<br />
Navigationssysteme sind GPS-gestützt, insbesondere in der<br />
Verkehrsluftfahrt sind jedoch weiterhin Systeme in Form von VOR-<br />
oder NDB-Empfängern üblich, das GPS nimmt hier in der Regel nur<br />
eine unterstützende Funktion ein.<br />
Theoretisch, vorbehaltlich der Zulassung, erlauben die Genauigkeiten<br />
(P/Y-Signal) sogar automatische Landungen, sofern die Mittellinien<br />
der Landebahnen vorher genau vermessen wurden, d. h. die<br />
Koordinaten bekannt sind und zusätzlich DGPS eingesetzt wird. Einige<br />
unbemannte Luftfahrzeuge, wie EuroHawk benutzen dieses Verfahren.<br />
In der Verkehrsluftfahrt ist es zurzeit (Ende 2008) teilweise<br />
zugelassen. Ob ein Anflug nur mit dem GPS als Navigationssystem<br />
Garmin GPS IIplus bei einem Flug mit einem<br />
Motorschirm-Trike<br />
zugelassen ist, hängt von den Sichtbedingungen, dem genutzten System (GPS, DGPS) und der Ausrüstung von<br />
Luftfahrzeug und Landebahn ab. Eine Vorreiterrolle nehmen hier die Vereinigten Staaten ein, jedoch verbreiten sich<br />
GPS-gestützte Anflüge auch in Europa immer mehr.<br />
Insbesondere in Sportflugzeugen wie Segelfliegern, Ultraleichtflugzeugen, die nicht über Funknavigationsanlagen<br />
wie VOR- oder NDB-Empfänger verfügen, erfreuen sich GPS-Empfänger großer Beliebtheit. Da sich der Pilot durch<br />
die einfachere Navigation voll auf das Fliegen konzentrieren kann, steigert die GPS-Nutzung auch die Sicherheit, die<br />
Wahrscheinlichkeit des Verfliegens sinkt. Jedoch muss auch immer mit einem Ausfall des Systems gerechnet<br />
werden, da es bei blindem Vertrauen in das System und gleichzeitigem Ausfall zu einem Verlust der Kenntnis der<br />
eigenen Position kommen kann, wodurch es unter Umständen auch zu gefährlichen Situationen, wie<br />
Treibstoffmangel, Einflug in Flugverbotszonen usw. kommen kann.<br />
Wie bei der Nutzung in Kraftfahrzeugen gibt es sowohl fest eingebaute Systeme, wie auch nachgerüstete Geräte.<br />
Insbesondere die Nutzung von PDAs mit angeschlossenen GPS-Mäusen nimmt im Freizeitbereich stark zu, da mit<br />
geringem Aufwand und Kosten ein leistungsstarkes Navigationssystem nachgerüstet werden kann.<br />
Im Auto<br />
Hier handelt es sich um GPS-Geräte, die mit umfangreicher<br />
Landkarten- und Stadtplan-Software ausgestattet sind. Sie ermöglichen<br />
meist akustische Richtungsanweisungen an den Fahrer, der zum<br />
Beispiel am Beginn der Fahrt lediglich den Zielort wie z. B.<br />
Straßenname und Ort einzugeben braucht. Im Auto wird bei<br />
Festeinbauten ab Werk (siehe Infotainmentsystem) unterschieden<br />
zwischen Systemen, die Sprachausgabe mit Richtungsangaben auf<br />
einem LCD (meist im Autoradioschacht) kombinieren, sowie<br />
Sprachausgabe mit farbiger Landkartendarstellung, bei welcher der<br />
Fahrer besser räumlich sieht, wo er unterwegs ist.<br />
Integriertes Navigationssystem mit Bildschirm<br />
von Audi<br />
In letzter Zeit haben PDA-, Smartphone- und mobile Navigationssysteme starken Zuwachs erhalten. Sie können<br />
flexibel in verschiedenen Fahrzeugen schnell eingesetzt werden. Meist wird die Routenführung grafisch auf einem<br />
Farbbildschirm mit Touchscreen dargestellt. Auch ist die Verbreitung durch ständig fallende Preise zu erklären.
Global Positioning System 159<br />
Bei den meisten Festeinbauten ab Werk sowie den neuesten PDA- und<br />
PNA-Lösungen werden Verkehrsmeldungen des TMC-Systems,<br />
wonach der Fahrer automatisch an Staus oder Behinderungen<br />
vorbeidirigiert werden soll, auch mit berücksichtigt.<br />
Festeingebaute Systeme sind in der Regel zwar erheblich teurer als<br />
mobile Geräte in Form von z. B. PDAs, haben jedoch den Vorteil, dass<br />
sie mit der Fahrzeugelektronik gekoppelt sind und zusätzlich<br />
Odometrie-Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung<br />
verwenden, um die Position präziser zu bestimmen und auch noch in<br />
Funklöchern wie z. B. Tunneln eine Position ermitteln zu können.<br />
Mobiles Navigationssystem für die Benutzung im<br />
Auto, Fahrrad oder zu Fuß (Größe: 10cm breit,<br />
7cm hoch)<br />
Der Vorteil der stark zunehmenden Navigation in Autos liegt darin, dass der Fahrer sich ganz auf den Verkehr<br />
konzentrieren kann. Auch kann ca. 1–3 % Treibstoffverbrauch eingespart werden, wenn alle Fahrzeuge den<br />
optimalen Weg wählen.<br />
GPS kann auch zur Diebstahlsicherung genutzt werden. Hierzu wird die GPS-Anlage z. B. des Fahrzeuges mit einem<br />
GSM-Modul kombiniert. Das Gerät sendet dann, im Falle eines Fahrzeugdiebstahls, die genauen Koordinaten an<br />
einen Dienstleister. In Verbindung mit einem PC kann dann z. B. über das Internet sofort die entsprechende Straße<br />
und der Ort abgelesen und die Polizei alarmiert werden.<br />
Den großen Unterschied macht jedoch heute in miteinander vergleichbaren Systemen weniger die Technik, sondern<br />
vielmehr das jeweilige Navigationsprogramm und deren benutze Datenbasis aus. So gibt es derzeit von Programm zu<br />
Programm noch durchaus Unterschiede in der Routenführung.<br />
Im Freien<br />
GPS-Geräte eignen sich auch zum Einsatz am Fahrrad, beim Wandern (zum<br />
Beispiel als kompaktes Gerät am Handgelenk) oder im Flugzeug oder neuerdings<br />
auch beim Fotografieren (Geo-Imaging, Geotagging, Georeferenzierung [22] ).<br />
Der Funktionsumfang der im Handel erhältlichen Geräte richtet sich nach<br />
Anwendungsbereich und Preis. Schon einfache Geräte können heute nicht bloß<br />
die Längen- und Breitengrade anzeigen, sondern auch Richtungsangaben<br />
machen, Entfernungen berechnen und die aktuelle Geschwindigkeit angeben. Die<br />
Anzeige kann so eingestellt werden, dass ein Richtungssymbol ausgegeben wird,<br />
das in die Richtung zeigt, die vom Benutzer durch die Eingabe der<br />
Zielkoordinaten (Wegpunkt) angegeben worden ist. GPS-Geräte stellen hier eine<br />
Weiterentwicklung der klassischen Navigation mit Kompass und Karte dar.<br />
Spezielles Foto-GPS auf<br />
GPS-fähiger Kamera<br />
Diese Funktion verwendet man zum größten Teil bei der Schatzsuche per GPS (Geocaching). Hochwertige, moderne<br />
Geräte können neben Wegpunkten, Routen und Track Logs auch digitale Karten speichern und damit den aktuellen<br />
Standort auf einer Karte darstellen. Für den Außenbereich liegen für verschiedene Länder Topografische Karten im<br />
Maßstab 1:25.000 zur Nutzung mit dem GPS vor.<br />
Wenngleich die Outdoor-GPS-Geräte dafür nicht primär gedacht sind, können selbst kleine Armbandgeräte in Autos<br />
oder in der Bahn (Fensterplatz, ggf. im Wagenübergang) verwendet werden; der Empfang in Gebäuden ist jedoch<br />
mit diesen Geräten gewöhnlich nicht möglich.
Global Positioning System 160<br />
In der Seefahrt<br />
Ein breites Angebot von GPS-Geräten ist auf die besonderen Anforderungen der Navigation in der Seefahrt<br />
zugeschnitten. GPS gehört heute zur Grundausstattung eines Schiffes, meist als Kartenplotter, bei dem der über GPS<br />
ermittelte Schiffsort in Echtzeit auf einer Elektronischen Seekarte angezeigt wird. Mobile GPS-Empfänger gibt es<br />
seit den 1980er Jahren. Mit einem Navigationsprogramm und einer GPS-Maus kann auch auf dem PC, Notebook<br />
oder PDA navigiert werden; heute sind auch viele Mobiltelefone GPS-fähig. In der Großschifffahrt werden<br />
integrierte elektronische Informations-, Navigations- und Schiffssteueranlagen (ECDIS) verwendet. Die für die<br />
Seenavigation bestimmten Geräte verfügen in der Regel über eine Kartenanzeige („Moving Map“) mit speziellen,<br />
elektronischen Seekarten in verschlüsselten Formaten. OpenSeaMap verwendet ein freies Format. Viele der Geräte<br />
sind wasserdicht gebaut; anspruchsvollere ermöglichen auch die kombinierte Darstellung der Seekarten mit weiteren<br />
Daten wie Wetterkarten oder Radardarstellungen. Beim AIS dient das GPS neben der Positionsermittlung auch als<br />
Zeitbasis zur Koordinierung der Slot-Benutzung.<br />
In Gebäuden<br />
In Gebäuden ist der GPS-Empfang generell reduziert bis unmöglich. Im konkreten Fall hängt es neben den<br />
verwendeten Baustoffen im Gebäude und deren Dämpfungsverhalten auch vom Standort innerhalb eines Gebäudes<br />
ab. In Fensternähe bzw. in Räumen mit großen Fenstern und freier Sicht auf den Himmel in Südrichtung kann je<br />
nach momentaner Satellitenposition durchaus noch eine Standortbestimmung mit reduzierter Genauigkeit möglich<br />
sein. In abgeschatteten Räumen wie beispielsweise Kellern ist der GPS-Empfang praktisch immer unmöglich.<br />
Mit neueren Empfänger-Chipsätzen der Firma SiRF (etwa SiRF Star III) oder der Firma u-blox (z. B. u-blox-5) ist in<br />
manchen Situationen wie in Gebäuden ein GPS-Empfang durch in Hardware massiv parallelisierte<br />
Korrelationsempfänger möglich. Statt wie bei herkömmlichen GPS-Empfängern die Korrelationen der Codefolgen<br />
(CDMA) zeitlich hintereinander durchzuprobieren und sich nur auf einen Empfangsweg festlegen zu können, werden<br />
bei diesen Chipsätzen 204.800 Korrelationsempfänger (SiRF Star III) parallel eingesetzt und zeitgleich ausgewertet.<br />
Damit kann der Mehrwegeempfang reduziert werden und in Kombination mit einer gesteigerten<br />
Eingangsempfindlichkeit des HF-Eingangsteils können die an Wänden oder Böden reflektierten GPS-Funksignale<br />
unter Umständen auch im Inneren von Gebäuden oder engen Gassen in dicht verbauten Gebieten noch ausgewertet<br />
werden. Allerdings ist bei indirektem Empfang von GPS-Signalen über Reflexionen eine Reduktion der Genauigkeit<br />
verbunden, da das Signal dann eine längere Laufzeit aufweist und die genauen zeitlichen Bezüge nicht mehr passen.<br />
Der zusätzliche Fehler über Mehrwegeempfang kann einige 10 m betragen.<br />
Als Kunstform<br />
GPS-Drawing bezeichnet das Erstellen von Bildern durch Aufzeichnung einer Route mit dem GPS-Empfänger.<br />
Hierbei werden aufgezeichnete Routen, auch Tracks genannt, später einfach am PC bearbeitet und als Bilddatei<br />
gespeichert. Teilweise werden auch Luftaufnahmen auf die Tracks überlagert. Möglich ist das GPS-Drawing mit<br />
jedem GPS-Gerät, das über eine Aufzeichnungsfunktion verfügt.<br />
Literatur<br />
• Günter Seeber: Satellite Geodesy. 2. Auflage. De Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017549-5<br />
• Guochang Xu: GPS. Theory, Algorithms and Applications. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-67812-3<br />
• Manfred Bauer: Vermessung und Ortung mit Satelliten. 5. Auflage. Wichmann, Heidelberg 2003, ISBN<br />
3-87907-360-0<br />
• Elliott D. Kaplan (Hrsg.): Understanding GPS. Principles and Applications. Artech House, Boston 1996, ISBN<br />
0-89006-793-7<br />
• Rainer Höh: GPS-Outdoor-Navigation. Reise-Know-How-Verlag Rump, Bielefeld 2005, ISBN 3-8317-1116-X
Global Positioning System 161<br />
• Uli Benker: GPS. Praxisbuch und Ratgeber für die GPS-Navigation auf Outdoor-Touren. Bruckmann, München<br />
2009, ISBN 3-7654-5110-X<br />
• Ralf Schönfeld: Das GPS-Handbuch. Monsenstein und Vannerdat, 2005, ISBN 3-86582-234-7 (Zwei Bände,<br />
Band 1: Grundlagen, Basis-Funktionen, Navigation und Orientierung, Karten.)<br />
• Alois Goiser: Handbuch der Spread-Spectrum-Technik. Springer, Wien 1998, ISBN 3-211-83080-4<br />
• Jean-Marie Zogg: und GNSS: Grundlagen der Ortung und Navigation mit Satelliten. [23] u-blox, Thalwil 2009<br />
(Online-Publikation, PDF, 8MB)<br />
Siehe auch<br />
• AGPS – schnellere Positionsbestimmung durch GPS in Kombination mit Positionsdaten von GSM-Betreibern<br />
• APRS – Automatic Position Reporting System (GPS Positionsdatenübermittlung im Amateurfunkdienst)<br />
• DGPS – Differential Global Positioning System<br />
• Geocaching – Schatzsuche mit GPS-Empfängern<br />
• Geodätisches Datum – zu Grunde liegende Ellipsoidmodelle der Erde, beispielsweise WGS84<br />
• Geo-Imaging – Fotoverortung, Fotos mit Koordinaten versehen<br />
• GPS-Levelling – Geoidbestimmung durch Kombination von GPS und Nivellement<br />
• GpsDrive – freie Navigationssoftware unter Linux<br />
• GPS-Technik<br />
• Liste der Navigationssatelliten<br />
• Live-Tracking<br />
• mobiles Navigationssystem<br />
• RAIM – Receiver Autonomous Integrity Monitoring (eine Technologie zur Überprüfung der Integrität von GPS)<br />
• Quasi-Zenit-Satelliten-System - Japans System mit geplanten 3 Satelliten<br />
Weblinks<br />
• aktuelle Satellitenkonstellation [24]<br />
• Zugesicherte Leistungsfähigkeit von GPS, 3. Ausgabe 2001 [25] (PDF; 2,05 MB)<br />
• Zugesicherte Leistungsfähigkeit von GPS, 4. Ausgabe 2008 [26] (PDF; 1,63 MB)<br />
• GPS General Information US Coast Guard [27]<br />
• Beispiel-Datensätze, C-Code [28] (engl.)<br />
• Profile: GPS Architect, Bradford W. Parkinson [29] Der Vater von GPS<br />
• alpentunnel.de [30] GPS und historische Vermessung<br />
• Die GPS-Satelliten bei Skyrocket [31]<br />
Referenzen<br />
[1] Mobile Computing: Grundlagen, Technik, Konzepte; Heidelberg, dpunkt-verlag 2002, Seite 259<br />
[2] IS-GPS-200 (http:/ / gps. losangeles. af. mil/ engineering/ icwg/ ) Offizielle US-Airforce Seite des GPS PUBLIC INTERFACE CONTROL<br />
WORKING GROUP (engl.) mit der Referenzdokumentation IS-GPS-200 in der jeweils aktuellen Fassung.<br />
[3] Decode Systems: Global Positioning System (http:/ / www. decodesystems. com/ gps. html)<br />
[4] Patent DE743758 (http:/ / v3. espacenet. com/ textdoc?DB=EPODOC& F=0& IDX=DE743758): Standortanzeiger, insbesondere für<br />
Luftfahrzeuge. Angemeldet am 11. Mai 1939, Erfinder: Hans Joachim <strong>Jan</strong>ke.<br />
[5] Mitteldeutscher Rundfunk (Hrsg.): Genie und Wahnsinn. In: mittendrin, Ausgabe Sachsen. 16, Nr. 11, Leipzig 2007 ( PDF, 5,4 MB (http:/ /<br />
www. mdr. de/ DL/ 4978585. pdf), abgerufen am 10.6.2008).<br />
[6] How Global Positioning Systems Work (http:/ / www. pcmag. com/ article2/ 0,2817,2316534,00. asp), pcmag.com, 8. Juli 2008<br />
[7] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar. htm<br />
[8] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar-2a. htm<br />
[9] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar-2f. htm<br />
[10] The May 2 Transition as Observed from Multiple International Sites (http:/ / www. ngs. noaa. gov/ FGCS/ info/ sans_SA/ world/ )
Global Positioning System 162<br />
[11] (http:/ / www. spaceflightnow. com/ delta/ d349/ ) Datum. 28 Mai 2010, Zugriff: 28. Mai 2010<br />
[12] <strong>Jan</strong>es Defense Weekly, 21. Mai 2008, p.10<br />
[13] http:/ / www. lockheed-martin. com/ products/ GPS/ index. html<br />
[14] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar-3a. htm<br />
[15] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar-2r. htm<br />
[16] (http:/ / www. spaceflightnow. com/ delta/ d343/ )<br />
[17] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sdat/ navstar-2rm. htm<br />
[18] http:/ / www. spaceflightnow. com/ delta/ d349/<br />
[19] GPS III (GlobalSecurity) (http:/ / www. globalsecurity. org/ space/ systems/ gps_3. htm)<br />
[20] J.-F. Pascual-Sánches: Introducing relativity in global navigation satellite systems. In: Annalen der Physik. 16, Nr. 4, Wiley-VCH, Leipzig<br />
2007, ISSN 0003-3804 (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0003-3804), S. 258–273, doi:<br />
10.1002/andp.200610229 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1002/ andp. 200610229).<br />
[21] http:/ / www. 100km-duathlon. de/ index. php/ 100km-duathlon-2010/ ergebnisse/ 208-racemap-2010. html<br />
[22] commons:Commons:Georeferenzierung Auch auf Wikimedia Commons gibt es georeferenzierte Fotos<br />
[23] http:/ / zogg-jm. ch/ Dateien/ Update_Zogg_Deutsche_Version_<strong>Jan</strong>_09_Version_Z4x. pdf''GPS<br />
[24] http:/ / www. kowoma. de/ gps/ gpsstatus/<br />
[25] http:/ / www. navcen. uscg. gov/ gps/ geninfo/ 2001SPSPerformanceStandardFINAL. pdf<br />
[26] http:/ / www. navcen. uscg. gov/ gps/ geninfo/ 2008SPSPerformanceStandardFINAL. pdf<br />
[27] http:/ / www. navcen. uscg. gov/ gps/ default. htm<br />
[28] http:/ / www. colorado. edu/ geography/ gcraft/ notes/ gps/ gps_f. html<br />
[29] http:/ / www. aero. org/ publications/ crosslink/ summer2002/ profile. html<br />
[30] http:/ / www. alpentunnel. de/ 30_Vermessung/ 40_GPS/ frame_vermessung_gps. htm<br />
[31] http:/ / space. skyrocket. de/ doc_sat/ gps. htm<br />
Open Source<br />
Open Source [oʊpən ˈsɔːɹs] (engl., US), [əʊpən ˈsɔːs] (brit.) und<br />
quelloffen ist eine Palette von Lizenzen für Software, deren Quelltext<br />
öffentlich zugänglich ist und durch die Lizenz Weiterentwicklungen<br />
fördert.<br />
Open-Source-Software steht unter einer von der Open Source Initiative<br />
(OSI) anerkannten Lizenz. Diese Organisation stützt sich bei ihrer<br />
Bewertung auf die Kriterien der Open Source Definition, die weit über<br />
die Verfügbarkeit des Quelltexts hinausgeht. Sie ist fast<br />
deckungsgleich mit der Definition Freier Software.<br />
Geschichte<br />
Logo der Open Source Initiative<br />
Beeinflusst durch das 1997 publizierte Essay Die Kathedrale und der Basar von Eric Steven Raymond, entschied<br />
Netscape im Jahre 1998 angesichts der wachsenden Dominanz von Microsoft am Browser-Markt, den Quelltext des<br />
wirtschaftlich nicht mehr verwertbaren Netscape Navigators freizugeben (aus dieser Freigabe entstand später das<br />
Mozilla-Projekt).<br />
Kurz darauf befanden Raymond, Bruce Perens, ein Informatiker, und Tim O’Reilly, Gründer und Vorstand des<br />
O’Reilly-Verlags, dass die Freie-Software-Gemeinde ein besseres Marketing benötige. Um die Freie Software als<br />
geschäftsfreundlich und weniger ideologisch belastet darstellen zu können, wurde dabei beschlossen, einen neuen<br />
Marketing-Begriff für Freie Software einzuführen – der Begriff Open Source wurde von da an flächendeckend im<br />
Marketing genutzt und war auch der Namensgeber für die von Raymond, Perens und Reilly gegründete Open Source<br />
Initiative (OSI). Es wurden für die Wirtschaft angepasste Open-Source-Lizenzen geschaffen, welche weiterhin den<br />
Bedürfnissen des Open-Source-Umfelds genügten, aber auch für die Wirtschaft interessant sein sollten. Eine der<br />
bekanntesten Lizenzen, die aus diesen Bestrebungen hervorging, ist die Mozilla Public License.
Open Source 163<br />
Definition der Open Source Initiative<br />
Hauptartikel: Open Source Definition<br />
Die Open Source Initiative wendet den Begriff Open Source auf all die Software an, deren Lizenzverträge den<br />
folgenden drei charakteristischen Merkmalen entsprechen und die zehn Punkte der Open Source Definition erfüllen:<br />
• Die Software (d. h. der Quelltext) liegt in einer für den Menschen lesbaren und verständlichen Form vor: In der<br />
Regel handelt es sich bei dieser Form um die Quelltexte in einer höheren Programmiersprache. Vor dem<br />
eigentlichen Programm(ab)lauf ist es normalerweise notwendig, diesen Text durch einen so genannten Compiler<br />
in eine binäre Form zu bringen, damit das Computerprogramm vom Rechner ausgeführt werden kann.<br />
Binärprogramme sind für den Menschen im semantischen Sinne praktisch nicht lesbar.<br />
• Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden: Für Open-Source-Software gibt es keine<br />
Nutzungsbeschränkungen. Weder bezüglich der Anzahl der Benutzer, noch bezüglich der Anzahl der<br />
Installationen. Mit der Vervielfältigung und der Verbreitung von Open-Source-Software sind auch keine<br />
Zahlungsverpflichtungen gegen einen Lizenzgeber verbunden.<br />
• Die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden: Durch den offengelegten<br />
Quelltext ist Verändern ohne weiteren Aufwand für jeden möglich. Weitergabe der Software soll ohne<br />
Lizenzgebühren möglich sein. Open-Source-Software ist auf die aktive Beteiligung der Anwender an der<br />
Entwicklung geradezu angewiesen. So bietet sich Open-Source-Software zum Lernen, Mitmachen und<br />
Verbessern an.<br />
Begriffsproblem Freie Software<br />
In der eigentlichen Bedeutung unterscheidet sich die Open-Source-Definition nicht von freier Software. Der Begriff<br />
Open-Source-Software scheint aber mit der Betonung der Überlegenheit des Entwicklungsprozesses (siehe The<br />
Cathedral and the Bazaar von Eric Steven Raymond) eher die Entwicklersicht wiederzugeben, während der Begriff<br />
Freie Software den Nutzen für den Anwender und die Gesellschaft heraushebt. Beide Begriffe können<br />
unterschiedliche Assoziationen auslösen, die ursprünglich nicht geplant waren.<br />
Die Entscheidung, den Terminus Open Source zu etablieren, vorgeschlagen von Christine Peterson vom Foresight<br />
Institute, begründete sich zum Teil auf der möglichen Missinterpretation des Wortes frei. Die Free Software<br />
Foundation (FSF) verstand das Wort im Sinne von Freiheit (“free speech, not free beer” – „freie Meinungsäußerung,<br />
nicht Freibier“), jedoch wurde es oft fälschlicherweise mit kostenlos assoziiert, da der englische Begriff free beide<br />
Bedeutungen haben kann. Tatsächlich ist freie Software in den meisten Fällen wirklich auch kostenlos erhältlich.<br />
Man hoffte, dass die Verwendung der Bezeichnung Open Source diese Mehrdeutigkeit beseitigt und auch eine<br />
einfachere Vermarktung von Open Source vor Vertretern der Wirtschaft ermöglicht. Außerdem weckt der Begriff<br />
Open Source nicht zwangsläufig eine Assoziation mit der GNU General Public License, die aus wirtschaftlicher<br />
Sicht problematisch sein kann.<br />
Seit der Einführung der neuen Bezeichnung wurde jedoch oft kritisiert, dass diese Bezeichnung für einen mit Open<br />
Source Software nicht vertrautem Menschen ebenfalls Verwirrung stiften kann: Der Begriff Open Source assoziiert<br />
die Verfügbarkeit des Quelltextes, sagt aber nichts über die Freiheit, ihn zu verwenden, zu verändern und<br />
weiterzugeben, aus. Kritisiert wird daher von der FSF vor allem die Tatsache, dass der Begriff Open Source die<br />
Einsicht in den Quellcode einer Software hervorhebt, nicht aber die Freiheit, diesen Quellcode auch beliebig<br />
weiterzugeben oder zu verändern. So nennt die PGP Corporation die aktuelle Version ihres<br />
Kryptographieprogramms PGP z. B. Open Source, da der Quellcode betrachtet werden kann. Weitergabe und<br />
Veränderung dieses Quellcodes sind aber verboten, so dass das Programm nicht unter die Open-Source-Definition<br />
fällt. Aus diesem Grund ist die freie Implementierung GNU Privacy Guard entstanden, die mit der GPL den<br />
Open-Source-Anforderungen gerecht wird.
Open Source 164<br />
Die Free Software Foundation, insbesondere Richard Stallman, kritisiert an der Open-Source-Bewegung, dass sie<br />
sozialethische Aspekte außen vor lässt und sich lediglich auf technische und wirtschaftliche Fragestellungen<br />
konzentriert. So werde die Grundidee von Freier Software nach Stallmans Meinung vernachlässigt. [1]<br />
Der Begriff Freie Software ist allerdings ebenfalls problematisch, da er häufig ausschließlich in Verbindung mit den<br />
Lizenzen der FSF (GNU-GPL, GNU LGPL und GNU-Lizenz für freie Dokumentation) gebracht wird. Diese<br />
Lizenzen sind zwar auch nach Auffassung der OSI frei, sie fordern allerdings, dass abgeleitete Werke die gleichen<br />
Freiheiten gewähren. Die GNU-Lizenz für freie Dokumentation ist hierbei besonders problematisch, unter anderem<br />
deswegen, weil sie die Möglichkeit bietet, die Modifikation ganz bestimmter Abschnitte zu verbieten. Die<br />
GNU-FDL erfüllt somit eine grundlegende Anforderung der Open-Source-Definition und der Definition freier<br />
Software sowie der Debian Free Software Guidelines nicht.<br />
Die Begriffe Freie Software und Open-Source-Software werden zwar synonym verwendet, allerdings bestehen<br />
Unterschiede in der Interpretation. Die meisten Menschen und Organisationen, die von freier Software sprechen,<br />
sehen Lizenzen als unfrei an, wenn sie Einschränkungen enthalten wie eine Begrenzung des Verkaufspreises, die<br />
Pflicht zur Veröffentlichung eigener Modifikationen oder die Bestimmung, dass jede Modifikation der Software an<br />
den ursprünglichen Autor gesandt werden muss. Die Open-Source-Initiative dagegen akzeptiert solche Lizenzen als<br />
Open Source. Dies ist unter anderem deshalb problematisch, weil Software unter diesen Lizenzen nicht oder nur<br />
unter starken Einschränkungen in andere freie Software-Projekte integriert werden kann, was dem Autor bei der<br />
Auswahl der Lizenz womöglich gar nicht bewusst war. Oft wird deshalb auch dazu geraten, keine eigene Lizenz zu<br />
verwenden, deren rechtliche und praktische Probleme man unter Umständen nicht überschaut, sondern auf eine<br />
erprobte und anerkannte freie Lizenz wie die GPL, die LGPL oder die BSD-Lizenz zurückzugreifen.<br />
Um den Namenskonflikt zwischen Freie Software und Open-Source-Software zu umgehen, werden in jüngerer Zeit<br />
auch häufig die Begriffe FOSS und FLOSS (Free(/Libre) and Open Source Software) verwendet.<br />
Andere Definitionen<br />
Der Begriff Open Source beschränkt sich nicht ausschließlich auf Software, sondern wird auch auf Wissen und<br />
Information allgemein ausgedehnt. Beispiele dafür sind OpenCola und Wikipedia. In diesem Zusammenhang wird<br />
von Open Content oder freien Inhalten gesprochen.<br />
Übertragen wurde die Idee des öffentlichen und freien Zugangs zu Information auch auf Entwicklungsprojekte. In<br />
diesem Zusammenhang wird oft von Open Hardware oder freier Hardware gesprochen, wobei es sich nicht um freien<br />
Zugang zur Hardware handelt, sondern um freien Zugang zu allen Informationen, eine entsprechende Hardware<br />
herzustellen.<br />
Motivation<br />
Die Verwendung und Entwicklung von Open-Source-Software wird sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen<br />
betrieben. Der Einsatz und Entwicklungsprozess kann dabei durchaus mit Kosten verbunden sein. Es bietet sich aber<br />
eine Reihe von Vorteilen:<br />
• An der Entwicklung eines Open-Source-Programms kann sich eine beinahe beliebig große Anzahl von Personen<br />
(und Firmen) beteiligen. Der Aufwand für die Entwicklung wird geteilt und jeder kann von der Arbeit der<br />
Anderen profitieren. Für eine Firma kann es sich finanziell lohnen, sich an einem Open-Source-Projekt zu<br />
beteiligen anstatt eine Eigenentwicklung zu starten oder fertige Software einzukaufen.<br />
• Der Nutzer einer Open-Source-Software ist niemals von einer bestimmten Herstellerfirma abhängig. Wünscht<br />
sich der Nutzer eine Erweiterung oder die Behebung eines Programmfehlers, so steht es ihm frei, diese Änderung<br />
vorzunehmen oder jemanden damit zu beauftragen. Bei proprietärer Software ist dies nicht möglich, und eine<br />
Änderung kann einzig beim Hersteller beantragt werden.
Open Source 165<br />
• Die Nutzung von Open-Source-Software ist an keine oder nur wenige Bedingungen geknüpft. Die Software darf<br />
von einer beliebigen Anzahl Benutzern für einen beliebigen Zweck eingesetzt werden. Bei der Vervielfältigung<br />
fallen keine Lizenzkosten an.<br />
• Open-Source-Software ermöglicht Einblick in den Sourcecode und üblicherweise auch die Versionsverwaltung.<br />
Damit ist es jedermann - beispielsweise unter Verwendung von dafür bestimmten Seiten wie Ohloh - möglich die<br />
Softwarequalität mittels Statischer Code-Analyse sowie die Anzahl der Entwickler und deren Veränderungen zu<br />
analysieren und daraus auf die Wartbarkeit und Maturität der Software zu schließen.<br />
Wirtschaftliche Bedeutung<br />
In den Bereichen Serverbetriebssysteme, Web- und Mailserver, Datenbanken und Middleware spielt<br />
Open-Source-Software eine wichtige Rolle.<br />
Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission hat im Jahr 2006 die wirtschaftliche Bedeutung von Open<br />
Source für Europa untersucht. Demnach ist der Marktanteil in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Den<br />
Gesamtwert beziffert die Untersuchung auf rund zwölf Milliarden Euro. Die Wertschöpfung wird in den<br />
Wirtschaftsstatistiken der EU-Staaten allerdings nur unzureichend erfasst, da die Software-Entwicklung nicht<br />
proprietär ist. Auf Unternehmensseite sind Sun, IBM und RedHat die größten Programmlieferanten.<br />
Für das Jahr 2010 prognostiziert die Studie bei den IT-Dienstleistungen einen Open-Source-Anteil von 32 Prozent<br />
und befürwortet eine stärkere Förderung von freier Software, damit Europa das wirtschaftliche Potenzial von Open<br />
Source besser nutzen kann. So findet das Thema zunehmend in der Wirtschaftsförderung Beachtung. Ein Beispiel ist<br />
die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, die eine Initiative für einen Open-Source-Cluster gestartet hat. [2]<br />
Seit einigen Jahren hat sich in den Wirtschaftswissenschaften eine lebhafte Debatte um Open-Source-Software<br />
entwickelt. Siehe dazu die Abschnitte „Volkswirtschaftliche Aspekte“ und „Betriebswirtschaftliche Aspekte“ in der<br />
Literatur über Freie und Open-Source-Software.<br />
Probleme<br />
Eric Raymond beschreibt in seinem Buch Die Kathedrale und der Basar eine Entwicklungsmethode (den Basar),<br />
durch die Open-Source-Projekte selbstständig von der Gemeinschaft verwaltet werden können. Ob diese<br />
Entwicklungsmethode tatsächlich Anwendung findet oder überhaupt praktisch umgesetzt werden kann, ist aber<br />
umstritten. [3]<br />
Es werden vereinzelt Firmen kritisiert, die Weiterentwicklungen von bestehender Open-Source-Software so weit an<br />
eigene Systeme anpassen, dass sie praktisch nicht mehr anders verwendet werden können. Die Weiterentwicklung<br />
steht dann zwar immer noch unter einer Open-Source-Lizenz, kann von der Gemeinschaft aber nicht mehr genutzt<br />
werden.<br />
Der Informatiker Niklaus Wirth äußert sich kritisch zur technischen Qualität komplexer Open-Source-Projekte: Die<br />
Open Source Bewegung ignoriere und behindere die Vorstellung, komplexe Softwaresysteme basierend auf streng<br />
hierarchischen Modulen aufzubauen. Entwickler sollten den Sourcecode der von ihnen verwendeten Module nicht<br />
kennen. Sie sollten rein auf die Spezifikationen der Schnittstellen der Module vertrauen. Wenn, wie bei<br />
Open-Source, der Sourcecode der Module vorhanden ist, führe das automatisch zu einer schlechteren Spezifikation<br />
der Schnittstellen, da ja das Verhalten der Module im Sourcecode nachlesbar ist. [4]
Open Source 166<br />
Siehe auch<br />
• Linux-Klausel<br />
• Proprietäre Software<br />
• Wissensgesellschaft bzw. Informationsgesellschaft<br />
• Open-Source-Film<br />
• Open-Source-Marketing<br />
Literatur<br />
• T3N Magazin, Open Source, Webentwicklung, CMS und TYPO3, Hannover, yeebase media solutions, 2006<br />
ISSN 1861-339X [5]<br />
• Linux-Magazin: zweitälteste Zeitschrift für Linux- und die Open-Source-Welt, München, Linux New <strong>Media</strong> AG,<br />
2006 ISSN 1432-640X [6]<br />
• Siehe auch Literatur über Freie und Open-Source-Software.<br />
• BARC Studie Open Source Business Intelligence; Quelloffene Werkzeuge für Reporting, OLAP und Data Mining<br />
im Vergleich, Oxygon-Verl. München 2009 ISBN 978-3-937818-41-2<br />
Weblinks<br />
• Warum „Freie Software“ besser ist als „Open Source“ [7] – Statement des GNU-Projekts<br />
• Wir sprechen von Freier Software [8] – ein Statement der Free Software Foundation Europe<br />
• Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung zu Open Source [9]<br />
• Fragen & Antworten zu Open Source Software in den Punkten Sicherheit und Recht [10] aus der Sicht vom<br />
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik<br />
• Open Source in der Schweiz und Bildungspolitik [11]<br />
• Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information<br />
and Communication Technologies (ICT) sector in the EU [12] – Englischsprachige Studie zur wirtschaftlichen<br />
Bedeutung, PDF 1,7 MB<br />
• Linkkatalog [13] zum Thema Open Source im ODP (Open Directory Project)<br />
• FAZIT-Forschungsbericht "Open Source Software und IT-Sicherheit" [14]<br />
Referenzen<br />
[1] Richard Stallman: Warum Open Source am Kern der Sache vorbei geht (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ open-source-misses-the-point.<br />
de. html) Stand: Juni 2008<br />
[2] Initiative für einen Open-Source-Cluster (http:/ / opensource. region-stuttgart. de)<br />
[3] Chuck Connell: Open Source Projects Manage Themselves? Dream on. (http:/ / www. chc-3. com/ pub/ manage_themselves. htm) (englisch)<br />
Stand: Juni 2008<br />
[4] Richard Morris: Niklaus Wirth: Geek of the Week (http:/ / www. simple-talk. com/ opinion/ geek-of-the-week/<br />
niklaus-wirth-geek-of-the-week). simple-talk.com, 2. Juli 2009, abgerufen am 16. Dezember 2009 (Englisch): „Besides all the good things, the<br />
open source movement ignores and actually hinders the perception of one of the most important ideas in designing complex systems, namely<br />
their partitioning in modules, and their formation as an orderly hierarchy of modules.“<br />
[5] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1861-339X<br />
[6] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1432-640X<br />
[7] http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ free-software-for-freedom. de. html<br />
[8] http:/ / www. germany. fsfeurope. org/ documents/ whyfs. de. html<br />
[9] http:/ / www. bpb. de/ opensource<br />
[10] https:/ / www. bsi-fuer-buerger. de/ cln_174/ BSIFB/ DE/ Themen/ OpenSourceSoftware/ FragenUndAntworten/ fragenundantworten_node.<br />
html<br />
[11] http:/ / www. userlearn. ch/ opensource<br />
[12] http:/ / ec. europa. eu/ enterprise/ ict/ policy/ doc/ 2006-11-20-flossimpact. pdf<br />
[13] http:/ / www. dmoz. org/ Computers/ Open_Source/
Open Source 167<br />
[14] http:/ / www. fazit-forschung. de/ fazit-opensource. html<br />
Suchmaschinenoptimierung<br />
Suchmaschinenoptimierung oder Search Engine Optimization (SEO) sind Maßnahmen, die dazu dienen, dass<br />
Webseiten im Suchmaschinenranking auf höheren Plätzen erscheinen. Suchmaschinenoptimierung ist ein Teilgebiet<br />
des Suchmaschinenmarketing.<br />
Arbeitsweise<br />
Bei der Suchmaschinenoptimierung werden die Techniken der Webcrawler und Sortieralgorithmen von<br />
Suchmaschinen untersucht. Diese werden von den Betreibern der Suchmaschinen meist nur zum Teil offen gelegt<br />
und häufig geändert, um Missbrauch zu erschweren und dem Benutzer relevante Ergebnisse zu liefern. Die nicht<br />
bekannten und geheim gehaltenen Techniken werden durch Reverse Engineering der Suchergebnisse untersucht.<br />
Dabei wird analysiert, wie Suchmaschinen Webseiten und deren Inhalte indizieren und nach welchen Kriterien diese<br />
von der Suchmaschine bewertet, zusammengestellt und sortiert werden.<br />
Das Aufsuchen und Einlesen der Inhalte von Webseiten folgt dagegen bekannten HTML-Standards des Web, deren<br />
Einhaltung bei der Erstellung von Webseiten den ersten und wesentlichen Schritt einer Optimierung darstellt.<br />
Ein weiterer Schritt ist die Auswahl der geeigneten Suchbegriffe. Hierzu kann man sich frei verfügbarer<br />
Datenbanken, wie einer Keyword-Datenbank oder des MetaGer Web-Assoziators, bedienen.<br />
Dabei werden Inhalte im Head- sowie im Bodybereich ausgewertet. Der eigentlich für Suchmaschinen konzipierte<br />
Meta-Tag Keyword wird inzwischen nicht mehr berücksichtigt.<br />
Wichtig ist die richtige Suchwortdichte in der betreffenden Internetpräsenz. Besonders bedeutsam sind außerdem die<br />
Wörter, die im Seitentitel (Title-Tag), in ausgewiesenen Überschriften (H1-, H2-Tags usw.), in Textlinks (auch<br />
solchen, die auf die betreffende Seite verweisen) sowie innerhalb der URL vorkommen.<br />
Traditionelle Suchmaschinenoptimierung<br />
Bei der traditionellen Suchmaschinenoptimierung wird üblicherweise eine Seite für ein oder zwei Suchwörter<br />
optimiert. Oft wird auch eine umfangreiche Seite in mehrere Einzelseiten aufgeteilt, um diese für verschiedene<br />
Suchbegriffe zu optimieren. Dabei werden die Suchwörter mit den entsprechenden Inhalten kombiniert. Dieser<br />
(klassische) Bereich zählt zur so genannten „OnPage-Optimierung“; dies bezeichnet alle Methoden und<br />
Möglichkeiten, die am Inhalt und der Struktur einer Website durchgeführt werden können. Eine Art der Optimierung<br />
erfolgt durch sog. Landing Pages.<br />
Mittlerweile genügt es nicht mehr alleine, die Relevanz von Webseiten zu erhöhen. Ein gutes Listing und eine gute<br />
Sichtbarkeit in Suchmaschinen sowie die Quantität und Qualität der eingehenden Links auf eine Website (Backlinks)<br />
sollten mit in Betracht gezogen werden. Dieser Bereich der Suchmaschinenoptimierung wird als<br />
„OffPage-Optimierung“ bezeichnet und insbesondere bei der redaktionellen Suchmaschinenoptimierung verwendet.<br />
Um Websites auf ihr Potenzial hin zu untersuchen, können kostenlose Online-Tools genutzt werden. Oftmals<br />
genügen kleine Veränderungen, um die Platzierung in Suchmaschinen stark zu erhöhen.
Suchmaschinenoptimierung 168<br />
Akademische Suchmaschinenoptimierung<br />
Suchmaschinenoptimierung wird nicht nur im Bereich von Webseiten angewendet, sondern auch für akademische<br />
PDF-Dateien, um diese für akademische Suchmaschinen wie Google Scholar und CiteSeer zu optimieren [1] . Das<br />
Grundprinzip der akademischen Suchmaschinenoptimierung (Academic Search Engine Optimization, ASEO) ist<br />
dasselbe wie bei der traditionellen Web-Suchmaschinenoptimierung. Das PDF sollte eine möglichst hohe<br />
Suchwortdichte aufweisen und anstatt von (Hyper)links zählen Zitationen. Der Bereich der akademischen<br />
Suchmaschinenoptimierung ist noch jung und wird derzeit sehr unterschiedlich bewertet von der akademischen<br />
Gemeinschaft [2] [3] [4] [5] [6] [7] . Manche halten es für unmoralisch, wissenschaftliche Artikel auf akademische<br />
Suchmaschinen zuzuschneiden, andere halten es für nötig, damit Suchmaschinen die Inhalte der PDFs besser und<br />
"fairer" indizieren und gewichten können.<br />
Ethische Regeln<br />
Methoden, die nicht relevante Webseiten auf vordere Plätze der Ergebnisseiten von Suchmaschinen bringen, werden<br />
als Suchmaschinen-Spamming bezeichnet; sie verstoßen gegen Regeln, die Suchmaschinen zum Schutz vor<br />
Manipulationen ihrer Suchergebnisse aufstellen. So ist es möglich, automatisierte Umleitungen einzurichten, die<br />
speziell für Suchmaschinen erstellte Textseiten enthalten. Diese Methode, mit so genannten Brückenseiten zu<br />
arbeiten, widerspricht jedoch den Richtlinien der meisten Suchmaschinen. Fälle, die von den<br />
Suchmaschinenbetreibern aufgedeckt werden, haben oftmals den Bann der betreffenden Seite zur Folge, d.h. die<br />
betreffenden Zielseiten werden aus dem Suchindex ausgeschlossen.<br />
So musste BMW Anfang 2006 kurzfristig hinnehmen, dass das Internetangebot des Automobilkonzernes komplett<br />
aus Google entfernt wurde, weil eine Reihe von automatisch weiterleitenden Brückenseiten erstellt wurden. [8]<br />
Nachdem BMW die beanstandeten Seiten entfernt hatte, wurde bmw.de wieder in den Google-Index<br />
aufgenommen. [9]<br />
Ethische Suchmaschinenoptimierung (engl. white hat search engine optimization) vermeidet Spamming. Sie<br />
verzichtet auf unerwünschte Praktiken wie den Einsatz von Brückenseiten oder einer Linkfarm und befolgt die<br />
Direktiven der einzelnen Suchmaschinen. Dadurch wird das Risiko eines Ausschlusses oder der Herabstufung in den<br />
Suchergebnisseiten vermieden.<br />
Technische Grenzen<br />
Rein grafisch orientierte, mit Filmen, Bildern und grafisch eingebetteten Texten gestaltete Seiten, wie es z.B. die<br />
Programmierung in Flash ermöglicht, bieten den Suchmaschinen kaum auswertbaren Textcode. Die Programmierung<br />
einer Webseite ausschließlich in Flash empfiehlt sich daher aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung nicht. Von den<br />
Suchmaschinenbetreibern wird jedoch daran gearbeitet, reine Flash-Seiten zu durchsuchen und in den Index<br />
aufzunehmen. [10]<br />
Siehe auch<br />
• Hommingberger Gepardenforelle, ein Suchbegriff, mit dem das Computermagazin c't im April 2005 einen<br />
Suchmaschinenoptimierungs-Wettstreit ausrief<br />
• Natural Listings<br />
• Online-Journalismus<br />
• PageRank<br />
• Schattendomain<br />
• Suchmaschinenmarketing<br />
• Textlinktausch<br />
• Linkaufbau
Suchmaschinenoptimierung 169<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Optimization<br />
Literatur<br />
• Yvonne von Bischopinck, Michael Ceyp: Suchmaschinen-Marketing. Springer, 2009, ISBN 978-3-540-76513-4<br />
• Steven Broschart: Suchmaschinenoptimierung & Usability, Franzis Verlag, 2009, ISBN 3772374492<br />
• Tara Calishain, Rael Dornfest: Google Hacks: 100 Insider-Tricks & Tools, O'Reilly, 2003 ISBN 3-89721-362-1<br />
• Sebastian Erlhofer: Suchmaschinen-Optimierung für Webentwickler, 4. Auflage, Galileo-Press, 2008 ISBN<br />
3-8362-1233-1<br />
• Mario Fischer: Website Boosting 2.0, mitp, 2008, ISBN 3-8266-1703-7<br />
• Thomas Kaiser: Top Platzierungen bei Google & Co, Business-Village, 2009 ISBN 3-9383-5849-1<br />
• Lukas Stuber: Suchmaschinen-Marketing: Direct Marketing im Internet, Orell Füssli, 2004, ISBN 3-280-05102-9<br />
• Tom Alby, Stefan Karzauninkat: Suchmaschinenoptimierung. Professionelles Website-Marketing für besseres<br />
Ranking, Hanser Fachbuchverlag, 2007, ISBN 978-3-446-41027-5<br />
Weblinks<br />
• Google-Richtlinien [11]<br />
• Yahoo-Richtlinien [12]<br />
• Bing-Richtlinien [13]<br />
• Handelsblatt: Wie Unternehmen bei Google glänzen [14] - recht ausführlicher Artikel zum Thema SEO<br />
Referenzen<br />
[1] Beel, Jöran and Gipp, Bela and Wilde, Erik (2010). Academic Search Engine Optimization (ASEO): Optimizing Scholarly Literature for<br />
Google Scholar and Co. (http:/ / www. sciplore. org/ publications/ 2010-ASEO--preprint. pdf) S. 176–190. Journal of Scholarly Publishing.<br />
Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[2] Meskó,Bertalan (2010). Academic Search Engine Optimization in Google Scholar (http:/ / scienceroll. com/ 2010/ 01/ 28/<br />
academic-search-engine-optimization-in-google-scholar/ ). ScienceRoll. Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[3] David (2010). Academic Search Engine Optimization: An inevitable evil? (http:/ / blog. webometrics. org. uk/ 2010/ 03/<br />
academic-search-engine-optimization. html/ ). Webometric Thoughts. Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[4] van Heerde, Bert (2010). Websites en Artikelen Optimaliseren voor Google Scholar (http:/ / www. insyde. nl/ weblog/<br />
aseo-academic-search-engine-optimization/ item435/ ). Insyde Blog. Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[5] Koch, Daniel (2010). Akademische Suchmaschinenoptimierung: Was Wissenschaftler von Webmastern lernen können (http:/ / blog. scholarz.<br />
net/ 2010/ 01/ 28/ akademische-suchmaschinenoptimierung-was-wissenschaftler-von-webmastern-lernen-konnen/ ). Scholarz Blog. Abgerufen<br />
am 18. April 2010.<br />
[6] Groß, Marie (2010). academic search engine optimization (http:/ / vokabelaustausch. wordpress. com/ 2010/ 02/ 15/<br />
academic-search-engine-optimization/ ). Vokabetausch Blog. Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[7] Reinboth, Christian (2010). Wie sinnvoll ist die Optimierung wissenschaftlicher Artikel für Google Scholar & Co.? (http:/ / www.<br />
scienceblogs. de/ frischer-wind/ 2010/ 03/ wie-sinnvoll-ist-die-optimierung-wissenschaftlicher-artikel-fur-google-scholar-co. php). Frischer<br />
Wind Blog (ScienceBlogs). Abgerufen am 18. April 2010.<br />
[8] heise online: BMW sieht Google-Vorwürfe gelassen (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 69264)<br />
[9] stern: BMW ist wieder drin (http:/ / www. stern. de/ computer-technik/ internet/ :Google-BMW/ 555255. html)<br />
[10] Adobe verbessert Suche in Rich <strong>Media</strong>-Inhalten (http:/ / www. adobe. com/ de/ aboutadobe/ pressroom/ pr/ jul2008/ 044. pdf)<br />
[11] http:/ / www. google. com/ intl/ de/ webmasters/ guidelines. html<br />
[12] http:/ / help. yahoo. com/ l/ de/ yahoo/ search/ allgemein/ basics-18. html<br />
[13] http:/ / help. live. com/ help. aspx?project=wl_webmasters& market=de-DE<br />
[14] http:/ / www. handelsblatt. com/ technologie/ it-internet/ wie-unternehmen-bei-google-glaenzen;1341018
Breitband-Internetzugang 170<br />
Breitband-Internetzugang<br />
Ein Breitband-Internetzugang (auch Breitbandzugang, Breitbandanschluss) ist ein Zugang zum Internet mit<br />
verhältnismäßig hoher Datenübertragungsrate (Bandbreite) von einem Vielfachen der Geschwindigkeit älterer<br />
Zugangstechniken wie der Telefonmodem- oder ISDN-Einwahl, die im Unterschied als Schmalbandtechniken<br />
bezeichnet werden. Ursprünglich wurde mit Breitband eine Realisierungsform von Datennetzwerken bezeichnet, die<br />
heute aber veraltet ist, und der Begriff daher heute sinnentfremdet verwendet wird. In vielen Gebieten findet seit den<br />
frühen 2000er Jahren ein starkes Wachstum des Marktes für Breitbandzugänge statt.<br />
In Japan bietet der staatliche Telefonbetreiber Nippon Telegraph and Telephone (NTT) eine schnelle<br />
Internetanbindung für Privatkunden an. Das dabei verwendete FTTH-System ermöglicht eine Datenübertragungsrate<br />
von 100 Mbit/s. Zur Zeit werden Tests mit Glasfasern durchgeführt, mit denen sogar 1 Gbit/s möglich sein werden.<br />
Das ist ungefähr ein Zehntel der Datenübertragungsrate der derzeitigen interkontinentalen Backboneverbindungen.<br />
Tatsächliche Verbindungen mit dieser Geschwindigkeit werden wirtschaftlich in naher Zukunft nicht realisierbar<br />
[1] [2] [3]<br />
sein. Neueste Breitbandzugänge in Deutschland ermöglichen Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s und mehr.<br />
Definitionen<br />
Eine eindeutige Definition, ab wann eine breitbandige Verbindung beginnt, existiert nicht – der Begriff wird<br />
(besonders im Marketing der Telekommunikationsindustrie) verwendet.<br />
• Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) definiert einen Dienst oder ein System als breitbandig, wenn die<br />
Datenübertragungsrate über 2048 kbit/s (entspricht der Primärmultiplexrate im ISDN) hinausgeht.<br />
• Der Breitbandatlas und das Breitband-Portal des deutschen Wirtschaftsministeriums nennen in Abstimmung mit<br />
den ITK-Branchenverbänden eine Download-Übertragungsrate von mehr als 128 kbit/s sowie eine<br />
Upload-Übertragungsrate von mindestens 128 kbit/s als Mindestvoraussetzungen für einen Breitbandzugang;<br />
gleichzeitig soll die Always-On-Nutzung möglich sein. [4]<br />
• Im März 2008 wurde von deutschen Regierungspolitikern und in einer von der öffentlichen Hand beauftragten<br />
wissenschaftlichen Studie eine Downstream-Übertragungsrate von 1 Mbit/s als Mindeststandard eines<br />
[5] [6]<br />
ausreichenden Breitbandzugangs für Privathaushalte genannt.<br />
• Die österreichische Regulationsbehörde definiert einen Internet-Festnetzanschluss als Breitbandanschluss, wenn<br />
er über eine Downloadrate von mehr als 144 kbit/s verfügt. Ein mobiler Breitbandanschluss hingegen bemisst sich<br />
laut RTR am Datenvolumen von min. 250 MB pro Monat. [7]<br />
• Die USA nennen in ihrem Nationalen Breitbandplan von 2010 einen minimalen Downstream von 4 Mbps [8]<br />
• In Südkorea beginnt der Breitbandbereich ab einem Downstream von 1 Mbit/s. [9]<br />
Technologien<br />
Telefonnetz<br />
Eine der verbreitetsten Technologien arbeitet mit einer verbesserten Nutzung der Kupferleitungen des Telefonnetzes,<br />
da durch die bestehende Infrastruktur geringere Neuinvestitionen nötig sind. Dabei sind in erster Linie die<br />
hauptsächlich verwendeten DSL-Techniken zu nennen. Es gibt oder gab jedoch auch andere Ansätze, wie die<br />
Entwicklung schnellerer Telefonmodems oder eines schnelleren ISDN-Standards, dem Breitband-ISDN (B-ISDN).<br />
DSL-Technologien sind nur zur Überbrückung kurzer Distanzen geeignet, was – je nach<br />
Übertragungsgeschwindigkeit – nach wenigen hundert Metern oder erst wenigen Kilometern den Übergang zu einer<br />
anderen Übertragungstechnik oder DSL-Verstärker oder Repeater nötig macht. Daher handelt es sich in der Regel<br />
um eine Hybridtechnik in Kombination mit, wie in den meisten Fällen, Glasfasern oder beispielsweise auch<br />
Richtfunkstrecken. Mit wachsenden Übertragungsraten rückt der Übergabepunkt immer näher an den Endnutzer.
Breitband-Internetzugang 171<br />
Eine andere Möglichkeit für breitbandige Datenübertragungen über Telefonleitungen ist die Bündelung mehrerer<br />
analoger oder ISDN-Leitungen, was hauptsächlich in Ermangelung des DSL temporär genutzt wurde oder teils noch<br />
wird.<br />
Kabelfernsehnetz<br />
Die Daten werden mit Kabelmodems auf die analogen Signale des Kabelfernsehnetzes aufmoduliert und so über<br />
diese Koaxialkabel übertragen. Auch hier handelt es sich aus ähnlichen Gründen wie bei DSL in der Regel um eine<br />
Hybridtechnik. Momentan werden Geschwindigkeiten bis zu 120 MBit/s im Downstream und 5 MBit/s im Upstream<br />
angeboten. [10]<br />
Direkte Glasfaseranbindung<br />
Den Endkunden direkt per Glasfaser anzubinden ermöglicht hohe Bandbreiten über große Entfernungen. Die<br />
notwendige Verlegung neuer Anschlüsse zu jedem Kunden machen diese Form sehr kostspielig.<br />
Elektrizitätsnetz<br />
Mittels Trägerfrequenzanlagen (TFA) können Internetzugänge über das Stromnetz realisiert werden, auch unter dem<br />
englischsprachigen Begriff Powerline Communication (PLC) bekannt. Meist werden damit Datenverbindungen<br />
zwischen heimischen Steckdosen und Trafostationen oder ähnlichen Einrichtungen realisiert, die zentral über<br />
Glasfaser oder Richtfunk angebunden werden.<br />
ISDN-Primärmultiplexanschluss<br />
Die Primärmultiplexanschlüsse gibt es in verschiedener Ausführung, als T-carrier, wie T-1/DS-1, T2, T3, als<br />
E-carrier oder Optical Carrier. Diese Technologien sind vergleichsweise kostspielige Möglichkeiten für breitbandige<br />
Internetanbindung über Kupfer- oder auch Glasfaserkabel, die für Geschäftskunden und ähnliche Nutzen mit<br />
größeren Netzen eingerichtet sind.<br />
Terrestrische Funktechnologien<br />
sind eine Möglichkeit, breitbandigen Datenaustausch zu ermöglichen. Vielerorts – insbesondere wo die Versorgung<br />
mittels herkömmlicher Kabeltechnologien nicht vorhanden ist – bauen Wireless Internet Access Provider sogenannte<br />
Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN) auf, um so einen schnellen Internetzugang anbieten zu können.<br />
Dabei kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz, darunter der speziell entwickelte WiMAX-Standard,<br />
Wireless Local Area Network (WLAN)-Technologien, sowie verschiedene Einzellösungen, die unter Namen wie<br />
Funk-DSL oder Wireless DSL vertrieben werden. Mehr oder weniger breitbandige Datendienste können auch<br />
Mobilfunkstandards wie HSDPA, UMTS oder EDGE bieten.<br />
Unter besonderen Bedingungen kann auch Packet Radio aus dem Amateurfunkbereich dazugezählt werden. Damit<br />
können Übertragungsraten bis zu mehreren Megabit pro Sekunde realisiert werden und entsprechende<br />
Übergabepunkte können damit Zugang zum Internet ermöglichen. Die Nutzung ist jedoch Funkamateuren<br />
vorbehalten.<br />
Internetzugang über Satellit<br />
Reine Satellitenverbindungen (2-Wege-Satellitenverbindung) sind unabhängig von landschaftlichen Gegebenheiten<br />
oder anderer Infrastruktur praktisch überall auf der Erdoberfläche verfügbar und eignen sich damit besonders für<br />
entlegene Gebiete und Schiffe. Problematisch sind bei Satellitenzugängen die immer noch deutlich höheren Kosten,<br />
die hohen Latenzzeiten und, sofern der Rückkanal nicht über den Satellit realisiert ist, die Abhängigkeit von einer<br />
weiteren Zugangsmöglichkeit. Im Beispiel eines Systems mit geostationären Satelliten ergeben sich typische
Breitband-Internetzugang 172<br />
Verzögerungen von 500–700 ms, was Echtzeitanwendungen empfindlich stört.<br />
Hochfliegende Luftfahrzeuge<br />
Über hochfliegende stationäre Luftschiffe können Funksignale für Dienste wie Fernsehausstrahlung, Mobiltelefonie<br />
und auch Internetzugänge vermittelt werden. Ein Beispiel für eine Umsetzung dieser Technologie trägt den<br />
Markennamen Stratellite. Ein weiterer Ansatz wären hochfliegende unbemannte (Leicht)Flugzeuge wie Helios.<br />
Verbreitung<br />
Insbesondere in den Industriestaaten entwickelt sich der Breitbandzugang zur vorherrschenden Zugangsart zum<br />
Internet, der zugleich auch zunehmend von Internet-Anwendungen zur sinnvollen Nutzung vorausgesetzt wird. Ende<br />
2006 kamen in den 30 OECD-Staaten 17 Breitbandanschlüsse auf 100 Einwohner, wobei als Technologie für<br />
• 62 % der Anschlüsse DSL Verwendung fand;<br />
• 29 % davon waren Kabelanschlüsse,<br />
• 7 % direkte Glasfaserzugänge und<br />
• 2 % waren über andere Techniken realisiert. [11]<br />
In der EU verfügen im Frühjahr 2008 80 % der Haushalte mit Internetanschluss über einen Breitbandzugang. [12] In<br />
Südkorea hatten Mitte 2007 bereits 90 % der Haushalte einen Breitbandanschluss, [13] während in Deutschland 2006<br />
lediglich 37 % der Haushalte über einen Breitbandanschluss verfügten. [14] In Deutschland stellen DSL-Zugänge via<br />
Telefonnetz alle anderen Verfahren in den Schatten: Von 19,8 Millionen Breitbandanschlüssen im Jahr 2007 waren<br />
18,7 Millionen DSL-Anschlüsse. Der Rest verteilte sich auf TV-Kabel wie auch alle anderen Anschlussarten. [15]<br />
TV-Kabel spielen als Breitbandzugangsform eine bisher nur geringe Rolle in Deutschland, anders als in Österreich,<br />
wo DSL und TV-Kabel etwa gleich häufig drahtgebundene Übertragungsform sind, oder auch den USA.<br />
Verfügbarkeit<br />
Besteht keine ausreichende Versorgung mit Breitbandzugängen [6] , spricht man von einer Breitbandkluft, Sie gilt als<br />
Teil der digitalen Kluft oder digitalen Spaltung. Der Breitbandatlas [16] des Bundeswirtschaftsministeriums gibt einen<br />
Eindruck von der Versorgungslage in Deutschland. Einige Bundesländer reagieren auf diese Situation mit der<br />
Gründung von Breitbandkompetenzzentren [17] , um den betroffenen Kommunen einen neutralen Ansprechpartner<br />
zur Verfügung zu stellen. Von der Interessengemeinschaft kein-DSL.de kommt ein Breitbandbedarfsatlas, der die<br />
konkrete Nachfrage abbildet. In diesen können Interessenten ihren Breitbandbedarf und ihren Bandbreitenwunsch<br />
eintragen [18] .<br />
Verschiedene staatliche, bürgerschaftliche und partnerschaftliche (PPP) Initiativen engagieren sich gegen die<br />
Unterversorgung auf Länderebene [19] , deutschlandweit [20] [21] und europaweit [22] [23] . Allerdings halten nicht alle<br />
dieselben Instrumente für tauglich zur schnellen Überwindung der Breitbandkluft. Eine Zugangsoption im ländlichen<br />
[24] [25]<br />
Raum kann ein Breitbandzugang mittels Satellit sein, die mittlerweile ernstzunehmende Angebote darstellen<br />
[26]<br />
.<br />
Um die flächendeckende Versorgung mit Breitband-Internetzugängen sicherzustellen, gilt in der Schweiz ab 2008<br />
ein Breitbandzugang mit 600 kbit/s in Empfangs- und 100 kbit/s in Senderichtung als Bestandteil des<br />
Grundversorgungskataloges. Ein ähnliches Versorgungsziel verfolgt Australien mit der Australian Broadband<br />
Guarantee seit 2007. [27] . In der EU soll bis zum Herbst Jahr 2008 ein Grünbuch vorgelegt werden, ob die<br />
Breitbandversorgung in den Katalog der Universaldienste aufgenommen werden soll.
Breitband-Internetzugang 173<br />
Siehe auch<br />
• Bandbreite (Elektrotechnik) (technischer Begriff der Bandbreite)<br />
• Breitbandkommunikation<br />
• Breitbandverteilnetz, Breitbandvermittlungsnetz<br />
• Triple Play<br />
Literatur<br />
• Georg Erber: Flächendeckende Bereitstellung von Breitbandanschlüssen. In: DIW Wochenbericht 37/2007,<br />
549-554.<br />
• Remco van der Velden: Wettbewerb und Kooperation auf dem deutschen DSL-Markt - Ökonomik, Technik und<br />
Regulierung. Mohr Siebeck, Tübingen 2007. ISBN 3-16-149117-3 (ISBN 978-3-16-149117-7)<br />
Weblinks<br />
The Global Growth of Broadband [28] (Grafik mit Zeitleiste, 1999 bis 2009), BBC, abgerufen am 15. September 2009<br />
Referenzen<br />
[1] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0712/ 56677. html) Kabel Deutschland testet Internetanschluss mit 100 MBit/s<br />
[2] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0710/ 55162. html) Hamburg: 300 MBit/s für unter 100,- Euro im Monat<br />
[3] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0710/ 55387. html) M-Net: Internet mit 100 MBit/s in München<br />
[4] Zwischenbericht zum Breitband-Atlas 2007 des Bundeswirtschaftsministeriums (PDF) (http:/ / www. zukunft-breitband. de/ Breitband/<br />
Portal/ Redaktion/ Pdf/ zwischenbericht-breitbandatlas-2007-01,property=pdf,bereich=breitband__portal,sprache=de,rwb=true. pdf) Punkt 2.1<br />
Breitband-Definition<br />
[5] heise.de, 7. März 2008: [[Martina Krogmann (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Bundestag-will-Luecken-bei-der-Breitbandversorgung-schliessen--/ meldung/ 104717)]: vier Millionen Haushalte ohne Zugang zu<br />
1 MBit-Breitband]<br />
[6] heise.de, 27. März 2008: WIK-Studie: Breitband unter 1 MBit/s auch fuer Privathaushalte unzureichend (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Studie-warnt-vor-Oeffnung-einer-Breitband-Schere--/ meldung/ 105602/ )<br />
[7] RTR Telekom Monitor 4.Quartal 2007; Seite 32 (http:/ / www. rtr. at/ de/ komp/ TKMonitor_Q42007)<br />
[8] Connecting America: The National Broadband Plan<br />
[9] http:/ / www. bbwo. org. uk/ broadband-3335 Breitband-Definition der koreanischen Regierung laut Breitbandportal der walisischen<br />
Regierung<br />
[10] DSL-Ratgeber: (http:/ / www. dsl-ratgeber. info/ News/ Kabel_News/ Unitymedia:_bis_zu_32_MBit s_im_Downstream/ ) Unitymedia<br />
erhöht verfügbare Bandbreite<br />
[11] Verbreitung von Breitband-Internetzugängen in den OECD-Industriestaaten (http:/ / www. oecd. org/ sti/ ict/ broadband)<br />
[12] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0804/ 59130. html) EU: Mehr als die Hälfte der EU-Bürger nutzt das Internet<br />
[13] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0707/ 53358. html) Südkorea: Fast jeder hat Breitband-Internet: Penetrationsrate in und um Seoul liegt<br />
teilweise über 100 Prozent<br />
[14] BMWi: (http:/ / www. bmwi. de/ BMWi/ Redaktion/ PDF/ M-O/<br />
monitoring-informations-kommunikations-wirtschaft-2007,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true. pdf) BMWi Monitoring<br />
Informations- und Kommunikationswirtschaft 2007<br />
[15] Bundesnetzagentur: Breitbandanschlüsse (Grafik) (pdf, 12 kb) (http:/ / www. bundesnetzagentur. de/ media/ archive/ 12489. pdf)<br />
[16] http:/ / www. breitbandatlas. de Breitbandatlas des BMWi<br />
[17] Breitband Initiative Niedersachsen: (http:/ / www. breitband-niedersachsen. de) Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen<br />
[18] Schmalbandatlas.de: Der deutschlandweite Breitbandbedarfsatlas der Interessengemeinschaft kein-DSL.de (http:/ / www. schmalbandatlas.<br />
de/ )<br />
[19] Breitband-Informationsportal: (http:/ / www. breitband-bw. info) Initiative der Clearingstelle "Neue Medien" des Landes<br />
Baden-Württemberg<br />
[20] Interessengemeinschaft kein-DSL.de http:/ / www. kein-dsl. de<br />
[21] geteilt.de - Initiative gegen digitale Spaltung http:/ / www. geteilt. de<br />
[22] Europäisches Parlament: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Juni 2007 zu der Entwicklung einer europäischen<br />
Breitbandpolitik http:/ / www. europarl. europa. eu/ sides/ getDoc. do?pubRef=-/ / EP/ / TEXT+ TA+ P6-TA-2007-0261+ 0+ DOC+ XML+<br />
V0/ / DE& language=DE<br />
[23] EU: Bridging the Broadband Gap http:/ / ec. europa. eu/ information_society/ eeurope/ i2010/ digital_divide/ index_en. htm
Breitband-Internetzugang 174<br />
[24] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0712/ 56614. html) StarDSL bietet ab sofort Internet per Satellit mit Rückkanal<br />
[25] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0703/ 51148. html) Filiago bringt Internet per Satellit mit Rückkanal<br />
[26] golem.de: (http:/ / www. golem. de/ 0806/ 60141. html) Internet per Satellit auch über TelDaFax<br />
[27] Australian Broadband Guarantee (http:/ / www. dbcde. gov. au/ communications_for_consumers/ funding_programs__and__support/<br />
australian_broadband_guarantee_-_for_consumers)<br />
[28] http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ technology/ 8255695. stm<br />
Smartphone<br />
Ein Smartphone [ˈsmɑːtˌfəʊn] ist ein in der Prozessorleistung leistungsfähiges Mobiltelefon, das den<br />
Funktionsumfang eines Mobiltelefons um den eines Personal Digital Assistants (PDA) erweitert. Fortschrittliche<br />
Smartphones können über zusätzliche Programme (sogenannte Apps) vom Anwender individuell mit neuen<br />
Funktionen aufgerüstet werden, diese Erweiterungen sind mehr oder weniger restriktiv der Kontrolle der<br />
Gerätehersteller unterworfen und ermöglichen diesen neue lukrative Geschäftsmodelle [1] . Der Smartphone-Markt<br />
gliedert sich laut Gartner im zweiten Quartal 2010 in folgende Marktanteile: Symbian 41 %, RIM 18 %, Android 17<br />
%, Apple 15 %, Windows Mobile 5 %, Linux 2,4 %, Andere 1,8 %. [2]<br />
Grundlagen<br />
Smartphones können durch folgende Merkmale von Handys,<br />
klassischen PDAs und Electronic Organizern unterschieden werden:<br />
• Smartphones verfügen meist über ein Betriebssystem eines anderen<br />
Anbieters (siehe unten). Es ermöglicht dem Benutzer, selbst<br />
Programme nach Belieben zu installieren. Handys haben im<br />
Gegensatz dazu meist eine vordefinierte Programmoberfläche, die<br />
nur begrenzt, z. B. durch Java-Anwendungen, erweitert werden<br />
kann.<br />
• Viele neue Smartphones verfügen über einen<br />
berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), der die<br />
Eingabe mit dem Finger oder einem speziellem Eingabestift<br />
ermöglicht. Jedoch besitzen bereits auch viele herkömmliche<br />
Handys einen Touchscreen.<br />
Durch diese Merkmale bieten Smartphones die Grundlagen zur<br />
mobilen Büro- und Datenkommunikation in einem Gerät. Moderne<br />
Geräte verfügen darüber hinaus noch über Digitalkameras und<br />
integrierte GPS-Empfänger. Der Benutzer kann Daten (wie Adressen,<br />
Android-Smartphone von HTC<br />
Smartphones von Apple und Samsung<br />
Texte und Termine) über die Tastatur oder einen Stift erfassen und zusätzliche Software selbst nachinstallieren.<br />
Die bei PDAs z. B. zur Synchronisierung üblichen Verbindungsarten wie WLAN, Bluetooth, Infrarot oder die<br />
USB-Kabelverbindung werden durch die aus dem Handy-Bereich üblichen Verbindungsprotokolle wie GSM, UMTS<br />
(und HSDPA), GPRS und beispielsweise auch HSCSD ergänzt.<br />
So ist es beispielsweise möglich, unterwegs neben der Mobiltelefonie auch SMS, MMS, E-Mails sowie, bei<br />
modernen Geräten, Videokonferenzen per UMTS oder Internet-Telefonie (VoIP) mit WLAN über<br />
Internet-Zugriffspunkte zu nutzen. Das Personal Mobile Tool von Sharp bietet volle Multimediafähigkeit und<br />
unterstützt neben den mittlerweile üblichen MP3-Songs auch Videodarstellung. Theoretisch können damit neben<br />
Videostreamings aus dem Internet (z. B. über WLAN) auch Fernsehprogramme über DVB-H und mit<br />
entsprechender Hardware auch DVB-T empfangen werden. [3]
Smartphone 175<br />
Ein weiteres Beispiel ist die eingebaute oder optionale Java-Unterstützung (auf CLDC- oder MIDP-Basis) –<br />
Mobiltelefone gelten als eine der populärsten Anwendungen von Embedded Java.<br />
Geschichte<br />
Vorreiter der Smartphone-Systeme war PEN/GEOS 3.0 des Herstellers GeoWorks im weltweit ersten Smartphone,<br />
der Nokia Communicator-Serie. Nokia wechselte später auf einen anderen Prozessor für die Communicator-Reihe<br />
92x0, 9300, 9300i und 9500 und bildete hierzu eine Allianz mit Psion und dessen EPOC-System, um Symbian OS zu<br />
entwickeln. Wenig bekannt ist, dass Palm, der spätere Entwickler des Palm OS, seinen ersten Software Marktauftritt<br />
innerhalb von PEN/GEOS 2.0, der frühen PDAs Zoomer und HP Omnigo 100/120 hatte.<br />
Vor- und Nachteile gegenüber Einzelgeräten<br />
Die wesentlichen Vorteile einer Kombination von Handy, PDA, PMT, Kamera: Man muss nur noch ein Gerät mit<br />
sich führen. Es muss nur noch ein Akkuladestand überwacht werden und es erübrigt sich, z. B. Adressdaten sowohl<br />
im Handy als auch im PDA oder PMT parallel verwalten bzw. synchronisieren zu müssen.<br />
Nachteile sind:<br />
• Manche Benutzer sind durch die Vielzahl der Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten überfordert.<br />
• Der Bildschirm eines Smartphones ist oft kleiner als der eines PDAs.<br />
• Es müssen häufig Kompromisse eingegangen werden. Kombigeräte können die meisten Aufgaben nicht so gut<br />
erledigen wie spezialisierte Geräte. Beispielsweise erreichen integrierte Digitalkameras nicht die<br />
Aufnahmequalität einer echten Digitalkamera. Auch ist die Handhabung der einzelnen Funktionen weniger<br />
ergonomisch als bei spezialisierten Geräten.<br />
• Die heutige Akku-Technologie stößt bei intensiver Nutzung der integrierten energiehungrigen Dienste wie<br />
Bluetooth, WLAN und GPS oder durch die Digitalkamera schnell an ihre Grenzen.<br />
• Durch die Erweiterbarkeit des Systems und die Möglichkeit, Software selbst installieren zu können (Apps),<br />
besteht grundsätzlich eine Anfälligkeit auch für Schadsoftware wie Computerviren, Trojaner etc.
Smartphone 176<br />
Merkmale<br />
Dank einer immer größer werdenden Funktionsfülle lassen sich moderne<br />
Smartphones je nach Ausstattung u. a. nutzen als:<br />
• Kommunikationszentrale (Mobiltelefon, Webbrowser, E-Mail, SMS,<br />
MMS, teilweise auch Fax)<br />
• Personal Information Manager (PIM) mit Adressbuch, Terminkalender,<br />
Aufgabenliste, Notizblock, Geburtstagsliste etc. mit Abgleich mit einer<br />
Desktop-Applikation<br />
• Diktiergerät<br />
• Datenspeicher<br />
• Medienfunktionen mit MP3-Player, Radio, Videoplayer, Bildbetrachter,<br />
einfacher Foto- und Videokamera<br />
• Taschencomputer (beispielsweise Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,<br />
PDF-Reader, Taschenrechner etc.)<br />
• Funk-Modem für den PC<br />
• Navigation mit Navigationssystem und Landkarten<br />
• Videospiel<br />
Ausführungen<br />
Smartphones sind in unterschiedlichen Bauformen verfügbar, die sich nicht<br />
klar voneinander abgrenzen lassen. Ein häufiges Merkmal ist eine<br />
Beispiel einer Zeitserver Anwendung:<br />
Ein Smartphone App justiert per<br />
Bluetooth selbstständig die Uhrzeit einer<br />
Armbanduhr, die Uhrzeit dazu bezieht<br />
das App von einem Zeitserver im<br />
Internet.<br />
QWERTZ-Tastatur, die entweder eingeklappt bzw. eingeschoben werden kann (bspw. Samsung F700 Qbowl) oder<br />
typischerweise fest an der Gerätefront angeordnet ist (bspw. Nokia E61i). Letztere Bauform wird auch als<br />
Q-Smartphones (Q = Qwertz oder Qwerty) bezeichnet. Als weiteres Merkmal besitzen Smartphones häufig einen<br />
Touchscreen und lassen sich ähnlich einem PDA bedienen. Während einige Geräte (bspw. Apple iPhone) komplett<br />
auf die Bedienung mit den Fingern ausgelegt sind (diese Bauform wird auch als Touch-Phone bezeichnet), sind bei<br />
anderen Geräten viele Funktionen zusätzlich mit einem Eingabestift bedienbar (bspw. Sony Ericsson P1i). Zusätzlich<br />
verfügen Smartphones häufig über WLAN und GPS.<br />
Verschiedene Smartphones<br />
Siemens SX1<br />
Smartphone<br />
(2004)<br />
Smartphones Nokia<br />
Communicator<br />
BlackBerry<br />
8700c: Qwerty<br />
Smartphone<br />
Palm Pre
Smartphone 177<br />
HTC Touch Apple iPhone:<br />
Betriebssysteme<br />
Touchscreen<br />
HTC-G1 Smartphone mit<br />
Google Android<br />
Am Markt haben sich aktuell mehrere Betriebssysteme für Smartphones etabliert:<br />
• Symbian OS<br />
Samsung SGH-I900 Omnia:<br />
Touchscreen<br />
• BlackBerry, von RIM: proprietäres System mit Schwerpunkt auf unternehmensweite E-Mail-Integration mit<br />
Pushtechnologie<br />
• Apple iOS: bis Juni 2010 iPhone OS<br />
• Windows Mobile von Microsoft<br />
• Linux in verschiedenen Ausgestaltungen:<br />
• Android, von der Open Handset Alliance (unter der Leitung von Google) entwickelt<br />
• webOS, von Palm<br />
• MeeGo, von Nokia und Intel initiiert<br />
• Mobilinux, von MontaVista<br />
• Openmoko<br />
• bada, von Samsung (eine Version mit Linux-Kernel)<br />
• Brew, von Qualcomm<br />
Da Smartphones komplexer sind als einfache Mobiltelefone, kann ein Smartphone als ein System bestehend aus<br />
unterschiedlichen, miteinander vernetzten Geräten betrachtet werden statt als ein einzelnes Gerät. Insbesondere das<br />
Mobilfunk-Modul bzw. -Modem ist dabei auch nur eines von vielen Geräten und hat daher zum Teil eine eigene<br />
Firmware und operiert in gewissem Maße unabhängig vom Rest des Systems, so etwa beim Apple iPhone, wo es als<br />
Baseband bezeichnet wird.
Smartphone 178<br />
Gemessen an weltweiten Marktanteilen der Hersteller je Smartphone<br />
Betriebssystem ergibt sich folgendes Bild: [5]<br />
Prozessor<br />
Hersteller Einheiten 2009 Marktanteil<br />
2009<br />
Q1 2010 Smartphone Marktanteil gemäß Gartner<br />
Inc. [4]<br />
Einheiten 2008 Marktanteil<br />
Symbian OS 78.511.980 47,2 % 74.926.550 52,4 %<br />
RIM BlackBerry 34.544.100 20,8 % 23.562.650 16,5 %<br />
Apple iOS 25.103.770 15,1 % 13.727.740 9,6 %<br />
Microsoft Windows Mobile 14.679.720 8,8 % 19.945.530 13,9 %<br />
Google Android 7.786.870 4,7 % 66.550 0,5 %<br />
Andere 5.644.610 3,4 % 10.241.510 7,2 %<br />
Der Prozessor übernimmt wie in jedem Computersystem die anfallenden Rechenoperationen. Je nach Hersteller und<br />
Modell gibt es dabei große Leistungsunterschiede. Während ältere und einfachere Geräte nur relativ geringe<br />
Prozessor-Taktraten haben, können aktuelle Modelle über 500 MHz und mehr verfügen. Die meisten in Smartphones<br />
verbauten Prozessoren basieren auf lizenzierten Designs auf Basis der ARM-Architektur. In Nokias N-Serie haben<br />
Texas-Instruments-Prozessoren große Verbreitung gefunden. Diverse Geräte, darunter das N70, N80 und N90 sind<br />
mit dem Texas Instruments TI OMAP 1710 ausgestattet, der mit einer Taktrate von 220 MHz läuft. Mit besserer<br />
Ausstattung, insbesondere im Fotobereich, stieg auch der Bedarf für schnellere Prozessoren, so erhielten die Modelle<br />
Nokia N93 und N95, die beide hochauflösende Videos drehen und auch Fotos mit hoher Auflösung schießen, den TI<br />
OMAP 2420, ebenfalls von Texas Instruments, der über 330 MHz verfügt. Dadurch sind diese Geräte auch im<br />
Normalbetrieb deutlich schneller zu bedienen und qualifizierten sich zudem für Nokias mobile Spieleplattform<br />
N-Gage.<br />
Über eine deutlich höhere Leistung verfügen Modelle von HTC. Sowohl im Touch Diamond, im Touch Pro als auch<br />
im Touch HD kommen Qualcomm-Prozessoren mit einer Taktfrequenz von 528 MHz zum Einsatz. Da HTC jedoch<br />
Windows Mobile als Betriebssystem einsetzt, welches auch mehr Ressourcen und Rechenleistung benötigt, bietet die<br />
höhere Prozessorleistung keinen großen Gewinn hinsichtlich der Arbeitsgeschwindigkeit. Noch höher ist die<br />
Prozessor-Geschwindigkeit von Apples iPhone, welches auch immer wieder für seine flüssige Bedienung gelobt<br />
wird. Seit den ersten Firmware-Updates ist bekannt, dass das iPhone mit 620 MHz getaktet wird. So laufen auch<br />
2008
Smartphone 179<br />
rechenintensive Funktionen wie Multi-Touch, ohne dass das Gerät dabei ins Stocken kommt und die Bedienung<br />
hakt. [6]<br />
Die nach eigenen Angaben mit einer Taktfrequenz von 1 GHz bisher schnellsten in einem Smartphone verbauten<br />
Prozessoren haben (Februar 2010) das TG01 von Toshiba, das Anfang 2010 erschienene Google Nexus One sowie<br />
das HTC HD2 und das HTC Desire mit einem 1 GHz Qualcomm-Snapdragon-Prozessor.<br />
Anmerkung<br />
Die ersten Nokia Communicator 9000 und 9110(i) benutzten das auf DOS basierte PEN/GEOS-Betriebssystem auf<br />
einer Intel-x86-kompatiblen Hardware-Plattform.<br />
Referenzen<br />
[1] Erfolgsgeschichte: 13.000 USD pro Monat mit Android-App (http:/ / www. google-oekonomie. de/<br />
erfolgsgeschichte-13-000-usd-pro-monat-mit-android-app/ ) www.google-oekonomie.de abgerufen am 13. Juni 2010<br />
[2] cite press release|title=Smartphone-Markt wächst um 50 Prozent|url=http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Smartphone-Markt-waechst-um-50-Prozent-1057411. html|date=11 August 2010|accessdate=11 August 2010|work=ZDNet<br />
[3] http:/ / www. golem. de/ 0803/ 58374. html LG stellt DVB-T Handy vor<br />
[4] Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 17 Per Cent in First Quarter 2010 (http:/ / www. gartner. com/ it/ page. jsp?id=1372013).<br />
Gartner Inc., 19. Mai 2010, abgerufen am 20. Juni 2010 (Englisch).<br />
[5] Canalys quarterly research highlights (http:/ / www. canalys. com/ pr/ 2010/ r2010021. html)<br />
[6] http:/ / smartphones24. org/ 2008102091/ ratgeber/ glossar/ definition-prozessor-cpu. html Definition Smartphone-Prozessor<br />
WordPress<br />
WordPress<br />
Weblog-Software / Web-CMS<br />
Basisdaten<br />
Entwickler Matt Mullenweg<br />
Ryan Boren<br />
Aktuelle Version 3.0.1 (29. Juli 2010)<br />
Betriebssystem plattformunabhängig<br />
Programmiersprache PHP<br />
Kategorie Weblog-Software<br />
Lizenz GPL (Freie Software)<br />
Deutschsprachig ja<br />
www.wordpress.org [1]<br />
WordPress ist ein System zur Verwaltung der Inhalte einer Website (Texte und Bilder). Es bietet sich besonders<br />
zum Aufbau und zur Pflege eines Weblogs an, da es erlaubt, jeden Beitrag einer oder mehreren frei erstellbaren
WordPress 180<br />
Kategorien zuzuweisen, und automatisch die entsprechenden Navigationselemente erzeugt. Parallel gestattet es auch<br />
unkategorisierte Einzelseiten.<br />
Weiter bietet das System Leserkommentare mit der Möglichkeit, diese vor der Veröffentlichung erst zu prüfen,<br />
sowie eine zentrale Linkverwaltung, eine Verwaltung der Benutzerrollen und -rechte und die Möglichkeit externer<br />
Plugins, womit WordPress in Richtung eines vollwertigen „Content-Management-Systems“ ausgebaut werden kann.<br />
WordPress basiert auf der Skriptsprache PHP (mindestens PHP 4.3) und benötigt eine MySQL-Datenbank<br />
(mindestens MySQL 4.1.2). [2] Es ist freie Software, die unter der GNU General Public License (GPL) lizenziert<br />
wurde. Die Entwickler stellen die quelloffene Software auf der Website kostenlos zum Download bereit. Laut<br />
Aussage der Entwickler legt das System besonderen Wert auf Webstandards, Eleganz, Benutzerfreundlichkeit und<br />
leichte Anpassbarkeit. WordPress ist der offizielle Nachfolger des Systems b2 und verfügt über eine stetig<br />
wachsende Benutzer- und Entwicklergemeinde.<br />
Geschichte<br />
In den Jahren 2001/2002 entwickelte Michel Valdrighi ein in PHP geschriebenes Weblogsystem mit dem Namen<br />
b2/cafelog, das unter GPL veröffentlicht wurde. Einige Monate nachdem Valdrighi die Entwicklung von b2<br />
eingestellt hatte, gab Matthew Mullenweg im <strong>Jan</strong>uar 2003 in seinem Blog bekannt, dass er auf der b2-Codebasis eine<br />
neue Webblog-Software schreiben wolle, die einfach zu bedienen, flexibel und gut anpassbar sein sollte. [3] Kurze<br />
Zeit später startete er zusammen mit Mike Little die Entwicklung von WordPress.<br />
Die erste stabile Version von WordPress erschien am 3. <strong>Jan</strong>uar 2004. Seit Version 1.0.1 sind alle Hauptversionen<br />
nach Jazzmusikern benannt. [4] Nachdem sich auch Michel Valdrighi der Entwicklergruppe um Mullenweg anschloss,<br />
wurde WordPress zum offiziellen Nachfolger von b2. [5] Im Laufe der Jahre wurde der Funktionsumfang immer<br />
weiter ausgebaut. Seit der Version 1.5 („Strayhorn“) unterstützt WordPress das Verwalten von statischen Seiten, also<br />
Beiträgen außerhalb der normalen Weblogchronologie. Damit war die Grundlage geschaffen, um WordPress nicht<br />
nur als reine Weblog-Software, sondern auch als einfaches Content-Management-System nutzen zu können.<br />
Im August 2005 gründete Matt Mullenweg zusammen mit einigen anderen Entwicklern die Firma Automattic mit<br />
dem Ziel, weitere Dienste rund um das Bloggen anzubieten und die Entwicklung von WordPress besser zu<br />
koordinieren. Im selben Jahr startete Automattic den Bloghosting-Dienst wordpress.com, der auf der<br />
Multi-User-Version von WordPress basiert. Ein Jahr später fand das erste WordCamp in San Francisco statt. [6]<br />
2007 gewann WordPress den Open Source CMS Award in der Kategorie Best Open Source <strong>Social</strong> Networking<br />
Content Management System [7] und 2009 in der Kategorie Overall Best Open Source CMS [8]<br />
Mit über 10 Millionen Downloads (allein von WordPress 2.8) [9] gehört WordPress heute zu den am weitesten<br />
verbreiteten Weblog-Systemen [10] .
WordPress 181<br />
Funktionen<br />
Die „5-Minuten-Installation“<br />
Vom Download des Pakets mit dem Quellcode bis zum fertigen Blog<br />
werden nach Herstellerangaben regelmäßig weniger als 5 Minuten<br />
benötigt. [11] Obwohl der Installations-Dialog in Wordpress 3.0<br />
erweitert wurde, werden die 5 Minuten weiterhin unterschritten. [12]<br />
Grundlegende Funktionen<br />
WordPress unterstützt das Erstellen und Verwalten von Blogartikeln.<br />
Die einzelnen Artikel können in verschiedene Kategorien eingeordnet<br />
werden. Außerdem können einem Artikel Tags und weitere selbst<br />
Administrationsoberfläche seit Version 2.7<br />
definierte Metadaten (mittels „Benutzerdefinierter Felder“) zugeordnet werden. Die Blogbeiträge werden neben der<br />
normalen Darstellung als Webseite den Lesern auch über Nachrichten-Feeds in den Protokollen RSS 2.0, RSS 0.93<br />
und Atom 0.3 angeboten.<br />
Mit WordPress kann man ebenfalls statische Seiten außerhalb der Bloghierarchie erstellen. Seit Version 2.6 wird<br />
zudem die Versionierung von Artikeln und Seiten unterstützt. Weiterhin kann WordPress Kommentareinträge und<br />
Links verwalten.<br />
WordPress besitzt ein einfaches Redaktionssystem mit 5 Benutzerrollen (Administrator, Redakteur, Autor,<br />
Mitarbeiter, Leser), eine Mediengalerie mit eingebautem Uploader und eine integrierte Volltext-Suche. Außerdem ist<br />
standardmäßig TinyMCE als Texteditor aktiviert.<br />
Plugins<br />
Mit Hilfe von Plugins kann WordPress um diverse Funktionen erweitert werden. Alle diese Erweiterungen lassen<br />
sich mittels des eingebauten Editors bearbeiten.<br />
Insgesamt sind im Plugin-Verzeichnis der Entwickler sowie über den integrierten „Plugin-Browser“ mehr als 5000<br />
verschiedene freie Plugins verfügbar. Es gibt beispielsweise Plugins die die Verwendung anderer Loginverfahren,<br />
wie LDAP, OpenID oder Shibboleth ermöglichen, den eigenen Blog mit Twitter verbinden oder WordPress um eine<br />
Statistik-Funktion erweitern.<br />
Automattic bietet zudem Plugins, die eine Verbindung mit den anderen hauseigenen Projekten wie der<br />
Forensoftware bbPress oder Services wie dem Anti-Spam-Dienst Akismet ermöglichen.<br />
Motive (Themes)<br />
Durch den Einsatz der Theme-Technik werden Design und Programmkern<br />
von WordPress klar getrennt, was es leicht macht, individuelle Designs zu<br />
entwickeln, ohne mit der Programmierung der Software an sich vertraut zu<br />
sein. Allerdings ist es in WordPress auch möglich diverse Funktionen direkt<br />
in ein Theme zu programmieren, wodurch diese Trennung teilweise wieder<br />
aufgehoben werden kann.<br />
Ein normales WordPress-Theme besteht aus einer Reihe von Bausteinen<br />
(Template-Tags) und HTML-Code. Jedes Theme folgt dabei einem<br />
Hierarchie innerhalb eines<br />
WordPress-Themes<br />
grundlegend gleichen Aufbau. Daher gibt es von einigen Entwicklern spezielle Themes, die bereits alle<br />
grundlegenden Bausteine beinhalten und somit die Entwicklung eines eigenen Themes vereinfachen.
WordPress 182<br />
Das seit Version 1.5 voreingestellte Theme war Kubrick (benannt nach Regisseur Stanley Kubrick). Auf der Seite<br />
der Entwickler und über den eingebauten „Theme-Browser“ sind zudem viele weitere freie Themes für WordPress<br />
verfügbar. WordPress-Themes fallen genauso wie WordPress selbst unter die GPL. [13]<br />
Seit Version 3.0 verwendet WordPress standardmäßig das neue Theme "Twenty-Ten" (dt. 2010), die bisher<br />
enthaltenen Themes "Classic" und "Default" (Kubrick) sind nur noch separat erhältlich.<br />
Versionen<br />
Legende: Ältere Version; nicht mehr unterstützt Ältere Version; noch unterstützt Aktuelle Version Zukünftige Version<br />
Wordpress-Stamm Version Releasename Veröffentlichung Anmerkungen<br />
b2 0.70 — 27. Mai 2003 0.70 war fast identisch mit der letzten b2-Version, behob aber einige Fehler.<br />
WordPress 1 1.0 — 3. <strong>Jan</strong>uar 2004 Erste stabile Version.<br />
Nur 0.71-gold ist heute noch über das Archiv von wordpress.org verfügbar.<br />
1.2 Mingus 22. Mai 2004 Neuerungen: Unterstützung für Plugins<br />
1.5 Strayhorn 17. Februar 2005 Neuerungen: Verwaltung von statischen Seiten, neues Template System. [14]<br />
WordPress 2 2.0 Duke 31. Dezember<br />
2005<br />
Neuerungen: diverse Verbesserungen im Bereich Administration, Bildimport<br />
und Pluginanbindung. [15] Sollte ursprünglich 5 Jahre mit Sicherheitsupdates<br />
versorgt werden. Dieser Plan wurde allerdings im Sommer 2009<br />
aufgegeben [16]<br />
2.1 Ella 22. <strong>Jan</strong>uar 2007 Neuerungen: Autosave-Funktion, Upload-Manager.<br />
2.2 Getz 16. Mai 2007<br />
2.3 Dexter 24. September<br />
2007<br />
2.5 Brecker 29. März 2008<br />
2.6 Tyner 15. Juli 2008<br />
2.7 Coltrane 10. Dezember<br />
2008<br />
2.8 Baker 11. Juni 2009<br />
2.9 Carmen 18. Dezember<br />
2009<br />
WordPress 3 3.0 Thelonious 17. Juni 2010<br />
3.1 (noch nicht<br />
bekannt)<br />
3.2 (noch nicht<br />
bekannt)<br />
15. Dezember<br />
2010<br />
Frühjahr 2011<br />
Neuerungen: Unterstützung für Widgets und das Atom-Feedformat [17]<br />
Neuerungen: native Unterstützung für Tags (Schlagwörter), verbesserter<br />
Texteditor [18]<br />
Neuerungen: neu gestaltetes Administrationsmenü, Tag-Verwaltung,<br />
„Dashboard-Widgets“, verbesserte Verschlüsselung für Passwörter [19]<br />
Neuerungen: Versionierung von Artikeln und Seiten, Unterstützung von<br />
Google Gears, Vorschau für Themes [20]<br />
Neuerungen: komplett neue Administrationsoberfläche, Funktion für<br />
automatische Updates, vereinfachte Plugin-Installation aus dem<br />
Administrationsmenü heraus [21]<br />
Neuerungen: einfache Installation von Themes ähnlich der für Plugins, neues<br />
Administrations-Interface für Widgets [22]<br />
Neuerungen: Papierkorb für Artikel, Seiten und Kommentare;<br />
Bearbeitungsfunktionen für Bilder (Schneiden, Drehen, Spiegeln) [23]<br />
Neuerungen: Zusammenlegung von WordPress und WordPress µ, neues<br />
Standard-Theme, Editor zum Erstellen von Webseiten-Menüs [24]<br />
Neuerungen: Erweiterte Taxonomie-Abfragen, Verbesserte<br />
Administrationsoberfläche, Adminbar (Toolbar im Frontend, über das man<br />
auf Backend-Funktionen zugreifen kann) [25]<br />
Neuerungen: Die Systemvoraussetzungen werden auf PHP 5.2 und MySQL<br />
5.0.15 erhöht [26]
WordPress 183<br />
WordPress µ<br />
Das Projekt WordPress µ (µ = mu, Abkürzung für Multiuser) bot die Möglichkeit, Weblogs zu hosten und damit<br />
einen Weblog-Dienst einzurichten. WordPress-µ-Versionen basierten jeweils auf der aktuellen WordPress-Version<br />
und erschienen meist zeitnah zu dieser. Das Projekt wurde ebenfalls von Automattic koordiniert.<br />
Seit WordPress 3.0 ist µ unter dem Namen "Multi-Site" ein fester Bestandteil der Blogsoftware.<br />
BuddyPress<br />
BuddyPress ist ein Plugin für WordPress (ursprünglich nur für WordPress µ), das das Blog-System in ein kleines<br />
<strong>Social</strong> Network verwandelt. Die aktuelle Version ist 1.2.2 vom 12. März 2010. [27] BuddyPress 1.3 soll gemeinsam<br />
mit WordPress 3.0 erscheinen. [28]<br />
WordPress für das iPhone<br />
Für das iPhone gibt es eine Applikation, die den mobilen Zugriff auf WordPress.com-Blogs und WordPress-Blogs ab<br />
Version 2.7 ermöglicht. Sie bietet dabei allerdings nur eine eingeschränkte Funktionalität. [29]<br />
Community<br />
WordPress Deutschland<br />
WordPress Deutschland ist die „zentrale Anlaufstelle der deutschsprachigen WordPress-Nutzer“. [30] Der<br />
kommerzielle Bloghoster wordpress.com fällt trotz Namensähnlichkeit explizit nicht darunter, da dies ein ganz<br />
anderes Produkt ist, für welches der Betreiber eine eigene deutschsprachige Seite anbietet [31] .<br />
Kritik<br />
DE-Edition<br />
Die Integration des Plugins „LinkLift“, das Werbeanzeigen durch Aktivierung des Benutzers in die inoffizielle<br />
deutsche Version 2.3 einband, löste Diskussionen unter Nutzern aus. [32] Als Reaktion darauf wurde am 1. Oktober<br />
2007 im WordPress Deutschland Blog [33] bekannt gegeben, dass die umstrittene Erweiterung ab sofort nicht mehr<br />
zum Lieferumfang der deutschen Edition gehört.<br />
Lange Zeit gab es zudem für WordPress im deutschsprachigen Raum mehrere Sprachdateien: eine von<br />
wordpress.org und zwei von WordPress Deutschland (eine „Du“- und eine „Sie“-Version). Da die Sprachdateien das<br />
gleiche Länderkürzel nutzten, kam es mit der Einführung des automatischen Updates mit WordPress 2.7 zu diversen<br />
Problemen mit der Update-Funktion. [34] Diese Probleme wurden erst mit Version 2.8 und der Zusammenlegung der<br />
deutschen Sprachversionen behoben. [35]<br />
Mehrsprachigkeit<br />
WordPress bietet keine native Unterstützung für mehrsprachige Webseiten. Zwar bieten Plugins [36] die Möglichkeit,<br />
mehrsprachigen Inhalt zu verwalten, jedoch beziehen sich diese nur auf einzelne Postings und nicht auf alle<br />
verfügbaren Elemente. Hierbei sollte die Entwicklung beobachtet werden, das Plugin WPML [37] kann so gut wie<br />
alle Elemente unterstützen. Alternativ ist es möglich, die MultiSite-Funktion von WordPress 3.0 zu nutzen und damit<br />
für jede Sprache ein eigenes Blog zu erstellen.
WordPress 184<br />
Speicherverbrauch<br />
In Version 2.8 ist der Speicherverbrauch verglichen mit den Vorgängerversionen vor allem auf 64-Bit-Systemen<br />
stark gestiegen. [38] Standardmäßig werden 32 MB RAM benötigt. [39] Diese - gemessen an modernen PCs geringe -<br />
Speicheranforderung stellt bei einfacheren Leistungspaketen kommerzieller Webhoster jedoch ein Problem dar.<br />
Literatur<br />
• Moritz Sauer: Weblogs, Podcasting & Online-Journalismus, O’Reilly-Verlag 2006, ISBN 978-3-89721-458-3<br />
• Frank Bültge: WordPress. Weblogs einrichten und administrieren. Open Source Press 2007, ISBN<br />
978-3-937514-33-8<br />
• Vladimir Simovic: WordPress: Das Einsteigerseminar. bhv-Buch 2009, ISBN 978-3-8266-7505-8<br />
• Vladimir Simovic: WordPress – Das Praxisbuch. mitp 2010, ISBN 978-3-8266-9043-3<br />
• Frank Bültge, Thomas Boley: Das WordPress-Buch. Vom Blog zum Content-Management-System [40] . Open<br />
Source Press Juli 2009, ISBN 978-3-937514-70-3<br />
• Thomas Frütel: WordPress professionell einsetzen. Data-Becker 2009, ISBN 978-3-8158-2803-8<br />
• Olivia Adler: Praxiswissen WordPress, O’Reilly-Verlag 2009, ISBN 978-3-89721-915-1<br />
Videotrainings<br />
• Sven Blomenkamp: Bloggen mit WordPress, mitp 2008, ISBN 978-3-8266-5065-9<br />
• Frank Bültge: WordPress - Das umfassende Training [41] , Galileo Press 2010, ISBN 978-3-8362-1532-9<br />
Weblinks<br />
• Englischsprachige Website [1]<br />
• Dokumentation [42] (engl.)<br />
• WordPress Deutschland [43]<br />
• Free WordPress Themes [44]<br />
• Automatisches Backup der Wordpress-Datenbank [45]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. wordpress. org/<br />
[2] Systemvoraussetzungen von WordPress 2.9 (http:/ / wordpress-deutschland. org/ voraussetzungen/ ) (abgerufen am 31. März 2010)<br />
[3] The Blogging Software Dilemma (engl.) (http:/ / ma. tt/ 2003/ 01/ the-blogging-software-dilemma/ )<br />
[4] Roadmap (http:/ / wordpress. org/ about/ roadmap/ ) der Entwicklung<br />
[5] Alte Entwicklerseite von b2 (http:/ / cafelog. com/ )<br />
[6] WordPress.org: About (http:/ / wordpress. org/ about/ )<br />
[7] (http:/ / www. packtpub. com/ open-source-cms-award-previous-winners)<br />
[8] Open Source CMS Award (http:/ / www. packtpub. com/ award/ )<br />
[9] WordPress.org Download-Zähler (http:/ / wordpress. org/ download/ counter/ ), abgefragt am 2. Dezember 2009<br />
[10] W3Techs.org (http:/ / w3techs. com/ technologies/ overview/ content_management/ all), abgefragt am 4. <strong>Jan</strong>uar 2010<br />
[11] Die 5-Minuten-Installation (http:/ / doku. wordpress-deutschland. org/ 5_Minuten_Installation) (abgerufen am 31. März 2010)<br />
[12] Angaben zur Installation von WordPress 3.0 (http:/ / www. perun. net/ 2010/ 03/ 19/ wp-3-0-angaben-zur-installation-erweitert/ ) (abgerufen<br />
am 31. März 2010)<br />
[13] http:/ / wordpress. org/ development/ 2009/ 07/ themes-are-gpl-too/<br />
[14] WordPress.org: Announcing WordPress 1.5 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2005/ 02/ strayhorn/ )<br />
[15] WordPress.org: WordPress 2 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2005/ 12/ wp2/ )<br />
[16] Blogeintrag der Entwickler zur Einstellung von WordPress 2.0 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2009/ 07/<br />
the-wordpress-2-0-x-legacy-branch-is-deprecated/ )<br />
[17] WordPress.org: WordPress 2.2 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2007/ 05/ wordpress-22/ )<br />
[18] WordPress.org: WordPress 2.3 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2007/ 09/ wordpress-23/ )<br />
[19] WordPress.org: WordPress 2.5 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2008/ 03/ wordpress-25-brecker/ )
WordPress 185<br />
[20] WordPress.org: WordPress 2.6 (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2008/ 07/ wordpress-26-tyner/ )<br />
[21] WordPress.org. WordPress 2.7 „Coltrane“ (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2008/ 12/ coltrane/ )<br />
[22] WordPress.org: 2.8 Release Jazzes Themes and Widgets (engl.) (http:/ / wordpress. org/ development/ 2009/ 06/ wordpress-28/ )<br />
[23] WordPress.org: Veröffentlichungsbeitrag zu WordPress 2.9 (http:/ / wordpress. org/ development/ 2009/ 12/ wordpress-2-9/ )<br />
[24] WordPress.org: Zeitplan zum Release von WordPress 3.0 (http:/ / wpdevel. wordpress. com/ version-3-0-project-schedule/ )<br />
[25] wpdevel: Process and Scope for 3.1, Part I (https:/ / wpdevel. wordpress. com/ 2010/ 09/ 03/ process-and-scope-for-3-1-part-i/ )<br />
[26] WordPress.org: PHP 4 and MySQL 4 End of Life Announcement (http:/ / wordpress. org/ news/ 2010/ 07/ eol-for-php4-and-mysql4/ )<br />
[27] BuddyPress-Deutschland (http:/ / buddypress. de/ blog/ 2010/ 03/ buddypress-1-2-2-veroeffentlicht. html)<br />
[28] BuddyPress-Deutschland - Blog (http:/ / buddypress. de/ blog/ 2009/ 12/ buddypress-1-2-untersttzung-des-normalen-wordpress. html)<br />
[29] WordPress für das iPhone (engl.) (http:/ / iphone. wordpress. org/ )<br />
[30] WordPress Deutschland (http:/ / wordpress-deutschland. org/ ). Rohé, Heinz, abgerufen am 21. Juli 2010: „WordPress Deutschland ist die<br />
zentrale Anlaufstelle der deutschsprachigen WordPress-Nutzer“<br />
[31] WordPress.com (http:/ / de. wordpress. com/ ). Abgerufen am 31. August 2010.<br />
[32] Forum von WordPress Deutschland (http:/ / forum. wordpress-deutschland. org/ feedback-und-ankuendigungen/<br />
25428-offene-anfrage-wordpress-deutschland. html)<br />
[33] WordPress Deutschland: Änderung der DE-Edition (http:/ / blog. wordpress-deutschland. org/ 2007/ 10/ 01/ aenderung-der-de-edition. html)<br />
[34] WordPress Deutschland: Sprachdateien Wirrwarr (http:/ / blog. wordpress-deutschland. org/ 2008/ 12/ 12/ sprachdateien-wirrwarr. html)<br />
[35] WordPress Deutschland: Ein WordPress Deutschland (http:/ / blog. wordpress-deutschland. org/ 2009/ 07/ 22/ wordpress-deutschland. html)<br />
[36] wie qTranslate (http:/ / www. qianqin. de/ qtranslate/ ) oder xLanguage (http:/ / hellosam. net/ project/ xlanguage)<br />
[37] http:/ / wpml. org<br />
[38] WordPress Deutschland: Informationen zum erhöhten Speicherbedarf (http:/ / blog. wordpress-deutschland. org/ 2009/ 06/ 16/<br />
fatal-error-allowed-memory-size-of-bytes-exhausted. html)<br />
[39] Siehe die Datei wp-includes/default-constants.php im Sourcecode von WordPress 2.9, zur Datei im offiziellen WordPress-Repository (http:/<br />
/ core. svn. wordpress. org/ trunk/ wp-includes/ default-constants. php).<br />
[40] http:/ / wordpress-buch. bueltge. de/ das-wordpress-buch/<br />
[41] http:/ / wordpress-video-training. bueltge. de/<br />
[42] http:/ / codex. wordpress. org/<br />
[43] http:/ / wordpress-deutschland. org/<br />
[44] http:/ / wordpress. org/ extend/ themes/<br />
[45] http:/ / www. beedy. de/ 2010/ 05/ 09/ automatisches-backup-der-wordpress-datenbank/
Der Hinterhof des digitalen Universums<br />
Google<br />
URL<br />
Kommerziell ja<br />
Google<br />
www.google.com [1]<br />
Beschreibung Internet-Suchmaschine<br />
Registrierung nicht erforderlich<br />
Sprachen 124 (inkl. Varianten und Kunstsprachen)<br />
Eigentümer Google Inc.<br />
Erschienen September 1998 (als Google; Vorläufer BackRub 1996)<br />
Google ist eine Suchmaschine des US-Unternehmens Google Inc..<br />
Übereinstimmende Statistiken zeigen mit Marktanteilen von mehr als<br />
80 Prozent aller weltweiten Suchanfragen Google als Marktführer<br />
unter den Internet-Suchmaschinen. [2] [3] [4] Außerdem ist Google<br />
inzwischen die weltweit wertvollste Marke. Der Vorläufer BackRub<br />
startete 1996, seit September 1998 ist die Suchmaschine unter dem<br />
Logo von Google Deutschland<br />
Namen Google online. [5] Seitdem hat sich ihre Oberfläche nur geringfügig verändert. Durch den Erfolg der<br />
Suchmaschine in Kombination mit kontextsensitiver Werbung (siehe Google AdSense) konnte das Unternehmen<br />
Google Inc. eine Reihe weiterer Software-Lösungen finanzieren, die über die Google-Seite zu erreichen sind. Die<br />
Suche ist nach wie vor der Kernbereich des Google-Geschäftsfelds. Zeitweise verwendete Konkurrent Yahoo die<br />
Datenbanken für die eigene Suche.<br />
Der Begriff „Google“<br />
Etymologie<br />
Die Bezeichnung Google basiert auf einem Wortspiel (manche Quellen sprechen auch von einem<br />
Rechtschreibfehler) mit der amerikanischen Aussprache des Wortes googol. [6] Milton Sirotta, der Neffe des<br />
amerikanischen Mathematikers Edward Kasner, hatte den Ausdruck im Jahr 1938 erfunden, um der Zahl mit einer<br />
Eins und hundert Nullen (10 100 ) einen Namen zu geben. Die Google-Gründer wiederum suchten eine treffende<br />
Bezeichnung für die Fülle an Informationen, die ihre Suchmaschine im Web finden sollte. [5]<br />
186
Google 187<br />
Das Verb „googeln“<br />
Der Rechtschreib-Duden nahm das Verb googeln (sprich: [ˈɡuːgl̩n] „guhg(e)ln“) 2004 in die 23. Auflage auf. [7]<br />
2006 forderte Google Zeitungs- und Wörterbuchredaktionen auf, „to google“ oder „googeln“ nicht allgemein für die<br />
Suche im Internet zu verwenden, um einer Gattungsbegriffbildung und damit dem Verlust des Markenschutzes<br />
vorzubeugen. Auf eine Bitte von Google wurde der Eintrag in der 24. Auflage des Duden genauer definiert („mit<br />
Google im Internet suchen“). [8]<br />
Arbeitsweise der Google-Suche<br />
Indexierung von Internetseiten<br />
Die Google-Suchmaschine folgt mit Hilfe so genannter Webcrawler den gefundenen Links und versucht so,<br />
möglichst viele publizierte Seiten in ihren Suchindex aufzunehmen. (Zum Umfang dieser Datenbank siehe<br />
Indexgröße). Dabei werden die Seiten nach Suchbegriffen und Schlüsselworten aufgegliedert.<br />
Sortierung der Suchergebnisse<br />
Google zielt darauf ab, den Nutzern die Suchergebnisse nach Relevanz zu sortieren. Der Sortieralgorithmus der<br />
Suchergebnisse stützt sich unter anderem auf ein patentiertes Verfahren, das den so genannten PageRank-Wert<br />
errechnet. Dieser repräsentiert die Linkpopularität, d. h. er gibt an wie gut ein Dokument verlinkt ist und von wem.<br />
Neben dem PageRank werden weitere Faktoren in die Sortierung einbezogen, so wird etwa das Auftreten der<br />
Suchbegriffe im Dokumententitel oder in Überschriften gewertet. Des Weiteren spielt die Verwendung der Begriffe<br />
als Ankertext in verweisenden Dokumenten eine große Rolle. Letzteres wird bei Google-Bomben missbraucht.<br />
Insgesamt gibt Google an, mehr als 200 Faktoren in die Berechnung einfließen zu lassen. [9]<br />
Die exakte Funktionsweise der Seitensortierung ist Googles Betriebsgeheimnis, nicht zuletzt, um Manipulationen<br />
durch Website-Betreiber zu erschweren, die die eigene Site für gewisse Begriffe auf den Ergebnisseiten möglichst<br />
weit nach oben bringen möchten. Die Suchmaschinenoptimierung beschäftigt sich mit Methoden, dies zu erreichen.<br />
Einschränkungen aufgrund Datenschutz<br />
Das politische Umfeld erlaubt teils nicht, dass alle Suchergebnisse angezeigt werden. Beispielsweise in der Schweiz<br />
können selbst private Personen eine Löschung eines Links fordern, sofern ein Link im Zusammenhang mit der<br />
eigenen Person im Suchergebnis von Google erscheint. Diesbezüglich muss sich Google Inc. an das Bundesgesetz<br />
über den Datenschutz halten.<br />
Design<br />
Das Design von Google ist einfach gestaltet, hat aber einige komplexe Funktionen.<br />
Beispiele:<br />
• Wenn der Benutzer ein Suchwort eintippt, werden die am häufigsten gesuchten Begriffe sofort unter dem<br />
Tippfeld angezeigt.<br />
• Wenn der Benutzer Google öffnet, sieht er zuerst bloß das Logo, das Tippfeld und die zwei Schaltflächen<br />
"Google-Suche" und "Auf gut Glück!". Bewegt er den Mauszeiger über die Seite, wird die Seite vollständig<br />
dargestellt.<br />
Am 5. Mai 2010 hat Google das Design an einigen Stellen verändert:<br />
• Auf der Startseite wird ein neues Logo angezeigt, das sich geringfügig vom alten unterscheidet.<br />
• Das Design der Schaltflächen „Google-Suche“ und „Auf gut Glück!“ sieht jetzt einheitlich aus. Früher bestimmte<br />
das Betriebssystem bzw. die Browsereinstellung dies.
Google 188<br />
• Auf der Ergebnisseite ist links eine neue Seitenleiste hinzugefügt worden. Von ihr aus kann man von der<br />
allgemeinen Websuche einfach zu speziellen Suchdiensten – wie zum Beispiel der Bildersuche - wechseln.<br />
Logos<br />
Google hat ein einfaches Logo. Auf ihm ist das Wort „Google“ zu sehen, geschrieben in vier Farben: blau für die<br />
beiden Buchstaben „G“, rot für das „o“ und „e“, gelb für das zweite „o“ und grün für das „l“. Das Logo wurde bisher<br />
einige Male leicht geändert. Hier die aktuelle und zwei ältere Versionen:<br />
Altes Logo Logo bis zum 5. Mai 2010 Aktuelles Logo<br />
Hintergrundbilder für die Startseite<br />
Seit dem 3. Juni 2010 bietet Google für Nutzer mit einem Google-Konto die Möglichkeit, statt des weißen<br />
Hintergrundes ein persönliches Hintergrundbild einzufügen. Am 10. Juni 2010 versuchte Google den ganzen Tag<br />
stündlich bestimmte Hintergrundbilder auf der Suchstartseite anzuzeigen. Diese Werbeaktion wurde aber vorzeitig<br />
abgebrochen, da die Nutzer von der Änderung irritiert waren. [10]<br />
Technik<br />
Hardware-Architektur<br />
Google Inc. betreibt weltweit eine Reihe von Rechenzentren, die jeweils die komplette Funktionalität der<br />
Suchmaschine enthalten. Eine Benutzeranfrage wird, durch das Domain Name System gesteuert, im Idealfall an das<br />
netztopologisch nächste Rechenzentrum – nur manchmal mit dem geographisch nächstgelegenen identisch – geleitet<br />
und von diesem beantwortet. Fällt ein Rechenzentrum komplett aus, können die verbleibenden Rechenzentren die<br />
Last übernehmen.<br />
Jedes Rechenzentrum besteht aus einem Computercluster. Die verwendeten Rechner sind IBM-kompatible Personal<br />
Computer, bestehen also aus preiswerten Standardkomponenten. Hier kommt das selbstentwickelte Google File<br />
System zum Einsatz, eine verteilte Architektur, bei der alle Daten mehrfach redundant auf verschiedenen Geräten<br />
gespeichert sind. Ist einer der Rechner oder nur eine Festplatte eines Rechners ausgefallen, werden die<br />
entsprechenden Daten von einer anderen Stelle im Cluster auf einen Ersatzrechner umkopiert und die ausgefallene<br />
Hardware-Komponente kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass Ausfälle entstehen. Das<br />
Gesamtsystem ist auch leicht skalierbar, da nach Bedarf immer weitere Rechner und Festplatten hinzugefügt werden<br />
können.<br />
Durch Ablage der einzelnen Datenstrukturen (Indizes, Dokumentenkopien, Verzeichnisse aller Art) auf<br />
verschiedenen Rechnern und die große Anzahl verfügbarer Einzelrechner lassen sich Anfragen sehr schnell<br />
beantworten, da durch die Parallelisierung der zu erledigenden Arbeit nur ein Bruchteil der Zeit benötigt wird, die<br />
ein einzelner Rechner benötigen würde – in der Tat beschäftigen sich bis zu 1000 Einzelrechner mit jeder<br />
Suchanfrage. Eine Antwortzeit von höchstens einer halben Sekunde wird als Richtwert angestrebt. Die schnelle<br />
Lieferung von Ergebnissen hatte auch frühzeitig zur Popularität von Google beigetragen. Die Konkurrenz ließ sich<br />
mit der Anfragebeantwortung oft mehr Zeit. Insbesondere bei inkrementellen Anfragen, also immer weiter<br />
verfeinerten Anfragen des Benutzers, der das jeweils vorige Suchergebnis berücksichtigt, ist die Zeitersparnis<br />
insgesamt deutlich spürbar. [11]
Google 189<br />
Software<br />
Als Betriebssystem wird eine funktionsreduzierte Variante der Linux-Distribution Red Hat verwendet. [12] Die<br />
Programmiersprachen C, C++ und Python spielen essentielle Rollen bei der Implementierung der proprietären<br />
Suchmaschinensoftware.<br />
MapReduce<br />
Der zentrale Aspekt aller verteilten Google-Anwendungen, allen voran die Indizierung des Internets und die Suche<br />
darin, ist der von Google entwickelte Algorithmus MapReduce für die automatisierte Parallelisierung von<br />
Arbeitsaufträgen in Clustern. [13] Der Entwickler muss bei diesem speziellen Programmierstil nur zwei Hooks<br />
implementieren, die, in Anlehnung an entsprechend benannte und ähnlich arbeitende Funktionen der<br />
LISP-Sprachfamilie, map und reduce genannt werden.<br />
Die Map-Funktion erzeugt dabei in allen entsprechend entworfenen Anwendungen aus dem gesamten Input (zum<br />
Beispiel der Gesamtheit aller betrachteten Webseiten) eine Liste von Zwischenresultaten in Form von Wertepaaren,<br />
die einen Schlüssel mit einem symbolischen Wert kombinieren. Zum Beispiel wird so für jedes Vorkommen von<br />
„Wert“ in einem Text ein Paar ('Wert','1') erzeugt – jedes mal, wenn die Funktion auf das Wort trifft. Die Menge der<br />
Zwischenresultate wird dann durch die Reduce-Funktion derart reduziert, dass mit jedem Schlüssel nur noch ein<br />
symbolischer Wert assoziiert ist, der sich aus der Menge aller symbolischen Werte für diesen Schlüssel in den<br />
Zwischenergebnissen ergibt. Eine typische Aufgabe wäre, unter Rückgriff auf das Beispiel weiter oben, alle<br />
(beispielsweise 43) Paare ('Wert','1') je Schlüssel zu einem einzigen Paar pro Schlüssel zu kombinieren – etwa<br />
('Wert','43'). [14]<br />
Die Leistung von MapReduce ist nun, dass alle anderen Aufgaben, die mit der Parallelisierung dieser Aufgaben<br />
zusammenhängen (und sich prinzipiell für alle solch parallelisierten Anwendungen wiederholen), vom Framework<br />
übernommen werden. Es kümmert sich um die Verteilung der Funktionalitäten, der Daten und Zwischenergebnisse<br />
und um das Einsammeln der Ergebnisse und beinhaltet zudem Maßnahmen zur Fehlerbehandlung (via redundanter<br />
oder wiederholter Ausführung) [15] [16] – etwa wenn ein einzelner Arbeiter-Rechner ausfällt oder so schlechte<br />
Leistungen zeigt, dass er die Fertigstellung des Gesamtergebnisses übermäßig verzögert.<br />
Google selbst setzt den Algorithmus in steigendem Maße für seine eigene Arbeit ein – nach Einführung von<br />
MapReduce im Jahre 2003 hatte sich die Anzahl der Produktionsanwendungen in der Code-Bibliothek von Google<br />
binnen zwei Jahren auf fast 1000 Anwendungen exponentiell vervielfacht. [17] In der zentralen Anwendung, dem<br />
Aufbau des Dokumenten-Indexes für die Suchmaschine selbst, sind 24 Instanzen von MapReduce hintereinander<br />
geschaltet. [18]<br />
Indexgröße<br />
Die ungefähre Anzahl der Dokumente im Index der Websuche wurde die ersten sieben Jahre unten auf der<br />
Hauptseite eingeblendet.
Google 190<br />
<strong>Jan</strong>uar 1998<br />
Zeitpunkt Ungefähre Anzahl<br />
(Unternehmensgründung)<br />
der<br />
Dokumente im Index<br />
25.000.000 [19]<br />
August 2000 1.060.000.000<br />
<strong>Jan</strong>uar 2002 2.073.000.000<br />
Februar 2003 3.083.000.000<br />
September 2004 4.285.000.000<br />
November 2004 8.058.044.651<br />
Juli 2008<br />
1.000.000.000.000 [20]<br />
Außerdem existierte im Juni 2005 nach eigener Aussage ein Index von 1.187.630.000 Bildern, einer Milliarde<br />
Usenet-Artikeln, 6.600 Katalogen und 4.500 Nachrichtenquellen.<br />
Seit dem siebten Geburtstag des Unternehmens Google im September 2005 wird die Größe des Index nicht mehr auf<br />
der Hauptseite angezeigt, da laut Eric Schmidt keine eindeutige Zählweise existiert. [21] Im Juli 2008 ermittelte<br />
Google nach eigenen Angaben [20] das Vorhandensein von mehr als einer Billion URLs im World Wide Web.<br />
Suchdienstleistungen für Portale<br />
Googles Suchtechnik wird auch an Internetportale lizenziert, um dort eine Websuche anbieten zu können, ohne dass<br />
Benutzer das Portal verlassen müssten.<br />
Google Appliance<br />
Mit der Google Appliance verkauft Google seine Suchtechnologie an Unternehmen, die sie im eigenen Intranet<br />
einsetzen möchten. Bei der Appliance handelt es sich um einen Server mit vorinstallierter Software, der im<br />
unternehmenseigenen Netz dieselbe Aufgabe übernimmt, die Google für das World Wide Web leistet. Dokumente<br />
werden im Index vorgehalten und Suchanfragen beantwortet.<br />
Zusatzfunktionen<br />
Google sucht Internetseiten als Hauptgebrauch, aber bietet auch andere Funktionen:<br />
Taschenrechner<br />
Bei Eingabe einfacher mathematischer Schreibweisen wie z. B. „2+5(4/5)^8“ gibt Google standardmäßig keine<br />
Seiten aus, in denen diese Formulierung vorkommt, sondern gibt das Ergebnis der Rechnung (= 2.8388608)<br />
zurück.<br />
Einheitenrechner<br />
Man kann auch Einheiten Umrechnen lassen: z. B. „inch in cm“, „usd in euro“, oder auch komplizierter<br />
„l/100km in miles/gallon“<br />
Rechtschreibprüfung<br />
Google liefert bei falsch geschriebenen Wörtern einen Vorschlag zur richtigen Schreibweise („Meinten Sie<br />
…“). Die Empfehlung beruht auf einem phonetischen, vollautomatisierten Vergleich, was teilweise zu<br />
abwegigen Vorschlägen führen kann.<br />
Adressen-Suche<br />
Wer eine Adresse bei der Google-Suche eingibt, bekommt diese sofort auf der Karte gezeigt.
Google 191<br />
Übersetzer<br />
Beim Eingeben von „Translate“ und einem beliebigen Wort übersetzt Google dieses automatisch.<br />
Folgende Funktionen stehen nicht in allen landesspezifischen Versionen von Google zur Verfügung. Unter anderem<br />
können sie in den Google-Mutationen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz verwendet werden:<br />
Zugauskunft<br />
Kinopläne<br />
Wetter<br />
Gibt man zwei Orte in die Suchleiste ein, schlägt Google einen aktuellen Fahrplan vor, der die nächsten<br />
Zugverbindungen zwischen den Orten anzeigt.<br />
Durch die Eingabe „Kino“ und dem entsprechenden Ort erhält man aktuelle Kinopläne aller ortsansässigen<br />
Kinos. Es werden dabei Angaben zu Film, Uhrzeiten, FSK und Genre gemacht.<br />
Ebenso lässt sich auch eine kurze Übersicht zu den Wetterverhältnissen anzeigen. Durch Eingabe von „Wetter“<br />
und dem Namen der Stadt erscheint der Wetterbericht für die kommenden drei Tage.<br />
Erweiterte Benutzung<br />
Es kann zusätzlich zu dieser einfachen Such-Syntax eine erweiterte Syntax in die Suchmaske eingegeben, bzw.<br />
größtenteils auch über die „erweiterte Suche“ zusammengeklickt werden. Folgende, teils undokumentierte<br />
Schlüsselbegriffe sind derzeit bekannt. Diese Schlüsselbegriffe werden durch einen Doppelpunkt „:“ gekennzeichnet.<br />
Google-Schlüsselbegriffe<br />
Schlüsselbegriff Funktionsweise<br />
cache: Gibt nur die von Google gespeicherten Seiten aus. Das kann zum Beispiel bei Portalen mit häufig wechselnden Inhalten nützlich<br />
sein. Der Link, den man bei Google findet, führt manchmal auf eine Seite, deren Inhalte sich inzwischen geändert haben oder gar<br />
gelöscht wurden. Die Inhalte sind aber über einen bestimmten Zeitraum noch bei Google gespeichert und können dort gelesen<br />
werden.<br />
define: Durchsucht Internet-Enzyklopädien wie Wikipedia und andere nach einer Definition des Suchbegriffes.<br />
filetype: oder<br />
ext:<br />
Sucht nach Dokumenten, mit bestimmten Dateiendungen. Beispiel: Geschäftsbericht filetype:xls . Möglich sind grundsätzlich<br />
alle Dateiendungen. Google kann derzeit aber nur in folgende Formate „reinschauen“: PS, PDF, AI, DOC, PPT, XLS, SWF,<br />
sowie alle textbasierten Dateien wie RTF, TXT, ASP, PHP, CGI, HTML, LOG, INI, JS usw.<br />
inanchor: Sucht nach den Begriffen nur in Links. Oftmals führt ein Link mit einer bestimmten Bezeichnung präziser zu einem Ziel, als<br />
wenn die Bezeichnung irgendwo im Text vorkommt.<br />
info: Gibt Informationen zu einer bestimmten Seite zurück. Die Informationen bestehen aus der Google-typischen Darstellung eines<br />
Suchergebnisses mit Titellink, Snippet und (Sub-) Domain sowie einer Reihe von Links zu Abfragen mit anderen<br />
Schlüsselbegriffen. Beispiel: info:google.com<br />
inurl: Gibt Seiten zurück, bei denen der Suchbegriff in der URL auftaucht. Beispiel: "Max Mustermann" inurl:impressum<br />
intitle: Sucht nach Dokumenten, bei denen der oder die Suchbegriffe nur im Titel der Datei vorkommen. Beispiel: intitle:"Bearbeiten<br />
von Google"<br />
intext: Sucht nach Dokumenten, bei denen der oder die Suchbegriffe nur im Text der Datei vorkommen. Beispiel: intext:"Bearbeiten<br />
von Google"<br />
link: Gibt alle Seiten aus, die auf eine bestimmte Seite verlinken. Beispiel: link:wikipedia.org<br />
Diese Ausgabe kann dazu verwendet werden, um den Page Rank zu optimieren oder verwandte Seiten zu finden.<br />
site: Mit diesem Schlüsselbegriff lässt sich die Suche auf eine bestimmte Domain eingrenzen, zum Beispiel falls eine Homepage<br />
keine eigene Suchfunktion hat (Beispiel: Desoxyribonukleinsäure site:de.wikipedia.org) oder zur Suche innerhalb einer<br />
Top-Level-Domain.<br />
related: Sucht nach ähnlichen Seiten (Beispiel: related:de.wikipedia.org)
Google 192<br />
Die angewendeten Suchformeln lassen sich auch in Form der URL, die Google bei einer Suche ausgibt, speichern<br />
bzw. wiederholen und verlinken. Weitere Funktionen bieten die zusätzlichen Google-Funktionen. [22]<br />
Ergebnisse<br />
Google zeigt zehn Suchergebnisse je Seite an. Die Darstellungsform eines Treffers kann sich unterscheiden,<br />
normalerweise wird der Titel, die Zusammenfassung und der Link angezeigt. Google schränkt die Anzeige von<br />
Treffern auf maximal 1000 ein.<br />
Einbettungen der Google-Suche<br />
• Die Google-Suche lässt sich über vorgefertigte Code-Fragmente in eine Webseite einbinden. [23]<br />
• Browser-Erweiterungen (Add-ons):<br />
• Die Google Toolbar ist für die Webbrowser Internet Explorer und Mozilla Firefox verfügbar.<br />
• Für Mozilla, Opera und Konqueror stehen spezielle search-plugins für die Einbettung in vorhandene<br />
Suchleisten zur Verfügung, auch für die Kontext-sensitive Verwendung.<br />
• Einbettungen gibt es auch für Textverarbeitungsprogramme wie StarOffice/OpenOffice.org.<br />
• In dem Google-eigenen Browser Google Chrome ist die Suche in die Adressleiste bereits eingebettet.<br />
Easter Eggs<br />
Die Programmierer haben in den Suchalgorithmen Easter Eggs, also scherzhafte Überraschungen, versteckt. Einige<br />
Beispiele:<br />
• Bei der Suche nach „answer to life, the universe and everything“ erhält man das Ergebnis 42. Dies ist eine<br />
Anspielung auf Douglas Adams' Werk Per Anhalter durch die Galaxis, in dem 42 die Antwort auf die Frage „nach<br />
dem Leben, dem Universum und allem“ ist.<br />
• sucht man nach „number of horns on a unicorn“ („Anzahl der Hörner eines Einhorns“) wird ebenfalls eine<br />
mathematische Berechnung angezeigt, natürlich mit dem Ergebnis 1.<br />
• die Suche nach „once in a blue moon“ zeigt eine mathematische Berechnung mit dem Ergebnis 1.16699016 × 10 -8<br />
Hertz.<br />
• Die Sprachversionen von Google werden auch in klingonisch, elmer fudd, pirate, hacker und bork angeboten.<br />
• Bei der Suche nach „ascii art“ wird das Google-Logo als ASCII-Art dargestellt.<br />
• Wenn man auf der englischen Google-Seite nach „recursion“ (Rekursion) sucht, wird das Wort als „Meinten Sie<br />
…“-Vorschlag angezeigt, obwohl es richtig geschrieben ist. Klickt man nun darauf, bekommt man dieselbe Seite<br />
wieder angezeigt, wieder mit dem selben Vorschlag.<br />
• Bei der Suche nach „Anagramm“ erhält man den „Meinten Sie …“-Vorschlag „Mama rang“.<br />
• In der linken unteren Ecke auf der Suchstartseite befindet sich ein Menü zur Auswahl des Hintergrundes. (siehe<br />
Hintergrundbilder für die Startseite)<br />
• Wenn man bei Google zum Beispiel „WM“ oder „Fußball WM 2010“ eingibt, ist der „Gooooogle“-Schriftzug am<br />
unteren Ende der Seite, mit dem man die Ergebnisseite auswählen kann, in „Goooooal“ geändert, was auf englisch<br />
„Tor“ heißt.<br />
Google Doodle<br />
Zu besonderen Anlässen, wie dem Tag der Erde oder dem Jahrestag des ersten Fluges der Montgolfière, wird das<br />
Google-Logo seit 2000 von dem Mitarbeiter Dennis Hwang verändert. Diese themenbasierten Logos werden auch<br />
Google Doodle (engl. Gekritzel) genannt. Zusätzlich sind diese Logos statt mit der Google-Homepage mit einer<br />
Suchanfrage mit dem entsprechenden Thema als Suchtitel verlinkt. Normalerweise ist ein Google-Doodle so lange<br />
wie der Anlass gegeben ist auf der Google-Seite zu sehen. Bei der Pac-Man-Präsentation zum 30. Geburtstag blieb<br />
es aber 3 Tage dort stehen.
Google 193<br />
Zur Fußball-Europameisterschaft 2008 veranstaltete Google erstmals in Deutschland einen Wettbewerb namens<br />
Doodle4Google, bei dem Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 aufgerufen wurden, ein Logo zur EM zu<br />
gestalten. Das Gewinnerlogo wurde am Tag des EM-Finales auf der deutschen Google-Startseite gezeigt. In anderen<br />
Ländern gab und gibt es ähnliche Wettbewerbe. Weitere Wettbewerbe in Deutschland folgten, so veranstaltete<br />
Google zum 20-jährigen Jubiläum des Tags der deutschen Einheit erneut einen Wettbewerb, bei dem das Thema<br />
Deutschland im Mittelpunkt stehen sollte. Der Wettbewerb wird auch zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010<br />
veranstaltet. Der Gewinner war am 13. Mai 2010 auf der Google-Startseite von Deutschland zu sehen. Erstmals<br />
startete auch ein internationaler Wettbewerb, wo alle Gewinner der einzelnen Länder mitspielten. Der Gewinner<br />
dieses Wettbewerbs, war am 11. Juli 2010 mit seinem Doodle auf den Google-Startseiten weltweit zu sehen.<br />
Anlässlich des 30. Geburtstags des Arcade-Spiels Pac-Man wurde vom 21. bis 23. Mai 2010 als Doodle erstmals ein<br />
interaktives Spiel präsentiert. Die in JavaScript programmierte Version des Klassikers umfasste alle 255 Level des<br />
Spiels, inklusive einer Zwei-Spieler-Version mit Ms. Pac-Man. Die Schaltfläche „Auf gut Glück“ wurde in der Zeit<br />
in „Münze einwerfen/Insert Coin“ umbenannt, mit der das Spiel gestartet wurde.<br />
Manipulation der Suchergebnisse<br />
Aufgrund seiner bedeutenden Marktposition ist Google Hauptziel von Suchmaschinen-Spamming. Dabei wird<br />
versucht, gute Positionen bei möglichst vielen Suchbegriffen zu erzielen. Diese Suchbegriffe haben oft nichts mit<br />
dem eigentlichen Inhalt der Seite zu tun. Manipulationen, die zum Zweck haben, das Ranking von Websites speziell<br />
bei Google zu verbessern, werden auch als Google-Spamming bezeichnet. Versuche, konkurrierende Internetseiten<br />
aus den Google-Ergebnissen herauszukegeln, bezeichnet man als Google Bowling.<br />
Google-Bombing<br />
Bei einer Google-Bombe werden die Google-Suchergebnisse für eine bestimmte Webseite durch vielfaches Setzen<br />
von Links manipuliert. Google-Bomben werden vielfach eingesetzt, um Webseiten bestimmter Personen gezielt mit<br />
oft diffamierenden Schlagworten in Verbindung zu bringen.<br />
Erstmals im größeren Umfang öffentlich wahrgenommen wurde die Möglichkeit der Suchmaschinenmanipulation im<br />
Zusammenhang mit einer Google-Bombe, die sich auf den amerikanischen Präsidenten George W. Bush bezog. Der<br />
Suchbegriff „miserable failure“ [24] (zu Deutsch: „klägliches Scheitern“ oder „jämmerlicher Versager“) wurde von<br />
Bush-Gegnern mit seiner offiziellen Biografie verknüpft. Im Gegenzug versuchten Bush-Unterstützer dasselbe mit<br />
Michael Moore. Die Plätze wechselten seither gelegentlich.<br />
Unlautere Suchmaschinen-Optimierung<br />
Im <strong>Jan</strong>uar 2006 wurde bekannt, dass Google stärker gegen unseriöse Methoden bei der Optimierung von<br />
internationalen Webseiten vorgehen will. Als erste Konsequenz des von Google-Mitarbeiter Matt Cutts [25]<br />
angekündigten verschärften Kampfes gegen Spam in Deutschland und anderen nicht-angelsächsischen Ländern,<br />
entfernte die Suchmaschine die Online-Fahrzeugbörse Automobile.de und den Fahrzeughersteller BMW aus ihrem<br />
Index. [26] Ihnen wurde vorgeworfen, durch massiven Einsatz von Keywords (Spam), Doorway-Pages und<br />
JavaScript-Weiterleitungen Suchergebnisse zum eigenen Vorteil unlauter optimiert zu haben. Die Seite von BMW<br />
wurde bereits nach wenigen Tagen wieder in den Index aufgenommen, nachdem der Betreiber die strittigen<br />
Doorway-Pages entfernt hatte. [27]<br />
Google ändert seine Algorithmen zur Bestimmung des Rankings regelmäßig ab, um Missbrauch zu erschweren.
Google 194<br />
Ergebnisfilterung in Deutschland<br />
Bereits seit einigen Jahren sind Suchergebnisse der Suchmaschine Google von Websites von verbotenen<br />
Meinungsäußerungen hauptsächlich politischer Natur bereinigt. Anfangs wurden wegen Urheberrechtsverletzung<br />
auch Seiten der Scientology-Kirche herausgefiltert. Mittlerweile entfernt Google alle Inhalte, für die jemand bei<br />
Google eine infringement notification (engl.: etwa „Rechtsverletzungsbescheid“) gemäß dem amerikanischen Digital<br />
Millennium Copyright Act einreicht. [28] Um wie viele Seiten es sich handelt und inwieweit derzeit eine Ausweitung<br />
auf andere Inhalte wie z. B. kinderpornografische oder politisch extremistische Inhalte stattfindet, ist nicht<br />
bekannt. [29] [30] Die Filtertechnik von Google wird auch als SafeSearch-Filtertechnik bezeichnet. Dieser Name<br />
wurde erstmalig von Google verwendet. Weitere Suchmaschinen bieten heute diese Filtertechnik an, um<br />
jugendgefährdende und pornografische Inhalte auszufiltern.<br />
Der Benutzer wird über einen Hinweis auf die Filterung der Suchergebnisse „aus Rechtsgründen“ aufmerksam<br />
gemacht. Dabei wird auf eine Erläuterung verwiesen, dass „von einer zuständigen Stelle in Deutschland mitgeteilt<br />
wurde, dass die entsprechende URL unrechtmäßig ist“. Welche zuständige Stelle das ist oder aufgrund welcher<br />
gesetzlichen Grundlage die Entfernung erfolgte, wird nicht erläutert. [31]<br />
Kritik an Google<br />
Die Suchmaschine Google und Google Inc., die nach Gründung anfänglich eine sehr gute Presse hatten, werden in<br />
jüngerer Zeit häufig aufgrund von Datenschutzproblemen und allein schon aufgrund der monopolähnlichen Stellung<br />
im Suchmaschinenmarkt in Deutschland kritisiert.<br />
Siehe auch: Google Inc.<br />
Literatur<br />
• Tara Calishain, Rael Dornfest: Google Hacks. 100 Insider-Tricks & Tools. O'Reilly, Beijing 2003, ISBN<br />
978-3-8972-1362-3.<br />
• Marcel Machill, Markus Beiler, Martin Zenker: Journalistische Recherche im Internet. Bestandsaufnahme<br />
journalistischer Arbeitsweisen in Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und Online. In: Schriftenreihe Medienforschung<br />
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. 60, Vistas, 2008, ISBN 978-3-8915-8480-4 (http:/ / www.<br />
lfm-nrw. de/ downloads/ veranstaltungen/ zus-jourrech. pdf).<br />
• Anja Sauerwald, Michael Weckerlin: Google-Suche & Google Earth. 2. Auflage. Knowware, 2007, ISBN<br />
978-8-7913-6434-1.<br />
• David A. Vise, Mark Malseed: The Google Story. Bantam Doubleday Dell, New York 2005, ISBN<br />
978-0-5538-0457-7.<br />
• Gerald Reischl: Die Google-Falle. Die unkontrollierte Weltmacht im Internet. 5. Auflage. Carl Ueberreuter<br />
Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-8000-7323-8.<br />
• Lars Reppesgaard: Das Google-Imperium. Murmann-Verlag GmbH, Hamburg 2008, ISBN 978-3-8677-4046-3.<br />
• Kai Lehmann, Michael Schetsche, Die Google-Gesellschaft. Vom digitalen Wandel des Wissens, (2. Auflage),<br />
Bielefeld: transcript 2007, ISBN 978-3-89942-780-6
Google 195<br />
Weblinks<br />
Offizielle Seiten<br />
• Google [1]<br />
• Liste von lokalen Google-Domains z.B. Deutschland, Österreich und Schweiz [32]<br />
• Google.org [33]<br />
• Offizieller Google-Blog [34] (englisch)<br />
Artikel über Google<br />
• Artikel zu Google und Anwendungen bei Dr. Web [35]<br />
• Webseite zum Buch "Die Google-Falle" [36]<br />
• Aktuelle Nachrichten bezüglich Google im GoogleWatchBlog [37]<br />
• Google Guide [38]<br />
• Google Watch [39] (Kritik, englisch)<br />
Presseberichte<br />
• „Die Welt ist keineswegs alles, was Google auflistet“ [40] , Telepolis, 25. Oktober 2002<br />
• „Google: Der alleswissende Gigant“ [41] , Tagesschau, 26. <strong>Jan</strong>uar 2006<br />
• „Weltmacht Google“ [42] , stern, 22. Mai 2006, Dossier<br />
• „Internet: Die wachsende Macht der Suchmaschinen“ [43] , FAZ, 28. Juni 2006<br />
• „Hermann Maurer vs. Google“ [44] , ORF, futurezone.ORF.at, 3. Dezember 2007<br />
• „neues.Spezial: Die Welt ist eine Google!“ [45] , 3sat, 30. März 2008<br />
• „Google, ein 100.000-Dollar-Missverständnis“ [46] , Heise online, 7. September 2008<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. google. com/ ncr<br />
[2] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,619398,00. html<br />
[3] http:/ / de. statista. com/ statistik/ daten/ studie/ 13117/ umfrage/ suchmaschinen-nach-anteil-der-suchanfragen-im-juni-2009/<br />
[4] http:/ / www. webhits. de/ deutsch/ index. shtml?/ deutsch/ webstats. html<br />
[5] Google Corporate Information: Google Milestones. ( (http:/ / www. google. com/ corporate/ history. html), abgerufen am 12. April 2010).<br />
[6] Der Triumph der grossen Zahl (http:/ / www. nzz. ch/ nachrichten/ medien/ der_triumph_der_grossen_zahl_1. 718652. html). Neue Zürcher<br />
Zeitung (25. April 2008). Abgerufen am 6. Mai 2008.<br />
[7] Peter Zschunke: Googeln im neuen Duden. Artikel bei Stern.de http:/ / www. stern. de/ computer-technik/ computer/ ?id=529233 Abgerufen<br />
am 7. Februar 2007<br />
[8] Nie mehr „googeln“ - NachrichtenWebwelt - WELT ONLINE. ( (http:/ / www. welt. de/ webwelt/ article235996/ Nie_mehr_googeln. html),<br />
abgerufen am 8. Februar 2008).<br />
[9] Google: Technology Overview (http:/ / www. google. com/ corporate/ tech. html)<br />
[10] http:/ / www. golem. de/ 1006/ 75730. html Google bricht Werbeaktion ab<br />
[11] Web Search for a Planet: The Google Cluster Architecture (http:/ / labs. google. com/ papers/ googlecluster. html)<br />
[12] Susan Kuchinskas: Peeking Into Google. Artikel, 2. März 2005, Internet News http:/ / www. internetnews. com/ xSP/ article. php/ 3487041<br />
Abgerufen am 7. Februar 2007.<br />
[13] MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce. html)<br />
[14] Datenflussgraph MapReduce (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce-osdi04-slides/ index-auto-0007. html)<br />
[15] Fault-Tolerance: Re-Execution in MapReduce (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce-osdi04-slides/ index-auto-0021. html)<br />
[16] Redundant Execution in MapReduce (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce-osdi04-slides/ index-auto-0022. html)<br />
[17] Anwendung von MapReduce im Google Source Tree (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce-osdi04-slides/ index-auto-0005. html)<br />
[18] 24 sequentielle Instanzen von MapReduce im Production Indexing System (http:/ / labs. google. com/ papers/ mapreduce-osdi04-slides/<br />
index-auto-0029. html)<br />
[19] Internet Archive Wayback Machine: Eintrag http:/ / google. com. ''& #32;( (http:/ / web. archive. org/ web/ */ google. com), abgerufen am<br />
8. Februar 2008).<br />
[20] Official Google Blog: We knew the web was big... (http:/ / googleblog. blogspot. com/ 2008/ 07/ we-knew-web-was-big. html)
Google 196<br />
[21] Elinor Mills: Google to Yahoo: Ours is bigger. 26. September 2005. Englisch. http:/ / news. com. com/ Google+ touts+ size+ of+ its+<br />
search+ index/ 2100-1038_3-5883345. html<br />
[22] Google-Funktionen: Übersicht http:/ / www. google. at/ intl/ de/ features. html<br />
[23] Google-Link: http:/ / www. google. at/ intl/ de/ searchcode. html<br />
[24] Google-Suche: miserable failure. ( (http:/ / www. google. com/ search?q=miserable+ failure), abgerufen am 8. Februar 2008).<br />
[25] Matt Cutts: SEO Mistakes: Spam in other languages. ( (http:/ / www. mattcutts. com/ blog/ seo-mistakes-spam-in-other-languages/ ),<br />
abgerufen am 8. Februar 2008).<br />
[26] Google setzt BMW vor die Tür - Golem.de. ( (http:/ / www. golem. de/ 0602/ 43155. html), abgerufen am 8. Februar 2008).<br />
[27] Google findet bmw.de wieder - Golem.de. ( (http:/ / www. golem. de/ 0602/ 43211. html), abgerufen am 8. Februar 2008).<br />
[28] Google: Digital Millennium Copyright Act (DMCA) – Benachrichtigung über eine Urheberrechtsverletzung in der Websuche und allen<br />
anderen Produkten. (http:/ / www. google. com/ dmca. html#notification). Abgerufen am 19. April 2009.<br />
[29] Sascha Zäch: Google zensiert Suchresultate (http:/ / www. pctipp. ch/ news/ 22353/ google_zensiert_suchresultate. html). PCtipp, 24.<br />
Oktober 2002, abgerufen am 19. April 2009.<br />
[30] Burkhard Schröder: Google filtert: Zensur bei Suchmaschinen und jugendschutz.net (http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 12/ 12948/ 1.<br />
html). Telepolis, 22. Juli 2002, abgerufen am 19. April 2009.<br />
[31] German regulatory body reported illegal material (http:/ / www. chillingeffects. org/ notice. cgi?sID=815). 14. Dezember 2005, abgerufen<br />
am 19. April 2009.<br />
[32] http:/ / www. google. com/ language_tools?hl=de<br />
[33] http:/ / google. org/<br />
[34] http:/ / googleblog. blogspot. com/<br />
[35] http:/ / www. drweb. de/ google/ index. shtml<br />
[36] http:/ / www. googlefalle. com/<br />
[37] http:/ / www. googlewatchblog. de/<br />
[38] http:/ / petergasser. com/ de/ google-guide. html<br />
[39] http:/ / www. google-watch. org/<br />
[40] http:/ / www. heise. de/ tp/ deutsch/ inhalt/ te/ 13486/ 1. html<br />
[41] http:/ / www. tagesschau. de/ aktuell/ meldungen/ 0,1185,OID5129496,00. html<br />
[42] http:/ / www. stern. de/ computer-technik/ 561422. html?nv=redir.<br />
[43] http:/ / www. faz. net/ s/ RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/<br />
Doc~E55F612B4A2174C118F97505129AA9777~ATpl~Ecommon~Scontent. html<br />
[44] http:/ / futurezone. orf. at/ it/ stories/ 240195/<br />
[45] http:/ / www. zdf. de/ ZDFmediathek/ content/ 458378?inPopup=true/<br />
[46] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 115569
Apple 197<br />
Apple<br />
Unternehmensform Incorporated<br />
ISIN US0378331005<br />
Apple Inc.<br />
Gründung 1976 (in Kalifornien)<br />
Unternehmenssitz Cupertino, Kalifornien<br />
München<br />
Wien<br />
Zürich<br />
Cork (europäische Hauptzentrale)<br />
Unternehmensleitung Steve Jobs (CEO),<br />
Timothy D. Cook (COO)<br />
Mitarbeiter 32.000 und 3.100 Aushilfskräfte (in<br />
Vollzeit-Äquivalenten)<br />
(27. Sep. 2008)<br />
Umsatz 42,905 Mrd. US-Dollar (2009)<br />
Branche Hardware-und Softwarehersteller<br />
Produkte Hardware<br />
Software<br />
Smartphone<br />
Tablet-PC<br />
Website<br />
www.apple.com [1]<br />
Apple Inc. [ˈæpəlˌɪŋk] (früher Apple Computer Inc.) ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien<br />
(Vereinigte Staaten), das Computer und Unterhaltungselektronik sowie Betriebssysteme und Anwendungssoftware<br />
herstellt. Apple gehörte in den 1970er-Jahren zu den ersten Herstellern von Personal Computern und trug zu ihrer<br />
Verbreitung bei. Bei der kommerziellen Einführung der grafischen Benutzeroberfläche und der Maus in den<br />
1980er-Jahren nahm Apple eine Vorreiterrolle ein. Mit dem Erscheinen des iPods 2001, des iPhones 2007 und des<br />
iPads 2010 weitete Apple sein Geschäft nach und nach auf andere Produktbereiche aus. Laut der<br />
Marktforschungsgruppe Millward Brown liegt Apple mit einem Wert von rund 83,15 Milliarden US-Dollar auf Platz<br />
drei der wertvollsten Marken der Welt. [2]
Apple 198<br />
Geschichte<br />
Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und<br />
Ronald Wayne gegründet. Das Startkapital von 1750 US-Dollar kam<br />
aus dem Verkauf von Jobs' VW-Bus und dem<br />
Hewlett-Packard-Taschenrechner von Wozniak. [3]<br />
Steve Wozniak entwarf die ersten Rechner in Los Altos im heute noch<br />
bekannten „Silicon Valley“, die Steve Jobs und er in der Garage<br />
zusammenbauten. Dort entstand 1976 auch der Apple I, der für<br />
666,66 US-Dollar bei der Computerkette Byte Shop verkauft wurde.<br />
Der erste Werbespruch lautete Byte into an Apple. Einige hundert<br />
Exemplare des Apple I wurden verkauft. Anfang 1977 wurde Apple<br />
Der Apple I, Smithsonian Museum<br />
Computer in eine Gesellschaft umgewandelt und die Partnerschaft der beiden Unternehmensgründer Steve Jobs und<br />
Steve Wozniak mit Ron Wayne aufgelöst.<br />
Nach dem verhältnismäßig geringen Erfolg des Apple I folgte der Apple II, dessen Entwicklung aus den<br />
Verkaufserlösen finanziert wurde. Dieser verkaufte sich bis 1985 knapp zwei Millionen Mal und gilt als einer der<br />
erfolgreichsten Personal-Computer seiner Zeit. Im Gegensatz zur heute bekannten Apple-Benutzeroberfläche waren<br />
der Apple I und II noch kommandozeilenorientiert, und die Portierung auf den Apple IIgs fiel der Marktausrichtung<br />
auf die Macintosh-Produktlinie zum Opfer, obgleich der Apple IIgs noch viele Jahre nach dessen Produktionsende<br />
und Verkauf bis in das Jahr 1993 bezüglich seiner Audiofähigkeiten ein leistungsfähiger PC blieb. Der Apple II war<br />
ein offenes System, in das Fremdhardware eingebaut werden konnte.<br />
Die von Rank Xerox im Xerox PARC entwickelte grafische Benutzeroberfläche (GUI = Graphical User Interface)<br />
inspirierte Apple diese mit Lisa (1983) und der Sparausgabe des Lisa, dem Macintosh (1984) auf dem entstehenden<br />
PC-Massenmarkt einzuführen. Das Management von Rank Xerox verpasste diese Chance.<br />
Grafische Benutzeroberfläche von Apple<br />
Bill Atkinson, ein ehemaliger Softwareentwickler Apples, motivierte<br />
Steve Jobs auf Drängen Jef Raskins hin, das Xerox Palo Alto Research<br />
Center (PARC) zu besuchen. Dort wurde Jobs vor allem der Prototyp<br />
eines Mesa-Entwicklungssystems gezeigt. Xerox hatte bereits mit dem<br />
ALTO (1973) und dem Star (1981) erste Rechner mit grafischer<br />
Benutzeroberfläche (GUI) entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt hatte<br />
Xerox keine Verwendung mehr für diese Technik. [4] Nach einer<br />
Präsentation für seine Entwickler sicherte sich Steve Jobs die Rechte<br />
von PARC an der grundlegenden Idee des GUI, da PARC sich vor<br />
allem als Forschungszentrum verstand und kein weiteres Interesse an<br />
Das LISA OS, eines der ersten Fenstersysteme<br />
eigenem Verkauf und Vermarktung hatte. Apple entwickelte aus dieser Idee das erste kommerzielle Betriebssystem<br />
mit GUI.<br />
Die meisten Merkmale und Prinzipien jeder modernen grafischen Benutzeroberfläche für Computer, wie sie heute<br />
gebräuchlich sind, sind Apple-Entwicklungen (Pull-down-Menüs, die Schreibtischmetapher, Drag and Drop,<br />
Doppelklick, der Papierkorb). Die Behauptung, Apple habe seine GUI der von Xerox nachgeahmt, ist ein ständiger<br />
Streitpunkt; es existieren jedoch gravierende Unterschiede zwischen einem Alto von Xerox und dem Macintosh.<br />
Apple hat das GUI zum Human Interface für die einfache Bedienung eines Computers entwickelt und für alle<br />
Programmierer, die Anwendungen für Apple-Rechner entwickeln, erstmals die Human Interface Guideline als<br />
Vorgabe für die Gestaltung von Benutzeroberflächen definiert. So wurde sichergestellt, dass alle Anwendungen über<br />
ein konsistentes Aussehen und eine gleichartige Bedienung (Menüstruktur) verfügen (Look & Feel).
Apple 199<br />
Mac-OS-Nachfolger<br />
Mitte der 1990er-Jahre steckte Apple in einer tiefen Krise – das Unternehmen stand kurz vor dem Ruin oder einer<br />
feindlichen Übernahme. Ein dringliches Problem war dabei, dass Apples Betriebssystem als veraltet betrachtet<br />
wurde, sodass sich Apple nach Alternativen umzusehen begann. Nach dem Scheitern von Pink [5] und der<br />
Ausgliederung an Taligent scheiterte der zweite Anlauf für ein modernes Betriebssystem mit dem Codenamen<br />
Copland. Auch das 1992 begonnene Projekt Star Trek, die Portierung von Mac OS auf x86-Prozessoren, wurde<br />
eingestellt. Nun sah sich Apple gezwungen, Ausschau nach einem für die eigenen Zwecke verwendungsfähigen<br />
Nachfolger für das eigene Betriebssystem zu halten, denn das Nachfolgeprojekt Gershwin kam nicht über die<br />
Konzeptionsphase hinaus. Apple verhandelte über den Kauf des Unternehmens Be Incorporated, mit der das auf<br />
Macs lauffähige Betriebssystem BeOS zu übernehmen gewesen wäre. Die Übernahme scheiterte im November 1996,<br />
da der frühere Apple-Manager und Chef von Be, Jean-Louis Gassée, im Falle einer Übernahme 300 Mio. US-Dollar<br />
und einen Sitz im Vorstand verlangte. Da Geschäftsführer Gil Amelio versprochen hatte, bis zur MacWorld im<br />
<strong>Jan</strong>uar 1997 die zukünftige Strategie in Bezug auf das Mac OS zu verkünden, musste schnell eine Alternative<br />
gefunden werden. Überraschend übernahm Apple noch im Dezember 1996 das Unternehmen NeXT des<br />
Apple-Gründers Steve Jobs und deren Betriebssystem NeXTStep/OPENSTEP für 400 Mio. US-Dollar. Dieses sollte<br />
die Grundlage für die nachfolgende Generation des Apple-Betriebssystems werden.<br />
Um die Basis des neuen Systems schneller und günstiger entwickeln zu können, wurde die Entwicklung dieser unter<br />
eine quelloffene Lizenz gestellt, die erst in der späteren Version 2.0 als Lizenz freier Software von der Free Software<br />
Foundation anerkannt wurde. Um eine Veröffentlichung unter einer quelloffenen Lizenz auf legalem Wege zu<br />
ermöglichen, musste das System von allen Original-UNIX-Codezeilen gereinigt werden, da der damalige Besitzer<br />
sämtlicher Rechte an UNIX AT&T keine Veröffentlichung des UNIX-Quellcodes mehr gestattete. Da diese Aufgabe<br />
einige Jahre zuvor bei der Distribution BSD vollzogen worden war, bot es sich an, die ursprünglich aus 4.4BSD<br />
stammenden Daemons und Server gegen ihre Nachfolger aus 4.4BSDlite (vollkommen von UNIX-Code bereinigte<br />
Neuveröffentlichung von BSD, auf der alle modernen BSD-Derivate basieren) oder dessen mittlerweile erschienenen<br />
Derivaten NetBSD und FreeBSD auszutauschen. Der Kernel wurde gegenüber NeXTStep umfassend überarbeitet.<br />
Während NeXTStep noch auf einem reinen Mach-Microkernel basierte, setzt das neue Apple-Betriebssystem auf<br />
einen Hybridkernel, dabei werden wieder einige Funktionen in den Kernel integriert, allerdings nicht so viele wie bei<br />
einem monolithischen Kernel. Als Basis für den XNU getauften Kernel wurde weiterhin Mach verwendet und mit<br />
Teilen des monolithischen FreeBSD-Kernels ergänzt. Dieses Basis-System trägt den Projektnamen Darwin und ist<br />
nicht zuletzt der Grund für die theoretische Resistenz gegen Hackerangriffe von außen.<br />
Darüber hinaus wurde die API von OpenStep weiterentwickelt und wird durch Cocoa umgesetzt. Mit Carbon wurde<br />
eine Programmbibliothek integriert, die unter den neuen Systemen und Mac OS 8 und OS 9 die gleichen<br />
Programmierschnittstellen zur Verfügung stellt und es somit ermöglicht, Programme zu schreiben, die in beiden<br />
Versionen lauffähig sind. Das Desktop Environment namens Aqua wurde neu entworfen und gilt mit dem Konzept<br />
von Sheets and Drawers, der Darstellung von Bildschirminhalten durch Quartz und der hardwarebeschleunigten<br />
Darstellung von Bildschirminhalten durch Quartz Extreme nach Apples eigenen Angaben als fortschrittlichste<br />
Benutzeroberfläche der Welt. Mittlerweile haben hier sowohl Linux als auch Windows aufgeholt. Diese unter<br />
proprietären Lizenzen veröffentlichten Systemteile bilden zusammen mit dem als freie Software veröffentlichten<br />
Darwin das neue Mac OS, das als Mac OS X in den Handel kam (das „X“ steht für die römische Zahl 10).<br />
Mit der Übernahme von NeXT zog bei Apple eine neue Unternehmenskultur ein. Steve Jobs, in den 1980ern nach<br />
zahlreichen Beschwerden und unternehmensinternen Reibereien von dem von ihm mitgegründeten Unternehmen<br />
vergrault, nun Chief Executive Officer (CEO) von NeXT, wurde 1997 wieder Unternehmenschef von Apple. Avie<br />
Tevanian, ein NeXT-Mitarbeiter, übernahm die Entwicklungsabteilung. Jobs beendete die Lizenzierung des<br />
Betriebssystems an andere Hersteller (zum Beispiel Power Computing) und stellte die Produktion des Newton ein.<br />
Mit der Einführung des Einsteigerrechners iMac führte Apple 1998 eine neue Gestaltung seiner Rechner ein: Sie<br />
waren fortan transparent und farbenfroh. Jonathan Ive, der Gestalter des iMac, wurde Chef der Gestaltungsabteilung
Apple 200<br />
bei Apple.<br />
Nachdem vorher die Rechner der Performa-Produktreihe als günstige Einsteiger-PCs vermarktet worden waren, galt<br />
eine neue Produktlinienstrategie: Künftig sollte es zwei Rechnerlinien geben, eine für Heimanwender und eine für<br />
Profis und in jeder Rechnerlinie je ein Gerät für den mobilen und eines für den stationären Einsatz, also insgesamt<br />
vier Rechnertypen. Diese vier Produktlinien sind das MacBook (der Nachfolger des iBook) und der iMac für die<br />
Heimanwender sowie das MacBook Pro (der Nachfolger des PowerBook) und der Mac Pro (früher PowerMac) für<br />
Profis. Um die Differenz zwischen steigenden Anforderungen im Heimbereich und der Nachfrage nach preiswerten<br />
Rechnern für das Bildungssegment auszugleichen, wurde von 2002 bis 2006 der eMac angeboten. Dieser wurde<br />
2006 von einer neuen Variante des iMac abgelöst.<br />
2005 erweiterte Apple die Produktreihe mit dem Mac mini in den unteren Preisbereich. Er zielt unter anderem auf<br />
Nutzer von Intel-kompatiblen Computern, die den Kaufentscheid vor allem anhand des Preises treffen.<br />
Am 6. Juni 2005 gab Steve Jobs bekannt, dass Apple die Macintosh-Produktlinie in den Jahren 2006 und 2007 nach<br />
und nach auf Prozessoren von Intel umstellen wolle. Bislang hatte Apple PowerPC-Prozessoren eingesetzt, die von<br />
IBM und Freescale (vorher Motorola) gefertigt wurden. Im <strong>Jan</strong>uar 2006 schließlich führte Apple mit dem MacBook<br />
Pro als Nachfolger des PowerBook ein Profi-Notebook sowie einen neuen iMac mit Intel-Core-Duo-Prozessoren ein.<br />
Kurze Zeit später folgte der Mac mini, in dem neben dem Intel Core Solo Intel-Core-Duo-Prozessoren verbaut<br />
werden. Mitte Mai kam der iBook-Nachfolger MacBook auf den Markt. Mit der Einführung des Mac Pro am 7.<br />
August 2006 wurde der Wechsel zu Intel-Prozessoren abgeschlossen.<br />
Am 9. <strong>Jan</strong>uar 2007 verkündete Apple im Rahmen der Macworld San Francisco einen tiefgreifenden Wechsel der<br />
Unternehmenspolitik. Im Zuge der Veröffentlichung des Apple TV und des iPhone im März und Juni 2007 begann<br />
Apple wesentlich mehr im Bereich der Unterhaltungselektronik zu avancieren. Aus diesem Grund wurde der Name<br />
des Unternehmens von ehemals Apple Computer Inc. auf Apple Inc. umfirmiert. Das iPhone bildet, nach der<br />
vorangegangenen Entwicklung des iTunes-Medienangebotes, eine weitere Basis Apples abseits des Mac-Geschäftes.<br />
Corporate Identity<br />
Entstehung des Namens<br />
Der Name „Apple Computer“ war die Idee von Steve Jobs, als sie das Unternehmen gründeten, doch Steve Wozniak<br />
war mit dem Namen nicht einverstanden. Jedoch hatten sie sich eine Frist von fünf Monaten für die Gründung ihres<br />
Unternehmens gegeben, und da ihnen kein anderer Name einfiel, meldete Jobs das Unternehmen als „Apple<br />
Computer“ an. Von Steve Jobs selbst gibt es dazu folgendes Zitat:<br />
“I was actually a fruitarian at that point in time. I ate only fruit. Now I'm a garbage can like everyone else. And<br />
we were about three months late in filing a fictitious business name so I threatened to call the company ‘Apple<br />
Computer’ unless someone suggested a more interesting name by five o'clock that day. Hoping to stimulate<br />
creativity. And it stuck. And that's why we're called ‘Apple’.”<br />
„Damals war ich tatsächlich noch Frutarier, aß nur Obst. Mittlerweile bin ich, wie jeder andere auch, ein<br />
Abfalleimer. Wir waren damals mit der Anmeldung unseres Unternehmensnamens drei Monate im Verzug,<br />
und ich drohte, das Unternehmen ‚Apple Computer‘ zu nennen, falls bis fünf Uhr niemandem ein<br />
interessanterer Name einfällt. Ich hoffte, so die Kreativität anzuheizen. Aber der Name blieb. Und deshalb<br />
heißen wir heute ‚Apple‘.“<br />
– Steve Jobs [6]<br />
Steve Wozniak liefert in seiner Autobiografie iWoz eine andere Erklärung:<br />
„Ein paar Wochen später fiel uns dann ein Name für die Partnerschaft ein. Wir fuhren gerade über den<br />
Highway 85 vom Flughafen in die Stadt. Steve war von einem Besuch in Oregon zurückgekommen, von<br />
einem Ort, den er ‚apple orchard‘ nannte, also Apfelgarten. Es war eigentlich so eine Art Kommune. Steve
Apple 201<br />
schlug den Namen vor: Apple Computer.“<br />
– Steve Wozniak [7]<br />
Apples Verkauf des iPods und der Betrieb des iTunes Stores sorgte für gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem<br />
Beatles-Label „Apple“. Die beiden Unternehmen hatten eine Vereinbarung unterschrieben, wonach sich Apple<br />
Computer nicht in der Musikindustrie betätigen würde. Durch diese Vereinbarung konnte Apple damals einen<br />
Prozess um den Namen vermeiden. Das Musiklabel sah diese Vereinbarung gebrochen und hatte gegen Apple<br />
Computer geklagt. Das zuständige Gericht entschied zugunsten von Apple Computer, da deren Apfellogo in erster<br />
Linie mit dem Computer-System verbunden werde und nicht mit Musik. „Apple Records“ kündigte bereits an, dass<br />
man gegen dieses Urteil Berufung einlegen wolle. 1999 verlor Apple Computer hingegen einen Prozess gegen das<br />
Plattenunternehmen „Apple Records“ der Beatles und musste 26 Mio. US-Dollar Strafe wegen Bruch eines Vertrages<br />
von 1981 zahlen, in dem festgelegt wurde, dass von Apple Computer keine Musikprodukte auf den Markt kommen<br />
dürfen, die in Zusammenhang mit dem kreativen Aspekt von Musik stehen. [8]<br />
Im Februar 2007 übernahm Apple die Rechte am Namen „Apple“ und den Apfel-Logos von Apple Records, das<br />
diese Warenzeichen zukünftig von Apple lizenziert. [9] [10] Die Apple Inc. ist dem Vergleich zufolge Eigentümerin<br />
aller Markenrechte, die mit dem Namen „Apple“ zu tun haben, und wird bestimmte Rechte an das<br />
Beatles-Unternehmen lizenzieren. [11] Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bereits im Zuge der Präsentation<br />
von Apples markenrechtlich ebenfalls umstrittenen iPhone auf der Macworld Conference & Expo 2007 zeichnete<br />
sich ab, dass mit Apple Records zumindest Verhandlungen geführt wurden, da in Verbindung mit dem Mobiltelefon<br />
das Schallplattencover Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band der Beatles dargestellt wurde, deren Musik bislang<br />
nicht über den wettbewerbsrechtlich umstrittenen iTunes Store zu beziehen gewesen war. [12] Spekulationen, dass am<br />
4. Februar 2007 im Rahmen der Super Bowl eine dem legendären Macintosh-Werbefilm von 1984 vergleichbare<br />
Ausstrahlung geplant würde, konnten sich dagegen nicht bestätigen. [13] Dem Präsidenten der Apple Corps Ltd. Neil<br />
Aspinall zufolge sollen alle 13 Alben der Beatles, die 1987 auf CD veröffentlicht wurden, zum gleichen Zeitpunkt<br />
bei allen Internetdiensten heruntergeladen werden können. Damit ist die Kompilation aus dem Jahr 1969 von Hey<br />
Jude weiterhin nur als Vinyl-Version verfügbar. [14]<br />
Apple-Logo<br />
Das erste Logo war eine Zeichnung im Stile eines barocken Kupferstichs, das Isaac Newton unter einem Apfelbaum<br />
sitzend zeigte; eine Anspielung auf die Entdeckung der Schwerkraft mithilfe eines Apfels. Dieser Entwurf stammte<br />
von Ron Wayne. Man stellte jedoch schnell fest, dass sich dieses Logo nur schlecht reproduzieren ließ, da es viel zu<br />
kleinteilig war, und so wurde es wieder verworfen.<br />
Erstes<br />
Apple-Logo<br />
Mehrfarbiges<br />
Apple-Logo<br />
Apple-II-Logo Apple-Schriftzug mit<br />
Logo aus den<br />
1990er-Jahren<br />
Blaues Apple-Logo<br />
mit<br />
Oberflächenstrukturen<br />
Das heutige Logo einer Apfelsilhouette mit Biss wurde von Regis McKenna 1976 entworfen. [15] Zusätzlich zu der<br />
ironischen Konnotation (natürlicher Apfel und künstliche Computer) bot das Design ein subtiles Wortspiel: Beißen<br />
heißt im Englischen to bite, was wiederum klingt wie Byte. Die farbigen Streifen waren zudem grafisch eine<br />
Anspielung auf das IBM-Logo von Paul Rand.<br />
Eine andere Erklärung lautet, dass der angebissene Apfel eine Anspielung auf den Selbstmord des Mathematikers<br />
Alan Turing sei, an dessen Totenbett sich ein angebissener, von ihm selbst vergifteter Apfel befunden hatte. Turing,<br />
zu dessen Lieblingsfilmen Disneys Schneewittchen zählte, gilt als einer der Väter des Computers.<br />
Mit der Einführung des Apple II und dessen Fähigkeit, Farben darzustellen, wurde das vorher schwarze Logo bunt in<br />
Querstreifen eingefärbt. Bei der Wortmarke kam die Schrift Motter Tektura von Othmar Motter zum Einsatz,
Apple 202<br />
erschienen bei Letraset Ltd. in Großbritannien. [16] Bei den ersten Macintosh-Modellen kam lediglich der farbige<br />
Apfel als Bildlogo zum Einsatz. Mit dem Betriebssystem 7 wurde das Logo in Form einer Wortmarke in einer<br />
Garamond-Schriftart dargestellt, die die neue TrueType-Fähigkeit besser nach außen kommunizieren konnte.<br />
Mit Einführung des ersten blaugrünen (bondi-blue) iMac im Jahr 1998 und den blau-transluzenten Power Macintosh<br />
G3 1999 (den ersten Produkten, die der zurückgekehrte Steve Jobs wieder verantwortete) wird das Logo wieder<br />
einfarbig dargestellt, jedoch in wechselnden Farben und teilweise mit Oberflächenstrukturen, je nach umgebendem<br />
Design. Die Erscheinung, der auf den heutigen Produkten befindlichen Logos, ist meist farblos. Sie heben sich nur<br />
durch ihre Form und Materialbearbeitung vom Untergrund ab.<br />
Slogan<br />
Der ehemalige Slogan von Apple, Think Different, ist eine Anspielung auf die Kampagne von IBM mit dem Slogan<br />
Think. Diesen greift Apple derzeit (nach längerer Zeit ohne Slogan) wieder auf.<br />
Unternehmen<br />
Besitzverhältnisse<br />
Knapp drei Viertel der Anteile liegen bei institutionellen Anlegern und Fonds. Steve Jobs hält zurzeit etwas über<br />
5,5 Mio. Aktien an Apple (ca. 0,64 %) mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar (Oktober 2007). [17] Ein<br />
weiterer Großaktionär ist Apple-Vizepräsident Ronald B. Johnson mit ca. 1,48 Mio. Aktien (0,17 %). Der Rest ist im<br />
Streubesitz. Der Mitwettbewerber Microsoft besitzt – entgegen hartnäckigen Gerüchten – keine größeren Anteile<br />
mehr an Apple, jedoch immer noch einige Aktien. Schätzungen, die auf der Jahresbilanz von Microsoft basieren,<br />
gehen von mindestens 6 bis 12 Mio. Aktien mit einem Wert von rund zwei Milliarden Dollar aus. [18]<br />
Mitarbeiter<br />
Im zur Zeit sechsköpfigen Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft Apple sind neben CEO Steve Jobs noch Bill Campbell<br />
(Vorsitzender und ehemaliger CEO Intuit Corp.), Millard Drexler (Vorsitzender und ehemaliger CEO J. Crew),<br />
Albert Gore Jr. (ehemaliger Vizepräsident der USA), Arthur D. Levinson, Ph. D. (Vorsitzender CEO Genentech) und<br />
Andrea Jung, Vorsitzende und CEO von Avon Products, vertreten. [19]<br />
Eric Schmidt, CEO von Google Inc., verließ am 3. August 2009 den Aufsichtsrat. [20] Als neues Mitglied kam<br />
Andrea Jung hinzu.<br />
Das ehemals siebte Mitglied des Aufsichtsrates, Jerry York, ehemaliger Finanzchef von IBM und ehemaliger<br />
Präsident und CEO von Harwinton Capital, verstarb am 18. März 2010. [21] Seine Stelle im Aufsichtsrat von Apple<br />
ist zur Zeit nicht besetzt. Es ist nicht geklärt, ob die Stelle neu besetzt wird oder der Aufsichtsrat fortan nur noch aus<br />
sechs Mitgliedern besteht.<br />
Wichtige Mitarbeiter von Apple im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lisa und Macintosh waren Jef Raskin<br />
(Usability-Spezialist), Andy Hertzfeld, Bill Atkinson und Susan Kare (entwarf unter anderem zahlreiche Icons für<br />
das Macintosh-System).<br />
Bekannte Mitarbeiter in der Führungsriege von Apple sind Tim Cook, Jon Rubinstein, Avie Tevanian, Jonathan Ive<br />
und Ron Johnson. Timothy E. Wasko war früher bereits Mitarbeiter von NeXT und entwickelte für Apple die<br />
Fotoblendenfreischaltung für die CD- und DVD-Brennfunktion und die Benutzeroberfläche des iPod. Der derzeitige<br />
CEO ist Steve Jobs. Senior Vice President of Worldwide Product Marketing ist Phil Schiller. Am 14. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
erklärte Jobs in einer Rundmail an die Mitarbeiter Apples, dass er aus gesundheitlichen Gründen bis Ende Juni 2009<br />
eine Auszeit nähme. Seine Aufgaben übernähme in dieser Zeit Apples COO Tim Cook. [22]<br />
Apple beschäftigte Ende September 2008 rund 32.000 Mitarbeiter (gezählt in Vollzeit-Äquivalenten) sowie 3.100 als<br />
vorübergehende Beschäftigte und Subunternehmer. Etwa 15.900 Angestellte sind im Retail-Sektor angesiedelt. [23]
Apple 203<br />
Marktanteile und Umsatzentwicklung<br />
• Computermarkt weltweit im 2. Quartal 2008 nach Stückzahl: 3,3<br />
% [24] – Apple liegt damit auf Rang sechs.<br />
• Computermarkt USA im 2. Quartal 2008 nach Stückzahl: 8,5 % [25]<br />
– Apple liegt damit auf Rang drei.<br />
• MP3-Player-Markt USA: 72 % durch verschiedene<br />
iPod-Modelle [26]<br />
• Internet-Musikdownloads USA: 85 % durch den iTunes Store [26]<br />
Der Unternehmenssitz in Cupertino, Kalifornien<br />
GJ<br />
Zeitraum<br />
Umsatz (Mio. USD) Gewinn (Mio. USD) Umsatzwachstum Umsatzrendite<br />
GJ 1981 (Okt. 1980 – Sept. 1981) 335 unbek. --- ---<br />
GJ 1982 (Okt. 1981 – Sept. 1982) 583 61 74 % 10 %<br />
GJ 1983 (Okt. 1982 – Sept. 1983) 983 77 69 % 8 %<br />
GJ 1984 (Okt. 1983 – Sept. 1984) 1.516 64 54 % 4 %<br />
GJ 1985 (Okt. 1984 – Sept. 1985) 1.918 61 27 % 3 %<br />
GJ 1986 (Okt. 1985 – Sept. 1986) 1.902 154 −1 % 8 %<br />
GJ 1987 (Okt. 1986 – Sept. 1987) 2.661 218 40 % 8 %<br />
GJ 1988 (Okt. 1987 – Sept. 1988) 4.071 400 53 % 10 %<br />
GJ 1989 (Okt. 1988 – Sept. 1989) 5.284 454 30 % 9 %<br />
GJ 1990 (Okt. 1989 – Sept. 1990) 5.558 475 5 % 9 %<br />
GJ 1991 (Okt. 1990 – Sept. 1991) 7.977 310 44 % 4 %<br />
GJ 1992 (Okt. 1991 – Sept. 1992) 7.087 530 −11 % 7 %<br />
GJ 1993 (Okt. 1992 – Sept. 1993) 6.309 87 −11 % 1 %<br />
GJ 1994 (Okt. 1993 – Sept. 1994) 9.189 310 46 % 3 %<br />
GJ 1995 (Okt. 1994 – Sept. 1995) 11.602 424 20 % 4 %<br />
GJ 1996 (Okt. 1995 – Sept. 1996) 9.833 −816 −11 % −8 %<br />
GJ 1997 (Okt. 1996 – Sept. 1997) 7.081 −1.045 −28 % −15 %<br />
GJ 1998 (Okt. 1997 – Sept. 1998) 5.941 309 −16 % 5 %<br />
GJ 1999 (Okt. 1998 – Sept. 1999) 6.134 601 3 % 10 %<br />
GJ 2000 (Okt. 1999 – Sept. 2000) 7.983 786 30 % 10 %<br />
GJ 2001 (Okt. 2000 – Sept. 2001) 5.363 −25 −33 % −0 %<br />
GJ 2002 (Okt. 2001 – Sept. 2002) 5.247 65 −2 % 1 %<br />
GJ 2003 (Okt. 2002 – Sept. 2003) 6.207 57 18 % 1 %<br />
GJ 2004 (Okt. 2003 – Sept. 2004) 8.279 266 33 % 3 %<br />
GJ 2005 (Okt. 2004 – Sept. 2005) 13.931 1.328 68 % 10 %<br />
GJ 2006 (Okt. 2005 – Sept. 2006) 19.315 1.989 39 % 10 %<br />
GJ 2007 (Okt. 2006 – Sept. 2007) 24.578 3.495 27 % 14 %
Apple 204<br />
GJ 2008 (Okt. 2007 – Sept. 2008) 37.491 6.119 53 % 16 %<br />
GJ 2009 (Okt. 2008 – Sept. 2009) 42.905 8.235 14 % 19 %<br />
Q1 2010 (Okt. 2009 – Dez. 2009) 15.683 3.378 32 % 22 %<br />
Q2 2010 (<strong>Jan</strong>. 2010 – März<br />
2010)<br />
13.499 3.074 49 % 23 %<br />
Q3 2010 (Apr. 2010 – Juni 2010) 15.700 3.253 61 % 21 %<br />
GJ = Geschäftsjahre von Apple gelten vom 1. Oktober bis zum 30. September des darauffolgenden Jahres, sodass<br />
beispielsweise das erste Quartal des Apple-Geschäftsjahres dem vierten Quartal des Kalendervorjahres entspricht<br />
(Q1/2009 Apple = Q4/2008 Kalender).<br />
Apple Stores<br />
Bislang betreibt Apple weltweit 286 „Apple Retail Stores“. Diese<br />
befinden sich überwiegend in den USA, in Kanada, Großbritannien,<br />
Italien, Schweiz, China, Japan, Deutschland, Spanien, Frankreich und<br />
Australien. Daraus erwirtschaftete Apple im Geschäftsjahr 2008 im<br />
Verkaufssektor einen Gewinn von insgesamt 1,3 Milliarden Dollar<br />
(920 Millionen Euro).<br />
In Deutschland gibt es neben dem ersten Geschäft in München [27] zwei<br />
weitere in Hamburg und in Frankfurt am Main (am 23. <strong>Jan</strong>uar 2010<br />
eröffnet [28] ). Ein viertes Geschäft soll im Frühjahr 2011 [29] in Dresden<br />
eröffnet werden. In der Schweiz existieren drei Apple Retail Stores<br />
(zwei in Zürich [30] und einer in Genf). Der weltweit größte Store<br />
befindet sich im Londoner Convent Garden.<br />
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr<br />
geöffnet: Der Apple-Store in New York<br />
Die „Apple Retail Mini Stores“ [31] wurden von dem multidisziplinären Design-Studio Eight Inc. in San Francisco<br />
entworfen. [32]<br />
Der weltweit größte Store befindet sich im Londoner Convent Garden.<br />
Produkte<br />
Apple entwirft sowohl Software als auch Hardware, und lässt diese von Vertragspartnern wie zum Beispiel von Asus<br />
fertigen. Die Produkte werden oft als innovativ angesehen und besitzen meist ein durchdachtes, funktionales Design.<br />
Ein Hauptaugenmerk wird außerdem auf einfache Benutzbarkeit gelegt.<br />
Industriestandards und Technologien von Apple<br />
• openCL (8. Dezember 2008) plattformunabhängige offene Programmierplattform für CPUs, GPUs und DSPs<br />
• WebKit (2002) Marktführende offene Browserengine im mobilen Bereich<br />
• FireWire (1998) Schnelle und robuste Kommunikationsarchitektur für Endgeräte (Videokameras, Festplatten,<br />
etc). Später wurde es zum Industriestandard, bekannt unter dem Namen IEEE 1394 oder auch iLink (Markenname<br />
von Sony, da Apple erst ab Mai 2002 die Verwendung des Begriffs FireWire freigegeben hatte)<br />
• TrueType (1991) Schriftdarstellungsstandard für Bildschirm und Druck<br />
• Unicode (1991) Kodierungsformat für weltweite Schriftzeichen. Erste Version Ende der 1980er-Jahre gemeinsam<br />
mit Xerox entwickelt [33] Spätere offizielle Versionen über ein Konsortium mit anderen Herstellern verabschiedet<br />
• QuickTime (25. Juni 1990) Speicherformat für Bild-, Ton- und Videodaten, gängiges Format in Digitalkameras,<br />
um audiovisuelle Sequenzen aufzuzeichnen
Apple 205<br />
Onlinedienste von Apple<br />
• iTunes Store (in iTunes integrierter Online-Musikstore, in dem auch Spielfilme, Fernsehserien und Spiele für iOS<br />
und iPods mit Click Wheel gekauft werden können)<br />
• MobileMe (kostenpflichtiger Dienst, der Mac OS X um Online-Funktionalität (Mail-Account, iDisk<br />
[Online-Speicher], Backup, Synchronisation mit iOS unter anderem) erweitert; wurde bis 10. Juli 2008 als .Mac<br />
vermarktet)<br />
• Apple Movie Trailers (weltweit größte Sammlung von Film-Trailern)<br />
• AppleLink (wurde 1985 als Support-Plattform für die Kunden und für Vertragshändler gestartet)<br />
• eWorld (als Apples Antwort auf AOL geplant, war aber nur von 1994 bis 1996 online)<br />
• App Store (Plattform zum Anbieten und Laden von Programmen für iPhone, iPod touch und iPad)<br />
• iWork.com (Dienst zum Veröffentlichen von iWork-Dokumenten im Internet, befindet sich derzeit noch in der<br />
Beta-Phase)<br />
• Apple Developer Connection (Plattform für Entwickler von Programmen für Mac OS X und das iPhone; bietet<br />
Downloads, Dokumente, Spezifikationen unter anderem)<br />
Software<br />
Betriebssysteme<br />
Apples erste Betriebssysteme waren befehlszeilenorientiert, wie damals (Ende der 1970er- und Anfang der<br />
1980er-Jahre) üblich. 1983 stellt Apple mit dem Lisa OS eines der ersten kommerziell erhältlichen Betriebssysteme<br />
vor, das vollständig über eine grafische Oberfläche bedient wurde. 1984 wurde mit dem Betriebssystem des<br />
Macintosh (später „Mac OS“ genannt) das erste grafische Betriebssystem auf den Markt gebracht, das sich in großem<br />
Umfang verkaufte.<br />
• Apple DOS<br />
• Apple SOS<br />
• Apple ProDOS<br />
• Lisa OS<br />
• GS/OS<br />
• A/UX<br />
• Mac OS<br />
• Newton OS<br />
• Mac OS X (von der Public Beta bis Snow Leopard)<br />
• Mac OS X Server (aktuelle Version: siehe Mac OS X)<br />
• iOS (früher: iPhone OS)<br />
• iPod OS<br />
Software von Apple<br />
Apple bietet eine Vielzahl verschiedenster Programme an. Dazu zählen die kostenlosen Standardanwendungen wie<br />
die Desktopsuchmaschine Spotlight, die Multimedia-Architektur QuickTime (kostenpflichtige Pro Version<br />
verfügbar), das Medienverwaltungsprogramm iTunes, der Webbrowser Safari, das Mailprogramm Mail, der Instant<br />
Messenger iChat (mit Audio- und Videokonferenzen), der Kalender iCal und Boot Camp (ermöglicht es, Microsoft<br />
Windows auf einem Intel Mac parallel zu Mac OS X zu installieren). Ein großer Teil ist beim Kauf eines neuen<br />
Macs bereits vorinstalliert, andere können bei Bedarf von der Homepage von Apple heruntergeladen und installiert<br />
werden.<br />
Im iLife-Paket, dass jedem neu gekauftem Mac beiliegt, sind unter anderem das Fotoverwaltungsprogramm iPhoto,<br />
das Videoschnittprogramm iMovie und das Musikprogramm GarageBand sowie im iWork-Paket das<br />
Textverarbeitungsprogramm Pages, das Präsentationsprogramm Keynote und seit August 2007 das
Apple 206<br />
Tabellenkalkulationsprogramm Numbers enthalten. 2009 wurde iWork ´09 ausgeliefert mit neuen Versionen von<br />
Pages, Numbers und Keynote. Dazu wurde eine Beta-Version von iWork.com ins Netz gestellt, um Dateien anderen<br />
Benutzern zur Verfügung zu stellen. Das Medienverwaltungsprogramm iTunes ist ein Bestandteil von Mac OS X.<br />
Für die professionelle Fotobearbeitung und den Videoschnitt bietet Apple Inc. Aperture und das Programmpaket<br />
Final Cut Studio an. Für ambitionierte Amateure, denen Final Cut Studio zu teuer ist, gibt es Final Cut Express. Die<br />
Anwendung Shake zur Postproduktion ist noch erhältlich, wird aber von Apple nicht mehr weiterentwickelt.<br />
Für die professionelle und semiprofessionelle Audiobearbeitung und das Sequencing hat Apple 2002 die<br />
Hauptbestandteile und Entwickler des deutschen Unternehmens Emagic gekauft und vertreibt diese als Logic und<br />
Logic Pro unter dem Logo von Apple. Seit Kauf sind mehrere neue Updates und Erweiterungen erschienen. Die<br />
Grundstruktur von Logic arbeitet auch unter der Oberfläche von Garage Band, welches Teil des iLife-Pakets ist.<br />
Softwarestandards<br />
Apple benutzt sowohl offene als auch proprietäre Standards in seinem Betriebssystem. Offene Standards werden vor<br />
allem im Betriebssystemkern Darwin eingesetzt, der unter einer Open-Source-Lizenz steht.<br />
In den darüberliegenden Schichten des Betriebssystems und der Anwendungssoftware kommen dagegen einige<br />
proprietäre Standards zum Einsatz:<br />
• Quartz als Grafikbibliothek, basierend auf PDF<br />
• Apples eigenes Aqua als GUI-Bibliothek<br />
• QuickTime als Multimedia-Technologie, auf der iTunes basiert<br />
Interoperabilität dieser proprietären Standards mit anderen Betriebssystemen stellt Apple selbst mit der folgenden<br />
Software her:<br />
• Quicktime for Windows, um Multimediainhalte auf PCs mit dem Betriebssystem Windows abspielen zu können.<br />
• iTunes für Windows, um iPods und im iTunes gekaufte Musik auf PCs mit Windows nutzen zu können.<br />
• Softwareprodukte von anderen Anbietern (zum Beispiel VLC <strong>Media</strong> Player) schließen die Kompatibilität mit<br />
QuickTime- und iTunes-Formaten ein.<br />
• Der Webbrowser Safari ist auch als Download für Windows verfügbar.<br />
Open Source<br />
Apple bietet Teile von Mac OS X, den Developer Tools (XCode etc.) und des iPhone OS (größtenteils unixoide<br />
Programme und Bibliotheken) als Open Source unter verschiedenen Lizenzen (hauptsächlich Apache-Lizenz, AGPL,<br />
BSD, GPL, MIT) an. [34]<br />
Darunter sind z. B. fast alle I/O-Treiber (für die Kommunikation mit Speichergeräten zuständig), Teile von Grand<br />
Central Dispatch, mit dem die Prozessorlast besser auf die Prozessorkerne verteilt wird, oder die GNU Compiler<br />
Collection (GCC).
Apple 207<br />
Hardware<br />
Personal Computers<br />
• Apple I / II / III-Modelle im Überblick (8- und 16-Bit Datenbus)<br />
• Apple Macintosh-Modelle im Überblick (16-, 32- und 64-Bit Datenbus)<br />
Notebooks<br />
Apple II (1977) Apple Lisa (1983) Apple Macintosh<br />
iMac G3 (1998) Power Mac G4<br />
Quicksilver (2002)<br />
(1984)<br />
Power Mac 6100 (1994)<br />
iMac G4 (2002) Mac mini (2005)<br />
Macintosh Portable (1989) PowerBook (1991) iBook (1999)<br />
MacBook (2006) MacBook Pro (2006) MacBook Air (2008)
Apple 208<br />
Von Apple eingesetzte Prozessoren<br />
• MOS 6502<br />
• 65816<br />
• Motorola 68000er-Familie<br />
• PowerPC-Prozessorfamilie: MPC601, MPC603 und MPC603e<br />
sowie G3, G4 und G5<br />
• Intel Core Solo: seit 28. Februar 2006 in Mac mini 1,5 Ghz bis zum<br />
6. September 2006. Ab diesen Zeitpunkt wurde die Mac-mini-Serie<br />
auf Core Duo umgestellt.<br />
Die Hauptplatine des Apple I<br />
• Intel Core Duo: seit 10. <strong>Jan</strong>uar 2006 in MacBook Pro und (bis September 2006) im iMac sowie seit 28. Februar<br />
2006 im Mac mini 1,66 Ghz, seit Mai 2006 auch im MacBook<br />
• Intel Core 2 Duo: seit dem 6. September 2006 im iMac, außerdem seit Oktober 2006 im MacBook und MacBook<br />
Pro, seit Mitte 2007 auch im Mac mini [35]<br />
• Intel Xeon: seit 7. August 2006 im Mac Pro<br />
• Intel Xeon 550 Serie „Nehalem“: seit 2009 im Xserve<br />
• Intel Core i5/Core i7: seit Oktober 2009 im iMac<br />
• Intel Core i3/ Intel Core i5/Core i7: seit März 2010 in MacBook Pro (13"–17")<br />
• Apple A4: seit 2010 im iPad, iPhone 4 sowie dem Apple TV verbaut.<br />
Weitere Hardware-Produkte von Apple<br />
Apple TV (2006) Apple<br />
Remote<br />
(2006)<br />
Apple iPad (2010) Verschiedene iPod-Modelle (von links):<br />
iPod shuffle (3. Gen.)<br />
iPod nano (5. Gen.)<br />
iPod classic (6. Gen.)<br />
iPod touch (3. Gen.)<br />
Apple Magic Trackpad (2010)<br />
iPhone 4 (2010)
Apple 209<br />
<strong>Media</strong>player<br />
• iPod<br />
• iPod mini (bis zur 2. Generation)<br />
• iPod shuffle (aktuell 4. Generation)<br />
• iPod nano (aktuell 6. Generation)<br />
• iPod classic (aktuell 6. Generation)<br />
• iPod touch (aktuell 4. Generation)<br />
Mobiltelefone<br />
• iPhone<br />
Webcams<br />
• iSight<br />
Funknetzwerkbasisstationen<br />
• Airport Extreme<br />
• Airport Express<br />
• Time Capsule<br />
Flachbildschirme<br />
• Apple Cinema Display<br />
Mäuse<br />
• Apple Mighty Mouse<br />
• Magic Mouse<br />
Tastaturen<br />
• Apple Keyboard<br />
• Wireless Keyboard<br />
Ältere Hardware-Produkte von Apple<br />
• 20th Anniversary Macintosh<br />
• Apple Pippin<br />
• Apple Set-Top-Box<br />
• Apple Silentype Thermodrucker<br />
• Apple Studio Display<br />
• AppleVision – ColorSync<br />
• ImageWriter grafikfähiger Nadeldrucker<br />
• ImageWriter LQ hochauflösender Nadeldrucker mit letter quality<br />
• iPod Hi-Fi<br />
• LaserWriter<br />
Apple Magic Mouse (2009)<br />
Silentype Thermodrucker
Apple 210<br />
• Multiple Scan<br />
• Newton<br />
• OneScanner<br />
• PowerBop<br />
• PowerCD<br />
• Power Mac G4 Cube<br />
• QuickTake 100/150/200<br />
• QuickTime Conferencing Video Camera<br />
• StyleWriter<br />
• Wireless Mighty Mouse<br />
Kritik<br />
Umweltschutz und Arbeitsbedingungen<br />
Die Elektronik- und PC-Industrie steht allgemein im Ruf, bei der Auftragsfertigung die arbeitsrechtlichen und<br />
gesundheitlichen Belange der Belegschaft sowie Belange des Umweltschutzes nicht hinreichend zu<br />
berücksichtigen. [36]<br />
Apple lässt seine Produkte vorwiegend in Asien fertigen. Die Auftragsfertigung hat Apple der taiwanesischen<br />
Aktiengesellschaft Foxconn übertragen, die in der chinesischen Sonderwirtschaftszone in Shenzhen nahe Hongkong<br />
produzieren lässt. Shenzhen wird mit der größten Elektronikfabrik der Welt als iPod-City bezeichnet. Foxconn ist im<br />
Jahr 2006 in den Medien aufgrund unmenschlicher Arbeitsbedingungen kritisiert worden. [37] Der Auftraggeber<br />
Apple hat zwischenzeitlich Defizite eingeräumt und zugleich auf den herstellereigenen Apple Supplier Code of<br />
Conduct verwiesen. [38] [39] Nach Apples eigenen Untersuchungen seien keine Verstöße gegen den Verhaltenskodex<br />
festgestellt worden, jedoch fanden sich bei Foxconn Verletzungen gegen den Supplier Code of Conduct. [40] Die<br />
Mitarbeiter bei Foxconn hätten den Medienberichten zufolge monatlich jeweils rund 80 Überstunden geleistet und<br />
teilweise mit knapp 50 Euro pro Monat weniger als im Mindestlohn-Gesetz vorgeschrieben verdient. [41] Foxconn<br />
hatte zunächst wegen der Vorwürfe Schadenersatzforderungen gegen zwei Journalisten in China geltend gemacht,<br />
diese letztlich aber wieder zurückgezogen. [42] Apple hat nach eigenem Bekunden Verité verpflichtet, für die<br />
Einhaltung sicherer, fairer und legaler Arbeitsplatzbedingungen Sorge zu tragen. [43] Außerdem hat sich Apple der<br />
Electronic Industry Code of Conduct (EICC) Implementation Group angeschlossen, die bereits Standards für die<br />
Industrie erarbeitet hat und Quellen zur Evaluierung der Auftragsfertiger anbietet. [44]<br />
Im Bereich des Umweltschutzes sieht sich Apple Vorwürfen zum Beispiel von Greenpeace und der Silicon Valley<br />
Toxics Coalition (SVTC) ausgesetzt. [45] [46] Nicht alle diese Vorwürfe scheinen gerechtfertigt zu sein. Insoweit sie<br />
substantiiert sind, betreffen sie mehr die gesamte Industrie als das Unternehmen Apple allein. Kritiker weisen zudem<br />
auf methodische Mängel des vergleichenden Rankings von Greenpeace [47] hin, bei dem zum Beispiel die<br />
durchschnittliche Nutzungsdauer der Produkte nicht berücksichtigt wird. [48] Steve Jobs hat als Reaktion auf die<br />
Vorwürfe von Greenpeace im Mai 2007 angekündigt, Apple führend im Bereich des Umweltschutzes machen zu<br />
wollen. [49] In seinem Text A Greener Apple [50] führt Jobs bereits erreichte Erfolge auf und kündigt weitere<br />
Maßnahmen für den Umweltschutz an.<br />
Apple begann 2008 sein Versprechen in die Tat umzusetzen. Das im <strong>Jan</strong>uar 2008 vorgestellte MacBook Air war das<br />
erste Produkt von Apple, das konsequent die Verwendung von giftigen Materialien drastisch reduzierte. Weitere<br />
Apple-Produkte folgten im Laufe des Jahres diesem Beispiel. 2009 erschien zur MacWorld Expo in San Francisco<br />
das 17 Zoll MacBook Pro mit einer längeren Batterielaufzeit. Die gesamte MacBook-Familie erfüllt die Energy Star<br />
4.0-Umweltauflagen, wobei keine bromhaltigen Flammschutzmittel enthalten sind und nur PVC-freie Kabel und<br />
Komponenten verwendet werden. Der Akku des MacBook Pro 17 Zoll liefert wegen seines verlängerten<br />
Lebenszyklus einen zusätzlichen Beitrag zur Umweltverträglichkeit, wodurch weniger verbrauchte Akkus und damit
Apple 211<br />
weniger Abfall resultieren. Ein verbrauchter Akku kann für 179 Euro ausgetauscht werden. Dies beinhaltet die<br />
Installation sowie die Entsorgung des alten Teils.<br />
Rückdatierte Aktienoptionen<br />
Apple steht im Verdacht, Aktienoptionen im Wert von 20 Millionen US-Dollar an Apple-Chef Steve Jobs im<br />
Geschäftsjahr 2001 rückdatiert zu haben. [51] Bereits im August hatte Apple Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung<br />
von Aktienoptionen bekannt gegeben, die alle seit dem 29. September 2002 veröffentlichten Finanzberichte betreffen<br />
könnten. [52] Apple stellte fest, dass Jobs von der Rückdatierung von Aktienoptionen zwar gewusst, aber geglaubt<br />
habe, nicht selbst von dieser Praxis der Datierung zu profitieren. Dem Manager seien die Folgen für die Bilanzen<br />
nicht klar gewesen. [53] Fraglich ist jedoch, ob CEO Steve Jobs tatsächlich von der Rückdatierung und deren Folgen<br />
keine Kenntnis hatte. Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass Apple im Juni 2006 weitere Optionen im Wert<br />
von nunmehr insgesamt 84 Millionen US-Dollar rückdatierte, worauf die Bilanzen für die Geschäftsjahre 2005 und<br />
2006 erneut geändert werden mussten. [54]<br />
Vorgehen gegen nichtautorisierte Berichterstattung<br />
Apple ist in den letzten Jahren wiederholt gegen nichtautorisierte Berichterstattungen über deren Produkte<br />
gerichtlich vorgegangen. [55] Betroffen waren hiervon in der Vergangenheit insbesondere Blogger von Apple Insider,<br />
PowerPage und Think Secret, die im Internet über geplante Produkteinführungen, über technische Neuerungen sowie<br />
Funktionsweisen von Appleprodukten berichteten. [56] Apple vermutete hinter den Berichterstattern zum Teil eigene<br />
Angestellte, die Unternehmensinterna preisgäben. [57] Zuletzt mahnte Apple Blogger ab, die über das markenrechtlich<br />
umstrittene iPhone von Apple berichteten und Abbildungen des Mobiltelefons veröffentlichten sowie Hinweise auf<br />
Programme gaben, die erlaubten, Wallpaper und Icons auf andere Mobiltelefone als das iPhone von Apple<br />
aufzuspielen. [58] [59] Apple hat unter anderem Paul O’Brien, den Gründer der Mobilfunk-Website MoDaCo,<br />
abgemahnt, da dieser neben Abbildungen von Apples iPhone ein Programm verlinkt hatte, das es ermöglichte, das<br />
Betriebssystem PalmOS der Treolinie mit Icons von Apples iPhone zu ergänzen. [60] [61] Unter anderem hatte<br />
SimToGo ein solches Programm unter dem Namen iPhony 0.1 bzw. 0.2 angeboten. [62] In den bisherigen<br />
gerichtlichen Verfahren gegen die Autoren der Berichte hatte Apple teilweise keinen Erfolg. [63] Erst im Jahr 2006<br />
hatte ein kalifornisches Gericht festgestellt, dass Blogger und Online-Journalisten denselben verfassungsgemäßen<br />
Schutz der Pressefreiheit genießen wie Vertreter der traditionellen Presse. [64] Außerdem musste Apple die Electronic<br />
Frontier Foundation mit einer Zahlung von 700.000 US-Dollar für die Übernahme der Verteidigung- und<br />
Gerichtskosten entschädigen. [65]<br />
Spiegel Online kritisiert weiterhin die „extreme Geheimhaltung“ und schreibt wörtlich, Apple sei ein „paranoider<br />
Konzern, für den Geheimnisse nicht nur Schutz vor der Konkurrenz sind, sondern auch ein Marketingwerkzeug.“ So<br />
sei kostenlose Werbung durch den Hype und die Gerüchteküche vor der Einführung eines neuen Produkts<br />
gewährleistet. [66] Geheimnisverrat werde nach Aussagen eines Augenzeugen mit geheimdienstähnlichen Methoden<br />
verfolgt. Geheimnisverrat werde demnach ohne Rücksicht auf die Privatsphäre der Mitarbeiter verfolgt, es herrsche<br />
„eine Kultur der Angst“. [66]<br />
Verbreitungsmethode der Windows-Version von Safari<br />
Am 18. März 2008 verließ die Windows-Version des Webbrowsers Safari das Beta-Entwicklungs-Stadium und<br />
wurde der breiten Öffentlichkeit zum Herunterladen auf der Apple-Website angeboten. Während eines Monates bis<br />
zum 18. April 2008 wurde Safari durch den Apple-eigenen automatischen Aktualisierungsdienst Apple Software<br />
Update installiert. Trotz des anders lautenden Namens (Update bedeutet Aktualisierung) wurde dabei Safari ohne<br />
bereits vorhandene ältere Version per Standardeinstellung zusammen mit sicherheitskritischen Aktualisierungen<br />
anderer Apple-Software auf dem betroffenen System eingerichtet. Wenn die Safari-Installation nicht gewünscht war,<br />
musste der Benutzer diese Option zuvor deaktivieren.
Apple 212<br />
Siehe auch → Kritik zu Safari<br />
Apples Einstellung zu Softwareverbreitung<br />
Bei Apples Smartphone iPhone und dem Tablet-PC iPad können nur von Apple genehmigte Anwendungen benutzt<br />
werden. Man ist demnach nicht frei in der Entscheidung, welche Software benutzt werden kann. Apple begründet<br />
diese Entscheidung mit Sicherheits- und Stabilitätsbedenken.<br />
Darüber hinaus hat Apple untersagt, bestimmte Entwicklungswerkzeuge für die Entwicklung von iPhone- und<br />
iPad-Anwendungen zu verwenden. Ebenso ist in den Anwendungen Werbung verboten, die Nutzungsdaten an einen<br />
Werbeprovider übermittelt, der einer Firma angehört, die mit Apple im Mobiltelefonbereich konkurriert. Die Federal<br />
Trade Commission hat diesbezüglich im Juni 2010 eine Untersuchung eingeleitet. [67]<br />
Datenschutz bei kundenbezogenen Nutzerdaten<br />
Auch der Umgang mit personenbezogenen Daten steht in der Kritik. Die deutsche Bundesjustizministerin Sabine<br />
Leutheusser-Schnarrenberger fordert mehr Transparenz und wird im Spiegel mit den Worten zitiert: „Den Nutzern<br />
von iPhones und anderen GPS-fähigen Geräten muss klar sein, welche Informationen über sie gesammelt werden.“<br />
Der Hinweis, dass sie der Nutzung der Daten widersprechen können, fehlt in Apples Datenschutzerklärung. [68]<br />
Literatur<br />
• Owen W. Linzmayer: Apple streng vertraulich. Die Tops und Flops der Macintosh-Geschichte. Midas, Zürich<br />
2000, ISBN 3-907100-12-3<br />
• Paul Kunkel: AppleDesign. The work of the Apple Industrial Design Group. Graphis, New York 1997, ISBN<br />
1-888001-25-9<br />
• Owen W. Linzmayer: Apple Confidential 2.0. The definitive history of the world’s most colorful company. No<br />
Starch Press, San Francisco 2004, ISBN 1-59327-010-0 (engl.)<br />
• Dr. Joachim Gartz: Die Apple-Story ISBN 3-908497-14-0<br />
• Steve Wozniak, Gina Smith: iWoz. Wie ich den Personal Computer erfand und Apple mitgründete. Carl Hanser<br />
Verlag, 2006 ISBN 3-446-40406-6<br />
Weblinks<br />
• Apple Deutschland [69] | Apple Österreich [70] | Apple Schweiz [71] | Apple USA [72]<br />
• macnews.de [73] – Online-Magazin für Macuser<br />
• MACup [74] – Online-Auftritt der ersten europäischen Mac-Zeitschrift mit Informationen rund um Apple, Mac<br />
und Co<br />
• mac-developer [75] – Entwicklermagazin für iPhone, iPad und iPod touch<br />
• macprime.ch – Apple History – Geschichte [76]<br />
• The Apple Museum [77] – Seite zur Geschichte von Apple (englisch)<br />
• apple-history.com [78] – Auflistung fast aller Apple-Geräte nach Datum, Familie oder Prozessor (englisch)<br />
• ApfelWiki [79] – Deutsches Apple-Wiki<br />
• Zeitleiste der Macintosh-Modelle in der englischsprachigen Wikipedia<br />
• iPhone developer conference [80] Die Entwickler- und Businesskonferenz für iPhone, iPad und iPod touch
Apple 213<br />
Einzelnachweise<br />
[1] http:/ / www. apple. com/ de<br />
[2] http:/ / www. millwardbrown. com/ Libraries/ Optimor_BrandZ_Files/ 2010_BrandZ_Top100_Report. sflb. ashx<br />
[3] Owen W. Linzmayer: Apple Confidential 2.0. The definitive history of the world's most colorful company; No Starch Press, San Francisco;<br />
2004; Seite 5 ISBN 1-59327-010-0<br />
[4] Jeffrey S. Young, William L. Simon: Steve Jobs und die Geschichte eines außergewöhnlichen Unternehmens<br />
[5] The Apple Museum (http:/ / www. theapplemuseum. com/ index. php?id=44#pink)<br />
[6] fire in the valley by freiberger and swaine (http:/ / www. fireinthevalley. com/ fitv_voices. html)<br />
[7] Steve Wozniak: iWoz – Wie ich den Personal Computer erfand und Apple mitgründete; Hanser Verlag, München; 2007; Seite 175; ISBN<br />
3-446-40406-6<br />
[8] Macwelt Der Kampf um den Apfel (12. Mai 2006) (http:/ / www. macwelt. de/ news/ ipod/ 337828/ index. html)<br />
[9] Apple Inc. Apple Inc. and The Beatles’ Apple Corps Ltd. Enter into New Agreement (5. Februar 2007) (http:/ / www. apple. com/ pr/ library/<br />
2007/ 02/ 05apple. html)<br />
[10] Süddeutsche Zeitung Streit über Markenrechte Apple schließt Frieden mit Apple (6. Februar 2007) (http:/ / www. sueddeutsche. de/ ,tt1m3/<br />
wirtschaft/ artikel/ 899/ 100799/ )<br />
[11] Apple Inc. Markenrechte – Der Apfel gehört jetzt Apple (5. Februar 2007) (http:/ / www. faz. net/ s/<br />
RubC8BA5576CDEE4A05AF8DFEC92E288D64/ Doc~E829A0B62453D42319C18139E3F6510CD~ATpl~Ecommon~Scontent. html)<br />
[12] San Francisco Chronicle Apple, Beatles come together Pact resolves trademark dispute with record label, but Fab Four still not on iTunes –<br />
yet (6. Februar 2007) (http:/ / www. sfgate. com/ cgi-bin/ article. cgi?f=/ c/ a/ 2007/ 02/ 06/ BUGNPNV8A820. DTL& hw=apple& sn=007&<br />
sc=622)<br />
[13] MacRumors.com Super Bowl XLI Apple Ad? (Update – No) (3. Februar 2007) (http:/ / www. macrumors. com/ 2007/ 02/ 03/<br />
super-bowl-xli-apple-ad/ )<br />
[14] Fox News Beatles Ready for Legal Downloading Soon (12. Februar 2007) (http:/ / www. foxnews. com/ story/ 0,2933,251410,00. html)<br />
[15] Claudia Leu: Index Logo, MITP, ISBN 3-8266-1507-7, S. 89<br />
[16] Letraset Handbuch, 1985, Herausgeber: Letraset Deutschland GmbH, Gestaltung; HSAG London, Druck: Boom-Ruybrok b.v.m,<br />
Niederlande, S. 139<br />
[17] World of Apple (http:/ / news. worldofapple. com/ archives/ 2007/ 08/ 16/ jobs-swallows-up-120000-apple-shares/ )<br />
[18] FinancialTimes 4/2004<br />
[19] Apple Inc. Board of Directors (http:/ / www. apple. com/ pr/ bios/ bod. html)<br />
[20] Apple Inc. (http:/ / www. apple. com/ pr/ library/ 2009/ 08/ 03bod. html)<br />
[21] Apple Inc. „Director Jerome B. York Passes Away“ (http:/ / www. apple. com/ pr/ library/ 2010/ 03/ 18york. html)<br />
[22] derNewsticker.de: Apple-Chef Steve Jobs zieht sich wegen Krankheit zurück (http:/ / www. derNewsticker. de/ news. php?id=77071), vom<br />
15. <strong>Jan</strong>uar 2009, Abgerufen am 15. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[23] Quelle Mitarbeiterzahlen: Apple Annual Report / SEC-Filing vom 5. November 2008 (http:/ / idea. sec. gov/ Archives/ edgar/ data/ 320193/<br />
000119312508224958/ d10k. htm)<br />
[24] palluxo Apple Ranks 3rd in the US, 6th Worldwide: Peliminary Results (http:/ / www. palluxo. com/ 2008/ 07/ 17/<br />
apple-ranks-3rd-in-the-us-6th-worldwide-peliminary-results/ )<br />
[25] Gartner Worldwide PC Market Grew 16 Percent in Second Quarter of 2008 (http:/ / www. gartner. com/ it/ page. jsp?id=724111)<br />
[26] Ars Technica Apple's record quarter: inside the numbers (18. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / arstechnica. com/ news. ars/ post/ 20070118-8656. html)<br />
[27] Heise online: Apple wagt sich mit deutschem Flagship Store auf heißes Pflaster (http:/ / www. heise. de/ resale/<br />
Apple-wagt-sich-mit-deutschem-Flagship-Store-auf-heisses-Pflaster--/ news/ meldung/ 119889)<br />
[28] Apple: (http:/ / www. apple. com/ de/ retail/ grossebockenheimerstrasse/ )<br />
[29] SZ-Online: (http:/ / www. sz-online. de/ nachrichten/ artikel. asp?id=2543986& newsfeed=rss)<br />
[30] macnews.de: Neuer Apple Store öffnet in Zürich die Türen (http:/ / www. macnews. de/ news/ 116201. html)<br />
[31] chi-athenaeum: Good Design Winners (http:/ / www. chi-athenaeum. org/ gdesign/ winners05. htm)<br />
[32] archi-europe: Archi-Europe Group (http:/ / www. archi-europe. com/ project2. php?id=711522)<br />
[33] Unicode.org of Unicode Version 1.0 (http:/ / unicode. org/ history/ ''Chronology)<br />
[34] Apple Open Source Download Center (engl.) (http:/ / www. apple. com/ opensource/ )<br />
[35] Apple Developer Connection Introduction to iMac Developer Note (http:/ / developer. apple. com/ documentation/ HardwareDrivers/<br />
Conceptual/ iMac_0609_SuperDrive/ index. html)<br />
[36] Sarah Bormann: 1.500 Liter Wasser für einen PC (10. August 2006) (http:/ / gipfelthemen. de/ weltweitetrends/ wissen_besitz/<br />
sbormann_pcglobal060728. shtml)<br />
[37] AppleInsider: Photos: inside Foxconns‚ iPod City‘ (14. Juni 2006) (http:/ / www. appleinsider. com/ article. php?id=1815)<br />
[38] Apple Inc: Report on iPod Manufacturing (17. August 2006) (http:/ / www. apple. com/ hotnews/ ipodreport/ )<br />
[39] MacNN: Apple: Foxconn violated code of conduct (17. August 2006) (http:/ / www. macnn. com/ articles/ 06/ 08/ 17/ apple. finds. labor.<br />
abuses/ )<br />
[40] Daniel Ploettner: Apple schließt Foxconn Untersuchung ab (18. August 2006) (http:/ / www. scheinwerfer-blog. de/ index. php/ archives/<br />
2006/ 08/ 18/ apple-schliesst-foxconn-untersuchung-ab/ )
Apple 214<br />
[41] Technology Review: Wenn Apple in China bleibt, sollte es auf Einhaltung von Arbeitsstandards drängen (4. September 2006) (http:/ / www.<br />
heise. de/ tr/ artikel/ 77681)<br />
[42] tecChannel.de: iPod-Produzent Foxconn zieht hohe Schadenersatzforderung in China zurück (31. August 2006) (http:/ / www. tecchannel.<br />
de/ news/ themen/ business/ 446742/ )<br />
[43] Verité: Some of the Companies Working With Verité (2002) (http:/ / www. verite. org/ aboutus/ portfolio. html)<br />
[44] EICC: Member Firms (2002) (http:/ / www. eicc. info/ EICC_SPONSOR. html)<br />
[45] Greenpeace: Green My Apple (http:/ / www. greenpeace. org/ apple/ )<br />
[46] Roughly Drafted: The SVTC’s Toxic Trash Attack on Apple (englisch) (http:/ / www. roughlydrafted. com/ RD/ Home/<br />
92974C85-AD76-436C-A4AC-EB52E4D969D6. html)<br />
[47] Vergleichendes Ranking von Greenpeace (http:/ / www. greenpeace. org/ international/ press/ reports/ green-guide-to-electro-5)<br />
[48] Roughly Drafted: ArsTechnica: Mary E Tyler Admits Greenpeace a Fraud (englisch) (http:/ / www. roughlydrafted. com/ RD/ RDM. Tech.<br />
Q1. 07/ A663D76C-DCED-442A-BD2E-6A557E98CA39. html)<br />
[49] Heise News: Steve Jobs will Apple führend im Umweltschutz machen (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 89181)<br />
[50] A Greener Apple von Steve Jobs (http:/ / www. apple. com/ hotnews/ agreenerapple/ )<br />
[51] Der Spiegel Jobs-Optionen werden zum Fall für die US-Justiz (12. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. spiegel. de/ wirtschaft/ 0,1518,459388,00.<br />
html)<br />
[52] Handelsblatt Apple schockt Aktionäre (4. August 2006) (http:/ / www. handelsblatt. com/ news/ Unternehmen/ IT-Medien/ _pv/ grid_id/<br />
808828/ _p/ 201197/ _t/ ft/ _b/ 1117065/ default. aspx/ apple-schockt-aktionaere. html)<br />
[53] ZDNet Aktien-Skandal kostet Apple 84 Millionen Dollar (29. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. zdnet. de/ news/ business/<br />
0,39023142,39150326,00. htm)<br />
[54] Macwelt Apples Aktienoptionsaffäre entwickelt sich zum Skandal (24. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. macwelt. de/ news/ apple/ 343106/ index.<br />
html)<br />
[55] Die Zeit Blogger verrieten Firmen-Interna (11. <strong>Jan</strong>uar 2005) (http:/ / www. zeit. de/ 2005/ 03/ apple_vorschau)<br />
[56] NZ Netzeitung GmbH Blogger wehren sich gegen Apple (5. April 2006) (http:/ / www. netzeitung. de/ internet/ 390702. html)<br />
[57] Golem.de Geheimhaltung: Apple lanciert gezielt fingierte Produkte (16. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. golem. de/ 0701/ 49962. html)<br />
[58] golem.de iPhone-Oberfläche – Apple geht gegen Nachahmer vor (15. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. golem. de/ 0701/ 49933. html)<br />
[59] Law-Blog Blogger verrieten Firmen-Interna (16. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. law-blog. de/ 349/<br />
apple-mahnt-blogger-wegen-iphone-berichterstattung-ab/ )<br />
[60] PCMagazin: iPhony – PalmOS-Programmstarter im iPhone-Look (18. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. pc-magazin. de/ common/ nws/<br />
einemeldung. php?id=50015)<br />
[61] Focus: Apple mahnt Blogger ab (16. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. focus. de/ digital/ netguide/ iphone_nid_42753. html)<br />
[62] MacTechNews: Apple-iPhone-Themes für Mobilgeräte (18. <strong>Jan</strong>uar 2007) (http:/ / www. mactechnews. de/ index. php?id=15579)<br />
[63] Electronic Frontier Foundation EFF: Breaking News (https:/ / www. eff. org/ cgi/ mt/ mt-search. cgi?IncludeBlogs=8& search=apple)<br />
[64] Mac Essentials Apple vs. Blogger: Sieg der Pressefreiheit (27. Mai 2006) (http:/ / www. mac-essentials. de/ index. php/ mac/ article/ 17511/<br />
)<br />
[65] InfoWeek Apple muss Blogger entschädigen (1. Februar 2007) (http:/ / www. infoweek. ch/ news/ NW_single. cfm?news_ID=15217)<br />
[66] Matthias Kremp und Christian Stöcker auf Spiegel Online: Apples Sicherheitspolitik — Der paranoide Konzern (http:/ / www. spiegel. de/<br />
netzwelt/ gadgets/ 0,1518,691202,00. html) vom 26. April 2010<br />
Spiegel Online zitiert einen Augenzeugenbericht aus Gizmodo.com: Apple Gestapo – How Apple Hunts Down Leaks<br />
(http:/ / gizmodo. com/ 5427058/ apple-gestapo-how-apple-hunts-down-leaks) (englisch)<br />
[67] Erica Ogg: Report: FTC will investigate Apple (http:/ / news. cnet. com/ 8301-31021_3-20007531-260. html). cnet news, 11. Juni 2010,<br />
abgerufen am 18. Juni 2010 (Englisch): „The new rules blocked developers using other platforms that allow them to make one application that<br />
runs on multiple devices. Then, earlier this week, Apple banned developers from using advertising in their iPhone applications that shares<br />
analytic data with »an advertising service provider owned by or affiliated with a developer or distributor of mobile devices, mobile operating<br />
systems or development environments other than Apple«.“<br />
[68] heise online: „Leutheusser-Schnarrenbergen kritiesiert Apples Datenschutzregeln“ (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/<br />
Leutheusser-Schnarrenberger-kritisiert-Apples-Datenschutzregeln-1029687. html)<br />
[69] http:/ / www. apple. com/ de/<br />
[70] http:/ / www. apple. com/ at/<br />
[71] http:/ / www. apple. com/ chde/<br />
[72] http:/ / www. apple. com/<br />
[73] http:/ / www. macnews. de/<br />
[74] http:/ / www. macup. com/<br />
[75] http:/ / www. mac-developer. de/<br />
[76] http:/ / www. macprime. ch/ applehistory/ geschichte<br />
[77] http:/ / www. theapplemuseum. com<br />
[78] http:/ / apple-history. com/<br />
[79] http:/ / www. apfelwiki. de/ Main/ ApfelWiki
Apple 215<br />
[80] http:/ / www. iphonedevcon. de/<br />
Koordinaten: 37° 19′ 54″ N, 122° 1′ 51″ W (http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Apple&<br />
language=de& params=37. 3316666667_N_122. 030833333_W_region:US-CA_type:landmark)<br />
Cisco Systems<br />
Cisco Systems, Inc.<br />
Unternehmensform Incorporated<br />
ISIN US17275R1023<br />
Gründung 1984<br />
Unternehmenssitz San José (Kalifornien), USA<br />
Unternehmensleitung John T. Chambers (CEO)<br />
Mitarbeiter<br />
Umsatz<br />
65.550 (Juli 2009) [1]<br />
36.117 Mio $ (2009) [1]<br />
Branche Rechnernetze und Telekommunikation<br />
Website<br />
www.cisco.com [2]<br />
Cisco Systems, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. Bekannt ist es<br />
vor allem für seine Router und Switches, die einen großen Teil des Internet-Backbones versorgen.<br />
Geschichte<br />
Cisco wurde im Dezember 1984 von einer Gruppe von Wissenschaftlern (vorrangig<br />
Leonard Bosack und Sandy Lerner) der Stanford University in San Francisco<br />
gegründet. Ziel war es, die Vernetzung von Computern zu vereinfachen und sie<br />
effektiver zu nutzen. 1986 brachte Cisco seinen ersten Multiprotokoll-Router auf<br />
den Markt – eine Mischung aus Hardware und intelligenter Software, die sich bald<br />
als Standard für Networking-Plattformen auf dem Markt etablierte.<br />
Logo bis Oktober 2006<br />
Durch den Internetboom Mitte der 1990er Jahre stieg der Aktienkurs vom Börsengang 1996 bis April 2000 um das<br />
14-fache. Damit war Cisco Systems mit einem Börsenwert von ca. 555 Mrd. US Dollar kurzzeitig das teuerste<br />
Unternehmen der Welt.<br />
Seither hat Cisco Systems ca. 80 % an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung liegt mit aktuell (2007) etwa 180<br />
Mrd. US-Dollar jedoch nach wie vor recht hoch. Im Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftete Cisco einen Rekordumsatz in<br />
Höhe von 39,5 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 8,1 Mrd. US-Dollar. Seit dem 8. Juni 2009 ist Cisco am<br />
DJIA gelistet und somit in den wichtigsten Index der Welt aufgenommen. Cisco hat dabei den Platz von General<br />
Motors eingenommen. [3]
Cisco Systems 216<br />
Name und Logo<br />
Der Name Cisco leitet sich von den beiden letzten Silben des Gründungsortes San Francisco ab. Das Firmenlogo<br />
zeigt in Form von grünen senkrechten Balken ein Kammspektrum eines periodischen Signals, das an die Form der<br />
Golden Gate Bridge erinnert.<br />
Tochterunternehmen<br />
Seit der Gründung hat Cisco Systems mittlerweile über 100 andere Unternehmen<br />
gekauft und integriert. [4] War Cisco traditionell nur bei IT-Abteilungen von<br />
Unternehmen bekannt, versucht sich das Unternehmen im Endverbrauchermarkt zu<br />
etablieren. Ein wichtiger Schritt war dazu im Juni 2003 der Kauf des Unternehmens<br />
Linksys für 500 Mio. USD – einem führenden Hersteller für<br />
Heim-Netzwerk-Technik.<br />
Logo der aufgekauften Linksys<br />
Die seitdem separat geführte Marke Linksys wird in Kürze zugunsten von Cisco aufgegeben, da sich letztere im<br />
Endverbrauchermarkt gut etabliert habe. [5]<br />
Produkte<br />
Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN,<br />
Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall,<br />
Authentifizierung, Virtual Private Network).<br />
Die Cisco-Router, die meisten Switches und Wireless Access<br />
Points arbeiten mit dem Betriebssystem Internetwork<br />
Operating System (IOS). Die Geräte sind durch das IOS<br />
extrem flexibel konfigurierbar/anpassbar, dadurch erklärt sich<br />
höchstwahrscheinlich auch der große Erfolg der<br />
Cisco-Produkte. Früher kam auf den Switches der<br />
Catalyst-Serie das Betriebssystem CatOS zum Einsatz.<br />
Aktuell ist es noch auf der Catalyst 4500, 6500 bzw. 6500-E<br />
Serie von Bedeutung und kann hier auf den<br />
Supervisor-Engines (SUP) sowohl exklusiv als auch im<br />
Hybrid-Modus zusammen mit einem IOS betrieben werden.<br />
In letzterem Fall wird eine Multi Switch Feature Card<br />
(MSFC) auf der SUP benötigt, auf der das IOS läuft. Das<br />
CatOS bietet weniger Features als das IOS, arbeitet aber<br />
Hochleistungsrouter (Cisco 7600 Serie Carrier-Class<br />
Ethernet Lösungen)<br />
dadurch auch stabiler, da es weniger Angriffspunkte bzw. mögliche Fehlerquellen hat. Für das Switching im<br />
Core-Bereich ist es ausreichend bzw. optimal, es wird aber aller Wahrscheinlichkeit komplett durch das IOS ersetzt<br />
werden.<br />
Mit der PIX-Reihe bzw. aktuell ASA ist Cisco auch im Bereich Verschlüsselung und Sicherheit aktiv am Markt. Im<br />
Niedrigpreissegment werden auch die Produkte von Linksys verkauft. Mit den aufkommenden Anordnungen zur<br />
Überwachung des Datenverkehrs im Internet (2000/2001) begann Cisco, passende Lösungen für kleine und große<br />
Internet Service Provider zu entwickeln, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Cisco Systems 217<br />
Unternehmensentwicklungen<br />
• Internetwork Operating System (IOS), Betriebssystem der Cisco-Router und -Switches<br />
• WRT54G, Router von Linksys, quelloffener Firmware-Code<br />
• NSLU2, NAS-Gerät zum Anschluss von USB-Geräten<br />
Protokolle und Standards:<br />
• Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), proprietäres Distance-Vector-Routing-Protokoll<br />
• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), proprietäres Routing-Protokoll<br />
• High-Level Data Link Control (Cisco-HDLC), proprietäre Variante des Sicherungsschicht-Protokolls<br />
• Inter-Switch Link Protocol (ISL), proprietäres VLAN-Protokoll<br />
• Skinny Client Control Protocol (SCCP), proprietäres Protokoll für Telefonate und Konferenzen<br />
• Hot Standby Router Protocol (HSRP), Verfahren zur Steigerung der Verfügbarkeit von wichtigen Gateways in<br />
lokalen Netzen<br />
Cisco Networking Academy<br />
Cisco bietet ein umfangreiches Programm zur Ausbildung und Zertifizierung von Netzwerktechnikern und<br />
Systembetreuern. [6] (Siehe auch: Liste der Cisco-Zertifizierungen)<br />
Cisco in Deutschland<br />
• Senior Vice President and President Cisco Europe: Chris Dedicoat<br />
• Vice President Cisco Germany: Michael Ganser<br />
• Direktor Partner und Allianzen: Bernd Heinrichs<br />
• Direktor Marketing: <strong>Jan</strong> Roschek<br />
• Mitarbeiter in Deutschland: 750<br />
• Standorte in Deutschland: Hallbergmoos bei München, Berlin,<br />
Bonn, Hamburg, Düsseldorf, Eschborn bei Frankfurt, Stuttgart,<br />
Mannheim<br />
(Stand: Juli 2008)<br />
Rechtsstreitigkeiten<br />
Umsatz- und Gewinnentwicklung<br />
Im Jahr 2003 verklagte Cisco Huawei, die angeblich Cisco-Produkte kopierten. [7] Das beklagte Unternehmen lenkte<br />
ein und modifizierte die eigenen Produkte. [8]<br />
Am 11. Dezember 2008 reichte die Free Software Foundation Klage gegen Cisco wegen angeblicher Verstöße gegen<br />
die GNU General Public License und die GNU Lesser General Public License ein. [9]<br />
Weblinks<br />
• Offizielle Website von Cisco (für Deutschland) [10]<br />
• Offizielle Website von Linksys [11]
Cisco Systems 218<br />
Referenzen<br />
[1] Cisco Systems, Inc.: Geschäftsbericht 2009 (https:/ / materials. proxyvote. com/ Approved/ 17275R/ 20090914/ AR_46080/ images/<br />
Cisco-AR2009. pdf). Abgerufen am 14. April 2010 (PDF, Englisch).<br />
[2] http:/ / www. cisco. com<br />
[3] Der Aktionär Online: Cisco Systems: Willkommen im Dow Jones! (http:/ / www. deraktionaer. de/ xist4c/ web/<br />
Cisco-ersetzt-GM-im-Dow_id_201__dId_10396919_. htm) (2. Juni 2009)<br />
[4] Liste der Übernahmen durch Cisco (http:/ / www. cisco. com/ web/ DE/ uinfo/ ubernahme_home. html), cisco.com<br />
[5] Meldung bei Heise zum Auslaufen der Marke Linksys (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 93451)<br />
[6] Cisco IT Certification and Career Paths (http:/ / www. cisco. com/ web/ learning/ le3/<br />
learning_career_certifications_and_learning_paths_home. html) (englisch)<br />
[7] Cisco Systems verklagt Huawei Technologies (http:/ / www. finanznachrichten. de/ nachrichten-2003-01/<br />
1100507-cisco-systems-verklagt-huawei-technologies-009. htm). finanznachrichten.de, 23. <strong>Jan</strong>uar 2003, abgerufen am 21. Dezember 2009.<br />
[8] Cisco zieht Klage gegen Huawei zurück (http:/ / www. finanznachrichten. de/ nachrichten-2004-07/<br />
3682134-cisco-zieht-klage-gegen-huawei-zurueck-009. htm). finanznachrichten.de, 24. Juli 2004, abgerufen am 21. Dezember 2009.<br />
[9] Brett Smith: Free Software Foundation Files Suit Against Cisco For GPL Violations (http:/ / www. fsf. org/ news/ 2008-12-cisco-suit). Free<br />
Software Foundation, 11. Dezember 2008, abgerufen am 21. Dezember 2009 (englisch).<br />
[10] http:/ / www. cisco. com/ web/ DE/ index. html<br />
[11] http:/ / www. linksysbycisco. com
Cluetrain-Manifest<br />
Die Kulturelle Dimension<br />
Das Cluetrain-Manifest (engl. cluetrain manifesto) ist der Titel einer Sammlung von 95 Thesen über das Verhältnis<br />
von Unternehmen und ihren Kunden im Zeitalter des Internets und der New Economy, die 1999 (zu Hochzeiten des<br />
Dotcom-Booms) von den US-Amerikanern Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger<br />
veröffentlicht und von zahlreichen bekannten Experten (etwa Eric S. Raymond) unterschrieben wurde. Später<br />
erschien auch ein Buch unter diesem Titel.<br />
In der Form wird Bezug genommen auf die 95 Thesen des Reformators Martin Luther.<br />
Aussage<br />
"wir sind keine zielgruppen oder endnutzer oder konsumenten. wir sind menschen - und unser einfluss entzieht<br />
sich eurem zugriff. kommt damit klar."<br />
Unter dieser Überschrift ist in 95 Thesen eine pragmatische Sicht auf Menschen und Märkte unter Einbeziehung der<br />
neuen Kommunikationswege wie z.B. des Internets und Handykommunikation formuliert. Es beschreibt, welchen<br />
wachsenden Einfluss die neuen Technologien auf die Kommunikation haben werden und wie dadurch die Macht des<br />
konventionellen Marketing schwindet. Das Manifest skizziert das Ende der einseitigen Kommunikation. Die Märkte<br />
der Zukunft basieren auf den Beziehungen der Menschen untereinander und auf den Beziehungen der Unternehmen<br />
zu den Menschen bzw. den Märkten.<br />
Literatur<br />
• Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls: Das Cluetrain Manifest. 95 Thesen für die neue<br />
Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter. Econ Verlag 2002, ISBN 3430159679<br />
Weblinks<br />
• http:/ / www. cluetrain. org engl.<br />
• http:/ / www. cluetrain. de deutsche Fassung<br />
219
Online-Community 220<br />
Online-Community<br />
Eine Online-Community (Netzgemeinschaft) ist eine Sonderform der Gemeinschaft; hier von Menschen, die<br />
einander via Internet begegnen und sich dort austauschen. Findet die Kommunikation in einem Sozialen Netzwerk<br />
statt, das als Plattform zum gegenseitigen Austausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen dient (oft in<br />
Form von User Generated Content), spricht man auch von Sozialen Medien.<br />
Struktur<br />
Ermöglicht wird dies durch dafür eingerichtete Plattformen. E-Mail, Chat, Instant-Messenger und Foren sind die<br />
bekanntesten Tools, die Kommunikation zwischen den Mitgliedern ermöglichen. Eine Online-Community muss<br />
aufgebaut, gepflegt und betreut werden. Oft werden Mitglieder aus der Online-Community für die Aufgaben mit<br />
einbezogen. Im crossmedial arbeitenden Journalismus spielen ausgehend vom Online-Journalismus Leser-, Hörer-<br />
und Zuschauer-Communitys bei der Leser-Blatt-Bindung eine wichtige Rolle. Anfangs wurde die<br />
Online-Community oft mit der Technik gleichgesetzt, die von der Online-Community genutzt wird. Eine<br />
Gemeinschaft definiert sich jedoch nicht über die Technik, sondern durch den Inhalt, der sie zusammenführt.<br />
Soziologisch betrachtet handelt es sich um ein soziales Phänomen.<br />
Geschichte<br />
Im Jahre 1985 konstituierte sich in Sausalito, San Francisco, Nordkalifornien, ein netzbasierter Debattierclub namens<br />
„The Well“ (the Whole Earth 'Lectronic Link). Die von Stewart Brand und Larry Brilliant gegründete Community<br />
kann als eine der ersten Communitys des Internet angesehen werden. Allerdings lassen sich auch die ersten<br />
Mailinglisten als Communitys auffassen. Howard Rheingold verwendete als erster in seinem Buch den Begriff<br />
‚virtuelle Gemeinschaften’, die heute als Online-, Net-, Cyber- oder E-Communitys bezeichnet werden.<br />
Schreibweise<br />
Der Duden (23. Auflage) empfiehlt „Onlinecommunity“ (ohne Bindestrich), respektive als Mehrzahl<br />
„Onlinecommunitys“, da der Begriff inzwischen ein Lehnwort darstelle und entsprechend den Regeln der deutschen<br />
Grammatik dekliniert werde.<br />
In der Literatur finden sich die Termini Virtuelle oder Online-Community, vor allem im Englischen ist "Virtual<br />
Community" weit verbreitet. Eine Suche in der ACM Digital Library zeigt eine etwa gleiche Verteilung der beiden<br />
Begriffe in vorhandenen Publikationen. Der Begriff Virtualität ist allerdings missverständlich: Virtuell kann "der<br />
Möglichkeit nach vorhanden" oder "so tun, als ob" bedeuten. Demnach wäre eine virtuelle Community keine<br />
vollwertige Gemeinschaft. Eine Online-Community soll aber als Teilmenge aller echten Gemeinschaften verstanden<br />
werden, deren Mitglieder sich online anstatt Face-To-Face austauschen. Daher empfiehlt es sich, den Begriff<br />
"Online-Community" konsequent zu verwenden.
Online-Community 221<br />
Bedeutung<br />
Eine Community-Plattform im Internet bietet die grundlegenden Werkzeuge zur Kommunikation wie E-Mail, Foren,<br />
Chatsysteme, Newsboards, Tauschbörsen, MatchMaking u.v.m. Je nach Zielgruppe werden die Funktionen<br />
abgestimmt und auf die Interessen der Benutzer zugeschnitten. Hierbei sind Rückmeldungen von Nutzern (Wünsche,<br />
Anfragen, Ideen) sinnvoll, da sie zur Steigerung der Attraktivität und Akzeptanz beitragen.<br />
Online-Communitys entwickeln sich vor allem dann erfolgreich, wenn ihre treibende Kraft nicht die Marketingidee<br />
eines Unternehmens ist, sondern sie aus sich selbst, also den Wünschen der Gemeinschaft zu wachsen verstehen.<br />
Beispiele für funktionierende Communitys:<br />
• Usenet<br />
• deviantART<br />
• MySpace<br />
Die meisten Online-Communitys sind dem Grunde nach demokratisch organisiert, in Einzelnen zeichnet sich aber<br />
eine steigende Tendenz zu Hierarchisierung und Institutionen ab. Im Idealfall gibt sich die Community eigene<br />
Regeln. Sogar gerichtsbarkeitsähnliche, parlamentarische oder polizeiähnliche Institutionen wurden – meist auf<br />
Wunsch der Benutzer – eingeführt. Insoweit wird auch eine Entwicklung zu „Gesetzen“ und starren Regularien –<br />
oder wenigstens der Wunsch danach – erkennbar. Juristische Begriffe wie „unzulässig“, „Angeklagter“,<br />
„unrechtmäßig“ usw. finden mit zunehmender Tendenz Verwendung in den Diskussionen.<br />
Kommerzielle Online-Communitys<br />
Eine kommerzielle Online-Community ist eine Online-Community, die unter Aufsicht eines Unternehmens steht.<br />
Die Gemeinschaft nutzt dabei zur Kommunikation die Infrastruktur des Unternehmens. Auch die Moderation wird<br />
meist von dem Unternehmen übernommen.<br />
Kommerzielle Online-Communitys erlauben im Unterschied zu nicht-kommerziellen Online-Communitys meist<br />
nicht die freie Wahl eines Vorstands und lassen Werbeeinnahmen nicht nur Gemeinschaftszwecken zugute kommen,<br />
sondern nutzen diese, um Gewinn auszuschütten.<br />
Eine besondere Form einer kommerziellen Online-Community ist das Kundenforum, das den Kunden die<br />
Kommunikation untereinander über die angebotenen Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. Es erspart den<br />
Kunden den Aufbau einer eigenen Kommunikationsplattform.<br />
Viele kommerzielle „<strong>Social</strong> Network“-Dienste sind mit einer kommerziellen Online-Community verbunden. Diese<br />
geschlossenen Online-Communitys erlauben keine Kommunikation mit Mitgliedern anderer Communitys. Dazu<br />
zählen MySpace, Facebook, StayFriends, wer-kennt-wen und Lokalisten sowie studiVZ, schülerVZ und meinVZ.<br />
Online-Dienstleistungsanbieter verbinden ihre Dienstleistung mit einer kommerziellen Online-Community, um<br />
Kunden an sich zu binden. Kunden müssen bei einem Wechsel des Anbieters auf diese Weise nicht nur die Qualität<br />
der Dienstleistung, sondern auch die mit der Dienstleistung verbundene Community beachten. Ein bekannter<br />
Anbieter ist der Foto-Hoster Flickr.<br />
Der Mikro-Blogging-Dienst Twitter ist mit einer geschlossenen kommerziellen Online-Community verbunden.<br />
Andere Mikro-Blogging-Dienste erlauben über offene Standards wie OpenMicroBlogging die Kommunikation mit<br />
beliebigen Personen.<br />
Seit 2002 erschienen im Internet auch kommerzielle, geschlossene Shopping-Communitys, die man erst durch eine<br />
Einladung eines Mitgliedes oder mit Hilfe eines so genannten Club-Schlüssels betreten konnte.
Online-Community 222<br />
Themenorientierte Communitys<br />
Themenorientierte Communitys bekommen ihre Anziehungskraft aus einem Thema, welches alle Nutzer eint. Dies<br />
kann ein Hobby sein, wie bei Sci-Fi-Communitys und Sport-Communitys oder der Glaube, wie bei religiösen<br />
Communitys, oder politische Netzwerke bzw. Politcommunitys.<br />
Sci-Fi-Community<br />
Eine Sci-Fi-Community ist im allgemeinen eine Online-Community, die sich mit Science Fiction beschäftigt. Es gibt<br />
diese Communitys in den unterschiedlichsten Arten und Ausrichtungen, z.B. online als Foren-Community, als<br />
Chat-Community aber in Einzelfällen auch offline, als Verein organisiert. Die meisten Sci-Fi-Communitys widmen<br />
sich einem oder einzelner Genres oder Serien. So gibt es z.B. Star-Trek-Communitys oder Star-Wars-Communitys<br />
als Subspezies der Sci-Fi-Communitys. Oft wird eine Vermischung von den Sci-Fi-Fans der einzelnen Genres mit<br />
Unmut betrachtet, manche tolerieren dieses gar nicht. Zwischen den unterschiedlichen Sci-Fi-Communitys bricht da<br />
auch schon mal Streit aus, welche Serie und welcher Film denn nun die bessere Grundlage, Möglichkeit zur dort<br />
gezeigten realen Umsetzung in der Zukunft oder welche Ideologie die Beste sei. Reine Sci-Fi-Communitys, die sich<br />
allen Serien und Genres gleichermaßen widmen, sind deshalb wenig verbreitet, fühlen sich aber als Beispiel für die<br />
Prinzipien von Toleranz, Akzeptanz und Zusammenleben im interkulturellen Maßstab. Wie bei Communitys üblich,<br />
werden die meisten auch hier ehrenamtlich von Fans betrieben und betreut und sind i. d. R. kostenlos. Es werden u.a.<br />
Events abgehalten, wie Chatrollenspiele, Quiz zu einzelnen Sci-Fi Themen, manche unternehmen auch online in<br />
Sci-Fi Online-Spielen Ausflüge oder es werden offline Treffen und Konventions veranstaltet, häufig sind hier die<br />
Schauspieler oder Autoren der Serien anzutreffen.<br />
Methodenorientierte Communitys<br />
Wiki Community<br />
Eine Wiki Community ist eine Online-Community, die sich um ein Wiki-Projekt herum bildete. Den Nutzern hier<br />
geht es im Gegensatz zu denen von anderen Untergruppen von Online-Communitys darum, gemeinsam – zumeist<br />
textliche – Inhalte online zu erstellen und sie anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. So verfolgt beispielsweise<br />
die Wikipedia das Ziel, „die Gesamtheit des Wissens unserer Zeit in lexikalischer Form anzubieten“. [1] Es finden<br />
über diese Inhaltserstellung teilweise heftige Diskussionen statt. Sie benutzen dafür eine spezielle Software und sind<br />
daher eher weniger über Chat oder Foren organisiert, es finden aber auch Offline-Treffen statt.<br />
Voting Community oder Rating Community<br />
Eine Voting Community bzw. eine Rating-Community ist eine Online-Community, deren Mitglieder sich einer<br />
Bewertung durch andere Mitglieder stellen. Einige dieser Communitys lassen auch Bewertungen durch<br />
Nichtmitglieder zu. In den meisten Fällen werden ausschließlich Fotos der Mitglieder zur Bewertung gestellt, die<br />
üblicherweise mit null bis zehn Punkten bewertet werden können. Einige wenige Communitys dieser Art legen<br />
jedoch bewusst Wert darauf, dass die Bewertungen nicht nur die Bilder betreffen sollen, sondern den<br />
Gesamteindruck aus Fotos, Vorstellungstexten, Beiträgen in eventuell vorhandenen Foren, privatem Kontakt und so<br />
weiter.<br />
In den meisten Voting Communitys laufen die Abstimmungen ununterbrochen, und es werden höchstens Wochen-<br />
oder Monatsbeste gekürt und dann auf der Hauptseite der Community entweder direkt oder per Link präsentiert.<br />
Einige wenige Voting Communitys führen allerdings tatsächlich ein Jahr lang laufende Runden durch und küren am<br />
Ende dieser Runden eine Siegerin und/oder einen Sieger, ganz ähnlich wie bei Misswahlen.<br />
In vielen Voting Communitys gibt es immer wieder Diskussionen darüber, wie viel nackte Haut denn toleriert<br />
werden soll. Abgesehen von solchen Communitys, die bewusst (zur Gewinnung von Werbekunden etwa und zur
Online-Community 223<br />
Steigerung der Zugriffszahlen) jegliche Entblößung tolerieren, gelten in den meisten Communitys<br />
Bikini/Unterwäsche bei Frauen und Unterhose bei Männern als minimale Bekleidung. Dennoch entbrennen<br />
regelmäßig Diskussionen darüber, wie „billig“ solch eine Präsentation ist. Oft wird dabei als Argument der Ruf der<br />
jeweiligen Community ins Feld geführt – welchem von der Gegenseite nicht selten damit begegnet wird, dass hier<br />
wohl der Neidfaktor eine Rolle spiele. Die Freizügigkeitstoleranz einer Voting Community ist deswegen auch eines<br />
der Kriterien, in welcher Community sich ein/eine Nutzer/in wohl fühlt.<br />
Siehe auch<br />
• Community Management<br />
• Cybergesellschaft<br />
• Soziales Netzwerk (Soziologie)<br />
• Soziales Netzwerk (Informatik)<br />
• Sprachgebrauch, ab Internet<br />
• Soziale Software<br />
Literatur<br />
• Michael Bächle: Virtuelle Communities als Basis für ein erfolgreiches Wissensmanagement. In: HMD. Praxis der<br />
Wirtschaftsinformatik. Nr. 246, Dezember 2005, S. 76–83.<br />
• Christian Eigner, Helmut Leitner, Peter Nausner: Online-Communities, Weblogs und die soziale Rückeroberung<br />
des Netzes. Nausner & Nausner, 2003. ISBN 3-901402-37-3.<br />
• Gabriele Hooffacker: Online-Journalismus. Schreiben und Konzipieren für das Internet. Ein Handbuch für<br />
Ausbildung und Praxis. 3. Auflage. Econ, Berlin 2010, ISBN 978-3-430-20096-7<br />
• Amy Jo Kim: Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities. Peachpit<br />
Press, 2000. ISBN 0-201-87484-9. (Anmerkung: mehr erfahrungsbasiertes HowTo, keine wissenschaftliche<br />
Arbeit)<br />
• Christian Jakubetz: Crossmedia. UVK, Konstanz 2008. ISBN 978-3-86764-044-2.<br />
• Erik Möller: Die heimliche Medienrevolution – Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern.<br />
Heise, 2004 ISBN 3-936931-16-X.<br />
• Derek M. Powazek: Design for Community – The Art of Connecting Real People in Virtual Places [2] . ISBN<br />
0-7357-1075-9.<br />
• Howard Rheingold: Virtuelle Gemeinschaften: Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers. Addison Wesley,<br />
Bonn/Paris 1994.<br />
• Howard Rheingold: The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier [3] . 2. Auflage. MIT Press,<br />
2000, ISBN 0-262-68121-8.<br />
• Rosenkranz, C., Feddersen, C. (2010). Managing viable virtual communities: an exploratory case study and<br />
explanatory model. International Journal of Web Based Communities. Volume 6, Number 1: 5-14.<br />
• Marc Smith, Peter Kollock (Hrsg.): Communities in Cyberspace. Routledge, 1998. ISBN 0-415-19140-8.<br />
• Claudia Verstraete: Virtuelle Marken-Communities. Newsgroups und Chats als Instrumente der Markenbindung.<br />
Josef Eul Verlag, Lohmar/Köln 2004. ISBN 3-89936-193-8.<br />
• Chris Werry, Miranda Mowbray: Online Communities. Prentice Hall, 2001. ISBN 0-13-032382-9.<br />
• Christian Stegbauer: Grenzen virtueller Gemeinschaft. Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen. Verlag<br />
für Sozialwissenschaften, 2001. ISBN 3-531-13644-5.<br />
• <strong>Jan</strong> Milz: Instant-Online-Communities (Diplomarbeit, http:/ / www. dir-info. de/ autor/ jan-milz/ diplomarbeit/ )
Online-Community 224<br />
Weblinks<br />
• Linkkatalog [4] zum Thema Communitys im ODP (Open Directory Project)<br />
Referenzen<br />
[1] q:Wikiquote:Schwesterprojekte<br />
[2] http:/ / designforcommunity. com/<br />
[3] http:/ / www. rheingold. com/ vc/ book/<br />
[4] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Deutsch/ Computer/ Internet/ WWW/ Communitys/<br />
Verbundenheit<br />
Als Verbundenheit wird in der Psychologie der Kommunikation das Gefühl bezeichnet, einer anderen Person oder<br />
einer Personengruppe zugehörig zu sein und in einer gegenseitig vertrauensvollen Beziehung zu stehen.<br />
Nach Friedemann Schulz von Thun ist die Verbundenheit eines der vier seelischen Grundbedürfnisse – neben dem<br />
Empfinden von Eigenwert, einem ausreichenden Grad an Freiheit und dem Bedürfnis, geliebt zu sein.<br />
Siehe auch<br />
• Soziologie<br />
• Gesprächstherapie<br />
• Empathie<br />
• Partnerschaft<br />
• Ehe<br />
• Encounter (Psychologie)
Globales Dorf 225<br />
Globales Dorf<br />
Globales Dorf (engl. Global Village) ist ein Begriff aus der Medientheorie, den Marshall McLuhan 1962 in seinem<br />
Buch The Gutenberg Galaxy prägte und in seinem letzten Buch The Global Village ausformulierte. Er bezieht sich<br />
damit auf die moderne Welt, die durch elektronische Vernetzungen zu einem "Dorf" zusammenwächst. Heute wird<br />
der Begriff zumeist als Metapher für das Internet und das World Wide Web gebraucht. Ohne seinen Standort zu<br />
ändern kann man über das Internet mit Menschen aus aller Welt in Kontakt treten.<br />
Obwohl der Begriff ein Toponym darstellt, versteht McLuhan darunter eher eine historische Epoche als einen Ort.<br />
Sie folgt laut ihm unmittelbar auf die sogenannte "Gutenberg-Galaxis", also das Buch-Zeitalter. Ihre Anfänge lassen<br />
sich bereits in der Erfindung der Alphabete erkennen, den entscheidenden Durchbruch brachte erst die Erfindung der<br />
Druckerpresse durch Johannes Gutenberg. Sie erst machte den allgemeinen Erwerb und die Nutzung von<br />
Schriftstücken und damit einer großen Menge an Information möglich.<br />
Das globale Dorf würde die Gutenberg-Galaxis nun ablösen (McLuhan schrieb das Buch in den Sechzigern).<br />
Individualität würde im Globalen Dorf zugunsten einer kollektiven Identität aufgegeben. McLuhan beschrieb den<br />
Begriff nicht mit dem positiven Beiklang, den es heute häufig hat. Er warnte vor Möglichkeiten des Missbrauchs,<br />
vor Totalitarismus und Terrorismus, wenn auf die Gefahren, die von den neuen Medien ausgehen, nicht angemessen<br />
reagiert würde.<br />
Der Begriff wird in der modernen Medientheorie im allgemeinen nicht mehr verwendet. Vielmehr spricht man heute<br />
von der McLuhan-Galaxis (Manuel Castells), die den Übergang zur Turing-Galaxis (Volker Grassmuck) stellt, oder<br />
man verwendet den allgemeinen Ausdruck elektronisches Zeitalter, um das Ende der Gutenberg-Galaxis zu<br />
bezeichnen.<br />
Siehe auch<br />
• Global City<br />
• Marshall McLuhan<br />
Literatur<br />
• McLuhan, Marshall: Gutenberg Galaxy. 1962 ISBN 0802060412<br />
• McLuhan, Marshall/ Powers, Bruce R.: The Global Village. Der Weg der Mediengesellschaft in das 21.<br />
Jahrhundert. 1995 ISBN 387387217X
Computer Supported Cooperative Work 226<br />
Computer Supported Cooperative Work<br />
Als Computer Supported Cooperative Work oder Computer Supported Collaborative Work (CSCW), dt.<br />
computerunterstützte oder rechnergestützte Gruppenarbeit, wird ein interdisziplinäres Forschungsgebiet aus<br />
Informatik, Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften,<br />
Medienwissenschaft und verschiedenen weiteren Disziplinen bezeichnet, das sich mit Gruppenarbeit und<br />
Zusammenarbeit und den die Gruppenarbeit unterstützenden Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
befasst; die zentralen Forschungsgegenstände der CSCW sind also die Kooperationen zwischen Menschen und deren<br />
Unterstützbarkeit mit Rechnern [1] .<br />
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) ist die Bezeichnung des Forschungsgebietes, welches auf<br />
interdisziplinärer Basis untersucht, wie Individuen in Arbeitsgruppen oder Teams zusammenarbeiten und wie sie<br />
dabei durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt werden können. Ziel aller Bemühungen im<br />
Gebiet CSCW ist es, unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Mittel der Informations- und<br />
Kommunikationstechnologie, Gruppenprozesse zu untersuchen und dabei die Effektivität und Effizienz der<br />
Gruppenarbeit zu erhöhen. In neueren Entwicklungen hat sich die Disziplin auch Kommunikations- und<br />
Kooperationsszenarien jenseits der Arbeitswelt zugewandt (z. B. Online-Communitys im Freizeit- und<br />
Heimbereich).<br />
Die Hilfsmittel für die Kooperation innerhalb von Gruppen und Teams werden als Groupware (für schwach<br />
strukturierte Arbeitsprozesse) oder Workflow-Management-Systeme (für stark strukturierte Arbeitsprozesse)<br />
bezeichnet; dies schließt sowohl Hardware (beispielsweise Kameras, Displays) als auch Software ein.<br />
In der Forschung zu CSCW werden drei eng miteinander zusammenhängende Forschungsbereiche unterschieden<br />
(nach Hasenkamp 1994):<br />
• die Entwicklung eines Verständnisses der Zusammenarbeit und Koordination<br />
• die Entwicklung von Konzepten und Werkzeugen für die Unterstützung arbeitsteiliger Prozesse<br />
• die Bewertung dieser Konzepte und Werkzeuge<br />
Umgangssprachlich werden die Begriffe CSCW, Groupware und Workgroup Computing häufig weitgehend<br />
synonym gebraucht.<br />
Geschichte<br />
Der Begriff CSCW wurde 1984 durch einen Workshop in Endicott House (MA) von Irene Greif und Paul Cashman<br />
geprägt.<br />
Die erste internationale Konferenz fand 1986 in Austin, Texas statt (CSCW '86), die nächste Februar 2010 in<br />
Savannah, Georgia [2] . In den ungeraden Jahren wird in Europa die ECSCW [3] organisiert: 2005 in Paris [4] , 2007 in<br />
Limerick, Irland, 2009 in Wien [5] , Konferenzbeiträge sind online verfügbar [6] .<br />
Die Anfänge der CSCW-Forschung gehen auf Arbeiten vom Anfang der 80er Jahre zurück, die auch als euphorische<br />
Phase bezeichnet werden.<br />
Ende der 80er Jahre stellte sich Ernüchterung aufgrund mangelnder Akzeptanz ein; diese Zeit wird auch als<br />
Katzenjammer-Phase bezeichnet.<br />
In den 90er Jahren setzte die pragmatische Phase ein, in deren Verlauf praktikable und benutzbare Lösungsansätze<br />
erarbeitet wurden, die weniger auf eine Automatisierung von Kooperationsprozessen, sondern auf eine flexible<br />
Unterstützung setzen.<br />
Eine Variante des CSCW-Ansatzes ist das Computer-Supported Cooperative Learning (CSCL).
Computer Supported Cooperative Work 227<br />
Systemkategorien<br />
Es gibt verschiedene Arten von Systemen. Grundsätzlich werden diese in folgende Typen unterteilt:<br />
• Konferenzsysteme<br />
• Entscheidungsunterstützung<br />
• Mehrbenutzereditoren<br />
• Hypermedia<br />
• Koordinationssysteme<br />
• Verteilte Büroabläufe<br />
Konferenzsysteme<br />
Konferenzsysteme sind dafür ausgelegt, dass mehrere Teilnehmer, welche sich meist an entfernten Orten befinden,<br />
über ein gemeinsames Problem diskutieren können. Dabei ermöglicht der Informations- und Dokumentenzugriff das<br />
Einsehen von Informationen von allen Teilnehmern. Meistens wird in solchen Systemen Anonymität als ein<br />
Merkmal gewährleistet, so dass beispielsweise eine Abstimmung anonym erfolgen kann. Konferenzsysteme lassen<br />
sich in 3 Kategorien einteilen:<br />
• Konferenzzentrum:<br />
Das Konferenzsystem ist zentral, meistens in einem Raum beziehungsweise Büro, untergebracht. Spezielle<br />
audiovisuelle Werkzeuge ermöglichen gute Präsentationstechnik und Informationsverarbeitung. Auch das<br />
Übertragen von Dokumenten sollte möglich sein.<br />
• Telekonferenzen:<br />
Diese Form der Konferenz ist am Leichtesten zu benutzen beziehungsweise aufzubauen, da sie zum Beispiel via<br />
ISDN als Telefonkonferenz zwischen mehreren Mithörenden eingerichtet werden kann. Aber auch in diesem Sektor<br />
sind verteilte Videokonferenzen möglich.<br />
• Elektronische Meeting Systeme:<br />
Elektronische Meeting Systeme (EMS) ermöglichen eine synchrone oder asynchrone Interaktion zwischen den<br />
Meeting-Teilnehmern, die durch spezifische Werkzeuge wie Brainstorming, Abstimmungen oder Diskussionen<br />
unterstützt und strukturiert wird. Meetings werden von einem Moderator über eine Agenda gegliedert und gesteuert.<br />
Beiträge werden in der Regel anonymisiert. Ergebnisse automatisch protokolliert. Für synchrone Meetings werden<br />
EMS häufig um Telefonkonferenzen oder Webkonferenzen (Screensharing) ergänzt.<br />
• Computerkonferenzen:<br />
Computerkonferenzen ermöglichen eine verteilte asynchrone Interaktion zwischen den einzelnen Teilnehmern. Zu<br />
verschiedenen Communities of Interest lassen sich einzelne Chaträume aufbauen, in dessen die Gruppenteilnehmer<br />
sich untereinander austauschen können. Die bekannteste Art der Computerkonferenz sind wahrscheinlich Internet<br />
usenet news.<br />
Mehrbenutzereditoren<br />
Mehrbenutzereditoren bezeichnen Systeme, die das gleichzeitige (synchrone) und/oder zeitlich versetzte<br />
(asynchrone) Bearbeiten von Texten, Bildern oder anderen Inhalten durch mehrere Benutzer ermöglichen. Während<br />
synchrone Systeme insbesondere mit der Technik eines gemeinsamen Arbeitsbereiches (shared view) nach dem<br />
Prinzip WYSIWIS (What You See Is What I See) arbeiten, unterstützen asynchrone Systeme die Zusammenarbeit<br />
insbesondere durch Kommentare (Annotationen) und die Nachverfolgbarkeit von Änderungen durch Versionierung.<br />
Als Beispiel für synchrone Mehrbenutzereditoren sind sogenannte Whiteboards (wie z.B. in Microsoft Netmeeting).<br />
Ein Beispiel für einen asynchronen Mehrbenutzereditor ist der zur Erstellung dieses Textes verwendete<br />
<strong>Media</strong>Wiki-Editor.
Computer Supported Cooperative Work 228<br />
Der Fokus von Mehrbenutzereditoren liegt (Stand:2007) auf der Erstellung von Texten jedoch ist bereits Software<br />
erhältlich, mit der kooperativ andere Medientypen erstellt und verändert werden können. Beispielsweise openCanvas<br />
1.1b oder andere Paint chat-Applikationen für synchrones Erstellen von Bildern. Auch für asynchrone<br />
Videoerstellung existieren bereits Softwarelösungen.<br />
Ein Anwendungsbereich ist das kollaborative Schreiben.<br />
Hypermedia<br />
Elektronische Dokumente, die Verbindungen (Hyperlinks) zu anderen Medien wie Grafik, Sound oder Video<br />
enthalten. Sie ermöglichen multimediale Informationspräsentationen und –zugriff mittels Verknüpfungen...<br />
Koordinationssysteme<br />
Sie ermöglichen die Koordinierung von für die Lösung einer Aufgabe notwendigen Schritten der einzelnen<br />
Teilnehmer einer Gruppe. Sie modellieren den Datenfluß, die Funktion, die Interaktion oder die Kommunikation<br />
innerhalb einer Organisationsstruktur.<br />
Literatur<br />
[1] Ellis et al: Groupware: some issues and experiences. 1991.<br />
[2] http:/ / www. cscw2010. org/<br />
[3] http:/ / www. ecscw. org/<br />
[4] http:/ / insitu. lri. fr/ ecscw/<br />
[5] http:/ / www. ecscw09. org/<br />
[6] http:/ / www. ecscw. org/ proceedings. htm<br />
• Tom Gross, Michael Koch: Computer-Supported Cooperative Work: Interaktive Medien zur Unterstützung von<br />
Teams und Communities, Oldenbourg Verlag, München, 2007. ISBN 3-486-58000-0<br />
• Schwabe, Gerhard; Streitz, Norbert; Unland, Rainer (Hrsg.): CSCW-Kompendium: Lehr- und Handbuch zum<br />
computerunterstützten kooperativen Arbeiten. Berlin: Springer, 2001. ISBN 3-540-67552-3.<br />
• Burger, Cora: Groupware. Kooperationsunterstützung für verteilte Anwendungen. Heidelberg 1997. ISBN<br />
3-920993-60-8.<br />
• Schmalzl, B (Hrsg.): Arbeit und elektronische Kommunikation der Zukunft: Methoden und Fallstudien zur<br />
Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung. Springer Verlag, Berlin et al. 2004. ISBN 3-540-00949-3.<br />
• Borghoff, Uwe M.; Schlichter, Johann H. : Rechnergestützte Gruppenarbeit - Eine Einführung in verteilte<br />
Anwendungen. Springer Verlag, 1998, 2.Auflage. ISBN 3-540-62873-8<br />
• Hasenkamp U., Kirn S., Syring M.(Hrsg.): CSCW - Computer Supported Cooperative Work.<br />
Informationssysteme für dezentralisierte Unternehmensstrukturen. Bonn, Addison Wesley, 1994. ISBN<br />
3-89319-648-X<br />
• Riemer, K., Strahringer, S. (Hrsg.): eCollaboration, HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 267, Juni 2009.<br />
ISBN 978-3898645997.<br />
Weblinks<br />
• Fachgruppe CSCW der Gesellschaft für Informatik (http:/ / www. fgcscw. de/ )<br />
• Proceedings der ECSCW (http:/ / www. ecscw. org)<br />
• InfoWissWiki (http:/ / wiki. infowiss. net/ CSCW) - Das Wiki der Informationswissenschaft, Artikel “CSCW“<br />
beschreibt Begriffe, Klassifikationen, Technologien
Millennials 229<br />
Millennials<br />
Millennials (zu deutsch etwa: die Jahrtausender) wird seitens Soziologen diejenige menschliche Generation der<br />
Bevölkerung genannt, die nach 1980 geboren wurde und jetzt (2010) etwa ein Lebensalter von Mitte bis Ende 20<br />
aufweist. Je nach Quelle werden die Millennials auch als Generation Y, Gen Y oder Digital Natives [1] bezeichnet.<br />
Sie gelten damit als Nachfolgegeneration der Baby-Boomer und der Generation X.<br />
Soziologische Charakterisierung<br />
Millennials gelten als gut ausgebildet, meist mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Sie zeichnen sich durch<br />
eine technologieaffine Lebensweise aus, da es sich um die erste Generation handelt, die größtenteils in einem<br />
Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen ist. Millennials arbeiten lieber in virtuellen Teams<br />
anstatt in tiefen Hierarchien. Sie sind multikulturell und weltoffen und arbeiten zusammen, ohne sich den Kopf über<br />
traditionelle Rollen (zum Beispiel Geschlecht) oder ethnische Herkunft zu zerbrechen. Die Millennials sind<br />
optimistisch und selbstbewusst und haben Vertrauen in die Regierung, weshalb sie sich auch nicht sehr aktiv ins<br />
politische Geschehen einbringen. Ihre politische Einstellung gilt in den USA als liberal, sie rebellieren weder gegen<br />
die Gesellschaft noch gegen den Kapitalismus, sondern suchen aktiv Veränderungen. Als „Gegenpol“ bzw. Verlierer<br />
dieser Generation bezeichnet Elisabeth Weyermann in einem Beitrag der Schweizer Zeitung „Der Bund“ unter Bezug<br />
auf den gleichnamigen Buchtitel von Susanne Finsterer und Edmund Fröhlich die Generation Chips, die –<br />
überwiegend in der sog. Unterschicht – durch zu viel Medienkonsum und einseitige Ernährung von der<br />
gesellschaftlichen Teilhabe weitgehend ausgeschlossen ist.<br />
Studie<br />
Im Auftrag des Technologiekonzerns Xerox erschien Ende 2006 unter dem Titel „Ist Europa bereit für die<br />
Millenials?“ eine Studie, welche die Bedeutung der Millenials als Mitarbeiter und Konsumenten begutachtet. [2]<br />
Weblinks<br />
• Generation Y ante portas [3] WISU-Beitrag mit Fallbeispielen (PDF-Datei; 115 kB)<br />
• Millennials - was der Nachwuchs wirklich will [4] Beitrag der „Computer Woche“<br />
• Broadband Consumers, Perspectives Paper [5] Studie von Ericsson über die Digital Natives und deren<br />
Konsumverhalten (Erschienen im <strong>Jan</strong>uar 2008; PDF-Datei)<br />
Referenzen<br />
[1] Studie von Ericsson über die Digital Natives und deren Konsumverhalten (Erschienen im <strong>Jan</strong>uar 2008) (http:/ / www. ericsson. com/ ericsson/<br />
corpinfo/ publications/ ericsson_business_review/ pdf/ 108/ understanding_digital_natives. pdf)<br />
[2] Is Europe Ready For The Millennials? (http:/ / www. ffpress. net/ Kunden/ XER/ Downloads/ XER87000/ XER87000. pdf) komplette<br />
Xerox-Studie in englischer Sprache<br />
[3] http:/ / www. darwiportunismus. de/ texte/ dp_wisu. pdf<br />
[4] http:/ / www. computerwoche. de/ job_karriere/ personal_management/ 588806/<br />
[5] http:/ / www. ericsson. com/ ericsson/ corpinfo/ publications/ ericsson_business_review/ pdf/ 108/ understanding_digital_natives. pdf
Digital Native 230<br />
Digital Native<br />
Als Digital Natives werden Personen bezeichnet, die zu einer Zeit aufgewachsen sind, in der bereits digitale<br />
Technologien wie Computer, das Internet, Handys und MP3s verfügbar waren. Als Antonym existiert der Begriff<br />
des Digital Immigrant (dt.: digitaler Einwanderer“ [1] oder digitaler Immigrant), der diese Dinge erst im<br />
Erwachsenenalter kennengelernt hat.<br />
Etymologie<br />
Der Begriff wurde von Marc Prensky [2] geprägt, einem ausgebildeten Pädagogen und Manager mit Aktivitäten auch<br />
im Bereich E-Learning. Als Ursprünge des Begriffs gelten der Artikel Digital Natives, Digital Immigrants in der<br />
Zeitschrift On The Horizon im Oktober 2001 und der Folgeartikel Do They Really Think Differently? im Dezember<br />
2001. Als Übertragungen ins Deutsche werden „[der] Digital-Native“ [3] , „digitale Eingeborene“ [4] , „digitaler<br />
Ureinwohner“ [1] , „Digital Einheimische“ [5] und Ähnliches verwendet.<br />
Ein Synonym ist der Begriff born digital („digital geboren“) [6] , welcher schon früher für Medien und Kunst<br />
verwendet wurde, die rein digital entstanden sind. Eine Bezeichnung mit anderem Schwerpunkt ist Generation<br />
Internet. [7] Im Gegensatz zur in die Zukunft sehr offenen Bezeichnung Digital Natives ist dieser Begriff eher endlich<br />
und wird irgendwann durch etwas Neues abgelöst, was auch für das ähnliche Generation M[edia] [7] gilt.<br />
Allgemeiner kann man sie als Millennials oder Generation Y bezeichnen.<br />
Beschreibung<br />
Prensky beschreibt mit Digital Natives 2001 alle Schüler vom Kindergarten bis zum College. John Palfrey und Urs<br />
Gasser legen mit 1980 als ältestem Geburtsjahrgang von Digital Natives in ihrem 2008 erschienenen Buch "Born<br />
Digital" eine noch deutlichere Grenze [8] . Es ist die erste Generation, welche von klein auf mit den neuen<br />
Technologien des digitalen Zeitalters aufgewachsenen ist. Computerspiele, E-Mails, Internet, Handys und Instant<br />
Messaging seien integrale Bestandteile ihres Lebens, sie wurden schon früh damit sozialisiert. Diese allgegenwärtige<br />
Ausstattung und die massive Interaktion damit führe zu einem anderen Denken, anderen Denkmustern und zu einem<br />
fundamentalen Unterschied, Informationen zu verarbeiten. Grundlage ist demnach, dass unterschiedliche<br />
Erfahrungen zu unterschiedlichen Hirnstrukturen führen. Sie seien gewohnt, Informationen sehr schnell zu<br />
empfangen, sie lieben es, parallel in Multitasking zu arbeiten. Sie lieben den Direktzugriff auf Informationen (im<br />
Gegensatz zum seriellen), ziehen die Grafik dem Text vor und funktionieren am besten, wenn sie vernetzt sind. Sie<br />
gedeihen bei sofortiger und häufiger Belohnung. [9]<br />
Digital Immigrants sind mit diesen Techniken nicht von klein auf vertraut, sie adaptieren ihre Umwelt, um damit zu<br />
arbeiten. Als Kennzeichen bringt Prensky folgende Beispiele: Sie drucken eher eine E-Mail aus oder lassen sie sich<br />
von der Sekretärin ausdrucken. Sie bringen eher Leute physisch ins Büro, um ihnen eine Webseite zu zeigen, als dass<br />
sie nur die URL versenden. Um einen Text zu überarbeiten, drucken sie ihn vorher aus. Sie können sich nicht<br />
vorstellen, dass man, während man Musik hört oder Fernsehen schaut, lernen kann, weil sie es selbst nicht können,<br />
da sie es in ihren Jugendjahren nicht gemacht haben. [9] Primär sind mit der Gruppe die Geburtenjahrgänge vor 1970<br />
gemeint. [10]<br />
Zwischen diesen beiden Gruppen besteht eine Kluft hinsichtlich der IT- und Computernutzung und Unverständnis.<br />
Die Schüler sind nicht mehr dieselben wie früher. Man hat nach Prensky dadurch die Unterrichtsmethoden und den<br />
Inhalt anzupassen. [9]<br />
Nach Moshe Rappoport von IBM Research zeichnet sich die junge Generation auch durch Risikobereitschaft und<br />
schnelles Handeln aus, analog zu Computerspielen, wo man mit Risikoverhalten schnell zum Ziel komme<br />
beziehungsweise nach einem Game over einfach neu beginne. Galt man früher als gescheitert, wenn eine<br />
Geschäftsidee nach zwei Jahren nicht mehr funktioniere, so gehe es heute stärker darum, Ideen auszuprobieren,
Digital Native 231<br />
umzusetzen und gegebenenfalls wieder zu verwerfen. Auch spiele die Akzeptanz für neue Technologien für die<br />
Einführung in Unternehmen eine wichtige Rolle und deshalb werde es beim Eintreten der Digital Natives in die<br />
Führungsebenen zu einem radikalen Umdenken in Unternehmensführungen kommen. [10]<br />
Wissenschaftlicher Diskurs des Konzeptes<br />
Verschiedene Studien öffentlicher, akadamischer und privater Institutionen zum Mediennutzungsverhalten von<br />
Jugendlichen haben sich mit der Identifikation typischer Muster auseinandergesetzt, zum Beispiel:<br />
• ARD/ZDF Langzeituntersuchung Massenmedien (1964–2005)<br />
• Statistisches Bundesamt: Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten (2002–2006)<br />
• Institute for <strong>Social</strong> Research, University of Michigan: Changing Times of American Youth (1981–2003)<br />
• Kaiser Family Foundation: Kids & <strong>Media</strong> @ the New Millennium (1999)<br />
Im Ergebnis ist die Definition von Begriffen wie „Digital Natives“ kritisch zu bewerten, wie unter anderem Rolf<br />
Schulmeister [11] gezeigt hat. Eine Klassifizierung als „Digital Native“, „Generation Y“, „Millenial“ oder Ähnlichem<br />
wird daher von mehreren Medienwissenschaftlern [12]<br />
[13] abgelehnt, da hinsichtlich des tatsächlichen<br />
Nutzungsverhaltens (das heißt für welche Aktivitäten werden die Medien verwendet) kaum Unterschiede zu früheren<br />
Nutzern identifizierbar sind und sich deshalb keine neue Generation im eigentlichen Sinne dieses Begriffs<br />
herausgebildet hat.<br />
Des Weiteren ist eine reine Klassifikation nach Alter nicht realitätskonform, da nicht selten auch Angehörige der<br />
digital immigrant-Generation, die mit den neuen Medien umgehen, als wären sie damit aufgewachsen. Daneben gibt<br />
es auch Angehörige der jungen Generation, die traditionellere Formen von Kommunikation und Zusammenarbeit<br />
bevorzugen. Demnach wäre der Begriff des digital native über die Art und Weise des Umgangs mit Medien und<br />
[14] [15]<br />
Technik zu definieren und nicht über das Alter.<br />
Anhang<br />
Literatur<br />
• Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants [16] , in: On The Horizon, ISSN 1074-8121, MCB University<br />
Press, Vol. 9 No. 5, Oktober 2001.<br />
• Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently? [17] , in: On The<br />
Horizon, ISSN 1074-8121, MCB University Press, Vol. 9 No. 6, Dezember 2001.<br />
• Marc Prensky: Listen to the Natives [18] , Educational Leadership, Vol. 63, Nr. Nr. 4, Dezember 2005/Jänner<br />
2006, Hefthema: Learning in the Digital Age, S. 8–13.<br />
• Marc Prensky, James Paul Gee: Don't Bother Me Mom – I'm Learning!, Paragon House Publishing, 2006, ISBN<br />
1-55778-858-8.<br />
• Johann Günther: Digital Natives & Digital Immigrants, Studienverlag GmbH, 2007, ISBN 3-7065-4409-1.<br />
• Patrick Horvath: Was tun mit den „digital natives“? – Herausforderungen für Wirtschaft, Politik und<br />
Bildungssystem jenseits bloßer Bewahrpädagogik [19] .<br />
• John Palfrey, Urs Gasser: Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, Basic Books,<br />
2008, ISBN 0-465-00515-2<br />
dt: Generation Internet. Die Digital Natives: Wie sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten, Hanser<br />
Wirtschaft, 2008, ISBN 3-446-41484-3.<br />
• Jens Frieling: Zielgruppe Digital Natives: Wie das Internet die Lebensweise von Jugendlichen verändert. Neue<br />
Herausforderungen an die Medienbranche, Diplomica 2009, ISBN 3836684888.
Digital Native 232<br />
Weblinks<br />
• www.digitalnative.org [20] – Forschungsprojekt des Berkman Center for Internet & Society an der Harvard<br />
University und dem Research Center for Information Law an der Universität von St. Gallen<br />
• www.dnadigital.de [21] – Zusammenschluss von Digital Natives, die den organisierten Dialog mit<br />
Führungskräften und Politikern aus der Gruppe der „Digital Immigrants“ suchen.<br />
Referenzen<br />
[1] Peter Marwan: PC-Arbeitsplatz der Zukunft: So stellen Firmen die Weichen - Teil 2:Digitale Ureinwohner (http:/ / www. zdnet. de/<br />
it_business_strategische_planung_pc_arbeitsplatz_der_zukunft_so_stellen_firmen_die_weichen_story-11000015-39186593-2. htm), zdnet.de,<br />
18. Februar 2008<br />
[2] http:/ / www. marcprensky. com/<br />
[3] Lothar Rolke, Johanna Höhn: Mediennutzung in der Webgesellschaft 2018: Wie das Internet das Kommunikationsverhalten von<br />
Unternehmen, Konsumenten und Medien in Deutschland verändern wird, BoD – Books on Demand, 2008, ISBN 3-8370-3162-4, S. 144<br />
[4] Gry Hasselbalch (Dänischer Medienrat für Kinder und Jugendliche): Unterrichten Sie Internetskian? (http:/ / www. saferinternet. org/ ww/ de/<br />
pub/ insafe/ news/ articles/ 0906/ dk. htm), 12. September 2006, Version: 5. August 2007, Insafe (European Schoolnet)<br />
[5] Christian Stöcker: Die Generation C64 schlägt zurück (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,628017,00. html), Spiegel<br />
Online/Netzwelt, 2. Juni 2009<br />
[6] Born Digital - Nicht ohne mein Offline-Selbst (http:/ / www. sueddeutsche. de/ kultur/ 94/ 313995/ text/ ), sueddeutsche.de, 14. Oktober 2008<br />
[7] Christian Bütikofer: Was die Generation Internet ihren Eltern voraus hat (http:/ / www. tagesanzeiger. ch/ leben/<br />
Was-die-Generation-Internet-ihren-Eltern-voraus-hat/ story/ 21246426), Tagesanzeiger, 3. November 2008<br />
[8] John Palfrey, Urs Gasser: Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, Basic Books, 2008, ISBN 0-465-00515-2, S. 1<br />
[9] Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants (http:/ / www. marcprensky. com/ writing/ Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants -<br />
Part1. pdf), in: On The Horizon, ISSN 1074-8121, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, Oktober 2001<br />
[10] Pressemitteilung: Digitale Immigranten - IBM ortet gespaltene Technologie-Gesellschaft (http:/ / www. channelpartner. de/ news/ 266463/ ),<br />
24. September 2008<br />
[11] R. Schulmeister: Gibt es eine Net Generation? Widerlegung einer Mystifizierung. In: S. Seehusen, U. Lucke, S. Fischer (Hrsg.): DeLFI<br />
2008: Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. 07.–10. September 2008, Lübeck. Lecture Notes in<br />
Informatics (LNI), Vol. P-132. Gesellschaft für Informatik Bonn 2008, S. 15–28.<br />
[12] Simson Garfinkel: The myth of Generation N. Not all kids are tech-savvy; how will they handle wired future? In: Technology Review Aug.<br />
13, 2003.<br />
[13] Scott Carlson: The Net Generation Goes to College; The Chronicle of Higher Education, Section: Information Technology, Volume 52,<br />
Issue 7, Page A34; 7. Oktober 2005.<br />
[14] www.digitalnative.org (http:/ / www. digitalnative. org/ ) → About → Are All Youths Digital Natives? (engl., Berkman Center for Internet &<br />
Society, Cambridge, MA), abgerufen am 19. Juni 2010<br />
[15] John Palfrey: Born Digital (http:/ / blogs. law. harvard. edu/ palfrey/ 2007/ 10/ 28/ born-digital/ ) (engl.), abgerufen am 19. Juni 2010<br />
[16] http:/ / www. marcprensky. com/ writing/ Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1. pdf<br />
[17] http:/ / www. marcprensky. com/ writing/ Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2. pdf<br />
[18] http:/ / www. ascd. org/ authors/ ed_lead/ el200512_prensky. html<br />
[19] http:/ / www2. mediamanual. at/ themen/ kompetenz/ 60_Horvath-Was_tun_mit. pdf<br />
[20] http:/ / www. digitalnative. org<br />
[21] http:/ / www. dnadigital. de
Netzkultur 233<br />
Netzkultur<br />
Netzkultur oder auch Internetkultur ist die Kultur des Internets. Für viele Menschen ist das Internet ein fester<br />
Bestandteil ihres Alltags geworden. Es verändert, wie jedes neue Medium, die Gesellschaft. Die soziologischen<br />
Auswirkungen der Kommunikation im Internet werden auch mit populären Schlagworten wie „Cybergesellschaft“<br />
und „Web 2.0“ zusammengefasst.<br />
Soziologie<br />
Bei der Internetkultur handelt es sich um eine weltweite Subkultur im soziologischen Sinne; sie konnte erst im<br />
Zusammenhang mit dem Internet entstehen. Ihre Geschichte spiegelt sich in der Internetfolklore wider. Mit der<br />
Netiquette existieren klare Verhaltensregeln. Daneben sind eine ganze Reihe von Insider-Witzen und Running Gags<br />
in Umlauf. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen dieser Kultur drückt sich unter anderem durch eine<br />
eigene Sprache, den so genannten Netzjargon, aus. In entsprechenden partizipativen Angeboten des Internets hat sich<br />
zudem eine spezifische Diskussionskultur entwickelt.<br />
Insider der Netzkultur bezeichnen sich selbst als Regulars oder Netizen im Unterschied zum Neuling (manchmal<br />
"newbie" oder "n00b" genannt) und erst recht zu „normalen Menschen“. Neben der Netzwelt gibt es auch noch das<br />
reale Leben, Real Life genannt, das sich außerhalb des Netzes und abseits des Computers abspielt.<br />
Das Internet bildet als Raum eine Lebenswelt für die Netzkultur. Die Techniken und Möglichkeiten von<br />
Web 2.0-Anwendungen wie soziale Software, <strong>Social</strong> Bookmarks und Politcommunitys, die es ermöglichen sich<br />
untereinander zu vernetzen, haben zur Ausbreitung der Netzkultur beigetragen. Durch die interaktiven<br />
Strukturmerkmale des Internets als Kommunikationsraum können Individuen und Gruppen miteinander<br />
kommunizieren und so Informationen austauschen, die zur Entwicklung von Identität beitragen. Es existieren<br />
spezifische Subkulturen in den jeweiligen Communitys. Für die Zukunft wird einerseits eine immer stärkere<br />
Vermischung des "Real Life" mit der Netzkultur erwartet, andererseits eine stärkere Ausdifferenzierung der<br />
Subkulturen online.<br />
Politik<br />
Hauptartikel: Netzpolitik<br />
Zu den politisch relevanten Themen innerhalb der Netzkultur gehören vor allem Datenschutz und<br />
Informationsfreiheit, sowie die Förderung freier Inhalte. Statt der strafrechtlichen Verfolgung von<br />
Urheberrechtsverletzungen bei Filesharing werden innerhalb der Netzkultur in der Regel alternative Modelle wie<br />
eine Kulturflatrate gefordert.<br />
Wissenschaftliche Beschäftigung<br />
Mittlerweile hat sich in der wissenschaftlichen Forschung ein eigenes Forschungsfeld zur Netzkultur etabliert.<br />
Insbesondere beschäftigt man sich in diesem Forschungsfeld mit der Frage sozialer Entitäten in vernetzten,<br />
virtualisierten Welten. Im Mittelpunkt stehen dementsprechend die vernetzten, internetbasierten Interaktionen<br />
zwischen Menschen. Diese Beschäftigung ist disziplinsübergreifend und beinhaltet insbesondere<br />
politikwissenschaftliche, soziologische, philosophische und psychologische Herangehensweisen. Verschiedene<br />
Forschungsjournale, -mailinglists und -zentren [1] bilden die Breite des Forschunsgfeldes ab.
Netzkultur 234<br />
Siehe auch<br />
• Netzkunst<br />
• Informationsgesellschaft<br />
• Elektrischer Reporter<br />
Literatur<br />
• Lovink, Geert: Dark Fiber – Auf den Spuren einer kritischen Internetkultur [2] . Bundeszentrale für politische<br />
Bildung, ISBN 3-8100-4145-9<br />
• Geert Lovink: Zero Comments. Elemente einer kritischen Internetkultur. transcript, Bielefeld 2008, ISBN<br />
978-3-89942-804-9<br />
• Ramón Reichert: Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im Web 2.0. transcript, Bielefeld<br />
2008, ISBN 978-3-89942-861-2<br />
• Internet – Netzkultur – Cybergesellschaft [3] , Denkansätze im Magazin Denkfabriq [4]<br />
Weblinks<br />
• Die Wandlung der Freaks [5] . In: taz, 23. Juli 2009.<br />
• Aufstand der Netzbürger [6] .In: Der Spiegel – Netzwelt, 3. August 2009.<br />
Referenzen<br />
[1] z. B. das Journal First Monday (http:/ / firstmonday. org/ ), die Mailingliste nettime (http:/ / www. nettime. org/ ) und das von Geert Lovink<br />
gegründete Institute of Network Cultures (http:/ / networkcultures. org/ wpmu/ portal/ ), das Resource Center for Cyberculture Studies (http:/ /<br />
rccs. usfca. edu/ ) oder das kulturwissenschaftliche Forschungskolleg Medienumbrüche (http:/ / www. fk615. uni-siegen. de/ de/ index. php)<br />
[2] http:/ / www. bpb. de/ publikationen/ HEK4GW,,0,Dark_Fiber. html<br />
[3] http:/ / www. denkfabriq. de/ index. php/ 2008/ 10/ 16/ internet-netzkultur-cybergesellschaft/<br />
[4] http:/ / www. denkfabriq. de/<br />
[5] http:/ / www. taz. de/ 1/ leben/ internet/ artikel/ 1/ die-wandlung-der-freaks/<br />
[6] http:/ / www. spiegel. de/ spiegel/ 0,1518,639993,00. html
Netiquette 235<br />
Netiquette<br />
Unter Netiquette oder Netikette (Kofferwort aus engl. net ,Netz‘ und etiquette ,Etikette‘) versteht man das gute<br />
Benehmen in der virtuellen Kommunikation. Der Begriff beschrieb ursprünglich Verhaltensempfehlungen im<br />
Usenet, wird aber mittlerweile für alle Bereiche in Datennetzen verwendet. Von vielen Netzteilnehmern als sinnvoll<br />
erachtet, hat sie meist keinerlei rechtliche Relevanz. Teilaspekte der Netiquette werden häufig kontrovers diskutiert.<br />
Was im Netz als guter Umgang miteinander (noch) akzeptiert wird, ist sehr unterschiedlich und hängt von den<br />
Teilnehmern innerhalb des Kommunikationssystems ab, wobei es in der Hand des jeweiligen<br />
Betreibers/Verantwortlichen liegt, Art und Ausmaß der Netiquette vorzugeben, deren Einhaltung zu kontrollieren<br />
und Verstöße ggf. durch Ausschluss von Teilnehmern negativ zu sanktionieren. Es gibt keinen einheitlichen<br />
Netiquettetext, sondern eine Vielzahl von Texten und Vorgaben.<br />
Themen<br />
Ziel der Netiquette ist eine möglichst für alle Teilnehmer angenehme Art der Kommunikation. Verschiedene<br />
Themenbereiche werden angeschnitten:<br />
• Zwischenmenschliches. Tonfall und Inhalt sollten dem Zielpublikum gegenüber angemessen sein (wird nur eine<br />
Person angesprochen oder eine Gruppe, wie gut kennt man sich bereits usw.). Insbesondere sollten<br />
Doppeldeutigkeiten oder gar Beleidigungen nicht die ohnehin komplizierte Kommunikation per Text erschweren.<br />
So gehört es in Singleforen zum guten Ton, anzugeben, ob man gebunden oder Single ist. So schützt man sich<br />
und andere vor unliebsamen Überraschungen.<br />
• Technik. Die Standards zur Übermittlung von Nachrichten sollten eingehalten werden, um sie möglichst vielen<br />
Lesern in der Form darzubieten, wie sie ursprünglich vorgesehen war. Dazu zählt etwa die korrekte Deklaration<br />
des Zeichensatzes.<br />
• Lesbarkeit. Damit sich Nachrichten möglichst einfach lesen lassen, sollten sie gewissen Gepflogenheiten<br />
genügen. Dazu gehören korrekter Satzbau und Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, richtiges Zitieren<br />
und das Weglassen überflüssiger Informationen wie auch das Einhalten einer maximalen Zeilenlänge von 78<br />
Zeichen (siehe RFC 2822) um Quoting nicht unnötig zu erschweren und eine entsprechende Darstellung der<br />
Nachricht generell zu gewährleisten. Dazu zählt auch das andauernde GROSSSCHREIBEN (bekannt als Caps),<br />
welches im allgemeinen als Schreien gilt oder auch übermäßiger Gebrauch von Farben.<br />
• Sicherheit. Je nach Medium können Personen, für die der Inhalt eigentlich nicht bestimmt ist, eine Nachricht<br />
einsehen. Entsprechend sollte man verschweigen, was nicht für Dritte bestimmt ist.<br />
• Rechtliches. Es existieren unterschiedliche Gesetze zum Recht an selbstverfassten Texten, die zu berücksichtigen<br />
sind. Ebenso gilt es, das Urheberrecht einzuhalten, wenn Materialien Dritter verschickt werden.<br />
Foren, Usenet<br />
Die erste und grundlegende Empfehlung der Usenet-Netiquette ist:<br />
„Vergessen Sie niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt!“<br />
Einzelne Empfehlungen der Netiquette werden manchmal kritisiert, etwa die Forderung nach einem Realnamen,<br />
nach der es im deutschsprachigen Usenet als unhöflich gilt, unter einem falschen Namen (Codename<br />
beziehungsweise Pseudonym) zu posten. In vielen Foren und zum Teil auch im Usenet hat diese Empfehlung seit<br />
etwa Anfang 2000 an Bedeutung verloren. Seither ist die anonyme Teilnahme an einem Forum allgemein akzeptiert<br />
und daher unkritisch, ganz besonders dann, wenn sie aufgrund des Themas oder der Art der Diskussion<br />
wünschenswert oder notwendig erscheint.<br />
Vorsicht bei der Verwendung von Crosspostings wird angeraten. Gänzlich verpönt sind Multipostings.
Netiquette 236<br />
Personen, welche sich – manchmal im übertriebenen Maße – freiwillig der Kontrolle der Netiquette-Einhaltung<br />
widmen, heißen oft abwertend Netcops.<br />
In deutschsprachigen Foren hat sich außerdem das Duzen als Form der Ansprache durchgesetzt. Siezt man, kann das<br />
als Ausdruck von Distanz verstanden werden. Zum Vergleich: In Frankreich etwa wird durchgehend gesiezt. In<br />
manchen anderen Sprachen, wie zum Beispiel dem Englischen, existiert dieses Problem nicht oder nur bedingt. Mit<br />
der Anrede „you“ wird zwar nicht direkt zwischen „du“ und „Sie“ unterschieden, sehr wohl aber durch eine Anrede<br />
per Vor- oder Nachnamen bzw. Mr./Mrs. usw.<br />
Chat<br />
Im Chat wird Netiquette zu Chatiquette. Die Anonymität eines Chats verleitet immer wieder Teilnehmer zu<br />
Äußerungen, die sie in nichtelektronischen Kommunikationsformen unterlassen würden. Diese reichen von<br />
penetranten Flirtversuchen und Unfreundlichkeiten über Pöbeleien bis zu Beleidigungen. Um Chattern<br />
Anhaltspunkte für das angemessene Verhalten in einem Chat zu geben, wurden viele verschiedene Chatiquetten<br />
geschrieben, die sich in den wichtigsten Punkten jedoch alle ähneln: Beleidigungen, rassistische Äußerungen und<br />
ständige Pöbeleien gelten beispielsweise als unerwünscht.<br />
Chatbetreiber achten meist auf diese Punkte und ahnden Verstöße auch, zum Beispiel mit dem Entfernen des<br />
Teilnehmers aus dem Chatraum.<br />
Soziale Medien<br />
Im Juni 2010 stellte die Deutsche Telekom eEtiquette vor, eine Sammlung von „101 Leitlinien für die digitale Welt“.<br />
[1] Wenig später veröffentlichte der Deutsche Knigge Rat (Moritz Freiherr Knigge) Höflichkeitsregeln für soziale<br />
Netzwerke. [2]<br />
Literatur<br />
• Katja Cronauer: Kommunizieren, organisieren und mobilisieren über E-Mail-Listen, Verlag Edition AV 2009,<br />
ISBN 978-3-86841-010-5, enthält einen ausführlichen Teil über Umgangsformen, Tipps für E-Mail-Versender<br />
und zum Lösen von Problemen, die bei Online-Kommunikation auftauchen können.<br />
• Martina Dressel: E-Mail-„Knigge“. 3. Auflage. WEB GOLD Akademie, Freital 2008, ISBN 978-3-00-026059-9.<br />
• Gundolf S. Freyermuth: Kommunikette 2.0. Heise, Hannover 2002, ISBN 3-88229-191-5.<br />
• Alfred Walze: Zum Thema E-Mail: Die Netiquette. In: Bürowirtschaft, Lehre und Praxis. KMI Bürowirtschaft,<br />
Bonn 2001, ISSN 0178-594X.<br />
Weblinks<br />
• RFC 1855 - Netiquette Guidelines (englisch)<br />
• Mustervorlage Netiquette und Board-Regeln [3]<br />
• Jessica Breidbach: Höflichkeit im Internet. [4]<br />
• Neubner, Thomas: Höflichkeitskonventionen in der Online-Kommunikation. Ein linguistischer Blick auf das<br />
Kommunikationsinstrument Chat [5] . 2009.
Netiquette 237<br />
Referenzen<br />
[1] eEtiquette (http:/ / eetiquette. de/ )<br />
[2] <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Knigge 2010 (http:/ / www. knigge-rat. de/ themen. html), knigge-rat.de<br />
[3] http:/ / www. lektorat-schreiben. li/ l2/ docs. php?id=21<br />
[4] http:/ / www. jessicabreidbach. com/ diskurs-und-medienanalyse/ hoeflichkeit-im-internet. html<br />
[5] http:/ / www. mykowi. net/ blog. php?user=PublicOn& blogentry_id=161<br />
Flame<br />
Ein Flame (aus dem Englischen: to flame, aufflammen) ist ein ruppiger oder polemischer Kommentar bzw. eine<br />
Beleidigung im Usenet, in einer E-Mail-Nachricht, Chatsitzung, einem Forenthread oder in einem Wiki. Im Usenet,<br />
wo der Begriff seinen Ursprung hat, wurde wie beim Begriff der Polemik nicht ausgeschlossen, dass ein Flame auch<br />
einen Sachbezug hat. Doch wird Flame inzwischen gerne für aggressive Beiträge ohne Sachbezug verwendet.<br />
Ein Flame-War ist demnach eine kontroverse Diskussion, bei der die Teilnehmer unsachlich und schließlich<br />
beleidigend werden. Ein Flame-War entsteht meist aus einer sachlichen Diskussion, die dann in<br />
Nebenkriegsschauplätze abrutscht. Typisch ist dabei, dass die „Argumente“ Schlag auf Schlag geliefert werden, so<br />
dass der Flame-War am Leben bleibt.<br />
Flame-Wars sind ein Teil der Netzkultur, auf Mailing-Listen oder News-Gruppen gehören sie zu den<br />
wiederkehrenden Phänomenen. Sie werden insbesondere durch die Anonymität der Kommunikation gefördert.<br />
Für diejenigen, die sich gern streiten, wurde eine eigene Newsgroup mit dem Namen news:de.alt.flame geschaffen.<br />
Flaming wird in den meisten Foren als Unsitte empfunden und wird von den Moderatoren meist mit einer<br />
Verwarnung geahndet. Flaming kann sich in bestimmten Foren, die nur schwach moderiert werden, mitunter schnell<br />
ausbreiten und die Atmosphäre zerstören.<br />
Auch auf Gameservern wird Flaming betrieben, oft beschimpfen Verlierer ihre Gegner als Hacker oder Cheater.<br />
Viele sogenannte „Pros“ prahlen aber auch gerne und flamen ihrerseits gegen die „Noobs“.<br />
Besonders in der Game-Szene wird Flaming oder werden Flamewars allerdings häufig auch auf<br />
ironisch-humorvoller Ebene betrieben. Dies wird teilweise deutlich durch den Zusatz von Smileys oder Emoticons<br />
kenntlich gemacht, wird aber auch ohne diese Zusätze auf vielen Servern nicht als unmittelbare Störung empfunden,<br />
sondern als übliche Floskel kaum beachtet.<br />
Sogenannte Flamethreads finden auch immer mehr Anhänger, so werden fast stündlich in diversen Foren Themen<br />
erstellt, die lediglich dazu dienen, andere User zu beschimpfen bzw. zu provozieren.<br />
Siehe auch<br />
• Netiquette<br />
• Troll (Netzkultur)<br />
• Jargon File<br />
Literatur<br />
• Mei Alonzo, Milam Aiken: Flaming in Electronic Communication. In: Decision Support Systems 1038, 2002, S.<br />
1–9<br />
• Joe Talmadge: The Flamer's bible. [1] 1987
Flame 238<br />
Weblinks<br />
• „The Tcl War“ [2] : (englisches) Beispiel für einen Flame-War aufgrund eines Artikels von Richard Stallman über<br />
die Programmiersprache Tcl, der die Entstehung des Scheme-Interpreters GNU Guile einleitete.<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. holysmoke. org/ wb/ wb0115. htm<br />
[2] http:/ / www. vanderburg. org/ OldPages/ Tcl/ war/
Emergenz<br />
Neue Erscheinungen ...Emergenz<br />
Emergenz ist die spontane Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen auf der Makroebene eines<br />
Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems<br />
nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert<br />
aufweisen. Synonyme sind Übersummativität und Fulguration.<br />
Etymologie<br />
Das Wort Emergenz ist abgeleitet vom lateinischen Verb emergo, das in seiner transitiven Form im Deutschen<br />
auftauchen lassen bedeutet. Als emergere meint es auch auftauchen, emporkommen. Als intransitives Verb hat es die<br />
Bedeutung von sich zeigen, sich herausarbeiten. [1] Zum ersten Mal verwendet wurde Emergenz im Zusammenhang<br />
mit der Erklärung von Bewusstsein durch George Henry Lewes. [2] [3] Als eine philosophische Kategorie haben<br />
sodann die englischen Philosophen Samuel Alexander und Conwy Lloyd Morgan das Wort in ihrer Theorie einer<br />
emergent evolution herausgebildet. [4]<br />
Schwache und starke Emergenz<br />
Emergenz ist grundsätzlich in einer schwachen und einer starken Form denkbar. Die schwache Form der Emergenz<br />
entspricht einer nur vorläufigen Nichterklärbarkeit emergenter Systeme auf der Grundlage der Beschreibung ihrer<br />
Elemente. Dagegen wird bei der starken Form von einigen Philosophen und Naturwissenschaftlern wie<br />
beispielsweise Philip W. Anderson [5] , Robert B. Laughlin [6] oder Stuart Kauffman [7] auch die prinzipielle<br />
Nichterklärbarkeit angenommen. Eine ähnliche Position der grundsätzlichen Unvollständigkeit der Erklärung<br />
komplexer Systeme wird seit den 1960er Jahren in der Diskussion über den Laplaceschen Dämon vertreten. Damit<br />
im Zusammenhang steht auch die von Donald Davidson in der Philosophie des Geistes entwickelte Vorstellung der<br />
„abwärtsgerichteten“ Kausalität von geistigen auf physikalische Prozesse.<br />
Gegner der starken Emergenzthese argumentieren, dass viele ehedem als emergent erklärte Eigenschaften des<br />
menschlichen Bewusstseins sich durch die Kenntnis der Eigenschaften der Bestandteile des Gehirns (z. B. der<br />
Nervenzellen und der Synapsen) erklären ließen. Allerdings ist selbst bei vergleichsweise einfachen, physikalischen<br />
Phänomenen, wie etwa Wetterereignissen, die vollständige Erklärung von Makrophänomenen auf der Ebene von<br />
Elementarteilchen praktisch so fernliegend, dass der Unterschied zwischen schwacher und starker Emergenz aktuell<br />
wenig Relevanz hat.<br />
Emergenz als disziplinübergreifendes Konzept<br />
Das Phänomen der Emergenz wird oft als Argument gegen einen reduktionistischen naturwissenschaftlichen<br />
Atomismus angeführt. Emergenztheoretiker bestreiten damit, dass eine vollständige Beschreibung der Welt allein<br />
aufgrund der Kenntnis der Elementarteilchen und allgemeiner physikalischer Gesetze prinzipiell möglich sei (vgl.<br />
Laplace'scher Dämon). Die Anerkennung emergenter Phänomene muß allerdings nicht zu einem Verzicht auf<br />
wissenschaftliche Erklärungen führen. Vielmehr zeigen die Entwicklungen in der Systemtheorie und der<br />
Chaostheorie, dass emergenzverwandte Phänomene wie Selbstorganisation und ihre Entstehungsbedingungen<br />
durchaus systematischen und objektiv nachvollziehbaren Erklärungen zugänglich sind. Allerdings tritt an die Stelle<br />
der hierarchischen Ableitung aus universalen Gesetzen ein transdisziplinärer Dialog, dessen Ziel es ist, analoge<br />
239
Emergenz 240<br />
Strukturen komplexer Systeme auf unterschiedlichen Emergenzebenen zu vergleichen.<br />
Kritik<br />
Konrad Lorenz hat den Begriff Emergenz kritisiert, da seine deutsche Bedeutung (Auftauchen) suggeriere, etwas<br />
bereits Existentes, lediglich bislang Verborgenes, komme zum Vorschein. Er hat stattdessen den Begriff Fulguration<br />
vorgeschlagen.<br />
Allgemeine Eigenschaften von Emergenzen<br />
Irreduzibilität<br />
Manche emergente Eigenschaften können dann bei einer reduktionistischen Betrachtungsweise nicht entdeckt<br />
werden, wenn sie erst im Zusammenwirken mit anderen Subsystemen auftreten. (Im Beispiel des Wolfes kann<br />
Sozialverhalten erst dann untersucht werden, wenn die Gemeinschaft der Mitglieder eines Wolfsrudels beobachtet<br />
wird.) Es ist in manchen Fällen möglich, bestimmte Elemente oder Wirkzusammenhänge zu ändern oder gar zu<br />
eliminieren, ohne dass sich bestimmte emergente Eigenschaften des Systems verändern, während andere sich sehr<br />
wohl ändern können. Beispiel: Die Fahrtüchtigkeit eines Autofahrers hängt nicht von der Farbe der Sitzbezüge ab,<br />
wohl aber von der Innenraumtemperatur bei Sonneneinstrahlung.<br />
Ob also bestimmte Elemente oder Wirkzusammenhänge reduzibel sind, hängt davon ab, wie essentiell oder<br />
bedeutend sie für die Ausbildung der emergenten Eigenschaft sind.<br />
Systeme, die aus repetitiven Einheiten zusammengesetzt sind, sind numerisch reduzierbar: Man kann die Anzahl der<br />
Elemente bis zu einer Grenzzahl von Einheiten verringern, ohne dass emergente Eigenschaften verloren gehen. Dies<br />
ist vor allem bei chemischen Stoffen und ihren spezifischen Eigenschaften der Fall. Beispiel: Wasser ist bei<br />
Zimmertemperatur flüssig, ein einzelnes Wassermolekül ist es nicht. Diese Eigenschaft ist daher emergent, weil sie<br />
sich erst aus dem Zusammenspiel vieler Wassermoleküle ergibt. Nach dem gleichen Denkmuster ist ein Baum kein<br />
Wald. Viele Eigenschaften eines Waldes lassen sich in den Eigenschaften eines einzelnen Baumes nicht<br />
wiederfinden.<br />
Es existiert für jedes System eine Mindestanzahl von interagierenden Bausteinen, die für die Entwicklung einer<br />
emergenten Eigenschaft notwendig ist.<br />
Unvorhersagbarkeit<br />
Wird ein neues Subsystem in ein bestehendes System integriert, also mit den anderen Systemelementen durch<br />
Wirkbeziehungen verknüpft, kann das System neue, emergente Eigenschaften aufweisen, die nicht vorhersehbar<br />
waren. So definiert der Evolutionsbiologe Ernst Mayr: [Emergenz ist] In Systemen das Auftreten von Merkmalen auf<br />
höheren Organisationsebenen, die nicht aufgrund bekannter Komponenten niedrigerer Ebenen hätten vorhergesagt<br />
werden können. [8]<br />
Gründe hierfür:<br />
• Das System ist bereits so komplex, dass es ohne Reduktion nicht untersuchbar oder simulierbar ist.<br />
• Es entstehen zwischen den Systemelementen neue Verbindungen, Wirkbeziehungen und Prozesse, die nicht<br />
implementiert (vorgeplant) waren.<br />
• Die Kopplungen oder Wirkbeziehungen zwischen allen Elementen werden durch die Integration des neuen<br />
Elementes verändert.
Emergenz 241<br />
Kontextbedingungen<br />
Die Kontextbedingungen emergenter Systeme stimmen weitgehend mit<br />
den Eigenschaften selbstorganisierter Systeme überein. Eine wichtige<br />
Rolle spielen dabei Rückkopplungsprozesse auf der Basis von<br />
Selbstreferenz oder zirkulärer Kausalität. Ein einfaches Beispiel ist die<br />
Entstehung von Rippelmarken auf einer Sandfläche, die von Luft oder<br />
Wasser überströmt ist. Durch wechselseitige Verstärkung von zunächst<br />
minimalen Unterschieden in der Oberflächenstruktur und Turbulenzen<br />
in der Strömung kommt es zur Herausbildung von Mustern.<br />
Geschichte der Emergenztheorie<br />
Anfänge in Philosophie und Psychologie<br />
Emergenz bezeichnet in Philosophie und Psychologie das Phänomen,<br />
dass sich bestimmte Eigenschaften eines Ganzen nicht aus seinen<br />
Teilen erklären lassen. Ein früher Vorläufer der Theorie von<br />
emergenten Eigenschaften eines Systems findet sich in der Metaphysik<br />
des Aristoteles: [9]<br />
• "Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein<br />
einheitliches Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines Haufens,<br />
sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe<br />
Durch Wechselwirkungen zwischen Wind und<br />
Oberflächenstruktur bilden sich in der Sandwüste<br />
emergente Rippelmuster und Dünenlandschaften<br />
seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch<br />
ist nicht dasselbe wie Feuer plus Erde."<br />
Vereinfacht wird das entsprechende Zitat in dem populären Ausdruck „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner<br />
Teile“ wiedergegeben (siehe Holismus und Gestaltpsychologie). Als weitere Vorstufen der Emergenztheorie können<br />
auch pantheistische Vorstellungen etwa bei Giordano Bruno und Baruch de Spinoza angesehen werden. Ihnen<br />
zufolge basiert die natürliche Ordnung weder auf einem personalen, intelligenten Wesen, noch kann sie auf isolierte<br />
materielle Elemente reduziert werden. Diese Gedanken wurden in der Philosophie des deutschen Idealismus und<br />
zum Teil im Marxismus aufgegriffen und in einer „dialektischen Naturphilosophie“ weiterentwickelt. Protagonisten<br />
sind etwa Hegel, Schelling und Friedrich Engels. Bekannt wurde die emergenztheoretische Relevanz der<br />
dialektischen Philosophen vor allem durch die politische Formel vom revolutionären Umschlag von Quantität in<br />
Qualität. [10]<br />
Aber auch in der liberalen angelsächsischen Tradition finden sich emergenztheoretische Vorstellungen. So schrieb<br />
John Stuart Mill über die Emergenz neuer Eigenschaften in chemischen Reaktionen. [11]<br />
Zusammen mit dem britischen Philosophen Samuel Alexander entwickelte Conwy Lloyd Morgan die sogenannte<br />
Emergenz-Theorie, welche die Bewusstseinsbildung als ein evolutionäres Phänomen ansieht, das sich biologisch<br />
nicht hinreichend erklären lässt. Neben Morgan und Alexander ist C. D. Broad ein Vertreter der<br />
„Emergenzphilosophie“ [12] . Die Emergenztheorie spielt in der neuzeitlichen Ontologie, bei der Erklärung des<br />
Bewusstseins, des Ich und des subjektiven Geistes eine bedeutende Rolle. Vor allem in der Philosophie des Geistes<br />
kam es seit den 1970er Jahren zu einer Renaissance des Emergenzbegriffes.<br />
aus
Emergenz 242<br />
Prozesstheorie Norbert Elias<br />
Der Soziologe und Humanwissenschaftler Norbert Elias geht im Rahmen seines Prozessmodells der Großen<br />
Evolution auf den Mechanismus ein, durch den bei Evolutionssprüngen Neues entsteht: die Integration bzw.<br />
Kombination bestehender Phänomene und die Funktionsteilung zwischen ihnen. Dabei füllt Elias die in der Literatur<br />
häufig vorkommende, aber oft relativ abstrakte Behauptung mit Leben: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner<br />
Teile.“ Durch die Verbindung relativ einfacher Einheiten entstehen zusammengesetzte, komplexere Einheiten, deren<br />
Teile in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander stehen, so dass kein Teil entfernt werden kann, ohne mehr oder<br />
weniger gravierende Folgen für die ganze Einheit und ihre Teileinheiten zu haben, im Extremfall den Zerfall beider<br />
in einfachere Einheiten zu verursachen.<br />
Diese Integration und Funktionsteilung, die gegenseitige Abhängigkeit und Komplexität ist im<br />
physikalisch-chemischen Bereich noch relativ locker, die „nächstniedere(n) Teileinheiten (sind) noch nicht<br />
funktionsteilig aneinander gebunden, so daß die Synthese reversibel ist, ohne daß diese Teileinheiten ihre<br />
Eigenschaften ändern“. [13] Elias spricht hier vom „reversiblen Integrationstyp“ und nennt als Beispiele<br />
Kleinmoleküle.<br />
Die Intensität der Integration und der Funktionsteilung steigt im Bereich der biologischen Evolution stark an. Hier<br />
entstehen „komplexere Gebilde, deren nächstniedere Teileinheiten funktionsteilig aneinander gebunden sind – die<br />
Struktur dieser Teileinheiten ist demgemäß auf ein Funktionieren im Rahmen einer bestimmten zusammengesetzten<br />
Einheit höherer Ordnung abgestimmt; die Teile verlieren in diesem Fall ihre Eigenstruktur, wenn die Einheit<br />
höherer Ordnung, die sie miteinander bilden, zerfällt“. Elias spricht hier vom „irreversiblen Integrationstyp“ und<br />
nennt als Beispiel einzellige Lebewesen.<br />
Integration und Funktionsteilung erreichen den bisher höchsten Stand im Bereich der sozio-kulturellen Evolution der<br />
Menschen. Hier ist eine weitere wissenschaftstheoretische Debatte der Sozialwissenschaften angesiedelt, die über<br />
das Verhältnis von „Individuum und Gesellschaft“. Insbesondere hier verweist Elias darauf, dass jeweils sowohl das<br />
Einzelne als auch ein Ganzes, zu dem es gehört, angemessen begrifflich repräsentiert werden müssen. Es dürfen<br />
weder die Ganzheiten auf die Einzelteile reduziert noch die Einzelteile aus dem Bild des Ganzen gedanklich entfernt<br />
werden, weil erst die komplexen Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten der Einzelteile das Ganze<br />
bilden.<br />
Systemtheoretische Betrachtungsweise<br />
Emergenz ist eine kennzeichnende Eigenschaft von hierarchisch strukturierten Systemen. Solche Systeme haben auf<br />
der Makroebene Eigenschaften, die auf der einfacheren Organisationsebene, der Mikroebene, nicht vorhanden sind.<br />
Sie entstehen durch synergetische Wechselwirkungen zwischen den Elementen auf der Mikroebene.<br />
Theorie komplexer Systeme<br />
Die Theorie komplexer Systeme baut auf systemtheoretischen und chaostheoretischen Erkenntnissen zur Emergenz<br />
auf.<br />
Beispiele<br />
Biologie<br />
In der theoretischen Biologie spielen emergente Eigenschaften etwa bei der Definition des Lebens eine zentrale<br />
Rolle. Organismen stellen ein solches hierarchisches System dar: Sie bestehen aus Organen, diese aus Zellen, diese<br />
wiederum aus Organellen und diese sind wiederum aus Makromolekülen zusammengesetzt. Ein Proteinmolekül<br />
besitzt Eigenschaften, die keines der Atome aufweist, aus welchen es zusammengesetzt ist. [14]
Emergenz 243<br />
• Die isolierte Betrachtung eines männlichen Wolfes (zum Beispiel<br />
unter den Aspekten der Autökologie, Physiologie oder Anatomie)<br />
führt zur Erklärung vieler Strukturen, ihrer Funktionen und<br />
Verhaltensweisen. Die Bedeutung der Geschlechtsorgane ergibt sich<br />
aber erst dann, wenn auch der Zusammenhang zu den Weibchen<br />
erkannt wird. Damit werden aber Männchen und Weibchen als<br />
Elemente eines übergeordneten Systems, der<br />
Fortpflanzungsgemeinschaft, betrachtet.<br />
• Für den Einzeller Chlamydomonas ist die Fähigkeit zur<br />
Photosynthese keine emergente Eigenschaft, da sie aus der<br />
Photosynthesefähigkeit bestimmter Teile, der Chloroplasten,<br />
resultiert.<br />
• Räumliches Sehen mit zwei Augen (deren Sichtfeld sich<br />
nennenswert überschneidet; Stereoskopisches Sehen oder<br />
Binokularsehen) ist mit nur einem Auge so nicht möglich.<br />
Neurologie<br />
Ein häufig verwendetes Beispiel stammt aus der Neurologie: Das<br />
Gehirn besteht aus sehr vielen, oberflächlich gesehen ähnlichen<br />
Elementen, den Nervenzellen, und weiteren Zellen, deren Funktion<br />
Kuhtritt auf der Gruberalm: Auch die Entstehung<br />
von Hangstrukturen durch Kuhtritt beruht auf<br />
Selbstverstärkung – Kühe laufen offenbar<br />
bevorzugt auf ausgetretenen Pfaden.<br />
teilweise noch wenig erforscht ist. Aus dem Zusammenspiel dieser Bausteine emergieren Aktivitätsmuster, die die<br />
eigentliche Gehirntätigkeit ausmachen, vgl → Situationskreis.<br />
Soziologie<br />
Seit Emile Durkheim, der die Soziologie mit Argumenten der Emergenztheorie als eigenständige Wissenschaft<br />
begründet hat, spielt die Vorstellung emergenter Phänomene in der Soziologie eine wichtige Rolle. Wichtige<br />
Exponenten soziologischer Emergenzkonzepte waren daneben Talcott Parsons und Niklas Luhmann und, wie oben<br />
bereits erwähnt, Norbert Elias. Bei Luhmann findet sich eine innovative Fassung des Emergenzbegriffs, bei dem das<br />
Verhältnis vom Ganzen und seinen Teilen im Theoriedesign durch die Differenz zwischen System und Umwelt<br />
ersetzt wird. So ist nach Luhmann die Gesellschaft emergent gegenüber den Individuen (im Sinne des psychischen<br />
Bewusstseins), die in seiner Theorie in der Umwelt der Gesellschaft ihren Platz finden.<br />
• Größe, Form/Gestalt, Richtung, Geschwindigkeit und Wellenbewegungen in Schwärmen sind emergent<br />
gegenüber dem Individuum, z. B. Fisch oder Vogel. Diese Änderungen oder Bewegungen laufen z. T. schneller<br />
ab, als es das Reaktionsvermögen des einzelnen Fisches oder Vogels isoliert zulassen würde.<br />
• Menschenmengen oder -massen können emergentes Verhalten bzw. Eigenschaften an den Tag legen z. B. bei<br />
Großveranstaltungen, (Monumental-) Paraden, in Stadien, wo farbige Kostüme oder Flaggen Muster, Ornamente,<br />
Bilder, ja ganze Bildergeschichten zu erzählen möglich machen. Auch die La Ola-Welle kommt in einem Stadion<br />
rundum am besten zur Geltung.<br />
In ihren Fortbewegungen entlang der Infrastruktur (an Bahnhöfen, Bahnsteigen, Flughäfen, Rolltreppen,<br />
Wartezonen, Autobahnbaustellen, Haltestellen) zeigen sie Strömungsverhalten oder Herdenverhalten – ein<br />
anderes bei Stau- und Stoßzeiten als bei Panik und als bei geringem Menschenaufkommen (siehe auch<br />
Massenpsychologie, Gruppendynamik).<br />
Demonstrationen, Truppenbewegungen, die einem Einsatzplan folgen, oder Wanderbewegungen (auch<br />
Völkerwanderungen in großem Maßstab) bergen je nach Situationsentwicklung Eigendynamik.
Emergenz 244<br />
Denken und Kommunikation<br />
Menschliche Gedankeninhalte (Ideen, Konzepte) besitzen Emergenzeigenschaften gegenüber den neurologischen<br />
Prozessen und psychischen Akten, aus denen sie entstehen. Ebenso sind Emergenzeffekte bei der Kommunikation<br />
von Gedankeninhalten zu erkennen, denn die Eigenschaften von Informationen lassen sich nicht linear aus den<br />
zugrunde liegenden grammatikalischen Strukturen (Buchstabe, Wort, Syntax) ableiten. Zwar ist Kommunikation auf<br />
Medien wie Papier und Tinte angewiesen, aber aus der physikalischen oder chemischen Beschaffenheit von Tinte<br />
und Papier lässt sich nichts über den Inhalt der damit geschriebenen Texte ableiten.<br />
Die evolutionäre, multiplikative Wirkung solcher kommunizierten Gedankeninhalte versucht die Theorie der<br />
Memetik, eine Erweiterung der darwinschen Theorie der natürlichen Selektion bezogen auf den Bereich der Kultur,<br />
zu beschreiben. Die Grundeinheit eines kommunikationsfähigen Gedankens ist hierin das Mem, welches sich erst im<br />
Fühl- und Denkvermögen eines Individuums und dann durch Kommunikation und Austausch mit anderen Memen<br />
weiterentwickelt bzw. durch Variation diversifiziert. Eine zunehmende „Evolutionsgeschwindigkeit“ der Meme ist<br />
nach dieser Theorie durch die Entwicklung der neuen Medien entstanden.<br />
Spezialfall: Unterricht<br />
Die Lernergruppe kann nach dem Modell des Gehirns konstituiert werden: Die Lerner werden metaphorisch als<br />
„Neurone“ definiert, die themenbezogen interagieren und Informationen zu Wissen umformen. Dazu müssen die<br />
Lerner über eine Reihe von kommunikativen Fähigkeiten (Reflexe) verfügen, die im Klassenraumdiskurs durch den<br />
Lehrer systematisch aufgebaut werden. Die gruppenspezifischen Fähigkeiten und Haltungen, die notwendig sind, um<br />
Wissen gemeinsam zu konstruieren (z. B. Bereitschaft und Fähigkeit, rasch zu interagieren), sind emergente<br />
Eigenschaften der Lernergruppe (vgl. u. a. Lernen durch Lehren, insbesondere Martin/Oebel 2007 [15] ).<br />
Neue Medien<br />
In Zusammenhang mit den Neuen Medien wie dem Internet wird ebenfalls von Emergenz gesprochen. Das Internet<br />
lässt neue Effekte entstehen, die man als emergent bezeichnen kann. Durch weitere Vernetzung werden diese Effekte<br />
verstärkt. Beispiele sind Netzkunst, Smart Mobs, Online-Spiele und Internetforen.<br />
Auch in den zeitgenössischen technikzentrierten und kybernetisch-systemtheoretisch orientierten Medientheorien der<br />
Medienwissenschaften bildet die Emergenz einen Schlüsselbegriff, der meist als Selbstentfaltung gelesen werden<br />
kann. Dabei sind Formulierungen wie „Seit Medienenvironments aus sich selbst emergieren ...“ zu finden (Norbert<br />
Bolz in Computer als Medium, München 1994, S. 11.).<br />
Auch Friedrich Kittler und Michael Giesecke (in Der Buchdruck in der frühen Neuzeit) verwenden den Begriff.<br />
Am radikalsten ist vielleicht die These von George Dyson, der in seinem Buch Darwin among the Machines<br />
voraussagt, dass im Internet eine Art künstlicher kollektiver Intelligenz emergieren wird.<br />
Wirtschaftswissenschaft<br />
In der Betriebswirtschaftslehre wird der Begriff Emergenz in Verbindung mit nicht-intendierten Effekten durch z. B.<br />
Handlungen des Managements großer Unternehmen (als eine Form von komplexen Systemen) verwendet.<br />
In der Volkswirtschaftslehre ist umstritten, ob das emergente Resultat des Handelns vieler individueller<br />
ökonomischer Akteure auf lange Sicht zu effizienten Gleichgewichtszuständen im Sinne von Adam Smiths<br />
unsichtbarer Hand des Marktes führt, oder zu einer Abfolge von kurzfristig destruktiven Innovationsschüben<br />
(Schumpeters Schöpferische Zerstörung).
Emergenz 245<br />
Physik<br />
Insbesondere in der Physik finden sich Beispiele für die Emergenz von Merkmalen, da die Eigenschaften der<br />
gesamten makroskopischen Welt emergente Eigenschaften sind.<br />
Ein Trupp Soldaten erlangt im Gleichschritt die Fähigkeit, eine Brücke zum Schwingen, dann zum Einsturz zu<br />
bringen.<br />
In einem einfachen Fall betrachtet man etwa die Eigenschaften eines Gases und die Eigenschaften der Moleküle, aus<br />
denen jenes Gas besteht. Während das Gas über Eigenschaften wie etwa „Temperatur“ oder „Druck“ verfügt, ist dies<br />
für keines der konstituierenden Moleküle der Fall. (Ein einzelnes Molekül hat weder eine „Temperatur“, noch einen<br />
„Druck“.) Die genannten Attribute sind emergent, da sie nicht Kennzeichen der Bestandteile sind, die das<br />
Gesamtsystem „Gas“ bilden. Dies gilt darüber hinaus für die gesamte Thermodynamik.<br />
Auch solche Phänomene wie etwa der Paramagnetismus, das Gefrieren von Wasser zu Eis, Supraleitfähigkeit, die<br />
Eigenschaften schwerer Sterne, das Wetter, das Spektrum eines schwarzen Strahlers (z. B. das Sonnenlicht) und<br />
selbst die vertikale Verteilung von Luftmolekülen in der Erdatmosphäre sind emergente Eigenschaften. Das<br />
Forschungsgebiet, welches die makroskopische Welt auf mikroskopischer Ebene untersucht und begründet, ist die<br />
statistische Physik.<br />
Dynamisches Beispiel ist die Bildung von Strudeln in Flüssigkeiten oder Gasen (Windhose/Tornado in Luft), die<br />
nicht einmal aus denselben Einzelelementen bestehen, die in einen Strudel hineingeraten und ihn wieder verlassen,<br />
während der Strudel bestehen bleibt.<br />
Die Emergenz spielt auch eine herausragende Bedeutung in der Clusterphysik, weil hier die Eigenschaften des<br />
Festkörpers evolutionär oder spontan durch die Vergrößerung der Atomanzahl bei Atomaggregaten (Cluster)<br />
entstehen.<br />
Im Bereich der Elektronik stelle man sich eine Spule und einen Kondensator in Parallel- oder Serienschaltung vor.<br />
Die Eigenschaften des resultierenden Schwingkreises lassen sich durch Betrachtung der einzelnen Bauelemente nicht<br />
erahnen.<br />
Der Nobelpreisträger (1998) Robert B. Laughlin versteht unter Emergenz ein physikalisches Ordnungsprinzip und<br />
erachtet sogar Einsteins spezielles Relativitätsprinzip als nicht fundamental, sondern als emergent. [16]<br />
Mathematik<br />
Vor allem in der Mathematik lassen sich emergente Phänomene leicht veranschaulichen: Conways Spiel des Lebens<br />
ist ein System vieler kleiner Zellen, die entweder lebendig oder tot sein können. Sehr einfache Regeln geben für jede<br />
einzelne Zelle an, wie diese mit der Zeit ihren Zustand (lebendig/tot) ändert. Das gesamte System kann dabei – je<br />
nach Anfangskonfiguration – ein außerordentlich komplexes, geordnetes und erstaunliches Verhalten aufweisen, das<br />
nicht darauf schließen lässt, dass die Einzelkomponenten (die Zellen) sehr primitiven Regeln gehorchen.<br />
Ein weiteres erstaunliches emergentes Verhalten zeigt Langtons Ameise.<br />
Zitate<br />
• Philip W. Anderson:<br />
• „In jedem Stadium entsteht die Welt, die wir wahrnehmen, durch »Emergenz«. Das heißt durch den Prozeß, bei<br />
dem beträchtliche Aggregationen von Materie spontan Eigenschaften entwickeln können, die für die<br />
einfacheren Einheiten, aus denen sie bestehen, keine Bedeutung haben. – Eine Zelle ist noch kein Tiger.<br />
Ebensowenig ist ein einzelnes Goldatom gelb und glänzend.“ [5]<br />
• "Dieses Prinzip der Emergenz ist eine ebenso alles durchdringende philosophische Grundlage moderner<br />
wissenschaftlicher Betrachtungsweise wie Reduktionismus."
Emergenz 246<br />
• Murray Gell-Mann:<br />
Original engl. "This principle of emergence is as pervasive a philosophical foundation of the<br />
viewpoint of modern science as is reductionism." [17]<br />
• „Es braucht nicht noch mehr, um mehr zu bekommen. Das ist was Emergenz bedeutet. Leben kann aus Physik<br />
und Chemie und einer Vielzahl von Zufälligkeiten emergieren (hervorgehen). Das menschliche Bewusstsein<br />
kann durch Neurobiologie und einer Vielzahl von Zufälligkeiten entstehen. Ebenfalls: die chemische Bindung<br />
entsteht durch Physik und gewissen Zufälligkeiten. Die Wichtigkeit dieser Dinge wird nicht etwa geschmälert,<br />
nur weil wir wissen, dass sie aus noch grundlegenderen Gegebenheiten, plus Zufälligkeiten, folgen. Es ist eine<br />
allgemeine Regel! Und dies zu erfassen ist von grösster Wichtigkeit. Es braucht nicht noch mehr, um mehr zu<br />
bekommen!“<br />
• Robert B. Laughlin<br />
Original engl.: "You don't need something more to get more - that is what emergence means. Life<br />
can emerge from physics and chemistry, plus a lot of accidents. The human mind can arise from<br />
neurobiology, and a lot of accidents. This way, the chemical bond arises from physics and certain<br />
accidents. It does not diminish the importance of these subjects, to know that they follow from<br />
more fundamenal things plus accidents. It's a general rule! And it's critically important to realize<br />
that. You don't need something more, in order to get something more!" [18]<br />
• „Aus physikalischer Sicht macht es besonders viel Spass über das Leben zu reden, weil es den extremsten Fall<br />
der Emergenz von Gesetzmässigkeiten darstellt.“ [19]<br />
• „Leider sind dem Ausdruck Emergenz einige Bedeutungen zugewachsen, die für unterschiedliche Dinge stehen,<br />
darunter übernatürliche Erscheinungen, die den physikalischen Gesetzen nicht unterworfen sind. So etwas<br />
meine ich nicht. Ich verstehe darunter ein physikalisches Ordnungsprinzip.“ [20]<br />
• „Einstein war Künstler und Gelehrter, aber vor allem war er Revolutionär. … Die unbegründete Überzeugung<br />
seiner Zeit war der Äther, genauer gesagt, die der Relativität vorangehende, naive Version des Äthers. Die<br />
unbegründete Überzeugung unserer Zeit ist die Relativität selbst. Es würde vollkommen seinem Naturell<br />
entsprechen, sich die Fakten erneut vorzunehmen, sie im Geiste umzuwerfen und zu dem Schluss zu kommen,<br />
dass sein geliebtes Relativitätsprinzip keineswegs fundamental, sondern emergent ist.“ [21]<br />
Literatur<br />
• Philip Clayton: Emergenz und Bewusstsein. Evolutionärer Prozess und die Grenzen des Naturalismus.<br />
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-56985-6<br />
• Jochen Fromm: The Emergence of Complexity. Kassel University Press, Kassel 2004, ISBN 3-89958-069-9<br />
• John H. Holland: Emergence. From Chaos to Order. Oxford University Press, Oxford/New York 1998, ISBN<br />
0192862111<br />
• Andrey Korotayev, Artemy Malkov, Daria Khaltourina: Introduction to <strong>Social</strong> Macrodynamics: Compact<br />
Macromodels of the World System Growth. URSS, Moscow 2006, ISBN 5-484-00414-4<br />
• Wolfgang Krohn, Günter Küppers (Hrsg.): Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und<br />
Bedeutung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992 ISBN 978-3518285848<br />
• Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, München/Zürich 2007, ISBN 978-3-492-04718-0<br />
• Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.<br />
• Karl Popper u. John C. Eccles: The self and its brain. An Argument für Interactionism. Springer,<br />
Heidelberg/Berlin/London/New York 1977, ISBN 0-387-08307-3<br />
• Deutsche Ausgabe: Das Ich und sein Gehirn. Aus dem Englischen übersetzt von Angela Hartung<br />
(Eccels-Teile), Willy Hochkeppel (Popper-Teile). Piper, München/Zürich 1987, ISBN 3-492-02817-9<br />
• Achim Stephan: Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation. Habilitationsschrift Universität<br />
Karlsruhe 1998. Universitäts Press, Dresden/München 1999, ISBN 3-933168-09-0 (Zweite Auflage: Emergenz.
Emergenz 247<br />
Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation. Mentis, Paderborn 2005, ISBN 3-89785-439-2)<br />
• Kritik: Peter <strong>Jan</strong>ich: Was ist Information? Kritik einer Legende. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN<br />
978-3518584705<br />
Siehe auch<br />
• Holismus<br />
• Quantenverschränkung<br />
• Gestalttheorie<br />
• Schwarmverhalten<br />
• Rekursion<br />
• Rückkoppelung<br />
• Paradoxie des Haufens<br />
• Kollektive Intelligenz<br />
• Künstliche Intelligenz<br />
• Komplexes System, Nichtreduzierbare Komplexität<br />
Weblinks<br />
• Eintrag [22] in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben).<br />
• Eintrag [23] im Biblionetz.<br />
• Parapluie, elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen: [24] Übersicht zum Thema Emergenz.<br />
• Emergenz bei uni-protokolle.de [25]<br />
• Bibliographie Jean-Louis Dessalles: [26] präsente Texte und Literatur zum Thema Emergenz (Englisch).<br />
• Paul Hoyningen-Huene: Zu Emergenz, Mikro- und Makrodetermination [27] .<br />
• Auszug aus dem Buch Thinking about Thought [28] von Piero Scaruffi zur Entwicklung einer Wissenschaft der<br />
Emergenz (Englisch, inkl. Literaturangaben).<br />
• Simulation der Emergenz einer Ameisenstraße [29] : Unterrichtseinheit für den Biologieunterricht.<br />
Referenzen<br />
[1] Wörterbuch Lateinisch: Lemma emergo. Langenscheidt, Berlin 1985.<br />
[2] G. H. Lewes: Problems of Life and Mind (First Series), vol. 2, Trübner, London 1875.<br />
[3] Siehe dazu auch das Zitat von Murray Gell-Mann unter den hier angeführten Zitaten oder<br />
[4] Georgi Schischkoff (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. Kröner, Stuttgart 1991, Lemma Emergenz.<br />
[5] Philip W. Anderson: Beitrag in: John Brockman (Hrsg.): Die wichtigsten Erfindungen der letzten 2000 Jahre. Ullstein, Berlin 2000, S. 178<br />
[6] Robert B. Laughlin stellt Emergenz als unverzichtbares Grundprinzip von Naturerscheinungen an den Beginn seiner Nobel Lecture (http:/ /<br />
nobelprize. org/ nobel_prizes/ physics/ laureates/ 1998/ laughlin-lecture. pdf) (pdf). Eine leicht verständliche Darstellung der Notwendigkeit<br />
des Emergenzprinzips zur Ermöglichung einer Vielfalt von im Grunde kollektiven physikalischen Erscheinungen findet sich in seinem Buch<br />
Abschied von der Weltformel. Die Neuerfindung der Physik (Piper Verlag, München 2007, ISBN 978-3-492-04718-0) – mit mehr als 30<br />
Referenzen zum Stichwort Emergenz.<br />
[7] Kauffman, Beyond Reductionism, www.edge.org, 2006 (http:/ / www. edge. org/ 3rd_culture/ kauffman06/ kauffman06_index. html)<br />
[8] Ernst Mayr: Das ist Biologie – Die Wissenschaft des Lebens, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg – Berlin, 2000, S. 403. ISBN<br />
3-8274-1015-0<br />
[9] Aristoteles, Metaphysik, Buch 8.6. 1045a: 8-10.<br />
[10] Friedrich Engels, Karl Marx/ Friedrich Engels – Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 20. Berlin/DDR. 1962. »Dialektik der Natur«, S.<br />
481-508. (http:/ / www. mlwerke. de/ me/ me20/ me20_481. htm)<br />
[11] "The chemical combination of two substances produces, as is well known, a third substance with properties different from those of either of<br />
the two substances separately, or of both of them taken together" Mill (1843)<br />
[12] Brockhaus Enzyklopädie, Band 5, S. 489, F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1968. ISBN 3-7653-0000-4<br />
[13] Norbert Elias: Engagement und Distanzierung. Arbeiten zur Wissenssoziologie I. 2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987, S. 196<br />
[14] Neil A. Campbell, <strong>Jan</strong>e B. Reece: Biologie, 6. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2003, S. 3
Emergenz 248<br />
[15] Jean-Pol Martin, Guido Oebel: Lernen durch Lehren: Paradigmenwechsel in der Didaktik?, In: Deutschunterricht in Japan, 12, 2007, S.<br />
4–21 (Zeitschrift des Japanischen Lehrerverbandes, ISSN 1342-6575 (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA&<br />
IKT=8& TRM=1342-6575))<br />
[16] Siehe dazu auch die beiden von Robert B. Laughlin unter angeführten Zitate oder<br />
[17] Philip W. Anderson: Physics: The opening to complexity (http:/ / www. pnas. org/ cgi/ reprint/ 92/ 15/ 6653) In: Proceedings of the National<br />
Academy of Sciences of the United States of America 92:15, 1995, S. 6653<br />
[18] Murray Gell-Mann: Vortrag März 2007 in Montery, Californien: "Beauty and truth in physics", TED TV – Ideas worth spreading.<br />
Zusammenfassung: (1.5 Min Video) (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=ONiWmzrmfuY)<br />
Ganzer Vortrag (16 Min Video) (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=UuRxRGR3VpM)<br />
Gesamter Vortragstext (http:/ / blog. ted. com/ 2007/ 12/ murray_gellmann. php)<br />
Murray Gell-Mann in der englischsprachigen Wikipedia<br />
[19] Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3492047180, S. 235.<br />
[20] Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3492047180, S. 25.<br />
[21] Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3492047180, S. 190.<br />
[22] http:/ / plato. stanford. edu/ entries/ properties-emergent/<br />
[23] http:/ / beat. doebe. li/ bibliothek/ w00505. html<br />
[24] http:/ / parapluie. de/ archiv/ sprung/ emergenz/<br />
[25] http:/ / www. uni-protokolle. de/ Lexikon/ Emergenz. html<br />
[26] http:/ / perso. enst. fr/ ~jld/ papiers/ emerstru. html<br />
[27] http:/ / www. unics. uni-hannover. de/ zeww/ 058_Hoyningen_Emerg. pdf<br />
[28] http:/ / www. thymos. com/ tat/ emergenc. html<br />
[29] http:/ / www. lehrer-online. de/ ameisenstrasse. php<br />
Prosument<br />
Der Begriff Prosument (vom Englischen Wort „prosumer“, welches meist darauf hindeutet, dass es sich um<br />
professionelle Kunden handelt; Bsp: "Professioneller und in der Herstellung aufwändiger sind 3-Chip-Kameras,<br />
meistens als Prosumer-Modelle bezeichnet") ist ein Kofferwort, also eine Wortbildung, die durch Verschmelzen von<br />
mindestens zwei Wortsegmenten zu einem inhaltlich neuen Begriff entstanden ist.<br />
Produzent & Konsument<br />
Alvin Toffler führte 1980 in dem Buch „Die dritte Welle“ („The Third Wave“) [1] den Begriff ein. Er bezeichnet<br />
Personen, die gleichzeitig Konsumenten, also Verbraucher (englisch: „consumer“), als auch Produzenten, also<br />
Hersteller (englisch: „producer“), des von ihnen Verwendeten sind. Im Rahmen der Personalisierung von Gütern gibt<br />
der Konsument (freiwillig) Informationen über seine Präferenzen preis, welche die Grundlage für die Erstellung des<br />
eigentlichen Gutes darstellen. Der Konsument wird Teil des Produktionsprozesses und somit zu einem gewissen<br />
Grad auch zum Produzenten des Gutes.<br />
Professional & Consumer<br />
Unabhängig von der Definition durch Toffler entstand Ende des 20. Jahrhunderts eine zweite Bedeutung,<br />
zusammengesetzt aus den englischen Begriffen „professional“ und „Consumer“ – also „Professionist“ und<br />
„Konsument“. Diese beschreibt eine Gattung von Produkten, die sich an eine Zielgruppe richten, die zwischen den<br />
einfachen Konsumenten und den beruflichen Anwendern („professional“) steht.<br />
Charakteristisch für diese Produkte ist es, dass sie eine Leistung bieten, die über die Bedürfnisse des<br />
Gelegenheitsbenutzers deutlich hinausgehen und oft eine erweiterte Sachkenntnis zur Benutzung erfordern. Produkte<br />
dieses Marktsegments werden auch als „semiprofessionell“ bezeichnet. Der Begriff Prosument bzw. Prosumer ist in<br />
dieser zweiten Bedeutung relativ weit verbreitet. So bezeichnet etwa Prosumerkamera semiprofessionelle<br />
Digitalkameras, die meist eine etwas höhere Auflösung und Bildqualität haben als digitale Kompaktkameras und die<br />
vergleichbare Einstellmöglichkeiten bieten wie professionelle Digitalkameras, aber nicht deren gesamten Funktions-
Prosument 249<br />
und Ausstattungsumfang wie z. B. Abdichtung gegen Wasser- und Staubeintritt oder die Möglichkeit der<br />
automatischen Scharfstellung bei sehr dunklen Lichtverhältnissen.<br />
Referenzen<br />
[1] Toffler, Alvin (1983): Die dritte Welle, Zukunftschance. Perspektiven für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. (Übers., The third wave,<br />
1980), München: Goldmann, ISBN 3-442-11350-4<br />
BarCamp<br />
Ein BarCamp ist eine offene Tagung, deren Ablauf und Inhalte von<br />
den Teilnehmern im Tagungsverlauf selber entwickelt werden.<br />
Seit dem ersten BarCamp in Palo Alto (Kalifornien) im August 2005 in<br />
den Räumlichkeiten der Firma <strong>Social</strong>text werden in Nordamerika,<br />
Asien und Europa BarCamps abgehalten. So fanden bereits Ende<br />
September 2006 in Berlin und Wien die ersten BarCamps im<br />
deutschsprachigen Raum statt.<br />
Entwicklung<br />
Der Name ist eine Anspielung auf eine von Tim O’Reilly initiierte<br />
Veranstaltungsreihe namens FooCamp, bei der ausgewählte Personen<br />
(Friends of O'Reilly) sich zum Austausch und zur Übernachtung<br />
(Camping) trafen. Während man zur Teilnahme am FooCamp eine<br />
Einladung von O'Reilly benötigt, kann an BarCamps ohne Einladung<br />
teilgenommen werden. Foo und Bar sind beides metasyntaktische<br />
Variablen.<br />
Der Ablauf von BarCamps hat Ähnlichkeiten mit der<br />
Open-Space-Methode, ist jedoch lockerer organisiert. Er besteht aus<br />
Vorträgen und Diskussionsrunden (Sessions), die jeden Morgen auf<br />
Whiteboards, Metaplänen oder Pinnwänden – sogenannten Grids<br />
(engl.: Gitter) – durch die Teilnehmer selbst koordiniert werden. Doch<br />
Teilnehmer eines BarCamps in Orlando, Florida:<br />
Es wird gleichzeitig diskutiert, zugehört und<br />
on-screen notiert.<br />
Grid eines BarCamps in Bangalore<br />
gibt es auch Regeln: Alle Teilnehmer sind aufgefordert, selbst einen Vortrag zu halten oder zu organisieren.<br />
BarCamps werden hauptsächlich in Wikis organisiert und über Kanäle wie Blogs, Mikro-Blogging, <strong>Social</strong><br />
Bookmarks und IRC beworben und dokumentiert. Jeder kann selbst ein BarCamp organisieren und dafür auch das<br />
Wiki auf Barcamp.org benutzen. Die Teilnahme ist kostenlos und nur aus Platzgründen limitiert, eine vorherige<br />
Anmeldung daher notwendig. Auf vielen BarCamps im Ausland ist es möglich, am Veranstaltungsort im eigenen<br />
Schlafsack die Nacht zu verbringen. Die Kosten der Veranstaltung und für Verpflegung werden von Sponsoren<br />
getragen.
BarCamp 250<br />
Themenspezialisierte BarCamps<br />
Im Regelfall werden auf BarCamps Web-2.0-Themen wie Webanwendungen in frühem Stadium,<br />
Open-Source-Technologien und Soziale Software diskutiert. Mittlerweile werden jedoch auch BarCamps zu allen<br />
Facetten bestimmter Themen ausgerichtet, wie das BibCamp, das sich mit dem Einsatz von Web 2.0 in Bibliotheken<br />
befasste [1] , oder WordCamps, die sich thematisch mit der Weblog-Software WordPress beschäftigen [2] . Auch zum<br />
Thema Tourismus gibt es bereits Barcamps in Deutschland [3] [4] [5] , und Österreich [6] .<br />
Tourismus Barcamp<br />
Tourismuscamp<br />
Mit den aktuellen Entwicklungen im Tourismus beschäftigt sich das Tourismuscamp seit 2008 regelmäßig einmal<br />
pro Jahr an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Bis zu 120 Teilnehmer diskutieren hier in verschiedenen Sessions<br />
per <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> bzw. Web 2.0. Via einem Livestream und Twitterwall können aber auch Interessierte aus der<br />
ganzen Welt an den Sessions teilnehmen. [7] Organisiert wird das Tourismuscamp von Tourismuszukunft-Institut für<br />
eTourismus und vom Lehrstuhl für Kulturgeographie der Universität Eichstätt-Ingolstadt . [8]<br />
Castlecamp<br />
Ein weiteres Beispiel für ein touristisches Barcamp, welches sich mit Web 2.0 und <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> im Tourismus<br />
beschäftig ist das Castlecamp auf der Burg Kaprun, das von der örtlichen Tourismus GmbH veranstaltet wird. [9]<br />
EduCamp<br />
Gegenstand der EduCamps ist der Dialog zwischen Experten, Lehrenden, Vertretern von Unternehmen und<br />
Agenturen, sowie interessierten Studierenden zu innovativen Formen, Formaten, Technologien und Strategien des<br />
mediengestützten Lernens und dies sowohl für Schulen und Hochschulen als auch im Unternehmensumfeld. [10]<br />
Basierend auf dem BarCamp-Prinzip, wurde das EduCamp durch etablierte Konferenzformen wie der<br />
Podiumsdiskussion und der Open-Space-Methode ergänzt. Der Begriff EduCamp stammt hierbei von einer als<br />
Open-Space angelegten Workshop-Reihe im Jahr 2007 in Kolumbien, initiiert von Diego Leal. [11]<br />
Das erste EduCamp im deutschsprachigen Raum fand vom 18. bis 20. April 2008 im thüringischen Ilmenau im<br />
Humboldtbau der dortigen Technischen Universität statt und wurde von 180 Teilnehmern besucht. [12] Seitdem haben<br />
weitere Educamp-Veranstaltungen in Berlin (2008), Ilmenau und Graz (2009) und Hamburg (Feb. 2010)<br />
stattgefunden.<br />
Future Music Camp<br />
Der Fokus des Future Music Camps liegt auf Musik und Entertainment im <strong>Social</strong> Web. Als Teilnehmerkreis wird<br />
eine Mischung angestrebt, aus Vertretern der Digitalabteilungen der Plattenfirmen, Digitalvertrieben, netzaffinen<br />
Künstlermanagern und anderen Musikindustriellen - aber auch Vordenkern angrenzender Branchen (Entertainment,<br />
Mobilfunk, Internet/Web 2.0, Medien), Vertretern der Netaudioszene, Beratern, Anwälten, Zukunftsexperten, sowie<br />
Kreativköpfen und jungen Querdenkern. [13]<br />
Veranstaltet wird das Future Music Camp von und in der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim.
BarCamp 251<br />
<strong>Social</strong>camp<br />
Ziel des <strong>Social</strong>camps ist es, den Austausch zwischen Internetexperten und Vertretern gemeinnütziger Organisationen<br />
zu fördern. [14]<br />
Das erste <strong>Social</strong>camp fand am 14. und 15. Juni 2008 in Berlin statt.<br />
PolitCamp<br />
PolitCamps verbinden das Organisationsprinzip von BarCamps mit der Diskussion politischer Themen, wobei<br />
Themen wie Netzpolitik, E-Government und Wahlkampf mit dem Web 2.0 typische Themen sind. PolitCamps haben<br />
bisher u.a. in Berlin (Deutschland) [15] [16] [17] und Graz (Österreich) [18] stattgefunden. Am 20./21. März 2010 fand<br />
das PolitCamp 2010 [19] im Radialsystm V in Berlin unter dem Motto „Politik trifft Web 2.0“ statt.<br />
BarCamps mit Afrika-Thematik<br />
Es gibt zur Zeit zwei Typen von BarCamps mit Afrika-Thematik: einerseits Barcamps, die in Afrika stattfinden und<br />
vorwiegend als Africamp bezeichnet werden [20] [21] , andererseits BarCamps in anderen Regionen der Welt mit dem<br />
inhaltlichen Fokus Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, etwa das Wiener AfrikaCamp, das<br />
erstmals am 31. <strong>Jan</strong>uar 2009 stattfand [22] [23] , oder das BarCampAfrica UK, das am 7. November 2009 startete [24] .<br />
Video-Barcamps<br />
Bei einem Video-BarCamp tauschen Video-Praktiker Kenntnisse, Erfahrungen und Tipps aus. Die Organisatoren<br />
kümmern sich um mögliche Sessions. Der Eintritt ist frei. Organisiert werden Video-BarCamps wie das Münchner<br />
VidCamp meist über Boards oder Wikis. [25]<br />
Weblinks<br />
• Oliver Gassner: Happy Campers [26] , Telepolis, 20. Dezember 2006<br />
• Patzig, Franz: Was ist eigentlich BarCamp? [27]<br />
• Mario Sixtus: Elektrischer Reporter 37 Zweites Barcamp Köln [28] (Video)<br />
• Die Zeit: Wissen durch Teilung [29]<br />
• t3n Magazin Übersicht über aktuelle BarCamps [30]<br />
Literatur<br />
• Dominik Rzepka und Franz Patzig: Think Tank für das Web 2.0. Heute.de vom 3. November 2007 Volltext [31]<br />
• Meike Richter: Barcamp: Wissen durch Teilung. Die Zeit Nr. 48 vom 26. November 2008 Volltext [29]<br />
• Laetitia Seybold: Barcamp - Pause als Programm. Focus Online vom 6. <strong>Jan</strong>uar 2009 Volltext [32]<br />
• Kapitel Barcamp in Charlie Hailey: Camps: A Guide to 21st Century Places. MIT Press, 2009. ISBN<br />
0262512874.<br />
Referenzen<br />
[1] pbwiki.de: BibCamp 2008 (http:/ / bibcamp. pbwiki. com/ ), Zugriff am 29. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[2] wordcamp.de: WordCamp Deutschland (http:/ / wordcamp. de), WordCamp meets Barcamp Mitteldeutschland 2009 (http:/ / 2009.<br />
wordcamp. de/ ), Zugriff am 3. Oktober 2008<br />
[3] tourismuscamp in Eichstätt: Tourismuscamp (http:/ / www. tourismuscamp. de), Zugriff am 20. Mai 2008<br />
[4] V.I.R. Camp 2009: V.I.R. Camp (http:/ / www. vircamp. de/ index. php/ Hauptseite)<br />
[5] Hotelcamp November 2009: Hotelcamp (http:/ / www. Hotelcamp. de)<br />
[6] Castlecamp auf Burg Kaprun: Castlecamp September 2008 (http:/ / www. castlecamp. at), Zugriff am 20. Mai 2008<br />
[7] http:/ / www. tourismuscamp. de/ index. php/ Hauptseite<br />
[8] http:/ / www. tourismuscamp. de/ index. php/ Organisatoren
BarCamp 252<br />
[9] http:/ / www. castlecamp. at/ index. php/ Castlecamp:Tourismus<br />
[10] educamp.mixxt.de: EduCamp @ mixxt (http:/ / educamp. mixxt. de/ networks/ wiki/ index. index), Zugriff am 29. <strong>Jan</strong>uar 2009<br />
[11] diegoleal.org: Diego Leal berichtet über die ersten EduCamps in Kolumbien (http:/ / www. diegoleal. org/ social/ blog/ blogs/ dotedu-dotco/<br />
index. php/ 2008/ 11/ 16/ educamp-colombia-2007-bogota-1)<br />
[12] Freies Wort: Das Lehren und Lernen am Puls der Zeit erforschen (vom 28. April 2008) (http:/ / www. freies-wort. de/ nachrichten/ regional/<br />
ilmenau/ ilmenaulokal/ art2447,804256)<br />
[13] futuremusiccamp.mixxt.de: Future Music Camp @ mixxt (http:/ / futuremusiccamp. mixxt. de), Zugriff am 25. Mai 2009<br />
[14] socialcamp-berlin.de: Das <strong>Social</strong>camp (http:/ / www. socialcamp-berlin. de/ networks/ wiki/ index. Das_<strong>Social</strong>Camp), Zugriff am 25. Juni<br />
2009<br />
[15] politcamp.org: Politcamp09: Was war, was ist, was wird? (http:/ / 09. politcamp. org/ 2009/ 05/ 04/ politcamp09-was-war-was-ist-was-wird/<br />
), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[16] politcamp.org: Das PolitCamp.30. – 31. <strong>Jan</strong>uar 2010 in Bonn. (http:/ / politcamp. org/ veranstaltung/ ), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[17] derwesten.de (Portal der WAZ Mediengruppe): DerWesten unterstützt das PolitCamp (http:/ / www. derwesten. de/ nachrichten/ politik/<br />
DerWesten-unterstuetzt-das-Politcamp-id2166839. html), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[18] ORF.at : PolitCamp 2008 (http:/ / fm4v2. orf. at/ grenzfurthner/ 222764/ main. html), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[19] http:/ / politcamp. org/<br />
[20] Africamp.com: About (http:/ / africamp. com/ eng/ page/ about/ ), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[21] Infoworld.com: Barcamp Africa gets an online home (http:/ / www. infoworld. com/ d/ adventures-in-it/<br />
barcamp-africa-gets-online-home-076), Zugriff am 21. Dezember 2009<br />
[22] barcamp.at: AfrikaCamp (http:/ / www. barcamp. at/ AfrikaCamp), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[23] ICT4D.at - Austrian Network for Information and Communication Technologies for Development: AfrikaCamp Vienna - Aftermath (http:/ /<br />
ict4d. at/ 2009/ 02/ 04/ afrikacamp-vienna-aftermath/ ), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[24] africamp.com: BarCampAfrika UK (http:/ / africamp. com/ uk/ ), Zugriff am 20. Dezember 2009<br />
[25] Beispiel: das VidCamp in München (http:/ / vidcamp. mixxt. de/ networks/ events/ show_event. 15251)<br />
[26] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 24/ 24251/ 1. html<br />
[27] http:/ / www. franztoo. de/ ?p=113<br />
[28] http:/ / www. elektrischer-reporter. de/ index. php/ site/ film/ 49/<br />
[29] http:/ / www. zeit. de/ online/ 2008/ 48/ barcamp<br />
[30] http:/ / t3n. de/ news/ grosser-barcamp-uberblick-alle-un-konferenzen-255252/<br />
[31] http:/ / www. heute. de/ ZDFheute/ inhalt/ 20/ 0,3672,7121300,00. html<br />
[32] http:/ / www. focus. de/ karriere/ perspektiven/ informationszeitalter/ tid-12960/ barcamp-pause-als-programm_aid_357743. html
Flashmob 253<br />
Flashmob<br />
Der Begriff Flashmob (englisch: Flash mob; flash = Blitz; mob [von<br />
mobilis beweglich] = aufgewiegelte Volksmenge, Pöbel – deutsch<br />
etwa Blitzpöbel) bezeichnet einen kurzen, scheinbar spontanen<br />
Menschenauflauf auf öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen, bei<br />
denen sich die Teilnehmer üblicherweise persönlich nicht kennen und<br />
ungewöhnliche Dinge tun. Flashmobs werden über<br />
Online-Communitys, Weblogs, Newsgroups, E-Mail-Kettenbriefe oder<br />
per Mobiltelefon organisiert. Flashmobs gelten als spezielle<br />
Ausprägungsformen der virtuellen Gesellschaft (virtual community,<br />
Online-Community), die neue Medien wie Mobiltelefone und Internet<br />
benutzt, um kollektive Direkte Aktionen zu organisieren.<br />
Szene eines Flashmobs vor dem<br />
Musikvereinssaal in Wien<br />
Obwohl die Ursprungsidee unpolitisch [1] war, gibt es mittlerweile auch Flashmobs mit politischem oder<br />
wirtschaftlichem Hintergrund [2] [3] , die auch Smart Mob genannt werden.<br />
Ablauf<br />
Einem Aufruf aus dem Internet folgend treffen sich die Teilnehmer an einem Ort, an dem sie weitere Instruktionen<br />
über den eigentlichen Aktionsort und Ablauf des Flashmobs bekommen. Typisch für Flashmobs sind die blitzartige<br />
Bildung des Mobs aus dem Nichts, das identische Handeln im Mob (z. B. applaudieren, telefonieren mit gleichen<br />
inhaltlichen Texten), und die abrupte Auflösung nach wenigen Minuten.<br />
Die Beteiligten, Blitzaufläufer, Smart Mobber oder Flash Mobber genannt, tauchen am vereinbarten Ort zur<br />
vereinbarten Zeit auf, um dort kurz und für die unwissenden Passanten völlig überraschend einer gänzlich sinn- und<br />
inhaltslosen Tätigkeit nachzugehen.<br />
So schnell wie die Menschen zusammengekommen sind, löst sich ihre Gruppe vor den Augen der verdutzten<br />
Zuschauer dann auch wieder auf. Dieses merkwürdige Verhalten wird vor allem durch die immer schnelleren<br />
zwischenmenschlichen Kommunikationsmöglichkeiten beeinflusst und unterstützt.<br />
Geschichte<br />
Das Projekt „Zebra Fußgängertheater“ [4] des Niederländers Will Spoor (Anfang der neunziger Jahre) kann als ein<br />
früher Vorläufer der Flashmobs betrachtet werden. Spoor rekrutierte (über Flugblätter, Telefonketten etc.) die<br />
Darsteller jeweils vor Ort in der Stadt, in der das Fußgängertheater gastierte. Gemeinsam wurden unangekündigte<br />
Darbietungen im öffentlichen Raum geprobt und durchgeführt, die von Konzept und Anmutung stark an heutige<br />
Flashmobs erinnern.<br />
Als ein früher zweckloser und damit vom Smart Mob unterscheidbarer Flashmob gilt eine Aktion des Journalisten<br />
Bill Wasik am 3. Juni 2003 in New York. Mehr als hundert Teilnehmer versammelten sich in einem Kaufhaus um<br />
einen Teppich. Kaufhaus-Mitarbeitern teilten sie mit, dass sie einen „Liebesteppich“ suchten und<br />
Kaufentscheidungen grundsätzlich gemeinsam träfen. Danach versammelte sich eine noch größere Gruppe in einer<br />
Hotel-Lobby und applaudierte exakt 15 Sekunden, schließlich strömten die Teilnehmer in ein Schuhgeschäft und<br />
gaben sich dort als Touristen aus. [5] Bill Wasik hat in einem Artikel im März 2006 bekundet, seine Absicht sei<br />
gewesen, hippe Leute vorzuführen, die in einer Atmosphäre der Konformität nur danach strebten, Teil der „nächsten<br />
großen Sache“ zu werden, egal, wie sinnfrei diese sei. [6]
Flashmob 254<br />
Die Freude an den sinnfreien Aktionen und der öffentlichen Aufmerksamkeit dafür führte rasch zu Nachahmungen<br />
ohne den ironischen Hintergrund. Bald darauf schwappte eine Flashmob-Welle von den USA auch nach Europa<br />
über, wo es Ende Juli 2003 erste Aktionen in Zürich, Rom und Wien gab. Das Phänomen erlangte für einige Monate<br />
große Medienaufmerksamkeit, bis im Herbst 2003 das Interesse zurückging.<br />
Im Sommer 2007 wurde die Idee wiederbelebt, anfänglich von Organisationen, die mit Aktionen auf<br />
gesellschaftliche Ziele aufmerksam machen wollen. Durch die neue Berichterstattung in den Medien wurden auch<br />
wieder reine Spaßaktionen inspiriert.<br />
„Flashmob-Aktionen“ wurden von der Handelsgewerkschaft ver.di gezielt zur Besetzung und Blockade von<br />
Geschäften bei Tarifauseinandersetzungen im Einzelhandel eingesetzt. [7] [8] Gegen eine Entscheidung des<br />
Bundesarbeitsgerichtes, die derartige flashmobs für eine zulässige Arbeitskampfform hält, hat der Handelsverband<br />
Deutschland nach eigenen Angaben im Dezember 2009 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht<br />
eingelegt. [9]<br />
In Philadelphia wurde im Frühjahr 2010 ein Trend beobachtet, dass Jugendliche hierbei wie ein „echter“ Mob ihre<br />
Gewaltbereitschaft ausleben. [10]<br />
Prominente Beispiele<br />
• Am 20. <strong>Jan</strong>uar 2008 versammelten sich ca. 700 Menschen auf dem Odeonsplatz in München, stürmten eine<br />
Filiale von McDonald’s am Stachus und kauften dort auf einmal 4.385 Hamburger und Cheeseburger. Auf diese<br />
Art wurden bereits in vielen deutschen Großstädten Flashmobs veranstaltet. Bei einer ähnlichen Aktion am 29.<br />
[11] [12]<br />
März 2008 wurden in einer Berliner Filiale von McDonald’s in einer Bestellung 10.355 Burger gekauft.<br />
• Am 4. April 2009 um 16:00 Uhr trafen sich mehrere tausend Jugendliche (Angaben schwanken zwischen 1000<br />
und 5000 Personen) aus Anlass des Pillow-Fight-Day zu einer Kissenschlacht vor dem Kölner Dom. [13]<br />
• Am 8. Juli 2009 trafen sich in Stockholm mehr als 300 Menschen zu Ehren von Michael Jackson. Diese<br />
versammelten sich an verschiedenen Orten der Stadt und tanzten zu Jacksons Lied „Beat it“. [14]<br />
Rechtliche Beurteilung<br />
Smart Mobs werden unter Umständen als „Versammlung unter freiem Himmel“ [15] interpretiert und fallen in<br />
Deutschland dann unter die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes. [16] Ein Smart Mob ist daher wie jede<br />
Versammlung unter freiem Himmel anzumelden. Der Flashmob gilt auf öffentlichem Gelände als öffentliche<br />
Vergnügung; solche sind bei der Gemeinde anzuzeigen. Wird die Straße mehr genutzt, als der Gemeingebrauch es<br />
zulässt, liegt eine Sondernutzung [17] vor. Werden Hindernisse bereitet, so sind die §§ 32 und 33 StVO einschlägig.<br />
Siehe auch<br />
• Mobile Clubbing<br />
• Critical Mass (Protestform)<br />
• Smart Mob<br />
• Die-in<br />
Video<br />
• Ein Flashmob-Tanz in Ankara mit Musik von Michael Jackson, „Beat It“ [18]<br />
• 20000-Menschen-Flashmob bei Black-Eyed-Peas-Konzert [19]
Flashmob 255<br />
Literatur<br />
• Volker Rieble: Flash-Mob - ein neues Kampfmittel? In: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 Seite 796.<br />
• Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 22. September 2009, Aktenzeichen 1 AZR 972/08 (veröffentlicht<br />
z.B. in Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2009 Seite 1347 ff.); Pressemitteilung: [20]<br />
Weblinks<br />
• Der kurze Sommer der Anarchie [21] , Die Zeit, 11. September 2003<br />
• Flash Mobs: Wenn dir plötzlich Hunderte applaudieren [22] , Spiegel Online, 28. Juli 2003<br />
Referenzen<br />
[1] Webster's New Millennium Dictionary of English: flash mob (http:/ / dictionary. reference. com/ browse/ flash mob). abgerufen am 30.<br />
Oktober 2009 (Englisch): „“a group of people who organize on the Internet and then quickly assemble in a public place, do something bizarre,<br />
and disperse.“<br />
[2] Stefan <strong>Jan</strong>ke und Bülend Ürük: Nächtlicher Ausnahmezustand an BFT-Tankstelle (http:/ / www. derwesten. de/ nachrichten/ staedte/ iserlohn/<br />
2008/ 1/ 11/ news-15575295/ detail. html) Der Westen, Waz-Mediengruppe 11. <strong>Jan</strong>uar 2008<br />
[3] Bundesarbeitsgericht: Streikbegleitende „Flashmob-Aktion - Urteil vom 22. September 2009 - 1 AZR 972/08 - Vorinstanz:<br />
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29. September 2008 - 5 Sa 967/08 - (http:/ / juris. bundesarbeitsgericht. de/ cgi-bin/<br />
rechtsprechung/ document. py?Gericht=bag& Art=pm& sid=60922e3a7e3d6b8497c133f55cd8f72c& nr=13901& pos=0& anz=1). In:<br />
Pressemitteilung Nr. 95/09. 22. September 2009, abgerufen am 24. September 2009: „Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts wies daher,<br />
wie bereits die Vorinstanzen, die Klage eines Arbeitgeberverbands ab, mit welcher der Gewerkschaft ver.di der Aufruf zu<br />
„Flashmob-Aktionen“ im Einzelhandel untersagt werden sollte. Die Gewerkschaft hatte im Rahmen eines Arbeitskampfes eine einstündige<br />
Aktion organisiert, bei der etwa 40 Personen überraschend eine Einzelhandelsfiliale aufgesucht und dort mit Waren vollgepackte<br />
Einkaufswagen zurückgelassen sowie durch den koordinierten Kauf von „Pfennig-Artikeln“ Warteschlangen an den Kassen verursacht hatten.“<br />
[4] Festivalprogramm „Glashauskultur 1992“ (http:/ / www. glashauskultur. de/ programm_1992. htm)<br />
[5] Flashmob-Revival: Die Verhaftung der lautlosen Ruhestörerin (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,547427,00. html), Spiegel<br />
Online,16. April 2008<br />
[6] My Crowd, or, Phase 5: A report from the inventor of the flash mob (http:/ / www. harpers. org/ media/ pages/ 2006/ 03/ pdf/<br />
HarpersMagazine-2006-03-0080963. pdf), Harper's Magazine, März 2006 (zahlungspflichtig)<br />
[7] youtube-Video (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=nCJ6ZTSh19Y)<br />
[8] Aus: Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften, Streikaktionen Einzelhandel Stuttgart: Menschenkette und Flash Mob (http:/ / www. rsb4.<br />
de/ content/ view/ 2806/ 77/ )<br />
[9] Verfassungsbeschwerde gegen Laden-Blockaden (http:/ / www. einzelhandel. de/ pb/ site/ hde/ node/ 334648/ Lde/ index. html)<br />
[10] Ian Urbina: Mobs Are Born as Word Grows by Text Message. (http:/ / www. nytimes. com/ 2010/ 03/ 25/ us/ 25mobs. html?hp) The New<br />
York Times, 24. März 2010.<br />
[11] Bestellung von 10.355 Cheeseburgern - Foto des Kassenbons (http:/ / www. imgimg. de/ uploads/ 10034304e4e5a47JPG. jpg)<br />
[12] Die neue Burger-Bewegung (http:/ / www. berlinonline. de/ berliner-zeitung/ archiv/ . bin/ dump. fcgi/ 2008/ 0331/ berlin/ 0027/ index.<br />
html)<br />
[13] Artikel aus dem KÖLNER STADTANZEIGER (http:/ / www. ksta. de/ html/ artikel/ 1238746024909. shtml)<br />
[14] Offizielles Youtube-Video, in Deutschland aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen nicht verfügbar. (http:/ / www. youtube. com/<br />
watch?gl=DE& hl=de& v=lVJVRywgmYM)<br />
[15] vgl. Versammlungsgesetz, Abschnitt III (http:/ / www. juraforum. de/ gesetze/ VersammlG/ gesetz_über_versammlungen_und_aufzüge_.<br />
html)<br />
[16] vgl. „Neonazis planen Flash Mob in Unna“ (http:/ / www. derwesten. de/ staedte/ unna/ Neonazis-planen-Flash-Mob-in-Unna-id95424.<br />
html), auf derwesten.de, abgerufen 5. April 2010<br />
[17] Flash-Mobs in Braunschweig verboten (http:/ / de. indymedia. org/ 2009/ 07/ 256867. shtml), von autor auf indymedia.org, abgerufen 5.<br />
April 2010<br />
[18] http:/ / www. facebook. com/ video/ video. php?v=307851682930<br />
[19] http:/ / www. clipfish. de/ special/ smash247/ video/ 3147596/ 20000-menschen-flashmob-bei-black-eyed-peas-konzert-smash247com/<br />
[20] http:/ / juris. bundesarbeitsgericht. de/ cgi-bin/ rechtsprechung/ document. py?Gericht=bag& Art=pm&<br />
sid=efe1a7138953fe178b7b0ffcdf6e1504& nr=13901& pos=0& anz=1<br />
[21] http:/ / www. zeit. de/ 2003/ 38/ Flashmobs<br />
[22] http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,258913,00. html
Crowdsourcing 256<br />
Crowdsourcing<br />
Crowdsourcing bzw. Schwarmauslagerung bezeichnet im Gegensatz zum Outsourcing nicht die Auslagerung von<br />
Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen, sondern die Auslagerung auf die Intelligenz und die<br />
Arbeitskraft einer Masse von Freizeitarbeitern im Internet. Eine Schar kostenloser oder gering bezahlter Amateure<br />
generiert Inhalte, löst diverse Aufgaben und Probleme oder ist an Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt<br />
(vgl. Schwarmintelligenz). Crowdsourcing ist ein 2006 von Jeff Howe und Mark Robinson (Wired Magazine)<br />
geprägter Neologismus. Zudem bezeichnet der Begriff Crowdsourcing auch das Insourcing von Ideen. [1] Eine<br />
besondere Form des Crowdsourcing ist das Crowdfunding, bei dem aus Unternehmenssicht nicht auf die Ideen oder<br />
die Arbeitsleistung der Masse der Internetuser abgezielt wird, sondern diese als Kapitalgeber gewonnen werden<br />
sollen.<br />
Eine erste sozialwissenschaftliche Annäherung an das junge Phänomen erarbeitet Christian Papsdorf mit folgender<br />
Definition: "Crowdsourcing ist die Strategie des Auslagerns einer üblicherweise von Erwerbstätigen entgeltlich<br />
erbrachten Leistung durch eine Organisation oder Privatperson mittels eines offenen Aufrufes an eine Masse von<br />
unbekannten Akteuren, bei dem der Crowdsourcer und/oder die Crowdsourcees frei verwertbare und direkte<br />
wirtschaftliche Vorteile erlangen." [2] Diese detaillierte Definition zielt darauf ab, ähnliche Phänomene wie Open<br />
Source, Mass Customization oder die These des Arbeitenden Kunden deutlich von Crowdsourcing zu unterscheiden.<br />
Crowdsourcing kann auch als Form des elektronischen Handels stattfinden und wird in diesem Zusammenhang als<br />
<strong>Social</strong> Commerce bezeichnet. Dabei werden Kunden eines Anbieters zu „persönlichen Filtern anderer Kunden“ und<br />
helfen diesen, das bestmögliche Angebot zu finden.<br />
Zudem wird Crowdsourcing als Chance zum Ausgleich des globalen Wohlstandgefälles diskutiert. [3]<br />
Literatur<br />
• Larissa Hammon, Stefan Hampel, Hajo Hippner: Crowdsourcing, in: WISU, Nr. 5, 2010, S. 698 - 704.<br />
• Jeff Howe: Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown<br />
Business Publishing 2008<br />
• Christian Papsdorf: Wie Surfen zu Arbeit wird. Crowdsourcing im Web 2.0. Frankfurt a.M./ New York: Campus<br />
2009<br />
• <strong>Jan</strong> Marco Leimeister, Michael Huber, Ulrich Bretschneider, Helmut Krcmar (2009): Leveraging Crowdsourcing:<br />
Activation-Supporting Components for IT-Based Ideas Competition. In: Journal of Management Information<br />
Systems (2009), Volume: 26, Issue: 1, Publisher: M.E. Sharpe Inc., Pages: 197-224, ISSN: 07421222, DOI:<br />
10.2753/MIS0742-1222260108 [4]<br />
• Winfried Ebner; <strong>Jan</strong> Marco Leimeister; Helmut Krcmar (2009): Community Engineering for Innovations -The<br />
Ideas Competition as a method to nurture a Virtual Community for Innovations. In: R&D Management, 39 (4),pp<br />
342-356 DOI: 10.1111/j.1467-9310.2009.00564.x [5]
Crowdsourcing 257<br />
Weblinks<br />
• Robert Niles: "A journalist’s guide to crowdsourcing [6] "<br />
• Markus Rohwetter: "Vom König zum Knecht [7] ". In: DIE ZEIT Nr. 39 vom 21. September 2006<br />
• Jeff Howe: "The Rise of Crowdsourcing [8] ". In: Wired Nr. 14, Juni 2006<br />
• Was ist Crowdsourcing? [9] Was, für wen, Regeln und Beispiele<br />
• Crowdsourcing und Recht [10]<br />
Referenzen<br />
[1] Gassmann, O. und E. Enkel, 2004, Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process, http:/ / www. alexandria. unisg. ch/<br />
Publikationen/ 274<br />
[2] Papsdorf, C., 2009, Wie Surfen zu Arbeit wird. Crowdsourcing im Web 2.0, S. 69.<br />
[3] Roth, S. (2008): Open Innovation AcrossThe Prosperity Gap: An Essay On Getting The Caucasus Back Into The European Innovation<br />
Society. In: International Black Sea University Scientific Journal, Vol 2., No. 2, pp. 5-20, http:/ / steffenroth. files. wordpress. com/ 2009/ 10/<br />
ibsusj_open-innovationacrossthe-prosperity-gap. pdf<br />
[4] http:/ / portal. acm. org/ citation. cfm?id=1653890<br />
[5] http:/ / www3. interscience. wiley. com/ search/ allsearch?mode=viewselected& product=journal& ID=122535413& view_selected. x=67&<br />
view_selected. y=8<br />
[6] http:/ / www. ojr. org/ ojr/ stories/ 070731niles/<br />
[7] http:/ / zeus. zeit. de/ text/ 2006/ 39/ Do-it-yourself<br />
[8] http:/ / www. wired. com/ wired/ archive/ 14. 06/ crowds. html<br />
[9] http:/ / www. andersdenken. at/ crowdsourcing<br />
[10] http:/ / www. rechtzweinull. de/ index. php?/ archives/ 47-Crowdsourcing-Recht-Wer-traegt-die-rechtlichen-Risiken. html<br />
Kollektive Intelligenz<br />
Kollektive Intelligenz, auch Gruppen- oder Schwarmintelligenz genannt, ist ein emergentes Phänomen.<br />
Kommunikation und spezifische Handlungen von Individuen können intelligente Verhaltensweisen des betreffenden<br />
„Superorganismus”, d. h. der sozialen Gemeinschaft, hervorrufen. Zur Erklärung dieses Phänomens existieren<br />
systemtheoretische, soziologische und pseudowissenschaftliche Ansätze.<br />
Eine frühe Formulierung des Grundgedankens der Kollektiven Intelligenz findet sich in Aristoteles’<br />
Summierungstheorie.<br />
Systemtheorie<br />
Francis Heylighen, Kybernetiker an der Vrije Universiteit Brussel, betrachtet das Internet und seine Nutzer als<br />
Superorganismus: „Eine Gesellschaft kann als vielzelliger Organismus angesehen werden, mit den Individuen in der<br />
Rolle der Zellen. Das Netzwerk der Kommunikationskanäle, die die Individuen verbinden, spielt die Rolle des<br />
Nervensystems für diesen Superorganismus”. Der Schwarm ersetzt das Netzwerk dabei also nicht, sondern bildet nur<br />
die Basis. Diese Sicht geht konform mit der Betrachtung des Internets als Informationsinfrastruktur. Die Bedeutung<br />
des Begriffes verschiebt sich dabei jedoch weg von künstlicher Intelligenz hin zu einer Art Aggregierung<br />
menschlicher Intelligenz.
Kollektive Intelligenz 258<br />
Soziologische Beschreibung<br />
So versteht eine soziologische Interpretation unter kollektiver Intelligenz gemeinsame, konsensbasierte<br />
Entscheidungsfindung. Kollektive Intelligenz ist ein altes Phänomen, auf das Fortschritte in Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien neu und verstärkt hinweisen. Das Internet vereinfacht wie nie, dezentral verstreutes<br />
Wissen der Menschen zu koordinieren und so deren kollektive Intelligenz nutzbar zu machen.<br />
So formuliert Howard Rheingold in Smart Mobs: „The ‚Killer-Apps’ of tomorrow's mobile infocom industry won't be<br />
hardware devices or software programs but social practices.” (Die Killerapplikationen der mobilen IT-Industrie von<br />
morgen werden nicht Hardware oder Software sein, sondern soziale Handlungen.) Dem Leitbild der<br />
Schwarmintelligenz wird das Potential unterstellt, Gesellschaft und Märkte zu transformieren. Als Beispiel hierfür<br />
werden Smart Mobs wie die Critical Mass-Bewegung angeführt.<br />
Naturwissenschaftliche Beschreibung<br />
Klassisches Beispiel ist der Ameisenstaat. Einzelne Ameisen haben ein sehr begrenztes Verhaltens- und<br />
Reaktionsrepertoire. Im selbstorganisierenden Zusammenspiel ergeben sich jedoch immer wieder Verhaltensmuster,<br />
die „intelligent“ genannt werden können.<br />
Die Individuen staatenbildender Insekten agieren mit eingeschränkter Unabhängigkeit, sind in der Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben jedoch sehr zielgerichtet. Die Gesamtheit solcher Insektengesellschaften ist überaus leistungsfähig, was<br />
Forscher auf eine hochgradig entwickelte Form der Selbstorganisation zurückführen. Zur Kommunikation<br />
untereinander nutzen Ameisen beispielsweise Pheromone, Bienen den Schwänzeltanz. Ohne zentralisierte Form der<br />
Oberaufsicht ist das Ganze also mehr als die Summe der Teile.<br />
In gewisser Weise ist auch ein Gehirn das Zusammenspiel eines Superorganismus aus für sich „dummen” Individuen,<br />
nämlich den Neuronen. Ein Neuron ist annähernd nichts weiter als ein Integrator mit Reaktionsschwelle, genauer,<br />
einer sigmoiden Reaktionskurve. Erst das komplexe und spezifischen Regeln unterliegende Zusammenwirken von<br />
Milliarden von Neuronen ergibt, was wir unter Intelligenz verstehen.<br />
Nach Ansicht des britischen Biologen Rupert Sheldrake liegt ein von ihm nicht näher definiertes biologisches (und<br />
potentiell gesellschaftliches) morphisches Feld zugrunde, das eine „formbildende Verursachung“ für die Entwicklung<br />
von Strukturen sein soll. Seine Thesen sind umstritten, da Sheldrake einen physikalischen oder chemischen<br />
Nachweis schuldig geblieben ist.<br />
Beschreibung in der Informatik<br />
Schwarmintelligenz (engl. swarm intelligence), das Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz (KI), das auf<br />
Agententechnologie basiert, heißt auch Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI). Das Arbeitsgebiet versucht, komplexe<br />
vernetzte Softwareagentensysteme nach dem Vorbild staatenbildender Insekten wie Ameisen, Bienen und Termiten,<br />
sowie teilweise auch Vogelschwärmen zu modellieren. G. Beni und J. Wang hatten den Begriff swarm intelligence<br />
1989 im Kontext der Robotikforschung geprägt. [1]<br />
Die VKI-Forschung geht davon aus, dass die Kooperation künstlicher Agenten höhere kognitive Leistungen<br />
simulieren kann; Marvin Minsky bezeichnet dies als The Society of Mind. Ein Einsatzbeispiel für diese so genannten<br />
Ameisenalgorithmen stellten Sunil Nakrani von der Oxford University und Craig Tovey vom Georgia Institute of<br />
Technology 2004 auf einer Konferenz über mathematische Modelle sozialer Insekten vor; sie modellierten die<br />
Berechnung der optimalen Lastverteilung bei einem Cluster von Internet-Servern nach dem Verhalten der Bienen<br />
beim Nektarsammeln. [2]<br />
Für die Kommunikation zwischen den Agenten wird häufig die Knowledge Query and Manipulation Language<br />
(KQML) eingesetzt.<br />
1986 bildete Craig Reynolds mit dem Computerprogramm Boids eine Simulation des Schwarmfluges ab.
Kollektive Intelligenz 259<br />
Neben dem Forschungsfeld der VKI ist Schwarmintelligenz auch ein unscharfes Mode-Schlagwort wie bereits ab<br />
etwa 2000 das Peer-to-Peer (P2P). Während letzteres antrat, das Paradigma der Client-Server-Architektur durch<br />
dezentralisierte P2P-Architekturen abzulösen, soll Schwarmintelligenz nun hardwarebasierte Netzwerke ersetzen.<br />
Forscher an der Princeton University befassen sich unter der Leitung von Roger Nelson seit 1988 mit dem Phänomen<br />
der kollektiven Wahrnehmung von Menschen und haben dazu Messstationen auf der ganzen Welt stationiert. Das<br />
„Global Consciousness Project“ sammelt die empirischen Daten und vergleicht sie mit der Nachrichtenlage, um zu<br />
erkennen, ob ein Ereignis bereits, bevor die Nachricht verbreitet wurde, neuronale Reaktionen hervorruft. Hierzu<br />
wurden signifikante, wenn auch minimale empirische Belege geliefert. [3]<br />
Anwendungsbeispiele<br />
In der Didaktik<br />
Es ist naheliegend, dass an Orten, an denen gemeinsam nachgedacht und kollektiv Wissen konstruiert wird, das<br />
Prinzip der kollektiven Intelligenz besondere Beachtung findet. So wird versucht, Lernergruppen so umzugestalten,<br />
dass die Ressourcen der einzelnen Lerner stärker ausgeschöpft werden, als es bei dem tradierten Frontalunterricht der<br />
Fall ist. Das Gehirn wird als Modell herangezogen und die Lerner werden metaphorisch als Neurone definiert. Auf<br />
der Basis intensiver Interaktionen zwischen den Lernern „emergieren“ kollektive Gedanken. Dieses Prinzip wird in<br />
der Unterrichtsmethode Lernen durch Lehren (nach Martin) systematisch eingesetzt.<br />
Das Internet<br />
Auch der Cyberspace wurde schon als kollektive Intelligenz bezeichnet. Im heutigen Zustand des Internet mit seinen<br />
Milliarden von größtenteils zusammenhanglosen, statischen Dokumenten wird jedoch gelegentlich auch etwas<br />
vorsichtiger von kollektivem (Un-)Wissen gesprochen (Stichwörter sind Informationsüberflutung und<br />
Informationsmüll). Allerdings werden Internetinhalte zunehmend dynamischer (Beispiele: RSS-Feed, Blogs, Wikis).<br />
Die Verwendung der Gehirnstruktur als Modell für Organisationen hat eine lange Tradition. [4] Bei Aufkommen des<br />
Internets wurden von Anfang an Analogien zwischen dem Internet und dem Gehirn gezogen, wobei die<br />
Interaktionen zwischen Benutzern mit Interaktionen zwischen Neuronen oder Neuronenensembles verglichen<br />
werden können. Nach anfänglicher Skepsis wächst die Anzahl an Publikationen, die das Internet metaphorisch als<br />
Weltgehirn betrachten. Auch wenn der Vergleich noch zahlreiche Schwachpunkte aufweist, so zeigt sich die<br />
Metapher als heuristisches Instrument sehr fruchtbar. [5]<br />
Kollektive Intelligenz in der Unterhaltungsliteratur<br />
• Stanisław Lem, Der Unbesiegbare<br />
• Michael Crichton, Beute<br />
• Frank Schätzing, Der Schwarm<br />
• Stephen Baxter, Der Orden<br />
• Star Trek (die Borg)
Kollektive Intelligenz 260<br />
Siehe auch<br />
• Ameisenalgorithmus<br />
• Die Weisheit der Vielen<br />
• Kollektive Wissenskonstruktion<br />
• Organisationsintelligenz<br />
Literatur<br />
• Christopher Adami: Introduction to Artificial Life. Springer (1998)<br />
• Rodney A. Brooks: Intelligence without representation. In: Artificial Intelligence, 1991 (47), 139–159. [6]<br />
• Eva Horn/Lucas Marco Gisi (Hgg.): Schwärme – Kollektive ohne Zentrum. Eine Wissensgeschichte zwischen<br />
Leben und Information, Bielefeld: transcript 2009. ISBN 978-3-8376-1133-5<br />
• Angelika Karger: Wissensmanagement und „Swarm intelligence“ - Wissenschaftstheoretische, semiotische und<br />
kognitionsphilosophische Analysen und Perspektiven in „Die Zukunft des Wissens: XVIII. Deutscher Kongress<br />
für Philosophie Konstanz 1999 Workshop-Beiträge, Hrsg. von Jürgen Mittelstrass, Universitätsverlag Konstanz,<br />
ISBN 3-87940-697-9<br />
• Ray Kurzweil: Homo S@piens<br />
• <strong>Jan</strong> Marco Leimeister, Michael Huber, Ulrich Bretschneider, Helmut Krcmar (2009): Leveraging Crowdsourcing:<br />
Activation-Supporting Components for IT-Based Ideas Competition. In: Journal of Management Information<br />
Systems (2009), Volume: 26, Issue: 1, Publisher: M.E. Sharpe Inc., Pages: 197-224, ISSN: 07421222, DOI:<br />
10.2753/MIS0742-1222260108 [4]<br />
• Pierre Lévy: Die kollektive Intelligenz. Eine Anthropologie des Cyberspace, Mannheim 1997<br />
• Lynne E. Parker: Multi-robot systems - From swarms to intelligent automata. Springer, Dordrecht 2005, ISBN<br />
1-4020-3388-5<br />
• James Surowiecki: Die Weisheit der Vielen.Warum Gruppen klüger sind als Einzelne, München 2007<br />
• Jean-Baptiste Waldner: Nanocomputers & Swarm Intelligence, ISTE, London, 2007, ISBN 1-84704-002-0<br />
Weblinks<br />
Disziplinübergreifend<br />
• Schwarmintelligenz - Der Hering im Menschen [7] : Podcast von Christoph Kersting auf br-online.de (IQ<br />
Wissenschaft und Forschung)<br />
Naturwissenschaften<br />
• Rüdiger Wehner (2001): Miniaturgehirne und kollektive Intelligenz [8]<br />
• Princeton, zur Erforschung des globalen Bewusstsein [9]<br />
• Simulation der Selbstorganisation einer Ameisenstraße [29] : Unterrichtseinheit für den Biologieunterricht<br />
• Schwarmlogistik - Was wir von den Ameisen noch lernen können [10] : Film über die Adaption von<br />
Schwarmintelligenz in die Logistik<br />
• Schwarmintelligenz in der Logistik [11]<br />
Informatik<br />
• Francoise Dupuy-Maury (2000): Ameisen ins Netz! Soziale Insekten entwickeln eine „Schwarmintelligenz”,<br />
welche die Informatiker fasziniert [12] , in: InfoScience für Die Woche der Wissenschaft (16. bis 22. Oktober<br />
2000).<br />
• Matthias Böhmer (2007): Schwarmintelligenz. Von natürlichen zu künstlichen Systemen [13]<br />
Gesellschaft, Ökonomie und Management<br />
• Andreas Neef (2003): Leben im Schwarm. Ein neues Leitbild transformiert Gesellschaft und Märkte [14]
Kollektive Intelligenz 261<br />
• Peter Wippermann (2005): Wer nicht erreichbar ist, hat schon verloren [15] , Interview, in: Neue Gegenwart.<br />
Magazin für Medienjournalismus, 44/05<br />
• Peter Kruse (2009): Interview in DNAdigital - Wenn Anzugträger auf Kapuzenpullis treffen [16] Über den<br />
Unterschied von Schwarmintelligenz und kollektiver Intelligenz und die Konsequenzen für Enterprise 2.0.<br />
Referenzen<br />
[1] Peter Miller: Schwarm-Intelligenz: Weisheit der Winzlinge, in: „National Geographic Deutschland“, Heft 08/2007<br />
[2] vgl. (http:/ / www. nzz. ch/ netzstoff/ 2004/ 2004. 02. 13-em-article9EF0Q. html)<br />
[3] siehe Current Results, Empirical Normalization unter http:/ / noosphere. princeton. edu<br />
[4] vgl. u.a. Heinz-Kurs Wahren: Lernende Unternehmen. Theorie und Praxis des organisationalen Lernens. Berlin. New-York: de Gruyter.<br />
1996<br />
[5] vgl. Florian Rötzer (1999): Megamaschine Wissen: Vision: Überleben im Netz. New York:Campus Verlag. Jean-Pol Martin (1998):<br />
Forschungshomepage – Homepageforschung, in: E. Piepho, A. Kubanek-German (Hrsg.): I beg to differ'. Beiträge zum sperrigen<br />
interkulturellen Nachdenken über eine Welt in Frieden. Festschrift für Hans Hunfeld. München: Judicum 1998: 205–213, (PDF-Datei) (http:/ /<br />
www. ldl. de/ material/ aufsatz/ homepage. pdf).Jean-Pol Martin (2002): „Wissenscontainer: Online-communities und kollektive<br />
Lernprozesse“, In: Christiane Neveling (Hrsg): Perspektiven für die zukünftige Fremdsprachendidaktik. (Giessener Beiträge zur<br />
Fremdsprachendidaktik). Gunter Narr Verlag Tübingen. S. 89–102. PDF (http:/ / www. ldl. de/ material/ aufsatz/ aufsatz2002. pdf) Jean-Pol<br />
Martin (2006): „Gemeinsam Wissen konstruieren: am Beispiel der Wikipedia“. In: Klebl, Michael, Köck, Michael (Hg.)(2006): Projekte und<br />
Perspektiven im Studium Digitale. Medienpädagogik, 3: 157–164. LIT Verlag Berlin. PDF (http:/ / www-edit. ku-eichstaett. de/ Fakultaeten/<br />
SLF/ romanistik/ didaktik/ Forschung/ ipk/ material/ papers/ wikipedia. pdf/ )<br />
[6] http:/ / www. google. ch/ url?sa=t& source=web& ct=res& cd=2& ved=0CA8QFjAB& url=http%3A%2F%2Fpeople. csail. mit.<br />
edu%2Fbrooks%2Fpapers%2Frepresentation. pdf& rct=j& q=ra+ brooks& ei=fVd6S4uWIpSD_AbgvdjgAQ&<br />
usg=AFQjCNHYyZ2yAP0XHqN6JZtX5QM4UxaAYg<br />
[7] http:/ / www. br-online. de/ imperia/ md/ audio/ podcast/ import/ 2009_01/ 2009_01_08_15_42_28_podcast_iq_schwarmintelligenz__a. mp3<br />
[8] http:/ / www. unipublic. unizh. ch/ campus/ uni-news/ 2001/ 0183/ Dies2001-Wehner. pdf<br />
[9] http:/ / noosphere. princeton. edu/<br />
[10] http:/ / de. youtube. com/ watch?v=p09VFRkjr8U<br />
[11] http:/ / www. schwarmlogistik. de/<br />
[12] http:/ / www. morgenwelt. de/ wissenschaft/ 001019-ameisen. htm<br />
[13] http:/ / www. m-boehmer. de/ pdf/ Schwarmintelligenz_Artikel. pdf<br />
[14] http:/ / www. changex. de/ d_a00924. html<br />
[15] http:/ / www. neuegegenwart. de/ ausgabe44/ wippermann. htm''<br />
[16] http:/ / www. nextpractice. de/ fileadmin/ PDF/ interviews/ DNAdigital_PeterKruse_20080218_D. pdf
Die Weisheit der Vielen 262<br />
Die Weisheit der Vielen<br />
Die Weisheit der Vielen – Warum Gruppen klüger sind als Einzelne (Original: The Wisdom of Crowds. Why the<br />
Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations)<br />
ist der Titel eines Buchs von James Surowiecki, das 2004 erschienen ist. Er argumentiert darin, dass die Kumulation<br />
von Informationen in Gruppen zu gemeinsamen Gruppenentscheidungen führen, die oft besser sind als<br />
Lösungsansätze einzelner Teilnehmer. Das Buch präsentiert zahlreiche Fallstudien und Anekdoten um seine<br />
Argumentation zu illustrieren. Dabei werden viele Fachgebiete berührt, hauptsächlich aber die Ökonomie und die<br />
Psychologie.<br />
Die einleitende Geschichte erzählt von Francis Galtons Überraschung, dass Besucher einer Vieh-Ausstellung im<br />
Rahmen eines Gewinnspiels das Schlachtgewicht eines Rindes genau schätzten, wenn man als Schätzwert der<br />
Gruppe den Mittelwert aller Schätzungen annahm. (Die Schätzung der Gruppe war sogar besser als die jedes<br />
einzelnen Teilnehmers, darunter manche Metzger.)<br />
Das Buch bezieht sich auf unterschiedliche Gruppen unabhängig entscheidender Personen, nicht auf Phänomene der<br />
Massenpsychologie. Er zieht Parallelen zu statistischen Auswahlverfahren, wonach eine unterschiedliche Gruppe<br />
individuell entscheidender Menschen eher die Gesamtheit aller möglichen Ausgänge eines Ereignisses repräsentieren<br />
kann und damit in der Lage ist, bessere Voraussagen für die Zukunft zu treffen.<br />
Der Titel des Buches ist eine Anspielung auf Charles Mackays Extraordinary Popular Delusions and the Madness of<br />
Crowds, welches 1841 veröffentlicht wurde.<br />
Typen der Weisheit der Vielen<br />
Surowiecki unterteilt Entscheidungen in drei Hauptgruppen auf, die er als Problemfelder klassifiziert:<br />
• Kognition: Surowiecki argumentiert, dass eine Gruppe viel genauer, schneller und unabhängiger von politischen<br />
Kräften entscheiden kann, als Experten oder Komitees von Experten dies können. Für diese Art von Problemen<br />
wird es eine definitive Lösung geben. Beispiele sind der nächste Sieger der Champions-League und der beste<br />
Standort für ein Schwimmbad.<br />
• Koordination: Koordination von Verhalten enthält die Optimierung der Nutzung eines Restaurants oder unfallfrei<br />
zu fahren. Das Buch enthält viele Beispiele aus der experimentellen Ökonomie, dieser Abschnitt beruht aber mehr<br />
auf natürlich vorkommenden Phänomenen, wie Fußgänger, die die Gehweg-Benutzung optimieren oder die<br />
Auslastung populärer Restaurants. Er untersucht wie geteilte Überzeugungen/Normen innerhalb einer Kultur<br />
erstaunlich genaue Voraussagen über die Reaktionen anderer Mitglieder dieser Kultur erlauben.<br />
• Kooperation: Wie Gruppen von Menschen ein Vertrauensnetzwerk aufbauen können, ohne dafür eine zentrale<br />
Kontrolle über ihr Verhalten oder eine direkte Durchsetzung der Regeln zu benötigen. Diese Sektion spricht sich<br />
besonders für einen freien Markt aus.<br />
Elemente der Gründung der Weisheit der Vielen<br />
Nicht alle Gruppen sind weise. Beispiele für solche Überlegungen sind zum Beispiel aufgebrachte Meuten von<br />
Menschen oder Investoren an der Börse nach einem Börsenboom oder –crash. Untersuchungen sind dahingehend<br />
nötig um mehr Beispiele für fehlerhafte Gruppenintelligenz aufzudecken und zu vermeiden. Welche<br />
Schlüsselkriterien gibt es, eine weise Gruppe von einer irrationalen zu unterscheiden?<br />
1. Meinungsvielfalt: Jeder Mensch besitzt unterschiedliche Informationen über einen Sachverhalt, so dass es immer<br />
zu individuellen Interpretationen eines Sachverhaltes kommen kann.<br />
2. Unabhängigkeit: Die Meinung des Einzelnen ist nicht festgelegt durch die Ansicht der Gruppe.<br />
3. Dezentralisierung: Hier steht die Spezialisierung im Mittelpunkt des Fokus, um das Wissen des Einzelnen<br />
anzuwenden.
Die Weisheit der Vielen 263<br />
4. Aggregation: Es sind Mechanismen vorhanden, um aus Einzelmeinungen eine Gruppenmeinung zu bilden.<br />
Fehler kollektiver Intelligenz<br />
Surowiecki untersuchte Situationen, in denen die Gruppe einen sehr schlechten Ruf aufbaute und argumentierte, dass<br />
in diesen Situationen das Wissen oder die Zusammenarbeit fehlerhaft war. Dies geschah seiner Ansicht nach<br />
dadurch, dass die Gruppenmitglieder zu sehr auf die Ansichten anderer Menschen hörten und ihnen nacheiferten,<br />
statt sich selbst ein Bild über die Situation zu machen und zu differenzieren. Er nennt verschiedene Details von<br />
Experimenten, wonach die Gruppengewohnheiten durch einen ausgewählten Sprecher bekannt werden. Er behauptet<br />
obendrein, dass der Hauptgrund für die intellektuelle Konformität einer Gruppe hauptsächlich darin besteht,<br />
systematische Fehlentscheidungen zu treffen.<br />
Wenn die entscheidende Instanz nicht in der Lage ist, die Gruppe zu akzeptieren, so führt das, laut Surowieckis<br />
Aussagen dazu, dass das Personenrecht und das Recht zur Selbstinformation verloren gehen. Die Zusammenarbeit in<br />
der Gruppe kann auf diese Weise nur so gut, beziehungsweise eher schlechter als besser sein, als das klügste<br />
Mitglied (Die Möglichkeit besteht dem Anschein nach). Detaillierte Fallbeispiele schließen folgende Fehler ein:<br />
1. Zentralismus: Das Unglück der Weltraumfähre Columbia, dessen Verschulden sich auf die bürokratische<br />
Hierarchie des NASA-Managements verschob, da es nichts von den Warnungen der Ingenieure gewusst haben<br />
will.<br />
2. Meinungsunterschiede: Beispiel: Die US-amerikanische Gemeinschaft konnte das Attentat des 11. September<br />
2001 nicht verhindern, da Informationen von einer Unterbehörde vermutlich nicht an eine andere weitergeleitet<br />
worden sind. Laut Surowiecki arbeiten Gruppen am besten, wenn sie sich ihre Arbeit selbst aussuchen und sich<br />
selbst Informationen, die sie benötigen, besorgen (in diesem Fall IQ-Forscher). Die Isolation des SARS-Virus<br />
dient als Beispiel für die Unmöglichkeit der Koordination von Forschung. Er legt die Isolation des Virus als ein<br />
Beispiel für den freien Datenfluss zur Koordinierung von Forschung, durch Labore rund um die Welt ohne einen<br />
zentralen Kontrollpunkt aus.<br />
3. Ambivalenz: Wo Übergänge sichtbar werden und verlangsamt dargestellt werden, kann es zu einer<br />
Informationsflut kommen, welche die entscheidenden Individuen, unter der Berücksichtigung der getroffenen<br />
Wahl nicht bemerken: Vorausgesetzt dies geschieht, fällt es dem Einzelnen leichter, sein Benehmen auf die<br />
Gruppe abzustimmen, da er das Benehmen der Gruppe leicht kopieren kann.<br />
Besteht die Möglichkeit einer zu guten Integration?<br />
Surowiecki sprach von unabhängigen Individuen und weisen Gruppen und davon, dass manche Individuen zu sehr<br />
eingebunden sein könnten.<br />
Er beschäftigte sich mit der Frage, wie ein Individuum seine Unabhängigkeit in Interaktionen behält, ohne ein<br />
gewisses Maß an Daten zu verarbeiten, was sich als Schlüsselfaktor der Gruppenintelligenz herausstellt.<br />
Er antwortet folgendermaßen:<br />
• Halte lockere Verbindungen.<br />
• Versuche, so viele Informationen wie möglich zu beziehen.<br />
Tim O’Reilly [1] und andere diskutieren den Erfolg von Google, Wikis, Blogging und Web 2.0 im Zusammenhang<br />
mit der Weisheit der Vielen.
Die Weisheit der Vielen 264<br />
Anforderungen<br />
Surowiecki ist ein strenger Verfechter der Vorteile der Entscheidungsmärkte und bedauert die Fehler in DARPAs<br />
kontroversen privatpolitischen Analysen (potentielles intellektuelles Abstammen von RANDs Delphi Methode und<br />
Autor John Brunners Delphi Pool), um auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Er baut auf den Erfolg von<br />
öffentlicher und interner Zusammenarbeit als Ausgangspunkt für eine neue individuelle Sichtweise einer Gruppe mit<br />
verschiedenen Erfahrungen und gleicher Motivation (für den Erfolg der Sache), um neue Voraussetzungen zu<br />
schaffen. Surowieckis im Voraus getätigte Prophezeiungen sind aussagekräftiger als alle Vorhersagen irgendeiner<br />
anderen Gruppe von Individuen, die Überlegungen anstellten. Seine Aussagen sind vor allen Dingen marktbezogen,<br />
so dass er genauso wenig die Zusammenarbeit von autoritären Märkten und Firmen, sowie nicht vorhersehbare<br />
terroristische Aktivitäten ausschließt.<br />
Um seine These zu untermauern, gibt er an, dass sein Herausgeber über Informationen verfügt, die eine zwingende<br />
Aussage in einem Buch veröffentlicht, welche aus mehreren individuellen Autoren besteht. Auf diese Weise soll es<br />
möglich sein, in die Weisheit einer viel größeren Masse einzutauchen, als es mit einem zu Hause schreibenden Team<br />
möglich wäre.<br />
Der Journalist Will Hutton argumentiert, dass Surowieckis Analyse genauso auf Vorurteilen wie auf sachlichen<br />
Hintergründen beruhe, sich berufend auf die Erfahrungen vieler Menschen, die „anständigerweise feststehende,<br />
eigene, gesammelte, freiwillige Erfahrung erstaunt“. Er schließt daraus, dass „es keinen besseren Weg gibt, um<br />
Gemeinschaft, Individualität und Demokratie zu lehren als mit einer tatsächlich freien Presse. [2]<br />
Nur einige wenige experimentelle Versuche wurden unternommen, um zu erforschen, wie kollektive Weisheit<br />
entsteht. Einer dieser Versuche ist ein sogenannter Poll- oder Voting Server namens Opinion Republic [3] . Hier<br />
sammeln Marktforscher nach dem Multiple Choice-Prinzip Meinungen zu Äußerungen zu einem jeweiligen<br />
Themenkomplex und werten diese aus. Mit dem normalerweise auch passive Nutzer also sogenannte "Lurker"<br />
aktivierenden Mechanismus des Votings kommt jeweils eine recht hohe Zahl von Meinungen zustande, die nach<br />
dem Gesetz der großen Zahlen zunehmend an Güte und damit an Aussagekraft gewinnt. Leider ist hier im Gegensatz<br />
zu anderen Stimmabgaben negativ anzumerken, dass jeder Nutzer vor seiner Abstimmung bereits die bis dato<br />
erzielten Resultate sieht, was die Unabhängigkeit seines Urteils gefährdet. Diese aber wären neben einer hohen<br />
Vielfalt der Perspektiven und Ansichten (Streubreite) erforderlich, wenn intelligente Lösungsvorschläge entstehen<br />
sollen.<br />
Sonstiges<br />
Am 20. <strong>Jan</strong>uar 2008 moderierte Günther Jauch eine interaktive, direktübertragene Fernsehsendung mit dem Titel Die<br />
Weisheit der Vielen. In dieser Sendung sollte die Frage geklärt werden, ob ein einzelner Experte klüger ist als die<br />
Gesamtheit der Zuschauer. Verschiedene Prominente wurden als Experten zu einem Themengebiet präsentiert und<br />
mussten aus diesem Wissens- oder Schätzfragen beantworten, während die Zuschauer telefonisch über die gleiche<br />
Frage abstimmten. Am Ende der Sendung war das Ergebnis zwischen Experten und Zuschauern ausgeglichen.
Die Weisheit der Vielen 265<br />
Siehe auch<br />
• Condorcet-Jury-Theorem<br />
• Kollektive Intelligenz<br />
• Intelligenz der Masse<br />
• Weisheit<br />
Literatur<br />
• Surowiecki, James; (2004). The Wisdom Of Crowds: Why The Many Are Smarter Than The Few And How<br />
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies And Nations Little, Brown ISBN 0-316-86173-1<br />
• Lee, Gerald, Stanley (1913). Crowds. A Moving-Picture Of Democracy. Doubleday, Page & Company. Available<br />
from Project Gutenberg at [4] , retrieved May 2005.<br />
• Le Bon; Gustave. (1895), The Crowd: A Study Of The Popular Mind. Available from Project Gutenberg at [5]<br />
• Karger, Angelika, Wissensmanagement und "Swarm intelligence", wissenschaftstheoretische und<br />
kognitionsphilosophische Perspektiven, "Die Zukunft des Wissens". XVIII. Deutscher Kongress für Philosophie,<br />
Workshopbeiträge, hrg. Jürgen Mittelstraß, S.1288-1296, Konstanz 1999<br />
Weblinks<br />
• James Surowiecki-Independent Individuals And Wise Crowds [6]<br />
• Klüger als der klügste Kopf [7]<br />
• Post zu Wisdom of the Crowds-Lösungen - Openeur - Open Innovation & Entrepreneruship [8]<br />
• Die Weisheit der Fankurve - mehr als 20.000 Fans sollen einen Fußballclub managen, den FC Berlin [9]<br />
• Online Crowds [10] - Die Nutzung der Onlinemassen für erfolgreiche Geschäftsmodelle im Internet<br />
Referenzen<br />
[1] Blogging and the Wisdom of Crowds (http:/ / www. oreillynet. com/ pub/ a/ oreilly/ tim/ news/ 2005/ 09/ 30/ what-is-web-20. html?page=3)<br />
(englisch), 20. September 2005<br />
[2] Will Hutton: " The crowd knows best - From cricket to fuel prices, our collective instinct invariably strikes the right note (http:/ / observer.<br />
guardian. co. uk/ comment/ story/ 0,6903,1572869,00. html)" In: The Observer 18. September 2005<br />
[3] www.opinionrepublic.com (http:/ / www. opinionrepublic. com)<br />
[4] Crowds by Gerald Stanley Lee (http:/ / www. gutenberg. org. / etext/ 15759)<br />
[5] The Crowd: A Study of the Popular Mind (http:/ / onlinebooks. library. upenn. edu/ webbin/ gutbook/ lookup?num=445)<br />
[6] http:/ / www. itconversations. com/ shows/ detail468. html<br />
[7] http:/ / www. perspektive-blau. de/ buch/ 0608a/ 0608a. htm<br />
[8] http:/ / www. openeur. com/ blog/ 2007/ 08/ 03/ wisdom-of-the-market/<br />
[9] http:/ / www. mein-fußballclub. de<br />
[10] http:/ / www. rusz. net/ research/ onlinecrowds. html
Enterprise 2.0<br />
Managing <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Enterprise 2.0 bezeichnet den Einsatz von Sozialer Software zur Projektkoordination, zum Wissensmanagement<br />
und zur Innen- und Außenkommunikation in Unternehmen. Diese Werkzeuge fördern den freien Wissensaustausch<br />
unter den Mitarbeitern, sie erfordern ihn aber auch, um sinnvoll zu funktionieren. Der Begriff umfasst daher nicht<br />
nur die Tools selbst, sondern auch eine Tendenz der Unternehmenskultur – weg von der hierarchischen, zentralen<br />
Steuerung und hin zur autonomen Selbststeuerung von Teams, die von Managern eher moderiert als geführt werden.<br />
Entstehung des Begriffs<br />
Der Begriff Enterprise 2.0 geht auf einen Artikel des Harvard-Professors Andrew P. McAfee zurück. In seinem<br />
Artikel "Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration" [1] beschreibt Andrew McAfee, Professor an der<br />
Harvard Business School, wie <strong>Social</strong> Software im Unternehmenskontext eingesetzt werden kann, um die<br />
Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu unterstützen (McAfee 2006a). Unter dem Begriff SLATES (deutsch:<br />
Schiefertafeln; SLATES steht für die Abkürzung von Search, Links, Authoring, Tags, Extensions and Signals – in<br />
Anlehnung an die Abkürzung WIMP) fasst er die Prinzipien, Merkmale und Eigenschaften von Web<br />
2.0-Werkzeugen zusammen. Er argumentiert, dass das Auffinden von Informationen (Search) im Internet<br />
nachweislich viel besser funktioniert als in Intranets, weil die Masse der Nutzer durch Links Informationen<br />
strukturieren und bewerten, die von Suchmaschinen ausgewertet werden. Durch eine vergleichbare Masse an<br />
Strukturen, die von Mitarbeitern mit Hilfe von einfachen Autoren-Tools (Authoring) und Verschlagwortung (Tags)<br />
erstellt werden, könnten Unternehmen die Vorteile der Wisdom of Crowds nutzen. In dem Nutzungsdaten für<br />
automatisierte Inhaltsvorschläge (Extensions) verwendet werden, können thematisch ähnliche Inhalte leichter<br />
entdeckt werden ("Nutzer, die diesen Beitrag spannend fanden, fanden auch...") und Signale wie RSS-Feeds<br />
(Signals) machen Änderungen verfolgbar.<br />
McAfee verwendet den Begriff für Web-2.0-Technologien zur Erzeugung, gemeinsamen Nutzung ("sharing") und<br />
Verfeinerung von Informationen, mit denen Wissensarbeiter in Unternehmen ihre Vorgehensweisen und Ergebnisse<br />
sichtbar machen (McAfee 2006a, S. 23). In der Definition in (McAfee 2006b) dehnt er den Nutzerkreis auf<br />
unternehmensübergreifende Kommunikation aus:<br />
„Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms within companies, or between companies and<br />
their partners or customers“<br />
– McAfee 2006b<br />
Richter und Koch erweitern den Begriff unter Bezugnahme auf einen Information-Week-Artikel und die<br />
Enterprise-2.0-Konferenz 2007 um die notwendigen Veränderungen der Unternehmenskultur:<br />
„Enterprise 2.0 bedeutet vielmehr die Konzepte des Web 2.0 und von <strong>Social</strong> Software nachzuvollziehen und zu<br />
versuchen, diese auf die Zusammenarbeit in den Unternehmen zu übertragen.“<br />
– Richter und Koch (2007), S. 16<br />
Buhse und Stamer beschreiben aufgrund von Erfahrungen im eigenen Unternehmen die notwendigen strategischen<br />
Änderungen in Marketing und Public Relations, die sich aus dem Einsatz von <strong>Social</strong> Software ergeben. Sie plädieren<br />
für eine ehrlichere Kommunikationskultur, bei der auch die Außenkommunikation von den Mitarbeitern gemacht<br />
wird und das Management lediglich Themen lanciert und Richtungen vorgibt. [2] Bisher zentral gesteuerte Bereiche<br />
wie Markenführung und Public Relations müssen in dieser Hinsicht neu überdacht werden.<br />
266
Enterprise 2.0 267<br />
Literatur<br />
• Albrecht, Jörg (2009): <strong>Social</strong> Software im Unternehmen: Chancen nutzen, Risiken managen. In:<br />
Wissensmanagement. (Ausgabe 6 August/September 2009).<br />
• Back, Andrea; Gronau, Norbert; Tochtermann, Klaus (Hg.) (2008): Web 2.0 in der Unternehmenspraxis.<br />
Grundlagen Fallstudien und Trends zum Einsatz von <strong>Social</strong> Software. Oldenbourg, München, ISBN<br />
978-3486585797.<br />
• Bode, Joachim (2009): Pragmatisches Wissensmanagement im Intranet. In: Lippert, Werner (Hg.): Annual<br />
Multimedia 2010. Regensburg: Walhalla und Praetoria, S. 58-63.<br />
• Buhse, Willms; Stamer, Sören (Hg.) (2008): Enterprise 2.0 – Die Kunst, loszulassen [3] 1. Aufl.,<br />
Rhombos-Verlag, Berlin, ISBN 978-3-938807-68-2.<br />
• Buhse, Willms; Reinhard, Ulrike (Hg.) (2009): Wenn Anzugträger auf Kapuzenpullis treffen 1. Aufl.,<br />
WhoIs-Verlag, Heidelberg, ISBN 978-3-934013-98-8.<br />
• Hertel, Guido; Konradt, Udo (2007): Telekooperation und Virtuelle Teamarbeit. Oldenbourg, München, ISBN<br />
9783486275186.<br />
• McAfee, Andrew (2006a): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration [4] . In: MIT Sloan Management<br />
Review, Jg. 47, H. 3, S. 20–28.<br />
• McAfee, Andrew (2006b): "Enterprise 2.0, version 2.0", Blog Post vom 27. Mai 2006, http:/ / blog. hbs. edu/<br />
faculty/ amcafee/ index. php/ faculty_amcafee_v3/ enterprise_20_version_20/ Letzter Zugriff am 14. August<br />
2007.<br />
• Koch, Michael (2008): "Enterprise 2.0 - <strong>Social</strong> Software in Unternehmen", White Paper, Universität der<br />
Bundeswehr München, http:/ / www. kooperationssysteme. de/ docs/ pubs/ Koch2008-bericht_enterprise20. pdf<br />
• Koch, Michael; Richter, Alexander (2007): Enterprise 2.0. Planung, Einführung und erfolgreicher Einsatz von<br />
<strong>Social</strong> Software in Unternehmen. Oldenbourg, München, ISBN 978-3-486-58578-0.<br />
• Most Business Tech Pros Wary About Web 2.0 Tools In Business - 'Enterprise 2.0' must overcome concerns<br />
about security and return to get a foothold in business [5] (englisch) von J. Nicholas Hoover, in InformationWeek<br />
vom 24. Februar 2007<br />
• Pfeiffer, Sabine (2009): Enterprise 2.0 — ein Weg zu neuen Formen von Innovations- und<br />
Wertschöpfungsprozessen. In: Gatermann, Inken; Fleck, Miriam (Hg.): Innovationsfähigkeit sichert Zukunft.<br />
Beiträge zum 2. Zukunftsforum Innovationsfähigkiet des BMBF. Berlin: Duncker & Humblot, S. 263-270. ISBN:<br />
978-3-428-13238-6. Auch als E-Book (PDF) erhältlich: ISBN 978-3-428-53238-4<br />
Weblinks<br />
• Enterprise 2.0 Konferenz 2007 [6]<br />
• Leisenberg,M.: Soziale Prozesse bringen Geld [7]<br />
• Ulrich Klotz: Die Entmündigten lernen, kreativ zu sein [7] . Artikel auf taz.de. 7. <strong>Jan</strong>uar 2008. (Gekürzte Fassung<br />
von: Mit dem 'Unternehmen 2.0' zur 'nächsten Gesellschaft'.)<br />
• Ulrich Klotz: Unternehmen und Arbeit 2.0. [8] Essay in Berliner Republik 1/2009.<br />
• Enterprise-2.0-Debatte 2009 als E-Book: [9] Digital Natives im Gespräch mit Internet-Experten wie David<br />
Weinberger, Don Tapscott, Peter Kruse u.a.<br />
• Liste von Fach-Blogs zum Thema Enterprise 2.0 [10]<br />
• Sabine Pfeiffer: Szenario zu Enterprise 2.0 im Maschinenbau [11]<br />
• Dada Lin: Wissensmanagement Reloaded - Ein Ordnungsrahmen für den systemischen Umgang mit Wissen im<br />
Enterprise 2.0 [12]
Enterprise 2.0 268<br />
Referenzen<br />
[1] McAfee, Andrew (2006a): Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. In: MIT Sloan Management Review, Jg. 47, H. 3, S. 20–28.<br />
[2] Buhse, Willms (2008): Schönheit kommt von innen. Die neue Kommunikationskultur eines Enterprise 2.0. In: Buhse und Stamer (2008)<br />
[3] http:/ / www. art-of-letting-go. com/<br />
[4] http:/ / www. wikiservice. at/ upload/ ChristopheDucamp/ McAfeeEntrepriseDeux. pdf<br />
[5] http:/ / www. informationweek. com/ news/ management/ showArticle. jhtml?articleID=197008457<br />
[6] http:/ / www. enterprise2conf. com<br />
[7] http:/ / www. taz. de/ 1/ archiv/ print-archiv/ printressorts/ digi-artikel/ ?ressort=bi& dig=2009%2F01%2F07%2Fa0121<br />
[8] http:/ / b-republik. de/ b-republik. php/ cat/ 8/ aid/ 1451/ title/ Unternehmen_und_Arbeit_2. 0/<br />
[9] http:/ / www. scribd. com/ doc/ 12544534/ DNAdigital-Wenn-Kapuzenpullis-auf-Anzugtraeger-treffen<br />
[10] http:/ / www. henningschuerig. de/ blog/ 2009/ 03/ 16/ blogs-zum-thema-enterprise-20/<br />
[11] http:/ / www. smarte-innovation. de/ downloads/ SInn-Nachrichten-03. pdf<br />
[12] http:/ / www. scribd. com/ doc/ 34599620/<br />
Diplomarbeit-Wissensmanagement-Reloaded-Ein-Ordnungsrahmen-fur-den-systemischen-Umgang-mit-Wissen-im-Enterprise-2-0<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance<br />
Theoriefindung --Riade 21:59, 24. Aug. 2010 (CEST)<br />
Unter <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance werden Strategien, Regeln und Strukturen für den Einsatz und die Nutzung von<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> (dt.: soziale Medien, umfasst Web-Dienste, die den Austausch von Meinungen, Eindrücken und<br />
Erfahrungen ermöglichen) im Rahmen der Organisationskommunikation zusammengefasst. Darin sind sowohl<br />
langfristige Konzepte als auch Zuständigkeiten und organisatorische Voraussetzungen geregelt. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Governance ist wegen des weit verbreiteten Einsatzes von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> durch Unternehmen und Organisationen<br />
bedeutsam. In diesem Rahmen soll eine <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance unter anderem dazu beitragen, die Risiken des<br />
Kontrollverlustes im <strong>Social</strong> Web auszugleichen und neu entstandene Chancen zu nutzen.<br />
Begriffsdefinition<br />
Eine Begriffsanalyse der Quellen zu <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance zeigt, dass zwei unterschiedlich weit greifende<br />
Verständnisse existieren:<br />
1. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance im engeren Sinne meint Regeln, Guidelines und Polices für den Einsatz und Umgang<br />
mit <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Plattformen (ISACA 2010). Die Bezeichnung dieser Leitlinien in der Praxis ist so facettenreich<br />
wie ihre Inhalte. Unter anderem wird von Mitarbeiter-Blogging-Policies, <strong>Social</strong> Network Guidelines,<br />
Mitarbeiterengagement in Online Communities und eben <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance gesprochen. Die Etablierung<br />
solcher Regeln beruht auf der Herausforderung, die eigene Organisation und entsprechend die Mitarbeiter als<br />
Kommunikatoren im <strong>Social</strong> Web zu befähigen und anzuleiten. Vor allem aus rechtlicher Perspektive ist es<br />
unabdingbar, gewisse Grundregeln zu schaffen machen. [1] Das betrifft die öffentliche Verbreitung von Interna,<br />
Verletzungen des Copyrights und der Persönlichkeitsrechte oder das Auslösen unternehmensweiter Krisen durch<br />
unbedachte Äußerungen einzelner Mitarbeiter. Darüber hinaus geht es. um den Schutz der<br />
Unternehmensreputation, die optimale Nutzung von Zeitressourcen und die Regelung von<br />
Haftungsgrundsätzen. [2] Das reine Verbot von <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Aktivitäten wäre allerdings wenig hilfreich, denn sie<br />
bieten auch vielfältige Vorteile wie verbesserte Kontakte zu Kunden, Partner und Interessenten. Ohnehin ist<br />
Nutzung partizipativer Plattformen im Alltag der Mitarbeiter und bei anderen Organisationen so weit verbreitet,<br />
dass dies kontraproduktiv wäre. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance kann hingegen den Gefahren vorbeugen und als<br />
Leitfaden für das <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Engagement dienen. Die Guidelines sollten allerdings nicht als Verbotskatalog<br />
verstanden werden, sondern das Vorgehen an konkreten Situationen verdeutlichen. [3] Wird nur durch negative<br />
Verbote in Form abstrakter Regeln verwiesen, erhöht das die Handlungsunsicherheit der Mitarbeiter anstatt sie<br />
durch positive Formulierungen zu ermutigen und zu lenken. Die Ansprüche an eine <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 269<br />
sind hoch: Sie muss für sehr heterogene Zielgruppen ansprechend und verständlich sein, flexibel auf<br />
unterschiedliche Situationen anwendbar sein und sich dynamisch an Neuerungen anpassen lassen. Dabei ist zu<br />
bedenken, dass die Guidelines nicht alle möglichen Szenarien erfassen können. Stattdessen sollten den<br />
Mitarbeitern auch Handlungsspielräume zugestanden werden. Hier wird bereits ersichtlich, dass der<br />
Regelungsanspruch von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance mit den Autonomiebedürfnissen der Mitarbeiter kollidieren<br />
kann, ein Phänomen, das für den gesamten <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Bereich in der Organisationskommunikation<br />
charakteristisch ist. Als inhaltliche Eckpfeiler sind folgende zu beantwortende Fragen denkbar: Welche<br />
unternehmensrechtliche Grundlagen existieren? Inwiefern sind private <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Aktivitäten von beruflichen<br />
zu trennen? Darf ich schreiben? Wer ist rechtlich verantwortlich? Unter welchem Namen bin ich aktiv? Wo darf<br />
ich mich engagieren? Mit wem darf ich interagieren? Wie viel Zeit darf ich dafür verwenden? Welche formalen<br />
und inhaltlichen Richtlinien gilt es zu beachten? Welche ethischen und Community-spezifischen Regeln<br />
existieren? Wie muss mit unternehmensinternen bzw. kundenbezogenen Informationen umgegangen werden?<br />
Wie lässt sich eine Qualitätskontrolle realisieren? Wie gehe ich mit negativem Feedback und Krisen um? Wen<br />
kann ich um Hilfe fragen? Wie wird mein Einsatz überwacht? Was passiert nach Austritt des Mitarbeiters aus<br />
dem Unternehmen? [4]<br />
2. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance in einem umfassenderen Sinn bezieht sich auf die Summe aller Rahmenbedingungen<br />
für die Verwendung von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>. Darunter fallen insbesondere Strukturen wie Regeln und<br />
Ressourcenverteilungen, aber auch bereichs- und instrumentenübergreifende Strategien (Fink/Zerfaß 2010). Hier<br />
wird dem Aspekt Rechnung getragen, dass der strategische Einsatz von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> neben ausformulierten<br />
Leitplanken in Form von Guidelines spezifische Ressourcen (geschulte Mitarbeiter, leistungsfähige IT, spezielles<br />
Budget) und Strukturen (Zuständigkeiten, Verfahren des Monitorings, Einarbeitung von Feedback,<br />
Redaktionsabläufe) benötigt. Die geschaffenen Governance-Strukturen ermöglichen und begrenzen das<br />
individuelle Handeln, werden aber auch durch wiederholte Handlungen reproduziert und verfestigt. [5] Folglich<br />
sollte die Etablierung eines organisatorischen Ordnungsrahmens für <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> an erster Stelle der Aufgaben<br />
für Unternehmen stehen. Dann können Mitarbeiter speziell für diese neuen Kommunikationsplattformen<br />
ausgebildet werden, um schließlich konkrete Maßnahmen zu entwickeln und einzusetzen. Beispielsweise lassen<br />
sich Kunden erst optimal in Unternehmensprozesse integrieren, wenn zunächst Guidelines für den Kundenkontakt<br />
über <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> sowie Strukturen wie <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Accounts und -Budgets geschaffen werden. Dann können<br />
die Mitarbeiter für dieses spezifische Aufgabenfeld geschult werden bevor sie mit dem eigentlichen<br />
Kundenbeziehungsmanagement auf <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Plattformen beginnen. [6] Zusammengefasst werden kann dieses<br />
umfassende Konzept mit Hilfe der 4 Ps:<br />
1. Planning: Hier geht es um konkrete Strategien und Zielformulierungen.<br />
2. Policy: Damit sind die Guidelines entsprechend des engeren Verständnisses von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Governance gemeint.<br />
3. Preparation: Dies spricht das Schaffen von Strukturen und Bereitstellen von Ressourcen sowie die<br />
Vorbereitung konkreter Maßnahmen an.<br />
4. Protocol: In diesem Schritt geht es um die konkrete Umsetzung und Begleitung von<br />
<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Aktivitäten durch konkrete Evaluationsmaßnahmen. [7]<br />
Die Entwicklung des <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Governance-Konzeptes lässt sich wie folgt nachvollziehen: Der Begriff basiert<br />
auf der Übertragung des Governance-Konzeptes auf den Einsatz von <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Anwendungen in Organisationen.<br />
Governance im eigentlichen Sinne stammt aus der Politikwissenschaft und meint die Summe aller Mittel zur<br />
Kontrolle und Koordinierung bei der Verwaltung von Interdependenzen zwischen zumeist kollektiven Akteuren. [8]<br />
Übertragen wurde dieses Konzept auch auf die Betriebswirtschaft, wo unter „Corporate Governance“ der<br />
übergreifenden Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens, insbesondere bezüglich der<br />
Einbindung des Unternehmens in sein Umfeld, zusammengefasst wird. [9] Im Zentrum steht bei allen drei Ansätzen<br />
die Bedeutung des strukturellen Rahmens für darin stattfindende Handlungen.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 270<br />
Forschung<br />
Der Einsatz von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> in Organisationen gewinnt in der wissenschaftlichen Betrachtung seit ihrer Einführung<br />
zunehmend an Bedeutung, allen vorab deren Nutzung in Marketing und Unternehmenskommunikation, aber auch bei<br />
Service-Anwendungen in Innovationsprozessen. Nach allgemeinen Analysen zur Bewertung der Neuerscheinungen<br />
und deren Einsatz auf Tool-Ebene rücken mittlerweile mehr und mehr die strategischen Aspekte wie die <strong>Social</strong><br />
<strong>Media</strong> Governance in den Mittelpunkt.<br />
• Für Guidelines gibt es inzwischen zahlreiche Fallstudien. Auch in größer angelegten Untersuchungen wird diese<br />
Governance im engeren Sinn inzwischen untersucht. Im European Communication Monitor [10] , einer jährlichen<br />
Studie mehrerer Universitäten zur Entwicklung der Unternehmenskommunikation in 46 Ländern, zeigte sich, dass<br />
im Frühjahr 2010 knapp 30 Prozent aller Organisationen bereits Guidelines implementiert hatten. Eine von der<br />
IESE Business School und dem E. Philip Saunders College of Business mit Unterstützung von Cisco 2010<br />
durchgeführte Studie [11] zu Enterprise 2.0 ermittelte etwas geringere Werte – hier hatte nur eines von fünf<br />
Unternehmen interne Leitlinien verfasst. Die meisten Entscheider haben Probleme, die richtige Balance zwischen<br />
der sozialen und persönlichen Natur dieser Plattformen und dem Steuerungsanspruch von Unternehmen zu finden.<br />
• Das umfassende Konzept von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance als Untersuchungsgegenstand ist komplexer und daher<br />
weniger erforscht. Hier geht es um den Zusammenhang zwischen <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Aktivitäten, Strategien und<br />
Strukturen. Dies wurde erstmals in der Studie <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 2010 [12] haben die Universität Leipzig,<br />
Fink & Fuchs Public Relations AG und das Magazin Pressesprecher analysiert. Die Befragung von über 1.000<br />
Verantwortlichen in deutschen Unternehmen, Behörden und NGOs im Sommer 2010 zeigt, dass <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Governance ein entscheidender Hebel ist, der sowohl zu steigender Expertise als auch tragfähigen Strategien und<br />
verstärkter <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Nutzung führt. Allerdings hinkt die Praxis noch hinterher, denn nur knapp 20 Prozent<br />
der Organisationen verfügen über einen ausgeprägten Ordnungsrahmen in Sinne einer ausgebauten <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Governance.<br />
Unternehmenspraxis<br />
Auch bei der Betrachtung der Unternehmenspraxis sind die beiden unterschiedlichen Auffassungen von <strong>Social</strong><br />
<strong>Media</strong> Governance zu berücksichtigen: Obwohl <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> mittlerweile zur Praxis der<br />
Unternehmenskommunikation gehören, sind dafür meist immer noch vereinzelte, an der Thematik interessierte<br />
Mitarbeiter oder Abteilungen verantwortlich. Auch privat nutzen die Mitarbeiter vermehrt <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>, ob auf dem<br />
privaten Rechner, im Arbeitsumfeld oder auf mobilen Geräten. Dadurch wird der Ruf nach einer Regelung der<br />
<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Aktivitäten in Organisationen in Form von Leitlinien immer offensichtlicher. Solche Regelungen sind<br />
jedoch selten zu finden. [13] Auch strategische Überlegungen explizit zu <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> stehen meist noch am Anfang<br />
und haben sich nur selten in festen Strategiepapieren niedergeschlagen – der Aktionismus dominiert. [14]<br />
Selbst wenn der Bedarf nach Leitlinien erkannt wird, schaffen nur wenige einen umfassenden Ordnungsrahmen für<br />
den Einsatz von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>. Der <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance mangelt es in der Praxis vor allem an Kennzahlen für<br />
die Erfolgskontrolle, gesonderten Budgets, dem Know-how der Mitarbeiter, Möglichkeiten zur Weiterbildung und<br />
personellen Ressourcen. [15] Hier spielen sowohl Ängste vor Kontrollverlust als auch organisationsinterne<br />
Restriktionen eine entscheidende Rolle. [16] 44 Prozent aller deutschen Unternehmen verbieten ihren Mitarbeitern<br />
sogar explizit die Nutzung von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>. [17] Demgegenüber verweist die Studie <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 2010<br />
darauf, dass gerade das Schaffen eines tragfähigen Ordnungsrahmens der Schlüssel zum Erfolg des<br />
<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Einsatzes in zukunftsorientierten Organisationen darstellt.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 271<br />
Literatur<br />
• Fink, Stephan/Zerfaß, Ansgar (2010): <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 2010. Wie Unternehmen, Staat und NGOs die<br />
Herausforderungen transparenter Kommunikation im Internet steuern, Leipzig/Wiesbaden: Universität<br />
Leipzig/FFPR. Online-Dkument: http:/ / www. ffpr. de/ fileadmin/ user_upload/ PDF-Dokumente/<br />
Studie_<strong>Social</strong>_<strong>Media</strong>_Governance_2010_-_Studienergebnisse. pdf<br />
• ISACA (2010) <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>: Business Benefits and Security, Governance and Assurance Perspectives, Rolling<br />
Meadows, Illinois.: ISACA White Paper. Online-Dokument: http:/ / www. isaca. org/ Knowledge-Center/<br />
Research/ ResearchDeliverables/ Pages/<br />
<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-Perspectives. asp<br />
Weblinks<br />
• Datenbank mit beispielhaften <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Guidelines: http:/ / socialmediagovernance. com/<br />
• Artikel "<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance – Manager sind gefordert": http:/ / blog. ffpr. de/ 2010/ 05/ 10/<br />
social-media-governance-%E2%80%93-manager-sind-gefordert/<br />
• Artikel „<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Guidelines – Regeln für das digitale Miteinander“: http:/ / www. rechtzweinull. de/<br />
uploads/ <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Guidelines-RegelnfrdasdigitaleMiteinander. pdf<br />
• Empirische Studie zur <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance in deutschen Organisationen: http:/ / www.<br />
socialmediagovernance. eu<br />
• Artikel „<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Guidelines – Regeln für das digitale Miteinander“: http:/ / www. rechtzweinull. de/<br />
uploads/ <strong>Social</strong><strong>Media</strong>Guidelines-RegelnfrdasdigitaleMiteinander. pdf<br />
• Blog-Beitrag zur Bedeutung von Strategien für <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>: http:/ / blog. talkabout. de/ 2010/ 04/ 26/<br />
vom-hype-zum-strategischen-einsatz-wie-social-media-nachweisbar-werte-in-organisationen-schafft/<br />
• Best Practices for Developing & Implementing a <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Policy: http:/ / sncr. org/ wp-content/ uploads/<br />
2008/ 09/ sncr-social-media-policy-best-practices. pdf<br />
• Präsentation zur <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance aus Agentursicht: http:/ / www. scribd. com/ doc/ 32752132/<br />
<strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Governance<br />
• Fallbeispiel Wikipedia und <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance: http:/ / www-cs. stanford. edu/ people/ jure/ pubs/<br />
voting-icwsm10. pdf<br />
Referenzen<br />
[1] (http:/ / govsocmed. pbworks. com/ Web-2-0-Governance-Policies-and-Best-Practices)Web-Sammlung von Best-Practise Web 2.0<br />
Governance und Policies.<br />
[2] Ulbricht, Carsten (2010): Enterprise 2.0 und Recht – Risiken vermeiden und Chancen nutzen. In: Eberspächer, Jörg; Holtel, Stefan (Hg.):<br />
Enterprise 2.0. Berlin/Heidelberg, S. 95-113 und http:/ / socialmediagovernance. com/ policies. php<br />
[3] (http:/ / www. slideshare. net/ djaar/<br />
developing-procedures-and-governance-policies-for-social-media-applications-and-ensuring-privacy-protection-presentation)Präsentation zur<br />
Erstellung von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance.<br />
[4] (http:/ / socialmediagovernance. com/ policies. php)Online-Datenbank mit <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Policies und entsprechenden Studien.<br />
[5] Zerfaß, Ansgar (2010): <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance. In: Pressesprecher, Nr. 9, S. 46-48.<br />
[6] Lattemann, C. and Stieglitz, S. (2007) ‘Online communities for customer relationship management on financial stock markets-a case study<br />
from a German stock exchange’, Proceedings of the 2007 Americas Conference on Information Systems, Paper 76, pp.1–11.<br />
[7] (http:/ / www. socialmediatoday. com/ peggy-dau/ 146128/ 4-ps-social-media-governance)Blogartikel von Peggy Dau in socialmediatoday.<br />
[8] Benz, Arthur (2004): Einleitung: Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept, in ders. (Hrsg.): Governance<br />
– Regieren in komplexen Regelsystemen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 17.<br />
[9] ebda., S. 25.<br />
[10] http:/ / www. zerfass. de/ ecm/<br />
[11] http:/ / newsroom. cisco. com/ dlls/ 2010/ prod_011310. html<br />
[12] http:/ / www. socialmediagovernance. eu/<br />
[13] (http:/ / blog. daimler. de/ 2010/ 04/ 21/ gastbeitrag-social-media-chancen-und-wandel-fuer-die-unternehmenskommunikation/ )Studie der<br />
Universität St. Gallen.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 272<br />
[14] (http:/ / faz-community. faz. net/ blogs/ netzkonom/ archive/ 2010/ 07/ 26/ unternehmen-und-social-media-aktionismus-statt-strategie. aspx.<br />
)Artikel in FAZ-Online.<br />
[15] (http:/ / www. socialmediagovernance. eu)Ergebnisbericht der Studie <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance 2010.<br />
[16] Hathi, Sonia (2007): Study reveals social media use. In: Strategic Communication Management, Jg. 11, H. 3, S. 9.<br />
[17] (http:/ / www. cisco. com/ web/ DE/ presse/ meld_2010/ 16-04-2010-studie_zeit. html) Studie zu <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Verboten am Arbeitsplatz.<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing (SMM) ist eine Form des Onlinemarketings, die Branding- und<br />
Marketingkommunikations-Ziele durch die Beteiligung in verschiedenen <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Angeboten erreichen will.<br />
Zudem ist es eine Komponente der integrierten Marketingkommunikation eines Unternehmens. Integrierte<br />
Marketingkommunikation ist ein Prinzip nachdem ein Unternehmen innerhalb seines Zielmarktes mit der Zielgruppe<br />
in Kontakt tritt. Es koordiniert die Elemente des Promotions-Mixes—Werbung, Direktvertrieb, Direktmarketing,<br />
Public Relations und Verkaufsförderung—mit der Zielsetzung kundenorientiert zu kommunizieren. [1]<br />
In der traditionellen Marketingkommunikation werden Inhalt, Frequenz, Timing und Kommunikationsmedium in<br />
Zusammenarbeit mit externen Agents, wie beispielsweise Agenturen, Marktforschunginstituten und/oder<br />
PR-Firmen. [2] Das Wachstum von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> hat einen großen Einfluss auf die Kommunikationsweise der<br />
Unternehmen mit ihren (potenziellen) Kunden. Seit der Entstehung des Web 2.0, bietet das Internet eine Reihe<br />
diverser Werkzeuge um soziale und wirtschaftliche Kontakte auf- und auszubauen. Zudem bietet es zahlreiche<br />
Möglichkeiten Informationen zu teilen und kollaborativ zusammenzuarbeiten. [3]<br />
Im Fokus des <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketings stehen gewöhnlich drei Bemühungen:<br />
1. Aufmerksamkeit für die Marke bzw. das Produkt generieren<br />
2. Generierung von Online-Unterhaltungen zu Unternehmensinhalten<br />
3. Animierung der Nutzer zum Teilen von Unternehmensinhalten mit ihrem Netzwerk.<br />
Ziele<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing kann u. a. bei der Erreichung der folgenden Ziele helfen:<br />
• Aufbau und Pflege eines positiven Markenimages (Reputation Management)<br />
• Steigerung der Markenbekanntheit (Brand Awareness)<br />
• Verbesserung der Besucherzahlen der Webseite<br />
• Akquise von Kunden<br />
• Weiter- und Neuentwicklung von Produkten.<br />
Da es die sozialen Medien erlauben, mit anderen nicht nur zu kommunizieren, sondern auch zu interagieren, hilft<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing dabei, die Early Adopters und die wichtigen Meinungsführer zu erreichen. Ziel des<br />
Marketings kann ein einzelnes Produkt sein, aber auch Personen – insbesondere Prominente, z. B. Politiker – nutzen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Angebote, um ihr Image zu erhöhen. [4]<br />
Vorteil des Verfolgen eines <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Marketing-Planes ist die verhältnismäßig kostengünstige Nutzung diverser<br />
Plattformen zwecks Implementierung einer Marketingkampagne. Die Unternehmen können auf diesem Weg direktes<br />
Feedback durch ihren Zielmarkt und ihre (potenziellen) Kunden erfahren.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing 273<br />
Empfehlungsmarketing<br />
Ferner ist ein Ziel, dass die Informationen von User zu User weitergeben werden und idealerweise nachhaltig positiv<br />
durch die Nutzer wahrgenommen werden, da eine ihnen vertraute Person positiv darüber berichtet. Empfehlungen<br />
durch die Endnutzer werden als glaub- und vertrauenswürdiger aufgefasst als Informationen die durch das<br />
Unternehmen bzw. eine Marke selbst verbreitet werden. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> ist inzwischen eine Plattform mit äußerst<br />
leichtem Zugang für jeden mit einem Internetzugang; ein Türöffner für Unternehmen, die ihre kundenbezogene<br />
Kommunikation forcieren möchten und ihre Markenbekanntheit steigern möchten.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit mittels <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> wird <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations genannt und ist von den<br />
Werbeaktivitäten abzugrenzen. Ein Instrument sind beispielsweise <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Releases. Gebündelt werden diese<br />
Maßnahmen häufig in einem <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Newsroom.<br />
Plattformen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing bietet Unternehmen und Individuen einen zusätzlichen Kanal für Kundenservice und<br />
dadurch die Möglichkeit neue Kunden zu gewinnen, ihren Markt zu beobachten, wie auch die Möglichkeit des<br />
Reputations Managements. Schlüsselfaktor ist hierbei stets die Relevanz für den Kunden und den Mehrwert, den er<br />
hieraus zieht.<br />
Beispiele für <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Plattformen sind u.a.<br />
• Facebook<br />
• LinkedIn<br />
• MySpace<br />
• Twitter<br />
• XING<br />
• YouTube<br />
Ziel einer <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Plattform ist es eine Basis zu bieten auf der Kunde und Unternehmen kommunizieren<br />
können. Es ist quasi das Spielfeld auf dem sich die Spieler bewegen. Eine solche Plattform ist wichtig, da sie dem<br />
Unternehmen die Möglichkeit bietet die Kundenresonanz zu bewerten und zu beobachten.<br />
Strategien<br />
Beim <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing kommen hauptsächlich die folgenden Strategien zum Einsatz [5] :<br />
• "Virale" Medien (Virales Marketing)<br />
• Communities – Aufbau einer eigenen Community beispielsweise durch einen Blog oder Forum<br />
• Monitoring<br />
• Optimierung von Inhalten (<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Optimization) – Verbesserung der Auffindbarkeit der Inhalte auf einer<br />
Webseite<br />
• Expertentum – Aufbau von Reputation als Experte auf einem Wissensgebiet<br />
• Sammeln von Informationen und Wissen<br />
• Kundenkontakt – Reine Präsenz bis hin zur intensiven Interaktion mit Usern [6]<br />
• aktuelle Nachrichten – Publikation aktueller, passender Nachrichten<br />
• Online-Reputation<br />
• Events – Schaffung des direkten Kontaktes der Community.
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing 274<br />
Chancen und Risiken<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing bietet dem Marketing von Unternehmen und Prominenten sowohl Chancen, als auch<br />
Risiken. Schnell kann kostengünstig ein breites Publikum erreicht werden und Produktnamen so insbesondere vor<br />
Markteinführungen große Aufmerksamkeit erlangen. So attraktiv <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing ist, birgt es allerdings<br />
auch die Gefahr, außer Kontrolle zu geraten, da die Meinungen im Internet nicht denen des Unternehmens<br />
entsprechen müssen. Leicht können dann negative Einstellungen im Web dem Image einer Marke oder einer Firma<br />
[7] [8] [9]<br />
schaden.<br />
Beispiele<br />
Verschiedene Unternehmen haben inzwischen den Weg in die sozialen Medien gewagt - einige erfolgreich, andere<br />
weniger erfolgreich. Der Schlüssel zum Erfolg war die Einstellung nicht als gesichtsloses Unternehmen aufzutreten.<br />
Im Rahmen des <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing erwarten Kunden Authentizität, Transparenz und vertrauenswürdigen<br />
Informationen von den Unternehmen mit denen sie eine Beziehung eingehen wollen.<br />
Best Practice<br />
Dell<br />
Dell Computer bietet mit ihrem Direct2Dell [10] -Blog eine starke Präsenz im Bereich der Weblogs. Neben der<br />
Möglichkeit für Blogger sich zu Dell-relevanten Themen zu informieren unterstützt diese Community Dell bei einer<br />
nachhaltigen Imageverbesserung. Die Anzahl negativer Blogs fiel seit dem Start der Seite von 49 % auf 22%. [11]<br />
Grund für diese positive Entwicklung ist der Umstand, dass Dell es schafft in direkten Kontakt mit ihren Kunden zu<br />
treten und ihre unmittelbaren Bedenken, Kommentare und Fragen aufzunehmen und zu berücksichtigen.<br />
Starbucks<br />
Das auf Kaffeeprodukte spezialisiertes und international tätige Einzelhandelsunternehmen Starbucks bedient eine<br />
vielzahl verschiedener <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Angebote. Zu ihnen zählen u. a. Facebook [12] , YouTube [13] , Flickr [14] ,<br />
Twitter [15] , und ihre eigenes Unternehmensblog "My Starbucks Idea" [16] . Starbucks wird als das Unternehmen mit<br />
einer der besten <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Strategien gesehen. Ihre Aktivitäten zielen auf die Bedürfnisse, Verlangen und<br />
Vorlieben ihrer Kunden ab und bestärken sowohl im Rahmen der Kundenbindung als auch im Rahmen der<br />
Kundengewinnung. [17]<br />
Worse Practice<br />
Nestlé<br />
Nestlé wird vehement durch Umweltschützer unter Beschuss genommen. Die gipfelte in einem Angriff auf Nestlé<br />
via Facebook und einen "twitstorm" auf Twitter. Darüber hinaus wurde auf YouTube ein Video veröffentlicht, das<br />
Nestlé wegen des kontinuierlichen Einsatzes von Palmöl und der Zerstörung des Regenwaldes stark kritisiert. Nestlé<br />
reagierte denkbar unglücklich auf die Kritik und bat seine Facebook-Fans nur positive Kommentare auf der<br />
[18] [19]<br />
Facebook-Wand zu hinterlassen.<br />
Wal-Mart<br />
Wal-Mart versagte seinen Kunden einen offenen Dialog. In der Angst vor negativen Kommentaren und Resonanzen<br />
beschnitten sie die Kommentarfunktion auf ihrem Blog. Ergebnis waren zahlreiche negativer Kommentare und<br />
Posts. Weiter verfolgte Wal-Mart selbst nicht ihre eigenen Kernkompetenzen. So suchte man auf der Facebook-Seite<br />
vergebens nach ihrem Slogan "Save Money. Live Better". Stattdessen fokussierte man sich auf "Fashion" und<br />
"Style". [20]
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing 275<br />
Siehe auch<br />
• Marketing<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
• Suchmaschinenoptimierung<br />
• Web 2.0<br />
Literatur<br />
• Bernhard Jodeleit, <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations: Leitfaden für erfolgreiche PR-Strategien und Öffentlichkeitsarbeit im<br />
Web 2.0, Dpunkt Verlag, 2010, ISBN 978-3-8986-4694-9<br />
• Eric Qualman, <strong>Social</strong>nomics: Wie <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Wirtschaft und Gesellschaft verändern, Mitp-Verlag, 2009, ISBN<br />
978-3-8266-9020-4<br />
• Frank Mühlenbeck und Klemens Skibicki, Verkaufsweg <strong>Social</strong> Commerce – Blogs, Podcasts, Communities – Wie<br />
man mit Web 2.0 Marketing Geld verdient, Books on Demand, 2007, ISBN 978-3-8334-9686-8<br />
• Frank Mühlenbeck und Klemens Skibicki, Community Marketing Management – Wie man Online-Communities<br />
im Internet-Zeitalter des Web 2.0 zum Erfolg führt , Books on Demand, 2008, ISBN 978-3-8334-9262-4<br />
• Tamar Weinberg, Corina Lange, Dorothea Heymann-Reder: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing: Strategien für Twitter,<br />
Facebook & Co.", O'Reilly Verlag, 2010 , ISBN 978-3-8972-1969-4<br />
• Wolfgang Hünnekens, Die Ich-Sender – Das <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>-Prinzip, 2009, ISBN 978-3-86980-005-9<br />
Weblinks<br />
• <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Leitfäden des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) [21]<br />
Referenzen<br />
[1] W. Glynn Mangold, David J. Faulds. <strong>Social</strong> media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, The Journal of the<br />
Kelley School of Business, Indiana University<br />
[2] W. Glynn Mangold, David J. Faulds. <strong>Social</strong> media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, The Journal of the<br />
Kelley School of Business, Indiana University<br />
[3] (http:/ / online. wsj. com/ article/ SB122884677205091919. html)<br />
[4] Politiker: Präsentationen in <strong>Social</strong> Networks (http:/ / www. beyond-print. de/ 2010/ 04/ 06/ wie-politiker-sich-auf-studivz-darstellen)<br />
[5] Online Marketing Strategies: Ten Ways To Promote Your Business With <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> (http:/ / www. masternewmedia. org/<br />
online_marketing/ social-media-marketing-smm-smo/ online-marketing-strategies-tools-10-ways-social-media-marketing-20070525. htm)<br />
[6] Interaktionsrate und -qualität auf Facebook-Microsites (http:/ / www. slideshare. net/ MusiolMunzingerSasserath/<br />
100519-brands-t-vandfacebookfinal)<br />
[7] Nestlé: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Desaster (http:/ / www. beyond-print. de/ 2010/ 03/ 21/ nestle-social-media-desaster-2)<br />
[8] Nestlé: Wenn Fanpages zum Kriegsschauplatz werden (http:/ / www. thomashutter. com/ index. php/ 2010/ 03/<br />
facebook-wenn-fanpages-kriegsschauplatz-werden)<br />
[9] Nestlé: der Supergau in Zahlen und Grafiken (http:/ / www. thomashutter. com/ index. php/ 2010/ 03/<br />
onlinepr-der-nestle-supergau-in-zahlen-und-grafiken)<br />
[10] http:/ / www. direct2dell. com<br />
[11] http:/ / marketingprofs. com<br />
[12] http:/ / facebook. com/ starbucks<br />
[13] http:/ / youtube. com/ starbucks<br />
[14] http:/ / flickr. com/ starbucks<br />
[15] http:/ / twitter. com/ starbucks<br />
[16] http:/ / mystarbucksidea. force. com<br />
[17] http:/ / www. dirjournal. com/ articles/ starbucks-social-media/<br />
[18] http:/ / www. allfacebook. com/ 2010/ 03/ the-facebook-nestle-mess-when-social-media-goes-anti-social/<br />
[19] http:/ / news. cnet. com/ 8301-13577_3-20000805-36. html<br />
[20] http:/ / social-media-optimization. com/ 2007/ 10/ a-failed-facebook-marketing-campaign/<br />
[21] http:/ / www. bvdw. org/ medien/ ?topic=37& type=1& year=& search=
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations 276<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations (SMR) sind <strong>Social</strong>–<strong>Media</strong>-Beziehungen, bzw. Beziehungen zu und in <strong>Social</strong> <strong>Media</strong>. SMR<br />
sind ein Teilbereich von Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Bei <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations liegt der<br />
Fokus auf der Beziehungspflege zu Multiplikatoren im Web mithilfe von <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Plattformen. [1] Des Weiteren<br />
sind SMR <strong>Social</strong> Relations (zu dt.: Soziale Beziehungen) unterzuordnen. Im Falle der <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations finden<br />
Beziehungen im Web 2.0 statt, d. h. auf und über Plattformen wie: Facebook, VZnet Netzwerke, MySpace,<br />
YouTube, Twitter, Blogs und über XING, LinkedIn. Auf diesen Plattformen treffen sich <strong>Social</strong> Communitys.<br />
Bei der Nutzung des Begriffs <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations sind zwei Aspekte zu beachten:<br />
1. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations sind (in erster Linie) Beziehungen von Personen und Communitys, die <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
nutzen, zu Unternehmen, Organisationen, Institutionen, öffentlichen Personen (z. B. Politikern, Prominenten etc.)<br />
und umgekehrt<br />
2. <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations sind auch Beziehungen von Personen, die <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> nutzen, untereinander und<br />
miteinander. Hierbei wird oft unterschieden zwischen Personen, die man bereits aus dem realen Leben kennt und<br />
Personen, die man ausschließlich aus dem Web kennt.<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations sind, wie anfangs beschrieben, die Beziehungspflege zu (relevanten) Personen bzw.<br />
Multiplikatoren im Web 2.0. Diese Multiplikatoren sind Personen, die sich im Web 2.0 aufhalten z. B. Blogger und<br />
eine hohe Reichweite haben (sogenannte Influencer). In einer Organisation o.Ä. beschäftigen sich die Bereiche<br />
Marketing, PR, Kommunikation und Human Ressources mit dem Thema <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations.<br />
Klassische Medienarbeit und <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations<br />
Genauso wie die klassische Medien- und Pressearbeit, Public Relations, sind <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations, ein Mittel der<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Sie ähneln sich untereinander. Ein grundsätzlicher Unterschied z. B. zwischen klassischer<br />
Medienarbeit und SMR ist der, dass <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations auf Interaktion mit den Rezipienten (die gleichzeitig<br />
auch Sender von Informationen, Reaktionen etc. sind) basieren und klassische Medienarbeit nicht. [2] Aus der<br />
Interaktion z. B. eines Unternehmens mit den Usern und <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Influencern können sich für das Unternehmen<br />
wertvolle Erkenntnisse ableiten lassen. Die Unternehmen können (in)direkte Reaktionen und Antworten ihrer<br />
Zielgruppe(n) erhalten, die sie dann entsprechend (auch in der klassischen Medienarbeit und anderen Bereichen wie<br />
z. B. Marketing) nutzen können.<br />
Ähnlich wie bei der klassischen Medienarbeit sind die Ziele von <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations positive<br />
PR/Öffentlichkeitsarbeit für das Unternehmen, die Organisation oder sich selbst zu schaffen. Dies wird im<br />
Gegensatz zur klassischen Medienarbeit mithilfe von sozialen Netzwerken und auf <strong>Social</strong>-<strong>Media</strong>-Plattformen, durch<br />
den Dialog mit den Usern, der Zielgruppe, die sich im Web aufhält, betrieben.<br />
Im Vergleich zu klassischen Medien sollte die Vorgehensweise hier eine andere sein. Die Etiquette weicht einer<br />
Netiquette. Im Web 2.0 ist die Tonalität zumeist informeller als bei den klassischen Medien. Zudem ist je nach<br />
Plattform die Tonalität eine andere (z. B. Facebook vs. XING). [3]
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations 277<br />
Literatur und Links<br />
• Bernhard Jodeleit: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations, dpunkt.verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-89864-694-9.<br />
• Phillippe Fabian: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations und ihre Anforderungen an Kommunikatoren. Ein Vergleich mit<br />
klassischer Medienarbeit anhand einer Befragung von Schweizer PR-Agenturen, Bachelor Arbeit: http:/ /<br />
bernetblog. ch/ wp-content/ uploads/ 2009/ 04/ 090311_bachelorarbeit_philippe-fabian. pdf<br />
• Jürgen Stüber: Websites abschalten? 27. Juli 2010 http:/ / www. welt. de/ die-welt/ wirtschaft/ webwelt/<br />
article8664451/ Websites-abschalten. html<br />
• <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Guidelines von KODAK, <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Tips http:/ / www. kodak. com/ US/ images/ en/ corp/<br />
aboutKodak/ onlineToday/ Kodak_<strong>Social</strong><strong>Media</strong>Tips_Aug14. pdf<br />
Referenzen<br />
[1] Phillippe Fabian: (http:/ / bernetblog. ch/ wp-content/ uploads/ 2009/ 04/ 090311_bachelorarbeit_philippe-fabian. pdf). <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Relations und ihre Anforderungen an Kommunikatoren. Ein Vergleich mit klassischer Medienarbeit anhand einer Befragung von Schweizer<br />
PR-Agenturen Seite 1<br />
[2] Vgl. (http:/ / bernetblog. ch/ wp-content/ uploads/ 2009/ 04/ 090311_bachelorarbeit_philippe-fabian. pdf). Phillippe Fabian: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong><br />
Relations und ihre Anforderungen an Kommunikatoren. Ein Vergleich mit klassischer Medienarbeit anhand einer Befragung von Schweizer<br />
PR-Agenturen Seite 6<br />
[3] Bernhard Jodeleit: <strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations, dpunkt.verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-89864-694-9.<br />
The Long Tail<br />
The Long Tail (englisch für „Der lange Schwanz“) ist eine auf den<br />
Arbeiten von Gladwell [1]<br />
[2] aufbauende Theorie, die der<br />
US-amerikanische Journalist und Chefredakteur des Wired Magazine<br />
Chris Anderson 2004 vorstellte, [3] [4] nach der ein Anbieter im Internet<br />
durch eine große Anzahl an Nischenprodukten Gewinn machen kann.<br />
Dieser Effekt trifft insbesondere für den Musik- und Bücherverkauf zu,<br />
wo selten verkaufte Titel in einem konventionellen Verkaufsgeschäft<br />
zu hohe Kosten verursachen würden. Der Name leitet sich von der<br />
Ähnlichkeit der Verkaufsgrafik mit einem langen Schwanz ab. Chris<br />
Anderson zeigte diesen Effekt anhand der Verkaufsstatistik des<br />
amerikanischen Online-Musikdiensts Rhapsody, bei der eine große<br />
Anzahl wenig gefragter Produkte mehr Umsatz erzielte als wenige<br />
Bestseller.<br />
Die drei Wirkungsfaktoren des Long Tail<br />
„The Long Tail“, hier gelb eingefärbt, ähnelt<br />
einem langen Schwanz. Auf der Y-Achse ist die<br />
Anzahl der Verkäufe und auf der X-Achse sind<br />
die Produkte nach Reihenfolge ihrer<br />
Verkaufsstatistik aufgelistet.<br />
Auf dem konventionellen, realen Markt sind die Kosten, um Nischen anzubieten und zu erreichen, häufig zu hoch,<br />
da die Nachfrage nach den Produkten aus den jeweiligen Nischen in einem geographisch begrenzten Gebiet zu<br />
gering ist. Global ist die Nachfrage jedoch enorm. Diese geographischen Beschränkungen gibt es im Internet nicht.<br />
Angebot und Nachfrage können sich hier auf einer virtuellen Ebene treffen, die keine realen Entfernungen kennt.<br />
Anderson hat im Detail drei Wirkungsmechanismen herausgearbeitet, die den Long Tail ermöglichen.
The Long Tail 278<br />
Demokratisierung der Produktionsmittel<br />
Indem die Produktionsmittel jedermann zu Verfügung gestellt werden, kann auch jeder etwas herstellen. Die<br />
Demokratisierung beschreibt hier vor allem die Einführung des PC, aber auch die Vermarktung z. B. von Tastaturen<br />
etc.<br />
Ein Beispiel für die Demokratisierung der Produktion ist auch Wikipedia. Die Herstellung eines Lexikons ist von<br />
einem Verlag in die Hände der Öffentlichkeit übergegangen. Allerdings zeigt Wikipedia auch, dass damit nicht<br />
zwangsläufig die Möglichkeit zum Profit verbunden ist, worum es bei "Long Tail" ja eigentlich geht.<br />
Weitere Beispiele dafür sind selbst hergestellte Musik oder Videos. Durch den Anstieg des Angebotes wird der Long<br />
Tail immer länger und facettenreicher.<br />
Demokratisierung des Vertriebes<br />
Es reicht allerdings nicht aus, nur die Herstellung der Masse zu überlassen, auch die Verteilung an sich musste<br />
demokratisiert werden. Auch hier spielt die Erfindung des PC und die Verbreitung des Internets, besonders auch des<br />
Breitband-Anschlusses, eine wichtige Rolle. Indem der Vertrieb mit Hilfe von Aggregatoren wie Ebay oder Amazon,<br />
bei denen jeder zum Anbieter werden kann, demokratisiert wird, erleichtert man den Zugang zu den eben<br />
beschriebenen hergestellten Werken und damit zu den Nischen. Und genau dieses reduziert dann auch die Kosten.<br />
Der Long Tail wird dadurch dicker.<br />
Verbindung von Angebot und Nachfrage<br />
Die dafür verantwortlichen Akteure im Internet werden von Chris Anderson auch als Filter bezeichnet.<br />
Suchmaschinen wie Google und die diversen Kunden-Empfehlungen auf Seiten wie Amazon fallen unter diesen<br />
Punkt. Diese Filter dienen dem Benutzer dafür, die von ihm begehrten Inhalte möglichst schnell und effizient zu<br />
finden. Die Suchkosten werden somit reduziert. Der daraus resultierende Effekt ist eine Umschichtung vom Anfang<br />
des Long Tail in die hinteren Bereiche.<br />
Einfluss auf Kultur und Politik<br />
Insbesondere im Bereich der Kultur kann sich der Einfluss des Long Tail stark bemerkbar machen, z. B. können<br />
verringerte Kosten für Produktion und Verbreitung von Audio- und Videoinhalten zu einem deutlich reichhaltigeren<br />
Angebot an Inhalten für kleinere Zielgruppen führen. Als Beispiele seien hier die zahllosen Spartensender (TV und<br />
Radio) genannt, die seit der Einführung der digitalen (komprimierten, bandbreitensparenden) Übertragung per<br />
Satellit und TV-Kabel, neuerdings auch per IPTV empfangbar sind. Noch stärker in diese Richtung weisen<br />
Internetportale wie YouTube, die es erstmals auch Hobbyisten ermöglichen, selbst produzierte Inhalte online<br />
weltweit verfügbar zu machen.<br />
Long Tail und virales Marketing<br />
Durch die Erkenntnisse von Chris Anderson zum Long Tail können auch Effekte auf Themen des viralen Marketings<br />
gezogen werden. Das virale Marketing beschreibt die rasante Ausbreitung eines Trends, einer Idee oder eines<br />
Phänomens ähnlich der Ausbreitung einer Epidemie. Die drei Gesetze des viralen Marketings, The Law of the few,<br />
The Stickyness Factor und The Power of Context können von den Wirkungsmechanismen des Long Tail stark<br />
beeinflusst werden. Besonders der dritte Wirkungsmechanismus bezüglich der Filter kann eine rasante Verbreitung<br />
eines Produktes, sei es nun kommerziell oder nicht, forcieren.
The Long Tail 279<br />
Kritik<br />
Inhaltliche Kritik<br />
Die Long-Tail-Theorie erfährt in der wissenschaftlichen Literatur eine weitgehend kritische Würdigung. So kommt<br />
Anita Elberse in ihrer Übersichtsarbeit [5] [6] bei der Analyse zwar zum Schluss, dass der Schwanz der Verteilung<br />
immer länger wird, gleichzeitig jedoch eine Konzentration bei den Verkaufsschlagern auftritt. Ein Problem ist die<br />
sehr geringe Verkaufszahl der Produkte im Schwanz der Verteilung: So wurden 2007 im iTunes Store 3,9 Millionen<br />
Lieder angeboten, von denen 24 % im gesamten Jahr genau einmal verkauft wurden. 91 % der angebotenen Lieder<br />
(3,6 Millionen) verkauften sich 2007 weniger als hundertmal. [5] Anderson sah sich zu einer Gegendarstellung<br />
genötigt, in der er die unterschiedlichen Definitionen der Grenze zwischen Kopf und Schwanz der Verteilung, sowie<br />
Elberses relativen Ansatz zu seiner absoluten Betrachtung der Absatzzahlen für die gegensätzlichen Ergebnisse<br />
verantwortlich machte. [7] In einer entsprechenden Antwort konnte Elberse die Vorwürfe jedoch entkräften. [8] Über<br />
die Auseinandersetzung wurde sogar in den deutschen Medien berichtet. [9]<br />
Bei einer Auswertung der Verkäufe von Videos zum privaten Gebrauch im Zeitraum von <strong>Jan</strong>uar 2000 bis August<br />
2005 konnte zwar eine Verschiebung in den Schwanz gezeigt werden, jedoch verdoppelte sich die Anzahl der<br />
Videos, von denen in einer Woche nur einige wenige verkauft wurden. Die Anzahl der Videos, von denen in einer<br />
Woche gar keine verkauft wurden, vervierfachte sich in den 5 Jahren. [10] Auch bei der Analyse der<br />
Videoverleih-Daten von Netflix für die Jahre 2000-2005 konnten die Thesen von Anderson nicht bestätigt werden.<br />
Vielmehr kam es zu einer Bestätigung des Paretoprinzips, nach dem im vorliegenden Fall 80 % der Verleihvorgänge<br />
20 % der Filmtitel betreffen. [11]<br />
Ferner postulierte Anderson einen Hunger der Massen für Produkte aus dem Schwanz der Verteilung.<br />
Suchmaschinen und automatisch generierten Produktempfehlungen können laut Anderson die nötige<br />
Übersichtlichkeit in das tiefere Sortiment bringen. Zusammengefasst lautet die Aussage, die Massen kaufen Produkte<br />
aus dem Schwanz der Verteilung, wenn nur die Markttransparenz gegeben ist. Dies ist ein klarer Widerspruch zu den<br />
weitgehend akzeptierten Regeln über Märkte: Bereits 1890 beschrieb Alfred Marshall in seinem Werk Principles of<br />
Economics stark wachsende Konzentrationsbestrebungen von Märkten mit steigender Markttransparenz. [12] Marshall<br />
betrachtet ein beschränkt verfügbares Gut (erstklassige Ölgemälde) und bildet die steigende Nachfrage über<br />
steigende Preise ab:<br />
There never was a time at which moderately good oil paintings sold more cheaply than now, and there never<br />
was a time at which first-rate paintings sold so dearly.<br />
(Noch nie gab es eine Zeit, zu der man mittelmäßige Ölgemälde so preiswert erwerben konnte wie jetzt und zu<br />
keinem Zeitpunkt wurden erstklassige Werke so teuer gehandelt).<br />
Diese Konzentrationsbewegung ist nichts anderes als eine durch Markttransparenz getriebene Umverteilung vom<br />
Schwanz in den Kopf der Verteilung. Eine entsprechende Umverteilung konnte in verschiedenen Märkten<br />
[5] [13]<br />
nachgewiesen werden.<br />
Der von Anderson propagierte Hunger der Massen für Produkte aus dem Schwanz der Verteilung konnte nicht<br />
nachgewiesen werden. Es waren vielmehr die Vielkonsumenten, die neben den häufig verkauften auch selten<br />
verlangte Produkte bestellten. Hervorzuheben ist weiterhin, dass die Zufriedenheit dieser Vielkonsumenten mit den<br />
Produkten des Schwanzes geringer war, als ihre Zufriedenheit mit den Verkaufsrennern. [5] Genau dies sind jedoch<br />
die Kernpunkte der Verhaltenstheorie von Massen, wie sie von William McPhee bereits 1963 mathematisch<br />
beschrieben wurde. [14]
The Long Tail 280<br />
Ursprung des Begriffs Long Tail<br />
Chris Anderson behauptet den Begriff Long Tail in Bezug auf die Häufigkeitsverteilung von Verkäufen eingeführt<br />
zu haben, [15] obwohl Clay Shirky ihn in seinem weit beachteten Blog Clay Shirky's Writings About the Internet<br />
bereits seit Februar 2003 genau in diesem Zusammenhang nutzte. [16] Anderson nutzte den Begriff erst in seiner<br />
Vortragsreihe Anfang 2004, die in der Veröffentlichung in Wired im Oktober 2004 mündete. [3] Unstrittig ist, dass es<br />
Anderson war, der den Begriff Long Tail popularisierte und in den alltäglichen Sprachgebrauch einführte.<br />
Literatur<br />
• Chris Anderson: The Long Tail – der lange Schwanz. Nischenprodukte statt Massenmarkt – Das Geschäft der<br />
Zukunft. 1. Auflage. Carl Hanser Verlag, München 2007 (Originaltitel: The Long Tail: Why the Future of<br />
Business is Selling Less of More), ISBN 978-3-446-40990-3, S. 287.<br />
• Originalarbeit: Chris Anderson: The Long Tail. The future of entertainment is in the millions of niche markets at<br />
the shallow end of the bitstream. In: Wired Magazine. 12, Nr. 10, The Conde Nast Publications, New York<br />
Oktober 2004, ISSN 1059-1028 [17] , S. 170-177 (hier online [18] , abgerufen am 8. August 2009).<br />
Referenzen<br />
[1] Malcom Gladwell: The Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference. 1 Auflage. Little, Brown and Company, Boston, MA<br />
2000, ISBN 0-316-31696-2.<br />
[2] Malcom Gladwell: Der Tipping Point. Wie kleine Dinge Großes bewirken können. 1. Auflage. Berlin Verlag, Berlin 2000 (Originaltitel: The<br />
Tipping Point), ISBN 3827002745.<br />
[3] Chris Anderson: The Long Tail. The future of entertainment is in the millions of niche markets at the shallow end of the bitstream. In: Wired<br />
Magazine. 12, Nr. 10, The Conde Nast Publications, New York Oktober 2004, ISSN 1059-1028 (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/<br />
CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1059-1028), S. 170-177 ( hier online (http:/ / www. wired. com/ wired/ archive/ 12. 10/ tail. html),<br />
abgerufen am 8. August 2009).<br />
[4] Chris Anderson: The Long Tail – der lange Schwanz. Nischenprodukte statt Massenmarkt – Das Geschäft der Zukunft. 1. Auflage. Carl<br />
Hanser Verlag, München 2007 (Originaltitel: The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More), ISBN 978-3-446-40990-3,<br />
S. 287.<br />
[5] Anita Elberse: Should You Invest in the Long Tail?. In: Harvard Business Review. 86, Nr. 7/8, Harvard business Publishing, Boston, MA Juli<br />
2008, ISSN 0017-8012 (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0017-8012), S. 88-96 ( (hier<br />
bestellbar) (http:/ / hbr. org/ 2008/ 07/ should-you-invest-in-the-long-tail/ ar/ 1), abgerufen am 28. März 2010).<br />
[6] Anita Elberse: Das Märchen vom Long Tail. In: Harvard Business Manager. Harvard Business Manager, Hamburg August 2008<br />
(Originaltitel: Should You Invest in the Long Tail), ISSN 0174-335X (http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA&<br />
IKT=8& TRM=0174-335X), S. 32-44 ( (hier bestellbar) (http:/ / wissen. harvardbusinessmanager. de/ wissen/ leseprobe/ 58276515/ artikel.<br />
html), abgerufen am 28. März 2010).<br />
[7] Chris Anderson: Debating the Long Tail. Juni 2008 ( hier online (http:/ / blogs. hbr. org/ cs/ 2008/ 06/ debating_the_long_tail. html),<br />
abgerufen am 25. August 2010).<br />
[8] Anita Elberse: The Long Tail Debate. A Resonse. Juli 2008 ( hier online (http:/ / blogs. hbr. org/ cs/ 2008/ 07/<br />
the_long_tail_debate_a_respons. html), abgerufen am 25. August 2010).<br />
[9] N. Hoffmann: Das Ende des Massengeschmacks. Nachrichten aus dem Netz (63). Sueddeutsche.de, 4. August 2008 ( hier online (http:/ /<br />
www. sueddeutsche. de/ kultur/ nachrichten-aus-dem-netz-das-ende-des-massengeschmacks-1. 593152), abgerufen am 25. August 2010).<br />
[10] Anita Elberse, Felix Oberholzer-Gee: Superstars and Underdogs. An Examination of the Long Tail Phenomenon in Video Sales. In:<br />
Harvard Business School Working Paper. Nr. 07-015, 2006, S. 42 ( (hier online verfügbar) (http:/ / www. people. hbs. edu/ aelberse/ papers/<br />
hbs_07-015. pdf), abgerufen am 28. März 2010).<br />
[11] Tom F. Tan, Serguei Netessine: Is Tom Cruise Threatened?. Using Netflix Prize Data to Examine the Long Tail of Electronic Commerce.<br />
September 2009 ( (hier online, Registrierung erforderlich) (http:/ / knowledge. wharton. upenn. edu/ papers/ 1361. pdf), abgerufen am<br />
28. März 2010).<br />
[12] Alfred Marshall: Principles of Economics. 1 Auflage. I, MacMillan and Co., London and New York 1890, Book VI, Chapter XIII, § 10,<br />
S. 728 ( hier online (http:/ / www. archive. org/ details/ principlesecono00marsgoog), abgerufen am 25. August 2010).<br />
[13] Robert H. Frank, Philip J. Cook: The Winner-Take-All Society. Why the Few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us. Penguin,<br />
1996, ISBN 0140259953.<br />
[14] William N. McPhee: Formal Theories of Mass Behavior. 1 Auflage. The Free Press of Glencoe, New York 1963, Natural Exposure and the<br />
Theory of Popularity, S. 103-168, insb. 126-133.
The Long Tail 281<br />
[15] Chris Anderson: The origins of "The Long Tail". 8. Mai 2005 ( hier online (http:/ / longtail. typepad. com/ the_long_tail/ 2005/ 05/<br />
the_origins_of_. html), abgerufen am 29. März 2010).<br />
[16] Clay Shirky: Power Laws, Weblogs, and Inequality. In: Clay Shirky's Writings About the Internet. 1.1 Auflage. Brooklyn, New York 8.<br />
Februar 2003 ( hier online (http:/ / www. shirky. com/ writings/ powerlaw_weblog. html), abgerufen am 29. März 2010).<br />
[17] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1059-1028<br />
[18] http:/ / www. wired. com/ wired/ archive/ 12. 10/ tail. html<br />
Creative Commons<br />
Creative Commons (englisch, ‚schöpferisches Gemeingut‘,<br />
‚Allmende‘) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die im Internet<br />
verschiedene Standard-Lizenzverträge veröffentlicht, mittels derer<br />
Autoren an ihren Werken, wie zum Beispiel Texten, Bildern,<br />
Musikstücken usw., der Öffentlichkeit Nutzungsrechte einräumen<br />
können. Anders als etwa die von der Freie-Software-Gemeinde<br />
Logo der Creative Commons<br />
bekannte GPL sind diese Lizenzen jedoch nicht auf einen einzelnen Werkstyp zugeschnitten, sondern für beliebige<br />
Werke anwendbar, deren Schutz sich aus dem Urheberrecht ableiten lässt. Ferner gibt es eine starke Abstufung der<br />
Freiheitsgrade: Von Lizenzen, die sich kaum vom völligen Vorbehalt der Rechte unterscheiden, bis hin zu Lizenzen,<br />
die das Werk in die Public Domain stellen, das heißt, bei denen auf das Urheberrecht so weit wie möglich verzichtet<br />
wird.<br />
Entwicklung<br />
Idee, Prinzip und Konzept von Creative Commons wurden 2001 in den<br />
USA entwickelt, maßgeblich von Lawrence Lessig, Rechtsprofessor an<br />
der Stanford Law School. Den traditionellen eher restriktiven<br />
Urheberrechten wird ein Modell gegenüber gestellt, das sich an den<br />
Grundwerten von Offenheit und Teilhabe orientiert. Kreativen, Kultur-<br />
und Medienschaffenden sowie Wissenschaftlern wird damit ein<br />
Werkzeug zur Verfügung gestellt, um selbst bestimmen zu können,<br />
was sie mit ihren Werken machen und wie sie diese verwerten wollen.<br />
Mit modulartigen Lizenzen unter dem Motto „some rights reserved“ –<br />
zwischen strengem Copyright „all rights reserved“ und public domain<br />
„no rights reserved“ – können Urheber bestimmen, unter welchen<br />
rechtlichen Bedingungen sie ihre Werke veröffentlichen und weiter<br />
verwendbar machen wollen.<br />
Schild an einem Lokal im spanischen Granada, in<br />
dem nur CC-lizenzierte Musik zu hören ist,<br />
Aufnahme 2006<br />
Im Rahmen der Initiative wurden mehrere Open-Content-Lizenzen entwickelt, die sich zunächst vor allem auf das<br />
Copyright der Vereinigten Staaten bezogen. Inzwischen werden jedoch auch auf andere Rechtssysteme<br />
zugeschnittene Lizenzen entwickelt. Der Stand der Anpassung an das deutsche Recht ist unter Creative Commons<br />
International: Germany dokumentiert; Legal Project Lead für den deutschen Rechtsraum sind seit Februar 2007 die<br />
Europäische EDV-Akademie des Rechts und das Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes. Public<br />
Project Lead und damit verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Communitybuilding in Deutschland ist die<br />
Berliner Agentur newthinking communications. Creative Commons Austria ist im Aufbau, ebenso Creative<br />
Commons Switzerland.<br />
Bei der Suche nach einer passenden Lizenz für Weiterverwertung konnte man sich ursprünglich drei<br />
Entscheidungsfragen stellen lassen:
Creative Commons 282<br />
• Soll die Nennung des Urhebers vorgeschrieben werden?<br />
• Ist kommerzielle Nutzung erlaubt?<br />
• Sind Veränderungen erlaubt? Wenn ja, nur bei der Verwendung derselben Lizenz?<br />
Daraus ergaben sich zwölf Lizenzmöglichkeiten. Antwortete man mit „nein“ auf die erste Frage und auf die zweite<br />
und dritte mit „ja“, so gibt man sein Werk in die Public Domain. Antwortet man auf die erste und zweite Frage mit<br />
„ja“ und auf die dritte mit „nur bei Verwendung derselben Lizenz“, erhält man etwas sehr Ähnliches zur GPL.<br />
Die Frage nach der Nennung des Urhebers wurde mit der Version 2.0 der Lizenzen abgeschafft – die Nennung ist<br />
jetzt immer Pflicht.<br />
Die Rechte-Module<br />
Icon Kurzform Name des Moduls Erklärung (stark verkürzt)<br />
by Namensnennung Der Name des Autors muss genannt werden.<br />
nc Nicht kommerziell (Non-Commercial) Das Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden, womit nach<br />
EU-Recht auch der Verkauf zum Selbstkostenpreis verboten wird.<br />
nd Keine Bearbeitung (No Derivatives) Das Werk darf nicht verändert werden.<br />
sa Weitergabe unter gleichen<br />
Bedingungen (Share Alike)<br />
Die sechs aktuellen Lizenzen<br />
Das Werk muss nach Veränderungen unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.<br />
Icons Kurzform Bedeutung Lizenzbedingungen<br />
by Namensnennung<br />
by-sa Namensnennung, Weitergabe unter gleichen<br />
Bedingungen<br />
(ähnlich zur GFDL, allerdings derzeit noch inkompatibel)<br />
by-nd Namensnennung, keine Bearbeitung<br />
by-nc Namensnennung, nicht kommerziell<br />
by-nc-sa Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter<br />
gleichen Bedingungen<br />
by-nc-nd Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung<br />
Music Sharing License<br />
(unported)<br />
Version 3.0 [1]<br />
Version 3.0 [3]<br />
Version 3.0 [5]<br />
Version 3.0 [7]<br />
Version 3.0 [9]<br />
Version 3.0 [11]<br />
Lizenzbedingungen<br />
Version 3.0 [2]<br />
Version 3.0 [4]<br />
Version 3.0 [6]<br />
Version 3.0 [8]<br />
(Deutschland)<br />
Version 3.0 [10]<br />
Version 3.0 [12]<br />
Die Music-Sharing-Lizenz ist keine eigenständige Lizenz, sondern lediglich eine andere, auf der CC-Webpräsenz<br />
inzwischen nicht mehr verwendete Bezeichnung für die by-nc-nd-Lizenz. Sie gestattet dem Nutzer, die vom Urheber<br />
derart lizenzierte Musik herunterzuladen, zu tauschen und über Webcasting zu verbreiten, jedoch nicht den Verkauf,<br />
die Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung. Die Bezeichnung „Music Sharing License“ ist dabei irreführend.<br />
Obgleich durch sie der Eindruck erweckt wird, diese Lizenz sei die einzig mögliche bzw. empfohlene CC-Lizenz für<br />
musikalische Inhalte, sind selbstverständlich auch andere, weniger restriktive CC-Lizenzen anwendbar. So finden<br />
beispielsweise auf der Internet-Musikplattform Jamendo alle sechs aktuellen Lizenzen Anwendung. Zum anderen<br />
kann diese Lizenz natürlich auch für andere Arten von Inhalten verwendet werden.
Creative Commons 283<br />
Neuere Lizenzen<br />
Icons Kurzform Bedeutung Lizenzbedingungen<br />
Sampling Plus Namensnennung, abgeleitete Werke nur in Form von Sampling oder Mashups<br />
NonCommercial Sampling<br />
Plus<br />
Sampling-Lizenzen<br />
erlaubt<br />
Namensnennung, abgeleitete Werke nur in Form von Sampling oder Mashups<br />
erlaubt, nicht kommerziell<br />
Version 1.0 [13]<br />
Version 1.0 [14]<br />
Die Sampling-Lizenzen (angepasst für die Vereinigten Staaten und Brasilien) wurden in Zusammenarbeit mit<br />
Gilberto Gil, Minister für Kultur in Brasilien und bekannter Musiker, entwickelt.<br />
Die Nutzung zu Werbezwecken wird von allen drei Varianten ausgeschlossen.<br />
Ältere Lizenzen<br />
In neueren Lizenzen ist eine Namensnennung (cc-by) zwingend notwendig. In älteren Lizenzen (Version 1.0) war<br />
das noch nicht so. Weiter wurden die Lizenzen eingestellt, die nicht-kommerzielle Kopien verbieten. Dazu gehören<br />
die Sampling und die DevNations Lizenz.<br />
Diese Lizenzen sind weiterhin gültig. Neue Werke sollten jedoch nicht mehr unter diesen Lizenzen lizenziert<br />
werden. [15]<br />
Icons Kurzform Bedeutung Lizenzbedingungen Grund für die Einstellung<br />
nd Keine Bearbeitung<br />
nd-nc keine Bearbeitung, nicht kommerziell<br />
nc Nicht kommerziell<br />
nc-sa Nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen<br />
sa Weitergabe unter gleichen Bedingungen (ähnlich zur GPL,<br />
allerdings inkompatibel)<br />
DevNations Namensnennung erforderlich, gilt nur in Entwicklungsländern<br />
Sampling Namensnennung erforderlich, verbietet Vervielfältigen des<br />
Werkes. Wiederverwendung von Teilen des Werkes (bei Film<br />
oder Musik) oder als Teil eines neuen Werkes (bei Bildern)<br />
erlaubt<br />
Version 1.0 [16] keine Nachfrage<br />
Version 1.0 [17] keine Nachfrage<br />
Version 1.0 [18] keine Nachfrage<br />
Version 1.0 [19] keine Nachfrage<br />
Version 1.0 [20] keine Nachfrage<br />
Version 2.0 [21] keine Nachfrage, erlaubt keine<br />
globale nicht-kommerzielle<br />
Vervielfältigung<br />
Version 1.0 [22] keine Nachfrage, erlaubt keine<br />
globale nicht-kommerzielle<br />
Vervielfältigung
Creative Commons 284<br />
Entwicklungsländer<br />
Die neueste Lizenz ist die „Developing Nations License“, welche Entwicklungsländern Veränderungen und<br />
Verarbeitungen (Derivate) jeder Art erlaubt. Entwicklungsländer sind in diesem Zusammenhang solche, die von der<br />
Weltbank nicht als „high-income economy“ eingestuft werden. Benutzer aus Industriestaaten sind von diesen<br />
Rechten ausgeschlossen, ihnen steht nur das Leserecht zu. Diese Lizenz wurde jedoch mittlerweile wieder<br />
eingestellt.<br />
Lizenzbedingungen<br />
Die Lizenzbedingungen der gewählten Creative-Commons-Lizenz werden in drei Dokumenten bereitgestellt:<br />
• Kurzversion für Laien, welche die maßgeblichen Grundgedanken der „Version für Juristen“ enthält (international<br />
gleich). Eine Laienversion gibt es deswegen, damit ein normaler Benutzer prägnant den rechtmäßigen Rahmen<br />
seiner Nutzung schnell erfassen kann. Nicht jedem Benutzer einer Tauschbörse ist es zuzumuten, sich durch einen<br />
Rechtsanwalt beraten zu lassen. Allein rechtlich maßgeblich ist jedoch die „Langversion“.<br />
• Langversion der Lizenz, als juristischer Volltext. Diese Juristen-Version ist allein maßgebend und entsprechend<br />
auf die nationalen Rechtsordnungen (Vereinigte Staaten, Deutschland, Frankreich etc.) angepasst. Alle auf die<br />
jeweiligen staatlichen Rechtssysteme angepasste Versionen werden jedoch von den gleichen Grundgedanken<br />
getragen. Diese sind in der Kurzversion zusammengefasst. Folglich ist die Kurzversion immer gleich, egal welche<br />
Staatsversion gilt.<br />
• Metadaten im RDF-Format, sodass die Lizenz von Suchmaschinen erkannt wird (international gleich).<br />
Es wird ein Set von verschiedenen CC-Lizenzen bereitgestellt:<br />
1. Die Lizenz gilt für ein bestimmtes Werk. Dadurch kann auf die spezifischen Besonderheiten des Werks<br />
(Homepage, also Text; Audio, Video, Bild) eingegangen werden. Die Lizenz ist damit sicherer, kann rechtlich<br />
nicht so leicht angegriffen werden.<br />
2. Die Lizenz ist auf ein bestimmtes Rechtssystem angepasst. Ist das Werk amerikanisch, so wird die amerikanische<br />
Version angewandt. Ist das Werk deutsch, so wird das deutsche Recht angewandt. Alle staatlichen Versionen der<br />
gleichen Lizenz werden vom gleichen Inhalt getragen. Diese sind unter anderem Veränderbarkeit, Erlaubnis der<br />
kommerziellen Nutzung oder nicht, etc. Dieses Vorgehen ist nötig, da es kein weltweit einheitliches Urheberrecht<br />
gibt.<br />
3. Die Lizenz ist abgestuft. Je nachdem, was der Urheber freigeben will, ist die Lizenz ausgestaltet. Beispielsweise<br />
könnte der Urheber etwas dagegen haben, dass sein Buch von einem fremden Verlag millionenfach verkauft wird,<br />
ohne dass er auch nur einen Cent vom Verlag erhält. Dann kann er per Lizenz die kommerzielle Nutzung seines<br />
Werks ausschließen.<br />
(Inter-)Nationalisierung<br />
Da das Urheberrecht in vielen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird, existieren für viele CC-Lizenzen auf<br />
das lokale Rechtssystem zugeschnittene Versionen.<br />
Seit dem 4. Juni 2004 existieren Lizenzversionen für Brasilien, am 11. Juni und 18. Juni folgten Umsetzungen für<br />
Deutschland und die Niederlande. Die deutschen Creative-Commons-Lizenzen in der Version 3.0 sind am 24. Juli<br />
2008 erschienen. [23] Österreichische Lizenzen sind ebenfalls seit 2004 und in der Version 3.0 seit August 2008<br />
verfügbar. Seit dem 26. Mai 2006 ist auch eine Schweizer Version der CC-Lizenzen (in der Version 2.5) verfügbar.
Creative Commons 285<br />
Projekte<br />
BBC-Archiv<br />
Das derzeit größte Projekt unter Verwendung einer CC-Lizenz plant die BBC mit einem riesigen Filmarchiv –<br />
Creative Archive, das online zugänglich gemacht werden soll. Das Archiv gibt es inzwischen, aber noch ohne<br />
BBC-Inhalte. Dabei hilft Lessig beim Entwickeln des Lizenzgerüsts: Britische Fernsehgebührenzahler werden die<br />
Filme im nicht-kommerziellen Rahmen bearbeiten und weiterverteilen dürfen. [24]<br />
Open Choice<br />
Durch den Umbruch der Open-Access-Initiative, der freien Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten im Internet,<br />
bietet der Springer-Verlag seinen Autoren die Möglichkeit ihre Werke gegen eine Pauschale von 3000 Dollar im<br />
Volltext freizuschalten und unter eine CC-Lizenz zu stellen. [25]<br />
Sonderlizenzen- Erklärungen<br />
CC Plus<br />
CC+ ist ein Protokoll, das die Erteilung von zusätzlichen Rechten, die über die<br />
Creative-Commons-Lizenz hinausgehen, maschinell abhandeln kann. Das Projekt soll<br />
den Einsatz von Creative-Commons-Lizenzen im kommerziellen Bereich erleichtern.<br />
Eine Möglichkeit wäre die kommerzielle Nutzung eines nur für nicht-kommerziellen<br />
Nutzen freigegebenen Werks oder eine Implementierung des Street Performer Protocols.<br />
CC+ benutzt ccRel, ein etabliertes Verfahren zur Kennzeichnung von CC-lizenziertem Inhalt.<br />
CC Zero<br />
CC+ Lizenzfeld<br />
CC0 ist ein Protokoll zum Veröffentlichen von gemeinfreien Werken. Anwender sollen prüfen können, ob ein Werk<br />
gemeinfrei ist, oder können ihre eigenen Werke in die Gemeinfreiheit überführen. Wenn dieses rechtlich nicht<br />
möglich ist, soll CC0 eine Creative-Commons-Lizenz ohne die bei den anderen aktuellen<br />
Creative-Commons-Lizenzen üblichen Lizenzbedingungen (z.B. BY, SA, ND, NC) sein [26] . Die Version 1.0 wurde<br />
im März 2009 vorgestellt. Zuvor befand sich das Projekt seit dem 16. <strong>Jan</strong>uar 2008 in der Beta-Phase. [27] Es ersetzt<br />
die „Public Domain Dedication and Certification“. Lizenzbedingungen: CC0 1.0 Universal [28]<br />
Founders’ Copyright<br />
Neben den Lizenzen stellt Creative Commons eine besondere Möglichkeit des amerikanischen Rechts zur<br />
Verfügung: Das sogenannte „Founders’ Copyright" (gilt nur für die amerikanische CC-Lizenz). Es ist ein noch<br />
anwendbares US-Copyright der Vereinigten Staaten von 1790. Daraus folgt eine Wirkungsdauer von 14 Jahren, die<br />
um nochmals 14 Jahre verlängert werden kann. Dann gilt das Werk als gemeinfrei.<br />
Zum Vergleich: Das heutige Urheberrecht gilt lebenslang plus 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Des Weiteren gibt<br />
es in den Vereinigten Staaten für Firmen die Möglichkeit, ein Copyright über 95 Jahre zu besitzen. [29]
Creative Commons 286<br />
Auszeichnungen<br />
• Creative Commons wurde 2004 beim Prix Ars Electronica mit der Goldenen Nica in der Kategorie „Net Vision“<br />
ausgezeichnet.<br />
Kritik und Probleme<br />
Es gibt einige Kritikpunkte, aber auch Vorurteile an Lizenzen des Creative-Commons-Projektes:<br />
• Laien-Kurzfassung reicht zum Verständnis nicht aus. Um die gewährten Rechte (zum Beispiel Veränderung,<br />
Weitergabe) des Werks umfassend verstehen zu können, bedarf es weiterer Lektüre, die dann viele Benutzer nicht<br />
mehr wahrnehmen.<br />
• Fehlende Verträglichkeit zu anderen Copyleft-Lizenzen: Problem ist hierbei die Klausel, dass veränderte<br />
Versionen nur unter derselben Lizenz (ggf. unter jeweils höherer aktueller Version der Lizenz) veröffentlicht<br />
werden dürfen. Dieses Verfahren nennt sich üblicherweise „Copyleft“ (in CC-Terminologie jedoch „Share Alike“)<br />
und dient dazu, die Freiheit veränderter Versionen zu bewahren. Hat man jedoch zwei Werke unter verschiedenen<br />
Copyleft-Lizenzen (etwa GNU GPL und Creative Commons), so ist es unmöglich, diese Werke zu etwas Neuem<br />
zu rekombinieren und das Resultat rechtmäßig zu verbreiten. Jede Lizenz für sich beansprucht ihre alleinige<br />
Geltung und schließt die andere Lizenz aus. Eine mögliche Lösung wäre, dass der Bearbeiter, der die beiden<br />
Werke zusammenführt, ein Wahlrecht hat, welche der alternativen Lizenzen gelten soll. Jedoch sind GNU FDL<br />
und CC in ihrem Anwendungsbereich nicht deckungsgleich. GNU FDL schließt bestimmte Rechte aus, die in CC<br />
eingeschlossen sind und umgekehrt.<br />
• Verträglichkeitsprobleme auch innerhalb von Creative Commons: Beim „Share-Alike“-Attribut (sa) kann es auch<br />
innerhalb von Creative-Commons-Projekten zu Problemen kommen, wenn gewisse verwendete Inhalte<br />
kommerzielle Nutzung nicht ausschließen (also etwa „by-sa“), aber das Gesamtprojekt kommerzielle Nutzung<br />
ausschließt (oder umgekehrt), denn „Share Alike“ impliziert, dass jeweils exakt dieselben Attribute für das<br />
Endprodukt auch wieder gelten. Inhalte die „by-sa“ bzw. „by-nc-sa“ sind, lassen sich somit nicht einfach mischen.<br />
• No Derived Work nicht trivial zu verstehen: Obwohl schon für nicht mit Creative Commons getaggte Musik, eine<br />
gewisse Meinung herrscht, dass diese im Sinne der Schaffung eines neuen Gesamtwerkes, für die Vertonung von<br />
Filmen unter gewissen Umständen nutzbar sein kann, schließt das „No-Derived-Work“-Attribut (nd) diese Rechte<br />
explizit aus. Eine Unterscheidung zwischen dem Modifizieren des Liedes und der Verwendung für die Vertonung<br />
von Filmen ist durch Creative-Commons-Attribute dabei nur bei Nutzung der Sampling-Lizenzen möglich, die<br />
aber für Musikstücke so gut wie nicht verwendet wird, sondern vor allem bei „Klängen“ und „Soundsamples“<br />
verbreitet ist, die als Einzelfragmente etwa zur Schaffung von Klanglandschaften dienen können.<br />
• Die Free Software Foundation erkennt CC-BY 2.0 und CC-BY-SA 2.0 als freie Lizenz (für andere Werke als<br />
Software oder dessen Dokumentation) an. [30] Jedoch wurde das Projekt von Richard Stallman heftig kritisiert, da<br />
Lizenzen veröffentlicht wurden, die keine globale nicht-kommerzielle Vervielfältigung zuließen (CC-Sampling,<br />
CC-DevNations). [31] Creative Commons stellte daraufhin die in Frage kommenden Lizenzen ein. [32]<br />
Urteile<br />
Adam Curry, ein Pionier des Podcasting, veröffentlichte in der Webcommunity Flickr Fotos seiner Familie unter der<br />
Lizenz „Non-commercial Share Alike (by-nc-sa)“ (nur nichtkommerzielle Zwecke). Das niederländische<br />
Boulevardmagazin Weekend verwendete die Fotos für einen Bericht über Currys fünfzehnjährige Tochter. Am 9.<br />
März 2006 erkannte ein Gericht in Amsterdam eine Urheberrechtsverletzung und verurteilte das Magazin bei<br />
weiteren Verstößen zu einer Geldstrafe von 1000 Euro je Bild, zu zahlen an Curry. [33] Obwohl die Strafe relativ<br />
gering ausfiel, wurde erstmals die Gültigkeit von Creative Commons bestätigt (LJN: AV4204, Rechtbank<br />
Amsterdam, 334492 / KG 06-176 S).
Creative Commons 287<br />
Ein weiteres Urteil wurde in Spanien gefällt. Dort hatte die spanische Verwertungsgesellschaft Sociedad General de<br />
Autores y Editores gegen einen Barbesitzer geklagt. Da dieser aber nur Musik spielte, die unter CC-Lizenz stand,<br />
bekam er Recht. [34] Die Rechte der Verwertungsgesellschaften erstrecken sich daher nicht auf nicht-proprietäre<br />
Inhalte.<br />
Im August 2008 bestätigte das United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) Verstöße gegen die<br />
Bedingungen freier Lizenzen als Urheberrechtsverletzung (Jacobsen vs. Katzer, JMRI Project license). [35]<br />
Neben den Urheberrechten sind zusätzlich noch das Recht am eigenen Bild sowie weitere nicht-urheberrechtliche<br />
Schutzrechte zu prüfen. [36] .<br />
Siehe auch<br />
• Jamendo<br />
• Netlabel<br />
• Freie Inhalte<br />
Literatur<br />
• Erik Möller: »Freiheit mit Fallstricken: Creative-Commons-NC-Lizenzen und ihre Folgen« [37]<br />
• Markus Eidenberger, Andreas Ortner: Kreativität in Fesseln: Wie Urheberrecht Kreativität behindert und doch mit<br />
seinen eigenen Waffen geschlagen werden kann. In: Leonhard Dobusch, Christian Forsterleitner (Hrsg.): Freie<br />
Netze. Freies Wissen., Echomedia: Wien, 2007, ISBN 3-901761-64-0 unter Creative Commons Lizenz; Beitrag<br />
als PDF-Datei: zum Herunterladen [38] (enthält u. a. Interview mit Lawrence Lessig).<br />
• Reto Mantz: Open Access-Lizenzen und Rechtsübertragung bei Open Access-Werken (PDF-Datei, 560 KB) [39]<br />
(u. a. Kommentierung der CC-Lizenzen).<br />
• Reto Mantz: Creative Commons-Lizenzen im Spiegel internationaler Gerichtsverfahren, GRUR International<br />
2008, S. 20<br />
Weblinks<br />
• Creative-Commons-Webseite [40] (Suche [41] )<br />
• Creative Commons Deutschland [42]<br />
• Creative Commons Österreich [43]<br />
• Creative Commons Schweiz [44]<br />
• Standpunkt der Free Software Foundation [45]<br />
• CC-Lizenzen Informationswissenschaft Universität Konstanz [46] Nutzung von CC-Lizenzen in<br />
wissenschaftlichen Dokumenten<br />
• „Creative Commons einfach erklärt“, 4teilige Serie bei Advisign [47]<br />
• dreiteiliger Podcast von law-podcasting.de zum Thema "Creative Commons License" aus rechtlicher Sicht Teil 1<br />
[48] , Teil 2 [49] , Teil 3 [50]
Creative Commons 288<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by/ 3. 0/ deed. de<br />
[2] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by/ 3. 0/ de/<br />
[3] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ deed. de<br />
[4] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ de/<br />
[5] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nd/ 3. 0/ deed. de<br />
[6] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nd/ 3. 0/ de/<br />
[7] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc/ 3. 0/ deed. de<br />
[8] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc/ 3. 0/ de/<br />
[9] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-sa/ 3. 0/ deed. de<br />
[10] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-sa/ 3. 0/ de/<br />
[11] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-nd/ 3. 0/ deed. de<br />
[12] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-nd/ 3. 0/ de/<br />
[13] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ sampling+ / 1. 0/ deed. de<br />
[14] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ nc-sampling+ / 1. 0/ deed. de<br />
[15] offiziell als Eingestellt geltende CC Lizenzen (http:/ / creativecommons. org/ retiredlicenses) (englisch)<br />
[16] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ nd/ 1. 0/ deed. de<br />
[17] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ nd-nc/ 1. 0/<br />
[18] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ nc/ 1. 0/<br />
[19] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ nc-sa/ 1. 0/<br />
[20] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ sa/ 1. 0/<br />
[21] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ devnations/ 2. 0/<br />
[22] http:/ / creativecommons. org/ licenses/ sampling/ 1. 0/<br />
[23] de.creativecommons.org: Deutsche Creative Commons-Lizenzen in Version 3.0 verfügbar (http:/ / de. creativecommons. org/<br />
deutsche-creative-commons-lizenzen-in-version-30-verfugbar/ )<br />
[24] (http:/ / creativearchive. bbc. co. uk)<br />
[25] „Springer Open Choice License“ (http:/ / www. springer. com/ dal/ home/ open+ choice?SGWID=1-40359-12-161193-0) (by-nc 2.5)<br />
[26] http:/ / de. creativecommons. org/ neu-im-programm-cc0/<br />
[27] Öffentliche Diskussion über CC Zero (http:/ / creativecommons. org/ weblog/ entry/ 7978)<br />
[28] http:/ / creativecommons. org/ publicdomain/ zero/ 1. 0/ deed. de<br />
[29] Founders’ Copyright (http:/ / creativecommons. org/ projects/ founderscopyright/ )<br />
[30] Erklärung der FSF für die Lizenzierung von anderen Werken als Software oder Dokumentation (http:/ / www. gnu. org/ licenses/ license-list.<br />
html#OtherLicenses)<br />
[31] Free Software Foundation blog (http:/ / www. fsf. org/ blogs/ rms/ entry-20050920. html)<br />
[32] http:/ / creativecommons. org/ weblog/ entry/ 7520<br />
[33] Weblogkommentar (http:/ / curry. podshow. com/ ?p=49)<br />
[34] Artikel auf Deutsch und Urteil auf Spanisch (http:/ / www. fspa. de/ 2006/ cc-lizenzen-erneut-vor-gericht-bestatigt-diesmal-in-spanien/ )<br />
[35] ROBERT JACOBSEN v.MATTHEW KATZER and KAMIND ASSOCIATES, INC. (doing business as KAM Industries) (http:/ / www.<br />
cafc. uscourts. gov/ opinions/ 08-1001. pdf) (PDF), United States Court of Appeals for the Federal Circuit<br />
[36] Kommerzielle Verwendung von Flickr-Bildern (http:/ / www. rechtzweinull. de/ index. php?/ archives/<br />
38-Kommerzielle-Verwertung-von-FLICKR-Bildern. html)<br />
[37] http:/ / www. opensourcejahrbuch. de/ download/ jb2006/ chapter_06/ osjb2006-06-01-moeller<br />
[38] http:/ / www. freienetze. at/ pdfs/ fnfw-kapitel2. pdf<br />
[39] http:/ / www. retosphere. de/ php/ download. php?fileId=5<br />
[40] http:/ / creativecommons. org/<br />
[41] http:/ / labs. creativecommons. org/ demos/ search/ search2/<br />
[42] http:/ / de. creativecommons. org/<br />
[43] http:/ / creativecommons. at/<br />
[44] http:/ / www. creativecommons. ch/<br />
[45] http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ license-list. html#OtherLicenses<br />
[46] http:/ / www. inf-wiss. uni-konstanz. de/ People/ JB/ index. html<br />
[47] http:/ / www. advisign. de/ urheberrecht/ 2007-09/ creative-commons-einfach-erklaert-teil-1-sinn-und-zweck-von-creative-commons<br />
[48] http:/ / www. law-podcasting. de/ die-creative-commons-license-teil-1<br />
[49] http:/ / www. law-podcasting. de/ die-creative-commons-license-teil-2<br />
[50] http:/ / www. law-podcasting. de/ die-creative-commons-license-teil-3
Komplexes System<br />
Organisation qua Internet<br />
Komplexe Systeme sind Systeme, welche sich der Vereinfachung verwehren und vielschichtig bleiben.<br />
Insbesondere gehören hierzu die komplexen adaptiven Systeme, die imstande sind, sich an ihre Umgebung<br />
anzupassen. Ihre Analyse ist Sache der Komplexitätstheorie (englisch complexity theory) bzw. Systemtheorie, die<br />
aber von der Komplexitätstheorie im informatischen Sinn abzugrenzen ist.<br />
Eigenschaften<br />
Komplexe Systeme zeigen eine Reihe von Eigenschaften (Auswahl):<br />
1. Agentenbasiert: Komplexe Systeme bestehen aus einzelnen Teilen, die miteinander in Wechselwirkung stehen<br />
(Moleküle, Individuen, Software Agenten, etc.).<br />
2. Nichtlinearität: Kleine Störungen des Systems oder minimale Unterschiede in den Anfangsbedingungen führen<br />
rasch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen (Schmetterlingseffekt, Phasenübergänge). Die Wirkzusammenhänge<br />
der Systemkomponenten sind im allgemeinen nichtlinear.<br />
3. Emergenz: Im Gegensatz zu lediglich komplizierten Systemen zeigen komplexe Systeme Emergenz. Entgegen<br />
einer verbreiteten Vereinfachung bedeutet Emergenz nicht, dass die Eigenschaften der emergierenden<br />
Systemebenen von den darunter liegenden Ebenen vollständig unabhängig sind. Emergente Eigenschaften lassen<br />
sich jedoch auch nicht aus der isolierten Analyse des Verhaltens einzelner Systemkomponenten erklären.<br />
4. Wechselwirkung (Interaktion): Die Wechselwirkungen zwischen den Teilen des Systems<br />
(Systemkomponenten) sind lokal, ihre Auswirkungen in der Regel global.<br />
5. Offenes System: Komplexe Systeme sind üblicherweise offene Systeme. Sie stehen also im Kontakt mit ihrer<br />
Umgebung und befinden sich fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Das bedeutet, dass sie von einem<br />
permanenten Durchfluss von Energie bzw. Materie abhängen.<br />
6. Selbstorganisation: Dies ermöglicht die Bildung insgesamt stabiler Strukturen (Selbststabilisierung oder<br />
Homöostase), die ihrerseits das thermodynamische Ungleichgewicht aufrechterhalten. Sie sind dabei in der Lage,<br />
Informationen zu verarbeiten bzw. zu lernen.<br />
7. Selbstregulation: Dadurch können sie die Fähigkeit zur inneren Harmonisierung entwickeln. Sie sind also in der<br />
Lage, aufgrund der Informationen und derer Verarbeitung das innere Gleichgewicht und Balance zu verstärken.<br />
8. Pfade: Komplexe Systeme zeigen Pfadabhängigkeit: Ihr zeitliches Verhalten ist nicht nur vom aktuellen Zustand,<br />
sondern auch von der Vorgeschichte des Systems abhängig.<br />
9. Attraktoren: Die meisten komplexen Systeme weisen so genannte Attraktoren auf, d. h. dass das System<br />
unabhängig von seinen Anfangsbedingungen bestimmte Zustände oder Zustandsabfolgen anstrebt, wobei diese<br />
Zustandsabfolgen auch chaotisch sein können; dies sind die "seltsamen Attraktoren" der Chaostheorie.<br />
Beispiel<br />
Das Gehirn des Menschen ist ein Beispiel für ein komplexes System, da es aus untereinander vielfach verknüpften<br />
Bausteinen, den Neuronen, und weiteren Begleitzellen, deren Funktion weitgehend unbekannt ist, aufgebaut ist.<br />
Bewusstsein ist eventuell ein emergentes Phänomen des menschlichen Gehirns. Es muss hier allerdings<br />
unterschieden werden zwischen Bewusstsein an sich (als Medium im ontologischen Sinne) und<br />
Bewusstseinsinhalten als Informationen, die sich innerhalb des ontologischen Mediums 'Bewusstsein' manifestieren.<br />
Weitere, v.a. aus dem Alltag bekannte, (hoch-)komplexe Systeme sind z.B. das Internet, Finanzmärkte,<br />
289
Komplexes System 290<br />
multinationale Konzerne, aber eben auch das menschliche Nervensystem, der Mensch selbst, Infrastrukturnetze und<br />
dergleichen.<br />
Bekannte Forscher<br />
• Ludwig von Bertalanffy<br />
• Jay Wright Forrester<br />
• Brian Goodwin<br />
• John Holland<br />
• Stuart Kauffman<br />
• Christopher Langton<br />
• Niklas Luhmann<br />
• Fredmund Malik<br />
• Bernhard von Mutius<br />
Bedeutende Institute zur Erforschung komplexer Systeme<br />
• Institute for Scientific Interchange in Turin.<br />
• Santa Fe Institute in New Mexico.<br />
• Center for the Study of Complex Systems [1] an der University of Michigan<br />
Einrichtungen in Deutschland<br />
• Arbeitsgruppe Komplexe Systeme [2] in Darmstadt<br />
• Arbeitsgruppe Komplexe Systeme [3] in Bremen<br />
• Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden.<br />
• Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg.<br />
Literatur<br />
• Bar-Yam, Yaneer: Dynamics of Complex Systems (Studies in Nonlinearity), Westwing Press, o.O. 2003, ISBN<br />
0-813-34121-3 (in Englisch, siehe auch Weblinks)<br />
• Hermann Haken, Günter Schiepek: Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten.<br />
Verlag Hogrefe, Göttingen 2006, ISBN 3-8017-1686-4<br />
• Klaus Mainzer: Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, Springer Verlag, 1999,<br />
ISBN 3-54-065329-5<br />
• Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. Introduction to <strong>Social</strong> Macrodynamics: Compact Macromodels of the<br />
World System Growth. [4] Moscow: URSS, 2006. ISBN 5-484-00414-4 [5] (in Englisch).<br />
• Lewin, Roger: Die Komplexitäts-Theorie, Hoffmann & Campe, 1993 (Allgemeinverständlich geschriebene<br />
Geschichte des jungen Wissenschaftszweiges)<br />
• Malik, Fredmund: Strategie des Managements komplexer Systeme - Ein Beitrag zur Managementkybernetik<br />
evolutionärer Systeme, 1. A. Bern 1984, 8. A. Bern 2003<br />
• Mutius, Bernhard von (Hrsg.): Die andere Intelligenz. Wie wir morgen denken werden, Klett-Cotta, Stuttgart<br />
2004, ISBN 3-608-94085-5<br />
• Pruckner, Maria: Die Komplexitätsfalle, Wie sich Komplexität auf den Menschen auswirkt: vom<br />
Informationsmangel bis zum Zusammenbruch, Books on Demand, Norderstedt 2005, ISBN 3-8334-3153-9<br />
• Reither, Franz: Komplexitätsmanagement. Denken und Handeln in komplexen Situationen, Gerling Akademie<br />
Verlag, München 1997, ISBN 3-9803352-6-7<br />
• Schuh, Günter: Produktkomplexität managen Strategien - Methoden - Tools, Carl Hanser Verlag, München,<br />
August 2001, 274 Seiten, ISBN 3-446-40043-5
Komplexes System 291<br />
• Schuh, Günter: Komplexität und Agilität, Springer-Verlag, 1997, 340 Seiten, ISBN 3-540-63099-6<br />
• Waldrop, M.Mitchell: Inseln im Chaos. Die Erforschung komplexer Systeme, Rowohlt Verlag, Reinbek bei<br />
Hamburg, Februar 1996, 480 S., ISBN 3-499-19990-4<br />
Weblinks<br />
• Significant Points in the Study of Complex Systems [6] von Yaneer Bar-Yam [7] , in Englisch<br />
• Dynamics of Complex Systems (Studies in Nonlinearity) [8] von Yaneer Bar-Yam [7] , in Englisch, Eingangsseite,<br />
von der aus das gesamte Werk im pdf-Format heruntergeladen werden kann<br />
• Drei Beispiele für komplexe Systeme, bzw. deren Anwendung von Yaneer Bar-Yam (englisch): HIV-Infektion<br />
[9] , Medizinisches Management [10] , Sport und Komplexität [11]<br />
• Modelling Complex Socio-Technical Systems using Morphological Analysis [12] From the Swedish<br />
Morphological Society [13] (PDF-Datei; 396 kB)<br />
Siehe auch<br />
• Selbstorganisation<br />
• Komplexität<br />
• Chaostheorie<br />
• Komplexe Adaptive Systeme<br />
• Nichtlineare Systeme<br />
• System<br />
• Systemeigenschaften<br />
• Theoretische Biologie<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. cscs. umich. edu/ index. html<br />
[2] http:/ / www. fkp. tu-darmstadt. de<br />
[3] http:/ / www. itp. uni-bremen. de/ complex/<br />
[4] http:/ / cliodynamics. ru/ index. php?option=com_content& task=view& id=124& Itemid=70<br />
[5] http:/ / urss. ru/ cgi-bin/ db. pl?cp=& lang=en& blang=en& list=14& page=Book& id=34250<br />
[6] http:/ / necsi. org/ projects/ yaneer/ points. html<br />
[7] http:/ / necsi. org/ faculty/ bar-yam. html<br />
[8] http:/ / necsi. org/ publications/ dcs/ index. html<br />
[9] http:/ / necsi. org/ guide/ examples/ hiv. html<br />
[10] http:/ / necsi. org/ guide/ examples/ er. html<br />
[11] http:/ / necsi. org/ guide/ examples/ sports. html<br />
[12] http:/ / www. swemorph. com/ pdf/ it-webart. pdf<br />
[13] http:/ / www. swemorph. com
Systemtheorie (Luhmann) 292<br />
Systemtheorie (Luhmann)<br />
Die Systemtheorie nach Niklas Luhmann ist eine philosophisch-soziologische Kommunikationstheorie mit<br />
universalem Anspruch, mit der die Gesellschaft als komplexes System von Kommunikationen beschrieben und<br />
erklärt werden soll. Kommunikationen sind dabei die Operationen, die diverse soziale Systeme der Gesellschaft<br />
entstehen lassen, vergehen lassen, erhalten, beenden, ausdifferenzieren, interpenetrieren und durch strukturelle<br />
Koppelung verbinden. Nach seinem Einführungsband Soziale Systeme arbeitete Luhmann seine Systemtheorie durch<br />
mehrere Bände zu bedeutenden Systemen der Gesellschaft aus - beispielsweise zur Politik und zum Recht. In<br />
zahlreichen Aufsätzen verdichtete er seine in dem Einführungsband dargelegten, theoretischen Erklärungsmodelle.<br />
Zugang zur Theorie Luhmanns<br />
1969 gab Luhmann bei seiner Aufnahme in die neu gegründete Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld<br />
als sein Forschungsprojekt an: „Theorie der Gesellschaft; Laufzeit: 30 Jahre; Kosten: keine.“ [1] 28 Jahre nach dieser<br />
Antragsstellung (1997) veröffentlichte er sein Werk Die Gesellschaft der Gesellschaft, das als umfassende Theorie<br />
der Gesellschaft angesehen werden kann, und starb wenig später (1998).<br />
Differenz von System und Umwelt statt Differenz von Teil und Ganzem<br />
Verbreitete Vorstellungen von Systemen betreffen Einzelteile, die zu einem Ganzen verbunden werden oder sich<br />
selbst zu einem Ganzen verbinden. Eine Gesellschaft besteht demnach aus einzelnen Menschen und ihren<br />
Beziehungen. Diese Vorstellungen stammen teilweise aus der Antike. Gesellschaftliche Prozesse wie die Entstehung<br />
oder Organisation wurden mit sozialen oder göttlichen Mächten erklärt. [2]<br />
An die zentralen soziologischen Fragen der Entstehung und Organisation von Gesellschaften geht die soziologische<br />
Systemtheorie grundsätzlich anders heran. Auf höchster Abstraktionsstufe geht Luhmann von einem Geschehen aus,<br />
das sich auf sich selbst bezieht (in Luhmanns Worten: Operationen, die aneinander anschließen). Durch diesen<br />
Selbstbezug entsteht eine Grenze. Mit der Bildung dieser Grenze durch Operationen entstehen System und<br />
(systemspezifische) Umwelt gleichermaßen. Diese Differenz System/Umwelt liegt der gesamten Systemtheorie<br />
zugrunde.<br />
Abgrenzung vom Handeln als zentralem Begriff<br />
Handeln im allgemein verstandenen Sinn (soziologische Handlungstheorie) ist kein Begriff der Systemtheorie. Auch<br />
„der Mensch“ kommt nicht begrifflich darin vor. Systemtheoretisch gesehen bestehen organische, psychische und<br />
soziale Systeme, die durch ihre systemspezifischen Operationen entstehen und sich aufrecht erhalten.<br />
Begriffe wie Kommunizieren und Beobachten sind demnach nicht als Handeln und auch nicht als „menschlich“ zu<br />
verstehen. Handelnde Menschen können zwar beobachtet werden; dass handelnde und kommunizierende Menschen<br />
in sozialen Wirklichkeiten vorkommen, wird von der Systemtheorie keineswegs ausgeschlossen. Solche<br />
Beobachtungen werden aber als Operationen von (z. B. psychischen) Systemen erklärt. Das heißt: Menschen können<br />
als Beobachtungen vorkommen, nicht aber begrifflich, sie sind keine Elemente der Theorie, mit der Luhmann die<br />
Gesellschaft erklärt. Das Gleiche gilt für Kommunikation als Begriff der Systemtheorie. „Kommunikation als<br />
soziales Handeln“ wäre eine Beobachtung, die innerhalb von Systemen geschieht. Als solche wäre sie kein Element<br />
der Erklärung in der soziologischen Systemtheorie.
Systemtheorie (Luhmann) 293<br />
Erkenntnistheoretische Voraussetzungen<br />
Luhmann schließt sich den zu seiner Zeit besonders diskutierten Grundannahmen der konstruktivistischen<br />
Denkweise an. Wirklichkeit wird darin als Resultat eines Konstruktionsprozesses angesehen, der voll und ganz auf<br />
die eigenen Bedingungen des Erkennens zurückgeführt wird und nicht auf die Bedingungen einer<br />
erkenntnisunabhängigen „Realität“. Erkenntnisprozesse werden angestoßen, aber sie stehen auch dann unter eigenen,<br />
z. B. körperlichen Bedingungen. Auch die Unterscheidung, ob dieser Anstoß von „innen“ oder „außen“ kommt, wird<br />
nachträglich gemacht und steht wie alles andere auch unter den eigenen Bedingungen. Eine vom Erkenntnisprozess<br />
unabhängige „Realität“, von der alle Erkenntnis ausgelöst wird und auf die alle Erkenntnis gerichtet sei, wird im<br />
Konstruktivismus nicht als Bestandteil von Erklärungen und Theorien verwendet. Statt dessen wird dem Begriff des<br />
Beobachters, der seine Wirklichkeiten konstruiert, eine besondere Bedeutung beigemessen.<br />
Luhmann bedient sich indes einer erkenntnistheoretischen Setzung, indem er sagt, „dass es Systeme gibt“. [3] Diese<br />
Setzung kann als ontologisch aufgefasst werden, also als Behauptung eines erkenntnisunabhängigen Fixpunkts, auf<br />
den Luhmann seine Theorie bezieht. Die Annahme, dass für den Beobachter keine erkenntnisunabhängige<br />
Wirklichkeit vorhanden sei, fußt demnach bei Luhmann auf einer Aussage, mit der Erkenntnisunabhängiges<br />
behauptet wird: „Es gibt Systeme“.<br />
Autopoiesis<br />
Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist die Übernahme des Konzepts der Autopoiesis von den chilenischen<br />
Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela. Autopoiesis heißt übersetzt „Selbstherstellung“. Maturana<br />
und Varela bezogen dies auf organische Prozesse und meinten damit, dass Systeme sich mit Hilfe ihrer eigenen<br />
Elemente selbst herstellen. Lebewesen sind die ursprünglichen Beispiele für autopoietische Systeme. Für den<br />
Beobachter ereignet sich Leben von selbst, ohne dass ein äußerer herstellender Prozess eingreift.<br />
Luhmann überträgt dieses Konzept auf Systeme, die er als „sinnkonstituierende Systeme“ beschreibt; das umfasst<br />
psychische und soziale Systeme. Das heißt: Auch psychische Systeme (synonym: Bewusstseine) und soziale<br />
Systeme reproduzieren sich selbst mit Hilfe ihrer systemeigenen Operationen.<br />
Geschlossenheit der Operationen<br />
Luhmann versteht unter Operation die Reproduktion eines Elements eines autopoietischen Systems mit Hilfe der<br />
Elemente desselben Systems. [4] Ein System entsteht und erhält sich dadurch, dass Operationen aneinander<br />
anschließen. [5] Wenn organische Prozesse als Operationen aneinander anschließen, entsteht ein organisches System.<br />
Wenn Gedanken als Operationen aneinander anschließen, entsteht ein psychisches System (auch:<br />
„Bewusstseinssystem“). Wenn Kommunikationen als Operationen aneinander anschließen, entsteht ein soziales<br />
System (auch: „Kommunikationssystem“).<br />
Ein System besteht so lange, wie Operationen jeweils nächste gleichartige Operation ermöglichen. Operationen<br />
müssen anschlussfähig sein. Wie eine Operation abläuft, hängt von der jeweils vorangegangenen Operation ab.<br />
Dadurch werden diese Systeme als operational geschlossen aufgefasst. Beispiel psychisches System (Bewusstsein):<br />
Gedanken schließen sich an Gedanken an. Systemfremde Operationen können sich nicht anschließen: In der Logik<br />
der operationalen Geschlossenheit können sich an Gedanken keine organischen Operationen anschließen.<br />
Abstraktionsniveau<br />
Mit einer alltäglichen Vorstellung von handelnden Menschen, die durch ihre Beziehungen Systeme bilden, ist kein<br />
Zugang zur Systemtheorie Luhmanns zu finden. Es entstehen sofort unauflösbare Widersprüche der Sätze Luhmanns<br />
zu den allgemein verstandenen Auffassungen. Eine Annäherung kann dagegen gelingen, wenn die Ebene der<br />
Begriffe und Erklärungen (theoretische Ebene) und die Ebenen der Beobachtung (Empirie) auseinander gehalten<br />
werden. Dazu gehört, die Sätze Luhmanns nicht sofort auf alltägliche Erfahrungen zu beziehen und sich zunächst<br />
auch auf das höchst abstrakte Niveau der Begriffe einzulassen.
Systemtheorie (Luhmann) 294<br />
Soziale Systeme<br />
Luhmann erläuterte das, was er unter sozialen Systemen versteht, einmal mit den folgenden Worten:<br />
„Ein soziales System kommt zustande, wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang<br />
entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale<br />
Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus<br />
Kommunikationen.“ [6]<br />
Kommunikation als Operation sozialer Systeme<br />
Der Kommunikationsbegriff bei Luhmann beruht auf der These der absoluten Geschlossenheit der Systeme in Bezug<br />
auf die systemeigenen Operationen. Die Operationen der psychischen Systeme – das wären die Gedanken der<br />
Bewusstseine – können das sich produzierende System niemals verlassen. Folglich können sie nicht in die<br />
Kommunikation eingehen und zu einem Bestandteil des Kommunikationsprozesses werden. Dies wird durch das<br />
Diktum Luhmanns beschrieben: „Der Mensch kann nicht kommunizieren; nur die Kommunikation kann<br />
kommunizieren.“ [7]<br />
Kommunikation verläuft nach Luhmann über eine generalisierende Verwendung bestimmter Medien, die dadurch<br />
einen symbolischen Gehalt bekommen. Beispielsweise fungieren Macht, Geld, Liebe, Kunst und Wahrheit als solche<br />
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien. [8]<br />
Ein systemspezifischer Code fungiert dabei als Leitunterscheidung aller systemspezifischen Kommunikationen und<br />
macht sie als systemzugehörig erkennbar. Im Wirtschaftssystem erhöht die Leitunterscheidung Zahlen/nicht Zahlen<br />
die Wahrscheinlichkeit, dass auf jede Zahlung eine neue erfolgt – dies wäre ein Beispiel für den Anschluss einer<br />
systemspezifischen Kommunikation an eine andere. (Kommunikation ist hier nicht als menschliche Handlung, gar<br />
als Sprachhandlung, anzusehen.) Dies funktioniert über das generalisierte Kommunikationsmedium Geld, das die<br />
letzte Zahlung mit der jetzigen verknüpft. Würde das Geld nicht mehr als Kommunikationsmedium akzeptiert, hätte<br />
das betreffende Wirtschaftssystem seine Anschlussfähigkeit verloren.<br />
Die Anschlussfähigkeit innerhalb eines Systems wird als Selbstreferenz bezeichnet – im Gegensatz zum<br />
fremdreferentiellen Bezug auf die Umwelt (Welt, andere Systeme).<br />
Soziale Systeme als sinnverarbeitende Systeme<br />
Soziale Systeme sind sinnverarbeitende Systeme. „Sinn“ ist nach Luhmann die Bezeichnung für die Art und Weise,<br />
in der soziale (und psychische) Systeme Komplexität reduzieren. Die Grenze eines sozialen Systems markiert somit<br />
ein Komplexitätsgefälle von der Umwelt zum sozialen System. Soziale Systeme sind die komplexesten Systeme, die<br />
Systemtheorien behandeln können. In einem sozialen System entsteht durch die Reduktion von Komplexität im<br />
Vergleich zur Umwelt eine höhere Ordnung mit weniger Möglichkeiten. Durch die Reduktion von Komplexität<br />
vermitteln soziale Systeme zwischen der unbestimmten Weltkomplexität und der<br />
Komplexitätsverarbeitungskapazität psychischer Systeme.<br />
Typen sozialer Systeme<br />
Luhmann unterscheidet drei Typen sozialer Systeme: [9] Interaktionen, Organisationen und Gesellschaften.<br />
Funktionale Ausdifferenzierung<br />
Jedes Gesellschaftssystem grenzt sich mit Hilfe eines zweiwertigen (binären) Codes von der Umwelt ab und hält auf<br />
diese Weise den Prozess der Selbstreproduktion aufrecht. Dies sind in der Wirtschaft: zahlen/nicht-zahlen; in der<br />
Politik: Macht/keine Macht; in der Religion: Immanenz/Transzendenz; im Rechtssystem: Recht/Unrecht; im<br />
Wissenschaftssystem: wahr/unwahr; in den (Massen-)Medien: Information/Nichtinformation u. a.
Systemtheorie (Luhmann) 295<br />
Kritik<br />
Viele Beiträge der kritischen Diskussion beziehen sich auf die Abgrenzung vom Handeln als Begriff in einer<br />
soziologischen Systemtheorie. Dabei wird die Frage gestellt, was eine soziologische Theorie nützt, die keine<br />
Begriffe für handelnde Menschen bereitstellt. Luhmann und seine Befürworter sehen jedoch diesen Zugang ohne<br />
handelnde Menschen als das Neue und Weiterführende in der Theoriebildung über Gesellschaften an.<br />
Die Verbindung von (theoretischer) Erklärung und den beobachteten Phänomenen ist ein weiterer Gegenstand der<br />
Kritik. Die Kritiker sehen in der universellen Anwendbarkeit den Grund für die Nutzlosigkeit der neuen<br />
systemtheoretischen Erklärungen für konkrete praktische Probleme. Luhmann und seine Befürworter sehen die<br />
umfassende Anwendbarkeit der neuen Systemtheorie als eine Stärke an. Demnach lässt sich mit Hilfe dieser Theorie<br />
tatsächlich alles erklären, was als gesellschaftlich bezeichnet werden kann.<br />
Die Systemtheorie nach Luhmann ist auch aufgrund ihres hohen begrifflichen Abstraktionsniveaus umstritten. Sie<br />
stelle eher eine Begriffssammlung als ein Theoriegebäude dar: "Hinter der Fassade ungeheurer Schwierigkeit und<br />
einem komplizierten Räderwerk artistischer Begrifflichkeit steckt lediglich eine Handvoll simpler Sätze: Die Welt ist<br />
kompliziert, alles ist mit allem verbunden, der Mensch erträgt nur ein begrenztes Maß an Kompliziertheit". [10] Dabei<br />
bestehe weder eine präzise und allgemein akzeptierte Definition des funktionalistischen Systembegriffs, noch gebe<br />
es über die Lösung der vier Problembereiche gemäß AGIL-Schema bei Parsons hinaus explizite Hypothesen.<br />
Dadurch, dass der Anspruch der Systemtheorie lediglich darin bestehe, funktional-strukturelle Beschreibungen zu<br />
liefern, folge auch ihr Selbstverständnis als nicht 'kritische', bzw. nicht am Ideal des Humanismus ausgerichtete<br />
Theorie. Bekannt ist in diesem Zusammenhang Luhmanns Kontroverse mit Jürgen Habermas.<br />
Außerdem wird der Systemtheorie eine versteckte Teleologie zum Vorwurf gemacht: Indem die Zielorientierung<br />
eines Subsystems zur Erhaltung des gesamten Systems als positive Funktion gewertet wird, geschieht eine versteckte<br />
Wertung und eine Legitimation des gesellschaftlichen Status quo. Bereits Robert K. Merton hatte von latenten<br />
(verborgenen) und manifesten (expliziten) Funktionen eines Systems gesprochen und somit die funktionale Einheit<br />
eines Systems zurückgewiesen.<br />
Da Systeme jeweils nach eigenen Gesetzmäßigkeiten arbeiten, hält Luhmann Eingriffs- bzw. Steuerungsversuche<br />
eines Systems in ein anderes grundsätzlich für problematisch: Die Wirtschaft kann etwa von der Politik nur sehr<br />
bedingt gesteuert werden oder auch umgekehrt. Das Gesetz der Autopoiesis setzt laut Luhmann den Bemühungen<br />
einer rationalen, ethischen, gerechten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse enge Grenzen – daher gilt<br />
Luhmann etwa im Vergleich zu Jürgen Habermas oder Ulrich Beck als politisch ausgesprochen konservativ. Dies ist<br />
umstritten, denn hier wird die Person anhand ihrer Theorie bewertet. Der hier wertende Begriff „konservativ“ setzt<br />
darüber hinaus die Begriffswelt der Handlungstheorie voraus.<br />
Weiterentwicklung<br />
Luhmanns Systemtheorie wird vor allem in Deutschland und Italien rezipiert. An der Weiterentwicklung der<br />
soziologischen Systemtheorie arbeiten in Deutschland vor allem die Soziologie-Professoren und Schüler Luhmanns<br />
Rudolf Stichweh, Peter Fuchs, Dirk Baecker, Elena Esposito, Armin Nassehi und André Kieserling.<br />
Weiterführende Artikel<br />
• Differenz (Systemtheorie)<br />
• Funktionale Differenzierung<br />
• Kommunikation (soziologische Systemtheorie) • Strukturelle Kopplung<br />
• Kontingenz (Soziologie)<br />
• Resonanz (Luhmann)<br />
• Soziale Systeme (1984)
Systemtheorie (Luhmann) 296<br />
Literatur<br />
chronologisch<br />
Primärliteratur<br />
• Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984, neue Auflage 2001, ISBN<br />
3518282662.<br />
• Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde., Frankfurt 1997, ISBN 351858247X.<br />
• Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 3. Auflage 2004, VS Verlag für Sozialwissenschaften,<br />
Wiesbaden 1996.<br />
Sekundärliteratur<br />
Einführungen<br />
• Helmut Willke: Systemtheorie. Eine Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer Systeme. 4.überarb.<br />
Aufl. Stuttgart, 1993.<br />
• Claudio Baraldi/Giancarlo Corsi/Elena Esposito: GLU, Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme.<br />
Frankfurt/Main 1999.<br />
• Detlef Krause: Luhmann-Lexikon, Stuttgart 2001.<br />
• Walter Reese-Schäfer: Niklas Luhmann zur Einführung. 4. Auflage. Junius, Hamburg 2001, ISBN 3-88506-305-0<br />
(Zur Einführung, Bd. 205).<br />
• Margot Berghaus: Luhmann leicht gemacht. Köln/Weimar/Wien 2003.<br />
• Christian Schuldt: Systemtheorie. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2003 (2. Aufl. 2006).<br />
• Niklas Luhmann, Dirk Baecker: Einführung in die Systemtheorie. 2004 ISBN 3896704591.<br />
• Georg Kneer, Armin Nassehi: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung. 1993 (4. Aufl. 2004),<br />
ISBN 3825217515.<br />
• Michael Gerth, Luhmann für Einsteiger. Multimediale Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann.<br />
Software [11], 2005.<br />
Kritische Diskussion<br />
• Hans Haferkamp, Michael Schmid (Hrsg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu<br />
Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am Main 1987.<br />
• Peter-Ulrich Merz-Benz, Gerhard Wagner (Hrsg.): Die Logik der Systeme. Zur Kritik der systemtheoretischen<br />
Soziologie Niklas Luhmanns. Konstanz 2000.<br />
• Alex Demirovic (Hrsg.): Komplexität und Emanzipation. Kritische Gesellschaftstheorie und die Herausforderung<br />
der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Münster 2001.<br />
• Hans-Joachim Giegel, Uwe Schimank (Hrsg.): Beobachter der Moderne – Beiträge zu Niklas Luhmanns „Die<br />
Gesellschaft der Gesellschaft“. Frankfurt am Main 2003.<br />
• Dirk Martin: Überkomplexe Gesellschaft. Eine Kritik der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Münster 2009.
Systemtheorie (Luhmann) 297<br />
Sonstiges<br />
• Andreas Metzner: Probleme sozio-ökologischer Systemtheorie – Natur und Gesellschaft in der Soziologie<br />
Luhmanns. Westdeutscher Verlag, Opladen 1993, ISBN 978-3531124711 (Volltext) [12] .<br />
• Andreas Göbel: Theoriegenese als Problemgenese: Eine problemgeschichtliche Rekonstruktion der<br />
soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns. Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 2000 (Univ. Diss., Essen<br />
1999), ISBN 3-87940-702-9.<br />
• Dirk Baecker: Wozu Systeme?. Berlin 2002, ISBN 3931659232.<br />
• Thomas Latka: Topisches Sozialsystem. Heidelberg 2003, ISBN 3896703218.<br />
• Gralf-Peter Calliess, Systemtheorie Luhmann / Teubner. In: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano, Neue Theorien<br />
des Rechts, ISBN 3825227448.<br />
Weblinks<br />
• Tabellarische Übersicht: Steuerungsmedien auf der Ebene des sozialen Systems [13]<br />
• Linksammlung von vielen präsenten Texten und Enzyklopädien aus der Systemtheorie [14]<br />
• Einführung in die Systemtheorie - Vorlesung von Niklas Luhmann als kostenloses 14-teiliges mp3-Archiv [15]<br />
Referenzen<br />
[1] Vorwort zu seinem letzten Werk: Die Gesellschaft der Gesellschaft (Luhmann 1998, S. 11; Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1360).<br />
[2] Vgl. Soziale Systeme, 1984, S. 20 f.<br />
[3] Soziale Systeme, 1984, S. 30<br />
[4] Soziale Systeme (1984), S. 79; Claudio Baraldi; Giancarlo Corsi; Elena Esposito: GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer<br />
Systeme, Frankfurt am Main 1999, S. 123 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1226).<br />
[5] Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1992, S. 271 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1001)<br />
[6] Luhmann, Ökologische Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1. Auflage 1986. ISBN 3-531-11775-0, 1986, S. 269.<br />
[7] Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1990, Seite 31.<br />
[8] In „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ legt Luhmann die am weitesten ausgearbeitete Theorie der Kommunikationsmedien vor.<br />
[9] Soziale Systeme, 1987, S. 16<br />
[10] Dirk Käsler, zitiert in Kunczik/Zipfel 2005: 84<br />
[11] http:/ / www. luhmann-online. de/<br />
[12] http:/ / sammelpunkt. philo. at:8080/ 1812/<br />
[13] http:/ / www. tu-harburg. de/ rzt/ rzt/ it/ sofie/ Steuerungsmedien. html<br />
[14] http:/ / wollumination. piranho. com/ linkliste. htm<br />
[15] http:/ / www. kickasstorrents. com/ luhmann-einfuehrung-in-die-systemtheorie-pb-t652909. html
Kommunikation (soziologische Systemtheorie) 298<br />
Kommunikation (soziologische Systemtheorie)<br />
Der Begriff Kommunikation beschreibt in der soziologischen Systemtheorie nach Niklas Luhmann eine Operation,<br />
die soziale Systeme erzeugt und erhält. Dieser Kommunikationsbegriff beschreibt etwas anderes als dasjenige, das<br />
allgemein unter „Kommunikation“ verstanden wird. Dies gilt insbesondere für die Vorstellung von Kommunikation<br />
als gemeinschaftlichem Handeln und auch für die Beschreibung von Kommunikation als Informationsübertragung.<br />
Kommunikation ist bei Luhmann eine Einheit aus den Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen. Diese<br />
Einheit stellt ein soziales System her und erhält sie aufrecht, so lange wie die Kommunikation anschlussfähig bleibt<br />
und weitere Kommunikationen folgen. Der Kommunikationsbegriff basiert auf der These der operationalen<br />
Geschlossenheit der Systeme. Kommunikation als Einheit dreier Selektionen verläuft gleichzeitig, aber operational<br />
getrennt von psychischen Systemen. Soziale und psychische Systeme sind durch strukturelle Kopplung miteinander<br />
verbunden.<br />
Kommunikation als autopoietische Operation<br />
Lebende, psychische und soziale Systeme werden in der soziologischen Systemtheorie nach Luhmann als<br />
autopoietisch (selbstherstellend) und operational geschlossen angesehen. Durch die operationale Schließung der<br />
autopoietischen Operation „Gedanken“ und „Kommunikation“ entstehen soziale Systeme und zugleich psychische<br />
Systeme (Bewusstseine) als Umwelten sozialer Systeme. [1]<br />
„Operationale Schließung“ bedeutet, dass keine Operation das System verlassen kann, das durch diese Operation<br />
entsteht. [2] Die Operation, die psychische Systeme (im weiten Sinne: Bewusstsein) entstehen lässt und<br />
aufrechterhält, ist als „Gedanken“ bezeichnet. Gedanken schließen an Gedanken an und erzeugen auf diese Weise das<br />
psychische System. Kein Gedanke verlässt das Bewusstsein, das durch ihn mit gebildet wird. Die Operation, die<br />
soziale Systeme entstehen lässt und aufrecht erhält, ist als „Kommunikation“ bezeichnet. Kommunikationen<br />
schließen an Kommunikationen an und erzeugen auf diese Weise das soziale System. Keine Kommunikation verlässt<br />
das soziale System, das durch sie gebildet wird. [3]<br />
In der These der operationalen Geschlossenheit ist die Abgrenzung zum Übertragungsmodell der Kommunikation<br />
begründet. [4]<br />
Kommunikation kann nicht in einzelnen Bewusstseinen entstehen oder durch Bewusstseinsoperationen erklärt<br />
werden. Luhmann formuliert dies an einer Stelle so: „Alle Begriffe, mit denen Kommunikation beschrieben wird,<br />
müssen daher aus jeder psychischen Systemreferenz herausgelöst und lediglich auf den selbstreferentiellen Prozeß<br />
der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation bezogen werden.“ [5]
Kommunikation (soziologische Systemtheorie) 299<br />
Kommunikation als Einheit von Information, Mitteilung und Verstehen<br />
Kommunikation fungiert als Synthese dreier Selektionen, als Einheit<br />
von Information, Mitteilung und Verstehen. [6] Es handelt sich dabei um<br />
Selektionen aus einer unbestimmten Menge von Möglichkeiten: Die<br />
Tatsache, dass mitgeteilt wird, ist eine Selektion (es hätte auch eine<br />
andere oder keine Mitteilung geschehen können); Die Information, die<br />
in Kommunikation entsteht, unterscheidet dieses und schließt im<br />
Moment der Kommunikation alles andere aus; Verstehen ist eine<br />
Selektion in dem Sinne, dass auch anders hätte verstanden werden<br />
können, und dass dadurch eine bestimmte Möglichkeit des Anschlusses<br />
weiterer Kommunikationen selektiert und andere ausgeschlossen<br />
werden. [7] Die Selektion einer bestimmten Mitteilung, die auf einer<br />
Seite stattfindet, führt zu einer Selektion eines bestimmten Verstehens<br />
auf einer anderen Seite. Aus beidem zusammen entsteht für das<br />
kommunizierende System Information als selektive Unterscheidung<br />
Die Trias aus Mitteilung, Information und<br />
Verstehen bestimmen den<br />
Kommunikationsprozess<br />
von Information und Mitteilung. Es wird etwas verstanden, und es wird zugleich damit von der Tatsache<br />
unterschieden, dass dieses Etwas mitgeteilt wurde. Die Operation Kommunikation führt so auf der Basis von<br />
einzelnen Selektionen zweier Seiten zu einer komplexeren, sich selbst stabilisierenden neuen Gesamtsituation, die<br />
als neues emergentes System gesehen wird.<br />
Kommunikation ist eine Einheit, die Mitteilen, Information und Verstehen auf mehreren Seiten einschließt.<br />
Kommunikation beginnt deshalb logisch mit dem Verstehen und nicht, wie oft angenommen wird, mit einer<br />
Mitteilung. Deshalb bezeichnet Luhmann in seinen Erläuterungen den Adressaten einer Mitteilung, durch dessen<br />
Selektionen Kommunikation als Einheit entsteht, als „Ego“ und den Mitteilenden als „Alter“. [8] Dieses Verstehen –<br />
als selektive Aktualisierung einer Differenz von Mitteilung und Information – ist etwas anderes als ein psychisches<br />
Verstehen. Verstehen innerhalb der Operation Kommunikation heißt: Eine Mitteilung und eine Information werden<br />
unterschieden und zugeschrieben. Verstehen heißt nicht, die Gefühle, Motivationen, Gedanken des Anderen zu<br />
erfassen. [9]<br />
Luhmann bezieht sich mit der Dreiteilung auf die drei Funktionen des sprachlichen Zeichens im Organon-Modell<br />
Karl Bühlers sowie auf die Typologie der Sprechakte bei Austin und Searle. Luhmann bezieht das, was Bühler als<br />
die Darstellungsfunktion der Sprache bezeichnete, auf die Selektivität der Information, die Ausdrucksfunktion auf<br />
die Selektion der Mitteilung und die Appellfunktion auf die Erwartung, dass verstanden wird und sich weitere<br />
Kommunikationen anschließen können („die Erwartung einer Annahmeselektion“). [10]<br />
Die Operation Kommunikation weist drei Merkmale auf: Anschluss, Auswahl und Fehlerkorrektur. Die weitere<br />
Prüfung, Bestätigung oder Korrektur der Operation Kommunikation kann nur durch sich autopoietisch anschließende<br />
kommunikative Operationen geschehen. Kommunikation stabilisiert sich einerseits im Wechselspiel gegenseitiger<br />
Erwartungen und erweitert sich andererseits fortlaufend durch die so geschaffenen Möglichkeiten weiterer<br />
Bezugnahmen. Sie ist bedroht durch inadäquate, falsche, ungewollte Selektionen und grenzt sich, wenn sie<br />
erfolgreich ist, gegen diese ab.<br />
Als Einheit einer Differenz − durch den Einbezug des abstrakten Beobachtungsbegriffs – wird Kommunikation für<br />
Luhmann zu einer selbstbeobachtenden Operation. [11]
Kommunikation (soziologische Systemtheorie) 300<br />
Kommunikationsmedien zur Reduktion von Unwahrscheinlichkeit<br />
Von einem evolutionären Standpunkt aus gesehen ist für Luhmann das Zustandekommen von Kommunikation<br />
unwahrscheinlich. Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation entsteht durch eine doppelte Kontingenz.<br />
Kontingenz bedeutet, dass etwas möglich, aber nicht notwendig ist. Doppelte Kontingenz bedeutet, dass (a) auf<br />
beiden Seiten (b) in Bezug auf die eine und die andere Seite eine Kontingenz besteht.<br />
Die Unwahrscheinlichkeit des Entstehens der Operation Kommunikation bezieht sich auf das Folgende:<br />
1. Verstehen – der Vollzug der Einheit der Kommunikation<br />
2. Erreichen des Adressaten<br />
3. Erfolg – Akzeptanz und Annahme der Mitteilung, sowie der Anschluss weiterer Kommunikationen<br />
Die Gesellschaft hat Einrichtungen geschaffen, um die Unwahrscheinlichkeit zu vermindern: die Medien.<br />
1. Das Medium Sprache reduziert die Unwahrscheinlichkeit des Verstehens.<br />
2. Die Medien der Verbreitung reduzieren die Unwahrscheinlichkeit, den Adressaten zu erreichen.<br />
3. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien reduzieren die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs.<br />
Literatur<br />
Primärliteratur<br />
• Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. - Frankfurt am Main : Suhrkamp.<br />
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 666). Seite 193 ff.<br />
• Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. - Frankfurt am Main : Suhrkamp. (Suhrkamp-Taschenbuch<br />
Wissenschaft ; 1360). Seite 81 ff.<br />
• Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie / Niklas Luhmann. Dirk Baecker (Hrsg.). - 1. Aufl. -<br />
Heidelberg : Carl-Auer-Systeme-Verl., 2002. Seite 288 ff.<br />
Sekundärliteratur<br />
• Baraldi, Claudio: GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme / von Claudio Baraldi ; Giancarlo<br />
Corsi ; Elena Esposito. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ;<br />
1226). Seite 89-93.<br />
Referenzen<br />
[1] Die Umwelt des Systems und die Umwelt, die ein Beobachter vom System unterscheidet, sind nicht unbedingt identisch; Luhmann bezieht<br />
sich hier auf Jakob von Uexküll, vgl. Einführung, S. 83.<br />
[2] Vgl. Baraldi, Claudio: GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme / von Claudio Baraldi ; Giancarlo Corsi ; Elena<br />
Esposito. - 1. Auflage. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1226), S. 195.<br />
[3] Vgl. Einführung in die Systemtheorie (2002), S. 78; vgl. GLU, S. 123 ff; S. 142 f.; S. 176 f.<br />
[4] Vgl. Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie / Niklas Luhmann. Dirk Baecker (Hrsg.). - 1. Aufl. - Heidelberg :<br />
Carl-Auer-Systeme-Verl., 2002, S. 288 ff.; Soziale Systeme, 1984, S. 193 f.<br />
[5] Luhmann, Niklas: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1990, Seite 24<br />
[6] Soziale Systeme, 1984, S. 203.<br />
[7] Vgl. Baraldi / Corsi / Esposito: GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, 1997, S. 89 f.<br />
[8] Soziale Systeme, 1984, S. 195 f.<br />
[9] Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1990, Seite 25; Vgl. Baraldi / Corsi / Esposito: GLU : Glossar zu Niklas Luhmanns<br />
Theorie sozialer Systeme, 1997, S. 90<br />
[10] Soziale Systeme, 1984, S. 196 f.; Einführung in die Systemtheorie, 2002, S. 292<br />
[11] Luhmann sieht Information, Mitteilung und Verstehen als „unit act“ an und grenzt sich dadurch von der Sprechakttheorie und von der<br />
Normativität und Rationalität bei Habermas ab; vgl. Einführung, S. 280 f; S. 293f.
Soziale Systeme (1984) 301<br />
Soziale Systeme (1984)<br />
Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie (abgekürzt als Sy, SoSy, SS und SY), das erste Hauptwerk<br />
von Niklas Luhmann, geht davon aus, dass es soziale Systeme gibt, die strukturell gekoppelt sind.<br />
Zusammengenommen bilden sie Die Gesellschaft der Gesellschaft, welches der Titel seines zweiten Hauptwerks ist<br />
(1997). In Soziale Systeme zeigt der Untertitel Grundriß einer allgemeinen Theorie an, dass es dort um die<br />
Einführung in eine kommunikations-theoretische, genaugenommen um eine grundlegend<br />
philosophisch-soziologische Systemtheorie geht, die er in jenem Werk (biologisch-)autopoietisch wendet hin zu der<br />
von ihm begründeten Systemtheorie (Luhmann).<br />
Inhalt<br />
Übersicht<br />
Das 1984 erstmals veröffentlichte Werk beginnt mit dem autopoietischen Paradigmawechsel der Systemtheorie,<br />
durch den Systeme und ihre Umwelt nicht ausschließlich und vollständig, wohl aber universal und als eine<br />
selbstreferentielle Wirklichkeit erfasst werden sollen. Die Autopoiesis schließt soziologisch an Max Weber und<br />
Talcott Parsons und kybernetisch an William R. Ashby und Heinz von Förster an, um mit Bezügen auf Humberto R.<br />
Maturana und Francisco J. Varela biologische Beziehungen auf soziale zu übertragen. Die unterscheidungslogische<br />
und paradoxie-aufhebende Begründung dieser Übertragung erfolgt gleichzeitig aufbauend auf Georg W. F. Hegel,<br />
Edmund Husserl und vor allem auf George Spencer Brown, so dass Luhmann im Ergebnis ein entsprechend<br />
abgesichertes, wirklichkeitsbezogenes und kommunikationstheoretisches Begriffsinstrumentarium darlegte, dass<br />
nicht nur Erkenntnistheorien und Gesellschaftstheorien, sondern quasi alle Wissenschaftsdisziplinen beeinflusst hat<br />
(Physik, Psychologie, Politikwissenschaft etc.).<br />
Begriffe<br />
Eine bekannte Einführung zu Luhmann, verfasst von Walter Reese-Schäfer, nennt als die „Schlüsselbegriffe“ [1] von<br />
jenem ‚System’, ‚Sinn’ und ‚Autopoiesis’. Hauptsächlich in Bezug auf das Verständnis dieser Begriffe in Soziale<br />
Systeme folgen hier einschlägige Zitate, um dann den Theoriekern zu umreißen. Für Weiteres siehe auch<br />
Systemtheorie (Luhmann)#Weiterführende Artikel.<br />
System<br />
Sinn<br />
Autopoiesis<br />
„Für die Theorie sozialer Systeme werden ihrerseits, und deshalb sprechen wir von »allgemein«,<br />
Universalitätsansprüche erhoben. Das heißt: Jeder soziale Kontakt wird als System begriffen bis hin zur<br />
Gesellschaft als Gesamtheit aller möglichen Kontakte.“ (Luhmann, Sy 33)<br />
„Der Systembegriff steht (im Sprachgebrauch unserer Untersuchungen) immer für ein realen Sachverhalt. Wir<br />
meinen mit »System« also nie ein nur analytisches System, eine bloße Konstruktion, ein bloßes Modell“.<br />
(Luhmann, Sy 599)<br />
„Nicht alle Systeme verarbeiten Komplexität und Selbstreferenz in der Form von Sinn; aber für die, die dies<br />
tun, gibt es nur diese Möglichkeit. Für sie wird Sinn zur Weltform und übergreift damit die Differenz von<br />
System und Umwelt“. (Luhmann, Sy 95)<br />
„Der allem Sinn immanente Weltbezug schließt es aus, dass wir Sinn als Zeichen definieren. Man muss<br />
Verweisungsstruktur und Zeichenstruktur sorgfältig unterscheiden. […] Ein Zeichen muß Sinn haben, um<br />
seine Funktion erfüllen zu können“. (Luhmann, Sy 107)
Soziale Systeme (1984) 302<br />
„Die Selbstbeweglichkeit des Sinngeschehens ist Autopoiesis par excellence. Auf dieser Grundlage kann dann<br />
jedes (wie immer kurze) Ereignis Sinn gewinnen und Systemelement werden. Damit ist nicht so etwas wie<br />
„rein geistige Existenz“ behauptet, wohl aber Geschlossenheit des Verweisungszusammenhangs der<br />
Selbstproduktion. Insofern sind auch Sinnbewegungen in ihrer Funktion, Informationsgewinn und<br />
Informationsverarbeitung zu ermöglichen, autonom konstituiert.“ (Sy 101)<br />
„Die eigentliche Theorieleistung, die den Einsatz funktionaler Analysen [in verschiedenen Bereichen der<br />
Gesellschaft] vorbereitet, liegt demnach in der Problemkonstruktion […] Vor allem ist jedoch die Wende zu<br />
beachten, die mit dem Konzept des selbstreferentiellen, autopoietischen Systems durchgeführt ist: Es geht<br />
nicht mehr um eine Einheit mit bestimmten Eigenschaften, über deren Bestand oder Nichtbestand eine<br />
Gesamtentscheidung fällt; sondern es geht um Fortsetzung oder Abbrechen der Reproduktion von Elementen<br />
durch ein relationales Arrangieren eben dieser Elemente. Erhaltung ist hier Erhaltung der Geschlossenheit und<br />
der Unaufhörlichkeit der Reproduktion von Elementen, die im Entstehen wieder verschwinden.“ (Sy 86)<br />
Theoriekern<br />
Die vorgelegte Theorie (siehe auch Systemtheorie (Luhmann)) ist entlang der Begriffe ‚Soziale Systeme’, ‚Sinn’ und<br />
‚Autopoiesis’ nachvollziehbar bezüglich ihres Bezugs (soziale Beziehungen), ihrer unhintergehbaren Form (Sinn)<br />
und ihrer polyzentristischen Anlage (Autopoiesis), die entsprechend auch für die von ihr abgeleiteten<br />
Untersuchungen gilt: Sobald eine Systemtheorie als universialistische Theorie „sich selbst als Forschungsprogramm<br />
eines Teilsystems (Soziologie) eines Teilsystems (Wissenschaft) des Gesellschaftssystems analysiert, wird sie<br />
genötigt, sich selbst als kontingent zu erfahren.“ (Sy 34) Ein stabiles Element ihrer Wirklichkeitskonstruktionen ist<br />
die Differenz von System und Umwelt, wobei Systeme auch zur Umwelt bestimmter Systeme gehören, wie etwa die<br />
Politik und die Wissenschaft als eine Umwelt des Rechts, das mit diesen Systemen strukturell gekoppelt ist.<br />
Hingegen sind die Systeme selbst davon abhängig, sich aufgrund ihrer Autopoiesis und im Zusammenwirken mit<br />
iher Umwelt immer wieder selbst zu (re-)produzieren, um weiterzubestehen zu können.<br />
„Eine der wichtigsten Konsequenzen ist: daß Systeme höherer (emergenter) Ordnung von geringerer<br />
Komplexität sein können als Systeme niederer Ordnung, da sie Einheit und Zahl der Elemente, aus denen sie<br />
bestehen, selbst bestimmen, also in ihrer Eingenkomplexität unabhängig sind von ihrem Realitätsunterbau.“<br />
(Sy 43) „Komplexität in dem angegebenen Sinne heißt Selektionszwang, Selektionszwang heißt Kontingenz,<br />
und Kontingenz heißt Risiko.“ (Sy 47)<br />
Weil nun Systeme aufgrund unterschiedlicher Komplexität und Operationsweisen füreinander unbestimmbar<br />
werden, entstehen neue Systeme zu ihrer Regulierung (Sy 53). Zum Beispiel operiere die Wissenschaft mit dem<br />
Code wahr/unwahr, während das Recht mit rechtmäßig/unrechtmäßig prozessiere, so dass das eine durch das andere<br />
reflektiert wird, Korrekturpoteniale bereit stelle und sich teilweise interpenetriere. Luhmann schließt unter anderem,<br />
dass die soziokulturelle Entwicklung durch interaktionsfreie Kommunikationsmöglichkeiten beschleunigt werde.<br />
Wie früher durch Schrift und Buchdruck kämen die Massenmedien hinzu (Sy 592). Um die Relationen mit einer<br />
zusammenhängenden Theorie begreifen zu können, entfaltet Luhmann nacheinander und systematisch aufeinander<br />
aufbauend weitere Unterscheidungspaare, die jeder ontologischen Tradition entgegen stehen und durch das<br />
Aufzeigen von Operationsalternativen die logische Dualität von richtig/falsch sprengt.<br />
Rezeption<br />
Das Werk wurde von einzelnen Forschern fast aller Wissenschaftsbereiche rezipiert, z.B. in der Rechtsphilosophie [2]<br />
, auch z.B. in der systemischen Beratung. Ideen dieses Werks und anderer Werke Luhmanns wurden wiederholt z.B.<br />
von Jürgen Habermas kritisch diskutiert [3] . Zu einflussreichen Veränderungen und Weiterentwicklungen von<br />
Luhmanns erstem Hauptwerk zählen unter anderem Soziologische Aufklärung (sechs Aufsatzbände, 1970–1995),<br />
Monographien-Reihe über einzelne Funktionssysteme (1988 bis postum 2008) und das diese Reihe erneut<br />
verbindende, zweite Hauptwerk Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997). Erweiterungen erfolgten dabei
Soziale Systeme (1984) 303<br />
insbesondere bei der Erläuterung der operativen Schließung von Systemen und im Verhältnis von sozialen und<br />
psychischen Systemen.<br />
Literatur<br />
chronologisch und sortiert<br />
Originalquellen<br />
das Werk<br />
• Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984, ISBN 3-518-28266-2.<br />
Einführung<br />
• mit Raffaele De Giorgi: Teoria della società. 1992, ISBN 88-204-7299-6<br />
• Interview mit Luhmann über Systemtheorie [4] 1994.<br />
• Einführung in die Systemtheorie. 2002 (postum), ISBN 3-89670-292-0.<br />
seine Weiterentwicklung (Auswahl)<br />
• Die Wirtschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-28752-4.<br />
• Die Wissenschaft der Gesellschaft. 1990, ISBN 3-518-28601-3.<br />
• Das Recht der Gesellschaft. 1993, ISBN 3-518-28783-4.<br />
• Die Realität der Massenmedien. 1996, ISBN 3-531-12841-8.<br />
• Die Kunst der Gesellschaft. 1997, ISBN 3-518-28903-9.<br />
• Die Gesellschaft der Gesellschaft. 1997, ISBN 3-518-28960-8 (Rezension [5] ).<br />
• Die Politik der Gesellschaft. 2000 (postum), ISBN 3-518-29182-3.<br />
• Die Religion der Gesellschaft. 2000 (postum), ISBN 3-518-29181-5.<br />
• Das Erziehungssystem der Gesellschaft. 2002 (postum), ISBN 3-518-29193-9.<br />
• Die Moral der Gesellschaft. 2008 (postum), ISBN 978-3-518-29471-0.<br />
Sekundärquellen<br />
werkbezogen (im engeren Sinn)<br />
• Daniel Zolo: Reflexive Selbstbegründung der Soziologie und Autopoiesis. In: Soziale Welt 36, 1985, S. 519-534.<br />
• Dirk Baecker, Jürgen Markowitz, Rudolf Stichweh (Hrsg.): Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum 60.<br />
Geburtstag. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.<br />
• Hans Haferkamp, Michael Schmid (Hrsg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu<br />
Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.<br />
• Werner Krawietz, Michael Welker (Hrsg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Suhrkamp, Frankfurt am Main<br />
1992. ISBN 978-3-531-15177-9.<br />
• Georg Kneer, Armin Nassehi (Hrsg.) Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Wilhelm Fink Verlag, München<br />
1993. ISBN 3825217515.<br />
• Andreas Metzner: Probleme sozio-ökologischer Systemtheorie – Natur und Gesellschaft in der Soziologie<br />
Luhmanns. Westdeutscher Verlag, Opladen 1993, ISBN 978-3531124711 (Volltext [12] ).<br />
• Andreas Göbel: Theoriegenese als Problemgenese: Eine problemgeschichtliche Rekonstruktion der<br />
soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns. Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 2000, ISBN<br />
3-87940-702-9 (Zugl.: Essen, Univ. Diss. 1999).<br />
• Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi, Elena Esposito: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme.<br />
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-28826-1 (Nachdruck; stw 1226)..<br />
• Christian Schuldt: Systemtheorie. 2. Auflage. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2006, ISBN 3-4344-6153-1..<br />
werkbezogen (im weiteren Sinn)
Soziale Systeme (1984) 304<br />
• Walter Reese-Schäfer: Niklas Luhmann zur Einführung. Junius, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-88506-305-0<br />
(bis zur 3. Auflage als Luhmann zur Einführung).<br />
• Dirk Baecker]: Wozu Systeme? 2002, ISBN 3931659232<br />
• Thomas Latka,: Topisches Sozialsystem. 2003, ISBN 3896703218<br />
• Gralf-Peter Calliess: Systemtheorie Luhmann / Teubner. In: Sonja Buckel (Hrsg.), Ralph Christensen (Hrsg.), und<br />
Andreas Fischer-Lescano (Hrsg.): Neue Theorien des Rechts. UTB, Stuttgart 2006, ISBN 3825227448.<br />
Weblinks<br />
• Einführung in Luhmanns Systemtheorie selbstreferentieller Systeme [6]<br />
• Luhmann für Einsteiger. Multimediale Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann [11]<br />
Referenzen<br />
[1] Walter Reese-Schäfer: Niklas Luhmann zur Einführung. Hamburg 2001, drittes Kapitel.<br />
[2] Gunther Teubner: Recht als autopoietisches System. Frankfurt am Main 1989.<br />
[3] Z.B. Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am Main 1985.<br />
[4] http:/ / www. fifoost. org/ user/ luhmann. html<br />
[5] http:/ / www. zeit. de/ 1997/ 25/ Abschied_von_Alteuropa<br />
[6] http:/ / www. systemische-beratung. de/ selbstreferentiell. htm<br />
Massenpsychologie<br />
Massenpsychologie ist ein Teilgebiet der Sozialpsychologie und beschäftigt sich mit dem Verhalten von Menschen<br />
in Menschenansammlungen. Ausgang für die Theoriebildung der Massenpsychologie ist die zum allgemeinen<br />
Erfahrungsschatz gehörende Tatsache, dass große Menschenmassen ein oft überraschend erscheinendes Verhalten<br />
zeigen. Zum Beispiel die Auslösung einer Panik aufgrund eines eher unbedeutenden Anlasses.<br />
Nach Studien von Davis und Harless (1996) werden wichtige Entscheidungen in einer Gruppe nicht von einzelnen<br />
Individuen getroffen, sondern von der Masse in Abstimmung herbeigeführt, um durch die Zusammenarbeit ein Ziel<br />
zu erreichen. In der Geschichte sind große Menschenmassen imstande gewesen, dramatische und plötzliche soziale<br />
Veränderungen außerhalb der etablierten Rechtsprozesse einzuleiten. Kollektive Zusammenarbeit wird von einigen<br />
verdammt, von anderen unterstützt. Sozialwissenschaftler haben einige unterschiedliche Theorien aufgestellt, um<br />
massenpsychologische Phänomene zu erklären und zu erläutern, inwiefern sich das Gruppenverhalten vom Verhalten<br />
der Einzelpersonen innerhalb der Gruppe signifikant unterscheidet.<br />
Ansteckungstheorie<br />
Eine frühe Theorie zum kollektiven Verhalten hat der französische Soziologe Gustave Le Bon formuliert. Nach Le<br />
Bons Ansteckungstheorie (engl. Contagion theory) üben soziale Gruppen eine hypnotische Wirkung auf ihre<br />
Mitglieder aus. Geschützt in der Anonymität der Menge, geben Menschen ihre persönliche Verantwortung auf und<br />
ergeben sich den ansteckenden Gefühlen der Masse. Die Menschenmenge entwickelt so ein Eigenleben, wühlt die<br />
Gefühle auf und verleitet die Personen tendenziell zu irrationalem Handeln. Wie Clark McPhail ausführt, offenbaren<br />
systematische Untersuchungen allerdings, dass „die verrückte Masse“ kein Eigenleben getrennt von den Gedanken<br />
und Intentionen ihrer Mitglieder führt. Norris Johnson, der eine Panik während eines Who-Konzerts 1979 erforschte,<br />
kam zu dem Schluss, dass die Masse aus vielen Kleingruppen bestand, deren Mitglieder vorwiegend versuchten,<br />
einander zu helfen.<br />
Le Bons Arbeiten bilden den Ausgangspunkt von Sigmund Freuds Studie Massenpsychologie und Ich-Analyse.<br />
Wilhelm Reich formuliert aus seiner eigenen Weiterentwicklung der Psychoanalyse 1933 sein Werk Die<br />
Massenpsychologie des Faschismus.
Massenpsychologie 305<br />
Annäherungstheorie<br />
Die Annäherungstheorie (engl. Convergence theory) postuliert, dass das Massenverhalten nicht von der Masse selbst<br />
ausgeht, sondern von einzelnen Individuen in die Gruppe hineingetragen wird. Die Gruppenbildung selbst läuft auf<br />
die Annäherung von Individuen mit ähnlicher Gesinnung hinaus. Mit anderen Worten ausgedrückt: Die<br />
Ansteckungstheorie besagt, dass Gruppen Menschen zu bestimmtem Handeln veranlassen; die Annäherungstheorie<br />
dagegen sagt das Gegenteil: Menschen, die in einer bestimmten Weise handeln wollen, schließen sich zusammen.<br />
Ein Beispiel für die Annäherungstheorie ist ein Phänomen, welches sich manchmal beobachten lässt, wenn in einer<br />
zuvor homogenen Gegend vermehrt Immigranten auftauchen und Mitglieder der bereits existierenden Gemeinschaft<br />
sich (offenbar spontan) verbünden, um die Zuzügler zu bedrohen. Anhänger der Konvergenztheorie glauben, dass in<br />
solchen Fällen nicht die Masse den Rassenhass oder Gewalt erzeugt, sondern dass die Feindseligkeit längere Zeit in<br />
vielen Bewohnern gebrodelt hat. Die Masse entsteht aus der Annäherung derjenigen Menschen, die gegen die neuen<br />
Nachbarn sind. Die Konvergenztheorie besagt, dass das Verhalten der Masse selbst nicht irrational ist, vielmehr<br />
drücken die Personen in der Gruppe existierende Ansichten und Werte aus, sodass die Reaktion des Pöbels nur das<br />
rationale Produkt von weitgestreuten populären Gefühlen ist.<br />
Methodik<br />
Bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Massenpsychologie stoßen klassische Methoden sehr schnell an ihre<br />
Grenzen. Anders als individualpsychologische Fragestellungen können Hypothesen der Massenpsychologie nicht mit<br />
Experimenten im Labor überprüft werden. Interviews und Fragebögen sind untaugliche Mittel, Feldstudien erweisen<br />
sich ebenfalls als eher ungeeignet, da sie in diesem Kontext kaum durchführbar sind. Neuere Forschungsarbeiten<br />
wenden Agentenbasierte Modelle an, um kollektive Phänomene zu analysieren (Brudermann 2010).<br />
Anwendungsgebiete<br />
Die Finanzmarktpsychologie ist ein wichtiges Anwendungsgebiet, in welchem sich die massenpsychologische<br />
Forschung etablieren kann. Die Zusammenführung von Wissen über Anlegerverhalten mit den Erkenntnissen der<br />
Massenpsychologie offenbart neue Modelle und Herangehensweisen für realistischere Erklärungskonzepte der<br />
Finanzmarktdynamik. Denn der Zyklus von Boom und Krise ist ein „natürliches“ Element in der<br />
Finanzmarktgeschichte und traditionellen ökonomischen Theorien und Finanzmarktmodelle (z.B.<br />
Effizienzmarkthypothese) versagen aber bei der Erklärung und Vorhersage solcher Trends und den ihnen<br />
zugrundeliegenden Verhaltensweisen der Marktteilnehmer. Denn sie berücksichtigen nicht den gesamten Menschen,<br />
sondern nur eine akademische Abstraktion jener Aspekte des menschlichen Verhaltens, die sie für ökonomisch<br />
relevant halten. Und sie vergessen auch die Gesellschaft, mit der die Märkte untrennbar verbunden sind. Und genau<br />
an diesem Punkt setzt die Massenpsychologie, die unter anderem auf den Konzepten der gegenseitigen sozialen und<br />
psychologischen Ansteckung sowie der menschlichen Neigung zur Orientierung und Nachahmung anderer im<br />
sozialen Umfeld basiert, an. Die Erforschung kollektiver Dynamiken liefert noch einen weiteren Beitrag zum<br />
besseren Verständnis der Prozesse an den Finanzmärkten, indem sie auf den Zusammenhang zwischen kurzfristigen<br />
Entwicklungen und langfristigen Veränderungsprozessen hinweist. Basierend auf dem Prinzip langer und kurzer<br />
Zyklen wird in der Massenpsychologie zwischen bewusst erkannten, kurzlebigen Auswirkungen und den ihnen<br />
zugrunde liegenden langsamen, subtilen und oftmals nicht erkannten Entwicklungen unterschieden. Durch diese<br />
zentrale Erkenntnis, die im Wesentlichen schon auf Gustave LeBon zurückgeht, leistet die massenpsychologische<br />
Forschung einen Beitrag zur Beschreibung des Zusammenwirkens eines seit den 1960er Jahren angehäufter<br />
Schuldenbergs und der periodischen Entstehung von Boom-Krisen-Zyklen während der vergangenen Jahrzehnte<br />
(Fenzl 2009).
Massenpsychologie 306<br />
Literatur<br />
• Richard A. Berk: Collective Behavior. Brown, Dubuque, Iowa 1974.<br />
• Edward Bernays: Propaganda – Die Kunst der Public Relations., 1928. Aus dem Amerikanischen von Patrick<br />
Schnur. orange-press, Freiburg 2007, ISBN 978-3-936086-35-5.<br />
• Hermann Broch: Massenwahntheorie. 1939 bis 1948.<br />
• Thomas Fenzl: Die Massenpsychologie der Finanzmarktkrise. US-Immobilienblase, Subprime Desaster,<br />
Schulden-Bubble und ihre Auswirkungen. Springer Verlag, Wien/New York 2009, ISBN 978-3-211-98090-3.<br />
• Thomas Brudermann: Massenpsychologie. Psychologische Ansteckung, Kollektive Dynamiken,<br />
Simulationsmodelle. Springer Verlag, Wien/New York 2010, ISBN 978-3-211-99760-4.<br />
• Elias Canetti: Masse und Macht. 1960.<br />
• Douglas D. Davis, David W. Harless: Group vs. Individual Performance in a Price-Searching Experiment. In:<br />
Organizational Behavior and Human Decision Processes. 66, 1996, S. 215–227.<br />
• Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ichanalyse. 1921. In: Sigmund Freud: Studienausgabe. Band IX: Fragen<br />
der Gesellschaft. Ursprünge der Religion. Fischer, Frankfurt am Main 1982, S. 61–134.<br />
• Peter R. Hofstätter, Gruppendynamik. Kritik der Massenpsychologie. Neuausgabe. Rowohlt, Reinbek bei<br />
Hamburg 1986.<br />
• Norris R. Johnson: Panic at 'The Who Concert Stampede': An Empirical Assessment. In: <strong>Social</strong> Problems. Vol.<br />
34, No. 4, 1987, S. 362–373.<br />
• Gustave Le Bon: La Psychologie des foules. 1895. engl. The Crowd: A Study of the Popular Mind. [1]<br />
• Thanos Lipowatz: Die Politik der Psyche. Turia & Kant, Wien 1998, ISBN 3-85132-156-1.<br />
• C. Mackay: Extraordinary Popuar Delusions and the Madness of Crowds. Wordsworth Editions, 1841, ISBN<br />
1-85326-349-4.<br />
• Serge Moscovici: Das Zeitalter der Massen. Eine histororische Abhandlung über die Massenpsychologie. Fischer,<br />
Frankfurt am Main 1986.<br />
• Wilhelm Reich: Die Massenpsychologie des Faschismus. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1986, ISBN<br />
3-462-01794-2.<br />
• Wilhelm Reich: Rede an den kleinen Mann. 15. Auflage. Fischer, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-596-26777-3.<br />
• Paul Reiwald: Vom Geist der Massen. 2. Auflage. Pan, Zürich 1946.<br />
• Ralph Turner, Lewis M. Killian: Collective Behavior. 4. Auflage. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1993.<br />
• Mario Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine Einführung in den<br />
ethnopsychoanalytischen Prozeß. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982.<br />
Siehe auch<br />
• Gruppenzwang<br />
• Die Weisheit der Vielen<br />
• Gruppendynamik<br />
Weblinks<br />
• Gustave Le Bon – Psychologie der Massen [2] in der Übersetzung von R. Eisler (1911)<br />
• Chris Russ – Online Crowds [10] Massenphänomene und kollektives Verhalten im Internet (2010)
Massenpsychologie 307<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / onlinebooks. library. upenn. edu/ webbin/ gutbook/ lookup?num=445<br />
[2] http:/ / www. textlog. de/ le-bon-psychologie. html<br />
Organisationstheorie<br />
Organisationstheorie und Organisationsforschung haben den Zweck, Organisationen – ihr Entstehen, ihr<br />
Bestehen und ihre Funktionsweise – zu erklären und zu verstehen. Es existieren eine Vielzahl von<br />
Organisationstheorien, da Organisationen hochkomplexe Gebilde sind und der Gegenstandsbereich der<br />
Organisationstheorie sehr breit ist. Allen Ansätzen ist ihr Objektbereich - die Organisationen und ihre Zielsetzung -<br />
gleich, während sie jeweils bestimmte Aspekte untersuchen.<br />
Klassische Ansätze<br />
Bürokratieansatz<br />
Als wesentlicher Ansatz kann der Bürokratieansatz des deutschen Soziologen Max Weber (1864–1920) genannt<br />
werden, welcher vor allem in den USA zur Erklärung formaler Organisationen herangezogen wurde. Weber versteht<br />
unter Bürokratie eine leistungsfähige Organisationsform, die durch Arbeitsteilung, Amtshierarchie, Regeln und<br />
Normen zur Aufgabenerfüllung und Aktenmäßigkeit der Verwaltung gekennzeichnet ist.<br />
Bis zum heutigen Tag ist Max Webers Bürokratieansatz ein Höhepunkt der Organisationstheorie geblieben. In den<br />
sechziger Jahren fand dieser Ansatz Eingang in die betriebswirtschaftliche Organisationslehre.<br />
Scientific Management und Taylorismus<br />
Geprägt wurde dieser Ansatz vor allem durch den verstärkten Einsatz von Maschinen und standardisierten<br />
Massenproduktionen (industrielle Revolution). Vor diesem Hintergrund entstand ein Bedarf an Managementleitfäden<br />
zur Gestaltung der neuartigen Fabriken. Frederick Winslow Taylor (1856–1915) entwickelte den Ansatz des<br />
Scientific Management, in der Weiterentwicklung auch Taylorismus genannt. Ziel war es, sowohl die Produktivität<br />
der Arbeiter als auch der Effizienz des Managements zu steigern.<br />
Taylors Managementprinzipien enthielten folgende fünf Komponenten: Trennung von Hand- und Kopfarbeit,<br />
Analyse der menschlichen Arbeit in Zeitstudien, Differential-Lohnsystem, Festlegung des täglichen Arbeitspensums<br />
und Funktionsmeistersystem.<br />
Administrations- und Managementlehre<br />
Die Administrations- und Managementlehre wurde in den USA und in Großbritannien entwickelt und lässt sich auf<br />
die Arbeiten von Henri Fayol (1841–1925) zurückführen.<br />
In erster Linie stehen Fragen der Aufgaben- und Abteilungsbildung und der Koordination im Mittelpunkt. Fragen der<br />
Verwaltung und Probleme der Unternehmensführung standen daher im Vordergrund. Einen wichtigen Teil der Lehre<br />
stellte der Katalog von Managementfunktionen dar, welcher Vorausplanung, Organisation, Auftragserteilung,<br />
Koordination und Kontrolle beinhaltete.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt seiner Lehre war der Grundsatz der Einheit der Auftragserteilung. Dieser besagt, dass<br />
eine in der Hierarchie nachgeordnete Stelle jeweils nur von einer übergeordneten Instanz Weisungen erhalten kann.<br />
Um aber den Nachteil langer Informationswege zu vermeiden, lässt Fayol den Kontakt zwischen gleichrangigen<br />
Positionen zu (Fayolsche Brücke).
Organisationstheorie 308<br />
Betriebswirtschaftliche Organisationslehre<br />
Die betriebswirtschaftliche Organisationslehre, eine Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre, ist eine deutsche<br />
Thematik und entwickelte sich ab 1930. Ausgangsbasen waren vor allem die Arbeiten von Fritz Nordsieck um 1930,<br />
aus denen sich die Aufbau- und Ablauforganisation herausbildete. Ebenso wie Nordsieck stellt auch Erich Kosiol die<br />
Aufgabe in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff des<br />
Aufgabenträgers geprägt. Eine Weiterentwicklung und der Abschluss dieses Ansatzes erfolgte durch Erwin Grochla.<br />
Organizational Behaviour<br />
Organizational Behaviour (britisches engl. auch Organizational Behavior für organisatorisches Verhalten) gehört im<br />
anglo-amerikanischen Sprachraum zum Grundstock aller sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge auf<br />
akademischem Niveau. Im Kern geht es um den auf Wertschöpfung zielenden Umgang mit Formen der Gestaltung<br />
und Sicherung von sozialen Regeln, Prozessen, Funktionen und Strukturen. Hierbei werden unterschiedliche<br />
Kontexte (z. B. Erwartungen, Verhalten oder Sinn) auf ihre Wirkungen hin betrachtet.<br />
Verhaltensorientierte Ansätze<br />
Human-Relations-Ansatz<br />
Der Ursprung der Human-Relations-Bewegung sind die Hawthorne-Experimente, in denen die Wirkungen der<br />
Arbeitsbedingungen auf die Arbeitsleistung untersucht wurden. Die Kernaussage dieses Ansatzes ist, dass der<br />
Mensch ein soziales Wesen ist und nach eigenen Gesetzen funktioniert. Daraus folgt, dass eine positive Einstellung<br />
gegenüber der Arbeit bei den Mitgliedern der Organisation und den Vorgesetzten zu einer hohen Zufriedenheit führt.<br />
Diese Zufriedenheit bewirkt wiederum eine hohe Arbeitsleistung.<br />
Organisationsentwicklung<br />
Die Organisationsentwicklung (OE) gründet auf Erkenntnissen aus der gruppendynamischen Laboratoriumsmethode<br />
(NTL-Institut) und dem Survey-Feedback. "Die Betroffenen zu Beteiligten Machen" ist ein Kernkonzept der OE und<br />
hat auch in vielen anderen Methoden Eingang gefunden. Gemeinsame Lernprozesse werden initiiert und methodisch<br />
begleitet. Durch "geplanten sozialen Wandel" werden die Fähigkeiten aller Beteiligten und der Organisation als<br />
Ganzes für Entwicklung und Veränderung genutzt. Dabei werden die Gesetzmässigkeiten sozialer Gemeinschaften<br />
genutzt und (wie beim Human-Relations-Ansatz) die Interessen der Mitarbeiter berücksichtigt. OE wird in grossen<br />
Firmen, in Verwaltungen, Kirchen, sozialen Einrichtungen und der Armee eingesetzt.<br />
Motivationstheoretische Ansätze<br />
Im Anschluss an die Human-Relations-Bewegung entwickelte sich mit der Motivationstheorie eine<br />
Forschungsrichtung, die das menschliche Verhalten zum Gegenstand hat. Es wird hauptsächlich der Zusammenhang<br />
zwischen Motivation bzw. Frustration, Zufriedenheit und Leistung untersucht.<br />
Als Vertreter sind vor allem Abraham Maslow, Douglas McGregor und Frederick Herzberg zu nennen. Maslow<br />
entwickelte die Bedürfnispyramide und klassifizierte die handlungsbestimmenden Motive des Menschen in ein<br />
Fünf-Stufen-Schema. Douglas McGregor ging mit seiner X-Y-Theorie davon aus, dass jede Führungsentscheidung<br />
durch ein bestimmtes Menschenbild geprägt wird. Die Kernaussage der Zweifaktoren-Theorie von Frederick<br />
Herzberg besagt hingegen, dass der Arbeitsinhalt, also die Hygienefaktoren und die Motivatoren, die Motivation<br />
maßgeblich bestimmen.
Organisationstheorie 309<br />
Entscheidungsorientierte Ansätze<br />
Entscheidungslogisch-orientierte Ansätze<br />
Der Entscheidungslogisch-orientierte Ansatz versucht, organisatorische Gestaltungsprobleme mit Hilfe von<br />
mathematischen Algorithmen oder in Form von verbalen Entscheidungsmodellen zu lösen. Jedoch weisen<br />
mathematische Verfahren als große Schwäche auf, dass sie nur wenige Variablen mit bestimmten<br />
Nebenbedingungen berücksichtigen.<br />
Entscheidungsprozess-orientierte Ansätze<br />
Entscheidungsprozess-orientierte Ansätze sehen in Organisationen Systeme, in denen Entscheidungen getroffen und<br />
koordiniert werden müssen. Das Entscheidungsverhalten wird dabei wesentlich durch die Organisationsstruktur<br />
beeinflusst.<br />
Situative Ansätze<br />
Analytische Varianten und pragmatische Varianten<br />
Die situativen Ansätze der Organisationstheorie entwickelten sich in den USA und in England Mitte der 60er Jahre.<br />
Ziel solcher Ansätze ist die Aufdeckung der Zusammenhänge zwischen der Organisationstheorie, dem Verhalten der<br />
Organisationsmitglieder, Effizienz der Organisation und der jeweiligen Situation.<br />
Der situative Ansatz formuliert seine Aussagen in Bedingtheitsaussagen. Es gibt daher keine optimale Form der<br />
Organisation. Unterschieden wird in analytische Varianten, wo es um die Verfolgung eines theoretischen<br />
Wissensziel geht und pragmatische Varianten, wo im Mittelpunkt die Formulierung von Gestaltungsmöglichkeiten<br />
und Gestaltungsempfehlungen steht.<br />
Siehe auch: Situativer Ansatz.<br />
Systemorientierte Ansätze<br />
Systemtheoretisch-kybernetischer Ansatz<br />
Die Systemtheorie geht auf den österreichischen Biologen Ludwig von Bertalanffy (1901–1972) zurück. Diese<br />
Theorie dient zur Erklärung von Prozessen des Wachstums, der Anpassung und der Selbstregulation. Die Kybernetik<br />
als Wissenschaft von der Steuerung und Regelung von Systemen hingegen, wurde vom Amerikaner Norbert Wiener<br />
(1894–1964) begründet.<br />
Beiden übergreifenden Wissenschaften liegen Denkweisen zugrunde, die oft als ganzheitliches Denken bzw.<br />
Lenkung von Systemen charakterisiert werden. Kernaussage ist, dass soziale Systeme über die Fähigkeit zur<br />
Selbstorganisation verfügen und hierbei Verhaltensregeln weiterentwickeln. Demnach entstehen nach der<br />
Systemtheorie und Kybernetik Strukturen von selbst.
Organisationstheorie 310<br />
Soziologie<br />
Ein soziologischer Systembegriff wurde erstmals von Talcott Parsons formuliert. Eine darauf aufbauende<br />
soziologische Systemtheorie wurde dann in den 1980er Jahren von Niklas Luhmann formuliert und etwa von seinem<br />
Schüler Dirk Baecker mit Blick auf Wirtschaft und Unternehmen weiter entwickelt.<br />
Ebenfalls die soziologische Perspektive auf Organisationen verfolgt grundsätzlich die Organisationssoziologie.<br />
Soziotechnischer Ansatz<br />
Das Konzept soziotechnischer Systeme wurde Anfang der 50er durch Eric Trist begründet. Sein Anliegen war es, die<br />
Arbeit menschlicher zu gestalten und gleichzeitig die Leistung zu steigern. Der soziotechnische Ansatz betrachtet<br />
Organisationen als offene Systeme, deren Hauptaufgabe die Transformation von Input in Output darstellt. Mensch,<br />
Arbeit, Organisation und Technik werden dabei grundsätzlich als gleichwertig angesehen.<br />
Anwendung in der Führung<br />
In der Praxis (Unternehmensführung, Geschäftsführung, Teamführung) werden verschiedene Führungsstile<br />
angewendet, denen teils theoretische Ansätze zugrunde liegen. Auf den situativen Ansatz folgt etwa die<br />
Kontingenztheorie. Weiter können nach den motivationstheoretischen Ansätze z. B. die Führungsstile nach Lewin<br />
verwendet werden, bei denen zum Beispiel zwischen autoritärer und demokratischer Führung unterschieden wird.<br />
Weitere Theorien sind die Prinzipal-Agent-Theorie oder die Transaktionskostentheorie.<br />
Literatur<br />
• Erich Frese (Hrsg.): Handwörterbuch der Organisation. 3. Auflage. Schäffer-Poeschl, Stuttgart 1992, ISBN<br />
3-7910-8027-X.<br />
• Helmut Kasper, Wolfgang Mayrhofer (Hrsg.): Personalmanagement, Führung, Organisation. 2. Auflage.<br />
Ueberreuter, Wien 1996, ISBN 3-7064-0248-3.<br />
• Alfred Kieser (Hrsg.): Organisationstheorien. 5. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2002, ISBN 3-17-017917-9.<br />
• Alfred Kieser, Peter Walgenbach (Hrsg.): Organisation. 4. Auflage. Schäffer-Poeschl, Stuttgart 2003,ISBN<br />
3-7910-2242-3.<br />
• Albert Martin (Hrsg.): Organizational Behaviour - Verhalten in Organisationen. Kohlhammer, Stuttgart 2003,<br />
ISBN 3-17-017193-3.<br />
• Georg Schreyögg, Axel v. Werder (Hrsg.): Handwörterbuch – Unternehmensführung und Organisation.<br />
Schäffer-Poeschl, Stuttgart 2004, ISBN 3-7910-8050-4.<br />
• Manfred Schulte-Zurhausen: Organisation. 4. Auflage. Vahlen, München 2005, ISBN 3-8006-3205-5.<br />
• Elke Weik, Rainhart Lang (Hrsg.): Moderne Organisationstheorien 1. Handlungsorientierte Ansätze. 2. Auflage.<br />
Gabler, Wiesbaden 2005, ISBN 3-409-21874-2.
Organisationstheorie 311<br />
Weblinks<br />
• Organisationstheorien [1]<br />
• Organisationstheorien als Grundlage für Lernende Organisationen [2]<br />
• Organization Studies [3] - Internationales Fachmagazin für Organisationsforschung<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. ub. uni-konstanz. de/ kops/ volltexte/ 1999/ 336/<br />
[2] http:/ / www. vordenker. de/ gerald/ orgtheorie. html<br />
[3] http:/ / www. sagepub. com/ journalsProdDesc. nav?prodId=Journal201657<br />
Netzwerkorganisation<br />
Die Netzwerkorganisation ist eine Form der Aufbauorganisation in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre.<br />
Sie ist eine Möglichkeit, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in einer Organisation zu verteilen. Die<br />
Netzwerkorganisation kann als Organisation mit relativ autonomen Mitgliedern, die langfristig durch gemeinsame<br />
Ziele miteinander verbunden sind und koordiniert zusammenarbeiten, (Lit.: Schulte-Zurhausen: Organisation, 2005,<br />
S. 286) beschrieben werden. Die Mitglieder der Netzwerkorganisation können Einzelpersonen, Gruppen oder<br />
Institutionen sein.<br />
Sofern Unternehmen sich auf diese Weise organisieren, spricht man von Unternehmensnetzwerken. Dieser Begriff<br />
bezeichnet eine auf die Erreichung von Vorteilen im Wettbewerb zielende Organisationsform ökonomischer<br />
Aktivitäten, die durch mittelfristig stabile, kooperative Beziehungen zwischen meist abhängigen, rechtlich jedoch<br />
selbständigen Unternehmen gekennzeichnet ist.<br />
Merkmale<br />
Die Netzwerkorganisation ist ein Mehrliniensystem mit hohem Grad an Dezentralisierung. Der hohe Grad an<br />
Dezentralisierung entsteht dadurch, dass jede Stelle mehreren Instanzen unterstellt sein kann. Die<br />
Aufgabengliederung kann bei dieser Organisationsform entweder objektorientiert, das heißt nach Zielobjekten<br />
strukturiert, oder verrichtungsorientiert, das heißt nach Funktionsbereichen strukturiert, sein. Wichtige<br />
Voraussetzungen für das Funktionieren von Netzwerken sind die Formulierung klarer Ziele und die Kommunikation<br />
dieser Ziele. Wegen der hohen Dezentralisierung ist auch die Abstimmung der von der Organisation gesetzten<br />
Aktivitäten notwendig. Entscheidend ist, dass die beteiligten Mitglieder ein übergeordnetes, gemeinsames Ziel<br />
verfolgen.<br />
Formen<br />
Netzwerkorganisationen können sowohl zur Abstimmung von unternehmensinternen Aktivitäten als auch zur<br />
Regulierung von unternehmensübergreifenden Beziehungen eingesetzt werden. Je nach dem wird zwischen internen<br />
und externen Netzwerken unterschieden:<br />
Interne Netzwerke<br />
Interne oder intraorganisationale Netzwerke bestehen aus Mitgliedern einer Organisation, die in intensiven sowohl<br />
horizontalen als auch vertikalen Beziehungen zueinander stehen. Interne Netzwerke sind vor allem durch kollegiale<br />
Beziehungen zwischen gleichrangigen Fachkräften und partnerschaftliche Zusammenarbeit charakterisiert. Sie<br />
beruhen in erster Linie auf persönlichen Kontakten. Derartige Netzwerke ergänzen oder überlagern die vorhandene<br />
Organisationsstruktur und sind deshalb der Sekundärorganisation zuzuordnen.
Netzwerkorganisation 312<br />
Externe Netzwerke<br />
Externe oder interorganisationale Netzwerke, auf der anderen Seite, bestehen aus mehreren rechtlich und<br />
wirtschaftlich eigenständigen Unternehmen. Gegenstand derartiger Kooperationen kann der gesamte Prozess der<br />
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen sein. Die Zusammenarbeit kann<br />
sich jedoch auch auf nur eine oder wenige Funktionen beziehen, so dass die kooperierenden Unternehmen bezüglich<br />
anderer Funktionsbereiche weiterhin zueinander im Wettbewerb stehen. Dadurch sollen Synergieeffekte oder<br />
Wettbewerbsvorteile erreicht werden, die ohne Kooperation aufgrund fehlender Ressourcen nicht möglich wären. Sie<br />
können nach dem Ort der Aktivität oder nach der Kooperationsrichtung eingeteilt werden. Beispiele für eine<br />
Unterteilung nach dem Ort der Aktivität sind regionale, nationale oder globale Zusammenarbeit. Werden externe<br />
Netzwerke nach der Kooperationsrichtung unterteilt, wird unterschieden, ob die zusammenarbeitenden Unternehmen<br />
aus unterschiedlichen Umfeldern stammen oder ob sie einander in der Wertschöpfungskette folgen. Wenn die<br />
Netzwerkpartner gemeinsam eine übergeordnete Strategie verfolgen, so wird auch von strategischen Netzwerken<br />
gesprochen. Diese unterscheiden sich von anderen Netzwerken vor allem dadurch, dass sie hierarchisch organisiert<br />
sind und von einem oder mehreren Kooperationspartnern die strategische Führung übernommen wird (z.B.<br />
Marktentscheidungen werden hauptsächlich von einem Unternehmen getroffen, Beispiel: Hollow Organization).<br />
Ein kooperatives Netzwerk lässt dagegen keine einheitliche Strategie erkennen. Als Beispiel sei hier eine<br />
Rationalisierungsgemeinschaft genannt.<br />
Zu den unterschiedlichen Ausprägungen der externen Netzwerke zählen die Virtuelle Organisation, das Franchising,<br />
das Subcontracting und Joint Ventures.<br />
Ferner ist zwischen dynamischen und stabilen Netzwerken zu unterscheiden.<br />
Nicht selten werden Unternehmensnetzwerke heute online realisiert. So genannte B2B-Netzwerke<br />
(Business-to-Business-Netzwerke) bieten geschlossenen oder halb-offenen Benutzergruppen vielfältige<br />
Möglichkeiten, ihre wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen.<br />
Ein Beispiel für solch ein Netzwerk ist das Open Business Network.<br />
Vorteile<br />
Durch die Netzwerkorganisation können Synergieeffekte und Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Die Beteiligten<br />
haben durch die Netzwerkorganisation eine Stellung, die ohne die Zusammenarbeit nicht erreichbar wäre. Weitere<br />
Vorteile sind der verbesserte Zugang zu Know-How und Informationen, da diese unter Netzwerkpartnern geteilt<br />
werden können. Netzwerke weisen des Weiteren eine verbesserte Flexibilität auf.<br />
Nachteile<br />
Nachteilig kann auf der anderen Seite der vermehrte Koordinations- und Kommunikationsaufwand, der durch die<br />
Abstimmung zwischen mehreren Beteiligten notwendig ist, sein. Bei mangelhafter Abstimmung zwischen den<br />
Netzwerkpartnern kann es zu Mehrfachausführungen bestimmter Aktivitäten und Mehrfacherfassungen von<br />
Informationen kommen - dies ist mit Zeitverzögernissen und nicht notwendigem Ressourceneinsatz verbunden. Die<br />
Vertrauensbildung zu zukünftigen Netzwerkpartnern kann sich ebenfalls schwierig gestalten.<br />
Anwendungsgebiete<br />
Die Netzwerkorganisation findet besonders bei Unternehmen mit hoher Spezialisierung, bei Klein- und<br />
Mittelbetrieben und bei international tätigen Unternehmen Anwendung. Der Grund dafür ist, dass einerseits Klein-<br />
und Mittelbetriebe durch die Netzwerkorganisation und den Zugriff auf externe Ressourcen mehr<br />
Wettbewerbsfähigkeit erlangen, andererseits können international tätige Unternehmen dadurch flexibler handeln. Die<br />
Netzwerkorganisation kann - allgemein gesprochen - überall dort gut eingesetzt werden, wo Anpassungsfähigkeit
Netzwerkorganisation 313<br />
wichtig ist.<br />
Literatur<br />
• Hans Corsten: Unternehmungsnetzwerke. Formen unternehmensübergreifender Zusammenarbeit. Oldenbourg,<br />
München/Wien 2001, ISBN 3-486-25733-1<br />
• Jörg Sydow (Hrsg.): Management von Netzwerkorganisationen. Gabler, Wiesbaden 2003, ISBN 3-409-31488-1<br />
• Jörg Sydow: Strategische Netzwerke. Evolution und Organisation. Gabler, Wiesbaden 1992, ISBN 3-409-13947-8<br />
• Victor Tiberius: Prozesse und Dynamik des Netzwerkwandels, Gabler, Wiesbaden 2008, ISBN<br />
978-3-8349-0967-1<br />
• Alfred Kieser, Peter Walgenbach: Organisation. Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-7910-2242-3<br />
• Georg Schreyögg: Organisation – Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. Gabler, Wiesbaden 2003,<br />
ISBN 3-409-47729-2<br />
• Manfred Schulte–Zurhausen: Organisation. Verlag Vahlen, München 2005, ISBN 3-8006-3205-5<br />
• Alexander Schmidt: co-opera - Kooperationen mit Leben füllen. Carl Auer, ISBN 978-3-89670-384-2<br />
• Arnold Windeler: Unternehmungsnetzwerke. Konstitution und Strukturation Westdeutscher Verlag 2001, ISBN<br />
3-531-13100-1<br />
• Udo Winand, Klaus Nathusius (Hrsg.): Unternehmungsnetzwerke und virtuelle Organisationen Schäffer-Poeschl<br />
1998, ISBN 3-7910-1309-2<br />
Siehe auch<br />
• Business-To-Business<br />
Weblinks<br />
• Kooperationsinitiative Maschinenbau in Braunschweig, Zusammenschluss von Maschinenbau-Unternehmen [1]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. made-in-braunschweig. de
Organisationssoziologie 314<br />
Organisationssoziologie<br />
Die Organisationssoziologie ist eine Teildisziplin der Soziologie, die sich der empirischen und theoretischen<br />
Erforschung der Formen sowie Strukturen und internen Prozesse von Organisationen widmet. Aufgrund der Vielfalt<br />
an Formen die Organisationen annehmen können (u.a. Unternehmen, Verbände, Vereine, Parteien, Universitäten,<br />
Schulen, Krankenhäuser, Theater, staatliche Verwaltung, Kirchen, Militär, Nichtregierungsorganisationen), bildet<br />
die Organisationstheorie traditionellerweise den Kern der Disziplin, da sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede<br />
dieser Formen sichtbar machen kann. Daneben weisen auch die Industrie- und Betriebssoziologie und die<br />
betriebswirtschaftliche Organisationslehre starke wechselseitige Bezüge zu der Organisationssoziologie auf.<br />
Während die betriebswirtschaftliche Organisationslehre sich mit dem zweckmäßigen und wirtschaftlich effizienten<br />
Aufbau von und Abläufen in Organisationen befasst, fokussiert die Organisationssoziologie auf die Erforschung von<br />
Strukturen, Mitgliedern, Zielen und Funktionen sowie von Handeln und Kommunikation in Organisationen.<br />
Gegenstand und Themen organisationssoziologischer Forschung<br />
Ihren Durchbruch verdankt die Disziplin Max Webers Bürokratietheorie und den Hawthornestudien<br />
(Hawthorne-Effekt, s. dort Roethlisberger/Dickson) während der Weltwirtschaftskrise. Letztere haben den<br />
Unterschied zwischen "formaler" und "informaler" Struktur von Organisationen entdeckt. Die Wechselwirkungen<br />
zwischen beiden sind bis heute Gegenstand der Forschung.<br />
Die organisationssoziologische Forschung beschäftigt sich u.a. mit den gesellschaftlichen Funktionen von<br />
Organisationen (Max Weber, Talcott Parsons, Charles Perrow, Niklas Luhmann), mit den Strukturtypen von<br />
Organisationen (Richard Scott), dem Prozessieren von Entscheidungen und der Absorption von Ungewissheit in<br />
Organisationen (Niklas Luhmann).<br />
Soziologen betrachten Organisationen sowohl als handlungsfähige Kollektivakteure bzw. als korporative Akteure in<br />
der Interaktion mit anderen Organisationen ihrer Umwelt wie auch als soziale Systeme [1] mit spezifischen<br />
Binnenproblemen (z.B. Bürokratie und Oligarchie, Mitgliederrekrutierung und -loyalität, Divergenz von<br />
Organisationsziel und Mitgliedermotivation).<br />
Entstehung der Organisationssoziologie als akademische Disziplin<br />
Die Institutionalisierung der Organisationssoziologie erfolgte in den USA und in Europa auf unterschiedlichen<br />
Entwicklungspfaden.<br />
In den USA wurde die Organisationstheorie – insbesondere durch die stark wachsende Bedeutung der<br />
Organisationsforschung an den Business Schools – praxisnah und interdisziplinär institutionalisiert. Die<br />
Theorieentwicklung gewann durch Robert K. Mertons Konzept der „Theorie mittlerer Reichweite“ an<br />
Unabhängigkeit von gesellschaftstheoretischen Fragen und den entsprechenden soziologischen „Großtheorien“<br />
(“grand theories”). Mertons Schüler (unter ihnen Philip Selznick, Alvin W. Gouldner, Peter Blau, Seymour M. Lipset<br />
und James S. Coleman) haben dieses Konzept erfolgreich vorangetrieben und zur nachhaltigen Etablierung der<br />
organization sciences als eigenständiger Disziplin mit einem umfangreichen Korpus empirischer Studien und einer<br />
Vielzahl spezialisierter Zeitschriften beigetragen. [2]<br />
Gegenüber dieser Erfolgsgeschichte nimmt sich die Organisationssoziologie in Europa als ein Orchideenfach aus.<br />
Von einer professionspolitischen Ausdifferenzierung wie in den USA sind die einzelnen europäischen „Schulen“ der<br />
Organisationstheorie weit entfernt. „Organisation“ wurde hier im Kontext von Kapitalismus- und Staatstheorien<br />
behandelt und ihre Probleme entsprechend in Debatten über Verwaltung oder Produktion thematisiert. Die konkreten<br />
Probleme der Praktiker wurden in der Unternehmens- und Organisationsberatung diskutiert. Sie wurden nicht als<br />
Probleme eigener Art betrachtet. Aus dem Schatten der Industriesoziologie – und der damals dominierenden<br />
Perspektive, der Kapitalverwertungslogik – vermochte sich die Organisationstheorie in Deutschland erst in den
Organisationssoziologie 315<br />
1980er-Jahren zu lösen.<br />
Die europäische Organisationstheorie befindet sich in einer Situation peripherer Bedeutung. Obwohl die historischen<br />
Wurzeln gleichermaßen in Europa und Nordamerika liegen, zeichnet sich bereits seit 1940, spätestens aber seit den<br />
1970er-Jahren eine Dominanz US-amerikanischer Ansätze ab, wenngleich in dieser „Zwischenphase“ teilweise enge<br />
Verbindungen amerikanischer Ansätze zu britischen Autoren und Schulen bestanden. Aus dem nordamerikanischen<br />
Zentrum beziehen europäische Organisationssoziologen ihre zentralen Ideen und Konzepte. Sie sind jedoch selber<br />
selten in der Lage, auf die wesentlichen Debatten in den USA mit innovativen und eigenständigen Konzepten zu<br />
antworten. [3]<br />
Anwendung<br />
Anwendung findet organisationssoziologische Forschung u. a. auch in Unternehmens- und Betriebsräteberatungen,<br />
die nach verschiedenen Schulen vorgehen, etwa dem mikropolitischen Ansatz (u. a. Crozier/Friedberg) oder dem<br />
systemtheoretischen Ansatz, den u. a. Niklas Luhmann und - in abgewandelter Form - auch Dirk Baecker für die<br />
Organisationssoziologie fruchtbar gemacht haben.<br />
Literatur<br />
• Martin Abraham / Günter Büschges: Organisationssoziologie. 3. Aufl. VS Verlag. Wiesbaden 2004.<br />
• Jutta Allmendinger / Thomas Hinz (Hrsg.): Organisationssoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und<br />
Sozialpsychologie, Sonderheft 42, 2002. Abstracts [4]<br />
• Günter Endruweit: Organisationssoziologie. 2. erweiterte und überarbeitete Auflage. Lucius & Lucius, Stuttgart<br />
2004.<br />
• Niklas Luhmann: Funktionen und Folgen formaler Organisation. Duncker & Humblot, Berlin 1964.<br />
• Niklas Luhmann: Organisation und Entscheidung. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2000.<br />
• Renate Mayntz: Soziologie der Organisation. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1963.<br />
• Walther Müller-Jentsch: Organisationssoziologie. Campus, Frankfurt am Main 2003.<br />
• Günther Ortmann, Jörg Sydow und Klaus Türk (Hrsg.): Theorien der Organisation. Die Rückkehr der<br />
Gesellschaft. VS, Wiesbaden 2000/1997, ISBN 978-3531329451.<br />
• Charles Perrow: Eine Gesellschaft von Organisationen. In: Journal für Gesellschaftsforschung. Jg. 28/1989, S.<br />
3-19.<br />
• W. Richard Scott: Grundlagen der Organisationstheorie. Campus, Frankfurt am Main 1986.<br />
Siehe auch<br />
• Arbeitsgruppe, Team<br />
• Managementsoziologie<br />
• Betriebswirtschaftliche Organisationslehre<br />
• Organisationspsychologie<br />
• Organisationstheorie
Organisationssoziologie 316<br />
Referenzen<br />
[1] Vgl. Unterkapitel "Organisation als Akteur und als System" in: Walther Müller-Jentsch: Organisationssoziologie, Frankfurt am Main 2003, S.<br />
18 ff.<br />
[2] Richard W. Scott: Institutions and Organizations: Theory and Research. Sage, Thousand Oaks, CA 1995.<br />
[3] Vgl. Hans-Joachim Gergs, Markus Pohlmann und Rudi Schmidt: Organisationssoziologie: Organisationstheorie, ihre gesellschaftliche<br />
Relevanz und "gesellschaftstheoretische Herausforderung". In: Richard Münch, Claudia Jauß und Carsten Stark (Hrsg.): „Soziologie 2000“ –<br />
Sonderheft der Soziologischen Revue. Sonderheft 5, 2000, S. 185f.; siehe auch Barry S. Turner: A Personal Trajectory through Organization<br />
Studies. In: Samuel Bacharach, Pasquale Gagliardi and Bryan Mundell (Hrsg.): Studies of Organizations in the European Tradition. Research<br />
in the Sociology of Organizations. 13, JAI Press, Greenwich/London 1995.; siehe auch Emil Walter-Busch: Organisationstheorien von Weber<br />
bis Weick. Fakultas, Amsterdam 1996, ISBN 978-90-5708-019-7.<br />
[4] http:/ / www. uni-koeln. de/ kzfss/ archiv00-02/ ks02shab. htm<br />
Dirk Baecker<br />
Dirk Baecker (* 11. August 1955 in Karlsruhe) ist ein deutscher Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für<br />
Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin University (ZU) in Friedrichshafen.<br />
Leben<br />
Nach seinem Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln und einem Studium der Soziologie und<br />
Nationalökonomie in Köln und Paris promovierte und habilitierte er im Fach Soziologie bei Niklas Luhmann an der<br />
Universität Bielefeld. Nach Forschungsaufenthalten an der Stanford University, Johns Hopkins University und an<br />
der London School of Economics erhielt er 1996 den Ruf auf den Reinhard-Mohn-Lehrstuhl für<br />
Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und gesellschaftlichen Wandel an der Universität Witten/Herdecke. Von<br />
2000 bis 2007 hatte er ebendort den Lehrstuhl für Soziologie inne. Zusammen mit Fritz B. Simon und Rudi Wimmer<br />
gründete er im <strong>Jan</strong>uar 2000 das Management-Zentrum Witten.<br />
Baecker erhielt im Jahr 2006 den Ruf auf den neuen Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse an die Zeppelin<br />
University (ZU), wo er seit 2007 forscht und lehrt. [1] Dirk Baecker lebt mit seiner Lebenspartnerin der Dramaturgin<br />
Carena Schlewitt und ihrem gemeinsamen Kind in Basel.<br />
Wirken<br />
Als Vertreter der Soziologischen Systemtheorie hat Baecker in Forschung und Lehre eine Vielzahl von<br />
soziologischen Gebieten und Fragestellungen durchdrungen. Dazu gehören Arbeiten zur Theorie der Kunst sowie<br />
der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien. Hervorgetreten ist er allerdings als Wirtschafts- und<br />
Organisationssoziologe mit Publikationen zu den Themen Planungs- und Entscheidungstheorie, Managementtheorie<br />
sowie mit Studien zum Begriff des Risikos. Auseinandergesetzt hat sich Baecker auch mit der Logik George<br />
Spencer-Browns.<br />
Baecker formuliert, dass Gott eine Beruhigung dafür sei, dass der Mensch an der Komplexität der Realität nichts<br />
ändern kann. Gott sei somit eine Erfindung des Menschen, die der Komplexitätsreduktion dient und den Menschen<br />
die Wahl abnimmt. Dieser Vorteil von Religionen für soziale Gruppen kann sich jedoch ins Gegenteil verkehren:<br />
Offenbar schafft die Religion derartige Prämien für ihre Anhänger, dass sich daraus im Extremfall auch<br />
Selbstmordattentate motivieren lassen. Indem Gott dem Menschen die Wahl abnimmt, besteht die Gefahr, Dinge<br />
nicht mehr zu hinterfragen. Religion stelle somit eine Gefahr für die Aufklärung dar. [2]<br />
Baecker sieht den derzeitigen Kapitalismus als „exklusive und exkludierende Religion“, der beständig illegitim<br />
Ressourcen verbrauche, und dessen religiös imperatives Bestreben die „Ausbeutung der einen und der<br />
Gewinnsteigerung der anderen“ sei. Dieser „Kapitalismus, seine Priester, seine Götter und seine Opfer“ seien „unter<br />
uns“, nur für die Auserwählten habe er „ein Herz und einen Sinn“. [3]
Dirk Baecker 317<br />
Baecker ist weiterhin Mitherausgeber der Zeitschriften Soziale Systeme und der „Revue für postheroisches<br />
Management“ [4] sowie Herausgeber der Buchreihe copyrights im Berliner Kulturverlag Kadmos. Dirk Baecker<br />
nahm am Projekt „Medientheater“ von Till Nikolaus von Heiseler teil, in dem es um experimentelle Theorieformate<br />
geht. Er ist in der intellektuellen Szene Berlins prominent und tritt regelmäßig bei Veranstaltungen vor allem im<br />
Hebbeltheater am Ufer auf.<br />
Schriften<br />
• Information und Risiko in der Marktwirtschaft, 1988<br />
• Womit handeln Banken?. Frankfurt am Main 1991 (Neues Vorwort Dezember 2008)<br />
• Probleme der Form. Frankfurt am Main 1993<br />
• Postheroisches Management. Ein Vademecum. Merve Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-88396-117-5<br />
• Poker im Osten. Probleme der Transformationsgesellschaft. Berlin: Merve. 1998. ISBN 3-88396-140-X<br />
• Die Form des Unternehmens. Frankfurt am Main 1993, Tb. 1999<br />
• Organisation als System. Frankfurt am Main 1999<br />
• Wozu Kultur?. Berlin 2000<br />
• Wozu Systeme?. o.O. (Berlin 2002)<br />
• Vom Nutzen ungelöster Probleme. Gespräch mit Alexander Kluge. Berlin: Merve. 2003. ISBN 3-88396-186-8<br />
• Organisation und Management. Frankfurt am Main 2003<br />
• Wozu Soziologie?. Berlin 2004<br />
• Schlüsselwerke der Systemtheorie. VS Verlag, Wiesbaden 2005<br />
• Kommunikation. Reclam, Leipzig 2005<br />
• Form und Formen der Kommunikation. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005<br />
• Wirtschaftssoziologie. Bielefeld: transcript, 2006<br />
• Wozu Gesellschaft?. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2007<br />
• Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt am Main 2007, ISBN 3-518-29456-3, Rezension [5] in der taz vom<br />
19. <strong>Jan</strong>uar 2008<br />
• Nie wieder Vernunft. Kleinere Beiträge zur Sozialkunde. Carl-Auer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-89670-622-5<br />
Weblinks<br />
• Literatur von und über Dirk Baecker [6] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek<br />
• http:/ / www. dirkbaecker. com/<br />
• http:/ / www. zeppelin-university. de/ kulturtheorie<br />
• „Zur Zukunft der Form“ Abschiedsvorlesung von Dirk Baecker an der Universität Witten/Herdecke [7]<br />
• Antrittsvorlesung von Dirk Baecker an der Zeppelin-University als mp3-Datei [8]<br />
• http:/ / journal. systemone. at/ spaces/ journal/ members/ Dirk+ Baecker<br />
• Videoclips: Antworten zu "Fragen zur Kunst" [9]<br />
• rebell.tv: Begegnungen mit Dirk Baecker [10]
Dirk Baecker 318<br />
Referenzen<br />
[1] „Professor Dr. Dirk Baecker an die [[Zeppelin University (http:/ / idw-online. de/ pages/ de/ news193394)] berufen“], idw, 24. <strong>Jan</strong>uar 2007.<br />
[2] „Meine Lehre ist, daß man keine Lehre akzeptieren soll“: Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen - eine Buchbesprechung“<br />
(http:/ / www. univie. ac. at/ constructivism/ HvF/ review_anfang. html), die tageszeitung, 16. Juni 1998 (Universität Wien)<br />
[3] Kapitalismus als Religion, mit W. Benjamin, N. Bolz, C. Deutschmann, Kulturverlag Kadmos, 2003<br />
[4] Postheroisches Management (http:/ / postheroisches-management. de) Internetpräsenz der „Revue für postheroisches Management“<br />
[5] http:/ / www. taz. de/ nc/ 1/ archiv/ digitaz/ artikel/ ?ressort=ku& dig=2008%2F01%2F19%2Fa0202& src=GI& cHash=75d1e45012<br />
[6] https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D120032929& method=simpleSearch<br />
[7] http:/ / www. kluge-software. com/ symposium/ audio/ baecker. mp3<br />
[8] http:/ / www. zeppelin-university. de/ index_de. php?navid=0<br />
[9] http:/ / www. fragen-zur-kunst. de/ #p40<br />
[10] http:/ / blog. rebell. tv/ p5240. html<br />
Niklas Luhmann<br />
Niklas Luhmann (* 8. Dezember 1927 in Lüneburg; † 6. November 1998 in Oerlinghausen) war ein deutscher<br />
Soziologe, Philosoph, Verwaltungsbeamter und Gesellschaftstheoretiker. Als einer der Begründer der soziologischen<br />
Systemtheorie gilt Luhmann als transdisziplinärer Sozialwissenschaftler. Seine zahlreichen Publikationen<br />
thematisieren philosophische, linguistische, literatur- und medienwissenschaftliche, juristische, ökonomische,<br />
biologische, theologische und pädagogische Probleme.<br />
Leben<br />
Luhmann wurde 1927 in die Familie eines Brauereibesitzers in Lüneburg geboren und besuchte das heute noch<br />
bestehende Johanneum. Im Alter von 15 Jahren wurde er als Luftwaffenhelfer eingezogen und war bis September<br />
1945 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, zu der er in einem Interview einmal sagte: „[…] die Behandlung war<br />
– gelinde gesagt – nicht nach den Regeln der internationalen Konventionen. [1] “ Wie erst 2007 bekannt wurde, war<br />
Niklas Luhmann zwar als Mitglied der NSDAP verzeichnet, jedoch berichtete der Spiegel [2] : „Unterschriebene<br />
Aufnahmeanträge liegen in keinem Fall vor“ [3] , sodass es möglich ist, dass Luhmann und andere Betroffene seiner<br />
Generation der damals 16- oder 17-Jährigen von ihrer Mitgliedschaft nichts gewusst hatten.<br />
Luhmann studierte von 1946 bis 1949 Rechtswissenschaft in Freiburg im Breisgau. Es folgte bis 1953 eine<br />
Referendarausbildung in Lüneburg. 1954–1962 war er Verwaltungsbeamter in Lüneburg, 1954–1955 am<br />
Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Assistent des Präsidenten. In dieser Zeit begann er auch mit dem Aufbau seiner<br />
Zettelkästen. 1960 heiratete er Ursula von Walter. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Seine Ehefrau verstarb<br />
1977.<br />
1960/1961 erhielt Luhmann ein Fortbildungs-Stipendium für die Harvard-Universität, das er nach erteilter<br />
Beurlaubung wahrnehmen konnte. Dort kam er in Kontakt mit Talcott Parsons und dessen strukturfunktionaler<br />
Systemtheorie. Nach seiner Tätigkeit als Referent an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften<br />
Speyer von 1962 bis 1965 und seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter an der Sozialforschungsstelle an der Universität<br />
Münster in Dortmund von 1965 bis 1968 (1965/66 daneben ein Semester Studium der Soziologie an der<br />
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster) promovierte er dort 1966 zum Dr. sc. pol. (Doktor der<br />
Sozialwissenschaften) mit dem bereits 1964 erschienenen Buch Funktionen und Folgen formaler Organisation und<br />
habilitierte sich fünf Monate später bei Dieter Claessens und Helmut Schelsky mit Recht und Automation in der<br />
öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung. 1968 bis 1993 lehrte er dann als<br />
Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld.<br />
1989 wurde er mit dem Hegel-Preis der Stadt Stuttgart ausgezeichnet, 1997 mit dem Premio Amalfi.<br />
Niklas Luhmann wohnte mehrere Jahrzehnte in Oerlinghausen bei Bielefeld, wo er 1998 an einer nicht endgültig<br />
geklärten Krankheit starb. Verschiedenen Quellen nach litt Luhmann an einem leukämieähnlichen Blutzellenkrebs [4]
Niklas Luhmann 319<br />
.<br />
Zwei Jahre nach seinem Tod wurde im Jahre 2000 das vorherige „Städtische Gymnasium Oerlinghausen“ in<br />
„Niklas-Luhmann-Gymnasium“ umbenannt.<br />
Seit 2004 verleiht die Stiftung der Sparkasse Bielefeld alle zwei Jahre im Gedächtnis an Niklas Luhmann den mit<br />
25.000 Euro dotierten Bielefelder Wissenschaftspreis.<br />
Die Geburtsstadt Niklas Luhmanns, die Hansestadt Lüneburg, hat ihm zu Ehren 2008 einer Straße in einem<br />
Neubaugebiet im Westen der Stadt seinen Namen verliehen. [5]<br />
Charakterisierung des Werks<br />
Luhmanns Systemtheorie versteht Gesellschaft nicht als eine Ansammlung von Menschen mit Blutkreisläufen und<br />
sonstigen, nicht-sozialen Systemen, sondern als einen operativ geschlossenen Prozess sozialer Kommunikation.<br />
Siehe auch den Hauptartikel Systemtheorie (Luhmann)<br />
Die Systemtheorie thematisiert selbstreferenzielle soziale Operationen (Kommunikation). Selbstreferenziell soll<br />
heißen, dass sich Systeme nur auf ihre internen Operationen beziehen und trotzdem kognitiv offen sind. Die<br />
Leitdifferenz eines gesellschaftlichen Funktionssystems bezieht sich immer auf die System/Umwelt-Unterscheidung<br />
(beispielsweise „Das Recht/alles außerhalb des Systems des Rechts“ für das Rechtssystem). Die Leitdifferenzen von<br />
gesellschaftlichen Funktionssystemen bezeichnet Luhmann als Codes (im Beispiel „Recht/Unrecht“ für das<br />
Rechtssystem). Die meisten Funktionssysteme orientieren sich an symbolisch generalisierten<br />
Kommunikationsmedien, die Wirtschaft etwa an Geld.<br />
Luhmanns Systemtheorie basiert auf der Gleichsetzung von Gesellschaft mit Kommunikation. Er behandelt<br />
Evolution von Kommunikation – von Oralität (mündlicher Kommunikation) über Schrift bis hin zu elektronischen<br />
Medien – und parallel auf der Evolution von Gesellschaft durch funktionale Ausdifferenzierung (siehe auch soziale<br />
Differenzierung). Daraus ergeben sich drei Stränge:<br />
1. Systemtheorie als Gesellschaftstheorie,<br />
2. Theorie der Interaktion (face-to-face-Kommunikation) und<br />
3. Evolutionstheorie,<br />
die sich durch sein gesamtes Werk ziehen. [6]<br />
Seit den 1980er Jahren bezieht sich Luhmann grundlegend auf die Differenzlogik der Laws of Form des britischen<br />
Mathematikers George Spencer-Brown.<br />
Wirkung in der Soziologie und darüber hinaus<br />
Die luhmannsche Systemtheorie (in Abgrenzung zur allgemeinen Systemtheorie von Ludwig von Bertalanffy u. a.<br />
sowie zur Theorie sozialer Systeme von Talcott Parsons) gilt derzeit als eines der wohl erfolgreichsten und<br />
populärsten Theorieangebote im deutschen Sprachraum, nicht nur in der Soziologie, sondern auch in so diversen<br />
Feldern wie der Psychologie, der Theorie des Managements oder der Literaturtheorie. Auch international beeinflusst<br />
sie den sozialphilosophischen Diskurs, wobei sich nennenswerte Luhmann-Strömungen in Deutschland, den USA,<br />
Japan, Italien und Skandinavien herausgebildet haben.<br />
Luhmann bezeichnete sich zwar zeitlebens als Soziologe, doch kann man ihn – ähnlich wie Jürgen Habermas –<br />
gleichzeitig auch als Wissenschaftstheoretiker auffassen, der die Soziologie sehr angeregt hat und der eine<br />
bemerkenswerte soziologische Urteilskraft besaß. In verschiedenen Bereichen der Philosophie werden Ideen<br />
Luhmanns rezipiert.<br />
Das Fehlen eines primär normativen Elements in der Systemtheorie Luhmanns hat eine teilweise heftige Debatte<br />
nicht nur in der Soziologie entfacht. Aus erkenntnistheoretischer Perspektive wird moniert, die Theorie laufe auf<br />
Grund ihres tautologischen, deskriptiven Ansatzes leer und sage uns nicht mehr über die Welt, als was wir aufgrund
Niklas Luhmann 320<br />
fachwissenschaftlicher Erkenntnisse ohnehin schon über sie wissen oder wissen könnten. Genau dieser<br />
konstruktivistische Ansatz ist allerdings der Kern des Ganzen: Als Beobachter der Welt können wir nach Luhmann<br />
nur das beobachten und identifizieren, was wir beobachten können, und nichts, was darüber hinausgeht.<br />
Schriften<br />
Grundlegende funktionssystemübergreifende Hauptwerke<br />
• Soziale Systeme (1984), ISBN 3-518-28266-2<br />
• Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997), ISBN 3-518-58240-2<br />
Monographien-Reihe über einzelne Funktionssysteme<br />
• Die Wirtschaft der Gesellschaft (1988), ISBN 3-518-28752-4<br />
• Die Wissenschaft der Gesellschaft (1990), ISBN 3-518-28601-3<br />
• Das Recht der Gesellschaft (1993), ISBN 3-518-28783-4<br />
• Die Realität der Massenmedien (1996), ISBN 3-531-12841-8<br />
• Die Kunst der Gesellschaft (1997), ISBN 3-518-28903-9<br />
• Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997), ISBN 3-518-28960-8<br />
• Rezension: [[Hauke Brunkhorst [5] ] in Die Zeit, 13. Juni 1997.]<br />
• Die Politik der Gesellschaft (2000), ISBN 3-518-29182-3<br />
• Die Religion der Gesellschaft (2000), ISBN 3-518-29181-5<br />
• Das Erziehungssystem der Gesellschaft (2002), ISBN 3-518-29193-9<br />
• Die Moral der Gesellschaft (zusammen mit Detlef Horster, 2008), ISBN 978-3-518-29471-0<br />
Einführend<br />
• Einführung in die Systemtheorie (2002), ISBN 3-89670-292-0<br />
• Einführung in die Theorie der Gesellschaft (2005), ISBN 3-89670-477-X<br />
• mit Raffaele De Giorgi Teoria della società (1992), ISBN 88-204-7299-6<br />
Organisationssoziologie<br />
• Funktionen und Folgen formaler Organisationen (1964)<br />
• Zweckbegriff und Systemrationalität (1968)<br />
• Organisation und Entscheidung (2000), ISBN 3-531-13451-5<br />
• Rezensionen: Detlef Horster in SZ, 17. Juni/18. Juni 2000; Niels Werber in: FR, 30. August 2000.<br />
Zur Gesellschaftsstruktur und Semantik<br />
• Gesellschaftsstruktur und Semantik, 4 Bde.<br />
• Liebe als Passion (1982)<br />
• Beobachtungen der Moderne (1992), ISBN 3-531-12263-0<br />
• Ideenevolution (Herausgegeben von André Kieserling, 2008), ISBN 3-518-29470-9<br />
Abklärung der Aufklärung<br />
• Soziologische Aufklärung, 6 Bde.<br />
Weitere Werke<br />
• Funktion und Kausalität. in: KZfSS 14, 1962, S. 617 - 644; wieder in Jürgen Friedrichs & Karl Ulrich Mayer &<br />
Wolfgang Schluchter, Hgg.: Soziologische Theorie und Empirie. KZfSS. Auswahlband. Westdeutscher Verlag,<br />
Opladen 1997 ISBN 3-5311-3139-7 S. 23 - 50<br />
• Grundrechte als Institution (1965), ISBN 3-428-00959-2<br />
• Öffentlich-rechtliche Entschädigung, rechtspolitisch betrachtet (1965)<br />
• Vertrauen - ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität (1968)<br />
• Zweckbegriff und Systemrationalität (1968)
Niklas Luhmann 321<br />
• Legitimation durch Verfahren (1969), ISBN 3-518-28043-0<br />
• Politische Planung (1972)<br />
• Macht (1975)<br />
• Funktion der Religion (1977)<br />
• Rechtssoziologie (1980)<br />
• Ökologische Kommunikation (1986), ISBN 3-531-51775-9<br />
• Reden und Schweigen (zusammen mit Peter Fuchs, 1989)<br />
• Soziologie des Risikos (1991), ISBN 3-11-012939-6<br />
• Schriften zu Kunst und Literatur (Herausgegeben von Niels Werber, 2008), ISBN 978-3-518-29472-7<br />
• Politische Soziologie (Herausgegeben von André Kieserling, 2010), ISBN 978-3-518-58541-2<br />
Siehe auch<br />
Zahlreiche Begriffe der Soziologie wurden von ihm geschaffen, mehr noch aufgegriffen und systemtheoretisch neu<br />
interpretiert. Hierzu siehe im Einzelnen:<br />
• Anschluss, Beobachtung, Differenz (Systemtheorie), Funktionale Differenzierung, Kommunikation<br />
(Systemtheorie), Resonanz, Soziales System, Strukturelle Kopplung, Zeitdimension<br />
• Autopoiesis, Doppelte Kontingenz (vgl. Kontingenz)<br />
Als renommierte Soziologen, die an Luhmanns Werk anknüpfen und sich ihm verbunden fühlen, gelten u. a. Dirk<br />
Baecker, Elena Esposito, Peter Fuchs, Andreas Göbel, André Kieserling, Armin Nassehi, Rudolf Stichweh, Gunther<br />
Teubner und Helmut Willke.<br />
Literatur<br />
Philosophiebibliographie: Niklas Luhmann – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema<br />
Einführungen<br />
• Margot Berghaus: Luhmann leicht gemacht. 2. Auflage. Böhlau-Verlag, Köln 2003, ISBN 3-8252-2360-4.<br />
• Peter Fuchs: Niklas Luhmann - beobachtet. 3. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004,<br />
ISBN 3-531-32352-0.<br />
• Helga Gripp-Hagelstange: Niklas Luhmann. Eine erkenntnistheoretische Einführung. 2. Auflage. Fink, München<br />
1997, ISBN 3-8252-1876-7, ISBN 3-7705-3060-8 (UTB 1876).<br />
• Detlef Horster: Niklas Luhmann. 2. Auflage. Beck, München 2005 (Beck'sche Reihe Bd. 538; Denker).<br />
• Georg Kneer, Armin Nassehi: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung. Fink, München 1993,<br />
ISBN 3825217515.<br />
• Walter Reese-Schäfer: Niklas Luhmann zur Einführung. 4. Auflage. Junius, Hamburg 2001, ISBN 3-88506-305-0<br />
(Zur Einführung, Bd. 205).<br />
• Christian Schuldt: Systemtheorie. 2. Auflage. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2006, ISBN 3-4344-6153-1.<br />
• David Seidl und Kai Helge Becker: Niklas Luhmann and Organization Studies. Copenhagen Business School<br />
Press, Kopenhagen 2005, ISBN 978-8763001625.<br />
Festschriften, Sonstiges, Bibliographien<br />
• Niklas Luhmann: Archimedes und wir. Interviews. In: Dirk Baecker, Georg Stanitzek (Hrsg.): {{{Sammelwerk}}}.<br />
Merve Verlag, Berlin 1987, ISBN 3-88396-063-2.<br />
• Wolfgang Hagen (Hrsg.): Warum haben Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann?. Letzte Gespräche mit Niklas<br />
Luhmann. Dirk Baecker, Norbert Bolz, Wolfgang Hagen, Alexander Kluge. Kulturverlag Kadmos, Berlin<br />
2004/2005, ISBN 3-931659-59-3.<br />
• Hörspiel Luhmann von Tom Peuckert, Regie: Leonhard Koppelmann, Produktion WDR 2006
Niklas Luhmann 322<br />
• Klaus Dammann & Dieter Grunow & Klaus P. Japp, Hgg.: Die Verwaltung des politischen Systems. Neuere<br />
systemtheoretische Zugriffe auf ein altes Thema. Niklas Luhmann zum 65. Geburtstag. Mit einem<br />
Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen L.s 1958-1992, Opladen 1994<br />
• Dirk Baecker & Jürgen Markowitz & Rudolf Stichweh & Hartmann Tyrell & Helmut Willke, Hgg.: Theorie als<br />
Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag. Frankfurt 1987. Mit Bibliographie<br />
Hilfsmittel<br />
• Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi, Elena Esposito: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme.<br />
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-28826-1 (Nachdruck; stw 1226).<br />
• Henk de Berg: Luhmann in literary studies. A bibliography. LUMIS, Siegen 1995 (Als Typoskript gedruckt;<br />
LUMIS-Schriften aus dem Institut für Empirische Literatur- und Medienforschung der<br />
Universität-Gesamthochschule Siegen Bd. 42).<br />
• Detlef Krause: Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann mit 27 Abbildungen<br />
und über 500 Stichworten. 4. Auflage. UTB, Stuttgart 2005, ISBN 3-825-22184-9.<br />
Literatur zu Luhmanns Systemtheorie befindet sich im Artikel Systemtheorie<br />
Audio<br />
• Ulrike Schmitzer: Der Mann mit dem Zettelkasten: Zum 10. Todestag von Niklas Luhmann, Salzburger<br />
Nachtstudio, 5. November 2008. [7]<br />
• Peter Lohmann: Der Streit um den Zettelkasten. Oktober 2003. [8]<br />
Weblinks<br />
• Literatur von und über Niklas Luhmann [9] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek<br />
• Bio-Bibliographischer Eintrag an der Universität Graz [10]<br />
• Einführung in Luhmanns Systemtheorie selbstreferentieller Systeme [6]<br />
• Luhmann für Einsteiger. Multimediale Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann [11]<br />
• Texte und Rezensionen, die eine Annäherung an Luhmanns Werk erleichtern [11]<br />
• Einführende und weiterführende Texte vor allem zu den philosophischen und medientheoretischen Aspekten<br />
Luhmanns [12]<br />
• Archiv der Luhmann Mailinglist bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft [13]<br />
• Interview mit Luhmann über Systemtheorie (1994) [4]<br />
• Zettelkasten als Programm für PCs [14]<br />
• Überblick über Luhmanns Humor [15]<br />
• Umfangreiche Reportage aus der WELT v. 5. November 2008 zum 10. Todestag Luhmanns [16]<br />
• Niklas Luhmann im kommunikationswissenschaftlichen Lern-Online-Software-System (KOLOSS) [17] auf<br />
myKoWi.net [18] (Universität Duisburg-Essen); mit Foto<br />
• Einführung in die Systemtheorie - Vorlesung von Niklas Luhmann als kostenloses 14-teiliges mp3-Archiv [15]
Niklas Luhmann 323<br />
Referenzen<br />
[1] Detlef Horster: Niklas Luhmann. München 1997, S. 28.<br />
[2] Mitgliederverzeichnis: Eppler räumt NSDAP-Parteimitgliedschaft ein - Panorama - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten (http:/ / www. spiegel.<br />
de/ panorama/ zeitgeschichte/ 0,1518,494425,00. html)<br />
[3] "[[Kategorie:Vorlage Der Spiegel mit alten Parametern (http:/ / www. spiegel. de/ spiegel/ print/ d-52263711. html)] Hoffnungslos<br />
dazwischen. Nazi-Akten geben neue prominente Namen preis - doch die Mitgliedskarten der NSDAP besagen nichts über Schuld oder<br />
Verstrickung der damals 16- oder 17-Jährigen]"; in: Der Spiegel (Hamburg), Nr. 29 v. 16. Juli 2007, S.134f., hier 134<br />
[4] Detlef Horster: Niklas Luhmann. Was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. In: Jochem Hennigfeld, Heinz <strong>Jan</strong>sohn (Hrsg.):<br />
Philosophen der Gegenwart. Darmstadt 2005, S. 179–197 (hier: S. 179).<br />
[5] Beschluss des Rates der Stadt Lüneburg zur Benennung der Niklas-Luhmann-Straße im Baugebiet Brockwinkler Weg (http:/ / www. stadt.<br />
lueneburg. de/ bi/ vo020. asp?VOLFDNR=2815)<br />
[6] Niklas Luhmann: Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie. In: Soziologische Gids. 22, Nr. 3, 1975, S. 154–168.<br />
[7] ORF Ö1 Salzburger Nachrichten (http:/ / oe1. orf. at/ programm/ 200811059201. html) Ö1 Luhmann + Systemtheorie (http:/ / oe1. orf. at/<br />
highlights/ 128676. html) Der Mann mit dem Zettelkasten. Zum 10. Todestag von Niklas Luhmann, 5. November 2008.<br />
[8] Peter Lohmann. Der Streit um den Zettelkasten. Oktober 2003. (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=FtFiqViBAik)<br />
[9] https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D118575147& method=simpleSearch<br />
[10] http:/ / agso. uni-graz. at/ lexikon/ klassiker/ luhmann/ 26bio. htm<br />
[11] http:/ / www. systemagazin. de/ beitraege/ luhmann/ index_luhmann_special_index. php<br />
[12] http:/ / www. autopoietische-systeme. de/<br />
[13] http:/ / www. listserv. dfn. de/ cgi-bin/ wa?A0=luhmann<br />
[14] http:/ / zettelkasten. danielluedecke. de/ index. php<br />
[15] http:/ / gedankenstrich. org/ 2010/ 05/ so-etwas-muss-sofort-beseitigt-werden/<br />
[16] http:/ / www. welt. de/ kultur/ article2674164/ Luhmann-lesen-ist-wie-Techno-zu-hoeren. html<br />
[17] http:/ / www. mykowi. net/ content. php?page=koloss<br />
[18] http:/ / www. mykowi. net
Protagonisten, Literatur & Quellen<br />
Tim Berners-Lee<br />
Sir Timothy John Berners-Lee, OM, KBE, FRS (* 8. Juni 1955 in London) ist<br />
ein britischer Informatiker. Er ist der Erfinder der HTML (Hypertext Markup<br />
Language) und der Begründer des World Wide Web. Heute steht er dem World<br />
Wide Web Consortium (W3C) vor und ist Professor am Massachusetts Institute<br />
of Technology (MIT).<br />
Biographie<br />
Erste Jahre<br />
Berners-Lee ist der Sohn eines Mathematiker-Ehepaares, das den Manchester<br />
Mark I mitentwickelte. Er beschäftigte sich bereits als Jugendlicher mit<br />
Computern. Nach dem Abschluss an der Emanuel School in Battersea studierte<br />
er an der University of Oxford in England Physik, wo er 1976 am Queens<br />
College abschloss. Es folgten zwei Jahre bei Plessey Telecommunications Ltd<br />
Tim Berners-Lee auf der Campus<br />
Party Brazil, 2009<br />
(Poole, UK). 1978 wechselte er zu D.G Nash Ltd (Ferndown, UK), wo er als Software-Entwickler arbeitete. In seiner<br />
Zeit als beratender Ingenieur hatte er von Juni bis Dezember 1980 seinen ersten Kontakt zum europäischen<br />
Kernforschungszentrum CERN. 1981 bis 1984 war er Direktor von Image Computer Systems in Bournemouth,<br />
kehrte aber 1984 wieder zum CERN zurück. [1]<br />
Berners-Lee und das World Wide Web<br />
Ein Problem am CERN war, dass sich ein Teil der Laboratorien auf<br />
französischem Gebiet befanden, ein anderer Teil auf schweizerischem<br />
Gebiet. In den beiden Ländern herrschte eine unterschiedliche<br />
Netzwerk-Infrastruktur, die den Austausch von Informationen<br />
erschwerte, wenn nicht unmöglich machte. 1989 schlug Berners-Lee<br />
seinem Arbeitgeber CERN ein Projekt vor, das auf dem Prinzip des<br />
Hypertexts beruhte und den weltweiten Austausch sowie die<br />
Aktualisierung von Informationen zwischen Wissenschaftlern<br />
vereinfachen sollte. Er verwirklichte dieses Projekt und entwickelte<br />
dazu den ersten Browser WorldWideWeb und den ersten Webserver<br />
unter dem Betriebssystem NeXTStep. Dies sollte den Ursprung des<br />
World Wide Webs darstellen.<br />
Der erste Webserver der Welt, entwickelt und<br />
implementiert von Berners-Lee auf einem<br />
NeXTcube-Computer<br />
Berners-Lee erstellte die erste Webpräsenz, http://info.cern.ch. Die Seite existiert nicht mehr, es gibt aber eine Kopie<br />
aus dem Jahr 1992 [2] . Sie erläuterte unter anderem,<br />
• was das World Wide Web sein sollte,<br />
• wie man an einen Webbrowser kommt,<br />
• wie man einen Webserver aufsetzt.<br />
324
Tim Berners-Lee 325<br />
Ursprünglich war dies auch die erste einfache Suchmaschine, denn Berners-Lee betreute noch andere Webpräsenzen<br />
außer seiner eigenen.<br />
Die Grundideen des World Wide Webs sind vergleichsweise einfach zu begreifen. Berners-Lee sah und verknüpfte<br />
sie jedoch in einer Weise, deren Möglichkeiten bis heute noch nicht vollständig ausgeschöpft sind.<br />
1994 gründete Berners-Lee das World Wide Web Consortium (W3C) am Massachusetts Institute of Technology.<br />
Wichtig war, dass er seine Ideen und technischen Umsetzungen nicht patentierte, sondern frei weitergab. Auch auf<br />
die Maxime des World Wide Web Consortiums, nur patentfreie Standards zu verabschieden, hatte er starken<br />
Einfluss.<br />
In seinem Buch Weaving the Web (deutsch: Der Web-Report, 1999) wird z. B. Folgendes betont:<br />
• Das Web editieren zu können ist genauso wichtig, wie durch das Web zu browsen (hierfür ist ein Wiki ein gutes<br />
Beispiel, siehe auch Writable Web).<br />
• Computer können genutzt werden, um im Hintergrund Aufgaben zu erledigen, damit Gruppen besser<br />
zusammenarbeiten können.<br />
• Jeder Bereich des Internets sollte eher eine Netzstruktur als eine Baumstruktur haben. Erwähnenswerte<br />
Ausnahmen sind das Domain Name System und die Regeln für die Vergabe von Domainnamen durch die ICANN.<br />
• Informatiker tragen nicht nur eine technische, sondern auch eine moralische Verantwortung.<br />
Berners-Lees Vorstellung von der Zukunft des Internet ist das semantische Web.<br />
Aktuelles<br />
Derzeit lebt Berners-Lee mit seiner Frau Nancy und seinen Kindern Alice und Ben in Lexington, Massachusetts,<br />
USA. Er ist seit 1999 Inhaber des 3Com-Founders-Lehrstuhls am Laboratory for Computer Science des<br />
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zudem steht er dem World Wide Web Consortium vor, dem von ihm<br />
gegründeten offenen Forum für Unternehmen und Organisationen, das die weitere Entwicklung des WWW begleitet.<br />
Für 2010 wurde das World Wide Web für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Da nur Institutionen mit<br />
persönlichen Repräsentanten ausgezeichnet werden dürfen, wurde Tim Berners-Lee gemeinsam mit Larry Roberts<br />
und Vint Cerf vorgeschlagen. [3]<br />
Auszeichnungen<br />
• 1995 erhält er den Ehren-Nica des Prix Ars Electronica für die Einführung des Hypertext [4]<br />
• 1998 erhält er den Eduard-Rhein-Technologiepreis „für die Schöpfung und Entwicklung des heute international<br />
sogenannten World Wide Web“. [5]<br />
• 2001 wird er in die Royal Society aufgenommen<br />
• 2002 erhält er den Japan-Preis<br />
• 2004 wurde er von Königin Elisabeth II. für seine Verdienste im Bereich der Wissenschaft mit dem Orden Knight<br />
Commander of the Order of the British Empire (KBE) ausgezeichnet und damit in den Ritterstand erhoben<br />
• 2004 erhält er den Millennium Technology Prize für seine Erfindung des World Wide Web<br />
• 2005 erhält er die Quadriga [6] Netzwerk des Wissens<br />
• Am 13. Juni 2007 wurde er von Königin Elisabeth II. in den Order of Merit (OM) aufgenommen.<br />
• 2007 Charles-Stark-Draper-Preis
Tim Berners-Lee 326<br />
Ehrendoktorwürden<br />
• Doctor of Fine Arts (DFA hon.), Parsons The New School for Design, New York City, 1996<br />
• Doctor of University (DU hon.), University of Essex, 1998<br />
• Doctor of University (DU hon.), Southern Cross University, 1998<br />
• Doctor of University (DU hon.), Open University, 2000<br />
• Doctor of Laws (DLaw hon.), Columbia University, 2001<br />
• Doctor of Science (DSc hon.), Universität Southampton, 1996<br />
• Doctor of Science (DSc hon.), Oxford University, 2001<br />
• Doctor of Science (DSc hon.), University of Port Elizabeth, 2002<br />
• Doctor of Science (DSc hon.), Lancaster University, 2004<br />
• Universitat Oberta de Catalunya, 2008<br />
[7] [8]<br />
• Polytechnische Universität Madrid, 2009<br />
Literatur<br />
• Tim Berners-Lee und Mark Fischetti: Der Web-Report. Der Schöpfer des World Wide Webs über das grenzenlose<br />
Potential des Internets. Aus dem Amerikanischen von Beate Majetschak. Econ, München 1999. ISBN<br />
3-430-11468-3<br />
• Weaving the Web. The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. (engl. Orig. Titel)<br />
Siehe auch<br />
• Webwissenschaft<br />
Weblinks<br />
• Literatur von und über Tim Berners-Lee [9] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek<br />
• Biographie Berners-Lees beim W3C [10] (englisch)<br />
• Weblog Berners-Lees beim MIT [11] (englisch)<br />
• Web Science Research Initiative WSRI [12] (englisch)<br />
Referenzen<br />
[1] Biographie bei www.w3.org (http:/ / www. w3. org/ People/ Berners-Lee/ Longer. html)<br />
[2] Kopie der ersten Webpräsenz info.cern.ch beim W3C (http:/ / www. w3. org/ History/ 19921103-hypertext/ hypertext/ WWW/ TheProject.<br />
html)<br />
[3] Sueddeutsche.de (http:/ / www. sueddeutsche. de/ computer/ 609/ 505797/ text/ ) (vom 13. März 2010)<br />
[4] Prix Ars Electronica 1995 (http:/ / www. aec. at/ de/ archives/ prix_archive/ prix_projekt. asp?iProjectID=9563)<br />
[5] Homepage der Eduard Rhein Stiftung (http:/ / www. eduard-rhein-stiftung. de/ html/ hauptseite. html)<br />
[6] Die Quadriga der Werkstatt Deutschland e.V. (http:/ / www. rat-fuer-deutschland. de/ quadriga/ )<br />
[7] WebSite der Polytechnische Universität Madrid (http:/ / www2. upm. es/ portal/ site/ institucional/ menuitem.<br />
fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/ ?vgnextoid=c5d0492bf33c0210VgnVCM10000009c7648aRCRD)<br />
[8] Rede zur Verleihung (http:/ / www2. upm. es/ portal/ site/ institucional/ menuitem. fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/<br />
?vgnextoid=bd1746d7428c0210VgnVCM10000009c7648aRCRD)<br />
[9] https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D121649091& method=simpleSearch<br />
[10] http:/ / www. w3. org/ People/ Berners-Lee/<br />
[11] http:/ / dig. csail. mit. edu/ breadcrumbs/ blog/ 4<br />
[12] http:/ / webscience. org/
Tim O’Reilly 327<br />
Tim O’Reilly<br />
Tim O’Reilly (* 1954 in Cork, Irland) ist Gründer und Chef des<br />
O’Reilly Verlages, sehr aktiver Softwareentwickler im Bereich freier<br />
Software und maßgeblich an der Entwicklung der Skriptsprache Perl<br />
beteiligt. 1975 schloss er sein Studium der Klassischen<br />
Altertumswissenschaften mit summa cum laude an der Harvard<br />
University ab. O’Reilly ist ebenfalls Autor mehrerer Bücher, die er in<br />
seinem eigenen Verlag vertreibt. Mit seinem Artikel über das Web 2.0<br />
trug er maßgeblich zur Durchsetzung und einheitlichen Wahrnehmung<br />
dieses veränderten Internet-Paradigmas bei.<br />
Geschichte<br />
Tim O’Reilly auf der MIX06-Konferenz in Las<br />
O’Reilly <strong>Media</strong> veröffentlichte 1992, als es nur wenige hundert Websites im ganzen Netz gab, das erste Buch im<br />
Internet. Im Buch selbst war ein ganzes Kapitel dem Internet gewidmet. O’Reilly <strong>Media</strong> erschuf 1993 ebenso das<br />
erste Web-Portal, den Global Network Navigator, kurz GNN. Diese Seite, die als erste überhaupt Werbung schaltete,<br />
wurde 1995 an AOL verkauft.<br />
Als O’Reilly 1997 erfuhr, dass das Buch Programming Perl zwar eines der Top 100 Bücher bei Borders während des<br />
Jahres 1996 war, aber von der Computer-Industrie kaum bemerkt wurde, veranstaltete er eine Perl-Konferenz, um<br />
Perl bekannter zu machen. Er erkannte bald, dass auch andere Bücher seiner Firma zwar Bestseller waren, aber von<br />
der Industrie nicht wahrgenommen wurden. Daraufhin lud er 1998 mehrere Leiter entsprechender Projekte zu einem<br />
Treffen ein. Dieses Treffen wurde ursprünglich freeware summit genannt, wurde aber später unter dem Namen Open<br />
Source Summit bekannt, da auf dieser Versammlung Open Source als neuer Oberbegriff für die Bewegung aufgefasst<br />
wurde. Die O’Reilly Open Source Convention, die auch die Perl-Konferenz beinhaltet, ist heute die<br />
Hauptveranstaltung von O’Reilly.<br />
2001 kam es zu Verstimmungen zwischen Tim O’Reilly und Amazon, als O’Reilly den Protest gegen Amazons<br />
one-click-Patent anführte und im besonderen das Vorgehen von Amazon gegen den Konkurrenten B&N.com<br />
kritisierte. Der Protest endete mit einem Besuch Tim O’Reillys und Jeff Bezos' in Washington D. C., wo sie<br />
Lobbyismus für eine Patentreform betrieben. Seitdem beantragte Amazon zwar weitere Patente, hat diese aber nicht<br />
offensiv eingesetzt.<br />
Persönliches<br />
Tim O’Reilly hat sechs Geschwister. Er ist seit 1975 verheiratet und hat zwei Töchter.<br />
Werke<br />
Zu seinen bekanntesten Werken als Autor zählen:<br />
• UNIX Text Processing (mit Dale Dougherty und Howard Sams, 1987)<br />
• Managing UUCP and USENET (mit Grace Todino)<br />
• The X Window System Users' Guide (mit Valerie Quercia)<br />
• The X Toolkit Intrinsics Programming Manual (mit Adrian Nye)<br />
• UNIX Power Tools (mit Jerry Peek und Mike Loukides)<br />
• Windows XP in a Nutshell (mit David Karp und Troy Mott)<br />
Vegas
Tim O’Reilly 328<br />
Weblinks<br />
• Firmenbiografie [1] (englisch)<br />
• Private Biografie [2] (englisch)<br />
• Artikel über das Web 2.0 [3] (englisch)<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. oreilly. com/ oreilly/ tim_bio. html<br />
[2] http:/ / tim. oreilly. com/ personal_bio. csp<br />
[3] http:/ / www. oreillynet. com/ pub/ a/ oreilly/ tim/ news/ 2005/ 09/ 30/ what-is-web-20. html
Massachusetts Institute of Technology 329<br />
Massachusetts Institute of Technology<br />
Massachusetts Institute of Technology<br />
Motto Mens et Manus<br />
(Geist und Hand)<br />
Gründung 1861, eröffnet 1865<br />
Trägerschaft privat<br />
Ort Cambridge, MA, Vereinigte Staaten<br />
Präsidentin Susan Hockfield<br />
Studenten 10.384<br />
Mitarbeiter 1.009 wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Stiftungsvermögen $8,4 Mrd. US-Dollar [1]<br />
Hochschulsport NCAA Division III<br />
Website<br />
mit.edu [2]<br />
Das Massachusetts Institute of Technology (MIT, Institut für Technologie Massachusetts) ist eine (private)<br />
Technische Hochschule und Universität in Cambridge (Massachusetts) in den USA, gegründet 1861. Das MIT gilt<br />
als eine der weltweit führenden Hochschulen im Bereich von technologischer Forschung und Lehre. Sie ist Mitglied<br />
der Association of American Universities, einem seit 1900 bestehenden Verbund führender forschungsintensiver<br />
nordamerikanischer Universitäten.<br />
Das MIT ist eine private, nicht-konfessionelle technische Universität, die als erste Chemie-Ingenieure ausbildete und<br />
die Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften in die Ingenieurausbildung einbezog. Derzeit studieren am MIT<br />
über 10.000 Studenten. Das MIT rühmt sich für das hohe Niveau der Ausbildung, wobei die Studenten schon früh in<br />
die Forschungsaktivitäten eingebunden werden.<br />
Die Hochschule liegt am Charles River in Cambridge, direkt gegenüber von Boston und stromabwärts von der<br />
Harvard-Universität.<br />
Rund um das MIT hat sich ein Netz aus Hochtechnologie-Kleinfirmen angesiedelt: In den späten 1990er Jahren war<br />
Risikokapital im Überfluss vorhanden, so dass der bevorzugte Karrierewunsch vieler Studenten darin bestand, eine<br />
Hightech-Startup-Firma zu gründen. Der als Telecom-Corridor bekannte Bereich entlang der Staatsstraße 128<br />
entwickelte sich so zu einem Gegenpol des Silicon Valleys.<br />
Die Hochschule ist zudem Gründungsorganisation und Host des World Wide Web Consortium (W3C), dem<br />
Standardisierungsgremium für das World Wide Web.
Massachusetts Institute of Technology 330<br />
Seit 2002 macht das MIT sukzessive seine gesamten Kursunterlagen über das Internet öffentlich zugänglich und<br />
unterstützt damit die OpenCourseWare. Alleine im MIT OpenCourseWare-Projekt wurden auf diese Weise fast 2000<br />
Kurse in 33 Fächern verfügbar gemacht.<br />
Geschichte<br />
Gegründet wurde das MIT nach dem Vorbild deutsch- und<br />
französischsprachiger polytechnischer Hochschulen am 10. April<br />
1861 als dreigliedrige Einrichtung, bestehend aus „a society of<br />
arts, a museum of arts [industrial arts], and a school of industrial<br />
science.“ Der Gründer William Barton Rogers, ein bekannter<br />
Naturforscher, wollte eine unabhängige Universität schaffen, mit<br />
Ausrichtung auf die Erfordernisse eines zunehmend<br />
industrialisierten Amerikas. Wegen des amerikanischen<br />
Bürgerkriegs konnten die ersten Studenten erst 1865<br />
aufgenommen werden. In den Folgejahren erlangte das MIT einen<br />
erstklassigen Ruf.<br />
Wegen der andauernden Finanzierungslücken wurde um 1900 ein<br />
Zusammenschluss mit der benachbarten Harvard-Universität<br />
geplant. Dies konnte jedoch wegen massiver Proteste ehemaliger<br />
MIT-Studenten nicht durchgesetzt werden. 1916 wurde der<br />
Campus von Boston nach Cambridge am gegenüberliegenden<br />
Flussufer verlegt.<br />
Nach dem 2. Weltkrieg, in dem das MIT zur Entwicklung der<br />
Radartechnik beitrug, stieg das Ansehen des MIT weiter an. Das<br />
Wettrüsten und die Raumfahrt in der Zeit des kalten Krieges<br />
erzeugten eine staatlich geförderte Nachfrage nach<br />
Hochtechnologie. Das MIT trug dazu bei, mit Entwicklungen, wie<br />
dem frühen Computerprojekt „Whirlwind“, 1947 bis 1952 unter<br />
der Leitung von Jay W. Forrester aufhorchen zu lassen.<br />
The Rogers Building, c1901<br />
Stata Center<br />
Weitere Entwicklungen aus den MIT-Labors der Nachkriegszeit waren der Ferrit-Kernspeicher sowie die<br />
automatische Raumsondensteuerung des Apollo-Programms. Seit dem Aufkommen des Personal Computers hat das<br />
MIT auch eine zentrale Rolle in den Schlüsseltechnologien des Informationszeitalters besetzt.<br />
2001 konstatierte MIT-Präsident Charles Vest, dass das MIT als Institution die Karriere von weiblichen<br />
Fakultätsmitgliedern und Forschern in diskriminierender Weise behindert hatte. Er kündigte organisatorische<br />
Schritte zur Gleichstellung der Geschlechter an.<br />
Am 6. Dezember 2004 trat Susan Hockfield, eine Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Molekularen<br />
Neurobiochemie, nach 15 männlichen Präsidenten als erste Präsidentin dieses Amt an.
Massachusetts Institute of Technology 331<br />
Organisation<br />
Campus<br />
Der Campus des MIT liegt in Cambridge unweit der<br />
Harvard University direkt am Charles River mit Blick<br />
auf die Skyline von Boston. Am östlichen Ende grenzt<br />
es an die Longfellow Bridge, welche nach Boston führt.<br />
Aus den Gründerjahren des MIT sind die »Maclaurin<br />
Buildings« zu erwähnen, die den Eingangsbereich zum<br />
Campus bilden. Sie wurden von Welles Bosworth im<br />
neoklassizistischen Stil der Zeit entworfen.<br />
Fertiggestellt wurden sie 1916. Kennzeichnend sind die<br />
großzügige Lichtführung und besonders der zentrale<br />
Kuppelbau.<br />
Die Friese tragen die Namen großer Naturforscher, zum<br />
Beispiel Aristoteles, Isaac Newton, Benjamin Franklin,<br />
Louis Pasteur, Antoine Lavoisier, Michael Faraday,<br />
Archimedes, Leonardo da Vinci, Charles Darwin und<br />
Nikolaus Kopernikus, jeweils umgeben von Gruppen<br />
mit Namen passender Forscher, die zum jeweiligen<br />
Forschungsgebiet der „Großen“ beigetragen haben.<br />
Lavoisier zum Beispiel befindet sich im Kreise von<br />
Boyle, Cavendish, Priestley, Dalton, Gay-Lussac,<br />
Berzelius, Woehler, Liebig, Bunsen, Mendelejew,<br />
Perkin und Van't Hoff.<br />
Kuppelbau<br />
Simmons Hall, fertiggestellt 2003<br />
Späteren Gebäuden aus den Jahren 1950 bis 1970 mangelt es dagegen an Ausstrahlung, auch wenn einige von ihnen<br />
vom MIT-Absolventen I. M. Pei entworfen wurden, so das Green Building (Hauptgebäude der Fakultät für Geo-,<br />
Atmosphären- und Planetenphysik), das Institut für Chemische Verfahrenstechnik als höchstes Gebäude auf dem<br />
Campus und das Wiesner Building, in dem das MIT <strong>Media</strong> Lab untergebracht ist.
Massachusetts Institute of Technology 332<br />
Ein umfangreiches Bauprogramm in jüngster Zeit umfasste das<br />
»Stata Center«, entworfen von Frank Gehry, das Simmons Hall<br />
Studentenwohnheim, entworfen von Steven Holl, das<br />
Zeisiger-Sportzentrum und ein neues Gebäude, entworfen von<br />
Charles Correa, für das »Picower Center for Learning and<br />
Memory«, das »Institute for Brain and Cognitive Science« und das<br />
»McGovern Institute for Brain Research«.<br />
Für das »Stata Center« musste 1998 ein altes Gebäude weichen,<br />
das im Zweiten Weltkrieg als Provisorium errichtet wurde.<br />
Eigentlich sollte es spätestens sechs Monate nach Kriegsende<br />
abgerissen werden, aber es erwies sich trotz seiner Hässlichkeit<br />
lange Jahre als eine Brutstätte für kreative Projekte.<br />
Das von Architekturkritikern kontrovers (siehe zum Beispiel hier<br />
[3] ) diskutierte Stata Center, das an seiner Stelle im März 2004<br />
eröffnet wurde, wird von vielen Benutzern als nutzerunfreundlich<br />
geschmäht. Die Arbeitsbedingungen sind nach Aussagen von<br />
Institutsangehörigen deutlich schlechter als bisher. Statt Büros für<br />
wenige Mitarbeiter gibt es nun Großraumbüros, für persönliche<br />
Unterlagen der Forschungsstudenten müssen Spinde reichen.<br />
Platznot ist überall zu spüren.<br />
Zu den neuesten und architektonisch interessanten Gebäuden gehören:<br />
• Baker House, entworfen von Alvar Aalto<br />
• Kresge Auditorium, entworfen von Eero Saarinen<br />
Simmons Hall (Wohnheim für alle Erstsemester, 2003<br />
fertiggestellt)<br />
• Wiesner Building, entworfen von I. M. Pei, mit dem von Kenneth Noland entworfenen gekachelten Außenbereich<br />
• Stata Center, fertiggestellt 2004<br />
Lehre<br />
Das Lernpensum am MIT ist in den unteren Semestern sehr groß. Dennoch ist die Quote erfolgreicher<br />
Kursabschlüsse hoch. Dies erklärt sich aus der antiautoritären Kultur und dem Paradigma, dass erworbenes Wissen<br />
geteilt werden muss. In der Praxis heißt das, dass ältere Studenten und Professoren den jüngeren hilfreich zur Seite<br />
stehen.<br />
Die Studieninhalte werden zunächst von einem Professor in einer Vorlesung vorgestellt und anschließend von<br />
Assistenten vertieft und detailliert. Die Assistenten stellen dann den Studenten Hausaufgaben zu den behandelten<br />
Themen, die meist in Gruppenarbeit gelöst werden: hier findet der eigentliche Lernprozess statt. Die erarbeiteten<br />
Resultate werden als „Bibeln“ gesammelt und von Semester zu Semester weitergereicht.<br />
Regelmäßig während des Semesters finden schriftliche Prüfungen statt. Dabei wird weniger konkretes Wissen<br />
abgefragt, sondern vielmehr die Fähigkeit der Studenten überprüft, komplexe Probleme zu lösen. So gibt es kaum<br />
Multiple-Choice-Tests, die Arbeitsergebnisse sind frei zu formulieren. Die Analyse und Korrektur dieser Tests sind<br />
dementsprechend aufwändiger.<br />
Es werden auch praktische Aufgaben zur Lösung gestellt. Die Studenten bekommen eine Konstruktionsaufgabe und<br />
wetteifern um den besten Entwurf zur Lösung.<br />
Im Rahmen des Undergrade Research Opportunities Program (UROP) werden bereits niedrige Semester in die<br />
Forschungsaktivitäten ihres Instituts eingebunden. Die praktischen Arbeiten hierzu finden größtenteils am<br />
Freitagnachmittag und am Wochenende statt, wenn der normale Lehrbetrieb ruht.
Massachusetts Institute of Technology 333<br />
Seit 2007 werden Vorlesungen auch über das Internet übertragen. Der 71-jährige niederländische Physiker Walter<br />
H. G. Lewin – Physikdozent am MIT – „ist mittlerweile zum Star im Internet avanciert.“ [4]<br />
Studienangebot<br />
Neben dem Schwerpunkt Naturwissenschaften und Technik hat das MIT auch Institute für Philosophie,<br />
Betriebswirtschaft, Linguistik und Anthropologie.<br />
• Architektur und Planung<br />
• Geisteswissenschaften, Künste und Sozialwissenschaften<br />
• Gesundheitswissenschaften und Technologie (Whitaker College of Health Sciences and Technology)<br />
• Ingenieurwissenschaften<br />
• Naturwissenschaften<br />
• Wirtschaftswissenschaften (Alfred P. Sloan School of Management)<br />
Forschung<br />
Institute<br />
Unter den bekanntesten Forschungsinstituten sind zu nennen:<br />
• Das vom MIT mitgegründete Auto-ID Center (1999-2003)<br />
wurde zu dem weltweit größten universitären<br />
Forschungsnetzwerk für vernetzte RFID-Technologie, den<br />
Auto-ID Labs<br />
• MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory<br />
(angeschlossen an das Forschungsnetzwerk BIRN)<br />
• Lab for Information and Decision Systems<br />
• Lincoln Lab<br />
• Research Lab of Electronics<br />
• MIT <strong>Media</strong> Lab<br />
• Radiation Laboratory at the Massachusetts Institute of Technology<br />
• Whitehead-Institut für biomedizinische Forschung<br />
Kooperationen<br />
Es gibt einige traditionelle Kooperationspartner:<br />
Gebäude der MIT Business School<br />
• Das Charles Draper Lab entwickelt unter anderem Raketentechnik für das US-Militär. Es gehörte früher als<br />
Instrumentation Lab direkt zum MIT, wurde aber während des Vietnamkriegs abgespalten, um den<br />
Vietnamkriegsgegnern unter den Studenten weniger Angriffsfläche zu bieten. Noch vor der Ausgliederung wurde<br />
hier der Apollo Guidance Computer entwickelt.<br />
• Die Woods Hole Oceanographic Institution hat ein gemeinsames Studienprogramm mit dem MIT für<br />
fortgeschrittene Semester.<br />
• Mit der benachbarten Harvard-Universität ist das MIT durch eine traditionelle Rivalität verbunden. Es gab in den<br />
Anfangszeiten beider Universitäten Pläne, diese zusammenzulegen. Diese mussten aber infolge des Widerstands<br />
von Studenten und Fakultätsmitgliedern fallengelassen werden.<br />
Heutzutage gibt es abgestimmte Studienpläne für untere Semester, so dass Studenten Kurse am MIT und an Harvard<br />
miteinander kombinieren können. Das Gleiche gilt auch für die Studentinnen am Wellesley College, einer<br />
traditionsreichen Hochschule nur für weibliche Studenten.
Massachusetts Institute of Technology 334<br />
• Mit der University of Southampton und der University of Cambridge in Großbritannien gibt es ein<br />
Austauschprogramm.<br />
Seit einigen Jahren geht das MIT verstärkt Partnerschaften mit diversen Universitäten sowie öffentlich und privat<br />
finanzierten Forschungslabors ein. Die Projekte sind im Allgemeinen vom externen Partner zu finanzieren und<br />
dienen somit der Geldmittelbeschaffung des MIT. Das MIT als privatwirtschaftliche Organisation vermarktet auf<br />
diese Weise sein Renommee und die Forschungskapazität der Fakultätsmitglieder und Studenten.<br />
Der Universitätsverlag MIT Press ist seit 1962 ein von der Universität unabhängiges Unternehmen, das für die<br />
Universität publiziert. Der Verlag publiziert ungefähr 200 Bücher und 40 wissenschaftliche Journale pro Jahr. [5]<br />
Studenten<br />
Statistik<br />
Von den 10.206 Studenten sind ungefähr 4000 „Undergraduates“<br />
und 6000 „Graduates“. 43 % der Studentenschaft sind weiblich (29<br />
% der Graduates). Es gibt Studenten aus allen 50<br />
US-Bundesstaaten und aus 110 verschiedenen Ländern. 9 % der<br />
„Undergraduates“ und 40 % der „Graduates“ sind ausländische<br />
Studenten.<br />
45 % der „Undergraduates“ (17 % der „Graduates“) gehören einer<br />
amerikanischen Minderheit an [6] :<br />
• 26,5 % (11,5 %) Asiatische Amerikaner<br />
• 11,3 % (2,9 %) Hispanische Amerikaner<br />
• 5,8 % (1,9 %) Afroamerikaner<br />
• 1,5 % (0,3 %) Amerikanische Ureinwohner<br />
Herkunft der internationalen Studenten (2006) [7] :<br />
Blick über den Charles River auf MITs Kuppelbau und<br />
benachbarte Gebäude<br />
• Asien (China 309, Südkorea 247, Indien 222, Taiwan 88, Japan 82, Singapur 69, Thailand 53, Türkei 52, Pakistan<br />
28, Hongkong 26, Indonesien 22, Malaysia 22, sonstige)<br />
• Europa (Frankreich 90, Griechenland 54, Deutschland 48, Italien 47, Großbritannien 41, Spanien 38, Russland 31,<br />
Bulgarien 23, Irland 20, sonstige)<br />
• Lateinamerika (Mexiko 55, Brasilien 33, Argentinien 24, Chile 23, sonstige)<br />
• Nordamerika (Kanada 225)<br />
• Naher und Mittlerer Osten (Israel 34, Iran 29, Libanon 21, sonstige)<br />
• Afrika (Kenia 13, Ghana 11, Nigeria 9, Ägypten 8, Simbabwe 6, sonstige)<br />
• Ozeanien (Australien 25, Neuseeland 5)<br />
Die MIT-Kultur<br />
Die Studenten sind mit hohen Anforderungen konfrontiert, allerdings zum überwiegenden Teil hoch motiviert. Das<br />
MIT hat auf Vorwürfe reagiert, die hohen Anforderungen würden Studenten sogar bis in den Selbstmord treiben:<br />
eine intensivere psychologische Betreuung soll die Situation verbessern.<br />
Wie an vielen amerikanischen Universitäten leben die Studenten meist recht beengt in Wohnheimen auf dem<br />
Campus. Es gibt traditionell deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Wohnheimen: In einigen ist die<br />
Hippie-Kultur präsent, während andere einen betont bürgerlichen Stil pflegen.<br />
Für eine nicht musisch geprägte Universität ist der Anteil aktiv musizierender Studenten recht hoch: Es gibt ein<br />
Symphonieorchester und mehrere klassische Chöre mit studentischen Musikern.
Massachusetts Institute of Technology 335<br />
Das Ethos des MIT ist ausgeprägt antiautoritär, gleichzeitig glaubt man an den Sinn einer Leistungselite, deren<br />
sozialer Status sich aus intellektueller Überlegenheit heraus rechtfertigt, nicht aus der Herkunft oder formaler<br />
hierarchischer Positionen.<br />
Am MIT ist es Usus, dass Informationen offengelegt werden sollen und nicht verdeckt werden dürfen. Jede<br />
Behauptung ist möglicher Gegenstand einer kritischen Überprüfung, ihre Akzeptanz darf sich nicht auf allgemein<br />
gültige Ansicht oder Direktiven „von oben“ berufen.<br />
Diese ethische Einstellung wird auch bei vielen Hackern angenommen: Am MIT wird der Begriff Hack weit<br />
definiert, im Sinne eines überraschenden technisch-ausgefeilten Kunstgriffs, wobei die besten Hacks einen<br />
humoristischen Aspekt besitzen. Der Begriff Hacker wurde am MIT geprägt, einige Wurzeln der Hacker-Kultur<br />
lassen sich zum MIT der 50er und 60er Jahre zurückverfolgen: Am MIT arbeiteten Urväter der Hacker-Szene wie<br />
Richard Stallman, Jay Sussman und Tom Knight.<br />
Sport<br />
Die Sportteams des MIT sind die MIT Engineers. Die Hochschule ist Mitglied in der New England Women's and<br />
Men's Athletic Conference und nehmen damit an der 3. Division der National College Athletic Association teil.<br />
Berühmte Persönlichkeiten<br />
Nobelpreisträger<br />
• George Akerlof, PhD 1966 – Wirtschaftswissenschaften 2001<br />
• Sidney Altman, S. B. 1960 – Chemie 1989<br />
• Kofi Annan, S. M. 1972 – Friedensnobelpreis 2001<br />
• Robert Aumann, PhD 1955 – Wirtschaftswissenschaften 2005<br />
• Elias James Corey Jr., S. B. 1948, PhD 1951 – Chemie 1990<br />
• Eric A. Cornell – Physik 2001<br />
• Robert F. Engle – Wirtschaftswissenschaften 2003<br />
• Richard Feynman, S. B. 1939 – Physik 1965<br />
• Andrew Z. Fire – Medizin 2006<br />
• Leland H. Hartwell, PhD 1964 – Medizin 2001<br />
• H. Robert Horvitz, SB 1968 – Medizin 2002<br />
• Henry W. Kendall, S. B. 1948, PhD 1951 – Physik 1990<br />
• Wolfgang Ketterle, – Physik 2001<br />
• Har Gobind Khorana – Medizin 1968<br />
• Lawrence Klein, PhD 1944 – Wirtschaftswissenschaften 1980<br />
• Paul Krugman – Wirtschaftswissenschaften 2008<br />
• Robert B. Laughlin, PhD 1979 – Physik 1998<br />
• Salvador Edward Luria - Biologie 1969<br />
• Murray Gell-Mann, PhD 1951 – Physik 1969<br />
• Eric S. Maskin – Wirtschaftswissenschaften 2007<br />
• Daniel McFadden – Wirtschaftswissenschaften 2000<br />
• Robert C. Merton, PhD 1970 – Wirtschaftswissenschaften 1997<br />
• Franco Modigliani – Wirtschaftswissenschaften 1985<br />
• Mario J. Molina – Chemie, 1995<br />
• Robert S. Mulliken, S. B. 1917 – Chemie 1966<br />
• Robert Mundell, PhD 1956 – Wirtschaftswissenschaften 1999<br />
• John Forbes Nash Jr. – Wirtschaftswissenschaften 1994
Massachusetts Institute of Technology 336<br />
• Charles Pedersen, S. M. 1927 – Chemie 1987<br />
• William D. Phillips, PhD 1976 – Physik 1997<br />
• Burton Richter, S. B. 1952, PhD 1956 – Physik 1976<br />
• Paul Samuelson – Wirtschaftswissenschaften 1970<br />
• Myron S. Scholes – Wirtschaftswissenschaften 1997<br />
• John Robert Schrieffer, S. B. 1953 – Physik 1972<br />
• Richard R. Schrock – Chemie, 2005<br />
• Phillip Sharp – Medizin 1993<br />
• Barry Sharpless – Chemie, 2001<br />
• William B. Shockley, PhD 1936 – Physik 1956<br />
• Clifford Shull - Physik 1994<br />
• George F. Smoot – Physik 2006<br />
• Robert M. Solow, PhD 1951 – Wirtschaftswissenschaften 1987<br />
• Joseph Stiglitz, PhD 1966 – Wirtschaftswissenschaften 2001<br />
• Samuel Chao Chung Ting – Physik 1976<br />
• Susumu Tonegawa – Medizin 1987<br />
• Charles H. Townes - Physik 1964<br />
• Steven Weinberg - Physik 1979<br />
• Carl E. Wieman, S. B. 1973 – Physik 2001<br />
• Frank Wilczek, Physik 2004<br />
• Oliver E. Williamson – Wirtschaftswissenschaften 2009<br />
• Robert B. Woodward, S. B. 1936 – Chemie 1965<br />
Professoren und Dozenten<br />
siehe: Kategorie: Hochschullehrer (MIT), u. a.:<br />
• Stephen A. Benton – Physiker, Erfinder des Regenbogen-Hologramms<br />
• Emilio Bizzi – Hirnforscher<br />
• Olivier Blanchard - Wirtschaftswissenschaftler<br />
• George Boolos – Philosoph und Mathematiker<br />
• Rodney Brooks – Roboterforscher und Verhaltenskundler<br />
• Vannevar Bush – Elektroingenieur, Erfinder des Hypertext-Prinzips<br />
• Noam Chomsky – Linguist<br />
• William David Coolidge - Physiker<br />
• John Deutch – Chemiker<br />
• Peter A. Diamond – Wirtschaftswissenschaftler<br />
• Mildred Dresselhaus – Physikerin, Elektronikingenieurin und Informatikerin<br />
• Harold E. Edgerton – Photograph<br />
• Jerome Friedman – Physiker<br />
• Shafrira Goldwasser – Informatikerin, zweifache Gödel-Preisträgerin, 1993 und 2001<br />
• William Higinbotham - Atomphysiker<br />
• Robert Langer - Chemieingenieur<br />
• Walter Lewin – Physiker<br />
• Richard Lindzen - Physiker und Meteorologe<br />
• John Little – Managementberater<br />
• Francis Low – Physiker<br />
• Douglas McGregor – Managementtheoretiker<br />
• Marvin Minsky – Informatiker
Massachusetts Institute of Technology 337<br />
• William J. Mitchell – Architekt und Schriftsteller, Medienwissenschaftler<br />
• Mario J. Molina – Chemiker<br />
• Franco Modigliani – Wirtschaftswissenschaftler<br />
• Philip Morrison – Physiker<br />
• Nicholas Negroponte – Medienforscher<br />
• Seymour Papert – Pädagoge und Informatiker<br />
• Steven Pinker – Bewusstseinsforscher<br />
• Gian-Carlo Rota – Mathematiker und Philosoph<br />
• Isadore M. Singer – Mathematiker (Abel-Preis 2004)<br />
• Robert M. Solow – Wirtschaftswissenschaftler<br />
• Arthur R. von Hippel – Elektronikingenieur und Informatiker<br />
• Edgar Schein – Organisationspsychologe<br />
• Myron S. Scholes – Wirtschaftswissenschaftler<br />
• Claude Shannon – Mathematiker<br />
• Richard Stallman – Informatiker, Aktivist für freie Software, Begründer der Free Software Foundation<br />
• Ivan Sutherland – Informatiker, Pionier der Computergrafik<br />
• Sherry Turkle – Psychologin und Soziologin<br />
• Robert Allan Weinberg – Molekularbiologe und Krebsforscher<br />
• Joseph Weizenbaum – Informatiker<br />
• Norbert Wiener – Mathematiker, Begründer der Kybernetik<br />
• Otto Piene Künstler (Art and visual studies)<br />
• Tim Berners-Lee – Informatiker, Begründer des World Wide Web, Entwickler des ersten Webbrowsers<br />
WorldWideWeb, Begründer und Vorsitzender des W3C.<br />
Absolventen<br />
• Buzz Aldrin - NASA-Astronaut, zweiter Mensch auf dem Mond<br />
• Virgilio Barco – ehemaliger Staatspräsident von Kolumbien<br />
• Hans Albrecht Bethe – Physiker<br />
• Manuel Blum – Informatiker, Turing-Preisträger 1995<br />
• Amar G. Bose – Unternehmer, Entwickler von Audiogeräten<br />
• Dan Bricklin – Miterfinder von VisiCalc, der ersten Tabellenkalkulationssoftware für PCs<br />
• Whitfield Diffie – Miterfinder des Kryptografieverfahrens mit öffentlichem Schlüssel und des<br />
Diffie-Hellman-Kryptografieverfahrens<br />
• Donald Douglas – Einer der Gründer des Luftfahrtkonzerns McDonnell Douglas<br />
• K. Eric Drexler – Nanotechnologe<br />
• Luis A. Ferré – Gouverneur von Puerto Rico<br />
• José Figueres Ferrer – Präsident von Costa Rica<br />
• Gordon Freeman - Atomphysiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Black Mesa Forschungseinrichtung<br />
• Sheldon Kay Friedlander - Ingenieur und Aerosolforscher<br />
• William (Bill) Hewlett – Mitbegründer des Technologiekonzerns Hewlett Packard<br />
• Danny Hillis – Mitbegründer der Firma Thinking Machines, Mitgründer der Long Now Foundation<br />
• David A. Huffman – PhD 1953, Informatiker, entwickelte die Huffman-Kodierung für verlustfreie<br />
Datenkompression<br />
• John David Jackson - Physiker<br />
• Brewster Kahle – Archivar des WWW, Kämpfer für die Informationsfreiheit<br />
• Mitch Kapor – Software-Unternehmer
Massachusetts Institute of Technology 338<br />
• Raymond Kurzweil – Erfinder auf diversen Gebieten (Musikinstrumente, Schrift- und<br />
Spracherkennungs-Software), Zukunftsforscher und Visionär<br />
• Harry Ward Leonard - Elektroingenieur, Erfinder des Ward-Leonard-Umrichters<br />
• Daniel Lewin – Internet-Unternehmer<br />
• Arthur D. Little – Gründer des gleichnamigen Beratungsunternehmens<br />
• Hugh Lofting – Bauingenieur, Autor von „Dr. Doolittle“<br />
• Wolfgang Mayrhuber - Manager, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG<br />
• Robert Metcalfe – Erfinder des Ethernet-Protocols für Computernetze, Gründer von 3Com<br />
• Edgar Mitchell - NASA-Astronaut, der sechste Mensch, der den Mond betrat<br />
• Benjamin Netanjahu – Premierminister von Israel<br />
• Robert Noyce – Miterfinder der integrierten Schaltung, Mitbegründer von Intel<br />
• Ken Olsen – Gründer von Digital Equipment Corporation (DEC)<br />
• Ieoh Ming Pei – Architekt<br />
• George P. Shultz – Secretary of State der US Regierung<br />
• James Harris Simons - Mathematiker, Hedge-Fonds-Manager, bekannt für seine Arbeit an Minimalflächen<br />
• Alfred P. Sloan, Jr. – Automobilunternehmer<br />
• Louis Sullivan – Architekt<br />
• Lawrence H. Summers – Wirtschaftswissenschaftler<br />
• Andrew S. Tanenbaum – Informatiker, Programmierer von Minix<br />
Literatur<br />
• Fred Hapgood: Up the Infinite Corridor: MIT and the Technical Imagination. Perseus Books, 1993, ISBN<br />
0-201-08293-4 (Beschreibung der Forschungsaktivität aus der Insider-Perspektive)<br />
• Stewart Brand: How Buildings Learn: What Happens after They’re Built. Penguin, New York 1995, ISBN<br />
0-14-013996-6 (Architekturstudie, behandelt unter anderem verschiedene Gebäude auf dem MIT-Campus)<br />
• Julius A. Stratton, Loretta H. Mannix: Mind and Hand - The Birth of MIT. MIT Press, Cambridge 2005, ISBN<br />
0-262-19524-0 (Geschichtlicher Hintergrund zur Gründung des MIT, unter anderem auf Grund von original<br />
Dokumenten)<br />
Weblinks<br />
• MIT Homepage [8] (englisch)<br />
• Hack gallery [9] (englisch)<br />
• MIT Technology Review [10] (englisch)<br />
Koordinaten: 42° 21′ 32″ N, 71° 5′ 34″ W [11]<br />
Referenzen<br />
[1] MIT endowment rises 23 percent to $8.4 billion (http:/ / www. boston. com/ news/ local/ massachusetts/ articles/ 2006/ 10/ 11/<br />
mit_endowment_rises_23_percent_to_84_billion/ ), Associated Press<br />
[2] http:/ / mit. edu/<br />
[3] http:/ / www-tech. mit. edu/ V121/ N7/ col07nesmi. 7c. html<br />
[4] Die Mutter aller Pendel (http:/ / www. sueddeutsche. de/ ,tt6m1/ jobkarriere/ artikel/ 584/ 149227/ ) www.sueddeutsche.de 21. Dezember<br />
2007<br />
[5] MIT Press (http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ MIT_Press). In: Wikipedia. Wikipedia, 19. Juni 2006, abgerufen am 18. Dezember 2008<br />
(englisch).<br />
[6] http:/ / web. mit. edu/ facts/ enrollment. shtml MIT Facts 2006, Enrollment<br />
[7] http:/ / web. mit. edu/ registrar/ www/ stats/ geofinal. html<br />
[8] http:/ / web. mit. edu/<br />
[9] http:/ / hacks. mit. edu/
Massachusetts Institute of Technology 339<br />
[10] http:/ / www. technologyreview. com/<br />
[11] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?pagename=Massachusetts_Institute_of_Technology& language=de& params=42.<br />
3588888889_N_71. 0927777778_W_region:US_type:landmark<br />
Jimmy Wales<br />
Jimmy Donal Wales (* 7. August 1966 [1] in Huntsville, Alabama),<br />
auch bekannt als „Jimbo Wales“, ist ein US-amerikanischer<br />
Unternehmer sowie Mitbegründer [2] der freien und kollaborativen<br />
Enzyklopädie Wikipedia.<br />
Leben<br />
Jimmy Donal Wales ist der Sohn von Jimmy Wales, einem<br />
Gemischtwarenhändler, und von Doris Wales, einer Lehrerin an einer<br />
kleinen privaten Schule, welche schon ihre Mutter betrieb. Im Alter<br />
von vier Jahren begann Wales zu lesen – am liebsten in der World<br />
Book Encyclopedia, die seine Mutter 1968 von einem Vertreter<br />
erstanden hatte. [3] Auch den High-School-Abschluss absolvierte er auf<br />
einer Privatschule, die bereits damals im Gegensatz zu den meisten<br />
öffentlichen Schulen seit 1979 über Computer verfügte. Er studierte<br />
danach Finanzwissenschaft an der Auburn University und machte dort<br />
1989 seinen Bachelor-Abschluss. Wales begann zwei Mal ein<br />
Promotionsstudium: zunächst an der University of Alabama, von der er<br />
den Master-Titel erhielt, danach an der Indiana University; eine<br />
Dissertation hat er jedoch nie eingereicht.<br />
In seiner Freizeit beschäftigte sich Wales mit und in Diskussionsforen<br />
im Netz, dem Usenet, besonders intensiv engagierte er sich in<br />
philosophischen Fragen. Wales bezeichnet sich als Anhänger des von<br />
der Schriftstellerin Ayn Rand begründeten Objektivismus. [4] 1992<br />
gründete Wales sein erstes Forum, das er moderierte. Alle Anfragen<br />
sollten zuerst an ihn gehen, um damit unsachliche Angriffe und<br />
chaotische Diskussionen zu unterbinden. Dennoch scheiterte dieser<br />
Versuch, da die jeweiligen Fragen nicht einmütig gelöst werden<br />
konnten.<br />
1994 wurde Wales als Händler für Futures und Options an der<br />
Chicagoer Börse tätig. Er erwarb damit ein gewisses Vermögen; Wales<br />
hält sich jedoch nicht für reich. [5]<br />
1996 gründete Wales mit zwei Geschäftspartnern die Internetfirma<br />
Bomis. Dort konnte und kann man noch heute kostenlos Foren zu den<br />
Jimmy Wales, 2008<br />
Jimmy Wales, Im Jahr 2005 auf dem Holbeinsteg<br />
in Frankfurt am Main während einer Drehpause<br />
eines arte-Dokumentarfilms über Wikipedia<br />
Themen Unterhaltung, Sport, Science-Fiction und „Babes“ (Erotikbilder) besuchen, [6] die mit Werbung finanziert<br />
werden. Wales ist seit 2006 nicht mehr aktiv am Unternehmen beteiligt.<br />
Nupedia und Wikipedia
Jimmy Wales 340<br />
Im März 2000 begann er in seiner Firma Bomis mit Nupedia das erste Projekt einer englischsprachigen<br />
Internet-Enzyklopädie auf der Basis von Peer-Review und mit Experten als Autoren. Larry Sanger stellte er als<br />
Chefredakteur ein; die beiden hatten sich bei Diskussionen über Philosophie im Usenet kennengelernt. Im <strong>Jan</strong>uar<br />
2001 schlug der Programmierer Ben Kovitz seinem Freund Sanger den Einsatz der Wiki-Software vor, um die<br />
Stagnation der Beteiligung bei Nupedia zu überwinden. [7] Sanger wiederum empfahl Wales am nächsten Tag, dieses<br />
Verfahren anzuwenden.<br />
Am 15. <strong>Jan</strong>uar 2001 ließ Wales Wikipedia freischalten, zunächst war diese Plattform nur als eine versuchsweise<br />
Ergänzung zu Nupedia gedacht. Wales bestimmte die strategischen Ziele von Wikipedia, vor allem eine Neutralität<br />
bei der Darstellung eines Themas („neutral point-of-view“). Aufgrund des unerwartet schnellen Anstiegs der Nutzer<br />
und ihrer Beiträge in Wikipedia wurde Nupedia im September 2003 eingestellt. Am 20. Juni 2003 gründete Wales<br />
die gemeinnützige Wikimedia Foundation, die er bis Ende 2006 leitete. Im Oktober 2006 trat Wales die Leitung des<br />
Vorstands an die Französin Florence Nibart-Devouard ab, blieb jedoch als Chairman emeritus weiter im Vorstand.<br />
Zum engeren Kern der deutschsprachigen Wikipedia zählt Wales nur „etwa 800 bis 900“ Autoren, dies sind nach<br />
seiner Definition „Wikipedianer, die mehr als 100 Beiträge monatlich neu schreiben oder ändern“. [8] Über diese<br />
zentrale Gruppe meinte er im November 2007 in der New York Times, dass sie „in Wahrheit ganz schön eingebildet“<br />
sei. Für das „größte Missverständnis über Wikipedia“ hält er die Annahme, dass sie demokratisch wäre. „Wir<br />
glauben, einige Leute sind Idioten und sollten gar nicht schreiben“. [9] Eine weitere Beurteilung äußerte er 2006:<br />
Wikipedia sei „in vielerlei Hinsicht egalitaristisch und basisdemokratisch“, aber „auch elitär“. [8] Er gehe „vom Guten<br />
im Menschen“ aus und setze daher auf „offenen Austausch von Informationen“ und auf eine „breite öffentliche<br />
Beteiligung“. [8]<br />
Nach den Aufbaujahren geht es Wales heute (2009) darum, nicht mehr nur die Anzahl, sondern vor allem die<br />
Qualität der Artikel zu steigern: „Unser Anspruch muss es sein, so gut zu sein wie der Brockhaus!“ [10] Daher begrüßt<br />
er es, wenn mehr akademische Spezialisten über ihr Fachgebiet in Wikipedia publizieren.<br />
Mittlerweile gab Wales einige seiner Sonderrechte zurück, da er die Community mittels unabgestimmter<br />
Löschungen brüskiert hatte. Es handelte sich dabei um das Löschen von – seiner Meinung nach – pornografischen<br />
Inhalten. [11]<br />
Wikia<br />
2004 gründete er mit Angela Beesley das Internetportal Wikia, einen kostenlosen Hosting-Dienst für Wiki-Projekte<br />
und -Foren, das sich durch Werbung, zum Beispiel Google-Textwerbung, finanziert und mehrere kommerzielle<br />
Wikis betreibt.<br />
2007 startete Wales das Projekt Wikia Search, eine freie und kollaborative Alternative zur Internetsuchmaschine<br />
Google auf Wiki-Basis, in welchem das Ranking der Suchergebnisse durch die Internetbenutzer erfolgt. Das Projekt<br />
basiert auf den Open-Source-Programmen Lucene, Nutch und Hadoop. [12] [13] [14] [15] Eine erste Alpha-Version von<br />
Wikia Search wurde am 7. <strong>Jan</strong>uar 2008 freigeschaltet. Nach rund 15 Monaten gab Wales in seinem Blog bekannt, [16]<br />
dass er den Betrieb der freien und kollaborativen Suchmaschine Wikia Search am 31. März 2009 eingestellt hat. Es<br />
waren nur 10.000 Besucher pro Monat in den letzten sechs Monaten zu verzeichnen gewesen. [17] In erster Linie<br />
machte er für die geringe Nutzung die Wirtschaftskrise verantwortlich. Er wolle sich jedoch weiterhin für freie<br />
Suchmaschinenprojekte einsetzen.
Jimmy Wales 341<br />
Privatleben<br />
Im März 1997 heiratete Jimmy Wales seine zweite Frau Christine Rohan. Sie haben eine Tochter (* 2000) [18] , leben<br />
aber mittlerweile getrennt. [19] Wales wohnt in Saint Petersburg, Florida, aber er ist etwa 200 [10] bis 250 Tage [20] im<br />
Jahr unterwegs, vor allem um weltweit für das Wikipedia-Projekt zu werben.<br />
Auszeichnungen<br />
• 2006: »Pioneer of the Electronic Frontier« von der Electronic<br />
Frontier Foundation (EFF) [21]<br />
• 2006: »TIME 100« „List of Most Influential People“ (Liste der 100<br />
[22] [23]<br />
einflussreichsten Menschen des Jahres 2006) Time Magazine<br />
• 2006: Wales erhält die Ehrendoktorwürde des Knox Colleges. [24]<br />
• 2006: Wales wird mit Tim Berners-Lee zum Mitglied des<br />
neugegründeten Beirats des »MIT Center for Collective<br />
Intelligence« ernannt. [25]<br />
• 2007: »Young Global Leader« vom Weltwirtschaftsforum [26]<br />
• 2007: Das Forbes Magazine platziert Wales auf Rang 12 in seiner<br />
ersten Jahresliste »The Web Celebs 25« (Die 25 Prominenten des Internets). [27]<br />
Jimmy Wales nimmt den Quadriga-Preis 2008<br />
entgegen<br />
• 3. Oktober 2008: Verleihung des Quadriga-Preises Mission der Aufklärung an die Wikipedia, vertreten durch<br />
Jimmy Wales, als Gründer und Ehrenvorsitzender. [28]<br />
• 2010: Millennium Vision Award des Deutschen Trendtages. [29]<br />
Schriften<br />
• Robert Brooks, Jon Corson, Jimmy Donal Wales: The Pricing of Index Options When the Underlying Assets All<br />
Follow a Lognormal Diffusion, in: Advances in Futures and Options Research 7, 1994, ISSN 1048-1559 [30] ,<br />
Abstract [31] .<br />
Weblinks<br />
• Blog von Jimmy Wales [32] (Englisch)<br />
• Jimmy Wales: Ich habe einen Traum: „Die Bildung wird revolutioniert“ [33] , Die Zeit, 11. Dezember 2008, Nr. 51<br />
Artikel<br />
• „Wikipedia. Der Diderot aus Alabama“ [34] , Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Juni 2005, Nr. 127, S. 11<br />
• „Growing Wikipedia Refines Its „Anyone Can Edit“ Policy“ [35] , New York Times, 17. Juni 2006<br />
• „Der gute Mensch des Internets“ [36] , Handelsblatt, 22. Juni 2005<br />
• „Mann des Tages: Jimmy Wales“ [37] , FinanzNachrichten.de, 22. Juni 2006<br />
• „Die anarchische Wiki-Welt. [38] Wikipedia, die Online-Enzyklopädie, kommt ohne Experten aus. Hier kann jeder<br />
mitmachen, Artikel schreiben und vorhandene ändern. Kann daraus ein seriöses Lexikon entstehen?“ Die Zeit, 7.<br />
September 2006, Nr. 37, S. 17–19 (Reportage)<br />
• „Internet-Suche: Das Anti-Google des Wikipedia-Gründers“ [39] , Die Welt, 24. Dezember 2006<br />
Interviews<br />
• Video: „Jimmy Wales über Wikipedia und Community-Design“ [40] , Elektrischer Reporter, 3. Juni 2007, 19 Min.<br />
• „Wales on Wikipedia“ [41] , EconTalk, 9. März 2009, 42 Min.<br />
• „Eine Britannica habe ich nie besessen“ [42] , Der Standard, 20. September 2006<br />
• „Wir glauben an das Gute“ [43] , Die Welt, 26. Juni 2006
Jimmy Wales 342<br />
Referenzen<br />
[1] „Die Entdeckung des Elfenbeinspechts“ (http:/ / www. berlinonline. de/ berliner-zeitung/ archiv/ . bin/ dump. fcgi/ 2008/ 1011/ magazin/<br />
0039/ index. html), Berliner Zeitung, 11. Oktober 2008, Interview mit Jimmy Wales<br />
[2] Brian Bergstein: „Sanger says he co-started Wikipedia. Wales insists Sanger was employee and not deserving of co-founder status“ (http:/ /<br />
www. msnbc. msn. com/ id/ 17798723/ ), Associated Press / MSNBC, 26. März 2007<br />
[3] Kerstin Kohlenberg: „Die anarchische Wiki-Welt“ (http:/ / www. zeit. de/ 2006/ 37/ wikipedia?page=all), Die Zeit, 7. September 2006, Nr.<br />
37, S. 17–19<br />
[4] Beiträge von Wales in Usenet-Diskussionen zu Ayn Rand (http:/ / groups. google. com/ groups/ search?hl=en& ie=UTF-8& safe=off&<br />
num=100& q=jimmy+ wales+ ayn+ rand& safe=off& qt_s=Search)<br />
[5] Brian Lamb: „Q&A: Jimmy Wales, Wikipedia founder“ (http:/ / www. q-and-a. org/ Transcript/ ?ProgramID=1042), C-SPAN, 25. September<br />
2005<br />
„I made enough money – I used to be a futures and options trader and I‘m not a wealthy person but I‘m a person who lives within my means.<br />
So I have enough money to live and I can‘t think of anything cooler to be doing so this is what I do.“<br />
[6] Aktuelles Bomis Angebot (http:/ / www. bomis. com/ tree/ entertainment/ adult/ )<br />
[7] Marshall Poe: „The Hive“ (http:/ / www. theatlantic. com/ doc/ 200609/ wikipedia/ 3), The Atlantic, September 2006<br />
[8] „Wir glauben an das Gute“ (http:/ / www. welt. de/ print-welt/ article225325/ Wir_glauben_an_das_Gute. html), Die Welt, 26. Juni 2006,<br />
Interview<br />
[9] Teilzitiert in: Der Spiegel: [[Kategorie:Vorlage Der Spiegel mit alten Parametern (http:/ / www. spiegel. de/ spiegel/ print/ d-54230971.<br />
html)] „Jimmy Wales“], 10. Dezember 2007, Nr. 50, Seite 185 und Originalquelle: „The Encyclopedist’s Lair“ (http:/ / www. nytimes. com/<br />
2007/ 11/ 18/ magazine/ 18wwln-domains-t. html?_r=1), NYT, 18. November 2007<br />
„We aren’t democratic. Our readers edit the entries, but we’re actually quite snobby. The core community appreciates when someone is<br />
knowledgeable, and thinks some people are idiots and shouldn’t be writing.“<br />
[10] Mark Diening: „Von wegen Guru. Der Missionar. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales will die Welt mit Wissen überziehen“ (http:/ / www.<br />
tagesspiegel. de/ medien-news/ Wikipedia-Jimmy-Wales-Wikia-Search;art15532,2768219), Tagesspiegel, 7. April 2009<br />
[11] http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ Porno-Streit-in-Wikipedia-eskaliert-996322. html<br />
[12] Heise online: Suchmaschine zum Mitmachen (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ meldung/ 82948), 23. Dezember 2006<br />
[13] AP: „Viel Wirbel um Anti-Google-Projekt“ (http:/ / www. epochtimes. de/ articles/ 2007/ 01/ 09/ 78186. html), 11. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[14] Roland Lindner: „Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Der Besserwisser“ (http:/ / www. faz. net/ s/<br />
Rub4C34FD0B1A7E46B88B0653D6358499FF/ Doc~EFA77B2D6443E4355AD710D763A5794EB~ATpl~Ecommon~Scontent. html), FAZ,<br />
22. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[15] Roland Lindner: „Google ist nicht gut genug“ (http:/ / www. faz. net/ s/ RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/<br />
Doc~E08E26713229A4AFFB5319D03DCED2417~ATpl~Ecommon~Scontent. html), FAZ, 22. November 2007<br />
[16] Jimmy Wales: „Update on Wikia – doing more of what’s working“ (http:/ / blog. jimmywales. com/ index. php/ archives/ 2009/ 03/ 31/<br />
update-on-wikia/ ), blog.jimmywales.com, 31. März 2009<br />
[17] Ben Schwan: „WikiSearch am Ende. Vom Scheitern im Web 2.0“ (http:/ / www. taz. de/ 1/ leben/ internet/ artikel/ 1/<br />
vom-scheitern-im-web-20/ ), die tageszeitung, 1. April 2009<br />
[18] Jimmy Wales (http:/ / www. whoswho. de/ templ/ te_bio. php?PID=2764& RID=1), whoswho.de<br />
[19] Ryan Kim: „Allegations swirl around Wikipedia's Wales“ (http:/ / www. sfgate. com/ cgi-bin/ article. cgi?f=/ c/ a/ 2008/ 03/ 05/<br />
BUVFVDM3H. DTL), San Francisco Chronicle, 5. März 2008<br />
[20] Edward Lewine: „The Encyclopedist’s Lair“ (http:/ / www. nytimes. com/ 2007/ 11/ 18/ magazine/ 18wwln-domains-t. html?_r=1), New<br />
York Times, 18. November 2007<br />
[21] Electronic Frontier Foundation: „EFF Honors Craigslist, Gigi Sohn, and Jimmy Wales with Pioneer Awards“ (http:/ / www. eff. org/ awards/<br />
pioneer/ ), 3. Mai 2006<br />
[22] Time Magazine: „The People Who Shape Our World“ (http:/ / www. time. com/ time/ archive/ preview/ 0,10987,1189247,00. html), 8. Mai<br />
2006<br />
[23] Time Magazine: „TIME Magazine Celebrates New 'TIME 100’ List of Most Influential People With Star-Studded Event April 19th“ (http:/ /<br />
www. time. com/ time/ press_releases/ article/ 0,8599,1049613,00. html), 15. April 2006<br />
[24] Knox College Honorary Degrees (http:/ / www. knox. edu/ x12330. xml)<br />
[25] Advisory Board (http:/ / cci. mit. edu/ people/ index. html), MIT Center for Collective Intelligence und MIT Reports to the President<br />
2006–2007 (http:/ / web. mit. edu/ annualreports/ pres07/ 06. 00. pdf), S. 26<br />
[26] Speakers. Jimmy Wales (http:/ / icommonssummit. org/ speakers/ 2008/ 04/ jimmy-wales. html), World Economic Forum, 2007<br />
[27] David M. Ewalt: „The Web Celeb 25“ (http:/ / www. forbes. com/ 2007/ 01/ 23/<br />
internet-fame-celebrity-tech-media-cx_de_06webceleb_0123intro. html), Forbes Magazine, 23. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[28] Preisträger des Quadriga-Preises 2008 (http:/ / loomarea. com/ die_quadriga/ d/ index. php?title=Preisträger_2008)<br />
[29] Pressemitteilung vom 8. Juli 2010 (http:/ / www. presseportal. de/ pm/ 80877/ 1645008/ deutsche_trendtag_gmbh)<br />
[30] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1048-1559<br />
[31] http:/ / papers. ssrn. com/ sol3/ papers. cfm?abstract_id=5735<br />
[32] http:/ / blog. jimmywales. com/
Jimmy Wales 343<br />
[33] http:/ / www. zeit. de/ 2008/ 51/ Traum-51?page=all<br />
[34] http:/ / www. faz. net/ s/ RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/<br />
Doc~E8BA60430FB27410FA863BE9902AFB7FB~ATpl~Ecommon~Scontent. html<br />
[35] http:/ / www. nytimes. com/ 2006/ 06/ 17/ technology/ 17wiki. html?ei=5090& en=646d3cf9d4e68f36& ex=1308196800&<br />
partner=rssuserland& emc=rss& pagewanted=all<br />
[36] http:/ / www. handelsblatt. com/ pshb/ fn/ relhbi/ sfn/ buildhbi/ cn/ GoArt!200014,200811,915920/ SH/ 0/ depot/ 0/<br />
Der_gute_Mensch_des_Internets. html<br />
[37] http:/ / web. archive. org/ web/ 20071107040513/ http:/ / www. finanznachrichten. de/ nachrichten-2006-06/ artikel-6604443. asp<br />
[38] http:/ / www. zeit. de/ 2006/ 37/ wikipedia?page=all<br />
[39] http:/ / www. welt. de/ data/ 2006/ 12/ 24/ 1156729. html?prx=1<br />
[40] http:/ / www. elektrischer-reporter. de/ index. php/ site/ film/ 43/<br />
[41] http:/ / www. econtalk. org/ archives/ 2009/ 03/ wales_on_wikipe. html<br />
[42] http:/ / derstandard. at/ ?id=2578112<br />
[43] http:/ / www. welt. de/ data/ 2006/ 06/ 26/ 932122. html<br />
Wikipedia<br />
URL<br />
Wikipedia<br />
de.wikipedia.org [1] (deutschsprachige Version)<br />
www.wikipedia.org [2] (Übersicht aller Sprachen)<br />
Motto Die freie Enzyklopädie<br />
Kommerziell Nein<br />
Beschreibung Wiki einer freien kollektiv erstellten Online-Enzyklopädie<br />
Registrierung optional<br />
Sprachen rund 260<br />
Eigentümer Wikimedia Foundation<br />
Urheber einzelne angemeldete und nicht angemeldete Autoren<br />
Erschienen 15. <strong>Jan</strong>uar 2001
Wikipedia 344<br />
Die Wikipedia [ˌvɪkiˈpeːdia], gebräuchlich auch ohne Artikel, ist eine 2001<br />
gegründete freie Online-Enzyklopädie in zahlreichen Sprachen. Der Name<br />
Wikipedia ist ein Kofferwort, das sich aus „Wiki“ (hawaiisch für „schnell“) und<br />
„Encyclopedia“ zusammensetzt, dem englischen Wort für Enzyklopädie.<br />
Die deutschsprachige Wikipedia umfasst über eine Million und die<br />
englischsprachige Wikipedia über drei Millionen Artikel.<br />
Überblick<br />
Die Artikel der Online-Enzyklopädie werden von einer weltweiten<br />
Autorengemeinschaft unentgeltlich erstellt. Jeder Internetbenutzer kann<br />
Wikipedia-Artikel nicht nur lesen, sondern auch überarbeiten. Dies kann unter<br />
vollem Namen, unter Pseudonym oder nicht angemeldet geschehen, also<br />
Logo der deutschsprachigen<br />
Wikipedia (2003 bis Juni 2010)<br />
anonym. In einem offenen Bearbeitungsprozess hat Bestand, was von der Gemeinschaft der Mitarbeitenden<br />
akzeptiert wird. Bisher haben international etwa 1.016.000 angemeldete (Stand: 31. Oktober 2009) und eine<br />
unbekannte Zahl nicht angemeldeter Nutzer zur Wikipedia beigetragen. Mehr als 6700 Autoren (Stand: 31. Oktober<br />
2009) arbeiten regelmäßig bei der deutschsprachigen Ausgabe mit. [3]<br />
Die Wikipedia ist gegenwärtig das meist benutzte Online-Nachschlagewerk und rangiert auf Platz sieben der<br />
meistbesuchten Websites. Die englischsprachige Version ist mit Abstand die am häufigsten aufgerufene, sie wird<br />
gefolgt von der japanischen und der deutschsprachigen. [4] Neben ihrer Funktion als Enzyklopädie spielt die<br />
Wikipedia eine wachsende Rolle als Medium für die Verbreitung von aktuellen Nachrichten, [5] zum Beispiel auch in<br />
Krisensituationen. [6]<br />
Alle Inhalte der Wikipedia stehen unter freien Lizenzen – die Artikeltexte unter der GNU-Lizenz für freie<br />
Dokumentation, seit dem 15. Juni 2009 auch unter der Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Lizenz<br />
(CC-BY-SA), [7] bei Bildern gibt es unterschiedliche Lizenzen – und können somit (unter bestimmten Bedingungen)<br />
selbst kommerziell genutzt, verändert und verbreitet werden.<br />
Betreiber ist die Wikimedia Foundation, Inc., eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. In<br />
vielen Ländern gibt es zudem unabhängige Wikimedia-Vereine, die mit der Stiftung zusammenarbeiten. Im<br />
deutschen Sprachbereich sind dies die Wikimedia Deutschland, die Wikimedia Österreich und die Wikimedia CH.<br />
Geschichte<br />
Nupedia war der Vorgänger der Wikipedia<br />
Der erste, der die Idee hatte, das Internet zur gemeinsamen Erstellung<br />
einer Enzyklopädie zu verwenden, ist, so wird allgemein angenommen,<br />
Rick Gates, ein Internet-Pionier, der sie in einem nicht erhaltenen<br />
Beitrag am 22. Oktober 1993 in einer Newsgroup im Usenet zur<br />
Diskussion stellte. [8] Das Projekt, das den Namen Interpedia erhielt,<br />
kam jedoch nicht über das Planungsstadium hinaus. Auch der 1999 von Richard Stallman angeregten GNUPedia war<br />
kein Erfolg beschieden.<br />
Im März 2000 startete der Internet-Unternehmer Jimmy Wales mit dem damaligen Doktoranden der Philosophie<br />
Larry Sanger über die Firma Bomis ein erstes Projekt einer englischsprachigen Internet-Enzyklopädie, die Nupedia.<br />
Der Redaktionsprozess der Nupedia lehnte sich stark an den bisheriger Enzyklopädien an: Sanger amtierte als<br />
Chefredakteur, Autoren mussten sich bewerben und ihre Texte anschließend ein Peer-Review-Verfahren<br />
durchlaufen.
Wikipedia 345<br />
Startseite von Wikipedia.org<br />
Startseite der englischen Wikipedia am 30. März<br />
2001<br />
Hauptseite der deutschsprachigen Wikipedia im<br />
<strong>Jan</strong>uar 2004<br />
Ende 2000/Anfang 2001 wurden Sanger und Wales auf das<br />
Wiki-System aufmerksam, mit dessen Hilfe Benutzer einer Website<br />
diese nicht nur lesen, sondern auch direkt im Browser verändern<br />
können. Am 15. <strong>Jan</strong>uar 2001 war das Wiki der Nupedia unter der<br />
eigenständigen Adresse wikipedia.com abrufbar, was seither als die<br />
Geburtsstunde der Wikipedia gilt. [9]<br />
Ursprünglich war die Wikipedia von Sanger auf Nupedia als<br />
Spaß-Projekt („fun project“ [10] ) neben der Nupedia angekündigt<br />
worden. Dank ihrer Offenheit jedoch entwickelte sich die Wikipedia –<br />
selbst zur Überraschung von Sanger und Wales – so schnell, [11] dass<br />
durch sie die Nupedia in den Hintergrund rückte und im September<br />
2003 ganz verdrängt wurde.
Wikipedia 346<br />
Am 15. März 2001 kündigte Wales in der Wikipedia-Mailingliste an,<br />
Versionen in weiteren Sprachen einrichten zu wollen; unter den ersten<br />
waren die deutschsprachige, die französische und die katalanische<br />
Wikipedia. [12] Ende 2001 existierte die Wikipedia bereits in 18<br />
Sprachen.<br />
Im Februar 2002 entschied sich Bomis, nicht länger einen<br />
Chefredakteur zu beschäftigen, und kündigte den Vertrag mit Larry<br />
Sanger, der wenig später seine Mitarbeit bei Nupedia und Wikipedia<br />
aufgab.<br />
Zur gleichen Zeit erlitt die Wikipedia ihren ersten Rückschlag.<br />
Artikelwachstum der deutschsprachigen<br />
Wikipedia<br />
Zahlreiche Autoren der spanischen Wikipedia entschlossen sich zu einer Abspaltung und gründeten die Enciclopedia<br />
Libre Universal en Español, da sie, nach einer entsprechenden Mitteilung von Sanger, befürchten mussten, in der<br />
Wikipedia werde künftig Werbung eingeblendet. [13]<br />
Um weitere Aufspaltungen zu verhindern, erklärte Wales im selben Jahr, dass die Wikipedia werbefrei bleiben<br />
werde. Außerdem wurde von der wikipedia.com-Website-Adresse zu der für nichtkommerzielle Organisationen<br />
reservierten Top-Level-Domain .org gewechselt.<br />
Am 20. Juni 2003 schließlich kündete Wales die Gründung der<br />
gemeinnützigen Wikimedia Foundation an und übereignete ihr die<br />
Namensrechte (die bei Bomis oder ihm persönlich lagen) und später<br />
auch die Server.<br />
Mittlerweile gibt es die Wikipedia in über 260 Sprachen. Im September<br />
2004 überschritt die Zahl der Artikel die Millionengrenze, derzeit sind<br />
es über zehn Millionen Artikel. Die deutschsprachige Wikipedia<br />
enthält seit dem 27. Dezember 2009 mehr als eine Million Artikel, die<br />
englischsprachige über drei Millionen (Stand: Dezember 2009).<br />
Die Wikipedia gewann mehrere Preise, darunter im Mai 2004 einen<br />
Jimmy Wales nimmt den Quadriga-Preis<br />
entgegen (2008 in Berlin)<br />
Prix Ars Electronica und einen Webby Award, 2005 den Grimme Online Award und 2006 den LeadAward als<br />
Webleader des Jahres sowie den OnlineStar in der Kategorie „News“. [14] 2008 erhielt die Wikipedia den<br />
Quadriga-Preis, den Jimmy Wales am 3. Oktober 2008 in der Berliner Komischen Oper entgegen nahm. Das<br />
Preisgeld von 25.000 Euro ging an die Wikimedia Deutschland. [15]<br />
Funktionsweise<br />
Grundsätze<br />
Vier Grundsätze sind den Angaben des Projekts zufolge unumstößlich und können auch nach Diskussionen nicht<br />
geändert werden: [16]<br />
• Wikipedia ist eine Enzyklopädie.<br />
• Beiträge sind so zu verfassen, dass sie dem Grundsatz des neutralen Standpunkts entsprechen.<br />
• Geltendes Recht – insbesondere das Urheberrecht – ist strikt zu beachten.<br />
• Andere Benutzer sind zu respektieren und die Wikiquette einzuhalten.
Wikipedia 347<br />
Die Grundsätze „neutraler Standpunkt“, „Nachprüfbarkeit“ und „Keine<br />
Theoriefindung“ sollen die inhaltliche Ausrichtung der Artikel<br />
festlegen. Um unweigerlich aufkommende Kämpfe um Artikelinhalte<br />
zu verhindern bzw. zu schlichten und um den Lesern zu ermöglichen,<br />
sich eine eigene Meinung zu bilden, und ihre intellektuelle<br />
Unabhängigkeit zu unterstützen, hat Wikipedia die Richtlinie des<br />
neutralen Standpunkts (NPOV, von englisch neutral point of view)<br />
aufgestellt. Danach soll ein Artikel so geschrieben sein, dass ihm<br />
möglichst viele Autoren zustimmen können. Existieren zu einem<br />
Thema verschiedene Ansichten, so soll ein Artikel diese fair<br />
beschreiben, aber nicht selbst Position beziehen. Der neutrale<br />
Standpunkt verlangt jedoch nicht, dass alle Ansichten gleichwertig<br />
präsentiert werden. Soziale Prozesse sollen gewährleisten, dass er<br />
eingehalten wird, was bei kontroversen Themen oft zu mühevollen<br />
Diskussionen führt.<br />
Welche Themen in die Enzyklopädie aufgenommen werden und in<br />
welcher Form, entscheidet der Theorie nach die Gemeinschaft der<br />
Hauptseite der deutschen Wikipedia vom März<br />
Bearbeiter in einem offenen Prozess. Konflikte entstehen in diesem Zusammenhang meist darüber, was „Wissen“<br />
darstellt, wo die Abgrenzung zu reinen Daten liegt und was unter enzyklopädischer Relevanz zu verstehen ist.<br />
Abgesehen von groben Leitlinien, die Wikipedia von anderen Werktypen, wie Wörterbuch, Datenbank, Link- oder<br />
Zitatsammlung, abgrenzen, gibt es keine allgemeinen Kriterienkataloge (z.B. für Biographien), wie sie in<br />
traditionellen Enzyklopädien gebräuchlich sind. Im Zweifel wird über den Einzelfall diskutiert. Empfindet ein<br />
Benutzer ein Thema als ungeeignet oder einen Artikel als dem Thema nicht angemessen, kann er einen Löschantrag<br />
stellen, der anschließend von jedem Interessierten diskutiert werden kann.<br />
Als Verhaltensvorschrift wird in einer der Usenet-Netiquette nachempfundenen Wikiquette von Mitarbeitern<br />
gefordert, ihre Mitautoren zu respektieren und niemanden in Diskussionen zu beleidigen oder persönlich<br />
anzugreifen. Grundlage ist hierbei die Regel „Gehe von guten Absichten aus!“.<br />
Die Autoren geben ferner mit dem Speichern ihrer Bearbeitung ihre Einwilligung, dass ihr Beitrag unter der<br />
GNU-Lizenz für freie Dokumentation (GFDL) und seit 15. Juni 2009 auch unter der<br />
Creative-Commons-Attribution-Share Alike-Lizenz (CC-BY-SA) veröffentlicht wird. Diese Lizenzen erlauben es<br />
anderen, die Inhalte nach Belieben zu ändern und auch kommerziell zu verbreiten, sofern die Bedingungen der<br />
Lizenzen eingehalten werden und die Inhalte wieder unter den gleichen Lizenzen veröffentlicht werden. Durch<br />
dieses sogenannte Copyleft-Prinzip ist es unmöglich, Wikipedia-Artikel und auf ihnen basierende Texte unter<br />
Berufung auf das Urheberrecht exklusiv zu verwerten.<br />
Erstellung von Inhalten<br />
Seite bearbeiten<br />
2009<br />
Das Wiki-System sieht vor, dass jeder Besucher der Websiten der<br />
Wikipedia Artikel und Beiträge verfassen und Texte ändern kann, ohne<br />
sich anmelden zu müssen. Bestimmte, dauerhaft umstrittene Artikel<br />
können jedoch von nicht angemeldeten oder neu angemeldeten<br />
Benutzern nicht bearbeitet werden (hierbei handelt es sich um eine<br />
sogenannte Halbsperre); es kommt auch vor, dass ein Artikel aktuell so<br />
stark umstritten ist oder mutwillig entstellt wird (Vandalismus), dass er für jegliche Bearbeitung vollgesperrt wird.
Wikipedia 348<br />
Eine eigentliche Redaktion gibt es nicht, das Prinzip basiert vielmehr<br />
auf der Annahme, dass sich die Benutzer gegenseitig kontrollieren und<br />
korrigieren. Die deutschsprachige Wikipedia hat 2008 das System der<br />
Sichtung eingeführt. Dadurch wird allen unangemeldeten Benutzern<br />
standardmäßig die letzte gesichtete Version eines Artikels angezeigt.<br />
Neuere, ungesichtete Versionen bereits gesichteter Artikel werden<br />
angemeldeten Benutzern standardmäßig angezeigt, können aber auch<br />
von unangemeldeten Benutzern über den Reiter Entwurf aufgerufen<br />
werden.<br />
Jede Seite verfügt über eine eigene Diskussionsseite, auf der jeder<br />
Benutzer Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge vorschlagen kann.<br />
Sie gibt zudem Aufschluss über die Entwicklungsgeschichte eines<br />
Artikels und eventuelle Kontroversen.<br />
Aufbau<br />
Die Wikipedia besteht aus vielen einzelnen Webseiten, die in als<br />
„Namensräume“ bezeichnete Gruppen aufgeteilt sind. In allen<br />
Namensräumen können die jeweiligen Seiten von aktiven Nutzern<br />
bearbeitet werden. Der wichtigste Namensraum ist der<br />
Artikelnamensraum mit den enzyklopädischen Artikeln für passive<br />
Nutzer. Daneben gibt es, für aktive Nutzer, weitere Namensräume.<br />
Beispielsweise den Wikipedianamensraum mit Seiten über<br />
Wikipediametadiskurse, unter anderem mit den Richtlinien. Im<br />
Hilfenamensraum sind Hilfeseiten zusammengefasst, die Anleitungen<br />
zur methodischen Umsetzung von Artikelbearbeitungen enthalten.<br />
Angemeldete Benutzer verfügen jeweils über Benutzerseiten im<br />
Artikel in Wikipedia werden direkt im Browser<br />
bearbeitet<br />
Menschen und Seiten in der deutschsprachigen<br />
Wikipedia.<br />
Benutzernamensraum, die sie jeweils frei mit Inhalten füllen und gestalten können, wobei ein Bezug zu Wikipedia<br />
bestehen soll. Häufige Einträge dort betreffen persönliche Angaben zu Alter, Herkunft und Beruf,<br />
benutzerspezifische technische Hilfen, Bearbeitungsschwerpunkte, Nennung der vom Benutzer eröffneten Artikel<br />
sowie Kritik an Wikipedia. Auch in den jeweiligen Namensräumen hat jede Seite eine ihr zugeordnete<br />
Diskussionsseite für aktive Nutzer.<br />
Der Inhalt ist als Hypertext organisiert. Querverweise und Formatierungsanweisungen geben die Autoren in einer<br />
einfachen Syntax ein. So wandelt die Software in doppelte eckige Klammern ([[]]) gesetzte Begriffe automatisch in<br />
einen internen Link auf den betreffenden Artikel um. Existiert der verlinkte Artikel bereits, wird der Link in blauer<br />
Farbe hervorgehoben. Existiert der Artikel noch nicht, erscheint der Verweis in Rot, und beim Anklicken öffnet sich<br />
ein Eingabefeld, in dem der Leser den neuen Artikel verfassen kann. Diese einfache Verknüpfungsmöglichkeit hat<br />
dafür gesorgt, dass die Artikel der Wikipedia wesentlich dichter miteinander vernetzt sind als die anderer<br />
Enzyklopädien auf CD-ROM oder im Internet.<br />
Neben den im Kontext angebrachten Hyperlinks auf andere Artikel bestehen noch weitere<br />
Navigationsmöglichkeiten, wie Kategorien oder der alphabetische Index, die jedoch eine untergeordnete Rolle<br />
spielen.
Wikipedia 349<br />
Organisationsstruktur<br />
Logo der Wikimedia Foundation<br />
Betreiberin der Wikipedia ist die Wikimedia Foundation mit Sitz in<br />
San Francisco. Die einzelnen Sprachversionen der Wikipedia sind alle<br />
nach dem gleichen Grundkonzept aufgebaut, genießen gleichzeitig<br />
aber große Eigenständigkeit.<br />
Die Organisationsstruktur wird hauptsächlich durch in informellen<br />
Organisationsprozessen entstandene Normen bestimmt. Benutzer<br />
können sich mit ihren Beiträgen in der Gemeinschaft (community)<br />
einen Ruf erwerben. Neben der Überzeugungskraft von Argumenten<br />
spielt der – etwa durch Fachkenntnis in bestimmten Gebieten, aber<br />
auch durch Aufnehmen von Kontakten und Bilden von informellen<br />
Cliquen [17]<br />
erworbene – soziale Status innerhalb der<br />
Wikipedia-Gemeinschaft eine Rolle für die Akzeptanz von<br />
Bearbeitungen im Artikelnamensraum.<br />
Angemeldete Benutzer, die bereits eine bestimmte Zahl von Bearbeitungen vorgenommen haben, verfügen über<br />
zusätzliche Rechte. Besonders engagierte Teilnehmer können von der Autorengemeinschaft zu Administratoren<br />
gewählt werden. Administratoren haben erweiterte Rechte und Aufgaben, wie z. B. das Recht, die Bearbeitung von<br />
umstrittenen Artikeln für nicht angemeldete Benutzer zu sperren oder auch Bearbeiter zeitweise auszuschließen, die<br />
grob oder wiederholt gegen die Regeln verstoßen.<br />
Die meisten Regeln der Wikipedia entstehen dadurch, dass viele Teilnehmer einen einzelnen Vorschlag aufgreifen<br />
und anwenden. Wird ein derartiger Vorschlag von einer qualifizierten Mehrheit der Benutzer getragen, gilt er als<br />
akzeptiert und kann zur Regel werden.<br />
Bei umstrittenen Entscheidungen wird in der Wikipedia traditionellerweise versucht, einen Konsens zu finden. In der<br />
Praxis ist ein echter Konsens unter der Vielzahl von Mitarbeitern jedoch oft nicht möglich. In solchen Fällen werden<br />
die Entscheidungen in Verfahren getroffen, die zwischen Diskussion und Abstimmung anzusiedeln sind.<br />
Den größten persönlichen Einfluss – vor allem in der englischsprachigen Wikipedia – hat der Gründer Jimmy<br />
Wales, der mit seiner persönlichen Autorität lange Zeit Konflikte in der Gemeinschaft schlichtete. Einen Teil seiner<br />
Aufgaben in der englischsprachigen Wikipedia übertrug er Anfang 2004 einem von den Teilnehmern gewählten<br />
„Arbitration committee“. Diese einem Schiedsgericht vergleichbare Institution existiert auch in anderen<br />
Sprachversionen, unter anderem in der deutsch- und französischsprachigen Wikipedia.<br />
Mit der Zeit haben sich gegensätzliche Überzeugungen herausgebildet, wie sich die Wikipedia entwickeln soll. Eine<br />
wesentliche Meinungsverschiedenheit besteht zwischen den sogenannten „Inklusionisten“ und den „Deletionisten“<br />
oder „ Exklusionisten“. Dabei plädieren die Inklusionisten dafür, möglichst viele Informationen in die Wikipedia<br />
aufzunehmen und möglichst keine Artikel zu löschen. Die Gegenposition vertreten die Deletionisten, die davor<br />
warnen, zu detaillierte und irrelevante Informationen aufzunehmen, da deren Überprüfung schwierig ist und sich<br />
schneller Fehler einschleichen können.<br />
Finanzierung<br />
Die Wikipedia finanziert sich ausschließlich über Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Die Ausgaben der<br />
Wikimedia Foundation beliefen sich im Fiskaljahr 2008/2009 auf rund 470.000 Dollar im Monat. [18] Davon entfielen<br />
ca. 40 % auf die Gehälter der rund 30 Angestellten [19] und etwa 70.000 Dollar auf das Internet-Hosting. Das Budget<br />
für das Fiskaljahr 2009/2010 beträgt 9,4 Millionen Dollar. [20] Mit einer Spende von 2 Mio. Dollar im Jahr 2010 ist<br />
das Internetunternehmen Google Inc. einer der größten Einzelspender. [21]<br />
An der Finanzierung der Wikipedia beteiligen sich auch die einzelnen nationalen Wikimedia-Chapter. Zum Beispiel<br />
hat Wikimedia Deutschland zehn Angestellte [22] und betreibt den sogenannten Toolserver, auf dem Werkzeuge für
Wikipedia 350<br />
Wikipedia-Autoren bereit stehen. [23]<br />
Technik<br />
Wikimedia-Server in Florida, USA<br />
Anfangs verwendete Wikipedia als Software das in Perl geschriebene<br />
UseModWiki, das den Anforderungen jedoch bald nicht mehr<br />
gewachsen war. Im <strong>Jan</strong>uar 2002 stellte Wikipedia auf eine vom<br />
deutschen Biologen Magnus Manske geschriebene, MySQL-basierte<br />
PHP-Applikation (Phase II) um, die speziell an die Bedürfnisse der<br />
Wikipedia angepasst war. Nachdem die Website sich über ein Jahr die<br />
Ressourcen mit dem Webangebot von Bomis geteilt hatte, zog die<br />
englische Wikipedia, später auch die anderen Sprachversionen, im Juli<br />
2002 auf einen eigenen Server mit einer von Lee Daniel Crocker<br />
überarbeiteten und teils neugeschriebenen Version von Manskes<br />
Software (Phase III) um. Diese erhielt später den Namen <strong>Media</strong>Wiki.<br />
Wikipedia läuft auf Linux-Servern, überwiegend auf der Server-Variante von<br />
Ubuntu [24] , und mit einigen OpenSolaris-Servern für ZFS. Ankommende<br />
HTTP-Requests gelangen zuerst an Squid-Caches, die nicht angemeldete<br />
Besucher, die nur lesen wollen, mit vorgenerierten Seiten versorgen. Die anderen<br />
Anfragen kommen an load-balanced Server auf Basis der Software Linux Virtual<br />
Server, von wo sie zu einem der Apache-HTTP-Server gelangen. Dieser nutzt die<br />
Skriptsprache PHP und die Datenbank MySQL, um die Seiten benutzerspezifisch<br />
zu generieren. Die MySQL-Datenbank läuft auf mehreren Servern mit<br />
Replikation im Master-Slave-Betrieb.<br />
Mit steigenden Zugriffszahlen erhöhten sich die Anforderungen an die Hardware.<br />
Waren es im Dezember 2003 noch drei Server, sind zum Betrieb der Wikipedia<br />
und ihrer Schwesterunternehmungen im November 2009 mittlerweile über 370<br />
Server in Florida und Amsterdam im Einsatz, die von einem Team sowohl<br />
Diagramm der<br />
Wikimedia-Server-Architektur vom<br />
5. April 2009<br />
ehrenamtlicher als auch fest angestellter Administratoren betreut werden. [25] Das Prinzip, die Server nach berühmten<br />
Enzyklopädisten zu benennen, wurde 2005 aufgegeben.<br />
Wikipedia-Server verarbeiten zwischen 25.000 und 60.000 Zugriffe pro Sekunde, je nach Tageszeit. Teilweise<br />
kommt es dabei zu Kapazitätsengpässen, die etwa dazu führen, dass Seiten nur langsam oder gar nicht geladen<br />
werden können.<br />
Mehrere Unternehmen und Organisationen boten der Wikimedia Foundation ihre Unterstützung an. Im April 2005<br />
erklärte sich der Suchmaschinenbetreiber Yahoo bereit, 23 Server in seinem Rechenzentrum in Asien für den Betrieb<br />
der Wikipedia bereitzustellen.<br />
Ein weiteres eigenes Rechenzentrum soll im <strong>Jan</strong>uar 2011 in Ashburn, Virginia (USA), den Betrieb aufnehmen. [26]<br />
Die Entwicklung der Software, etwa den Einbau neuer Funktionen, bestimmt das von der Community unabhängige<br />
Team der Programmierer, das sich einerseits an den Wünschen der Nutzer orientiert, andererseits auch neue Ideen,<br />
wie zum Beispiel Erweiterungen, [27] von außerhalb implementiert.
Wikipedia 351<br />
Statistik<br />
Die Wikipedia wird intern umfassend statistisch erfasst. Das Hauptranking der einzelnen Sprachversionen basiert auf<br />
der absoluten Artikelzahl. Da die Mindestanforderungen an einen Artikel in den einzelnen Versionen sehr<br />
unterschiedlich sind – einige haben Bots eingesetzt, um automatisch Artikel zu schaffen; notorisch dafür ist die<br />
Volapük-Wikipedia, [28] von deren über 118.000 Artikeln nur etwa ein Prozent mehr als zwei Kilobyte groß ist –<br />
werden die einzelnen Wikipedias auch nach dem Umfang der Artikel aufgelistet. Ein anderes Ranking resultiert aus<br />
der Anzahl der Besuche der Website; ein weiterer Anhaltspunkt ist die Anzahl der Bearbeitungen. [29]<br />
Autoren<br />
Identität und Sachkompetenz<br />
Die Identität der Wikipedia-Autoren („Wikipedianer“) ist vielfach nicht<br />
bekannt. Zwar machen viele angemeldete Autoren Angaben zur<br />
eigenen Person auf ihrer Benutzerseite, doch ist dies freiwillig und<br />
kaum überprüfbar. Ein erheblicher Anteil editiert unangemeldet ohne<br />
Benutzerkonto. Im Frühjahr 2007 geriet der Fall des 24-jährigen<br />
amerikanischen Wikipedia-Autors Essjay in die Schlagzeilen, der sich<br />
fälschlich als Universitätsprofessor ausgegeben hatte und in der<br />
englischsprachigen Wikipedia in die höchsten Community-Ämter<br />
aufgestiegen war. [30]<br />
Sozialstruktur<br />
Administratorencollage der deutschen Wikipedia<br />
(<strong>Jan</strong>uar 2010)<br />
Zur Sozialstruktur der Wikipedia-Autoren existieren noch wenige Untersuchungen. Eine Umfrage von Würzburger<br />
Psychologen ergab einen Männeranteil von 88 Prozent und etwa 50 Prozent Singles. 43 Prozent der Befragten<br />
arbeiten Vollzeit. Eine große Gruppe bilden Studenten. Zu ihrer Motivation befragt, bewerteten über 80 Prozent die<br />
Erweiterung des eigenen Wissens als wichtig bis sehr wichtig. [31]<br />
In einer Analyse des Partizipationsverhaltens angemeldeter Teilnehmer stellte Wales fest, dass die Hälfte aller<br />
Beiträge von nur 2,5 Prozent der Nutzer stammte. [32] Er stützte damit seine These von der Wikipedia als „community<br />
of thoughtful users“, die er einer Auffassung als emergentem Phänomen gegenüberstellte, in dem sich aus den<br />
Beiträgen einer Vielzahl anonymer Internetnutzer eher spontan eine Enzyklopädie herausbildet. [33]<br />
Entwicklung<br />
Seit einiger Zeit hat die Wikipedia-Gemeinde zunehmend Schwierigkeiten, engagierte Autoren zu finden und zu<br />
halten. Eine im Herbst 2007 veröffentlichte Erhebung in der englischsprachigen Version ergab, dass die Wikipedia<br />
erstmals seit ihrer Gründung ein sinkendes Engagement ihrer aktiven Benutzer zu verzeichnen hat, und auch die Zahl<br />
der Neuanmeldungen rückläufig ist. Einer der Hauptgründe ist laut einer Studie ein immer rauer werdender<br />
Umgangston. [34] Eine Studie aus dem Jahr 2009 besagt, dass die Erstellung neuer Artikel seit 2005 um ⅔ gefallen<br />
ist, ebenso wird die Anzahl der Bearbeitungen und aktiver Editoren immer geringer. Als einer der Gründe dafür gilt<br />
der Widerstand in der Community gegen neue Inhalte und neue Autoren. Laut dieser Studie werde die Qualität der<br />
Wikipedia deshalb langfristig sinken, da diese neuen Autoren in Zukunft fehlen würden. [35] Eine andere Erklärung<br />
ist die, dass die Einstiegsschwierigkeiten für technisch nicht versierte Erstautoren zu groß sind. Dem soll bis April<br />
2010 mit einem von der Stanton Foundation mit 890 000 Dollar finanzierten Projekt zur Verbesserung der<br />
Benutzerfreundlichkeit abgeholfen werden. [36]
Wikipedia 352<br />
Die zunehmende relative Macht einer sich sozial schließenden Administratorenschaft, der häufig verletzende Tonfall<br />
auf den Diskussionsseiten und in Projektdebatten, eine zunehmend brüske Behandlung von anonymen Mitarbeitern<br />
(IP) und neuangemeldeten sogenannten Benutzern, [37] könnten hier eine problematische Entwicklung kennzeichnen.<br />
Mehrsprachigkeit und internationale Zusammenarbeit<br />
Wikimedia-Organisationen<br />
Die Wikipedia entwickelte sich schon kurz nach ihrer Gründung zu<br />
einem mehrsprachigen Unterfangen. Eine neue Wikipedia in einer<br />
anderen Sprache kann jederzeit gegründet werden, sobald sich<br />
genügend Interessierte finden. Über die Grenze zwischen Sprache und<br />
Dialekt können in der Community heftige Kontroversen entstehen.<br />
Auch ausgestorbene oder Plansprachen sind grundsätzlich zulässig.<br />
Mittlerweile gibt es mehrere Wikipedias in Dialekten wie Plattdeutsch,<br />
Kölsch oder Bayrisch. Die Artikel der durch Interwiki-Links<br />
miteinander verknüpften Sprachversionen sind oft nicht Übersetzungen bestehender Artikel, sondern eigenständige<br />
Beiträge.<br />
Eine Untersuchung eines britischen Forscherteams hat gezeigt, dass der kulturelle Hintergrund einen erheblichen<br />
Einfluss auf das Editierverhalten der Autoren hat. So wird in der deutschsprachigen Wikipedia deutlich öfter Text<br />
gelöscht als in der niederländisch-, französisch- oder japanischsprachigen. [38]<br />
Bedingt durch Sprachbarrieren besteht zwischen den Sprachgemeinschaften in der Regel wenig Austausch; die<br />
Communitys organisieren und entwickeln sich unabhängig voneinander. Einzelne Initiativen wie die „Übersetzung<br />
der Woche“ versuchen, diese Barriere zu überwinden und für mehr Austausch zu sorgen.<br />
Besonders die Gründung von Wikimedia Commons bewirkte einen Aufschwung in der internationalen<br />
Zusammenarbeit. Auf den mehrsprachig angelegten Commons arbeiten Wikipedia-Teilnehmer aus allen<br />
Sprachversionen am Aufbau eines zentralen Medien-Repositoriums.<br />
Rezeption<br />
Wissenschaftliche Untersuchungen<br />
Markenbildung<br />
Erfolg und Publizität des offenen Enzyklopädiekonzepts (Wikipedia lag 2007 erstmals auf Platz Vier der<br />
international bekanntesten Marken) [39] weckten auch das Interesse zahlreicher Wissenschafter und Studierender.<br />
So visualisierte und analysierte ein Forscherteam von IBM und MIT beispielsweise 2004 mit dem<br />
Historyflow-Verfahren die Evolution von Artikeln. Die Autoren stellten dabei unter anderem fest, dass die<br />
Gemeinschaft Vandalismus erstaunlich schnell beseitigte. [40]<br />
Machtprozesse<br />
Eine Autorengruppe um den Soziologen Christian Stegbauer untersuchte die deutsche Wikipedia auf dem Stand vom<br />
September 2006 netzwerkanalytisch. Sie ermittelte eine zunehmende Schließung der Gruppe der Administratoren<br />
mit Selbstrekrutierung und sozialer Exklusion der später kommenden Mitarbeiter. [41]<br />
Sie sieht darin zum Teil einen Selbststeuerungsprozess. Stegbauer verwendet für diese Gruppen (in verschiedenen<br />
Fachbereichen) den Ausdruck Führungseliten, die – allerdings nicht im politischen oder ökonomischen Sinn –<br />
Macht auf sich versammelt. Er ermittelt und beschreibt im Einzelnen die Erstellung von Artikeln in einem System,<br />
das sich in ständigen Reputations- und Rollenkämpfen stabilisiert und dessen eines Kerninstrument der persönliche<br />
Fleiß sei. Am deutlichsten ortet er es im Zugang zum Administratorenamt innerhalb der Autorenschaft. Denn die<br />
dort praktizierte formelle Wahl durch alle interessierten Wikipedia-Nutzer habe sich de facto zu einem
Wikipedia 353<br />
Kooptationsverfahren von Spezialisten, sei es Spezialisten für Redigieren oder Regelwissen, entwickelt. [42] Er<br />
identifizierte insgesamt acht soziale Rollen: neben den Führungseliten noch Artikelschreiber, Vandalen,<br />
Vandalenjäger, Administratoren, Begrüßer, Trolle und Propagandisten. [43]<br />
Quellenlage<br />
Einen Überblick über die Lehr- und Forschungstätigkeit zu Wikis im Allgemeinen und der Wikipedia im Besonderen<br />
geben englisch die Wiki Research Bibliography und deutsch die Wikipedistik (siehe den Abschnitt Weblinks).<br />
Wikipedia im Vergleich zu anderen Enzyklopädien<br />
Der erste groß angelegte Vergleich der deutschsprachigen Wikipedia mit den etablierten digitalen<br />
Nachschlagewerken Microsoft Encarta Professional 2005 und Brockhaus multimedial 2005 Premium erschien im<br />
Oktober 2004 in der Computer-Fachzeitschrift c’t (Ausgabe 21/04). Wikipedia erreichte dort im Inhaltstest die<br />
höchste durchschnittliche Gesamtpunktzahl, in der Kategorie Multimedia schnitt die freie Enzyklopädie dagegen<br />
schlecht ab − ähnliche Wertungen erzielte die deutschsprachige Wikipedia kurz darauf in einem Lexikavergleich der<br />
Wochenzeitung Die Zeit. Beide Tests basierten auf einer kleinen Stichprobe von insgesamt 60 bis 70 Artikeln aus<br />
verschiedenen Themengebieten. 2007 führte die c’t einen weiteren Vergleich zwischen Bertelsmann, Brockhaus,<br />
Encarta und Wikipedia durch, bei dem Wikipedia hinsichtlich Fehlerzahl nicht schlechter als die kommerziellen<br />
Enzyklopädien abschnitt und in den Kategorien „Vollständigkeit“ und „Aktualität“ vorne lag. Dabei empfanden die<br />
Tester die Artikel der Wikipedia vielfach als zu ausführlich und langatmig. [44]<br />
Im Dezember 2005 veröffentlichte die Zeitschrift Nature einen Vergleich der<br />
englischen Wikipedia mit der Encyclopædia Britannica. [45] In einem Blindtest<br />
hatten 50 Experten je einen Artikel aus beiden Werken aus ihrem Fachgebiet<br />
ausschließlich auf Fehler geprüft. Mit durchschnittlich vier Fehlern pro Artikel<br />
lag die Wikipedia nur knapp hinter der Britannica, in der im Durchschnitt drei<br />
Fehler gefunden wurden.<br />
Britannica reagierte darauf im März 2006 mit einer Kritik der Nature-Studie, in<br />
der sie dem Wissenschaftsmagazin schwere handwerkliche Fehler vorwarf – so<br />
seien etwa Artikel herangezogen worden, die gar nicht aus der eigentlichen<br />
Enzyklopädie, sondern aus Jahrbüchern stammten, außerdem seien die Reviews<br />
selbst nicht auf Fehler geprüft worden. [46] Die Zeitschrift Nature wies die<br />
Vorwürfe zurück und erklärte, sie habe die Online-Ausgaben verglichen, die<br />
auch die Jahrbuchartikel enthalte. Dass die Reviews auf Fehler geprüft seien,<br />
Encyclopædia Britannica<br />
habe sie nie behauptet; und dadurch, dass die Studie als Blindtest durchgeführt worden sei, träfen sämtliche<br />
Kritikpunkte auch auf die Reviews der Wikipedia-Artikel zu, das Gesamtergebnis ändere sich folglich nicht. [47]<br />
Gute Vergleichsnoten erhielt Wikipedia von Günter Schuler im Juli 2007 sowohl in der Konkurrenz zu den<br />
bekannten Universalenzyklopädien wie auch in der Gegenüberstellung mit diversen Fachlexika und<br />
Online-Suchmaschinen wie Yahoo und Google. [48] Die Vorzüge der Wikipedia gegenüber den klassischen<br />
Online-Suchmaschinen sah Schuler vor allem in der günstigen Kombination aus Weblinks, die „vom Feinsten“ seien,<br />
und der Tatsache, dass zumindest „die größeren Wikipedia-Sprachversionen mittlerweile so gut wie alle<br />
Themenbereiche abdecken.“ [49]<br />
Im Dezember 2007 veröffentlichte die Zeitschrift Stern einen Vergleich zwischen Wikipedia und der<br />
Online-Ausgabe des Brockhaus. Der Recherchedienst „Wissenschaftlicher Informationsdienst WIND GmbH“ in<br />
Köln überprüfte 50 zufällig ausgewählte Einträge zu den Themen Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Kultur,<br />
Unterhaltung, Erdkunde, Medizin, Geschichte und Religion auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und<br />
Verständlichkeit. [50] Wikipedia erzielte über alle Bereiche eine Durchschnittsnote von 1,7 nach deutschen<br />
Schulnoten, während die Brockhaus-Einträge zu den gleichen Stichworten nur auf eine Durchschnittsnote von 2,7
Wikipedia 354<br />
kamen. Bei 43 Artikeln gaben die Tester der Wikipedia bessere Noten als der kostenpflichtigen Konkurrenz, in<br />
einem Fall erhielten beide Nachschlagewerke die gleiche Note, bei sechs Stichworten lag der Brockhaus vorn.<br />
Ebenso bei der Verständlichkeit; einige Wikipedia-Artikel fanden die Tester zu kompliziert, andere zu weitschweifig<br />
und zu lang. Lobend erwähnte der Stern das besonders gute Abschneiden der Wikipedia in der Kategorie<br />
„Aktualität“, während er sich überrascht zeigte, dass die Wikipedia auch in der Rubrik „Richtigkeit“ siegte;<br />
„angesichts der Tatsache, dass hier Freiwillige gratis gegen professionelle Redakteure antreten, [sei] dies nicht zu<br />
erwarten [gewesen].“ [51]<br />
Probleme<br />
Wechselverhältnis mit anderen Medien<br />
Wechselwirkung zwischen<br />
Wikipedia und den Medien aus Sicht<br />
des Satiremagazins Titanic. [52]<br />
Ein Teil der Informationen in der Wikipedia, besonders bei aktuellen politischen<br />
Themen, stammt aus Berichten in Mainstream-Medien. Da viele Medien<br />
ihrerseits Beiträge aus der Wikipedia für ihre Berichte verwenden, zum Teil ohne<br />
sie zu überprüfen, [53] entsteht ein gegenseitiges Wechselverhältnis zwischen<br />
Wikipedia und anderen Medien. Wird von den Medien eine Falschinformation<br />
aus einem Wikipedia-Artikel übernommen, kann das zur Folge haben, dass<br />
dieser fehlerhafte Medienbericht dem Wikipedia-Artikel anschließend als<br />
Nachweis dient und sich die Falschmeldung so – von Lesern und Autoren<br />
akzeptiert − immer weiter verbreitet.<br />
Ein bekanntes Beispiel dafür ist ein Vorfall in der deutschsprachigen Wikipedia<br />
im Februar 2009, als ein anonymer Blogger in eine Politikerbiografie mutwillig<br />
einen falschen Vornamen zusätzlich zu den zahlreichen richtigen eingefügt<br />
hatte, [54] der danach von einer großen Anzahl deutscher Medien übernommen wurde, die ihn aus der Wikipedia<br />
abgeschrieben hatten. Der Fehler wurde von der Wikipedia zwar bemerkt und korrigiert, die Korrektur wurde aber<br />
wieder rückgängig gemacht, weil man sich in der Wikipedia auf die Medien verließ, die den erfundenen, aus der<br />
Wikipedia abgeschriebenen Vornamen aufführten. [55]<br />
Qualität und Verlässlichkeit der Inhalte<br />
Die am häufigsten geäußerte Kritik an der Wikipedia ist die, dass sie dadurch, dass jeder Internetnutzer ihre Inhalte<br />
verändern und verfälschen kann, im Unterschied zu herkömmlichen Enzyklopädien keine Gewähr für die Richtigkeit<br />
und Vollständigkeit ihrer Artikel bietet.<br />
Das prominenteste Beispiel eines Hoax-Eintrags waren die von einem anonymen Autor in der englischsprachigen<br />
Wikipedia verfassten falschen Angaben in der Biographie des amerikanischen Journalisten John Seigenthaler sen. im<br />
Jahr 2005, die erst nach mehreren Monaten entdeckt und erst auf Seigenthalers Intervention hin von Jimmy Wales<br />
vollständig gelöscht wurden. [56] Der Autor gab sich später zu erkennen und erklärte, er habe sich lediglich einen<br />
Scherz mit einem Arbeitskollegen, der die Familie Seigenthaler kannte, erlaubt und nicht gewusst, dass die<br />
Wikipedia eine seriöse Enzyklopädie sei. [57]<br />
Neben dem Problem bewusster Fehleintragungen besteht das weit komplexere Problem, dass sich statt Wissen<br />
Halbwissen in der Wikipedia durchsetzen könnte. In einer durch Arbeitsteilung ausgezeichneten Gesellschaft verfügt<br />
immer nur eine Minderheit über Fachwissen. Diese Minderheit läuft jedoch stets Gefahr, von der Mehrheit<br />
„korrigiert“ zu werden. Der US-amerikanische Informatiker und Künstler Jaron Lanier bezeichnet solche<br />
kollektivistischen Ansätze im Internet als „Digitalen Maoismus“. [58] Der Gefahr, dass die Inhalte der Wikipedia nicht<br />
den Wissensstand der Gesellschaft, sondern die vorherrschenden Vorurteile abbilden könnten, bekräftigen und<br />
tradieren, wäre auch durch administrative Vorgänge und korrektives Eingreifen von Autoren nicht vollständig
Wikipedia 355<br />
beizukommen.<br />
Anders als in herkömmlichen Enzyklopädien sagen Länge und Umfang eines Artikels der Wikipedia nichts über<br />
seine Bedeutung aus, was oft kritisiert wird. Während viele Popkultur- und Computerthemen in aller Breite<br />
dargestellt sind, kann es durchaus sein, dass zum Beispiel zu einem zentralen Begriff der Philosophie nur ein extrem<br />
kurzer Eintrag vorhanden ist.<br />
Inhaltliche Ausrichtung<br />
Die Historikerin Maren Lorenz kritisiert, dass in Wikipedia ein sehr traditionelles, männlich geprägtes<br />
Geschichtsbild vorherrsche, das vor allem ereignis- und militärgeschichtliche Sichtweisen repräsentiere. Sie führt<br />
das auf die soziale Zusammensetzung der Editoren zurück, die größtenteils aus naturwissenschaftlich und<br />
technik-interessierten männlichen Hobbyhistorikern bestehe [59] .<br />
Marc Graham vom The Guardian merkt an, dass die Wikipedia ein beträchtliches Ungleichgewicht zwischen dem<br />
globalen Norden und dem globalen Süden widerspiegele. Insbesondere sei Wissen zu Ländern und Ereignissen auf<br />
dem afrikanischen Kontinent, aber auch zu einigen süd- und mittelamerikanischen Ländern sowie zum Südpazifik<br />
extrem unterrepräsentiert. [60]<br />
Einflussnahme von Interessengruppen<br />
Wegen der zunehmenden Bekanntheit und breiten Nutzung der Wikipedia suchen unterschiedliche<br />
Interessengruppen, unter anderem aus Politik, Religion und Wirtschaft, vermehrt Einfluss auf Inhalte von Artikeln zu<br />
nehmen. Der Journalist Günter Schuler sieht in der Wikipedia „das zielgerichtete Hijacken von Artikel-Inhalten für<br />
die jeweilige politische Sicht sowie die Praxis des Artikel-Aufschönens zu PR-Zwecken.“ [61] In der Presse sorgte der<br />
WikiScanner für Aufsehen, weil sich dadurch Beiträge unangemeldeter Benutzer den Netzwerken der Firmen,<br />
Organisationen oder politischen Gruppen, von denen sie stammen, eindeutig zuordnen lassen. [62] So wurde zum<br />
Beispiel bekannt, dass in den USA Änderungen an Politikerbiographien vorgenommen worden waren, von denen<br />
einige eindeutig auf Computer im US-Kongress zurückzuführen waren. [63] In der deutschsprachigen Wikipedia<br />
wurde ein ähnlicher Fall, in dem deutsche Politikerbiographien von Computern aus dem Deutschen Bundestag<br />
bearbeitet worden waren, publik; [64] und auch die Konrad-Adenauer-Stiftung benutzte einen ihrer eigenen Computer,<br />
um einen ihr nicht genehmen Eintrag zu löschen. [65]<br />
Eine weitere Gefahr ist die Einflussnahme von rechtsextremistischen Kräften. Günter Schuler weist darauf hin, dass<br />
Rechtsextremisten aufgrund der „inhaltlichen Beliebigkeit“ des „neutralen Standpunkts“ ihre ideologischen<br />
Vorstellungen mittels Wikipedia einer größeren Leserschaft in propagandistischer Absicht zugänglich machen<br />
können. Er fordert als Gegenmaßnahme die Einführung bestimmter Antidiskriminierungs- und<br />
Antifaschismusetikette. [66]<br />
Die Politikwissenschaftlerin Margret Chatwin untersuchte den kampagnenartigen Einfluss der Neuen Rechten auf<br />
die Wikipedia am Beispiel der Wochenzeitung „Junge Freiheit“. Chatwin kommt zum Schluss, dass es vor allem die<br />
garantierte Anonymität sei, die es der Neuen Rechten ermögliche, eine „Volkspädagogik von rechts“ breit in die<br />
Enzyklopädie zu tragen. Die Wikipedia biete wie kaum ein anderes Medium die Möglichkeit, gesellschaftliche<br />
Diskurse zu prägen und bestimmte Begriffe und Werte zu entlasten oder neu zu besetzen, wobei die Akteure sowohl<br />
zu Diffamierungen wie Täuschungen greifen können. [67] Chatwin bemängelt „das Fehlen einer redaktionellen<br />
Durchsicht und insbesondere einer Fachredaktion zu zeitgeschichtlichen und politischen Themen“, das sie für „das<br />
größte Defizit der Wikipedia“ erachtet. [68]
Wikipedia 356<br />
Strikte Relevanzkriterien und schnelles Löschen<br />
In der deutschen Blogosphäre und anschließend auch in anderen Medien wurden gegen Ende 2009 die zu strikten<br />
Relevanzkriterien der deutschen Wikipedia kritisiert, die zur Löschung von zahlreichen eigentlich behaltenswerten<br />
Artikeln führen würden. Auch würden viele Artikel zu schnell gelöscht, so dass sie gar nicht erst verbessert werden<br />
könnten [69] .<br />
Zensur<br />
Der prominenteste und bisher schwerstwiegende Zensurfall, dessen Opfer die Wikipedia wurde, sind die Sperrungen<br />
in der Volksrepublik China im Zeitraum zwischen 2004 und 2008, von denen zeitweise große Teile Chinas betroffen<br />
waren. Im September 2006 widersetzte sich Jimmy Wales einer Aufforderung der chinesischen Regierung, politische<br />
Einträge für eine chinesische Version der Wikipedia zu blockieren, mit der Begründung, Zensur widerspreche der<br />
Philosophie von Wikipedia. Dem Observer sagte Wales: „Wir stehen für die Freiheit von Information, und wenn wir<br />
einen Kompromiss eingingen, würde das meiner Ansicht nach ein ganz falsches Signal senden, nämlich dass es<br />
niemanden mehr […] gibt, der sagt: ‚Wisst ihr was? Wir geben nicht auf.‘“ [70]<br />
Der Organisation Reporter ohne Grenzen zufolge blockierte der Iran 2006 mehrere Monate lang die kurdische<br />
Wikipedia. [71]<br />
Thailändische Nutzer berichteten im Oktober 2008 von einer Sperrung des englischen Artikels über König<br />
Bhumipol. [72]<br />
Im Dezember 2008 blockierten britische Provider den Artikel über das Scorpions-Album Virgin Killer wegen des<br />
dort abgebildeten Album-Covers, das die Internet Watch Foundation, eine halbstaatliche britische Organisation zur<br />
Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet, als Kinderpornografie eingestuft und auf ihre Sperrliste gesetzt<br />
hatte. [73]<br />
Lizenz<br />
CC-BY-SA-Icon GNU logo<br />
Es hat sich gezeigt, dass die GNU-Lizenz für freie Dokumentation (GFDL), unter der die Wikipedia-Inhalte stehen,<br />
für die Wiki-basierte Erstellung einer freien Enzyklopädie nur bedingt tauglich ist. Die Lizenz wurde ursprünglich<br />
für freie EDV-Dokumentationen entwickelt, bei denen die Anzahl der Textrevisionen und der beteiligten Autoren in<br />
der Regel überschaubar ist. In der Wikipedia hingegen ist gerade an Artikeln zu populären oder kontroversen<br />
Themen mitunter eine große Anzahl von Autoren beteiligt. Artikelverschmelzungen und -aufspaltungen,<br />
Übersetzungen aus anderssprachigen Wikipedia-Versionen sowie anonyme Textspenden aus unklaren Quellen sind<br />
an der Tagesordnung. Der komplexe Entstehungsprozess vieler Artikel lässt sich oft nur mühsam rekonstruieren.<br />
Es wird daher auch unter Juristen diskutiert, wie die GFDL-Lizenzbedingungen im Einzelnen anzuwenden sind. Dies<br />
gilt etwa für die Bereitstellung der vollständigen Versionsgeschichte, die Ermittlung von Hauptautoren oder die<br />
Pflicht zur vollständigen Wiedergabe des Lizenztextes.<br />
Nach einer Abstimmung innerhalb der Wikipedia hat die Wikimedia Foundation am 21. Mai 2009 bekannt gegeben,<br />
dass die Wikipedia ab 15. Juni 2009 sowohl unter GNU-Lizenz für freie Dokumentationen als auch unter<br />
Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Lizenz (Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen) [74]
Wikipedia 357<br />
lizenziert wird. Die Creative-Commons-Lizenzen sind im Gegensatz zur GNU-Lizenz nicht nur für<br />
EDV-Dokumentationen konzipiert und können daher zum Beispiel bei Bildern Vorteile bieten. [75]<br />
Urheberrechtsverletzungen<br />
Die offene Natur eines Wiki bietet keinen Schutz vor Urheber- und anderen Rechtsverletzungen. Ergibt sich ein<br />
entsprechender Verdacht, so prüfen aktive Nutzer Artikel darauf, ob sie von anderen Quellen kopiert wurden. Wenn<br />
sich der Verdacht bestätigt, werden diese von den Administratoren nach einer Einspruchsfrist gelöscht. Vollständige<br />
Sicherheit bietet dieses Verfahren jedoch nicht.<br />
Der größte bekannt gewordene Fall einer Urheberrechtsverletzung wurde im November 2005 von Mitarbeitern der<br />
deutschsprachigen Wikipedia entdeckt. Ein anonymer Autor hatte zwei Jahre lang Beiträge aus Büchern, vorwiegend<br />
alten DDR-Lexika, kopiert. Über 1000 Artikel wurden zuerst unter Quarantäne gestellt und viele davon gelöscht,<br />
nachdem sie sich als direkte Kopien erwiesen hatten. Umgekehrt sind Fälle bekannt, in denen Urheberrechte der<br />
Autoren der Wikipedia verletzt wurden, indem Beiträge ohne Einhaltung der Lizenz aus Wikipedia kopiert und in<br />
fremde Webseiten eingearbeitet wurden.<br />
Formen der Nutzung<br />
Der erste WikiReader<br />
Wikipedia-Inhalte werden von zahlreichen Websites dank der freien Lizenz<br />
aufgenommen, einige verdienen dabei an der Einblendung von Werbung. Auch<br />
viele Medien verwenden für ihre Berichte Beiträge aus der Wikipedia, oft ohne<br />
sie zu überprüfen.<br />
Es gibt Wikipedia-Versionen für Handy und PDA, [76] und es entstanden mehrere<br />
Offline-Reader, bei deren Verbreitung die deutschsprachige Wikipedia eine<br />
Vorreiterrolle spielte. Deutschsprachige Wikipedianer stellten sogenannte<br />
WikiReader zusammen, Artikelsammlungen zu einem Thema, von denen einige<br />
in kleinen Auflagen auch gedruckt erschienen.<br />
Im Herbst 2004 veröffentlichte der Berliner Verlag Directmedia Publishing in<br />
Zusammenarbeit mit der Wikipedia-Community eine CD-Version der<br />
deutschsprachigen Wikipedia. Etwa halbjährlich erschienen bis 2007<br />
DVD-Ausgaben, die auch frei im Netz zum Herunterladen bereitgestellt wurden.<br />
Lektorierte Sammlungen von Wikipedia-Texten veröffentlichte in den Jahren<br />
2005 und 2006 die Zenodot Verlagsgesellschaft als Taschenbuchreihe WikiPress.<br />
Seit 2008 gibt es den Freeware-Offline-Reader WikiTaxi. Er ermöglicht den<br />
Import von aktuellen Wikipedia-Datenbankauszügen in allen verfügbaren<br />
Sprachen und stellt die Offline-Nutzung von Wikipedia und den<br />
Schwesterprodukten sicher. [77]<br />
Der zu Bertelsmann gehörende Wissen <strong>Media</strong> Verlag brachte im September 2008<br />
DVD-Ausgabe der deutschen<br />
Wikipedia<br />
das Wikipedia Lexikon in einem Band heraus, eine knapp 1000-seitige Druckfassung mit 20.000 Stichwörtern auf<br />
Basis der 2007/2008 am häufigsten aufgerufenen Artikel der deutschsprachigen Wikipedia. [78]<br />
Seit Februar 2009 können Auszüge aus der deutschsprachigen Wikipedia als vom Benutzer individuell<br />
zusammenstellbares Book-on-Demand im A5-Format mit mindestens 48 und höchstens 828 Seiten hergestellt
Wikipedia 358<br />
werden. [79]<br />
Weitere Wikimedia-Projekte<br />
Da sich Wikipedia auf Enzyklopädieartikel beschränkt, sind<br />
inzwischen Ableger entstanden, die sich anderer Textsorten und<br />
weiterer Medien annehmen.<br />
Ein solcher Ableger ist Wiktionary, bei dem das Wiki-Konzept auf<br />
Wörterbücher angewendet wird. Im Juli 2003 wurde Wikibooks mit<br />
dem Ziel gegründet, freie Lehrbücher zu erstellen. Wikiquote sammelt<br />
Zitate; Wikisource ist eine Sammlung freier Originalquellen.<br />
Seit September 2004 gibt es mit den Wikimedia Commons eine<br />
zentrale Datenbank, die Bilder und andere Medien für alle<br />
Wikimedia-Organigramm 2008<br />
Wikimedia-Projekte gemeinsam zugänglich macht und Wikispecies, ein Verzeichnis sämtlicher Arten.<br />
Wikinews, das sich dem Aufbau einer freien Nachrichtenquelle widmet, wurde Anfang November 2004 ins Leben<br />
gerufen. Seit August 2006 gibt es Wikiversity, eine Studien- und Forschungsplattform auf Basis eines Wiki.<br />
Partnerschaften<br />
Am 23. April 2009 haben die Wikimedia Foundation und das Telekommunikationsunternehmen Orange eine<br />
Partnerschaft angekündigt, mit dem Ziel, die „Zugangsmöglichkeiten von Menschen zu freiem Wissen zu erweitern“.<br />
Auf den Mobile- und Webportalen von Orange sollen eigene Wikipedia-Kanäle mit entsprechenden Links<br />
bereitgestellt werden. [80]<br />
Wikipedia als Modell<br />
Wikipedia inspirierte die Gründung zahlreicher anderer Wikis, so zum Beispiel die Enzyklopädieprojekte Wikiweise<br />
und Citizendium. Beide sehen sich als Gegenentwurf zur freien Wikipedia und wollen einen höheren<br />
Qualitätsstandard bieten. Aus der Wikipedia-Gemeinschaft entwickelten sich ab 2004 die Parodien Kamelopedia,<br />
Uncyclopedia und Stupidedia. Im Juli 2008 hat Google ein verwandtes ebenfalls mehrsprachiges Projekt namens<br />
Knol gestartet, das als mögliche ernsthafte Konkurrenz zur Wikipedia angesehen wird. Das Projekt OpenStreetMap<br />
bezieht sich in der Arbeitsweise gerne auf die Wikipedia und bezeichnet sich häufiger als „Die Wikipedia für<br />
Karten“. Am 11. Juli 2009 wurde in Portugal vom Institut für portugiesische Demokratie (IDP) das Projekt<br />
Constituição 2.0 lanciert. Dabei soll, nach dem Vorbild der Wikipedia, eine neue, mit dem Wiki-System kollektiv<br />
erstellte, portugiesische Verfassung entstehen. [81] In einem Artikel in der israelischen Tageszeitung Haaretz wird die<br />
Idee als Möglichkeit zur Schaffung einer Verfassung Israels aufgegriffen. [82]<br />
Literatur<br />
• Literatur über Wikipedia in Bibliothekskatalogen: DNB [83] , GBV [84]<br />
• Ulrike Pfeil: Cultural Differences in Collaborative Authoring of Wikipedia. [85] In: Journal of Computer-<strong>Media</strong>ted<br />
Communication. Washington 12.2006, Nr. 1, S.88. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.00316.x [86] ISSN 1083-6101<br />
[87]<br />
• HL Chen: The use and sharing of information from Wikipedia by high-tech professionals for work purposes. In:<br />
Electronic Library. 27, Nr. 6, 2009, ISSN 0264-0473 [88] , S. 893–905.<br />
• D. Fallis: Toward an epistemology of Wikipedia. In: Journal of the American Society for Information Science and<br />
Technology. 59, Nr. 10, August 2008, ISSN 1532-2882 [89] , S. 1662–1674.<br />
• Henriette Fiebig (Hrsg.): Wikipedia. Das Buch. [90] WikiPress. Bd. 1. Zenodot, Berlin 2005. ISBN 3-86640-001-2
Wikipedia 359<br />
• Andrew Lih: The Wikipedia Revolution. Hyperion, New York 2009. ISBN 1-4013-0371-4<br />
• S. Lim: How and Why Do College Students Use Wikipedia?. In: Journalf of the American Society for Information<br />
Science and Technology. 60, Nr. 11, November 2009, ISSN 1532-2882 [89] , S. 2189–2202.<br />
• PD Magnus: On Trusting Wikipedia. In: Episteme: A Journal of <strong>Social</strong> Epistemology.. 6, Nr. 1, 2009, ISSN<br />
1472-3600 [91] , S. 74–90.<br />
• Frank Schulenburg, Achim Raschka, Michail Jungierek: Der „McDonald’s der Informationen“? Ein Blick hinter<br />
die Kulissen des kollaborativen Wissensmanagements in der deutschsprachigen Wikipedia. In: Bibliothek.<br />
Forschung und Praxis. 31, Nr. 2, 2007, ISSN 0341-4183 [92] , S. 225-230.<br />
• Lawrence Mark Sanger: The Fate of Expertise after Wikipedia. In: Episteme: A Journal of <strong>Social</strong> Epistemology. 6,<br />
Nr. 1, ISSN 1472-3600 [91] , S. 52–73.<br />
• P. Shachaf: The paradox of expertise: is the Wikipedia Reference Desk as good as your library?. In: Journal of<br />
Documentation. 65, Nr. 6, 2009, ISSN 0022-0418 [93] , S. 977–996.<br />
• Christian Stegbauer: Die Bedeutung positionaler Netzwerke für die Sicherstellung der Online-Kooperation: Das<br />
Beispiel Wikipedia. In: Medien + Erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik. 51, Nr. 6, 2007, ISSN 0176-4918<br />
[94] , S. 59–73.<br />
• Christian Stegbauer: Wikipedia: Das Rätsel der Kooperation. VS Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 3-531-16589-5<br />
• Stefan Weber: Die Ethik wissenschaftlicher Textproduktion im Zeitalter des Internets. Wie google und Wikipedia<br />
zunehmend die Recherche in der Bibliothek ersetzen. In: Communicatio <strong>Social</strong>is. Internationale Zeitschrift für<br />
Kommunikation in Religion, Kirche und Gesellschaft. 41, Nr. 1, 2008, ISSN 0010-3497 [95] , S. 14-36.<br />
• K Brad Wray: The Epistemic Cultures of Science and Wikipedia. A Comparison. In: Episteme: A Journal of<br />
<strong>Social</strong> Epistemology.. 6, Nr. 1, 2009, ISSN 1472-3600 [91] , S. 38–51.<br />
Weblinks<br />
• Internationales Wikipedia-Portal [96] – Übersicht über die verschiedenen Wikipedia-Ausgaben<br />
• Wiki Research Bibliography [97] (englisch) – mit wissenschaftlichen Arbeiten über Wikipedia und Wikis<br />
• Wikipedistik [98] – Informationen über laufende Forschungsprojekte zur Wikipedia auf Deutsch<br />
• Geschichte der Wikipedia [99] und Kritische Betrachtung der Wikipedia [100] – Wikipedia-intern<br />
• Larry Sanger: The Early History of Nupedia and Wikipedia: A Memoir. [101] (englisch)<br />
• Jaron Lanier: Digital Maoism. The Hazards of the New Online Collectivism. [102] in: Edge – The Third Culture.<br />
vom 30. Mai 2006 (englisch)<br />
• Maoismus. Kollektivismus im Internet, Weisheit der Massen, Fortschritt der Communities? Alles<br />
Trugschlüsse. [103] (Deutsche Übersetzung gekürzt) in: Süddeutsche Zeitung vom 16. Juni 2006<br />
• Douglas Rushkoff, Quentin Hardy, Yochai Benkler, Clay Shirky, Cory Doctorow, Kevin Kelly, Esther Dyson,<br />
Larry Sanger, Fernanda Viegas, Martin Wattenberg, Jimmy Wales, George Dyson, Dan Gillmor, Howard<br />
Rheingold: Responses to Lanier’s essay. [104] (englisch)<br />
• Herbert Hrachovec: Hegel, Bildung, Wikipedia [105] (139 kB pdf)<br />
• Peter Haber im Interview mit der ZEIT: Wikipedia. Je umstrittener, desto besser [106] , 8. Juli 2010
Wikipedia 360<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / de. wikipedia. org/<br />
[2] http:/ / www. wikipedia. org/<br />
[3] Erik Zachte: Wikipedia-Statistik (http:/ / en. wikipedia. org/ wikistats/ DE/ TablesRecentTrends. htm), erzeugt am Sonntag, 18. Februar 2007<br />
aus dem SQL-Dump vom Samstag, 20. <strong>Jan</strong>uar 2007. Internationale Benutzer: Stand September 2006.<br />
[4] Alexa Statistik für wikipedia.org (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ wikipedia. org?range=5y& size=large& y=t) abgerufen am 26. Mai 2009<br />
[5] Jonathan Dee: All the News That’s Fit to Print; (http:/ / www. nytimes. com/ 2007/ 07/ 01/ magazine/ 01WIKIPEDIA-t. html?_r=1) The New<br />
York Times Magazine, 1. Juli 2007<br />
[6] Thelwall, Mike & David Stuart (2007): „RUOK? Blogging communication technologies during crises“ (http:/ / jcmc. indiana. edu/ vol12/<br />
issue2/ thelwall. html) Journal of Computer-<strong>Media</strong>ted Communication 12(2), article 9. Letzter Zugriff: 24. März 2009<br />
[7] Update der Wikimedia zur Lizenzänderung (http:/ / meta. wikimedia. org/ wiki/ Licensing_update/ Result/ de)<br />
[8] Diskussion zu Interpedia; Newsgroup Usenet (http:/ / groups. google. com/ group/ comp. groupware/ browse_thread/ thread/<br />
886c532755b1b3a2/ 3a896eeab1318741?q=interpedia)<br />
[9] Larry Sanger: E-Mails an die Mailingliste nupedia-l: Let’s make a wiki (10. <strong>Jan</strong>uar 2001) (http:/ / web. archive. org/ web/ 20030414014355/<br />
http:/ / www. nupedia. com/ pipermail/ nupedia-l/ 2001-<strong>Jan</strong>uary/ 000676. html), Nupedia’s wiki: try it out (10. <strong>Jan</strong>uar 2001) (http:/ / web.<br />
archive. org/ web/ 20030425173342/ www. nupedia. com/ pipermail/ nupedia-l/ 2001-<strong>Jan</strong>uary/ 000678. html),<br />
Nupedia’s wiki: try it out (11. <strong>Jan</strong>uar 2001; Name Wikipedia) (http:/ / web. archive. org/ web/ 20030414021138/ www. nupedia. com/<br />
pipermail/ nupedia-l/ 2001-<strong>Jan</strong>uary/ 000680. html), Wikipedia is up! (17. <strong>Jan</strong>uar 2001) (http:/ / web. archive. org/ web/ 20010506042824/<br />
www. nupedia. com/ pipermail/ nupedia-l/ 2001-<strong>Jan</strong>uary/ 000684. html) (alle über Internet Archive).<br />
[10] fun project (18. <strong>Jan</strong>uar 2001) (http:/ / web. archive. org/ web/ 20010118225800/ http:/ / www. nupedia. com/ ).<br />
[11] Kerstin Kohlenberg: Die anarchische Wiki-Welt (http:/ / www. zeit. de/ 2006/ 37/ wikipedia?page=all) In: Die Zeit Online vom 7. September<br />
2006, abgerufen am 29. Mai 2009<br />
[12] Jimmy Wales: Alternative language wikipedias (http:/ / lists. wikimedia. org/ pipermail/ wikipedia-l/ 2001-March/ 000048. html),<br />
Einrichtung von „deutsche.wikipedia.com“ (http:/ / lists. wikimedia. org/ pipermail/ wikipedia-l/ 2001-March/ 000049. html) (Posting an<br />
Wikipedia-l, 16. März 2001) und<br />
Änderungen in der katalanischen Wikipedia von 16. März 2001 (http:/ / web. archive. org/ web/ 20010413083954/ catalan. wikipedia. com/<br />
wiki. cgi?action=history& id=HomePage).<br />
[13] Wikipedia-Mailingliste Intlwiki vom Februar 2002 (http:/ / marc. info/ ?l=intlwiki-l& r=1& b=200202& w=2)<br />
[14] onlinestar.de (http:/ / www. onlinestar. de/ news0. html), OnlineStar Gewinner 2006.<br />
[15] Wikipedia erhält Preis für Verdienste um die Aufklärung. (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,573198,00. html) In:<br />
Spiegel-Online vom 20. August 2008.<br />
[16] Grundprinzipien der deutschsprachigen Wikipedia (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Grundprinzipien)<br />
[17] Vgl. dazu etwa Günter Schuler, Wikipedia inside, S. 117f.; Anneke Wolf: Wikipedia: Kollaboratives Arbeiten im Internet (http:/ / www.<br />
annekewolf. de/ wolf_wikipedia_dgv. pdf), in: Thomas Hengartner, Johannes Moser (Hrsg.): Grenzen und Differenzen. Zur Macht sozialer<br />
und kultureller Grenzziehungen, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, S. 639–650, hier S. 648–650.<br />
[18] Wikimedia Foundation, Finanzreport (http:/ / upload. wikimedia. org/ wikipedia/ foundation/ 4/ 4f/ FINAL_08_09From_KPMG. pdf)<br />
2008/2009<br />
[19] Wikimedia Foundation, Angestellte (http:/ / wikimediafoundation. org/ w/ index. php?title=Staff& oldid=40598& uselang=de) der<br />
Wikimedia Foundation<br />
[20] Wikimedia Foundation, Annual Plan 2009/2010 (http:/ / wikimediafoundation. org/ wiki/ Resolution:2009-10_Plan)<br />
[21] http:/ / www. taz. de/ 1/ netz/ netzoekonomie/ artikel/ 1/ google-spendet-2-millionen<br />
[22] Wikimedia Deutschland, Mitarbeiter (http:/ / wikimedia. de/ index. php?id=11)<br />
[23] Wikimedia Deutschland, Tätigkeitsbericht 2007 (http:/ / www. wikimedia. de/ files/ Taetigkeitsbericht_2007. pdf)<br />
[24] Wikipedia adopts Ubuntu for its server infrastructure (http:/ / arstechnica. com/ news. ars/ post/<br />
20081009-wikipedia-adopts-ubuntu-for-its-server-infrastructure. html)<br />
[25] Wiki der Serveradmins: Server roles (http:/ / wikitech. wikimedia. org/ index. php?title=Server_roles& oldid=23753), eingesehen am 29.<br />
November 2009<br />
[26] Q&A: Danese Cooper, Wikimedia (http:/ / www. thewhir. com/ web-hosting-news/<br />
072910_QA_Jay_Walsh_spokesperson_for_Wikimedia), Web hosting industry reviews, thewhir.com, 29. Juli 2010, abgerufen am 9. August<br />
2010.<br />
[27] Sammlung aller <strong>Media</strong>Wiki-Extensions (http:/ / www. mediawiki. org/ wiki/ Category:All_extensions)<br />
[28] Benutzerseite von Kunar (http:/ / eo. wikipedia. org/ wiki/ Vikipediisto:Kunar/ kvalito) (Volapük)<br />
[29] Statistikenübersicht zu allen Wikipedias (http:/ / stats. wikimedia. org/ DE/ Sitemap. htm)<br />
[30] Falscher Professor muss Wikipedia verlassen. (http:/ / www. heise. de/ newsticker/ Falscher-Professor-muss-Wikipedia-verlassen--/<br />
meldung/ 86203) In: heise online vom 5. März 2007; abgerufen am 29. Mai 2009<br />
[31] Joachim Schroer und Guido Hertel: Voluntary Engagement in an Open Web-based Encyclopedia: Wikipedians, and Why They Do It. (http:/ /<br />
www. abo. psychologie. uni-wuerzburg. de/ virtualcollaboration/ publications. php?action=view& id=44) In: nichtpublizierte Schrift,<br />
Universität Würzburg, Dezember 2007
Wikipedia 361<br />
[32] Jimmy Wales: Wikipedia Sociographics; What the wikipedia community doesn't know about itself (http:/ / www. ccc. de/ congress/ 2004/<br />
fahrplan/ event/ 59. de. html) Referat gehalten am 21. Chaos Communication Congress vom 27. bis 29. Dezember 2004 in Berlin, Deutschland<br />
[33] Zusammenfassung von Jimmy Wales Referat Wikipedia Sociographics von Marcus Völkel (http:/ / 21c3. konferenzblogger. de/ 12/ 27/<br />
wikipedia-sociographics. shtml); abgerufen am 29. Mai 2009<br />
[34] Hendrik Werner: Wikipedia laufen die fleißigen Autoren weg. (http:/ / www. welt. de/ kultur/ article1271014/<br />
Wikipedia_laufen_die_fleissigen_Autoren_weg. html) In Die Welt vom 17. Oktober 2007; abgerufen am 27. August 2009<br />
[35] Wikipedia steckt in der ersten Krise (http:/ / derstandard. at/ fs/ 1246543790154/<br />
Online-Enzyklopaedie-Wikipedia-steckt-in-der-ersten-Krise) In: Der Standard vom 5. August 2009<br />
[36] Presseerklärung der Wikimedia Foundation: Wikipedia to become more user-friendly for new volunteer writers (http:/ /<br />
wikimediafoundation. org/ wiki/ Press_releases/ Wikipedia_to_become_more_user-friendly_for_new_volunteer_writers)<br />
[37] Vgl. Stegbauer a.a.O.<br />
[38] Ulrike Pfeil, Zaphiris Panayiotis Zaphiris und Ang Chee Siang: „Cultural differences in collaborative authoring of Wikipedia“ (http:/ / jcmc.<br />
indiana. edu/ vol12/ issue1/ pfeil. html) In: Journal of Computer-<strong>Media</strong>ted Communication 12, 2006, Artikel 5.<br />
[39] Platz4 der Brandchannel-Studie (http:/ / www. welt. de/ data/ 2007/ 01/ 26/ 1190449. html) In: Die Welt vom 26. <strong>Jan</strong>uar 2007<br />
[40] Fernanda B. Viégas, Martin Wattenberg, Kushal Dave: Cooperation and Conflict between Authors with history flow Visualizations (http:/ /<br />
alumni. media. mit. edu/ ~fviegas/ papers/ history_flow. pdf). In: CHI 2004 Paper. 24-29 April 2004, abgerufen am 19. Mai 2009 (englisch).<br />
[41] Christian Stegbauer, Wikipedia. Das Rätsel der Kooperation, Wiesbaden 2009, vor allem S. 173–192<br />
[42] Vgl. Thomas Thiel: Wissen im kleinen Zirkel, FAZ 10. August 2009.<br />
[43] Stegbauer a. a. O., S. 166 ff.<br />
[44] Dorothee Wiegand Entdeckungsreise: Digitale Enzyklopädien erklären die Welt. In: c’t 6, 2007, S. 136ff.<br />
[45] Jim Jiles: Internet encyclopaedias go head to head (http:/ / www. nature. com/ doifinder/ 10. 1038/ 438900a) In: Nature vom 14. Dezember<br />
2005<br />
[46] Britannica: Fatally flawed (http:/ / corporate. britannica. com/ britannica_nature_response. pdf), März 2006<br />
[47] Nature: Response Britannica (http:/ / nature. com/ press_releases/ Britannica_response. pdf)<br />
[48] Günter Schuler: Wikipedia inside; Unrast, Münster 2007, ISBN 978-3-89771-463-2 S. 59 f., S. 71f<br />
[49] Günter Schuler: Wikipedia inside; S. 71f<br />
[50] Stern-Artikel: Wissen für alle (http:/ / www. stern. de/ computer-technik/ internet/ :Wikipedia-Wissen/ 606048. html?nv=ct_cb)<br />
[51] Stern-Test: Wikipedia schlägt Brockhaus (http:/ / www. stern. de/ computer-technik/ internet/ 604423. html?nv=sml) vom 5. Dezember 2007<br />
[52] TITANIC Infografik (http:/ / www. titanic-magazin. de/ uploads/ pics/ 1211a-infogesellschaft. gif), Startcartoon, im Dezember 2008,<br />
titanic-magazin.de<br />
[53] Marcel Machill, Markus Beiler, Martin Zenker (Universität Leipzig): Journalistische Recherche im Internet (http:/ / www. lfm-nrw. de/<br />
downloads/ veranstaltungen/ zus-jourrech. pdf) (Zusammenfassung, PDF-Datei), Vistas, Berlin 2008, Schriftenreihe Medienforschung der<br />
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Band 60, ISBN 978-3-89158-480-4, S. 26<br />
[54] BildBlog: Wie ich Freiherr von Guttenberg zu Wilhelm machte (http:/ / www. bildblog. de/ 5695/<br />
wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte/ ) abgerufen am 10. Februar 2009<br />
[55] Kai Biermann: "Mich hat überrascht, wie viele den Fehler übernahmen" (http:/ / www. zeit. de/ online/ 2009/ 08/<br />
guttenberg-bildblog-namensfaelschung?page=all) In: Zeit Online vom 13. Februar 2009<br />
[56] John Seigenthaler: A false Wikipedia “biography” (http:/ / www. usatoday. com/ news/ opinion/ editorials/ 2005-11-29-wikipedia-edit_x.<br />
htm) In: USA Today vom 29. November 2005<br />
[57] Autor von falscher Biografie entschuldigt sich (http:/ / www. sueddeutsche. de/ computer/ 439/ 320309/ text/ ) In: Süddeutsche Zeitung vom<br />
12. Dezember 2005<br />
[58] Digital Maoism: The hazards of the New Online Collectivism (http:/ / www. edge. org/ 3rd_culture/ lanier06/ lanier06_index. html) In: Edge<br />
vom 30. Mai 2006, in gekürzter deutscher Übersetzung: Digital Maoism (http:/ / www. sueddeutsche. de/ kultur/ artikel/ 306/ 78228/ ) In:<br />
Süddeutsche Zeitung vom 16. Juni 2006<br />
[59] Lorenz, Maren: Wikipedia. Zum Verhältnis von Struktur und Wirkungsmacht eines heimlichen Leitmediums, in: Werkstatt Geschichte,<br />
2006, 43, S. 84-95.<br />
[60] Wikipedia's known unknowns, guardian.co.uk, abgerufen am 24. April 2010 (http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2009/ dec/ 02/<br />
wikipedia-known-unknowns-geotagging-knowledge)<br />
[61] Wikipedia inside, S. 8, Unrast, Münster 2007<br />
[62] WikiScanner (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Enzyklopädie/ WikiScanner) auf einer Wikipedia-Projektseite<br />
[63] Evan Lehmann: Rewriting history under the dome: Online "encyclopedia" allows anyone to edit entries, and congressional staffers do just<br />
that to bosses' bios. In: The Lowell Sun vom 27. <strong>Jan</strong>uar 2006<br />
[64] Richard Meusers: Wer manipuliert Rüttgers’ Wiki-Einträge? (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,356570,00. html) In: Spiegel<br />
Online vom 19. Mai 2005<br />
[65] Torsten Kleinz: Nestbeschmutzer in Wikipedia - Strategie 1: Die Löschtruppe (http:/ / www. focus. de/ digital/ internet/ tid-7242/<br />
online-enzyklopaedie_aid_130683. html) In: FOCUS-Online abgerufen am 18. Mai 2008<br />
Difflink (http:/ / de. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Konrad-Adenauer-Stiftung& action=historysubmit& diff=19779574&<br />
oldid=18652748) und whois (http:/ / www. ping. eu/ ns_whois/ ?host=193. 175. 253. 253)
Wikipedia 362<br />
[66] Günter Schuler, befragt von Patrick Gensing: Rechtsextremismus im Netz; "Beharrlich und manchmal klug" (http:/ / zuender. zeit. de/ 2007/<br />
45/ interview-nazis-bei-wikipedia) Interview in: Zeit Online ZUENDER 45/2007. Letzter Zugriff: 24. März 2009<br />
[67] Margret Chatwin: Griff nach der Meinungshoheit. Internetkampagen der „Jungen Freiheit“ am Beispiel von Wikipedia. In: Stephan Braun,<br />
Ute Vogt (Hg.): Die Wochenzeitung „Junge Freiheit“. Kritische Analysen zu Programmatik, Inhalten, Autoren und Kunden; VS Verlag,<br />
Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-15421-3, S. 238<br />
[68] Margret Chatwin: S. 264<br />
[69] stellvertretend für viele Medien: Manfred Dworschak: Lustverlust in der Lexikon-Maschine, Spiegel Online, 1. Dezember 2009, im Internet:<br />
http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,664195,00. html<br />
[70] David Smith und Jo Revill Wikipedia defies China's censors (http:/ / www. guardian. co. uk/ technology/ 2006/ sep/ 10/ news. china) In: The<br />
Observer vom 10. September 2006; abgerufen am 30. Mai 2009<br />
[71] Voice of America: Iran Cracks Down On Internet Use (http:/ / www. voanews. com/ uspolicy/ archive/ 2006-12/ 2006-12-12-voa10.<br />
cfm?CFID=198219675& CFTOKEN=87205376& jsessionid=003074da3bbaa2730f083463503d6a5a186d), 11. Dezember 2006<br />
[72] Wikipedia blocked by some Thai ISPs (http:/ / facthai. wordpress. com/ 2008/ 10/ 22/ wikipedia-blocked-by-some-thai-isps-fact-exclusive/ ).<br />
22.10.2008, abgerufen am 19. Mai 2009.<br />
[73] Torsten Kleinz: Britische Provider sperren Wikipedia-Artikel (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Britische-Provider-sperren-Wikipedia-Artikel--/ meldung/ 120048) In: heise.de vom 7. Dezember 2008<br />
[74] Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen-Lizenz (http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ de/ )<br />
[75] Wikipedia-Community stimmt über Lizenzwechsel ab. (http:/ / www. heise. de/ newsticker/<br />
Wikipedia-Community-stimmt-ueber-Lizenzwechsel-ab--/ meldung/ 136120) In: heise online vom 14. April 2009; abgerufen am 29. Mai 2009<br />
[76] Wikipedia:Unterwegs (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Unterwegs) – Übersicht der Handy- und PDA-Versionen der deutschen<br />
Wikipedia<br />
[77] Wikipedia-Offline-Browser WikiTaxi (http:/ / www. wikitaxi. org)<br />
[78] Wissen <strong>Media</strong> Verlag: Das Wikipedia Lexikon in einem Band. Die meistgesuchten Inhalte der freien Enzyklopädie (http:/ / books. google.<br />
com/ books/ p/ wissen_media_verlag?vid=ISBN9783577091022& printsec=frontcover)<br />
[79] Wikipedia on Demand (http:/ / www. boersenblatt. net/ 308411/ ) boersenblatt.net 23. Februar 2009<br />
[80] Presseerklärung der Wikimedia Foundation zur Partnerschaft mit Orange (http:/ / wikimediafoundation. org/ wiki/ Press_releases/<br />
Orange_and_Wikimedia_announce_partnership_April_2009)<br />
[81] Website des Instituto da Democracia Portuguesa (IDP) (http:/ / www. democraciaportuguesa. org/ ) abgerufen am 20. Juli 2009<br />
[82] Cnaan Liphshiz: Should Israel let wiki-users draft its constitution? (http:/ / www. haaretz. com/ hasen/ spages/ 1101164. html) In: Haaretz<br />
vom 19. Juli 2009; abgerufen am 20. Juli 2009<br />
[83] http:/ / d-nb. info/ gnd/ 7545251-0<br />
[84] http:/ / gso. gbv. de/ DB=2. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=1016& SRT=YOP& TRM=7545251-0<br />
[85] http:/ / jcmc. indiana. edu. / vol12/ issue1/ pfeil. html<br />
[86] http:/ / dx. doi. org/ 10. 1111%2Fj. 1083-6101. 2006. 00316. x<br />
[87] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1083-6101<br />
[88] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0264-0473<br />
[89] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1532-2882<br />
[90] http:/ / www. wikipress. de/ WikiPress:Wikipedia<br />
[91] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=1472-3600<br />
[92] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0341-4183<br />
[93] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0022-0418<br />
[94] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0176-4918<br />
[95] http:/ / dispatch. opac. d-nb. de/ DB=1. 1/ CMD?ACT=SRCHA& IKT=8& TRM=0010-3497<br />
[96] http:/ / www. wikipedia. org<br />
[97] http:/ / meta. wikimedia. org/ wiki/ Wiki_Research_Bibliography<br />
[98] http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Wikipedistik<br />
[99] http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Geschichte_der_Wikipedia<br />
[100] http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Kritik<br />
[101] http:/ / features. slashdot. org/ article. pl?sid=05/ 04/ 18/ 164213<br />
[102] http:/ / www. edge. org/ 3rd_culture/ lanier06/ lanier06_index. html<br />
[103] http:/ / www. sueddeutsche. de/ kultur/ artikel/ 306/ 78228/ ''Digitaler<br />
[104] http:/ / www. edge. org/ discourse/ digital_maoism. html<br />
[105] http:/ / sammelpunkt. philo. at:8080/ 1546/ 1/ hegel_bildung_wiki. pdf<br />
[106] http:/ / www. zeit. de/ 2010/ 28/ Wikipedia-Daten
Clay Shirky 363<br />
Clay Shirky<br />
Clay Shirky (* 1964) ist ein US-amerikanischer Redner, Autor und<br />
Berater zum Thema Internet. Er unterrichtet Neue Medien als<br />
Assistenzprofessor im Rahmen des Interactive Telecommunications<br />
Program an der New York University. Sein Unterricht umfasst unter<br />
anderem die Effekte der Netzwerktopologien von sozialen Netzwerken<br />
und die Frage, wie das Internet menschliche Beziehungen,<br />
Kommunikation und Gesellschaft verändert.<br />
Shirkys Kolumnen und Artikel wurden unter anderem in Business 2.0,<br />
der New York Times, dem Wall Street Journal, dem Harvard Business<br />
Review und dem Wired-Magazin veröffentlicht. Am 3. April 2008 trat<br />
Shirky im Colbert Report auf.<br />
Clay Shirky auf der<br />
O'Reilly-Emerging-Technology-Konferenz 2006<br />
In seiner Beratungstätigkeit fokussiert sich Shirky auf die steigende Bedeutung dezentraler Technologien wie<br />
Peer-to-Peer, Webservices und Funknetze, die Alternativen zur Client-Server-Infrastruktur darstellen, die das World<br />
Wide Web charakterisiert. Zu seinen Kunden zählen Nokia, die U.S.-Library of Congress und die BBC.<br />
Publikationen<br />
• The Internet by E-Mail (1994) – ISBN 1-56276-240-0<br />
• Voices from the Net (1995) – ISBN 1-56276-303-2<br />
• P2P Networking Overview (2001) – ISBN 0-596-00185-1<br />
• Planning for Web Services: Obstacles and Opportunities (2003) – ISBN 0-596-00364-1<br />
• The Best Software Writing I (2005) – ISBN 1-59059-500-9<br />
• Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations (2008) – ISBN 978-1594201530<br />
• "Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age" (2010) - ISBN 978-1594202537<br />
Weblinks<br />
• Clay Shirkys Website [1]<br />
• Clay Shirkys Artikel im O'Reilly-Network [2]<br />
• Video-Interview mit Shirky [3] , Elektrischer Reporter<br />
• Interview mit Clay Shirky über den Siegeszug der Netzgesellschaft und Bier für den kreativen Brückenschlag im<br />
MFG Innovationcast, Folge 20 [4]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. shirky. com<br />
[2] http:/ / www. oreillynet. com/ pub/ au/ 106<br />
[3] http:/ / www. elektrischer-reporter. de/ site/ film/ 61/<br />
[4] http:/ / www. podcast. mfg-innovation. de/ folge20
Chris Anderson (Journalist) 364<br />
Chris Anderson (Journalist)<br />
Chris Anderson (* 1961 in London) ist ein US-amerikanischer Journalist und<br />
Chefredakteur der Zeitschrift Wired. Vorher war er bei dem britischen<br />
Wirtschaftsblatt The Economist beschäftigt. [1]<br />
Ideen<br />
Anderson sorgte mit seiner Long-Tail-Theorie, die er im Jahre 2004 in einem<br />
Artikel für Wired erstmals vorstellte, für Aufsehen in und außerhalb der<br />
Computer- und Medienbranche. In einem gleichnamigen Buch aus dem Jahre<br />
2006 (The Long Tail. Why the Future of Business Is Selling Less of More.)<br />
erläuterte er sie näher. Es geht dabei um das Phänomen, dass neben den<br />
sogenannten Blockbustern z. B. im Musikgeschäft heutzutage beträchtliche<br />
Kaufkraft auch in Nischenmärkte mit weniger bekannten Künstlern entfalle [2]<br />
und so der Anteil der Hits relativ gesehen abnehme, Dies werde möglich<br />
Chris Anderson<br />
gemacht durch moderne Produktionstechniken wie z. B. Musiksoftware zum Selberaufnehmen von Musiktiteln, das<br />
Internet als Distributionsmedium sowie Foren wie MySpace oder auch Amazon, in den weniger die<br />
Werbebotschaften der Produzenten als vielmehr die Beurteilungen durch sogenannte Peers über den Erfolg eines<br />
Musikstücks oder eines Künstlers entschieden.<br />
Plagiatsvorwurf 2009<br />
Bei der Vorstellung seines Buches Free im Juni 2009 warf ein Rezensent Anderson vor, weite Strecken seines<br />
Buches unter anderem aus der Wikipedia übernommen zu haben. [3] Anderson gab zu, dies getan zu haben; eine<br />
ordentliche Herkunftsangabe sei bedauerlicherweise teilweise unterblieben, da er im Gespräch mit dem Verlag keine<br />
geeignete Zitierweise gefunden habe. Die Herkunftsangaben würden nachgereicht werden. [4]<br />
Schriften<br />
• The Long Tail – der lange Schwanz. Nischenprodukte statt Massenmarkt – Das Geschäft der Zukunft. Aus dem<br />
Amerikanischn von Michael Bayer und Heike Schlatterer . Hanser, München 2007, ISBN 3-446-40990-4.<br />
• Free − Kostenlos: Geschäftsmodelle für die Herausforderungen des Internets. Campus, Frankfurt am Main 2009,<br />
ISBN 978-3-593-39088-8.<br />
Weblinks<br />
• Literatur von und über Chris Anderson [5] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek<br />
• Chris Andersons Blog zur Long Tail Theorie [6]<br />
• Audiobuch Free [7] (englisch)<br />
Referenzen<br />
[1] Interview mit Spiegel Online, 2002 (http:/ / www. spiegel. de/ netzwelt/ web/ 0,1518,204323,00. html)<br />
[2] Interview mit ARTE 2007 (http:/ / www. arte. tv/ de/ Kultur-entdecken/ tracks/ Kuenstler-bei-Tracks-A-Z/ 1499742. html)<br />
[3] Virginia Quarterly Review (http:/ / www. vqronline. org/ blog/ 2009/ 06/ 23/ chris-anderson-free/ ), zuletzt gesehen am 16. Oktober 2009.<br />
[4] Plagiarism Today (http:/ / www. plagiarismtoday. com/ 2009/ 06/ 24/ the-chris-anderson-plagiarism-controversy/ ), Huffington Post (http:/ /<br />
www. huffingtonpost. com/ 2009/ 06/ 24/ wired-editor-accused-of-p_n_220332. html), zuletzt gesehen am 16. Oktober 2009.<br />
[5] https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D132786168& method=simpleSearch<br />
[6] http:/ / www. longtail. com/
Chris Anderson (Journalist) 365<br />
[7] http:/ / www. wired. com/ images/ multimedia/ free/ FREE_Audiobook_unabridged. zip<br />
Don Tapscott<br />
Don Tapscott (* 1947) ist Professor für Management an der Joseph L. Rotman School of Management, University<br />
of Toronto und Autor von elf Büchern.<br />
In seinem bekanntesten Buch "Wikinomics: die Revolution im Netz" beschreibt er, wie und warum die Arbeitsweise<br />
traditioneller Unternehmen durch den Einsatz von Prinzipien von Web 2.0 in Unternehmen (Enterprise 2.0) vor eine<br />
Herausforderung gestellt werden. Wer die Vorteile der wenig kostenintensiven Herangehensweise nutzen wolle,<br />
müsse jedoch sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage stellen und große Teile des wertvollen Unternehmenswissens<br />
offen verfügbar machen.<br />
Sein neuestes Buch "Grown Up Digital" (2008) beschäftigt sich mit den Denk- und Vorgehensweisen der digitalen<br />
Generation ("Digital Natives").<br />
Literatur<br />
• Don Tapscott: Die digitale Revolution : Verheißungen einer vernetzten Welt - die Folgen für Wirtschaft,<br />
Management und Gesellschaft, Wiesbaden, Gabler, 1996, ISBN 3-409-18929-7<br />
• Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomics: die Revolution im Netz, 1. Aufl., Hanser, München 2007, ISBN<br />
978-3-446-41219-4<br />
• Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, B&T, New<br />
York 2006, ISBN 978-1-59184-138-8<br />
• Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill Professional<br />
2008. ISBN 978-0-07-150863-6<br />
Weblinks<br />
• Literatur von und über Don Tapscott [1] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Referenzen<br />
[1] https:/ / portal. d-nb. de/ opac. htm?query=Woe%3D133518930& method=simpleSearch
Wikinomics 366<br />
Wikinomics<br />
Wikinomics (quasi Wikinomie) bezeichnet eine neue Form des Wirtschaftens mit revolutionären Formen der<br />
Zusammenarbeit. Der Begriff wurde vom Kanadier Don Tapscott (* 1947) geprägt.<br />
Menschen arbeiten nach der Vorstellung selbstorganisiert ohne Hierarchien und starre Organisationsstrukturen<br />
gemeinsam an Projekten: Von der Open Source Software-Entwicklung (z. B. Linux) über die Online-Enzyklopädie<br />
Wikipedia bis hin zur Aufschlüsselung des menschlichen Genoms (Humangenomprojekt). Weitere Beispiele sind<br />
MySpace, YouTube und Flickr. In dem gleichnamigen Buch Wikinomics wird über Erfolge in der freien Wirtschaft<br />
berichtet. Die Goldcorp-Challenge wird ebenso erwähnt wie die Beteiligung von IBM am Apache HTTP Server und<br />
die interne Kommunikation von Mitarbeitern der Geek Squad über Battlefield 2.<br />
Diese neue Form des Wirtschaftens ermöglicht erst das Internet, d. h. eine globale Infrastruktur, in der die Kosten<br />
der Bündelung von Arbeit, Wissen und Kapital (sog. Kollaborationskosten) nahezu wegfallen. Tapscott nennt vier<br />
Faktoren, die für Wikinomics charakteristisch sind:<br />
• freiwillige Zusammenarbeit<br />
• Offenheit<br />
• eine Kultur des Teilens<br />
• globales Handeln<br />
Wikinomics bindet erstmals in der Geschichte der Menschheit die Konsumenten als Prosumenten in den<br />
Produktionsprozess ein. Insofern ist laut Tapscott die neue Bewegung gewissermaßen das Gegenteil der Versklavung<br />
von Menschen in früheren Zeiten. Die treibende Kraft hinter Wikinomics, die „Net Generation“, produziert auf der<br />
Basis von Freiwilligkeit einen Mehrwert für die gesamte Volkswirtschaft.<br />
Literatur<br />
• Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomics: die Revolution im Netz, 1. Aufl., Hanser, München 2007, ISBN<br />
978-3-446-41219-4<br />
• Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, B&T, New<br />
York 2006, ISBN 978-1-59184-138-8<br />
Siehe auch<br />
• Crowdsourcing<br />
• Die Weisheit der Vielen<br />
• Open Innovation<br />
• Open Access<br />
• Open Source<br />
• Open Business (i.S. von Wikinomics)<br />
• Offenes System<br />
• Freie Inhalte<br />
• Web 2.0<br />
• Kollektive Erfindung<br />
• Kollektive Intelligenz<br />
• Individualisierte Massenfertigung<br />
• The Long Tail<br />
• Ideenmanagement<br />
• Innovationscontrolling
Wikinomics 367<br />
• Unternehmenskybernetik<br />
• Komplexes System<br />
• Systemtheorie<br />
• Trittbrettfahrerproblem<br />
Weblinks<br />
• http:/ / www. wikinomics. com/ [1] Webseite zum Buch/ Begriff<br />
• BusinessWeek: Innovation in the Age of Mass Collaboration (en) [2] (1. Februar 2007)<br />
• Enterprise 2.0 Conference Boston: "Winning with the Enterprise 2.0" Presentation by Don Tapscott (en) [3] (18.<br />
Juni 2007)<br />
• Offene Webseite für das letzte Kapitel (Website for the public to create the "unwritten chapter") [4]<br />
• "Wikinomics – Harnessing collaboration outside and inside the corporation" erschienen im Vodafone Receiver<br />
Magazine Ausgabe 19") [5]<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. wikinomics. com/<br />
[2] http:/ / www. businessweek. com/ innovate/ content/ feb2007/ id20070201_774736. htm?chan=search<br />
[3] http:/ / enterprise2conf. vportal. net/<br />
[4] http:/ / www. socialtext. net/ wikinomics/<br />
[5] http:/ / www. receiver. vodafone. com/ 19-wikinomics/<br />
James Surowiecki<br />
James Surowiecki (* 1967 in Meriden (Connecticut)) ist ein<br />
US-amerikanischer Journalist, der mit seinem Buch Die Weisheit der<br />
Vielen (Originaltitel The Wisdom of Crowds) international bekannt<br />
wurde. In diesem stellt er dar, wie durch Selbstorganisation, aber auch<br />
statistische Effekte Entscheidungen von Massen klüger ausfallen<br />
können als die von Einzelpersonen. Er ist Redakteur von The New<br />
Yorker.<br />
Werke<br />
• Die Weisheit der Vielen, 2005<br />
Weblinks<br />
• Autorenseite beim Verlag Random House [1]<br />
• brand eins: Schlaue Menge [2] (PDF-Datei; 766 kB)<br />
• Vortrag bei ITConversations.com [6]<br />
Surowiecki (2005)
James Surowiecki 368<br />
Referenzen<br />
[1] http:/ / www. randomhouse. com/ features/ wisdomofcrowds/ author. html<br />
[2] http:/ / www. brandeins. de/ ximages/ 24003_114smartcr. pdf<br />
Peter Kruse<br />
Peter Kruse (* 30. <strong>Jan</strong>uar 1955 in Osnabrück) ist ein deutscher<br />
Psychologe [1] mit dem Schwerpunkt Komplexitätsverarbeitung in<br />
intelligenten Netzwerken sowie Leiter des Methoden- und<br />
Beratungsunternehmens nextpractice in Bremen. Kruse lehrt als<br />
Honorarprofessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der<br />
Universität Bremen. Im Rahmen seiner interdisziplinären Tätigkeit<br />
widmet er sich vor allem der Nutzung von kollektiver Intelligenz zur<br />
Förderung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher<br />
Entwicklungsprozesse.<br />
Leben<br />
Kruse studierte von 1976 bis 1981 in Münster und Bremen<br />
Psychologie, Humanmedizin und Biologie. 1984 promovierte er im<br />
Fach Psychologie mit der Note summa cum laude. Von 1979 bis 1980<br />
und von 1981 bis 1982 wurde er als Stipendiat von der Studienstiftung<br />
des deutschen Volkes gefördert. Anschließend war er als<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Assistent und Lehrbeauftragter an den<br />
Universitäten Bremen, Oldenburg und Gießen tätig. 2001 wurde er<br />
Peter Kruse (2008)<br />
vom Senator für Bildung und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen zum Honorarprofessor ernannt.<br />
Kruse arbeitete gemeinsam u. a. mit dem Psychologen Michael Stadler und dem Neurobiologen Gerhard Roth. Als<br />
Wissenschaftler beschäftigte sich Kruse über 15 Jahre mit Ordnungsbildungsprozessen im menschlichen Gehirn.<br />
Seine Forschungen bewegten sich an der Schnittstelle von Neurophysiologie und Experimentalpsychologie. Kruse<br />
verband dabei die Prinzipien von Selbstorganisation und Konstruktivismus mit der Tradition der Gestalttheorie. [2]<br />
Seit 1995 ist Kruse als Unternehmensberater tätig. 2001 gründete er die nextpractice GmbH, die sich auf die<br />
strategische und praktische Begleitung von kulturellem Wandel sowie Trend- und Zukunftsforschung spezialisiert<br />
hat. Kruses Beratungsansatz überträgt Erkenntnisse der jüngeren Hirnforschung und der Theorie dynamischer<br />
Systeme auf Unternehmensprozesse. Kruse ist Ideengeber und Mitentwickler verschiedener computergestützter<br />
Managementwerkzeuge zum innovativen Umgang mit Komplexität und Vernetzung. Zu den wichtigsten gehören das<br />
Programmsystem „nextmoderator“ zur Moderation großer Gruppen und das qualitative Interviewverfahren<br />
„nextexpertizer“. Das Interviewtool nextexpertizer ist eine eigenständige Weiterentwicklung der<br />
Repertory-Grid-Technik des amerikanischen Psychologen George A. Kelly. Mit nextexpertizer ist es möglich,<br />
qualitative Einschätzungen von mehreren hundert Auskunftspersonen unter Lösung des Semantik-Problems<br />
quantitativ vergleichbar zu machen. [3] Kruse ist Autor zahlreicher Schriften zur Kognitionspsychologie, zur Theorie<br />
dynamischer Systeme, zum Konstruktivismus und zur Managementlehre. [4]<br />
Zusammen mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie zum Beispiel der Global-Marshall-Plan-Initiative, der<br />
Bertelsmann-Stiftung, dem Institut für Interkulturelle und Internationale Studien (InIIS), dem Ökosozialen Forum<br />
Europa u. a. beschäftigt er sich intensiv mit neuen Ansätzen der Partizipation in politischen<br />
[5] [6]<br />
Entscheidungsprozessen.
Peter Kruse 369<br />
In jüngster Zeit setzt er sich zudem im Rahmen von Livestreams und Video-Interviews mit Fragestellungen zu Web<br />
2.0 und Enterprise 2.0 auseinander [7] [8] sowie mit den Auswirkungen der Netzwerkkultur auf die Gesellschaft. Mit<br />
letztgenannten Themen beschäftigt sich auf das in Gründung befindliche International Institute for Cultural<br />
Understanding and Participation (II-CUP), kurz WHATS's NEXT?<br />
Kruses wissenschaftliches wie beraterisches Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. [9] 1994 erhielt er den<br />
Berninghausen-Preis für innovative Lehre. Von der ZfU International Business School in der Schweiz wurde ihm der<br />
Teaching Award in Gold verliehen. 2004 war er Träger des Innovationspreises von SPD und Arbeitsgemeinschaft<br />
Selbstständiger (AGS) in der SPD. Mit seinem Beratungsunternehmen hat er 2002 den Meeting Business Award<br />
(MBA) in der Kategorie Mitarbeiterveranstaltungen und 2004 den Weiterbildungs-Award der Kongressmesse<br />
MUWIT gewonnen.<br />
Die Computerwoche bezeichnete ihn 2005 als „Deutschlands Change-Management-Papst“. [10] Im Jahr 2009 wählte<br />
ihn das „Personalmagazin“ zum dritten Mal (2005/2007/2009) in die Liste der 40 einflussreichsten Persönlichkeiten<br />
für das Personalwesen. [11] Das Magazin „managerSeminare“ nannte ihn 2008 „Deutschlands Querdenker Nummer<br />
1“. [12]<br />
Werke (Auswahl)<br />
• Kruse, P./Stadler, M.: The significance of nonlinear phenomena for the investigation of cognitive systems. In:<br />
Haken, H./Mikhailov, A. S. (Hg.): Interdisciplinary approaches to nonlinear complex systems, S. 138–160.<br />
Springer, Berlin 1993, ISBN 3-540-56834-4.<br />
• Kruse, P./Stadler, M. (Hg.): Ambiguity in nature and mind. Multistability in cognition. Springer, Berlin 1995,<br />
ISBN 3-540-57082-9.<br />
• Kruse, P.: next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität. Gabal, Offenbach 2004, ISBN<br />
3-89749-439-6.<br />
• Kruse, P./Dittler, A./Schomburg, F.: nextexpertizer und nextcoach: Kompetenzmessung aus der Sicht der Theorie<br />
kognitiver Selbstorganisation In: Erpenbeck, John/Rosenstiel, Lutz von (Hg.): Handbuch Kompetenzmessung,<br />
S. 405–427.Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-7910-2477-6.<br />
• Stadler, M / Kruse, P. / Strüber, D.: Struktur und Bedeutung in kognitiven Systemen. In: Metz-Göckel. H. (Hg.):<br />
Gestalttheorie aktuell, Band 1, S. 71–96. Krammer, Wien 2008, ISBN 978-3-901811-36-4.<br />
• Kruse, P., CH.: Ein Kultobjekt wird abgewrackt. In: Gottlieb Duttweiler Institute (Hg.): GDI Impuls 1-2009,<br />
S. 12–19. Gottlieb Duttweiler Institute (GDI), Rüschlikon/Zürich 2009, ISSN 1422-0-482. [13]<br />
• Kruse, P., D.: Der letzte Tanz ums Goldene Kalb. In: Süddeutscher Verlag GmbH (Hg.): Süddeutsche Zeitung Nr.<br />
124 (Dienstag, 2. Juni 2009), S. 33. Süddeutscher Verlag GmbH, München 2009. [14]<br />
• Kruse, P., D.: Rechts, Links, Mitte - Raus! Vom politischen Wagnis der Partizipation. In: Hendrik<br />
Heuermann/Ulrike Reinhard (Hrsg.): Reboot_D Digitale Demokratie - Alles auf Anfang, S. 46-59, 2009. [15]<br />
• Kruse, P.: Kontrollverlust als Voraussetzung für die digitale Teilhabe. In: Hubert Burda / Mathias Döpfner / Bodo<br />
Hombach / Jürgen Rüttgers (Hrsg.): 2020 – Gedanken zur Zukunft des Internets. Klartext, Essen 2010, ISBN<br />
978-3-8375-0376-0.
Peter Kruse 370<br />
Literatur<br />
• Edo Reents: Der Vollweise : Peter Kruse gilt im Internet vielen als Guru. Dabei gehört auch er nur zu den<br />
Leuten, die das Einfache kompliziert erklären und sich als Berater geben. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.<br />
Mai 2010, Seite 42<br />
Weblinks<br />
• Liste wissenschaftlicher Publikationen [16]<br />
• nextpractice.de [17] – das Methoden- und Beratungsunternehmen in Bremen<br />
• blog.whatsnext.de [18] - International Institute for Cultural Understanding and Participation (II-CUP)<br />
Referenzen<br />
[1] Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 2009, Bd. 2, H-L. München: Saur, 2276.<br />
[2] Kruse, P./Stadler, M. 1995 (Hrsg.): Ambiguity in nature and mind. Multistability in cognition. Berlin: Springer<br />
[3] Kruse, P./Dittler, A./Schomburg, F. ²2007: nextexpertizer und nextcoach: Kompetenzmessung aus der Sicht der Theorie kognitiver<br />
Selbstorganisation. In: Erpenbeck, J./Rosenstiel, L.v. (Hg.): Handbuch Kompetenzmessung, S. 405–427. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.<br />
[4] Liste aktueller Publikationen (http:/ / www. nextpractice. de/ unternehmen/ prof-dr-peter-kruse/ zur-person/ publikationen/ ). nextpractice.de,<br />
abgerufen am 17. April 2010.<br />
[5] Initiative Perspektive Bremen 2007 (http:/ / www. nextpractice. de/ referenzen/ fallbeispiele/ gesellschaft/ perspektive-bremen-2007/ ).<br />
nextpractice.de, abgerufen am 17. April 2010.<br />
[6] „IdeenWerkstatt“ 2008 (http:/ / www. nextpractice. de/ referenzen/ fallbeispiele/ gesellschaft/ ideenwerkstatt-2008/ ). nextpractice.de,<br />
abgerufen am 17. April 2010.<br />
[7] Livestream-Aufzeichnung eines Gesprächs, das Digital Natives am 15. <strong>Jan</strong> 2009 mit Prof. Peter Kruse führten. (http:/ / www. nextpractice.<br />
de/ unternehmen/ prof-dr-peter-kruse/ zur-person/ video-statements/ #dnadigital/ ). nextpractice.de, abgerufen am 17. April 2010.<br />
[8] DNAdigital - Wenn Anzugträger auf Kapuzenpullis treffen. (http:/ / www. scribd. com/ doc/ 12544534/<br />
DNAdigital-Wenn-Kapuzenpullis-auf-Anzugtraeger-treffen). Buhse, W./Reinhard, U., 2009, S. 80–99, abgerufen am 17. April 2010.<br />
[9] Liste der Awards (http:/ / www. nextpractice. de/ referenzen/ awards/ awards/ spd-innovationspreis-2004/ ). nextpractice.de, abgerufen am<br />
17. April 2010.<br />
[10] Syra Thiel: „Die Deutschen sind zu ängstlich“ (http:/ / www. nextpractice. de/ fileadmin/ PDF/ presse/ 2005/<br />
Computerwoche-6-2005-ForumKiedrich. pdf). Computerwoche, 11. Februar 2005, abgerufen am 17. April 2010 (PDF).<br />
[11] „Die 40 führenden Köpfe – Vordenker und Vorbilder im Personalwesen 2007“ (http:/ / www. nextpractice. de/ fileadmin/ PDF/ presse/ 2007/<br />
PERSONALmagazin-40Koepfe-2007. pdf). In: Personalmagazin 9/2007 und Personalmagazin 9/2009. S. 18ff, bzw. 12ff, abgerufen am<br />
17. April 2010 (PDF).<br />
[12] „Arbeiten im Zeitalter von Web 2.0“ (http:/ / www. managerseminare. de/ managerSeminare/ Archiv/ Artikel?urlID=168409). In:<br />
managerSeminare 11/2008. Abgerufen am 17. April 2010.<br />
[13] http:/ / www. nextpractice. de/ pdfviewer/ PDF/ publikationen/ / 2009/ GDI_Impuls_Mobilitaet_2009-01. pdf<br />
[14] http:/ / www. nextpractice. de/ pdfviewer/ PDF/ publikationen/ / 2009/ SueddeutscheZeitung-DerletzteTanzumsGoldeneKalb-2009-06-02.<br />
pdf<br />
[15] http:/ / www. scribd. com/ doc/ 22327279/ Reboot-D-Digitale-Demokratie-Alles-auf-Anfang<br />
[16] http:/ / www. nextpractice. de/ unternehmen/ prof-dr-peter-kruse/ zur-person/ wissenschaft/<br />
[17] http:/ / www. nextpractice. de/ home/ aktuelles/ ?no_cache=1<br />
[18] http:/ / blog. whatsnext. de/ ?no_cache=1
TED (Konferenz) 371<br />
TED (Konferenz)<br />
TED (Abkürzung für Technology, Entertainment, Design) ist eine<br />
alljährliche Konferenz in Monterey, Kalifornien. Auf der Konferenz<br />
tauscht eine exklusive Gruppe von rund 1.000 Fachleuten der<br />
unterschiedlichsten Gebiete ihre Ideen aus. Seit 2005 werden weitere<br />
TED-Konferenzen weltweit abgehalten. Wer an den Konferenzen<br />
teilnehmen möchte, muss sich um eine Einladung bewerben. Die<br />
Teilnahme an den unterschiedlichen Konferenzen kostet zwischen<br />
3.000 und 6.000 US-Dollar.<br />
TED Konferenz<br />
Im Jahr 1984 wurde TED von Richard Saul Wurman ins Leben<br />
Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton auf der<br />
TED 2007<br />
gerufen. Da die erste Veranstaltung finanziell ein Misserfolg war, dauerte es sechs Jahre bis zur nächsten Konferenz.<br />
Seit 1990 findet TED jährlich statt. Nach der Tagung im Jahre 2002 hörte Wurman auf, seitdem wird TED von Chris<br />
Anderson geleitet.<br />
TEDGlobal<br />
Im Juli 2005 wurde die erste „TEDGlobal“ in Oxford, England abgehalten. Die zweite TEDGlobal fand im Juni 2007<br />
in Arusha, Tansania statt. 2009 und 2010 findet die TEDGlobal jeweils im Juli wieder in Oxford statt. [1]<br />
TEDIndia<br />
Im November 2009 wurde zum ersten Mal eine TED-Konferenz in Mysore, Indien abgehalten, die TEDIndia. [2]<br />
TEDMED<br />
TEDMED ist eine jährlich stattfindende medizinische Technologiekonferenz in den USA. Gegründet wurde die<br />
Tagung 2009 von Marc Hodosh und Richard Saul Wurman. Schwerpunkte sind Medizintechnik, Krebsforschung so<br />
wie Themen im Bereich der privaten und öffentlichen Gesundheitsfürsorge. Die mitgeschnittenen Vorträge können<br />
auf der TEDMED-Internetseite abgerufen werden. [3]<br />
TED Talks<br />
Seit dem Frühjahr 2006 werden auf der TED-Internetseite Vorträge von TED-Konferenzen veröffentlicht. [4] Das<br />
Motto dieser Vorträge lautet: „TED Ideas worth spreading“ (dt.: „Ideen mit Verbreitungswert“). Die Videoaufnahmen<br />
der Vorträge, die normalerweise nicht länger als 20 Minuten sind, werden unter einer Creative Commons-Lizenz<br />
veröffentlicht (by-nc-nd). [5]<br />
Im Mai 2009 wurden erstmals – im Rahmen des TED Open Translation Project [6] – zu 300 englischsprachigen<br />
Vorträgen zeitcodierte Untertitel in 40 Sprachen veröffentlicht.
TED (Konferenz) 372<br />
TEDx<br />
TEDx ist ein Konzept, das allen Menschen ermöglichen soll, Lizenzen und Know-How für eigene, unabhängige<br />
TED-artige Veranstaltungen zu bekommen, so dass sie diese selbst organisieren und durchführen können. Es richtet<br />
sich beispielsweise an Schulen, Geschäfte, Bibliotheken, und an Gemeinschaften oder Gruppen aller Art. [7]<br />
TED Prize<br />
Seit 2005 wird der TED Prize verliehen. Der Preis ist mit 100.000 US-Dollar dotiert.<br />
Weblinks<br />
2005 [8]<br />
2006 [9]<br />
2007 [10]<br />
2008 [11]<br />
2009 [12]<br />
Bono Dr. Larry Brilliant Bill Clinton Neil Turok Sylvia Earle Jamie<br />
Edward Burtynsky Jehane Noujaim Edward O.<br />
Wilson<br />
Dave Eggers Jill Tarter<br />
Robert Fischell Cameron Sinclair James Nachtwey Karen Armstrong José Antonio Abreu<br />
• Hauptseite der TED Conference [14]<br />
• Beiträge von TED auf Youtube [15]<br />
Referenzen<br />
[1] TED Global 2009 - The Substance of Things Not Seen (http:/ / conferences. ted. com/ TEDGlobal2009/ ) (englisch).<br />
www.conferences.ted.com. Abgerufen am 11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
2010 [13]<br />
[2] TED India - The Future Beckons (http:/ / conferences. ted. com/ TEDIndia/ ) (englisch). www.conferences.ted.com. Abgerufen am<br />
11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[3] TEDMED Videos (http:/ / www. tedmed. com/ videos) (englisch). www.tedmed.com. Abgerufen am 5. August 2010.<br />
[4] TED Talks (http:/ / www. ted. com/ index. php/ pages/ view/ id/ 127) (englisch). www.ted.com. Abgerufen am 11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[5] Are TEDTalks copyrighted? (http:/ / www. ted. com/ index. php/ help#talks5) (englisch). www.ted.com. Abgerufen am 11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[6] TED Open Translation Project (http:/ / www. ted. com/ translate/ about) (englisch). www.ted.com. Abgerufen am 11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
Oliver<br />
[7] Webseiten zum Konzept von TEDx (http:/ / www. ted. com/ tedx) (englisch). www.ted.com. Abgerufen am 11. <strong>Jan</strong>uar 2010.<br />
[8] TED Prize 2005 (http:/ / www. tedprize. org/ 2005-winners/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 1. Februar 2009.<br />
[9] TED Prize 2006 (http:/ / www. tedprize. org/ 2006-winners/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 1. Februar 2009.<br />
[10] TED Prize 2007 (http:/ / www. tedprize. org/ 2007-winners/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 1. Februar 2009.<br />
[11] TED Prize 2008 (http:/ / www. tedprize. org/ 2008-winners/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 1. Februar 2009.<br />
[12] TED Prize 2009 (http:/ / www. tedprize. org/ 2009-winners/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 1. Februar 2009.<br />
[13] TED Prize 2010 (http:/ / www. tedprize. org/ jamie-oliver/ ). TEDPrize.org. Abgerufen am 21. Februar 2010.<br />
[14] http:/ / www. ted. com/<br />
[15] http:/ / youtube. com/ user/ TEDtalksDirector
Quellen und Bearbeiter der Artikel 373<br />
Quellen und Bearbeiter der Artikel<br />
Internet Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78720092 Bearbeiter: 1-1111, 790, APPER, AZH, Abubiju, Achim Raschka, Aconcagua, Ahasver, Ahellwig, Ahoerstemeier, Aka,<br />
Alauda, Albertschulz, Alfred Heiligenbrunner, Alkab, Alkibiades, Andek, Andre M., Andreas -horn- Hornig, Andreas 06, Andreas Marc Klingler, Andreas kunert, Andrest, Andrsvoss, Andy1982,<br />
Anwiha, Armin P., Arnomane, Asb, Astc, Aule, Avatar, Ayacop, BLueFiSH.as, Bapho, Barthi, Batke, Baynado, Bdk, Ben-Zin, Benatrevqre, Berliner Schildkröte, Bernd vdB, Besim Karadeniz,<br />
Betterworld, Betweeneastandwest, Bhaskara, Bib, Bitsandbytes, Blacklibra, Blaumaler, Bling Bling, Blunt., Borcherding, Brackenheim, Braveheart, Brenzliglöscher, Bugert, Bücherhexe,<br />
Caramdir, Carter666, Casp11, Caulfield, CedricBLN, Chd, Cherubino, Chesk, Chippolino, Chotaire, Chrigu F, Chris Ulbrich, Christian Günther, Christian Plasa, Christian94, ChristophDemmer,<br />
Cic, Cirdan, Clemensfranz, Clue4fun, Complex, Conny, Conversion script, Corrigo, Crux, Cujo, Cymothoa exigua, Cyper, D, Dachris, Dagonet, Danyalov, Das Eierplätzchen des Todes, Dave81,<br />
Dejus, Der Ersteller, DerHexer, DerSchim, Dextwin, Diba, Diddi, Die.keimzelle, Dirk Weber, Dishayloo, Dominic Z., Dominik, Don Magnifico, Don.haraldo, Dundak, E.Biermann, Echoray,<br />
Eddia, Egore911, ElRaki, Ela-luca, Elend, Ellenmz, Eloquence, Elya, Englandfan, Ephraim33, Euku, EvaK, Fabchief, Fabian6129, Falense, FeddaHeiko, FirstClass, FischX, Fkoch, Floffm,<br />
Fomafix, Forevermore, Frank Jacobsen, Franz Richter, Freak111, Fristu, Fuechsle, Fuenfundachtzig, Funji, FutureCrash, G-u-t, Gabbahead., Gardini, Geos, Gerbil, GerhardG, Gnu1742,<br />
GodsBoss, Graf Alge, Groucho M, Guandalug, Guety, Guillermo, Gujoh, Gum'Mib'Aer, H-stt, Hadhuey, HaeB, Haeber, Hagbard, Hanauska, Hangy, Hank van Helvete, HaukeZuehl, He3nry,<br />
Head, Heliozentrik, Hella, Helmut Zenz, Herbert Lehner, HerbertErwin, Hey Teacher, Hofres, Holman, Hot Fuzz, Howwi, Hubertl, Hubi, Hutch, Hüning, I net12, IGEL, Ice Hawk123456, Ich,<br />
Ichmichi, Ilja Lorek, InMooseWeTrust, Indianerfreund, Interbay, Irmgard, Irmi.b, J budissin, J-PG, JARU, Jae, <strong>Jan</strong> Schreiber, Jeanpol, Jergen, JeromyKeloway, Jivee Blau, Jjanis, Jkbw, Johanna<br />
R., Jonny good, Josch1992, Jowo, Jpp, JuergenL, Juesch, Kaihuener, Kalligraf, Kam Solusar, Karl-Henner, Kbrose, Kdwnv, Kerbel, Kereul, Kgfleischmann, Klamser, Klaus Eifert, Kliv, Klmann,<br />
Kniffmaster, Knoerz, Koethnig, Kolja21, Konrad F., Kopoltra, Koskar, Kristjan, Krtschil, Krügi, Kubrick, Kuemmi, Kuli, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kuru, KönigAlex, LKD, LabFox, Lane09, Lapidar,<br />
Le-comte, Learny, Lehmi, Lencer, Lennex, Lewofra, Littl, Logograph, Lucky strike, Lustiger seth, Lyzzy, M-J-G, M.L, M.lange, MAK, MFM, MGla, MadWheel, Maedhros dsg, Maggot,<br />
Magnummandel, Manecke, MannMaus, Marcm, Markus Schweiß, Martin Aggel, Martin Herbst, Martin Loga, Martin-vogel, Martinroell, Martinwilke1980, Mathias Schindler, Matt1971,<br />
Matthias Bock, Matthäus Wander, Matzee, MauriceKA, Mavimi, Max Mira, Maxb88, <strong>Media</strong> lib, Medienblogger, Meister Yoda, Melancholie, Melkom, Meph666, Merenda, Merkel, Merlissimo,<br />
MetalSnake, Michael Micklei, Michael32710, MichaelDiederich, MichaelSchoenitzer, Michail, Michiwerfeli, Mikano, Mikue, Mis-wolff, Mitten, Mnh, MoLa, Molily, Morpheus1703, Mps,<br />
MrBurns, MsChaos, Muck31, Muckelchen, Multi io, Murat Bezel, Mwka, N-true, Nachtgestalt, Nb, Nemissimo, Nerdi, Nerezza, Netzi111, NiTeChiLLeR, NiTenIchiRyu, Nichtbesserwisser,<br />
NicoHaase, Nicolas G., Nicor, Ninabeck, Ningling, Ninjamask, Niteshift, Nocturne, Numbo3, Nx7000, Ocrho, Onkel Sam, Onno, Organic Thought, Ot, Owltom, Oxcuro, P. Birken, PDD, PM3,<br />
Paddy, Pascal76, PatriceNeff, PeeCee, Pelz, Pendulin, Pessottino, PhJ, Phil41, Philipendula, Philipp Wetzlar, Phoks, Phrood, Piatkowskk, Pill, Pionic, Pittimann, Pixelfire, Pkn, Polarlys, Postman<br />
Lee, Prolineserver, Qualle, Quosch, Ratzer, Rdb, RegMan, Regi51, Reinhard Kraasch, Reykholt, Ri st, Riptor, Rischmueller, Robert Kropf, RobertLechner, Roest, Roland Bless, Roo1812,<br />
Roxbury, S1, SDB, SMAMSinator, SPS, STBR, SWAT, Sabria, Sallynase, Schattenraum, Schindlermarco, Schlesinger, Schnargel, Schwarzseher, Scoid, Scooter, Scorpion2211, Scraps, Scravy,<br />
Seb1982, Sebastian Witt, Sechmet, Seewolf, Semper, Sicherlich, Siebzehnwolkenfrei, Siekermann, Silvestre Zabala, SimpleMinder, Sina Eetezadi, Sir, Sir Anguilla, Small Axe, Sms, Snc,<br />
Sommerkom, SonicY, Southpark, Sportman69, Srbauer, StYxXx, StarShaper, SteBo, Stefan, Stefan Kühn, Stefan Neumeier, Stefan64, Stern, SteveK, StillesGrinsen, Stummvoll, Suricata,<br />
Swgreed, Syrcro, Tali, Taprogge, Team Rocket, TheK, ThePacker, Theosch, Thomas Dancker, Thomas280793, Thorbjoern, Ticketautomat, Till, Till.niermann, Tinz, Tobias Conradi, Tom Jac,<br />
TomK32, Tomcat83, Torfkopp, Torsten.otto, Traroth, Trash:Pet, Tronicum, Trustable, Tsor, Tsukasa, Ulrich.fuchs, Umweltschützen, Unscheinbar, User399, User500, V.R.S., VanGore, Vareside,<br />
Verbund, Vitoek82, WAH, WKr, Wachs, Wahldresdner, Wahrerwattwurm, Webverbesserer, Wega14, Wendelin, Wiki-vr, WikiNick, WikiPimpi, Wildtierreservat, Wingthom, Wirthi,<br />
WissensDürster, Wo st 01, Wombi, Wst, Xoius, YMS, YourEyesOnly, Z()cki, Zaibatsu, Zeno Gantner, Ziko, Zinnmann, Zorglub, Zxb, 901 anonyme Bearbeitungen<br />
World Wide Web Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78606416 Bearbeiter: A11158, AWak3N, Ahellwig, Aka, Alauda, Andreas Buthmann, Andrsvoss, Armin P., Avoided,<br />
BD, Baumfreund-FFM, Ben-Zin, Binningench1, Björn Bornhöft, Boatideas, Bordor, BosonD, Brion VIBBER, Buckie, C-Lover, C-M, Cfaerber, Chris.aw, Christian List, Complex, Conversion<br />
script, Cyper, D, DaB., Dachris, Dalailama89, Daniel 1992, Der.Traeumer, DerHexer, Diba, Doc z, Dodo von den Bergen, Dominic Z., Don Leut, Duczmal, Dundak, Dvd-junkie, Eehmke, Eike<br />
sauer, Elwood j blues, Elya, Engie, Fabian7351, Fanatickson, FelixBlumstrauß, FelixReimann, Finex, Fire, Flashtech123, Florian Adler, Fomafix, Fozloki, FreeGroup, Fritz, FritzG, Gabbahead.,<br />
Garnichtsoeinfach, Gerd Fahrenhorst, Guandalug, Guety, H-j, HaThoRator, HaeB, Hammacool, HdEATH, Head, Hendrik Brummermann, Hfastedge, Howwi, Hubertl, Hydro, Ich, Inkowik,<br />
InterceptorIII, JD, JGalt, JakobVoss, <strong>Jan</strong> Giesen, Jennifer-Love-Hewitt-Fan, Jens Meißner, JensBaitinger, Joli Tambour, JotW, Joystick, Jpp, Jsson, JuergenL, Kaffeefan, Kaisersoft, Karl-Henner,<br />
Katharina, Kedmanee, Kgfleischmann, Kh555, Kku, Konrad F., Kreuzschnabel, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, Laudrin, Lehmi, Leseratte, Liebeskind, Liquidat, Logograph, LosHawlos, MAK, Magnus,<br />
MainFrame, Malte Hangsleben, MalteAhrens, MarkusHagenlocher, Martin Bahmann, Martin Wantke, Mc-404, Metoc, Mguenther, Michael Micklei, MichaelDiederich, Michail der Trunkene,<br />
Mijozi, Mikl, MilesTeg, Mnh, Molily, Mons Maenalus, Mravinszky, Mue, Musik-chris, NACHTFALKEueberBERLIN, Nachbarnebenan, Nb, Nicolas G., Ninjamask, Nocturne, Nolispanmo,<br />
Normalo, Olei, Onee, Ot, Paul Ebermann, PeeCee, Pendulin, Perlentaucher, Peter200, Phrood, Pygmalion, RalfZosel, Raphael Kirchner, Regi51, Remi, Ri st, Roo1812, S.lukas, S1, SCPS, STBR,<br />
Sabria, Sadako, Schaengel89, Schlurcher, Schuhpuppe, Sebastian.Dietrich, Seewolf, Semper, Siebrand, Sinn, Smart, Smial, Sokonbud, Solphusion, Stefan64, Steffen, Steindy, Stern, Steschke,<br />
Syntronica, TMg, Timk70, Timo Baumann, Tobi B., Togs, TomK32, Tschax, Tsor, Tuxman, Tönjes, Uhr, Ulrich.fuchs, Uwe W., V.R.S., VanGore, Verbund, Vodimivado, Volunteer, WAH,<br />
Wiegels, WikiNick, Wissenschaffer, Wittkowsky, Wkrautter, Wolfgang Kopp, XenonX3, Xqt, YMS, YourEyesOnly, Zahnstein, Zbik, Zellreder, Zenit, Zeno Gantner, Zulu55,<br />
pD9503B16.dip.t-dialin.net, 364 anonyme Bearbeitungen<br />
Web 2.0 Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77484065 Bearbeiter: -jha-, 404now, 4dem, 6grad, 790, ABF, AHZ, APPER, Adlange, Aka, Alexander Warta, Alien, Allesmüller,<br />
Alvanx, Amano1, Andim, Anhi, Annabanana86, Antaios, Ardo Beltz, Atlan da Gonozal, Avatar, Awful lasagne, Azimut, BJ Axel, Bamsery, Bdk, BeatePaland, Ben Ben, Bernburgerin, Bernd<br />
vdB, Bertram 2.0, Bhaak, Bibaone, Bibhai, Biernot, BirteHannah, Bjelli, Björn König, Bkmzde, Blauebirke, Bmcompufreak, Bodo Thiesen, Boonekamp, Bseeger, Bubo bubo, C-M, Carl<br />
Steinbeißer, Carol.Christiansen, Cgroetsch, Chb, Cherubino, Chiccodoro, ChrisHamburg, Chrisir, ChristophDemmer, Christophe Watier, Chrisweiss, Coaster J, Cokeser, Complex,<br />
ComputerHelpGerman101, Conny, CrazyForce, CroMagnon, D, DM AP, DPachali, DanielSHaischt, Darkking3, DasBee, Datenralfi, Dein Freund der Baum, Der kleine grüne Schornstein,<br />
Der.Traeumer, DerHexer, Diba, Dickbauch, Dodo von den Bergen, Domspach, Don Magnifico, Don-golione, Dreipholz, Dynamonit, EMatt, Elmschrat, Elwood j blues, Elya, Entlinkt,<br />
Ephraim33, Erdhummel, Euphoriceyes, Felix Stember, Feliz, Figapu, Filefanatic, Flominator, Florian, Florian Adler, Flunse, Foyo, Frank C. Müller, Freshjive, GT1976, Garnichtsoeinfach,<br />
Gerbil, Gestumblindi, Giftmischer, Grander, Guido Watermann, Guidod, Gwyndon, HG Herrmann, Hadzro, Hafenbar, Harro von Wuff, Helianthus, HugoRune, IdeenNetz, Ifrost, Igge, Igo,<br />
IngoPan, Inkowik, Irmgard, Isue, JFKCom, Jacob Köhler, Jahn Henne, <strong>Jan</strong> eissfeldt, <strong>Jan</strong>ka, Jazzguy, Jens Ilg, Jhr-online, Jogi, Josef.schneider, Joystick, Juerg.fraefel, JuergenL, Juesch, Jón,<br />
Kai-Hendrik, Kajk, Kalligraf, Karsten11, Kku, Knoerz, Koerpertraining, Konrad F., Konstantinopel, Kosmar, Kossatsch, Krawi, Kuddeldaddeldu, Kuebi, LKD, Leonidobusch, LepoRello, Lgxxl,<br />
Liberal Freemason, Liberatus, Life-is-more, Lowenthusio, Lukeen, Lxp, MFM, MSchmidt20, MacTekDoc, Magnummandel, Mandelschnitte, Marcoscramer, Mario Jakobs, Mark-weaver, Markus<br />
Moll, Markus.schulze, MarkusHagenlocher, Martin Bahmann, MaryKris, MattisManzel, Meikelarts, Meisterkoch, Memex, Memnon335bc, Memset, Metalhead64, Mgoecke, Michael Micklei,<br />
Michi.bo, Micwil, Mijozi, Mika555, Minke75, Mirra, Mo4jolo, Moldy, Molily, Monument of the unknown editor, Morinini, MovGP0, Mudd1, Muffin, Mzapf, Napa, Neu1, NiTenIchiRyu,<br />
Nico83, Nicor, Niemeyerstein, Nightfoxy, Nils3000, Nina, Nize, Nolispanmo, Nonstopo2000, Normalo, Nyks, Ole.Hinz, Onkel Pit, OriginalLA, Ot, Otto bufonto, Oxymoron83, P UdK, PM3,<br />
Parzi, PaulBommel, PeeCee, PeeWee, Pelz, Pendulin, Peter200, Pittimann, Psyche-delic, Ra'ike, Raeb, Raison d'etre, Ratman, Rechercheur, Regi51, Remi, ReqEngineer, Rolf H., Romankawe,<br />
Romwriter, Roterraecher, S.hagemann, S1, STBR, Schillergarcia, Schlauf, Schr66, Schwalbe, Sebastian.Dietrich, Secretgardener, Seewolf, Semper, Shimon, Siebzehnwolkenfrei, Sinn,<br />
Solphusion, Spekulatius2410, Splattne, Splinter, Srbauer, StG1990, StYxXx, Stefan, Stepro, Subbuteo, Sunergy, Sunnybug, Svejk, Swann, Szicholl, TRauMa, TXiKi, Tagme, Talaris, Teschke,<br />
TheK, Thomas Gebel, Tiger of the world, Tim Swilton, TimoPM, Tobias1983, Togs, Tourist12, Train-und-coach.de, Trainspotter, Transhuman, Trumpf, Ttbya, Tuxman, Tönjes, UlrichAAB,<br />
Uncopy, Unsterblicher, Ute-s, Uwe Gille, V.R.S., Venyo, W-alter, WAH, Was man wissen sollte, Watchcaptain, Wiegels, Wiki-vr, Wimmerm, WinfriedSchneider, WiseWoman, Wurstendbinder,<br />
Xeph, YMS, Yoshi, YourEyesOnly, Zaphiro, Zbik, Zinnmann, Zykure, 577 anonyme Bearbeitungen<br />
Soziales Netzwerk (Internet) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78708854 Bearbeiter: -jha-, 02xK, AXelarator, Aaaah, Aconcagua, Aka, Alex d 76, Altbau, Amerin,<br />
AndreasLuft, Androl, Ariro, Armin P., Artur4ik93, Aschmidt, Asdfj, AustinMartin, BMLoidl, Bachauf, Bastianberger, Bautsch, Beceem, BenediktM, Bernard Ladenthin, Bildungsbürger,<br />
Blauebirke, Blubbalutsch, CKerkmann, Cc1, Chaddy, Cherubino, Chrisir, Christian Storm, ChristophDemmer, Coco wiki, Conny, CroMagnon, Crux, Dagonet, Daniel 1992, Danielsl, DasBee,<br />
Dave81, David Ludwig, Dein Freund der Baum, Der kleine grüne Schornstein, Der.Traeumer, Derpapst3000, Dirkgrund, Dodo von den Bergen, Dr. Crisp, Emkaer, Enngoo, Ephraim33,<br />
Eschenmoser, Euku, Evilboy, Fecchi, Felistoria, Feliz, Forevermore, Fossa, Fouk, Fxp, Gamsbart, Garnichtsoeinfach, Gbrink, Gemics, Gena Haltmair, Gerd Roppelt, Gerold Broser, Giftmischer,<br />
Gorkacov26, Groupsixty, HE-BS, Hadmar von Wieser, Hafenbar, Hamena314, Hans J. Castorp, Helmut Zenz, Hermannthomas, Herr riede, Himuralibima, Howwi, Hsnmedia, Hydro, ISBN,<br />
JakobVoss, <strong>Jan</strong> Mathys, <strong>Jan</strong> eissfeldt, <strong>Jan</strong>pol, Jeanpol, Jkadauke, Jlorenz1, Jossi, Jpp, Juliabackhausen, Juttysay, KSR, Kai-Hendrik, Kairos, KapitänZukunft, Karl-Henner, Karsten11, Kku, Krd,<br />
Krtschil, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, Lalvers, LaurensvanLieshout, Leon Tsvasman, Liberal Freemason, Lx, Manfred Paul, Manuae, Marc van Woerkom, MarcoS90, Matt1971, Meisterkoch, Mermer,<br />
Mira, Moucis, MrPJH, Nfabier, NiTenIchiRyu, Nicor, Noddy93, Nyks, Oliversum, Omi´s Törtchen, Openbc, Ordnung, PatrickD, PeeCee, Peng, Peter-falkenberg, Peter200, Phfactor,<br />
Philipendula, Philippschaumann, Pischdi, Playmobilonhishorse, ProfessorX, PsY.cHo, PsychoKim, Querverplänkler, Reinhard Kraasch, Revvar, Robert Bombeck, Rosti99, Ruben22, Salbader,<br />
Sampi, Schlesinger, Schneiderya, Schultheis,Klaus, Sechmet, Seewolf, Seidlbar, Siebzehnwolkenfrei, Sitetalk-Unaico, Slat4atf, Southpark, Sportschuh, Srittau, Staro1, Steevie, Stepro, Stern,<br />
Stobs, Suhadi Sadono, Supermartl, Sypholux, T3rminat0r, TNolte, Talaris, TheJH, Theoprakt, Tinloaf, Tmp373, Tönjes, UKGB, Umweltschützen, VanGore, Vanillabean, VictorAnyakin,<br />
Vikingosegundo, Vintagesound, Volunteer, Weinfurtnerp, WinfriedSchneider, Wolfgang1018, Wst, Xario, Yülli, Zaphiro, Ĝù, €pa, 276 anonyme Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78895424 Bearbeiter: .Mag, Benihana, Benikrama, Capaci34, Cherubino, CroMagnon, Doc z, Dynamonit, Elednehsamoht,<br />
Fossa, Giftmischer, Grossus, Guido Watermann, HAL Neuntausend, HaSee, Howwi, Inkowik, Invisigoth67, <strong>Jan</strong>Korger, Jojo283, KradenHayes, Krd, LKD, Lakedaimon, Larf, Maedsie,<br />
Magnummandel, MaryKris, Michael-W, Moehre2000, NPunkt, Nanko, Napa, NiTeChiLLeR, NiTenIchiRyu, Normalo, Norro, Oth11, RAMI, Ramonowics, Rocket Scientist, Roterraecher,<br />
Rudolfox, Septembermorgen, <strong>Social</strong>mediaschweiz, Solphusion, Spuk968, Stelten, Swetteborn, Tipptopp, Ulsimitsuki, V.R.S., Wattisdattdenn, Wortgefecht, 43 anonyme Bearbeitungen
Quellen und Bearbeiter der Artikel 374<br />
Soziale Software Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76168486 Bearbeiter: -jha-, Achimbode, Alter Fritz, Amano1, Amtiss, Ariro, Avron, Borisniko, Cecil, Christian Storm,<br />
Christianrueger, ChristophDemmer, Cjesch, Cordulal, Dave81, DerHexer, Electrocat, Elwood j blues, Ephraim33, Euphoriceyes, Felixjansen, Feliz, Fladi, Flominator, Florian Adler, Fristu, Gerd<br />
Taddicken, Glanz, Grander, Harro von Wuff, He3nry, Herr Th., Hildegund, Igo, JakobVoss, Jonasbinding, Jpp, Jürgen Engel, Kai-Hendrik, Karstenpe, Kerbel, Kku, Klaus pennew, Kochm,<br />
Krawi, Kurmis, LKD, MFM, Marc van Woerkom, Martin Szugat, Mastad, MattisManzel, Mnh, Molily, Napa, Nerun, Netspy, Noddy93, Ocrho, Ot, Paddy, Pargo, Parzi, Peacemaker, Peter200,<br />
Pferdt, PhMis, Playmobilonhishorse, Ra'ike, RichardHeigl, RudolfSimon, Samtrot, Schmafu, Schultheis,Klaus, Sebastian Wallroth, Solphusion, Squiddle, Stepro, Swann, TMg, This Born,<br />
Torstenphilipp, Trellerlouis, Urban-listening, Uwe Gille, Video2005, Volunteer, WalterWolli, WikiNick, WissenVeredeln, Wolfi.de, Zaboura, Zaphiro, Zenit, 152 anonyme Bearbeitungen<br />
Facebook Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78883260 Bearbeiter: A. B. 10, Adornix, Aka, Akrause91, Alfredovic, Alleswissender, Amstuzmarco, AndiBerta, Andreasklug,<br />
Antiquar, Aristeas, Aschmidt, Avatar, Avoided, Beek100, BiLL, Biktora, Binninger, Braveheart, BrunosapiJens, C-M, CKerkmann, Capaci34, Chire, Christian Storm, Church of emacs,<br />
CommonsDelinker, Complex, Conspiration, Cpuhl51, Curtis Newton, Daniel 1992, Ddxc, Der Wolf im Wald, Der.Traeumer, DerHexer, DerSchnüffler, Diba, Die Winterreise, Djallal, Doc z, Don<br />
Magnifico, DorisAntony, Dr. Crisp, Dr.Hasi, DrLee, Elednehsamoht, Eminn, Emkaer, Engie, Ennimate, Entlinkt, Erik Warmelink, Facebooker, Facebookguru, Farmerviller, Feba, Fecchi, Fipsy,<br />
Florian Adler, Floriot, Fossa, Frank Behnsen, FriedolinH, Fw, G-C, GMH, GT1976, Gamgee, Gemuesegriller, GerdSchugge, Gf1961, Gidolf, Ginomorion, Guandalug, Haemmerli, Hannah<br />
Wehmeyer, Hans J. Castorp, Hardenacke, HelenaSophiaCastellina, Helpman1972, Hofres, Holder, Hoo man, Howwi, Hubertl, Ickle, Informatik, Investor, Ireas, Itti, Jacktd, Jenswiese, Jergen, Jill<br />
Gate, Jivee Blau, Jodo, Jorge B, Juliabackhausen, Jürgen Engel, Kai-Hendrik, Kaisersoft, Kandana, Kantor.JH, Klingon83, Knallexus, Knoerz, Komischn, Konnie, Krawi, KurtR, LKD, Leider,<br />
Letdemsay, Liesel, Lindemann-de, Lirum Larum, Lucianoschulz, MB-one, Maelcum, Magglz, Magnummandel, Manuae, Marrrci, Marsupilami04, Matt1971, Matthias M., Matvei3, McCourt,<br />
Mdxxx, Meiersjonas, MichaelHensch, Michi1308, Misburg3014, Moritz schlarb, Muck31, MusenMuddi, Nachtigalle, Namoraka, Neil Hilist, Neun-x, NiTenIchiRyu, Nikkis, Nina, Noebse,<br />
Nolispanmo, Numbo3, Okin, Olaf Kosinsky, Onee, Ot, PAPPL, Parzi, Pemu, Pentiumforever, Pill, Pischdi, Pittimann, Pocci, Politics, PsY.cHo, RacoonyRE, Razvanus, Rdc, Regi51, Rigolos,<br />
Rlbberlin, Rumpf14, Rupert Pupkin, S-T-U-D-E-X, Schlesinger, Schmelzle, Schwijker, Scooter, Seewolf, Seniix, Shenpen, Shoshone, SibFreak, Sinn, Skof, Small butterfly, Smeiko,<br />
<strong>Social</strong>mediaschweiz, Sogeking, Sosak, Speck-Made, Spiff77, Sportschuh, Spuk968, Sralihn, Stefan64, Stelten, Sternschläger, Struppi-das-Hündchen, Sunny04, T.M.L.-KuTV, Tafkas,<br />
TanjaBense, Thobach, Thomashutter, Tigeryoshi, Timk70, Timonf, Tmfreitag, Tmid, Tofra, Tomfinnern, Trolinus, Trustable, Turkey73, UKGB, Ubongo azul, Umweltschützen, Ute Erb, VPiaNo,<br />
Volunteer, WAH, WOBE3333, Wangen, Waterstrider, Werwiewas, Wickie37, Wiki Gh!, WikiNick, Wildtierreservat, Wolfgang1018, X-Weinzar, Xeph, YMS, Yellowcard, ZacPac, Zaibatsu,<br />
Zaphiro, Zollernalb, Århus, Ĝù, 335 anonyme Bearbeitungen<br />
Blog Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78862473 Bearbeiter: 20percent, 2Bios, A-Z, A-giâu, AGerads, AHZ, Abe Lincoln, Abubiju, AcE, Adlange, Ahoerstemeier, Aka,<br />
Albertschulz, Aldawalda, Alfred Grudszus, Amtiss, AndreasPraefcke, AneinemDonnerstag, Anesta, Anhi, Anneke Wolf, Anntheres, Ansouis, Aprinz, Architekturgelehrter, Armin P.,<br />
ArtMechanic, Asb, Aschmidt, Ath, Athalis, Aths, Aufräumer, Auge24.eu, Avariel, Avatar, Avoided, BJ Axel, BLueFiSH.as, Balû, Bdk, BeatePaland, Benikrama, Bernard Ladenthin, Bernd vdB,<br />
Bhfr, Bitsandbytes, BlackIce, Blaubahn, Blogwart, Blugger, Bmcompufreak, Bogen, Boguslaw Sylla, Bonzo*, Boris23, Braveheart, Buroll, BvK, Bücherhexe, Camil, Carstor, Cash walton, Casra,<br />
Cdab, Cherubino, Choas, ChristophDemmer, Church of emacs, Chyth, Cirdan, Cm., Complex, Cordobes, Crazy1880, Cronotron, Cyzzie, Czalex, D, D.Rudolph, D.Schiebener, DEr devil, DaSch,<br />
Dachris, Dagonet, DanM, Danieltgross, Dapete, DasBee, Dein Freund der Baum, DemoiselleBrindacier, Der Messer, Der kleine grüne Schornstein, Der.Traeumer, DerHexer, DerMudder,<br />
DerWahreKeks, DiabolicDevilX, Diba, Digitus, Dinah, Dirk1812, Dishayloo, Dominicp, Dominikboe, DorisAntony, Dosc, Doublecleaner, Dr.peter, Drahreg01, Duesentrieb, Dundak,<br />
Dunkelangst, Dynamonit, Ehsc, Eiferer, Eike sauer, Eiskalt, Eldred, Eloquence, Elwood j blues, Elya, Emha, Engie, Entlinkt, Erdimax, ErikDunsing, Euku, Euphoriceyes, FGodard,<br />
Familienwikipedianer, Felix Stember, Filzstift, FischX, Fit, Flo 1, Flokru, Florian3, FlorianL, Fock Gorch, Fomafix, FordPrefect42, Forevermore, Franczeska, Freedom Wizard,<br />
FreelancerHamburg, Fristu, Fritz, Garrett, GeorgR (de), Giftmischer, Gms, Gnu1742, GrossmeisterT, Grossonkel, Guandalug, Guido Watermann, Guillermo, Gunther, Gurt, Gut informiert, HAL<br />
Neuntausend, HaSee, Hadhuey, HaeB, Hagbard, Hammerson, Hangy, Hansbaer, HdEATH, He3nry, Heierlon, Helge.at, Hiaslee, Himuralibima, Historiograf, HoHun, Hollemann, Howwi,<br />
Hubertl, Hukukçu, Humpaaa, IGEL, ISBN, Ifrost, Igo, Inza, J.-H. <strong>Jan</strong>ßen, J.Ammon, JFKCom, JVO, JakobVoss, <strong>Jan</strong> sh, <strong>Jan</strong>CK, <strong>Jan</strong>Schmidt, Jergen, Jodo, Joerg1982, JoergHoltmann, Jofi,<br />
Johnny Controletti, Jonny123, Jorges, Jtt, Ju52, JuergenL, Kam Solusar, Karameloso, Karl-Friedrich Lenz, Karl-Henner, Katharina, Ken-nedy, KerLeone, Kersti Nebelsiek, Kickof, King,<br />
Klauseck, Klever, KommX, Kossatsch, Kotofei Iwanowitsch, Krawi, Krissie, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kzee, Körnerbrötchen, LKD, Langec, Leipnizkeks, Lennert B, Leppus, Lib, Lightbringer, Limasign,<br />
Linda.md, Lirum Larum, Littl, Louis Bafrance, Lsaffre, Lumpenpack, Ma.y, Maet, Magipulus, Magnummandel, Magnus, Maiakinfo, Malte Schierholz, Manjel, Marc22, Mariachi, Martin-vogel,<br />
Martinroell, Martinwilke1980, Matt314, MatthiasGutfeldt, MauriceKA, Mawa, Max Sinister, Maxe.wiki, Maxliebscher, <strong>Media</strong> lib, Meister-Mini, Mellibere, Memex, Merlissimo, Michael<br />
Kühntopf, Michael-Herrmann, Michael-W, Michail, Michi.bo, Mike Krüger, Mike Rüb, Mikenolte, Mikue, Minderbinder, Missi, Mjwerner, Mmueller 123, Monemone, Monsta, Mulk,<br />
Musik-chris, Möchtegern, Napa, Nd, Neg, Nerd, NetSpy, NeuPopSpeck, Neun-x, Neutralstandpunkt, NiTenIchiRyu, Nicolas G., Noddy93, Nolispanmo, Oceancetaceen, Oktaeder, Onee, Opi27,<br />
Ot, Otto Normalverbraucher, Otv2007, Owltom, PDD, PM3, Palli, Parka Lewis, PatXPat, Patruh, Pbihr, PeeCee, Pendulin, Pere Ubu, Perlenfischer, Peter Ralf Lipka, Peter12345peter, Peter200,<br />
Peter774, Philipd, Philipendula, Philipp Aregger, PhilippWeissenbacher, Pica05, Pietz, Pittimann, Porsche Diesel, Portenkirchner, Primordial, Primus von Quack, Prinz Rupi, PsY.cHo,<br />
RaimundZiegler, RainerB., RalfZosel, Ralfk, Rasterzeileninterrupt, Raven, Rdb, Regi51, Reinhard Kraasch, Remi, Ri st, Rogmann, Roo1812, Rudolfox, Ruhrstadt, S1, STBR, Sae1962, Saliha,<br />
Sam k, Sargoth, Sascha Kremer, Schlaubi08, Schlurcher, Schmafu, Schwalbe, Schweigendeslamm, Sechmet, Seewolf, Semper, Shizu, SibFreak, Siebzehnwolkenfrei, Siggisiggi, Sikilai, Sinn, Sir,<br />
Slmcnonlinear, Small Axe, Sms, Solphusion, Sommerkom, Soultcer, Speifensender, Spuk968, SteBo, Stefan Kühn, Stefan Schärli, Steffen, Stelten, StephanMosel, Stern, Sternschläger, Stipriaan,<br />
Strmfld, Superbass, Sypholux, T H, T-Zee, TNolte, Tester010, Texon, ThS, The.Modificator, The<strong>Jan</strong>itor, ThePeritus, TheTacker, Theoprakt, Thmsfrst, ThomasGigold, Thorbjoern,<br />
ThorstenSommer, Til132, Till.niermann, Tilman Berger, TimoPM, Tokikake, TomK32, Tonundbewegung, TorsTen, Transparent, Triathlet, TrueQ, Trustable, Tubor1, TupajAmaru, Tuxman,<br />
Tönjes, Ubongo azul, Ugh, Ulho, Umweltschützen, Unscheinbar, Urzeit, Uwe Gille, Uwe Hermann, Vinci, WAH, WIKImaniac, WOBE3333, Waltershausen, Web-spy, Wiegand, Wiegels,<br />
Wiki-blogger, WikiNick, Wikisearcher, Wikitoni, Wilhans, Wolfgang1018, Wst, Wwelke, Www.storyal.de, YMS, Yodokus, Youandme, Zaphiro, Zaungast, Zinnmann, Zumbo, Özgurdunyam,<br />
938 anonyme Bearbeitungen<br />
Mikroblogging Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76786955 Bearbeiter: Achim Raschka, AndreasLuft, Aschmidt, Capaci34, CenturioST, ChristianNeumann, Complex,<br />
Cpesch, Cptblaubaer, Cptblaubaerac, DiegoRod, Dishayloo, Doc z, Dunstkreis, Felix Stember, Goodoo, Guido Watermann, HAL Neuntausend, <strong>Jan</strong> Giesen, Kai-Hendrik, Keirath Medien, LKD,<br />
Lirum Larum, MatthiasRauer, Misssk, Neustradamus, RoodyAlien, Rosti99, Soenke2008, Speck-Made, Sputnik, Supaari, Thosch66, Titus44, Trustable, Tuxman, VanGore, Wortgefecht,<br />
Yaotang, 35 anonyme Bearbeitungen<br />
Twitter Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78765744 Bearbeiter: 790, A1bi, Abu-Dun, AchimP, Agitier, Ahanta, Alexander.neuhaus, AndreasFahrrad, Andreasklug, Aschmidt,<br />
Aths, BLueFiSH.as, BTTV, Beckett, Benoit85, Bihlerin, Birger Fricke, BirteHannah, Boonekamp, Borkert, Bronko, Burks, CaZeRillo, Captaingrog, Carl Steinbeißer, Cartinal, Casa rolf, Cellstar,<br />
Cem Basman, CenturioST, Cherubino, ChrisHamburg, Cube42, Cyrotux, Cäsium137, DaB., Dachbewohner, Daniel Bovensiepen, DanielDüsentrieb, DarkScipio, Darth NormaN, Dawn,<br />
Der.Traeumer, DerKarren, Diddy Editi, Doerki, Don Magnifico, Dsfranzi, Dubium, Dynamonit, ERWEH, El nappo, Elednehsamoht, Elvaube, Emkaer, Entlinkt, Euku, Euphoriceyes, Eva Stirner,<br />
Fernrohr, Fidepus, Firefox13, Flurfunker, Frank Murmann, Frederic, Fritz Jörn, G-Reg-24, Gaianer, Garver, Gaspode8, Geitost, Geräusch, Giftmischer, Gnu1742, Gondlir, Gorillamoon,<br />
Grigoriosp, GringoStar, Gsälzbär, Gtwkndhpqu, Guido Watermann, HAL Neuntausend, Handle, Henlen, Holder, Holthus, Howwi, Hubertl, I wanna be sedated, Innonet, Invisigoth67, Isarwolf,<br />
Itti, J o-1, JFKCom, Jack 1982, JakobVoss, <strong>Jan</strong> Giesen, <strong>Jan</strong>CK, <strong>Jan</strong>uario, Jergen, Jkbw, Jodo, Joux, Ju52, Juliabackhausen, Kai-Hendrik, Kaisersoft, Kalorie, Karl-Friedrich Lenz, Karl.Kirst,<br />
Karsten11, Kenny1987, Klauseck, Klingon83, KnightMove, Krawi, LIU, LKD, Lalü, Letdemsay, Lindemann-de, Lirum Larum, Lobservateur, M.L, Maiakinfo, Makem99, Mannerheim, Marius<br />
wellhoener, Markus1975, Marrrci, Martin Sauter, MatthiasGutfeldt, Maz3r, Meister-Lampe, Melnomany, Michael Timm, Michael Zapf, Michael von Aichberger, Michelvoss, Mikano, Mk-gfx,<br />
Moneybrother, Mps, Mthie, Mudi, Neoexpert, NewcomerBLN, NiTenIchiRyu, Nicolas17, Nobelhobel, Nolispanmo, Norbert Hagemann, Normalo, Norro, O'Brien, Ocrho, Onee, Ot, PeeCee,<br />
Peter12345peter, Petra26, Philhaus, Phlow.net, Pinneberg, Pintman, Pistol Pete, Pittimann, Pixelguy, Pjebsen, Polluks, Pottschalk, Powerboy1110, Presseschauer, PsY.cHo, Q344, Quintero,<br />
Qwqchris, Rainer Wasserfuhr, ReiKi, Rgelpke, Royalsolo, Rr2000, Runoratsu, Sarah777, Sargoth, Sebastian Wallroth, Seelefant, Sepp, Septembermorgen, Sevela.p, Shoshone, Sirround, Skorvo,<br />
Solphusion, Spiteactor, Spuk968, Stargaming, Stauba, Stefan Bernd, StefanAndres, Stelten, StephanKetz, Steschke, StillesGrinsen, Suirenn, Supaari, Supercoach, TNolte, Talaris, Team07,<br />
Texteuse, Th1979, TheK, Theoprakt, Thrown-out, Tillmo, Timpetu7, Tischbeinahe, Torsten.hoppe, Totie, Trustable, TweetKrake, Twitt3r3r, TwittCoach, Tymcat, Ulfilas, Ulrich Waack,<br />
Umweltschützen, Unsterblicher, WAH, WIKImaniac, WOBE3333, WStephan, Walter101, Wasserseele, Wefeel, Wildtierreservat, Williundpeter, WinfriedSchneider, Winheld, WissensDürster,<br />
Wolfgang1018, Wondervoll, XchrissyX, Yellowcard, YourEyesOnly, Zaibatsu, Zwitscherfreund, ³²P, º the Bench º, 260 anonyme Bearbeitungen<br />
XING Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78430771 Bearbeiter: -jha-, 08-15, 790, A.ba, ALE!, Aalhuhnsuppe, Aka, Akl, Alauda, AlterVista, AndreasE, Ankid, Anshelina,<br />
Ariro, Armin P., Arved, Aschmidt, Asdert, Badenserbub, Berliner Schildkröte, Bernard Ladenthin, Bernhard Wallisch, Bhoffmann, Braveheart, Buehnenheld, Chiccodoro, Chillvie, Chris Reuas,<br />
ChristianR, Complex, Curtis Newton, Cusquena, DaFux, Dan3k5, Datenralfi, Denkergehirn, DerHexer, Diba, Don Rodrigo, Engie, Eschenmoser, Evershagen, FAEP, Falense, Felix Stember,<br />
Fight, Fleasoft, Fomafix, Forevermore, Frank Schulenburg, Fußballmeister, Geher, Geisslr, Giftmischer, Grossernarr, Guido Watermann, H005, HaSee, Haeber, Hajumal, Hendrik J., House1630,<br />
Ifrost, Islaya, Itti, <strong>Jan</strong>urah, Jivee Blau, JuergenL, Jürgen Pierau, Kawana, Klingon83, Koljan, Konrad F., Konstantinopel, Krawi, Krd, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, Learny, Leider, Lichtkind, Lipice,<br />
Lofor, Maclemo, Madmaharaja, Maikel, Manfreeed, Mannerheim, Markuja, Marsupilami, Martin67, Martinroell, Matt1971, Maysev, Memex, Menphrad, Mermer, Mo-eagle, Moros, Muck31,<br />
Mueck, NiTeChiLLeR, Niegelnagel, Nilstissen, Noddy93, Noebse, Nzlwf8, Olei, Oliver.Faulhaber, OpenBC, Ordnung, P77a, PeeCee, Peter200, Piecestory, Pmkpmk, Rautenfreund, Reddy,<br />
Regi51, RonaldWoelfel, RudolfSimon, Rujadd, Rumohr, STBR, Schubladenschaf, Schultheis,Klaus, Sebastian Wallroth, SieckH, Siehe-auch-Löscher, Sigi fikanz, Sirdon, Smeiko, Stefan Hintz,<br />
Stefanbcn, Stephanbim, Stepro, Talaris, Telakin, Tengai, Thavis, Thegrid, Tomatenmark, Trickstar, Trockenfisch, Umweltschützen, Uwe Gille, VanGore, Vieuxloup, Vinci, Volunteer,<br />
WalterWolli, Wasserseele, Webverbesserer, WikiNick, Wikinger77, Wikipeder, Wikiritter, WiseWoman, Zingh, °, 201 anonyme Bearbeitungen<br />
LinkedIn Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78178780 Bearbeiter: Aschmidt, CKerkmann, Callidior, Eschenmoser, FeG, Giftmischer, Gpuchta, JCIV, Johnny Controletti,<br />
Marcus Schätzle, Minderbinder, Schwijker, Seth Cohen, StefanWorm, WalterWolli, WolfgangS, Wolkenunddreck, 11 anonyme Bearbeitungen<br />
MySpace Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76984910 Bearbeiter: -jha-, A2r4e1, Aaaah, Abu-Dun, Agadez, Aka, Alexander Fischer, Arbeo, Arii Samsonov, BK-Master,<br />
Ba3072, Brackenheim, Budelrumser, ChrisHamburg, Church of emacs, Coaster J, Danny Fields, Das-Dinchen, Der Chaos king, Der Wolf im Wald, DerHexer, Devil5, Diba, Don Magnifico, Dr.<br />
Colossus, Dr.H114, Eldred, Elendur, Eli Scrubs, Eneldo, Ephraim33, Erschaffung, Feierfrosch, Fleshgrinder, Frank Murmann, Fußballmeister, Gamgee, Gerbil, Giftmischer, Gogutza, Guggles,
Quellen und Bearbeiter der Artikel 375<br />
Gurgelgonzo, HS.Mueller, Haeber, Heinte, Hey wickie hey, Hinzke, Howwi, Hubertl, Hufi, Igge, JD, JakobVoss, <strong>Jan</strong>Schmidt, Jorunn, Josh135, Juliana, Keila Bran, Kh80, Krawi, Linus Pogo,<br />
MB-one, Marilyn.hanson, Melvin Blitzny, Mister redman, Mjh, Moros, Muck31, Niall Mackay, Noddy93, Noebse, Numbo3, Otto Normalverbraucher, Paunaro, Paygar, PeeCee, Pendethan,<br />
Peter200, Pfalzfrank, Philipendula, Piedro, PsY.cHo, Red Grasshopper, Regi51, Ri st, Rugal Bernstein, S1, Sabata, SchirmerPower, Schultheis,Klaus, Sebs, Seewolf, Sem-rub, Shadak, Shoot the<br />
moon, Sinn, Sonntag.michael, Staro1, Starpromi, Stefan64, StephanKetz, Stephanbim, Stern, SteveTheGuitarChief, Susan Brown, Svencb, Tafkas, TiKu, Tilla, Trustable, Tsor, Ulz, Vaifan90<br />
(official), Verwüstung, VillaStraylight, WAH, Wgtranquillo, WikiNick, Wittener, Würstchenkönigin, Xario, XchrissyX, Yashiro Nanakase, YourEyesOnly, Yülli, Zaphiro, Zollernalb, 162<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
studiVZ Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78428263 Bearbeiter: -jha-, 0vertake, 24seven, A2r4e1, AQ, AWendt, Aarakast, Abe Lincoln, Addi Rabe, Afromme, Agadez, Aka,<br />
Akmu, Alibi, AlterVista, Amtiss, Andante, Andreas 06, Andreas aus Hamburg in Berlin, Andrest, Angelangie, Ariro, Armin P., Arnomane, Aschmidt, Avoided, Ayatollah, BLueFiSH.as,<br />
Barçelonista, Baumfreund-FFM, Baumi, BaxBann-Ih, Bbommel, Bdk, Bender235, BishkekRocks, Bivinz, Blade1802, Blah, Blar, Blauerflummi, Blur4760, Bo$$toleur, Bonace, Br4ti,<br />
Brezelsuppe, Bruenftig, Buckeye, Bujan, Buntfalke, Burgherr, Burts, Buster Baxter, Buttermichi, C-M, CKerkmann, Callidior, Capaci34, Cepheiden, Chatfix, Che010, ChrisHamburg, Chrischris,<br />
ChrisiPK, Chrisqwq, Christian Storm, Christopher Persson, Cinzia, ClemiMD, Cliffhanger, CmcTd, Complex, Cybertorte, D, D0c, Daniel Strüber, Darina, Darkfire01, DasBee, Dasdasdasdasd,<br />
Datenschutz2007, DavidG, Dawn, Dead-Eye, Defchris, Demus Wiesbaden, Dennis 1510, Der Ed, Der Wolf im Wald, Der.Traeumer, DerAndre, DerErgaenzer, DerHexer, Diba, Dktz,<br />
Dr.Pressure, Drbashir117, Du3n5cH, Dundak, Ellowitsch, Elvaube, Emkaer, Enth'ust'eac, Entlinkt, Ernstl, Erschaffung, Euku, Euphoriceyes, Evilmalcom, Farnpflanze, Feliz, Fesalz, Fkoch,<br />
Flawed reality, Flominator, Florian, Florian Adler, FlorianN, Forevermore, Forscher93, FrankyOn, Freak 1.5, Freddieprince, From Autumn To Ashes, Fulmen, Funkhauser, Fxb, Gamma,<br />
Gammaflyer, Gaspard, Gauner 1, Gegenwind, Generalpd, Geos, Giftmischer, Gnom, Gnu1742, Gohnarch, Goodbye, Gordon Zola, Gressenicher, Gromit1128, Groobie, Guandalug, Guggles,<br />
Gunnar.Forbrig, H-stt, HALsixsixsix, HaSee, Haascht, HahnChristoph, He3nry, Head, Hendrik J., Hmilch, Holgado, Holly Tyler, Hristina, Hubertl, HurwiczRocks, Hydro, Igge, Inkowik,<br />
Intoxication, Irakli, Ireas, Isotherm, Itti, JD, Jacks grinsende Rache, <strong>Jan</strong> Schreiber, <strong>Jan</strong> der harte1001, Jartope, Jean-Pierre Hecht, Jeune du fevrier, Jivee Blau, Jodo, John Eff, Johnny Yen, Jonas<br />
Grote, Jonasbinding, Jonathan Groß, Juliabackhausen, Juliane, Julianrabe, Julius1990, Jürgen Pierau, KAMiKAZOW, KagamiNoMiko, Kardan, Karl Prall, Karlkiste, Katjaweidner, Kenny1987,<br />
Kero, Knickel, Komischn, Krankman, Kungfuman, LKD, Le petit prince, LinusV, Linxs united, Lirum Larum, Lu Wunsch-Rolshoven, MB-one, Magadan, Mail2tiffy, Maloxp, Manjel,<br />
MannMaus, MarkGGN, Markus Mueller, Mascobado, Max666, Medi-Ritter, Medienhai, Mgalvis88, MichaelDiederich, MichaelHensch, Michelvoss, MichiK, Mifrank, Millbart, Mistmano,<br />
Mk83, Mmmkay, Mo4jolo, MoLa, Modran, Molily, Mondmotte, Moni M, Monkel, Monni Mayer, Morgenstund, Moritz Wicky, Moucis, Mps, Mrlu, Mue, Muschkopp, Musicsciencer, N-true,<br />
Nepenthes, Nfes, NiTeChiLLeR, Nicor, Nikkis, Nilsandi, Nilsjuenemann, NimmZwo, Nina, NoCultureIcons, Noclador, Noddy93, Nolispanmo, Norm, Norquinco, Nraeth, Ocrho, Odo, Oernzen,<br />
OliverG4692, Omarius, OpenAccess, Ot, Otonga der Nasenbär, PDD, Paxarion, PeeCee, Peter12345peter, Peter200, PeterWashington, Peterschink, Pfalzfrank, PhHertzog, Philip83, Philipp<br />
Gruber, Philipp Wetzlar, Philmo1, Phoenix1983, Phogenkamp, Pill, Plehn, Polarlys, Porter2005, Protobobosch, PsY.cHo, Psychopaul, Quo vadis - m, RacoonyRE, Ralf Roletschek, Rdb,<br />
Reinhard Kraasch, Revolus, Rhun, Ri st, Rob1709, Robert Alexander, Robert Weemeyer, Rub1993, Rubenarslan, Rudolfox, S1, STBR, Saippuakauppias, Sarefo, Schedeffen, Scherben, Schimon,<br />
SchirmerPower, Schlaubi08, Schlaule, Schmiddtchen, Schreibvieh, Sebayer, Sebmol, Seelefant, Seewolf, Sfisches, Shimon, Sinn, Skyman gozilla, Skyruner2, Smeiko, Sokai, Speck-Made,<br />
Spekulatius2410, Sportschuh, Starloop, SteBo, Steevie, Stefan, Stefan Birkner, Steffen, Stein1001, Stephan Schneider, Stephan1982, Stylor, Succu, Summit, Syrcro, Tabi Lorang, Tafkas, Talaris,<br />
Tankwart, Taratonga, Tattoo, Tcommbee, Texas Longhorn, Textkorrektur, TheK, Theredheadcraze, Theredmonkey, Thogo, Thornard, Timmaexx, Timonf, Tischbeinahe, Tobiask, Totenmontag,<br />
Trolinus, Trublu, TruebadiX, Trustable, Tuxman, Tuxo, Tönjes, U.m, Umweltschützen, Unenzyklopädisch, Ussschrotti, Val99, Veoco, Vigenzo, Volty, W!B:, WIKImaniac, WMA33,<br />
WOBE3333, Wahldresdner, WalterWolli, Wesener, Wglas, Wickie37, WikiNick, Wolfgang H., Wranzl, Wurgl, Wüstling, X-Weinzar, XJaPaN, XenonX3, Xocolatl, YMS, YourEyesOnly,<br />
ZES2000, Zaphir, Zaphiro, Zumbo, °, 545 anonyme Bearbeitungen<br />
Flickr Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78417047 Bearbeiter: 7645, AWendt, Abu-Dun, Acienix, Akriesch, Albspotter, AlexR, Ar-ras, Arch2all, Bertkower Jung, Blaufisch,<br />
Boris23, Brainspace, Bubinator, Burkhard, Carlconrad, Cjlpa, CroMagnon, Curtis Newton, Dachris, Damien615, DanielSHaischt, David84, Dbenzhuser, Dein Freund der Baum, Denis92,<br />
DerHexer, Dha, Doc z, Elwood j blues, Ernstl, Eschaper, Felix Stember, Feuerrabe, Floker, Florian Adler, Florian.b, Gartenflo, Gissi, Gregorfischer, H005, Historiograf, IboS2000, Irmgard, JD,<br />
Jochen Böttcher, JuMiNi, Kalyxo, Ken-nedy, Kh80, Kirschblut, Knergy, Koerpertraining, Kolja21, Kongokingbongo, Lama2000, Le-max, Leider, Lennard255, Leon, LittleJoe, Marilyn.hanson,<br />
Mathias Schindler, Matt1971, Maturion, Mef.ellingen, Michmo, Mnh, Molily, Mononoke, MutluMan, My name, MyBBCoder, Nico83, Nicor, Nocturne, Noddy93, Nogo, Nolispanmo, Noorg,<br />
Nyks, Patrickschulze, Paunaro, Phantom, Picasso, Pixelman, RacoonyRE, Rax, Regi51, Ritter-lambert, Rohieb, S.K., S1, Schlafgarbe, Schlapfm, Schneller2000, Schumir, Secretgardener,<br />
Semper, Senfi, Seth Cohen, Smeiko, Snevern, Solotoj, Spider-spax, Sprachpfleger, Staro1, Stefan@freimark.de, The<strong>Jan</strong>itor, TheK, TheWolf, Thire, Tim Lehmann, Tobias1983, Tobiwae, Tohma,<br />
Tommy Kellas, TommyK, Umweltschützen, Ureinwohner, Uwe W., Vandango, WAH, WIKIdesigner, Wst, Xerxes2k, Zaccarias, 127 anonyme Bearbeitungen<br />
YouTube Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78709207 Bearbeiter: $traight-$hoota, 123Jon4, 3122WIKI, 790, A Ruprecht, A1bi, Abe Lincoln, Abu-Dun, Aidschie, Aka, Akor,<br />
Alnor Nick, Amgon, Andibrunt, AndreR, Andreas 06, Andreashgw, Andreasklug, Andànor, Arii Samsonov, Aschmidt, Atebbai, Atompilz, Avoided, Axel Wagner, BWMOD2, Baumfreund-FFM,<br />
Bbommel, Bertiroth, Bitsandbytes, BjoernF, Blubbalutsch, BluppFlash, Bob Andrews, Boersianerin, Boonekamp, Borisbaran, Bugert, Bunker, Bücherwürmlein, C-M, CK-Manu, Cactus007, Carl<br />
Steinbeißer, Cesarpe, Cherubino, Chigliak, Chpfeiffer, Chrisahn, Chucksen, Church of emacs, Cirdan, Claaser, Coaster J, Codeispoetry, Colobje, Conny, Cottbus, Cschultzzz, D, DanM, Darklock,<br />
Darkone, Dauerbaustelle, Defchris, DerAndre, Dha, Diba, Digedag1234, Discostu, Doc Sleeve, Dodo von den Bergen, DoktorZink, Dr. Crisp, DrLee, Dreftis, EMatt, Eagleeye2222, Ebuah667,<br />
Echolot, Edgar8, Editor 1, Electronicsports.eu, Emh Edt Inlvakao, Emkaer, Engie, Ervog, Eschenmoser, Euku, Euphoriceyes, F30, Fabthegap, Falke93, Fatma G., Felix Stember, Felixkamer,<br />
FiatLUX, Fjellen, Flo 1, Florian Adler, Frankyboy09, FredericII, Friedemann Lindenthal, Frumpy, GLGermann, Gabbahead., Gameboys, Games4fun, Gamsbart, Gartenflo, Geos, Geräusch,<br />
Giftmischer, Gnu1742, GoldenCinnamon, Gosu, Grim.fandango, Gromobir, Guidod, Gustavf, Haeber, Hamburger-Wiki-Styler, Hasannovic, Haseluenne, Hasitschka, Hauner, Hebbet, Hedwig in<br />
Washington, Heierlon, Heilswegler, Henry91, Henryf, Hermannthomas, Hitch, Hoax42, Howwi, HugoRune, Hukukçu, Hüning, Ilion, Imzadi, Initrc, Ionenweaper, Iq1000, Itu, J-PG, JD,<br />
JFKCom, <strong>Jan</strong> van der Loos, <strong>Jan</strong>AR, <strong>Jan</strong>tleman, Jayfrog, Jergen, Jobu0101, Joeb07, John-vogel, Johnny Yen, Josh135, JuergenL, Jörg Wiesehöfer, KWa, Kaisersoft, Karl.Kirst, Kauan, Kh80,<br />
Kickof, King Milka, Klotzig, Koerpertraining, Komischn, Konstantin Zwirlein, Krawi, Krischan111, Krisi12345, Kriskra, Kungfuman, Körnerbrötchen, LKD, LUZIFER, LabFox, Leeeroy,<br />
Legohaus, LeroyPetig, Lichtkind, Linus Pogo, Linveggie, Lirum Larum, MB-one, MBq, MMSwa02, Ma1043, Maedsie, MannMaus, Manni88, Marcus Cyron, Marilyn.hanson, Mark192, Markus<br />
Schweiß, Martin Wantke, Martin-vogel, MartinC, Marvolo, Matt1971, Matz91, Maus-78, Mavimi, Max4288, Maximeex, Mdxxx, Mehrleisealslaut, Metalhead64, MichaelFrey, Michi.bo, Mikano,<br />
Mino, Mister Mex, Mistmano, Mnh, Montezuma, Musicsciencer, NCC1291, Nassauer27, Nebaon, Nemissimo, Nicadapa, Nicor, Nik238, Nils-Hero, Nintendere, Nobidick, Nolispanmo, Norro,<br />
Numbo3, Nyks, Oberflussmeister, Old Man, One-eyed pirate, Onee, PIGSgrame, Pascal Herbert, Paskal T., Patricks Wiki, Paunaro, Peter200, Peterschink, Pfalzfrank, Philausmtal, PhilipW,<br />
Philipendula, Pietz, Pikachu, Pikarl, Pinchorrero, Pionic, Polarlys, Porter2005, Projekt-Till, PsY.cHo, Quarte, RAMI, Ratzer, Raymond83, Red Grasshopper, Redfrettchen, Reissdorf, Revolus,<br />
Rewireable, Rolf H., Rowland, Rr2000, Rudolph der Große, Rusti, Ryumaou, S1, SW4ever, Satmap, Sauropode, Schmiddtchen, SchwarzerKrauser, Schwijker, Schüler93, Sciptor, Sedago,<br />
Seewolf, Sefki, Seminal, Septembermorgen, Sezer11, Siebzehnwolkenfrei, Snafu2k, Socob, Southpark, Speck-Made, Spekulatius2410, Staro1, SteBo, Stell, Stern, Stipriaan, Supereditor, Sven.B,<br />
Sypholux, Syrcro, T H, THOMAS, Talaris, Technosenior, Texec, ThE cRaCkEr, The age, The real Marcoman, The<strong>Jan</strong>itor, ThePeritus, Theclaw, Thorbjoern, Thyll, Tilla, Tobias1983, Tomen,<br />
Toter Alter Mann, Tw86, Twili, Umweltschützen, VCSEL, VanRaz, VierFünfZwei, VincentBrems, Vreekz, W!B:, WIKImaniac, Weerth, Wiegels, Wildfeuer, Willmaster, Windharp, Wmnnd,<br />
Wolfwende, WurmWEB, XT3000, Xeo, Xeph, Yokel, Yülli, Zaibatsu, Zaphiro, Zweinuller, Ĝù, Αζ, 188 anonyme Bearbeitungen<br />
Wiki Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78218139 Bearbeiter: 08-15, 790, A.Rhein, AHZ, APPER, Acf, Achim Raschka, Achimbode, Addy-Mania, Ahandrich, Aka, Akl,<br />
Alaffa, Alex1011, Alien4, Amano1, Apulix, Arcy, Ariro, Asb, Average Man, BD, Baaderst, BalY, Balbor T'han, Balthazzar, Basil75, Bbommel, Bdk, Benedikt, Bernd vom Kasten, Beyer,<br />
Binningench1, Bpascal, Bundesrowdyplik Doitsland, Bur, Bynk, C-Lover, Capaci34, Carbenium, Casimir, ChWolff, Chaddy, Chef, Cholo Aleman, Christian Günther, Christian List, Christian<br />
Storm, Christian2003, ChristophDemmer, Chrkl, Ciciban, ClMueller, Clanget, Colman, Conversion script, CorneliusWasmund, Crazy1880, CroMagnon, Crux, Cujo301, Cuthbert, CyborgMax,<br />
D, Daniel Paul Schreber, Danny243, David Rohr, Dawn, DennisWWU, Der kleine Bär, Der.Traeumer, DerSchim, Derwaldrandfoerster eng, Digitus, Diskostu, Duschgeldrache2, Edoe, Ein<br />
bißchen Spaß muss sein, El, ElRaki, Elian, Eloquence, Elya, Emma7stern, EnterpriseWiki, Enyavar, EoNy, Erzbischof, Esra84, FEXX, Factumquintus, Federi, Felix Stember, Felix-freiberger, Fh,<br />
Filzstift, Fkkportal, Flame99, Flominator, Flothi, Formatierungshilfe, Forrester, Frank Jacobsen, Frank Schulenburg, Fristu, FritzG, Fuzzy, GMH, Galadh, Gar Niemand, Giftmischer, Gormo,<br />
Gross bellmann, Guety, HAL Neuntausend, HBR, Haberlon, HaeB, Hansele, Hauke Löffler, He3nry, Head, HeavyMonsterFisch, Hildegund, Himuralibima, HoHun, Hoseache, Ice Boy Tell, IdS,<br />
Igelball, Igge, Ilja Lorek, Ing. Schröder Walter, Interpretix, Invisigoth67, Ireas, Jackson, Jailbird, JakobVoss, <strong>Jan</strong>Fader, Jens Lang, JensBaitinger, Jergen, Jmsanta, Jobu0101, Joeboy, Johannes<br />
Becker, JohannesPonader, Joho345, JonasA, Jonelo, JuergenL, Juesch, Julian, Jwnabd, Jürgen Engel, KWa, Kalli R, Kam Solusar, Karl Gruber, Karl-Henner, Kataniza, Kawana, Kdkeller,<br />
Kingpez, Kissaki, Kku, Klever, Knopfkind, Konstantinopel, Kosh, Kpjas, Kpwessel, Kris Kaiser, Kristjan, Kronf, Kuebi, Kuroi-ryu, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Lady Whistler, Lambo, Lamento5, Langec,<br />
Lax, Leonardodavinci22, Lerten, Lichtkind, Littl, Lukian, Lunochod, Lupino, Lupussy, Lustiger seth, Lyzzy, Löschfix, MBq, Magnus, Magnus Manske, Maha, Manecke, Marilyn.hanson, Markus<br />
Mueller, MarkusHagenlocher, Marlowe, Martin Aggel, Martin-D1, Martin-vogel, Martinroell, Matt1971, Matt314, MatthiasRauer, MattisManzel, Mbdortmund, Mef.ellingen, Melancholie,<br />
Merlissimo, Mh26, MichaelDiederich, MichaelKoch, Michail, Micwil, Mik81, Mikue, Milvus, Mkogler, Mnh, Monade, Monemone, Moskaliuk, Mravinszky, Nd, Neg, Neptune, Nerd, Neuer<br />
Gelber, Nick Rivers, Nicor, Nikkis, Nikolaus, Nilsk, Nocturne, Noddy93, NullPlan, Numbo3, Nyks, Oki, Okipage8p, Olenz, Owltom, P. Birken, PatriceNeff, Paul Ebermann, Pcgod, Peacemaker,<br />
Peter200, Philipendula, Phlow.net, Phu, PiLu, Picard16, Pill, Pischdi, Pistazienfresser, Pit, Pittimann, Plasmagunman, Playmobilonhishorse, Polluks, Primus von Quack, Professor Einstein, Psyxx,<br />
Pyrdracon, Quirin, Ra1dN, Rainer Bielefeld, RajHid, RalfZosel, Ranunculus, Ratatosk, Raven, Rdb, Rdl-vision, Regi51, Reinhard Kraasch, Revvar, RobertRoggenbuck, Roland2, Royalsolo,<br />
SK-Genius, STBR, Sa-se, Saethwr, Samuel Ja, Sansculotte, Schaengel89, Schewek, Schlonz, Schlurcher, Schnargel, Schneidermanfred, Seabass, Sebastian, Sebastian.Dietrich, Sechmet, Seewolf,<br />
Showmaster, Sicherlich, Sikilai, Silberchen, Sirgoofy, Skyman gozilla, Skyrun, Slimcase, Sockenpuppe 15 from outer space, Solphusion, SonniWP2, Southpark, Speck-Made, Srbauer, Srittau,<br />
Stekin-rain, StephanKetz, Stern, StillesGrinsen, Stubaileh, Subbuteo, Swacker, Swing, Systems2005, TMg, Tamelt, Taschenrechner, Terabyte, TheK, Therapiekind, Thomas Klein, Thomas<br />
Tunsch, Thommess, Tilla, TimoPM, Tirkon, Tjö, Tobi B., Toblu, TomK32, Towih, Trellerlouis, Tsor, Tuvix, Tuxerado, Tuxman, Uebel, Ulrich.fuchs, Umherirrender, Umweltschützen, Uncopy,<br />
Unscheinbar, Unukorno, Urbanus, Ute Erb, Uwe Gille, Uwe Hermann, Video2005, VincentVanGogh, Vinci, Vodimivado, Vulture, W-C, Wadis, WiESi, WikiNick, Wikieditoroftoday, Wikinaut,<br />
Wikipeditor, Wikitoni, Willy9785254, Wimpernschlag, Windharp, Wissling, Wolfgang1018, Wondigoma, Wumpus3000, Wurblzap, Xario, XenonX3, Xeph, YMS, Ychri, YourEyesOnly,<br />
Zaphiro, Zapyon, Zeno Gantner, Zenon, Zeus, ZicheFan, Zoidberg, \ldblquote, ^^, pD9EB7488.dip.t-dialin.net, 845 anonyme Bearbeitungen
Quellen und Bearbeiter der Artikel 376<br />
Hypertext Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77584543 Bearbeiter: Achim Raschka, Acky69, Agramonte, Aka, Androl, Andrsvoss, Apulix, Asb, Axel Kittenberger, Baird's<br />
Tapir, Balbor T'han, Bbommel, Ben-Zin, Bernd vdB, Cherubino, Christian List, ChristophDemmer, Conversion script, D, Dasidu, DerHexer, DerSchnüffler, Diba, Dominik Kuropka, Don<br />
Magnifico, Elya, Flo 1, Fritz, Gerbil, Groucho M, Guido Watermann, HaeB, Head, Heidas, Hubertl, Hutzel-Hugo, Igelball, Infotopia, JakobVoss, Jperl, JuergenL, Kam Solusar, Karl-Henner,<br />
Knopfkind, Krawi, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Langec, Lars Trebing, Lirum Larum, Livani, Lustiger seth, Löschfix, Magnus Manske, Matthäus Wander, Mbdortmund, Mikue, Minotauros, Mnh, Molily,<br />
Mudd1, Nol Aders, Nolispanmo, Nxxos, Partonopier, Pato-logic, Pendulin, Peter200, Phrood, Qhx, Qunst, RalfZosel, Rolf Todesco, S1, STBR, Salocin, Schlesinger, Schorschski, Sechmet,<br />
Semper, Shamrock7, Shaun72, Sinn, Skriptor, Stefan64, Tali, Tamas Szabo, ThT, ThePeritus, Thomas Tunsch, Thomassk, Tilo, Tim Pritlove, TomK32, Tönjes, Ulli Purwin, Ulm,<br />
VerwaisterArtikel, Wb2000, WiESi, Wikifantexter, WikipediaMaster, Wikitoni, Wiky, Wildtierreservat, WissensDürster, Yodokus, Zeno Gantner, Zenon, Ziko, Zumbo,<br />
p3E9D33A5.dip.t-dialin.net, 152 anonyme Bearbeitungen<br />
Posting Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65036534 Bearbeiter: Aka, Andy E, ChristophDemmer, Conny, Cotchobee, Florian Adler, Fomafix, Harmonica, LabFox, MFM,<br />
Mikue, Misan12, Mjchael, My, PeterFrankfurt, Peterlustig, Smial, Trublu, Urs, Weede, Y10K, 10 anonyme Bearbeitungen<br />
Instant Messaging Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77760734 Bearbeiter: 04Regan, 1-1111, Achim Raschka, Aka, Andre Engels, Ari, Arntantin, Atx512, Avoided, Barbara<br />
Grün, Bdk, Ben-Zin, Bernardissimo, Beyer, Blah, Bling Bling, Buergi, C-M, Chpfeiffer, Cirdan, Cmi, CommonsDelinker, Conversion script, Counter-part, Crux, D, D0ktorz, DEr devil, DWay,<br />
Daaavid, Dalamma, Defox, Der-Rob, Derkilian, Dermartn, DestroyerHero, Diddi, Doroli, Druffeler, Dyne, Edmund Mielach, Ehtron, Elasto, Emes, Ephraim33, ErikDunsing, ErnestoZERO,<br />
FGodard, Faux, Fluke667, Fomafix, Frank Murmann, Frederik.kunz, Friedels, GREDSC, Gildemax, GillianAnderson, Gluon, Google, Guandalug, Gulli, HGSB, Head, Hendric Stattmann,<br />
Hetchy, Hhdw, Hhielscher, Igge, Inte, J-PG, J. 'mach' wust, JUDGE, Jarling, John Doe, Joni2, Jpkoester1, Jpp, Jsuelwald, Julika-chan, K@rl, KAMiKAZOW, Kappert, Karl-Henner, Kdwnv,<br />
Keil, Kgfleischmann, Kixx, Kku, Klaus Jesper, Klever, KraRalle, Kristjan, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LarynX, Lehmi, Liebeskind, Lycrazius, MaKoLine, Maestro alubia, Magnus, MarianSigler,<br />
MarkusKnittig, Martin-vogel, Matthäus Wander, <strong>Media</strong> lib, Meph666, MetalSnake, MichiK, Mihawk90, Mikegr, Mnh, Mr. Anderson, Mstenz, Muin gelir, Musik-chris, Nbx2001, Netguru,<br />
Noname199, Orkenspalter, Ot, Overbenny, Owltom, PSYCloned Area, Patrick Hanft, PeeCee, Pendulin, Philipp Gruber, Phoque, Pietz, Pill, Polarlys, Qlined, Quafzi, Quirin, RanuKanu,<br />
Raphaelrojas, Rax, RealLink, Regi51, Robby.is.on, Robin Goblin, Rototom, Rs newhouse, S.lukas, Sagitario, Salitos, Scavenger86, Schlurcher, Schnelliboy, Shakademus, Sheilaaa, Sinn,<br />
Slipstream, Staubi, SteBo, Steffen Kaufmann, SymlynX, ThePeritus, Tibi, Tilla, Tom.stein, TomK32, Trustable, Tsor, Tsui, Unterstrichmoepunterstrich, Unukorno, Uwe Gille, VektoRX,<br />
Verwüstung, Voyager, Wst, Würfel, Xorx77, Xypher, Zbik, Zxb, °, Ĝù, 460 anonyme Bearbeitungen<br />
Chat Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78802987 Bearbeiter: --=Titanus=--, 192,168,0,1, 790, A Ruprecht, ABF, AN, AV, Abe Lincoln, Achim Raschka, Admean, Aka,<br />
Alauda, Andre Engels, Anneke Wolf, AntjeBrunner, Avoided, Axel.ehlers, Azazel93, Balû, Bdk, Benny der 1., Beyer, Bierdimpfl, Bitsandbytes, Blah, BuSchu, Bzzz, Caliga, Capaci34, Chatkids,<br />
Cherilyn, Cherubino, Chotaire, ChrisHamburg, Christoph Thieme, ChristophDemmer, Church of emacs, Codeispoetry, Complex, Conversion script, Coroico, Cultos, D, DaB., Daffman, DasBee,<br />
Dekar, Der.Traeumer, DerHexer, Derfeu, Dhvh, Diba, Diddi, Dodo von den Bergen, Don Magnifico, Dr. 91.41, Dundak, Dyne, Elta, Emes, Energy1031, Engie, Entlinkt, Erik Warmelink,<br />
Euphoriceyes, Eva Platten, F.Bulla, Fomafix, Forevermore, FritzG, Fullhouse, Gereon K., Gestumblindi, Gilliamjf, Ginomorion, Gorgo, Gromobir, Gross bellmann, Guido Steenkamp, Gulp,<br />
HaeB, Haize, He3nry, Head, Hemmi93, Hildegund, HsT, Hubertl, HurwiczRocks, Hydro, Inte, J. 'mach' wust, JakobVoss, <strong>Jan</strong> eissfeldt, Jed, Jivee Blau, Joachim aka Destiny, Jonathan Hornung,<br />
Joni2, KL47, Kam Solusar, Karkazon, Katimpe, Kh80, Kirschblut, Kku, Klever, Krawi, Kubrick, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, LabFox, Learny, Legohaus, Leider, Lirum Larum, Louie, LucaLuca, M.L,<br />
MAK, Magnummandel, Magnus, Magnus Manske, Marcel-Patrick, Markuja, Martin Aggel, Martin Bahmann, Martin-vogel, Matt1971, Matzematik, Medi-Ritter, Melancholie, Metaxa, MiND,<br />
Michael Micklei, MichaelDiederich, Mifrank, Miriel, Mnh, Mstenz, Musik-chris, Nahadriel, Nd, Neustradamus, NiTenIchiRyu, Nockel12, Nogideck, Norro, O-fey, Odeesi, Odin, Oktaeder,<br />
Peter200, Petersoft, Pfandflaschensammlerfreiheitskämpfer, Philipendula, Pjacobi, Quincunx, Qwqchris, Raffo32, RainerB., Rapober, Raymond, Rechtsberatung, Regi51, Remi, Revvar,<br />
RicardoSSB, Rob Irgendwer, RoswithaC, Roxi, S1, SDB, STBR, Saethwr, Sallynase, Schewek, Schlurcher, Scooter, Sd5, SebastianWilken, Semper, Sgop, Shairon, Sicherlich, Sinn, Sinnlosalex,<br />
Southpark, Spectrum, Springfeld, Srbauer, Stefan h, Stefan64, StefanRybo, Steffen, Strauch, Stw, Sundance Raphael, Svenchen 115, SymlynX, Terabyte, Testen, ThePeritus, TheTacker, Thogo,<br />
Tobias K., TomK32, Tsor, Tönjes, Umweltschützen, Ungebeten, Unukorno, Uwe Gille, Video2005, W!B:, WAH, Wingthom, WissensDürster, Witobias, Wolfgang1018, Wolle1024, YMS,<br />
YourEyesOnly, Zaburaska, Zaibatsu, Zaphiro, Zeithase, ZelleAP, Zio, Zoid, Zor2112, Zorrolero, 357 anonyme Bearbeitungen<br />
Streaming <strong>Media</strong> Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78540284 Bearbeiter: 1893prozentiger, A Ruprecht, Aka, Andek, Anmeldenamenloser, Anneke Wolf, Asb, Badman026,<br />
Baschtler, Bpewien, BrainmanJM, Captain Crunch, Carminox, Carmol7, Cepheiden, Chillvie, Chris2000SP, ChrisiPK, Complex, D, DasBee, Der.Traeumer, Don Magnifico, Ela-luca,<br />
Erdhummel, Fenice, Ferrydun, Fomafix, Goldi666666, Gonzosft, Gromobir, Hasitschka, Hermannthomas, Kai-Hendrik, Kallistratos, Karsten88, Kergi, Kku, Klaus Eifert, Kolja21, Krawi, LKD,<br />
Leider, Linum, Little-devil, Marcuse7, Matthäus Wander, Merlissimo, Morki, Mps, NiTenIchiRyu, Nolispanmo, Notlandung, Oneiros, Overdose, Paddy, PerfektesChaos, Peter200, Phobie,<br />
Poke770, Qhx, Qopep, Raoul4, Regi51, Rischmueller, Roest, Schaengel, Self, Semper, Siehe-auch-Löscher, Sloyment, Sonnenblumen, Stadtmaus0815, Stalefish, Staro1, Stefan Kühn, Stern,<br />
THamTHon, Taivo, ThomasBRuecker, TomK32, Tomte, Trustable, Verwüstung, Vinci, W!B:, WhiteKnight, YMS, Z1tsti, Zuckerberg, 215 anonyme Bearbeitungen<br />
RSS Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78871685 Bearbeiter: A-giâu, AHZ, Abzt, Adrian.aulbach, Aka, Alexander.stohr, Andre76, Andreas 06, Andys, Armin P., Authentic,<br />
Avatar, Avoided, BKSlink, BSI, Babeuf, Balumir, Bdk, Benzen, Bernard Ladenthin, Bernd vdB, Bierfaß, Blar, Bmcompufreak, Bpasero, Cherubino, ChrisHamburg, Cliffhanger,<br />
CommonsDelinker, Complex, Curtis Newton, D, DWay, Daaavid, Darkking3, Dave81, Deckname, Der Rabe Ralf, Derwatz, Dfdsjumbo, DiabolicDevilX, Diba, Dpesek, Echterhoff, Edoe,<br />
Einmaliger, ElRaki, Empro2, Engie, Enomil, Enzyklofant, Erdhummel, ErhardRainer, Flominator, Florian Adler, Flynx, Fomafix, Fuenfundachtzig, GNosis, Gwitto, Hadhuey, HaeB, Hafenbar,<br />
Halbarath, Hanssmann, Hardenacke, Head, Helmut Hahn, Helmut Zenz, Hendrik Brummermann, Himuralibima, Hofres, Hubertl, IAsterix, ISBN, Interactive, Isotherm, ItsMe, Itu, J.Ammon,<br />
J.C.K., JAF, JFKCom, Jack (tR), JakobVoss, <strong>Jan</strong>neman, <strong>Jan</strong>urah, Jbuechler, Jelko Arnds, Jergen, Jivee Blau, Jmsanta, Johanna R., JonnyJD, Jplie, Jpp, Jungpionier, Kai Wasserbäch,<br />
Kaneiderdaniel, Karl-Henner, Karsten Busch, Kedmanee, Kku, Klapper, KnoedelDealer, Krd, Krza, Kuli, Lambo, Langec, Langläufer, Lateiner, Lenny222, LostTime, MGla, Magnummandel,<br />
Manducus, Manu b, MarkusKnittig, Martin-vogel, Martinroell, MasterEvil, Matt1971, Matthäus Wander, Maxb88, Mega, Meph666, Michail, Mip, Mnh, Molily, Moros, MovGP0, Mps, Nadira Al<br />
Schabah, Nandinho, Napa, Ncnever, Netspy, NonScolae, Norro, Ocrho, Odino, Oliver Hisecke, Oscar Woodruff, Ostsee, PIGSgrame, Pehaa, Perlentaucher, Perrak, Philipendula, Philipp<br />
Grunwald, Philipp Wetzlar, PhilippWeissenbacher, Pi, Pittimann, Polluks, PromoMasters, Querverplänkler, Qwertzfreude, Ra'ike, Ri st, Rion76, Robb, RobertLechner, Rumbero, Rydel, S.K.,<br />
Sargoth, Sascha wagner, Schildie, Schwijker, Seewolf, Semper, Seth Cohen, Setrok, Sig11, Sinn, Snert, Sparti, StYxXx, Staro1, Stefan, Stefan Hintz, Stefan Schärli, StephanMosel, Stern,<br />
Stuetze9, Suchhund, Supaari, Swalter, T H, TMg, Talaris, ThePeritus, Theonlyandy, ThoMo7.2, Thomas Witt, ThomasGigold, ThomasMielke, Timk70, Tolentino, TomK32, Tribble, Triotex,<br />
Trustable, Tschild, Ttbya, Tuxi81, Tönjes, Udl-intermedia, Umherirrender, Uwe Gille, VanGore, Vincent.bloch, Volker E., WAH, WeißNix, Wiegels, Wikinaut, Wolfgang H., Wolfgang1018,<br />
X-Weinzar, YourEyesOnly, Zaphiro, Zollernalb, Zxb, 541 anonyme Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> Tagging Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75121265 Bearbeiter: Alaman, Ariro, Bernburgerin, Björn Bornhöft, Captaingrog, Cherubino, Christian Günther,<br />
Christian2003, ChristophDemmer, Dickbauch, Digitus, Doc z, Dodo von den Bergen, Electrocat, Feliz, Frank C. Müller, Grille Chompa, Guido Watermann, Helge.at, Historiograf, Hybscher,<br />
JakobVoss, Jarekadam, Jesusfreund, JohnnyB, Kku, Kossatsch, Lirum Larum, LonelyPixel, Loopkid, Martinroell, Meph666, Minbo, N3MO, Norro, Npool, Peter200, Qk, SebastianRueckoldt,<br />
Siebzehnwolkenfrei, Simanowski, Solphusion, Stefan64, Subfader, Sweets, Timwi, U9612as, Uwe Gille, Vigilius, Wulf R. Halbach, Zinnmann, Zvpunry, 59 anonyme Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> Bookmarks Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78059198 Bearbeiter: 2bms, Aka, AndreasFahrrad, Aschmidt, Avatar, Aykie, B. Wolterding, B0b, Baynado, Bernard<br />
Ladenthin, Bivinz, BuSchu, Chesk, ChristophDemmer, Curtis Newton, DasBee, Der funker, Derfu, Diogenes in der Tonne, Doc z, Elchjagd, Elektronenhirn, Engie, Eric42, Flominator, Florian<br />
Adler, Flotsam, Friedemann Lindenthal, Ghoraidh, Grimlock, Hannah Wehmeyer, HardDisk, Herrick, Himuralibima, Hodihu, Hosim, Hubertl, IDTK, Indexpage, JakobVoss, JuTa, Kkretsch,<br />
Kledy, Kleinereumel, Kossatsch, Krawi, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, Labuschin, Manecke, Martin Bahmann, Master-davinci, Mhth, Michbona, Micruso, Mightymike1978, Millbart, Mnh, Mr.easht,<br />
Neontrauma, Nicolas G., Niemeyerstein, Nolispanmo, OecherAlemanne, Onee, Otterstedt, Patrick.trettenbrein, PeeCee, Peter200, Pittimann, Poeloq, Polarlys, Querverplänkler, Radh, Regi51,<br />
Reisi1990, RoodyAlien, Rufus46, Sascha Kraska, Sbrams, Schandolf, Schwalbe, Sergant, SilP, Ska13351, Stern, Stine, Stoppt-bürokratie, Telgorn2061, Thestan, ThorstenO, Uebel, Uimp,<br />
Ulkomaalainen, Wiegels, Wilhelm Bergner, Windharp, Wolfgang1018, Zaungast, 228 anonyme Bearbeitungen<br />
Cloud Computing Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78818397 Bearbeiter: Achimew, Aka, Andys, Anneke Wolf, AquariaNR, Aschmidt, Azimut, Bantak, Bautsch,<br />
Bitsandbytes, Blumo, Buntfalke, Carewiki, Carolyn67, Ceburider, David Mörike, Density, Dick Tracy, Doc z, E2B, Eco30, Ekuah, Ephraim33, Fahnder99, Feder und Schwert, Feliz, Fischkopp,<br />
Flash1984, Florescu, Florian Adler, Friedrichheinz, Fritz Jörn, Frz, Fxb, GS, Gamgee, Grochim, Guandalug, Gut informiert, Hydro, Itebob, Jkbw, Jkirschbaum, Jpp, Kerbel, Khen, Kingsvillager,<br />
Kku, Klaus19, Kobschaetzki, Konrad F., Krd, Kurt <strong>Jan</strong>sson, MFM, MacSmith, Maddylliieeee, MatthiasRauer, Mcflashgordon, Meffo, Michael Reschke, Michelvoss, Mikano, Milvus,<br />
Minderbinder, Nevercold, Nmoas, Pascal64, PeeCee, Phileuk, PinguX, RadioStar12, RedWyverex, Robertsan, Sacerd01, Schmitty, Scub3, Sebbl2go, Silverstar99, Smitty, Solphusion,<br />
Speifensender, Spunki69, Supaari, Tasma3197, Teefxiwlana, Texteuse, TheJH, Theonly1, Tomreplay, Tonk, TorPedo, Trienchen, Tuhl, Urs.Waefler, WIKIdesigner, XZise, Xario, 114 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
Mashup (Internet) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78088349 Bearbeiter: AnselmP, Ariro, BLueFiSH.as, Bernard Ladenthin, Bitsandbytes, Brauwauhaumau, Chotaire,<br />
Corrigo, DasBee, Diba, Euphoriceyes, Flash1984, Flominator, Frakturfreund, He3nry, Hhdw1, Hubertl, Hystrix, JakobVoss, JohnnyB, Joli Tambour, Kai-Hendrik, Krawi, Leonidobusch, Lxp,<br />
MissParker, Noddy93, Osch, Parzi, PeeCee, Sanfamedia, Srbauer, THWZ, Temporäres Interesse, Terrapop, Thobach, Till.niermann, Trublu, Tschach, Tönjes, Uncopy, WAH, Wiegels, Zoerbnet,<br />
83 anonyme Bearbeitungen<br />
Kollaboratives Schreiben Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78873416 Bearbeiter: Alexander Warta, Androl, Ar291, Ardo Beltz, Ariro, ArtMechanic, Avron, Bmcompufreak,<br />
Callidior, Carl Steinbeißer, Christian Storm, DasBee, Eike sauer, Erkan Yilmaz, Eschenmoser, Felbion, Franz002, Gesichts;-)kontrolle, Guido Watermann, Herr Lampe, Hozro, JakobVoss,<br />
JensKohl, Jón, Karl.Kirst, Laudrin, Lonewolf81, Markus Pfeil, Max Leo Apel, Mongole, Nothere, Oberchecker, Pgassner, Philipp Kern, Platte, Sabbue, Sheimberger, Sobeky, Spischot,<br />
Supermartl, Tobhaeg, Tobias.Vogel, Tomattac, Volunteer, Wolfgang1018, 36 anonyme Bearbeitungen
Quellen und Bearbeiter der Artikel 377<br />
High Speed Downlink Packet Access Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77965620 Bearbeiter: 3de, Abena, Aloiswuest, Androl, Asdert, Avatar, Blaubahn, Bmsonline,<br />
Bodoppels, Christianrueger, Clemens Alexander Schulz, Coaster J, Daniel MS, Dealerofsalvation, Devil86, Dick Tracy, Dickbauch, Dimelina, Dreiundvierzig, Drizzd, FEXX, Flea, Fruli, GGraf,<br />
Ghoraidh, Giles gs, HaeB, Hicks21, Hubertl, Hugo75, JoBa2282, Jodo, Jofleck, Johatho, JuTa, Juliabackhausen, Jörg-Peter Wagner, Kivi, Koerpertraining, Kollyn, Krd, Kurmis, Kwbolte,<br />
Lemmermen, Lhoppelhase, Libro, Lx, McB, Mhohner, Micham6, Migra, Monsterxxl, NauarchLysander, Nolispanmo, OecherAlemanne, Operator576, Osch, PeeCee, Pemu, Pessottino, Plp,<br />
Polluks, Qfreak, R.Hainberg, Rr2000, S-Man42, SGAbi2007, Sankyo, Sarina81, Sebman81, Section6, Silvestre Zabala, Sinn, Snevern, Speakers, Stefan Kühn, Stephan1982, Succu, Sunks, Taube<br />
Nuss, TheWolf, ThiloHarich, Timbim, Uweschwoebel, Wdwd, WikiNick, Yoghurt, Zefrian, 131 anonyme Bearbeitungen<br />
Global Positioning System Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78728151 Bearbeiter: 7645, A-Jim, APPER, Abutoum, Acf, Achim Raschka, Aka, AlexR, AlexanderFrühwald,<br />
Allesmüller, Aloismaierl, Aloiswuest, Alpentunnel, Alvaro, Ameins, Anaximander, Andrea74, Andreas -horn- Hornig, AndreasFahrrad, AndreasH, Andreasklug, Anitagraser, Arcturus, Arcy,<br />
Arved, Asdert, AssetBurned, AviationExpert, Avoided, Avron, Azaël, BJ Axel, BSI, Bahnmoeller, Baird's Tapir, Balz, Balû, Basmu, Beckerfrederik, Bello, Berklas, Bernd.Brincken, Berthold<br />
Werner, Biezl, Bigbug21, Blue Sky, Bonanza, Braegel, Bricktop1, Bumbulski, C.Löser, Calrosfking, Captain Crunch, Carolin, Cepheiden, Cherubino, Cholera, Chrisbenz, Christian Gawron,<br />
ChristophDemmer, Cliffhanger, Complex, CrashOverride83, Cstim, DaSch, Dachbewohner, Daniel Roth, Dantor, Dark Dragon, Density, Der Barbar, Der Messer, Der.Traeumer, Diba, Dishayloo,<br />
Don Magnifico, Dorei, Dr. Angelika Rosenberger, DrScott, Draco2111, Drahtloser, Echoray, Eehmke, Effort, Ehsc, Eintragung ins Nichts, El Dirko, El., ElRaki, Elias scharf, Entlinkt,<br />
Ephraim33, ErikDunsing, Euphoriceyes, FWG, Fedi, Felix Stember, FelixReimann, Filzstift, Fire, FlorianB, FlugTurboFan, Flyout, FordPrefect42, Fortress, FreeMustang, Freedom4all,<br />
FriedhelmW, Friedrich.Kromberg, Fristu, Fubar, Fxp, GDK, GNosis, GT1976, Garak76, Geof, Geoz, GerdKempf, Giftmischer, Gilliamjf, Gleiberg, Gnu1742, Grafkaroly, Grf, Grille Chompa,<br />
Gschuetz, Guffi, GuidoGer, Guidod, H005, HAH, HAL Neuntausend, HBR, Hafenbar, Halbarath, HalcyonDays, HardDisk, Harro von Wuff, Haya, He3nry, HeWö, Henristosch, Herr<br />
Klugbeisser, Homer Landskirty, Howwi, HugoRune, HungryHugo, HurwiczRocks, Igerm, Inschanör, Itu, Ixitixel, JHeuser, JPlenert, <strong>Jan</strong>us, Jennergruhle, Joachimkuehnel, Joeopitz,<br />
Joey-das-WBF, Jonathan Hornung, Jsgermany, JuTa, Jv, Kapege.de, Kar98, Karl-Henner, Karobube, Kassander der Minoer, Kbechtold, Keiichi, Kku, Klausklaus79, Klever, Knopfkind,<br />
Kolossos, Kommissario, Kopoltra, Krawi, Kuroi-ryu, Lalü, Langläufer, Laurenz Widhalm, Laza, Leon, Lindi44, Logan, Loscher, Lucanus, Lying8, Lzur, Löschfix, MFM, Mandavi, Mantis,<br />
Marcel601, Markus Bärlocher, Martin H., Martinli, Matthias Hake, Matthäus Wander, Matzematik, Mawa, Meister-Lampe, Membeth, Menolit, Mfranck, Mh26, MichaelDiederich, Michail,<br />
Mikue, Mistmano, Moddy, Morten Haan, Nachtigall, Napa, Naturtrunken, Neo08, Netwolle, Nico83, Norro, Nothere, Nyks, Ocrho, Oseidel, Otaku, Otets, Otto Normalverbraucher, Oxffffff,<br />
PRP1445, PSGPS, PasO, PaterMcFly, PaulT, Perrak, Peter Steinberg, Petit, Phobie, Phr, Physikr, Pi314-429, Pianojoe, Pierre gronau, Pittimann, Planetspace.de, Pmsyyz, Polarlys, Priwo,<br />
Prolineserver, Pschrey, Querverplänkler, Rafiq, Rainald62, RainerB., Rax, Realulim, Regi51, Reinhard Kraasch, René M. Kieselmann, Revolus, Rex250, Rjh, Robb, RobbyBer, Robert Kropf,<br />
RobertLechner, RokerHRO, Roland Berger, Rolz-reus, Rotkaeppchen68, Rr2000, STBR, Saibo, Schewek, Schnargel, Schulzjo, Semper, Seufert.st, Siehe-auch-Löscher, SilP, Silversurfer4u,<br />
Simplicius, Sinn, Slyfox1972, Solid State, Spawn Avatar, Srittau, Staehler, Stahlkocher, Stankov, Star Flyer, Stardado, Staro1, Steef389, Stefan Kühn, Stefan Ruehrup, Stefan h, StefanAndres,<br />
SteffenKa, Stern, Steschke, Stimpson, Stoecker, Stylor, T-o-b-y, TA, TableSitter, Tambora, Tethys, The real psycho, TheFreak, ThoKay, Thogo, Thuringius, Tim Pritlove, Tobi B., TobiasEgg,<br />
Tom.berger, Torsten Crull, TruebadiX, Tsor, Ufudu, Unscheinbar, Urgedover, Urgent necessity, Uwe Hermann, Uwe W., VWdude, Vintagesound, Wahler, Wanderprofi, Wdwd, Webbie,<br />
Wessmann.clp, WikiJourney, WikiPimpi, Wikinaut, Wisi, WodyS, Wolfgangbeyer, WonderBlood, Wschroedter, Wst, Xvlun, YellowShark, YourEyesOnly, Zeitan, Zumbo, Zuse, Ökologix, 594<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
Open Source Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76861359 Bearbeiter: 1893prozentiger, 3ecken1elfer, AHZ, Aa1bb2cc3dd4ee5, Achates, Achim Raschka, Agent-of-change,<br />
Aka, Aktions, Ambros.gleissner, Amtiss, Andre Riemann, AndreasE, Anton, Aristeides, Armin P., Arty, Arved, Asarion, Asb, Bautsch, BeEs, Ben-Zin, Ber, Bernd vdB, Bertram, Biitli,<br />
Bitteloeschen, Blaubahn, Breogan67, Brunft, Btr, Budjonny, Bundesrowdyplik Doitsland, Cassandro, Ce2, Chricho, Chrisfrenzel, Christian Günther, Ckeen, Coaster J, Complex, Cosmonaut,<br />
Cstim, Cyper, D, Daaavid, Dachris, DanielDüsentrieb, Diba, Diddi, Dishayloo, Don Magnifico, Dundak, Ecki, Eike sauer, Eins, ElRaki, Elwood j blues, Elya, Empro2, Enth'ust'eac, EricPoehlsen,<br />
ErikDunsing, Euku, Fbenkert, Felix Stember, Felixjansen, Ferrydun, Filzstift, Fire, Fkuehne, Flink spook, Forbe's, FreeOsFan, Frosty79, Fubar, FutureCrash, GNosis, Garnichtsoeinfach,<br />
Gnu1742, Guaka, Guidod, Guidos19, Hadhuey, HaeB, Haeber, Hagbard, Hans Xaver, Have, HbJ, Head, Heliogabel, Hendrik Brummermann, Herr Th., Herrick, Howwi, Hyper555, IGEL, Ifrost,<br />
Igelball, Iriedaily, J. 'mach' wust, JCBrand, <strong>Jan</strong>a Henningowa, Jayday21, Jesauer, Johanna R., Jonathan Hornung, Jonelo, Joni2, JonnyJD, Jost ammon, Jpkoester1, Jpp, Judith.lenz, Kai-Hendrik,<br />
KaiMartin, Kalamanar, Kaneiderdaniel, Karl-Henner, Kgfleischmann, Knofferba, Knopfkind, Koblaid, Krd, Kris Kaiser, Krischan111, Kristjan, Kryptolog, Kuli, Kurt <strong>Jan</strong>sson, LKD, Lalü, Ldi91,<br />
Lehmi, Lenny222, Levin, Lille, Liquidat, Logograph, Loveless, Lustiger seth, Lxg, MFM, MGla, Maha, Mario23, Markus Mueller, MarkusHagenlocher, Martin Ankerl, Martin Möller, Martin<br />
Riedel, Martin nigg com, Martin-vogel, Mathias Schindler, Matthäus Wander, Maurice, Mauro.bieg, Max Plenert, <strong>Media</strong>max, Meisterkoch, Melancholie, MichaelB., MichiWe, Mijozi, MilesTeg,<br />
Mion, Moldy, Morten Haan, Mot2, Mr. Anderson, Musik-chris, Nerd, Nico22, NilzThorbo, Not-Pierre, Nowic, Oliver Emmler, Olli42, Onee, Oreg, Oryx2233, Pacsman, Paterbrown, Pavlo<br />
Shevelo, Pendulin, Peter200, Pilosa.Folivora, Pistazienfresser, Pit, Piumpiu, Pkn, PsY.cHo, Pureschaos, Quirin, Raphael Frey, Regenbahntal, Ri st, Rosenzweig, Rsteinkampf, Rtc, S1, Sabata,<br />
Salvina, Schelle, Schily, Schlapfm, Schulzmatthias, ScotB9, Sebastian.Dietrich, Seewolf, Shefaat, SilentSurfer, Simplicius, Sinn, Sir, Small Axe, Sockenpüppchens Klonaccount, Southpark,<br />
Sprachpfleger, Starbuckzero, Stefan Kühn, Stefan-hoehn, Steffus, Stern, Stevy76, Stw, Su root, Subn, Subversiv-action, Suchenwi, Sypholux, TheK, TheWolf, Thornard, Til Lydis, Tobias Rohde,<br />
TomK32, Tony L., Trac3R, Trainspotter, Trellerlouis, Trustable, Tsor, Tuchomat, Tullius, Ubuntufan, Umaluagr, UncleOwen, Unscheinbar, Uwe Gille, Uwe Hermann, Vanger, Vanis, Vog, W<br />
like wiki, W. Edlmeier, Wasabi, WeißNix, WiESi, Windharp, Wishlist, Wolfgang H., Wurblzap, Xorx77, YMS, Yu Kei, Zaphiro, Zeno Gantner, 378 anonyme Bearbeitungen<br />
Suchmaschinenoptimierung Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78548101 Bearbeiter: AHZ, ARS, Agent00, Aka, Aktions, AlexaKatharina, Aliens, Ar291, Benatrevqre,<br />
Bernhard Mäser, Bethor, Bitsandbytes, Brenzliglöscher, Broschart, Carol.Christiansen, Christianvan11, ChristophDemmer, Clicktsde, Complex, Curtis Newton, D, DaB., Dachris, Daniel3880,<br />
Davocc, Defchris, Denkenhilft, Der.Traeumer, Doc z, Don Quichote, Duesentrieb, Eazy262, Ebcdic, Ein-uwe, ElRaki, Electrocat, Elvis untot, Enth'ust'eac, Euphoriceyes, Evr, FinnBlue,<br />
Flingeflung, Flo12, Fouad14, Friendlyclient, GNosis, Gammasche, Gnu1742, Gormo, Gretus, Guido Watermann, HaeB, Hagbard, Hans-Jürgen Hübner, Hape, Harmonica, Heinz-Erhart-Inferno,<br />
Hoffoso, Hubertl, Hufi, Hydro, Indivisual, Inza, Jamey, Jcr, Jnn95, Jobu0101, JochenK, JoergStroisch, Johannes Ries, Karl-Henner, Knweiss, Krawi, LKD, Linus-M, Malino, Manute, Martin<br />
Bahmann, MbibA, Melowtrax, Miaow Miaow, Mich, Mkubeile, Mnh, Nedem, Newsseo, NiTenIchiRyu, Nicolas G., Nolispanmo, Olschimke, Openbc, Ot, Pallando, Patrick Gajic, PeeCee, Pill,<br />
Platus, Polluks, Psyk42, Purodha, Q1712, Qualle, Quirin, RSX, Rdb, Reinhard Kraasch, Revvar, Romulus, Ronald M. F., Roterraecher, Rudibert, Seewolf, Semper, Splayn, Staro1, Stern, TCoJ,<br />
TPHH, Tafkas, Thoken, ThorstenO, Tomkyle43, Trumpf, Tsor, Ugly Kid Joe, Unscheinbar, VanGore, Wedderkop, Wiki0419, Wiska Bodo, Wortgefecht, Würzburg, Xsurf, Xxlfeuerwalze,<br />
YourEyesOnly, Ypsie, Zaphiro, Zoebby, Zumbo, 268 anonyme Bearbeitungen<br />
Breitband-Internetzugang Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78766455 Bearbeiter: Avatar, Avron, Azby, Boonekamp, C-M, Conversion script, Csee80, Dg6xu, Diba, Diddi,<br />
Die tiefe blaue See, Filzpantoffel, Fink, Flominator, Fruli, Frut, HaSee, HarmTiding, Heinte, Itu, Jkü, Jpp, JvE, KIeopatra, Karl-Henner, Kgfleischmann, Kh555, Kivi, Koerpertraining, LA2,<br />
Markus Moll, Martin-vogel, Meisterkoch, Muck31, Odin, Onee, Ot, PLauppert, Panthalassa, Pit, Pitboar, QEDquid, Quirin, Raymond, SOIR, Sinn, Speck-Made, Spuk968, Staro1, Timosch,<br />
Trustable, Ulv, Uweschwoebel, Verbund, Wega14, Wolfgang1018, YourEyesOnly, fw1-252e.ptb.de, 89 anonyme Bearbeitungen<br />
Smartphone Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78461040 Bearbeiter: AHZ, Accountalive, Agadez, Aicer, Aka, AlexanderG, Alexzop, Andi777, Andreas 06, AndreasFahrrad,<br />
AnnaMobil, AntiBMH, Arnulf zu Linden, Atikos, Avoided, Azimut, BLueFiSH.as, Benatrevqre, BorisHB, Broli, Buster Baxter, C-we, Coaster J, CommonsDelinker, Darklordjr8, DasBee, Doc z,<br />
Dr. Pepper, DrSeehas, Druckwelle, Electrocat, Engie, Englischer Limonen-Harald, Euku, EvaK, Falense, Flattervieh, Florian Adler, Fomafix, Froggy, GLGerman, Galadh, Geos, Gnu1742,<br />
Grambler1, Graypi, Guffi, Hafenarbeiter, HansMowlwurf, HansiHermann, Head, HeavyMonsterFisch, Highdelbeere, Hitch, Holgerjakobs, Hweihe, Hydro, INM, Ilion, Invisigoth67, Ishta, Jacks<br />
grinsende Rache, Jaellee, Jawbone, Jed, Jivee Blau, K41f1r, Kersolax, Klapper, Kollyn, Konrad F., Leider, Locusta, Lustiger seth, Lzur, Lönne, MB-one, MFM, Maestro alubia, Magnus,<br />
MainFrame, Manuel Funk, Marc Zimmermann, Mask, Master db, Matthäus Wander, Maye, Mef.ellingen, Menolit, Miaow Miaow, Munibert, Musik-chris, NSX-Racer, Netspy, Nopax,<br />
OecherAlemanne, Oge, Ordnung, Ot, Paul Chelariu, Paulis, Peter200, Pjp, Prolinesurfer, PsY.cHo, Qualitaetsuser, Qwertzuiopüa, Raschi, Rdb, RedBullAL600, Regi51, Reinraum, RoadsterDirk,<br />
Rs newhouse, S.lukas, Samweis, Satmap, Sebastian.Dietrich, Sebi506, Seewolf, Semperor, Siebzehnwolkenfrei, Slpeter, Stefan Bernd, Stefan Kühn, Stephan Herz, Stephan1982, Suit, SuperFLoh,<br />
The88One, TheK, Theosch, Thire, Thorbjoern, Togs, Tohma, Tolliver, Trainspotter, Trustable, Ulkomaalainen, Uwe Gille, W!B:, Weissmann, Wiegels, WikiWork, Wimmerm, Wolfgang1018,<br />
Wookie, YourEyesOnly, Z1, ¡0-8-15!, 215 anonyme Bearbeitungen<br />
WordPress Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78780979 Bearbeiter: 08-15, 3d-mediadesign, 3x3cut3r, AN, Aka, Alucardxxx, Ashiba, Atirador, Aufräumer, Avatar, Bdk,<br />
Beek100, Bernard Ladenthin, Betatester wiki, Biezl, Biktora, BlackIce, Blacky24, Blauebirke, CDrueeke, CaZeRillo, Chineseleper, Chrissitopher, Christian2003, Christoph Eichhorn, Corrino,<br />
Ctulhu, D135-1r43, Daaavid, DanielV95, Darkking3, Darth NormaN, Datenschutz2007, DiabolicDevilX, DonSalierie, Dottore E., Druffeler, Dsfranzi, Dunkelangst, Ebcdic, Emhauck,<br />
Ephraim33, EstebanFaustamente, Euku, Euphoriceyes, Farin12, Felix von Felanitx, Flominator, Fozloki, FreelancerHamburg, FrobenChristoph, Frumpy, G-Reg-24, Gabberdancer, Gge,<br />
Gigalinux, Gilliamjf, Granny Smith, Gringux, Gsälzbär, Guido Watermann, Hansele, Hugo75, Hungerhirn, Hunzelpunzel-1, IGEL, INM, <strong>Jan</strong>shi, Jimynu, Jnic, Johannes Ries, JuTa, Jörgi12345,<br />
Kai Schmidt, Karsten11, Knoerz, Kosmo100, Krd, LachendesKnie, Le petit prince, Leon, Lirum Larum, Magnummandel, Martin-vogel, <strong>Media</strong> lib, Meister-Lampe, Merderein, Michael-W,<br />
Michelvoss, MichiK, MisteR33, Mnh, Morray, Mot2, Muck31, NSX-Racer, Neils, Neontrauma, NicoHaase, Nolispanmo, Nopax, Nori, Norro, Odious, Pascal Herbert, PeeCee, Pere Ubu,<br />
Philipendula, PhilippWeissenbacher, Phlow.net, Pittimann, Pool, PsY.cHo, Purist, RacoonyRE, Ranunculus, Robert Wetzlmayr, Robin Stocker, Roland Berger, Rs2411, S.Didam, Schaetzer,<br />
Schniggendiller, Schulzenator, Seewolf, Seir, Septembermorgen, Seth Cohen, Skasdorf, Small Axe, Sonnenbrand, Sputnik, Stefan Schultz, Stefanf74, Steffen, Ster, Söan, TMg, The0bone, Tilla,<br />
Tim Lehmann, Tobbis-Blog, Tobias K., Trustable, Tuxman, Viciarg, Vlad-Perun, W. Edlmeier, Wiegels, Wiki de, Wikisearcher, ZRH, 158 anonyme Bearbeitungen<br />
Google Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78373100 Bearbeiter: *Biker*, .tom, 123Christian, 1257787, 20percent, 3122WIKI, AK Haustür, ASK, AWendt, Abu-Dun, Abubiju,<br />
Acf, Achates, Acky69, AdamSmith, Adameus23, Adlange, Agruwie, Ahellwig, Ahoerstemeier, Aka, Akribix, AleMonaco, Alexander.steffens, Aloiswuest, Alter Sockemann, Alvanx, Amtiss,<br />
Andi357, Andim, Andreas 06, Andrsvoss, Andy king50, Andyg, Anneke Wolf, Apnoist, Apolloxer, Apsomol, Armag3ddon, Armin P., AstroGK, Axarches, Azrahel, BKSlink, BLueFiSH.as,<br />
BRotondi, Bahnemann, Baird's Tapir, Bapho, Bartelmess, Bdk, BeBa123456789, Ben-Zin, Benji, Benutzernameschonvorhanden, Berlin-Jurist, Berlina, Bernard Ladenthin, Bernardissimo, Bernd<br />
Untiedt, Bernhard Wallisch, Bitsandbytes, Björn Bornhöft, Bkmzde, Blankaholm, Blaufisch, BlueGerbil, Blunt., Bonzo*, Bprinzis, Brimberry, Brion VIBBER, Buntfalke, Busted,<br />
Bücherwürmlein, C rall, C-M, C.Löser, Callidior, Camino7, Capaci34, Cardioid, Carl Steinbeißer, Carol.Christiansen, Catreaper, Caulfield, Caytchen, Cellstar, Cepheiden, Chaddy,<br />
Charlottenburger witwer, Cherubino, Chesk, ChrisHamburg, Christian H., Christian Juner, Christian Krumholz, Christian.fickinger, ChristianBier, ChristophDemmer, Church of emacs, Ckendel,
Quellen und Bearbeiter der Artikel 378<br />
Cleverboy, Coastalcitizen, Cobra 11 fan, CommonsDelinker, Complex, Conny, Conversion script, Crazylink, Crusader1, Crux, CyborgMax, D, Dachris, Dagobert2000, Daniel 1992, Dapete,<br />
Darkone, Darkweasel, DasBee, Debauchery, Dellex, Denis1992, Dennis Schröter, Der Messer, Der.Traeumer, DerHexer, DevEye, Dha, Dhanyavaada, DiRe, Diba, DivineDanteRay, Dmstromer,<br />
Dnaber, Doc z, Dodo von den Bergen, Dominationier, Domser, Don Quichote, DorisAntony, Dozor, Dr. Crisp, Duesentrieb, Dundak, Ebcdic, Edia, Eike sauer, Einmaliger, Eisbaer44, Eldred,<br />
Elian, Ellion, Elrond Mc Bong, Emdee, Emes, Emkaer, Engie, Englischer Limonen-Harald, Enth'ust'eac, Entlinkt, Ento, Ephraim33, Erebino, ErhardRainer, Erik Streb, Erki der Loony,<br />
Eschenmoser, Euku, Euphoriceyes, EvaC, EwinderKahle, ExIP, Exxu, FEXX, FVision, Faber-Castell, Factumquintus, Fadisto, Fanatickson, Farinaeurlaub, Fasan73, Faulenzius Seltenda, Fb78,<br />
Felanox, Felgentraeger, FelixReimann, Feliz, Filnik, Filzstift, Firefox13, Flashlight91, Flo 1, Floffm, Florimaexle, FlugTurboFan, Fluppens, Foerster2002, Fomafix, Fornax, Fortress, Freddy36,<br />
FreelancerHamburg, Fristu, FritzG, Frumpy, Fundriver, Fusslkopp, FutureCrash, G.hooffacker, GDK, GDSystem.de, GFJ, GLGerman, Gabbahead., Gail, Gal Buki, Geist, der stets verneint,<br />
Gensmer, Geof, Gerald Drausinger, Gerbil, Gereon K., Gflohr, GiantPanda, Giessener, Gilliamjf, GillianAnderson, Gleiberg, Gnu1742, Gohnarch, Gonzo1994, Goodmorningworld, Goreb,<br />
Gr650, Graf, Gratisaktie, Greifensee, Grim.fandango, GringoStar, Grottenolm, Gsälzbär, Guenther1977, Guety, Guido Watermann, Gulp68, Gunther, Gustavf, Gyoergi, H-j, H005, HPich,<br />
Habakuk, Haberlon, Hadhuey, HaeB, Haeber, Haize, Hannes Kuhnert, Hannes1995, HansenFlensburg, HansivomDock, Hardcore-Mike, Hardenacke, Hari, Harmonica, Haruspex, Hashar,<br />
Hausner, He3nry, Head, Heartbeaz, Hebbet, Heinrich5991, HenHei, Hendrik Brummermann, HenningB, High Contrast, Historiograf, Hofchrissi, Hofres, Holger Gruber, Horgner, Howwi, Hozro,<br />
Hubertl, Hukukçu, Hydro, IWorld, Iceman247, Ifrost, Igge, Ilja Lorek, Immanuel Giel, Ionenweaper, Ireas, Itchy & Scratchy, Item, Itu, Iwoelbern, Izidor, J C D, J Schmitt, JAF, JDavis, JFKCom,<br />
Jack Brian, Jacky13, <strong>Jan</strong>ina.peltz, <strong>Jan</strong>kammerath, <strong>Jan</strong>nis2, Jbuechler, Jcr, Jebediah42, JensM, JensMueller, Jeschu, Jesi, Jesusgeek, Jivee Blau, Jkbw, JoachimS, Job Killer, Jodoform, Joeopitz,<br />
JohannWalter, John albert, John-vogel, Jonasclemens, Jonathan Hornung, Jonavogt, Joni2, Joriki, JuergenL, Juesch, JulianMcDean, K-Style, KFlash, KGF, KKteamonline, Kai1337, Kaisersoft,<br />
Kam Solusar, Kammerjaeger, Karl-Friedrich Lenz, Karl-Henner, Karlscharbert, Karski, Kerbel, Kh80, Kiker99, Kimse, King Milka, Kku, Klever, Klugschnacker, Kmuefreeentertainment,<br />
Kolossos, Komischn, Kommissario, Kontextsensitive Werbung, Kopoltra, Korg, KoshPalmer, Krawi, Kristjan, Krtek76, Kräuter-Oliven, Kubrick, Kungfuman, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kuschelchen,<br />
KwITworks, Körnerbrötchen, LKD, LaWa, Lambdacore, Langec, Langhaarschneider, Leithian, Level plus, Levin, Lextard, Leyo, Limasign, LinveggieLÄ, Lode, Lofor, Logograph, Lohne1997,<br />
Lucky strike, Lugel, Lukas Geier, Lumpenpack, Lustiger seth, Lvqr, Löschfix, M.Marangio, MAK, MFM, MaTi, Madden, Maddinh, Magnummandel, MainFrame, Manfreeed, Manni88,<br />
Mantsch95, Manuel Bieling, Marcel.salz, Marco Schneider, Markus Mueller, MarkusWedemeyer, Marrrci, Marsupilami, Martin Bahmann, Martin Wantke, Martin-vogel, Martina Steiner,<br />
Matt1971, Matt314, Matthäus Wander, Matzu, Max games, Maxx82, Mbs, McB, <strong>Media</strong> lib, <strong>Media</strong>designer, Medienblogger, Meister-Lampe, Melancholie, Menphrad, Metalhead64, Mfb, Michael<br />
David, Michael Fichmann, Michael Rohde, Michael.bender, Michail, Mijobe, Mimeyer, Mipe, Mister redman, MisterS, Mitternacht, Mkzero, Mnh, Mo4jolo, MoePercent, Moino, Monet,<br />
Mononoke, Monsterxxl, Montego, Morten Haan, MovGP0, Mps, MrWebber, Mullinger, Munibert, NPunkt, Ncnever, Neg, Neraton, Nerd, Netspy, Neutralstandpunkt, NiTenIchiRyu, Nico<br />
Düsing, Niemot, NikP, Nikkis, NiklasP, Ninjamask, Nolispanmo, Norro, Nutzer 2206, Nöle-me, OLI-ramses, Objektivieren, Oceancetaceen, Ocrho, OecherAlemanne, Oerly, Olaf4, Olei, Ork37,<br />
Ot, Outburn, Oxymoron83, PDD, PSIplus, Pacifier, Patrick, Patrick.trettenbrein, Patricks Wiki, Peacemaker, Pendragon, Perrak, Peter200, Peter439, Peterschink, Phileasson, Philipendula,<br />
PhilippWeissenbacher, Philwiki, Phoque, Piczo, Pietz, Pill, Pionic, Pittimann, Pixelfire, Pixumilian, Platus, PlusPedia Glenn, Primula7, Priwo, Professor Einstein, PsY.cHo, Pz, Q4teX, Qpaly,<br />
Qualle, Quasimodo, Quedel, Quilbert, Quirin, R. Möws, RFIT, Ralf Roletschek, Rama, Ramgeis, Random lover, Ravn, Raymond83, Reaper35, Redf0x, Reeno, Regi51, Reinhard Kraasch, Remi,<br />
Revvar, Roentgenium111, RolWg, Roland4735, Roman009, Rr2000, Rrdd, Rtc, Rudy23, Rufus34, Ruprecht, S.Didam, S1, S3riouZ, SPS, STBR, Sadida, Sallynase, Salmi, Sam k, Sammy,<br />
Sandrino, SaschaC, Schaengel89, Scherben, Schlauer03, Schlaule, Schlechtwetter, Schmelzle, Schmiddtchen, Schnargel, Schniggendiller, Schnupf, Schomb@, Scooter, SeL, Seb80, Sebastian<br />
Wallroth, Sebastian.nohn, SebastianG, Sebbl2go, Sebi506, Seewolf, Seminal, Senzaltro, Serpens, Serv, Sesselfurzer, Seth Cohen, Sg050, Shadak, Shaevy, Shannon, Sheila's mom, Sheilanier,<br />
Shidata, Shoot the moon, ShortyAurna, Siebzehnwolkenfrei, Silberchen, Simlicker2, Singsangsung, Sir, Sir Anguilla, Sir James, SirTobey, Slimcase, Small Axe, Smdt, Smial, Snoof19, Sol, Soli,<br />
Solid State, Solphusion, SoulWind, Southpark, Sozi, Spectrums, Spuk968, Srbauer, Srittau, Stanqo, Stargate12, Startx, Starwash, Stefan, Stefan Kühn, Stefan Zwierlein, Stefan-Xp, Stefan2904,<br />
Stefan64, Stefanbcn, Stefffi, Stephan1982, StephanKetz, Stevieswebsite, Stowasser, Stummvoll, Sturmbringer, Suisui, Suit, Superbass, Sussudio, SwissAirForceSoldier, Syrcro, Sys.Bak, T-Zee,<br />
T0ast3r, Tangos, Tantalus222, The weaver, The-Digit, TheGuy, TheJH, TheK, TheWolf, Theonlytruth, Thewob, Thkperson, Thoken, Thomas Fernstein, Thomas G. Graf, ThomasMielke,<br />
Thornard, ThorstenO, Till Menke, Tilla, Tkarcher, Tobias K., Tokikake, TomK32, Tomey88, Topfklao, Toppe, Torben Schröder, Treaki, Trustable, Tröte, Tsor, Tubor2, Turkey73, Turmkater,<br />
Ultratomio, Ulz, Umweltschützen, Ungebeten, Ungebildet, Unscheinbar, Untergeek, Upim, Urs.Waefler, Uwe Hermann, Uwe Schwenker, V.R.S., Valuejoe, VanGore, Vandyrk, Viciarg,<br />
Video2005, VierFünfZwei, Vulkan, Vulture, W!B:, W. Berlin, WAH, Wanderheuschrecke 23, Webverbesserer, Wega14, Wgtranquillo, WiESi, Wiegels, Wiki Gh!, Wikinero, Wikinger77,<br />
Wikinger86, Wikip€di@, Wikiritter, Wikitom2, Wildwing, Wimmerm, Wirtschaftsberater, Wisdom, WissensDürster, Wo st 01, Wolfgang H.W., Wosabeu, Wurzeldrei, XZise, Xaano<strong>Media</strong>,<br />
Xeph, Xmax, Xocolatl, Xorx77, Xxvid, Y2kbug, YMS, Yannick2007, Youandme, YourEyesOnly, ZH2010, Zahnstein, Zaibatsu, Zaoul, Zaphiro, Zar alex, Zaungast, Zenon, Zitronenquetscher,<br />
Zollernalb, Zumbo, Zweinuller, ¡0-8-15!, Ĝù, ℜepress, 876 anonyme Bearbeitungen<br />
Apple Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78878223 Bearbeiter: 1-1111, 32bitmaschine, 486er, A1bi, A2r4e1, ADK, Aaaah, Aaron Abentheuer, Adaxl, Adomnan, Afrank99,<br />
Agadez, Ahmedplayer55, Aka, Aktuelles100, Alauda, Aldawalda, Alfred Grudszus, AlterEgo, Am90, Anathema, Andreas -horn- Hornig, Andreas86, Andredol, Androl, Anneke Wolf, Anschub,<br />
Antgila, Apple Imac, Ar291, Aristeas, Artmax, Aschmidt, Asselprinz, Atamari, Atlan da Gonozal, Atrosk, Augenohrenmund, Augiasstallputzer, Avoided, BK-Master, BKSlink, BSide,<br />
Bahnemann, Bammsi, Bauernopfer, Bayern, Bdk, BeJotHaDe, Ben Ben, Ben-Zin, Ben1990, Bernard Ladenthin, BesondereUmstaende, Bettenlager, BigMacLuke, BjKa, Bjoernihorst, Björn<br />
Bornhöft, Blah, Blaubahn, Blauebirke, Blinry, Blnklaus, Blunt., Brian Ammon, Btr, C.lingg, Cactus26, Callaghan, Canis Lupus, Canubis, Captainguinness, Carbidfischer, Carlos-X,<br />
Carol.Christiansen, Carter666, Caspdud, Cat1105, Cepheiden, Chaddy, Chemiewikibm, ChrisHamburg, Christian.fickinger, Christian2003, ChristianBier, Chrizel, Chrkl, Ckeen, ClemensHimmer,<br />
Clemensfranz, Coatilex, CommonsDelinker, Complex, Computer356, Conan123, Conversion script, Cottbus, Creando, Cwagener, D, D0n3, DCzoczek, DEr devil, DIH7184, DJBassTi, DaMutz,<br />
Daboss, Dancerffm, Daniel, Daniel 1992, DanielDüsentrieb, DanielXP, Daniela Ziebell, Danusch, Darealclub, DarkWulf, Denis Barthel, Der.Traeumer, DerHexer, Dev107, DiabTeen, Diba,<br />
Diddy Editi, Diftong, Domrepper, Don Leut, Don Magnifico, Dr. Lars Dobratz, Druffeler, ERZ, Eckbert, Eckhart Wörner, Eddy Renard, Edoe, Eezy, ElRaki, Elian, Emes, Emmridet, Engie,<br />
Ephraim33, Erdgeist, Ergänzer, Erik Streb, Eriosw, Eruedin, Esai12, Eschenmoser, Euku, Euphoriceyes, Eusterw, Exxx, Eynre, F174e, Fasan73, Felix Stember, Ferdl95, Feutre, Filzstift, Florian<br />
Adler, Fomafix, Forty2, FotoFux, Frank Murmann, Franz Kappes, Franz Richter, Frau Olga, FreelancerHamburg, Fristu, Fritz, FritzG, Frumpy, Fuenfundachtzig, Fuf42, FuryDE, FutureCrash, G,<br />
GFJ, GLGerman, GNosis, Gail, Gamba, Gaston70, Geist, der stets verneint, GenJack, Geos, Gerry1982, Giessauf A, Global667, Gmhofmann, Gnu1742, Golle95, Graf, Granny Smith,<br />
Greyergerhard, Grindinger, Grm wnr, GroovePark, GruppeCN, Guandalug, Gunnar.Forbrig, HaeB, Haeber, Hajotka, Hannibal470, Hansbaer, Hansele, Harald Kühle, Hardenacke, Harro von<br />
Wuff, He3nry, Hear, Hieke, Highdelbeere, HighdrowJCD, Howwi, HsT, Hubertl, Hukl, Hyperioon, IWorld, Iamhere, IchFloque, Ichbindas, Igge, Imme, Incognito86, Ingoluecker, Inkowik,<br />
Invisigoth67, Ionenweaper, Itti, J. 'mach' wust, JAF, JOE, Jacklelemmon, <strong>Jan</strong> Deterling, <strong>Jan</strong>ge, <strong>Jan</strong>niss, Jatayuh, Jed, Jello, Jivee Blau, Jofi, Johan, Johannes Bergerhausen, Joschy, Jpp, Juesch,<br />
Juhuu!, Juliane, Julius1990, KAMiKAZOW, Kaisersoft, Karl-Henner, Katharina, Kauan, Ketchupfreak88, Kevang, Kipfi, Kju, Kleine robbe, Kleinkrieger, KnoffHoffGnome, Kockster,<br />
Koerpertraining, Koethnig, Konsti 89, Kotte, Krawi, Kriga, Kristina Walter, Kubrick, Kuhlo, Kungfuman, Kurt <strong>Jan</strong>sson, KurtR, Kwiatkowski, Kyro, Köhl1, LKD, Langec, Lasst uns chillen,<br />
Le-max, Leevande, Leider, Lemming81, Lenny222, Leopard, LepoRello, Libro, Limasign, Lofor, Louis Bafrance, LuisDeLirio, Luki1602, Lutheraner, M.L, MB-one, MMSwa02, Mac, MacPac,<br />
Macmediendesigner, Maelcum, Maestro alubia, Magnus, Make, Malcdu3, Malte.seibt, Manfred Paul, MarkGGN, Markus Mueller, Markus.oehler, MarkusHagenlocher, Marlowe, Marsupilami,<br />
Martin Bahmann, Martin-vogel, Matt1971, Mcdanilo, Mechanicus, <strong>Media</strong>tus, Meidiggsding, Memset, Meph666, MetalSnake, Michael Fonfara, Michel-a, Mikano, Mike Krüger, MikeAtari,<br />
Mikenolte, Mikue, Miky1, Millbart, Misery, Mitterertux, Mjh, Mmp78, Mney, Mnh, Mo4jolo, Moeb, Moguntiner, Momorientes, Moritz Gradmann, Moros, Morran, Morten Haan, Moschitz,<br />
MrsMyer, Mschlindwein, Muck31, MuscleRumble, Musik-chris, My name, Myself488, N-Gon, N-Lange.de, NEUROtiker, NSX-Racer, Nameless23, Nante85, Nbruechert, Ne discere cessa!,<br />
Neoexpert, Nevrdull, Niceman, NicoE, Nicolas G., Nikai, Nobi-nobita, Nocturne, Noebse, Nolispanmo, Norro, Ocrho, Octavian, OecherAlemanne, Oefe, Olei, Omerzu, Onkel74, OnkelMongo,<br />
OpMF, Orik, Ot, Owltom, PIGSgrame, PRollbis, Parakletes, Parpan05, Patrik, PaulBommel, Pendulin, Pentiumforever, Perrak, Peter200, Philipp Wetzlar, PhilippWeissenbacher, Philwjan, Piczo,<br />
Pill, Pilzi, Pischdi, Pittimann, Poc, Polarit, Polarlys, Polluks, Poloonice, Pot, Poupou l'quourouce, PowerToaster, Powerlocke, Prolinesurfer, PsY.cHo, Publius, Qhx, Quedel, Rainer Lippert,<br />
Rajue, Ralfii, Raphaelrojas, Rapod, Ratatosk, Rax, Rdb, Red Grasshopper, Redaktion42, Redman04, Regi51, Reinhard Kraasch, Renredam, Rhun, Richardigel, Rihs, Rmarques, RobertLechner,<br />
Robertbarta, Roblacroix, Roo1812, RoswithaC, Roterraecher, Rotstifttäter, S.K., S.lukas, S1, STBR, SaarEagle, Saemon, Sargoth, Satmap, Schaelss, Schattenkrieger, Schirello, Schnargel,<br />
Schwijker, Scr00ge, Sebastian.Dietrich, SebastianWicker, Sebastien, Seewolf, Semper, SibFreak, Sicherlich, Siechfred, SigbertW, Sinn, Skriptor, Slimcase, Small Axe, Solid State, SonniWP2,<br />
Speakers, Spuk968, Srittau, St.Krekeler, Stahlkocher, Staldi, SteBo, Stefan, Stefan Kühn, Stefan h, Stefan506, Stefan64, Stern, Stickedy, Stoph, Streetkiller, StromBer, Subversiv-action, Succu,<br />
Suirenn, SvenEric, Syrcro, T-Zee, T.a.k., Tafkas, Terabyte, Terranic, TheK, Theclaw, Thewob, Thgoiter, Thomas Schultz, Thommyk-ms, Thorsten Busch, Tilman Berger, Timbo81, Timo Müller,<br />
Timokl, Timwi, Tintenfleck, Tischlampe, Tobi B., Tobi31061, Tobnu, Tobo, Toffel, Togs, Tommy Kellas, Topfen, Toscanna, Tostedt, Toto, Tschure, Tschäfer, Turkey73, Tuxman, Tönjes,<br />
UKGB, Uhag, Umweltschützen, Und46halbe, UnitX, Unsterblicher, Uwe Gille, Uwe Rumberg, VM123, Valentin k, VampLanginus, Vasquesbc, Vigenzo, Vinci, Voilalal, W!B:, WAH,<br />
Wahrheitsministerium, Wantuh, Warp, Wasabi, Webkart, Wfbyankee, Wiesecke, Wiki-observer, Wikinator, Wolfgang1018, Wzwz, Würfel, Xvlun, YMS, Yannick2007, YourEyesOnly,<br />
Zahnstein, Zaibatsu, Zaphiro, Zaubermann, Zeithase, Zenginahmed, Zeno Gantner, Zilti, Zoid, Zollernalb, Zxb, Århus, Ĝù, ℜepress, 1123 anonyme Bearbeitungen<br />
Cisco Systems Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78803799 Bearbeiter: Ack, Afrank99, Afromme, AiRWOLF, Aka, AlexDin, Archwizard, Arved, BCSBlecher, Bahnemann,<br />
Bernardissimo, Bsteinmann, C-M, Cmoder, Cocker68, Codeispoetry, Complex, Dev107, Don Magnifico, EricS, Exxu, FelixReimann, Firefox13, Florian Adler, Fullhouse, GDK, GLGerman,<br />
Gum'Mib'Aer, Gurt, H-stt, Hansele, He3nry, Hieke, Hinrich, Hochwürden, Hoshbad, JAF, <strong>Jan</strong> Giesen, Jashuah, Jed, Joschi71, Jpp, Jrrtolkien, Kantor.JH, Kapeka, Kdwnv, Kedmanee, Kheinisch,<br />
Koerpertraining, Krokofant, Kvedulv, LKD, Magnus, MainFrame, Malte Landwehr, MarkusHagenlocher, Martin-vogel, McB, MiLuZi, Mordechai, Mupfelkicker, Nandi1986, Naoag,<br />
Netzschrauber, Nightwish62, NikP, Nmoas, Paede, Pfalzfrank, Pflastertreter, Poc, Publius, Quirin, Reinhard Kraasch, Remi, Revvar, STBR, Schlaksi, Schneider24, Sebho, Seewolf, Sinn,<br />
Skispringer, Sleepsheep, Speakers, Srittau, Stefan Majewsky, Teflon21, Tobi B., Tohma, Tomte, Traumtaucher, Uli64, W!B:, W.girmes, WAH, Wikpeded, WinfriedSchneider, Xarax, Zaibatsu,<br />
183 anonyme Bearbeitungen<br />
Cluetrain-Manifest Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72662415 Bearbeiter: Apnoist, Catrin, Darkone, Feliz, Gratisaktie, HaeB, Kai-Hendrik, Kasaba, Lirum Larum, Livani,<br />
Martinroell, Ordnung, Sandstorm, Sargoth, Saschase, WikiCare, 4 anonyme Bearbeitungen<br />
Online-Community Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77831145 Bearbeiter: -jha-, AHZ, AN, Achak, Afterwhoru, Aka, Baumfreund-FFM, Biezl, Bitnic, Caradhras, Chbegga,<br />
ChristophDemmer, Come-to-date, Community, Cottbus, D, DanielXP, Diskriminierung, Doc z, Dodo von den Bergen, Don Serapio, Dr. Enrico, Eborutta, Edi Goetschel, Effeksys, Emkaer, Erkan<br />
Yilmaz, FWHS, Fasten, Flirtheini, Fluss, Foo030, Gamsbart, Geitost, Gerd Taddicken, Greno2, Gross bellmann, Groucho M, Guido Watermann, HAL Neuntausend, Hafenbar, Heckp, Hildegund,<br />
Howwi, Hugin07, Ifrost, Innocent2, JD, JakobVoss, Jamie12, <strong>Jan</strong>a Hochberg, <strong>Jan</strong>wo, Jed, Jergen, Jlorenz1, Jonnyisback, Knoerz, KommX, Kubieziel, LC, Lammwirt, Lung, MBq, Marc van
Quellen und Bearbeiter der Artikel 379<br />
Woerkom, Mardil, MarkusHagenlocher, Martin Stettler, Maschla, <strong>Media</strong> lib, MenoK, Mercurya, MicWei, Michael Micklei, MichaelDiederich, Milez, Mordan, Mps, Mr-alex, Nerun, Netzlabor,<br />
NiTeChiLLeR, NiTenIchiRyu, Ninety Mile Beach, Ottsch, Pandrion, Pelz, Petersoft, PhChAK, Pilli2611, ProfessorX, RalfZosel, Rax, Rosenzweig, S.Didam, STBR, Sabine0111, Saint-Louis,<br />
Schandi, Seewolf, Semmel, SherryP, Siebzehnwolkenfrei, Skyrun, Slomox, Southpark, St0n3d, Staro1, Steffen78, Stevenurkel, Syrcro, Thzi, Timmoh, Tobi B., Tobnu, Tsor, Tubbiekiller,<br />
Umherirrender, Unscheinbar, Uwe Gille, VegaS, Verbund, VillaStraylight, Wi00194, Wiki-journalistin, WikiNick, Wikitoni, YMS, Zaphiro, Zeithase, €pa, 71 anonyme Bearbeitungen<br />
Verbundenheit Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52989698 Bearbeiter: AHZ, Besserwissi, Dave81, Geof, Henning M, PsY.cHo, 3 anonyme Bearbeitungen<br />
Globales Dorf Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78579142 Bearbeiter: 790, 82er, Andy1982, Anwalts EDV, Armin P., Faduci, Heinte, Jhartmann, Matzematik, Muck,<br />
Primordial, Roo1812, SilP, 23 anonyme Bearbeitungen<br />
Computer Supported Cooperative Work Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77742709 Bearbeiter: Abena, Aka, Ariro, Asb, BjBlunck, Centic, ChristophDemmer, Danbreit,<br />
Darkone, Der Bischof mit der E-Gitarre, Florian Adler, Friedemann Lindenthal, GLGerman, Guido Watermann, Head, Holgernohr, Horcrux7, JakobVoss, Jed, Jens Vogel, Jörn Dreyer,<br />
Karl-Henner, Kh80, Kochm, Lakedaimon, Lu, MFM, Max Sinister, Mehothra, Paddy, Ptandler, RichiH, Roterraecher, Schwalbe, Seewolf, Sinisterstudent, Speck-Made, Stern, Thetawave,<br />
WolHo27, Wprinz, Yamavu, Yotwen, °, 37 anonyme Bearbeitungen<br />
Millennials Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77914855 Bearbeiter: Andreas Groß, DasBee, Der Hakawati, Flominator, <strong>Jan</strong> eissfeldt, Kungfuman, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Millenial-lsa,<br />
Peng, Petermueller21q2, Senator2108, The pyr o man, VMH, Zaphiro, 34 anonyme Bearbeitungen<br />
Digital Native Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75756897 Bearbeiter: Atalanta, Auszeit, Carbenium, Christian Lindecke, DoktorUlli, Dr Thomas H. Gebel, Fake4d, Fg68at,<br />
Finrod, Geitost, JenniferHailey, Kalorie, Knoerz, Laibwächter, Leoloewe, NiTenIchiRyu, Ot, Pass3456, STBR, Sbohmann, Sebastian Muders, Shisma, Stern, W!B:, Wesener, Wo st 01, 16<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
Netzkultur Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76492443 Bearbeiter: -jha-, Andys, Anwiha, Asb, Aschmidt, Augensternchen, Autorenkollektiv, Badenserbub, Bapho,<br />
BastianVenthur, Ben g, Bitsandbytes, Ca$e, Cherubino, D, Fire, Fiselgrulm, Franzwegener, Gecek, Gesus, Guido Watermann, Hagbard, Hella, Howwi, Hubibaa, IdS, Ifsm, Jonathan Hornung,<br />
Joschi90, Josefschweijk, Kai-Hendrik, Karsten11, Katharina, Klingon83, Kristjan, Kultur-Videos-Myregioclip, Maschla, MauriceKA, Mjh, Mrs robinson, Mvoelkl, Nicor, Oktaeder,<br />
PerfektesChaos, Qno, S1, Sebastian Wallroth, Shikeishu, Sig11, Siggi sorglos, Silberchen, Swgreed, Theredmonkey, Tim Pritlove, TomK32, Trilo, Ubongo azul, Ukroell, Umweltschützen,<br />
Unscheinbar, Wicket, Xwolf, YMS, 37 anonyme Bearbeitungen<br />
Netiquette Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78024574 Bearbeiter: ABF, APPER, Abubiju, Achim Raschka, Aka, Andy1982, Aschmidt, Avoided, Axpde, Benedikt, Bernd<br />
Wurst, BesondereUmstaende, Bijick, Bugert, C.Löser, Cbee, Ce, Cecil, Chbegga, Cherubino, Chrisbenz, ChristianErtl, ChristophDemmer, Cnagl, Complex, Correctum, Daniel FR,<br />
DanielDüsentrieb, Der.Traeumer, DerHexer, Diba, Diddi, Dr.Hasi, Dunkelangst, ElRaki, Elian, Emes, Engie, Entlinkt, Euphoriceyes, FZiegler, Felix Stember, FlugTurboFan, Flups, Fomafix,<br />
Gammaflyer, Geitost, Geof, Gnu1742, Gronau, Guidepoint, Gunther, HAL Neuntausend, HaeB, Halbarath, Harmonica, HenHei, Hendrik Brummermann, HerbertErwin, Himuralibima, Hogi82,<br />
Hæggis, IGEL, Inkowik, Inlandsgeheimdienst, Jeanpol, Jumbo1435, Kaisersoft, Karl-Henner, Karsten88, Katharina, King2500, Korinth, Krawi, Krd, Kuroi-ryu, LKD, Lord Osiris, Luxo,<br />
M@rkus, Magnus, MarkusHagenlocher, MauriceKA, Melancholie, Meph666, Mermer, Metoc, MichaelDiederich, MichiBerlin, MyLynn, NWO, Nicor, Nightwish62, Nikai, Nikkis, Nyks, Onee,<br />
Ot, P UdK, PeeCee, Pelz, Pittimann, Pleasant, Q Ö, RaimundZiegler, Rax, Renekaemmerer, Revvar, Robin Goblin, Rollin, Rrblah, STBR, Sallynase, Schaengel89, Schoggigipfel,<br />
Siebzehnwolkenfrei, Sinn, Small Axe, Spauli, Spuk968, Stefan64, T34, TheK, ThePeritus, ThePeter, Theredmonkey, Thogo, Tholari, Timk70, Tischlampe, TobiasHerp, TomK32, Trainspotter,<br />
Tönjes, Ulrich Rosemeyer, Umherirrender, Umweltschützen, Verita, Vinci, W.alter, WAH, Warhog, Web-Lady, Weede, Wendelin, Wiki-piet, Wkrautter, Wst, YourEyesOnly, Zaungast, °, 216<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
Flame Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72685679 Bearbeiter: Achim Raschka, Aka, Alien, Almeida, B0b, Björn Bornhöft, Bmr, Cepheiden, Daniel FR, Das-Dinchen,<br />
DerHexer, Diddi, Doc z, El Conde, FLX-macad, Freak 1.5, Gudrun Meyer, HardDisk, Harro von Wuff, Head, JakobVoss, JazzTh!ng, Johnny Yen, Karl.Kirst, Kubieziel, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Limasign,<br />
M.L, Nyxos, Odeesi, OliverNagel, PDD, Palica, Pischdi, Pm, Primus von Quack, RJensch, RacoonyRE, Ranas, RoswithaC, Sagittarius Albus, Sallynase, SchallundRauch, SchwarzerKrauser,<br />
Sinn, Spinne, Splatter, Stefan Kohler, ThePeritus, Timo Müller, Trainspotter, Tsui, Ulrich.fuchs, Urbanus, VanGore, Wiki-vr, WinfriedSchneider, XenonX3, Yoshi, Zaphiro, 88 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
Emergenz Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78822058 Bearbeiter: Aka, Alexander Gamauf, Allen McC., Anaxo, Andreas aus Hamburg in Berlin, Arno Matthias, Asb, Bernd<br />
vdB, Boggie, Bornemju, Ca$e, Cami de Son Duc, Cartaphilus, ChristophDemmer, DaDa, DannyBusch, David Ludwig, Denis Barthel, Diba, Eckhart Triebel, Emergenz, Ephraim33, Erkan<br />
Yilmaz, Fah, Felix Stember, Fester franz, Fluffythekitten, Fluss, GS, Gamma, Gerhardvalentin, Ghghg, Gsälzbär, HHK, HaSee, Habakuk, HannesH, Hati, Heinte, Hob Gadling, Homosapiens,<br />
Inber, JKS, Jeanpol, Jonny good, Jürgen Engel, KMJ, Kai-Hendrik, Katach, Kku, Kschoen, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kurt vom Walde, Kyber, Liborianer, Linksverdreher, Lupussy, Manuel Krüger-Krusche,<br />
Mario23, Markus Mueller, MarquardtM, Michaelsy, Mogelzahn, MovGP0, Muck, Muesse, Myukew, Nerd, Nerdi, Nuntius Legis, Olag, PANAMATIK, Panter Rei, Paulae, Pelz, PhFactor, Pm,<br />
Prophyle, Proxima, Rax, Reinhard Kraasch, Rosentod, Rtc, Rufus46, Rumbero, Schumir, Sicherlich, Sol1, Soli, Steevie, Stefan Kühn, Stummvoll, ThePeritus, TiAdiMundo, Tresckow, Tuxman,<br />
Tzeh, Ulrich.fuchs, Ute Erb, Vernanimalcula, Victor Eremita, Wiedemann, Willglov, Wollumination, Zaltvyksle, Zeitan, ZweiBein, Zwikki, 140 anonyme Bearbeitungen<br />
Prosument Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75901392 Bearbeiter: Dendrolo, Eike sauer, Enlarge, Eric79, Guido Watermann, Heiko, Ibn Battuta, Iwoelbern, Kku, Lirum<br />
Larum, LisbethS, Markus Mueller, Matt1971, Mikue, Nerezza, Ocrho, Peterpauen, SDB, Smial, Solphusion, StraSSenBahn, ThomasMielke, Victor Eremita, 24 anonyme Bearbeitungen<br />
BarCamp Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78826618 Bearbeiter: Aboerger, Anajemstaht, Aueb, Bernd vdB, Blaufisch, Cethegus, ChrisHamburg, Coast path, Derphysiker,<br />
Edei, Feba, FischX, Flominator, Friedels, Frosty79, Furukama, Guido Watermann, Hajumal, He3nry, Helge.at, JakobVoss, Jeanpol, Joachim Köhler, Kai-Hendrik, Karsten11, Leon Roth, Lgxxl,<br />
MONit, MeiersHans, Nolispanmo, Ot, PGrell, Padeluun, Papphase, PaterMcFly, Pischdi, Rax, Reinhard Kraasch, Sachaschlegel, Scherben, Schoasch, Syanzac, Tbonnemann, Thbernhardt,<br />
Tischbeinahe, TomK32, Vinci, Weissbier, Wesener, Woi, Xut, YMS, °, 51 anonyme Bearbeitungen<br />
Flashmob Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78394845 Bearbeiter: 1000の言葉, 217, Abisz2, Aka, Alex1011, Alexflob, Andi 3ö, Armin P., Aschmidt, Asdert, Atlan da<br />
Gonozal, Avatar, Baird's Tapir, BigBen212, CaptPicard, Cat, CavemanJones, ChikagoDeCuba, Cholo Aleman, Claaser, Codeispoetry, Complex, Curtis Newton, Cymothoa exigua, Dan-yell,<br />
Daniel Strüber, Dave81, David Mörike, Defchris, DerSchnüffler, Dombart, Engie, Entlinkt, Eynre, Ferrero2, Finex, Flashmob, Florian Höfer, FritzG, Fuzzy, Gabbahead., Gideonstar, Giftmischer,<br />
Gobnuts, Gormo, Gottlos, Gratisaktie, Grindinger, Grünes Fiet, Guido Watermann, Guillermo, H005, Heimspiel, Heutige Jugend, Hofres, Hubertl, Ifrost, Iromeister, Jodo, Jodoform, JogyB,<br />
Johnny@aut, Jürgen Engel, KTo288, Kaktus, Karl Gruber, Katharina, Kdwnv, Kiezkicker, King Kane, Kingmob, Kingneptune1, Klaus Richter, Koerpertraining, Krassdaniel, Krawi, Krd, LKD,<br />
Latidor, LepoRello, Mam-solution, Marcoscramer, MattisManzel, MauriceKA, Maxibt, Mediocrity, Meffo, Metroskop, Miaow Miaow, Mikue, Millbart, Minalcar, Minipark, Mirkophonix,<br />
Mucus, Mussklprozz, NH, Nankea, Nerd, Nifoto, Ninety Mile Beach, Nockel12, NonScolae, Onee, P. Birken, Pc, Pelz, Pere Ubu, Philipp Wetzlar, Pill, Pittimann, Ploekkel, Pool, Raffi,<br />
Rainbowfish, Rainer Bielefeld, Rajuneon, Rasko, Rax, Redman04, Regi51, Repat, Rorkhete, Rufus46, Rynacher2, S.Didam, Sargoth, Sascha.moeckel, SchirmerPower, Schmitty, Seers, Seewolf,<br />
Seppitm, SibFreak, Sozi, Spuk968, Stefan, Stefan Bernd, Stefan Tischler, StefanDT, Taadma, Thorbjoern, Tikurion, Tilla, Timo33, Tobi B., Tobnu, Trillium9111, Trugbild, Trustable, UW, Uncle<br />
Pain, Unight Party Community, Usien, V36 109, VanGore, VanRaz, Veritatis splendor, Vertigo21, Virtualone, WaldiR, Web108, Wegner8, Wikinaut, WittyMissSophie, Wolfgang1018,<br />
Wolfgangmixer, Wuttkea, XV HTV 1352, Zaibatsu, Zaphiro, Zehdeh, Zollernalb, Zonk44, 213 anonyme Bearbeitungen<br />
Crowdsourcing Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78475741 Bearbeiter: AlexLinden, Antje 65, Ariro, Baschti23, Baumeister, ChristophDemmer, DasBee, Der.Traeumer,<br />
Diba, Doerki80, Englischer Limonen-Harald, Enomil, Felix Stember, Flash1984, Florian Adler, Fridemar, Gidze3000, Guandalug, Guido Watermann, HG Herrmann, HaeB, He3nry, Howwi,<br />
Hystrix, Ichmirmich, Jpp, Kallistratos, Krawi, LKD, MatiasRoskos, <strong>Media</strong> lib, Mermer, Millbart, Nicor, PeeCee, Ribo, Sanoj, Schwijker, Siebzehnwolkenfrei, Speck-Made, Staro1, Stefan, Strot,<br />
Thedaendy, Thunder-cobra, Tomi, WOBE3333, WikiNick, Wikibus, Wikitoni, 76 anonyme Bearbeitungen<br />
Kollektive Intelligenz Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78749363 Bearbeiter: Abubiju, Aka, Allesmüller, Anaxo, AndreasSchelske, Anima, Antje 65, Athenchen, Avoided,<br />
Baumfreund-FFM, Ben Ben, Bitsandbytes, Bremser, Bronko, Carbenium, Carl Steinbeißer, ChristophDemmer, DasBee, Dexterinus, Don Magnifico, Felix Stember, Filterraum, FlorianB, Frank<br />
Oleschko, Gastreferenten, Georg-Johann, Gerbil, Gnu1742, Gravitophoton, Grotesk und lächerlich, Hao Xi, Herrick, Huerdentaenzerin, Ijbond, JakobVoss, Jeanpol, Jkbw, Jorma, Jón, KaPe,<br />
Kai-Hendrik, Kku, Kollektive Intelligenz in der Wikipedia, Konrad F., Krawi, Kurt <strong>Jan</strong>sson, L3XLoGiC, LKD, Landschof, Mboehmer, Michaelk, Michi.bo, Millbart, Mtree80, Muck31,<br />
Mueslifix, Naddy, Onkelkoeln, Ot, PM3, Parhamer, PortoAlegre, Radulf, Rainbowfish, Rainer Volck, Redecke, Regi51, RichardHeigl, S1, Schreibkraft, Schwarmintelligenz oder Herdengeblöke,<br />
Semper, Siebzehnwolkenfrei, Sirdon, Stalefish, Stefan Kühn, TaHan, ThePeritus, Themistokles1984, Theredmonkey, Thomas Gebel, TomK32, Torvikal, Tower of Orthanc, Trublu, UlrichIberer,<br />
Uranus95, Ute Erb, Uwe Gille, Wiska Bodo, Zaphiro, Zollernalb, €pa, 78 anonyme Bearbeitungen<br />
Die Weisheit der Vielen Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76555566 Bearbeiter: 111man, A1bi, Alkibiades, Arno Matthias, Blaufisch, Church of emacs, Cleverboy, Cocrea,<br />
Commandercool, Crunfuzzy, Cspan64, DrJunge, Earendil, Erdbeerquetscher, Eynre, Froggy, Gleiberg, Gnu1742, Gronkor, Guido Watermann, HZi, Inzestuöses Referenzieren, Kai-Hendrik, Kam<br />
Solusar, Keigauna, LKD, Lyzzy, MCK, MarkusHagenlocher, Martin Häcker, Mebsi, Membeth, Ri st, Riepichiep, Seidenkäfer, Spartanischer Esel, StillesGrinsen, TenGen, Uwe Gille, Vinci,<br />
Webverbesserer, Wikinger08, WortUmBruch, Zollernalb, 33 anonyme Bearbeitungen<br />
Enterprise 2.0 Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78197734 Bearbeiter: AchimBode, Achimbode, Aka, ArtepSchuett, Azrah, Cleverboy, Dada 1987, Euku, Flominator,<br />
Greki79, Hschaefer, Kai-Hendrik, Klaus pennew, Kochm, La Corona, MFM, Mannerheim, NiTenIchiRyu, Norro, Regi51, Sabata, Tglassne, Thomas Gebel, Ullky, WIKIdesigner, WOBE3333,
Quellen und Bearbeiter der Artikel 380<br />
YMS, 16 anonyme Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Governance Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78733194 Bearbeiter: Amygdala77, GeorgeLocksmith, Mef.ellingen, Nessianni, PM3, Riade, 1 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Marketing Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78500659 Bearbeiter: Aka, Bamsery, Carl Steinbeißer, Cherubino, Doc z, Guido Watermann, HaSee, Henlen,<br />
Hofres, Krd, Leanderwattig, Marketingelo, MaryKris, Mattis Berger, Mivacron, Muehlenbeck, NiTenIchiRyu, Sebastian Kneifel, Stelten, Sternstefan, Stevoplanning, TanjaBense, Thommy<br />
Smith, Williundpeter, Wortgefecht, 27 anonyme Bearbeitungen<br />
<strong>Social</strong> <strong>Media</strong> Relations Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78325050 Bearbeiter: AHZ, Aka, Bianissim, Florentyna, GiordanoBruno, Meikel1965, Wikiroe, Wolf32at<br />
The Long Tail Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78272944 Bearbeiter: Bassloader, Bigbug21, Carl Steinbeißer, CharlyK, DrJunge, Eintragung ins Nichts, Elmschrat, Greki79,<br />
JCG-Krabbe, Jpp, KWiNK, Kai-Hendrik, Klapper, Kolja21, LKD, Medienblogger, Mermer, Millbart, Noebse, Oceancetaceen, P. Birken, Plakos, Rapober, Seelefant, Seth Cohen, Sprachpfleger,<br />
Uncopy, 14 anonyme Bearbeitungen<br />
Creative Commons Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78453264 Bearbeiter: 32X, 5-I²-2-3-I\I-6-3-1-3-2, Abaumg, Adverpert, Alexandra lb, AlgorithMan, Alkibiades,<br />
AndreKR, Ansgar Walk, Anwiha, Ben g, Bender235, Benji, BesondereUmstaende, Björn Klippstein, Blauebirke, Blobu de, Chaddy, Cherubino, ChristianErtl, Church of emacs, Complex,<br />
Cubefox, D0ktorz, DaB., Daaavid, Dapete, DasBee, Derwok, Dirkhillbrecht, Don Magnifico, Eike sauer, Eldred, Electrocat, Elya, Empro2, Erik Warmelink, ErikDunsing, Erschaffung, F30,<br />
Felanox, Fire, Fleasoft, Florian Adler, Flyout, Forrester, Frakturfreund, Fschoenm, GFDL-Fan, Gardini, Georgp, Gerdthiele, Gestumblindi, Gismatis, Gnurpsnewoel, Grimmi59 rade, Guety,<br />
Head, Heinte, Herrick, Historiograf, Horgner, Hubi, IGEL, IP X, IngmarS, Inkowik, Jailbird, JakobVoss, <strong>Jan</strong>ra, Jodo, Joerg schuster, Joghurt42, Jürgen Engel, Kai-Hendrik, Karl-Friedrich Lenz,<br />
Karl-Henner, Kh80, Klever, Kuef, Kuroi-ryu, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kuru, Le-max, Limasign, LonelyPixel, Magister Edufix, Mahmudmasri, MainFrame, Mannerheim, MarkusHagenlocher,<br />
Martin-vogel, Mathias Schindler, Melancholie, Metalhead64, Metoc, Michael Kümmling, MichaelSchoenitzer, Michi.bo, Mikegr, Mm1, Monade, Napa, Nerd, Nicolas G., Nikolas Nießen,<br />
Nilskolaus, Nyks, OnlineT, Ordnung, PDD, Peacemaker, Peter774, Phrood, Pistazienfresser, Plenz, Pool, Raphael Frey, Rbuchholz, Rdb, Revolus, Robb der Physiker, RokerHRO, S!ska,<br />
S.Didam, Saethwr, Schimon, Schnacksel, Simplicius, SiriusB, Sloyment, Small Axe, St.s, Stechlin, Steindy, Subfader, Subversiv-action, Suhadi Sadono, Sumwiki, Svencb, Tenzintrepp,<br />
Theredmonkey, ThoMo7.2, Thomas G. Graf, Threedots, Timo Müller, Tobias K., Túrelio, Umaluagr, Uwe W., VanGore, Vatolin, Verwüstung, Vinci, Wahrheitsministerium, Wiki-vr, Wutsje,<br />
Wölkchen, Xato, Yamavu, Zefram, Zoid, 117 anonyme Bearbeitungen<br />
Komplexes System Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78881793 Bearbeiter: AlexIvanov, ChristophDemmer, ClaudiusHansch, Dennis.noll.ks, DerHexer, Engelbaet,<br />
EwigLernender, Fenice, Fester franz, Frisbeeralf, Gratisaktie, Guidod, Hati, Hydro, Interwest, Jed, Jkbw, Jorges, Jwdietrich2, Kku, Liberatus, MRA, Ma-Lik, Mhm, Mikue, Monade, Nachtagent,<br />
Nolispanmo, Olag, Ollio, Omikron23, PM3, PhHertzog, Phi, Proxima, QualiStattQuanti, Rusnak2000, Stot, Tinz, Update, Ventus55, Wok lok, Yotwen, 51 anonyme Bearbeitungen<br />
Systemtheorie (Luhmann) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78790547 Bearbeiter: Aka, Alexandre84, Bertzbach, Bärski, C.Löser, Carlolf, Cepheiden, Chatter, Chrisqwq,<br />
ChristophDemmer, Dave81, Der Geo-Graf, DerHexer, Eagle22, Edoe, Ephraim33, Fabianpittroff, Florian Höfer, Franz Richter, Froggy, GS, Gleiberg, Graphikus, H h, HaSee, Heinte, Hemeier,<br />
<strong>Jan</strong>us von Abaton, Jazzman, Jesi, Jpp, Kasimirflo, Klingon83, Knoerz, Kolja21, Kriddl, Kyber, Lorenzo, Machahn, Metapolytrop, MichaelG, Mondamo, Musashihagakure, Namknarf, Otto<br />
Normalverbraucher, PM3, Paulpaulsen, Pelz, Qwqchris, Rohkost, S1, Sargoth, Sebastian L1, Small Axe, VanGore, Wasseralm, Wiki-Hypo, Wollumination, Woodywoodpegger, Wosen, €pa, 70<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
Kommunikation (soziologische Systemtheorie) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77835468 Bearbeiter: Afrank99, Ai24, Baumfreund-FFM, Conversion script, David<br />
Hoeffer, Emes, Florian Höfer, Fossa, Heinte, Herr Andrax, Jkdecker, Jotzet, Mira, Old toby, OsGr, Otto Normalverbraucher, PM3, Pm, QualiStattQuanti, Rolf Todesco, StefanRybo, Stefanwege,<br />
Steffen, Traumdenker, Uwe Gille, Vulture, WortUmBruch, Wst, 13 anonyme Bearbeitungen<br />
Soziale Systeme (1984) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77393935 Bearbeiter: Bertzbach, Ca$e, Calzino, Cepheiden, Florian Höfer, Gagel, Graphikus, Hi-Lo, Rolf Todesco,<br />
Uwe Gille, 7 anonyme Bearbeitungen<br />
Massenpsychologie Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78224779 Bearbeiter: 111man, A-Toast, Aka, Almeida, BjekicBorg20, ChristophDemmer, CollectiveStupidity,<br />
Ephraim33, He3nry, HermesCom, JOE, Jesi, Kai-Hendrik, Keigauna, LogoX, MBq, Obersachse, Ot, Ribo, Roger Dorman, S.Didam, Sf67, Thfenzl, ThoR, TillF, WissensDürster, Wst, Zaphiro,<br />
18 anonyme Bearbeitungen<br />
Organisationstheorie Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78893729 Bearbeiter: AHZ, Aka, AnhaltER1960, BKSlink, Bernd vdB, Bernd.Brincken, Cecil, ChristophDemmer,<br />
Coco wiki, Dave81, Don Magnifico, DorisH, Edoe, ErikDunsing, Erkan Yilmaz, Falko Wilms, Flominator, HaSee, Hoss, Hydro, <strong>Jan</strong> eissfeldt, Jesi, Jpp, Mariusmilo, Markus Bärlocher, Millbart,<br />
Monikam, Philipp Grunwald, Qwqchris, Sandysonne, Sirdon, Steffen Blaschke, Sukarnobhumibol, Tasma3197, UKGB, Wiegels, Wien1190, Wikiwikigreif, WissensDürster, Xls, Xqt, Yotwen,<br />
20 anonyme Bearbeitungen<br />
Netzwerkorganisation Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69156130 Bearbeiter: Anneke Wolf, Astrobeamer, Centic, ChristianBier, Elmschrat, Fasten, Gratisaktie, Hermannk,<br />
JCBrunner, Jmsanta, Jpp, Kibert, Lenipiwonka, Linschi, Matthias Bock, Ordnung, Samy, Tafkas, 29 anonyme Bearbeitungen<br />
Organisationssoziologie Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72268549 Bearbeiter: APPER, Anwiha, Bernd vdB, Bernhard Bierwurst, C.Löser, Cethegus, Cherubino,<br />
ChristophDemmer, Dergreg:, Edoe, FelMol, Fleasoft, Franz Richter, Fringebenefit, GS, Gerd Roppelt, Gratisaktie, Hans Koberger, <strong>Jan</strong> eissfeldt, Joti, Kai-Hendrik, LKD, Lupussy, Noddy93,<br />
Nolispanmo, ObservingSystems, Otto Normalverbraucher, Robert Weemeyer, Sampi, Senfsaat, Tim Simms, Tophee, Wiegels, Wollumination, Wossen, €pa, 27 anonyme Bearbeitungen<br />
Dirk Baecker Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71789179 Bearbeiter: APPER, Aka, Bdk, BillBo, Crato, DPachali, Dirkbaecker, Docmo, Dpoersch, Edoe, Elmar Nolte, Erkan<br />
Yilmaz, Inspektor.Godot, <strong>Jan</strong>us von Abaton, Kyber, LKD, Luhmannius, Maddadkar, Mechanicus, Mobilo, Nepenthes, Nerd, Orwlska, Ot, PDD, Pelz, Peter200, Phrood, STBR, Schwalbe,<br />
Scooter, Sei Shonagon, Sms, Speaker, Sroski, Stauba, Stefan Kühn, Tickle me, WernerHerdecke, Wollumination, Zenon, €pa, 43 anonyme Bearbeitungen<br />
Niklas Luhmann Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78042243 Bearbeiter: APPER, Add3328, Aeggy, Andy1982, Anima, Anton-kurt, Anuque, Anwiha, Arist0s, Artur<br />
Weinhold, Avoided, Bartleby08, Bender235, Bernd vdB, Bertzbach, Blaueva52h7jk, Brion VIBBER, Brodbeck, Btr, Bullpit, C.Löser, Ca$e, Captain Cook, Chrisfrenzel, CleaningUp, Conversion<br />
script, Crato, Crazy-Chemist, Crux, DL5MDA, David Hoeffer, Diskriminierung, Divna Jaksic, Donatien, Dr. med. Ieval, Drahreg01, Eagle22, Eckhart Wörner, Eingangskontrolle, Eisbaer44, El,<br />
Elwikipedista, Ennio, Ercas, Erkan Yilmaz, Eryakaas, Falense, Fantasio, Fehlerteufel, Florian Adler, Fossa, GS, Geisslr, Gfis, Gnufish, Grundsatzfrage, Gurgelgonzo, He3nry, Henningninneh,<br />
Hubertl, Ifrost, Igelball, InfoDL, Isa Blake, JD, JakobVoss, <strong>Jan</strong>us von Abaton, Jcr, Jesi, Jesusfreund, Jjkorff, Joachim Feltkamp, Jodo, Joe-Tomato, John Milton, Jürgen Engel, Kam Solusar,<br />
Karl-Henner, Karlrt, Kku, Kresspahl, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Kyber, LKD, Longamp, Longinus Müller, Luha, Luhmannius, Lysandros, MSGrabia, Mandelafreund, Markus Mueller, Mathias Schindler,<br />
Matt1971, Maya, Meister-Lampe, Merlissimo, Metapolytrop, Metaroll, Michail, Mira, Mitchell, Mogelzahn, Nicke L, Nikkis, Ninahotzenplotz, Nockel12, Odin, OecherAlemanne, Oerly, Olaf<br />
Kosinsky, Ollio, Ot, Ottosmops, Palica, Pan, PanchoS, Perennis, Peter Hammer, Pjacobi, Pygmalion, Qwqchris, RagnarHeil, René M. Kieselmann, Richardfabi, Roughneck, S.K., STBR, Sabria,<br />
Schneeeule, Schwalbe, Sei Shonagon, Shannon, Sigune, Sinn, Sokratka, Southpark, Speaker, Sroski, StefanRybo, Stern, Streifengrasmaus, Suspekt, TGS, Tharudhin, Thogo, Tohma, Tomberlin,<br />
Trienchen, Töns, Umweltschützen, Unscheinbar, Ute Erb, Uwe Gille, VanGore, Victor Eremita, Voyager, Vulture, WIKImaniac, WOBE3333, Welsenburg, WilhelmSchneider, Wistula, Zefram,<br />
Zenit, Zeno Gantner, Zenon, ³²P, €pa, 313 anonyme Bearbeitungen<br />
Tim Berners-Lee Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78732222 Bearbeiter: Achim Raschka, AchimP, Aka, Albrecht1, Alkab, Amodorrado, Anathema, Andreas Marc Klingler,<br />
ArnoLagrange, Bauernfreund, Bender235, Bernard Ladenthin, BesondereUmstaende, C-M, Captain Crunch, Cherubino, ChrisHamburg, ChristophDemmer, Church of emacs, Ciceronl, Cmenke,<br />
Cqixk, Diba, Digital Nerd, Diskriminierung, Dr. Günter Bechly, Edia, El Conde, Engie, Esperantisto, Fabian R, Flo 1, Flo89, FloSch, Florian Weber, Fu-Lank, Furfur, GNosis, Gaudio, GenJack,<br />
Gerbil, Giftmischer, Gilliamjf, Graphikus, Gödeke, H005, HaSee, HaeB, Henning M, Hoiroix, Howwi, Ikonos, Interpretix, JFKCom, Jed, Jivee Blau, Joerg s, Kai-Hendrik, Karl-Henner,<br />
Karsten11, Kdwnv, Khobar, Knarf, Knochen, Krawi, Kungfuman, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Leider, Lichtenauer, Linveggie, Logograph, Lou.gruber, Löschfix, Magnus, MarkusHagenlocher, Martin Stettler,<br />
Michael32710, Michael82, MichaelDiederich, Milvus, Morphopos, Morten Haan, MrTux, Nagy+, Nodutschke, Norx, Novox, Nowis, OHLEG, Oberpepe, Ot, PDD, Paddy, PartnerSweeny, Peter<br />
Putzer, Peter200, PhilippWeissenbacher, Pink lady, Pittigrilli, Pittimann, Proofreader, Prud, Q'Alex, Rainbowfish, RalfZosel, Regi51, Rodrigo.argenton, Roo1812, Salevin18, Sallynase,<br />
Schlämmer, Schwatzwutz, Shikai shaw, Sinn, SonicY, Southpark, Spuk968, Srittau, StYxXx, Stefan h, Steffen, Stern, Tadzio, Tcmb, Thalan, Timk70, TomK32, Tönjes, Uncopy, ViennaUK,<br />
Voyager, WAH, WIKImaniac, Westiandi, Wikidienst, WissensDürster, Wissenschaffer, Wissling, Wolfgang Deppert, Wolfgang1018, YMS, Zaphiro, Zeno Gantner, 182 anonyme Bearbeitungen<br />
Tim O’Reilly Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=76696864 Bearbeiter: Aka, Albrecht 2, Baumfreund-FFM, D0ktorz, Dolos, Duesentrieb, Electrocat, Guety, Hagbard, Hansele,<br />
Hildegund, ITGirl85, Infinito, Itu, Jailbird, <strong>Jan</strong> B, Katty, Koffie, Lafferty monolar, Liquidat, Magnus, Mitten, Nicolas G., Ri st, Salmi, Srbauer, Stefan Kühn, StephanKetz, Theclaw, Thornard,<br />
V.R.S., Weisserd, YMS, 11 anonyme Bearbeitungen<br />
Massachusetts Institute of Technology Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78439740 Bearbeiter: 08-15, 7Pinguine, APPER, Achim Raschka, Achtzehnvierzig, Aka, Aki52,<br />
Andreas 06, Andreas Groß, Anton O., Appaloosa, Bahnemann, Balcer, Baldhur, Bender235, Bernard Ladenthin, Bigbug21, Blomike, Bonzo*, Breimelche, C-Lover, Chemiewikibm,<br />
ChristianBier, ChristianErtl, ChristophDemmer, Clemensfranz, Coaster J, Creando, Cspan64, Der Lange, Drahreg01, ElRaki, Empro2, Ephraim33, ErnstA, Euka, Farino, Feinschreiber, Felix<br />
Wiemann, Firefox13, Florian.Keßler, Fluss, Frank Dietmar, Fred Link, Fujugu, GNB, Geos, Grabert, Graf, Guenson, Guidod, HaSee, Hankdetweiler, Hannes Röst, He1ix, High Contrast,
Quellen und Bearbeiter der Artikel 381<br />
Highpriority, Holoclaus, Hr, InfoGeist, Informatik, J. Schwerdtfeger, JAF, JFKCom, Jed, Jodo, JohannWalter, Joho345, Jschlosser, Katty, Kdwnv, King of chaos, Kingruedi, Kjuto, Kku,<br />
Koerpertraining, Kopoltra, Korrekturleser1st, LKD, Locusta, Logograph, Lowenthusio, Lucky77, Lukian, M9IN0G, MD, MGla, Mac, Magnus, MarcoBorn, MarkusHagenlocher, Marsupilami,<br />
Martin-vogel, Max Hester, Meister-Lampe, MeisterV, Micha L. Rieser, MooX, Mschlindwein, Müsli, Nameless, Necrophorus, Nerd, Nicouh, Nikai, Nornen3, Numbo3, P. Birken, Paddy,<br />
Pendulin, PhiliM, Piedro, Piefke, Pischdi, Quickfix, RainerB., Ralf Roletschek, ReclaM, Redf0x, René Schwarz, Revolus, S.T.E.F.A.N, Salier100, Salmi, Sbezold, Schlämmer, Secofr, Siechfred,<br />
Small Axe, Solid State, Southpark, Spauli, Spielblau, Srittau, SteMicha, Steschke, Strikerman, Subn, Sukarnobhumibol, TDF, Tim Simms, Tobias1983, Toka, Torinberl, Traitor, Tschaensky, Tux,<br />
UW, Ultraschall, Umherirrender, Ummikaug, Umweltschützen, Unukorno, Vinci, WissensDürster, Xitrix, Yoto, Zaibatsu, ¡0-8-15!, 161 anonyme Bearbeitungen<br />
Jimmy Wales Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78815919 Bearbeiter: 08-15, 32X, APPER, Achim Raschka, Adornix, Aetas volat., Ajnem, Aka, Aktions, Allesmüller, Alofok,<br />
AndreasSchelske, Angela, Arouetlj, Atlan da Gonozal, Avjoska, Bachforelle, Bdk, Ben Ben, Bennsenson, Bhuck, BlueCücü, Bodo Sperling, Bogart99, Bonzo*, Carbidfischer, Cat, CdaMVvWgS,<br />
Che010, Chrislb, Christoph Knoth, Church of emacs, Ciceronl, Citizendium, Cleverboy, Clive3, Collinj, Colman, Conny, Conspiration, Cruzer83, DEr devil, DaB., Dachris, Dein Freund der<br />
Baum, DerHexer, Dishayloo, Dodo von den Bergen, Don Quichote, Dr Tiger, Dr. Crisp, Edelpunk, Elian, Ellard38, Elwikipedista, Englandfan, Ew-h2002, Fabchief, Factumquintus, Feliks, Felix<br />
Stember, FloSch, Flominator, Frank Schulenburg, Frankee 67, Freitag13, FritzG, FutureCrash, GDK, Gardini, GenJack, Gerhard M, Geschäftskanzler, Gnu1742, Grass, Gunnar Eberlein, H-stt,<br />
Hardenacke, Head, Hilf dem Elch, HolGr, Hoo man, Horrendus, Hotcha2, Hæggis, Ims, JD, JFKCom, Jarlhelm, Jesusfreund, Jpp, Juliana da Costa José, Justausernr1, Jürgen Engel, Kaare, Kam<br />
Solusar, Karl-Henner, Katach, Klausmach, Kolja21, Konsumvieh, Kuebi, Kurt <strong>Jan</strong>sson, König Rhampsinitos, Lakoke, LennartBolks, Leon, LewisHamiltonTR, M(e)ister Eiskalt, M.Vogel,<br />
Magnus, Marcika, Marcl1984, Marcus Cyron, Martin-vogel, MartinIGB, Mathias Schindler, Matt1971, Mehrleisealslaut, Melancholie, Melkom, Mezzofortist, Michael Reschke,<br />
MichaelDiederich, MichaelFrey, Molily, Morgaine, MrDM, Napa, Noebse, Nolispanmo, Numbo3, Onno Garms, Ot, PDD, Palica, Philipp.b, Phzh, Pischdi, Pixelfire, Ponte, Ralf Roletschek, Rax,<br />
Raymond, Rechercheur, Reinhard Kraasch, Reissdorf, Rogarten, Rolf H., S1, Saibo, Saperaud, Sargoth, Schaengel89, Scheppi80, SchirmerPower, Schniggendiller, Seewolf, Sei Shonagon, Senfi,<br />
Sicherlich, Siebzehnwolkenfrei, Silberchen, Snotty, Sorbonne, Southpark, Sportreport, Sslider, SteMicha, Stefan64, Steschke, Succu, Suchenwi, Sukarnobhumibol, TheK, ThoR, Thomaskh,<br />
Thommess, Tiem Borussia 73, Tilla, Tobi B., Tobias1983, TomCatX, Tuxman, Umweltschützen, Venividiwiki, W-j-s, Walter Falter, Wicket, Widescreen, Wiki-Hypo, WikiNick, Wikwatch.LOL,<br />
XenonX3, YMS, Yonatanh, Zaungast, Zaxxon, Zbisasimone, Zwangsumbenennung238, Zwangsumbenennung239, Österreicher, Ĝù, לערי ריינהארט, शुनक, 57 anonyme Bearbeitungen<br />
Wikipedia Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=78346991 Bearbeiter: 08-15, 0g1o2i3k4e5n6, 217, 3122WIKI, 32X, 5yntax-3rror, 6b616e, 790, A B M, AF666, APPER, Abe<br />
Lincoln, Abfall-Reiniger, Abubiju, Achates, Achim Raschka, Ad.ac, Adrian Suter, Agadez, Agak, Aha, Ajnem, Aka, Akl, Aktions, Akumachan, Al3x, Albert Krantz, Albertcip, Albinfo,<br />
Alex1011, Alexander ehmann, Alfons2, Alkab, Allegutennamen, Almeida, Altbau, Alvaro de Mendaña de Neyra, Amrhingar, Anathema, Anatolpanom, Andante, Andre Engels, Andrea.Nimsch,<br />
Andreas 06, Andreas Möllenkamp, AndreasE, AndreasFahrrad, AndreasPraefcke, Angr, Anima, Anneke Wolf, Anton-Josef, Antonia Chott, Aphaia, Apsomol, Arafael, Arcimboldo, Arcy, Arfst,<br />
Argos der Argos, Arne List, Arnomane, ArtMechanic, Asb, Aschmidt, Asdert, Asdfj, Asia Minor, Asthma, Athenaios, Atlan da Gonozal, Avatar, Avron, AxelHH, Azor, B.gliwa, BLueFiSH.as,<br />
Baerenwurm3000, Bangin, Barnos, Bautsch, Bdk, Benni Bärmann, Bennsenson, Berlin-Jurist, Bernd vdB, Bernhard-h, Big.N, Bigbug21, Biggerj1, Birger Fricke, Björn Bornhöft, Braunschweig<br />
MD, Breogan67, Bubo bubo, Buehnle23, Bugert, Buh, Bundesstefan, Buster Baxter, Bynk, C-8, CBC, Cactus26, Campus TV Duisburg, Carebo69, Cat, Caulfield, CdaMVvWgS, Chatter,<br />
Chautauqua Tourbillon, Chd, Chemiewikibm, Cherubino, Chrislb, Chrissolon, Christa13, Christian Günther, ChristianHeldt, Church of emacs, ClemiMD, Colman, Complex, Conny,<br />
Conspiration, Conti, Conversion script, Core Networks GmbH, Crix, CroMagnon, Crux, Cybercraft, CyborgMax, Cymothoa exigua, CyruzdaViruz, D, D0c, DEr devil, DaB., DaSch, Daaavid,<br />
Dackelvandalismus? - Nein Danke!, Dagonet, Danetto, Daniel FR, Daniel3880, DanielDüsentrieb, DanielXP, Dapete, Darev, Darkone, David Ludwig, DavidG, Dbenzhuser, Dein Freund der<br />
Baum, Deirdre, Deni100, Der Messer, Der Rabe Ralf, Der fast kopflose Nick, Der funker, Der.Traeumer, DerHexer, DerkleineNick, Diba, Diddi, Diebu, Dishayloo, Doc Sleeve, DocMario, Dodo<br />
von den Bergen, Dolos, Dominique TU, Don Quichote, Dr Möpuse, DrTemp, DuMonde, Duden-Dödel, Duesentrieb, DunCrow, Dundak, Dwi Secundus, Dylac, E.Maron, EBB, Echoray, Eclipse,<br />
Ecology, Eike sauer, Eilmeldung, Eisbaer44, ElRaki, Elian, Eloquence, Elvis untot, Emdee, Englischer Limonen-Harald, Entlinkt, Ephraim33, Erdbeermaeulchen, Erdhummel, Erik Zachte,<br />
ErikDunsing, Ernst Kausen, Euku, EvaK, EvilEye, EvilFiek, ExIP, FAR, FEXX, Falense, Familiennamenbearbeiter, Farino, Fast richtig, FatBabetProduktions, Faulks, Feivel Mauswanderer,<br />
Feldhase, Feliks, Felix Stember, Felix der Glückliche, Fewskulchor, Fexxa, Filzstift, Finnenfreund, Fleshgrinder, Flo 1, Flominator, Floralys, Florean Fortescue, Florian Adler, Florian Weber-alt,<br />
Forevermore, Fossa, FotoFux, Frakturfreund, Freedom Wizard, Fristu, FritzG, From Autumn To Ashes, Froop, Frostbaum, Fu7uR, Fujnky, Fussball fanatiker, FêlíxRôdér, GDK, GS, Gaga1995,<br />
Gardini, Gary Luck, Gdm, Gecko21, GedSperber, Geldmaschine, Geräusch, Gestumblindi, Gianna13, Giftmischer, Giftpflanze, Gimpkiller, Ginger-Ale6932, Gmetzel, Gnom, Gorp, Graf, Guety,<br />
Gutmensch, H005, HaSee, Hadhuey, HaeB, Haeber, Hairstyler, Hanfin, Hans Dunkelberg, Hans J. Castorp, Hans-Jürgen Hübner, Hans-Peter Scholz, Hansa95, HardDisk, Hashar, Head, Heiko<br />
Herkenrath, Heinrich5991, Hektor von Hofmark, Hella, HenHei, Henning Blatt, Herr Andrax, Herrick, Heurik, Hey Teacher, Himuralibima, Hoo man, Hubi, Hunding, Hydro, Hæggis, I'm not<br />
Johnny Cash, IWorld, Ibn Battuta, Ich hab hunga, Ifrost, Igelball, Igge, Ilja Lorek, Ing. Schröder Walter, Interpretix, Itu, J budissin, J. 'mach' wust, J.Ammon, JD, JFKCom, JPense, Jacktd, Jaer,<br />
Jakkede, JakobVoss, James Johnson, Jarlhelm, Jarling, Jeanpol, Jeburkh, Jens Liebenau, Jergen, Jobu0101, Jodo, Jogo.obb, Johannes <strong>Jan</strong>ssen, Johannes Ries, JohannesO, John-vogel, Jonas kork,<br />
Jonathan Groß, Josef Spindelböck, Jpkoester1, Jpp, JuTa, JuergenL, Juesch, Julia69, Juliana, Juliane, Jürgen Engel, Kaffeefan, Kai3k, Kakadu142, Kampfmaus, KapitänZukunft, Karl-Henner,<br />
Kassander der Minoer, Kaszeba, Katimpe, Kdkeller, Keichwa, Keimzelle, Keine Ahnung, Kerbel, Kgfleischmann, Kibert, Kickof, Kiezkicker, Kiker99, Kilian Marquardt, Kingruedi, Klaus Eifert,<br />
Klever, Klmann, Koblaid, Kockmeyer, Koethnig, Kolossos, Konrad F., Kritop, Krokofant, Krächz, Kräuter-Oliven, Kubrick, Kuebi, Kurt <strong>Jan</strong>sson, Königsgambit, LA2, LKD, Label5, Lambo,<br />
Langec, Laza, Leider, Leipnizkeks, Leon, LeonardoG, LepoRello, Lewenstein, Liberal Freemason, Liberaler Humanist, Limasign, Linveggie, Lockenlord, Lofor, Logograph, Longbow4u, Lothar<br />
der Allerweiseste, Lotse, Louie, Lpz1976, Lugel, Lukask, Lumpenpack, Lustiger seth, Lutoma, Lyzzy, Löschfix, M. Yasan, MAK, MF-Warburg, MFM, Maestro alubia, Magnus, Maha,<br />
MainFrame, Manniac, Marc-André Aßbrock, Marco Krohn, Marcus Cyron, MarkGGN, Markus Bärlocher, Markus Mueller, Markus Schweiß, MarkusHagenlocher, Martin-vogel, Martin.k,<br />
MartinIGB, Martinb, Master Fowl, Mathias Schindler, Matt1971, Matthäus Wander, Max Mira, Mbimmler, Mclaufpass, Medi-Ritter, <strong>Media</strong> lib, Megatog, Meisterkoch, Melancholie, Merlissimo,<br />
Micha2564, MichaelDiederich, MichaelFrey, MichaelHof, Michail, Michi.bo, Mici03, Mideg, Mirona Thetin, Mitten, Mnh, Montrone, Mosmas, Mossakowiki, Mullinger, Muns, Möchtegern,<br />
NCC1291, Nanokras, Napa, NatiSythen, Nb, Nd, Necrophorus, Negerfreund, Nemissimo, Neon02, Nerd, Nescio*, Neun-x, Neuroca, Newsflash, NiTenIchiRyu, Nick64, NicoHaase, Nicor,<br />
Nikkis, Nina, Ninety Mile Beach, Nocturne, Noddy93, Noebse, Norro, Nrainer, Numbo3, Nurciano, Nutzer86, O mii C, OS, Oceancetaceen, Ocrho, OffsBlink, Okatjerute, Olag, Ole, Oliver<br />
Emmler, Omit, One-eyed pirate, Ot, Ovim-Obscurum, Owltom, Owly, P .de, P A, P. Birken, PDD, PSS, Paddy1989, PatDi, PaterMcFly, Paul Ebermann, Paul Horn, PaulBommel, Paunaro,<br />
Pausetaste, Paxarion, PeCeBe, Peacemaker, Pelagus, Pemu, Penta, Perlenklauben, Peter Littmann, Peter Thomassen, PeterBonn, Peterlustig, Petrissa, PhilG, Philipendula, Philipp.b, Philtime,<br />
Phobetor, Phrood, Phymorra, Pianist Berlin, Pill, Pionic, Pismire, Pjacobi, Pkn, Plani, Plasmagunman, Plastronaut, Poketyce, Polarlys, PolskiNiemiec, Precog, Primus von Quack, Prince Kassad,<br />
Professor Hastig, Projekt-Till, Pruefer, PsY.cHo, Qualle, Quatschkopp, Queryzo, Qwqchris, RTH, Racedriver123, RacoonyRE, Rafl, Rainer Lippert, Ralf Roletschek, Rallig, Rambo66,<br />
Ranunculus, Rasterzeileninterrupt, Ratatosk, Rax, Raymond, Raymond83, Rdb, Rechercheur, Regi51, Regine Seidel, Reinhard Kraasch, Revolus, Richard Huber, Richardigel, Rigardo, Roadside<br />
Attractions, Roland2, Rolz-reus, Ronny Michel, Root axs, Rosa Schlagfertig, Rosenkohl, RoswithaC, Rote4132, Rotstift, Roughneck, Rtc, S-Man23, S1, SCPS, SML, STBR, Sa-se, Sansculotte,<br />
Saperaud, Sarcelles, Sargoth, Sascha Claus, Sava, Scavenger86, Schaengel89, Scherben, Schewek, SchirmerPower, Schnargel, Schreyner, Schroll, Schusch, Scorpion2211, Scytheman,<br />
Sebastian.Dietrich, Sechmet, Secular mind, Seewolf, Sefo, Sensenmann, Senzaltro, Sepia, Serpens, Servus100, Seth Cohen, Sewa, Sicherlich, Siebzehnwolkenfrei, Siego, Sierra-Tequila, Sig11,<br />
Sikilai, Siku-Sammler, Silberchen, Sin, Singer, Skriptor, Skyman gozilla, Skywalker2011, Slomox, Soebe, Soloturn, Solphusion, Sommerkom, Southpark, Spawn Avatar, Speck-Made, Spundun,<br />
Sputnik, StYxXx, Staro1, SteMicha, Steevie, Stefan, Stefan Bernd, Stefan Kühn, Stefan-Xp, Stefan040780, Stefanwege, Steffen, Steffen Löwe Gera, Stefreak, Stegosaurus Rex, Steigi1900,<br />
Stephan Schneider, StephanKetz, Stephanbim, Stern, Steschke, SteveK, Stf, Stummvoll, Stw, Styg, Succu, Super2000, Svencb, Syrcro, TAXman, Taurec, The0bone, TheK, Thire, Thoken,<br />
Thomas Tunsch, ThomasMielke, ThomasPusch, Thorbjoern, Thornard, Tilla, Timwi, Tinabe, Tinz, Tirkon, Tlustulimu, To old, Tobi B., Tobias1983, Toblu, Tohma, Tolanor, TomCatX, TomK32,<br />
Toter Alter Mann, Towih, Trac3R, Tressco, Triebtäter, Tritonus05, Trustable, Tschikay, Tschoertschi, Tsor, Tsui, Tuxman, Tw86, UHT, Ulrich.fuchs, Umaluagr, Umherirrender,<br />
Umweltschützen, Unauffällig, UndeadKing, Uni, Universitätsbuchdrucker, Unscheinbar, Unukorno, Urbanus, Ureinwohner, Ute Erb, Uuu87, V.R.S., Van Flamm, VanGore, Velton,<br />
Verschiebedepp, Vikipedija, Vinci, Vision321, Viva Zapata, Vodimivado, Volunteer, Voyager, Vulture, W!B:, W. Edlmeier, WIKIdesigner, WIKImaniac, Wasabi, Watchcaptain, Wavelength,<br />
Wedderkop, Wega14, Weialawaga, WerWil, Wesener, Wetterwolke, White-Shadow, Whizzy81, Wiegels, WikiControl, WikiMax, WikiNick, WikiWichtel, Wikibär, Wikidienst, Wikiholic,<br />
Wikimurmeltier, Wikinger77, Wilske, Wimmerm, Wiska Bodo, Wissens-helfer, Wissling, Wohingenau, Wolfgang1018, Wolfgangbeyer, Wst, Wuffff, Wuzur, Xario, XenonX3, Xocolatl, Xtv,<br />
YMS, Yamavu, Yokel, YourEyesOnly, Yurik, Yülli, Zablotczan, Zaibatsu, Zaphiro, Zeno Gantner, Ziko, Zinnmann, Zipferlak, Zualio, pD9E943F2.dip0.t-ipconnect.de, לערי ריינהארט, शुनक, €pa,<br />
671 anonyme Bearbeitungen<br />
Clay Shirky Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77440047 Bearbeiter: Aka, Ca$e, EvDa13, Helge.at, Nepomucki, 5 anonyme Bearbeitungen<br />
Chris Anderson (Journalist) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77162758 Bearbeiter: AHZ, APPER, AWak3N, Apollinaire23, Carl Steinbeißer, Dancer, Dockster, DrJunge,<br />
Eaaumi, Elmschrat, HaeB, Hirt des Seyns, Jaellee, Jesi, Joho345, Konrad Lackerbeck, Omerzu, Onkelkoeln, Pessottino, PtM, Tsor, Uncopy, Ziko, 2 anonyme Bearbeitungen<br />
Don Tapscott Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=73307139 Bearbeiter: Achimbode, Conny, Crazy1880, Pelz, Powerboy1110, 2 anonyme Bearbeitungen<br />
Wikinomics Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=73076645 Bearbeiter: Bigbug21, Birkenkrahe, ChristophDemmer, Efgschulz, Flominator, Fridemar, HaSee, Helge.at, Ifrost, Itti,<br />
<strong>Jan</strong> eissfeldt, Kai-Hendrik, Krawi, PDD, Peter200, Plehn, RudolfSimon, S1, Sebastian Schaefer, Siebzehnwolkenfrei, Solphusion, Staro1, TNolte, Thomas.regli, Uncopy, 14 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
James Surowiecki Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77614176 Bearbeiter: Andim, Arno Matthias, Buergi, JCS, Joho345, Kku, Longbow4u, MarkusHagenlocher, MorbZ, P.<br />
Birken, Roberto de Lyra, Rybak, Wesener, 3 anonyme Bearbeitungen<br />
Peter Kruse Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77124686 Bearbeiter: ++gardenfriend++, Atlasowa, Bitzer, Cholo Aleman, Eingangskontrolle, F2hg.amsterdam, FSHL, Frank<br />
C. Müller, HaSee, Internezzo, JD, KaPe, Kalorie, Laibwächter, Markus Roling, Marsupilami, NoFluor, Pittimann, Roland Kutzki, STBR, Sei Shonagon, Stefan Bernd, Thomas Gebel, Thraker,<br />
Tobias1983, Zollernalb, 9 anonyme Bearbeitungen
Quellen und Bearbeiter der Artikel 382<br />
TED (Konferenz) Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=77920899 Bearbeiter: Aka, Antaya, Dorieo, Eiferer, Feliz, Funke, Gökhan, Henriette Fiebig, Hydro, Jeb, Joho345,<br />
Kolja21, Marti7D3, Mike Krüger, Rainer Wasserfuhr, Rsteinkampf, Salier100, Sikarjan, Stefan Bernd, Stefanostrian, Till.niermann, UlrichJ, Wantanabe, Wikinils, Zerebrum, Zwikki, 15 anonyme<br />
Bearbeitungen
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder 383<br />
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder<br />
Datei:Internet map 1024.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Internet_map_1024.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: Matt Britt<br />
Datei:WorldWideWebAroundWikipedia.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WorldWideWebAroundWikipedia.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:Chris 73<br />
Datei:Verbindungen mit dem Internet Home User.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verbindungen_mit_dem_Internet_Home_User.jpg Lizenz: unbekannt<br />
Bearbeiter: Ladyt, Lukas9950, Nolispanmo, RacoonyRE, Spuk968, Suhadi Sadono, Team Rocket, 5 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Verbindungen mit dem Internet Business User.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verbindungen_mit_dem_Internet_Business_User.jpg Lizenz: unbekannt<br />
Bearbeiter: Lukas9950, Niteshift, Nolispanmo, Team Rocket<br />
Datei:WWW logo by Robert Cailliau.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WWW_logo_by_Robert_Cailliau.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Bibi<br />
Saint-Pol<br />
Datei:Tim berners lee webserver.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tim_berners_lee_webserver.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
Ahellwig, Lorra, Nerits, Regi51, 4 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Web20en.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Web20en.png Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Germany Bearbeiter: Kosmar, Sinn,<br />
Stepri2003, 3 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Web20buzztime-11_2008.gif Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Web20buzztime-11_2008.gif Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Afrank99,<br />
Datenralfi<br />
File:Vulkanmodell_Sozialer_Software.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vulkanmodell_Sozialer_Software.png Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0<br />
Bearbeiter: User:Karstenpe<br />
Datei:Facebook.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Facebook.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: Facebook<br />
Datei:MarkZuckerberg.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MarkZuckerberg.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: Elaine Chan and Priscilla<br />
Chan<br />
Datei:Twitter logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Twitter_logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Original uploader was GageSkidmore at en.wikipedia<br />
Datei:Twitter-Bird.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Twitter-Bird.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Garver<br />
Datei:Jack Dorsey-20080723.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jack_Dorsey-20080723.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Joi Ito from<br />
Inbamura, Japan<br />
Datei:Evan-Williams.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Evan-Williams.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Joi Ito<br />
Datei:Biz Stone-20080723.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Biz_Stone-20080723.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Joi Ito from Inbamura,<br />
Japan<br />
Datei:Biz Stone-Jack Dorsey-20080118.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Biz_Stone-Jack_Dorsey-20080118.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0<br />
Bearbeiter: FlickreviewR, SusanLesch, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Twttr sketch-Dorsey-2006.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Twttr_sketch-Dorsey-2006.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Jack<br />
Dorsey<br />
Datei:Building where Twitter HQ is.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Building_where_Twitter_HQ_is.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter:<br />
jesperdj<br />
Bild:Xing_logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Xing_logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Marsupilami<br />
Datei:MySpace Logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MySpace_Logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Fleshgrinder<br />
Datei:Myspace_deutschland_logo.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Myspace_deutschland_logo.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Red Grasshopper<br />
Datei:StudiVZ.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StudiVZ.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Gaspard<br />
Datei:VZ-Datenschutzlogo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:VZ-Datenschutzlogo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: DavidG<br />
Datei:Flickr wordmark.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flickr_wordmark.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: Brands of the World<br />
Datei:YouTube.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:YouTube.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: AwOc, DH93, Dodo von den Bergen, Fredyo, Umweltschützen, 3<br />
anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Youtubeheadquarters.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Youtubeheadquarters.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Original uploader<br />
was Coolcaesar at en.wikipedia<br />
Datei:Youtubeheadquarterssanbruno.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Youtubeheadquarterssanbruno.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
Original uploader was Coolcaesar at en.wikipedia<br />
Datei:Youtube logo.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Youtube_logo.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Chaddy, Flow2, JuTa, NilsV, PsY.cHo, Red Grasshopper, S1,<br />
Slomox, Sonaz, Syrcro, 10 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Youtubecompfull.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Youtubecompfull.png Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter: User:Old Guard<br />
Datei:TiddlyWiki Tiddler edit.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TiddlyWiki_Tiddler_edit.png Lizenz: BSD Bearbeiter: (c) Osmosoft Limited 2004-2007<br />
Datei:HNL Wiki Wiki Bus.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: Andrew<br />
Laing<br />
Datei:Gajim_roster2.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gajim_roster2.png Lizenz: GNU General Public License Bearbeiter: Overbenny, Shooke, Sven<br />
Datei:Feed-icon.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Feed-icon.svg Lizenz: GNU General Public License Bearbeiter: unnamed (Mozilla Foundation)<br />
Datei:Netbib tag cloud.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Netbib_tag_cloud.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: http://log.netbib.de<br />
Datei:Cloud computing.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cloud_computing.svg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter: Sam Johnston<br />
Datei:Architektur_cloudcomputing.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Architektur_cloudcomputing.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Sebbl2go<br />
Datei:Navstar-2.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Navstar-2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Bricktop, GDK, Ustas<br />
Datei:ConstellationGPS.gif Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ConstellationGPS.gif Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Original uploader was El pak at en.wikipedia<br />
Datei:GPS roof antenna dsc06160.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GPS_roof_antenna_dsc06160.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
User:David.Monniaux<br />
Datei:2 SOPS space systems operator 040205-F-0000C-001.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:2_SOPS_space_systems_operator_040205-F-0000C-001.jpg Lizenz:<br />
unbekannt Bearbeiter: United States Air Force photo by Airman 1st Class Mike Meares)<br />
Datei:Transit-o.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Transit-o.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: CarolSpears, GDK<br />
Datei:Delta II 7925-9.5 launches with GPS IIR-15.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Delta_II_7925-9.5_launches_with_GPS_IIR-15.jpg Lizenz: unbekannt<br />
Bearbeiter: GDK, GW Simulations, Uwe W.<br />
Datei:Orbits around earth scale diagram.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Orbits_around_earth_scale_diagram.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter:<br />
User:Mike1024<br />
Datei:Holux M 241 BW 1.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Holux_M_241_BW_1.JPG Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Berthold Werner<br />
Datei:GPS.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GPS.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: user:Geoz<br />
Datei:Royaltek rgm-3800 IMGP9822 wp.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Royaltek_rgm-3800_IMGP9822_wp.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:Smial<br />
Datei:Garmin Forerunner 101.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Garmin_Forerunner_101.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter:<br />
User:MB-one<br />
Datei:Garmin in Aktion.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Garmin_in_Aktion.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: Haya, MB-one<br />
Datei:AudiNavigation.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AudiNavigation.JPG Lizenz: Public Domain Bearbeiter: joho345
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder 384<br />
Datei:Mobilenavigation.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mobilenavigation.JPG Lizenz: Public Domain Bearbeiter: joho345<br />
Datei:Solmeta Geotagger N2 auf D5000 Seitenansicht.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Solmeta_Geotagger_N2_auf_D5000_Seitenansicht.jpg Lizenz: Creative<br />
Commons Attribution 3.0 Bearbeiter: User:YellowShark<br />
Datei:Opensource.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Opensource.svg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: Converted from file at<br />
http://opensource.org/trademarks by en:User:Brighterorange<br />
Datei:HTC_Desire_-_Sense_2.1.jpeg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HTC_Desire_-_Sense_2.1.jpeg Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Bearbeiter: Espen<br />
Irwing Swang, Mobilen.no<br />
Datei:IPhone_3G_vs_Blackjack_II.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IPhone_3G_vs_Blackjack_II.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0<br />
Bearbeiter: whalesalad<br />
Datei:Bluetooth Watch.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bluetooth_Watch.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Reinraum<br />
Datei:Siemens-sx1.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Siemens-sx1.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Dubidub, Noddy93, 1 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
Datei:All9xxx.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:All9xxx.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Original uploader was R@y at de.wikipedia<br />
Datei:BlackBerry 8700c.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BlackBerry_8700c.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Bearbeiter: User:sfoskett<br />
Datei:Palm Pre.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Palm_Pre.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: James Whatley<br />
Datei:HTC Touch P3450.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HTC_Touch_P3450.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter: User:Tuomas<br />
Datei:IPhone bei der Macworld.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IPhone_bei_der_Macworld.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Rabenkind<br />
Datei:T-Mobile G1 launch event 2.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:T-Mobile_G1_launch_event_2.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0<br />
Bearbeiter: Michael Oryl<br />
Datei:Samsung i900 Omnia.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Samsung_i900_Omnia.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Umairanwer at<br />
en.wikipedia<br />
Datei:Smartphone share 2009 full.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Smartphone_share_2009_full.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: --<br />
Eraserhead1 12:49, 3 March 2010 (UTC) Graph created by myself. Original uploader was Eraserhead1 at en.wikipedia<br />
Datei:Wordpress-logo.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wordpress-logo.png Lizenz: GNU General Public License Bearbeiter: w:WordPressWordPress<br />
Datei:WordPress Screenshot.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WordPress_Screenshot.png Lizenz: GNU General Public License Bearbeiter: me<br />
Datei:Wordpressadmin2.7.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wordpressadmin2.7.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Matt Mullenweg, Ryan Boren<br />
Datei:Wordpress Template Hierarchy.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wordpress_Template_Hierarchy.png Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Rami<br />
File:Google-Logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Google-Logo.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: Google Inc/User:Nicky Nouse. Original uploader was Nicky<br />
Nouse at en.wikipedia<br />
Datei:Flag of World.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_World.svg Lizenz: GNU Lesser General Public License Bearbeiter: Adrien Facélina, edited by<br />
ThePhil<br />
Datei:Googlegermanlogo.PNG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Googlegermanlogo.PNG Lizenz: Trademarked Bearbeiter: Original uploader was Patricks Wiki at<br />
de.wikipedia. Later version(s) were uploaded by Jabiko at de.wikipedia.<br />
Datei:Google wordmark.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Google_wordmark.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: AVRS, Adamxl1, Hautala, Krinkle, Locos<br />
epraix, Sertion, Sevela.p, ZZeBaH Punk, 4 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Google.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Google.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Google Inc.. Original uploader was Tene at en.wikipedia. Later version(s)<br />
were uploaded by Stannered, Scarce, Wikipedian64, Neurolysis, Calvin 1998 at en.wikipedia.<br />
Datei:Google-Logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Google-Logo.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: Google Inc/User:Nicky Nouse. Original uploader was Nicky<br />
Nouse at en.wikipedia<br />
Datei:Apple logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Engie, RokerHRO, Sa-se, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Flag of the United States.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_the_United_States.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Dbenbenn,<br />
User:Indolences, User:Jacobolus, User:Technion, User:Zscout370<br />
Datei:Flag of Germany.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Germany.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Pumbaa80<br />
Datei:Flag of Austria.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Austria.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:SKopp<br />
Bild:Flag of Switzerland within 2to3.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Switzerland_within_2to3.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Burts<br />
Bild:Flag of Ireland.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Ireland.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:SKopp<br />
Datei:Apple I.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_I.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: Photo taken by rebelpilot<br />
Datei:AppleLisa.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AppleLisa.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Chaddy, Global667<br />
Datei:Apple first logo.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_first_logo.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Original uploader was TigerK 69 at en.wikipedia<br />
Datei:Apple 1976 logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_1976_logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Marsupilami<br />
Datei:Apple2Logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple2Logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: ChristianBier, Frank Murmann<br />
Datei:Apple Computer Inc Logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_Computer_Inc_Logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Gunnar.Forbrig<br />
Datei:Blaues Apple-Logo.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Blaues_Apple-Logo.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Chaddy, Benutzer:Leyo<br />
Datei:Applecomputerheadquarters.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Applecomputerheadquarters.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
Coolcaesar, Edward, Grm wnr, Kyro, Xnatedawgx, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Applestore-NYC.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Applestore-NYC.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:N-Lange.de<br />
Datei:Apple2.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple2.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Bukk, German, Grm wnr, Museo8bits, NeonZero,<br />
StuartBrady<br />
Datei:Apple Lisa.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_Lisa.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Grm wnr, Idrougge, Mschlindwein,<br />
Zzyzx11, 2 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Macintosh 128k transparency.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Macintosh_128k_transparency.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
w:User:Grm wnr<br />
Datei:Power Macintosh 6100-66.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Power_Macintosh_6100-66.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Beavis,<br />
Grm wnr<br />
Datei:IMac Bondi Blue.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IMac_Bondi_Blue.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: Apalsola, Dodo,<br />
Grm wnr, HereToHelp, Ilse@, Thuresson<br />
Datei:Apple-ppc-G4-2003.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple-ppc-G4-2003.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Grm wnr, Panoramafotos.net<br />
Datei:IMac G4 sunflower8.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IMac_G4_sunflower8.png Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Bishonen, Grm wnr, 1 anonyme<br />
Bearbeitungen<br />
Datei:Macmini.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Macmini.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Grm wnr, Romantiker<br />
Datei:Macintosh portable.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Macintosh_portable.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Beavis, Grm wnr, Kozuch, Kyro, Ranveig,<br />
Wutsje, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:PowerBook Duo 280c.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PowerBook_Duo_280c.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Beavis, Grm wnr,<br />
Jpk, Nick Name Two, Vlad2i<br />
Datei:Clamshell iBook G3.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Clamshell_iBook_G3.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: FlickreviewR, Grm<br />
wnr, Nilfanion
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder 385<br />
Datei:MacBook.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MacBook.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: User:redjar<br />
Datei:MacBook Pros.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MacBook_Pros.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: Benjamin Nagel<br />
Datei:MacBook Air.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MacBook_Air.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Dan Taylor from London, UK<br />
Datei:Apple1-Mainboard.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple1-Mainboard.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: German, Grm wnr,<br />
Hellisp, Liftarn<br />
Datei:Apple TV.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_TV.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Max Lewis<br />
Datei:Apple Remote.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_Remote.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: User:Grm wnr<br />
Datei:Apple Magic Trackpad.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_Magic_Trackpad.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Micky Aldridge<br />
Datei:Apple iPad Event03.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Apple_iPad_Event03.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: matt buchanan<br />
Datei:IPod family.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IPod_family.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Kyro<br />
Datei:IPhone 4 Black.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IPhone_4_Black.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Taylor Shomaker<br />
Datei:Magic Mouse 01 Pengo.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Magic_Mouse_01_Pengo.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter:<br />
User:Pengo<br />
Datei:ThermodruckerSilentypeApple.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ThermodruckerSilentypeApple.JPG Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
StromBer<br />
Bild:Cisco Logo 2007.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cisco_Logo_2007.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Afrank99<br />
Bild:Cisco Systems.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cisco_Systems.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Afrank99<br />
Bild:Linksys Logo 2007.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Linksys_Logo_2007.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Afrank99<br />
Bild:Cisco7600seriesrouter.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cisco7600seriesrouter.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Supplied by Cisco<br />
Systems and released under the GFDL. See also w:en:Image talk:Cisco7600seriesrouter.jpg.<br />
Bild:Umsatz- und Gewinnentwicklung Cisco.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Umsatz-_und_Gewinnentwicklung_Cisco.svg Lizenz: Creative Commons<br />
Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter: User:FelixReimann<br />
Datei:Dune Flickr Rosino December 30 2005 Morocco Africa.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dune_Flickr_Rosino_December_30_2005_Morocco_Africa.jpg<br />
Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: FlickreviewR, Quasipalm, Rmhermen, Uroboros<br />
Datei:OsterhorngruppeGruberalmKuhtritt.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:OsterhorngruppeGruberalmKuhtritt.jpg Lizenz: Creative Commons<br />
Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter: Herzi Pinki<br />
Datei:BarCamp Orlando.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BarCamp_Orlando.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: Josh Hallett<br />
from Winter Haven, FL, USA<br />
Datei:BarCamp Bangalore.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BarCamp_Bangalore.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Bearbeiter: tara hunt<br />
from San Francisco, USA<br />
Datei:P9275463.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:P9275463.JPG Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Srvban, Virtualone, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Long tail.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Long_tail.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: User:Husky<br />
Datei:CreativeCommond logo trademark.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CreativeCommond_logo_trademark.svg Lizenz: Trademarked Bearbeiter: User:F30,<br />
User:Sven, User:F30, User:Sven<br />
Datei:Creativecommons spanien.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Creativecommons_spanien.jpg Lizenz: Attribution Bearbeiter: Klaus Graf<br />
Datei:cc-by new.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-by_new.svg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: User:Sting<br />
Datei:cc-nc.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-nc.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:cc-nd.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-nd.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:cc-sa.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-sa.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:CC-sampling.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CC-sampling.svg Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Bearbeiter: User:Petrus Adamus<br />
Datei:cc-nd white.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-nd_white.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:Cc-nd white.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-nd_white.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:Cc-sa white.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-sa_white.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:cc-sa white.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cc-sa_white.svg Lizenz: Attribution Bearbeiter: User:Rfl<br />
Datei:CC-devnations.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CC-devnations.svg Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Bearbeiter: User:Yamavu<br />
Datei:CC+Commercial-license-button.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CC+Commercial-license-button.svg Lizenz: Creative Commons Public Domain Bearbeiter:<br />
Creative Commons (Copyright holder)<br />
Bild:KommunikationSystemtheorie.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:KommunikationSystemtheorie.svg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
Benutzer:ZeJa.<br />
Datei:Tim Berners-Lee_CP.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tim_Berners-Lee_CP.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: Silvio Tanaka<br />
Bild:First_Web_Server.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:First_Web_Server.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:Coolcaesar at en.wikipedia<br />
Bild:Tim O'Reilly.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tim_O'Reilly.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Bearbeiter: Calliopejen, Johnleemk<br />
Datei:Massachusetts Institute of Technology logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Massachusetts_Institute_of_Technology_logo.svg Lizenz: unbekannt<br />
Bearbeiter: unbekannt<br />
Datei:MIT c1901 LOC cph 3g09599.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MIT_c1901_LOC_cph_3g09599.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: AnRo0002, Balcer,<br />
Infrogmation, M2545<br />
Datei:Wfm stata center.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wfm_stata_center.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: User:Finlay McWalter,<br />
User:Raul654<br />
Datei:MIT Dome night1 Edit.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MIT_Dome_night1_Edit.jpg Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: User:Thermos<br />
Datei:Simmon-hall-mit-boston-usa.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Simmon-hall-mit-boston-usa.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter:<br />
Geofrog, Infrogmation, Jareha, Morven, ReneS, Solipsist, TomAlt<br />
Datei: MIT20040307-02.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MIT20040307-02.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Beleghil, Jcornelius, Spauli<br />
Datei:MIT Sloan.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MIT_Sloan.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Breimelche, ChristianBier<br />
Datei:Mitgreatdome.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mitgreatdome.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Daniel P. B. Smith<br />
Datei:Jimmy Wales Fundraiser Appeal.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jimmy_Wales_Fundraiser_Appeal.JPG Lizenz: Attribution Bearbeiter: Manuel Archain,<br />
Buenos Aires, http://www.manuelarchain.com/ - work for hire, copyright owned by Jimmy Wales<br />
Datei:Jimbo-Frankfurt-skyline.jpeg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jimbo-Frankfurt-skyline.jpeg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Bearbeiter: User:Elian<br />
Datei:Quadriga-verleihung-rr-02.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Quadriga-verleihung-rr-02.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:Ralf Roletschek<br />
Datei:Wikipedia-logo-v2-de.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikipedia-logo-v2-de.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Wikimedia Foundation<br />
Datei:Wikipedia svg logo-de.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikipedia_svg_logo-de.svg Lizenz: logo Bearbeiter: User:Mandavi, User:Otourly<br />
Datei:ImageNupedia.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ImageNupedia.png Lizenz: logo Bearbeiter: milodesign.com<br />
Datei:Www.wikipedia.org screenshot.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Www.wikipedia.org_screenshot.png Lizenz: logo Bearbeiter: 555, CatherineMunro, Chuck<br />
Marean, Danny B., Dbenbenn, Deadstar, Dsmurat, Ecr, Er Komandante, Eusebius, Froztbyte, GaynaJones, Gurch, Haha169, Herbythyme, I Love Pi, J.delanoy, J.smith, Jose silveira, Juliancolton,<br />
Kanonkas, Kelvinc, Killiondude, Krofesyonel, LX, Learnsales, Leon2323, Lockal, Mahahahaneapneap, Mandavi, Mike.lifeguard, Mxn, Nard the Bard, Prince Kassad, Rocket000, Sertion,<br />
Stratford490, Thehelpfulone, Tiptoety, Vanderdecken, VolodymyrF, WikiSlasher, Yarnalgo, Алексей Скрипник, 40 anonyme Bearbeitungen
Quellen, Lizenzen und Autoren der Bilder 386<br />
Datei:WikipediaHomePage30March200.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WikipediaHomePage30March200.png Lizenz: GNU Free Documentation License<br />
Bearbeiter: User:119<br />
Datei:Hauptseite-januar2004.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hauptseite-januar2004.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Church of emacs,<br />
Elian, John-vogel, Mardus, Simon Shek<br />
Datei:Meilensteine.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Meilensteine.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter: Akinom, Cepheiden, Chumwa, Elian,<br />
Ikiwaner, Knopfkind, Marcus Cyron, Markus Schweiss, Rosenzweig, Spitzl, 2 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Wikipedia Hauptseite 2008-03-16.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikipedia_Hauptseite_2008-03-16.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: -<br />
Datei:Seite bearbeiten1.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Seite_bearbeiten1.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Dominic Z.<br />
Datei:Wikipedia-artikel-bearbeiten.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikipedia-artikel-bearbeiten.png Lizenz: GNU Free Documentation License Bearbeiter:<br />
User:ALE!<br />
Datei:MB WP Organisation.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MB_WP_Organisation.png Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Bearbeiter:<br />
User:Ziko<br />
Datei:Wikimedia-logo.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikimedia-logo.svg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: User:Dbenbenn, User:Zscout370<br />
Datei:Floridaserversfront1.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Floridaserversfront1.jpg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: Hamish2k, Mysid, SolarKennedy,<br />
Überraschungsbilder, 9 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Wikimedia-servers-2009-04-05.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikimedia-servers-2009-04-05.svg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0<br />
Bearbeiter: self-made<br />
Datei:Administratorencollage der deutschen Wikipedia.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Administratorencollage_der_deutschen_Wikipedia.jpg Lizenz: GNU Free<br />
Documentation License Bearbeiter: Benutzer:Euku, Benutzer:Euku/Admingalerie<br />
Datei:Wikimedia chapters existing.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikimedia_chapters_existing.svg Lizenz: Public Domain Bearbeiter: user:Bastique<br />
Datei:Göttingen-SUB-Britannica.02.JPG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Göttingen-SUB-Britannica.02.JPG Lizenz: Public Domain Bearbeiter: DrJunge, Kilom691,<br />
Thangmar, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Beziehung zwischen Wikipedia und der Presse.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Beziehung_zwischen_Wikipedia_und_der_Presse.svg Lizenz: GNU Lesser<br />
General Public License Bearbeiter: User:Niabot<br />
Datei:CC-BY-SA icon.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CC-BY-SA_icon.svg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Bearbeiter: Creative Commons<br />
Datei:Heckert_GNU_white.svg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Heckert_GNU_white.svg Lizenz: Free Art License Bearbeiter: Aurelio A. Heckert<br />
<br />
Datei:WR Schweden Titel.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WR_Schweden_Titel.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Benutzer:Tkarcher<br />
Datei:Wikipedia 2005 Label DVD small.PNG Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikipedia_2005_Label_DVD_small.PNG Lizenz: logo Bearbeiter: Elian, Guillom,<br />
Mats Halldin, Waldir, 1 anonyme Bearbeitungen<br />
Datei:Wikimedia-Organigramm-2008.png Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wikimedia-Organigramm-2008.png Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5<br />
Bearbeiter: Petar Marjanovic<br />
Bild:Clay Shirky.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Clay_Shirky.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: FlickreviewR, GeeJo, Nilfanion, Para, Ö<br />
Datei:Etech05 Chris.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Etech05_Chris.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: FlickrLickr<br />
Datei:Etech05 James1.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Etech05_James1.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Bearbeiter: FlickrLickr, FlickreviewR, Gary<br />
King, Greudin, Husky, TarHippo<br />
Datei:Prof._Peter_Kruse.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Prof._Peter_Kruse.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Germany Bearbeiter:<br />
Original uploader was Markus Roling at de.wikipedia<br />
Datei:Bill Clinton talking at TED 2007.jpg Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bill_Clinton_talking_at_TED_2007.jpg Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike<br />
2.0 Bearbeiter: advencap
Lizenz 387<br />
Lizenz<br />
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen<br />
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste<br />
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.<br />
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.<br />
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed<br />
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)<br />
in allgemeinverständlicher Sprache.<br />
Sie dürfen:<br />
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen<br />
• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen<br />
Zu den folgenden Bedingungen:<br />
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.<br />
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die<br />
daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.<br />
Wobei gilt:<br />
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.<br />
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:<br />
• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;<br />
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;<br />
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.<br />
• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/<br />
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.<br />
Haftungsbeschränkung<br />
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst<br />
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.<br />
GNU Free Documentation License<br />
Version 1.2, November 2002<br />
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.<br />
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies<br />
of this license document, but changing it is not allowed.<br />
0. PREAMBLE<br />
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,<br />
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.<br />
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free<br />
software.<br />
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this<br />
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or<br />
reference.<br />
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS<br />
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free<br />
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license<br />
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.<br />
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.<br />
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)<br />
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of<br />
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.<br />
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above<br />
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.<br />
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a<br />
Back-Cover Text may be at most 25 words.<br />
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors<br />
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to<br />
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not<br />
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".<br />
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,<br />
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,<br />
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.<br />
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title<br />
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.<br />
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section<br />
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according<br />
to this definition.<br />
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards<br />
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.<br />
2. VERBATIM COPYING<br />
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced<br />
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may<br />
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.<br />
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.<br />
3. COPYING IN QUANTITY<br />
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that<br />
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover<br />
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document<br />
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.<br />
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.<br />
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a<br />
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter<br />
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time<br />
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.<br />
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.<br />
4. MODIFICATIONS<br />
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role<br />
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:<br />
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use<br />
the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.<br />
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal<br />
authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.<br />
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.<br />
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.<br />
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.<br />
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.<br />
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.<br />
• H. Include an unaltered copy of this License.<br />
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled<br />
"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.<br />
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These<br />
may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.<br />
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given<br />
therein.<br />
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.<br />
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.<br />
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.<br />
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.<br />
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as<br />
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.<br />
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization<br />
as the authoritative definition of a standard.<br />
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of<br />
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are<br />
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.<br />
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.<br />
5. COMBINING DOCUMENTS<br />
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of<br />
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.<br />
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the<br />
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of<br />
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
Lizenz 388<br />
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled<br />
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".<br />
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS<br />
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,<br />
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.<br />
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding<br />
verbatim copying of that document.<br />
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS<br />
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation<br />
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not<br />
themselves derivative works of the Document.<br />
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the<br />
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.<br />
8. TRANSLATION<br />
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,<br />
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any<br />
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of<br />
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.<br />
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.<br />
9. TERMINATION<br />
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate<br />
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.<br />
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE<br />
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new<br />
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .<br />
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and<br />
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version<br />
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.<br />
ADDENDUM: How to use this License for your documents<br />
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:<br />
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.<br />
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document<br />
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2<br />
or any later version published by the Free Software Foundation;<br />
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.<br />
A copy of the license is included in the section entitled<br />
"GNU Free Documentation License".<br />
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:<br />
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the<br />
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.<br />
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.<br />
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free<br />
software.