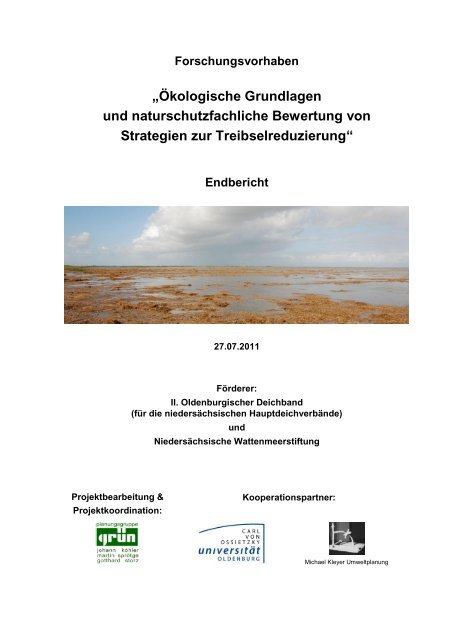FB Treibsel.pdf - planungsgruppe grün gmbh
FB Treibsel.pdf - planungsgruppe grün gmbh
FB Treibsel.pdf - planungsgruppe grün gmbh
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsvorhaben<br />
„Ökologische Grundlagen<br />
und naturschutzfachliche Bewertung von<br />
Projektbearbeitung &<br />
Projektkoordination:<br />
Strategien zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung“<br />
Endbericht<br />
27.07.2011<br />
Förderer:<br />
II. Oldenburgischer Deichband<br />
(für die niedersächsischen Hauptdeichverbände)<br />
und<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Kooperationspartner:<br />
Michael Kleyer Umweltplanung
Forschungsvorhaben<br />
„Ökologische Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
von Strategien zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung“<br />
(Projekt 10/05 der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung)<br />
Endbericht<br />
Förderer:<br />
II. Oldenburgischer Deichband<br />
Franz-Schubert-Str. 31<br />
26919 Brake<br />
(für die niedersächsischen Hauptdeichverbände)<br />
&<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
im Niedersächsischen Umweltministerium für Umwelt und Klimaschutz<br />
Archivstr. 2<br />
30129 Hannover<br />
Projektpartner:<br />
Kleyer Umweltplanung<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Universität Oldenburg, AG Landschaftsökologie<br />
Projektkoordination:<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Dipl.-Ing. Martin Sprötge<br />
Dipl.-Landschaftsökol. Antje Bremermann<br />
Projektnummer: P 1840<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong> Klein-Zetel 22, 26939 Ovelgönne-Frieschenmoor<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
Tel.: 04737 / 8113-0, Fax: 04737 / 8113-29<br />
Rembertistraße 29 / 30, 28203 Bremen<br />
Tel.: 0421 / 33 75 2-0, Fax: 0421 / 33 75 2-33<br />
frieschenmoor@pgg.de / bremen@pgg.de<br />
www.pgg.de
Inhalt Seite V<br />
INHALTSVERZEICHNIS (BIS 2. EBENE)<br />
1 Zusammenfassung ....................................................................................... 1<br />
2 Anlass und Zielsetzung ................................................................................ 6<br />
2.1 Anlass ............................................................................................................. 6<br />
2.2 Zielsetzung ..................................................................................................... 6<br />
3 Betrachtungsraum ........................................................................................ 9<br />
3.1 Lage ................................................................................................................ 9<br />
3.2 Allgemeine Beschreibung................................................................................ 9<br />
4 Teilprojekt 1A: Dokumentation und Analyse der<br />
Ausgangssituation sowie Aufbereitung der Informationen für die<br />
Teilprojekte 2 und 3 .................................................................................... 12<br />
4.1 Anlass und Zielsetzung des Teilprojektes 1A ................................................ 12<br />
4.2 Beschreibung des aktuellen Zustandes und der Entwicklung der<br />
Aussendeichsflächen .................................................................................... 13<br />
4.3 Auswahl der Untersuchungsgebiete .............................................................. 42<br />
4.4 Dokumentation der Sturmfluten ..................................................................... 50<br />
4.5 Datenaufbereitung für die statistische Auswertung ........................................ 59<br />
4.6 Fazit Teilprojekt 1A ....................................................................................... 59<br />
4.7 Literatur ......................................................................................................... 61<br />
5 Teilprojekt 2: Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen,<br />
Biomasseproduktion und <strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der<br />
Küste und Ästuare ...................................................................................... 64<br />
5.1 Anlass und Zielsetzung ................................................................................. 64<br />
5.2 Teilprojekt 2A: Biomasseproduktion niedersächsischer Salzwiesen<br />
und Brackwasserröhrichte in Abhängigkeit von Umweltbedingungen ............ 64<br />
5.3 Teilprojekt 2B: <strong>Treibsel</strong>aufkommen am Deichfuß bei Sturmfluten in<br />
Abhängigkeit von der Biomasseproduktion des Vorlandes ............................ 94<br />
5.4 Fazit ............................................................................................................ 113<br />
5.5 Literaturverzeichnis ..................................................................................... 115<br />
6 Ergebnisbericht Teilprojekt 3: Habitatmodelle für<br />
charakteristische Vogelarten der niedersächsischen Salzwiese .......... 120<br />
6.1 Anlass und Zielsetzung ............................................................................... 120<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite VI Inhalt<br />
6.2 Rastvögel .................................................................................................... 120<br />
6.3 Brutvögel ..................................................................................................... 125<br />
6.4 Vegetationsstruktur ..................................................................................... 138<br />
6.5 Nahrungsangebot ........................................................................................ 142<br />
6.6 Gesamtdiskussion ....................................................................................... 150<br />
6.7 Fazit ............................................................................................................ 151<br />
6.8 Literatur ....................................................................................................... 153<br />
7 Teilprojekt 1B: Entwicklung und Bewertung von Managementstrategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung .......................................................... 154<br />
7.1 Anlass und Zielsetzung des Teilprojekts 1B ................................................ 154<br />
7.2 „Schwerpunktbereiche“ Vorlandmanagement Treisbselreduzierung ............ 154<br />
7.3 Management-Optionen ................................................................................ 163<br />
7.4 Bewertung der Management-Optionen ........................................................ 184<br />
7.5 Modellhafte Managementkonzepte – Darstellung und Bewertung ............... 201<br />
7.6 Fazit ............................................................................................................ 280<br />
7.7 Literatur ....................................................................................................... 283<br />
8 Gesamtfazit ................................................................................................ 286<br />
9 Ausblick ..................................................................................................... 291<br />
10 Anhang....................................................................................................... 293<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Inhalt Seite VII<br />
INHALTSVERZEICHNIS (ALLE EBENEN)<br />
1 Zusammenfassung ....................................................................................... 1<br />
2 Anlass und Zielsetzung ................................................................................ 6<br />
2.1 Anlass ............................................................................................................. 6<br />
2.2 Zielsetzung ..................................................................................................... 6<br />
3 Betrachtungsraum ........................................................................................ 9<br />
3.1 Lage ................................................................................................................ 9<br />
3.2 Allgemeine Beschreibung................................................................................ 9<br />
3.2.1 Festlandsküste .............................................................................................. 10<br />
3.2.2 Ästuare von Ems, Elbe und Weser ................................................................ 10<br />
4 Teilprojekt 1A: Dokumentation und Analyse der Ausgangssituation<br />
sowie Aufbereitung der Informationen für die<br />
Teilprojekte 2 und 3 .................................................................................... 12<br />
4.1 Anlass und Zielsetzung des Teilprojektes 1A ................................................ 12<br />
4.2 Beschreibung des aktuellen Zustandes und der Entwicklung der<br />
Aussendeichsflächen .................................................................................... 13<br />
4.2.1 Festlandsküste .............................................................................................. 13<br />
4.2.1.1 Aktueller naturschutzrechtlicher Status ......................................................... 13<br />
4.2.1.2 Aktuelle Vorlandgrössen ............................................................................... 14<br />
4.2.1.3 Entwicklung der Vorlandgrössen ................................................................... 14<br />
4.2.1.4 Aktueller Zustand des Bodens ...................................................................... 15<br />
4.2.1.5 Aktuelle Landnutzung .................................................................................... 15<br />
4.2.1.6 Entwicklung der Landnutzung ....................................................................... 17<br />
4.2.1.7 Aktuelle Vegetation ....................................................................................... 19<br />
4.2.1.8 Entwicklung der Vegetation ........................................................................... 20<br />
4.2.1.9 Entwicklung von <strong>Treibsel</strong>mengen und Entsorgungskosten ............................ 22<br />
4.2.2 Ästuare von Elbe, Weser und Ems ................................................................ 23<br />
4.2.2.1 Aktueller naturschutzrechtlicher Status ......................................................... 23<br />
4.2.2.2 Aktuelle Vorlandgrössen ............................................................................... 26<br />
4.2.2.3 Entwicklung der Vorlandgrössen ................................................................... 27<br />
4.2.2.4 Aktueller Zustand des Bodens ...................................................................... 28<br />
4.2.2.5 Aktuelle Landnutzung .................................................................................... 28<br />
4.2.2.6 Entwicklung der Landnutzung ....................................................................... 32<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite VIII Inhalt<br />
4.2.2.7 Aktuelle Vegetation ....................................................................................... 33<br />
4.2.2.8 Entwicklung der Vegetation ........................................................................... 36<br />
4.2.2.9 Entwicklung von <strong>Treibsel</strong>mengen und Entsorgungskosten ............................ 38<br />
4.2.3 Übersicht über die eingeworbenen GIS-Datensätze ...................................... 40<br />
4.3 Auswahl der Untersuchungsgebiete .............................................................. 42<br />
4.3.1 Einleitung ...................................................................................................... 42<br />
4.3.2 Methodik ....................................................................................................... 43<br />
4.3.3 Ergebnisse .................................................................................................... 43<br />
4.4 Dokumentation der Sturmfluten ..................................................................... 50<br />
4.4.1 Einleitung ...................................................................................................... 50<br />
4.4.2 Methode ........................................................................................................ 51<br />
4.4.3 Ergebnisse .................................................................................................... 54<br />
4.4.3.1 Dokumentation der Sturmfluten ..................................................................... 54<br />
4.4.3.2 Dokumentation des <strong>Treibsel</strong>anfalls ................................................................ 55<br />
4.4.4 Diskussion ..................................................................................................... 58<br />
4.5 Datenaufbereitung für die statistische Auswertung ........................................ 59<br />
4.6 Fazit Teilprojekt 1A ....................................................................................... 59<br />
4.7 Literatur ......................................................................................................... 61<br />
5 Teilprojekt 2: Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen,<br />
Biomasseproduktion und <strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der<br />
Küste und Ästuare ...................................................................................... 64<br />
5.1 Anlass und Zielsetzung ................................................................................. 64<br />
5.2 Teilprojekt 2A: Biomasseproduktion niedersächsischer Salzwiesen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
und Brackwasserröhrichte in Abhängigkeit von Umweltbedingungen ............ 64<br />
5.2.1 Einleitung ...................................................................................................... 64<br />
5.2.1.1 Zonierung der Salzwiese und Umweltbedingungen ....................................... 66<br />
5.2.1.2 Einfluss der Umwelt auf die Biomasseproduktion in Salzwiesen ................... 67<br />
5.2.2 Methodik ....................................................................................................... 68<br />
5.2.2.1 Untersuchungsgebiete .................................................................................. 68<br />
5.2.2.2 Biomasse-Entnahme ..................................................................................... 70<br />
5.2.2.3 Frequenzanalysen ......................................................................................... 72<br />
5.2.2.4 Streuverlust (Dekomposition) ........................................................................ 73<br />
5.2.2.5 Bodenparameter Salzwiesen ......................................................................... 74<br />
5.2.2.6 Grundwassermessungen .............................................................................. 75<br />
5.2.2.7 Statistische Analysen .................................................................................... 75
Inhalt Seite IX<br />
5.2.3 Ergebnisse .................................................................................................... 76<br />
5.2.3.1 Die Standortbedingungen der Untersuchungsgebiete ................................... 76<br />
5.2.3.2 Die Produktivität der Salzwiesen in Abhängigkeit von abiotischen<br />
Bedingungen ................................................................................................. 80<br />
5.2.3.3 Einfluss der Landschaftspflege auf die Beziehung zwischen<br />
Produktivität der Salzwiesen und abiotischen Bedingungen .......................... 84<br />
5.2.3.4 Die Produktivität der Ästuare in Abhängigkeit von abiotischen<br />
Bedingungen und Nutzung ............................................................................ 85<br />
5.2.4 Diskussion .................................................................................................... 87<br />
5.2.4.1 Einfluss von Umweltfaktoren ......................................................................... 88<br />
5.2.4.2 Bedeutung der Geländehöhe für die Ausbildung der Pflanzen-<br />
gesellschaften ............................................................................................... 90<br />
5.2.4.3 Auswirkung der Nutzung auf die Produktivität von Salzwiesen und<br />
Ästuaren ....................................................................................................... 91<br />
5.3 Teilprojekt 2B: <strong>Treibsel</strong>aufkommen am Deichfuß bei Sturmfluten in<br />
Abhängigkeit von der Biomasseproduktion des Vorlandes ............................ 94<br />
5.3.1 Einleitung ...................................................................................................... 94<br />
5.3.2 Methodik ....................................................................................................... 96<br />
5.3.2.1 Erfassung und Aufbereitung der <strong>Treibsel</strong>mengendaten ................................. 96<br />
5.3.2.2 Transfer der Biomasseberechnungen von der Probeflächen-Ebene<br />
auf die Landschaftsebene ............................................................................. 96<br />
5.3.3 Ergebnisse .................................................................................................. 100<br />
5.3.3.1 <strong>Treibsel</strong>mengen .......................................................................................... 100<br />
5.3.3.2 Biomasseproduktion .................................................................................... 103<br />
5.3.3.3 <strong>Treibsel</strong>mengen an den Deichen der Festlandsküste und der Ästuare<br />
Ems, Elbe und Weser ................................................................................. 108<br />
5.3.4 Diskussion .................................................................................................. 110<br />
5.4 Fazit ............................................................................................................ 113<br />
5.5 Literaturverzeichnis ..................................................................................... 115<br />
6 Ergebnisbericht Teilprojekt 3: Habitatmodelle für<br />
charakteristische Vogelarten der niedersächsischen Salzwiese .......... 120<br />
6.1 Anlass und Zielsetzung ............................................................................... 120<br />
6.2 Rastvögel .................................................................................................... 120<br />
6.2.1 Singvögel .................................................................................................... 120<br />
6.2.1.1 Methodik ..................................................................................................... 121<br />
6.2.1.2 Ergebnisse .................................................................................................. 121<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite X Inhalt<br />
6.2.2 Gänse ......................................................................................................... 122<br />
6.2.2.1 Methodik ..................................................................................................... 122<br />
6.2.2.2 Ergebnisse .................................................................................................. 123<br />
6.2.3 Diskussion Rastvögel .................................................................................. 124<br />
6.3 Brutvögel ..................................................................................................... 125<br />
6.3.1 Revierkartierung Brutvögel .......................................................................... 125<br />
6.3.1.1 Methodik ..................................................................................................... 125<br />
6.3.1.2 Ergebnisse .................................................................................................. 127<br />
6.3.1.3 Diskussion ................................................................................................... 129<br />
6.3.2 Detailuntersuchung Brutvögel ..................................................................... 130<br />
6.3.2.1 Methodik ..................................................................................................... 130<br />
6.3.2.2 Ergebnisse .................................................................................................. 132<br />
6.3.2.3 Diskussion ................................................................................................... 133<br />
6.3.3 Prädation ..................................................................................................... 134<br />
6.3.3.1 Methodik ..................................................................................................... 134<br />
6.3.3.2 Ergebnisse .................................................................................................. 135<br />
6.3.3.3 Diskussion ................................................................................................... 137<br />
6.4 Vegetationsstruktur ..................................................................................... 138<br />
6.4.1 Methodik ..................................................................................................... 138<br />
6.4.2 Ergebnisse .................................................................................................. 138<br />
6.4.3 Diskussion ................................................................................................... 141<br />
6.5 Nahrungsangebot ........................................................................................ 142<br />
6.5.1 Methodik ..................................................................................................... 142<br />
6.5.2 Ergebnisse .................................................................................................. 144<br />
6.5.3 Diskussion ................................................................................................... 149<br />
6.6 Gesamtdiskussion ....................................................................................... 150<br />
6.7 Fazit ............................................................................................................ 151<br />
6.8 Literatur ....................................................................................................... 153<br />
7 Teilprojekt 1B: Entwicklung und Bewertung von Managementstrategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung .......................................................... 154<br />
7.1 Anlass und Zielsetzung des Teilprojekts 1B ................................................ 154<br />
7.2 „Schwerpunktbereiche“ Vorlandmanagement Treisbselreduzierung ............ 154<br />
7.2.1 Einleitung .................................................................................................... 154<br />
7.2.2 Methodik ..................................................................................................... 156<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Inhalt Seite XI<br />
7.2.2.1 Erzeugung von standardisierten Deichabschnitten ...................................... 156<br />
7.2.2.2 Berechnung der stehenden Biomasse von Vorlandabschnitten ................... 156<br />
7.2.2.3 Ermittlung von “<strong>Treibsel</strong>-Schwerpunktbereichen“ ........................................ 158<br />
7.2.3 Ergebnisse .................................................................................................. 159<br />
7.2.3.1 Überblick ..................................................................................................... 159<br />
7.2.3.2 „<strong>Treibsel</strong>-Schwerpunktbereiche“ .................................................................. 160<br />
7.2.4 Diskussion .................................................................................................. 163<br />
7.3 Management-Optionen ............................................................................... 163<br />
7.3.1 Einleitung .................................................................................................... 163<br />
7.3.2 Methodik ..................................................................................................... 164<br />
7.3.3 Ergebnisse .................................................................................................. 165<br />
7.3.4 Diskussion .................................................................................................. 177<br />
7.4 Bewertung der Management-Optionen ........................................................ 184<br />
7.4.1 Einleitung .................................................................................................... 184<br />
7.4.2 Methodik ..................................................................................................... 184<br />
7.4.3 Ergebnisse .................................................................................................. 188<br />
7.4.4 Diskussion .................................................................................................. 197<br />
7.5 Modellhafte Managementkonzepte – Darstellung und Bewertung ............... 201<br />
7.5.1 Einleitung .................................................................................................... 201<br />
7.5.2 Methodik ..................................................................................................... 201<br />
7.5.2.1 Flächenauswahl .......................................................................................... 201<br />
7.5.2.2 Entwicklung Modellhafter Managementkonzepte ........................................ 202<br />
7.5.2.3 Bewertung Modellhafter Managementkonzepte .......................................... 203<br />
7.5.3 Ergebnisse .................................................................................................. 205<br />
7.5.3.1 Vorlandflächenauswahl für Modellhafte Managementkonzepte ................... 205<br />
7.5.3.2 Modellfläche „Nordender Außengroden“ ..................................................... 208<br />
7.5.3.2.1 Ausgangssituation ....................................................................................... 208<br />
7.5.3.2.2 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Kultureinfluss“ ..................... 212<br />
7.5.3.2.3 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Natürliche Dynamik“ ............ 219<br />
7.5.3.2.4 Vergleich der modellhaften Managementkonzepte ...................................... 226<br />
7.5.3.3 Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“ ................................................... 227<br />
7.5.3.3.1 Ausgangssituation ....................................................................................... 227<br />
7.5.3.3.2 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Kultureinfluss“ ..................... 231<br />
7.5.3.3.3 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Natürliche Dynamik“ ............ 238<br />
7.5.3.3.4 Vergleich der modellhaften Managementkonzepte ...................................... 245<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XII Inhalt<br />
7.5.3.4 Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“ ................................................. 246<br />
7.5.3.4.1 Ausgangssituation ....................................................................................... 246<br />
7.5.3.4.2 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Kultureinfluss“ ..................... 251<br />
7.5.3.4.3 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Natürliche Dynamik“ ............ 257<br />
7.5.3.4.4 Vergleich der modellhaften Managementkonzepte ...................................... 264<br />
7.5.3.5 Modellfläche „Neuenlander Außendeich“ (Weser-Ästuar) ............................ 265<br />
7.5.3.5.1 Ausgangssituation ....................................................................................... 265<br />
7.5.3.5.2 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Kultureinfluss“ ..................... 268<br />
7.5.3.5.3 Modellhaftes Managementkonzept: Strategie „Natürliche Dynamik“ ............ 273<br />
7.5.3.5.4 Vergleich der modellhaften Managementkonzepte ...................................... 277<br />
7.5.4 Diskussion ................................................................................................... 279<br />
7.6 Fazit ............................................................................................................ 280<br />
7.7 Literatur ....................................................................................................... 283<br />
8 Gesamtfazit ................................................................................................ 286<br />
9 Ausblick ..................................................................................................... 291<br />
10 Anhang....................................................................................................... 293<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Inhalt Seite XIII<br />
ABILDUNGSVERZEICHNIS<br />
Abbildung 1: Projektaufbau ........................................................................................... 7<br />
Abbildung 2: Lage und Ausdehnung des Betrachtungsraums an der nieder-<br />
sächsischen Nordseeküste ....................................................................... 9<br />
Abbildung 3: Übersicht über den Teilbereich Festlandsküste ...................................... 10<br />
Abbildung 4: Übersicht über den Teilbereich Ästuare .................................................. 11<br />
Abbildung 5: Entsorgte <strong>Treibsel</strong>mengen an der niedersächsischen Haupt-<br />
deichlinie der Festlandküste sowie zum Vergleich der Ästuare .............. 23<br />
Abbildung 6: Entsorgte <strong>Treibsel</strong>mengen an der niedersächsischen Haupt-<br />
deichlinie der Ästuare sowie zum Vergleich der Festlandsküste ............. 39<br />
Abbildung 7: Lage des Untersuchungsgebietes Leybucht ........................................... 46<br />
Abbildung 8: Lage des Untersuchungsgebietes Norderland ........................................ 46<br />
Abbildung 9: Lage der Untersuchungsgebiete im Jadebusen ...................................... 47<br />
Abbildung 10: Lage der Untersuchungsgebiete auf der West- und Ostseite der<br />
Weser..................................................................................................... 50<br />
Abbildung 11: Erwartungen zur Ausprägung der Umweltfaktoren in Salzwiesen ........... 67<br />
Abbildung 12: Lage der Untersuchungsgebiete der Salzwiesen .................................... 69<br />
Abbildung 13: Lage der Untersuchungsgebiete im Weserästuar ................................... 70<br />
Abbildung 14: Links: Beispiel eines fertig beprobten Rahmens. Rechts:<br />
Biomasse-Design und Aufteilung der Wiederholungen für den<br />
jeweiligen Zeitpunkt der Entnahme in Salzwiesenflächen. ...................... 71<br />
Abbildung 15: Exclosure zum Schutz vor Rinderbeweidung .......................................... 72<br />
Abbildung 16: Ausgebrachter Frequenzrahmen mit Einteilung in 25 Kästchen ............. 73<br />
Abbildung 17: Links: Litter Bags im Feld, durch Draht gesichert. Rechts:<br />
Schema des Litter Bags-Versuchsaufbaus. ............................................ 73<br />
Abbildung 18: Stechzylinder mit definiertem Volumen und Einschlag von zwei<br />
Zylindern in die Bodenwand ................................................................... 74<br />
Abbildung 19 a-i: Streuung von Umweltvariablen in den Untersuchungsgebieten<br />
mit Hilfe von sog. Boxplots ..................................................................... 77<br />
Abbildung 20: Beziehung zwischen Geländehöhe und mittlerem Grundwasser-<br />
stand sowie Salzgehalt des Grundwassers ............................................ 78<br />
Abbildung 21 a-d: Streuung von Umweltvariablen in den Pflanzengemeinschaften<br />
der Salzwiesen ....................................................................................... 80<br />
Abbildung 22: Links: Streumaße der oberirdischen Nettoprimärproduktion<br />
(ANPP) in ungenutzten Bereichen oder in Exclosures, bezogen<br />
auf die Pflanzengemeinschaften der Salzwiese. Rechts: ANPP in<br />
Abhängigkeit von Nährstoffen, sowie Grundwasser. ............................... 81<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XIV Inhalt<br />
Abbildung 23: Links: stehende Biomasse im Sommer 2007 lebend u. tot ohne<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzung pro Vegetationseinheit. Rechts: Stehende oberirdische<br />
Biomasse in Abhängigkeit von Nährstoffen sowie Grundwasser. ........... 82<br />
Abbildung 24: Abgestorbene und lebende Biomasse in Abhängigkeit von<br />
Nährstoffen sowie Grundwassertiefe und Salzgehalt .............................. 83<br />
Abbildung 25: Streuung von Parametern des Streuabbaus in den Pflanzen-<br />
gemeinschaften der Salzwiesen. Links: Zersetzung von Heu als<br />
Standard-Streu; Mitte: Zersetzung der nativen Streu. Rechts:<br />
Geschätzter Rest der Biomasse, die im Herbst gemessen wurde........... 84<br />
Abbildung 26: Rechts: Einfluss der Beweidung und Mahd. Links: Westerhever<br />
Marsch in Schleswig-Holstein.. ............................................................... 85<br />
Abbildung 27: Streuung der Umweltvariablen in den Pflanzengemeinschaften<br />
der Ästuare ............................................................................................. 86<br />
Abbildung 28: Streuung von Biomasseparametern in den Pflanzengemein-<br />
schaften der Ästuare .............................................................................. 87<br />
Abbildung 29: Verschneidung der Informationen der Vorlandflächen und der<br />
Treibelmengen am Deichfuß ................................................................ 100<br />
Abbildung 30: Verteilung der <strong>Treibsel</strong>-Mengenkategorien entlang der Haupt-<br />
deichlinie der niedersächsischen Küste und der Ästuare Ems,<br />
Elbe und Weser nach den Sturmfluten am 01.11.2006 und<br />
09.11.2007 ........................................................................................... 101<br />
Abbildung 31: Stehende Biomasse Sommer 2007, Vorlandbereich „Norderland“ ........ 104<br />
Abbildung 32: Stehende Biomasse Herbst 2006, Vorlandbereich „Norderland“ ........... 104<br />
Abbildung 33: Landnutzung, Vorlandbereich „Norderland“ .......................................... 105<br />
Abbildung 34: Stehende Biomasse Sommer 2007, Vorlandbereich „Strohauser<br />
Plate“ .................................................................................................... 106<br />
Abbildung 35: Landnutzung, Vorlandbereich „Strohauser Plate“ ................................. 106<br />
Abbildung 36: Geschätzte stehende Biomasse auf den Vorländern der<br />
niedersächsischen Festlandsküste einschließlich der Ästuare .............. 107<br />
Abbildung 37: Wahrscheinlichkeit von <strong>Treibsel</strong>mengen an der Küste in<br />
Abhängigkeit von der stehenden Biomasse im Vorland ........................ 109<br />
Abbildung 38: Lage der Untersuchungsgebiete ........................................................... 125<br />
Abbildung 39: Rotschenkel auf Gelege und Wiesenpieper-Gelege ............................. 131<br />
Abbildung 40: Kunstgelege aus einem Knetgummi-Ei und 3 Wachteleiern ................. 134<br />
Abbildung 41: Vergleich des täglichen Prädationsrisikos zwischen den<br />
Untersuchungsgebieten an Kunstnestern im Jahr 2008 ........................ 136<br />
Abbildung 42: Zeitlicher Verlauf der Prädationsraten in den sechs<br />
Untersuchungsgebieten im Jahr 2008 .................................................. 137
Inhalt Seite XV<br />
Abbildung 43: Methodik zur Analyse der Vegetationsstruktur ...................................... 138<br />
Abbildung 44: Dichte der Vegetation in verschiedenen Höhenschichten bei<br />
unbewirtschafteten Andel-Rasen und Quecken-Rasen ........................ 141<br />
Abbildung 45: Einfluss der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Lichteinfall von<br />
Andel-Rasen und Quecken-Rasen ....................................................... 141<br />
Abbildung 46: Vergleich der Insekten aus Bodenfallen der Jahre 2007 und 2008<br />
je Nutzungsform ................................................................................... 147<br />
Abbildung 47: Mittelwerte der Eindringwiderstände pro Untersuchungsfläche<br />
und die mittlere Individuenanzahl an Krebstieren pro Woche ............... 149<br />
Abbildung 48: Ermittlung von Schwerpunktbereichen für Vorlandmanagement<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung ........................................................................ 155<br />
Abbildung 49: Streuung der Werte der stehenden Biomasse Herbst (kg/lfd. m)<br />
an der Festlandsküste und der Ästuare im Vergleich ............................ 157<br />
Abbildung 50: Streuung aller Werte der stehenden Biomasse Herbst pro Deich-<br />
abschnitt und Zuordnung des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung ......... 158<br />
Abbildung 51: Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung von Vorlandabschnitten,<br />
Mittelwerte des <strong>Treibsel</strong>anfalls nach den Novemberfluten der<br />
Jahre 2006 und 2007 und „<strong>Treibsel</strong>-Schwerpunktbereiche“ .................. 162<br />
Abbildung 52: Bewertungsgrundlage der naturschutzfachliche Bewertung der<br />
Brut- und Rastvogelarten...................................................................... 188<br />
Abbildung 53: Verhältnis von Biomassereduzierung zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung ............. 198<br />
Abbildung 54: Lage der Modellflächen des Norderlandes, westlich gelegen<br />
„Hilgenrieder Außengroden“ und östlich gelegen „Neßmersieler<br />
Außengroden“ ...................................................................................... 206<br />
Abbildung 55: Lage der Modellfläche im südwestlichen Jadebusen „Nordender<br />
Außengroden“ ...................................................................................... 206<br />
Abbildung 56: Lage der Modellfläche auf der rechten Weserseite „Neuenlander<br />
Außendeich“ ......................................................................................... 207<br />
Abbildung 57: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 209<br />
Abbildung 58: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Nordender Außen-<br />
groden“) ............................................................................................... 210<br />
Abbildung 59: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 210<br />
Abbildung 60: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Nordender Außen-<br />
groden“) ............................................................................................... 211<br />
Abbildung 61: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 212<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XVI Inhalt<br />
Abbildung 62: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
(Modellfläche „Nordender Außengroden“) ............................................ 213<br />
Abbildung 63: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 214<br />
Abbildung 64: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 215<br />
Abbildung 65: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Nordender Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ................................... 216<br />
Abbildung 66: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche<br />
„Nordender Außengroden“ ................................................................... 218<br />
Abbildung 67: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ (Modellfläche „Nordender Außengroden) .............................. 220<br />
Abbildung 68: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“) ............................................................................................. 221<br />
Abbildung 69: Entwicklungsprognose Biomasse Vegetation (Modellfläche<br />
„Nordender Außengroden“, Managementkonzept „Strategie<br />
Natürliche Dynamik“) ............................................................................ 222<br />
Abbildung 70: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Nordender Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“) .......................... 223<br />
Abbildung 71: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ der<br />
Modellfläche „Nordender Außengroden“ ............................................... 225<br />
Abbildung 72: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 228<br />
Abbildung 73: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 229<br />
Abbildung 74: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“) ................................................................ 229<br />
Abbildung 75: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 230<br />
Abbildung 76: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 231<br />
Abbildung 77: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“<br />
(Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“) .......................................... 232
Inhalt Seite XVII<br />
Abbildung 78: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 233<br />
Abbildung 79: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 234<br />
Abbildung 80: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ................................... 235<br />
Abbildung 81: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“ ................................................................. 237<br />
Abbildung 82: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“) .......................... 239<br />
Abbildung 83: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“, Managementkonzept „Strategie<br />
Natürliche Dynamik“) ............................................................................ 240<br />
Abbildung 84: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“) ............................................................................................. 241<br />
Abbildung 85: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“) .......................... 242<br />
Abbildung 86: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ der<br />
Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“ ............................................ 244<br />
Abbildung 87: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 248<br />
Abbildung 88: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 248<br />
Abbildung 89: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Neßmer-<br />
sieler Außengroden“) ............................................................................ 249<br />
Abbildung 90: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 249<br />
Abbildung 91: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“) ..................................................................................... 250<br />
Abbildung 92: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“<br />
(Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“) ........................................ 251<br />
Abbildung 93: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 252<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XVIII Inhalt<br />
Abbildung 94: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neßmersieler<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ........... 253<br />
Abbildung 95: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ................................... 254<br />
Abbildung 96: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche<br />
„Neßmersieler Außengroden“ ............................................................... 256<br />
Abbildung 97: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“) ........................ 258<br />
Abbildung 98: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Neßmer-<br />
sieler Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“) ............................................................................................. 259<br />
Abbildung 99: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“) ............................................................................................. 260<br />
Abbildung 100: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“) .......................... 261<br />
Abbildung 101: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ der<br />
Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“ .......................................... 263<br />
Abbildung 102: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“) ........................................................................................ 266<br />
Abbildung 103: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“) ........................................................................................ 267<br />
Abbildung 104: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche<br />
„Neuenlander Außendeich“) ................................................................. 267<br />
Abbildung 105: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“) ........................................................................................ 268<br />
Abbildung 106: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“<br />
(Modellfläche „Neuenlander Außendeich“) ........................................... 269<br />
Abbildung 107: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ............. 270<br />
Abbildung 108: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ............. 271<br />
Abbildung 109: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“) ................................... 272
Inhalt Seite XIX<br />
Abbildung 110: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“) ........................... 274<br />
Abbildung 111: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche<br />
„Neuenlander Außendeich“, Managementkonzept „Strategie<br />
Natürliche Dynamik“) ............................................................................ 275<br />
Abbildung 112: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“) ............................................................................................. 276<br />
Abbildung 113: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes<br />
TABELLENVERZEICHNIS<br />
„Naturlandschaft“ (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“) .......................... 277<br />
Tabelle 1: Aktuelle Landnutzung ............................................................................. 16<br />
Tabelle 2: Entwicklung der Nutzungsanteile der Vorländer an der<br />
niedersächsischen Festlandsküste im Zeitraum 1987-2003 ................... 19<br />
Tabelle 3: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an der<br />
niedersächsischen Festlandsküste ......................................................... 20<br />
Tabelle 4: Entwicklung der Flächenanteile der Vegetationstypen mit<br />
vermutetem starkem Anteil an der <strong>Treibsel</strong>produktion in der<br />
Leybucht im Zeitraum 1995-2004 ........................................................... 21<br />
Tabelle 5: Schutzgebiete der Ästuarvorländer ........................................................ 24<br />
Tabelle 6: Größe der Vorlandflächen der Ästuare von Elbe, Weser und Ems ......... 26<br />
Tabelle 7 : Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des<br />
Elbeästuars ............................................................................................ 29<br />
Tabelle 8: Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des<br />
Weserästuars ......................................................................................... 31<br />
Tabelle 9: Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des<br />
Emsästuars ............................................................................................ 31<br />
Tabelle 10: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den<br />
Außendeichsflächen im Elbästuar .......................................................... 34<br />
Tabelle 11: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den<br />
Außendeichsflächen im Weserästuar ..................................................... 35<br />
Tabelle 12: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den<br />
Außendeichsflächen im Emsästuar ........................................................ 36<br />
Tabelle 13: Vorliegende GIS-Datensätze .................................................................. 40<br />
Tabelle 14: Auf ihre Eignung als Probeflächen für das Projekt untersuchte<br />
Vorlandabschnitte der Festlandsküste .................................................... 44<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XX Inhalt<br />
Tabelle 15: In den Ästuaren hauptsächlich zu erwartende Nutzungstypen ................ 48<br />
Tabelle 16: Auf ihre Eignung als Probeflächen für das Projekt untersuchte<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Vorlandabschnitte des Weserästuars (oligohaliner Bereich) ................... 49<br />
Tabelle 17: Schlüssel zur Kategorisierung des <strong>Treibsel</strong>anfalls .................................. 52<br />
Tabelle 18: Zur Erklärung des beobachteten <strong>Treibsel</strong>aufkommens<br />
verwendete Variablen ............................................................................. 54<br />
Tabelle 19: Übersicht über geschätzte angefallene <strong>Treibsel</strong>mengen und<br />
geschätzte Entsorgungskosten durch die Sturmfluten am<br />
01.11.2006 und 09.11.2007 an der Festlandsküste ................................ 57<br />
Tabelle 20: Übersicht über geschätzte angefallene <strong>Treibsel</strong>mengen und<br />
geschätzte Entsorgungskosten durch die Sturmflut vom<br />
01.11.2006 in den Ästuaren.................................................................... 58<br />
Tabelle 21: Übersicht über Salzwiesenliteratur ......................................................... 65<br />
Tabelle 22: Verteilung der Probeflächen für den Salzwiesendatensatz ..................... 69<br />
Tabelle 23: Verteilung der Probeflächen für den Datensatz des Ästuars ................... 70<br />
Tabelle 24: Verteilung der Vegetationsaufnahmen in Salzwiesen auf TMAP-<br />
Typen und daraus aggregierte Einheiten ................................................ 79<br />
Tabelle 25: Angaben anderer Autoren zur stehenden Biomasse von<br />
Salzwiesen ............................................................................................. 88<br />
Tabelle 26: Zuordnung von TMAP- und Biotoptypen zu Vegetationseinheiten .......... 97<br />
Tabelle 27: Zuordnung von Nutzungsformen zu 'Nutzungstypen' .............................. 98<br />
Tabelle 28: Überblick über die Vegetationseinheiten im Gesamt-Datensatz ........... 102<br />
Tabelle 29: Überblick über die Nutzungstypen bzw. -intensitäten im Gesamt-<br />
Datensatz ............................................................................................. 102<br />
Tabelle 30: Übersicht der Datensätzen zu den Sturmfluten 2006 und 2007 ............ 103<br />
Tabelle 31: Im Projekt bearbeitete überwinternde Singvogelarten........................... 121<br />
Tabelle 32: Präferenz-Indexwerte überwinternde Singvögel ................................... 122<br />
Tabelle 33: Präferenz-Indexwerte für Nonnen- und Ringelgans .............................. 123<br />
Tabelle 34: Indexwerte Nonnengans ....................................................................... 124<br />
Tabelle 35: Indexwerte Ringelgans ......................................................................... 124<br />
Tabelle 36: Revieranzahlen der wichtigsten Brutvogelarten .................................... 126<br />
Tabelle 37: Datengrundlage für Präferenzanalysen der Brutvogelarten,<br />
aufgeschlüsselt nach Nutzungsformen und Untersuchungs-<br />
gebieten ............................................................................................... 128<br />
Tabelle 38: Flächengröße und Vorkommen von Vegetationseinheiten in<br />
Nutzungsformen und Untersuchungsgebieten ...................................... 129<br />
Tabelle 39: Bestand Feldlerche und Wiesenpieper im Vergleich ............................. 131
Inhalt Seite XXI<br />
Tabelle 40: Datengrundlage für die Analyse der Gelegestandorte von<br />
Rotschenkel und Wiesenpieper nach Nutzungsformen ........................ 132<br />
Tabelle 41: Habitatparameter Rotschenkel ............................................................. 132<br />
Tabelle 42: Habitatparameter Wiesenpieper ........................................................... 133<br />
Tabelle 43: Habitatparameter Rotschenkelnester mit Schlupferfolg ........................ 133<br />
Tabelle 44: Anhand von Bissspuren festgestellte Prädatoren pro<br />
Untersuchungsgebiet ........................................................................... 135<br />
Tabelle 45: TMAP-Vegetationseinheiten, bei denen Analysen der<br />
Vegetationsstruktur durchgeführt wurden ............................................. 139<br />
Tabelle 46: Parameter zur Charakterisierung der Vegetationsstruktur .................... 139<br />
Tabelle 47: Ergebnisse Vegetationsstrukturmessungen je Nutzungsform ............... 140<br />
Tabelle 48: Übersicht über die Bodenfallenstandorte .............................................. 143<br />
Tabelle 49: Stark vereinfachte Übersicht über die in Bodenfallen<br />
festgestellten Tierartengruppen ............................................................ 145<br />
Tabelle 50: Festgestellte Laufkäferarten ................................................................. 146<br />
Tabelle 51: Indexwerte für Insekten ........................................................................ 147<br />
Tabelle 52: Indexwerte für Spinnentiere .................................................................. 148<br />
Tabelle 53: Indexwerte für Krebstiere ..................................................................... 148<br />
Tabelle 54: Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung mit Angabe der<br />
prognostizierten Biomassereduzierung ................................................. 167<br />
Tabelle 55: Wertebereiche der Klassifizierung der Differenz-Indexwerte ................ 187<br />
Tabelle 56: Naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung .............................................................................. 191<br />
Tabelle 57: Flächenauswahl modellhafte Managementkonzepte an der<br />
Festlandsküste ..................................................................................... 205<br />
Tabelle 58: Flächenauswahl modellhafte Managementkonzepte an den<br />
Ästuaren ............................................................................................... 207<br />
Tabelle 59: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften<br />
Managementkonzepte für die Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“ ...................................................................................... 226<br />
Tabelle 60: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften<br />
Managementkonzepte für die Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“ ...................................................................................... 245<br />
Tabelle 61: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften<br />
Managementkonzepte für die Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“ ...................................................................................... 264<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite XXII Inhalt<br />
Tabelle 62: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften<br />
ANHANG<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Managementkonzepte für die Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“ ......................................................................................... 278<br />
Anhang 1: Ausgewertete Literatur für Präferenz-Indexwerte der rastenden<br />
Gänse .................................................................................................. 293<br />
Anhang 2: Präferenz-Indexwerte Brutvögel ........................................................... 301<br />
Anhang 3: Literaturauswertung im Rahmen des Teilprojektes 1B:<br />
KARTENVERZEICHNIS<br />
„Schilfmahd als Management-Option zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung in<br />
den Flussästuaren Niedersachsens – Auswirkungen auf<br />
Röhrichtbrüter und naturschutzfachliche Bewertung ............................. 306<br />
Karte 1a: <strong>Treibsel</strong>mengen nach den Sturmfluten 01.11.2006 und 09.11.2007 &<br />
stehende Biomasse im Herbst; westlicher Betrachtungsraum (Herbrum bis<br />
Bremerhaven)<br />
Karte 1b: <strong>Treibsel</strong>mengen nach den Sturmfluten 01.11.2006 und 09.11.2007 &<br />
stehende Biomasse im Herbst; östlicher Betrachtungsraum (Bremerhaven<br />
bis Geesthacht)
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 1<br />
1 ZUSAMMENFASSUNG<br />
Vorliegender Bericht ist der Endbericht des Forschungsvorhabens „Ökologische Grundlagen<br />
und naturschutzfachliche Bewertung von Strategien zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung“ (Projekt 10/05<br />
der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung). Die wesentlichen Inhalte sind:<br />
1. eine Dokumentation und Analyse der Ausgangssituation sowie der Sturmfluten vom<br />
01.11.2006 und 09.11.2007 (Teilprojekt 1A),<br />
2. die Darstellung der Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen, Biomasseproduktion<br />
und <strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der Küste und Ästuare (Teilprojekt 2),<br />
3. eine Analyse der kausalen Zusammenhänge zwischen den wichtigsten Habitatparametern<br />
und der Reaktion von Brut- und Rastvogelarten bezüglich der Nist- bzw.<br />
Rastplatzwahl anhand von Habitatmodellen (Teilprojekt 3),<br />
4. die Darstellung und Bewertung von Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
sowie von modellhaften Managementkonzepten (Teilprojekt 1B).<br />
zu 1.<br />
Dokumentation und Analyse der Ausgangssituation<br />
Es konnten umfassende Daten zur Beschreibung des aktuellen Zustandes und der<br />
Entwicklung von Größe der Vorlandflächen, Landnutzung, Vegetation und <strong>Treibsel</strong>mengen<br />
für die gesamten Vorländer der Festlandsküste sowie für die der Ästuare eingeholt werden.<br />
Diese Informationen wurden in einem geografischen Informationssystem aufbereitet und<br />
liegen nun als einheitlicher Datensatz für die gesamten niedersächsischen Vorländer vor.<br />
Für die Vorländer der niedersächsischen Festlandsküste ist festzustellen:<br />
Die Vorländer haben aktuell eine Ausdehnung von ca. 7.900 ha. Hiervon sind 1.450 ha<br />
(18 %) von Sommerdeichen umgeben.<br />
Die Größe der Vorländer hat in den letzten Jahrzehnten um ca. 1.400 ha zugenommen.<br />
Ursache sind überwiegend Landgewinnungsmaßnahmen.<br />
45 % der Vorlandfläche (inklusive der Sommerpolder) werden aktuell landwirtschaftlich<br />
genutzt.<br />
Ein flächendeckender Vergleich des Zustandes der Vegetation vor zehn oder 20 Jahren<br />
mit dem heutigen für die gesamte Festlandsküste ist auf der vorliegenden<br />
Datengrundlage nicht möglich, wohl aber für Teilgebiete. In der Leybucht nahm der<br />
Flächenanteil von Vegetationstypen mit hohem Anteil an der <strong>Treibsel</strong>produktion im<br />
Zeitraum 1995-2004 von 9 % auf 32 % zu (ohne Strandaster). Er liegt damit 2004 in der<br />
gleichen Größenordnung wie an der gesamten Festlandsküste.<br />
Im Zeitraum 1994/95-2009/10 beliefen sich die <strong>Treibsel</strong>mengen auf durchschnittlich<br />
37.000 m³ (Maximalwert rund 100.000 m³ (2006/07)), die Entsorgungskosten auf<br />
durchschnittlich 230.000 € (Maximalaufwand knapp 2 Mio. € (2007/08)).<br />
Für die Vorländer der Ästuare von Elbe, Weser und Ems ist festzustellen:<br />
Die Vorländer in den Ästuaren haben aktuell eine Ausdehnung von insgesamt 9.823 ha,<br />
wovon 3.606 ha Elbvorländer, 4.343 ha Weservorländer und 1.874 ha Emsvorländer<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 2 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
sind. Hiervon sind ca. 14 % (Elbe) bzw. 44 % (Weser) vor Sommerhochwässern<br />
geschützt. Für die Ems liegen hierzu keine Daten vor. (Angaben für die Elbe exkl.<br />
Schleswig-Holstein).<br />
Die Vorländer in den Ästuaren waren in den 1980er Jahren ca. 74 % (niedersächsische<br />
Seite der Elbe) bzw. 21 % (Weser) kleiner als Ende des 19. Jahrhunderts. Ursache sind<br />
Eindeichungen.<br />
Die Vorländer werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die ungenutzten Bereiche<br />
bestehen überwiegend aus Röhrichten und machen ca. 17 % (niedersächsische Seite<br />
der Elbe), 25 % (Weser) bzw. 27 % (Ems) aus. Reetmahd findet in Niedersachsen nur<br />
noch an der Weser statt.<br />
Die Röhrichtflächen der Ästuare haben in den letzten Jahrzehnten insgesamt<br />
zugenommen, wobei stromabwärts von Hamburg bzw. Brake eine deutliche Zunahme<br />
von 180 ha (Elbe) bzw. 230 ha (Weser), stromaufwärts hingegen eine leichte Abnahme<br />
von 30 ha (Elbe) bzw. 138 ha (Weser) zu verzeichnen ist.<br />
Im Zeitraum 1994/95-2009/10 beliefen sich die <strong>Treibsel</strong>mengen auf durchschnittlich<br />
55.000 m³ (Maximalwert rund 170.000 m³ (2006/07)), die Entsorgungskosten auf<br />
durchschnittlich 280.000 € (Maximalaufwand rund 824.000 € (2007/08)).<br />
Auf Grundlage der umfassenden Dokumentation und umfangreicher Vorkenntnisse wurden<br />
die am besten geeigneten Untersuchungsgebiete für die Freilanduntersuchungen der<br />
Teilprojekte 2 und 3 ausgewählt, bei denen unterschiedliche Nutzungsformen und<br />
-intensitäten sowie unterschiedliche Standorttypen vertreten sind. Diese liegen an der<br />
Festlandsküste im Bereich der Leybucht, des Norderlandes und im Jadebusen sowie im<br />
Weserästuar auf Höhe der Strohauser Plate.<br />
Dokumentation und Analyse der Sturmfluten<br />
Nach den sehr schweren Sturmfluten am 01.11.2006 und 09.11.2007 wurde unter Mithilfe<br />
der Deichverbände und des NLWKN der <strong>Treibsel</strong>anfall entlang der gesamten Hauptdeichlinie<br />
erfasst und dokumentiert. Es entstanden nach Angaben von Deichverbänden und NLWKN<br />
nach der Sturmflut am 01.11.2006 Entsorgungskosten von mind. 1,28 Mio. € für mind.<br />
165.500 m 3 <strong>Treibsel</strong>. Nach der Sturmflut am 09.11.2007 fielen mind. 79.500 m³ <strong>Treibsel</strong> an.<br />
Die gewonnenen Daten zur räumlichen Verteilung des <strong>Treibsel</strong>s wurden einer statistischen<br />
Auswertung zugeführt, um Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen <strong>Treibsel</strong>aufkommen<br />
einerseits und Umweltbedingungen, Biomasseproduktion andererseits zu analysieren.<br />
zu 2.<br />
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen, Biomasseproduktion und<br />
<strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der Küste und Ästuare ist festzustellen:<br />
Die Biomasseproduktion der Salzwiesen hängt erheblich von der Höhe und dem<br />
Salzgehalt des Grundwassers ab.<br />
Um die Biomasse durch Nutzung in Form von Mahd oder Beweidung effektiv zu<br />
reduzieren, muss auf den Salzwiesen der Festlandsküste die Besatzdichte mit Weidevieh<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 3<br />
zu 3.<br />
sehr hoch sein (bis zu 2-3 GV/ha) bzw. die Mahd am Ende der Vegetationsperiode<br />
erfolgen.<br />
Auf den mit Röhricht bestandenen Vorländern der Ästuare kann weder durch<br />
Wassermanagement die Produktivität eingeschränkt noch durch bisherige<br />
Nutzungsformen die Biomasse reduziert werden. Die Wintermahd verstärkt den<br />
Biomasseaufwuchs im folgenden Sommer, so dass bei Herbststurmfluten - also vor der<br />
Wintermahd - besonders hohe Biomassemenge zu besonders hohem <strong>Treibsel</strong>anfall<br />
führen können.<br />
Wenn die an Probeflächen gewonnenen Beziehungen zwischen Biomasseproduktion und<br />
Umweltbedingungen auf die Gesamtfläche der niedersächsischen Vorländer übertragen<br />
wird, so ergibt sich eine mittlere Gesamtmenge von 94.000 t Trockenmasse oder bei<br />
Annahme von 80 % Wassergehalt eine Menge von 752.000 t Frischmasse.<br />
Die Auswertung des <strong>Treibsel</strong>-Anfalls an den Deichen hat gezeigt, dass eine signifikante<br />
Korrelation zwischen der Biomasseproduktion des Vorlandes und der am Deich<br />
angeschwemmten <strong>Treibsel</strong>menge besteht. Dabei sind die Größe des Vorlandes und der<br />
Bestand an Vegetation mit besonders hoher Biomasseproduktion besonders wichtig.<br />
Bezüglich der Analyse der kausalen Zusammenhänge zwischen den wichtigsten Habitat-<br />
parametern und der Reaktion von Brut- und Rastvogelarten bezüglich der Nist- bzw.<br />
Rastplatzwahl anhand von Habitatmodellen ist festzustellen:<br />
zu 4.<br />
Es ist gelungen, für eine Vielzahl von Brut- und Rastvogelarten eine solide,<br />
Bewertungsgrundlage zu schaffen, die dazu genutzt werden kann, Maßnahmen zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel zu<br />
bewerten.<br />
Ferner konnten Einblicke in die Zusammenhänge von Vegetationstypen, deren Nutzung<br />
und dem Vorkommen von Brut- und Rastvogelarten gewonnen werden.<br />
Generelle Aussagen über die Auswirkungen von Managementmaßnahmen auf die<br />
Avifauna lassen sich nur bedingt treffen, da die Habitatansprüche der einzelnen Arten zu<br />
unterschiedlich sind. Die Auswirkungen sind somit jeweils von der betrachteten Art bzw.<br />
Artengruppe abhängig.<br />
Da die im Rahmen dieses Projektes generierten Bewertungsgrundlagen noch bei keiner<br />
Maßnahmenumsetzung evaluiert werden konnten, sollten Maßnahmen zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung mit einem aussagekräftigen Monitoring begleitet werden.<br />
Bezüglich der Entwicklung und Bewertung von Managementstrategien sind folgende Punkte<br />
festzuhalten:<br />
Es konnten 11 Vorlandbereiche identifiziert werden, die maßgeblich für lokal hohe<br />
<strong>Treibsel</strong>aufkommen verantwortlich sind. Für diese sog. „Schwerpunktbereiche“ wäre ein<br />
Management zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung am dringlichsten und effektivsten.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 4 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Es wurden insgesamt 15 Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung ausgearbeitet.<br />
Für diese Optionen wurde die potenziell erreichbare Biomassereduzierung prognostiziert<br />
und eine naturschutzfachliche Bewertung vorgenommen. Somit liegt mit diesem Bericht<br />
eine umfassende Planungs- und Diskussionsgrundlage für zukünftige Vorhaben eines<br />
<strong>Treibsel</strong>managements, aber auch für die Erstellung von Managementplänen gemäß § 7<br />
Abs. 3 NWattNPG vor.<br />
Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen<br />
beruht (Ausnahme „passiver Prozessschutz“) sowie ein naturschutzfachlich sinnvoll<br />
gestaltetes Beweidungsmanagement, wirken sich sowohl aus treibselreduzierender Sicht<br />
als auch hinsichtlich der Habitatansprüche der hier betrachteten Vogelarten überwiegend<br />
positiv aus.<br />
Reine Quecken-Rasen weisen gegenüber anderen Vegetationstypen der Salzwiese eine<br />
sehr hohe stehende Biomasse auf und sind auch aus naturschutzfachlicher Sicht eher<br />
als geringwertiger zu bewerten. Daher wirken sich Management-Optionen, die eine<br />
Entwicklung von Quecken-Rasen zu anderen Ausprägungen der oberen Salzwiese bzw.<br />
der unteren Salzwiese begünstigen, hinsichtlich aller Bewertungskriterien positiv aus.<br />
Ein Nebeneinander von Management-Optionen, die auf natürlichen Prozessen beruhen<br />
und solchen, die durch Landnutzung bedingt sind, kann bei einem Vorlandmanagement -<br />
je nach Zielsetzung des jeweiligen Betrachtungsraumes - durchaus sinnvoll sein.<br />
Anhand von modellhaften Managementkonzepten wurden exemplarisch Möglichkeiten<br />
eines Vorlandmanagements zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung für ausgewählte Vorlandbereiche<br />
dargestellt und die Auswirkungen dargelegt.<br />
Mit Managementkonzepten, welche vorwiegend auf natürlichen Prozessen beruhen,<br />
können im Vergleich zu Managementkonzepten, die vorwiegend durch Landnutzung<br />
bedingt sind, vergleichbare oder sogar höhere Biomassereduzierungen erreicht<br />
werden.<br />
In der Regel wirken sich die modellhaften Managementkonzepte der Strategie<br />
„Natürliche Dynamik“ positiver aus als die der Strategie „Kultureinfluss“, wobei dies<br />
für jedes Konzept und jede hier betrachtete Brut- und Rastvogelart differenziert zu<br />
betrachten ist.<br />
Auf Grundlage der Ergebnisse des vorliegenden Forschungsvorhabens ist ausblickend<br />
festzuhalten:<br />
Für ein umfassendes <strong>Treibsel</strong>management sind neben vorsorglich greifenden<br />
Maßnahmen (wie der Biomassereduzierung) auch Maßnahmen der Nachsorge (wie einer<br />
Verbesserung der Infrastruktur zur <strong>Treibsel</strong>abfuhr, der -deponierung und -verwertung)<br />
erforderlich.<br />
Im Zuge von Kompensationsmaßnahmen in Ästuaren, als Ausgleich oder Ersatz i.S.d.<br />
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, muss neben den naturschutzrechtlichen<br />
Aspekten die <strong>Treibsel</strong>problematik Berücksichtigung finden.<br />
Die Prognosen zur Effektivität und zu den naturschutzfachlichen Auswirkungen von den<br />
in dieser Forschungsarbeit dargelegten Management-Optionen und modellhaften<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 5<br />
Managementkonzepten zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung sind - insbesondere für solche, für die<br />
bislang kaum oder keine Praxiserfahrungen vorliegen - anhand von Feldversuchen im<br />
Rahmen von Pilot- oder Monitoringprojekten zu überprüfen.<br />
Forschungsbedarf wird vor allem hinsichtlich folgender Fragestellungen gesehen:<br />
der Erprobung von naturschutzfachlich verträglichen und treibselreduzierenden<br />
Beweidungsformen (Intensität und Zeitraum der Beweidung während und nach der<br />
Brutzeit),<br />
geeigneter Umsetzungsstrategien (wie auch Finanzierungsmöglichkeiten) von<br />
Restrukturierungsmaßnahmen ehemals bewirtschafteter und entwässerter<br />
Vorlandflächen mit dem Ziel, ein hohes Entwicklungspotenzial mit dem Ziel einer<br />
natürlichen Dynamik zu schaffen,<br />
der Verbreitungsgrenzen heimischer Auwaldarten in den stark anthropogen<br />
überprägten Ästuaren sowie der Eignung von Auwaldstreifen als <strong>Treibsel</strong>fänger bzw.<br />
Dämpfer von Wellen- und Strömungsenergie,<br />
der Ergänzung und Evaluierung der im Rahmen dieses Projektes ermittelten<br />
Indexwerte zur Bewertung der Auswirkungen von Managementstrategien auf Brut-<br />
und Rastvögel, insbesondere zur besseren Abbildung des Nutzungseinflusses,<br />
der Verwertung von Biomasse als Energieträger (technische und infrastrukturelle<br />
Umsetzbarkeit).<br />
Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit einem begleitenden Arbeitskreis unter<br />
Beteiligung folgender Vertreter durchgeführt:<br />
Umweltministerium für Umwelt und Klimaschutz<br />
(vertreten durch die Herren Dr. Rapsch, Horn und von Hammerstein)<br />
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz<br />
(vertreten durch Herrn Thorenz, NLWKN Norden)<br />
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer<br />
(vertreten durch Herrn Bunje)<br />
Wasserverbandstag e. V.<br />
(vertreten durch Herrn Hennies)<br />
Landkreise<br />
(vertreten durch Herrn Tuinmann, Landkreis Friesland)<br />
Niedersächsische Deichverbände<br />
(vertreten durch Herrn Hahlbom, Deichverband Osterstader Marsch)<br />
Mellumrat e. V.<br />
(vertreten durch Herrn Dr. Wrede)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 6 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
2 ANLASS UND ZIELSETZUNG<br />
2.1 ANLASS<br />
Die Außendeichsflächen der niedersächsischen Festlandsküste und Ästuare mit ihren<br />
Salzwiesen, Röhrichten und Grünländern sind naturnahe Elemente der Küstenlandschaft<br />
und aufgrund ihrer Weiträumigkeit und ihres floristischen und faunistischen Arteninventars<br />
von großer naturschutzfachlicher Bedeutung. Sie werden traditionell auch landwirtschaftlich<br />
in unterschiedlicher Weise genutzt und sind ebenfalls von großer Bedeutung für den<br />
Küstenschutz. Die unterschiedlichen Funktionen dieser Flächen (Küstenschutz, Naturschutz,<br />
Landwirtschaft) führten in der Vergangenheit zu intensiven Auseinandersetzungen über den<br />
Umgang mit diesen Flächen sowie die Folgen von Managementkonzepten, z.B. im Zuge der<br />
Etablierung des Nationalparks.<br />
Ein Aspekt dieser Auseinandersetzungen ist die Diskussion um das an den Deichen<br />
abgelagerte <strong>Treibsel</strong>. Allerdings wird diese Diskussion teilweise auf der Grundlage wenig<br />
belastbarer Daten geführt. Die Herkunft des <strong>Treibsel</strong>s, insbesondere der Biomasseaufwuchs<br />
in den Vorländern, Möglichkeiten der Reduzierung dieses Biomasseaufwuchses und<br />
entsprechende naturschutzfachliche Konsequenzen wurden bislang nicht umfassend<br />
dargestellt. Auf einer solchen Grundlage könnte jedoch ein mögliches „<strong>Treibsel</strong>-<br />
Management“ basieren. Ein solches Management ist vorstellbar als Teil einer Strategie des<br />
Integrierten Küstenzonen-Managements, also des abgestimmten Handelns verschiedener<br />
Akteure im Küstenraum.<br />
In seinem Beschluss vom 14.5.2004 hat der Niedersächsische Landtag den tendenziellen<br />
Anstieg der <strong>Treibsel</strong>mengen im Bereich der niedersächsischen Festlandsküste und der<br />
Ästuare festgestellt, die damit verbundenen Probleme für Küstenschutz und<br />
Deichunterhaltung dargestellt und die Landesregierung zur Durchführung eines<br />
Modellversuches aufgefordert, welcher in Form dieses Projektes umgesetzt wurde.<br />
2.2 ZIELSETZUNG<br />
Das Projekt „Ökologische Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung von Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung“ (Projekt 10/05 der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung, Laufzeit<br />
2006 – 2010, Verlängerung bis 2011) befasst sich mit dem an die Deiche der<br />
niedersächsischen Festlandsküste und Ästuare angeschwemmten <strong>Treibsel</strong> sowie der<br />
Möglichkeit einer <strong>Treibsel</strong>reduzierung durch entsprechendes Flächenmanagement im<br />
Deichvorland. Es sollen:<br />
die ökologischen Ursachen für die zeitlich und örtlich unterschiedlichen <strong>Treibsel</strong>-Mengen<br />
und ihr Zusammenhang mit der Produktivität der Vorländer erforscht werden,<br />
darauf aufbauend mögliche Strategien für ein <strong>Treibsel</strong>-Management entwickelt und<br />
diese möglichen Strategien naturschutzfachlich bewertet werden, so dass<br />
abschließend beispielhaft modellhafte Managementkonzepte für die detailliert<br />
untersuchten Teilgebiete aufgestellt werden können.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 7<br />
Die Ergebnisse des Projektes bilden somit die Basis für ein Handlungskonzept, das einer<br />
kontroversen Diskussion standhält und den naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen<br />
(NATURA 2000) Rechnung trägt. Die flächenhafte Umsetzung dieses Handlungskonzeptes<br />
außerhalb der detailliert untersuchten Teilgebiete kann zu einem späteren Zeitpunkt in Form<br />
von Managementkonzepten für die einzelnen Verbandsgebiete erfolgen, ist selbst aber nicht<br />
Teil des Projektes.<br />
Den Aufbau des Projektes zeigt Abbildung 1.<br />
Teilprojekt 1A:<br />
Dokumentation der Ausgangssituation (Beschreibung des aktuellen Zustandes, Dokumentation des <strong>Treibsel</strong>anfalls)<br />
Auswahl von Untersuchungsgebieten<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong><br />
Teilprojekt 2:<br />
Verständnis der ökologischen<br />
Zusammenhänge<br />
(Biomasseproduktion,<br />
<strong>Treibsel</strong>aufkommen)<br />
Universität Oldenburg, Kleyer<br />
Umweltplanung (i. Z. mit der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>)<br />
Teilprojekt 1B:<br />
Entwicklung und naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen<br />
modellhafte Managementkonzepte<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> (in Zusammenarbeit mit der Uni Oldenburg, Kleyer Umweltplanung)<br />
Abbildung 1: Projektaufbau<br />
Das Teilprojekt 1 ist das Rahmenprojekt, innerhalb dessen zunächst die Grundlagen für die<br />
anderen Teilprojekte erarbeitet werden und später durch die Zusammenführung aller<br />
Ergebnisse eine Entwicklung und Bewertung von Management-Strategien erfolgt. Die<br />
Teilprojekte 2 und 3 sowie das von den Deichverbänden separat zusätzlich finanzierte sog.<br />
Vegetationsprojekt liefern die für ein Managementkonzept notwendigen ökologischen<br />
Grundlagen und zeigen die ökologischen Auswirkungen verschiedener Management-<br />
Optionen auf.<br />
Das Projekt wurde am 30.06.2005 vom II. Oldenburgischen Deichband (stellvertretend für<br />
die niedersächsischen Hauptdeichverbände) bei der Niedersächsischen Wattenmeerstiftung<br />
zur Förderung beantragt. Diese Förderung wurde mit Schreiben vom 31.01.2006 (Zeichen<br />
NWS 10/05) bewilligt.<br />
Zusätzliche Untersuchungen<br />
(vom Auftraggeber beauftragt):<br />
Biomasse<br />
Produktivität<br />
Standorteigenschaften<br />
Uni Oldenburg<br />
Teilprojekt 3:<br />
Habitatmodelle für die Avifauna<br />
zur Prognose der Auswirkungen<br />
von Management-Optionen<br />
Vertiefende Untersuchungen zur<br />
Validierung<br />
Uni Oldenburg<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Projektbegleitender Ausschuss
Seite 8 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Gemäß den Förderrichtlinien der Nds. Wattenmeerstiftung bzw. dem Bewilligungsbescheid<br />
für die Projektförderung sind regelmäßig Zwischenberichte über den Fortgang des Projektes<br />
vorzulegen. Zur Dokumentation des aktuellen Arbeitsstandes sowie der Darstellung bereits<br />
erzielter Ergebnisse der einzelnen Teilprojekte wurde am 17.07.2007 der erste und am<br />
25.07.08 der zweite Zwischenbericht vorgelegt. Von weiteren Zwischenberichten wurde in<br />
Abstimmung mit dem projektbegleitenden Ausschuss abgesehen. Der hier vorgelegte<br />
Endbericht dient der Gesamtdarstellung der im Projekt erworbenen Ergebnisse.<br />
Der vorliegende Endbericht beinhaltet im Wesentlichen:<br />
die Beschreibung der gegenwärtigen landschaftlichen Situation an der Festlandsküste<br />
und in den Ästuaren in Bezug auf aktuelle Vegetation und Landnutzung sowie die<br />
Entwicklung von Landnutzung, Vorlandgrößen, der Röhrichtbestände und der<br />
<strong>Treibsel</strong>mengen (Teilprojekt 1A, Kapitel 4),<br />
die Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen, Biomasseproduktion und<br />
<strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der Küste und Ästuare (Teilprojekt 2, Kapitel 5),<br />
die Zusammenhänge zwischen den wichtigsten Habitatparametern und der Reaktion von<br />
Brut- und Rastvogelarten bezüglich der Nistplatzwahl unter Berücksichtigung der<br />
verschiedenen Vorlandnutzungsformen (Teilprojekt 3, Kapitel 6),<br />
die Darstellung von „Schwerpunktbereichen“ für ein Vorlandmanagement zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung (Teilprojekt 1B, Kapitel 7.2),<br />
die Erläuterung und naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen<br />
(Teilprojekt 1B, Kapitel 7.3 und 7.4),<br />
die Darstellung und naturschutzfachliche Bewertung von modellhaften<br />
Managementkonzepten (Teilprojekt 1B, Kapitel 7.5).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 9<br />
3 BETRACHTUNGSRAUM<br />
3.1 LAGE<br />
Der in diesem Bericht behandelte Betrachtungsraum umfasst sämtliche Vorländer der<br />
niedersächsischen Festlandsküste sowie der Ästuare Elbe, Weser und Ems. Dies sind die<br />
Vorländer der Festlandsküste zwischen Dollart und Cuxhaven sowie der genannten Ästuare<br />
bis zur Grenze des Tideeinflusses; diese liegt bei Geesthacht (Elbe), Bremen-Hemelingen<br />
(Weser) bzw. Herbrum (Ems).<br />
Die Lage der Vorländer im Betrachtungsraum zeigt Abbildung 2 (<strong>grün</strong> dargestellt).<br />
Niederlande<br />
Ems<br />
Niedersachsen<br />
Weser<br />
Bremen<br />
Elbe<br />
Schleswig-Holstein<br />
Hamburg<br />
0 10 20<br />
Kilometer<br />
0 10 20<br />
Kilometer<br />
Abbildung 2: Lage und Ausdehnung des Betrachtungsraums an der niedersächsischen<br />
Nordseeküste<br />
3.2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG<br />
Im Rahmen dieses Projektes wird der Betrachtungsraum in die Teilräume „Festlandsküste”<br />
und „Ästuare” unterteilt. Ökologisch gesehen ergeben sich Überschneidungen bzw.<br />
unscharfe Grenzen zwischen diesen Räumen. Aus pragmatischen Gründen werden hier<br />
sämtliche im Bereich des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer gelegenen<br />
Vorländer der „Festlandsküste” zugeordnet. Auch der Dollart sowie die Butjadinger Küste<br />
nördlich von Nordenham und die Wurster Küste nördlich von Bremerhaven werden also als<br />
Teile der Festlandsküste aufgefasst. Dies erscheint auch ökologisch vertretbar, da die<br />
genannten Küstenabschnitte seeseitig der Mündungsengen von Ems bzw. Weser liegen und<br />
somit bereits stärker vom Wattenmeer als von den Flussoberläufen geprägt sind. Somit<br />
werden an der Elbe sämtliche stromaufwärts von Cuxhaven gelegenen Vorländer dem<br />
Ästuar zugerechnet; an der Weser die stromaufwärts von Bremerhaven gelegenen, an der<br />
Ems die stromaufwärts von Pogum.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 10 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
3.2.1 FESTLANDSKÜSTE<br />
Das Vorland der niedersächsischen Festlandsküste zwischen Dollart und Cuxhaven erstreckt<br />
sich in einem bis zu 2.000 m breiten, in Teilen unterbrochenen Gürtel entlang der 266 km<br />
langen Küste. Die Größe des Festlandsvorlandes beträgt 7.910 Hektar (Fläche des<br />
Vorlandes ohne Deiche).<br />
Naturräumlich gehören die Vorländer der niedersächsischen Festlandsküste zu den „Watten<br />
und Marschen“ (nach MEYNEN & SCHMITHÜSEN 1959-1962 und BFN 1994) und liegen<br />
vollständig im Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“. Bodenkundlich gehören sie<br />
den Seemarschen an. Das Vorlandgelände ist überwiegend gegliedert in Beete und<br />
Grüppen, Hauptgräben, Priele und (lokal) Blänken. Teilweise existieren außerdem<br />
unbegrüppte natürliche Anwachsbereiche (z. B. süd- und westlicher Jadebusen). Örtlich sind<br />
alte Bodenentnahmestellen (sog. Pütten) vorhanden. Die Geländehöhen steigen im<br />
Allgemeinen vom deichnahen Teil des Vorlandes in Richtung Vorlandkante an. Eine<br />
Besonderheit stellt ferner der wattenmeerweit einzige rezente, außendeichs gelegene<br />
Hochmoorkörper (bei Sehestedt, Jadebusen) dar. Eine Übersicht über den Teilbereich<br />
„Festlandsküste” mit Bezeichnungen einiger lokaler Bezeichnungen gibt Abbildung 3.<br />
Leybucht<br />
Niederlande<br />
Krummhörn<br />
Dollart<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Norderland<br />
Harlinger-/<br />
Wangerland<br />
Niedersachsen<br />
Jadebusen<br />
Butjadingen<br />
Wurster Küste<br />
0 10 20<br />
Abbildung 3: Übersicht über den Teilbereich Festlandsküste<br />
Orange hinterlegt: Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer; Grün hinterlegt: Vorlandflächen<br />
3.2.2 ÄSTUARE VON EMS, ELBE UND WESER<br />
Kilometer<br />
Die Ästuare umfassen die Flussmündungen und -läufe, solange noch Brackwasser- und<br />
Tideeinfluss aus der Nordsee besteht. Per Definition dieses Projektes enden die Ästuare mit<br />
den Grenzen des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer (vgl. Kap 3.2). Die<br />
Gesamtgröße der untersuchten Vorländer der Ästuare beträgt 9.823 ha.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 11<br />
Naturräumlich gehören die Vorländer der Ästuare in die Haupteinheit „Ems-Weser-Marsch“<br />
und „Unterelbeniederung“ (nach MEYNEN & SCHMITHÜSEN 1959-1962 und BFN 1994). Sie<br />
sind bodenkundlich durch Marschenböden gekennzeichnet. Morphologisch und hydrologisch<br />
sind die Ästuare durch den natürlichen sowie anthropogen veränderten Flussunterlauf<br />
beeinflusst. Durch den kleinräumigen Wechsel der Salinität und der<br />
Strömungsgeschwindigkeit zeichnen sich die Ästuare ferner durch eine hohe Variabilität<br />
verschiedener Umweltparameter aus.<br />
Die Ufervegetation (z. B. Brackwasserröhrichte, Anuellen-Bestände, Salz<strong>grün</strong>land) wird als<br />
Bestandteil dieses Lebensraumtyps einbezogen. Überwiegend sind diese Ästuarvorländer<br />
als Grünländer oder Röhrichte ausgeprägt und können eine Breite von bis zu 2.000 m<br />
erreichen. An einigen Stellen, so etwa an der Weser bei Brake (Strohauser Plate oder<br />
Harrier Sand), liegen zusammenhängende Vorlandflächen von über 1.000 ha vor.<br />
Die Gestalt der Vorländer ist durch zahlreiche und umfangreiche Flussbaumaßnahmen<br />
anthropogen geprägt. Als Schlagwörter sollen an dieser Stelle die Flussbegradigungen,<br />
Deichbau, Entwässerung und Fahrrinnenausbaumaßnahmen mit einhergehender<br />
veränderter Strömungs- und Sedimentationsdynamik lediglich benannt werden.<br />
Ems<br />
Niedersachsen<br />
Bremen<br />
Abbildung 4: Übersicht über den Teilbereich Ästuare<br />
Grün hinterlegt: Vorlandflächen<br />
Weser<br />
Elbe<br />
Schleswig-Holstein<br />
Hamburg<br />
0 10 20<br />
Kilometer<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 12 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
4 TEILPROJEKT 1A: DOKUMENTATION UND ANALYSE DER<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
AUSGANGSSITUATION SOWIE AU<strong>FB</strong>EREITUNG DER INFORMATIONEN<br />
FÜR DIE TEILPROJEKTE 2 UND 3<br />
Dipl. Landschaftsökologen Stefan Schrader, Antje Bremermann & Julia<br />
Schwienheer (<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>)<br />
4.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG DES TEILPROJEKTES 1A<br />
Im Rahmen des Teilprojektes 1A werden Grundlagendaten, die für die übrigen Teilprojekte<br />
dieses Forschungsvorhabens erforderlich sind, dokumentiert, analysiert und aufbereitet. Dies<br />
beinhaltet:<br />
1. eine Beschreibung des aktuellen Zustandes und der Entwicklung der<br />
Außendeichsflächen,<br />
2. eine Auswahl der Untersuchungsgebiete für die Erhebungen im Rahmen der<br />
Teilprojekte 2 und 3,<br />
3. eine Dokumentation des <strong>Treibsel</strong>anfalls nach zwei Sturmfluten,<br />
4. eine Datenaufbereitung der eingeworbenen Daten in ein geografisches<br />
Informationssystem als Grundlage für eine statistische Auswertung im Rahmen des<br />
Teilprojektes 2 sowie für Auswertungen im Rahmen des Teilprojektes 1B.<br />
Zu 1.: Der Außendeichsbereich unterliegt hinsichtlich der Art und Intensität der<br />
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der Größe der genutzten Flächen einem starken Wandel<br />
(Eindeichungen, Ausdeichungen, wechselndes Interesse der Landwirtschaft aus<br />
ökonomischen Gründen [Strukturwandel], Maßnahmen des Naturschutzes, großflächige<br />
Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in den Ästuaren). Dieser Wandel hat Auswirkungen<br />
auf den <strong>Treibsel</strong>anfall, auch wenn ein Teil dieser Aspekte bislang kaum mit einem Anstieg<br />
der <strong>Treibsel</strong>menge in Verbindung gebracht wurde (Kompensationsmaßnahmen im<br />
Ästuarbereich, Strukturwandel). Eine systematische Dokumentation dieser Entwicklungen<br />
lag bislang nicht vor; sie ist – für den Zeitraum der letzten 30 Jahre - Gegenstand dieses<br />
Teilprojektes.<br />
Zu 2.: Auf Grundlage der Ergebnisse der Dokumentation soll eine Auswahl der Bereiche, die<br />
als Untersuchungsgebiete für die Freilanduntersuchungen der Teilprojekte 2 (Kapitel 5) und<br />
3 (Kapitel 6) am besten geeignet sind, erfolgen. In diesen Bereichen sollen unterschiedliche<br />
Nutzungsformen und -intensitäten sowie unterschiedliche Standorttypen vertreten sein.<br />
Zu 3. & 4.: Ursachen für das lokal sehr stark unterschiedliche <strong>Treibsel</strong>aufkommen sind<br />
Strömungsstärken und –richtungen, Windstärken und –richtungen bei Sturmflutereignissen<br />
sowie möglicherweise die Größe des dem Deich vorgelagerten Vorlandes und die im Vorland<br />
vorhandene Pflanzenmasse. Ferner spielt die Exposition des Deiches zur Hauptwindrichtung<br />
bzw. zu Strömungen eine Rolle. Die Zusammenhänge sind Grundlage für die Erarbeitung
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 13<br />
einer effektiven Management-Strategie. Sie sollen auf Basis von räumlichen <strong>Treibsel</strong>-<br />
dokumentationen nach zwei Sturmfluten für den gesamten Betrachtungsraum ermittelt<br />
werden. Die <strong>Treibsel</strong>dokumentation sowie die Aufbereitung dieser Daten für die Auswertung<br />
bezüglich des <strong>Treibsel</strong>aufkommens sind Gegenstand dieses Teilprojektes.<br />
4.2 BESCHREIBUNG DES AKTUELLEN ZUSTANDES UND DER<br />
ENTWICKLUNG DER AUSSENDEICHSFLÄCHEN<br />
4.2.1 FESTLANDSKÜSTE<br />
Der im Rahmen dieses Projektes betrachtete Raum wird in die Teilräume „Festlandsküste”<br />
und „Ästuare” unterteilt (vgl. Kap. 3.2). In den folgenden Unterkapiteln wird der aktuelle<br />
Zustand für die Festlandsküste beschrieben.<br />
4.2.1.1 AKTUELLER NATURSCHUTZRECHTLICHER STATUS<br />
Der bei weitem überwiegende Teil der Festlandsküste ist Teil des Nationalparks<br />
Niedersächsisches Wattenmeer. Der Nationalpark beginnt in der Regel am seeseitigen Fuß<br />
des Hauptdeiches und umfasst somit quasi alle Vorland-/Salzwiesenbereiche, von<br />
kleinräumigen Ausnahmen im Umfeld von Häfen abgesehen. Weitere Angaben zu<br />
Ausdehnung, Schutzstatus und Schutzziel lassen sich dem Nationalparkgesetz (NWattPG)<br />
entnehmen. Teile des Wattenmeeres, die nicht zum Nationalpark gehören, befinden sich bei<br />
Emden und Wilhelmshaven (im Bereich der landseitigen Vorrangebiete für<br />
Hafenentwicklung) sowie im Bereich der Seeschifffahrtsstraßen von Außenelbe,<br />
Außenweser und Außenems.<br />
Der Nationalpark hat ferner den Status eines Europäischen Vogelschutzgebietes (V01-<br />
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer) sowie eines<br />
Schutzgebietes nach FFH-Richtlinie und ist somit Teil von NATURA 2000, dem Netzwerk<br />
europäischer Schutzgebiete.<br />
Als weitere Schutzgebietskategorie befinden sich die Außendeichsflächen in dem seit 1992<br />
anerkannten UNESCO-Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer. Das<br />
Schutzgebiet ist so konzipiert, dass die Flächen, welche Nationalparkstatus aufweisen, als<br />
Kern- und Pflegezone definiert sind, während die sich landwärts anschließenden<br />
Binnendeichsflächen die Entwicklungszone umfassen, in der Modellprojekte für eine<br />
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung umgesetzt werden können. Ferner hat<br />
die UNESCO im Jahr 2009 das Wattenmeer (inkl. der Vorlandflächen) als Weltnaturerbe<br />
anerkannt.<br />
Neben den genannten naturschutzrechtlich festgelegten Gebieten kommen im<br />
Betrachtungsraum gesetzlich geschützte Biotope vor, die im Bundesnaturschutzgesetz in<br />
§ 30 BNatSchG definiert werden und aufgrund ihrer besonderen Bedeutung einem<br />
Zerstörungs- und Beeinträchtigungsverbot unterliegen. Als geschützte Biotoptypen der<br />
Vorländer der Festlandsküste werden Salzwiesen, Wattflächen, Küstendünen und<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 14 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Strandwälle, Moore sowie Röhrichte genannt. Somit besitzt der überwiegende Anteil der<br />
Vorlandflächen (intensiv genutzte Wirtschafts<strong>grün</strong>länder ausgenommen) einen gesetzlichen<br />
Schutzstatus.<br />
4.2.1.2 AKTUELLE VORLANDGRÖSSEN<br />
Die aktuellen Größen der Vorländer der Festlandsküste (Stand: 2004; ohne Hafenbereiche)<br />
wurden aus den GIS-Daten der TMAP-Vegetationskartierung der Nationalparkverwaltung<br />
abgeleitet. Die Vorländer der niedersächsischen Festlandsküste haben aktuell eine<br />
Ausdehnung von ca. 7.900 ha. Hiervon sind rund 1.450 ha (knapp 20 %) von<br />
Sommerdeichen umgeben.<br />
4.2.1.3 ENTWICKLUNG DER VORLANDGRÖSSEN<br />
Die Entwicklung der Größe der Vorländer des Nationalparks für den Zeitraum 1966-1997<br />
wird in BUNJE & RINGOT (2003) ausführlich beschrieben.<br />
BUNJE & RINGOT (2003) dokumentieren die Flächenentwicklung der Salzwiesen des<br />
Nationalparks im Zeitraum 1966 bis 1997 aufgrund von Luftbildauswertungen. In diesem<br />
Zeitraum ist die Salzwiesenfläche an der Festlandsküste um ca. 1.400 ha gewachsen, auf<br />
den Inseln um ca. 1.000 ha.<br />
Die Autoren zeigen die Entwicklung für die einzelnen Küstenabschnitte. Es ist ersichtlich,<br />
dass der Zuwachs auf den Inseln überwiegend natürlichen Ursprungs ist (Wachstum der<br />
Ostenden der Inseln). An der Festlandsküste hingegen war das Flächenwachstum<br />
überwiegend Folge von Küstenschutzmaßnahmen (Lahnungsbau, Verlandung, der Leybucht<br />
infolge des Baus der „Leybuchtnase”).<br />
Für die Wurster Küste sowie die Nordküste Butjadingens existiert ferner mit der „Digitalen<br />
Aufbereitung von Unterlagen zur Vegetationsentwicklung des Vorlandes an Unter- und<br />
Außenweser seit ca. 1950 [bis 2002]” (KÜFOG 2005) eine weitere Quelle. So hat an der<br />
Wurster Küste zwischen Weddewarden und Spieka-Neufeld von 1952/53 bis 2002 eine<br />
Landzunahme von 3 % (ca. 25 ha) stattgefunden. Von 1991 bis 2002 hat sich die<br />
Außendeichsfläche dabei um 0,3 ha vergrößert. Die größte Zunahme der Außendeichsfläche<br />
fand im Norden des Gebietes zwischen 1952/53 und 1975 statt und ist auf<br />
Landgewinnungsmaßnahmen zurückzuführen. Im Bereich Tettenser Plate/Langlütjen II hat<br />
sich die bewachsene Außendeichsfläche zwischen 1952 und 2002 ebenfalls vergrößert,<br />
wobei die stärkste Zunahme (ca. 26 ha) zwischen 1952 und 1962 stattgefunden hat. Diese<br />
Angaben decken sich in ihrer Tendenz mit denen von BUNJE & RINGOT (2003), wenn auch<br />
die von KÜFOG (2005) angegebenen Zahlen niedriger sind. Denkbare Ursache für die<br />
Differenzen ist eine unterschiedliche Definition der Grenze des Übergangs von der<br />
Pionierzone zur Salzwiese, also der Grenze, ab der neuer Anwachs tatsächlich als Vorland<br />
angesehen wird.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 15<br />
4.2.1.4 AKTUELLER ZUSTAND DES BODENS<br />
Die Kenntnis der Bodenverhältnisse ist von Bedeutung, um die in den<br />
Untersuchungsgebieten gewonnenen Erkenntnisse auf weitere Bereiche des<br />
Betrachtungsraumes übertragen zu können.<br />
Bodenkundliche Informationen (Stand 2007) wurden dem Projekt vom MU als GIS-Daten der<br />
Bodenkarte 1:25.000 und der Boden-Übersichtkarte 1:50.000 zur Verfügung gestellt. Die<br />
Karten decken die überwiegenden Teile des Betrachtungsraumes ab. Die Vorlandflächen der<br />
„Festlandsküste” für die Bereiche der Topographischen Kartenblätter (Maßstab 1:25.000)<br />
2117 „Cuxhaven West“, 2118 „Cuxhaven“, 2212 „Spiekeroog“, 2213 „Wangerooge“, 2214<br />
„Mellum“ und 2308 „Juist Ost“ sind durch die Bodenkarte (1:25.000) nicht abgedeckt, wobei<br />
diese Kartenblätter meist nur geringe Vorlandflächen abbilden.<br />
Im Bereich der Elbmündung (nordöstlich von Sahlenburg), der hier als Teil der<br />
Festlandsküste aufgefasst wird (vgl. Kapitel 3.2), sind zudem Daten zu Bodentypen und<br />
weiteren Bodenparametern aus den Antragsunterlagen für die Fahrrinnenanpassung der<br />
Unter- und Außenelbe (WSA HH 2007) flächendeckend digital verfügbar.<br />
Überwiegend sind die Böden der Vorländer semiterrestrische Böden im Anschluss an die<br />
semisubhydrischen Böden des Watts. Der Übergang zu den terrestrischen Böden wird in der<br />
Regel durch die Deichlinie unterbrochen. Marschböden durchlaufen einen Reifungsprozess<br />
von der Rohmarsch bis zur Knickmarsch, der im Wesentlichen durch den Prozess der<br />
Entkalkung gesteuert wird. In den Vorlandflächen der Festlandsküste sind verschiedene<br />
Entwicklungsstufen der Marschenböden zu finden.<br />
Vorländer auf reinem Hochmoorboden befinden sich (im Verhältnis zur Gesamtküste äußerst<br />
kleinflächig) im Sehestedter Außendeichsmoor. Kleinere Vorlandflächen überschneiden sich<br />
ebenfalls in diesem Bereich mit Moormarschen. Auftragsböden und somit anthropogene<br />
Böden sind als aufgespülte Flächen im Umfeld der Sielhäfen Ostfrieslands vorhanden. Sie<br />
nehmen ebenfalls eine sehr untergeordnete Flächengröße ein.<br />
4.2.1.5 AKTUELLE LANDNUTZUNG<br />
Die Landnutzung basiert auf verschiedenen, im Folgenden aufgeführten Datenquellen sowie<br />
eigenen Erhebungen.<br />
Flächenscharfe Angaben zur Nutzung im Maßstab 1:5.000 liegen als GIS-Daten für das<br />
Norderland (Abgrenzung beweideter Flächen sowie Zahlen zum Viehbesatz, vgl. NLWKN<br />
NOR 2003) sowie für den größten Teil der Vorländer des Jadebusens (Abgrenzungen,<br />
Nutzungsart sowie Angaben zu Zeitpunkt und Häufigkeit der Mahd und Viehbesatz) vor.<br />
Punktuell – so zum Beispiel im Bereich des Westerneßmerheller - wurden die<br />
Nutzungsangaben auf Plausibilität überprüft und ggf. nachkartiert.<br />
Für den restlichen Abschnitt der Festlandsküste zwischen Ems und Weser sind die<br />
genutzten Bereiche und die vertraglich vereinbarten Nutzungsintensitäten aufgrund einer<br />
eigens durchgeführten Kartierung und Gesprächen mit Mitarbeitern der<br />
Nationalparkverwaltung im Wesentlichen bekannt. Die Außendeichsflächen an der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 16 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Festlandsküste zwischen Ems und Weser befinden sich im Eigentum des Landes, weshalb<br />
die Domänenverwaltung für die Vergabe von Nutzungsrechten zuständig ist.<br />
Die aktuelle Landnutzung für den Küstenabschnitt zwischen Weser und Elbe konnte für den<br />
überwiegenden Teil der Flächen von der Nationalparkverwaltung abgefragt werden. Da sich<br />
in diesem Abschnitt jedoch viele Flächen im Privateigentum befinden, sind die<br />
Nutzungsinformationen im Vergleich zu den landeseigenen Flächen nicht derart detailliert.<br />
Tabelle 1 fasst die aktuellen Landnutzungsintensitäten zusammen. Die Daten stammen<br />
aufgrund der unterschiedlichen Quellen aus unterschiedlichen Jahren zwischen 2002-2007.<br />
Tabelle 1: Aktuelle Landnutzung (inkl. Sommerpolder)<br />
Quelle: Nationalparkverwaltung Wilhelmshaven, NLWKN NOR (2003), eigene Erhebungen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Landnutzung Flächengröße Flächenanteil<br />
Brache 4.045 ha 51 %<br />
Extensive Nutzung 1.079 ha 14 %<br />
Intensive Nutzung 2.453 ha 31 %<br />
Sonstige Nutzung 306 ha 3 %<br />
Nutzung unbekannt 28 ha < 1 %<br />
Summe 7.911 ha 100 %<br />
Die Tabelle zeigt, dass etwa die Hälfte der Vorländer ungenutzt ist. Der Anteil extensiv<br />
genutzter Vorlandflächen beträgt etwa 14 %. Unter dieser Nutzungsintensität sind alle<br />
Weiden mit einer Besatzdichte von 0,5-0,8 Rindern/ha, extensiven Schafweiden und<br />
gemähte Vorlandflächen (i.d.R. nach dem 1. Juli, ohne Nachweide) geführt. Intensive<br />
Landnutzung findet auf 31 % der Flächen statt und beinhaltet alle Weiden mit Besatzdichten<br />
von einem bis 1,5 Rindern pro Hektar, intensiven Schafweiden sowie die intensiv genutzten<br />
Sommerpolderflächen. Ohne Berücksichtigung der Sommerpolderflächen ist das Verhältnis<br />
des Anteils von extensiv zu intensiv genutzten Flächen etwa gleich (vgl. Tabelle 2). Unter<br />
„Sonstige Nutzung“ fallen touristische oder hafenwirtschaftliche Nutzungsformen außerhalb<br />
der Landwirtschaft.<br />
Ob eine Beweidung mit einem Besatz von 1-1,5 Rindern/ha einer intensiven Nutzung<br />
zuzuordnen ist, kann diskutiert werden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit Daten aus<br />
vorherigen Jahren wurde hier die Definitionen nach KEMPF et al. (1987) und BUNJE & ZANDER<br />
(1999) (vgl. Kapitel 4.2.1.6) zugrunde gelegt. Nach der Definition von BAKKER et al. (2005:<br />
169) (vgl. Kapitel 7.3.2) und den im Rahmen dieses Projektes gewonnenen Ergebnissen,<br />
sind diese Beweidungsintensitäten, aufgrund der resultierenden heterogenen<br />
Vegetationsstruktur, einer extensiven Nutzung zuzuordnen. Nach dieser Definition liegt der<br />
Anteil extensiver Nutzung bei 25 % und der intensiver Nutzung bei 20 %, von denen etwa<br />
86 % auf die Sommerpolderflächen entfallen.<br />
Die dargelegte Flächenstatistik beinhaltet die Sommerpolder an der Festlandsküste. Diese<br />
sind zu 95 % landwirtschaftlich intensiv genutzt.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 17<br />
Einen aktuellen Vergleich der landwirtschaftlichen Nutzung von Salzwiesen (ebenfalls<br />
inklusive der Flächen mit Sommerdeichen) zwischen den Wattenmeer-Anrainerstaaten<br />
liefern BAKKER et al. (2005). Es existieren regionale Unterschiede in der Nutzungsart und<br />
-intensität. Während in den Niederlanden und in Niedersachsen traditionell überwiegend<br />
Rinder als Weidetiere zum Einsatz kommen, sind es in Schleswig-Holstein Schafe. Mahd<br />
wird an der Festlandsküste des Wattenmeeres nur in den Landkreisen Wesermarsch und<br />
Friesland (im Bereich des II. u. des III. Oldenburgischen Deichbandes) sowie in Dänemark<br />
durchgeführt. Der Anteil an ungenutzten Flächen ist in Niedersachsen mit etwa 50 % am<br />
höchsten; in Schleswig-Holstein und Dänemark liegt etwa ein Drittel der Festland-Salzwiesen<br />
brach, während es in den Niederlanden nur 20 % sind.<br />
4.2.1.6 ENTWICKLUNG DER LANDNUTZUNG<br />
Über die historische Nutzung von Salzwiesen durch die Landwirtschaft bestehen durchaus<br />
unterschiedliche Ansichten. Nach holländischen Autoren werden Salzwiesen traditionell<br />
landwirtschaftlich genutzt. Bereits mit der Gründung der ersten Siedlungen im Küstenbereich<br />
um 2700-2300 vor heute kam es nach ihren Angaben zur Beweidung der Salzwiesen durch<br />
Haustiere; für die Zeit 1900-1700 vor heute (Römische Kaiserzeit) wird eine rekonstruierte<br />
Beweidungsdichte von einem Rind pro Hektar angegeben (MIEDEMA 1983 in: ESSELINK<br />
2000). BAKKER et al. (1997) kommen aufgrund der nur geringen fossilen Funde von<br />
beweidungsempfindlichen Arten wie Atriplex portulacoides (Salz-Melde), Artemisia maritima<br />
(Strand-Beifuß) und Elytrigia atherica (Strand-Quecke) zu dem Schluss, dass die Beweidung<br />
früherer Zeiten bereits so intensiv war, dass um 2000 vor heute keine ursprünglichen<br />
Salzwiesen an den Festlandsküsten mehr vorhanden waren.<br />
Dem stehen Überlegungen entgegen, die auch bei der Salzwiesennutzung in heutiger Zeit<br />
von Bedeutung sind. So ist beispielsweise die Verfügbarkeit von nicht salzigem<br />
Tränkewasser in den Salzwiesen sehr eingeschränkt. Der Transport von Süßwasser (per<br />
Leitung oder anders) ist in unwegsamem Gelände aufwendig, wenngleich die Anlage von<br />
Warften mit Süsswasserteichen (Fethinge) möglich war und ist. Allerdings war die Zahl der in<br />
früheren Zeiten pro Hofstelle gehaltenen Tiere im Vergleich zu heute sehr gering. Somit war<br />
auch der Verlust einzelner Tiere durch höhere Fluten für die Landnutzer ungleich schwerer<br />
wiegend als heute. Dies spricht dafür, dass vor allem die siedlungsnahen bzw.<br />
hofstellennahen Salzwiesenbereiche relativ intensiv genutzt gewesen sein mögen, mit<br />
zunehmender Entfernung die Nutzungsintensität aber eventuell stark abnahm.<br />
Wahrscheinlich kann also gesagt werden, dass es in früheren Zeiten (wie heute) keine<br />
einheitliche Nutzung der Salzwiesen gab. Hier sind verschiedene räumliche (regionale<br />
Unterschiede, Unterschiede mit Entfernung zur Hofstelle, lokale Erreichbarkeit) und zeitliche<br />
(Besiedlungsschübe) Ebenen zu betrachten. Die Nutzung könnte sich also durchaus als<br />
Nutzungsmosaik dargestellt haben.<br />
In den letzten Jahrzehnten kam es in großen Bereichen der Salzwiesen des Wattenmeeres<br />
zur Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung. In den Niederlanden erfolgte die<br />
Nutzungsaufgabe meist aus mangelndem Interesse seitens der Landwirtschaft (BAKKER et<br />
al. 1993, DIJKEMA & WOLFF 1983), in der Bundesrepublik Deutschland hingegen aus<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 18 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Gründen des Naturschutzes im Zuge der Etablierung und Ausgestaltung der Wattenmeer-<br />
Nationalparke ab Mitte der 1980er Jahre (STOCK et al. 1997, STOCK & KIEHL 2000,<br />
WESEMÜLLER & LAMP 1987). In Niedersachsen erfolgten Naturschutzbemühungen bereits vor<br />
Einrichtung des Nationalparks. So sind beispielsweise die von der Domänenverwaltung im<br />
damaligen Regierungsbezirk Weser-Ems angelegten Mittelgräben zur Trennung genutzter<br />
und ungenutzter Bereiche älter als der Nationalpark. Auch tragen in Niedersachsen der<br />
Strukturwandel in der Landwirtschaft (Rückgang der Pensionsviehhaltung) sowie<br />
Kompensationsmaßnahmen für Deichbauten zu einem Rückgang der landwirtschaftlich<br />
genutzten Salzwiesenfläche bei. In den letzten Jahren führt allerdings ein zunehmender<br />
Bedarf an landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgrund der Entwicklungen im Bereich<br />
Bioenergiegewinnung sowie durch die Umstellung von Prämienzahlungen im Zuge der EU-<br />
Agrarreform wiederum zu einem gesteigerten Nutzungsinteresse der Vorlandflächen.<br />
Bei der Integration von Salzwiesen als bewirtschaftete Flächen in den Ablauf moderner,<br />
rationell arbeitender landwirtschaftlicher Betriebe können Probleme auftreten, da diese<br />
Flächen, z.B. aufgrund ihrer Überflutungsgefährdung, einen hohen Betreuungsaufwand<br />
erfordern. Das Interesse von Seiten der Landwirte an einer Nutzung ist dementsprechend<br />
nicht überall gegeben. So ist beispielsweise aus den Bereichen der ostfriesischen Küste<br />
stark nachlassendes Interesse zu verzeichnen, in den dortigen jungen Ackermarschen gibt<br />
es praktisch keine Viehhalter mehr. In der Wesermarsch hingegen besteht offenbar höheres<br />
Interesse an der Nutzung. Die von der Domänenverwaltung den Landwirten unter Auflagen<br />
pachtfrei zur Nutzung überlassenen Flächen werden hier auch tatsächlich genutzt, obwohl<br />
eine Nichtnutzung für den Nutzer keine direkten finanziellen Einbußen zur Folge hätte. Die<br />
Salzwiesenvegetation wird als zwar wenig proteinhaltiges, gleichwohl als hochwertiges<br />
Futter geschätzt. Zur Heugewinnung genutzte Flächen dienen in trockenen Sommern wie<br />
2003 als Futterreserve.<br />
Wie sich das Interesse der Landwirte bei Einführung einer Pachtgebühr entwickeln würde,<br />
bleibt Spekulation. Bei der realen Flächennutzung spielt sicher auch eine Rolle, ob die<br />
Außendeichsflächen für die Bemessung der Flächenprämien herangezogen werden und wie<br />
stark die jeweils zuständigen Deichbände sich aus Gründen der <strong>Treibsel</strong>reduzierung für die<br />
Durchführung erlaubter Nutzungen einsetzen. Die Auswirkungen des Strukturwandels in der<br />
Landwirtschaft auf die Nutzung der Salzwiesen sind deshalb nicht eindeutig zu<br />
prognostizieren.<br />
Für die niedersächsische Festlandsküste ist in nachfolgender Tabelle 2 die Entwicklung der<br />
Nutzungsanteile für den Zeitraum seit 1987 dargestellt. Frühere Angaben sind nicht<br />
verfügbar. Es ist zu beachten, dass die ausgewerteten Quellen nicht auf einer einheitlichen<br />
Kartengrundlage beruhen. Die Zahlen sind somit in ihrer Absolutheit nicht völlig kompatibel,<br />
in ihrer Tendenz aber sicherlich aussagekräftig. Die Sommerpolder sind in diesen Zahlen<br />
nicht mehr enthalten, da sich an ihrer Nutzung in den vergangenen Jahren wenig geändert<br />
hat; sie werden nach wie vor zu fast 100% landwirtschaftlich genutzt (2004: 98 %).<br />
Ferner ist bei dem Vergleich der Landnutzungsintensität die Definition der jeweiligen<br />
Nutzungsstufen zu berücksichtigen. Die Autoren KEMPF et al. (1987) und BUNJE & ZANDER<br />
(1999) definieren in ihren Auswertungen die Nutzungsklassen wie folgt:<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 19<br />
Extensiv: Eingeschränkt genutzte Salzwiesen mit weniger als 1 Rind oder 3 Schafen<br />
(einschl. Lämmern) pro Hektar oder einmalige Mahd nach dem 1. Juli ohne<br />
Nachweide.<br />
Intensiv: Beweidung mit 3-6 Schafen/ha oder 1-1,5 Rindern/ha; Mahd vor dem 1. Juli;<br />
Umtriebsweide mit kurzfristig stark erhöhtem Besatz; Mehrfachnutzung.<br />
Sehr intensiv: Beweidung mit mehr als 6 Schafen/ha oder mehr als 1,5 Rindern/ha;<br />
Mehrfachmahd, Düngung; Umtriebsweide mit hohem Besatz.<br />
Somit entsprechen sich die Definitionen zur Landnutzungsintensität der genannten Autoren<br />
mit der im Kapitel 4.2.1.5 aufgeführten Definition weitestgehend. Allerdings ist bei dem<br />
vorliegenden Datensatz (2003) der Mahdzeitpunkt nicht bekannt, weshalb hier zwischen<br />
extensiver und intensiver Sommermahd nur anhand von Nachweide unterschieden werden<br />
kann.<br />
Tabelle 2: Entwicklung der Nutzungsanteile der Vorländer (ohne Sommerpolder) an der<br />
niedersächsischen Festlandsküste im Zeitraum 1987-2003<br />
Quelle: KEMPF et al. (1987), BUNJE & ZANDER (1999), s. Kap. 4.2.1.5 (2003)<br />
1987 1994 2003<br />
Intensiv genutzt 24 % 17 % 17 %<br />
Extensiv genutzt 28 % 31 % 17 %<br />
Ungenutzt 42 % 48 % 61 %<br />
Summe genutzt 58 % 52 % 34 %<br />
Demnach hat der Anteil der ungenutzten Flächen von 42 % auf 61 % deutlich zugenommen.<br />
Diese Zunahme lässt sich zu einem Teil dadurch erklären, dass neu entstehender Anwachs<br />
(z.B. großflächig in der Leybucht) die ungenutzten Flächen vergrößert, ohne dass die<br />
genutzten Flächen (in ihrer absoluten Größe) kleiner werden.<br />
Die Anteile extensiv und intensiv genutzter Flächen sind im Jahr 2003 etwa gleich groß. Der<br />
Unterschied des Verhältnisses von extensiver zu intensiver Nutzung im Vergleich zur Tabelle<br />
1 ergibt sich durch die Berücksichtigung der Sommerpolderflächen, welche in der Tabelle 2<br />
aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Daten von KEMPF et al. (1987) und BUNJE &<br />
ZANDER (1999) nicht mit einbezogen wurden.<br />
4.2.1.7 AKTUELLE VEGETATION<br />
Für die Festlandsküste liegen flächenscharfe digitale Aussagen zur aktuellen Vegetation des<br />
gesamten Nationalparks auf dem Stand von 2004 in Form von GIS-Daten vor<br />
(Nationalparkverwaltung 2006). Diese Kartierung wurde im Rahmen des Trilateralen<br />
Wattenmeer-Monitorings der Anrainerstaaten Dänemark, Deutschland und der Niederlande<br />
erhoben (Trilateral Monitoring and Assessment Programm, TMAP).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 20 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die Vegetation der unbedeichten Flächen kann anhand ihrer Höhenlage und<br />
Überflutungshäufigkeit in unterschiedliche Zonen eingeteilt werden. Ihre Anteile können<br />
folgender Tabelle 3 entnommen werden.<br />
Tabelle 3: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an der niedersächsischen<br />
Festlandsküste (inkl. Sommerpolder)<br />
Quelle: eigene Auswertung der TMAP-Kartierung 2004 der NLP-V<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Vegetationszone Flächenanteil Flächengröße<br />
Küstenwatt 2 % 140<br />
Pionierzone 9 % 724<br />
Untere Salzwiese 21 % 1.649<br />
Obere Salzwiese 38 % 2.979<br />
Röhricht 5 % 410<br />
Grünland 20 % 1.590<br />
Sonstige Vegetationszone 3 % 212<br />
Unbekannt 3 % 207<br />
Summe 100 % 7.911 ha<br />
Zur Erläuterung sei angemerkt, dass die untere Salzwiese die „Salzwiese im engeren Sinne”<br />
darstellt; hier finden sich Arten wie Andelgras, Rotschwingel, Strandflieder, Strandaster etc.<br />
Die Pionierzone wird stark vom Queller und dem Schlickgras dominiert, während in der<br />
oberen Salzwiese oft Queckenbestände vorherrschen und die Salzarten bereits in den<br />
Hintergrund treten. Die Ausprägung der Zonierung auf einem bestimmten Standort ist von<br />
Höhenlage, Überflutungshäufigkeit und Landnutzung abhängig.<br />
Der Röhrichtanteil der Außendeichsflächen der Festlandsküste ist relativ gering, da die<br />
Röhrichte auf die von Brackwasser beeinflussten Bereiche beschränkt bleiben. Sie würden<br />
sich somit landseitig an die obere Salzwiese anschließen und so den Übergang zu den<br />
frischwassergeprägten Biotopen des Binnenlandes bilden. Dieser Übergangsbereich ist<br />
jedoch durch die Deichlinie als harte Grenze in der Regel nicht mehr vorhanden. Deshalb<br />
treten Röhrichte hauptsächlich im Dollart sowie an der Butjadinger und der Wurster Küste in<br />
Erscheinung, wo durch das einströmende Wasser von Weser bzw. Ems weniger salzige<br />
Verhältnisse herrschen.<br />
Die Sommerpolder sind aufgrund ihrer bereits relativ hohen Geländelage und ihrer Nutzung<br />
von Wirtschafts<strong>grün</strong>ländern dominiert, die überwiegend nur wenige Salzarten beherbergen.<br />
Unter die Kategorie „Sonstige Vegetationszonen“ fallen neben Hoch- und Niedermooren<br />
auch Dünenvegetationskomplexe.<br />
4.2.1.8 ENTWICKLUNG DER VEGETATION<br />
Ein flächendeckender Vergleich des Zustandes der Vegetation vor zehn oder 20 Jahren mit<br />
dem heutigen für die gesamte Festlandsküste ist nicht möglich, da die TMAP-Kartierung des<br />
Jahres 2004 zwar qualitativ hochwertig ist, die vorhergehenden Kartierungen (z.B.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 21<br />
Biotoptypenkartierung NLP-V 1997) jedoch inhaltlich wie auch qualitativ dieses Niveau nicht<br />
erreichen. Die Vegetationsentwicklung wurde nur in Teilgebieten genauer untersucht, dies<br />
betrifft im Wesentlichen die Leybucht (ARENS 2005) oder die Röhrichtentwicklung an der<br />
Wurster Küste und im Bereich Tettenser Plate/Langlütjen II zwischen ca. 1950 und 2002, die<br />
in KÜFOG (2005) beschrieben wird.<br />
Die Entwicklung einiger ausgewählter Vegetationstypen ist in Tabelle 4 dargestellt.<br />
Es ist zu erkennen, dass die Vegetationstypen, die nach bisherigem Wissensstand einen<br />
hohen Anteil an der <strong>Treibsel</strong>produktion haben, heute größere Flächenanteile einnehmen als<br />
Mitte der 1990er Jahre. Hierin spiegeln sich nach ARENS (2005) sowohl<br />
Nutzungsänderungen als auch Sukzessions- und Auflandungsprozesse wider. Ob die<br />
dargestellte Entwicklung in der Leybucht ebenfalls für die restlichen Küstenabschnitte zutrifft,<br />
kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden. Der Flächenanteil im Jahr 2004 liegt jedoch in<br />
der Leybucht in einer ähnlichen Größenordnung wie an der gesamten Küste (Tabelle 4).<br />
Tabelle 4: Entwicklung der Flächenanteile der Vegetationstypen mit vermutetem starkem<br />
Anteil an der <strong>Treibsel</strong>produktion in der Leybucht im Zeitraum 1995-2004<br />
Quelle: nach Angaben in ARENS (2005)<br />
Vegetationstyp nach<br />
ARENS (2005)<br />
dominante Arten Flächenanteil 1995 Flächenanteil 2004<br />
Atriplicetum littoralis Melden 0,25 % 5,40 %<br />
Halimionietum<br />
portulacoidis<br />
Portulak-Keilmelde<br />
(= Strandsalzmelde)<br />
0,01 % 0,01 %<br />
Agropyretum Quecken 8,59 % 25,96 %<br />
Astero-Phragmitetum<br />
australis<br />
Schilf 0,11 % 0,30 %<br />
Summe 8,95 % 31,68 %<br />
Ferner tragen die röhrichtbildenden Arten einen erheblichen Teil zum <strong>Treibsel</strong>aufkommen<br />
bei, wenn dies an der Festlandsküste auch ein lokales Problem ist. Zur Entwicklung der<br />
Röhrichtbestände an der Küste liegen für die Wurster (Weddewarden bis Spieka-Neufeld)<br />
und die Butjadinger Küste Auswertungen vor (KÜFOG 2005).<br />
Die Ufervegetation an der Wurster Küste im Vergleich der Jahre 1952/53 bis 2002 hat eine<br />
zurückweichende Tendenz. War zwischen den 1950er Jahren und 1991 ein Anstieg um<br />
1,8 ha Röhrichtfläche zu verzeichnen, so nahm diese um das gleiche Maß bis 2002 wieder<br />
ab und befindet sich somit annähernd auf dem Stand von 1952/53. Als mögliche Gründe<br />
hierfür wird die windexponierte Lage dieses Küstenabschnitts, der schnelle<br />
Meeresspiegelanstieg und in Teilen auch der Fahrrinnenausbau der Weser genannt<br />
(KÜFOG 2005).<br />
Für den ebenfalls untersuchten Küstenbereich Tettenser Plate/Langlütjen II wird hingegen<br />
eine Zunahme der Röhrichtbestände verzeichnet. An der Tettenser Plate nahmen die<br />
Röhrichtbestände von 1952 bis 2002 um 32 ha zu. Infolge von Geländeerhöhung verdrängte<br />
dabei das Schilf die übrigen Brackwasser-Röhrichte, welche 2002 nur noch einen schmalen<br />
Saum vor dem Schilf-Röhricht ausbildeten. Mit Einstellung von landwirtschaftlicher Nutzung<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 22 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
wurde eine Ausbreitung von Schilf-Röhricht auch in brachliegende Grünlandflächen<br />
beobachtet. An Standorten mit geringerer Bodenfeuchte nahmen stellenweise Quecke<br />
(Elymus repens) und Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea) einen hohen Anteil ein (ebd.).<br />
4.2.1.9 ENTWICKLUNG VON TREIBSELMENGEN UND ENTSORGUNGSKOSTEN<br />
Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zum <strong>Treibsel</strong>problem (AG TREIBSEL 1996) nennt<br />
<strong>Treibsel</strong>mengen für viele (aber nicht alle) niedersächsische Deichverbände aus den Jahren<br />
1975-1995.<br />
Der Wasserverbandstag hat die Entsorgungskosten aller niedersächsischen<br />
Hauptdeichverbände zwischen 1995 und 2010 in einer Tabelle aufgelistet und dem Projekt<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Ferner führen einige Deichverbände eigene Statistiken über die in seinem Verbandsgebiet<br />
angefallenen <strong>Treibsel</strong>mengen und Entsorgungskosten. Diese liegen dem Projekt für den<br />
III. Oldenburgische Deichband (1992–2004) und dem Deichverband Land Wursten (1980–<br />
2008) vor.<br />
Die Entwicklung der <strong>Treibsel</strong>mengen in m³ für den Zeitraum 1994/95-2009/10 zeigt<br />
Abbildung 5. Zum Vergleich sind neben den <strong>Treibsel</strong>mengen der Festlandsküste auch die<br />
der Ästuare dargestellt. Deutlich wird, dass das <strong>Treibsel</strong>aufkommen in den Ästuaren<br />
gegenüber dem der Festlandsküste überwiegt. Die Entwicklungen laufen weitgehend<br />
parallel: in Jahren mit hohem <strong>Treibsel</strong>anfall in den Ästuaren kam es auch zu einem hohen<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall an der Festlandsküste.<br />
Die Entsorgungskosten steigen proportional mit der Entsorgungsmenge an und belaufen sich<br />
an der Festlandsküste auf durchschnittlich 234.000 € jährlich. Während der Sturmflutsaison<br />
1995/96 fielen im genannten Zeitraum die geringsten Entsorgungskosten von 29.000 € an,<br />
während der finanzielle Maximalaufwand in der Saison 2007/08 mit mehr als 1.989.000 € zu<br />
Buche schlug.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 23<br />
Entsorgtes <strong>Treibsel</strong> (m³)<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Sturmflutsaison<br />
Festlandsküste Ästuare<br />
Abbildung 5: Entsorgte <strong>Treibsel</strong>mengen (m³) an der niedersächsischen Hauptdeichlinie der<br />
Festlandküste (<strong>grün</strong>) sowie zum Vergleich der Ästuare (grau)<br />
Zahlen nach Angaben der Deichverbände, ohne NLWKN.<br />
Die Mengen des II. Oldenburgischen Deichbandes wurden zu gleichen Anteilen auf beide Kategorien<br />
(Festlandsküste/Ästuare) aufgeteilt. Die Mengen des Deichverbandes Rheider Deichacht wurden dem<br />
Ästuar zugerechnet, da der Großteil des Verbandgebiets an die Ems angrenzt. Der I. Oldenburgische<br />
Deichband hat die Entsorgungsmenge in Tonnen gemeldet, so dass die Werte aufgrund der<br />
Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt werden können.<br />
4.2.2 ÄSTUARE VON ELBE, WESER UND EMS<br />
Der im Rahmen dieses Projektes betrachtete Raum wird in die Teilräume „Festlandsküste”<br />
und „Ästuare” unterteilt (vgl. Kap. 3.2). In den folgenden Unterkapiteln wird der aktuelle<br />
Zustand für die Ästuare beschrieben.<br />
Die Recherchearbeiten für die Darstellung des aktuellen Zustandes sowie der Entwicklung<br />
von Außendeichsflächen im Bereich der Ästuare sind im Vergleich zu denen der<br />
Festlandküste deutlich aufwendiger, da hier keine einheitliche Datenvorhaltung existiert.<br />
Grund hierfür ist das Fehlen einer einheitlichen behördlichen Zuständigkeit, wie diese im<br />
Wattenmeer durch die Nationalparkverwaltung gegeben ist, sowie des sehr<br />
unterschiedlichen Schutzstatus„ dieser Gebiete. Auch bestehen für die Ästuare keine<br />
systematischen Dokumentationen von Befliegungen, Kartierungen, landwirtschaftlicher<br />
Nutzung oder der Entwicklung der Größe der Außendeichsflächen. Dennoch konnten für die<br />
Vorländer der Ästuare sehr umfangreiche Daten zusammengetragen werden.<br />
4.2.2.1 AKTUELLER NATURSCHUTZRECHTLICHER STATUS<br />
Angaben zum naturschutzrechtlichen Status der Außendeichsflächen der Ästuare können<br />
über die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise sowie das NLWKN bezogen werden.<br />
Auf dem niedersächsischen Geodatenserver werden die Schutzgebietsgrenzen mit Stand<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 24 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
von 30.09.2010 zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um rechtskräftig<br />
ausgewiesene Schutzgebiete der Kategorien Landschafts- und Naturschutzgebiete und<br />
Natura 2000-Gebiete. Nationalparke kommen im Bereich der Ästuare nicht vor.<br />
Tabelle 5 umfasst alle Landschafts-, Natur- sowie NATURA 2000-Schutzgebiete, die sich mit<br />
den Ästuarvorländern überlagern, zusammen. Nicht aufgenommen sind die Schutzgebiete,<br />
die sich nur auf wenigen Quadratmetern aufgrund von Maßstabsungenauigkeiten mit den<br />
Vorlandflächen überlagern.<br />
Tabelle 5: Schutzgebiete der Ästuarvorländer<br />
Kennzeichen und Name des Schutzgebietes Teilbereich Größe<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Landschaftsschutzgebiete<br />
Summe:<br />
164,97 ha<br />
LSG BRA 024 Warflether Sand / Juliusplate Weserästuar 64,84 ha<br />
LSG BRA 026 Strohauser Plate Weserästuar 6,29 ha<br />
LSG STD 017 Lühesand Elbeästuar 93,83 ha<br />
Naturschutzgebiete<br />
Summe:<br />
5390,25 ha<br />
NSG LÜ 048 Allwördener Außendeich / Brammersand Elbeästuar 505,59 ha<br />
NSG LÜ 049 Neßsand Elbeästuar 87,52 ha<br />
NSG LÜ 055 Vogelschutzgebiet Hullen Elbeästuar 91,23 ha<br />
NSG LÜ 059 Außendeich Nordkehdingen I Elbeästuar 306,88 ha<br />
NSG LÜ 060 Ostemündung Elbeästuar 84,29 ha<br />
NSG LÜ 068 Neuenlander Außendeich Weserästuar 16,77 ha<br />
NSG LÜ 082 Außendeich Nordkehdingen II Elbeästuar 266,24 ha<br />
NSG LÜ 100 Hadelner und Belumer Außendeich Elbeästuar 731,02 ha<br />
NSG LÜ 110 Rechter Nebenarm der Weser Weserästuar 266,46 ha<br />
NSG LÜ 126 Schwarztonnensand Elbeästuar 234,2 ha<br />
NSG LÜ 169 Asselersand Elbeästuar 307,34 ha<br />
NSG LÜ 286 Hahnöfersand Elbeästuar 48,26 ha<br />
NSG WE 219 Petkumer Deichvorland Emsästuar 130,59 ha<br />
NSG WE 242 Nendorper Deichvorland Emsästuar 104,97 ha<br />
NSG WE 260 Strohauser Vorländer und Plate Weserästuar 930,46 ha<br />
NSG WE 263 Juliusplate Weserästuar 61,26 ha<br />
NSG WE 268 Emsauen zwischen Herbrum und Vellage Emsästuar 686,3 ha<br />
NSG WE 272 Emsauen zwischen Ledamündung und Oldersum Emsästuar 500,89 ha
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 25<br />
Kennzeichen und Name des Schutzgebietes Teilbereich Größe<br />
FFH-Gebiete<br />
Summe:<br />
6356,03 ha<br />
2018-331 Unterelbe Elbeästuar 3027,47 ha<br />
2316-331 Unterweser Weserästuar 678,18 ha<br />
2507-331 Unterems und Außenems Emsästuar 857,87 ha<br />
2516-331 Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate Weserästuar 969,85 ha<br />
2517-331 Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven / Bremen Weserästuar 15,15 ha<br />
2526-332 Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg Elbeästuar 115,25 ha<br />
2809-331 Ems Emsästuar 692,26 ha<br />
EU-Vogelschutzgebiete<br />
Summe:<br />
7432,07 ha<br />
DE2121-401 Unterelbe Elbeästuar 2785,45 ha<br />
DE2609-401 Emsmarsch von Leer bis Emden Emsästuar, Küste 738,67 ha<br />
DE2617-401 Unterweser Weserästuar 3232,06 ha<br />
DE2909-401 Emstal von Lathen bis Papenburg Emsästuar 675,89 ha<br />
Die bei weitem überwiegenden Bereiche der Vorlandflächen aller drei Ästuare sind als<br />
Schutzgebiete ausgewiesen: Für die Weser beträgt der Flächenanteil mit überlagerten<br />
Schutzgebieten mindestens einer Kategorie 75 %, im Ästuar der Ems 83 % und an der Elbe<br />
sogar 91 %. Ein Schwerpunkt des Naturschutzes liegt in den Ästuaren auf der<br />
unbeeinflussten Entwicklung von naturnahen Lebensräumen sowie dem Erhalt extensiv<br />
genutzter Biotoptypen. Als Schutzzweck wird häufig die Erhaltung und Entwicklung von<br />
Nahrungs- und Rasthabitaten für gefährdete und/oder seltene Vogelarten angeführt.<br />
Die Erklärung von Gebieten zu Europäischen Vogelschutzgebieten ist mit der<br />
Bekanntmachung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom<br />
28.7.2009 erfolgt. Die FFH-Gebiete sind weitestgehend bereits im Amtsblatt der<br />
Europäischen Union vom 2.2.2010 bekannt gegeben worden. Eine Ausnahme bildet das<br />
FFH-Gebiet „Unterems und Außenems“: Diese ist zwar an die EU-Kommission gemeldet,<br />
aber noch nicht in die Kommissionsliste eingetragen worden. Aktuell hat das<br />
Verwaltungsgericht Oldenburg am 22.11.2010 eine Klage der Landkreise Emsland und Leer<br />
und der Stadt Emden sowie der Meyer Werft gegen die Aufnahme des Gebietes „Unterems<br />
und Außenems" in das europäische Schutzgebietsnetz NATURA 2000 abgewiesen, so dass<br />
nach Auskunft des Bundesumweltministeriums „die Gemeinschaftsliste der so genannten<br />
FFH-Gebiete in Deutschland“ bald abgeschlossen werden kann. Die NATURA 2000-<br />
Gebietskulisse sowie die Abgrenzungen der Gebiete sind somit als weitestgehend<br />
vollständig anzusehen. Informationen zu den wertgebenden Vogelarten und<br />
Lebensraumtypen sind ebenfalls auf dem Geodatenserver unter<br />
http://www.nlwkn.niedersachsen.de verfügbar.<br />
Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in § 30 gesetzlich geschützte Biotope, die aufgrund<br />
ihrer besonderen Bedeutung einem Zerstörungs- und Beeinträchtigungsverbot unterliegen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 26 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Als geschützte Biotoptypen der Ästuarvorländer werden alle natürlichen oder naturnahen<br />
Bereiche fließender Gewässer (z.B. Flusswatt) einschließlich ihrer Ufer und der<br />
dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation bzw. deren<br />
Verlandungsbereiche sowie alle regelmäßig überschwemmten Bereiche genannt. Ferner<br />
unterliegen Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche<br />
Nasswiesen dem gesetzlichen Schutzstatus nach BNatSchG. Das niedersächsische<br />
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz erweitert die Aufzählung in § 24 um<br />
hochstaudenreiche Nasswiesen. Somit sind abgesehen von ackerbaulich und als<br />
Intensiv<strong>grün</strong>land genutzte Bereiche und Gehölzbestände außerhalb der regelmäßig<br />
überschwemmten Bereiche die überwiegende Anzahl der Biotoptypen der Ästuarvorländer<br />
gesetzlich geschützt.<br />
4.2.2.2 AKTUELLE VORLANDGRÖSSEN<br />
Die aktuellen Größen der Vorlandflächen in den Ästuaren können in einem Geographischen<br />
Informationssystem (GIS) aus den aktuellen Vegetationskartierungen (Elbe: Stand<br />
2000/2002 sowie 2005, Ems: Stand 2006/2007/2008, Weser: Stand 2002) abgeleitet werden.<br />
Es finden sich ferner Angaben in KÜFOG (2005) und BIOS (2005) und WSA HH (2007)<br />
(Röhrichtentwicklung, andere Unterlagen PFV), die auf Auswertungen der genannten Daten<br />
beruhen.<br />
Die aktuellen Vorlandgrößen wurden aus den aktuellen Vegetationskartierungen abgeleitet.<br />
Hierbei wurden die Röhrichte in Gänze dem Vorland zugerechnet. Eine Berechnung der<br />
Flächen bis zur Linie des Mittleren Tidehochwassers (entsprechend der Vorlandgrenze in<br />
Topographischen Karten) war anhand der Vegetationskarten nicht möglich, da diese Linie<br />
nicht aus der Vegetation abgeleitet werden kann.<br />
Die betrachteten Vorlandflächen der Ästuare belaufen sich auf insgesamt 9.800 ha. Den<br />
größten Anteil hat daran das Weserästuar (vgl. Tabelle 6). Die Flächengröße der<br />
Sommerpolder differiert zwischen den Ästuaren. Für die Ems werden keine genauen<br />
Angaben gemacht, da hier die Auswertung nicht zu einem abschließenden Ergebnis führte.<br />
Ein Abgleich mit topographischen Karten zeigt jedoch, dass der Großteil der Vorländer nicht<br />
von einem Sommerdeich umgeben ist.<br />
Tabelle 6: Größe der Vorlandflächen der Ästuare von Elbe (exkl. Schleswig-Holstein), Weser<br />
und Ems<br />
Quelle: eigene Auswertungen der vorliegenden Vegetationskartierungen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
unbedeicht Sommerpolder Summe<br />
Elbe 3.086 ha 521 ha 3.607 ha<br />
Weser 2.415 ha 1.928 ha 4.343 ha<br />
Ems Keine Auswertung Keine Auswertung 1.874 ha<br />
Summe 9.824 ha
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 27<br />
4.2.2.3 ENTWICKLUNG DER VORLANDGRÖSSEN<br />
Zur Entwicklung der Vorlandgrößen finden sich Angaben für die Elbe in ARGE Elbe (1984).<br />
Hier wird der Zeitraum 1896/1905-1981/1982 ausgewertet. Für die Weser wurde im<br />
„Rahmenkonzept zur Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch” (GLP 1993) die<br />
Entwicklung der Größe der Vorlandflächen im Zeitraum 1887-1988 dargestellt. KÜFOG<br />
(2005) und BIOS (2005) liefern Aussagen für den Zeitraum von ca. 1950 bis 2002.<br />
Für die Ems liegen dem Projekt keine Informationen über die Entwicklung der Vorlandflächen<br />
vor.<br />
ELBE<br />
Die Arge Elbe (1984) legt detaillierte Bilanzen vor für die Entwicklung der Vorlandgrößen am<br />
(schleswig-holsteinischen) Nordufer und dem (niedersächsischen) Südufer der Elbe im<br />
Zeitraum 1896/1905-1981/82. Diese sind ferner nach einzelnen Vorlandabschnitten<br />
aufgeteilt. Die Auswertungen beziehen sich auf den Abschnitt von Cuxhaven bis Hamburg.<br />
Hiernach hat sich die Größe der Außendeichsflächen auf niedersächsischer Seite im<br />
angegebenen Zeitraum drastisch verringert. Die Abnahme betrug ca. 74 %, entsprechend<br />
ca. 11.000 ha. Auf schleswig-holsteinischer Seite war die Entwicklung ähnlich (Abnahme um<br />
ca. 50 % entsprechend ca. 3.200 ha). Die größte Veränderung ergab sich im Bereich<br />
Nordkehdingen (zwischen Freiburg und Ostemündung). Allein hier wurde die Größe der<br />
Vorlandflächen durch Eindeichungen nach der Sturmflut von 1962 um ca. 3.600 ha<br />
verringert.<br />
WESER<br />
Das „Rahmenkonzept zur Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch” (GLP 1993)<br />
nennt Flächenbilanzen für das Deichvorland der Unterweser zwischen 1887 und 1988.<br />
Insgesamt wurde demnach die Fläche des Vorlandes um 21 % verringert. Hauptursache<br />
hierfür war die Eindeichung der südlich von Bremerhaven gelegenen Luneplate. Darüber<br />
hinaus ist die natürliche Dynamik der Vorlandentwicklung durch den verstärkten Bau von<br />
Sommerdeichen und die damit verbundene Abnahme unbedeichter Flächen im genannten<br />
Zeitraum stark eingeschränkt worden.<br />
Auf der westlichen Weserseite hat es im angegebenen Zeitraum weder eine deutliche Zu-<br />
noch Abnahme der Vorlandflächengrößen gegeben. Einerseits wurde die Vorlandfläche<br />
durch das Zusammenkoppeln von Inseln (Sände vor Elsfleth), die Anbindung von Inseln ans<br />
Festland (z. B. Warflether Arm) sowie durch Verlandungen im Bereich der Seitengewässer<br />
(z. B. Strohhauser Plate) um 209 ha vergrößert. Deichrückverlegungen trugen nicht zu dieser<br />
Zunahme bei. Andererseits führten Aufspülungen für Industrie- und Hafenansiedlung (insb.<br />
Ochtumer Sand) zu einem Verlust von 310 ha Vorland.<br />
Auf der östlichen Weserseite hingegen hat die Vorlandgröße seit 1887 um fast 30 %<br />
abgenommen, was vor allem auf die Eindeichung der Luneplate zurückzuführen ist.<br />
Für die Entwicklung seit 1950 liefert ferner die „Digitale Aufbereitung von Unterlagen zur<br />
Vegetationsentwicklung des Vorlandes an Unter- und Außenweser seit ca. 1950 [bis 2002]”<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 28 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
(KÜFOG 2005) punktuelle Angaben. Demnach hat sich zwischen Brake und Motzen die<br />
Außendeichsfläche um 4 % (26,7 ha) verringert. Dieser Rückgang ist vor allem auf<br />
wasserbauliche Maßnahmen wie den Bau des Huntesperrwerks mit Verlegung der<br />
Huntemündung sowie Abdeichung der Westergate zurückzuführen. Nach BIOS (2005) war<br />
ferner im gleichen Zeitraum am rechten Weserufer zwischen Sandstedt und Bremerhaven<br />
ein Vorland-Zuwachs um 41 ha festzustellen, am linken Weserufer zwischen Brake und<br />
Nordenham hingegen eine Abnahme um 8 ha.<br />
EMS<br />
Für die Ems liegen dem Projekt keine Informationen über die Entwicklung der Vorlandflächen<br />
vor.<br />
4.2.2.4 AKTUELLER ZUSTAND DES BODENS<br />
Bodenkundliche Informationen (Stand 2007) wurden dem Projekt vom MU als GIS-Daten der<br />
Bodenkarte 1:25.000 und der Boden-Übersichtkarte 1:50.000 zur Verfügung gestellt. Die<br />
Karten decken die überwiegenden Teile des Betrachtungsraumes ab.<br />
Für die Vorlandflächen der Elbe sind zudem flächendeckend Daten zu Bodentypen und<br />
weiteren Bodenparametern aus den Antragsunterlagen für die Fahrrinnenanpassung der<br />
Unter- und Außenelbe (WSA HH 2007) digital verfügbar. Des Weiteren wurden die Digitale<br />
Bodenkarte 1:25.000 und Karten der Biotoptypen zur vorherigen Fahrrinnenanpassung, die<br />
Digitale Topographische Karte 1:25.000, die Deutsche Bundeswasserstraßenkarte 1:2.000<br />
und Daten der Beweissicherungsdatenband der WSD Cuxhaven ausgewertet. Die<br />
Vorlandbereiche der Weser werden durch die vorliegenden Daten vollständig abgedeckt.<br />
Die Vorlandflächen des Emsästuars für die Bereiche der Topographischen Kartenblätter<br />
(Maßstab 1:25.000) 2610 „Moormerland“ und 2909 „Rhede“ sind durch die Bodenkarte nicht<br />
abgedeckt, wobei diese einen vergleichsweise geringen Flächenanteil ausmachen.<br />
Die Kenntnis der Bodenverhältnisse ist von Bedeutung, um die in den<br />
Untersuchungsgebieten gewonnenen Erkenntnisse auf weitere Bereiche des<br />
Betrachtungsraumes übertragen zu können.<br />
Wie in den Salzwiesen auch, so sind in den Vorländern der Ästuare natürlicherweise<br />
überwiegend Marschböden zu erwarten. Im Gegensatz zu den von starkem Salzeinfluss<br />
geprägten Seemarschen handelt es sich hier aber um Brack- bzw. Flussmarschen.<br />
Kleinräumig sind auch Auenböden zu erwarten, deren Entstehung und Charakteristik<br />
weniger von den gezeitenbedingten Überschwemmungen als von den jahreszeitlich<br />
bedingten Hochständen des Oberwassers geprägt sind. In eher kleinräumigen Teilbereichen<br />
der Ästuarvorländer wurden die Böden durch Sand- und Schlickaufspülungen verändert, so<br />
dass nun in der Regel sandiger Auftragsboden vorliegt.<br />
4.2.2.5 AKTUELLE LANDNUTZUNG<br />
Da in den Ästuaren im Gegensatz zur Festlandsküste kein einheitliches Großschutzgebiet<br />
mit eigener Verwaltung existiert, gibt es keine Behörde, deren Auftrag es wäre, die aktuelle<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 29<br />
Landnutzung zu dokumentieren. Dementsprechend schlecht bzw. heterogen ist die<br />
Datenbasis. Verantwortlich hierfür sind<br />
die fehlende Dokumentation von behördlicher Seite. So existiert für keines der<br />
Ästuare eine flächendeckende Dokumentation der Landnutzung in den<br />
Vorlandflächen.<br />
die zersplitterte behördliche Zuständigkeit (Untere Naturschutzbehörden,<br />
Domänenverwaltung, Untere Deichbehörden)<br />
die zersplitterten Eigentumsverhältnisse (privat, Domänenverwaltung, Wasser- und<br />
Schifffahrtsverwaltung, Hafenbehörden wie bremenports).<br />
Für die Sommerpolderflächen, für die in der Regel keine Nutzungsangaben vorlagen, wurde<br />
eine intensive Nutzung angenommen.<br />
ELBE<br />
Für die Elbe liegen flächenscharfe Angaben zur aktuellen Nutzung vor. Diese Informationen<br />
konnte Herr Jürgen Ludwig (Naturschutzstation Unterelbe, Außenstelle des NLWKN<br />
Betriebsstelle Lüneburg) aufgrund seiner umfangreichen Ortskenntnis mit dem Stand von<br />
2008 vermitteln. Diese Angaben wurden von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> in eine Karte umgesetzt<br />
und beziehen sich auf den Bereich von Otterndorf bis Abbenfleth. Somit liegen<br />
Nutzungsinformationen für den überwiegenden Anteil der Vorlandflächen der Elbe vor.<br />
Für die übrigen Abschnitte des Tidebereiches der Elbe (Cuxhaven bis Otterndorf sowie<br />
Hamburg bis Geesthacht) konnte eine Ableitung der aktuellen Nutzung auf Ebene der<br />
Nutzungstypen (Acker, Grünland) ferner aus den vorliegenden GIS-Daten über die<br />
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2004) erfolgen (vgl. Abschnitt 4.2.2.7 sowie Tabelle 13).<br />
Eine Ableitung der Nutzungsintensität ist allerdings nicht möglich. Ungenutzte Flächen ließen<br />
sich wiederum in einigen Fällen aus dem Auftreten bestimmter Biotoptypen schlussfolgern.<br />
Tabelle 7 : Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des Elbeästuars (exkl.<br />
Schleswig-Holstein, inkl. Sommerpolder)<br />
Quelle: eigene Auswertung der GIS-Daten von WSA HH(2007)<br />
Landnutzung Flächenanteil Flächengröße<br />
Brache 33 % 1.188 ha<br />
Extensive Nutzung 6 % 230 ha<br />
Intensive Nutzung 52 % 1.858 ha<br />
Sonstige Nutzung 2 % 72 ha<br />
Nutzung unbekannt 7 % 259 ha<br />
Summe 100 % 3.607 ha<br />
Es werden knapp 60 % der Vorlandflächen landwirtschaftlich genutzt, wobei die Nutzflächen<br />
überwiegend aus Grünland (Weiden oder Mähwiesen) bestehen. Extensive Nutzungen<br />
(Mähwiesen ohne Nachbeweidung) erfolgen auf 6 % der Vorlandflächen, intensive<br />
Nutzungen (Weiden mit Besatzdichten ≥ 1 Rind/Pferd, ≥ 3 Schafen bzw. 1 GV sowie intensiv<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 30 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
genutzte Mähwiesen, teilweise mit Nachweide). Eine vergleichsweise geringe Fläche von<br />
58 ha des betrachteten Bereiches wird zum Obstanbau genutzt. Auf niedersächsischer Seite<br />
wird Obstanbau nördlich der Lühe-Mündung, auf dem Asseler Sand sowie auf einer<br />
kleineren Fläche bei Krautsand betrieben.<br />
In den Landkreisen Cuxhaven und Stade sind momentan keine Genehmigungen zur Mahd<br />
von Röhrichten erteilt (mündliche Auskünfte der UNB‟s). Es findet jedoch kleinflächig nicht<br />
genehmigte Reet- und Binsengewinnung statt. Im Landkreis Stade ist in der Vergangenheit<br />
vermutlich eine Nutzung im Flusswatt-Röhricht bei Schwarztonnensand, Asseler Sand und<br />
Krautsand erfolgt.<br />
Auf schleswig-holsteinischer Seite werden in Randbereichen der Haseldorfer Binnenelbe, auf<br />
dem Bishorster Sand, Auberg und Drommel sowie im Bereich Fährmannssand Binsen<br />
geschnitten. Genehmigungen wurden seitens des Kreises Pinneberg erteilt. Die Nutzung im<br />
Bereich Fährmannssand wird voraussichtlich reduziert oder aufgegeben, da die Qualität der<br />
Binsen für eine wirtschaftliche Verwendung als Flechtmaterial nicht mehr ausreichend ist.<br />
Stattdessen wurde ein Antrag auf Nutzung von Bereichen an der Nordspitze der Inseln<br />
Auberg/Drommel (südlich Pagensand bzw. Pagensander Nebenelbe) gestellt.<br />
Ein Drittel des Elbeästuars befindet sich in einem ungenutzten Zustand. Diese ungenutzten<br />
Bereiche bestehen überwiegend aus Röhrichten.<br />
WESER<br />
Für die Westseite der Weser führt der Landkreis Brake (Untere Naturschutzbehörde) ein<br />
GIS-gestütztes Kataster der Flächen, für die er eine Genehmigung für die winterliche<br />
Schilfmahd erteilt hat. Weitere Nutzungsinformationen werden dort jedoch nicht vorgehalten.<br />
Für die Ostseite der Weser konnte H. v. Häfen (Untere Deichbehörde Landkreis Cuxhaven)<br />
aus seiner Ortskenntnis einen guten Überblick über die Landnutzung geben, die aber<br />
aufgrund der Größe des Bereiches nicht flächenscharf sein konnte. Ferner wurde im<br />
Rahmen des Projektes Mitte Mai 2007 eine grobe Nutzungskartierung der nicht von<br />
Sommerdeichen geschützten Außendeichsflächen der Unterweser zwischen Berne und<br />
Bremerhaven durchgeführt.<br />
Für die übrigen Abschnitte des Tidebereiches der Weser (Berne bis Hemelingen sowie<br />
Sommerpolder) konnte eine Ableitung der aktuellen Nutzung auf Ebene der Nutzungstypen<br />
(Acker, Grünland) ferner aus den vorliegenden GIS-Daten über die Biotoptypen nach<br />
DRACHENFELS (2004) erfolgen (vgl. Abschnitt 4.2.2.7 sowie Tabelle 13). Eine Ableitung der<br />
Nutzungsintensität ist allerdings nicht möglich.<br />
Es werden etwa 59 % der Vorlandflächen landwirtschaftlich genutzt (Tabelle 8). Extensive<br />
Nutzungen (Mähwiesen ohne Nachbeweidung) erfolgen auf 12 % der Vorlandflächen,<br />
intensive Nutzungen (Weiden mit Besatzdichten ≥ 1 Rind, ≥ 3 Schafen bzw. 1 GV, intensiv<br />
genutzte Mähwiesen, Ackerbau und Röhrichtmahd). Die landwirtschaftlichen Nutzflächen<br />
bestehen überwiegend aus Grünland. Im Gegensatz zur Elbe und Ems sind aber auch<br />
nennenswerte Anteile von Ackerland vorhanden. Diese beschränken sich auf hochgelegene<br />
(aufgespülte) bzw. von Sommerdeichen geschützte Bereiche.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 31<br />
Tabelle 8: Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des Weserästuars<br />
(inkl. Sommerpolder)<br />
Quelle: eigene Auswertung der GIS-Daten von HS Vechta (2006)<br />
Landnutzung Flächenanteil Flächengröße<br />
Brache 36 % 1.578 ha<br />
Extensive Nutzung 12 % 539 ha<br />
Intensive Nutzung 47 % 2034 ha<br />
Sonstige Nutzung 1 % 39 ha<br />
Nutzung unbekannt 4 % 153 ha<br />
Summe 100 % 4.343 ha<br />
Von den ungenutzten Flächen sind überwiegende Bereiche mit Röhrichten bestanden.<br />
Reetmahd findet an der Weser auf ca. 63 ha statt (5,8 % der Röhrichtfläche). Die größten<br />
zusammenhängenden Röhrichte liegen auf der rechten Weserseite zwischen Rechtenfleth<br />
und dem Neuenlander Siel (LK Cuxhaven). Auf der linken Weserseite existiert eine Vielzahl<br />
gemähter Flächen, die verstreut zwischen der Butjadinger Küste und der Bremer<br />
Landesgrenze liegen (LK Wesermarsch).<br />
EMS<br />
Die Nutzungen wurden weitestgehend aus der Biotoptypenkartierung (IBL 2008, NLWKN<br />
2007) abgeleitet, was aufgrund der Zusatzmerkmale sehr umfänglich möglich war. Die<br />
Intensität der Weidenutzung konnte jedoch nicht abgeleitet werden.<br />
Tabelle 9: Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzungen der Vorländer des Emsästuars<br />
Quelle: eigene Auswertung der GIS-Daten IBL (2008) und NLWKN (2007)<br />
Landnutzung Flächenanteil Flächengröße<br />
Brache 35 % 661 ha<br />
Extensive Nutzung 16 % 297 ha<br />
Intensive Nutzung 6 % 104 ha<br />
Weidenutzung (Intensität unbekannt) 34 % 634 ha<br />
Sonstige Nutzung < 1 % 12 ha<br />
Nutzung unbekannt 9 % 166 ha<br />
Summe 100 % 1.874 ha<br />
Etwa 35 % des Emsästuars sind ungenutzt. Wie in den anderen Ästuaren ist der<br />
überwiegende Anteil dieser Flächen von Röhrichten bestanden. Extensive Nutzungen<br />
(Mähwiesen ohne Nachbeweidung) erfolgen auf 16 % der Vorlandflächen, intensive<br />
Nutzungen (Mähwiesen mit Nachweide) auf 6 %. Eine reine Weidenutzung erfolgt auf 34 %<br />
der Flächen.<br />
Eine Reetmahd wird an der Ems nicht betrieben (mdl. Auskünfte Hr. Pott, UNB LK Emsland,<br />
16.08.06, Hr. Kloppenburg, UNB LK Leer, 18.04.07; Hr. Hensmann, NLWKN Aurich,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 32 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
02.04.07). Nach Aussage von Hr. Pott ist Reetmahd an der Ems auch nicht als traditionelle<br />
Nutzung anzusehen.<br />
Ackernutzung findet im Vorlandbereich der Ems im Gegensatz zum Weserästuar nicht statt.<br />
4.2.2.6 ENTWICKLUNG DER LANDNUTZUNG<br />
Aussagen zur Entwicklung der Landnutzung im nordwestdeutschen Küstenbereich und den<br />
Ästuaren von Ems, Weser und Elbe liegen zumeist in recht allgemeiner, nicht<br />
ortsspezifischer Form vor. Flächendeckende, parzellenscharfe Erfassungen sind nicht<br />
vorhanden.<br />
Für die Weser existieren Aussagen zur Entwicklung der Außendeichsnutzung im Landkreis<br />
Wesermarsch (LK Wesermarsch/UBA 1989). Weitere Hinweise zu aktueller und historischer<br />
Nutzung der Weservorländer ergaben Gespräche mit ortsansässigen Landwirten, dem Leiter<br />
der Betriebsstelle Brake-Oldenburg des NLWKN, der Unteren Naturschutzbehörde des<br />
Landkreises Wesermarsch, der Unteren Deichbehörde des Landkreises Cuxhaven sowie<br />
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven.<br />
Für Elbe und Ems gibt es Informationen über die Entwicklung der Landnutzung aus<br />
verschiedenen Literaturquellen bzw. mündlichen Auskünften (Untere Naturschutzbehörden<br />
Landkreise Emsland und Stade, Naturschutzstation Unterelbe, NLWKN Meppen, NLWKN<br />
Aurich).<br />
Somit liegen keine gesicherten, quantitativ zu erfassenden Angaben zur Entwicklung der<br />
Landnutzung auf den Vorlandflächen der Ästuare in den letzten Jahrzehnten vor. Folgende<br />
Rahmenbedingungen spielen jedoch nach den Expertenaussagen eine Rolle:<br />
Durchführung von Kompensationsmaßnahmen für Hafenerweiterungen und<br />
Fahrrinnenvertiefungen<br />
Die wiederholt durchgeführten Vertiefungen der Fahrrinnen von Elbe, Weser und<br />
Ems sowie die Erweiterungen bestehender Häfen (Containerterminals in Hamburg<br />
und Bremerhaven) zogen umfangreiche Kompensationsmaßnahmen (Ausgleich oder<br />
Ersatz i.S.d. naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung) nach sich. Hierbei wurde die<br />
Nutzung größerer Vorlandbereiche extensiviert oder aufgegeben, oft war die<br />
Entwicklung naturnaher Röhrichte das Entwicklungsziel.<br />
Ausweisung von Naturschutzgebieten<br />
Die in den Ästuaren ausgewiesenen Naturschutzgebiete sollen u.a. die Sicherung<br />
bzw. Wiederherstellung und Entwicklung naturnaher Ästuarlebensräume für die<br />
entsprechende Flora und Fauna gewährleisten. Auch hierdurch kam es zur<br />
Verkleinerung der landwirtschaftlich genutzten Fläche.<br />
Strukturwandel in der Landwirtschaft<br />
Mit zunehmendem Kosten- und Rationalisierungsdruck lässt das Interesse an der<br />
Nutzung der Außendeichsflächen offenbar nach, da diese Flächen in ihrer<br />
Bewirtschaftung recht anspruchsvoll sind (Überflutungen etc.). Nach mdl. Auskunft<br />
eines Landwirtes aus der Wesermarsch (W. Rüpke, Golzwarden) hat der Anteil<br />
genutzter Fläche im Außendeichsbereich bei Brake von ca. 80 % in den 1970er<br />
Jahren auf etwa 50-60 % heute abgenommen. Dies sei vermutlich darauf<br />
zurückzuführen, dass Flächen trotz Genehmigung nicht genutzt werden, da sie<br />
wegen ihrer Lage schlecht in die Betriebsabläufe der größer werdenden Betriebe zu<br />
integrieren sind. In den letzten Jahren führt allerdings ein zunehmender Bedarf an<br />
landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgrund der Entwicklungen im Bereich<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 33<br />
Bioenergiegewinnung wiederum zu einem gesteigerten Nutzungsinteresse der<br />
Vorlandflächen.<br />
4.2.2.7 AKTUELLE VEGETATION<br />
Für den gesamten Tidebereich von Ems, Weser und Elbe liegen einheitliche digitale Daten<br />
zu Biotoptypen nach DRACHENFELS (2004) vor.<br />
Diese Daten stammen für die Elbe aus der Beweissicherung zur Fahrrinnenvertiefung<br />
1999/2000 (14,5 m-Ausbau) (BfG 2004; Datenerhebung 2000/02) sowie aus dem<br />
Planfeststellungsverfahren 2006/07 (Datenerhebung 2005) für die nächste<br />
Fahrrinnenvertiefung (WSA HH 2007). Für die Weser stammen sie aus dem Jahr 2002 (HS<br />
Vechta 2006). Sie werden ebenfalls im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 2006/07 für<br />
die nächste Fahrrinnenvertiefung verwendet. Für die Tideems stammen die Daten aus der<br />
Basiserfassung FFH-Gebiet 013 „Ems“ (Datenerfassung 2006/07) (NLWKN BRA-OL 2008)<br />
und aus dem Planfeststellungsverfahren (Datenerhebung 2007) im Zuge der Emsvertiefung<br />
sowie aus der Basiserfassung FFH-Gebiet 002 „Unterems und Außenems“ (IBL 2008).<br />
ELBE<br />
Nach WSA HH (2007) besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den Biotoptypen der<br />
Elbabschnitte oberhalb des Hamburger Hafens und unterhalb Hamburgs: „Während<br />
unterhalb Hamburgs die Intensivierung der zu ca. 90 % landwirtschaftlich genutzten<br />
Außendeichsflächen stark vorangeschritten war und dort im rein terrestrischen Bereich kaum<br />
noch irgendwelche botanisch interessanten Flächen zu finden waren, konnten oberhalb des<br />
Hamburger Hafens mit dem NSG Heuckenlock, dem NSG Zollenspieker und dem<br />
Mündungstrichter der Ilmenau noch sehr interessante und von den Unterelbe-Lebensräumen<br />
vollkommen verschiedene Lebensräume gefunden werden.”<br />
Hinsichtlich der gefährdeten Pflanzenarten wird ausgeführt (WSA HH 2007): „Es konnten<br />
also noch die meisten Arten der früheren Artenvielfalt an der Elbe gefunden werden,<br />
allerdings in der Regel in geringeren Stückzahlen. Die Arten höherer Gefährdung<br />
konzentrieren sich vorwiegend auf wenige Gebiete, wie z.B. den ehemaligen<br />
Mündungstrichter der Ilmenau, Neufeld, St. Margarethen und die Elbinseln, während manche<br />
weniger gefährdete Arten wie Wibel-Schmiele sich offenbar in Ausbreitung befinden, gehen<br />
andere vom Aussterben bedrohte wie der Schierlings-Wasserfenchel weiter zurück.”<br />
Eine Übersicht über die Vegetationszonen der Elbvorländer zeigt Tabelle 10.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 34 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 10: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den Außendeichsflächen im<br />
Elbästuar<br />
Quelle: Eigene Auswertungen der GIS-Daten von WSA HH (2007)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Vegetationszone Flächengröße Flächenanteil<br />
Salzwiese 374 ha 10 %<br />
Röhrichte 621 ha 17 %<br />
Grünland 1.921 ha 53 %<br />
Ruderalfluren 288 ha 8 %<br />
Gehölze 222 ha 6 %<br />
Acker- und Gartenbaubiotope 57 ha 2 %<br />
Sonstige Vegetationszone 124 ha 4 %<br />
Summe 3.607 ha 100 %<br />
Die aktuellen Daten aus dem Jahr 2005/06 zeigen, dass Röhrichtbestände relativ großflächig<br />
vorhanden sind (fast 20 %). Grünländer kommen auf 53 % der Fläche vor, wobei der<br />
überwiegende Anteil durch Intensiv<strong>grün</strong>länder aufgebaut wird. Gehölze und Ruderalflächen<br />
nehmen einen sehr geringen Flächenanteil ein; sie sind neben Ackerbauflächen und sehr<br />
kleinflächigen Flusswattbiotopen unter den „Sonstigen Vegetationszonen“<br />
zusammengefasst.<br />
Die Salzwiesen, die 10 % des Flächenanteils ausmachen, erstrecken sich über Gebiete<br />
unterhalb Brunsbüttel bzw. ab Südwestspitze des Neufelder Koogs (Schleswig-Holstein)<br />
sowie größere Flächen zwischen Oste-Mündung und Cuxhaven, kleinere auch oberhalb der<br />
Oste-Mündung (Niedersachsen). Diese Salzwiesen auf niedersächsischem Gebiet liegen<br />
außerhalb des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Sie sind vegetationskundlich<br />
auch eher als Grünland mit dem Vorkommen einzelner Salzarten zu verstehen; sie sind nicht<br />
mit den Salzwiesen der Festlandsküste vergleichbar. Ihr Vorkommen ist an eine<br />
landwirtschaftliche Nutzung gebunden, da bei Brachfallen die Salzarten den Süßwasserarten<br />
in der Konkurrenz unterlegen sind.<br />
Im mündungsnahen Bereich zwischen Otterndorf und Allwörden herrschte laut Daten aus<br />
dem Jahr 2001 ein hoher Anteil an Intensiv<strong>grün</strong>land (über 70 %) vor. Extensives Grünland<br />
bzw. Salzwiesen machten einen Anteil von unter 15 % der Flächen aus. In etwa gleichem<br />
Umfang befanden sich Röhrichte auf den Flächen. Der Anteil von Gehölzen und<br />
Ruderalbereichen war sehr gering.<br />
Der Bereich der Elbvorländer zwischen Wischhafen und Finkenwerder wurde 2002 von<br />
Röhrichtbeständen dominiert (ca. 50 %). Ruderalfächen und Gehölze nahmen zusammen<br />
etwa 20 % der Flächen ein. Grünländer hatten hier nur ca. 30 % Flächenanteil, wovon vier<br />
Fünftel intensiv, ein Fünftel extensiv bewirtschaftet wurden.<br />
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen der Elbe von der Mündung bis Hamburg Hafen<br />
bestehen vor allem aus Salzwiesen, Grünland, Obstanbau und Deich<strong>grün</strong>land. Insgesamt<br />
werden ca. 58 ha des betrachteten Bereiches zum Obstanbau genutzt. Auf
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 35<br />
niedersächsischer Seite wird Obstanbau nördlich der Lühe-Mündung, auf dem Asseler Sand<br />
sowie auf einer kleineren Fläche bei Krautsand betrieben.<br />
WESER<br />
Eine Übersicht über die häufigsten Vegetationszonen der Weservorländer zeigt Tabelle 11.<br />
Tabelle 11: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den Außendeichsflächen im<br />
Weserästuar<br />
Quelle: eigene Auswertung der GIS-Daten der HS Vechta (2006)<br />
Vegetationszone Flächengröße Flächenanteil<br />
Röhrichte 1.083 ha 25 %<br />
Grünland 2.172 ha 50 %<br />
Ruderalfluren 285 ha 7 %<br />
Gehölze 184 ha 4 %<br />
Acker- und Gartenbaubiotope 552 ha 13 %<br />
Sonstige Vegetationszone 67 ha 1 %<br />
Summe 4.343 ha 100 %<br />
Im Weserästuar sind insgesamt ein Viertel aller Vorlandflächen durch Röhrichte aufgebaut,<br />
von dem wiederum der Großteil durch Schilfröhrichte geprägt ist. Grünland nimmt insgesamt<br />
die Hälfte der Vorlandflächen ein. Ackerflächen, die insgesamt einen Anteil von 12 %<br />
ausmachen, fallen unter die Einheit „Sonstige Vegetationszonen“. Weitere Biotope dieser<br />
Vegetationszone sind den Gebüschen und Gehölzbeständen und in geringen<br />
Flächenausdehnungen den Wäldern, Magerrasen, Parkanlagen und der Pioniervegetation<br />
zuzuordnen. Im Gegensatz zu den Elb- und Emsästuaren kommen untere Salzwiesen im<br />
Weserästuar nicht vor.<br />
Eine ausführliche Beschreibung erfolgt in GFL, BIOCONSULT & KÜFOG (2006).<br />
EMS<br />
Die Informationen der aktuellen Vegetation (Tabelle 12) sind den GIS-Daten der<br />
Biotoptypenkartierung (IBL 2008, NLWKN BRA-OL 2008) entnommen worden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 36 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 12: Flächenanteil unterschiedlicher Vegetationszonen an den Außendeichsflächen im<br />
Emsästuar<br />
Quelle: eigene Auswertung der GIS Daten IBL (2008), NLWKN BRA-OL (2008)<br />
Vegetationszone Flächengröße Flächenanteil<br />
Salzwiese 170 ha 9 %<br />
Röhrichte 500 ha 27 %<br />
Grünland 924 ha 49 %<br />
Ruderalfluren 121 ha 7 %<br />
Gehölzfreie Biotope der Sümpfe und Ufer (ohne Landröhrichte) 78 ha 4 %<br />
Gehölze 57 ha 3 %<br />
Sonstige Vegetationszone 24 ha 1 %<br />
Summe 1.874 ha 100 %<br />
Der Anteil von Röhricht ist vergleichbar mit dem der Weser und beträgt etwa ein Viertel der<br />
Gesamtvorlandfläche. Ebenso ist die Ausdehnung von Grünland ca. 50 % nahezu identisch<br />
mit dem Anteil an den anderen Ästuaren. Unter die Einheit „Sonstige Vegetationszonen“<br />
fallen neben (Halb-)Ruderalfluren unterschiedlich frischer Ausprägungen auch Sümpfe,<br />
Großseggerieder, Uferstaudenfluren, Gebüsche und Gehölzbestände, Wälder sowie<br />
kleinflächige Wattflächen.<br />
4.2.2.8 ENTWICKLUNG DER VEGETATION<br />
Eine Beschreibung der Entwicklung der gesamten Vorlandvegetation der Ästuare ist nicht<br />
möglich, da flächendeckende Vergleichskartierungen nicht vorhanden sind. Allerdings liegen<br />
Auswertungen zur Entwicklung der Röhrichtbestände vor.<br />
Im Zuge der zuletzt durchgeführten Fahrrinnenvertiefungen von Elbe und Weser wurden<br />
Beweissicherungen durchgeführt, da ein Rückgang der Röhrichtbestände befürchtet wurde.<br />
Hierfür wurde für weite Teile der Vorländer dieser beiden Flüsse die Entwicklung der<br />
Röhrichtbestände in den Jahrzehnten seit etwa 1950 anhand von Luftbildern ausgewertet.<br />
Für die Elbe liegt der ausgewertete Bereich zwischen Wischhafen und Wedel (BfG 2004).<br />
Für die Weser umfassen die untersuchten Bereiche alle relevanten Vorländer zwischen<br />
Berne und Bremerhaven (KÜFOG 2005, BIOS 2005).<br />
Für die Ems liegen keine Angaben zur Röhrichtentwicklung vor.<br />
ELBE<br />
Untersuchungen der aktuellen und historischen Röhricht- und Uferstaudenentwicklung an<br />
der Unter- und Außenelbe (BFG 2004, SCHRÖDER 2007) ergaben auch für die Elbe eine<br />
kontinuierliche Zunahme der Röhrichte in den letzten 30 Jahren.<br />
Dies gilt allerdings nur für die Bereiche stromabwärts von Hamburg. Hier vergrößerte sich die<br />
Röhrichtfläche von ca. 750 ha auf ca. 930 ha. Lokal sind die Veränderungen jedoch<br />
unterschiedlich, Gebiete mit stetigem Röhrichtzuwachs stehen solchen mit einer<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 37<br />
Röhrichtabnahme gegenüber. Die Abnahmen sind auf Erosion zurückzuführen, die Zunahme<br />
sowohl auf Nutzungsaufgabe als auch auf Anlandung bzw. Aufspülungen (Verbringung von<br />
Baggergut). Über 100 ha des Zuwachses von insg. 180 ha gehen zurück auf die Aufgabe<br />
von Korbweidenplantagen auf den Inseln Auberg und Drommel (Bereich Haseldorfer<br />
Marsch).<br />
Stromaufwärts Hamburgs hingegen ist eine leichte Abnahme der Röhrichtbestände von<br />
130 ha auf 100 ha zu erkennen.<br />
In der Untersuchung wird nicht zwischen unterschiedlichen Röhrichttypen (Schilf, Binsen<br />
etc.) differenziert. Auch wird keine Differenzierung zwischen Niedersachsen und Schleswig-<br />
Holstein vorgenommen.<br />
WESER<br />
Für die Unterweser ist die Röhrichtentwicklung zwischen ca. 1950 und 2002 in KÜFOG<br />
(2005) und BIOS (2005) dokumentiert. Südlich von Brake erfolgte im genannten Zeitraum<br />
eine Abnahme der Röhrichtbestände um über 30 % von ca. 208 ha auf ca. 138 ha. Dies ist<br />
vermutlich auf direkte Flächenverluste durch verschiedene Bau- und Infrastruktur-<br />
maßnahmen im betrachteten Bereich zurückzuführen (KÜFOG 2005).<br />
Zwischen Brake und Bremerhaven nahmen die Röhrichtflächen am Ostufer der Unterweser<br />
von Sandstedt bis Bremerhaven zwischen 1954 und 2002 kontinuierlich um ca. 71 % von<br />
ca. 146 ha auf ca. 249 ha zu, was überwiegend auf Nutzungsänderungen zurückzuführen ist.<br />
Wie auch in den Küstenbereichen Butjadingens haben sich dabei die Schilfröhrichtbestände<br />
mehr als verdoppelt, während das sonstige Brackwasserröhricht deutlich zurückgegangen ist<br />
(BIOS 2005). Am Westufer der Weser nahmen die Röhrichtflächen ebenfalls zu, und zwar<br />
um ca. 32 % von ca. 278 ha auf ca. 369 ha. Auch dies wird vornehmlich auf<br />
Nutzungsänderungen zurückgeführt. Ein Zuwachs ist hier vor allem bei den Phragmites-<br />
Beständen zu verzeichnen, wobei die Bolboschoenus-Bestände jedoch nicht wie am Ostufer<br />
zurückgegangen, sondern in etwa gleich geblieben sind. Am Rechten Nebenarm erfolgte<br />
über den gesamten Untersuchungszeitraum eine generelle und relativ kontinuierliche<br />
Röhrichtzunahme um 36 ha, die auf die zunehmende Verlandung zurückgeführt wird. Dabei<br />
wurde beobachtet, dass die Rohrkolbenbestände (Typha spec.) eher stagnierten, während<br />
die Schilfbestände stark zunahmen. Die Scirpus- und Bolboschoenus-Bestände wiesen<br />
einen starken, vermutlich auf den Salzgehalt des Wassers zurückzuführenden Nord-Süd-<br />
Gradienten auf (BIOS 2005).<br />
Entgegen dieser auf Grundlage von Luftbildauswertungen getroffenen Aussagen zur<br />
Röhrichtentwicklung an der Unterweser kommt eine “Ökologische Potenzial- und<br />
Belastungsanalyse” (LK Wesermarsch/UBA 1989) zu dem Ergebnis, dass die Röhricht-<br />
bestände am westlichen Unterweserufer zwischen 1922-1979 um 46,2 % dezimiert wurden.<br />
Diese unterschiedlichen Angaben müssen sich jedoch nicht widersprechen, sondern können<br />
durch die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume erklärt werden. Offenbar fand der in LK<br />
Wesermarsch/UBA (1989) beschriebene Rückgang hauptsächlich zwischen 1922 und ca.<br />
1950 statt und setzte sich auch nach 1950 südlich von Brake noch fort. Dem entgegen läuft<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 38 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
die Zunahme der Röhrichtfläche nördlich von Brake, die offenbar nach 1979 nochmals an<br />
Bedeutung gewann und ab dann stärker war als der anhaltende Verlust.<br />
EMS<br />
Nach Informationen von IBL (2008) ist die landwirtschaftliche Nutzung der ufernahen<br />
Flächen insbesondere durch den Bau der Hauptdeichlinie in den 1960er Jahren begünstigt<br />
worden. Mit dem Bau des Hauptdeiches wurde eine Grundwasserhaltung binnendeichs<br />
ermöglicht sowie Sommerdeiche und ein Entwässerungssystem durch Grabensysteme mit<br />
Sielen und Schöpfwerken angelegt. Naturnahe Vegetationselemente sind infolge der<br />
agrarischen Nutzung nur kleinflächig vorhanden. Sie nehmen nach Aussage von IBL (2008)<br />
seit den 1990er Jahren wieder zu.<br />
Genauere Daten über die Vegetationsentwicklung an der Ems liegen dem Projekt nicht vor.<br />
4.2.2.9 ENTWICKLUNG VON TREIBSELMENGEN UND ENTSORGUNGSKOSTEN<br />
Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zum <strong>Treibsel</strong>problem (AG TREIBSEL 1996) nennt<br />
<strong>Treibsel</strong>mengen für viele (aber nicht alle) niedersächsische Deichverbände aus den Jahren<br />
1975-1995.<br />
Zusätzlich hat der Wasserverbandstag die Entsorgungskosten aller niedersächsischen<br />
Hauptdeichverbände zwischen 1995 und 2010 in einer Tabelle aufgelistet und dem Projekt<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Ferner führen einige Deichverbände eigene Statistiken über die in ihrem Verbandsgebiet<br />
angefallenen <strong>Treibsel</strong>mengen und Entsorgungskosten. Diese liegen dem Projekt für den<br />
Deichverband Osterstader Marsch (1980 – 2008) vor.<br />
Die Entwicklung der entsorgten <strong>Treibsel</strong>mengen für die Sturmflutsaisons 1994/95 bis<br />
2009/10 zeigt Abbildung 6. Zum Vergleich sind neben den entsorgten <strong>Treibsel</strong>mengen der<br />
Ästuare auch die der Festlandsküste dargestellt. Deutlich wird, dass in den Ästuaren mehr<br />
<strong>Treibsel</strong> angefallen ist als an der Festlandsküste. Die Entwicklung in beiden Teilbereichen<br />
läuft weitgehend parallel: in Jahren mit hohem <strong>Treibsel</strong>anfall in den Ästuaren kam es auch zu<br />
einem hohen <strong>Treibsel</strong>anfall an der Festlandsküste.<br />
Die Entsorgungskosten steigen proportional mit der Entsorgungsmenge an und belaufen sich<br />
für den Ästuarbereich zwischen 36.000 € im Jahr 2008/09 und fast 824.000 € im Jahr<br />
2007/08. Durchschnittlich sind in den Jahren 1994 bis 2010 etwa 282.000 €<br />
Entsorgungskosten für das <strong>Treibsel</strong> angefallen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 39<br />
Entsorgtes <strong>Treibsel</strong> (m³)<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Sturmflutsaison<br />
Festlandsküste Ästuare<br />
Abbildung 6: Entsorgte <strong>Treibsel</strong>mengen (m³) an der niedersächsischen Hauptdeichlinie der<br />
Ästuare (orange) sowie zum Vergleich der Festlandsküste (grau)<br />
Zahlen nach Angaben der Deichverbände, ohne NLWKN.<br />
grau: Festlandsküste, rot: Ästuare. Die Kosten des II. Oldenburgischen Deichbandes wurden zu<br />
gleichen Anteilen auf beide Kategorien (Festlandsküste/Ästuare) aufgeteilt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 40 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
4.2.3 ÜBERSICHT ÜBER DIE EINGEWORBENEN GIS-DATENSÄTZE<br />
Tabelle 13: Vorliegende GIS-Datensätze<br />
Bezugsraum Inhalt Jahr der<br />
Datenerhebung<br />
bzw. Stand der<br />
Aktualisierung<br />
Festlandsküste<br />
gesamte<br />
Festlandsküste<br />
gesamte<br />
Festlandsküste<br />
Salzwiesen des<br />
Jadebusens<br />
(Verbandsgebiet<br />
des II.<br />
Oldenburgischen<br />
Deichbandes)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Anlass der<br />
Datenerhebung<br />
Hauptdeichlinie 2007 Erstellung<br />
Generalplan<br />
Küstenschutz<br />
Verbandsgebiete<br />
der<br />
Deichverbände<br />
Höhendaten<br />
aus Laserscans<br />
Norderland Höhendaten<br />
aus Laserscans<br />
Leybucht Höhendaten<br />
aus Laserscans<br />
Langwarder Groden Höhendaten<br />
aus Laserscans<br />
gesamte<br />
Festlandsküste<br />
Salzwiesen des<br />
Jadebusens<br />
(Verbandsgebiet<br />
des II.<br />
Oldenburgischen<br />
Deichbandes)<br />
unbekannt Erstellung<br />
Generalplan<br />
Küstenschutz<br />
Bezugsquelle verwendeter<br />
Schlüssel/<br />
Symbologie<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
2005 Gutachten II.<br />
Oldenburgischer<br />
Deichband / pgg<br />
2003 Monitoring NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
2005 Monitoring WSA-Emden<br />
2006 Planfeststellungsverfahren<br />
Jade-<br />
Weser-Port<br />
Bodendaten 2007 bodenkundliche<br />
Landesaufnahmen<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
Nieders. Umweltministerium<br />
Landnutzung 2003/2004 Gutachten II.<br />
Oldenburgischer<br />
Deichband / pgg<br />
Norderland Landnutzung 2007 <strong>Treibsel</strong>-Projekt AG Landschaftsökologie,<br />
Uni<br />
Oldenburg<br />
gesamter<br />
Nationalpark<br />
gesamter<br />
Nationalpark<br />
Landnutzung 2002 Monitoring Nationalparkverwaltung <br />
Vegetationstypen<br />
2004 Monitoring Nationalparkverwaltung<br />
TMAP und<br />
Lebensraumtypen<br />
nach<br />
FFH-RL
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 41<br />
Fortsetzung Tabelle 13: Vorliegende GIS-Datensätze<br />
Bezugsraum Inhalt Jahr der<br />
Datenerhebung<br />
bzw. Stand der<br />
Aktualisierung<br />
Festlandsküste<br />
Salzwiesen des<br />
Jadebusens<br />
(Verbandsgebiet<br />
des II.<br />
Oldenburgischen<br />
Deichbandes)<br />
Salzwiesen des<br />
Jadebusens<br />
(Verbandsgebiet<br />
des II.<br />
Oldenburgischen<br />
Deichbandes)<br />
gesamte<br />
Festlandsküste<br />
Ästuare<br />
Gesamt (Elbe,<br />
Weser Ems)<br />
Vegetationstypen<br />
Vegetation:<br />
gesetzlich<br />
geschützte<br />
Arten<br />
Wasserstandsdaten<br />
Anlass der<br />
Datenerhebung<br />
2003/2004 Gutachten II. Oldenburgischer<br />
Deichband / pgg<br />
2004 Gutachten II. Oldenburgischer<br />
Deichband / pgg<br />
2006/2007 Daueraufzeich-<br />
nungen<br />
Elbe, Weser, Ems Hauptdeichlinie 2007 Erstellung<br />
Generalplan<br />
Küstenschutz<br />
Elbe, Weser, Ems Verbandsgebiet<br />
e der<br />
Deichverbände<br />
unbekannt Erstellung<br />
Generalplan<br />
Küstenschutz<br />
Elbe, Weser, Ems Bodendaten Stand 2007 bodenkundliche<br />
Landesaufnahmen<br />
Elbe, Weser, Ems Wasserstandsdaten<br />
Elbe<br />
Elbe von<br />
Geesthacht bis<br />
Cuxhaven<br />
(gesamtes<br />
Elbästuar)<br />
Elbe von Otterndorf<br />
bis Abbenfleth<br />
diverse<br />
bodenkundliche<br />
Informationen<br />
2006/2007 Daueraufzeich-<br />
nungen<br />
2006 Planfeststellungsverfahren<br />
2006/2007 zur<br />
Fahrrinnenanpassung<br />
Bezugsquelle verwendeter<br />
Schlüssel/<br />
Symbologie<br />
NLWKN, WSA<br />
(siehe Kapitel<br />
4.4)<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Norden-<br />
Norderney<br />
Nieders. Umweltministerium<br />
NLWKN, WSA,<br />
HPA (siehe<br />
Kapitel 4.4)<br />
WSA Hamburg<br />
Landnutzung 2008 Lokalkenntnisse Naturschutzstation<br />
Unterelbe<br />
(Außenstelle des<br />
NLWKN,<br />
Betriebsstelle<br />
Lüneburg)<br />
TMAP,<br />
ausführliche<br />
Version<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 42 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Fortsetzung Tabelle 13: Vorliegende GIS-Datensätze<br />
Bezugsraum Inhalt Jahr der<br />
Datenerhebung<br />
bzw. Stand der<br />
Aktualisierung<br />
Ästuare<br />
Elbe von<br />
Geesthacht bis<br />
Cuxhaven<br />
(gesamtes<br />
Elbästuar)<br />
Elbe von Freiburg<br />
bis Cuxhaven<br />
Weser<br />
linke Weserseite<br />
von Landesgrenze<br />
Bremen bis<br />
Fedderwardersiel<br />
Weser von Bremen-<br />
Hemelingen bis<br />
Langwarden/<br />
Spieka-Neufeld<br />
Weser von<br />
Blexen/Bremerhaven<br />
bis<br />
Ochtum/Lesum<br />
Ems<br />
Ems von Borßumer<br />
Siel bis Papenburg<br />
Ems von<br />
Papenburg bis<br />
Herbrum<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Anlass der<br />
Datenerhebung<br />
Biotoptypen 2000/2002 Beweissicherung<br />
zur Fahrrinnenanpassung<br />
1999/2000<br />
Biotoptypen 2005 Planfeststellungsverfahren<br />
2006/2007 zur<br />
Fahrrinnenanpassung<br />
Flächen, auf<br />
denen<br />
Reetmahd<br />
genehmigt<br />
wurde<br />
2007 Kataster UNB LK<br />
Wesermarsch<br />
Biotoptypen 2002 Planfeststellungsverfahren<br />
2006/2007 zur<br />
Fahrrinnenanpassung<br />
Landnutzung 2007 <strong>Treibsel</strong>-Projekt pgg<br />
Biotoptypen 2007 Planfeststellungsverfahren<br />
(2008/2009) zur<br />
Emsvertiefung<br />
Biotoptypen 2006/2007 Basiserfassung<br />
FFH-Gebiet 013<br />
„Ems“<br />
4.3 AUSWAHL DER UNTERSUCHUNGSGEBIETE<br />
4.3.1 EINLEITUNG<br />
Bezugsquelle verwendeter<br />
Schlüssel/<br />
Symbologie<br />
WSA Hamburg Biotoptypen<br />
nach<br />
DRACHENFELS<br />
(2004)<br />
WSA Hamburg Biotoptypen<br />
nach<br />
DRACHENFELS<br />
(2004)<br />
UNB LK<br />
Wesermarsch<br />
WSA<br />
Bremerhaven,<br />
aufgenommen<br />
durch HS Vechta<br />
(2006)<br />
IBL Umweltplanung<br />
GmbH<br />
NLWKN<br />
Betriebsstelle<br />
Brake -<br />
Oldenburg<br />
Biotoptypen<br />
nach<br />
DRACHENFELS<br />
(2004)<br />
Biotoptypen<br />
nach<br />
DRACHENFELS<br />
(2004)<br />
Biotoptypen<br />
nach<br />
DRACHENFELS<br />
(2004)<br />
Auf Grundlage der Dokumentation sollen Bereiche ausgewählt werden, die als<br />
Untersuchungsgebiete für die Freilanduntersuchungen der Teilprojekte 2 und 3 am besten<br />
geeignet sind. In diesen Bereichen sollten unterschiedliche Nutzungsformen und -<br />
intensitäten sowie unterschiedliche Standorttypen vertreten sein.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 43<br />
4.3.2 METHODIK<br />
Für die Auswahl der Untersuchungsgebiete wurden folgende Grundsätze berücksichtigt:<br />
Es werden landwirtschaftlich unterschiedlich genutzte Außendeichsflächen<br />
untersucht. Dies meint sowohl unterschiedliche Formen der Nutzung (Mahd,<br />
Beweidung) als auch unterschiedliche Nutzungsintensitäten (unterschiedliche<br />
Beweidungsdichten).<br />
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen werden mit standörtlich möglichst ähnlichen<br />
ungenutzten Flächen verglichen, um die Effekte der unterschiedlichen Nutzungen<br />
darstellen zu können.<br />
Es werden solche Flächen untersucht, deren Nutzungsart und –intensität bis hin zum<br />
Brachestadium bereits langjährig konstant ist. Nur so können relevante Ergebnisse<br />
erzielt werden, da die ökologischen Änderungen in den ersten Jahren nach einer<br />
Nutzungsänderung gravierend sein können.<br />
Die zu untersuchenden Flächen müssen eine gewisse Mindestgröße aufweisen, um<br />
die Auswirkungen der jeweiligen Nutzungsart und –intensität auf kleinräumig<br />
variierenden Standortbedingungen abbilden zu können.<br />
Die zu untersuchenden Flächen sind unbedeicht, weisen also auch keine<br />
Sommerdeiche auf. Aufgrund der intensiveren landschaftlichen Nutzung der<br />
Sommerpolder gehen diese mit nur geringem Biomasse-Aufwuchs in den Winter und<br />
tragen dementsprechend zur <strong>Treibsel</strong>entstehung wenig bei.<br />
Die zu untersuchenden Flächen müssen aus logistischen Gründen (Abtransport der<br />
Biomasse) gut erreichbar und zugänglich sein.<br />
Die Flächeneigentümer müssen der Durchführung von Untersuchungen zustimmen.<br />
Die zu untersuchenden Flächen werden anhand der genannten Kriterien<br />
vorausgewählt. Vor Beginn der Untersuchungen erfolgt jedoch eine<br />
Inaugenscheinnahme durch Projektleiter und –bearbeiter, um die tatsächliche<br />
Eignung der Flächen zu bestätigen.<br />
4.3.3 ERGEBNISSE<br />
FESTLANDSKÜSTE<br />
Aufgrund der umfangreichen Vorkenntnisse von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> sowie der guten<br />
Datenlage war die Auswahl der Probeflächen an der Festlandsküste relativ problemlos<br />
möglich. Es erfolgten dennoch umfangreiche Konsultationen:<br />
In Gesprächen mit der Nationalpark-Verwaltung wurde die aktuelle Nutzungssituation<br />
abgefragt.<br />
Verschiedene Vertreter von Nationalparkverwaltung, Domänenverwaltung und<br />
NLWKN rieten aufgrund der privaten Eigentumsverhältnisse an der Wurster Küste<br />
davon ab, Probeflächen in diesem Gebiet vorzusehen. Es sollten vielmehr die<br />
Domänenflächen zwischen Weser und Ems bevorzugt werden.<br />
Somit kamen die in Tabelle 14 aufgeführten Bereiche in die engere Auswahl.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 44 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 14: Auf ihre Eignung als Probeflächen für das Projekt untersuchte Vorlandabschnitte<br />
der Festlandsküste<br />
Sofern nicht anders angegeben, sind Brachflächen in allen genannten Vorlandabschnitten vorhanden.<br />
Vorlandabschnitt vorhandene Nutzung Ortstermine / Gespräche<br />
mit<br />
Dollart Rinderweiden, teilw. mit<br />
Nachmahd, Schafweiden<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Ausschlusskriterien<br />
bzw. Entscheidung<br />
NLWKN Norden keine Salzwiesen<br />
(Brackwasser)<br />
Krummhörn (Harmswehrum) Schafweide (extensiv) Deichschäfer,<br />
Nationalparkverwaltung<br />
Nutzung jährlich variierend<br />
und nicht dokumentiert,<br />
ferner rechtlicher Status<br />
unklar<br />
Pilsum Rinderweide NLWKN Norden Nutzung 2005 eingestellt<br />
Leybucht (Buscher Heller) Rinderweide<br />
(1,0 Rinder/ha)<br />
Norderland<br />
(Hilgenriedersiel-Neßmersiel)<br />
Norderland<br />
(östlich Neßmersiel)<br />
Rinderweide<br />
(0,5, 1,0, 1,5 Rinder/ha)<br />
Rinderweide<br />
(extensiv)<br />
NLWKN Norden,<br />
Nationalparkverwaltung<br />
NLWKN Norden,<br />
Nationalparkverwaltung<br />
östlich Westeraccumersiel Schafweide (extensiv) Deichacht Esens,<br />
Nationalparkverwaltung<br />
Fläche wird untersucht<br />
Fläche wird untersucht<br />
NLWKN Norden Privateigentum, Nutzung<br />
nicht dokumentiert<br />
(Wieder-)Aufnahme der<br />
Beweidung erst 2006<br />
westlich Bensersiel Schafweide (intensiv) Deichacht Esens ökologische Effekte<br />
intensiver<br />
Schafbeweidung sind<br />
bekannt<br />
Harlingerland<br />
(westlich Harlesiel)<br />
Rinderweide (extensiv) Deichacht Esens Aufnahme der Beweidung<br />
erst 2006<br />
Elisabeth-Aussengroden Mahd III. Oldenburgischer<br />
Deichband,<br />
Grodenaufseher<br />
Pakens Schafweide (extensiv) III. Oldenburgischer<br />
Deichband<br />
nordwestlicher Jadebusen<br />
(Wilhelmshaven-Dangast)<br />
südwestlicher Jadebusen<br />
(Dangast-Jade Wapeler Siel)<br />
südlicher Jadebusen<br />
(Jade Wapeler Siel-<br />
Schweiburger Siel)<br />
östlicher Jadebusen<br />
(Vorlandbereich Sehestedter<br />
Moor)<br />
Mahd III. Oldenburgischer<br />
Deichband,<br />
Rinderweide (extensiv),<br />
Mahd<br />
Rinderweide (extensiv),<br />
Mahd<br />
Nationalparkverwaltung<br />
umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
Rinderweiden umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
östlicher Jadebusen Mahd umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
aktuelle Deichbaustelle,<br />
Mahdflächen im<br />
Jadebusen besser<br />
dokumentiert<br />
Fläche zu klein, keine<br />
Brache als Referenz<br />
Nutzung unregelmäßig,<br />
Mahdflächen im<br />
Jadebusen besser<br />
dokumentiert<br />
Mahd-Fläche wird<br />
untersucht<br />
(Rinderweiden im<br />
Norderland als<br />
Probeflächen optimal, da<br />
unterschiedliche<br />
Beweidungsdichten)<br />
standörtlich entsprechend<br />
denen zwischen Dangast-<br />
Jade Wapeler Siel<br />
Aufnahme der Beweidung<br />
erst 2005<br />
Fläche wird untersucht
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 45<br />
Vorlandabschnitt vorhandene Nutzung Ortstermine / Gespräche<br />
mit<br />
(Augustgroden)<br />
Butjadinger Küste<br />
(westlich Langwarden)<br />
Butjadinger Küste<br />
(Fedderwardersiel-Blexen)<br />
Rinderweide umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
Rinderweiden (extensiv),<br />
Schafweiden (extensiv),<br />
Mahd<br />
umfangreiche<br />
Ortskenntnis pgg<br />
Ausschlusskriterien<br />
bzw. Entscheidung<br />
Rinderweiden im<br />
Norderland als<br />
Probeflächen optimal, da<br />
unterschiedliche<br />
Beweidungsdichten<br />
keine Salzwiesen<br />
(Brackwasser)<br />
Somit wurden als Untersuchungsgebiete an der Festlandsküste gemäß der in Tabelle 14<br />
aufgeführten Kriterien folgende Flächen ausgewählt:<br />
Leybucht (Buscher-Heller)<br />
Norderland (Hilgenriedersiel - Neßmersiel)<br />
südwestlicher Jadebusen (Dangast – Jade Wapeler Siel)<br />
östlicher Jadebusen (Augustgroden)<br />
Untersucht werden können somit die folgenden Nutzungstypen:<br />
gemäht (jährlich, im Sommer)<br />
gemäht (evtl. nicht jährlich, im Sommer)<br />
beweidet (0,5 Rind/ha)<br />
beweidet (1,0 Rind/ha)<br />
beweidet (1,5 Rind/ha)<br />
In jedem Untersuchungsgebiet werden ungenutzte Bereiche als Referenzflächen untersucht.<br />
Die ökologischen Effekte von Schafbeweidung wurden in Schleswig-Holstein bereits<br />
ausführlich untersucht. Im Rahmen dieses Projektes werden deshalb keine erneuten<br />
Untersuchungen von mit Schafen beweideten Flächen durchgeführt.<br />
Die Lage der Untersuchungsgebiete zeigen die nachfolgenden Abbildung 7 bis Abbildung 9.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 46 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 7: Lage des Untersuchungsgebietes Leybucht<br />
Abbildung unmaßstäblich. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung,<br />
Abbildung 8: Lage des Untersuchungsgebietes Norderland<br />
Abbildung unmaßstäblich. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 47<br />
Abbildung 9: Lage der Untersuchungsgebiete im Jadebusen<br />
Abbildung unmaßstäblich. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung.<br />
ÄSTUARE VON ELBE, WESER UND EMS<br />
Die Auswahl von Probeflächen in den Ästuaren gestaltete sich schwieriger. Verantwortlich<br />
hierfür sind:<br />
die fehlende Dokumentation von behördlicher Seite. So existiert für keines der<br />
Ästuare eine flächendeckende Dokumentation der Landnutzung in den<br />
Vorlandflächen,<br />
die zersplitterte behördliche Zuständigkeit (Untere Naturschutzbehörden,<br />
Domänenverwaltung, Untere Deichbehörden),<br />
die zersplitterten Eigentumsverhältnisse (privat, Domänenverwaltung, Wasser- und<br />
Schifffahrtsverwaltung, Hafenbehörden wie bremenports).<br />
Aufgrund der zusammengetragenen Informationen war mit relevanten Flächenanteilen<br />
folgender Nutzungstypen zu rechnen (Tabelle 15):<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 48 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 15: In den Ästuaren hauptsächlich zu erwartende Nutzungstypen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzung Vegetation<br />
ungenutzt / brach Röhricht / Grünlandbrache<br />
Rinderweiden Grünland-Ersatzgesellschaften<br />
auf Röhricht-Standorten<br />
Mahd im Sommer Grünland-Ersatzgesellschaften<br />
auf Röhricht-Standorten<br />
Mahd im Winter<br />
(Reetmahd)<br />
Röhricht<br />
Über die in Kapitel 4.3.2 genannten Kriterien hinaus wurden nun folgende Überlegungen<br />
angestellt:<br />
die Reetmahd ist als Nutzungsform unbedingt zu untersuchen, da sie eine<br />
traditionelle Nutzungsform darstellt, deren ökologische Auswirkung auf das Ästuar<br />
aber weitgehend unbekannt ist<br />
die Probeflächen sollen innerhalb eines Flusssystems liegen, um unbekannte<br />
Einflussfaktoren zu reduzieren<br />
die Probeflächen werden auf den oligohalinen (tidebeeinflussten, schwach<br />
salzwasserbeeinflussten) Bereich des ausgesuchten Ästuars beschränkt, da dieser<br />
Bereich in allen drei Ästuaren mutmaßlich die längste Ausdehnung hat und<br />
außerdem hier der <strong>Treibsel</strong>anfall am größten ist.<br />
Da Reetmahd in nennenswertem Umfang nur noch an der Weser betrieben wird (vgl. Kapitel<br />
4.2.2.5), wurden die Vorländer von Elbe und Ems als Untersuchungsflächen<br />
ausgeschlossen. An der Elbe werden ferner aktuelle umfangreiche Untersuchungen durch<br />
die Uni Hamburg durchgeführt (AG von Prof. Kai Jensen), die sich mit der Produktivität von<br />
Röhrichtbeständen entlang des Längsverlaufs des Ästuars beschäftigen. Diese Daten<br />
können als gute Vergleichsdaten herangezogen werden; eine erneute Untersuchung<br />
derselben Standorte erschien nicht sinnvoll.<br />
Der zu untersuchende (oligohaline) Abschnitt der Weser erstreckt sich von der Nordspitze<br />
des Harriersandes (etwas nördlich von Brake) bis zur Mündungsenge bei<br />
Bremerhaven/Blexen (vgl. GfL, BioConsult & KüFoG 2006, Grotjahn 1983, Witt 2004).<br />
Aufgrund der durchgeführten Nutzungskartierung sowie der Vorinformationen von Seiten der<br />
Landkreise Cuxhaven (Untere Deichbehörde) und Wesermarsch (Untere<br />
Naturschutzbehörde) konnten folgende Bereiche als potenziell geeignet identifiziert werden<br />
(Tabelle 16).
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 49<br />
Tabelle 16: Auf ihre Eignung als Probeflächen für das Projekt untersuchte<br />
Vorlandabschnitte des Weserästuars (oligohaliner Bereich)<br />
Sofern nicht anders angegeben, sind Brachflächen in allen genannten Vorlandabschnitten vorhanden.<br />
Vorlandabschnitt vorhandene Nutzung Ortstermine / Gespräche<br />
mit<br />
linke Weserseite<br />
Strohauser Plate Rinderweide<br />
Mahd im Sommer<br />
Brake-Fähranleger<br />
Golzwarden<br />
Schmalenflether Sand/<br />
Sürwürder Sand<br />
(Fähranleger Golzwarden-<br />
Sürwürderdeich/Harkenbrake)<br />
Sürwürderdeich-<br />
Strohauserdeich<br />
Strohauserdeich-<br />
Kernkraftwerk<br />
Kernkraftwerk-ehem.<br />
Fähranleger Kleinensiel<br />
ehem. Fähranleger<br />
Kleinensiel-Großensiel<br />
(Kleinensieler Plate)<br />
rechte Weserseite<br />
Fähranleger Sandstedt-<br />
Rechtenfleth<br />
intern pgg,<br />
Mellumrat,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
Ausschlusskriterien<br />
bzw. Entscheidung<br />
Untersuchungen logistisch<br />
zu aufwendig<br />
Mahd im Sommer intern pgg Fläche wird für<br />
Bodenabbau und<br />
Hafenerweiterung Brake<br />
beansprucht<br />
Mahd im Sommer<br />
Mahd im Winter<br />
(Reetmahd)<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
Mahd im Sommer intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
Rinderweide<br />
Mahd im Sommer<br />
Acker<br />
Mahd im Sommer<br />
Mahd im Winter<br />
(Reetmahd)<br />
Rinderweide<br />
Mahd im Sommer<br />
Campingplatz,<br />
Kleingärten, Ferienhäuser<br />
Rechtenfleth-Lunesiel Mahd im Winter<br />
(Reetmahd)<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
UNB LK Wesermarsch<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
GLL Stade, Untere<br />
Deichbehörde LK CUX<br />
Lunesiel-Dedesdorf Acker intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
Untere Deichbehörde LK<br />
CUX<br />
Blexer Plate/<br />
Eidewarder Plate<br />
Einswarder Plate/<br />
Vorland Luneplate<br />
Acker<br />
Rinderweide<br />
Mahd im Sommer<br />
Rinderweide<br />
Mahd im Sommer<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
GLL Stade, Untere<br />
Deichbehörde LK CUX<br />
intern pgg,<br />
WSA Bremerhaven,<br />
bremenports,<br />
GLL Stade, Untere<br />
Deichbehörde LK CUX<br />
Fläche wird untersucht<br />
keine Reetmahd als<br />
Referenz<br />
teilweise Sommerdeich,<br />
keine Reetmahd als<br />
Referenz<br />
keine Brache als Referenz<br />
Sommerdeich oder<br />
aufgespült, Nutzungsänderung<br />
durch<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
aufgespült,<br />
Fläche wird untersucht<br />
aufgespült<br />
keine Abstimmung über<br />
Betreten mit<br />
Flächeneigentümer<br />
(bremenports) möglich<br />
keine Abstimmung über<br />
Betreten mit<br />
Flächeneigentümer<br />
(bremenports) möglich<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 50 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Somit wurden als Untersuchungsgebiete an den Ästuaren gemäß der in Tabelle 16<br />
aufgeführten Kriterien folgende Flächen ausgewählt:<br />
Schmalenflether Sand/Sürwürder Sand (Fähranleger Golzwarden-Sürwürderdeich/<br />
Harkenbrake)<br />
Rechtenfleth-Lunesiel<br />
Untersucht werden somit folgende Nutzungstypen:<br />
gemäht (im Sommer; Grünlandersatzgesellschaften auf Röhrichtstandorten)<br />
gemäht (im Winter, Reetmahd)<br />
In jedem Untersuchungsgebiet werden ungenutzte Bereiche als Referenzflächen untersucht.<br />
Die Lage der Untersuchungsgebiete zeigt die nachfolgende Abbildung 10.<br />
Abbildung 10: Lage der Untersuchungsgebiete auf der West- und Ostseite der Weser<br />
Abbildung unmaßstäblich. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung.<br />
4.4 DOKUMENTATION DER STURMFLUTEN<br />
4.4.1 EINLEITUNG<br />
Um das <strong>Treibsel</strong>aufkommen in seiner räumlichen und zeitlichen Variabilität zu erfassen,<br />
wurde nach zwei sehr schweren Sturmfluten in den Jahren 2006 und 2007 die Menge des<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 51<br />
angelandeten <strong>Treibsel</strong>materials erfasst und ausgewertet. Die Ergebnisse dienen zum einen<br />
als Grundlage für die Fragestellung der Zusammenhänge des <strong>Treibsel</strong>aufkommens am<br />
Deichfuß bei Sturmfluten in Abhängigkeit der Biomasseproduktion des Vorlandes (Teilprojekt<br />
2, Kapitel 5) und zum anderen der Ermittlung von Schwerpunktbereichen hinsichtlich des<br />
Erfordernisses eines treibselreduzierenden Vorlandmanagements (vgl. Kapitel 7.2).<br />
4.4.2 METHODE<br />
Zur <strong>Treibsel</strong>dokumentation der Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 wurden die<br />
Deichverbände der gesamten niedersächsischen Küste gebeten, die <strong>Treibsel</strong>menge pro<br />
Deichabschnitt nach der Sturmflut bzw. bei der Abfuhr auf einer fünfteiligen Skala anhand<br />
eines standardisierten Schlüssels zu schätzen.<br />
Am 02./03.11.2006 unternahmen Mitarbeiter von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> eine Bereisung der<br />
ostfriesischen Festlandsküste von der Krummhörn bis zur Wesermündung, um sich ein Bild<br />
vom <strong>Treibsel</strong>anfall zu machen. Hierbei wurden Fotos angefertigt, die zur Erstellung eines<br />
Schlüssels verwendet wurden: Der <strong>Treibsel</strong>anfall wurde in Mengenkategorien unterteilt und<br />
mit je zwei Beispielfotos belegt (vgl. Tabelle 17).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 52 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 17: Schlüssel zur Kategorisierung des <strong>Treibsel</strong>anfalls<br />
Mengenkategorie<br />
Nr. Bezeichnung Beispielfotos<br />
0 kein <strong>Treibsel</strong><br />
1 wenig <strong>Treibsel</strong><br />
2<br />
mäßiges <strong>Treibsel</strong>-<br />
aufkommen<br />
3 viel <strong>Treibsel</strong><br />
4 sehr viel <strong>Treibsel</strong><br />
Die so entstandene Erfassungsanleitung wurde an alle niedersächsischen<br />
Hauptdeichverbände sowie das NLWKN, Betriebsstelle Norden-Norderney verschickt. Die<br />
Erfassung des <strong>Treibsel</strong>anfalls erfolgte im Jahr 2006 für das Gebiet des II. Oldenburgischen<br />
Deichbandes sowie im Jahr 2007 für das Verbandsgebiet des Deichverbandes der<br />
Osterstader Marsch durch Mitarbeiter von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>.<br />
Die Angeschriebenen wurden aufgefordert, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich den<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall anhand des mitgeschickten Schlüssels einzuordnen, die entsprechenden<br />
Deichabschnitte in Karten einzutragen und die Karten an <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong><br />
zurückzusenden. Die Angeschriebenen wurden ausdrücklich gebeten, bei ihren Angaben<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 53<br />
ausschließlich den durch die Sturmflut am 01.11.2006 bzw. 09.11.2007 verursachten<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall zu berücksichtigen und die bei früheren oder späteren Sturmfluten zusätzlich<br />
angefallenen <strong>Treibsel</strong>mengen nicht zu berücksichtigen.<br />
Der relativ einfach gehaltene Schlüssel mit Fotos sollte die möglichst objektive Erfassung<br />
des <strong>Treibsel</strong>aufkommens durch unterschiedliche Personen ermöglichen. Es sollten für die<br />
gesamte Deichlinie vergleichbare, „absolute“ Werte aufgenommen werden. Es ging nicht<br />
darum, zu dokumentieren, ob der <strong>Treibsel</strong>anfall an einem bestimmten Deichabschnitt höher<br />
war als in anderen Wintern.<br />
Die von den Deichverbänden eingesendeten Karten wurden von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> in<br />
GIS-Daten übersetzt. Als topologische Datengrundlagen wurden folgende GIS-Daten<br />
herangezogen:<br />
die Hauptdeichlinie des gesamten Tidebereichs der Festlandsküste und der drei<br />
Ästuare von Ems (flussaufwärts bis Herbrum), Weser (bis Bremen) und Elbe (bis<br />
Geesthacht) (Linien-Thema),<br />
die Vegetationskartierungen der Vorländer der Festlandsküste und der Ästuare<br />
(Quellen siehe Kapitel 4.2.3).<br />
Betrachtungsraum der Auswertung ist:<br />
die gesamte niedersächsische Festlandsküste mit ihren drei großen Buchten Dollart,<br />
Leybucht und Jadebusen, ihren westexponierten Abschnitten in der Krummhörn und<br />
dem Land Wursten sowie ihren überwiegend nordexponierten Abschnitten an der<br />
friesischen und ostfriesischen Festlandsküste,<br />
der gesamte Tidebereich von Elbe und Weser, wobei an der Elbe nur die<br />
niedersächsische Seite in die Betrachtung einbezogen wurde.<br />
Da beide Sturmfluten die Sommerdeiche überspült hatten, wurden dem Hauptdeich<br />
vorgelagerte Sommerpolderflächen in die Untersuchung einbezogen.<br />
Die gewonnenen Daten wurden in ein Geographisches Informationssystem (GIS) überführt.<br />
Das Linien-Thema mit der Hauptdeichlinie wurde in Abschnitte unterteilt und für jeden<br />
Abschnitt die ermittelte Mengenkategorie attributiert. Ein Deichabschnitt ist hierbei definiert<br />
durch eine einheitliche Mengenkategorie des angefallenen <strong>Treibsel</strong>s. Änderte sich die<br />
erfasste Kategorie, so wurde an dieser Stelle ein neuer Deichabschnitt begonnen. Diese<br />
Bearbeitung erfolgte sowohl für die Daten aus 2006 als auch aus 2007.<br />
Anhand der Analyse der GIS-Daten konnten 5 Variablen gewonnen werden, die das<br />
<strong>Treibsel</strong>aufkommen eines einzelnen Deichabschnitts erklären (siehe nachfolgende Tabelle<br />
18). Diese Variablen lagen als Einträge in den GIS-Datensätzen (Attributtabellen) für jede<br />
betrachtete Flächeneinheit vor.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 54 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 18: Zur Erklärung des beobachteten <strong>Treibsel</strong>aufkommens verwendete Variablen<br />
erklärende Variable methodische Erläuterung<br />
Vorlandfläche je<br />
Deichabschnitt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Dazu wurde das Linien-Thema „<strong>Treibsel</strong>mengen“ mit dem Flächen-Thema<br />
„Vorland“ verschnitten. Für jeden Deichabschnitt wurde die Summe aller<br />
Einzelflächen gebildet und die Summe auf einen lfd. m Deichabschnitt<br />
umgerechnet. Da die Zahl sehr kleiner Flächen überwiegt, wird die Variable zur<br />
Annäherung an eine Normalverteilung logarithmiert (zur Basis 10).<br />
Nutzung des Vorlandes Auf der Basis der verschnittenen Karten „<strong>Treibsel</strong>mengen“ und „Vorland“ wurde die<br />
Summe aller Einzelflächen eines Nutzungstyps pro Deichabschnitt gebildet und<br />
diese auf lfd. m Deichabschnitt bezogen.<br />
Vegetation des Vorlandes Auf der Basis der verschnittenen Karten „<strong>Treibsel</strong>mengen“ und „Vorland“ wurde die<br />
Summe aller Einzelflächen eines Vegetationstyps pro Deichabschnitt gebildet und<br />
diese auf lfd. m Deichabschnitt bezogen.<br />
Sommerdeich vorhanden<br />
oder nicht<br />
Exposition der<br />
Deichabschnitte zur<br />
Hauptwindrichtung der<br />
Sturmfluten 2006 und<br />
2007<br />
4.4.3 ERGEBNISSE<br />
Das Vorkommen von Sommerdeichen pro Deichabschnitt wurde folgendermaßen<br />
codiert: ja = 1, nein = 0.<br />
Mit Hilfe eines Skriptes wurde in ArcGIS/ArcMap die Exposition der<br />
Deichabschnitte in Grad berechnet. Entsprechend der Hauptwindrichtung während<br />
der Sturmflut wurden an der Küste die N- und NW- exponierten Deichabschnitte mit<br />
1 (Luv), die NO-, O-, SO-, S-, SW-, W-Abschnitte mit 0 (Lee) codiert. In Ästuaren<br />
wurden die N-, NW-, W-Abschnitte mit 1, die<br />
NO-, O-, SO-, S-, SW-Abschnitte mit 0 codiert. Ein Grund dafür ist, dass die Flüsse<br />
entweder in nördlicher Richtung (Ems und Weser) oder in nordwestlicher Richtung<br />
orientiert (Elbe) sind. Mithin weisen die Uferlinien entweder Ost- oder<br />
Westorientierung (Ems, Weser) bzw. Nordost- oder Südwestorientierung (Elbe) auf.<br />
Da der Wind während der Sturmfluten aus Nord bis Nordwest kam, haben wir auch<br />
west-exponierte Ufer als luvwärts codiert.<br />
4.4.3.1 DOKUMENTATION DER STURMFLUTEN<br />
Am Morgen des 01.11.2006 kam es aufgrund von lang anhaltenden starken nordwestlichen<br />
Winden, die zeitlich mit den Eintritt des Tidehochwassers zusammenkamen, zu einer sehr<br />
schweren Sturmflut an der deutschen Nordseeküste. Die Sturmflut zählt zu den schwersten<br />
der letzten 100 Jahre an der niedersächsischen Nordseeküste. Die Höhe dieser Flut fiel<br />
allerdings regional sehr unterschiedlich aus. Brennpunkt des Geschehens waren die<br />
Emsmündung und die Jade, wo der NLWKN eine sehr schwere Sturmflut verzeichnete. Im<br />
Bereich der ostfriesischen Küste und des Jadebusens wurden die Wasserstände der 1962er-<br />
Sturmflut teilweise erreicht, teilweise sogar übertroffen (NLWKN NOR 2006). So registrierte<br />
der NLWKN im Bereich der Emsmündung an den Pegeln Knock und Emssperrwerk die<br />
höchsten jemals gemessenen Wasserstände: An der Knock bei Emden lag der Höchstwert<br />
bei circa 3,6 m über MThw, am Emssperrwerk bei Gandersum bei rund 3,9 m. Die<br />
Betriebsstelle Brake-Oldenburg des NLWKN meldete ebenfalls eine sehr schwere Sturmflut<br />
im Jade-Revier mit Werten deutlich über drei Metern über MThw (Wilhelmshaven: 3,15 m,<br />
Vareler Schleuse 3,49 m).<br />
In den weiter östlich bzw. nördlich gelegenen Küstenabschnitten (Wurster Küste,<br />
Elbmündung, Schleswig-Holstein) hingegen waren die Wasserstände deutlich niedriger.<br />
Ursache für die sehr hohen Wasserstände im Bereich zwischen Ems und Weser war der
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 55<br />
zum Scheitelpunkt der Flut von NW über N hinaus auf bis NNO drehende Wind, der das<br />
Wasser direkt auf die Festlandsküste drückte und dort staute. Gleichwohl verzeichnete die<br />
Betriebsstelle Stade des NLWKN an den Pegeln der Unterelbe in Bremerhaven, Cuxhaven,<br />
Otterndorf und Standersand jeweils Werte deutlich über zwei Meter über dem normalen<br />
Hochwasser.<br />
Im Jahr 2007 erzeugte Orkan „Tilo“ vom 8.11. nachts bis 9.11. mittags über der gesamten<br />
Nordsee einen schweren Sturm aus nordwestlicher Richtung. Vor der Emsmündung wurden<br />
im Mittel 22 m/s entsprechend 80 km/h (9 Bft.) gemessen mit Böen bis 31 m/s entsprechend<br />
111 km/h. Weiter zur Küste war der Wind schwächer. Etwa 80 km vor der Küste wurden im<br />
Mittel 19 m/s entsprechend 69 km/h (8 Bft.) gemessen. Durch die große Ausdehnung und<br />
Schwere des Windfeldes kam es am Vormittag des 9.11.2007 an der deutschen<br />
Nordseeküste zu einer Sturmflut, die im Bereich der großen Tidebuchten Dollart (Emden<br />
3,29 m über MThw) und Jadebusen (Wilhelmshaven 3,08 m über MThw) das Ausmaß einer<br />
sehr schweren Sturmflut erreichte (NLWKN NOR 2007).<br />
4.4.3.2 DOKUMENTATION DES TREIBSELANFALLS<br />
Zahlreiche Deichverbände sind der Aufforderung der „<strong>Treibsel</strong>dokumentation“ nach den<br />
Sturmfluten im Jahr 2006 und 2007 nachgekommen. Dennoch liegen für einzelne<br />
Deichabschnitte keine Angaben vor, da von einigen Deichverbänden keine Informationen<br />
einzuholen waren. Hierfür liegen unterschiedlichste Gründe vor; sei es mangels Interesse<br />
aufgrund von geringem <strong>Treibsel</strong>anfall im Verbandsgebiet, personeller Möglichkeiten oder<br />
sonstiger unbekannter Gründe. Insgesamt konnten für beide Jahre Daten zum <strong>Treibsel</strong>anfall<br />
für den überwiegenden Teil der niedersächsischen Festlandküste zusammengetragen<br />
werden. Die erhobenen Daten wurden von <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> in Karten umgesetzt.<br />
Zur Dokumentation der Sturmfluten in den Jahren 2006 und 2007 wurden zudem die<br />
Scheitelwerte (maximale Wasserstände) sämtlicher Pegel entlang der Festlandsküste an den<br />
Tagen 01.11.2006 und 09.11.2007 bei den zuständigen Institutionen (NLWKN AUR 2009,<br />
NLWKN BRA-OL 2009, NLWKN STD 2009, WSA CUX 2009, WSA EMD 2009, WSA WEM<br />
2009, WSA WHV 2009) abgefragt.<br />
Die räumliche Verteilung des <strong>Treibsel</strong>s nach den Sturmfluten am 01.11.2006 und 09.11.2007<br />
an der gesamten niedersächsischen Hauptdeichlinie kann den Karten 1a und 1b entnommen<br />
werden.<br />
Im Bereich der Elbe ist die besondere Situation zu beachten, dass das abgelagerte <strong>Treibsel</strong><br />
bei nachfolgenden, höheren Fluten teilweise wieder weggeschwemmt und auf der schleswig-<br />
holsteinischen Seite abgelagert wurde. Dieses Phänomen ist offenbar regelmäßig zu<br />
beobachten (telef. Auskunft von H. Barwig, Vorsteher DV Kehdingen-Oste, 17.01.2007).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 56 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Es ist erkennbar, dass die angefallenen <strong>Treibsel</strong>mengen in beiden Jahren am höchsten<br />
waren:<br />
an west- und nordexponierten Deichabschnitten, besonders mit vorgelagertem<br />
Vorland (Küste und Elbe),<br />
auf den Ostufern von Ems und Weser (Ästuare).<br />
Nur geringer <strong>Treibsel</strong>anfall wurde an den schar liegenden Deichen (Deiche ohne<br />
vorgelagertes Vorland) dokumentiert.<br />
Vor den Hauptdeichen vorgelagerte Sommerdeiche fingen teilweise größere Mengen<br />
<strong>Treibsel</strong> ab, so dass an diesen Stellen der <strong>Treibsel</strong>anfall am Hauptdeich deutlich geringer<br />
war (z.B. Langwarder Groden, Belumer Außendeich). Wurden die Sommerdeiche jedoch<br />
überspült, so wurde das <strong>Treibsel</strong> überwiegend am Hauptdeich abgelagert (z.B.<br />
Westerneßmer Sommerpolder).<br />
Die geschätzte Menge angelandeten <strong>Treibsel</strong>s belief sich nach der Sturmflut 2006 an der<br />
Festlandsküste auf mindestens 165.510 m³. Die Deichbände haben zur Beseitigung dieser<br />
Mengen Entsorgungskosten von mindestens 1,28 Mio. € einschließlich der Beseitigung<br />
kleinerer Schäden geschätzt. Für das Jahr 2007 betrug die geschätzte Menge an der<br />
Festlandsküste mindestens 79.580 m³ und somit wesentlich weniger als im Vorjahr – hier ist<br />
jedoch zu beachten, dass nicht alle Deichbände die <strong>Treibsel</strong>mengen und Entsorgungskosten<br />
gemeldet haben. Beispielsweise fehlen Daten vom II. Oldenburgischen Deichband, der im<br />
Jahr 2006 ein Gros des <strong>Treibsel</strong>aufkommens auf seinem Verbandsgebiet aufgefunden hat<br />
(vgl. Tabelle 19).<br />
In den Ästuaren ist nach Schätzungen der Deichbände im Verlauf der Sturmflut 2006 mehr<br />
als 112.000 m³ <strong>Treibsel</strong>material angefallen. Für die Entsorgung wurden Kosten von<br />
mindestens 86.300 € gemeldet, allerdings liegen für mehrere Deichverbände, die von<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall betroffen waren, hierzu keine Angaben vor. Für die darauffolgende starke<br />
Sturmflut 2007 gaben die Verbände <strong>Treibsel</strong>mengen von mindestens 79.580 m³ an. Über die<br />
damit verbundenen Entsorgungskosten dieses Jahres liegen dem Projekt keine Schätzungen<br />
vor (vgl. Tabelle 20).<br />
Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass nicht von sämtlichen<br />
Deichbänden Angaben oder nur sehr grobe Schätzungen gemacht werden konnten.<br />
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung zwischen den <strong>Treibsel</strong>mengen einerseits und<br />
der Exposition des Deichabschnittes, der Vorlandtiefe und weiteren Faktoren sind in Kapitel<br />
5.3 dargestellt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 57<br />
Tabelle 19: Übersicht über geschätzte angefallene <strong>Treibsel</strong>mengen und geschätzte<br />
Entsorgungskosten durch die Sturmfluten am 01.11.2006 und 09.11.2007 an der Festlandsküste<br />
Quelle: Angaben der Institutionen<br />
Institution geschätzte<br />
Menge<br />
Deichacht<br />
Esens-Harlingerland<br />
Deichacht Krummhörn 15.000-18.000<br />
m 3<br />
geschätzte<br />
Entsorgungskosten<br />
geschätzte<br />
Menge<br />
geschätzte<br />
Entsorgungskosten<br />
2006 2006 2007 2007<br />
6.070 m 3 33.000 € 4.210 m³ k. A.<br />
ca. 75.000 € 11.100 m³ k. A.<br />
Deichacht Norden 7.500 m 3 k.A. 4.550 m 3 k.A.<br />
Deichverband<br />
Land Wursten<br />
k.A. k.A. 22.000 m³ k.A.<br />
II. Oldenburgischer Deichband 72.000 m 3 1.100.000. € k. A. k. A.<br />
III. Oldenburgischer Deichband 33.000 m 3 70.000 € 29.000 m³ k. A.<br />
Rheider Deichacht 3.000 m 3 6.300 € k. A. k. A.<br />
NLWKN Norden<br />
Sommerdeiche Ostfriesland<br />
Leybucht<br />
Dollart<br />
Emsmündung<br />
11.040 m³<br />
7.900 m 3<br />
10.000 m³<br />
k. A.<br />
k.A.<br />
k.A.<br />
k.A.<br />
k.A.<br />
1.970 m³<br />
1.700 m³<br />
4.600 m³<br />
450 m³<br />
Summe min. 165.510 m 3 min 1,28 Mio. € min. 79.580 m³ k.A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 58 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 20: Übersicht über geschätzte angefallene <strong>Treibsel</strong>mengen und geschätzte<br />
Entsorgungskosten durch die Sturmflut vom 01.11.2006 in den Ästuaren<br />
Quelle: Angaben der Institutionen<br />
Institution geschätzte Menge geschätzte<br />
Entsorgungskost<br />
en<br />
Artlenburger<br />
Deichverband<br />
Cuxhavener<br />
Deichverband<br />
Deich- u.<br />
Wasserverband<br />
Vogtei-Neuland<br />
Deichverband der I.<br />
Meile Alten Landes<br />
Deichverband der II.<br />
Meile Alten Landes<br />
Deichverband<br />
Heede-Aschendorf-<br />
Papenburg<br />
Deichverband<br />
Kehdingen-Oste<br />
Deichverband<br />
Osterstader Marsch<br />
Hadelner Deich- u.<br />
Uferbauverband<br />
Harburger<br />
Deichverband<br />
I. Oldenburgischer<br />
Deichband<br />
Leda-Jümme-<br />
Verband<br />
Moormerländer<br />
Deichacht<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
geschätzte Menge geschätzte<br />
Entsorgungskost<br />
en<br />
2006 2006 2007 2007<br />
k. A. k. A. 1.420 m³ k. A.<br />
k. A. k. A. k. A. k. A.<br />
0 m 3 k. A. k. A. k. A.<br />
0 m 3 k. A. k. A. k. A.<br />
0 m³ k. A. k. A. k. A.<br />
200 m3 k. A. 900 m³ k. A.<br />
80.000 m3 80-100.000 € 52.000 m³ k. A.<br />
20.000-25.000 m³ k.A. k.A. k.A.<br />
3.500-5.500 m3 k. A. 11.500 m³ k. A.<br />
0 m 3 k. A. 0 m³ k. A.<br />
480 m 3 k. A. k. A. k. A.<br />
50 m 3 k. A. 20 m³ k. A.<br />
3.000m 3 k. A. 1.470 m³ k. A.<br />
Ostedeichverband 1.800 m 3 k. A. k. A. k. A.<br />
Overledinger<br />
Deichacht<br />
600 m 3 k. A. 700 m³ k.A.<br />
Rheider Deichacht 3.000 m 3 6.300 € k. A. k. A.<br />
Summe min. 112.630 m³ min 86.300 € min. 68.010 m³ k. A.<br />
4.4.4 DISKUSSION<br />
Das Ereignis einer sehr schweren Sturmflut, wie es in den Jahren 2006 und Jahr 2007 in<br />
einigen Nordseeküstenabschnitten eingetreten ist, tritt seltener als einmal in 20 Jahren auf
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 59<br />
(NLWKN NOR 2007). Aus Sicht des hier betrachteten Forschungsvorhabens waren die<br />
Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 äußert günstige Umstände, da somit beste<br />
Voraussetzungen für eine sachdienliche Datengrundlage vorliegen.<br />
Die Rückläufe der Meldungen von <strong>Treibsel</strong>mengen einzelner Deichverbände erfolgten aus<br />
verschiedenen Gründen nicht vollständig. Die Rücklaufquote beider Jahre ist aber<br />
ausreichend, um belastbare Aussagen zur räumlichen Variabilität treffen zu können.<br />
Die angegebenen Zahlen bzw. Mengen bezüglich des <strong>Treibsel</strong>anfalls und der<br />
Entsorgungskosten sind mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, da sie auf relativ<br />
spontanen Schätzungen in den Tagen unmittelbar nach der Sturmflut basieren. Innerhalb<br />
von Wochen reduziert sich das Volumen des angelandeten <strong>Treibsel</strong>s durch Trocknungs- und<br />
Zersetzungsprozesse merklich, weshalb die Angabe der <strong>Treibsel</strong>mengen nicht in<br />
Kubikmetern oder Tonnen erfolgte, sondern anhand der fünf Mengenkategorien. Ferner ist<br />
zu beachten, dass es sich bei einer Schätzung immer um die subjektive Betrachtung des<br />
jeweiligen Erfassers handelt. Durch die methodischen Vorgaben und den für die konkrete<br />
Fragestellung und der Betrachtungsraum erarbeiteten „Schlüssel“ wird jedoch eine<br />
bestmögliche Vergleichbarkeit gewahrt.<br />
4.5 DATENAU<strong>FB</strong>EREITUNG FÜR DIE STATISTISCHE AUSWERTUNG<br />
Die Datenaufbereitung der eingeworbenen Informationen zur Vorlandvegetation und<br />
-nutzung sowie zu den <strong>Treibsel</strong>mengen erfolgte im Rahmen des Teilprojektes 1A durch<br />
Mitarbeiter der <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>. Die statistische Auswertung dieser Daten erfolgt<br />
jedoch im Rahmen des Teilprojektes 2, weshalb die Aufbereitung der Daten in enger<br />
Abstimmung der Projektbeteiligten erfolgte. Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit und<br />
eines besseren Verständnisses wird die Methode der Aufbereitung der Daten im<br />
entsprechenden Kapitel des Teilprojektes 2 (Kapitel 5) dargelegt.<br />
4.6 FAZIT TEILPROJEKT 1A<br />
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens konnte eine umfangreiche Beschreibung des<br />
aktuellen Zustandes und der Entwicklung der Vorländer sowohl für die der Festlandsküste<br />
als auch der Ästuare erfolgen. Dies erforderte insbesondere für den Bereich der Ästuare eine<br />
umfangreiche Recherche, da hier eine einheitliche behördliche Zuständigkeit fehlt, wie sie für<br />
die Festlandsküste durch die Nationalparkverwaltung gegeben ist. Auch bestehen für die<br />
Ästuare keine systematischen Dokumentationen von Befliegungen, Kartierungen,<br />
landwirtschaftlicher Nutzung oder der Entwicklung der Größe der Außendeichsflächen. Somit<br />
stellt der im Rahmen dieses Projektes zusammengestellte und im geografischen<br />
Informationssystem aufbereitete Datensatz nicht nur eine optimale Datengrundlage für<br />
dieses Projekt dar, sondern steht nun auch für andere Fragestellungen zur Verfügung.<br />
Auf Grundlage dieser Dokumentation konnten die am besten geeigneten<br />
Untersuchungsgebiete für die Freilanduntersuchungen der Teilprojekte 2 (Kapitel 5) und 3<br />
(Kapitel 6) ausgewählt werden. In diesen Untersuchungsgebieten sind sowohl<br />
unterschiedliche Nutzungsformen und -intensitäten als auch unterschiedliche Standorttypen<br />
vertreten. Für die Festlandsküste wurden Standorte im Bereich der Leybucht, des<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 60 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Norderlandes und im Jadebusen mit Mahdnutzungen (jährlich und nicht jährlich, im Sommer)<br />
sowie Nutzung durch Beweidung (0,5; 1,0 und 1,5 Rind/ha) ermittelt. Als<br />
Untersuchungsgebiete für die Ästuare wurden drei Vorlandbereiche des Weserabschnittes<br />
auf Höhe der Strohauser Plate mit den Mahdnutzungen (Grünland-Mahd im Sommer,<br />
Röhricht-Mahd im Winter) ausgewählt.<br />
Die Erfassung des <strong>Treibsel</strong>aufkommens in seiner räumlichen und zeitlichen Variabilität<br />
erfolgte nach den sehr schweren Sturmfluten in den Jahren 2006 und 2007. Das Ereignis<br />
einer sehr schweren Sturmflut tritt seltener als einmal in 20 Jahren auf (NLWKN NOR 2007).<br />
Dies macht deutlich, dass hinsichtlich der Fragestellungen, Zusammenhänge des<br />
<strong>Treibsel</strong>aufkommens am Deichfuß bei Sturmfluten in Abhängigkeit der Biomasseproduktion<br />
des Vorlandes sowie der Ermittlung von Schwerpunktbereichen hinsichtlich des<br />
Erfordernisses eines treibselreduzierenden Vorlandmanagements, eine ausgezeichnete<br />
Datengrundlage geschaffen werden konnte.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 61<br />
4.7 LITERATUR<br />
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE REINHALTUNG DER ELBE (ARGE ELBE) (Hrsg., 1984):<br />
Gewässerökologische Studie der Elbe von Schnackenburg bis zur See. Hamburg, 99 S.<br />
ARBEITSGRUPPE ZUM TREIBSELPROBLEM (AG TREIBSEL) (1996): <strong>Treibsel</strong>problematik an den<br />
Hauptdeichen der niedersächsischen Nordseeküste und der von der Tide beeinflussten<br />
Flussläufe. – Bericht im Auftrag der Bezirksregierung Lüneburg, 150 S. + Anhang.<br />
ARENS, S. (2005): Beweissicherung Küstenschutz Leybucht von 1995-2004. – Bericht des NLWKN,<br />
108 S. 11 Anlagen. Brake, Oldenburg, Wilhelmshaven.<br />
BAKKER, J. P., J. BUNJE, K. DIJKEMA, J. FRIKKE, N. HECKER, B. KERS, P. KÖRBER, J. KOHLUS & M. STOCK<br />
(2005): Salt Marshes. – In: ESSINK, K., C. DETTMANN, H. FARKE, K. LAURSEN, G. LÜERßEN, H.<br />
MARENCIC & W. WIERSINGA (Hrsg.): Wadden Sea Quality Status Report 2004. – Wadden Sea<br />
Ecosystem 19: 163-179.<br />
BAKKER, J. P., J. DE LEEUW, K. S. DIJKEMA, P. C. LEENDERTSE, H. H. T. PRINS & J. ROZEMA (1993): Salt<br />
marshes along the coast of The Netherlands. - Hydrobiologia 265: 73-95.<br />
BAKKER, J. P., P. ESSELINK, R. V. DER WAAL & K. S. DIJKEMA (1997): Options for restoration and<br />
management of coastal salt marshes in Europe. - In: URBANSKA, K. M., N. R. WEBB & P. J.<br />
EDWARDS: Restoration ecology and sustainable development. Cambridge: University Press.<br />
286-322.<br />
BIOS (2005): Digitale Aufbereitung von Unterlagen zur Ausdehnung von Röhrichten an der Unter- und<br />
Außenweser seit ca. 1950. Teil I bis IV. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des<br />
Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven.<br />
BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (BFG) (2004): Analyse der aktuellen räumlichen Veränderungen<br />
ufernaher Röhrichte und Uferstauden unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen<br />
Entwicklung der letzten 30 bis 50 Jahre, Schröder, BfG-1441<br />
BUNJE, J. & J.L. RINGOT (2003): Lebensräume im Wandel. Flächenbilanz von Salzwiesen und Dünen<br />
im niedersächsischen Wattenmeer zwischen den Jahren 1966 und 1997 - eine<br />
Luftbildauswertung - Schriftenreihe Nationalpark Nds. Wattenmeer, Bd. 7. 46 S. + CD-Rom.<br />
BUNJE, J. & R. ZANDER (1999): Salzwiesenschutz im Nationalpark Niedersächsiches Wattenmeer. – In:<br />
Nationalparkverwaltung Niedersächsiches Wattenmeer & Umweltbundesamt (Hrsg.):<br />
Umweltatlas Wattenmeer, Bd.2. Wattenmeer zwischen Elb- und Emsmündung. Stuttgart:<br />
Ulmer, 200 S.<br />
DIJKEMA, K. S. & W. J. WOLFF (Bearb.; 1983): Ecology of the Wadden Sea. Rotterdam: Balkema.<br />
DRACHENFELS, O. V. (2004): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer<br />
Berücksichtigung der nach § 28a und 28b NNatG geschützten Biotope sowie der<br />
Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie. Naturschutz Landschaftspfl.<br />
Niedersachs. Heft A/4. 240 S.<br />
ESSELINK, P. (2000): Nature management of coastal salt marshes. Dissertation, Universität Groningen.<br />
GEMEINSAME LANDESPLANUNG BREMEN/NIEDERSACHSEN (GLP) (1993): Rahmenkonzept zur<br />
Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch. Teil 1. 369 S.<br />
GFL, BIOCONSULT & KÜFOG (2006): Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser an die<br />
Entwicklungen im Schiffsverkehr mit Tiefenanpassung der hafenbezogenen Wendestelle.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 62 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung - Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes.<br />
Gutachten im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsämter Bremerhaven und Bremen.<br />
Bremen, Loxstedt: 485 S.<br />
GROTJAHN, M. (1983): Die eulitorale Ufervegetation der Wesermündung. – Forschungsstelle für Insel-<br />
und Küstenschutz. Bd. 34 (Jahresbericht 1982).<br />
HOCHSCHULE VECHTA, FORSCHUNGSZENTRUM FÜR GEOINFORMATIK UND FERNERKUNDUNG (HS VECHTA)<br />
(2006): Biotoptypen-/Vegetationskartierung von Vordeichsflächen an Unter- und<br />
Außenweser auf der Grundlage einer HRSC-AX-Befliegung (28. Juli 2002). Endbericht,<br />
Stand: Mai 2006. – Gutachten im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven.<br />
Vechta, 42 S. + Anlagen.<br />
IBL Umweltplanung GmbH (IBL) (2008): Kartierung der Biotop- und FFH-Lebensraumtypen im Ems-<br />
Außenbereich (Datenerfassung 2006/2007). Erfassung im Auftrag der Meyer-Werft GmbH.<br />
GIS-Daten und veröffentlichtes Gutachten, Oldenburg.<br />
KEMPF, N., J. LAMP & P. PROKOSCH (Bearb.; 1987): Salzwiesen - geformt von Küstenschutz,<br />
Landwirtschaft oder Natur? WWF-Tagungsberichte 1.<br />
KÜFOG (2005): Digitale Aufbereitung von Unterlagen zur Ausdehnung von Röhrichten an der Unter-<br />
und Außenweser seit ca. 1950. 3 Bände. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des<br />
Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven.<br />
LANDKREIS (LK) WESERMARSCH/ UMWELTBUNDESAMT (UBA) (1989): Ökologische Potential- und<br />
Belastungsanalyse Landkreis Wesermarsch. Abschlussbericht des Forschungs- und<br />
Entwicklungsvorhabens. ARSU GmbH Oldenburg im Auftrag des LK Wesermarsch und des<br />
UBA. 349 S.<br />
NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ – BETRIEBSSTELLE<br />
NORDEN (NLWKN NOR) (2003): Vorlandmanagementplan für den Bereich der Deichacht<br />
Norden. Unveröffentlichtes Gutachten, 40 S. + Karten, Norden.<br />
NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ NORDEN (NLWKN<br />
NOR) (2006): Pressemitteilung vom 01.11.2006. Verantw.: H. Heyken & A. Stolz.<br />
NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ NORDEN (NLWKN<br />
NOR) (2007): Pressemitteilung vom 09.11.2007. Verantw.: H. Heyken.<br />
NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ – BETRIEBSSTELLE<br />
BRAKE - OLDENBURG (NLWKN BRA-OL) (2008): FFH-Gebiet 013 „Ems“ - FFH-<br />
Lebensraumtypen und Biotoptypen, Stand 2006/2007. GIS-Daten, Brake – Oldenburg.<br />
SCHRÖDER, U.(2007): Aktuelle und historische Röhrichtentwicklung an der Unter- und Außenelbe. - In:<br />
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) (2007): Veranstaltungen – Röhrichte an<br />
Bundeswasserstraßen (im norddeutschen Raum), Heft 2/2007: 20 – 30.<br />
STOCK, M. & K. KIEHL (2000): Empfehlungen zum Salzwiesenmanagement im Nationalpark Schleswig-<br />
Holsteinisches Wattenmeer. - In: Stock, M. & K. Kiehl (Hrsg.): Die Salzwiesen der<br />
Hamburger Hallig. - Schriftenreihe des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer<br />
11: 74-77.<br />
STOCK, M., K. KIEHL & H. D. REINKE (1997): Salzwiesenschutz im schleswig-holsteinischen<br />
Wattenmeer. - Schriftenreihe des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 7.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 63<br />
WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT HAMBURG (WSA HH) (2007): Anpassung der Fahrrinne von Unter- und<br />
Außenelbe an die Containerschifffahrt. Planfeststellungsunterlage nach<br />
Bundeswasserstraßengesetz. http://www.zukunftelbe.de/Projektbuero/service/ index.php,<br />
01.06.07.<br />
WESEMÜLLER, H. & J. LAMP (1987): Die Nutzung der Salzwiesen im niedersächsischen und<br />
hamburgischen Wattenmeer. - In: KEMPF, N., J. LAMP & P. PROKOSCH (Bearb.): Salzwiesen -<br />
geformt von Küstenschutz, Landwirtschaft oder Natur? WWF-Tagungsberichte 1: 113-122.<br />
WITT, J. (2004): Analysing brackish benthic communities of the Weser estuary: Spatial distribution,<br />
variability and sensitivity of estuarine invertebrates. – Dissertation Universität Bremen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 64 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
5 TEILPROJEKT 2: ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN<br />
UMWELTBEDINGUNGEN, BIOMASSEPRODUKTION UND<br />
TREIBSELMENGE IN DEICHVORLÄNDERN DER KÜSTE UND ÄSTUARE<br />
5.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG<br />
Die Pflanzen des Deichvorlandes produzieren Biomasse, von der ein mehr oder weniger<br />
großer Teil als <strong>Treibsel</strong> an die Deiche angespült wird. Wenn die <strong>Treibsel</strong>menge reduziert<br />
werden soll, so muss auch die Biomassebildung der Vorländer reduziert werden. Die<br />
Biomasse des Vorlandes ist allerdings nicht überall gleich, sondern ausgesprochen<br />
unterschiedlich. Diese Unterschiede hängen einerseits von den Umweltfaktoren ab,<br />
andererseits von den Fähigkeiten und Eigenschaften der Pflanzen zur Bildung und zum<br />
natürlichen Abbau der Biomasse. Diese Beziehungen sind zu quantifizieren, bevor<br />
angepasste Managementstrategien entwickelt werden. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob<br />
die Biomasseproduktion des Vorlandes eines gegebenen Deichabschnittes auch für die<br />
<strong>Treibsel</strong>anspülung an diesem Deichabschnitt verantwortlich ist. Man kann annehmen, dass<br />
Sturmfluten <strong>Treibsel</strong> aus Vorländern örtlich unterschiedlich aufnehmen und absetzen.<br />
Deshalb ist es notwendig, nachzuweisen, ob eine enge Beziehung zwischen produzierter<br />
Biomasse des Vorlandes und der <strong>Treibsel</strong>menge besteht, die an dem Deichabschnitt<br />
angespült wurde, welcher das Vorland landseitig begrenzt.<br />
5.2 TEILPROJEKT 2A: BIOMASSEPRODUKTION NIEDERSÄCHSISCHER<br />
SALZWIESEN UND BRACKWASSERRÖHRICHTE IN ABHÄNGIGKEIT<br />
VON UMWELTBEDINGUNGEN<br />
5.2.1 EINLEITUNG<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Prof. Dr. Michael Kleyer, Dr. Vanessa Minden, Dipl. Landschaftsökologen<br />
Sandra Andratschke, Janina Spalke, Hanna Timmermann (Uni Oldenburg) &<br />
Antje Bremermann (<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>)<br />
Salzwiesen und Brackwasserröhrichte gehören zu den produktivsten Ökosystemen der Erde<br />
(Begon et al. 2005). Die Produktivität dieser Ökosysteme stellt eine für die Gesellschaft<br />
wesentliche Dienstleistung (i.S.v. ‚ecosystem service„) dar. Durch Pflanzenwachstum und<br />
Biomassebildung wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre sequestriert, die Sedimentierung<br />
und damit das Anwachsen der Küste gefördert und die Wellenenergie bei Sturmfluten<br />
gedämpft. Zudem bieten diese Ökosysteme Habitatfunktionen für Tiere, wie z.B. Nahrung<br />
und Brut- und Rastplätze, u.a. für Küstenvögel (Bakker et al. 2005, Blew et al. 2005).<br />
Darüber hinaus kann die pflanzliche Biomasse der Salzwiesen und Brackwasserröhrichte für<br />
die Milchvieh- und Schafwirtschaft oder als Grundlage für erneuerbare Energie verwendet<br />
werden, sofern Naturschutzziele dem nicht entgegenstehen. Die als Streu anfallende<br />
Biomasse von Salzwiesen und Brackwasserröhrichten wird zum großen Teil direkt am<br />
Wuchsort abgebaut und mineralisiert, bei Sturmfluten aber auch abgerissen und<br />
abtransportiert. Sie wird dann teilweise ins Meer gespült und größtenteils als <strong>Treibsel</strong> (Teek)<br />
am Deich oder im Vorland abgelagert. Sofern die Streu ins Meer gespült wird, wird sie dort<br />
zum Bestandteil der marinen Nahrungskette. Am Deich kann <strong>Treibsel</strong> dazu führen, dass die
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 65<br />
Grasnarbe unter massiven Lagen von <strong>Treibsel</strong> zerstört wird und damit der Deich bei<br />
zukünftigen Sturmfluten anfälliger für Schäden wird (Erchinger 1985, Gettner 2003). Um dies<br />
zu verhindern, wird das anfallende <strong>Treibsel</strong> beseitigt, wodurch Kosten entstehen, die<br />
gegebenenfalls durch eine weitere Verwendung, z.B. als Material zur Energiegewinnung,<br />
kompensiert werden könnten.<br />
Die Biomasseproduktion und ihr Umsatz in den Ökosystemen Salzwiese und<br />
Brackwasserröhricht werden einerseits von der Nutzung durch Beweidung oder Mahd,<br />
andererseits von den sehr unterschiedlichen abiotischen Umweltbedingungen (z.B.<br />
Salzgehalt, Grundwasser, Nährstoffe) bestimmt. Um die genannten Funktionen gesamthaft<br />
in die Abwägung einzubringen, ob Salzwiesenschutz mit oder ohne Nutzung geschehen soll,<br />
ist es wesentlich, die Veränderung der Biomasseproduktion in Abhängigkeit von den<br />
Umweltbedingungen und der Nutzung zu kennen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die<br />
Umweltfaktoren, die für die Produktion, die stehende Biomasse im Sommer und ihre<br />
Abbaurate wesentlich sind, zu identifizieren. Managementstrategien können dann daran<br />
ansetzen, durch gezielte Veränderung der Umweltbedingungen die Biomasseproduktion zu<br />
beeinflussen.<br />
Die bisherigen Arbeiten zu diesem Thema zeigen, dass Salzwiesen weit intensiver als<br />
tidebeeinflusste Brackwasserröhrichte untersucht wurden. Bei den auch im Vergleich zu<br />
terrestrischen Lebensräumen sehr gut bearbeiteten Salzwiesen wurden die in Tabelle 21<br />
genannten Themen besonders bearbeitet.<br />
Tabelle 21: Übersicht über Salzwiesenliteratur<br />
Schwerpunkt Bearbeitet von<br />
Vegetationsentwicklung und<br />
-dynamik<br />
Nährstoffbilanzen, -dynamik,<br />
-verfügbarkeit<br />
Zonierung in Abhängigkeit von Salinität,<br />
Überflutung und Staunässe<br />
Kiehl et al. 1997a, Bakker 1998, Esselink et al. 1998, Heinze et al.<br />
1999, Kinder and Vagts 1999, Van Wijnen 1999, Rozema et al.<br />
2000, Stock and Kiehl 2000, Janssen 2001, Schroeder et al. 2002,<br />
Freund et al. 2003, Kleyer et al. 2003<br />
Kiehl et al. 1997a, van Wijnen and Bakker 1997, Van Wijnen<br />
1999, Rozema et al. 2000, Van Wijnen and Bakker 2000<br />
Vince and Snow 1984, Roozen and Westhoff 1985, Kiehl 1997,<br />
Leendertse et al. 1997, Bockelmann et al. 2002<br />
Biomasseproduktion Van de Koppel et al. 1996, Van Wijnen and Bakker 2000, Kuijper<br />
and Bakker 2003<br />
Bisher fehlt jedoch eine integrierte Darstellung der Biomassebildung in Relation zu allen<br />
wesentlichen Umweltfaktoren, in der der Einfluss der Umweltfaktoren und ihre Interaktionen<br />
ermittelt werden. Außerdem sind bisher wenige Arbeiten bekannt, in denen sowohl die<br />
stehende Biomasse als auch der Zuwachs über die Zeit und der Abbau der Biomasse in<br />
Bezug zu den Umweltfaktoren untersucht wurden. Um diese Integration zu gewährleisten, ist<br />
es allerdings notwendig, an jeder Probefläche alle wesentlichen abiotischen<br />
Umweltparameter, die Nutzungsintensität, die Vegetation und die Parameter der<br />
Biomasseproduktion zu erfassen. Zum anderen muss die Lage der Probeflächen so<br />
angeordnet („stratifiziert“) werden, dass alle wichtigen Umweltausprägungen an der Küste in<br />
ausreichender Wiederholung repräsentiert sind. Dieser Untersuchungsansatz wurde hier<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 66 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
verfolgt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den anthropogenen, vielfach im Rahmen des<br />
Lahnungsbaus entstandenen Festlandssalzwiesen. Sehr viele Arbeiten zu den Salzwiesen<br />
des Wattenmeeres beziehen sich aber auf natürliche Salzwiesen der Inseln im Wattenmeer,<br />
die sandigeren Untergrund als die Festlandküste aufweisen. Um einen Vergleich zur Literatur<br />
zu gewährleisten, wurde zusätzlich Salzwiesen der Insel Mellum untersucht. Da von dieser<br />
Insel nur ein geringer Teil durch Menschen umgestaltet wurde (der „Ringdeich“ mit dem<br />
Vogelwärterhaus), ermöglicht diese Untersuchung eine Referenz auf natürliche Salzwiesen<br />
im Gegensatz zu anthropogenen Salzwiesen.<br />
Die Erfassungen zu bodenkundlichen Standortparametern, Höhe von Biomasse und<br />
Produktivität der Vegetationsbestände sowie der Höhe des winterlichen Austrags durch<br />
Sturmfluten erfolgte im Rahmen der Untersuchungen für den II. Oldenburgischen Deichband<br />
„Standortbedingungen und Biomasse von Vorländern als Ursache für <strong>Treibsel</strong>anfall“.<br />
5.2.1.1 ZONIERUNG DER SALZWIESE UND UMWELTBEDINGUNGEN<br />
Makronährstoffe wie Phosphor und Stickstoff sind im Meerwasser in gelösten organischen<br />
und anorganischen Stoffen und partikulären Schwebstoffen enthalten (Meyer-Reil 2005). Im<br />
Wattenmeer stammen sie aus den Flüssen, dem Nordseewasser, der Atmosphäre und aus<br />
anthropogenen Einträgen (Brockmann et al. 1990). Während gelöste Stoffe mit den<br />
Wassermassen transportiert werden, können Schwebstoffe in Abhängigkeit von der<br />
Strömungsgeschwindigkeit und der Partikelgröße sedimentieren (ebenda). Eisma & Kalf<br />
(1987) beschreiben die Ästuare und das Wattenmeer als Sedimentfallen für Schwebstoffe<br />
und die darin enthaltenen Nährstoffe. Besonders Schlick ist reich an sedimentierter<br />
organischer Substanz und damit an Stickstoff und Phosphor (Gray and Bunce 1972,<br />
Ellenberg 1996). Außerdem sind der Tongehalt und damit die Bindungsfähigkeit für<br />
Nährstoffe höher als in Sandböden. Olff et al. (1997b) stellten deshalb einen Zusammenhang<br />
zwischen der Mächtigkeit der Schlickauflage auf den Salzwiesen von Schiermonnikoog und<br />
dem Stickstoffgehalt im Boden fest.<br />
Da die Mineralisierung von Nährstoffen aus organischer Substanz bei Überschwemmung,<br />
hohem Grundwasserstand und anoxischen Bedingungen abnimmt (Hemminga et al. 1991),<br />
kann angenommen werden, dass die pflanzenverfügbaren Nährstoffe von der Pionierzone<br />
zur oberen Salzwiese ansteigen (Van Wijnen and Bakker 2000, Abbildung 11).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 67<br />
Abbildung 11: Erwartungen zur Ausprägung der Umweltfaktoren in Salzwiesen<br />
5.2.1.2 EINFLUSS DER UMWELT AUF DIE BIOMASSEPRODUKTION IN<br />
SALZWIESEN<br />
Die Überflutungshäufigkeit nimmt von der Pionierzone zur oberen Salzwiese ab. Während<br />
die Pionierzone zweimal täglich überflutet wird, wird die obere Salzwiese nur bei hohen<br />
Springtiden und Sturmfluten überflutet. Die Überflutungshäufigkeit wird als wichtiger<br />
Umweltfaktor für die Artenverteilung der Salzwiesen angesehen (Bockelmann et al. 2002).<br />
Jedoch muss dies nicht für die Biomasse gelten, da unterschiedliche<br />
Pflanzengemeinschaften ähnliche Biomassemengen bilden können. Aus der Interaktion<br />
dieser Umweltfaktoren lässt sich die Erwartung ableiten, dass die Biomasse von der unteren<br />
zur oberen Salzwiese ansteigen wird. Die Arbeiten von Van Wijnen (1999) zeigen allerdings,<br />
dass die Biomassebildung ebenfalls von dem Alter und der Kleiauflage der Salzwiese<br />
bestimmt wird.<br />
Experimente mit verschiedenen Bestockungsvarianten (Schafe, Rinder) und unbeweideten<br />
Kontrollflächen haben gezeigt, dass die Phytodiversität bei landwirtschaftlich üblicher<br />
Bestockung sehr gering ist und zunimmt, wenn die Beweidung reduziert wird. Mehrere<br />
Dauerbeobachtungen entlang der Wattenmeerküste ergaben aber auch, dass die Diversität<br />
der Pflanzenarten einzelner Probeflächen auf unbeweideten Flächen gegenüber solchen auf<br />
moderat beweideten Flächen signifikant abnimmt (Bakker et al. 2002b).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 68 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Stock & Kiehl (2000) argumentieren demgegenüber, dass die Aufgabe der künstlichen<br />
Drainierung der Salzwiesen, der Anstieg des Wasserspiegels und die Entwicklung natürlich<br />
mäandrierender Entwässerungssysteme die Zahl und Größe von nassen und salzreichen<br />
Mulden, Prielbänken und anderen extrazonalen Habitaten erhöhen würde. Mit der damit<br />
entstehenden höheren Habitatvielfalt in Zeit und Raum würde die auch unter natürlicher<br />
Entwicklung auf Einzelflächen zurückgehende Artenzahl kompensiert werden. Nach ihrer<br />
Annahme würden unbeweidete Salzwiesen die gleiche Artenzusammensetzung beinhalten<br />
wie moderat beweidete Salzwiesen, bloß in einem in Zeit und Raum eher unregelmäßigen<br />
Muster von Habitaten. Eine Studie von Kleyer et al. (2003) zeigt, dass die Sukzession zu<br />
dominanten Queckenbeständen in feuchten Mulden verzögert wird, was die Argumentation<br />
von Stock & Kiel (2000) unterstützt. Gemäß den oben genannten Erwartungen zum Einfluss<br />
des Grundwasserstandes und des Salzgehaltes könnte dann in der Fläche die Produktivität<br />
fallen.<br />
Um diese Erwartungen zu überprüfen, haben wir an mehreren Standorten der<br />
niedersächsischen Festlandsküste zwischen Weser und Ems sowie auf der Insel Mellum<br />
Messungen zu den Umweltparametern, den Pflanzengemeinschaften, der<br />
Biomasseproduktion und dem Abbau der Biomasse durchgeführt.<br />
Die Fragestellungen bei dieser Untersuchung waren:<br />
Welche Umweltfaktoren bestimmen die oberirdische Produktion, die stehende<br />
Biomasse und den Abbau der Biomasse?<br />
Wie wirkt sich Nutzung auf die Biomassemengen aus?<br />
Wie unterscheiden sich die Pflanzengemeinschaften im Hinblick auf die<br />
Biomassebildung?<br />
Kann die Produktivität der Salzwiesen, welche das <strong>Treibsel</strong> verursacht, durch<br />
natürliche Dynamik und den damit neu entstehenden Habitaten (feuchte Mulden,<br />
Salzanreicherungen) verringert werden und damit die <strong>Treibsel</strong>mengen reduziert<br />
werden? Dabei ist zu berücksichtigen, auf welchen Flächen ein Management durch<br />
natürliche Dynamik aus Sicht des Küstenschutzes und des Naturschutzes möglich ist.<br />
5.2.2 METHODIK<br />
5.2.2.1 UNTERSUCHUNGSGEBIETE<br />
In den überwiegend anthropogenen Salzwiesen der Festlandsküste wurden insgesamt 113<br />
Probeflächen eingerichtet (Tabelle 22), die sich zwischen Weser- und Emsmündung<br />
verteilen (Abbildung 12). Zusätzlich wurden 57 Probeflächen auf Mellum einbezogen, die im<br />
Rahmen anderer Forschungsprojekte angelegt worden sind. Mellum ist eine unbewohnte<br />
Insel zwischen der Außen-Jade und der Außen-Weser, die hier als Referenzgebiet für<br />
natürliche Salzwiesenentstehung und unbeeinflusstes Küstenökosystem mit natürlicher<br />
Entwässerung herangezogen wird. Abiotische Parameter wurden auf allen Probeflächen,<br />
Biomasse-Messungen auf 113 Probeflächen (keine Messung auf 57 Probeflächen im<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 69<br />
Norderland) und Streuabbau-Messungen auf 72 Probeflächen (keine Messung auf 57<br />
Probeflächen im Norderland und keine auf Mellum) erhoben.<br />
Tabelle 22: Verteilung der Probeflächen für den Salzwiesendatensatz<br />
Ort Lage im Gradnetz Anzahl bei jeweiliger Nutzungsform Anzahl insgesamt<br />
Leybucht 53°55„ N, 7°12„ E 4 Brache, 4 beweidet (1,0 GVE/ha) 8<br />
Norderland 53°68„ N, 7°32„ E 65 Brache, 24 beweidet<br />
(GVE/ha: 6 x 0,5; 5 x 1,0; 13 x 1,5)<br />
Jadebusen 53°50„ N, 8°32„ E<br />
Beckmannsfeld 8 Brache 8<br />
Ahndeich 4 Brache, 8 Mahd 12<br />
Dangast 8 Brache, 4 Mahd 12<br />
Mellum 53°43‟ N, 8° 9‟ E 41 Brache 41<br />
Abbildung 12: Lage der Untersuchungsgebiete der Salzwiesen<br />
An den Ästuaren wurden die Probenahmen an der Weser durchgeführt. Die 32 Probeflächen<br />
liegen im oligohalinen Bereich der Weser zwischen Brake und Rodenkirchen. Hier finden<br />
sich vier wesentliche Vegetationstypen vor dem Deich: das genutzte, höher gelegene<br />
Grünland, unterhalb des Grünlandes gelegene, hin und wieder gemähte Seggenrieder, sowie<br />
in Ufernähe die bei Flut überschwemmten Schilfriede. Von Letzteren wurden ungemähte und<br />
im Winter gemähte Flächen untersucht (Tabelle 23).<br />
89<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 70 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 23: Verteilung der Probeflächen für den Datensatz des Ästuars<br />
Untersuchungs-gebiet Schilf-Röhricht<br />
(ungenutzt)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Schilf-Röhricht<br />
(Wintermahd)<br />
Grünland auf<br />
Röhricht<br />
Standorten<br />
(extensive<br />
Nutzung)<br />
Grünland auf<br />
Röhricht<br />
Standorten<br />
(intensive<br />
Nutzung)<br />
Abser Sand 2 - - 4<br />
Dreptersiel 4 6 - -<br />
Schmalenflether Sand 2 2 8 4<br />
Abbildung 13: Lage der Untersuchungsgebiete im Weserästuar<br />
5.2.2.2 BIOMASSE-ENTNAHME<br />
Auf den Flächen in den Salzwiesen wurden jeweils im November 2006, März und August<br />
2007 Biomasseproben entnommen. Die Beprobung der Ästuarflächen fand im März und<br />
August 2008 statt. Auf jeder Fläche wurde innerhalb von Alurahmen (0,5 x 0,25 m) die<br />
oberirdische Biomasse entnommen. Es erfolgte eine viermalige Wiederholung, so dass<br />
insgesamt 0,5 m 2 beprobt wurde. Für statistische Analysen wurden diese auf 1 m 2<br />
hochgerechnet. Zwischen jedem Entnahme-Punkt wurde eine Rahmengröße freigelassen,<br />
um Störungen und eventuelle Verschiebungen der Rahmen auszugleichen. Die Anordnung<br />
der Entnahme-Felder am Beispiel einer Salzwiesen-Beprobung zeigt Abbildung 14. Nach der<br />
Ernte folgte die Reinigung aller Proben wegen teilweiser erheblicher Verschmutzung durch<br />
Sedimente. Die Biomasse der Proben, die im Frühjahr und Sommer 2007 sowie im Frühjahr<br />
und Sommer 2008 geerntet wurden, wurden dann nach tot und lebend getrennt und<br />
anschließend bei 80 °C für 72 Stunden getrocknet und ausgewogen.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 71<br />
Abbildung 14: Links: Beispiel eines fertig beprobten Rahmens. Rechts: Biomasse-Design und<br />
Aufteilung der Wiederholungen für den jeweiligen Zeitpunkt der Entnahme in Salzwiesenflächen.<br />
Anhand dieser Biomasse-Entnahmen konnten drei Variablen ermittelt werden:<br />
die stehende Biomasse (lebendig und tot) im Sommer (für die Festlandsküste<br />
Sommer 2007, für das Weserästuar Sommer 2008)<br />
die stehende Biomasse im Herbst (nur für die Festlandsküste), die von Winter-<br />
Sturmfluten teilweise verdriftet wird, und<br />
die oberirdische Primärproduktivität (Above-Ground Net Primary Productivity (ANPP);<br />
für die Festlandsküste und das Weserästuar).<br />
Die Produktivität der einzelnen Flächen lässt sich danach durch folgende Formel berechnen:<br />
ANPP = Biomasse Sommer lebend -<br />
Fläche * Anzahl Monate<br />
Biomasse Frühjahr lebend<br />
Hierbei ist die Fläche gleich 1 m 2 und die Anzahl der Monate gleich 6 (Anfang März bis<br />
Anfang August). Während sich die Variable ‚stehende Biomasse„ die gesamte stehende,<br />
oberirdische Pflanzenmaterial einschließt, die sich aus dem Wachstum mehrerer Jahre<br />
ergeben kann, nimmt der Begriff ‚ANPP (Aboveground Net Primary Productivity)„ Bezug auf<br />
den Zuwachs auf einem Standort, d.h. wie viel Pflanzenmaterial in einem bestimmten<br />
Zeitraum produziert wird. Bei Angaben zur stehenden Biomasse kann nicht differenziert<br />
werden, wann das Pflanzenmaterial produziert wurde, d.h. in den Wert kann auch Biomasse<br />
aus vorherigen Jahren eingehen. Bei Angaben zur ANPP hingegen ist genau bekannt, wie<br />
viel Biomasse in welchem Zeitraum produziert wurde.<br />
Auf den Flächen mit Rinderbeweidung wurden zum Schutz vor Fraß an jeder Probenstelle<br />
eingezäunte Bereiche, sogenannte ‚Exclosures„, errichtet (Abbildung 15). Auf den mit<br />
Rindern beweideten Flächen wurde innerhalb und außerhalb der Exclosures Biomasse<br />
entnommen. Der Biomassegehalt der Fläche innerhalb wurde auf 100 % gesetzt und der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 72 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Gehalt außerhalb gegengerechnet. Somit wurde der Anteil an Biomasseentnahme durch<br />
Rinderbeweidung in Prozent ermittelt.<br />
Abbildung 15: Exclosure zum Schutz vor Rinderbeweidung<br />
5.2.2.3 FREQUENZANALYSEN<br />
Auf allen Probeflächen wurde mit Hilfe sog. Frequenzrahmen die Frequenz (Häufigkeit) aller<br />
Pflanzenarten auf einer Grundlfäche von 1 m² erfasst. Der Rahmen hat eine Kantenlänge<br />
von 50 x 50 cm und ist in Teilflächen von 10 x 10 cm unterteilt (siehe Abbildung 16). Auf<br />
jeder Probefläche wurden vier Wiederholungen durchgeführt, so dass pro Probefläche 100<br />
Teilflächen á 1m² ausgezählt wurden. Pro Teilfläche wurde die An- bzw. Abwesenheit einer<br />
Art vermerkt. Durch die große Anzahl der Wiederholungen gleicht sich die Frequenz der<br />
Deckung der Pflanzen an. Die Frequenzaufnahmen der Vegetation der Probeflächen wurden<br />
in Tabellen zusammengestellt und zu Pflanzengemeinschaften sortiert, welche sich an die<br />
TMAP-Einheiten anlehnen.<br />
Die Zählung der Frequenz ist eine Alternative zur klassischerweise angewendeten<br />
Schätzung des Deckungsgrades. Zwar ist die für die Frequenzermittlung verwendete Fläche<br />
kleiner als die für die Schätzung des Deckungsgrades verwendete (Grünland: ca. 20 m 2 ). Im<br />
Gegensatz zum subjektiven Ergebnis einer Deckungsschätzung ist die gezählte Frequenz<br />
jedoch ein objektiver Wert. Durch die große Anzahl der Wiederholungen gleicht sich die<br />
Frequenz der Deckung an.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 73<br />
Abbildung 16: Ausgebrachter Frequenzrahmen (50 x 50 cm) mit Einteilung in 25 Kästchen (je<br />
10 x 10 cm)<br />
5.2.2.4 STREUVERLUST (DEKOMPOSITION)<br />
Die Zersetzungrate ist ein wesentlicher Parameter für die <strong>Treibsel</strong>produktion, denn<br />
unzersetzte, auf dem Boden liegende Streu kann bei Überflutungen besonders leicht<br />
aufschwimmen und verdriftet werden. Pflanzengemeinschaften, deren Biomasse schlecht<br />
zersetzbar ist, werden also besonders zur <strong>Treibsel</strong>bildung beitragen. Zur Bestimmung der<br />
Zersetzungsraten wurden im Herbst 2007 in den Salzwiesen sogenannte ‚Litter Bags„, mit<br />
Biomasse gefüllte Taschen, ins Feld gebracht (Abbildung 17). Hierbei wurden jeweils vier<br />
Litter Bags mit 2 g Biomasse des jeweiligen Standortes (native Streu) und vier mit einem<br />
Standard (Standard-Streu), in diesem Fall Heu, gefüllt. Die Methode richtete sich nach<br />
Garnier et al. (2007).<br />
Die ‚Standard-Biomasse„ Heu diente dazu, den Einfluss der Umwelt auf die Zersetungsraten<br />
ableiten zu können, während bei der mit nativer Vorland-Streu gefüllten Litter Bags die<br />
Abbaufähigkeit der Vorlandarten eine Rolle spielt.<br />
Abbildung 17: Links: Litter Bags im Feld, durch Draht gesichert. Rechts: Schema des Litter<br />
Bags-Versuchsaufbaus.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 74 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die Litter Bags wurden jeweils nach 6 und 12 Monaten eingesammelt, ihr Inhalt von<br />
Verunreinigungen gesäubert und bei 70 °C 72 Stunden lang getrocknet und anschließend<br />
ausgewogen.<br />
5.2.2.5 BODENPARAMETER SALZWIESEN<br />
FELDAUFNAHME DER BODENPROBEN<br />
Im Frühjahr 2007 wurden auf allen Untersuchungsflächen Bodenproben entnommen<br />
(Stechzylinderproben und Nährstoffproben). Diese wurden in der Universität Oldenburg auf<br />
die folgenden Eigenschaften untersucht.<br />
BODENART:<br />
Die Bodenart wird mithilfe der sog. Fingerprobe entsprechend Ad-Hoc-AG Boden (2005)<br />
bestimmt.<br />
LAGERUNGSDICHTE:<br />
Die Lagerungsdichte wurde erfasst, um die gemessenen Parameter auf die Gesamtfläche<br />
(Horizonttiefe) beziehen zu können. Im Gelände wurden mit Hilfe von Stechzylindern mit<br />
definiertem Volumen (100cm 3 ) je zwei Proben pro Horizont entnommen (Abbildung 18).<br />
Diese wurden bei 30 °C 72 Stunden lang getrocknet und ausgewogen.<br />
Abbildung 18: Stechzylinder (links) mit definiertem Volumen und Einschlag von zwei<br />
Zylindern in die Bodenwand (rechts)<br />
PH-WERT:<br />
Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregrad (Azidität) eines Bodens. Böden des humiden<br />
Klimabereiches weisen pH-Werte im Bereich von 3,0 (sehr stark sauer) bis etwa 7,5<br />
(schwach alkalisch) auf. Die pH-Zahlen sind die vereinfachte Schreibweise für die Menge an<br />
freien Wasserstoffionen in einem Liter Wasser. Mit jeder pH-Stufe nimmt die Konzentration<br />
an Wasserstoffionen um den Faktor 10 ab. Bei pH 3 befinden sich 10 -3 (0,001) g H + -Ionen in<br />
1 l Bodenlösung. Je 10 g Boden wurden in ein Gefäß gegeben und mit 25 ml Aqua dest.<br />
homogenisiert und während einer Gleichgewichtseinstellung (1 bis 2 Stunden) mehrmals<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 75<br />
umgerührt. Das Spannungsmessgerät (pH-Meter) wurde mit Standard-Pufferlösungen von<br />
pH 4 und 7 geeicht, anschließend wurde der pH-Wert gemessen.<br />
SALINITÄT:<br />
Als Salinität bezeichnet man den Salzgehalt eines Wasserkörpers bzw. Wasser. Sie wird in<br />
der dimensionslosen Einheit PSU (Practical Salinity Units) angegeben und wurde mithilfe<br />
eines Salinometers bestimmt. Die Bodenproben wurden hierzu mit Wasser vermischt und die<br />
Salinität gemessen.<br />
CARBONATGEHALT (CACO3):<br />
Die CaCO3-Bestimmung erfolgte nach der Methode von Scheibler, bei dem HCl mit der<br />
Bodenprobe versetzt wird und über die Bildung von CO2 und späterer Umrechnung der<br />
CaCO3-Gehalt ableitbar ist.<br />
C:N-VERHÄLTNIS:<br />
Im C:N-Analyzer werden die Bodenproben bei 1.020 °C in einer mit Wolfram und Kupfer<br />
gefüllten Säule verbrannt. Dabei werden die Kohlenstoffverbindungen zu CO2 oxidiert und<br />
ihre Stickstoffverbindungen über NOX zu N2 reduziert. In einem integrierten<br />
Gaschromatographen wird das Gasgemisch getrennt und mit Hilfe eines<br />
Wärmeleitfähigkeitsdetektors gemessen.<br />
5.2.2.6 GRUNDWASSERMESSUNGEN<br />
In senkrecht eingegrabenen Drainagerohren wurden vom 10. Mai bis 24. Oktober 2007 alle<br />
14 Tage bei Niedrigwasser die Salinität und der Abstand des Grundwassers zur<br />
Geländeoberkante gemessen. Außerdem wurden an ausgewählten Probeflächen in den<br />
Drainagerohren mit Hilfe von Data-Loggern („Divern“) vom 23. April bis 22. Oktober 2007<br />
Messungen des Wasserstandes im einstündigen Abstand durchgeführt. Diese umfassten<br />
sowohl Hoch- und Niedrigwasserzeiten und dienten der Umrechnung der bei Niedrigwasser<br />
gefundenen Grundwassertiefen auf den mittleren Wasserstand. Dazu wurden von den<br />
Probeflächen jeweils die Mittelwerte der stündlich und 14-tägig gemessenen<br />
Grundwasserhöhen über die ganze Messperiode errechnet und eine lineare Regression der<br />
Wertepaare durchgeführt. Die Steigung der Regressionsgerade konnte dazu genutzt werden,<br />
die 14-tägig gemessenen Werte aller anderen Probeflächen zu korrigieren.<br />
5.2.2.7 STATISTISCHE ANALYSEN<br />
Zur statistischen Quantifizierung der Beziehungen zwischen Umweltvariablen und<br />
Parametern der Biomassebildung (ANPP, stehende Biomasse, Abbaurate) wurden lineare,<br />
multiple Regressionsanalyse mit dem Software Paket R durchgeführt (The R Foundation for<br />
Statistical Computing 2008).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 76 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
5.2.3 ERGEBNISSE<br />
5.2.3.1 DIE STANDORTBEDINGUNGEN DER UNTERSUCHUNGSGEBIETE<br />
Die Untersuchungsgebiete der Festlandsküste unterscheiden sich in ihren<br />
Standortsbedingungen sowohl untereinander als auch von der Insel Mellum, die als Referenz<br />
für ein unbeeinflusstes Küstenökosystem dient (Abbildung 19). Mellum weist geringere<br />
verfügbare Phosphor-, Kalk- und Kaliummengen und höhere Sandgehalte in den Böden als<br />
alle Festlandsstandorte auf (Abbildung 19 a-d). Die Salzwiesen Mellums wachsen also bei<br />
deutlich geringeren Nährstoffangeboten auf, was auf die geringe Sorptionskraft des auf<br />
Mellum vorherrschenden Sandes im Boden zurückgeführt werden kann. Die pH-Werte der<br />
verschiedenen Untersuchungsgebiete weisen kaum Unterschiede zueinander auf (Abbildung<br />
19 e).<br />
In Bezug auf die Nährstoffversorgung ist Mellum also nur bedingt mit den<br />
Festlandsstandorten vergleichbar, da es auf Grund des höheren Sandanteils im Boden<br />
generell nährstoffärmer ist. Allerdings ist an der Festlandsküste aber kein anderer Standort<br />
vorhanden, der als ebenso unbeeinflusstes Küstenökosystem wie Mellum angesehen<br />
werden kann.<br />
Bezüglich der Überflutungshäufigkeit weisen die Probeflächen der Leybucht und<br />
Neßmerheller höhere Überschwemmungsfrequenzen auf als die der anderen Standorte der<br />
Festlandssalzwiesen (Abbildung 19 f). Im Bereich des Neßmerhellers, der vor allem<br />
Standorte der oberen Salzwiese aufweist, liegt dies vor allem an dem naturnahen<br />
Prielsystem, welches Flutwasser in die Geländedepressionen führt, die am deichwärtigen<br />
Ende von früheren Lahnungsbauten entstanden sind. Insgesamt unterscheiden sich die<br />
einzelnen Gebiete hinsichtlich ihres Umweltregimes deutlich voneinander. Die Hypothese,<br />
dass die Böden der großen Buchten (Leybucht, Jadebusen) wesentlich weniger sandig und<br />
eher nährstoffreicher sind als der zur See hin exponierte Standort Neßmerheller, wurde<br />
durch die Untersuchungen nicht bestätigt (Abbildung 19 a-d). Vielmehr scheinen lokale<br />
Expositionen, Lage zu Meeresströmungen und Einflüsse durch Lahnungsbau wesentlich zu<br />
sein.<br />
In Bezug auf den Salzgehalt im Boden, mittleren Grundwasserstand und Salzgehalt im<br />
Grundwasser weist der Standort Beckmannsfeld höhere Werte auf als die übrigen Standorte<br />
(Abbildung 19 g-i).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 77<br />
Abbildung 19 a-i: Streuung von Umweltvariablen in den Untersuchungsgebieten mit Hilfe von<br />
sog. Boxplots<br />
Die schwarzen Querbalken geben den Median an, die Box entspricht dem Bereich, in dem die<br />
mittleren 50 % der Daten liegen. Innerhalb der vertikalen Linien (Whiskergrenzen) und der Box liegen<br />
95 % aller beobachteten Werte.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 78 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die Beziehungen zwischen Geländehöhe und Grundwasserstand sowie Salzgehalt im<br />
Grundwasser sind nicht linear (Abbildung 20). Mittlere Grundwasserstände um -20 bis -30<br />
cm finden sich auf niedrig gelegenen und hoch gelegenen Flächen. Ebenso sind hohe<br />
Salzgehalte im Grundwasser nicht nur in der unteren Salzwiese mit häufigen<br />
Überschwemmungen, sondern auch bei hoch gelegenen Flächen zu finden. Ein Grund für<br />
hohe Grundwasserstände im Bereich der oberen Salzwiese können grundwasserstauende<br />
Kleischichten im Boden sein oder flache Senken in der oberen Salzwiese, die im Bereich des<br />
Neßmersiels z.B. hinter Lahnungen entstanden sind. Grundwasserstände und Salzgehalte<br />
sind mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,6 zwar relativ hoch korreliert (d.h. starker<br />
positiver Zusammenhang), jedoch gibt es auch Probeflächen, an denen relativ niedrige<br />
Grundwasserstände mit hohen Salzgehalten angetroffen wurden. Ein Grund dafür kann die<br />
sommerliche Evapotranspiration (Verdunstung der Pflanzen und des Bodens) auf den<br />
Probeflächen sein, die kapillaren Anschluss an das salzhaltige Grundwasser haben (De<br />
Leeuw et al. 1990). Dabei verdunstet das aufsteigende Grundwasser, während die Salze<br />
zurückbleiben und sich im Boden anreichern.<br />
Die zwei Variablen 'mittlerer Grundwasserstand' und 'Salzgehalt des Grundwassers' werden<br />
in weiteren Analysen aggregiert und als ' Grundwasser' bezeichnet.<br />
Abbildung 20: Beziehung zwischen Geländehöhe und mittlerem Grundwasserstand (links)<br />
sowie Salzgehalt des Grundwassers (rechts)<br />
Die Vegetatiosaufnahmen wurden in einer Tabelle sortiert und TMAP-Einheiten zugeordnet<br />
(Tabelle 24). Einheiten, die nur mit wenig Aufnahmen belegt waren, wurden mit anderen<br />
zusammengelegt, sofern dies sinnvoll war. Die aggregierten Einheiten sind in Tabelle 24<br />
dargestellt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 79<br />
Tabelle 24: Verteilung der Vegetationsaufnahmen in Salzwiesen auf TMAP-Typen und daraus<br />
aggregierte Einheiten<br />
TMAP-<br />
Code<br />
TMAP-Typ<br />
Anzahl<br />
Aufnahmen<br />
S 12 Offene Wattflächen 1 0.6 Watt<br />
Prozent Aggregierte Einheiten<br />
S 1.1 Spartina 6 3.5 Queller-Schlickgras<br />
S 1.2 Salicornia 8 4.7 Queller-Schlickgras<br />
S 2.1 Andel-Rasen (+/- dominante Strandflieder-<br />
Bereiche)<br />
38 22.2 Strandflieder-Andel<br />
S 2.2 Limonium vulgare / Puccinellia maritima 10 5.8 Strandflieder-Andel<br />
S 2.3 Aster tripolium / Puccinellia maritima 2 1.2 Andel-Aster<br />
S 2.4 Atriplex portulacoides 31 18.1 Salzmelden<br />
S 3.3 Festuca rubra 4 2.3 Rotschwingel-Beifuß<br />
S 3.4 Atriplex portulacoides / Artemisia maritima 5 2.9 Rotschwingel-Beifuß<br />
S 3.5 Artemisia maritima 8 4.7 Rotschwingel-Beifuß<br />
S 3.7 Elymus spp. 48 28.1 Quecke<br />
S 3.9 Atriplex spp. 10 5.8 Quecke<br />
Fasst man die Probeflächen nach aggregierten TMAP-Vegetationseinheiten zusammen, so<br />
zeigt sich, dass die Pionierzone und die Strandflieder-Andel-Gemeinschaft beide bei sehr<br />
hohen Grundwasserständen, Salzgehalten und niedriger Höhe über NN vorkommen<br />
(Abbildung 21 a-c). Auch die Salzmelden-Gemeinschaft unterscheidet sich nur geringfügig<br />
von diesen Einheiten. Anders ist allerdings die Situation beim verfügbaren Phosphor.<br />
Strandflieder-Andel und Pionierzone kommen zusammen mit der Rotschwingel-Beifuß<br />
Gemeinschaft vor allem bei niedrigen Phosphor-Werten vor, während Salzmelden ähnlich<br />
wie die Andel-Aster-Gemeinschaft der unteren Salzwiese und die Queckenfluren der oberen<br />
Salzwiese besonders bei phosphorreichen Bedingungen vorkommen (Abbildung 21 d).<br />
Andel-Aster Flächen unterscheiden sich auch nicht in der Höhe von den Rotschwingel-<br />
Beifuß Gemeinschaften und den Quecken-Gemeinschaften, wohl aber durch den etwas<br />
höheren Grundwasserspiegel und Salzgehalt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 80 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 21 a-d: Streuung von Umweltvariablen in den Pflanzengemeinschaften der<br />
Salzwiesen (P = Phosphor)<br />
5.2.3.2 DIE PRODUKTIVITÄT DER SALZWIESEN IN ABHÄNGIGKEIT VON<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
ABIOTISCHEN BEDINGUNGEN<br />
Die monatlichen oberirdischen Zuwachsraten (ANPP) der Vegetationseinheiten sind nahezu<br />
gleich und liegen im Mittel zwischen 60 und 100 g qm -1 Monat -1 . Lediglich die Pionierzone<br />
und insbesondere Atriplex portolacoides – Dominanzbestände fallen durch geringere Werte<br />
unter 50 g qm -1 Monat -1 auf. Dies liegt v.a. an der starken Verholzung von Atriplex<br />
portulacoides, denn für Lignin muss mehr Assimilat eingesetzt werden als für Zellulose, aus<br />
dem die Zellwände krautiger Pflanzen bestehen. Mit zunehmenden Nährstoffen im Boden<br />
steigt die ANPP zunächst stark an und sinkt dann bei höheren Nährstoffen wieder ab. Dieser<br />
Abfall liegt wahrscheinlich an der relativ geringen ANPP von Atriplex portulacoides, deren<br />
Reinbestände bei hohen Nährstoffgehalten vorkommen (siehe oben). Mit steigendem<br />
Grundwasser und Salz im Grundwasser fällt der Zuwachs generell stark ab. Das statistische<br />
Modell von ANPP zu Grundwasser und Nährstoffen ist signifikant (Abbildung 22), aber mit<br />
einem Bestimmtheitsmaß von nur 0,2 schlecht kalibriert (Bestimmheitsmaß: beschreibt die<br />
Stärke eines Zusammenhanges; bei r² = 0 kein Zusammenhang, r² = 1 vollständiger<br />
Zusammenhang).
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 81<br />
Abbildung 22: Links: Streumaße der oberirdischen Nettoprimärproduktion (ANPP [g/m²]) in<br />
ungenutzten Bereichen oder in Exclosures, bezogen auf die Pflanzengemeinschaften der<br />
Salzwiese. Rechts: ANPP [g/m²/Monat] in Abhängigkeit von Nährstoffen (aggregiert aus<br />
Phosphor-, Kalium-, Carbonat- und Sandgehalt), sowie Grundwasser (aggregiert aus<br />
Grundwassertiefe und –salzgehalt).<br />
Grafik berechnet mit dem Median der Überschwemmungsdauer; R² = 0,21, hoch signifikant.<br />
Die für die <strong>Treibsel</strong>produktion besonders wesentliche stehende Biomasse im August (peak<br />
standing biomass) zeigt andere Werte als die der Produktivität (Abbildung 23). Zwar besitzen<br />
die beiden Gemeinschaften der oberen Salzwiese die höchste stehende Biomasse, jedoch<br />
ist die Salzmelden-Gemeinschaft ebenso produktiv, obwohl der jährliche Zuwachs viel<br />
geringer ist. Dies ist auf die Verholzung und dadurch mögliche Akkumulation von Biomasse<br />
über mehrere Jahre zurückzuführen. Gegenüber diesen drei Gemeinschaften fallen die<br />
Mittelwerte der Pionierzone sowie der Aster-Andel und Strandflieder-Andel-Gemeinschaften<br />
ab. Die Regressionsoberfläche zeigt, dass die gesamte oberirdische Biomasse besonders<br />
von der Variablen „Grundwasser“ bestimmt wird. Sie kann von ca. 10 t/ha (= 1000 g/m²) bei<br />
mittleren Nährstoffen auf nahe Null fallen, wenn der Grundwasserstand und -salzgehalt stark<br />
ansteigen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 82 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 23: Links: stehende Biomasse im Sommer 2007 lebend u. tot [g/m2] ohne Nutzung<br />
(in Exclosures) pro Vegetationseinheit. Rechts: Stehende oberirdische Biomasse [g/m²] in<br />
Abhängigkeit von Nährstoffen sowie Grundwasser.<br />
Grafik berechnet mit dem Median der Überschwemmungsdauer; R² = 0,25, hoch signifikant<br />
Die Gesamt-Biomasse lässt sich in stehende lebende und tote Biomasse aufteilen. Die<br />
beiden Regressionsoberflächen für diese Biomasseteile zeigen, dass die Menge an toter<br />
Biomasse auf einer Fläche ausschließlich durch das Grundwasser bestimmt wird, d.h. die in<br />
dieser Variablen aggregierten Variablen Höhe des Grundwassers und Salzgehalt des<br />
Grundwassers (Abbildung 24). Je höher und salzreicher das Grundwasser ist, desto<br />
niedriger ist die abgestorbene Biomasse. Dies ist zunächst widersprüchlich, ist aber darauf<br />
zurückzuführen, dass besonders die obere Salzwiese Streu akkumuliert. Auf den<br />
salzreicheren Standorten sind die Arten besser an Salz adaptiert und haben effektive<br />
Mechanismen der Salzabscheidung entwickelt. Außerdem wird die abgestorbene Biomasse<br />
schnell abgebaut, wie die Streu-Abbauversuche gezeigt haben (Abbildung 25). Pflanzen der<br />
oberen Salzwiese sind weniger erfolgreich in der Bewältigung des Salzstresses, sie<br />
reduzieren im Wesentlichen die Transpiration, um weniger Salzwasser aufzunehmen.<br />
Außerdem ist die Streu schlechter abbaubar. Deshalb steigt der Anteil toter Biomasse mit<br />
geringerem Salzeinfluss und tieferem Grundwasserstand.<br />
Die lebende Biomasse ist bei mittlerem Grundwasser und mittleren Nährstoffen am<br />
höchsten. Bei hohem Grundwasserstand und Salzgehalt ist die lebende wie die gesamte<br />
Biomasse generell niedrig. Bei tiefem Grundwasserstand und niedrigem Salzgehalt besteht<br />
ein höherer Anteil der Gesamt-Biomasse aus toter Biomasse. Unter den<br />
Pflanzengemeinschaften weist die Salzmelden-Gemeineschaft die höchste lebende<br />
Biomasse auf (einschließlich verholzter Stängel), welche aber bei eher niedrigen Nährstoffen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 83<br />
vorkommt. Demgegenüber ist die lebende Biomasse der auf eher auf nährstoffreichen<br />
Standorten auftretenden Gemeinschaften Aster-Andel und Quecke geringer. Dies ist ein<br />
Grund dafür, dass die lebende Biomasse bei steigenden Nährstoffen wieder absinkt. Aus<br />
dem unterschiedlichen Zusammenwirken der Variablen Grundwasser und Nährstoffe auf die<br />
tote und lebende Biomasse ergibt sich die gewölbte Regressionsoberfläche der gesamten<br />
Biomasse (Abbildung 24).<br />
Abbildung 24: Abgestorbene (links) und lebende (rechts) Biomasse [g/m²] in Abhängigkeit von<br />
Nährstoffen sowie Grundwassertiefe und Salzgehalt<br />
Ein entscheidender Punkt für die <strong>Treibsel</strong>produktion ist der Streuabbau auf der Fläche.<br />
Wenn ein großer Teil der im Sommer produzierten Biomasse im Herbst und Winter schnell<br />
wieder abgebaut wird, so kann sie bei Sturmfluten im Spätwinter und Frühjahr nicht an den<br />
Deich transportiert werden.<br />
Die Streuabbau-Versuche wurden mit Heu als Standard und mit nativem Pflanzenmaterial<br />
aus den einzelnen Flächen angesetzt (vgl. Kapitel 5.2.2.4). Die Zersetzungsrate des<br />
Standards (Heu) spiegelt den Einfluss der Standortbedingungen wider, da für alle<br />
Probenflächen das gleiche Pflanzenmaterial verwendet wurde. Unterschiede zwischen den<br />
Pflanzengemeinschaften sind also allein auf Standortunterschiede zurückzuführen.<br />
Demgegenüber stammt das native Material aus den Flächen selbst. Unterschiede in der<br />
Zersetzung zwischen diesem Material und der Standard-Streu sind auf Unterschiede in der<br />
Zersetzbarkeit des Pflanzenmaterials zurückzuführen, was mit mechanischen und<br />
chemischen Eigenschaften der Pflanzen zusammenhängt.<br />
In Abbildung 25 sind die Verluste in Prozent des eingebrachten Materials gezeigt, wobei zu<br />
beachten ist, dass die Y-Achse der Standard-Streu und der nativen Streu unterschiedlich<br />
skaliert ist. Nach 6 Monaten, d.h. zwischen November und April, sind 70 – 87 % der<br />
Standard-Streu zersetzt. Die Zersetzungsbedingungen steigen von der unteren Salzwiese<br />
zur oberen Salzwiese an. Je niedriger das Grundwasser ansteht, je geringer der Salzgehalt<br />
ist und je seltener der Standort überschwemmt ist, desto höher ist die mikrobielle Aktivität<br />
und damit die Zersetzung der Standard-Streu (Queller-Schlickgras in Abbildung 25 nur durch<br />
eine Probefläche repräsentiert). Bemerkenswert ist, dass diese Beziehung sich umkehrt,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 84 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
wenn die native Streu betrachtet wird. Erstens sind die Zersetzungsraten dieser Streu viel<br />
geringer und zweitens fällt die Zersetzung von der unteren zur oberen Salzwiese ab, wobei<br />
die Salzmeldenflur der unteren Salzwiese ähnlich schlecht zersetzt wird wie die Schwingel-<br />
Beifuß-Flur der oberen Salzwiese. Die Streu der Queckenflur wird nur halb so gut zersetzt<br />
wie die Standard-Streu am gleichen Standort. Hier sind es also die biologischen<br />
Eigenschaften der Pflanzen, die zu einer völlig anderen Zersetzungsrate führen als diejenige,<br />
welche durch die Standortbedingungen vorgegeben wird. Die Differenz von<br />
Biomasseproduktion des Herbstes 2006 und prozentualer Zersetzung nach 6 Monaten zeigt,<br />
dass die beiden Dominanzgesellschaften der unteren und oberen Salzwiese (Salzmeldenflur<br />
und Queckenflur) im April des Folgejahres noch die höchsten Biomassewerte aufweisen.<br />
Dies kann ein wesentlicher Grund für ihre hohe Konkurrenzkraft sein, da die schlecht<br />
abbaubare Streu akkumuliert und die Keimung anderer Pflanzen verhindert.<br />
Abbildung 25: Streuung von Parametern des Streuabbaus in den Pflanzengemeinschaften der<br />
Salzwiesen. Links: Zersetzung von Heu als Standard-Streu; Mitte: Zersetzung der nativen<br />
Streu. Rechts: Geschätzter Rest der Biomasse, die im Herbst gemessen wurde, nach einem<br />
Abbau von 6 Monaten, unter Berücksichtigung der in der mittleren Grafik gezeigten<br />
Abbauraten.<br />
5.2.3.3 EINFLUSS DER LANDSCHAFTSPFLEGE AUF DIE BEZIEHUNG<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
ZWISCHEN PRODUKTIVITÄT DER SALZWIESEN UND ABIOTISCHEN<br />
BEDINGUNGEN<br />
Die bisherigen Ergebnisse beziehen sich auf ungenutzte Salzwiesen. Dort, wo Beweidung<br />
oder Mahd stattfand, haben wir Flächen ausgezäunt („Exclosures“), um darin den Einfluss<br />
der abiotischen Umweltparameter auf die Vegetation zu bestimmen. Zugleich wurde auch<br />
außerhalb der ausgezäunten Flächen die Biomasse bestimmt. Durch den Vergleich der<br />
Biomasse innerhalb und außerhalb des Exclosure entstand eine Datenbasis für die<br />
Bestimmung der durch Beweidung oder Mahd entzogenen Biomasse. In Abbildung 26 ist die<br />
entfernte Biomasse auf der x-Achse in Prozent der innerhalb des Exclosure erzeugten
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 85<br />
Biomasse angegeben. Auf der y-Achse ist die Menge der noch stehenden Biomasse<br />
dargestellt. Auf ungenutzten Flächen (weder gemäht noch beweidet = 0 % Biomasseentzug)<br />
zeigt die Menge der Biomasse eine hohe Varianz, was durch den Einfluss der abiotischen<br />
Variablen zustande kommt. Niedrige Biomasse kommt auf ungenutzten Standorten bei<br />
hohem Grundwasserstand und Salzgehalt sowie niedrigen Nährstoffgehalten im Boden<br />
zustande; hohe Biomassemengen finden sich bei günstigen Bedingungen, wie oben<br />
erläutert. Steigt der Biomasseentzug, dann sinkt – wie erwartet - die absolute Menge der<br />
Biomasse deutlich ab. Allerdings ist eine Reduzierung um 40 % nur durch sehr hohe<br />
Beweidungsdichten zwischen 2 – 4 Großvieheinheiten pro ha möglich. Diese hohen Entzüge<br />
konnten auch bei niedrigeren Gesamt-Beweidungsdichten gemessen werden, weil sich die<br />
Rinder bei einigen Aufnahmeflächen bevorzugt aufgehalten haben und dort intensiv<br />
geweidet haben.<br />
Abbildung 26: Rechts: Einfluss der Beweidung und Mahd (entfernte Biomasse). R² = 0,66,<br />
hoch signifikant. Links: Westerhever Marsch in Schleswig-Holstein. Linke Bildhälfte: Intensive<br />
Beweidung durch Schafe; rechte Bildhälfte: Exclosure mit Salzmelden-Salzwiese ohne<br />
Nutzung.<br />
5.2.3.4 DIE PRODUKTIVITÄT DER ÄSTUARE IN ABHÄNGIGKEIT VON<br />
ABIOTISCHEN BEDINGUNGEN UND NUTZUNG<br />
Der Vergleich der Umweltparameter zwischen den Pflanzengemeinschaften der Ästuare<br />
zeigt, dass die Salzgehalte in der Bodenlösung von Schilfbeständen und Seggenrieder<br />
ähnlich sind, während das Grünland salzfrei ist (Abbildung 27). Die hier untersuchten<br />
Vegetationstypen unterscheiden sich kaum in der Nährstoffverfügbarkeit von Phosphor und<br />
Kalium (Daten nicht gezeigt), wohl aber im Kalkgehalt des Bodens, der im Grünland relativ<br />
hoch ist, vom ungemähten zu dem gemähten Schilfried abfällt und in den Seggenriedern<br />
sehr gering ist.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 86 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 27: Streuung der Umweltvariablen in den Pflanzengemeinschaften der Ästuare<br />
Leider wurden einige Exclosures bei der Bewirtschaftung der Grünlandflächen entfernt, so<br />
dass keine Daten für Produktion der Seggenriede und weniger Daten als ursprünglich<br />
geplant für die Grünlandflächen erhoben werden konnten. Für die Seggenriede konnten<br />
deshalb keine Nettoprimärproduktion bestimmt und die stehende Biomasse nur im gemähten<br />
Zustand erhoben werden (Abbildung 28).<br />
Es zeigte sich, dass die Nettoprimärproduktion von Schilf doppelt bis dreifach so hoch ist wie<br />
die von frischem Grünland. Das gemähte Schilf zeigt signifikant höhere Wachstumsraten als<br />
ungemähtes Schilf. Nach einer Mahd bzw. durch mechanische Zerstörung von<br />
Primärsprossen bilden die Pflanzen Sekundärsprosse aus (meist 2 Sekundärsprosse pro<br />
Primärspross), wodurch sich die Halmdichte und somit die oberirdische Biomasse des<br />
Schilfbestandes erhöht. Zwar sinkt die Biomasse pro Halm durch geringerer<br />
Stengeldurchmesser und -höhe, jedoch ergibt sich aufgrund der Zunahme der Halmanzahl<br />
insgesamt ein Anstieg der Biomasse von etwa 10 % (BJÖRNDAHL, 1985; OSTENDORP, 1987;<br />
VALKAMA et al., 2008).<br />
Wachstumsrate des gemähten Schilfes ist auch dafür verantwortlich, dass stehende<br />
Biomasse im Sommer höher ist als die des ungemähten Schilfes. Während das ungemähte<br />
Schilf im Frühjahr noch zwischen 1,5 und 6 t/ha Biomasse erbringt, liegt der Wert für<br />
gemähtes Schilf bei 1-2 t/ha. Im Sommer dagegen erreicht das gemähte Schilf Spitzenwerte<br />
bis zu 20 t Trockenmasse/ha. Dies ist wesentlich mehr als Energiemais (13 t/ha).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 87<br />
Abbildung 28: Streuung von Biomasseparametern in den Pflanzengemeinschaften der Ästuare<br />
Das im Winter gemähte Schilf zeigt im März 2007 niedrige Biomassewerte, die jedoch im August die<br />
Werte der ungemähten Schilfrieder übertreffen.<br />
5.2.4 DISKUSSION<br />
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Biomasseproduktion und die stehende<br />
Biomasse im Sommer nicht genutzter Salzwiesen vor allem von der Höhe des Grundwassers<br />
und von der Salinität des Grundwassers bestimmt werden, welche eine nichtlineare<br />
Beziehung mit der Geländehöhe aufweisen. Als weniger wichtige Faktoren sind noch die<br />
Überschwemmungshäufigkeit und die Nährstoffverfügbarkeit zu nennen.<br />
Werden die Flächen gemäht oder beweidet, so nimmt die stehende Biomasse entsprechend<br />
ab. Allerdings wird sie erst bei intensiver Beweidung (ab 2-3 GV/ha) sehr deutlich reduziert.<br />
Anders ist es bei Schilfried in Ästuaren. Hier führt Mahd im Winter sogar zu größeren<br />
Zuwächsen als ungenutztes Schilfried.<br />
Die stehende Biomasse von ungenutzten Salzwiesen liegt zwischen 300 und 1000 g<br />
Trockensubstanz pro m² = 3 und 10 t/ha und damit zwischen den Werten einer ungedüngten<br />
Extensivwiese und einer intensiv gedüngten Weidelgraswiese. Diese Spannweite findet sich<br />
auch in vielen anderen Arbeiten (Tabelle 25, Umrechnungfaktor 0,01 von g/m² in t/ha).<br />
Bemerkenswert ist, dass sich diese Spannweiten in allen Vegetationszonen finden, auch in<br />
der Pionierzone, in der Spartina spp. erhebliche Mengen produzieren kann. Die<br />
Unterschiede hängen einerseits mit den Pflanzengemeinschaften zusammen, welche große<br />
Unterschiede in der Biomassebildung zeigen. Die in Tabelle 25 gezeigten Werte anderer<br />
Autoren stammen überwiegend von Andelgrasflächen, die auch in den hier dargestellten<br />
Untersuchungen geringere Werte aufweisen als die Salzmeldenflächen. Letztere<br />
unterscheiden sich in der stehenden Biomasse nicht von den Gemeinschaften der oberen<br />
Salzwiese.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 88 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 25: Angaben anderer Autoren zur stehenden Biomasse [g/m²] von Salzwiesen (nach<br />
Spalke 2008)<br />
UG = Untersuchungsgebiet, PZ = Pionierzone, USW = Untere Salzwiese, OSW = Obere Salzwiese, **<br />
= Angaben aus einem Diagramm abgelesen<br />
Quelle<br />
Zone<br />
UG<br />
SPALK<br />
E 2008<br />
Mellum,<br />
D<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
BAKKER ET<br />
AL. 1993<br />
Niederländische<br />
Küste, NL<br />
PZ 0-586 1500<br />
USW 68-1307<br />
OSW 152-681 300-400<br />
BUTH<br />
1993<br />
Oosterschelde-<br />
Ästuar, NL<br />
370-839<br />
(Juncus<br />
gerardii)<br />
JANIESCH<br />
1991<br />
Elisabeth-<br />
Außengroden,<br />
D<br />
743<br />
(Puccinellietum<br />
maritimae)<br />
784<br />
(Armerio-<br />
Festucetum)<br />
DE LEEUW<br />
1990<br />
Schiermonnikoog,<br />
NL<br />
273<br />
(Festuca rubra<br />
– Limonium<br />
vulgare)<br />
266<br />
(Elymus<br />
athericus)<br />
5.2.4.1 EINFLUSS VON UMWELTFAKTOREN<br />
HANSEN<br />
1982<br />
Nordfriesland,<br />
D<br />
609<br />
(Puccinellietum<br />
maritimae)<br />
489<br />
(Festuca<br />
rubra)<br />
WOLF ET<br />
AL. 1979<br />
Oosterschelde-<br />
Ästuar, NL<br />
0-188**<br />
(Spartina<br />
anglica)<br />
112-336**<br />
(Puccinellia<br />
maritima)<br />
448-769*<br />
(Elymus<br />
athericus)<br />
KETTNER<br />
1972<br />
Terschelling, NL<br />
max. 397-466<br />
(Plantagini-<br />
Limonietum)<br />
max.335-464<br />
(Puccinellietum<br />
maritimae<br />
unbeweidet)<br />
max.228-342<br />
(Puccinellietum<br />
maritimae beweidet)<br />
Die hier dargestellten Untersuchungen zeigen, dass die Biomassebildung erheblich durch<br />
Grundwasserstand, Salzgehalt des Grundwassers und Nährstoffangebot des Bodens<br />
beeinflusst wird. Für das Nährstoffangebot ist die Mächtigkeit der Kleiauflage entscheidend,<br />
wie Arbeiten vor allem auf Schiermonnikoog gezeigt haben (De Leeuw et al. 1993, Van de<br />
Koppel et al. 1996, van Wijnen and Bakker 1999b). Der hohe Tongehalt des Kleis begünstigt<br />
eine hohe Nährspeicherkapazität und Austauschkapazität, während diese für den<br />
Nährstoffhaushalt entscheidenden Bodenfaktoren in reinen Sandböden sehr schwach<br />
ausgeprägt sind. Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen: die eher sandigen Böden von<br />
Mellum und Beckmannsfeld sind ärmer an Kalium und Phosphor als die weniger sandigen<br />
Böden der anderen Untersuchungsgebiete. Geringe Phosphorangebote sind nach van<br />
Wijnen & Bakker (1999a) in jüngeren, aufgrund von dünneren Schlickauflagen<br />
nährstoffärmeren Salzwiesen verbreitet.<br />
Die Böden der durch Lahnungsbau entstandenen Festlands-Salzwiesen sind generell<br />
tonreich und damit auch nährstoffreich, da das beruhigte Wasser hinter den Lahnungen der<br />
Sedimentation von Feinboden Vorschub leistet. Allerdings erhöht sich mit der Zeit auch die<br />
Tonauflage der Böden natürlicher Salzwiesen. Dies ist auf Mellum gut zu beobachten, wo die<br />
alten Salzwiesen des „Grünlandes“ nahe dem Ringdeich eine wesentlich höhere Kleiauflage<br />
besitzen als die sich erst Ende der siebziger Jahre be<strong>grün</strong>ten Bereiche des zentralen Teils<br />
der Insel, welche vorher eine Sandplate war. Der pflanzenverfügbare Stickstoff als weiterer<br />
wesentlicher Makronährstoff konnte im Rahmen dieses Projektes leider nicht gemessen<br />
werden, da die Analyse zu aufwändig ist. Olff et al. (1997a) haben aber gezeigt, dass das
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 89<br />
Stickstoffangebot ebenso wie das der anderen Nährstoffe an die Höhe der Kleiauflage<br />
gekoppelt ist, welche negativ mit dem Sandgehalt der Böden zusammenhängt. Der<br />
Sandgehalt der Böden ist in den hier dargelegten Auswertungen in die aggregierte Variable<br />
Nährstoffe („nutrients“) eingegangen. Kiehl et al. (1997b) und Jefferies & Perkins (1977)<br />
stellten fest, dass Salzwiesen generell stickstofflimitierte Lebensräume sind. Ist aber<br />
Stickstoff im Überfluss verfügbar, kann trotzdem eine Phosphorlimitierung auftreten.<br />
Der wichtigste Umweltfaktor für die Biomassebildung ist die mittlere Höhe des Grundwassers<br />
und sein Salzgehalt, die beide miteinander korreliert sind und deshalb zu der Variablen<br />
„Grundwasser“ aggregiert wurden. Permanent durch Grundwasser gefüllte Bodenbereiche<br />
bedingen ein Sauerstoffdefizit im Wurzelbereich und schränken die Wurzelatmung und<br />
Nährstoffaufnahme ein. Dazu kommt die Bildung von Pflanzengiften wie Sulfid und die<br />
Freisetzung von Mangan (Adam 1990), welche das Wurzelwachstum behindert. Um unter<br />
diesen Bedingungen zu überleben, benötigen Pflanzen Durchlüftungsgewebe in den<br />
Wurzeln, in dem Sauerstoff vom Spross in die Wurzel transportiert wird. Diese<br />
Durchlüftungsgewebe weisen vor allem Pflanzen der unteren Salzwiese auf. In den<br />
Salzwiesen ist ein hoher Grundwasserspiegel außerdem häufig mit hohen Salzgehalten<br />
korreliert, die für Pflanzen toxisch sind, sofern sie nicht über Mechanismen verfügen, das<br />
Salz unschädlich zu machen. Zu den effektiven Mechanismen, die vor allem bei Pflanzen der<br />
Pionierzone und unteren Salzwiese verbreitet sind, gehören Barrieren in der Wurzel gegen<br />
die Aufnahme von Salz, Exkretion von Salz und Speicherung im Zellsaftraum (Vakuole,<br />
Kinzel 1982, Schirmer and Breckle 1982, Rozema et al. 1985, Van Diggelen et al. 1986). Die<br />
Pflanzen der oberen Salzwiese schützen sich vor allem durch eine Verringerung der<br />
Transpiration und damit einer verringerten Salzwasser-Aufnahme über die Wurzeln.<br />
Verglichen mit dem Artenpool der terrestrischen Pflanzen auf salzfreien Standorten<br />
(„Glykophyten“) in Nordwest-Europa ist der Artenpool der Salzpflanzen, die solche<br />
Anpassungen entwickelt haben („Halophyten“), sehr klein. Wie die hier vorgelegten<br />
Ergebnisse zeigen, schränken hohe Salzgehalte im wurzelnahen Grundwasser die<br />
Biomassebildung stark ein. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Schilfbestände in<br />
oligohalinen Ästuargewässern der Weser unter ähnlichen Tide- und Bodenbedingungen bis<br />
zur dreifachen Menge an Biomasse produzieren. Allerdings sind hohe Salzgehalte allein<br />
nicht für Unterschiede in der Produktivität von Pflanzen innerhalb einer<br />
Salzwiesengemeinschaft verantwortlich zu machen, da die damit korrelierten hohen<br />
Grundwasserstände, niedrige Sauerstoffgehalte und erniedrigte Nährstoffangebote sich<br />
ebenfalls auswirken.<br />
Ebenso wie stehende Biomasse im Sommer wird der Zuwachs an Biomasse (Produktivität)<br />
von Frühjahr bis Sommer (ANPP) durch Grundwasserhöhe und –salzgehalt bestimmt.<br />
Allerdings ist das Regressionsmodell der Produktivität weniger gut an die Daten angepasst<br />
als das der stehenden Biomasse. Der Grund dafür ist, dass Zuwächse der<br />
Pflanzengemeinschaften der unteren und oberen Salzwiese sehr unterschiedlich sind und<br />
offenbar stark von den biologischen Eigenschaften der Arten, insbesondere dem<br />
Verholzungsgrad bestimmt werden (vgl. Kapitel 5.2.3.2). Nur die Pionierzone zeigt deutlich<br />
geringere Zuwächse als alle anderen Vegetationseinheiten. Wenn allerdings die stehende<br />
Biomasse nicht direkt von dem Zuwachs bestimmt wird, stellt sich die Frage, wie die<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 90 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Unterschiede in der stehenden Biomasse zwischen den Pflanzengemeinschaften zustande<br />
kommen. Der Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Abbauraten der Streu. Zum Beispiel<br />
hat die Keilmeldenflur zwar vergleichsweise geringe Zuwachsraten, jedoch wird dies durch<br />
die niedrige Abbaurate kompensiert, so dass die stehende Biomasse ähnlich hoch ist wie die<br />
anderer, schneller aufwachsender Gemeinschaften (vgl. Abbildung 25).<br />
5.2.4.2 BEDEUTUNG DER GELÄNDEHÖHE FÜR DIE AUSBILDUNG DER<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
PFLANZENGESELLSCHAFTEN<br />
Viele Studien nehmen an, dass Grundwasserstände und –salzgehalte mit der Geländehöhe<br />
fallen und benutzen deshalb die Geländehöhe als stellvertretenden Parameter für den Salz-<br />
und Wassereinfluss. Die Messungen zeigen, dass dies nicht uneingeschränkt gilt. Vielmehr<br />
gibt es auch bei relativ hoch liegenden Flächen hohe Grundwasserstände und hohe<br />
Salzgehalte, wie Abbildung 20 zeigt. Hohe Grundwasserstände bei relativ hoch gelegenen<br />
Flächen können durch Kleischichten im Untergrund und/oder fehlenden Anschluss an<br />
Prielsysteme oder künstliche Grabensysteme induziert werden. Hohe Salzgehalte entstehen,<br />
wenn Salzwasser bei längeren Trockenperioden über kapillaren Aufstieg an die<br />
Bodenoberfläche transportiert wird und dann verdunstet, wobei sich Salz anreichert. Die<br />
Folge davon ist, dass Pflanzen der unteren Salzwiese und Pionierzone bei Geländehöhen<br />
vorkommen, die eigentlich der oberen Salzwiese vorbehalten sind. Da gerade die Arten der<br />
Pionierzone, insbesondere Salicornia spp. und Suaeda maritima, relativ niedrige<br />
Produktivitäten aufweisen, wird damit auch die Biomassebildung in der Fläche reduziert. Der<br />
negative Einfluss der Salzanreicherung auf die Biomassebildung nach Trockenperioden<br />
konnte von de Leeuw et al. (1990) in Salzwiesen auf Schiermonnikoog nachgewiesen<br />
werden.<br />
Das in vielen Lehrbüchern gezeigte Modell eines linearen Anstiegs der Geländehöhe vom<br />
Watt bis zum Deich ist überdies recht selten in der Wirklichkeit anzutreffen. Die hier<br />
dargelegten Ergebnisse und die Biotopkartierungen zeigen, dass die Pflanzengesellschaften<br />
der Pionierzone, unteren und oberen Salzwiese sich nicht unbedingt linear und regelhaft vom<br />
Watt bis zum Deich abwechseln, sondern vielfältig miteinander verzahnt vorkommen. Dies<br />
wird umso deutlicher, je jünger und natürlicher die Salzwiesen sind. Vorländer, die als Folge<br />
der Landgewinnung durch Lahnungsbau entstanden sind, zeigen häufig ein<br />
charakteristisches Muster aus seewärtigen Wällen und rückwärtigen Senken, die auf<br />
Unterschiede in der Sedimentation in den Lahnungsfeldern zurückzuführen sind. Diese<br />
Senken werden u.U. bei normaler Flut nicht überschwemmt, da sie durch die Wälle von der<br />
Flut abgeschirmt werden. Sind jedoch Gräben und Grüppen vorhanden, die durch die Wälle<br />
hindurch eine Verbindung zu See schaffen, so können die rückwärtigen Senken regelmäßig<br />
überflutet werden und sind dann mit Arten der Pionierzone und unteren Salzwiese<br />
bewachsen. Auch auf Mellum ist der lehrbuchmäßige, lineare Anstieg nicht anzutreffen. Hier<br />
entstand die Salzwiese auf einer ehemaligen Sandplate, nachdem Dünen die Plate<br />
gegenüber der seewärtigen Brandung abgeschlossen hatten. Die Plate hatte wahrscheinlich<br />
keine homogene Oberfläche, sondern war von vielen Senken und kleinen Primärdünen<br />
durchsetzt. Diese Oberflächenstruktur blieb im Laufe der Salzwiesenentwicklung bestehen.<br />
Es ist anzunehmen, dass das einströmende und ablaufende Wasser die Erhebungen im
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 91<br />
Laufe der Zeit durch Erosion noch deutlicher herausmodelliert. Die geomorphologische<br />
Entstehung der Senken und Wälle ist allerdings noch besser zu erforschen, jedoch von<br />
erheblicher Bedeutung für die Prognose der Biomassebildung von Vorländern, die nicht mehr<br />
entwässert werden und mit dem Ziel des Prozessschutzes sich selbst überlassen bleiben.<br />
Grundsätzlich andere Bedingungen bestimmen die Biomassebildung der<br />
Brackwasserröhrichte, welche in den oligohalinen Bereichen der Flussästuare vorkommen.<br />
Da der Salzgehalt sehr niedrig ist, spielt er bei der Regulation der Biomassebildung kaum<br />
eine Rolle. Das Wasser ist ausgesprochen nährstoffreich, was durch die nach wie vor hohe<br />
Nährstoffbelastung der Flüsse und durch die im Fluss-Sediment gespeicherten Nährstoffe<br />
bedingt wird. Unter diesen Bedingungen gedeiht Schilf optimal. Da es an schwankende<br />
Wasserstände angepasst ist und bis zu 1,5 m Überstau gut vertragen kann, bedeutet die<br />
tägliche Überschwemmung mit dem Tidenhub nur eine geringe Wachstumseinschränkung.<br />
Schilf besitzt Durchlüftungsgewebe, welche die Wurzel auch bei andauernd anaeroben<br />
Bedingungen effizient mit Sauerstoff versorgen. Im Gegensatz zur Salzwiese schränken also<br />
weder Überstau, anaerobe Bedingungen noch mangelnde Nährstoffe die Produktivität ein.<br />
Da Schilf sehr hohe Transpirationsleistungen erbringen kann, kann es bei wassergesättigten<br />
Bedingungen sehr viel Biomasse bilden, weit mehr als jede andere natürliche<br />
Vegetationseinheit. Die von uns gemessenen Biomassewerte von Schilf liegen höher als die<br />
von Mais, der für die Vergasung in Biogasanlagen angebaut wird. An der südlichen und<br />
mittleren Ostsee, wo Schilf die natürliche Seeufervegetation darstellt, sind teilweise noch<br />
höhere Werte gemessen worden (Wichtmann 1999).<br />
Für die Vermeidung von <strong>Treibsel</strong> und für die Reduzierung der Biomasse-Produktion<br />
ungenutzter Vorländer ergeben sich aus den beschriebenen Ergebnissen wesentliche<br />
Unterschiede zwischen Brackwasser-Röhrichten und Salzwiesen. Auf Salzwiesen führt eine<br />
Erhöhung des Grundwasserstandes zu einer Reduzierung der Produktivität.<br />
Wassermanagement kann deshalb eine Strategie für die Einschränkung der potentiellen<br />
<strong>Treibsel</strong>menge sein. Dies gilt jedoch nicht für die Brackwasserröhrichte, die auch bei<br />
Überstau mit Brackwasser sehr wuchskräftig sind.<br />
5.2.4.3 AUSWIRKUNG DER NUTZUNG AUF DIE PRODUKTIVITÄT VON<br />
SALZWIESEN UND ÄSTUAREN<br />
Werden Salzwiesen beweidet, so wird ihnen Biomasse entzogen. Die Ergebnisse zeigen<br />
deutlich, dass die stehende Biomasse stark reduziert wird, wenn die Biomasseentnahme<br />
durch Rinderbeweidung ansteigt. Die Ergebnisse beziehen sich allerdings auf die<br />
Probeflächen und lassen sich nicht einfach auf die Fläche einer Weide extrapolieren. Die<br />
Probeflächen liegen unter anderem auf Teilflächen einer Weide, die von den Rindern<br />
bevorzugt und intensiv beweidet werden, während andere Teilflächen gar nicht beweidet<br />
werden (siehe unten). Sollte die gesamte Weide gleichmäßig abgeweidet werden, so müsste<br />
die Weide mit etwa 3 GV pro ha besetzt werden. Diese Besatzdichte, die notwendig ist, um<br />
eine komplette Reduktion der Biomasse auf der gesamten Weide zu erreichen, kann bei<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 92 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Kenntnis der stehenden Biomasse leicht abgeschätzt werden. Die Menge der nach der<br />
Beweidung noch stehenden Biomasse hängt von der Zahl der Großvieheinheiten pro ha, der<br />
Beweidungsdauer und der Produktivität ab. Da die mittlere stehende Biomassemenge<br />
zwischen 3 t/ha in Pionierzonen und 7 t/ha auf der oberen Salzwiese liegt, kann die für eine<br />
komplette Reduktion der Biomasse notwendige Besatzdichte leicht errechnet werden. Wenn<br />
Rindern Heu mäßiger Qualität und spätem Schnittzeitpunkt angeboten wird, dann fressen sie<br />
üblicherweise nur 10 kg Trockensubstanz/Tier und Tag, dagegen von guten Anwelksilagen<br />
bis zu 15 kg TM (BMLFUW 2010). Wahrscheinlich liegt die max. Aufnahme der Rinder auf<br />
Salzwiesen zwischen 10 und 15 kg TM pro Tag. Unter der eher optimistischen Annahme von<br />
einer Aufnahme von 15 kg TM pro Tag, einer Besatzzeit von Anfang Mai bis Ende<br />
September (150 Tage) und einer Besatzdichte von 1 GV/ha liegt der Entzug bei 2,25 t/ha.<br />
Zur Reduktion der auf oberen Salzwiesen produzierten Biomasse von 6–8 t/ha sind also<br />
etwa 3 GV/ha notwendig. Hierbei ist die Überkompensation des Biomasseverlustes durch<br />
Nachwachsen bei andauernder Beweidung noch nicht eingerechnet. Geht man dagegen von<br />
einer Besatzzeit von Mitte Juli bis Ende September aus (d.h. nach Ende der Brutzeit), dann<br />
wären 6 GV/ha notwendig, um eine vollständige Reduktion des Aufwuchses der oberen<br />
Salzwiese zu erreichen.<br />
Aktuell ist die Besatzdichte allerdings erheblich geringer, weshalb die produzierte Biomasse<br />
nicht vollständig konsumiert wird. Wenn Herbivoren nicht alle Pflanzenteile abfressen, dann<br />
bilden die Pflanzen Stängel und Blütenstände auf Kosten von Blättern, womit der<br />
Rohfasergehalt des Futters steigt und der Proteingehalt abnimmt. Die Tiere konzentrieren<br />
sich dann auf Teilbereiche der Futterfläche, die intensiv befressen werden, so dass<br />
proteinreicher Jungwuchs gefördert wird. Andere Bereiche werden gar nicht mehr befressen.<br />
Letztere Bereiche bilden sich zum Beispiel um Pflanzenbestände, die auf Grund bestimmter<br />
Eigenschaften nicht gerne gefressen werden, wie die Meerstrand-Binse Juncus maritimus.<br />
Die Aufteilung der Weidefläche in intensiv und nicht befressene Bereiche sind in Rangeland<br />
– Systemen vielfach beschrieben und dort als „patch grazing“ bezeichnet worden (Adler et al.<br />
2001). Bakker et al. (2002a) haben dieses Phänomen auf Schiermonnikoog intensiv<br />
untersucht und „micro pattern“ genannt. Da also mit abnehmender Besatzdichte die<br />
entnommene Biomasse nicht linear weniger wird, sondern große Bereiche gar nicht<br />
befressen werden, können unsere Ergebnisse an den Probeflächen nicht einfach auf die<br />
Fläche einer Weide und damit auf die dortige Besatzdichte übertragen werden. Es wird aber<br />
deutlich, dass bei Besatzdichten, die erheblich unter 3 GV/ha bei einer Besatzzeit von 150<br />
Tagen oder 6 GV/ha über 75 Tage bleiben, große Mengen an Biomasse auf der Fläche<br />
verbleiben.<br />
Im Gegensatz zur extensiven Beweidung reduziert Mahd die Biomasse auf der ganzen<br />
gemähten Fläche. Je nach Mahdzeitpunkt und Mahdfrequenz wächst bis zum Ende der<br />
Vegetationsperiode Biomasse auf der Fläche nach. Findet nur eine Mahd im Juli oder<br />
Anfang August statt, so wird die Salzwiese bis zum Ende der Vegetationsperiode<br />
wahrscheinlich nahezu vollständig nachwachsen. Leider können jedoch zu dieser Frage<br />
keine genauen Angaben gemacht werden, da im Untersuchungsjahr die Mahdflächen mit<br />
den Probeflächen nicht gemäht wurden, weil sie zu nass waren.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 93<br />
In den Ästuargebieten stellt sich die Situation wiederum anders dar. Vor Beginn des<br />
Deichbaus bestand der überwiegende Teil der Marschen aus Schilfried (Behre 2008). Heute<br />
besteht das höher gelegene, deichnahe Vorland überwiegend aus intensiv genutztem<br />
Grünland und, in nassen Mulden, aus Seggenried, die ebenfalls gemäht oder beweidet<br />
werden. Die nicht nutzbaren, bei Flut überschwemmten Bereiche bestehen aus Schilfried,<br />
das zum Teil im Winter gemäht wird. Der deutliche Gegensatz zwischen den<br />
Vegetationseinheiten Grünland und Schilfried liegt darin, dass Schilf, abgesehen von den<br />
naturschutzfachlichen Auswirkungen, weder mehrmalige Sommermahd noch Beweidung<br />
verträgt (z.B. Van Deursen & Drost 1990). Eine kurzfristige Reduktion von Biomasse des<br />
Schilfes ist lediglich bei Mahd im Herbst für die Energieerzeugung und im Winter für die<br />
Gewinnung von Reet denkbar. Für die Mahd im Herbst sind allerdings schonende<br />
Mahdverfahren zu entwickeln, die weder den Boden verdichten, noch die Rhizome<br />
schädigen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 94 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
5.3 TEILPROJEKT 2B: TREIBSELAUFKOMMEN AM DEICHFUß BEI<br />
STURMFLUTEN IN ABHÄNGIGKEIT VON DER BIOMASSEPRODUKTION<br />
DES VORLANDES<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Prof. Dr. Michael Kleyer (Kleyer Umweltplanung) & Diplom Landschaftsökol.<br />
Antje Bremermann (pgg)<br />
5.3.1 EINLEITUNG<br />
Die Außendeichsflächen der niedersächsischen Festlandsküste und Ästuare mit ihren<br />
Salzwiesen, Röhrichten und Grünländern sind naturnahe Elemente der Küstenlandschaft<br />
und aufgrund ihrer Weiträumigkeit und ihres floristischen und faunistischen Arteninventars<br />
von großer naturschutzfachlicher Bedeutung. Sie werden traditionell auch landwirtschaftlich<br />
in unterschiedlicher Weise genutzt und sind gleichzeitig von großer Bedeutung für den<br />
Küstenschutz. Die unterschiedlichen Funktionen dieser Flächen (Küstenschutz, Naturschutz,<br />
Landwirtschaft) führten in der Vergangenheit zu intensiven Auseinandersetzungen über das<br />
Management dieser Flächen, z.B. im Zuge der Etablierung des Nationalparks.<br />
Ein Aspekt dieser Auseinandersetzungen ist das an den Deichen abgelagerte <strong>Treibsel</strong>. Es<br />
entsteht in der Regel, wenn durch Sturmfluten die Wasserstände an der Küste und in den<br />
Ästuaren über das mittlere Tidehochwasser steigen und das Vorland überflutet wird. Dabei<br />
wird bereits abgestorbene Streu im Vorland aufgeschwemmt und ggf. noch <strong>grün</strong>es<br />
Pflanzenmaterial der Salzwiesen oder Röhrichte abgerissen und größtenteils deichwärts<br />
transportiert. Der Eintrag aus binnendeichs gelegenen Gebieten über Nebenflüsse sowie die<br />
Anteile von Algen oder Seegras aus der offenen See oder dem Wattenmeer sind dabei von<br />
untergeordneter Bedeutung (AG <strong>Treibsel</strong> 1996, PERSICKE et al. 1999). Im Zeitraum 1975-<br />
1995 fielen jährlich durchschnittlich ca. 71.000 m 3 <strong>Treibsel</strong> im Bereich der niedersächsischen<br />
Ästuare und der Festlandsküste an (AG <strong>Treibsel</strong> 1996). Allerdings ist die Varianz sehr hoch:<br />
Zwischen den Jahren schwankt die <strong>Treibsel</strong>menge um den Faktor 7 (AG <strong>Treibsel</strong> 1996).<br />
Die Ablagerung größerer Mengen von <strong>Treibsel</strong> am Deich kann die Deichsicherheit<br />
einschränken bzw. gefährden, da es zum oberflächlichen Aufweichen des Deichkörpers<br />
sowie der Zerstörung der Grasnarbe kommt. Der Deich weist dann gegenüber den<br />
möglicherweise folgenden Sturmfluten eine geringere Widerstandsfähigkeit auf und neigt<br />
eher zu Auskolkungen. Durch die Abfuhr des <strong>Treibsel</strong>s entstanden den niedersächsischen<br />
Deichverbänden im Zeitraum von 1985 bis 2008 jährlich durchschnittlich Kosten von rund<br />
575.000 € (Wasserverbandstag schriftlich). Allerdings ist eine Abfuhr des <strong>Treibsel</strong>s oft nicht<br />
möglich, da an weiten Abschnitten der niedersächsischen Deiche keine außendeichs<br />
verlaufenden <strong>Treibsel</strong>abfuhrwege vorhanden sind und winterliches Befahren des nassen<br />
Deichkörpers diesen zerstört. Aus Sicht der Deichverbände ist deshalb eine Reduzierung der<br />
Menge des anfallenden <strong>Treibsel</strong>s erwünscht.<br />
Um Strategien gegen die <strong>Treibsel</strong>ablagerungen auszuarbeiten, muss bekannt sein, ob das<br />
<strong>Treibsel</strong> im Wesentlichen lokal produziert wird, d.h. in den Vorlandflächen direkt vor dem<br />
Deich, oder ob es von entfernt gelegenen Vorländern stammt. So könnte das an der<br />
Festlandsküste antreibende <strong>Treibsel</strong> auch von den ausgedehnten Salzwiesen der<br />
vorgelagerten Inseln stammen. Dann würden sich andere Prioritäten für die Reduzierung von
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 95<br />
<strong>Treibsel</strong> ergeben als bei einer ausschließlich lokalen <strong>Treibsel</strong>verlagerung. Sowohl Gettner<br />
(2003) als auch die Betriebsstelle Norden des NLWKN (unveröffentl.) führten hierzu<br />
Versuche mit Treibkörpern durch. Diese Versuche brachten keine eindeutigen Ergebnisse,<br />
was hauptsächlich methodische Ursachen hatte. Eigene experimentelle Versuche durch<br />
Auslegen von farbig markierten Röhrichthalmen auf den Vorlandflächen des Wapeler<br />
Grodens (südlicher Jadebusen) zeigten, dass das <strong>Treibsel</strong> nicht nur deichwärts, sondern<br />
auch entlang der Küste transportiert wird. Untersuchungen mit einer statistisch<br />
ausreichenden Anzahl von Treibkörpern für die Ableitung belastbarer Aussagen sind<br />
allerdings logistisch kaum durchführbar (Ausbringen und Einsammeln großer Stückzahlen<br />
entlang der gesamten Küstenlinie).<br />
Nach den Angaben in AG <strong>Treibsel</strong> (1996) fielen im Zeitraum 1980-1995 ca. 79 % des<br />
gesamten niedersächsischen <strong>Treibsel</strong>s in den Ästuaren an (21 % Ems/Dollart, 45 % Weser,<br />
14 % Elbe), die restlichen 21 % an der Festlandsküste (18 %) sowie auf den Inseln (3 %).<br />
33 % des gesamten Anfalls betreffen einen einzigen Deichverband (DV Osterstader Marsch,<br />
rechte Weserseite).<br />
Allerdings fehlt eine adäquate Differenzierung des <strong>Treibsel</strong>anfalls nach dem Belastungsgrad<br />
der Deichstrecken. Die bisher verfügbaren Daten beziehen sich auf die gesamten<br />
Deichabschnitte der jeweiligen Deichverbände und sind teilweise sehr heterogen. So fallen in<br />
den Bereich des II. Oldenburgischen Deichbandes sowohl Deiche im Jadebusen, an der<br />
Küste von Butjadingen, an der Unterweser bis zur Huntemündung sowie die Huntedeiche<br />
von der Huntemündung bis nach Oldenburg. Das <strong>Treibsel</strong>aufkommen an einem derart<br />
großen Deichabschnitt eindeutig mit bestimmten ökologischen Veränderungen in Verbindung<br />
zu bringen, ist kaum möglich. Ebenfalls nicht untersucht wurde bislang der Zusammenhang<br />
zwischen Vorlandgröße und <strong>Treibsel</strong>aufkommen.<br />
Außerdem haben sich die Vegetationsverhältnisse auf den Vorländern seit 1996 (Stand der<br />
Auswertung AG <strong>Treibsel</strong>) weiter verändert. Nachdem ein Teil der Salzwiesen im Verlauf der<br />
Einrichtung des niedersächsischen Wattenmeer-Nationalparks aus der Nutzung genommen<br />
wurden, waren die Vegetationstypen, obwohl bereits Brachen, noch durch die vergangene<br />
Nutzung geprägt. Beobachtungen langjährig ungenutzter Flächen zeigen allerdings, dass<br />
sich nach etwa 10-20 Jahren auf den meisten Salzwiesen, bei denen keine natürliche<br />
Entwässerung gegeben ist, Quecken und andere dominante Arten ausbreiten (BOS et al.<br />
2002 für die Sandsalzwiesen; ESSELINK et al. 2002 für die Ästuarsalzwiesen; GETTNER et al.<br />
2000, KIEHL et al. 2000, SCHRÖDER et al. 2002 für die Vorlandsalzwiesen). Quecken-<br />
Dominanzbestände zeichnen sich durch eine besonders hohe stehende Biomasse aus<br />
(Minden & Kleyer subm.).<br />
Die Höhe des <strong>Treibsel</strong>aufkommens an einem Deichabschnitt ist im Wesentlichen abhängig<br />
von den Faktoren Bewuchs des Vorlandes, Lage der Deichstrecke zur Hauptwindrichtung<br />
und Häufigkeit von Sturmfluten (AG <strong>Treibsel</strong> 1996). Für ein wirksames Management zur<br />
Reduzierung des <strong>Treibsel</strong>aufkommens und somit zur Sicherung der Deichanlagen ist es<br />
notwendig, das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Faktoren zu klären. Angesichts<br />
der unterschiedlichen Einflussfaktoren ist ein großräumiger Untersuchungsansatz notwendig.<br />
Da <strong>Treibsel</strong>mengen und –anlandung abhängig von der Hauptwindrichtung während der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 96 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Sturmflut sind, ist es wesentlich, dass der <strong>Treibsel</strong>anfall in Bezug auf einzelne Sturmflut-<br />
Ereignisse bestimmt wird, anstelle der Betrachtung jährlicher Durchschnittsmengen.<br />
Das Ziel unserer Untersuchung ist es daher, auf der Basis der von den Deichverbänden an<br />
den niedersächsischen Deichen flächendeckend gemeldeten <strong>Treibsel</strong>mengen nach zwei<br />
Sturmfluten folgende Fragen zu beantworten:<br />
Gibt es einen Zusammenhang zwischen <strong>Treibsel</strong>aufkommen am Deichfuß und der<br />
Biomassebildung im Vorland?<br />
Spielt die Hauptwindrichtung während der Sturmflut eine wesentliche Rolle für die<br />
Varianz des <strong>Treibsel</strong>aufkommens an niedersächsischen Deichen?<br />
Unterscheiden sich schilfgeprägte Ästuare und Salzwiesen bezüglich produzierter<br />
Biomasse und <strong>Treibsel</strong>aufkommen am Deich?<br />
Auf der Basis dieser Untersuchungen können Prognosen erstellt werden, mit denen durch<br />
<strong>Treibsel</strong> besonders belastete Deichabschnitte identifiziert werden können. Sofern die<br />
Prognosegüte akzeptabel ist, könnten diese Deichabschnitte vorrangig für die Durchführung<br />
von Managementoptionen in Betracht gezogen werden.<br />
5.3.2 METHODIK<br />
5.3.2.1 ERFASSUNG UND AU<strong>FB</strong>EREITUNG DER TREIBSELMENGENDATEN<br />
Die Erfassung und Aufbereitung der <strong>Treibsel</strong>mengendaten ist Bestandteil des Teilprojektes<br />
1A und ist unter Kapitel 4.4.2 erläutert.<br />
5.3.2.2 TRANSFER DER BIOMASSEBERECHNUNGEN VON DER<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
PROBEFLÄCHEN-EBENE AUF DIE LANDSCHAFTSEBENE<br />
Um die Abhängigkeit des <strong>Treibsel</strong>anfalls am Deich von der Biomasseproduktion des<br />
Vorlandes zu quantifizieren, wurde zunächst die Biomasseproduktion der jeweiligen<br />
Vegetation und Nutzung an den Probeflächen ermittelt und auf das gesamte Vorland<br />
hochgerechnet. Dazu wurden zunächst aus den im Untersuchungsgebiet vorkommenden<br />
Biotop- und TMAP (Trilateral Monitoring and Assessment Program)-Typen<br />
'Vegetationseinheiten' gebildet, die hinsichtlich ihrer Produktivität vergleichbar sind. Auch die<br />
einzelnen Nutzungsformen wurden hinsichtlich der Nutzungsintensität in 'Nutzungstypen'<br />
eingeteilt. Die Zuordnungen sind in der Tabelle 26 und Tabelle 27 aufgeführt.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 97<br />
Tabelle 26: Zuordnung von TMAP- und Biotoptypen zu Vegetationseinheiten<br />
Vegetationseinheit Zuordnung nach<br />
TMAP<br />
Küstenwatt S.12, S.13 -<br />
Pionierzone s.1, S.1.1, S.1.2 -<br />
Zuordnung<br />
nach Biotoptyp<br />
Untere Salzwiese S.2.1 KHU, KHF, KHW<br />
Portulak-Keilmeldenbestände<br />
(Halimione)<br />
S.2.4<br />
Obere Salzwiese S.3 KHO<br />
Queckenbestände (Elymus) S.3.7 KHQ<br />
Grünland G.0 alle G<br />
Schilf (Phragmites) H.4, S.5.2 KRP, NRS<br />
Sonstiges Röhricht S.5, S.5.1 KBR, FWR, KRS, KRH, KRZ, NRG, NRW, NRR,<br />
VER<br />
Sonstige Vegetation mit geringer<br />
<strong>Treibsel</strong>produktion<br />
Sonstige Vegetation mit hoher<br />
<strong>Treibsel</strong>produktion.<br />
D, H.5.1, H.6,<br />
H.6.1, H.6.2, SAM,<br />
S.13, alle X, O, W<br />
AT, BAS, BAT, BAZ, BE, BFR, BMS, BRS, BRX,<br />
DOL, DOZ, EOB, FGM, FGR, FGS, FKK, FWO,<br />
FWP, FZH, FZT, HB, HBA, HBE, H<strong>FB</strong>, HFM,<br />
HFS, HN, HPG, HS, HSE, HX, KBO, KBP, KBS,<br />
KFR, KPB, KPS, KSA, KSI, KSN, KWG, alle KX,<br />
alle KY, NSR, NPF, NPZ, alle OD, alle OG, alle<br />
ON, alle OS, alle OV, alle OX, PHO, PKR, alle<br />
PS, alle PZ, RAG, RSR, RSZ, SAZ, SEN, SEZ,<br />
SRF, SSK, ST, STG, alle SX, alle TF, WHT,<br />
WPS, WPS, WPW, WWT, WXH, WXP (u.a.)<br />
keine alle U, NUT, NSB, NSG, NSS<br />
Keine Information n keine<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 98 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 27: Zuordnung von Nutzungsformen zu 'Nutzungstypen'<br />
Nutzungstyp Nutzungsform<br />
Brache Brache<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Mahd Winter (da zum Zeitpunkt der Sturmfluten noch nicht gemäht)<br />
Extensiv genutzt Weide Rinder, 0,5 – 0,8 Rinder/ha<br />
Weide Rinder, extensive Nutzung<br />
Weide Schafe, (sehr) extensive Nutzung<br />
Intensiv genutzt Weide Rinder, 1,0 – 1,5 Rinder/ha bzw. 1 GVE<br />
Weide Rinder/Schafe, intensive Nutzung<br />
Mahd Sommer (teilw. mit Nachbeweidung)<br />
Acker<br />
Keine Information Weide, Art und Nutzungsintensität unbekannt<br />
Art und Nutzungsintensität unbekannt<br />
Sonstige Nutzungen z.B. Campingplätze, Strandbereiche, bebaute Flächen<br />
Für die Hauptfaktoren der Biomassebildung, nämlich Grundwasserstand und Salzgehalt des<br />
Grundwassers sowie Nährstoffgehalte der Böden, sind keine flächenhaften Daten verfügbar.<br />
Deshalb konnten diese Parameter nicht als Grundlage für die Biomasseberechnung des hier<br />
betrachteten Küsten- und Ästuar-Vorlandes herangezogen werden. Allerdings ist jede<br />
Vegetationseinheit auch ein Ausdruck der an dem Standort herrschenden<br />
Umweltbedingungen. Einheiten der unteren Salzwiese weisen z.B. höhere<br />
Grundwasserstände und Salzgehalte als die der oberen Salzwiese auf. Deshalb wurde<br />
angestrebt, die Beziehung zwischen Nutzungsintensität und stehender Biomasse für jede<br />
Vegetationseinheit in Form von Regressionsanalysen zu quantifizieren. Aus diesen<br />
Berechnungen ergaben sich für jeden Nutzungstyp und jede Vegetationstypenklasse<br />
detaillierte Werte der stehenden Biomasse. Allerdings ist die Stichprobenmenge gering,<br />
wenn für die Berechnungen nur Probeflächen einer Vegetationstypenklasse berücksichtigt<br />
werden. Deshalb konnten diese Berechnungen nur für die Vegetationseinheiten 'Untere<br />
Salzwiese' und 'Quecken' durchgeführt werden. Wenn die Stichprobenmenge einer<br />
Vegetationseinheit zu gering für eine Regressionsanalyse war (z.B. für Grünland, obere<br />
Salzwiese), oder wenn die Vegetationseinheiten nicht genutzt wurden (z.B. Portulak-<br />
Keilmeldenbestände), dann wurden anstelle von Regressionswerten die Mittelwerte der<br />
Probeflächen genommen, die zur Verfügung standen. Für kartierte Schilfflächen wurden die<br />
Sommerwerte der Biomasse der genutzten oder ungenutzten Schilfbestände genommen, da<br />
die Sturmfluten im Jahr 2006 und 2007 vor der Mahd der Schilfflächen auftraten, somit die<br />
niedrigen Frühjahrswerte der gemähten Schilfflächen nicht zutrafen.<br />
Die stehende Biomasse zeigt auch innerhalb einzelner Vegetationseinheiten erhebliche<br />
Unterschiede, da sie durch Umweltfaktoren wie Nährstoffversorgung, Salinität,<br />
Grundwasserhöhe und Überflutungshäufigkeit beeinflusst wird. Sie weist daher ein<br />
Spannweite an Werten auf, die bei dem Upscaling von Probeflächen-Ebene auf<br />
Landschaftsebene berücksichtigt werden muss. Deshalb wurden drei verschiedene Werte für
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 99<br />
die Berechnung der stehenden Biomasse jeder Vegetationseinheit herangezogen: (i) die<br />
Werte, welche dem unteren Quartil der Biomassewerte entsprechen (optimistische<br />
Prognose, da auf den geringsten gefundenen Biomassewerten beruhend), (ii) die<br />
Mittelwerte, (iii) die Werte, welche dem oberen Quartil entsprechen (pessimistische<br />
Prognose). Bei den Vegetationseinheiten der unteren Salzwiese ('Untere Salzwiese',<br />
'Portulak-Keilmeldenbestände') und der 'Quecken', deren Biomassewerte unter<br />
verschiedenen Nutzungen durch Regressionen errechnet wurden, wurden die Werte des<br />
25 % und 75 % Konfidenzintervalles, der Wahrscheinlichkeit der Lage des Mittelwertes,<br />
anstelle der Quartile herangezogen.<br />
Für den Fall, das Vegetationseinheiten nicht durch Probeflächen abgedeckt werden konnten,<br />
wurden Expertenschätzungen der stehenden Biomasse vorgenommen.<br />
Mit diesen Vorarbeiten konnten für alle flächenrelevanten TMAP-Einheiten der Vorländer der<br />
niedersächsischen Küste und alle Biotoptypen der Vorländer der Ästuare Werte für die<br />
stehende Biomasse geschätzt werden. Diese Werte (Einheit g/m²) wurden mit der Fläche der<br />
entsprechenden Vegetationseinheiten der Vorländer vor jedem Deichabschnitt multipliziert.<br />
Da die Länge der Deichabschnitte unterschiedlich ist, wurden die Flächensummen der<br />
stehenden Biomasse aller Vegetationseinheiten durch die Länge der Deichabschnitte geteilt<br />
und so auf laufende Meter Deichabschnitt normiert. Da diese Variable sehr viele kleine und<br />
wenige große Werte aufwies (entsprechend vielen kleinen und wenigen großen Flächen),<br />
wurde die Variable Biomasse/lfd. m Deichlänge wurzeltransformiert, um näher an normal<br />
verteilte Werte heranzukommen, welche für die weiteren statistischen Auswertungen<br />
wesentlich sind. Da alle Werte in gleicher Form transformiert wurden, blieben die<br />
Unterschiede zwischen den Werten erhalten.<br />
Um die Produktivität der Flächen und die <strong>Treibsel</strong>menge am Deichfuß miteinander in Bezug<br />
zu setzen, wurde das Flächen-Thema der stehenden Biomasse von Vorlandflächen mit dem<br />
Linien-Thema zur <strong>Treibsel</strong>menge miteinander verschnitten (siehe Abbildung 29). Um<br />
stehende Biomasse pro laufenden Meter Deichlänge in Bezug zu dem <strong>Treibsel</strong>anfall zu<br />
stellen, wurden wiederum Regressionsanalysen eingesetzt. Da die zu erklärende Variable<br />
<strong>Treibsel</strong>aufkommen aus vier Rangstufen besteht und somit ordinal skaliert ist, wurde ein<br />
ordinales logistisches Regressionsverfahren gewählt. Logistische Regressionen ermöglichen<br />
Regressionskurven, die einen Maximal-Wert annehmen können. Dazu wurde das Verhältnis<br />
beobachtete <strong>Treibsel</strong>kategorie zu max. <strong>Treibsel</strong>kategorie (4) gebildet. Das<br />
Regressionsverfahren ermittelt die Wahrscheinlichkeit, bei welcher Kombination der<br />
erklärenden Variablen das <strong>Treibsel</strong>aufkommen den Rang 4 (sehr hoch) einnimmt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 100 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 29: Verschneidung der Informationen der Vorlandflächen und der Treibelmengen<br />
am Deichfuß<br />
5.3.3 ERGEBNISSE<br />
5.3.3.1 TREIBSELMENGEN<br />
Die gesamte berücksichtigte Deichlänge betrug für beide Jahre 609 km. Davon waren<br />
280 km Küsten-Deiche und 330 km Ästuar-Deiche an Ems, Weser und Elbe. Die gesamte<br />
Vorlandfläche unter Berücksichtigung der Sommerpolderflächen betrug 17.735 ha, wobei<br />
7.911 ha den Küstenvorländern und 9.824 ha den Ästuarvorländern zuzurechnen sind.<br />
Nach der Sturmflut am 01.11.2006 wurden an 68 % der gesamten Deichlinie geringe bis<br />
mittlere <strong>Treibsel</strong>mengen angeschwemmt (Kategorien 0 bis 2), während 30 % mit hohen bis<br />
sehr hohen <strong>Treibsel</strong>mengen belastet wurden (Kategorien 2-3 bis 4). Ein Drittel der<br />
Deichstrecken blieb ohne <strong>Treibsel</strong>anfall (vgl. Abbildung 30). Für knapp 2 % der Deichstrecke<br />
liegen keine Daten vor. Insgesamt nahm der prozentuale Anteil an der Deichlinienabschnitte<br />
mit den jeweiligen Mengenkategorien von der Kategorie 0 zur Kategorie 4 hin ab (vgl.<br />
Abbildung 30).<br />
Die Verteilung der <strong>Treibsel</strong>mengen nach der Sturmflut am 09.11.2007 stellt ein anderes Bild<br />
dar, wobei hier der Anteil der Deichstrecken, für die keine Daten vorlagen, mit 41 %<br />
erheblich höher war. Entlang der Deichlinien, für die Daten zusammengetragen werden<br />
konnten, verteilten sich 39 % auf geringe bis mittlere <strong>Treibsel</strong>mengen und 21 % auf hohe bis<br />
sehr hohe <strong>Treibsel</strong>mengen (vgl. Abbildung 30).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 101<br />
Die 'Zwischenkategorien' (0-1, 1-2, …) waren ursprünglich nicht vorgesehen, wurden aber<br />
vereinzelt von einigen Deichverbänden vergeben, weshalb hier der Flächenanteil im<br />
Vergleich deutlich geringer ist.<br />
Abbildung 30: Verteilung der <strong>Treibsel</strong>-Mengenkategorien entlang der Hauptdeichlinie der<br />
niedersächsischen Küste und der Ästuare Ems, Elbe und Weser nach den Sturmfluten am<br />
01.11.2006 (oben) und 09.11.2007 (unten)<br />
In Bezug auf die Vegetation ist das gesamte Vorland unter Berücksichtigung der<br />
Sommerpolderflächen von 17.735 ha etwa zur Hälfte von Salzwiesen oder Schilfflächen der<br />
Ästuare bedeckt, die maßgeblich zur <strong>Treibsel</strong>produktion beitragen (Vegetationseinheiten:<br />
'Untere Salzwiese', 'Portulak-Keilmelde', 'Obere Salzwiese', 'Queckenbestände', 'Schilf',<br />
Sonstiges Röhricht, Sonstige Vegetation mit hoher <strong>Treibsel</strong>produktion). Die größten<br />
Flächenanteile werden hier von den Vegetationseinheiten 'Untere Salzwiese' und 'Quecke'<br />
eingenommen, gefolgt von 'Schilf' und 'Sonstiges Röhricht'.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 102 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die andere Hälfte ist mit Vegetationseinheiten bedeckt, die nur geringfügig bis gar nicht zur<br />
<strong>Treibsel</strong>produktion beitragen (Vegetationseinheit: 'Küstenwatt', 'Pionierzone', 'Grünland',<br />
'Sonstige Vegetation mit geringer <strong>Treibsel</strong>produktion'). Davon machen allein die<br />
Grünlandflächen 70 % aus (Tabelle 28).<br />
Tabelle 28: Überblick über die Vegetationseinheiten im Gesamt-Datensatz<br />
Vegetationstyp Größe (ha) Flächenanteil in %<br />
Küstenwatt 140 0,8<br />
Pionierzone 724 4,1<br />
Untere Salzwiese 2.162 12,2<br />
Portulak-Keilmeldenbestände (Halimione) 21 0,1<br />
Obere Salzwiese 851 4,8<br />
Queckenbestände (Elymus) 2.138 12,1<br />
Grünland 6.607 37,3<br />
Schilf (Phragmites) 1.647 9,3<br />
Sonstiges Röhricht 968 5,5<br />
Sonstige Vegetation mit geringer <strong>Treibsel</strong>produktion 1.514 8,5<br />
Sonstige Vegetation mit hoher <strong>Treibsel</strong>produktion 757 4,3<br />
Keine Information 207 1,2<br />
Gesamt-Vorland 17.735 100,0<br />
In Bezug auf die Nutzung sind rund 43 % der Flächen ungenutzt, 46 % intensiv genutzt. Ein<br />
sehr geringer Teil (2 %) wird extensiv genutzt. Für die übrigen Flächenanteile erfolgen<br />
sonstige Nutzungen oder es liegen keine Nutzungsinformationen vor (Tabelle 29).<br />
Tabelle 29: Überblick über die Nutzungstypen bzw. -intensitäten im Gesamt-Datensatz<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzungstyp Größe (ha) Flächenanteil in %<br />
Brache 7.472 42,1<br />
Extensiv genutzt 321 1,8<br />
Intensiv genutzt 8.274 46,7<br />
Keine Information 1.239 7,0<br />
Sonstige Nutzungen 429 2,4<br />
Gesamt-Vorland 17.735 100,0<br />
Im Vergleich zu den Tabellen zur aktuellen Landnutzung in den Kapiteln 4.2.1.5 und 4.2.2.5<br />
ist zu beachten, dass hinsichtlich der Auswertung des <strong>Treibsel</strong>aufkommens die<br />
Sommermahd zum Nutzungstyp „Intensiv genutzt“ und die Weidenutzung mit unbekannter<br />
Besatzdichte zu der Kategorie „Keine Information“ gerechnet wurde (vgl. Tabelle 27).
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 103<br />
Für einige Deichabschnitte konnten in beiden Jahren keine Daten zum <strong>Treibsel</strong>anfall<br />
gewonnen werden. Die Vorlandflächen dieser Deichabschnitte konnten demzufolge bei den<br />
Auswertungen nicht berücksichtigt werden (vgl. Tabelle 30).<br />
Die gesamte berücksichtigte Deichlänge betrug rund 610 km, die gesamte Vorlandfläche<br />
unter Berücksichtigung der Sommerpolderflächen 17.735 ha. Die nachfolgende Tabelle gibt<br />
einen Überblick über die Daten, die bei der Auswertung der Datensätze der Sturmfluten in<br />
den Jahren 2006 und 2007 berücksichtigt werden konnten.<br />
Tabelle 30: Übersicht der Datensätzen zu den Sturmfluten 2006 und 2007<br />
Datensatz 2006 2007<br />
Deichlänge gesamt (km) 609,85<br />
Deichlänge, für die keine <strong>Treibsel</strong>daten vorlagen [km]<br />
(nicht ausgewertet)<br />
Deichlänge, für die <strong>Treibsel</strong>daten vorlagen [km]<br />
(ausgewertet)<br />
8,87 248,12<br />
600,99 361,74<br />
Vorlandfläche gesamt [ha] 17.735,2. 17.734,96<br />
Vorlandfläche, für die keine <strong>Treibsel</strong>daten am Deich vorlagen [ha]<br />
(nicht ausgewertet)<br />
Vorlandfläche, für die <strong>Treibsel</strong>daten am Deich vorlagen [ha]<br />
(ausgewertet)<br />
49,11 6384,54<br />
17.686,12 11.350,43<br />
Mittlere Vorlandfläche [m²] pro lfd. Meter Deichlänge 290,81 290,80<br />
5.3.3.2 BIOMASSEPRODUKTION<br />
Die Biomasseproduktion wird hier am Beispiel der Probegebiete Norderland und Strohauser<br />
Plate dargestellt. Für das Norderland sind die Biomassewerte im Herbst 2006 und im<br />
Sommer 2007 zu Grunde gelegt worden, für die Ästuarflächen der Strohauser Plate nur der<br />
Sommer 2007, da hier im Herbst 2006 keine Probenahme durchgeführt wurde (Kapitel<br />
5.2.2.2). Die Abbildungen zur Stehenden Biomasse des Norderlandes von 2006 (Abbildung<br />
31 und Abbildung 32) und 2007 (Abbildung 34) zeigen, dass die Produktivität im Jahr 2006<br />
auf einem Großteil der Fläche (Sommerpolder ausgenommen) um etwa 1 bis 2 t TM/ha<br />
(entspricht 100-200 g TM/m²) höher gewesen ist als im Jahr 2007, was wahrscheinlich auf<br />
die längere Wachstumszeit bis zum Erntetermin Herbst 2006 zurückzuführen ist. Außerdem<br />
zeigen sie auch den Einfluss der Beweidung (vgl. Abbildung 33), denn die stehende<br />
Biomasse in den Brachen ist 1 – 2 t/ha höher als die der eher intensiv beweideten Flächen.<br />
Der Vergleich von extensiv beweideten Flächen mit Brachen zeigt lediglich im Jahr 2007<br />
eine Verringerung der Biomasse durch Beweidung um etwa 100 gTM/m². Dagegen zeigt sich<br />
im Jahr 2006 ein Mosaik, das zum geringeren Teil aus Flächen besteht, in denen die Rinder<br />
die Biomasse reduziert haben, zum größeren Teil aber aus Flächen, in denen<br />
Biomassemengen wie in den Brachen zu finden sind. Die extensive Beweidung mit einer<br />
Besatzdichte von 0,5 Rindern pro ha konnte also die stehende Biomasse im Jahr 2006 kaum<br />
reduzieren.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 104 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
johann köhler martin sprötge gotthard storz<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
0 500 m<br />
Forschungsvorhaben: Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung -<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Stehende Biomasse Sommer 2007<br />
Niedersächsische Deichverbände &<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Stehende Biomasse im Sommer<br />
(Datengrundlage 2007, Einheit g/m²)<br />
0 - 100<br />
Quelle Geobasisdaten:<br />
> 100 - 200<br />
> 200 - 300<br />
> 300 - 400<br />
> 400 - 500<br />
> 500 - 600<br />
> 600 - 700<br />
> 700 - 800<br />
> 800 - 900<br />
> 900 (1469)<br />
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung<br />
Projekt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Forschungsvorhaben "Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung"<br />
26939 ovelgönne<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
klein-zetel 22<br />
tel 04737/8113-0<br />
Finanzierer<br />
fax 04737/8113-29<br />
email<br />
Niedersächsische Deichverbände & frieschenmoor@pgg.de<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
28203 bremen<br />
Teilvorhaben<br />
rembertistraße 29/30<br />
tel 0421/33752-0<br />
Modellhafte Managementkonzepte fax 0421/33752-33<br />
email bremen@pgg.de<br />
Plandarstellung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Stehende Biomasse Sommer 2006<br />
Abbildung 31: Stehende Biomasse Sommer 2007, Vorlandbereich „Norderland“<br />
johann köhler martin sprötge gotthard storz<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
0 500 m<br />
Projekt-Nr.<br />
1840<br />
bearbeitet<br />
Sp/AB<br />
gezeichnet<br />
AB<br />
geprüft<br />
Datum<br />
10.03.2011<br />
Maßstab<br />
s. Leiste<br />
Blatt<br />
Karte 1<br />
geändert<br />
Datei<br />
g/projekte/1840/<br />
plaene/1-5<br />
Plotdatei<br />
g/projekte/1840/<br />
plots/1-5<br />
internet: www.pgg.de<br />
Forschungsvorhaben: Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung -<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Stehende Biomasse Herbst 2006<br />
Niedersächsische Deichverbände &<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Stehende Biomasse im Herbst<br />
(Datengrundlage 2006, Einheit g/m²)<br />
0 - 100<br />
Quelle Geobasisdaten:<br />
> 100 - 200<br />
> 200 - 300<br />
> 300 - 400<br />
> 400 - 500<br />
> 500 - 600<br />
> 600 - 700<br />
> 700 - 800<br />
> 800 - 900<br />
> 900 (1469)<br />
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung<br />
Abbildung 32: Stehende Biomasse Herbst 2006, Vorlandbereich „Norderland“<br />
Projekt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Forschungsvorhaben "Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung"<br />
26939 ovelgönne<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
klein-zetel 22<br />
tel 04737/8113-0<br />
Finanzierer<br />
fax 04737/8113-29<br />
email<br />
Niedersächsische Deichverbände & frieschenmoor@pgg.de<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
28203 bremen<br />
Teilvorhaben<br />
rembertistraße 29/30<br />
tel 0421/33752-0<br />
Modellhafte Managementkonzepte fax 0421/33752-33<br />
email bremen@pgg.de<br />
Plandarstellung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Stehende Biomasse Herbst 2006<br />
Projekt-Nr.<br />
1840<br />
bearbeitet<br />
Sp/AB<br />
gezeichnet<br />
AB<br />
geprüft<br />
Datum<br />
10.03.2011<br />
Maßstab<br />
s. Leiste<br />
Blatt<br />
Karte 1<br />
geändert<br />
Datei<br />
g/projekte/1840/<br />
plaene/1-5<br />
Plotdatei<br />
g/projekte/1840/<br />
plots/1-5<br />
internet: www.pgg.de
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 105<br />
Abbildung 33: Landnutzung, Vorlandbereich „Norderland“<br />
johann köhler martin sprötge gotthard storz<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
0 500 m<br />
Forschungsvorhaben: Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung -<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Landnutzung<br />
Niedersächsische Deichverbände &<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Landnutzung<br />
Quelle Geobasisdaten:<br />
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung<br />
Projekt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Forschungsvorhaben "Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung"<br />
26939 ovelgönne<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
klein-zetel 22<br />
tel 04737/8113-0<br />
Finanzierer<br />
fax 04737/8113-29<br />
email<br />
Niedersächsische Deichverbände & frieschenmoor@pgg.de<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
28203 bremen<br />
Teilvorhaben<br />
rembertistraße 29/30<br />
tel 0421/33752-0<br />
Modellhafte Managementkonzepte fax 0421/33752-33<br />
email bremen@pgg.de<br />
Plandarstellung<br />
Vorlandbereich "Norderland"<br />
Landnutzung<br />
Projekt-Nr.<br />
1840<br />
bearbeitet<br />
Sp/AB<br />
geprüft<br />
Brache<br />
Beweidung mit Rindern, Intensität unbek.<br />
Beweidung mit 0,5 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 1,0 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 1,5 Rindern/ha<br />
Mahd, Sommer<br />
intensive Bewirtschaftung<br />
Acker<br />
Röhricht-Mahd, Winter<br />
Sonstige Nutzung<br />
Nutzung unbekannt<br />
Im Vergleich zum Norderland befindet sich auf der Strohauser Plate, mit seinen<br />
ausgedehnten Schilfflächen, eine wesentlich höhere stehende Biomasse. Entlang des<br />
Weserufers und auf der Nordseite der Plate wurden im Jahr 2007 bis zu 14 t/ha stehende<br />
Biomasse gebildet (Abbildung 34).<br />
gezeichnet<br />
AB<br />
Datum<br />
10.03.2011<br />
Maßstab<br />
s. Leiste<br />
Blatt<br />
Karte 1<br />
geändert<br />
Datei<br />
g/projekte/1840/<br />
plaene/5<br />
Plotdatei<br />
g/projekte/1840/<br />
plots/5<br />
internet: www.pgg.de<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 106 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
johann köhler martin sprötge gotthard storz<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
0 500 m<br />
Forschungsvorhaben: Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung -<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
Vorlandbereich "Strohauser Plate"<br />
Stehende Biomasse Sommer 2007<br />
Niedersächsische Deichverbände &<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Stehende Biomasse im Sommer<br />
(Datengrundlage 2007, Einheit g/m²)<br />
0 - 100<br />
Quelle Geobasisdaten:<br />
> 100 - 200<br />
> 200 - 300<br />
> 300 - 400<br />
> 400 - 500<br />
> 500 - 600<br />
> 600 - 700<br />
> 700 - 800<br />
> 800 - 900<br />
> 900 (1469)<br />
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung<br />
Projekt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Forschungsvorhaben "Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung"<br />
26939 ovelgönne<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
klein-zetel 22<br />
tel 04737/8113-0<br />
Finanzierer<br />
fax 04737/8113-29<br />
email<br />
Niedersächsische Deichverbände & frieschenmoor@pgg.de<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
28203 bremen<br />
Teilvorhaben<br />
rembertistraße 29/30<br />
tel 0421/33752-0<br />
Modellhafte Managementkonzepte fax 0421/33752-33<br />
email bremen@pgg.de<br />
Plandarstellung<br />
Vorlandbereich "Strohauser Plate"<br />
Stehende Biomasse Sommer 2007<br />
Abbildung 34: Stehende Biomasse Sommer 2007, Vorlandbereich „Strohauser Plate“<br />
Abbildung 35: Landnutzung, Vorlandbereich „Strohauser Plate“<br />
johann köhler martin sprötge gotthard storz<br />
landschaftsarchitekten stadtplaner ingenieure<br />
0 500 m<br />
Projekt-Nr.<br />
1840<br />
bearbeitet<br />
Sp/AB<br />
gezeichnet<br />
AB<br />
geprüft<br />
Datum<br />
10.03.2011<br />
Maßstab<br />
s. Leiste<br />
Blatt<br />
Karte 1<br />
geändert<br />
Datei<br />
g/projekte/1840/<br />
plaene/1-5<br />
Plotdatei<br />
g/projekte/1840/<br />
plots/1-5<br />
Vorlandbereich "Strohauser Plate"<br />
Landnutzung<br />
Plandarstellung<br />
Vorlandbereich "Strohauser Plate"<br />
Landnutzung<br />
Projekt-Nr.<br />
1840<br />
Datum<br />
10.03.2011<br />
Maßstab<br />
s. Leiste<br />
Blatt<br />
Karte 1<br />
geändert<br />
internet: www.pgg.de<br />
Forschungsvorhaben: Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung -<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
Niedersächsische Deichverbände &<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
Landnutzung<br />
Quelle Geobasisdaten:<br />
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen<br />
Vermessungs- und Katasterverwaltung<br />
Projekt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Forschungsvorhaben "Strategien<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung"<br />
26939 ovelgönne<br />
Grundlagen und naturschutzfachliche Bewertung<br />
klein-zetel 22<br />
tel 04737/8113-0<br />
Finanzierer<br />
fax 04737/8113-29<br />
email<br />
Niedersächsische Deichverbände & frieschenmoor@pgg.de<br />
Niedersächsische Wattenmeerstiftung<br />
28203 bremen<br />
Teilvorhaben<br />
rembertistraße 29/30<br />
tel 0421/33752-0<br />
Modellhafte Managementkonzepte fax 0421/33752-33<br />
email bremen@pgg.de<br />
bearbeitet<br />
Sp/AB<br />
gezeichnet<br />
AB<br />
geprüft<br />
Brache<br />
Beweidung mit Rindern, Intensität unbek.<br />
Beweidung mit 0,5 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 1,0 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 1,5 Rindern/ha<br />
Mahd, Sommer<br />
intensive Bewirtschaftung<br />
Acker<br />
Röhricht-Mahd, Winter<br />
Sonstige Nutzung<br />
Nutzung unbekannt<br />
Datei<br />
g/projekte/1840/<br />
plaene/5<br />
Plotdatei<br />
g/projekte/1840/<br />
plots/5<br />
internet: www.pgg.de
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 107<br />
Rechnet man unsere Biomasseerhebungen für die wichtigsten Vegetationseinheiten und<br />
Schätzungen für flächenmäßig weniger relevante Vegetationseinheiten auf die gesamten<br />
niedersächsischen Vorländer der Küste und der Ästuare hoch, so ergeben sich Gesamtwerte<br />
für die stehende Biomasse von 71.000 t bis 114.500 t Trockenmasse (unteres bis oberes<br />
Quartil), trotz erfolgter Nutzung (Abbildung 36). Ohne Nutzung ergäbe sich eine geschätzte<br />
mittlere Menge von 135.000 t Trockenmasse. Die entsprechende Frischmasse kann bis zum<br />
Zehnfachen dieser Werte betragen, je nach Wassergehalt der Biomasse.<br />
Abbildung 36: Geschätzte stehende Biomasse auf den Vorländern der niedersächsischen<br />
Festlandsküste einschließlich der Ästuare<br />
Oben: Zahlen für die stehende Biomasse, welche trotz Nutzung auf den Vorländern steht; unten:<br />
Potenzielle stehende Biomasse unter der Annahme, dass keine Nutzung stattfindet. Alle Werte geben<br />
die Trockenmasse an.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 108 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
5.3.3.3 TREIBSELMENGEN AN DEN DEICHEN DER FESTLANDSKÜSTE UND<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
DER ÄSTUARE EMS, ELBE UND WESER<br />
Bei dem Vergleich der <strong>Treibsel</strong>mengen in den Jahren 2006 und 2007 zeigt sich an den<br />
Deichen der Salzwiesen und der Ästuäre ein ähnliches Bild: Die <strong>Treibsel</strong>mengen an den<br />
Deichen steigen signifikant mit der im Vorland produzierten Biomasse (Abbildung 37). Die<br />
Graphen in Abbildung 37 zeigen auf der y-Achse die Wahrscheinlichkeit, dass die höchsten<br />
<strong>Treibsel</strong>mengen (Kategorie 4) am Deich abgelagert werden. Auf der x-Achse ist die<br />
stehende Biomasse des Vorlandes dargestellt, die wegen der unterschiedlichen Längen der<br />
Deichabschnitte auf laufende Meter Deichlänge normiert wurde. Diese Werte ergeben sich<br />
aus der Multiplikation von Vorlandgröße und Biomasseproduktion im Vorland. Ein gegebener<br />
Wert „Biomasse/lfd. m Deich“ kann also entweder durch hohe Biomasseproduktion auf<br />
kleiner Fläche oder geringe Biomasseproduktion auf großer Fläche erreicht werden. Nimmt<br />
man eine 50 %ige Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der <strong>Treibsel</strong>kategorie 4 (50 % = 0.5<br />
auf der y-Achse, 4 = sehr hohe <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich) an, so wird diese bei x-Achsen-<br />
Werten von 300 = 90 kg Biomasse/lfd. m Deich auf den Salzwiesen und 400 – 500 = 160 kg<br />
– 250 kg Biomasse/pro lfd. m Deich in den Ästuaren erreicht. Auf den Salzwiesen tritt bei x-<br />
Achsenwerten von 700 = 490 kg Biomasse/lfd. m Deich eine Sättigung ein, ab diesem Wert<br />
werden die höchsten <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich angelandet. Das Bestimmtheitsmaß R² zeigt<br />
an, wie hoch die Varianz in den Daten ist und wie gut die Regressionskurven die Beziehung<br />
zwischen <strong>Treibsel</strong>mengen und Biomasse im Vorland wiedergeben. Das R² ist generell<br />
niedrig, die Varianz also hoch, was bedeutet, dass die Beziehung zwischen <strong>Treibsel</strong> und<br />
Biomasse im Vorland des Deiches an vielen Deichabschnitten nicht eindeutig ist, sondern<br />
durch Strömung oder andere Faktoren abgewandelt wird. Generell wird der <strong>Treibsel</strong>anfall an<br />
Deichen der Ästuare etwas schlechter durch die Biomassebildung der Vorländer erklärt als<br />
die der Salzwiesen.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 109<br />
Abbildung 37: Wahrscheinlichkeit von <strong>Treibsel</strong>mengen an der Küste (Auf Grundlage der Daten<br />
der Sturmflut Nov. 2006 und 2007) in Abhängigkeit von der stehenden Biomasse im Vorland<br />
Gezeigt sind Regressionslinien für das 25 % Quartil (blau), den Median (schwarz) und das 75 %<br />
Quartil (rot) der Biomassebildung. Die y-Achse zeigt die Wahrscheinlichkeit, die <strong>Treibsel</strong>kategorie 4 zu<br />
erreichen, dargestellt zwischen 0 (kein <strong>Treibsel</strong>) und 1 (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit<br />
<strong>Treibsel</strong>kategorie 4). Die x-Achse zeigt die wurzeltransformierte Menge an Biomasse [g] im Vorland<br />
pro lfd. m Deich. Ein Wert von 200 ergibt umgerechnet 40.000 g = 40 kg, ein Wert von 800 ergibt<br />
640.000 = 640 kg stehende Biomasse.<br />
In keinem Fall trug die Exposition der Deichlinie relativ zur Hauptwindrichtung signifikant zur<br />
Erklärung des <strong>Treibsel</strong>aufkommens am Deich bei. Leewärts gelegene Deichlinien werden<br />
nur geringfügig weniger durch <strong>Treibsel</strong> belastet als direkt dem Wind ausgesetzte Deichlinien,<br />
d.h. luvwärts gelegene Deiche. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu unseren<br />
Erwartungen, dass luvwärts gelegene Deichabschnitte besonders stark von <strong>Treibsel</strong><br />
beeinflusst werden (vgl. Karten 1a und 1b).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 110 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
5.3.4 DISKUSSION<br />
In dieser Untersuchung haben wir die Ergebnisse zur Biomassebildung auf Probeflächen<br />
(vgl. Kapitel 5.2) auf alle Vorlandflächen der niedersächsischen Küsten und Ästuare<br />
übertragen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich signifikant von<br />
der stehenden Biomasse im Vorland des Deiches bestimmt werden. Die Exposition zur<br />
Hauptwindrichtung spielt dabei eine untergeordnete Rolle, wobei allerdings zu<br />
berücksichtigen ist, dass nur eine Hauptwindrichtung zugrunde gelegt werden konnte, was<br />
nur bedingt der Realität entspricht.<br />
Die Beziehung zwischen <strong>Treibsel</strong>mengen und stehender Biomasse war in Salzwiesen und<br />
Ästuaren unterschiedlich. Hohe <strong>Treibsel</strong>mengen wurden an der Küste schon bei erheblich<br />
geringeren Biomassemengen in den Salzwiesen erreicht als in den Ästuaren. Diese<br />
Unterschiede sind nicht leicht zu verstehen, da man zunächst annehmen würde, dass<br />
gleiche <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich auf gleiche Biomassemengen im Vorland zurückzuführen<br />
sind. Gründe für die Unterschiede können in der unterschiedlichen <strong>Treibsel</strong>bildung bei Schilf<br />
und Salzwiesen liegen, der höheren kinetischen Energie der Wellen an der Küste oder auch<br />
unterschiedlichen <strong>Treibsel</strong>einschätzungen bei der Abfuhr durch die Deichverbände liegen.<br />
Insbesondere die höhere Wellenenergie an der Küste könnte dazu führen, dass bei<br />
geringerer stehender Biomasse in den Salzwiesen höhere <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich<br />
angelandet werden. Da Schilf hochwüchsiger ist und u.U. nicht völlig überflutet wird, könnte<br />
<strong>Treibsel</strong> auch von stehendem Schilf vor dem Deich abgefangen werden, statt am Deich zu<br />
landen.<br />
Generell ist die Varianz der Daten sehr hoch (bzw. das Bestimmtheitsmaß niedrig), was eine<br />
Prognose von Deichabschnitten mit besonderer <strong>Treibsel</strong>belastung erschwert. Diese Varianz<br />
ist in den Ästuaren höher als an der Küste. Zu den Ursachen zählen:<br />
Subjektivität und Unterschiede in der Genauigkeit der Schätzung der <strong>Treibsel</strong>-<br />
Kategorien. Viele verschiedene Bearbeiter haben die <strong>Treibsel</strong>mengen an Hand eines<br />
Fotoschlüssels geschätzt (Kap. 5.3.2.1). Abweichungen in den Schätzungen um eine<br />
Stufe sind dabei durchaus möglich. Zudem wurden kleinräumige Unterschiede in den<br />
<strong>Treibsel</strong>mengen vermutlich nicht erfasst, stattdessen ist anzunehmen, dass<br />
überschlägige Schätzungen für größere Abschnitte vorgenommen wurden.<br />
Ungenaue Informationen zur Nutzung oder Vegetation der Vorlandflächen. Die Qualität<br />
der Informationen insbesondere zur Nutzung ist sehr heterogen. In vielen Fällen sind<br />
genaue Informationen über Nutzungsintensitäten vorhanden (z.B. bei beweideten<br />
Flächen), in anderen Fällen aber nur sehr allgemeine Informationen. Darunter fallen vor<br />
allem touristisch genutzte Bereiche oder bebaute Flächen, in denen allerdings häufig nur<br />
wenig Biomasse produziert wird und von Sturmfluten abtransportiert werden kann.<br />
Deshalb wird dieser Aspekt nur wenig Auswirkung auf das Ergebnis haben.<br />
Ungenauigkeiten bei der Abschätzung der Biomassebildung der jeweiligen<br />
Vegetationseinheiten. Umwelteinflüsse (Nährstoffe, Salinität, etc.) führten zu einer<br />
erheblichen Varianz der stehenden Biomasse, wie sich aus den 'boxplots' der Ergebnisse<br />
der Probeflächen anhand der großen Wertespannen ersehen lässt (Abbildung 23). Diese<br />
Varianz konnte dadurch aufgefangen werden, dass drei voneinander unabhängige<br />
Analysen für die untere, mittlere und obere Biomassemenge in den Vegetationseinheiten<br />
durchgeführt wurden, so dass die Spannweite der Varianz der stehenden Biomasse bei<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 111<br />
dem „upscaling“ von den Probeflächen auf die Gesamtfläche der Küste erhalten und<br />
ersichtlich bleibt. Für viele kleinere Flächennutzungen entlang der Küste, seien es Äcker,<br />
Parks, Spielplätze, Gehölze u.a., lagen aber keine Daten von Probeflächen vor, so dass<br />
wir hier Schätzungen vornehmen mussten. Diese sind natürlich mit Unsicherheiten<br />
behaftet.<br />
Alle Ergebnisse beruhen auf den Ereignissen von zwei Sturmfluten mit spezifischen<br />
Wasserständen, Strömungen, Windrichtungen und Windstärken. Ob unsere Ergebnisse<br />
auch für andere Jahre und Sturmfluten repräsentativ sind, können Folgeuntersuchungen<br />
nach weiteren Sturmfluten zeigen.<br />
Zu den methodischen Problemen kommt die hohe Bedeutung zufälliger Prozesse, die sich in<br />
den geringen Bestimmtheitsmaßen der Regressionen niederschlagen. Dazu zählen:<br />
Unterschiede in der Strömungsrichtung und in der Hauptwindrichtung. So kann auf den<br />
Flüssen einerseits eine flussabwärtsgerichtete Strömung stattfinden, andererseits eine<br />
seitwärts gerichtete, die durch den Wind verursacht wird. Auch an der Küste müssen die<br />
Strömungen, welche das <strong>Treibsel</strong> auf die Deichabschnitte verteilen, nicht immer mit der<br />
Windrichtung übereinstimmen. Dies ließ sich nach der Sturmflut 2006 am Jadebusen<br />
beobachten: Während am luvwärts gelegenen Deich am nördlichen Augustgroden, der<br />
aber im „Strömungsschatten“ des Eckwarder Ahndeichs liegt, nur wenig <strong>Treibsel</strong> aufwies,<br />
ist der leewärts gelegene Deich zwischen Dangast und Varel mit hohen <strong>Treibsel</strong>mengen<br />
belastet worden, obwohl die Vorlandgröße vergleichbar ist. Offenbar drehte die Strömung<br />
vom Eingang des Jadebusens her im Uhrzeigersinn rund um den Jadebusen und folgte<br />
deshalb nur bedingt der Hauptwindrichtung.<br />
Veränderung der Strömung und Beeinflussung der Wellenhöhe durch die Uferlinie.<br />
Bestimmte Uferlinien können je nach Hauptwindrichtung im Strömungs- und<br />
Wellenschatten anderer Uferlinien liegen.<br />
Räumliche Unterschiede zwischen <strong>Treibsel</strong>entstehung und <strong>Treibsel</strong>anlandung.<br />
Insbesondere entlang der Flüsse kann <strong>Treibsel</strong> auf der einen Uferseite aufgeschwemmt<br />
und dann an der anderen Seite abgelagert werden. Leider konnte in dieser Untersuchung<br />
nur das Vorland direkt vor der Deichlinie betrachtet werden. Gegenüberliegende<br />
Vorländer gingen in die Auswertung nicht ein.<br />
Trotz der methodischen Unwägbarkeiten und dem Einfluss zufallsgesteuerter Prozesse ist<br />
die Beziehung zwischen <strong>Treibsel</strong>anfall am Deich und stehender Biomasse im Vorland hoch<br />
signifikant. Mit unseren Erwartungen deckt sich das Ergebnis, dass große Vorlandflächen<br />
viel <strong>Treibsel</strong> produzieren. Die Bedeutung der Flächengröße des Vorlandes zeigt sich darin,<br />
dass die teils erhebliche Varianz der Biomasseproduktion in den Probeflächen sich in der<br />
Beziehung zwischen Biomasse und <strong>Treibsel</strong>bildung kaum auswirkt, da die Linien der unteren<br />
und oberen Quartile sowie der Mittelwerte eng beieinander liegen. <strong>Treibsel</strong> wird also im<br />
Wesentlichen lokal produziert und dann bei Sturmfluten an den Deich geschwemmt. Dies<br />
bedeutet, dass durch <strong>Treibsel</strong> besonders belastete Deichabschnitte anhand der<br />
Biomasseproduktion und Vorlandgröße identifiziert werden können.<br />
Ebenfalls die Erwartungen bestätigt hat das Ergebnis, dass besonders produktive Vegetation<br />
am daran angrenzenden Deichfuß viel <strong>Treibsel</strong> produziert. Ob das <strong>Treibsel</strong> allerdings einen<br />
großen Anteil der stehenden Biomasse der Vegetation ausmacht, kann bezweifelt werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 112 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Nach BOUCHARD et al. (1998) exportieren täglich zweimal überflutete Spartina-Bestände im<br />
makrotialen Bereich der Bay of Fundy (Kanada) zwar fast ihre gesamte überirdische<br />
Biomasseproduktion in die Küstengewässer, jedoch können in der oberen Salzwiese bis zu<br />
75 % der Streu überwintern. Letzteres würde einen Export von 25 % der Streu aus der<br />
oberen Salzwiese bedeuten. Für Atriplex portulacoides, eine Art mit Schwerpunkt in der<br />
unteren Salzwiese, geben die Autoren an, dass 86 % der anfallenden Nekromasse<br />
(abgestorbene Biomasse, bezogen auf die überirdische Biomase) direkt unter der Vegetation<br />
verbleiben, 14 % hingegen exportiert werden. Über den weiteren Verbleib dieser in die<br />
Küstengewässer exportierten Pflanzenbestandteile machen die Autoren keine Angaben.<br />
Nach den Angaben von DANKERS et al. (1984) werden im Dollart 5-6 % der überirdisch<br />
produzierten Biomasse als <strong>Treibsel</strong> am Deich abgesammelt. Diese Angaben beziehen sich<br />
aber nicht auf einzelne Vegetationstypen und wurden außerdem an einem Deichabschnitt<br />
mit Nordost-Exposition, bei Sturmfluten also ablandigem Wind ermittelt. Nach DAME (1982)<br />
hingegen (Angaben für ein Salzwiesensystem von der Ostküste Nordamerikas) beträgt der<br />
Austrag von Makro-Detritus aus Spartina-Beständen sogar nur ca. 1 % der gesamten<br />
Primärproduktion.<br />
Zum Austrag von Biomasse aus Schilfbeständen gibt es in der wissenschaftlichen Literatur<br />
nur wenige Veröffentlichungen. Nach KUHL & KOHL (1992) führt erhöhte Stickstoffversorgung,<br />
z.B. aufgrund der Eutrophierung von Gewässern, zu einer verringerten Halmstabilität von<br />
Schilf (Phragmites communis) und damit zu einer höheren Bildung von <strong>Treibsel</strong> aus<br />
Schilfresten. OSTENDORP (1995) entwickelte ein Modell zur Widerstandsfähigkeit von Schilf<br />
gegenüber mechanischen Belastungen wie Wellenschlag. Nach diesem Modell ist der<br />
winterliche Austrag von Pflanzenmasse aus gemähten bzw. gebrannten Beständen des<br />
Bodensees höher als der aus ungenutzten Beständen, da die Halme der genutzten Bestände<br />
eine geringere Widerstandsfähigkeit aufweisen.<br />
Nach unseren Daten lässt sich für die niedersächsische Küste folgende Schätzung<br />
aufmachen. Im Zeitraum der Jahre 1995 (94/95) bis 2010 (09/10) wurden von den<br />
Deichverbänden mittlere jährliche <strong>Treibsel</strong>mengen von 92.000 m² gemeldet. Nach unserer<br />
Hochrechnung wurden in den Vorländern zwischen 71.000 und 114.500 t Trockenmasse<br />
produziert (Abbildung 36). Leider liegen keine Daten für das Raumgewicht der Biomasse von<br />
Salzwiesen und Schilf vor. Schätzt man auf der Grundlage des Raumgewichtes von<br />
Grassilage, das bei einem Trockenmassegehalt von 20 % etwa 600 kg Feuchtmasse/m³<br />
aufweist, das Gewicht der mittleren jährlichen <strong>Treibsel</strong>menge, so kommt man auf 71.000 m³<br />
x 600 kg = 42.600 t Frischmasse. Nimmt man für die Umrechnung von Trockenmasse (TM)<br />
auf Frischmasse (FM) einen Faktor von 8 für die Biomassewerte, so erhält man zwischen<br />
568.000 und 916.000 t FM Biomasse, die in den nds. Vorländern produziert werden. Der<br />
mittlere jährliche <strong>Treibsel</strong>anfall an der niedersächsischen Küste beträgt also 10 bis 16 % der<br />
produzierten Biomasse (Berechnungsgrundlage 2006). Dies ist etwa doppelt so hoch wie die<br />
von DANKERS et al. (1984) für den Dollart geschätzten Werte.<br />
Aus der Literatur und unseren Daten zeigt sich also, dass nur ein geringer Anteil, d.h. 10 bis<br />
20 % der oberirdischen Biomasse aus den Vorland-Beständen als <strong>Treibsel</strong> auf den Deich<br />
geworfen wird (unter Berücksichtigung der bereits durch Nutzung abgeführten Mengen). Der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 113<br />
größte Teil der Biomasse wird innerhalb der Vorländer relativ schnell abgebaut, wobei es<br />
allerdings deutliche, auf biologische Eigenschaften der Arten zurückzuführende Unterschiede<br />
zwischen den Vegetationseinheiten gibt (Kapitel 5.2.3.2)).<br />
Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass das <strong>Treibsel</strong>aufkommen am Deich im Wesentlichen<br />
aus dem davor gelegenen Vorland stammt und bei Vorland-Vegetation mit hoher Biomasse<br />
besonders hoch ist. Strömungen und andere Faktoren können diese Beziehung allerdings<br />
lokal beeinflussen. Erstmals liegen jetzt Schätzungen der Biomasseproduktion des gesamten<br />
niedersächsischen Vorlandes vor. Übersteigen die Biomassewerte 90 kg TM/m Deichlänge<br />
in den Salzwiesen und ca. 200 kg TM/m Deichlänge in den Ästuaren, so können wir von<br />
Risikogebieten mit hohem <strong>Treibsel</strong>anfall sprechen, für die besondere<br />
Infrastrukturmaßnahmen und -einrichtungen für die <strong>Treibsel</strong>abfuhr notwendig sind.<br />
5.4 FAZIT<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass die Biomasseproduktion der Salzwiesen erheblich von der<br />
Höhe und dem Salzgehalt des Grundwasser abhängt. Heute wird der Grundwasserstand auf<br />
den meisten Salzwiesen durch Grüppen und Gräben künstlich erniedrigt. Durch eine<br />
Erhöhung euhalinen Grundwassers lässt sich die Produktivität auf Standorten einschränken,<br />
die mit Vegetationseinheiten der oberen Salzwiese, insbesondere mit Quecken bestanden<br />
sind. Diese Strategie funktioniert nur auf Salzwiesen, aber nicht in den Brackwasser-<br />
Röhrichten der Fluss-Ästuare, da hier der Salzgehalt zu niedrig ist und das Schilf sehr gut an<br />
hohe Grundwasserstände und sogar Überstau angepasst ist.<br />
Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Nutzung in Form von Mahd oder Beweidung die<br />
Biomasse einschränken kann. Auf den Salzwiesen der Festlandsküste müsste die<br />
Besatzdichte mit Weidevieh sehr hoch sein, um die Biomasse effektiv zu reduzieren<br />
(2-3 GV/ha).<br />
Durch eine einmalige Mahd am Ende der Vegetationsperiode könnte vor Beginn der<br />
Sturmflut-Saison die gesamte Jahresproduktivität der Salzwiese abgeschöpft werden.<br />
Jedoch ist dieses rohfaserreiche und proteinarme Material nicht für die Verfütterung geeignet<br />
und müsste auf die Deponie gefahren werden. Angesichts einer Produktivität von 6-8 t/ha<br />
Trockensubstanz, welche einer effektiv zu deponierenden Menge von 40-60 t/ha<br />
Feuchtsubstanz entspricht, ergeben sich daraus sehr hohe Deponiekosten. Würden die<br />
Flächen stattdessen im Frühsommer gemäht werden, so könnte zwar die Biomasse verfüttert<br />
werden können. Jedoch zeigen unsere Ergebnisse, dass die Biomasse nach diesem Schnitt<br />
bis zum Ende der Vegetationsperiode wieder fast vollständig aufgewachsen ist. Deshalb<br />
müsste zur <strong>Treibsel</strong>vermeidung im Herbst eine zweite Mahd erfolgen, bei der in etwa die<br />
gleiche Menge zu verfüttern bzw. – sofern diese für die Verfütterung ungeeignet ist -<br />
deponiert werden. Alternativ könnte aber über eine Vergasung in Biogasanlagen<br />
nachgedacht werden.<br />
Auf den Vorländern der Ästuare, die ja nicht zum Nationalpark gehören, wird die<br />
landwirtschaftliche Beweidung oder Mahd dort praktiziert, wo eine Entwässerung möglich ist<br />
und keine Überflutung stattfindet. Auf tieferliegenden Flächen, die bei Flut überschwemmt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 114 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
werden, wächst in der Regel Brackwasser-Röhricht. Es kann durch Wassermanagement<br />
nicht in seiner Produktivität eingeschränkt werden. Dort ist Beweidung unmöglich und eine<br />
Mahd am besten im Winter möglich. Wintermahd reduziert aber nicht den<br />
Biomasseaufwuchs im folgenden Sommer, sondern verstärkt ihn noch. Finden die<br />
Sturmfluten bereits Ende Oktober/Anfang November statt, d.h. vor der Wintermahd, so kann<br />
die besonders hohe Biomassemenge der Brackwasser-Röhrichte zu besonders hohem<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall führen.<br />
Wenn die an Probeflächen gewonnenen Beziehungen zwischen Biomasseproduktion und<br />
Umweltbedingungen auf die Gesamtfläche der niedersächsischen Vorländer übertragen<br />
wird, so ergibt sich eine mittlere Gesamtmenge von 94.000 t Trockenmasse oder bei<br />
Annahme von 80 % Wassergehalt eine Menge von 752.000 t Frischmasse. Diese Werte<br />
basieren auf errechneten oder geschätzten Biomassemengen von Vegetationseinheiten,<br />
deren Verteilung und Flächengröße entlang der niedersächsischen Küste bekannt ist.<br />
Die Auswertung des <strong>Treibsel</strong>-Anfalls an den Deichen hat gezeigt, dass eine signifikante<br />
Korrelation zwischen der Biomasseproduktion des Vorlandes und der am Deich<br />
angeschwemmten <strong>Treibsel</strong>menge besteht. Dabei sind die Größe des Vorlandes und der<br />
Bestand an Vegetation mit besonders hoher Biomasseproduktion besonders wichtig.<br />
Allerdings wird diese Beziehung durch zahlreiche nicht quantifizierbare Faktoren beeinflusst.<br />
So hängt die Verdriftung des <strong>Treibsel</strong>s von der Stärke der Sturmflut, den Strömungen und<br />
der Hauptwindrichtung ab. Das Zusammenwirken dieser Faktoren führt dazu, dass der<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall an einem einzelnen Deichabschnitt nicht sicher vorhergesagt werden kann.<br />
Sicher aber ist, dass große Vorlandareale vor dem Deich die Grundlage für hohen<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall bilden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 115<br />
5.5 LITERATURVERZEICHNIS<br />
AD-HOC-AG BODEN (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. E. Schweitzerbart'sche<br />
Verlagsbuchhandlung, Hannover.<br />
ADAM, P. (1990): Saltmarsh ecology. Cambridge University Press, Cambridge.<br />
ADLER, P. B., D. A. RAFF, AND W. K. LAUENROTH (2001): The effect of grazing on the spatial<br />
heterogeneity of vegetation. Oecologia 128:465-479.<br />
ARBEITSGRUPPE ZUM TREIBSELPROBLEM (AG TREIBSEL, 1996): <strong>Treibsel</strong>problematik an den Hauptdeichen<br />
der niedersächsischen Nordseeküste und der von der Tide beeinflussten Flussläufe. –<br />
Bericht im Auftrag der Bezirksregierung Lüneburg, 150 S. + Anhang.<br />
BAKKER, J. P. (1998): The impact of grazing on plant communities.in M. F. WallisDeVries, J. P. Bakker,<br />
and S. E. Van Wieren, editors. Grazing and Conservation Management. Kluwer Academic<br />
Publishers, Dordrecht.<br />
BAKKER, J. P., J. BUNJE, K. S. DIJKEMA, J. FRIKKE, N. HECKER, B. KERS, P. KÖRBER, J. KOHLUS, AND M.<br />
STOCK (2005): Salt Marshes.in K. Essink, C. Dettman, H. Farke, K. Laursen, G. Lüerßen, H.<br />
Marencic, and W. Wiersinga, editors. Wadden Sea Quality Status Report 2004, Wadden Sea<br />
Ecosystem No. 19 - 2005. Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven.<br />
BAKKER, J. P., P. ESSELINK, K. S. DIJKEMA, W. E. VAN DUIN, AND D. J. DE JONG (2002a): Restoration of<br />
salt marshes. Hydrobiologia 478:29-51.<br />
BAKKER, J. P., R. H. MARRS, AND R. J. PAKEMAN (2002b): Long-term vegetation dynamcis: Successional<br />
pattern and processes. Introduction. Applied Vegetation Science 5:2-6.<br />
BEGON, M., TOWNSEND C.R., HARPER, J.L. (2005): Ecology: From Individuals to Ecosystems, 4th<br />
Edition, Wiley.<br />
BEHRE, K.-E. (2008): Landschaftsgeschichte Norddeutschlands. 308 S., 250 Abb., Neumünster.<br />
BJÖRNDAHL, G. (1985): Influence of winter harvest on stand structure and biomass production of the<br />
Common Reed, Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steud. in Lake Tǻkern, Southern<br />
Sweden. Biomass 7: 303-319.<br />
BLEW, J., K. GÜNTHER, K. LAURSEN, M. VAN ROOMEN, P. SÜDBECK, K. ESKILDSEN, P. POTEL, AND H.-U.<br />
RÖSNER (2005): Overview on trend and numbers of migratory waterbirds in the Wadden Sea<br />
1980-2000 in J. Blew and P. Südbeck, editors. Migratory water birds in the Wadden Sea<br />
1980-2000. Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) Wilhelmshaven, Germany.<br />
BOCKELMANN, A. C., J. P. BAKKER, R. NEUHAUS, AND J. LAGE (2002): The relation between vegetation<br />
zonation, elevation and inundation frequency in a Wadden Sea salt marsh. Aquatic Botany<br />
73:211-221.<br />
BOS, D., J. P. BAKKER, Y. DE VRIES & S. VAN LIESHOUT (2002): Long-term vegetation changes in<br />
experimentally grazed and ungrazed back-barrier marshes in the Wadden Sea. - Applied<br />
Vegetation Science 5 (1): 45-54.<br />
BOUCHARD, V., V. CREACH, J. C. LEFEUVRE, G. BERTRU & A. MARIOTTI (1998): Fate of plant detritus in a<br />
European salt marsh dominated by Atriplex portulacoides (L.) Aellen. – Hydrobiologia<br />
373/374: 75-87.<br />
BROCKMANN, U. H., R. LAANE, AND H. POSTMA (1990): Cycling of Nutrient Elements in the North-Sea.<br />
Netherlands Journal of Sea Research 26:239-264.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 116 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT (BMLFUW,<br />
2010): LANDnet - Beratung - Beratung A-Z - Tierproduktion. - URL:<br />
http://land.lebensministerium.at/ article/articleview/34462/1/4998 vom 15.10.2010<br />
BUNJE, J. & J. L. RINGOT (2003): Lebensräume im Wandel. Flächenbilanz von Salzwiesen und Dünen<br />
im niedersächsischen Wattenmeer zwischen den Jahren 1966 und 1997. – Schriftenreihe<br />
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 7.<br />
DAME, R. F. (1982): The flux of floating Macrodetritus in the North Inlet Estuarine ecosystem. –<br />
Estuarine, Coastal and Shelf Science 15: 337-344.<br />
DANKERS, N., M. BINSBERGEN, K. ZEGERS, R. LAANE & M. R. V. D. LOEFF (1984): Transportation of Water,<br />
Particulate and Dissolves Inorganic Matter between a Salt Marsh and the Ems-Dollard<br />
Estuary, The Netherlands. – Estuarine, Coastal and Shelf Science 19: 143-165.<br />
DE LEEUW, J., W. DE MUNCK, H. OLFF, AND J. P. BAKKER (1993): Does zonation reflect the succession of<br />
salt-marsh vegetation? A comparison of an estuarine and a coastal bar island marsh in The<br />
Netherlands. Acta Botanica Neerlandica 42:435-445.<br />
DE LEEUW, J., H. OLFF, AND J. P. BAKKER (1990): Year-to-year variation in peak above-ground biomass<br />
of six salt-marsh angiosperm communities as related to rainfall deficit and inundation<br />
frequency. Aquatic Botany 36:139-151.<br />
EISMA, D., AND J. KALF (1987): Dispersal, Concentration and Deposition of Suspended Matter in the<br />
North-Sea. Journal of the Geological Society 144:161-178.<br />
ELLENBERG, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer, Stuttgart.<br />
ERCHINGER, H.-F. (1985): Dünen, Watt und Salzwiese. Soltau-Kurier-Verlag, Norden.<br />
ESSELINK, P., K. S. DIJKEMA, S. REENTS, AND G. HAGEMAN (1998): Vertical accretion and profile changes<br />
in abandoned man-made tidal marshes in the Dollard esturay, the Netherlands. Journal of<br />
Coastal Research 14:570-582.<br />
ESSELINK, P., L. F. M. FRESCO & K. S. DIJKEMA (2002): Vegetation change in a man-made salt-marsh<br />
affected by a reduction in both grazing and drainage. - Applied Vegetation Sciene 5 (1): 17-<br />
32.<br />
FORSCHUNGSVORHABEN TREIBSELREDUZIERUNG (2007): 1. Zwischenbericht des Projektes 10/05 der<br />
Niedersächsischen Wattenmeerstiftung.<br />
FREUND, H., J. PETERSEN, AND R. POTT (2003): Investigations on recent and subfossil salt-marsh<br />
vegetation of the East Frisian barrier islands in the southern North Sea (Germany).<br />
Phytocoenologia 33:349-375.<br />
GARNIER, E., S. LAVOREL, P. ANSQUER, H. CASTRO, P. CRUZ, J. DOLEZAL, O. ERIKSSON, C. FORTUNEL, H.<br />
FREITAS, C. GOLODETS, K. GRUGULIS, C. JOUANY, E. KAZAKOU, J. KIGEL, M. KLEYER, V.<br />
LEHSTEN, J. LEPŠ, T. MEIER, R. PAKEMAN, M. PAPADIMITRIOU, V. P. PAPANASTASIS, H. QUESTED,<br />
F. QUÉTIER, M. ROBSON, C. ROUMET, G. RUSCH, C. SKARPE, M. STERNBERG, J.-P. THEAU, A.<br />
THÉBAULT, D. VILE, AND M. ZAROVALI (2007): Assessing the effects of land-use change on<br />
plant traits, communities and ecosystem functioning in grasslands: a standadized<br />
methodology and lessons from an application to 11 european sites. Annals of Botany<br />
99:967-985.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 117<br />
GETTNER, S. (2003): Untersuchung des Zusammenhangs zwischen <strong>Treibsel</strong>mengen und<br />
Vorlandnutzung an der Westküste Schleswig-Holsteins. Kieler Notiz. Pflanzenkd. Schleswig-<br />
Holstein Hamb. 31:57-71.<br />
GETTNER, S., K. HEINZEL & J. KOHLUS (2000): Die Entwicklung der aktuellen Vegetation auf der<br />
Hamburger Hallig. - In: Stock, M. & K. Kiehl (Hrsg.): Die Salzwiesen der Hamburger Hallig. –<br />
Schriftenreihe des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 11: 24-33.<br />
GRAY, A. J., AND R. G. H. BUNCE (1972): Ecology of Morecambe Bay. 6. Soils and Vegetation of Salt<br />
Marshes - Multivariate Approach. Journal of Applied Ecology 9:221-&.<br />
HEINZE, C., K. KIEHL, AND R. NEUHAUS. (1999): Vegetation succession over 30 years in the ungrazed<br />
salt marsh of Süderhafen (Nordstrand Island). Senkenbergiana maritima 29:63-66.<br />
HEMMINGA, M. A., J. D. LEEUW, W. D. MUNCK, AND B. P. KOUTSTAAL (1991): Decomposition in estuarine<br />
salt marshes: the effects of soil salinity and soil-water content. Vegetatio 94:25-33.<br />
JANSSEN, J. (2001): Monitoring of salt-marsh vegetation by sequential mapping. University of<br />
Groningen, Groningen.<br />
JEFFERIES, R. L., AND N. PERKINS (1977): Effects on Vegetation of Additions of Inorganic Nutrients to<br />
Salt-Marsh Soils at Stiffkey, Norfolk. Journal of Ecology 65:867-882.<br />
KEMPF, N., J. LAMP & P. PROKOSCH (Bearb.; 1987): Salzwiesen - geformt von Küstenschutz,<br />
Landwirtschaft oder Natur? WWF-Tagungsberichte 1.<br />
KIEHL, K. (1997): Vegetationsmuster in Vorlandsalzwiesen in Abhängigkeit von Beweidung und<br />
abiotischen Standortbedingungen. Dissertation. University of Kiel, Kiel.<br />
KIEHL, K., P. ESSELINK, AND J. P. BAKKER (1997a): Nutrient limitation and plant species composition in<br />
temperate salt marshes. Oecologia 111:325-330.<br />
KIEHL, K., P. ESSELINK, AND J. P. BAKKER (1997b): Nutrient limitation and plant species composition in<br />
temperate salt marshes. Oecologia 111:325-330.<br />
KIEHL, K., H. SCHRÖDER, B. BREDEMEIER & A. WIGGERSHAUS (2000): Der Einfluss von Extensivierung<br />
und Beweidungsaufgabe auf Artenzusammensetzung und Struktur der Vegetation. - In:<br />
Stock, M. & K. Kiehl (Hrsg.): Die Salzwiesen der Hamburger Hallig. - Schriftenreihe des<br />
Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 11: 34-42.<br />
KINDER, M., AND I. VAGTS (1999): Die Vegetation der Ästuar-Salzwiesen und Brackwasserröhrichte an<br />
der südlichen Wurster Küste bei Weddewarden (Bremerhaven). Abhandlungen des<br />
Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 44:523-544.<br />
KINZEL, H. (1982): Pflanzenökologie und Mineralstoffwechsel. Ulmer Verlag, Stuttgart.<br />
KLEYER, M., H. FEDDERSEN, AND R. BOCKHOLT (2003): Secondary succession on a high marsh at<br />
different grazing intensities. Journal of Coastal Conservation 9:123-134.<br />
KRAFT, D., S. OSTERKAMP & M. SCHIRMER (2005): Ökologische Folgen eines Klimawandels für die<br />
Unterweser und ihre Marsch. – In: SCHUCHHARDT, B. & M. SCHIRMER (Hrsg.): Klimawandel<br />
und Küste. Die Zukunft der Unterweserregion. Berlin; Heidelberg: Springer. 167-188.<br />
KUHL, H. & J. G. KOHL (1992): Nitrogen accumulation, productivity and stability of reed stands<br />
(Phragmites australis (cav) trin ex steudel) at different lakes and sites of the lake districts of<br />
Uckermark and Mark Brandenburg (Germany). - Internationale Revue der gesamten<br />
Hydrobiologie 77 (1): 85-107.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 118 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
KUIJPER, D. P. J., AND J. P. BAKKER (2003): Experimental tests on the effects of one or two herbivore on<br />
the outcome of plant succession over a productivity gradient. University of Groningen,<br />
Groningen.<br />
LEENDERTSE, P. C., A. J. M. ROOZEN, AND J. ROZEMA (1997): Long-term changes (1953-1990) in the salt<br />
marsh vegetation at the Boschplaat on Terschelling in relation to sedimentation and flooding.<br />
Plant Ecology 132:49-58.<br />
MEYER-REIL, L. A. (2005): Mikrobiologie des Meeres. Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Facultas<br />
Universitätsverlag, Wien.<br />
NATIONALPARKVERWALTUNG NIEDERSÄCHSISCHES WATTENMEER & UMWELTBUNDESAMT (Hrsg.; 1999):<br />
Umweltatlas Wattenmeer. Bd. 2, Wattenmeer zwischen Elb- und Emsmündung. – Stuttgart:<br />
Ulmer.<br />
NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM DES INNEREN & SENATOR FÜR UMWELTSCHUTZ UND STADTENTWICKLUNG<br />
DES LANDES BREMEN (1994): Rahmenkonzept zur Renaturierung der Unterweser und ihrer<br />
Marsch. Gutachten im Auftrag des Landkreises Wesermarsch. – Veröffentlichungen der<br />
Gemeinsamen Landesplanung Bremen / Niedersachsen 1-94 (Teil 1) u. 8-94 (Teil 2).<br />
OLFF, H., J. DE LEEUW, J. P. BAKKER, R. J. PLATERINK, H. J. VAN WIJNEN, AND W. DE MUNCK (1997a):<br />
Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and<br />
silt deposition along an elevation gradient. Journal of Ecology 85:799-814.<br />
OLFF, H., J. DE LEEUW, J. P. BAKKER, R. J. PLATERINK, H. J. VAN WIJNEN, AND W. DE MUNCK (1997b):<br />
Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and<br />
silt deposition along an elevational gradient. Journal of Ecology 85:799-814.<br />
OSTENDORP, W. (1987): Die Auswirkungen von Mahd und Brand auf die Ufer-Schilfbestände des<br />
Bodensee-Untersees. Natur und. Landschaft 62: 99–102.<br />
OSTENDORP, W. (1995): Effect of management on the mechanical stability of lakeside reeds in Lake<br />
Constance-Untersee. - Acta Oecologica 16 (3): 277-294.<br />
PERSICKE, U., A. GERLACH & W. HEIBER (1999): Zur botanischen Zusammensetzung von <strong>Treibsel</strong> der<br />
niedersächsischen Deichvorländer und Deichabschnitte. – Drosera ‟99 (1): 23-34.<br />
PLANUNGSGRUPPE GRÜN (2004): Landschaftspflegekonzept Vorland Jadebusen. Zwischenbericht:<br />
Ergebnisse Nutzungskartierung 2003 sowie Untersuchungskonzept für 2004. –<br />
Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des II. Oldenburgischen Deichbandes, Brake.<br />
ROOZEN, A. J. M., AND V. WESTHOFF (1985): A study on long-term salt-marsh succession using<br />
permanent plots. Vegetatio 61:23-32.<br />
ROZEMA, J., P. BIJWAARD, G. PRAST, AND R. BROEKMAN (1985): Ecophysiological adaptations of coastal<br />
halophytes from foredunes and salt marshes. Vegetatio 62:499-521.<br />
ROZEMA, J., P. C. LEENDERTSE, J. P. BAKKER, AND H. J. VAN WIJNEN (2000): Nitrogen and vegetation<br />
dynamics in European salt marshes. Pages 469-491 in D. A. Kreeger and M. P. Weinstein,<br />
editors. Concepts and Controversies in Tidal marsh Ecology. Kluwer Academic Publisher,<br />
Dordrecht.<br />
SCHIRMER, U., AND S. W. BRECKLE (1982): The role of bladders for salt removal in some<br />
Chenopodiaceae (mainly Atriplex species). Pages 215-231 in D. N. Sen and K. S.<br />
Rajpurohit, editors. Contributions to the Ecology of Halophytes. Dr Junk, The Hague.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 119<br />
SCHROEDER, H. K., K. KIEHL, AND M. STOCK (2002): Directional and non-directional vegetation changes<br />
in a temperate salt marsh in relation to biotic and abiotic factors. Applied Vegetation Science<br />
5:33-44.<br />
STOCK, M., AND K. KIEHL, EDITORS (2000): Die Salzwiesen der Hamburger Hallig.<br />
THE R FOUNDATION FOR STATISTICAL COMPUTING (2008): R version 2.8.1.<br />
VALKAMA, E., S. LYYTINEN, J. KORICHEVA (2008): The impact of reed management on wildlife: A meta-<br />
analytical review of European studies. Biological Conservation 141: 364-374.<br />
VAN DE KOPPEL, J., J. HUISMAN, R. VAN DER WAL, AND H. OLFF (1996): Patterns of herbivory along a<br />
productivity gradient: an empirical and theoretical investigation. Ecology 77:736-745.<br />
VAN DEURSEN, E. J. M. AND H. J. DROST (1990): Defoliation and Treading by Cattle of Reed Phragmites<br />
australis - Journal of Applied Ecology: Vol. 27, No. 1 (Apr., 1990), pp. 284-297<br />
VAN DIGGELEN, J., J. ROZEMA, D. M. DICKSON, AND R. BROEKMAN (1986): β-3-<br />
Dimethylsulphoniopropionate, proline and quaternary ammonium compounds in Spartina<br />
anglica in relation to sodium chloride, nitrogen and sulfur. New Phytologist 103:573-586.<br />
VAN WIJNEN, H. J. (1999): Nitrogen dynamics and vegetation succession in salt marshes. University of<br />
Groningen, Groningen.<br />
VAN WIJNEN, H. J., AND J. P. BAKKER (1997): Nitrogen accumulation and plant species replacement in<br />
three salt-marsh systems in the Wadden sea. Journal of Coastal Conservation 3:19-26.<br />
VAN WIJNEN, H. J., AND J. P. BAKKER (1999a): Nitrogen and phosphorus limitation in a coastal barrier<br />
salt marsh: the implications for vegetation succession. Journal of Ecology 87:265-272.<br />
VAN WIJNEN, H. J., AND J. P. BAKKER (1999b): Nitrogen and phosporous limitation in a coastal barrier<br />
salt marsh: the implication for vegetation succession. Journal of Ecology 87:265-272.<br />
VAN WIJNEN, H. J., AND J. P. BAKKER (2000): Annual nitrogen budget of a temperate coastal barrier salt-<br />
marsh system along a productivity gradient at low and high marsh elevation. Perspectives in<br />
Plant Ecology, Evolution and Systematics 3:128-141.<br />
VINCE, S. W., AND A. A. SNOW (1984): Plant zonation in an Alaskan Salt-Marsh.1. Distribution,<br />
Abundance and Environmental Factors. Journal of Ecology 72:651-667.<br />
WICHTMANN, W. (1999): Schilfanbau als Alternative zur Nutzungsauflassung von Niedermooren.<br />
Archives of Nature Conservation and Landscape Research 38:37-110.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 120 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
6 ERGEBNISBERICHT TEILPROJEKT 3:<br />
HABITATMODELLE FÜR CHARAKTERISTISCHE VOGELARTEN DER<br />
NIEDERSÄCHSISCHEN SALZWIESE<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Dipl. Landschaftsökol. Martin Maier & Dr. Julia Stahl, Universität Oldenburg<br />
6.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG<br />
Das Teilprojekt 3 richtet sich innerhalb der Studie zum <strong>Treibsel</strong>aufkommen entlang der<br />
niedersächsischen Küste auf das Ökosystem-Prozessverständnis: Welche Konsequenzen<br />
hat eine Änderung der Vorlandnutzung für die Küstenökologie und den Naturschutz?<br />
Im Rahmen dieses Teilprojektes wurden die kausalen Zusammenhänge zwischen den<br />
wichtigsten Habitatparametern und der Reaktion von Brut- und Rastvogelarten bezüglich der<br />
Nist-, bzw. Rastplatzwahl untersucht, wobei die verschiedenen Vorlandnutzungsformen<br />
besondere Berücksichtigung fanden.<br />
Zu den Habitatansprüchen von Brut- und Rastvögeln auf Küstenvorlandflächen werden im<br />
Folgenden wissenschaftlich fundierte Aussagen gemacht, die eine Bewertung verschiedener<br />
Maßnahmen zulassen. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Beurteilung der<br />
Konsequenzen verschiedener Nutzungsformen (Brache, Mahd, Beweidung) für Brut-<br />
vorkommen typischer Salzwiesenarten sowie für Rastbestände.<br />
Die Informationen zu Rastvögeln der Salzwiesen wurden anhand einer umfangreichen<br />
Literaturrecherche gewonnen und lassen Aussagen zu ausgewählten Singvogelarten<br />
(Kapitel 6.2.1) sowie zu Nonnengans und Ringelgans (Kapitel 6.2.2) zu.<br />
Untersuchungen zu Brutvögeln fanden in repräsentativen Gebieten entlang der<br />
niedersächsischen Küste in den Jahren 2007 bis 2009 statt. Dabei wurden einerseits Revier-<br />
kartierungen durchgeführt (Kapitel 6.3.1) und andererseits brutbiologische Parameter sowie<br />
Habitatfaktoren an den Gelegestandorten von Rotschenkel und Wiesenpieper erhoben<br />
(Kapitel 6.3.2).<br />
Die Ergebnisdarstellung des Teilprojektes 3 wird in zwei Teilaspekte untergliedert. In Kapitel<br />
6.2 wird die Bedeutung der Salzwiesen für Rastvögel im Herbst, Winter und Frühjahr in<br />
Abhängigkeit der Nutzung dargestellt. In Kapitel 6.3 werden die Ergebnisse der<br />
Untersuchung zur Brutvogelgemeinschaft der Salzwiesen präsentiert.<br />
6.2 RASTVÖGEL<br />
6.2.1 SINGVÖGEL<br />
Rastende und überwinternde Singvögel leben überwiegend granivor (samenfressend) und<br />
sind daher auf wenige Futterpflanzen spezialisiert. Nutzungsänderungen oder Management-<br />
maßnahmen beeinflussen das Vorkommen dieser Futterpflanzen. Daher wurde diese bisher<br />
auf den Salzwiesen wenig untersuchte Gruppe in die avifaunistische Bewertung einbezogen.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 121<br />
6.2.1.1 METHODIK<br />
Untersuchungen zur Nahrungspräferenz von überwinternden Singvogelarten wurden von<br />
DIERSCHKE (2001) durchgeführt. Die in DIERSCHKE (2001) verzeichneten Nahrungspflanzen<br />
der überwinternden Singvögel wurden im Rahmen dieser Untersuchung TMAP-Vegetations-<br />
einheiten zugeordnet, und falls einer TMAP-Vegetationseinheit mehrere Nahrungspflanzen<br />
zugeordnet wurden, ein gewichtetes Mittel [gewichtet anhand der Samenanzahlen im<br />
Spülsaum, Daten aus DIERSCHKE (2001)] pro TMAP-Vegetationseinheit und pro Singvogelart<br />
errechnet. Aufgrund der so errechneten Präferenzen wurden Indexwerte gebildet, die die<br />
Bedeutung der jeweiligen TMAP-Vegetationseinheit für die überwinternde Singvogelart<br />
wiedergeben. Diese Indexwerte werden auf einer Skala von -1 (keine Bedeutung für die Art)<br />
bis 1 (höchste Bedeutung) dargestellt. Für die drei häufigsten, auf Salzwiesen<br />
überwinternden Singvogelarten (Tabelle 31) konnten anhand der Ergebnisse von DIERSCHKE<br />
(2001) Präferenz-Indexwerte realisiert werden. Für die Klassifizierung der TMAP-<br />
Vegetationseinheiten lag die Systematik nach ESSELINK ET AL. (2009) zugrunde.<br />
Tabelle 31: Im Projekt bearbeitete überwinternde Singvogelarten<br />
Artname Wiss. Bezeichnung<br />
Berghänfling Carduelis flavirostris<br />
Ohrenlerche Eremophila alpestris<br />
Schneeammer Plectrophenax nivalis<br />
6.2.1.2 ERGEBNISSE<br />
Für die in Tabelle 31 aufgeführten Singvogelarten wurden Indexwerte errechnet (Tabelle 32).<br />
Deutlich wird die hohe Bedeutung der Rotschwingel-Wiese (S.3.3), der Melden-Flur (S.3.9)<br />
und des Queller-Watts (S.1.2) für die untersuchten überwinternden Singvögel. Schlickgras<br />
und Quecke spielen in der Ernährung dieser Arten keine Rolle.<br />
Die Indexwerte konnten bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzungsformen nicht<br />
differenziert werden, da die ausgewerteten Datengrundlage (DIERSCHKE 2001) dies nicht<br />
ermöglicht.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 122 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 32: Präferenz-Indexwerte überwinternde Singvögel<br />
Vegetations-<br />
einheit<br />
Artname<br />
Schlickgras-Watt<br />
(S.1.1)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Queller-<br />
Watt<br />
S.1.2)<br />
Andel-<br />
Rasen<br />
(S.2.1)<br />
Strandsalzmelden-<br />
Rasen (S.2.4)<br />
Rotschwingel-Wiese<br />
(S.3.3)<br />
Quecken-<br />
Rasen<br />
(S.3.7)<br />
Melden<br />
-Flur<br />
(S.3.9)<br />
Berghänfling -1.00 0.41 -0.91 -0.41 -0.05 -1.00 -0.32<br />
Ohrenlerche -1.00 0.38 -0.22 0.18 0.55 -1.00 0.50<br />
Schneeammer -1.00 0.05 0.14 0.09 0.59 -1.00 0.50<br />
In Klammern: TMAP-Code<br />
6.2.2 GÄNSE<br />
6.2.2.1 METHODIK<br />
Zur Abschätzung der Bedeutung einzelner TMAP-Vegetationseinheiten für rastende Gänse<br />
wurde eine ausführliche Literaturstudie, in der über 100 fachwissenschaftliche Artikel und<br />
Monographien gesichtet wurden (siehe Anhang 1), durchgeführt. Anhand der in der Literatur<br />
dokumentierten Untersuchungen zu Individuendichten verschiedener Gänsearten konnte die<br />
Bedeutung einzelner TMAP-Vegetationseinheiten für rastende Gänse abgeschätzt werden.<br />
Für die beiden häufigsten überwinternden Gänsearten auf Salzwiesen (Nonnengans Branta<br />
leucopsis und Ringelgans Branta bernicla) liegen hierzu sehr detaillierte Studien vor, die gut<br />
in der Fachliteratur dokumentiert sind. Aus den Individuendichten (Einheit: Gänsetage pro<br />
Hektar) wurden Mediane der Gänsedichten pro Vegetationseinheit errechnet und anhand<br />
dieser ein Index (I) gebildet. Dieser Index orientiert sich an der maximalen Gänsedichte pro<br />
Art (I = 1) und bewegt sich zwischen -1 (Gänsedichte = 0) und 1 (maximale Gänsedichte).<br />
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zu den Indexwerten der rastenden Singvögel (Kapitel<br />
6.2.1) und der Brutvögel (Kapitel 6.3.1) gegeben.<br />
Daten aus folgenden Publikationen sind in die Indexberechnungen eingeflossen (genaue<br />
Angaben siehe Anhang 1: Ausgewertete Literatur für Präferenz-Indexwerte der rastenden<br />
Gänse):<br />
ARENDS & ELISSEN 1997<br />
BOS 2002<br />
BROEKMAN 1998<br />
DUIN ET AL. 2007<br />
EBBINGE & CANTERS 1973<br />
ENGELMOER ET AL. 1998<br />
INEKE 1998<br />
KATS 1994<br />
KEITZ & HOFFMANN 1996<br />
KUIJPER 1997<br />
LUBBE 2003<br />
ROWCLIFFE ET AL. 1995<br />
ROWCLIFFE ET AL. 1998<br />
STOCK & KIEHL 2000
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 123<br />
SUMMERS ET AL. 1993<br />
TIJDENS &VEENEKLASS 1998<br />
VEEN 2004<br />
außerdem:<br />
eigene Erhebungen, Milieustudie 2008 Schiermonnikoog<br />
6.2.2.2 ERGEBNISSE<br />
Im Folgenden wird jeweils ein Präferenz-Indexwert für die Vegetationseinheit insgesamt<br />
(GESAMT) angegeben, als auch für die Vegetationseinheit unter bestimmten<br />
landwirtschaftlichen Nutzungsformen (BRACHE und WEIDE), sofern die Datengrundlage<br />
dies ermöglicht.<br />
In den ausgewerteten Studien zu Gänsevorkommen auf Salzwiesen spielten gemähte<br />
Salzwiesenbereiche keine Rolle, daher sind zu dieser Nutzungsform keine Informationen für<br />
die rastenden Gänsearten vorhanden.<br />
In einigen Studien, die im Rahmen der Literaturrecherche ausgewertet wurden, konnte nicht<br />
zwischen Nonnen- und Ringelgänsen unterschieden werden, da Gänsedichten anhand von<br />
Kotdichtezählungen ermittelt wurden. Aus diesen Daten wurden Indexwerte für das<br />
Gesamtvorkommen dieser beiden Arten errechnet (Tabelle 33).<br />
Tabelle 33: Präferenz-Indexwerte für Nonnen- und Ringelgans (Gesamtvorkommen beider<br />
Arten)<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide<br />
Küstenwatt, unspezifisch (S.1.0) -0.72<br />
Untere Salzwiese, unspezifisch (S.2.0) -0.59<br />
Obere Salzwiese, unspezifisch (S.3.0) -0.88<br />
Schlickgras-Watt (S.1.1) -1.00<br />
Queller-Watt (S.1.2) -0.69<br />
Andel-Rasen (S.2.1) -0.54<br />
Strandsalzmelden-Rasen (S.2.4) -1.00<br />
Salzbinsen-Wiese (S.3.2) -0.51 -0.88 0.53<br />
Rotschwingel-Wiese (S.3.3) -0.87 -0.89 -0.08<br />
Strandbeifuß-Wiese (S.3.5) -0.94 -0.95 -0.29<br />
Quecken-Rasen (S.3.7) -1.00<br />
Erdbeerklee-Wiese (S.3.10) -0.08 -0.48 1.00<br />
Die höchsten Gänsedichten wurden in beweideten Erdbeerklee-Wiesen (S.3.10) festgestellt.<br />
Dies wird durch die dargestellten Indexwerte abgebildet. Es wird deutlich, dass beweidete<br />
Flächen insgesamt höhere Dichten von Ringel- und Nonnengänse aufweisen. Ungenutzte<br />
Bereiche werden eher gemieden. Für TMAP-Vegetationseinheiten, bei denen Indexwerte für<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 124 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
alle drei Nutzungskategorien vorliegen, liegen die Werte für die Nutzungskategorie GESAMT<br />
zwischen den Werten von BRACHE und WEIDE.<br />
Durch Studien, die zwischen den Arten Ringelgans und Nonnengans unterschieden haben,<br />
konnten auch für die jeweiligen Arten getrennt Indexwerte ermittelt werden (Tabelle 34 und<br />
Tabelle 35).<br />
Tabelle 34: Indexwerte Nonnengans<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide<br />
Untere Salzwiese, unspezifisch (S.2.0) -0.35<br />
Obere Salzwiese, unspezifisch (S.3.0) -0.07<br />
Andel-Rasen (S.2.1) -0.41<br />
Rotschwingel-Wiese (S.3.3) -0.34<br />
Erdbeerklee-Wiese (S.3.10) 0.04 -0.21 1.00<br />
Tabelle 35: Indexwerte Ringelgans<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide<br />
Küstenwatt, unspezifisch (S.1.0) -0.20<br />
Untere Salzwiese, unspezifisch (S.2.0) -0.24<br />
Obere Salzwiese, unspezifisch (S.3.0) 1.00<br />
Queller-Watt (S.1.2) -0.20<br />
Andel-Rasen (S.2.1) 0.07<br />
Salzbinsen-Wiese (S.3.2) 1.00<br />
Erdbeerklee-Wiese (S.3.10) 0.17<br />
Nonnengänse präferieren beweidete Erdbeerklee-Wiesen (S.3.10) am stärksten (Tabelle<br />
34). Für Ringelgänse können aufgrund der vorliegenden Daten keine Aussagen über<br />
einzelne Nutzungsformen gemacht werden. Diese Rastvogelart lässt eine Präferenz zur<br />
oberen Salzwiese (S.3.0) erkennen, wobei insbesondere die Salzbinsen-Wiese (S.3.2)<br />
bevorzugt wird.<br />
6.2.3 DISKUSSION RASTVÖGEL<br />
Sowohl für drei überwinternde Singvogelarten als auch für die beiden häufigsten<br />
überwinternden Gänsearten war es möglich, Präferenz-Indexwerte zu bilden, die die<br />
Bedeutung einzelner TMAP-Vegetationseinheiten für die jeweilige Vogelart abbilden. Bei<br />
Nonnen- und Ringelgans wurde eine Präferenz für kurzwüchsige proteinreiche<br />
Vegetationsbestände festgestellt, die häufig durch Beweidung entstehen. Rastende<br />
Singvögel hängen stark vom Vorhandensein der bevorzugten Nahrung (Samen von Melde,<br />
Queller, Rotschwingel) ab. Samen von Schlickgras und Quecke spielen für die Ernährung<br />
der untersuchten Arten keine Rolle. Durch die Präferenz-Indexwerte konnte eine gute<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 125<br />
Grundlage für die planerischen Schritte und zur Bewertung von Auswirkungen auf die<br />
Rastvogelfauna erstellt werden (vgl. Kapitel 7.4 & 7.5).<br />
6.3 BRUTVÖGEL<br />
6.3.1 REVIERKARTIERUNG BRUTVÖGEL<br />
6.3.1.1 METHODIK<br />
Zur Erfassung der Brutbestände von Wiesenvögeln wurden in vier repräsentativen<br />
Untersuchungsgebieten (Abbildung 38) entlang der niedersächsischen Festlandsküste<br />
Revierkartierungen durchgeführt. Durch diese Methode ist es möglich, auf größeren Flächen<br />
absolute Bestandszahlen für den größten Teil des Artenspektrums zu erhalten (BIBBY ET AL.<br />
1995).<br />
Abbildung 38: Lage der Untersuchungsgebiete<br />
Jadebusen (1: Augustgroden/Beckmannsfeld; 2: Nordender Groden); Norderland (3: Neßmerheller);<br />
Leybucht (4: Buscherheller). Karte: A. Cervencl<br />
Bei den Begehungen wurden sämtliche revieranzeigende Individuen sowie direkte Brutnach-<br />
weise aller Brutvogelarten in Kartierkarten eingetragen. Es wurden wöchentliche<br />
Begehungen im Zeitraum zwischen Mitte April bis Mitte Juli 2007 sowie zwischen Anfang<br />
April und Anfang Juli 2008 durchgeführt.<br />
Ergänzend wurde von der PLANUNGSGRUPPE GRÜN (PGG 2008) im Jahr 2008 eine<br />
großflächige Revierkartierung, die über die eigentlichen Untersuchungsflächen hinausging, in<br />
der Leybucht (Buscherheller) und im Norderland (Neßmerheller) durchgeführt. Zudem stand<br />
dem Projekt noch eine Revierkartierung aus dem Jahre 2004 im Jadebusen zur Verfügung<br />
(PGG 2006). Dadurch konnte eine große Anzahl Reviere von 12 Brutvogelarten der<br />
Salzwiesen analysiert werden (Tabelle 36).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 126 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 36: Revieranzahlen der wichtigsten Brutvogelarten (Datengrundlage für die Analysen)<br />
Brutvogelart Wissenschaftlicher Name 2004 2007/2008 Summe<br />
Austernfischer Haematopus ostralegus 138 60 198<br />
Brandgans Tadorna tadorna 17 5 22<br />
Feldlerche Alauda arvensis 198 39 237<br />
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 21 0 21<br />
Kiebitz Vanellus vanellus 12 18 30<br />
Rohrammer Emberiza schoeniclus 229 24 253<br />
Rotschenkel Tringa totanus 514 305 819<br />
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta 1 6 7<br />
Schafstelze Motacilla flava 230 38 268<br />
Stockente Anas platyrhynchos 43 4 47<br />
Uferschnepfe Limosa limosa 7 4 11<br />
Wiesenpieper Anthus pratensis 435 403 838<br />
Für jedes Revier wurde um das Revierzentrum bzw. den Neststandort eine Kernzone des<br />
Reviers im geographischen Informationssystem (GIS) konstruiert. Hierzu wurde anhand von<br />
vorliegenden Informationen zur exakten Lage von Reviergrenzen von Rotschenkel und<br />
Wiesenpieper auf Salzwiesen eine mittlere Reviergröße je Art ermittelt. Daraus ergaben sich<br />
theoretische mittlere Radien für Reviere beim Wiesenpieper zwischen 18 m und 55 m und<br />
beim Rotschenkel zwischen 16 m und 45 m, abhängig von Nutzungsform und Unter-<br />
suchungsgebiet. Aus methodischen Gründen wurde für alle Arten ein einheitlicher Radius<br />
von 30 m für die Bildung der Kernzonen der Reviere verwendet. Im Bereich dieser Kernzone<br />
der Reviere wurde eine Flächenbilanz der darin vorhandenen TMAP-Vegetationseinheiten<br />
erstellt. Um Präferenzen bzw. Meidungen bestimmter Vegetationseinheiten analysieren zu<br />
können, wurden zudem 3.200 Zufallspunkte generiert und entsprechend der Revierzentren<br />
und Neststandorte ausgewertet.<br />
Durch einen Vergleich der Kernzonen der Reviere mit den Zufallspunkten konnte die<br />
Selektivität der jeweiligen Brutvogelart berechnet werden. Hierzu wurde dieselbe Anzahl an<br />
Zufallspunkten, wie Revierzentren bzw. Neststandorte einer Art vorhanden waren, zufällig<br />
ausgewählt (mit entsprechenden Anzahlen auf den jeweiligen Nutzungstypen und in den<br />
Untersuchungsgebieten) und mithilfe logistischer Regression die Signifikanz zwischen<br />
Zufallspunkten und Vorkommen (pro Vegetationseinheit) der Art überprüft. Dieser Vorgang<br />
wurde 100-mal wiederholt, wobei bei jedem Durchgang die Auswahl der Zufallspunkte neu<br />
durchgeführt wurde. Falls für mehr als 30 der 100 Durchgänge signifikante Unterschiede<br />
zwischen den Kernzonen der Reviere und den Zufallspunkten festgestellt wurden, wurde der<br />
Selektivitätsindex nach IVLEV (1961) gemittelt über alle Zufallspunkte ausgegeben.<br />
Andernfalls wird davon ausgegangen, dass keine Selektion der entsprechenden<br />
Vegetationseinheit für die analysierte Brutvogelart vorliegt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 127<br />
Selektivitätsindex (E) nach IVLEV (1961):<br />
E<br />
( r<br />
( r<br />
p)<br />
p)<br />
E = Selektivitätsindex (-1 ≤ E < 0: Ablehnung, E = 0: unselektiert, 0 < E ≤ +1: positive<br />
Selektion)<br />
p = relativer Anteil der Vegetationseinheit an den Zufallspunkten<br />
r = relativer Anteil der Vegetationseinheit in den Kernbereichen der Reviere<br />
Der Index variiert von -1 bis +1. Werte kleiner 0 bedeuten eine Meidung der betrachteten<br />
Vegetationseinheit, Werte größer 0 bedeuten eine Präferenz für die jeweilige Vegetations-<br />
einheit. Wenn E = 0, dann ist der Anteil der Vegetationseinheit in den Zufallspunkten und den<br />
Kernzonen der Reviere im Mittel gleich groß und somit ist diese Vegetationseinheit<br />
entsprechend ihrem Vorkommen auf dem betrachteten Salzwiesenbereich auch in den<br />
Kernzonen der Reviere vorhanden. Sie wird somit weder präferiert noch gemieden.<br />
Aufgrund der Problematik, dass einige Vegetationseinheiten ähnliche Habitatfunktionen für<br />
die Brutvögel erfüllen können, wurden zusätzlich zu den Vegetationseinheiten alle möglichen<br />
Kombinationen zweier Vegetationseinheiten analysiert, um Präferenzen bzw. Meidungen von<br />
Kombinationen der Vegetationseinheiten ebenfalls zu erfassen. Wies die Kombination aus<br />
zwei Vegetationstypen signifikante Ergebnisse auf, die einzelnen Vegetationseinheiten<br />
jedoch nicht, so wurden beiden Vegetationseinheiten die Indexwerte der Kombination<br />
zugewiesen.<br />
6.3.1.2 ERGEBNISSE<br />
Von einigen der in Tabelle 36 aufgeführten Brutvogelarten lagen nicht in allen Gebieten bzw.<br />
Nutzungsformen mehr als vier Reviere vor, sodass die Analyse zur Ermittlung der Präferenz-<br />
Indexwerte nicht durchgeführt werden konnte (Tabelle 37). Für diese Kombinationen sind<br />
somit auch keine bewertenden Aussagen möglich.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 128 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 37: Datengrundlage für Präferenzanalysen der Brutvogelarten, aufgeschlüsselt nach<br />
Nutzungsformen und Untersuchungsgebieten<br />
Art Nutzungen Gebiete<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Brache Wiese Weide August-<br />
groden<br />
Leybucht<br />
Nordender<br />
Groden<br />
Norderland <br />
Wapelergroden<br />
Summe<br />
Austernfischer 143 21 34 134 10 18 26 10 198<br />
Brandgans 14 4 4 9 0 3 5 5 22<br />
Feldlerche 107 92 38 120 9 49 16 43 237<br />
Flussseeschwalbe 21 0 0 20 0 0 0 1 21<br />
Kiebitz 6 9 15 3 14 5 0 8 30<br />
Rohrammer 242 6 5 70 0 95 9 79 253<br />
Rotschenkel 566 126 127 329 87 198 57 148 819<br />
Säbelschnäbler 2 0 5 1 5 0 0 1 7<br />
Schafstelze 198 50 20 98 3 105 4 58 268<br />
Stockente 37 9 1 24 0 15 0 8 47<br />
Uferschnepfe 1 8 2 4 2 0 0 5 11<br />
Wiesenpieper 479 107 252 175 84 177 259 143 838<br />
Fettdruck: Aufgrund geringer Anzahl konnte keine Analyse durchgeführt werden<br />
Unter bestimmten Nutzungsformen und in einzelnen Untersuchungsgebieten kamen nicht<br />
alle TMAP-Vegetationseinheiten vor und konnten daher nicht analysiert werden (Tabelle 38).
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 129<br />
Tabelle 38: Flächengröße und Vorkommen von Vegetationseinheiten in Nutzungsformen und<br />
Untersuchungsgebieten<br />
(n.v. = nicht vorhanden)<br />
Vegetationeinheiten <br />
Flächengröße<br />
(ha)<br />
Nutzungen Gebiete<br />
Brache Wiese Weide August-<br />
groden<br />
Leybucht Nordender<br />
Groden<br />
Norderland<br />
S.1.1 25,78 X n.v. X X X X X X<br />
S.1.2 38,86 X X X X X X X X<br />
S.2.1 428,29 X X X X X X X X<br />
S.2.4 154,66 X X X X X X n.v. X<br />
S.3 117,78 X X X X X X X X<br />
S.3.2 1,24 n.v. X n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. X<br />
S.3.3 4,36 X X X X n.v. X n.v. X<br />
Wapeler-<br />
S.3.5 9,01 X n.v. n.v. X n.v. n.v. n.v. n.v.<br />
S.3.7 632,46 X X X X X X X X<br />
S.3.9 148,69 X X X X n.v. X n.v. X<br />
S.5.1 0,55 X X X n.v. X n.v. n.v. X<br />
S.5.2 2,35 X X X X n.v. X n.v. X<br />
S.7 6,80 X n.v. X n.v. X n.v. X n.v.<br />
S.9 6,36 X n.v. X n.v. X n.v. X n.v.<br />
S.12 3,20 X n.v. X n.v. X n.v. X n.v.<br />
Watt 50,86 X X X X X X X X<br />
Deich 29,15 X X X X X X X X<br />
groden<br />
Für die häufigsten Brutvogelarten der niedersächsischen Salzwiesen (Tabelle 36) befinden<br />
sich im Anhang (Anhang 2: Präferenz-Indexwerte Brutvögel) Tabellen mit Indexwerten. Da<br />
sich die Präferenzen der Arten stark unterscheiden, ist eine Einzelbetrachtung, bei der die<br />
Arten entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet werden, erforderlich. Zur Gesamtbewertung<br />
bezüglich der Brutvögel siehe Kapitel 7.4 & 7.5.<br />
6.3.1.3 DISKUSSION<br />
Für die zwölf in Tabelle 36 aufgeführten Brutvogelarten konnten bei hinreichender Anzahl an<br />
Revieren je Gebiet bzw. Nutzungsform Revieranalysen erfolgreich durchgeführt werden.<br />
Aufgrund der unterschiedlichen Habitatansprüche der Arten ist kein einheitliches Muster der<br />
Präferenzen erkennbar. Es wurden sowohl Präferenzen für offene Bereiche (Pionierzone,<br />
Wattflächen) bei Austernfischer und Flussseeschwalbe als auch Präferenzen für<br />
hochwüchsige, dichte Vegetationsbestände (Strandbeifuß-Wiese, Quecken-Rasen) bei<br />
Rotschenkel und Wiesenpieper festgestellt, mit vielen Arten mit Präferenzen für intermediäre<br />
Vegetation. Einige Arten zeigen Präferenzen für Sonderbereiche der Salzwiesen wie bspw.<br />
die Rohrammer mit einer Präferenz für Grabenstrukturen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 130 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Durch die ermittelten Indexwerte ist es möglich, für zwölf Brutvogelarten Abschätzungen der<br />
Auswirkungen von Habitatveränderungen, die durch Managementmaßnahmen<br />
hervorgerufen werden, zu geben. Offenbar gibt es jedoch kein Management, das für alle<br />
Arten optimal ist. Nahezu jede Maßnahme fördert einige Arten und wirkt sich ungünstig auf<br />
andere Arten aus. Deshalb müssen die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf die<br />
Brutvögel im Einzelnen analysiert werden (siehe Kapitel 7.4 & 7.5).<br />
6.3.2 DETAILUNTERSUCHUNG BRUTVÖGEL<br />
6.3.2.1 METHODIK<br />
Um die Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen von Brutvögeln und Habitateigen-<br />
schaften der Salzwiesen zu untersuchen, wurden Detailuntersuchungen an Neststandorten<br />
von einer Watvogelart und einer Singvogelart, die repräsentativ für niedersächsische<br />
Festlandssalzwiesen sein sollten, durchgeführt.<br />
Der Rotschenkel Tringa totanus ist die häufigste Watvogelart auf den niedersächsischen<br />
Salzwiesen und wurde daher für die Detailuntersuchungen ausgewählt. Der Gesamtbestand<br />
dieser Art in Niedersachsen wird mit 5.800 Brutpaaren angegeben (KRÜGER & OLTMANNS<br />
2007). Die Art kommt auf den meisten Salzwiesen der niedersächsischen Festlandsküste, in<br />
zum Teil sehr hohen Brutpaardichten mit bis zu 2 Brutpaaren pro Hektar vor (THYEN & EXO<br />
2005).<br />
Als Singvogelart wurde der Wiesenpieper Anthus pratensis ausgewählt. Dieser ist neben<br />
Feldlerche, Rohrammer und Schafstelze die häufigste Singvogelart der niedersächsischen<br />
Salzwiesen. Insbesondere Feldlerche und Wiesenpieper sind von größerem<br />
naturschutzfachlichem Interesse, da diese beiden Arten im Binnenland großräumig<br />
abnehmende Bestände aufweisen (KRÜGER & OLTMANNS 2007).<br />
Als Maß für die Repräsentativität der jeweiligen Art für den Lebensraum Salzwiese kann die<br />
Höhe des Anteils der landesweiten Gesamtpopulation, die in den Salzwiesen brütet (d.h.<br />
Brutbestand Salzwiese/Brutbestand Niedersachsen * 100), angesehen werden. Eine Angabe<br />
für den Gesamtbestand der beiden Arten im Nationalpark bzw. in den niedersächsischen<br />
Salzwiesen liegt nicht vor. Als Ersatz hierfür wurden die von pgg in ca. 600 ha Salzwiese am<br />
Jadebusen ermittelten Bestandszahlen (PGG 2006) verwendet. Der Bestand des<br />
Wiesenpiepers ist in diesen Gebieten ca. 2-mal so hoch wie der der Feldlerche (Tabelle 39).<br />
Dieses Verhältnis gilt offenbar auch für große Bereiche des Nationalparks<br />
Niedersächsisches Wattenmeer (P. POTEL, persönl. Mitteilung). Im Vergleich mit dem<br />
niedersächsischen Gesamtbestand ergibt sich somit ein 10-15fach höherer Populationsanteil<br />
des Wiesenpiepers in den Salzwiesen, als dies bei der Feldlerche der Fall ist (Tabelle 39).<br />
Somit sind die Salzwiesen für den Wiesenpieper von ungleich höherer Bedeutung als für die<br />
Feldlerche, und daher wurde der Wiesenpieper für die Detailuntersuchungen herangezogen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 131<br />
Tabelle 39: Bestand Feldlerche und Wiesenpieper im Vergleich<br />
Brutvogelart Bestand<br />
Nordender<br />
Groden<br />
(PGG 2006)<br />
Bestand<br />
Wapeler<br />
Groden<br />
(PGG 2006)<br />
Bestand<br />
August-<br />
groden<br />
(PGG 2006)<br />
Bestand<br />
Salzwiesen<br />
Jadebusen<br />
(PGG 2006)<br />
Bestand<br />
Niedersachsen<br />
(KRÜGER &<br />
OLTMANNS 2007)<br />
Anteil Spalten<br />
2-4 an Bestand<br />
Niedersachsen<br />
Feldlerche 44 43 108 195 180.000 0,11 %<br />
Wiesenpieper 154 136 125 415 30.000 1,38 %<br />
Neben der in Kapitel 6.3.1.1 dargestellten Revierkartierung wurden auf den<br />
Untersuchungsflächen (Abbildung 38) Gelegestandorte von Rotschenkel und Wiesenpieper<br />
ermittelt. Hierzu wurden die Probeflächen flächendeckend begangen, um brütende Altvögel<br />
und somit die Nester ausfindig zu machen. Die Gelegesuche wurde zeitgleich mit den<br />
Begehungen zur Revierkartierung durchgeführt, um die Störung der Brutvögel zu minimieren.<br />
Ergänzend wurden Brutpaare gezielt vom Deich aus beobachtet.<br />
An den Gelegestandorten wurden brutbiologische Parameter (Anzahl Eier, Größe und<br />
Gewicht der Eier, Pflanzenarten, die das Nest bilden) aufgenommen und ein Kunstei<br />
(Knetgummi-Ei zur Erfassung von Prädatoren, siehe Kapitel 6.3.3) in das Gelege<br />
eingebracht. Die Gelege wurden wöchentlich kontrolliert, um den Schlupferfolg<br />
dokumentieren zu können. Des Weiteren wurden als Habitatfaktoren die Vegetations-<br />
zusammensetzung und Vegetationsstruktur in der Nestumgebung erfasst, anschließend im<br />
geografischen Informationssystem (GIS) die Höhe über MTHW und Entfernung zum<br />
nächstgelegenen Graben bzw. zur Wattfläche ermittelt.<br />
Abbildung 39: Rotschenkel auf Gelege (links) und Wiesenpieper-Gelege (rechts)<br />
Zur Analyse der Habitatfaktoren, die die Nistplatzwahl beeinflussen, wurde ein Vergleich von<br />
Neststandorten mit 240 Zufallspunkten durchgeführt. An den Zufallspunkten wurden<br />
vergleichbare Messungen wie an den Neststandorten getätigt. Mithilfe von statistischen<br />
Habitatmodellen (logistische Regression) wurde ermittelt, welche Habitatfaktoren den<br />
stärksten Einfluss auf die Nistplatzwahl zeigen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 132 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
6.3.2.2 ERGEBNISSE<br />
Auf allen Probeflächen wurden insgesamt 81 Gelegestandorte vom Rotschenkel und 26<br />
Gelegestandorte vom Wiesenpieper gefunden. Die Gelegestandorte verteilen sich<br />
entsprechend Tabelle 40 auf die drei Nutzungsformen.<br />
Tabelle 40: Datengrundlage für die Analyse der Gelegestandorte von Rotschenkel und<br />
Wiesenpieper nach Nutzungsformen<br />
Brutvogelart Weide (ca. 1 Rind/ha) Brache Wiese<br />
Rotschenkel 10 52 19<br />
Wiesenpieper 5 19 2<br />
Von den 81 Rotschenkel-Gelegen wurde an 36 Gelegen (44 %) Schlupferfolg festgestellt.<br />
Aus 20 von 26 Wiesenpieper-Gelegen (77 %) schlüpften Küken. Alle übrigen Gelege wurden<br />
ausgeraubt oder von den Altvögeln aufgegeben.<br />
Durch die Analyse der Habitatwahl (Habitatmodellierung) kann festgestellt werden, welche<br />
Habitatfaktoren wie stark die Nistplatzwahl beeinflussen. Im Folgenden werden die besten<br />
univariaten Habitatmodelle mit den Gütemaßen Area Under ROC-Curve (AUC) und<br />
Bestimmtheitsmaß nach Nagelkerke (R²N) sowie der Form des Zusammenhanges und das<br />
Optimum für die jeweilige Art dargestellt. Demnach wird die Nistplatzwahl des Rotschenkels<br />
am stärksten von der Höhe über MTHW beeinflusst (Tabelle 41).<br />
Tabelle 41: Habitatparameter Rotschenkel<br />
(beste univariate Habitatmodelle, AUC = Area Under ROC-Curve, R²N = Bestimmtheitsmaß nach<br />
Nagelkerke)<br />
Habitatparameter AUC R²N Form Optimum für Art<br />
Höhe über MTHW 0,73 0,29 unimodal 0,4 m ü. MTHW<br />
Vegetationsdichte 0,70 0,15 sigmoid je dichter umso besser<br />
Heterogenität der Vegetation 0,67 0,12 unimodal je heterogener umso besser<br />
Des Weiteren ist die Habitatwahl des Rotschenkels von der Vegetationsstruktur beeinflusst<br />
(Vegetationsdichte und Heterogenität der Vegetation).<br />
Den stärksten Einfluss auf die Nistplatzwahl beim Wiesenpieper hat die Heterogenität der<br />
Vegetation (Tabelle 42), wiederum gefolgt von der Vegetationsdichte. Beim Wiesenpieper ist<br />
insbesondere die Dichte der Vegetation zwischen 0 cm und 10 cm über dem Boden<br />
bedeutend.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 133<br />
Tabelle 42: Habitatparameter Wiesenpieper<br />
(beste univariate Habitatmodelle, AUC = Area Under ROC-Curve, R²N = Bestimmtheitsmaß nach<br />
Nagelkerke)<br />
Habitatparameter AUC R²N Form Optimum für Art<br />
Heterogenität der Vegetation 0,77 0,31 unimodal je heterogener, umso besser<br />
Vegetationsdichte 0,73 0,26 sigmoid je dichter, umso besser<br />
Vegetationsdichte 0-10 cm über Boden 0,62 0,14 sigmoid je dichter, umso besser<br />
Eine Analyse der Rotschenkelnester mit Schlupferfolg zeigt, dass auch hier die Höhe über<br />
MTHW der wichtigste Habitatparameter ist (Tabelle 43). Hinzu kommen bei den<br />
erfolgreichen Rotschenkel-Gelegen die Vegetationshöhe und der Zeitpunkt der Eiablage. Die<br />
Prädationsversuche können die höheren Schlupferfolge bei Rotschenkeln, die früh mit der<br />
Brut beginnen, erklären (siehe Kapitel 6.3.3), da durch den frühen Schlupf die Zeiten mit<br />
höchster Prädation vermieden werden können.<br />
Tabelle 43: Habitatparameter Rotschenkelnester mit Schlupferfolg<br />
(beste univariate Habitatmodelle, AUC = Area Under ROC-Curve, R²N = Bestimmtheitsmaß nach<br />
Nagelkerke)<br />
Habitatparameter AUC R²N Form Optimum für Art<br />
Höhe über MTHW 0,70 0,16 sigmoid unter 0,5 m über MTHW<br />
Vegetationshöhe 0,69 0,17 unimodal zwischen 20 und 30 cm<br />
Legedatum (Zeitpunkt der Eiablage) 0,67 0,12 unimodal je früher desto besser<br />
6.3.2.3 DISKUSSION<br />
Mit den 81 Gelegestandorten des Rotschenkels und den 26 Gelegestandorten des<br />
Wiesenpiepers ist es möglich, die Nistplatzwahl dieser beiden Arten detailliert zu<br />
untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass für den Rotschenkel insbesondere die Höhe über<br />
MTHW als auch die Vegetationsstruktur eine große Rolle bei der Nistplatzwahl spielen,<br />
wobei Bereiche mit ca. 0,4 m ü. MTHW mit heterogener, aber dichter Vegetationsstrukur<br />
bevorzugt werden. Dies führt zu einer guten Deckung der Nester. Höchste Schlupferfolge<br />
wurden beim Rotschenkel in Bereichen unter 0,5 m ü. MTHW festgestellt. Der Wiesenpieper<br />
nutzt nahezu alle Höhenlagen der untersuchten Salzwiesen, benötigt jedoch dichte<br />
Vegetation am Boden. Die Detailuntersuchungen zu Rotschenkel und Wiesenpieper weisen<br />
auf eine herausragende Bedeutung der Vegetationsstruktur bei der Nistplatzwahl hin. Trotz<br />
ihrer sonst sehr unterschiedlichen Lebensweise richten sich beide Arten bei der<br />
Nistplatzwahl nach diesem Habitatparameter. Die Vegetationsstruktur wurde im Rahmen<br />
dieses Forschungsprojektes für ausgewählte Vegetationseinheiten detailliert charakterisiert<br />
(siehe Kapitel 6.4).<br />
Durch eine veränderte Salzwiesennutzung wird lediglich die Vegetationsstruktur als<br />
bedeutender Habitatfaktor beeinflusst, wobei durch Veränderungen des Wasserregimes auf<br />
Salzwiesen zudem eine Reaktion des Rotschenkels (dessen Habitatwahl in Abhängigkeit der<br />
Höhe über MTHW stattfindet) auf die veränderten Feuchteverhältnisse zu erwarten ist. So<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 134 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
könnten ausgedehnte Vernässungen durch Bodenabtrag oder Wasseranstau die<br />
Schlupferfolge des Rotschenkels zunächst erhöhen, jedoch bei starker Vernässung die<br />
Brutplatzwahl negativ beeinflussen. Andererseits würde eine scharfe Beweidung zu einer zu<br />
homogenen und zu niedrigen Vegetationsdecke führen, die für beide Arten als Brutplatzwahl<br />
ungeeignet ist.<br />
Für erfolgreichen Schlupf beim Rotschenkel spielt neben der Höhe über MTHW und der<br />
Vegetationsstruktur der Zeitpunkt der Eiablage eine Rolle, da durch eine frühe Eiablage<br />
Zeiten hoher Prädation vermieden werden können (siehe Kapitel 6.3.3).<br />
Weitere betrachtete Habitatfaktoren wie Entfernung zu nächstgelegenem Graben und<br />
Abstand zur Wattfläche zeigten keinen signifikanten Einfluss auf die Nistplatzwahl und den<br />
Schlupferfolg der beiden Brutvogelarten.<br />
6.3.3 PRÄDATION<br />
6.3.3.1 METHODIK<br />
Die Untersuchungen zur Prädation sind in Ergänzung zu den Untersuchungen im Rahmen<br />
dieses Forschungsvorhabens in Kooperation mit dem Institut für Vogelforschung (IfV,<br />
Wilhelmshaven) durchgeführt worden. Um die Stärke des Prädationsdrucks in den<br />
unterschiedlichen Untersuchungsgebieten zu analysieren sowie das Spektrum an möglichen<br />
Prädatoren (Räubern) zu erfassen, wurden im Jahr 2007 Methoden zur Erfassungen der<br />
Prädation mit Hilfe von Kunstgelegen entwickelt.<br />
Die Untersuchungen zum Prädationsdruck wurden mithilfe von künstlichen Gelegen, jeweils<br />
bestehend aus einem Knetgummi-Ei und drei Wachteleiern, durchgeführt (siehe Abbildung<br />
40).<br />
Abbildung 40: Kunstgelege (offene Vegetation) aus einem Knetgummi-Ei (rechts unten) und 3<br />
Wachteleiern<br />
Durch das Knetgummi-Ei können Säugetiere anhand von Bissspuren im Vergleich mit<br />
Schädeln der potentiellen Raubtiere identifiziert werden. Durch die große Ähnlichkeit der<br />
Schnabelspuren bei Vögeln war es jedoch nicht möglich, mit Sicherheit zu bestimmen,<br />
welche Vogelart für die jeweilige durch Vögel verursachten Nestverluste verantwortlich war.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 135<br />
Die künstlichen Nester wurden Gelegen von Rotschenkeln nachempfunden und somit in<br />
hochwüchsiger Vegetation angelegt. Dazu wurde mit der Hand eine Kuhle in die Vegetation<br />
gedreht und dorthinein die Eier gelegt. Die hochwüchsigen Pflanzenteile wurden<br />
anschließend über dem Nest zusammengezogen, so dass das Kunstgelege von oben nicht<br />
sichtbar war.<br />
Während der Brutperiode 2008 wurde dreimal (Ende April bis Mitte Mai, Ende Mai bis Anfang<br />
Juni, Ende Juni bis Anfang Juli) eine jeweils zweiwöchige Untersuchungsreihe in sechs<br />
Untersuchungsgebieten (vier Flächen im Jadebusen: Petersgroden, Idagroden,<br />
Beckmannsfeld, Nordender Groden; je eine Fläche in der Leybucht: Buscherheller und im<br />
Norderland: Neßmerheller) mit jeweils 20 Kunstgelegen durchgeführt. Dabei wurden die<br />
Kunstgelege dreimalig kontrolliert (nach 24 Stunden, 6 Tagen und 14 Tagen) und dabei die<br />
Menge an geraubten Gelegen festgestellt. Dadurch lassen sich relative Prädationsraten im<br />
Vergleich der Untersuchungsgebiete errechnen sowie der zeitliche Verlauf des Prädations-<br />
drucks der drei Untersuchungsreihen nachzeichnen.<br />
6.3.3.2 ERGEBNISSE<br />
Die in den Untersuchungsgebieten festgestellten Säugetierarten, die als Prädatoren<br />
nachgewiesen werden konnten, sind in Tabelle 44 dargestellt. Das Prädatorenspektrum<br />
ähnelt sich in den Gebieten stark. Lediglich im Jadebusen wurde kein Mauswiesel und in der<br />
Leybucht kein Igel und keine Maus (Spitzmaus) bei der Nestprädation nachgewiesen.<br />
Aufgrund methodischer Schwierigkeiten (Kapitel 6.3.3.1) kann keine Aufstellung der<br />
Vogelarten, die für Gelegeverluste verantwortlich waren, gegeben werden.<br />
Tabelle 44: Anhand von Bissspuren festgestellte Prädatoren pro Untersuchungsgebiet (nur<br />
Säugetiere)<br />
Jadebusen Leybucht Norderland<br />
Rotfuchs Rotfuchs Rotfuchs<br />
Igel Igel<br />
Mauswiesel Mauswiesel<br />
Ratte Ratte Ratte<br />
Maus (Spitzmaus) Maus (Spitzmaus)<br />
Mithilfe der Kunstnester ist es möglich, den Prädationsdruck (Wahrscheinlichkeit des<br />
Eiverlustes pro Tag) zwischen den Untersuchungsgebieten zu vergleichen (Abbildung 41).<br />
Im Beckmannsfeld (Jadebusen) war der Prädationsdruck im Jahr 2008 signifikant geringer<br />
als im Nordender Groden (Jadebusen) und der Leybucht. Die anderen Gebiete zeigen keine<br />
signifikanten Unterschiede.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 136 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tägliches Prädationsrisiko<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,0<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Petersgroden<br />
Idagroden<br />
*<br />
*<br />
Beckmannsfeld<br />
Leybucht<br />
Nordender Groden<br />
Norderland<br />
Abbildung 41: Vergleich des täglichen Prädationsrisikos (Wahrscheinlichkeit des Eiverlustes<br />
pro Tag) zwischen den Untersuchungsgebieten an Kunstnestern im Jahr 2008<br />
* Signifikanzwert p ≤ 0,05<br />
Durch die dreimalige Wiederholung der Prädationsversuche mit Kunstnestern ist es zudem<br />
möglich, den zeitlichen Verlauf der Prädationsraten während der Brutsaison nachzubilden. In<br />
Abbildung 42 wird deutlich, dass ein Maximum der Nest-Prädation Anfang Juni in allen<br />
untersuchten Gebieten vorhanden war. Trotz der Tatsache, dass sich die Prädationsraten<br />
der ersten und letzten Wiederholung in einigen Gebieten unterscheiden, treten doch in allen<br />
Gebieten die höchsten Werte in Versuchsreihe 2 auf. Dies deutet auf einen einheitlichen<br />
Verlauf der Prädationsraten hin, wobei das Maximum in der Leybucht und im Norderland<br />
etwas zeitiger auftritt als im Mittel, und im Nordender Groden und Petersgroden etwas<br />
später.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 137<br />
Ei - Prädation [%]<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Versuchsreihe 1<br />
Versuchsreihe 2 Versuchsreihe 3<br />
April Mai Juni Juli<br />
Lege- und Bebrütungsphase<br />
Schlupfphase und nicht flügge Küken<br />
Abbildung 42: Zeitlicher Verlauf der Prädationsraten in den sechs Untersuchungsgebieten im<br />
Jahr 2008<br />
Die unterschiedlichen Symbole stehen für die sechs Untersuchungsgebiete (� Leybucht, �<br />
Norderland, � Idagroden, � Petersgroden, � Nordender Groden, � Beckmannsfeld).<br />
6.3.3.3 DISKUSSION<br />
Durch die Ergebnisse der Prädationsuntersuchungen wird deutlich, dass<br />
Wiesenbrütergelege in allen Gebieten stark von Prädation betroffen sind, wobei sich lediglich<br />
das Untersuchungsgebiet Beckmannsfeld signifikant vom Nordender Groden und der<br />
Leybucht unterscheidet. Das Prädatorenspektrum unterscheidet sich nur gering zwischen<br />
den Gebieten und der zeitliche Verlauf der Prädationsraten weist in allen Gebieten ein<br />
vergleichbares Muster mit den höchsten Werten Anfang Juni auf. Auch in räumlich nahe<br />
beieinander liegenden Gebieten können sich die Prädationsraten deutlich unterscheiden, so<br />
liegt sowohl die Fläche mit den höchsten Prädationsraten (Nordender Groden) als auch die<br />
Fläche mit den geringsten Werten (Beckmannsfeld) im Jadebusen. Für die Management-<br />
Optionen ergibt sich, dass die für hohen Schlupferfolg günstigen Habitatbedingungen (Tab.<br />
43) möglichst gut reproduziert werden, um das Auffinden der Gelege für die Prädatoren zu<br />
erschweren. Da ein wesentlicher Anteil der Prädationsereignisse auf Säuger zurückgeht, die<br />
wahrscheinlich aus der Agrarlandschaft über den Deich in die Salzwiesen wechseln, könnte<br />
es sinnvoll sein, potentiellen Brutareale durch ein Netz offener Stillgewässer von diesen<br />
Wechseln abzuschneiden. Dies würde allerdings auf ein inselartiges Geländerelief<br />
hinausführen, was für Festlandssalzwiesen eher untypisch wäre. Einschränkend muss<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 138 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
allerdings gesagt werden, dass wir nicht genau wissen, welches Relief Festlandssalzwiesen<br />
haben würden, die von rein natürlichen Entwässerungssystemen geprägt sind.<br />
Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich jedoch nur auf den durch die Kunstnester<br />
nachgebildeten Nesttyp von gut in der Vegetation versteckten relativ großen Nestern.<br />
Derartige Nester werden beispielsweise von Rotschenkel und Uferschnepfe angelegt. Offene<br />
Nester oder Nester von Singvögeln von deutlich geringerer Nestgröße werden vermutlich<br />
von einem abweichenden Prädatorenspektrum geraubt. Daher sind die hier dargestellten<br />
Ergebnisse nur mit Einschränkungen auf derartige Nesttypen übertragbar.<br />
6.4 VEGETATIONSSTRUKTUR<br />
6.4.1 METHODIK<br />
Die Vegetationsstruktur spielt bei der Nistplatzwahl von Rotschenkel und Wiesenpieper eine<br />
herausragende Rolle (siehe Kapitel 6.3.2.2). Um die von Brutvögeln zur Anlage des Nestes<br />
genutzte Vegetationsstruktur analysieren zu können, wurde an den insgesamt 107<br />
Gelegestandorten von Rotschenkel und Wiesenpieper (vgl. Tabelle 40) sowie an 240<br />
Zufallspunkten die Vegetationsstruktur analysiert.<br />
Mit den Strukturinformationen an den Gelegestandorten und den Zufallspunkten ist es<br />
möglich, herauszuarbeiten, welche Vegetationsstruktur von den beiden detailliert<br />
untersuchten Brutvogelarten präferiert wird (siehe Kapitel 6.3.2.2). Zudem ist es möglich, den<br />
Einfluss der landwirtschaftlichen Flächennutzung auf die Vegetationsstruktur zu ermitteln.<br />
Zur Erfassung der Struktur wurden digitale Fotos von der Vegetation vor einem dunklen<br />
Hintergrund erstellt. Diese Fotos wurden in schwarz-weiß Bilder umgewandelt, um daran die<br />
Ausprägung der Vegetationsstruktur automatisiert am Computer analysieren zu können<br />
(Abbildung 43). Mit diesen Fotos ist es möglich, Dichte und Höhe der Vegetation in<br />
verschiedenen Bildbereichen (z.B. in unterschiedlichen Vegetationsstrata) detailliert zu<br />
analysieren (ZEHM ET AL. 2003).<br />
Abbildung 43: Methodik zur Analyse der Vegetationsstruktur<br />
Ergänzend wurden Lichtmessungen durchgeführt, wodurch die Dichte der Vegetation<br />
anhand der bis zum Boden eindringenden Lichtmenge bestimmt werden kann.<br />
6.4.2 ERGEBNISSE<br />
Mithilfe der Fotoauswertung und Lichtmessung können acht TMAP-Vegetationseinheiten<br />
bezüglich der Vegetationsstruktur detailliert charakterisiert werden (Tabelle 45).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 139<br />
Tabelle 45: TMAP-Vegetationseinheiten, bei denen Analysen der Vegetationsstruktur<br />
durchgeführt wurden<br />
TMAP-Code TMAP-Vegetationseinheit<br />
S.1.2 Küstenwatt, Queller-Watt<br />
S.2.1 Untere Salzwiese, Andel-Rasen<br />
S.2.4 Untere Salzwiese, Strandsalzmelden-Rasen<br />
S.3.0 Obere Salzwiese, unspezifisch<br />
S.3.3 Obere Salzwiese, Rotschwingel-Wiese<br />
S.3.5 Obere Salzwiese, Strandbeifuß-Wiese<br />
S.3.7 Obere Salzwiese, Quecken-Rasen<br />
S.3.9 Obere Salzwiese, Melden-Flur<br />
Die Charakterisierung der Vegetationsstruktur erfolgte mithilfe von neun Parametern (Tabelle<br />
46), die durch die Methode der Fotoauswertung bzw. durch direkte Lichtmessungen erhoben<br />
wurden.<br />
Tabelle 46: Parameter zur Charakterisierung der Vegetationsstruktur<br />
Parameter (Codes) Definition<br />
Lichteinfall [%]<br />
(incidence.PAR)<br />
Streuung der Lichtwerte<br />
(spread.PAR)<br />
Mittlere Spaltendichte [%]<br />
(mean.density)<br />
Unterschiede der Spaltendichte [%]<br />
(diff.density)<br />
Maximale Vegetationshöhe [cm]<br />
(max.height)<br />
Unterschiede der Spaltenhöhen [cm]<br />
(diff.height)<br />
Top-line Länge<br />
(tl.length)<br />
Höhe, bei der ein spezifischer prozentualer<br />
Anteil der Dichte erreicht wird [cm]<br />
(pc-50 / pc-75)<br />
Zeilendichte [%]<br />
(rdX-Y)<br />
Licht (Photsynthetic Active Radiation: PAR) das den Boden<br />
erreicht, in Prozent der Lichtintensität über der Vegetation<br />
Streuung der 64 Einzellichtmessungen (PAR) am Boden,<br />
gemessen auf einer Fläche von 100 cm x 1 cm<br />
Mittlere Vegetationsdichte, berechnet aus den Dichtewerten pro<br />
Spalte (10 cm breite Streifen des analysierten Fotos)<br />
Differenz zwischen dem geringsten und höchsten Dichtewert pro<br />
Spalte (10 cm breite Streifen des analysierten Fotos)<br />
Maximale Vegetationshöhe im analysierten Foto<br />
Differenz zwischen der maximalen Höhe pro Spalte (10 cm<br />
breite Streifen des analysierten Fotos)<br />
Länge einer Linie über die höchsten Pflanzenteile, geteilt durch<br />
die Breite des analysierten Fotos<br />
Höhe unter der 50 % / 75 % der Vegetationsdichte (kumulative<br />
Vegetationsdichte) erreicht wird.<br />
Dichte der Vegetation in einem Bereich zwischen X und Y cm<br />
über dem Boden (10 cm breite Zeilen des analysierten Fotos)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 140 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die drei verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungsformen wirken sich stark auf die<br />
Vegetationsstruktur aus (Tabelle 47) und werden daher in den Ergebnisdarstellungen<br />
unterschieden.<br />
Tabelle 47: Ergebnisse Vegetationsstrukturmessungen je Nutzungsform<br />
(Vegetationseinheiten siehe Tabelle 45, Abkürzungen siehe Codes in Tabelle 46)<br />
Weide<br />
Brache<br />
Wiese<br />
Weide<br />
Brache<br />
Wiese<br />
N incidence.PAR N spread.PAR N mean.density diff.density max.height diff.height tl.length pc-50 pc-75<br />
S.1.2 5 0,49 ±0,25 5 0,41 ±0,20 6 23,53 ±14,46 6,57 ±1,80 42,75 ±21,40 14,9 ±6,68 5,75 ±1,58 13,48 ±5,00 20,03 ±7,81<br />
S.2.1 13 0,72 ±0,14 13 0,19 ±0,14 37 18,35 ±8,96 4,96 ±4,36 30,35 ±17,75 8,04 ±6,33 4,62 ±1,61 9,47 ±4,53 14,27 ±7,01<br />
S.3.0 14 0,57 ±0,20 13 0,27 ±0,15 22 19,12 ±5,05 4,57 ±3,31 34,16 ±12,46 12,23 ±10,54 5,52 ±1,67 9,68 ±2,48 14,65 ±3,77<br />
S.3.3 NA NA 7 20,95 ±8,89 8,64 ±5,88 39,10 ±19,00 14,1 ±7,61 4,67 ±0,72 10,76 ±4,44 16,47 ±7,05<br />
S.3.5 7 0,31 ±0,17 7 0,70 ±0,25 7 36,61 ±4,67 13,23 ±6,66 51,64 ±7,28 11,81 ±7,48 4,51 ±0,94 18,36 ±2,33 28,29 ±3,39<br />
S.3.7 7 0,19 ±0,06 6 0,88 ±0,14 34 40,14 ±7,75 9,77 ±4,51 69,07 ±14,04 18,4 ±9,35 3,72 ±1,36 20,91 ±4,30 32,34 ±6,55<br />
S.3.9 NA NA 5 40,73 ±8,23 11,26 ±6,04 66,56 ±10,84 18,7 ±7,85 4,03 ±1,45 20,72 ±4,12 32,48 ±6,23<br />
S.2.1 78 0,23 ±0,18 39 0,67 ±0,27 65 31,77 ±6,73 11,44 ±7,64 54,65 ±18,65 14,15 ±12,99 4,97 ±1,56 17,04 ±3,79 27,04 ±8,05<br />
S.2.4 24 0,14 ±0,09 20 1,11 ±0,53 21 36,93 ±6,66 7,63 ±2,72 52,67 ±8,29 9,31 ±4,43 4,25 ±0,84 18,76 ±3,14 28,68 ±4,83<br />
S.3.3 14 0,15 ±0,09 6 1,03 ±0,11 9 38,82 ±5,96 14,43 ±5,16 63,12 ±18,50 19,04 ±15,53 4,21 ±0,96 20,1 ±3,07 31,30 ±5,92<br />
S.3.7 53 0,15 ±0,15 28 0,98 ±0,36 34 41,52 ±8,04 11,78 ±6,44 71,59 ±17,89 14,15 ±12,12 5,18 ±2,63 22,81 ±7,91 36,32 ±11,04<br />
S.3.9 23 0,19 ±0,21 12 0,86 ±0,35 17 40,49 ±9,48 19,71 ±8,99 73,89 ±20,72 21,76 ±13,37 6,14 ±3,81 22,53 ±5,07 35,84 ±8,35<br />
S.2.1 15 0,37 ±0,15 15 0,43 ±0,21 15 33,11 ±7,25 9,03 ±6,58 47,11 ±11,48 8,05 ±5,59 5,41 ±0,92 16,83 ±3,71 26,00 ±6,17<br />
S.3.7 22 0,20 ±0,24 14 0,68 ±0,31 18 53,72 ±10,70 16,64 ±8,37 94,85 ±17,24 15,13 ±7,77 6,41 ±2,29 28,76 ±5,90 45,79 ±8,85<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Lichtmessung Fotomethode<br />
Fotomethode / Vegetationsdichte in Zeilen<br />
N rd0-10 rd10-20 rd20-30 rd30-40 rd40-50 rd50-60 rd60-70 rd70-80 rd80-90 rd90-100<br />
S.1.2 6 84,02 ±37,84 74,72 ±36,05 45,08 ±45,15 22,3 ±31,77 6,58 ±13,52 2 ,00±4,90 0,6 0±1,47 0,35 ±0,86 0 ±0 0 ±0<br />
S.2.1 37 96,06 ±4,94 53,53 ±38,80 22,72 ±33,94 8,23 ±16,22 2,43 ±6,35 0,77 ±2,76 0,19 ±0,74 0,03 ±0,16 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.0 22 99,05 ±1,61 70,89 ±32,89 18,99 ±16,64 2,27 ±4,04 0,46 ±1,34 0,02 ±0,07 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.3 7 96,81 ±3,11 65,1 ±39,05 34,29 ±33,29 10,86 ±15,52 2,10 ±3,73 0,54 ±0,94 0,13 ±0,34 0 ±0 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.5 7 100 ±0 99,40 ±0,75 85,63 ±15,40 60,64 ±19,91 18,10 ±13,22 2,46 ±4,99 0,11 ±0,30 0 ±0 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.7 34 98,57 ±4,30 94,80 ±6,87 84,59 ±13,66 65,73 ±22,52 36,99 ±25,39 13,7 ±15,27 4,60 ±7,63 1,90 ±5,36 0,71 ±2,08 0,2 0±0,71<br />
S.3.9 5 99,48 ±1,16 97,74 ±3,42 85,54 ±9,24 69,56 ±24,65 37,26 ±28,11 11,56 ±14,49 4,96 ±9,01 1,74 ±3,89 0 ±0 0 ±0<br />
S.2.1 65 96,14 ±5,63 89,01 ±12,67 71,77 ±20,27 39,78 ±24,05 11,89 ±12,57 3,44 ±7,82 1,83 ±6,55 1,54 ±5,79 1,22 ±4,67 1,13 ±4,71<br />
S.2.4 21 99,17 ±3,16 97,29 ±7,15 88,63 ±12,26 57,73 ±25,06 22,00 ±23,33 4,54 ±11,19 0,30 ±0,70 0 ±0 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.3 9 98,67 ±2,60 95,29 ±7,23 89,12 ±7,24 62,88 ±13,88 27,51 ±17,75 7,89 ±14,05 3,44 ±9,92 1,51 ±4,53 0,77 ±2,30 0,78 ±2,33<br />
S.3.7 34 96,28 ±15,55 93,26 ±14,29 84,83 ±16,22 63,54 ±23,34 37,02 ±23,95 19,15 ±19,42 10,59 ±17,66 7,33 ±18,12 2,87 ±7,58 0,74 ±2,27<br />
S.3.9 17 94,71 ±8,56 87,11 ±16,10 80,21 ±13,79 61,01 ±19,03 38,65 ±23,90 21,92 ±20,14 12,91 ±14,44 5,74 ±8,50 2,11 ±4,18 0,57 ±1,42<br />
S.2.1 15 99,27 ±2,34 96,41 ±4,87 75,16 ±24,90 42,23 ±29,79 14,33 ±17,65 2,94 ±8,68 0,99 ±3,82 0,09 ±0,34 0 ±0 0 ±0<br />
S.3.7 18 96,59 ±7,46 95,49 ±7,01 87,22 ±10,44 78,25 ±11,29 64,79 ±18,41 46,38 ±26,14 30,63 ±22,89 19,28 ±18,50 10,61 ±11,38 5,36 ±7,82<br />
Mithilfe der Daten zur Vegetationsstruktur in Tabelle 47 lassen sich die jeweiligen<br />
Vegetationseinheiten bezüglich Höhe und Dichte der Vegetation detailliert charakterisieren<br />
und untereinander vergleichen. Dabei kann auch die Höhenschichtung, die für brütende<br />
Vögel eine wichtige Rolle spielt, berücksichtigt werden. Beispielsweise sind Andel-Rasen<br />
und Quecken-Rasen bis 20 cm über dem Boden noch beide sehr dicht. Bei größeren Höhen<br />
sind Andelrasen dann deutlich weniger dicht als Queckenrasen. (Abbildung 44).
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 141<br />
Vegetationshöhe [cm]<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 20 40 60 80 100<br />
S.2.1 Andel-Rasen<br />
(65)<br />
Dichte der Vegetation [%]<br />
S.3.7 Quecken-Rasen<br />
(34)<br />
Abbildung 44: Dichte der Vegetation in verschiedenen Höhenschichten bei unbewirtschafteten<br />
Andel-Rasen und Quecken-Rasen<br />
Zudem ist es möglich, mit diesen detaillierten Informationen zur Vegetationsstruktur den<br />
Einfluss der verschiedenen Nutzungsformen auf einzelne Struktureigenschaften zu<br />
analysieren. So wird der Lichteinfall im Andel-Rasen stark durch die unterschiedlichen<br />
Nutzungsformen beeinflusst, wohingegen im Quecken-Rasen kein signifikanter Einfluss<br />
festzustellen ist (Abbildung 45).<br />
Lichteinfall [%]<br />
100<br />
0 20 40 60 80<br />
S.2.1 Andel-Rasen<br />
Weide<br />
(13)<br />
***<br />
***<br />
Brache<br />
(78)<br />
***<br />
Wiese<br />
(15)<br />
Lichteinfall [%]<br />
100<br />
0 20 40 60 80<br />
S.3.7 Quecken-Rasen<br />
Weide<br />
(7)<br />
Brache<br />
(53)<br />
Abbildung 45: Einfluss der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Lichteinfall von Andel-Rasen<br />
und Quecken-Rasen<br />
*** Signifikanzwert p ≤ 0,001<br />
6.4.3 DISKUSSION<br />
Durch die detaillierte Analyse der Vegetationsstruktur ist es möglich, acht TMAP-<br />
Vegetationseinheiten unter verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungen zu<br />
Wiese<br />
(22)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 142 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
charakterisieren und damit ihre Eignung für verschiedene Brutvogelarten abzuschätzen.<br />
Analysiert wurden neun Eigenschaften der Vegetationsstruktur die für Brutvögel von<br />
Bedeutung sind. Es wurde festgestellt, dass landwirtschaftliche Nutzung die Höhe und Dichte<br />
der Vegetation meist verringert sowie den Lichteinfall auf den Boden vergrößert. Diese<br />
Ergebnisse belegen die in der Diskussion der Nistplatzwahl angesprochenen Bewertung,<br />
dass starke Beweidung für die Nistplatzwahl von Rotschenkel und Wiesenpieper negative<br />
Folgen hat. Die Ergebnisse zur Vegetationsstruktur waren für die Ermittlung der Indexwerte<br />
(siehe Kapitel 6.2 und 6.3.1) erforderlich, können jedoch auch für weitere Abschätzungen der<br />
Habitateignung genutzt werden.<br />
Aufgrund der hohen Stichprobenzahl von insgesamt fast 300 Messungen ist anzunehmen,<br />
dass es sich um für die niedersächsische Küste repräsentative Daten handelt, sodass eine<br />
Übertragung dieser Werte auf andere Gebiete an der niedersächsischen Festlandsküste, aus<br />
denen die Vegetationseinheiten zusammen mit den landwirtschaftlichen Nutzungen bekannt<br />
sind, möglich ist.<br />
6.5 NAHRUNGSANGEBOT<br />
6.5.1 METHODIK<br />
Zur Erfassung des Nahrungsangebotes für Brutvögel wurde die Wirbellosenfauna an 12<br />
Standorten (siehe Tabelle 48, B01 bis B12) mit je drei Barberfallen beprobt. Dabei bestand<br />
jede Falle aus einem Fangglas mit 7 cm Durchmesser, welches ebenerdig eingegraben<br />
wurde. Als Fangflüssigkeit wurde 3,7 %-iges Formalin, versetzt mit 0,1 % Agepon als<br />
Entspannungsmittel, verwendet. Die Fallen wurden im Zeitraum 23.05.07 bis 19.06.07<br />
ausgebracht und wöchentlich geleert. Tabelle 48 zeigt die Verteilung der Bodenfallen auf die<br />
Vegetations- und Nutzungstypen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 143<br />
Tabelle 48: Übersicht über die Bodenfallenstandorte<br />
Die Klassifizierung der Vegetation entspricht der TMAP-Vegetationskartierung der<br />
Nationalparkverwaltung, Koordinaten nach Gauß-Krüger Koordinatensystem.<br />
Nutzung Vegetationseinheit (TMAP-Code) Gebiet Bodenfalle Rechtswert Hochwert<br />
Brache Andel-Rasen (S.2.1) Jadebusen B03 3454733 5930082<br />
Brache Andel-Rasen (S.2.1) Norderland B14 (nur 2008) 2587591 5950907<br />
Brache Strandsalzmelden-Rasen (S.2.4) Jadebusen B04 3454708 5930070<br />
Brache Obere Salzwiese, unspezifisch (S.3.0) Jadebusen B06 3454686 5930007<br />
Brache Strandbeifuß-Wiese (S.3.5) Jadebusen B09 3454863 5931599<br />
Brache Quecken-Rasen (S.3.7) Jadebusen B02 3454912 5930047<br />
Brache Quecken-Rasen (S.3.7) Norderland B13 (nur 2008) 2587611 5950853<br />
Brache Meldenflur (S.3.9) Jadebusen B05 3454818 5930040<br />
Weide Andel-Rasen (S.2.1) Norderland B12 2586651 5950698<br />
Weide Obere Salzwiese, unspezifisch (S.3.0) Norderland B10 2586610 5950522<br />
Weide Quecken-Rasen (S.3.7) Norderland B11 2586623 5950609<br />
Wiese Andel-Rasen (S.2.1) Jadebusen B08 3455258 5930013<br />
Wiese Quecken-Rasen (S.3.7) Jadebusen B01 3455069 5930050<br />
Wiese Meldenflur (S.3.9) Jadebusen B07 3454990 5930013<br />
Im Labor wurden die gefangenen Individuen auf Familien- oder Ordnungsebene pro<br />
Größenklasse (0-5 mm, >5-10 mm, >10-15 mm, >15 mm) ausgezählt (siehe Tabelle 49).<br />
Schnecken (Gastropoda) beider Jahre und Laufkäfer (Carabidae), die im Jahr 2007<br />
gefangen wurden, wurden bis auf Artebene bestimmt.<br />
Ergänzend zu den Fängen mit Bodenfallen wurden am 19.06.2007 und 20.06.2007 an den<br />
12 Standorten Kescherfänge mit je 100 Schlägen pro Standort durchgeführt. Die Individuen<br />
wurden entsprechend den Bodenfallenfängen sortiert und ausgezählt. Zudem wurde das<br />
Frischgewicht der Tiere ermittelt.<br />
Im Jahr 2008 wurden an sechs ausgewählten Standorten (B01, B02, B03, B08, B11 und<br />
B12) die Erfassungen wiederholt (27.05.2008 bis 26.06.2008), um jährliche Schwankungen<br />
ermitteln zu können, zudem wurden zwei weitere Standorte im Norderland (B13 und B14) in<br />
die Erfassungen einbezogen, um bessere Vergleichsmöglichkeiten zwischen den<br />
Untersuchungsgebieten zu erhalten. Ergänzend fanden 2009 Messungen des Eindringwider-<br />
standes der Böden (Maß für Festigkeit des Bodens) an den Bodenfallenstandorten statt, um<br />
die Verdichtung der Böden durch die unterschiedlichen Nutzungsformen zu analysieren.<br />
Diese Messungen wurden dreimal wiederholt und an allen Standorten innerhalb eines Tages<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 144 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
durchgeführt, um Einflüsse durch Witterung zu minimieren. Die Messungen zum<br />
Eindringwiderstand erfolgten mithilfe eines Taschenpenetrometers (CL 700a).<br />
Die Ergebnisse der Wirbellosenerfassungen wurden genutzt, um jeder Vegetationseinheit<br />
einen Indexwert (vergleichbar den Indexwerten in Kapitel 6.2 und 6.3) zuweisen zu können.<br />
Durch den Indexwert wird die Bedeutung einer jeden Vegetationseinheit in Bezug auf<br />
Wirbellose und damit auf das Nahrungsangebot für Brutvögel repräsentiert. Die Indexwerte<br />
wurden aus den mittleren Anzahlen der jeweiligen Tiergruppen in den betreffenden<br />
Vegetationseinheiten errechnet. Dabei wurde der Vegetationseinheit mit der höchsten<br />
mittleren Individuenzahl der Indexwert 1 zugewiesen. Ein Indexwert von -1 bedeutet, dass<br />
keine Individuen dieser Tiergruppe vorhanden waren, und 0, dass halb so viele Individuen<br />
wie der maximale Wert festgestellt wurden (vgl. auch Kapitel 6.2.2.1). Für die Ermittlung der<br />
Indexwerte wurde nach Nutzungsformen unterschieden.<br />
6.5.2 ERGEBNISSE<br />
In beiden Untersuchungsjahren wurden rund 284.000 Individuen bestimmt, vermessen und<br />
ausgezählt. Dabei wurde eine Vielzahl an Artengruppen festgestellt (Tabelle 49).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 145<br />
Tabelle 49: Stark vereinfachte Übersicht über die in Bodenfallen festgestellten<br />
Tierartengruppen<br />
Mollusca Weichtiere<br />
Gastropoda Schnecken<br />
Arachnida Spinnentiere<br />
Araneida Spinnen<br />
Acarina Milben<br />
Crustacea Krebstiere<br />
Amphipoda Flohkrebse<br />
Decapoda Zehnfüßer<br />
Portunidae Schwimmkrabben<br />
(nur gemeine Strandkrabbe)<br />
Isopoda Asseln<br />
Insecta Insekten<br />
Diplura Doppelschwänze<br />
Collembola Springschwänze<br />
Saltatoria Heuschrecken<br />
Ensifera Langfühlerschrecken<br />
Caelifera Kurzfühlerschrecken<br />
Phthiraptera Lauskerfe, Läuslinge<br />
Anoplura Tierläuse<br />
Thysanoptera Fransenflügler<br />
Dermaptera Ohrwürmer<br />
"Homoptera" Gleichflügler, Pflanzensauger<br />
Rhynchota Schnabelkerfe<br />
Darunter Heteroptera und Auchenorrhyncha Darunter Wanzen und Zikaden<br />
Aphidina Blattläuse<br />
Coleoptera Käfer<br />
Carabidae Laufkäfer<br />
Silphidae Aaskäfer<br />
Staphylinidae Kurzflügler<br />
Elateridae Schnellkäfer<br />
Cantharidae Weichkäfer<br />
Dermestidae Speckkäfer<br />
Coccinellidae Marienkäfer<br />
Chrysomelidae Blattkäfer<br />
Curculionidae Rüsselkäfer<br />
Hymenoptera Hautflügler<br />
Symphyta Pflanzenwespen<br />
Apocrita Taillenwespen (Unterordnung)<br />
Formicidae getrennt erfasst Ameisen getrennt erfasst<br />
Trichoptera Köcherfliegen<br />
Lepidoptera Schmetterlinge<br />
Schmetterlingslarven<br />
Diptera Zweiflügler<br />
Nematocera Mücken<br />
Brachycera Fliegen<br />
Bei den Schnecken wurden zwei Arten festgestellt. Mäuseöhrchen (Myosotella myosotis in<br />
B03, B04, B05, B09) und Kegelige Marschenschnecke (Assiminea grayana in B01, B02,<br />
B04, B05, B07, B08, B09). Beide Arten werden in der Rote Liste von Deutschland<br />
(JUNGBLUTH ET AL. 1998) und auch in der vorläufigen Roten Liste für Niedersachsen<br />
(JUNGBLUTH & VOGT 1990) als gefährdet eingestuft.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 146 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Im Rahmen dieser Untersuchung konnten zudem 20 Laufkäferarten auf den<br />
Untersuchungsflächen für das Jahr 2007 nachgewiesen werden (Tabelle 50), darunter<br />
Bembidion iricolor. Diese Art wird sowohl auf der Roten Liste für Deutschland (TRAUTNER ET<br />
AL. 1998) als auch für Niedersachsen (ASSMANN ET AL. 2003) als stark gefährdet geführt.<br />
Tabelle 50: Festgestellte Laufkäferarten<br />
(RL D = Rote Liste Laufkäfer für Deutschland (Trautner et al. 1998), RL NDS = Rote Liste Laufkäfer<br />
für Niedersachsen (Assmann et al. 2003)<br />
Laufkäferart RL D RL NDS Fundorte (Bodenfallen)<br />
Amara convexiuscula (Marsham, 1802) B02, B05, B07<br />
Bembidion aeneum Germar, 1824 alle Standorte<br />
Bembidion iricolor Bedel, 1879 2 2 B01, B02, B05, B09<br />
Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) B01, B02, B05, B06, B07, B11<br />
Bembidion minimum (Fabricius, 1792) alle Standorte<br />
Bembidion normannum Dejean, 1831 alle Standorte<br />
Bembidion varium (Olivier, 1795) B08, B12<br />
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) B01, B02, B07, B10, B11, B12<br />
Dicheirotrichus gustavii Crotch, 1871 V B01, B02, B03, B04, B07, B08, B09, B12<br />
Dyschirius globosus (Herbst, 1784) B01, B02, B05, B07, B09, B11<br />
Harpalus affinis (Schrank, 1781) B09, B11<br />
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) B05<br />
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) B01, B06<br />
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) B01, B02, B05, B07<br />
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) B01, B02, B05<br />
Pogonus chalceus (Marsham, 1802) V B01, B03, B04, B06, B08, B10, B11, B12<br />
Pseudophonus rufipes (de Geer, 1774) B06, B07,<br />
Pterostichus anthracinus (Iliger, 1798) B01, B02, B05<br />
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) V B01<br />
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) B02, B05, B11<br />
Der Vergleich der Bodenfallenstandorte, die in beiden Untersuchungsjahren beprobt wurden,<br />
zeigt, dass es lediglich auf den gemähten Standorten signifikante Unterschiede zwischen<br />
den Jahren (Abbildung 46) gab (in der Gruppe der Insekten und der Krebstiere). Da aufgrund<br />
der sehr nassen Witterung im Jahr 2007 eine reguläre Mahd der Flächen nicht möglich war,<br />
ist es möglich, dass diese Abweichungen mit der veränderten Flächennutzung im Jahr 2007<br />
(Schlegeln der Flächen im Oktober) zusammenhängen. Auf den übrigen Nutzungsformen<br />
waren nur geringe Unterschiede zwischen den Jahren vorhanden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 147<br />
Anzahl Insekten pro Falle und Woche<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />
2007 2008 2007 2008 2007 2008<br />
Weide Wiese Brache<br />
Abbildung 46: Vergleich der Insekten aus Bodenfallen der Jahre 2007 und 2008 je<br />
Nutzungsform<br />
Zur Bewertung der Bedeutung einzelner Vegetationseinheiten für die Wirbellosenfauna, und<br />
damit für das Nahrungsangebot für Brutvögel, dienen die ermittelten Indexwerte (Tabelle 51<br />
bis Tabelle 53).<br />
Ein Vergleich der Artengruppen zeigt, dass die höchsten Abundanzen je Artengruppe auf<br />
unterschiedlicher Vegetation vorhanden sind. Insekten weisen die höchsten Individuenzahlen<br />
auf gemähten Meldenfluren auf. Diese sind in Tabelle 51 mit 1.00 bezeichnet. Die dort<br />
genannten Indexwerte zeigen für die anderen Vegetationseinheiten und Nutzungen, wie<br />
stark diese in der Insektenabundanz gegenüber der Meldenflur abfallen. Bei den<br />
Spinnentieren ist es die ungenutzte obere Salzwiese. Im Vergleich zu den Insekten verteilt<br />
sich die Abundanz der Spinnentiere eher gleichmäßig über alle Vegetationstypen (Tabelle<br />
52). Die höchsten Anzahlen an Krebstieren wurden auf der ungenutzten Strandbeifuß-Wiese<br />
festgestellt (Tabelle 53).<br />
Tabelle 51: Indexwerte für Insekten<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide Wiese<br />
Andel-Rasen (S.2.1) -0.85 -0.65 -0.91 -0.83<br />
Strandsalzmelden-Rasen (S.2.4) -0.40<br />
Obere Salzwiese unspezifisch (S.3.0) -0.66 -0.66 -0.70<br />
Strandbeifuß-Wiese (S.3.5) -0.52<br />
Quecken-Rasen (S.3.7) -0.47 -0.37 -0.91 -0.05<br />
Meldenflur (S.3.9) 0.54 0.22 1.00<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 148 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Tabelle 52: Indexwerte für Spinnentiere<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide Wiese<br />
Andel-Rasen (S.2.1) 0.31 0.17 0.10 0.65<br />
Strandsalzmelden-Rasen (S.2.4) 0.30<br />
Obere Salzwiese unspezifisch (S.3.0) -0.11 1.00 -0.33<br />
Strandbeifuß-Wiese (S.3.5) -0.53<br />
Quecken-Rasen (S.3.7) 0.31 0.43 -0.19 0.26<br />
Meldenflur (S.3.9) 0.77 0.73 0.93<br />
Tabelle 53: Indexwerte für Krebstiere<br />
Vegetationseinheit Gesamt Brache Weide Wiese<br />
Andel-Rasen (S.2.1) -0.72 -0.32 -1.00 -0.78<br />
Strandsalzmelden-Rasen (S.2.4) 0.38<br />
Obere Salzwiese unspezifisch (S.3.0) -0.69 -0.78 -0.26<br />
Strandbeifuß-Wiese (S.3.5) 1.00<br />
Quecken-Rasen (S.3.7) -0.30 -0.30 -0.63 0.05<br />
Meldenflur (S.3.9) -0.65 -0.69 -0.62<br />
Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Anzahl an Individuen als<br />
Nahrungsgrundlage für die Vögel, sagen aber nichts über die Artenzahlen und damit die<br />
Biodiversität aus.<br />
Bei allen drei Artengruppen zeigt ein Vergleich der Nutzungsformen pro Vegetationseinheit,<br />
dass auf den beweideten Flächen bis auf eine Ausnahme die geringsten Anzahlen<br />
vorhanden sind. Somit muss davon ausgegangen werden, dass eine Beweidung von<br />
Salzwiesen zu einem Rückgang der Individuenanzahl an Wirbellosen führt.<br />
Die Untersuchung zum Eindringwiderstand der Böden zeigt, dass besonders hohe<br />
Eindringwiderstände auf beweideten Flächen vorhanden sind (Abbildung 47). Dies deutet<br />
darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen durch Viehtritt verdichteten Böden auf<br />
beweideten Flächen und den geringen Individuenzahlen an Wirbellosen auf beweideten<br />
Flächen besteht. Dies zeigt sich deutlich im linearen Zusammenhang zwischen<br />
Individuenanzahl und Eindringwiderstand für die Laufkäfer, Spinnen und Krebstiere<br />
(Abbildung 47).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 149<br />
Individuenzahl Krebstiere / Woche<br />
0 500 1000 1500 2000<br />
100 150 200 250 300 350<br />
Eindringwiderstand [kN/m²]<br />
Abbildung 47: Mittelwerte der Eindringwiderstände pro Untersuchungsfläche und die mittlere<br />
Individuenanzahl an Krebstieren pro Woche<br />
Regressionsgerade y= 3161,14 – 9,68x; R² 0,51<br />
6.5.3 DISKUSSION<br />
Mithilfe von 14 Bodenfallenstandorten ist es gelungen, für sechs Vegetationseinheiten<br />
fundierte Aussagen über das Vorkommen von Wirbellosen zu treffen, welche für viele<br />
Vogelarten die Nahrungsgrundlage darstellen. Demnach ist die Wirbellosendichte bei<br />
Beweidung am geringsten, wofür vor allem die bei Beweidung eintretende Bodenverdichtung<br />
verantwortlich ist. Bei den Insekten wurden auf gemähten Meldenfluren die höchsten<br />
Individuenzahlen festgestellt, bei den Spinnentieren auf ungenutzter oberer Salzwiese, die<br />
aber kaum höhere Abundanzen aufwies als Meldenfluren. Die höchsten Anzahlen an<br />
Wiese<br />
Brache<br />
Weide<br />
Krebstieren wurden auf einer ungenutzten Strandbeifuß-Wiese festgestellt.<br />
Für vier der sechs Vegetationseinheiten ist es zudem möglich, die Auswirkungen<br />
verschiedener Nutzungsformen auf das Wirbellosenvorkommen abzuschätzen. Bei allen drei<br />
Artengruppen zeigt ein Vergleich der Nutzungsformen pro Vegetationseinheit, dass auf den<br />
beweideten Flächen die geringsten Anzahlen vorhanden sind. Somit muss davon<br />
ausgegangen werden, dass eine Beweidung von Salzwiesen aufgrund von<br />
Bodenverdichtung durch Viehtritt zu einem Rückgang der Individuenanzahl an Wirbellosen<br />
führt.<br />
Zwei gefährdete Schneckenarten (Myosotella myosotis, Assiminea grayana) und eine stark<br />
gefährdete Laufkäferart (Bembidion iricolor) konnten auf den untersuchten Salzwiesen<br />
nachgewiesen werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 150 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Durch die Bildung von Indexwerten konnte für einen wichtigen Habitatparameter für<br />
Brutvögel eine gute planerische Grundlage geschaffen werden, die es zulässt, Bewertungen<br />
und Prognosen unter bestimmten Annahmen für die Menge an Wirbellosen und damit für das<br />
Nahrungsangebot für Brutvögel zu treffen (siehe Kapitel 7.4 & 7.5). Auf Grund der<br />
Ergebnisse ist deutlich geworden, dass die Management-Option Beweidung die<br />
Nahrungsressourcen für Brutvögel erheblich vermindern würde.<br />
6.6 GESAMTDISKUSSION<br />
Ziel der Untersuchungen in Teilprojekt 3 war, ein Ökosystem–Prozessverständnis der<br />
Avifauna auf Salzwiesen zu erreichen, um damit die Frage beantworten zu können, welche<br />
Konsequenzen sich aus einer Änderung der Vorlandnutzung für die Küstenökologie und den<br />
Naturschutz insbesondere für die Avifauna ergeben. Dies konnte für fünf Rastvogelarten und<br />
12 Brutvogelarten der niedersächsischen Salzwiesen erreicht werden.<br />
Durch eine Beweidung oder Mahd der Salzwiesen wird die Vegetationsstruktur signifikant<br />
verändert. Bei Rastvögeln wurde für Gänse eine Präferenz für kurzwüchsige, proteinreiche<br />
Vegetationsbestände festgestellt, die häufig auf beweideten Flächen anzutreffen ist.<br />
Beweidung ist also für herbivore Gänse von Vorteil.<br />
Rastende Singvögel sind auf das Vorhandensein der bevorzugten Nahrung (Samen von<br />
Melde, Queller und Rotschwingel) angewiesen und werden damit besonders gefördert, wenn<br />
diese Pflanzenarten durch Management gefördert werden. Bei den 12 untersuchten<br />
Brutvogelarten ergibt sich kein einheitliches Bild der Präferenzen. Hier reicht die Spanne von<br />
Präferenzen für offene Bereiche (Pionierzone, Wattflächen) bei Austernfischer und<br />
Flussseeschwalbe bis hin zur Präferenz für hochwüchsige, dichte Vegetationsbestände<br />
(Strandbeifuß-Wiese, Quecken-Rasen) bei Rotschenkel und Wiesenpieper. Zwar sind die<br />
Habitatmodelle für den Rotschenkel für einige Kombinationen von Nutzung und<br />
Vegetationstyp nicht signifikant, da diese Art dafür keine eindeutigen Präferenzen zeigt, doch<br />
lassen sich die Indexwerte durch die Detailuntersuchungen besser verstehen und<br />
interpretieren. Einige Arten zeigen Präferenzen für besondere Strukturen in Salzwiesen wie<br />
bspw. die Rohrammer, die besonders entlang von Gräben zu finden ist. Erhebungen zu<br />
Wirbellosen, die zahlreichen Brutvogelarten als Nahrungsgrundlage dienen, zeigten, dass<br />
auf beweideten Flächen gleich welcher Vegetationseinheit stets die geringsten Individuen-<br />
anzahlen vorhanden sind. Somit muss davon ausgegangen werden, dass eine Beweidung<br />
von Salzwiesen aufgrund der Bodenverdichtung von tonhaltigem Material durch Viehtritt<br />
ganz allgemein zu einem Rückgang an Nahrungstieren für Brutvögel führt.<br />
Die höchsten Prädationsraten wurden in allen untersuchten Gebieten Anfang Juni<br />
festgestellt. Das Artenspektrum der Nesträuber unterscheidet sich nur minimal zwischen den<br />
Festlandsgebieten. Trotz räumlicher Nähe der Gebiete können sich jedoch die Prädations-<br />
raten signifikant unterscheiden. Setzt man die Prädationsraten mit dem Schlupferfolg beim<br />
Rotschenkel in Bezug, so wird deutlich, dass der Bruterfolg dieser Art nur gewährleistet ist,<br />
wenn das Nest sehr gut in heterogener und dichter Vegetation getarnt werden kann. Ein<br />
Management, das den Rotschenkel fördern will, sollte also auf eine starke Beweidung<br />
verzichten, da sonst die Bestände homogen und kurzrasig werden und der Bestand an<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 151<br />
wirbellosen Tieren stark vermindert wird, welche die Nahrungsgrundlage für den Rotschenkel<br />
und viele anderen Brutvögel sind.<br />
Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass die Ergebnisse nur für die<br />
niedersächsische Festlandsküste verwendet werden können. Eine Übertragung auf weitere<br />
Küstenbereiche ist nicht ungeprüft möglich. Es ist zudem davon auszugehen, dass bei<br />
Nutzungsformen, die von den hier untersuchten Nutzungsformen abweichen, sich die<br />
Vegetationstypen entsprechend verändern (z.B. veränderte Vegetationsstruktur,<br />
Verschiebung der Dominanzverhältnisse), dass es fraglich erscheint, inwieweit die Aussagen<br />
für Nutzungsformen, die nicht Gegenstand dieser Untersuchung waren (Schlegeln,<br />
Beweidung mit Schafen oder Pferden, frühere/spätere Mahd), möglich sind. Dies sollte durch<br />
begleitende Untersuchungen bei Maßnahmenumsetzung überprüft werden. Insbesondere für<br />
von den untersuchten Nutzungsformen deutlich abweichende Nutzungen, wie z.B. Schlegeln<br />
statt Mahdnutzung, ist eine Übertragung der hier vorgestellten Ergebnisse nicht möglich.<br />
Hierzu sollten gezielte, ergänzende Vergleichsuntersuchungen der Vegetationsstruktur,<br />
Artenzusammensetzung und Effekte auf Brut- und Rastvögel durchgeführt werden.<br />
Für nur selten auf Salzwiesen vorkommende Arten konnten keine Aussagen im Rahmen<br />
dieses Projektes gemacht werden, da die hier angewandten Methoden auf einer Mindest-<br />
anzahl an Vorkommen beruhen. Seltene Arten sind jedoch häufig auch als stark in ihrem<br />
Bestand gefährdet eingestuft und sollten daher im Rahmen von gesonderten<br />
Schutzmaßnahmen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Berücksichtigung<br />
finden. Die regelmäßig auf niedersächsischen Salzwiesen vertretenen Arten wurden in<br />
dieser Untersuchung analysiert und fließen damit in die Bewertung der Auswirkungen von<br />
Maßnahmen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung mit ein.<br />
Um Abweichungen von den prognostizierten Veränderungen der Brut- und Rastvogelfauna<br />
frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls gegensteuern zu können, wird empfohlen,<br />
Maßnahmen zu <strong>Treibsel</strong>minimierung stets mit einem Monitoring zu begleiten. Durch<br />
begleitendes Monitoring kann zudem die Möglichkeit genutzt werden, die hier dargestellte<br />
Bewertungsgrundlage mit den neu erhobenen Daten für zukünftige Maßnahmen zu ergänzen<br />
und zu erweitern.<br />
6.7 FAZIT<br />
Durch Beweidung oder Mahd wird die Vegetationsstruktur als bedeutender Habitatfaktor für<br />
die Avifauna stark beeinflusst. Eine Verkürzung der Vegetation durch Beweidung fördert<br />
Gänse und hemmt zahlreiche Brutvogelarten, da diese ihre Nester nicht mehr gut verstecken<br />
können.<br />
Beweidung schränkt durch Bodenverdichtung auch das Nahrungsangebot an wirbellosen<br />
Tieren für zahlreiche Brutvogelarten stark ein. Deshalb ist eine flächendeckende Rückkehr<br />
zu einer intensiven Beweidung von Salzwiesen aus ornithologischer Sicht nicht zu<br />
empfehlen. Eine weitere Beeinflussung der Habitateigenschaften ist durch Veränderungen<br />
des Wasserregimes der Salzwiesen zu erwarten. Allerdings lässt sich eine einfache,<br />
generelle Aussage über die Auswirkungen derartiger Veränderungen auf die Avifauna nicht<br />
machen, da die Habitatansprüche der einzelnen Arten zu unterschiedlich sind. Deshalb wird<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 152 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
in dem nachfolgenden Kapitel jede Management-Strategie einzeln im Hinblick auf ihre<br />
Auswirkungen auf die Vogelwelt bewertet.<br />
Da die im Rahmen dieses Projektes generierten Bewertungsgrundlagen noch bei keiner<br />
Maßnahmenumsetzung evaluiert werden konnten, sollten Maßnahmen zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung mit einem aussagekräftigen Monitoring begleitet werden, um<br />
Abweichungen von den Prognosen erkennen zu können und damit bei negativen<br />
Auswirkungen ein korrigierendes Eingreifen zu ermöglichen. Zudem wird durch ein<br />
Monitoring die Möglichkeit geschaffen, die hier vorgestellte Bewertungsgrundlage für weitere<br />
Vorhaben zu evaluieren und zu ergänzen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 153<br />
6.8 LITERATUR<br />
ASSMANN T., DORMANN W., FRÄMBS H., GÜRLICH S., HANDKE K., HUK T., SPRICK P. & TERLUTTER H.<br />
(2003). Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer und<br />
Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) mit Gesamtartenverzeichnis, 1. Fassung<br />
vom 1.6.2002. Inform. d. Naturschutz Niedersachsen, 23, 70-95.<br />
BIBBY C.J., BURGESS N.D. & HILL D.A. (1995). Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung in<br />
der Praxis. Neumann Verlag GmbH, Radebeul.<br />
DIERSCHKE J. (2001). Die Überwinterungsökologie von Ohrenlerchen Eremophila alpestris,<br />
Schneeammern Plectrophenax nivalis und Berghänflingen Carduelis flavirostris im<br />
Wattenmeer. In: Fachbereich Biologie. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, p. 128.<br />
ESSELINK P., PETERSEN J., ARENS S., BAKKER J.P., BUNJE J., DIJKEMA K.S., HECKER N., HELLWIG U.,<br />
JENSEN A.-V., KERS A.S., KÖRBER P., LAMMERTS E.J., STOCK M., VEENEKLAAS R.M., VREEKEN<br />
M. & WOLTERS M. (2009). Salt Marshes. In: Quality Status Report 2009. Wadden Sea<br />
Ecosystem No. 25 (eds. Marencic H & Vlas J). Common Wadden Sea Secretariat<br />
Wilhelmshaven, Germany.<br />
IVLEV V.S. (1961). Experimental ecology of the feeding fishes. Yale University Press, New Haven, CT.<br />
JUNGBLUTH J.H., KNORRE D.V., FALKNER G., GROH K. & SCHMID G. (1998). Rote Liste der<br />
Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)]. In: Rote Liste<br />
gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz 55 (ed.<br />
Bundesamt für Naturschutz), pp. 243-249.<br />
JUNGBLUTH J.H. & VOGT D. (1990). Vorläufige "Rote Liste" der bestandsbedrohten und gefährdeten<br />
Binnenmollusken (Weichtiere: Schnecken und Muscheln) von Niedersachsen. Stand: 25.<br />
März 1990. unveröffentlicht. In: Neckarsteinach, p. 28.<br />
KRÜGER T. & OLTMANNS B. (2007). Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten<br />
Vogelarten. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 27, 131-175.<br />
PGG (2006). Landschaftspflegekonzept Vorland Jadebusen. In: NLWKN, <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong><br />
Övelgönne-Frieschenmoor.<br />
PGG (2008). Einfluss von Beweidung auf Brutbestände von Rotschenkel und Wiesenpieper in<br />
Festlandsalzwiesen Niedersachsens. In: <strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> Övelgönne-Frieschenmoor.<br />
THYEN S. & EXO K.M. (2005). Interactive effects of time and vegetation on reproduction of redshanks<br />
(Tringa totanus) breeding in Wadden Sea salt marshes. Journal of Ornithology, 146, 215-<br />
225.<br />
TRAUTNER J., MÜLLER-MOTZFELD G. & BRÄUNICKE M. (1998). Rote Liste der Sandlaufkäfer und<br />
Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). 2. Fassung, Stand Dezember 1996. In:<br />
Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe Landschaftspflege und<br />
Naturschutz 55 (ed. Bundesamt für Naturschutz), pp. 159-167.<br />
ZEHM A., NOBIS M. & SCHWABE A. (2003). Multiparameter analysis of vertical vegetation structure<br />
based on digital image processing. Flora, 198, 142-160.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 154 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7 TEILPROJEKT 1B: ENTWICKLUNG UND BEWERTUNG VON<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
MANAGEMENTSTRATEGIEN ZUR TREIBSELREDUZIERUNG<br />
Dipl. Landschaftsökol. Antje Bremermann, Julia Schwienheer; Dipl.-Ing. Martin<br />
Sprötge (<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong>) & Prof. Dr. Michael Kleyer (Uni Oldenburg)<br />
7.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG DES TEILPROJEKTS 1B<br />
Unter Verwendung der Ergebnisse des Teilprojektes 1A „Dokumentation und Analyse der<br />
Ausgangssituation sowie Aufbereitung der Informationen für die Teilprojekte 2 und 3“ (Kapitel<br />
4) sowie des Teilprojektes 2 „Zusammenhänge zwischen Umweltbedingungen,<br />
Biomasseproduktion und <strong>Treibsel</strong>menge in Deichvorländern der Küste und Ästuare“ (Kapitel<br />
5) sollen Vorlandbereiche identifiziert werden, die im besonderen Maße für die Entstehung<br />
von <strong>Treibsel</strong> verantwortlich sind.<br />
Auf Grundlage der in den Teilprojekten gewonnenen Erkenntnissen, Fachgesprächen<br />
innerhalb und außerhalb des projektbegleitenden Ausschusses sowie von geplanten oder<br />
umgesetzten Vorhaben im Rahmen anderer Projekte sollen Management-Optionen<br />
erarbeitet werden, die für ein Vorlandmanagement zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung in Frage<br />
kommen.<br />
Für diese Management-Optionen soll anhand der Ergebnisse des Teilprojektes 3<br />
„Habitatmodelle für charakteristische Vogelarten der niedersächsischen Salzwiese“<br />
(Kapitel 6) für die Salzwiesen eine naturschutzfachliche Bewertung der unterschiedlichen<br />
Management-Optionen erfolgen. Für die Ästuare sollen entsprechende Bewertungen<br />
durchgeführt werden, wobei hier für die Avifauna nicht auf die in Teilprojekt 3 ermittelten<br />
Daten zurückgegriffen werden kann. Die entsprechenden Daten sind aber im Gegensatz zu<br />
denen der Salzwiese, über Literaturrecherche erhältlich. Ursache hierfür ist, dass sich in den<br />
Salzwiesen mit zunehmender Nutzungsintensität das Arteninventar langsam und<br />
kontinuierlich verändert. In den Ästuaren findet hingegen durch eine Nutzung von Röhrichten<br />
ein weitgehender Artenaustausch statt. Die Ergebnisse der Bewertung zeigen auf, welche<br />
Management-Optionen auf einzelnen Vegetationstypen naturschutzfachlich wie zu bewerten<br />
wäre.<br />
Für die detailliert untersuchten Flächen sollen modellhafte Managementkonzepte entwickelt<br />
und Prognosen der zu erwartenden Biomasse-, und damit der potenziellen<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung, erstellt werden. Des Weiteren sollen die modellhaften<br />
Managementkonzepte naturschutzfachlich bewertet werden, welche auf Grundlage eines<br />
Leitbildes erfolgt, welches für den gesamten Betrachtungsraum definiert wurde.<br />
7.2 „SCHWERPUNKTBEREICHE“ VORLANDMANAGEMENT<br />
7.2.1 EINLEITUNG<br />
TREISBSELREDUZIERUNG<br />
Für ein effektives Management zur Reduzierung von <strong>Treibsel</strong> ist zunächst die Identifizierung<br />
von Vorlandbereichen, die für lokal hohe <strong>Treibsel</strong>aufkommen maßgeblich verantwortlich<br />
sind, erforderlich.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 155<br />
<strong>Treibsel</strong>anlandungen an Deichabschnitten werden im Wesentlichen durch zwei Faktoren<br />
beeinflusst:<br />
1. der stehenden Biomassemenge zur Sturmflutsaison auf den vorgelagerten<br />
Vorländern<br />
2. und dem Biomasseaustrag (Abriss und Verdriftung der Biomasse bis an den<br />
Deichfuß).<br />
Die Biomassemenge der Vorlandflächen wird durch den Aufwuchs, die evtl. Entnahme durch<br />
Landnutzung und durch die Tiefe des Vorlandes bestimmt und ergibt das Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung. Das Potenzial des Biomasseaustrages, welches durch den<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall nach den Sturmfluten dokumentiert wird, hängt im Wesentlichen von der Lage<br />
des Vorlandes ab, aber auch von den Eigenschaften der Vegetation (Standhaftigkeit<br />
gegenüber Wellenenergie).<br />
Die Wahrscheinlichkeit der <strong>Treibsel</strong>anlandung wird für den gesamten Betrachtungsraum auf<br />
Grundlage der oben genannten Parameter ermittelt. Als Ergebnis werden untereinander<br />
vergleichbare Vorlandabschnitte in Bereiche unterschiedlichen Potenzials der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung (hoch/mäßig/gering) auf Grundlage der stehenden Biomasse definiert.<br />
Des Weiteren werden Bereiche ausgewiesen, in denen sowohl ein hohes Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung als auch ein hohes Potenzial an Biomasseaustrag besteht. Diese werden<br />
im Folgenden als Bereiche hoher <strong>Treibsel</strong>entstehung bezeichnet. Da für diese Bereiche ein<br />
Management zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung besonders effektiv wäre, wurden diese als<br />
„Schwerpunktbereiche Vorlandmanagement <strong>Treibsel</strong>reduzierung“, kurz „Schwerpunkt-<br />
Bereiche“, ausgewiesen (Abbildung 48).<br />
Aufwuchs Biomasseentnahme<br />
Stehende Biomassemenge<br />
gering<br />
Potenzial<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
Bereich geringer/mittlerer<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
mittel, gering<br />
mäßig hoch<br />
hoch<br />
Vorlandtiefe Lage Vegetationseigenschaften<br />
Bereich hoher<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
Schwerpunktbereich<br />
Vorlandmanagement<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall 2006/2007<br />
hoch<br />
kein bis sehr viel<br />
Potenzial<br />
Biomasseaustrag<br />
mittel, gering<br />
Bereich geringer /mittlerer<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
Abbildung 48: Ermittlung von Schwerpunktbereichen für Vorlandmanagement zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 156 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7.2.2 METHODIK<br />
Die Ermittlung der „Schwerpunktbereiche“ erfolgte in drei Arbeitsschritten. Dabei wurden<br />
zunächst anhand eines standardisierten Verfahrens untereinander vergleichbare<br />
Deichabschnitte gebildet. Für diese Vorlandabschnitte wurde die Menge der stehenden<br />
Biomasse pro Deichmeter bestimmt, um die Bereiche zu analysieren, in denen ein hohes<br />
Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung besteht. Für die Vorlandflächen mit einem hohen Potenzial<br />
der <strong>Treibsel</strong>entstehung wurde eine eingehende Analyse (auf Grundlage des tatsächlichen<br />
<strong>Treibsel</strong>anfalls nach den Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 und der Lage des Vorlandes)<br />
vorgenommen, um das Potenzial des Biomasseaustrages einzuschätzen. Anhand der<br />
Potenziale der <strong>Treibsel</strong>entstehung und des Biomasseaustrages wurden Bereiche hoher<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung und somit die „Schwerpunktbereiche“, ermittelt (vgl. Abbildung 48).<br />
7.2.2.1 ERZEUGUNG VON STANDARDISIERTEN DEICHABSCHNITTEN<br />
Zur Erzeugung von standardisierten Deichabschnitten wurden zunächst die Küsten- und die<br />
Ästuaruferlinie des gesamten Betrachtungsraumes im GIS entlang der Deichlinie in 2 km<br />
lange Abschnitte segmentiert.<br />
In einem weiteren Bearbeitungsschritt wurden die Vorländer an den Endpunkten der 2 km<br />
langen Abschnitte senkrecht zur Hauptdeichlinie unterteilt. Als Ergebnis liegen somit<br />
Vorlandabschnitte mit einheitlicher Deichlinienlänge vor.<br />
7.2.2.2 BERECHNUNG DER STEHENDEN BIOMASSE VON<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
VORLANDABSCHNITTEN<br />
Zur Identifizierung der Vorlandbereiche mit einer hohen stehenden Biomasse, also einem<br />
hohen Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung, wurde zunächst die stehende Biomasse im Herbst<br />
pro Vorlandabschnitt berechnet (Datengrundlage stehende Biomasse 2006, vgl. Kapitel<br />
5.2.2.2).<br />
Für die jeweiligen Vorlandabschnitte wurde dann die „stehende Biomasse pro Deichmeter“<br />
berechnet (gemäß der nachfolgenden Formel), um eine vergleichbare Bezugsgröße zu<br />
erhalten.<br />
Formel zur Berechnung der stehenden Biomasse pro Deichmeter:<br />
StehendeBiomasseHerbst<br />
g<br />
m²<br />
* Vorlandfläche<br />
( m²)<br />
2000m<br />
Deichlinie<br />
StehendeBiomassepro<br />
lfd.<br />
m Deichlinefür<br />
den gesamten Vorlandabschnitt<br />
Hohe Werte stehender Biomasse pro laufenden Meter Deichlinie für die jeweiligen<br />
Vorlandabschnitt, im Folgenden stehende Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt), lassen<br />
sich dementsprechend auf besonders produktive Vegetationsbestände mit hoher stehender<br />
Biomasse und/oder auf eine ausgedehnte Vorlandfläche zurückführen.<br />
Um Vorlandabschnitte zu definieren, in denen ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
besteht, wurde die stehende Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt) einer dreistufigen
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 157<br />
Skala (hoch/mäßig/gering) zugeordnet. Die Zuordnung orientiert sich an der statistischen<br />
Verteilung der Werte stehender Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt).<br />
Da sich die Verteilung der Werte der stehenden Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt) an<br />
der Festlandsküste und der Ästuare nicht signifikant unterscheidet (U-Test: p-Wert >0,05),<br />
werden für beide Bereiche gleiche Grenzwerte für die Zuordnung verwendet (Abbildung 49).<br />
Abbildung 49: Streuung der Werte der stehenden Biomasse Herbst (kg/lfd. m) an der<br />
Festlandsküste und der Ästuare im Vergleich<br />
Darstellung mit Hilfe von sog. Boxplots. Die schwarzen Querbalken geben den Median an, die Box<br />
entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50 % der Daten liegen. Innerhalb der vertikalen Linien<br />
(Whiskergrenzen) und der Box liegen 95 % aller beobachteten Werte.<br />
Ein hohes Potenzial hinsichtlich der <strong>Treibsel</strong>entstehung wurde für alle Abschnitte mit mehr<br />
als 246 kg Biomasseproduktion pro laufenden Deichmeter (Werte oberhalb des oberen<br />
Quantils, 25 % der Werte) definiert. Ein mittleres Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung besteht<br />
für die Abschnitte mit 141-246 kg/lfd. m (oberes Quantil, 25 % der Werte) und ein geringes<br />
für alle Vorlandabschnitte mit weniger als 141 kg/lfd. m (unteres Quantil bis Minimumwert,<br />
50 % der Werte) (Abbildung 50).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 158 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
hoch = > 246 kg / lfd. m<br />
mäßig = 141 – 246 kg / lfd. m<br />
gering = < 141 kg / lfd. m<br />
Abbildung 50: Streuung aller Werte der stehenden Biomasse Herbst pro Deichabschnitt<br />
(kg/lfd. m) und Zuordnung des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
Darstellung mit Hilfe von sog. Boxplots, Erläuterung s. Abbildung 49<br />
7.2.2.3 ERMITTLUNG VON “TREIBSEL-SCHWERPUNKTBEREICHEN“<br />
Die Vorlandabschnitte, die mit einer stehenden Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt) von<br />
mehr als 246 kg/lfd. m ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung aufweisen, wurden einer<br />
eingehende Analyse unterzogen. Diese erfolgte anhand eines Abgleichs mit dem<br />
tatsächlichen <strong>Treibsel</strong>anfall nach den Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 (Kapitel 4.4)<br />
sowie der Lage des Vorlandabschnittes. Hierbei wurde, unter Berücksichtigung der<br />
vorliegenden Ergebnisse zum <strong>Treibsel</strong>anfall, eine fachliche Einschätzung vorgenommen, ob<br />
für die Vorlandbereiche mit einem hohen Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung auch ein hohes<br />
Potenzial des Biomasseaustrages besteht. Dieses liegt z.B. in exponierten Lagen vor, wo die<br />
Vorlandvegetation einer hohen Wellen- und Strömungsenergie ausgesetzt ist und keine<br />
Vegetationsbestände bestehen, die <strong>Treibsel</strong> bei Sturmfluten vor dem Deichfuß abfangen.<br />
Solche Vorlandbereiche mit hohem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung und hohem Potenzial<br />
des Biomasseaustrages wurden als „Schwerpunktbereiche“ ausgewiesen. Vorlandbereiche<br />
hingegen, die zwar ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung aufweisen, aber z.B.<br />
aufgrund einer geschützten Buchtenlage nur ein geringes Potenzial des Biomasseaustrages<br />
aufweisen, welches auch durch die <strong>Treibsel</strong>anfalldaten der Jahre 2006 und 2007 bestätigt<br />
wurde, werden nicht als „Schwerpunktbereich“ definiert.<br />
Bei den Ästuaren wurden die Vorländer beider Uferseiten in ihrer Gesamtheit betrachtet, da<br />
ein hoher Biomasseaustrag aus den Vorländern der einen Uferseite den <strong>Treibsel</strong>anfall auf<br />
der anderen Uferseite maßgeblich beeinflussen kann.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 159<br />
7.2.3 ERGEBNISSE<br />
7.2.3.1 ÜBERBLICK<br />
Das Ergebnis der Einstufung von Vorlandabschnitten hinsichtlich des Potenzials der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung ist in Abbildung 51 dargestellt.<br />
Diese Grafik zeigt, dass Vorlandbereiche mit einem hohen Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
über den gesamten Betrachtungsraum verteilt sind, sich aber deutliche Häufungen dieser<br />
Abschnitte erkennen lassen.<br />
Die durchschnittlichen Werte der stehenden Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt) sind<br />
im Weserästuar (243 kg/lfd. m) und im Bereich der Festlandsküste mit 192 kg/lfd. m am<br />
höchsten. Die Ems zeichnet sich mit 120 kg/lfd. m durch die niedrigsten Durchschnittswerte<br />
der stehenden Biomasse (pro lfd. m je Vorlandabschnitt) aus. Dementsprechend ist die<br />
Anzahl an Vorlandabschnitten mit hohem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung in diesem Ästuar<br />
geringer als in den anderen Teilbereichen. Dabei ist hier zu berücksichtigen, dass die<br />
Vorlandflächen häufig eine geringere Ausdehnung haben, insbesondere im Vergleich zu dem<br />
Weserästuar mit den tiefen Vorlandbereichen und großflächigen Weserinseln. Ferner ist<br />
auffällig, dass es im Verlauf der Ems einen kleinteiligeren Wechsel zwischen<br />
Vorlandabschnitten mit hohem und geringem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung gibt. Andere<br />
Abschnitte an der Weser oder entlang der Festlandsküste stellen sich diesbezüglich<br />
wesentlich homogener dar.<br />
Maximalwerte treten in den Ästuaren der Weser und Elbe auf. Hier kommt es in einigen<br />
Abschnitten zu Maximalwerten von über 1000 kg/lfd. m im Bereich des<br />
Schwarztonnensandes im Elbästuar und über 970 kg/lfd. m auf der Strohauser Plate im<br />
Weserästuar.<br />
Erwartungsgemäß befinden sich Vorlandabschnitte mit hohem Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung in den Bereichen, in denen das Vorland sehr großflächig ausgeprägt ist,<br />
so zum Beispiel im Bereich bei Tettens, an der Wurster Küste, in der Leybucht oder im<br />
Norderland. Dass jedoch eine sehr hohe stehende Biomasse auch bei vergleichsweise<br />
kleinen Vorlandflächen zu einem hohen Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung führen kann, wird<br />
beispielsweise an den Vorländern bei Harlesiel oder am Rysumer Nacken deutlich.<br />
Die Abbildung 51 zeigt, neben dem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung der jeweiligen<br />
Vorlandabschnitte, die Mittelwerte des <strong>Treibsel</strong>anfalls nach den Novemberfluten der Jahre<br />
2006 und 2007. Der Vergleich zwischen dem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung und den<br />
angeschwemmten <strong>Treibsel</strong>mengen zeigt in einigen Fällen Abweichungen.<br />
Ein Beispiel hierfür befindet sich im westlichen Jadebusen bei Cäciliengroden: Obwohl in<br />
dem breiten Vorlandgürtel im Herbst fiel Biomasse steht und somit ein hohes Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung vorliegt, viel für die entsprechenden Deichabschnitte nach den<br />
Sturmfluten der Jahre 2006/2007 nach den Angaben des Deichbandes kein <strong>Treibsel</strong> an.<br />
Ausschlaggebend hierfür dürfte die geschützte Buchtenlage am Rande der Hauptströmung<br />
sein. Aufgrund der geringen Wellen- und Strömungsenergie wird die Vegetation nicht<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 160 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
losgerissen und es entsteht kein <strong>Treibsel</strong>. In diesem Bereich von einem<br />
„Schwerpunktbereich“ zu sprechen, ist darum nicht gerechtfertigt. Ähnlich verhält es sich im<br />
Süden der Ems zwischen Aschendorf und Papenburg sowie die an der Elbe bei Freiburg<br />
sowie dem Hahnhöfer Sand (vgl. Abbildung 51).<br />
Der entgegengesetzte Fall liegt hingegen in Vorlandbereichen der Krummhörn nördlich der<br />
Emsmündung vor. Hier wurde sehr viel angelandetes <strong>Treibsel</strong> gemeldet, das Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung ist jedoch überwiegend auf mittlerem Niveau. Als Ursache kann in<br />
diesem Fall Verdriftung von <strong>Treibsel</strong> aus umliegenden Vorlandbereichen weitestgehend<br />
ausgeschlossen werden, da auch dort – mit Ausnahme der Leybucht – eher geringes bis<br />
kein Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung vorliegt. Eine Verdriftung von <strong>Treibsel</strong> aus der<br />
Leybucht, also in südwestlich Richtung aus der Bucht heraus, ist eher unwahrscheinlich.<br />
Mögliche Ursachen könnten<br />
sein.<br />
eine weiträumige Verdriftung von <strong>Treibsel</strong> (z.B. niederländischer Vorländer) kann<br />
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, ist aber aufgrund unserer Ergebnisse<br />
(vgl. Kapitel 5.4) eher unwahrscheinlich,<br />
die Lage und Westexposition dieser Vorlandabschnitte (hohe Wellen- und<br />
Strömungsenergie),<br />
die subjektive Schätzung der <strong>Treibsel</strong>mengen<br />
7.2.3.2 „TREIBSEL-SCHWERPUNKTBEREICHE“<br />
Vorlandbereiche mit hohem Potenzial an <strong>Treibsel</strong>entstehung und hohem Potenzial des<br />
Biomasseaustrages wurden als „Schwerpunktbereiche“ ausgewiesen (vgl. Kapitel 7.2.2.3<br />
und 7.2.3.1).<br />
Als „Schwerpunktbereich“ (in der Abbildung 51 rot eingekreist) werden Bereiche, die<br />
definiert.<br />
zusammenhängende Vorlandabschnitte mit mittlerem und hohem Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung, von denen mindestens zwei Vorlandabschnitte ein hohes<br />
Potenzial aufweisen und<br />
im Mittel mindestens mäßig viel <strong>Treibsel</strong>anlandung nach den Sturmfluten 2006/2007<br />
aufweisen,<br />
Die Abbildung 51 zeigt, dass sich nach dieser Definition elf „Schwerpunktbereiche“<br />
ausmachen lassen. Der größte „Schwerpunktbereich“ befindet sich im Bereich des<br />
Weserästuars. Hier kommen alle Faktoren, die einen „Schwerpunktbereich“ bedingen,<br />
zusammen: große Vorlandflächen, hohe stehende Biomasse im Herbst und vergleichsweise<br />
hohe Strömungsintensitäten (vertiefter Ästuarunterlauf). Zwar ist der <strong>Treibsel</strong>anfall an der<br />
linken Weserdeichlinie für ausgedehnte Deichstrecken gering, aber - wie unter Kapitel<br />
7.2.2.3 erläutert - werden in den Ästuaren die Vorländer beider Uferseiten bei der<br />
Ausweisung von Schwerpunktbereichen als Gesamtheit betrachtet. Da in dem als<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 161<br />
Schwerpunktbereich markierten Weserabschnitt mindestens auf einer Weserseite<br />
Vorlandbereiche mit hohem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung und im Mittel mindestens<br />
mäßig viel <strong>Treibsel</strong>anlandung nach den Sturmfluten 2006/2007 aufweisen, wurde dieser<br />
Abschnitt im Gesamten als Schwerpunktbereich ausgewiesen.<br />
Überwiegende Vorlandbereiche des Jadebusens – mit Ausnahme der westlichen Bucht –<br />
sind ebenfalls als „Schwerpunktbereich“ einzustufen. Wie auch bei dem zuvor genannten<br />
„Schwerpunktbereich“ im Weserästuar sind auch hier die drei Faktoren große<br />
Vorlandflächen, hohe stehende Biomasse im Herbst und vergleichsweise hohe<br />
Strömungsintensitäten (bedingt durch Lage und Form der Bucht) entscheidend. Gleiches trifft<br />
auch für den „Schwerpunktbereich“ in der Leybucht zu.<br />
Die Lage sämtlicher „Schwerpunktbereiche“ ist Abbildung 51 zu entnehmen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 162 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 51: Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung von Vorlandabschnitten, Mittelwerte des<br />
<strong>Treibsel</strong>anfalls nach den Novemberfluten der Jahre 2006 und 2007 und „<strong>Treibsel</strong>-<br />
Schwerpunktbereiche“<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 163<br />
7.2.4 DISKUSSION<br />
Für Vorlandflächen des gesamten Betrachtungsraumes konnte eine Unterteilung in<br />
untereinander vergleichbare Abschnitte und eine Einstufung dieser Vorlandabschnitte<br />
hinsichtlich des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung vorgenommen werden. Auf Grundlage<br />
eines Abgleichs des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung von Vorlandbereichen und dem<br />
tatsächlichen <strong>Treibsel</strong>anfall nach den Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 an den<br />
entsprechenden Deichstrecken konnten 11 „Schwerpunktbereiche“ abgeleitet werden. Diese<br />
„Schwerpunktbereiche“ zeigen auf, in welchen Bereichen ein Management zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung am erforderlichsten und effektivsten wäre. Vorlandbereiche mit hoher<br />
stehender Biomasse im Herbst stellen generell ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung<br />
dar. Welcher Anteil der Biomasse bei einer Sturmflut jedoch tatsächlich als <strong>Treibsel</strong> aus den<br />
Vorländern ausgetragen wird, hängt von vielen Faktoren (u.a. Vegetationsbestand,<br />
Vegetationsstruktur, Höhenlage, Exposition, Windrichtung) ab und kann in einem derart<br />
dynamischen System kaum prognostiziert werden. Daher wurde hier der allgemeine Ansatz,<br />
hohe stehende Biomasse im Herbst gleich hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung, gewählt.<br />
Die Ausweisung von „Schwerpunktbereichen“ basiert auf einem halbsystematischen Ansatz<br />
(Kapitel 7.2.2). Durch diese Methode wird bis zu einem gewissen Grad gewährleistet, dass<br />
für alle Vorlandbereiche des Betrachtungsraumes eine vergleichbare Auswertung hinsichtlich<br />
der Schwere der <strong>Treibsel</strong>problematik (viel <strong>Treibsel</strong>entstehung und –anfall) erfolgt. Die<br />
Bildung von 2 km langen Deichabschnitten, die als Auswertungsgrundlage diente, wurde<br />
vorgenommen, um großräumige „Schwerpunktbereiche“ darzustellen, da insbesondere diese<br />
Bereiche für ein <strong>Treibsel</strong>-Management in Betracht kommen. Kleinräumige Bereiche mit viel<br />
<strong>Treibsel</strong>entstehung und –anfall, die für die betroffenen Deichverbände durchaus ein Problem<br />
hinsichtlich des Küstenschutzes und Deichunterhaltung darstellen können, werden bei<br />
diesem Bewertungsansatz nicht als „Schwerpunktbereich“ - im Sinne von großräumigen<br />
<strong>Treibsel</strong>problembereichen - betrachtet. Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung sind<br />
selbstverständlich auch hier in Betracht zu ziehen.<br />
Die Grenzen der Vorlandabschnitte, die sich durch die einheitlichen 2 km langen Abschnitte<br />
ergeben, orientieren sich folglich nicht an naturräumlichen Gegebenheiten. So grenzt<br />
mitunter ein Vorlandabschnitt mit geringem Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung an einen mit<br />
hohem Potenzial, wobei die Grenze durch einen Vorlandbereich verläuft, der - kleinräumig<br />
betrachtet - ein vergleichbares Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung aufweist. Hinsichtlich der<br />
Fragestellung dieses Forschungsvorhabens, großräumige „Schwerpunktbereiche“ für die<br />
gesamte niedersächsische Küste und der Ästuare Ems, Elbe und Weser mit insgesamt rund<br />
610 km Deichlinie aufzuzeigen, sind diese Details jedoch unerheblich.<br />
7.3 MANAGEMENT-OPTIONEN<br />
7.3.1 EINLEITUNG<br />
Aufgabenstellung des Teilprojektes 1B ist u.a. die Entwicklung von Management-Optionen<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung. In diesem Kapitel werden die Management-Optionen wertfrei<br />
dargestellt, die im Rahmen dieses Projektes erarbeitet wurden und als treibselreduzierende<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 164 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Maßnahme für Vorländer der niedersächsischen Festlandsküste und Ästuare grundsätzlich<br />
in Betracht kommen.<br />
7.3.2 METHODIK<br />
Als mögliche Management-Option wurden zunächst alle derzeit praktizierten Maßnahmen<br />
berücksichtigt (z.B. Beweidung mit 0,5-1,5 Rindern pro Hektar, Mahd im Sommer, Röhricht-<br />
Mahd im Winter), um diese hinsichtlich ihrer Effizienz zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung zu betrachten<br />
und einer naturschutzfachlichen Bewertung zu unterziehen. Des Weiteren wurden<br />
Management-Optionen einbezogen, die derzeit nicht praktiziert werden, aber immer wieder<br />
von verschiedenen Interessensvertretern zur Diskussion gestellt werden (wie z.B.<br />
Beweidung mit mehr als 1,5 Rindern pro Hektar oder intensive Schafbeweidung), um hier<br />
eine wissenschaftliche Diskussionsgrundlage und Entscheidungshilfe vorlegen zu können.<br />
Es wurden auch Management-Optionen betrachtet, deren Praktikabilität derzeit nicht<br />
endgültig geklärt ist, die aber möglicherweise in naher Zukunft in Betracht gezogen werden<br />
können. Hierunter sind die Management-Optionen zu verstehen, bei denen eine<br />
energetische Verwendung von Vorlandsubtraten vorgesehen wird, auch wenn verschiedene<br />
Aspekte (Verwendbarkeit des Substrates, Erfordernisse an das Substrat, Menge und<br />
Verfügbarkeit) noch zu klären sind. Da bereits bei den Landkreisen erste Anfragen vorliegen<br />
und Forschungsarbeiten zu diesen Fragestellungen laufen, ist die Realisierung nicht<br />
auszuschließen. Um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen, scheint eine Bewertung<br />
dieser Management-Optionen ebenfalls erforderlich.<br />
Die bisher erwähnten Management-Optionen unterliegen ausnahmslos einer Landnutzung.<br />
Es werden aber auch Management-Optionen betrachtet, die nicht auf einer<br />
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung basieren, sondern auf natürlichen Prozessen beruhen.<br />
Auf Grundlage der im Teilprojekt 2 (Kapitel 5) gewonnenen Erkenntnisse über die<br />
Zusammenhänge von Produktivität und Standorteigenschaften sowie auf Grundlage von<br />
weiteren Praxis- und Forschungsarbeiten wurden Management-Optionen entwickelt, bei<br />
denen eine Biomassereduzierung über Änderungen des hydrologischen Systems oder<br />
„Prozessschutz“ erfolgen soll.<br />
Somit setzt sich die Gesamtheit der hier aufgeführten Management-Optionen aus solchen<br />
zusammen, die<br />
derzeit praktiziert werden,<br />
häufig im Zusammenhang mit „<strong>Treibsel</strong>reduzierung“ zur Diskussion gestellten<br />
werden,<br />
zukünftig möglich erscheinen, aber deren Realisierbarkeit noch nicht endgültig geklärt<br />
ist,<br />
auf natürlichen Prozessen, wie Änderung des hydrologischen Systems oder<br />
Prozessschutz, beruhen.<br />
Die Management-Optionen wurden auf Grundlage von Kenntnissen bereits angewendeter<br />
Landnutzungen, der in den Teilprojekten gewonnenen Erkenntnisse, Fachgesprächen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 165<br />
innerhalb und außerhalb des projektbegleitenden Ausschusses sowie von geplanten oder<br />
umgesetzten Vorhaben im Rahmen anderer Projekte erarbeitet.<br />
Grundsätzlich sind die Management-Optionen zwei Strategien zuzuordnen: Management-<br />
Optionen, bei denen die Biomassereduzierung<br />
durch eine Landnutzung bedingt ist (Strategie „Kultureinfluss“),<br />
auf natürlichen Prozessen beruht (Strategie „Natürliche Dynamik“).<br />
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens sind die oben genannten Strategien wie folgt<br />
definiert:<br />
Strategie „Natürliche Dynamik“<br />
Das Grundmotiv der Strategie „Natürliche Dynamik“ sieht eine Entwicklung auf Grundlage<br />
natürlicher Prozesse bei möglichst geringem anthropogenen Einfluss vor. Dies bedeutet im<br />
Wesentlichen das Fehlen (momentaner) menschlicher Nutzung sowie einen hohen Grad<br />
natürlicher Selbstorganisation. Es ist normativ abgesichert durch die FFH-Richtlinie<br />
(FFH-RL) und das BNatSchG und im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer über<br />
§ 2 (1) des Nationalparkgesetzes. Die Deicherhaltung gemäß NDG (§ 5) ist dabei<br />
sicherzustellen.<br />
Strategie „Kultureinfluss“<br />
Unter Berücksichtigung der Erhaltung der besonderen Eigenart von Natur und Landschaft<br />
sowie deren Funktionalität soll hier ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung im<br />
Sinne des NWattNPG bzw. der entsprechenden Schutzgebietsverordungen durchgeführt<br />
werden. Hierunter sind auch Bodennutzungen zu verstehen, die über pflegende Maßnahmen<br />
im naturschutzfachlichen Sinne hinausgehen und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen.<br />
Ob eine Beweidung als extensiv bezeichnet werden kann, ist weniger an der absoluten Zahl<br />
der Tiere pro Flächeneinheit festzumachen als vielmehr standortbezogen an den<br />
Auswirkungen der Beweidung auf die Vegetation. BAKKER et al. (2005: 169) verwenden<br />
deshalb folgende Definitionen, auf die sich auch die folgenden Ausführungen zur<br />
Nutzungsintensität beziehen:<br />
extensive Beweidung: Muster von Bereichen kurzer und hoher Vegetation,<br />
intensive Beweidung: durchgängig kurze Vegetationsdecke.<br />
7.3.3 ERGEBNISSE<br />
Insgesamt wurden 15 Management-Optionen als biomassereduzierende Strategien - und<br />
damit auch potenziell treibselreduzierend - herausgearbeitet. Davon wird bei 10<br />
Management-Optionen die Biomassereduzierung durch Landnutzungsstrategien erreicht, 5<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 166 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
entfallen auf Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen<br />
Prozessen beruht (Tabelle 54). Dieser Tabelle ist auch zu entnehmen, für welche<br />
Vorlandbereiche (Festland, Ästuar) die Management-Optionen vorzusehen sind, auf welchen<br />
Vegetationseinheiten diese biomassereduzierend wirken und eine Prognose der<br />
Biomassereduzierung in Prozent (im Vergleich zu brachliegenden Flächen).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Management zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
Management-Typ Management-Option<br />
Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung durch Landnutzung bedingt ist (Strategie Kultureinfluss)<br />
Beweidung<br />
(ausgehend von einer Beweidung bis in<br />
den Herbst)<br />
Mahd<br />
Festlandsküste<br />
Ästuare<br />
Beweidung mit 0,5 - 1,0 Rindern/ha x x • x x x x - x x • 20 20 25 10 -100 40 50<br />
Beweidung mit 1,5 Rindern/ha x x • x x x x x x x • 70 70 25 30 90 75 75<br />
Beweidung mit Rindern 2 - 3 Rindern/ha** x x • x x x x x x x • 90 90 70 50 90 90 90<br />
Beweidung mit < 3 Schafen/ha x x • x x x x - x x • 20 20 25 10 -100 40 50<br />
Beweidung mit 3 - 6 Schafen/ha** x x • x x x x x x x • 90 90 80 90 90 90 90<br />
Salzwiesen-Mahd bis August/September<br />
(landw. Verwendung des Mahdguts)<br />
Salzwiesen-Mahd bis September/Oktober<br />
(landwirtschaftliche oder energetische Verwendung des Mahdguts)<br />
Pionierzone<br />
Untere Salzwiese<br />
Halimione<br />
Obere Salzwiese<br />
Quecke<br />
Grünland<br />
Schilf<br />
Sonstiges Röhricht<br />
x x • x x x x x x x • 40 40 25 40 60 70 40<br />
x x • x x x x x x x • 90 90 80 90 90 80 90<br />
Röhricht-Mahd Winter (Verwendung des Mahdguts zur Dachdeckung) - x • • • • • • - • • • • • • • 0 •<br />
Röhricht-Mahd (energetische Verwendung des Mahdguts) - x • • • • • • x x • • • • • • 70-90 70-90<br />
Schlegeln/Mulchen Schlegeln/Mulchen (Spätsommer/Herbst) x x • x x x x x • x • 10 10 10 5 10 • 10<br />
Management-Option, bei denen Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen beruht (Strategie Natürliche Dynamik)<br />
Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses<br />
"Prozessschutz"<br />
Weiden-Auwaldentwicklung<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses<br />
durch Änderung des hydrologischen Systems und Wassereinstau<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses<br />
durch Bodenabtrag<br />
"passiver Prozessschutz"<br />
(Nutzungsaufgabe, Aufgabe der Unterhaltung von Entwässerungssystemen)<br />
"aktiver Prozessschutz"<br />
(Nutzungsaufgabe, Verfüllung von Entwässerungsgräben)<br />
Auwaldanpflanzung zur <strong>Treibsel</strong>vermeidung (Dämpfung der Strömungsenergie,<br />
Biomassereduzierung) und <strong>Treibsel</strong>fänger (<strong>Treibsel</strong> wird vor dem Deichfuß<br />
abgefangen)<br />
Eignung Effektivität zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
bei Anwendung auf die Vegetationseinheit …<br />
x x x x x x x - - - 80 50 50 50 50 -200 0 -100<br />
x x x x x x x - - - 100 80 70 30 50 -200 0 -100<br />
x x - x x x x - - - 0 30 20 20 20 -200 0 -100<br />
x x - x x x x - - - 0 30 20 50 30 -200 0 -100<br />
- x • • • • • • x x • • • • • • 30 30<br />
*: ausgehend von einem vorherigen Brachestadium, Zeitpunkt Herbst, Prognose beruht auf den Ergebnissen des Teilprojektes 2 (Verweis Kapitel 5), **: innerhalb der Brutsaison Beweidung mit < 2 Rindern bzw. 3 Schafen/ha<br />
x : trifft zu; - : trifft nicht zu; • : keine Bewertung; (x): trifft zu, sofern dauerhafte Pflege vorgesehen wird<br />
Tabelle 54: Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung mit Angabe der prognostizierten Biomassereduzierung<br />
Pionierzone<br />
Untere Salzwiese<br />
Biomassereduzierung [%]<br />
bei Anwendung auf die Vegetationseinheit… *<br />
Halimione<br />
Obere Salzwiese<br />
Quecke<br />
Grünland<br />
Schilf<br />
Sonstiges Röhricht
Seite 168 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Nachfolgend werden alle in der Tabelle 54 aufgeführten Management-Optionen erläutert. Es<br />
erschließt sich von selbst, dass die jeweiligen Management-Optionen nur an dafür<br />
geeigneten Standorten anwendbar sind. So ist zum Beispiel der Management-Typ<br />
„Erhöhung des Salzeinflusses und der Überflutungshäufigkeit bzw. –dauer“ in der<br />
Pionierzone oder „Prozessschutz“ auf Quecken-Rasen wenig zielführend.<br />
Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung durch eine Landnutzung<br />
bedingt ist (Strategie Kultureinfluss)<br />
Management-Typ: Beweidung<br />
Für alle Management-Optionen der Kategorie „Beweidung“ ist eine Entwässerung der<br />
Flächen erforderlich. Begrüppung führt zu einer beschleunigten Bodenentwicklung (kürzere<br />
Verweildauer des Wassers, stärkeres Abtrocknen des Bodens, schnellere Bodenentwicklung<br />
durch erhöhte Bodendurchlüftung), die wiederum zu einer beschleunigten Sukzession der<br />
Vegetation führt (ERCHINGER et al. 1994, FÜHRBÖTER et al. 1992). Dies bedeutet einen<br />
schnelleren Übergang der Vegetation zu den Beständen der oberen Salzwiese und somit<br />
letztlich auch ein früheres Auftreten von artenarmen, biomassereichen Dominanzbeständen.<br />
Daher sollte das Ausmaß der Entwässerung nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert<br />
werden, wobei natürlich die Deichfußentwässerung gewährleistet bleiben muss.<br />
Die Management-Optionen „Beweidung mit x Rindern pro Hektar“ können alternativ auch<br />
durch Beweidungen mit Pferden erfolgen. Hierbei sind allerdings etwas geringere<br />
Beweidungsintensitäten anzusetzen, da Pferde aktiver sind und somit mehr Vertritt<br />
verursachen.<br />
Grundsätzlich sollten für die Vorlandbeweidung vorzugsweise Alttiere von mind. 2 Jahren<br />
vorgesehen werden, da diese im Vergleich zu Jungtieren weniger aktiv sind und sich ruhiger<br />
verhalten. Dadurch wird weniger Tritt verursacht und die Gefahr, dass Brutgelege zerstört<br />
werden, wird verringert. Zudem wird durch die Beweidung mit ausgewachsenen Tieren das<br />
Verhältnis „hohe Biomasseentnahme – wenig Tritt“ optimiert. Nachfolgende Management-<br />
Optionen des Typs „Beweidung“ gehen von der Beweidung mit Alttieren aus.<br />
Die Angaben der Tierzahlen bei den Beweidungsintensitäten sind nicht als absolute Zahlen<br />
zu verstehen, da sich diese je nach Standorteigenschaften sehr unterschiedlich auswirkten<br />
können. So stellt beispielsweise eine Beweidung mit 1,5 Rindern/ha in einer unteren<br />
Salzwiese eine höhere Intensität der Beweidung dar als in der oberen Salzwiese, da der<br />
feuchtere Boden weniger Tritt verträgt und weniger Biomasse verfügbar ist. Daher ist<br />
weniger die Tierzahl als vielmehr die Ausprägung der Vegetationsstruktur, welche durch die<br />
Beweidung entsteht, entscheidend.<br />
Bei hohen Beweidungsintensitäten auf großflächigen Vorlandbereichen kann die Anzahl der<br />
erforderlichen Weidetiere sehr groß sein. In diesem Fall ist die Herde ggf. in kleinere<br />
Einzelherden aufzuteilen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 169<br />
Beweidung mit 0,5 – 1,0 Rindern pro Hektar<br />
Eine Beweidung mit 0,5 – 1,0 Rindern pro Hektar erfolgt derzeit auf knapp 8 % Prozent<br />
der Vorlandflächen des Betrachtungsraumes. Sie stellt eine sehr extensive Landnutzung<br />
dar, welche eine strukturell heterogene Vegetationsausprägung, Muster von Bereichen<br />
kurzer und hoher Vegetation, bedingt, wobei Bereiche niedriger Vegetation<br />
- insbesondere bei einer Beweidungsintensität von 0,5 Rindern/ha - nur sehr kleinflächig<br />
ausgeprägt sind. Von Flächenanteilen mit kurzer Vegetation bzw. einem geringen Verbiss<br />
profitieren einige der wertgebenden Tier- und Pflanzenarten der Natura 2000 Gebiete<br />
(Richtlinie 92/43/EWG Anhang IV, 79/409EWG Anhang I), so dass diese Management-<br />
Option vorrangig aus Artenschutz<strong>grün</strong>den durchgeführt wird.<br />
Beweidung mit 1,5 Rindern pro Hektar<br />
Eine Beweidung mit einer Intensität von 1,5 Rindern pro Hektar wird derzeit auf den<br />
Vorlandflächen der Festlandsküste angewendet und macht nur 0,2 % der Vorlandfläche<br />
des gesamten Betrachtungsraumes aus. Bei dieser Beweidungsintensität prägt sich eine<br />
Vegetationsstruktur mit sowohl kleinräumig durchgängig kurzen Vegetationsdecken (meist<br />
Vegetationsbestände, die von den Weidetieren bevorzugt werden) neben hochwüchsigen<br />
Bereichen (Vegetationsbestände, die von den Weidetieren gemieden werden, wie z.B.<br />
Quecken-Rasen), die weniger intensiv beweidet werden aus. Demzufolge ist diese<br />
Beweidungsintensität einer extensiven Beweidung (im Sinne von BAKKER et al. (2005))<br />
zuzurechnen.<br />
Beweidung mit 2,0-3,0 Rindern pro Hektar<br />
Eine Beweidung mit 2,0-3,0 Rindern pro Hektar wird im Betrachtungsraum derzeit nicht<br />
praktiziert. Auf Teilflächen kann durch selektives Grasen der Rinder eine derart hohe<br />
Beweidung entstehen, obwohl die Gesamtbeweidung nur bei 1,5 Rindern pro Hektar liegt.<br />
Allerdings machen diese intensiv befressenen Flächen nur einen sehr kleinen Teil einer<br />
Weide aus. Bei einer Beweidungsintensität von 2-3 Rindern pro Hektar wäre der<br />
Beweidungsdruck bereits derart hoch, dass nahezu alle Vegetationsbestände<br />
abgefressen werden und daraus eine durchgängige kurze Vegetationsdecke resultiert und<br />
somit eine intensive Beweidung vorliegt.<br />
Durch eine intensive Beweidung kommt es neben der vollständigen Veränderung der<br />
Vegetationsstruktur zu einer sehr starken Störung der Brutvögel durch die Weidetiere, die<br />
zu deutlich erhöhtem Stress der Brutvögel führen kann. Zudem wäre ein direkter<br />
Gelegeverlust aufgrund des starken Viehtritts wahrscheinlich. Eine derartige Störung der<br />
Bruthabitate wäre mit den Zielen des Nationalparks nicht vereinbar, weshalb für die<br />
Brutsaison die Beweidungsintensität auf höchstens 1,5 Rinder/ha vermindert werden<br />
muss. Sofern Arten gefördert werden sollen, die eine heterogene Struktur als Bruthabitat<br />
präferieren, ist die Beweidungsintensität entsprechend frühzeitig zu mindern. Nach dem<br />
Brutzeitraum ist die Beweidungsintensität wieder auf 2 – 3 Rinder/ha zu erhöhen, um die<br />
stehende Biomasse bis zur Strumflutsaison deutlich zu minimieren.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 170 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Brutvögel ergeben sich durch eine temporär hohe<br />
Beweidungsintensität zwei Vorteile: zum einen werden die direkten negativen<br />
Auswirkungen des Beweidungseinflusses auf die Brutvögel während der Brutsaison<br />
reduziert, zum anderen können Quecken-Rasen durch die intensive Beweidung<br />
zugunsten stärker präferierter Vegetationstypen verdrängt werden.<br />
Diese Management-Option wird als effektive treibselreduzierende Maßnahme häufig zur<br />
Diskussion gestellt. Um das Maß der Biomassereduzierung und die naturschutzfachlichen<br />
Auswirkungen bewerten zu können, wird diese Management-Option hier berücksichtigt.<br />
Beweidung mit < 3 Schafen pro Hektar "extensiv"<br />
Eine Beweidung mit höchstens 2 Schafen pro Hektar, die als extensive Beweidung<br />
(resultierende Vegetationsstruktur: Muster von Bereichen kurzer und hoher Vegetation)<br />
angesehen werden kann (SEIBERLING ET AL. 2009), findet im Betrachtungsraum nach den<br />
vorliegenden Nutzungsdaten auf gut 0,4 % der Vorlandflächen statt. Die extensive<br />
Beweidung mit Schafen ist auch auf größeren Flächen denkbar und wird daher als<br />
Management-Option betrachtet.<br />
Beweidung mit 3-6 Schafen pro Hektar "intensiv"<br />
Eine Beweidung mit 3 bis 6 Schafen pro Hektar kann als intensive Beweidung<br />
(resultierende Vegetationsstruktur: durchgängig kurze Vegetationsdecke) angesehen<br />
werden (SEIBERLING ET AL. 2009) und findet im Betrachtungsraum derzeit auf knapp 0,3 %<br />
der Vorlandflächen des Betrachtungsraumes statt.<br />
Die unter der Management-Option „Beweidung mit 2 – 3 Rindern/ha“ beschriebenen<br />
Auswirkungen einer intensiven Beweidung gelten auch für eine intensive<br />
Schafbeweidung. Daher ist auch bei dieser Management-Option für den Zeitraum der<br />
Brutsaison die Beweidungsintensität auf höchstens 2 Schafe/ha zu vermindern. Sofern<br />
Arten gefördert werden sollen, die eine heterogene Struktur als Bruthabitat präferieren, ist<br />
die Beweidungsintensität entsprechend frühzeitig zu mindern. Nach dem Brutzeitraum ist<br />
die Beweidungsintensität wieder auf 3 – 6 Schafe/ha zu erhöhen, um die stehende<br />
Biomasse bis zur Strumflutsaison wieder zu minimieren.<br />
Da diese Management-Option - wie auch die intensive Beweidung mit Rindern oder<br />
Pferden - als effektive treibselreduzierende Maßnahme diskutiert wird, soll diese<br />
Management-Option hier betrachtet werden, um das Maß der Biomassereduzierung und<br />
die naturschutzfachlichen Auswirkungen zu bewerten.<br />
Management-Typ: Mahd<br />
Für die Management-Optionen der Kategorie „Mahd“ auf Salzwiesen ist, wie auch bei der<br />
Beweidung, in der Regel eine Entwässerung der Flächen erforderlich. Da die Auswirkungen<br />
der für die Mahd notwendigen Begrüppung denen der Begrüppung für die Beweidung<br />
entsprechen, sollte diese ebenfalls auf ein Mindestmaß reduziert werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 171<br />
Eine Röhricht-Mahd zum Zweck der <strong>Treibsel</strong>reduzierung sollte nach Möglichkeit jährlich<br />
durchgeführt werden, da die Produktivität von Schilf durch eine Mahd zunimmt (vgl. Kapitel<br />
5.2.3.4). Zugleich verliert das Schilf an Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost, Wellenschlag<br />
oder Eisschur, da die Halme dünner und weniger steif sind (BJÖRNDAHL, 1985; OSTENDORP,<br />
1987; VALKAMA et al., 2008). Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bei mechanischer<br />
Belastung Pflanzenmaterial abgetragen und somit <strong>Treibsel</strong>material freigesetzt wird.<br />
Salzwiesen-Mahd bis August/September (landwirtschaftliche Verwendung des Mahdguts)<br />
Salzwiesen-Mahd findet derzeit auf den Vorländern der Festlandsküste und den Ästuaren<br />
auf etwa 13 % der Vorländer des gesamten Betrachtungsraumes statt. Teilweise werden<br />
diese Flächen mit Rindern, Pferden oder Schafen nachbeweidet. Das Mahdgut dient vor<br />
allem der Heu-, Heulage- und Silagegewinnung. Vereinzelt wird eine Mahd auch dazu<br />
genutzt, um die Vegetation in einen für die Weidetiere attraktiveren Zustand zu versetzen,<br />
oder um Schneisen niedriger Vegetation bis zur Vorlandkante zu schaffen, die von den<br />
Tieren genutzt werden. Meist erfolgt die Mahdnutzung einschürig im Juli oder August.<br />
Teilweise wird auch eine zweite Mahd, meist im September, durchgeführt.<br />
Aus treibselreduzierender Sicht sollte die Mahd möglichst spät erfolgen, da der Aufwuchs<br />
nach einer einmaligen Mahd im Juli bis zur Sturmflutsaison erheblich ist. Da hier aber<br />
landwirtschaftliche Interessen (Verwendung des Mahdguts als möglichst hochwertiges<br />
Futter) berücksichtigt werden, richtet sich der Mahdzeitpunkt überwiegend nach den<br />
Wetterverhältnissen, wodurch eine Mahd bis in den August/September nicht immer<br />
möglich ist.<br />
Salzwiesen-Mahd bis September/Oktober (energetische/landwirtschaftliche Verwendung)<br />
Der wesentliche Unterschied dieser Management-Option zur Salzwiesen-Mahd möglichst<br />
bis August/September ist der Mahdzeitpunkt der letzten Mahd. Diese sollte, sofern dies<br />
die Wetterverhältnisse erlauben, möglichst im September/Oktober erfolgen, so dass auf<br />
den Flächen bis zur Sturmflutsaison nur noch wenig Biomasse aufwachsen kann. Ob<br />
hierbei eine ein- oder mehrschürige Mahd erfolgt und für welche Zwecke das Mahdgut<br />
verwendet wird, ist zunächst unerheblich. Neben einer landwirtschaftlichen Verwendung<br />
(zumindest des 1. Schnittes, ggf. auch des 2. Schnittes) ist eine energetische<br />
Verwendung des Mahdguts (als nachwachsender Rohstoff, als Neben-, ggf. sogar<br />
Hauptsubstrat) denkbar. Auch wenn die für die Bioenergiegewinnung erforderliche<br />
Infrastruktur (Biogasanlagen, Verfügbarkeit von Co-Substraten, Lagerungskapazitäten,<br />
Wärmenutzungskonzept) bzw. Gesamtkonzepte derzeit weitestgehend nicht vorhanden<br />
sind, gibt es bereits zahlreiche Ansätze der Bioenergiegewinnung im Küstenraum im<br />
allgemeinen und speziell auch für die Verwendung von salzhaltigen Substraten, so dass<br />
diese Management-Option im Rahmen dieses Projektes nicht unberücksichtigt bleiben<br />
soll.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 172 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Sofern weder eine landwirtschaftliche noch eine energetische Verwendung möglich ist,<br />
kann eine Nachweide eine Alternative darstellen, welche abhängig von der Wetterlage bis<br />
Mitte/Ende September erfolgen kann.<br />
Röhricht-Mahd im Winter (Verwendung für Dachdeckung)<br />
Eine Röhricht-Mahd, bei der das Mahdgut zum Zweck der Dachdeckung verwendet wird,<br />
wird derzeit vor allem im Weserästuar praktiziert. Sie macht nach den vorliegenden<br />
Nutzungsdaten weniger als 1 % der Ästuar-Vorlandflächen und knapp 3 % der Ästuar-<br />
Röhrichte aus. Um das Mahdgut für die Dachdeckung verwenden zu können und auch<br />
aus Gründen der Zugänglichkeit der Röhrichtflächen zur Mahd, wird die Mahd nach den<br />
ersten Frösten, also in der Regel im Januar/Februar, durchgeführt. Diese Maßnahme wirkt<br />
nur dann treibselreduzierend, wenn die erste Sturmflut der Saison nach der Röhricht-<br />
Mahd erfolgt. Häufig treten die ersten Sturmfluten aber bereits im Herbst ein, so dass<br />
diese Maßnahme nur sehr bedingt als treibselreduzierend betrachtet werden kann. Die<br />
Biomassereduzierung dieser Management-Option ist in der Tabelle 54 mit 0 %<br />
angegeben, da hier der Zustand zum Zeitpunkt Herbst betrachtet wurde, also noch keine<br />
Mahd erfolgt ist.<br />
Röhricht-Mahd im Herbst (energetische Verwendung)<br />
Der Unterschied dieser Management-Option zur Röhricht-Mahd im Winter ist wiederum<br />
der Mahdzeitpunkt. Um die Biomasse vor der Sturmflutsaison aus den Vorlandflächen zu<br />
entfernen, ist hier eine Mahd im September/Oktober vorgesehen. Da zu diesem Zeitpunkt<br />
die Vorlandflächen nicht gefroren sind und damit die Zugänglichkeit der Röhrichte<br />
erschwert ist, sind hierfür geeignete Mähgeräte erforderlich. Das Mahdgut ist nicht für die<br />
Dachdeckung geeignet, da die Halme noch nicht vollständig abgestorben sind und somit<br />
die erforderliche Widerstandsfähigkeit des Erntegutes nicht gegeben ist. Eine<br />
Verwendung als Substrat für Biogasanlagen oder für eine thermische Verwertung wäre<br />
allerdings denkbar; Anfragen diesbezüglich sind beim LK Wesermarsch bereits<br />
eingegangen (mündliche Auskunft Landkreis Wesermarsch).<br />
Management-Typ: Schlegeln/Mulchen<br />
Auf Initiative des Niedersächsischen Umweltministeriums (MU) wurden im Spätsommer 2008<br />
im Verbandsgebiet des II. Oldenburgischen Deichbandes bislang ungenutzte Salzwiesen mit<br />
dem Ziel der <strong>Treibsel</strong>reduzierung geschlegelt (d.h. Mahd, grobe Zerkleinerung und Verbleib<br />
des Schlegelguts auf der Fläche). Daher soll diese Management-Option auch im Rahmen<br />
dieses Forschungsvorhabens betrachtet werden. Zwischen der NLP-V und dem Deichband<br />
wurde die Durchführung eines mehrjährigen Monitorings vereinbart. Ein Abschlussbericht ist<br />
für das Jahr 2013 vorgesehen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 173<br />
Schlegeln/Mulchen<br />
Mit einem Schlegelmäher wird die Vegetation bis etwa 10 cm über Geländeniveau<br />
abgemäht. Das Schlegelgut besteht aus ca. etwa 5-10 cm langen, klein gehäckselten<br />
Pflanzenbestandteilen, die nicht abgeräumt werden, sondern auf der Fläche verbleiben.<br />
Ein früher Mahdzeitpunkt ermöglicht eine weitreichende Mineralisierung des<br />
Schlegelgutes, allerdings ist die Zerkleinerung des Pflanzenmaterials aufgrund des<br />
geringen Verholzungsgrades schwierig und die Menge der nachwachsenden Biomasse<br />
kann erheblich sein. Ein später Schlegelzeitpunkt kann hingegen bei sehr frühen<br />
Sturmfluten zu erheblichen <strong>Treibsel</strong>mengen am Deich führen, da das unmineralisierte<br />
Schlegelgut leicht aufschwemmt und verdriftet wird. Der ideale Schlegelzeitpunkt soll im<br />
Rahmen des oben genannten Monitorings ermittelt werden.<br />
Alternativ zum Schlegeln ist auch ein Mulchen des Pflanzenmaterials denkbar. Hierbei<br />
werden die Pflanzenteile deutlich stärker zerkleinert. Die Problematik hinsichtlich des<br />
günstigsten Zeitpunktes verhält sich beim Mulchen ähnlich wie beim Schlegeln.<br />
Durch ein spätes Mulchen, wodurch bereits verholzte Pflanzenteile leichter bzw. feiner zu<br />
zerkleinern sind, werden Prozesse der Zersetzung und Mineralisierung beschleunigt,<br />
allerdings besteht auch hier die Gefahr von hohen <strong>Treibsel</strong>anlandungen. Erste<br />
Erfahrungen der Management-Optionen werden in Kapitel 7.3.4 erläutert.<br />
Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen<br />
beruht (Strategie Natürliche Dynamik)<br />
Bei allen Management-Optionen dieser Kategorie hat die Deichfußentwässerung höchste<br />
Priorität und ist bei jeder Planung zu berücksichtigen. Bei der Anwendung des Management-<br />
Typs „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ oder „Prozessschutz“ ist ein<br />
Mindestabstand zum Deichkörper von 100 m einzuhalten. Für diese deichparallelen<br />
Vorlandstreifen sind die oben genannten Landnutzungs-Management-Optionen denkbar.<br />
Zudem muss eine deichparallele Entwässerung gewährleistet sein, welche unabhängig von<br />
dem hydrologischen System der seewärts gelegenen Flächen funktioniert.<br />
Management-Typ: Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses<br />
Bei den Management-Optionen des Typs „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ wird<br />
eine Reduzierung der Biomassemenge durch eine Erhöhung der Überflutungshäufigkeit bzw.<br />
-dauer und somit des Salzeinflusses erreicht. Die Ergebnisse des Teilprojektes 2 (Kapitel<br />
5.2.3.2) haben diese Zusammenhänge dargelegt. Dieser Management-Typ sollte vor allem in<br />
Bereichen der oberen Salzwiese Anwendung finden, da hier eine natürliche Dynamik<br />
aufgrund von Entwässerungsmaßnahmen nur noch gering ausgeprägt ist.<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des hydrologischen Systems<br />
Weite Bereiche der Vorlandflächen sind durch ausgedehnte anthropogene<br />
Entwässerungssysteme geprägt. Dies gilt auch für ehemals genutzte Flächen, die bereits<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 174 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
seit langer Zeit brachgefallen sind, da sich das Entwässerungssystem über lange<br />
Zeiträume erhält. Die mittelbaren Folgen sind u.a. eine beschleunigte Sukzession und<br />
damit eine Förderung der Dominanzen von Arten, die das Ende der Sukzessionsreihen<br />
darstellen und eine besonders hohe Produktivität zeigen (Quecke Elytrigia spp.) (CROOKS<br />
et al. 2002). Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist eine Änderung des<br />
hydrologischen Systems, mit dem Ziel der Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses,<br />
erforderlich. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahme bedarf einer sorgfältigen,<br />
standortspezifischen Planung. Möglichkeiten der Änderung des hydrologischen Systems<br />
und des Wassereinstaus sind z.B. Umfunktionierung der Entwässerungssysteme zu<br />
Bewässerungssystemen (immer unter Berücksichtigung der Deichfußentwässerung),<br />
Anbindung von Senken an das Bewässerungssystem, gezielte Bodenumlagerungen zur<br />
Lenkung des Abfluss- bzw. Zuflussregimes.<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag<br />
In hoch gelegenen Vorlandbereichen, in denen die Flächen nur noch einige Male im Jahr<br />
überflutet werden, wodurch der Wasser- und Salzeinfluss entsprechend gering ist und<br />
sich infolgedessen großflächige Quecken-Rasen ausdehnen können, ist ein flächenhafter<br />
Bodenabtrag eine mögliche Management-Option. Durch den Bodenabtrag wird zum einen<br />
der Dominanzbestand mitsamt dem überwiegenden Anteil der Rhizome entfernt und<br />
gleichzeitig ein Höhenniveau geschaffen, welches eine deutliche Erhöhung der<br />
Überflutungshäufigkeit/–dauer und somit des Salzeinflusses bedingt und dadurch einer<br />
erneuten Ausbreitung der Quecke entgegenwirkt. Anstelle dessen würden sich abhängig<br />
von der neu geschaffenen Höhenlage naturnähere Gesellschaften der unteren Salzwiese<br />
(ggf. auch der Pionierzone und der oberen Salzwiese) entwickeln, die weniger produktiv<br />
sind.<br />
Diese Management-Option ist ausschließlich für Bereiche mit vergleichsweise geringer<br />
naturschutzfachlicher Wertigkeit vorzusehen (großflächige Quecken-Dominanzbestände),<br />
da nur in diesen Bereichen von einer deutlichen naturschutzfachlichen Wertsteigerung<br />
ausgegangen werden kann. Nur die Annahme einer deutlichen Verbesserung der<br />
naturschutzfachlichen Wertigkeit kann eine flächenhafte Veränderung der Boden- und<br />
Vegetationsstrukturen in den Salzwiesen rechtfertigen.<br />
Management-Typ: „Prozessschutz“<br />
Ein biomassereduzierender Effekt wird bei den Management-Optionen des Management-<br />
Typs „Prozessschutz“ durch die gleichen Einflüsse wie beim Management-Typs „Erhöhung<br />
des Wasser- und Salzeinflusses“ (s. oben) erreicht. Allerdings ist die Biomassereduzierung<br />
bei diesem Management-Typ geringer, da durch reinen Prozessschutz nur eine geringere<br />
Erhöhung der Überflutungshäufigkeit/-dauer und damit des Salzeinflusses erreicht werden<br />
kann. Demzufolge ist die Anwendung dieses Management-Typs vorwiegend auf<br />
Vorlandbereichen der unteren Salzwiese, ggf. auf naturnahen Ausprägungen der oberen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 175<br />
Salzwiese vorzusehen, da diese Maßnahme eine Entwicklung zu reinen, sehr produktiven<br />
Quecken-Rasen aufhalten bzw. verhindern kann.<br />
Im Unterschied zum Management-Typ „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ sind<br />
Management-Optionen des Typs „Prozessschutz“ vor allem für Vorlandbereiche vorzusehen,<br />
die<br />
die höhere naturschutzfachliche Wertigkeiten aufweisen, die eine flächenhafte<br />
Veränderung von Boden- und Vegetationsstrukturen nicht rechtfertigen,<br />
eine Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses aufgrund standörtlicher, technischer<br />
Voraussetzungen nicht möglich sind.<br />
Bei den Management-Optionen des Management-Typs „Prozessschutz“ besteht die Gefahr,<br />
dass sich auf wenig wasser- und salzbeeinflussten Flächen arten- und strukturarme<br />
Vegetationsbestände ausbilden. Auf diesen Flächen wäre aus artenschutzrechtlichen<br />
Aspekten eine Pflegebeweidung denkbar. Allerdings sind hier naturschutzmotivierte<br />
Beweidungsformen vorzusehen, die einer naturnahen Weidelandschaft entsprechen (keine<br />
Entwässerung, großflächige extensive genutzte Weidebereiche, Einsatz von geeigneten<br />
Rassen). Veterinärrechtliche und tierschutzrechtliche Bestimmungen sind hierbei zu<br />
berücksichtigen.<br />
„passiver Prozessschutz“<br />
Unter "passivem Prozessschutz" wird hier die Aufgabe bzw. der Unterlass von<br />
Landnutzung, Entwässerung (Ausnahme Deichfußentwässerung) und anderen<br />
anthropogenen Eingriffen verstanden. Bestehende Entwässerungssysteme werden nicht<br />
zurückgebaut aber auch nicht mehr unterhalten, so dass diese den natürlichen Prozessen<br />
der Erosion und Sedimentation ausgesetzt sind. Allerdings erhalten sich anthropogen<br />
angelegte Entwässerungssysteme über sehr lange Zeiträume und es ist bislang nicht<br />
geklärt, bis zu welchem Grad diese Veränderungen reversibel sind (s.a. Kapitel 7.3.4).<br />
„aktiver Prozessschutz“<br />
Unter "aktivem Prozessschutz“ wird hier, neben der Aufgabe bzw. dem Unterlass der<br />
Landnutzung und der Entwässerung, die „aktive“ Aufgabe des bestehenden<br />
Entwässerungssystems durch vollständige Verfüllung von Entwässerungsgräben und ggf.<br />
Initialisierung von Prielsystemen vorgesehen. Durch die „aktive“ Aufgabe des<br />
Entwässerungssystems wird der natürlichen Rückbildung der Entwässerungssysteme,<br />
sofern sie überhaupt erfolgen würde, vorgegriffen und so die Entwicklung zu naturnäheren<br />
Ausprägungen beschleunigt.<br />
Auwaldentwicklung<br />
In den ausgedehnten Röhricht-Beständen der Ästuar-Vorländer, mit einer sehr hohen<br />
stehenden Biomasse, besteht für exponierte Lagen bei einer Sturmflut ein sehr hohes<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 176 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung. In diesen Bereichen ist eine Entwicklung von Auwald<br />
zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung vorstellbar. Ein ausgedehnter Auwaldbereich oder auch<br />
Auwaldstreifen, flussseitig des Röhrichtgürtels gelegen, dämpft zum einen die Strömungs-<br />
und Wellenenergie, wodurch das Potenzial des Biomasseaustrages (Abriss von Röhricht)<br />
verringert wird. Zum anderen wirkt der Auwaldstreifen als <strong>Treibsel</strong>fänger, so dass frei<br />
treibendes <strong>Treibsel</strong> aus anderen Bereichen vom Deichkörper ferngehalten wird. Zudem<br />
wird durch die Entwicklung von Auwaldgebüsch auf derzeitigen Röhrichtbeständen und<br />
durch die Beschattung von Röhrichten und Hochstauden das Potenzial der<br />
<strong>Treibsel</strong>enstehung verringert.<br />
Um die Deichsicherheit zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand der Auwaldbereiche zum<br />
Deichkörper von 50 m vorzusehen. Somit ist gewährleistet, dass eine Beschattung von<br />
Deich<strong>grün</strong>land, die zur Zerstörung der Grasnarbe führen könnte, ausgeschlossen ist.<br />
Auch ein direkter Totholzeintrag ist somit ausgeschlossen. Ein Pflegeschnitt der<br />
Weichholzauen, um potenzielles Treibholz zu vermeiden, kann im Einzelfall in Betracht<br />
gezogen werden, ist aber voraussichtlich nicht erforderlich, da das Treibholz in einem<br />
dicht stehenden Auwaldstreifen ebenfalls größtenteils abgefangen wird.<br />
Bei der Initialpflanzung ist ein dichter Pflanzabstand vorzusehen. Dadurch wird<br />
gewährleistet, dass sich ein reiner Auwaldbestand ausbildet, der aufgrund der geringen<br />
Stammzwischenräume als <strong>Treibsel</strong>fänger fungieren kann. Bei größeren Abständen<br />
besteht die Gefahr der Röhrichtausbreitung im Unterwuchs. Zudem können größere<br />
Mengen <strong>Treibsel</strong> ungehindert durch einen lichten Auwaldbereich treiben. Je nach<br />
Pflanzmaterial sollte eine Pflege des Auwaldbereiches in Form von Röhricht-Mahd und<br />
ggf. Pflegeschnitt vorgesehen werden, um die Etablierung des Auwaldes, welcher in<br />
Konkurrenz zu den Röhricht-Beständen steht, zu begünstigen.<br />
Für die Initialpflanzungen innerhalb des Überflutungsbereiches werden vorwiegend Salix-<br />
Arten als Strauch- wie auch Baumweiden, vorgesehen, da diese Art in oft<br />
überschwemmten, wenig beeinflussten Tieflandauen vorherrscht (vgl. Kapitel 7.3.4).<br />
Baumweiden sind weniger standhaft, weshalb sie nur in geschützteren Lagen vorgesehen<br />
werden sollten. Von Anpflanzungen der Schwarz-Pappel (Populus nigra) wird abgesehen,<br />
da sie höchstwahrscheinlich von Natur aus im nordwestlichen Tiefland fehlen würde.<br />
Zudem werden sie in überschwemmten Flussauen bei Stürmen leicht umgeworfen<br />
(ELLENBERG, 1986), wodurch sich der Anteil an Totholz erhöhen würde. Arten der<br />
Hartholzauen, die sich im Auenbereich ab ca. 2 m oberhalb des MThw entwickeln können<br />
(KURZ 1997 in OSTERKAMP 2006, KESEL 1999), sollten für Initialpflanzungen weniger<br />
feuchter, sandiger Bereiche ebenfalls vorgesehen werden. Hier kommen vor allem<br />
Baumarten wie Esche, Stieleiche, Flatterulme und Feldahorn in Betracht (mündliche<br />
Auskünfte Fachhochschule Bremen).<br />
Geeignete Standorte für Auwälder sind Höhenlagen, die sowohl mehrmals monatlich als<br />
auch nur wenige Male im Jahr bei Sturmfluten überschwemmt werden. Generell sind<br />
Standorte mit überwiegend sandigen Böden eher für eine Etablierung von Auwäldern<br />
geeignet, da hier das Salz leicht ausgewaschen wird und eine bessere Bodendurchlüftung<br />
erfolgt (KURZ 1997). An der Elbe haben sich schon kurz oberhalb der MThw-Linie<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 177<br />
Weidengebüschsäume angesiedelt, die häufigen Überflutungen ausgesetzt sind, während<br />
höher gelegene Bereiche am Übergang zum sich anschließenden Grünland nur etwa ein<br />
Dutzend Mal im Jahr unter Wasser stehen (KURZ 1997). Nach OSTERKAMP (2006) könnte<br />
sich eine Weichholzaue entlang der Unterweser aufgrund des Salzeinflusses vermutlich<br />
nur bis Brake (ca. Uw-km 40) und auf den dem Tideeinfluss entzogenen Spülfeldern noch<br />
bis zur Tegeler Plate und Kleinensieler Plate (ca. Uw-km 50) etablieren. Nach KAISER et<br />
al. (2003) stellen Auwaldkomplexe auf den Vorländern des Weserästuars flussaufwärts<br />
von Sandstedt (bei Brake), des Emsästuars von Leerort und im Elbeästuar von Krautsand<br />
(bei Glückstadt) die potenziell natürliche Vegetation dar. Für die Vorlandflächen im häufig<br />
überfluteten Bereich sind Weiden-Weichholz-Auwald mit kleinflächig vorgelagerten<br />
Zweizahnfluren und Röhrichten, in den weniger feuchten Bereichen Eichen-Ulmen-<br />
Auwald, Traubenkirschen-Erlen-Eschen-Auwald oder feuchter bis nasser Eichen-<br />
Hainbuchenwald als potenziell natürliche Vegetation zu erwarten (KAISER et al. 2003).<br />
Allerdings werden die Ästuare v.a. durch den Ausbau als Schifffahrtsstraßen<br />
(Begradigung und Vertiefung) derart nachhaltig anthropogen beeinflusst, dass eine<br />
Prognose der potenziell natürlichen Vegetation der Vorlandflächen unter den derzeitigen<br />
Bedingungen kaum möglich ist (mündliche Auskünfte Fachhochschule Bremen).<br />
Da über die Etablierung von Hartholzarten in Ästuaren unter den derzeitigen Bedingungen<br />
wenig Kenntnisse vorliegen, sollten auch bei Initialplanzungen in häufig überfluteten<br />
Bereichen kleine Gruppen von Hartholzarten angepflanzt werden, um die<br />
Ausbreitungsgrenzen hinsichtlich verschiedener Standortbedingungen untersuchen zu<br />
können. Die konkrete Artenauswahl dieser Management-Variante und das Vorgehen zur<br />
Etablierung dieser Arten erfordern im Rahmen von Ausführungsplanungen weitere<br />
standortbezogene Recherchen.<br />
Für alle Management-Optionen gilt, dass im Rahmen von Ausführungsplanungen eine<br />
Konkretisierung, ggf. standortbezogene Anpassung der Optionen erforderlich ist. Sofern für<br />
Management-Optionen nur wenige Erfahrungen aus der Praxis vorliegen, sind ggf. weitere<br />
Untersuchungen erforderlich, auf jeden Fall ist aber ein geeignetes Monitoring zur<br />
Erfolgskontrolle durchzuführen.<br />
7.3.4 DISKUSSION<br />
Die Beweidung der Vorlandflächen als eine Form der Landnutzung wird seit historischer Zeit<br />
praktiziert und auf den Festlandssalzwiesen auch seit der Gründung des Nationalparks<br />
Niedersächsisches Wattenmeer im Jahr 1986 im Sinne der Nationalparkziele fortgeführt.<br />
Eine Beweidung führt, neben den Auswirkungen der dafür notwendigen Entwässerung<br />
(Kapitel 0), zu einer Trittbelastung des Bodens durch die Weidetiere und somit zu<br />
veränderten Bodeneigenschaften. Diese führen zu einer Beeinflussung der Geschwindigkeit<br />
der Bodenentwicklung, die wiederum einen ökologischen Schlüsselfaktor darstellt, da sie<br />
maßgeblich die Ausprägung der Vegetation eines Standortes bestimmt. Während die<br />
Begrüppung durch erhöhte Bodendurchlüftung zu einer Beschleunigung der<br />
Bodenentwicklung führt, bewirkt die Beweidung durch Bodenverdichtung eine Verzögerung<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 178 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
der Bodenentwicklung. Diese beiden Faktoren wirken also in gewisser Weise gegeneinander<br />
(PGG 2008).<br />
Die Geschwindigkeit der Bodenentwicklung und damit der Vegetationsentwicklung hin zu<br />
Beständen der oberen Salzwiese und somit letztlich auch zum Auftreten von artenarmen<br />
Dominanzbeständen wird also stark von der Intensität der Begrüppung und der Beweidung<br />
beeinflusst. Demzufolge sollte die Begrüppung auf ein erforderliches Minimum reduziert<br />
werden. Das Maß der Beweidungsintensität ist hingegen etwas differenzierter zu betrachten,<br />
da eine hohe Beweidungsintensität zwar die Bodenentwicklung verlangsamt, sich aber auch<br />
- vor allem bei hohen Beweidungsintensitäten - negativ auswirken kann (u.a. homogene<br />
Vegetationsstruktur, Zerstörung der Vegetationsdecke, Vertritt von Gelegen, Verringerung<br />
der Nahrungsressourcen für Brutvögel). Um die Auswirkungen unterschiedlicher<br />
Beweidungsintensitäten aus treibselreduzierender und naturschutzfachlicher Sicht zu<br />
bewerten, wurden sehr extensive (0,5 – 1,0 Rinder bzw. < 3 Schafe/ha), extensive<br />
(1,5 Rinder/ha) und intensive (2-3 Rinder bzw., 3-6 Schafe/ha) Beweidungen betrachtet.<br />
Die Auswirkungen unterschiedlicher Beweidungsintensitäten bzw. Landnutzungen auf die<br />
Stabilität der tonigen Festlands-Vorländer wurden von PGG (2008) nach FÜHRBÖTER et al.<br />
(1992) wie folgt zusammengefasst:<br />
Größere flächige Erosion tritt bei keiner Nutzungsform auf, auch nicht unter<br />
Brachebedingungen.<br />
Die Begrüppung des Vorlandes im Bereich der unteren Salzwiese führt zu einer<br />
erhöhten Stabilität des Bodens (beschleunigte Bodenentwicklung, somit zu einer<br />
beschleunigten Ausbildung eines Krümelgefüges; ferner Durchbrechen der<br />
sturmflutbedingten Schichtung des Bodens, die Schichten sind untereinander<br />
schlecht verbunden und begünstigen Erosion).<br />
Die Beweidung des Vorlandes verringert die Stabilität des Bodens (wenigstens im<br />
Bereich der unteren Salzwiese), da die Bodenentwicklung verlangsamt wird.<br />
Umgekehrt bedeutet die Einstellung der Beweidung somit keinesfalls einen Verlust an<br />
Bodenstabilität.<br />
Extensiv beweidete oder ungenutzte grasdominierte Vegetationsbestände bieten<br />
aufgrund der Elastizität und Dichtheit der Vegetation den höchsten Erosionsschutz.<br />
Dies dürfte auch für gemähte Flächen gelten.<br />
Bezüglich der Wechselwirkungen von Begrüppung und extensiver Beweidung und der<br />
resultierenden Auswirkung auf die Stabilität des Vorlandes existieren jedoch unterschiedliche<br />
Ansichten. Die Autoren der Teilberichte des sog. KFKI-Gutachtens zur Erosionsfestigkeit von<br />
Hellern kommen zu folgenden Schlüssen:<br />
Führböter et al. (1992) kommt für das Teilprojekt Hydromechanik und Hydraulik zum<br />
Ergebnis, dass die höchste Stabilität in begrüppten, extensiv beweideten Bereichen<br />
gemessen wurden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 179<br />
Frank (1994) kommt für das Teilprojekt Boden zu dem Ergebnis, dass die durch "die<br />
Begrüppung bewirkten bodenstabilisierenden Effekte bereits durch extensive<br />
Beweidung deutlich limitiert werden".<br />
Steinke (1994) stellt für das Teilprojekt Botanik fest, dass "die Anzahl der Wurzeln auf<br />
ungenutzten Salzwiesen besonders in den oberen Bereichen des Bodens stets höher<br />
(ist) als auf den beweideten Flächen. Die Abnahme der Durchwurzelungsintensität<br />
bei Beweidung wird hierdurch bestätigt.“<br />
Die Frage, ob brachliegende oder begrüppte, extensiv beweidete Vorländer eine höhere<br />
Stabilität aufweisen, scheint demnach nicht eindeutig zu beantworten zu sein. Einig sind sich<br />
die Autoren jedoch darüber, dass eine intensive Beweidung der Stabilität des Vorlandes<br />
abträglich ist.<br />
Die Salzwiesen-Mahd bis in den August/September wird in Niedersachsen ebenfalls seit<br />
langer Zeit praktiziert. Eine spätere Mahd hingegen wurde bislang nicht durchgeführt, da das<br />
Mahdgut in erster Linie als Futter aufbereitet wird. Bei einer Mahd im September/Oktober ist<br />
mit feuchteren Wetterlagen und älterem (z.T. verholzten) Pflanzenmaterial zu rechnen,<br />
welches für die Futteraufbereitung geringwertiger ist. Demzufolge sind für die Verwendung<br />
des Mahdguts Alternativen, wie z.B. der energetischen Verwendung, vorzusehen. Aufgrund<br />
der Entwicklungen im Bereich regenerativer Energiegewinnung könnte die Verwendung<br />
dieses Mahdguts zukünftig durchaus von Interesse sein, so dass diese Management-Option<br />
im Rahmen dieses Projektes nicht unberücksichtigt bleiben soll.<br />
Ähnlich verhält es sich mit dem Mahdgut, welches bei der Röhricht-Mahd gewonnen wird.<br />
Auch hier soll eine energetische Verwendung des Mahdguts aus den oben genannten<br />
Gründen nicht außer Acht gelassen werden. Die Röhricht-Mahd ist allerdings aufgrund der<br />
naturschutzrechtlichen Gesetzgebung nur in sehr begrenztem Maße durchführbar. Das<br />
Mahdgut könnte demzufolge lediglich als Zusatzsubstrat, neben anderen Hauptsubstraten,<br />
für den Betrieb von Biogasanlagen oder zur thermischen Verwertung dienen. Auch wenn die<br />
Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der Management-Optionen im Rahmen dieses Projektes<br />
nicht vorgesehen ist, so ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Management-Option<br />
denkbar ungünstig. Für eine effektive <strong>Treibsel</strong>reduzierung müssten, unabhängig von der<br />
rechtlichen Durchführbarkeit dieser Maßnahme, erhebliche Kosten für eine jährliche Mahd<br />
(möglichst ausgedehnter Flächen) aufgebracht werden, wobei ein Nutzen aus<br />
treibselreduzierender Sicht nur in den Jahren vorhanden wäre, in denen die erste Sturmflut<br />
der Saison nach der Mahd eintreten würde.<br />
Die Hinter<strong>grün</strong>de der Management-Option „Schlegeln“ wurden bei der Ergebnisdarstellung<br />
(Kapitel 0) bereits erläutert und sollen an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Zu<br />
dieser Management-Option sowie zu der Alternative „Mulchen“ liegen allerdings bereits erste<br />
Erfahrungen vor, die an dieser Stelle dargelegt werden sollen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 180 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Seit dem Jahr 2008 wird im Wapeler-Außengroden eine 18,5 ha große Fläche ungenutzter<br />
Salzwiese geschlegelt. Sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2009 erfolgte die Schlegelung<br />
im Herbst. Im Herbst dieser Jahre traten aber auch die ersten Sturmfluten, bei denen das<br />
Wasser im Wapeler-Groden bis an den Deichfuß reichte, kurz nach dem Schlegeln auf.<br />
Dabei wurde nahezu das gesamte Schlegelgut als <strong>Treibsel</strong> am Deichfuß angeschwemmt.<br />
Aufgrund dieser Erfahrungen blieb im Jahr 2010 ein 10 m breiter deichseitiger Streifen<br />
ungeschlegelt, der als „<strong>Treibsel</strong>fänger“ dienen soll. Diese Methode hat sich bei der ersten<br />
leichten Sturmflut der Saison bewährt. Das <strong>Treibsel</strong> wurde vor dem 10 m breiten,<br />
hochwüchsigen Vegetationsstreifen abgefangen und nach der Flut flächenhaft abgelagert.<br />
Ob das <strong>Treibsel</strong> auch bei stärkeren Sturmfluten durch den hochwüchsigen<br />
Vegetationsstreifen vom Deichfuß ferngehalten werden kann, muss sich noch zeigen.<br />
Aufgrund einer Nutzungsauflage des Kreistages des Landkreises Emsland, welche im Zuge<br />
von LPCB-Belastungen der Vegetation der Emsvorländer im Jahr 2009 für öffentliche<br />
Flächen auferlegt wurde, wurden 280 ha Emsvorlandflächen im September 2009 gemulcht.<br />
Obwohl der späte Mulchzeitpunkt, der ein leichteres Mulchen ermöglichen soll, eingehalten<br />
wurde, war die „Qualität“ des Mulchguts unbefriedigend. Aufgrund der Dichte und Menge der<br />
Vegetation konnte dieses nur grob zerkleinert werden (und ist somit mit dem Schlegelgut<br />
vergleichbar). Mit der Sturmflut am 4. Oktober 2009 wurde das gesamte „Mulchgut“<br />
aufgeschwemmt und zusammen mit aufgewühltem Schlick am Deichfuß abgelagert.<br />
Aufgrund der Durchmischung des <strong>Treibsel</strong>s mit Schlicksedimenten war dieses nur sehr<br />
schwer von den Vorlandflächen und vom Deichkörper zu entfernen. Letztlich wurde die<br />
<strong>Treibsel</strong>-Schlick-Masse von dem Deichkörper und den Nutzungsflächen in die<br />
Sukzessionsflächen geschoben. Die geplante Fortführung dieser Maßnahme wurde<br />
daraufhin sofort gestoppt (mündliche Auskünfte Landkreis Emsland).<br />
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der oben genannten Schlegel- bzw. Mulch-Projekte ist<br />
sehr fraglich, ob diese Management-Option weiterhin als treibselreduzierende Maßnahme in<br />
Betracht gezogen werden sollte. Um einen starken Vegetationsaufwuchs nach dem<br />
Schlegeln/Mulchen zu vermeiden, ist der Schlegel-/Mulchzeitpunkt im Spätsommer/Herbst<br />
vorzusehen. Zu diesem Zeitpunkt können allerdings bereits die ersten Sturmfluten eintreten,<br />
so dass im schlechtesten Fall der Zeitraum zwischen dem Schlegel-/Mulchzeitpunkt und der<br />
ersten Sturmflut nur sehr gering ist. In diesem Fall liegt das Schlegel-/Mulchgut<br />
unmineralisiert auf den Vorlandflächen und wird nahezu vollständig aufgetrieben und an den<br />
Deichfuß transportiert. Somit kann man bei dieser Maßnahme zumindest bei frühen<br />
Sturmfluten von zusätzlichem <strong>Treibsel</strong>anfall ausgehen, da ohne ein vorheriges Schlegeln<br />
oder Mulchen nicht davon auszugehen ist, dass die vollständige Biomasse aus den<br />
Vorlandflächen abgetragen wird. Ob sich diese Management-Option im günstigsten Fall<br />
(sehr spätes Eintreffen der ersten Sturmflut) treibselreduzierend auswirkt, wird sich im<br />
Rahmen des oben genannten Monitorings zeigen.<br />
Die Landnutzung der Vorlandflächen mit Schutzstatus (Nationalpark, FFH-, EU-Vogel- und<br />
Landschaftsschutzgebiete), die einen Großteil des Betrachtungsraumes ausmachen, ist<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 181<br />
unter Berücksichtigung der Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben nur begrenzt möglich.<br />
Biomassereduzierung und damit potenzielle <strong>Treibsel</strong>reduzierung kann aber auch durch<br />
Maßnahmen, die auf natürlichen Prozessen beruhen, gesteuert werden. Dies ist das Ziel der<br />
Management-Optionen der Management-Typen „Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses“, „Prozessschutz“ und „Auwaldentwicklung“. Die Hinter<strong>grün</strong>de wurden bereits<br />
in dem Kapitel 0 erläutert, allerdings sollen hier einzelne Punkte diskutiert werden.<br />
Inwieweit Entwässerungssysteme durch Unterlass von Unterhaltungsarbeiten reversibel<br />
sind, wie es bei der Management-Option „passiver Prozessschutz“ vorgesehen wird, ist<br />
bislang nicht endgültig geklärt.<br />
BLINDOW (1991) vermutet, dass eine Renaturierung des Entwässerungssystems von<br />
Salzwiesen in unterer und mittlerer Höhenlage möglich ist. In oberer Höhenlage hält er dies<br />
aufgrund der Beobachtungen im Elisabeth-Außengroden für nicht möglich. Dort erfolgte auch<br />
im Zeitraum von 20-30 Jahren nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und der<br />
Einstellung der Grüppenunterhaltung keine Entwicklung des Entwässerungssystems hin zu<br />
naturnäheren Strukturen. BLINDOW (1991: 87) nennt als Ursachen die Beseitigung der<br />
Wasserscheiden durch Planierung sowie die Bodenverdichtung und hält das künstliche<br />
Entwässerungssystem für auf natürlichem Wege unumkehrbar. Solange das alte<br />
Entwässerungssystem noch vorhanden und wirksam ist, verhindert es auch die großflächige<br />
Entstehung schlecht entwässerter und nur spärlich vegetationsbestandener Senken, deren<br />
Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung gering ist (JAKOBSEN 1954, DIJKEMA 1983 in: BAKKER et al.<br />
2002: 36).<br />
Die „Dynamisierung“ der anthropogenen Vorländer, d.h. die Ausbildung eines<br />
Gewässersystems mit mäandrierenden Prielverläufen, erfolgt also schon aufgrund des<br />
bindigen Kleibodens extrem langsam und dauert offenbar mehrere Jahrzehnte. Jedoch<br />
kommt es nach Einstellung der Entwässerung u.U. bereits relativ kurzfristig zu kleinflächigen<br />
Vernässungen des Vorlandes. In Senken kommt es lokal zur Entstehung von Stillgewässern,<br />
evtl. von Salzpfannen (BAKKER et al. 2005: 177). Eine ausführliche Beschreibung der Effekte<br />
geben ESSELINK et al. (1998) für Salzwiesen des Dollart. Sie beschreiben eine Zunahme der<br />
Höhenunterschiede im Vorland durch die Entwicklung von „Uferwällen“ entlang ehemaliger<br />
Grüppen sowie die Entstehung schlecht drainierter Senken. In Zusammenhang mit der<br />
räumlich stark unterschiedlichen Vegetationsstruktur, welche die Sedimentationsrate<br />
beeinflusst, kam es so zu einer erheblichen Steigerung der abiotischen Diversität, auch als<br />
Standortfaktor für die Vegetation.<br />
Auch bieten vernässte Senken Raum für die Ansiedlung von Vegetation jüngerer<br />
Salzwiesenstadien und sie sind von großer Attraktivität für Vögel.<br />
Der Vorteil eines aktiven Prozessschutzes mit Verfüllung von Entwässerungsgräben<br />
besteht darin, dass der Grundwasserspiegel schnell hochgesetzt wird und damit eine<br />
Verminderung der stehenden Biomasse erreicht wird. Durch die damit einhergehende<br />
Stimulierung eines natürlichen, mäandrierenden Prielsystems würde sich die Vielfalt an<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 182 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
unterschiedlichen Standorten in der Landschaft erhöhen und somit auch die Vielfalt an Arten.<br />
Eine Initialisierung eines Prielsystems sollte hierbei vorgesehen werden, da ansonsten die<br />
Gefahr besteht, dass die verfüllten Entwässerungssysteme, aufgrund des noch nicht<br />
gesetzten Bodens, schnell wieder freigespült werden. Dies würde der Entwicklung eines<br />
mäandrierenden Prielsystems entgegenwirken.<br />
In den Ästuaren sind die Möglichkeiten treibselreduzierender Management-Optionen sehr<br />
begrenzt. <strong>Treibsel</strong> entsteht hier überwiegend in den Röhrichten, die eine hohe stehende<br />
Biomasse aufweisen und starker Strömungs- und Wellenenergie nicht standhalten können.<br />
Eine Reduzierung der Biomasse durch ein Wassermanagement, welches bei den<br />
Festlandsvorländern eine Möglichkeit darstellt, ist bei Röhrichten nicht möglich (Kapitel 5.4).<br />
Somit bleiben als treibselreduzierende Management-Option lediglich die Entnahme der<br />
Biomasse (Mahd, siehe oben) oder die Entwicklung von Biotoptypen, die sich<br />
treibselminimierend auswirken.<br />
Die Entwicklung von Auwäldern auf Ästuarvorländern als treibselreduzierende<br />
Management-Option soll hier näher erläutert werden, da man zunächst von einer<br />
Biomasseerhöhung ausgehen könnte. Dies ist auch nicht ganz falsch, aber für die<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung ist entscheidend, dass die überwiegende Biomasse des Auwaldes – im<br />
Gegensatz zum Röhricht – standhaft gegenüber Strömungs- und Wellenenergie bleibt. Somit<br />
verringert sich die Biomasse an sich nicht, aber das Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung ist<br />
deutlich geringer. Weitaus wichtiger ist aber der Effekt der <strong>Treibsel</strong>minimierung am Deichfuß<br />
durch die Funktion des Auwaldes als <strong>Treibsel</strong>fänger.<br />
Erfahrungen hierzu liegen wiederum aus dem Emsästuar vor. Hier wurden im Bereich<br />
zwischen Papenburg und Aschendorf auf insgesamt 27 ha Auwaldanpflanzungen im Zuge<br />
des Planfeststellungsverfahrens zum Emssperrwerk in Gandersum als Kompensations-<br />
maßnahme vorgenommen. Hier erfolgte die Anpflanzung überwiegend auf ganzer Breite des<br />
Vorlandes mit bis zu 100 m Breite, aber auch als 10 bis 15 m breite Streifen. Zunächst<br />
wurden Pflanzabstände von 4 m x 4 m gewählt, die sich nicht bewährt haben, da sich im<br />
Unterwuchs Röhrichte ausbilden konnten und die Funktion als <strong>Treibsel</strong>fänger nicht gegeben<br />
war. Pflanzabstände von 1,5 m x 1,5 m hingegen bewirken bereits nach wenigen Jahren eine<br />
starke Beschattung, die Röhrichtaufwuchs stark vermindern und große Mengen an <strong>Treibsel</strong><br />
vom Deichfuß abhalten können.<br />
Mindestabstände zum Deich wurden bei dieser Kompensationsmaßnahme nicht festgelegt,<br />
es wurde aber darauf geachtet, dass der Deichkörper durch die Bäume nicht beschattet wird,<br />
so dass die Deichsicherheit nicht beeinträchtigt wird. Eine Beeinträchtigung der<br />
Deichsicherheit ist auch nicht durch freitreibendes Totholz zu befürchten, da zum einen der<br />
Zeitraum, in dem sich ein Baumstamm bis zu einem mächtigen und bereits morschen Ast<br />
oder Stamm entwickelt hat, der als Treibholz den Deichkörper beschädigen könnte, sehr<br />
groß ist. Zum anderen ist davon auszugehen, dass ein Großteil des Treibholzes innerhalb<br />
der Auwaldbereiche verbleibt, sofern der Stammabstand entsprechend gering ist. Eine<br />
Gefährdung der Deichsicherheit durch Auwaldanpflanzungen ist unwahrscheinlich, da die Art<br />
des Vorlandbewuchses nur geringen Einfluss auf die Wasserstände hat. Nach IBL (1996)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 183<br />
ergeben sich durch dichten Vorlandbewuchs für die Ems nur bei einer Überlagerung von<br />
hohen Tidewasserständen und sehr großen Abflussmengen höhere Wasserstände. Aktuelle<br />
Forschungen zu hydraulischen Grundlagenuntersuchungen, wie der Erweiterung<br />
bestehender und der Entwicklung neuer Berechnungsansätze zur Beschreibung der<br />
Rauheitswirkung natürlicher Gewässerstrukturen (z.B. Vegetationsbestand) auf das<br />
übergeordnete Strömungsfeld, laufen am Leichtweiß-Institut für Wasserbau der Technischen<br />
Universität Braunschweig.<br />
Die Artenzusammensetzung der Auwälder und damit der Artenauswahl für Anpflanzungen<br />
soll möglichst der potenziell natürlichen Vegetation entsprechen, sofern diese unter den<br />
heutigen Bedingungen überhaupt zu prognostizieren ist. Auwälder in oft überschwemmten<br />
Tieflandauen werden in natürlichen Ausprägungen neben Mandelweiden-<br />
Korbweidengebüsch (Salicetum triandro-viminalis) von Silber-Weidenwald (Salicetum albae)<br />
beherrscht. Die Silber-Weide (Salix alba), in Gesellschaft mit der Purpur-Weide<br />
(S. purpurea), siedelt sich schon auf niedrigsten Uferbänken, auf denen Weiden überhaupt<br />
Fuß fassen können, an. Zur vollen Ausprägung mit einer Höhe von bis zu 20 m gelangt sie<br />
aber auf den etwas höher gelegenen, nicht mehr so oft und rasch überströmten Auen. Als<br />
höchste und langlebigste Weidenart beherrscht sie diesen Lebensraum allein oder allenfalls<br />
zusammen mit ihrem Bastard der Fahl-Weide (S. rubens). Diese Weidenarten haben<br />
schmale Blätter, die dem strömenden Wasser wenig Widerstand entgegensetzen und haben<br />
somit geringen Einfluss auf das Abflussregime. Ihre Stämme und Zweige sind zumindest in<br />
der Jugend sehr biegsam und regenerieren sich nach Beschädigungen leicht, so dass<br />
vergleichsweise wenig Totholz anfällt (ELLENBERG, 1986). Entsprechend werden für die<br />
Auwaldanpflanzungen vorwiegend Salix-Arten vorgesehen. In weniger salzwasser-<br />
beeinflussten Bereichen sind auch Hartholzauen mit entsprechender Artenzusammen-<br />
setzung denkbar. Da diese Management-Option aber vorwiegend auf Röhricht-<br />
Dominanzbeständen, welche in der Regel auf stark vernässten und salzbeeinflussten<br />
Standorten stehen, ist die Etablierung von Harthölzern eher unwahrscheinlich. Dennoch<br />
sollten Harthölzer zumindest kleinflächig für die Initialpflanzungen vorgesehen werden, da<br />
die Ausbreitungsgrenzen unter den derzeitigen Bedingungen wenig bekannt sind.<br />
Auwälder sind in den Ästuarbereichen des Betrachtungsraumes mit gut 1 % Flächenanteil<br />
nur zu einem geringen Flächenanteil vertreten. Es ist davon auszugehen, dass der Ausbau<br />
von Ästuaren zu Schifffahrtsstraßen und auch die Landwirtschaft und Freizeitnutzung von<br />
Vorlandbereichen zu einem Rückgang auentypischer Lebensräume und Vegetation, wie u.a.<br />
von Auwäldern, beigetragen haben (CLAUS 1998, CLAUS et al. 1994a, SCHIRMER 1994). Die<br />
langfristige Entwicklung von artenreichen Auengebüschen und Auwäldern ist nach KESEL<br />
(1999) auf Bracheflächen unter naturnahen Sukzessionsbedingungen ab ca. 0,5 m über<br />
MThw neben Röhrichten denkbar. Die Etablierungszeiträume für Auwald oder<br />
auwaldähnliche Strukturen sind allerdings im Vergleich zu denen des Röhrichts sehr lang<br />
(Claus 1994a). Vorhandene Röhrichtbestände können zudem sehr stabile Populationen<br />
bilden (ROSENTHAL 1992), da durch die starke Streubildung die Etablierung anderer Arten<br />
gehemmt wird. Zudem sind Röhrichte mit ihren Rhizomen als große Nährstoffspeicher und<br />
dem damit bedingten schnellen Aufwachsen im Frühjahr begünstigt. Weidengebüsche<br />
können sich in reinen Röhrichtbeständen nur dann ausbreiten, wenn sie diese durch<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 184 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Überwuchs überschatten und so verdrängen. Daher können sich Auwaldstrukturen oder<br />
Auwälder in Röhricht-Dominanzbeständen vor allem über Initialpflanzungen etablieren (KURZ<br />
1997 in OSTERKAMP 2006).<br />
Hinsichtlich der Auwaldetablierung auf den Vorländern der Ästuare werden zukünftig zwei<br />
Faktoren eine entscheidende Rolle spielen: der Klimawandel und die Zunahme des<br />
Tidenhubs. Im Zuge des Klimawandels werden längere sommerliche Trockenphasen und<br />
feuchtere mildere Winter prognostiziert, was sich hinsichtlich einer Auwaldentwicklung positiv<br />
auswirken würde. Hingegen würde sich ein zunehmender Tidenhub, bedingt durch den<br />
Anstieg des Meeresspiegels und weitere Flussvertiefungen, welche zu einer höheren<br />
Strömung und einem zunehmenden Salzeinfluss führen, negativ auswirken. Diese Prozesse<br />
wirken also gegenläufig. Die konkreten Ausbreitungs- und die Toleranzgrenzen in den<br />
Ästuaren des Nordwestdeutschen Tieflandes gegenüber anthropogen beeinflussten<br />
Standortbedingungen von Weich- und Hartholzauen bzw. einzelnen Gehölzarten müssen<br />
daher anhand von Praxisversuchen ermittelt werden.<br />
7.4 BEWERTUNG DER MANAGEMENT-OPTIONEN<br />
7.4.1 EINLEITUNG<br />
In Kapitel 7.3 wurden die Management-Optionen, die für ein Vorlandmanagement zur<br />
Treibelreduzierung generell in Betracht kommen, aufgeführt und diskutiert. In diesem Kapitel<br />
sollen diese Management-Optionen hinsichtlich ihrer treibselreduzierenden Wirkung und<br />
naturschutzfachlichen Auswirkungen bewertet werden. Hierzu werden die Ergebnisse aus<br />
den Teilprojekten 2 und 3 (Kapitel 5 und 6) sowie die Ergebnisse einer Literaturauswertung<br />
im Rahmen des Teilprojektes 1B (Anhang 3) herangezogen. Anhand der Bewertung können<br />
die Management-Optionen hinsichtlich ihrer Eignung und Effektivität für ein Management zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung sowie die zu erwartenden naturschutzfachlichen Auswirkungen<br />
differenziert dargestellt werden.<br />
Eine Bewertung des Nutzens und der Ökonomie dieser Management-Optionen, wie z.B. eine<br />
Kostenkalkulation oder das Aufzeigen von Perspektiven von Nutzung und Pflege, ist nicht<br />
Gegenstand dieser Arbeit. Daher können im Rahmen dieses Projektes keine konkreten<br />
Aussagen diesbezüglich gemacht werden.<br />
7.4.2 METHODIK<br />
Die Bewertung der Management-Optionen teilt sich im Wesentlichen in drei Teile:<br />
1. Prognose der Biomassereduzierung,<br />
2. Bewertung der prognostizierten Vegetationsausprägung,<br />
3. Bewertung der Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel.<br />
Die Prognosen bzw. Bewertungen wurden für alle der in Kapitel 7.3 aufgeführten<br />
Management-Optionen vorgenommen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 185<br />
Dabei wurden die Vegetationseinheiten der Ausgangssituation (Tabelle 26) berücksichtigt,<br />
für die die jeweilige Management-Option generell in Betracht kommt. Demzufolge werden<br />
z.B. für die Management-Optionen des Management-Typs „Beweidung“ alle<br />
Vegetationseinheiten der unteren und oberen Salzwiese betrachtet. Bei der Management-<br />
Option „Röhricht-Mahd“ hingegen kommen nur die Vegetationseinheiten der Röhrichte in<br />
Betracht.<br />
Die Vegetationseinheiten der Pionierzone wurden bei der allgemeinen Bewertung nicht<br />
berücksichtigt, da ein Management zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung hier nicht notwendig ist. Somit<br />
liegt für Vegetationseinheiten der Pionierzone auch keine allgemeine Bewertung hinsichtlich<br />
der Auswirkungen von Management-Optionen vor. Da die Pionierzone für die Avifauna aber<br />
sehr wohl von Bedeutung ist (z.B. zur Nahrungssuche), findet dieser Aspekt (Vorkommen<br />
von Pionierzone) bei der Bewertung der modellhaften Managementkonzepte (Kapitel 7.5.3)<br />
Berücksichtigung.<br />
Für alle sich daraus ergebenden Kombinationen von Management-Optionen und<br />
Vegetationseinheiten der Ausgangssituation wurden die genannten Prognosen und<br />
Bewertungen durchgeführt.<br />
Zu Punkt 1. Prognose der Biomassereduzierung<br />
Grundlage für eine Prognose der Biomassereduzierung ist zunächst eine Prognose der zu<br />
erwartenden Vegetationsausprägung bei Anwendung der Management-Optionen auf den<br />
charakteristischen Vegetationseinheiten. Die Prognose der Biomassereduzierung beruht auf<br />
den statistischen Analysen (Regressionsfunktionen) zur Abhängigkeit der stehenden<br />
Biomasse von Umweltbedingungen und Landnutzungen, die im Rahmen des Teilprojektes 2<br />
(Kapitel 5) ermittelt wurden. Die prognostizierte Biomassereduzierung ergibt sich aus der<br />
Differenz der stehenden Biomasse pro Flächeneinheit zwischen der Ausgangssituation (Ist-<br />
Zustand) und der Entwicklungssituation. Dabei wurde bei der Ausgangssituation von einer<br />
Nichtnutzung der Flächen ausgegangen. Die Prognosen wurden auf TMAP- und<br />
Biotoptypen-Ebene vorgenommen. Für Ausprägungen der Entwicklungsprognose, bei denen<br />
ein Muster von mehreren Vegetationstypen zu erwarten ist, wurden entsprechend bis zu vier<br />
Vegetationstypen angegeben. Für diese wurde zudem der flächenhafte Anteil an der<br />
Gesamtvegetation geschätzt, welcher für eine flächenscharfe Bewertung erforderlich ist.<br />
Zu Punkt 2. Bewertung der prognostizierten Vegetationsausprägung hinsichtlich eines<br />
Leitbildes<br />
Prinzipiell sind alle Vegetationstypen der Salzwiesen und der Röhrichte geschützt. Daher<br />
können klassische Verfahren der Bewertung (ungeschützt vs. geschützt) hier nicht<br />
angewendet werden. Deshalb wurde die naturschutzfachliche Bewertung auf Grundlage<br />
einer Leitbildformulierung vorgenommen. Für die Vorländer des gesamten<br />
Betrachtungsraumes wurde das Leitbild „Naturlandschaft“ formuliert, welches sich schon<br />
allein durch die Ziele der verschiedenen Schutzgebiete (Nationalpark Niedersächsisches<br />
Wattenmeer, FFH-, EU-Vogelschutz- und Landschaftsschutzgebiete), die für überwiegende<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 186 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Flächen des Betrachtungsraumes gelten, bedingt. Unter dem Leitbild „Naturlandschaft“ wird<br />
eine naturnahe Ausprägung der Vorlandbereiche verstanden, welche durch natürliche<br />
Dynamik von Erosion und Sedimentation geprägt ist. Auf diese Weise können sich<br />
differenzierte Lebensräume entwickeln, auf denen sich eine Vielfalt typischer<br />
Lebensgemeinschaften etablieren kann. Selbst wenn einzelne Lebensgemeinschaften, etwa<br />
die Queckenbestände, durch ausgesprochen niedrige Artenzahlen gekennzeichnet sind,<br />
führt das Nebeneinander unterschiedlicher Gemeinschaften auf Landschaftsebene doch zur<br />
Verwirklichung des gesamten Artenpools.<br />
Für Teilgebiete des Betrachtungsraumes können im Rahmen von Ausführungsplanungen<br />
standortspezifische Leitbilder formuliert werden, die z.B. artenschutzrechtliche Aspekte oder<br />
Zielartenkonzepte beinhalten. Die Bewertung der modellhaften Managementkonzepte wird<br />
aber auf der Grundlage des allgemeinen Leitbildes „Naturlandschaft“ erfolgen, da die<br />
Bewertung untereinander vergleichbar sein soll. Die Bewertung des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ erfolgt auf Grundlage von Informationen zur potenziellen natürlichen<br />
Vegetation und unseren Untersuchungen.<br />
Zu Punkt 3. Bewertung der Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel<br />
Für die Bewertung der Management-Optionen auf Salzwiesen der Festlandsküste<br />
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Brut- und Rastvogelarten wurden im Teilprojekt 2<br />
(Kapitel 5), auf Grundlage von ermittelten Habitatpräferenzen dieser Arten, Indexwerte<br />
ermittelt, die die Bedeutung eines Vegetationstyps für das Vorkommen der untersuchten<br />
Brut- und Rastvogelarten wiedergeben. Diese Indexwerte werden auf einer Skala von -1<br />
(keine Bedeutung bzw. Meidung) bis 1 (höchste Bedeutung) dargestellt. Hierbei wurden,<br />
soweit möglich, auch die Nutzungseinflüsse berücksichtigt.<br />
Anhand dieser Indexwerte kann - auf Grundlage der TMAP-Einheiten - sowohl für die<br />
Ausgangssituation als auch für die Entwicklungssituation die Eignung für die hier<br />
betrachteten Arten dargestellt werden. Anhand der Differenz der Indexwerte<br />
„Ausganssituation“ und „Entwicklungsprognose“ lässt sich ermitteln, ob sich die<br />
Habitateigenschaften für die hier betrachteten Arten verbessern (positiver Differenzwert)<br />
oder verschlechtern (negativer Differenzwert).<br />
Die Indexwerte stellen lediglich einen Näherungswert dar, da bei Modellrechnungen<br />
unmöglich sämtliche Umwelteinflüsse berücksichtigt werden können. Daher sind die<br />
Indexwerte - und damit auch die Index-Differenzwerte - nicht als absolute Werte zu<br />
verstehen, sondern als Tendenzen. Deshalb wurden die Index-Differenzwerte, mit einem<br />
Wertebereich von – 2 (ergibt sich aus der max. Verschlechterung) bis 2 (max.<br />
Verbesserung), in fünf Wertebereiche klassifiziert, die eine tendenzielle Verbesserung oder<br />
Verschlechterung hinsichtlich der Habitateigenschaften für die jeweiligen Arten darstellen<br />
(Tabelle 55). Sofern für die Ausgangssituation und/oder der Entwicklungssituation kein<br />
Indexwert vorlag, da entweder kein Wert ermittelt werden konnte oder kein Modell signifikant<br />
war (Hinter<strong>grün</strong>de s. Kapitel 6.3.1.1), konnte auch kein Differenz-Indexwert berechnet<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 187<br />
werden. In diesen Fällen kann aber zumindest für die Arten Rotschenkel und Wiesenpieper,<br />
anhand der Ergebnisse der zusätzlichen Detailuntersuchungen, eine verbalargumentative<br />
Bewertung durchgeführt werden (vgl. Kapitel 7.5.3).<br />
Tabelle 55: Wertebereiche der Klassifizierung der Differenz-Indexwerte<br />
Wertebereich Symbol Änderung hinsichtlich der Habitateigenschaften<br />
2,0 bis > 1,2 ++ deutlich positiv<br />
1,2 bis > 0,4 + leicht positiv<br />
0,4 bis > - 0,4 o neutral<br />
< -0,4 bis – 1,2 - leicht negativ<br />
< -1,2 bis - 2,0 - - deutlich negativ<br />
Für die Arten Nonnen- und Ringelgans liegen Indexwerte sowohl für die jeweilige Art als<br />
auch als zusammengefasster Index für beide Arten vor. Letzterer stützt sich auf eine deutlich<br />
größere Datenbasis (Literaturangaben) und wird aus diesem Grund für die Bewertung der<br />
Management-Optionen herangezogen.<br />
Die für die Bewertung herangezogenen Indexwerte stellen immer den Einfluss des<br />
Vegetationstyps für eine Art dar, der Einfluss der Nutzungsform hingegen kann nur für einen<br />
Teil der Indexwerte dargestellt werden (vgl. Anhang 2). Dies ist auf die Datengrundlage, die<br />
dem Teilprojekt 3 zur Verfügung stand (Literaturdaten, eigene Erhebungen), zurückzuführen.<br />
Der Einfluss der Nutzungsform konnte nicht in die Indexwerte einfließen, wenn entweder<br />
keine Literaturangaben (rastende Singvögel, für einen Teil der Vegetationstypen der<br />
rastenden Gänse) oder nicht genügend Gelege für eine Kombination aus Vegetationstyp und<br />
Nutzungsform gefunden wurden, um eine Modellrechnung für die Ermittlung der Indexwerte<br />
durchzuführen. Sofern für eine Kombination Vegetationstyp/Nutzungsform kein Indexwert<br />
vorlag, wurde auf den Indexwert „gesamt“ zurückgegriffen, der zwar die Einflüsse des<br />
Vegetationstyps, nicht aber den Einfluss der Nutzungsform wiedergibt. Die Nutzungsform<br />
kann aber deutlichen Einfluss auf die Habitatpräferenzen (Änderung der Struktur, Viehtritt,<br />
Bodenverdichtung, Stress) haben. Auch wenn der Einfluss der Nutzungsform im Indexwert<br />
enthalten ist, so fehlt dennoch der Einfluss der Nutzungsintensität. Die Indexwerte für die<br />
Nutzungsform „Beweidung“ differenzieren beispielsweise nicht zwischen sehr extensiver und<br />
intensiver Beweidung.<br />
Aufgrund der genannten Einflüsse, die durch die Indexwerte nur bedingt (Nutzungsform)<br />
oder gar nicht (Nutzungsintensität) wiedergegeben werden können, ist bei einigen<br />
Bewertungen auf Grundlage von dem Wissen aus der Feldarbeit und Literaturauswertungen<br />
eine Prüfung und ggf. Korrektur der Bewertung vorzunehmen (Abbildung 52). Dennoch<br />
erlauben die Indexwerte eine für die Planung durchaus neuartige, quantitative Vorhersage<br />
der Auswirkungen der Management-Optionen auf die Vögel, wie sie bisher in Deutschland<br />
selten angewandt wurde.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 188 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Die naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen auf Vorländern der Ästuare<br />
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die bedeutenden Vogelarten erfolgt auf Grundlage einer<br />
im Rahmen dieses Teilprojektes erstellten Literaturauswertung (Anhang 3). Hierbei bezieht<br />
sich die naturschutzfachliche Bewertung auf die Auswirkungen von Röhricht-Nutzungen, da<br />
- aufgrund Bewertung der Auswirkungen extrem hohen auf die Brut- Biomassemenge und Rastvögel der Röhrichte - vorrangig auf diesen<br />
treibselreduzierende Management-Optionen vorzusehen sind.<br />
TMAP-/ Biotop-Typ & Nutzungsform<br />
Indexwert, der den Einfluss des Vegetationstyps<br />
und der Nutzungsform wiedergibt, vorhanden?<br />
Nein<br />
Indexwert, der den Einfluss des Vegetationstyps<br />
wiedergibt, vorhanden?<br />
Nein<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Ja<br />
Ja<br />
Wissen aus der Feldarbeit,<br />
Literaturauswertung<br />
Literaturauswertung<br />
Bewertung auf Grundlage von:<br />
Indexwerten<br />
Indexwerten und Fachwissen<br />
Fachwissen<br />
Abbildung 52: Bewertungsgrundlage der naturschutzfachliche Bewertung der Brut- und<br />
Rastvogelarten<br />
7.4.3 ERGEBNISSE<br />
Die Ergebnisse der Bewertung der Management-Optionen sind im Wesentlichen<br />
die Prognose der Biomassereduzierung,<br />
die Bewertung der prognostizierten Vegetationsausprägung hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ und<br />
die Bewertung der Auswirkungen auf die bedeutenden Rast- und Brutvögel,<br />
welche in der Tabelle 56 aufgeführt sind.<br />
Nachfolgend ein Lesebeispiel mit der Fragestellung: „Wie wirkt sich eine Beweidung von 1,5<br />
Rindern/ha auf einen gegenwärtigen Strandsalzmelden-Rasen aus?“<br />
In der Spalte „Management-Option“ findet sich unter der Kategorie „Beweidung“ die<br />
Management-Option „Beweidung mit 1,5 Rindern/ha“. Im rechtsstehenden Block der Spalte<br />
„Ausgangssituation“ befindet sich u.a. die Vegetationseinheit „Untere Salzwiese:<br />
Strandsalzmelden-Rasen“. Die Entwicklungsprognose ist der nebenstehenden Spalte dieser<br />
Zeile zu entnehmen: Andel-Rasen mit einem Flächenanteil von 100 %. Folgt man dieser<br />
Zeile, so kann man der Tabelle entnehmen, dass<br />
die prognostizierte Biomassereduzierung 70 % beträgt,<br />
sich hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“ eine mittlere Bewertung ergibt,
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 189<br />
die Habitatveränderungen für die rastenden Singvögel eine leichte Verschlechterung<br />
(Berghänfling) bzw. gleichbleibende Habitatqualitäten (Ohrenlerche, Schneeammer)<br />
ergeben,<br />
die Habitatveränderungen für die rastenden Gänse eine leichte Verbesserung<br />
(Nonnen- und Ringelgans in entspr. Lit.-Quellen nicht differenziert) ergeben.<br />
Dies kann in gleicher Weise für die Brutvögel fortgesetzt werden. Um die tabellarisch<br />
aufgeführten Bewertungsergebnisse leichter erfassen zu können, wurden die<br />
Bewertungsfelder farbig mit den „Ampelfarben“ hinterlegt:<br />
<strong>grün</strong> = positive Entwicklung (hohe Biomassereduzierung, hohe Bewertung hinsichtlich<br />
des Leitbildes „Naturlandschaft“, leichte bis deutliche Verbesserung des Habitats für<br />
eine Vogelart),<br />
gelb = mittelmäßige/neutrale Entwicklung (mittlere Biomassereduzierung, mittlere<br />
Bewertung hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“, gleichbleibende<br />
Habitatbedingungen für eine Vogelart),<br />
rot = negative Entwicklung (geringe Biomassereduzierung, geringe Bewertung<br />
hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“, leichte bis deutliche Verschlechterung<br />
des Habitats für eine Vogelart).<br />
Die Differenz-Indexwerte für die Management-Optionen „Beweidung mit 2–3 Rindern bzw.<br />
3-6 Schafen/ha“ sind rot umrandet, da hier zu berücksichtigen ist, dass die Indexwerte auf<br />
den bestehenden Beweidungsintensitäten (0,5–1,5 Rindern/ha) beruhen. Demzufolge wird<br />
bei dieser Bewertung zwar der sich entwickelnde Vegetationstyp, nicht aber der Einfluss der<br />
stark veränderten Vegetationsstruktur durch eine Beweidung mit mehr als 1,5 Rindern<br />
berücksichtigt. Da aber bei den Management-Optionen mit intensiven Beweidungs-<br />
intensitäten zur Brutzeit eine verminderte, extensive Beweidungsintensität vorgesehen ist,<br />
wird der Einfluss von Beweidung auf das unmittelbare Brutgeschehen (verstärkter Viehtritt,<br />
ggf. Herdenverhalten und. zunehmende Störungen durch den Menschen) durch die<br />
Indexwerte wiedergegeben.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 190 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 191<br />
Tabelle 56: Naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
Management-Typ<br />
Beweidung<br />
Management-Option Bezeichnung TMAP (Nds. Schlüssel)/<br />
Management-Optionen, bei denen eine Biomassereduzierung durch Landnutzung bedingt ist (Strategie Kultureinfluss)<br />
Schlegeln Schlegeln Reetmahd<br />
Mahd<br />
Legende<br />
Management-Option<br />
Beweidung mit 0,5 - 1,0 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 1,5 Rindern/ha<br />
Beweidung mit 2 - 3 Rindern/ha*<br />
Beweidung mit < 3 Schafen/ha<br />
Beweidung mit 3 - 6 Schafen/ha*<br />
Mahd bis August/September<br />
abhängig von der Wetterlage<br />
(vorwiegend landwirtschaftliche Verwendung )<br />
Mahd bis September/Oktober<br />
unabhängig von der Wetterlage<br />
(landwirtschaftliche oder energetische<br />
Verwendung )<br />
Biotoptyp<br />
Bezeichnung TMAP (Nds. Schlüssel)/<br />
Biotoptyp<br />
Anteil in %<br />
Biomassereduzierung<br />
in % (Bezug<br />
vorheringer Zustand)<br />
Bewertung<br />
Vegetation<br />
Berghänfling<br />
Leitbild "Naturlandschaft"<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 20 mittel o o o o o o o n.s o n.s o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 20 mittel - o o + o + + n.s o n.s - n.s n.s k.W. + k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 25 mittel - - - - - - - - o - - o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 10 mittel o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 70 mittel o o o o o o o n.s o n.s o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 70 mittel - o o + o + + n.s o n.s - n.s n.s k.W. + k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Salzbinsen-Wiese S.3.2 20 25 mittel k.W. k.W. k.W. + + o o + o o o o o o o o k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 80 25 mittel o o o + o o o o o o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Salzbinsen-Wiese S.3.2 20 30 mittel k.W. k.W. k.W. + + + + + + + o o n.s o o + k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 80 30 mittel + + + + + + + + + + o o n.s o + + k.W.<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 90 gering o o o o o o o n.s o n.s o n.s o n.s o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 90 gering o o o + o + + n.s o n.s - n.s n.s n.s + k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 70 gering o o o + o o o o o o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 50 gering + + + + + + + + o + + o o n.s o + + k.W.<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 20 mittel o o o o o o o n.s o n.s o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 80 20 mittel - o + + o + + n.s o n.s - n.s n.s k.W. + k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 20 20 mittel o o o o o o o n.s o o o n.s n.s k.W. o k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 25 mittel o o o o o o o o o o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 10 mittel o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 90 gering o o o o o o o n.s o n.s o n.s o n.s o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 90 gering + o o + o + + n.s o n.s + n.s n.s n.s - k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 80 gering o o o + o o o o o o o n.s o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 90 gering + + + + + + + + o + + o o n.s o - - k.W.<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 40 mittel o o o o o o o n.s o n.s o n.s o k.W. o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 40 gering - o o + o + + n.s o n.s o n.s n.s k.W. + k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 100 25 mittel o o o o o o o o o o + n.s o + o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 40 40 mittel + + + + + o + + o + + o + n.s o + + k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 60 40 mittel o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 80 90 mittel o o o o o o o n.s o n.s o n.s o k.W. o o<br />
" " Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 20 90 mittel + o o - o - + n.s o n.s + n.s k.W. k.W. - k.W.<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 80 90 mittel - o o + o + + n.s o n.s o n.s n.s k.W. + k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 20 90 mittel o o o o o o o n.s o o + n.s n.s k.W. o k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 80 mittel - - - - - o - - o - - o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 90 mittel o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Reetmahd Winter Röhricht: Schilf KRP, NRS Röhricht: Schilf KRP, NRS 100 0-90 mittel k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Reetmahd Herbst<br />
Schlegeln<br />
Ausgangssituation<br />
Vegetationseinheit<br />
Entwicklungsprognose<br />
prognostizierte Vegetationseinheit (nach ~ 15 Jahren) (Vergleich<br />
(Entwicklungs-<br />
vorher/nachher) prognose)<br />
Röhricht: Schilf KRP, NRS Röhricht: Schilf KRP, NRS 100 70-90 mittel k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Röhricht: Sonstiges Röhricht KBR, FWR* Röhricht: Sonstiges Röhricht KBR, FWR* 100 50-70 mittel k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 10 gering k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 80 10 gering k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 20 10 gering k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 10 gering k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 5 gering k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
* zur Brutsaison verminderte * KBR, FWR, KRS, KRH, KRZ, NRG, NRW, NRR, VER<br />
+ + 2,0 bis > 1,2 deutlich positiv<br />
Beweidungsintensität hoch ≥ 40% Wertigkeit hoch + 1,2 bis > 0,4 leicht positiv<br />
mittel ≥ 20% Wertigkeit mittel o 0,4 bis - 0,4 neutral<br />
gering < 20% Wertigkeit gering - < - 0,4 bis -1,2 leicht negativ<br />
- - < - 1,2 bis - 2,0 deutlich positiv<br />
n.s nicht signifikant (Ausgangssituation und/oder Entwicklungsprognose)<br />
k.W. kein Wert (Ausgangssituation und/oder Entwicklungsprognose)<br />
Zeilen Management-Typ "Beweidung": Einfluss von Beweidungsdichten > 1,5 Rinder bzw. ab 3 Schafen/ha (veränderte<br />
Vegetationsstrukur) nicht enthalten; Spalten "rastende Singvögel": Einfluss unterschiedlicher Nutzungsformen nicht enthalten<br />
Ohrenlerche<br />
Bewertung von Auswirkungen der Management-Optionen auf die Avifauna<br />
(Differenz der Indexwerte Vegetationstyp Ausgangssituation/Entwicklungsprognose klassifiziert dargestellt)<br />
Rastvögel Brutvögel<br />
Singvögel Gänse Küstenvögel Singvögel Sonstige Arten<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- / Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Brandgans<br />
Flussseeschwalbe<br />
Rotschenkel<br />
Säbelschnäbler<br />
Feldlerche<br />
Rohrammer<br />
Schafstelze<br />
Wiesenpieper<br />
Kiebitz<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Stockente<br />
Uferschnepfe
Seite 192 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Fortsetzung Tabelle 56: Naturschutzfachliche Bewertung von Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
Management-Typ<br />
Erhöhung Wasser- und Salzeinfluss<br />
Prozessschutz<br />
Auw.<br />
Management-Option Bezeichnung TMAP<br />
Management-Optionen, bei denen eine Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen beruht (Strategie Natürliche Dynamik)<br />
Legende<br />
Management-Option<br />
Erhöhung Wasser- und Salzeinfluss durch<br />
Änderung des hydrologischen Systems*<br />
Erhöhung Wasser- und Salzeinfluss durch<br />
Bodenabtrag*<br />
"passiver Prozessschutz"<br />
(Aufgabe der Unterhaltung von<br />
Entwässerungssystemen, Prozessschutz)*<br />
"aktiver Prozessschutz"<br />
(Verfüllung von Entwässerungssystemen, ggf.<br />
Prielinitialisierung, Prozessschutz)*<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Ausgangssituation<br />
Vegetationseinheit<br />
(Nds. Schlüssel)<br />
Entwicklungsprognose<br />
Bezeichnung TMAP<br />
(Nds. Schlüssel)<br />
Anteil in %<br />
Biomassereduzierung<br />
in % (Bezug<br />
vorheringer Zustand)<br />
Bewertung<br />
Vegetation<br />
Berghänfling<br />
Leitbild "Naturlandschaft"<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Küstenwatt: Queller-Watt S.1.2 30 50 hoch + + + o o o o o n.s + n.s o n.s o o o k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 70 50 hoch o o o o o o o n.s o n.s o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 100 50 hoch o o o o o o o n.s o o o n.s n.s k.W. o k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 50 hoch - - o o - o + n.s - n.s o n.s o o + k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Küstenwatt: Queller-Watt S.1.2 20 50 hoch + + + + + o o o + + + o o n.s o o + k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: unspezifisch S.2.0 20 50 hoch o + + + + o + k.W. o k.W. o n.s o k.W. o k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 10 50 hoch + + + o + o + n.s o o o n.s n.s k.W. o k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 50 50 hoch + + + + + o + + o + + o o n.s o o + k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Küstenwatt: Queller-Watt S.1.2 70 30 hoch + o - o - o + o o o o o o o + k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 30 30 hoch - - o o - o + n.s - n.s o n.s o o + k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Küstenwatt: Queller-Watt S.1.2 70 50 hoch + + + + + o o + + + + o o n.s o o + k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 30 50 hoch o + + + + o + n.s o n.s o n.s o o + +<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 100 30 hoch + o o - o o o n.s o n.s o n.s n.s k.W. - k.W.<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 100 20 hoch o o o o o o o n.s o o o n.s n.s k.W. o k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 10 20 hoch o o o o o o + + o o o o o o o + k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 90 20 hoch - - - - - o - - o - - o o o o o o k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 100 20 hoch o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 Küstenwatt: Queller-Watt S.1.2 10 30 hoch + + + o o o o o n.s + n.s o n.s o o o k.W.<br />
" " Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 90 30 hoch o o o o o o o n.s o n.s o n.s o o o o<br />
Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 Untere Salzwiese: Strandsalzmelden-Rasen S.2.4 100 20 hoch o o o o o o o n.s o o o n.s n.s k.W. o k.W.<br />
Obere Salzwiese: unspezifisch S.3.0 Untere Salzwiese: Andel-Rasen S.2.1 100 50 hoch - - o o - o + n.s - n.s o n.s o o + k.W.<br />
Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 Untere Salzwiese: unspezifisch S.2.0 30 30 hoch o + + + + o + k.W. o k.W. o n.s o k.W. o k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Rotschwingel-Wiese S.3.3 30 30 hoch + + + + + o + + + + + + o o n.s o o + k.W.<br />
" " Obere Salzwiese: Quecken-Rasen S.3.7 40 30 hoch o o o o o o o o o o o n.s o o o o<br />
Auwaldentwicklung* Röhricht: Schilf KRP, NRS Auwaldkomplex WW (WH) 100 30 hoch k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
Röhricht: Sonstiges Röhricht KBR, FWR* Auwaldkomplex WW (WH) 100 30 hoch k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.<br />
* unter Gewährleistung der * KBR, FWR, KRS, KRH, KRZ, NRG, NRW, NRR, VER<br />
+ + 2,0 bis > 1,2 deutlich positiv<br />
Deichfußentwässerung hoch ≥ 40% Wertigkeit hoch + 1,2 bis > 0,4 leicht positiv<br />
mittel ≥ 20% Wertigkeit mittel o 0,4 bis - 0,4 neutral<br />
gering < 20% Wertigkeit gering - < - 0,4 bis -1,2 leicht negativ<br />
- - < - 1,2 bis - 2,0 deutlich positiv<br />
n.s nicht signifikant (Ausgangssituation und/oder Entwicklungsprognose)<br />
k.W. kein Wert (Ausgangssituation und/oder Entwicklungsprognose)<br />
Ohrenlerche<br />
Bewertung von Auswirkungen der Management-Optionen auf die Avifauna<br />
(Differenz der Indexwerte Vegetationstyp Ausgangssituation/Entwicklungsprognose klassifiziert dargestellt)<br />
prognostizierte Vegetationseinheit (nach ~ 15 Jahren) (Vergleich (Entwicklungsprog<br />
Rastvögel Brutvögel<br />
vorher/nachher)<br />
nose) Singvögel Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- / Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Brandgans<br />
Flussseeschwalbe<br />
Rotschenkel<br />
Säbelschnäbler<br />
Feldlerche<br />
Rohrammer<br />
Schafstelze<br />
Wiesenpieper<br />
Kiebitz<br />
Sonstige Arten<br />
Stockente<br />
Uferschnepfe
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 193<br />
Hohe Biomassereduzierungen (≥ 40 % in Bezug auf den vorherigen Zustand) werden vor<br />
allem durch Management-Optionen mit einer hohen Nutzungsintensität wie Beweidungen mit<br />
hohen Besatzdichten ((1,5) 2-3 Rinder oder 3-6 Schafe/ha) oder Mahd erzielt, wobei eine<br />
Mahd bis September/Oktober die Biomassereduzierung gegenüber einer Mahd bis<br />
August/September - sofern keine Sommerfluten eintreten - deutlich erhöht. Aber auch durch<br />
Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen<br />
beruht, wie die des Typs „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ oder auch „aktiver<br />
Prozessschutz“, können hohe Biomassereduzierungen erreicht werden. Als wenig<br />
zielführend hinsichtlich einer <strong>Treibsel</strong>reduzierung können Management-Optionen angesehen<br />
werden, die geringe Biomassereduzierungen (< 20 % in Bezug auf den vorherigen Zustand)<br />
bewirken. Hierzu sind sehr geringe Nutzungsintensitäten auf Quecken-Rasen sowie die<br />
Management-Option „Schlegeln“ zu zählen.<br />
Die Bewertung der prognostizierten Vegetationsausprägung hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ entspricht weitestgehend den Erwartungen. Hohe Nutzungsintensitäten<br />
wie Beweidungen mit hohen Besatzdichten und „Schlegeln“ führen zu Vegetations-<br />
ausprägungen, die hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“ aufgrund einer einheitlichen<br />
Vegetationsstruktur und der Artenzusammensetzung mit „gering“ bewertet wurden. Mittlere<br />
Wertigkeiten ergeben sich für geringere Nutzungsintensitäten wie Beweidungen mit bis zu<br />
1,5 Rindern bzw. < 3 Schafen pro Hektar sowie für Mahd. Die Vegetationsausprägungen, die<br />
sich durch Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen<br />
Prozessen beruht, entwickeln, sind aufgrund der naturnahen Ausprägung als „hoch“ zu<br />
bewerten.<br />
Die Bewertung von Auswirkungen der Management-Optionen auf die Brut- und<br />
Rastvögel macht deutlich, dass sich eine Management-Option sehr unterschiedlich auf die<br />
jeweiligen Vogelarten auswirken kann. Beispielsweise wirkt sich die Management-Option<br />
„Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des hydrologischen Systems“<br />
für die rastenden Gänse eher negativ, hingegen für die brütenden Küstenvögel eher positiv<br />
aus. Somit wird deutlich, dass im Rahmen von Ausführungsplanungen standortspezifische<br />
Leitbilder erstellt werden müssen, aus denen hervorgeht, welche Arten vorrangig<br />
berücksichtigt werden sollen. Aus diesem Grund können die Management-Optionen<br />
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Brut- und Rastvögel nicht pauschal bewertet werden.<br />
Generell lässt sich jedoch sagen, dass eine Beweidung oder Mahd auf Quecken-Rasen mit<br />
zwei Ausnahmen (Beweidung mit 3-6 Schafen/ha für Kiebitz und Stockente) zu keiner<br />
Verschlechterung führt. Für viele Arten wird sogar eine leichte bis deutliche Verbesserung<br />
erreicht. Ähnliches gilt für die Management-Optionen, bei denen eine Biomassereduzierung<br />
auf natürlichen Prozessen beruht. Diese Management-Optionen wirken sich auf Quecken-<br />
Rasen für alle hier betrachteten Vogelarten positiv oder zumindest neutral aus. Beweidung<br />
wirkt sich durch die Bodenverdichtung allerdings negativ auf das Vorkommen von<br />
wirbellosen Tieren aus, welche eine wesentliche Nahrungsquelle für viele Brutvögel<br />
darstellen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 194 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Auf den Vegetationseinheiten der unteren Salzwiese (z.B. Andelrasen) wirken sich die<br />
Management-Optionen Beweidung oder Mahd zumindest auf rastende Gänse und von den<br />
Brutvögeln auf die Gruppe der Küstenvögel neutral bis positiv aus, wenn man von der Mahd<br />
im September/Oktober absieht, die für Nonnen-/Ringelgans und Brandgans negativ ist.<br />
Ebenso wirken sich Management-Optionen, bei denen eine Biomassereduzierung auf<br />
natürlichen Prozessen beruht, bei Anwendung auf die Vegetationseinheiten der unteren<br />
Salzwiese mit zwei Ausnahmen („passiver Prozessschutz“ für Nonnen-/Ringelgans und<br />
Stockente) ebenfalls neutral bis positiv aus. In den genannten Ausnahmen entsteht sehr<br />
hochwüchsige Vegetation, welche die Gänse nicht präferieren.<br />
Wie in Kapitel 0 beschrieben, sind insbesondere bei höheren Beweidungsintensitäten Alttiere<br />
vorzusehen, die sich in der Regel ruhiger verhalten als Jungtiere, somit weniger Viehtritt<br />
verursachen und Gelege eher umlaufen. Die Herdengröße spielt ebenfalls eine Rolle: je<br />
größer die Herde ist, umso stärker entwickeln diese Tiere Herdenverhalten. Beim Grasen<br />
und Fortbewegen einer großen, dichtstehenden Herde auf einer großen Weidefläche ist die<br />
Gefahr, dass Gelege durch Tritt zerstört oder brütende Vögel aufgescheucht werden, größer<br />
als auf einer kleinen Fläche mit einer geringen Tierzahl.<br />
Bei den Management-Optionen mit intensiven Beweidungsintensitäten könnte durch die<br />
verminderte Beweidungsintensität während der Brutzeit (bis zu 1,5 Rinder/ha bzw.<br />
2 Schafe/ha) und einer wiederum erhöhten Beweidungsintensität (bis zu 3 Rinder bzw.<br />
3-6 Schafe/ha) nach der Brutzeit sowohl ein treibselreduzierender Effekt als auch positive<br />
Auswirkungen auf die Avifauna (vergleichsweise geringerer Tritt zur Brutzeit, Verdrängung<br />
von Quecken-Rasen durch zeitweilig hohe Beweidungsintensität und günstigeres<br />
Nahrungshabitat für Rastvögel) erreicht werden. Allerdings ist der positive Effekt der<br />
Verdrängung reiner Quecken-Rasen durch hohe Beweidungsintensitäten gegen negative<br />
Effekte des Beweidungseinflusses abzuwägen.<br />
Negative Auswirkungen auf die Avifauna treten vor allem dann auf, wenn sich - wie bei den<br />
Management-Optionen „Beweidung mit 0,5-1,0 Rindern/ha“, „Mahd bis September/Oktober“<br />
und „passiver Prozessschutz“ - die Vegetationseinheit der „Oberen Salzwiese: unspezifisch“<br />
(Vegetationstypen der oberen Salzwiese außer Quecken-Rasen) zu einem Quecken-<br />
Reinbestand entwickelt. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf die Avifauna neutral bis<br />
deutlich negativ. Aber auch die Entwicklung des Vegetationstyps von der „Oberen Salzwiese:<br />
unspezifisch“ hin zu Vegetationstypen der unteren Salzwiese oder Pionierzone entwickelt,<br />
wie sie z.B. durch die Management-Optionen „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“<br />
oder „aktiver Prozessschutz“ erfolgt, wirken sich eher negativ für die Avifauna aus. Dies liegt<br />
vor allem daran, dass der Vegetationstyp „Obere Salzwiese: unspezifisch“ (S.3.0) meist<br />
heterogene Vegetationsstrukturen mit Flächen niedriger und hochwüchsiger Vegetation<br />
aufweist, also sehr gute Bedingungen für eine Vielzahl der hier betrachteten Vogelarten, wie<br />
gute Tarnung der Gelege, Nahrungssuche und Sichtschutz, bietet. Gegenüber Standorten im<br />
Bereich der unteren Salzwiese mit vergleichbarer Vegetationsstruktur ist die „Obere<br />
Salzwiese: unspezifisch“ im Vorteil, da die Gefahr geringer ist, dass Gelege überflutet<br />
werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 195<br />
Die Vorlandnutzung „Schlegeln“ konnte im Rahmen des Teilprojektes 3 (Kapitel 6) nicht<br />
berücksichtigt werden, da die Maßnahme erst seit 2008 im Rahmen eines Pilotprojektes<br />
erprobt wird. Erste Ergebnisse aus dem Monitoring zu der Schlegelmaßnahme deuten<br />
jedoch darauf hin, dass sich diese Management-Option für die wertbestimmenden<br />
Brutvogelarten des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer deutlich negativ auswirkt.<br />
Dies gilt insbesondere für die Arten Rohrammer, Rotschenkel und Schafstelze, für die für die<br />
Jahre 2009 und 2010 im Vergleich zu den Bestandsdaten von 2004 deutlich weniger<br />
Brutnachweise, -verdachte erbracht werden konnten. Ursache hierfür dürfte die strukturelle<br />
Verarmung bzw. das Fehlen vorjähriger Vegetationsstrukturen sein, welche für die<br />
genannten Brutvogelarten entscheidende Habitatparameter darstellen.<br />
Eine sichere Bewertung der Maßnahme hinsichtlich ihres Einflusses auf die<br />
Vorlandvegetation ist trotz sich deutlicher abzeichnender Trends, wie Verschiebungen der<br />
Mengenanteile dominanter Arten, nach der bisherigen kurzen Entwicklungsdauer noch nicht<br />
möglich. Die Differenzierung für die Fragestellung irrelevanter kurzfristiger<br />
Bestandsschwankungen (natürliche Fluktuationen und stochastische Prozesse) von<br />
tatsächlichen Maßnahmenwirkungen erfordert die Fortsetzung der Untersuchungen über<br />
mehrere Jahre hinweg.<br />
Für die Management-Option „Röhricht-Mahd“ liegen ebenfalls keine Indexwerte vor, da hier<br />
im Rahmen des Teilprojektes 3 keine Untersuchungen vorgesehen waren. Anhand einer<br />
Literaturauswertung „Schilfmahd als Management-Option zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung in den<br />
Flussästuaren Niedersachsens - Auswirkungen auf Röhrichtbrüter und naturschutzfachliche<br />
Bewertung“ (Anhang 3) lassen sich aber die Auswirkungen wie folgt beschreiben.<br />
Die Gilde der Röhrichtbrüter zeichnet sich durch ihr besonderes ökologisches<br />
Anpassungspotenzial an den Lebensraum aus. Röhrichtbrüter sind Habitatspezialisten, die<br />
unterschiedliche ökologische Nischen im Röhricht besetzen sowie unterschiedliche<br />
Strukturen und Altersstadien benötigen.<br />
Die Literaturauswertung ergab, dass es durch Schilfmahd v.a. zu negativen Auswirkungen<br />
auf die Brutvogelfauna kommt. Schilfmahd führt zu einer strukturellen Vereinheitlichung und<br />
somit zu einer Verarmung von Röhrichten. Natürliche Prozesse wie Erosion oder Eisschur,<br />
die ebenfalls Schilfröhrichte strukturell stark verändern können, wirken in der Regel<br />
punktuell-kleinteiliger und sorgen durch das Nebeneinander mit Altschilfbeständen für<br />
abwechslungsreiche Strukturen. Sie sind daher in der Wirkung mit Schilfmahd keineswegs<br />
vergleichbar. Die strukturelle Vereinheitlichung durch Mahd ist über Jahre erkennbar und<br />
macht sich im Fernbleiben von Arten oder in geringeren Siedlungsdichten nachhaltig<br />
bemerkbar. So fehlen beispielsweise Drossel- und Teichrohrsängern stabile, alte Halme aus<br />
dem Vorjahr zur Nestanlage. Arten wie z.B. Bartmeise, Rohrschwirl, Rallen fehlt die Schicht<br />
abgeknickter Altpflanzen als Brut- und Nahrungsplatz. Die Studien ergaben, dass gemähte<br />
Flächen im ersten Jahr nach einer Wintermahd von keiner Art besiedelt wurden. Die<br />
Wiederbesiedlung einmal geschnittener Schilfe dauert umso länger, je stärker Arten an<br />
Altschilfstrukturen wie z.B. die Knickschicht gebunden sind (z.B. Bartmeise > 5 Jahre).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 196 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Neben der strukturellen Beeinträchtigung kommt es durch die Abfuhr oder Zerkleinerung des<br />
Schilfs zum Verlust Schilf bewohnender Insekten, Spinnen etc. Diese fehlen als<br />
Nahrungsgrundlage in den Revieren der Brutvögel, wobei Schilfröhrichte aufgrund der<br />
geringen Produktion von tierischer Biomasse ohnehin schon als relativ nahrungsarme<br />
Habitate gelten, in denen die Bewohner zusätzlich von außen Nahrung eintragen müssen.<br />
Die auch von Teilen des Naturschutzes vorgebrachte Argumentation, Schilfmahd führe zu<br />
einer Aufwertung durch Erhöhung der Randlinienanteils, wird widerlegt. Eher muss davon<br />
ausgegangen werden, dass sie zu direkter Störung und zu einer Zerschneidung ursprünglich<br />
großflächiger Röhrichte führt. Einzelne Studien ergaben, dass zudem das Prädationsrisiko in<br />
gemähten Schilfröhrichten doppelt so hoch und höher sein kann.<br />
Naturschutzfachlich kann also die Schilfmahd zu negativen Auswirkungen auf die Schutz-<br />
und Entwicklungsziele europäischer Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete der Ästuare<br />
führen.<br />
Um die Konflikt zwischen Brutvogel-Schutz und Röhricht-Mahd zu vermeiden, sollte auf<br />
diese Management-Option verzichtet werden. Röhrichte sollten entweder nur in<br />
geschützteren Lagen mit geringem Potenzial des Biomasseaustrages gefördert werden oder<br />
als wasserseitiger Streifen vor Tide-Auwäldern vorgesehen werden. Schilftreibsel wird sich<br />
dann im Auwaldgürtel ablagern.<br />
Durch die Management-Option „Auwaldentwicklung“ erfolgt eine Sukzession der Vegetation<br />
von Röhrichtbeständen hin zu Weichholzauen. Demzufolge ist auch ein weitgehender<br />
Artenaustausch der Vogelarten von Röhricht-Arten hin zu charakteristischen Arten der<br />
Weichholzauen zu erwarten. Da die Entwicklung von Auwäldern als treibselreduzierende<br />
Maßnahme in Form von Auwald-Streifen vorgesehen wird, bleiben für Röhricht-Arten<br />
entsprechende Habitate – wenn auch in verringerter Ausdehnung – erhalten. Gleichzeitig<br />
werden seltene und für die Avifauna wertvolle (FLADE 1994) Weichholzauen-Habitate<br />
geschaffen. Den hohen naturschutzfachlichen Wert von Weidenwäldern auf die Avifauna<br />
be<strong>grün</strong>det FLADE (1994) mit „extrem hohe Artenzahlen“ und insbesondere aufgrund der<br />
Gesamtdichte der Brutvögel. Die typische Vogelgemeinschaft wird aufgrund der Naturnähe<br />
des Habitats als ebenfalls sehr naturnah eingestuft. Bei entsprechender Entwicklung des<br />
Auwaldbestandes bietet der Strukturreichtum dieses Lebensraumes einen kleinteiligen<br />
Wechsel verschiedener Strukturen sowie einen Insektenreichtum, der günstige Nahrungs-<br />
und Nistmöglichkeiten für eine Vielzahl von Arten – auch gefährdeter sowie seltener Arten –<br />
bietet. FLADE (1994) führt als Leitarten Beutelmeisen, Gelbspötter, Pirol, Nachtigall, und<br />
Kleinspecht auf (in dieser Auflistung sind nur die Arten genannt, deren Verbreitungsgebiet<br />
sich mit dem Betrachtungsraum deckt).<br />
Selbst bei ausgedehnteren Auwaldanpflanzungen, beispielsweise auf der gesamten Breite<br />
eines Vorlandbereiches, blieben Röhricht-Habitate in Form von gewässerseitigen<br />
Röhrichtstreifen entlang des Auwaldes in geringer Ausprägung erhalten. Somit wird diese<br />
Management-Option hinsichtlich der Auswirkungen auf die Avifauna leicht negativ auf<br />
einzelne Röhrichtarten eingeschätzt, wobei jedoch seltene und ebenfalls naturschutzfachlich<br />
wertvolle Auwaldhabitate neu geschaffen werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 197<br />
7.4.4 DISKUSSION<br />
Anhand der Prognose zur Biomassereduzierung, der Bewertung der prognostizierten<br />
Vegetationsausprägung hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“ und der Bewertung der<br />
Auswirkungen auf die bedeutenden Rast- und Brutvögel konnten die Auswirkungen der<br />
Management-Optionen bezüglich der Vegetation und der Avifauna umfassend beschrieben<br />
werden.<br />
Es mag zunächst erstaunen, dass in der Tabelle 56 die gleichen Vegetationseinheiten<br />
unterschiedlich bewertet werden. Dies liegt daran, dass nicht nur die reine Artenkombination<br />
bewertet wurde, sondern auch der Besatz mit nicht natürlichen Herbivoren (z.B. Rinder,<br />
Schafe), da für deren Haltung eine Entwässerung der Böden und ein Netz von Triebwegen<br />
und ggf. Zäunen notwendig ist. Dazu kommt der Vertritt bei Beweidung, der sich in einer<br />
veränderten Vegetationsstruktur und, bei gleicher Artenzusammensetzung,<br />
unterschiedlichen Deckungsanteilen der Arten niederschlägt. Zudem sind die<br />
Vegetationsgemeinschaften in der Strategie „Naturlandschaft“ häufig kleinflächiger und<br />
ineinander verzahnter ausgeprägt, was die Artenvielfalt auf Landschaftsebene verstärken<br />
kann. Dieser Aspekt führt dazu, dass auch nahezu einartige Queckenbestände unter der<br />
Strategie „Naturlandschaft“ als „hoch“ bewertet wurden.<br />
Hinsichtlich der Biomassereduzierung sind neben Management-Optionen mit hohen<br />
Nutzungsintensitäten (Beweidung mit hohem Besatz und vor allem der späten Mahd) auch<br />
die Management-Optionen „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des<br />
hydrologischen Systems bzw. durch Bodenabtrag“ sehr effektiv. Letztere, auf natürlichen<br />
Prozessen beruhende Management-Optionen, bedingen eine naturnahe<br />
Vegetationsausprägung mit einer heterogenen Struktur und einem kleinräumigen<br />
Nebeneinander von verschiedenen Lebensräumen. Zudem unterliegen sie keiner ständigen<br />
Pflege. Somit stellt die „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des<br />
hydrologischen Systems bzw. durch Bodenabtrag“ aus treibselreduzierender und<br />
naturschutzrechtlicher Sicht eine äußerst günstige Management-Optionen dar. Allerdings ist<br />
hierbei zu berücksichtigen, dass die Umsetzung vorerst eine deutliche Veränderung des<br />
- wenn auch anthropogen geformten - Naturhaushalts darstellt (Bodenumlagerung,<br />
Bodenabtrag), mit einmalig erheblichen Kosten verbunden ist und im Falle von Bodenabtrag<br />
die Verwendung der Bodenmassen gegeben sein muss. Demzufolge sind die Management-<br />
Optionen des Typs „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ nur auf begrenzten<br />
Vorlandflächen nutzbar.<br />
Für die Management-Option „Schlegeln/Mulchen“ wird mit 5–10 % die geringste<br />
Biomassereduzierung prognostiziert. Diese Annahme ist dabei noch sehr optimistisch, denn<br />
wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, sind frühzeitige Sturmfluten im Oktober/November<br />
keine Seltenheit (Jahr - Monat der ersten Sturmflut: 2006 – Okt., 2007 - Nov., 2008 - Okt.,<br />
2009 - Okt., 2010 – Okt; schriftlich NLWKN). Dann wird die gesamte geschlegelte/gemulchte<br />
Biomasse aufgeschwemmt und an den Deich gespült, die ansonsten zu einem mehr oder<br />
weniger hohen Anteil auf der Fläche verblieben wäre. Im Rahmen des genannten<br />
Pilotprojektes werden Versuche zur Optimierung dieser Management-Option unternommen,<br />
deren Ergebnisse erst im Jahr 2012 vorliegen werden. Daher wird im Rahmen dieses<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 198 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Forschungsvorhabens diese Management-Option nicht für die modellhaften<br />
Managementkonzepte in Betracht gezogen.<br />
Nach den Prognosen ergibt sich bei den meisten Management-Optionen eine<br />
Biomassereduzierung von 20-50 %. Lediglich bei Mahd im Herbst und bei intensiver<br />
Beweidung sind Reduzierungen bis zu 90 % möglich. Sofern man davon ausgeht, dass der<br />
Anteil der oberirdischen Biomasse aus den Vorland-Beständen, der als <strong>Treibsel</strong> auf den<br />
Deich geworfen wird, gleich bleibt, entspricht die Biomassereduzierung der<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung. Nach Literaturangaben und unseren Daten liegt dieser Anteil<br />
durchschnittlich bei etwa 10 bis 20 % der stehenden Biomasse (unter Berücksichtigung der<br />
bereits durch Nutzung abgeführten Mengen) (Kapitel 5.3.4).<br />
Allerdings dürfte der Anteil der Biomasse, der aus den Vorlandflächen als <strong>Treibsel</strong><br />
ausgetragen wird, bei einer sehr geringen stehenden Biomassemenge deutlich geringer sein,<br />
da zum einen die Angriffsfläche der Vegetation gegenüber Strömungs- und Wellenenergie<br />
sehr gering ist und zum anderen die vorwiegend jungen Pflanzenteile elastischer sind und<br />
somit ein geringes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung besteht. Bei einer mittleren bis hohen<br />
Ausgangssituation<br />
stehenden Biomassemenge hingegen ist die Angriffsfläche größer und es ist mehr altes,<br />
hohe Biomassereduzierung<br />
sprödes Pflanzenmaterial vorhanden (sofern keine flächige Mahd erfolgte), wodurch das<br />
Potenzial des Biomasseaustrages höher ist. Der treibselreduzierende Effekt wird also bei<br />
ringere Biomassereduzierung<br />
einer hohen Biomassereduzierung noch durch das geringere Potenzial des<br />
Biomasseaustrages Legende: stehende der verbleibenden Biomasse Herbst Biomasse <strong>Treibsel</strong>anteil erhöht (vgl. Abbildung Biomassereduzierung 53).<br />
Vegetation und die Avifauna) negativ bewertet werden. Management-Optionen, die eine<br />
Legende<br />
Entwicklung von Quecken-Rasen zu anderen Ausprägungen der oberen Salzwiese bzw. der<br />
Stehende Biomasse Herbst<br />
unteren Salzwiese Biomassereduzierung<br />
begünstigen, sind:<br />
Beweidung <strong>Treibsel</strong> mit Nutzungsintensitäten ≥ 1,5 Rindern bzw. ≥ 3 Schafen/ha. Diese<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
stehende Biomasse Herbst geschätzter <strong>Treibsel</strong>anteil<br />
Abbildung 53: Verhältnis von Biomassereduzierung zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
Die Auswirkungen der Management-Optionen auf die Avifauna sind artspezifisch und können<br />
daher nur bedingt pauschal bewertet werden. Grundsätzlich lässt sich aber für die<br />
Salzwiesen der Festlandsküste festhalten, dass reine Quecken-Rasen hinsichtlich der<br />
Bewertungsansätze (Biomassereduzierung, Bewertungen der Auswirkungen auf die<br />
Option ist mit relativ geringen Anfangskosten, aber relevanten Folgekosten<br />
verbunden, um die Entwässerung zu garantieren.<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des hydrologischen<br />
Systems und Einstau oder durch Bodenabtrag. Diese Option ist mit mittleren
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 199<br />
Anfangskosten und mittleren bis geringen Folgekosten verbunden, vor allem um den<br />
Einstau zu sichern.<br />
„Aktiver Prozessschutz“, also einer Verfüllung von Entwässerungsgräben, ggf.<br />
Initialisierung von Prielsystemen und Nutzungsaufgabe. Diese Option ist mit relativ<br />
hohen Anfangskosten, aber geringen Folgekosten verbunden.<br />
Hingegen wird die Entwicklung hin zu Quecken-Beständen durch folgende Management-<br />
Optionen auf Vegetationsausprägungen der oberen Salzwiese begünstigt:<br />
Beweidung mit 0,5 – 1,0 Rindern pro Hektar,<br />
Salzwiesen-Mahd,<br />
Schlegeln,<br />
„passiver Prozessschutz“, also keine Nutzung und Aufgabe der Unterhaltung von<br />
Entwässerungssystemen (ohne weitere Veränderung).<br />
Ein sinnvoll gestaltetes Beweidungsmanagement mit mittleren, auf Teilflächen bzw. zeitlich<br />
begrenzt auch höheren Beweidungsintensitäten sowie Management-Optionen, bei denen die<br />
Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen beruht (Ausnahme „passiver<br />
Prozessschutz“), wirken sich sowohl aus treibselreduzierender Sicht als auch hinsichtlich der<br />
Habitatansprüche der hier betrachteten Vogelarten überwiegend positiv aus. Es bietet sich<br />
sogar ein enges Nebeneinander dieser Management-Optionen an: beispielsweise mittlere<br />
bis hohe Nutzungsintensitäten auf deichparallelen Vorlandstreifen mit einer Breite von etwa<br />
100 m (nur bei tiefen Salzwiesen) und daran seeseitig angrenzend Flächen, die durch<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses oder durch „aktiven Prozessschutz“ mit<br />
Strategien der „Natürlichen Dynamik“ gemanagt werden.<br />
Bei jedem Management sind allerdings die standörtlichen Gegebenheiten (u.a.<br />
naturräumliche Ausstattung, Höhenlage, Schutzziele, Nutzungsinteressen, Küstenschutz-<br />
funktionen) zu berücksichtigen, da dies für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich ist.<br />
Zudem sollte bei der Umsetzung von Management-Optionen - insbesondere für diejenigen,<br />
deren Auswirkungen auf die Vegetation, Avifauna und weitere Schutzgüter wenig bekannt<br />
sind - ein mehrjähriges Monitoring vorgesehen werden, um die hier erstellten Prognosen und<br />
Bewertungen zu prüfen und ggf. korrigierend eingreifen zu können.<br />
Die Auswirkungen einer Röhricht-Mahd auf Röhrichtbrüter wurde im Anhang 3 sowie<br />
zusammenfassend in Kapitel 7.4.3 dargestellt. Demnach wirkt sich diese Management-<br />
Option vorwiegend negativ auf die Brutvogelfauna aus. Zudem sind alle Röhrichtbestände<br />
gesetzlich geschützte Biotope im Sinnes des § 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG und überwiegende<br />
Flächenanteile unterliegen einem Schutzstatus als europäisches oder nationales<br />
Schutzgebiet. Somit ist eine hohe naturschutzfachliche Konfliktträchtigkeit dieser<br />
Management-Option „Röhricht-Mahd“ gegeben. Zur Lösung dieser Konflikte sind<br />
verschiedene Ansätze denkbar.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 200 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Eine regelmäßige Röhricht-Mahd im Herbst wäre aus treibselreduzierender Sicht vor allem<br />
an Standorten erwägbar, deren Röhrichtflächen zum einen eine exponierte Lage (hohe<br />
Strömungs- und Wellenenergie, hohes Potenzial an Biomasseaustrag) und zum anderen<br />
eine Lage zur Deichlinie aufweisen, die eine hohe <strong>Treibsel</strong>anlandung am Deichfuß<br />
begünstigt, also auf röhrichtbestandenen Vorlandflächen entlang von Deichabschnitten, die<br />
nach Sturmfluten hohe <strong>Treibsel</strong>mengen aufweisen. Da durch die regelmäßige Röhricht-Mahd<br />
im Herbst Habitate europäischer Vogelarten dauerhaft zerstört oder zumindest abgewertet<br />
würden (vgl. Kapitel Anhang 3), wäre ein Ersatz an Röhrichtflächen an anderer Stelle zu<br />
schaffen. Um hier aber keinen neuen Bereich hoher <strong>Treibsel</strong>entstehung zu schaffen, kämen<br />
nur geschützte Lagen in Frage, bei denen ein hoher Biomasseaustrag unwahrscheinlich<br />
wäre.<br />
Auch wenn die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Management-Optionen nicht<br />
Gegenstand dieser Arbeit ist, so soll an dieser Stelle dennoch darauf hingewiesen werden,<br />
dass die Röhricht-Mahd eine jährliche Nutzung mit beträchtlichem Aufwand (ungefrorene<br />
Böden erschweren die Zugänglichkeit) bei derzeit ungeklärter Verwendbarkeit des Mahdguts<br />
darstellt. Eine regelmäßige Mahd wäre erforderlich, da das Eintreten einer schweren<br />
Sturmflut nicht vorhersehbar ist. Des Weiteren wären Ersatzhabitate zu schaffen, bei denen<br />
ein Biomasseaustrag nicht ausgeschlossen werden kann, deren Planung und Ausführung<br />
ebenfalls mit Kosten verbunden sind. Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte ist die<br />
Eignung der Röhricht-Mahd als treibselreduzierende Management-Option und die<br />
naturschutzfachliche Vertretbarkeit äußerst fraglich.<br />
Ein weiterer Lösungsansatz ist der Verzicht auf eine Röhricht-Mahd und anstelle dessen eine<br />
Förderung der Entwicklung von Tide-Auwäldern, welche als Management-Option in Kapitel 0<br />
auch vorgesehen wird. Somit könnte zum einen eine <strong>Treibsel</strong>reduzierung durch Verringerung<br />
des Potenzials an <strong>Treibsel</strong>entstehung sowie an Biomasseaustrag und zum anderen eine<br />
naturschutzfachliche Aufwertung dieses Lebensraumes erreicht werden, da viele<br />
Röhrichtbrüter von einem Komplex von Schilf- und Gehölzbeständen profitieren<br />
(Zwergdommel, Beutelmeise, Nachtigall).<br />
Im Zuge der Bearbeitung und in der anschließenden Diskussion der Ergebnisse der<br />
genannten Literaturauswertung wurden Wissensdefizite deutlich. Diese sind in erster Linie<br />
Erkenntnislücken in Bezug auf naturräumliche Gegebenheiten wie z.B. eine mögliche<br />
strukturelle Veränderung der Tideröhrichte (z.B. verursacht durch Stromausbauten und<br />
-vertiefungen) sowie eine Einschätzung der wesentlichen Ursachen der<br />
Gefährdungssituation der Röhrichtbrüter in den Ästuaren, die sich im derzeit überwiegend<br />
mäßigen bis schlechten Erhaltungszustand vieler Röhrichtbrüter widerspiegelt. Die einzelnen<br />
Fragestellungen und Antwortthesen werden in der genannten Literarturauswertung (Anhang<br />
3) geschildert.<br />
Röhrichte gehören nach dem BNatSchG § 30 zu den gesetzlich geschützten Biotopen, für<br />
welche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen<br />
Beeinträchtigung führen, verboten sind. Bei einer Auwaldanpflanzung würde zwar der<br />
Biotoptyp „Röhricht“ zurückgedrängt werden, allerdings würden sich anstelle dieser Auwälder<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 201<br />
entwickeln, die für Teilbereiche der Ästuare des Betrachtungsraumes als potenziell<br />
natürliche Vegetation anzusehen sind (KESEL 1999, KAISER ET AL. 2003), die gemäß<br />
BNatSchG § 30 ebenfalls zu den gesetzlich geschützten Biotopen gehören und für die<br />
Avifauna von hohem naturschutzfachlichen Wert sind FLADE (1994). Darüber hinaus gehören<br />
Weiden-Auwälder nach Anhang I der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) zu den prioritären<br />
Lebensraumtypen (91E0) mit besonders hohem Schutzstatus, welche im Betrachtungsraum<br />
mit 114 ha nur zu einem vergleichsweise geringen Flächenanteil (gegenüber Röhrichten der<br />
Ästuare mit 2205 ha) vertreten sind. Demnach erfolgt durch diese Management-Option an<br />
dafür geeigneten Standorten keine naturschutzfachliche Wertminderung.<br />
7.5 MODELLHAFTE MANAGEMENTKONZEPTE – DARSTELLUNG UND<br />
BEWERTUNG<br />
7.5.1 EINLEITUNG<br />
Für eine Auswahl der detailliert untersuchten Flächen sollen modellhafte<br />
Managementkonzepte erstellt werden, bei denen auf die im Rahmen dieses Projektes<br />
erarbeiteten Management-Optionen zurückgegriffen werden soll. Anhand dieser<br />
modellhaften Managementkonzepte können exemplarisch Möglichkeiten eines<br />
Vorlandmanagements zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung dargestellt werden. Auf dieser Grundlage soll<br />
eine standortbezogene Prognose der Vegetationsentwicklung und der Biomassereduzierung<br />
sowie eine Bewertung der naturschutzfachlichen Auswirkungen, die eine Gegenüberstellung<br />
verschiedener Konzepte ermöglicht, erfolgen.<br />
Eine Bewertung des Nutzens und der Ökonomie dieser Managementkonzepte, wie z.B. eine<br />
Kostenkalkulation oder das Aufzeigen von Perspektiven von Nutzung und Pflege, ist nicht<br />
Gegenstand dieses Projektes (vgl. 7.4.1).<br />
7.5.2 METHODIK<br />
7.5.2.1 FLÄCHENAUSWAHL<br />
Zur Auswahl der Flächen, für die modellhafte Managementkonzepte erstellt werden sollen,<br />
wurden folgende Grundsätze berücksichtigt:<br />
Die ausgewählten Flächen sollen innerhalb der für die Teilprojekte 2 und 3 (Kapitel 5 und<br />
6) festgelegten Probeflächen liegen, da hierfür detaillierte Ergebnisse<br />
zur Biomasse, Produktivität und dem winterlichen Austrag für alle dominanten<br />
Pflanzengesellschaften,<br />
zu der Höhe der durch die Nutzung entnommenen Biomasse bei beweideten und<br />
gemähten Flächen,<br />
zum Brutvogelbestand, zu Vegetationsstrukturparametern sowie zum<br />
Nahrungsangebot vorliegen und<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 202 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
diese Probeflächen entscheidende Voraussetzungen (z.B. unterschiedliche<br />
landwirtschaftliche Nutzungen, Mindestgröße der Fläche, unbedeichte Vorländer)<br />
erfüllen (vgl. Kapitel 4.3).<br />
Es sollen vornehmlich Vorlandflächen einbezogen werden, für die Höheninformationen<br />
aus Laserscanbefliegungen vorliegen, da Management-Optionen, die auf dem<br />
Management-Typ „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses“ basieren, nur auf dieser<br />
Datengrundlage konzipiert werden können (gilt nur für Vorländer der Festlandsküste,<br />
nicht für die der Ästuare).<br />
Es sollen vorrangig öffentliche Flächen berücksichtigt werden, da bei Privatflächen eine<br />
spätere Umsetzung der Management-Optionen schwierig sein könnte.<br />
Des Weiteren sollen als Modellflächen vorrangig Vorlandflächen in Betracht gezogen<br />
werden,<br />
die einen „Schwerpunktbereich“ für ein Vorlandmanagement <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
darstellen; also ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung sowie ein hohes Potenzial<br />
des Biomasseaustrages aufweisen (vgl. Kapitel 7.2.3.2),<br />
deren naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der Vegetationsausprägung und des<br />
avifaunistischen Artenspektrums eher als gering einzustufen ist, da hier Maßnahmen im<br />
Zuge eines <strong>Treibsel</strong>vorlandmanagements in ein - wenn auch anthropogen geformtes -<br />
„Ökosystem“ naturschutzrechtlich vertretbarer sind,<br />
die sich aufgrund ihrer naturräumlichen Ausstattung unterscheiden (z.B. Grad der<br />
anthropogenen Prägung), so dass für verschiedene Ausgangssituationen modellhafte<br />
Managementkonzepte zu erstellen sind und ein weites Spektrum an Management-<br />
Optionen bei den modellhaften Managementkonzepten Anwendung findet.<br />
Die Vorlandflächen für die modellhaften Managementkonzepte werden anhand der<br />
genannten Kriterien ausgewählt.<br />
7.5.2.2 ENTWICKLUNG MODELLHAFTER MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Ziel der modellhaften Managementkonzepte ist, exemplarisch Möglichkeiten des<br />
Vorlandmanagements zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung für ausgewählte Vorlandbereiche darzustellen<br />
und anhand dieser die unterschiedlichen Auswirkungen aufzuzeigen.<br />
In der Regel werden für ein Vorlandmanagement zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung von<br />
Deichverbänden und Landwirten Management-Optionen in Form einer Landnutzung<br />
präferiert. Im Gegensatz hierzu stehen die Interessen der Nationalparkverwaltung und<br />
Naturschutzvertreter, die eine Biomassereduzierung auf Grundlage natürlicher Prozesse<br />
sowie Pflegenutzungen bevorzugen. Da die Ergebnisse des Teilprojektes 2A (Kapitel 5.2)<br />
ergeben, dass eine Biomassereduzierung durch Management-Optionen, die auf natürlichen<br />
Prozessen beruhen, im Vergleich zu Management-Optionen, die eine Landnutzungen<br />
bedingen, durchaus vergleichbare Biomassereduzierungen erreicht werden können, sollen<br />
diese beiden Strategien für jede Modellfläche berücksichtigt werden. Somit werden pro<br />
Modellfläche zwei modellhafte Managementkonzepte erstellt: eines, welches vorrangig auf<br />
Management-Optionen der Strategie „Natürliche Dynamik“ beruht, und eines, das<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 203<br />
Management-Optionen der Strategie „Kultureinfluss“ stärker berücksichtigt. Ein<br />
Nebeneinander von Management-Optionen beider Strategien soll hierbei nicht<br />
ausgeschlossen sein, sofern dies als sinnvoll erachtet wird. Anhand dieser<br />
Managementkonzepte unterschiedlicher Strategien können die Auswirkungen anschaulich<br />
dargelegt und gegenübergestellt werden.<br />
Damit eine Vielzahl an Management-Optionen bei den modellhaften Managementkonzepten<br />
exemplarisch angewendet und somit die unterschiedlichen Auswirkungen am Beispiel<br />
darstellt werden können, wurden die einzelnen Management-Optionen möglichst nur für ein<br />
Konzept großflächig vorgesehen. Dennoch wurden die modellhaften Managementkonzepte<br />
auf Grundlage einer Analyse der Ausgangssituation und Problemstellung für jede<br />
Modellfläche individuell ausgearbeitet.<br />
Für die naturschutzfachliche Bewertung ist die Formulierung eines Leitbildes als<br />
Bewertungsmaßstab erforderlich. Aufgrund des Schutzstatus überwiegender Flächenanteile<br />
des Betrachtungsraumes als Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, FFH-, EU-Vogel-<br />
und Landschaftsschutzgebiet sind als oberstes Ziel der Schutz natürlicher Prozesse und die<br />
Entwicklung von natürlichen Zuständen in den Vorländern der Salzmarschen und Ästuare<br />
anzusehen. Dieses Ziel wird im Weiteren unter dem generellen Leitbild „Naturlandschaft“ für<br />
den gesamten Betrachtungsraum vorausgesetzt.<br />
Für die Erstellung von Managementplänen im Rahmen von Ausführungsplanungen ist das<br />
Leitbild standortbezogen zu konkretisieren, da sich kein Management auf alle<br />
Bewertungskriterien positiv auswirken kann und somit konkretere Bewertungsmaßstäbe<br />
definiert werden müssen. Hierunter fallen klassische Ziele des Naturschutzes wie Biotop-<br />
und Artenschutz. So könnte beispielsweise das standortspezifische Leitbild für<br />
Vorlandbereiche des Jadebusens den Rotschenkel aufgrund des Vorkommens-<br />
schwerpunktes vorrangig berücksichtigen, hingegen ein standortspezifisches Leitbild für<br />
Vorlandbereiche der Leybucht den Schutz der nordischen Gänse.<br />
Die naturschutzfachliche Bewertung der modellhaften Managementkonzepte wird aus<br />
verschiedenen Gründen auf Grundlage des generellen Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
vorgenommen:<br />
Nur anhand eines einheitlichen Bewertungsansatzes ist eine Vergleichbarkeit der<br />
einzelnen Konzepte möglich (vgl. Kapitel 7.5.2.3).<br />
Die Übertragbarkeit der modellhaften Managementkonzepte auf vergleichbare<br />
Vorlandbereiche des Betrachtungsraumes soll gegeben sein.<br />
7.5.2.3 BEWERTUNG MODELLHAFTER MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Die Bewertung der modellhaften Managementkonzepte erfolgt im Wesentlichen analog zur<br />
Bewertung der Management-Optionen (Kapitel 7.4.2) und teilt sich demzufolge ebenfalls in<br />
drei Hauptkomponenten:<br />
1. Prognose der Biomassereduzierung,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 204 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
2. Bewertung der prognostizierten Vegetationsausprägung hinsichtlich eines Leitbildes,<br />
3. Bewertung der Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel.<br />
Das Vorgehen dieser Bewertungen wurde unter Kapitel 7.4.2 ausführlich erläutert und wird<br />
daher an dieser Stelle nicht erneut aufgeführt.<br />
Die Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte auf die Brut- und Rastvögel soll<br />
am Beispiel von sechs Arten verschiedener Artengruppen dargestellt werden, da die<br />
Bewertung aller im Rahmen des Teilprojektes 3 berücksichtigten Arten (17) sehr umfänglich<br />
und für eine modellhafte Bewertung wenig zielführend wäre. Folgende Arten (Artengruppen)<br />
wurden beispielhaft für die Bewertung ausgewählt: Schneeammer (rastende Singvögel),<br />
Nonnen- und Ringelgans (rastende Gänse), Austernfischer, Rotschenkel (brütende<br />
Küstenvögel) und Wiesenpieper (brütende Singvögel). Die naturschutzfachliche Bewertung<br />
derselben Arten für jedes Managementkonzept ermöglicht zudem den Vergleich<br />
untereinander. Diese Auswahl stellt keine Gewichtung der Bedeutung dieser Arten als<br />
Bewertungsgrundlage dar. Welche Arten bei Ausführungsplanungen bewertungsrelevant<br />
sind, ist aus den standortspezifischen Leitbildformulierungen abzuleiten. Da die modellhaften<br />
Managementkonzepte u.a. aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht auf standortbezogenen<br />
Leitbildern basieren (Kapitel 7.5.2.2), wurde eine Artenauswahl für die modellhafte<br />
Bewertung getroffen.<br />
Die naturschutzfachliche Bewertung der Brut- und Rastvögel beruht auf den in Teilprojekt 3<br />
ermittelten Indexwerten (Anhang 2). Im Gegensatz zur Bewertung der Management-<br />
Optionen allgemein, bei der für die Ausgangssituation von einer Nichtnutzung ausgegangen<br />
wurde, kann bei der Bewertung der modellhaften Managementkonzepte bei der<br />
Ausgangssituation auch die vorhandene Nutzungsform berücksichtigt werden. Die<br />
Ergebnisse der Bewertung mittels Indexwerten werden - nicht wie bei der Bewertung der<br />
Management-Optionen als Differenzwert zwischen Ausgangssituation und<br />
Entwicklungsprognose - sowohl für die Ausgangssituation als auch für die Entwicklungs-<br />
prognose anhand von Tellerdiagrammen dargestellt.<br />
Die für die Bewertung herangezogenen Indexwerte stellen immer den Einfluss des<br />
Vegetationstyps für eine Art dar, der Einfluss der Nutzungsform hingegen kann nur für einen<br />
Teil der Indexwerte dargestellt werden (Kapitel 7.4.2, Anhang 2). Sofern für eine<br />
Kombination Vegetationstyp/Nutzungsform kein Indexwert vorlag, wurde auf den Indexwert<br />
„gesamt“ zurückgegriffen, der zwar die Einflüsse des Vegetationstyps, nicht aber den<br />
Einfluss der Nutzungsform wiedergibt. Die Nutzungsform kann aber deutlichen Einfluss auf<br />
die Habitatpräferenzen (Änderung der Struktur, Viehtritt, Bodenverdichtung, Stress) haben.<br />
Auch wenn der Einfluss der Nutzungsform im Indexwert enthalten ist, so fehlt dennoch der<br />
Einfluss der Nutzungsintensität. Die Indexwerte für die Nutzungsform „Beweidung“<br />
differenzieren beispielsweise nicht zwischen sehr extensiver und intensiver Beweidung.<br />
Aufgrund der genannten Einflüsse, die durch die Indexwerte nur bedingt (Nutzungsform)<br />
oder gar nicht (Nutzungsintensität) wiedergegeben werden können, ist bei einigen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 205<br />
Bewertungen auf Grundlage von dem Wissen aus der Feldarbeit und Literaturauswertungen<br />
eine Prüfung und ggf. Korrektur vorzunehmen. Sofern Korrekturen erforderlich sind, werden<br />
diese verbal argumentativ erläutert und in den grafischen Bewertungsübersichten dargestellt<br />
(vgl. Abbildung 52).<br />
7.5.3 ERGEBNISSE<br />
7.5.3.1 VORLANDFLÄCHENAUSWAHL FÜR MODELLHAFTE<br />
MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Anhand der unter Kapitel 7.5.2.1 erläuterten Kriterien wurden für die Festlandsküste von<br />
den detailliert untersuchten Probeflächen drei Vorlandbereiche für modellhafte Management-<br />
konzepte ausgewählt, die in Tabelle 57 aufgeführt sind.<br />
Tabelle 57: Flächenauswahl modellhafte Managementkonzepte an der Festlandsküste<br />
Vorlandbereiche vorhandene Nutzung Ausschlußkriterien bzw. Entscheidung<br />
Leybucht<br />
(Buscher Heller)<br />
Norderland<br />
(Hilgenriedersiel-Neßmersiel)<br />
Teilfläche A<br />
„Hilgenrieder Außengroden“<br />
Beweidung mit 1,0<br />
Rindern/ha, Brache<br />
Beweidung mit 0,5<br />
Rindern/ha, Brache<br />
Teilfläche B Beweidung mit 1,0<br />
Rindern/ha<br />
Teilfläche C<br />
„Neßmersieler Außengroden“<br />
Teilfläche D Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha<br />
südwestlicher Jadebusen<br />
(Dangast - Jade Wapeler Siel)<br />
„Nordender Außengroden“<br />
östlicher Jadebusen<br />
(Augustgroden)<br />
Fläche fällt raus<br />
(mittelhohe stehende Biomasse, wenig bis<br />
mäßig viel <strong>Treibsel</strong>, strukturreicher)<br />
als Modellfläche ausgewählt<br />
(sehr hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturarm)<br />
Fläche fällt raus<br />
(hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturärmer)<br />
Brache als Modellfläche ausgewählt<br />
(sehr hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturarm)<br />
Fläche fällt raus<br />
(mittelhohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturreicher)<br />
Mahd, Brache als Modellfläche ausgewählt<br />
(sehr hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturarm)<br />
Teilfläche A Mahd, Brache Fläche fällt raus<br />
(hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
strukturärmer)<br />
Teilfläche B Brache Fläche fällt raus<br />
(mittelhohe stehende Biomasse, wenig bis viel<br />
<strong>Treibsel</strong>, strukturreicher)<br />
Die Lage der ausgewählten Flächen für die modellhaften Managementkonzepte zeigen die<br />
Abbildung 54 und Abbildung 55.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 206 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 54: Lage der Modellflächen des Norderlandes, westlich gelegen „Hilgenrieder<br />
Außengroden“ und östlich gelegen „Neßmersieler Außengroden“<br />
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und<br />
Katasterverwaltung<br />
Abbildung 55: Lage der Modellfläche im südwestlichen Jadebusen „Nordender Außengroden“<br />
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und<br />
Katasterverwaltung,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 207<br />
Von den detailliert untersuchten Flächen der Ästuare wurde eine Modellfläche, für die<br />
modellhafte Managementkonzepte erstellt werden sollen, ausgewählt. Die Auswahlkriterien<br />
sind in der Tabelle 58 aufgeführt.<br />
Tabelle 58: Flächenauswahl modellhafte Managementkonzepte an den Ästuaren (Weser)<br />
Vorlandbereich vorhandene Nutzung Ausschlußkriterien bzw. Entscheidung<br />
linke Weserseite<br />
Abser Sand Mahd im Sommer Fläche fällt raus<br />
(geringe stehende Biomasse, kein <strong>Treibsel</strong>, kein<br />
Röhricht)<br />
Dreptersiel Mahd im Sommer,<br />
Brache<br />
rechte Weserseite<br />
Rechtenfleth-Lunesiel<br />
„Neuenlander Außendeich“<br />
Röhricht-Mahd Winter,<br />
Brache<br />
Fläche fällt raus<br />
(geringe stehende Biomasse, wenig <strong>Treibsel</strong>, kein<br />
Röhricht)<br />
als Modellfläche ausgewählt<br />
(sehr hohe stehende Biomasse, viel <strong>Treibsel</strong>,<br />
Röhricht)<br />
Die Lage der ausgewählten Fläche für die modellhaften Managementkonzepte zeigt die<br />
Abbildung 56.<br />
Abbildung 56: Lage der Modellfläche auf der rechten Weserseite „Neuenlander Außendeich“<br />
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und<br />
Katasterverwaltung<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 208 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Für jede Modellfläche wurden zwei modellhafte Managementkonzepte erstellt. Hierbei<br />
wurden bewusst je Modellfläche ein Managementkonzept, welches vorrangig auf<br />
Management-Optionen der Strategie „Natürliche Dynamik“, und eines, welches maßgeblich<br />
auf Management-Optionen der Strategie „Kultureinfluss“ beruht, ausgearbeitet. Anhand<br />
dieser Managementkonzepte unterschiedlicher Strategien können die Auswirkungen<br />
dargelegt und gegenübergestellt werden.<br />
7.5.3.2 MODELLFLÄCHE „NORDENDER AUßENGRODEN“<br />
7.5.3.2.1 AUSGANGSSITUATION<br />
Der Vorlandbereich der Modellfläche „Nordender Außengroden“ liegt im südwestlichen<br />
Jadebusen. Die insgesamt 64 ha große Vorlandfläche weist eine Vorlandtiefe von 520-600 m<br />
auf. Sie liegt innerhalb des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, des FFH-<br />
Gebietes 01 „Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“ sowie des EU-Vogelschutz-<br />
gebietes V01 „Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer“. Die<br />
Höhenlage des Vorlandes nimmt seewärts von 3,1 auf 1,6 m ü. NN ab, wobei deichwärts des<br />
Mittelgrabens das Vorlandniveau etwas geringer ist als bei den Flächen seewärts des<br />
Mittelgrabens. Das mittlere Tidehochwasser liegt hier bei 1,89 m ü. NN (Pegel „Vareler<br />
Schleuse“).<br />
Die Flächen deichseitig des Mittelgrabens werden durch Grüppen, welche in regelmäßigen<br />
Abständen von etwa 30 m angelegt sind, in den Mittelgraben entwässert. Seeseitig des<br />
Mittelgrabens ist das Entwässerungssystem mit wenigen Hauptentwässerungsgräben<br />
schwächer ausgestaltet.<br />
Die Vorlandfläche wird bis zum Mittelgraben (mittig gelegener deichparalleler<br />
Entwässerungsgraben) auf einer Breite von etwa 300 m durch eine einschürige Salzwiesen-<br />
Mahd im Sommer genutzt (Abbildung 57). Die Fläche nordwestlich des Mittelgrabens liegt<br />
brach.<br />
Die Umweltbedingungen (Nährstoffe, Überflutung, Salzgehalte etc.) sind in (Abbildung 19 a-i)<br />
im Vergleich zu anderen Untersuchungsgebieten dargestellt (Bezeichnung der Modellfläche<br />
in der Abb. „Dangast“). Demnach zeichnet sich diese Modellfläche durch eher niedrige<br />
Nährstoffgehalte und niedrige Salzgehalte bei gleichzeitig recht hohem Grundwasserstand<br />
und geringen Überflutungshäufigkeiten aus. Die Vegetation setzt sich von der See her aus<br />
der Abfolge der Vegetationstypen von „Schlickgras-Watt“ (Spartina type) und „Queller-Watt“<br />
(Salicornia type) über „Andel-Rasen“ (Puccinellia maritima type) bis hin zu „Quecken-Rasen“<br />
(Elymus spp. type) zusammen, wobei die Queckenbestände, mit einer Ausdehnung von<br />
knapp 400 m Breite des Vorlandes, diesen Vorlandbereich dominieren (Abbildung 58).<br />
Die Mahd der Queckenbestände führt zu keiner Steigerung der Artenvielfalt. Die unteren<br />
Salzwiesen/Andelrasen bestehen vor allem aus besonders hochwüchsigen Beständen von<br />
Andelgras und Strandaster.<br />
Obwohl im Sommer durch die Salzwiesen-Mahd der Quecken-Rasen eine erhebliche Menge<br />
an Biomasse ausgetragen wird, ist die stehende Biomasse im Herbst dieser Modellfläche<br />
hoch. Dies liegt zum einen an dem hohen Aufwuchs der produktiven Elymus-Arten nach der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 209<br />
Mahd, so dass die stehende Biomasse im Herbst auf den gemähten Quecken-Rasen mit<br />
~ 740 g/m² nur geringfügig niedriger ist als in ungemähten mit ~ 830 g/m². Zum anderen wirkt<br />
sich die große Vorlandtiefe mit überwiegend hohen, stehenden Biomassemengen auf die<br />
gesamte Biomassemenge dieser Modellfläche aus, so dass auf dieser 64 ha großen<br />
Vorlandfläche im Herbst rund 433 t Biomasse (~ 6,8 t/ha) stehen (vgl. Abbildung 59). Für den<br />
Deichabschnitt entlang dieser Modellfläche wurde nach den Sturmfluten 2006 und 2007 im<br />
Mittel „viel <strong>Treibsel</strong>“ gemeldet (vgl. Karte 1a).<br />
Abbildung 57: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Nordender Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 210 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 58: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Nordender Außengroden“)<br />
Abbildung 59: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 211<br />
Abbildung 60: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Nordender Außengroden“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Für die gemähten Quecken-Rasen deichseitig des Mittelgrabens ergibt sich aufgrund der<br />
Landnutzung und deren Auswirkungen auf die Vegetation eine mittlere naturschutzfachliche<br />
Wertigkeit. Den brachliegenden Salzwiesen, mit Ausprägungen der oberen und unteren<br />
Salzwiese sowie der Pionierzone, wird eine hohe Wertigkeit beigemessen (Abbildung 61).<br />
Der Bereich der oberen Salzwiese ist allerdings aufgrund der reinen Quecken-Bestände,<br />
welche durch eine geringe Artenvielfalt und homogene Vegetationsstruktur geprägt ist, als<br />
geringwertiger einzuschätzen als naturnähere Ausprägungen der oberen Salzwiese.<br />
Die Entwässerung ist auf einem Großteil der Modellfläche - insbesondere aber auf den<br />
Flächen deichseitig des Mittelgrabens -, aufgrund der künstlich angelegten<br />
Entwässerungssysteme, anthropogen geprägt und unterliegt nur sehr bedingt einer<br />
natürlichen Dynamik. Die Sedimentationsraten auf diesen Vorlandflächen sind aufgrund der<br />
Buchtenlage sehr hoch. Im Frühjahr ist die Vegetationsdecke der Vorlandbereiche nahe der<br />
Wasserkante i.d.R. mit einigen cm Schlick bedeckt.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 212 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 61: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Nordender Außengroden“)<br />
7.5.3.2.2 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
„KULTUREINFLUSS“<br />
Die derzeit durchgeführte einschürige Salzwiesen-Mahd wirkt sich nur mäßig<br />
biomassereduzierend aus, da die produktiven Quecken-Arten nach der Mahd, meist im<br />
Juli/August, bis zum Beginn der Sturmflutsaison im Herbst stark nachwachsen und nahezu<br />
die Biomassemenge zum Zeitpunkt vor der Mahd erreichen. Um die Salzwiesen-Mahd<br />
hinsichtlich des Ziels der <strong>Treibsel</strong>reduzierung effizienter durchzuführen, wird bei dem<br />
modellhaften Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ (Abbildung 62) eine Salzwiesen-<br />
Mahd vorgesehen, bei der die letzte Mahd im Jahr im September/Oktober auf sämtlichen<br />
Quecken-Rasen, also über den Mittelgraben hinaus, vorgesehen wird. Von einer<br />
Zugänglichkeit der Flächen seeseitig des Mittelgrabens wird bei der derzeitigen Intensität der<br />
Entwässerung ausgegangen. Das Mahdgut kann bei ausreichender Qualität<br />
landwirtschaftlich, alternativ energetisch genutzt werden. Sofern eine energetische Nutzung<br />
auch zukünftig nicht in Betracht gezogen werden kann, wäre eine intensive Nachweide der<br />
Flächen als Alternative denkbar. Seeseitig der derzeitigen Quecken-Rasen werden keine<br />
Management-Optionen vorgesehen, da die Vegetationstypen eher geringe stehende<br />
Biomasse im Herbst aufweisen und naturschutzfachlich hochwertige Flächen darstellen.<br />
Hinsichtlich der Entwässerungsintensität im Vorlandbereich deichseitig des Mittelgrabens ist<br />
zu prüfen, ob unter der vorgesehenen Landnutzung die Anzahl der Gräben reduziert werden
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 213<br />
kann. Die Deichfußentwässerung könnte, sofern die verringerte Zahl an Gräben diese nicht<br />
mehr gewährleistet wäre, über einen deichparallelen Entwässerungsgraben erfolgen.<br />
Diese Management-Variante ist allerdings stark witterungsabhängig, da die Mahd nur<br />
durchgeführt werden kann, wenn der Boden trocken genug ist, um ihn zu befahren. In den<br />
Untersuchungsjahren war dies teilweise auch im August nicht der Fall, so dass die Mahd<br />
unterblieb und die Biomasse ungestört aufwachsen konnte. Je weiter der Mahdtermin zum<br />
Herbst hin verschoben wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, das mit zunehmendem<br />
Niederschlag, abnehmenden Temperaturen und geringerer Verdunstung die Böden zu nass<br />
werden, um sie für die Mahd befahren zu können. Eine großfläche Zerfurchung der<br />
Salzmarschen durch einsackende Traktorräder kann nicht im Interesse des Naturschutzes<br />
sein.<br />
Abbildung 62: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“ (Modellfläche<br />
„Nordender Außengroden“)<br />
PROGNOSE<br />
Durch das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ würden sich im Vergleich zur<br />
Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.2.1) hinsichtlich der Vegetationstypen keine<br />
Veränderungen ergeben, da davon auszugehen ist, dass der Vegetationstyp „Quecken-<br />
Rasen“ durch eine späte Mahd im September/Oktober nicht verdrängt, sondern eher<br />
gefördert würde (Abbildung 63). Die Vegetationsstruktur würde sich allerdings dahingehend<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 214 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
ändern, dass die im September/Oktober gemähten Quecken-Rasen im Winterhalbjahr<br />
kurzwüchsiger und homogener wären als die bei einer Mahd im August/September. Im<br />
Frühjahr (zur Brutzeit) wären kaum alte Vegetationsstrukturen aus dem Vorjahr vorhanden,<br />
somit dann eine offenere, homogenere Struktur vorhanden.<br />
Abbildung 63: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Aufgrund des späten Biomasseaustrages durch eine Mahd im September/Oktober und dem<br />
geringen Biomasseaufwuchs nach dem Mahdzeitpunkt wäre die gesamte stehende<br />
Biomasse (Herbst) des Vorlandes der Modellfläche mit rund 145 t deutlich geringer als bei<br />
der Ausgangssituation mit 433 t (vgl. Kapitel 7.5.3.2.1). Durch das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ ergäbe sich also im Vergleich zur Ausgangssituation eine<br />
Biomassereduzierung von 288 t auf 64 ha (~ 4,5 t/ha) (Abbildung 64).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 215<br />
Abbildung 64: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Nordender Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Für die queckenbestandenen Mahdflächen ergäbe sich aufgrund des Nutzungseinflusses<br />
eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit der Vegetation. Die ungenutzten Salzwiesen<br />
seeseitig der Mahdflächen wären als hoch zu bewerten (Abbildung 65).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 216 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 65: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Nordender Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ würde sich anhand der ermittelten<br />
Indexwerte auf alle hier betrachteten Vogelarten hinsichtlich der Habitateigenschaften mehr<br />
oder weniger neutral auswirken, wobei sich die Habitateigenschaften für den Austernfischer<br />
leicht verbessern würden (Abbildung 66). Die geringfügigen Auswirkungen auf die hier<br />
dargestellten Arten sind mit der geringen Veränderung der Landnutzung und der<br />
unveränderten Vegetationsausprägung der Ausgangssituation und der Entwicklungs-<br />
prognose zu be<strong>grün</strong>den. Die einzige Veränderung, die sich in den Indexwerten widerspiegelt,<br />
wird durch die Mahd von zuvor brachliegenden Quecken-Rasen hervorgerufen, die sich für<br />
den Austernfischer leicht positiv auswirken würde. Für die übrigen hier dargestellten Arten<br />
liegen für den Vegetationstyp „Quecken-Rasen“ nur Indexwerte vor, die den Einfluss des<br />
Vegetationstyps, nicht aber der Nutzungsform darstellen, weshalb sich für diese Arten keine<br />
Veränderungen ergeben.<br />
Für die Schneeammer dürfte die Mahd bzw. der Mahdzeitpunkt weitestgehend unbedeutend<br />
sein, da Queckensamen nicht zum Nahrungsspektrum gehören. Lediglich bei einer<br />
Verschiebung der Artenzusammensetzung innerhalb der Queckenrasen hin zu einem<br />
höheren Anteil von Melden (Keil- und Spießmelde) würde sich diese Managementoption<br />
positiv auf die Ansprüche der Schneeammer auswirken, da die Samen der Melde zum<br />
Nahrungsspektrum gehören. Sofern die Flächen kurzrasig in den Winter gehen und nach der<br />
Mahd nicht weiter aufwachsen, könnten diese Flächen von rastenden Gänsen als<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 217<br />
Rastflächen genutzt werden. Als Flächen zur Nahrungssuche sind diese jedoch ungeeignet,<br />
da die Quecke zu geringe Proteinmengen enthält.<br />
Für den Austernfischer dürfte die Mahd der Quecken-Rasen kaum Auswirkungen haben, da<br />
diese Art nicht in hochwüchsiger Vegetation brütet. Ob durch die sehr späte Mahd die<br />
Vegetation im Frühjahr noch so kurzwüchsig ist, dass Austernfischer in den gemähten<br />
Quecken-Rasen mit der Brut beginnen würden, ist fraglich.<br />
Die durch die Mahd im September/Oktober verursachte herabgesetzte Heterogenität der<br />
Vegetation und der geringeren Vegetationsdichte würde - vor allem in den derzeit<br />
brachliegenden Flächen (18 % Flächenanteil) - zu einer Verschlechterung der<br />
Habitateigenschaften für brütende Rotschenkel und Wiesenpieper führen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 218 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
30%<br />
20%<br />
83%<br />
20%<br />
10%<br />
87%<br />
3%<br />
70%<br />
80%<br />
17%<br />
67%<br />
3% 10%<br />
30%<br />
10%<br />
20%<br />
20%<br />
100<br />
%<br />
3%<br />
70%<br />
80%<br />
67%<br />
3% 10%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund herabgesetzter Heterogenität).<br />
Abbildung 66: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche „Nordender Außengroden“<br />
87%<br />
*<br />
*
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 219<br />
7.5.3.2.3 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE „NATÜRLICHE<br />
DYNAMIK“<br />
Da die derzeitige Ausprägung des Vorlandbereiches der Modellfläche aufgrund der<br />
anthropogenen Entwässerung und deren Auswirkungen auf die Ökologie des Vorlandes<br />
wenig naturnah ist, ist für die Erreichung einer natürlichen Dynamik ein entsprechendes<br />
Managementkonzept erforderlich. Hierzu wird für den gesamten Vorlandbereich, in einem<br />
Abstand von 100 m zum Deichfuß, die Management-Option „Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses durch Änderung der Hydrologie“, sowie kleinflächig auch „ … durch<br />
Bodenabtrag“, vorgesehen.<br />
Das bestehende Entwässerungssystem soll derart umgestaltet werden, dass eine<br />
Entwässerung der Vorlandflächen über den natürlichen Grad hinaus nicht mehr gegeben ist.<br />
Stattdessen soll eine Bewässerung, ggf. über bestehende, entsprechend umgestaltete<br />
Entwässerungssysteme, gefördert werden. Optimalerweise ist das hydrologische System so<br />
auszugestalten, dass in Geländedepressionen (Senken) ein Wassereinstau erfolgt. Bereiche,<br />
für die aufgrund des Geländeniveaus eine deutliche Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses durch Änderung der Hydrologie nicht gegeben ist, sollte kleinflächig<br />
Bodenabtrag erfolgen. Diese, durch den Bodenabtrag geschaffenen Senken, könnten<br />
ebenfalls Bereiche für Wassereinstau darstellen. Der Bodenabtrag soll nicht pauschal auf der<br />
gesamten Fläche, sondern nur in dem aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvollen Maße<br />
erfolgen. Dabei sollte die Reliefgestaltung nur soweit vorgenommen werden, dass eine<br />
Entwicklung hin zu einer natürlichen Dynamik gegeben und unterstützt wird; also die<br />
vollständige Ausgestaltung nicht anthropogen, sondern durch das Wirken natürlicher<br />
Prozesse erfolgt.<br />
Eine derartige Umgestaltung des hydrologischen Systems im Vorlandbereich ist in der<br />
Abbildung 67, welche das modellhafte Managementkonzept hinsichtlich der Strategie<br />
„Natürliche Dynamik“, für die Modellfläche „Nordender Außengroden“ schematisch<br />
dargestellt. Eine detaillierte Planung bedingt eine sehr genaue Kenntnis über das Relief<br />
(Laserscandaten, Geländevermessungen) und die hydrologischen Verhältnisse<br />
(Strömungsverläufe, Durchflussmengen). Nur auf dieser Grundlage kann eine solide Planung<br />
erfolgen, die im Rahmen von Ausführungsplanungen erforderlich wird, aber nicht<br />
Gegenstand dieser modellhaften Planung ist.<br />
Auf einem deichparallelen 100 m breiten Vorlandstreifen wird eine Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha vorgesehen. Eine Entwässerung dieser Vorlandflächen ist aufgrund der Nutzung<br />
erforderlich, so dass das vorhandene Entwässerungssystem, ggf. auf ein Mindestmaß<br />
reduziert, weiter unterhalten werden sollte. Der Abfluss dieser Gräben wäre durch einen<br />
deichparallelen Graben an der seeseitigen Grenze dieser Vorlandflächen zu gewährleisten,<br />
welcher gleichzeitig eine viehkehrende Wirkung haben sollte. Die Nutzung eines an den<br />
Deich angrenzenden Vorlandstreifens, bringt mehrere Vorteile mit sich:<br />
Der genutzte Vorlandbereich stellt eine „Pufferzone“ zwischen dem stark zu<br />
entwässernden Deichfuß und den Vorlandflächen, die nur einem natürlichen Grad der<br />
Entwässerung unterliegen, dar.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 220 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Es werden sowohl Naturschutzaspekte als auch Küstenschutzaspekte und<br />
Nutzungsinteressen auf einer Fläche berücksichtigt. Auch eine intensive Nutzung ist<br />
aufgrund der umfangreichen naturschutzfachlichen Aufwertung auf den seewärtigen<br />
Vorländern zu rechtfertigen.<br />
Abbildung 67: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche Dynamik“<br />
(Modellfläche „Nordender Außengroden)<br />
PROGNOSE<br />
Durch ein Management gemäß dem Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
würden sich im Vergleich zur Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.2.1) hinsichtlich der<br />
Vegetationsausprägung deutliche Veränderungen ergeben (Abbildung 68). Auf den<br />
Vorlandflächen, auf denen eine Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung<br />
der Hydrologie vorgesehen wurde, würde sich auf den derzeitigen Quecken-Rasen ein<br />
Muster von Vegetationstypen der oberen Salzwiese (unspezifisch) (~ 50 %),<br />
Strandsalzmelden-Rasen (~ 10 %), unteren Salzwiese (unspezifisch) (~ 20 %) und<br />
Schlickgras-Watt (~ 20 %) ergeben. Auf den derzeitigen Quecken-Rasen, auf denen ein<br />
Bodenabtrag von etwa 20 bis 30 cm vorgesehen ist, würden sich Vegetationstypen der<br />
unteren Salzwiese (Andel-Rasen) und der Pionierzone (Schlickgras-Watt) im Verhältnis etwa<br />
3:7 ausprägen. Diese Vegetationstypen würden sich auch auf den Flächen der derzeitigen<br />
unteren Salzwiese ausprägen, wenn der Wasser- und Salzeinflusses erhöht würde,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 221<br />
allerdings im Verhältnis 7:3. Der derzeitige Pionierbereich bliebe unberührt, so dass sich hier<br />
keine Änderungen ergeben würden.<br />
Auf dem mit 1,5 Rindern/ha beweideten deichnahen Vorlandstreifen würden sich die<br />
Quecken-Rasen hin zu einem Komplex der oberen Salzwiese aus Salzbinsen-Wiesen<br />
(~ 20 %) und Rotschwingel-Rasen (~ 80 %) entwickeln.<br />
Abbildung 68: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
Mit der oben dargelegten Vegetationsentwicklung entstehen Vegetationstypen, die weniger<br />
produktiv sind als die der Ausgangssituation. Deshalb würde sich auch die im Herbst<br />
stehende Biomasse deutlich verringern. Die Biomassemenge des beweideten<br />
Vorlandstreifens bliebe im Vergleich zur Ausgangssituation nahezu unverändert.<br />
Die gesamte stehende Biomasse des Vorlandes der Modellfläche wäre im Herbst mit rund<br />
247 t deutlich geringer als bei der Ausgangssituation mit 433 t (vgl. Kapitel 7.5.3.2.1). Durch<br />
das Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ ergäbe sich also im Vergleich zur<br />
Ausgangssituation eine Biomassereduzierung von 186 t auf 64 ha (~ 2,9 t/ha) (Abbildung<br />
69).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 222 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 69: Entwicklungsprognose Biomasse Vegetation (Modellfläche „Nordender<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der Vegetation ist in Abbildung 70 dargestellt.<br />
Aufgrund des größeren Flächenanteils ungenutzter Salzwiesen ergäbe sich durch ein<br />
Management gemäß dem modellhaften Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
eine höhere Wertigkeit der Vegetation, da sich ein Vegetationsmosaik aus unterschiedlichen<br />
Einheiten der unteren und oberen Salzwiese ergeben würde, in der beinahe alle<br />
Vegetationsarten der Salzwiese vertreten sein würden.<br />
Darüber hinaus wird durch die Aufgabe der anthropogenen Entwässerung für die<br />
Vorlandbereiche, auf denen eine Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses vorgesehen ist,<br />
ein natürlicheres hydrologisches System erreicht, welches aus naturschutzfachlicher Sicht<br />
deutlich positiv zu bewerten ist. Hier erfolgt die Bodenentwicklung im Vergleich zu<br />
anthropogen entwässerten Bereichen langsamer (längere Verweildauer des Wassers,<br />
geringeres Abtrocknen des Bodens, langsamere Bodenentwicklung durch geringere<br />
Bodendurchlüftung), die wiederum zu einer verlangsamten Sukzession der Vegetation führt<br />
(ERCHINGER et al. 1994, FÜHRBÖTER et al. 1992). Dies bedeutet einen langsameren<br />
Übergang der Vegetation zu den Beständen der oberen Salzwiese und somit letztlich auch<br />
ein früheres Auftreten von artenarmen, biomassereichen Dominanzbeständen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 223<br />
Abbildung 70: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Nordender Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“)<br />
Mit der Strategie „Natürliche Dynamik“ ergäben sich auch anhand der ermittelten Indexwerte<br />
für die hier bewerteten Brut- und Rastvögel überwiegende positive Entwicklungstendenzen<br />
hinsichtlich der Habitatpräferenzen dieser Arten. Lediglich für den Wiesenpieper ergäbe sich<br />
eine leicht negative Tendenz (Abbildung 71). Diese Bewertung beruht auf Indexwerten, die<br />
überwiegend den Einfluss der Vegetationstypen wiedergeben, bei einem Teil der hier<br />
eingeflossenen Indexwerte konnte zudem der Einfluss der Nutzungsform berücksichtigt<br />
werden (vgl. Anhang 2).<br />
Positiv würde sich bei diesem Managementkonzept die durch extensive Beweidung bedingte<br />
Entwicklung von Quecken-Rasen hin zu den Vegetationstypen Salzbinsen- und<br />
Rotschwingel-Wiese auswirken (19 % der Fläche). Diese Vegetationstypen stellen für die<br />
hier betrachteten Arten - mit Ausnahme des Wiesenpiepers, für den sich keine wesentlichen<br />
Änderungen hinsichtlich der Habitatpräferenzen ergäben - deutlich günstigere Habitat-<br />
eigenschaften dar. Der auf etwa 9 % der Vorlandfläche modellhaft geplante Bodenabtrag auf<br />
derzeit queckenbestandenen Vorlandflächen würde sich aufgrund der prognostizierten<br />
Entwicklung von Andel-Rasen und Queller-Watt ebenfalls für die hier betrachteten Arten –<br />
wiederum mit Ausnahme des Wiesenpiepers, für den sich die Habitateigenschaften aufgrund<br />
der Entstehung von Pionierbereichen verschlechtert – positiv auswirken. Maßgebliche<br />
Ursache für die überwiegend positive Entwicklung ist die großflächig vorgesehene<br />
Management-Option „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 224 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Hydrologie“ auf den derzeitigen Quecken- (40 %) und Andel-Rasen (20 %). Das für diese<br />
Flächen prognostizierte Mosaik aus Vegetationstypen der Pionierzone, unterer und oberer<br />
Salzwiese ohne Quecken-Rasen würde sich für die Arten Schneeammer, Austernfischer und<br />
Rotschenkel deutlich positiv auswirken, für die Gänse kaum eine Veränderung und für den<br />
Wiesenpieper eine leicht negative Entwicklung darstellen.<br />
Grundsätzlich findet bei einer Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung der<br />
Hydrologie eine Anpassung der Vegetation und damit eine Veränderung der<br />
Vegetationseinheiten statt. Hierdurch werden je nach Höhenlage günstigere oder<br />
ungünstigere Bedingungen für Brutvögel geschaffen. Falls regelmäßig eine großflächige,<br />
längere Überflutung der Flächen stattfindet, sind diese Bereiche als Brutgebiete nicht mehr<br />
nutzbar. Wenn sich die Überflutungen jedoch auf Teilbereiche beschränken, mit Ausbildung<br />
von Pionierzonen bzw. unteren Salzwiesen in diesen Bereichen, und dadurch eine größere<br />
Diversität an Vegetationseinheiten geschaffen wird, trägt dies zur Bereicherung der Habitate<br />
und damit zu günstigeren Bedingungen für Brutvögel bei.<br />
Zudem ist unter einer natürlichen Entwicklung ein kleinräumiger Wechsel verschiedener<br />
Vegetationseinheiten zu erwarten, der zur Bildung von Standorten mit einer hohen<br />
Heterogenität beiträgt. Diese heterogenen Standorte sind für versteckt brütende Arten sehr<br />
geeignete Habitate, an denen neben einer versteckten Nestanlage auch eine gute Übersicht<br />
zur Räubererkennung möglich ist. Aufgrund dieser Zunahme der Heterogenität ist im<br />
Gegensatz der Einzelbetrachtung der Vegetationstypen für den Wiesenpieper eine<br />
Aufwertung der Habitatqualität zu erwarten.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 225<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
30%<br />
20%<br />
83%<br />
20%<br />
10%<br />
87%<br />
3%<br />
70%<br />
80%<br />
17%<br />
67%<br />
3% 10%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund heraufgesetzter Heterogenität).<br />
Abbildung 71: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Natürliche Dynamik“ der Modellfläche „Nordender Außengroden“<br />
35%<br />
15%<br />
28%<br />
24%<br />
24%<br />
4%<br />
4%<br />
15%<br />
67%<br />
11%<br />
24%<br />
4%<br />
3%<br />
3%<br />
58%<br />
53%<br />
61%<br />
41%<br />
26%<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
*
Seite 226 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7.5.3.2.4 VERGLEICH DER MODELLHAFTEN MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Die Gegenüberstellung der Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte der<br />
Strategien „Kultureinfluss“ und „Natürliche Dynamik“ hinsichtlich der stehenden Biomasse im<br />
Herbst, der Vegetation und der Brut- und Rastvögel zeigt, dass mit dem modellhaften<br />
Managementkonzept „Natürliche Dynamik“ zwar eine geringere, aber nicht unerhebliche<br />
Biomassereduzierung erreicht würde, während die naturschutzfachlichen Auswirkungen<br />
hinsichtlich der Vegetation und der hier betrachteten Vogelarten insgesamt deutlich positiver<br />
ausfallen würde (Tabelle 59).<br />
Tabelle 59: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte für die<br />
Modellfläche „Nordender Außengroden“<br />
Bewertungsgrundlage<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzung bzw. Management-<br />
Optionen (Flächenanteil)<br />
Ausgangssituation Mahd Sommer (50 %),<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie<br />
„Kultureinfluss“<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“<br />
Brache (50 %)<br />
Mahd Herbst (68 %),<br />
Brache (32 %)<br />
Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses durch<br />
Änderung der Hydrologie<br />
(60 %) sowie kleinflächig<br />
durch Bodenabtrag (9 %),<br />
Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha (19 %),<br />
Brache (12 %)<br />
Stehende<br />
Biomasse im<br />
Herbst<br />
Auswirkungen<br />
auf die<br />
Vegetation*<br />
433 t naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
145 t<br />
(Reduzierung<br />
um 64 %)*<br />
247 t<br />
(Reduzierung<br />
um 43 %)*<br />
hoch 50 %<br />
mittel 50 %<br />
gering 0 %<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 32 %<br />
mittel 68 %<br />
gering 0 %<br />
Tendenz:<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 81 %<br />
mittel 19 %<br />
gering 0 %<br />
Tendenz:<br />
Auswirkungen<br />
auf die Brut-<br />
und Rastvögel*<br />
Säule: grau - Anteil der Biomassereduzierung, <strong>grün</strong> - verbleibender Anteil in Bezug zur Ausgangssituation;<br />
*: In Bezug auf die Ausgangssituation. Die Bewertung der Vegetation bezieht sich auf das Leitbild<br />
„Naturlandschaft“. Die Bewertung der Brut- und Rastvögel erfolgt beispielhaft für die Arten Schneeammer (SA),<br />
Nonnen- & Ringelgans (NRG), Austernfischer (AF), Rotschenkel (RS) und Wiesenpieper (WP).<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 227<br />
7.5.3.3 MODELLFLÄCHE „HILGENRIEDER AUßENGRODEN“<br />
7.5.3.3.1 AUSGANGSSITUATION<br />
Die Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“ liegt an der ostfriesischen Festlandsküste im<br />
Landkreis Aurich bei Neßmersiel. Der Vorlandbereich der Modellfläche ist dem Sommerdeich<br />
des Wester Neßmerhellers vorgelagert und weist eine Vorlandgröße von 74 ha auf. Die<br />
Vorlandtiefe beträgt bis zu 610 m, wobei kleine Vorlandinseln bis zur Rückseite der<br />
seeseitigen Lahnungen reichen. Sie liegt innerhalb des Nationalparks Niedersächsisches<br />
Wattenmeer, des FFH-Gebietes 01 „Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“ sowie<br />
des EU-Vogelschutzgebietes V01 „Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes<br />
Küstenmeer“. Die Höhen des Vorlandes variieren zwischen 2,6 und 1,0 m ü. NN, wobei das<br />
Höhenniveau nicht wie bei der Modellfläche „Nordender Außengroden“ zur See hin abnimmt.<br />
Höhere Bereiche finden sich vor allem im westlichen Bereich der Modellfläche sowie an der<br />
nordöstlichen Vorlandkante, die im Schutz der Lahnungen liegt. Der Verlandungsbereich<br />
einer ehemaligen Pütte im Südwesten der Modellfläche weist eine mittlere Höhe von<br />
1,6 m ü. NN auf. Das mittlere Tidehochwasser liegt hier bei 1,41 m ü. NN (Pegel<br />
„Bensersiel“).<br />
Der gesamte Vorlandbereich wird durch ein Netz von Entwässerungsgräben entwässert. Die<br />
von Entwässerungsgräben umgebenen Flächen werden wiederum durch parallel angelegte<br />
Grüppen, mit einem Abstand von etwa 10-15 m, entwässert. Vom Sommerdeich zur<br />
Vorlandkante verlaufen mehrere Erddämme, die als Zuwegung zu den Lahnungsbauten<br />
dienen.<br />
Auf den überwiegenden Vorlandflächen erfolgt eine Beweidung mit 0,5 Rindern/ha. Die<br />
Vorlandinseln werden vermutlich aufgrund der schlechten Zugänglichkeit für Rinder nicht<br />
oder nur sehr sporadisch beweidet. Der westliche Bereich der Modellfläche liegt brach<br />
(Abbildung 72).<br />
Entsprechend dem Relief der Vorlandfläche ergibt sich auch hinsichtlich der Vegetation<br />
keine klassische Abfolge von oberer Salzwiese über untere Salzwiese hin zur Pionierzone.<br />
Der überwiegende Vorlandbereich wird von Quecken-Rasen dominiert, der kleinflächig von<br />
anderen Vegetationsausprägungen der oberen Salzwiese unterbrochen wird. Ausprägungen<br />
der unteren Salzwiese finden sich nur im südöstlichen Bereich, auf und nahe der Fläche der<br />
ehemaligen Pütte, wo sich Andel-Rasen ausgebildet haben. Diese bestehen neben Andel<br />
vor allem aus hochwüchsigen Strand-Astern. Einige Aufnahmen aus diesem Gebiet zeigen<br />
Übergänge zwischen oberer und unterer Salzwiese, in denen sich Arten der Andelrasen mit<br />
Rotschwingel und Strand-Beifuß, als typische Vertreter der artenreicheren Ausprägungen<br />
der oberen Salzwiese, erreicht. An der Vorlandkante sind Vegetationstypen der unteren<br />
Salzwiese, wenn überhaupt, nur sehr kleinflächig vorhanden. Die bis zu 40 m breite<br />
Pionierzone wird von Queller-Watt dominiert, vereinzelt findet sich auch Schlickgras-Watt<br />
(Abbildung 73).<br />
Aufgrund der ausgedehnten produktiven Quecken-Rasen, der sehr extensiven<br />
Beweidungsintensität und der großen Vorlandtiefe ist die stehende Biomasse im Herbst auf<br />
dieser Modellfläche sehr hoch. Der Biomasseaustrag durch die Beweidung macht nach den<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 228 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Ergebnisse aus dem Teilprojekt 2 (Kapitel 5) nur etwa 10 g/m² aus. Bei einer stehenden<br />
Biomasse der ungenutzten Quecken-Rasen von rund 830 g/m² wirkt sich diese Nutzung also<br />
aus treibselreduzierender Sicht kaum bis gar nicht aus. Insgesamt stehen auf den 74 ha<br />
großen Vorlandflächen im Herbst rund 556 t Biomasse (~ 7,5 t/ha) (vgl. Abbildung 74). Für<br />
den Deichabschnitt entlang dieser Modellfläche wurde nach den Sturmfluten 2006 und 2007<br />
im Mittel „sehr viel <strong>Treibsel</strong>“ gemeldet.<br />
Abbildung 72: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 229<br />
Abbildung 73: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“)<br />
Abbildung 74: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 230 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 75: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die Entwässerung der Vorlandfläche ist durch ein Netz an Gräben anthropogen geprägt und<br />
unterliegt nur sehr bedingt einer natürlichen Dynamik. Die Vegetation wurde<br />
naturschutzfachlich als „mittel“ bewertet, da Beweidung und Entwässerung zu einer<br />
weitgehenden Homogenisierung der Vegetation führt und die Diversität auf<br />
Landschaftsebene gering ist.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 231<br />
Abbildung 76: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“)<br />
7.5.3.3.2 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE<br />
„KULTUREINFLUSS“<br />
Die sehr extensive Beweidung der Vorlandflächen dieser Modellfläche wirkt sich hinsichtlich<br />
einer Biomassereduzierung kaum aus, da der Austrag durch eine Beweidung nur 10 g/m²<br />
ausmacht. Um die Biomasse der Vorlandflächen durch Beweidung aus treibselreduzierender<br />
Sicht spürbar zu reduzieren, wird bei dem modellhaften Managementkonzept „Strategie<br />
Kultureinfluss“ (Abbildung 77) eine Beweidungsintensität von 2–3 Rindern/ha (verminderte<br />
Beweidungsintensität während der Brutsaison) auf den gesamten Vorländern der<br />
Modellfläche vorgesehen. Wie in Kapitel 0 beschrieben, sind hierbei Alttiere vorzusehen, die<br />
sich in der Regel ruhiger verhalten als Jungtiere, somit weniger Viehtritt verursachen und<br />
Gelege eher umlaufen.<br />
Bei einer derart hohen Beweidungszahl sollte die Herde auf jeden Fall in mehrere Herden<br />
(etwa 3–4) aufgeteilt werden, da das Herdenverhalten mit zunehmender Herdengröße<br />
zunimmt (Kapitel 7.4.3). Für die Bereiche der Pionierzone wird kein Management<br />
vorgesehen, sie bleiben ungenutzt.<br />
Die Entwässerung könnte in Anlehnung an die Planungen des Vorlandmanagementplans für<br />
den Bereiche Deichacht Norden (NLWKN NOR 2003) erfolgen. Demnach erfolgt eine<br />
Entwässerung durch eine deichferne (mind. 50 m) parallele Deichfußentwässerung und<br />
bedarfsweise Begrüppung des Zwischenbereichs zum Deichfuß. Des Weiteren sollte<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 232 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
hinsichtlich der Entwässerungsintensität geprüft werden, ob unter der vorgesehenen<br />
Landnutzung die Anzahl der Grüppen reduziert werden kann. Die Deichfußentwässerung ist<br />
hierbei auf jeden Fall sicherzustellen.<br />
Abbildung 77: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“ (Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“)<br />
PROGNOSE<br />
In Folge der großflächigen intensiven Beweidung der Vorlandflächen mit 2–3 Rindern/ha (zur<br />
Brutsaison mit max. 1,5 Rindern/ha) wird eine Entwicklung der Quecken-Rasen und der<br />
anderen Vegetationstypen der oberen Salzwiese hin zu Rotschwingel-Wiesen prognostiziert.<br />
Die mit Andel-Rasen bestandenen Bereiche der unteren Salzwiese würden sich durch die<br />
höhere Beweidungsintensität lediglich in ihrer Struktur, Artenzusammensetzung und<br />
Artendiversität, nicht aber hinsichtlich des Vegetationstyps ändern. Für die Bereiche der<br />
Pionierzone wurde keine Nutzung angenommen, so dass sich hier hinsichtlich der<br />
Vegetation keine Änderungen ergeben würden (Abbildung 78).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 233<br />
Abbildung 78: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Für die mit 2–3 Rindern/ha (zur Brutsaison mit max. 1,5 Rindern/ha) beweideten<br />
Vorlandflächen der oberen Salzwiese wird eine stehende Biomasse im Herbst von 250 g/m²,<br />
für die der unteren Salzwiese 150 g/m² geschätzt. (Diese Beweidungsintensität wird derzeit<br />
nicht praktiziert, so dass im Rahmen des Teilprojektes 2 hierzu keine Werte der stehenden<br />
Biomasse ermittelt werden konnten.) Für die Bereiche der Pionierzone ergäben sich<br />
hinsichtlich der stehenden Biomasse keine Änderungen. Die daraus resultierende gesamte<br />
stehende Biomasse des Vorlandes der Modellfläche wäre mit rund 174 t deutlich geringer als<br />
bei der Ausgangssituation mit 556 t (vgl. Kapitel 7.5.3.3.1). Durch das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ ergäbe sich also im Vergleich zur Ausgangssituation eine<br />
Biomassereduzierung von 383 t auf 74 ha (~ 5,2 t/ha) (Abbildung 79).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 234 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 79: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Aufgrund der hohen Beweidungsintensität würde die Vegetation der beweideten Flächen<br />
eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit beigemessen werden. Die ungenutzten<br />
Salzwiesenbereiche würden hingegen eine hohe Wertigkeit aufweisen (Abbildung 80). Im<br />
Vergleich zur Ausgangssituation ergäbe sich hinsichtlich der Vegetation eine<br />
Verschlechterung der Wertigkeit.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 235<br />
Abbildung 80: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Durch das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ ergäben sich anhand der<br />
ermittelten Indexwerte für die hier bewerteten Rast- und Brutvögel - mit Ausnahme des<br />
Wiesenpiepers (neutrale Entwicklungstendenz) - deutlich positive Veränderungen der<br />
Habitateigenschaften (Abbildung 81). Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass diese<br />
Bewertung vorwiegend auf dem Einfluss des Vegetationstyps beruht (vgl. Anhang 2). Die<br />
Vegetationsausprägung wirkt sich also überwiegend positiv aus, der Einfluss durch die<br />
veränderte Vegetationsstruktur, des erhöhten Viehtritts, Bodenverdichtung und der Störung,<br />
der mit den Indexwerten nicht wiedergegeben werden kann, könnte sich hingegen deutlich<br />
negativ auf die Habitateigenschaften auswirken. Diese entgegenläufigen Auswirkungen sind<br />
also gegeneinander abzuwägen und die tatsächlichen Auswirkungen einer<br />
Beweidungsintensität von 2-3 Rindern/ha, bei verminderter Besatzdichte zur Brutsaison,<br />
anhand von Feldversuchen im Rahmen von Pilot- oder Monitoringprojekten zu prüfen. Auf<br />
Grundlage der vorliegenden Ergebnisse lassen sich aber folgende Aussagen treffen:<br />
Die positiven Entwicklungen sind vor allem auf die Änderung des Vegetationstyps „Quecken-<br />
Rasen“ hin zu „Rotschwingel-Wiese“ auf 67 % der Fläche zurückzuführen. Hochwüchsige,<br />
wenig strukturierte Quecken-Rasen, die die Vegetation der Ausgangssituation trotz sehr<br />
extensiver Beweidung dominieren, stellen für die hier betrachteten Arten überwiegend<br />
ungünstige Habitateigenschaften dar: Die hier betrachteten Rastvögel finden auf diesen<br />
Flächen kein geeignetes Nahungsangebot, die hier betrachteten Brutvögel bevorzugen<br />
strukturreiche (Rotschenkel, Wiesenpieper) oder offene Vegetation (Austernfischer).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 236 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Generell stellt eine Rotschwingel-Wiese im Vergleich zum Quecken-Rasen aufgrund der<br />
geringeren Wuchshöhe und offeneren, günstigeren Voraussetzungen für die hier<br />
betrachteten Arten dar. Allerdings werden durch die intensive Beweidung vor und einer<br />
extensiven Beweidung während der Brutsaison die Vegetationsstruktur und die<br />
Bodeneigenschaften extrem stark überprägt, was zu einem sehr ungünstigen Zustand der<br />
Habitateigenschaften für Austernfischer, Rotschenkel und Wiesenpieper mit nahezu<br />
homogener und sehr kurzer Vegetation auf stark verdichteten Böden führt, womit eine<br />
Abnahme der Nahrung einhergeht. Derartige Bestände sind als Bruthabitate für Rotschenkel<br />
und Wiesenpieper ungeeignet. Durch eine extensive Beweidung während der Brutsaison<br />
kommt es neben den Veränderungen der Vegetationsstruktur zu einer Störung der Brutvögel<br />
durch die Weidetiere, die zu erhöhtem Stress der Brutvögel bis zur Nestaufgabe führen<br />
kann. Zudem ist ein direkter Gelegeverlust aufgrund von Viehtritt möglich. Diese Faktoren<br />
wirken sich umso negativer auf Brutvögel aus, je höher die Viehdichte (Anzahl Tiere/Hektar)<br />
bzw. die Herdengröße ist.<br />
Die positiven Auswirkungen der Vegetationsentwicklung von Quecken-Rasen hin zu<br />
strukturreicheren Vegetationstypen sind also gegen die negativen Auswirkungen durch stark<br />
veränderte Vegetationsstruktur, erhöhten Viehtritt - mit Bodenverdichtung, darauf folgender<br />
Abnahme der Nahrungsressourcen und direktem Gelegeverlust - und Stress durch<br />
Beweidung abzuwägen.<br />
Die Veränderung der unspezifischen oberen Salzwiese hin zu Rotschwingel-Wiesen auf<br />
einem Flächenanteil von 23 % führt bei zwei Arten zu einer veränderten Bewertung<br />
(Austernfischer = positive Tendenz, Rotschenkel = negative Tendenz). Da sowohl bei der<br />
Ausgangssituation als auch bei der Entwicklungssituation eine Beweidungsnutzung erfolgt<br />
und der Vegetationstyp „unspezifische obere Salzwiese“ auch den Vegetationstyp<br />
Rotschwingel-Wiese umfassen kann, sollte dieser Veränderung nicht zu viel Wert<br />
beigemessen werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 237<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
3%<br />
4%<br />
1%<br />
5%<br />
9%<br />
23%<br />
22%<br />
28%<br />
1%<br />
3% 1%<br />
23%<br />
93%<br />
1% 6%<br />
68%<br />
75%<br />
67%<br />
67%<br />
90%<br />
90%<br />
90%<br />
1%<br />
9%<br />
7%<br />
3% 1%<br />
10%<br />
96%<br />
1% 6%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund Beweidungseinfluss zur Brutzeit).<br />
Abbildung 81: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“<br />
93%<br />
3%<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
*<br />
*<br />
*
Seite 238 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7.5.3.3.3 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE „NATÜRLICHE<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
DYNAMIK“<br />
Der Vorlandbereich der Modellfläche unterliegt derzeit aufgrund der anthropogenen<br />
Entwässerung und deren Auswirkungen auf die Ökologie des Vorlandes, den<br />
Lahnungsbauten sowie den künstlich angelegten Erddämmen nur sehr bedingt einer<br />
natürlichen Dynamik. Um auf diesen Vorlandflächen, eine Entwicklung hin zu mehr<br />
Naturnähe zu erreichen, sind grundlegende Änderungen erforderlich. Bei dem hier<br />
schematisch dargestellten Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ (Abbildung<br />
82) wird aufgrund des nahezu durchgängig hohen Geländeniveaus ein flächiger<br />
Bodenabtrag vorgesehen, um die Überflutungsfrequenz und –dauer zu erhöhen. Im Zuge<br />
des Bodenabtrages sollte das Verfüllen von Entwässerungsgräben, geeignete<br />
Prielinitialisierungen, die Nivellierung der Erddämme, die Ausgestaltung von Senken sowie<br />
deren Anbindung an Zuflüsse (vgl. Kapitel 7.5.3.2.3) vorgesehen werden, um ein eine<br />
vielgestaltige Landschaft zu entwickeln. Auch bei dieser Management-Option gilt, dass ein<br />
Bodenabtrag nicht pauschal auf der gesamten Fläche, sondern nur in dem aus<br />
naturschutzfachlicher Sicht sinnvollen Maße erfolgt. Zudem sollte die Reliefgestaltung nur<br />
soweit vorgenommen werden, dass eine Entwicklung hin zu einer natürlichen Dynamik<br />
initialisiert und unterstützt wird; also die vollständige Ausgestaltung nicht anthropogen,<br />
sondern durch das Wirken natürlicher Prozesse erfolgt.<br />
Wie bei der Management-Planung „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch<br />
Änderung der Hydrologie und Einstau“ setzt auch die Planung für einen Bodenabtrag eine<br />
genaue Kenntnis über das Relief (Laserscandaten, Geländevermessungen) und die<br />
hydrologischen Verhältnisse (Strömungsverläufe, Durchflussmengen) voraus. Nur auf dieser<br />
Grundlage kann eine solide Planung erfolgen, die im Rahmen von Ausführungsplanungen<br />
erforderlich wird, aber nicht Gegenstand dieses Forschungsvorhabens ist.<br />
Die Entwässerung ist, wie bei dem modellhaften Managementkonzept „Strategie<br />
Kultureinfluss“, in Anlehnung an die Planungen des Vorlandmanagementplans für den<br />
Bereiche Deichacht Norden (NLWKN NOR 2003) vorgesehen. Demnach erfolgt eine<br />
Entwässerung durch eine deichferne (mind. 50 m) parallele Deichfußentwässerung und<br />
bedarfsweise Begrüppung des Zwischenbereichs zum Deichfuß.<br />
Für die zwischen Deich und deichparallelen Entwässerungsgraben gelegenen<br />
Vorlandflächen ist eine Landnutzung in Form einer Beweidung mit 2–3 Rindern/ha, mit<br />
verminderter Beweidungsintensität während der Brutsaison (vgl. Kapitel 0), vorgesehen. Der<br />
deichparallele Graben dient neben der Entwässerung auch der Viehkehrung, um unnötige<br />
Zäune zu vermeiden, in durch <strong>Treibsel</strong> zerstört werden könnten.<br />
Auch bei diesem Managementkonzept stellt der genutzte Vorlandbereich eine „Pufferzone“<br />
zwischen dem stark zu entwässernden Deichfuß und den Vorlandflächen, die nur einem<br />
natürlichen Grad der Entwässerung unterliegen, dar. Trotz Umgestaltung der Vorlandflächen,<br />
die eine Entwicklung hin zu einer Naturlandschaft begünstigen soll, ist die Möglichkeit einer<br />
Nutzung von Vorlandflächen gegeben. Eine intensive Nutzung kann aufgrund der<br />
umfangreichen naturschutzfachlichen Aufwertung auf den seewärtigen Vorländern<br />
gerechtfertigt werden.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 239<br />
Wie unter Kapitel 7.5.2.2 erläutert, dienen die Managementkonzepte dazu, die Management-<br />
Optionen an einem Beispiel darzustellen und naturschutzfachlich zu bewerten. Die<br />
Management-Option „Veränderung des Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag“<br />
wurde für diese Modellfläche aufgrund der gegebenen Flächenstrukturen (hohes<br />
Höhenniveau, Erdwälle, starke anthropogene Entwässerung, Dominanz von Quecken-<br />
Rasen) ausgewählt, da auf solchen Vorlandflächen eine Entwicklung hin zu mehr Naturnähe<br />
nur durch grundlegende Änderungen möglich ist. Allerdings ist bei dieser Modellfläche<br />
fraglich, ob ein Bodenabtrag nicht zu weiteren Erosionen und Abbrüchen führen würde.<br />
Diese Frage wäre für diesen Vorlandbereich im Falle von Ausführungsplanungen zu klären.<br />
Abbildung 82: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche Dynamik“<br />
(Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“)<br />
PROGNOSE<br />
Durch ein Management gemäß dem Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
würden sich im Vergleich zur Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.3.1) hinsichtlich der<br />
Vegetationsausprägung deutliche Veränderungen ergeben. Auf den Vorlandflächen, auf<br />
denen eine Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag vorgesehen<br />
wurde, würde sich auf den derzeitigen Vegetationstypen der oberen Salzwiese (Quecken-<br />
Rasen, obere Salzwiese unspezifisch) ein Muster von Vegetationstypen der unteren<br />
Salzwiese (Andel-Rasen, ~ 30 %) und der Pionierzone (Queller-Watt, ~ 70 %) ergeben. Die<br />
derzeitigen Bereiche der unteren Salzwiese sowie der Pionierzone blieben unberührt, so<br />
dass sich hier keine Änderungen ergeben würden (Abbildung 83).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 240 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Auf dem mit 2-3 Rindern/ha beweideten deichnahen Vorlandstreifen würden sich die<br />
derzeitigen Vegetationstypen der oberen Salzwiese (Quecken-Rasen, obere Salzwiese<br />
unspezifisch) zu Rotschwingel-Wiesen entwickeln.<br />
Abbildung 83: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
Aufgrund der oben dargelegten Vegetationsentwicklung, die sich durch die Erhöhung des<br />
Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag ergeben würde, hin zu Vegetationstypen, die<br />
weniger produktiv sind als die der Ausgangssituation, würde sich die stehende Biomasse im<br />
Herbst im Vergleich zur Ausgangssituation deutlich verringern. Die stehende<br />
Biomassemenge im Herbst für den durch Beweidung genutzten Vorlandstreifen würde im<br />
Vergleich zur Ausgangssituation ebenfalls deutlich verringert. Die gesamte stehende<br />
Biomasse des Vorlandes der Modellfläche wäre mit rund 216 t deutlich geringer als bei der<br />
Ausgangssituation mit 556 t (vgl. Kapitel 7.5.3.3.1). Durch das Managementkonzept<br />
„Strategie Natürliche Dynamik“ ergäbe sich also im Vergleich zur Ausgangssituation eine<br />
Biomassereduzierung von 340 t auf 74 ha (~ 4,6 t/ha) (Abbildung 84).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 241<br />
Abbildung 84: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der Vegetation ist in Abbildung 85 dargestellt.<br />
Den ungenutzten Salzwiesenbereichen wäre vor allem wegen des heterogenen<br />
Landschaftsmusters, der natürlichen Entwässerung mit mäandrierenden Prielen und des<br />
Nebeneinanders von unterer und oberer Salzwiese eine hohe Wertigkeit beizumessen, den<br />
intensiv beweideten eine geringe Wertigkeit. Insgesamt ergäbe sich für die<br />
naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der Vegetation eine Aufwertung (Abbildung 85).<br />
Darüber hinaus wird durch die Aufgabe der anthropogenen Entwässerung für die<br />
Vorlandbereiche, auf denen eine Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses vorgesehen ist,<br />
ein natürlicheres hydrologisches System initiiert, welches aus naturschutzfachlicher Sicht<br />
- insbesondere für diese derzeit stark anthropogen entwässerten Flächen - deutlich positiv zu<br />
bewerten ist (vgl. Kapitel 7.5.3.2.3).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 242 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 85: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“)<br />
Die Auswirkungen des modellhaften Managementkonzeptes „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
für den intensiv (während der Brutsaison extensiv) beweideten deichparallelen<br />
Vorlandstreifen (24 % der Fläche), werden bei den Auswirkungen des modellhaften<br />
Managementkonzeptes „Strategie Kultureinfluss“ (Kapitel 7.5.3.3.2) ausführlich beschrieben<br />
und werden daher an dieser Stelle nicht erneut ausgeführt.<br />
Die Habitateigenschaften für die hier betrachteten Arten würden sich durch die Management-<br />
Option „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag“ anhand der<br />
ermittelten Indexwerte, mit Ausnahme des Wiesenpiepers (negative Tendenz), positiv<br />
auswirken (Abbildung 86). Diese Management-Option betrifft 66 % der Fläche. Ursache<br />
hierfür ist der hohe Anteil an Pionierbereichen (46 %), die für diese Flächen prognostiziert<br />
werden.<br />
Die hohe Habitatpräferenz des Rotschenkels der prognostizierten Vegetationstypen auf 76 %<br />
der Fläche resultiert aus den positiven Indexwerten, die sich durch die Beweidung (24 %)<br />
ergeben - welche aber aufgrund der strukturellen Veränderungen und der Einflüsse durch<br />
Viehtritt und Stress deutlich negativer zu bewerten sind (s.o.) - und die sich für die<br />
Pionierbereiche ergeben. Allerdings benötigt der Rotschenkel zudem geeignete Standorte<br />
als Nistplatz. Es wurde festgestellt, dass der Schlupferfolg beim Rotschenkel in Bereichen<br />
unter 0,5 m ü. MTHW größer ist als in höher liegenden Bereichen, wobei eine Präferenz von<br />
brütenden Rotschenkeln für Höhen um 0,4 m ü. MTHW festgestellt wurde. Dies bedeutet,<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 243<br />
dass sich ein Bodenabtrag auf ein Niveau von ca. 0,4 m positiv auswirken kann. Es ist<br />
jedoch zu beachten, dass durch Bodenabtrag die Flächen einem erhöhten Risiko, von<br />
Sommersturmfluten überflutet zu werden, ausgesetzt werden. Dies kann zu einem<br />
Totalverlust von Bodenbrütergelegen in Sommersturmfluten führen und damit die Vorteile in<br />
Bezug auf den Schlupferfolg konterkarieren.<br />
Bei der Management-Option „Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Bodenabtrag“<br />
wird von einem Bodenabtrag ausgegangen, der zu einer Vegetationsausprägung mit<br />
Vegetationstypen der Pionierzone mit einem Flächenanteil von etwa 70 % und der unteren<br />
Salzwiese mit etwa 30 % ausgegangen, also einer sehr starken Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses. Für Arten, die Vegetationsausprägungen mit überwiegenden Flächenanteilen<br />
der unteren Salzwiese präferieren, wie z.B. dem Wiesenpieper, würde sich ein geringerer<br />
Bodenabtrag positiver auswirken.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 244 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
3%<br />
4%<br />
1%<br />
5%<br />
9%<br />
23%<br />
22%<br />
28%<br />
1%<br />
3% 1%<br />
23%<br />
93%<br />
1% 6%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund Beweidungseinfluss zur Brutzeit).<br />
Abbildung 86: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Natürliche Dynamik“ der Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“<br />
68%<br />
75%<br />
67%<br />
67%<br />
24%<br />
24%<br />
23%<br />
24%<br />
23%<br />
47%<br />
0%<br />
1%<br />
1%<br />
75%<br />
53%<br />
76%<br />
76%<br />
52%<br />
*<br />
*<br />
*
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 245<br />
7.5.3.3.4 VERGLEICH DER MODELLHAFTEN MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Die Gegenüberstellung der Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte der<br />
Strategien „Kultureinfluss“ und „Natürliche Dynamik“ hinsichtlich der stehenden Biomasse im<br />
Herbst, der Vegetation und der Brut- und Rastvögel zeigt, dass bei dem modellhaften<br />
Managementkonzept „Natürliche Dynamik“ die Biomassereduzierung nur 8 % geringer wäre,<br />
aber die naturschutzfachlichen Auswirkungen - hinsichtlich der Vegetation deutlich und<br />
hinsichtlich der hier betrachteten Vogelarten etwas - positiver zu bewerten wären (Tabelle<br />
60). Die Auswirkungen einer temporär intensiven Beweidung unter der Strategie<br />
„Kultureinfluss“ auf die Avifauna sind ohne Praxiserfahrungen nicht sicher einzuschätzen, so<br />
dass ein Vergleich der Managementkonzepte nur bedingt möglich ist. Welches<br />
Managementkonzept den Zielvorstellungen näher käme, hängt letztendlich von den<br />
standortspezifischen Leitbildern ab und kann daher hier nicht beurteilt werden.<br />
Tabelle 60: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte für die<br />
Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“<br />
Bewertungsgrundlage<br />
Nutzung bzw. Management-<br />
Optionen (Flächenanteil)<br />
Ausgangssituation Beweidung mit<br />
0,5 Rindern/ha (90 %),<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie<br />
„Kultureinfluss“<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“<br />
Brache (10 %)<br />
Beweidung mit 2 – 3<br />
Rindern/ha (1,5 Rindern/ha<br />
während der Brutsaison)<br />
(93 %),<br />
Brache (7 %)<br />
Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses durch<br />
Bodenabtrag (66 %)<br />
Beweidung mit 2 – 3<br />
Rindern/ha (1,5 Rindern/ha<br />
während der Brutsaison)<br />
(24 %),<br />
Brache (10 %)<br />
Stehende<br />
Biomasse im<br />
Herbst<br />
Auswirkungen<br />
auf die<br />
Vegetation*<br />
556 t naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
174 t<br />
(Reduzierung<br />
um 69 %)*<br />
216 t<br />
(Reduzierung<br />
um 61 %)*<br />
hoch 10 %<br />
mittel 90 %<br />
gering 0 %<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 7 %<br />
mittel 0 %<br />
gering 93 %<br />
Tendenz:<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 76 %<br />
mittel 0 %<br />
gering 24 %<br />
Tendenz:<br />
Auswirkungen<br />
auf die Brut-<br />
und Rastvögel*<br />
Säule: grau - Anteil der Biomassereduzierung, <strong>grün</strong> - verbleibender Anteil in Bezug zur Ausgangssituation;<br />
*: In Bezug auf die Ausgangssituation. Die Bewertung der Vegetation bezieht sich auf das Leitbild<br />
„Naturlandschaft“. Die Bewertung der Brut- und Rastvögel erfolgt beispielhaft für die Arten Schneeammer (SA),<br />
Nonnen- & Ringelgans (NRG), Austernfischer (AF), Rotschenkel (RS) und Wiesenpieper (WP).<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 246 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7.5.3.4 MODELLFLÄCHE „NEßMERSIELER AUßENGRODEN“<br />
7.5.3.4.1 AUSGANGSSITUATION<br />
Die Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“ liegt - östlich der Modellfläche „Hilgenrieder<br />
Außengroden“ - an der ostfriesischen Festlandsküste im Landkreis Aurich bei Neßmersiel.<br />
Der Vorlandbereich der Modellfläche ist dem Sommerdeich des Wester Neßmerhellers<br />
vorgelagert und weist eine Vorlandgröße von 68 ha auf. Die Vorlandtiefe beträgt bis zu<br />
500 m, unter Berücksichtigung der kleinen Vorlandinseln, die im strömungsberuhigten<br />
Bereich der westlich gelegenen Lahnungen aufsedimentiert sind, bis zu 600 m.<br />
Lahnungsbauten sind nur an der westlich angrenzenden Fläche vorhanden, nicht aber vor<br />
den Vorländern der Modellfläche.<br />
Wie auch die anderen Modellflächen der Festlandsküste liegt sie innerhalb des<br />
Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, des FFH-Gebietes 01 „Nationalpark<br />
Niedersächsisches Wattenmeer“ sowie des EU-Vogelschutzgebietes V01<br />
„Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer“. Die Höhen des Vorlandes<br />
variieren zwischen 2,6 und 0,7 m ü. NN, wobei das Höhenniveau - wie bei der Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“ - auf der gesamten Modellfläche ein ähnliches Höhenniveau<br />
aufweist. Höhenunterschiede zeichnen sich nicht durch eine Abnahme zur See hin, sondern<br />
kleinteiliger innerhalb der Flächen, die von Entwässerungsgräben umgeben sind, ab. Ein<br />
Uferwall an der Vorlandkante ist anhand der Höhendaten deutlich zu erkennen. Dort kommt<br />
es seit 1980/90 (COLDEWEY ET AL., 1996) zu verstärkten Abbrüchen und Erosion. Das<br />
mittlere Tidehochwasser liegt hier bei 1,41 m ü. NN (Pegel „Bensersiel“).<br />
Die Vorlandflächen unterliegen keiner Nutzung. Die intensiv genutzten Flächen im südlichen<br />
Randbereich der Modellfläche sind Deich<strong>grün</strong>länder (Abbildung 87).<br />
Die Vorlandflächen sind zu großen Teilen aus Landgewinnungsmaßnahmen in den 30iger<br />
Jahren des letzten Jahrhunderts hervorgegangen. Der gesamte Vorlandbereich wird heute<br />
durch ein einheitliches Raster von Entwässerungsgräben sowie auf den von<br />
Entwässerungsgräben umgebenen Flächen durch parallel angelegte Grüppen, mit einem<br />
Abstand von etwa 12 m, entwässert. Allerdings werden die Grüppen nicht gepflegt. Vom<br />
Sommerdeich zur Vorlandkante verlaufen mehrere Erddämme, die als Zuwegung zur<br />
Vorlandkante dienen. Das Mikrorelief zeichnet sich durch weiträumige höher gelegene<br />
Bereiche südlich der ehemaligen querlaufenden Lahnungen auf, in denen während der<br />
Landgewinnung besonders viel Sediment abgelagert wurde. Weiter landseitig vor dem<br />
vorherigen Lahnungsbau war die Sedimentation offenbar geringer, so dass hier Senken<br />
entstanden sind, die 20 bis 30 cm tiefer liegen.<br />
Entsprechend dem Relief der Vorlandfläche ergibt sich auch hinsichtlich der Vegetation ein<br />
Muster, welches durch die Entwässerung geprägt ist (Abbildung 88). Auf den niedriger<br />
gelegenen Flächen innerhalb eines Entwässerungsgraben-Rasters sind, vor allem in den<br />
seeseitigen Rasterflächen, Andel-Rasen der unteren Salzwiese ausgeprägt. Im Übergang<br />
zur oberen Salzwiese sowie randlich von Entwässerungsgräben finden sich teilweise<br />
kleinflächige Ausprägungen des Typs „Obere Salzwiese, unspezifisch“ die dann in die<br />
Modellfläche dominierenden Quecken-Rasen übergehen. Die vegetationsbestandenen<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 247<br />
Wattbereiche sowie Senken innerhalb der Modellfläche sind, im Gegensatz zur Modellfläche<br />
„Hilgenrieder Außengroden“, von Schlickgras-Watt geprägt. Queller-Watt findet sich nur auf<br />
einer kleinen Fläche im Nordwesten der Fläche.<br />
Durch Kartierungen in den Jahren 1997, 2004 und 2007 (ANDRATSCHKE, 2009) ist die<br />
Veränderung der Vegetation nach Aufgabe der Nutzung zwischen 1992 und 1996 recht<br />
genau bekannt. Noch 1997 bestand ein Großteil der Fläche aus artenarmen Andelrasen und<br />
Rotschwingelrasen, die aus der Beweidung hervorgegangen waren. Diese Bereiche haben<br />
sich größtenteils zu noch artenärmeren Queckenfluren gewandelt. Nur in den Senken hinter<br />
den alten Lahnungen blieben Andelrasen erhalten, die jetzt mit Astern vergesellschaftet sind.<br />
Im Mittel liegen diese Flächen bei 1,80 m ü. NN mit einem mittleren Grundwasserstand von<br />
25 bis 30 cm unter Flur (2007). Senken, die nur wenige Zentimeter tiefer liegen (ca.<br />
1,75 cm ü. NN), sind mit Andelrasen bestanden, die mit Arten der Pionierzone wie<br />
Strandsode und Queller oder mit Keilmelden vergesellschaftet sind. Hier lag der mittlere<br />
Grundwasserstand im Jahr 2007 bei nur 15 bis 20 cm unter Flur, was auch damit<br />
zusammenhängt, dass die ja sehr landseitig gelegenen Senken bei Flut über die<br />
Entwässerungsgräben „bewässert“ werden. Demgegenüber liegen die Einheiten der oberen<br />
Salzwiese etwa 20 bis 30 cm höher. Die reinen Queckenbestände finden sich bei einem<br />
mittleren Grundwasserstand von 45 cm unter Flur. Das Grundwasser ist zudem weniger<br />
salzhaltig. Dies zeigt die Bedeutung des Wasserhaushaltes und der Geländehöhe für die<br />
Ausprägung von Pflanzengesellschaften mit unterschiedlicher Biomasseproduktion. Im<br />
Gegensatz dazu zeigen sich keine Unterschiede im Phosphor- und Carbonatgehalt der<br />
Böden.<br />
Aufgrund der ausgedehnten produktiven Quecken-Rasen, der Nichtnutzung und der großen<br />
Vorlandtiefe ist die stehende Biomasse im Herbst auf dieser Modellfläche sehr hoch.<br />
Insgesamt stehen auf der rund 68 ha großen Vorlandfläch im Herbst rund 532 t Biomasse<br />
(~ 7,8 t/ha) (vgl. Abbildung 89). Für den Deichabschnitt entlang dieser Modellfläche wurde<br />
nach den Sturmfluten 2006 und 2007 im Mittel „sehr viel <strong>Treibsel</strong>“ gemeldet.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 248 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 87: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“)<br />
Abbildung 88: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 249<br />
Abbildung 89: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“)<br />
Abbildung 90: Ausgangssituation Höhenlage (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 250 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die Entwässerung der Vorlandfläche ist durch ein Netz an Gräben anthropogen geprägt und<br />
unterliegt nur sehr bedingt einer natürlichen Dynamik. Die Vegetation der oberen Salzwiese<br />
wurde naturschutzfachlich als „mittel“ bewertet, da die Entwässerung zu einer weitgehenden<br />
Homogenisierung der Vegetation führt und die Diversität auf Landschaftsebene gering ist.<br />
Die Vegetationseinheiten der unteren Salzwiese wurden hingegen als „hoch“ bewertet, da<br />
auf diesen Flächen der Einfluss der Entwässerung geringer ausgeprägt und die Diversität<br />
höher ist.<br />
Für die Vegetation der gesamten Vorlandfläche dieser Modellfläche ergibt sich aufgrund der<br />
ungenutzten Salzwiesen eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit (Abbildung 91). Lediglich<br />
die Flächen des Deich<strong>grün</strong>landes im südlichen Randbereich sind aufgrund der intensiven<br />
Nutzung als gering zu bewerten.<br />
Die Entwässerung der Vorlandflächen ist durch ein Netz an Entwässerungssystemen<br />
anthropogen geprägt und unterliegt nur sehr bedingt einer natürlichen Dynamik. Zudem ist<br />
auch noch die Höhenlage durch anthropogene Einflüsse geprägt. Man sieht nach wie vor<br />
anhand der Höhenkarte die alten Lahnungsfelder.<br />
Abbildung 91: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 251<br />
7.5.3.4.2 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE<br />
„KULTUREINFLUSS“<br />
Die ungenutzten, produktiven Quecken-Rasen bedingen eine hohe stehende Biomasse im<br />
Herbst, so dass hier ein hohes Potenzial der <strong>Treibsel</strong>entstehung besteht. Um die Biomasse<br />
zu reduzieren, wird bei dem modellhaften Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“<br />
(Abbildung 92) eine Beweidungsintensität von 1,5 Rindern/ha auf den gesamten Vorländern<br />
der Modellfläche vorgesehen. Zum einen erfolgt durch die extensive Beweidung ein direkter<br />
Biomasseaustrag, zum anderen wird durch diese Nutzung die Entwicklung zu weniger<br />
produktiven Vegetationstypen gefördert, wodurch sich ebenfalls ein biomassereduzierender<br />
Effekt ergibt. Für die Vorlandlandinseln wird keine Beweidung angenommen, sie liegen<br />
brach.<br />
Die Entwässerung könnte – wie auch bei der Modellfläche „Hilgenrieder Außengroden“ - in<br />
Anlehnung an die Planungen des Vorlandmanagementplans für den Bereiche Deichacht<br />
Norden (NLWKN NOR 2003) erfolgen. Demnach erfolgt eine Entwässerung durch eine<br />
deichferne (mind. 50 m) parallele Deichfußentwässerung und bedarfsweise Begrüppung des<br />
Zwischenbereichs zum Deichfuß. Des Weiteren sollte hinsichtlich der<br />
Entwässerungsintensität geprüft werden, ob unter der vorgesehenen Landnutzung die<br />
Anzahl der Grüppen reduziert werden kann. Die Deichfußentwässerung ist hierbei auf jeden<br />
Fall sicherzustellen.<br />
Abbildung 92: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“ (Modellfläche<br />
„Neßmersieler Außengroden“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 252 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
PROGNOSE<br />
Als Folge der großflächigen Beweidung der Vorlandflächen mit 1,5 Rindern/ha wird eine<br />
Entwicklung der Quecken-Rasen, wie auch für die nicht weiter spezifizierten<br />
Vegetationstypen der oberen Salzwiese, hin zu einem Komplex von Salzbinsen- (17 %) und<br />
Rotschwingel-Wiesen (68 %) prognostiziert. Die mit Andel-Rasen bestandenen Bereiche der<br />
unteren Salzwiese würden sich durch die höhere Beweidungsintensität lediglich in ihrer<br />
Struktur, nicht aber hinsichtlich des Typs, ändern. Für die Bereiche der Pionierzone wurde<br />
keine Nutzung angenommen, so dass sich hier hinsichtlich der Vegetation keine Änderungen<br />
ergeben würden (Abbildung 93).<br />
Abbildung 93: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Für die mit 1,5 Rindern/ha beweideten Vorlandflächen der oberen Salzwiese würde sich eine<br />
stehende Biomasse im Herbst von 730 g/m², für die der unteren Salzwiese 299 g/m²<br />
ergeben. Für die Bereiche der Pionierzone ergäben sich hinsichtlich der stehenden<br />
Biomasse keine Änderungen. Die daraus resultierende gesamte stehende Biomasse des<br />
Vorlandes der Modellfläche wäre mit rund 453 t deutlich geringer als bei der<br />
Ausgangssituation mit 532 t (vgl. Kapitel 7.5.3.4.1). Durch das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ ergäbe sich also im Vergleich zur Ausgangssituation eine<br />
Biomassereduzierung von 79 t auf 68 ha (~ 1,2 t/ha) (Abbildung 94).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 253<br />
Abbildung 94: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Aufgrund der extensiven Beweidungsintensität und der damit verbundenen Entwässerung<br />
würde der Vegetation der beweideten Flächen eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit<br />
hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“ beigemessen werden. Die ungenutzten<br />
Salzwiesenbereiche würden hingegen eine hohe Wertigkeit aufweisen (Abbildung 95). Im<br />
Vergleich zur Ausgangssituation ergäbe sich also eine Verschlechterung der Wertigkeit<br />
hinsichtlich der Vegetation.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 254 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 95: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Die Auswirkungen des modellhaften Managementkonzeptes „Strategie Kultureinfluss“ auf die<br />
hier betrachteten Brut- und Rastvögel würde sich anhand der ermittelten Indexwerte für alle<br />
Arten - mit Ausnahme des Wiesenpiepers (neutrale Entwicklungstendenz) - deutlich positiv<br />
auf die Habitateigenschaften auswirken (Abbildung 96). Diese Bewertung basiert auf<br />
Indexwerten, die vorwiegend den Einfluss des Vegetationstyps, jedoch nur zum Teil den<br />
Einfluss der Nutzungsform wiedergeben.<br />
Die Ursache der überwiegend positiven Entwicklung ist in der Entwicklung der Quecken-<br />
Rasen (77 %), wie auch der nicht weiter spezifizierten Vegetationstypen der oberen<br />
Salzwiese (8 %), hin zu einem Komplex von Salzbinsen- (17 %) und Rotschwingel-Wiesen<br />
(68 %) zu sehen. Hochwüchsige, wenig strukturierte Quecken-Rasen, die die Vegetation der<br />
Ausgangssituation dominieren, stellen für die hier betrachteten Arten überwiegend<br />
ungünstige Habitateigenschaften dar: Die hier betrachteten Rastvögel finden auf diesen<br />
Flächen keine geeignete Nahrung, die hier betrachteten Brutvögel bevorzugen strukturreiche<br />
(Rotschenkel, Wiesenpieper) oder offene Vegetation (Austernfischer). Generell stellt eine<br />
Rotschwingel-Wiese im Vergleich zum Quecken-Rasen aufgrund der kurzwüchsigen,<br />
offenen Struktur und des Nahrungsangebotes günstigere Voraussetzungen für die hier<br />
betrachteten Arten dar.<br />
Durch eine Rinderbeweidung ergeben sich deutliche Veränderungen der<br />
Vegetationsstruktur. Signifikante Änderungen wurden für die Vegetationsdichte, die<br />
Heterogenität der Vegetation und die Vegetationshöhe festgestellt. Dabei wird durch die<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 255<br />
Beweidung die Vegetationsdichte verringert, die kleinräumige Heterogenität und die<br />
Vegetationshöhen nehmen ab. Dies führt zu einer Verschlechterung der Habitate für<br />
brütende Rotschenkel und Wiesenpieper. Durch eine Beweidung kommt es neben den<br />
Veränderungen der Vegetationsstruktur und der Bodenverdichtung (vermindertes<br />
Nahrungsangebot für Brutvögel) zu einer Störung der Brutvögel durch die Weidetiere, die zu<br />
erhöhtem Stress der Brutvögel führen kann. Zudem ist ein direkter Gelegeverlust aufgrund<br />
von Viehtritt möglich. Diese Faktoren wirken sich umso negativer auf Brutvögel aus, je höher<br />
die Viehdichte (Anzahl Tiere/Hektar) ist.<br />
Die positiven Auswirkungen der Vegetationsentwicklung von Quecken-Rasen hin zu<br />
strukturreicheren Vegetationstypen sind also gegen die negativen Auswirkungen durch eine<br />
veränderte Vegetationsstruktur, Viehtritt und Stress durch die extensive Beweidung<br />
abzuwägen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 256 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
12%<br />
15%<br />
8%<br />
8%<br />
12%<br />
12%<br />
8%<br />
3%<br />
97%<br />
3%<br />
80%<br />
88%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund Beweidungseinfluss zur Brutzeit).<br />
Abbildung 96: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Kultureinfluss“ der Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“<br />
77%<br />
77%<br />
68%<br />
17%<br />
17%<br />
14%<br />
4%<br />
97%<br />
3%<br />
12%<br />
68%<br />
3%<br />
12%<br />
68%<br />
15%<br />
3%<br />
82%<br />
17%<br />
*<br />
*<br />
*
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 257<br />
7.5.3.4.3 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE „NATÜRLICHE<br />
DYNAMIK“<br />
Obwohl die Vorlandflächen nicht in Nutzung stehen, unterliegt die derzeitige Ausprägung des<br />
Vorlandbereiches der Modellfläche aufgrund der anthropogenen Entwässerung und deren<br />
Auswirkungen auf die Ökologie des Vorlandes sowie den künstlich angelegten Erddämmen<br />
nur bedingt einer natürlichen Dynamik. Um auf diesen vom Menschen geprägten<br />
Vorlandflächen eine Entwicklung hin zu mehr Naturnähe zu erreichen, wird beim<br />
modellhaften Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ (Abbildung 97) auf eine<br />
Management-Option des Typs „Prozessschutz“ zurückgegriffen.<br />
Die Entwässerung ist, wie bei dem modellhaften Managementkonzept „Strategie<br />
Kultureinfluss“, in Anlehnung an die Planungen des Vorlandmanagementplans für den<br />
Bereiche Deichacht Norden (NLWKN NOR 2003) vorgesehen. Demnach erfolgt eine<br />
Entwässerung durch eine deichferne (mind. 50 m) parallele Deichfußentwässerung und<br />
bedarfsweise Begrüppung des Zwischenbereichs zum Deichfuß.<br />
Der Prozessschutz soll für alle Vorlandflächen seeseitig dieser Deichfußentwässerung<br />
erfolgen. Ein reiner Prozessschutz wäre auf diesen stark anthropogen geprägten<br />
Vorlandflächen (Entwässerung, Erddämme), ohne vorherige Umgestaltung der Flächen aus<br />
treibselreduzierender Sicht, aber auch aus naturschutzfachlicher Sicht, wenig zielführend<br />
(vgl. Kapitel 7.3.4). Daher wird hier die Management-Option „aktiver Prozessschutz“<br />
vorgesehen, bei der neben der Nutzungsaufgabe der Rückbau des Entwässerungssystems<br />
vorgesehen ist. Das bestehende Entwässerungssystem soll durch vollständige und<br />
nachhaltige Verfüllung der Gräben (ggf. auch der Grüppen) aufgegeben werden. Die<br />
Erddämme, welche optimale Rückzugsräume für Prädatoren (Füchse) darstellen und einem<br />
natürlichen Wasserzu- und -abfluss entgegenstehen, sollen abgetragen werden.<br />
Hinsichtlich des Ziels einer möglichst natürlichen Entwässerung der Flächen über<br />
mäandrierende Priele wird einer vollständigen Verfüllung der bestehenden<br />
Entwässerungssysteme ohne weitere Maßnahmen wenig Aussicht auf Erfolg beigemessen.<br />
Wie sich bereits in der Praxis gezeigt hat, wird das Verfüllungsmaterial, zumindest in<br />
Bereichen mit hohen Strömungsintensitäten, schnell wieder ausgespült. Aus diesem Grund<br />
werden an geeigneten Stellen (hohe Strömungsintensitäten, Umgestaltung vorhandener<br />
Strukturen) Prielinitialisierungen vorgesehen. Die Reliefgestaltung sollte nur soweit<br />
vorgenommen werden, dass eine Entwicklung hin zu einer natürlichen Dynamik gegeben<br />
und unterstützt wird; also die vollständige Ausgestaltung nicht anthropogen, sondern durch<br />
das Wirken natürlicher Prozesse erfolgt.<br />
Die Planung für die Initialisierung von Prielsystemen setzt eine sehr genaue Kenntnis über<br />
das Relief (Laserscandaten, Geländevermessungen) und die hydraulischen Verhältnisse<br />
(Strömungsverläufe, Durchflussmengen) voraus. Nur auf dieser Grundlage kann eine<br />
erfolgreiche Umsetzung erfolgen, die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht zu<br />
leisten ist. Die in Abbildung 97 dargestellten Prielsysteme sind rein schematisch und stellen<br />
keine Grundlage für konkrete Planungen dar.<br />
Für die südlich des deichparallelen Entwässerungsgrabens gelegenen Vorlandflächen ist<br />
eine Landnutzung in Form einer Beweidung mit 1,5 Rindern/ha vorgesehen. Der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 258 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
deichparallele Graben dient neben der Entwässerung auch der Viehkehrung, um unnötige<br />
Zäune, in denen sich <strong>Treibsel</strong> verfangen, zu vermeiden.<br />
Auch bei diesem Managementkonzept stellt der genutzte Vorlandbereich eine „Pufferzone“<br />
zwischen dem zu entwässernden Deichfuß und den Vorlandflächen, die nur einem<br />
natürlichen Grad der Entwässerung unterliegen, dar. Trotz Umgestaltung der Vorlandflächen,<br />
die eine Entwicklung hin zu einer Naturlandschaft begünstigen soll, ist die Möglichkeit einer<br />
Nutzung von Vorlandflächen gegeben. Eine intensive Nutzung kann aufgrund der<br />
umfangreichen naturschutzfachlichen Aufwertung auf den seewärtigen Vorländern<br />
gerechtfertigt werden.<br />
Abbildung 97: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche Dynamik“ (Modellfläche<br />
„Neßmersieler Außengroden“)<br />
PROGNOSE<br />
Durch ein Management gemäß dem Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
würden sich im Vergleich zur Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.4.1) hinsichtlich der<br />
Vegetationsausprägung deutliche Veränderungen ergeben. Auf den Vorlandflächen, auf<br />
denen Prozessschutz nach aktiver Aufgabe der Entwässerung vorgesehen wurde, würde<br />
sich auf den derzeitigen Quecken-Rasen ein Muster von Vegetationstypen aus Quecken-<br />
Rasen (~ 40 %), Rotschwingel-Wiese (~ 30 %) und untere Salzwiese unspezifisch (~ 30 %)<br />
ergeben. Auf Vorlandflächen mit Beständen der oberen Salzwiese unspezifisch würden sich<br />
Andel-Rasen der unteren Salzwiese ausprägen. Die derzeitigen Andel-Rasen (12 %) würden<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 259<br />
zu etwa 10 % durch Queller-Watt-Bereiche geprägt sein. Für die Pionierzone wird keine<br />
Veränderung prognostiziert (Abbildung 98).<br />
Auf dem mit 3-6 Schafen/ha (zur Brutsaison mit < 3 Schafen/ha) beweideten deichnahen<br />
Vorlandstreifen würden sich die derzeitigen Vegetationstypen der oberen Salzwiese<br />
(Quecken-Rasen, obere Salzwiese unspezifisch) zu Rotschwingel-Wiesen entwickeln.<br />
Abbildung 98: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Neßmersieler<br />
Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
Aufgrund der oben dargelegten Vegetationsentwicklung, die sich durch „aktiven<br />
Prozessschutz“ ergibt, würde sich die stehende Biomasse im Herbst im Vergleich zur<br />
Ausgangssituation deutlich verringern. Die stehende Biomassemenge im Herbst für den<br />
durch Beweidung genutzten Vorlandstreifen würde im Vergleich zur Ausgangssituation<br />
ebenfalls deutlich verringert. Die gesamte stehende Biomasse des Vorlandes der<br />
Modellfläche wäre mit rund 305 t geringer als bei der Ausgangssituation mit 532 t (vgl.<br />
Kapitel 7.5.3.4.1). Durch das Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ ergäbe<br />
sich also im Vergleich zur Ausgangssituation eine Biomassereduzierung von 228 t auf den<br />
rund 68 ha (~ 3,3 t/ha) (Abbildung 99).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 260 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 99: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der Vegetation ist in Abbildung 100<br />
dargestellt. Den ungenutzten Salzwiesenbereichen wäre wegen der natürlichen<br />
Entwässerung mit mäandrierenden Prielen und dem Nebeneinander von unterer und oberer<br />
Salzwiese eine hohe Wertigkeit beizumessen, den intensiv beweideten eine geringe<br />
Wertigkeit. Insgesamt ergäbe sich für die naturschutzfachliche Wertigkeit hinsichtlich der<br />
Vegetation im Vergleich zur Ausgangssituation eine Wertminderung.<br />
Allerdings wird durch die Aufgabe der anthropogenen Entwässerung für die Vorlandbereiche,<br />
auf denen „aktiver Prozessschutz“ (Verfüllung vorhandener Entwässerungssysteme und<br />
Prielinitiierung) vorgesehen ist, die Entwicklung eines natürlicheren hydrologischen Systems<br />
ermöglicht, welches aus naturschutzfachlicher Sicht - insbesondere für diese derzeit stark<br />
anthropogen entwässerten Flächen - deutlich positiv zu bewerten ist (vgl. Kapitel 7.5.3.2.3).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 261<br />
Abbildung 100: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“)<br />
Die Gesamtbewertung der hier betrachteten Vogelarten für das modellhafte<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ würde anhand der ermittelten<br />
Indexwerte - mit Ausnahme des Wiesenpiepers (leicht negative Entwicklungstendenz) - leicht<br />
bis deutlich positiv ausfallen (Abbildung 101). Die Bewertung beruht auf Indexwerten, die<br />
vorwiegend den Einfluss des Vegetationstyps, zum Teil aber auch den Einfluss der<br />
Nutzungsform abbilden (vgl. Anhang 2).<br />
Die positive Entwicklung für die Arten Schneeammer, Nonnen-, Ringelgans, Austernfischer<br />
und Rotschenkel ergäbe sich aufgrund des „aktiven Prozessschutzes“ auf etwa 59 % der<br />
Fläche der mit Quecken-Rasen bestandenen Flächen. Der prognostizierte<br />
Vegetationskomplex aus Typen der oberen und unteren Salzwiese würde für die Arten aus<br />
den oben genannten Gründen günstigere Habitateigenschaften mit sich bringen. Die<br />
vorwiegend negativen Auswirkungen des Entwicklungsbestandes an Quecken-Rasen (21 %)<br />
werden an den Diagrammdarstellungen deutlich.<br />
Für die übrigen Vegetationstypen würden sich unter dieser Management-Option nur<br />
geringfügige Änderungen ergeben (insg. 21 % der Fläche). So würde sich der zusätzliche<br />
Anteil an Pionierbereichen für die Gänse und den Wiesenpieper negativ, für den Rotschenkel<br />
hingegen positiv auswirken.<br />
Die intensive, zur Brutsaison extensive Schafbeweidung des deichparallelen<br />
Vorlandstreifens auf 27 % der Fläche würde sich hinsichtlich des Einflusses des<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 262 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Vegetationstyps - mit Ausnahme des Wiesenpiepers (neutrale Entwicklungstendenz) –<br />
anhand der Indexwerte deutlich positiv darstellen. Allerdings bilden die zugrunde liegenden<br />
Indexwerte weder den Einfluss der Nutzungsform noch den der Beweidungsintensität ab.<br />
Eine Schafbeweidung mit 3-6 Schafen/ha führt im Allgemeinen zu großflächig homogenen,<br />
kurzwüchsigen Vegetationsbeständen, die ungeeignet für brütende Rotschenkel und<br />
Wiesenpieper sind. Zudem ist der Einfluss durch Störung von Weidetieren sowie möglichen<br />
Gelegeverlusten aufgrund von Viehtritt auf die Brutvögel zu berücksichtigen.<br />
Generell wird, auf nicht zu hoch gelegenen Flächen, durch Aufgabe der Nutzung die<br />
Heterogenität der Vegetation gefördert, in der sich dichte, hochwüchsige<br />
Vegetationsbestände mit offeneren Bereichen abwechseln. Dies sind die bevorzugten<br />
Bruthabitate von Rotschenkeln und Wiesenpiepern. Durch eine aktive Aufgabe der<br />
Entwässerung wird die Bildung von nassen Senken im Wechsel mit höher gelegenen<br />
trockenen Bereichen gefördert, wodurch die Diversität der Vegetationseinheiten zunimmt und<br />
damit die Vielfalt der Bruthabitate gefördert wird. Dadurch stehen für Wiesenlimikolen neben<br />
günstigen Bruthabitaten auch günstige Nahrungshabitate für die Küken zur Verfügung, wobei<br />
die Attraktivität der Flächen für Prädatoren durch nasse Bereiche zurückgeht.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 263<br />
R a s t v ö g e l<br />
B r u t v ö g e l<br />
Singvögel<br />
Gänse<br />
Küstenvögel<br />
Singvögel<br />
Schneeammer<br />
Nonnen- &<br />
Ringelgans<br />
Austernfischer<br />
Rotschenkel<br />
Wiesenpieper<br />
Art Ausgangssituation Entwicklungsprognose Tendenz<br />
12%<br />
15%<br />
8%<br />
8%<br />
12%<br />
12%<br />
8%<br />
3%<br />
97%<br />
3%<br />
80%<br />
88%<br />
77%<br />
77%<br />
43%<br />
8%<br />
27%<br />
23%<br />
27%<br />
19%<br />
24%<br />
33%<br />
21%<br />
52%<br />
21%<br />
52%<br />
50%<br />
3% 10%<br />
Habitatpräferenz : sehr hoch, hoch, keine , gering , sehr gering, nicht signifikant, kein Wert<br />
Diagrammdarstellung: Vorlandflächenanteile unterschiedlicher Habitateignung für die jeweiligen Arten.<br />
Vergleich zwischen Ausgangssituation und Entwicklungsprognose sowie Entwicklungstendenz. Grauer Pfeil: Tendenz<br />
Indexwerte, rot umrandeter Pfeil: korrigierte Tendenz (* aufgrund Beweidungseinfluss zur Brutzeit).<br />
Abbildung 101: Gesamtbewertung Rast- und Brutvögel (Artenauswahl) für das Managementkonzept<br />
„Strategie Natürliche Dynamik“ der Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“<br />
87%<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
*<br />
*<br />
*
Seite 264 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
7.5.3.4.4 VERGLEICH DER MODELLHAFTEN MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Die Gegenüberstellung der Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte der<br />
Strategien „Kultureinfluss“ und „Natürliche Dynamik“ hinsichtlich der stehenden Biomasse im<br />
Herbst, der Vegetation und der Brut- und Rastvögel zeigt, dass mit dem modellhaften<br />
Managementkonzept „Natürliche Dynamik“ sowohl eine deutlich höhere Biomasse-<br />
reduzierung erreicht würde als auch die naturschutzfachlichen Auswirkungen - hinsichtlich<br />
der Vegetation deutlich und hinsichtlich der hier betrachteten Vogelarten etwas - positiver zu<br />
bewerten wären (Tabelle 61). Welches Managementkonzept den Zielvorstellungen näher<br />
käme, hängt letztendlich von den standortspezifischen Leitbildern ab und kann daher hier<br />
nicht beurteilt werden.<br />
Tabelle 61: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte für die<br />
Modellfläche „Neßmersieler Außengroden“<br />
Bewertungsgrundlage<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzung bzw. Management-<br />
Optionen (Flächenanteil)<br />
Stehende<br />
Biomasse im<br />
Herbst<br />
Auswirkungen<br />
auf die<br />
Vegetation*<br />
Ausgangssituation Brache (100 %) 532 t naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie<br />
„Kultureinfluss“<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“<br />
Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha (97 %),<br />
Brache (3 %)<br />
„aktiver“ Prozessschutz<br />
(71 %),<br />
Beweidung mit 3 – 6<br />
Schafen/ha (< 3 Schafen /ha<br />
zur Brutsaison) (27 %),<br />
Brache (2 %)<br />
453 t<br />
(Reduzierung<br />
um 19 %)*<br />
305 t<br />
(Reduzierung<br />
um 43 %)*<br />
hoch 15 %<br />
mittel 85 %<br />
gering 0 %<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 3 %<br />
mittel 97 %<br />
gering 0 %<br />
Tendenz:<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 73 %<br />
mittel 0 %<br />
gering 27 %<br />
Tendenz:<br />
Auswirkungen<br />
auf die Brut-<br />
und Rastvögel*<br />
Säule: grau - Anteil der Biomassereduzierung, <strong>grün</strong> - verbleibender Anteil in Bezug zur Ausgangssituation;<br />
*: In Bezug auf die Ausgangssituation. Die Bewertung der Vegetation bezieht sich auf das Leitbild<br />
„Naturlandschaft“. Die Bewertung der Brut- und Rastvögel erfolgt beispielhaft für die Arten Schneeammer (SA),<br />
Nonnen- & Ringelgans (NRG), Austernfischer (AF), Rotschenkel (RS) und Wiesenpieper (WP).<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP<br />
SA<br />
NG<br />
AF<br />
RS<br />
WP
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 265<br />
7.5.3.5 MODELLFLÄCHE „NEUENLANDER AUßENDEICH“ (WESER-ÄSTUAR)<br />
7.5.3.5.1 AUSGANGSSITUATION<br />
Der Vorlandbereich der Modellfläche „Neuenlander Außendeich“ liegt rechtseitig des Weser-<br />
Ästuars nördlich von Brake auf Höhe der Weserinsel „Strohauser Plate“. Die insgesamt<br />
28 ha große Vorlandfläche weist eine Vorlandtiefe von 100-300 m auf. Der Vorlandbereich<br />
kann durch den Wasserweg zum Neuenlander Siel in zwei Teilbereiche aufgeteilt werden:<br />
Einen rund 10 ha großen, nördlich gelegenen Teil und einen etwa 18 ha großen, südlich<br />
gelegenen Teil. Beide Vorlandbereiche liegen innerhalb des FFH-Gebietes 203<br />
„Unterweser“, der südliche Teilbereich zudem in dem Naturschutzgebiet „Neuenlander<br />
Außendeich“. Der Weserabschnitt im Bereich dieser Vorlandflächen liegt in der oligohalinen<br />
Zone (Salinität 0,5 – 5 ‰), wobei die Lage der Salinitätszonen sehr variabel ist, da sie kurz-<br />
und mittelfristig durch den Oberflächenabfluss, das Tidegeschehen und den Wind beeinflusst<br />
wird (GFL et al. 2006).<br />
Die überwiegend mit Röhricht bestandenen Vorlandflächen des südlichen Teilbereichs<br />
werden derzeit in Abstimmung mit der UNB des Landkreises Cuxhaven im Winter gemäht.<br />
Aus naturschutzfachlichen Gründen wird bei der Röhricht-Mahd ein 20 m breiter Abstand zur<br />
Vorlandkante gehalten und etwa 30 m breiter Röhrichtstreifen in der Mitte dieser Teilfläche<br />
als Rückzugsraum stehen gelassen. Somit ergibt sich eine Mahdfläche von etwa 12 ha,<br />
deren Mahdgut für die hiesige Dachdeckung verwendet wird. Der nördliche Teilbereich wird<br />
nach den vorliegenden Daten nicht genutzt, allerdings geht aus den Vegetationsdaten<br />
hervor, dass auf einer Breite von etwa 80 m deichnah Grünländer liegen, welche eine<br />
Nutzung bedingen. Demzufolge ist hier von einer Nutzung durch Weide oder Mahd<br />
auszugehen (Abbildung 102).<br />
Die Vegetation wird von ausgedehnten Schilf-Röhrichten der Brackmarsch dominiert. Auf<br />
dem südlichen Teilbereich bedecken Schilf-Röhrichte die gesamte Vorlandfläche bis auf<br />
einen schmalen deichnahen Streifen, welcher mit halbruderalen Gras- und Staudenfluren<br />
feuchter bis mittlerer Standorte bestanden ist. Dieser deichnahe Streifen mit Gras- und<br />
Staudenfluren findet sich auch auf der nördlichen Teilfläche wieder. Flussseitig daran<br />
angrenzend dehnen sich diese Gras- und Staudenfluren in einem etwa 80 m breiten<br />
Vorlandbereich aus, der überwiegend von artenärmerem mesophilen Grünland geprägt ist.<br />
Das übrige Vorland des nördlichen Teilbereichs ist mit Schilf-Röhrichten sowie an der<br />
Vorlandkante kleinflächig mit Strandsimsen-Röhricht bewachsen (Abbildung 103). Das<br />
Schilf-Röhricht ist ausgesprochen dicht und hochwüchsig und besteht deshalb beinahe<br />
ausschließlich aus Schilf (Phragmites communis).<br />
Die gesamte stehende Biomasse (im Herbst) dieser Modellfläche ist aufgrund der bis zum<br />
Herbst ungenutzten, vorwiegend mit Schilf-Röhricht bestandenen Flächen zu Beginn der<br />
Sturmflutsaison äußerst hoch. Die bis in den Herbst ungenutzten Schilf-Röhrichte weisen<br />
eine stehende Biomasse von rund 1.470 g/m² auf. Auf der 28 ha großen Modellfläche stehen<br />
insgesamt rund 384 t Biomasse (~ 13,7 t/ha) (vgl. Abbildung 104). Für den Deichabschnitt<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 266 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
entlang des südlichen Teilbereichs der Modellfläche wurde nach den Sturmfluten 2006 und<br />
2007 im Mittel „viel <strong>Treibsel</strong>“ gemeldet, entlang des nördlichen Teilbereichs wenig bis mäßig<br />
viel <strong>Treibsel</strong>.<br />
Abbildung 102: Ausgangssituation Landnutzung (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 267<br />
Abbildung 103: Ausgangssituation Vegetation (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“)<br />
Abbildung 104: Ausgangssituation stehende Biomasse (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 268 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Die naturschutzfachliche Wertigkeit der gemähten und ungemähten Röhrichtbestände<br />
hinsichtlich der Vegetation ist als hoch einzustufen. Die Wintermahd hat auf die<br />
Artenzusammensetzung der Vegetation - im Gegensatz zur Vogelwelt - praktisch keinen<br />
Einfluss. Deshalb werden gemähte und ungemähte Schilfröhrichte gleich bewertet. Die Gras-<br />
und Staudenfluren sind mit einer mittleren naturschutzfachlichen Wertigkeit einzustufen, die<br />
Grünländer als gering, da sie sich unter natürlichen Bedingungen nicht halten würden.<br />
Hinsichtlich der hydrologischen Verhältnisse weist das Weserästuar (wie auch die Ästuare<br />
Elbe und Ems) aufgrund der starken anthropogenen Überformung im Zuge von<br />
Ausbaumaßnahmen zu Schifffahrtsstraßen (u.a. veränderte Flussverläufe, Uferprofile,<br />
Tidenhübe, Strömungsgeschwindigkeiten, Salinitätszonen) wenig Naturnähe auf.<br />
Abbildung 105: Naturschutzfachliche Wertigkeit (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“)<br />
7.5.3.5.2 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
„KULTUREINFLUSS“<br />
Die derzeit durchgeführte Röhricht-Mahd im Winter wirkt sich nur dann treibselreduzierend<br />
aus, wenn die ersten stärkeren Sturmfluten erst nach der Wintermahd auftreten. In diesem<br />
Fall stehen nur noch die Randstreifen der Mahdfläche im südlichen Teilbereich (welche<br />
vermutlich gegenüber Strömungs- und Wellenenergie schneller losgerissen werden als<br />
Röhrichte in einem großen Bestand) und die ungemähten Röhrichtbestände des nördlichen<br />
Teilbereichs. Im Falle einer vor der Wintermahd auftretenden Herbst-Sturmflut hingegen,
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 269<br />
welche durchaus wahrscheinlich ist (vgl. Kapitel 7.4.4), stehen 384 t Biomasse (~ 13,7 t/ha)<br />
als potenzielles <strong>Treibsel</strong> auf der Fläche.<br />
Um die Röhricht-Mahd hinsichtlich des Ziels der <strong>Treibsel</strong>reduzierung effizienter<br />
durchzuführen, wird bei dem modellhaften Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“<br />
(Abbildung 106) eine Röhricht-Mahd vorgesehen, bei der die Mahd bereits im frühzeitigen<br />
Herbst, also vor der Sturmflutsaison, erfolgt. Aufgrund des Mahdzeitpunkts kann das<br />
Mahdgut nicht für die Dachdeckung verwendet werden, so dass dieses entweder für<br />
energetische Verwendungen zur Verfügung stünde oder anderweitig verwendet oder<br />
entsorgt werden müsste. Für den nördlichen Teilbereich wird keine Röhricht-Mahd<br />
vorgesehen, da die röhrichtbestandenen Flächen deutlich kleiner sind. Stattdessen wird hier<br />
die Entwicklung eines Auwaldstreifens von etwa 60 m Breite zwischen den Grünlandflächen<br />
und den Röhrichtbeständen vorgesehen. Da dieser auf derzeitigen Röhrichtbeständen<br />
vorgesehen ist, wird hierdurch eine direkte <strong>Treibsel</strong>reduzierung erreicht. Der Effekt der<br />
indirekten <strong>Treibsel</strong>reduzierung durch die Funktion des Auwaldstreifens als „<strong>Treibsel</strong>fänger“<br />
dürfte aber entscheidender sein. Diese Management-Option wird im größeren Umfang auch<br />
bei dem Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ erreicht und wird daher dort<br />
näher erläutert. Für die derzeitigen Grünlandflächen wird eine Beweidung von 1,5 Rindern/ha<br />
vorgesehen.<br />
Abbildung 106: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Kultureinfluss“ (Modellfläche<br />
„Neuenlander Außendeich“)<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 270 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
PROGNOSE<br />
Durch das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ würden sich im Vergleich zur<br />
Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.5.1) für den südlichen Teilbereich hinsichtlich der<br />
Vegetationstypen keine Veränderungen ergeben, da davon auszugehen ist, dass die Schilf-<br />
Röhrichte durch eine Röhricht-Mahd im Herbst erhalten blieben (Abbildung 107). Allerdings<br />
kommt es durch die Mahd zu einer starken strukturellen Veränderung der Röhrichte. Nach<br />
den Untersuchungen KUBE & PROBST (1999) unterscheiden sich gemähte Bestände deutlich<br />
durch eine höhere Halmdichte, eine geringere Halmlänge sowie eine fehlende<br />
Knickschilfschicht gegenüber ungemähten Beständen.<br />
Für den nördlichen Teilbereich würden sich hingegen auf den Flächen, auf denen eine<br />
Auwaldentwicklung vorgesehen ist, entsprechend Auwaldbereiche entwickeln. Auf den<br />
beweideten Flächen würde sich mesophiles Grünland sowie Schilf-Röhricht in den<br />
Randbereichen ausprägen.<br />
Abbildung 107: Entwicklungsprognose Vegetation (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Durch die Röhricht-Mahd im Herbst ist die stehende Biomasse im Herbst auf den gemähten<br />
Flächen mit 20 g/m² erheblich geringer im Vergleich zur Ausgangssituation mit 1.469 g/m².<br />
Auch auf dem nördlichen Teilbereich wird durch die Auwaldentwicklung und Beweidung eine<br />
Biomassereduzierung erreicht. Die stehende Biomasse des gesamten Vorlandes der<br />
Modellfläche wäre mit rund 147 t deutlich geringer als bei der Ausgangssituation mit 384 t<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 271<br />
(vgl. Kapitel 7.5.3.5.1). Durch das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ ergäbe sich<br />
also im Vergleich zur Ausgangssituation eine Biomassereduzierung von 237 t auf 28 ha<br />
(~ 8,4 t/ha) (Abbildung 108).<br />
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass eine Röhricht-Mahd im Herbst naturschutzrechtlich<br />
voraussichtlich nur durch Schaffung von Ersatzhabitaten von Röhrichtlebensräumen<br />
realisierbar wäre. Hierfür kämen nur geschützte Lagen in Frage, bei denen ein hoher<br />
Biomasseaustrag unwahrscheinlich wäre, wobei ein Biomasseaustrag nicht ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
Abbildung 108: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“,<br />
Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Für die durch Röhricht-Mahd und Beweidung genutzten Vorlandflächen ergäbe sich aufgrund<br />
des Nutzungseinflusses eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit der Vegetation<br />
hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“. Die ungenutzten Röhricht-Bestände der<br />
Modellfläche wären als hoch, die Strandsimsen-Röhrichte und Hochstaudenfluren als mittel<br />
zu bewerten. Somit ergäbe sich im Vergleich zur Ausgangssituation insgesamt eine<br />
naturschutzfachliche Wertminderung (Abbildung 109).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 272 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 109: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Neuenlander Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“)<br />
Das modellhafte Managementkonzept der Strategie „Kultureinfluss“ beruht für den südlichen<br />
Teilbereich auf einer Röhricht-Mahd im Herbst. Die naturschutzfachliche Bewertung<br />
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gilde der Röhrichtbrüter erfolgt auf Grundlage einer<br />
Literaturstudie (Anhang 3), deren Ergebnisse bereits in Kapitel 7.4.3 zusammenfassend<br />
dargestellt sowie in Kapitel 7.4.4 diskutiert wurden und daher an dieser Stelle nicht erneut<br />
aufgeführt werden.<br />
Naturschutzfachlich könnte die Schilfmahd zu negativen Auswirkungen auf die Schutz- und<br />
Entwicklungsziele des FFH-Gebietes 203 „Unterweser“ und des Naturschutzgebietes<br />
„Neuenlander Außendeich“ führen. Die Auswertung belegt ein hohes naturschutzfachliches<br />
Konfliktpotenzial zwischen Röhricht-Mahd und Brutvögeln. Hinsichtlich dieses Konfliktes wird<br />
nur eine Lösungsmöglichkeit gesehen, die darin besteht, Ersatzhabitate zu schaffen. Um hier<br />
aber keinen neuen Bereich hoher <strong>Treibsel</strong>entstehung zu schaffen, kämen nur geschützte<br />
Lagen in Frage, bei denen ein hoher Biomasseaustrag unwahrscheinlich wäre.<br />
Für den nördlichen Teilbereich werden als Management-Optionen neben brachliegenden<br />
Flächen Beweidung und Auwaldentwicklung vorgesehen. Die naturschutzfachliche<br />
Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Röhrichtbrüter erfolgt auf Grundlage von<br />
Literaturangaben, welche bereits in Kapitel 7.4.3 dargestellt sowie in Kapitel 7.4.4 diskutiert<br />
wurden und daher an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt werden. Da die Entwicklung des<br />
Auwaldstreifens nur auf einem Teil der derzeitigen Röhrichte vorgesehen wird, blieben für<br />
Röhricht-Arten entsprechende Habitate – wenn auch in verringerter Ausdehnung – erhalten.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 273<br />
Gleichzeitig würden seltene und für die Avifauna wertvolle (FLADE 1994) Weichholzauen-<br />
Habitate geschaffen. Zudem würden viele Röhrichtbrüter von einem Komplex von Schilf- und<br />
Gehölzbeständen profitieren (wie z.B. Zwergdommel, Beutelmeise, Nachtigall).<br />
7.5.3.5.3 MODELLHAFTES MANAGEMENTKONZEPT: STRATEGIE „NATÜRLICHE<br />
DYNAMIK“<br />
Neben den bisher berücksichtigten Management-Optionen, deren treibselreduzierender<br />
Effekt entweder auf der Biomasseentnahme oder Verminderung des Biomasseaufwuchses<br />
beruht, soll für das modellhafte Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“<br />
(Abbildung 110) eine Management-Option vorgesehen werden, die zwar kleinflächig auf der<br />
Verminderung von potenziellem <strong>Treibsel</strong> beruht, im Wesentlichen aber durch die Funktion<br />
als <strong>Treibsel</strong>fänger zur <strong>Treibsel</strong>minimierung am Deichfuß führt. Gemeint ist die Entwicklung<br />
von Auwaldbereichen auf derzeit röhrichtbestandenen Flächen. Auf den Auwaldflächen<br />
würde sich die Biomasse an sich zwar nicht ausschlaggebend verringern, sehr wohl aber das<br />
potenzielle <strong>Treibsel</strong>, da die Stämme und Äste von Auwaldarten (insbesondere Weiden)<br />
wesentlich widerstandsfähiger sind als die Halme der Röhrichte. Zudem soll die<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung durch die Funktion als „<strong>Treibsel</strong>fänger“ sowie durch die Verminderung<br />
der Strömungs- und Wellenenergie für deichseitig gelegene Röhrichte erfolgen. Aufgrund der<br />
Lage der Vorländer dieser Modellfläche, welche für Vorlandbereiche im täglichen<br />
Tideeinfluss aufgrund der Salzgehalte vermutlich die nördlichste Verbreitungsgrenze von<br />
Auwald-Ausprägungen darstellen dürfte, sollen hier Anpflanzungen von Strauchweiden<br />
vorgesehen werden, da sich diese am ehesten unter diesen Standortbedingungen etablieren<br />
können (vgl. Kapitel 0 und 7.3.4).<br />
Für den nördlichen Teilbereich ergeben sich hinsichtlich des Managementkonzepts keine<br />
Änderungen gegenüber dem der Strategie „Kultureinfluss“.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 274 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 110: modellhaftes Managementkonzept Strategie „Natürliche Dynamik“<br />
(Modellfläche „Neuenlander Außendeich“)<br />
PROGNOSE<br />
Durch das Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“ würden sich im Vergleich zur<br />
Ausgangssituation (vgl. Kapitel 7.5.3.5.1) folgende Veränderungen ergeben. Auf den<br />
Vorlandflächen, auf denen eine Auwaldentwicklung vorgesehen ist, würden sich<br />
entsprechende Auwaldbestände entwickeln. Auf den beweideten Flächen würde sich<br />
mesophiles Grünland sowie Schilf-Röhricht in den Randbereichen ausprägen (Abbildung<br />
111).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 275<br />
Abbildung 111: Entwicklungsprognose der Vegetation (Modellfläche „Neuenlander<br />
Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
Durch die Auwaldentwicklung und Beweidung würde eine leichte Biomassereduzierung auf<br />
den Vorlandflächen erreicht werden. Die stehende Biomasse des gesamten Vorlandes der<br />
Modellfläche wäre mit rund 309 t geringer als bei der Ausgangssituation mit 384 t (vgl.<br />
Kapitel 7.5.3.5.1). Durch das Managementkonzept „Strategie Kultureinfluss“ ergäbe sich also<br />
im Vergleich zur Ausgangssituation eine Biomassereduzierung von 75 t auf 28 ha (~ 2,7 t/ha)<br />
(Abbildung 112). Allerdings wird bei diesem Managementkonzept die <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
nicht nur über die Biomassereduzierung, sondern auch durch die Funktion des<br />
Auwaldstreifens als „<strong>Treibsel</strong>fänger“ (im nördlichen Teilbereich) bzw. als „Dämpfer der<br />
Strömungs- und Wellenenergie“ (im südlichen Teilbereich) erreicht. Somit wäre von einer<br />
deutlich höheren Reduzierung des <strong>Treibsel</strong>s am Deichfuß auszugehen (Abbildung 112).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 276 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Abbildung 112: Entwicklungsprognose Biomasse (Modellfläche „Neuenlander Außendeich“,<br />
Managementkonzept „Strategie Natürliche Dynamik“)<br />
NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
Für die durch Beweidung genutzten Vorlandflächen ergäbe sich aufgrund des<br />
Nutzungseinflusses je nach Vegetationsausprägung eine mittlere bis geringe<br />
naturschutzfachliche Wertigkeit der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“.<br />
Die ungenutzten Röhricht- und Auwald-Bestände wären als hoch, die ungenutzten<br />
Strandsimsen-Röhrichte und Gras- und Hochstaudenfluren als mittel zu bewerten. Somit<br />
ergäbe sich insgesamt keine wesentliche naturschutzfachliche Wertänderung im Vergleich<br />
zur Ausgangssituation (Abbildung 113).<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 277<br />
Abbildung 113: Bewertung der Vegetation hinsichtlich des Leitbildes „Naturlandschaft“<br />
(Modellfläche „Neuenlander Außendeich“, Managementkonzept „Strategie Natürliche<br />
Dynamik“)<br />
Das modellhafte Managementkonzept der Strategie „Natürliche Dynamik“ beruht im<br />
Wesentlichen auf der Management-Option Auwaldentwicklung. Die naturschutzfachliche<br />
Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Röhrichtbrüter erfolgt auf Grundlage von<br />
Literaturangaben, welche bereits in Kapitel 7.4.3 dargestellt sowie in Kapitel 7.4.4 diskutiert<br />
wurden und daher an dieser Stelle nur kurz aufgeführt werden.<br />
Durch die Management-Option „Auwaldentwicklung“ würde eine Sukzession der Vegetation<br />
von Röhrichtbeständen hin zu Weichholzauen erfolgen. Demzufolge wäre auch ein<br />
weitgehender Artenaustausch der Vogelarten von Röhricht-Arten hin zu charakteristischen<br />
Arten der Weichholzauen zu erwarten. Da die Entwicklung von Auwäldern als<br />
treibselreduzierende Maßnahme in Form von Auwald-Streifen gewässerseitig von<br />
Röhrichtbeständen vorgesehen wird, blieben für Röhricht-Arten entsprechende Habitate –<br />
wenn auch in verringerter Ausdehnung – erhalten. Gleichzeitig würden seltene und für die<br />
Avifauna wertvolle (FLADE 1994) Weichholzauen-Habitate geschaffen. Zudem würden viele<br />
Röhrichtbrüter von einem Komplex von Schilf- und Gehölzbeständen profitieren (wie z.B.<br />
Zwergdommel, Beutelmeise, Nachtigall).<br />
7.5.3.5.4 VERGLEICH DER MODELLHAFTEN MANAGEMENTKONZEPTE<br />
Die Gegenüberstellung der Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte der<br />
Strategien „Kultureinfluss“ und „Natürliche Dynamik“ hinsichtlich der stehenden Biomasse im<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 278 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Herbst, der Vegetation und der Brutvögel zeigt, dass mit dem modellhaften<br />
Managementkonzept „Natürliche Dynamik“ zwar eine deutlich geringere<br />
Biomassereduzierung erreicht würde, die <strong>Treibsel</strong>reduzierung am Deichfuß durch die<br />
Funktion des Auwaldstreifens als „<strong>Treibsel</strong>fänger“ dürfte aber deutlich höher sein. Die<br />
naturschutzfachlichen Auswirkungen des Managementkonzeptes „Natürliche Dynamik“<br />
würden hinsichtlich der Vegetation und der Röhrichtbrüter insgesamt deutlich positiver<br />
ausfallen (Tabelle 62).<br />
Unter Berücksichtigung der in Kapitel 7.4.4 genannten Aspekte ist nicht nur die Eignung der<br />
Röhricht-Mahd als treibselreduzierende Management-Option, sondern auch die<br />
naturschutzfachliche Verträglichkeit äußerst fraglich.<br />
Tabelle 62: Übersicht über die Auswirkungen der modellhaften Managementkonzepte für die<br />
Modellfläche „Neuenlander Außendeich“<br />
Bewertungsgrundlage<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong><br />
Nutzung bzw. Management-<br />
Optionen (Flächenanteil)<br />
Ausgangssituation Röhricht-Mahd, Winter<br />
(53 %),<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie<br />
„Kultureinfluss“<br />
Entwicklungsprognose<br />
Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“<br />
Brache (47 %)<br />
Röhricht-Mahd, Herbst<br />
(49 %),<br />
Brache (33 %)<br />
Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha (10 %),<br />
Auwaldentwicklung (8 %)<br />
Brache (64 %)<br />
Auwaldentwicklung (26 %)<br />
Beweidung mit 1,5<br />
Rindern/ha (10 %),<br />
Stehende<br />
Biomasse im<br />
Herbst<br />
Auswirkungen<br />
auf die<br />
Vegetation*<br />
384 t naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
147 t<br />
(Reduzierung<br />
um 71 %)*<br />
309 t<br />
(Reduzierung<br />
um 19 %)*<br />
Zusätzliche<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
durch<br />
Funktion als<br />
<strong>Treibsel</strong>fänge<br />
r<br />
hoch 84 %<br />
mittel 11 %<br />
gering 5 %<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 41 %<br />
mittel 59 %<br />
gering 0 %<br />
Tendenz:<br />
naturschutzfachl.<br />
Wertigkeit<br />
hoch 82 %<br />
mittel 13 %<br />
gering 5 %<br />
Tendenz:<br />
Auswirkungen<br />
auf die Brut-<br />
und Rastvögel*<br />
Röhrichtbrüter:<br />
Röhrichtbrüter:<br />
Säule: grau - Anteil der Biomassereduzierung, <strong>grün</strong> - verbleibender Anteil in Bezug zur Ausgangssituation;<br />
*: In Bezug auf die Ausgangssituation. Die Bewertung der Vegetation bezieht sich auf das Leitbild<br />
„Naturlandschaft“.
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 279<br />
7.5.4 DISKUSSION<br />
Die hier dargestellten Managementkonzepte werden jeweils von einer Management-Option,<br />
die auf dem überwiegenden Flächenanteil angewendet wurde, geprägt. Dies wurde ganz<br />
bewusst so ausgearbeitet, um bei der naturschutzfachlichen Bewertung die Auswirkungen<br />
der verschiedenen Management-Optionen deutlicher darstellen zu können. Im Rahmen von<br />
Ausführungsplanungen kann auch ein kleinräumigeres Nebeneinander von Management-<br />
Optionen, z.B. unterschiedlicher Beweidungsintensitäten, aber auch von verschiedenen<br />
Management-Typen, sinnvoll sein. Auch ein Wechsel von Management-Optionen im<br />
Jahresverlauf, z.B. geringe Beweidungsintensität zur Brutzeit und zunehmende<br />
Beweidungsintensität im Spätsommer und Herbst oder Mahd- und Weidenutzung, können<br />
sowohl aus treibselreduzierender als auch naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll sein, wurden<br />
aber aus Gründen der Vergleichbarkeit der Bewertung unterschiedlicher Management-<br />
Optionen für die Managementkonzepte nicht herangezogen.<br />
Alle Modellflächen liegen innerhalb der detailliert untersuchten Untersuchungsgebiete.<br />
Demzufolge könnte die Beschreibung der Ausgangssituation sowohl für die Vegetation als<br />
auch für die Avifauna sehr detailliert dargestellt werden. Dies wurde bewusst unterlassen, da<br />
eine Darstellung der Ausgangssituation weit über die Genauigkeit der Darstellung der<br />
Entwicklungssituation hinausginge und damit wenig zielführend wäre.<br />
Die Möglichkeiten an Management-Optionen hinsichtlich einer <strong>Treibsel</strong>reduzierung für die<br />
Vorländer der Ästuare sind, wie bereits in Kapitel 7.3.4 erläutert, sehr begrenzt. Die<br />
Management-Optionen, die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens für ein Management<br />
von Röhrichtflächen ausgearbeitet wurden, wurden bei den modellhaften<br />
Managementkonzepten berücksichtigt, um diese bei der Bewertung (Kapitel 7.5.3.5)<br />
vergleichen zu können. Beide Konzepte werfen Fragen auf, die möglicherweise erst im<br />
Rahmen von Ausführungsmaßnahmen beantwortet werden können.<br />
Hinsichtlich der Röhricht-Mahd im Herbst wurde im Rahmen dieses Projektes eine<br />
Literaturauswertung vorgenommen, die die naturschutzfachlichen Auswirkungen - soweit<br />
möglich - darstellt (Anhang 3). Diese Literaturauswertung basiert jedoch überwiegend auf<br />
Quellen, deren Ergebnisse auf Untersuchungen von Binnenröhrichten basieren, da<br />
entsprechende Literatur für Vorlandröhrichte nur vereinzelt vorlag. Sollte diese Management-<br />
Option trotz naturschutzfachlicher Konflikte umgesetzt werden, ist ein umfangreiches<br />
Monitoring, bei dem die naturschutzfachlichen Auswirkungen dieser Management-Option<br />
untersucht werden, vorzusehen.<br />
Bei der Management-Option „Auwaldentwicklung“ stehen weniger naturschutzfachliche<br />
Fragestellungen im Raum als vielmehr Fragen der Erfolgsaussichten einer Etablierung von<br />
Auwald unterschiedlicher Ausprägungen (Kapitel 7.3.4). Hierzu gibt es bislang zumindest für<br />
oligohaline Bereiche der Ästuare wenige Erfahrungen, so dass Praxiserfahrungen aus<br />
kleinen Pilotprojekten sehr hilfreich wären.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 280 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Insgesamt zeigt sich, dass die Strategie „Natürliche Dynamik“ im Vergleich mit der Strategie<br />
„Kultureinfluss“ vergleichbare oder sogar höhere Biomassereduzierungen erreichen kann,<br />
was sich in geringeren <strong>Treibsel</strong>mengen niederschlagen wird. Die naturschutzfachliche<br />
Wertigkeit der Vegetation fällt für alle Modellflächen bei der Strategie „Natürliche Dynamik“<br />
positiver aus, während die Konsequenzen für die Vogelwelt unterschiedlich sind.<br />
7.6 FAZIT<br />
Für die Vorlandflächen des gesamten Betrachtungsraumes konnte eine Einstufung<br />
hinsichtlich des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung vorgenommen werden. Auf Grundlage<br />
eines Abgleichs des Potenzials der <strong>Treibsel</strong>entstehung von Vorlandbereichen und dem<br />
tatsächlichen <strong>Treibsel</strong>anfall nach den Sturmfluten der Jahre 2006 und 2007 an den<br />
entsprechenden Deichstrecken konnten 11 „Schwerpunktbereiche“ (Definition s. Kapitel<br />
7.2.1) abgeleitet werden. Diese „Schwerpunktbereiche“ zeigen auf, in welchen Bereichen ein<br />
Management zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung am erforderlichsten und effektivsten wäre.<br />
Im Rahmen dieses Projektes wurden insgesamt 15 Management-Optionen<br />
zusammengestellt. Diese setzten sich aus Management-Optionen zusammen, die bereits<br />
praktiziert, häufig im Zusammenhang von <strong>Treibsel</strong>reduzierung oder Vorlandmanagement<br />
diskutiert werden, zukünftig - durch Fortentwicklung der Bioenergiegewinnung - zum Einsatz<br />
kommen könnten oder auf natürlichen Prozessen, wie Änderung des hydrologischen<br />
Systems oder Prozessschutz, beruhen. Diese Zusammenstellung an Management-Optionen,<br />
deren treibselreduzierender Effekt berechnet bzw. prognostiziert und die einer<br />
naturschutzfachlichen Bewertung unterzogen werden, stellt somit eine umfassende, fundierte<br />
Planungs- und Diskussionsgrundlage für zukünftige Vorhaben eines <strong>Treibsel</strong>managements,<br />
aber auch für die Erstellung von Managementplänen gemäß § 7 Abs. 3 NWattNPG, dar.<br />
Grundsätzlich sind die Management-Optionen zwei Strategien zuzuordnen: Management-<br />
Optionen, bei denen die Biomassereduzierung<br />
durch eine Landnutzung bedingt ist (Strategie Kultureinfluss),<br />
auf natürlichen Prozessen beruht (Strategie Natürliche Dynamik).<br />
Quecken-Reinbestände weisen gegenüber anderen Vegetationstypen der Salzwiese eine<br />
sehr hohe, schlecht abbaubare stehende Biomasse auf. Deshalb verbleibt auch im Winter<br />
noch viel abgestorbene Biomasse auf der Fläche, die bei Wintersturmfluten an den Deich<br />
geworfen werden kann. Quecken-Reinbestände sind auch aus naturschutzfachlicher Sicht<br />
eher als geringwertiger zu bewerten. Allerdings handelt es sich um natürliche Bestände.<br />
Deshalb kann es nicht darum gehen, Quecken-Reinbestände zu unterdrücken, sondern eine<br />
höhere Landschaftsvielfalt zu erreichen, in der neben Queckenbeständen andere, weniger<br />
produktive Vegetationstypen vorkommen. Daher wirken sich Management-Optionen, die<br />
andere Ausprägungen der oberen Salzwiese bzw. der unteren Salzwiese begünstigen,<br />
hinsichtlich aller Bewertungskriterien positiv aus. Hierzu zählen folgende Management-<br />
Optionen:<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 281<br />
Beweidung mit Nutzungsintensitäten ≥ 1,5 Rindern bzw. ≥ 3 Schafen/ha,<br />
Erhöhung des Wasser- und Salzeinflusses durch Änderung des hydrologischen<br />
Systems und Einstau oder durch Bodenabtrag und<br />
bedingt auch durch „aktiven Prozessschutz“, also einer Verfüllung von<br />
Entwässerungsgräben, ggf. Initialisierung von Prielsystemen und Nutzungsaufgabe.<br />
Generell wirken sich ein sinnvoll gestaltetes Beweidungsmanagement mit mittleren, auf<br />
Teilflächen bzw. zeitlich begrenzt auch höheren Beweidungsintensitäten sowie Management-<br />
Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen beruht (Ausnahme<br />
„passiver Prozessschutz“), sowohl aus treibselreduzierender Sicht als auch hinsichtlich der<br />
Habitatansprüche der hier betrachteten Vogelarten überwiegend positiv aus. Es bietet sich<br />
sogar ein enges Nebeneinander dieser Management-Optionen an: beispielsweise mittlere<br />
bis hohe Nutzungsintensitäten auf deichparallelen Vorlandstreifen mit einer Breite von mind.<br />
100 m und daran seeseitig angrenzend Flächen, die durch Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses oder durch „aktiven Prozessschutz“ mit Strategien der „Natürlichen Dynamik“<br />
gemanagt werden. Ein kleinräumiges Nebeneinander von genutzten und ungenutzten,<br />
naturnahen Vorlandbreichen kann durch die Erhöhung der Strukturvielfalt (räumliche Nähe<br />
von hoch- und kurzwüchsiger bzw. dichtere und offenere Vegetation) ebenfalls Vorteile für<br />
einige Arten mit sich bringen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ökologische Fallen<br />
der genutzten Bereiche (z.B. zu hohe Beweidungsintensitäten zur Brutzeit) weitestgehend<br />
vermieden werden.<br />
Ziel der modellhaften Managementkonzepte ist, exemplarisch die Möglichkeiten von<br />
Vorlandmanagement zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung für ausgewählte Vorlandbereiche darzustellen<br />
und anhand dieser die unterschiedlichen Auswirkungen des Managements darzulegen und<br />
gegenüberzustellen. Für die ausgewählten Modellflächen wurden jeweils zwei<br />
Managementkonzepte erstellt; je Modellfläche ein Managementkonzept, das vorrangig auf<br />
Management-Optionen der Strategie „Natürliche Dynamik“ bzw. der Strategie „Kultureinfluss“<br />
beruht. Ein Nebeneinander beider Management-Strategien soll hierbei nicht ausgeschlossen<br />
sein.<br />
Bei den modellhaften Managementkonzepten „Strategie Natürliche Dynamik“ wurde, um die<br />
Deichsicherheit zu gewährleisten, für die Modellflächen der Festlandküste ein genutzter, den<br />
Deich angrenzender Vorlandstreifen, vorgesehen. Dieser bringt mehrere Vorteile mit sich:<br />
Der genutzte Vorlandbereich stellt eine „Pufferzone“ zwischen dem zu<br />
entwässernden Deichfuß und den Vorlandflächen, die nur einem natürlichen Grad der<br />
Entwässerung unterliegen, dar.<br />
Es werden sowohl Naturschutzaspekte als auch Küstenschutzaspekte und<br />
Nutzungsinteressen auf einer Fläche berücksichtigt. Auch eine intensivere Nutzung<br />
ist aufgrund der umfangreichen naturschutzfachlichen Aufwertung auf den<br />
seewärtigen Vorländern zu rechtfertigen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 282 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Anhand der Bewertung der Managementkonzepte konnten die Auswirkungen verschiedener<br />
Managementkonzepte sowie verschiedener Strategien beispielhaft dargestellt werden. Die<br />
Bewertung der Effizienz hinsichtlich der <strong>Treibsel</strong>reduzierung zeigt, dass durch ein<br />
Managementkonzept, welches vorwiegend auf natürlichen Prozessen beruht, im Vergleich<br />
zu Managementkonzepten, die vorwiegend durch Landnutzung bedingt sind, vergleichbare<br />
oder sogar höhere Biomassereduzierungen erreicht werden können.<br />
In der Regel wirken sich die modellhaften Managementkonzepte der Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ positiver aus als die der Strategie „Kultureinfluss“, wobei dies für jede Brut- und<br />
Rastvogelart differenziert zu betrachten ist. Die tatsächlichen Auswirkungen dieser oder<br />
ähnlicher Managementkonzepte, insbesondere derer, für die bislang wenige oder keine<br />
Erfahrungen aus der Praxis vorliegen, sollten vor einer großflächigen Anwendung in Form<br />
von Pilotprojekten mit entsprechendem Monitoring erprobt werden.<br />
Die Management-Optionen der Strategie „Kultureinfluss“ sind im Vergleich zu denen der<br />
Strategie „Natürliche Dynamik“ leichter umzusetzen (Ausnahme „passiver Prozessschutz“).<br />
Der Aufwand für die Initialisierung der Management-Optionen der Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ ist sehr hoch (Bodenbewegungen, Anpflanzungen), demgegenüber ist der<br />
Aufwand für die Umsetzung von Management-Optionen der Strategie „Kultureinfluss“ bei<br />
vorhandenem Nutzungsinteresse wesentlich geringer, da bereits entsprechende Strukturen<br />
für landwirtschaftliche Nutzungen (Grüppensysteme, Einebnungen der Flächen, Zufahrten zu<br />
den Flächen) in der Vergangenheit geschaffen wurden und damit vorhanden sind. Langfristig<br />
gesehen relativiert sich der Aufwandsunterschied dadurch, dass eine Landnutzung<br />
kontinuierlich, die Änderungen der Voraussetzungen für eine natürliche Entwicklung<br />
hingegen nur einmalig (ggf. korrigierende Maßnahmen) notwendig ist.<br />
Die meist positiveren Auswirkungen der Managementkonzepte der Strategie „Natürliche<br />
Dynamik“ auf die naturschutzfachliche Wertigkeit der Vegetation und der Avifauna ist also<br />
gegen den hohen Aufwand zur Initialisierung der Management-Optionen abzuwägen. Durch<br />
die naturschutzfachliche Wertsteigerung könnten diese aber im Rahmen von<br />
Kompensationsmaßnahmen realisiert werden. Unter der Voraussetzung, dass im Zuge eines<br />
Managements ein flächenhafter Bodenabtrag - entsprechend den Maßgaben des<br />
Naturschutzes - vorgesehen ist und nach der Reliefgestaltung mit dem Ziel der Erhöhung<br />
des Wasser- und Salzeinflusses (u.a. Verfüllung von vorhandenen Entwässerungssystemen)<br />
deichbaufähiges Bodenmaterial zur Verfügung steht, könnte hier der Synergieeffekt zur<br />
Realisierung dieser Maßnahme genutzt werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 283<br />
7.7 LITERATUR<br />
ANDRATSCHKE S. (2009) Vegetationsökologische Untersuchungen und Managementansätze für eine<br />
anthropogen beeinflusste Salzwiese im Westneßmerheller, sowie leaf lifespan typischer<br />
Arten, unveröff. Diplomarbeit Universität Oldenburg.<br />
BAKKER, J. P., P. ESSELINK, K. S. DIJKEMA, W. E. V. DUIN & D. J. DE JONG (2002): Restoration of salt<br />
marshes in the Netherlands. – Hydrobiologia 478: 29-51.<br />
BAKKER, J. P., J. BUNJE, K. DIJKEMA, J. FRIKKE, N. HECKER, B. KERS, P. KÖRBER, J. KOHLUS & M. STOCK<br />
(2005): Salt Marshes. – In: ESSINK, K., C. DETTMANN, H. FARKE, K. LAURSEN, G. LÜERßEN, H.<br />
MARENCIC & W. WIERSINGA (Hrsg.): Wadden Sea Quality Status Report 2004. – Wadden Sea<br />
Ecosystem 19: 163-179.<br />
BLINDOW, H. (1991): Gutachten über die Avifauna des Jadebusens und die Renaturierung<br />
anthropogen verformter Salzwiesen. – Unveröffentlichtes Gutachten, 108 S.<br />
BJÖRNDAHL, G. (1985): Influence of winter harvest on stand structure and biomass production of the<br />
Common Reed, Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steud. in Lake Tǻkern, Southern<br />
Sweden. Biomass 7: 303-319.<br />
CLAUS, B., NEUMANN, P. & SCHIRMER, M. (1994): Rahmenkonzept zur Renaturierung der Unterweser<br />
und ihrer Marsch. Teil 1, Veröffentlichungen der gemeinsamen Landesplanung<br />
Bremen/Niedersachsen, 1/94: 368 S.<br />
CLAUS, B. (1998): Länderübergreifendes Schutzkonzept für die Ästuare Elbe, Weser und Ems.<br />
Gutachten im Auftrag der Umweltstiftung WWF Deutschland und des Bundes für Umwelt<br />
und Naturschutz BUND.<br />
COLDEWEY, H-G. & H. F.ERCHINGER (1996): Deichvorland: Seine Entwicklung zwischen Ems und Jade<br />
und die Untersuchungen im Forschungsvorhaben „Erosionsfestigkeit von Hellern“. Die Küste<br />
58: S. 2-45.<br />
CROOKS, SCHUTTEN, SHEERN, PYE & DAVY (2002): Drainage and elevation as factors in the restoration<br />
of salt marsh in Britain. – Restoration Ecology 10 (3): 591-602.<br />
DIJKEMA, K. S. & W. J. WOLFF (Bearb.; 1983): Ecology of the Wadden Sea. Rotterdam: Balkema.<br />
ELLENBERG H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. Ulmer, Stuttgart:<br />
989 S.<br />
ERCHINGER, H. F., H.-G. COLDEWEY & C. MEYER (1994): Endbericht des Teilprojekts Hydrologie und<br />
Morphologie des KFKI-Forschungsvorhabens „Erosionsfestigkeit von Hellern“. –<br />
Unveröffentlichtes Forschungsgutachten, StAIK, Norden. Förderkennzeichen MTK 047300<br />
des Bundesministeriums für Forschung und Technologie.<br />
ESSELINK, P. K. S. DIJKEMA, S. REENTS & G. HAGEMAN (1998): Vertical accretion and profile changes in<br />
abandoned man-made tidal marshes in the Dollard estuary, the Netherlands. – Journal of<br />
Coastal Research 14 (2): 570-582.<br />
FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands - Grundlagen für den<br />
Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. - IHW, Eching.Focke, W.O.<br />
(1915): Die Uferflora der Niederweser. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins<br />
zu Bremen, Bd. XXIII: 305-337<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 284 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
FRANK, U. (1994): Endbericht des Teilprojekts Bodenkunde des KFKI-Forschungsvorhabens<br />
„Erosionsfestigkeit von Hellern“. – Unveröffentlichtes Forschungsgutachten, Carl von<br />
Ossietzky - Universität Oldenburg. Förderkennzeichen MTK 047300 des<br />
Bundesministeriums für Forschung und Technologie.<br />
FÜHRBÖTER, A., H. MANZENRIEDER & M. SCHULZE (1992): Bericht des Teilprojekts Hydromechanik und<br />
Hydraulik des KFKI-Forschungsvorhabens „Erosionsfestigkeit von Hellern“. –<br />
Unveröffentlichtes Forschungsgutachten, Leichtweiss-Institut für Wasserbau der<br />
Technischen Universität Braunschweig. Förderkennzeichen MTK 0473A4 des<br />
Bundesministeriums für Forschung und Technologie.<br />
GFL, BIO CONSULT, KÜFOK (2006): Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser an die<br />
Entwicklungen im Schiffsverkehr mit Tiefenanpassung der hafenbezogenen Wendestelle –<br />
Auswirkungen auf die Landwirtschaft. – im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland<br />
(Wasser- und Schifffahrtsverwalung des Bundes).<br />
IBL (1996): Pflege- und Entwicklungsplan für das Außendeichsland der Ems von Herbrum<br />
flussabwärts bis zur Kreisgrenze.<br />
KAISER, T., D. ZACHARIAS (2003): PNV-Karten für Niedersachsen auf Basis der BÜK 50 – Weiteres<br />
Thema: Kartiertreffen zur Erforschung der Flora Niedersachsens 1983 - 2003.<br />
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, Heft 1/2003, S 68.<br />
KESEL, R. (1999): Vegetationskundliche Studie zu den Weichholz-Auwäldern (Salicion albae) an der<br />
Unterems zwischen Herbrum und Leer. Auftraggeber: Umweltstiftung WWF-Deutschland,<br />
Fachbereich Meere & Küsten, Bremen, unveröffentlichter Bericht.<br />
KUBE, J. & S. PROBST (1999): Bestandsabnahme bei schilfbewohnenden Vogelarten an der südlichen<br />
Ostseeküste: Welchen Einfluß hat die Schilfmahd auf die Brutvogeldichte? Vogelwelt 120:<br />
27-38.<br />
NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ – BETRIEBSSTELLE<br />
NORDEN (NLWKN NOR) (2003): Vorlandmanagementplan für den Bereich der Deichacht<br />
Norden. Unveröffentlichtes Gutachten, 40 S. + Karten, Norden.<br />
OSTENDORP, W. (1987): Die Auswirkungen von Mahd und Brand auf die Ufer-Schilfbestände des<br />
Bodensee-Untersees. Natur und. Landschaft 62: 99–102.<br />
OSTERKAMP, S. (2006): GIS-gestützte Modellierung der räumlichen Verteilung der Vegetation im<br />
Tidebreich von Ästuaren unter den Bedingungen einer Klimaänderung Mittels der<br />
Klassifikation- und Regressionsanalyse (CART) am Beispiel der Unterweservorländer.<br />
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften, Universität Bremen.<br />
PLANUNGSGRUPPE GRÜN (PGG) (2008): Landschaftspflegekonzept Vorland Jadebusen. Im Auftrag des<br />
II. Oldenburgischen Deichbands. Unveröffentlichtes Gutachten, 268 S. + Karten,<br />
Frieschenmoor-Ovelgönne<br />
ROSENTHAL, G. (1992): Erhaltung und Regeneration von Feuchtwiesen – Vegetationskundliche<br />
Untersuchungen auf Dauerflächen. Dissertationes Botanicae 182. J. Cramer, Berlin: 283 S.<br />
SCHIRMER, M. (1994): Ökologische Konsequenzen des Ausbaus der Ästuare von Elbe und Weser. In:<br />
Lozán, J.L., Rachor, E., Reise, K., Westernhagen, H. von, Lenz, W. (Hrsg.): Warnsignale<br />
aus dem Wattenmeer. Wissenschaftliche Fakten. Blackwell, Berlin: 164-175<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 285<br />
SEIBERLING, S., STOCK, M., P. P. THAPA (2009): Renaturierung von Salzgrassländern bzw. Salzwiesen<br />
der Küsten. – In: Zerbe, S. & G. Wiegleb (Hrsg.): Renaturierung von Ökosystemen in<br />
Mitteleuropa. – Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2009: 181-208<br />
STEINKE, W. (1994) Endbericht des Teilprojekts Botanik des KFKI-Forschungsvorhabens<br />
„Erosionsfestigkeit von Hellern“. – Unveröffentlichtes Forschungsgutachten, Institut für<br />
Angewandte Botanik der Universität Münster. Förderkennzeichen MTK 047300 des<br />
Bundesministeriums für Forschung und Technologie.<br />
VALKAMA, E., S. LYYTINEN, J. KORICHEVA (2008): The impact of reed management on wildlife: A meta-<br />
analytical review of European studies. Biological Conservation 141: 364-374.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 286 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
8 GESAMTFAZIT<br />
Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Ökologische Grundlagen und naturschutzfachliche<br />
Bewertung von Strategien zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung“ wurden<br />
ökologische Ursachen für die zeitlich und örtlich unterschiedlich auftretenden<br />
<strong>Treibsel</strong>-Mengen und ihr Zusammenhang mit der Produktivität der Vorländer<br />
erforscht,<br />
darauf aufbauend Management-Optionen zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung entwickelt und<br />
deren Auswirkungen naturschutzfachlich bewertet.<br />
Abschließend wurden Flächen, die für lokal hohe <strong>Treibsel</strong>aufkommen maßgeblich<br />
verantwortlich sind, identifiziert und<br />
exemplarisch Managementkonzepte für diese Vorlandbereiche erstellt und<br />
naturschutzfachlich bewertet.<br />
Somit liegt mit diesem Endbericht eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die<br />
Entwicklung von Vorlandmanagementplänen unter Berücksichtigung der <strong>Treibsel</strong>reduzierung<br />
sowie für die naturschutzfachliche Bewertung von deren Auswirkungen auf die Vegetation<br />
und auf Brut- und Rastvögel vor. Die zentralen Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.<br />
Die Biomasseproduktion der Salzwiesen hängt erheblich von der Höhe und dem Salzgehalt<br />
des Grundwassers ab. Durch eine Erhöhung euhalinen Grundwassers lässt sich die<br />
Produktivität auf Standorten einschränken, die mit Vegetationseinheiten der oberen<br />
Salzwiese, insbesondere mit Quecken, bestanden sind. Heute wird der Grundwasserstand<br />
auf den meisten Salzwiesen durch Entwässerung hingegen künstlich erniedrigt und somit die<br />
Produktivität gesteigert. Die Beseitigung von Entwässerungssystemen, unter Gewährleistung<br />
der aus Deichsicherheits<strong>grün</strong>den erforderlichen Deichfußentwässerung, würde folglich zu<br />
einer Verringerung der Biomasse führen.<br />
Bei den Röhrichten der Ästuare, die maßgeblich zur <strong>Treibsel</strong>produktion beitragen, wären<br />
hydrologische Veränderungen hingegen nicht zielführend, da das Schilf sehr gut an hohe<br />
Grundwasserstände und sogar an Überstau angepasst ist. Eine Beweidung ist aufgrund der<br />
Überflutung nicht möglich; eine Mahd im Winter schon, reduziert aber nicht den<br />
Biomasseaufwuchs im folgenden Sommer, sondern verstärkt ihn noch. Finden die<br />
Sturmfluten bereits Ende Oktober/Anfang November statt, d.h. vor der Wintermahd, so kann<br />
die besonders hohe Biomassemenge der gemähten Brackwasser-Röhrichte zu besonders<br />
hohem <strong>Treibsel</strong>anfall führen. Die Wintermahd von Röhrichten kann demzufolge nicht als<br />
treibselreduzierende Maßnahme betrachten werden, da diese nur dann treibselreduzierend<br />
wirkt, wenn Sturmfluten erst nach einer Mahd stattfinden.<br />
Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Landnutzungen erst ab einer vergleichsweise hohen<br />
Intensität und nur, wenn sie bis oder zum Ende der Vegetationsperiode erfolgen, die<br />
stehende Biomasse im Herbst effektiv reduzieren. Dies widerlegt die landläufig verbreitete<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 287<br />
Annahme, dass extensive Nutzungsformen maßgeblich zur Biomasse- und damit auch zur<br />
<strong>Treibsel</strong>reduzierung beitragen.<br />
Die Auswertungen zum <strong>Treibsel</strong>anfall an den Deichen nach den Sturmfluten am 01.11.2006<br />
und 09.11.2007 haben gezeigt, dass eine signifikante Korrelation zwischen der<br />
Biomasseproduktion des Vorlandes und der am Deich angeschwemmten <strong>Treibsel</strong>menge<br />
besteht. Dabei sind die Größe des Vorlandes und die Biomassemenge des<br />
Vegetationsbestandes besonders entscheidend. Allerdings wird diese Beziehung durch<br />
zahlreiche nicht quantifizierbare Faktoren beeinflusst. So hängt die Verdriftung des <strong>Treibsel</strong>s<br />
von der Stärke, den Strömungen und der Hauptwindrichtung der Sturmflut ab. Das<br />
Zusammenwirken dieser Faktoren führt dazu, dass der <strong>Treibsel</strong>anfall an einem einzelnen<br />
Deichabschnitt nicht sicher vorhergesagt werden kann. Sicher aber ist, dass große<br />
Vorlandareale vor dem Deich die Grundlage für hohen <strong>Treibsel</strong>anfall bilden.<br />
Anhand der Ergebnisse zur Biomassemenge der Vorlandvegetation im Herbst und den<br />
ermittelten <strong>Treibsel</strong>mengen nach den Novembersturmfluten der Jahre 2006 und 2007<br />
wurden Vorlandbereiche identifiziert, die für lokal hohe <strong>Treibsel</strong>aufkommen maßgeblich<br />
verantwortlich sind. Insgesamt wurden 11 dieser sog. „Schwerpunktbereiche“ ermittelt,<br />
welche sich auf die Vorlandbereiche der Festlandsküste und des Weserästuars<br />
konzentrieren (vgl. Abbildung 51). Der größte „Schwerpunktbereich“ befindet sich im Bereich<br />
des Weserästuars, wo alle Faktoren, die ein lokal hohes <strong>Treibsel</strong>aufkommen bedingen,<br />
zusammenkommen: große Vorlandflächen, hohe stehende Biomassemengen im Herbst und<br />
vergleichsweise hohe Strömungsintensitäten (vertiefter Ästuarunterlauf). Ein effektives<br />
Vorlandmanagement zur <strong>Treibsel</strong>reduzierung sollte vornehmlich in den ermittelten<br />
Schwerpunktbereichen umgesetzt werden, da hier der <strong>Treibsel</strong>anfall besonders hoch ist und<br />
am effizientesten vermindert werden kann.<br />
Auf der Grundlage der Ergebnisse zu ökologischen Ursachen für die zeitlich und örtlich<br />
unterschiedlich auftretenden <strong>Treibsel</strong>-Mengen und ihr Zusammenhang mit der Produktivität<br />
der Vorländer wurden insgesamt 15 Management-Optionen als biomassereduzierende - und<br />
damit auch potenziell treibselreduzierende - Strategien ausgearbeitet. Davon wird bei 10<br />
Management-Optionen die Biomassereduzierung durch Landnutzungsstrategien (wie<br />
Beweidung, Mahd) erreicht, 5 entfallen auf Management-Optionen, bei denen die<br />
Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen (wie Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses, Prozessschutz) beruht. Als effektive Management-Optionen haben sich<br />
neben denen, die auf hohen Nutzungsintensitäten beruhen, auch solche, bei denen die<br />
Biomassereduzierung auf natürlichen Prozessen beruht, erwiesen. Letztere, auf natürlichen<br />
Prozessen beruhende Management-Optionen, begünstigen eine naturnahe Vegetations-<br />
ausprägung mit einer heterogenen Struktur und einem kleinräumigen Nebeneinander von<br />
verschiedenen Lebensräumen. Zudem unterliegen sie keiner regelmäßigen Pflege. Somit<br />
stellen diese Management-Optionen, insbesondere die „Erhöhung des Wasser- und<br />
Salzeinflusses durch Änderung des hydrologischen Systems bzw. durch Bodenabtrag“<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 288 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
hinsichtlich einer treibselreduzierenden Wirkung und auch aus naturschutzrechtlicher Sicht<br />
äußerst günstige Management-Optionen dar.<br />
Die Möglichkeiten eines <strong>Treibsel</strong>-Managements der röhrichtbestandenen Ästuarvorländer<br />
sind sehr begrenzt. Hier werden die Schilfmahd sowie Auwaldinitiierungen als Management-<br />
Option in Betracht gezogen. Ungeachtet der naturschutzfachlichen Auswirkungen tritt ein<br />
biomassereduzierender Effekt bei einer Mahd im Winter nur dann ein, wenn die erste<br />
schwere Sturmflut der Saison nach der Mahd (i.d.R. im Februar) auftritt und die Bestände<br />
jährlich gemäht werden würden. Dies ist erforderlich, da zum einen nicht bekannt ist, in<br />
welchem Jahr eine schwere Sturmflut eintritt, und zum anderen die stehende<br />
Biomassemenge gemähter Röhrichte im Folgejahr erhöht ist.<br />
Für die Management-Optionen wurde als Basis der naturschutzfachlichen Bewertung die<br />
Vegetationsausprägung des Entwicklungszustandes (etwa nach 15 Jahren) prognostiziert.<br />
Die Vorländer an der Festlandküste stehen vollständig unter Schutz, in den Ästuaren ist dies<br />
überwiegend der Fall. Die Unterschutzstellung geht i.d.R. mit dem Ziel einer naturnahen<br />
Entwicklung einher, an die der Grad des Nutzungseinflusses gekoppelt ist. Daher fällt die<br />
naturschutzfachliche Bewertung der Vegetationsausprägung hinsichtlich des Leitbildes<br />
„Naturlandschaft“ erwartungsgemäß für hohe Nutzungsintensitäten tendenziell negativ,<br />
hingegen bei Management-Optionen, bei denen die Biomassereduzierung auf natürlichen<br />
Prozessen beruht, eher positiv aus.<br />
Die Auswirkungen der Management-Optionen auf die Brut- und Rastvögel fällt wesentlich<br />
differenzierter aus, da sich eine Management-Option für die hier betrachteten Arten aufgrund<br />
der jeweiligen Habitatansprüche sehr unterschiedlich auswirken kann. Eine konkrete<br />
Bewertung setzt daher die Bestimmung von Zielarten voraus. Generell lässt sich jedoch<br />
sagen, dass die Anwendung von Management-Optionen, die zu einer partiellen oder<br />
weitreichenderen Verdrängung von reinen Queckenbeständen führen, sich überwiegend<br />
positiv auswirken.<br />
Darüber hinaus ist hinsichtlich der Bewertung der Auswirkungen von Management-Optionen<br />
auf Brut- und Rastvögel festzuhalten, dass:<br />
mit den im Teilprojekt 3 (Kapitel 6) ermittelten Indexwerten mit verschiedenen<br />
Methoden eine Bewertungsgrundlage gebildet werden konnte,<br />
übertragbare und erweiterbare Indexwerte ermittelt wurden (die Ermittlung weiterer<br />
Indexwerte ist insbesondere für Management-Optionen sinnvoll, für die bislang kaum<br />
oder nur wenige Werte vorliegen),<br />
die vorliegenden Indexwerte die Auswirkungen der Management-Optionen, die auf<br />
natürlichen Prozessen beruhen, sehr gut abbilden können (für die Bewertung der<br />
Auswirkungen der Management-Optionen, die durch Nutzung bedingt sind, liegen<br />
hingegen noch Wissensdefizite vor),<br />
die Auswirkungen der Management-Optionen letztendlich stark von der<br />
Ausführungsplanung abhängen (erst auf dieser Planungsebene kann detailliert<br />
prognostiziert werden, in welcher flächenhaften Verteilung (Verteilungsmuster) sich<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 289<br />
Vegetationstypen entwickeln würden und wie sich diese auf Brut- und Rastvögel<br />
auswirken).<br />
Bei den Management-Optionen, die für die Ästuarvorländer ausgearbeitet wurden, erfolgte<br />
die Bewertung der Brut- und Rastvögel anhand von Literaturauswertungen. Bei einer<br />
Röhricht-Mahd wird aufgrund des weitreichenden Habitatverlustes von einer deutlichen<br />
Verschlechterung, hingegen bei einer partiellen Auwaldentwicklung neben<br />
Röhrichtbeständen von einer Aufwertung ausgegangen, da für eine Vielzahl von zum Teil<br />
gefährdeten sowie seltenen Arten wie Beutelmeise, Gelbspötter, Pirol, Nachtigall, und<br />
Kleinspecht geeignete Habitate geschaffen würden, die im Untersuchungsraum nur zu sehr<br />
geringen Anteilen vorkommen.<br />
Die naturschutzfachliche Bewertung der Management-Optionen basiert auf den im Rahmen<br />
dieses Projektes gewonnenen Ergebnissen und stellt eine nach vorliegendem Wissensstand<br />
bestmögliche Prognose dar. Ausführungen von Management-Optionen, für die bislang nur<br />
wenige oder keine Praxiserfahrungen vorliegen, sollten mit einem aussagekräftigen<br />
Monitoring begleitet werden, um Abweichungen von den Prognosen erkennen zu können<br />
und damit bei negativen Auswirkungen ein korrigierendes Eingreifen zu ermöglichen. Zudem<br />
wird durch ein Monitoring die Möglichkeit geschaffen, die hier vorgestellte Bewertungs-<br />
grundlage für weitere Vorhaben zu evaluieren und zu ergänzen.<br />
Um die verschiedenen Möglichkeiten eines <strong>Treibsel</strong>-Managements am Beispiel zu<br />
veranschaulichen, wurden für ausgewählte Modellflächen exemplarische Management-<br />
konzepte erstellt. Hierbei wurde für 3 Modellflächen an der Festlandsküste und eine im<br />
Weserästuar je ein Konzept erstellt, welches auf der Strategie „Kultureinfluss“ bzw.<br />
„Natürliche Dynamik“ basiert. Somit konnten die Auswirkungen dieser Strategien gegenüber-<br />
gestellt und bewertet werden. Die Folgen der Maßnahmen konnten quantitativ dargestellt<br />
werden, sowohl im Hinblick auf die Biomassereduktion wie im Hinblick auf die Folgen für<br />
Vegetation und Tierwelt. Die Prognosen über die Folgen der Planungen waren nur möglich,<br />
weil vorher umfängliche, das gesamte Ökosystem umfassende Untersuchungen<br />
stattgefunden haben, mit denen die Beziehungen zwischen Umwelt (Salz, Überflutung,<br />
Grundwasser, Böden, Nährstoffe), Organismen in der Nahrungskette (Pflanzen, Wirbellose,<br />
Vögel), sowie Ökosystemparametern (Biomasse, Produktivität, Stoffabbau) quantifiziert<br />
werden konnten. Die damit geschaffene Datengrundlage geht weit über die Daten hinaus,<br />
die in normalen Planungsverfahren erhoben werden.<br />
Die Bewertung der Effizienz hinsichtlich der <strong>Treibsel</strong>reduzierung zeigt, dass mit einem<br />
Managementkonzept, welches vorwiegend auf natürlichen Prozessen beruht, vergleichbare<br />
oder sogar höhere Biomassereduzierungen erreicht werden können, als mit einem, welches<br />
auf Landnutzungen beruht. In der Regel wirken sich die Managementkonzepte der Strategie<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 290 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
„Natürliche Dynamik“ positiver auf die hier betrachteten Brut- und Rastvogelarten aus als die<br />
der Strategie „Kultureinfluss“.<br />
Allerdings sind Management-Optionen der Strategie „Kultureinfluss“ im Vergleich zu denen<br />
der Strategie „Natürliche Dynamik“ zumeist leichter umsetzbar. Die vorwiegend positiveren<br />
Auswirkungen der Managementkonzepte der Strategie „Natürliche Dynamik“ auf die<br />
naturschutzfachliche Wertigkeit der Vegetation und der Avifauna sind also - sofern die<br />
Anwendbarkeit beider Strategien gegeben ist - gegen den hohen Aufwand zur Initialisierung<br />
dieser Management-Optionen abzuwägen. Durch die naturschutzfachliche Wertsteigerung<br />
könnten diese aber im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen realisiert werden. Ein<br />
Nebeneinander von Management-Optionen beider Strategien – ggf. auch zu gleichen<br />
Flächenanteilen - kann somit bei einem Vorlandmanagement je nach Zielsetzung durchaus<br />
sinnvoll sein.<br />
Der vorliegende Bericht stellt auf Grundlage der ermittelten ökologischen Zusammenhänge<br />
zum <strong>Treibsel</strong>aufkommen sowie den entwickelten und naturschutzfachlich bewerteten<br />
Management-Optionen bzw. -konzepten eine Handlungsgrundlage für die Entwicklung von<br />
Vorlandmanagementplänen unter Berücksichtigung der <strong>Treibsel</strong>reduzierung dar. Aufgrund<br />
des wissenschaftlichen Ansatzes kann diese einer kontroversen Diskussion wie auch den<br />
naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen (NATURA 2000) standhalten.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht Seite 291<br />
9 AUSBLICK<br />
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden Management-Optionen und –konzepte<br />
aufgezeigt, die zu beträchtlichen Biomassereduzierungen und somit auch zu einer deutlichen<br />
Verminderung des <strong>Treibsel</strong>anfalls führen können. Allerdings ist eine Biomassereduzierung,<br />
welche zu einer derart geringen stehenden Biomasse im Herbst führt, dass kaum noch<br />
<strong>Treibsel</strong> aus den Vorländern ausgetragen wird, für den gesamten Betrachtungsraum<br />
unrealistisch und nicht mit den Zielvorgaben des Nationalparks und denen der FFH-, EU-<br />
Vogel- und Naturschutzgebieten vereinbar.<br />
Selbst eine Reduzierung der stehenden Biomasse im gesamten Betrachtungsraum um 20 %<br />
würde beispielsweise eine Halbierung der stehenden Biomassemenge auf 40 % der<br />
Vorlandfläche (rund 7.100 ha) erfordern. Die durch den <strong>Treibsel</strong>anfall verursachten Probleme<br />
wären hierdurch zwar gemindert aber bei weitem nicht behoben. Ein <strong>Treibsel</strong>management,<br />
welches sich nur auf Management-Optionen zur Biomassereduzierung beschränkt, kann also<br />
nicht die alleinige Lösung sein. Für ein umfassendes <strong>Treibsel</strong>management sind daher neben<br />
vorsorglich greifenden Maßnahmen (wie einer Biomassereduzierung) auch Maßnahmen der<br />
Nachsorge (wie einer Verbesserung der Infrastruktur zur <strong>Treibsel</strong>abfuhr, der -deponierung<br />
und -verwertung) sowie die Klärung der institutionellen und finanziellen Zuständigkeiten<br />
erforderlich.<br />
Die Röhrichtbestände, die derzeit rund 2.200 ha der Vorlandfläche der Ästuare ausmachen,<br />
tragen aufgrund ihrer hohen stehenden Biomasse (Trockenmasse 1.469 g/m²) und der<br />
geringen Standhaftigkeit gegenüber starker Wellen- und Strömungsenergie maßgeblich zum<br />
<strong>Treibsel</strong>anfall bei. Im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen wurde in der Vergangenheit<br />
die Ausdehnung bzw. Entwicklung von Röhrichtbeständen gefördert. Hierbei sollte für<br />
zukünftige Planungen neben den naturschutzrechtlichen Aspekten die <strong>Treibsel</strong>problematik<br />
berücksichtigt werden. So sollten Röhrichtflächen nach Möglichkeit nur in von Wellen- und<br />
Strömungsenergie geschützten Lagen neu geschaffen werden und exponiert gelegene<br />
Röhrichtbestände durch Auwaldgebüsch geschützt werden. Des Weiteren könnten<br />
landseitige Auwaldstreifen vorgesehen werden, die <strong>Treibsel</strong> aus vorgelagerten Röhricht-<br />
beständen abfangen und somit vom Deich fernhalten könnten. Generell sollte bei<br />
Kompensationsmaßnahmen verstärkt die Frage berücksichtigt werden, ob und in welchem<br />
Ausmaß der Anteil an Auwaldbeständen gegenüber Röhrichtflächen naturräumlich möglich<br />
und naturschutzfachlich sinnvoll ist.<br />
Die Prognosen zur Effektivität und zu den naturschutzfachlichen Auswirkungen der in dieser<br />
Forschungsarbeit aufgezeigten Management-Optionen und -konzepte zur <strong>Treibsel</strong>-<br />
reduzierung sind - insbesondere für solche, für die bislang kaum oder keine<br />
Praxiserfahrungen vorliegen - anhand von Feldversuchen im Rahmen von Pilot- oder<br />
Monitoringprojekten zu überprüfen. Nur so kann gewährleistet werden, dass von der<br />
Prognose abweichende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden und bei negativen<br />
Auswirkungen korrigierend eingegriffen werden kann. Zudem wird durch ein Monitoring die<br />
Möglichkeit geschaffen, die hier vorgestellte Bewertungsgrundlage hinsichtlich der<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 292 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht<br />
Auswirkungen auf die Brut- und Rastvögel für weitere Vorhaben zu evaluieren und zu<br />
ergänzen. Darüber hinaus erfordert ein Management von Vorlandflächen, welche<br />
Bestandteile eines sehr dynamischen Systems sind, eine regelmäßige Erfolgskontrolle und<br />
ggf. Anpassung.<br />
Bei den im vorliegenden Bericht aufgezeigten Management-Optionen wurden auch solche<br />
berücksichtigt, deren Umsetzbarkeit möglich, aber technisch noch nicht ausgereift ist.<br />
Hierunter fallen die Management-Optionen, bei denen eine energetische Verwertung der<br />
Biomasse vorgesehen ist. Sofern diese Management-Optionen für ein <strong>Treibsel</strong>management<br />
weiter verfolgt werden sollen, sind hier entsprechende Forschungsarbeiten voranzutreiben,<br />
um Fragen der technischen und infrastrukturellen Umsetzbarkeit zu klären.<br />
Bei der Management-Option Auwaldentwicklung, die sowohl hinsichtlich ihrer<br />
treibselreduzierenden Wirkung als auch aus naturschutzfachlicher Sicht eine aussichtsreiche<br />
Management-Option für röhrichtbestandene Vorländer der Ästuare darstellt, sind vor allem<br />
Fragen bezüglich der Verbreitungsgrenzen in den stark anthropogen geprägten Ästuaren<br />
verschiedener Auwaldarten und der Eignung von Auwaldstreifen als <strong>Treibsel</strong>fänger bzw.<br />
Dämpfer von Wellen- und Strömungsenergie zu klären.<br />
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit bzw. die Schätzung des Kostenaufwandes von<br />
Management-Optionen bzw. –konzepten war nicht Gegenstand dieses Forschungs-<br />
vorhabens. Auf Finanzierungsmöglichkeiten von kostenintensiven Management-Optionen,<br />
wie die Realisierung im Zuge von Kompensationsmaßnahmen oder die Nutzung von<br />
Synergieeffekten, wurde jedoch hingewiesen. Eine überschlägige Kalkulation der Kosten<br />
wäre jedoch für die zuständigen Institutionen als Planungsgrundlage sehr hilfreich und sollte<br />
im Zuge von Monitoring- und Pilotprojekten ebenfalls ermittelt und dargelegt werden.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 293<br />
10 ANHANG<br />
ANHANG 1: AUSGEWERTETE LITERATUR FÜR PRÄFERENZ-INDEXWERTE DER<br />
RASTENDEN GÄNSE<br />
Die folgenden Werke wurden für die Berechnung der Präferenz-Indexwerte für rastende<br />
Gänse ausgewertet.<br />
AMAT J.A., GARCIA-CRIADO B. & GARCIA-CIUDAD A. (1991). Food, feeding behaviour and nutritional<br />
ecology of wintering greylag geese Anser anser. Ardea, 79, 271-282.<br />
ARENDS N. & ELISSEN H. (1997): Cycliciteit bij rotgansbegrazing op Schiermonnikoog, Student Report<br />
Animal Ecology Course Rijksuniversiteit Groningen, Haren.<br />
BALLASUS H. (2004): Ökologie und Verhalten überwinternder Bläss- und Saatgänse: Faktoren der<br />
Koexistenz, Dissertation Universität Bielefeld, Bielefeld.<br />
BERGMANN H.-H., STOCK M. & TEN THOREN B. (1994). Ringelgänse - Arktische Gäste an unseren<br />
Küsten. 1. edn. AULA-Verlag, Wiesbaden.<br />
BEZZEL E. (1985). Kompendium der Vögel Mitteleuropas. AULA-Verlag, Wiesbaden.<br />
BLACK J.D., C. & OWEN, M. (1991). Foraging behavior and site selection of barnacle geese Branta<br />
leucopsins in a traditional ans newly colonized spring staging habitat. Ardea, 79, 349-358.<br />
BORBACH-JAENE J. (2001). Gänseparadies aus Menschenhand? - Einfluss der Salzwiesenbeweidung<br />
auf die Raumnutzung von Nonnengänsen. Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 33,<br />
155-162.<br />
BORBACH-JAENE J. (2002): Anthropogen bedingte Verluste von Lebensraum und ihre Folgen - Zur<br />
Ökologie und zum Verhalten in der nordwestdeutschen Küstenlandschaft überwinternder<br />
arktischer Gänse, Dissertation Universität Osnabrück, Osnabrück.<br />
BORBACH-JAENE J., KRUCKENBERG H., LAUENSTEIN H. & SÜDBECK P. (2001). Arktische Gänse als<br />
Rastvögel im Rheiderland - eine Studie zur Ökologie und zum Einfluss auf den Ertrag<br />
landwirtschaftlicher Kulturen. Landwirtschaftsverlag Weser-Ems, Oldenburg.<br />
BOS D. (2002): Grazing in coastal grasslands - Brent geese and facilitation by herbivory, Dissertation<br />
Universität Groningen, Groningen.<br />
BOS D., DRENT R.H., RUBINIGG M. & STAHL J. (2005). The relative importance of food biomass and<br />
quality for patch and habitat choice in brent geese Branta bernicla. Ardea, 93, 5-16.<br />
BROEKMAN M. (1998): Onderzoek naar terreinkeuze van Rot- en Brandganzen, Student Report<br />
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
BRUNCKHORST H. (1996): Ökologie und Energetik der Pfeifente im Schleswig-Holsteinischen<br />
Wattenmeer, Dissertation Christian-Albrechts-Universität Kiel, Kiel.<br />
BRUNS K. (1988): Nahrungsverwertung bei Ringelgänsen (Branta bernicla), Diplomarbeit Universität<br />
Osnabrück, Osnabrück.<br />
CADWALLADR D.A. & MORLEY J.V. (1973a). Sheep Grazing Preferences on a Saltings Pasture and<br />
Their Significance for Wigeon (Anas-Penelope L) Conservation. Journal of the British<br />
Grassland Society, 28, 235-242.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 294 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
CADWALLADR D.A. & MORLEY J.V. (1973b). Sheep grazing preferences on a saltings pasture and their<br />
significance for wigeon (Anas penelope L.) conservation. Journal of the British Grassland<br />
Society, 28, 235-242.<br />
CADWALLADR D.A., OWEN M., COOK R.S. & MORLEY J.V. (1972). Wigeon (Anas penelope L.)<br />
conservation and salting pasture management at bridgewater bay national nature reserve,<br />
Somerset. Journal of Applied Ecology, 9, 417-425.<br />
CLAUSEN P. (1998). Choosing between feeding on Zostera and salt marsh: Factors affecting habitat<br />
use by brent geese in spring. In: Research on arctic geese. Proceedings of the Svalbard<br />
Goose Symposium (eds. Mehlum F, Black JM & Madsen J). Norsk Polarinstitutt Skrifter<br />
Oslo, Norway, pp. 277-294.<br />
CLAUSEN P. & PERCIVAL S.M. (1998). Changes in distribution and habitat use of Svalbard light-bellied<br />
brent geese Branta bernicla hrota, 1980-1995: Driven by Zostera availability? In: Research<br />
on arctic geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium 1997 (eds. Mehlum F,<br />
Black JM & Madsen J). Norsk Polarinstitutt Skrifter Oslo, Norway, pp. 253-276.<br />
COEHOORN P. (2004 ). The influence of tiller density and sward height of red fescue (Festuca rubra) on<br />
the intake rate of barnacle geese (Branta leucopsis), Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
DEGRO H.N. (1998): Habitatwahl von überwinternden und migrierenden Weißwangengänsen Branta<br />
leucopsis (Bechstein) auf Schiermonnikoog, Niederlande, Diplomarbeit Universität Kiel, Kiel.<br />
DICK G., REHFISCH M., SKINNER J. & SMART M. (1991). Wintering greylag geese Anser anser in North<br />
Africa. Ardea, 79, 283-286.<br />
DIJKSTRA L.D.D.V., R. (1977): Voedseloecologie van de Rotgans, Dissertation Rijksuniversiteit<br />
Groningen, Groningen.<br />
DON W. (2000). Determination of intake rate for three species of goose, Anser anser, Branta bernicla<br />
and Branta leucopsis at different levels of biomass, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
DOROZYNSKA N. (1969). The part played by water in the nutrition of the domestic goose Anser anser L.<br />
fed on green plants. Zoologica Poloniae, 19, 167-85.<br />
DRENT R.E., B. & WEIJANDS, B. (1978). Balancing the energybudget of arctic-breeding geese<br />
throughout the annual cycle: a progress report. Verhandl Ornitholog Gesel Bayern, 23, 239–<br />
263.<br />
DRENT R.H. & VAN DER WAL R. (1999). Cyclic grazing in vertebrates and the manipulation of the food<br />
resource In: Herbivores: between plants and predators (eds. Olff H, Brown VK & Drent RH).<br />
Blackwell Scientific, Oxford, pp. 271-299.<br />
DUIN W.E., ESSELINK P., BOS D., KLAVER R., VERWEIJ G. & LEEUWEN V.P.W. (2007). Proefverkweldering<br />
Noard-Frysland Butendyks, evaluatie kwelderherstel 2000-2005, It Fryske Gea, Olterterp.<br />
DURANT D. & FRITZ H. (2006). Variation of pecking rate with sward height in wild wigeon Anas<br />
penelope. Journal of Ornithology, 147, 367-370.<br />
DURANT D., FRITZ H., BLAIS S. & DUNCAN P. (2003). The functional response in three species of<br />
herbivorous Anatidae: effects of sward height, body mass and bill size. Journal of Animal<br />
Ecology, 72, 220-231.<br />
DURANT D., FRITZ H. & DUNCAN P. (2004). Feeding patch selection by herbivorous Anatidae: the<br />
influence of body size, and of plant quantity and quality. Journal of Avian Biology, 35, 144-<br />
152.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 295<br />
DURANT D., KERSTEN M., FRITZ H., JUIN H. & LILA M. (2006). Constraints of feeding on Salicornia<br />
ramosissima by wigeon Anas penelope: an experimental approach. Journal of Ornithology,<br />
147, 1-12.<br />
EBBINGE B. & CANTERS K. (1973): De Brandgans en zijn Overwinteringsgebied, Diplomarbeit<br />
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
EBBINGE B., CANTERS K. & DRENT R. (1975). Foraging routines and estimated daily food intake in<br />
barnacle geese wintering in the northern Netherlands. The Wildfowl Trust, 26, 5-19.<br />
EBBINGE B., JOSEPH A.S., PROKOSCH P. & SPANS B. (1982). The importance of spring staging areas for<br />
arcticbreeding geese, wintering in western Europe. Aquila, 89, 249-258.<br />
EBBINGE B.S. (1989). A multifactorial explanation for variation in breeding performance of brent geese<br />
Branta bernicla. Ibis, 131, 196-204.<br />
EBBINGE B.S. (1992). Regulation of numbers of dark-bellied brent geese Branta bernicla bernicla on<br />
spring staging sites. Ardea, 80, 203-228.<br />
EBBINGE B.S. & SPAANS B. (1995). The importance of body reserves accumulated in spring staging<br />
areas in the temperate zone for breeding in dark-bellied brent geese Branta b. bernicla in the<br />
high arctic. Journal of Avian Biology, 26, 105-113.<br />
ELY C.R., WARD D.H. & BOLLINGER K.S. (1999). Behavioral correlates of heart rates of free-living<br />
greater white-fronted geese. Condor, 101, 390-395.<br />
ENGELMOER M., ALMA R., VAN DEN DOOL G., INEKE M.-J., VROOM A. & WYMENGA E. (1998). Pleisterende<br />
Ganzen en Zwanen langs de Friese Waddenkust, Seizoen 1997/98, Veenwouden.<br />
FOX A.D., BOYD H. & BROMLEY R.G. (1994). Mutual benefits of associations between breeding and non-<br />
breeding white-fronted gees Anser albifrons. Ibis, 137, 151-156.<br />
GERDES K. (1994). Lang- und kurzfristige Bestandsänderungen der Gänse (Anser fabalis, A. albifrons,<br />
A. anser, Branta leucopsis) am Dollart und ihre ökologischen Wechselbeziehungen.<br />
Vogelwarte, 37, 157-178.<br />
GOSS-CUSTARD J.D., STILLMAN R.A., CALDOW R.W.G., WEST A.D. & GUILLEMAIN M. (2003). Carrying<br />
capacity in overwintering birds: when are spatial models needed? Journal of Applied<br />
Ecology, 40, 176-187.<br />
GREEN M.A., T. (2000). Flight speeds and climb rates of brent geese: mass-dependent differences<br />
between spring and autumn migration. Journal of Avian Biology, 31, 215-225.<br />
GWLIK D.E. & SLACK R.D. (1996). Comparative foraging behavior of sympatic Snow Gees, Greater<br />
White-fronted Gees, and Canada Gees during the non-breeding season. The Wilson<br />
Bulletin, 108, 154-159.<br />
HASSALL M. & LANE S.J. (2005). Partial feeding preferences and the profitability of winter-feeding sites<br />
for brent geese. Basic and Applied Ecology, 6, 559-570.<br />
HASSALL M., LANE S.J., STOCK M., PERCIVAL S.M. & POHL B. (2001a). Monitoring feeding behaviour of<br />
brent geese Branta bernicla using position-sensitive ratio transmitters. Wildlife Biology, 7, 77-<br />
86.<br />
HASSALL M., RIDDINGTON R. & HELDEN A. (2001b). Foraging behaviour of brent geese, Branta b.<br />
bernicla, on grasslands: effects of sward length and nitrogen content. Oecologia, 127, 97-<br />
104.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 296 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
HEUERMANN N. (2001): Experimentally testing foraging preferences with captive brent and barnacle<br />
geese, Diplomarbeit Universität Osnabrück, Osnabrück.<br />
HEUERMANN N. (2007): Tall swards and small grazers - Competition, facilitation and coexistence of<br />
different-sized grazers, Dissertation Universität Wageningen, Wageningen.<br />
INEKE M.J. (1998): Het effect van het beweidingbeheer op de verspreiding van Brandganzen in Noord-<br />
Friesland Buitendijks: De rol van de vegetatiesamenstelling, Student Report Rijksuniversiteit<br />
Groningen, Groningen.<br />
JACOBSEN O.W. (1992). Factors affecting selection of nitrogen-fertilized grassland areas by breeding<br />
wigeon Anas penelope. Ornis Scandinavica, 23, 121-131.<br />
JAENE J. & KRUCKENBERG H. (1996): Raumnutzung überwinternder Gänse (Anser albifrons, Branta<br />
leucopsis) in Abhängigkeit von Straßenführung und Bebauung, Diplomarbeit Universität<br />
Osnabrück, Osnabrück.<br />
KATS R.K.H. (1994): Herbivory and vegetation succession on the Shiermonnikoog saltmarsh,<br />
Doctoraal Verslag Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
KEITZ M. & HOFFMANN F. (1996): De invloed van vegetatiesuccessie in de kwelder op het<br />
fourageergedrag van Rotganzen (Branta bernicla bernicla), Student Report Animal Ecology<br />
Course Rijksuniversiteit Groningen, Haren.<br />
KELLER V.E. (1991). The effect of disturbance from roads on the distribution of feeding sites of geese<br />
(Anser brachyrhynchus, A. anser), wintering in north-east Scotland. Ardea, 79, 229-233.<br />
KNOKE V. (1991): Untersuchungen zur Nahrungsbiologie der Pfeifente, Anas penelope L. 1758, im<br />
Beltringharder Koog, Diplomarbeit Christian-Albrechts-Universität Kiel, Kiel.<br />
KORTE H. (1988): Conditie Bepalingen aan Rotganzen (Branta b. bernicla), Dissertation<br />
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
KOWALLIK C. & BORBACH-JAENE J. (2001). Windräder als Vogelscheuchen? - Über den Einfluss der<br />
Windkraftnutzung in Gänserastgebieten an der nordwestdeutschen Küste. Vogelkundliche<br />
Berichte aus Niedersachsen, 33, 97-102.<br />
KRUCKENBERG H. (2003): Muster der Raumnutzung markierter Blessgänse (Anser albifrons albifrons)<br />
in West- und Mitteleuropa unter der Berücksichtigung sozialer Aspekte, Dissertation<br />
Universität Osnabrück, Osnabrück.<br />
KRUCKENBERG H. & BORBACH-JAENE J. (2001). Auswirkungen eines Windparks auf die Raumnutzung<br />
nahrungssuchender Blessgänse - Ergebnisse aus einem Monitoringprojekt mit Hinweisen<br />
auf ökoethologischen Forschungsbedarf. Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 33,<br />
103-109.<br />
KRUCKENBERG H. & JAENE J. (1999). Zum Einfluss eines Windparks auf die Verteilung weidender<br />
Bläßgänse im Rheiderland (Landkreis Leer, Niedersachsen). Natur und Landschaft, 74, 420-<br />
426.<br />
KRUCKENBERG H., JAENE J. & BERGMANN H.-H. (1998). Mut oder Verzweiflung am Straßenrand? Der<br />
Einfluß von Straßen auf die Raumnutzung und das Verhaltern von äsenden Bläß-und<br />
Nonnengänsen am Dollart, NW-Niedersachsen. Natur und Landschaft, 73, 3-8.<br />
KRUCKENBERG H., WILLE V., HEARN R., EBBINGE B.S. & BERGMANN H.-H. (EDS.) (2003). Blessgänse<br />
(Anser a. albifrons) auf dem Weg durch Europa - erste Ergebnisse eines europäischen<br />
Farbmarkierungsprojektes. Universität Osnabrück, Osnabrück.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 297<br />
KUIJPER D. (1997): Habitat-Selectie van de Brand- en de Rotgans aan de Groninger Kust, Master<br />
Thesis Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
LAMBECK R.H.D. (1990). Differences in migratory pattern and habitat choice between social classes of<br />
the brent goose Branta b. bernicla. Ardea, 78, 426-439.<br />
LANE S.J. & HASSALL M. (1996). Nocturnal feeding by dark-bellid brent geese Branta bernicla bernicla.<br />
Ibis, 138, 291-297.<br />
LANG A. & BLACK J.M. (2001). Foraging efficiency in barnacle geese Branta leucopsis: a functional<br />
response to sward height and an analysis of sources of individual variation. Wildfowl, 52, 7-<br />
20.<br />
LEFEBVRE E.A.R., D.G. (1967). Distribution of Canada geese in winter as related to heat loss at varying<br />
environmental temperatures. Journal of Wildlife Management, 31, 538-546.<br />
LOONEN M.J.J.E. (1984). Rotganzen 1983, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
LOONEN M.J.J.E., OOSTERBEEK K. & DRENT R.H. (1997). Variation in growth of young and adult size in<br />
barnacle geese Branta leucopsis: Evidence for density dependence. Ardea, 85, 177-192.<br />
LOONEN M.J.J.E., ZIJLSTRA M. & VAN EERDEN M.R. (1991). Timing of wing moult in greylag geese Anser<br />
anser in relation to the availability of their food plants. Ardea, 79, 253-259.<br />
LUBBE G. (2003). Competitie voor Festuca tussen brandganzen en hazen; de rol van biomassa en<br />
kwaliteit, Rijksuniversiteit Groningen, Haren.<br />
MADGE S. & BURN H. (1989). Wassergeflügel. Parey, Hamburg.<br />
MADSEN J. (1988). Autumn feeding ecology of herbivorous wildfowl in the Danish Wadden Sea, and<br />
impact of food supplies and shooting on movements. Danish Review of Game Biology, 13, 1-<br />
32.<br />
MAYES E. (1991). The winter ecology of Greenland white-fronted geese Anser albifrons flavirostris on<br />
semi-natural grassland and intensive farmland. Ardea, 79, 295-304.<br />
MAYHEW P. & HOUSTON D. (1999). Effects of winter and early spring grazing by wigeon Anas penelope<br />
on their food supply. Ibis, 141, 80-84.<br />
MAYHEW P.W. (1985): The feeding ecology and behaviour of Wigeon (Anas penelope), PhD Thesis<br />
University of Glasgow, Glasgow.<br />
MCKAY H.V., BISHOP J.D. & ENNIS D.C. (1994). The possible importance of nutritional-requirements for<br />
dark-bellied brent geese in the seasonal shift from winter cereals to pasture. Ardea, 82, 123-<br />
132.<br />
NACKEN N. & REISE K. (2000). Effects of herbivorous birds on intertidal seagrass beds in the northern<br />
Wadden Sea. Helgoland Marine Research, 54, 87-94.<br />
O'BRIAN M. & HEALY B. (1991). Winter distribution of light-bellied brent geese Branta bernicla hrota in<br />
Ireland. Ardea, 79, 317-326.<br />
OWEN M. (1972). Movements and ecology of white-fronted geese at the New Grounds, Slimbridge.<br />
Journal of Applied Ecology, 9, 385-98.<br />
OWEN M. (1973). Winter feeding ecology of pigeon at bridgwater bay, Somerset. Ibis, 115, 227-243.<br />
OWEN M. (1980). Wild geese of the world. Batsford Ltd., London.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 298 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
PERCIVAL S.M. & ANDERSON G.Q.A. (1998). Habitat use and site fidelity of Svalbard light-bellied brent<br />
geese Branta bernicla hrota at Lindisfarne: Exploitation of a novel food resource. In:<br />
Research in Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium (eds. Mehlum F,<br />
Black JM & Madsen J). Norsk Polarinstitutt Skrifter Oslo, Norway, pp. 295-301.<br />
PERCIVAL S.M. & EVANS P.R. (1997). Brent geese Branta bernicla and Zostera; Factors affecting the<br />
exploitation of a seasonally declining food resource. Ibis, 139, 121-128.<br />
PRINS H.H.T., YDENBERG, R.C. & DRENT, R.H. (1980). The interaction of brent geese - Branta bernicla -<br />
and sea plantain - Plantago maritima - during spring staging: Field observations and<br />
experiments. Acta Botanica Neerlandica, 29, 585-596.<br />
PROP J. (1991). Food exploitation patterns by brent geese Branta bernicla during spring staging.<br />
Ardea, 79, 331-341.<br />
PROP J. (2004): Food finding - On the trail to successful reproduction in migratory geese, Dissertation<br />
Universität Groningen, Groningen.<br />
PROP J. & DEERENBERG C. (1991). Spring staging in brent geese Branta bernicla: feeding constraints<br />
and the impact of diet on the accumulation of body reserves. Oecologia, 87, 19-28.<br />
PROP J. & LOONEN M. (1986). Goose flocks and food exploitation: the importance of being first. Acta<br />
XIX Congressus Internationalis Ornithologici (Ottawa, Canada), 1878-1887.<br />
RIDDINGTON R., HASSALL M. & LANE S.J. (1997). The selection of grass swards by brent geese Branta<br />
b. bernicla: Interactions between food quality and quantity. Biological Conservation, 81, 153-<br />
160.<br />
RIDDINGTON R., HASSALL M., LANE S.J., TURNER P.A. & WALTERS R. (1996). The impact of disturbance<br />
on the behaviour and energy budgets of brent gees Branta b. bernicla. Bird Study, 43, 269-<br />
279.<br />
RIJNSDORP A.D. (1986). Winter ecology and food of wigeon in inland pasture areas in the Netherlands.<br />
Ardea, 74, 121-128.<br />
ROTHKEGEL C. (1999): Grazing lawns für Ringelgänse Branta bernicla in der Salzwiese? Ein<br />
Experiment mit zahmen Gänsen über den Einfluß weidender Nonnengänse Branta<br />
leucopsos auf die Vegetation im Frühjahr und die Präferenz von Gänsen für grazing lawns,<br />
Philipps-Universität Marburg, Marburg.<br />
ROWCLIFFE J.M., SUTHERLAND W.J. & WATKINSON A.R. (1999). The functional and aggregative<br />
responses of a herbivore: underlying mechanisms and the spatial implications for plant<br />
depletion. Journal of Animal Ecology, 68, 853-868.<br />
ROWCLIFFE J.M., WATKINSON A.R. & SUTHERLAND W.J. (1998). Aggregative responses of brent geese<br />
on salt marsh and their impact on plant community dynamics. Oecologia, 114, 417-426.<br />
ROWCLIFFE J.M., WATKINSON A.R., SUTHERLAND W.J. & VICKERY J.A. (1995). Cyclic winter grazing<br />
patterns in brent geese and the regrowth of salt-marsh grass. Functional Ecology, 9, 931-<br />
941.<br />
SAGEL M. (1997). The effects of plant standing crop on the foraging of barnacle geese, Universität<br />
Groningen, Groningen.<br />
SPAANS B. (1983): Sociaal gedrag bij de Rotgans, een oecologische benadering april 1979 - mai 1980,<br />
Master Thesis Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 299<br />
SPAANS B. & POSTMA P. (2001). Inland pastures are an appropriate alternative for salt-marshes as a<br />
feeding area for spring-fattening dark-bellied brent geese Branta bernicla. Ardea, 89, 427-<br />
440.<br />
SPILLING E. (1998): Raumnutzung überwinternder Gänse und Schwäne an der Unteren Mittelelbe:<br />
Raumbedarf und anthropogene Raumbegrenzung, Dissertation Universität Osnabrück,<br />
Osnabrück.<br />
STAHL J., BOS D. & LOONEN M.J.J.E. (2002). Foraging along a salinity gradient - the effect of tidal<br />
inundation on site choice by dark-bellied brent geese Branta bernicla and barnacle geese B.<br />
leucopsis. Ardea, 90, 201-212.<br />
STOCK M. & HOFEDITZ F. (1996). Zeit-Aktivitäts-Bugets von Ringelgänsen (Branta bernicla bernicla) in<br />
unterschiedlich stark von Menschen beeinflußten Salzwiesen des Wattenmeeres.<br />
Vogelwarte, 38, 121-145.<br />
STOCK M. & KIEHL K. (2000). Die Salzwiesen der Hamburger Hallig. Schriftenreihe des Nationalparks<br />
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, 89.<br />
SUMMERS R.W., STANSFIELD J., PERRY S., ATKINS C. & BISHOP J. (1993). Utilization, diet and diet<br />
selection by brent geese Branta bernicla bernicla on salt-marshes in Norfolk. Journal of<br />
Zoology, 231, 249-273.<br />
SUMMERS R.W.C., C.N.R. (1990). Use of grassland and field selection by brent geese Branta bernicla.<br />
Journal of applied Ecology, 27, 834-846.<br />
SUTHERLAND A.J. & ALLPORT G.A. (1994). A spatial depletion model of the interaction between bean<br />
geese and wigeon with the consequences for habitat management. Journal of Animal<br />
Ecology, 63, 51-59.<br />
THERKILDSEN O.R. & BREGNBALLE T. (2006). The importance of salt-marsh wetness for seed<br />
exploitation by dabbling ducks Anas sp. Journal of Ornithology, 147, 591-598.<br />
TIJDENS M. & VEENEKLAAS R. (1998). Habitat Preferentie bij Branta bernicla bernicla, Rijksuniversiteit<br />
Groningen, Groningen.<br />
VAN DER HAAR R. (1999): Opnamesnelheid van de Rotgans (Branta bernicla bernicla) op verschillende<br />
vegetatietypen en de voorkeur voor een bepaald vegetatietype, Student Report<br />
Rijksuniversiteit Groningen, Haren.<br />
VAN DER JEUGD H.P., OLTHOFF M.P. & STAHL J. (2001). Breeding range translates into staging site<br />
choice: Baltic and arctic barnacle geese Branta leucopsis use different habitats at a Dutch<br />
Wadden Sea island. Ardea, 89, 253-265.<br />
VAN DUIN W.E., ESSELINK P., BOS D., KLAVER R., VERWEIJ G. & VAN LEEUWEN P.-W. (2007).<br />
Proefverkweldering Noard-Fryslan Butendyks. Evaluatie kwelderherstel 2000-2005.<br />
Altenburg & Wymenga, Veenwouden.<br />
VAN EERDEN M.R. (1998): Patchwork - Patch use, habitat exploitation and carrying capacity for water<br />
birds in dutch freshwater wetlands, Dissertation Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.<br />
VAN EERDEN M.R., ZIJLSTRA M. & LOONEN M.J.J.E. (1991). Individual patterns of staging during autumn<br />
migration in relation to body condition in greylag geese Anser anser in the Netherlands.<br />
Ardea, 79, 261-264.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 300 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
VAN EERDEN M.R., ZIJLSTRA M., VAN ROOMEN M. & TIMMERMAN A. (1996). The response of Anatidae to<br />
changes in agricultural practice: long-term shifts in the carrying capacity of wintering<br />
waterfowl. Gibier Faune Sauvage, 13, 681-706.<br />
VAN NUGTEREN J. (ED.) (1994). Brent geese in the Wadden Sea. Dutch Society for the Preservation of<br />
the Wadden Sea, Harlingen.<br />
VAN NUGTEREN J. (1997). Dark-bellied brent goose - Branta bernicla bernicla - Flyway Management<br />
Plan. Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea, Wageningen.<br />
VAN WINJGAARDEN A. (1970). Primary and secondary production of some vegetation types in pastured<br />
and unpastured salt marshes (Nature Reserve "De Boschplaat", Isle of Terschelling),<br />
Amsterdam.<br />
VEEN C. (2004). Effects of biomass and quality of forage on grazing by breeding and spring staging<br />
barnacle geese (Branta leucopsis), Universität Groningen, Groningen.<br />
WEIGT H. (2001). Keine Rinder - keine Gänse? Beweidungseinstellung in der Leybucht und ihre<br />
Folgen. Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 33, 163-169.<br />
YDENBERG R.C. & PRINS H.H.T. (1981). Spring grazing and the manipulation of food quality by barnacle<br />
geese. Journal of Applied Ecology, 18, 443-453.<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 301<br />
ANHANG 2: PRÄFERENZ-INDEXWERTE BRUTVÖGEL<br />
Im Folgenden sind für die in Kapitel 6.3.1 beschriebenen Brutvogelarten die Präferenz-<br />
Indexwerte aufgeführt. In Tabelle 37 (Seite 128) findet sich für die hier aufgeführten<br />
Vogelarten die Anzahl der Reviere, die für die Berechnung der Indexwerte berücksichtigt<br />
wurden.<br />
Austernfischer<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 0,38 0,08 0,77<br />
S.1.2 0,41 -0,13 0,39 0,65<br />
S.2.1 0,11 0,12 -0,14<br />
S.2.4 -0,02 0,10<br />
S.3.0 0,40 0,56<br />
S.3.2 0,26 0,79<br />
S.3.3 0,16 0,77<br />
S.3.5 0,31 0,16<br />
S.3.7 -0,35 -0,36 -0,14<br />
S.3.9 -0,48 -0,47 0,58 0,63<br />
S.5.1 0,27<br />
S.5.2 0,25 0,79<br />
S.7 0,82 0,81<br />
S.9 0,22 0,03 0,62<br />
S.12 0,65 0,68<br />
Deich 0,66 0,19 0,83<br />
Watt 0,67 0,64 0,77<br />
Brandgans<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 0,42 0,40<br />
S.1.2 0,40 0,25<br />
S.2.1 0,55 0,20<br />
S.2.4 -0,39 0,01<br />
S.3.0 0,13 0,25<br />
S.3.2 0,54<br />
S.3.3 0,35 0,44<br />
S.3.5 0,52 0,54<br />
S.3.7 -0,23 -0,20<br />
S.3.9 -0,83 -0,17<br />
S.7 0,65<br />
S.12 0,36 0,45<br />
Deich 0,54 -0,09<br />
Watt 0,42 0,48<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 302 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
Feldlerche<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,90<br />
S.1.2 0,70 -0,88<br />
S.2.4 0,42<br />
S.3.0 0,39<br />
S.3.3 0,67<br />
S.3.9 0,63<br />
S.5.1 0,42<br />
S.7 -0,86<br />
S.9 -0,85 -0,83<br />
S.12 -0,77<br />
Deich 0,88 0,63<br />
Watt -0,81 0,42<br />
Flussseeschwalbe<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 0,83 -0,76<br />
S.1.2 -0,19<br />
S.2.1 0,46 0,10<br />
S.2.4 0,18 -0,05<br />
S.3.0 -0,09 -1,00<br />
S.3.3 -0,76<br />
S.3.7 -0,74 -0,73<br />
S.3.9 -1,00 -1,00<br />
Deich 0,87<br />
Watt 0,91 0,86<br />
Kiebitz<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,18<br />
S.1.2 0,09 0,37<br />
S.2.1 0,19<br />
S.3.0 0,47 0,37<br />
S.3.2 0,09<br />
S.3.7 0,03<br />
S.3.9 -1,00 -0,11<br />
S.5.1 0,18 0,47<br />
S.5.2 0,15 0,42<br />
S.7 0,03<br />
S.9 0,08<br />
Watt 0,28<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 303<br />
Rohrammer<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,42<br />
S.1.2 -0,24<br />
S.2.1 -0,20 -0,57 -0,23<br />
S.2.4 -0,07 0,86<br />
S.3.0 -0,24 0,87<br />
S.3.2 0,60 0,02<br />
S.3.5 0,24<br />
S.3.7 0,09 -0,07<br />
S.3.9 0,06 0,35<br />
S.5.1 -0,07<br />
S.5.2 0,25 0,93<br />
S.7 0,23<br />
S.9 0,60<br />
S.12 0,59<br />
Deich 0,26 0,89<br />
Watt -0,24 0,58 0,87<br />
Rotschenkel<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.2 0,56 0,16 0,53<br />
S.3.0 0,68<br />
S.3.2 0,64<br />
S.3.3 0,36<br />
S.3.5 0,62<br />
S.3.7 -0,23<br />
S.3.9 0,45<br />
S.5.2 0,45 0,65<br />
S.7 0,52<br />
S.9 0,43 0,42<br />
S.12 0,47<br />
Deich 0,75 -0,79 0,70<br />
Watt 0,41 -0,79<br />
Säbelschnäbler<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,10<br />
S.1.2 0,09<br />
S.2.1 -0,52<br />
S.2.4 -0,50<br />
S.3.0 0,47 0,48<br />
S.3.3 0,13<br />
S.3.5 0,09<br />
S.3.7 -0,52<br />
S.5.2 0,16<br />
Watt -0,49<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 304 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
Schafstelze<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,88 -0,52<br />
S.1.2 -0,64<br />
S.3.0 -0,58<br />
S.3.3 -0,72<br />
S.3.5 -0,62<br />
S.5.2 -0,83 -0,78<br />
Watt -0,71 -0,52<br />
Stockente<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 0,49 0,34<br />
S.1.2 0,36 0,35<br />
S.2.1 0,21<br />
S.2.4 -0,42<br />
S.3.0 0,05 -0,22<br />
S.3.3 0,45<br />
S.3.5 0,57 0,43<br />
S.3.7 -0,43<br />
S.3.9 -0,08 -0,22<br />
S.5.2 -0,44 0,47<br />
S.7 0,56 0,45<br />
S.9 0,56 0,45<br />
S.12 0,59 0,45<br />
Deich 0,65 0,35<br />
Watt 0,55 0,48<br />
Uferschnepfe<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.2.1 0,47<br />
S.3.7 -0,07<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang Seite 305<br />
Wiesenpieper<br />
TMAP-Code gesamt ungenutzt beweidet gemäht<br />
S.1.1 -0,63 -0,93<br />
S.1.2 -0,28 -0,56<br />
S.2.1 0,06<br />
S.3.0 0,06<br />
S.3.7 0,06<br />
S.3.9 -0,56<br />
S.5.1 -0,30 -0,90<br />
S.7 -0,95 -0,96<br />
S.9 -0,30 -0,25<br />
S.12 -0,58<br />
Deich -0,65 -0,57<br />
Watt -0,72 -0,85<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>
Seite 306 Forschungsvorhaben <strong>Treibsel</strong>reduzierung: Endbericht - Anhang<br />
ANHANG 3: LITERATURAUSWERTUNG IM RAHMEN DES TEILPROJEKTES 1B:<br />
„SCHILFMAHD ALS MANAGEMENT-OPTION ZUR TREIBSELREDUZIERUNG IN DEN<br />
FLUSSÄSTUAREN NIEDERSACHSENS – AUSWIRKUNGEN AUF RÖHRICHTBRÜTER<br />
UND NATURSCHUTZFACHLICHE BEWERTUNG<br />
<strong>planungsgruppe</strong> <strong>grün</strong> <strong>gmbh</strong>