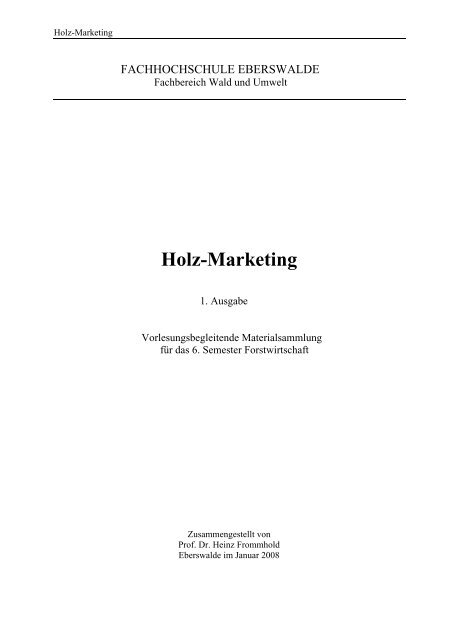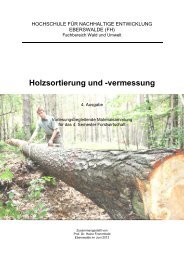Holz-Marketing - Prof. Frommhold
Holz-Marketing - Prof. Frommhold
Holz-Marketing - Prof. Frommhold
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong><br />
FACHHOCHSCHULE EBERSWALDE<br />
Fachbereich Wald und Umwelt<br />
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong><br />
1. Ausgabe<br />
Vorlesungsbegleitende Materialsammlung<br />
für das 6. Semester Forstwirtschaft<br />
Zusammengestellt von<br />
<strong>Prof</strong>. Dr. Heinz <strong>Frommhold</strong><br />
Eberswalde im Januar 2008
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis.......................................................................................................................... I<br />
Vorwort .........................................................................................................................................1<br />
1. <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt ................................................................................................2<br />
1.1 Einführung.....................................................................................................................2<br />
1.2 <strong>Holz</strong>bilanzen..................................................................................................................2<br />
1.3 <strong>Holz</strong>markt und <strong>Holz</strong>marktstatistik ................................................................................2<br />
1.4 Zertifizierungen.............................................................................................................3<br />
1.5 <strong>Holz</strong>marktentwicklungen ..............................................................................................5<br />
1.6 Forstwirtschaftliche und holzwirtschaftliche Zusammenschlüsse ................................5<br />
1.7 Kartellrechtsbeschwerden .............................................................................................6<br />
1.8 Forstschädenausgleichsgesetz .......................................................................................6<br />
2. <strong>Holz</strong>aufbereitung, Rundholz-Handel und <strong>Holz</strong>transport ......................................................7<br />
2.1 <strong>Holz</strong>aufbereitung...........................................................................................................7<br />
2.1.1 Losbildung.............................................................................................................7<br />
2.1.2 Lospräsentation .....................................................................................................7<br />
2.2 Rundholz-Handel ..........................................................................................................8<br />
2.3 <strong>Holz</strong>transport.................................................................................................................8<br />
2.3.1 <strong>Holz</strong>transport auf dem Wasser ..............................................................................9<br />
2.3.2 <strong>Holz</strong>transport mit der Bahn...................................................................................9<br />
2.3.3 <strong>Holz</strong>transport auf der Straße .................................................................................9<br />
2.4 Elektronische Hilfen der <strong>Holz</strong>logistik.........................................................................10<br />
3. Gesetzliche Grundlagen des <strong>Holz</strong>verkaufs und Verkaufsarten...........................................11<br />
3.1 Gesetzliche und landesrechtliche Grundlagen ............................................................11<br />
3.2 Verkaufsarten und Verkaufsverfahren ........................................................................12<br />
3.2.1 Versteigerung und Taxwerte ...............................................................................12<br />
3.2.2 Submission ..........................................................................................................14<br />
3.2.3 Freihandverkauf ..................................................................................................16<br />
3.2.3.1 Vorverkauf auf dem Stock (Vorverkauf mit Käuferhieb)...............................16<br />
3.2.3.2 Vorverkauf aufzubereitender Sorten (Vorverkauf mit Verkäuferhieb)...........16<br />
3.2.3.3 Nachverkauf ....................................................................................................17<br />
3.3 <strong>Holz</strong>kaufvertrag und Rahmenvereinbarung ................................................................17<br />
4. Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen..............................................................18<br />
4.1 Rechnungslegung (nicht in AVZB ausgeführt)...........................................................19<br />
4.2 Vertragsabschluß.........................................................................................................20<br />
4.3 Mengenabweichung ....................................................................................................20<br />
4.4 Gefahrenübergang .......................................................................................................20<br />
4.5 Eigentumsübergang.....................................................................................................21<br />
4.6 Gewährleistung und Sachmängel................................................................................21<br />
4.7 Erfüllungsort................................................................................................................22<br />
4.8 Zahlungsverkehr..........................................................................................................22<br />
4.8.1 Bankbürgschaft....................................................................................................23<br />
4.8.2 Zahlungsfristen und Skonto ................................................................................23<br />
4.8.3 Stundung..............................................................................................................23<br />
4.8.4 Zahlungsverzug ...................................................................................................23<br />
4.9 Wiederverkauf.............................................................................................................24<br />
4.10 Abweichungen in anderen Bundesländern..................................................................24<br />
5. Messzahlen, <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte und Steuern............................................................25<br />
5.1 Messzahlen, <strong>Holz</strong>preise, Grundlagen und Entwicklungen..........................................25<br />
5.2 <strong>Holz</strong>preise am Beispiel Brandenburgs ........................................................................26<br />
5.3 Preisberichte am Beispiel Brandenburgs.....................................................................29<br />
- I -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong><br />
5.4 Umsatz-Besteuerung ...................................................................................................31<br />
6. Forstliche Nebennutzungen.................................................................................................32<br />
6.1 Weihnachtsbäume und Schmuckreisig........................................................................32<br />
6.2 Beeren, Pilze und andere Produkte des Waldes ..........................................................32<br />
6.3 Harz .............................................................................................................................33<br />
6.4 Rinde und Kork ...........................................................................................................37<br />
6.5. Gerbstoffe....................................................................................................................39<br />
6.6. Weitere Nebennutzungen des Waldes.........................................................................41<br />
Literaturverzeichnis.....................................................................................................................III<br />
Abbildungsverzeichnis................................................................................................................III<br />
Tabellenverzeichnis.....................................................................................................................III<br />
- II -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong><br />
Vorwort<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
diese erste Ausgabe der vorlesungsbegleitenden Materialsammlung des Lehrfaches <strong>Holz</strong>-<br />
<strong>Marketing</strong> für das 6. Semester Forstwirtschaft soll dazu beitragen, den Vorlesungsstoff besser<br />
nacharbeiten zu können.<br />
Dazu wurden früher lose Blätter und Broschüren unregelmäßig in Vorlesungen zum Kopieren<br />
herausgegeben. Dieses Vorgehen hat sich nicht bewährt. Aus diesem Grunde wird das<br />
vorgelegte Skript mit einer Auswahl der Kopien von in Vorlesungen gezeigten Folien und<br />
Beispielen ergänzt. Der Kommentar zur Handelsklassensortierung Rohholz (HKS) vom Mai<br />
2001 (68 Seiten) wurde Ihnen zum besseren Verständnis bereits ausgehändigt. Die<br />
Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Landes Brandenburg vom ... können Sie<br />
von meiner Homepage herunter laden.<br />
Das beigefügte Inhaltsverzeichnis entspricht der Gliederung der dazugehörigen Vorlesung. Die<br />
Feingliederung Ihrer Vorlesung ist außerdem beigefügt.<br />
Beigefügt ist auch das Seminar- und Exkursionsprogramm mit einzelnen inhaltlichen<br />
Darstellungen, die in meiner Homepage ausführlich und aktuell zu finden sind unter:<br />
http://www6.fh-eberswalde.de/forst/forstnutzung/bachelor_fowi/index.html<br />
� Vorlesungsgliederung für das 6. Semester Forstwirtschaft mit Skripten<br />
� Seminar- und Exkursionsprogramm<br />
� Bachelorthemen<br />
� Exkursionsführer<br />
� Downloads<br />
Jährlich soll eine Überarbeitung erfolgen, die zur Verbesserung und Ergänzung dieser Ausgabe<br />
führen soll.<br />
Jeden sachdienlichen Hinweis und Ihre aktive Mitarbeit als studentische Hilfskraft nehme ich<br />
dankbar entgegen.<br />
gez. H. <strong>Frommhold</strong> 04. Februar 2008<br />
- 1 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
1. <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
1.1 Einführung<br />
1.2 <strong>Holz</strong>bilanzen<br />
In den neuen Bundesländern wurde der <strong>Holz</strong>absatz auf der Basis fester Preise nach<br />
Preisanordnung (PAO) und Bilanzeinweisungen inklusive Transport vollzogen.<br />
Bilanzeinweisung hieß, dass Kunden, Sorte, Qualität, Menge und Preis von staatswegen<br />
festgelegt waren. In der Marktwirtschaft sind dies variable Größen, deshalb steht dem Begriff<br />
des <strong>Holz</strong>absatzes der Begriff der <strong>Holz</strong>vermarktung entgegen. Zur <strong>Holz</strong>vermarktung gehören<br />
neben den bereits angeführten Punkten die Analyse der Angebots- und Nachfrageseite, (also<br />
Marktforschung) sowie Absatzwerbung, <strong>Marketing</strong>, Produktgestaltung und die Kenntnis von<br />
<strong>Holz</strong>bilanzen (Bilanz = zahlenmäßiger Abgleich der innerhalb eines bestimmten Gebietes<br />
angebotenen und umgesetzten <strong>Holz</strong>mengen, lateinisch: Bilanz = doppelte Waagschale).<br />
Der aus dem Italienischen kommende kaufmännische Begriff Bilancia bezieht sich auf zwei im<br />
Gleichgewicht befindliche Waagschalen. Die <strong>Holz</strong>bilanz besitzt die Waagschalen<br />
Aufkommens- und Verwendungsseite (KROTH/BARTELHEIMER, S. 70).<br />
Dabei ist <strong>Holz</strong> auch in seinen Erscheinungsformen als Rohstoff, als Halbware und als<br />
Fertigware zu berücksichtigen (deshalb auch die Angabe in Rohholzäquivalenten).<br />
1.3 <strong>Holz</strong>markt und <strong>Holz</strong>marktstatistik<br />
Der <strong>Holz</strong>markt ist der ökonomische Ort für den Kauf und Verkauf des Wirtschaftsgutes <strong>Holz</strong>.<br />
Ein Markt bildet sich nur dann heraus, wenn mehrere Anbieter und Abnehmer vorhanden sind,<br />
die Waren anbieten und sich um die angebotene Ware bemühen. So bilden sich je nach <strong>Holz</strong>art<br />
und Sorte verschiedene Teilmärkte heraus, z. B. für Kiefer oder Eiche, für Stammholz oder<br />
Industrieholz, wuchsgebietsorientiert oder verbraucherorientiert.<br />
Der <strong>Holz</strong>markt weicht in einigen bedeutenden Merkmalen erheblich von der Modellvorstellung<br />
der freien bzw. sozialen Marktwirtschaft mit vollkommener Konkurrenz ab:<br />
1. die Festlegung von Mindestpreisen auf der Basis von entstehenden Kosten ist wegen<br />
der langen Produktionszeiträume erschwert<br />
2. die Mindestholzpreise orientieren sich nicht immer an den entstandenen<br />
Kosten<br />
3. im System des Einheits-Forstamtes fassen die Landesforstverwaltungen als<br />
Verkaufsführer große <strong>Holz</strong>mengen zusammen und sind daher Marktführer<br />
4. Saison- und Witterungseinflüsse beeinflussen in starkem Maße das <strong>Holz</strong>angebot<br />
mengenmäßig und zeitlich<br />
Statt nur von <strong>Holz</strong>verkauf zu sprechen, ist es wichtig, neben dem Verkauf auch die Bereiche<br />
Marktforschung, Losbildung, Service und Werbung mit einzubeziehen und den ganzen<br />
Komplex Rohholzmarketing zu nennen.<br />
Die Werbung für <strong>Holz</strong>verkäufe beschränkt sich derzeit auf das individuelle Anbieten des<br />
<strong>Holz</strong>es an bekannte Kunden. Ausgenommen davon sind überregionale Versteigerungstermine<br />
und Versuche, <strong>Holz</strong> über das Internet über verschiedene <strong>Holz</strong>börsen 1) in Form von Inseraten<br />
oder Katalogblättern von Versteigerungen anzubieten.<br />
Die Forstverwaltungen und die Verarbeitungsbetriebe der Furnier-, Sperrholz- und<br />
Sägeindustrie (letztere seit 01.01.1999) beteiligen sich an der Werbung für <strong>Holz</strong> und<br />
<strong>Holz</strong>produkte durch Beiträge zum <strong>Holz</strong>absatzfonds, derzeit 0,8 % der Erlöse von Umsatz bzw.<br />
Verkauf von Stammholz (Absatzfondsgesetz vom 13.12.1990 incl. Änderungen).<br />
Hauptsächlich wird mit diesen Mitteln die Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP)<br />
finanziert und fördert damit die Herausgabe des „<strong>Holz</strong>-Journal“ (wöchentlich) und der „ZMP-<br />
Marktbilanz Forst und <strong>Holz</strong>“ (jährlich).<br />
1) FROMMHOLD, H. (2007) www.rohholzmarkt.de: Rohholzversteigerung im Internet, AFZ/DerWald, S. 85<br />
- 2 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
Die wirtschaftliche Bedeutung der Forstwirtschaft ist gering. Das zeigt sich am absoluten<br />
Beitrag der Forstwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt der BRD. Er lag 1980 bei 0,2 %. Als<br />
relativer Wert änderte er sich ständig nach unten, da sich die Bezugsgröße bisher immer<br />
erhöhte.<br />
Prinzipien des <strong>Holz</strong>verkaufes :<br />
� Versorgungsprinzip<br />
Dieses Prinzip beruht auf der Fiktion, dass der Bezieher einer Ware einen Anspruch<br />
auf die Versorgung seines Bedarfes hat. Das Versorgungsprinzip setzt eine strenge<br />
Planwirtschaft mit Lieferauflagen voraus. In den Jahren 1933 bis 1948 gab es schon<br />
Ansätze solcher Wirtschaftspolitik. Markenzeichen dafür ist ein Bezugsschein.<br />
In den neuen Bundesländern ist diese Wirtschaftsweise bekannt, da sie lange geübte<br />
Praxis war.<br />
� Entsorgungsprinzip<br />
Grundlage dieses Verkaufes sind vermeintliche ökologische bzw. ideologische Grund-<br />
sätze unter Aufgabe des Prinzips der Gewinnoptimierung. Als Begründung werden<br />
häufig Forstschutzkriterien genannt. In Zukunft kann der Entsorgungsgedanke eine<br />
bedeutendere Rolle spielen, da im öffentlichen Wald die Tendenz besteht, Geldwert-<br />
schöpfungen vor ökologischen Wertschöpfungen zurücktreten zu lassen.<br />
� Gewinnprinzip (zumindest hohe geldwerte Deckungsbeiträge)<br />
Eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtete Forstwirtschaft wird<br />
weiterhin den <strong>Holz</strong>verkauf mit dem Ziel höchstmöglicher gesicherter Geldbeträge<br />
betreiben müssen. Dies ist insbesondere durch Kundenpflege zu erreichen.<br />
<strong>Holz</strong>marktstatistiken werden zu unterschiedlichen Zeiträumen und auf verschiedenen<br />
Verwaltungsebenen geführt. Unterschiedliche Zeiträume ergeben sich aus der Tatsache, dass in<br />
den meisten Bundesländern das Forstwirtschaftsjahr im Zeitraum vom 1. Oktober des laufenden<br />
Jahres bis zum 30. September des Folgejahres gilt. In Brandenburg gilt das Kalenderjahr als<br />
Abrechnungsbasis für <strong>Holz</strong>einschlag und Verkauf.<br />
Hinsichtlich unterschiedlicher Verwaltungsebenen werden <strong>Holz</strong>marktstatistiken auf<br />
Bundesebene vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
mit der statistischen Erfassung der Mengen des <strong>Holz</strong>einschlages und des <strong>Holz</strong>verkaufes nach<br />
<strong>Holz</strong>arten und <strong>Holz</strong>artengruppen benötigt. Die Daten müssen auf der Grundlage des<br />
<strong>Holz</strong>statistikgesetzes vom 30.04.1968 erhoben werden und münden letztlich im Statistischen<br />
Bundesamt Wiesbaden. Außerdem werden Statistiken auf Länderebene geführt.<br />
In Brandenburg werden für die Ämter für Forstwirtschaft über das Forstliche Informations- und<br />
Controlling System (FICoS) im Rahmen der Kosten-Leistungsrechnung Daten der<br />
<strong>Holz</strong>buchführung bereitgestellt.<br />
Außerdem werden Preisberichte ämterweise und landesweit monatlich und jährlich kumuliert<br />
zusammengefasst erstellt.<br />
1.4 Zertifizierungen<br />
Forest Stewardship Council, (FSC) ist ein Weltforstwirtschaftsrat mit Sitz in Mexiko, der 1993<br />
unter Beteiligung von Umweltorganisationen und Unternehmen der Forst- und <strong>Holz</strong>wirtschaft<br />
in Toronto gegründet wurde. Von hier ging die FSC-Zertifizierung aus. Nationale FSC-<br />
Arbeitsgruppen wurden akkreditiert.<br />
Die Zertifizierung von <strong>Holz</strong> spielt neben ehemals angestrebten ökologischen Zielen zunehmend<br />
eine Rolle als marktbeeinflussender Faktor. Diese Kampagne wurde von Kanada und<br />
Skandinavien ausgelöst. Dabei geht es nicht um ein Gütesiegel im Sinne einer<br />
Produktzertifizierung, sondern um eine Prozesszertifizierung im Sinne der<br />
Waldbewirtschaftung und besonders der <strong>Holz</strong>ernte unter Berücksichtigung von Ökologie und<br />
sozialen Belangen.<br />
- 3 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
Arten der Zertifikate:<br />
� Produktzertifikate gibt es z.B. für Lebensmittel<br />
� Prozesszertifikate gelten für den Entstehungsprozess, z. B. für <strong>Holz</strong><br />
� Erteilung eines Erkennungszeichens (auch Herkunftszeichen),<br />
z.B. Hoflieferanten der Monarchie (Bäckerei), Märkisches Kiefernholz<br />
Um kostenaufwendige und unüberschaubare Zertifizierungsprozesse zu vermeiden und weil in<br />
Deutschland seit 200 Jahren nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird, hat der Deutsche<br />
Forstwirtschaftsrat damals empfohlen, ein bereits vorhandenes Logo als<br />
Zertifizierungsmerkmal zu modifizieren und generell in Deutschland zu vergeben: aus „<strong>Holz</strong><br />
und Deine Welt hat wieder ein Gesicht“ wurde „<strong>Holz</strong> aus nachhaltiger Forstwirtschaft.<br />
Gewachsen in Deutschlands Wäldern“<br />
Auch in Österreich wollte man eine einzelbetriebliche Zertifizierung umgehen und hat deshalb<br />
ein allgemeingültiges Zeichen geprägt: „OK! <strong>Holz</strong> aus Österreich. Natürlich. Kontrolliert.“<br />
Längst ist der Deutsche Forstwirtschaftsrat davon abgekommen, einen Alleingang zu betreiben<br />
und hat mit viel Erfolg in kurzer Zeit in Deutschland auf großer Fläche die „Pan-Europäische<br />
Forstzertifizierung“ (PEFC) voran getrieben (jetzt: Programme for the Endorsement of Forest<br />
Certification Schemes).<br />
Die nach PEFC zertifizierte Waldfläche in Deutschland betrug per 04.04.2007<br />
etwa eine 7 Mio. ha<br />
Treibende Kräfte für eine Zertifizierung waren<br />
neben Umweltschutzorganisationen vor allem<br />
deutsche Papierhersteller und<br />
Zeitungsverleger. Auch verarbeitende<br />
Unternehmen und Baumärkte suchen verstärkt<br />
nach Möglichkeiten, die<br />
Umweltverträglichkeit ihrer Produkte im<br />
Hinblick auf den Entstehungsprozess ihrer<br />
eingesetzten Rohstoffe zu verdeutlichen, um<br />
ihre Marktchancen zu halten oder zu<br />
verbessern. Am Beispiel des ehemaligen<br />
Parkettwerkes Stavenhagen wird deutlich, wie<br />
schwierig es ist, das Endprodukt zu 100 % aus<br />
<strong>Holz</strong> eines einzigen Zertifizierungssystemes<br />
herzustellen. Aus diesem Grunde ist es<br />
inzwischen möglich, bis zu 30 % der Menge<br />
nicht oder anders zertifiziertes <strong>Holz</strong> dem<br />
Produkt beizumischen, ohne das Kennzeichen<br />
zu verletzen. Eine Lösung des Problems kann<br />
langfristig nur in einer Annäherung und<br />
letztlich in einer Zusammenführung der beiden<br />
großen Zertifizierungssysteme liegen.<br />
Abb. 1 PEFC zertifizierte Waldfläche<br />
Der ursprüngliche Grundsatz, <strong>Holz</strong> aus<br />
nachhaltiger Forstwirtschaft (diese Nachhaltigkeit ist nicht nur holzbezogen, sondern bezieht<br />
sich auch auf soziale und ökologische Aspekte) zu fördern, wurde damit marktbeeinflussenden<br />
Aspekten untergeordnet.<br />
- 4 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
1.5 <strong>Holz</strong>marktentwicklungen<br />
In den vergangenen Jahren konnte ein stabiler und sich ständig steigernder <strong>Holz</strong>verkauf<br />
abgewickelt werden. Stabilitätsfördernd waren die positiven Entwicklungen der<br />
marktbestimmenden <strong>Holz</strong>verarbeitungsbetriebe in den neuen und alten Bundesländern.<br />
Eine stabile Marktlage mit steigender Preistendenz hat auch im Privatwald zu einer deutlichen<br />
Belebung der Einschlags- und Vermarktungstätigkeit geführt. Die Auswirkungen der<br />
Sturmkatastrophe „Kyrill“ hatten mit Einschlagsbegrenzungen und Preisverfall bei Buche und<br />
Kiefer Auswirkungen bis Brandenburg.<br />
In den benachbarten Bundesländern sind mit den MDF-Werken Kronospan Lampertswalde und<br />
Varioboard Magdeburg leistungsfähige Kapazitäten entstanden, die auch in Brandenburg die<br />
Nachfrage steigen lassen. Neben den Plattenwerken der Firmen Hornitex (ehemals), jetzt<br />
Sonae Industria und Kronotex beleben insbesondere Kapazitätserweiterungen in den<br />
Großsägewerken den Markt:<br />
� die Klausner-Gruppe kommt mit ihren Werken in Saalburg-Ebersdorf (Klausner <strong>Holz</strong><br />
Thüringen), in Wismar (Klausner Nordic Timber), in Kodersdorf (Klausner <strong>Holz</strong><br />
Sachsen) und Adelebsen (ehemals Fa. Kühne GmbH) auf ca. 7 Mio. m³<br />
Rundholzeinschnitt und gehört damit weltweit zu den größten ihrer Branche<br />
� Klenk kommt mit seinen Werken in Oberrot, Gaildorf, Wolffegg, Vogelsheim<br />
(Frankreich) und Baruth auf ca. 2,8 Mio. m³ Rundholzeinschnitt (Baruth ist Europas<br />
größtes Kiefern-Sägewerk, 1,5 Mio. m³), Quelle: BraFoNa (2005), Ausgabe 16, S. 9<br />
� Pollmeier mit seinen Werken in Creutzburg und Malchow erweitert seine<br />
Laubholzkapazitäten mit neuen Standorten in Heimsheim und Aschaffenburg<br />
Weitere neue Verarbeitungskapazitäten sind im Zellstoffwerk Blankenstein und mit der<br />
Inbetriebnahme des Zellstoffwerkes Stendal im Jahre 2005 entstanden. Dieses Werk wird mit<br />
2,1 Mio. m 3 Waldholz und 0,9 Mio. m³ Restholz versorgt. Damit steigt die Nachfrage in den<br />
Bereichen Industrieholz und Sägeholz weiter an. Eine weitere Belebung erfuhr der <strong>Holz</strong>markt<br />
durch den Bau von neuen Pelletwerken und durch die enorme Steigerung der Produktion von<br />
<strong>Holz</strong>hackschnitzeln zur Energieerzeugung.<br />
Mit der Zunahme der Binnennachfrage verliert der Rohholzexport aus Brandenburg an<br />
Bedeutung. Dagegen steigen die Rohholzimporte der <strong>Holz</strong>industrie aus dem Ostseeraum.<br />
1.6 Forstwirtschaftliche und holzwirtschaftliche Zusammenschlüsse<br />
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse sind nach § 15 Bundeswaldgesetz anerkannte<br />
Forstbetriebsgemeinschaften (FBG), Forstbetriebsverbände und anerkannte forstwirtschaftliche<br />
Vereinigungen. Bundesweit sind 500000 Waldbesitzer in 4500 Zusammenschlüssen organisiert<br />
und bewirtschaften mehr als ein Drittel der deutschen Waldfläche.<br />
Eine forstwirtschaftliche Vereinigung wird aus dem Zusammenschluss von<br />
Forstbetriebsgemeinschaften gebildet und hat insbesondere den Vorteil der gemeinsamen<br />
Koordinierung der <strong>Holz</strong>bereitstellung. Die gemeinsame <strong>Holz</strong>vermarktung ist nach § 37<br />
Bundeswaldgesetz nicht zulässig. Hierzu müsste eine GmbH gebildet werden, welche die<br />
Marktposition der Privatwaldbesitzer gegenüber der <strong>Holz</strong>industrie entscheidend verbessern<br />
könnte (siehe LEBEN, N., AFZ/DerWald 3/2004, S.112-113).<br />
Namhafte Vertreter der Sägeindustrie sowie der Zellstoff- und Papierindustrie haben eine<br />
„Arbeitsgemeinschaft der <strong>Holz</strong>verbraucher e. V.“ gegründet. Zu den beteiligten Unternehmen<br />
gehören das Zellstoffwerk Stendal, das Sägewerk Heggenstaller und das Papierwerk UPM-<br />
Kymmene Papier. Im Mittelpunkt der künftigen Tätigkeit stehen Rohholzmobilisierung,<br />
Rohholzbereitstellung, Logistik und <strong>Holz</strong>transport.<br />
- 5 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>bilanzen und <strong>Holz</strong>markt<br />
1.7 Kartellrechtsbeschwerden<br />
Eine Kartellrechtsbeschwerde vom Verband Deutscher Sägewerke (VDS) wurde vom<br />
Bundeskartellamt angenommen gegen einige Landesforstverwaltungen bezüglich von<br />
Rahmenkaufverträgen über unterschiedliche Eigentumsverhältnisse hinweg. Das<br />
Bundeskartellamt hat inzwischen festgestellt, dass besitzartenübergreifende Rahmenverträge<br />
den Wettbewerb beschränken und demzufolge nicht mit dem Kartellrecht in Einklang stehen.<br />
Forstbetriebsgemeinschaften sind jedoch nach Bundeswaldgesetz berechtigt, selbst den<br />
<strong>Holz</strong>verkauf zu übernehmen und sind von kartellrechtlichen Beschränkungen befreit. Die<br />
Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen sind<br />
zunächst Gegenstand der Kartellrechtsbeschwerde des VDS beim Bundeskartellamt. Die hier<br />
mit den Länderforstchefs ausgehandelten Grenzen werden später auf alle Bundesländer<br />
übertragen. Mit Stand vom 6.12.2006 soll als Grenzwert zur gemeinsamen Vermarktung von<br />
<strong>Holz</strong> aus dem Staats- und Privatwald bei einer Privatwaldfläche von kleiner 3000 ha festgelegt<br />
werden. Ausnahmen sind im Einzelfall möglich. <strong>Holz</strong> dürfen Forstbetriebe generell nicht<br />
gemeinsam vermarkten, wenn ihre Waldflächen jeweils größer als 12000 ha sind (gilt für<br />
Staatswald wie für Privatwald).<br />
Außerdem liegt eine Kartellrechtsbeschwerde vom Verband der freiberuflichen<br />
Forstsachverständigen bei der Generaldirektion Wettbewerb in Brüssel bezüglich der<br />
marktgerechten Entgeltesätze vor. Es geht dabei um die Höhe der Entgeltesätze, welche die<br />
Landesforstverwaltungen den privaten Waldbesitzern für Beratung und Betreuung in Rechnung<br />
stellen. Diese Beschwerde wurde an das Bundeskartellamt verwiesen.<br />
Außerdem ist eine Kartellrechtsbeschwerde in Arbeit, bei der es um die marktbeherrschende<br />
Stellung des Staatswaldes geht. Man ist der Meinung, dass der hohe Staatswaldanteil in<br />
Deutschland zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. Ob dieser Vorgang von einer<br />
Kartellrechtsbehörde angenommen wird, ist fraglich (siehe SEELING, U. AFZ/DerWald,<br />
3/2004, S. 124).<br />
1.8 Forstschädenausgleichsgesetz<br />
Das Forstschädenausgleichsgesetz (FSchädG, BGBl. I, S. 1756) „Gesetz zum Ausgleich von<br />
Auswirkungen besonderer Schadensereignisse in der Forstwirtschaft“ vom 26.08.1985 sieht<br />
folgende Maßnahmen vor, wenn erhebliche und überregionale Störungen des Rohholzmarktes<br />
auf der Basis von Naturereignissen auftreten:<br />
� Beschränkung des ordentlichen <strong>Holz</strong>einschlages auf höchstens 70 % des<br />
Nutzungssatzes, wenn die Kalamitätsnutzung bestimmte Prozentsätze überschreitet<br />
� Beschränkung der <strong>Holz</strong>einfuhr<br />
� Bildung von steuerfreien Rücklagen<br />
� steuerlichen Vergünstigungen<br />
Unabhängig vom Forstschädenausgleichsgesetz können bei o.g. Störungen die<br />
Nutzlastbegrenzungen bei <strong>Holz</strong>transportfahrzeugen geändert und die Sonn- und<br />
Feiertagsbeschränkungen vorübergehend aufgehoben werden.<br />
- 6 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>aufbereitung und Rundholz-Handel<br />
2. <strong>Holz</strong>aufbereitung, Rundholz-Handel und <strong>Holz</strong>transport<br />
2.1 <strong>Holz</strong>aufbereitung<br />
2.1.1 Losbildung<br />
Zu einem Los werden <strong>Holz</strong>mengen zusammengefasst, welche bei Angebot, Verkauf,<br />
Rechnungslegung und Bezahlung eine Einheit bilden sollen. Dabei ist auf folgende Merkmale<br />
zu achten:<br />
� Stammhölzer einer <strong>Holz</strong>art<br />
� Nahe beieinander liegende <strong>Holz</strong>qualitäten (bei Werthölzern auch nur eine Güte)<br />
� Homogenität in der Länge (wegen des Transportes und mit Rücksicht auf die jeweiligen<br />
Verarbeitungslängen des Verbrauchers)<br />
� Homogenität im Durchmesser bzw. in der Stärkeklassenverteilung<br />
Einzelstammweiser Verkauf (Einzellos) ist im Gegensatz zur Losbildung zu empfehlen, wenn<br />
aus dem sonstigen Angebot herausragende Merkmale auftreten wie:<br />
� bessere Qualität (Jahrringaufbau, Ast- und Beulenfreiheit bei Kiefer oder weiße<br />
Stirnflächen bei Buche)<br />
� besondere Länge<br />
� erheblich größerer Durchmesser<br />
� gute Kombination aus Qualität, Durchmesser und Länge<br />
Diese Situation ist in der Regel nur bei Meistgebotsterminen gegeben, sollte aber dort<br />
unbedingt genutzt werden.<br />
Als Folge der forstlichen Koppelproduktion fallen zwangsläufig Sorten für mehrere Verwender<br />
an, z.B. Sägeholz für bessere und schlechtere Verwendung, Industrieholz und Brennholz. Die<br />
Losbildung ist damit ein wichtiges Instrument des <strong>Marketing</strong>s, d.h. der Produktgestaltung.<br />
Die Losgröße als Angebotsmenge je Verkaufseinheit ist kundenfreundlich zu gestalten,<br />
möglichst als Transporteinheiten oder Vielfaches davon. Sehr kleine Lose sind nur zu bilden,<br />
wenn tatsächlich nicht mehr zusammengehörige Exemplare vorhanden sind.<br />
2.1.2 Lospräsentation<br />
Die Darbietung der Hölzer ist neben der Losbildung ein wichtiges Mittel der Verkaufswerbung.<br />
Dazu gehören:<br />
� stammnahe Entastung<br />
� rechtwinklige Hirnschnitte an Zopf und Stammfuß<br />
� stammfußgleiche Polterung<br />
� Abtrennen von Waldbärten und Stockausrissen<br />
� Abtrennen von störenden Wurzelanläufen<br />
gut lesbare Nummerierung (<strong>Holz</strong>-Nr., Güte, Durchmesser und Länge am richtigen Ort, in der<br />
richtigen Ziffernkombination und mit eindeutigen Ziffern und Zeichen; Vor- und Nachteile der<br />
Verwendung von Plaste-, Metall- und <strong>Holz</strong>marken beachten)<br />
Polterung an geeigneten Polterplätzen (keine Nass-Stellen, gute Zufahrt, Freischneiden der<br />
Fahrzeugprofile, Kranfreiheit für den LKW)<br />
Polterung bei längerer Lagerung, wie bei Meistgebotsterminen auf Unterlagen oder auf<br />
betonierten bzw. gepflasterten Flächen, z.B. auf <strong>Holz</strong>höfen, nicht an stehende Bäume poltern<br />
Vermeidung von Verschmutzungen der Stirnflächen beim Rückeprozeß oder<br />
Neunummerierung (Abtrennen einer Stammscheibe)<br />
kein Präsentieren von unerlaubten Fehlern auf den Hirnschnitten (z.B. Anschneiden von<br />
Faulästen, Spinne, Rückeschäden), wenn der ganze Stamm besser ist<br />
- 7 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>aufbereitung und Rundholz-Handel<br />
Anbringen von S-Haken bei besserem Buchen-Stammholz, kein Einschlagen von Stahlteilen in<br />
Eichenstammholz<br />
Zugaben bzw. Vergütungen auf ein Mindestmaß beschränken<br />
2.2 Rundholz-Handel<br />
Der <strong>Holz</strong>handel ist zwar kein unmittelbarer <strong>Holz</strong>verbraucher, spielt aber als Mittler zwischen<br />
Erzeuger und Verbraucher eine wichtige Rolle und kann durch Lenkung der Warenströme das<br />
<strong>Holz</strong>marktgeschehen wesentlich beeinflussen.<br />
Der Bedarf der <strong>Holz</strong>verbraucher wird zu einem großen Teil unmittelbar beim Waldbesitz<br />
gedeckt, das trifft insbesondere auf Sägeholz zu.<br />
Der <strong>Holz</strong>handel ist in der amtlichen Statistik weder funktional noch institutionell abgegrenzt.<br />
Er hat aber eine Bedeutung mit Sammel-, Sortier und Verteilfunktion.<br />
Sammeln heißt, die über weite Gebiete verstreut anfallende Ware <strong>Holz</strong> einzukaufen, zu<br />
transportieren und gelegentlich auch zu lagern.<br />
Sortieren heißt, dass wegen geringen Anfalls en bloc gekaufte Ware nachträglich beim Käufer<br />
sortiert wird.<br />
Verteilen heißt nicht nur, mit Gewinn an verschiedene Verbraucher weiter zu veräußern,<br />
sondern auch gewisse Zeitausgleichsfunktionen zu erfüllen zwischen der jahreszeitlichen<br />
Schwankung der <strong>Holz</strong>ernte und den saisonbedingten Bedarfswünschen der <strong>Holz</strong>verbraucher.<br />
Eine besondere Bedeutung hat der Handel beim <strong>Holz</strong>export und -import.<br />
Vorteile sind:<br />
� keine Währungsumstellung<br />
� weniger Probleme bei Reklamationen<br />
� Transportlogistik liegt beim Händler (wichtig bei Bahnversand)<br />
� MwSt kann wie im Inland erhoben werden<br />
Aber auch im Inland werden die Leistungen der Händler wegen der oben genannten Vorteile in<br />
Anspruch genommen, obwohl sie zusätzlich Geld kosten. Außerdem muss dadurch der<br />
<strong>Holz</strong>abgabepreis nicht automatisch höher liegen. Der Händler erwirkt mitunter beim<br />
<strong>Holz</strong>verbraucher einen höheren Einkaufspreis. Außerdem findet auch <strong>Holz</strong>import statt, der<br />
ebenfalls von Händlern durchgeführt wird.<br />
Tropenstammholzimporte<br />
2.3 <strong>Holz</strong>transport<br />
Der <strong>Holz</strong>transport, insbesondere per LKW, gehörte in den neuen Bundesländern zu den<br />
Aufgaben der Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe (StFB). Jetzt wird überwiegend "frei<br />
Waldweg gerückt" verkauft.<br />
Warum wird trotzdem der <strong>Holz</strong>transport hier so ausführlich behandelt, obwohl er nicht zu den<br />
Aufgaben der Forstverwaltungen gehört? Weil für den <strong>Holz</strong>verbraucher der Einstandspreis,<br />
also <strong>Holz</strong>preis plus Transportkosten ausschlaggebend ist. Er wird versuchen, höhere<br />
Transportkosten mit niedrigeren <strong>Holz</strong>preisen zu kompensieren. Deshalb ist die Kenntnis der<br />
nachfolgenden Fakten und Zusammenhänge wichtig.<br />
Außerdem sind ständig Bemühungen der <strong>Holz</strong>verbraucher zu „frei-Werk-Lieferungen“ im<br />
Gange. Das setzt Kenntnisse über den <strong>Holz</strong>transport voraus. Bei diesen Bemühungen gab es<br />
Probleme mit der MwSt, weil die Landesforstverwaltungen pauschal mit 5 % auf Rohholz<br />
versteuert waren, der Transport aber höher versteuert war. Inzwischen haben sich viele<br />
Landesforstbetriebe wie auch die Landesforstverwaltung Brandenburg für die<br />
Regelbesteuerung entschieden, mit einem Steuersatz von 19 % seit dem 1.1.2007.<br />
<strong>Holz</strong> ist eine meist schwere und sperrige und im Verhältnis zu seinem Gewicht bzw.<br />
Rauminhalt geringwertige Ware. Wegen dieser Geringwertigkeit verbieten sich aus<br />
betriebswirtschaftlichen Gründen aufwendige aber technisch machbare Transporte.<br />
- 8 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>transport<br />
<strong>Holz</strong> ist in der BRD mit ca. 5 % an der Gesamttransportmenge beteiligt. Mögliche<br />
Transportarten sind Bahn, Wasser, Straße und Rohrleitungen.<br />
2.3.1 <strong>Holz</strong>transport auf dem Wasser<br />
- Flößerei<br />
Der billigste und technisch am leichtesten durchzuführende Transport ist die Flößerei.<br />
Die Flößerei diente dabei nicht nur der <strong>Holz</strong>verfrachtung, sondern auch dem<br />
zusätzlichen Warentransport auf den Flößen. Außerdem kann in der Flößerei auch eine<br />
Art der Wasserlagerung gesehen werden.<br />
- Trift<br />
Eine weitere Methode der Wasserverfrachtung ist die Trift, sie ist verbunden mit<br />
aufwendigen technischen Vorbereitungen (z.B. Triftkanälen).<br />
- Binnenschifffahrt<br />
Das Binnenwasserstraßennetz der BRD umfasst 4365 km mit 84 öffentlichen<br />
Binnenhäfen. Meist findet doppelt gebrochener Verkehr statt, trotzdem ist diese<br />
Transportart konkurrenzfähig. Entscheidend für den Rückgang des <strong>Holz</strong>transportes auf<br />
dem Binnenschiff sind die kurzen Lieferfristen (hängt alles mit der Verringerung der<br />
Lagerhaltung zusammen) und das Fehlen eines genormtes Wasserstraßennetzes<br />
(Engpässe für größere Schiffe an manchen Stellen).<br />
- Seetransport<br />
Im internationalen <strong>Holz</strong>transport spielt der Schiffsversand eine dominierende Rolle,<br />
meistens gibt es dafür keine konkurrenzfähige Alternative. Die Frachtbelastung von<br />
<strong>Holz</strong> aus dem nordeuropäischen Raum bis zu den Verbrauchern im Ruhrgebiet ist z.B.<br />
nicht viel höher als die Kostenbelastung aus Süddeutschland stammender Produkte bis<br />
zum Ruhrgebiet.<br />
2.3.2 <strong>Holz</strong>transport mit der Bahn<br />
Das Eisenbahnnetz wurde seit 1835 bis zur Privatisierung ständig ausgebaut und damit der<br />
Schiffstransport zunächst ergänzt, später wurde dazu in Konkurrenz getreten.<br />
Das Streckennetz der Bahn kam auf etwa 30 Tkm mit über 3000 Bahnhöfen, bevor ein Abbau<br />
erfolgte.<br />
Vorteile der Eisenbahn: schnelle und witterungsunabhängige Beförderung, die Tendenz ist<br />
allerdings rückläufig, unter anderem wegen hoher Transportkosten.<br />
2.3.3 <strong>Holz</strong>transport auf der Straße<br />
Das Straßennetz im überörtlichen Verkehr umfasst 174 Tkm in der BRD. Mit der raschen<br />
Zunahme der Leistungsfähigkeit der Kraftfahrzeuge übernahm der Straßenverkehr den ersten<br />
Rang unter den Verkehrsträgern.<br />
Die Bedeutung von Pferdefuhrwerken auf der Straße ist inzwischen völlig zurückgegangen.<br />
Vorteile: schneller und direkter Transport (kein gebrochener Verkehr) vom Produzenten zum<br />
Verbraucher, erfordert aber ein gut ausgebautes Wegenetz im Wald (bis zu 40 t Tragfähigkeit<br />
und ständiges Freischneiden des <strong>Prof</strong>ils in Höhe und Breite)<br />
Die Verteuerung der Eisenbahnfrachten und die Erschwerung durch den oft zweimaligen<br />
Umschlag haben bei der Bahn dazu geführt, dass neben dem Rundholz- auch die<br />
Schnittholzverfrachtung auf den LKW übergegangen ist.<br />
Es gibt zahlreiche Gesetze zum Binnenverkehr und im einzelnen zur Binnenschifffahrt, zu den<br />
Eisenbahnen, zum Straßenverkehr und zu den Verkehrssteuern, die hier nicht alle aufgeführt<br />
werden sollen. Das wichtigste war das Güterkraftverkehrsgesetz in der Fassung vom 10.3.1983<br />
(siehe S. 114). Eine bewusste Steuerung der Güterverfrachtung wird mit diesem Gesetz<br />
angestrebt. Es regelt den Marktzutritt und legt die Beförderungsbedingungen fest.<br />
- 9 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>transport<br />
Die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), die Straßenverkehrsordnung (StVO) und das<br />
Güterkraftverkehrsgesetz enthalten u. a. Beschränkungen über Gewicht und Abmessungen von<br />
LKW und Anhängern, z. B. <strong>Holz</strong>transporter incl.<br />
Ladung:<br />
� Länge 24 m, mit Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO über die untere<br />
Verkehrsbehörde mit Längen bis 30 m und Gewicht bis 46 t (bei Sturmschaden), dabei<br />
ist ein Eigengewicht des Fahrzeuges von ca. 15 t zu beachten.<br />
� Gesamtgewicht 38 t für Sattelfahrzeuge und Lastzüge<br />
Im gewerblichen Güterfernverkehr wurde zwischen Güterfernverkehr, Güternahverkehr und<br />
Werkverkehr unterschieden.<br />
Der Güternahverkehr betraf ein Gebiet mit dem Radius von 50 km Luftlinie vom<br />
Ortsmittelpunkt des tatsächlichen oder fiktiven Standortes der Kraftfahrzeuge. Werkverkehr<br />
war jede Beförderung von Gütern für eigene Zwecke der Firma, daran waren zahlreiche<br />
Voraussetzungen geknüpft. Diese Unterscheidungen spielen keine Rolle mehr. Es gibt nur noch<br />
eine Lizenz zur Beförderung. Die Transportentfernungen werden nicht eingegrenzt.<br />
Auch die Frachtpreise werden für den LKW-Transport frei ausgehandelt.<br />
Frachttarife :<br />
Auf der Schiene richten sich die Frachttarife nach dem Eisenbahngüterfrachttarif (DEGT), der<br />
u.a. eine nichtlineare Staffelung des Preises in €/t nach Entfernung und Waggonauslastung<br />
vorsieht.<br />
Auf der Straße fand der Güterfernverkehrstarif (GFT) nach ähnlichen Gesichtspunkten<br />
Anwendung wie der DEGT. Das war ein Tarif für Güterfernverkehr nach Tonnage und<br />
Kilometern, gleichgültig wie viel geladen wurde.<br />
Ebenso gab es einen Güternahverkehrstarif GNT. Beides wurde außer Kraft gesetzt. Die Preise<br />
sind jetzt frei verhandelbar.<br />
Für Binnenschifffahrt und Seefrachtverkehr gibt es Beförderungsverträge, die im<br />
Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt sind. Rechtsverhältnisse zwischen Verlader, Verfrachter<br />
und Empfänger werden im Konnossement festgelegt.<br />
Gefahrentragung und Kostenverteilung werden entweder in Verträgen geregelt oder nach<br />
Handelsbrauch gemäß Incoterms (International Commercial Terms) gehandhabt.<br />
Dabei gibt es folgende Formulierungen:<br />
fas (free alongside ship) = Ware wird frei Längsseite des Schiffes geliefert<br />
fob (free on board) = Ware wird frei an Bord geliefert<br />
cif (cost, insurance, freight) = der Verkäufer trägt alle Kosten, Versicherung und<br />
Fracht<br />
Transportkostenvergleich:<br />
Beim Transportkostenvergleich zwischen Schiff, Schiene und Straße muss neben den<br />
Frachttarifen auch beachtet werden, ob es sich um Direktverkehr, doppelt oder einfach<br />
gebrochenen Verkehr handelt. Da es sich bei LKW-Verkehr fast ausschließlich um<br />
Direktverkehr handelt, müssen auch die Kosten für den gebrochenen Verkehr beim<br />
Kostenvergleich zwischen Schiff und Schiene berücksichtigt werden. Beim LKW-Transport<br />
werden dann auch mittlere Entfernungen günstiger als Bahntransporte.<br />
2.4 Elektronische Hilfen der <strong>Holz</strong>logistik<br />
Der <strong>Holz</strong>marktausschuss des deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR) hat am 11. Dezember<br />
2007 eine Arbeitsgruppe beauftragt, nach alternativen Lösungsansätzen für einen bundeseinheitlichen<br />
navigationsfähigen Datensatz zu suchen.<br />
Folgende Ansatzpunkte wurden diskutiert:<br />
- 10 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>logistik<br />
� eine digitale Datenerfassung anstatt, analoger Datenerfassung<br />
� Übertragung der Dienstleistungen, die über die Erstellung und Pflege der konsolidierten<br />
Datensätze hinausgehen an kommerzielle Anbieter<br />
� einen Länderbeitrag zu prüfen<br />
� Vorabverkauf von Lizenzen<br />
Das Projekt der Fa. NavLog soll weiterhin aufrechterhalten werden, eventuell ohne Beteiligung<br />
der <strong>Holz</strong>branche. Die Lösungsvorschläge dazu werden in der Forstchefkonferenz der<br />
Bundesländer beraten werden.<br />
Eine Bundesförderung des NavLog-Projekts kann nicht erfolgen, weil mit dem Projekt bereits<br />
begonnen wurde und die Vereinbarungen zwischen Forst- und <strong>Holz</strong>seite durch eine Förderung<br />
zu Verwerfungen führen könnten. Logistikbetreiber befürchten einen Markteingriff durch den<br />
Bund.<br />
Neben dem NavLog-Projekt existieren andere Anbieter wie z.B. LogiBall. Im Rahmen der<br />
Sturmholzbeseitigung in NRW hat die Fa. Logiball in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb<br />
Wald und <strong>Holz</strong> eine Navigationskarte mit detailliertem Waldwegenetz geschaffen. Basis für<br />
diese Lösung ist die „Navigationskarte Deutschland Plus“ der Fa. Logiball. Grundlage dafür ist<br />
die Navigationskarte der Fa. Navteq für öffentliche Straßen.<br />
3. Gesetzliche Grundlagen des <strong>Holz</strong>verkaufs und Verkaufsarten<br />
3.1 Gesetzliche und landesrechtliche Grundlagen<br />
<strong>Holz</strong>verkäufe sind Rechtsgeschäfte zwischen Privatpersonen und unterliegen damit den<br />
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Es besteht somit Vertragsfreiheit<br />
zwischen den Parteien. Für den Landeswald wurden zur Sicherheit „Allgemeine <strong>Holz</strong>verkaufsund<br />
Zahlungsbedingungen“ (AVZB) herausgegeben. Sie sind in den Staatsforstverwaltungen<br />
verpflichtend. Private und kommunale Waldbesitzer können sie übernehmen. Diese AVZB sind<br />
länderspezifisch wie die HKS, haben unterschiedliche Bezeichnungen und Abkürzungen, z.B.<br />
HZB für Mecklenburg und haben ihre Basis im AGB-Gesetz (Allgemeine<br />
Geschäftsbedingungen). Für den Landeswald von Brandenburg von Brandenburg ist<br />
inzwischen die 3. Fassung der AVZB vom 01.08.2000 gültig 1) . Prozentsätze für Verzug,<br />
Stundung und Skonto sind dabei bundesweit festgelegt. Landesunterschiedlich wird z.B.<br />
festgelegt, ob Skonto gezahlt wird oder nicht und welche Zahlungsfristen dafür eingeräumt<br />
werden.<br />
Weiterhin wird landesrechtlich bestimmt, wer Rahmenkaufverträge und <strong>Holz</strong>kaufverträge<br />
abschließen darf, ab welcher Werthöhe mündliche oder schriftliche Verträge abgeschlossen<br />
werden und wer dazu berechtigt ist. In Brandenburg dürfen mündliche Kaufverträge bis zu<br />
einem Warenwert von 500.- €, eingeschränkt für bestimmte Sorten, abgeschlossen werden.<br />
Darüber hinausgehende Kaufverträge schließt das jeweilige Amt für Forstwirtschaft ab.<br />
Rahmenvereinbarungen (Rahmenkaufverträge) werden vom Ministerium abgeschlossen.<br />
Der <strong>Holz</strong>markt ist der ökonomische Ort für den Kauf und Verkauf des Wirtschaftsgutes <strong>Holz</strong>.<br />
Ein Markt bildet sich nur dann heraus, wenn mehrere Abnehmer vorhanden sind, die sich um<br />
die angebotene Ware bemühen. So bilden sich je nach <strong>Holz</strong>art und Sorte verschiedene<br />
Teilmärkte heraus, z.B. für Kiefer oder Eiche, für Stammholz oder Industrieholz,<br />
wuchsgebietsorientiert oder verbraucherorientiert.<br />
1)<br />
FROMMHOLD, H.; MÖSER, C. (2002) Verkaufs- und Zahlungsbedingungen der Bundesländer für<br />
<strong>Holz</strong>verkäufe“ AFZ/DerWald, 8, 422-424<br />
- 11 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
Der <strong>Holz</strong>markt weicht in einigen bedeutenden Merkmalen erheblich von der Modellvorstellung<br />
der freien bzw. sozialen Marktwirtschaft mit vollkommener Konkurrenz ab:<br />
� die Festlegung von Mindestpreisen auf der Basis von entstehenden Kosten ist wegen der<br />
langen Produktionszeiträume erschwert<br />
� im Landeswald sind Mindestpreise nicht immer an den entstehenden Kosten orientiert<br />
� im System des Einheits-Forstamtes fassen die Landesforstverwaltungen als<br />
Verkaufsführer große <strong>Holz</strong>mengen zusammen und sind daher Marktführer<br />
� Saison- und Witterungseinflüsse beeinflussen in starkem Maße das <strong>Holz</strong>angebot<br />
mengenmäßig und zeitlich<br />
� wenige große Industrieholzabnehmer haben die Möglichkeit, dem Waldbesitzer Preise<br />
und Mengen zu diktieren<br />
� die Einfuhr von Rundholz, Schnittholz, Halbfertig- und Fertigprodukten aus <strong>Holz</strong> führt<br />
zu starken Schwankungen auf der Importseite<br />
Statt nur von <strong>Holz</strong>verkauf zu sprechen, ist es wichtig, neben dem Verkauf auch die Bereiche<br />
Marktforschung, Service, Werbung, Losbildung und Lospräsentation in die <strong>Holz</strong>vermarktung<br />
einzubeziehen.<br />
Verkaufsarten (nach KROTH/BARTELHEIMER S. 158 ff) richten sich nach dem Zeitpunkt<br />
des Vertragsabschlusses (vor oder nach der Fällung)<br />
� Vorverkauf auf dem Stock (Vertrag vor der Fällung)<br />
� Vorverkauf aufbereiteter Sorten (Vertrag vor der Fällung)<br />
� Nachverkauf (Vertrag nach der Fällung)<br />
Verkaufsverfahren richten sich nach dem Verfahren der Preisbestimmung (ob frei, verdeckt<br />
oder offen bei bestimmten Bieterkreis)<br />
� Freihandverkauf<br />
� Submission<br />
� Versteigerung<br />
3.2 Verkaufsarten und Verkaufsverfahren<br />
Verkaufsarten (nach KROTH/BARTELHEIMER S. 158 ff) richten sich nach dem Zeitpunkt<br />
des Vertragsabschlusses (vor oder nach der Fällung)<br />
� Vorverkauf auf dem Stock (Vertrag vor der Fällung)<br />
� Vorverkauf aufbereiteter Sorten (Vertrag vor der Fällung)<br />
� Nachverkauf (Vertrag nach der Fällung)<br />
Verkaufsverfahren richten sich nach dem Verfahren der Preisbestimmung (ob frei, verdeckt<br />
oder offen bei bestimmten Bieterkreis)<br />
� Freihandverkauf<br />
� Submission<br />
� Versteigerung<br />
3.2.1 Versteigerung und Taxwerte<br />
Die offene Versteigerung (kurz: Versteigerung) steht im Gegensatz zur verdeckten<br />
Versteigerung, welche als Submission bezeichnet wird und mit geheimen Geboten in<br />
verschlossenen Umschlägen stattfindet. Bei der offenen Versteigerung werden die Gebote<br />
(Bieterpreise) durch lautes Ausrufen oder Zeichengebung des Bieters zur Bestätigung des<br />
Angebotes des Verkaufsleiters akzeptiert. Öffentlich sind sowohl Versteigerung als auch<br />
Submission.<br />
- 12 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
Die Versteigerungsstufen sind unterschiedlich von 2.- € bis 50.- € oder mehr je nach absoluter<br />
Höhe des Preisniveaus. Dabei gibt es Versteigerungen mit Aufstrich und mit Abstrich. Mit<br />
Aufstrich wird versteigert, wenn im Preis von unten nach oben gesteigert wird. Bei der<br />
Versteigerung mit Abstrich nennt der Verkaufsleiter einen hohen Preis und senkt ihn so lange<br />
bis jemand einwilligt. Diese Methode läuft sehr schnell ab, ist aber bei <strong>Holz</strong>versteigerungen<br />
nicht üblich. Sie wird bei morgendlichen Blumen-, Gemüse- und Fischmärkten angewandt.<br />
Weiterhin werden Versteigerungen mit beschränktem und unbeschränktem Bieterkreis<br />
unterschieden. Wegen der geringen <strong>Holz</strong>nachfrage wurde der Käuferkreis in letzter Zeit nicht<br />
eingeschränkt.<br />
Vorteile:<br />
� eine individuelle Bevorzugung ist ausgeschlossen<br />
� große Mengen können schnell ihre Abnehmer finden<br />
� die Preisbildung erfolgt durch den Nachfrager und ist wegen des Wettbewerbes in der<br />
Regel hoch<br />
Nachteile:<br />
� wenn durch Absprachen (Ringbildung) die Konkurrenz ausgeschlossen wird oder zu<br />
wenige Interessenten mit bieten, funktioniert die erwähnte hohe Preisbildung nicht mehr<br />
� Meistgebotstermine sind mit hohem Organisationsaufwand verbunden (Zeit, Kosten)<br />
Organisation:<br />
� Einschlag<br />
� Veröffentlichung in der Fachpresse<br />
� Transport zum Lagerplatz<br />
� Katalogblätter ausfüllen<br />
� Eingabe in Computer<br />
� Ausdruck<br />
� Binden<br />
� Auslieferung der Kataloge (auch unter www.mluv.brandenburg.de weiter mit - Forst, -<br />
<strong>Holz</strong>auktionen oder www.wald-online.de<br />
• weiter mit - Wertholz Angebote, - Brandenburg,<br />
• 18. Laubholzsubmission bzw. 16. Kiefernwertholzversteigerung<br />
• (vom 15.01.2008)<br />
� Besichtigung durch den Käufer<br />
� Festlegung des Taxpreises<br />
� Versteigerungs- bzw. Submissionsveranstaltung<br />
Die Ankündigung der Verkaufsabsichten erfolgt in überregionalen Fachzeitungen,<br />
durch Anschreiben und Zusenden von Versteigerungskatalogen für bekannte Kunden.<br />
Versteigerungskataloge sind platzweise gegliedert und enthalten folgende Angaben:<br />
� allgemeine Bedingungen für die Versteigerungen<br />
� Versteigerungsbedingungen<br />
� tabellarische Auflistung des Gesamtgebotes<br />
� Losangaben mit Mengenangaben, Stärkeklassen, Güteklassen, Los-Nummern,<br />
Stärkemesszahlen, Herkunftsort und <strong>Holz</strong>-Nummern<br />
� Einzelstammauflistungen mit <strong>Holz</strong>nummer, Durchmesser, Länge und Güte<br />
Erklärung der Stärkemesszahlen:<br />
Stärkemesszahl 100 bedeutet, dass dieses Los Nr. 117 im Jahre 1952<br />
67,05 DM/m 3 gekostet hätte und zwar in der Güte B Stärkeklasse 3b 55 DM<br />
in der Stärkeklasse 4 65 DM<br />
in der Stärkeklasse 5 75 DM<br />
gewichtet mit der Menge, sonst 65 DM.<br />
- 13 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
Bei 130 MZE (früher MZP) für Güteklasse B ergibt sich daraus rechnerisch ein Taxpreis von<br />
87,17 €/m 3 , gerundet auf 80.- €/m³. Das Mindestgebot wird bei 80 % des Taxpreises angesetzt,<br />
am Beispiel 64.- €/m³. Verkauft wurde das Los für 83.- €/m³.<br />
Hinzu kommen 5,5 % MWSt (bei Pauschalversteuerung gemäß § 24 Abs.1 UStG) bzw. 19 %<br />
MWSt (bei Regelbesteuerung gemäß § 12 UStG) auf <strong>Holz</strong>, 0,8 % <strong>Holz</strong>absatzfonds (0,5 % + 0,3<br />
%) und 10 €/m³ Anfuhrpauschale plus 10,7 % bzw. 19 % MWSt auf sonstige Leistungen für<br />
Dritte (siehe 5.4.4. Umsatz-Besteuerung).<br />
Wie werden die Taxwerte ermittelt? Stärkemesszahlen mal Messzahlprozent für die jeweilige<br />
<strong>Holz</strong>güte aus Erfahrungswerten des Vorjahres und aus der Marktbeobachtung des abgelaufenen<br />
Jahres ergeben die Taxwerte. Es wir davon ausgegangen, dass jeder Bieter vor dem<br />
Versteigerungsprozess die zu bebietenden Hölzer besichtigt hat.<br />
3.2.2 Submission<br />
Die Submission ist eine verdeckte Versteigerung mit geheimer Gebotsabgabe. Der Aufbau der<br />
Submissionskataloge ähnelt dem der Versteigerungskataloge. Submissionskataloge enthalten<br />
zusätzlich vorgedruckte Gebotslisten, in welche der Bieter sein Gebot in Ziffern und<br />
Buchstaben sowie seine Anschrift mit Unterschrift eintragen muss und abschicken kann (bis<br />
zum Zeitpunkt der öffentlichen Öffnung der Gebote müssen die Gebote beim Verkaufsleiter<br />
vorliegen, am besten in 2 Umschlägen).<br />
Zum Submissionstermin werden die geschlossenen Umschläge geöffnet und die Gebote<br />
öffentlich bekannt gegeben. Derjenige, welcher das höchste Gebot abgibt, erhält auch hier den<br />
Zuschlag. Bei Geboten gleicher Höhe entscheidet das Los oder es zieht jemand sein Gebot<br />
zurück. Der Bieter muß zum Termin nicht vertreten sein, das Ergebnis wird ihm dann<br />
schriftlich mitgeteilt.<br />
Dieses Verkaufsverfahren ist beim Kunden wenig beliebt, da die Markttransparenz nicht<br />
gegeben ist. Der Kunde kann während der Veranstaltung keinen Einfluss mehr auf Preis und<br />
Kaufmenge nehmen. Letzteres ist z.B. wichtig für die Zusammenstellung von<br />
Transportmengen. Es kann auch vorkommen, dass ein Bieter trotz mehrfacher Gebote nicht<br />
zum Zuge kommt oder auch mehr <strong>Holz</strong> erhält als benötigt wird. Möglicherweise muß er dann<br />
unter dem Einkaufspreis einen Teil seines Rohholzes wieder verkaufen. Außerdem kann der<br />
Kunde mit seinem Gebot weit entfernt von seinen Mitbietern liegen und dadurch Geld<br />
verschenken. Andererseits muss der zukünftige Käufer ein recht hohes Gebot abgeben, wenn er<br />
mit Sicherheit erreichen will, dass er ein bestimmtes Los für einen gezielten Bedarf erhält.<br />
Hohe Preise wurden bisher z.B. erzielt für:<br />
- 14 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
Abb. 2<br />
Ahorn 1996,<br />
5739.- DM/m 3<br />
Kirsche in Schwerin 1996,<br />
7400.- DM/m 3<br />
Ahorn 2004,<br />
1536.- €/m³<br />
• Berg-Ahorn Mühlhausen 2004, 9010.-€/m 3<br />
• Riegelahorn Nidda1996, 12639.- DM/m 3<br />
mit insgesamt 3,87 m³ ergibt ca. 38 TDM inklusive billigerem Zopfstück<br />
An Meistgebotsterminen beteiligen sich neben der Landesforstverwaltung auch andere<br />
Besitzarten wie Privatwald, Kommunalwald und Bundeswald. Laut Entgeltordnung vom<br />
01.05.2004 sind für die Leistungen der Landesforstverwaltung 5,40 €/m³ zu zahlen.<br />
- 15 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
3.2.3 Freihandverkauf<br />
Der Freihandverkauf stellt den Regelfall des <strong>Holz</strong>verkaufes dar und ist das einfachste<br />
Verkaufsverfahren bei einem festen Kundenstamm. Dabei werden die Lose einem oder<br />
mehreren Kunden angeboten. Die potentiellen Käufer prüfen das Angebot und geben innerhalb<br />
einer bestimmten Frist eine Absage oder Zusage ab bzw. machen ein Gegenangebot. Dabei<br />
kommt in freier Verhandlung der endgültige Verkaufspreis zustande und der <strong>Holz</strong>kaufvertrag<br />
wird abgeschlossen. Der Verkauf wird im Stillen abgewickelt. Die Preise sind nicht immer dem<br />
aktuellen Marktgeschehen angepasst.<br />
Ablauf einer Freihandverkaufsaktion:<br />
� Vertragsangebot<br />
� Annahme oder Ablehnung<br />
� Vertragsunterzeichnung<br />
� <strong>Holz</strong>abnahme (Vorzeigung)<br />
� Rechnungslegung<br />
� Zahlungsfrist<br />
� Bezahlung<br />
� Abfuhr<br />
Im Freihandverkauf werden die Verkaufsarten Vorverkauf auf dem Stock, Vorverkauf<br />
aufzubereitender Sorten und Nachverkauf unterschieden. Generell ist dabei zu beachten, zu<br />
welchem Zeitpunkt der Kaufvertrag abgeschlossen wird und zu welchem Zeitpunkt die<br />
Rechnung geschrieben wird.<br />
3.2.3.1 Vorverkauf auf dem Stock (Vorverkauf mit Käuferhieb)<br />
Dies ist eine Verkaufsform, die in Deutschland wenig üblich ist. Sie wird in Frankreich,<br />
Nordamerika und in den Tropen praktiziert. Dabei werden ganze Bestände oder bestimmte<br />
Exemplare zu einem vereinbarten Gesamtpreis des <strong>Holz</strong>es auf dem Stock verkauft. Einschlag<br />
und Rücken gehen zu Lasten des Käufers. Er lässt diese Gewerke durch eigene Arbeitskräfte<br />
oder durch fremde Unternehmer verrichten.<br />
Im Deutschen Reich war der Vorverkauf auf dem Stock nach einer Verordnung aus dem Jahre<br />
1938 verboten. Diese Verordnung wurde erst im Jahre 1969 aufgehoben.<br />
Vorteilhaft für die Forstverwaltung ist ein geringes vorzuhaltendes Arbeitspotential. Nachteilig<br />
ist, dass der Käufer gewisse Mehrerlöse durch vorteilhafte Aushaltung und Sortierung erzielen<br />
kann und somit beim <strong>Holz</strong>verarbeiter das Preisniveau gewisser Sorten unterlaufen kann.<br />
Außerdem muss auf pflegliches Arbeiten und auf den Einschlag angezeichneter Stämme<br />
geachtet werden, was durch Beaufsichtigung oder Kontrollmaßnahmen erreicht werden kann.<br />
Gute Ergebnisse kann der Verkäufer erzielen, wenn der Vorverkauf auf dem Stock über<br />
Versteigerungen abgewickelt wird. Es gibt auch die Möglichkeit, den Vertag vor dem<br />
Einschlag abzuschließen und die Rechnung erst nach dem Einschlag zu erstellen.<br />
3.2.3.2 Vorverkauf aufzubereitender Sorten (Vorverkauf mit Verkäuferhieb)<br />
Hier werden die Verträge abgeschlossen, bevor das <strong>Holz</strong> eingeschlagen und gerückt wird.<br />
Verkaufsobjekt ist trotzdem eingeschlagenes, gerücktes, vermessenes und sortiertes Rundholz.<br />
Die genauen Mengen in den Güteklassen und die exakte Stärkeklassenverteilung sind zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht bekannt.<br />
Geringe Abweichungen in Menge und Qualität des <strong>Holz</strong>es müssen dabei in Kauf genommen<br />
werden. Industrieholzsorten werden in der Regel über Vorverkauf an Großabnehmer verkauft.<br />
Preis und Vertragsbedingungen werden vor Beginn des <strong>Holz</strong>einschlages ausgehandelt. Die<br />
Bereitstellung des <strong>Holz</strong>es findet dann nach einem beiderseits akzeptierten Terminplan mit<br />
Wochen- bzw. Monats- oder Quartalsraten statt. Die Rechnung wird selbstverständlich nur über<br />
<strong>Holz</strong> geschrieben, welches eingeschlagen und vermessen wurde, während der Vertag<br />
- 16 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
geschlossen wurde, als dieses <strong>Holz</strong> noch auf dem Stock stand. Verkauf nach Gewicht und<br />
Werksvermessung gehören auch dazu.<br />
Vorteile:<br />
� Planung und Organisation werden erleichtert<br />
� Rücke- und Einschlagskapazitäten können besser ausgelastet werden<br />
� <strong>Holz</strong>preise sind besser kalkulierbar, da sie vor Einschlagsbeginn für<br />
das ganze Jahr festgelegt werden<br />
Nachteile:<br />
� jährlich festgelegte <strong>Holz</strong>preise können je nach Marktentwicklung für einen der beiden<br />
Vertragspartner zum Nachteil werden<br />
� bei guter Mengenkonjunktur ist es für nicht gebundene Kunden schwer,<br />
� laufend freie Mengen zu erwerben<br />
� ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage ist außer Kraft gesetzt<br />
� bei zu erwartenden Preisrückgängen wird vom Vorvertragsangebot wenig Gebrauch<br />
gemacht<br />
3.2.3.3 Nachverkauf<br />
<strong>Holz</strong> wurde eingeschlagen, ohne zu wissen an wen, wann und ob das <strong>Holz</strong> verkauft werden<br />
kann.<br />
Einschlag und Rücken finden vor Vertragsabschluß statt. Die Käufer können dabei noch<br />
unbekannt sein. Bis zum Jahre 1969 war der Nachverkauf die ausschließliche Verkaufsart. Für<br />
Werthölzer gilt dies nach wie vor (siehe Versteigerungen und Submissionen).<br />
Vorteile:<br />
� bei Vertragsabschluß besteht Klarheit über Mengenanteile je Qualität, in der Regel<br />
konnte das angebotene <strong>Holz</strong> auch vorher besichtigt werden<br />
� Kleinabnehmer haben hier eine größere Chance, <strong>Holz</strong> zu erwerben<br />
Nachteil:<br />
� der Forstbetrieb muss die Aufarbeitungskosten länger vorhalten, als bei anderen<br />
Verkaufsarten<br />
� ins Blaue hinein wird eingeschlagen und gerückt<br />
3.3 <strong>Holz</strong>kaufvertrag und Rahmenvereinbarung<br />
Es gibt kurzfristige und langfristige Verträge. Der kurzfristige Vertrag gehört neben dem<br />
Vertrag auf dem Spotmarkt zu den Einmalgeschäften mit Wiederholungsabsicht, während für<br />
den Spotmarkt keine Wiederholungsabsicht besteht. Der langfristige Vertrag stellt ein<br />
Dauergeschäft dar. Bei der vertikalen Integration verschmelzen Käufer und Verkäufer zu einem<br />
Betrieb oder wenigstens zu einer Form der finanziellen Beteiligung.<br />
Neben schriftlichen Verträgen gibt es auch und mündliche <strong>Holz</strong>kaufverträge. Schriftliche<br />
<strong>Holz</strong>kaufverträge haben einen notwendigen und einen ergänzenden Inhalt. Zum notwendigen<br />
Inhalt gehören:<br />
� Name und Anschrift der Vertragsparteien, dazu gehören Vertreter der<br />
Vertragschließenden Parteien, die gegebenenfalls gerichtlich belangt werden können,<br />
z B. Geschäftsführer oder Prokurist nach HGB<br />
� Vertragsmenge<br />
� Angaben zur Sorte und/oder Qualität<br />
� Preis<br />
� Vertragsbeginn und Vertragsende<br />
� Unterschriften der unterzeichnungsberechtigten Vertreter<br />
- 17 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Gesetzliche Grundlagen und Verkaufsverfahren<br />
Bei nachträglichen Vertragsstreitigkeiten wird dieser Inhalt geprüft und gegebenenfalls der<br />
Vertrag angefochten, wenn z.B. Nichtberechtigte den Vertrag unterschrieben haben.<br />
Als ergänzender Inhalt kann aufgeführt werden:<br />
� anteilige Liefermengen innerhalb des Vertragszeitraumes<br />
� Hinweis auf die Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
� Hinweis auf die Handelsklassensortierung<br />
� Angaben zur Bankverbindung (stehen aber später ohnehin auf der Rechnung)<br />
� Hinweis darauf, ob der Vertrag der Zustimmung einer übergeordneten Behörde bedarf<br />
� Gerichtsstand (wenn dieser nicht vereinbart wird, ist es der Standort des Gerichtes, in<br />
dessen Nähe sich der Hauptsitz des Klägers befindet), die Art des Gerichtes hängt von<br />
der Höhe des Streitwertes ab z.B. Amtsgericht bis 5000.- €, Landgericht über 5000.- €<br />
� Erfüllungsort (wenn nichts genannt wird gilt „frei Waldweg gerückt“)<br />
� Formulierung für eine mögliche Bankbürgschaft<br />
Rahmenvereinbarungen werden durch die Landesforstverwaltung, Forstdirektion,<br />
Oberforstdirektion oder Höhere Forstbehörde mit dem Großkunden abgeschlossen. Sie<br />
schließen aus, dass bei Vertragsverhandlungen einzelne Forstämter (untere Forstbehörden)<br />
hinsichtlich Preis und Menge gegeneinander ausgestochen werden. Das gilt auch für regionale<br />
Benachteiligungen z.B. wegen Transportentfernungen oder Transportarten.<br />
Für den notwendigen und ergänzenden Inhalt der Rahmenvereinbarungen gilt das bereits<br />
Erwähnte. Zusätzlich werden Mengenaufteilungen für die Aufkommensgebiete (in<br />
Brandenburg sind das die Ämter für Forstwirtschaft) und gegebenenfalls differenzierte<br />
Preisangaben gemacht.<br />
4. Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
Jedes Bundesland gibt eigene Formulierungen und Fassungen heraus, die sich<br />
selbstverständlich an den gesetzlichen Bestimmungen (BGB, §§ 305-310) orientieren. Diese<br />
Regelungen gelten für alle <strong>Holz</strong>verkäufe aus dem Landeswald durch die Forstbehörden.<br />
Im folgenden werden einige wichtige Punkte am Beispiel der AVZB Brandenburg in der<br />
Fassung mit In-Kraft-Treten vom 01.08.2000 erläutert. Neben dieser Fassung gab es zwei<br />
weitere veränderte Ausgaben vom 17.03.1993 und vom 16.03.1991.<br />
Einige Unterschiede zwischen den Ausgaben:<br />
- Wechsel gestrichen<br />
- Stundungszinsen gesenkt<br />
- Skontofrist verlängert<br />
- Mengentoleranzen des Kaufvertrages von 10 % gestrichen<br />
Ursache für die Veränderungen waren Einwendungen der Rechnungshöfe und insbesondere ein<br />
Urteil des Landgerichtes Frankenthal (Pfalz) im Rechtsstreit zwischen dem Verband der<br />
Pfälzischen Sägewerke e.V. und dem Land Rheinland-Pfalz als Beklagten vom 17.06.1997.<br />
Darin sind insgesamt 32 Formulierungen der Verkaufs- und Zahlungsbedingungen beanstandet<br />
worden. Diese Formulierungen waren auch in den AVZB anderer Bundesländer enthalten 1) .<br />
Inzwischen ist für Brandenburg eine 4. Ausgabe in Bearbeitung, die ihre Ursache in der<br />
Schuldrechtsreform hat.<br />
1) FROMMHOLD, H., C. MÖSER: (2002): Verkaufs- und Zahlungsbedingungen der Bundesländer für <strong>Holz</strong>verkäufe. AFZ/DerWald 57, 422-<br />
424<br />
- 18 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
4.1 Rechnungslegung (nicht in AVZB ausgeführt)<br />
Abb. 3 Beispiel einer <strong>Holz</strong>rechnung<br />
Die Rechnungslegung erfolgt 3 bis 5 Tage nach Vorzeigung oder Überweisung bzw.<br />
Übernahme (Übergabe) des <strong>Holz</strong>es bei Freihandverkäufen. Bei Meistgebotsverkäufen läuft die<br />
Frist ab Zuschlagserteilung. Der Tag der Rechnungslegung ist ausschlaggebend für den Beginn<br />
von Zahlungsfristen, Skonto, Stundungsanträgen, Verzugszinsen und Wiederverkäufen.<br />
Notwendiger Rechnungsinhalt:<br />
- Adresse des Rechnungsempfängers<br />
- Konto und Adresse des Verkäufers<br />
- Menge<br />
- Preis<br />
- 19 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
- MWSt. extra ausgewiesen, eventuell mit unterschiedlichen Beträgen für <strong>Holz</strong>, Rückung<br />
und Transport<br />
- Formulierung über den bereits abgeführten Beitrag zum <strong>Holz</strong>absatzfonds<br />
- Allgemeiner Zahlungstag (AZT)<br />
- Sorte<br />
- Güte<br />
Ergänzender Rechnungsinhalt :<br />
- <strong>Holz</strong> darf erst nach Bezahlung abgefahren werden<br />
- Kunden-Nr.<br />
- Rechnungs-Nr.<br />
- Hinweis auf AVZB<br />
- Skontobetrag und -frist<br />
- Rechnungsbetrag unter Abzug von Skonto<br />
- Meßzahlprozente<br />
- Haushaltsjahr<br />
- Titel<br />
- Kapitel<br />
Im Programm der <strong>Holz</strong>buchführung gibt es unveränderbare Formulierungen und frei wählbare<br />
Formulierungen, z.B. frei wählbar: Kundenangabe<br />
unveränderbar: Skontobetrag, MWSt<br />
Zu beachten ist ferner bei der Rechnungslegung:<br />
- Skonto muß nicht automatisch nach AVZB gewährt werden, sondern es muß<br />
Vertraglich vereinbart werden, z.B. bei Kleinkunden kein Skonto<br />
- AZT ist bei Kleinkunden nicht automatisch 42 Tage, sondern 14 Tage, wenn<br />
nicht anders vereinbart<br />
- „0,8 % <strong>Holz</strong>absatzfonds ...“, dieser Passus steht nicht automatisch bei Kleinkunden,<br />
sondern bei vertraglich gebundenen Großkunden z.B. des Sägewerkerverbandes<br />
4.2 Vertragsabschluß<br />
Ein Kaufvertrag kommt durch Abgabe und Annahme eines Angebotes zustande.<br />
Käufer und Verkäufer sind, wenn nichts anderes vereinbart wird, 14 Kalendertage an das<br />
Angebot gebunden.<br />
Der Vertrag selbst muss nicht schriftlich formuliert werden, sondern es gelten Wertgrenzen in<br />
Brandenburg von 500.- €.<br />
4.3 Mengenabweichung<br />
Mengenabweichungen mit der Bezeichnung „zirka“ berechtigen den Verkäufer, bis zu 10 %<br />
weniger als die vertraglich vereinbarte Menge zu liefern. Der Verkäufer ist dann aber<br />
verpflichtet, auf Verlangen des Käufers einen Vertrag über den Nachkauf von <strong>Holz</strong><br />
vergleichbarer Art und Güte in der fehlenden Menge aus anderen Forstämtern zu schließen.<br />
Bei Einschlagsbeschränkungen durch Rechtsvorschrift (Forstschädenausgleichsgesetz) ist der<br />
Verkäufer berechtigt, Liefermengen zu kürzen. Darüber ist der Käufer spätestens 4 Wochen<br />
nach Erlass der Rechtsvorschrift zu informieren.<br />
4.4 Gefahrenübergang<br />
Der Gefahrenübergang erfolgt entweder<br />
bei Meistgebotsverkäufen mit der Zuschlagerteilung oder<br />
bei sonstigen Verkäufen mit der Übernahme des <strong>Holz</strong>es.<br />
- 20 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
Mit der Überweisung des <strong>Holz</strong>es oder, wenn eine Vorzeigung erfolgt ist, mit Abschluss der<br />
Vorzeigung, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung<br />
des <strong>Holz</strong>es auf den Käufer über.<br />
Der Gefahrenübergang betrifft auch Gefahren für Dritte oder von Dritten, die vom <strong>Holz</strong><br />
ausgehen können bzw. auf das <strong>Holz</strong> einwirken..<br />
4.5 Eigentumsübergang<br />
Eigentum erlangt der Käufer erst bei vollständiger Bezahlung des Kaufpreises und aller<br />
Nebenkosten aus dem Kaufvertrag.<br />
Dem Käufer oder seinem Beauftragten wird als Zeichen dafür ein Abfuhrausweis überstellt.<br />
Nach Bezahlung bzw. dem Vorlegen einer Bankbürgschaft oder einer anderen Sicherheit wird<br />
dem Käufer oder seinem Beauftragten ein Abfuhrausweis oder ein vorläufiger Abfuhrausweis<br />
ausgehändigt oder übersandt. Für Teilmengen wird der Abfuhrausweis für die Menge<br />
ausgehändigt, die der Höhe der geleisteten Zahlung entspricht.<br />
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenkosten bleibt das verkaufte<br />
<strong>Holz</strong> Eigentum des Verkäufers.<br />
<strong>Holz</strong> darf also entweder nach<br />
vollständiger Bezahlung oder<br />
Teilzahlung für Teilmengen oder<br />
Bankbürgschaft oder<br />
Abschlagszahlung bei Werkseingangsvermessung ohne Bankbürgschaft abgefahren<br />
werden.<br />
Eine Bankbürgschaft bewirkt noch keinen Eigentumsübergang.<br />
4.6 Gewährleistung und Sachmängel<br />
Umfang der Sachmängelhaftung:<br />
Der Verkäufer leistet Gewähr bei äußerlich erkennbaren erheblichen Mängeln oder<br />
Abweichungen von den zugesicherten Eigenschaften des <strong>Holz</strong>es. Der Verkäufer haftet auch für<br />
Fehler, die nicht äußerlich erkennbar sind, wenn er sie arglistig verschwiegen hat oder bei<br />
grobem Verschulden.<br />
Mängelrügenfrist:<br />
Mängel sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Abschluss der Vorzeigung oder<br />
Übernahme des <strong>Holz</strong>es zu rügen. Für versteckte Mängel, sofern der Verkäufer diese<br />
nicht arglistig verschwiegen hat oder ihm grobes Verschulden trifft, gilt eine Frist von<br />
3 Wochen nach Vorzeigung oder Übergabe des <strong>Holz</strong>es.<br />
Mängelrügen können nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Käufer oder sein<br />
Beauftragter mit der Bearbeitung oder Entrindung des <strong>Holz</strong>es begonnen hat.<br />
Über Splitterbefall hat der Verkäufer den Käufer vor Vertragsabschluß zu informieren. Hat er<br />
das getan, wird er frei von der Haftung, weil juristisch kein Mangel gegenüber den<br />
zugesicherten Eigenschaften des <strong>Holz</strong>es vorliegt.<br />
Um zu dieser Information zu gelangen, sollten Splittersuchgeräte verwendet und frühere<br />
Splitterfunde beachtet werden.<br />
Wenn diese Information über Splitterfunde unterbleibt, liegt arglistige Täuschung oder grobes<br />
Verschulden vor und es muss Schadensersatz wegen Nichterfüllung geleistet werden, soweit<br />
sich der Beweis dafür erbringen lässt<br />
Für Splitter, sofern der Verkäufer diese nicht arglistig verschwiegen hat oder ihm grobes<br />
Verschulden trifft, gilt eine Frist von 3 Wochen nach Abfuhrbeginn.<br />
Durchführung der Gewährleistung:<br />
- 21 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
Ist die Mängelrüge begründet, kann der Verkäufer nach seiner Wahl verlangen, dass der<br />
Kaufpreis gemindert, Ersatz durch anderes <strong>Holz</strong> in vereinbarter Art und Güte geleistet oder der<br />
Kaufvertrag rückgängig gemacht wird.<br />
Bei begründeter Mängelrüge kann der Käufer also wahlweise folgendes nach §§, 472, 465, 346<br />
BGB verlangen:<br />
Kaufpreisminderung (Minderung § 472)<br />
Ersatz durch anderes <strong>Holz</strong> gleicher Art und Güte (Nacherfüllung § 465)<br />
Rückgängigmachen des Kaufvertrages (auch als Wandlung oder Rücktritt bezeichnet §<br />
346)<br />
Ein Schadenersatz wegen Nichterfüllung kann nur geltend gemacht werden, wenn der<br />
Verkäufer, sein Beauftragter oder Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt<br />
haben.<br />
Fehler im <strong>Holz</strong>, wie Rotkern, Fauläste und Fäule, sind auf diese Weise nicht zu beanstanden,<br />
weil Verkäufer und Käufer die gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, von äußerlich<br />
erkennbaren Anzeichen auf diese Fehler zu schließen oder weil für beide diese Möglichkeit<br />
nicht besteht.<br />
4.7 Erfüllungsort<br />
Unter dem Erfüllungsort ist der Ort zur Übergabe bzw. Übernahme der Ware zu verstehen.<br />
Erfüllungsort ist, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart ist, der LKW befahrbare<br />
Abfuhrweg.<br />
Im Vertrag ist dann entweder nichts angegeben oder es heißt:<br />
frei Waldweg gerückt<br />
Abweichend können im Vertrag als Erfüllungsort vereinbart werden:<br />
� Hiebsort ungerückt<br />
� frei <strong>Holz</strong>hof<br />
� frei Transportmittel verladen<br />
� frei Werk<br />
Andere Formulierungen sind:<br />
� frei Waggon verladen<br />
� frei Bestimmungshafen<br />
� frei Bord gestaut<br />
� frei LKW<br />
4.8 Zahlungsverkehr<br />
Zahlungen sind durch Überweisung/Einzahlung zu leisten (damit sind Geldüberweisungen<br />
gemeint). Sie können ausnahmsweise auch per Scheck erfolgen. Schecks werden nur<br />
erfüllungshalber angenommen.<br />
Es wurde absichtlich erfüllungshalber formuliert und nicht „erfüllungsstatt vom Käufer<br />
angenommen“. Der Käufer hat damit seine Zahlungsverpflichtung erst dann erfüllt, wenn der<br />
Kaufpreis einschließlich eventueller Spesen dem Verkäufer zugeflossen ist.<br />
Sobald die bezogene Bank den Scheck einlöst oder die Einlösung schriftlich bestätigt hat, wird<br />
der Abfuhrausweis erteilt.<br />
Barzahlung ist bis zur Höhe von 500 € zulässig, wenn sich der Verkäufer ausdrücklich damit<br />
einverstanden erklärt.<br />
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Zahlungen in Euro zu leisten.<br />
Eine Bezahlung über Wechsel ist in Brandenburg nicht möglich.<br />
- 22 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
4.8.1 Bankbürgschaft<br />
Der Käufer kann zur Sicherheit der Zahlung eine unwiderrufliche Bankbürgschaft unter<br />
Verzicht auf die Einreden der Anfechtung, Aufrechnung und unter Verzicht der Einrede der<br />
Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) stellen.<br />
Die Bankbürgschaft soll von einer deutschen Bank erstellt werden. Bei<br />
Zahlungsschwierigkeiten des Kunden übernimmt die Bank die Zahlung nach Aufforderung<br />
durch den Verkäufer. Bankbürgschaften werden in der Regel in Höhe des unterwegs<br />
befindlichen <strong>Holz</strong>es ausgestellt. Eine Bankbürgschaft über den Wert eines Jahresvertrages ist<br />
nicht nötig, da zwischen den Lieferterminen Rechnungen erstellt werden und diese nach 42<br />
Tagen auch bezahlt sein müssen.<br />
In diesem Falle kann die Abfuhr vor Bezahlung erlaubt werden.<br />
4.8.2 Zahlungsfristen und Skonto<br />
Zahlungsfristen beginnen bei Freihandverkäufen am ersten Tag nach Ausfertigung der<br />
Rechnung, bei Meistgebotsverkäufen am ersten Tag nach Erteilung des Zuschlages.<br />
Allgemeiner Zahlungstag ( AZT ) ist der auf den Tag der Ausstellung der Rechnung bzw. des<br />
Zuschlages folgende 42. Tag.<br />
Bei Überweisung mit Gutschrift bis zum 21. Kalendertag nach Ausfertigung der Rechnung wird<br />
Skonto in Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages gewährt.<br />
Bei Verträgen bis zu einem Betrag von 500.- € kann der Verkäufer kürzere Zahlungsfristen und<br />
eine bestimmte Zahlungsart festlegen. Skonto wird nicht gewährt.<br />
Bei Verkäufen nach Werkseingangsmaß wird Skonto nur gewährt, wenn Abschlagszahlungen<br />
und Restzahlungen bis zum AZT nach Werkseingang entrichtet worden sind.<br />
Auf gesondert berechnete Nebenkosten wie <strong>Holz</strong>schutz, Entrindung, Verladung und Transport<br />
wird Skonto nicht gewährt.<br />
4.8.3 Stundung<br />
Auf Antrag kann Stundung der Zahlung gewährt werden.<br />
Der Antrag muss vor Ablauf der Zahlungsfrist bei dem Verkäufer eingegangen sein. Eine<br />
rückwirkende Stundungsgenehmigung kann nicht erteilt werden. Für die Dauer der Stundung<br />
werden Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweils geltenden Basissatz gemäß BGB (3,19 %<br />
Stand Juli 2008) erhoben.<br />
Die Forstverwaltung kann den Antrag ablehnen, wenn ihr eine spätere Zahlung fraglich<br />
erscheint.<br />
Die Zinsen werden von dem auf den AZT folgenden Tag an gerechnet.<br />
4.8.4 Zahlungsverzug<br />
Werden Zahlungsfristen aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, überschritten, ohne dass<br />
Stundung vereinbart ist, so werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils geltenden<br />
Basissatz gemäß BGB (s. o.) erhoben.<br />
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche wegen Verzuges bleibt davon<br />
unberührt.<br />
Nicht bezahlte Rechnungen gelten als überfällige Forderungen, sie werden unterschieden nach:<br />
� <strong>Holz</strong> liegt noch im Walde<br />
� <strong>Holz</strong> ist bereits abgefahren (ohne Abfuhrausweis und ohne Genehmigung = Diebstahl)<br />
- 23 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Verkaufs- und Zahlungsbedingungen<br />
4.9 Wiederverkauf<br />
Kommt der Käufer aus Gründen, die er zu vertreten hat, mit seinen Zahlungen in Verzug, kann<br />
der Verkäufer nach Mahnung des Käufers mit Fristsetzung und Androhung des Wiederverkaufs<br />
die Kaufsache weiter veräußern.<br />
Im Falle des Wiederverkaufs hat der Verkäufer gegen den Erstkäufer einen Anspruch auf<br />
Erstattung der dadurch entstandenen Kosten sowie auf den gegenüber der Vertragssumme etwa<br />
entstandenen Mindererlös.<br />
Verzugszinsen werden dem Erstkäufer bis zur Bezahlung durch den Zweitkäufer, also<br />
möglicherweise bis zum 42. Tag nach der Zweitrechnung berechnet.<br />
Bei auftretenden Mindererlösen werden dafür die Verzugszinsen bis zu deren Ausgleich weiter<br />
berechnet.<br />
Der Erstkäufer kann nicht geltend machen, dass der Verkäufer beim Wiederverkauf einen<br />
günstigeren Erlös hätte erzielen können. Ein etwaiger Mehrerlös verbleibt dagegen beim<br />
Verkäufer.<br />
Der Erstkäufer hat keinen Anspruch auf Ersatz seiner durch Bearbeiten, Entrinden, Rücken<br />
usw. entstandenen Aufwendungen.<br />
Unbezahltes aber vertragliches gebundenes <strong>Holz</strong> kann unter diesen Bedingungen<br />
weiterverkauft werden. Auch bezahltes <strong>Holz</strong> kann weiterverkauft werden, wenn es nicht<br />
rechtzeitig abgefahren wird.<br />
Kommt der Verkäufer mit seiner Abfuhrpflicht in Verzug, so kann der Verkäufer nach Ablauf<br />
von 12 Monaten nach Übernahme bezahltes aber noch nicht abgefahrenes <strong>Holz</strong><br />
wiederverkaufen.<br />
Von der Absicht des Wiederverkaufes wird der Käufer drei Wochen vorher verständigt.<br />
Der Wiederverkaufserlös abzüglich der dem Käufer entstandenen nachweisbaren Kosten wird<br />
dem Erstkäufer erstattet.<br />
4.10 Abweichungen in anderen Bundesländern<br />
Folgende markante Abweichungen der AVZB von Brandenburg zu anderen Bundesländern gab<br />
es früher:<br />
- Skonto 0 % bis 3 %<br />
- unterschiedliche Skontofristen (10 bis 21 Tage)<br />
- Wechselzahlung möglich, da Sicherung durch Landesbürgschaften<br />
- unterschiedliche Stundungszinsen (2 %und 3 %)<br />
- keine Stundung erlaubt<br />
- unterschiedliche Sicherheiten für Stundung<br />
- unterschiedlicher Beginn der Zahlungsfristen, z.B. Rechnungslegung,<br />
Rechnungszugang, Abschluss Kaufvertrag, Verkaufstag.<br />
- unterschiedliche Zahlungsfristen (20 bis 42 Tage)<br />
- unterschiedliche Verzugszinsen (2 % bis 6 %)<br />
- Bankbürgschaften zur vorzeitigen Abfuhr des <strong>Holz</strong>es möglich<br />
- 24 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
5. Messzahlen, <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte und Steuern<br />
5.1 Messzahlen, <strong>Holz</strong>preise, Grundlagen und Entwicklungen<br />
Die Theorie der Preisbildung unterscheidet zwei Extreme:<br />
die absolut zentral gelenkte Wirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft)<br />
die absolut freie Marktwirtschaft<br />
Beide Formen gibt es nicht in Reinkultur, sondern es existiert eine Vielzahl von<br />
Übergangsformen.<br />
In der staatlich gelenkten Zentralverwaltungswirtschaft sind Preise, Produktion und somit<br />
Konsum festgeschrieben. Es kommt zu Mangel- oder Überschussproduktion. Bei der Preis-<br />
Festsetzung gibt es Schwierigkeiten, da oft keine brauchbaren Maßstäbe zu finden sind.<br />
Besonders in der Forstwirtschaft sind die Schwierigkeiten wegen der Koppelproduktion und<br />
wegen starker standortsbedingter Kostenunterschiede groß. Die Nachteile solcher Wirtschaft<br />
waren u. a. von 1934 bis 1948 zu erkennen.<br />
Die absolut freie Marktwirtschaft gibt es nicht. Der Staat greift in das Marktgeschehen immer<br />
irgendwie ein. So entwickelte sich die "soziale Marktwirtschaft".<br />
Mit dem Kartellgesetz (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) sollen<br />
marktbeherrschende Kartelle oder Firmenzusammenschlüsse, die dann auch den Preis<br />
bestimmen können, verhindert werden.<br />
Angebot und Nachfrage bestimmen neben anderen Faktoren den Preis. Ist die Nachfrage groß,<br />
kann auch der Preis hochgehalten werden. Das Angebot wird steigen. Sinkt der Preis, wird<br />
auch das Angebot fallen.<br />
In der forstlichen Nachhaltshiebswirtschaft ist die Regulierung des Angebotes bei<br />
Preisveränderungen nicht ohne weiteres möglich. Wenn bedingt durch Preisrückgang<br />
Waldbesitzer Einkommenseinbußen haben, die sie nicht anders decken können, dann wird<br />
mehr <strong>Holz</strong> auf den Markt gebracht, um den durch Preisverfall bedingten<br />
Einkommensrückgang zu kompensieren. Eigentlich müsste aber das Angebot zurückgehen,<br />
damit der Preis wieder steigen kann. Außerdem müssen Pflegemaßnahmen durchgeführt<br />
werden, die nach gewissen Zeiträumen unaufschiebbar sind.<br />
Messzahlen:<br />
Messzahlen waren die letzten fixen <strong>Holz</strong>preise aus dem Jahre 1952 der Güteklasse B,<br />
gestaffelt nach Stärkeklassen in DM/m³(f) laut Preisanordnung ohne Mehrwertsteuer im<br />
Altbundesgebiet. Sie stellen Preiswerte dar, welche die Wertunterschiede von <strong>Holz</strong>arten und<br />
Stärkeklassen in der Güteklasse B berücksichtigen.<br />
Beispiel für Kiefer, Stärkeklasse 2b: 40 DM/m³(f)<br />
Preisanordnungen existierten von 1939 bis 1948 in Deutschland und in den alten<br />
Bundesländern von 1948 bis 1952 und in den neuen Bundesländern bis 1989. Die Relationen<br />
der Messzahlen (besser: Stärkemesszahlen) untereinander wurden nachträglich geändert mit<br />
Veröffentlichungen vom 22.7.1970 und vom 5.3.1974.<br />
Es gibt<br />
- Stärkemesszahlen (früher in HKS, S. 24)<br />
- Zu- und Abschlagsprozente (früher: Gütemesszahlen) Die Gütemesszahlen geben<br />
die Preisrelationen zwischen den Güteklassen in Prozent an. Da sich diese<br />
Relationen mehr und mehr auch in den Stärkeklassen ändern, werden die Preise<br />
zunehmend in absoluten Werten angegeben, außer bei Güteklasse D, z.B. 30 % für<br />
Laubholz und 40 % für Nadelholz.<br />
Messzahlen sind die Basis für Messzahlprozente (MZP), welche den erzielten <strong>Holz</strong>preis als<br />
Prozentsatz zu den Messzahlen (gleich 100 %) darstellen.<br />
Beispiel für Kiefer Stärkeklasse 2b: 120.- DM/m³(f) bedeutet 300 MZP.<br />
- 25 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Mit Wirkung vom 01.01.2002 wurden nach einer Anweisung im Bundesanzeiger Nr. 36 vom<br />
21.02. 2001 die Messzahlen auf Euro umgestellt und als €/m³(f) ausgewiesen. Diese<br />
Umstellung hat zur Folge, dass die Messzahlprozente (MZP, neuerdings MZE) je nach<br />
Marktlage nur noch etwa den halben Wert gegenüber früher aufweisen. Am Beispiel s. o.<br />
bedeutet das: Kiefer Stärkeklasse 2b, 60.- €/m³(f) gleich 150 MZE.<br />
5.2 <strong>Holz</strong>preise am Beispiel Brandenburgs<br />
Die Orientierung für die Preise von Rundholz aus dem Landeswald wird in Brandenburg wie<br />
auch früher in anderen Bundesländern durch die jährlichen „Herbsterlässe“ gegeben. Der<br />
Preisrahmen richtet sich dabei nach <strong>Holz</strong>art, Güte- und Stärkeklasse. Die Staffelung der<br />
Stammholzpreise je Stärkeklasse sieht niedrige Preise für kleine Durchmesser und hohe Preise<br />
für große Durchmesser vor. In den letzten Jahren konnte stärkeres Nadelsägeholz nicht mehr<br />
zu höheren Preisen verkauft werden, so dass Kappungsgrenzen je nach <strong>Holz</strong>arten bei den<br />
Stärkeklassen 3, 4 und 5 gesetzt wurden. Das Preisgefälle zwischen den Güteklassen wurde<br />
früher in einem einheitlichen Prozentsatz über alle Güteklassen angegeben (z.B. 150 % für A,<br />
100 % für B, 80 für C und 30 % für D). In den letzten Jahren wurden auch in der Güteklasse<br />
C differenzierte Relationen je Stärkeklasse festgelegt. Diese Differenzierung sieht prozentual<br />
niedrigere Preise für stärkeres <strong>Holz</strong> und prozentual höhere Preise für schwächeres <strong>Holz</strong> vor.<br />
Außerdem sieht der Herbsterlass Preiszuschläge und -abschläge für Besonderheiten wie fixe<br />
Längen und veränderte Zopfdurchmesser vor. An Hand von Folien des jeweiligen aktuellen<br />
„Herbsterlasses“ werden die Orientierungspreise erläutert. Um sich ein grobes Preisgerüst<br />
besser einprägen zu können, wird empfohlen, auf das Preisgefälle zwischen den <strong>Holz</strong>arten in<br />
der Reihenfolge Eiche, Buche, Erle, Esche Robinie, Birke, Kiefer Fichte z.B. in der<br />
Stärkeklasse 4 zu achten, unter 3b ist allerdings die Fichte teuerer als die Kiefer. Weiterhin<br />
sind die unterschiedlichen Preisdifferenzen zwischen den Stärkeklassen verschiedener<br />
<strong>Holz</strong>arten zu beachten, bei Kiefer etwa 10 €, bei Buche etwa 25 € und bei Eiche etwa 50 €.<br />
Tab. 1 Nadel-Stammholz lang (mit prozentualem C-Preis)<br />
Kiefern-Stammholz, Preise €/m³(f)<br />
2001/2002<br />
Stkl B C Prozent<br />
1a - - -<br />
1b 36.- 30.- 83 %<br />
2a 47.- 38.- 81 %<br />
2b 60.- 46.- 77 %<br />
3a 70.- 53.- 76 %<br />
3b 80.- 57.- 71 %<br />
4+ 80.- 57.- 71 %<br />
zu beachten sind die o.g. prozentualen C-Preise bei Kiefer<br />
von 71 % bei Stärkeklasse 4 und 83 % bei Stärkeklasse 1b<br />
- 26 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Tab. 2<br />
Laub- Stammholz, Preis in Euro pro m³(f) 2001/2002<br />
Stkl Eiche Buche<br />
B C Prozent B C Prozent<br />
2b - - - - - -<br />
3a - - - - - -<br />
3b 120.- 61.- 51 % 116.- 50.- 43 %<br />
4 179.- 77.- 43 % 138.- 52.- 38 %<br />
5 215.- 84.- 39 % 160.- 55.- 34 %<br />
6 215.- 84.- 39 % 164.- 57.- 35 %<br />
Buche und Eiche (mit prozentualem C-Preis, B entspricht 100 %)<br />
zu beachten sind auch hier die ehemaligen prozentualen C-Preise von 34 % bis 51 %. Im<br />
Jahre 2007 lagen die Preise der Güteklasse B und der Stärkeklasse 4 für Eiche bei 234 € und<br />
für Buche bei 118 €.<br />
Paletten- und Parkettholz<br />
Zu beachten ist der stärkeklassenunabhängige Preis zwischen 40 und 50 € für Palettenholz<br />
unterschiedlicher <strong>Holz</strong>arten.<br />
LAS Kiefer/Lärche/Douglasie und Fichte<br />
Zu beachten ist, dass die LAS-Preise in den letzten Jahren deutlich unter den Langholzpreisen<br />
lagen. Nur für LAS der Stärkeklasse 1b musste im Jahre 2007 mehr bezahlt werden als für<br />
Langholz.<br />
Preiskappungsgrenze<br />
zu beachten sind die stärkeklassenabhängigen Preiskappungsgrenzen im Zeitraum von 1991<br />
bis 2007<br />
- 27 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Tab. 3<br />
Kiefern-Stammholz-Preise in DM pro m³(f)<br />
Güte B gem äß H erbsterlaß<br />
Stkl 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1999 2000<br />
1b 81.- 75.- 65.- 72.- 75.- 75.- 76.- 76.-<br />
2a 111.- 114.- 80.- 90.- 93.- 97.- 99.- 99.-<br />
2b 130.- 134.- 102.- 110.- 113.- 122.- 125.- 125.-<br />
3a 150.- 155.- 120.- 130.- 133.- 144.- 144.- 144.-<br />
3b 160.- 175.- 140.- 150.- 155.- 168.- 168.- 168.-<br />
4 175.- 185.- 155.- 170.- 180.- 190.- 168.- 168.-<br />
5 185.- 185.- 165.- 188.- 190.- 200.- 168.- 168.-<br />
6 185.- 185.- 165.- 200.- 190.- 200.- 168.- 168.-<br />
Anstieg bis Stkl. 6 Kappung bei Stkl. 3b<br />
Industrieschichtholz<br />
Gegenüber 2001 sind die Industrieholzpreise deutlich gestiegen.<br />
Neu ist der höhere Preis für ISN zur OSB-Herstellung.<br />
Tab. 4<br />
Industrieholz-Preise in €/rm der Landesforstverwaltung Brandenburg<br />
Sorte Preis aus<br />
Preis aus<br />
Preisbericht 2007 Herbsterlass 2001/2002<br />
Eiche IS 17,41 -<br />
Buche IS 26,09 13,80<br />
Birke IS 18,36 11,00<br />
Kiefer IS 21,22 13,00<br />
Erle IS 18,83 11,00<br />
Pappel IS 16,51 11,00<br />
Die Informationen des Herbsterlasses mit dem exakten Titel „Orientierung für die<br />
<strong>Holz</strong>vermarktung“ sind nur für den internen Dienstgebrauch der Landesforstverwaltung<br />
bestimmt. Demzufolge sind die darin getroffenen Festlegungen nur für die Landesforsten<br />
verbindlich und eine Weitergabe an Dritte außerhalb der Landesforstverwaltung ist nicht<br />
gestattet.<br />
Weil diese Homepage der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, werden aus diesem Grunde<br />
hier keine aktuellen Angaben zu Preisvorstellungen der Landesforstverwaltung Brandenburg<br />
gemacht.<br />
Im Regelfall wurden die „Herbsterlässe“, wie der Name schon aussagt, im Herbst eines jeden<br />
Jahres neu formuliert. Wenn keine gravierenden Änderungen nötig sind, gelten sie<br />
gelegentlich auch länger, mitunter werden sie auch ausgesetzt. „Herbsterlässe“ werden nur<br />
noch selten herausgegeben.<br />
Neben Preisorientierungen wurden früher auch Aussagen zur Beurteilung der Marktlage<br />
sowie zur Handhabung dieser Vorschrift gemacht. Außerdem wurde ein<br />
Ermächtigungsrahmen gegeben für<br />
- 28 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
- Preisnachlässe für verringerte Zopfdurchmesser und kürzere Längen<br />
- Genehmigungsvorbehalte<br />
- Erläuterungen zur gegenwärtigen Marktsituation<br />
5.3 Preisberichte am Beispiel Brandenburgs<br />
Preisberichte werden monatlich und kumulativ bis zum Jahresende erstellt<br />
- für das Land Brandenburg<br />
- für die ÄfF<br />
Sie enthalten Angaben Sorten, <strong>Holz</strong>arten, Güteklassen, Stärkeklassen, Nettoerlösen je<br />
Mengeneinheit, Mengen und zum Rücke- und Entrindungszustand von verkauftem <strong>Holz</strong>.<br />
Da die verkauften Mengen nach den genannten Kategorien und getrennt nach Langholz und<br />
LAS in Tabellen zusammengefasst werden, ist bei Summenbildung und bei der Ermittlung der<br />
Durchschnittspreise in den neuen Summen auf die breite Palette innerhalb der <strong>Holz</strong>arten zu<br />
achten. Zur Beurteilung der Verallgemeinerungswürdigkeit von <strong>Holz</strong>preisen ist die Angabe<br />
über die verkaufte Menge unbedingt mit heranzuziehen.<br />
- 29 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Tab. 5 Auszug aus Rohholzpreisbericht 2007 des Landes Brandenburg<br />
- 30 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Tab. 6 Entwicklung der Kiefernstammholzpreise<br />
Kiefern-Stammholz-Preise lt. Preisbericht in € pro m³(f) Güte B<br />
Stkl 2002 (LAS) 2003 2004 2005 2006 2007<br />
1b 36,93 33,51 32,85 32,70 33,82 42,94<br />
2a 41,97 44,17 40,11 40,25 41,02 51,79<br />
2b 45,51 54,63 50,41 49,96 51,80 59,79<br />
3a 50,79 62,72 57,57 58,12 61,29 67,15<br />
3b 55,38 68,16 64,02 65,10 70,08 74,22<br />
4 55,47 70,11 64,72 68,30 74,56 89,39<br />
5 55,13 72,89 66,10 65,80 81,70 97,78<br />
6 - 92,05 60,68 57,02 86,90 80,00<br />
5.4 Umsatz-Besteuerung<br />
Gesetzliche Grundlage ist das Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung vom 21. 2. 2005<br />
(BGBl I S. 386), zuletzt geändert am 20. 12. 2007 (BGBl I S. 3150).<br />
RÜTTINGER „Umsatzsteuer in der Land- und Forstwirtschaft“, Verlag Pflug und Feder,<br />
1987, liegt als lose Blattsammlung in der Bibliothek vor.<br />
Ist gibt Umsatzsteuersätze von 0 %, 5,5 %, 7 %, 10,7 % und 19 %. Wer zahlt was? Wer erhält<br />
was?<br />
Das Umsatzsteuergesetz sieht 3 Besteuerungsverfahren vor:<br />
- die Regelbesteuerung<br />
- die Besteuerung von Kleinunternehmen<br />
- die Pauschalbesteuerung (Besteuerung nach Durchschnittsätzen)<br />
Der Steuersatz von Kleinunternehmen liegt bei 0 %.<br />
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe incl. Staatswald können optional die<br />
Pauschalbesteuerung (nach Durchschnittsteuersätzen) wählen, sind dann nicht<br />
vorsteuerabzugsberechtigt und die Umsatzsteuer wird dann nicht an das Finanzamt abgeführt,<br />
sie verbleibt als Gewinn im Betrieb. Die Pauschalsteuerbeträge sind unterschiedlich, nämlich<br />
- für Rohholz, Faschinen, Rinde, Samen, Weihnachtsbäume und Schmuckreisig aus<br />
Forstkulturen (nicht aus eigens dafür angelegten Plantagen)<br />
gemäß § 24, Abs. 1, Nr. 1, UStG 5,5 %<br />
- Einnahmen aus dem Verkauf von <strong>Holz</strong> außerhalb des Waldes<br />
( Flurholz ) 10,7 %<br />
- - sonstige Leistungen im Rahmen des <strong>Holz</strong>verkaufes 10,7 %<br />
- -Einnahmen aus dem nachträglichen Entrinden und<br />
Rücken des <strong>Holz</strong>es 10,7 %<br />
Alternativ dazu kann die Regelbesteuerung gewählt werden. Die Landesforstverwaltung<br />
Brandenburg ist seit dem Jahre 2004 regelbesteuert. Seit 01.01.2007 beträgt der Steuersatz der<br />
- 31 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> <strong>Holz</strong>preise, Preisberichte & Steuern<br />
Regelbesteuerung 19 %. Der ermäßigte Regelsteuersatz für Produkte außer Rohholz, wie z. B.<br />
Schmuckbäume, Schmuckreisig, Faschinen und sonstiges Leistungen für Dritte. Für<br />
Selbstwerbung von <strong>Holz</strong> kommen in Abhängigkeit vom geworbenen Sortiment Steuersätze<br />
von 7 % oder 19 % in Frage. Für Brennholz in Selbstwerbung werden z. B. 7 % erhoben.<br />
Für Hackschnitzel werden entweder 19 % oder 7 % erhoben, je nachdem, ob die<br />
Hackschnitzel aus Waldholz oder aus Restholz gewonnen werden.<br />
Außerdem ist für die Rechnungslegung das ehemalige Forstabsatzfondsgesetz (FAfG) vom<br />
13.12.86 (BGBl. I, S. 2084 von Bedeutung, neu formuliert als <strong>Holz</strong>absatzfondsgesetz (HAfG)<br />
in der Fassung vom 6.10.1998 (BGBl.1 S. 1170) und zuletzt geändert am 26.07.2007 (BGBl. I<br />
S. 1170).<br />
Demnach wird der Beitrag für Stammholz auf 0,8 % festgelegt. Davon führt die<br />
Forstwirtschaft anteilig 0,5 % und die <strong>Holz</strong>industrie anteilig 0,3 % ab. Skonto bleibt dabei<br />
unberücksichtigt (www.holzabsatzfonds.de/de/download/holzabsatzfondsgesetz-2007-06-<br />
26.pdf).<br />
6. Forstliche Nebennutzungen<br />
Unter forstlicher Nebennutzung wird die Herstellung oder Gewinnung aller Produkte des<br />
Waldes und des Waldbodens zusammengefasst, die außerhalb der primären <strong>Holz</strong>nutzung<br />
liegen. Im Mittelalter übertraf die Nebennutzung die wirtschaftliche Bedeutung der<br />
<strong>Holz</strong>produktion, z.B. durch die Schweinemast im Walde und durch Waldprodukte.<br />
In der DDR war die forstliche Nebennutzung und Nebenproduktion sehr umfangreich. Neben<br />
Spielzeugproduktion, Enten-, Gänse- und Putenmast gab es noch weitere Betätigungsfelder.<br />
So wurden z.B. im Staatlichen Forstbetrieb Eberswalde bis zur Wende noch <strong>Holz</strong>kohle,<br />
Spanplatten, Wildfleischprodukte, Sägewerkserzeugnisse, Kleinmöbel und<br />
Maschinenbauerzeugnisse hergestellt.<br />
6.1 Weihnachtsbäume und Schmuckreisig<br />
Der Verkauf von einheimischen Weihnachtsbäumen aus dem Walde ist nach der Wende<br />
drastisch zurückgegangen. Ursache dafür sind der Import von edlen Baumarten aus Dänemark<br />
und die plantagenmäßige Produktion von Weihnachtsbäumen z. B. aus Schleswig-Holstein<br />
und aus dem Sauerland. Selbstwerbung von Weihnachtsbäumen ist eine gute Möglichkeit der<br />
Lobby für Wald und Forstwirtschaft.<br />
Public relation für Weihnachtsbaumselbstwerbung geht z.B. von der CMA (Centrale<br />
<strong>Marketing</strong>gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft GmbH) aus.<br />
Schmuckreisig, wie auch Zier- und Deckreisig werden in dt, t bzw. in Bunden verkauft. Die<br />
Qualitäten richten sich nach dem Benadelungsgrad. Eine gewisse regionale Bevorzugung<br />
bestimmter Nadelgehölze ist zu verzeichnen. Im Raum Eberswalde sind das besonders<br />
Douglasie und geringe Vorkommen von Küstentanne.<br />
Unter Reisig sind auch Faschinen zu verstehen. Faschinen bestehen aus dem Reisig<br />
gebündelter dünner Bäume und/oder Äste zur Verwendung im Erd- oder Wasserbau,<br />
insbesondere zur Uferbefestigung. Sie werden in Längen von 2 m bis 4 m und im<br />
Durchmesser von 15 cm bis 30 cm angeboten.<br />
6.2 Beeren, Pilze und andere Produkte des Waldes<br />
Größere Vorkommen von Beeren gibt es bei Heidelbeere, Preiselbeere, Erdbeere, Him- und<br />
Brombeere. Außerdem können noch genutzt werden Holunder, Berberitze, Wachholder,<br />
Hagebutte, Mehlbeere, Rauschbeere, Moosbeere und Mistelbeere.<br />
Nennenswerte wirtschaftliche Bedeutung hat nur die Heidelbeere mit Erträgen von 300 kg bis<br />
350 kg/ha.<br />
- 32 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Außerdem können Kräuter, Moos, Wurzeln, Knollen, Heil- und Gewürzpflanzen genutzt<br />
werden, z.B. wurde Seegras (Carex brizoides) als Rosshaarersatz verwendet.<br />
Ertrag: 1200 kg/ha.<br />
Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Produkte ist in Deutschland stark zurückgegangen. In<br />
anderen Ländern Europas spielen die Waldprodukte eine größere Rolle, so exportiert<br />
Weißrussland jährlich 6000 t Pilze und 3500 t Beeren (siehe BDF-aktuell, Heft 10/1998, S. 8)<br />
Auch in Nordamerika ziehen die Beerensammler mit der Beerenreife vom Süden nach dem<br />
Norden (von Kalifornien bis Kanada).<br />
Abb. 4 Gewinnung von Ahornsaft<br />
6.3 Harz<br />
Die durchschnittliche jährliche Harzproduktion lag in der DDR zuletzt bei Film ca. 12000 t<br />
auf ca. 30000 ha Waldfläche.<br />
Das entspricht einer Kolophoniumproduktion von 8000 t, benötigt wurden aber 18000 t<br />
Kolophonium in der DDR. Harz enthält ca. 2,2 bis 6,4 % Schmutz, 5,0 bis 8,8 % Wasser, 13,4<br />
bis 18,3 % Terpentin, der Restprozentsatz ist Kolophonium.<br />
Weltweit wurden ca. 1,3 Mio. t Kolophonium produziert.<br />
Die Harzung fand überall dort statt, wo nennenswerte Kiefernbestockung (Pinus silvestris)<br />
vorhanden war. Im StFB Eberswalde lag das Plansoll bei etwa 375 t. Es gab Reizmittel- und<br />
Stimulationsharzung. Pro Riss können bei Stimulationsharzung 160 bis 200 g Harz gewonnen<br />
werden.<br />
Ausbildung und Organisation der Harzung befanden sich auf hohem Niveau. Die DDR war in<br />
der Stimulationsharzung weltweit führend. Für die Tonne Rohharz wurde beim Verkauf an<br />
den zuletzt noch existierenden einzigen Verarbeitungsbetrieb ein Festpreis von 5134.- Mark<br />
(DDR-Währung) gezahlt. Dagegen kostete 1 Tonne Kolophonium als Endprodukt auf dem<br />
Weltmarkt 800 bis 1000.- DM.<br />
Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Harzung Mitte 1990 zu Beginn der Ernteperiode<br />
offiziell eingestellt wurde. Meist wurde nur noch gerötet, mitunter wurden noch einige Risse<br />
angebracht, andere Betriebe verzichteten auch schon auf die Rötung im Winter. Auf dem<br />
Weltmarkt wurde Harz billiger angeboten als in Deutschland, weil hier die wenig ergiebige<br />
- 33 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Pinus sylvestris geharzt wurde, während in südlichen Ländern ergiebigere Kiefernarten mit<br />
einer längeren und klimatisch günstigeren Harzungssaison genutzt wurden. Außerdem spielte<br />
das enorme Lohngefälle bei dieser überwiegend manuellen Tätigkeit eine große Rolle.<br />
Die mit geharzter Kiefer bestockte Fläche betrug im Jahre 1989 in Brandenburg noch 20905<br />
ha, während sie bis zum Jahre 2000 auf 18010 ha mit einem Vorrat von ca. 1,35 Mio m³ sank.<br />
Die Veränderungen waren unter anderem auch deswegen so geringfügig, weil einerseits der<br />
Kahlschlagbetrieb fast völlig eingestellt wurde und andererseits der Einschlag zurückging und<br />
der Zuwachs an den verbleibenden Beständen die Nutzung zum Teil aufwog. Ferner wirkten<br />
sich auch die Verlängerung der Umtriebszeiten und die Nutzungsbeschränkungen durch den<br />
Naturschutz negativ auf den raschen Abbau der geharzten Kiefernbestände aus. Geschätzt<br />
wird, dass bei weiterhin so geringer Nutzung auch im Jahre 2024 noch eine Menge von ca.<br />
150000 m³ geharzten Kiefernholzes stehen wird (siehe Fußzeile).<br />
Welche <strong>Holz</strong>arten wurden oder werden geharzt?<br />
Pinus silvestris in der DDR (mit niedrigen Erträgen im Vergleich zu anderen Kiefernarten und<br />
geographischen Breiten), aber auch in Russland, Polen und Bulgarien<br />
Pinus nigra in Österreich (mit wesentlich höheren Erträgen)<br />
Pinus maritima (pinaster), Seestrandkiefer auch Pinus palustris in Frankreich, Portugal und<br />
Spanien<br />
Pinus elliottii, plantagenmäßig in Brasilien<br />
Mit der Harzung wurde meist an Kiefern im Alter kurz vor der Umtriebszeit mit dem Ziel<br />
begonnen, diese 5 bis 6 Jahre zu betreiben, um anschließend die Bäume zu ernten. Die Ernte<br />
sollte bis 12 Jahre nach Beginn der Harzung abgeschlossen sein.<br />
Die Verarbeitung des Rohharzes erfolgte zuletzt ausschließlich in der Pechsiederei Eich<br />
(Vogtland), welche 1795 gegründet wurde und über 6 Generationen geführt wurde. In der<br />
Vergangenheit war besonders die Scharrharzgewinnung an der Fichte bekannt (Vogtland,<br />
Bayern, Harz). Erstarrtes Harz wurde dabei von künstlich angelegten oder von natürlichen<br />
Wunden abgekratzt. Eine planmäßige Kiefernharzgewinnung war in Deutschland bis zum<br />
Ausbruch des 1. Weltkrieges nicht bekannt. Erst im Jahre 1916 wurde die Kiefernharzung in<br />
Deutschland wegen der Handelssanktionen infolge Kriegsausbruches eingeführt und nach<br />
dem Jahre 1926 nur noch vereinzelt fortgesetzt.<br />
Die Kiefernharzung wurde in größerem Umfang in Deutschland während des 2. Weltkrieges<br />
wieder aufgenommen, dazu wurde ein Reichsharzamt eingerichtet.<br />
Es gibt 3 Methoden der Harzgewinnung:<br />
Lebendharzung zu 65 % in Ländern mit niedrigem Lohnniveau, besonders in China, Vietnam<br />
und in der ehemaligen Sowjetunion<br />
Extraktion von Kiefernstockholz (USA seit 1910) zu 5 %<br />
Tallöldestillation im Sulfatzellstoffverfahren (seit 1930), dabei wird Tallöl zu Tallharz<br />
verarbeitet (Tall = Kiefer, aus dem Schwedischen), besonders in den USA, China und<br />
Finnland, 1 m 3 Kiefern-Faserholz ergibt 2,8 kg Tallharz, zu 30 % in der Weltharzproduktion<br />
Verwendung von Harz:<br />
Bei der Destillation zerfällt Harz in Kolophonium und Terpentinöl. Kolophonium ist eine<br />
feste bernsteinartige Masse, welche von den alten Griechen zur Kalfaterung (=Lückenfüller<br />
zwischen den Schiffsplanken) im Schiffsbau verwendet wurde. Daher auch der Name der<br />
griechischen Stadt Kolophon (heute türkisch). Kolophon war 400 v. Chr. Handelsplatz für<br />
dieses Harzprodukt.<br />
- 34 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Kolophonium (ca. 1,3 Mio. t jährlich weltweit) wird heute verwendet zu<br />
28 % in der Papierindustrie<br />
10 % in der Seifenindustrie<br />
8 % in der Lackindustrie<br />
7 % für Linoleum<br />
5 % für Buchdruckerfarben und Kabelindustrie<br />
37 % für sonstige Verwendungen, z B. in der Gummiindustrie als Weichmacher und<br />
Emulgator, als Optikpech<br />
Terpentinöl ist flüchtig und wird zur Campher-Herstellung verwendet. Campher wird über<br />
alpha-Pinen aus Terpentin hergestellt. Es ist ein bicyclisches Terpenketon, welches früher aus<br />
dem Campherbaum (Laurus camphora) gewonnen wurde.<br />
Weitere Verwendungen von Terpentinöl:<br />
Lösungsmittel für Lacke und Farben<br />
Schuhcreme<br />
Riechstoffe<br />
Antiseptikum<br />
Arzneimittel<br />
Celluloidherstellung<br />
Geschichte und Verfahren der Harzgewinnung:<br />
In der Chronik von Hangelsberg wurden 2 „Pecher“ erwähnt, die mit einem Dechseleisen<br />
Lachten angelegt haben.<br />
Im Splettstößerschen Fischgrätenverfahren wurden bereits Rillen in Fischgrätenform angelegt.<br />
Choriner Verfahren (steigend oder fallend), die fallende Harzung hat durchschnittlich 10 bis<br />
12 % höhere Erträge, als die steigende Harzung. Das hängt angeblich mit den<br />
Temperaturunterschieden im Splintholz zusammen. Das Harz fließt aus bis zu 1 m entfernten<br />
Gebieten zur Wunde hin, vornehmlich aber vom Stammfuß kommend.<br />
Reizmittelharzung unter Behandlung der Risse mit Salzsäure oder Schwefelsäure<br />
Stimulationsharzung, z.B. mit Sulfitspiritusschlempe oder später Hefeextrakt und Etephon<br />
unter Zusatz von Herbiziden. Damit war eine Steigerung auf 160 bis 200 g je Riss und<br />
Lachtenmeter zu erreichen.<br />
Arbeitsgänge:<br />
Verkabeln<br />
Kluppen, Vermessen und Vorzeichnen der Lachten<br />
Röten mit Bügelschaber<br />
Tropfrinne ziehen<br />
Topfhalter einschlagen<br />
Reißen<br />
Anbringen der Harztöpfe<br />
- 35 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Schöpfen<br />
Röten ist das Entfernen der äußeren Borke zur Vorbereitung der späteren Harznutzung. Auf<br />
der Fläche der späteren Harzlachte wird mit speziellen Röteisen (Bügelschaber) die Borke<br />
ohne Verletzung der Bastschicht abgetragen. Das Röten wird während der Vegetationsruhe<br />
vor Beginn der Harzungsperiode durchgeführt (<strong>Holz</strong>lexikon, S. 607).<br />
Reißen ist das Anbringen von Rissen in Zeiträumen von 3 bis 7 Tagen während der<br />
Vegetationsperiode von Mai bis Oktober mit bis zu 30 Rissen in einer Länge von ca. 30 cm.<br />
Die Länge des Risses richtet sich nach dem Durchmesser des Baumes, nach der Anzahl der<br />
Lachten und nach der Breite des notwendigen Lebensstreifens (ca. 1/3 des Stammumfanges).<br />
Nach dem Röten wird die Tropfrinne für ein Jahr angebracht, der Topfhalter eingeschlagen<br />
und es werden die Töpfe verteilt.<br />
Die Risse werden im Winkel von 40 ° zur Tropfrinne im Abstand von 10 mm und bei einer<br />
Tiefe im <strong>Holz</strong> von 3 mm angebracht. Bei flacherem Winkel läuft Harz über die Risse, bei<br />
steilerem Winkel wird zu viel Lachtenfläche verschenkt.<br />
Bei steigender Harzung bleibt ein Steg zwischen den Rissen stehen. Die Maßeinheit für die<br />
Harzfläche ist der Lam (Lachtenmeter) = Breite der Lachte. Von einem Harzer wurden etwa<br />
5000 Kiefern (2400 Lam) bearbeitet, d.h. gerötet, gerissen und geschöpft. Diese<br />
Verrichtungen wurden aber arbeitsteilig vorgenommen, so dass sich die Harzarbeiter<br />
spezialisieren konnten und auch Frauen eingesetzt werden konnten z.B. für das Schöpfen.<br />
Im Zeitraum von 3 bis 7 Tagen wurde je ein Riss auf der rechten und linken Seite der Lachte<br />
angebracht, beim ersten Reißen brachte man gleichzeitig 2 Risse hintereinander an. 6 Risse<br />
ergeben eine Topffüllung. Der Ertrag reicht von 1,5 kg pro Jahr und Lachte bis 6 kg in<br />
Frankreich und Portugal.<br />
Das Schöpfen wurde mit manuellen, später mit maschinellen Schöpfgeräten vorgenommen.<br />
Dabei wurde Harz aus Ton-, Glas oder Kunststofftöpfen herausgekratzt. Zuletzt wurden<br />
Folienbeutel verwendet.<br />
Werkzeuge:<br />
Dechseleisen (anfangs)<br />
Verschiedene Risser bzw. Hobel, z.B. Wiener Hobel, standardisierter Hobel 1 der DDR mit<br />
und ohne Tropfrinnenreiniger für fallende Harzung (mit 2 Führungsschienen) zum Anbringen<br />
der Risse<br />
Bügelschaber zum Röten<br />
Hobel für Tropfrinne (mitunter am Hammer angebracht)<br />
Tropfrinne wird gleich nach dem Röten angebracht, dann wird der Topfhalter eingeschlagen<br />
Topfhalter für 2 Halterichtungen und als Führungsblech für das ablaufende Harz<br />
Die Pechsiederei Eich hat das sog. „Piering-Pech“ = Kolophonium in breiter Produktpalette<br />
hergestellt. Unter anderem war das Vogtländer Fichtenpech begehrt. Es wurde mit offener<br />
Flamme in Bier-Lagerfässer gepicht. Dadurch wurde bei Pilsner ein leicht bitterer Geschmack<br />
hervorgerufen, der nach dem 3. bis 4. Glas zum Mehrtrinken anregte.<br />
Auch Weinfässer wurden mit Kolophonium ausgepicht. Redzina ist ein Wein, der seinen<br />
typischen Geschmack auch heute noch dem Harz verdankt. Da diese Weinfässer nicht mehr<br />
aus <strong>Holz</strong> bestehen oder zumindest nicht mehr ausgepicht werden, wird pro Hektoliter Wein 1<br />
kg Kolophonium zugegeben.<br />
Lärchenharz wird durch Stammfußbohrungen gewonnen und für optische Zwecke verwendet.<br />
Diese Nutzung fand bisher fast ausschließlich im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb<br />
Haldensleben an etwa 120 Jahre alten Lärchen mit einem Längsriss im Inneren statt, in<br />
- 36 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
welchem sich das Harz gesammelt hat. 4 Jahre lang wurde geharzt, ab 3. Jahr nur 2-mal im<br />
Jahr mit einem Ertrag von ca. 2 kg pro Baum in diesem Zeitraum. Lärchenharz bleibt bei<br />
normalen Temperaturen stets flüssig und wurde bisher zusammen mit Kanadabalsam (Harz<br />
aus der Rinde von Abies balsamea) als Optikkitt verwendet.<br />
Im Gegensatz zu Kiefernharz, für das 5,13 DM/kg gezahlt wurde, zahlte Zeiss 177 DM/kg für<br />
Lärchenharz.<br />
(FROMMHOLD, H. „Absatzchancen geharzter Kiefern“ AFZ/DerWald, 45 (1995), Heft 25,<br />
S. 1365-1367)<br />
6.4 Rinde und Kork<br />
Rinde:<br />
Vom Kambium wird nach innen <strong>Holz</strong> und nach außen Rinde erzeugt, bestehend aus Außenund<br />
Innenrinde bzw. aus Borke und Bast. Die Rinde ist die äußere Schutzschicht des Baumes.<br />
Der Extrakt Trockenmasse der Rinde beträgt 20 % bis 30 % gegenüber dem Extrakt des<br />
<strong>Holz</strong>es mit 2 % bis 4 %. Extraktstoffe sind Bindemittel, Leime, Tannine, Wachse, Harze,<br />
ätherische Öle, Gummistoffe, Heilmittel, Aromastoffe, Gerb- und Bitterstoffe sowie Gifte.<br />
Chemischer Unterschied zwischen Rinde und <strong>Holz</strong>:<br />
weniger Cellulose und <strong>Holz</strong>polyosen<br />
mehr Lignin<br />
wesentlich mehr akzessorische Bestandteile<br />
Abb. 5 Entrindeter Baum Gewinnung von Kork<br />
- 37 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Dieser unterschiedliche chemische Aufbau führt in der Regel dazu, dass die gemeinsame<br />
Verarbeitung von <strong>Holz</strong> und Rinde nicht günstig ist. Außerdem ist die Rinde häufig stark<br />
verschmutzt, was zu hohen Schmutzanteilen in den Endprodukten führt bzw. die Standzeiten<br />
der Bearbeitungswerkzeuge sehr verringert.<br />
Mit zunehmender Rationalisierung wurde die Entrindung aus dem Wald zu den<br />
Verarbeitungsbetrieben verlagert.<br />
Rindenanteile: durchschnittlich 10 % vom <strong>Holz</strong>.<br />
In einem Sägewerk von 50 Tm³ Jahreseinschnitt Fichte und Tanne fallen ca. 6500 m³ Rinde<br />
an.<br />
Rindenverwertung:<br />
bei Zellstoff- und <strong>Holz</strong>schlifferzeugung ist eine Verwendung der Rinde unerwünscht<br />
bei Sulfatzellstoffherstellung zwar möglich, führt aber zu höheren Chemikalienverbrauch und<br />
zu geringerer Produktivität.<br />
bei der Spanplattenerzeugung ist die Verarbeitung von <strong>Holz</strong> mit Rinde möglich<br />
Rindenverbrennung zur Energiegewinnung<br />
Heizwert von trockener Rinde 4500 kcal/ kg.<br />
Heizwert mit Wassergehalt 40 bis 50 % 2000 kcal/ kg.<br />
Pyrolyse der Rinde zur Gasherstellung<br />
Plattenwerkstoffe aus Rinde mit gutem Quellverhalten und günstiger Wärmedämmung<br />
Rindenmulch mit Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, darunter ist zerkleinerte und<br />
teilweise fraktionierte rohe Rinde ohne Zusätze zu verstehen, die nicht kompostiert ist.<br />
Vorteile: keimungshemmend, Schutz vor Austrocknung, temperaturausgleichend<br />
Außerdem gibt es noch Rindenhumus (aufbereitete gemahlene Rinde) und<br />
Rindenkultursubstrate (fertige Pflanzerden).<br />
Kork:<br />
Weltweit werden ca. 300000 t Kork auf einer Fläche von ca. 2 Mio. ha geerntet.<br />
Die Korkgewinnung ist von wirtschaftlicher Bedeutung in den westlichen Mittelmeerländern,<br />
besonders in Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, Algerien, Frankreich und Italien. In<br />
Portugal werden jährlich ca. 150 000 t Kork auf einer Fläche von 750000 ha produziert.<br />
Damit trägt Portugal allein mit einem Anteil 50 % zur Weltkorkerzeugung bei. Zur<br />
Korkwerbung wird die Rinde von Quercus suber (Suberin wird in der Zellwand eingelagert)<br />
genutzt. Die zuerst angelegte und abgelöste Korkschicht ist wirtschaftlich unbedeutend, da sie<br />
viele Risse, Unebenheiten und Verunreinigungen enthält. Sie wird auch als „Jungfern-“ oder<br />
„männlicher Kork“ bezeichnet und zu Korkschrot oder Korkmehl verarbeitet. Ab Alter 20<br />
Jahre können alle 8 bis 10 Jahre starke Wundkorkschichten geerntet werden, die als<br />
„weiblicher“ Kork bezeichnet werden. Die Korkernte erfolgt in den Monaten Juli und August.<br />
Von einer Korkeiche können im Alter zwischen 35 und 150 Jahren ca. 200 kg Kork<br />
gewonnen werden. Ab Alter 50 Jahre ist die Korkqualität der Eiche die beste. Die gewonnen<br />
Korkschichten sind 2 cm bis 6 cm dick und werden als Platten mit einer Länge von ca. 1 m<br />
geerntet und 1 Jahr lang an einem luftigen und sonnigen Ort gelagert (siehe Fußzeile).<br />
Kork wird nicht nur zum Verschließen von Flaschen verwendet, sondern auch für<br />
Tapeten<br />
Fußbodenbelag<br />
Dämmstoffe<br />
- 38 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
Schuhsohlen<br />
Isoliermaterial<br />
Rettungsringe<br />
Die Korknutzung hatte einen wesentlichen Aufschwung mit Beginn der industriemäßigen<br />
Flaschenproduktion genommen.<br />
Abb. 6 Kork<br />
6.5. Gerbstoffe<br />
Chemisch gesehen ist Gerbstoffe keine einheitliche Substanz. Gerbstoffe sind chemische<br />
Verbindungen, die tierische Haut in Leder verwandeln. Es sind Verbindungen, die den<br />
Leimstoff der tierischen Haut zu einem unlöslichen Körper ausfällen. Normalerweise quillt<br />
dieser Leimstoff in Wasser auf. Leimerzeugende Hautteile verbinden sich mit dem Gerbstoff<br />
zu Leder.<br />
Pflanzliche Rohstoffe zur Gerbstoffgewinnung können aus Blättern, Früchten, krankhaften<br />
Auswüchsen, Rinde und <strong>Holz</strong> gewonnen werden:<br />
Rinde von Eiche 5 bis 17 %<br />
Fichte 7 bis 20 %<br />
Weide 10 %<br />
Mangrove 36 %<br />
<strong>Holz</strong> von Esskastanie 6 bis 15 %<br />
Eiche 6 %<br />
Quebracho 14 bis 26 % (aus Südamerika, färbt neben der Gerbung außerdem das Leder rot)<br />
Neben pflanzlichen Gerbstoffen gibt es auch tierische, mineralische und synthetische<br />
Gerbmittel, die z.B. in der Fettgerbung (Sämischgerbung), in der Gerbung mit Alaun<br />
(Weißgerbung), in der Chromgerbung und in der Formalingerbung angewendet werden. Mit<br />
- 39 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
pflanzlichen Gerbstoffen behandeltes Leder wurde schon aus der Zeit von 2500 v.u.Z. in<br />
Pyramiden gefunden.<br />
Die Gerbstoffgewinnung erfolgt durch Extraktion von zerkleinertem Rindenmaterial in<br />
Wasser bei 50 bis 100 °C, d. h. die Gerbstoffe werden ausgekocht und anschließend<br />
eingedampft bis zur Trocknung. Rinde aus der Frühjahrs- und Sommerfällung der genannten<br />
<strong>Holz</strong>arten wird zu diesem Zweck zunächst vom <strong>Holz</strong> entfernt, luftgetrocknet und<br />
anschließend gemahlen.<br />
Verwendung der Gerbstoffe:<br />
Wegen der Zunahme der Mengenanteile von synthetischem Leder und wegen des Einsatzes<br />
von synthetischen Gerbstoffen haben die natürlichen Gerbstoffe an Bedeutung verloren.<br />
Stattdessen wird in Australien und Neuseeland versucht, Gerbstoff mit Formaldehyd zu<br />
<strong>Holz</strong>leimen für die Spanplattenindustrie umzusetzen.<br />
Kautschuk<br />
Ein Drittel der weltweiten Gummiproduktion erfolgt noch auf der Basis natürlich gewonnenen<br />
Kautschuks von Hevea brasiliensis. 1876 wurden 70000 Samen zur Sämlingsgewinnung nach<br />
England und dann weiter zu Plantagengründung nach Südostasien gebracht.<br />
Abb. 7 Kautschukproduktion<br />
Der Kautschukbaum kann ab Alter 6 Jahre alle 2 bis 3 Tage gerissen werden. Dabei wird die<br />
Rinde 8 bis 9 mm tief einseitig den halben Stamm umgreifend angeschnitten, ohne das<br />
Kambium zu verletzen. Latex befindet sich in den Milchröhren der Rinde.<br />
Die flüssige Latexmilch wird in geteilten Kokosnussschalen gesammelt, anschließend mit<br />
Chemikalien zum Ausfällen gebracht, gewalzt und zum Trocknen aufgehängt. Pro Jahr und<br />
Baum können 2 bis 5 kg Trockenkautschuk gewonnen werden. Im Gegensatz zur Harzung<br />
werden hier die Risse nur einseitig zur Tropfrinne angebracht.<br />
- 40 -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Forstliche Nebennutzungen<br />
6.6. Weitere Nebennutzungen des Waldes<br />
Zu erwähnen ist noch die Bastgewinnung aus Lindenrinde. Verwendung des Bastes zu<br />
Matten, Körben, Säcken, Seilen und Geweben.<br />
Hauberge sind historische Niederwaldnutzungen mit landwirtschaftlichem Zwischenspiel zur<br />
Gewinnung von Brennholz, Lohrinde, <strong>Holz</strong>kohle, Korn und Ginster sowie mit Schaf- und<br />
Rindereintrieb.<br />
Zur Nebennutzung gehören auch Flechtweidenplantagen (so genannte Weidenheger) und<br />
Forstsamengewinnung.<br />
Weitere Produkte der Waldbäume sind neben Kautschuk auch Öle, Fette, Chinin, Wachs,<br />
ätherische Öle, Weihrauch, Baumsäfte wie Birkensaft und Sirup des Zuckerahornes.<br />
Streunutzung<br />
Grundsätzlich ist die Streunutzung schädlich für die Waldwirtschaft und wurde deshalb in den<br />
50er Jahren weitestgehend eingestellt. Genutzt wurden bis dahin Moosstreu, Farnkraut,<br />
Laubstreu, Nadelstreu und Heidestreu. Diese Reihenfolge ist zugleich die Wertigkeit der Streu<br />
hauptsächlich im Hinblick auf ihre spätere Düngewirkung als Stallmist.<br />
Waldweide<br />
Die Waldweide hatte Bedeutung im Mittelalter und ist jetzt nicht mehr verbreitet.<br />
Erwähnenswert ist heute noch der Wald als Bienenweide.<br />
Torf, Kies, Sand Steine, Erden<br />
Torf ist ein dunkles, kohlenstoffreiches Gemenge unvollständig zersetzter Pflanzenteile. Es<br />
entsteht durch Inkohlung ähnlich wie Braunkohle. Eine Anreicherung von Kohlenstoff und<br />
Stickstoff ist zu verzeichnen. Der Wassergehalt beträgt 90 %. Vor dem Torfabbau per Hand<br />
oder mit Torfstichmaschinen ist eine Entwässerung nötig.<br />
Verwendung: als Brennmaterial auch mit Brikettierung, Stalleinstreu, Humusdünger bzw.<br />
Mulchmaterial, für Moorbäder und zur Herstellung von Platten. Die Torfgewinnung müsste in<br />
Nieder- oder Hochmooren geschehen, die vielfach zu den landschaftlich geschützten Arealen<br />
gehören. In Deutschland hat die Torfgewinnung deshalb keine große wirtschaftliche<br />
Bedeutung mehr. In Finnland und Irland gibt es noch einen großflächigen Torfabbau.<br />
Kiesabbau erfolgt für den Waldwegebau, für den örtlichen Bedarf in den Gemeinden und für<br />
die Versorgung großer Baustellen. Durch den großräumigen Kiesabbau ist ein erheblicher<br />
Flächenverlust zu verzeichnen.<br />
Der Abbau von Granit, Basalt, Grauwacken und Buntsandstein hat in Brandenburg keine<br />
Bedeutung.<br />
- 41 -
<strong>Holz</strong>kunde Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
[1] AUTORENKOLLEKTIV, 1990: Lexikon der <strong>Holz</strong>technik<br />
Leipzig: Fachbuchverlag, 4. Auflage<br />
ISBN 3-343-00611–4<br />
[2] AUTORENKOLLEKTIV, 2003: Das große Buch vom <strong>Holz</strong><br />
Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft<br />
ISBN 3-7611-0708-0<br />
[3] GRAMMEL, R., 1989: Forstbenutzung<br />
Hamburg/Berlin: Verlag Paul Parey<br />
(Pareys Studientexte Nr. 67)<br />
ISBN 3-490-03716–2<br />
[4] FINSTERBUSCH, E.,<br />
THIELE,W., 1987: Vom Steinbeil zum Sägegatter<br />
Leipzig: Fachbuchverlag<br />
DK 630/902 Fin<br />
ISBN 3-343-00275-5<br />
[5] FROMMHOLD: H., 2001: Kommentar zu –Rohholzaushaltung Rohholzverkauf<br />
(Handelsklassensortierung, HKS Brandenburg)<br />
Herausgeber: MULR, Potsdam/Berlin<br />
DK 630/854.1/Roh<br />
ISBN 3-933352-40-1<br />
[6] KNIGGE, W.;<br />
SCHULZ, H., 1966: Grundriss der Forstbenutzung<br />
Berlin / Hamburg: Parey – Verlag<br />
DK 630/8 Kni<br />
[7] METTE, H.-J., 1989: <strong>Holz</strong>kundliche Grundlagen der Forstnutzung<br />
Berlin: Landwirtschaftsverlag Berlin, 2.Auflage<br />
ISBN 3-331-00204-6<br />
[8] o.V. , 1994: Messung und Sortierung von Rohholz in den sächsischen<br />
Staatsforsten<br />
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft, Ernährung uns Forsten<br />
[9] o.V. , 1992: Rohholzaushaltung, Rohholzverkauf<br />
Herausgeber: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten des Landes Brandenburg<br />
[10] SACHSSE, H., 1984: Einheimische Nutzhölzer und ihre Bestimmung nach<br />
makroskopischen Merkmalen<br />
Hamburg/Berlin: Verlag Paul Parey<br />
(Pareys Studientexte Nr.44)<br />
ISBN 3-490-07916-7<br />
- III -
<strong>Holz</strong>kunde Literaturverzeichnis<br />
[11] STÄHLI, R., 1992: <strong>Holz</strong>kunde<br />
Eigenverlag Richard Stähli, 2. Auflage<br />
A 6705<br />
ISBN 3–9520274<br />
[12] STEUER, W., 1990: Vom Baum zum <strong>Holz</strong><br />
Stuttgart: DRW-Verlag, 2. Auflage<br />
DK 630/811.1/Ste<br />
ISBN 3-87181-311–7<br />
[13] WAGENFÜHR, R., 1989: Anatomie des <strong>Holz</strong>es<br />
Leipzig: Fachbuchverlag, 4.neubearbeitete Auflage<br />
Freihand. 811 Wag 4.A<br />
ISBN 3-343-00455-3<br />
[14] WAGENFÜHR, R., 1989: <strong>Holz</strong>atlas<br />
Leipzig: Fachbuchverlag, 3. Auflage<br />
ISBN 3-343-00459-6<br />
[15] WAGENFÜHR, R., 1996: <strong>Holz</strong>atlas<br />
Leipzig: Fachbuchverlag, 4. Auflage<br />
ISBN 3-446-00900-0<br />
- IV -
<strong>Holz</strong>-<strong>Marketing</strong> Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1 PEFC zertifizierte Waldfläche........................................................................................ 4<br />
Abb. 2....................................................................................................................................... 15<br />
Abb. 3 Beispiel einer <strong>Holz</strong>rechnung ........................................................................................ 19<br />
Abb. 4....................................................................................................................................... 33<br />
Abb. 5 Entrindeter Baum Gewinnung von Kork ............................................................... 37<br />
Abb. 6 Kork.............................................................................................................................. 39<br />
Abb. 7 Kautschukproduktion ................................................................................................... 40<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1 Nadel-Stammholz lang (mit prozentualem C-Preis)..................................................... 26<br />
Tab. 2........................................................................................................................................ 27<br />
Tab. 3........................................................................................................................................ 28<br />
Tab. 4........................................................................................................................................ 28<br />
Tab. 5 Auszug aus Rohholzpreisbericht 2007 des Landes Brandenburg................................. 30<br />
Tab. 6 Entwicklung der Kiefernstammholzpreise.................................................................... 31<br />
- V -