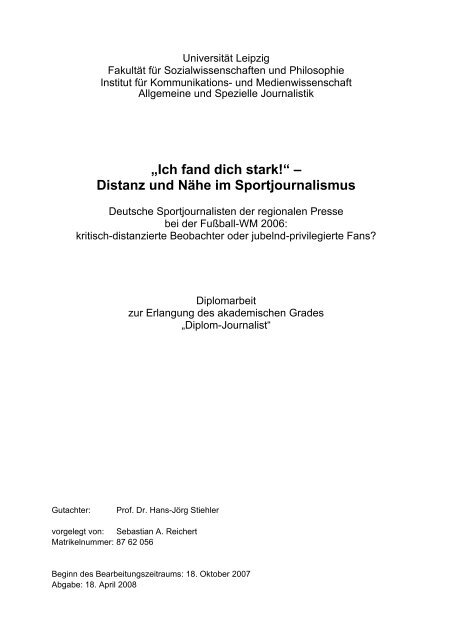„Ich fand dich stark!“ – Distanz und Nähe im Sportjournalismus
„Ich fand dich stark!“ – Distanz und Nähe im Sportjournalismus
„Ich fand dich stark!“ – Distanz und Nähe im Sportjournalismus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Leipzig<br />
Fakultät für Sozialwissenschaften <strong>und</strong> Philosophie<br />
Institut für Kommunikations- <strong>und</strong> Medienwissenschaft<br />
Allgemeine <strong>und</strong> Spezielle Journalistik<br />
<strong>„Ich</strong> <strong>fand</strong> <strong>dich</strong> <strong>stark</strong>!<strong>“</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>Distanz</strong> <strong>und</strong> <strong>Nähe</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
Deutsche Sportjournalisten der regionalen Presse<br />
bei der Fußball-WM 2006:<br />
kritisch-distanzierte Beobachter oder jubelnd-privilegierte Fans?<br />
Diplomarbeit<br />
zur Erlangung des akademischen Grades<br />
„Diplom-Journalist<strong>“</strong><br />
Gutachter: Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler<br />
vorgelegt von: Sebastian A. Reichert<br />
Matrikelnummer: 87 62 056<br />
Beginn des Bearbeitungszeitraums: 18. Oktober 2007<br />
Abgabe: 18. April 2008
„Das wesentliche Merkmal der Begeisterung<br />
ist der Verlust der Urteilsfähigkeit.<strong>“</strong><br />
Alfons Spiegel, ehemaliger ZDF-Sportchef.
INHALTSVERZEICHNIS I<br />
Abstract VI<br />
Glossar VII<br />
1. EINLEITUNG 1<br />
1.1 Entdeckungszusammenhang........................................................................................ 1<br />
2. FORSCHUNGSSTAND 3<br />
2.1 Vorwissenschaftliche Beschreibungen....................................................................... 3<br />
2.2 Stand der wissenschaftlichen Forschung....................................................................4<br />
2.2.1 Relevante Untersuchungen 5<br />
2.2.2 Einzelne Kritikpunkte aus den Forschungsergebnissen 7<br />
2.2.2.1 Journalisten mit Sportlervergangenheit 7<br />
2.2.2.2 Mitglieder in Sportvereinen 7<br />
2.2.2.3 Ereignis- <strong>und</strong> ergebniszentriert 7<br />
2.2.2.4 Konfliktfreiheit 9<br />
2.2.2.5 Entertainer statt distanziert-zurückhaltende Vermittler 10<br />
2.2.2.6 Enge Kontakte zu Sportlern 11<br />
2.2.2.7 Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit 12<br />
2.2.2.8 Wenig (sportexterne) Quellen 13<br />
2.2.2.9 Affektive Verb<strong>und</strong>enheit 13<br />
2.2.2.10 Quasi selbstwertdienliche Ursachenzuschreibungen 14<br />
2.2.2.11 Einfluss der Öffentlichkeitsarbeit 16<br />
2.2.2.12 Bestechung mit Geschenken 16<br />
2.2.2.13 Experten, Kolumnisten <strong>und</strong> Co-Kommentatoren 17<br />
2.2.3 Zusammenfassung der wissenschaftlichen Kritik 18<br />
3. EXKURS: DER JOURNALISTISCHE QUALITÄTSBEGRIFF 19<br />
3.1 Qualität <strong>–</strong> ein komplexer Begriff................................................................................. 19<br />
3.2 Herleitungskriterien journalistischer Qualität........................................................... 21<br />
3.2.1 Die normative Begründung 21<br />
3.2.1.1 (Sport-)Journalistische Kodizes 23<br />
3.2.1.1.1 Pressekodex des Deutschen Presserates 23<br />
3.2.1.1.2 Medienkodex des Netzwerks Recherche 24<br />
3.2.1.1.3 Qualitäts-Charta des DJV 24<br />
3.2.1.1.4 Pariser Leitsätze 24<br />
3.2.1.1.5 Ehrenkodex des VDS 25<br />
3.2.1.2 Herausforderungen sportjournalistischer Ethik 26<br />
3.2.1.3 Kodizes: Gemeinsamkeiten <strong>und</strong> Kritik 27<br />
3.2.2 Die system- <strong>und</strong> handlungstheoretische Begründung 28<br />
3.2.3 Zusammenfassung: Herleitungskriterien <strong>im</strong> Überblick 29<br />
3.3 Journalistische Qualität: Spezielle Gefährdung <strong>im</strong> Sportressort............................ 30<br />
3.3.1 Exkurs: Parallelen der Qualitätsgefährdung in der Kriegsberichterstattung 33<br />
3.4 Zusammenfassung: Qualitätsverständnis <strong>und</strong> Untersuchungsthema.................... 34<br />
I
4. HINTERGRUND 36<br />
4.1 Sport in der Tageszeitung........................................................................................... 36<br />
4.1.1 Definition <strong>und</strong> Typologie der Tageszeitung 36<br />
4.1.2 Geschichte der Zeitung bis 1945 36<br />
4.1.3 Zeitungen in Deutschland von 1945 bis zur gegenwärtigen Situation 38<br />
4.1.4 Geschichte der Sportpresse 41<br />
4.1.5 Zusammenfassung 46<br />
5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 47<br />
5.1 Forschungsfrage……………………............................................................................. 47<br />
5.1.1 Relevanz der Forschungsfrage 47<br />
5.1.2 Vorüberlegungen zur Hypothesenentwicklung 48<br />
5.1.3 Entwicklung der Untersuchungshypothesen 50<br />
5.2 Auswahl des Untersuchungsmaterials...................................................................... 52<br />
5.2.1 Untersuchte Zeitungen <strong>im</strong> Kurzporträt 55<br />
5.2.1.1 Nicht akkreditierte Zeitungen 55<br />
5.2.1.1.1 Hanauer Anzeiger 56<br />
5.2.1.1.2 Mindener Tageblatt 57<br />
5.2.1.1.3 Ludwigsburger Kreiszeitung 57<br />
5.2.1.1.4 Schweriner Volkszeitung 58<br />
5.2.1.2 Akkreditierte Zeitungen 59<br />
5.2.1.2.1 Oldenburgische Volkszeitung 59<br />
5.2.1.2.2 Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung 61<br />
5.2.1.2.3 Eßlinger Zeitung 62<br />
5.2.1.2.4 Lausitzer R<strong>und</strong>schau 62<br />
5.3 Die inhaltsanalytische Methode................................................................................. 63<br />
5.4 Reliabilitätstest............................................................................................................ 65<br />
6. EMPIRISCHE ERGEBNISSE 70<br />
6.1 Deskriptive Ergebnisse................................................................................................ 70<br />
6.1.1 Analyseeinheit Artikel 70<br />
6.1.2 Analyseeinheit Wertende Aussage 81<br />
6.1.3 Analyseeinheit Attribution 83<br />
6.2 Analytische Ergebnisse……….................................................................................. 84<br />
6.2.1 Hypothese 01: Fakten statt Argumente 85<br />
6.2.1.1 Urheber nur Redakteure 85<br />
6.2.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 87<br />
6.2.1.3 Urheber relevant 88<br />
6.2.1.4 Zeitungsschicht 90<br />
6.2.2 Hypothese 02: Eigene Themensetzung 91<br />
6.2.2.1 Urheber nur Redakteure 91<br />
6.2.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 92<br />
6.2.2.3 Urheber relevant 92<br />
6.2.2.4 Zeitungsschicht 93<br />
6.2.3 Hypothese 03: Kaum Konflikthaltiges 94<br />
6.2.3.1 Urheber nur Redakteure 94<br />
II
6.2.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 95<br />
6.2.3.3 Urheber relevant 96<br />
6.2.3.4 Zeitungsschicht 96<br />
6.2.4 Hypothese 04: Oberfläche statt Hintergr<strong>und</strong> 97<br />
6.2.4.1 Urheber nur Redakteure 97<br />
6.2.4.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 97<br />
6.2.4.3 Urheber relevant 98<br />
6.2.4.4 Zeitungsschicht 99<br />
6.2.5 Hypothese 05: Häufig aktive Sportler als Handlungsträger 100<br />
6.2.5.1 Herkunft Handlungsträger Gesamt 100<br />
6.2.5.1.1 Urheber nur Redakteure 100<br />
6.2.5.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 101<br />
6.2.5.1.3 Urheber relevant 102<br />
6.2.5.1.4 Zeitungsschicht 102<br />
6.2.5.2 Herkunft Handlungsträger 1 103<br />
6.2.5.2.1 Urheber nur Redakteure 103<br />
6.2.5.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 104<br />
6.2.5.2.3 Urheber relevant 104<br />
6.2.5.2.4 Zeitungsschicht 105<br />
6.2.5.3 Anzahl Handlungsträger 106<br />
6.2.5.3.1 Urheber nur Redakteure 106<br />
6.2.5.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 107<br />
6.2.5.3.3 Urheber relevant 107<br />
6.2.5.3.4 Zeitungsschicht 109<br />
6.2.6 Hypothese 06: Häufig aktive Sportler als Quellen 109<br />
6.2.6.1 Herkunft Quelle Gesamt 109<br />
6.2.6.1.1 Urheber nur Redakteure 109<br />
6.2.6.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 110<br />
6.2.6.1.3 Urheber relevant 111<br />
6.2.6.1.4 Zeitungsschicht 112<br />
6.2.6.2 Herkunft Quelle 1 112<br />
6.2.6.2.1 Urheber nur Redakteure 112<br />
6.2.6.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 113<br />
6.2.6.2.3 Urheber relevant 114<br />
6.2.6.2.4 Zeitungsschicht 114<br />
6.2.6.3 Anzahl Quellen 115<br />
6.2.6.3.1 Urheber nur Redakteure 115<br />
6.2.6.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 116<br />
6.2.6.3.3 Urheber relevant 116<br />
6.2.6.3.4 Zeitungsschicht 117<br />
6.2.7 Hypothese 07: Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit 118<br />
6.2.7.1 Anzahl Vornamen 118<br />
6.2.7.1.1 Urheber nur Redakteure 118<br />
6.2.7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 119<br />
6.2.7.1.3 Urheber relevant 119<br />
6.2.7.1.4 Zeitungsschicht 120<br />
6.2.7.2 Anzahl Spitznamen 121<br />
III
6.2.7.2.1 Urheber nur Redakteure 121<br />
6.2.7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 121<br />
6.2.7.2.3 Urheber relevant 122<br />
6.2.7.2.4 Zeitungsschicht 123<br />
6.2.7.3 Anzahl Identifikationen 123<br />
6.2.7.3.1 Urheber nur Redakteure 123<br />
6.2.7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 124<br />
6.2.7.3.3 Urheber relevant 124<br />
6.2.7.3.4 Zeitungsschicht 124<br />
6.2.8 Hypothese 08: Verstecken hinter Experten 125<br />
6.2.8.1 Artikel-Umfang 125<br />
6.2.8.2 Anzahl wertender Aussagen 127<br />
6.2.9 Hypothese 09: Rosarote Brille 129<br />
6.2.10 Hypothese 10: Quasi selbstwertdienliche Attributionen 134<br />
6.2.10.1 Urheber nur Redakteure 134<br />
6.2.10.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 138<br />
6.2.10.3 Urheber relevant 140<br />
6.2.10.4 Zeitungsschicht 142<br />
7. HYPOTHESENDISKUSSION UND INTERPRETATION 146<br />
7.1 Hypothese 01: Fakten statt Argumente.................................................................... 146<br />
7.1.1 Urheber nur Redakteure 146<br />
7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 147<br />
7.1.3 Urheber relevant 147<br />
7.1.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 148<br />
7.2 Hypothese 02: Eigene Themensetzung.................................................................... 148<br />
7.2.1 Urheber nur Redakteure 148<br />
7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 149<br />
7.2.3 Urheber relevant 149<br />
7.2.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 150<br />
7.3 Hypothese 03: Kaum Konflikthaltiges...................................................................... 150<br />
7.3.1 Urheber nur Redakteure 150<br />
7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 150<br />
7.3.3 Urheber relevant 151<br />
7.3.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 151<br />
7.4 Hypothese 04: Oberfläche statt Hintergr<strong>und</strong>........................................................... 151<br />
7.4.1 Urheber nur Redakteure 151<br />
7.4.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 152<br />
7.4.3 Urheber relevant 152<br />
7.4.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 152<br />
7.5 Hypothese 05: Häufig aktive Sportler als Handlungsträger................................... 153<br />
7.5.1 Urheber nur Redakteure 153<br />
7.5.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 153<br />
7.5.3 Urheber relevant 154<br />
7.5.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 154<br />
7.6 Hypothese 06: Häufig aktive Sportler als Quellen................................................... 155<br />
7.6.1 Urheber nur Redakteure 155<br />
IV
7.6.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 155<br />
7.6.3 Urheber relevant 156<br />
7.6.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 157<br />
7.7 Hypothese 07: Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit............................................. 158<br />
7.7.1 Anzahl Vornamen 158<br />
7.7.1.1 Urheber nur Redakteure 158<br />
7.7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 158<br />
7.7.1.3 Urheber relevant 158<br />
7.7.1.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 159<br />
7.7.2 Anzahl Spitznamen 159<br />
7.7.2.1 Urheber nur Redakteure 159<br />
7.7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 159<br />
7.7.2.3 Urheber relevant 160<br />
7.7.2.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 160<br />
7.7.3 Anzahl Identifikationen 160<br />
7.7.3.1 Urheber nur Redakteure 160<br />
7.7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 161<br />
7.7.3.3 Urheber relevant 161<br />
7.7.3.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 161<br />
7.7.4 Zusammenfassung 161<br />
7.8 Hypothese 08: Verstecken hinter Experten.............................................................. 162<br />
7.8.1 Artikel-Umfang 162<br />
7.8.2 Anzahl wertender Aussagen 163<br />
7.8.3 Zusammenfassung 164<br />
7.9 Hypothese 09: Rosarote Brille................................................................................... 164<br />
7.10 Hypothese 10: Quasi selbstwertdienliche Attributionen.........................................165<br />
7.10.1 Urheber nur Redakteure 166<br />
7.10.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur 166<br />
7.10.3 Urheber relevant 166<br />
7.10.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht 166<br />
7.11 Zusammenfassung..................................................................................................... 167<br />
8. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 169<br />
8.1 Kritische Überlegungen zur Untersuchung.............................................................. 169<br />
8.2 Zusammenfassung der Ergebnisse <strong>und</strong> Schlussfolgerungen............................... 171<br />
8.3 Fazit <strong>und</strong> Ausblick...................................................................................................... 174<br />
9. VERZEICHNISSE UND ERKLÄRUNGEN 176<br />
9.1 Abkürzungsverzeichnis.............................................................................................. 176<br />
9.2 Abbildungsverzeichnis............................................................................................... 179<br />
9.3 Tabellenverzeichnis.................................................................................................... 180<br />
9.3 Literaturverzeichnis.................................................................................................... 183<br />
9.5 Selbständigkeitserklärung......................................................................................... 208<br />
10. ANHANG CD-Rom<br />
V
Abstract<br />
Seit Jahrzehnten wird Sportjournalisten mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> vorgehalten. Die vorliegende<br />
Arbeit beschäftigt sich mit diesem Vorwurf, indem über die Schilderung subjektiver<br />
Beobachtungen hinausgehend die Sportberichterstattung deutscher regionaler Tageszeitungen<br />
empirisch untersucht wird. Erstmals wird ein Katalog von Indikatoren zusammengestellt,<br />
der sich auf Textmerkmale bezieht <strong>und</strong> in seiner Gesamtheit mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> in<br />
der Berichterstattung anzeigt. Der Text hat das Ziel die Frage zu beantworten, wie kritisch,<br />
distanziert über die Fußball-WM 2006 <strong>und</strong> die deutsche Nationalmannschaft während der<br />
Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Spiele berichtet wurde. Dabei wird untersucht, ob ein signifikanter Unterschied<br />
zwischen den Texten akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Urheber sowie zwischen<br />
den Texten der Zeitungen, die ihre Berichterstattung teilweise auf akkreditierte eigene<br />
Journalisten stützen, <strong>und</strong> den Texten der Zeitungen ohne akkreditierte eigene Journalisten<br />
besteht. Es wird die Methode der Inhaltsanalyse genutzt. Die Arbeit basiert auf 2349 Analyseeinheiten,<br />
die sich aus 782 Artikeln, 675 wertenden Aussagen <strong>und</strong> 892 Attributionen zusammensetzen.<br />
Diese Fälle stammen aus der überregionalen Sportberichterstattung acht<br />
deutscher regionaler Mittel- <strong>und</strong> Kleinzeitungen, die „Publizistische Einheiten<strong>“</strong> sind. Das Ergebnis<br />
ist, dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure unkritischer, distanzloser berichten<br />
als nicht akkreditierte Redakteure der Regionalzeitungen. Gestützt auf dieselben Indikatoren<br />
wird jedoch nicht verifiziert, dass Zeitungen, die ihre Berichterstattung teilweise auf akkreditierte<br />
eigene Journalisten stützen, unkritischer <strong>und</strong> distanzloser schreiben als solche ohne<br />
akkreditierte eigene Redakteure. Wenn allerdings allein die meinungsbetonte Berichterstattung<br />
betrachtet wird, kommentieren „akkreditierte<strong>“</strong> Zeitungen unkritischer als „nicht akkreditierte<strong>“</strong><br />
Zeitungen. Künftige Forschungen können sich auf den Indikatoren-Katalog zur Messung<br />
kritischer <strong>Distanz</strong> in der Berichterstattung beziehen bzw. diesen weiterentwickeln sowie<br />
die Arbeit als Anregung verstehen, den <strong>Sportjournalismus</strong> nicht nur kritisch beschreibend zu<br />
begleiten, sondern ihn weiter auch empirisch überprüfbar zu untersuchen.<br />
Abstract<br />
For several decades sports journalists have been charged with a lack of critical distance from<br />
their subject. This charge will be discussed by the present thesis. It does not s<strong>im</strong>ply describe<br />
instances of subjective observation but investigates empirically the coverage of sports events<br />
in regional newspapers. For the first t<strong>im</strong>e a set of indicators is developed relating to textual<br />
features which in their entirety are marking a lack of critical distance in press coverage of<br />
sports events. This paper a<strong>im</strong>s at answering the question if the press maintained a critical<br />
and detached position in its coverage of the 2006 football world cup and, in particular, of the<br />
performance of the German national team in the quarter-finals and semi-finals. It examines if<br />
there exists a significant difference between the texts of accredited and non-accredited<br />
authors as well as between the texts printed in newspapers whose coverage is based on<br />
accredited journalists and those printed in newspapers whose coverage is not based on accredited<br />
journalists. The method approach applied is content analysis. Research is based on<br />
a sample of 2349 analytical units composed of 782 articles plus 675 judgmental statements<br />
and 892 attributions. The sample cases derive from the coverage of nationwide sports events<br />
in small or medium-sized regional newspapers constituting <strong>“</strong>independent editorial units”. The<br />
first result of this content analysis is that accredited regional newspaper editors report in a<br />
less critical or detached way than non-accredited regional newspaper editors. Content analysis<br />
of the same sample, however, cannot verify the assumption that texts in newspapers<br />
whose coverage is in part based on their own accredited journalists are written in a less critical<br />
or detached way than are texts in newspapers without own accredited journalists. However,<br />
as far as opinion pieces are concerned <strong>“</strong>accredited” newspapers comment on sports<br />
events in a less critical way than do <strong>“</strong>non-accredited” newspapers. Future research can seize<br />
and enhance the suggestion of a set of indicators for the rating of critical distance as developed<br />
in this thesis. This thesis proposes to move beyond a mere critical description of sports<br />
journalism. Instead it a<strong>im</strong>s at constituting sports journalism as an object of empirical research.<br />
VI
Glossar<br />
Die folgenden Erläuterungen sind als Lese- <strong>und</strong> Verständnishilfe für die vorliegende Diplomarbeit<br />
zu verstehen.<br />
Der Verfasser hat sich für die alphabetische Methode der Quellenverweisung entschieden.<br />
Literaturverweise <strong>und</strong> Zitate werden mit dem Namen des Autors, dem Erscheinungsjahr <strong>und</strong><br />
der Seitenzahl des Zitats <strong>im</strong> Fließtext belegt. Familiennamen des Autors bzw. des Herausgebers<br />
werden in Versalien hervorgehoben. Die Zitate werden durch Anführungszeichen<br />
gekennzeichnet, Zitate in Zitaten durch einfache Anführungszeichen. Längere Zitate (ab vier<br />
Zeilen) werden durch Einrückung <strong>und</strong> eine kleinere Schrift vom Fließtext abgesetzt.<br />
Alle Quellen werden in einem Literaturverzeichnis aufgeführt, damit bei der Suche nach einer<br />
best<strong>im</strong>mten Quelle nicht verschiedene Kapitel des Verzeichnisses geprüft werden müssen.<br />
Benutzte elektronische Quellen aus dem Internet sind <strong>im</strong> Literaturverzeichnis unter Angabe<br />
des Namen des Autors, des Titels des Dokuments, des Datums der Veröffentlichung <strong>und</strong> des<br />
Datums des Zugriffs aufgelistet. Sollten sich bei Internet-Quellen Schwierigkeiten bei der<br />
Rekonstruktion des Autors ergeben haben, wird das Dokument unter Angabe der Verfasserbezeichnung<br />
O.V. geführt. Internet- <strong>und</strong> E-Mail-Adressen werden angegeben, indem sie jeweils<br />
am Ende eines Titeleintrags in spitze Klammern gesetzt werden.<br />
Die Arbeit ist gemäß den Regeln der neuen Rechtschreibung verfasst. Werden Texte zitiert,<br />
die in der alten Rechtschreibung erschienen sind, wird diese Schreibweise beibehalten. Für<br />
einen besseren Lesefluss wird ausschließlich die maskuline Form verwendet.<br />
Bei der Verwendung von Eigennamen, die mehr als einmal verwendet werden, steht in<br />
Klammern die Abkürzung, die be<strong>im</strong> weiteren Gebrauch benutzt wird, wie z.B. Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung (FAZ). Die Namen von Medien bzw. Organisationen werden nicht unbedingt<br />
mit der von ihnen selbst gewählten Schreibweise wiedergegeben <strong>–</strong> z.B. wird u.a. das<br />
Sportnetzwerk nicht mit kleinen Buchstaben <strong>und</strong> der Weltfußballverband Fifa aufgr<strong>und</strong> der<br />
gesprochenen Form als Kurzwort nicht durchgehend in Großbuchstaben geschrieben. Alle<br />
verwendeten Abkürzungen sind <strong>im</strong> Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. Ausschließlich die<br />
Namen von Printmedien bzw. Produkte der Printmedien werden zur besseren Lesbarkeit<br />
kursiv gesetzt.<br />
Ganze Zahlen bis zwölf werden in der Regel ausgeschrieben. Werden Zahlen allerdings zueinander<br />
in Beziehung gesetzt, werden der besseren Vergleichbarkeit wegen entweder alle<br />
ausgeschrieben oder <strong>–</strong> sollte dies nicht der Regel entsprechen <strong>–</strong> beide als Ziffer wiedergegeben.<br />
Zahlen als Eigennamen (z.B. Kapitel 1), bei der Nummerierung der Hypothesen oder<br />
als Stellvertreter best<strong>im</strong>mter Variablen-Ausprägungen sowie Prozent- <strong>und</strong> Häufigkeitsangaben<br />
werden nicht ausgeschrieben. Prozentwerte werden mit einer Stelle nach dem Komma<br />
angegeben, sofern das möglich ist.<br />
Die untersuchten Fälle werden <strong>im</strong> Fall der Analyseeinheit Artikel auch als Texte oder Beiträge<br />
bezeichnet, <strong>im</strong> Fall der Analyseeinheit Wertende Aussage auch als Wertung oder Bewertung<br />
<strong>und</strong> <strong>im</strong> Fall der Analyseeinheit Attribution auch als Ursachenzuschreibung.<br />
VII
1. EINLEITUNG<br />
1.1 Entdeckungszusammenhang<br />
„Unter den Kollegen arbeiten Duzmaschinen, Promoter, Lokalpatrioten, Fans, die es über die<br />
Absperrung geschafft haben, Schwärmer, Verniedlicher, Verherrlicher, Schönfärber <strong>–</strong> <strong>und</strong><br />
die, die ihren Job ernst nehmen<strong>“</strong>, schreibt der Berliner Sportjournalist Jens WEINREICH über<br />
den Zustand der deutschen Sportjournalisten <strong>im</strong> Jahr 2005 (WEINREICH 2005, 38). U.a.<br />
Anlass seines Urteils: die Berichterstattung über den Schiedsrichterskandal <strong>im</strong> deutschen<br />
Profifußball um Referee Robert Hoyzer. Ein Jahr nachdem der bestochene „Unparteiische<strong>“</strong><br />
<strong>im</strong> Januar 2005 seinen Rücktritt erklärt hat, formulieren Weinreich <strong>und</strong> 23 weitere Sportjournalisten<br />
in einem offenen Brief an den Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) ihre<br />
Gründe für den Austritt aus den jeweiligen VDS-Regionalvereinen.<br />
„Das Abdriften [...] in das reine Unterhaltungsressort <strong>und</strong> der Rückgang kritischer, distanzierter Berichterstattung<br />
werden anstandslos hingenommen. [...] Sportjournalisten sollten keine Promoter <strong>und</strong> Verkäufer<br />
sein; sie sitzen nicht mit den Objekten ihrer Berichterstattung in einem Boot <strong>–</strong> eine derartige Betrachtungsweise<br />
scheint allerdings <strong>im</strong> VDS nur wenige Anhänger zu finden.<strong>“</strong> (O.V. 2006c).<br />
Weinreich, Sportchef der Berliner Zeitung, gründet mit einigen Kollegen das „Sportnetzwerk<strong>“</strong>.<br />
„Uns geht es um Recherche statt Quote, um <strong>Distanz</strong> statt <strong>Nähe</strong>, um Analyse statt St<strong>im</strong>mungsmache,<br />
um Berichterstattung statt Präsentation <strong>–</strong> also um journalistische Qualitätssicherung.<strong>“</strong><br />
(ebd.). Die angeführten Vorwürfe sind nicht neu. Sportjournalisten wird seit Jahrzehnten<br />
Kumpanei, mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> <strong>und</strong> fehlende Unabhängigkeit vorgehalten.<br />
Helmut DIGEL versucht anhand von Beispielen zu belegen, dass „die Kritik an der Sportberichterstattung<br />
[...] so alt [ist] wie die Sportjournalistik selbst<strong>“</strong> (DIGEL 1993, 71). „Ihre größten<br />
Probleme sind <strong>Distanz</strong>losigkeit <strong>und</strong> Sprachklischee. Zu wenig Kritik. Immer dieselben Ausdrücke.<strong>“</strong><br />
(HOPPNER 1975, 25). Ständig <strong>im</strong> Spektrum der aufgezählten Vorwürfe: mangelnde<br />
<strong>Distanz</strong> der Sportjournalisten zu ihren Berichterstattungsobjekten. 1 Jobst THOMAS folgert,<br />
dass der Sportberichterstattung ein besonderes Negativ<strong>im</strong>age anhaftet <strong>und</strong> dass „kein anderes<br />
journalistisches Tätigkeitsfeld [...] mit vergleichbar massiven Vorwürfen belastet<strong>“</strong> ist<br />
(THOMAS 1988, 52).<br />
Ob diese sich ständig wiederholende Kritik zutreffend ist, wurde selten empirisch untersucht. 2<br />
Dennoch spitzt das Sportnetzwerk die Kritik zu, indem es fragt: „Sind Sportjournalisten eigentlich<br />
Journalisten oder doch nur Fans, die es über die Absperrung geschafft haben?<strong>“</strong><br />
(O.V. 2006a). 3<br />
Die Sportberichterstattung während der Fußball-WM 2006 stellt nach Meinung des Verfassers<br />
ein ideal geeignetes Untersuchungsmaterial dar, um die Gültigkeit dieser speziellen<br />
Sportjournalisten-Kritik zu prüfen. Die Fußball-WM ist das „größte globale Ereignis des Mediensports<strong>“</strong><br />
(SCHWIER, 2002, 79). Das gilt für Journalisten <strong>und</strong> Fernsehzuschauer: 15.000<br />
Journalisten sind bei der WM 2006 in Deutschland akkreditiert. Die Halbfinalbegegnung<br />
Deutschland gegen Italien erreicht mit 29,66 Millionen Zuschauern <strong>und</strong> einem Marktanteil<br />
von 84,1 % die höchste je in Deutschland gemessene TV-Reichweite seit Einführung der<br />
Messungen 1975/76. Laut Schätzungen des Fußball-Weltverbands Fifa sollen das Turnier<br />
weltweit insgesamt über 32 Milliarden Menschen am Fernsehen verfolgt haben <strong>–</strong> dazu kommen<br />
noch Millionen Menschen, die die Fußballspiele bei öffentlichen Übertragungen auf<br />
Großleinwänden gesehen haben (RUDOLPH 2006; GEESE/ZEUGHARDT/GERHARDT<br />
2006, 454; O.V. 2006f.).<br />
1<br />
Vgl. u.a. WEISCHENBERG 1976, 188ff.; THOMAS 1988, 52ff.; NAUSE 1987, 227; DIGEL 1993, 71; FISCHER<br />
1994, 57; GÖRNER 1995, 88ff. <strong>und</strong> SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 1ff.<br />
2<br />
Vgl. Kapitel 2.1 <strong>und</strong> 2.2 der vorliegenden Arbeit.<br />
3<br />
Am 15. <strong>und</strong> 16. Februar 2008 richtete das Sportnetzwerk gemeinsam mit dem Journalistik-Institut der Universität<br />
Dortm<strong>und</strong> eine Sportjournalisten-Konferenz mit dem Titel „Unter Druck: Qualitätssicherung <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><strong>“</strong><br />
aus, an der mehr als 160 Personen teilnahmen.<br />
1
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden Texte deutscher Presse-Sportjournalisten zur Fußball-WM<br />
2006 in Bezug auf den Vorwurf des Sportnetzwerkes (Journalisten oder Fans?) untersucht<br />
<strong>–</strong> <strong>und</strong> zwar daraufhin, ob anhand von Beitragsmerkmalen darauf geschlossen werden<br />
kann, dass die Verfasser sich entweder wie kritisch-distanzierte Beobachter oder doch<br />
wie jubelnd-privilegierte Fans verhalten. Mit anderen Worten: Es geht darum, zu untersuchen,<br />
wie viel Substanz der Vorwurf der fehlenden kritischen <strong>Distanz</strong> hat, wenn sportjournalistische<br />
Texte in regionalen Tageszeitungen die Untersuchungsgr<strong>und</strong>lage bilden.<br />
Der Zeitpunkt für die Untersuchung wird vom Verfasser aus den erwähnten Bedingungen als<br />
günstig angesehen: Erstens findet der traditionsreiche Vorwurf der mangelnden <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong><br />
medienwirksamen Austritt einiger namhafter Sportjournalisten aus dem VDS sowie der<br />
Gründung der Initiative Sportnetzwerk einen vorläufigen Höhepunkt, <strong>und</strong> zweitens bietet die<br />
Fußball-WM 2006 als das sportliche Medienereignis (für deutsche Sportjournalisten)<br />
schlechthin <strong>und</strong> damit als ein wichtiger Meilenstein in der Karriere vieler Sportjournalisten<br />
gute Voraussetzungen zur Untersuchung der Kritik (WIPPER 2003, 12 <strong>und</strong> 123ff.).<br />
2
2. FORSCHUNGSSTAND<br />
2.1 Vorwissenschaftliche Beschreibungen<br />
Es „besteht ein krasses Missverhältnis zwischen der Kritik an der Sportberichterstattung <strong>und</strong><br />
ihrer wissenschaftlichen F<strong>und</strong>ierung<strong>“</strong> (DIGEL 1993, 73). THOMAS bezeichnet die meisten<br />
Bewertungen als „pauschale Verurteilungen<strong>“</strong> <strong>und</strong> Erkenntnisse, die nicht aus „kommunikationswissenschaftlichen<br />
Inhaltsanalysen hervorgegangen sind<strong>“</strong> (THOMAS 1988, 54). Felix<br />
GÖRNER kommt zu dem Schluss: „Die [...] ,Mängelliste’ des <strong>Sportjournalismus</strong> basiert zumeist<br />
auf subjektiven Beobachtungen, welche jedoch in einigen Fällen durch Inhaltsanalysen<br />
empirisch abgesichert sind.<strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 115f.). Für einen Großteil der Arbeiten gilt die<br />
zusammenfassende Bemerkung von Jens MÖLLER <strong>und</strong> Bernd STRAUSS: „Auffallend ist,<br />
dass zahlreiche Arbeiten lediglich beschreibend sind <strong>und</strong> meistens keine empirisch überprüfbaren<br />
Theorien zugr<strong>und</strong>e liegen.<strong>“</strong> (MÖLLER/STRAUSS 1993a, 8; vgl. LOOSEN 1997,<br />
206; SCHAFFRATH 2000, 13). Der Medienpsychologe Uli GLEICH überschreibt 1998 einen<br />
Aufsatz mit dem Titel „Sport, Medien <strong>und</strong> Publikum <strong>–</strong> eine wenig erforschte Allianz<strong>“</strong> <strong>und</strong> erklärt<br />
darin, „dass das Thema ,Sport <strong>und</strong> Medien’ <strong>im</strong> Rahmen der empirischen Medienforschung<br />
<strong>im</strong> Vergleich zu anderen Themen bislang eher geringe Berücksichtigung <strong>fand</strong><strong>“</strong><br />
(GLEICH 1998, 144).<br />
Das massive Vorkommen kritischer Deskriptionen ist zumindest ein deutlicher Hinweis darauf,<br />
dass <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> in Sachen kritischer <strong>Distanz</strong> einiges <strong>im</strong> Argen liegen könnte.<br />
Mit dem Vermerk darauf, dass die große Anzahl der kritischen Beschreibungen, die empirischen<br />
Prüfungen nicht standhalten, ein Indiz auf mögliche Problemfelder <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
ist, soll nicht der Fehler gemacht werden, diese Beobachtungen <strong>–</strong> mit welcher Beweisführung<br />
auch <strong>im</strong>mer <strong>–</strong> zu wissenschaftlich belastbaren Aussagen erheben zu wollen. Dieser<br />
Versuch würde zurück zum oben beschriebenen Problem der mangelnden empirischen Überprüfbarkeit<br />
führen (vgl. LOOSEN 1997, 7). Trotzdem ist es interessant, sich kurz einen<br />
Überblick über die Bandbreite der „subjektiven Beobachtungen<strong>“</strong> zur mangelnden <strong>Distanz</strong> von<br />
Sportjournalisten zu verschaffen, denn die Vorwürfe der Kritiker sind <strong>im</strong>merhin ein Anlass,<br />
sich mit dem Problem der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> der Sportjournalisten zu beschäftigen.<br />
4<br />
Einige Medienvertreter haben nach eigenen Aussagen keine Probleme mit engen Verbindungen<br />
zum Berichterstattungsgegenstand. Der ZDF-Sportjournalist Rolf Töpperwien sagt:<br />
<strong>„Ich</strong> versuche auch, wenn ich am Abend [...] noch in der jeweiligen Stadt bin, mit Spielern oder Trainern<br />
oder Präsidenten oder Managern zusammenzusitzen. Es ist eine große Familie. Und ich gehöre nicht<br />
zu denjenigen Journalisten, die sagen, es sind zwei Boote, in denen Journalisten <strong>und</strong> Spieler sitzen. Ich<br />
sage, wir sitzen in einem Boot.<strong>“</strong> (O.V. 2004b).<br />
Der Sportjournalist Oliver FRITSCH urteilt über eine große Anzahl seiner Kollegen: „Sie sind<br />
eher Fans als Journalisten; sie machen Unterhaltung, nicht Information; ihnen fehlt die <strong>Distanz</strong><br />
zum Berichtgegenstand. Schon so mancher Kollege ist <strong>im</strong> Trikot seines Lieblingsvereins<br />
auf der Tribüne gesehen worden.<strong>“</strong> (FRITSCH 2006b). Jürgen Kaube, Feuilleton-Redakteur<br />
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), äußert sich in einem Interview wie folgt:<br />
„Be<strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> kommen noch die Teilhabe an dem großen Ereignis <strong>und</strong>, bei manchen, das<br />
Daumendrücken hinzu. Ich frage mich oft: Wie kann es sein, dass ein Reporter <strong>im</strong> Fernsehen den Trainer<br />
duzt? Wie würde man denn einen Theaterkritiker einschätzen, von dem man wüsste, dass er nach<br />
dem Theater mit dem Regisseur einen heben geht? Würde man ihm noch glauben, wenn er das Stück<br />
gut findet? Wenn Sportjournalisten sogar schon die Auftragsbiographien schreiben, was kann man<br />
dann noch an Objektivität erwarten? Das ist ein Problem des <strong>Sportjournalismus</strong>’: die Partizipation am<br />
Ereignis <strong>und</strong> die <strong>Nähe</strong> zum Helden. Das geht natürlich auf Kosten der Analyse <strong>und</strong> des nüchternen Prüfens<br />
<strong>–</strong> insbesondere be<strong>im</strong> Fernsehen, das ein vitales Interesse an der guten St<strong>im</strong>mung hat.<strong>“</strong> (FRITSCH<br />
2006c).<br />
4<br />
Da die nachfolgend kurz zusammengefassten Aussagen wissenschaftlich nicht belastbar sind, besitzen sie nur<br />
Indizien-Charakter. Aus den genannten Gründen werden sie dennoch <strong>im</strong> Text kurz dargestellt.<br />
3
Bei der Recherche in Fachzeitschriften <strong>und</strong> medienjournalistischen Beiträgen, die sich mit<br />
den Vorwürfen der fehlenden kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> beschäftigen, fallen<br />
ähnlich drastische Formulierungen: Sportjournalisten sind eine „seltsame Mischung aus Fans<br />
<strong>und</strong> ehemaligen Sportlern<strong>“</strong> (LAHME 2006), sie sind „Fans, die es irgendwie auf die andere<br />
Seite der Barriere geschafft haben <strong>und</strong> stolz wie Bolle sind, auf der richtigen Seite angekommen<br />
zu sein<strong>“</strong> (LEYENDECKER 2006), oder wahlweise auch „Duz-Brüder, Kumpel des<br />
Athleten<strong>“</strong> (FRÜTEL 2005, 309), „Sportfre<strong>und</strong>e, Steigbügelhalter einer Sache, der sie sich mit<br />
Leib <strong>und</strong> Seele verschrieben haben<strong>“</strong> (SCHEU 1995, 159) sowie „geschickte Vermarkter<strong>“</strong><br />
(HACKFORTH/SCHAFFRATH 1998b, 251). „Da sind Kritik <strong>und</strong> Kontrolle natürlich kontraproduktiv.<strong>“</strong><br />
(SCHAFFRATH 2007, 48). Sie sind mit Sportstars „dermaßen ein Herz <strong>und</strong> eine<br />
Seele, dass sich Interviews erübrigen<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1976, 279). 5 <strong>Sportjournalismus</strong> ist<br />
zum „Public-Relations-Geschäft<strong>“</strong> verkommen (DIGEL 1993, 80). „Die Begeisterung frisst die<br />
Urteilsfähigkeit.<strong>“</strong> (GERTZ 2006b).<br />
„Unser guter alter <strong>Sportjournalismus</strong> [hat sich] zu einem dampfenden Kessel Buntes entwickelt, mit<br />
Töppi <strong>und</strong> Toppi, Rubi <strong>und</strong> Andi, Franzi <strong>und</strong> Hansi, Waldi <strong>und</strong> Berti, piep, piep, piep, ich hab’ <strong>dich</strong> lieb <strong>–</strong><br />
<strong>und</strong> wehe, das Ringelreihen wird gelegentlich noch gestört von neugierigen Fragern, die den Rückfall<br />
vom Kinderview zum Interview wagen.<strong>“</strong> (BECK 1998, 170f.).<br />
An eindeutig kritischen Formulierungen zum <strong>Sportjournalismus</strong> mangelt es nicht: „Es fehlt<br />
[…] die Gr<strong>und</strong>tugend eines guten Journalismus: Skepsis. Zu oft ist kritische Sportberichterstattung<br />
Genörgel von Journalisten, die letztlich nur enttäusche Fans sind.<strong>“</strong> (KISTNER 2004,<br />
14). „Es sieht so aus, als würden die Sportler <strong>und</strong> die Sportkommentatoren <strong>und</strong> die Verbandsleute<br />
alle auf einem Ast sitzen. Und nun wird darauf geachtet, dass niemand diesen<br />
Ast absägt<strong>“</strong>, sagt der Berliner Sportsoziologe Gunter Gebauer (O.V. 2006d). Der ehemalige<br />
ZDF-Sportreporter Michael Palme erklärt: „Mittendrin statt nur dabei. Das ist genau das, was<br />
ich nicht will. Ich will nicht mittendrin sein. Ich will <strong>im</strong>mer dabei sein, aber nicht mittendrin.<br />
Denn wenn sie mittendrin sind als Journalist, können sie nicht mehr objektiv sein.<strong>“</strong> (O.V.<br />
2006d).<br />
Ein ARD-Reporter, der anonym bleiben will, gibt zu: „Als journalistisches Aushängeschild gilt<br />
bei uns intern nicht die <strong>Distanz</strong> zu einem Sportler, sondern die besondere <strong>Nähe</strong>.<strong>“</strong> (BACH-<br />
NER 2001, 23). „In der Spannung zwischen Sympathie <strong>und</strong> <strong>Distanz</strong> scheint ein wesentliches<br />
Problem der Sportberichterstattung zu liegen.<strong>“</strong> (FISCHER 1994, 54).<br />
„Viele Sportjournalisten sind ein viel zu enges Verhältnis, eine viel zu enge Beziehung zu jenen eingegangen,<br />
über die sie eigentlich kritisch informieren <strong>und</strong> berichten sollten. Die nicht zu verkennende<br />
Kumpanei zwischen Sportjournalisten, Sportlern <strong>und</strong> Funktionären [...] ist eine der Hauptursachen für<br />
die Unfähigkeit zu kritischer <strong>Distanz</strong>.<strong>“</strong> (PILZ 1983, 73).<br />
2.2 Stand der wissenschaftlichen Forschung<br />
Konträr zur Anzahl der Vorwürfe steht es dagegen mit der Quantität (<strong>und</strong> Qualität) der empirischen<br />
Beweise. Dennoch hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem (deutschen)<br />
<strong>Sportjournalismus</strong>, besonders seit den 1970er Jahren, eine Reihe von Standardwerken<br />
hervorgebracht. Die für das Thema der vorliegenden Arbeit relevanten Ergebnisse dieser<br />
Studien hinsichtlich des Vorwurfes der mangelnden <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> Print-<strong>Sportjournalismus</strong><br />
werden nachfolgend kurz dargestellt. Zeitfaktor <strong>und</strong> thematischer Zusammenhang geben die<br />
grobe Struktur bei der Vorstellung der Untersuchungen <strong>und</strong> ihrer Ergebnisse vor. Da sich die<br />
Untersuchung mit der Berichterstattung in der Tageszeitung beschäftigt, bleibt die Darstellung<br />
<strong>im</strong> wesentlichen auf Forschungsergebnisse für Printmedien beschränkt <strong>–</strong> soweit es<br />
nicht notwendig erscheint, auf Interdependenzen z.B. mit der TV-Sportberichterstattung zu<br />
verweisen.<br />
5<br />
Ein Journalist wird als „Mechaniker verkleideter Motorsportfan<strong>“</strong> beschrieben, der sich gerade „in einem Werbespot<br />
[...] zum Affen gemacht hat <strong>–</strong> ganz so wie in seinen Interviews<strong>“</strong> (KLAWITTER/ROSENBACH/WULZINGER<br />
2002, 69).<br />
4
2.2.1 Relevante Untersuchungen<br />
Harald BINNEWIES untersucht in einer Vollerhebung, die keine repräsentativen Aussagen<br />
für die gesamte deutsche Sportberichterstattung zulässt, neun Tageszeitungen unterschiedlicher<br />
Typologien (Verkaufs-, überregionale <strong>und</strong> lokale Zeitungen) über einen Zeitraum von<br />
drei Monaten (BINNEWIES 1975). Die Studie von BINNEWIES steht in der Tradition der Arbeiten,<br />
die darauf angelegt sind, zu überprüfen, inwieweit Sportberichterstattung <strong>und</strong> Realität<br />
übereinst<strong>im</strong>men bzw. wodurch Verzerrungen bedingt sind (vgl. LOOSEN 1997, 11ff.) <strong>–</strong> trotz<br />
der einschränkenden Hinweise, dass es falsch sei, davon auszugehen, dass die Sportpresse<br />
eine getreues Abbild der Sportrealität liefern könne (BINNEWIES 1975, 38ff.).<br />
Die Ergebnisse der Untersuchung von Siegfried WEISCHENBERG, mit der zentralen These<br />
vom Sportjournalist als „Außenseiter der Redaktion<strong>“</strong>, waren trotz methodischer Kritik lange<br />
Jahre richtungsweisend (vgl. GÖRNER 1995, 66; WEISCHENBERG 1976). Nach mündlichen<br />
Intensiv-Interviews mit 47 systematisch ausgewählten Presse- <strong>und</strong> R<strong>und</strong>funk-<br />
Sportjournalisten stellt WEISCHENBERG u.a. fest, dass weit mehr als die Hälfte der befragten<br />
Sportjournalisten ein enges Verhältnis zu den Sportlern, über die sie berichten, als nicht<br />
richtig empfindet.<br />
THOMAS vergleicht 83 Sportinterviews, die <strong>im</strong> ZDF <strong>und</strong> <strong>im</strong> DDR-Fernsehen ausgestrahlt<br />
wurden (THOMAS 1988). Positive Bestätigungen, Lob <strong>und</strong> Glückwünsche lassen laut THO-<br />
MAS das Aktuelle Sportstudio wie auch die Sportsendungen <strong>im</strong> DDR-Fernsehen zu PR-<br />
Veranstaltungen der Sieger werden. Negativ-Themen sind quasi nicht existent. Dissens, Kritik<br />
<strong>und</strong> Widersprüche werden vermieden. Auf das Nachhaken wird verzichtet.<br />
Schwierigkeiten <strong>im</strong> engen Verhältnis zwischen Berichterstatter <strong>und</strong> Berichterstattungsgegenstand<br />
weist Udo LUDWIG mit Intensiv-Interviews von 13 Tageszeitungs-Sportjournalisten<br />
<strong>und</strong> fünf leitenden Vertretern des Fußballb<strong>und</strong>esligavereins Borussia Dortm<strong>und</strong> nach (LUD-<br />
WIG 1987). Danach besteht ein „engmaschiges Netz der Beziehungen<strong>“</strong> mit häufigen Kontakte,<br />
wobei es teilweise so weit geht, dass sich einige Journalisten von Vereinspräsident <strong>und</strong><br />
„Rechtsanwalt Rauball juristisch vertreten lassen<strong>“</strong> (ebd., 214 <strong>und</strong> 329). Die Beziehung der<br />
Journalisten zum Fußballclub wird von LUDWIG als sehr emotional eingeschätzt.<br />
Günter TEWES beschäftigt sich in seiner Dissertation „Kritik der Sportberichterstattung<strong>“</strong> mit<br />
der Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung von acht Zeitungen (TEWES 1991). Seine forschungsleitende<br />
Frage lautet: „Nach welchen Regeln konstruieren die verschiedenen Tageszeitungen<br />
der Düsseldorfer Presse den Sport als Medienthema?<strong>“</strong> (ebd., 72). Der Autor der Studie ordnet<br />
nicht best<strong>im</strong>mte Themen der Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung zu, sondern unterscheidet zur<br />
klareren Definition des Begriffes „Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung<strong>“</strong> zwischen der Tiefe der vermittelten<br />
Argumentation: Thematisierung, Hintergr<strong>und</strong>information <strong>und</strong> Interpretation (ebd.,<br />
81ff.). Die Studie sagt aus, dass die Sportpresse zum Teil eine Art Komplementärfunktion<br />
übernommen <strong>und</strong> akzeptiert hat. Überregionale Zeitungen setzen auf Analysen, die Boulevardpresse<br />
auf Geschichten aus dem Privatleben der Sportstars. Die Presse orientiert sich<br />
an der TV-Berichterstattung <strong>und</strong> versucht Nischen zu besetzen, wenn sich auch viele regionale<br />
Blätter weiterhin auf eine 1:0-Berichterstattung beschränken (ebd., 378ff.).<br />
In der „Kölner Studie<strong>“</strong> von Felix GÖRNER wurden 4.087 Sportjournalisten angeschrieben<br />
(GÖRNER 1995). 1.739 (42,55 %) der Angeschriebenen antworteten auf die standardisierte,<br />
schriftliche Befragung, in der es u.a. um Prognosen, den Umgang mit Sportlern <strong>und</strong> das<br />
journalistische Selbstverständnis ging. Bei der repräsentativen Untersuchung wurden 56,7 %<br />
der Befragten der Presse <strong>und</strong> 16,8 % dem Fernsehen zugeordnet.<br />
In ihrer Dissertation überträgt Wiebke LOOSEN die Nachrichtenwerttheorie auf die <strong>Sportjournalismus</strong>forschung,<br />
indem sie elf Tageszeitungstitel (sechs regionale, drei überregionale<br />
Abonnementszeitungen sowie eine regionale <strong>und</strong> eine überregionale Kaufzeitung) eine Woche<br />
<strong>im</strong> März 1995 untersucht (LOOSEN 1997). Ihre Ergebnisse: Die Nachrichtenfaktoren<br />
5
Personalisierung, Elite, Räumliche <strong>Nähe</strong>, Faktizität <strong>und</strong> Ethnozentrismus nehmen den breitesten<br />
Raum ein. Die dominierende Fußballberichterstattung (45 %) weist laut der Studie<br />
außer durch den deutlichen Nationalbezug keine besondere Faktorenstruktur auf, wobei das<br />
Thema Fußball in den Medien auch von einem „Thematisierungseffekt<strong>“</strong> profitiert (ebd., 144).<br />
„Wir <strong>und</strong> die anderen... <strong>–</strong> Nationale Stereotypen <strong>im</strong> Kontext des Mediensports<strong>“</strong>, heißt die<br />
Dissertation von Jens WERNECKEN, in der national codierte Medien- <strong>und</strong> Publikumsbilder<br />
des Sports systematisch untersucht werden (WERNECKEN 2000). Knapp 14.000 Artikel <strong>und</strong><br />
4.500 Fotos des Sportteils von 18 Tageszeitungen (lokale/regionale Abonnementszeitungen,<br />
überregionale Tageszeitungen <strong>und</strong> Straßenverkaufstitel) werden ausgewertet, um Entstehungen,<br />
Qualitäten <strong>und</strong> Funktionen nationaler Stereotypen <strong>im</strong> Mediensport zu analysieren<br />
<strong>und</strong> interpretieren. WERNECKEN resümiert letztlich, dass „über national codierte<br />
Sprachstigmen chauvinistische <strong>und</strong> identifikatorische Haltungen in der Berichterstattung zum<br />
internationalen Sport dokumentiert<strong>“</strong> werden (ebd., 452).<br />
Der Kommunikationswissenschaftler Michael SCHAFFRATH wertet in einer Untersuchung<br />
212 direkt nach einem Spiel geführte Fußball-Interviews aus, die von privaten <strong>und</strong> öffentlichrechtlichen<br />
Sendern geführt wurden (SCHAFFRATH 2000). Das Ergebnis: „Es wird kaum<br />
kritisch gefragt.<strong>“</strong> (BACHNER 2001, 23).<br />
Herdin WIPPER untersucht u.a. mit Flächenanalysen <strong>und</strong> Experteninterviews die Sportberichterstattung<br />
der Presse zu den Fußball-Weltmeisterschaften 1990 <strong>und</strong> 1998. Dazu analysiert<br />
er 5.633 Artikel einer überregionalen Abonnementszeitung, einer Regional- <strong>und</strong> einer<br />
Boulevardzeitung sowie von zwei Sportfachzeitschriften (WIPPER 2003). Die Ergebnisse der<br />
Dissertation zeigen u.a., dass sich die Sportpresse in Übereinst<strong>im</strong>mung mit den Bef<strong>und</strong>en<br />
von TEWES weiter von der reinen Spielberichterstattung abgewandt hat, auch wenn diese<br />
<strong>im</strong>mer noch eine dominierende Stellung einn<strong>im</strong>mt (ebd., 211).<br />
Sportjournalisten rühren pr<strong>im</strong>är die Werbetrommel für die wirtschaftlich zunehmend bedeutendere<br />
Sportindustrie. Zu diesem Schluss kommt die bislang umfassendste internationale<br />
Studie zur Sportberichterstattung in der Tageszeitung mit dem Titel „International Sports<br />
Press Survey<strong>“</strong> (SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 1ff.). Berücksichtigt wurden 37 Tageszeitungen<br />
in zehn Ländern aus drei Kontinenten. In die Auswertung gingen r<strong>und</strong> 10.000 Artikel ein,<br />
die über einen Zeitraum von 14 Tagen erschienen waren. Finanziert wurde die Untersuchung<br />
vom Danish Institute for Sports Studies <strong>und</strong> von Play the Game, einem in Dänemark ansässigen<br />
Netzwerk, das sich für einen kritischen Umgang mit der Sportwelt einsetzt.<br />
Mit Hilfe von Befragungen <strong>und</strong> Inhaltsanalysen belegt Guido ELLERT, dass bei elf von ihm<br />
untersuchten Sportveranstaltungen in Deutschland <strong>im</strong> Jahr 2002 zwischen Sportjournalisten<br />
<strong>und</strong> PR-Managern fre<strong>und</strong>liches Entgegenkommen erkennbar ist (ELLERT 2006). Die 160<br />
Interviewten sind zu 72,3 % Tageszeitungsjournalisten, stammen zu 57 % von Regionalmedien<br />
<strong>und</strong> zu 43 % von überregionalen Zeitungen. Die Werte dieser Dissertation sind nicht<br />
repräsentativ für die betroffenen Berufsfelder <strong>im</strong> allgemeinen, aber es werden Tendenzen<br />
deutlich, die <strong>im</strong> Hinblick auf den Vorwurf der mangelnden <strong>Distanz</strong> von Sportjournalisten relevant<br />
sind.<br />
Die Sportberichterstattung ist <strong>im</strong> Bereich „spontaner<strong>“</strong> Erklärungen von Leistungen ein geeignetes<br />
Forschungsfeld für die Attributionstheorie (vgl. BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 179).<br />
Journalisten attribuieren in den meisten Fällen „spontan<strong>“</strong>, d.h. dass sportlichen Leistungen<br />
ohne exper<strong>im</strong>entelle Aufforderung unter Rückgriff auf best<strong>im</strong>mte Informationen Ursachen<br />
zugeschrieben werden. Dabei werden bei Ursachenzuschreibungen der Sportjournalisten<br />
genauso wie bei denen der Athleten Attributionsmuster oder attributionale Verzerrungen gef<strong>und</strong>en:<br />
Erfolgreiche Personen neigen dazu, internal <strong>und</strong> stabil zu attribuieren. Diese Tendenz<br />
lässt sich sowohl bei Akteuren als auch bei Beobachtern feststellen. Bei der Berichterstattung<br />
von Sportlern kann in der Regel „eine Tendenz zu quasi stellvertretenden Selbstwerterhöhung<br />
oder -erhaltung<strong>“</strong> festgestellt werden (STRAUSS/MÖLLER 1996, 38). Die In-<br />
6
volviertheit oder mangelnde <strong>Distanz</strong> der Journalisten findet in der Art <strong>und</strong> Weise ihrer Berichterstattung<br />
messbaren Niederschlag. Oder anders formuliert: „Aus neutraler <strong>Distanz</strong> ergeben<br />
sich andere Perspektiven.<strong>“</strong> (STIEHLER/MARR 2001, 126).<br />
2.2.2 Einzelne Kritikpunkte aus Forschungsergebnissen<br />
In den folgenden Abschnitten werden kurz die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen<br />
dargestellt, die in Bezug auf mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> relevant sind.<br />
Da die meisten dieser folgenden thematisch geordneten Blöcke der Kritik später nur in Teilaspekte<br />
überführt werden <strong>und</strong> damit nicht allein den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit<br />
darstellen, ist der jeweilige Kurzüberblick gerechtfertigt, um nicht den wissenschaftlichen<br />
Hintergr<strong>und</strong> unnötig ausführlich zu behandeln. 6<br />
2.2.2.1 Journalisten mit Sportlervergangenheit<br />
GÖRNER ermittelt, dass vier von fünf Sportjournalisten früher selbst <strong>im</strong> Leistungssport aktiv<br />
waren. Bei einer analogen Befragung internationalen Charakters findet Sybille FRÜTEL heraus,<br />
dass 66,8 % der Sportjournalisten früher Wettkampfsport betrieben haben. Die „innere<br />
<strong>Nähe</strong> zum Sujet Sport [prägt] sicherlich den <strong>Sportjournalismus</strong><strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 208; vgl.<br />
FRÜTEL 2005, 227; NAUSE 1987, 243). WEISCHENBERG bemerkt, dass Sportjournalisten<br />
sich meistens aus der sportlichen Praxis rekrutieren <strong>–</strong> daraus haben sie ihr Sportverständnis<br />
gebildet. Sport hat ihrer Meinung nach in erster Linie die Aufgabe der Ges<strong>und</strong>erhaltung<br />
(WEISCHENBERG 1976, 288). BINNEWIES gibt in seiner Untersuchung an, dass 40 % der<br />
Sportjournalisten aus dem Leistungssport stammen (BINNEWIES 1975, 166). Bei ELLERTS<br />
Untersuchung haben r<strong>und</strong> 45 % der Print-Journalisten eigene Erfahrungen in der Sportart<br />
gemacht, über die sie berichten. Fußball wird von einem Großteil (83,3 %) der Journalisten<br />
auch selbst ausgeübt (vgl. ELLERT 2006, 304f.). Die wichtigste Voraussetzung für kompetente<br />
sportjournalistische Arbeit ist, früher selbst einmal aktiv Sport getrieben zu haben,<br />
glaubt in der Studie von SCHAFFRATH zumindest die Mehrzahl der befragten Spitzensportler<br />
(SCHAFFRATH 2007a, 37).<br />
2.2.2.2 Mitglieder in Sportvereinen<br />
Über 71 % der Befragten sind nach GÖRNER Mitglied in einem oder in mehreren Sportvereinen,<br />
was der Autor der Studie als einen Indikator für die enge Beziehung zwischen Sportjournalisten<br />
<strong>und</strong> ihrem Berichterstattungsgegenstand ansieht (GÖRNER 1995, 212ff.). Bei<br />
FRÜTEL sind es knapp drei Viertel, die in einem oder mehreren Sportclubs aktiv sind.<br />
„Die <strong>Nähe</strong> zum Sport bringt Vor- <strong>und</strong> Nachteile. Auf der einen Seite stehen Verständnis, Erfahrungsschatz<br />
<strong>und</strong> Nachvollziehbarkeit, die zusammengenommen zur Fachkompetenz beitragen, auf der anderen<br />
Seite steht eventuell die fehlende <strong>Distanz</strong>, die eine kritische Berichterstattung unmöglich macht.<strong>“</strong><br />
(FRÜTEL 2005, 228).<br />
2.2.2.3 Ereignis- <strong>und</strong> ergebniszentriert<br />
Die Ergebnisse der Studie von WERNECKEN zeigen, dass fast drei Viertel der Texte zu den<br />
informierenden Darstellungsformen gezählt werden können. Kommentare machen 3,9 % der<br />
erfassten Beiträge aus, wobei die verschiedenen Zeitungstypen meinungsäußernde Darstellungsform<br />
quantitativ unterschiedlich einsetzen. Bei den Themen dominiert die reine Ereignisberichterstattung<br />
<strong>–</strong> übereinst<strong>im</strong>mend damit sind über 85 % der Handlungsträger in Texten<br />
<strong>und</strong> auf Fotos aktive Sportler (WERNECKEN 2000, 293ff.; vgl. GLEICH 2000, 511;<br />
SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 3; ELLERT 2006, 264).<br />
6 Allein <strong>im</strong> Kapitel 2.2.2.10 Selbstwertdienliche Ursachenzuschreibungen könnte ausführlich Entwicklung <strong>und</strong><br />
Bandbreite der Attributionstheorien sowie ihre Anwendung auf die Sportberichterstattung <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
speziellen Probleme dargestellt werden (vgl. FRIEDRICH 1997).<br />
7
WIPPER zeigt, dass die Sportpresse in den vergangenen Jahren vermehrt von der reinen<br />
Spielberichterstattung abgerückt ist, aber die Möglichkeit sich gegenüber dem Fernsehen zu<br />
profilieren nur ungenügend ausgeschöpft, weil sie nicht konsequent alle Chancen nutzt, ihre<br />
Komplementärfunktion auszufüllen, da unter Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung häufig die Analyse<br />
des Spielgeschehens oder das Aufgreifen von Human-Interest-Stories verstanden wird. Die<br />
tatsächlichen Hintergründe werden so ausgeblendet. Es besteht „eine Konvergenz zwischen<br />
Fernseh- <strong>und</strong> Pressesportberichterstattung [...], da beide weiterhin <strong>stark</strong> ereignisabhängig<br />
gestaltet werden<strong>“</strong> (WIPPER 2003, 213). TEWES stellt zuvor fest, dass Regionalzeitungen in<br />
seiner Untersuchung am häufigsten auf 1:0-Berichterstattung setzen (TEWES 1991, 378).<br />
Laut BINNEWIES konzentriert sich die Berichterstattung in seinem Untersuchungszeitraum<br />
fast ausschließlich auf Leistungssport. Damit werden fast zwangsläufig z.B. sportpolitische,<br />
sportgesellschaftliche <strong>und</strong> sportwissenschaftliche Themen, aber auch Fragen der zunehmenden<br />
Kommerzialisierung <strong>und</strong> der Einflussnahme von Wirtschaft <strong>und</strong> Medien oder die<br />
Thematisierung von Doping <strong>und</strong> Gewalt, vernachlässigt (BINNEWIES 1975, 144; vgl.<br />
GLEICH 2000, 512; LOOSEN 2001, 140ff.).<br />
Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel „International Sports Press Survey<strong>“</strong> zeigen, dass die<br />
Prioritäten <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> überall fast die gleichen sind: 58 % der analysierten Artikel<br />
befassen sich mit einem Sportanlass, nur einer von 30 Artikeln beleuchtet sportpolitische<br />
Aspekte, lediglich 1,5 % setzen sich mit der Thematik Doping auseinander, nur 6 % behandeln<br />
sportökonomische Themen. Der soziale Aspekt von Sport spielt nur bei 2,5 % der Berichte<br />
eine Rolle.<br />
„We need to acknowledge that we have created a ghetto of sports coverage. A ghetto of sports results,<br />
entertainment and top events catering to a narrow interest. By pigeonholing issues and editorial staff,<br />
we have lost the attention of readers who are interested in issues such as sports in relation to business,<br />
health and keeping fit, local voluntary work and so forth.<strong>“</strong> (SCHULTZ JÖRGENSEN 2002, 3f.).<br />
Themen abseits der Stadionscheinwerfer kommen bei deutschen Zeitungen genauso zu<br />
kurz. So weisen in den 1.741 Artikeln aus den in der internationalen Studie untersuchten<br />
sechs deutschen Tageszeitungen (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), Bild-Zeitung, Hannoversche<br />
Allgemeine Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Hamburger Abendblatt) die<br />
Themen Sportpolitik (113 Artikel), Fan-Kultur (49) oder Doping (42) eher den Status von<br />
Randnotizen auf (ebd., 3).<br />
Sportjournalisten selbst sind laut LERCH zu 70 % der Meinung, dass zu wenig über Problemfelder<br />
berichtet wird (LERCH 1990, 22). „Eher wird in den Medien eine heile Welt des<br />
Sports aufrechterhalten, deren Bedrohung durch negative Ereignisse, wie zum Beispiel randalierende<br />
Fans, Dopingskandale etc. nur unzureichend <strong>und</strong> einseitig kommentiert werden.<strong>“</strong><br />
(GLEICH 2000, 512; vgl. KÖSTNER 2005, 236). „Das Sportressort bleibt in seinem Unterhaltungsanspruch<br />
an der Oberfläche haften.<strong>“</strong> (ebd.). Auch WEISCHENBERG attestiert, dass<br />
Sportjournalisten sportgesellschaftlichen Themen wenig Platz einräumen. Sport hat ihrer<br />
Meinung nach nichts mit Politik zu tun (WEISCHENBERG 1976, 291). Martina NAUSE stellt<br />
in ihrer Fallstudie, die WEISCHENBERGS Untersuchung aktualisieren soll, mit dem Vermerk<br />
auf die mögliche Beeinflussung durch das Phänomen der Sozialen Wünschbarkeit, Hinweise<br />
auf einen „Umdenkungsprozess<strong>“</strong> fest. Über die Hälfte der Befragten geben an, Sport <strong>und</strong><br />
Politik seien nicht zu trennen (NAUSE 1987, 236).<br />
SCHAFFRATH analysiert in seiner Untersuchung von Sportinterviews, dass <strong>im</strong> Mittelpunkt<br />
der Interviews vorrangig das aktuelle Spiel steht, selten werden hintergründige Themen angesprochen,<br />
was insgesamt somit eine gewisse Gültigkeit der Ereignisfixierung auch für das<br />
Interview in der Sportberichterstattung anzeigt (SCHAFFRATH 2000, 154).<br />
Sportjournalisten wollen laut WEISCHENBERG vor allem objektiv informieren. „Der Sport<br />
[wird] als gesellschaftlicher Freiraum ideologisch vernebelt. [...] Eine kritische Reflexion des<br />
Sports findet in den Sportteilen <strong>und</strong> Sportsendungen nicht statt.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1976,<br />
8
327). BINNEWIES kritisiert, dass sich die Sportberichterstattung „weitgehend auf eine Reproduktion<br />
beschränkt<strong>“</strong> (BINNEWIES 1975, 154). GÖRNER präsentiert knapp 20 Jahre später<br />
diese Ergebnisse: Sportjournalisten sehen es als oberste Pflicht an, neutral <strong>und</strong> sachlich<br />
zu informieren (99,2%). Die Unterhaltungsfunktion steht mit 71,1 % an dritter Stelle. An zweiter<br />
Stelle möchten die Journalisten Missstände kritisieren (83%) (GÖRNER 1995, 246ff.).<br />
Ähnliche Ergebnisse liefert FRÜTEL in ihrer internationalen Studie (FRÜTEL 2005, 232).<br />
2.2.2.4 Konfliktfreiheit<br />
In der logischen Anlehnung an die oben dargestellte Fixierung auf Informationsvermittlung<br />
<strong>und</strong> Ereignisberichterstattung kommen Kommentare <strong>–</strong> wie bereits erwähnt <strong>–</strong> in der Sportberichterstattung<br />
<strong>im</strong> Vergleich zu anderen journalistischen Stilformen seltener vor (vgl. BIN-<br />
NEWIES, 161; WERNECKEN 2000, 293ff.; ELLERT 2006, 264). „Trotz betonter Funktion,<br />
Missstände zu kritisieren, muss sich gerade die Sportberichterstattung Vorwürfe wegen<br />
mangelnder Kritik- <strong>und</strong> Kontrollfunktion gefallen lassen.<strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 265). GÖRNER<br />
verweist allerdings auf medienbedingte <strong>und</strong> altersspezifische Unterschiede.<br />
BINNEWIES schreibt, dass „auf die Chance der Einflussnahme, der Kontrolle <strong>und</strong> der Kritik<strong>“</strong><br />
meistens verzichtet wird (BINNEWIES 1975, 190). Die Sportberichterstattung „beraubt sich<br />
einer ihrer ureigensten Funktionen<strong>“</strong> (ebd., 161), denn „den naiven, unschuldigen Sport <strong>im</strong><br />
Sinne einer schönsten Nebensache der Welt gibt es nicht mehr<strong>“</strong> (ebd., 165). TEWES erinnert<br />
daran, dass vor allem die Sportpresse <strong>im</strong> Mittelpunkt dieser Kritik stehen sollte, da nicht die<br />
Erstinformation, sondern z.B. die Kommentierung <strong>im</strong> Unterschied zum Fernsehen als „herausragende<br />
Stärke dieses Mediums bezeichnet<strong>“</strong> wird (TEWES 1991, 80).<br />
LOOSEN urteilt, dass der Nachrichtenfaktor Kontroverse so gut wie keinen Einfluss auf die<br />
Sportberichterstattung hat. Als kontrovers codierte Beiträge sind bei ihr fast zur Hälfte nur<br />
kurze Meldungen. „Qualitätszeitungen weisen insgesamt eine signifikant erhöhte Tendenz zu<br />
kontroversen Nachrichten auf.<strong>“</strong> (LOOSEN 1997, 200).<br />
Das Fehlen journalistischer Kritik hat THOMAS bei Untersuchungen von TV-Interviews <strong>im</strong><br />
ZDF <strong>und</strong> <strong>im</strong> Fernsehen der DDR festgestellt. „Vertraulichkeiten zwischen den Sprechern<br />
demonstrieren gegenüber der Öffentlichkeit eine Interviewatmosphäre der Harmonie <strong>und</strong> der<br />
absoluten Konfliktfreiheit. In solchen Situationen profiliert sich der Interviewer coram publico<br />
als Int<strong>im</strong>us des Sport-Stars.<strong>“</strong> (THOMAS 1988, 189). Sowohl be<strong>im</strong> ZDF als auch be<strong>im</strong> DDR-<br />
Fernsehen verwenden die Interviewer einen Teil der Zeit darauf, „Erfolge über Belobigungen<br />
<strong>und</strong> Beglückwünschungen zu zelebrieren<strong>“</strong> (ebd., 218). Affektive Teilnahme <strong>und</strong> völlige <strong>Distanz</strong>unfähigkeit<br />
beherrschen das Interviewhandeln. Den Sportbeiträgen der jeweiligen Sender<br />
ist gemein, dass ein unausgesprochenes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Interviewer<br />
<strong>und</strong> Befragtem aufgebaut wird.<br />
„Unabhängig von der Verschiedenheit jeweiliger Motive <strong>und</strong> Interessen der Akteure in beiden deutschen<br />
Staaten [...] ist die Kooperationswilligkeit offensichtlich ein Anliegen aller Beteiligten. Diese vorherrschende<br />
Prinzipientreue lässt Gr<strong>und</strong>legendes über das Verhältnis der Interviewpartner zueinander<br />
erkennen: gegenseitige Abhängigkeit. Wenn sich auch ein Ausbruch aus der Symbiose von Befragtem<br />
nicht gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>und</strong> nicht <strong>im</strong>mer folgenschwer als existentielle Frage stellen muss, so ist doch allein<br />
dessen Seltenheit ausreichendes Indiz für die Gewichtigkeit <strong>und</strong> Tragweite der so scheinbar lapidaren<br />
Aussage von Franz Beckenbauer: (...) denn wir leben ja voneinander.<strong>“</strong> (ebd., 225f.)<br />
SCHAFFRATH kommt nach der Analyse von Fernseh-Interviews mit Sportlern zu dem Ergebnis,<br />
dass ARD <strong>und</strong> ZDF von allen untersuchten Sendern <strong>im</strong> Beobachtungszeitraum relativ<br />
gesehen den geringsten Bewertungsgrad aufweisen.<br />
„Eigentlich hätte man erwarten können, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender dem gesellschaftlichen<br />
Auftrag journalistischer Kritik <strong>und</strong> Kontrolle auch bei der Stilform ,Interview’ stärker nachkommen<br />
als die privatwirtschaftliche Konkurrenz.<strong>“</strong> (SCHAFFRATH 2000, 154).<br />
9
SCHAFFRATH zieht das Fazit: „Das Fußballinterview ist keine Bühne für Konflikthaltiges.<br />
Offene Kritik an einzelnen Spielern ist eher selten, an Trainern eine absolute Ausnahme <strong>und</strong><br />
an Funktionären eigentlich völlig <strong>und</strong>enkbar.<strong>“</strong> (ebd., 78). Kommen wertende Äußerungen vor,<br />
so sind mehr als zwei Drittel (68,6 %) der Einschätzungen positiv. „Legendär ZDF-Mann Rolf<br />
Töpperwien. Frage an Mario Basler vom 1. FC Kaiserslautern. ,Ich <strong>fand</strong> <strong>dich</strong> <strong>stark</strong>!’ Basler:<br />
,Da sind Sie aber der Einzige.’<strong>“</strong> (BACHNER 2001, 23).<br />
2.2.2.5 Entertainer statt distanziert-zurückhaltende Vermittler<br />
Zwei Jahrzehnte nach seiner ersten Untersuchung der Sportjournalisten spricht WEI-<br />
SCHENBERG von einer „Reduzierung der Außenseiterstellung<strong>“</strong>, während GÖRNER den<br />
Sportjournalisten den Übergang „vom Außenseiter zum Aufsteiger<strong>“</strong> mit der dominierenden<br />
Selbstbeschreibung der Unterhalterrolle der Berufsgruppe bescheinigt (WEISCHENBERG<br />
1994, 428f.; GÖRNER 1995, 245ff.). Dieses Funktionsverständnis sei aber medienbedingt<br />
<strong>und</strong> altersspezifisch zu betrachten, wobei das Unterhaltungsmotiv seit der Einführung des<br />
Fernsehens in den Presseberichten eine größere Rolle spielt (RICHTER 1997, 68). Laut<br />
GÖRNERS „Kölner Studie<strong>“</strong> hat die Unterhaltungsfunktion bei jüngeren Kollegen eine höhere<br />
Akzeptanz. Während sich Sportjournalisten privatrechtlicher Sender als Entertainer verpflichtet<br />
sehen (88,3%), sind es bei den Printkollegen 68,7 %. GÖRNER stellt heraus, dass die<br />
distanziert-zurückhaltende Rolle als Vermittler linear an Akzeptanz <strong>und</strong> Aktualität verliert, je<br />
jünger die Sportjournalisten sind, während linear die Zust<strong>im</strong>mung zur Unterhaltungsfunktion<br />
steigt (GÖRNER 1995, 251f.; vgl. GLEICH 2000, 512f.).<br />
Die Unterhaltungsfunktion hat laut WEISCHENBERG <strong>im</strong> Journalismus insgesamt an Relevanz<br />
<strong>und</strong> Akzeptanz gewonnen. „Für den <strong>Sportjournalismus</strong> bedeutet dies gewiss, dass die<br />
Schere zwischen beruflichem Bewusstsein <strong>und</strong> beruflicher Wirklichkeit zusammengeht.<strong>“</strong><br />
(WEISCHENBERG 1994, 447; vgl. FRÜTEL 2005, 143). Damit gibt es zwei unterschiedliche<br />
Deutungen der Bef<strong>und</strong>e: Die einen bescheinigen den Sportjournalisten „den Übergang vom<br />
Außenseiter zum Aufsteiger<strong>“</strong> <strong>und</strong> damit eine Aufwertung der Unterhalterrolle (GÖRNER<br />
1995). Die anderen sprechen von der „Annäherung an die Außenseiter<strong>“</strong>, da sich die Leistungen<br />
des Journalismus insgesamt denen des <strong>Sportjournalismus</strong> angenähert haben, weil es <strong>im</strong><br />
Journalismus allgemein Prozesse zunehmender Entertainisierung <strong>und</strong> Kommerzialisierung<br />
gibt (WEISCHENBERG 1994).<br />
Die sportlichen Medieninhalte charakterisiert LOOSEN als „ein echtes Hybrid aus Information<br />
<strong>und</strong> Unterhaltung, sowohl auf Seiten der Anbieter als auch auf Seiten der Rezipienten<strong>“</strong>. Die<br />
Sportberichterstattung unterscheide sich durch ihren faktischen Charakter aber von rein fiktionaler<br />
Unterhaltung, was erklären könnte, warum dem Mediensport mehr Relevanz zugesprochen<br />
wird (LOOSEN 2001, 137ff.; vgl. GLEICH 2000, 515). „Jedoch nur für einen kleineren<br />
Teil der Zuschauer hat Sport pr<strong>im</strong>är Informations- bzw. Modellfunktion. [...] Ein weitaus<br />
größerer Teil der Zuschauer ist jedoch an Sport pr<strong>im</strong>är wegen seiner Unterhaltungs-<br />
<strong>und</strong>/oder Anregungsfunktion interessiert.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
Immer wieder muss das (angebliche) Leserverlangen nach Unterhaltung auf den Sportseiten<br />
als Rechtfertigung herhalten, wie es Bild-Redakteur Ach<strong>im</strong> Stecker formuliert: „The readers<br />
prefer to see how football stars live, the cars they drive and who they are married to than to<br />
read about doping, sponsors and political power games in the sports federations. So we<br />
make our priorities accordingly. It is logical.<strong>“</strong> (SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 5).<br />
Journalisten der Tageszeitungen geben laut LUDWIG an, dass unterhaltsame <strong>und</strong> Recherche<br />
erfordernde Hintergr<strong>und</strong>informationen ihre Berichterstattung best<strong>im</strong>men. Folglich sind<br />
Kontakte unerlässlich, denn die Informationen für solche Texte sind nicht durch bloßes Zuschauen<br />
von der Tribüne erhältlich (LUDWIG 1987, 281f.). WEISCHENBERG beschreibt das<br />
Abhängigkeitsverhältnis:<br />
10
„Der Sportjournalist ist heute [...] auf einen so engen Kontakt zu seinem journalistischen Gegenstand<br />
angewiesen, wie wohl in keiner publizistischen Sparte sonst üblich. Auf der Suche nach Hintergründen<br />
des Sports <strong>im</strong> Sinne der Unterhaltungsfunktion muss der Sportjournalist [...] mit dem Sportler, mit dem<br />
Star, paktieren. [...] Von einer Kumpanei zwischen einem Teil der Sportjournalisten <strong>und</strong> einem Teil der<br />
Sportler zu sprechen, geht wohl nicht an den Realitäten vorbei. Wenn eine der beiden Seiten die Verhaltenserwartungen<br />
einmal kurzzeitig nicht erfüllt, also etwa heftige Kritik übt oder Informationen vorenthält,<br />
wird der Streit <strong>im</strong> Interesse der gemeinsamen Sache schnell beigelegt.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG<br />
1976, 277f.).<br />
FRÜTEL zieht allerdings aus den Ergebnissen ihrer Frage nach dem Einschätzen des beruflichen<br />
Verhältnisses zu Sportlern den gegenteiligen Schluss zu den Folgerungen LUDWIGS:<br />
„Die zunehmende Kommerzialisierung <strong>und</strong> <strong>im</strong>mer stärker ausgeprägte Unterhaltungsfunktion<br />
führt dafür häufiger zu einem eher neutralen Umgang.<strong>“</strong> (FRÜTEL 2005, 310). Manuela<br />
KÖSTNER merkt an, dass „die Unterhaltungsorientierung kein Hinderungsgr<strong>und</strong><strong>“</strong> ist, trotzdem<br />
kritisch über den Sport, seine Akteure <strong>und</strong> Problemfelder des Sports zu reflektieren<br />
(KÖSTNER 2005, 238).<br />
2.2.2.6 Enge Kontakte zu Sportlern<br />
Nach mündlichen Intensiv-Interviews mit 47 systematisch ausgewählten Presse- <strong>und</strong> R<strong>und</strong>funk-Sportjournalisten<br />
stellt WEISCHENBERG u.a. fest, dass weit mehr als die Hälfte der<br />
befragten Sportjournalisten ein enges Verhältnis zu den Sportlern, über die sie berichten, als<br />
nicht richtig empfindet. Er fragt: „Halten Sie es für richtig oder falsch, wenn sich Sportjournalisten<br />
mit Sportlern, über die sie ständig berichten, duzen?<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1976, 278).<br />
Der Autor der Studie folgert, dass den meisten Sportjournalisten die mögliche Gefährdung<br />
der journalistischen Freiheit durch enge Kontakte durchaus bewusst sei. Allerdings weist<br />
WEISCHENBERG darauf hin, dass von den befragten Lokalsportjournalisten die Hälfte einen<br />
engen Kontakt nicht als falsch empfindet, was seiner Meinung darauf hindeutet, dass die<br />
Einstellung mit der Entfernung zum Berichterstattungsobjekt zusammenhängt (vgl. ebd.,<br />
279). Vielfach wird angemerkt, dass freie Mitarbeiter in den Lokalsportredaktionen eine noch<br />
geringere <strong>Distanz</strong> zum lokalen Sport besitzen (ROHRBERG 1982, 127ff.).<br />
NAUSE ermittelt in ihrer Aktualisierung der WEISCHENBERG-Daten mit einer Fallstudie<br />
eine größere <strong>Distanz</strong>losigkeit, wobei sie darauf aufmerksam macht, dass die Antworten bei<br />
der Frage nach Tabus in der Berichterstattung in die andere Richtung weisen (NAUSE 1987,<br />
242). Ein knappes Drittel der Befragten hält das Duzen für richtig, ein Drittel stuft es als<br />
falsch ein. Die meisten Befragten entziehen sich durch die Wahl der Kategorie „kommt darauf<br />
an<strong>“</strong> einer eindeutigen Entscheidung. Bei LERCH hält es die Hälfte der Befragten für richtig,<br />
sich zu duzen <strong>–</strong> 47 % waren teilweise oder völlig dagegen (LERCH 1989, 131; LERCH<br />
1990, 21). GÖRNER folgert daraus: „In den 80er Jahren stieg die <strong>Distanz</strong>losigkeit zwischen<br />
Berichterstatter <strong>und</strong> Sujet.<strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 403).<br />
Trotz des gestiegenen Ansehens des <strong>Sportjournalismus</strong> sieht WEISCHENBERG 1994 angesichts<br />
vieler „Indizienbeweise<strong>“</strong> keinen Anlass, dem <strong>Sportjournalismus</strong> eine bessere Qualität<br />
zu unterstellen.<br />
„Nach wie vor lässt ein Teil der Fernseh-Moderatoren bei der Befragung von Spitzensportlern nicht<br />
einmal Ansätze einer journalistischen Interviewtechnik erkennen; nach wie vor spielen sich vor den<br />
Fernsehkameras regelrechte Verbrüderungsszenen mit emsigem Duzen ab. [...] Nach wie vor gibt es<br />
auch politische Ahnungslosigkeit <strong>und</strong> Naivität unter den Sportjournalisten. Vielen fehlt weiterhin <strong>–</strong> <strong>und</strong><br />
mehr denn je <strong>–</strong> eine kritische journalistische <strong>Distanz</strong> zu den Sportlern, mit denen sie beruflich zu tun<br />
haben.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994, 447f.).<br />
Die „Kölner-Studie<strong>“</strong> eruiert, dass über 43 % der Befragten ihr Verhältnis zu Sportlern als<br />
„neutral<strong>“</strong> bezeichnen <strong>–</strong> 37,7 % geben an, „fre<strong>und</strong>schaftlich<strong>“</strong> mit Sportlern umzugehen, jeder<br />
fünfte Sportjournalist stuft sein Verhältnis als „kritisch<strong>“</strong> ein (GÖRNER 1995, 403ff.). FRÜTEL<br />
stellt eine ähnliche Verteilung bei ihrer Befragung mit internationalem Charakter fest (FRÜ-<br />
TEL 2005, 309ff.). Je jünger die befragen Sportberichterstatter, desto distanzloser ihr selbst<br />
11
eingeschätzter Umgang mit ihren Berichterstattungsobjekten (GÖRNER 1995, 416). GÖR-<br />
NER schreibt zu den möglichen Konsequenzen, die sich aus einem engen Verhältnis ergeben<br />
können:<br />
„Die Streitfrage bleibt jedoch bestehen, ob trotz eines fre<strong>und</strong>schaftlich-„kumpelhaften<strong>“</strong> Verhältnisses zu<br />
Sportlern die Journalisten noch in der Lage sind, kritisch-distanziert über sie zu berichten. Unbestreitbar<br />
bleibt, dass notwendige <strong>und</strong> sachlich-f<strong>und</strong>ierte Kritik am Sportler für den Journalisten <strong>im</strong>mer schwieriger<br />
wird, je enger er mit ihm verb<strong>und</strong>en ist.<strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 406).<br />
GÖRNER äußert die Vermutung:<br />
„Durch die steigende Unterhaltungsorientierung <strong>und</strong> den härteren medialen Konkurrenzkampf kann davon<br />
ausgegangen werden, dass auch in Zukunft das Verhältnis zwischen Athlet <strong>und</strong> Journalist ressortspezifisch<br />
eng bleiben wird, was die Antworten gerade der jüngeren Generation unterstreichen. Das<br />
Problem bleibt, ob trotz wachsender <strong>Distanz</strong>losigkeit <strong>–</strong> nicht nur der Boulevardpresse <strong>–</strong> kritischdistanziert<br />
über den Sport berichtet <strong>und</strong> notwendige, sachlich-f<strong>und</strong>ierte Kritik geäußert werden kann.<br />
Die Gefahr der Hofberichterstattung bleibt bestehen. Allerdings haben diese Bef<strong>und</strong>e nur tendenziellen<br />
Charakter <strong>und</strong> müssen durch spezielle Untersuchungen vertieft werden.<strong>“</strong> (ebd., 407).<br />
In der aktuellen Studie „Spitzensport & Journalismus<strong>“</strong> aus dem Jahr 2007 untersucht<br />
SCHAFFRATH u.a., ob Sportler ihre Beziehungen zu Sportjournalisten als symbiotisch ansehen.<br />
Die meisten Sportler sehen laut der Untersuchung ihr zwischenmenschliches Verhältnis<br />
zu Journalisten als „fre<strong>und</strong>lich<strong>“</strong>, aber nicht als „fre<strong>und</strong>schaftlich<strong>“</strong> an, die wenigsten<br />
zählen Medienvertreter zu ihren Fre<strong>und</strong>en. SCHAFFRATH folgert: „Damit ist das häufig kultivierte<br />
Klischee der ,Clique von Kumpeln’ nicht mehr haltbar, weil es aus Sicht der Profisportler<br />
keineswegs zutrifft.<strong>“</strong> (SCHAFFRATH 2007a, 37). Geht die unterstellte Fre<strong>und</strong>schaft von<br />
den Journalisten aus?<br />
2.2.2.7 Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<br />
„Ob Waldi mit Hanni oder Poschi mit Anni: Man kennt sich. Man duzt sich. Man schätzt sich. Und <strong>–</strong> man<br />
braucht sich. Die Athleten müssen auch bei sportlichem Totalausfall keine Angst vor verbalen Bodychecks<br />
haben. Viel größer ist die Gefahr, dass sie von einem mitfühlenden Reporter in den Arm genommen<br />
werden.<strong>“</strong> (KLAWITTER/ROSENBACH/WULZINGER 2002, 68).<br />
WERNECKEN listet neben dem bereits erwähnten Duzen, das allerdings in der Berichterstattung<br />
der Presse zumindest in den Zeitungstexten nicht untersucht werden kann, weil Gesprächssituationen<br />
nicht wie <strong>im</strong> Fernsehen beobachtet werden können, weitere Sprachvariablen<br />
auf, die für mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> sprechen können.<br />
„<strong>Distanz</strong>losigkeit gegenüber den Aktiven des Sports, vorgetäuschte Int<strong>im</strong>ität oder die den Sportjournalisten<br />
vielfach attestierte ,Verbrüderung’ mit Sportlerinnen <strong>und</strong> Sportlern äußern sich verbal durch die<br />
Praxis des ,Duzens’, des alleinigen Vornamensgebrauchs oder auch in Verballhornungen von Namen<br />
wie Klinsi oder Schumi.<strong>“</strong> (WERNECKEN 2000, 242).<br />
Solch vorgetäuschte <strong>Nähe</strong> wird insgesamt in 18 % der Texte festgestellt, in 19 % der Artikel<br />
wird die Benennung der Aktiven mit Spitznamen eruiert. Identifikation mit den „deutschen<br />
Vertretern <strong>im</strong> internationalen Sport<strong>“</strong> über Sprachvariable wie „wir<strong>“</strong> oder „unser<strong>“</strong> wird für r<strong>und</strong><br />
4 % der Textbeiträge nachgewiesen. WERNECKEN zieht das Fazit, dass der Sprachgebrauch<br />
<strong>im</strong> Sport der Tagespresse in weiten Teilen konvergent ist <strong>und</strong> dass auch in Bezug<br />
zum TV-Sport <strong>–</strong> was Themen, Berichterstattungsperspektiven <strong>und</strong> Darstellungsmuster betrifft<br />
<strong>–</strong> „weitreichende intermediäre Übereinst<strong>im</strong>mungen<strong>“</strong> festzustellen sind. (ebd., 363).<br />
Diese Ergebnisse sprechen seiner Meinung nach „deutlich gegen eine zum TV-Sport alternativ-komplementäre<br />
Funktion des Tageszeitungssports <strong>und</strong> stattdessen für einen intermediär<br />
vorherrschenden ,Mainstream’<strong>“</strong> (ebd., 447). WERNECKEN schränkt diese Konvergenz-<br />
Schlussfolgerung allerdings ein, indem er schreibt, dass „Sprachstigmatisierungen<strong>“</strong> <strong>im</strong> TV-<br />
Sport vorrangig in informativ-unterhaltenden Beiträgen zum Ausdruck gebracht werden, während<br />
das in der Presse pr<strong>im</strong>är in analytisch-akzentuierenden <strong>und</strong> portraitierenden Artikeln<br />
geschieht. Damit deutet er an, dass sich die Komplementärfunktion der Presse nicht nur auf<br />
12
die Berichterstattungsgegenstände beschränkt, sondern auch mit der Art der Herangehensweise<br />
zu tun hat. Die Kritik an WERNECKENS Konvergenzbef<strong>und</strong>en ist damit zumindest<br />
zum Teil schon entkräftet (vgl. WIPPER 2003, 213).<br />
2.2.2.8 Wenig (sportexterne) Quellen<br />
Die „International Sports Press Survey<strong>“</strong>-Verfasser bezeichnen die Sportberichterstattung als<br />
„Journalism without sources<strong>“</strong>, nachdem sie analysiert hatten, wie viele Quellen in Sportartikeln<br />
zitiert werden. 20 % der 10.007 von ihnen untersuchten Artikel aus Tageszeitungen<br />
kommen ohne jede Quelle aus. 40 % aller Sportartikel beziehen sich auf lediglich eine Quelle.<br />
„Als Qualitätsmerkmal <strong>im</strong> Journalismus gilt, wenn sich ein Zeitungsartikel auf mehr als<br />
lediglich eine Quelle stützt.<strong>“</strong> (MÜHLETHALER 2006). Allerdings ist dies nur bei 36 % der in<br />
der Analyse ausgewerteten Beiträge der Fall. In 21 % der Artikel werden zwei Quellen zitiert<br />
<strong>und</strong> in 16 % mehr als drei Quellen (SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 5). Bei den benutzten<br />
Quellen handelt es sich in erster Linie um Personen aus der Welt des Sports: Sportler, Trainer<br />
<strong>und</strong> Vereinsfunktionäre dominieren die Quellen der Sportjournalisten. Die Verfasser der<br />
Studie geben an, dass die Journalisten in nur einem von 25 Texten Zitate oder Kommentare<br />
von Personen verarbeitet hatten, die nicht aus der Welt des Sports stammen <strong>–</strong> etwa von<br />
Wissenschaftlern oder Politikern (ebd.; vgl. WERNECKEN 2000, 310).<br />
„The sports editors [...] all have the same stories about their problems with systematic attempts by clubs<br />
and sports stars to exclude critical journalists from getting interviews. At the moment only a handful of<br />
journalists are allowed to talk to the German Formula One champion, Michael Schumacher. The Danish<br />
football legend Michael Laudrup used the same strategy for many years <strong>–</strong> and in that way a few lucky<br />
journalists were eating out of his hand.” (SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 4). 7<br />
SCHAFFRATH macht auf die Zuspitzung dieser Probleme für die Presse aufmerksam, die<br />
damit verb<strong>und</strong>en ist, dass die Printmedien in der „medialen Versorgungskette<strong>“</strong> an letzter<br />
Stelle stehen, was nur „noch über persönliche Beziehungen des Journalisten zum Spieler<br />
oder Trainer durchbrochen werden<strong>“</strong> kann:<br />
„Dieses aus dem <strong>Sportjournalismus</strong> bekannte Phänomen der ,persönlichen Beziehungen’ (manche<br />
sprechen auch von Kumpanei) zwischen Berichterstatter <strong>und</strong> Berichterstattungsgegenstand ist <strong>–</strong> mit<br />
Blick auf Ursachen <strong>und</strong> Konsequenzen <strong>–</strong> mitnichten ein Garant für eine unabhängige <strong>und</strong> kritische Darstellung<br />
des Sports.<strong>“</strong> (SCHAFFRATH 2000, 159, vgl. WIPPER 2003, 144ff. <strong>und</strong> 153ff.).<br />
2.2.2.9 Affektive Verb<strong>und</strong>enheit<br />
2,8 % der Print-Sportjournalisten gehen <strong>–</strong> so die Ergebnisse von ELLERT <strong>–</strong> nicht gerne auf<br />
einen Sportevent. Jeder dritte Journalist der Presse ist dem Ausgang des Sportereignisses<br />
gegenüber nicht gleichgültig eingestellt. Die Mehrzahl der emotional Beteiligten (58,7 %) übt<br />
die Sportart selbst aus, über die sie berichtet. Kongruent dazu betreibt über zwei Drittel der<br />
neutral eingestellten Journalisten (69 %) die Sportart nicht aktiv. „[D]ie persönliche aktive<br />
Erfahrung mit der Sportart [ist] ein Gr<strong>und</strong> für ein emotionaleres Miterleben.<strong>“</strong> (ELLERT 2006,<br />
220). Die Ergebnisse zeigen, dass das untersuchte Länderspiel des deutschen Fußball-<br />
Nationalteams mit 75 % emotional beteiligten Berichterstattern zu den Events gehört, die von<br />
den befragten deutschen Sportjournalisten besonders leidenschaftlich begleitet werden. „Zu<br />
der Emotionalisierung führt sicher auch ein gewisser Teil an Patriotismus.<strong>“</strong> (ebd., 221).<br />
LUDWIG präsentiert das Ergebnis, dass 8 von 13 befragten Journalisten, die den Fußball-<br />
B<strong>und</strong>esligisten Borussia Dortm<strong>und</strong> betreuen, weiter zu den Spielen ins Stadion gehen würden,<br />
wenn sie journalistisch nichts mehr mit dem Verein zu tun hätten <strong>–</strong> vier Befragte würden<br />
7<br />
Der Züricher Medienwissenschaftler Mirko Marr sieht in der <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> mehrheitlich fehlenden <strong>Distanz</strong><br />
den „größten Handlungsbedarf<strong>“</strong>. Allerdings weist er gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung auf ein Problem hin:<br />
„Wer <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> keine <strong>Nähe</strong> hat, erhält keinerlei Informationen.<strong>“</strong> (MÜHLETHALER 2006). Damit spricht<br />
Marr an, was in einigen Sportarten längst Realität ist. Etwa in der Formel 1 oder <strong>im</strong> Fußball, wo nur eine Handvoll<br />
Journalisten die Möglichkeit hat, sich mit den Stars zu unterhalten.<br />
13
sich sogar möglichst jedes Spiel ansehen (LUDWIG 1987, 240f.). Die Folge der Verquickung<br />
von beruflichen <strong>und</strong> persönlichen Interessen: ein Drittel der Journalisten bekennt sich zu einem<br />
wohlwollenden Verhalten zum Verein.<br />
„Die kognitiven, aus der Verpflichtung als Journalist resultierenden Variablen der Einstellung zum Verein<br />
werden durch die affektiven maßgeblich beeinflusst oder sogar verdrängt. Die Sportjournalisten sind<br />
sich dieses Einflusspotentials bewusst, sehen sich jedoch oftmals außerstande, den bestehenden Gefühlen<br />
entgegenzuarbeiten.<strong>“</strong> (ebd., 342).<br />
Es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl; der Verein kann durch Forcieren der „Wirsitzen-doch-alle-in-einem-Boot-Ideologie<strong>“</strong><br />
Druck auf die Journalisten ausüben. Zudem neigen<br />
Sportjournalisten dazu, sich <strong>im</strong> Erfolg „ihrer<strong>“</strong> Mannschaft zu sonnen, um auf diese Weise das<br />
eigene Selbstwertgefühl zu heben (vgl. BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 214ff.; LUDWIG<br />
1987, 243ff.; WERNECKEN 2003, 363).<br />
2.2.2.10 Quasi selbstwertdienliche Ursachenzuschreibungen<br />
Die Analyse von Leistungen <strong>und</strong> die Begründung von Erfolg oder Misserfolg ist, wie oben für<br />
Sportinterviews angedeutet, ein wichtiger Bestandteil der Sportberichterstattung. An dieser<br />
Stelle ist das Einbeziehen der Attributionsforschung aus der Sportpsychologie hilfreich, die<br />
sich u.a. mit Erklärungen sportlicher Leistungen beschäftigt. Ausgangspunkt ist die Annahme,<br />
dass Personen als „naive Wissenschaftler<strong>“</strong> aus ihnen vorliegenden Informationen Rückschlüsse<br />
auf Merkmale der handelnden Personen oder der jeweiligen Situation ziehen (vgl.<br />
MÖLLER 1994a, 82; STRAUSS/MÖLLER 1996, 35). In der Sportberichterstattung ist es die<br />
Aufgabe von Journalisten, Ursachen für sportliche Erfolge bzw. Misserfolge zu nennen (vgl.<br />
STIEHLER/MARR 2001, 115ff.; BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 169). In der Forschung<br />
kommt der Sportberichterstattung wegen ihrer „spontanen<strong>“</strong> Attributionen <strong>–</strong> nicht exper<strong>im</strong>entell<br />
durch Fragesteller hervorgerufen <strong>–</strong> eine besondere Rolle zu (vgl. STRAUSS/MÖLLER<br />
1994b, 248); solchen Untersuchungen wird eine „hohe ökologische Validität<strong>“</strong> zugeschrieben<br />
(MÖLLER/BRANDT 1994, 266). Gemeinsam ist allen Ansätzen der Attributionstheorie, dass<br />
sie sich auf die Forschungen Fritz Heiders aus den 1950er Jahren berufen. Für die Anwendung<br />
der Attributionstheorie auf den Sport waren die Arbeiten Bernard Weiners von Bedeutung.<br />
Er entwickelte ein zweid<strong>im</strong>ensionales Schema mit der Unterscheidung nach den D<strong>im</strong>ensionen<br />
Lokalität (internal oder external) <strong>und</strong> Stabilität (stabil oder variabel). Anstrengung<br />
gilt demnach z.B. als variable <strong>und</strong> internale Variable (WEINER 1988, 257ff.; vgl. MÖLLER<br />
1994a, 85f.; STRAUSS/MÖLLER 1994a, 242). STRAUSS/MÖLLER erweitern die Ursachenfaktoren<br />
für den Sport (STRAUSS/MÖLLER 1996, 36).<br />
Menschen attribuieren nicht nach rein rationalen Kriterien. Es lassen sich Attributionsmuster<br />
erkennen, nach denen Ursachen zugeschrieben werden. Außerdem gibt es nach MÖLLER<br />
f<strong>und</strong>amentale Attributionsfehler (vgl. MÖLLER 1994a, 86). BIERHOFF-ALFERMANN<br />
schränkt ein, dass die Bezeichnung „Attributionsfehler<strong>“</strong> zu kurz gegriffen ist. Die Funktion von<br />
Attributionen bestehe nicht nur darin, sich ein möglichst logisches <strong>und</strong> wissenschaftsgetreues<br />
Kausalmodell zu machen, sondern auch darin, „sich ein möglichst schmeichelhaftes Bild<br />
von der (oftmals rauen) Wirklichkeit <strong>und</strong> von sich selbst zu verschaffen <strong>und</strong> sich nach außen<br />
hin gut darzustellen<strong>“</strong> (BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 174; vgl. STIEHLER/MARR 2001,<br />
121). Für den Bereich des Sports <strong>und</strong> speziell für die Überprüfung des Vorwurfes der mangelnden<br />
kritischen <strong>Distanz</strong> von Sportjournalisten sind besonders selbstwertdienliche bzw. -<br />
schützende Attributionsmuster interessant. Nach der Selbstwerttheorie werden besonders<br />
positive Leistungen auf internale Ursachen (z.B. eigene Fähigkeit) attribuiert, um das eigene<br />
Selbstvertrauen zu stärken. Dieser als Self-Serving-Bias bezeichnete Effekt wird für den<br />
Sport bestätigt (vgl. STRAUSS/MÖLLER 1994a, 242).<br />
Auch Sportjournalisten als Beobachter sportlicher Leistungen unterliegen attributionalen Verzerrungen.<br />
Es kann von einem quasi stellvertretendem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung<br />
bzw. -schutz gesprochen werden (STRAUSS/MÖLLER 1996, 37). Dieses kann zur Überprüfung<br />
des Vorwurfes der mangelnden <strong>Distanz</strong> herangezogen werden. Journalisten ordnen<br />
14
z.B. Erfolge „ihrer<strong>“</strong> Sportler häufiger internalen Faktoren zu. Involvierte Beobachter attribuierten<br />
die Einnahme von Dopingmitteln <strong>im</strong> Fall des Sprinters Ben Johnson hauptsächlich situational,<br />
um den Sportler zu entlasten <strong>–</strong> sie gaben z.B. an, er habe das Anabolika ohne Wissen<br />
um die Wirkung eingenommen oder die Urinprobe sei manipuliert worden (ebd.; MÖLLER<br />
1994a, 90).<br />
„Mit zunehmender Involviertheit in die zu erklärende Handlung stellt sich auch zunehmend die Frage<br />
nach einer möglichen motivationalen Funktion von Kausalattributionen. <strong>Distanz</strong>ierte, passive Beobachter<br />
entsprechen in ihrem Attributionsverhalten am ehesten den Anforderungen wissenschaftslogischer<br />
Modelle. Sobald aber ein Beobachter in die zu erklärende Handlung selbst mit einbezogen ist, etwa als<br />
Interaktionspartner, oder gar Akteur seine eigene Handlung erklären soll, können Attributionen sich von<br />
Erklärungen zunehmend in die Richtung von Handlungsrechtfertigen bewegen. Dies besonders dann,<br />
wenn Ereignisse von hoher subjektiver Bedeutsamkeit erklärt werden sollen, die das eigene Selbstwertgefühl<br />
tangieren, <strong>und</strong> wenn Erklärungen in der Öffentlichkeit abgegeben werden sollen.<strong>“</strong> (BIER-<br />
HOFF-ALFERMANN 1986, 174f.).<br />
„Bisher vorliegende Untersuchungen von Attributionsmustern von Sportjournalisten ergeben<br />
in der Regel eine Tendenz zur quasi stellvertretenden Selbstwerterhöhung oder -erhaltung.<strong>“</strong><br />
(STRAUSS/MÖLLER 1996, 38). Journalisten attribuieren also Erfolge „ihrer<strong>“</strong> Mannschaften<br />
eher internal <strong>und</strong> Misserfolge stärker external. Je unerwarteter das Resultat, desto größer<br />
die Anzahl der Attributionen (STRAUSS/MÖLLER 1994b, 248; MARR/STIEHLER 1995,<br />
338). MÖLLER/BRANDT bestätigen die Hypothese, dass in der Zeitungsberichterstattung<br />
die relative Anzahl der Attributionen größer ist als in der TV-Berichterstattung, wobei die Autoren<br />
darauf aufmerksam machen, dass dies nicht eindeutig mit dem Faktor Zeit begründet<br />
werden kann, da es sich auch um einen „dispositionalen Shift zwischen dem Medium Fernsehen<br />
<strong>und</strong> dem Medium Zeitung<strong>“</strong> handeln könnte. Ferner zeigen die Ergebnisse, dass Pressejournalisten<br />
<strong>im</strong> Gegensatz zu ihren TV-Kollegen eine „reflektierende ,observerperspective’<strong>“</strong><br />
einnehmen <strong>und</strong> häufiger internal attribuieren. Zudem wurde erneut ein Self-<br />
Serving-Bias festgestellt: die Berichterstattung war „sportlerfre<strong>und</strong>lich<strong>“</strong> (MÖLLER/BRANDT<br />
1994, 271ff., vgl. BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 181).<br />
MÖLLER/STRAUSS, die spontane Attributionen in der Fernsehberichterstattung zu den Olympischen<br />
Spielen 1988 <strong>und</strong> zu der Leichtathletik-WM 1991 untersuchen, bemerken eine<br />
„Entschuldigungstendenz<strong>“</strong> in den Beiträgen der Journalisten zu negativen Leistungen der<br />
„eigenen<strong>“</strong> Athleten (MÖLLER/STRAUSS 1994b, 251). STIEHLER/MARR weisen darauf hin,<br />
dass die Neigung zu „selbstwertdienlichen<strong>“</strong> Attributionen der Journalisten durch Rituale in<br />
der Berichterstattung, den Zwang zur Seriosität <strong>und</strong> Nachrichtenfaktoren begrenzt werden<br />
(STIEHLER/MARR 2001, 123). Auch sie können in einer Untersuchung der TV-<br />
Berichterstattung zu den jeweils letzten Spielen der deutschen Fußball-<br />
Nationalmannschaften bei großen Turnieren von 1994 bis 2000 nachweisen, dass „internale<br />
Attributionen dominieren<strong>“</strong>. Als Gründe geben sie die „Internalitätsnorm<strong>“</strong> <strong>im</strong> Sport <strong>und</strong> den<br />
„Ethnozentrismus<strong>“</strong> der Medien an (ebd., 128).<br />
„Die Involviertheit der Journalisten [findet] einen messbaren Niederschlag in der Art <strong>und</strong><br />
Weise ihrer Berichterstattung.<strong>“</strong> (STRAUSS/MÖLLER 1996, 40). Auch MARR/STIEHLER bestätigten,<br />
dass Ursachenzuschreibungen <strong>stark</strong> durch die Perspektive geprägt sind <strong>und</strong> nicht<br />
nur die Realität erklären, sondern auch den Misserfolg bewältigen sollen.<br />
„Zumindest für den Mediensport, bei dem der distanzierte <strong>und</strong> neutrale Beobachter weder in den Medien<br />
noch <strong>im</strong> Publikum als Normalfall vermutet werden kann, lässt sich das behaupten. [...] Die medialprofessionellen<br />
,Erklärer’ [waren] in diesem Fall selbst ,zutiefst’ Betroffene [...], die <strong>–</strong> händeringend,<br />
wenn man die Fernsehbilder sieht <strong>–</strong> nach Erklärungen suchten. Sie hatten <strong>–</strong> auch wegen mangelnder<br />
<strong>Distanz</strong> gegenüber dem Geschehen <strong>–</strong> keinen Kompetenzvorsprung gegenüber Teilen des Publikums.<strong>“</strong><br />
(MARR/STIEHLER 1995, 347).<br />
Entscheidend ist bei der Untersuchung journalistischer Attributionen die Frage, ob diese der<br />
Versuch sind, Handlungen rational zu erklären oder ob sie darauf abzielen, best<strong>im</strong>mte Handlungen<br />
zu rechtfertigen (vgl. FRIEDRICH 1997, 6).<br />
15
2.2.2.11 Einfluss der Öffentlichkeitsarbeit<br />
WEISCHENBERG stellt fest, dass andere Ressorts eine weitaus kritischere Haltung als<br />
Sportredaktionen haben, was externe Einflüsse durch PR auf die Berichterstattung betreffen.<br />
Knapp ein Viertel der befragten Sportjournalisten gibt an, dass Pressemitteilungen zu unkritischer<br />
Berichterstattung verführen. (WEISCHENBERG 1994, 437). Fast ein Drittel der befragten<br />
Journalisten erwartet nach ELLERT selbst nach dem Sportereignis z.B. eine Versorgung<br />
mit Pressemitteilungen, die sie als wichtige Arbeitshilfe ansieht. Über ein Drittel der Pressevertreter<br />
gibt an, täglich alle Presse-Informationen zu lesen. Fast zwei Drittel der Print-<br />
Journalisten (62,3 %) behaupten, dass sie kein PR-Material benutzen. ELLERTS Ergebnisse<br />
zeigen, dass 65,7 % der Print-Journalisten, die angaben, keine PR zu übernehmen, Kernbotschaften<br />
adaptiert hatten. „Bei diesem Ergebnis bleibt die Frage offen, ob die Journalisten<br />
diese Übernahme von PR-Material nicht wahrnehmen oder nicht zugeben.<strong>“</strong> (ELLERT 2006,<br />
248; vgl. HALLER 2005, 17ff.).<br />
Die PR-Arbeit hat den Zweck, eine positive <strong>und</strong> umfangreiche Berichterstattung zu generieren,<br />
schätzt über die Hälfte (51,9%) der befragten Medienvertreter. Am häufigsten wünschen<br />
sich die befragten Journalisten von der PR-Abteilung Zugang zu den Sportlern (98,5 %), einen<br />
guten Platz, um den Wettkampf verfolgen zu können (97,5 %), gute PR-Texte (95,6 %)<br />
<strong>und</strong> ein hochwertiges Catering (89,2 %) (ELLERT 2006, 280ff.). Ein Drittel der Journalisten<br />
gibt an, dass die Medien nicht beeinflussbarer werden, wenn sich das Medium, für das der<br />
Journalist arbeitet, als Sponsor engagiert (ebd., 295).<br />
Die Sportpresse wird <strong>im</strong> „International Sports Press Survey<strong>“</strong> als „the World’s Best Advertising<br />
Agency” bezeichnet. „Sports editors of daily newspapers allow the sports industry to set the<br />
agenda and the priorities for coverage of sports events.” (SCHULTZ JÖRGENSEN 2005, 1).<br />
Bestätigt sehen die Autoren der Untersuchung diese Einschätzung in ihren Resultaten, mit<br />
denen sie belegen, dass die Sportseiten in den Zeitungen vor allem jene Sportstars <strong>und</strong> Anlässe<br />
berücksichtigen, die am meisten Werbung, Sponsoren <strong>und</strong> Zuschauer an sich ziehen.<br />
Umgekehrt berichten Sportjournalisten offenbar nicht so gerne über Ereignisse, die für den<br />
Sport relevant sind, sich jedoch außerhalb des Blickwinkels der Fernsehkameras bewegen<br />
(ebd., 1ff.).<br />
2.2.2.12 Bestechung mit Geschenken<br />
GÖRNER fragt in seiner Studie die Sportjournalisten nach wirtschaftlichen Einflüssen; dies<br />
„nur sehr oberflächlich<strong>“</strong> <strong>–</strong> wohl auch damit der Rücklauf der Fragebögen nicht durch „schwierige<strong>“</strong><br />
Fragen gefährdet wird (ELLERT 2006, 291; vgl. GÖRNER 1995, 386). Er stellt die Frage,<br />
ob Journalisten Einflussnahmen durch die werbetreibende Wirtschaft erfahren. Allerdings<br />
entschärft GÖRNER seine Frage durch die Wahl einer <strong>dich</strong>otomen Nominalskala in der Antwort<br />
(Ja, Nein). Etwas über 58 % der Tageszeitungsjournalisten bestätigen die Einflussnahme<br />
der Wirtschaft. Es wird nicht weiter hinterfragt, ob z.B. die Einflussnahmen erfolgreich<br />
sind.<br />
„Dieser Bereich sollte nochmals überprüft werden, denn diese Fragen lassen die Vermutung zu, dass<br />
die Probanden aus Gründen der ,Looking-good’-Tendenz nicht die Vermutung von Gerhard LERCH offenbaren<br />
wollten. Damit würden sie nämlich ihre wohl gehütete Unabhängigkeit aufgeben.<strong>“</strong> (ELLERT<br />
2006, 291).<br />
In der Studie von LERCH geben 85 % an, dass sie selten oder gelegentlich mit Zuwendungen<br />
oder Geschenken bedacht werden. LERCH äußert den Verdacht, „dass ,direkte Leistungen’<br />
zur Instrumentalisierung der Journalisten <strong>im</strong> Sportressort eine nicht unerhebliche Rolle<br />
spielen<strong>“</strong> (LERCH 1989, 134). Laut FRÜTEL haben aus Sicht der befragten internationalen<br />
Sportjournalisten Sportfachverbände oder Sponsoren wenig Einfluss auf die eigene Arbeit:<br />
nationale Sportverbände (13,8 %), Sponsoren (12,5 %), Fifa (8,8 %). „Inwieweit an diesem<br />
Punkt Wunsch <strong>und</strong> Wirklichkeit auseinanderklaffen, werden weiterführende Untersuchungen<br />
klären müssen.<strong>“</strong> (FRÜTEL 2005, 258).<br />
16
Die Studie von ELLERT ergibt, dass 59,4 % der befragten Berichterstatter angeben, dass sie<br />
von Veranstalter, Pressebetreuung oder Sponsoren keine materiellen Zuwendungen erhalten<br />
<strong>und</strong> ihnen nichts kostenlos ermöglicht wird. „Zwischen der Zahl der wahrgenommenen <strong>und</strong><br />
der tatsächlichen kostenlosen Zuwendungen besteht ein sehr großer Unterschied.<strong>“</strong> (ELLERT<br />
2006, 298). NAUSE erwähnt in diesem Zusammenhang, dass bei diesem „neuralgischen<br />
Punkt<strong>“</strong>, der den unabhängigen Journalismus in Frage stellt, wohl nicht mit „uneingeschränkter<br />
Offenheit<strong>“</strong> zu rechnen ist (NAUSE 1987, 241). Denn die Angaben der PR-Manager sprechen<br />
eine andere Sprache, wie ELLERT durch eine Auflistung der Zuwendungen für die<br />
Journalisten zeigt:<br />
„980 Fahrservicefahrten, 558 PR-Texte, 350 Presse-Parkplätze, 82 internetfähige PCs <strong>und</strong> 150 Extra-<br />
Eintrittskarten [...], 84 Caterings, 25 Pressepartys, 80 kleine Geschenke (mit einer Gesamtauflage von<br />
1.500 Stück) <strong>und</strong> acht große Geschenke (Auflage:150 Stück).<strong>“</strong> (ELLERT 2006, 300f.).<br />
„Die Ergebnisse erwecken den Eindruck, als ob Catering, gute Plätze etc. von den Journalisten<br />
als selbstverständlich angesehen werden <strong>und</strong> nicht als Geschenk bzw. Zuwendung eingestuft<br />
werden.<strong>“</strong> (ebd., 299). ELLERT gibt dazu diesen Hinweis: „Einige Interviews werden<br />
während des Caterings geführt, dabei geben die Journalisten an, nichts kostenlos zu bekommen,<br />
obwohl es keine Kasse gibt, das Catering also offensichtlich kostenlos ist.<strong>“</strong> (ebd.,<br />
299; vgl. FREUDENREICH 1983a, 50ff.).<br />
2.2.2.13 Experten, Kolumnisten <strong>und</strong> Co-Kommentatoren<br />
„Dieses ,Expertentum’ <strong>im</strong> Fernsehen schadet dem Journalismus <strong>und</strong> dem deutschen Fußball<strong>“</strong>,<br />
schreibt der Sportjournalist Oliver FRITSCH mit Blick auf Oliver Bierhoff <strong>und</strong> Franz Beckenbauer<br />
als TV-Experten <strong>und</strong> die Vorwürfe, dass Lehmanns Nominierung als WM-Torwart<br />
Nummer eins durch die Fre<strong>und</strong>schaft zu Bierhoff beeinflusst worden sei (FRITSCH 2006e).<br />
„Experten, die ja gr<strong>und</strong>sätzlich frei vom journalistischen Normendruck sind, repräsentieren<br />
[...] Rollenträger, die zwischen den Beobachterperspektiven von Fans <strong>und</strong> Journalisten vermitteln.<strong>“</strong><br />
(STIEHLER/MARR 2001, 117). Thomas HORKY erklärt, dass die Anteile von Expertengesprächen<br />
in der TV-Sportberichterstattung zwischen 15 <strong>und</strong> 30 % liegen <strong>und</strong> ihre Bedeutung<br />
zun<strong>im</strong>mt. Auch bei Zeitungen spielen Experten-Kolumnen eine wichtige Rolle (vgl.<br />
HORKY 2005, 109ff.).<br />
„Man kann sich hinter dem prominenten Schreiber als Blattmacher […] gut verstecken.<strong>“</strong><br />
(FRITSCH 2006g). „[D]ie Verlagerung von Meinung transportierender Aussagen der Journalisten<br />
auf die befragten Experten [stellt] eine best<strong>im</strong>mende Funktion <strong>im</strong> System Mediensport<br />
dar […].<strong>“</strong> (HORKY 2005, 125). Das Expertengespräch weist Elemente der Unterhaltung unter<br />
Fre<strong>und</strong>en auf. Das Problem von <strong>Nähe</strong> <strong>und</strong> <strong>Distanz</strong> wird erneut deutlich: Franz Beckenbauer<br />
ist in Sachen WM-Organisation kein unabhängiger Experte, arbeitet als dieser aber be<strong>im</strong><br />
ZDF. Private Kontakte, wie sie zwischen Journalisten mit einer Sportkarriere in der Vergangenheit<br />
<strong>und</strong> aktuell aktiven Athleten vorkommen, stehen einer „unabhängigen Recherche <strong>im</strong><br />
Wege<strong>“</strong> (ebd., 115).<br />
„In anderen journalistischen Subsystemen würde diese strukturelle System<strong>im</strong>manenz die<br />
Glaubwürdigkeit des Experten <strong>und</strong> damit der Berichterstattung erschüttern. Man stelle sich<br />
vor, ein Politiker würde den Wahlsieg seiner eigenen Partei als Experte bewerten...<strong>“</strong> (ebd.,<br />
126). Interessanterweise überwiegt bei Sportjournalisten laut NAUSE eine ablehnende Haltung<br />
gegenüber der journalistischen Arbeit bekannter Sportler. Diese wird als Abwertung<br />
ihrer eigenen Tätigkeit empf<strong>und</strong>en. Auffallend sei der relativ große Anteil der bei Printmedien<br />
beschäftigten Sportjournalisten in dieser Gruppe der Befragten (NAUSE 1987, 237f.). Bleibt<br />
die Frage, warum sich Sportjournalisten dennoch hinter (abhängigen) Experten „verstecken<strong>“</strong>.<br />
Um die Konsequenzen zu vermeiden, denen kritische Sportjournalisten oft ausgesetzt sind<br />
(vgl. HORKY 2005, 114)?<br />
17
2.2.3 Zusammenfassung der wissenschaftlichen Kritik<br />
Aus den oben dargestellten Ergebnissen der für das Thema relevanten wissenschaftlichen<br />
Untersuchungen werden folgende Punkte zusammengefasst: Der Vorwurf der mangelnden<br />
<strong>Distanz</strong> <strong>und</strong> Kritikfähigkeit von Sportjournalisten wurde in den meisten Fällen mit Hilfe von<br />
Befragungen untersucht, deren Ergebnisse das Selbstverständnis von Medienvertretern wiedergeben<br />
(sollen). Das Problem der Sozialen Erwünschtheit von Antworten sei (erneut) angedeutet.<br />
Andere Arbeiten konzentrieren sich <strong>–</strong> häufig dominierend formal-deskriptiv ansetzend<br />
<strong>–</strong> fast ausschließlich auf journalistische Darstellungsformen, Häufigkeiten der präsentierten<br />
Sportarten, Hauptthemen, Handlungsträger, Quellen. Ergebnisse zum Vorwurf der<br />
<strong>Distanz</strong>losigkeit lassen sich aus diesen Forschungen allenfalls vereinzelt als Randergebnisse<br />
entnehmen.<br />
Spezielle Studien, die allein darauf ausgerichtet sind zu untersuchen, wie viel Substanz an<br />
dem Vorwurf der Sportjournalisten als mitjubelnde Kumpanen ist, sind die Ausnahme. Zwei<br />
Arbeiten, die in diese Richtung gehen (THOMAS 1988; SCHAFFRATH 2000), konzentrieren<br />
sich ausschließlich auf Sportinterviews <strong>im</strong> Fernsehen, so dass die Kritik der <strong>Distanz</strong>losigkeit<br />
bei Sportjournalisten von Tageszeitungen nach Einschätzung des Verfassers noch nicht<br />
konzentriert in wissenschaftlichen Studien untersucht worden ist <strong>–</strong> zumindest nicht, wenn<br />
man auch die Texte der Journalisten an sich mit in die Untersuchung einbezieht, da LUDWIG<br />
mittels Intensiv-Interviews mit Tageszeitungs-Sportjournalisten <strong>und</strong> Mitgliedern eines Profifußballvereins<br />
auf ein großes Konfliktpotenzial <strong>im</strong> Verhältnis zwischen Berichterstatter <strong>und</strong><br />
Gegenstand hinweist (LUDWIG 1987). 8<br />
8<br />
Voraussichtlich Anfang 2009 sollen die Ergebnisse einer internationalen Studie veröffentlicht werden, die die<br />
Sportberichterstattung in den Printmedien untersucht. Herausgeber der Studie „<strong>Sportjournalismus</strong><strong>“</strong> sind Jürgen<br />
SCHWIER, Thomas HORKY <strong>und</strong> Thorsten SCHAUERTE. Gegenstand sind laut ersten Informationen ähnlich wie<br />
in der vorliegenden Arbeit u.a. Themenvielfalt, Quellenanzahl <strong>und</strong> Problemorientierung der Sportberichterstattung<br />
der Presse (SCHULZ 2008).<br />
18
3. EXKURS: DER JOURNALISTISCHE QUALITÄTSBEGRIFF<br />
3.1 Qualität <strong>–</strong> ein komplexer Begriff<br />
Der Kritik am <strong>Sportjournalismus</strong> bezüglich der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> liegt ein best<strong>im</strong>mtes<br />
Verständnis von Qualität <strong>im</strong> Journalismus zugr<strong>und</strong>e. Können spezielle Merkmale,<br />
die charakteristisch für Qualitätsjournalismus sind oder sein sollen, in der Berichterstattung<br />
nicht nachgewiesen werden, gelten die Texte oder Sendungen journalistisch als mangelhaft.<br />
Deshalb soll kurz erklärt werden, welche Qualitätskriterien für den Journalismus angeführt<br />
werden können. Was ist Qualität bezogen auf Journalismus? Die Frage <strong>–</strong> in Anlehnung an<br />
eine Definition des Qualitätsbegriffs von Hans Heinz FABRIS <strong>und</strong> Rudi RENGER <strong>–</strong> ist: Was<br />
sind <strong>im</strong> Journalismus die Merkmale, die dazu geeignet sind, „festgelegte <strong>und</strong> vorausgesetzte<br />
Erfordernisse zu erfüllen<strong>“</strong> (FABRIS/RENGER 2003, 81)?<br />
Die Debatte um journalistische Qualität ist kein neues Phänomen. Während der Entwicklung<br />
des Mediums Zeitung verändern sich die Qualitätsforderungen (vgl. WILKE 2003, 38ff.;<br />
BEHMER 2004, 34ff.). Im 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert sind solche Forderungen z.B. <strong>stark</strong> von<br />
(religiösen) Dogmen geprägt <strong>und</strong> konzentrieren sich auf den erzieherischen Wert des neuen<br />
Mediums. Auf Parteinahme wird zu dieser Zeit in den Zeitungen verzichtet, weil ein möglichst<br />
weites Publikum angesprochen werden soll, die Zeitungsgründer oft als Drucker oder Posthalter<br />
keine publizistischen Ansprüche haben, strenge Zensur herrscht <strong>und</strong> es ferner „neben<br />
den weltlichen wie geistlichen Obrigkeiten noch gar keine (organisierten) Interessen [gibt],<br />
denen die Zeitungen als Sprachrohr hätten dienen können<strong>“</strong> (ebd., 34). Ende des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
werden erstmals <strong>–</strong> ähnlich wie derzeit <strong>–</strong> Aktualität, unverfälschte Nachrichten, Sorgfältigkeit<br />
<strong>und</strong> Unabhängigkeit für die Berichterstattung gefordert. Das 18. <strong>und</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
ist hinsichtlich der Zeitungsgeschichte geprägt durch den Kampf gegen die Zensur <strong>–</strong> ein<br />
Umstand, der, wie WILKE ausführt, die „Herausbildung autonomer Qualitätsnormen<strong>“</strong> verhindert<br />
(WILKE 2003, 43). Erstmals äußern sich Journalisten selbst öffentlich zur Medienqualität<br />
<strong>und</strong> machen die Zensur für die Mängel verantwortlich. Die Zeitung soll ein „Spion des Publikums<strong>“</strong>,<br />
ein „unbestechliches Tribunal<strong>“</strong> <strong>und</strong> ein „Schild der öffentlichen Meinung<strong>“</strong> sein. Sie soll<br />
die wahren politischen Verhältnisse darstellen <strong>und</strong> nicht der herrschende Klasse huldigen<br />
(ebd.).<br />
Das 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bringt schließlich den Aufstieg der Parteipresse wie der Massenpresse.<br />
Scheinbar unpolitisch <strong>und</strong> mit populären Inhalten <strong>–</strong> u.a. mit dem Sport <strong>–</strong> suchen die General-<br />
Anzeiger unter Vorgabe des Ethos der neutralen Vermittlung, eine möglichst breite Leserschaft<br />
anzusprechen. Mit der Aufhebung der Zensur <strong>und</strong> der Ausweitung des Zeitungswesens<br />
(steigende Anzahl an Zeitungen, Erweiterung des Umfangs, Aufgliederung in verschiedene<br />
Ressorts, Untergliederung durch Layout-Elemente) nehmen <strong>im</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert aufgr<strong>und</strong><br />
des wachsenden Textbedarfs laut WILKE Fälschungen zu. U.a. diesen Mängeln sowie<br />
Druckfehlern <strong>und</strong> der Kommerzialisierung wird mit ersten universitären Ausbildungen von<br />
Journalisten begegnet. Nach dem Ende des Reg<strong>im</strong>es der Nationalsozialisten, in dem journalistische<br />
Qualität gleichbedeutend mit der Bereitschaft war, die Nazi-Ideologie zu unterstützen,<br />
entstehen in Deutschland unter dem Einfluss der Besatzungsmächte neue, teilweise<br />
nach anglo-amerikanischem Vorbild ausgerichtete Normen, wie z.B. der Aufbau der Nachricht<br />
aus Lead <strong>und</strong> Body oder die Trennung von Nachricht <strong>und</strong> Kommentar (vgl. ebd., 51). 9<br />
Besonders seit Anfang der 1990er Jahre widmen sich medienwissenschaftliche Arbeiten<br />
dem Begriff der journalistischen Qualität. 10 Unstrittig in der derzeitigen wissenschaftlichen<br />
Diskussion ist, dass der Qualitätsbegriff <strong>im</strong> Journalismus nicht eindeutig zu definieren ist <strong>und</strong><br />
dass aufgr<strong>und</strong> der Vielschichtigkeit <strong>und</strong> der Komplexität des Begriffes unterschiedliche Di-<br />
9 Vgl. SCHÖNHAGEN 1998 zur Herleitung konkreter journalistischer Qualitätsanleitungen, die sich aus der Tradition<br />
des deutschen Journalismus ableiten <strong>und</strong> sich bereits seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert ausgebildet haben.<br />
10 Vgl. zum Begriff journalistische Qualität u.a. SCHATZ/SCHULZ 1992, BAMMÉ/KOTZMANN/RESCHENBERG<br />
1993, RAGER 1994.<br />
19
mensionen diskutiert werden. „Einen klar umrissenen Qualitätsbegriff <strong>im</strong> Journalismus gibt<br />
es offensichtlich nicht.<strong>“</strong> (GLEICH 2003, 139). FABRIS/RENGER zitieren den Leipziger Journalistik-Professor<br />
Michael Haller: „Alle wünschen Qualität, doch jeder meint etwas anderes<br />
damit.<strong>“</strong> (FABRIS/RENGER 2003, 81). Stephan RUSS-MOHL zieht das viel zitierte Fazit:<br />
„Qualität <strong>im</strong> Journalismus definieren zu wollen, gleicht dem Versuch, einen Pudding an die<br />
Wand zu nageln.<strong>“</strong> (RUSS-MOHL 1992, 85). 11 Gianluca WALLISCH resümiert am Ende seiner<br />
Dissertation: „Die journalistische Qualität schlechthin kann es nicht geben.<strong>“</strong> (WALLISCH<br />
1995, 233). 12 Zudem weist RUSS-MOHL daraufhin, dass das Qualitätsverständnis vom Begründungszusammenhang<br />
abhängt. Qualität ist <strong>–</strong> so der Kommunikationswissenschaftler <strong>–</strong><br />
abhängig von einer ganzen Reihe von Variablen, darunter u.a. dem Medium selbst, dem<br />
Selbstverständnis der Journalisten, der Funktion des Journalismus (z.B. Information, Kritik<br />
<strong>und</strong>/oder Unterhaltung), dem Publikum <strong>und</strong> den journalistischen Darstellungsformen (vgl.<br />
RUSS-MOHL 1992, 85).<br />
In der geplanten Untersuchung wird in erster Linie journalistische Qualität aus Sicht des Informationsjournalismus<br />
diskutiert. Damit sind z.B. emotionalisierende oder unterhaltende<br />
Funktionen des Journalismus weniger wichtig für die Untersuchung sportjournalistischer<br />
Qualität. Die große Mehrzahl der deutschen Journalisten möchte ihr Publikum in Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
mit den Prämissen des Informationsjournalismus zunächst „möglichst neutral <strong>und</strong><br />
präzise informieren<strong>“</strong> (WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006, 356). 13 Die Informationsvermittlung<br />
wird als Kernaufgabe der Medien angesehen. Auch wenn die informierende Sportberichterstattung<br />
oft mit unterhaltenden Elementen vermischt wird, sehen es Sportjournalisten<br />
als oberste Pflicht an, neutral <strong>und</strong> sachlich zu informieren. Die Unterhaltungsfunktion wird<br />
von ihnen an dritter Stelle genannt (GÖRNER 1995, 246ff.; FRÜTEL 2005, 232). 14<br />
Neben der Diskussion darüber, wie Qualität <strong>im</strong> Journalismus definiert werden kann, wird in<br />
der Literatur danach gefragt, was entscheidend für die Herstellung <strong>und</strong> Sicherung von journalistischer<br />
Qualität ist: Ist es vorrangig die Aufgabe der Redaktion (WYSS 2003, 130f.)? Ist<br />
es eine Vielzahl an präventiv <strong>und</strong> korrektiv wirkenden den Produktionsprozess begleitenden<br />
Elementen (u.a. Ausbildung, innerredaktionelle Blattkritik, Presserat) (RUSS-MOHL 1992,<br />
86f.)? Läuft Qualitätssicherung mehrstufig <strong>–</strong> z.B. auf der journalismusinternen, der journalismusexternen,<br />
der Produkt- <strong>und</strong> der Medienebene <strong>–</strong> ab (ALTMEPPEN 2003, 114)?<br />
Was den Begriff der journalistischen Qualität betrifft, gibt es in der wissenschaftlichen Diskussion<br />
rege Debatten. Unsicherheiten bestehen darüber, was Qualität <strong>im</strong> Journalismus überhaupt<br />
ist, wie sie definiert werden kann, welche Indikatoren für sie festgelegt werden kön-<br />
11 Vgl. SCHÖNHAGEN 1998, die in ihrer Abhandlung zur „Unparteilichkeit <strong>im</strong> Journalismus<strong>“</strong> Bezug auf die weiter<br />
gefasste Qualitätsdiskussion n<strong>im</strong>mt. SCHÖNHAGEN stellt drei Ebenen der Auseinandersetzung mit dem Begriff<br />
Objektivität <strong>im</strong> Journalismus fest: erstens Wünschbarkeit <strong>und</strong> Relevanz, zweitens die Möglichkeit journalistischer<br />
Objektivität, drittens die Best<strong>im</strong>mung von Kriterien praktischer Umsetzbarkeit eines Objektivitätsanspruches<br />
(SCHÖNHAGEN 1998, 235). SCHÖNHAGEN plädiert dafür, „den (erkenntnistheoretisch irreführenden) Begriff<br />
der Objektivität durch Unparteilichkeit zu ersetzen<strong>“</strong> (ebd., 261). Laut der Autorin umfasst die Unparteilichkeitsmax<strong>im</strong>e<br />
diese D<strong>im</strong>ensionen: das Audiatur-Et-Altera-Pars-Prinzip (allseitige Vermittlung, Pluralismus), Trennung von<br />
Nachricht <strong>und</strong> Kommentar, Offenlegen der Pr<strong>im</strong>ärquellen, getreue Vermittlung (sinngemäß, vollständig), ein spezifisches<br />
journalistisches Selbstverständnis als neutraler Vermittler (nicht von Fremdinteressen geleitet, <strong>im</strong> Sinne<br />
aller gesellschaftlicher Gruppen) (ebd., 272ff.).<br />
12 Trotz des viel versprechenden Titels „Journalistische Qualität. Definitionen, Modelle, Kritik<strong>“</strong> beschränkt sich<br />
WALLISCH vor allem auf literarischen Journalismus; weitreichende Erkenntnisse zu Kriterien journalistischer<br />
Qualität für die Praxis sind bei ihm nicht zu finden.<br />
13 Vgl. hierzu die Studie „Journalismus in Deutschland 2005<strong>“</strong>: „Die Auswertung zeigt ein journalistisches Selbstverständnis,<br />
das vom Informationsjournalismus dominiert wird. [...] Informieren <strong>und</strong> vermitteln ist in den Augen der<br />
Journalisten auch dann zentrales Ziel ihrer Arbeit, wenn sie in Medien <strong>und</strong> Sparten arbeiten, in denen Unterhaltung,<br />
Ratgeberfunktionen <strong>und</strong> Service eine große Rolle spielen, also etwa <strong>im</strong> Unterhaltungsressort oder bei Publikumszeitschriften.<br />
Offenbar sind die Standards des Informationsjournalismus in allen Bereichen des Journalismus<br />
am besten generalisierbar <strong>und</strong> dann mit jeweils anderen Rollenbildern (Ratgeberjournalismus oder politischer<br />
Journalismus) kombinierbar.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006, 355ff.).<br />
14 Vgl. Kapitel 3.3 <strong>und</strong> 2.2.2.5 der vorliegenden Arbeit zur speziellen Gefährdung <strong>im</strong> Sportressort aufgr<strong>und</strong> der<br />
enthaltenen Unterhaltungselemente.<br />
20
nen, wie sie gesichert <strong>und</strong> wie sie messbar gemacht werden kann. Im nächsten Kapitel wird<br />
dargestellt, aus welchen Sichtweisen journalistische Qualität hergeleitet werden kann.<br />
3.2 Herleitungskriterien journalistischer Qualität<br />
Um journalistische Qualität messen zu können, müssen best<strong>im</strong>mte Indikatoren für Qualität<br />
festgelegt werden. Dabei gibt es verschiedene Ausgangspunkte, um diese definieren zu<br />
können. So unterteilt Michael KARMASIN journalistische Qualität in ethische (übereinst<strong>im</strong>mend<br />
mit journalistischen Normen), ästhetische <strong>und</strong> ökonomische Qualität (KARMASIN<br />
1996, 18f.). Die zusammengefasst dargestellte, zum Teil wissenschaftlich f<strong>und</strong>ierte Kritik<br />
zum Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> in der Sportberichterstattung orientiert sich<br />
in erster Linie an einem normativen Journalismus-Verständnis (vgl. Kapitel 2). Der Vorwurf<br />
der mangelnden <strong>Distanz</strong> <strong>und</strong> Kritikfähigkeit von Sportjournalisten wird <strong>–</strong> wenn er wissenschaftlich<br />
untersucht wird <strong>–</strong> in den meisten Fällen mit Hilfe von Befragungen untersucht, deren<br />
Ergebnisse das Selbstverständnis von Medienvertretern wiedergeben (sollen). Befragte<br />
Journalisten beziehen sich in der Regel auf Forderungen von Standesorganisationen <strong>und</strong><br />
prominenten Kollegen, die für Qualität <strong>im</strong> Journalismus eintreten. Solche gesellschaftlichen<br />
Normen (<strong>und</strong> Gesetze) erzeugen Druck, die entsprechenden Qualitäten zu beachten. Ob<br />
z.B. handlungs- oder systemtheoretisch hergeleitete Qualitätsforderungen ähnlichen Druck<br />
hervorrufen können, erscheint fraglich. Nachfolgend wird deshalb vor allem auf die normative<br />
Herleitung von journalistischer Qualität eingegangen <strong>–</strong> zurückgegriffen wird dabei auf die<br />
Einteilung von Klaus ARNOLD, der Qualitätskriterien aus normativer, systemtheoretischer<br />
<strong>und</strong> handlungstheoretischer Perspektive begründet (ARNOLD 2004, 1f., vgl. STREITEN-<br />
BERGER/PENSHORN 2005, 16f.). Alle wesentlichen in der wissenschaftlichen Diskussion<br />
aufgeführten Kriterien werden durch sein Modell abgedeckt. Auf system- <strong>und</strong> handlungstheoretische<br />
Begründungen wird kurz eingegangen, da sich aus diesen Perspektiven ähnliche<br />
Kriterien für journalistische Qualität ergeben <strong>und</strong> sich die Sichtweisen überschneiden. 15<br />
3.2.1 Die normative Begründung<br />
Allgemein kann Qualität, wenn sie normativ hergeleitet wird, als eine Eigenschaft verstanden<br />
werden, die einer best<strong>im</strong>mten Norm entspricht. Diese Normen sind aus Wertesystemen abgeleitet.<br />
Zur Beurteilung der Qualität von Medien kommen mehrere Wertesysteme in Betracht:<br />
politisch-gesellschaftliche Werte, Werte der Profession, Werte der allgemeinen Ästhetik<br />
<strong>und</strong> Werte des Publikums (SCHATZ/SCHULZ 1992, 690f.). Die normative Begründung<br />
journalistischer Qualität leitet sich aus der öffentlichen Aufgabe der Presse (Beitrag zur Meinungsbildung,<br />
Üben von Kritik), aus den rechtlichen Grenzen der Pressefreiheit durch die<br />
Landespressegesetze (wie z.B. die Sorgfaltspflicht <strong>und</strong> die Achtung von Persönlichkeitsrechten)<br />
sowie aus den berufsethischen Normen des Journalismus ab.<br />
Die Freiheit der Presse ist u.a. durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützt. Aber die Presse ist auch,<br />
was journalistische Inhalte <strong>und</strong> damit Qualität betrifft, an best<strong>im</strong>mte Verpflichtungen geb<strong>und</strong>en<br />
<strong>–</strong> so z.B. an die journalistische Sorgfaltspflicht. „Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer<br />
Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt <strong>und</strong> Herkunft<br />
zu prüfen<strong>“</strong>, heißt es bspw. <strong>im</strong> §6 LPG Bremen (FRICKE 1997, 46). Daraus lassen sich<br />
u.a. die Pflicht zur Wahrhaftigkeit, zur Vollständigkeit, zur Prüfung von Informationsquellen,<br />
zur richtigen Wiedergabe von Zitaten sowie zur Abwägung zwischen Recht auf Pressefreiheit<br />
<strong>und</strong> zum Schutz der Persönlichkeit ableiten (vgl. LÖFFLER/RICKER 2000, 308ff.).<br />
15<br />
Neben der Einteilung von ARNOLD gibt es eine Vielzahl von Versuchen, die Herleitung <strong>und</strong> Verantwortlichkeiten<br />
für journalistische Qualität zu ordnen. Hans-Jürgen BUCHER unterscheidet z.B. zwischen akteursorientierter<br />
(individuelle Leistung), rollenorientierter (instutionalisiertes Handeln) <strong>und</strong> systemorientierter (Systemerfüllung)<br />
Herleitung von journalistischer Qualität (BUCHER 2003, 15ff.). Robin JANTOS ordnet die Herleitung von journalistischer<br />
Qualität danach wie sie legit<strong>im</strong>iert wird: gesellschaftlich orientiert oder Rezipienten orientiert. Rechtliche<br />
Vorgaben <strong>und</strong> Kodizes von Journalistenorganisationen stuft er als gesellschaftlich orientierte Qualitätskriterien<br />
ein, weil sie z.B. in den Präambeln ausdrücklich „mit gesellschaftlichen Funktionen des Journalismus begründet<br />
werden<strong>“</strong> (JANTOS 2004, 57f.).<br />
21
Aus Sicht der Wissenschaft verkörpern berufsethische Kodizes, die die Normen ihrer jeweiligen<br />
Profession zusammenfassen, verallgemeinerte Erwartungen an das professionelle Handeln<br />
der Journalisten. Wenn Einzelne ihr Verhalten an diesen normativen Maßstäben ausrichten,<br />
gilt ihre Berichterstattung als qualitativ gut <strong>–</strong> gleichzeitig dienen Kodizes als Konfliktvermeidungsprogramme<br />
für den Berufsstand als Ganzes (vgl. RAUPP 2004, 182f.; MEIN-<br />
BERG 2004, 41). Kodizes, wie z.B. der als Berufsethik angelegte Kodex des Deutschen<br />
Presserats, der wohl prominenteste Kodex <strong>im</strong> deutschen Journalismus, produzieren normative<br />
Erwartungen, mit denen Journalisten in der Praxis konfrontiert werden. Obwohl es nur<br />
schwache Sanktionsmöglichkeiten gibt <strong>–</strong> wie z.B. Rügen des Deutschen Presserates <strong>–</strong>, sollte<br />
deren Wirkung nicht unterschätzt werden. 16 In der Regel greifen Gerichte auf diese Regelwerke<br />
zurück, wenn sie überprüfen, ob Journalisten z.B. ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen<br />
sind (LÖFFLER/RICKER 2000, 316).<br />
Besonders die oben zitierten Heribert SCHATZ <strong>und</strong> Winfried SCHULZ sind als Vertreter<br />
normativ begründeter Qualitätsforderungen zu nennen. Sie leiten aus den angeführten normativen<br />
Wertesystemen u.a. die Qualitätskriterien<br />
• der strukturellen <strong>und</strong> inhaltlichen Vielfalt,<br />
• der Rechtmäßigkeit,<br />
• der inhaltlichen <strong>und</strong> gestalterischen Professionalität,<br />
• der Relevanz <strong>und</strong><br />
• der Akzeptanz durch das Publikum<br />
von Journalisten ab. Unter dem Merkmal der Professionalität listen sie u.a. folgende handwerklichen<br />
Kriterien auf:<br />
• Verständlichkeit,<br />
• Richtigkeit,<br />
• Relevanz,<br />
• Ausgewogenheit,<br />
• Neutralität,<br />
• Trennung von Nachricht <strong>und</strong> Meinung (SCHATZ/SCHULZ 1992, 709).<br />
RUSS-MOHL nennt als journalistische Qualitätskriterien ebenfalls allgemeine Professionalitätsstandards<br />
wie<br />
• Komplexitätsreduktion (Faktentreue, Vereinfachung, Verständlichkeit),<br />
• Aktualität (zeitliche Aktualität <strong>und</strong> Problemaktualität),<br />
• Originalität (Leseanreiz, Eigenrecherche),<br />
• Transparenz,<br />
• Reflexivität (Offenlegen der Berichterstattungsbedingungen, Quellenkritik),<br />
• Objektivität (RUSS-MOHL 1992, 86).<br />
Unter dem Kriterium Objektivität versteht RUSS-MOHL Faktentreue, das Beachten der<br />
Nachrichtenwerte <strong>und</strong> Auswahlregeln, die Trennung von Nachricht <strong>und</strong> Meinung, Vielfalt der<br />
Perspektiven, Fairness <strong>und</strong> Ausgewogenheit sowie den Einsatz von Hintergr<strong>und</strong>informationen<br />
(ebd.).<br />
Praktiker verbinden mit Qualität in der Berichterstattung die Standards des journalistischen<br />
Handwerks, wie das Ergebnis einer Umfrage unter leitenden Redakteuren regionaler Tageszeitungen<br />
zeigt. Die überwiegende Mehrheit der Befragten nennt auf die Frage, was Qualität<br />
<strong>im</strong> Journalismus sei, als Erstes die gängigen Standards des journalistischen Handwerks: „die<br />
Leser aktuell, umfassend <strong>und</strong> verständlich informieren<strong>“</strong>, „Sorgfaltspflichten beachten<strong>“</strong>, „genau<br />
recherchieren<strong>“</strong>, „wahrheitsgemäß berichten<strong>“</strong>, „Zusammenhänge aufzeigen<strong>“</strong> <strong>und</strong> „das<br />
16 Vgl. Kapitel 3.2 <strong>und</strong> 3.2.1.1 der vorliegenden Arbeit u.a. mit Informationen über den Deutschen Presserat.<br />
22
aktuelle Geschehen insgesamt verständlich machen<strong>“</strong> (SCHMIDT 2000, 36f.). ARNOLD<br />
sammelt diese Forderungen unter dem Begriff Objektivitätskriterien (ARNOLD 2004, 2). 17<br />
3.2.1.1 (Sport-)Journalistische Kodizes<br />
Best<strong>im</strong>mungen zur Presse sind wie erwähnt in Form von Art. 5 mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung,<br />
der Gewährleistung der Pressefreiheit <strong>und</strong> der Nichtexistenz der Zensur in<br />
das Gr<strong>und</strong>gesetz eingeflossen. Allerdings lassen gesetzliche Regelungen häufig große<br />
Spielräume zu. Journalistische Kodizes wurden <strong>und</strong> werden formuliert, um dem Berufstand<br />
Handlungsanleitung zu geben <strong>und</strong> somit für gewisse Sicherheit <strong>im</strong> praktischen Handeln zu<br />
sorgen. Für den <strong>Sportjournalismus</strong> existieren spezielle sportjournalistische Regelwerke.<br />
Vorab muss darauf hingewiesen werden, dass aus normativer Perspektive nicht nur die jeweils<br />
einzelnen Journalisten für journalistische Qualität verantwortlich gemacht werden können,<br />
wie einleitend in diesem Kapitel erwähnt. Berufsspezifische Werte, wie sie nachfolgend<br />
ausführlich dargestellt werden, richten sich in erster Linie zwar an Journalisten, aber neben<br />
der individualethischen spielt auch die sozialethische Perspektive eine Rolle, wenn es um die<br />
Verantwortung von journalistischer Qualität geht. So ist z.B. der soziale Kontext „Redaktion<strong>“</strong><br />
für die Resultate des Handelns des einzelnen Journalisten nicht nur mitverantwortlich, sondern<br />
„die Bedingungen <strong>und</strong> der Entscheidungsspielraum der Einzelakteure [sind] entscheidend<br />
vom strukturellen <strong>und</strong> organisatorischen Kontext best<strong>im</strong>mt<strong>“</strong> (FUNIOK 2002, 47).<br />
Nicht Pressekodizes allein, sondern auch Statute oder redaktionelle Prinzipien innerhalb der<br />
Redaktionen, best<strong>im</strong>mte Rahmenbedingungen <strong>und</strong> moralische Gr<strong>und</strong>sätze des gesamten<br />
Medienunternehmens spielen eine Rolle, wenn es darum geht, wer die Verantwortung für<br />
journalistische Qualität trägt (ebd., 48). Daneben rechnet FUNIOK dem kritisch mündigen<br />
Publikum, das die Medien kritisch beobachtet, eine Mitverantwortung zu <strong>und</strong> nennt drei weitere<br />
Gruppen, die sich gegenseitig ergänzen <strong>und</strong> „die Aufgabe haben, den Medienbereich zu<br />
reflektieren <strong>und</strong> zu regulieren<strong>“</strong> (ebd., 49). Dies sind laut FUNIOK die Gremien der freiwilligen<br />
Selbstkontrolle <strong>–</strong> meist zusammengesetzt aus Interessengruppen <strong>–</strong>, die medienkritische Öffentlichkeit<br />
sowie die Gremien <strong>und</strong> Verfahren der gesetzlichen Kontrolle <strong>und</strong> Gestaltung<br />
(B<strong>und</strong>esverfassungsgericht, Parlamente, R<strong>und</strong>funkräte, Landesmedienanstalten) (ebd.).<br />
3.2.1.1.1 Pressekodex des Deutschen Presserates<br />
Im Jahr 1973 wird der Pressekodex des Deutschen Presserates eingeführt. Dieses ethische<br />
Ideal enthält Formulierungen zur journalistischen Qualität <strong>und</strong> soll der „Wahrung der Berufsethik<strong>“</strong><br />
u.a. mit der Forderung nach „Achtung vor der Wahrheit<strong>“</strong> <strong>und</strong> „Sorgfalt<strong>“</strong> dienen. Im<br />
Pressekodex heißt es auszugsweise in der novellierten Fassung vom 13. September 2006<br />
mit Blick auf den Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong>:<br />
„Journalisten [...] nehmen ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen <strong>und</strong> Gewissen, unbeeinflusst<br />
von persönlichen Interessen <strong>und</strong> sachfremden Beweggründen wahr. [...]<br />
7. Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen<br />
nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter beeinflusst werden. Verleger <strong>und</strong> Redakteure<br />
wehren derartige Versuche ab <strong>und</strong> achten auf eine klare Trennung zwischen redaktionellen<br />
Texten <strong>und</strong> Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken. [...]<br />
15. Die Annahme <strong>und</strong> Gewährung von Vorteilen jeder Art, die geeignet sein könnten, die Entscheidungsfreiheit<br />
von Verlag <strong>und</strong> Redaktion zu beeinträchtigen, sind mit dem Ansehen, der Unabhängigkeit<br />
<strong>und</strong> der Aufgabe der Presse unvereinbar.<strong>“</strong> (DEUTSCHER PRESSERAT 2006b).<br />
17<br />
Auf erkenntnistheoretische Probleme mit dem Begriff der „journalistischen Objektivität<strong>“</strong> <strong>und</strong> auf den gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Streit zwischen „Subjektivisten<strong>“</strong> <strong>und</strong> „Objektivisten<strong>“</strong> sei an dieser Stelle kurz hingewiesen (vgl. SCHÖNHA-<br />
GEN 1998, 239ff.; BEHMER 2004, 32f.; DONSBACH 1990, 18ff.). HALLER erklärt z.B., dass „die normativ verstandene<br />
Erwartung an die Neutralität des Beobachters aus prinzipiellen Gründen nur begrenzt einlösbar ist<strong>“</strong>. Er<br />
fügt aber hinzu, dass „für die Wahrnehmung dieser Rolle präventiv wirksame Korrekturverfahren <strong>und</strong> rigide<br />
Handwerksregeln erforderlich sind<strong>“</strong> (HALLER 2004, 21).<br />
23
3.2.1.1.2 Medienkodex des Netzwerks Recherche<br />
Journalistische Normen sind teilweise umstritten, was sich zuletzt an der Diskussion um den<br />
<strong>im</strong> Februar 2006 präsentierten Medienkodex des Netzwerks Recherche gezeigt hat (vgl.<br />
RAUPP 2004, 182f.). Besonders die Forderung „Journalisten machen keine PR<strong>“</strong> ruft heftige<br />
Reaktionen hervor. Dabei geht es hauptsächlich um die Frage: Ist dieser Satz naiv <strong>und</strong> realitätsfern<br />
oder ist darin eine dringend notwendige Forderung enthalten, damit die Glaubwürdigkeit<br />
von Journalisten geschützt wird? Journalistik-Professor Michael Haller erklärt, dass<br />
„als normativer Anspruch [...] diese Setzung richtig <strong>und</strong> wichtig [ist], unabhängig davon, wie<br />
derzeit die Praxis aussieht<strong>“</strong> (SCHNEDLER 2006, 42). Professor Hans Mathias Kepplinger<br />
vom Mainzer Institut für Publizistik urteilt: „Das ist normativ notwendig <strong>und</strong> richtig, empirisch<br />
naiv <strong>und</strong> falsch.<strong>“</strong> (ebd., 43). Im Hinblick auf die Untersuchung des Vorwurfs der mangelnden<br />
kritischen <strong>Distanz</strong> in der Sportberichterstattung sind u.a. folgende normativen Forderungen<br />
aus dem Medienkodex relevant:<br />
„1. Journalisten berichten unabhängig, sorgfältig, umfassend <strong>und</strong> wahrhaftig. Sie achten die Menschenwürde<br />
<strong>und</strong> Persönlichkeitsrechte.<br />
2. Journalisten recherchieren, gewichten <strong>und</strong> veröffentlichen nach dem Gr<strong>und</strong>satz ,Sicherheit vor<br />
Schnelligkeit’. [...]<br />
4. Journalisten garantieren handwerklich saubere <strong>und</strong> ausführliche Recherche aller zur Verfügung stehenden<br />
Quellen. [...]<br />
6. Journalisten verzichten auf jegliche Vorteilsannahme <strong>und</strong> Vergünstigung.<br />
7. Journalisten unterscheiden erkennbar zwischen Fakten <strong>und</strong> Meinungen.<strong>“</strong> (NETZWERK RECHER-<br />
CHE 2006).<br />
3.2.1.1.3 Qualitäts-Charta des DJV<br />
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fasst seine Positionen zur Qualität <strong>im</strong> Journalismus<br />
in einer Charta zusammen, die <strong>im</strong> Jahr 2002 verabschiedet worden ist <strong>und</strong> weitestgehend<br />
Qualitätsd<strong>im</strong>ensionen beinhaltet, die auch Bestandteil anderer Kodizes sind. Bezüglich<br />
des Vorwurfes der mangelnden <strong>Distanz</strong> sind besonders folgende Punkte von Interesse:<br />
„4. Qualität <strong>im</strong> Journalismus setzt die Beherrschung des journalistischen Handwerks, Präzision in<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> Wiedergabe, Faktentreue, verständlichen Sprachstil, überlegten Einsatz unterschiedlicher<br />
Darstellungsformen sowie eine f<strong>und</strong>ierte Recherche voraus. [...]<br />
7. Qualität <strong>im</strong> Journalismus ist Anliegen praxisorientierter Kommunikationswissenschaft. Journalistinnen<br />
<strong>und</strong> Journalisten sind offen für den Austausch zwischen Theorie <strong>und</strong> Praxis sowie für neue (wissenschaftliche)<br />
Erkenntnisse über Medien <strong>und</strong> Beruf <strong>und</strong> beziehen diese in die Qualitätsdebatte ein.<br />
9. Qualität <strong>im</strong> Journalismus bedingt Unabhängigkeit von sachfremden Interessen. Journalistinnen <strong>und</strong><br />
Journalisten sind vorrangig der Öffentlichkeit verpflichtet. Sie trennen redaktionelle Inhalte von Werbung,<br />
unterscheiden Journalismus von Public Relations <strong>und</strong> ordnen in der Informationsvermittlung Auflagen-<br />
<strong>und</strong> Quotendenken dem öffentlichen Auftrag unter.<strong>“</strong> (DJV 2002).<br />
3.2.1.1.4 Pariser Leitsätze<br />
Die Aufgabe der Sportpresse <strong>im</strong> Besonderen ist genau beschrieben worden; 1924 verabschieden<br />
die Teilnehmer des ersten Kongresses des „Internationalen Sportpresseverbandes<strong>“</strong><br />
in Paris die Leitsätze für ihre Zunft.<br />
„Die Sportpresse will eine erzieherische Rolle spielen. Ein echter <strong>und</strong> gemeinsamer Wille beseelt die<br />
Sportjournalisten aller Länder, zusammenzuarbeiten für die Verteidigung der sittlichen Werte ihres<br />
schönen Berufes.<br />
Die Sportjournalisten betrachten die Pflege <strong>und</strong> Förderung aller der Verständigung <strong>und</strong> dem Frieden<br />
unter den Völkern dienenden fortschrittlichen <strong>und</strong> erzieherischen Bestrebungen als ihre Hauptaufgabe.<br />
24
Berichterstattung <strong>und</strong> Kritik sollen <strong>im</strong>mer von dem Geiste größter Verantwortung <strong>und</strong> Wahrheit getragen<br />
sein.<br />
Die Sportjournalisten sind insbesondere bestrebt, durch unvoreingenommenes <strong>und</strong> unparteiisches Urteil<br />
der Jugend ein nachahmenswertes Beispiel zu geben. Indem sie die vielfach durch sportlichen Übereifer<br />
verursachte unsachliche oder unfaire Rivalität bekämpfen, wollen sie den Sport seinem höheren<br />
Ziel näher bringen, den Menschen besserzumachen <strong>und</strong> seine Gemeinschaft zu wecken.<br />
Trotz der selbstverständlichen Liebe eines jeden zu seinem Vaterlande betrachten sich die Sportjournalisten<br />
als Wegbereiter einer kulturellen Zusammenarbeit, die <strong>im</strong> sportlichen Wettkampf ihren Niederschlag<br />
findet.<br />
Die Sportjournalisten bekennen sich zu den Prinzipien sportverb<strong>und</strong>ener Kameradschaft, die in hohem<br />
Maße dazu angetan ist, den Geist der Eintracht, der Gerechtigkeit <strong>und</strong> gegenseitigen Achtung unter der<br />
menschlichen Gesellschaft zu fördern.<strong>“</strong> (BINNEWIES 1981, 36).<br />
Es wurde früh ein eigenständiges Ethos für die Berufsgruppe der Sportjournalisten formuliert.<br />
Das zeigt u.a., dass die Besonderheit sportjournalistischer Tätigkeit gewürdigt werden sollte.<br />
Nur andeutungsweise werden in den zitierten Pariser Leitlinien allgemein verbindliche<br />
Gr<strong>und</strong>sätze für journalistische Tätigkeiten bestätigt, vor allem wird die Besonderheit des<br />
<strong>Sportjournalismus</strong> betont, wenn „eine erzieherische Rolle<strong>“</strong>, Vorbildwirkungen für die Jugend<br />
<strong>und</strong> das Ziel menschlicher Perfektionierung herausgestellt werden. 18<br />
„Unausgesprochen lebt dieses journalistische Sonderethos von einem Erziehungsopt<strong>im</strong>ismus, dem ein<br />
opt<strong>im</strong>istisches Menschenbild korrespondiert. Gleichzeitig transportiert dieser Kodex ein ideologisches<br />
Sportverständnis, das, auch wiederum ungeschrieben, Sport als moralische Besserungsanstalt glorifiziert<br />
<strong>und</strong> <strong>stark</strong>e Anklänge an Coubertins Olympische Idee verrät, die eine pädagogische war.<strong>“</strong> (MEIN-<br />
BERG 2004, 42).<br />
3.2.1.1.5 Ehrenkodex des VDS<br />
Der Ehrenkodex des VDS aus dem Jahr 1995 stellt sich in die Tradition der 1924er Deklaration.<br />
Allerdings werden die Richtlinien von Formulierungen befreit, die als nicht mehr zeitgemäß<br />
gelten, <strong>und</strong> der VDS-Kodex passt sich laut MEINBERG „dem allgemein ethischen<br />
Trend an, dass eine individuell fixierte Ausprägung der älteren Standesethik um eine folgenethische<br />
Makroethik zu erweitern sei<strong>“</strong> (ebd., 43). Gemäß diesem Kodex sollen Sportjournalisten<br />
„in ihrer journalistischen <strong>und</strong> publizistischen Arbeit folgenden ethischen Ansprüchen <strong>und</strong><br />
beruflichen Zielsetzungen verpflichtet<strong>“</strong> sein <strong>–</strong> <strong>und</strong> das „gleichgültig in welchem Medien tätig<br />
<strong>und</strong> unabhängig vom Arbeitsverhältnis<strong>“</strong>. Sie sollen „das berufsständische Privileg [...] verantwortungsbewusst<br />
<strong>und</strong> moralisch unanfechtbar<strong>“</strong> anwenden (VDS 1995). In Bezug auf den<br />
Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> sind folgende Forderungen relevant:<br />
„Sozial ausgleichend, friedensfördernd: SportjournalistInnen widersetzen sich jeder nationalistischen,<br />
chauvinistischen, rassistischen, religiösen <strong>und</strong> politischen Verleumdung <strong>und</strong> Ausgrenzung. Sie begreifen<br />
ihre Tätigkeit als sozial ausgleichend, völkerverbindend <strong>und</strong> friedensfördernd.<br />
Kritisch <strong>und</strong> kontrollierend: SportjournalistInnen bearbeiten <strong>und</strong> bewerten alle Bereiche des Sports. Sie<br />
setzen sich für humanen Sport ein; negative Entwicklungen <strong>im</strong> Sport begleiten sie in Wort <strong>und</strong> Bild kritisch<br />
<strong>und</strong> kontrollierend.<br />
Würde <strong>und</strong> Fairness: Im Umgang mit Beteiligten <strong>und</strong> Betroffenen sind die Würde des Einzelnen, der<br />
Schutz der Persönlichkeit <strong>und</strong> die Int<strong>im</strong>sphäre zu achten. In jedem Fall sind die Folgen der Berichterstattung<br />
mitzubedenken. Zu den Gr<strong>und</strong>lagen der Arbeit gehören sorgfältige Recherchen, korrekte Wiedergabe<br />
von Zitaten <strong>und</strong> unmissverständliche Sprache. Der Fairnessgedanke muss <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
deutlich zur Geltung kommen. [...]<br />
Höchstmaß an Wahrhaftigkeit: Selbstverständnis <strong>und</strong> Ehrgefühl von SportjournalistInnen gebieten Respekt,<br />
Solidarität <strong>und</strong> Professionalität unter den Berufskollegen; sie verpflichten zu Achtung <strong>und</strong> Fairness<br />
gegenüber den Objekten der Berichterstattung sowie Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Feinge-<br />
18<br />
Die Forderungen der Pariser Leitsätze könnten auch aus systemtheoretischer Sicht hergeleitet werden. Dabei<br />
würde es um die Funktionserfüllung des Systems Sport gehen. Vgl. Kapitel 3.2.1.2 zu den Herausforderungen<br />
sportjournalistischer Ethik.<br />
25
fühl gegenüber den Lesern, Hörern <strong>und</strong> Zuschauern. Die Kontrollfunktion der Medien beinhaltet ein<br />
Höchstmaß an Wahrhaftigkeit <strong>und</strong> Sachlichkeit sowie maßvolle <strong>und</strong> angemessene Kritik.<strong>“</strong> (VDS 1995).<br />
Jüngstes Beispiel eines sportjournalistischen Regelwerks ist eine acht Punkte umfassende<br />
Selbstverpflichtung der WDR-Sportredaktionen mit dem Titel „<strong>Distanz</strong> in der Sportberichterstattung<strong>“</strong>,<br />
die <strong>im</strong> Januar 2008 veröffentlicht worden ist (HUBERT 2008a, 2). 19<br />
3.2.1.2 Herausforderungen sportjournalistischer Ethik<br />
MEINBERG macht auf eine Besonderheit der sportjournalistischen Ethik aufmerksam, die<br />
aus den Kodizes des VDS <strong>und</strong> des Internationalen Sportpresseverbandes aus dem Jahr<br />
1924 deutlich geworden sind. In der Ethik der Sportberichterstattung berühren sich mehrere<br />
Bereiche: vor allem die (sport-)journalistische Ethik, die Sportethik <strong>und</strong> eine pädagogische<br />
Ethik. „So wird für das sportjournalistische Ethos jenes Prinzip als handlungsleitend angesehen,<br />
das sich in der Vergangenheit quasi als die sportethische Drehscheibe schlechthin <strong>und</strong><br />
als unüberbietbare Leitidee erwiesen hat: die Fairness.<strong>“</strong> (MEINBERG 2004, 48). Der Sportpublizistikwissenschaftler<br />
Josef HACKFORTH sieht das ähnlich, wenn er in die Zukunft blickend<br />
kritisiert, dass „der Olympismus, der Fair-Play-Gedanke<strong>“</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> künftig<br />
noch weiter ausgespart werden wird (HACKFORTH 1994, 37). Sportjournalisten selbst betonen<br />
die Wichtigkeit des Prinzips der Fairness für den <strong>Sportjournalismus</strong> (vgl. SCHEU 1995,<br />
156ff.).<br />
Nach MEINBERG berühren sich Medien- <strong>und</strong> Sportethik nicht nur, sondern die Sportethik<br />
wird sogar als Vorbild für eine qualitativ gute Sportberichterstattung dargestellt. „Der Sportjournalist<br />
muss wenigstens ein ,moralischer Doppelgänger’ sein: Medien- <strong>und</strong> Sportethiker<br />
zugleich. Zwei Ethosformen schlagen in seiner moralischen Brust <strong>und</strong> prägen dadurch seinen<br />
Habitus stärker oder schwächer.<strong>“</strong> (MEINBERG 2004, 49). Gerade ein best<strong>im</strong>mtes Fairplay-Verständnis<br />
<strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>, das dazu führen kann, dass nicht mehr kritisch berichtet<br />
wird, wird derzeit heftig angegriffen.<br />
„Die viel beschworene Fairness zählt zu den beliebtesten Standardfloskeln. Sie macht ja, richtig verstanden,<br />
die Arbeit für alle leichter. Denn hauptsächlich besteht sie <strong>im</strong> Stillhalten. Die besondere Art<br />
,Fairness’, die in der Branche praktiziert wird, ist meist ein kritikloses, gedankenarmes Wiederkäuen<br />
von Leerformeln, das Durchreichen von Neuigkeiten einfach so, wie sie präsentiert wurden <strong>–</strong> <strong>und</strong> das<br />
alles eingekleidet in berufsethische Begriffe wie Objektivität, Präzision, Unparteilichkeit.<strong>“</strong> (KISTNER<br />
2004, 10).<br />
Wenn ein solches Fairplay-Verständnis in der Praxis der Sportberichterstattung umgesetzt<br />
wird, können Sportjournalisten den Eindruck erwecken <strong>–</strong> so der Vorwurf von Günter PILZ <strong>–</strong>,<br />
dass Fairness die oberste Handlungsmax<strong>im</strong>e <strong>im</strong> Sport ist. Spektakuläre Fälle <strong>–</strong> z.B. der Gewalt<br />
<strong>–</strong> können leicht als (individuelle) Ausnahme hingestellt werden, wenn Sportjournalisten<br />
nicht kritisch alle komplexen Bereiche des Sports beleuchten, sondern stattdessen von der<br />
„schönsten Nebensache der Welt<strong>“</strong> oder „einer heilen Welt des Sports, die durch Fairness,<br />
Kameradschaft, Ritterlichkeit<strong>“</strong> gekennzeichnet ist, ausgehen (PILZ 1983, 60).<br />
„Viele Sportjournalisten klammern sich verzweifelt an den Glauben, der Sport sei eine Art<br />
Elysium, in dem Erwachsene wie Kinder spielen können <strong>–</strong> frei von Zweifeln <strong>und</strong> Sorgen. Diesen<br />
Mythos möchten sie sich nicht kaputtmachen lassen.<strong>“</strong> (HILL 2005, 45).<br />
19<br />
Darin heißt es u.a., dass „wir uns nicht mit dem Gegenstand unserer Berichterstattung gemein machen <strong>und</strong><br />
journalistische Prinzipien aufs Spiel setzen [dürfen]. Nur durch Unabhängigkeit können wir die Glaubwürdigkeit<br />
unserer Sportberichterstattung wahren <strong>und</strong> stärken.<strong>“</strong> (HUBERT 2008a, 2). Durch Workshops sollen die Inhalte<br />
des Papiers den Sportredakteuren vermittelt werden. Dazu gehört u.a., dass Höchstleistungen kritisch hinterfragt<br />
werden sollen, die Konversationsform gr<strong>und</strong>sätzlich das „Sie<strong>“</strong> sein soll, zu Wort kommende Experten kritisch <strong>und</strong><br />
sorgfältig ausgewählt werden, Hintergründe kritisch hinterleuchtet werden sollen sowie investigativ gearbeitet<br />
werden soll statt Sportereignisse nur abzubilden (ebd.).<br />
26
3.2.1.3 Kodizes: Gemeinsamkeiten <strong>und</strong> Kritik<br />
Zusammenfassend werden Kodizes wie folgt verstanden: Kodizes sind moralische Steuerinstrumentarien<br />
für die journalistische Praxis. Sie bringen „in der Regel best<strong>im</strong>mte Gr<strong>und</strong>sätze<br />
[in eine sprachliche Form], die keine rigiden Verbots-, sondern eher Gebotsethiken sind, die<br />
moralische Leitlinien für die journalistische Arbeit formulieren<strong>“</strong> (MEINBERG 2004, 41). Wahrheitsliebe,<br />
Fairness durch das ausschließliche Verwenden redlicher Recherche-Methoden<br />
oder Unabhängigkeit durch Ablehnung von Bestechung <strong>und</strong> anderen externen Einflüssen<br />
sind Elemente, denen in den meisten europäischen Journalisten-Kodizes eine hohe Aufmerksamkeit<br />
zukommt (vgl. ebd.). Die meisten deutschen Kodizes beinhalten ähnliche Qualitätsd<strong>im</strong>ensionen,<br />
wie aus den genannten Beispielen deutlich wird.<br />
HALLER bezeichnet Verhaltenskodizes als „die vermutlich wirksamste Sicherung gegen interne<br />
wie externe Verführungen<strong>“</strong> (HALLER 2004, 24). 20 Er sagt, dass „Kodizes <strong>und</strong> Redaktionsstatute<br />
die Unabhängigkeit des Journalismus nicht hinreichend schützen<strong>“</strong> können; „dies<br />
müssen in verstärktem Maße die Journalisten <strong>und</strong> ihre Berufsorganisationen selbst tun, indem<br />
sie als Beobachter zweiter Ordnung solche Trends untersuchen <strong>und</strong> darüber berichten<br />
<strong>–</strong> <strong>und</strong> ihre Missbräuche anprangern (ebd., 30).<br />
Kritiker der berufsethischen journalistischen Kodizes bemängeln u.a., dass es den Regelwerken<br />
ohne schlagkräftige Sanktionsmöglichkeiten in der Regel an Durchsetzungskraft<br />
fehlt, die Formulierungen an vielen Stellen zu allgemein, ohne große Aussagekraft, zu abstrahiert<br />
<strong>und</strong> zu unsystematisch sind (vgl. RAUPP 2004, 183f.). Zudem würden ihre Maßstäbe<br />
erkenntnistheoretischen <strong>und</strong> empirischen Überprüfungen nicht standhalten können <strong>–</strong><br />
<strong>und</strong> sie seien zu wenig komplex (vgl. WEISCHENBERG 1992, 507ff.).<br />
MEINBERG merkt die Gefahr der zu großen Differenz von Forderungen <strong>und</strong> deren Erfüllbarkeit<br />
an. „Brisant wird die Lage, wenn solche Ethiken die Bodenhaftung verlieren, den Menschen<br />
,aus Fleisch <strong>und</strong> Blut’ an Ansprüchen messen, die <strong>im</strong> irdischen Dasein kaum erfüllbar<br />
sind. Dann kann die normativ ausgelegte Humanität leicht in Inhumanität umschlagen.<strong>“</strong><br />
(MEINBERG 2004, 50). Deshalb fordert er ein „empirisches Korrektiv<strong>“</strong>, das nicht über normative<br />
Gr<strong>und</strong>sätze des Handelns urteilt <strong>und</strong> nicht diese zu begründen versucht, aber dafür sorgen<br />
muss, dass „die Differenz von Sein <strong>und</strong> Sollen nicht unüberbrückbar wird<strong>“</strong> (ebd.).<br />
„Empirische Erkenntnisse über die ethischen Selbstkonzepte der Sportjournalisten [...] müssten gefördert<br />
werden, um sich nicht in Anforderungs- <strong>und</strong> Anspruchsdenken einer rein normativen Medienethik<br />
zu verlieren [...]. Eine Medienethik, die sowohl normativ wie deskriptiv-empirisch, also <strong>im</strong> gewissen Sinne<br />
co-existenzial verfährt, könnte den Mediensport neuartige Einsichten abtrotzen.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
MEINBERG führt an, dass nicht nur eine „normative Sollensethik<strong>“</strong> mit Kodizes <strong>und</strong> Appellen,<br />
die wohlklingend <strong>und</strong> überzeugend aber auch wirkungslos sein mögen, sondern „eine Art der<br />
Strebensethik<strong>“</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> wünschenswert ist (ebd., 43). In Erinnerung an Sokrates<br />
formuliert er in Reminiszenz an die Frage „Wie soll man leben?<strong>“</strong> für den <strong>Sportjournalismus</strong><br />
spezialisierte Fragen an, die sich auch aus dem vorigen Abschnitt ableiten lassen:<br />
„Warum betreibe ich <strong>Sportjournalismus</strong>? Welche Güter stecken in dieser Praxis, die ich wertschätze?<br />
Was nötigt mich, diese berufliche Tätigkeit auszuüben? Gründet die Attraktivität in meiner Wahrheitsliebe?<br />
Gründet sie vielleicht auch in meinem Sportenthusiasmus? Verstehe ich mich nicht auch <strong>im</strong> weitesten<br />
Sinne als Vermittler, als Botschafter des Sports?<strong>“</strong> (ebd., 44).<br />
Am Ende seines Beitrags schlägt MEINBERG gewissermaßen die Brücke zum Untersuchungsthema.<br />
Er fordert, dass die Medien einen gewichtigen Beitrag zur Mündigkeitsförde-<br />
20<br />
HALLER merkt zudem an, dass best<strong>im</strong>mte äußere Rahmenbedingungen erforderlich sind, damit der <strong>im</strong> Idealfall<br />
„handwerklich gut ausgebildete, über Statuten <strong>und</strong> Kodizes auf seiner (relative) Unabhängigkeit eingeschworene,<br />
seiner sozialen Verantwortung bewusste Journalist<strong>“</strong> überhaupt dazu beitragen kann, dass das Leitbild der Unabhängigkeit<br />
verwirklicht werden kann. Zu diesen Bedingungen nennt er: die Pressefreiheit, die Verwirklichung des<br />
Rechtsstaats, Demokratie, Vorhandensein eines möglichst zutrittsoffenen Marktes (HALLER 2004, 24ff.).<br />
27
ung darstellen, indem sie den Sport kritisch begleiten. „Zur Unterhaltung [muss] Aufklärung<br />
hinzutreten.<strong>“</strong> Gerade die „großen Festtage des Sports<strong>“</strong>, wie z.B. eine Fußball-WM, könnten<br />
„aktuelle Auslöser für kritisch anregende Berichterstattung sein, die zugleich ethische Impulse<br />
setzten könnten<strong>“</strong> (ebd., 52).<br />
„Eine Medienethik besitzt mit dem Mediensport ein lohnendes Betätigungsfeld, das, eingeb<strong>und</strong>en in eine<br />
globale Unterhaltungsindustrie, sich unter der Oberfläche Kardinalproblemen wie Freiheit, Verantwortung,<br />
Selbstbest<strong>im</strong>mung, Gerechtigkeit, Fairness <strong>und</strong> dergleichen öffnet <strong>und</strong> dadurch geradewegs<br />
zu ethischen Besinnungen einlädt.<strong>“</strong> (ebd., 42).<br />
3.2.2 Die system- <strong>und</strong> handlungstheoretische Begründung<br />
Nicht nur aus normativer Sicht lassen sich Kriterien für journalistische Qualität ableiten. AR-<br />
NOLD führt z.B. Begründungszusammenhänge aus systemtheoretischer <strong>und</strong> handlungstheoretischer<br />
Perspektive an, die kurz dargestellt werden sollen <strong>–</strong> besonders insoweit sie den<br />
Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> betreffend relevante Aussagen enthalten. Aus<br />
systemtheoretischer Sicht ist der Maßstab der Qualität die Erfüllung des autonomen Systems<br />
„Journalismus<strong>“</strong> als Selekteur, Bearbeiter <strong>und</strong> Präsentator von Informationen für andere gesellschaftliche<br />
Teilsysteme (vgl. ALTMEPPEN 2003, 125).<br />
„Versteht man Journalismus als System, das sich ‚autopoetisch’ selbst steuert <strong>und</strong> das eine spezifische<br />
Funktion erfüllt, die es von anderen Systemen unterscheidet, dann lassen sich Standards, Normen,<br />
Qualitätskriterien als Teil der Steuerungsinstanzen auffassen, die die Stabilität <strong>und</strong> Integration des Systems<br />
sowie seine Abst<strong>im</strong>mung <strong>–</strong> die ‚strukturelle Kopplung’ <strong>–</strong> mit anderen Systemen sicherstellen.<strong>“</strong><br />
(BUCHER 2003, 18).<br />
ARNOLD leitet aus der systemtheoretischen Betrachtung vier Kriterien für journalistische<br />
Qualität ab, die sich bereits aus der oben dargestellten normativen Perspektive ergeben haben<br />
<strong>und</strong> relevant für das Untersuchungsthema sind:<br />
• Vielfalt (in Themen, Meinungen <strong>und</strong> Akteuren),<br />
• Relevanz (Aktualität, Faktizität),<br />
• Unabhängigkeit (eigene Themensetzung, Recherche <strong>und</strong> Meinung),<br />
• Verständlichkeit (in der Umsetzung) (ARNOLD 2004, 1).<br />
Für den Tageszeitungsjournalismus nennt ARNOLD vier weitere Qualitätsmerkmale:<br />
• Universalität,<br />
• räumlicher Bezug auf das Regionale,<br />
• Meinungsbildung,<br />
• Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung (ebd.).<br />
Das Qualitätsmerkmal der Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung, verstanden als Analyse <strong>und</strong> tiefgehende<br />
Darstellung von Zusammenhängen, ist dabei besonders bedeutsam für die Untersuchung<br />
der Pressetexte auf kritische <strong>Distanz</strong>. 21 Deutlich wird aus der aus systemtheoretischer<br />
Sicht hergeleiteten Darstellung von Qualitätskriterien, dass normativ <strong>und</strong> systemisch hergeleitete<br />
Qualität nicht isoliert betrachtet werden kann. Handwerkliches Können ist förderlich,<br />
um gute Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung leisten zu können.<br />
Innerhalb der Systemtheorie ist für ARNOLD die handlungstheoretische Perspektive auf<br />
journalistische Qualität zu finden, weil es bei dieser Betrachtung um die Bedürfniserfüllung<br />
des Individuums geht <strong>–</strong> <strong>und</strong> nicht mehr nur um die Funktionserfüllung für das System. AR-<br />
NOLD nennt folgende journalistischen Qualitätskriterien, die aus handlungstheoretischer<br />
Sicht eine Rolle spielen:<br />
• Attraktivität (Gestaltung <strong>und</strong> Inhalt),<br />
21 Vgl. Kapitel 2.2.2.3 zur Zentrierung auf Ereignisse <strong>und</strong> Ergebnisse in der Sportberichterstattung.<br />
28
• Transparenz (Quellen <strong>und</strong> Zuständigkeiten),<br />
• Partizipationsmöglichkeiten (der Rezipienten),<br />
• Problemlösungs- <strong>und</strong> Handlungsvorschläge (Nutzwert),<br />
• Meinungsbildung (als Orientierungshilfe),<br />
• Relevanz (Was interessiert den Rezipienten, welche Probleme hat er?) (ebd.)<br />
Wie erwähnt, steht aus handlungstheoretischer Perspektive die Funktion der individuellen<br />
Bedürfniserfüllung der Rezipienten <strong>im</strong> Mittelpunkt der Qualitätsmessung. Diese Sichtweise<br />
ist für diese Untersuchung nicht so entscheidend, da der Vorwurf der mangelnden kritischen<br />
<strong>Distanz</strong> von Journalisten untersucht werden soll <strong>–</strong> <strong>und</strong> es muss nicht zwingend sein, dass<br />
kritische, distanzierte Sportberichterstattung hohe Akzeptanz bei den Rezipienten garantiert.<br />
„Hohe Akzeptanz be<strong>im</strong> Rezipienten [ist] per se kein Qualitätsausweis [...] Auch Ramsch lässt<br />
sich mitunter gut verkaufen.<strong>“</strong> (RUSS-MOHL 1992, 89). Allerdings kann nicht über Qualitätsjournalismus<br />
diskutiert werden, wenn damit nicht zumindest ein gewisses Interesse des Publikums<br />
angesprochen wird.<br />
Nach Christoph NEUBERGER müssen aus Sicht der Rezipienten folgende Qualitätskriterien<br />
erfüllt sein: Befriedigung des Informationsbedürfnisses, Hilfestellung zum Finden <strong>und</strong> Verwerten<br />
der Informationen sowie Rezeptionsanreize der Informationen durch unterhaltsame<br />
Elemente (NEUBERGER 1997, 179). Ziel aus dieser Sichtweise ist ein informiertes Publikum,<br />
das aktiv an der öffentlichen Willensbildung teilnehmen kann. Somit wird die Einbettung<br />
der handlungstheoretischen Sicht in den systemtheoretischen Zusammenhang <strong>–</strong> wie u.a.<br />
ARNOLD sie vorn<strong>im</strong>mt <strong>–</strong> deutlich.<br />
Auch wenn relativ wenige Informationen über Leserwünsche <strong>und</strong> -bedürfnisse vorliegen <strong>und</strong><br />
an solchen Untersuchungen kritisiert wird, dass der Leser nicht wüsste, was er will, liefern<br />
Studien mit der Opus- <strong>und</strong> der Readerscan-Methode 22 Aussagen, die zeigen, dass Rezipienten<br />
durchaus kritische, distanzierte Berichterstattung wünschen. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen<br />
zeigen, dass die Leser u.a. mehr kritischen Journalismus (SCHNEIDER/RAUE<br />
1998, 255ff.), meinungsfreudigere Zeitungen, mehr Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung (SCHÜTZ<br />
1996, 3) <strong>und</strong> eine gute Mischung der Darstellungsformen (MEIER 2004, 25) fordern.<br />
3.2.3 Zusammenfassung: Herleitungskriterien <strong>im</strong> Überblick<br />
Interessanterweise ergeben sich bei der Herleitung aus den unterschiedlichen Perspektiven<br />
ähnliche journalistische Qualitätskriterien, die in Kapitel 2.2 ausführlich thematisiert worden<br />
sind. Best<strong>im</strong>mte Merkmale können sowohl der normativen, der systemtheoretischen <strong>und</strong> der<br />
handlungstheoretischen Sicht zugeordnet werden, wie z.B. das Kriterium der (unabhängigen)<br />
Meinungsbildung zeigt.<br />
HALLER nutzt in seinem Ansatz zur Begründung journalistischer Qualität ein Zusammenspiel<br />
von normativer, system- <strong>und</strong> handlungstheoretischer Perspektive. Ziel kommunikativen,<br />
journalistischen Handelns sei gesellschaftliche Kommunikation. Die gr<strong>und</strong>legende Aufgabe <strong>–</strong><br />
in diesem Fall der Regionalzeitung <strong>–</strong> sei die Orientierungsfunktion. Sie sei der wichtigste<br />
Bezugspunkt für die Beurteilung journalistischer Qualität (HALLER 2003, 181f.). Journalistische<br />
Qualität bei Tageszeitungen misst sich nach HALLER<br />
• an unstrittigen handwerklichen Standards (Professionalität),<br />
22<br />
Die Opus-Methode ist ein dreistufiges Erhebungsverfahren, das zur Opt<strong>im</strong>ierung von Printmedien eingesetzt<br />
wird. Ziel ist es, herauszufinden, was die Leser nicht wollen. Qualitative Fokusgruppengespräche werden mit<br />
einer anschließenden quantitativen Gewichtung der genannten Mankos kombiniert. So entsteht eine Reihenfolge<br />
der Problemfelder. Mit der Readerscan-Methode kann eine Redaktion noch am selben Tag für jeden Zeitungsartikel<br />
eine Leserquote erstellen. Dazu markiert eine ausgewählte Gruppe von Lesern z.B. mit einem elektronischen<br />
Stift, welchen Text er bis zu welcher Stelle gelesen hat. Dabei wird allerdings nicht erfasst, wie die gelesenen<br />
Passagen bewertet werden.<br />
29
• am blattmacherischen Konzept nach der Medienwahrnehmung <strong>und</strong> -nutzung (Wahrnehmungsforschung),<br />
• am spezifischen Profil der Gattung Regionalzeitung (Orientierungsfunktion) <strong>und</strong><br />
• an den Erwartungen der tatsächlichen wie potenziellen Leser nach Maßgabe der<br />
Leserforschung (HALLER 2001, 268).<br />
Mithilfe eines Abgleichs von Leser- <strong>und</strong> Abbesteller-Analysen sowie von Beiträgen zur Nutzungsforschung<br />
mit den Standards journalistischen Handwerks <strong>und</strong> der Funktion der Regionalzeitung<br />
filtert HALLER für die Regionalzeitung, die Gegenstand der Untersuchung sein<br />
soll, neun Qualitätsmerkmale heraus, die opt<strong>im</strong>ale journalistische Qualität gewährleisten:<br />
• alles Wichtige in der Welt berichten <strong>und</strong> einordnen,<br />
• umfassender als Radio <strong>und</strong> TV,<br />
• mehr Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Deutungshilfen,<br />
• lokales Leben repräsentieren,<br />
• Nutzwert vor allem <strong>im</strong> Lokalen,<br />
• unabhängige, kritische Instanz,<br />
• Landesebene angemessen vermitteln,<br />
• übersichtlich, leicht verständlich <strong>und</strong> unterhaltsam,<br />
• attraktives, Neugier befriedigendes Angebot (HALLER 2000, 44f.).<br />
Für diese Studie ist besonders das von HALLER an sechster Stelle genannte Qualitätskriterium<br />
interessant: Eine gute Regionalzeitung muss eine unabhängige, kritische Instanz sein.<br />
Der Exkurs zum journalistischen Qualitätsbegriff macht deutlich, worauf sich der Vorwurf der<br />
mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> in der Sportberichterstattung stützt <strong>–</strong> in erster Linie auf ein<br />
normatives Journalismus-Verständnis. Allerdings lässt sich Kritik zur fehlenden <strong>Distanz</strong> <strong>–</strong> wie<br />
die oben ausgeführten Punkte zeigen <strong>–</strong> anhand system- oder handlungstheoretischen Herleitungen<br />
stützen, zumal es bei den Begründungen best<strong>im</strong>mter Merkmale Überschneidungen in<br />
ihrer Herleitung gibt. Es besteht weitgehend Konsens darüber, was journalistische Qualitätskriterien<br />
sind <strong>–</strong> unabhängig aus welcher Perspektive oder aus welchem Verständnis das<br />
Problem diskutiert wird. 23 Unstrittig unter den Autoren ist, dass journalistische Qualität für<br />
messbar <strong>und</strong> vergleichbar gehalten wird, wenn der Begriff in zahlreiche Einzelfaktoren zerlegt<br />
wird. Die wissenschaftliche Debatte um den Qualitätsbegriff <strong>im</strong> Journalismus ist nicht<br />
abgeschlossen. Theoretische Absicherung, klar <strong>und</strong> trennscharf formulierte Qualitätskriterien<br />
sowie das Verbinden der Perspektiven <strong>und</strong> Journalismusfunktionen <strong>–</strong> mit diesen Elementen<br />
müsste sich die wissenschaftliche Qualitätsdiskussion präziser <strong>und</strong> übergreifender befassen.<br />
3.3 Journalistische Qualität: Spezielle Gefährdung <strong>im</strong> Sportressort<br />
Wie erwähnt, existieren spezielle sportjournalistische Kodizes. Welche speziellen Gefahren<br />
bezüglich journalistischer Qualität treten <strong>im</strong> Ressort Sport auf? Können Tendenzen ausgemacht<br />
werden, aus denen geschlussfolgert werden könnte, das die Rezipienten gerade bei<br />
der Berichterstattung über eine Fußball-WM mit einer gewissen Parteilichkeit der Journalisten<br />
rechnen müssen <strong>–</strong> z.B. aus Gründen des Nationalismus? Auf diese Fragen soll nachfolgend<br />
eingegangen werden.<br />
23<br />
Wie kurz angesprochen, ordnet bspw. JANTOS die Herleitung von journalistischer Qualität danach wie sie<br />
legit<strong>im</strong>iert wird. Qualitätskriterien können demnach z.B. gesellschaftlich orientiert sein. Werden sie wissenschaftlich<br />
legit<strong>im</strong>iert, dann wird in der Regel auf den funktionalen Zusammenhang zu einer best<strong>im</strong>mten Journalismus-<br />
Funktion Bezug genommen (vgl. JANTOS 2004, 57ff.). RAGER leitet z.B. aus dem für ihn zentralen Vielfaltsgebot<br />
die Kriterien Aktualität, Relevanz, Richtigkeit <strong>und</strong> Vermittlung ab (RAGER 1994, 197ff.). Richtigkeit, Vollständigkeit/Relevanz,<br />
Wahrhaftigkeit, Verschiedenartigkeit, Unabhängigkeit, Zeitigkeit/Aktualität, Verständlichkeit <strong>und</strong><br />
Unterhaltsamkeit sind für Horst PÖTTKER die entscheidenden Kriterien, die er aus der Funktion des Journalismus<br />
ableitet, Öffentlichkeit herzustellen (PÖTTKER 2000, 377ff.).<br />
30
Der Mediensport gehorcht laut dem Leipziger Medienwissenschaftler Hans-Jörg STIEHLER<br />
„eigenen Gesetzen<strong>“</strong>. In verschiedener Hinsicht seien Abweichungen vom „normalen<strong>“</strong> Informationsjournalismus<br />
möglich <strong>und</strong> real. „Zum einen ist [...] an die Reportertätigkeit zu denken,<br />
der Verstöße gegen die Normen der Neutralität, Ausgewogenheit usw. zugunsten der Zuschauerbindung<br />
<strong>und</strong> -ansprache durchaus verziehen werden <strong>und</strong> die andere (vor allem emotionale)<br />
Stilistiken pflegt als beispielsweise die Parlamentsreportage.<strong>“</strong> (STIEHLER 2003,<br />
165). Parteilichkeit wird in der Sportberichterstattung gefordert, um die Möglichkeit der Identifikation<br />
zu erhöhen. „Jeder Kommentator muss in der Lage sein, seinen Äußerungen Spannungsmomente<br />
zu verleihen: [...] indem er auch Parteilichkeit signalisiert.<strong>“</strong> (NEUGEBAUER<br />
1986, 427). 24<br />
STIEHLER bemerkt, dass die Rezeption von Sport ohne Anteil <strong>und</strong> Partei zu nehmen, wenn<br />
nicht sinnlos, so doch weniger unterhaltsam sei. Er folgert, dass „der neutrale Beobachter,<br />
der ,Rezensent’, eine Ausnahme darstellt <strong>und</strong> Verlauf <strong>und</strong> Ergebnis von Fernsehsport (wie<br />
auch die Darstellung!) <strong>stark</strong> durch die ,Brille’ der eigenen Präferenzen wahrgenommen werden<strong>“</strong><br />
(STIEHLER 2003, 173). „Der distanzierte <strong>und</strong> neutrale Beobachter [kann] weder in den<br />
Medien noch <strong>im</strong> Publikum als Normalfall vermutet werden.<strong>“</strong> Sowohl berichterstattende Medienvertreter<br />
als auch Fans gewinnen <strong>und</strong> verlieren mit, wenn Sportler als „Stellvertreter biografisch<br />
entstandener regionaler Loyalitäten<strong>“</strong> einen Wettkampf bestreiten <strong>–</strong> sowohl emotional<br />
als auch möglicherweise in ihrem journalistischen Standing (MARR/STIEHLER 1995, 347;<br />
KÖNIG 2002, 11; STOLLENWERK 1996, 82ff.; LUDWIG 1987, 213).<br />
„Wer wissen will, wie es um das Verhältnis zwischen Sport <strong>und</strong> Medien bestellt ist, darf be<strong>im</strong> Fußball<br />
nicht aufs Spielfeld schauen <strong>–</strong> ein Blick zur Pressetribüne gibt da mehr her: Samstagnachmittag, 17<br />
Uhr, erste B<strong>und</strong>esliga. Spitze Schreie <strong>und</strong> geballte Fäuste unter Journalisten, wenn ,ihr’ Verein endlich<br />
das 1:0 erzielt, dem Europacup ein wenig näher kommt <strong>und</strong> damit der ganze Tross den schönen, weiten<br />
Reisen. Madrid, Mailand, Manchester. [...] Der Erfolg des umjubelten Athleten (oder Clubs) [scheint]<br />
den Erfolg des ihn umjubelnden Journalisten zu bedingen: Madrid, Mailand, Manchester.<strong>“</strong> (SUSSE-<br />
BACH 2006).<br />
Außerdem ist bei der Sportrezeption <strong>–</strong> auf der Tribüne <strong>und</strong> indirekt durch die Medien (besonders<br />
bei den Live-Medien) <strong>–</strong> körperliches Miterleben, Mitfiebern oder Mitgehen möglich.<br />
„Zum einen handelt es sich um Erlebnisintensität <strong>und</strong> Anteilnahme, die sich ihren körperlichen<br />
Ausdruck suchen. Zum anderen spielen die Dramen des Sports <strong>im</strong> ,Medium’ des Körpers,<br />
was körperliche Formen des Mitagierens begünstigt oder evoziert.<strong>“</strong> (STIEHLER 2003,<br />
175). Dies kann auf die professionellen Beobachter von Sportereignissen übertragen werden<br />
<strong>–</strong> wie folgende Übertragung auf die Sportberichterstattung möglich ist, was die Normiertheit<br />
der Verhaltensregeln der Journalisten bei der Beobachtung der sportlichen Ereignisse betrifft.<br />
STIEHLER schreibt, dass bei der Sportrezeption eine Vielzahl von Gefühlen, die <strong>im</strong><br />
normalen Leben eher Anlass zur Irritation sind, „möglich, ja erwünscht<strong>“</strong> sind (ebd., 178). 25<br />
24<br />
Die Norm der Unparteilichkeit ist mit einem best<strong>im</strong>mten (dominierenden) Verständnis von der Funktion des<br />
Journalismus verb<strong>und</strong>en <strong>–</strong> „als Instanz einer neutralen Vermittlung der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation<strong>“</strong><br />
(SCHÖNHAGEN 1998, 260). Auch das gegensätzliche Prinzip der Parteilichkeit in der journalistischen Berichterstattung<br />
kann hergeleitet werden <strong>–</strong> wenn es die Aufgabe des Journalismus sein soll, „mit kritischem Engagement<br />
best<strong>im</strong>mte Interessen zu vertreten oder vorwiegend mit eigenen Erkenntnissen <strong>und</strong> Auffassungen als Partner in<br />
der gesellschaftlichen Kommunikation zu fungieren<strong>“</strong> (ebd.).<br />
25<br />
Ein mit einem CDU-Shirt gekleideter Journalist würde <strong>im</strong> B<strong>und</strong>estag wohl für größere Irritationen sorgen. Und<br />
<strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>? „Schon manch Kollege ist <strong>im</strong> Trikot seines Lieblingsvereins auf der Tribüne gesehen worden.<strong>“</strong><br />
(FRITSCH 2006b). Es ist aufschlussreich, was z.B. Albrecht Schmitt-Fleckenstein, Arena-Redaktionsleiter<br />
vor der Fußball-WM 2006, auf die Frage geantwortet hat, was „die größte journalistische Herausforderung dieser<br />
WM in Deutschland<strong>“</strong> sein wird. Schmitt-Fleckenstein: „Es wird [...] interessant zu beobachten sein, wie die vor Ort<br />
arbeitenden Kollegen es schaffen, Freude <strong>und</strong> Begeisterung bei sich selbst zuzulassen.<strong>“</strong> Andere Journalisten<br />
geben nicht das Ziel vor, sich begeistern zu müssen, weisen allerdings warnend auf die Gefahr hin, dass das in<br />
der Praxis schnell geschehen könnte. Clemens Gerlach, Spiegel-Online-Redakteur, gibt vorab an, dass es<br />
schwer wird, „nicht dem WM-Wahn zu verfallen, sondern trotz Begeisterung darauf zu achten, Journalist zu bleiben<br />
<strong>und</strong> den Überblick zu behalten<strong>“</strong>. Und ZDF-Reporter Béla Réthy mahnt, „sich unabhängig zu machen von<br />
Euphorie <strong>und</strong> Trauer<strong>“</strong>. (WALTHER 2006, 58f.). Pay-TV-Anbieter Arena bietet neben dem regulären Kommentar<br />
den „gefärbten<strong>“</strong> Kommentar an. Eine solche Parteinahme für eine Mannschaft wird von Praktikern als ein „durch<br />
<strong>und</strong> durch unjournalistisches Vorgehen<strong>“</strong> angesehen (VOSS 2006).<br />
31
Dem Sport gilt die Unterhaltungsfunktion bzw. der Unterhaltungswert als inhärent. Das trägt<br />
dazu bei, dass die Qualität der Sportberichterstattung aus der Perspektive des Informationsjournalismus<br />
besonders gefährdet ist, da dann <strong>–</strong> so könnte gefolgert werden <strong>–</strong> die Qualitätsnormen<br />
des Informationsjournalismus nicht mehr streng umgesetzt werden müssten (WEISS<br />
1991, 316; STIEHLER 1999; STIEHLER 2003, 160ff.). 26 Gerade die Nutzung der unterhaltenden<br />
Elemente des Sports ist eine entscheidende Ursache für den endgültigen Durchbruch<br />
der Sportberichterstattung. Die sich entwickelnde Massenpresse findet <strong>im</strong> Sport einen idealen<br />
Partner, als sie auf der Suche nach publikumswirksamen neuen Themen ist (WEI-<br />
SCHENBERG 1976, 130; WEISCHENBERG 1978, 12; WEISCHENBERG 1994, 428ff.). 27 In<br />
der heutigen Sportberichterstattung werden informierende <strong>und</strong> unterhaltende Funktionen<br />
vermischt eingesetzt. „Sportberichterstattung ist ein echtes Hybrid aus Information <strong>und</strong> Unterhaltung,<br />
sowohl auf Seiten der Anbieter als auch auf Seiten der Rezipienten.<strong>“</strong> (LOOSEN<br />
2001, 137).<br />
Allerdings kritisiert das Sportnetzwerk gerade den Trend <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>, auf unterhaltende<br />
Elemente zu setzen, <strong>und</strong> positioniert sich gegen „das Abdriften des <strong>Sportjournalismus</strong><br />
in das reine Unterhaltungsressort<strong>“</strong> (O.V. 2006c). „Das Sportnetzwerk wendet sich gegen absolute<br />
Gleichsetzung von Sport <strong>und</strong> Unterhaltung, die auf Dauer journalistische Standards<br />
außer Kraft setzt.<strong>“</strong> (O.V. 2006a). Holger GERTZ, Mitglied des Sportnetzwerks <strong>und</strong> Redakteur<br />
der Süddeutschen Zeitung, formuliert: „Fußball ist ja nur zum Teil Unterhaltung, unter der<br />
Oberfläche schlummern tausend ernste Fragen, deren Beantwortung das Ziel eines Sportjournalisten<br />
sein sollte.<strong>“</strong> (GERTZ 2006b).<br />
„Eine Sportberichterstattung in der Presse, deren einseitige Meßlatte der Unterhaltungswert ist, befindet<br />
sich jedoch in der Gefahr, in Widerspruch zu den weiteren Aufgaben zu geraten, die üblicherweise<br />
Journalisten in unserer Gesellschaft zu erfüllen haben. Wird Sportberichterstattung auf deren unterhaltende<br />
Funktion reduziert, so widerspricht sie den journalistischen Pflichten <strong>und</strong> Möglichkeiten, die den<br />
Massenmedien in einer aufgeklärten <strong>und</strong> aufklärungsbedürftigen Gesellschaft zukommen.<strong>“</strong> (DIGEL<br />
1993, 78)<br />
WEISCHENBERG schreibt: „Der <strong>Sportjournalismus</strong> ist keine Insel des Journalismus. Dieses<br />
System macht lediglich generelle Strukturen, Funktionen <strong>und</strong> Prozesse <strong>im</strong> gesamten Journalismus<br />
besonders deutlich.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994, 450).<br />
Einer der häufigsten Vorwürfe ist, dass die deutsche Sportberichterstattung bei internationalen<br />
Wettkämpfen einen Hang zum Nationalismus hat (WEISCHENBERG 1976, 193f.). Jürgen<br />
SCHWIER macht darauf aufmerksam, dass die Massenmedien „D<strong>im</strong>ensionen des Nationalbezugs<br />
<strong>und</strong> der Stiftung von Wir-Identifikationen<strong>“</strong> <strong>im</strong> Ressort Sport <strong>stark</strong> betonen.<br />
„Fußballnationalmannschaften [haben] <strong>im</strong> Medienzeitalter die Aufgabe, das Bild <strong>und</strong> die Vorstellungen,<br />
die ein Land von sich besitzt, wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. [...] Ethnozentristische Formulierungen,<br />
nationalistische Bilder <strong>und</strong> patriotische St<strong>im</strong>mung gehören gegenwärtig zum festen Repertoire des<br />
Mediensports.<strong>“</strong> (SCHWIER 2002, 85ff.).<br />
Der Mediensport <strong>und</strong> besonders der Medienfußball folgt der Gr<strong>und</strong>figur „Wir <strong>und</strong> die anderen<strong>“</strong>.<br />
Spiele zwischen Fußballnationalteams werden in den Medien häufig als Wettkämpfe<br />
zwischen „uns<strong>“</strong> <strong>und</strong> den „Anderen<strong>“</strong> entworfen (SCHWIER 2002, 88; WERNECKEN 2000).<br />
Untersuchungen zur Attributionsforschung weisen daraufhin, dass <strong>im</strong> Mediensport internale<br />
Ursachenzuschreibungen dominieren. Als ein Gr<strong>und</strong> dafür kann die Konzentration auf die<br />
nationale Perspektive angeführt werden. Das Abschneiden anderer Mannschaften interessiert<br />
demnach bei einer WM zumindest weit weniger als das des eigenen Teams (vgl.<br />
STIEHLER/MARR 2001, 128). POULTON erklärt, dass die Presse über internationale Fußballwettkämpfe<br />
häufiger nationalistischer eingefärbt berichtet als das Fernsehen (POULTON<br />
2004, 437ff.).<br />
26<br />
„Stellt man die Unterhaltung in den Vordergr<strong>und</strong>, so ließe sich argumentieren, auch bei der Hitparade werde<br />
nicht über das Gemauschel der Plattenbosse <strong>und</strong> das Zustandekommen der Top Ten berichtet.<strong>“</strong> (VOSS 2005a).<br />
27<br />
Vgl. Kapitel 4.1.4 zur Geschichte der Sportpresse.<br />
32
STIEHLER <strong>und</strong> MARR schreiben, dass „quasiwissenschaftliche<strong>“</strong> Sportberichterstattung <strong>–</strong><br />
also z.B. die analytische Suche nach Ursachen von Spielergebnissen vor, während <strong>und</strong> nach<br />
der Übertragung eines Sportereignisses quasi wie ein „naiver Wissenschaftler<strong>“</strong> <strong>–</strong> als Strategie<br />
betrachtet werden kann, Konflikte zu umgehen, zu denen die Verletzung journalistischer<br />
Normen führen könnte, <strong>und</strong> gleichzeitig nicht auf die Parteinahme für eine Mannschaft verzichten<br />
zu müssen. Die Autoren fassen zusammen, inwiefern in der Sportberichterstattung<br />
eine besondere Gefährdung journalistischer Qualität besteht:<br />
„Sportberichterstattung unterliegt insbesondere bei internationalen Wettkämpfen der Tendenz zur einseitigen<br />
Fokussierung auf die eigene Mannschaft <strong>und</strong> steht somit unter permanenten Verdacht, die<br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen journalistischen Berufsnormen der Objektivität, Unabhängigkeit <strong>und</strong> Ausgewogenheit<br />
zu verletzen. Gleichzeitig muss die nationale Positionierung als wichtige Voraussetzung für die Publikumsresonanz<br />
bei internationalen Vergleichen vorausgesetzt werden.<strong>“</strong> (STIEHLER/MARR 2001, 117).<br />
In der Sportberichterstattung wird häufig auf Experten zurückgegriffen, die eine Perspektive<br />
zwischen Fans <strong>und</strong> Journalisten einnehmen, frei von journalistischen Normen sind <strong>und</strong> zwischen<br />
den Perspektiven vermitteln sollen.<br />
3.3.1 Exkurs: Parallelen der Qualitätsgefährdung in der Kriegsberichterstattung<br />
Ein häufig zitierter Vorwurf, der sich an die Sportberichterstattung richtet, ist, dass diese inflationär<br />
Gebrauch von Kriegsmetaphern macht. 28 Passend zu diesem Vorwurf wird nachfolgend<br />
andeutungsweise der Versuch unternommen, Parallelen zur Qualitätsgefährdung <strong>im</strong><br />
<strong>Sportjournalismus</strong> aus einem Aufsatz des Kommunikationswissenschaftlers Uli GLEICH zu<br />
ziehen, der sich mit der „Qualität <strong>im</strong> Journalismus am Beispiel der Kriegsberichterstattung<strong>“</strong><br />
beschäftigt (vgl. GLEICH 2003, 139ff.).<br />
Sowohl Kriege als auch Sportwettkämpfe werden u.a. deshalb zu herausragenden Medienereignissen,<br />
weil sie aktualitätsorientierte, anschauliche, zugängliche, personalisierbare <strong>und</strong><br />
visualisierbare Themen darstellen, die sich dramaturgisch wirksam auf die Alternative Sieg<br />
oder Niederlage (mitunter sogar Gut oder Böse) reduzieren lassen. Gemeinsamkeiten zwischen<br />
beiden Berichterstattungsbereichen können hinsichtlich der Nachrichtenfaktoren festgestellt<br />
werden, aufgr<strong>und</strong> denen ein Ereignis als berichtenswert eingeschätzt wird: hoher<br />
Betroffenheitsgrad des eigenen Landes, Beteiligung von Elite-Nationen, Möglichkeit der Anschlusskommunikation<br />
<strong>und</strong> geringe kulturelle, politische <strong>und</strong> ökonomische <strong>Distanz</strong>. Kriege<br />
<strong>und</strong> große Sportereignisse beförderten <strong>und</strong> befördern die Entstehung, Verbreitung <strong>und</strong> Popularisierung<br />
neuer Medientechniken (vgl. LOOSEN 2001, 138f.). Stereotypisierungen <strong>und</strong><br />
Fre<strong>und</strong>-Feind-Polarisierungen können der Berichterstattung beider Felder attestiert werden<br />
(vgl. WERNECKEN 2000).<br />
GLEICH arbeitet für die Kriegsberichterstattung heraus, dass die häufige Wiedergabe „offizieller<strong>“</strong><br />
Positionen nur scheinbare Objektivität vermittelt. Alternative Quellen werden kaum<br />
benutzt, die Medien orientieren sich an der von den Militärs vorgegebenen Nachrichtenagenda<br />
<strong>und</strong> nur ein kleiner Prozentsatz der Hintergr<strong>und</strong>informationen geht über den aktuellen<br />
Konflikt hinaus. Im Raum steht der Vorwurf, dass die Medien nationale Parteien unterstützen.<br />
Punkte, die ähnlich auch für die Sportberichterstattung vermutet werden können<br />
bzw. festgestellt worden sind.<br />
„[A]uch durch die erschwerten Arbeitsbedingungen von Journalisten <strong>und</strong> nicht zuletzt durch die <strong>im</strong>plizite<br />
oder explizite Parteinahme der Medien werden die unterschiedlichen Qualitätskriterien des Journalismus<br />
<strong>im</strong> Rahmen der Kriegsberichterstattung absichtlich oder unabsichtlich häufig nicht mehr beachtet.<br />
Dies führt zu den vielfach dokumentierten Mängeln der Berichterstattung [...].<strong>“</strong> (GLEICH 2003, 147)<br />
28<br />
Mannschaften werden zu „Truppen<strong>“</strong>, Trainer zu „Feldherren<strong>“</strong> oder „Generälen<strong>“</strong>, Geschäftsstellen zu „Hauptquartieren<strong>“</strong>.<br />
Spieler werden <strong>im</strong> Trainingslager „einkaserniert<strong>“</strong>. Wörter wie „Schlacht<strong>“</strong>, „Abfangjäger<strong>“</strong>, „Bombenst<strong>im</strong>mung<strong>“</strong>,<br />
„Granate<strong>“</strong>, groß angelegte Offensive<strong>“</strong> <strong>und</strong> „unter Beschuss stehen<strong>“</strong> sind fast täglich in der Sportberichterstattung<br />
zu lesen oder zu hören (vgl. LINDEN 1994, S. 89f.; FREUDENREICH 1983c, 95).<br />
33
GLEICH führt aus der Literatur verschiedene Faktoren an, die zur Qualitätsverbesserung der<br />
Kriegsberichterstattung beitragen sollen: Ein Opt<strong>im</strong>ierungsfaktor ist das ständige Beobachten<br />
der Krisenherde durch die Medien, damit sich die Berichterstattung vom reaktiven zum aktiven<br />
Verhalten verändert. Außerdem sei eine bessere Ausbildung der Journalisten notwendig,<br />
um für das spezielle Berichterstattungsfeld opt<strong>im</strong>aler qualifiziert zu sein <strong>und</strong> u.a. offizielle<br />
Aussagen kritisch werten zu können <strong>und</strong> sich nicht die Agenda der Berichterstattung diktieren<br />
zu lassen (vgl. MEYER 2007). Zudem sei das solidarische Vorgehen gegen die Monopolisierung<br />
von Informationen <strong>und</strong> eine reflektierte Darstellung <strong>–</strong> unter Einbeziehung der unterrepräsentierten<br />
(Teil-)Öffentlichkeiten <strong>–</strong> notwendig, um die Kriegsberichterstattung qualitativ<br />
opt<strong>im</strong>ieren zu können. „Die Ausrichtung auf Leitmedien, die Übersteigerung des Aktualitätsprinzips,<br />
der Kult der S<strong>im</strong>ultanität von Ereignis <strong>und</strong> Berichterstattung sind zu hinterfragen,<br />
zugunsten von ausführlicheren <strong>und</strong> besseren Hintergr<strong>und</strong>informationen.<strong>“</strong> (GLEICH 2003,<br />
147).<br />
Unter Berücksichtigung der Hinweise, sich nicht auf Verlautbarungsjournalismus <strong>und</strong> inszenierte<br />
Pressekonferenzen zu verlassen, können etliche Parallelen zu den Vorwürfen <strong>und</strong> zu<br />
den Opt<strong>im</strong>ierungsvorschlägen hinsichtlich der Qualität <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> aus der wissenschaftlichen<br />
Beschäftigung mit der Kriegsberichterstattung festgestellt werden. Sportliche<br />
Themen können fast beliebig in die Forderungen zur Verbesserung der Kriegsberichterstattung<br />
eingesetzt werden. So wäre z.B. ein aktives statt reaktives Mediensystem <strong>im</strong> Sport sehr<br />
förderlich, wenn die journalistische Qualität verbessert werden soll <strong>–</strong> zu denken ist bei diesen<br />
Stichworten z.B. an den sportjournalistischen Umgang mit dem Themen „Doping<strong>“</strong> <strong>und</strong> „gewaltbereite<br />
Zuschauer<strong>“</strong>.<br />
3.4 Zusammenfassung: Qualitätsverständnis <strong>und</strong> Untersuchungsthema<br />
Fasst man die in diesem Kapitel dargestellten Ausführungen zum (sport-)journalistischen<br />
Qualitätsbegriff zusammen, werden folgende Punkte festgestellt: Qualität <strong>im</strong> Journalismus<br />
eindeutig definieren zu wollen, ist aufgr<strong>und</strong> der Vielschichtigkeit des Begriffes sehr schwierig.<br />
Es gibt einen Pluralismus der Erklärungsansätze. Die wissenschaftliche Debatte zum journalistischen<br />
Qualitätsbegriff ist keineswegs abgeschlossen. Über Qualität <strong>im</strong> Journalismus<br />
kann nur diskutiert werden, wenn dieser Begriff in eine ganze Reihe von Einzelkriterien untergliedert<br />
wird, die sich aus den verschiedenen Überlegungen der Wissenschaft <strong>und</strong> des<br />
praktischen Journalismus ergeben.<br />
Die Kritik zum Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> in der Sportberichterstattung, die<br />
Gegenstand dieser Untersuchung ist, orientiert sich in erster Linie an einem normativen<br />
Journalismus-Verständnis. Die verschiedenen Kodizes als moralische, normative Steuerinstrumentarien<br />
enthalten ähnliche, sich teilweise in der Herleitung überschneidende Qualitätsd<strong>im</strong>ensionen.<br />
Wird journalistische Qualität aus system- oder handlungstheoretischer<br />
Sicht beschrieben, ergeben sich allerdings zum größten Teil identische Kriterien.<br />
Für den <strong>Sportjournalismus</strong> können neben der Schwierigkeit, journalistische Qualität eindeutig<br />
zu definieren, spezielle Gefährdungspotenziale angeführt werden <strong>–</strong> wenn lediglich beispielhaft<br />
an den großen Stellenwert der Unterhaltung oder an das Problem der oft falsch verstandenen<br />
Fairness aufgr<strong>und</strong> der Vermischung von sportlichem <strong>und</strong> journalistischem Ethos erinnert<br />
wird. Allerdings kann der <strong>Sportjournalismus</strong> nicht als Parallelwelt des Journalismus verstanden<br />
werden, an den andere Qualitätskriterien angelegt werden müssen als an Journalismus<br />
anderer Ressorts.<br />
Problematisch ist, journalistische Qualität zu operationalisieren bzw. messbar zu machen.<br />
Dies kann nur anhand von best<strong>im</strong>mten festzulegenden Indikatoren geschehen. HALLER leistet<br />
eine solche Operationalisierung. Bei seinem Benchmarking-Projekt für Regionalzeitungen<br />
ist er der Meinung, dass nur das Produkt selbst Aufschluss über journalistische Qualität geben<br />
könne. Denn bei der Kaufentscheidung der Abonnenten <strong>und</strong> Leser würden auch andere<br />
Gründe eine Rolle spielen (vgl. HALLER 2001, 255). HALLER wählt die Inhaltsanalyse als<br />
34
Überprüfungsinstrument <strong>und</strong> wählt dabei Kategorien, die den neun Qualitätsmerkmalen entsprechen,<br />
die oben genannt wurden. 29 Besonders das an sechster Stelle aufgeführte Merkmal<br />
der Notwendigkeit der Zeitung als unabhängige, kritische Instanz ist in dieser Untersuchung<br />
vorrangig von Interesse. Dieses Kriterium HALLERS ist deshalb ein Ausgangspunkt<br />
bei der vorliegenden Untersuchung, die sich ebenfalls auf Regionalzeitungen konzentriert. 30<br />
Gr<strong>und</strong>lage dieser Studie ist ein Qualitätsverständnis als opt<strong>im</strong>ales Zusammenspiel von Normenerfüllung<br />
<strong>und</strong> Funktionserfüllung, die mit ARNOLDS Herleitung aus normativer <strong>und</strong> systemtheoretischer<br />
Perspektive übereinst<strong>im</strong>mt (vgl. STREITENBERGER/PENSHORN 2005,<br />
55). Unter Normenerfüllung wird die Einhaltung journalistischer Handwerksregeln, Kodizes<br />
<strong>und</strong> Gesetze verstanden, was als wichtige Ergänzung der Funktionserfüllung angesehen<br />
wird. Unter dieser wird in Anlehnung an HALLER die Orientierungsfunktion als die wichtigste<br />
systemtheoretische Aufgabe von Tageszeitungen betrachtet. 31 Bezüglich des Vorwurfes der<br />
mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> werden vor allem die Funktionserfüllung der öffentlichen Kritik<br />
<strong>und</strong> Kontrolle sowie die Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung genannt (vgl. HALLER 2000, 44f.). Die<br />
Bedürfniserfüllung <strong>–</strong> korrespondierend mit ARNOLDS handlungstheoretischer Sicht <strong>–</strong> wird<br />
als nicht entscheidende Gr<strong>und</strong>lage für diese Untersuchung angesehen, wobei <strong>–</strong> wie angemerkt<br />
<strong>–</strong> journalistische Qualität nicht völlig an den Lesererwartungen vorbei diskutiert werden<br />
kann <strong>und</strong> Forschungsergebnisse zeigen, dass Zeitungsleser durchaus mehr kritischeren,<br />
meinungsfreudigeren <strong>und</strong> hintergründigeren <strong>Sportjournalismus</strong> fordern (vgl. SCHNEI-<br />
DER/RAUE 1998, 255ff.; SCHÜTZ 1996, 3).<br />
Ausgehend von diesem Qualitätsverständnis <strong>und</strong> dem ausführlich dargestellten Stand der<br />
wissenschaftlichen Kritik zum Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
kann z.B. inhaltsanalytisch untersucht werden, wie hintergründig die betreffende Sportberichterstattung<br />
ist, indem Themen <strong>und</strong> Darstellungsformen sowie die Art <strong>und</strong> Zahl der<br />
Quellen ausgezählt werden. Merkmale wie die Häufigkeit von Konfliktthemen <strong>und</strong> deren Darstellung,<br />
Anzahl von Meinungsartikeln sowie redaktionelle Eigenleistungen können in Beziehung<br />
zum Kriterium des geforderten kritischen Journalismus gesetzt werden.<br />
29<br />
Vgl. Kapitel 3.2.3 zur überblicksartigen Darstellung der Herleitungskriterien.<br />
30<br />
Allerdings klammert HALLER für seinen Leistungsvergleich bei Regionalzeitungen sowohl die überregionale als<br />
die lokale Sportberichterstattung aus (vgl. HALLER 2000, 44ff.).<br />
31<br />
Kommentare von Sportjournalisten während TV-Live-Übertragungen bieten den Zuschauern ebenfalls wichtige<br />
Orientierungshilfen <strong>–</strong> vor allem in Bezug auf Erinnerungsleistungen <strong>und</strong> Leistungsbeurteilungen (vgl.<br />
SCHAFFRATH 2003, 82ff.).<br />
35
4. HINTERGRUND<br />
4.1 Sport in der Tageszeitung<br />
In der vorliegenden Arbeit wird die Sportberichterstattung regionaler deutscher Tageszeitungen<br />
untersucht. Wie kommt es dazu, dass regionale Blätter den deutschen Tageszeitungsmarkt<br />
dominieren? Seit wann <strong>und</strong> warum findet der Sport als Berichterstattungsthema Berücksichtigung<br />
in der Presse? Wie kann das Problem der Unfähigkeit zu distanzierter Berichterstattung<br />
speziell <strong>im</strong> Sport historisch erklärt werden? In diesem Kapitel wird versucht,<br />
u.a. diese Fragen in aller Kürze zu beantworten, um die Hintergründe entsprechend der Forschungsfrage<br />
zu verstehen. Außerdem werden Begriffe definiert, die in der vorliegenden Arbeit<br />
benutzt werden. Am Ende wird die derzeitige (Konkurrenz-)Situation des deutschen<br />
(Sport-)Tageszeitungsmarktes mit einigen aktuellen Zahlen umrissen.<br />
4.1.1 Definition <strong>und</strong> Typologie der Tageszeitung<br />
Es existieren unterschiedliche Definitionsversuche zum Begriff „Tageszeitung<strong>“</strong>. Emil DOVI-<br />
FAT erklärt z.B.:<br />
„Die Zeitung ist ein in regelmäßiger Folge erscheinendes, gr<strong>und</strong>sätzlich jedermann zugängliches Medium,<br />
das aktuelle Informationen aus allen Lebensbereichen verbreitet. [...] Die Zeitung vermittelt jüngstes<br />
Gegenwartsgeschehen in kürzester regelmäßiger Folge der breitesten Öffentlichkeit.<strong>“</strong> (DOVI-<br />
FAT/WILKE 1976, 16.)<br />
Konsens besteht über die Auffassung, dass die vier folgenden gr<strong>und</strong>legenden Merkmale das<br />
Wesen einer Zeitung ausmachen <strong>und</strong> sie gegenüber anderen Medien abgrenzen:<br />
• Aktualität, d.h. die Berichterstattung bezieht sich auf die Gegenwart,<br />
• Periodizität, d.h. Zeitungen erscheinen regelmäßig, mindestens zwe<strong>im</strong>al wöchentlich,<br />
• Publizität, d.h. allgemeine Zugänglichkeit, Öffentlichkeit <strong>im</strong> Verbreitungsgebiet,<br />
• Universalität, d.h. es gibt keine thematische Begrenzung (vgl. UENK/LAARMANN<br />
1992, 17; MAST 2000, 18).<br />
Tageszeitungen erscheinen in vielfältigen Formen. FRANKENFELD legt drei Typengruppen<br />
fest. Sein Unterscheidungskriterium ist die Verbreitung:<br />
1. Überregionale Blätter,<br />
2. Regionale Blätter:<br />
a) Regionale Großzeitungen,<br />
b) Regionale Mittel- <strong>und</strong> Kleinzeitungen, He<strong>im</strong>atblätter,<br />
3. Boulevardzeitungen: in Aufmachung <strong>und</strong> Vertrieb auf den Straßenverkauf ausgerichtet,<br />
werden zu mehr als 90 % <strong>im</strong> Einzelverkauf vertrieben (FRANKENFELD 1969,<br />
154).<br />
HACKFORTH fasst Lokalzeitungen als eigenständige Typengruppe (HACKFORTH 1985,<br />
21), wobei die Unterscheidung zwischen den Begriffen „regional<strong>“</strong> <strong>und</strong> „lokal<strong>“</strong> bei ihm nicht<br />
eindeutig geklärt ist. Sowohl Regional- als Lokalzeitungen haben die exklusive Information in<br />
einem best<strong>im</strong>mten Bereich gemeinsam. Eine <strong>stark</strong>e Leser-Blatt-Bindung entsteht, weil u.a.<br />
die jeweilige Zeitung häufig das einzige Medium ist, das über örtliche Geschehnisse informiert<br />
(vgl. RAGER 1999, 136).<br />
4.1.2 Geschichte der Zeitung bis 1945<br />
Nach Gutenbergs Buchdruckerfindung <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert erscheinen zwischen 1568 <strong>und</strong><br />
1605 die Fuggerzeitungen. Mit diesen handgeschriebenen Nachrichten beginnt die Geschichte<br />
des deutschen Zeitungswesens <strong>im</strong> Sinne periodisch erscheinender Zeitungen<br />
36
(JARREN/BONFADELLI 2001, 58). Im 16. Jahrh<strong>und</strong>ert entsteht der Beruf des Korrespondenten<br />
oder Nachrichtenagenten, der meist <strong>im</strong> Dienst von Hof, Kirche oder Handelshäusern<br />
steht. Die „Neuen Zeitungen<strong>“</strong> des 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>erts berichten mit Holzschnitten illustriert<br />
über aktuelle, gesellschaftliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Ereignisse. Sie sind in der jeweiligen<br />
Landessprache verfasst <strong>und</strong> für fast jeden erschwinglich. Bei der ältesten heute bekannten<br />
gedruckten Zeitung (Newe zytung vom orient vnnd auffgange) aus dem Jahr 1502 ist zum<br />
ersten Mal das Wort Zeitung nachweisbar (ebd.).<br />
Die Herausgeber der wöchentlich erscheinenden Druckwerke, die <strong>im</strong> ersten Jahrzehnt des<br />
17. Jahrh<strong>und</strong>erts entstehen, orientieren sich bereits an den Tageszeitungsmerkmalen Publizität,<br />
Aktualität, Universalität <strong>und</strong> Periodizität. Eine der ersten überlieferten Wochenzeitungen<br />
ist der Wolfenbütteler Aviso aus dem Jahr 1609. Die erste täglich (sechsmal in der Woche)<br />
erscheinende Zeitung der Welt kommt ab 1. Juli 1650 als Einkommende Zeitungen in Leipzig<br />
heraus. Das Erscheinen der Leipziger Zeitung, der Folgezeitung dieser ersten Tageszeitung,<br />
vom Drucker <strong>und</strong> Buchhändler T<strong>im</strong>otheus Ritzsch herausgegeben, wird erst 1921 eingestellt.<br />
Die älteste noch heute erscheinende Tageszeitung in Deutschland ist nach eigenen Angaben<br />
die Hildeshe<strong>im</strong>er Allgemeine Zeitung, die 1705 unter dem Titel Hildeshe<strong>im</strong>er Relations-<br />
Courier gegründet wird <strong>und</strong> zunächst nicht täglich erscheint.<br />
Zum Ende des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts bestehen in Deutschland nebeneinander 60 deutsche Zeitungen<br />
<strong>–</strong> hauptsächlich Wochenzeitungen <strong>–</strong> mit einer Auflage von jeweils 350 bis 400 Exemplaren.<br />
Sie erreichen vermutlich eine Leserschaft von 250.000 Menschen (WILKE 2002,<br />
465ff.).<br />
„Das deutsche Zeitungswesen war bereits damals von einer beachtlichen Vielfalt <strong>und</strong> einem erstaunlichen<br />
Regionalismus gekennzeichnet, der später zu einer ausgeprägten Tiefengliederung der Zeitungslandschaft<br />
führte. In Deutschland des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts hat es mehr Zeitungen gegeben als <strong>im</strong> gesamten<br />
damaligen Europa zusammen.<strong>“</strong> (PÜRER/RAABE 1996, 18f.)<br />
Gründe für die führende Rolle Deutschlands in Europa in Bezug auf die Zeitungsvielfalt <strong>und</strong><br />
deren regionalen Charakter sind die Buchdruckerfindung <strong>und</strong> wirtschaftliches Gewinnstreben,<br />
das steigende Informations- <strong>und</strong> Nachrichtenbedürfnis von Gesellschafts- <strong>und</strong> Handelsgruppen,<br />
die Gründung von Nachrichtenzentren <strong>und</strong> Botendienste zum Nachrichtenhandel<br />
sowie die Auseinandersetzung der Menschen untereinander mit ihren unterschiedlichen politischen,<br />
konfessionellen <strong>und</strong> weltanschaulichen Gesinnungen (WILKE 2002, 464f.; PÜ-<br />
RER/RAABE 1996, 18; KIESLICH 1966, 253ff.).<br />
Seit Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts ist eine vielfältiger werdende Ressort- oder Sparteneinteilung<br />
dokumentiert. Während Ansätze des Kulturteils schon um 1730 beobachtet werden können,<br />
kommen Sportnachrichten erst Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts hinzu (WILKE 2002, 465).<br />
Technische Neuerungen <strong>–</strong> vor allem die ständige Verbesserung bzw. Erfindung neuer<br />
Druckpress-Techniken <strong>–</strong> ebnen den Weg zur Massenpresse. Erstmals ist es möglich, Zeitungen<br />
relativ kostengünstig in hoher Auflage zu produzieren <strong>und</strong> durch den Straßenverkauf<br />
zu vertreiben (vgl. LINDEMANN 1969, 23). Mit der Aufhebung des staatlichen Anzeigenmonopols<br />
am 1. Januar 1850 werden die ökonomischen Bedingungen für Zeitungen verbessert.<br />
Noch größere Auflagen als bisher <strong>und</strong> mit weniger personellem Aufwand können nach der<br />
Erfindung der Rotations-Druckmaschine <strong>und</strong> deren Weiterentwicklung Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
gedruckt werden. So kaufen die Leipziger Neusten Nachrichten 1895 die erste 32seitige<br />
Zwillingsrotation mit einer Leistung von 12.000 gedruckten Exemplaren in der St<strong>und</strong>e<br />
(KOSZYK 1966, 268).<br />
Nach 1871 setzt eine Welle von Zeitungsgründungen in Deutschland ein. Fast die Hälfte aller<br />
2.900 Zeitungen, die 1916 in Deutschland erscheinen, wird zwischen 1871 <strong>und</strong> 1900 gegründet<br />
(KOCH 1994, 89f.). Die Leipziger Illustrirte Zeitung druckt 1883 die erste gerasterte<br />
Fotografie in Deutschland mit dem Autotypie-Verfahren. 19 Jahre später, 1902, n<strong>im</strong>mt die<br />
37
Berliner Illustrierte Zeitung die erste Rotationsmaschine in Betrieb, die gleichzeitig Bilder <strong>und</strong><br />
Texte <strong>–</strong> auch <strong>im</strong> Innenteil der Zeitung <strong>–</strong> drucken kann. Neben Organen der Parteipresse <strong>und</strong><br />
Boulevard-Blättern wie B.Z. am Mittag treten um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende vermehrt „General-<br />
Anzeiger<strong>“</strong> auf, die parteipolitisch nicht geb<strong>und</strong>en sind („General<strong>“</strong>) <strong>und</strong> einen ausgedehnten<br />
Anzeigenteil aufweisen („Anzeiger<strong>“</strong>).<br />
Auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs <strong>und</strong> dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs<br />
ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Art. 48 der We<strong>im</strong>arer Verfassung erlaubt es<br />
dem Reichspräsidenten, mehrfach durch die sog. Notverordnungen die Pressefreiheit für<br />
eine best<strong>im</strong>mte Zeit außer Kraft zu setzen. Die Weltwirtschaftskrise verursacht einen <strong>stark</strong>en<br />
Titelrückgang.<br />
Sehr schnell nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verändert sich die Presselandschaft<br />
gr<strong>und</strong>legend. Schon am 28. Februar 1933 wird die Pressefreiheit eingeschränkt.<br />
Journalisten <strong>und</strong> Verleger sind dem Staat durch das Reichsschriftleitergesetz vom<br />
4. Oktober 1933 gleichgeschaltet (WILKE 2002, 492ff.; PÜRER/RAABE 1996, 64ff.). Während<br />
1932 in Deutschland 4.703 Zeitungen herausgegeben wurden, sind es 1939 noch 2.288<br />
Zeitungen. Im Jahr 1944 sinkt die Zahl auf 977 (vgl. MEYN 1999, 45). Dieser Entwicklung<br />
entgegengesetzt schnellt die Anzahl der Zeitungen der Nationalsozialistischen Deutschen<br />
Arbeiterpartei (NSDAP) in die Höhe. Während es 1926 lediglich eine einzige Tageszeitung<br />
der NSDAP in Deutschland gibt, erscheinen 1939 einschließlich Österreich <strong>und</strong> dem Sudetenland<br />
200 Titel mit einer Gesamtauflage von 6,12 Millionen Exemplaren (KOSZYK 1972,<br />
398; MEYN 1999, 43f., 101). Zeitungen geben mehr oder weniger freiwillig unter dem nationalsozialistischen<br />
Druck auf oder werden zur Gleichschaltung gezwungen. Sich der Parteilinie<br />
anpassende Blätter dürfen weiter herausgegeben werden. Die Presselenkung erfolgt auf<br />
institutioneller, rechtlicher, ökonomischer sowie inhaltlicher Ebene (PÜRER/RAABE 1996,<br />
64). 1943/44 kontrolliert die NSDAP die meisten Verlage (ebd., 85).<br />
4.1.3 Zeitungen in Deutschland von 1945 bis zur gegenwärtigen Situation<br />
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs untersagt die alliierte Militärregierung zunächst den Druck<br />
<strong>und</strong> die Veröffentlichung jeglicher Medien. Noch <strong>im</strong> Jahr 1945 vergeben die Militärverwaltungen<br />
Lizenzen zur Herausgabe von Zeitungen. Das Ziel: Eine neue deutsche, demokratische<br />
Presse soll entstehen <strong>–</strong> ohne Bindung an nationalsozialistische Traditionen (KOSZYK 1988,<br />
61ff.; MEYN 1999, 79ff.). Der Lizenzzwang wird am 21. September 1949 aufgehoben. Das<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz der neu gegründeten B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland garantiert seither die Pressefreiheit<br />
(PÜRER/RAABE 1996, 104f.). 32 Bisher von der Lizenzvergabe ausgeschlossene<br />
(Alt-)Verleger spielen wieder eine Rolle. 1949 steigt die Zahl der Tageszeitungstitel laut PÜ-<br />
RER/RAABE von 169 auf 600 (ebd., 108). 33<br />
Nach einer Phase des Wiederaufbaus <strong>im</strong> Zeitungswesen gibt es ab 1954 nur noch wenige<br />
Versuche, neue Zeitungen zu gründen. Am 14. Juli 1954 wird der B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Zeitungsverleger (BDZV) gegründet. Der BDZV repräsentiert seitdem die Gesamtheit der<br />
deutschen Zeitungsverleger. Die pressestatistische Zählung setzt ein. Walter Justus<br />
SCHÜTZ führt die Zähl- <strong>und</strong> Messeinheit „Publizistische Einheit<strong>“</strong> (PE) 34 sowie die Begriffe<br />
(redaktionelle) Ausgabe<strong>“</strong> 35 <strong>und</strong> „Verlage als Herausgeber<strong>“</strong> 36 ein.<br />
32<br />
Art. 5 GG: „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift <strong>und</strong> Bild frei zu äußern <strong>und</strong> zu verbreiten<br />
<strong>und</strong> sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit <strong>und</strong> die Freiheit der<br />
Berichterstattung durch R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte<br />
finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Best<strong>im</strong>mungen zum Schutze<br />
der Jugend <strong>und</strong> dem Recht der persönlichen Ehre.<strong>“</strong><br />
33<br />
MEYN spricht von einem Anstieg der Zeitungen innerhalb eines halben Jahres um etwa 400 auf 568 (MEYN<br />
1999, 84).<br />
34<br />
Die „Publizistische Einheit<strong>“</strong> (PE) ist ein pressestatistischer Zählbegriff. „In der [...] Kategorie ,Publizistische<br />
Einheit’ sind alle ,Verlage als Herausgeber’ mit den jeweiligen Ausgaben eingeordnet, deren Mantel <strong>–</strong> <strong>im</strong> Regelfall<br />
die Seiten 1 <strong>und</strong> 2 mit aktuellen politischen Nachrichten <strong>–</strong> vollständig oder [...] in wesentlichen Teilen überein-<br />
38
Eine Phase der Pressekonzentration beginnt, was besonders kleinere Tageszeitungen betrifft.<br />
Folglich n<strong>im</strong>mt die Zahl der Ein-Zeitungs-Kreise drastisch zu. Während es 1954 erst 85<br />
Ein-Zeitungs-Kreise gibt, existieren 1976 schon 146 Gebiete mit nur einer Tageszeitung<br />
(EICH 2005, 32). Bis 2004 ist die Zahl der Ein-Zeitungs-Kreise auf 256 gestiegen (SCHÜTZ<br />
2005a, 230).<br />
NOELLE-NEUMANN differenziert die Pressekonzentration mit ihrer terminologischen Dreiteilung<br />
in „publizistische Konzentration<strong>“</strong> (Verringerung der Zahl der Publizistischen Einheiten/redaktionellen<br />
Ausgaben), „Verlagskonzentration<strong>“</strong> (Verringerung der Zahl der Zeitungsverlage<br />
u.a. durch Fusionen) <strong>und</strong> „Auflagenkonzentration<strong>“</strong> (zunehmende Vereinigung der<br />
Auflagenanteile eines Zeitungstyps bei einem bzw. wenigen Verlagen) (NOELLE-NEUMANN<br />
1968, 107ff.; vgl. JONSCHER 1995, 187ff.). 1980 erreichen die Produkte der fünf dominierenden<br />
Zeitungskonzerne <strong>–</strong> Springer-Verlag (Hamburg), WAZ-Gruppe (Essen), Gruppe<br />
Stuttgarter Zeitung (Stuttgart), Dumont-Schauberg (Köln), Süddeutsche Verlag (München) <strong>–</strong><br />
45,5 % der Gesamtauflage b<strong>und</strong>esdeutscher Tageszeitungen (PÜRER/RAABE 1996, 124). 37<br />
2006 stammen 41,3 % der Auflage <strong>im</strong> Tageszeitungsgesamtmarkt von den fünf größten Verlagsgruppen,<br />
55,7 % von den zehn größten Gruppen (RÖPER 2006, 283f.). 38 In der folgenden<br />
Phase der Konsolidierung <strong>im</strong> Zeitungswesen festigt sich die Stellung der Regionalzeitungen.<br />
Die führenden Zeitungsverlage können ihre Position am Markt zum Teil ausbauen.<br />
Lediglich die Anzahl der Verlage als Herausgeber sinkt weiter (PÜRER/RAABE 1996, 147f.).<br />
Im Jahr 2006 gibt es 137 PE in Deutschland. Sie produzieren insgesamt 1.529 Ausgaben.<br />
Die Zahl der Verlage als Herausgeber beträgt 353. Im Jahr 2006 gibt es 334 lokale <strong>und</strong> regionale<br />
Abonnementszeitungen mit einer Auflage von 14,85 Millionen Exemplaren, zehn überregionale<br />
Zeitungen (1,64 Millionen), neun Straßenverkaufszeitungen (4,7 Millionen), 28 Wochenzeitungen<br />
39 (2,04 Millionen) <strong>und</strong> sechs Sonntagszeitungen 40 (3,72 Millionen). Die verkaufte<br />
Gesamtauflage beträgt 26,96 Millionen Exemplare. Auf je 1000 Einwohner über 14<br />
Jahren kommen 303 Zeitungsexemplare (BDZV 2006, 3).<br />
Die Ein-Zeitungs-Kreise bleiben in den vergangenen Jahren nahezu konstant. 2004 können<br />
sich 42,1 % der Deutschen nur aus einer einzigen Zeitung über das aktuelle örtliche Geschehen<br />
informieren, während 57,9 % über eine Wahlmöglichkeit verfügen. In absoluten<br />
Zahlen bedeutet das, dass es 256 Kreise <strong>und</strong> kreisfreie Städte gibt, in denen nur eine einzige<br />
Lokalzeitung erscheint (SCHÜTZ 2005a, 230.). Die Krise, in der sich die gesamte Medienbranche<br />
ab Mitte 2001 befindet, führt zum weiteren Abnehmen der Zeitungs<strong>dich</strong>te.<br />
st<strong>im</strong>mt. Daraus ergibt sich: Innerhalb einer ,Publizistischen Einheit’ haben alle ,Ausgaben’, unabhängig ihrer verlegerischen<br />
Struktur, den weitgehend gleichen Zeitungsmantel.<strong>“</strong> (SCHÜTZ 2005a, 205). Der Begriff stellt allerdings<br />
nur Mindestanforderungen an einen „Mantel<strong>“</strong>, so dass der Begriff „Vollredaktion<strong>“</strong> dafür nicht als eindeutig<br />
treffendes Synonym benutzt werden kann <strong>–</strong> „auch wenn nach wie vor richtig ist, dass man den meisten (aber<br />
eben nicht allen) ,Publizistischen Einheiten’ auch eine ,Vollredaktion’ zuordnen kann<strong>“</strong> (ebd., 211).<br />
35<br />
„Kleinste pressestatistische Einheit der [...] Tageszeitung ist die ,Ausgabe’. Sie ist durch variierende inhaltliche<br />
Gestaltung (z.B. Regionalseiten, lokaler Text- <strong>und</strong> Anzeigenteil) auf das jeweilige Verbreitungsgebiet abgest<strong>im</strong>mt.<br />
Das Kriterium für eine ,Ausgabe’ erfüllen auch Zeitungen, bei denen der örtliche bzw. regionale Teil nicht täglich<br />
erscheint, nur in seiner Reihenfolge geändert wird <strong>und</strong> lediglich der Wechsel des Haupt- <strong>und</strong> Untertitels (Kopfblätter)<br />
die Ortsbezogenheit <strong>und</strong> damit die Bindung an eine best<strong>im</strong>mtes Verbreitungsgebiet herstellt.<strong>“</strong> (SCHÜTZ<br />
2005a, 205).<br />
36<br />
Zur Kategorie ,Verlage als Herausgeber’ lassen sich alle Ausgaben zusammenfassen, bei denen <strong>im</strong> Impressum<br />
der gleiche Herausgeber <strong>und</strong>/oder Verlag genannt sind.<strong>“</strong> (SCHÜTZ 2005a, 205).<br />
37<br />
Nach der Wiedervereinigung n<strong>im</strong>mt die Pressekonzentration zu. Verlage aus den westdeutschen B<strong>und</strong>esländern<br />
dehnen ihr Tätigkeitsfeld in den neuen B<strong>und</strong>esländern aus, wo am 5. Februar 1990 der Lizenzzwang aufgehoben<br />
wurde. Bauer, Springer, Gruner + Jahr (G+J), WAZ, Madsack, FAZ <strong>und</strong> andere sicheren sich bis Juli 1990<br />
Beteiligungen an so gut wie allen DDR-Verlagshäusern.<br />
38<br />
Die zehn größten Verlagsgruppen <strong>im</strong> Jahr 2006 mit anteiliger Auflage in Prozent: Springer-Verlag (22,5 %),<br />
WAZ-Gruppe (5,6 %), Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung/Die Rheinpfalz/Südwest Presse (5,2 %), Ippen-Gruppe<br />
(4,1 %), Verlagsgruppe Dumont-Schauberg (3,9 %), Holtzbrinck (3,7%), FAZ (3,0%), Süddeutsche Zeitung (2,6<br />
%), Madsack (2,5 %), DDVG (2,2%) (RÖPER 2006, 284).<br />
39<br />
Wochenzeitungen, die dem IVW angeschlossen sind.<br />
40<br />
Alle durch die IVW separat ausgewiesenen Sonntagszeitungen.<br />
39
„Als Teil der Bemühungen um Kostenreduktionen sind auch zahlreiche Lokalausgaben in nachrangiger<br />
Marktposition eingestellt worden. Damit ist die Zeitungs<strong>dich</strong>te als statistischer Wert über das Angebot<br />
von Zeitungen mit lokaler Information für das jeweilige Verbreitungsgebiet weiter gesunken.<strong>“</strong> (RÖPER<br />
2006, 283).<br />
Obwohl sich die Reichweiten deutscher Tageszeitungen auf relativ hohem Niveau bewegen,<br />
nehmen sie weiter ab <strong>–</strong> besonders hoch sind die Verluste bei den jüngeren Altersgruppen.<br />
Die Reichweite der Tageszeitungen insgesamt in Deutschland liegt bei 73,7 %. „Der in<br />
Deutschland vorherrschende Zeitungstyp der lokalen/regionalen Abonnementzeitung erreichte<br />
[…] noch eine Reichweite von 62,6 Prozent. Die Verluste der letzten zehn Jahre waren mit<br />
7,6 Prozentpunkten überdurchschnittlich.<strong>“</strong> (RÖPER 2006, 283). Die Tageszeitung gilt unter<br />
der Bevölkerung weiterhin als glaubwürdigstes Medium. 41<br />
Der Dortm<strong>und</strong>er Medienwissenschaftler Horst RÖPER nennt die Kernprobleme des deutschen<br />
Zeitungsmarktes: Sinken der Auflage <strong>und</strong> Reichweite sowie deutlich weniger Werbeeinnahmen<br />
als Ende der 1990er Jahre. Dennoch stehen die Zeitungsverlage nach den rigorosen<br />
Sparkursen der vergangenen Jahre wieder wirtschaftlich besser da. 42<br />
„Im Werbemarkt sind bei anhaltend niedrigem Niveau Besserungen erkennbar. Der Tiefpunkt nach Beginn<br />
des Einbruchs <strong>im</strong> Jahr 2001 scheint 2003 durchschritten worden zu sein. 2004 gab es mit 1 Prozent<br />
nach drei Verlustjahren erstmals wieder ein Plus. Die Werbeeinnahmen der Tageszeitungen lagen<br />
mit 4,5 Mrd. Euro aber <strong>im</strong>mer noch um ein Viertel unter denen des Jahres 1999 (6,1 Mrd.) <strong>und</strong> gar gut 2<br />
Mrd. Euro niedriger als <strong>im</strong> Ausnahmejahr 2000 (6,6 Mrd. Euro).<strong>“</strong> (RÖPER 2006, 283).<br />
Da die Verlage Einnahmeausfälle u.a. durch höhere Vertriebserlöse ausgleichen können,<br />
haben sich die Relationen zwischen Anzeigen- <strong>und</strong> Vertriebserlösen mitunter deutlich verschoben.<br />
2004 erzielen die Abonnementszeitungen 55,4 % ihres Umsatzes mit Werbung <strong>und</strong><br />
44,6 % mit dem Vertrieb, mit dem über die Jahre zuvor relativ stabil ein Drittel des Umsatzes<br />
erreicht wird. „Als positive Begleiterscheinung dieser Entwicklung kann die nachlassende<br />
Abhängigkeit vom Werbemarkt <strong>und</strong> die gewachsene Bedeutung des Lesers bzw. Käufers<br />
gewertet werden.<strong>“</strong> (RÖPER 2006, 283).<br />
Lokale <strong>und</strong> regionale Informationen aus dem Verbreitungsgebiet eines Blattes sind dem Leser<br />
besonders wichtig. Auf die Frage einer Studie „... <strong>und</strong> das lese ich <strong>im</strong> Allgemeinen <strong>im</strong>mer<strong>“</strong><br />
nennen 83 % der Befragten „lokale Berichte<strong>“</strong>, die damit vor innenpolitischen Berichten<br />
auf Platz eins genannt werden (vgl. BDZV 2006, 32). Eine weitere Untersuchung zeigt: Nur<br />
etwas mehr als die Hälfte (57 %) der Befragten ab 14 Jahren sagen, dass man regelmäßig<br />
eine Tageszeitung lesen müsse, um auf dem Laufenden zu sein <strong>–</strong> <strong>und</strong> dass das Nutzen anderer<br />
Medien demnach nicht ausreiche. Während 65 % der ab 45-Jährigen angeben, dass<br />
man regelmäßig eine Tageszeitung lesen solle, sehen 29 % der 14- bis 29-Jährigen das genauso<br />
(BDZV 2006, 31).<br />
Um <strong>im</strong> Konkurrenzkampf mit anderen (neueren) Medien bestehen zu können, müssen Tageszeitungen<br />
durch überzeugenden Mehrwert punkten <strong>–</strong> wobei u.a. Argumente genannt<br />
werden, die für eine kritische, distanzierte Berichterstattung wichtig sind: z.B. mutige Kommentare<br />
oder eine ausgewogene Mischung der Darstellungsformen. Ein Vorteil der Tageszeitung<br />
gegenüber überregional geprägten Medienangeboten ist laut Eike SCHULZ, dass die<br />
41<br />
Laut BDZV gilt die Tageszeitung mit 43,0 Prozent bei der Bevölkerung ab 14 Jahren als das glaubwürdigste<br />
Medium. Für 27 % der Befragten trifft dies auf die öffentlich-rechtlichen TV-Sender zu, gefolgt vom öffentlichrechtlichen<br />
Hörfunk (10 %) sowie den privaten TV-Anstalten (6 %), Internet-Online-Diensten (6 %) <strong>und</strong> den privaten<br />
Hörfunk-Anstalten (2 %). 6 % Prozent der Befragten hielten keins der Medien für glaubhaft (BDZV 2006, 35).<br />
42<br />
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die gedruckten Massenkommunikationsmittel in Deutschland<br />
<strong>im</strong> Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Hörfunk-Anstalten privatwirtschaftlich organisiert sind. D.h., dass bei<br />
aller Konzentration auf publizistische Ziele das Erzielen von Gewinnen bei der Presse Priorität besitzt. Die Presse<br />
steht <strong>–</strong> in verstärktem Maße seit der Einführung des Dualen R<strong>und</strong>funksystems 1984 <strong>–</strong> vor der Herausforderung,<br />
einerseits eine öffentliche Institution mit einem von der Verfassung legit<strong>im</strong>ierten Auftrag sein zu wollen <strong>und</strong> andererseits<br />
ein auf Gewinn orientiertes Wirtschaftsunternehmen sein zu müssen (vgl. LUDWIG 1987, 114).<br />
40
Leser am stärksten das interessiert, was in ihrer unmittelbaren <strong>Nähe</strong> passiert (SCHULZ<br />
2000, 14). 43<br />
Laut der Studie „Journalismus in Deutschland 2005<strong>“</strong> arbeiten in Deutschland r<strong>und</strong> 48.000<br />
hauptberufliche Journalisten. Der größte Teil von ihnen (35,4 %) ist bei Zeitungen beschäftigt<br />
(WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006, 349). 44<br />
4.1.4 Geschichte der Sportpresse<br />
Von den klassischen Ressorts gilt der Sportteil als die jüngste Rubrik (LUDWIG 1987, 116;<br />
WEISCHENBERG 1976, 188ff.). Zuvor wird über Sport <strong>im</strong> Lokalteil der Tageszeitungen oder<br />
in Fachzeitschriften berichtet, die sich vorrangig mit den Sportarten der Oberschicht beschäftigen.<br />
Um 1900, als die Sportbegeisterung der Gesellschaft besonders für die Massensportarten<br />
ständig zun<strong>im</strong>mt, berichten Tageszeitungen regelmäßig über den Sport, der vorher <strong>im</strong><br />
Allgemeinen auf Ablehnung in der Oberschicht gestoßen ist (WILKE 2002, 463). Die Entwicklung<br />
von Sport <strong>und</strong> Sportpresse stehen in unmittelbarem Zusammenhang.<br />
Obwohl Deutschland <strong>–</strong> wie oben beschrieben <strong>–</strong> als Ursprungsland der Zeitung gilt, hat die<br />
Sportberichterstattung in der Tageszeitung ihren Ursprung in England: Dort wird die erste<br />
Sportnachricht gedruckt, dort sind die ersten Sportjournalisten tätig <strong>und</strong> dort erscheinen die<br />
ersten Sportzeitschriften, die ersten Sportteile in einer Tageszeitung sowie die ersten reinen<br />
Sport-Tageszeitungen. 45 1681 veröffentlicht True Protestant Mercury erstmals eine Notiz<br />
über einen Boxwettkampf <strong>–</strong> die erste Sportnachricht. 1792 erscheint in England mit dem<br />
Sporting Magazine die erste Sportzeitschrift. Ab 1817 sind in der Morning Herald <strong>und</strong> ab<br />
1818 in The Globe regelmäßig Sportteile zu finden. Im Jahr 1821 erscheint die erste tägliche<br />
reine Sport-Tageszeitung namens Sporting life. 1829 veröffentlicht die seriöse T<strong>im</strong>es einen<br />
regelmäßigen Sportteil (vgl. STRAUSS 2002, 151; WEISCHENBERG 1976, 121; BINNE-<br />
WIES 1975, 18; ERTL 1972, 128). 46<br />
In Deutschland sind Turnfachblätter die „Pioniere [...] der Sportpresse<strong>“</strong> (WEISCHENBERG<br />
1976, 123). Die Turnpresse, die die erste Stufe der Entwicklung des <strong>Sportjournalismus</strong> in<br />
Deutschland bildet, soll vor allem die Ideologie der körperlichen Ertüchtigung propagieren.<br />
Der deutsche Arzt Michael Richter bringt 1842 in Erlangen erstmals die Allgemeine Turn-<br />
Zeitung heraus. „Die ersten Anfänge einer geordneten Berichterstattung nach den damaligen<br />
journalistischen Prinzipien<strong>“</strong> sind bei der 1856 in Leipzig gegründeten Deutschen Turnzeitung<br />
festzustellen (ebd., 122).<br />
Die zweite Stufe in der Entwicklung der deutschen Sportpresse bilden ab den 1860er Jahren<br />
die Sportfachblätter, die Insider-Informationen über eine best<strong>im</strong>mte Sportart verbreiten. Der<br />
Sporn, ein Pferdesportfachblatt, macht 1862 den Anfang (ebd., 123). Danach kommen Fachzeitschriften<br />
für Rad-, Wasser- <strong>und</strong> Automobilsport heraus (ERTL 1972, 128). Zunächst werden<br />
Sportarten medial abgebildet, die aufgr<strong>und</strong> ihrer gesellschaftlichen Stellung Geldgeber<br />
<strong>und</strong> Leser für eigene Druckschriften finden. In der Regel sind diese Produkte finanziell <strong>und</strong><br />
thematisch abhängig von der jeweiligen Sportorganisation. Mit dem großen Aufschwung des<br />
Fußballsports zu Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts findet die Presse eine weitere Sportart, der<br />
sie sich medial vermehrt widmet. Ab 1894 wird das Fachblatt Der Fußball herausgegeben,<br />
43<br />
Vgl. BLÖDORN/GERHADS 2004. Bei der aktuellen Berichterstattung zu Ereignissen in der Region <strong>und</strong> bei<br />
Hintergr<strong>und</strong>informationen zu lokalen Ereignissen spielen Tageszeitungen die wichtigste Rolle. Im Bereich der<br />
Hintergr<strong>und</strong>informationen aus Deutschland <strong>und</strong> der Welt befindet sich die Tageszeitung hinter dem Fernsehen<br />
auf Position zwei (BLÖDORN/GERHADS 2004, 10ff.).<br />
44<br />
Nach DJV-Angaben sind in Deutschland insgesamt etwa 70.000 Personen hauptberuflich journalistisch tätig<br />
(DJV 2006). Eine genaue Best<strong>im</strong>mung der Zahl ist aufgr<strong>und</strong> des offenen Berufszugangs nicht möglich.<br />
45<br />
Zur schwierigen definitorischen Abgrenzung der Begriffe „Zeitschrift<strong>“</strong> <strong>und</strong> „Zeitung<strong>“</strong> nehmen u.a. MEN-<br />
HARD/TREEDE Stellung (MENHARD/TREEDE 2004, 15ff.).<br />
46<br />
Bei FRÜTEL ist eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der Sportpresse <strong>im</strong> Ausland zu finden (vgl.<br />
FRÜTEL 2005, 102ff.).<br />
41
das nach einem Jahr in eine allgemeine Sportzeitung umgewandelt wird. Erst die Zeitschrift<br />
Fußball <strong>–</strong> 1911 von Eugen Seybold in München gegründet <strong>–</strong> beschäftigt sich von Anfang an<br />
ausschließlich mit dieser Sportart <strong>und</strong> kann sich mit diesem Konzept behaupten (vgl. WEI-<br />
SCHENBERG 1978, 13).<br />
Während das publizistische Ziel der Sportfachblätter in der Regel die Werbung für eine best<strong>im</strong>mte<br />
Sportart ist <strong>und</strong> in erster Linie Information für in die jeweilige Sportart Eingeweihte<br />
beinhaltet, beschäftigen sich die allgemeinen Sportzeitschriften ab den 1880er Jahren mit<br />
einer ganzen Palette von Sportarten <strong>und</strong> prägen den künftigen <strong>Sportjournalismus</strong>. 1878 erscheint<br />
in Wien erstmals die Allgemeine Sportzeitung <strong>–</strong> eine allgemeine Sportzeitschrift, in<br />
der ein weiter Sportbegriff zugr<strong>und</strong>e gelegt wird <strong>und</strong> Reiseberichte, Theater- <strong>und</strong> Literaturaufsätze<br />
gedruckt werden (ERTL1972, 128; WEISCHENBERG 1978, 125). Der Gründer der<br />
Allgemeinen Sportzeitung, Viktor Silberer, fordert von den Redakteuren gutes <strong>und</strong> leicht verständliches<br />
Deutsch, so dass selbst einfache Leser die Texte verstehen können <strong>und</strong> Sport<br />
somit populärer gemacht werden kann. Ab 1912 erscheint die Zeitschrift dre<strong>im</strong>al wöchentlich.<br />
„Nicht zuletzt mit der ,Allgemeinen Sportzeitung’ hatte der Sport seine Ghettosituation in der<br />
Presse verlassen <strong>und</strong> ein breiteres Publikum gef<strong>und</strong>en.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1976, 125. Hervorhebung<br />
<strong>–</strong> d.V.).<br />
Um die Wende des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts steigen bedeutende Großverlage in das Sportpressegeschäft<br />
ein. So gibt z. B. der Berliner Großverleger August Scherl ab 1895 eine Wochenzeitschrift<br />
für alle Sportarten heraus: Sport <strong>im</strong> Bild ist die erste Sportillustrierte. 1899 führt<br />
Scherl mit Sport <strong>im</strong> Wort eine Sporttageszeitung ein, die sich bis zum Beginn des Ersten<br />
Weltkriegs hält (ebd., 124).<br />
Der 23. Mai 1886 kann als Geburtstag des Sportressorts in den deutschen Tageszeitungen<br />
bezeichnet werden. Der erste eigenständige Sportteil in den Münchener Neusten Nachrichten<br />
ist mit dem Titel Sportzeitung überschrieben (STRAUSS 2002, 151; WEISCHENBERG<br />
1976, 126). 47 Trotz der Einführung eines eigenen Sportressorts in dieser Münchener Tageszeitung<br />
<strong>im</strong> Jahr 1886 dauert es Jahre, ehe sich ein Sportteil, so wie er heute bekannt ist, in<br />
den Tageszeitungen durchsetzt. Eine Vorreiterrolle spielt hierbei die 1904 gegründete Berliner<br />
Zeitung am Mittag. Sie ist die erste Tageszeitung, die Redakteure beschäftigt, die sich<br />
unter der Leitung eines eigenen Chefredakteurs ausschließlich um den Sportteil kümmern<br />
(BINNEWIES 1983a, 114; WEISCHENBERG1978, 14). 48 Berichtet wird in erster Linie über<br />
populäre Sportarten, wie Turnen, alpiner Skisport, Schach <strong>und</strong> Fußball. Zu Beginn des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts ist Fußball die beliebteste Sportart der Tageszeitung (FISCHER 1993b, 38).<br />
Untersuchungen um das Jahr 1910 herum belegen, dass der Anteil des Sports am Gesamtumfang<br />
des redaktionellen Teils einer Tageszeitung zwischen drei <strong>und</strong> vier Prozent beträgt<br />
(KOSZYK 1966, 217). Mit der ständig steigenden Zahl der sportlichen Veranstaltungen Anfang<br />
des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts wird 1904 der erste Sport-Nachrichtendienst in Deutschland gegründet<br />
<strong>–</strong> die „Sportliche R<strong>und</strong>schau<strong>“</strong> (KAPF 1958, 37f.).<br />
Der Sport unterstützt als verkaufsförderndes <strong>und</strong> publikumswirksames Thema den Weg von<br />
der Gesinnungs- zur Massenpresse (LOOSEN 1997, 10; WEISCHENBERG 1976, 116ff.).<br />
Besonders die Verlagerung des Schwergewichts von Sportarten, die von der Oberschicht<br />
favorisiert werden, auf Massensportarten wie Fußball oder Boxen steigert die Attraktivität der<br />
Sportberichterstattung <strong>und</strong> lässt Verleger an diesem Themenbereich nicht mehr vorbeikommen.<br />
Die Eingliederung des Sports (als Thema) in die Zeitungen erfolgt bis Anfang des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts schrittweise: zunächst in kleinen Meldungen, später in Beilagen <strong>und</strong> schließlich<br />
47<br />
WEISCHENBERG führt an, dass es in den 37 Zeilen um die „Zahl der Rebhühner in einem Ort, die Ausschreibung<br />
von Pferde- <strong>und</strong> Radrennen, Ergebnisse eines Pferderennens<strong>“</strong> geht sowie um eine Laufwette (WEI-<br />
SCHENBERG 1976, 128).<br />
48<br />
BINNEWIES schreibt, dass der Berliner Börsen-Courier 1885 die erste deutsche Tageszeitung ist, die den<br />
Sportbericht vom lokalen Teil trennt <strong>und</strong> dafür einen eigenen Sportredakteur beschäftigt (BINNEWIES 1983a,<br />
114). Der Tag-Verlag bringt 1900 in der Morgenausgabe Der Morgen eine der ersten Beilagen heraus, die sich<br />
mit dem Sport befasst (WEISCHENBERG 1976, 126).<br />
42
in eigenen Ressorts. Schon in der sportjournalistischen Gründungsphase setzen die Verlage<br />
auf sportspezifische Fachkräfte statt auf speziell für das neue Ressort ausgebildete Journalisten<br />
(LUDWIG 1987, 117). Der Sport gilt als der journalistischen Bearbeitung nicht würdig.<br />
Sportsachverständige statt Journalisten arbeiten in den Redaktionen. WEISCHENBERG<br />
bezeichnet dies als eine frühe Zementierung der Sonderstellung (WEISCHENBERG 1976,<br />
120). 49 „Man musste auf Leute zurückgreifen, die aus der Sportbewegung kamen <strong>und</strong> zumindest<br />
genug sportliches Sachwissen besaßen, um das bearbeiten zu können, was die<br />
anderen Redakteure mangels Kompetenz oder Interesse nicht übernehmen konnten oder<br />
wollten.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994, 429).<br />
In der Zeit des Ersten Weltkriegs wird der Sportbetrieb weitgehend eingestellt, was zum Verschwinden<br />
des Sports aus der Tageszeitung führt. Zudem geben auch die meisten Sportzeitschriften<br />
auf. Nach Kriegsende erlebt die Sportpresse einen enormen Aufschwung <strong>–</strong> wird<br />
dem Leser durch die Sportberichterstattung scheinbar eine Flucht in unpolitische Freiräume<br />
ermöglicht (vgl. FISCHER 1993b, 39; WEISCHENBERG 1976, 130).<br />
„Entscheidende Ursache für diesen endgültigen Durchbruch der Sportberichterstattung war die Nutzung<br />
der unterhaltenden Elemente des Sports. Weder die Unterrichtung eines zahlenmäßig kleinen Bevölkerungsteils<br />
über seine Freizeitvergnügen noch fachliche Informationen einer Gruppe von Eingeweihten<br />
hätten eine solche Umsatzsteigerung bringen können. Vielmehr war in dem geschichtlichen Umfeld das<br />
Bedürfnis nach Ablenkung durch Massenvergnügen entstanden. [...] Die Akzente waren endgültig zugunsten<br />
der Unterhaltung, der Vermarktung des Sports verschoben worden <strong>–</strong> Kennzeichen des modernen<br />
<strong>Sportjournalismus</strong> überhaupt.<strong>“</strong> (ebd., 130f.).<br />
Fast jede Tageszeitung beschäftigt sich nun mit dem Sport. Vor allem die Sportzeitschriften<br />
erleben einen riesigen Aufschwung. Eine der prominentesten Neugründungen: die Sportzeitschrift<br />
Der Kicker, die Walter Bensemann <strong>im</strong> Jahr 1920 in Konstanz mit Verlagsort in Nürnberg<br />
gründet. Sein Schwerpunktthema: Fußball. Bis 1933 wächst die Zahl der Sportzeitschriften<br />
auf über 400 Titel. Die We<strong>im</strong>arer Republik wird deshalb als Blütezeit der unabhängigen<br />
Sportpresse angesehen. Diese ist zu einem rentablen Geschäft geworden, sie drängt<br />
die meist abhängigen Fachzeitschriften in den Hintergr<strong>und</strong> (WEISCHENBERG 1978, 15).<br />
Den Kern der Sportnachrichten bilden zu jener Zeit messbare Größen wie Tore, Sek<strong>und</strong>en<br />
oder Meter (KREBS 1969, 253) <strong>–</strong> bereitgestellt von „den Sportreibenden aus dem eigenen<br />
Lager<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1978, 16). Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland<br />
an sich reißen, sind Sport, Presse <strong>und</strong> Sportpresse längst politisiert.<br />
„Die Parteipresse stellte sich der unpolitisch gebärdenden bürgerlichen Sportpresse in ihren Sportinhalten<br />
das andere Extrem entgegen: Sport zum Zwecke der Werbung für die eigenen Ideen [...]. [...] Die<br />
Rivalitäten zwischen den politischen Gruppierungen der We<strong>im</strong>arer Republik hatten sich trotz aller gegenteiligen<br />
Bek<strong>und</strong>ungen auch auf den Sport <strong>und</strong> seine Presse übertragen.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
Mit der Aufhebung der Pressefreiheit durch die Nationalsozialisten ist die formelle Voraussetzung<br />
für die ideologische Gleichschaltung der Sportpresse geschaffen. Sportblätter, die<br />
einen anderen politischen Hintergr<strong>und</strong> als den nationalsozialistischen haben, werden verboten,<br />
die bürgerliche Sportpresse wird in das neue politische System eingegliedert. 1935 erscheinen<br />
239 Sportzeitschriften. Wie fast alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, n<strong>im</strong>mt die<br />
Sportpresse die Gleichschaltung beinahe widerstandslos hin (WEISCHENBERG 1976, 136).<br />
„Mit kulturpolitischen Argumenten, der Anknüpfung an die Tradition der Turnpresse, der Feststellung<br />
mangelnder Professionalisierung des <strong>Sportjournalismus</strong> vor allem bei der Provinzpresse <strong>und</strong> einer Demontage<br />
der Fiktion vom ,unpolitischen <strong>Sportjournalismus</strong>’ konnten die Nationalsozialisten leicht einen<br />
,neuen <strong>Sportjournalismus</strong>’ propagieren.<strong>“</strong> (ebd., 16).<br />
49<br />
WEISCHENBERG spricht davon, dass dem <strong>Sportjournalismus</strong> „der Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis<br />
von Sportjournalisten, die Charakterbildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswerte des Sports vermitteln wollten, <strong>und</strong><br />
der Wirklichkeit der Sportkommunikation, die als Unterhaltungsware produziert <strong>und</strong> rezipiert wurde, in die Wiege<br />
gelegt<strong>“</strong> wurde. Sportliche Sachkompetenz dominierte gegenüber journalistischer Fach- <strong>und</strong> Vermittlungskompetenz.<br />
Die Außenseiterstellung innerhalb der Redaktion „erfuhr durch die mangelhafte sprachliche Präsentation<br />
sportlicher Inhalte sozusagen tägliche Legit<strong>im</strong>ation<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994, 429f.).<br />
43
Der „neue <strong>Sportjournalismus</strong><strong>“</strong> stellt andere Ansprüche an die Redaktionen. „Das neue Stilmittel<br />
war der feuilletonistische Spielbericht.<strong>“</strong> (ebd., 136). Um systematisch Propaganda für<br />
die NS-Ideologie verbreiten zu können, müssen Sportjournalisten mehr können, als nüchterne<br />
Zahlen <strong>und</strong> Ergebnisse an die Leser weiterzugeben. Die Folgen des Kriegs führen jedoch<br />
schnell zum Stillstand des Sportbetriebs. Ende 1942 existieren 50 größere Blätter, ein Jahr<br />
später sind es etwa 20. Im Oktober 1944 gibt es keine Sportzeitschrift in Deutschland mehr<br />
(ebd., 138).<br />
Nach Kriegsende verläuft die Entwicklung zunächst ähnlich wie 27 Jahre zuvor <strong>–</strong> ein lebendiger<br />
Neubeginn setzt ein. „Sport <strong>und</strong> seine Berichterstattung besaßen so etwas wie eine<br />
sozialtherapeutische Funktion.<strong>“</strong> (BECKER 1983b, 28). Erneut haben die von Diktatur <strong>und</strong><br />
Krieg gebeutelten Menschen ein <strong>stark</strong>es Verlangen nach Ablenkung <strong>und</strong> Unterhaltung als<br />
Kompensation. Als Deutschland 1952 wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen darf<br />
<strong>und</strong> zwei Jahre später Fußballweltmeister wird, stößt die Sportpresse auf großes Interesse.<br />
Die meisten Deutschen sehen <strong>im</strong> Sport eine Möglichkeit, internationale Anerkennung zurückzugewinnen.<br />
Durch entsprechende appellierende Berichterstattung hat die Sportpresse<br />
zuvor betont, dass Deutschland wieder am internationalen Sport teilnehmen müsse. Mit der<br />
erneut aufflammenden Sportbegeisterung <strong>–</strong> z.B. nach dem Gewinn der Fußball-WM 1954 <strong>–</strong><br />
n<strong>im</strong>mt die Sportberichterstattung wieder einen größeren Raum ein <strong>und</strong> ihr wird eine größere<br />
Bedeutung zugemessen (WEISCHENBERG 1978, 17).<br />
Die Sportberichterstattung hat sich bis in die Gegenwart quantitativ ausgeweitet <strong>–</strong> genannt<br />
seien beispielhaft nur die Montagsausgaben der Tageszeitungen. Der Lokalsport hat sich<br />
längst vom Lokalressort losgelöst (FISCHER 1993b, 43). Dabei sind die sich ständig verändernden<br />
Produktionsbedingungen für die Sportjournalisten durch die Weiterentwicklung der<br />
Drucktechnik <strong>–</strong> von der Entwicklung der Rotationsmaschine über die elektronische Datenverarbeitung<br />
<strong>und</strong> Computer-to-plate-Technik bis hin zum Digitaldruck <strong>–</strong> als Einflussgrößen zu<br />
beachten. Der Begriff des (Sport-)Redakteurs hat heute eine neue Bedeutung bekommen.<br />
Vom Journalisten früher unabhängige Aufgabenbereiche müssen zusätzlich geleistet werden.<br />
Der Redakteur kümmert sich neben redaktionellen Dingen um die Layout-Gestaltung<br />
der Seiten, wählt Fotos <strong>und</strong> Grafiken <strong>und</strong> deren Ausschnitte aus, platziert Fotos <strong>und</strong> integriert<br />
Anzeigen auf den Seiten.<br />
Derzeit gibt es in Deutschland trotz eines großen Tageszeitungssportmarktes <strong>im</strong> Gegensatz<br />
zu vielen Ländern des europäischen Auslands keine reine tägliche Sporttageszeitung <strong>–</strong> <strong>und</strong><br />
das, obwohl sich die Sportberichterstattung der Printmedien hauptsächlich in der Tageszeitung<br />
manifestiert. Bereits in den 1950er Jahren versucht Axel Springer, Verleger der Bild-<br />
Zeitung, eine Sporttageszeitung zu gründen. Am 3. Oktober 1990 steigt der Axel-Springer-<br />
Verlag dann be<strong>im</strong> DDR-Blatt Deutsches Sportecho ein. Die Sporttageszeitung aus dem<br />
Sportverlag der ehemaligen DDR wird <strong>im</strong> April 1991 wegen mangelnder Nachfrage wieder<br />
vom Markt genommen (FISCHER 1993b, 37f.). SCHULZ stellt die Frage, ob nicht eine Konkurrenzsituation<br />
zwischen den Sportpublizistischen Einheiten (SPE) 50 <strong>und</strong> einer potenziellen<br />
überregionalen Sporttageszeitung bestehen könnte. 51 Als Ergebnis weist er u.a. eine konvergente<br />
Berichterstattung über die Fußball-B<strong>und</strong>esliga bei 126 SPE nach (vgl. SCHULZ<br />
1995, 59 <strong>und</strong> 196ff.). Aufgr<strong>und</strong> dieser konformen Inhalte beständen Zweifel, ob sich eine<br />
Sporttageszeitung in Deutschland überhaupt durchsetzen <strong>und</strong> finanzieren ließe. Wolfgang J.<br />
KOSCHNICK vermutet, dass reine Sportzeitschriften nur in Ländern erfolgreich sind, in de-<br />
50<br />
„Publizistische Einheiten werden als Sportpublizistische Einheiten bezeichnet, wenn sie einen sich voneinander<br />
unterschiedlichen Hauptsportteil als Sportmantel öffentlich <strong>und</strong> mindestens zwe<strong>im</strong>al wöchentlich in Schrift <strong>und</strong><br />
Druck in deutscher Sprache mit einem aktuell-universellen <strong>und</strong> unbegrenzten Sportinhalt verbreiten<strong>“</strong> (SCHULZ<br />
1995, 69).<br />
51<br />
SCHULZ spricht von fehlenden, validen Statistiken, die den Beweis liefern, dass der Sportteil der Zeitungsgattungen<br />
nach gleichen oder unterschiedlichen Kriterien produziert wird. TEWES formuliert: „Ob Bild oder Frankfurter<br />
Allgemeine, Sport bleibt eben nicht Sport<strong>“</strong> (TEWES 1991, 170ff.), während BINNEWIES die Zeitungstypen<br />
nach inhaltlichen sowie strukturellen Merkmalen „als weitgehend konform<strong>“</strong> bezeichnet (BINNEWIES 1978, 42; vgl.<br />
WERNECKEN 2000, 81f.).<br />
44
nen sie nicht mit auflagen<strong>stark</strong>en Boulevardzeitungen konkurrieren müssen (KOSCHNICK<br />
1999, 42ff.). Unter Sportjournalisten wird teilweise die Bild-Zeitung als „he<strong>im</strong>liche<strong>“</strong> tägliche<br />
Sporttageszeitung betrachtet. Zuletzt gab es Ende 2005 Spekulationen über eine Wiederbelebung<br />
der Sporttageszeitung Deutsches Sportecho.<br />
In Deutschland dominieren die regionalen Tageszeitungen die tägliche Sportberichterstattung.<br />
Diese Blätter stützen sich in der überregionalen Sportberichterstattung vor allem<br />
auf die dominierenden beiden deutschen Presseagenturen <strong>im</strong> Ressort Sport: Deutsche<br />
Presse-Agentur (DPA) <strong>und</strong> Sport-Informations-Dienst (SID). Regionale Zeitungen konzentrieren<br />
sich schwerpunktmäßig auf die lokale Sportberichterstattung. Dort verfügen sie häufig<br />
über ein Informationsmonopol. „Es ist unumstritten, dass Lokalberichterstattung höchste Leserattraktivität<br />
besitzt <strong>und</strong> auch auf lange Sicht Bestandsgarantie für das Medium Tageszeitung<br />
ist. 84 % der Leser sind in erster Linie an lokalen Berichten aus ihrer direkten Umgebung<br />
interessiert.<strong>“</strong> (FISCHER 1993b, 99). Laut HALLER ist die gr<strong>und</strong>legende Aufgabe der<br />
Regionalzeitungen die Orientierungsfunktion, die in einem regionalen Umfeld eine regionale<br />
Zeitung am besten gewährleisten kann (HALLER 2003, 181f.). Dementsprechend setzen<br />
viele regionale Tageszeitungen auf Sportberichterstattung mit Fokus auf den lokalen oder<br />
regionalen Sport (vgl. BAUSINGER 1983, 107). SCHULZ nennt weitere Vorteile, auf die die<br />
Sportpresse setzen sollte. „Bezogen auf den Sportteil einer Tageszeitung haben Redakteure<br />
bis zum Erscheinen der Montagsausgabe mehr Zeit zum Recherchieren <strong>und</strong> Schreiben ihrer<br />
Beiträge als die TV-Kollegen.<strong>“</strong> (SCHULZ 2000, 14). Die Zeitung kennt keine teure Live-<br />
Berichterstattung des Fernsehens, die kaum Platz für Hintergr<strong>und</strong>informationen offen lässt.<br />
Sportjournalisten müssten die Vorteile der Tageszeitungen besser ausspielen <strong>–</strong> <strong>und</strong> zusätzlich<br />
mehr eigene Autorentexte nutzen, den Blick für den Hintergr<strong>und</strong> schärfen, über den Tellerrand<br />
der „1:0-Fußballberichterstattung<strong>“</strong> schauen sowie eine kritische Haltung bewahren<br />
(vgl. SCHULZ 2000, 14).<br />
SCHULZ ermittelt, dass der Sport bei Tageszeitungen durchschnittlich 25,5 % des redaktionellen<br />
Teils einn<strong>im</strong>mt. Der Anteil des Lokalsports am redaktionellen Teil wird mit 10,6 % eruiert<br />
(SCHULZ 1995, 120). 55 % der deutschen B<strong>und</strong>esbürger lesen laut einer Evaluation von<br />
2001 regelmäßig die Sportberichterstattung in der Tageszeitung. 52 Zwei Drittel verfolgen<br />
Sport <strong>im</strong> Fernsehen, r<strong>und</strong> 30 % hören Sportberichte <strong>im</strong> Radio, 22 % konsumieren Sportzeitschriften,<br />
11 % lesen Sportbücher <strong>und</strong> 10 % der Befragten nutzen die Sportangebote <strong>im</strong> Internet<br />
(SCHAUERTE 2002a, 199). 53 Be<strong>im</strong> zeitlichen Umfang der Sportmediennutzung verschiebt<br />
sich die Reihenfolge leicht. Während die Gesamtnutzungszeit der Sportangebote in<br />
Fernsehen, Radio, Tageszeitung <strong>und</strong> Sportzeitschrift 257 Minuten pro Woche beträgt, ist der<br />
Nutzungsumfang der TV-Sportberichterstattung mit 104 Minuten am größten. Es folgen<br />
Sportzeitschrift (58 Minuten), Radio (48 Minuten) <strong>und</strong> die Tageszeitung (47 Minuten) (BLÖ-<br />
DORN/GERHARDS 2004, 12).<br />
Laut WERNECKEN sind „nicht nur Reichweitenverluste <strong>und</strong> eine auf relativ niedrigem Niveau<br />
stagnierende Nutzungsdauer, sondern auch die einsetzende Aberkennung von Kernaufgaben<br />
der Tagespresse<strong>“</strong> kennzeichnend für die Rezeption der Tageszeitungen. Vor allem<br />
jüngere Leser würden „typische Zeitungsfunktionen<strong>“</strong> nicht mehr uneingeschränkt dem Kompetenzbereich<br />
der Tagespresse zuordnen (WERNECKEN 2000, 83). „Für den Tageszeitungssport<br />
[wird] eine Qualitätsdiskussion geführt, die Frage der Komplementarität zu den<br />
AV-Angeboten steht dabei <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>.<strong>“</strong> (ebd., 82).<br />
Etwa sechs Prozent aller r<strong>und</strong> 48.000 hauptberuflichen Journalisten sind vorrangig <strong>im</strong> Ressort<br />
Sport tätig <strong>–</strong> wobei <strong>im</strong> Sport deutlich mehr Journalisten beschäftig sind, aber nicht in<br />
erster Linie in diesem Ressort (WEISCHENBERG/MALIK/SCHOLL 2006, 351).<br />
52<br />
Die Rezipienten des Tageszeitungs-Sportteils widmen 23,0 Prozent des Gesamtnutzungsumfangs diesem<br />
Ressort. Der zeitliche Nutzungsumfang n<strong>im</strong>mt mit sinkendem Alter stetig ab. Die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen<br />
erreicht laut der Gießener-Studie mit 33 Minuten pro Woche den niedrigsten Wert (SCHAUERTE 2002a, 199).<br />
53<br />
Andere Studien liefern leicht differente Werte (vgl. SCHAUERTE 2002c, 113).<br />
45
SCHAFFRATH schätzt, dass die Zahl der <strong>im</strong> Sportressort arbeitenden Journalisten über<br />
5.000 liegt (SCHAFFRATH 2002a, 11). 54<br />
4.1.5 Zusammenfassung<br />
Der moderne <strong>Sportjournalismus</strong> beginnt sich in Deutschland Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zu<br />
entwickeln, als der Sport als Medienthema Interesse findet <strong>und</strong> zum Publikumssport wird.<br />
Das Bedürfnis nach einer eigenen Sportberichterstattung entsteht. Die Presse entwickelt sich<br />
in dieser Zeit von der Gesinnungs- zur Massenpresse <strong>und</strong> sucht nach verkaufsfördernden<br />
<strong>und</strong> publikumswirksamen Themen. Sportliche Sachkompetenz dominiert in den sportjournalistischen<br />
Anfängen gegenüber journalistischer Fach- <strong>und</strong> Vermittlungskompetenz, weil Zeitungen<br />
auf Experten aus der Sportbewegung oder zumindest mit genug sportlichem Sachwissen<br />
zurückgreifen. Andere Redakteure wollen, können oder dürfen mangels Kompetenz<br />
oder Interesse sportliche Themen nicht bearbeiten.<br />
Später machen sich elektronische Medien den Unterhaltungswert des Sports zunutze, laufen<br />
in der Sportberichterstattung der Presse den Rang ab <strong>und</strong> zwingen die Zeitungen zu einer<br />
komplementären Berichterstattung. Tageszeitungen gehen dazu über, den vom Fernsehen<br />
geweckten „,Appetit zu stillen’. ,Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung’ anstelle von ,1:0-<br />
Berichterstattung’ ist seither angesagt <strong>–</strong> womit gewöhnlich Steigerung des Unterhaltungswerts<br />
durch Personalisierung, durch ,human touch’ gemeint ist<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994,<br />
429). Regionale Tageszeitungen dominieren in Deutschland die tägliche Sportberichterstattung.<br />
Das Entstehen dieser Dominanz kann in der Geschichte der Tageszeitung in Deutschland<br />
nachvollzogen werden. Regionalzeitungen konzentrieren sich häufig schwerpunktmäßig<br />
auf die lokale Sportberichterstattung, u.a. weil sie in diesem Bereich in der Regel keine <strong>stark</strong>e<br />
Konkurrenz durch andere Medien zu fürchten haben.<br />
54<br />
Der VDS hat laut eigenen Angaben 3.500 Mitglieder, schätzt die Zahl der hauptberuflichen Sportjournalisten<br />
auf etwa 4.500. Als Kriterium für eine hauptberufliche Tätigkeit <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> legt der VDS fest, dass mehr<br />
als 50 % des Einkommens aus sportjournalistischer Tätigkeit stammen müssen (VDS 2005).<br />
46
5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG<br />
5.1 Forschungsfrage<br />
Um zu Beginn der Inhaltsanalyse das Untersuchungsziel genau zu best<strong>im</strong>men, wird folgende<br />
Forschungsfrage bzw. Problemstellung mit offenem „Entdeckungspotential<strong>“</strong> (FRÜH 2007, 78)<br />
formuliert: Wie kritisch, distanziert berichten Sportjournalisten deutscher Regionalzeitungen 55<br />
über die Fußball-WM 2006 <strong>im</strong> Allgemeinen <strong>und</strong> die deutsche Fußball-Nationalmannschaft<br />
während ihrer Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Spiele?<br />
5.1.1 Relevanz der Forschungsfrage<br />
Wie oben dargestellt, wird Sportjournalisten seit Jahrzehnten Kumpanei, mangelnde kritische<br />
<strong>Distanz</strong> <strong>und</strong> fehlende Unabhängigkeit vorgehalten. Wissenschaftliche Studien, die das Ziel<br />
haben, hauptsächlich diese speziellen Vorwürfe bei regionalen Zeitungen zu untersuchen,<br />
gibt es jedoch (fast) nicht. Aussagen zur mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> von Presse-<br />
Sportjournalisten sind allenfalls Randergebnisse empirischer Forschung. Die Kritik am <strong>Sportjournalismus</strong><br />
gipfelt zu Beginn des Jahres 2005 <strong>im</strong> Austritt einiger namhafter Sportjournalisten<br />
aus dem VDS sowie in der Gründung der Initiative Sportnetzwerk, die die provokante<br />
Frage stellt: „Sind Sportjournalisten eigentlich Journalisten oder doch nur Fans, die es über<br />
die Absperrung geschafft haben?<strong>“</strong> (O.V. 2006a). Das Zitat ist mittlerweile zu einem geflügelten<br />
Wort geworden (SUNDERMEYER 2007, 15; vgl. LEYENDECKER 2006).<br />
Obwohl Befragungen zum Selbstverständnis bedenklich st<strong>im</strong>mende Ergebnisse <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
zur kritischen <strong>Distanz</strong> von Sportjournalisten liefern (vgl. GÖRNER 1995, 416)<br />
<strong>und</strong> es eine Vielzahl an vorwissenschaftlichen Erfahrungsberichten gibt, die anhand von anschaulich<br />
geschilderten Beobachtungen <strong>–</strong> wie oben an Beispielen dargestellt <strong>–</strong> diesen Eindruck<br />
vermitteln (wollen), bleibt die Frage offen, ob sich dadurch Konsequenzen für die praktische<br />
Berichterstattung ergeben, ob die Berichterstattung der Sportjournalisten empirisch<br />
nachweislich unkritisch <strong>und</strong> distanzlos ist <strong>und</strong> wie dies zum Ausdruck kommt.<br />
„Die Streitfrage bleibt jedoch bestehen, ob trotz eines fre<strong>und</strong>schaftlich-„kumpelhaften<strong>“</strong> Verhältnisses zu<br />
Sportlern die Journalisten noch in der Lage sind, kritisch-distanziert über sie zu berichten. Unbestreitbar<br />
bleibt, dass notwendige <strong>und</strong> sachlich-f<strong>und</strong>ierte Kritik am Sportler für den Journalisten <strong>im</strong>mer schwieriger<br />
wird, je enger er mit ihm verb<strong>und</strong>en ist. […] Das Problem bleibt, ob trotz wachsender <strong>Distanz</strong>losigkeit <strong>–</strong><br />
nicht nur der Boulevardpresse <strong>–</strong> kritisch-distanziert über den Sport berichtet <strong>und</strong> notwendige, sachlichf<strong>und</strong>ierte<br />
Kritik geäußert werden kann. Die Gefahr der Hofberichterstattung bleibt bestehen. Allerdings<br />
haben diese Bef<strong>und</strong>e nur tendenziellen Charakter <strong>und</strong> müssen durch spezielle Untersuchungen vertieft<br />
werden.<strong>“</strong> (GÖRNER 1995, 406f.).<br />
Es ist fraglich, ob z.B. sachlich-f<strong>und</strong>ierte Kritik nicht nur geäußert werden kann, sondern ob<br />
sie geäußert wird <strong>–</strong> ob nicht nur die Möglichkeit kritischer, distanzierter Berichterstattung besteht,<br />
sondern ob kritisch <strong>und</strong> distanziert berichtet wird.<br />
Die vorliegende Untersuchung hat das Ziel, den Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong><br />
<strong>im</strong> regionalen Print-<strong>Sportjournalismus</strong> zu untersuchen <strong>und</strong> damit (ansatzweise) die skizzierte<br />
<strong>und</strong> derzeit diskutierte Forschungslücke zu verkleinern. Damit wird die Relevanz der Forschungsfrage<br />
begründet. Es geht darum, Ergebnisse zu liefern, die über eigene beschreibende<br />
Aussagen von Journalisten hinausgehen, was ihr Verständnis von kritischer <strong>Distanz</strong><br />
betrifft. Das Problem der Sozialen Erwünschtheit kann bei solchen Themen <strong>–</strong> in Befragungen<br />
<strong>–</strong> eine große Rolle spielen, da die Unabhängigkeit von Journalisten ein zentrales Element in<br />
ihrem Berufsverständnis ist. In der vorliegenden Arbeit werden Texte deutscher regionaler<br />
Tageszeitungen bezüglich unkritischer <strong>und</strong> distanzloser bzw. kritischer <strong>und</strong> distanzierter Elemente<br />
untersucht.<br />
55<br />
Vgl. Kapitel 5.2 zu den Hinweisen, dass streng genommen von „regionalen Mittel- <strong>und</strong> Kleinzeitungen<strong>“</strong> gesprochen<br />
werden müsste, da „regionale Großzeitungen<strong>“</strong> mit einer Auflage von über 110.000 verkauften Exemplaren<br />
aus Forschungszwängen in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden (FRANKENFELD 1969, 154).<br />
47
5.1.2 Vorüberlegungen zur Hypothesenentwicklung<br />
Vor der Entwicklung <strong>und</strong> Formulierung detaillierter Hypothesen werden kurz einige elementare<br />
Vorüberlegungen diskutiert, um die Konstruktion des Untersuchungsinstruments offen zu<br />
legen: Mit dem Vorwurf, dass Sportjournalisten nur Fans sind, die es über die Absperrung<br />
geschafft haben, wird suggeriert, dass die Berichterstatter durch ihre Tätigkeit in irgendeiner<br />
Form (<strong>im</strong> Vergleich zu den „normalen<strong>“</strong> Fans) privilegiert sind <strong>und</strong> ihre (räumliche <strong>und</strong> innere)<br />
<strong>Distanz</strong> zu den Berichterstattungsobjekten <strong>im</strong> Vergleich zu anderen Journalisten geringer ist<br />
<strong>–</strong> dass sie z.B. konkret bei der WM auf der Tribüne sitzen dürfen oder in der Mixed-Zone die<br />
Spieler nach ihrer Meinung (oder auch nach Autogrammen 56 ) fragen können. Um diesem<br />
entstandenen Eindruck gerecht zu werden, sollen u.a. Texte analysiert werden, die von<br />
Journalisten geschrieben worden sind, die für die jeweiligen Spiele akkreditiert waren <strong>–</strong><br />
Beitrage von Journalisten, die es bei der WM „über die Absperrung<strong>“</strong> ins ausverkaufte Stadion<br />
<strong>und</strong> in die Mixed-Zone geschafft haben.<br />
FRÜH empfiehlt für die Inhaltsanalyse eine sowohl deduktive als auch induktive Arbeitsweise<br />
zur Formulierung von Hypothesen (FRÜH 2007, 74). Konkret bedeutet das für diese Arbeit,<br />
dass die Hypothesen sowohl aus der oben dargestellten Literatur als auch aus der Betrachtung<br />
des ausgewählten Medienangebots abgeleitet werden. Aufgr<strong>und</strong> der kombinierten deduktiven<br />
<strong>und</strong> induktiven Perspektive vermutet der Verfasser, dass akkreditierte Regionalzeitungsjournalisten<br />
distanzloser <strong>und</strong> unkritischer berichten als Kollegen ohne Akkreditierung,<br />
die zur selben Zeit in ihren jeweiligen Redaktionen arbeiten. WEISCHENBERG zeigt, dass<br />
sich Lokalsportjournalisten in Bezug auf die Einschätzung der Gefahr zu geringer <strong>Distanz</strong><br />
von anderen Journalisten unterscheiden. Seiner Meinung nach deutet das daraufhin, dass<br />
die Einstellung mit der Entfernung zum Berichterstattungsobjekt zusammenhängt (WEI-<br />
SCHENBERG 1976, 279). Regionalzeitungsjournalisten arbeiten in einem Umfeld, das sich<br />
durch eine geringe <strong>Distanz</strong> zum (lokalen) Sport auszeichnet (vgl. ROHRBERG 1982, 127ff.).<br />
Bei akkreditierten Journalisten besteht zum einen tatsächlich eine größere (räumliche) <strong>Nähe</strong><br />
zu den Berichterstattungsobjekten, zum anderen sind Journalisten der regionalen Presse<br />
selten bei Fußball-Spielen mit so großer Bedeutung wie einer WM anwesend, so dass dieses<br />
Ereignis für sie einen besonderen Stellenwert einn<strong>im</strong>mt. Mit anderen Worten: Journalisten<br />
der regionalen Presse dürften sich (noch) mehr als Journalisten gefreut haben, die z.B. für<br />
größere Agenturen <strong>und</strong> überregionale Zeitungen arbeiten <strong>und</strong> regelmäßig bei solchen Großereignissen<br />
dabei sind, es bei der Fußball-WM „über die Absperrung<strong>“</strong> geschafft zu haben.<br />
Die enorme Anzahl von Akkreditierungen bei den WM-Spielen auch von Zeitungen mit kleinen<br />
Auflagen legt den Schluss nahe, dass zumindest nicht nur redaktionelle Gründe ausschlaggebend<br />
dafür waren, sich als Regionalzeitungsjournalist um eine Akkreditierung zu<br />
bemühen. 57 Der Verfasser geht davon aus, dass akkreditierte Journalisten überregionaler<br />
Zeitungen oder größerer Agenturen regelmäßiger bei Spielen mit vergleichbaren Bedeutungen<br />
anwesend sind <strong>und</strong> deshalb aufgr<strong>und</strong> einer gewissen Arbeitsroutine <strong>und</strong> dem „Zwang<br />
zur Seriosität<strong>“</strong> (STIEHLER/MARR 2001, 123) <strong>im</strong> Vergleich zu akkreditierten Journalisten<br />
kleinerer Regionalzeitungen nicht so anfällig für „die Begeisterung [sind, die] die Urteilsfähigkeit<strong>“</strong><br />
frisst (GERTZ 2006b). Die Aufteilung von journalistischen Arbeitsvorgängen bei Presseagenturen<br />
<strong>und</strong> größeren (überregionalen) Zeitungen wird als unterstützendes Argument in<br />
dieselbe Richtung angeführt.<br />
Die Forschungsfrage bezieht sich nicht auf die gesamte Sportberichterstattung, sondern nur<br />
auf ein kleinen Ausschnitt davon: die Sportberichterstattung deutscher Regionalzeitungen.<br />
56<br />
Wie es der Verfasser selbst in Ausübung seiner Arbeit als Medien-Volunteer in der Mixed-Zone bei einigen<br />
WM-Spielen in Leipzig beobachtet hat.<br />
57<br />
Vergleiche die Aussagen einiger Sportressortleiter, die z.B. auf nicht ausreichende Finanzen <strong>und</strong> Zeit innerhalb<br />
der regionalen Sportredaktionen hinweisen <strong>–</strong> Gründe, warum auf WM-Akkreditierungen verzichtet worden ist.<br />
„Wer <strong>im</strong> Stadion sitzt, fehlt in der Redaktion.<strong>“</strong> (BAUER 2007). Zudem wird der mangelnde journalistische Handlungsspielraum<br />
erwähnt, der es für einige Regionalzeitungen laut eigenen Aussagen nicht sinnvoll erscheinen<br />
lässt, sich um eine Akkreditierung zu bemühen (GRÄBER 2007).<br />
48
Damit ist z.B. die Berichterstattung ausländischer Zeitungen <strong>und</strong> Fernsehsender ausgeschlossen.<br />
Die Beschränkung sei kurz erklärt: Die Vorwürfe des Sportnetzwerks richten sich<br />
nicht ausschließlich, aber in erster Linie an in Deutschland tätige Journalisten. Nach Meinung<br />
des Verfassers stellt eine WM <strong>im</strong> eigenen Land zudem deutsche Sportjournalisten vor eine<br />
besondere Herausforderung, was die journalistische <strong>Distanz</strong> betrifft. Ferner wird die Untersuchung<br />
auf die Printberichterstattung beschränkt. Zum einen kann z.B. laut GÖRNERS Bef<strong>und</strong>en<br />
kritischer, distanzierter <strong>Sportjournalismus</strong> <strong>–</strong> <strong>im</strong> Vergleich mit dem <strong>stark</strong> auf die Unterhaltung<br />
setzenden Medium Fernsehen <strong>–</strong> eher in den Printmedien gef<strong>und</strong>en werden (GÖR-<br />
NER 1995, 251f.; vgl. FRÜTEL 2005, 142). 58 Die Chancen für Tageszeitungen bestehen gerade<br />
darin, eine Komplementär- <strong>und</strong> Nischenfunktion der Sportberichterstattung zu nutzen<br />
(KÖSTNER 2005, 237; vgl. TEWES 1991, 378f.; WEISCHENBERG 1994, 449; WIPPER<br />
2003, 213). Wer z.B. abends ein Fußballspiel live <strong>im</strong> Fernsehen gesehen hat, kennt den<br />
Spielverlauf <strong>und</strong> erwartet am nächsten Morgen, in der Zeitung darüber hinausgehende Hintergründe<br />
erfahren zu können.<br />
„Sport <strong>im</strong> Fernsehen ist vor allem dramaturgisch aufbereitetes Entertainment <strong>und</strong> kommt damit den<br />
Printmedien insgesamt wohl eher entgegen: Die Inszenierung <strong>und</strong> moderne Aufbereitung des Sports<br />
schafft die Nachfrage für Orientierungsangebote <strong>und</strong> Hintergr<strong>und</strong>berichterstattung <strong>–</strong> <strong>im</strong> Sinne klassischer<br />
journalistischer Kompetenzen. Je weniger das Fernsehen, das Impulse für eine differenziertere<br />
journalistische Auseinandersetzung meist erst schafft, diese Themenstrukturierung aufgreift, desto größer<br />
ist die Chance für die Printmedien, diese Lücke zu füllen.<strong>“</strong> (LOOSEN 1997, 211; vgl. TEWES 1991,<br />
226).<br />
Die Forschung hat sich relativ häufig mit dem Fernsehen beschäftigt. Im dem vergleichsweise<br />
seltener untersuchten Printbereich arbeiten allerdings die meisten deutschen Sportjournalisten<br />
(WEISCHENBERG 2006, 349; vgl. GÖRNER 1995, 133).<br />
„Regionale Tageszeitungen werden in Inhaltsanalysen zur Sportberichterstattung häufig vernachlässigt,<br />
obwohl sie die umfangreichste <strong>und</strong> damit eine wesentliche Gattung der Tageszeitungen<br />
darstellen.<strong>“</strong> (LOOSEN 1997, 71). Auf der anderen Seite wird besonders Journalisten<br />
von Regionalzeitungen eine ergebniszentrierte <strong>und</strong> oberflächliche 1:0-Berichterstattung<br />
vorgeworfen (TEWES 1991, 378ff.). Deshalb sollen regionale Tageszeitungen in der Untersuchung<br />
berücksichtigt werden. Überregionale Tageszeitungen werden bei dieser Untersuchung<br />
aus mehreren Gründen nicht berücksichtigt: Ein Typen übergreifender Vergleich zwischen<br />
der Berichterstattung regionaler <strong>und</strong> überregionaler Tageszeitungen führt zu vielen<br />
Vergleichsschwierigkeiten. Zu groß sind die Unterschiede, wenn z.B. als recht s<strong>im</strong>pler Faktor<br />
unterschiedliche Redaktionsschlusszeiten genannt wird. Journalisten überregionaler Tageszeitungen<br />
produzieren in der Gesamtheit qualitativ bessere Berichterstattung. TEWES zeigt<br />
z.B., dass <strong>im</strong> Zeitungstyp überregionaler Zeitungen eine hintergründig-analytische Berichterstattung<br />
zu finden ist (TEWES 1991, 378ff.).<br />
Laut Forschungsfrage beschränkt sich die Untersuchung auf die Berichterstattung über zwei<br />
WM-Begegnungen. Die beiden Spiele <strong>im</strong> Viertel- <strong>und</strong> Halbfinale waren entscheidende Spiele,<br />
die am Ende für die beiden betreffenden Mannschaften zwei mögliche Konsequenzen<br />
zuließen: eine R<strong>und</strong>e weiter oder Turnier-Aus. Sie sind für diese Studie relevant, weil deutsche<br />
distanzlose Sportjournalisten es gerne sehen, wenn die deutsche Mannschaft so lange<br />
wie möglich <strong>im</strong> Turnier bleibt. Zudem erscheinen die Spiellausgänge dieser beiden Partien<br />
günstig für eine Untersuchung <strong>–</strong> gerade <strong>im</strong> Hinblick auf Kausalattributionen.<br />
STRAUSS/MÖLLER <strong>und</strong> MARR/STIEHLER zeigen, dass die Anzahl der Ursachenzuschreibungen<br />
größer ist, wenn das Resultat unerwartet <strong>und</strong> unerfreulich ist (vgl.<br />
STRAUSS/MÖLLER 1994b, 248; MARR/STIEHLER 1995, 338). Zudem bieten die Begegnungen<br />
Anlass zur Kritik, wenn z.B. die Streitigkeiten zwischen der deutschen <strong>und</strong> der argentinischen<br />
Mannschaft auf dem Spielfeld nach dem Abpfiff sowie die daraus resultierende<br />
Sperre für einen deutschen Stammspieler berücksichtigt werden. Diese Umstände bieten<br />
58<br />
TV-Sportjournalist Ulrich Potofski gibt <strong>im</strong> Interview zu, dass „Leute, die sich um Profisport <strong>im</strong> Fernsehen kümmern,<br />
[...] eigentlich keine Journalisten mehr<strong>“</strong> sind (REICHERT 2006a).<br />
49
geeignete Vorlagen für Wertungen. Allerdings müssen bei einem etwaigen Vergleich der<br />
beiden Spiele die unterschiedlichen Anstoßzeiten beachtet werden.<br />
5.1.3 Entwicklung der Untersuchungshypothesen<br />
Aus den dargestellten begründeten Vorüberlegungen <strong>und</strong> der formulierten Forschungsfrage<br />
resultiert folgende zentrale (übergeordnete) Untersuchungshypothese:<br />
Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
hinsichtlich distanzloser, unkritischer Berichterstattung. 59<br />
Als Anschlusshypothese wird formuliert:<br />
Es existiert ein Unterschied bezüglich kritischer <strong>Distanz</strong> zwischen Regionalzeitungen,<br />
die ihre Berichterstattung teilweise auf eigene akkreditierte Journalisten stützen<br />
<strong>und</strong> Regionalzeitungen mit Texten ausschließlich nicht akkreditierter Journalisten. 60<br />
Eine systematische Auswertung der oben präsentierten wissenschaftlichen Aussagen zur<br />
kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> hat den Zweck, die Forschungsfrage „in einzelne,<br />
prüfbare Behauptungen<strong>“</strong> zu übersetzen (FRÜH 2007, 78). Wenn es sich in dieser speziellen<br />
Zuspitzung auf die Frage der kritischen <strong>Distanz</strong> in der Summe um einen explorativen Untersuchungsgegenstand<br />
handelt, ist dennoch eine vorrangig deduktive Hypothesenbildung gerechtfertigt,<br />
weil durch die Gesamtheit der bisherigen Ausführungen das „Entdeckungspotenzial<br />
definierbar<strong>“</strong> geworden ist (ebd.). Neben den oben diskutierten Vorüberlegungen sind bei<br />
der Bildung des Hypothesenkatalogs bzw. bei der Ausdifferenzierung der zentralen Hypothese<br />
in einzelne Hypothesen die Ergebnisse aus den dargestellten bisherigen Forschungen<br />
zum Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> zu berücksichtigen.<br />
Die Formulierung des folgenden Hypothesenkatalogs, dessen einzelne Aussagen in dem<br />
vorliegenden Projekt überprüft werden sollen, orientiert sich an den Kritikpunkten der diskutierten<br />
Studien.<br />
Hinsichtlich des unterschiedlichen Einsatzes der journalistischen Darstellungsformen <strong>im</strong><br />
<strong>Sportjournalismus</strong> bezüglich der Häufigkeit sind die Aussagen eindeutig. Informierende oder<br />
objektivierend-faktizierende Darstellungsformen werden weitaus häufiger als subjektivierendargumentierende<br />
Formen eingesetzt. Deshalb lautet die erste entwickelte Hypothese:<br />
H01: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber hinsichtlich der Dominanz objektiv-faktizierender Darstellungsformen.<br />
Aus dieser ersten Hypothese folgt u.a., dass sich in der Berichterstattung der Zeitungen mit<br />
akkreditierten Journalisten z.B. weniger Kommentare oder weniger wertende Aussagen als<br />
in Blättern mit ausschließlich nicht akkreditierten Journalisten finden lassen. In den folgenden<br />
Hypothesen werden Aspekte angesprochen, die teilweise eng mit der ersten Hypothese zusammenhängen.<br />
Dem <strong>Sportjournalismus</strong> wird vorgeworfen, dass best<strong>im</strong>mte Inhalte die Be-<br />
59<br />
Der unterschiedliche Ursprung von Texten wird der Einfachheit halber wie folgt festgelegt <strong>und</strong> nachfolgend<br />
verwendet: Texte akkreditierter Journalisten <strong>im</strong> Vergleich zu Texten nicht akkreditierter Journalisten. Als Texte<br />
akkreditierter Journalisten werden ausschließlich solche Texte bezeichnet, die von Journalisten der Regionalzeitungen<br />
stammen, die bei den jeweiligen Spielen <strong>im</strong> Stadion auf der Tribüne saßen. Unter Texten nicht akkreditierter<br />
Journalisten werden in der Folge solche Beiträge verstanden, die u.a. von nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
geschrieben worden sind oder in Regionalzeitungen erschienen sind, die bei den jeweiligen<br />
Spielen keine Tribünen-Akkreditierung für ihre angestellten Journalisten hatten. Sicherlich stammen diese Texte<br />
ursprünglich meistens von akkreditierten Journalisten <strong>–</strong> in der Regel von bei Agenturen angestellten Kollegen.<br />
Diese Texte wurden letztlich von nicht akkreditierten Journalisten in unterschiedlicher Stärke redigiert <strong>und</strong> in ihre<br />
Endfassung gebracht. Oben wurde zudem der vermutete Unterschied zwischen Agentur-Journalisten <strong>und</strong> Redakteuren<br />
kleinerer Zeitungen bezüglich kritischer <strong>Distanz</strong> bei sportlichen Großereignissen formuliert.<br />
60<br />
Der Verfasser dieser Arbeit verwendet zweiseitige Hypothesen, da die eingesetzten Signifikanztests, die mit<br />
dem Programm SPSS berechnet werden, in der Regel auf der Annahme einer zweiseitigen Hypothese beruhen.<br />
50
ichterstattung <strong>stark</strong> best<strong>im</strong>men, andere dagegen <strong>stark</strong> vernachlässigt werden. Deshalb lautet<br />
die zweite Hypothese:<br />
H02: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
bezüglich aktiver bzw. passiver Themensetzung <strong>–</strong> gemessen am Beitragsanlass.<br />
Weiter wird dem <strong>Sportjournalismus</strong> vorgehalten, eine heile Welt des Sports aufrecht erhalten<br />
oder verteidigen zu wollen, weshalb dieses Bild bedrohende oder diesbezüglich negative<br />
Ereignisse in der Berichterstattung selten thematisiert werden. Die nächste entwickelte<br />
Hypothese lautet deshalb:<br />
H03: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber hinsichtlich der Beschäftigung mit Bereichen mit negativer Geschehens-<br />
Valenz (Problemfelder, Kontroverses, Konflikte o.ä.).<br />
Gerade die regionale Sportpresse nutzt häufig nicht die Chance, sich gegenüber der Fernsehberichterstattung<br />
zu profilieren. Sie schöpft ihre Komplementärfunktion ungenügend aus.<br />
Besonders Regionalzeitungen ignorieren in der Berichterstattung häufig tatsächliche Hintergründe,<br />
wie oben gezeigt. Die vierte Untersuchungshypothese lautet:<br />
H04: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber bezüglich der Tiefe der Argumentation. 61<br />
In Übereinst<strong>im</strong>mung mit den bisher genannten Untersuchungshypothesen sind die verwendeten<br />
Handlungsträger dominierend aktive Sportler. Die fünfte entwickelte Hypothese erschließt<br />
sich deshalb wie folgt:<br />
H05: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber hinsichtlich des Gebrauchs aktiver Sportler als Handlungsträger.<br />
Die Sportberichterstattung wird häufig als „Journalismus ohne Quellen<strong>“</strong> bezeichnet. Viele<br />
Texte kommen entweder völlig ohne Quellen aus oder benutzen eine einzige Quelle, die<br />
häufig keine sportexterne Quelle ist. Die sechste Untersuchungshypothese lautet:<br />
H06: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber bezüglich der Anzahl <strong>und</strong> Herkunft der benutzten Quellen.<br />
Als Kriterium, mit dem große <strong>Nähe</strong> zu den Berichterstattungspersonen gemessen werden<br />
kann, wird oft das Duzen angeführt. Da dieses Kriterium in den Zeitungstexten selbst<br />
schlecht untersucht werden kann, sollen weitere Indikatoren, die für mangelnde kritische <strong>Distanz</strong><br />
stehen können, untersucht werden. Dies sind: der alleinige Gebrauch der Vornamen der<br />
Akteure, der Gebrauch der Spitznamen der Akteure <strong>und</strong>/oder „Verballhornungen<strong>“</strong> sowie identifizierende<br />
Sprachvariablen. Die siebte Hypothese lautet:<br />
H07: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber was die Anzahl der verwendeten „Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<strong>“</strong> betrifft.<br />
Das Verlagern von Meinung transportierenden Aussagen auf Experten, die frei vom journalistischen<br />
Normendruck <strong>und</strong> selten unabhängig bezüglich des Berichterstattungsgegenstands<br />
sind, wird als eine best<strong>im</strong>mendes Element <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> angesehen. Die achte<br />
Hypothese lautet:<br />
61 Nach TEWES 1991.<br />
51
H08: Akkreditierte Zeitungen unterscheiden sich von nicht akkreditierten Zeitungen<br />
hinsichtlich der Verlagerung des Transports von Meinungen auf Experten <strong>–</strong> gemessen<br />
am Textumfang <strong>und</strong> der Anzahl wertender Aussagen.<br />
Bei Sportinterviews <strong>im</strong> Fernsehen wird festgestellt, dass wertende Aussagen, wenn sie vorkommen,<br />
zu großer Wahrscheinlichkeit positiv sind. Dieses Ergebnis soll in Darstellungsformen<br />
untersucht werden, in denen per Definition Wertungen zu finden sind. In den Texten<br />
kann die reale Gesprächssituation <strong>im</strong> Vergleich zum Fernsehinterview nicht analysiert werden.<br />
Die neunte Untersuchungshypothese lautet:<br />
H09: Akkreditierte Zeitungen unterscheiden sich von nicht akkreditierten Zeitungen<br />
was die Dominanz positiv wertender Aussagen in subjektivierend-argumentierenden<br />
Darstellungsformen der Journalisten <strong>und</strong> Experten betrifft.<br />
Sportjournalisten, die sportliche Leistungen beobachten <strong>und</strong> beurteilen, unterliegen attributionalen<br />
Verzerrungen, die Aussagen zum Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> ermöglichen.<br />
Es kann von einem quasi stellvertretenden Bedürfnis der Journalisten nach Selbstwerterhöhung<br />
oder -schutz gesprochen werden. Die zehnte Hypothese lautet:<br />
H10: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
hinsichtlich das „eigene<strong>“</strong> Team betreffender, quasi selbstwertdienlicher Ursachenzuschreibung.<br />
Diese zehn Hypothesen formulieren überprüfbare Detailantworten auf die Forschungsfrage<br />
<strong>und</strong> lassen die Formulierung der zentralen Untersuchungshypothese zu, die damit in der<br />
oben genannten Form bestätigt wird:<br />
H: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber hinsichtlich distanzloser, unkritischer Berichterstattung.<br />
Anschlusshypothese: Es existiert ein Unterschied bezüglich kritischer <strong>Distanz</strong> zwischen<br />
Regionalzeitungen, die ihre Berichterstattung teilweise auf eigene akkreditierte<br />
Journalisten stützen <strong>und</strong> Regionalzeitungen mit Texten ausschließlich nicht akkreditierter<br />
Journalisten.<br />
5.2 Auswahl des Untersuchungsmaterials<br />
Das Untersuchungsziel gemäß der Forschungsfrage lautet: Wie kritisch, distanziert berichten<br />
Sportjournalisten deutscher Regionalzeitungen über die Fußball-WM 2006 <strong>im</strong> Allgemeinen<br />
<strong>und</strong> die deutsche Fußball-Nationalmannschaft während ihrer Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Spiele?<br />
Entsprechend ist folgendes die Gr<strong>und</strong>gesamtheit: die WM-Sportberichterstattung deutscher<br />
Regionalzeitungen zur Zeit der genannten beiden Spiele über allgemeine WM-Themen <strong>und</strong><br />
die deutsche Nationalmannschaft sowie ihre Gegner. Diese Gr<strong>und</strong>gesamtheit wird wie folgt<br />
definiert: Die WM-Sportberichterstattung aller regelmäßig erscheinenden deutschsprachigen<br />
Tageszeitungen mit Verlagsort innerhalb der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, die in einem regional<br />
eingeschränkten Verbreitungsgebiet erscheinen <strong>und</strong> für die exklusive Informationen aus<br />
diesem best<strong>im</strong>mten Bereich charakteristisch sind <strong>–</strong> sofern sie Publizistische Einheiten sind<br />
<strong>und</strong> ihre hauptsächliche Vertriebsart das Abonnement ist.<br />
Ausgeschlossen aus der Gr<strong>und</strong>gesamtheit ist damit die Sportberichterstattung folgender<br />
Publikationen: überregionale Zeitungen, Kauf- oder Boulevardzeitungen, Wochenzeitungen,<br />
Wochenmagazine, Publikumszeitschriften sowie Regional- <strong>und</strong> Lokalzeitungen, wenn sie<br />
sich nicht von anderen Zeitungen in Bezug auf die überregionale Sportberichterstattung unterscheiden.<br />
In der Untersuchung werden nur Publizistische Einheiten berücksichtigt. Damit<br />
wird vermieden, dass in der Gr<strong>und</strong>gesamtheit dieselben Hauptsportteile bzw. identische Teile<br />
überregionaler Sportberichterstattung mehrfach vorkommen <strong>und</strong> diese folglich eine größe-<br />
52
e Chance haben, in die zu analysierende Stichprobe zu gelangen. 62 Alle anderen oben angeführten<br />
Presseorgane sind durch die Forschungsfrage ausgeschlossen, die sich nicht auf<br />
die deutsche Presse insgesamt, sondern auf ein spezielles Teilsegment davon bezieht. Die<br />
zu untersuchende Gr<strong>und</strong>gesamtheit besteht aus der WM-Sportberichterstattung regionaler<br />
Publizistischer Einheiten 63 , die während der Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Spiele der deutschen Nationalmannschaft<br />
bei der Fußball-WM 2006 zu allgemeinen WM-Themen <strong>und</strong> zur deutschen<br />
Nationalmannschaft <strong>und</strong> ihrem Gegner produziert worden ist.<br />
Nach der Best<strong>im</strong>mung der Gr<strong>und</strong>gesamtheit muss die Auswahleinheit (sampling unit) definiert<br />
werden. Angesichts der Forschungsfrage ist die Auswahleinheit zeitlich eingegrenzt<br />
worden: Es geht um die WM-Berichterstattung zu den WM-Viertel- <strong>und</strong> Halbfinalspielen der<br />
deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Diese Spiele <strong>fand</strong>en am Freitag, 30. Juni 2006, <strong>und</strong><br />
am Dienstag, 4. Juli 2006, statt. Aufgr<strong>und</strong> der oft schematischen Sportberichterstattung (vgl.<br />
LOOSEN 1997, 199) ist davon auszugehen, dass Vorberichte (am Spieltag), Berichte zum<br />
Spiel (einen Tag danach) <strong>und</strong> Nachberichte (zwei Tage nach dem Spiel) in den Zeitungen<br />
erschienen sind. Zeitlich wird das Untersuchungsmaterial auf Erscheinungstermine zwischen<br />
dem 30. Juni <strong>und</strong> dem 6. Juli 2006 eingegrenzt, womit jeder der sechs üblichen Erscheinungstage<br />
von Tageszeitungen einmal in der Untersuchung berücksichtigt ist. Zudem ist aus<br />
der Forschungsfrage die Eingrenzung in Bezug auf den räumlichen Geltungsbereich<br />
(Deutschland) <strong>und</strong> die Mediengattung (Printmedien, Tageszeitungen) abzuleiten.<br />
Die weitere Eingrenzung der Auswahleinheit soll mit einer geschichteten Zufallsauswahl erfolgen.<br />
Schichtungskriterium ist „Akkreditierung<strong>“</strong> oder „Nicht-Akkreditierung<strong>“</strong>. Es geht also<br />
darum, ob regionale PE bei den WM-Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Spielen mit eigenen Journalisten<br />
akkreditiert waren oder nicht. 64 Dem Schichtungsvorschlag liegt die oben formulierte übergeordnete<br />
Haupt- bzw. daraus folgernde Anschlusshypothese zugr<strong>und</strong>e: Zeitungen mit akkreditierten<br />
Mitarbeitern berichten, was die kritische <strong>Distanz</strong> betrifft, anders als Zeitungen mit ausschließlich<br />
nicht akkreditierten Mitarbeitern. Jede Schicht soll mit vier Zeitungen besetzt sein.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des umfangreichen Untersuchungsmaterials lässt sich diese willkürliche Beschränkung<br />
rechtfertigen (vgl. FRÜH 2007, 151). Innerhalb der nicht akkreditierten Zeitungen wer-<br />
62<br />
Streng gesehen könnten auch unter den regionalen PE identische (oder teilweise identische) Hauptsportteile<br />
mehrfach vorkommen, da der Begriff nur Mindestanforderungen an einen Zeitungsmantel stellt. Vgl. Kapitel 4.1.3<br />
zu den Definitionen der Begriffe „Publizistische Einheit<strong>“</strong>, „Vollredaktion<strong>“</strong> <strong>und</strong> „Sportpublizistische Einheit<strong>“</strong>. In den<br />
meisten Fällen produzieren PE allerdings einen eigenen Hauptsportteil. Zudem ist vom Verfasser durch persönliche<br />
Kontaktaufnahme mit allen Sportredaktionen der Gr<strong>und</strong>gesamtheit überprüft worden, worauf sie ihre überregionale<br />
WM-Sportberichterstattung gestützt haben.<br />
63<br />
Wie aus den unten folgenden Ausführungen ersichtlich ist, hat die Schweriner Volkszeitung als Zeitung mit der<br />
höchsten Auflage der Gruppe der nicht akkreditierten Zeitungen eine Auflage von knapp 110.000 verkauften Exemplaren<br />
(IVW 2006, 121). Um bessere Vergleichbarkeit zu erzielen, müssen etwa 30 akkreditierte Zeitungen mit<br />
einer Auflage von über 110.000 verkauften Exemplaren in der vorliegenden Arbeit unberücksichtigt bleiben. Die<br />
Gr<strong>und</strong>gesamtheit stellen demnach streng genommen „regionale Mittel- <strong>und</strong> Kleinzeitungen<strong>“</strong> dar (FRANKENFELD<br />
1969, 154; vgl. Kapitel 4.1.1). Der Einfachheit halber wird weiter von Regionalzeitungen gesprochen.<br />
64<br />
Nach Durchsicht der Akkreditierungslisten für die Stadien-Pressetribüne bei den beiden zu untersuchenden<br />
WM-Spielen, die für den Verfasser als Medien-Volunteer auf der Fifa-Homepage einseh- <strong>und</strong> archivierbar waren,<br />
ergaben sich folgende Ergebnisse: 83 regionale PE waren mindestens mit einem Journalisten bei beiden zu untersuchenden<br />
Spielen akkreditiert. 14 regionale PE waren bei keinem der beiden Spiele akkreditiert <strong>–</strong> wobei die<br />
Ostthüringer Zeitung auszusortieren ist, da sie sich in der Berichterstattung auf freie Mitarbeiter, die sich selbstständig<br />
als freie Journalisten akkreditiert hatten, <strong>und</strong> auf eigene Redakteure, die über Sponsoren-Einladungen <strong>im</strong><br />
Stadion waren, gestützt hat. Die 14 bzw. 13 nicht akkreditierten Zeitungen wurden durch den Vergleich der Fifa-<br />
Akkreditierungslisten mit allen 137 Publizistischen Einheiten <strong>und</strong> durch anschließende persönliche Kontaktaufnahme<br />
durch den Verfasser mit den jeweiligen Sportredaktionen ermittelt. Dabei wurde ersichtlich, dass einige<br />
regionale PE, die nicht akkreditiert waren, ihre WM-Berichterstattung auf akkreditierte Journalisten von Zeitungen<br />
gestützt haben, die z.B. zur selben Zeitungsgruppe gehören. Diese Zeitungen werden nicht berücksichtigt, um zu<br />
vermeiden, dass (quasi) dieselben Artikel derselben akkreditierten Journalisten eine höhere Chance haben, untersucht<br />
zu werden. Die Differenz zu 137 <strong>im</strong> Jahr 2006 existierenden PE setzt sich zudem u.a. aus den nicht<br />
berücksichtigten überregionalen Zeitungen <strong>und</strong> Boulevardblättern zusammen. Ferner werden regionale PE nicht<br />
in die Untersuchung miteinbezogen, die nur bei einem der beiden zu untersuchenden Spiele akkreditiert waren<br />
(z.B. Badische Neueste Nachrichten, Fuldaer Zeitung <strong>und</strong> Hessisch Niedersächsische Allgemeine (HNA)). Würden<br />
diese Zeitungen berücksichtigt, müsste eine dritte Gruppe eröffnet werden: teilweise akkreditierte Zeitungen.<br />
53
den die Titel nach dem Zufallskriterium ausgewählt, was eine Liste folgender Zeitungen ergibt:<br />
1) Nicht akkreditierte Regionalzeitungen<br />
a) Hanauer Anzeiger (18.398) 65<br />
b) Mindener Tageblatt (37.800)<br />
c) Ludwigsburger Kreiszeitung (43.204)<br />
d) Schweriner Volkszeitung (106.570)<br />
Mit einem folgenden disproportionalen Schichtungsschritt werden nach einer Vorsortierung<br />
anhand von Auflagenzahlen <strong>–</strong> ger<strong>und</strong>et nach 10.000er Stufen <strong>–</strong> vier akkreditierte Regionalzeitungen<br />
nach dem Zufallskriterium ausgewählt, die sich bezüglich der Auflage mit den vier<br />
nicht akkreditierten Zeitungen vergleichen lassen. Diese disproportionale Auswahlmethode<br />
erscheint dem Verfasser sinnvoll, weil es Ziel der Untersuchung ist, die Berichterstattung<br />
akkreditierter Zeitungen mit der nicht akkreditierter Blätter zu vergleichen (vgl. RÖSSLER<br />
2005, 59). Es ergibt sich folgende Liste akkreditierter Regionalzeitungen:<br />
2) Akkreditierte Regionalzeitungen<br />
a) Oldenburgische Volkszeitung (22.548)<br />
b) Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung (41.475)<br />
c) Eßlinger Zeitung (43.483)<br />
d) Lausitzer R<strong>und</strong>schau (106.991)<br />
Die Auswahleinheit wird somit definiert: die überregionale WM-Sportberichterstattung der<br />
Regionalzeitungen Hanauer Anzeiger (HA), Mindener Tageblatt (MT), Ludwigsburger Kreiszeitung<br />
(LKZ), Schweriner Volkszeitung (SVZ), Oldenburgische Volkszeitung (OV), Pforzhe<strong>im</strong>er<br />
Zeitung (PZ), Eßlinger Zeitung (EZ) <strong>und</strong> Lausitzer R<strong>und</strong>schau (LR) an den sechs<br />
Erscheinungstagen zwischen dem 30. Juni <strong>und</strong> 6. Juli 2006, die sich mit allgemeinen WM-<br />
Themen sowie der deutschen Nationalmannschaft <strong>und</strong> der gegnerischen Mannschaft befasst.<br />
Unter überregionaler WM-Sportberichterstattung werden subsumiert: In Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
mit der PE-Definition WM-Artikel, die auf den Seiten eins <strong>und</strong> zwei sowie <strong>im</strong> überregionalen<br />
Sportteil abgedruckt worden sind (vgl. SCHÜTZ 2005a, 205). Die Analyse bezieht sich einerseits<br />
<strong>stark</strong> auf Texte zur deutschen Mannschaft bzw. zu ihrem Gegner. Anderseits handelt es<br />
sich um eine ressortspezifische Untersuchung. WM-Artikel auf den ersten beiden Seiten<br />
wurden dort aufgr<strong>und</strong> ihrer Wichtigkeit platziert <strong>und</strong> nicht, weil sie nicht mehr zum Ressort<br />
Sport gehören. Texte mit WM-Bezug, die z.B. auf Wirtschafts-, Feuilleton- oder lokalen Seiten<br />
zu finden sind, wurden dort nach einer thematischen Zugehörigkeit z.B. zu dem Wirtschaftsressort<br />
gedruckt. Somit gehören sie nach dem beschriebenen Verständnis nicht mehr<br />
zur überregionalen Berichterstattung des Ressorts Sport.<br />
Theoriegeleitet sind aus den Hypothesen diese Hauptkategorien abgeleitet worden: Verfasser,<br />
Darstellungsform, Anlass der Berichterstattung, Valenz des Geschehens, Argumentationstiefe,<br />
Handlungsträger, Quellen, Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit, Textumfang, wertende<br />
Aussagen, positive journalistische Valenz <strong>und</strong> selbstwerterhöhende/-schützende Attributionen.<br />
Die meisten dieser Sachverhalte lassen sich angemessen auf Artikelebene erfassen.<br />
So zielt z.B. das Forschungsinteresse nicht darauf ab, die Handlungsträger genau zu<br />
beschreiben. Diese werden als ein Aspekt der WM-Berichterstattung betrachtet. Deshalb<br />
65<br />
Die genannten Auflagenzahlen sind auf dem Stand des dritten Quartals 2006 (IVW 2006). Es werden also die<br />
Auflagenzahlen genannt, die die Zeitungen größten Teils während der WM-Viertel- <strong>und</strong> Halbfinal-Begegnungen<br />
vorweisen konnten. Der Erscheinungstag „30. Juni 2006<strong>“</strong> gehört als einziger von diesen zum zweiten Quartal<br />
2006.<br />
54
wird ausgerichtet auf das Ziel der Studie als hauptsächliche Analyseeinheit der einzelne Artikel<br />
oder Beitrag gewählt. Allerdings wird das Untersuchungsmaterial hierarchisch in zwei<br />
weitere Analyseeinheiten zerlegt (vgl. RÖSSLER 2005, 71ff.). Innerhalb der Analyseeinheit<br />
Artikel werden auch Informationen codiert, die für Artikel desselben Sportteils konstant<br />
sind. 66 Daneben beziehen sich zwei Kategorien auf Aussagenebene, um Bewertungen <strong>und</strong><br />
Attributionen zu analysieren, deren Untersuchung auf Artikelebene zu fehleranfällig <strong>und</strong> nur<br />
als Globalbewertung möglich wäre (vgl. ebd., 153). Es interessiert aber die Verteilung der<br />
einzelnen Wertungen <strong>und</strong> Ursachenzuschreibungen. 67 Somit liegen die Analyseeinheiten<br />
Artikel, Wertende Aussage <strong>und</strong> Attribution vor. Datenerfassung <strong>und</strong> -auswertung wurde mit<br />
dem Statistikprogramm SPSS für Windows (Version 15.0) durchgeführt. Die generierten Tabellen<br />
<strong>und</strong> Abbildungen wurden mit SPPS in die gedruckte Form gebracht.<br />
5.2.1 Untersuchte Zeitungen <strong>im</strong> Kurzporträt<br />
13 der 137 <strong>im</strong> Jahr 2006 existierenden PE in Deutschland waren nach Durchsicht der Fifa-<br />
Listen 68 bei keinem der zwei Spiele der Fußball-WM akkreditiert, die Gegenstand der Untersuchung<br />
in dieser Arbeit sein sollen (vgl. BDZV 2006, 3). 9 dieser 13 Zeitungen waren bei<br />
keinem einzigen Spiel des deutschen Nationalteams für die Tribüne <strong>im</strong> Stadion zugelassen,<br />
4 Blätter waren zwar nicht bei den deutschen Viertel- <strong>und</strong> Halbfinale-Begegnungen live dabei,<br />
waren aber bei anderen deutschen WM-Partien anwesend.<br />
Die Zeitung mit der kleinsten Auflage, die zu den 13 nicht akkreditierten PE gehört, ist mit<br />
10.575 69 verkauften Exemplaren die Emder Zeitung. Das Blatt mit der höchsten Auflage ist<br />
die Ostthüringer Zeitung (OTZ) mit 124.000 verkauften Exemplaren. 70 Allerdings wird die<br />
OTZ in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da sie sich in ihrer Berichterstattung auf freie Mitarbeiter,<br />
die sich selbständig als freie Journalisten akkreditiert hatten oder auf eigene Redakteure<br />
gestützt hat, die über Sponsoren-Einladungen <strong>im</strong> Stadion waren. Insofern ist die OTZ-<br />
Berichterstattung aus diesem Gesichtspunkt für diese Arbeit nicht interessant, da gerade<br />
Zeitungen für die erste Untersuchungsgruppe ausgewählt werden sollten, die nicht auf Texte<br />
„eigener Leute<strong>“</strong> <strong>im</strong> Stadion zurückgegriffen haben, sondern auf Beiträge der Presseagenturen.<br />
Die Zeitung mit der höchsten Auflage ist in dieser Gruppe die Schweriner Volkszeitung<br />
(108.221) (IVW 2006). Nachfolgend werden kurz die vier ausgewählten, nicht bei den beiden<br />
zu untersuchenden Spielen akkreditierten Zeitungen vorgestellt.<br />
5.2.1.1 Nicht akkreditierte Zeitungen<br />
Zu den 13 bei keinem der zu untersuchenden WM-Spielen akkreditierten Zeitungen, die<br />
nachfolgend nicht näher beschrieben werden, gehören das Badische Tagblatt (37.007 verkaufte<br />
Exemplare), die Emder Zeitung (10.575), die Oberhessische Presse (29.756), das<br />
Offenburger Tageblatt (56.162), die Pirmasenser Zeitung 71 (12.967), die Saale-Zeitung<br />
(14.919), das Traunsteiner Tagblatt (15.431) <strong>und</strong> das Trostberger Tageblatt (18.734) (IVW<br />
66<br />
Der dadurch zusätzlich entstehende Codieraufwand ist nicht zu hoch. Zuerst war geplant, die Informationen in<br />
der übergeordneten Analyseeinheit Überregionaler Sportteil zu erfassen.<br />
67<br />
Die Definitionen der Analyseeinheiten sind <strong>im</strong> Codebuch formuliert.<br />
68<br />
Die Akkreditierungslisten der Fifa für die Presse-Tribünen in den jeweiligen Stadien waren für den Verfasser<br />
dieser Arbeit auf der Internetseite der Fifa für die Weltmeisterschaft 2006 (www.fifaworldcup.yahoo.com) einsehbar<br />
<strong>–</strong> <strong>und</strong> zwar als für den „Media Channel<strong>“</strong> akkreditierter freier Journalist sowie als ehrenamtlicher freiwilliger<br />
Helfer des Turniers (Volunteer) mit Einsatzort auf der Presse-Tribüne <strong>im</strong> Leipziger Stadion. Die Akkreditierungslisten<br />
sind inzwischen nicht mehr online, vom Verfasser aber archiviert.<br />
69<br />
Alle genannten Auflagenzahlen der Zeitungen, die in dieser Untersuchung berücksichtigt werden, sind <strong>–</strong> wenn<br />
nicht gesondert darauf hingewiesen wird <strong>–</strong> auf dem Stand des dritten Quartals 2006 (vgl. IVW 2006). Es werden<br />
die Auflagenzahlen genannt, die die Zeitungen <strong>im</strong> größten Teil des Untersuchungszeitraums vorweisen konnten.<br />
Der erste Tag des Untersuchungszeitraums (30. Juni bis 6. Juli 2007) fällt allerdings in das zweite Quartal 2006.<br />
70<br />
Diese Zahl beruht <strong>–</strong> <strong>im</strong> Gegensatz zu den anderen genannten Auflagenzahlen <strong>–</strong> auf einer Schätzung (vgl.<br />
RÖPER 2006, 290). Für die drei Tageszeitungen Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung <strong>und</strong> Ostthüringer<br />
Zeitung wird eine Gesamtauflage von 356.290 Exemplaren angegeben (IVW 2006, 47).<br />
71<br />
Seit Oktober 2006 erstellt die MSSW Print-Medien Service Südwest GmbH aus Ludwigshafen den überregionalen<br />
Teil der Pirmasenser Zeitung, deren Vollredaktion aufgelöst worden ist (vgl. DOSTAL 2007).<br />
55
2006). Einige dieser Zeitungen verweigern die Zusammenarbeit, von anderen dieser Blätter<br />
ist es nicht möglich, die benötigten Seiten komplett zu erhalten.<br />
5.2.1.1.1 Hanauer Anzeiger<br />
Der Hanauer Anzeiger (HA) wird am 27. September 1725 erstmals unter dem Titel Wochentliche<br />
Hanauer Frag- <strong>und</strong> Anzeigungs-Nachrichten herausgegeben. Der HA n<strong>im</strong>mt für sich in<br />
Anspruch, die zweitälteste noch erscheinende Tageszeitung oder die älteste noch existierende<br />
Tageszeitung mit Vollredaktion in Deutschland zu sein. Verlegt wird das Blatt vom Hanauer<br />
Anzeiger GmbH + Co Druck- <strong>und</strong> Verlagshaus, das in Besitz der Verlegerfamilie Bauer<br />
ist. Chefredakteur ist Dieter Schreier, Herausgeber ist Thomas Bauer. Verlagsort der Zeitung,<br />
die <strong>im</strong> Rheinischen Format mit einer Auflage von 18.406 Exemplaren erscheint, ist Hanau.<br />
90 % des HA werden <strong>im</strong> Abonnement verkauft. Der HA erscheint <strong>im</strong> südwestlichen Teil<br />
des hessischen Main-Kinzig-Kreises. Im Verbreitungsgebiet liegen die Städte Hanau, Bruchköbel,<br />
Maintal <strong>und</strong> Nidderau sowie Langenselbold, wo die Langenselbolder Zeitung vertrieben<br />
wird (HA 2007; IVW 2006, 67). Konkurrent ist die Hanau-Post <strong>–</strong> eine Regionalausgabe<br />
der Offenbach-Post. Konkurrenten sind mit Abstrichen auch die Frankfurter R<strong>und</strong>schau <strong>und</strong><br />
die Gelnhäuser Neue Zeitung (BREIDEBAND 2007).<br />
Nach mehrmaligem Wechsel der Eigentumsverhältnisse <strong>und</strong> Änderung des Titels erscheint<br />
die Zeitung ab dem 1. Mai 1872 täglich als Hanauer Anzeiger. Jahrzehntelang gehören die<br />
Verlagsrechte einem evangelisch-reformierten Waisenhaus. Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel<br />
hat dies <strong>–</strong> nach dem Vorbild des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. <strong>–</strong><br />
veranlasst, um die wirtschaftliche Lage der Stiftung zu verbessern. Später wird das Blatt in<br />
einer waisenhauseigenen Druckerei produziert. In der November-Revolution nach dem Ersten<br />
Weltkrieg besetzt der Arbeiter- <strong>und</strong> Soldatenrat den eher konservativen HA. Vom 14.<br />
November 1918 bis 25. Januar 1919 bringen die Besetzer die Zeitung mit der hinzugefügten<br />
Unterzeile „Publikationsorgan des Arbeiter- <strong>und</strong> Soldatenrates für den Stadt- <strong>und</strong> Landkreis<br />
Hanau am Main<strong>“</strong> heraus (HA 2007).<br />
Paul Nack, der den HA nach der folgenden Inflationszeit wirtschaftlich ges<strong>und</strong> aufstellte, erwirbt<br />
am 1. April 1936 die Verlagsrechte <strong>und</strong> das technische Inventar, nachdem er zuvor<br />
vom Waisenhaus als persönlich Haftender benannt worden war. Die Nationalsozialisten hatten<br />
Stiftungen als Eigentümer von Zeitungen abgelehnt. Am 31. Mai 1941 erscheint der HA<br />
vorläufig zum letzten Mal vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit der Erteilung der Generallizenz<br />
am 1. September 1949 wird der HA wieder gedruckt. Nach dem Umzug in ein neues<br />
funktionaleres Gebäude Ende der 1990er Jahre kann der HA nachts produziert werden. Ab<br />
dem 2. Mai 1997 wird die Erscheinungsweise von einer Mittag- auf eine Morgenzeitung umgestellt.<br />
Seitdem wird der HA von Thomas Bauer, dem Enkelsohn Paul Nacks, als Verleger<br />
herausgegeben. Das Druck- <strong>und</strong> Verlagshaus verlegt neben dem HA ein Anzeigenblatt, hat<br />
die Langenselbolder Zeitung gepachtet <strong>und</strong> hält u.a. Anteile am Maintal Tagesanzeiger sowie<br />
am privaten Radiosender Hit Radio FFH (HA 2007).<br />
Während der WM ist Jan Topitsch Sportressortleiter <strong>–</strong> seit der Umstrukturierung der Redaktion<br />
Anfang 2007 gibt es keinen klassischen Sportressortleiter mehr. Inklusive Sportchef arbeiten<br />
während des Turniers drei Redakteure <strong>im</strong> HA-Sport. Redaktionsschluss ist um 24.00<br />
Uhr. Die HA greift <strong>im</strong> Sport auf die Text-Agenturen DPA <strong>und</strong> SID sowie als Bild-Agenturen<br />
Reuters <strong>und</strong> DPA zurück <strong>–</strong> zusätzlich werden während der WM Fotos von der Agentur DDP<br />
bezogen. Das Ziel der HA-Sportberichterstattung laut Sportredakteur Jochen BREIDEBAND:<br />
„So weit von der 1:0-Berichterstattung wegzukommen wie möglich. Wir legen Wert darauf,<br />
dass nicht alles <strong>–</strong> wie bei Lokalzeitungen oft üblich <strong>–</strong> auf Berichtsform beschränkt ist.<strong>“</strong><br />
(BREIDEBAND 2007). Regelmäßig sollen Interviews, Portraits <strong>und</strong> andere Darstellungsformen<br />
eingesetzt werden. Bei der WM-Berichterstattung sehen die Sportredakteure „Aktualität<br />
als Muss<strong>“</strong> an. WM-Themen mit lokalen Bezügen sollen täglich auf einer ganzen Seite dargestellt<br />
werden. Täglich erscheint ein separates WM-Heft: „WM-Spezial<strong>“</strong>. Zusätzlich will die HA<br />
„möglichst viel kommentieren oder anders beleuchten<strong>“</strong>. Dazu gibt es u.a. die Rubriken „WM-<br />
56
Rückpass<strong>“</strong> <strong>und</strong> „Mein WM-Tagebuch<strong>“</strong> (ebd.). Sportredakteur Breideband ist bei den Partien<br />
Deutschlands gegen Costa Rica, Polen <strong>und</strong> Schweden akkreditiert.<br />
5.2.1.1.2 Mindener Tageblatt<br />
Das Mindener Tageblatt (MT) erscheint von montags bis samstags als Regionalzeitung in<br />
der ostwestfälischen Stadt Minden. Verbreitungsgebiet des Blattes <strong>im</strong> Berliner Format aus<br />
dem Verlag J.C.C. Bruns Betriebs GmbH ist fast der gesamte Altkreis Minden. Herausgeber<br />
sind Reiner Thomas, Sven Thomas, Johannes Obieglo <strong>und</strong> Lars Schweichart. Inhaber <strong>und</strong><br />
Geschäftsführer Rainer Thomas <strong>und</strong> Sohn Sven Thomas stehen zu Beginn des 21. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
in fünfter <strong>und</strong> sechster Generation an der Spitze des Mindener Familienunternehmens<br />
J.C.C. Bruns. Chefredakteur ist Christoph Pepper. Leiter des Sportressorts ist seit Juli<br />
2007 Markus Riechmann. Das MT, dessen Erstausgabe am 5. Juni 1856 erscheint, muss<br />
sich <strong>im</strong> Verbreitungsgebiet nicht gegen die Konkurrenz einer anderen Tageszeitung behaupten.<br />
Seit Januar 2004 erscheint der benachbarte Vlothoer Anzeiger, der zuvor zur Ippen-<br />
Zeitungsgruppe gehört <strong>und</strong> nur zwe<strong>im</strong>al wöchentlich gedruckt wurde, sechsmal wöchentlich<br />
<strong>im</strong> MT-Verlag J.C.C. Bruns <strong>und</strong> wird durch eine eigene Redaktion unterstützt. Der Vlothoer<br />
Anzeiger steht in Konkurrenz zum Bielefelder Westfalenblatt. Zusammen haben beide Blätter<br />
aus dem Bruns-Verlag eine Auflage von 36.602 Exemplaren (IVW 2006, 95; LANGENKÄM-<br />
PER 2002; MT 2007; PEPPER 2002; RIECHMANN 2007):<br />
Das MT wird am 5. Juli 1856 als Minden-Lübbecker Kreisblatt von Johann Christian Conrad<br />
Bruns gegründet. Ab 1893 kommt das Blatt täglich heraus. Seit 1919 trägt das MT seinen<br />
heutigen Namen. 1941 wird die weserabwärts benachbarte Lokalzeitung Bote an der Weser<br />
integriert. 1943 wird die Zeitung von Nationalsozialisten stillgelegt, 1945 von den Besatzungstruppen<br />
demontiert. Am 1. Dezember 1949 erscheint die erste Nachkriegsausgabe des<br />
MT. 1972 wird ein neues Druckhaus gebaut (MT 2007, RIECHMANN 2007).<br />
Mehrfach ausgezeichnet wird die Zeitung für ihr Design. So erhält sie <strong>im</strong> Wettbewerb um den<br />
„European Newspaper Award<strong>“</strong> in den Jahren 2000, 2001 <strong>und</strong> 2002 jeweils einen „Award of<br />
Excellence<strong>“</strong> in verschiedenen Kategorien wie „Titelseite/Regionalzeitungen<strong>“</strong> oder „Fotografie<strong>“</strong>.<br />
Mehr als 90 % der Auflage werden <strong>im</strong> Abonnement vertrieben <strong>–</strong> die Bedeutung des Einzelverkaufs<br />
be<strong>im</strong> MT wächst aber ständig. Der Verlag produziert neben dem MT das Anzeigenblatt<br />
Weserspucker, das Veranstaltungsmagazin News <strong>und</strong> weitere Druckschriften.<br />
J.C.C. Bruns ist zudem an der Betriebsgesellschaft von Radio Westfalica beteiligt (MT 2007).<br />
Heute unterhält die Zeitung mit einem 26-köpfigen Redaktionsstab eine Vollredaktion <strong>–</strong> inklusive<br />
fünf Sportredakteure. Damit ist die Sportredaktion zahlenmäßig nach der Lokalredaktion<br />
die stärkste Abteilung. Während der WM wird die Sportabteilung von zwei Redakteuren<br />
anderer Ressorts unterstützt. Unter der Leitung von Markus Riechmann, der kürzlich den<br />
langjährigen Ressortleiter Friedhelm Sölter ablöste, ist vor allem Handball in der Handballhochburg<br />
Minden eine wichtige mediale Sportart (RIECHMANN 2007; SÖLTER 1999). Redaktionsschluss<br />
ist 23.30 Uhr für die Mindener Ausgabe. Während der Fußball-WM werden<br />
die Fristen auf 24.00 Uhr verschoben. Die überregionale Sportberichterstattung stützt sich<br />
vor allem auf die abonnierten Agenturen DPA (Text <strong>und</strong> Fotos), SID (Text) <strong>und</strong> DDP (Fotos).<br />
Zur Fußball-WM produziert das MT ein tägliches, mehrseitiges WM-Extra, „um dem Ereignis<br />
gerecht zu werden, eine geeignete Bühne für Werbemaßnahmen zu schaffen <strong>und</strong> das Image<br />
als in der Sportberichterstattung <strong>stark</strong>es Blatt zu pflegen<strong>“</strong> (RIECHMANN 2007). Aufgr<strong>und</strong> zu<br />
wenig Personals hat das MT laut eigener Aussage bei den WM-Spielen des deutschen<br />
Teams <strong>im</strong> Viertel- <strong>und</strong> Halbfinale nicht versucht, sich zu akkreditieren. Be<strong>im</strong> Vorr<strong>und</strong>enspiel<br />
gegen Polen in Dortm<strong>und</strong> ist das MT aber wie bei einigen anderen Spielen dabei (ebd.).<br />
5.2.1.1.3 Ludwigsburger Kreiszeitung<br />
Die Ludwigsburger Kreiszeitung (LKZ) aus dem Verlag Ungeheuer + Ulmer KG GmbH & Co<br />
ist eine Regionalzeitung in Baden-Württemberg mit Verbreitungsgebiet <strong>im</strong> gesamten<br />
57
Landkreis Ludwigsburg <strong>–</strong> mit Ausnahme des Stadtkreises Vaihingen. Die Auflage der Zeitung<br />
mit Verlagsort Ludwigsburg liegt bei 43.133 Exemplaren. Die LKZ erscheint täglich von<br />
Montag bis Samstag <strong>im</strong> Rheinischen Format. 93 % der Auflage wird über Abonnements verkauft.<br />
Verleger ist Gerhard Ulmer. Chefredakteurin Isabell FUNK beschreibt die LKZ als „Regionalzeitung<br />
mit besonders <strong>stark</strong>er lokaler Ausprägung<strong>“</strong> (FUNK 2007). Die Zeitung erscheint<br />
in sechs Ausgaben, wobei der 1930 erworbene Neckar- <strong>und</strong> Enzbote ein eigenes Kopfblatt<br />
ist. Konkurrenz besteht mit folgenden Zeitungen: Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten,<br />
Bietighe<strong>im</strong>er Zeitung, Marbacher Zeitung, Kornwesthe<strong>im</strong>er Zeitung. An den Rändern des<br />
Verbreitungsgebiets besteht Wettbewerb mit der Vaihinger Kreiszeitung, der Leonberger<br />
Kreiszeitung <strong>und</strong> der Heilbronner St<strong>im</strong>me (ebd.; IVW 2006, 88; LKZ 2007)<br />
Die erste Ausgabe wird 1818 als Ludwigsburger Wochenblatt herausgegeben. Ein Jahr später<br />
erfolgt die Umbenennung in Intelligenzblatt für den Neckarkreis <strong>und</strong> Ludwigsburger Wochenblatt.<br />
1846 erscheint das Blatt als Ludwigsburger Tagblatt, ab 1873 wird es als Ludwigsburger<br />
Zeitung gedruckt. Gründer ist Christoph Dietrich Nast, der Verlag <strong>und</strong> Druckerei<br />
1864 an Heinrich Ungeheuer <strong>und</strong> Louis Greiner verkauft. Nach Greiners Tod gründet Ungeheuer<br />
gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Moritz Ulmer das Druckerei- <strong>und</strong> Verlagshaus<br />
Ungeheuer + Ulmer, das heute noch in Familienbesitz ist. Nach der Enteignung durch die<br />
Nationalsozialisten erscheint ab 1945 in diversen Rechtskonstruktionen unregelmäßig eine<br />
Zeitung. Seit 1949 wird das Blatt mit seinem heutigen Namen gedruckt. Die LKZ hält Anteile<br />
am Staatsanzeiger Baden-Württemberg <strong>und</strong> an der Citi-Post. Komplett <strong>im</strong> Besitz von Ungeheuer<br />
+ Ulmer ist das Anzeigenblatt Ludwigsburger Wochenblatt, ein Plakatverlag, der<br />
Dienstleistungsverlag Astra <strong>und</strong> ein Telefonbuchverlag (FUNK 2007).<br />
Sportressortleiter ist Hans-Horst Bauer. In seinem Ressort arbeiten insgesamt drei Redakteure<br />
<strong>–</strong> insgesamt sind 32 Redakteure beschäftigt. Die Sportberichterstattung der LKZ legt<br />
den Schwerpunkt auf den Lokalsport. Bei überregionalen Themen stützt sie sich auf DPA<br />
(Text <strong>und</strong> Bild) sowie die Bild-Agentur Baumann. Ein gesondertes tägliches WM-Magazin<br />
war laut eigener Aussage technisch nicht umsetzbar. Redaktionsschluss während der WM ist<br />
für die letzte Ausgabe um 1.45 Uhr, für die erste Ausgabe um 22.45 Uhr. Die LKZ-<br />
Sportredaktion ist bei der WM-Vorr<strong>und</strong>e bei den Spielen in Stuttgart akkreditiert. Ressortleiter<br />
BAUER erklärt: „Eine Begleitung der deutschen Spiele durch eigene Redakteure war personell<br />
für uns gar nicht machbar. Wer <strong>im</strong> Stadion sitzt, fehlt in der Redaktion <strong>–</strong> zumal die<br />
Seitenumfänge zu WM-Seiten noch deutlich zugenommen haben.<strong>“</strong> (BAUER 2007).<br />
5.2.1.1.4 Schweriner Volkszeitung<br />
Die Schweriner Volkszeitung (SVZ) ist eine der drei größeren führenden Tageszeitungen in<br />
Mecklenburg-Vorpommern. Sie erscheint werktäglich <strong>im</strong> Rheinischen Format. Im nördlichen<br />
Brandenburg wird <strong>im</strong> Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co KG zudem der Titel Der Prignitzer<br />
verlegt. In Rostock existiert als eigenständiger Verlag die Norddeutsche Neuesten Nachrichten<br />
GmbH. Diese 100-prozentige Tochter publiziert den Titel Norddeutsche Neueste<br />
Nachrichten (NNN), der mit dem Mantel der SVZ verkauft wird. Die Gesamtauflage aller Titel<br />
beträgt 108.221 Exemplare. Chefredakteur der Zeitung mit Verlagsort Schwerin ist Thomas<br />
Schunck. Herausgeber ist der Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co. KG. Leiter des Sportressorts<br />
ist Ingo Gräber (GRÄBER 2007; IVW 2006, 121; SVZ 2007).<br />
Am 13. Juli 1945 erscheint die erste wöchentliche Ausgabe der Schweriner Volkszeitung als<br />
mecklenburgisches KPD-Organ. Die erste Ausgabe der Schweriner Volksst<strong>im</strong>me wird als<br />
SPD-Organ ab dem 7. September 1945 zwe<strong>im</strong>al wöchentlich herausgegeben. Am 10. April<br />
1946 wird die erste Ausgabe der Landeszeitung als Fusion aus Volkszeitung <strong>und</strong> Volksst<strong>im</strong>me<br />
gedruckt. Am 15. August 1952 erscheint erstmals entsprechend der neuen Bezirksstruktur<br />
die SVZ <strong>–</strong> zeitgleich mit der Rostocker Ostseezeitung <strong>und</strong> der Neubrandenburger Freien<br />
Erde. Der Untertitel „Organ der Bezirksleitung der SED<strong>“</strong> wird in den Zeitungskopf integriert.<br />
Die SVZ erreicht in den folgenden Jahren eine tägliche Auflage von r<strong>und</strong> 170.000 Exemplaren.<br />
1991 kauft der Burda-Verlag von der Treuhandanstalt neben den NNN auch die SVZ.<br />
58
Seit 2005 gehört das Blatt zur Zeitungsgruppe Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag in<br />
Flensburg. Im Schweriner Hauptverbreitungsgebiet ist die SVZ als Tageszeitung ohne Konkurrenz.<br />
Wettbewerb herrscht vor allem an den Rändern des Verbreitungsgebiets <strong>–</strong> z.B. <strong>im</strong><br />
Norden (Ostseezeitung, Rostock), <strong>im</strong> Osten (Nordkurier, Landkreis Güstrow) <strong>und</strong> <strong>im</strong> Süden<br />
(Märkische Allgemeine, Prignitz). Etwa 93 % werden <strong>im</strong> Abonnement verkauft (GRÄBER<br />
2007; IVW 2006, 121; SVZ 2007).<br />
Die SVZ ging am 5. Mai 1995 mit einem Webauftritt online <strong>und</strong> ist damit die erste deutsche<br />
Tageszeitung, die ihre gedruckten Ausgaben durch Präsenz <strong>im</strong> Internet ergänzt. Insgesamt<br />
arbeiten während der Fußball-WM etwa 70 Redakteure bei der SVZ <strong>–</strong> drei davon <strong>im</strong> Ressort<br />
Sport. 72 Redaktionsschluss während der Fußball-WM für die betreffenden Seiten ist 23.00<br />
Uhr. In der überregionalen Sportberichterstattung stützt sich die SVZ auf drei verschiedene<br />
Text- (DPA, SID, DDP) <strong>und</strong> drei verschiedene Bild-Agenturen (DPA, DDP, AFP). 73<br />
Sportchef Ingo GRÄBER gibt vor, welche Ziele die Sportberichterstattung in der SVZ verfolgt:<br />
„Wir wollen Geschichten erzählen <strong>und</strong> keine 1:0-Berichterstattung machen. Die statistische<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung muss natürlich trotzdem gewährleistet werden.<strong>“</strong> (GRÄBER 2007).<br />
Täglich werden <strong>im</strong> „WM-Magazin<strong>“</strong> Elemente wie eine „Angeberkarte<strong>“</strong> (Kasten mit Insider-<br />
Informationen über einen WM-Spieler) oder „Unterm Strich<strong>“</strong> (Fußball-Kolumne, in der sich<br />
vor allem Redakteurinnen zur WM äußern sollten) eingesetzt. „Unser Anspruch war, dass die<br />
Frauen versuchen sollten, morgens schneller am Briefkasten zu sein als die Männer. Das<br />
Magazin sollte sich durch viele Ideen <strong>und</strong> hohen Unterhaltungswert auszeichnen.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
Dazu werden täglich Gastkolumnen bekannter norddeutscher Sportler gedruckt, die „den<br />
Promi- <strong>und</strong> Expertenfaktor erhöhen sollten; also möglichst unterhaltsam sein oder vor Fachkenntnis<br />
triefen sollten <strong>–</strong> <strong>und</strong> möglichst nichts kosten sollten<strong>“</strong> (ebd.). Bei der WM sind SVZ-<br />
Sportredakteure bei keinem einzigen Spiel akkreditiert. Sportchef GRÄBER nennt bei der<br />
Begründung der Nicht-Akkreditierung, die bei der Fußball-WM für eine Zeitung in der Auflagenhöhe<br />
der SVZ eine absolute Ausnahme ist, u.a. Stichworte wie „Personalkonzepte, Finanzen,<br />
Zeit <strong>und</strong> Arbeitsbelastungen<strong>“</strong>. Er ergänzt: „Der journalistische Handlungsspielraum <strong>–</strong><br />
vor allem der Bewegungsspielraum <strong>im</strong> Stadion <strong>–</strong> ist bei solchen Partien allerdings auch sehr<br />
begrenzt.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
5.2.1.2 Akkreditierte Zeitungen<br />
Es folgen einige Informationen zu den vier Blättern, die die zweite Untersuchungsgruppe<br />
bilden <strong>und</strong> die bei beiden ausgewählten Begegnungen akkreditiert waren. Diese akkreditierten<br />
Zeitungen werden so ausgesucht, dass sie in etwa die gleichen Arbeitsbedingungen<br />
aufweisen wie die ausgewählten nicht akkreditierten Zeitungen. PE mit ähnlich hohen Auflagenzahlen<br />
oder ähnlichen Konkurrenzsituationen werden dafür ausgesucht, um aussagekräftige<br />
Vergleiche zuzulassen. Zudem wird darauf geachtet, dass für die jeweiligen Zeitungen<br />
möglichst bei beiden Spielen dieselben Redakteure akkreditiert sind, um Unterschiede in der<br />
Berichterstattung z.B. aufgr<strong>und</strong> eines unterschiedlichen Stils zu min<strong>im</strong>ieren.<br />
5.2.1.2.1 Oldenburgische Volkszeitung<br />
Die Oldenburgische Volkszeitung (OV) ist eine Tageszeitung mit Verlagsort <strong>im</strong> westniedersächsischen<br />
Vechta, die montags bis samstags <strong>im</strong> Berliner Format erscheint. Sonntags wird<br />
seit 1998 die kostenlose OV am Sonntag vertrieben. Die OV zählt mit einer Auflage von<br />
22.719 Exemplaren zu den kleinsten PE Deutschlands. Das Blatt, das 93 % der Auflage über<br />
Abonnements verkauft, ist ohne Konkurrenz <strong>im</strong> Landkreis Vechta. Für die Münsterländische<br />
72<br />
Alle Angaben bei den vorgestellten Zeitungen, wie z.B. zu Personalzahlen, beziehen sich <strong>–</strong> wenn nicht anders<br />
angegeben <strong>–</strong> auf den Zeitraum während der Fußball-WM.<br />
73<br />
Da die sich die SVZ-Redaktion während der Fußball-WM 2006 auf das Redaktionssystem „Multicom<strong>“</strong> umgestellt<br />
hat, war es schwierig, die für die Untersuchung benötigten Seiten zu erhalten (GRÄBER 2007). Letztlich<br />
gelang dies durch Mithilfe der Landesbibliothek Schwerin.<br />
59
Tageszeitung in Cloppenburg mit einer Auflage von 17.930 Exemplaren produziert die OV<br />
den Mantel. Etwa 20 Redakteure <strong>und</strong> Volontäre bilden eine Vollredaktion. Die Sportredaktion<br />
besteht aus vier Redakteuren, bei der WM unterstützt ein fünfter Redakteur aus dem Lokalteil<br />
das Sportressort. Herausgebender Verlag ist die Oldenburgische Volkszeitung Druckerei<br />
<strong>und</strong> Verlag KG mit Geschäftsführer <strong>und</strong> Verlagsleiter Jörg Peter Knochen. Chefredakteur ist<br />
Uwe Haring, das Sportressort leitet Franz-Josef Schlömer (IVW 2006, 131; OV 2007;<br />
SCHLÖMER 2007).<br />
Die OV bezeichnet sich <strong>im</strong> Titelkopf selbst als „christliche Tageszeitung<strong>“</strong>. Sie gilt als konservative<br />
St<strong>im</strong>me in einer katholischen Enklave <strong>im</strong> nordwestlichen Deutschland. Die kleine regionale<br />
Tageszeitung sieht sich in der Tradition des Wochenblatts namens Sonntags-Blatt, das<br />
am 5. April 1834 erstmals in Vechta erscheint. Nach der Vereinigung mit einem katholischen<br />
Wochenblatt ist die Druckschrift aus dem von Carl Hermann Fauvel gegründeten Verlag auf<br />
kirchlich-katholischem Kurs. Die zunächst als Neue Zeitung erscheinende Zeitung nennt <strong>im</strong><br />
Untertitel das Zielpublikum: „Für den katholischen Teil Oldenburgs<strong>“</strong>. 1882 wird ein neuer<br />
Name eingeführt <strong>–</strong> Vechtaer Zeitung. In der neu gegründeten Vechtaer Druckerei <strong>und</strong> Verlag<br />
GmbH erscheint ab dem 1. Januar 1895 erstmals die Oldenburgische Volkszeitung, die vor<br />
allem die Interessen der katholischen Zentrumspartei vertreten soll. 1896 erwirbt der neue<br />
Vechtaer Verlag den Fauvel-Verlag mit den Rechten an der marktbeherrschenden Vechtaer<br />
Zeitung. Die OV erreicht nach dem Zusammenschluss mit dem früheren Konkurrenten eine<br />
Auflagenhöhe von 3.000 Exemplaren (OV 2007)<br />
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten muss Chefredakteur Vikar Franz Morthorst<br />
aufhören <strong>–</strong> Geistliche dürfen nach einem neuen Gesetz nicht mehr als Tageszeitungsredakteure<br />
arbeiten. Die Zentrumspartei wird aufgelöst. Die OV formuliert ein verändertes Zielpublikum:<br />
„das ganze katholische Volk der münsterländischen He<strong>im</strong>at<strong>“</strong>. 1935 müssen alle kirchlichen<br />
Anteilseigner aus der Verlag GmbH ausscheiden. Die OV erscheint ab 1936 <strong>im</strong> NS-<br />
Gau-Verlag weiter <strong>und</strong> wird später amtliches NSDAP-Verkündigungsorgan. Am 9. April 1945<br />
erscheint die OV vorerst zum letzten Mal. Erst nach Aufhebung des Lizenzzwangs wird die<br />
OV am 16. Oktober 1949 wieder gedruckt. 1972 wird ein neues Druckhaus gebaut. Der Verlag<br />
wird Gesellschafter der Deutschen Presseagentur GmbH. 1997 ist die OV erstmals <strong>im</strong><br />
Internet präsent (ebd.).<br />
Die Sportredaktion erhält für ihre lokale Berichterstattung zur Fußball-WM 2006 den Veltins-<br />
Lokalsportpreis 2007 <strong>–</strong> Bereich Strategie. Bei allen deutschen WM-Partien ist OV-Sportchef<br />
Schlömer für die Tribüne akkreditiert. Be<strong>im</strong> Finale sind zwei OV-Sportredakteure <strong>im</strong> Stadion:<br />
Andreas Hausfeld, der zudem einige weitere Spiele <strong>und</strong> das zweite Halbfinale besucht, <strong>und</strong><br />
Franz-Josef Schlömer. Jeweils einer der beiden akkreditierten Redakteure hat Dienst in der<br />
Vechtaer Redaktion. Redaktionsschluss ist bei der OV generell um 22.00 Uhr. Während der<br />
WM wird er auf 23.00 Uhr verlängert <strong>–</strong> mit der Option ein mögliches Elfmeterschießen mitnehmen<br />
zu können. Ihre überregionale Sportberichterstattung stützt die OV auf DPA (Text,<br />
Bild), SID (Text) <strong>und</strong> DDP (Bild).<br />
„Der He<strong>im</strong>atsport genießt bei uns oberste Priorität. Dies lässt sich aus dem Verhältnis von<br />
etwa 3:1 <strong>im</strong> Vergleich zum überregionalen Sport ablesen.<strong>“</strong> (SCHLÖMER 2007). Täglich<br />
druckt die OV die Glosse „Linksaußen<strong>“</strong>. Regelmäßig kommentieren Redakteure den überregionalen<br />
Sport <strong>–</strong> etwa jeden Montag den aktuellen B<strong>und</strong>esliga-Spieltag. „Da wir mit Vorschauen,<br />
Berichten, Analysen, Storys <strong>und</strong> Statistiken der großen Printmedien ohnehin nicht<br />
mithalten können, haben wir uns auf ein eigenes WM-Profil gestützt <strong>–</strong> geprägt durch unsere<br />
Gesichter, Meinungen <strong>und</strong> Erlebnisse sowie durch lokale Ereignisse.<strong>“</strong> (ebd.). Die ersten beiden<br />
WM-Seiten sind reserviert für eigene Kommentare <strong>und</strong> tägliche Kolumnen der akkreditierten<br />
(„On Tour<strong>“</strong>) sowie der dahe<strong>im</strong> gebliebenen Redakteure („Stubenhocker<strong>“</strong>). Dazu erscheint<br />
mehrmals wöchentlich die Gastkolumne des Vechtaer Ex-B<strong>und</strong>esliga-Profis Ansgar<br />
Brinkmann („Der weiße Brasilianer<strong>“</strong>). WM-Seite Nummer drei bietet bunte Boulevardthemen<br />
mit einer eigenen Kolumne („Abseits<strong>“</strong>). Die vierte WM-Seite ist für lokale Themen vorbehalten.<br />
Dort werden u.a. Bilder eines Malwettbewerbs („WM-Kunterbunt<strong>“</strong>) <strong>und</strong> Kurzkommentare<br />
60
von jungen Fußballern („DFB-Talente<strong>“</strong>) gedruckt. Während der WM macht die OV nicht mit<br />
dem Lokalsport auf, sondern stellt die WM-Seiten an den Anfang des Sportbuches<br />
(SCHLÖMER 2007).<br />
5.2.1.2.2 Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung<br />
Die Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung (PZ) ist die marktführende Tageszeitung in der Stadt Pforzhe<strong>im</strong> <strong>im</strong><br />
westlichen Baden-Württemberg am Nordrand des Schwarzwalds. Das Verbreitungsgebiet<br />
der unabhängigen PZ, die zu keiner Zeitungsgruppe gehört, erstreckt sich auf den Enzkreis<br />
<strong>und</strong> einige angrenzende Gemeinden <strong>–</strong> vor allem <strong>im</strong> Landkreis Calw. Verleger der PZ ist Albert<br />
Esslinger-Kiefer, Sohn von Rosa <strong>und</strong> Jakob Esslinger, die die Zeitung am 1. Oktober<br />
1948 gründen.<br />
Das Blatt <strong>im</strong> Rheinischen Format, das früher als Pforzhe<strong>im</strong>er R<strong>und</strong>schau verlegt wird, erscheint<br />
werktäglich <strong>im</strong> Verlag J. Esslinger GmbH & Co KG in Pforzhe<strong>im</strong> in einer Auflage von<br />
41.428 verkauften Exemplaren in drei verschiedenen Ausgaben: Pforzhe<strong>im</strong>, Mühlacker,<br />
Nordschwarzwald. 91 % der Auflage werden über Abonnements verkauft. Chefredakteur ist<br />
Jürgen Metkemeyer, das Sportressort leitet Udo Koller. 35 Redakteure sind bei der PZ beschäftigt;<br />
davon arbeiten drei in der Sportredaktion. Die Zeitung wird in einer eigenen Druckerei<br />
produziert, die sich <strong>im</strong> ehemaligen Hauptpostgebäude befindet. Hervorzuheben ist,<br />
dass sich die PZ in einigen Gebieten in Konkurrenzsituation zu anderen Blättern befindet <strong>–</strong><br />
so z.B. zu Lokalausgaben der Badischen Neuesten Nachrichten, der Stuttgarter Zeitung <strong>und</strong><br />
der Stuttgarter Nachrichten. So erscheint in Pforzhe<strong>im</strong> der Pforzhe<strong>im</strong>er Kurier, eine Regionalausgabe<br />
der Badischen Neuesten Nachrichten. Konkurrent <strong>im</strong> Verbreitungsgebiet der PZ<br />
sind zudem der Schwarzwälder Bote <strong>und</strong> die Vaihinger Zeitung (IVW 2006, 110; PZ 2006).<br />
Die PZ hält Anteile an den Blättern PZ-Extra, Esslinger-Woche <strong>und</strong> Fielder Woche.<br />
Die PZ ist laut Sportchef Udo Koller eine „typische Lokalzeitung<strong>“</strong>. Nach der Überarbeitung<br />
des Layouts setzt das Blatt vor allem auf einen „bunten Auftritt mit besonderen Bildformaten<strong>“</strong><br />
(KOLLER 2007). In der überregionalen Sportberichterstattung stützt sich die PZ auf zwei<br />
verschiedene Agenturen (DPA, GES). Darauf, ein tägliches extra WM-Magazin zu produzieren,<br />
verzichtete die PZ, weil es „drucktechnisch zu viel Aufwand<strong>“</strong> gewesen wäre (ebd.). Die<br />
PZ setzt in ihrer allgemeinen Sportberichterstattung viel auf den Lokalsport <strong>und</strong> legt besonderes<br />
Augenmerk auf den Karlsruher SC <strong>und</strong> den VfB Stuttgart als benachbarte Fußball-<br />
B<strong>und</strong>esliga-Vereine.<br />
Zur Zielsetzung während der WM gibt Koller kurz an: „Alles um die deutschen Spiele.<strong>“</strong> (ebd.).<br />
Bei allen deutschen WM-Partien war PZ-Sportchef Koller für die Tribüne akkreditiert. Be<strong>im</strong><br />
Spiel um Platz drei war zudem Kollege Martin Mildenberger mit dabei. Die PZ gehört zu einem<br />
Kreis von 14 Zeitungen, die in einer Kooperation zusammenarbeiten <strong>und</strong> dabei z.B.<br />
eigene Texte den kooperierenden Blättern zur Verfügung stellen. 74 Ziel ist es, eine größere<br />
Textauswahl zu bekommen <strong>und</strong> sich vom üblichen Agentur-Material abzusetzen. „Außerdem<br />
bekommt man als Zusammenschluss, der eine Gesamtauflage von mehr als 1,5 Millionen<br />
Leser erreicht, andere Interview-Partner oder wird vom DFB auch mal zum kleinen Interview-<br />
Zirkel mit B<strong>und</strong>estrainer <strong>und</strong> Team-Manager usw. eingeladen.<strong>“</strong> (ebd.). Die Kooperation lief<br />
vor allem während der Fußball-WM, funktioniert zu besonderen Themen (Doping-Serie, Saisonstarts<br />
usw.) aber weiter. Redaktionsschluss während der WM 2006 war laut Koller „nach<br />
Bedarf<strong>“</strong>, d.h., dass über ein Spiel mit Verlängerung <strong>und</strong> Elfmeterschießen aktuell in der<br />
nächsten Ausgabe berichtet werden konnte. Regulärer Redaktionsschluss ist um 23.00 Uhr.<br />
74<br />
Zu dieser Kooperation 14 verschiedener Zeitungen gehören: Darmstädter Echo, Donaukurier (Ingolstadt), Eßlinger<br />
Zeitung, General-Anzeiger (Bonn), Heilbronner St<strong>im</strong>me, Kieler Nachrichten, Main-Post (Würzburg), Neue<br />
Osnabrücker Zeitung, Neue Westfälische (Bielefeld), Nordsee-Zeitung (Bremerhaven)/Stader Tageblatt, Pforzhe<strong>im</strong>er<br />
Zeitung, Reutlinger General-Anzeiger, Westfälische Nachrichten (Münster), Wetzlarer Neue Zeitung. Inzwischen<br />
ist der General-Anzeiger aus Bonn ausgeschieden. Neu dabei ist dafür die Westdeutsche Zeitung<br />
(Düsseldorf) (KOLLER 2007; PAESLER 2007).<br />
61
Während der WM erscheinen <strong>im</strong> Wechsel Kolumnen von Ulrich Kaiser, Manuel Andrack <strong>und</strong><br />
Reiner Calm<strong>und</strong>.<br />
5.2.1.2.3 Eßlinger Zeitung<br />
Die Eßlinger Zeitung (EZ) ist eine regionale Tageszeitung, die seit dem 1. Mai 1868 werktäglich<br />
in der Umgebung der baden-württembergischen Stadt Esslingen am Neckar erscheint.<br />
Die erste Ausgabe wird am 25. April 1868 gedruckt. Die EZ, die <strong>im</strong> Rheinischen Format produziert<br />
wird <strong>und</strong> 96 % der Auflage über Abonnements verkauft, kommt zusammen mit den<br />
Unterausgaben Cannstatter Zeitung <strong>und</strong> Untertürkhe<strong>im</strong>er Zeitung auf eine Auflage von<br />
42.986 Exemplaren. Sie gehört zum Verlagshaus Bechtle in Esslingen. Verleger sind Dr.<br />
Christine Bechtle-Kobarg <strong>und</strong> Otto-Wolfgang Bechtle. Chefredakteur ist Dr. Markus Bleistein.<br />
Das Sportressort leitet Hannes Kern. Konkurrenten der EZ sind vor allem die Stuttgarter Zeitung,<br />
die auch in Esslingen vertrieben wird, <strong>und</strong> die Stuttgarter Nachrichten. Zudem steht das<br />
Blatt <strong>im</strong> Wettbewerb mit der Nürtinger Zeitung <strong>und</strong> dem Teckboten in Kirchhe<strong>im</strong>, die den<br />
Mantel von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Südwestpresse in Ulm beziehen (EZ 2007;<br />
IVW 2006, 50; PAESLER 2007).<br />
Einige Monate nach dem Erscheinen der ersten EZ-Probennummer <strong>im</strong> April 1868 ist Otto<br />
Bechtle der Alleineigentümer. 1933 muss sein Sohn Richard Bechtle die Mehrheit der Verlagsrechte<br />
an die NS-Presse abgeben <strong>–</strong> ohne jegliche Entschädigung. Bechtle wird mit Berufsverbot<br />
belegt <strong>und</strong> aus der Leitung von Verlag <strong>und</strong> Redaktion ausgeschlossen. Nachdem<br />
ab dem 1. Februar 1949 mit Lizenz der US-Besatzungsmacht eine Zeitung für Esslingen mit<br />
dem Titel Neckarpost erscheint, wird das Blatt ab Juli 1949 wieder unter dem früheren Namen<br />
gedruckt. 1995 übern<strong>im</strong>mt die Familie Otto Wolfgang Bechtle die Mehrheit am Unternehmen.<br />
Weitere Gesellschafter sind die Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft Eberle<br />
GmbH & Co sowie A. Gottliebs <strong>und</strong> F. Osswalds Buchdruckereien GmbH & Co. Neben der<br />
EZ gibt Bechtle die Anzeigenblätter Esslinger Echo, Filder Echo <strong>und</strong> Neckar Echo heraus.<br />
Einmal wöchentlich erscheint ein kostenloses Informations- <strong>und</strong> Anzeigenblatt, einmal monatlich<br />
wird ein Veranstaltungsmagazin produziert. Zudem druckt der Verlag seit 1963 auch<br />
die Bild-Zeitung für das regionale Umfeld (ebd.; SCHUMACHER 2007).<br />
Der Sportteil der EZ ist unterteilt in überregionalen Sport <strong>und</strong> Lokalsport <strong>–</strong> personell aufgeteilt<br />
ist aber lediglich die Berichterstattung über den VfB Stuttgart (drei Kollegen) <strong>und</strong> die<br />
Stuttgarter Kickers (eine Kollegin). Die EZ beschäftigt fünf Sportredakteure <strong>und</strong> insgesamt<br />
etwa 50 Redakteure. Bei allen deutschen WM-Partien ist Michael Thiem für die EZ akkreditiert.<br />
Bei zwei weiteren Spielen <strong>–</strong> <strong>im</strong> Halbfinale <strong>und</strong> <strong>im</strong> Spiel um Platz drei <strong>–</strong> ist zudem noch<br />
mit Carlos Ubina bzw. Sigor Paesler jeweils ein weiterer Kollege mit dabei. EZ-Redakteur<br />
Ubina, der bei einigen anderen Spielen anwesend ist, beobachtet außerdem das Finale in<br />
Berlin. Paesler ist bei allen Spielen in Stuttgart akkreditiert. Redaktionsschluss während der<br />
WM ist frühestens „nach Beendigung des 21-Uhr-Spiels<strong>“</strong> (PAESLER 2007). Die Sportredaktion<br />
benutzt als abonnierte Agentur lediglich DPA (Bild <strong>und</strong> Text). Zudem besteht eine Kooperation<br />
mit 13 weiteren Zeitungen, bei der untereinander Texte von (akkreditierten) Redakteuren<br />
ausgetauscht werden. 75 Ziel der EZ-Sportberichterstattung ist es, „eine Mischung aus<br />
Lokal- <strong>und</strong> überregionalem Sport zu finden, möglichst oft weg von der 1:0-Berichterstattung<br />
zu kommen<strong>“</strong> <strong>und</strong> was die Begleitung der WM betrifft, sollen vor allem die drei EZ-WM-<br />
Reporter „mehr Geschichten als lange Spielberichte<strong>“</strong> liefern (ebd.). Täglich bzw. möglichst<br />
täglich erscheinen die Kolumnen „In-Thiem<strong>“</strong> von Michael Thiem <strong>und</strong> „Auszeit<strong>“</strong> von der gesamten<br />
Redaktion (ebd.).<br />
5.2.1.2.4 Lausitzer R<strong>und</strong>schau<br />
Die Lausitzer R<strong>und</strong>schau (LR) ist eine regionale Tageszeitung, die hauptsächlich in Brandenburg<br />
<strong>und</strong> Sachsen vertrieben wird <strong>und</strong> werktäglich erscheint. Die LR wird am 20. Mai<br />
75 Vgl. dazu den Abschnitt zur Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung, die ebenfalls Mitglied dieser Kooperation ist.<br />
62
1946 in Bautzen gegründet <strong>und</strong> zieht 1952 nach Cottbus. Herausgeber ist die Lausitzer<br />
R<strong>und</strong>schau Medienverlag GmbH <strong>–</strong> seit 1990 eine 100-prozentige Tochter der Saarbrücker<br />
Zeitung Verlag <strong>und</strong> Druckerei GmbH, die wiederum zur Holzbrinck-Tageszeitungsgruppe<br />
gehört. Die LR ist in der DDR Organ der SED für die Lausitz, später Organ der SED-<br />
Bezirksleitung <strong>im</strong> Braunkohlebezirk Cottbus (JUSCHUS 2007; LR 2007).<br />
Chefredakteur ist derzeit Dieter Schulz. Die LR erscheint <strong>im</strong> Rheinischen Format mit einer<br />
Auflage von 108.780 Exemplaren <strong>–</strong> aufgeteilt in 13 Lokalausgaben in Brandenburg <strong>und</strong><br />
Sachsen: Cottbus, Finsterwalde, Calau/Lübbenau, Forst, Guben, Herzberg, Lübben, Spremberg,<br />
Bad Liebenwerda/Elsterwerda, Hoyerswerda, Luckau/Dahme, Senftenberg/Lauchhammer,<br />
Weißwasser/Niesky. Über Zeitungsabonnements werden 94 % der Auflage verkauft.<br />
Konkurrenz besteht in Sachsen bei den Lokalausgaben Hoyerswerda <strong>und</strong> Weißwasser mit<br />
der Sächsischen Zeitung; <strong>im</strong> Sport gibt es zudem eine Konkurrenz mit der Bild-Zeitung <strong>–</strong><br />
besonders bei der Berichterstattung über den Fußball-B<strong>und</strong>esligisten Energie Cottbus. Der<br />
LR-Verlag gibt zudem noch 20cent als junge Tageszeitung sowie die LR-Woche als Gratiswochenzeitung<br />
heraus. Neben der LR <strong>und</strong> den beiden weiteren Zeitungen setzt der Verlag<br />
noch auf Druckerei, Anzeigen- <strong>und</strong> PR-Service, Post- <strong>und</strong> Zustelldienste sowie auf Online-<br />
Angebote <strong>und</strong> Callcenter (IVW 2006, 36; JUSCHUS 2007; LR 2007).<br />
Insgesamt arbeiten 78 Redakteure bei der LR. Im Sport sind zwei Redakteure <strong>und</strong> eine Pauschalistin<br />
beschäftigt. Während der Fußball-WM 2006 erhöht sich die Zahl auf sechs Redakteure.<br />
Thomas Juschus <strong>und</strong> T<strong>im</strong> Albert sind Leiter des Ressorts Aktuelles, zu dem das ehemalige<br />
Sportressort gehört. Redaktionsschluss ist 23.10 Uhr. Abonnierte Agenturen für Texte<br />
<strong>und</strong> Bilder sind DPA, DDP <strong>und</strong> AFP. Zusätzlich werden Texte des Berliner Medienservice<br />
(BMS) bezogen. Die LR setzt auf regionale Kompetenz <strong>und</strong> legt ihren Berichterstattungsschwerpunkt<br />
u.a. auf Fußball-B<strong>und</strong>esligist Energie Cottbus, Handball-Zweitligist LHC Cottbus,<br />
Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse <strong>und</strong> den deutschen Mannschaftsturnmeister SC<br />
Cottbus. Im besonderen Fokus stehen ferner der Radsport (Klöden, Worrack), die DTM auf<br />
dem Lausitzring, Boxen (2. B<strong>und</strong>esliga) <strong>und</strong> weitere Olympiakandidaten. „Wir wollen uns<br />
damit von den B<strong>und</strong>esliga-, Formel-1- <strong>und</strong> Boxübertragungen <strong>im</strong> TV abheben.<strong>“</strong> (JUSCHUS<br />
2007).<br />
LR-Sportredakteur Frank Noack ist bei den WM-Spielen der DFB-Auswahl gegen Costa Rica,<br />
Polen, Ecuador, Schweden <strong>und</strong> Italien <strong>im</strong> Stadion. Sein Kollege Thomas Juschus begleitet<br />
ihn bei der deutschen Halbfinal-Partie <strong>und</strong> beobachtet live das Viertelfinale gegen Argentinien.<br />
Beide sind zudem be<strong>im</strong> Finale zugegen. Was Begegnungen mit Beteiligung der deutschen<br />
Mannschaft betrifft, ist lediglich be<strong>im</strong> Spiel um Platz drei niemand von der LR anwesend.<br />
Bei der WM-Berichterstattung setzt die LR auf Aktualität: von Abendspielen wird berichtet,<br />
indem die normale Andruckzeit um 21.15 ausgesetzt wird. Zudem konzentriert sich<br />
die Redaktion darauf, die WM auch „in die Region zu holen<strong>“</strong> (ebd.). So schrieb Juschus be<strong>im</strong><br />
Besuch von Spielen in Leipzig <strong>und</strong> Berlin über Stadionbesuche von Vereinen aus der Lausitz<br />
<strong>und</strong> über Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten, die aus der Region stammen. Während der<br />
WM erhöht die LR ihre überregionale Sportberichterstattung von zwei auf sechs Seiten<br />
(ebd.).<br />
5.3 Die inhaltsanalytische Methode<br />
Bei einem Vergleich der Hypothesen mit der Darstellung der Ergebnisse aus bisherigen Forschungen<br />
fällt auf, dass zu einigen Kritikpunkten keine Hypothesen formuliert worden sind.<br />
Das resultiert daraus, dass einige Hypothesen sich nicht mit dem Instrument der Inhaltsanalyse<br />
überprüfen lassen. Inhaltsanalytisch lässt sich in der vorliegenden Untersuchung nicht<br />
ermitteln, ob ein Journalist früher Leistungssportler war oder Mitglied eines Sportvereins ist.<br />
Kontakte <strong>und</strong> Beziehungen zwischen Sportlern <strong>und</strong> Journalisten sowie affektive Verb<strong>und</strong>en-<br />
63
heit können auf der Basis inhaltsanalytisch untersuchter Texte nicht erforscht werden. 76 Die<br />
meisten Kritikpunkte aus den Forschungsergebnissen bezüglich mangelnder kritischer <strong>Distanz</strong><br />
lassen sich in die oben formulierten Hypothesen überführen, die inhaltsanalytisch überprüft<br />
werden können. Es wird angestrebt, einen best<strong>im</strong>mten Aspekt der Berichterstattung zu<br />
beschreiben <strong>und</strong> darüber hinausgehend Schlussfolgerungen hinsichtlich der Journalisten als<br />
Urheber der Texte anzustellen (vgl. RÖSSLER 2005, 24). Deshalb wird entschieden, als geeignetes<br />
Untersuchungsinstrument die Inhaltsanalyse zu wählen.<br />
Das zentrale Element der Forschungsfrage der vorliegenden Diplomarbeit ist die Sportberichterstattung<br />
in regionalen Tageszeitungen <strong>und</strong> die Beschreibung ihrer Elemente <strong>und</strong> Charakteristik<br />
in Bezug auf den Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong>. Es geht um die Analyse<br />
von Zeitungstexten mit Fokus auf Fragestellungen, die Aussagen zur Kritik der mangelnden<br />
kritischen, distanzierten Berichterstattung treffen können. Die Inhaltsanalyse wird als<br />
„eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung<br />
inhaltlicher <strong>und</strong> formaler Merkmale von Mitteilungen<strong>“</strong> definiert (FRÜH 2007, 27). Sie ist<br />
die geeignete empirische Methode für die geplante Untersuchung, weil sie u.a. ermöglicht,<br />
mit Hilfe einer kategoriengesteuerten Reduktion von Komplexität „größere strukturelle Zusammenhänge<br />
[zu] erkennen <strong>und</strong> [...] Vergleiche auf eine systematische Gr<strong>und</strong>lage<strong>“</strong> zu stellen<br />
(ebd., 42).<br />
STRAUSS fordert dazu auf, bei Untersuchungen zur Motivation von Zuschauern, Sportereignisse<br />
zu besuchen, weniger auf Fragebögen <strong>und</strong> Selbstauskünfte zu setzen, weil „mit den<br />
<strong>im</strong>mer gleichen Fragebögen nach Dingen [gefragt wird], die sie nicht beantworten können<strong>“</strong><br />
(STRAUSS 2002, 167f.). Die gleiche Schlussfolgerung kann in Bezug auf den Vorwurf der<br />
mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> bei Sportjournalisten gezogen werden. Es ist anzunehmen,<br />
dass Journalisten bei Befragungen zur <strong>Distanz</strong> keine völlig zutreffende Einschätzung zum<br />
Verhältnis zu ihrem Berichterstattungsgegenstand angeben können <strong>und</strong> gemäß einer „Looking-good<strong>“</strong>-Tendenz<br />
nicht wollen (vgl. KÜBERT 1994, 94). Gerade bei Untersuchungen zu<br />
Konflikten spielt das Phänomen der „Sozialen Erwünschtheit<strong>“</strong> eine große Rolle (vgl. KAUER<br />
1998, 60). Würden Sportjournalisten in Befragungen eine mangelnde kritische <strong>Distanz</strong> erkennen<br />
lassen, würden sie damit „ihre wohl gehütete Unabhängigkeit aufgeben<strong>“</strong> (ELLERT<br />
2006, 291). Bei einer Befragung würde sich das Problem ergeben, zwischen Wunsch <strong>und</strong><br />
Wirklichkeit zu unterscheiden. Deshalb ist die Methode der Inhaltsanalyse am besten geeignet,<br />
die Forschungsfrage zu untersuchen.<br />
Die Aussagekraft der vorliegenden Inhaltsanalyse ist begrenzt, insofern dass das Niveau<br />
eines Textes mit ihr nicht angemessen abgebildet werden kann. Es können nur Indizien untersucht<br />
werden, die auf kritische <strong>Distanz</strong> schließen lassen. Wie verständlich, wie stilistisch<br />
ausgereift <strong>und</strong> originell ein identifizierter Beitrag ist, kann mit den erfassten Variablen nicht<br />
ausgedrückt werden, sondern nur, ob es sich z.B. um einen meinungsbetonten Text ohne<br />
Quellengebrauch handelt.<br />
WEISCHENBERG weist darauf hin, dass Gr<strong>und</strong>haltungen von Journalisten nicht allein mit<br />
Inhaltsanalysen heraus interpretiert werden können (vgl. WEISCHENBERG 1976, 247).<br />
Dennoch kann eine Inhaltsanalyse relevante Ergebnisse liefern, da die <strong>Distanz</strong> zwischen<br />
Journalisten <strong>und</strong> ihrem Berichterstattungsgegenstand durch die Inhalte der journalistischen<br />
Beiträge zum Ausdruck gebracht wird (vgl. LUDWIG 1987, 310). Zumal es schwierig zu entscheiden<br />
ist, ob nicht ein möglicherweise vorhandenes <strong>Distanz</strong>problem in den journalistischen<br />
Beiträgen für die Berichterstattung <strong>und</strong> damit für die Rezipienten negativere Auswirkungen<br />
hat als ein fehlender Abstand zum Sujet in den Köpfen der Journalisten. Zudem gilt:<br />
„[J]ede Analyse formulierter Kommunikatorabsichten [setzt] zunächst die Beschreibung dessen<br />
voraus, was als Ursache aller Ergebnisse dieser Kommunikationsabsichten vorliegt.<strong>“</strong><br />
76<br />
Dagegen könnte inhaltsanalytisch überprüft werden, ob <strong>und</strong> wie oft Botschaften aus Fifa-Pressemitteilungen<br />
übernommen werden <strong>und</strong> ob diese PR-Übernahme kenntlich gemacht wird. Diese Fragestellungen wurden jedoch<br />
ausgeklammert, weil der zusätzliche Aufwand dafür den Rahmen dieser Diplomarbeit übersteigen würde.<br />
64
(FRÜH 2007, 49). Generell ist anzumerken: Vor allem die Methode der Beobachtung <strong>–</strong> möglicherweise<br />
ergänzt mit der Methode der Befragung <strong>–</strong> würde sinnvolle ergänzende empirische<br />
Ergebnisse zu der vorliegenden inhaltsanalytischen Untersuchung liefern, was zu einem<br />
stringenten Beweischarakter der Inferenzschlüsse auf die Kommunikatoren führen würde<br />
(ebd., 44f.).<br />
FRÜH weist darauf hin, dass die Inhaltsanalyse „häufig mit dem Ziel einer darauf gestützten<br />
interpretativen Inferenz<strong>“</strong> verb<strong>und</strong>en ist (ebd., 27). Klaus MERTEN definiert die Inhaltsanalyse<br />
als „eine Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten<br />
Textes auf Merkmale eines nichtmanifesten Kontextes geschlossen wird<strong>“</strong> (MERTEN<br />
1995, 16). Die Ergebnisse einer Inhaltsanalyse lassen eine Abstraktion auf die Bedeutung<br />
der Kommunikationsinhalte, auf kausale Zusammenhänge zwischen Text <strong>und</strong> Kontext zu,<br />
was das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist. Neben der Beschreibung der Sportberichterstattung<br />
in Bezug auf kritische <strong>Distanz</strong> sind weitergehende Inferenzschlüsse auf den<br />
Kommunikator angestrebt. Diesem kann „in seinen Handlungen [...] eine gewisse Absicht<br />
unterstellt werden. Umgekehrt erscheint es dann nur legit<strong>im</strong>, das Ergebnis seiner Handlung <strong>–</strong><br />
die Medieninhalte <strong>–</strong> als Hinweise auf seine Kommunikationsabsichten zu interpretieren.<strong>“</strong><br />
(RÖSSLER 2005, 29).<br />
Die vorliegende Inhaltsanalyse soll nach FRÜH neben einem „formal-deskriptiven<strong>“</strong> einen<br />
„diagnostischen Ansatz<strong>“</strong> besitzen, der z.B. die Frage beantwortet, welche Eigenschaften der<br />
Autor bezüglich der Forschungsfrage besitzt (FRÜH 2007, 44). Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass „die Aussagekraft solcher inhaltsanalytisch f<strong>und</strong>ierter Inferenzen [...] begrenzt<strong>“</strong> ist, u.a.<br />
weil die Ableitung nicht zwangsläufig zwingend erfolgen kann <strong>und</strong> eine Vielzahl von Einflüssen<br />
inhaltsanalytisch unberücksichtigt bleibt (ebd.). Nochmals sei in diesem Zusammenhang<br />
auf die Notwendigkeit ergänzender Datenerhebungsmethoden hingewiesen. Dennoch sind<br />
relativ gut begründete <strong>und</strong> plausible Inferenzschlüsse <strong>und</strong> Interpretationen auf den Kommunikator<br />
möglich <strong>–</strong> allerdings ohne zwingende Beweiskraft (ebd., 41ff.; RÖSSLER 2005, 28ff.).<br />
Zudem ist die Wahl der Methode dadurch zu begründen, dass die Inhaltsanalyse in diesem<br />
Fall die einzig anwendbare Methode zur wissenschaftlichen Bearbeitung ist <strong>–</strong> aufgr<strong>und</strong> der<br />
Tatsache, dass es sich bei der Fußball-WM 2006 um ein zurückliegendes Ereignis handelt<br />
<strong>und</strong> die damalige Berichterstattungssituation mit der Methode der Beobachtung nicht mehr<br />
analysierbar ist (vgl. FRÜH 2007, 41).<br />
Vorteile der Inhaltsanalyse gegenüber anderen empirischen Methoden sind bei der geplanten<br />
Untersuchung die Tatsachen, dass Texte, die zur Fußball-WM verfasst worden sind,<br />
problemlos bearbeitet werden können <strong>und</strong> dass Aussagen über berichterstattende Kommunikatoren<br />
getroffen werden können, ohne den Untersuchungsgegenstand oder befragte Personen<br />
durch die Erhebung zu verändern oder zu beeinflussen. Die Inhaltsanalyse wird deshalb<br />
als „nicht-reaktives Verfahren<strong>“</strong> bezeichnet (BROSIUS/KOSCHEL 2001, 175; vgl. FRÜH<br />
2007, 42).<br />
5.4 Reliabilitätstest<br />
Nach der langwierigen <strong>und</strong> mühseligen Definitionsarbeit an Begriffen, Einheiten, Kategorien,<br />
Ausprägungen, Aufgreifkriterien <strong>und</strong> Anweisungen 77 folgte die Trainingsphase mit dem fertig<br />
gestellten Instrument. Während dieser Phase wurden Codieranweisungen <strong>und</strong> Kategoriendefinitionen<br />
teilweise <strong>stark</strong> ergänzt, modifiziert <strong>und</strong> präzisiert. Die Anweisungen zur Variablen<br />
Anzahl Spitznamen mussten z.B. für den Autor unerwartet um Regeln ergänzt werden, um<br />
Spitznamen von verschiedenen Codierern übereinst<strong>im</strong>mend identifizieren zu können <strong>und</strong><br />
eine willkürliche Zuordnung bei dieser Kategorie zu verhindern. Bei der Variablen Valenz des<br />
Geschehens stellten sich die bisherigen Ausprägungen als nicht eindeutig trennscharf dar.<br />
An dieser Stelle <strong>und</strong> bei weiteren Kategorien wurden neue Ausprägungen <strong>und</strong> Definitionen<br />
formuliert. Das gesamte Instrument wurde nach dem ersten Praxistest korrigiert <strong>und</strong> präzi-<br />
77 Vgl. die ausführliche Dokumentation <strong>im</strong> Codebuch, das <strong>im</strong> Anhang der Arbeit zu finden ist.<br />
65
siert, um zu gewährleisten, dass verschiedene Codierer das Codebuch auf dieselbe Art <strong>und</strong><br />
Weise anwenden <strong>und</strong> bei identischem Material zu (nahezu) demselben Ergebnis kommen.<br />
Nur dann kann der Anspruch auf Intersubjektivität der Ergebnisse erhoben werden (RÖSS-<br />
LER 2005, 166).<br />
Um in der vorliegenden Studie annähernd sicher zu stellen, dass bei einer Wiederholung<br />
unter gleichen Voraussetzungen mit demselben Material von unterschiedlichen Codierern<br />
dieselben Ergebnisse produziert werden, wurden vor der Datenerhebung Tests durchgeführt,<br />
die die Verlässlichkeit des Untersuchungsinstruments prüfen sollten. Validität (Gültigkeit) <strong>und</strong><br />
Reliabilität (Zuverlässigkeit) sind die wichtigsten Gütekriterien für Inhaltsanalysen (ebd.,<br />
183). „Eine valide Inhaltsanalyse setzt ein verlässliches Messinstrument voraus. Umgekehrt<br />
aber ist die die Gültigkeit einer Untersuchung keine notwendige Vorbedingung für deren Reliabilität.<br />
Man kann mit hoher Verlässlichkeit <strong>im</strong>mer wieder denselben Unsinn messen […].<strong>“</strong><br />
(FRÜH 2007, 120). Damit wird deutlich, dass Validität der übergeordnete Begriff ist, er umfasst<br />
den gesamten Erhebungsvorgang (vgl. RÖSSLER 2005, 183).<br />
Die Reliabilität gibt Auskunft über die Güte des Instruments <strong>und</strong> über die Sorgfalt der Codierung<br />
(FRÜH 2007, 188). Die Zuverlässigkeit der Messung wird in der vorliegenden Untersuchung<br />
durch die Intercoder- <strong>und</strong> die Intracoder-Reliabilität erfasst. Wobei die Intercoder-<br />
Reliabilität bei dem vorliegenden Reliabilitätstest mit der Forscher-Codierer-Reliabilität<br />
gleichzusetzen ist, da zwischen den Codierungen des Autors der vorliegenden Arbeit <strong>und</strong><br />
den Codierungen eines weiteren Codierers verglichen wurde. Bei der Intracoder-Reliabilität<br />
werden Codierungen des Autors berücksichtigt, die in einem zeitlichen Abstand von vier Wochen<br />
entstanden sind. Aus dem Untersuchungsmaterial wurde eine Stichprobe von 30 Zeitungsartikeln<br />
sechs verschiedener Zeitungen gezogen, um zu garantieren, dass für jede Kategorie<br />
eine ausreichend große Zahl von Testcodierungen vorliegt (FRÜH 2007, 189). In diesen<br />
30 Artikeln wurden insgesamt 48 verschiedene wertende Aussagen <strong>und</strong> 47 verschiedene<br />
Attributionen identifiziert, so dass für diese beiden Analyseeinheiten genügend Fälle für<br />
den Test vorliegen <strong>und</strong> strukturelle Besonderheiten des Materials ausreichend berücksichtigt<br />
werden.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wurde als Übereinst<strong>im</strong>mung nur gewertet, wenn die jeweiligen beiden Codierer<br />
auf ihrem Codebogen denselben Code bei derselben Kategorie vermerkt haben. Eine<br />
Ausnahme von dieser Regel wurde bei Variablen Artikel-Umfang gemacht, weil bei dieser<br />
Kategorie geringfügige Abweichungen <strong>im</strong> Sinne des Forschungsziels als unbedenklich betrachtet<br />
werden können. Für diese Kategorie wird ein Toleranzintervall von 10 % definiert,<br />
was mit Blick auf die feingliedrige Erfassung des Umfangs der Artikel in Zeichen genügend<br />
begründet ist. Die Variablen Herkunft Handlungsträger 1 bis 5 (V17 bis V21) <strong>und</strong> Herkunft<br />
Quelle 1 bis 5 (V23 bis V27) wurden jeweils gemeinsam geprüft, weil der Vergleich von identischen<br />
Codepaaren unangemessen ist, da bei Mehrfachnennungen die Positionen durchaus<br />
vergleichbarer Codes sich nicht zwangsläufig entsprechen müssen (vgl. ebd., 191). Nach<br />
FRÜH wird es bei solchen Kategorien für vertretbar gehalten, „ein Verfahren zu wählen, das<br />
die Häufigkeit der vergebenen Codes zweier Codierer miteinander vergleicht […]<strong>“</strong> (ebd.,<br />
192).<br />
Im Fall der Analyseeinheiten Artikel, Wertende Aussage <strong>und</strong> Attribution muss der Codierer<br />
das zu codierende Element erst identifizieren.<br />
„[E]s erscheint verfehlt, bei einer falschen Identifikation <strong>–</strong> ein Codierer übersieht eine Analyseeinheit,<br />
ein anderer nicht <strong>–</strong> pauschal alle Kategorien als Nichtübereinst<strong>im</strong>mung in der Codierung zu werten. Es<br />
wurde ja aufgr<strong>und</strong> eines Folgefehlers bei der Identifikation gar nicht codiert, weshalb dieser Fall <strong>im</strong><br />
Gr<strong>und</strong>e nichts über die Codierrelabilität aussagt.<strong>“</strong> (RÖSSLER 2005, 189).<br />
Deshalb erfolgte nach RÖSSLER die Reliabilitätsprüfung zweistufig: zuerst wird die Identifikationsreliabilität<br />
berechnet, danach die Codierreliabilität.<br />
66
Analyseeinheiten Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Artikel 1 1<br />
Wertende Aussage .63 .69<br />
Attributionen .78 .74<br />
Gesamt .80 .81<br />
Tab. 1: Identifikationsreliabilität der Analyseeinheiten<br />
Der Identifikationskoeffizient beträgt bei der Analyseeinheit Artikel sowohl be<strong>im</strong> Forscher-<br />
Codierer-Vergleich als auch be<strong>im</strong> Intracoder-Vergleich 1. Bei der Analyseeinheit Wertende<br />
Aussage werden in derselben Reihenfolge die Koeffizienten .63 <strong>und</strong> .69 ermittelt, bei der<br />
Analyseeinheit Attribution die Koeffizienten .78 <strong>und</strong> .74. Insgesamt wird als Mittelwert die<br />
Identifikationsreliabilität mit den Koeffizienten .80 (Forscher-Codierer-Reliabilität) <strong>und</strong> .81<br />
(Intracoder-Reliabilität) ermittelt.<br />
Die jeweils erzielten Reliabilitätswerte werden aus drei Gründen separat für (fast) jede Kategorie<br />
ausgewiesen (vgl. RÖSSLER 2005, 188ff.; FRÜH 2007, 193ff.). Erstens weisen die<br />
Kategorien die oben beschriebenen unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Reliabilitätsberechnung<br />
auf. Zweitens lassen sich die Kategorien in formale <strong>und</strong> inhaltliche Variablen<br />
unterscheiden. Die Beurteilung des Reliabilitätskoeffizienten kann aber nur anhand des<br />
Schwierigkeitsgrades der jeweiligen Kategorie erfolgen. Drittens ist es entscheidend, wie<br />
viele Ausprägungen bei der jeweiligen Kategorie zur Wahl standen. Deshalb wird bei jeder<br />
Kategorie in den Abbildungen dokumentiert, auf wie viele mögliche Ausprägungen sich die<br />
Berechnung bezieht.<br />
Die Reliabilitätskoeffizienten werden nach dem Reliabilitätsmaß nach Holsti ermittelt (vgl.<br />
ebd., 190). Wie in der Literatur gefordert, ergeben sich für die formalen Kategorien der Analyseeinheit<br />
Artikel Werte nahe 1 (vgl. RÖSSLER 2005, 192). Insgesamt beträgt der Koeffizient<br />
sowohl bei der Forscher-Codierer-Reliabilität als auch bei der Intracoder-Reliabilität .98.<br />
Kategorien Analyseeinheit<br />
Artikel (formal)<br />
Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Mögliche<br />
Ausprägungen<br />
V01. Codierer 1 1 2<br />
V02. Zeitungsschicht 1 1 2<br />
V03. Zeitung 1 1 8<br />
V04. Erscheinungsdatum 1 1 6<br />
V05. Nummer 1 1 ∞<br />
V06. Platzierung 1 1 9<br />
V07. Artikel-Umfang .90 .90 ∞<br />
V08. Aufmachung .97 .97 4<br />
V09. Urheber .93 .93 7<br />
Gesamt .98 .98 <strong>–</strong><br />
Tab. 2: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Artikel (formal)<br />
Bei der Variablen Artikel-Umfang wird wie oben beschrieben ein Toleranzintervall von zehn<br />
Prozent definiert. In zwei Fällen ist bei dieser Kategorie nicht sorgfältig genug codiert worden.<br />
Die Codieranweisungen wurden präziser formuliert.<br />
Wie bei den oben diskutierten Kategorien weisen die Reliabilitätskoeffizienten für die inhaltlichen<br />
Kategorien der Analyseeinheit Artikel zufriedenstellende Ergebnisse auf. Insgesamt<br />
ergeben sich für die beiden gemessen Reliabilitätstypen Werte von .89 <strong>und</strong> .90. Zu den <strong>im</strong><br />
Vergleich schlechteren Ergebnissen bei den Variablen Nebenthema <strong>und</strong> Anzahl Handlungsträger<br />
ist zu sagen, dass die große Anzahl der möglichen Ausprägungen bei beiden Kategorien<br />
berücksichtigt werden muss. Zum anderen ist es denkbar, die Variable Nebenthema<br />
67
zusammen mit der Variablen Hauptthema zu berechnen <strong>–</strong> genauso wie bei den Kategorien<br />
Herkunft Handlungsträger 1 bis 5 <strong>und</strong> Herkunft Quelle 1 bis 5.<br />
Kategorien Analyseeinheit<br />
Artikel (inhaltlich)<br />
Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Mögliche<br />
Ausprägungen<br />
V10. Darstellungsform 1 1 4<br />
V11. Hauptthema .80 .83 10<br />
V12. Nebenthema .60 .80 11<br />
V13. Anlass .93 .90 5<br />
V14. Valenz des Geschehens .87 .83 4<br />
V15. Argumentationstiefe .97 .93 3<br />
V16. Anzahl Handlungsträger .67 .67 ∞<br />
V17. bis V21. Herkunft Handlungsträger .92 .90 4<br />
V22. Anzahl Quellen .97 .97 ∞<br />
V23. bis V27. Herkunft Quelle .93 .93 4<br />
V28. Anzahl Vornamen 1 1 ∞<br />
V29. Anzahl Spitznamen .97 .97 ∞<br />
V30. Anzahl Identifikation .97 .97 ∞<br />
Gesamt .89 .90 <strong>–</strong><br />
Tab. 3: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Artikel (inhaltlich)<br />
Die Reliabilitätskoeffizienten der formalen Variablen Nummer Wertende Aussage <strong>und</strong> Nummer<br />
Attribution betragen jeweils 1. 78 Bei der Analyseeinheit Wertende Aussage werden bei<br />
den inhaltlichen Kategorien gute Reliabilitätskoeffizienten von .96 <strong>und</strong> .95 ermittelt. Die Werte<br />
zur Identifikationsreliabilität (.63 <strong>und</strong> .69) liefern wichtige Zusatzinformationen (vgl. RÖSS-<br />
LER 2005, 189). Relativierend muss eingeräumt werden, dass die korrekte Identifikation wertender<br />
Aussagen sehr schwierig ist. RÖSSLER bezeichnet die Erfassung wertender Sachverhalte<br />
„als Königsdisziplin der standardisierten Inhaltsanalyse<strong>“</strong> (ebd., 161). 79<br />
Kategorien Analyseeinheit<br />
Wertende Aussage (inhaltlich)<br />
Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Mögliche<br />
Ausprägungen<br />
V32. Urheber Wertende Aussage .97 .97 5<br />
V33. Gegenstand Wertende Aussage .86 .81 10<br />
V34. Bezug Wertende Aussage .96 .95 3<br />
V35. Bewertung Wertende Aussage 1 1 2<br />
V36. Aussageobjekt Wertende Aussage 1 1 5<br />
Gesamt .96 .95 <strong>–</strong><br />
Tab. 4: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Wertende Aussage (inhaltlich)<br />
Kategorien Analyseeinheit<br />
Attribution (inhaltlich)<br />
Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Mögliche<br />
Ausprägungen<br />
V39. Bezug Attribution 1 1 2<br />
V40. Urheber Attribution 1 1 4<br />
V41. Valenz Attribution .97 .97 2<br />
V42. Ursache Attribution .94 .97 5<br />
Gesamt .98 .99 <strong>–</strong><br />
Tab. 5: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Attribution (inhaltlich)<br />
78<br />
Werte zur Kategorie Anzahl Wertende Aussage werden nicht angegeben. Folgende Verhältnisse von positiven<br />
zu negativen wertenden Aussagen werden ermittelt: 27:16, 23:9 <strong>und</strong> 31:13. Siehe zur Aussagekraft dieser Ergebnisse<br />
die folgenden Ausführungen zu den Koeffizienten der Identifikationsreliabilität wertender Aussagen.<br />
79<br />
Die schlechteren Werte bei den Koeffizienten <strong>im</strong> Rahmen der Reliabilitätskontrolle hängen häufig von der ersten<br />
Codierung ab. Der Umgang mit dem Instrument ist zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht gut beherrscht worden.<br />
68
Die Werte zur Analyseeinheit Attribution werden als hinreichend zuverlässig interpretiert. Sie<br />
genügen quasi den Ansprüchen für formale Kategorien <strong>–</strong> besonders mit Blick auf die für diese<br />
Art von Einheit guten Koeffizienten der Identifikationsreliabilität von .78 <strong>und</strong> .74.<br />
Eine Mittelwertberechnung aller Ergebnisse zu formalen Kategorien ergibt Reliabilitätskoeffizienten<br />
von jeweils .98. In Bezug auf alle inhaltlichen Kategorien betragen die Koeffizienten<br />
.94 <strong>und</strong> .95. Der pauschale Mittelwert für diese Untersuchung wird mit .96 (Forscher-<br />
Codierer-Reliabilität) <strong>und</strong> .97 (Intracoder-Reliabilität) angegeben.<br />
Analyseeinheiten Forscher-<br />
Codierer-<br />
Reliabilität<br />
Intracoder-<br />
Reliabilität<br />
(Forscher)<br />
Gesamt (formal) .98 .98<br />
Gesamt (inhaltlich) .94 .95<br />
Gesamt .96 .97<br />
Tab. 6: Codiererreliabilität Gesamt<br />
Validität ist gegeben, wenn die Inhaltsanalyse „wirklich das [misst], was sie messen soll<strong>“</strong><br />
(FRÜH 2007, 196). Validität bezieht sich auf die Gültigkeit der Ergebnisse der Analyse. Treffen<br />
meine erhobenen Daten wirklich das zu messende Konstrukt? (ebd.). FRÜH weist daraufhin,<br />
dass die oben beschriebene Forscher-Codierer-Reliabilität Auskunft darüber gibt, wie<br />
gut der vom Forscher gemeinte Bedeutungsgehalt durch die Codierer getroffen wird (ebd.,<br />
197f.). Der Forscher wird so codieren, wie es seinem Klassifikationsverständnis entspricht.<br />
„Dies mag <strong>im</strong> Einzelfall nicht richtiger oder falscher sein als das eines Codierers <strong>–</strong> aber es ist das entscheidende<br />
Verständnis, denn es entspricht der Logik, auf deren Basis später auch die Hypothesen geprüft<br />
<strong>und</strong> Forschungsfragen beantwortet werden. Die Codierung des Forschers kann man deswegen<br />
quasi als ,gesetzt‘ betrachten […].<strong>“</strong> (RÖSSLER 2005, 194).<br />
Diese einzige quantifizierbare Art von Validität wird wie oben erwähnt bei der Reliabilitätsberechnung<br />
zwischen Forscher <strong>und</strong> Codierer ermittelt. Ein zweiter Validitätstyp ist die Inhaltsvalidität,<br />
die sich auf die Frage bezieht, ob „die zu messenden Konstrukte durch die Messung<br />
vollständig abgebildet wurden<strong>“</strong> (RÖSSLER 2005, 194).<br />
Dadurch, dass frühere Forschungen, externe Quellen <strong>und</strong> die Ergebnisse erster Sichtungen<br />
des Untersuchungsmaterials bei der Konstruktion des Kategoriensystems berücksichtigt<br />
wurden, wird versucht, ein vollständiges Instrument zu entwickeln. Da Auffangkategorien bei<br />
den Tests relativ selten benutzt werden müssen, kann u.a. abgeleitet werden, dass eine gute<br />
Inhaltsvalidität erreicht wurde (vgl. RÖSSLER 2005, 195). 80 Zur Beurteilung der Kriteriums-<br />
<strong>und</strong> Inferenzvalidität sind externe Erhebungen erforderlich, die zur Einschätzung der Plausibilität<br />
der Ergebnisse <strong>und</strong> weitergehender Schlussfolgerungen benutzt werden können. Diese<br />
beiden Typen der Validität sind erst relevant, wenn das jeweilige neue Projekt Ergebnisse<br />
produziert hat (vgl. ebd., 195f.; FRÜH 1007, 197).<br />
80 Bei den Kategorien Hauptthema <strong>und</strong> Nebenthema mit zehn bzw. elf Ausprägungen wird z.B. bei der Probecodierung<br />
bei den insgesamt 180 Codiervorgängen fünfmal die Ausprägung „Sonstiges<strong>“</strong> registriert.<br />
69
6. EMPIRISCHE ERGEBNISSE<br />
6.1 Deskriptive Ergebnisse<br />
Bevor die Ergebnisse der Codierung analytisch mit Signifikanztests auf Zusammenhänge<br />
zwischen den Variablen geprüft werden, werden nachfolgend die deskriptiven Ergebnisse<br />
der einzelnen Variablen in Kurzform beschreibend dargestellt. Die vollständigen deskriptiven<br />
Ergebnisse der einzelnen Variablen sind in den Abbildungen <strong>und</strong> Tabellen <strong>im</strong> Anhang einsehbar.<br />
6.1.1 Analyseeinheit Artikel<br />
In der überregionalen Sportberichterstattung der acht ausgewählten regionalen Tageszeitungen<br />
wurden <strong>im</strong> Untersuchungszeitraum 30. Juni bis 6. Juli 2006 insgesamt 782 Artikel identifiziert,<br />
die gemäß Definition für diese Analyse als relevant gelten. Codiert wurde vom Verfasser<br />
dieser Arbeit. Lediglich für den Reliabilitätstest wurde eine Stichprobe von 30 Beiträgen<br />
zusätzlich von einem zweiten Codierer verschlüsselt. 81 Die acht Zeitungen wurden so ausgewählt,<br />
dass vier Zeitungen eigene Redakteure bei den beiden Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft<br />
<strong>im</strong> Untersuchungszeitraum für die Stadiontribüne akkreditiert hatten<br />
<strong>und</strong> die anderen vier Blätter ausschließlich Texte gedruckt haben, die nicht von eigenen akkreditierten<br />
Mitarbeitern stammten.<br />
Die Zeitung mit den meisten relevanten Artikeln ist die LR. 22,5 % aller Beiträge stammen<br />
von diesem Blatt. 43,5 % aller relevanten Beiträge entfallen auf nicht akkreditierte Zeitungen.<br />
Tab. 7: Codierte Artikel <strong>–</strong> nach Zeitung<br />
Am häufigsten gehen in die vorliegende Analyse Beiträge des Erscheinungstages 4. Juli<br />
2006 ein <strong>–</strong> 19,4 % aller relevanten Artikel wurden an diesem Tag gedruckt. Der Tag mit der<br />
zweithöchsten Häufigkeit an relevanten Beiträgen ist der 6. Juli <strong>–</strong> an diesem Tag erschienen<br />
19,1 % der Artikel. Die wenigsten Texte waren am 5. Juli zu finden (12,7 %). 82<br />
Mit 27,0 % aller Artikel sind die meisten relevanten Beiträge auf der ersten Seite des überregionalen<br />
Sportteils platziert. Die wenigsten Texte in der Analyse sind auf der Seite 2 der Zeitungen<br />
gedruckt (0,5 %). Be<strong>im</strong> Vergleich der Artikelverteilung nach Platzierung <strong>–</strong> aufgeteilt<br />
nach Zeitung <strong>–</strong> wird deutlich, dass auf den hinteren Seiten der EZ <strong>und</strong> LR vergleichsweise<br />
mehr relevante kurze Meldungen zu finden sind <strong>und</strong> dass bei der LKZ nicht mehr als zwei<br />
Seiten des jeweiligen Sportteils in die Analyse eingehen.<br />
Für die Kategorie Artikel-Umfang ergibt sich ein Mittelwert von 1614,33 Zeichen (Median:<br />
1253,00; Modus: 408). Im Schnitt haben die Artikel der HA mit 2022,61 Zeichen den größten<br />
81<br />
Zu den Ergebnissen <strong>und</strong> der genauen Vorgehensweise bei der Überprüfung der Reliabilität <strong>und</strong> Validität vgl.<br />
Kapitel 5.4 Reliabilitätstest.<br />
82<br />
Dabei muss beachtet werden, dass die Anstoßzeit für das erste Spiel der deutschen Mannschaft (gegen Argentinien)<br />
am 30. Juni 2006 um 17.00 Uhr war, während das zweite Spiel Deutschlands (gegen Italien) am 4. Juli<br />
2006 um 21.00 Uhr begann.<br />
70
Textumfang, die Beiträge der LR mit 1228,06 Zeichen den kleinsten Textumfang der acht<br />
untersuchten Regionalzeitungen. Die Texte akkreditierter Zeitungen weisen <strong>im</strong> Schnitt einen<br />
kleineren Textumfang auf als die Artikel nicht akkreditierter Zeitungen.<br />
Abb. 1: Durchschnittlicher Artikel-Umfang <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
21,1 % aller relevanten Beiträge werden gemäß Codieranweisung <strong>und</strong> Definition des Codebuchs<br />
als Aufmacher identifiziert, 16,6 % als zweitwichtigste Artikel der jeweiligen Zeitungsseite,<br />
32,6 % als weniger <strong>stark</strong> aufgemachte Texte <strong>und</strong> 29,7 % als kurze Meldungen mit max<strong>im</strong>al<br />
600 Zeichen.<br />
Abb. 2: Aufmachung der Artikel<br />
Unterschiede zu diesen Ergebnissen werden festgestellt, wenn nach akkreditierten <strong>und</strong> nicht<br />
akkreditierten Zeitungen differenziert wird. Besonders be<strong>im</strong> Gebrauch kürzerer Meldungen<br />
unterscheiden sich die vier akkreditierten Blätter (33,0 %) von den vier nicht akkreditierten<br />
Regionalzeitungen (25,3 %). Be<strong>im</strong> genaueren Blick auf die Zahlen nach den einzelnen Zeitungen<br />
wird deutlich, dass MT (39,8 %), EZ (33,3 %) <strong>und</strong> LR (45,5 %) relativ häufigen<br />
Gebrauch von kurzen Meldungen machen, während die SVZ mit 11,4 % am seltensten kurze<br />
Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen einsetzt.<br />
Da sich die weiteren Ergebnisse in Bezug auf die einzelnen Kategorien, mit denen kritische<br />
<strong>Distanz</strong> überprüft werden soll, je nach häufigerem oder seltenerem Gebrauch kurzer Meldungen<br />
unterscheiden dürften, wie z.B. bei der Anzahl der Quellen, werden zusätzlich Werte<br />
ohne Berücksichtigung der kurzen Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen ermittelt. 83 Ohne Einbezug<br />
der Kurzmeldungen verteilen sich die Artikel nach Aufmachung wie folgt: Aufmacher<br />
30,0 %, zweitwichtigster Artikel 23,6 % <strong>und</strong> weniger <strong>stark</strong> aufgemachte Texte 46,4 %.<br />
54,9 (53,3) % aller Texte stammen von Agenturen. Urheber von 8,2 (11,5) % der Artikel sind<br />
nicht akkreditierte Redakteure; 10,7 (14,9) % der Beiträge haben akkreditierte Redakteure<br />
geschrieben. Be<strong>im</strong> Vergleich der Urheberschaft inklusive <strong>und</strong> exklusive Meldungen fällt auf,<br />
dass sich der Prozentwert der Artikel fast halbiert, die in Bezug auf den Urheber nicht zugeordnet<br />
werden können <strong>–</strong> statt 18,0 % sind es bei der Analyse ohne Meldungen 9,8 %. Bei<br />
83<br />
Werden die Ergebnisse nicht getrennt nach Analyse inklusive <strong>und</strong> exklusive Meldungen aufgeführt, bezieht sich<br />
der zweite Wert in Klammern bei den nachfolgend dargestellten Ergebnissen auf Analysen exklusive Meldungen.<br />
71
der Betrachtung ohne Meldungen n<strong>im</strong>mt der Anteil der Texte der Zeitungsredakteure zu <strong>und</strong><br />
der Anteil der Agentur-Texte ab.<br />
Der Anteil der Agentur-Texte ist bei nicht akkreditierten Zeitungen höher (Tab. 8). Bei den<br />
akkreditierten Blättern werden häufiger Beiträge eigener akkreditierter Redakteure eingesetzt.<br />
Werden Meldungen nicht berücksichtigt, sinkt in beiden Zeitungsschichten der Anteil<br />
der Agentur-Texte, während die Anteile der Artikel der Redakteure steigen. Be<strong>im</strong> Vergleich<br />
der Verteilungen inklusive <strong>und</strong> exklusive Meldungen zeigt sich, dass kurze Texte, deren Urheberschaft<br />
nicht festgestellt werden kann, häufiger bei akkreditierten Zeitungen codiert werden.<br />
84 Werden Meldungen nicht miteinbezogen, ergeben sich bei den Zeitungsschichten dieselben<br />
Anteilswerte für diese Ausprägung.<br />
Tab. 8: Urheber <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Um die Hypothesen detailliert <strong>–</strong> auch auf Ebenen unterhalb der Zeitungsschichten <strong>–</strong> überprüfen<br />
zu können, wurde nach der Codierung mittels der Kategorie Urheber die beiden zusätzlichen<br />
Kategorien Urheber relevant <strong>und</strong> Urheber nur Redakteure erstellt. 85 11,0 (15,5) % aller<br />
Texte der Stichprobe Urheber relevant stammen von akkreditierten Redakteuren. Bei der<br />
Schicht der akkreditierten Zeitungen sind akkreditierte Redakteure bei 19,6 (29,0) % aller<br />
Texte die Urheber. Die EZ mit 26,6 (39,5) % <strong>und</strong> die OVZ mit 26,2 (30,6) % sind die akkreditierten<br />
Zeitungen mit dem größten Anteil an Artikeln eigener akkreditierter Journalisten. Bei<br />
der LR unterscheiden sich die Anteile der Texte eigener akkreditierter Mitarbeiter aus den<br />
genannten Gründen <strong>stark</strong> danach, ob Meldungen berücksichtigt werden oder nicht <strong>–</strong> inklusive<br />
Meldungen: 13,5 %, exklusive Meldungen: 24,2 %. 18,1 (22,4) % aller relevanten Texte<br />
der PZ stammen von eigenen akkreditierten Mitarbeitern.<br />
Werden als Urheber nur Redakteure der Regionalzeitungen berücksichtigt, sind 56,8 % der<br />
betreffenden Texte von akkreditierten Journalisten (56,6 %). Bei akkreditierten Zeitungen<br />
stammen 74,3 % aller relevanten Texte von akkreditierten Redakteuren (74,5 %). Bei nicht<br />
akkreditierten Zeitungen stammen logischerweise 100,0 % der Beiträge von nicht akkreditierten<br />
Redakteuren. Die LR hat mit 79,3 % den größten Anteil an Beiträgen akkreditierter eigener<br />
Redakteure <strong>im</strong> Vergleich zu den Texten eigener nicht akkreditierter Redakteure; bei<br />
Nichtberücksichtigung der Meldungen ist es die EZ mit 81,1 %. Prozentual die wenigsten<br />
Texte eigener akkreditierter Redakteure verwendet die PZ mit jeweils 62,5 %.<br />
79,0 (71,6) % aller Texte werden als objektivierend-faktizierende Darstellungsform codiert,<br />
10,2 (14,4) % als subjektivierend-argumentierend. Der Anteil der Mischform beträgt 4,0 (5,5)<br />
%. Das MT mit 89,3 % <strong>und</strong> der HA mit 82,4 % (ohne Meldungen) sind die Zeitungen mit den<br />
höchsten Anteilen an objektivierend-faktizierenden Darstellungsformen. Die OVZ mit 61,9<br />
(54,9) % ist die Zeitung mit dem geringsten Anteil an objektivierend-faktizierenden Formen.<br />
84<br />
Die Ursache dafür ist u.a., dass die LR <strong>im</strong> Vergleich sehr viele Meldungen einsetzt <strong>und</strong> bei diesen kurzen Texten<br />
<strong>im</strong> Gegensatz zu den anderen sieben Zeitungen in den meisten Fällen keine Urheberkürzel verwendet.<br />
85<br />
Vgl. Kapitel 6.2 zur genaueren Beschreibung der Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Urheber nur Redakteure.<br />
72
Die höchsten Anteile an subjektivierend-argumentierenden Formen weisen mit 27,0 (31,4) %<br />
die OVZ <strong>und</strong> mit 20,3 (22,9) % die SVZ auf. Mit Abstand am wenigsten auf solche meinungsbetonten<br />
Stilformen setzt die LKZ mit einem Anteil von 1,4 (1,9) %.<br />
Häufigstes Hauptthema in den Artikeln ist mit der Ausprägung Lokalkolorit die St<strong>im</strong>mung, die<br />
Atmosphäre o.ä. mit 23,5 %. 86 Es folgen nach der Häufigkeit des jeweiligen Beitragshauptthemas<br />
Ästhetik (17,4 %), Leistung (16,8 %) <strong>und</strong> Organisation (15,6 %). Am seltensten werden<br />
medizinische Aspekte thematisiert. Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen stehen<br />
dieselben Themen an der Spitze: Ästhetik (24,2 %) hat mit Lokalkolorit (20,5 %) den Platz<br />
getauscht, es folgen Leistung (19,3 %) <strong>und</strong> Organisation (15,6 %).<br />
Abb. 3: Hauptthema der Artikel<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich der Zeitungsschichten fällt auf, dass bei akkreditierten Zeitungen am häufigsten<br />
Lokalkolorit (26,7 %) behandelt wird, zweithäufigstes Thema ist Organisation (15,6 %).<br />
Bei nicht akkreditierten Zeitungen werden Ästhetik (20,6 %), Leistung (19,7 %) <strong>und</strong> Lokalkolorit<br />
(19,4 %) relativ gleich häufig gesetzt. Werden Meldungen nicht berücksichtigt, ist bei<br />
akkreditierten Zeitungen Lokalkolorit mit 24,7 % das häufigste Hauptthema, bei nicht akkreditierten<br />
Zeitungen werden stattdessen Ästhetik (27,2 %) <strong>und</strong> Leistung (20,5 %) zu den am<br />
häufigsten thematisierten Sachverhalten <strong>–</strong> Lokalkolorit wird in 15,7 % der Artikel behandelt.<br />
Was die Modalwerte betrifft, fallen bei den Zeitungen das MT mit Organisation (23,3 %) <strong>und</strong><br />
die LKZ mit Leistung (29,6 %) als die am häufigsten verwendeten Hauptthemen auf. Die LR<br />
spricht am häufigsten das Thema Lokalkolorit (30,7 %) an.<br />
Bei der Artikelhäufigkeit nach dem Nebenthema werden nach der Ausprägung Kein zweites<br />
Thema (47,7 %) am häufigsten die Themen Ästhetik (12,1 %), Leistung (10,7) <strong>und</strong> Lokalkolorit<br />
(10,1 %) codiert. Ohne Berücksichtigung der Meldungen ergibt sich nach der Ausprägung<br />
Kein zweites Thema (36,0 %) folgende Reihenfolge: Ästhetik (16,5 %), Leistung (14,5 %)<br />
<strong>und</strong> Lokalkolorit (10,9 %). Be<strong>im</strong> Vergleich der beiden Zeitungsschichten fällt <strong>–</strong> wie bei der<br />
Variablen Hauptthema <strong>–</strong> auf, dass bei akkreditierten Zeitungen nach der Ausprägung Kein<br />
zweites Thema (51,1 %) am häufigsten Lokalkolorit (11,5 %) behandelt wird. Es folgen Ästhetik<br />
(10,2 %) <strong>und</strong> Leistung (9,5 %). Bei nicht akkreditierten Zeitungen ergibt sich nach der<br />
Ausprägung Kein zweites Thema die folgende Reihenfolge: Ästhetik (14,7 %), Leistung (12,7<br />
%), Lokalkolorit (8,2 %) <strong>und</strong> Organisation (6,8 %). 87<br />
Bei 15,9 % aller Artikel ist kein Anlass außerhalb der jeweiligen Zeitung oder Agentur er-<br />
86<br />
Die Ergebnisse der Variablen Hauptthema <strong>und</strong> Nebenthema <strong>–</strong> auch bezüglich des Themas wertender Aussagen<br />
<strong>–</strong> werden nur deskriptiv univariat dargestellt. Die Überprüfung von Abhängigkeiten der Variablen mit zehn<br />
bzw. elf Ausprägungen konnte <strong>im</strong> Rahmen der Arbeit aus forschungsökonomischen Gründen nicht gewährleistet<br />
werden.<br />
87<br />
Exklusive Meldungen ist bei akkreditierten Zeitungen nach der Ausprägung Kein zweites Thema (38,5 %) Ästhetik<br />
(14,5 %) vor Leistung (12,8 %) <strong>und</strong> Lokalkolorit (12,5 %) das am häufigsten besprochene Hauptthema; bei<br />
nicht akkreditierten Zeitungen werden nach Kein zweites Thema (33,1 %) Ästhetik (18,9 %) <strong>und</strong> Leistung (16,5<br />
%) zu den am häufigsten thematisierten Sachverhalten <strong>–</strong> Lokalkolorit wird in 9,1 % der Artikel behandelt.<br />
73
kennbar, d.h. dass das untersuchte Medium oder die Agentur ein Thema selbst aufgegriffen<br />
<strong>und</strong> sich mit einem Ereignis beschäftigt hat, das sonst nicht in die Presse gekommen wäre.<br />
Bei 45,1 % aller Beiträge ist die Art des Anlasses nicht klar erkennbar. Der zweithäufigste<br />
Anlass zur Berichterstattung sind öffentlich stattfindende Ereignisse (23,4 %). Die Medien<br />
sind bei jedem zehnten Text selbst der Anlass (10,1 %). 88<br />
Abb. 4: Anlass der Artikel<br />
Bei akkreditierten Zeitungen ist <strong>im</strong> Vergleich zu nicht akkreditierten Zeitungen der Anteil unklarer<br />
Anlässe größer (47,5 zu 42,1 %), eigene Themen werden häufiger gesetzt (17,6 zu<br />
13,5 %) <strong>und</strong> öffentliche Ereignisse sind seltener der Anlass zur Berichterstattung (20,4 zu<br />
27,4 %). Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen ist erkennbar, dass bei akkreditierten<br />
Zeitungen häufiger Medien selbst der Anlass zur Berichterstattung sind (10,8 zu 8,3 %) <strong>und</strong><br />
dass häufiger eigene Themen gesetzt werden (25,3 zu 18,1 %).<br />
Die Modalwerte der einzelnen Zeitungen zeigen u.a., dass die LKZ mit 45,1 % fast doppelt<br />
so häufig wie alle Zeitungen <strong>im</strong> Durchschnitt öffentliche Ereignisse zum Anlass der Berichterstattung<br />
macht <strong>und</strong> dass die OVZ genauso häufig eigene Themen setzt wie der Anlass<br />
unklar ist (jeweils 30,2 %). Die SVZ bringt am häufigsten eigene Themen (31,6 %), die LKZ<br />
am wenigsten (4,2 %). Ohne Meldungen sind mit 35,7 % redaktionsinterne Anlässe der häufigste<br />
Anlass zur Berichterstattung bei der SVZ.<br />
Abb. 5: Valenz des Geschehens der Artikel<br />
Bei 62,1 (60,2) % der Artikel wird die Valenz des Geschehens als neutral codiert, d.h. dass<br />
keine Wertungen möglich sind, nur subjektiv erfolgen können oder sich die jeweiligen Beiträge<br />
mit dem Ausgang sportlicher Wettkämpfe beschäftigen. 89 Die weitere Reihenfolge: ambi-<br />
88<br />
Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen ergibt sich dieselbe Reihenfolge: Anlass nicht klar erkennbar (35,6<br />
%), Anlass öffentlich (26,0 %), kein Anlass außerhalb Redaktion (22,0 %) <strong>und</strong> Medien als Anlass (9,6 %). Unklare<br />
Anlässe <strong>und</strong> die Medien selbst als Anlass werden ohne Meldungen seltener codiert.<br />
89<br />
Vgl. die ausführlichen Definitionen der Ausprägungen <strong>im</strong> Codebuch (Anhang).<br />
74
valent (14,8 % bzw. 16,5 %), positiv (12,5 % bzw. 13,6 %) <strong>und</strong> negativ (10,5 % bzw. 9,6 %).<br />
Die am zweithäufigsten codierte Ausprägung nach neutral (61,1 %) bei akkreditierten Regionalzeitungen<br />
ist positiv (14,7 %). Bei nicht akkreditierten Blättern wird dieser Wert am seltensten<br />
verschlüsselt (9,7 %). Am häufigsten positiv berichten PZ (20,5 %), LKZ (18,3 %)<br />
<strong>und</strong> OVZ (17,5 %), am häufigsten negativ OVZ (12,7 %), HA (11,5 %) <strong>und</strong> PZ (11,4 %). Am<br />
seltensten positiv ist die Berichterstattung der HA (3,4 %), der EZ (6,1 %) <strong>und</strong> der SVZ (8,9<br />
%), am seltensten negativ wird bei der SVZ (7,6 %), der LR (9,7 %) <strong>und</strong> der EZ (10,4 %) codiert.<br />
90<br />
In 72,1 % aller Texte der acht Regionalzeitungen wird bei der Variablen Argumentationstiefe<br />
die Ausprägung Thematisierung codiert. Hintergr<strong>und</strong>informationen <strong>und</strong> Interpretation werden<br />
mit 26,6 % bzw. 1,3 % seltener verschlüsselt. Ohne Meldungen zu berücksichtigen, sinkt der<br />
Anteil der Thematisierung (63,1 %). Der Anteil der Hintergr<strong>und</strong>information (35,1 %) <strong>und</strong> der<br />
Anteil der Interpretation (1,8 %) steigen.<br />
Abb. 6: Argumentationstiefe der Artikel<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich der Schichten zeigt sich, dass nicht akkreditierte Zeitungen mit 69,4 % seltener<br />
als akkreditierte Zeitungen (74,2 %) Thematisierung einsetzen <strong>und</strong> mit 29,7 % häufiger<br />
Hintergründe als akkreditierte Medien (24,2 %) anbieten. Ein Unterschied ist bei Nichtberücksichtigung<br />
der Meldungen ebenfalls vorhanden. Die größten Thematisierungs-Anteile<br />
werden bei der LR mit 77,3 % <strong>und</strong> ohne Meldungen bei der SVZ mit 74,3 % ermittelt, der<br />
größte Hintergr<strong>und</strong>-Anteil be<strong>im</strong> MT mit 35,0 (50,0) %. Am wenigsten auf Thematisierung<br />
setzt das MT mit 64,1 (48,4) %. Die wenigsten Codierungen für Hintergr<strong>und</strong> werden bei der<br />
SVZ 21,5 (24,3) % <strong>und</strong> der LR mit 21,6 % eingetragen.<br />
Der Durchschnittswert bei der Anzahl der Handlungsträger pro Artikel beträgt 10,08. Die am<br />
stärksten besetzte Merkmalsausprägung ist die Anzahl von vier Handlungsträgern, der Medianwert<br />
ist 8,00. Vier Texte kommen ohne Handlungsträger aus, 25 Beiträge mit jeweils<br />
einem Handlungsträger.<br />
Abb. 7: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Handlungsträger pro Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
90 Bei der Analyse exklusive Meldungen fallen die Ergebnisse ähnlich aus, die meisten Werte sind deutlicher<br />
ausgeprägt.<br />
75
Bei der Berechnung exklusive Meldungen erhöhen sich die Werte der Lageparameter: Mittelwert<br />
12,65; Median 11,00 <strong>und</strong> Modus 7. 42 Texte kommen mit weniger als acht oder völlig<br />
ohne Handlungsträger aus. Der Mittelwert ist bei den nicht akkreditierten Zeitungen mit 10,99<br />
höher als bei akkreditierten Blättern mit 9,37. Höhere Werte sind bei den nicht akkreditierten<br />
Blättern auch bei den beiden anderen Lageparametern festzustellen <strong>–</strong> das gilt jeweils mit der<br />
Ausnahme eines Modalwerts bei Nichtberücksichtigung der Meldungen. Die größten Unterschiede<br />
zum Mittelwert aller Artikel werden bei der LKZ (12,72) <strong>und</strong> bei der LR (7,66) festgestellt.<br />
Diese Zeitungen haben durchschnittlich 2,64 mehr bzw. 2,42 Handlungsträger weniger<br />
benutzt. Ohne Meldungen mit zu analysieren, werden bei der LKZ (15,17) <strong>und</strong> bei der OVZ<br />
(10,53) die größten Unterschiede zum Mittelwert ermittelt. Sie haben durchschnittlich 2,52<br />
mehr bzw. 2,12 Handlungsträger weniger benutzt.<br />
Bei gemeinsamer Berücksichtigung aller fünf erfassten Handlungsträger ergeben sich folgende<br />
durchschnittlichen Anteile, denen ein zusätzlicher Datensatz auf Basis der Variablen<br />
Herkunft Handlungsträger 1 bis 5 zugr<strong>und</strong>e liegt: 42,5 % aller Handlungsträger sind aktive<br />
Sportler. Danach ergibt sich diese Reihenfolge: Nicht aus Sportwelt (27,0 %), aus Sportwelt<br />
(11,1 %) <strong>und</strong> Trainer (7,9 %). In 11,6 % aller Artikel ist kein bzw. kein weiterer Handlungsträger<br />
vorhanden.<br />
Abb. 8: Herkunft der fünf wichtigsten Handlungsträger<br />
Ohne Meldungen ergeben sich folgende Durchschnittswerte für die Variable Herkunft Handlungsträger<br />
Gesamt: aktive Sportler (48,8 %), Trainer (9,7 %), aus Sportwelt (11,6 %), Nicht<br />
aus Sportwelt (25,9 %), Kein (weiterer) Handlungsträger (4,0 %).<br />
61,4 (70,1) % der Handlungsträger stammen aus dem Umfeld des Sports. Der Rest setzt<br />
sich aus sportexternen <strong>und</strong> fehlenden Handlungsträgern zusammen. Die Analyse getrennt<br />
nach den Zeitungsschichten zeigt, dass bei nicht akkreditierten Blättern höhere Werte für<br />
Handlungsträger aus dem Sportumfeld (69,1 %) als bei akkreditierten Medien (55,5 %) zu<br />
finden sind. Akkreditierte Redaktionen benutzen mit 31,2 % häufiger sportexterne Handlungsträger<br />
als nicht akkreditierte Zeitungen (21,5 %). Die Berechnung exklusive Meldungen<br />
zeigt denselben Trend. Am häufigsten setzt das MT mit 73,2 (87,7) % der Handlungsträger<br />
auf Personen aus dem Sportumfeld, am häufigsten sportexterne Handlungsträger verwendet<br />
die LR: 39,3 (38,3) %.<br />
40,2 % aller Handlungsträger sind aktive Sportler, wenn Handlungsträger 1 <strong>–</strong> als wichtigster<br />
Handlungsträger <strong>–</strong> einzeln erfasst wird; nicht aus der Sportwelt (32,0 %), aus der Sportwelt<br />
(16,9 %) <strong>und</strong> Trainer (10,5 %). In vier Artikeln ist kein Handlungsträger vorhanden (0,5 %).<br />
67,5 % der Handlungsträger stammen damit bei Handlungsträger 1 aus dem unmittelbaren<br />
Umfeld des Sports. Ohne Meldungen zu berücksichtigen, ergeben sich folgende Durchschnittswerte<br />
bezüglich der Herkunft des wichtigsten Handlungsträgers: aktive Sportler (46,7<br />
%), Trainer (12,5 %), aus Sportwelt (13,6 %), Nicht aus Sportwelt (26,9 %), Kein Handlungsträger<br />
(0,2 %). 72,9 % der Handlungsträger stammen damit aus dem unmittelbaren Sportumfeld.<br />
76
Abb. 9: Herkunft des wichtigsten Handlungsträgers<br />
Die Analyse getrennt nach Zeitungsschichten zeigt analog zu den vorherigen Ergebnissen,<br />
dass bei nicht akkreditierten Blättern höhere Werte für Handlungsträger 1 aus dem Sportumfeld<br />
(76,5 %) als bei akkreditierten Medien (60,6 %) zu finden sind. Die akkreditierten Redaktionen<br />
benutzen mit 39,1 % häufiger sportexterne Handlungsträger als die nicht akkreditierten<br />
Zeitungen (22,6 %). Die Berechnung exklusive Meldungen zeigt denselben Trend. In<br />
einem Artikel akkreditierter <strong>und</strong> in drei Artikeln nicht akkreditierter Zeitungen findet sich kein<br />
Handlungsträger. Am häufigsten setzt das MT bei der Variablen Herkunft Handlungsträger 1<br />
mit 85,4 (93,5) % der Handlungsträger auf Personen aus dem Sportumfeld, am häufigsten<br />
sportexterne Handlungsträger verwendet die LR: 52,8 (40,6) %.<br />
Bei der Kategorie Herkunft Handlungsträger 5 ist <strong>im</strong> Vergleich zu Handlungsträger 1 häufiger<br />
kein Handlungsträger vorhanden <strong>–</strong> nämlich in 27,4 (10,7) % der Artikel. Ohne Berücksichtigung<br />
der Ausprägung Kein (weiterer) Handlungsträger ergeben sich diese Werte: sportexterne<br />
Handlungsträger 26,6 (25,1) %. Die Analyse getrennt nach Zeitungsschichten zeigt<br />
analog zu den vorherigen Ergebnissen, dass bei nicht akkreditierten Blättern höhere Werte<br />
für Handlungsträger 5 aus dem Sportumfeld (63,2 %) als bei akkreditierten Medien (45,7 %)<br />
zu finden sind. Akkreditierte Redaktionen benutzen mit 22,6 % häufiger sportexterne Handlungsträger<br />
als nicht akkreditierte Zeitungen (15,0 %). Die Berechnung exklusive kurzer Meldungen<br />
zeigt denselben Trend. In 31,7 % der Artikel akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 21,8 % der<br />
Artikel nicht akkreditierter Zeitungen sind keine Handlungsträger vorhanden. Bei der Variablen<br />
Herkunft Handlungsträger 5 setzt die LKZ mit 67,6 % der Handlungsträger am häufigsten<br />
auf Personen aus dem Sportumfeld <strong>–</strong> ohne Ausprägung Kein (weiterer) Handlungsträger:<br />
82,8 %. Ohne Meldungen ist der Anteil der Handlungsträger aus dem Sportumfeld be<strong>im</strong> MT<br />
mit 83,9 % am größten <strong>–</strong> ohne Ausprägung Kein (weiterer) Handlungsträger: 88,1 %. Am<br />
häufigsten sportexterne Handlungsträger verwendet die LR: 26,7 (35,4) % <strong>–</strong> ohne Ausprägung<br />
Kein (weiterer) Handlungsträger: 47,0 (41,0) %.<br />
Der Durchschnittswert bei der Anzahl der Quellen pro codiertem Artikel beträgt 1,92. Die am<br />
stärksten besetzte Merkmalsausprägung ist die Anzahl von einer Quelle, der Medianwert ist<br />
1,00. 23,7 % der Artikel verwenden keine Quelle, 37,5 % eine einzige <strong>–</strong> zusammen sind das<br />
61,1 % der Beiträge.<br />
Abb. 10: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Quellen pro Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
77
Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen erhöhen sich teilweise die Werte der Lageparameter:<br />
Mittelwert 2,40; Median 2,00 <strong>und</strong> Modus 1. In 21,3 % der Artikel exklusive Meldungen<br />
wird keine Quelle angeführt, in 26,5 % eine Quelle <strong>–</strong> zusammen sind das 47,8 %. Der Mittelwert<br />
nicht akkreditierter Zeitungen ist mit 2,16 (2,66) größer als der Mittelwert akkreditierter<br />
Blätter mit 1,74 (2,18).<br />
Bei akkreditierten Zeitungen ist der Anteil der Texte mit keiner <strong>und</strong> einer einzigen Quelle mit<br />
65,6 (52,0 %) größer als bei nicht akkreditierten Zeitungen mit 55,3 (42,9) %. Die größten<br />
Unterschiede zum Mittelwert aller Artikel werden bei der LKZ (2,7) <strong>und</strong> bei der OVZ (1,51)<br />
festgestellt. Diese benutzen durchschnittlich 0,78 mehr bzw. 0,41 Quellen weniger. Ohne<br />
Meldungen mit in die Analyse zu nehmen, werden bei der LKZ (3,3) <strong>und</strong> bei der OVZ (1,78)<br />
die größten Unterschiede zum Mittelwert ermittelt. Sie benutzen durchschnittlich 0,9 mehr<br />
bzw. 0,62 Quellen weniger. Den größten Anteil an Artikeln mit keiner oder einer Quelle weisen<br />
mit 72,2 % die LR <strong>und</strong> mit 66,7 % die OVZ auf <strong>–</strong> exklusive Meldungen sind es mit 58,8<br />
% die OVZ <strong>und</strong> mit 55,6 % die PZ. Der kleinste Anteil an Artikeln mit keiner oder einer Quelle<br />
wird mit 47,1 (33,8) % bei der HA <strong>und</strong> mit 49,3 (35,2) % bei der LKZ ermittelt.<br />
Abb. 11: Herkunft der fünf wichtigsten Quellen 91<br />
Bei der gemeinsamen Berücksichtigung der Herkunft der Quellen 1 bis 5 in einem zusätzlich<br />
angefertigten Datensatz ergeben sich folgende Werte zu deren Herkunft: Insgesamt sind<br />
39,9 % der benutzten Quellen nicht aus der Sportwelt, 23,1 % aktive Sportler <strong>und</strong> 19,7 %<br />
aus der Sportwelt, d.h., dass 60,1 % der Quellen aus dem unmittelbaren Sportumfeld stammen.<br />
92<br />
Ohne Meldungen ergeben sich folgende Durchschnittswerte für die Variable Herkunft Quelle<br />
Gesamt: aktive Sportler 25,1 %, Trainer 19,3 %, aus der Sportwelt 18,5 % <strong>und</strong> nicht aus der<br />
Sportwelt 37,1 %. 62,9 % der Quellen sind damit sportinterne Quellen. Die Analyse der existierenden<br />
Quellen getrennt nach Zeitungsschichten zeigt, dass bei nicht akkreditierten Blättern<br />
höhere Werte für Quellen aus dem Sportumfeld (67,6 %) als bei akkreditierten Medien<br />
(53,4 %) zu finden sind. Die akkreditierten Redaktionen benutzen mit 46,6 % häufiger sportexterne<br />
Quellen als die nicht akkreditierten (32,4 %). Am häufigsten setzt das MT mit 83,4<br />
(86,1) % der Quellen auf Personen aus dem Sportumfeld, am häufigsten sportexterne Quellen<br />
verwendet die LR: 62,6 (57,3) %.<br />
13,0 % aller Quellen sind aktive Sportler, wenn Quelle 1 <strong>–</strong> als wichtigste Quelle <strong>–</strong> einzeln<br />
erfasst wird. Nicht aus der Sportwelt sind 32,1 % der Quellen, aus der Sportwelt 16,2 % <strong>und</strong><br />
Trainer 14,6 %. In 188 von 782 Artikeln ist keine Quelle vorhanden (24,0 %). 43,9 % insge-<br />
91<br />
Darstellung ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> = Keine (weitere) Quelle.<br />
92<br />
Bei der Berechnung inklusive Ausprägung „9<strong>“</strong> sind 7,9 % der 1335 codierten Quellen aktive Sportler, nicht aus<br />
der Sportwelt sind 13,6 %, aus der Sportwelt 6,7 % <strong>und</strong> Trainer 5,9 %. In 65,9 % aller Artikel ist keine bzw. keine<br />
weitere Quelle vorhanden. Aufgr<strong>und</strong> der erwähnten hohen Anzahl an Texten mit keiner (weiteren) Quelle beziehen<br />
sich die nachfolgend dargestellten Ergebnisse jeweils auf Werte ohne Berücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong>.<br />
78
samt <strong>und</strong> 57,7 % der existierenden Quellen stammen folglich bei Quelle 1 aus dem unmittelbaren<br />
Umfeld des Sports.<br />
Abb. 12: Herkunft der wichtigsten Quelle<br />
Ohne Meldungen ergeben sich folgende Durchschnittswerte für die Quelle 1: aktiver Sportler<br />
15,6 %, Trainer 19,1 %, aus Sportwelt 15,5 %, nicht aus Sportwelt 28,2 % <strong>und</strong> keine Quelle<br />
21,6 %. 50,2 % insgesamt <strong>und</strong> 64,0 % der vorhandenen Quellen stammen damit aus dem<br />
unmittelbaren Umfeld des Sports.<br />
Die Analyse getrennt nach den beiden Zeitungsschichten zeigt analog zu den vorherigen<br />
Ergebnissen, dass bei nicht akkreditierten Blättern höhere Werte für Quelle 1 aus dem<br />
Sportumfeld (50,6 %) als bei akkreditierten Medien (38,7 %) zu finden sind. Akkreditierte<br />
Redaktionen benutzen mit 37,8 % häufiger sportexterne Quellen als nicht akkreditierte Zeitungen<br />
mit 24,7 %. Akkreditierte Zeitungen haben mit 23,5 % weniger Artikel ohne Quellen<br />
als nicht akkreditierte Zeitungen (24,7 %). Die Berechnung exklusive Meldungen zeigt denselben<br />
Trend, bei diesen Ergebnissen haben nicht akkreditierte Zeitungen mit 19,7 % weniger<br />
Artikel ohne Quellen als nicht akkreditierte Zeitungen (23,3 %). Am häufigsten setzt das<br />
MT bei der Kategorie Herkunft Quelle 1 mit 64,1 (74,2) % der Quellen auf Personen aus dem<br />
Sportumfeld, am häufigsten sportexterne Quellen verwendet die LR: 51,7 (41,7) %.<br />
Bei der Kategorie Herkunft Quelle 5 ist <strong>im</strong> Vergleich zu Quelle 1 häufiger keine Quelle vorhanden<br />
<strong>–</strong> nämlich in 88,1 (83,1) % der Artikel. Ohne Berücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong><br />
(Keine (weitere) Quelle) beträgt der Anteil sportexterner Quellen 44,1 (44,1) %. Die Ergebnisse<br />
getrennt nach Zeitungsschichten zeigen, dass bei Analyse der existierenden Quellen<br />
<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen kleinen Anzahl von 49 bzw. 44 Fällen bei nicht akkreditierten<br />
Blättern höhere Werte für Quelle 5 aus dem Sportumfeld (59,2 %) als bei akkreditierten Medien<br />
(52,3 %) zu finden sind. Akkreditierte Redaktionen benutzen mit 47,7 % häufiger sportexterne<br />
Handlungsträger als nicht akkreditierte Zeitungen mit 40,8 %. In 90,0 % der Artikel<br />
akkreditierter <strong>und</strong> in 85,6 % der Artikel nicht akkreditierter Zeitungen ist keine fünfte Quelle<br />
vorhanden.<br />
In 81 von 782 Artikeln <strong>–</strong> <strong>und</strong> damit in 10,4 % der Texte <strong>–</strong> werden Personen alleine mit Vornamen<br />
genannt; das ergibt einem Mittelwert von identifizierten Vornamen pro Artikel von<br />
0,20. Ohne Meldungen beträgt der Mittelwert 0,27, was bedeutet, dass in 75 von 550 Texten<br />
<strong>–</strong> <strong>und</strong> damit in 13,6 % der Artikel <strong>–</strong> Personen mindestens einmal <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 15 Mal alleine<br />
mit dem Vornamen genannt werden. Der Mittelwert der vier untersuchten nicht akkreditierten<br />
Zeitungen ist mit 0,24 (0,32) höher als der Mittelwert akkreditierter Zeitungen mit 0,16 (0,23)<br />
Vornamen pro Artikel. Während in akkreditierten Zeitungen in 8,8 (11,5) % aller Texte mindestens<br />
einmal <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 12-mal Vornamen gebraucht werden, ist das bei nicht akkreditierten<br />
Zeitungen in 12,4 (16,1) % der Texte mindestens einmal <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 15-mal der Fall.<br />
Bei der SVZ wird mit 0,47 (0,53) Vornamen pro Artikel der höchste Mittelwert festgestellt,<br />
be<strong>im</strong> MT mit 0,09 der niedrigste. Ohne Meldungen hat die OVZ mit 0,14 den niedrigsten Mittelwert.<br />
79
Abb. 13: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Vornamen pro Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Der Mittelwert für die Anzahl der codierten Spitznamen pro Artikel beträgt 0,78 (1,04). In 32,2<br />
(40,7) % der Beiträge werden mindestens ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 50 Spitznamen verschlüsselt.<br />
Der Mittelwert nicht akkreditierter Zeitungen ist mit 1,04 (1,33) höher als der Mittelwert<br />
akkreditierter Zeitungen mit 0,59 (0,80). In 27,6 (36,1) % der Artikel akkreditierter Zeitungen<br />
werden mindestens einmal ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al siebenmal Spitznamen verwendet,<br />
in 38,2 (46,1) % der Texte nicht akkreditierter Zeitungen werden mindestens einmal<br />
ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 50-mal Spitznamen ermittelt. Bei der SVZ wird mit 1,89 (2,11)<br />
Spitznamen pro Artikel der höchste Mittelwert festgestellt, bei der LR mit 0,47 der niedrigste<br />
<strong>–</strong> ohne Meldungen hat die OVZ mit 0,65 den niedrigsten Mittelwert.<br />
Abb. 14: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Spitznamen pro Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Bei den Mittelwerten für die Anzahl der codierten Spitznamen pro Artikel muss darauf hingewiesen<br />
werden, dass eine Erhöhung der Werte bei den nicht akkreditierten Zeitungen <strong>und</strong><br />
speziell bei der SVZ u.a. dadurch zustande kommt, dass in einem SVZ-Beitrag, der sich explizit<br />
als Thema mit Fußballer-Spitznamen beschäftigt, 50 Nennungen verschlüsselt werden.<br />
In diesem Fall kann anhand der Definition <strong>im</strong> Codebuch nicht eindeutig geklärt werden, ob es<br />
sich um relevante Codierungen handelt. Das Ziel ist die Erfassung von Spitznamen als ein<br />
Indikator für mangelnde kritische <strong>Distanz</strong>. Deshalb werden die Mittelwerte für die Anzahl der<br />
Spitznamen ein zweites Mal angegeben <strong>–</strong> bereinigt, ohne den betreffenden SVZ-Artikel.<br />
Der Mittelwert für die Anzahl der codierten Spitznamen pro Artikel beträgt bereinigt 0,72<br />
(0,95). Mindestens ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 11 Spitznamen werden in 32,1 % der Beiträge<br />
(40,6 %) verschlüsselt. Der Mittelwert nicht akkreditierter Zeitungen ist mit 0,89 (1,13)<br />
höher als der Mittelwert akkreditierter Zeitungen mit 0,59 (0,80). In 27,6 % der Artikel akkreditierter<br />
Zeitungen (36,1 %) werden mindestens einmal ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al siebenmal<br />
Spitznamen verwendet, in 38,1 (45,8) % der Texte nicht akkreditierter Zeitungen werden<br />
mindestens einmal ein Spitzname <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al 50-mal Spitznamen ermittelt. Bei der SVZ<br />
wird mit 1,27 Spitznamen pro Artikel (1,42) der höchste Mittelwert festgestellt.<br />
Der Mittelwert für die Anzahl der Identifikationen pro Text beträgt 0,18 (0,25). In 5,1 (7,1) %<br />
der Artikel werden mindestens eine Identifikation <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al zwölf Identifikationen codiert.<br />
Der Mittelwert akkreditierter Zeitungen ist mit 0,19 (0,28) höher als der Mittelwert nicht akkreditierter<br />
Zeitungen mit 0,16 (0,22). In 4,8 % (6,8) der Texte akkreditierter Blätter werden<br />
mindestens eine Identifikation <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al zwölf Identifikationen ermittelt. Bei nicht akkreditierten<br />
Zeitungen sind es 5,6 (7,5) % der Artikel, in denen mindestens eine Identifikation <strong>und</strong><br />
max<strong>im</strong>al zehn Identifikationen verwendet werden.<br />
80
Abb. 15: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Identifikationen pro Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Die SVZ ist die Zeitung, die mit 0,62 (0,70) den höchsten Mittelwert aufweist; die LKZ <strong>und</strong><br />
das MT besitzen mit 0,1 (0,2) bzw. mit 0,2 (0,3) die geringsten Werte.<br />
6.1.2 Analyseeinheit Wertende Aussage<br />
In 80 meinungsbetonten Texten werden 675 wertende Aussagen codiert <strong>–</strong> 434 in 55 Artikeln<br />
akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 241 in 25 Beiträgen nicht akkreditierter Zeitungen. 93<br />
Tab. 9: Meinungsbetonte Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Der Mittelwert für die Anzahl wertender Aussagen in den 80 codierten Texten beträgt 8,43<br />
(8,49). Median <strong>und</strong> Modus sind 7,00 (7,00) bzw. 7 (7). 51,3 (50,6) % der relevanten Texte<br />
enthalten mindestens eine <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al sieben Wertungen. In 6,3 (6,3) % der Artikel ist eine<br />
einzige Wertung zu finden, in 18,8 (17,7) % max<strong>im</strong>al drei. Die 55 meinungsbetonten Artikel<br />
der akkreditierten Zeitungen beinhalten durchschnittlich 7,89 (7,98) wertende Aussagen, die<br />
25 Texte der nicht akkreditierten Zeitungen 9,60 (9,60) wertende Aussagen. In 9,1 (9,3) %<br />
der Artikel akkreditierter Zeitungen ist eine einzige Wertung zu finden, in 25,5 (24,1) % max<strong>im</strong>al<br />
drei. Unter den Texten nicht akkreditierter Zeitungen sind 4,0 (4,0) % mit der geringsten<br />
Anzahl an Wertungen <strong>–</strong> mit max<strong>im</strong>al drei <strong>–</strong> zu finden. Der größte Mittelwert beträgt bei<br />
der Kommentierung des MT 11,67 (11,67), der geringste bei der OVZ 5,11 (5,24).<br />
Abb. 16: Durchschnittliche Anzahl identifizierter wertender Aussagen pro meinungsbetonter Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Urheber sind am häufigsten die jeweiligen Urheber des Textes mit 95,6 (95,5) % <strong>–</strong> es folgen<br />
sportexterne Personen mit 3,1 (3,1) %. Bei nicht akkreditierten Zeitungen sind die Text-<br />
Urheber mit 92,1 (92,1) % seltener der Urheber der Wertung als bei akkreditierten Zeitungen<br />
mit 97,5 (7,4) %.<br />
27,7 (27,8) % der 675 identifizierten Wertungen haben als Gegenstand die Ausprägungen<br />
Leistung <strong>und</strong> Lokalkolorit; zusammen mit den beiden nach Häufigkeit nächst folgenden Aus-<br />
93 Weitere Zwischenergebnisse vor der eigentlichen Überprüfung der Hypothese sind zur Analyseeinheit Werten-<br />
de Aussage in Kapitel 6.2.8 <strong>und</strong> 6.2.9 zu finden.<br />
81
prägungen Ästhetik mit 14,8 (14,9) % <strong>und</strong> Organisation mit 13,0 (12,6) % kommen diese vier<br />
am häufigsten codierten Labels auf einen Anteil von 83,2 (83,1) %. 94 Bei akkreditierten Zeitungen<br />
wird die Ausprägung Lokalkolorit mit 27,0 % vor Leistung mit 23,3 % am häufigsten<br />
codiert. Bei nicht akkreditierten Zeitungen rückt die Ausprägung Organisation mit 14,1 % vor<br />
Ästhetik (12,9 %) auf den dritten Platz vor. Die am häufigsten genannten Ausprägungen <strong>–</strong><br />
Leistung, Lokalkolorit, Ästhetik, Organisation <strong>–</strong> sind bei beiden Zeitungsschichten identisch.<br />
Bei nicht akkreditierten Zeitungen kommen diese häufigsten Ausprägungen mit 91,7 % auf<br />
einen höheren Anteil als bei akkreditierten Zeitungen mit 78,6 %. Nach Zeitungen betrachtet,<br />
bildet die EZ eine Ausnahme mit folgenden Anteilen nach der häufigsten Ausprägung Lokalkolorit<br />
mit 33,3 %: Kommerzialisierung 24,6 %, Ästhetik 14,0 %, Ethik 10,5 % <strong>und</strong> Leistung<br />
8,8 %. In der LKZ werden lediglich sieben wertende Aussagen identifiziert.<br />
Abb. 17: Wertende Aussagen nach Gegenstand<br />
59,1 % aller wertenden Aussagen beziehen sich auf das deutsche Team, 11,6 % auf den<br />
jeweiligen Gegner <strong>–</strong> 29,3 % der Aussagen haben sonstige, allgemeine Bezüge. Akkreditierte<br />
Zeitungen beziehen 52,5 % ihrer wertenden Aussagen auf das deutsche Team, 12,7 % auf<br />
die gegnerische Mannschaft <strong>und</strong> 34,8 % auf allgemeine Themen. Bei nicht akkreditierten<br />
Zeitungen stellt sich die Verteilung der Bezüge wie folgt dar: deutsches Team 71,0 %, gegnerisches<br />
Team 9,5 %, sonstige Bezüge 19,5 %. Der größte Anteil Wertungen mit Bezug auf<br />
die deutsche Mannschaft wird bei der HA mit 87,1 % ermittelt, den geringsten Anteil bei der<br />
OVZ mit 41,3 %. Den größten Anteil sich auf den Gegner beziehende wertende Aussagen<br />
hat die LR mit 26,7 %, den geringsten Anteil hat die PZ mit 2,1 %.<br />
Abb. 18: Wertende Aussagen nach Bezug<br />
60,4 % der wertenden Aussagen beinhalten positive Wertungen, 39,6 % negative. Nicht akkreditierte<br />
Zeitungen bewerten mit 61,8 % positiver als akkreditierte Zeitungen mit 59,7 %.<br />
Am positivsten bewertet das MT mit 71,4 %, am wenigsten positiv der HA mit 48,4 %.<br />
94<br />
Da lediglich drei wertende Aussagen der vorliegenden Arbeit von Meldungen stammen, beziehen sich die folgenden<br />
Ergebnisse ausschließlich auf die Texte inklusive Meldungen. Im Anhang sind die Ergebnisse exklusive<br />
Meldungen einsehbar.<br />
82
6.1.3 Analyseeinheit Attribution<br />
Der Mittelwert für die Anzahl der Attributionen in den 129 Texten, in denen Ursachenzuschreibungen<br />
codiert werden, beträgt 6,91 (7,02). Median <strong>und</strong> Modus sind 5,00 (6,00) bzw. 3<br />
(3). 31,8 (30,1) % der relevanten Texte enthalten mindestens eine <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al drei Attributionen.<br />
In 8,5 (8,7) % der Artikel ist eine einzige Ursachenzuschreibung zu finden, in 13,2<br />
(13,5) % max<strong>im</strong>al drei. 95<br />
Abb. 19: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Attributionen pro Artikel 96 <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
Die 55 Artikel mit Attributionen akkreditierter Zeitungen beinhalten durchschnittlich 6,33<br />
(6,41) Ursachenzuschreibungen, die 74 Texte nicht akkreditierter Zeitungen 7,34 (7,49) Attributionen.<br />
In 9,1 (9,3) % der Artikel akkreditierter Zeitungen ist eine Attribution zu finden, in<br />
38,2 (37,0) % max<strong>im</strong>al drei. Unter den Texten nicht akkreditierter Zeitungen sind 8,1 (8,3) %<br />
mit max<strong>im</strong>al einer Attribution <strong>und</strong> 27,0 (25,0) % mit max<strong>im</strong>al drei Attributionen zu finden. Der<br />
höchste Mittelwert beträgt be<strong>im</strong> HA 9,59 (9,59), der geringste bei der LR 4,65 (4,81).<br />
71,4 (71,6) %) aller Attributionen beziehen sich auf das deutsche Team <strong>–</strong> die Restanteile<br />
entfallen jeweils auf die gegnerische Mannschaft. Ursachenzuschreibungen akkreditierter<br />
Zeitungen betreffen zu 67,0 (66,8) % das deutsche Team. Bei nicht akkreditierten Zeitungen<br />
werden 74,3 (74,6) % der Attributionen mit Bezug auf das deutsche Team codiert. Der größte<br />
Anteil Attributionen mit Bezug auf die deutsche Mannschaft wird bei der SVZ mit 79,7<br />
(79,7) % ermittelt, der geringsten Anteil bei der PZ mit 58,7 (58,7) %.<br />
Urheber der Attributionen sind am häufigsten die jeweiligen Text-Urheber mit 70,6 (71,1) % <strong>–</strong><br />
es folgen aktive Sportler mit 12,3 (12,0) %. Bei nicht akkreditierten Zeitungen sind die Text-<br />
Urheber mit 65,1 (65,6) % seltener die Urheber der Attribution als bei akkreditierten Zeitungen<br />
mit 79,3 (79,6) %. Mit 92,0 (92,0) % bei der EZ ist am häufigsten der Urheber der Ursachenzuschreibung<br />
der Text-Urheber; bei dem MT mit 53,9 (56,1) % am seltensten.<br />
66,8 % der Attributionen sind Erklärungen zu positiven Ereignissen. Mit 70,6 % bezieht sich<br />
ein größerer Anteil der Ursachenzuschreibungen nicht akkreditierter Zeitungen auf positive<br />
Ereignisse als das bei akkreditierten Zeitungen mit 60,9 % der Fall ist. Bei den Attributionen<br />
des MT wird mit 83,5 % der größte Anteil an Bezügen zu positiven Ereignissen ermittelt, bei<br />
der OVZ mit 55,3 % der kleinste Anteil.<br />
Die am häufigsten codierte Ursache der 892 Attributionen ist mit 55,4 % die Ausprägung internal-variabel.<br />
Für die Ausprägung internal-stabil werden 13,8 % ermittelt, während external-stabil<br />
11,2 % <strong>und</strong> external-variabel 19,2 % erreichten. 0,5 % der identifizierten Ursachenzuschreibungen<br />
konnten anhand dieses Schemas nicht eingeordnet werden. 69,2 % sind<br />
internale Attributionen <strong>–</strong> dies ist mit 72,6 % häufiger der Fall bei nicht akkreditierten Zeitungen<br />
als bei akkreditierten Zeitungen mit 63,5 %, bei denen geringere Prozentwerte bei den<br />
internalen Ausprägungen codiert werden. Am häufigsten internale <strong>und</strong> internal-variable Attri-<br />
95<br />
Weitere Zwischenergebnisse vor der eigentlichen Überprüfung der Hypothese sind zur Analyseeinheit Attribution<br />
in Kapitel 6.2.10 zu finden.<br />
96<br />
Aussagen <strong>und</strong> Berechnungen beziehen sich bei der Analyseeinheit auf 129 relevante Artikel, in denen Ursa-<br />
chenzuschreibungen registriert werden.<br />
83
utionen verwendet mit 79,9 bzw. 64,0 % das MT, am häufigsten externale bzw. externalvariable<br />
Ursachenzuschreibungen benutzt die LR mit 41,8 bzw. 30,4 %.<br />
Abb. 20: Attribution nach Ursache 97<br />
69,0 % der 100 als external-stabil codierten Attributionen beziehen sich auf den Trainer. Bei<br />
akkreditierten Zeitungen betreffen 83,3 % der 42 external-stabilen Ursachenzuschreibungen<br />
den Trainer, bei nicht akkreditierten Zeitungen 58,6 % der relevanten 58 Attributionen.<br />
6.2 Analytische Ergebnisse<br />
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Codierung mit Signifikanztests auf Zusammenhänge<br />
geprüft <strong>–</strong> wie es zur Überprüfung der Hypothesen notwendig ist. Die vollständigen analytischen<br />
Ergebnisse der einzelnen Berechnungen sind jeweils <strong>im</strong> Anhang einsehbar, wenn sie<br />
aus Platzgründen nachfolgend <strong>im</strong> Text nicht aufgeführt sind. Um die Hypothesen detailliert<br />
überprüfen zu können, werden innerhalb jeder Hypothese mindestens vier verschiedene Berechnungen<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage vier Urheber-Ausprägungen bzw. -Kategorien durchgeführt.<br />
4. Zeitungsschicht: akkreditiert/nicht akkreditiert<br />
3. Urheber relevant<br />
2. Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
1. Urheber nur Redakteure<br />
Abb. 21: Vorgehensweise bei der Prüfung der Hypothesen<br />
Begonnen wird mit dem detaillierten Blick auf ausschließlich Texte der Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>–</strong> unterschieden nach akkreditierten <strong>und</strong> nicht akkreditierten Redakteuren der acht<br />
Regionalzeitungen (1.). Danach werden die Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>und</strong> Artikel der Presseagenturen analysiert (2.). Es folgt die Prüfung der Urheber-Kategorie<br />
Urheber relevant, in der Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure allen Artikeln sonstiger<br />
Urheber mit Ausnahme der Ausprägung Experte/Gastautor <strong>und</strong> Agentur/Redaktion<br />
(akkreditiert) gegenübergestellt werden (3). 98 Zuletzt wird die Berechnung anhand der Zeitungsschichten<br />
akkreditiert <strong>und</strong> nicht akkreditiert diskutiert (4).<br />
97<br />
Ohne Berücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> (Nicht (eindeutig) zuzuordnen=.<br />
98<br />
Auf die Diskussion der Vergleiche mit der Variablen Urheber mit den sieben Ausprägungen wird verzichtet. Das<br />
würde die D<strong>im</strong>ension dieser Diplomarbeit übersteigen. Zudem sind die Ergebnisse teilweise aufgr<strong>und</strong> kleiner<br />
Häufigkeiten in einzelnen Ausprägungen unübersichtlich <strong>und</strong> statistisch kompliziert auswertbar.<br />
84
Innerhalb der Urheber-Ausprägungen bzw. -Kategorien erfolgen teilweise weitere Analysen,<br />
wie z.B. ohne die Berücksichtigung von Meldungen, u.a. um die Voraussetzungen für den<br />
Chi-Quadrat-Test zu gewährleisten oder um einen aussagekräftigeren Vergleich der Stichproben<br />
zu erzielen (vgl. BALTES-GÖTZ 2001, 148).<br />
6.2.1 Hypothese 01: Fakten statt Argumente<br />
6.2.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
148 (18,9 %) der insgesamt 782 als relevant identifizierten Texte wurden von Redakteuren<br />
der Regionalzeitungen geschrieben <strong>–</strong> davon 84 Artikel (56,8 %) von für die Spiele akkreditierten<br />
Journalisten <strong>und</strong> 64 Beiträge (43,2 %) von nicht akkreditierten Redakteuren. Die Variable<br />
Urheber nur Redakteure verfügt über die Ausprägungen „1<strong>“</strong> für akkreditiert <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> für<br />
nicht akkreditiert. 99 Bei der Variablen Darstellungsform liegen Ausprägungen „0<strong>“</strong> für Sonstiges,<br />
„1<strong>“</strong> für objektivierend-faktizierend, „2<strong>“</strong> für Mischform <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> für subjektivierendargumentierend<br />
vor.<br />
Werden die Variable Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> die abhängige (bzw. als abhängig angesehene)<br />
Variable Darstellungsform kreuztabelliert, ergibt sich die unten nachfolgend abgedruckte<br />
Kreuztabelle (Tab. 10). Mit dem Chi-Quadrat-Test wird die Unabhängigkeit der beiden<br />
Variablen der Kreuztabelle überprüft. Die standardisierten Residuen von 2 <strong>und</strong> größer<br />
bei den Ausprägungen objektivierend-faktizierend <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierend zeigen<br />
eine signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an (vgl.<br />
BÜHL 2006, 209). 100<br />
Tab. 10: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Darstellungsform<br />
Bei Texten akkreditierter Redakteure werden häufiger objektivierend-faktizierende <strong>und</strong> seltener<br />
subjektivierend-argumentierende Beiträge codiert als erwartet. Bei Artikeln nicht akkreditierter<br />
Redakteure sind die Werte gegenläufig. Es ergibt sich nach Pearson ein höchst signifikanter<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 18,521, der bei drei Freiheitsgraden die Nullhypothese<br />
verwerfen lässt. Die Variablen sind nicht unabhängig voneinander, was die höchst signifikanten<br />
Ergebnisse (p = 0,000) nach dem exakten Test nach Fisher bestätigen. 101<br />
99<br />
Die vorliegenden Codierungen der Variablen Urheber mit den relevanten Ausprägungen „1<strong>“</strong> Redaktion (nicht<br />
akkreditiert) <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> Redaktion (akkreditiert) wurden zu der neuen <strong>dich</strong>otomen Variablen Urheber nur Redakteure<br />
mit den Ausprägungen akkreditiert <strong>und</strong> nicht akkreditiert umcodiert.<br />
100<br />
Laut BÜHL 2006 liegt ein signifikanter Unterschied zwischen beobachteter <strong>und</strong> erwarteter Häufigkeit vor, wenn<br />
das standardisierte Residuum einen Wert größer oder gleich 2 hat. Wenn das standardisierte Residuum einen<br />
Wert größer oder gleich 2,6 hat, besteht ein sehr signifikanter Unterschied. 3,3 ist der Grenzwert für höchste<br />
Signifikanz (BÜHL 2006, 209).<br />
101<br />
Das Ergebnis des exakten Tests nach Fisher wird herangezogen, weil der Chi-Quadrat-Test nach Pearson<br />
voraussetzt, dass in max<strong>im</strong>al 20 % der Felder der Kreuztabelle erwartete Häufigkeiten kleiner 5 auftreten dürfen.<br />
Dies ist bei der vorliegenden Berechnung nicht gewährleistet: 25 % der Zellen haben eine erwartete Häufigkeit<br />
kleiner 5 (vgl. BALTES-GÖTZ 2001, 147f; BÜHL 2006, 209).<br />
85
Tab. 11: Chi-Quadrat Test Urheber nur Redakteure × Darstellungsform 102<br />
Nach der Bestätigung des statistischen Zusammenhangs zwischen den Variablen soll eine<br />
Aussage über die Stärke, Art <strong>und</strong> Richtung der Beziehung getroffen werden. Da ordinalskalierte<br />
bzw. zweifach abgestufte nominalskalierte Variablen vorliegen, wird der Spearman’sche<br />
Korrelationskoeffizient benutzt (vgl. ebd., 262). 103<br />
Tab. 12: Symmetrische Maße Urheber nur Redakteure × Darstellungsform<br />
Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt <strong>im</strong> vorliegenden Fall 0,346 <strong>und</strong> ist höchst<br />
signifikant (p = 0,000). Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,354 ermittelt.<br />
Zwischen den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Darstellungsform liegt nach<br />
BÜHL eine geringe Korrelation vor, die Variablen sind positiv korreliert (vgl. BÜHL 2006,<br />
263). Texte akkreditierter Redakteure sind häufiger objektivierend-faktizierend als Texte nicht<br />
akkreditierter Journalisten der Regionalzeitungen.<br />
U.a., weil die Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test nicht erfüllt sind, werden die Berechnungen<br />
zur Überprüfung signifikanter Unterschiede zusätzlich ohne die Ausprägungen<br />
„0<strong>“</strong> (Sonstiges) <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> (Mischform) der Variablen Darstellungsform durchgeführt (vgl. BAL-<br />
TES-GÖTZ 2001, 147f.).<br />
Während 66,2 % der Texte akkreditierter Redakteure objektivierend-faktizierend sind, sind es<br />
31,5 % der Texte nicht akkreditierter Redakteure. Die Werte der standardisierten Residuen<br />
weisen auf eine signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit bei<br />
den nicht akkreditierten Redakteuren hin. Bei den Texten akkreditierter Redakteure werden<br />
häufiger objektivierend-faktizierende <strong>und</strong> seltener subjektivierend-argumentierende Beiträge<br />
codiert als erwartet. Bei den Zeitungsartikeln nicht akkreditierter Redakteure stellen sich die<br />
Werte gegenläufig dar. Der Chi-Quadrat-Wert nach Pearson von 14,795 ist höchst signifikant<br />
(p = 0,000). Bei einem Freiheitsgrad wird die Nullhypothese verworfen <strong>–</strong> die Variablen sind<br />
voneinander abhängig. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p =<br />
0,000) beträgt 0,344. Zwischen den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Darstellungsform<br />
liegt eine geringe Korrelation vor. Texte akkreditierter Redakteure sind unter Nichtberücksichtigung<br />
der Ausprägungen Sonstiges <strong>und</strong> Mischform der Variablen Darstellungsform häu-<br />
102<br />
Chi-Quadrat-Test-Ergebnisse <strong>und</strong> symmetrischen Maße werden exemplarisch vollständig als Tabellen in den<br />
Text integriert. Aus Platzgründen sind diese Tabellen nicht <strong>im</strong>mer komplett <strong>im</strong> Text zu finden (siehe Anhang).<br />
103<br />
Es kann diskutiert werden, ob die Variable Darstellungsform mit der Auffangausprägung „0<strong>“</strong> (Sonstiges ) ordinalskaliert<br />
ist oder nicht. Aus diesem Gr<strong>und</strong> werden zusätzlich jeweils Berechnungen ohne Ausprägung „0<strong>“</strong> der<br />
Variablen Darstellungsform durchgeführt <strong>und</strong> es wird zusätzlich <strong>–</strong> <strong>im</strong> Fall der Berechnungen inklusive Ausprägung<br />
„0<strong>“</strong> <strong>–</strong> zum Spearman-Korrelationskoeffizienten der Cramer-V-Wert angegeben.<br />
86
figer objektivierend-faktizierend als Texte nicht akkreditierter Journalisten der untersuchten<br />
Regionalzeitungen. 104<br />
Tab. 13: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Darstellungsform (ohne „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>)<br />
Die Ergebnisse aller vier Berechnungen zu der Beziehung der beiden Variablen zeigen <strong>–</strong> vor<br />
allem auf die Darstellungsformen objektivierend-faktizierend <strong>und</strong> subjektivierendargumentierend<br />
bezogen: Niedrige Werte der Variablen Urheber nur Redakteure gehen mit<br />
niedrigen Werten der Variablen Darstellungsform einher sowie hohe Werte der Variablen<br />
Urheber nur Redakteure mit hohen Werten der Variablen Darstellungsform. Texte akkreditierter<br />
Redakteure sind häufiger als erwartet objektivierend-faktizierend, Artikel nicht akkreditierter<br />
Redakteure sind häufiger als erwartet subjektivierend-argumentierend.<br />
6.2.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Von den 513 bei dieser Berechnung relevanten Texten stammen 84 (16,4 %) von akkreditierten<br />
Regionalzeitungsredakteuren <strong>und</strong> 429 (83,6 %) von Presseagenturen. Akkreditierte Redakteure<br />
berichten höchst signifikant seltener objektivierend-faktizierend sowie höchst signifikant<br />
häufiger subjektivierend-argumentierend <strong>und</strong> mit Mischformen als erwartet, wie die<br />
Werte der standardisierten Residuen anzeigen.<br />
Tab. 14: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Darstellungsform<br />
104<br />
Ohne Meldungen ergeben sich aus 145 Texten mit der Warnung, dass 25 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit<br />
kleiner 5 haben, ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 20,607 <strong>und</strong> ein höchst signifikanter<br />
Wert (p = 0,000) des exakten Tests nach Fisher; der Spearman’sche Korrelationskoeffizient von 0,367 ist ebenfalls<br />
höchst signifikant (p = 0,000). Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,377 ermittelt. Bei<br />
der Berechnung exklusive Meldungen <strong>und</strong> Darstellungsform-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> werden 123 Texte berücksichtigt<br />
<strong>–</strong> der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) beträgt 16,482; der Spearman’sche Korrelationskoeffizient<br />
von 0,366 ist höchst signifikant (p = 0,000). Die Ergebnisse der beiden zusätzlich ohne Meldungen<br />
durchgeführten Analysen belegen eine geringe Korrelation, die Nullhypothesen werden verworfen.<br />
87
Presseagenturen berichten in den untersuchten Zeitungen höchst signifikant seltener meinungsbetont<br />
als erwartet. Es ergeben sich be<strong>im</strong> Chi-Quadrat-Test nach Pearson <strong>und</strong> be<strong>im</strong><br />
exakten Test nach Fisher höchst signifikante Wert (p = 0,000). Die Nullhypothese wird verworfen.<br />
Betrachtet man die standardisierten Residuen, so erkennt man, dass die Signifikanz<br />
vor allem in den Feldern akkreditierter Redakteure begründet liegt. Der höchst signifikante<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) beträgt -0,406. Der höchst signifikante<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,533 ermittelt. Zwischen den Ausprägungen „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong><br />
der Variablen Urheber <strong>und</strong> der Variablen Darstellungsform liegt laut Spearman’schem Korrelationskoeffizienten<br />
eine geringe Korrelation vor. Texten akkreditierter Redakteure sind häufiger<br />
als erwartet Mischformen <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen<br />
zuzuordnen als Agentur-Texten, die seltener als erwartet meinungsbetont sind.<br />
Akkreditierte Redakteure berichten unter Nichtberücksichtigung der Meldungen sehr signifikant<br />
seltener objektivierend-faktizierend sowie höchst signifikant häufiger subjektivierendargumentierend<br />
<strong>und</strong> signifikant häufiger mit Mischformen als erwartet. Subjektivierendargumentierende<br />
Berichterstattung findet höchst signifikant seltener als erwartet in den Agentur-Texten<br />
statt. Meinungsbetonte Artikel machen ohne Meldungen zu berücksichtigen<br />
bei den Texten akkreditierter Redakteure 28,0 % aus, bei Agentur-Beiträgen 0,3 %. Bei der<br />
Überprüfung der Unabhängigkeit der Ausprägungen „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> der Variablen Urheber <strong>und</strong><br />
der Variablen Darstellungsform ohne Berücksichtigung der Meldungen ergeben sich nach<br />
dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson <strong>und</strong> nach dem exakten Test nach Fisher höchst signifikante<br />
Werte (p = 0,000). Die aufgestellte Nullhypothese wird verworfen. Es besteht keine<br />
Unabhängigkeit. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000)<br />
beträgt -0,381. Es liegt eine geringe Korrelation vor. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert<br />
(p = 0,000) wird mit 0,502 ermittelt. 105<br />
6.2.1.3 Urheber relevant<br />
Von den 762 als relevant identifizierten Texten wurden 84 (11,0 %) von akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
<strong>und</strong> 678 (89,0 %) von sonstigen nicht als akkreditiert geltenden Autoren<br />
der Regionalzeitungen geschrieben, wie z.B. von nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
oder Agentur-Journalisten. 106 Akkreditierte Urheber relevant berichten signifikant<br />
seltener objektivierend-faktizierend <strong>und</strong> sehr signifikant häufiger mit Mischformen sowie<br />
höchst signifikant häufiger subjektivierend-argumentierend als erwartet. Bei den Texten nicht<br />
akkreditierter Urheber relevant st<strong>im</strong>men die beobachteten Häufigkeiten mit den erwarteten<br />
Häufigkeiten <strong>im</strong> Rahmen der Signifikanz-Grenzwerte überein <strong>–</strong> einzig das standardisierte<br />
Residuum bei der Darstellungsform subjektivierend-argumentierend von -2,3 zeigt eine signifikante<br />
Abweichung der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an.<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
66,589. Die Nullhypothese wird verworfen. Betrachtet man die standardisierten Residuen, so<br />
erkennt man, dass die Signifikanz vor allem in den Feldern akkreditiert begründet liegt. Der<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt -0,244 <strong>und</strong> ist höchst signifikant (p = 0,000).<br />
Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,296 ermittelt. Zwischen den<br />
Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Darstellungsform liegt eine geringe Korrelation vor.<br />
105<br />
Ohne die Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform ergeben sich aus 483 Texten mit der<br />
Warnung, dass 25 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner 5 haben, höchst signifikante Werte (p = 0,000)<br />
be<strong>im</strong> Chi-Quadrat-Test <strong>und</strong> be<strong>im</strong> exakten Test nach Fisher; der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient<br />
(p = 0,000) beträgt -0,536. Bei der Berechnung exklusive Meldungen <strong>und</strong> Darstellungsform-<br />
Ausprägungen Sonstiges <strong>und</strong> Mischform werden 347 Texte berücksichtigt. Die Werte des Chi-Quadrat-Tests <strong>und</strong><br />
des exakten Tests nach Fisher sowie des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten von -0,514 sind jeweils<br />
höchst signifikant (p = 0,000). Es wird eine mittlere Korrelation belegt, die Nullhypothesen werden verworfen.<br />
106<br />
Die vorliegenden Codierungen der Variablen Urheber mit sieben Ausprägungen wurden zu der neuen Variablen<br />
Urheber relevant mit den beiden Ausprägungen akkreditiert <strong>und</strong> nicht akkreditiert umcodiert. Experten-<br />
Beiträge <strong>und</strong> Texte der Mischform Agentur/Redaktion (akkreditiert) sind ausgeschlossen, da diese nicht eindeutig<br />
<strong>im</strong> Forschungsinn als akkreditiert oder nicht akkreditiert eingeordnet werden können.<br />
88
Tab. 15: Kreuztabelle Urheber relevant × Darstellungsform<br />
Texten der akkreditierten Urheber relevant sind häufiger als erwartet Mischformen <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende<br />
Darstellungsformen zuzuordnen, Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber relevant seltener als erwartet subjektivierend-argumentierende Beiträge.<br />
Da nur 12,5 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner 5 aufweisen, wird auf die Diskussion<br />
der separaten Berechnung exklusive Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform<br />
verzichtet. 107 Nicht weggelassen wird die Erläuterung der Analyse ohne Meldungen,<br />
da sich die Anteile an Meldungen <strong>stark</strong> unterscheiden <strong>und</strong> es deshalb zu Verzerrungen<br />
bei den Ergebnissen kommen könnte, weil kurze Texte eher objektivierend-faktizierenden als<br />
subjektivierend-faktizierenden Charakter haben dürften.<br />
Tab. 16: Kreuztabelle Urheber relevant × Darstellungsform (ohne Meldungen)<br />
Akkreditierte Urheber relevant berichten unter Nichtberücksichtigung der Meldungen häufiger<br />
subjektivierend-argumentierend als erwartet. Das auf eine höchst signifikante Abweichung<br />
hinweisende standardisierende Residuum beträgt 4,4. Bei der Überprüfung der Unabhängigkeit<br />
der Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Darstellungsform ohne Berücksichtigung der Meldungen<br />
ergibt sich nach Pearson ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
31,307. Die Nullhypothese wird verworfen. Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt<br />
-0,217 <strong>und</strong> ist höchst signifikant (p = 0,001). Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p =<br />
0,000) wird mit 0,243 ermittelt. Zwischen den Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Darstellungsform<br />
liegt eine geringe Korrelation vor. Sie ist etwas geringer als bei der Berechnung inklusive<br />
Meldungen. Die Beziehung ist vor allem darin begründet, dass Texten der akkreditierten<br />
Urheber relevant häufiger als erwartet subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen<br />
zugeordnet sind.<br />
107<br />
Diese Berechnungen ergeben ebenfalls geringe Korrelationen (siehe Anhang). Erinnert sei an die oben erwähnte<br />
Frage der Ordinalskalierung der Variablen Darstellungsform inklusive der Auffangausprägung „0<strong>“</strong> (Sonstiges).<br />
89
6.2.1.4 Zeitungsschicht<br />
Während 76,9 % der Texte akkreditierter Zeitungen als objektivierend-faktifizierend codiert<br />
werden, sind es 81,8 % der Texte nicht akkreditierter Zeitungen. Akkreditierte Regionalzeitungen<br />
weisen eine geringere Anzahl dieser tatsachenbetonten journalistischen Darstellungsform<br />
auf als erwartet; bei den nicht akkreditierten Regionalzeitungen ist die beobachtete<br />
Häufigkeit größer als die erwartete Häufigkeit. Die standardisierten Residuen bei der meinungsbetonten<br />
Darstellungsform von 1,5 <strong>und</strong> -1,7 weisen nicht auf signifikante Abweichungen<br />
hin.<br />
Tab. 17: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Darstellungsform<br />
Nach Pearson ergibt sich ein nicht signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,140) von 5,474,<br />
d.h., dass bei drei Freiheitsgraden die Nullhypothese bestätigt wird <strong>–</strong> die Variablen sind voneinander<br />
unabhängig.<br />
Besteht ein Zusammenhang zwischen den Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Darstellungsform,<br />
wenn Meldungen nicht berücksichtigt werden? In allen Zellen der Kreuztabelle wird bei den<br />
standardisierten Residuen kein Wert von 2 oder größer erreicht, was eine signifikante Abweichung<br />
anzeigen würde. Bei der Ausprägung subjektivierend-argumentierend sind mit 1,8<br />
<strong>und</strong> -1,9 die größten Unterschiede festzustellen. Die untersuchten akkreditierten Zeitungen<br />
verwenden diese Darstellungsform häufiger als erwartet, nicht akkreditierte Zeitungen seltener<br />
als erwartet.<br />
Tab. 18: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Darstellungsform (ohne Meldungen)<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,048) von 7,893. Die<br />
Nullhypothese wird bei drei Freiheitsgraden verworfen. Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient<br />
beträgt -0,096 <strong>und</strong> ist signifikant (p = 0,024). Der signifikante Cramer-V-Wert (p =<br />
0,048) wird mit 0,120 ermittelt. Zwischen den Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Darstellungs-<br />
90
form liegt eine sehr geringe Korrelation vor, wenn Meldungen bei der Analyse unberücksichtigt<br />
bleiben. 108<br />
6.2.2 Hypothese 02: Eigene Themensetzung<br />
6.2.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Variable Anlass verfügt über die Ausprägungen „0<strong>“</strong> für Anlass unklar, „1<strong>“</strong> für kein äußerer<br />
Anlass, „2<strong>“</strong> für Medien als Anlass, „3<strong>“</strong> für öffentlicher Anlass <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> für anderes System als<br />
Anlass. Werden die Variable Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> die Variable Anlass kreuztabelliert,<br />
ergibt sich nachfolgend abgedruckte Tabelle (Tab. 19). Bei den Ausprägungen „1<strong>“</strong> bis<br />
„3<strong>“</strong> der Variablen Anlass st<strong>im</strong>men die beobachteten Häufigkeiten signifikant nicht mit den<br />
erwarteten Häufigkeiten überein <strong>–</strong> die standardisierten Residuen weisen Werte von -2,2 bzw.<br />
2,1 bis -2,4 bzw. 2,5 auf. Bei den Texten akkreditierter Redakteure werden signifikant seltener<br />
Texte mit redaktionsinternem Anlass zur Berichterstattung verschlüsselt als erwartet,<br />
Texte mit Medien als Anlass <strong>und</strong> mit öffentlichem Anlass werden dagegen signifikant häufiger<br />
als erwartet gef<strong>und</strong>en. Bei den Artikeln nicht akkreditierter Redakteure werden gegenläufige<br />
Werte festgestellt: Kein äußerer Anlass wird signifikant häufiger beobachtet als erwartet,<br />
Texte mit Medien als Anlass <strong>und</strong> mit öffentlichem Anlass werden dagegen signifikant seltener<br />
als erwartet nachgewiesen.<br />
Tab. 19: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Anlass<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
32,070. 109 Die Nullhypothese wird verworfen. Zur Best<strong>im</strong>mung des Grades der Abhängigkeit<br />
werden Assoziationsmaße für nominalskalierte Variablen herangezogen, weil die Variable<br />
Anlass weder ordinalskaliert noch <strong>dich</strong>otom nominalskaliert ist. Da Cramers V unabhängig<br />
von der Anzahl der Zeilen <strong>und</strong> Spalten ist, wird dieser höchst signifikante Wert (p = 0,000)<br />
diskutiert. Cramers V = 0,465 belegt eine geringe Korrelation zwischen den Variablen. 110<br />
108<br />
Ohne die Darstellungsform-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> ergibt sich aus 698 Texten ein signifikanter Chi-Quadrat-<br />
Wert (p = 0,020) von 5,483. Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt -0,088 <strong>und</strong> ist ebenfalls signifikant<br />
(p = 0,020). Bei der Berechnung exklusive Meldungen <strong>und</strong> Darstellungsform-Ausprägungen Sonstiges <strong>und</strong> Mischform<br />
werden 473 Texte berücksichtigt <strong>–</strong> der sehr signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,005) beträgt 7,736; der<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (-0,128) ist höchst signifikant (p = 0,005). Es besteht in beiden Fällen eine<br />
sehr geringe Korrelation; die Nullhypothesen werden jeweils verworfen.<br />
109<br />
Die Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test sind mit 20,0 % der Zellen mit einer erwarteten Häufigkeit<br />
kleiner 5 erfüllt. Der höchst signifikante Wert (p = 0,000) des exakten Tests nach Fisher unterstützt das Ergebnis.<br />
110<br />
Bei der Berechnung ohne die Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass weisen die standardisierten<br />
Residuen Werte von -2,4 bis 2,3 auf signifikante Abweichungen hin. Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p<br />
= 0,000) beträgt nach Pearson 30,656. Der höchst signifikante Cramers-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,499 angegeben.<br />
Ohne Meldungen betragen Chi-Quadrat 33,977 <strong>und</strong> Cramers V 0,484 <strong>–</strong> beide Werte sind höchst signifikant<br />
(p = 0,000). Bei den standardisierten Residuen werden Werte von -2,4 bis 2,7 angegeben. Die genannten<br />
Berechnungen weisen auf eine geringe Korrelation zwischen den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Anlass<br />
hin. Die Nullhypothesen werden verworfen. Unter Nichtberücksichtigung der Meldungen <strong>und</strong> der Ausprägungen<br />
91
6.2.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
39,3 % der Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure beziehen sich auf redaktionsinterne<br />
Anlässe, bei Urheber Agentur weisen 3,5 % der Texte diesen Bezug auf, bei dem in<br />
der Kreuztabelle die größten Werte der standardisierten Residuen nachgewiesen werden.<br />
Diese standardisierten Residuen zeigen mit Werten von 9,0 bzw. -4,0 höchst signifikante<br />
Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an.<br />
Tab. 20: Kreuztabelle Urheber ( „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Anlass<br />
Bei den Anlass-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> werden bei den akkreditierten Redakteuren signifikante<br />
bzw. höchst signifikante Abweichungen ermittelt. Ihre Texte beziehen sich seltener als<br />
erwartet auf unklare Anlässe <strong>und</strong> auf andere Systeme als Anlass. Es ergibt sich nach Pearson<br />
ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 120,129. Die Nullhypothese<br />
wird verworfen. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,484 belegt eine<br />
geringe Korrelation zwischen den Variablen. 111<br />
6.2.2.3 Urheber relevant<br />
Werden die Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Anlass kreuztabelliert, wird deutlich, dass es bei<br />
den Ausprägungen öffentlicher Anlass (0,4 <strong>und</strong> -0,1), Medien als Anlass (1,5 <strong>und</strong> -0,5) <strong>und</strong><br />
anderes System als Anlass (-1,7 <strong>und</strong> 0,6) keine signifikanten Abweichungen zwischen beobachteten<br />
<strong>und</strong> erwarteten Häufigkeiten gibt, wie an den genannten Werten der standardisierten<br />
Residuen zu erkennen ist. Dagegen beziehen sich die Texte akkreditierter Urheber relevant<br />
höchst signifikant seltener auf unklare Anlässe <strong>und</strong> höchst signifikant häufiger auf redaktionsinterne<br />
Anlässe; bei den Texten nicht akkreditierter Urheber relevant verhält es sich<br />
(ohne Signifikanz anzeigend) gegenläufig.<br />
„0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass belegen ein Chi-Quadrat-Wert von 32,018 <strong>und</strong> ein Cramers-V-Wert von 0,514<br />
eine mittlere Korrelation <strong>–</strong> beide Werte sind höchst signifikant (p = 0,000). Die Nullhypothese wird verworfen.<br />
111<br />
Bei der Berechnung exklusive Meldungen wird aufgr<strong>und</strong> der Werte der standardisierten Residuen ersichtlich,<br />
dass akkreditierte Redakteure der Regionalzeitungen höchst signifikant häufiger Texte mit keinem äußeren Anlass<br />
sowie höchst signifikant seltener Artikel mit unklarem Anlass <strong>und</strong> signifikant seltener mit anderem System als<br />
Anlass verwenden. Bei den Agentur-Beiträgen weist ein standardisiertes Residuum von -3,5 darauf hin, dass<br />
höchst signifikant seltener redaktionsinterne Anlasse codiert werden. Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p<br />
= 0,000) <strong>und</strong> der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,447 belegen die Abhängigkeit bzw. eine<br />
geringe Korrelation. Bei Löschung der Ausprägungen Anlass „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass zeigen die signifikanten<br />
bzw. höchst signifikanten Werte der standardisierten Residuen an, dass akkreditierte Redakteure höchst<br />
signifikant häufiger als erwartet Texte mit redaktionsinternen Anlassen sowie signifikant seltener als erwartet<br />
Texte mit öffentlichen Anlässen schreiben. Bei Agentur-Journalisten wird höchst signifikant seltener als erwartet<br />
die Ausprägung Kein äußerer Anlass verschlüsselt. Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) <strong>und</strong> der<br />
höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,445 belegen die Abhängigkeit bzw. eine geringe Korrelation.<br />
Ohne Meldungen <strong>und</strong> die Ausprägungen Anlass „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass zu berücksichtigen, ergibt sich<br />
mit 0,000 asymptotischer Signifikanz ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert. Die Nullhypothese wird verworfen.<br />
Der höchst signifikante Cramer-V-Wert von 0,397 belegt einen geringen Zusammenhang.<br />
92
Tab. 21: Kreuztabelle Urheber relevant × Anlass<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
66,412. Die aufgestellte Nullhypothese wird verworfen. Der höchst signifikante Cramers-V-<br />
Wert (p = 0,000) beträgt 0,295. Zwischen den Variablen liegt eine geringe Korrelation vor. 112<br />
6.2.2.4 Zeitungsschicht<br />
20,4 % der Texte akkreditierter Zeitungen beziehen sich auf öffentliche Anlässe, bei nicht<br />
akkreditierten Zeitungen weisen 27,4 % der Texte diesen Bezug auf, bei dem in der Kreuztabelle<br />
die größten Werte der standardisierten Residuen nachgewiesen werden können. Diese<br />
zeigen mit Werten von -1,3 <strong>und</strong> 1,5 keine signifikanten Abweichungen der beobachteten von<br />
der erwarteten Häufigkeit an.<br />
Tab. 22: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Anlass<br />
Bei dieser Berechnung ergibt sich nach Pearson ein nicht signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,058) von 9,109. Die Nullhypothese wird bestätigt; die beiden Variablen sind unabhängig<br />
voneinander. Ohne die Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass ergibt sich ein nicht<br />
signifikanter Chi-Quadrat-Wert.<br />
Bei der Berechnung unter Nichtberücksichtigung der beiden Ausprägungen Anlass „0<strong>“</strong> <strong>und</strong><br />
„4<strong>“</strong> der Variablen Anlass werden insgesamt keine Werte der standardisierten Residuen ermit-<br />
112<br />
Unter Nichtberücksichtigung der Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen Anlass wird Cramers V mit 0,212<br />
angegeben. Unter Nichtberücksichtigung der Meldungen mit 0,255. Cramers V <strong>und</strong> Chi-Quadrat liefern jeweils<br />
höchst signifikante Werte (p = 0,000). Unter Nichtberücksichtigung der Meldungen <strong>und</strong> der Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong><br />
„4<strong>“</strong> der Variablen Anlass beträgt Chi-Quadrat 7,879 <strong>und</strong> Cramers V 0,163 <strong>–</strong> beiden Werte sind signifikant (p =<br />
0,019). Die Werte dieser Berechnungen belegen, dass die Nullhypothese jeweils verworfen wird <strong>und</strong> dass eine<br />
geringe bis sehr geringe Korrelation zwischen den Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Anlass besteht.<br />
93
telt, die signifikante Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeiten anzeigen.<br />
Ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong> die Ausprägungen Anlass „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> der Variablen<br />
Anlass zu berücksichtigen, ergeben sich mit 0,036 bzw. 0,024 asymptotischer Signifikanz<br />
signifikante Chi-Quadrat-Werte (p ≤ 0,05). Die aufgestellte Nullhypothese wird jeweils<br />
verworfen. Cramers-V-Werte von 0,137 bzw. 0,154 belegen einen sehr geringen Zusammenhang.<br />
6.2.3 Hypothese 03: Kaum Konflikthaltiges<br />
6.2.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
65,5 % der Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure weisen eine neutrale Valenz des<br />
Geschehens auf, der Anteil der Texte nicht akkreditierter Kollegen ist 68,8 %. Wie bei dieser<br />
Ausprägung liegen die Anteile der Stichproben an den jeweiligen Ausprägungen nah beieinander;<br />
die Werte der standardisierten Residuen zeigen keine signifikanten Abweichungen<br />
der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an. Nach Pearson ergibt sich mit 0,222<br />
ein kleines, nicht signifikantes Chi-Quadrat (p = 0,974), das auf keinen bestehenden Zusammenhang<br />
zwischen den Variablen hindeutet, was aufgr<strong>und</strong> der nicht gewährleisteten<br />
Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test durch den nicht signifikanten Wert (p = 0,979)<br />
des exakten Tests nach Fisher unterstützt wird. Unterschiede sind zufällig zustande gekommen,<br />
die Nullhypothese wird angenommen.<br />
Tab. 23: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Valenz des Geschehens<br />
Da be<strong>im</strong> Chi-Quadrat-Test in 25,0 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner 5 auftritt<br />
<strong>und</strong> damit die Voraussetzungen für diesen Test nicht erfüllt sind, erfolgen weitere Berechnung.<br />
Zunächst wird die Ausprägung „1<strong>“</strong> (negativ) ausgeklammert.<br />
Tab. 24: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Valenz des Geschehens (ohne „1<strong>“</strong>)<br />
94
Wie die oben abgebildete Tabelle (Tab. 24) zeigt, weisen bei dieser Berechnung die standardisierten<br />
Residuen keine signifikanten Abweichungen auf. Ein kleiner, nicht signifikanter<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,895) nach Pearson von 0,222 deutet auf keinen bestehenden Zusammenhang<br />
zwischen den Variablen hin. Unterschiede sind zufällig zustande gekommen,<br />
die Nullhypothese wird angenommen. 113<br />
6.2.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Die standardisierten Residuen zeigen mit Werten kleiner 2 keine signifikanten Abweichungen<br />
der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an. 4,8 % der Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
weisen eine negative Valenz des Geschehens auf, der Anteil der Agentur-Texte<br />
bei dieser Ausprägung ist 13,1 %. Die Texte akkreditierter Redakteure sind <strong>–</strong><br />
wie die Werte der standardisierten Residuen von -1,9 bzw. 1,5 dokumentieren <strong>–</strong> ohne signifikante<br />
Abweichungen anzeigend seltener negativ <strong>und</strong> häufiger positiv als erwartet.<br />
Tab. 25: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Valenz des Geschehens<br />
Nach Pearson ergibt sich ein bei drei existierenden Freiheitsgraden signifikanter Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,049) von 7,838. Die Nullhypothese wird nicht bestätigt. Unterschiede<br />
kommen überzufällig zustande. Der signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,049) wird mit 0,124<br />
angegeben. Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient ist nicht signifikant (p = 0,837) <strong>und</strong><br />
beträgt 0,009.<br />
Nach Pearson werden bei den Berechnungen ohne Ausprägung „0<strong>“</strong> der Variablen Valenz<br />
des Geschehens signifikante Chi-Quadrat-Wert ermittelt <strong>–</strong> die p-Werte betragen 0,021 bzw.<br />
ohne Meldungen 0,043. Die Nullhypothese wird jeweils nicht bestätigt. Unterschiede kommen<br />
überzufällig zustande. Der Wert des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten ist sehr<br />
signifikant (p = 0,006) bzw. ohne Meldungen signifikant (p = 0,013) <strong>und</strong> beträgt -0,194 bzw.<br />
ohne Meldungen -0,197. Es liegt jeweils eine sehr geringe Korrelation vor. 114<br />
113<br />
Die standardisierten Residuen bei der Berechnung ohne Meldungen zeigen -0,4 bzw. 0,3 oder kleiner an.<br />
Nach dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson <strong>und</strong> nach dem exakten Test nach Fisher ergeben sich mit 0,578 bzw.<br />
0,599 kleine, nicht signifikante Werte (p = 0,902 bzw. p = 0,928). Ohne Meldungen <strong>und</strong> ohne die Ausprägung „1<strong>“</strong><br />
der Variablen Valenz des Geschehens werden folgende Ergebnisse ermittelt: standardisierte Residuen von -0,3<br />
bzw. 0,3 <strong>und</strong> kleiner, ein kleines, nicht signifikantes Chi-Quadrat (p = 0,854) von 0,316. Diese Werte zeigen, dass<br />
kein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht. Unterschiede sind zufällig zustande gekommen, die Nullhypothese<br />
wird jeweils angenommen. Zwei zusätzliche Berechnungen ohne die Ausprägung „0<strong>“</strong> der Variablen<br />
Valenz des Geschehens sowie ohne die Ausprägung „0<strong>“</strong> der Variablen Valenz des Geschehens <strong>und</strong> ohne Meldungen<br />
bestätigen die Nullhypothese. Die Berechnungen ohne die Ausprägung „0<strong>“</strong> der Variablen Valenz des<br />
Geschehens werden durchgeführt, weil die Ordinalskalierung der Variablen Valenz inklusive Ausprägung „0<strong>“</strong><br />
diskussionswürdig ist.<br />
114<br />
Die standardisierten Residuen bei der Berechnung ohne Meldungen zeigen -1,9 bzw. 1,0 oder kleiner an. Der<br />
nicht signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,052) beträgt nach Pearson 7,746. Die Nullhypothese wird bei dieser<br />
<strong>und</strong> bei den Analysen ohne Meldungen <strong>und</strong> ohne Ausprägung „1<strong>“</strong> der Variablen Valenz des Geschehens sowie<br />
ohne Ausprägung „1<strong>“</strong> aufgr<strong>und</strong> nicht signifikanter Chi-Quadrat-Werte (p ˃ 0,05) angenommen. Es besteht keine<br />
Abhängigkeit voneinander. Unterschiede kommen zufällig zustande.<br />
95
6.2.3.3 Urheber relevant<br />
Die beobachtete Häufigkeit der Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure mit negativer<br />
Valenz des Geschehens ist kleiner als die erwartete Häufigkeit, die beobachtete Häufigkeit<br />
der Texte mit positiver Valenz des Geschehens ist größer als die erwartete Häufigkeit.<br />
Standardisierte Residuen von -1,7 <strong>und</strong> 1,2 zeigen keine signifikanten Abweichungen an.<br />
Tab. 26: Kreuztabelle Urheber relevant × Valenz des Geschehens<br />
Nach Pearson ergibt sich mit 5,012 ein kleines, nicht signifikantes Chi-Quadrat (p = 0,171),<br />
das auf keinen bestehenden Zusammenhang zwischen den Variablen hindeutet. Unterschiede<br />
sind zufällig zustande gekommen, die Nullhypothese wird angenommen. 115<br />
6.2.3.4 Zeitungsschicht<br />
Die mit -1,5 <strong>und</strong> 1,3 größten Werte der standardisierten Residuen fallen in der Spalte der<br />
Ausprägung positive Valenz auf. Akkreditierte Zeitungen berichten, was die Valenz des Geschehens<br />
betrifft, häufiger positiv als erwartet. Bei nicht akkreditierten Zeitungen ist bei dieser<br />
Ausprägung die beobachtete Häufigkeit kleiner als die erwartete.<br />
Tab. 27: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Valenz des Geschehens<br />
Die Werte der standardisierten Residuen zeigen keine signifikanten Abweichungen an. Nach<br />
Pearson ergibt sich ein bei drei existierenden Freiheitsgraden nicht signifikanter Chi-<br />
115<br />
Bei der Berechnung ohne Meldungen zeigen die standardisierten Residuen von -1,5 <strong>und</strong> 1,0 <strong>und</strong> kleiner sowie<br />
ein nicht signifikantes Chi-Quadrat (p = 0,215) von 4,666, dass kein Zusammenhang zwischen den Variablen<br />
besteht. Bei beiden oben diskutierten Berechnungen nehmen die Werte der standardisierten Residuen bei den<br />
akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren größere Werte als bei den nicht akkreditierten Urhebern relevant ein.<br />
Auf die Darstellung weiterer Berechnungen mit den Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Valenz des Geschehens wird<br />
verzichtet, da die Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test bei den beiden vorgestellten Analysen erfüllt sind.<br />
Die vier weiteren Analysen lassen die Nullhypothese annehmen (siehe Anhang).<br />
96
Quadrat-Wert (p = 0,163) von 5,126. Die Nullhypothese wird bestätigt; die beiden Variablen<br />
sind unabhängig voneinander. Unterschiede kommen zufällig zustande. 116<br />
6.2.4 Hypothese 04: Oberfläche statt Hintergr<strong>und</strong><br />
6.2.4.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Variable Argumentationstiefe weist die Ausprägungen „1<strong>“</strong> Thematisierung, „2<strong>“</strong> Hintergr<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> „3<strong>“</strong> Interpretation auf. Da aufgr<strong>und</strong> der seltenen Besetzung der Spalte Interpretation<br />
mit insgesamt zehn <strong>und</strong> bei der Variablen Urheber nur Redakteure sechs Codierungen<br />
die Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test nicht erfüllt sind <strong>und</strong> die seltene Codierung<br />
der Ausprägung anzeigt, dass die Definition <strong>im</strong> Codebuch nicht präzise genug ist, wird die<br />
Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe aus der Berechnung ausgeklammert. 117<br />
Die standardisierten Residuen zeigen Werte von -1,0 bis 1,1 <strong>und</strong> kleiner. Bei den Texten<br />
akkreditierter Regionalzeitungsredakteure werden häufiger Texte mit Thematisierung <strong>und</strong><br />
seltener Texte mit Hintergr<strong>und</strong> beobachtet als erwartet. Bei den Texten nicht akkreditierter<br />
Redakteure sind gegenläufige Werte auszumachen, ohne dass jeweils Signifikanz anzeigende<br />
Werte ermittelt werden.<br />
Tab. 28: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Argumentationstiefe (ohne „3<strong>“</strong>)<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein bei einem Freiheitsgrad signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,049) von 3,859. Die Nullhypothese wird verworfen; es liegt keine Unabhängigkeit vor. Der<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt 0,165 <strong>und</strong> ist signifikant (p = 0,050). Zwischen<br />
den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Tiefe liegt eine sehr geringe Korrelation vor. Texte<br />
akkreditierter Redakteure thematisieren häufiger <strong>und</strong> sind seltener hintergründig als erwartet.<br />
Texte nicht akkreditierter Journalisten der Regionalzeitungen thematisieren seltener <strong>und</strong><br />
sind häufiger hintergründig als erwartet. 118<br />
6.2.4.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure sind in ihren Texten signifikant häufiger interpretativ<br />
<strong>und</strong> häufiger hintergründig sowie thematisieren seltener als erwartet. Die Werte der Grup-<br />
116<br />
Sowohl die Berechnungen ohne Meldungen als auch ohne Meldungen <strong>und</strong> ohne Ausprägung „1<strong>“</strong> der Variablen<br />
Valenz des Geschehens sowie ohne Ausprägung „1<strong>“</strong> der Variablen Valenz des Geschehens liefern kleine, nicht<br />
signifikante Chi-Quadrat-Werte (p ˃ 0,05). Dies ist auch bei den durchgeführten Analysen ohne Ausprägung „0<strong>“</strong><br />
der Variablen Valenz des Geschehens der Fall. Die Nullhypothese wird jeweils bestätigt.<br />
117<br />
Wie in den Berechnungen <strong>im</strong> Anhang einsehbar, dokumentiert der exakte Test nach Fisher bei zwei Berechnungen<br />
mit der Variablen Urheber nur Redakteure inklusive der Tiefe-Ausprägung „3<strong>“</strong> die Nicht-Signifikanz der<br />
Unterschiede der Stichproben.<br />
118<br />
Bei der Berechnung ohne Meldungen <strong>und</strong> ohne Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe, was dazu führt, dass drei<br />
Texte weniger einbezogen sind, ergibt sich ein bei einem Freiheitsgrad nicht signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,053) von 3,743. Die Nullhypothese wird angenommen; die Variablen sind unabhängig voneinander.<br />
97
pe Urheber Agentur sind gegenläufig. Ein möglicherweise signifikanter Unterschied liegt aufgr<strong>und</strong><br />
der höheren Werte der standardisierten Residuen in der Gruppe der akkreditierten<br />
Redakteure begründet.<br />
Tab. 29: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Argumentationstiefe<br />
Der sehr signifikante Wert (p = 0,002) des exakten Tests nach Fisher beweist, dass die Nullhypothese<br />
verworfen wird <strong>und</strong> dass die beiden Variablen voneinander abhängig sind. Der<br />
sehr signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,002) beträgt -0,136 <strong>und</strong> beweist<br />
eine sehr geringe Korrelation. Ohne die Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe zu berücksichtigen<br />
wird ein sehr signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,009) nach Pearson <strong>und</strong> ein sehr<br />
signifikanter Spearman’scher Korrelationskoeffizient (p = 0,009) von -0,115 ermittelt.<br />
Bei der Berechnung ohne Meldungen <strong>und</strong> ohne Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe ergibt<br />
sich ein bei einem Freiheitsgrad nicht signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,224) von 1,481.<br />
Die Nullhypothese wird angenommen; es liegt eine Unabhängigkeit vor, was bei der Analyse<br />
ohne Meldungen mit einem nicht signifikanten Wert des exakten Tests nach Fisher bestätigt<br />
wird (p = 0,056).<br />
6.2.4.3 Urheber relevant<br />
Die standardisierten Residuen zeigen bei der Berechnung mit der Variablen Urheber relevant<br />
Werte von -1,7 bzw. 2,3 <strong>und</strong> kleiner an. Die Werte, die eine signifikante Abweichung der beobachteten<br />
von der erwarteten Häufigkeit anzeigen, existieren in der Zeile der akkreditierten<br />
Urheber relevant. Diese Urheber-Ausprägung thematisiert seltener als erwartet, berichtet<br />
dagegen häufiger hintergründig <strong>und</strong> interpretativ als erwartet.<br />
Tab. 30: Kreuztabelle Urheber relevant × Argumentationstiefe<br />
Es ergibt sich nach Pearson ein bei zwei Freiheitsgraden höchst signifikanter Chi-Quadrat-<br />
Wert (p = 0,001) von 14,977. Die Nullhypothese wird nicht bestätigt; die Variablen sind nicht<br />
98
unabhängig voneinander. Der Spearman’sche Korrelationskoeffizient beträgt -0,127 <strong>und</strong> ist<br />
höchst signifikant (p = 0,000). Zwischen den Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Tiefe liegt eine<br />
sehr geringe Korrelation vor. Texte akkreditierter Urheber relevant (Ausprägung „1<strong>“</strong>) sind<br />
häufiger hintergründig <strong>und</strong> interpretativ (Ausprägungen „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) als erwartet. Nicht akkreditierte<br />
Urheber relevant (Ausprägung „2<strong>“</strong>) thematisieren (Ausprägung „1<strong>“</strong>) häufiger in ihren<br />
Texten als erwartet. 119<br />
Berücksichtigt man Meldungen nicht, gehen bei den akkreditierten Urhebern zwei Texte weniger<br />
bei der Ausprägung Thematisierung in die Analyse ein; bei den Texten nicht akkreditierter<br />
Urheber relevant sind es 215 weniger bei der Ausprägung Thematisierung <strong>und</strong> 15 weniger<br />
bei der Ausprägung Hintergr<strong>und</strong>. Während unter Nichtberücksichtigung der Texte mit<br />
max<strong>im</strong>al 600 Zeichen bei den akkreditierten Urhebern relevant bei der Ausprägung „Thematisierung<strong>“</strong><br />
4,2 % der Beiträge ausgeklammert werden, fallen bei den nicht akkreditierten Urhebern<br />
relevant insgesamt 33,9 % Artikel heraus <strong>–</strong> <strong>und</strong> zwar 42,5 % der Texte mit Ausprägung<br />
Thematisierung <strong>und</strong> 9,0 % der Texte mit Ausprägung Hintergr<strong>und</strong>. Diese Verschiebungen<br />
führen dazu, dass die standardisierten Residuen kleiner ausfallen <strong>–</strong> in einer Zeile wird<br />
ein Wert von 1,6 ermittelt, die restlichen Werte sind kleiner 1.<br />
Tab. 31: Kreuztabelle Urheber relevant × Argumentationstiefe (ohne Meldungen)<br />
Der nicht signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,099) von 4,616 beweist bei zwei Freiheitsgraden,<br />
dass die Nullhypothese ohne die Berücksichtigung der Meldungen angenommen werden<br />
muss <strong>und</strong> dass damit die beiden Variablen unabhängig voneinander sind. 120<br />
6.2.4.4 Zeitungsschicht<br />
Die standardisierten Residuen, die bei der Kreuztabellierung der Variablen Zeitungsschicht<br />
<strong>und</strong> Tiefe entstehen, zeigen mit Werten von -1,0 bzw. 1,1 <strong>und</strong> kleiner keine signifikanten<br />
Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an. Der Chi-Quadrat-Wert<br />
beträgt bei zwei Freiheitsgraden 3,536 <strong>und</strong> ist nicht signifikant (p = 0,171). Die Nullhypothese<br />
wird bestätigt; die Variablen sind unabhängig voneinander. 121<br />
119<br />
Wird die Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe nicht berücksichtigt, zeigen sich die größten Werte der standardisierten<br />
Residuen mit -1,5 <strong>und</strong> 2,5 wie bei der vorherigen Analyse bei der Urheber-Ausprägung akkreditierte Urheber<br />
relevant. Nach Pearson ergibt sich ein sehr signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,002) von 9,410. Die Nullhypothese<br />
wird verworfen; die beiden Variablen sind abhängig voneinander. Der sehr signifikante Spearman’sche<br />
Korrelationskoeffizient (p = 0,002) von -0,112 belegt eine sehr geringe Korrelation.<br />
120<br />
Bei der Berechnung exklusive Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe ergeben sich keine signifikanten<br />
Abweichungen der standardisierten Residuen, <strong>und</strong> der Chi-Quadrat-Wert von 3,743 ist bei einem Freiheitsgrad<br />
nicht signifikant (p = 0,202). Die Nullhypothese wird bestätigt; es besteht kein statistischer Zusammenhang<br />
zwischen den beiden geprüften Variablen.<br />
121<br />
Bei Nichtberücksichtigung der Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Tiefe sind die Werte der standardisierten Residuen<br />
kleiner -0,9 <strong>und</strong> 1,1 <strong>und</strong> zeigen keine signifikanten Abweichungen an; der Chi-Quadrat-Wert von 2,785 ist bei<br />
einem Freiheitsgrad nicht signifikant (p = 0,095). Keine Signifikanz anzeigenden Werte der standardisierenden<br />
Residuen <strong>und</strong> nicht signifikante Chi-Quadrat-Werte ergeben sich, wenn Meldungen oder Meldungen <strong>und</strong> die<br />
99
Tab. 32: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Argumentationstiefe<br />
6.2.5 Hypothese 05: Häufig aktive Sportler als Handlungsträger<br />
Die fünfte Hypothese wird bezüglich der Herkunft der in den Texten handelnden Personen<br />
mit zwei verschiedenen Handlungsträger-Variablen geprüft. Bei der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger 1 wird der wichtigste Handlungsträger eines Textes erfasst. Um die Variable<br />
Herkunft Handlungsträger Gesamt zu erhalten, wurden die Codierungen der Variablen<br />
Herkunft Handlungsträger 1 bis Herkunft Handlungsträger 5 in einem neuen Datensatz zu<br />
einer neuen gemeinsamen Variablen zusammengefasst. Diese Umcodierung wurde durchgeführt,<br />
um eine Aussage zur Herkunft der wichtigsten fünf Handlungsträger eines Textes<br />
treffen zu können. 122<br />
6.2.5.1 Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
6.2.5.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Variable Herkunft Handlungsträger Gesamt weist die Ausprägungen „1<strong>“</strong> Aktiver Sportler,<br />
„2<strong>“</strong> Trainer, „3<strong>“</strong> Aus Sportwelt (außer „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>), „4<strong>“</strong> Nicht aus Sportwelt <strong>und</strong> „5<strong>“</strong> Kein (weiterer)<br />
Handlungsträger auf. Die zellenweisen Prozentwerte <strong>und</strong> die größten Werte der standardisierten<br />
Residuen von -3,8 bzw. 4,3 zeigen signifikante Abweichungen der beobachteten<br />
von den erwarteten Häufigkeiten an.<br />
Tab. 33: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
Tiefe-Ausprägung „3<strong>“</strong> bei der Analyse nicht berücksichtigt werden. In der Reihenfolge der genannten Berechnungen<br />
werden kleiner werdende Werte der standardisierten Residuen <strong>und</strong> des jeweils nicht signifikanten Chi-<br />
Quadrats (p > 0,05) festgestellt. Die Nullhypothese wird jeweils angenommen; die Unabhängigkeit der Variablen<br />
ist bestätigt.<br />
122<br />
Die Berechnungen mit der Variablen Herkunft Handlungsträger 5 sind zusätzlich <strong>im</strong> Anhang zu finden.<br />
100
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden als Handlungsträger häufiger aktive<br />
Sportler, signifikant häufiger Trainer <strong>und</strong> häufiger Personen aus der Sportwelt als erwartet;<br />
sportexterne Handlungsträger höchst signifikant seltener <strong>und</strong> fehlende Handlungsträger seltener<br />
als erwartet. Bei nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren sind die gegenläufigen<br />
Häufigkeiten festzustellen. Sie benutzen signifikant seltener aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer,<br />
seltener Personen aus der Sportwelt als erwartet; sportexterne werden höchst signifikant<br />
häufiger <strong>und</strong> fehlende Handlungsträger häufiger als erwartet codiert.<br />
Nach Pearson wird ein bei vier Freiheitsgraden höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,000) von 53,923 ermittelt. Die Nullhypothese wird nicht bestätigt; die beiden Variablen sind<br />
abhängig voneinander. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p =<br />
0,000) beträgt 0,201. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,270 ermittelt.<br />
123 Zwischen den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
liegt eine geringe Korrelation vor. In Texten akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
(Ausprägung „1<strong>“</strong>) sind häufiger als erwartet aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> Personen aus der<br />
Sportwelt (Ausprägungen „1<strong>“</strong> bis „3<strong>“</strong>) als Handlungsträger zu finden, in Texten nicht akkreditierter<br />
Journalisten der untersuchten Regionalzeitungen (Ausprägung „2<strong>“</strong>) werden häufiger<br />
als erwartet sportexterne Handlungsträger oder keine Handlungsträger (Ausprägungen „4<strong>“</strong><br />
<strong>und</strong> „9<strong>“</strong>) eingesetzt. 124<br />
6.2.5.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Bei der Kreuztabellierung der Ausprägungen „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> mit der Variablen Herkunft Handlungsträger<br />
Gesamt ergeben sich Auffälligkeiten: Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
verwenden als Handlungsträger höchst signifikant häufiger aktive Sportler <strong>und</strong> sehr signifikant<br />
häufiger Trainer sowie höchst signifikant seltener die Ausprägungen Nicht aus Sportwelt<br />
<strong>und</strong> Kein (weiterer) Handlungsträger. Bei nicht akkreditierten Redakteuren sind gegenläufige<br />
Werte zu beobachten, die kleiner 2 sind <strong>und</strong> keine signifikanten Abweichungen anzeigen.<br />
Tab. 34: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
123<br />
Der Cramer-V-Wert wird zusätzlich angegeben, da die Frage nach Ordinalskalierung der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger Gesamt <strong>und</strong> Herkunft Handlungsträger 1 inklusive der Ausprägung „9<strong>“</strong> (Kein (weiterer) Handlungsträger)<br />
gestellt werden kann. Deshalb <strong>und</strong> um Aussagen über die existierenden Handlungsträger treffen zu<br />
können, werden ergänzend Berechnungen ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> durchgeführt.<br />
124<br />
Wird die Ausprägung „9<strong>“</strong> (Kein (weiterer) Handlungsträger) der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
aus der Analyse ausgeklammert, ergeben sich hohe, signifikante Abweichungen anzeigende Werte der standardisierten<br />
Residuen von -3,9 bzw. 4,5 <strong>und</strong> kleiner. Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
51,215 zeigt bei drei Freiheitsgraden an, dass die Variablen abhängig voneinander sind; die Nullhypothese wird<br />
verworfen. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) beträgt 0,199 <strong>und</strong> beweist<br />
eine sehr geringe Korrelation. Höchst signifikante Chi-Quadrat- <strong>und</strong> Spearman-Korrelationskoeffizienten-Werte<br />
bzw. Cramer-V-Werte werden berechnet, wenn Analysen ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung<br />
„9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt durchgeführt werden. Es werden jeweils laut dem<br />
Spearman’schen Korrelationskoeffizienten sehr geringe Korrelation bewiesen (0,2 < r ≤ 0,5).<br />
101
Der Chi-Quadrat-Wert nach Pearson von 55,421 ist höchst signifikant (p = 0,000). Bei einem<br />
Freiheitsgrad wird die Nullhypothese verworfen; es besteht eine Abhängigkeit. Der höchst<br />
signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) beträgt 0,134 <strong>und</strong> beweist<br />
eine sehr geringe Korrelation. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit<br />
0,147 ermittelt. 125<br />
6.2.5.1.3 Urheber relevant<br />
Mit Werten der standardisierten Residuen von -5,1 bzw. 5,1 <strong>und</strong> kleiner wird bei der Kreuztabellierung<br />
der Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Herkunft Handlungsträger Gesamt ersichtlich,<br />
dass signifikante Abweichungen der beobachteten Häufigkeiten von den erwarteten<br />
Häufigkeiten in der Zeile der akkreditierten Urheber relevant feststellbar sind. Der bei vier<br />
Freiheitsgraden höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 99,451 beweist, dass<br />
die Nullhypothese nicht st<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> dass die beiden Variablen abhängig voneinander sind.<br />
Tab. 35: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
Der höchst signifikante Wert des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p = 0,000) von<br />
0,147 zeigt eine sehr geringe Korrelation an. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p =<br />
0,000) wird mit 0,162 ermittelt. 126<br />
6.2.5.1.4 Zeitungsschicht<br />
Acht von zehn möglichen Werten der standardisierten Residuen weisen Werte von 2 oder<br />
größer auf, was eine signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit<br />
anzeigt. Akkreditierte Zeitungen benutzen sehr signifikant seltener als erwartet aktive<br />
Sportler, signifikant seltener Trainer <strong>und</strong> seltener sonstige Personen aus der Sportwelt als<br />
Handlungsträger; sportexterne <strong>und</strong> keine Handlungsträger sind höchst bzw. signifikant häufiger<br />
als erwartet festzustellen. Bei nicht akkreditierten Zeitungen sind die Werte gegenläufig.<br />
Bei ihnen werden aktive Sportler höchst signifikant häufiger <strong>und</strong> Trainer signifikant häufiger<br />
sowie die Ausprägung Nicht aus Sportwelt höchst signifikant seltener <strong>und</strong> die Ausprägung<br />
Kein (weiterer) Handlungsträger sehr signifikant seltener als erwartet codiert.<br />
125<br />
Unter Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt wird mit<br />
einem höchst signifikanten Spearman-Korrelationskoeffizient-Wert (p = 0,000) von 0,117 eine sehr geringe Korrelation<br />
nachgewiesen. Bei dieser Berechnung <strong>und</strong> bei der Analyse ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong><br />
Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt sind die Chi-Quadrat-Werte höchst signifikant (p<br />
= 0,000). Es wird jeweils eine sehr geringe Korrelation festgestellt (0 < r ≤ 0,2).<br />
126<br />
Unter Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt wird mit<br />
einem höchst signifikanten Spearman-Korrelationskoeffizient-Wert (p = 0,000) von 0,127 eine sehr geringe Korrelation<br />
nachgewiesen. Bei dieser Berechnung <strong>und</strong> bei der Analyse ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong><br />
Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt sind die Chi-Quadrat-Werte höchst signifikant (p<br />
= 0,001). Es wird jeweils eine sehr geringe Korrelation festgestellt (0 < r ≤ 0,2).<br />
102
Tab. 36: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Handlungsträger Gesamt<br />
Der bei vier Ausprägungen höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 77,379 bestätigt<br />
die Abhängigkeit der beiden Variablen; die Nullhypothese wird nicht angenommen. Es<br />
liegt eine sehr geringe Korrelation vor, da der Wert des höchst signifikanten Spearman’schen<br />
Korrelationskoeffizienten (p = 0,000) -0,124 beträgt. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert<br />
(p = 0,000) wird mit 0,141 ermittelt. 127<br />
6.2.5.2 Herkunft Handlungsträger 1<br />
6.2.5.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Werte der standardisierten Residuen bei der Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger 1 deuten eine signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten<br />
Häufigkeit an. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden signifikant seltener<br />
sportexterne Handlungsträger als erwartet, ihre nicht akkreditierten Kollegen benutzen sehr<br />
signifikant häufiger sportexterne Handlungsträger als erwartet. Der bei drei Freiheitsgraden<br />
höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 19,198 führt dazu, dass die Nullhypothese<br />
nicht bestätigt wird. Die Variablen sind abhängig voneinander.<br />
Tab. 37: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Handlungsträger 1<br />
127<br />
Bei der Berechnung ohne Meldungen sind die Werte der standardisierten Residuen, des höchst signifikanten<br />
Chi-Quadrats (p = 0,000) mit 43,613 <strong>und</strong> des höchst signifikanten Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p =<br />
0,000) mit -0,100 kleiner als bei der Analyse inklusive Meldungen. Die Nullhypothese wird verworfen; die Variablen<br />
sind voneinander abhängig, <strong>und</strong> es besteht eine sehr geringe Korrelation. Der höchst signifikante Cramer-V-<br />
Wert (p = 0,000) wird mit 0,126 ermittelt. Bei Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger Gesamt bzw. bei Nichtberücksichtigung der Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger Gesamt beträgt der Spearman’sche Korrelationskoeffizient -0,116 bzw. -0,087. Es werden<br />
sehr geringe Korrelationen bei jeweiligem Verwerfen der Nullhypothese aufgr<strong>und</strong> des jeweils höchst signifikanten<br />
Chi-Quadrat-Werts (p ≤ 0,001) nachgewiesen.<br />
103
Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,001) beträgt 0,334 <strong>und</strong><br />
stützt eine geringe Korrelation, die stärker als bei der Variablen Herkunft Handlungsträger<br />
Gesamt (0,201) ist. 128<br />
6.2.5.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>im</strong> Vergleich mit den Urhebern der<br />
Presseagentur-Texten als wichtigsten Handlungsträger sehr signifikant häufiger aktive Sportler<br />
<strong>und</strong> signifikant seltener als erwartet sonstige Personen innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der<br />
Sportwelt. Bei den Agentur-Texten werden in allen fünf Zellen gegenläufige Werte zu den<br />
Regionalzeitungsredakteuren festgestellt. Die Werte der standardisierten Residuen sind in<br />
dieser Gruppe kleiner -1,2 bzw. 0,9 <strong>und</strong> weisen demnach nicht auf signifikante Abweichungen<br />
der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten hin. Der sehr signifikante Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,002) beträgt 16,886. Es besteht keine Unabhängigkeit; die Nullhypothese<br />
wird verworfen. Der hoch signifikante Wert (p = 0,000) des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten<br />
von 0,159 dokumentiert eine sehr geringe Korrelation. Der sehr signifikante<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,002) wird mit 0,181 ermittelt. 129<br />
Tab. 38: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Handlungsträger 1<br />
6.2.5.2.3 Urheber relevant<br />
Die größten Signifikanz anzeigenden Werte der standardisierten Residuen sind bei der<br />
Kreuztabellierung der Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Herkunft Handlungsträger 1 mit -2,5<br />
<strong>und</strong> 3,6 bei den akkreditierten Urhebern relevant zu finden. Diese verwenden als wichtigsten<br />
Handlungsträger höchst signifikant häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> signifikant seltener<br />
als erwartet sportexterne Personen. Nach Pearson ergibt sich ein höchst signifikanter<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 25,324, aufgr<strong>und</strong> dessen die Nullhypothese verworfen<br />
wird. Die Variablen sind abhängig voneinander.<br />
128<br />
Ohne Meldungen belegen Werte der standardisierten Residuen der Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger 1 von -2,3 <strong>und</strong> 2,6 <strong>und</strong> der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,001) von 17,587, dass<br />
die Variablen statistisch nicht unabhängig voneinander sind. Die Nullhypothese wird verworfen <strong>und</strong> eine geringe<br />
Korrelation ermittelt, da der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) 0,327 beträgt.<br />
129<br />
Ohne die Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger 1 zu berücksichtigen, werden höchst signifikante<br />
Werte (p ≤ 0,001) des Chi-Quadrats <strong>und</strong> des Spearman-Korrelationskoeffizienten von 0,156 ermittelt. Bei<br />
der Berechnung exklusive Meldungen werden <strong>im</strong> Vergleich zur Analyse mit Meldungen 2 (2,4 %) codierte Texte<br />
der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> 136 (31,7 %) Agentur-Beiträge gelöscht. Bei der Kreuztabellierung<br />
entstehen keine Werte der standardisierten Residuen größer oder gleich 2. Die größte Abweichung ist mit<br />
einem Wert der standardisierten Residuen von 1,9 bei der Handlungsträger-Ausprägung „1<strong>“</strong> in der Gruppe der<br />
akkreditierten Redakteure der Regionalzeitungen auszumachen. Der signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,022)<br />
bestätigt, dass die Nullhypothese nicht st<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> Abhängigkeiten existieren. Der sehr signifikante Wert (p =<br />
0,010) des Spearman-Korrelationskoeffizienten von 0,133 beweist eine sehr geringe Korrelation. Der signifikant<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,022) wird mit 0,160 ermittelt.<br />
104
Tab. 39: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Handlungsträger 1<br />
Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) von 0,173 zeigt<br />
eine sehr geringe Korrelation an. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit<br />
0,182 ermittelt. 130<br />
6.2.5.2.4 Zeitungsschicht<br />
Wenn die beiden Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Herkunft Handlungsträger 1 kreuztabelliert<br />
werden, zeigen vier von zehn Zellen Werte der standardisierten Residuen von 2 <strong>und</strong> größer<br />
an, was auf signifikante Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten<br />
hinweist.<br />
Tab. 40: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Handlungsträger 1<br />
Nach Pearson ergibt sich ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 32,786.<br />
Die Nullhypothese wird nicht angenommen; die beiden geprüften Variablen gelten nicht als<br />
unabhängig voneinander. Nach dem höchst signifikanten Spearman’schen Korrelationskoef-<br />
130<br />
Ohne Meldungen zeigt mit 2,5 der standardisierte Residuen-Wert einer Zelle eine signifikante Abweichung der<br />
beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an. Akkreditierte Urheber relevant benutzen aktive Sportler signifikant<br />
häufiger als erwartet. Der sehr signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,009) von 13,514 zeigt, dass die Nullhypothese<br />
zu verwerfen <strong>und</strong> dass die Abhängigkeit der Variablen zu bestätigen ist. Nach dem höchst signifikanten<br />
Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p = 0,000) von 0,151 besteht eine sehr geringe Korrelation. Der<br />
sehr signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,009) wird mit 0,160 ermittelt. Ohne die Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen<br />
Herkunft Handlungsträger 1 ergibt sich ein bei drei Freiheitsgraden höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,000) von 24,712. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) von 0,172 zeigt<br />
eine sehr geringe Korrelation an. Ohne Meldungen <strong>und</strong> die Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger<br />
1 ergeben sich folgende Werte: ein sehr signifikanter Chi-Quadrat (p = 0,004) von 13,310 <strong>und</strong> ein höchst<br />
signifikanter Spearman-Korrelationskoeffizient (p = 0,001) von 0,150. Es besteht eine sehr geringe Korrelation.<br />
Die Nullhypothese wird jeweils nicht angenommen; die Variablen sind voneinander abhängig.<br />
105
fizienten (p = 0,000) von 0,155 besteht eine sehr geringe Korrelation. Der höchst signifikante<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,205 ermittelt. 131<br />
6.2.5.3 Anzahl Handlungsträger<br />
6.2.5.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
Weil die Stichproben, die auf den beiden Ausprägungen der Variablen Urheber nur Redakteure<br />
basieren, nach dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest teilweise normalverteilt <strong>und</strong><br />
teilweise nicht normalverteilt sind, wird zur Prüfung möglicherweise vorliegender signifikanter<br />
Unterschiede der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney benutzt. 132<br />
Tab. 41: Ränge 133 Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>–</strong> wie die mittleren Ränge zeigen <strong>–</strong> in<br />
ihren Texten <strong>im</strong> Schnitt mehr Handlungsträger als nicht akkreditierte Redakteure.<br />
Tab. 42: Mediane Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Die Werte der beiden Mediane belegen, was die mittleren Ränge anzeigen: Der Median der<br />
Anzahl Handlungsträger ist bei den Texten akkreditierter Redakteure größer als bei denen<br />
nicht akkreditierter Redakteure.<br />
Tab. 43: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Das Ergebnis des U-Tests beweist, dass ein höchst signifikanter Unterschied hinsichtlich der<br />
Anzahl der verwendeten Handlungsträger in den Texten der beiden Redakteursgruppen besteht<br />
(p = 0,001). Der Kolmogorov-Smirnov-Test zeigt ebenfalls einen höchst signifikanten<br />
Unterschied an (p = 0,000). 134<br />
131<br />
Ohne Meldungen wird die Unabhängigkeit der Variablen mit einem sehr signifikanten Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,002) von 17,089 verworfen. Der sehr signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,005) von -0,118<br />
belegt eine sehr geringe Korrelation. Der sehr signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,002) wird mit 0,176 ermittelt.<br />
Sehr bzw. höchst signifikante Spearman-Koeffizienten von -0,163 <strong>und</strong> -0,116 belegen bei den Berechnungen<br />
ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Handlungsträger 1 bzw. ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Handlungsträger 1 <strong>und</strong> ohne Meldungen sehr geringe Korrelationen.<br />
132<br />
Im Anhang sind alle Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests zur Überprüfung der Verteilungsform<br />
einsehbar.<br />
133<br />
Jeweils nach Mann-Whitney-U-Test.<br />
134<br />
Bei der Berechnung ohne Berücksichtigung der Meldungen besteht wie bei der oben beschriebenen Analyse<br />
ein höchst signifikanter Unterschied zwischen den beiden Stichproben (p = 0,001). Die Mediane betragen 11,00<br />
<strong>und</strong> 7,00.<br />
106
6.2.5.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney wird eingesetzt, da die eine Stichprobe (akkreditierte<br />
Redakteure) normalverteilt ist <strong>und</strong> die andere Stichprobe (Agentur) nicht normalverteilt ist.<br />
Tab. 44: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Wie die Werte der mittleren Ränge zeigen, werden in den Texten akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>im</strong> Schnitt mehr Handlungsträger identifiziert als in Agentur-Texten. Dieser<br />
Unterschied wird durch den Median von 11,00 bei den Redakteuren <strong>und</strong> 8,00 bei der Ausprägung<br />
Agentur bestätigt.<br />
Tab. 45: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Das Ergebnis des durchgeführten U-Tests dokumentiert einen höchst signifikanten Unterschied<br />
hinsichtlich der Anzahl der benutzten Handlungsträger in den Texten der beiden geprüften<br />
Gruppen (p = 0,000).<br />
Bei der Analyse exklusive Meldungen werden in der Gruppe akkreditierter Redakteure zwei<br />
Fälle (2,4 %) <strong>und</strong> in der Gruppe Agentur 136 Fälle (31,7 %) gelöscht. Das Ergebnis des U-<br />
Tests belegt, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl der verwendeten<br />
Handlungsträger in den Texten der Gruppen besteht (p = 0,822), wenn Meldungen in der<br />
Analyse unberücksichtigt bleiben.<br />
Tab. 46: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Exklusive Meldungen beträgt der mittlere Rang der Gruppe akkreditierter Redakteure<br />
190,38, der Wert der Ausprägung Agentur wird mit 187,33 ermittelt. Es liegen Median-Werte<br />
von 11,00 <strong>und</strong> 12,00 vor.<br />
6.2.5.3.3 Urheber relevant<br />
Die Stichprobe Urheber relevant, die auf der Ausprägung nicht akkreditiert beruht, ist nicht<br />
normalverteilt. Die zu vergleichende Stichprobe ist normalverteilt.<br />
107
Tab. 47: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Das Ergebnis der mittleren Ränge nach dem U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney zeigt, dass in<br />
Texten akkreditierter Urheber relevant <strong>im</strong> Schnitt mehr Handlungsträger eingesetzt werden<br />
als in den Texten nicht akkreditierter Urheber relevant.<br />
Tab. 48: Mediane Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Der Median der Anzahl Handlungsträger ist bei den Texten akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
größer als bei den Texten nicht akkreditierten Urhebern relevant. Dieser Unterschied<br />
ist höchst signifikant, wie das Ergebnis des U-Tests (p = 0,000) <strong>und</strong> des Kolmogorov-<br />
Smirnov-Tests (p = 0,000) beweisen.<br />
Werden kurze Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen bei der Berechnung nicht berücksichtigt,<br />
schrumpft die Gruppe akkreditierter Urheber relevant um zwei Fälle (2,4 %), die der Gruppe<br />
nicht akkreditierter Urheber relevant um 230 Fälle (33,9 %).<br />
Tab. 49: Ränge Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen) <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Die mittleren Ränge akkreditierter Urheber relevant fallen höher als die nicht akkreditierter<br />
Urheber relevant aus. Die (nicht gruppierten) Median-Ergebnisse unterscheiden sich nicht.<br />
Tab. 50: Mediane Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen) <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Die Ergebnisse des U-Tests beweisen, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der<br />
Anzahl der verwendeten Handlungsträger in den Texten der beiden Urheber-relevant-<br />
Gruppen besteht (p = 0,295), wenn Meldungen in der Analyse unberücksichtigt bleiben.<br />
Tab. 51: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
108
6.2.5.3.4 Urheber Zeitungsschicht<br />
Da beide Stichproben, die auf den beiden Ausprägungen der Variablen Zeitungsschicht basieren,<br />
nicht normalverteilt sind, wird zum Vergleichen der Mittelwerte der Mann-Whitney-U-<br />
Test benutzt.<br />
Tab. 52: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Die mittleren Rangplätze der akkreditierten Zeitungen sind kleiner als die der nicht akkreditierten<br />
Zeitungen.<br />
Tab. 53: Mediane Anzahl Handlungsträger<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Die Median-Werte belegen, was die Ränge anzeigen: Der Median Anzahl Handlungsträger<br />
ist bei den Texten akkreditierter Zeitungen kleiner als bei Texten nicht akkreditierter Blätter.<br />
Tab. 54: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist höchst signifikant (p = 0,001) nach dem<br />
Mann-Whitney-U-Test. Ohne Meldungen zu berücksichtigen wird mit dem Mann-Whitney-U-<br />
Test ein signifikanter Unterschied (p = 0,002) zwischen den beiden Gruppen berechnet.<br />
6.2.6 Hypothese 06: Häufig aktive Sportler als Quellen<br />
6.2.6.1 Herkunft Quelle Gesamt<br />
6.2.6.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Variable Herkunft Quelle Gesamt weist die Ausprägungen „1<strong>“</strong> Aktiver Sportler, „2<strong>“</strong> Trainer,<br />
„3<strong>“</strong> Aus Sportwelt, „4<strong>“</strong> Nicht aus Sportwelt <strong>und</strong> „9<strong>“</strong> Keine (weitere) Quelle auf. Bei dieser<br />
Variablen wurden die Codierungen der Variablen Herkunft Quelle 1 bis Herkunft Quelle 5 in<br />
einem neuen Datensatz zu einer gemeinsamen Variable zusammengefasst, um eine Aussage<br />
zur Herkunft aller codierten fünf Quellen treffen zu können.<br />
Die Unterschiede der zellenweisen Prozentwerte zwischen den Ausprägungen akkreditiert<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditiert sowie die größten Werte der standardisierten Residuen von -3,9 bzw.<br />
3,4 zeigen höchst signifikante Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten<br />
an. Sieben von zehn möglichen Werten der standardisierten Residuen zeigen mit<br />
Werten von 2,0 <strong>und</strong> größer mindestens signifikante Abweichungen an. Akkreditierte Redak-<br />
109
teure verwenden als Quellen höchst signifikant häufiger als erwartet aktive Sportler, sehr<br />
signifikant häufiger Trainer sowie signifikant seltener als erwartet sportexterne Personen.<br />
Nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure benutzen als Quellen höchst signifikant seltener<br />
aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer sowie signifikant seltener sportexterne Personen <strong>und</strong> die<br />
Ausprägung Keine (weitere) Quelle.<br />
Tab. 55: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Quelle Gesamt<br />
Nach Pearson wird ein bei vier Freiheitsgraden höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,000) von 66,989 ermittelt. Die Nullhypothese wird nicht bestätigt; die beiden Variablen sind<br />
abhängig voneinander. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p =<br />
0,000) beträgt 0,227. Zwischen den Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Herkunft Quelle<br />
Gesamt liegt eine geringe Korrelation vor; die Variablen sind positiv korreliert.<br />
In Texten akkreditierter Redakteure (Ausprägung „1<strong>“</strong>) sind häufiger als erwartet aktive Sportler,<br />
Trainer <strong>und</strong> Personen aus der Sportwelt (Ausprägungen „1<strong>“</strong> bis „3<strong>“</strong>) als Quelle zu finden,<br />
in Texten nicht akkreditierter Journalisten der Regionalzeitungen (Ausprägung „2<strong>“</strong>) werden<br />
häufiger als erwartet sportexterne Quellen oder keine Quelle (Ausprägungen „4<strong>“</strong> <strong>und</strong> „9<strong>“</strong>)<br />
eingesetzt. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,301 ermittelt. 135<br />
6.2.6.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich der Stichproben der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> der Urheber-Ausprägung<br />
Agentur werden folgende Auffälligkeiten bei der Kreuztabellierung ermittelt:<br />
Akkreditierte Redakteure verwenden als Quellen höchst signifikant häufiger aktive Sportler<br />
<strong>und</strong> signifikant häufiger Trainer als erwartet sowie höchst signifikant seltener als erwartet<br />
sportexterne Personen. Bei der Analyse der Texte der Nachrichtenagenturen werden keine<br />
signifikanten Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten festgestellt.<br />
Der Chi-Quadrat-Test nach Pearson ermittelt einen bei vier Freiheitsgraden höchst signifikanten<br />
Wert (p = 0,000) von 41,569. Die beiden Stichproben sind bezüglich der Herkunft der<br />
verwendeten Quellen nicht unabhängig voneinander. Die Nullhypothese wird verworfen. Der<br />
signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,030) beträgt 0,043. Es liegt eine<br />
135<br />
Wird die Ausprägung „9<strong>“</strong> (Keine (weitere) Quelle) aus der Analyse ausgeklammert, ergeben sich hohe, teilweise<br />
höchst signifikante Abweichungen anzeigende Werte der standardisierten Residuen von -3,1 bzw. 4,8 <strong>und</strong><br />
kleiner. Vier von acht Werten der standardisierten Residuen haben Werte größer 2,0 <strong>–</strong> davon drei in der Zeile der<br />
nicht akkreditierten Urheber relevant <strong>und</strong> zwei in der Spalte Nicht aus Sportwelt. Der höchst signifikante Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,000) von 48,336 zeigt bei drei Freiheitsgraden an, dass die Variablen abhängig voneinander<br />
sind; die Nullhypothese wird verworfen. Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000)<br />
beträgt 0,413 <strong>und</strong> beweist eine geringe Korrelation. Höchst signifikante Chi-Quadrat- <strong>und</strong> Spearman-Korrelations-<br />
Werte werden berechnet, wenn Analyse ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen<br />
Herkunft Quelle Gesamt durchgeführt werden. Spearman-Korrelations-Werte von 0,234 bzw. 0,406 belegen<br />
geringe Korrelationen. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird bei der Analyse ohne Meldungen<br />
mit 0,303 ermittelt.<br />
110
sehr geringe Korrelation vor. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit<br />
0,127 ermittelt. 136<br />
Tab. 56: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Quelle Gesamt<br />
6.2.6.1.3 Urheber relevant<br />
Mit Werten der standardisierten Residuen von -4,4 bzw. 5,4 <strong>und</strong> kleiner wird in der Kreuztabelle<br />
ersichtlich, dass teilweise höchst signifikante Abweichungen der beobachteten von den<br />
erwarteten Häufigkeiten existieren. Die drei Werte der standardisierten Residuen, die signifikante<br />
Abweichungen anzeigen, befinden sich in der Zeile akkreditierter Urheber relevant.<br />
Tab. 57: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Quelle Gesamt<br />
Der bei vier Freiheitsgraden höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 74,182<br />
beweist, dass die Nullhypothese nicht st<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> dass die beiden Variablen abhängig voneinander<br />
sind. Der höchst signifikante Wert des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p<br />
136<br />
Bei der Berechnung ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt wird ein höchst signifikanter<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) <strong>und</strong> ein höchst signifikanter Spearman’scher Korrelationskoeffizient (p = 0,000) von<br />
0,198 ermittelt. Damit wird eine sehr geringe Korrelation gestützt. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure berichten<br />
höchst signifikant häufiger als erwartet mit aktiven Sportlern als Quellen <strong>und</strong> höchst signifikant seltener als<br />
erwartet mit sportexternen Quellen. Exklusive Meldungen beträgt der nicht signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient<br />
(p = 0,336) -0,022. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,138 ermittelt. Die<br />
Nullhypothese wird aufgr<strong>und</strong> eines höchst signifikanten Chi-Quadrat-Werts (p = 0,000) verworfen. Die Werte der<br />
standardisierten Residuen zeigen an, dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure höchst signifikant seltener<br />
als erwartet sportexterne Personen verwenden <strong>und</strong> dass Agentur-Urheber signifikant häufiger als erwartet sportexterne<br />
Quellen einsetzen. Bei Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt<br />
<strong>und</strong> der Meldungen beträgt der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) 0,186. Es<br />
wird eine sehr geringe Korrelation bei Verwerfen der Nullhypothese aufgr<strong>und</strong> des höchst signifikanten Chi-<br />
Quadrat-Werts (p = 0,000) nachgewiesen. Die Werte der standardisierten Residuen, die auch höchst signifikante<br />
Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten anzeigen, sind bei der Gruppe der akkreditierten<br />
Redakteure <strong>und</strong> bei den Quellen-Ausprägungen „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> zu finden.<br />
111
= 0,000) von 0,059 zeigt eine sehr geringe Korrelation an. Der höchst signifikante Cramer-V-<br />
Wert (p = 0,000) wird mit 0,140 ermittelt. 137<br />
6.2.6.1.4 Zeitungsschicht<br />
Vier von zehn möglichen Werten der standardisierten Residuen weisen Werte von 2 oder<br />
größer auf, was mindestens eine signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten<br />
Häufigkeit anzeigt. Diese Signifikanz anzeigenden Werte befinden sich in den ersten beiden<br />
Spalten der Ausprägungen Aktiver Sportler <strong>und</strong> Trainer. Akkreditierte Zeitungen benutzen<br />
seltener als erwartet aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> sonstige Personen aus der Sportwelt<br />
als Quellen; sportexterne <strong>und</strong> keine Quellen sind häufiger als erwartet festzustellen.<br />
Tab. 58: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Quelle Gesamt<br />
Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 45,511 bestätigt die Abhängigkeit;<br />
die Nullhypothese wird nicht angenommen. Es liegt eine sehr geringe Korrelation vor. Der<br />
Wert des höchst signifikanten Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p = 0,000) wird mit<br />
-0,079 ermittelt. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) beträgt 0,108. 138<br />
6.2.6.2 Herkunft Quelle 1<br />
6.2.6.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Werte der standardisierten Residuen deuten in drei von zehn Zellen eine signifikante<br />
Abweichung der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an <strong>–</strong> davon befinden sich zwei<br />
signifikante Werte in den Zellen der Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1. Akkreditierte<br />
Regionalzeitungsredakteure verwenden als wichtigste Quelle signifikant seltener<br />
sportexterne Personen als erwartet, ihre nicht akkreditierten Kollegen benutzen signifikant<br />
häufiger externe Quellen als erwartet <strong>und</strong> signifikant seltener aktive Sportler als erwartet.<br />
137<br />
Unter Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt wird mit einem höchst<br />
signifikanten Spearman-Korrelationskoeffizient-Wert (p = 0,000) von 0,215 eine geringe Korrelation nachgewiesen.<br />
Bei dieser Berechnung <strong>und</strong> bei der Analyse ohne Meldungen bzw. ohne Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der<br />
Variablen Herkunft Quelle Gesamt sind die Chi-Quadrat-Werte höchst signifikant (p = 0,000). Bei der Berechnung<br />
ohne Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt wird aufgr<strong>und</strong> eines höchst signifikanten<br />
Werts des Spearman-Korrelationskoeffizienten (p = 0,000) von 0,201 eine geringe Korrelation festgestellt.<br />
Bei der alleinigen Nichtberücksichtigung der Meldungen ergibt sich ein nicht signifikanter Wert des Spearman-<br />
Korrelationskoeffizienten (p = 0,671), der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,134 ermittelt.<br />
138<br />
Bei der Berechnung ohne Meldungen sind die Werte der standardisierten Residuen <strong>und</strong> des höchst signifikanten<br />
Chi-Quadrats (p = 0,000) mit 30,319 kleiner als bei der Analyse inklusive Meldungen. Der höchst signifikante<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) beträgt -0,084. Die Nullhypothese wird verworfen; die Variablen<br />
sind voneinander abhängig, <strong>und</strong> es besteht eine sehr geringe Korrelation. Der höchst signifikante Cramer-V-<br />
Wert (p = 0,000) wird mit 0,105 ermittelt. Bei Nichtberücksichtigung der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Quelle Gesamt bzw. bei Nichtberücksichtigung der Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle<br />
Gesamt beträgt der Spearman’sche Korrelationskoeffizient -0,149 bzw. -0,118. Es werden sehr geringe Korrelationen<br />
bei jeweiligem Verwerfen der Nullhypothese aufgr<strong>und</strong> des Chi-Quadrats (p = 0,000) nachgewiesen.<br />
112
Tab. 59: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Quelle 1<br />
Der bei vier Freiheitsgraden höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 22,845<br />
führt dazu, dass die Nullhypothese nicht bestätigt wird. Die Variablen sind voneinander abhängig.<br />
Der höchst signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,001) beträgt<br />
0,283 <strong>und</strong> dokumentiert eine geringe Korrelation, die stärker als bei der Variablen Herkunft<br />
Quelle Gesamt (0,227) ist. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,393<br />
ermittelt. 139<br />
6.2.6.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden als wichtigste Quelle bei dieser Berechnung<br />
sehr signifikant häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> signifikant seltener als<br />
erwartet sonstige sportinterne <strong>und</strong> sportexterne Personen.<br />
Tab. 60: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Quelle 1<br />
21,908 beträgt der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000), der die Abhängigkeit<br />
beweist. Der Wert des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten ist nicht signifikant (p =<br />
0,173). Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,207 ermittelt. 140<br />
139<br />
Ohne Meldungen belegen Werte der standardisierten Residuen in zwei von zehn Zellen <strong>und</strong> der höchst signifikante<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 21,589, dass die Variablen statistisch nicht unabhängig voneinander<br />
sind. Die Nullhypothese wird verworfen <strong>und</strong> eine geringe Korrelation ermittelt, da der höchst signifikante Spearman’sche<br />
Korrelationskoeffizient (p = 0,000) 0,287 beträgt. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000)<br />
wird mit 0,386 ermittelt. Nicht akkreditierte Redakteure benutzen als wichtigste Quelle signifikant seltener aktive<br />
Sportler <strong>und</strong> signifikant häufiger externe Personen als erwartet. Ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Quelle 1 bzw. ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 <strong>und</strong> Meldungen zu berücksichtigen, sprechen<br />
höchst signifikante Chi-Quadrat-Werte (p = 0,000) für die Abhängigkeit der jeweiligen Variablen <strong>und</strong> höchst<br />
signifikante Spearman-Korrelationskoeffizient-Werte (p = 0,000) von 0,446 bzw. 0,433 für geringe Korrelationen.<br />
140<br />
Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen wird ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) berechnet,<br />
der zum Verwerfen der Nullhypothese führt. Die Stichproben sind abhängig. Ein standardisiertes Residuum<br />
von 2,6 zeigt an, dass akkreditierte Redakteure sehr signifikant häufiger überhaupt keine Quellen verwenden. Der<br />
113
6.2.6.2.3 Urheber relevant<br />
Die größten Signifikanz anzeigenden Werte der standardisierten Residuen sind mit -2,9 <strong>und</strong><br />
3,9 bei der Kreuztabellierung der Variablen Urheber relevant <strong>und</strong> Herkunft Quelle 1 bei den<br />
akkreditierten Urhebern relevant zu finden, was bedeutet, dass diese höchst signifikant häufiger<br />
als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> sehr signifikant seltener als erwartet sportexterne Personen<br />
als wichtigste Quelle verwenden.<br />
Tab. 61: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Quelle 1<br />
Nach Pearson ergibt sich bei der Berechnung ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p =<br />
0,000) von 32,311, aufgr<strong>und</strong> dessen die Nullhypothese verworfen wird. Die beiden Variablen<br />
werden als voneinander abhängig angesehen. Der sehr signifikante Spearman’sche Korrelationskoeffizient<br />
(p = 0,009) von 0,095 zeigt eine sehr geringe Korrelation der Variablen an.<br />
Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,206 ermittelt. 141<br />
6.2.6.2.4 Zeitungsschicht<br />
Wenn die beiden Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Herkunft Quelle 1 kreuztabelliert werden,<br />
zeigen insgesamt zwei von zehn Zellen Werte der standardisierten Residuen von 2 <strong>und</strong> grö-<br />
Wert des Spearman’schen Korrelationskoeffizienten ist nicht signifikant (p = 0,836). Der höchst signifikante Cramer-V-Wert<br />
(p = 0,000) wird mit 0,239 ermittelt. Bei der Analyse exklusive der Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft<br />
Quelle 1 wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Stichproben aufgr<strong>und</strong> eines höchst signifikanten<br />
Chi-Quadrat-Werts (p = 0,000) festgestellt. Es besteht eine sehr geringe Korrelation, wie der höchst signifikante<br />
Spearman-Korrelationskoeffizient von 0,195 (p = 0,000) belegt. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden<br />
als wichtigste Quelle höchst signifikant häufiger als erwartet aktive Sportler. Bei der Berechnung exklusive<br />
Meldungen <strong>und</strong> Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 wird ein sehr signifikanter Chi-Quadrat-Wert<br />
(p = 0,007) ermittelt. Ein Signifikanz anzeigender Wert der standardisierten Residuen gleich oder größer 2 ist mit<br />
2,5 in der Gruppe der akkreditierten Redakteure bei der Quellen-Ausprägung „1<strong>“</strong> zu finden. Der sehr signifikante<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,002) von 0,175 zeigt eine sehr geringe Korrelation an.<br />
141<br />
Ohne Meldungen zeigen mit -2,4 <strong>und</strong> 2,7 dieselben standardisierten Residuen-Werte wie bei der Analyse<br />
inklusive Meldungen eine signifikante bzw. sehr signifikante Abweichung der beobachteten von der erwarteten<br />
Häufigkeit an. Akkreditierte Urheber relevant benutzen als Quellen sehr signifikant häufiger aktive Sportler <strong>und</strong><br />
sportexterne Personen signifikant seltener als erwartet. Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von<br />
20,444 zeigt, dass die Nullhypothese zu verwerfen <strong>und</strong> dass die Abhängigkeit der Variablen zu bestätigen ist. Der<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,123) von 0,067 ist nicht signifikant. Der höchst signifikante Cramer-<br />
V-Wert (p = 0,000) wird mit 0,196 ermittelt. Ohne die Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 ergibt sich<br />
ein bei drei Freiheitsgraden höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 32,917. Der höchst signifikante<br />
Spearman’sche Korrelationskoeffizient (p = 0,000) von 0,218 zeigt eine geringe, positive Korrelation an. Der Blick<br />
auf die Werte der standardisierten Residuen zeigt, dass die Signifikanz in der ersten (Aktiver Sportler: 4,2) <strong>und</strong><br />
vierten Zelle (Nicht aus Sportwelt: -2,7) der akkreditierten Urheber relevant begründet liegt. Ohne Meldungen <strong>und</strong><br />
die Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 ergeben sich folgende Werte: ein höchst signifikanter Chi-<br />
Quadrat (p = 0,000) von 18,808 <strong>und</strong> ein höchst signifikanter Spearman-Korrelationskoeffizient (p = 0,000) von<br />
0,197. Es besteht eine sehr geringe Korrelation. Die Nullhypothese wird jeweils nicht angenommen; die Variablen<br />
sind voneinander abhängig. Es werden signifikante bis sehr signifikante Abweichungen bei denselben Zellen wie<br />
zuvor ermittelt.<br />
114
ßer an, was signifikante Abweichungen der beobachteten Häufigkeiten von den erwarteten<br />
Häufigkeiten anzeigt. Nach Pearson ergibt sich ein höchst signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p<br />
= 0,001) von 18,835. Die Nullhypothese wird deshalb nicht angenommen, <strong>und</strong> die beiden<br />
geprüften Variablen gelten nicht als unabhängig voneinander. Nach dem signifikanten<br />
Spearman’schen Korrelationskoeffizienten (p = 0,015) von -0,087 besteht eine sehr geringe<br />
Korrelation. Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,001) wird zudem mit 0,155 ermittelt.<br />
142<br />
Tab. 62: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Quelle 1<br />
Ohne Meldungen wird die Unabhängigkeit der Variablen mit einem nicht signifikanten Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,078) von 8,398 angenommen. Bei der Berechnung ohne Ausprägung<br />
„9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 <strong>und</strong> ohne Meldungen wird die Nullhypothese aufgr<strong>und</strong><br />
eines nicht signifikanten Chi-Quadrat-Werts (p = 0,062) akzeptiert.<br />
6.2.6.3 Anzahl Quellen<br />
6.2.6.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die beiden Stichproben, die auf den Ausprägungen der Variablen Urheber nur Redakteure<br />
basieren, sind nach dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest nicht normalverteilt. Als<br />
nichtparametrischer Test wird deshalb der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney benutzt. 143<br />
Tab. 63: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>–</strong> wie die mittleren Ränge zeigen <strong>–</strong> in<br />
ihren Texten <strong>im</strong> Schnitt mehr Quellen als nicht akkreditierte Redakteure.<br />
Tab. 64: Mediane Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
142<br />
Ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 zu berücksichtigen, wird eine sehr geringe Korrelation<br />
ermittelt, da der Spearman-Koeffizient -0,173 beträgt. Spearman-Koeffizient <strong>und</strong> Chi-Quadrat-Wert sind höchst<br />
signifikant (p = 0,000). Akkreditierte Zeitungen verwenden als wichtigste Quelle signifikant häufiger sportexterne<br />
Personen, bei den nicht akkreditierten Zeitungen wird signifikant seltener als erwartet die Ausprägung „4<strong>“</strong> codiert.<br />
143<br />
Im Anhang sind alle Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests einsehbar.<br />
115
Die Werte der beiden Mediane belegen, was die mittleren Ränge angezeigt haben: Der Median<br />
der Anzahl Quellen ist bei den Texten akkreditierter Redakteure größer als bei Beiträgen<br />
nicht akkreditierter Redakteure.<br />
Tab. 65: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Das U-Test-Ergebnis beweist, dass ein sehr signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl<br />
der verwendeten Handlungsträger in den Texten der Gruppen besteht (p = 0,005). 144<br />
6.2.6.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Der Wert des mittleren Rangs der akkreditierten Redakteure ist mit 256,70 kleiner als der<br />
mittlere Rang-Wert der Ausprägung Agentur mit 257,06. Der Median der ersten Gruppe beträgt<br />
2,00, der Median der zweiten Gruppe 1,00. Der U-Test beweist bei den beiden nicht<br />
normalverteilten Stichproben keinen signifikanten Unterschied (p = 0,983). 145<br />
Tab. 66: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen in der Analyse ergibt sich nach dem U-Test eine<br />
Irrtumswahrscheinlichkeit p von 0,031. Es besteht ein signifikanter Unterschied. Der Wert<br />
des mittleren Ranges mit 165,60 ist bei den Regionalzeitungsredakteuren kleiner als bei den<br />
Nachrichtenagenturen mit 194,27. Der Median bei den Stichproben beträgt 2,00.<br />
Werden meinungsbetonte Texte aussortiert, ist der mittlere Rang akkreditierter Redakteure<br />
mit 286,46 <strong>und</strong> der Median mit 2,00 größer als der mittlere Rang der Ausprägung Agentur<br />
mit 238,62 <strong>und</strong> der Median mit 1,00. Der U-Test liefert für die Irrtumswahrscheinlichkeit p<br />
einen signifikanten Wert von 0,011. Akkreditierte Redakteure verwenden signifikant mehr<br />
Quellen als Agenturen, wenn meinungsbetonte Texte nicht berücksichtigt werden.<br />
6.2.6.3.3 Urheber relevant<br />
Die mittleren Rangplätze der nicht normalverteilten Stichproben, die auf den Ausprägungen<br />
der Variablen Urheber nur Redakteure basieren, zeigen an, dass akkreditierte Urheber relevant<br />
mehr Quellen in den Texten benutzen als nicht akkreditierte Urheber relevant.<br />
144<br />
Bei der Berechnung ohne Berücksichtigung der Meldungen besteht wie bei der oben beschriebenen Analyse<br />
mit dem U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney ein sehr signifikanter Unterschied zwischen den beiden geprüften Stichproben<br />
(p = 0,003). Die Mediane betragen 2,00 <strong>und</strong> 1,00. Jeweils signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen<br />
werden ermittelt, wenn subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen (p = 0,011) bzw. Meldungen<br />
<strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen (p = 0,012) ausgeklammert werden.<br />
145<br />
Kein signifikanter Unterschied liegt vor, wenn Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonte Texte ausgeklammert werden.<br />
Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit p mit 0,710 an. Der mittlere Rang akkreditierter<br />
Regionalzeitungsredakteure beträgt 180,41 <strong>und</strong> der mittlere Rang der Ausprägung Agentur 175,11.<br />
116
Tab. 67: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Die Differenz zwischen den Median-Werten der Gruppen bestätigt den Unterschied. Der Median<br />
der Stichprobe akkreditierte Urheber relevant beträgt 2,00; der Median der anderen<br />
Stichprobe 1,00. Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney belegt, dass kein signifikanter Unterschied<br />
hinsichtlich der codierten Anzahl an Quellen der Gruppen vorliegt (p = 0,438). 146<br />
Tab. 68: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Exklusive subjektivierend-argumentierende Texte besteht ein signifikanter Unterschied zwischen<br />
den Gruppen hinsichtlich der Anzahl der identifizierten Quellen. Die mittleren Ränge<br />
weisen einen deutlichen Unterschied zwischen akkreditierten Urhebern relevant (422,90) <strong>und</strong><br />
nicht akkreditierten Urhebern relevant auf (342,71) <strong>–</strong> wie die beiden Mediane dokumentieren<br />
(2,00 bzw. 1,00). Eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,003 nach dem Mann-Whitney-U-Test<br />
belegt den sehr signifikanten Unterschied. Werden neben meinungsbetonten Texten zusätzlich<br />
Meldungen aus der Berechnung entfernt, ist der Unterschied nicht signifikant (p = 0,582).<br />
6.2.6.3.4 Zeitungsschicht<br />
Der Wert des mittleren Rangs der akkreditierten Zeitungen ist mit 377,22 kleiner als der mittlere<br />
Rang-Wert der nicht akkreditierten Zeitungen mit 410,07.<br />
Tab. 69: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Der Median der Anzahl der Quellen beträgt bei beiden Gruppen 1,00. Der U-Test nach Mann<br />
<strong>und</strong> Whitney (p = 0,037) beweist einen signifikanten Unterschied. 147<br />
Tab. 70: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
146<br />
Werden Meldungen nicht berücksichtigt, sind die Werte der mittleren Ränge der akkreditierten Urheber relevant<br />
kleiner als die Werte der nicht akkreditierten Urheber relevant. Der Mann-Whitney-U-Test beweist, dass der<br />
Unterschied nicht signifikant ist (p = 0,190).<br />
147<br />
Bei Nichtberücksichtigung der Meldungen in der Analyse ergibt sich nach dem Mann-Whitney-U-Test eine<br />
Irrtumswahrscheinlichkeit p von 0,029. Es besteht ein signifikanter Unterschied. Sowohl der Wert des mittleren<br />
Ranges (262,04) als auch der Median (1,00) der akkreditierten Zeitungen ist kleiner als der mittlere Rang-Wert<br />
(291,18) <strong>und</strong> der Median (2,00) der nicht akkreditierten Zeitungen.<br />
117
Werden meinungsbetonte Texte aussortiert, ist der mittlere Rang der akkreditierten Zeitungen<br />
zwar kleiner, es liegt aber kein signifikanter Unterschied vor. Der U-Test nach Mann <strong>und</strong><br />
Whitney liefert für die Irrtumswahrscheinlichkeit p einen Wert von 0,097. 148<br />
6.2.7 Hypothese 07: Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<br />
6.2.7.1 Anzahl Vornamen<br />
Die Ergebnisse des H-Tests nach Kruskal <strong>und</strong> Wallis be<strong>im</strong> Mittelwertvergleich der Anzahl der<br />
Vornamen innerhalb der sieben Ausprägungen der Variablen Urheber sind mit p-Werten von<br />
0,000 bzw. 0,024 höchst signifikant <strong>und</strong> ohne Meldungen signifikant. Zur genaueren Untersuchung<br />
werden die aufgr<strong>und</strong> der Forschungsfrage besonders interessanten Urheber-<br />
Gruppen Redaktion nicht akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion akkreditiert <strong>–</strong> zugleich die beiden Ausprägungen<br />
der Variablen Urheber nur Redakteure <strong>–</strong> sowie Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Agentur<br />
miteinander mittels des U-Tests nach Mann <strong>und</strong> Whitney bezüglich des Vornamen-<br />
Gebrauchs verglichen.<br />
6.2.7.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Stichproben, die auf den Ausprägungen der Variablen Urheber nur Redakteure akkreditiert<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditiert basieren, sind nach dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest<br />
nicht normalverteilt. Als nichtparametrischer Test wird der Mann-Whitney-U-Test benutzt. 149<br />
Tab. 71: Ränge Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>–</strong> wie die mittleren Ränge zeigen <strong>–</strong> <strong>im</strong><br />
Schnitt weniger Vornamen in den Texten als nicht akkreditierte Redakteure.<br />
Tab. 72: Mediane Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Der Median-Wert beider Gruppen beträgt 0,00. Die Mittelwerte bestätigen allerdings, was die<br />
mittleren Ränge angezeigt haben: Der Mittelwert der Anzahl Vornamen ist bei akkreditierten<br />
Redakteuren kleiner als bei nicht akkreditierten Journalisten.<br />
Tab. 73: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
148<br />
Kein signifikanter Unterschied liegt vor, wenn Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonte Texte ausgeklammert werden.<br />
Der mittlere Rang akkreditierter Zeitungen beträgt 228,48 <strong>und</strong> der mittlere Rang nicht akkreditierter 243,95. Der<br />
U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit p mit 0,211 an.<br />
149<br />
Sofern nicht explizit angegeben, sind die nachfolgend diskutierten Stichproben nicht normalverteilt. Im Anhang<br />
sind alle Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests zur Überprüfung der Verteilungsform einsehbar.<br />
118
Die Ergebnisse des U-Tests beweisen, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der<br />
Anzahl der codierten Vornamen in den Texten der beiden Gruppen besteht (p = 0,302). 150<br />
6.2.7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Der mittlere Rang der Ausprägung Redaktion akkreditiert ist mit 270,89 größer als der Wert<br />
der Agentur mit 254,28. In Artikeln akkreditierter Redakteure ist <strong>im</strong> Schnitt eine größere Anzahl<br />
an Vornamen zu finden. Der Mittelwert der Ausprägung Redaktion akkreditiert beträgt<br />
0,35 <strong>–</strong> der Mittelwert der Ausprägung Agentur 0,13.<br />
Tab. 74: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Die Ergebnisse des U-Tests beweisen, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der<br />
Anzahl der codierten Vornamen in den Texten der beiden geprüften Urheber-Gruppen besteht<br />
(p = 0,060). 151<br />
Werden meinungsbetonte Texte aus der Untersuchung aussortiert, reduziert sich die Anzahl<br />
der relevanten Texte akkreditierter Redakteure um 24 auf 60. Auf der anderen Seite wird ein<br />
Agentur-Text ausgeklammert. Der Mittelwert der Gruppe akkreditierter Redakteure erhöht<br />
sich auf 0,45. Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney bestätigt einen sehr signifikanten Unterschied<br />
(p = 0,008).<br />
Tab. 75: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Bei allen vier Berechnungsvarianten zeigen die Werte der mittleren Ränge, dass Texte akkreditierter<br />
Redakteure <strong>im</strong> Schnitt mehr Vornamen aufweisen als Artikel, die von Agenturen<br />
stammen.<br />
6.2.7.1.3 Urheber relevant<br />
Die mittleren Rangplätze der beiden nicht normalverteilten Stichproben, die auf den Ausprägungen<br />
der Variablen Urheber relevant basieren, zeigen an, dass akkreditierte Urheber relevant,<br />
die akkreditierten Regionalzeitungsredakteure, mehr Vornamen in den Texten benutzen<br />
als nicht akkreditierte Urheber relevant.<br />
150<br />
Bei den Berechnungen ohne Meldungen (p = 0,311), ohne subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen<br />
(p = 0,337) sowie ohne Meldungen <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen (p = 0,310)<br />
existieren aufgr<strong>und</strong> der ermittelten Irrtumswahrscheinlichkeiten p nach dem Mann-Whitney-U-Test keine signifikanten<br />
Unterschiede zwischen den Gruppen.<br />
151<br />
Bei der Berechnung exklusive subjektivierend-argumentierender Texte <strong>und</strong> kurzer Texte mit max<strong>im</strong>al 600<br />
Zeichen wird aufgr<strong>und</strong> einer Irrtumswahrscheinlichkeit p von 0,090 ein nicht signifikanter Unterschied hinsichtlich<br />
der Anzahl der identifizierten Vornamen festgestellt. Werden Meldungen nicht berücksichtigt, zeigt das Ergebnis<br />
des Mann-Whitney-Tests, dass der Unterschied nicht signifikant ist (p = 0,345).<br />
119
Tab. 76: Ränge Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney belegt, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich<br />
der codierten Anzahl an Vornamen in den Texten vorliegt (p = 0,117). 152<br />
Tab. 77: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Exklusive subjektivierend-argumentierender Texte wird ein signifikanter Unterschied zwischen<br />
den Stichproben festgestellt (p = 0,012). Wie die mittleren Ränge anzeigen, werden in<br />
den Texten akkreditierter Urheber relevant mit einem Mittelwert von 0,47 mehr Vornamen<br />
verschlüsselt als in den Beiträgen nicht akkreditierter Urheber relevant (0,16).<br />
Tab. 78: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
6.2.7.1.4 Zeitungsschicht<br />
Der Wert des mittleren Rangs akkreditierter Zeitungen ist mit 385,29 kleiner als der mittlere<br />
Rang-Wert nicht akkreditierter Zeitungen mit 399,57. Der Median der Variablen Anzahl Vornamen<br />
beider Gruppen beträgt 0,00. Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney beweist, dass kein<br />
signifikanter Unterschied bezüglich der Variablen Anzahl Vornamen existiert (p = 0,097). 153<br />
Tab. 79: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
152<br />
Bei der Berechnung exklusive subjektivierend-argumentierender Texte <strong>und</strong> kurzer Texte mit max<strong>im</strong>al 600<br />
Zeichen wird aufgr<strong>und</strong> einer Irrtumswahrscheinlichkeit p von 0,142 ein nicht signifikanter Unterschied hinsichtlich<br />
der Anzahl der identifizierten Vornamen festgestellt. Werden Meldungen nicht berücksichtigt, zeigt das Ergebnis<br />
des Mann-Whitney-U-Tests, dass der Unterschied nicht signifikant ist (p = 0,551). Bei allen vier Berechnungsvarianten<br />
zeigen die Werte der mittleren Ränge, dass die Texte akkreditierter Urheber relevant <strong>im</strong> Schnitt größere<br />
Werte der Vornamen-Anzahl aufweisen als die Texte nicht akkreditierter Urheber relevant.<br />
153<br />
Bei der Aussortierung meinungsbetonter Texte, kurzer Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen oder meinungsbetonter<br />
Texte <strong>und</strong> kurzer Texte zeigen die mittleren Ränge jeweils an, dass in akkreditierten Zeitungen <strong>im</strong> Schnitt weniger<br />
Vornamen benutzt werden. Aufgr<strong>und</strong> der p-Werte von 0,358 über 0,103 bis 0,430 wird den Unterschieden keine<br />
Signifikanz attestiert.<br />
120
6.2.7.2 Anzahl Spitznamen<br />
Die Ergebnisse des H-Tests nach Kruskal <strong>und</strong> Wallis be<strong>im</strong> Mittelwertvergleich der Anzahl der<br />
codierten Spitznamen innerhalb der sieben Ausprägungen der Variablen Urheber sind <strong>im</strong><br />
Fall der Berechnungen ohne Aussortierung bzw. mit Aussortierung meinungsbetonter Texte<br />
mit p-Werten von 0,018 bzw. 0,012 signifikant. Die Analysen exklusive Meldungen bzw. exklusive<br />
Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonter Texte ergeben keine signifikanten Unterschiede (p<br />
= 0,895 bzw. p = 0,725). Zur genaueren Untersuchung werden die Urheber-Ausprägungen<br />
Redaktion nicht akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion akkreditiert bzw. Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Agentur<br />
miteinander mittels des U-Tests nach Mann <strong>und</strong> Whitney bezüglich der Anzahl der gebrauchten<br />
Spitznamen verglichen.<br />
6.2.7.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>–</strong> wie die mittleren Ränge zeigen <strong>–</strong> <strong>im</strong><br />
Schnitt mehr Spitznamen in ihren Texten als nicht akkreditierte Redakteure.<br />
Tab. 80: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
Die Ergebnisse des U-Tests nach Mann <strong>und</strong> Whitney beweisen, dass kein signifikanter Unterschied<br />
hinsichtlich der Anzahl der codierten Spitznamen in den Texten der beiden Gruppen<br />
besteht (p = 0,584). 154<br />
Tab. 81: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
6.2.7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Ein Beitrag in der SVZ beschäftigt sich explizit mit Fußballer-Spitznamen. In diesem Text,<br />
der von Agentur-Journalisten stammt, werden 50 Spitznamen codiert, was zur Erhöhung der<br />
Werte bei den Ausprägungen Agentur, nicht akkreditierte Urheber relevant <strong>und</strong> nicht akkreditierte<br />
Zeitungsschicht führt. Ziel der Variablen Anzahl Spitznamen ist die Erfassung der<br />
Spitznamen als ein Indikator für mangelnde kritische <strong>Distanz</strong>, was bei einem Artikel, der sich<br />
explizit mit Spitznamen befasst, aufgr<strong>und</strong> der Definitionen <strong>und</strong> Codier-Anweisungen nicht<br />
zweifelsfrei der Fall sein muss. Deshalb werden bei der Berechnung mit den Urheber-<br />
Ausprägungen Redaktion nicht akkreditiert <strong>und</strong> Agentur bzw. mit den Variablen Urheber relevant<br />
<strong>und</strong> Zeitungsschicht zusätzlich die um die Spitznamen-Anzahl des betreffenden Artikels<br />
bereinigten Mann-Whitney-U-Test-Ergebnisse der Mittelwert-Vergleiche angegeben. 155<br />
154<br />
Bei den Berechnungen exklusive Meldungen (p = 0,659), subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen<br />
(p = 0,859) sowie Meldungen <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen (p = 0,929) existieren<br />
aufgr<strong>und</strong> der ermittelten Irrtumswahrscheinlichkeiten p nach dem Mann-Whitney-U-Test keine signifikanten Unterschiede<br />
zwischen den Gruppen. Die mittleren Ränge akkreditierter Redakteure nehmen jeweils größere Werte<br />
an als die Werte nicht akkreditierter Redakteure.<br />
155<br />
Die gesamten Ergebnisse der bereinigten Berechnungen sind <strong>im</strong> Anhang zu finden.<br />
121
Die Werte der mittleren Ränge zeigen bei den vier jeweils durchgeführten Berechnungsvarianten,<br />
dass ein Unterschied zwischen den Gruppen besteht: Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
setzen <strong>im</strong> Schnitt häufiger Spitznamen ein als Urheber von Agentur-Beiträgen.<br />
Lediglich der Unterschied bei der Analysevariante ohne meinungsbetonte Texte erweist sich<br />
nach dem Mann-Whitney-U-Test als signifikant (p = 0,040). Der bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit<br />
p beträgt 0,037. Ohne Meldungen wird mit p = 0,927 der größte Wert der<br />
Irrtumswahrscheinlichkeit angegeben.<br />
Tab. 82: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
6.2.7.2.3 Urheber relevant<br />
Die mittleren Rangplätze der beiden nicht normalverteilten Stichproben, die auf den beiden<br />
Ausprägungen der Variablen Urheber relevant basieren, zeigen an, dass akkreditierte Urheber<br />
relevant mehr Vornamen in ihren Texten benutzen als nicht akkreditierte Urheber relevant.<br />
Tab. 83: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney belegt, dass ein signifikanter Unterschied hinsichtlich<br />
der codierten Anzahl an Spitznamen zwischen den beiden Gruppen vorliegt (p = 0,015). Der<br />
bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,014. 156<br />
Tab. 84: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant<br />
Bei der Berechnung exklusive subjektivierend-argumentierender Texte <strong>und</strong> kurzer Texte mit<br />
max<strong>im</strong>al 600 Zeichen wird aufgr<strong>und</strong> einer Irrtumswahrscheinlichkeit p von 0,423 ein nicht<br />
signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl der identifizierten Spitznamen festgestellt.<br />
Der bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,402. 157 Bei allen vier Berechnungsvarianten<br />
zeigen die Werte der mittleren Ränge, dass die Texte akkreditierter Urheber<br />
relevant <strong>im</strong> Schnitt größere Werte der Spitznamen-Anzahl haben als die Texte nicht akkreditierter<br />
Urheber relevant.<br />
156<br />
Exklusive subjektivierend-argumentierende Texte wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Stichproben<br />
festgestellt (p = 0,011). Der bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,010. Wie die mittleren Ränge<br />
anzeigen, werden in den Texten akkreditierter Urheber relevant mit einem Mittelwert von 1,03 mehr Vornamen<br />
verschlüsselt als in den Beiträgen nicht akkreditierter Urheber relevant mit einem Mittelwert von 0,78.<br />
157<br />
Werden Meldungen nicht berücksichtigt, zeigt das Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests, dass der Unterschied<br />
nicht signifikant ist (p = 0,677). Der bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,650.<br />
122
6.2.7.2.4 Zeitungsschicht<br />
Mittlere Ränge von 371,82 bei den akkreditierten Zeitungen <strong>und</strong> 417,09 bei den nicht akkreditierten<br />
Zeitungen bedeuten, dass die akkreditierten Zeitungen <strong>im</strong> Schnitt niedrigere Werte<br />
der Spitznamen-Anzahl haben als die nicht akkreditierten Zeitungen.<br />
Tab. 85: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Dieser Unterschied ist überzufällig, da der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney einen p-Wert von<br />
0,001 ermittelt. Der bereinigte Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,001. 158<br />
Tab. 86: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
6.2.7.3 Anzahl Identifikationen<br />
Die Ergebnisse des H-Tests nach Kruskal <strong>und</strong> Wallis be<strong>im</strong> Mittelwertvergleich der Anzahl der<br />
codierten Identifikationen innerhalb der sieben Ausprägungen der Variablen Urheber sind bei<br />
den vier Berechnungsvarianten mit p-Werten von 0,000 höchst signifikant bzw. mit einem p-<br />
Wert von 0,006 bei der Analyse ohne Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonter Texte sehr signifikant.<br />
Zur genaueren Untersuchung werden die Urheber-Ausprägungen Redaktion nicht akkreditiert<br />
<strong>und</strong> Redaktion akkreditiert bzw. Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Agentur mittels des<br />
Mann-Whitney-U-Tests bezüglich der Anzahl identifizierter Identifikationen verglichen.<br />
6.2.7.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Redakteure kommen auf kleinere Werte der benutzen Identifikationen-Anzahl in<br />
ihren Texten als nicht akkreditierte Redakteure. Dies belegen die Werte der mittleren Ränge.<br />
In den Artikeln akkreditierter Redakteure wird ein Mittelwert von 0,17 Identifikationen ermittelt;<br />
der Mittelwert nicht akkreditierter Redakteure beträgt 0,66. Das U-Test-Ergebnis beweist,<br />
dass ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl der Identifikationen besteht<br />
(p = 0,012) <strong>–</strong> bei der Berechnung exklusive Meldungen wird p = 0,013 ermittelt.<br />
Tab. 87: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure<br />
158<br />
Bei der Aussortierung meinungsbetonter Texte, kurzer Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen oder meinungsbetonter<br />
Texte <strong>und</strong> kurzer Texte zeigen die mittleren Ränge jeweils an, dass in akkreditierten Zeitungen <strong>im</strong> Schnitt weniger<br />
Spitznamen benutzt werden. Aufgr<strong>und</strong> der p-Werte von 0,000 über 0,007 bis 0,006 sind die Unterschiede höchst<br />
bzw. sehr signifikant. Die bereinigten p-Werte betragen 0,000 <strong>und</strong> 0,009 sowie 0,008.<br />
123
Bei den Untersuchungen ohne subjektivierend-argumentierende journalistische Darstellungsformen<br />
(p = 0,113) sowie ohne Meldungen <strong>und</strong> subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen<br />
(p = 0,105) existieren aufgr<strong>und</strong> der ermittelten Irrtumswahrscheinlichkeiten p<br />
nach dem Mann-Whitney-U-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.<br />
6.2.7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Die Werte der mittleren Ränge zeigen an, dass in Texten akkreditierter Redakteure häufiger<br />
Identifikationen zu finden sind als in Agentur-Texten. Bei den weiteren drei Berechnungsvarianten<br />
ist ein Unterschied derselben Richtung festzustellen.<br />
Tab. 88: Ränge Anzahl Identifikationen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Der U-Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney belegt, dass ein sehr signifikanter Unterschied hinsichtlich<br />
der codierten Anzahl an Identifikationen zwischen den beiden geprüften Gruppen vorliegt<br />
(p = 0,009).<br />
Tab. 89: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)<br />
Bei den weiteren drei Berechnungsvarianten wird kein signifikanter Unterschied ermittelt. Die<br />
Irrtumswahrscheinlichkeit p ist jeweils größer 0,05.<br />
6.2.7.3.3 Urheber relevant<br />
Die mittleren Rangplätze der nicht normalverteilten Stichproben, die auf den Ausprägungen<br />
der Variablen Urheber relevant basieren, zeigen an, dass akkreditierte Urheber relevant<br />
mehr Identifikationen in den Texten benutzen als nicht akkreditierte Urheber relevant. Der U-<br />
Test nach Mann <strong>und</strong> Whitney belegt, dass kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der codierten<br />
Anzahl an Identifikationen zwischen den beiden Gruppen vorliegt (p = 0,183). 159 Bei<br />
allen vier Berechnungsvarianten zeigen die Werte der mittleren Ränge, dass die Stichprobe<br />
akkreditierter Urheber relevant <strong>im</strong> Schnitt größere Werte der Identifikationen-Anzahl aufweist<br />
als die Stichprobe nicht akkreditierter Urheber relevant.<br />
6.2.7.3.4 Zeitungsschicht<br />
Der Unterschied zwischen den beiden Stichproben akkreditierte <strong>und</strong> nicht akkreditierte Zeitungen<br />
ist nicht überzufällig, wie das Ergebnis des U-Tests anzeigt (p = 0,603). Die weiteren<br />
drei Berechnungen ermitteln nicht signifikante Unterschiede (p > 0,05).<br />
159<br />
Exklusive subjektivierend-argumentierender Texte (p = 0,142), Meldungen (p = 0,545) oder subjektivierendargumentierender<br />
Texte <strong>und</strong> kurzer Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen (p = 0,381) sind die Unterschiede hinsichtlich<br />
der Anzahl der identifizierten Identifikationen nicht signifikant.<br />
124
Tab. 90: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
6.2.8 Hypothese 08: Verstecken hinter Experten<br />
6.2.8.1 Artikel-Umfang<br />
Bei den Stichproben, die sich aus meinungsbetonten Texten <strong>und</strong> den Ausprägungen akkreditierter<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierter Zeitungsschicht zusammensetzen, kann die Annahme der<br />
Normalverteilung aufgr<strong>und</strong> der Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest aufrecht<br />
erhalten werden. Der Vergleich der Stichproben hinsichtlich der Mittelwerte mittels des<br />
t-Tests nach Student klärt die Frage, ob auftretende Mittelwertunterschiede sich mit zufälligen<br />
Schwankungen erklären lassen oder signifikante Unterschiede bestehen. 160<br />
Der t-Test bei unabhängigen Stichproben gibt für den aufgr<strong>und</strong> des Levene-Test-<br />
Ergebnisses angenommenen Fall der Varianzhomogenität eine Irrtumswahrscheinlichkeit p<br />
von 0,041 an. Im Schnitt sind meinungsbetonte Texte akkreditierter Zeitungen 1598,13 Zeichen<br />
lang, subjektivierend-argumentierende Beiträge nicht akkreditierter Zeitungen 1979,08<br />
Zeichen lang. Zwischen den Gruppen besteht ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des<br />
Umfangs meinungsbetonter Texte. Werden kurze Texte aussortiert, fällt ein OVZ-Kommentar<br />
<strong>und</strong> damit der akkreditierten Gruppe heraus <strong>–</strong> der t-Test liefert einen p-Wert von 0,052.<br />
Die von Regionalzeitungsredakteuren geschriebenen meinungsbetonten Texte unterscheiden<br />
sich aufgeteilt nach Zeitungsschichten signifikant voneinander (p = 0,000). Beiträge akkreditierter<br />
Zeitungen sind mit durchschnittlich 1386,07 Zeichen kürzer als Beiträge nicht<br />
akkreditierter Zeitungen mit 1938,35 Zeichen. Die von Experten geschriebenen meinungsbetonten<br />
Texte unterscheiden sich aufgeteilt nach Zeitungsschichten nicht signifikant voneinander<br />
(p = 0,603). Experten-Texte akkreditierter Zeitungen sind mit durchschnittlich 2446,36<br />
Zeichen länger als Experten-Texte nicht akkreditierter Zeitungen mit 2157,71 Zeichen.<br />
Eine einfache Varianzanalyse zum Vergleich von mehr als zwei unabhängigen Stichproben<br />
überprüft, ob sich die Textumfänge in den Urheber-Gruppen signifikant voneinander unterscheiden.<br />
Im Fall eines signifikanten Ergebnisses der Varianzanalyse zeigt der Duncan-Test<br />
(Post-Hoc-Test) an, welche Urheber-Gruppen sich <strong>im</strong> Einzelnen signifikant voneinander unterscheiden.<br />
Meinungsbetonte Texte stammen von vier Urheber-Gruppen:<br />
1. Redaktion (nicht akkreditiert),<br />
2. Redaktion (akkreditiert),<br />
3. Agentur <strong>und</strong><br />
4. Experte/Gastautor.<br />
Der Post-Hoc-Test kann für den Textumfang meinungsbetonter Texte nicht durchgeführt<br />
werden, wenn die Ausprägung Agentur mitberücksichtigt wird, da diese Gruppe mit einem<br />
codierten Text weniger als zwei Fälle aufweist. Deshalb wird die Ausprägung Agentur aus<br />
der Analyse <strong>und</strong> den folgenden Berechnungen entfernt. Die Varianzanalyse ermittelt ein<br />
160<br />
Die Mittelwerte, die zur Überprüfung der achten Hypothese verwendet werden, stammen in der Regel aus<br />
Stichproben mit normalverteilten Werten. Besteht keine Normalverteilung wird explizit darauf hingewiesen. Es<br />
muss beachtet werden, dass sich die Berechnungen auf 80 Texte der Ausprägung subjektivierendargumentierend<br />
der Variablen Darstellungsform stützen.<br />
125
höchst signifikantes Ergebnis (p = 0,000). Die Textumfänge unterscheiden sind in den drei<br />
Gruppen signifikant voneinander.<br />
Tab. 91: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Umfang meinungsbetonter Texte <strong>–</strong> Faktor Urheber<br />
Der Duncan-Test liefert auf dem Niveau p = 0,05 zwei homogene Untergruppen, von denen<br />
die eine aus der Urheber-Gruppe Experte/Gastautor <strong>und</strong> die andere aus den beiden Urheber-Gruppen<br />
Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht akkreditiert besteht. Dies bedeutet,<br />
dass sich die Urheber-Gruppe Experte/Gastautor von den anderen beiden Gruppen signifikant<br />
unterscheidet, die beiden Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht<br />
akkreditiert aber untereinander keinen signifikanten Unterschied aufweisen. Werden Meldungen<br />
aus der Analyse ausgeklammert, werden derselbe p-Wert <strong>und</strong> dieselben homogenen<br />
Untergruppen ermittelt.<br />
Tab. 92: Duncan-Test-Ergebnis Umfang meinungsbetonter Texte <strong>–</strong> Faktor Urheber<br />
Mittelwert-Vergleiche nach der Aufteilung der Stichproben in die Schichten akkreditierte Zeitung<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierte Zeitung zeigen, ob sich die Textumfänge in den Urheber-<br />
Gruppen jeweils in den beiden Zeitungsschichten signifikant voneinander unterscheiden. Aus<br />
dem oben genannten Gr<strong>und</strong> wird die Urheber-Ausprägung Agentur erneut aussortiert.<br />
Tab. 93: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (aufgeteilt nach Zeitungsschicht)<br />
Die Varianzanalyse ermittelt ein höchst signifikantes Ergebnis (p = 0,001) in der Zeitungsschicht<br />
akkreditiert. Die Textumfänge unterscheiden sich in den Gruppen signifikant voneinander.<br />
In der Schicht nicht akkreditiert wird ein nicht signifikanter Unterschied registriert (p =<br />
0,272). Die Umfänge unterscheiden sich in den Gruppen nicht signifikant voneinander.<br />
Nach dem Ergebnis des Duncan-Tests existieren in der Zeitungsschicht akkreditiert zwei<br />
homogene Untergruppen: Die eine besteht aus der Urheber-Gruppe Experte/Gastautor <strong>und</strong><br />
die andere aus den beiden Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht akkreditiert.<br />
Die Urheber-Gruppe Experte/Gastautor unterscheidet sich von den anderen bei-<br />
126
den Gruppen signifikant. Die beiden Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion<br />
nicht akkreditiert weisen <strong>im</strong> Vergleich keinen signifikanten Unterschied auf. Werden Meldungen<br />
aus der Analyse ausgeklammert, werden innerhalb der Zeitungsschicht akkreditiert derselbe<br />
p-Wert <strong>und</strong> dieselben homogenen Untergruppen ermittelt.<br />
Tab. 94: Duncan-Test-Ergebnis Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (nur Zeitungsschicht akkreditiert)<br />
Da in der Zeitungsschicht nicht akkreditiert weniger als drei Gruppen vorhanden sind, kann in<br />
dieser Gruppe kein Duncan-Test für den Umfang durchgeführt werden. Zur Überprüfung eines<br />
möglichen signifikanten Unterschieds wird der t-Test durchgeführt, der wie das oben<br />
genannte Ergebnis der einfachen Varianzanalyse keinen signifikanten Unterschied zwischen<br />
den Mittelwerten der Textumfänge nicht akkreditierter Redakteure (1938,35) <strong>und</strong> der Experten/Gastautoren<br />
(2157,71) feststellt (p = 0,272).<br />
6.2.8.2 Anzahl wertender Aussagen<br />
Bei den Stichproben, die sich aus der Variablen Anzahl Wertende Aussage <strong>und</strong> den Ausprägungen<br />
akkreditierte <strong>und</strong> nicht akkreditierte Zeitungsschicht zusammensetzen, kann die Annahme<br />
der Normalverteilung aufgr<strong>und</strong> der Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-<br />
Anpassungstest aufrecht erhalten werden. Der t-Test gibt für den aufgr<strong>und</strong> des Levene-Test-<br />
Ergebnisses angenommenen Fall der Varianzheterogenität eine Irrtumswahrscheinlichkeit p<br />
von 0,095 an.<br />
Tab. 95: t-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussagen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht<br />
Im Schnitt sind in meinungsbetonten Texten akkreditierter Zeitungen 7,89 wertende Aussagen<br />
zu finden <strong>–</strong> in subjektivierend-argumentierenden Beiträgen nicht akkreditierter Zeitungen<br />
9,60 wertende Aussagen. Zwischen den beiden Zeitungsgruppen besteht kein signifikanter<br />
Unterschied hinsichtlich der Anzahl wertender Aussagen in meinungsbetonten Texten (p =<br />
0,095). Werden kurze Texte aussortiert, fällt ein Kommentar aus der OVZ <strong>und</strong> damit der akkreditierten<br />
Gruppe heraus. Der t-Test liefert dann einen p-Wert von 0,116. Die von Regionalzeitungsredakteuren<br />
geschriebenen meinungsbetonten Texte unterscheiden sich bezüglich<br />
der Anzahl wertender Aussagen aufgeteilt nach Zeitungsschichten nicht signifikant voneinander<br />
(p = 0,079). Die von Experten geschriebenen meinungsbetonten Texte unterscheiden<br />
sich aufgeteilt nach Zeitungsschichten nicht signifikant voneinander (p = 0,403).<br />
Eine einfache Varianzanalyse mit Duncan-Test klärt die Frage, ob sich die Anzahl Wertungen<br />
in den Ausprägungen der Variablen Urheber signifikant voneinander unterscheidet bzw.<br />
127
welche Ausprägungen sich diesbezüglich <strong>im</strong> Einzelnen signifikant voneinander unterscheiden.<br />
Die Ausprägung Agentur wird aus den genannten Gründen aussortiert. Die Varianzanalyse<br />
ermittelt ein sehr signifikantes Ergebnis (p = 0,006). Die Anzahl wertender Aussagen<br />
unterscheidet sich in den drei Gruppen signifikant voneinander.<br />
Tab. 96: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Anzahl Wertende Aussage <strong>–</strong> Faktor Urheber<br />
Der Duncan-Test liefert zwei homogene Untergruppen, von denen die eine aus der Urheber-<br />
Ausprägung Experte/Gastautor <strong>und</strong> die andere aus den beiden Urheber-Gruppen Redaktion<br />
(akkreditiert) <strong>und</strong> Redaktion (nicht akkreditiert) besteht. Die Urheber-Gruppe Experte/Gastautor<br />
unterscheidet sich damit nicht nur bezüglich des Umfangs meinungsbetonter<br />
Texte, sondern auch hinsichtlich der Anzahl wertender Aussagen signifikant von den anderen<br />
beiden Gruppen. Die Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht akkreditiert<br />
weisen untereinander keinen signifikanten Unterschied auf. Exklusive Meldungen<br />
werden ein p-Wert von 0,009 <strong>und</strong> dieselben homogenen Untergruppen ermittelt.<br />
Tab. 97: Duncan-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussagen <strong>–</strong> Faktor Urheber<br />
Mittels einfacher Varianzanalyse, Duncan-Test <strong>und</strong> t-Test wird geprüft, ob sich die codierte<br />
Anzahl wertender Aussagen in den Urheber-Gruppen der jeweiligen Zeitungsschichten signifikant<br />
voneinander unterscheidet. Die Urheber-Ausprägung Agentur wird nicht berücksichtigt.<br />
Tab. 98: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Anzahl Wertende Aussage<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (aufgeteilt nach Zeitungsschicht)<br />
Die Varianzanalyse ermittelt ein signifikantes Ergebnis (p = 0,012) in der Schicht akkreditiert.<br />
Die Anzahl der Wertungen unterscheidet sich in den drei Gruppen signifikant voneinander. In<br />
der Schicht nicht akkreditiert wird ein nicht signifikanter Unterschied registriert (p = 0,418).<br />
Die Anzahl wertender Aussagen unterscheidet sind in den Gruppen nicht überzufällig voneinander.<br />
Es bestehen in der Stichprobe der akkreditierten Zeitungen zwei homogene Untergruppen: In<br />
der einen ist die Urheber-Gruppe Experte/Gastautor aufgelistet, in der anderen werden die<br />
128
eiden Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht akkreditiert geführt. Die<br />
Urheber-Gruppe Experte/Gastautor unterscheidet sich von den anderen beiden Gruppen<br />
signifikant. Die beiden Urheber-Gruppen Redaktion akkreditiert <strong>und</strong> Redaktion nicht akkreditiert<br />
weisen untereinander keinen signifikanten Unterschied auf. Werden Meldungen aus der<br />
Analyse ausgeklammert, werden dieselben homogenen Untergruppen ermittelt. Für die Zeitungsschicht<br />
wird ein p-Wert von 0,014 ermittelt, für die andere Schicht beträgt er 0,418.<br />
Tab. 99: Duncan-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussage<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (nur Zeitungsschicht akkreditiert)<br />
Da in der Zeitungsschicht nicht akkreditiert weniger als drei Gruppen vorhanden sind, kann in<br />
dieser Gruppe kein Duncan-Test für die Anzahl wertender Aussagen durchgeführt werden.<br />
Zur Überprüfung eines möglichen signifikanten Unterschieds wird der t-Test ausgeführt, der<br />
wie die oben beschriebene einfache Varianzanalyse keinen signifikanten Unterschied zwischen<br />
den Mittelwerten der Anzahl wertender Aussagen nicht akkreditierter Redakteure<br />
(9,29) <strong>und</strong> der Experten/Gastautoren (10,57) feststellt (p = 0,418).<br />
6.2.9 Hypothese 09: Rosarote Brille<br />
60,4 % der 675 codierten wertenden Aussagen sind positiv, 39,6 % negativ. Werden die Variablen<br />
Bezug WA <strong>und</strong> Bewertung WA kreuztabelliert, zeigen die Werte der standardisierten<br />
Residuen von max<strong>im</strong>al -3,2 bzw. 3,9 <strong>und</strong> die zellenweisen Prozentwerte an, dass die Bewertung<br />
von der Bezugsperspektive abhängig ist. Wird das deutsche Team oder Deutschland<br />
als Veranstalter bewertet, sind mehr Wertungen positiv <strong>und</strong> weniger negativ als erwartet.<br />
Tab. 100: Kreuztabelle Bezug WA x Bewertung WA<br />
Betreffen wertende Aussage Themen bzw. Gegenstände, die sich nicht eindeutig auf die<br />
deutsche Perspektive, die deutsche Mannschaft bzw. ihren Gegner beziehen, werden selte-<br />
129
ner positive <strong>und</strong> häufiger negative Wertungen codiert als erwartet. Anhand der standardisierten<br />
Residuen zeigt sich die Mittellage der Ausprägung Gegnerisches Team/Perspektive. Die<br />
Nullhypothese wird aufgr<strong>und</strong> eines höchst signifikanten Chi-Quadrat-Werts (p = 0,000) von<br />
36,460 bei zwei Freiheitsgraden verworfen. Die Variablen sind statistisch abhängig voneinander.<br />
Ein höchst signifikanter Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,232 belegt eine geringe<br />
Korrelation.<br />
Die Abhängigkeit der beiden geprüften Variablen wird durch höchst signifikante Chi-Quadrat-<br />
Werte (p ≤ 0,001) für die wertenden Aussagen der Urheber-Ausprägungen akkreditierte <strong>und</strong><br />
nicht akkreditierte Redakteure bewiesen. Ein Chi-Quadrat-Wert für die Urheber-Ausprägung<br />
Agentur kann nicht berechnet werden, da in einem relevanten Kommentar bei acht positiven<br />
Wertungen keine negative Wertung codiert wird. Für die Urheber-Ausprägung Gastautor/Experte<br />
wird dagegen die Unabhängigkeit der Variablen festgestellt. Der nicht signifikante<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,218) beträgt bei zwei Freiheitsgraden 3,048. 71,9 % der insgesamt<br />
210 Experten-Wertungen sind positiv <strong>–</strong> allgemeine Themen werden zu 60,0 % positiv<br />
bewertet, das deutsche Team zu 73,6 % <strong>und</strong> der Gegner mit 76,0 %. 161 Unterteilt nach<br />
akkreditierten <strong>und</strong> nicht akkreditierten Zeitungen wird die Abhängigkeit der beiden Variablen<br />
mit höchst bzw. sehr signifikanten p-Werten von 0,000 <strong>und</strong> 0,010 bestätigt.<br />
Die Werte der standardisierten Residuen von max<strong>im</strong>al -0,1 bzw. 0,1 <strong>und</strong> die zellenweisen<br />
Prozentwerte zeigen keine signifikanten Abweichungen der beobachteten von den erwarteten<br />
Häufigkeiten an, wenn die Variablen Urheber nur Redakteure <strong>und</strong> Bewertung WA miteinander<br />
kreuztabelliert werden. 54,8 % der wertenden Aussagen akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
sind positiv, 54,3 % der Wertungen nicht akkreditierter Redakteure.<br />
Tab. 101: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Bewertung WA<br />
Ein bei einem Freiheitsgrad nicht signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,914) von 0,012 wird<br />
nach Pearson ermittelt. Die Nullhypothese wird bestätigt; die beiden Variablen sind unabhängig<br />
voneinander.<br />
Getrennt nach den drei Ausprägungen der Variablen Bezug WA ergeben sich jeweils nicht<br />
signifikante Unterschiede. Zu der deutschen Perspektive sind z.B. bei den akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
64,7 % der Wertungen positiv, bei den nicht akkreditierten Redakteuren<br />
63,8 %, was zu einem nicht signifikanten p-Wert von 0,558 führt. 162<br />
161<br />
Im Anhang sind die diesbezüglichen detaillierten Ergebnisse <strong>und</strong> alle dazugehörigen Berechnungen zu finden.<br />
Im Text wird nur kurz auf die Überprüfung der Unabhängigkeit der Variablen Bewertung WA <strong>und</strong> Bezug WA eingegangen,<br />
da dies bei der Überprüfung der Hypothese erst ein Zwischenergebnis ist.<br />
162<br />
Siehe Anhang. Dort sind alle Ergebnisse der Signifikanz-Tests zu finden, die <strong>im</strong> Text nur kurz angedeutet<br />
werden können. Insgesamt acht wertende Aussagen eines Agentur-Kommentars, die alle positiv sind, werden<br />
codiert. Auf die Diskussion der Ergebnisse des Vergleichs der Urheber-Ausprägungen Redaktion (akkreditiert)<br />
<strong>und</strong> Agentur sowie der beiden Stichproben der Variablen Urheber relevant wird aufgr<strong>und</strong> der wenigen <strong>und</strong> einseitig<br />
verschlüsselten wertenden Agentur-Aussagen verzichtet. Der Urheber-relevant-Vergleich, auf dessen Diskus-<br />
130
Es folgt der Vergleich der Stichproben der bei dieser Hypothese relevanten Urheber-<br />
Ausprägungen akkreditierte Redakteure, nicht akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Gastautoren/Experten:<br />
Um die Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test zu erfüllen, dass in max<strong>im</strong>al<br />
20 % der Felder erwartete Häufigkeiten kleiner 5 auftreten, werden die acht wertenden<br />
Aussagen der Urheber-Ausprägung Agentur aus der Signifikanz-Überprüfung el<strong>im</strong>iniert. 163<br />
Die Werte der standardisierten Residuen von -2,7 <strong>und</strong> 2,2 weisen auf signifikante bzw. sehr<br />
signifikante Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten in der Zeile<br />
der Urheber-Ausprägung Gastautor/Experte hin. Experten bewerten häufiger positiv <strong>und</strong> seltener<br />
negativ als erwartet. Die Verteilung positiver <strong>und</strong> negativer Wertungen liegt bei den<br />
anderen Ausprägungen <strong>im</strong> Schnitt unterhalb der Signifikanz-Grenzwerte.<br />
Tab. 102: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA<br />
Der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 18,198 beweist die Abhängigkeit<br />
der beiden Variablen <strong>–</strong> die Nullhypothese wird nicht angenommen. Der höchst signifikante<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,165 zeigt, dass zwischen den Variablen Urheber <strong>und</strong> Bezug<br />
WA eine sehr geringe Korrelation vorliegt.<br />
Wenn die Variablen Urheber <strong>und</strong> Bewertung WA unter Einbezug der Schichtenvariablen Bezug<br />
WA miteinander kreuztabelliert werden, zeigen die zellenweisen Prozentwerte <strong>und</strong> die<br />
Werte der standardisierten Residuen von<br />
a) max<strong>im</strong>al -1,6 bzw. 1,1 bei der Ausprägung der Schichtenvariablen Bezug WA Deutsches<br />
Team/Perspektive,<br />
b) max<strong>im</strong>al -1,4 bzw. 1,5 bei der Ausprägung der Schichtenvariablen Bezug WA Gegnerisches<br />
Team/Perspektive,<br />
c) max<strong>im</strong>al -1,4 bzw. 1,5 bei der Ausprägung der Schichtenvariablen Bezug WA Sonstiges/Allgemeine<br />
Perspektive<br />
keine signifikanten Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an.<br />
Die jeweiligen Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests beweisen, dass <strong>im</strong> Falle der beiden Ausprägungen<br />
Deutsches Team/Perspektive <strong>und</strong> Sonstiges/Allgemeine Perspektive der Schichtenvariablen<br />
Bezug WA die Unabhängigkeit der Variablen bestätigt wird (p ˃ 0,05). Im Fall<br />
der Ausprägung der Schichtenvariablen Bezug WA Gegnerisches Team/Perspektive belegt<br />
ein signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,012), dass die Nullhypothese verworfen wird; die<br />
sion aufgr<strong>und</strong> der geringfügigen Unterschiede verzichtet wird, ermittelt einen nicht signifikanten Chi-Quadrat-Wert<br />
(p = 0,884) von 0,021 <strong>und</strong> bestätigt die Nullhypothese.<br />
163<br />
Die Ergebnisse des exakten Tests nach Fisher sind <strong>im</strong> Anhang zu finden.<br />
131
Variablen sind abhängig voneinander. Der signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,012) von 0,338<br />
führt zur Annahme einer geringen Korrelation.<br />
Tab. 103: Chi-Quadrat-Test Urheber × Bewertung WA <strong>–</strong> nach Bezug WA<br />
Nach den diskutierten vorbereitenden Berechnungen folgen die entscheidenden Analysen<br />
zur Prüfung der neunten Hypothese: Werden die Variablen Urheber <strong>und</strong> Bewertung WA unter<br />
Einsatz der Schichtenvariablen Zeitungsschicht kreuztabelliert, zeigen die Werte der<br />
standardisierten Residuen <strong>und</strong> das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests, dass bei den akkreditierten<br />
Zeitungen die Nullhypothese angenommen (p = 0,076), bei den nicht akkreditierten<br />
Zeitungen die Nullhypothese verworfen wird (p = 0,000). 164<br />
Tab. 104: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht<br />
164<br />
Die Urheber-Ausprägung Agentur wird <strong>–</strong> wie bei den nachfolgend diskutierten Berechnungen <strong>–</strong> ausgeklammert,<br />
da sonst wie beschrieben die Voraussetzungen des Chi-Quadrat-Tests nicht gewährleistet sind.<br />
132
Bei nicht akkreditierten Zeitungen urteilen die Redakteure seltener positiv <strong>und</strong> häufiger negativ<br />
als erwartet, Experten häufiger positiv <strong>und</strong> seltener negativ als erwartet. Der höchst signifikante<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,275 beweist eine geringe Korrelation.<br />
Aussagekräftige Ergebnisse zur Unabhängigkeit der Variablen Urheber <strong>und</strong> Bewertung WA<br />
bei Schichtung durch die Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Bezug WA können aufgr<strong>und</strong> zu geringer<br />
erwarteter Häufigkeiten nur für die Bezug-Ausprägung Deutsches Team/Perspektive<br />
getroffen werden. Wie bei der oben dargestellten Berechnung ohne die zusätzliche Schichtung<br />
durch die Variable Bezug WA liegt bei den akkreditierten Zeitungen kein signifikantes<br />
Ergebnis vor (p = 0,423). Es bestehen keine signifikanten Abweichungen der erwarteten von<br />
den beobachteten Häufigkeiten. Bei den nicht akkreditierten Zeitungen wird mit einem p-Wert<br />
von 0,001 nach Pearson ein signifikanter Chi-Quadrat-Wert ermittelt. Seltener positive <strong>und</strong><br />
häufiger negative Wertungen als erwartet werden bei den Redakteuren registriert sowie häufiger<br />
positive <strong>und</strong> seltener negative Wertungen als erwartet bei den Experten. Es besteht<br />
eine geringe Korrelation, wie der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,001) von 0,258<br />
belegt.<br />
Tab. 105: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht <strong>und</strong> Bezug WA<br />
Bei der Kreuztabellierung der beiden Variablen Zeitungsschicht <strong>und</strong> Bewertung WA liegt kein<br />
signifikantes Ergebnis vor, wie die Werte der standardisierten Residuen anzeigen (Tab. 106).<br />
Max<strong>im</strong>al werden Werte von -0,3 bzw. 0,3 dokumentiert. Ein bei einem Freiheitsgrad nicht<br />
signifikanter Chi-Quadrat-Wert (p = 0,584) von 0,299 wird nach Pearson ermittelt. Die Nullhypothese<br />
wird bestätigt; die beiden geprüften Variablen sind unabhängig voneinander.<br />
Werden nur Regionalzeitungsredakteure bzw. nur Experten als Urheber identifizierter wertender<br />
Aussagen berücksichtigt, besteht keine Abhängigkeit der Variablen Zeitungsschicht<br />
<strong>und</strong> Bewertung WA. Die Nullhypothese wird bei nicht signifikanten Chi-Quadrat-Werten (p =<br />
0,315 bzw. p = 0,052) angenommen.<br />
133
Tab. 106: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Bewertung WA<br />
Bei der Aufteilung nach dem Bezug der wertenden Aussage wird bei der separaten Betrachtung<br />
der Wertungen der Regionalzeitungsredakteure bei der Bezug-Ausprägung Deutsches<br />
Team/Perspektive ein signifikanter Unterschied festgestellt (p = 0,011). Die Redakteure akkreditierter<br />
Regionalzeitungen urteilen bezüglich des deutschen Teams häufiger positiv <strong>und</strong><br />
seltener negativ als erwartet; die Redakteure der nicht akkreditierten untersuchten Regionalzeitungen<br />
kommentieren seltener positiv <strong>und</strong> häufiger negativ als erwartet. Der signifikante<br />
Spearman-Korrelationskoeffizient (p = 0,011) von 0,156 zeigt eine sehr geringe Korrelation<br />
an.<br />
Tab. 107: Kreuztabelle Zeitungsschicht (nur Urheber „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>) × Bewertung WA<br />
<strong>–</strong> aufgeteilt nach Bezug WA<br />
6.2.10 Hypothese 10: Quasi selbstwertdienliche Attributionen<br />
6.2.10.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Werte der standardisierten Residuen zeigen bei der Kreuztabellierung der Variablen Bezug<br />
Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external 165 , dass Regionalzeitungsredakteure<br />
Leistungen mit deutschen Bezügen häufiger internal <strong>und</strong> seltener external als erwartet begründen.<br />
166 Bei den Ursachenzuschreibungen zum Gegner verhält es sich gegenläufig. Aufgr<strong>und</strong><br />
eines signifikanten Werts des exakten Tests nach Fisher (p = 0,011) wird die Nullhypothese<br />
verworfen. Die beiden geprüften Variablen sind statistisch gesehen abhängig voneinander.<br />
Ein sehr signifikanter Cramer-V-Wert (p = 0,007) von 0,197 belegt eine sehr geringe<br />
Korrelation.<br />
165<br />
Die Variable Ursache Attribution internal-external mit den Ausprägen internal <strong>und</strong> external wurde durch Umcodieren<br />
der Variablen Ursache Attribution mit vier dazugehörigen Ausprägungen geschaffen.<br />
166<br />
Die Berechnungen erfolgen jeweils ohne Berücksichtigung der insgesamt vier Codierungen der Ausprägung<br />
„9<strong>“</strong> (nicht (eindeutig) zuzuordnen) der Variablen Ursache Attribution.<br />
134
Tab. 108: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
(Urheber nur Redakteure)<br />
Bei der Kreuztabellierung der beiden Variablen Bezug Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution ist<br />
an den Werten der standardisierten Residuen ablesbar, dass Leistungen mit deutschen Bezügen<br />
häufiger internal-stabil <strong>und</strong> internal-variabel sowie seltener external-stabil <strong>und</strong> external-variabel<br />
begründet werden. Die gegenläufigen Ursachenzuschreibungen zur gegnerischen<br />
Mannschaft weisen größere Werte der standardisierten Residuen auf, was aber nicht<br />
zu einem signifikanten Unterschied der Ursachenzuschreibungen der geprüften beiden<br />
Gruppen führt, denn der ermittelte Chi-Quadrat-Wert ist nicht signifikant (p = 0,051) <strong>und</strong> beträgt<br />
7,769.<br />
Tab. 109: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution (Urheber nur Redakteure)<br />
Die Kreuztabellierung der Variablen Valenz Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internalexternal<br />
mit der Schichtenvariablen Bezug Attribution zeigt (Tab. 110), dass die Werte der<br />
standardisierten Residuen erkennen lassen , dass bei Bezug auf Erfolge Deutschlands häufiger<br />
internal <strong>und</strong> sehr signifikant seltener external als erwartet attribuiert wird. Bei negativen<br />
Ereignissen aus der Perspektive der deutschen Mannschaft werden seltener internale <strong>und</strong><br />
sehr signifikant häufiger externale Ursachenzuschreibungen codiert. Bei den Attributionen<br />
zum gegnerischen Team wird ein Abweichungstrend derselben Richtung festgestellt. Die<br />
Abhängigkeit der Variablen wird durch höchst signifikante Deutschland betreffende (p =<br />
0,000) <strong>und</strong> sehr signifikante den Gegner betreffende Werte (p = 0,004) des exakten Tests<br />
nach Fisher bewiesen.<br />
135
Tab. 110: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
(Urheber nur Redakteure) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution<br />
Wird die Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution durchgeführt, zeigen die standardisierten<br />
Residuen signifikante Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit<br />
an: Bei aus deutscher Perspektive positiven Ereignissen wird von Redakteuren signifikant<br />
häufiger internal-stabil <strong>und</strong> signifikant seltener external-variabel als erwartet attribuiert.<br />
Misserfolge des deutschen Teams werden signifikant seltener internal-stabil <strong>und</strong> signifikant<br />
häufiger external-variabel erklärt. Bei aus gegnerischer Perspektive negativen Ereignissen<br />
wird von Redakteuren signifikant häufiger als erwartet external-variabel attribuiert.<br />
Tab. 111: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution<br />
(Urheber nur Redakteure) <strong>–</strong>nach Bezug Attribution<br />
136
Die Abhängigkeit der Variablen wird durch bei drei Freiheitsgraden höchst signifikante<br />
Deutschland betreffende bzw. sehr signifikante den Gegner betreffende Werte (p = 0,000<br />
bzw. 0,010) des exakten Tests nach Fisher bewiesen. Der Wert der Ausprägung Deutschland<br />
der Schichtvariablen Bezug Attribution ist mit 25,031 größer als der Wert der Ausprägung<br />
Gegner mit 10,030. Die Ergebnisse zeigen, dass in der Schicht Deutschland eine<br />
„Tendenz zur quasi stellvertretenden Selbstwerterhöhung oder -erhaltung<strong>“</strong> festzustellen ist<br />
(STRAUSS/MÖLLER 1996, 38). Die häufiger als erwartet beobachtete Häufigkeit der external-variablen<br />
Attributionen bei Misserfolgen des Gegners ist ebenfalls als (quasi) selbstwertschützend<br />
zu bewerten, da diese Faktoren künftige Erfolge nicht stabil verhindern werden. 167<br />
Nach diesen vorbereitenden Analysen geht es nachfolgend um die Prüfung der zehnten<br />
Hypothese: Die nicht signifikanten Werte (p ˃ 0,05) des exakten Tests nach Fisher zeigen,<br />
dass keine signifikanten Unterschiede in den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong><br />
nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure bestehen. Die Variablen sind nicht voneinander<br />
abhängig, <strong>und</strong> die Nullhypothese wird angenommen, wenn die <strong>dich</strong>otome Variable<br />
Ursache Attribution internal-external benutzt wird. Die größten Werte der standardisierten<br />
Residuen weist mit -1,4 <strong>und</strong> 1,1 die Gruppe der Attributionen zu gegnerischen Erfolgen auf,<br />
was sich <strong>im</strong> kleinsten nicht signifikanten p-Wert von 0,132 nach dem exakten Fisher-Test<br />
niederschlägt.<br />
Tab. 112: Chi-Quadrat-Test Zeitungsschicht x Ursache Attribution internal-external (Urheber nur Redakteure)<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution <strong>und</strong> Valenz Attribution<br />
Die Werte des exakten Tests nach Fisher ermitteln bei der Kreuztabellen-Berechnung mit<br />
der Variablen Ursache Attribution in zwei von vier Fällen keinen signifikanten Unterschied<br />
zwischen den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Redakteure<br />
der Regionalzeitungen (p ˃ 0,05). Bei Attributionen zu Misserfolgen Deutschlands wird ein<br />
höchst signifikanter (p = 0,000) <strong>und</strong> bei Erfolgen des Gegners ein signifikanter Unterschied<br />
167 Zur genauen Definition der Ausprägungen der Variablen Ursache Attribution vgl. Codebuch <strong>im</strong> Anhang.<br />
137
(p = 0,035) festgestellt. Die Werte der standardisierten Residuen zeigen, dass bei Misserfolgen<br />
Deutschlands die Signifikanz <strong>im</strong> ersten Feld nicht akkreditierter Redakteure begründet<br />
liegt. 168 Diese Redakteure begründen negative Ereignisse Deutschlands häufiger als erwartet<br />
internal-stabil. Der Wert des exakten Tests nach Fisher ist höchst signifikant (p = 0,000). Der<br />
höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,723 gibt eine hohe Korrelation an. 169<br />
Tab. 113: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure x Ursache Attribution<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution („1<strong>“</strong>) <strong>und</strong> Valenz Attribution („2<strong>“</strong>)<br />
6.2.10.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Bei der Kreuztabellierung der Variablen Bezug Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internalexternal<br />
bzw. Ursache Attribution belegen die Werte der standardisierten Residuen <strong>und</strong> des<br />
Chi-Quadrat-Tests, dass die Variablen nicht unabhängig sind. Leistungen mit deutschen Bezügen<br />
werden häufiger internal <strong>und</strong> signifikant seltener external als erwartet begründet. Bei<br />
den Ursachenzuschreibungen zum Gegner verhält es sich gegenläufig. Bei der Berechnung<br />
mit der Variablen Ursache Attribution wird deutlich, dass Leistungen mit deutschen Bezügen<br />
häufiger internal-stabil <strong>und</strong> internal-variabel sowie seltener external-variabel <strong>und</strong> signifikant<br />
seltener external-stabil als erwartet begründet werden. Bei den Ursachenzuschreibungen<br />
zum Gegner verhält es sich gegenläufig <strong>–</strong> es wird signifikant seltener internal-variabel <strong>und</strong><br />
höchst signifikant häufiger external-stabil als erwartet codiert. Der höchst signifikante Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,000) von 31,997 beweist die Abhängigkeit der Variablen Bezug Attribution<br />
<strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external <strong>–</strong> die Nullhypothese wird nicht angenommen.<br />
Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,231 zeigt, dass zwischen den Variablen<br />
eine geringe Korrelation vorliegt. Bei der Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution<br />
beträgt der höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert 54,098 (p = 0,000). Die Variablen<br />
sind abhängig voneinander, die Nullhypothese wird nicht angenommen. Nach dem höchst<br />
signifikanten Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,300 besteht eine geringe Korrelation. 170<br />
Werden die Variablen Valenz Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external unter Berücksichtigung<br />
der Schichtenvariablen Bezug Attribution kreuztabelliert, zeigen die Werte der<br />
standardisierten Residuen in allen acht Zellen signifikante bis höchst signifikante Abweichungen<br />
der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an. Beziehen sich Attributionen<br />
auf Erfolge Deutschlands wird signifikant häufiger internal <strong>und</strong> höchst signifikant seltener<br />
external als erwartet attribuiert. Bei negativen Ereignissen aus der Perspektive der deutschen<br />
Mannschaft werden höchst signifikant seltener internale <strong>und</strong> höchst signifikant häufi-<br />
168<br />
Die kompletten Kreuztabellen mit allen Ausprägungen der Variablen Bezug Attribution <strong>und</strong> Valenz Attribution<br />
sind <strong>im</strong> Anhang zu finden.<br />
169<br />
Bei Erfolgen des Gegners attribuieren nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure signifikant häufiger als<br />
erwartet internal-stabil. Der Wert des exakten Tests nach Fisher ist signifikant (p = 0,035). Der signifikante Cramer-V-Wert<br />
(p = 0,017) von 0,555 gibt eine mittlere Korrelation an.<br />
170<br />
Die Kreuztabellen <strong>und</strong> die Werte der Chi-Quadrat-Tests zu diesen Zwischenergebnissen vor den Tests zur<br />
Überprüfung der Hypothese werden aus Platzgründen <strong>im</strong> Text nicht abgedruckt. Sie sind komplett <strong>im</strong> Anhang zu<br />
finden.<br />
138
ger externale Ursachenzuschreibungen codiert. Bei den Attributionen zum Gegner wird ein<br />
Abweichungstrend derselben Richtung festgestellt. Die Abhängigkeit der Variablen wird<br />
durch höchst signifikante Werte (p = 0,000) des exakten Tests nach Fisher <strong>und</strong> des Chi-<br />
Quadrat-Tests nach Pearson bewiesen. Der Chi-Quadrat-Wert der Ausprägung Deutschland<br />
der Schichtvariablen Bezug Attribution ist mit 73,213 größer als der Wert der Ausprägung<br />
Gegner mit 48,421.<br />
Werden die vier relevanten Ausprägungen der Variablen Ursache Attribution in die Berechnung<br />
miteinbezogen, zeigen die Werte der standardisierten Residuen folgende signifikanten<br />
Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an:<br />
a) Bei aus deutscher Perspektive positiven Ereignissen wird sehr signifikant häufiger internal-stabil<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant seltener external-variabel als erwartet attribuiert.<br />
Misserfolge der deutschen Mannschaft werden höchst signifikant seltener internalstabil<br />
<strong>und</strong> signifikant seltener internal-variabel sowie signifikant häufiger externalstabil<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant häufiger external-variabel erklärt <strong>–</strong> die Werte der Ausprägung<br />
internal-stabil <strong>und</strong> external-variabel zeigen jeweils höchst signifikante Abweichungen<br />
an.<br />
b) Bei aus gegnerischer Perspektive positiven Ereignissen wird signifikant häufiger internal-stabil<br />
<strong>und</strong> internal-variabel sowie höchst signifikant seltener external-stabil als<br />
erwartet attribuiert. Misserfolge des Gegners werden sehr signifikant seltener internalstabil<br />
<strong>und</strong> internal-variabel sowie höchst signifikant häufiger external-stabil als erwartet<br />
erklärt <strong>–</strong> die Werte der Ausprägung internal-variabel <strong>und</strong> external-stabil zeigen jeweils<br />
höchst signifikante Abweichungen an.<br />
Tab. 114: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution<br />
(nur Ausprägungen Urheber „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution<br />
Diese Ergebnisse zeigen, dass in beiden Schichten eine „Tendenz zur quasi stellvertretenden<br />
Selbstwerterhöhung oder -erhaltung<strong>“</strong> festzustellen ist, die allerdings be<strong>im</strong> Deutschland-<br />
Bezug stärker als be<strong>im</strong> Gegner-Bezug ausfällt, was die jeweils mit den größten standardisierten<br />
Residuen besetzten unterschiedlichen Ausprägungen zeigen (STRAUSS/MÖLLER<br />
139
1996, 38). Deutsche Misserfolge werden z.B. höchst signifikant häufiger external <strong>und</strong> variabel<br />
erklärt, gegnerische negative Ereignisse dagegen external <strong>und</strong> stabil. Die Attributionen<br />
zur deutschen Mannschaft sind quasi selbstwertschützend, indem der Misserfolg nicht nur<br />
external <strong>–</strong> wie bei den Attributionen zum Gegner <strong>–</strong>, sondern zudem noch variabel begründet<br />
wird. Damit sind die Gründe zum Misserfolg der deutschen Mannschaft z.B. das Wetter, das<br />
Publikum, die momentane Aufgabenschwierigkeit oder Pech, während Misserfolge des Gegners<br />
mit schwieriger selbst zu steuernden Faktoren erklärt werden (Fähigkeiten des Gegners,<br />
Reglement usw.). Die Abhängigkeit der Variablen wird durch bei drei Freiheitsgraden<br />
höchst signifikante Chi-Quadrat-Werte (p = 0,000) nach Pearson bewiesen. Der Chi-<br />
Quadrat-Wert der Ausprägung Deutschland der Schichtvariablen Bezug Attribution ist mit<br />
84,976 größer als der Wert der Ausprägung Gegner mit 64,071. Die höchst signifikanten<br />
Cramer-V-Werte (p = 0,000) von 0,451 bzw. 0,588 beweisen eine geringe bzw. mittlere Korrelation.<br />
Nach diesen diskutierten vorbereitenden Analysen zeigen die nicht signifikanten Chi-<br />
Quadrat-Werte (p ˃ 0,05), dass keine signifikanten Unterschiede in den Ursachenzuschreibungen<br />
akkreditierter Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> Agentur-Journalisten existieren. Die<br />
Variablen sind in den berechneten vier Fällen nicht voneinander abhängig; die Nullhypothese<br />
wird angenommen, wenn die Variable Ursache Attribution internal-external benutzt wird.<br />
Die Chi-Quadrat-Werte der Kreuztabellen-Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution<br />
bestätigen in drei von vier Fällen das oben dargestellte Ergebnis. Nicht signifikante Chi-<br />
Quadrat-Werte (p ˃ 0,05) dokumentieren, dass bei den Attributionen mit Bezug Deutschland<br />
sowie mit Bezug Gegner <strong>und</strong> Valenz positives Ereignis kein signifikanter Unterschied zwischen<br />
den Ursachenzuschreibungen akkreditierter Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> denen<br />
der Agentur-Journalisten besteht. Bei Attributionen zu Misserfolgen des Gegners wird ein<br />
signifikanter Unterschied festgestellt, wie der höchst signifikante Wert (p = 0,000) des exakten<br />
Tests nach Fisher beweist. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden bei der<br />
Begründung gegnerischer Misserfolge signifikant seltener external-stabile Faktoren <strong>und</strong><br />
höchst signifikant häufiger external-variable Ursachen als erwartet. In Agentur-Texten werden<br />
die beiden internalen Faktoren gegenläufig eingesetzt.<br />
6.2.10.3 Urheber relevant<br />
Bei der Kreuztabellierung der Variablen Bezug Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internalexternal<br />
bzw. Ursache Attribution belegen die Werte der standardisierten Residuen <strong>und</strong> des<br />
Chi-Quadrat-Tests unter Berücksichtigung aller bei der Variablen Urheber relevant identifizierten<br />
Attributionen, dass die Variablen nicht unabhängig sind. Leistungen mit deutschen<br />
Bezügen werden häufiger internal <strong>und</strong> sehr signifikant seltener external begründet. Bei den<br />
Ursachenzuschreibungen zum Gegner verhält es sich gegenläufig. Der höchst signifikante<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) von 35,487 beweist die Abhängigkeit der Variablen Bezug<br />
Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external <strong>–</strong> die Nullhypothese wird nicht angenommen.<br />
Der höchst signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,204 zeigt, dass zwischen<br />
den Variablen eine geringe Korrelation vorliegt.<br />
Bei der Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution wird deutlich, dass Leistungen mit<br />
deutschen Bezügen häufiger internal-stabil <strong>und</strong> internal-variabel sowie seltener externalvariabel<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant seltener external-stabil begründet werden. Bei den Ursachenzuschreibungen<br />
zum Gegner verhält es sich gegenläufig <strong>–</strong> es wird sehr signifikant seltener<br />
internal-variabel <strong>und</strong> höchst signifikant häufiger als erwartet external-stabil codiert. Bei der<br />
Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution beträgt der höchst signifikante Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,000) 63,689. Die Variablen sind abhängig voneinander, die Nullhypothese<br />
wird nicht angenommen. Nach dem höchst signifikanten Cramer-V-Wert (p = 0,000)<br />
von 0,273 besteht eine geringe Korrelation.<br />
140
Werden die Variablen Valenz Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external unter Berücksichtigung<br />
der Schichtenvariablen Bezug Attribution kreuztabelliert, zeigen die Werte der<br />
standardisierten Residuen in allen acht Zellen sehr bis höchst signifikante Abweichungen der<br />
beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an. Beziehen sich Attributionen auf Erfolge<br />
Deutschlands wird sehr signifikant häufiger internal <strong>und</strong> höchst signifikant seltener external<br />
als erwartet attribuiert. Bei negativen Ereignissen aus der Perspektive des deutschen Teams<br />
werden höchst signifikant seltener internale <strong>und</strong> häufiger externale Ursachenzuschreibungen<br />
codiert. Bei den Attributionen zum Gegner wird ein Abweichungstrend derselben Richtung<br />
mit Werten der standardisierten Residuen festgestellt, die sehr signifikante bis höchst signifikante<br />
Unterschiede anzeigen. Die Abhängigkeit der Variablen wird durch höchst signifikante<br />
Werte (p = 0,000) des exakten Tests nach Fisher <strong>und</strong> des Chi-Quadrat-Tests nach Pearson<br />
bewiesen. Der Chi-Quadrat-Wert der Ausprägung Deutschland der Schichtvariablen Bezug<br />
Attribution ist mit 86,304 größer als der Wert der Ausprägung Gegner mit 54,877.<br />
Werden die vier relevanten Ausprägungen der Variablen Ursache Attribution in die Berechnung<br />
miteinbezogen, zeigen die Werte der standardisierten Residuen folgende signifikanten<br />
Abweichungen der beobachteten von der erwarteten Häufigkeit an:<br />
a) Bei aus deutscher Perspektive positiven Ereignissen wird höchst signifikant häufiger<br />
internal-stabil <strong>und</strong> höchst signifikant seltener external-variabel als erwartet attribuiert.<br />
Misserfolge der deutschen Mannschaft werden höchst signifikant seltener internalstabil<br />
<strong>und</strong> signifikant seltener internal-variabel sowie signifikant häufiger externalstabil<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant häufiger external-variabel als erwartet erklärt.<br />
b) Bei aus Gegner-Perspektive positiven Ereignissen wird signifikant häufiger internalstabil<br />
<strong>und</strong> internal-variabel sowie höchst signifikant seltener external-stabil als erwartet<br />
attribuiert. Gegnerische Misserfolge werden sehr signifikant seltener internalstabil,<br />
höchst signifikant seltener internal-variabel sowie höchst signifikant häufiger<br />
external-stabil als erwartet erklärt. Die Werte der Ausprägung internal-variabel <strong>und</strong><br />
external-stabil zeigen jeweils die größten Werte der standardisierten Residuen an.<br />
Tab. 115: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution (nur Urheber relevant)<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution<br />
141
Diese Ergebnisse belegen <strong>–</strong> wie oben anhand der Berechnungen diskutiert <strong>–</strong> eine Tendenz<br />
zu quasi stellvertretenden selbstwertdienlichen Ursachenzuschreibungen. Die Abhängigkeit<br />
der Variablen wird durch bei drei Freiheitsgraden höchst signifikante Chi-Quadrat-Werte (p =<br />
0,000) nach Pearson bewiesen. Der Chi-Quadrat-Wert der Ausprägung Deutschland der<br />
Schichtvariablen Bezug Attribution ist mit 102,143 größer als der Wert der Ausprägung Gegner<br />
mit 84,928. Die höchst signifikanten Cramer-V-Werte (p = 0,000) von 0,403 bzw. 0,596<br />
beweisen eine geringe bzw. mittlere Korrelation.<br />
Es folgen die entscheidenden Berechnungen zur Überprüfung der Hypothese: Wenn die Variable<br />
Ursache Attribution internal-external verwendet wird, zeigen die nicht signifikanten Chi-<br />
Quadrat-Werte (p > 0,05), dass in drei von vier Fällen keine signifikanten Unterschiede in<br />
den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Urheber relevant bestehen.<br />
Die Variablen sind bei Bezug Deutschland sowie bei Bezug Gegner <strong>und</strong> Valenz negatives<br />
Ereignis nicht voneinander abhängig; die Nullhypothese wird angenommen. Ein signifikanter<br />
Unterschied wird bei Bezug Gegner <strong>und</strong> Valenz positives Ereignis ermittelt. Der signifikante<br />
Chi-Quadrat-Wert (p = 0,025) beträgt 5,003. Die Variablen sind in diesem Fall voneinander<br />
abhängig; die Nullhypothese wird verworfen. 171<br />
Die Chi-Quadrat-Werte bzw. Werte des exakten Tests nach Fisher der Kreuztabellen-<br />
Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution sind in drei von vier Fällen nicht signifikant<br />
(p ˃ 0,05). Bei den Attributionen mit Bezug Deutschland sowie mit Bezug Gegner <strong>und</strong> Valenz<br />
positives Ereignis besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Ursachenzuschreibungen<br />
akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Urheber relevant. Bei Attributionen zu Misserfolgen<br />
des Gegners wird ein signifikanter Unterschied festgestellt, wie der höchst signifikante<br />
Wert (p = 0,000) des exakten Tests nach Fisher beweist. 172<br />
6.2.10.4 Zeitungsschicht<br />
Die Werte der standardisierten Residuen zeigen bei der Kreuztabellierung der Variablen Bezug<br />
Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution an, dass signifikante Unterschiede nach der Ausprägung<br />
der Variablen Bezug Attribution vorliegen. Leistungen mit deutschen Bezügen werden<br />
häufiger internal-stabil <strong>und</strong> internal-variabel sowie höchst signifikant seltener external-stabil<br />
<strong>und</strong> seltener external-variabel begründet. Bei den Ursachenzuschreibungen zum Gegner<br />
verhält es sich gegenläufig.<br />
Tab. 116: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution<br />
171<br />
Akkreditierte Urheber relevant bieten seltener internale <strong>und</strong> häufiger externale Begründungen für positive<br />
Ereignisse des Gegners an. Nicht akkreditierte Urheber relevant attribuieren gegenläufig. Der signifikante Cramer-V-Wert<br />
(p = 0,025) von 0,176 bestätigt eine sehr geringe Korrelation.<br />
172<br />
Bei zwei Zellen (33,3 Prozent) ist die erwartete Häufigkeit kleiner 5. Akkreditierte Urheber relevant führen<br />
gegnerische Misserfolge zu 90,0 % auf external-variable Ursachen zurück, die sie höchst signifikant häufiger als<br />
erwartet verwenden. External-stabile Attributionen benutzen sie signifikant seltener. Nicht akkreditierte Urheber<br />
relevant begründen negative Ereignisse des Gegners zu 67,6 % mit external-stabilen Faktoren.<br />
142
Die Nullhypothese wird aufgr<strong>und</strong> eines höchst signifikanten Chi-Quadrat-Werts (p = 0,000)<br />
nach Pearson von 58,754 bei drei Freiheitsgraden verworfen. Die Variablen sind statistisch<br />
abhängig voneinander. Ein höchst signifikanter Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,257 belegt<br />
eine geringe Korrelation. 173<br />
Werden die Variablen Valenz Attribution <strong>und</strong> Ursache Attribution internal-external unter Berücksichtigung<br />
der Schichtenvariablen Bezug Attribution kreuztabelliert, zeigen die Werte der<br />
standardisierten Residuen in allen acht Zellen sehr bzw. höchst signifikante Abweichungen<br />
der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an. Beziehen sich Attributionen auf Erfolge<br />
Deutschlands wird sehr signifikant häufiger internal <strong>und</strong> höchst signifikant seltener external<br />
als erwartet attribuiert. Bei negativen Ereignissen aus der Perspektive der deutschen<br />
Mannschaft werden höchst signifikant seltener internale <strong>und</strong> höchst signifikant häufiger externale<br />
Ursachenzuschreibungen codiert. Bei den Attributionen zum Gegner wird ein Abweichungstrend<br />
derselben Richtung festgestellt.<br />
Tab. 117: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution<br />
Die Abhängigkeit der Variablen wird durch höchst signifikante Werte (p = 0,000) des exakten<br />
Tests nach Fisher bewiesen. Nach Pearson ist der Chi-Quadrat-Wert der Ausprägung<br />
Deutschland der Schichtvariablen Bezug Attribution mit 85,788 größer als der Wert der Ausprägung<br />
Gegner mit 72,534.<br />
Wird mit der Variablen Ursache Attribution berechnet, zeigen die Werte der standardisierten<br />
Residuen signifikante Abweichungen der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten an:<br />
a) Bei aus deutscher Perspektive positiven Ereignissen wird sehr signifikant häufiger internal-stabil<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant seltener external-variabel als erwartet attribuiert.<br />
173<br />
Bei der Analyse mit der Variablen Ursache Attribution internal-external zeigen die Werte der standardisierten<br />
Residuen von -2,4 bis 3,8 signifikante bis höchst signifikante Abweichungen der beobachteten von den erwarteten<br />
Häufigkeiten an. Der bei einem Freiheitsgrad höchst signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,000) nach Pearson<br />
von 29,740 dokumentiert die Abhängigkeit der Variablen. Die Nullhypothese wird verworfen. Ein höchst signifikanter<br />
Cramer-V-Wert (p = 0,000) von 0,183 stützt eine sehr geringe Korrelation.<br />
143
Misserfolge der deutschen Mannschaft werden höchst signifikant seltener internalstabil<br />
<strong>und</strong> signifikant seltener internal-variabel sowie signifikant häufiger externalstabil<br />
<strong>und</strong> höchst signifikant häufiger external-variabel erklärt <strong>–</strong> wobei die Werte der<br />
Ausprägung internal-stabil <strong>und</strong> external-variabel jeweils höchst signifikante Abweichungen<br />
anzeigen.<br />
b) Bei aus gegnerischer Perspektive positiven Ereignissen wird sehr signifikant häufiger<br />
internal-variabel <strong>und</strong> höchst signifikant seltener external-stabil als erwartet attribuiert.<br />
Misserfolge des Gegners werden sehr signifikant seltener internal-stabil <strong>und</strong> höchst<br />
signifikant seltener internal-variabel sowie höchst signifikant häufiger external-stabil<br />
als erwartet erklärt <strong>–</strong> wobei die Werte der Ausprägung internal-variabel <strong>und</strong> externalstabil<br />
jeweils höchst signifikante Abweichungen anzeigen.<br />
Tab. 118: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution <strong>–</strong> nach Bezug Attribution<br />
Diese Ergebnisse zeigen, dass in beiden Schichten eine „Tendenz zur quasi stellvertretenden<br />
Selbstwerterhöhung oder -erhaltung<strong>“</strong> festzustellen ist, die be<strong>im</strong> Deutschland-Bezug stärker<br />
als be<strong>im</strong> Gegner-Bezug ausfällt, was die jeweils mit den größten standardisierten Residuen<br />
besetzten unterschiedlichen Ausprägungen zeigen (STRAUSS/MÖLLER 1996, 38).<br />
Deutsche Misserfolge werden z.B. signifikant häufiger external <strong>und</strong> variabel erklärt, gegnerische<br />
negative Ereignisse dagegen external <strong>und</strong> stabil. Die Attributionen zur deutschen<br />
Mannschaft sind quasi selbstwertschützend, indem der Misserfolg nicht nur external <strong>–</strong> wie<br />
bei den Attributionen zum Gegner <strong>–</strong>, sondern zudem noch variabel begründet wird. Damit<br />
sind die Gründe zum Misserfolg der deutschen Mannschaft z.B. das Wetter, das Publikum,<br />
die momentane Aufgabenschwierigkeit oder Pech, während Misserfolge des Gegners mit<br />
schwieriger selbst zu steuernden Faktoren erklärt werden (Fähigkeiten des Gegners, Reglement<br />
usw.). Die Abhängigkeit der Variablen wird durch bei drei Freiheitsgraden höchst signifikante<br />
Chi-Quadrat-Werte (p = 0,000) nach Pearson bewiesen. Der Chi-Quadrat-Wert der<br />
Ausprägung Deutschland der Schichtvariablen Bezug Attribution ist mit 101,108 größer als<br />
der Wert der Ausprägung Gegner mit 91,533.<br />
Bestehen signifikante Unterschiede in den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht<br />
akkreditierter Zeitungen? Die nicht signifikanten Chi-Quadrat-Werte (p ˃ 0,05) zeigen, dass<br />
144
die Variablen in drei von vier Fällen nicht voneinander abhängig sind <strong>und</strong> die Nullhypothese<br />
angenommen wird, wenn die Variable Ursache Attribution internal-external benutzt wird. Bei<br />
Attributionen zu Erfolgen des Gegners wird ein signifikanter Unterschied zwischen den akkreditierten<br />
<strong>und</strong> den nicht akkreditierten Zeitungen festgestellt, wie der signifikanten Chi-<br />
Quadrat-Wert (p = 0,027) nach Pearson beweist. 174<br />
Die Chi-Quadrat-Werte der Kreuztabellen-Berechnung mit der Variablen Ursache Attribution<br />
bestätigt das oben dargestellte Ergebnis. In drei von vier Fällen wird kein signifikanter Unterschied<br />
zwischen den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Zeitungen<br />
festgestellt, wie die nicht signifikanten Chi-Quadrat-Werte dokumentieren (p ˃ 0,05). Bei<br />
Attributionen zu Erfolgen des Gegners wird ein signifikanter Unterschied festgestellt, wie der<br />
signifikante Chi-Quadrat-Wert (p = 0,021) nach Pearson beweist. 175<br />
174<br />
Die Werte der standardisierten Residuen zeigen, dass bei Erfolgen der Gegner akkreditierte Zeitungen seltener<br />
internal <strong>und</strong> häufiger external attribuieren als erwartet. Die Ursachenzuschreibungen nicht akkreditierter Zeitungen<br />
verhalten sich gegenläufig. Der signifikante Cramer-V-Wert (p = 0,027) von 0,168 gibt eine sehr geringe<br />
Korrelation an.<br />
175<br />
Die Werte der standardisierten Residuen zeigen, dass bei Erfolgen der Gegner akkreditierte Zeitungen seltener<br />
internal-stabil sowie häufiger external-stabil <strong>und</strong> external-variabel attribuieren als erwartet. Die Ursachenzuschreibungen<br />
der nicht akkreditierten Regionalzeitungen verhalten sich gegenläufig. Der signifikante Cramer-V-<br />
Wert (p = 0,021) von 0,235 gibt eine geringe Korrelation an.<br />
145
7. HYPOTHESENDISKUSSION UND INTERPRETATION<br />
Anhand der empirischen analytischen Ergebnisse lassen sich die formulierten Hypothesen<br />
beantworten. Um eine überschaubare Darstellung zu gewährleisten, werden die Hypothesen<br />
erneut rezitiert. Zunächst wird für jede Hypothese diskutiert, ob sie sich aufgr<strong>und</strong> der berechneten<br />
Ergebnisse verifizieren, bedingt verifizieren oder falsifizieren lässt. In der Regel <strong>–</strong><br />
sofern für die jeweilige Hypothesenprüfung relevant <strong>–</strong> wird dabei wie in Kapitel 6.2 dargestellt<br />
mit dem detaillierten Blick auf die Fälle der Regionalzeitungsredakteure als Urheber begonnen.<br />
Bevor die Ergebnisse mittels des Vergleichs der Variablen Zeitungsschicht diskutiert<br />
werden, wird besprochen, was Signifikanzen bezüglich distanzloser, unkritischer Berichterstattung<br />
zu bedeuten haben. Danach folgt diesbezüglich ein Fazit für jede Hypothese.<br />
7.1 Hypothese 01: Fakten statt Argumente<br />
H01: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
hinsichtlich der Dominanz objektiv-faktizierender Darstellungsformen.<br />
7.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Ergebnisse der vier Berechnungen zur Beziehung der Variablen Urheber nur Redakteure<br />
<strong>und</strong> Darstellungsform zeigen <strong>–</strong> vor allem auf die Darstellungsformen objektivierendfaktizierend<br />
<strong>und</strong> subjektivierend-argumentierend bezogen: Niedrige Werte der Variablen Urheber<br />
nur Redakteure gehen mit niedrigen Werten der Variablen Darstellungsform einher<br />
sowie hohe Werte der Variablen Urheber nur Redakteure mit hohen Werten der Variablen<br />
Darstellungsform. Texte akkreditierter Redakteure sind häufiger objektivierend-faktizierend<br />
als Texte nicht akkreditierter Redakteure. Artikel nicht akkreditierter Redakteure sind häufiger<br />
subjektivierend-argumentierend als Artikel akkreditierter Redakteure. Es wird ein signifikanter<br />
Unterschied festgestellt. Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Abb. 22: Darstellungsformen der Regionalzeitungsredakteure<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Verifizierung der Hypothese <strong>und</strong> der beschriebenen Ergebnisse wird ersichtlich,<br />
dass sich die Texte der beiden Gruppen insofern unterscheiden, dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
unkritischer <strong>im</strong> Sinn der ersten Hypothese berichten, was die <strong>im</strong><br />
Vergleich seltenere Verwendung subjektivierend-argumentierender Beiträge anzeigt. Je nach<br />
durchgeführter Analysevariante ergeben sich kaum Unterschiede, da die Fallzahlen in den<br />
Ausprägungen relativ gleichmäßig verteilt abnehmen. 176<br />
176<br />
In der Stichprobe nicht akkreditierter Redakteure sind 1,6 % der Texte Meldungen, was auf 2,4 % der Texte<br />
akkreditierter Redakteure, auf 31,7 % der Agentur-Texte, auf 33,9 % der Texte nicht akkreditierter Urheber relevant<br />
sowie auf 33,0 % der Beiträge akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 25,3 % der Beiträge nicht akkreditierter Zeitungen<br />
zutrifft. Aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile an Meldungen sind be<strong>im</strong> Vergleich der Texte akkreditierter<br />
Redakteure mit Beiträgen der Agenturen bzw. nicht akkreditierter Urheber relevant nach Meinung des Verfassers<br />
die Berechnungen ohne Meldungen am aussagekräftigsten.<br />
146
7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Zeitungsredakteure verwenden bei dem Vergleich mit Agentur-Texten häufiger<br />
als erwartet subjektivierend-argumentierende Texte <strong>und</strong> Mischformen sowie seltener als erwartet<br />
objektivierend-faktizierende Darstellungsformen, wie die vier durchgeführten Berechnungen<br />
belegen. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist signifikant; es liegt je nach Berechnungsvariante<br />
eine geringe bis mittlere Korrelation vor. Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Abb. 23: Darstellungsformen akkreditierter Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> der Agenturen<br />
Der Vergleich der Gruppen akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Agentur macht ersichtlich, dass die<br />
Berichterstattung akkreditierter Redakteure <strong>im</strong> Sinn der ersten Hypothese <strong>und</strong> die reine Verwendung<br />
meinungsbetonter Texte betreffend kritischer als die Agentur-Berichterstattung ist.<br />
Anzumerken ist, dass bei der Ausprägung Agentur ein einziger als subjektivierendargumentierend<br />
codierter Text in der Auswahl ist. Bei den Berechnungen exklusive Meldungen<br />
werden anteilig mehr Darstellungsform-Ausprägungen „0<strong>“</strong> bis „3<strong>“</strong> als „4<strong>“</strong> aussortiert.<br />
7.1.3 Urheber relevant<br />
Meinungsbetonte Artikel machen bei den Texten akkreditierter Urheber relevant 28,6 % aus,<br />
bei den Texten nicht akkreditierter Urheber relevant 5,6 % <strong>–</strong> bzw. bei der Berechnung ohne<br />
Meldungen werden 28,0 % <strong>und</strong> 8,5 % ermittelt. Die Unterschiede sind signifikant; es wird<br />
eine geringe Korrelation nachgewiesen. Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Abb. 24: Darstellungsformen Urheber relevant<br />
Im Sinn der ersten Hypothese ist die Berichterstattung akkreditierter Urheber relevant kritischer<br />
als die Berichterstattung nicht akkreditierter Urheber relevant. Es gelten dieselben o-<br />
147
en erwähnten Hinweise zu den Berechnungen ohne Meldungen. Unter den Fällen nicht<br />
akkreditierter Urheber relevant ist ein Agentur-Kommentar <strong>und</strong> 37 meinungsbetonte Beiträge<br />
nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure subsummiert.<br />
7.1.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Die drei beschriebenen Vergleiche belegen jeweils einen signifikanten Unterschied in der<br />
Verwendung meinungsbetonter Texte. Bei den Texten der Regionalzeitungsredakteure führt<br />
der Status akkreditiert zu unkritischerer Berichterstattung, be<strong>im</strong> Vergleich der Beiträge akkreditierter<br />
Redakteure mit der Ausprägung Agentur bzw. nicht akkreditierter Urheber relevant<br />
zu kritischerer Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn der Hypothese.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht zeigt: Akkreditierte Zeitungen verwenden<br />
subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen häufiger als erwartet, nicht akkreditierte<br />
Zeitungen seltener als erwartet. Objektivierend-faktizierende Texte werden von akkreditierten<br />
Zeitungen seltener als erwartet benutzt, von nicht akkreditierten Zeitungen häufiger<br />
als erwartet. Ein signifikanter Unterschied wird ermittelt, wenn Meldungen <strong>und</strong>/oder die<br />
Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform aus der Berechnung gelöscht<br />
werden. 177 Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Innerhalb der beiden Zeitungsschichten ist der Status akkreditiert mit kritischerer Berichterstattung<br />
<strong>im</strong> Sinn der ersten formulierten Untersuchungshypothese verb<strong>und</strong>en. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
erwähnten Frage nach Ordinalskalierung der Variablen Darstellungsform sind die Analysen<br />
ohne Berücksichtigung der Ausprägung „0<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform jeweils nach<br />
Meinung des Verfassers aussagekräftiger. Werden Meldungen aus der Berechnung gelöscht,<br />
werden anteilig am meisten Texte der Darstellungsform-Ausprägung „1<strong>“</strong> aussortiert <strong>–</strong><br />
<strong>und</strong> zwar 40,6 % der objektivierend-faktizierenden Texte akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 30,9 %<br />
der Texte nicht akkreditierter Zeitungen. Deshalb n<strong>im</strong>mt der Korrelationskoeffizient unter dieser<br />
Filterbedingung jeweils größere Werte an, ohne eine stärkere als sehr geringe Korrelation<br />
anzuzeigen.<br />
7.2 Hypothese 02: Eigene Themensetzung<br />
H02: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
bezüglich aktiver oder passiver Themensetzung <strong>–</strong> gemessen am Beitragsanlass.<br />
7.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure beziehen sich seltener als erwartet auf redaktionsinterne<br />
Anlässe; die Ausprägungen Medien als Anlass <strong>und</strong> Öffentlicher Anlass werden<br />
häufiger als erwartet gef<strong>und</strong>en. Bei Artikeln nicht akkreditierter Redakteure der Regionalzeitungen<br />
werden gegenläufige Werte festgestellt: Kein äußerer Anlass wird häufiger beobachtet<br />
als erwartet, Texte mit Medien als Anlass <strong>und</strong> mit öffentlichem Anlass werden seltener<br />
als erwartet nachgewiesen. Die vier Berechnungsvarianten weisen einen signifikanten<br />
Unterschied nach; es besteht eine geringe bis mittlere Korrelation. Die Hypothese wird verifiziert.<br />
177<br />
Bei der Löschung der Meldungen aus der Berechnung werden von 442 Fällen akkreditierter Zeitungen 146<br />
Fälle (33,0 %) <strong>und</strong> von 340 Fällen nicht akkreditierter Zeitungen 86 Fälle (25,3 %) aussortiert. Der Vergleich zwischen<br />
den beiden Zeitungsschichten zeigt, dass bei Nichtberücksichtigung der Meldungen weniger große Unterschiede<br />
hinsichtlich der Anteile der Aufmachungs-Ausprägungen festgestellt werden als bei den Berechnungen<br />
inklusive Kurztexte (siehe Kapitel 6.1.1). Zudem sei auf die oben erwähnte Frage nach der Ordinalskalierung der<br />
Variablen Darstellungsform inklusive der Ausprägung „0<strong>“</strong> (Sonstiges) hingewiesen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die<br />
Berechnung mit Aussortierung der Meldungen <strong>und</strong> der Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform<br />
nach Meinung des Verfassers die aussagekräftigste. Dieser Hinweis ist <strong>–</strong> was das Herausfiltern der Meldungen<br />
betrifft <strong>–</strong> bei der Diskussion der folgenden Hypothesen zu beachten.<br />
148
Abb. 25: Anlass der Berichterstattung der Regionalzeitungsredakteure<br />
Der überzufällige Zusammenhang besteht insofern, dass Akkreditierung unter den Regionalzeitungsredakteuren<br />
mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en ist, da die<br />
Texte akkreditierter Redakteure seltener als erwartet nicht von der äußeren Themenagenda<br />
veranlasst werden sowie häufiger Anlässe zu finden sind, die wie z.B. Pressekonferenzen<br />
extra für die Medien inszeniert werden oder sowieso öffentlich statt<strong>fand</strong>en <strong>–</strong> bei denen keine<br />
journalistische Initiative zur Schaffung des Anlasses erforderlich war.<br />
7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Es wird eine geringe Korrelation festgestellt. Die Unterschiede zwischen den Urheber-<br />
Gruppen sind signifikant. In Texten akkreditierter Regionalzeitungredakteure werden häufiger<br />
als erwartet redaktionsinterne Anlässe zur Berichterstattung ermittelt. Die Werte der standardisierten<br />
Residuen zeigen in den beiden Gruppen bei dieser Anlass-Ausprägung jeweils<br />
höchst signifikante Abweichungen an. Je nachdem, ob die Anlass-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong><br />
berücksichtigt werden, werden bei der Stichprobe der akkreditierten Redakteure häufiger<br />
oder seltener als erwartet Medien als Anlass <strong>und</strong> Öffentlicher Anlass codiert. Die Hypothese<br />
wird bedingt verifiziert.<br />
Bezogen auf die Ausprägung Kein äußerer Anlass steht Akkreditierung mit kritischerer, distanzierterer<br />
Berichterstattung in Verbindung, da häufiger als erwartet Themen abseits der<br />
vorgegebenen Agenda mit redaktionsinternem Anlass codiert werden. Es gilt zu beachten,<br />
dass laut Codieranweisung bei allen meinungsbetonten Texten die Ausprägung Kein äußerer<br />
Anlass verschlüsselt wurde. Die Abweichungen der Ausprägungen Medien als Anlass <strong>und</strong><br />
Öffentlicher Anlass können aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Abweichungsrichtung je nach<br />
Berechnung nicht zweifelsfrei als Anzeichen für unkritischere, distanzlosere Berichterstattung<br />
herangezogen werden. Die Kreuztabellen machen deutlich, dass innerhalb der Gruppe der<br />
Agentur-Beiträge neben der Ausprägung Unklarer Anlass bei kurzen Meldungen vor allem<br />
die Ausprägung Medien als Anlass codiert wird, was die Abweichungen zwischen den Berechnungen<br />
erklärt. Dies trifft auch bei der Variablen Urheber relevant zu.<br />
7.2.3 Urheber relevant<br />
Bei den vier Analysevarianten wird ersichtlich, dass akkreditierte Urheber relevant sich in<br />
ihren Texten häufiger auf redaktionsinterne Anlässe beziehen, nicht akkreditierte Urheber<br />
relevant seltener auf diese Ausprägung. Drei von vier Berechnungen zeigen, dass bei der<br />
akkreditierten Stichprobe häufiger Medien als Anlass codiert wird. Bei den Untersuchungen<br />
ohne die Anlass-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „4<strong>“</strong> wird bei den akkreditierten Urhebern seltener die<br />
Ausprägung Öffentlicher Anlass verschlüsselt. Die Unterschiede der Gruppen werden jeweils<br />
als signifikant berechnet; es liegen sehr geringe bis geringe Korrelationen vor. Die Hypothese<br />
wird bedingt verifiziert.<br />
149
Allein auf die Ausprägung Kein äußerer Anlass bezogen <strong>–</strong> deshalb erfolgt wie be<strong>im</strong> zuvor<br />
genannten Vergleich eine bedingte Verifizierung der Hypothese <strong>–</strong> ist der Status akkreditiert<br />
mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn der zweiten Hypothese verb<strong>und</strong>en.<br />
7.2.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Drei von drei durchgeführten Vergleichen beweisen (teilweise unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen)<br />
einen signifikanten Unterschied in der Zuordnung der Anlass-Ausprägungen zu den<br />
Text-Stichproben. Be<strong>im</strong> Vergleich der Regionalzeitungsredakteure ergibt der Status akkreditiert<br />
eine unkritischere, distanzlosere Berichterstattung, be<strong>im</strong> Vergleich akkreditierter Redakteure<br />
mit der Ausprägung Agentur bzw. nicht akkreditierter Urheber relevant <strong>–</strong> allein auf die<br />
Ausprägung Kein äußerer Anlass bezogen <strong>–</strong> eine kritischere, distanziertere Berichterstattung.<br />
Der Vergleich der Stichproben der Variablen Zeitungsschicht zeigt: Bei den Analysen inklusive<br />
Meldungen treten keine signifikanten Unterschiede auf. Werden Meldungen aussortiert,<br />
sind die Unterschiede signifikant. Es liegen sehr geringe Korrelationen vor. Dass in den Texten<br />
akkreditierter Zeitungen häufiger als erwartet redaktionsinterne <strong>und</strong> seltener als erwartet<br />
öffentliche Anlässe gef<strong>und</strong>en werden, wird mit kritischerer, distanzierter Berichterstattung in<br />
Verbindung gebracht. 178 Da speziell für die Medien arrangierte Anlässe häufiger als erwartet<br />
identifiziert werden, was den gegenteiligen Schluss zulässt, gilt: Die Hypothese wird bedingt<br />
verifiziert.<br />
Innerhalb der beiden Zeitungsschichten ist der Status akkreditiert bezüglich der Verwendung<br />
redaktionsinterner <strong>und</strong> öffentlicher Text-Anlässe mit kritischerer Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn der<br />
zweiten Hypothese verb<strong>und</strong>en, wenn Meldungen nicht mitberücksichtigt werden.<br />
7.3 Hypothese 03: Kaum Konflikthaltiges<br />
H03: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
hinsichtlich der Beschäftigung mit Bereichen mit negativer Geschehens-Valenz (Problemfelder,<br />
Kontroverses, Konflikte o.ä.).<br />
7.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
Die Ergebnisse der vier berechneten Analysevarianten zeigen, dass jeweils kein statistischer<br />
Zusammenhang zwischen den geprüften Variablen besteht. Unterschiede sind zufällig zustande<br />
gekommen, die Nullhypothese wird jeweils angenommen. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure berichten in allen sechs durchgeführten Analysen<br />
häufiger positiv <strong>und</strong> seltener ambivalent als erwartet sowie in drei von vier dies betreffenden<br />
Berechnungen häufiger neutral als erwartet. In den vier Untersuchungen ohne Löschung der<br />
Valenz-Ausprägung „1<strong>“</strong> wird seltener als erwartet bei der Stichprobe der akkreditierten Regionalzeitungsjournalisten<br />
die Ausprägung negativ codiert. Ohne jegliche Ausklammerung sowie<br />
bei den Berechnungen ohne Valenz-Ausprägung „0<strong>“</strong> wird ein signifikanter Unterschied<br />
berechnet, bei der Analyse ohne Meldungen <strong>und</strong>/oder ohne Valenz-Ausprägung „1<strong>“</strong> wird kein<br />
signifikanter Unterschied in den Stichproben ermittelt. Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
178<br />
Zur Erklärung: Wenn Meldungen aus der Analyse gelöscht werden, werden u.a. 27,3 % der Texte akkreditierter<br />
Zeitungen <strong>und</strong> 40,0 % der Texte nicht akkreditierter Zeitungen der Anlass-Ausprägung „2<strong>“</strong> (Medien als Anlass)<br />
sowie 26,7 % der Texte akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 17,3 % der Texte nicht akkreditierter Zeitungen der Anlass-<br />
Ausprägung „3<strong>“</strong> (Öffentlicher Anlass) aussortiert.<br />
150
Abb. 26: Valenz des Geschehens akkreditierter Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> der Agenturen<br />
Unter den Filterbedingungen, die die Hypothese verifizieren lassen, wird Akkreditierung mit<br />
unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung in Verbindung gebracht, da akkreditierte Redakteure<br />
häufiger als erwartet neutral <strong>–</strong> sofern nicht aussortiert <strong>–</strong> <strong>und</strong> positiv sowie seltener<br />
als erwartet ambivalent <strong>und</strong> negativ <strong>–</strong> sofern nicht aussortiert <strong>–</strong> berichten. Die größten Abweichungen<br />
werden bei den Valenz-Ausprägungen negativ <strong>und</strong> positiv beobachtet.<br />
7.3.3 Urheber relevant<br />
Es werden (fast) dieselben Abweichungen der erwarteten von den beobachteten Häufigkeiten<br />
wie bei den zuvor diskutierten Stichproben ermittelt, was die Richtung betrifft, ohne dass<br />
diese Unterschiede signifikant sind. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.3.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Ein Vergleich (von drei durchgeführten) beweist unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen einen<br />
signifikanten Unterschied bezüglich der Valenz des Geschehens. Be<strong>im</strong> Vergleich akkreditierter<br />
Redakteure mit der Ausprägung Agentur ergibt der Status akkreditiert eine unkritischere,<br />
distanzlosere Berichterstattung.<br />
Die Chi-Quadrat-Tests belegen be<strong>im</strong> Vergleich der Stichproben der Variablen Zeitungsschicht,<br />
dass keine signifikanten Unterschiede bestehen. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.4 Hypothese 04: Oberfläche statt Hintergr<strong>und</strong><br />
H04: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
bezüglich der Tiefe der Argumentation (nach TEWES 1991).<br />
7.4.1 Urheber nur Redakteure<br />
Folgende Abweichungen werden festgestellt: Texte akkreditierter Redakteure thematisieren<br />
häufiger <strong>und</strong> sind seltener hintergründig als erwartet. Texte nicht akkreditierter Journalisten<br />
der Regionalzeitungen thematisieren seltener <strong>und</strong> sind häufiger hintergründig als erwartet.<br />
Eine von zwei diskutierten Berechnungen liefert aufgr<strong>und</strong> des Chi-Quadrat-Werts einen signifikanten<br />
Unterschied, wobei der Wert des exakten Tests nach Fisher keine Signifikanz der<br />
Unterschiede anzeigt. Die Untersuchung ohne Berücksichtigung kürzerer Texte ergibt keinen<br />
signifikanten Unterschied. Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Im Fall des festgestellten signifikanten Unterschieds der Stichproben zeigen die Ergebnisse,<br />
dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure unkritischer <strong>im</strong> Sinn der vierten Hypothese<br />
151
erichten, was die <strong>im</strong> Vergleich häufiger als erwartete Verwendung der Ausprägung Thematisierung<br />
<strong>und</strong> seltener als erwartete Verwendung der Ausprägung Hintergr<strong>und</strong> anzeigt.<br />
7.4.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure sind in ihren Texten häufiger als erwartet hintergründig<br />
<strong>und</strong> <strong>–</strong> falls berücksichtigt <strong>–</strong> interpretativ sowie thematisieren seltener als erwartet.<br />
Die Werte der Gruppe Urheber Agentur sind gegenläufig. Werden Meldungen mitberücksichtigt,<br />
sind die Unterschiede signifikant. Werden Meldungen aus dem Test gelöscht, sind die<br />
Unterschiede der Stichproben nicht signifikant. Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Die Ergebnisse der Berechnungen, die einen signifikanten Unterschied ermitteln, zeigen,<br />
dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure kritischer, distanzierter berichten was die<br />
Verwendung der Tiefe-Ausprägungen betrifft. Allerdings wird die Hypothese bedingt verifiziert,<br />
da unter Nichtberücksichtigung der Meldungen kein signifikanter Unterschied ermittelt<br />
wird. Bei der Löschung der Meldungen werden 4,2 % der Fälle akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>und</strong> 39,2 % der Fälle der Agenturen bei der Tiefe-Ausprägung „1<strong>“</strong> gelöscht.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der oben erwähnten ungleichen Verteilung der Meldungen sind die Berechnungen<br />
ohne Meldungen, die keine signifikanten Unterschiede ergeben, aussagekräftiger.<br />
7.4.3 Urheber relevant<br />
Ausprägung Urheber relevant akkreditiert thematisiert seltener als erwartet, berichtet dagegen<br />
häufiger hintergründig <strong>und</strong> <strong>–</strong> falls berücksichtigt <strong>–</strong> interpretativ als erwartet. Inklusive<br />
Meldungen ist der Unterschied signifikant, exklusive Meldungen ist er nicht signifikant. Die<br />
Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Abb. 27: Tiefe der Argumentation der Urheber relevant<br />
Die Signifikanzen bedeuten, dass Akkreditierung <strong>im</strong> Sinn der vierten Hypothese mit kritischerer,<br />
distanzierterer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en ist. Es gelten dieselben Aussagen wie bei<br />
der Analyse der Variablen Urheber relevant hinsichtlich der bedingten Verifizierung. Während<br />
unter Nichtberücksichtigung der Texte mit max<strong>im</strong>al 600 Zeichen bei akkreditierten Urhebern<br />
relevant bei der Ausprägung Thematisierung 4,2 % der Beiträge ausgeklammert<br />
werden, fallen bei nicht akkreditierten Urhebern relevant 33,9 % Artikel heraus <strong>–</strong> 42,5 % der<br />
Texte mit Ausprägung „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> 9,0 % der Texte mit Ausprägung „2<strong>“</strong>. Die Berechnungen ohne<br />
Meldungen ergeben keine signifikanten Unterschiede <strong>–</strong> <strong>und</strong> sind aussagekräftiger.<br />
7.4.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Drei Vergleiche (von drei durchgeführten) beweisen unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen<br />
einen signifikanten Unterschied bezüglich der Tiefe der Argumentation. Be<strong>im</strong> Vergleich der<br />
152
Stichproben der Variablen Urheber nur Redakteure ergibt der Status akkreditiert eine <strong>im</strong> Sinn<br />
der vierten Hypothese unkritischere, distanzlosere Berichterstattung <strong>–</strong> be<strong>im</strong> Vergleich akkreditierter<br />
Redakteure mit der Ausprägung Agentur bzw. nicht akkreditierter Urheber relevant<br />
kritischere, distanziertere Berichterstattung <strong>–</strong> wobei zu beachten ist, dass die aussagekräftigeren<br />
Analysen ohne Meldungen jeweils keine signifikanten Unterschiede belegen.<br />
Die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests beweisen be<strong>im</strong> Vergleich der Stichproben der Variablen<br />
Zeitungsschicht, dass die Unterschiede der Stichproben bei den vier Berechnungsvarianten<br />
nicht signifikant sind. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.5 Hypothese 05: Häufig aktive Sportler als Handlungsträger<br />
H05: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
hinsichtlich des Gebrauchs aktiver Sportler als Handlungsträger.<br />
7.5.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden als Handlungsträger insgesamt häufiger<br />
als erwartet aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> Personen aus der Sportwelt, seltener als erwartet<br />
sportexterne Handlungsträger. Der Chi-Quadrat-Test bestätigt bei den vier durchgeführten<br />
Berechnungen signifikante Unterschiede. Es liegen geringe bis sehr geringe Korrelationen<br />
vor. Werden die Codierungen der Variablen Herkunft Handlungsträger 1 separat analysiert,<br />
werden Abweichungen wie zu der Variablen Herkunft Handlungsträger Gesamt beschrieben<br />
sowie signifikante Unterschiede <strong>und</strong> geringe Korrelationen ermittelt. Die Hypothese<br />
wird verifiziert.<br />
Abb. 28: Herkunft Handlungsträger Gesamt (ohne „9<strong>“</strong>) der Redakteure (ohne Meldungen)<br />
Die signifikanten Ergebnisse interpretierend bedeutet Akkreditierung hinsichtlich der Herkunft<br />
existierender Handlungsträger eine distanzlosere Berichterstattung, da häufiger als erwartet<br />
Personen aus dem Sportumfeld (Ausprägungen „1<strong>“</strong> bis „3<strong>“</strong>) <strong>und</strong> seltener sportexterne Personen<br />
verwendet werden, wobei bei dieser zuletzt genannten Ausprägung die größten Abweichungen<br />
festgestellt werden. 179<br />
7.5.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden bei den vier Untersuchungsvarianten<br />
als Handlungsträger häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer sowie seltener als er-<br />
179<br />
Akkreditierte Redakteure verwenden zudem in den Texten <strong>im</strong> Schnitt signifikant mehr Handlungsträger, was<br />
aber <strong>im</strong> Unterschied zur unten nachfolgend interpretierten Anzahl der benutzten Quellen nicht als Indikator für<br />
kritischere, distanziertere bzw. unkritischere, distanzlosere Berichterstattung diskutiert wird.<br />
153
wartet z.B. Sportfunktionäre <strong>und</strong> sportexterne Personen. Bei der Ausprägung Agentur sind<br />
gegenläufige Werte zu beobachten. Die Unterschiede werden als signifikant berechnet. Es<br />
bestehen sehr geringe Korrelationen. Bei der separaten Analyse der Verschlüsslungen der<br />
Variablen Herkunft Handlungsträger 1 zeigt sich, dass akkreditierte Redakteure der Regionalzeitungen<br />
häufiger als erwartet aktive Sportler als Handlungsträger benutzen, seltener als<br />
erwartet werden die Ausprägungen „2<strong>“</strong> bis „4<strong>“</strong> codiert. Die Unterschiede werden als signifikant<br />
geprüft, <strong>und</strong> es werden sehr geringe Korrelationen nachgewiesen. Die Hypothese wird<br />
verifiziert.<br />
Im Sinn der fünften Hypothese ist der Status akkreditiert verb<strong>und</strong>en mit distanzloserer Berichterstattung.<br />
Bei Akkreditierung werden häufiger als erwartet aktive Sportler als Handlungsträger<br />
verwendet, was u.a. zur Ereignis- <strong>und</strong> Ergebniszentrierung passt. 180<br />
7.5.3 Urheber relevant<br />
Die Ausprägungen Aktiver Sportler <strong>und</strong> Trainer werden insgesamt bei den fünf wichtigsten<br />
Handlungsträgern eines Textes von den akkreditierten Urhebern relevant häufiger als erwartet<br />
eingesetzt, die Ausprägungen Aus Sportwelt <strong>und</strong> Nicht aus Sportwelt seltener als erwartet.<br />
Die Werte der nicht akkreditierten Urheber relevant sind gegenläufig. Die Unterschiede<br />
sind laut Chi-Quadrat-Test-Ergebnissen signifikant; es werden bei den vier Berechnungen<br />
sehr geringe Korrelationen nachgewiesen. Die Ergebnisse der separaten Analyse der Codierungen<br />
der Variablen Herkunft Handlungsträger 1 führen dazu, dass die Nullhypothese jeweils<br />
nicht angenommen wird; die Variablen sind voneinander abhängig. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
verwenden als wichtigsten Handlungsträger häufiger als erwartet<br />
aktive Sportler, die restlichen Ausprägungen werden seltener als erwartet beobachtet. Die<br />
Hypothese wird verifiziert.<br />
Akkreditierung ist bei dem Vergleich der Stichproben der Variablen Urheber relevant mit<br />
distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Aktive Sportler werden häufiger als erwartet benutzt.<br />
Häufiger als erwartet werden, was die Variable Herkunft Handlungsträger Gesamt betrifft,<br />
auch Trainer codiert. Die Ausprägungen „2<strong>“</strong> bis „4<strong>“</strong> bzw. „3<strong>“</strong> bis „4<strong>“</strong> werden seltener als<br />
erwartet bei akkreditierten Urhebern relevant verschlüsselt. 181<br />
7.5.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Drei Vergleiche (von drei durchgeführten) beweisen einen signifikanten Unterschied. Der<br />
Status akkreditiert ist jeweils mit distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Bei allen Berechnungen<br />
werden signifikante Unterschiede ermittelt. Bei den Stichproben akkreditierter<br />
Urheber führt dies mindestens bei der Ausprägung Aktiver Sportler zur häufigeren als erwarteten<br />
Verwendung <strong>und</strong> bei der Ausprägung Nicht aus Sportwelt zur selteneren als erwarteten<br />
Verwendung.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht zeigt: In akkreditierten Zeitungen werden<br />
seltener als erwartet aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> Personen aus der Sportwelt sowie häufiger<br />
als erwartet Handlungsträger, die nicht aus der Sportwelt stammen, identifiziert. Die<br />
Werte nicht akkreditierter Zeitungen sind gegenläufig. Alle vier Berechnungsvarianten führen<br />
zur Annahme der Existenz eines signifikanten Unterschieds. Es liegt eine sehr geringe Korrelation<br />
vor. Bei der separaten Untersuchung der Variablen Herkunft Handlungsträger 1 wird<br />
deutlich, dass akkreditierte Zeitungen seltener als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer <strong>und</strong><br />
häufiger als erwartet sportexterne Personen als wichtigsten Handlungsträger einsetzen. Die<br />
180<br />
Bei der Analyse inklusive Meldungen wird ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl der verwendeten<br />
Handlungsträger in den Texten dokumentiert, bei der Analyse exklusive Meldungen wird kein signifikanter<br />
Unterschied ermittelt.<br />
181<br />
In Texten akkreditierter Urheber relevant werden <strong>im</strong> Schnitt mehr Handlungsträger eingesetzt als in den Texten<br />
nicht akkreditierter Urheber relevant. Bei der Berechnung inklusive Meldungen ist der Unterschied signifikant,<br />
bei der Berechnung exklusive Meldungen ist er nicht signifikant.<br />
154
Unterschiede erweisen sich als signifikant <strong>und</strong> zeigen jeweils sehr geringe Korrelationen an.<br />
Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Abb. 29: Herkunft Handlungsträger 1 (ohne „9<strong>“</strong>) der Zeitungsschichten (ohne Meldungen)<br />
Innerhalb der beiden Zeitungsschichten ist der Status akkreditiert bezüglich des Gebrauchs<br />
aktiver Sportler als Handlungsträger mit distanzierterer Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn der fünften<br />
Hypothese verb<strong>und</strong>en. 182<br />
7.6 Hypothese 06: Häufig aktive Sportler als Quellen<br />
H06: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
bezüglich der Anzahl <strong>und</strong> Herkunft der benutzten Quellen.<br />
7.6.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Redakteure verwenden Texten <strong>im</strong> Schnitt mehr Quellen als nicht akkreditierte<br />
Redakteure. Dieser Unterschied ist bei den Berechnungsvarianten jeweils signifikant.<br />
Was insgesamt die Herkunft der codierten Handlungsträger betrifft, werden von akkreditierten<br />
Redakteuren häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer eingesetzt sowie seltener<br />
als erwartet sportexterne Quellen. Der Unterschied ist signifikant; es besteht eine geringe<br />
Korrelation. Als wichtigste Quelle benutzen akkreditierte Redakteure häufiger als erwartet<br />
aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer sowie seltener sonstige Quellen aus dem Sportumfeld <strong>und</strong> sportexterne<br />
Personen. Der Unterschied ist signifikant; es wird eine geringe Korrelation nachgewiesen.<br />
Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Der Status akkreditiert ist bei diesem Vergleich ambivalent aus der Perspektive der Forschungsfrage<br />
zu interpretieren: Hinsichtlich der Quellenanzahl ist Akkreditierung bei Regionalzeitungsredakteuren<br />
mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en, hinsichtlich<br />
der Quellenherkunft mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung.<br />
7.6.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Werden Meldungen nicht berücksichtigt, verwenden Agenturen mehr Quellen. Werden dagegen<br />
subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen nicht berücksichtigt, setzen akkreditierte<br />
Regionalzeitungsredakteure mehr Quellen ein. 183 Die Unterschiede bei den beiden<br />
182<br />
In Texten akkreditierter Zeitungen werden <strong>im</strong> Schnitt weniger Handlungsträger eingesetzt als in den Texten<br />
nicht akkreditierter Blätter. Der Unterschied ist signifikant.<br />
183<br />
Bei der Analyse exklusive Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform wird bei den akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
ein Quellen-Mittelwert von 2,67 ermittelt, bei den Agentur-Texten beträgt der Mittelwert<br />
155
genannten Varianten sind jeweils signifikant. Aufgr<strong>und</strong> der oben erwähnten unterschiedlichen<br />
Anteile an Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonten Beiträgen der Stichproben ist die Berechnungsvariante<br />
mit Löschung der Meldungen <strong>und</strong> der meinungsbetonten Texte aus Sicht<br />
des Verfassers am aussagekräftigsten, bei der akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
(nicht signifikant) mehr Quellen als Agentur-Journalisten benutzen. 184 Unter Berücksichtigung<br />
aller Codierungen wird ein nicht signifikanter Unterschied gef<strong>und</strong>en.<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure berichten insgesamt gesehen <strong>–</strong> was die fünf wichtigsten<br />
Quellen betrifft <strong>–</strong> häufiger als erwartet mit aktiven Sportlern <strong>und</strong> Trainern als Quellen<br />
sowie seltener als erwartet mit sonstigen Personen aus dem Sportumfeld <strong>und</strong> sportexternen<br />
Quellen. Die Werte der Agentur-Texte sind gegenläufig. Es besteht bei beiden Berechnungsvarianten<br />
ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt ein signifikanter Unterschied;<br />
bei beiden relevanten Berechnungsvarianten ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen<br />
Herkunft Quelle 1 wird eine sehr geringe Korrelation bewiesen. 185 Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
verwenden als wichtigste Quelle häufiger als erwartet aktive Sportler sowie<br />
seltener sonstige sportinterne <strong>und</strong> sportexterne Personen als erwartet. Die beiden relevanten<br />
Berechnungsvarianten ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle 1 zeigen, dass<br />
die Unterschiede signifikant sind. Es besteht eine sehr geringe Korrelation. Die Hypothese<br />
wird was die Quellenanzahl betrifft <strong>–</strong> gestützt auf die aussagekräftigste Analysevariante<br />
<strong>–</strong> falsifiziert <strong>und</strong> was die Quellenherkunft betrifft verifiziert.<br />
Hinsichtlich der Quellenherkunft ist der Status akkreditiert bei diesem Vergleich mit unkritischerer,<br />
distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en.<br />
7.6.3 Urheber relevant<br />
Akkreditierte Urheber relevant verwenden ohne Löschungen in der Analyse <strong>im</strong> Schnitt mehr<br />
Quellen als nicht akkreditierte Urheber relevant. Werden Meldungen nicht berücksichtigt,<br />
sind mehr Quellen in den Agentur-Texten zu finden. Der Unterschied ist <strong>–</strong> aus den oben diskutierten<br />
Umständen <strong>–</strong> nur signifikant, wenn meinungsbetonte Texte ausgeklammert werden.<br />
Dann benutzen akkreditierte Redakteure signifikant mehr Quellen als Agentur-Journalisten.<br />
Die aufgr<strong>und</strong> der erwähnten Gründe aussagekräftigste Berechnungsvariante mit Löschung<br />
der Meldungen <strong>und</strong> der meinungsbetonten Texte ermittelt einen nicht signifikanten Unterschied.<br />
In Texten akkreditierter Urheber relevant sind <strong>–</strong> insgesamt <strong>und</strong> was die wichtigste Quelle<br />
betrifft <strong>–</strong> häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> Trainer sowie seltener als erwartet sonstige<br />
sportinterne <strong>und</strong> sportexterne Personen zu finden. Die Werte nicht akkreditierter Urheber<br />
relevant sind gegenläufig. Es besteht jeweils ein signifikanter Unterschied. Die relevanten<br />
Berechnungen ohne Ausprägung „9<strong>“</strong> der Variablen Herkunft Quelle Gesamt bzw. der Variablen<br />
Herkunft Quelle 1 zeigen jeweils geringe Korrelationen bzw. bei der Analyse ohne Meldungen<br />
auf die wichtigste Quelle bezogen eine sehr geringe Korrelation an. Die Hypothese<br />
2,01. Bei der Berechnung exklusive Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen Aufmachung wird für akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
der Mittelwert von 2,11 ermittelt, für Agentur-Texte 2,58.<br />
184<br />
In 24 meinungsbetonten Beiträgen der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure werden <strong>im</strong> Schnitt 0,58<br />
Quellen benutzt. Gemäß dem Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests besteht bezüglich der verwendeten Quellenanzahl<br />
der subjektivierend-argumentierenden <strong>und</strong> objektivierend-faktizierenden Darstellungsformen ein höchst<br />
signifikanter Unterschied (p = 0,000). Aufgr<strong>und</strong> der speziellen Anforderungen für meinungsbetonte Texte erscheint<br />
dem Verfasser der vorliegenden Arbeit die Annahme logisch, dass eine hohe Anzahl an verwendeten<br />
Quellen bei meinungsbetonten Texten <strong>im</strong> Vergleich zu eher informierenden Texten ein nicht so geeigneter Indikator<br />
für kritische, distanzierte Berichterstattung ist.<br />
185<br />
Wird Ausprägung „9<strong>“</strong> (Keine (weitere) Quelle) der Variablen Herkunft Quelle Gesamt oder der Variablen Herkunft<br />
Quelle 1 bei der Berechnung berücksichtigt, kann diskutiert werden, ob die jeweilige Variable dann nicht<br />
mehr ordinalskaliert ist, da die Ausprägung „9<strong>“</strong> sich nicht in eine Rangordnung bezüglich der <strong>Distanz</strong> der Quellen<br />
zum Berichterstattungsgegenstand einordnen lässt. Zudem kann argumentiert werden, dass eine Aussage über<br />
die existierenden Quellen getroffen werden soll.<br />
156
wird was die Quellenanzahl betrifft <strong>–</strong> gestützt auf die aussagekräftigste Analysevariante<br />
<strong>–</strong> falsifiziert <strong>und</strong> was die Quellenherkunft betrifft verifiziert.<br />
Abb. 30: Herkunft Quelle Gesamt (ohne „9<strong>“</strong>) der Urheber relevant (ohne Meldungen)<br />
Der Status akkreditiert bei dem Vergleich der Stichproben der Variablen Urheber relevant<br />
hinsichtlich der Quellenanzahl führt <strong>–</strong> auf die aussagekräftigste Analysevariante gestützt <strong>–</strong> zu<br />
keinem signifikanten Unterschied bezüglich kritischer, distanzierter Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn<br />
der sechsten Hypothese. Hinsichtlich der Quellenherkunft ist Akkreditierung mit unkritischerer,<br />
distanzloserer Berichterstattung <strong>im</strong> Sinn der sechsten Hypothese verb<strong>und</strong>en.<br />
7.6.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Ein Vergleich (von drei durchgeführten) beweist einen signifikanten Unterschied bezüglich<br />
der Quellenanzahl. Akkreditierte Redakteure verwenden signifikant mehr Quellen als nicht<br />
akkreditierte Regionalzeitungsredakteure. Der Status akkreditiert ist bei diesem Vergleich mit<br />
distanzierterer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Drei von drei durchgeführten Vergleichen beweisen<br />
einen signifikanten Unterschied bezüglich der Quellenherkunft. Der Status akkreditiert<br />
ist jeweils mit distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Akkreditierte Urheber benutzen<br />
häufiger aktive Sportler als erwartet <strong>und</strong> seltener sportexterne Quellen als erwartet.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht zeigt: In Texten akkreditierter Zeitungen<br />
werden weniger Quellen gef<strong>und</strong>en als in Texten nicht akkreditierter Zeitungen. Ein signifikanter<br />
Unterschied wird sowohl bei der Berechnung mit Berücksichtigung aller Codierungen<br />
<strong>und</strong> als auch bei der Berechnung ohne Meldungen festgestellt. 186<br />
Was die Herkunft der Quellen insgesamt <strong>und</strong> der wichtigsten Quelle betrifft, benutzen akkreditierte<br />
Zeitungen seltener als erwartet aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> sonstige Personen aus<br />
der Sportwelt als Quellen; sportexterne Quellen sind häufiger als erwartet festzustellen. Die<br />
Werte nicht akkreditierter Zeitungen sind gegenläufig. Der Unterschied ist jeweils signifikant<br />
<strong>–</strong> mit Ausnahme der Berechnungen exklusive Meldungen bei der Analyse der wichtigsten<br />
Quelle, bei denen kein signifikanter Unterschied bemerkt wird. Die Korrelation ist jeweils sehr<br />
gering. Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Hinsichtlich der Quellenanzahl ist der Status akkreditiert bei dem Vergleich der Zeitungsschicht-Stichproben<br />
mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en, hinsichtlich<br />
der Quellenherkunft mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung.<br />
186<br />
Wenn Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform nicht in der Analyse berücksichtigt wird, werden insgesamt<br />
10,2 % der Fälle aussortiert <strong>–</strong> 12,4 % der Fälle akkreditierter Zeitungen <strong>und</strong> 7,4 % der Fälle nicht akkreditierter<br />
Zeitungen.<br />
157
7.7 Hypothese 07: Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<br />
H07: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierter Urheber<br />
was die Anzahl der verwendeten „Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<strong>“</strong> betrifft.<br />
7.7.1. Anzahl Vornamen<br />
7.7.1.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>im</strong> Schnitt weniger Vornamen in den<br />
Texten als nicht akkreditierte Redakteure. Der Unterschied ist nicht signifikant. Die Hypothese<br />
wird falsifiziert.<br />
7.7.1.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
In den Texten der Agentur-Journalisten werden <strong>im</strong> Schnitt weniger Vornamen gef<strong>und</strong>en als<br />
in den Texten akkreditierter Regionalzeitungsredakteure. Ein signifikanter Unterschied wird<br />
bei der Berechnung ohne subjektivierend-argumentierende Darstellungsformen ermittelt. 187<br />
Die anderen drei Analysevarianten belegen jeweils nicht signifikante Unterschiede. 188 Die<br />
Hypothese wird bedingt verifiziert. Unter den Meldungen ausschließenden Filterbedingungen<br />
wird die Hypothese falsifiziert <strong>–</strong> diese Ergebnisse werden als am aussagekräftigsten<br />
angesehen.<br />
Hinsichtlich der Anzahl an Vornamen ist der Status akkreditiert bei diesem Vergleich <strong>im</strong> Fall<br />
des signifikanten Unterschieds bei der Berechnung ohne subjektivierend-argumentierende<br />
Darstellungsformen mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Die Hypothese<br />
kann allerdings nur bedingt verifiziert werden, da akkreditierte Redakteure weniger<br />
Vornamen in meinungsbetonten Texten <strong>und</strong> Agentur-Journalisten mehr Vornamen in Texten<br />
verwenden, die einen größeren Umfang haben als Meldungen. Die Berechnung, die meinungsbetonte<br />
Texte <strong>und</strong> Meldungen aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile der beiden<br />
Stichproben an den genannten Ausprägungen aus der Analyse ausschließt, belegt keinen<br />
signifikanten Unterschied.<br />
7.7.1.3 Urheber relevant<br />
Akkreditierte Urheber relevant benutzen mehr Vornamen als nicht akkreditierte Urheber relevant.<br />
Exklusive subjektivierend-argumentierender Texte wird ein signifikanter Unterschied<br />
zwischen den beiden Stichproben festgestellt. Die anderen drei Analysevarianten ergeben<br />
keine signifikanten Unterschiede. Die Hypothese wird bedingt verifiziert. Unter den Meldungen<br />
ausschließenden Filterbedingungen wird die Hypothese falsifiziert <strong>–</strong> diese<br />
Ergebnisse werden als am aussagekräftigsten angesehen.<br />
187<br />
Die 24 Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure mit Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform<br />
weisen einen Mittelwert von 0,04 Vornamen pro Text auf. Im Vergleich dazu beträgt der Mittelwert in den Texten<br />
der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure mit den restlichen Darstellungsform-Ausprägungen zusammen<br />
0,47. Der Mittelwert der Ausprägung „1<strong>“</strong> wird mit 0,23 ermittelt. Bezüglich der verwendeten Anzahl von Vornamen<br />
der Ausprägungen „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform der Stichprobe akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
wird laut Mann-Whitney-U-Test kein signifikanter Unterschied ermittelt (p = 0,170).<br />
188<br />
Aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile an Meldungen der Stichproben der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure,<br />
der Urheber-Ausprägung Agentur <strong>und</strong> nicht akkreditierter Urheber relevant, werden die Analysevarianten<br />
exklusive Meldungen nach Meinung des Verfassers für am aussagekräftigsten gehalten. Der Mittelwert an<br />
Vornamen beträgt insgesamt in 232 Meldungen 0,03 <strong>und</strong> in allen 782 Texten 0,20. Die Unterschiede zwischen<br />
den Aufmachungs-Ausprägungen „1<strong>“</strong> (Vornamen-Mittelwert 0,39), „2<strong>“</strong> (Mittelwert 0,35) <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> (Mittelwert 0,15)<br />
<strong>und</strong> der Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen Aufmachung sind bezüglich verwendeter Vornamen laut Mann-Whitney-U-<br />
Test jeweils höchst signifikant (p ≤ 0,001). Es erscheint dem Verfasser der vorliegenden Arbeit <strong>im</strong> Gegensatz zur<br />
vorherigen Hypothese sinnvoll die Berechnungen inklusive meinungsbetonter Beiträge zu diskutieren, da die<br />
Anzahl der „Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<strong>“</strong> auch bei meinungsbetonten Texten als geeigneter Indikator für<br />
unkritische, distanzlose Berichterstattung angesehen wird.<br />
158
Akkreditierung ist bei diesem Vergleich bezüglich der verwendeten Anzahl an Vornamen <strong>im</strong><br />
Fall des signifikanten Unterschieds bei der Berechnung ohne subjektivierendargumentierende<br />
Darstellungsformen mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung<br />
verb<strong>und</strong>en. 189<br />
7.7.1.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Zwei von drei Vergleichen zeigen, dass unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen jeweils ein signifikanter<br />
Unterschied hinsichtlich der Verwendung von Vornamen besteht. Die aus den genannten<br />
Gründen für am aussagekräftigsten gehaltenen Analysevarianten exklusive Meldungen<br />
belegen keine signifikanten Unterschiede.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht ermittelt keinen signifikanten Unterschied<br />
bezüglich der Variablen Anzahl Vornamen. Akkreditierte Zeitungen benutzen <strong>im</strong><br />
Schnitt nicht signifikant weniger Vornamen als nicht akkreditierte Zeitungen. Die Hypothese<br />
wird falsifiziert.<br />
7.7.2 Anzahl Spitznamen<br />
7.7.2.1 Urheber nur Redakteure<br />
Der Unterschied zwischen den Artikeln der akkreditierten <strong>und</strong> der nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteure<br />
hinsichtlich der Anzahl verwendeter Spitznamen ist nicht signifikant.<br />
Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.7.2.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Lediglich der Unterschied bei der Analysevariante ohne meinungsbetonte Texte weist einen<br />
signifikanten Unterschied auf. 190 Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure setzen bei dieser<br />
Berechnung häufiger Spitznamen ein als Urheber der Agentur-Beiträge. Die anderen drei<br />
Analysevarianten belegen jeweils nicht signifikante Unterschiede. 191 Die Hypothese wird<br />
bedingt verifiziert. Unter den Meldungen ausschließenden Filterbedingungen wird die<br />
Hypothese falsifiziert <strong>–</strong> diese Ergebnisse werden als am aussagekräftigsten angesehen.<br />
Hinsichtlich der Anzahl an identifizierten Spitznamen ist der Status akkreditiert bei diesem<br />
Vergleich <strong>im</strong> Fall des signifikanten Unterschieds bei der Berechnung ohne subjektivierendargumentierende<br />
Darstellungsformen mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung<br />
verb<strong>und</strong>en, da mehr Spitznamen verwendet werden. Die Hypothese kann allerdings nur bedingt<br />
verifiziert werden, da akkreditierte Redakteure weniger Spitznamen in meinungsbetonten<br />
Texten <strong>und</strong> Agentur-Journalisten mehr Spitznamen in Texten verwenden, die einen grö-<br />
189<br />
Es gelten dieselben Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse wie bei dem oben diskutierten Vergleich der<br />
Texte der akkreditierten Redakteure <strong>und</strong> der Agenturen.<br />
190<br />
Die 24 Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure mit Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform<br />
weisen einen Mittelwert von 0,63 Spitznamen auf <strong>–</strong> <strong>im</strong> Vergleich dazu beträgt der Mittelwert in den Texten der<br />
akkreditierten Regionalzeitungsredakteure mit den anderen Darstellungsform-Ausprägungen zusammen 1,03 <strong>–</strong><br />
der Mittelwert der Ausprägung „1<strong>“</strong> wird mit 0,83 ermittelt. Bezüglich der verwendeten Anzahl von Spitznamen der<br />
Ausprägungen „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform der Stichprobe akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
wird laut Mann-Whitney-U-Test kein signifikanter Unterschied ermittelt (p = 0,638).<br />
191<br />
Aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile an Meldungen der Stichproben der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure,<br />
der Urheber-Ausprägung Agentur <strong>und</strong> der nicht akkreditierten Urheber relevant, werden die Analysevarianten<br />
exklusive Meldungen für am aussagekräftigsten gehalten. Der Mittelwert an Spitznamen beträgt in 232<br />
Meldungen insgesamt 0,17 <strong>und</strong> in allen 782 Texten 0,78. Die Unterschiede zwischen den Aufmachungs-<br />
Ausprägungen „1<strong>“</strong> (Spitznamen-Mittelwert 1,84), „2<strong>“</strong> (Mittelwert 1,02) <strong>und</strong> „3<strong>“</strong> (Mittelwert 0,53) <strong>und</strong> der Ausprägung<br />
„4<strong>“</strong> der Variablen Aufmachung sind bezüglich verwendeter Spitznamen laut Mann-Whitney-U-Test jeweils<br />
höchst signifikant (p = 0,000). Aus den oben genannten Gründen werden auch die Berechnungen inklusive meinungsbetonter<br />
Beiträge diskutiert.<br />
159
ßeren Umfang haben als Meldungen. Die Berechnung, die meinungsbetonte Texte <strong>und</strong> Meldungen<br />
aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile der beiden Stichproben an den genannten<br />
Ausprägungen aus der Analyse ausschließt, belegt keinen signifikanten Unterschied.<br />
7.7.2.3 Urheber relevant<br />
Ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der codierten Anzahl an Spitznamen zwischen den<br />
beiden Gruppen liegt vor, wenn Meldungen nicht aus der Analyse gelöscht werden. In den<br />
Texten akkreditierter Urheber relevant werden unter dieser Filterbedingung mehr Spitznamen<br />
codiert als in den Texten nicht akkreditierter Urheber relevant. Die Hypothese wird<br />
bedingt verifiziert. Unter den Meldungen ausschließenden Filterbedingungen, die für<br />
am aussagekräftigsten gehaltene Ergebnisse liefern, wird die Hypothese falsifiziert.<br />
Akkreditierung ist bei diesem Vergleich bezüglich der verwendeten Anzahl an Spitznamen <strong>im</strong><br />
Fall des signifikanten Unterschieds bei den Berechnungen inklusive Meldungen mit unkritischerer,<br />
distanzloserer Sportberichterstattung verb<strong>und</strong>en. Es erfolgt allerdings nur eine bedingte<br />
Verifizierung der Untersuchungshypothese, da Agentur-Journalisten mehr Spitznamen<br />
in ihren Texten verwenden, die einen größeren Umfang haben als Meldungen, <strong>und</strong> sich die<br />
Anteile an Meldungen der verglichenen beiden Stichproben wie oben beschrieben <strong>stark</strong> unterscheiden.<br />
7.7.2.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Zwei von drei Vergleichen zeigen, dass unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen jeweils ein signifikanter<br />
Unterschied hinsichtlich der Verwendung von Spitznamen besteht. Die aus den<br />
genannten Gründen für am aussagekräftigsten gehaltenen Analysevarianten exklusive Meldungen<br />
belegen keine signifikanten Unterschiede.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht ergibt: In den acht untersuchten akkreditierten<br />
Regionalzeitungen werden <strong>im</strong> Schnitt weniger Spitznamen verschlüsselt. Alle vier<br />
Berechnungsvarianten belegen, dass der Unterschied jeweils signifikant ist. Die Hypothese<br />
wird verifiziert.<br />
Hinsichtlich der Anzahl an verwendeten Spitznamen in den Texten ist der Status akkreditiert<br />
bei dem Vergleich der Zeitungsschicht-Stichproben mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung<br />
verb<strong>und</strong>en.<br />
7.7.3 Anzahl Identifikationen<br />
7.7.3.1 Urheber nur Redakteure<br />
Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure verwenden <strong>im</strong> Schnitt weniger Identifikationen in<br />
den Texten als nicht akkreditierte Redakteure. Der Unterschied ist nicht signifikant, wenn<br />
meinungsbetonte Texte aus der Analyse gelöscht werden. 192 Bei den Berechnungen aller<br />
Codierungen oder ohne Meldungen wird jeweils ein signifikanter Unterschied ermittelt. 193 Die<br />
Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
192<br />
Bei Aussortierung meinungsbetonter Texte werden bei der Stichprobe akkreditierter Redakteure 28,5 % bzw.<br />
ohne Meldungen 28,0 % der Fälle aussortiert, bei der Stichprobe nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
57,8 % bzw. ohne Meldungen 58,7 % der Fälle.<br />
193<br />
Die 24 Texte akkreditierter Regionalzeitungsredakteure mit Ausprägung „3<strong>“</strong> der Variablen Darstellungsform<br />
weisen einen Mittelwert von 0,08 Identifikationen auf, bei den 37 meinungsbetonten Beiträgen der nicht akkreditierten<br />
Regionalzeitungsredakteure wird ein Mittelwert von 0,68 Identifikationen ermittelt <strong>–</strong> <strong>im</strong> Vergleich dazu<br />
beträgt der Mittelwert der anderen Darstellungsform-Ausprägungen zusammen in den Texten der akkreditierten<br />
Regionalzeitungsredakteure 0,20 <strong>und</strong> in den Texten der nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteure 0,63.<br />
Der Mittelwert der Ausprägung „1<strong>“</strong> wird bei den akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren mit 0,21 <strong>und</strong> bei den<br />
nicht akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren mit 1,00 ermittelt.<br />
160
Hinsichtlich der Anzahl an identifizierten Identifikationen ist der Status akkreditiert bei diesem<br />
Vergleich <strong>im</strong> Fall des signifikanten Unterschieds bei den Berechnungen inklusive subjektivierend-argumentierender<br />
Darstellungsformen mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung<br />
verb<strong>und</strong>en, da weniger Identifikationen verwendet werden. Akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
verwenden weniger Identifikationen in meinungsbetonten Texten <strong>im</strong> Vergleich zu<br />
den sonstigen Darstellungsform-Ausprägungen <strong>und</strong> nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
verwenden mehr Identifikationen in meinungsbetonten Texten <strong>im</strong> Vergleich zu den<br />
sonstigen Darstellungsform-Ausprägungen. Der Anteil an meinungsbetonten Texten unterscheidet<br />
sich zwischen den Stichproben <strong>stark</strong>. Die Berechnungen, die meinungsbetonte Texte<br />
aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Anteile der beiden Stichproben an der Ausprägung aus der<br />
Analyse ausschließen, belegen keine signifikanten Unterschiede.<br />
7.7.3.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
In den Texten akkreditierter Redakteure sind mehr Identifikationen zu finden sind als in den<br />
Agentur-Texten. Ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der codierten Anzahl an Identifikationen<br />
zwischen den beiden Gruppen existiert bei der Berechnung aller Codierungen. Bei der<br />
Löschung der Meldungen <strong>und</strong>/oder subjektivierend-argumentierender Darstellungsformen<br />
liegt kein signifikanter Unterschied vor. Die Hypothese wird bedingt verifiziert. Unter den<br />
Meldungen ausschließenden Filterbedingungen, die für am aussagekräftigsten gehaltene<br />
Ergebnisse liefern, wird die Hypothese falsifiziert.<br />
Akkreditierung ist bei diesem Vergleich <strong>im</strong> Fall des signifikanten Unterschieds bei der Berechnung<br />
ohne Löschung von Fällen <strong>im</strong> Sinn der siebten Hypothese mit unkritischerer,<br />
distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en. Aufgr<strong>und</strong> der erwähnten Unterschiede der<br />
Stichproben an Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonten Texten wird die Analysevariante mit Löschung<br />
dieser Ausprägungen für am aussagekräftigsten gehalten.<br />
7.7.3.3 Urheber relevant<br />
Akkreditierte Urheber relevant setzen mehr Identifikationen in den Texten ein als nicht akkreditierte<br />
Urheber relevant. Der Unterschied ist nicht signifikant. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.7.3.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Zwei von drei Vergleichen zeigen, dass unter best<strong>im</strong>mten Filterbedingungen jeweils ein signifikanter<br />
Unterschied hinsichtlich der Verwendung von Identifikationen besteht. Die aus den<br />
genannten Gründen für am aussagekräftigsten gehaltenen Analysevarianten exklusive Meldungen<br />
(<strong>und</strong> meinungsbetonter Texte) belegen in einem Fall bzw. in keinem Fall einen signifikanten<br />
Unterschied.<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht ermittelt keinen signifikanten Unterschied<br />
bezüglich der Variablen Anzahl Identifikationen. Die Hypothese wird falsifiziert.<br />
7.7.4 Zusammenfassung<br />
Unter der Filterbedingung, dass meinungsbetonte Texte in der Analyse enthalten sind, wird<br />
einzig bei der Variablen Anzahl Identifikationen ein signifikanter Unterschied be<strong>im</strong> Vergleich<br />
der Stichproben der Regionalzeitungsredakteure ermittelt, wobei der Status akkreditiert als<br />
mit kritischerer, distanzierterer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en interpretiert werden kann.<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich zwischen den Stichproben akkreditierter Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong><br />
Agentur bzw. nicht akkreditierten Urhebern relevant wird in fünf von sechs Fällen unter best<strong>im</strong>mten<br />
Filterbedingungen jeweils ein signifikanter Unterschied ermittelt, wobei Akkreditierung<br />
jeweils mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en ist.<br />
161
Bei der Analyse mit der Variablen Anzahl Identifikationen ergibt sich be<strong>im</strong> Vergleich der<br />
Stichproben der Variablen Urheber relevant kein signifikanter Unterschied. Signifikanzen<br />
werden bei Berechnungen exklusive Meldungen nicht festgestellt. Be<strong>im</strong> Vergleich der Stichproben<br />
der Variablen Zeitungsschicht besteht nur bezüglich der Spitznamen-Anzahl ein signifikanter<br />
Unterschied, der die Verbindung des Status akkreditiert mit kritischerer, distanzierterer<br />
Berichterstattung andeutet. Die Ergebnisse der beiden zuvor erfolgten Vergleiche werden<br />
allerdings so interpretiert, dass Akkreditierung mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung<br />
verknüpft ist.<br />
7.8 Hypothese 08: Verstecken hinter Experten<br />
H08: Akkreditierte Zeitungen unterscheiden sich von nicht akkreditierten Zeitungen hinsichtlich<br />
der Verlagerung des Transports von Meinungen auf Experten <strong>–</strong> gemessen am Textumfang<br />
<strong>und</strong> der Anzahl wertender Aussagen.<br />
7.8.1 Artikel-Umfang<br />
Meinungsbetonte Texte akkreditierter Zeitungen sind signifikant kürzer als subjektivierendargumentierende<br />
Beiträge nicht akkreditierter Zeitungen, wenn die Ausprägung „4<strong>“</strong> der Variablen<br />
Aufmachung in der Analyse mitberücksichtigt wird. Die von akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren<br />
geschriebenen meinungsbetonten Texte sind signifikant kürzer als die Beiträge<br />
nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure. Die von Experten geschriebenen meinungsbetonten<br />
Texte unterscheiden sich aufgeteilt nach Zeitungsschichten nicht signifikant<br />
voneinander. Insgesamt betrachtet unterscheiden sich die Textumfänge in den drei Gruppen<br />
akkreditierte Redakteure, nicht akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Experte/Gastautor signifikant<br />
voneinander, wobei die zuerst genannten beiden Urheber-Gruppen eine homogene Untergruppe<br />
darstellen <strong>und</strong> Experten mit durchschnittlich 2334,11 Zeichen Texte mit signifikant<br />
größeren Umfängen verfassen.<br />
Zeitungsschicht<br />
Abb. 31: Artikel-Umfang meinungsbetonter Texte <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Innerhalb der Zeitungsschicht akkreditiert unterscheiden sich die Textumfänge der drei relevanten<br />
Urheber-Gruppen signifikant voneinander. Die beiden Redakteursgruppen bilden eine<br />
homogene Untergruppe. Experten verfassen <strong>–</strong> mit durchschnittlich 2446,36 Zeichen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> Texte mit signifikant größeren Umfängen als akkreditierte Redakteure mit 1357,83 Zeichen<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierter Redakteure mit 1419,95 Zeichen. Innerhalb der Zeitungsschicht<br />
nicht akkreditiert wird kein signifikanter Unterschied registriert. Meinungsbetonte Texte nicht<br />
akkreditierter Redakteure weisen <strong>im</strong> Schnitt einen Textumfang von 1938,35 Zeichen auf,<br />
Texte der Experten/Gastautoren 2157,71 Zeichen. Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Experten werden innerhalb beider Zeitungsschichten größere Umfänge <strong>im</strong> Vergleich zur<br />
Kommentierung durch eigene Redakteure eingeräumt. Dieser Unterschied ist bei akkreditierten<br />
Regionalzeitungen signifikant <strong>und</strong> bei nicht akkreditierten Regionalzeitungen nicht signifi-<br />
162
kant. Signifikanzen bzw. Nicht-Signifikanzen kommen durch die Text-Umfänge der Regionalzeitungsredakteure<br />
zustande, da sich die Experten-Texte der beiden Zeitungsschichten bezüglich<br />
des Umfangs der Artikel nicht signifikant unterscheiden, wohl aber die Texte der Regionalzeitungsredakteure<br />
der Zeitungsschichten. Meinungsbetonte Texte der Redakteure<br />
akkreditierter Zeitungen weisen signifikant kleinere Umfänge auf als meinungsbetonte Texte<br />
der Redakteure nicht akkreditierter Zeitungen. Im Sinn der achten Untersuchungshypothese<br />
ist Akkreditierung mit unkritischerer Sportberichterstattung verb<strong>und</strong>en, da bezüglich der Artikel-Umfänge<br />
der Transport von Meinungen signifikant stärker auf Experten <strong>und</strong> Gastautoren<br />
verlagert wird.<br />
7.8.2 Anzahl wertender Aussagen<br />
Zwischen den beiden Zeitungsgruppen besteht ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der<br />
Anzahl wertender Aussagen in meinungsbetonten Texten. Im Schnitt sind in subjektivierendargumentierenden<br />
Texten akkreditierter Regionalzeitungen 7,89 wertende Aussagen zu finden<br />
<strong>–</strong> in subjektivierend-argumentierenden Beiträgen nicht akkreditierter Zeitungen 9,60 wertende<br />
Aussagen. Die von Regionalzeitungsredakteuren bzw. von Experten geschriebenen<br />
meinungsbetonten Beiträge unterscheiden sich bezüglich der Anzahl wertender Aussagen<br />
aufgeteilt nach den Zeitungsschichten nicht signifikant voneinander (p = 0,079 bzw. p =<br />
0,403).<br />
Die Anzahl wertender Aussagen unterscheidet sich insgesamt betrachtet in den drei Gruppen<br />
akkreditierte Redakteure, nicht akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Experte/Gastautor signifikant<br />
voneinander, wobei die zuerst genannten beiden Urheber-Gruppen eine homogene<br />
Untergruppe darstellen <strong>und</strong> in den Experten-Texten mit 11,61 wertenden Aussagen mehr<br />
Wertungen codiert werden.<br />
Zeitungsschicht<br />
Abb. 32: Anzahl wertender Aussagen <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Innerhalb der Zeitungsschicht akkreditiert unterscheidet sich die Anzahl wertender Aussagen<br />
der drei Gruppen signifikant voneinander. Meinungsbetonte Texte akkreditierter Redakteure<br />
weisen <strong>im</strong> Schnitt 6,92 Wertungen auf, Texte nicht akkreditierter Redakteure 6,65 Wertungen<br />
<strong>und</strong> Experte/Gastautor 12,27 Wertungen. Die beiden Redakteursgruppen bilden eine homogene<br />
Untergruppe. Innerhalb der Zeitungsschicht nicht akkreditiert wird kein signifikanter<br />
Unterschied registriert. Meinungsbetonte Texte nicht akkreditierter Redakteure weisen <strong>im</strong><br />
Schnitt 9,29 wertende Aussagen auf, Texte der Experten/Gastautoren 10,57 wertende Aussagen.<br />
Die Hypothese wird verifiziert.<br />
Meinungsbetonte Texte der Experten beinhalten innerhalb der Zeitungsschichten <strong>im</strong> Vergleich<br />
zur Kommentierung durch eigene Redakteure der Zeitungen mehr wertende Aussagen.<br />
Dieser Unterschied ist bei akkreditierten Regionalzeitungen signifikant <strong>und</strong> bei nicht<br />
akkreditierten Zeitungen nicht signifikant. Im Sinn der achten Hypothese ist der Status ak-<br />
163
kreditiert der Zeitungen mit unkritischerer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en, da bezüglich der Anzahl<br />
wertender Aussagen der Transport von Meinungen signifikant stärker auf Experten verlagert<br />
wird.<br />
7.8.3 Zusammenfassung<br />
Experten-Beiträge weisen innerhalb der Zeitungsschichten <strong>im</strong> Vergleich zu Kommentaren<br />
der Redakteure <strong>im</strong> Schnitt größere Textumfänge <strong>und</strong> eine größere Anzahl wertender Aussagen<br />
auf. Diese Unterschiede sind bei akkreditierten Zeitungen jeweils signifikant <strong>und</strong> bei<br />
nicht akkreditierten Zeitungen jeweils nicht signifikant. Im Sinn der achten Hypothese ist Akkreditierung<br />
mit unkritischerer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en, da Meinungen sowohl die Textumfänge<br />
als auch die Anzahl der Wertungen betreffend stärker durch Experten transportiert<br />
werden.<br />
7.9 Hypothese 09: Rosarote Brille<br />
H09: Akkreditierte Zeitungen unterscheiden sich von nicht akkreditierten Zeitungen was die<br />
Dominanz positiv wertender Aussagen in argumentierenden Darstellungsformen der Journalisten<br />
<strong>und</strong> Experten betrifft.<br />
Akkreditierte Redakteure der Regionalzeitungen kommentieren nicht signifikant positiver als<br />
nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure <strong>–</strong> auch nicht bei der Aufteilung nach dem Bezug<br />
der wertenden Aussagen. Insgesamt unterscheiden sich die Wertungen akkreditierter<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierter Zeitungen nicht signifikant voneinander <strong>–</strong> auch nicht bei separater<br />
Analyse der Urheber-Ausprägungen Experten oder Redakteure. Bei der Aufteilung nach dem<br />
Bezug der wertenden Aussagen werden einzig bei der separaten Betrachtung der Wertungen<br />
der Redakteure bei der Bezugs-Ausprägung Deutsches Team/Perspektive ein signifikanter<br />
Unterschied festgestellt. Redakteure akkreditierter Zeitungen urteilen bezüglich des<br />
deutschen Teams häufiger positiv <strong>und</strong> seltener negativ als erwartet. Redakteure nicht akkreditierter<br />
Zeitungen kommentieren seltener positiv <strong>und</strong> häufiger negativ als erwartet. Akkreditierung<br />
ist in dem Fall dieser Analysevariante, die einen signifikanten Unterschied ermittelt,<br />
mit unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verknüpft, da Redakteure akkreditierter<br />
Regionalzeitungen Leistungen (der „eigenen<strong>“</strong> Mannschaft) häufiger positiv als erwartet bewerten<br />
<strong>und</strong> die Werte der Redakteure der nicht akkreditierten Zeitungen gegenläufig sind.<br />
Der Vergleich der drei meinungsbetonte Texte betreffend relevanten Urheber-Ausprägungen<br />
inklusive Gastautor/Experte zeigt: 194 Experten bewerten häufiger positiv <strong>und</strong> seltener negativ<br />
als erwartet. Bei akkreditierten <strong>und</strong> nicht akkreditierten Redakteuren werden seltener positive<br />
<strong>und</strong> häufiger negative Wertungen als erwartet beobachtet. Es besteht eine Abhängigkeit <strong>und</strong><br />
eine sehr geringe Korrelation.<br />
Bei akkreditierten Zeitungen unterscheiden sich Redakteure <strong>und</strong> Experten bezüglich der<br />
Wertungen nicht signifikant voneinander, bei nicht akkreditierten Zeitungen besteht ein signifikanter<br />
Unterschied. Redakteure urteilen seltener positiv <strong>und</strong> häufiger negativ als erwartet,<br />
Experten häufiger positiv <strong>und</strong> seltener negativ als erwartet. Es wird eine geringe Korrelation<br />
nachgewiesen.<br />
194<br />
Acht ausschließlich positiv wertende Aussagen eines Kommentars werden in der Analyse zusätzlich zur oben<br />
beschrieben Berechnung der Kommentare akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
berücksichtigt, wenn neben Regionalzeitungsredakteuren Verfasser der Agentur-Texte als Urheber wertender<br />
Aussagen miteinbezogen werden. Deshalb wird auf die Diskussion der Vergleiche akkreditierte Redakteure <strong>und</strong><br />
Agentur bzw. nicht akkreditierte Urheber relevant verzichtet. Um die Bewertungen der Experten <strong>und</strong> Gastautoren<br />
zu berücksichtigen, werden die Ergebnisse des Vergleichs der Urheber-Ausprägungen akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure sowie Experten/Gastautoren interpretiert.<br />
164
Abb. 33: Bewertung wertender Aussagen <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Bei der Aufteilung nach dem Bezug der wertenden Aussagen zeigt sich bei der deutschen<br />
Perspektive bei den Urhebern akkreditierter Regionalzeitungen kein signifikanter Unterschied.<br />
Ein signifikanter Unterschied existiert bei den Urhebern nicht akkreditierter Zeitungen:<br />
Seltener positive <strong>und</strong> häufiger negative Wertungen als erwartet werden bei den Redakteuren<br />
registriert sowie häufiger positive <strong>und</strong> seltener negative Wertungen als erwartet bei<br />
den Experten <strong>und</strong> Gastautoren. Es liegt eine geringe Korrelation vor. Die Hypothese wird<br />
verifiziert.<br />
Abb. 34: Bewertung wertender Aussagen zu Deutschland <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass je nach Akkreditierung der Zeitungsschicht signifikante bzw.<br />
nicht signifikante Unterschiede zwischen den Urheber-Ausprägungen bestehen. Bei akkreditierten<br />
Regionalzeitungen existiert kein signifikanter Unterschied in der Verteilung positiver<br />
<strong>und</strong> negativer Wertungen, was bedeutet, dass in akkreditierten Regionalzeitungen sich die<br />
Urheber-Ausprägungen in der dominierend positiven Beurteilung nicht signifikant voneinander<br />
unterscheiden. Bei nicht akkreditierten Regionalzeitungen urteilen Redakteure signifikant<br />
nicht so <strong>stark</strong> positiv dominierend wie Experten <strong>und</strong> Gastautoren. Damit steht die Akkreditierung<br />
der untersuchten Regionalzeitungen mit vergleichsweise unkritischerer, distanzloserer<br />
WM-Sportberichterstattung in Verbindung.<br />
7.10 Hypothese 10: Quasi selbstwertdienliche Attributionen<br />
H10: Texte akkreditierter Urheber unterscheiden sich von Texten nicht akkreditierten Urhebern<br />
hinsichtlich das „eigene<strong>“</strong> Team betreffender, quasi selbstwertschützender Ursachenzuschreibung.<br />
165
7.10.1 Urheber nur Redakteure<br />
Werden die Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Redakteure anhand<br />
der <strong>dich</strong>otomen Variablen Ursache Attribution internal-external <strong>–</strong> unter Einbezug der<br />
Schichtvariablen Bezug Attribution <strong>und</strong> Valenz Attribution <strong>–</strong> verglichen, wird kein signifikanter<br />
Unterschied ermittelt. Be<strong>im</strong> Vergleich anhand der Variablen Ursache Attribution wird in zwei<br />
von vier Fällen kein signifikanter Unterschied festgestellt. Bei Attributionen zu deutschen<br />
Misserfolgen <strong>und</strong> zu gegnerischen Erfolgen ist der Unterschied signifikant. Nicht akkreditierte<br />
Regionalzeitungsredakteure führen für Deutschland negative Ereignisse häufiger als erwartet<br />
auf internal-stabile Ursachen zurück. Es liegt eine hohe Korrelation vor. Bei gegnerischen<br />
Erfolgen attribuieren nicht akkreditierte Regionalzeitungsredakteure häufiger als erwartet<br />
internal-stabil. Es besteht eine mittlere Korrelation. Die Hypothese wird bedingt verifiziert.<br />
Im Bewusstsein, dass bei akkreditierten Regionalzeitungsredakteuren 64 Fälle <strong>und</strong> bei nicht<br />
akkreditierten Redakteuren 4 Fälle miteinander verglichen werden, kann das signifikante<br />
Ergebnis zu deutschen Misserfolgen so interpretiert werden, dass der Status akkreditiert mit<br />
unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung in Verbindung gebracht werden kann. Akkreditierte<br />
Redakteure attribuieren seltener mit den beiden stabilen Kategorien, nicht akkreditierte<br />
Regionalzeitungsredakteure führen deutsche Misserfolge quasi nicht selbstwertschützend<br />
höchst signifikant häufiger als erwartet auf internal-stabile Ursachen zurück.<br />
7.10.2 Redaktion (akkreditiert) vs. Agentur<br />
Es existieren keine signifikanten Unterschiede in den Ursachenzuschreibungen der akkreditierten<br />
Regionalzeitungsredakteure <strong>und</strong> der Agentur-Journalisten, wenn anhand der Variablen<br />
Ursache Attribution internal-external verglichen wird. Be<strong>im</strong> Vergleich anhand der Variablen<br />
Ursache Attribution wird in drei von vier Fällen kein signifikanter Unterschied festgestellt.<br />
Bei Attributionen zu gegnerischen Misserfolgen ist der Unterschied signifikant. Akkreditierte<br />
Regionalzeitungsredakteure verwenden seltener external-stabile Faktoren <strong>und</strong> häufiger external-variable<br />
Ursachen als erwartet. Die Hypothese wird <strong>–</strong> bezogen auf die Deutschland<br />
betreffenden Attributionen <strong>–</strong> falsifiziert.<br />
7.10.3 Urheber relevant<br />
Wenn die Variable Ursache Attribution internal-external verwendet wird, bestehen in drei von<br />
vier Fällen keine signifikanten Unterschiede in den Ursachenzuschreibungen akkreditierter<br />
<strong>und</strong> nicht akkreditierter Urheber relevant. Ein signifikanter Unterschied wird bei Bezug Gegner<br />
<strong>und</strong> Valenz positives Ereignis ermittelt: Akkreditierte Urheber relevant attribuieren seltener<br />
internal <strong>und</strong> häufiger external als erwartet. Be<strong>im</strong> Vergleich anhand der Variablen Ursache<br />
Attribution wird in drei von vier Fällen kein signifikanter Unterschied festgestellt. Bei<br />
Attributionen zu Misserfolgen des Gegners ist der Unterschied signifikant, weil akkreditierte<br />
Urheber relevant seltener external-stabile Faktoren <strong>und</strong> häufiger external-variable Ursachen<br />
als erwartet verwenden. Die Hypothese wird <strong>–</strong> bezogen auf die Deutschland betreffenden<br />
Attributionen <strong>–</strong> falsifiziert.<br />
7.10.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Zeitungsschicht<br />
Ein Vergleich ermittelt <strong>–</strong> bezogen auf Deutschland betreffende Attributionen <strong>–</strong> einen signifikanten<br />
Unterschied <strong>im</strong> Sinn der zehnten Hypothese, wobei der Status akkreditiert als mit<br />
unkritischerer, distanzloserer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en interpretiert werden kann.<br />
Die Signifikanzen <strong>–</strong> bezogen auf den Gegner betreffende Attributionen <strong>–</strong> können ambivalent<br />
in Bezug auf den Zusammenhang zu kritischer, distanzierter Berichterstattung gedeutet werden:<br />
Die signifikanten Ergebnisse zeigen, dass akkreditierte Urheber einerseits bei gegnerischen<br />
Erfolgen seltener als erwartet internal(-stabil) attribuieren, was für den jeweiligen<br />
deutschen Gegner quasi nicht als selbstwerterhöhende Begründung betrachtet werden kann.<br />
166
Andererseits werden gegnerische Misserfolge seltener als erwartet external-stabil <strong>und</strong> häufiger<br />
als erwartet external-variabel erklärt, was als selbstwertschützend interpretiert werden<br />
kann, da der Gegner zukünftige Misserfolge leichter bei variablen als bei internalen Faktoren<br />
verhindern kann. 195<br />
Der Vergleich innerhalb der Variablen Zeitungsschicht zeigt, dass keine signifikanten Unterschiede<br />
in den Ursachenzuschreibungen akkreditierter <strong>und</strong> nicht akkreditierter Zeitungen in<br />
drei von vier Fällen vorliegen, wenn die Variable Ursache Attribution internal-external benutzt<br />
wird. Einzig bei gegnerischen Erfolgen wird ein signifikanter Unterschied festgestellt: Akkreditierte<br />
Zeitungen begründen diese seltener internal <strong>und</strong> häufiger external als erwartet. Be<strong>im</strong><br />
Vergleich anhand der Variablen Ursache Attribution wird in drei von vier Fällen kein signifikanter<br />
Unterschied festgestellt. Einzig bei gegnerischen Erfolgen ist der Unterschied signifikant.<br />
Akkreditierte Zeitungen führen diese seltener als erwartet auf internal-stabile sowie<br />
häufiger als erwartet auf external-stabile <strong>und</strong> external-variable Faktoren zurück. Die Hypothese<br />
wird <strong>–</strong> bezogen auf die Deutschland betreffenden Attributionen <strong>–</strong> falsifiziert.<br />
7.11 Zusammenfassung<br />
Von den elf Berechnungen zur Variablen Urheber nur Redakteure sind drei nicht signifikant<br />
(Tab. 119). Die größten Werte der standardisierten Residuen bei den nicht signifikanten Unterschieden<br />
werden z.B. bei der Hypothese 03 mit -0,4 bzw. 0,3 ermittelt. Die Texte der<br />
Gruppen unterscheiden sich bezüglich der Dominanz neutraler <strong>und</strong> positiver Valenz des Geschehens<br />
nicht voneinander. Bei der Hypothese 07.1 verwenden beide Gruppen der Redakteure<br />
in den Texten signifikant mehr Vornamen als z.B. Agentur-Journalisten. Die Gruppen<br />
der Redakteure untereinander unterscheiden sich aber nicht signifikant.<br />
Der Blick auf die acht signifikanten Ergebnisse zur Variablen Urheber nur Redakteure zeigt,<br />
dass <strong>–</strong> mit Einschränkung bei der Hypothese 07.3 <strong>–</strong> alle Hypothesen entweder ohne Bedingungen<br />
oder durch die aussagekräftigsten Analysevarianten bestätigt werden können. Sechs<br />
der acht signifikanten Ergebnisse (75,0 %) belegen, dass die Berichterstattung akkreditierter<br />
Regionalzeitungsredakteure unkritischer, distanzloser als die Berichterstattung nicht akkreditierter<br />
Redakteure ist, wobei sich alle sechs Ergebnisse jeweils auf die aussagekräftigste<br />
Berechnungsvariante stützen. Positiv für die akkreditierten Regionalzeitungsjournalisten<br />
kann gewertet werden, dass sie signifikant mehr Quellen benutzen, die allerdings signifikant<br />
häufiger als erwartet aktive Sportler <strong>und</strong> signifikant seltener sportexterne Quellen sind.<br />
Von den elf Berechnungen zu den Urheber-Ausprägungen akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Agentur<br />
zeigen zehn Ergebnisse signifikante Unterschiede an <strong>–</strong> davon sind sieben unter best<strong>im</strong>mten<br />
Bedingungen signifikant, die in sechs Fällen nicht die aussagekräftigste Analysevariante<br />
kennzeichnen. Sechs der neun signifikanten Ergebnisse (60,0 %) beweisen eindeutig,<br />
dass die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure unkritischer, distanzloser<br />
als die Agentur-Berichterstattung ist, wobei sich davon vier Ergebnisse nicht auf die aussagekräftigste<br />
Berechnungsvariante stützen. 196 Die bei der unten abgedruckten Tabelle dargestellten<br />
Filterbedingungen zeigen, dass u.a. Meldungen nicht aus der Analyse ausgeschlossen<br />
werden dürfen oder meinungsbetonte Texte aussortiert werden müssen, um signifikante<br />
Ergebnisse zu ermitteln. Dies zeigt sich an den Ergebnissen der Hypothese 06.1. Je<br />
nachdem, ob meinungsbetonte Texte oder Meldungen ausgeschlossen werden, steht Akkreditierung<br />
mit distanzierterer oder distanzloserer Berichterstattung bezüglich der Anzahl benutzter<br />
Quellen in Verbindung. Aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher Anteile an meinungsbetonten Texten<br />
oder Meldungen z.B. in den Urheber-Ausprägungen akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Agentur<br />
werden diese Berechnungen nicht als die aussagekräftigsten angesehen.<br />
195<br />
Da gegnerische Misserfolge in der vorliegenden Arbeit quasi gleichbedeutend mit deutschen Erfolgen sind,<br />
könnten die Ergebnisse zusätzlich auf die jeweils andere Perspektive bezogen <strong>und</strong> interpretiert werden.<br />
196<br />
Das zehnte signifikante Ergebnis wird aufgr<strong>und</strong> seines nachfolgend erklärten ambivalent zu interpretierenden<br />
Ergebnisses bezüglich kritischer, distanzierter Berichterstattung nicht mitdiskutiert.<br />
167
Urheber<br />
nur<br />
Redaktion<br />
(akkreditiert)<br />
Redakteure vs. Agentur<br />
Urheber<br />
relevant<br />
Hypothese 01 X X X X a<br />
Hypothese 02 X X b X b X c<br />
Hypothese 03 O X d O O<br />
Hypothese 04 X e X f X f O<br />
Hypothese 05 X X X X<br />
Hypothese 06.1 X X g /X h X h X i<br />
Hypothese 06.2 X X X X j<br />
Hypothese 07.1 O X h X h O<br />
Hypothese 07.2 O X h X j X<br />
Hypothese 07.3 X k X f O O<br />
Hypothese 08.1 <strong>–</strong> <strong>–</strong> <strong>–</strong> X<br />
Hypothese 08.2 <strong>–</strong> <strong>–</strong> <strong>–</strong> X<br />
Hypothese 09 <strong>–</strong> <strong>–</strong> <strong>–</strong> X<br />
Hypothese 10 X l O O O<br />
a.<br />
b.<br />
c.<br />
d.<br />
e.<br />
f.<br />
g.<br />
h.<br />
i.<br />
j.<br />
k.<br />
l.<br />
Zeitungsschicht<br />
O <strong>–</strong> nicht signifikanter<br />
Unterschied<br />
X <strong>–</strong> signifikanter<br />
Unterschied<br />
X x <strong>–</strong> bedingter<br />
signifikanter<br />
Unterschied<br />
X <strong>–</strong> unkritischere,<br />
distanzlosere<br />
Berichterstattung<br />
akkreditierter<br />
Urheber belegt<br />
Bedingung: Berechnung ohne Meldungen <strong>und</strong>/oder Darstellungsform-Ausprägungen „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante: signifikant.<br />
Bedingung: Aussage nur bezogen auf Anlass-Ausprägung „1<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante ist signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung ohne Meldungen. Aussage bezogen auf Anlass-Ausprägungen „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante: signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung inklusive aller Codierungen oder ohne Valenz-Ausprägung „0<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung inklusive aller Codierungen <strong>und</strong> ohne Tiefe-Ausprägung „3<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante: signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung inklusive aller Codierungen. Aussagekräftigste Variante: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung ohne Meldungen. Aussagekräftigste Variante: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung ohne Darstellungsform-Ausprägung „3<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Variante: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung inklusive aller Codierungen oder ohne Meldungen. Aussagekräftigste Variante: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Berechnung (bei der Variablen Herkunft Quelle 1) inklusive Meldungen.<br />
Bedingung: Berechnung inklusive Darstellungsform-Ausprägung „3<strong>“</strong>. Aussagekräftigste Varianten: nicht signifikant.<br />
Bedingung: Aussage nur bezogen auf Vergleich der Variablen Ursache Attribution mit Bezug-Ausprägung „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> Valenz-Ausprägung „2<strong>“</strong>.<br />
Tab. 119: Signifikanzen der Hypothesen <strong>–</strong> nach Urheber-Ausprägungen bzw. -Kategorien<br />
Von den elf Berechnungen zu der Variablen Urheber relevant beweisen acht Ergebnisse<br />
signifikante Unterschiede <strong>–</strong> davon sind fünf unter best<strong>im</strong>mten Bedingungen signifikant, die in<br />
vier Fällen nicht die aussagekräftigste Analysevariante darstellen. Vier der acht signifikanten<br />
Ergebnisse (50,0 %) beweisen, dass die Berichterstattung akkreditierter Urheber relevant<br />
unkritischer, distanzloser als die Berichterstattung nicht akkreditierter Urheber relevant ist,<br />
wobei sich davon zwei Ergebnisse jeweils nicht auf die aussagekräftigste Berechnungsvariante<br />
stützen. Die Spalte Urheber relevant zeigt <strong>im</strong> Vergleich zum zuvor erwähnten Stichproben-Vergleich<br />
ähnliche Filterbedingungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Meldungen<br />
oder meinungsbetonter Texte an, um signifikante Unterschiede zu ermitteln.<br />
Von den 14 Berechnungen zur Variablen Zeitungsschicht sind neun signifikant <strong>und</strong> fünf nicht<br />
signifikant. Von den neun signifikanten Ergebnissen sind vier unter best<strong>im</strong>mten Bedingungen<br />
signifikant. Vier der neun signifikanten Ergebnisse (44,4 %) beweisen, dass die Berichterstattung<br />
akkreditierter Zeitungen unkritischer, distanzloser als die Berichterstattung nicht akkreditierter<br />
Zeitungen ist, wobei sich ein Ergebnis nicht auf die aussagekräftigste Berechnungsvariante<br />
stützt. 197 Fünf signifikante Ergebnisse (55,6 %) belegen die umgekehrte Beziehung.<br />
Die Tabelle oben zeigt, dass eine unkritischere, distanzlosere Sportberichterstattung akkreditierter<br />
Urheber <strong>im</strong> Fall signifikant festgestellter Unterschiede am häufigsten be<strong>im</strong> Vergleich<br />
der Variablen Urheber nur Redakteure (75,0 %) belegt wird, am seltensten be<strong>im</strong> Vergleich<br />
der Variablen Zeitungsschicht (44,4 %). Der Vergleich mit den Urheber-Ausprägungen akkreditierte<br />
Redakteure <strong>und</strong> Agentur (60,0 %) sowie der Vergleich der Variablen Urheber relevant<br />
(50,0 %) liefert prozentuale Anteile, die sich dazwischen einordnen lassen.<br />
197<br />
Die Signifikanzüberprüfung der achten <strong>und</strong> neunten Hypothese unterscheidet sich allerdings methodisch von<br />
der Überprüfung der Überprüfung der sonstigen Untersuchungshypothesen.<br />
168
8. SCHLUSSBETRACHTUNGEN<br />
8.1 Kritische Überlegungen zur Untersuchung<br />
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden zehn Hypothesen, die in vier Fällen noch aus Teilhypothesen<br />
bestehen, bezüglich unterschiedlicher Aspekte überprüft, die jeweils als Indikatoren<br />
für kritische <strong>Distanz</strong> angesehen werden. Dies war aufgr<strong>und</strong> der zeitlichen Bedingungen<br />
<strong>und</strong> der Kenntnisse kommunikationswissenschaftlicher empirischer Forschungsarbeit des<br />
Verfassers nicht <strong>im</strong>mer max<strong>im</strong>al zufriedenstellend durchführbar. Jede Hypothese stellt den<br />
Forscher methodisch vor spezielle Herausforderungen. Der Hypothesenkatalog wurde daraufhin<br />
allerdings bewusst nicht reduziert, da sich bisherige Forschungen lediglich fragmentarisch<br />
mit einigen bezüglich (mangelnder) kritischer <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> relevanter<br />
Elemente <strong>–</strong> wie z.B. der Anzahl der benutzen Quellen <strong>–</strong> beschäftigt haben <strong>und</strong> die vorliegende<br />
Arbeit auch das Ziel hat, sich dem Begriff der kritischen <strong>Distanz</strong> möglichst in komplexer<br />
Form wissenschaftlich zu widmen. Damit sollen auch Anregungen für weitere Forschungen<br />
gegeben werden. Dem umfangreichen Hypothesenkatalog <strong>und</strong> der Überprüfung der meisten<br />
Hypothesen mit vier Urheber-Vergleichen unter jeweils mehreren Filterbedingungen ist u.a.<br />
der für eine Diplomarbeit vergleichsweise große Umfang der Arbeit geschuldet.<br />
Eine Herausforderung war es, regionale Publizistische Einheiten zu finden, die keine Redakteure<br />
bei Spielen der Fußball-WM 2006 akkreditiert hatten. Obwohl z.B. mittels der verkauften<br />
Auflage <strong>und</strong> der Konkurrenzsituation versucht wurde, für die Stichproben der Variablen<br />
Zeitungsschicht Regionalzeitungen zu finden, die sich jeweils miteinander vergleichen lassen,<br />
erscheint die Vergleichbarkeit der einzelnen Zeitungen <strong>im</strong> Rückblick nicht max<strong>im</strong>al zufriedenstellend<br />
gewährleistet. So ist es z.B. ungünstig, dass bei den einzelnen acht Regionalzeitungen<br />
ein großes Ungleichgewicht bezüglich einiger Ausprägungen herrscht, wie<br />
bspw. der unterschiedlich häufige Einsatz von kurzen Meldungen zeigt. Obwohl SVZ <strong>und</strong> LR<br />
z.B. relativ ähnliche Auflagenzahlen haben, unterscheiden sie sich hinsichtlich der generellen<br />
Ausrichtung ihrer (Sport-)Berichterstattung. Während die SVZ u.a. aufgr<strong>und</strong> der Art <strong>und</strong> Weise<br />
der Verwendung der Bilder, „bunter<strong>“</strong> Themen <strong>und</strong> der Formulierung der Überschriften<br />
tendenziell einen boulevardesken Eindruck vermittelt, konzentriert sich die Berichterstattung<br />
der LR auf die Vermittlung vieler unterschiedlicher Informationen, was sich z.B. an der Verwendung<br />
der meisten Kurzmeldungen aller untersuchten Zeitungen zeigt. Im Nachhinein<br />
wäre eine noch sorgfältigere, unterschiedliche Faktoren berücksichtigende Auswahl der Untersuchungsobjekte<br />
wünschenswert, was eine bessere Vergleichbarkeit der Zeitungsschichten<br />
garantieren würde. Die Auswahlmöglichkeit war allerdings seht eingeschränkt, da bei den<br />
beiden betreffenden WM-Spielen nur 13 regionale Publizistische Einheiten nicht akkreditiert<br />
waren. Die zuvor erwähnten Probleme deuten an, dass durchaus gewisse Unterschiede in<br />
der überregionalen Sportberichterstattung der Regionalzeitungen existieren.<br />
Bei einigen Berechnungen ist die Anzahl der codierten Fälle zu gering. Dies trifft z.B. auf den<br />
Vergleich der Stichproben der Redakteure der Regionalzeitungen zu <strong>–</strong> besonders wenn zusätzlich<br />
eine oder sogar mehrere Schichtenvariablen eingesetzt werden. Auch bei den Vergleichen<br />
der Artikel-Umfänge <strong>und</strong> der Anzahl wertender Aussagen der meinungsbetonten<br />
Texte existieren mit 80 Fällen relativ wenige Codierungen. Auf die Darstellung <strong>und</strong> Diskussion<br />
einiger Ergebnisse wird aus diesen Gründen verzichtet oder es wird z.B. zumindest neben<br />
dem Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests das Ergebnis des exakten Tests nach Fisher angegeben<br />
<strong>und</strong> auf die geringe zugr<strong>und</strong>e liegende Fallzahl hingewiesen.<br />
Rückblickend ist die Aufteilung der Variablen Darstellungsform nicht opt<strong>im</strong>al gelungen <strong>–</strong> besonders<br />
was die Ausprägung subjektivierend-argumentierend betrifft. Als meinungsbetonte<br />
Texte werden in der Studie Kommentare, Glossen, Tagebücher, Kolumnen o.ä. verstanden.<br />
Das führt dazu, dass unter dieser Ausprägung auch Texte codiert werden, die weniger meinungsbetont<br />
oder argumentierend sind, sondern vielmehr die Funktion haben, dem Leser<br />
das Gefühl zu vermitteln, dass der Redakteur der „eigenen<strong>“</strong> Zeitung insofern privilegiert ist,<br />
169
dass er bei der WM <strong>im</strong> Stadion anwesend ist. Solche Texte beschreiben z.B. Situationen der<br />
eigenen journalistischen Arbeit, sind mitunter vergleichsweise kurz <strong>und</strong> transportieren wenig<br />
Meinung des jeweiligen Urhebers, was sich an den Ergebnissen der achten Hypothese zeigt.<br />
Rückblickend erscheint eine feingliedrigere Erfassung der subjektiven Texte sinnvoller, wie<br />
z.B. nach Kommentaren, Glossen oder Artikeln, die Tagebuch-Einträgen ähneln. Zudem ist<br />
in der Gr<strong>und</strong>gesamtheit lediglich ein Kommentar enthalten, der von Agentur-Journalisten<br />
stammt, was die Interpretation best<strong>im</strong>mter Ergebnisse relativiert. Die oben beschriebenen<br />
Umstände müssen auch bei der Interpretation der Ergebnisse der ersten Hypothese berücksichtigt<br />
werden. Zudem sollte bei der Deutung der Ergebnisse der zweiten Hypothese beachtet<br />
werden, dass laut Codieranweisung bei der Variablen Anlass die Ausprägung Kein äußerer<br />
Anlass verschlüsselt werden sollte, sofern ein Text als subjektivierend-argumentierend<br />
eingestuft wird. Künftige Untersuchungen könnten sich speziell mit der Kommentierung <strong>im</strong><br />
<strong>Sportjournalismus</strong> der Printmedien beschäftigen<br />
Bei der Codierung der Ausprägung „3<strong>“</strong> (Interpretation) der Variablen Tiefe der Argumentation<br />
bestanden Schwierigkeiten <strong>–</strong> weil die Definition nicht präzise genug formuliert worden war,<br />
das Verständnis des Codierers nicht ausreichend war <strong>und</strong>/oder generell diese Art von Kategorien<br />
schwer zu codieren ist. Meinungsbetonte Texte durften nicht automatisch mit der Tiefe-Ausprägung<br />
„3<strong>“</strong> codiert werden <strong>–</strong> gerade mit Blick auf die erwähnten „WM-Tagebücher<strong>“</strong><br />
der Redakteure. Die Konsequenz war, dass <strong>im</strong> Zweifel die Ausprägung „3<strong>“</strong> in der Codierpraxis<br />
nicht verschlüsselt wurde. Die Berechnungen wurden deshalb alternativ, ohne Tiefe-<br />
Ausprägung „3<strong>“</strong> zu berücksichtigen, durchgeführt, womit die Variable quasi <strong>dich</strong>otom ist.<br />
Bei der Untersuchung der Herkunft <strong>und</strong> Anzahl der benutzten Quellen können z.B. keine<br />
Aussagen darüber getroffen werden, woher diese Quellen stammen. Ob bspw. Statements<br />
von Sportlern aus Fifa-Pressemitteilungen oder <strong>im</strong> Fall von Regionalzeitungsredakteuren aus<br />
Texten von Presseagenturen abgeschrieben wurden <strong>und</strong> anschließend in den jeweiligen<br />
Text eingefügt wurden, kann mit dem Instrument der vorliegenden Studie nicht thematisiert<br />
werden. 198 Folgende Forschungen zur kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong> der Presse<br />
könnten sich mit dieser Frage beschäftigen.<br />
Abhängigkeiten der Variablen Hauptthema <strong>und</strong> Nebenthema zum Status Akkreditierung oder<br />
Nicht-Akkreditierung <strong>–</strong> auch hinsichtlich der diesbezüglichen Ausrichtung wertender Aussagen<br />
<strong>–</strong> konnten <strong>im</strong> Rahmen aus forschungsökonomischen Gründen nicht geprüft werden <strong>und</strong><br />
wurden lediglich deskriptiv univariat beschrieben. Die Untersuchung von Zusammenhängen<br />
zwischen Akkreditierung <strong>und</strong> der Beschäftigung mit verschiedenen Themen wäre dennoch<br />
interessant <strong>und</strong> könnte bei weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden.<br />
Ungünstig bezüglich der Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist, dass die achte <strong>und</strong> neunte<br />
Hypothese nicht mittels der vier bei den restlichen Hypothesen durchgeführten Vergleiche<br />
überprüft werden konnten. Dies war nicht möglich, da <strong>im</strong> Unterschied zu den Prüfungen der<br />
übrigen Hypothesen zusätzlich Experten <strong>und</strong> Gastautoren als Urheber meinungsbetonter<br />
Texte berücksichtigt werden mussten <strong>und</strong> Presseagenturen als Urheber wertender Aussagen<br />
aufgr<strong>und</strong> zu geringer Fallzahlen in der vorliegenden Studie vernachlässigt wurden.<br />
Nach Durchsicht der Literatur sind Attributionen, die den Trainer benennen, als Ursache-<br />
Ausprägung external-stabil zu codieren (vgl. BIERHOFF-ALFERMANN 1986, 172). Der Trainer<br />
gehört nicht zu den Aktiven, hat aber erheblichen Einfluss auf das aktive Sportgeschehen.<br />
Er ist ein Quasi-Aktiver. Das Ursachenelement Trainer kann unterschiedlich eingeordnet<br />
werden. FRIEDRICH zeigt z.B., dass bei Erklärungen von Niederlagen der „eigenen<strong>“</strong><br />
Mannschaft die Tendenz besteht, „den Trainer von der Mannschaft weg[zu]rück[en], ihn als<br />
stabile Größe nicht mehr [zu] akzeptier[en] <strong>und</strong> ihn als quasi-variabel <strong>und</strong> external [zu] lokalisier[en]<strong>“</strong><br />
(FRIEDRICH 1997, 138). Obwohl Attributionen, die als external-stabil codiert wur-<br />
198 Vgl. Kapitel 5.3 zur Aussagekraft der Ergebnisse der vorliegenden Inhaltsanalyse.<br />
170
den, daraufhin überprüft wurden, ob sie sich auf den Trainer beziehen oder nicht, konnte in<br />
der vorliegenden Arbeit auf eine solche mögliche Kategorienverschiebung aus forschungsökonomischen<br />
Zwängen nicht näher eingegangen werden, wie es in Untersuchungen möglich<br />
wäre, die sich nur mit einem speziellen Aspekt beschäftigen. 199 Dies trifft auch auf die<br />
Untersuchung der Urheberschaft der einzelnen Ursachenzuschreibungen zu.<br />
8.2 Zusammenfassung der Ergebnisse <strong>und</strong> Schlussfolgerungen<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>im</strong> Vergleich zur Berichterstattung ihrer nicht akkreditierten Kollegen insofern unkritischer<br />
<strong>und</strong> distanzloser ist, indem signifikant<br />
• seltener meinungsbetonte Texte verwendet werden,<br />
• seltener eigene Themensetzung stattfindet,<br />
• seltener argumentativ in die Tiefe gegangen wird,<br />
• was die fünf wichtigsten Handlungsträger <strong>und</strong> den wichtigsten Handlungsträger betrifft<br />
häufiger aktive Sportler, Trainer <strong>und</strong> sonstige Handlungsträger aus der Sportwelt<br />
sowie seltener sportexterne Handlungsträger benutzt werden,<br />
• was die fünf wichtigsten Quellen <strong>und</strong> die wichtigste Quelle betrifft häufiger aktive<br />
Sportler <strong>und</strong> Trainer sowie seltener sportexterne Personen benutzt werden,<br />
• bei für das „eigene<strong>“</strong> Team negativen Ereignissen tendenziell quasi selbstwertschützender<br />
attribuiert wird.<br />
Die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure ist <strong>im</strong> Vergleich zur Berichterstattung<br />
nicht akkreditierter Redakteure der Regionalzeitungen nicht unkritischer <strong>und</strong><br />
distanzloser, indem keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Valenz des Geschehens<br />
belegt werden <strong>und</strong> nicht die aussagekräftigste Analysevariante zeigt, dass akkreditierte Redakteure<br />
signifikant weniger Identifikationen verwenden. Zudem gebrauchen sie signifikant<br />
mehr Quellen, was isoliert betrachtet auf eine kritischere, distanziertere Berichterstattung<br />
hinweist.<br />
Die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure ist <strong>im</strong> Vergleich zur Berichterstattung,<br />
die sich auf Agentur-Material stützt, insofern bei den untersuchten acht Zeitungen<br />
unkritischer <strong>und</strong> distanzloser, indem signifikant<br />
• was die fünf wichtigsten Handlungsträger <strong>und</strong> den wichtigsten Handlungsträger betrifft<br />
häufiger aktive Sportler sowie seltener sonstige Handlungsträger aus der Sportwelt<br />
<strong>und</strong> sportexterne Personen benutzt werden,<br />
• was die fünf wichtigsten Quellen <strong>und</strong> die wichtigste Quelle betrifft häufiger aktive<br />
Sportler sowie seltener sonstige Quellen aus der Sportwelt <strong>und</strong> sportexterne Personen<br />
benutzt werden.<br />
Eine <strong>im</strong> Vergleich zu der in den untersuchten Zeitungen existierenden Agentur-<br />
Berichterstattung unkritischere, distanzlosere Beschäftigung mit der Fußball-WM wird ferner<br />
bezüglich der signifikant selteneren Zuwendung zu Geschehnissen mit ambivalenter oder<br />
negativer Valenz <strong>und</strong> des signifikant häufigeren Gebrauchs der „Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<strong>“</strong><br />
festgestellt. Diese Ergebnisse haben aber keine hohe Aussagekraft, da als<br />
Filterbedingung vorausgesetzt wird, dass Meldungen nicht aussortiert oder meinungsbetonte<br />
Texte gelöscht werden müssen. Die Urheber-Ausprägungen akkreditierte Redakteure <strong>und</strong><br />
Agentur weisen allerdings sehr unterschiedliche Anteile an Meldungen <strong>und</strong> meinungsbetonten<br />
Texten auf. Sehr deutlich zeigt sich der Einfluss von Aufmachungs- <strong>und</strong> Darstellungsform-Ausprägungen<br />
auf die Ergebnisse wie oben erwähnt an der Hypothese 06.1. Eine vergleichsweise<br />
kritischere Berichterstattung wird durch den signifikant häufigeren Einsatz mei-<br />
199 70,3 % der insgesamt 101 external-stabilen Attributionen beziehen sich auf den Trainer, 29,7 % weisen keinen<br />
Trainer-Bezug auf.<br />
171
nungsbetonter Texte <strong>und</strong> eigener Themensetzung angezeigt, wobei ein Zusammenhang<br />
zwischen diesen Variablen besteht, da <strong>im</strong> Fall der Codierung subjektivierend-argumentierend<br />
laut Codieranweisung bei der Variablen Anlass die Ausprägung Kein äußerer Anlass verschlüsselt<br />
werden sollte. Außerdem gehen akkreditierte Regionalzeitungsredakteure bei der<br />
nicht sehr aussagekräftigen Analysevariante inklusive Meldungen häufiger als erwartet argumentativ<br />
in die Tiefe, was eine kritischere, distanziertere Berichterstattung anzeigt.<br />
Zum Vergleich der Berichterstattung der beiden Stichproben der Variablen Urheber relevant<br />
gelten fast dieselben Interpretationen wie zum oben beschriebenen Vergleich der Stichproben<br />
der Urheber-Ausprägungen akkreditierte Redakteure <strong>und</strong> Agentur <strong>–</strong> außer, dass die<br />
(bedingten) Signifikanzen hinsichtlich der Valenz des Geschehens <strong>und</strong> des Gebrauchs der<br />
Identifikationen bei dem Urheber-relevant-Vergleich nicht existieren <strong>und</strong> eine bedingte Signifikanz<br />
unter einer anderen, aber auch nicht der nicht aussagekräftigsten Analysevariante<br />
bezüglich des Gebrauchs der Spitznamen vorliegt.<br />
Die Ergebnisse der drei oben diskutierten Vergleiche zeigen, dass <strong>im</strong> Fall existierender signifikanter<br />
Unterschiede akkreditierte Redakteure unkritischer, distanzloser berichten als nicht<br />
akkreditierte Redakteure der Regionalzeitungen. Dass akkreditierte Redakteure signifikant<br />
mehr Quellen benutzen, zeigt zwar eine umgekehrte Beziehung bezüglich kritischer <strong>Distanz</strong>.<br />
Diese wird allerdings dadurch relativiert, dass die Quellen signifikant häufiger aktive Sportler<br />
<strong>und</strong> seltener sportexterne Personen sind. Die bedingte Signifikanz der Hypothese 07.3 besitzt<br />
u.a. durch die Bezugnahme auf die nicht aussagekräftigste Analysevariante einen geringeren<br />
Stellenwert. Alle sechs signifikanten, unkritischere Berichterstattung anzeigenden<br />
Ergebnisse stützen sich dagegen jeweils auf die Berechnungsvariante, die aus den erwähnten<br />
Gründen für die jeweils aussagekräftigste gehalten wird.<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich der Berichterstattung der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure mit der<br />
Berichterstattung der Urheber-Ausprägung Agentur oder nicht akkreditierte Urheber relevant<br />
zeigt sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Akkreditierung <strong>und</strong> unkritischer,<br />
distanzloser Beschäftigung mit der Fußball-WM. Die signifikanten Unterschiede die Herkunft<br />
der verwendeten Handlungsträger <strong>und</strong> Quellen betreffend belegen, dass akkreditierte Regionalzeitungsredakteure<br />
diesbezüglich distanzloser berichten. Die signifikanten Unterschiede,<br />
die den Gebrauch meinungsbetonter Darstellungsformen <strong>und</strong> das Setzen eigener Themen<br />
betreffen, zeigen die gegenläufige Richtung eines Zusammenhangs an. Alle weiteren signifikanten<br />
Unterschiede beziehen sich nicht auf die jeweils aussagekräftigsten Berechnungen.<br />
Zeitungsredakteure überlassen <strong>im</strong> Fall der Akkreditierung die hintergründigere, kommentierende<br />
Berichterstattung ihren in den Redaktionen verbliebenen Kollegen <strong>und</strong> widmen sich<br />
dafür stärker dem reinen Sportgeschehen, was die signifikant häufigere Verwendung aktiver<br />
Sportler als Handlungsträger <strong>und</strong> Quellen in den Texten anzeigt. Dies müsste aber nicht<br />
zwangsläufig so sein, denn Regionalzeitungsjournalisten könnten die Ak-kreditierung auch<br />
als Möglichkeit ansehen, Hintergr<strong>und</strong>informationen zu anderen Themen als sportlicher Leistung<br />
zu sammeln. Oder sie könnten vermehrt Wert auf die Kommentierung des sportlichen<br />
Geschehens legen. Sportexterne Quellen <strong>und</strong> Handlungsträger zu benutzen wird den nicht<br />
akkreditierten Kollegen oder den Urhebern der ausgewählten Sportberichterstattung der<br />
Presseagenturen überlassen. Subjektive, meinungsbetonte Texte zu verfassen, wird aus<br />
Sicht der Regionalzeitungen nicht an Presseagenturen abgetreten, wobei von akkreditierten<br />
Regionalzeitungsredakteuren besonders Texte mit Tagebuch-Charakter <strong>und</strong> folglich mit relativ<br />
wenig eigener Meinung oder argumentierenden, wertenden Aussagen abgefasst werden.<br />
Bei keiner formulierten Untersuchungshypothese können alle Ergebnisse der vier Urheber-<br />
Vergleiche in jeweils eine Richtung bezüglich kritischer <strong>Distanz</strong> interpretiert werden. Von den<br />
Hypothesen, zu denen vier verschiedene Urheber-Vergleiche berechnet wurden, zeigt lediglich<br />
die Teilhypothese zur verwendeten Anzahl von Quellen bei akkreditierten Regionalzeitungen<br />
eine unkritischere Berichterstattung an, wobei die Signifikanz anzeigende Berech-<br />
172
nungsvariante vom Verfasser nicht für die aussagekräftigste gehalten wird. Den Gebrauch<br />
meinungsbetonter Texte <strong>und</strong> das Setzen eigener Themen betreffend werden die Signifikanzen<br />
so interpretiert, dass be<strong>im</strong> Vergleich der Variablen Urheber nur Redakteure der Status<br />
akkreditiert mit unkritischerer Berichterstattung <strong>und</strong> bei den restlichen drei Urheber-<br />
Vergleichen mit kritischerer Berichterstattung verb<strong>und</strong>en ist. Hinsichtlich der Herkunft der<br />
Handlungsträger <strong>und</strong> Quellen werden bei den ersten drei Urheber-Vergleichen Signifikanzen<br />
ermittelt, die auf unkritischere Berichterstattung der jeweils akkreditierten Urheber schließen<br />
lassen, während be<strong>im</strong> Vergleich der Stichproben der Variablen Zeitungsschicht eine Beziehung<br />
der umgekehrten Richtung angenommen werden kann. Mit Ausnahme des Vergleichs<br />
innerhalb der Variablen Zeitungsschicht bezüglich des Gebrauchs von Spitznamen bei den<br />
„Sprachvariablen der <strong>Distanz</strong>losigkeit<strong>“</strong> existieren keine uneingeschränkten signifikanten Unterschiede.<br />
Bei der Überprüfung der achten <strong>und</strong> neunten Hypothese zur Verlagerung des Meinungstransports<br />
auf Experten <strong>und</strong> der Dominanz positiver Wertungen wird deutlich, dass die akkreditierten<br />
Zeitungen unkritischer berichten. 200 Bei den akkreditierten Zeitungen sind meinungsbetonte<br />
Texte der Redakteure signifikant kürzer als die Beiträge der Gastautoren <strong>und</strong><br />
weisen signifikant weniger wertende Aussagen als die Artikel der Experten auf. Bei den nicht<br />
akkreditierten Regionalzeitungen sind die Texte der Experten <strong>im</strong> Vergleich zu den meinungsbetonten<br />
Artikeln der Redakteure auch länger <strong>und</strong> beinhalten mehr Wertungen <strong>–</strong> die Unterschiede<br />
sind aber nicht signifikant. Außerdem sind die Wertungen in meinungsbetonten Texten<br />
der Regionalzeitungsredakteure signifikant seltener positiv als die wertenden Aussagen<br />
in Beiträgen der Experten, wenn die Fälle der vier nicht akkreditierten Zeitungen zugr<strong>und</strong>e<br />
gelegt werden. Redakteure urteilen zwar auch in den vier akkreditierten Zeitungen etwas<br />
seltener positiv als Experten. Dieser ermittelte Unterschied ist <strong>im</strong> Vergleich zur Zeitungsschicht<br />
nicht akkreditiert allerdings geringer <strong>und</strong> nicht signifikant.<br />
In den Fällen, in denen bei der Hypothesenprüfung signifikante Unterschiede festgestellt<br />
werden, zeigen die Ergebnisse folgendes (vgl. Tab. 119):<br />
1. Die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure ist <strong>–</strong> mit der Ausnahme,<br />
dass mehr Quellen eingesetzt werden <strong>–</strong> unkritischerer, distanzloserer als die<br />
Berichterstattung nicht akkreditierter Redakteure der Regionalzeitungen.<br />
2. Die <strong>im</strong> Vergleich zu nicht akkreditierten Redakteuren unkritischere Berichterstattung<br />
akkreditierter Regionalzeitungsredakteure ist aufgr<strong>und</strong> ambivalent auslegbarer <strong>und</strong><br />
nicht uneingeschränkt gültiger Ergebnisse der Hypothesenprüfung nicht gleichzeitig<br />
auch zweifelsfrei unkritischer <strong>und</strong> distanzloser als die Berichterstattung der verwendeten<br />
Agentur-Beiträge <strong>und</strong> der sonstigen nicht akkreditierten Urheber relevant in<br />
den untersuchten Zeitungen.<br />
3. Trotz der <strong>im</strong> Vergleich zu nicht akkreditierten Redakteuren der Regionalzeitungen unkritischeren<br />
Berichterstattung der akkreditierten Regionalzeitungsredakteure folgt bei<br />
keiner Hypothese daraus eine unkritischere Berichterstattung der akkreditierten Zeitungsschicht.<br />
Die Vermutung der formulierten Anschlusshypothese, dass bezüglich<br />
kritischer <strong>Distanz</strong> zwischen Regionalzeitungen, die ihre Berichterstattung teilweise<br />
auf eigene akkreditierte Journalisten stützen <strong>und</strong> Regionalzeitungen mit Texten ausschließlich<br />
(eigener) nicht akkreditierter Journalisten ein signifikanter Unterschied besteht,<br />
kann nicht eindeutig verifiziert werden. Eine unkritischere, distanzlosere Berichterstattung<br />
akkreditierter Urheber wird be<strong>im</strong> Vergleich der Variablen Zeitungsschicht<br />
bei vier von neun Signifikanzen (44,4 Prozent) ermittelt <strong>–</strong> <strong>und</strong> damit am seltensten<br />
von den vier durchgeführten vier Urheber-Vergleichen.<br />
200 Die Prüfung der Signifikanz bei der achten <strong>und</strong> neunten Hypothese unterscheidet sich methodisch von den<br />
übrigen Hypothesen.<br />
173
8.3 Fazit <strong>und</strong> Ausblick<br />
Die Berichterstattung akkreditierter Regionalzeitungsredakteure ist unkritischer <strong>und</strong> distanzloser<br />
als die Berichterstattung nicht akkreditierter Regionalzeitungsredakteure. 201 Allerdings<br />
kann nicht eindeutig verifiziert werden, dass Regionalzeitungen, die ihre Berichterstattung<br />
teilweise auf eigene akkreditierte Journalisten stützen, unkritischer <strong>und</strong> distanzloser berichten<br />
als Regionalzeitungen, die keine eigenen Redakteure akkreditiert haben. Gründe dafür<br />
sind,<br />
• dass erstens akkreditierte Regionalzeitungsredakteure nicht eindeutig unkritischer<br />
<strong>und</strong> distanzloser berichten als z.B. Agentur-Journalisten, sofern das aus der von den<br />
Zeitungen verwendeten Agentur-Berichterstattung geschlossen werden kann, <strong>und</strong><br />
• dass zweitens zwischen den untersuchten acht Zeitungen z.B. bezüglich ihrer generellen<br />
Ausrichtung, speziellen Charakteristika <strong>und</strong> Ziele der (Sport-)Berichterstattung<br />
(<strong>stark</strong>e) Unterschiede bestehen. 202<br />
Zusätzlich zeigt die Untersuchung: Die Kommentierung akkreditierter Zeitungen ist unkritischer<br />
als die Kommentierung nicht akkreditierter Zeitungen, da bei der akkreditierten Gruppe<br />
jeweils <strong>im</strong> Gegensatz zur nicht akkreditierten Vergleichsgruppe<br />
• erstens Experten-Beiträge <strong>im</strong> Vergleich zu meinungsbetonten Texten der Regionalzeitungsredakteure<br />
signifikant größere Textumfänge <strong>und</strong> eine größere Anzahl wertender<br />
Aussagen aufweisen <strong>und</strong><br />
• zweitens keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Dominanz positiver Wertungen<br />
zwischen den meinungsbetonten Texten der Regionalzeitungredakteure <strong>und</strong> der<br />
Experten bestehen.<br />
Das sind die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit.<br />
Diese Ergebnisse lassen nach Meinung des Verfassers die plausible Hypothese zu, dass die<br />
Akkreditierung zu Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2006 dazu<br />
geführt hat, dass Sportredakteure kleiner regionaler deutscher Tageszeitungen unkritischere,<br />
distanzlosere Texte verfasst haben, als das der Fall ohne Akkreditierung gewesen wäre. Dabei<br />
darf nicht vergessen werden, dass die Aussagekraft dieser inhaltsanalytisch f<strong>und</strong>ierten<br />
Inferenz begrenzt ist (vgl. FRÜH 2007, 44). 203 Es wurde allerdings zumindest angestrebt, „ein<br />
Netz mehr oder weniger eindeutiger Anhaltspunkte<strong>“</strong> in den untersuchten Texten zu ziehen,<br />
das „ein relativ hohes Plausibilitätsniveau für den Schluss von inhaltsanalytischen Daten<strong>“</strong> auf<br />
Eigenschaften des Kommunikators zulässt (FRÜH 2007, 47). Zudem wäre es wünschenswert,<br />
wenn dieses „gezogene Netz<strong>“</strong> als Anregung für weitere Forschungen verstanden werden<br />
würde, die sich mit dem Vorwurf der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
beschäftigen, <strong>und</strong> Bausteine der vorliegenden Untersuchung verwendet <strong>und</strong> weiterentwickelt<br />
werden würden. Nur so kann die Lücke weiter verringert werden, die zwischen den<br />
zahlreichen Vorwürfen gegenüber dem <strong>Sportjournalismus</strong> speziell bezüglich mangelnder<br />
kritischer <strong>Distanz</strong> einerseits <strong>und</strong> der wissenschaftlichen Überprüfung der Vorhaltungen andererseits<br />
existiert.<br />
Sinnvoll wären weitere Datenerhebungen, um die Beweiskraft der inhaltsanalytischen Bef<strong>und</strong>e<br />
zu erhöhen. Interessant wäre es, z.B. Gespräche der Sportjournalisten mit Aktiven <strong>und</strong><br />
201 Unter den oben erwähnten einschränkenden Bedingungen <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der ermittelten Indikatoren, die der<br />
Verfasser als geeignet betrachtet, kritische <strong>Distanz</strong> annäherungsweise messen zu können.<br />
202 Vgl. dazu die deskriptiven Ergebnisse, die in Kapitel 6.1 teilweise für die einzelnen acht Zeitungen dargestellt<br />
werden. Bei der SVZ sind z.B. redaktionsinterne Anlässe bei der Analyse exklusive Meldungen der häufigste<br />
Anlass zur Berichterstattung (35,7 Prozent). Dagegen beruhen bei der LKZ 4,2 Prozent der Texte auf eigener<br />
Themensetzung. Vgl. auch die deskriptiven Ergebnisse, die <strong>im</strong> Anhang zu finden sind.<br />
203 FRÜH gibt einen Überblick darüber, warum sich mit Hilfe der Inhaltsanalyse allein „<strong>im</strong> strikten Sinne […] [keine]<br />
Absichten von Kommunikatoren nachweisen<strong>“</strong> lassen (FRÜH 2007, 44ff.).<br />
174
weiteren Personen in den sog. Mixed-Zonen mit der Methode der Beobachtung zu untersuchen,<br />
da bezüglich der Erforschung kritischer <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> (Sport-)Journalismus nicht nur die<br />
Texte als Endprodukte, sondern auch die Entstehungssituationen relevant sind. Nach Kenntnisstand<br />
des Verfassers existieren für den <strong>Sportjournalismus</strong> der Printmedien solche Untersuchungen<br />
noch nicht.<br />
Obwohl die Hypothese, dass Regionalzeitungen, die ihre Berichterstattung teilweise auf eigene<br />
akkreditierte Journalisten stützen, unkritischer <strong>und</strong> distanzloser berichten als Regionalzeitungen<br />
ohne eigene akkreditierte Redakteure, durch die Ergebnisse der vorliegenden<br />
Studie nicht eindeutig verifiziert werden kann, wäre es verfehlt, daraus automatisch zu<br />
schlussfolgern, dass die WM-Berichterstattung der untersuchten Regionalzeitungen insgesamt<br />
kritisch <strong>und</strong> distanziert ist. Was den quantitativen Gebrauch von Quellen oder Spitznamen<br />
betrifft, wurden bspw. in der vorliegenden Arbeit bei den Urheber-Vergleichen zwar keine<br />
uneingeschränkt gültigen signifikanten Unterschiede nachgewiesen, die auf unkritischere,<br />
distanzlosere Berichterstattung akkreditierter Urheber hinweisen würden. 204 23,7 % aller 782<br />
untersuchten Beiträge kommen aber laut Ergebnis dieser Studie ohne jegliche Quelle aus.<br />
37,5 % beziehen sich auf eine einzige Quelle. Damit werden in 61,2 % der Texte weniger als<br />
zwei Quellen angegeben. 205 Und wie oben erwähnt können keine Aussagen über die Qualität<br />
oder den Modus der Beschaffung der Quellen aufgr<strong>und</strong> des vorliegenden Instruments getroffen<br />
werden. Die Berechnung ohne Meldungen ergibt einen Mittelwert von 1,04 für die Anzahl<br />
der identifizierten Spitznamen pro Artikel. Im Schnitt wurde folglich in jedem Text, der länger<br />
als 600 Zeichen ist, mindestens ein Spitzname identifiziert. 206 Lobeshymnen hinsichtlich der<br />
Qualität <strong>und</strong> der kritischen <strong>Distanz</strong> der Sportberichterstattung in regionalen Printmedien nach<br />
Art des Sportreporters Rolf Töpperwien (<strong>„Ich</strong> <strong>fand</strong> <strong>dich</strong> <strong>stark</strong>!<strong>“</strong>) sind bei solchen Ergebnissen<br />
nicht angebracht <strong>–</strong> genauso wenig wie das in Interviews mit Sportlern passend ist. 207<br />
Die Ergebnisse dieser angeführten Kategorien ohne signifikante Unterschiede zeigen u.a.:<br />
Nützlich wären bezüglich des Vorwurfs der mangelnden kritischen <strong>Distanz</strong> <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong><br />
wissenschaftliche Gegenüberstellungen der Sportberichterstattung mit vergleichbarerer<br />
Berichterstattung anderer Ressorts. Solche Untersuchungen sollten aber berücksichtigen,<br />
dass rückblickend gerade die Nutzung der unterhaltenden Elemente des Sports als eine entscheidende<br />
Ursache für den endgültigen Durchbruch der Sportberichterstattung angesehen<br />
werden kann <strong>und</strong> dass dem Sport die Unterhaltungsfunktion bzw. der Unterhaltungswert als<br />
inhärent gilt. Durch Studien, die die Berichterstattung des Sportressorts mit anderen journalistischen<br />
Arbeitsbereichen hinsichtlich kritischer <strong>Distanz</strong> vergleichen, könnte möglicherweise<br />
die Frage beantwortet werden, ob sich die Sportberichterstattung <strong>im</strong> Vergleich zur Berichterstattung<br />
anderer Ressorts auf einem signifikant schlechteren Niveau bewegt, was die kritische<br />
<strong>Distanz</strong> betrifft. Sollte dies der Fall sein, müssten z.B. die Ergebnisse von Untersuchungen<br />
wie der vorliegenden negativer interpretiert werden. Denn trotz aller einschränkender<br />
Bemerkungen gilt der Satz von Siegried WEISCHENBERG, was das journalistische<br />
Selbstverständnis <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Anforderungen <strong>und</strong> Ansprüche betrifft: „Der<br />
<strong>Sportjournalismus</strong> ist keine Insel des Journalismus.<strong>“</strong> (WEISCHENBERG 1994, 450).<br />
204 Dies gilt analog für die Ergebnisse einiger weiterer Variablen. So wird aufgr<strong>und</strong> der codierten Ursachenzuschreibungen<br />
eine absolut „sportlerfre<strong>und</strong>liche<strong>“</strong> Attribuierung festgestellt. Es existieren diesbezüglich lediglich<br />
keine signifikanten Unterschiede zwischen den betreffenden Urheber-Stichproben. Vgl. Kapitel 6.2.10. Auch die<br />
Verteilung der Themen, die nicht auf Signifikanzen geprüft wurde, zeigt bedenklich st<strong>im</strong>mende Ergebnisse: Die<br />
vier Ausprägungen Lokalkolorit, Ästhetik, Leistung <strong>und</strong> Organisation kommen z.B. bei der Variablen Hauptthema<br />
auf 73,3 % <strong>und</strong> bei der Berechnung exklusive Meldungen auf 79,6 % der codierten Themen. Vgl. Kapitel 6.1.1.<br />
205 Vgl. Kapitel 2.2.2.8 der vorliegenden Arbeit.<br />
206 Be<strong>im</strong> Codieren wurde deutlich, dass einige (ehemalige) Sportler in den Medien so konsequent mit Spitznamen<br />
behandelt werden, dass der Gebrauch des gemäß Geburtsurk<strong>und</strong>e korrekten Namens (Rudolf Völler, Gerhard<br />
Müller, Hans-Hubert Vogts, Ulrich Hoeneß) auffälliger ist als die Nennung mit der verkleinernden Form des Vornamens,<br />
wobei es damit <strong>im</strong> Fall der meisten genannten Personen nicht belassen wird. Sie werden zusätzlich mit<br />
weiteren Spitznamen beschrieben („Tante Käthe<strong>“</strong>, „Bomber der Nation<strong>“</strong>, „Terrier<strong>“</strong>).<br />
207 Töpperwien begann ein Interview mit dem Fußballer Mario Basler vom 1. FC Kaiserslautern mit dem Lob <strong>„Ich</strong><br />
<strong>fand</strong> <strong>dich</strong> <strong>stark</strong>!<strong>“</strong> Worauf Basler, der nicht zurückduzte, entgegnete: „Da sind Sie aber der Einzige.<strong>“</strong> (BACHNER<br />
2001, 23).<br />
175
9. VERZEICHNISSE UND ERKLÄRUNGEN<br />
9.1 Abkürzungsverzeichnis<br />
Abb. Abbildung<br />
Abs. Absatz<br />
AE Analyseeinheit<br />
AFP Agence France-Presse<br />
ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen R<strong>und</strong>funkanstalten der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland<br />
ARG Argentinien<br />
Art. Artikel<br />
Attr. Attribution<br />
AV audiovisuell<br />
Bd. Band<br />
BDZV B<strong>und</strong>esverband Deutscher Zeitungsverleger<br />
BMS Berliner Medienservice<br />
bspw. beispielsweise<br />
bzw. beziehungsweise<br />
ca. circa<br />
Co Compagnie<br />
D Deutschland<br />
d.h. das heißt<br />
d.V. der Verfasser<br />
DDP Deutscher Depeschendienst<br />
DDR Deutsche Demokratische Republik<br />
DDVG Deutsche Druck- <strong>und</strong> Verlagsgesellschaft mbH<br />
DF Darstellungsform<br />
DFB Deutscher Fußball-B<strong>und</strong><br />
dgl. dergleichen<br />
DJV Deutscher Journalisten-Verband<br />
DPA Deutsche Presse-Agentur<br />
DTM Deutsche Tourenwagen-Masters<br />
e.V. eingetragener Verein<br />
ebd. ebenda<br />
evtl. eventuell<br />
EZ Eßlinger Zeitung<br />
f. folgende (Seite)<br />
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
ff. folgende (Seiten)<br />
FFH Funk <strong>und</strong> Fernsehen Hessen<br />
Fifa Fédération Internationale de Football Association<br />
GfK Gesellschaft für Konsumforschung<br />
GG Gr<strong>und</strong>gesetz<br />
ggf. gegebenenfalls<br />
G+J Gruner + Jahr AG & <strong>und</strong> Co. KG<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
H Hypothese<br />
HA Hanauer Anzeiger<br />
176
Hg. Herausgeber<br />
HNA Hessisch Niedersächsische Allgemeine<br />
HT Handlungsträger<br />
ITA Italien<br />
IVW Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.<br />
Jg. Jahrgang<br />
KG Kommanditgesellschaft<br />
KPD Kommunistische Partei Deutschlands<br />
LHC Lausitzer Handballclub<br />
LKZ Ludwigsburger Kreiszeitung<br />
LPG Landespressegesetz<br />
LR Lausitzer R<strong>und</strong>schau<br />
Mrd. Milliarde<br />
MSSW Medien Service Südwest<br />
MT Mindener Tageblatt<br />
N Größe der Gr<strong>und</strong>gesamtheit<br />
NNN Norddeutsche Neueste Nachrichten<br />
Nr. Nummer<br />
NS nationalsozialistisch<br />
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei<br />
o.ä. oder ähnliches<br />
o.O. ohne Ort<br />
O.V. ohne Verfasserangabe<br />
OTZ Ostthüringer Zeitung<br />
OV Oldenburgische Volkszeitung<br />
p Irrtumswahrscheinlichkeit<br />
PE Publizistische Einheit<br />
PR Public Relations<br />
PZ Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung<br />
Q Quelle<br />
r Korrelationskoeffizient<br />
S. Seite<br />
SC Sportclub<br />
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands<br />
SID Sport-Informations-Dienst<br />
sog. so genannt<br />
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands<br />
SPE Sportpublizistische Einheit<br />
SPSS Statistical Package for Social Sciences<br />
SVZ Schweriner Volkszeitung<br />
Tab. Tabelle<br />
TV Television/Fernsehen<br />
177
u.a. <strong>und</strong> andere, unter anderem<br />
US United States<br />
usw. <strong>und</strong> so weiter<br />
V Variable<br />
VDS Verband deutscher Sportjournalisten<br />
VfB Verein für Bewegungsspiele<br />
vgl. vergleiche<br />
vs. versus<br />
WA Wertende Aussage<br />
WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung<br />
WDR Westdeutscher R<strong>und</strong>funk<br />
WM Weltmeisterschaft<br />
www world wide web<br />
z.B. zum Beispiel<br />
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen<br />
Mathematische Zeichen <strong>und</strong> Symbole<br />
= gleich<br />
˃ größer<br />
≥ größer oder gleich<br />
< kleiner<br />
≤ kleiner oder gleich<br />
§ Paragraph<br />
% Prozent<br />
∞ unendlich<br />
178
9.2 Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Durchschnittlicher Artikel-Umfang <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht..................................... 71<br />
Abb. 2: Aufmachung der Artikel........................................................................................... 71<br />
Abb. 3: Hauptthema der Artikel........................................................................................... 73<br />
Abb. 4: Anlass der Artikel.................................................................................................... 74<br />
Abb. 5: Valenz des Geschehens der Artikel........................................................................ 74<br />
Abb. 6: Argumentationstiefe der Artikel………………......................................................... 75<br />
Abb. 7: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Handlungsträger pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 75<br />
Abb. 8: Herkunft der fünf wichtigsten Handlungsträger....................................................... 76<br />
Abb. 9: Herkunft des wichtigsten Handlungsträgers............................................................77<br />
Abb. 10: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Quellen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 77<br />
Abb. 11: Herkunft der fünf wichtigsten Quellen..................................................................... 78<br />
Abb. 12: Herkunft der wichtigsten Quelle……………….........................................................79<br />
Abb. 13: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Vornamen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 80<br />
Abb. 14: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Spitznamen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 80<br />
Abb. 15: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Identifikationen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 81<br />
Abb. 16: Durchschnittliche Anzahl identifizierter wertender Aussagen<br />
pro meinungsbetonter Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht............................................ 81<br />
Abb. 17: Wertende Aussagen nach Gegenstand.................................................................. 82<br />
Abb. 18: Wertende Aussagen nach Bezug............................................................................82<br />
Abb. 19: Durchschnittliche Anzahl identifizierter Attributionen pro Artikel<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht........................................................................................... 83<br />
Abb. 20: Attribution nach Ursache......................................................................................... 84<br />
Abb. 21: Vorgehensweise bei der Prüfung der Hypothesen..................................................84<br />
Abb. 22: Darstellungsformen der Regionalzeitungsredakteure .......................................... 146<br />
Abb. 23: Darstellungsformen akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>und</strong> der Agenturen................................................................................................ 147<br />
Abb. 24: Darstellungsformen Urheber relevant................................................................... 147<br />
Abb. 25: Anlass der Berichterstattung der Regionalzeitungsredakteure............................. 149<br />
Abb. 26: Valenz des Geschehens akkreditierter Regionalzeitungsredakteure<br />
<strong>und</strong> der Agenturen................................................................................................ 151<br />
Abb. 27: Tiefe der Argumentation der Urheber relevant………………................................ 152<br />
Abb. 28: Herkunft Handlungsträger Gesamt (ohne „9<strong>“</strong>)<br />
der Regionalzeitungsredakteure (ohne Meldungen)………................................. 153<br />
Abb. 29: Herkunft Handlungsträger 1 (ohne „9<strong>“</strong>) der Zeitungsschichten<br />
(ohne Meldungen)................................................................................................. 155<br />
Abb. 30: Herkunft Quelle Gesamt (ohne „9<strong>“</strong>) der Urheber relevant (ohne Meldungen) ......157<br />
Abb. 31: Artikel-Umfang meinungsbetonter Texte <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht ... 162<br />
Abb. 32: Anzahl wertender Aussagen <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht ..................... 163<br />
Abb. 33: Bewertung Wertender Aussagen <strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht .............. 165<br />
Abb. 34: Bewertung Wertender Aussagen zu Deutschland<br />
<strong>–</strong> nach Urheber <strong>und</strong> Zeitungsschicht.................................................................... 165<br />
179
9.3 Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1: Identifikationsreliabilität der Analyseeinheiten........................................................ 67<br />
Tab. 2: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Artikel (formal)............................................ 67<br />
Tab. 3: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Artikel (inhaltlich)........................................ 68<br />
Tab. 4: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Wertende Aussage (inhaltlich)....................68<br />
Tab. 5: Codiererreliabilität der Analyseeinheit Attribution (inhaltlich).................................. 68<br />
Tab. 6: Codiererreliabilität Gesamt………………………………….…………………..……... 69<br />
Tab. 7: Codierte Artikel <strong>–</strong> nach Zeitung ……………………………..……………………….. 70<br />
Tab. 8: Urheber <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht..…………..………………………………………... 72<br />
Tab. 9: Meinungsbetonte Artikel <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht....………..……………….……… 81<br />
Tab. 10: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Darstellungsform..................................... 85<br />
Tab. 11: Chi-Quadrat-Test Urheber nur Redakteure × Darstellungsform............................. 86<br />
Tab. 12: Symmetrische Maße Urheber nur Redakteure × Darstellungsform........................ 86<br />
Tab. 13: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Darstellungsform (ohne „0<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>)........ 87<br />
Tab. 14: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Darstellungsform........................................... 87<br />
Tab. 15: Kreuztabelle Urheber relevant × Darstellungsform................................................. 89<br />
Tab. 16: Kreuztabelle Urheber relevant × Darstellungsform (ohne Meldungen)................... 89<br />
Tab. 17: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Darstellungsform................................................... 90<br />
Tab. 18: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Darstellungsform (ohne Meldungen)..................... 90<br />
Tab. 19: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Anlass..................................................... 91<br />
Tab. 20: Kreuztabelle Urheber ( „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Anlass.......................................................... 92<br />
Tab. 21: Kreuztabelle Urheber relevant × Anlass................................................................. 93<br />
Tab. 22: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Anlass................................................................... 93<br />
Tab. 23: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Valenz des Geschehens......................... 94<br />
Tab. 24: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Valenz des Geschehens (ohne „1<strong>“</strong>)........ 94<br />
Tab. 25: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Valenz des Geschehens……........................ 95<br />
Tab. 26: Kreuztabelle Urheber relevant × Valenz des Geschehens…….............................. 96<br />
Tab. 27: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Valenz des Geschehens……................................ 96<br />
Tab. 28: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Argumentationstiefe (ohne „3<strong>“</strong>)............... 97<br />
Tab. 29: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Argumentationstiefe….................................. 98<br />
Tab. 30: Kreuztabelle Urheber relevant × Argumentationstiefe…......................................... 98<br />
Tab. 31: Kreuztabelle Urheber relevant × Argumentationstiefe (ohne Meldungen).............. 99<br />
Tab. 32: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Argumentationstiefe…………………................... 100<br />
Tab. 33: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Handlungsträger Gesamt....... 100<br />
Tab. 34: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Handlungsträger Gesamt……...... 101<br />
Tab. 35: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Handlungsträger Gesamt……............ 102<br />
Tab. 36: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Handlungsträger Gesamt…….............. 103<br />
Tab. 37: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Handlungsträger 1.................. 103<br />
Tab. 38: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Handlungsträger........................... 104<br />
Tab. 39: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Handlungsträger 1.............................. 105<br />
Tab. 40: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Handlungsträger 1................................ 105<br />
Tab. 41: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure..... 106<br />
Tab. 42: Mediane Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure.. 106<br />
Tab. 43: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure………………….…………………..... 106<br />
Tab. 44: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)........... 107<br />
Tab. 45: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 107<br />
Tab. 46: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 107<br />
Tab. 47: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant................. 108<br />
Tab. 48: Mediane Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant.............. 108<br />
Tab. 49: Ränge Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 108<br />
180
Tab. 50: Mediane Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 108<br />
Tab. 51: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger (ohne Meldungen)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 108<br />
Tab. 52: Ränge Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht…................ 109<br />
Tab. 53: Mediane Anzahl Handlungsträger <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht................ 109<br />
Tab. 54: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Handlungsträger<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht.......................................................................109<br />
Tab. 55: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Quelle Gesamt….................... 110<br />
Tab. 56: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Quelle Gesamt............................. 111<br />
Tab. 57: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Quelle Gesamt…................................ 111<br />
Tab. 58: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Quelle Gesamt….................................. 112<br />
Tab. 59: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Herkunft Quelle 1.................................. 113<br />
Tab. 60: Kreuztabelle Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) × Herkunft Quelle 1........................................ 113<br />
Tab. 61: Kreuztabelle Urheber relevant × Herkunft Quelle 1.............................................. 114<br />
Tab. 62: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Herkunft Quelle 1................................................ 115<br />
Tab. 63: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure.................... 115<br />
Tab. 64: Mediane Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure................ 115<br />
Tab. 65: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure......................................................... 116<br />
Tab. 66: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 116<br />
Tab. 67: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant................................ 117<br />
Tab. 68: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 117<br />
Tab. 69: Ränge Anzahl Quellen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht..................................117<br />
Tab. 70: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Quellen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht.......................................................................117<br />
Tab. 71: Ränge Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure............... 118<br />
Tab. 72: Mediane Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure............ 118<br />
Tab. 73: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure......................................................... 118<br />
Tab. 74: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)……………..…………………................. 119<br />
Tab. 75: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 119<br />
Tab. 76: Ränge Anzahl Vornamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant............................120<br />
Tab. 77: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 120<br />
Tab. 78: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 120<br />
Tab. 79: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Vornamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht.......................................................................120<br />
Tab. 80: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure............. 121<br />
Tab. 81: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure……………..………………............... 121<br />
Tab. 82: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen (ohne DF „3<strong>“</strong>)<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 122<br />
Tab. 83: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant......................... 122<br />
Tab. 84: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber relevant..................................................................... 122<br />
Tab. 85: Ränge Anzahl Spitznamen <strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht........................... 123<br />
Tab. 86: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Spitznamen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht.......................................................................123<br />
Tab. 87: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber nur Redakteure......................................................... 123<br />
181
Tab. 88: Ränge Anzahl Identifikationen <strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>)..............124<br />
Tab. 89: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Urheber („2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>).............................................................. 124<br />
Tab. 90: Mann-Whitney-U-Test-Ergebnis Anzahl Identifikationen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht.......................................................................125<br />
Tab. 91: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (ohne „3<strong>“</strong>).................................................................................. 126<br />
Tab. 92: Duncan-Test-Ergebnis Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (ohne „3<strong>“</strong>).................................................................................. 126<br />
Tab. 93: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (aufgeteilt nach Zeitungsschicht).............................................. 126<br />
Tab. 94: Duncan-Test-Ergebnis Umfang meinungsbetonter Texte<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (nur Zeitungsschicht akkreditiert).............................................. 127<br />
Tab. 95: t-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussagen<br />
<strong>–</strong> Gruppenvariable Zeitungsschicht…………………..…………………………….... 127<br />
Tab. 96: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Anzahl Wertende Aussage<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber................................................................................................... 128<br />
Tab. 97: Duncan-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussagen <strong>–</strong> Faktor Urheber................ 128<br />
Tab. 98: Ergebnis einfacher Varianzanalyse Anzahl Wertende Aussage<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (aufgeteilt nach Zeitungsschicht).............................................. 128<br />
Tab. 99: Duncan-Test-Ergebnis Anzahl Wertende Aussage<br />
<strong>–</strong> Faktor Urheber (nur Zeitungsschicht akkreditiert).............................................. 129<br />
Tab. 100: Kreuztabelle Bezug WA x Bewertung WA............................................................ 129<br />
Tab. 101: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure × Bewertung WA...................................... 130<br />
Tab. 102: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA................................................................ 131<br />
Tab. 103: Chi-Quadrat-Test Urheber × Bewertung WA <strong>–</strong> nach Bezug WA.......................... 132<br />
Tab. 104: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA <strong>–</strong> nach Zeitungsschicht.......................... 132<br />
Tab. 105: Kreuztabelle Urheber × Bewertung WA<br />
<strong>–</strong> nach Zeitungsschicht <strong>und</strong> Bezug WA……………………………………………... 133<br />
Tab. 106: Kreuztabelle Zeitungsschicht × Bewertung WA…………………........................... 134<br />
Tab. 107: Kreuztabelle Zeitungsschicht (nur Urheber „1<strong>“</strong> <strong>und</strong> „2<strong>“</strong>) × Bewertung WA<br />
<strong>–</strong> aufgeteilt nach Bezug WA.................................................................................. 134<br />
Tab. 108: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
(Urheber nur Redakteure)..................................................................................... 135<br />
Tab. 109: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution<br />
(Urheber nur Redakteure)..................................................................................... 135<br />
Tab. 110: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
(Urheber nur Redakteure) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution............................................. 136<br />
Tab. 111: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution<br />
(Urheber nur Redakteure) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution ………................................. 136<br />
Tab. 112: Chi-Quadrat-Test Zeitungsschicht x Ursache Attribution internal-external<br />
(Urheber nur Redakteure) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution <strong>und</strong> Valenz Attribution.........137<br />
Tab. 113: Kreuztabelle Urheber nur Redakteure x Ursache Attribution<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution („1<strong>“</strong>) <strong>und</strong> Valenz Attribution („2)……............................. 138<br />
Tab. 114: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution<br />
(nur Ausprägungen Urheber „2<strong>“</strong> <strong>und</strong> „3<strong>“</strong>) <strong>–</strong> nach Bezug Attribution...................... 139<br />
Tab. 115: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution (nur Urheber relevant)<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution....................................................................................... 141<br />
Tab. 116: Kreuztabelle Bezug Attribution x Ursache Attribution……….................................142<br />
Tab. 117: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution internal-external<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution………..….......................................................................143<br />
Tab. 118: Kreuztabelle Valenz Attribution x Ursache Attribution<br />
<strong>–</strong> nach Bezug Attribution…………….…................................................................ 144<br />
Tab. 119: Signifikanzen der Hypothesen<br />
<strong>–</strong> nach Urheber-Ausprägungen bzw. -Kategorien …………................................. 168<br />
182
9.4 Literaturverzeichnis<br />
ALLMER, Henning (1978): Ursachenerklärungen <strong>und</strong> Handlungszufriedenheit <strong>im</strong> Sport.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
ALTMEPPEN, Klaus-Dieter (2003): Ist der Journalismus strukturell qualitätsfähig? Der Stellenwert<br />
journalistischer Organisationen, journalistischer Produkte <strong>und</strong> journalistischer<br />
Medien für die Qualität. In: BUCHER, Hans-Jürgen/ALTMEPPEN, Klaus-Dieter [Hg.]:<br />
Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Gr<strong>und</strong>lagen <strong>–</strong> D<strong>im</strong>ensionen <strong>–</strong> Praxismodelle. Wiesbaden:<br />
Westdeutscher Verlag. S. 113 - 128.<br />
ARNOLD, Klaus (2004): Begründungszusammenhänge von Qualitätskriterien. Verfassungsdatum:<br />
8 Juni 2004. Unveröffentlichtes Seminarskript.<br />
ARNOWSKI, Christoph (2004): Laudatio anlässlich der Verleihung der Verschlossenen Auster<br />
von Netzwerk Recherche. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 3. November<br />
2006. .<br />
ASCHENBECK, Arndt (1998): Fußballfans <strong>im</strong> Abseits. Kassel: Agon.<br />
AUST, Michael (2006): Schluss mit mittendrin. In: Die Tageszeitung 28. Jg. 2006, Nr. 7878<br />
(23. Januar 2006), S. 18.<br />
BACHNER, Frank (2001): Fans mit Mikrofonen. In: Der Tagesspiegel 57. Jg. 2001, Nr. 17<br />
(8. April 2001), S. 23.<br />
BALTES-GÖTZ, Bernhard (2001) Statistische Datenanalyse mit SPSS 10 für Windows.<br />
Trier: Universitäts-Rechenzentrum der Universität Trier.<br />
BAMMÉ, Arno/KOTZMANN, Ernst/RESCHENBERG, Hasso [Hg.] (1993): Publizistische<br />
Qualität. Probleme <strong>und</strong> Perspektiven ihrer Bewertung. München/Wien: Profil.<br />
BAUER, Hans-Horst (2007): Persönliches Telefonat des Verfassers mit dem Sportchef der<br />
Ludwigsburger Kreiszeitung am 11. September 2007.<br />
BAUSINGER, Hermann (1983): Familie K. am Wochenende. Die K<strong>und</strong>schaft der Sportberichterstatter.<br />
In: DIGEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek: Rowohlt.<br />
S. 99-108.<br />
BDZV [Hg.] (2006): Die deutschen Zeitungen in Zahlen <strong>und</strong> Daten. Auszug aus dem Jahrbuch<br />
Zeitungen 2006. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 15. Juli 2007.<br />
.<br />
BECK, Oskar (1998): Spitz den Griffel, schlag <strong>dich</strong> durch! In: HACKFORTH, Josef/<br />
SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern<br />
sich. Berlin: Sportverlag. S. 166 - 176.<br />
BECKER, Peter (1983a): Ob FAZ oder Bild, Sport bleibt Sport. Zur Bedeutungskonsonanz<br />
der Sportberichterstattung. In: DIGEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek:<br />
Rowohlt. S. 74 - 95.<br />
BECKER, Peter (1983b): Sport in den Massenmedien. Zur Herstellung <strong>und</strong> Wirkung einer<br />
eigenen Welt. In: Sportwissenschaft 13. Jg. 1983, Heft 1, S. 24 - 45.<br />
183
BEHMER, Markus (2004): Gesinnung <strong>–</strong> Parteilichkeit <strong>–</strong> Überparteilichkeit. Zur Geschichte<br />
des Rollenwandels der Presse seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert. In: DUVE, Fre<strong>im</strong>ut/HALLER,<br />
Michael [Hg.]: Leitbild Unabhängigkeit. Zur Sicherung publizistischer Verantwortung.<br />
Konstanz: UVK. S. 31 - 52.<br />
BELZ, Christopher/HALLER, Michael/SELLHEIM, Armin (1999): Berufsbilder <strong>im</strong> Journalismus.<br />
Von den alten zu den neuen Medien. Konstanz: UVK.<br />
BERTZ, Thomas (2006): Folgenreicher Austritt. In: Message 8. Jg. 2006, Heft 2, S. 82 - 83.<br />
BETTE, Karl-Heinz (1999): Systemtheorie <strong>und</strong> Sport. Organisierte Komplexität als Bezugsproblem.<br />
Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
BIEBER, Christoph (2002): Prominenzierungsstrategien bei Politikern <strong>und</strong> Sportlern. In:<br />
SCHWIER, Jürgen/LEGGEWIE, Claus [Hg.]: Wettbewerbsspiele. Die Inszenierung von<br />
Sport <strong>und</strong> Politik in den Medien. Frankfurt am Main: Campus. S. 120 - 146.<br />
BIERHOFF-ALFERMANN, Dorothee (1986): Sportpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
BINNEWIES, Harald (1975): Sport <strong>und</strong> Sportberichterstattung. Ahrensburg: Czwalina.<br />
BINNEWIES, Harald (1981): Die Leitsätze der Sportpresse. In: Arbeitskreis Kirche <strong>und</strong> Sport<br />
Berlin [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Eine Dokumentation zweier Tagungen des Arbeitskreises<br />
Kirche <strong>und</strong> Sport Berlin. Ahrensburg: Czwalina. S. 36.<br />
BINNEWIES, Harald (1983a): Sportberichterstattung in den Tageszeitungen. In: DIGEL,<br />
Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek: Rowohlt. S. 114 - 122.<br />
BINNEWIES, Harald (1983b): Sportpublizistik. In: SCHULKE, Hans-Jürgen [Hg.]: Kritische<br />
Stichwörter zum Sport. München: UTB. S. 223 - 224.<br />
BINNEWIES, Harald (1988): <strong>Sportjournalismus</strong> <strong>–</strong> neue Strukturen, neue Funktionen. In:<br />
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang [Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung.<br />
Baden-Baden: Nomos. S. 57 - 65.<br />
BIZER, Peter (1988): Sportberichterstattung in den Printmedien. In: HOFFMANN-RIEM,<br />
Wolfgang [Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung. Baden-Baden:<br />
Nomos. S. 137 - 143.<br />
BLAKE, Mariah (2006): Soccer’s Dark Side. In: Columbia Journalism Review 45. Jg. 2006,<br />
Heft 3 (Web Spezial). Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 2. November 2006.<br />
.<br />
BLASBERG, Anita (2006): Auf seine Tour. In: Die Zeit 61. Jg. 2006, Nr. 44 (26. Oktober<br />
2006), S. 79 - 80.<br />
BLÖBAUM, Bernd (1999): Der Journalist als beteiligter Beobachter. In: Publizistik 44. Jg.<br />
1999, Heft 3, S. 334 - 336.<br />
BLÖDORN, Manfred (1974): Fußballprofis. Die Helden der Nation. Hamburg: Hoffmann <strong>und</strong><br />
Campe.<br />
BLÖDORN, Manfred (1988): Das Magische Dreieck. Sport <strong>–</strong> Fernsehen <strong>–</strong> Kommerz. In:<br />
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang [Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung.<br />
Baden-Baden: Nomos. S. 100 - 129.<br />
184
BLÖDORN, Sascha/GERHARDS, Maria (2004): Informationsverhalten der Deutschen. Ergebnisse<br />
einer Repräsentativbefragung. In: Media Perspektiven 35. Jg. 2004, Heft 1,<br />
S. 2 - 14.<br />
BREIDEBAND, Jochen (2007): Persönliche E-Mail des Sportredakteurs des Hanauer Anzeigers<br />
an den Verfasser. Datum: 19. September 2007. .<br />
BRINKMANN, Tomas (2000): Sport <strong>und</strong> Medien. Die Auflösung einer ursprünglichen Interessengemeinschaft?<br />
In: Media Perspektiven 31. Jg. 2000, Heft 11, S. 491 - 498.<br />
BRINKMANN, Tomas (2001): Sport <strong>und</strong> Medien. Die Auflösung einer ursprünglichen Interessensgemeinschaft?<br />
In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER, Walter/GERHARDS, Maria<br />
[Hg.]: Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-Baden: Nomos. S. 41 - 57.<br />
BROSIUS, Hans-Bernd/KOSCHEL, Friederike (2001): Methoden der empirischen Kommunikationsforschung.<br />
Eine Einführung. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
BROSIUS, Hans-Bernd/TULLIUS, Christiane (1993): Die Wirkung dramatisierender Formulierungen<br />
in der Sportberichterstattung. In: Sportpsychologie 7. Jg. 1993, Heft 3, S. 24 -<br />
30.<br />
BRÜCKNER, Rudolph (1998): Kollege Zufall stand Pate. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFF-<br />
RATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin:<br />
Sportverlag. S. 160 - 165.<br />
BUCHER, Hans-Jürgen (2003): Journalistische Qualität <strong>und</strong> Theorien des Journalismus. In:<br />
BUCHER, Hans-Jürgen/ALTMEPPEN, Klaus-Dieter [Hg.]: Qualität <strong>im</strong> Journalismus.<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>–</strong> D<strong>im</strong>ensionen <strong>–</strong> Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 11 -<br />
34.<br />
BÜHL, Ach<strong>im</strong> (2006): SPSS 14. Einführung in die moderne Datenanalyse. München [u.a.]:<br />
Pearson Studium.<br />
BÜRER, Barbara (1997): Zum Beispiel der <strong>Sportjournalismus</strong>. Barbara Bücher über die<br />
Reportage <strong>im</strong> Sportteil des Zürcher Tages-Anzeiger. In: HALLER, Michael [Hg.]: Die<br />
Reportage. Ein Handbuch für Journalisten. Konstanz: UVK. S. 216 - 227.<br />
BÜRNER, Julia (2006): Der große Skandal: Der deutsche <strong>Sportjournalismus</strong> <strong>und</strong> die Affäre<br />
Robert Hoyzer. Universität Leipzig: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
BURK, Verena/DIGEL, Helmut (2002): Die Entwicklung des Fernsehsports in Deutschland.<br />
In: SCHWIER, Jürgen [Hg.]: Mediensport. Ein einführendes Handbuch. Hohengehren:<br />
Schneider. S. 101 - 124.<br />
CRITCHER, Charles (1998): Der Fußballfan. In: HOPF, Wilhelm [Hg.]: Fußball. Soziologie<br />
<strong>und</strong> Sozialgeschichte einer populären Sportart. Münster: Lit. S. 150 - 161.<br />
CSOKLICH, Fritz (1996): Zeitungs-Journalismus. In: PÜRER, Heinz [Hg.]: Praktischer Journalismus<br />
in Zeitung, Radio <strong>und</strong> Fernsehen. Salzburg: Kuratorium für Journalistenausbildung.<br />
S. 3 - 6.<br />
DJV (2002): Charta Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Veröffentlichungsdatum: 2002 (genaues Datum<br />
unbekannt). Zugriff: 9. Juli 2007.<br />
.<br />
185
DJV (2006): Journalismus <strong>–</strong> mehr als ein Beruf. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff:<br />
22. April 2007. .<br />
DEUTSCHER PRESSERAT (2006a): Publizistische Gr<strong>und</strong>sätze (Pressekodex). Veröffentlichungsdatum:<br />
2. März 2006. Zugriff: 9. Juli 2007.<br />
<br />
DEUTSCHER PRESSERAT (2006b): Publizistische Gr<strong>und</strong>sätze (Pressekodex). Veröffentlichungsdatum:<br />
13. September 2006. Zugriff: 9. Juli 2007.<br />
.<br />
DIEKMANN; Andreas (2004): Empirische Sozialforschung. Gr<strong>und</strong>lagen, Methoden, Anwendungen.<br />
Reinbek: Rowohlt.<br />
DIGEL, Helmut (1981): Erwartungen an den Sportjournalisten. In: BINNEWIES, Harald [Hg.]:<br />
Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Ahrensburg: Czwalina. S. 47 - 51.<br />
DIGEL, Helmut (1983): Überblick. Der Prozess der Massenkommunikation <strong>im</strong> Sport. In: DI-<br />
GEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek: Rowohlt. S. 11 - 43.<br />
DIGEL, Helmut (1993): Probleme der Sportberichterstattung. Versuch einer konstruktivkritischen<br />
Betrachtung. In: KRÖGER, Christian [Hg.]: Zeitzeichen des Sports. Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
DIGEL, Helmut/BURK, Verena (2001): Sport <strong>und</strong> Medien. Entwicklungstendenzen <strong>und</strong> Probleme<br />
einer lukrativen Beziehung. In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER, Walter/GERHARDS,<br />
Maria [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-Baden: Nomos. S. 15 - 31.<br />
DONSBACH, Wolfgang (1990): Objektivitätsmaße in der Publizistikwissenschaft. In: Publizistik<br />
35. Jg. 1990, Heft 1, S. 18 - 29.<br />
DONSBACH, Wolfgang/BÜTTNER, Katrin (2005): Boulevardisierungs-Trend in deutschen<br />
Fernsehnachrichten. Codebuch. Veröffentlichungsdatum: 6. Januar 2005. Zugriff: 21.<br />
November 2007. .<br />
DORNER, Oskar (1990): Sportsprache <strong>und</strong> Sportberichterstattung. Analyse der Kärtner Tagesberichterstattung.<br />
Universität Graz: Dissertation. Zugriff: 4. November 2006.<br />
<br />
DOSTAL, Michael (2007): Pirmasenser Zeitung. Homepage der MSSW Print-Medien Service<br />
Südwest GmbH, Ludwigshafen. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 12. September<br />
2007. .<br />
DOVIFAT, Emil/WILKE, Jürgen (1976): Zeitungslehre. Band 1. Theoretische <strong>und</strong> rechtliche<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, Nachricht <strong>und</strong> Meinung, Sprache <strong>und</strong> Form. Berlin: de Gruyter.<br />
EICH, Patrick (2005): Dekaden unter der Lupe. Empirische Untersuchung zur Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Veränderung des Hauptsports <strong>im</strong> Südkurier von 1945 bis 2002. Universität Konstanz:<br />
Dissertation. Zugriff: 28. November 2007. .<br />
EICKELKAMP, Andreas (2005): Qualität von Ratgeberseiten in Zeitungen. Codebuch. Universität<br />
Leipzig. Veröffentlichungsdatum: 25. Juli 2005. Zugriff: 21. November 2007.<br />
.<br />
186
EISENBERG, Christiane (2004): Fußball als globales Phänomen. Historische Perspektiven.<br />
In: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. 54. Jg.<br />
2004, Nr. 26, S. 7 - 15.<br />
ELLERT, Guido (2006): Konzilianz von PR <strong>und</strong> Medien <strong>im</strong> Sport. Theoretische Annäherung<br />
<strong>und</strong> empirische Erkenntnisse. Technische Universität München: Dissertation. Zugriff: 28.<br />
November 2007. .<br />
EMIG, Jürgen (1987): Barrieren eines investigativen <strong>Sportjournalismus</strong>. Eine empirische Untersuchung<br />
zu Bedingungen <strong>und</strong> Selektionskriterien be<strong>im</strong> Informationstransport. Bochum:<br />
Brockmeyer.<br />
ERTL, Eric (1972): <strong>Sportjournalismus</strong>. Wie der Leistungssport auf seinen Begriff kommt. In:<br />
VINNAI, Gerhard [Hg.]: Sport in der Klassengesellschaft. Frankfurt am Main: Fischer. S.<br />
128 - 152.<br />
ERTL, Eric (1978): Funktionen des <strong>Sportjournalismus</strong>. In: HACKFORTH, Josef/WEISCHEN-<br />
BERG, Siegfried [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Bad Homburg: L<strong>im</strong>pert. S. 178-188.<br />
EZ (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff:<br />
17. September 2007. .<br />
FABRIS, Hans Heinz/RENGER, Rudi (2003). Vom Ethik- zum Qualitätsdiskurs. In: BUCHER,<br />
Hans-Jürgen/Altmeppen, Klaus-Dieter [Hg.]: Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Praxismodelle.<br />
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 79 - 92.<br />
FASEL, Christoph [Hg.] (2005): Qualität <strong>und</strong> Erfolg <strong>im</strong> Journalismus. Konstanz: UVK.<br />
FASSBENDER, Heribert (2006): Den Kinderschuhen entwachsen. Veröffentlichungsdatum:<br />
5. April 2006. Zugriff: 30. Januar 2007.<br />
.<br />
FEY, Ulrich (1994): Linford Christie gegen Carl Lewis. Die Sportreportage in der FAZ. In:<br />
HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>. München:<br />
Ölschläger. S. 119 - 149.<br />
FISCHER, Christoph (1993a): Sport <strong>und</strong> Medien 1993. In: Sportpsychologie 7. Jg. 1993, Heft<br />
3, S. 15 - 20.<br />
FISCHER, Christoph (1993b): Professionelle Sport-Kommunikatoren. Redaktionelle Textproduktionen<br />
<strong>und</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>-Didaktik. Band 1 der Beiträge des Instituts für Sportpublizistik.<br />
Berlin: Vistas.<br />
FISCHER, Christoph (1994): Bedeutungswandel des Sports. Aufwertung des <strong>Sportjournalismus</strong>?<br />
In: HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>.<br />
München: Ölschläger. S. 50 - 76.<br />
FISCHER, Heinz-Dietrich [Hg.] (1993): Exquisiter Sport-Journalismus. Artikel aus drei Jahrzehnten<br />
<strong>–</strong> ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis. Berlin: Vistas.<br />
FLEISCHMANN, Sebastian (2007): Alle in einem Boot? Investigativer <strong>Sportjournalismus</strong> in<br />
Deutschland. Eine Untersuchung der Voraussetzungen, Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Einstellungen.<br />
Universität Eichstätt Ingolstadt: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
187
FRANKENFELD, Alfred (1969): Typologie der Zeitung. In: DOVIFAT, Emil [Hg.]: Handbuch<br />
der Publizistik. Band 3. Berlin: de Gruyter. S. 153 - 160.<br />
FREUDENREICH, Josef-Otto (1983a): Wir schreiben Sport. Der Sport in der Presse. In: DI-<br />
GEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek: Rowohlt. S. 45 <strong>–</strong> 56.<br />
FREUDENREICH, Josef-Otto (1983b): Alternative Berichterstattung oder die Sportborniertheit<br />
der Linken. In: Olympische Jugend Jg. unbekannt 1983, Heft 9, S. 6 - 7.<br />
FREUDENREICH, Josef-Otto (1983c): Die Sport-Show. Ein Sportjournalist berichtet. Reinbek:<br />
Rowohlt.<br />
FRICKE, Ernst (1997): Recht für Journalisten. Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Fallbeispiele. Konstanz:<br />
UVK.<br />
FRIEDRICH, Jasper A. (1997): Self Serving Bias in medialen Attributionen bei Erfolg <strong>und</strong><br />
Misserfolg <strong>im</strong> Mannschaftssport. Untersuchung von Attributionsprozessen in deutschen<br />
<strong>und</strong> italienischen Printmedien zur Fußballweltmeisterschaft 1996 in England. Universität<br />
Leipzig: Unveröffentlichte Magisterarbeit.<br />
FRIEDT, Marina/PIUNTEK, Claudia (2006): Zweigleisig fahren <strong>und</strong> trotzdem die Spur halten.<br />
In: DJV Nordspitze 2. Jg. 2006, Heft 4, S. 8 - 9.<br />
FRITSCH, Oliver (2006a): In den Wald gelockt. Die Kampagne der Bild-Zeitung gegen Jürgen<br />
Klinsmann. In: Frankfurter R<strong>und</strong>schau 62. Jg. 2006, Heft 60 (11. März 2006).<br />
FRITSCH, Oliver (2006b): tz, Schweinsteiger. Dem <strong>Sportjournalismus</strong> fehlt die Selbstreinigungskraft.<br />
In: 11 Fre<strong>und</strong>e 7. Jg., Heft 54 (4/2006).<br />
FRITSCH, Oliver (2006c): Eine traurige Sportberichterstattung. Veröffentlichungsdatum:<br />
9. Juli 2006. Zugriff: 3. November 2006.<br />
.<br />
FRITSCH, Oliver (2006d): Aufklärung, bitte! Veröffentlichungsdatum: 9. Juli 2006. Zugriff:<br />
3. November 2006. .<br />
FRITSCH, Oliver (2006e): Welche Bild-Kampagne? Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2006.<br />
Zugriff: 3. November 2006. .<br />
FRITSCH, Oliver (2006f): Ich werde Basler nicht den M<strong>und</strong> verbieten. Veröffentlichungsdatum:<br />
August 2006. Zugriff: 3. November 2006.<br />
.<br />
FRITSCH, Oliver (2006g): Ein guter Boulevardjournalismus startet keine Kampagnen. Veröffentlichungsdatum:<br />
August 2006. Zugriff: 3. November 2006.<br />
.<br />
FRITSCH, Oliver (2006h): Polemik <strong>und</strong> Feuilletonismus. Das war mal innovativ. Veröffentlichungsdatum:<br />
August 2006. Zugriff: 3. November 2006.<br />
.<br />
FRITSCH, Oliver (2006i): Morbus JB Kerner. In: 11 Fre<strong>und</strong>e 7. Jg., Heft 58 (8/2006).<br />
FRÜH, Werner (2007): Inhaltsanalyse. Theorie <strong>und</strong> Praxis. Konstanz: UVK.<br />
188
FRÜH, Werner/KUHLMANN, Christoph/STIEHLER, Hans-Jörg (2007): Codebücher zum<br />
Projekt Ostdeutschland <strong>im</strong> Fernsehen. Veröffentlichungsdatum: 18. April 2007. Zugriff:<br />
21. November 2007. .<br />
FRÜTEL, Sybille (2005): Toy Department for Men. Eine empirische Studie zum internationalen<br />
<strong>Sportjournalismus</strong>. In: HACKFORTH, Josef [Hg.]: Beiträge des Lehrstuhls für Sport,<br />
Medien <strong>und</strong> Kommunikation. Pulhe<strong>im</strong>: Mediensport-Verlag.<br />
FUNIOK, Rüdiger (2002): Medienethik. Trotz Stolpersteinen ist der Wertediskurs über Medien<br />
unverzichtbar. In: KARMASIN, Matthias [Hg.]: Medien <strong>und</strong> Ethik: Stuttgart: Reclam.<br />
S. 37 - 58.<br />
FUNK, Isabell (2007): Persönliche E-Mail der Chefredakteurin der Ludwigsburger Kreiszeitung<br />
an den Verfasser. Datum: 13. September 2007. .<br />
GABLER, Hartmut (2002): Motive <strong>im</strong> Sport. motivationspsychologische Analysen <strong>und</strong> empirische<br />
Studien. Schorndorf: Hofmann.<br />
GABRIEL, Markus/QUAST, Thomas (2006a): König Fifa regiert die Welt. In: PR Magazin 37.<br />
Jg. 2006, Heft 7, S. 32 - 35.<br />
GABRIEL, Markus/QUAST, Thomas (2006b): Champions League oder Kreisklasse. In: PR<br />
Magazin 37. Jg. 2006, Heft 8, S. 28 - 33.<br />
GEESE, Stefan, ZEUGHARDT, Claudia/GERHARDT, Heinz (2006): Die Fußball-<br />
Weltmeisterschaft 2006 <strong>im</strong> Fernsehen. In: Media Perspektiven 34. Jg. 2006, Heft 9, S.<br />
454 - 464.<br />
GERHARD, Heinz (2006): Die Fußball-WM als Fernsehevent. In: Media Perspektiven 37. Jg.<br />
2006, Heft 9, S. 465 - 474.<br />
GERHARDS, Jürgen/ROOSE, Jochen/OFFERHAUS, Anke (2004): Die europäische Union<br />
<strong>und</strong> die massenmediale Attribution von Verantwortung. Codebuch. Universität Leipzig.<br />
Veröffentlichungsdatum: 2. Februar 2005. Zugriff: 21. November 2007.<br />
.<br />
GERHARDS, Jürgen/SCHÄFER, Mike Steffen (2003): Mediale Diskurse über Humangenomforschung<br />
in Deutschland <strong>und</strong> den USA <strong>im</strong> Vergleich. Codebuch. Universität Leipzig.<br />
Veröffentlichungsdatum: 17. November 2003. Zugriff: 21. November 2007.<br />
.<br />
GERNANDT, Michael (2006): Goldrausch, Doping <strong>und</strong> Waldi & Harry. In: Message 8. Jg.<br />
2006, Heft 2, S. 14 - 16.<br />
GERTZ, Holger (2006a): Die Dope-Soap aus der Skihütte. In: Message 8. Jg. 2006, Heft 2,<br />
S. 19 - 20.<br />
GERTZ, Holger (2006b): Nur das Wort ist schneller. Der Fußball <strong>und</strong> seine Kommentatoren.<br />
In: Das Parlament 56. Jg. 2006, Heft 19. Veröffentlichungsdatum: 8. Mai 2006. Zugriff: 3.<br />
November 2006. .<br />
GLEICH, Uli (1998): Sport, Medien <strong>und</strong> Publikum. Eine wenig erforschte Allianz. In: Media<br />
Perspektiven 29. Jg. 1998, Heft 3, S. 144 - 148.<br />
189
GLEICH, Uli (2000): Merkmale <strong>und</strong> Funktionen der Sportberichterstattung. In: Media Perspektiven<br />
31. Jg. 2000, Heft 11, S. 511 - 516.<br />
GLEICH, Uli (2003): Qualität <strong>im</strong> Journalismus am Beispiel der Kriegsberichterstattung. In:<br />
Media Perspektiven 34. Jg. 2003, Heft 3, S. 139 - 148.<br />
GLEICH, Uli (2004): Sportkommunikation <strong>und</strong> ihre Bedeutung für die Nutzer. In: Media Perspektiven<br />
35. Jg. 2004, Heft 10, S. 500 - 505.<br />
GOLZ, Wolfgang (1998): Hauptgeschichten stecken oft in Nebensätzen. In: HACKFORTH,<br />
Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern<br />
sich. Berlin: Sportverlag. S. 114 - 121.<br />
GÖRNER, Felix (1995): Vom Außenseiter zum Aufsteiger. Ergebnisse der repräsentativen<br />
Befragung von Sportjournalisten in Deutschland. Beiträge des Instituts für Sportpublizistik,<br />
Band 4. Berlin: Vistas.<br />
GÖRNER, Felix (1998): Leben ist gut, lernen ist besser Gelerntes, gelebtes Leben ist am<br />
besten. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach<br />
vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin: Sportverlag. S. 135 - 150.<br />
GRÄBER, Ingo (2007): Persönliche E-Mail des Sportchefs der Schweriner Volkszeitung an<br />
den Verfasser. Datum: 10. September 2007. .<br />
GROSSHANS, Götz-Tillmann (1997): Fußball <strong>im</strong> deutschen Fernsehen. Frankfurt am Main:<br />
Lang.<br />
GÜLDENPFENNIG, Sven (1992): Politische D<strong>im</strong>ensionen des Sport-Begriffs. In: DSB [Hg.]:<br />
Der politische Diskurs des Sports. Zeitgeschichtliche Beobachtungen <strong>und</strong> theoretische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen. Edition Sport <strong>und</strong> Wissenschaft. Band 16. Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer.<br />
S. 37 - 66.<br />
GUMBRECHT, Hans Ulrich (1988): Dabei sein ist alles. Über die Geschichte von Medien,<br />
Sport <strong>und</strong> Publikum. Siegen: DFG-Sonderforschungsbereich (Arbeitshefte Bildschirmmedien).<br />
HA (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
HAAS, Hannes/PÜRER, Heinz (1996): Berufsauffassungen <strong>im</strong> Journalismus. In: PÜRER,<br />
Heinz [Hg.]: Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio <strong>und</strong> Fernsehen. Salzburg: Kuratorium<br />
für Journalistenausbildung. S. 355 - 365.<br />
HACKFORTH, Josef (1985): Der Freizeitsport sucht seine Medien. Bestandsaufnahme <strong>und</strong><br />
Kritik. In: Führungs- <strong>und</strong> Verwaltungsakademie Berlin des Deutschen Sportb<strong>und</strong>es e.V.<br />
[Hg.]: 33 Akademieschrift. Berlin: FVA. S.16 - 28.<br />
HACKFORTH, Josef (1994): <strong>Sportjournalismus</strong> in Deutschland. Die Kölner Studie. In:<br />
HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>. München:<br />
Ölschläger. S. 13 - 49.<br />
HACKFORTH, Josef (2001a): Auf dem Weg in die Sportgesellschaft? In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER,<br />
Walter/GERHARDS, Maria [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-<br />
Baden: Nomos. S. 33 - 40.<br />
190
HACKFORTH, Josef (2001b): Medien <strong>–</strong> Sport <strong>–</strong> Wirklichkeit. Ungeordnete Gedanken <strong>und</strong><br />
geordnete Fakten. In: TROSIEN, Gerhard/DINKEL, Michael [Hg.]: Verkaufen Medien die<br />
Sportwirklichkeit? Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer. S. 45 - 54.<br />
HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael (1998a): Ein Blick zurück nach vorn. Lese-<br />
Perspektiven. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück<br />
nach vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin: Sportverlag. S. 9 - 13.<br />
HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael (1998b): <strong>Sportjournalismus</strong> <strong>im</strong> Dritten Jahrtausend.<br />
In: HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach<br />
vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin: Sportverlag. S. 248 - 252.<br />
HAGEMANN, Florian (2006): Top 5 <strong>–</strong> TV-Flops. Johannes B. Kerner. In: Hessisch/Niedersächsische<br />
Allgemeine Jg. unbekannt 2006, Nr. ubekannt (16. Dezember 2006), S. 7<br />
(Sonderbeilage).<br />
HALLER, Michael (1994): Recherche <strong>und</strong> Nachrichtenproduktion als Konstruktionsprozesse.<br />
In: MERTEN, Klaus/SCHMIDT, Siegfried J./WEISCHENBERG, Siegfried [Hg.]: Die Wirklichkeit<br />
der Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 277 - 290.<br />
HALLER, Michael (1997): Die Reportage. Ein Handbuch für Journalisten. Konstanz: UVK.<br />
HALLER, Michael (2000): TÜV für Regionalblätter. In: Message 2. Jg. 2000, Heft 4,<br />
S. 44 - 48.<br />
HALLER, Michael (2001): Prüfstand. Benchmarking für die redaktionelle Leistung. In: B<strong>und</strong>esverband<br />
Deutscher Zeitungsverleger e.V. [Hg.]: Zeitungen 2001. Berlin: ZV Zeitungs-<br />
Verlag Service GmbH. S. 249 - 270.<br />
HALLER, Michael (2004): Die Idee des neutralen Beobachters. Über das Paradigma des<br />
modernen Informationsjournalismus. In: DUVE, Fre<strong>im</strong>ut/HALLER, Michael [Hg.]: Leitbild<br />
Unabhängigkeit. Zur Sicherung publizistischer Verantwortung. Konstanz: UVK.<br />
S. 13 - 30.<br />
HALLER, Michael (2005): K<strong>und</strong>endienst statt Journalismus? In: Message 7. Jg. 2005, Heft<br />
3, S. 14 - 19.<br />
HANSEN, Hans (1988): Erwartungen des Sports an die Medien. In: HOFFMANN-RIEM,<br />
Wolfgang [Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung. Baden-Baden:<br />
Nomos. S. 27 - 31.<br />
HILL, Declan (2005): Reporter <strong>im</strong> Abseits. In: Message 7. Jg. 2005, Heft 2, S. 43 - 45.<br />
HOFSÜMMER, Karl-Heinz/SIMON, Erk/ZUBAYR, Camille (2004): Die ARD-Sportschau <strong>–</strong><br />
erfolgreich in allen Zielgruppen. In: Media Perspektiven 35. Jg. 2004, Heft 7,<br />
S. 310 - 321.<br />
HOLZSCHUH, Rainer (1999): Zur Beziehungskiste zwischen Sport <strong>und</strong> Medien. Sport-<br />
journalisten als Vertraute, Vermittler <strong>und</strong> Verkäufer? In: TROSIEN, Gerhard/DINKEL,<br />
Michael [Hg.]: Verkaufen Medien die Sportwirklichkeit? Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer.<br />
S. 73 - 82.<br />
HOPF, Wilhelm (1998): Fernsehsport. Fußball <strong>und</strong> anderes. In: HOPF, Wilhelm [Hg.]:<br />
Fußball: Soziologie <strong>und</strong> Sozialgeschichte einer populären Sportart. Münster: Lit.<br />
S. 227 - 238.<br />
191
HOPPNER, Joach<strong>im</strong> (1975): Die einen wollen mobil sein, die anderen geben sich brav. In:<br />
Frankfurter R<strong>und</strong>schau 31. Jg. 1975, Nr. unbekannt (25. April 1975), S. 25.<br />
HORKY, Thomas (2001): Die Inszenierung des Sports in der Massenkommunikation. Theoretische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Analyse von Medienberichterstattung. Jesterburg: XOX.<br />
HORKY, Thomas (2005a): Franz, was würden Sie sagen? Zur Funktion von Experten <strong>im</strong><br />
System Mediensport. In: HORKY, Thomas [Hg.]: Erfahrungsberichte <strong>und</strong> Studien zur<br />
Fußball-Europameisterschaft. Hamburg: Horky. S. 107 - 128.<br />
HORKY, Thomas (2005b): Sonne, Smoking, Superlativ. Fernsehsport als Abendunterhaltung<br />
zwischen Sensation <strong>und</strong> Journalismus. In: Deutscher Sportb<strong>und</strong> [Hg.]: DSB-Jahrbuch<br />
2005/2006. Dreieich: Kühne. S. 108 - 109.<br />
HUBERT, Heinz-Josef (2008a): Auf <strong>Distanz</strong>. In: WDR Print, Jg. unbekannt, Heft 381.<br />
Veröffentlichungsdatum: 11. Januar 2009. Zugriff: 29. Februar 2008. S. 2.<br />
.<br />
HUBERT, Heinz-Josef (2008b): Selbstverpflichtung zu journalistischer <strong>Distanz</strong>. In: WDR<br />
Print, Jg. unbekannt, Heft 381. Veröffentlichungsdatum: 11. Januar 2009. Zugriff: 29.<br />
Februar 2008. S. 7. .<br />
HUS, Christoph (2006): Interview mit Thomas Leif, Vorsitzender des Netzwerks Recherche.<br />
In: Insight 14. Jg., Heft 4. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 3. November<br />
2006. .<br />
IHLE, Alf (2006): Erste Besucher sind schon da. Homepage Bild-Zeitung. Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 14. Dezember 2006.<br />
.<br />
IVW (2006): Auflagenliste 3/2006. Veröffentlichungsdatum: 25. Oktober 2006. Zugriff: 30.<br />
November 2007. .<br />
IVW (2007): Auflagenliste 1/2007. Veröffentlichungsdatum: 26. April 2007. Zugriff: 30. November<br />
2007. <br />
JANTOS, Robin (2004): Mittel <strong>und</strong> Ziele <strong>im</strong> Journalismus. Zum Verhältnis von Handwerksregeln<br />
<strong>und</strong> Journalismusfunktionen. Universität Leipzig: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
JARREN, Otfried/BONFADELLI, Heinz [Hg.] (2001): Einführung in die Publizistikwissenschaft.<br />
Bern: Haupt.<br />
JONSCHER, Norbert (1995) Lokale Publizistik. Theorie <strong>und</strong> Praxis der örtlichen Berichterstattung.<br />
Ein Lehrbuch. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
JÜRGENS, Malte (2000): Dabei sein ist noch nicht alles. In: MAST, Claudia [Hg.]: ABC des<br />
Journalismus. Ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit. Konstanz: UVK. S. 363 - 367.<br />
JUSCHUS, Thomas (2007): Persönliche E-Mail des Leiter Aktuelles der Lausitzer R<strong>und</strong>schau<br />
an den Verfasser. Datum: 13. September 2007. .<br />
KAPF, Gottfried (1958): Die soziologische <strong>und</strong> politische Problematik der Sportbericht-<br />
erstattung in der Publizistik. Wien: Unveröffentlichte Dissertation.<br />
KARMASIN, Matthias (1996): Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Ein medienökonomisches <strong>und</strong><br />
medienethisches Problem. In: Medien Journal 20. Jg. 1996, Heft 2, S. 17 - 26.<br />
192
KAUER, Oliver (1998): Behindertensport in den Medien. Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer.<br />
KEHM, Sabine (1998): Viel reden, nichts sagen. Von der seltsamen Kommunikation zwischen<br />
Sportler <strong>und</strong> Journalist. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]:<br />
Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin: Sportverlag.<br />
S. 28 - 36.<br />
KERNER, Johannes B. (2005): Nicht wie ein Fußballreporter reden. Zum Live-Kommentar<br />
bei Fernsehübertragungen der Fußball-EM. In: HORKY, Thomas [Hg.]: Erfahrungsberichte<br />
<strong>und</strong> Studien zur Fußball-Europameisterschaft. Hamburg: Horky. S. 39 - 44.<br />
KIESLICH, Günter (1966) Berufsbilder <strong>im</strong> früheren Zeitungswesen. In: Publizistik 11. Jg.<br />
1966, Heft 3-4, S. 253 - 263.<br />
KISTNER, Thomas (1998): Vertuschen, verraten, verkaufen. Gaunerstücke der Sportpolitik.<br />
In: HACKFORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn.<br />
Sportjournalisten erinnern sich. Berlin: Sportverlag. S. 211 - 221.<br />
KISTNER, Thomas (2004): Fairness auf deutsche Art. In: Message 6. Jg. 2004, Heft 3,<br />
S. 10 - 14.<br />
KLAWITTER, Nils (2002): Totalitäres System. In: Der Spiegel 56. Jg. 2002, Heft 7<br />
(9. Februar 2002), S. 70.<br />
KLAWITTER, Nils/ROSENBACH, Marcel/WULZINGER, Michael (2002): Es soll menscheln.<br />
In: Der Spiegel 56. Jg. 2002, Heft 7 (9. Februar 2002), S. 68 - 70.<br />
KLEIN, Wolfgang (1983): Kriterien moderner Berichterstattung. Ansprüche an Presse <strong>und</strong><br />
ihre Institutionen. In MENTZ, Siegfried [Hg.]: Die Sportberichterstattung <strong>im</strong> Spiegel der<br />
Öffentlichkeit. Loccumer Protokolle 14/1983. o.O.: unbekannt. S. 9 - 15.<br />
KLEMM, Thomas (2005): Ausleuchten, wo etwas aufgeblitzt ist. EM-Berichterstattung in der<br />
Tageszeitung zwischen Originalität <strong>und</strong> Exklusivität. In: HORKY, Thomas [Hg.]: Erfahrungsberichte<br />
<strong>und</strong> Studien zur Fußball-Europameisterschaft. Hamburg: Horky.<br />
S. 21 - 30.<br />
KOCH, Ursula E. (1994): Generalanzeiger. In: BOHRMANN, Hans/UBBENS, Wilbert [Hg.]:<br />
Zeitungswörterbuch. Sachwörterbuch für den bibliothekarischen Umgang mit Zeitungen.<br />
Berlin: Deutsches Bibliotheks-Institut. S. unbekannt.<br />
KOLLER, Udo (2007): Persönliche E-Mail des Sportchefs der Pforzhe<strong>im</strong>er Zeitung an den<br />
Verfasser. Datum: 22. Oktober 2007. .<br />
KÖNIG, Thomas (2002): Fankultur. Eine soziologische Studie am Beispiel des Fußballfans.<br />
Münster: Lit.<br />
KÖSTNER, Manuela (2005): Werte, Moral <strong>und</strong> Identifikation <strong>im</strong> Sportressort. Eine vergleichende<br />
Inhaltsanalyse der Süddeutschen Zeitung mit der Bild Zeitung. Köln: Mediensport-Verlag.<br />
KOSCHNICK, Wolfgang J. (1999): Eine Zielgruppe, die keine ist. Sportzeitungen haben neben<br />
Boulevardpresse <strong>und</strong> Fernsehen kaum eine Chance. In: Media Trend Journal 16.<br />
Jg. 1999, Heft 12, S. 42 - 45.<br />
KOSZYK, Kurt (1966): Deutsche Presse <strong>im</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert. In: FRITZ, Eberhard [Hg.]: Abhandlungen<br />
<strong>und</strong> Materialien zur Publizistik. Band 6. Berlin: Colloquium. S. 35 - 126.<br />
193
KOSZYK, Kurt (1972): Deutsche Presse 1914 bis 1945. In: FRITZ, Eberhard [Hg.]: Abhandlungen<br />
<strong>und</strong> Materialien zur Publizistik. Band 7. Berlin: Colloquium. S. 102 - 239.<br />
KREBS, Hans-Dieter (1969): Der Sportteil in der Zeitung. In: DOVIFAT, Emil [Hg.]: Handbuch<br />
der Publizistik. Band 3. Praktische Publizistik. Berlin: de Gruyter. S. 252 - 259.<br />
KROPPACH, Dieter (1978): Gedruckt. Pathos oder Sachlichkeit? In: HACKFORTH, Josef/WEISCHENBERG,<br />
Siegfried [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Bad Homburg: L<strong>im</strong>pert.<br />
S. 133 - 141.<br />
KÜBERT, Rainer/NEUMANN, Holger/HÜTHER, Jürgen (1994): Fußball, Medien <strong>und</strong> Gewalt.<br />
München: KoPäd.<br />
LAASER, Erich (2006): Die veröffentlichte Meinung. In: Sportjournalist 56. Jg. 2006, Heft 3,<br />
S. 3.<br />
LAHME, Tilmann (2006): Fernsehthema Doping. Öffentlich-rechtlicher Gedächtnisschw<strong>und</strong>?<br />
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 57. Jg 2006, Heft 176, S. 36.<br />
LANGENKÄMPER, Jürgen (2002): Kultur <strong>und</strong> Sport liegen Tür an Tür. Sonderdruck des<br />
Mindener Tageblatts. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
LAUX, Alexander (2005): Schreiben mit Hindernissen. Handy, PK <strong>und</strong> PR bei der Fußball-<br />
Europameisterschaft. In: HORKY, Thomas [Hg.]: Erfahrungsberichte <strong>und</strong> Studien zur<br />
Fußball-Europameisterschaft. Hamburg: Horky. S. 13 - 20.<br />
LEIF, Thomas (2004):Die Recherche. Von Pflicht <strong>und</strong> Kür des Journalisten. In: MASSAGU-<br />
IÉ, Vivian/RESCH, Resch [Hg.]: Faszination TV-Journalismus. Nürnberg: Bildung <strong>und</strong><br />
Wissen. S. 35 - 58.<br />
LEIF, Thomas (2005): PR <strong>und</strong> Journalismus wie Teufel <strong>und</strong> Weihwasser. Presseinformation<br />
der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Veröffentlichungsdatum: 1. August<br />
2005. Zugriff: 4. November 2006.<br />
.<br />
LEIF, Thomas (2006): Journalismus ist mehr als die Kommentierung von Marketing. Argumente<br />
gegen die freiwillige Selbstaufgabe des Journalismus <strong>und</strong> die empfohlene Kapitulation<br />
vor der PR-Falle. In: V.i.S.d.P. 3. Jg. 2006, Heft 3, S. 28 - 29.<br />
LERCH, Gerhard (1989): Der Sportjournalist aus Sicht des Sportjournalisten. Eine schriftliche<br />
Umfrage zur Sportberichterstattung in Presse <strong>und</strong> R<strong>und</strong>funk unter Berücksichtigung<br />
der Kommerzialisierung des Sports. Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Unveröffentlichte<br />
Magisterarbeit.<br />
LERCH, Gerhard (1990): Aus Sicht der Macher. In: Sportjournalist 40. Jg. 1990, Nr. 3,<br />
S. 20 - unbekannt.<br />
LEYENDECKER, Hans (2006): Laudatio für Hajo Seppelt anlässlich der Verleihung des<br />
Leichtturmpreises für besondere publizistische Leistungen 2006. Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 28. November 2007.<br />
.<br />
LIERHAUS, Monica/KÖSTER, Philipp (2006): Die Zeit der <strong>Nähe</strong> ist vorbei. In: Medium Magazin<br />
21. Jg. 2006, Heft 6, S. 52 - 55.<br />
194
LIESKE, Matthias (2006): Die letzten zwei Fragen bitte. In: Message 8. Jg. 2006, Heft 2,<br />
S. 16 - 18.<br />
LINDEMANN, Margot (1969): Deutsche Presse bis 1815. Geschichte der deutschen Presse.<br />
Teil 1. In: FRITZ, Eberhard [Hg.]: Abhandlung <strong>und</strong> Materialien zur Publizistik. Band 5.<br />
Berlin: Colloquium. S.1 - 360.<br />
LINDEN, Peter: Der Athlet trägt sein Herz auf der Zunge. Zur Sprache der Sportberichterstattung.<br />
In: HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>.<br />
München 1994, S. 77 - 97.<br />
LKZ (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
LÖFFLER, Martin/RICKER, Reinhart (2000): Handbuch des Presserechts. München: Beck.<br />
LOOSEN, Wiebke (1997): Die Medienrealität des Sports. Evaluation <strong>und</strong> Analyse der Printberichterstattung.<br />
Wiesbaden: DUV.<br />
LOOSEN, Wiebke (2001): Das wird alles von den Medien hochsterilisiert. Themenkarrieren<br />
<strong>und</strong> Konjunkturkurven der Sportberichterstattung. In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER,<br />
Walter/GERHARDS, Maria [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-Baden: Nomos. S.<br />
133 - 148.<br />
LR (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
;<br />
.<br />
LUDWIG, Udo (1987): Kabale <strong>und</strong> Liebe. Sportjournalisten an Tageszeitungen <strong>und</strong> Profi-<br />
Fußballvereine. Münsteraner Schriften zur Körperkultur. Münster: Lit.<br />
MAI, Lothar (2006): Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 <strong>im</strong> Radio. In: Media Perspektiven<br />
37. Jg. 2006, Heft 9, S. 475 - 477.<br />
MARR, Mirko/STIEHLER, Hans-Jörg (1995): Zwei Fehler sind gemacht worden, <strong>und</strong> deshalb<br />
sind wir nicht mehr <strong>im</strong> Wettbewerb. Erklärungsmuster der Medien <strong>und</strong> des Publikums in<br />
der Kommentierung des Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-<br />
Weltmeisterschaft 1994. In: R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Fernsehen 43. Jg. 1995, Heft 3,<br />
S. 330 - 349.<br />
MAST, Claudia [Hg.] (2000): ABC des Journalismus. Ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit.<br />
Konstanz: UVK.<br />
MEIER, Christian (2004): Der gläserne Leser. In: Medium Magazin 19. Jg. 2004, Heft 11,<br />
S. 24 - 26.<br />
MEINBERG, Eckhard (2004): Mediensport. Ethisch betrachtet. In: FREI, Peter/KÖRNER,<br />
Swen [Hg.]: Sport <strong>–</strong> Medien <strong>–</strong> Kultur. Sankt Augustin: Academia. S. 32 - 54.<br />
MENHARD, Edigna/TREEDE, Tilo (2004): Die Zeitschrift. Von der Idee bis zur Vermarktung.<br />
Konstanz: UVK.<br />
MENTZ, Siegfried (1983): Einführung in die Tagesthematik. In MENTZ, Siegfried [Hg.]: Die<br />
Sportberichterstattung <strong>im</strong> Spiegel der Öffentlichkeit. Loccumer Protokolle 14/1983. o.O.:<br />
unbekannt. S. 5 - 8.<br />
195
MERTEN, Klaus (1995): Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode <strong>und</strong> Praxis. Opladen:<br />
Westdeutscher Verlag.<br />
MERTENS, Mathias (2002): Der Rummel wuchs <strong>und</strong> kumulierte. Über den Prozess des Medienereignisses.<br />
In: SCHWIER, Jürgen/LEGGEWIE, Claus [Hg.]: Wettbewerbsspiele.<br />
Die Inszenierung von Sport <strong>und</strong> Politik in den Medien. Frankfurt: Campus. S. 20 - 41.<br />
MESSING, Manfred/LAMES, Martin (1996): Zur Sozialfigur des Sportzuschauers. Niedernhausen:<br />
Schors.<br />
MEUTGENS, Ralf (2002): Wir warten auf die B-Probe. In: Message 4. Jg. 2002, Heft 3,<br />
S. 34 - 36.<br />
MEYER, Tino (2007): Die Sportjournalistenausbildung an deutschen Hochschulen.<br />
Universität Leipzig: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
MEYN, Hermann (1999): Massenmedien in Deutschland. Alte <strong>und</strong> neue B<strong>und</strong>esländer. Konstanz:<br />
UVK.<br />
MIKOS, Lothar (2002): Fre<strong>und</strong>e fürs Leben. Kulturelle Aspekte von Fußball, Fernsehen <strong>und</strong><br />
Fernsehfußball. In: SCHWIER, Jürgen [Hg.]: Mediensport. Ein einführendes Handbuch.<br />
Hohengehren: Schneider. S. 27 - 50.<br />
MÖLLER Jens (1993): Attributionen in Massenmedien. Zum Einfluss nationaler Gruppenzugehörigkeit,<br />
Gruppengröße <strong>und</strong> Geschlecht auf spontane Ursachenzuschreibungen.<br />
Reihe: Angewandte Psychologie. Band 1. Bonn: Holos.<br />
MÖLLER, Jens (1994a): Attributionsforschung <strong>im</strong> Sport. Ein Überblick. Teil 1. In: Psychologie<br />
<strong>und</strong> Sport Jg. unbekannt 1994, Nr. 1, S. 82 - 93.<br />
MÖLLER, Jens (1994b): Attributionsforschung <strong>im</strong> Sport. Ein Überblick. Teil 2. In: Psychologie<br />
<strong>und</strong> Sport Jg. unbekannt 1994, Nr. 1, S. 149 - 156.<br />
MÖLLER, Jens/BRANDT, Henrik (1994): Personale <strong>und</strong> situationale Leistungsbegründungen<br />
in Fernseh- <strong>und</strong> Zeitungsberichten. In: Medienpsychologie 6. Jg. 1994, Heft 4,<br />
S. 266 - 277.<br />
MÖLLER, Jens/STRAUSS, Bernd (1993a): Einige Bemerkungen zu Forschungen über<br />
Sportberichterstattung. In: Sportpsychologie 7. Jg. 1993, Heft 3, S. 5 - 19.<br />
MÖLLER, Jens/STRAUSS, Bernd (1993b): Günter Jauch <strong>im</strong> Gespräch. Bitte keine Standardfragen.<br />
In: Sportpsychologie 7. Jg. 1993, Heft 3, S. 10 - 13.<br />
MÖWIUS, Dirk (1987): Lokalsportberichterstattung. Aufgeschlossene Leser. In: Hackforth,<br />
Josef [Hg.]: Sportmedien <strong>und</strong> Mediensport. Wirkungen <strong>–</strong> Nutzung <strong>–</strong> Inhalte. Berlin:<br />
Vistas. S. 161 - 179.<br />
MT (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
MÜHLETHALER, Jan (2006): Die Sportpresse als weltbeste Werbeagentur. In: NZZ-Online.<br />
Homepage der Neuen Zürcher Zeitung. Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2006. Zugriff:<br />
8. Februar 2007. .<br />
196
NAUSE, Martina (1987): Der Sportjournalist. Mit neuem Selbstbewusstsein? In: Hackforth,<br />
Josef [Hg.]: Sportmedien <strong>und</strong> Mediensport. Wirkungen <strong>–</strong> Nutzung <strong>–</strong> Inhalte. Berlin:<br />
Vistas. S. 227 - 248.<br />
NETZWERK RECHERCHE (2006): Medienkodex. Richtlinie der Journalistenvereinigung<br />
Netzwerk Recherche. Veröffentlichungsdatum: Februar 2006 (genaues Datum unbekannt).<br />
Zugriff: 4. November 2006.<br />
.<br />
NEUBERGER, Christoph (1997): Was das Publikum wirklich wollen könnte. Autonome <strong>und</strong><br />
repräsentative Bewertung journalistischer Leistungen. In: WESSLER, Hartmut/MATZEN,<br />
Christiane/JARREN, Otfried/HASEBRINK, Uwe [Hg.]: Perspektiven der Medienkritik.<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 171 - 184.<br />
NEUGEBAUER, Eva (1986): Mitspielen be<strong>im</strong> Zuschauen. Analyse zeitgleicher Sportberichterstattung<br />
des Fernsehens. Frankfurt: Lang.<br />
NIGGEMEIER, Stefan/SCHULTHEIS, Christoph (2006): Erfolgreiche WM mit Klinsmann<br />
kaum möglich. Veröffentlichungsdatum: 6. Juli 2006. Zugriff: 3. November 2006.<br />
.<br />
NITSCHMANN, Johannes (1983): Weltmeister <strong>im</strong> Schaumschlagen. In: Die Feder Jg. unbekannt<br />
1983, Heft 8, S. 14 - 18, 32 - 33.<br />
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth (1968): Pressekonzentration <strong>und</strong> Meinungsbildung. In: Publizistik<br />
13. Jg. 1968, Heft 2 - 4, S. 107 - 136.<br />
OBERMANN, Holger (1983): Wir (be)sprechen <strong>und</strong> zeigen Sport. Der Sport <strong>im</strong> Fernsehen.<br />
In: DIGEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek: Rowohlt. S. 57 - 73.<br />
ORTNER, Helmut (2006): Auf Ballhöhe. In: Medium Magazin 21. Jg. 2006, Heft 7, S. 10 - 11.<br />
O.V. (1993a): Bitte keine Standardfragen. Interview mit Günther Jauch. In: Sportpsychologie<br />
7. Jg. 1993, Heft 3, S. 10 - 13.<br />
O.V. (1993b): Man kann sich nicht ganz vom Mediendruck befreien. Interview mit Erich Rutemöller.<br />
In: Sportpsychologie 7. Jg. 1993, Heft 3, S. 21 - 23.<br />
O.V. (2002): Frustrierende Anstrengungen. In: Message 4. Jg. 2002, Heft 3, S. 8 - 9.<br />
O.V. (2004a): Rechercheure oder Entertainer? In: Message 6. Jg. 2004, Heft 3, S. 8 - 9.<br />
O.V. (2004b): Journalisten. Sportreporter am Spielfeldrand. Homepage TV-Magazin Zapp.<br />
Veröffentlichungsdatum: 8. August 2004. Zugriff: 12. Dezember 2006.<br />
.<br />
O.V. (2006a): Was wir wollen. Homepage des Sportnetzwerks. Veröffentlichungsdatum: unbekannt.<br />
Zugriff: 12. Oktober 2006. .<br />
O.V. (2006b): Programm des Sportnetzwerks. Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt.<br />
Zugriff: 12. Oktober 2006. .<br />
O.V. (2006c): Offener Brief an den Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS). Homepage<br />
des Sportnetzwerks. Veröffentlichungsdatum: 21. Januar 2006. Zugriff: 12. Dezember<br />
2006. .<br />
197
O.V. (2006d): Sportjournalisten kämpfen für besseren Journalismus. Homepage TV-Magazin<br />
Zapp. Veröffentlichungsdatum: 18. Januar 2004. Zugriff: 12. Dezember 2006.<br />
.<br />
O.V. (2006e): Dopingsumpf <strong>im</strong> Fernsehen. Homepage TV-Magazin Zapp. Veröffentlichungsdatum:<br />
2. August 2006. Zugriff: 12. Dezember 2006.<br />
.<br />
O.V. (2006f): Fakten <strong>und</strong> Zahlen. Die TV-Übertragung der FIFA WM 2006. Homepage der<br />
Fifa zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Veröffentlichungsdatum: 7. Juli 2006. Zugriff:<br />
30. Januar 2007. .<br />
OV (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
PAESLER, Sigor (2007): Persönliche E-Mail des Sportredakteurs der Eßlinger Zeitung an<br />
den Verfasser. Datum: 12. September 2007. .<br />
PASQUAY, Anja (2007): Zur Lage der Zeitungen in Deutschland 2007. Veröffentlichungsdatum:<br />
August 2007. Zugriff: 20. August 2007.<br />
.<br />
PASTORS, Wilfried (1994): Boulevardjournalismus pur. BILD-Geschichten <strong>und</strong> deren Zustandekommen.<br />
In: HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>.<br />
München: Ölschläger. S. 177 - 186.<br />
PEPPER, Christoph (2002): Vom Buchdrucker zum Medienhaus. Mit Johann Christian Conrad<br />
Bruns fing 1834 alles an. Sonderdruck des Mindener Tageblatts. Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
PFAD, Michael (1998): Budgethoheit <strong>und</strong> Bildschirmpräsenz. Pay-Per-Visionen. In: HACK-<br />
FORTH, Josef/SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten<br />
erinnern sich. Berlin: Sportverlag. S. 62 - 76.<br />
PILZ, Gunter (1983): <strong>Sportjournalismus</strong>. Oder die Unfähigkeit zur kritischen <strong>Distanz</strong>. In<br />
MENTZ, Siegfried [Hg.]: Die Sportberichterstattung <strong>im</strong> Spiegel der Öffentlichkeit. Loccumer<br />
Protokolle 14/1983. Loccum: unbekannt. S. 57 - 82.<br />
PISTORIUS, Harald (1994): Sechs gute Gründe. Der Weltrekord <strong>im</strong> Lokalen. In: HACK-<br />
FORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>. München:<br />
Ölschläger. S. 162 - 176.<br />
PLASCHKE, Bill (2000): The Reporter. That’s twice you get me. I’m gonna hit you, right now,<br />
right now! In: Columbia Journalism Review 39. Jg. 2000, Heft 1. Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 2. November 2006. .<br />
PÖTTKER, Horst (2000): Kompensation von Komplexität. Journalismustheorie als Begründung<br />
journalistischer Qualitätsmaßstäbe. In: LÖFFELHOLZ, Martin [Hg.]: Theorien des<br />
Journalismus. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 375 - 390.<br />
POULTON, Emma (2004): Mediated Patriot Games. The Construction and Representation of<br />
National Identities in the British Television Production of Euro 96. In: International Review<br />
for the Sociology of Sport 39 Jg. 2004, Heft 4, S. 437 - 455.<br />
198
PÜRER, Heinz (1992): Ethik in Journalismus <strong>und</strong> Massenkommunikation. Versuch einer<br />
Theorien-Synopse. In: Publizistik 37. Jg. 1992, Heft 3, S. 304 - 321.<br />
PÜRER, Heinz (1996): Ethik <strong>und</strong> Verantwortung <strong>im</strong> Journalismus. In: PÜRER, Heinz [Hg.]:<br />
Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio <strong>und</strong> Fernsehen. Salzburg: Kuratorium für<br />
Journalistenausbildung. S. 366 - 379.<br />
PÜRER, Heinz/RAABE, Johannes (1996): Medien in Deutschland. Band 1. Presse. Konstanz:<br />
UVK.<br />
PUNTAS BERNET, Daniel (2006): Gefährliche Liaison. In: Neue Zürcher Zeitung 227. Jg.<br />
2006, Heft 32 (15. Oktober 2006), S. 46 - 47.<br />
PZ (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
RAGER, Günther (1994): D<strong>im</strong>ensionen der Qualität. Weg aus den allseitig offenen Richter-<br />
Skalen? In: BENTELE, Günter/HESSE, Kurt R. [Hg.]: Publizistik in der Gesellschaft.<br />
Festschrift für Manfred Rühl. Konstanz: UVK. S. 189 - 209.<br />
RAGER, Günther (1999): Wie verändern die neuen Techniken die Tageszeitungen? In:<br />
SCHÄFER, Ulrich P../ SCHILLER, Thomas/ SCHÜTTE, Georg (Hrsg.): Journalismus in<br />
Theorie <strong>und</strong> Praxis, Konstanz: UVK. S. 135 - 144.<br />
RAUPP, Juliana (2004): Berufsethische Kodizes als Konfliktvermeidungsprogramme.<br />
PR-Kodizes <strong>und</strong> Pressekodizes <strong>im</strong> Vergleich. In: ALTMEPPEN, Klaus Dieter u.a. [Hg.]:<br />
Schwierige Verhältnisse. Interdependenzen zwischen Journalismus <strong>und</strong> PR. Wiesbaden:<br />
Verlag für Sozialwissenschaften. S. 181 - 195.<br />
REICHERT, Sebastian (2006a): Die Fifa ist mächtiger als die Kirche. In: Fuldaer Zeitung<br />
132. Jg. 2006, Heft unbekannt, S. unbekannt.<br />
REICHERT, Sebastian (2006b): Zwischen Hektik <strong>und</strong> Drohungen. In: Fuldaer Zeitung 132.<br />
Jg. 2006, Heft unbekannt, S. unbekannt.<br />
REPPLINGER, Roger (2006): Bumm Bumm BILD. In: Die Zeit 61. Jg. 2006 (6. Juni 2006).<br />
Zugriff: 5. November 2006.<br />
.<br />
RICHTER, MARTINA (1997): Massenmedien <strong>und</strong> Sportverein. Eine theoretisch-empirische<br />
Analyse von Wirkungen der Mediensportrealität auf den Sportverein in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. Münster: Lit.<br />
RIECHMANN, Markus (2007): Persönliche E-Mail des Sportchefs des Mindener Tageblatts<br />
an den Verfasser. Datum: 10. September 2007. .<br />
RITCHIE, Joe (2004): US-Sportskandale. Doping, Sex <strong>und</strong> Glücksspiel. In: Message 6. Jg.<br />
2004, Heft 3, S. 15.<br />
RÖPER, Horst (2006): Probleme <strong>und</strong> Perspektiven des Zeitungsmarktes. In: Media Perspektiven<br />
37. Jg. 2006, Heft 5, S. 283 - 297.<br />
RÖSSLER, Patrick (2005): Inhaltsanalyse. Konstanz: UVK.<br />
199
ROHRBERG, Dirk (1982): Wasserträger der Redaktion. Freie Mitarbeiter <strong>im</strong> Lokalsportressort.<br />
Fallstudie am Beispiel der drei Dortm<strong>und</strong>er Tageszeitungen Westfälische R<strong>und</strong>schau,<br />
Ruhr Nachrichten, Westdeutsche Allgemeine. Universität Dortm<strong>und</strong>: Unveröffentlichte<br />
Diplomarbeit.<br />
ROTHER, Anja (2003): Krisenkommunikation in der Automobilindustrie. Eine inhaltsanalytische<br />
Studie am Beispiel der Mercedes-Benz A-Klasse. Universität Tübingen: Dissertation.<br />
Veröffentlichungsdatum: 8. April 2003. Zugriff: 21. November 2007.<br />
.<br />
RUDOLPH, Nils (2006): Off the Pitch. Homepage der Fifa zur Fußball-Weltmeisterschaft<br />
2006. Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2006. Zugriff: 30. Januar 2007.<br />
.<br />
RÜHLE, Angela (2003): Sportprofile deutscher Fernsehsender 2002. In: Media Perspektiven<br />
34. Jg. 2003, Heft 5, S. 216 - 230.<br />
RUSS-MOHL, Stephan (1992): Am eigenen Schopfe. Qualitätssicherung <strong>im</strong> Journalismus <strong>–</strong><br />
Gr<strong>und</strong>fragen, Ansätze, <strong>Nähe</strong>rungsversuche. In: Publizistik 37. Jg. 1992, Heft 1,<br />
S. 83 - 96.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2000): Das sportjournalistische Interview <strong>im</strong> deutschen Fernsehen.<br />
Empirische Vergleichsstudie zu Live-Gesprächen bei Fußballübertragungen auf ARD,<br />
ZDF, RTL, Sat.1, DSF <strong>und</strong> Premiere. Münster: Lit.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2002a): <strong>Sportjournalismus</strong> in Deutschland. In: SCHWIER, Jürgen<br />
[Hg.]: Mediensport. Ein einführendes Handbuch. Hohengehren: Schneider. S. 7 - 26.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2002b): 5 Mark ins Phrasenschwein. Interviews, Gespräche <strong>und</strong><br />
Talkr<strong>und</strong>en in der Sportberichterstattung. In: TENSCHER, Jens/SCHICHA, Christian<br />
[Hg.]: Talk auf allen Kanälen. Angebote, Akteure <strong>und</strong> Nutzer von Fernsehgesprächssendungen.<br />
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 199 - 211.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2003): Mehr als 1:0! Bedeutung des Live-Kommentars bei Fußballübertragungen<br />
<strong>–</strong> eine explorative Fallstudie. In: Medien & Kommunikationswissenschaft<br />
51. Jg. 2003, Heft 1, S. 82 - 104.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2007a): Komplexe <strong>und</strong> Komplexes. In: Journalist 57. Jg. 2007, Nr.<br />
1, S. 36 - 38.<br />
SCHAFFRATH, Michael (2007b): Placebos gegen eine Seuche. In: Journalist 57. Jg. 2007,<br />
Nr. 7, S. 46 - 48.<br />
SCHATZ, Heribert/SCHULZ, Winfried (1992): Qualität von Fernsehprogrammen. Kriterien<br />
<strong>und</strong> Methoden zur Beurteilung von Programmqualität <strong>im</strong> dualen Fernsehsystem. In: Media<br />
Perspektiven 23. Jg. 1992, Heft 11, S. 690 <strong>–</strong> 712.<br />
SCHAUERTE, Thorsten (2002a): Wirkung des Mediensports. In: SCHWIER, Jürgen [Hg.]:<br />
Mediensport. Ein einführendes Handbuch. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.<br />
S. 193 - 210.<br />
SCHAUERTE, Thorsten (2002b): Kanzler oder Kaiser. Hauptsache investigativ! In:<br />
SCHWIER, Jürgen/LEGGEWIE, Claus [Hg.]: Wettbewerbsspiele. Die Inszenierung von<br />
Sport <strong>und</strong> Politik in den Medien. Frankfurt am Main: Campus. S. 42 - 63.<br />
200
SCHAUERTE, Thorsten (2002c): Quotengaranten <strong>und</strong> Minderheitenprogramm. Theoretischempirische<br />
Analyse der Nutzung von medialen Sportangeboten in Deutschland. Berlin:<br />
dissertation.de.<br />
SCHERZER, Hartmut (1998): <strong>Nähe</strong> ja, Verbrüderung nein. In: HACKFORTH, Josef/<br />
SCHAFFRATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern<br />
sich. Berlin: Sportverlag. S. 77 - 86.<br />
SCHEU, Hans-Reinhard (1995): Fair Play. Von der Verantwortung der Medien. In: GER-<br />
HARDT, Volker/LÄMMER, Manfred [Hg.]: Fairness <strong>und</strong> Fair Play. Sankt Augustin: Academia.<br />
S. 156 - 172.<br />
SCHINDELBECK, Dirk (2004): Mittendrin statt nur dabei? Zur Entwicklungsdynamik von<br />
Fußball, Medien <strong>und</strong> Kommerz. In: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung<br />
Das Parlament. 54. Jg. 2004, Nr. 26, S. 16 - 22.<br />
SCHLÖMER, Franz-Josef (2007): Persönliche E-Mail des Sportchefs der Oldenburgischen<br />
Volkszeitung an den Verfasser. Datum: 12. September 2007.<br />
.<br />
SCHMIDT, Siegfried J. (1994): Die Wirklichkeit des Beobachters. In: MERTEN,<br />
Klaus/SCHMIDT, Siegfried J./WEISCHENBERG, Siegfried [Hg.]: Die Wirklichkeit der<br />
Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 3 - 19.<br />
SCHMIDT, Siegfried (2000): Es hängt vom Handwerk ab. In: Message 2. Jg. 2000, Heft 4,<br />
S. 36 - 40.<br />
SCHMIDT, Siegfried J./WEISCHENBERG, Siegfried (1994): Mediengattungen, Berichterstattungsmuster,<br />
Darstellungsformen. In: MERTEN, Klaus/SCHMIDT, Siegfried<br />
J./WEISCHENBERG, Siegfried [Hg.]: Die Wirklichkeit der Medien. Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag. S. 212 - 236.<br />
SCHNEDLER, Thomas (2006): Getrennte Welten? Journalismus <strong>und</strong> PR in Deutschland.<br />
Netzwerkrecherche-Werkstatt Nr. 4/2006. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 6.<br />
November 2006.<br />
.<br />
SCHNEIDER, Wolf/RAUE, Paul-Josef (1998): Handbuch des Journalismus. Reinbek: Rowohlt.<br />
SCHNELL, Reiner/HILL, Paul B./ESSER, Elke (1993): Methoden der empirischen Sozialforschung.<br />
München: Oldenbourg.<br />
SCHNEYDER, Werner (1980): Über Sport. Dabeisein ist gar nichts. Luzern/Frankfurt: Bucher.<br />
SCHNURR, Eva Maria (2006): Offenbarungseid. In: Medium Magazin 21. Jg. 2006, Heft 4,<br />
S. 52 - 53.<br />
SCHÖNHAGEN, Philomen (1998): Unparteilichkeit <strong>im</strong> Journalismus. Tradition einer Qualitätsnorm.<br />
Tübingen: Niemeyer.<br />
SCHÖNHAGEN, Philomen (1999): Der Journalist als unbeteiligter Beobachter. In: Publizistik<br />
44. Jg. 1999, Heft 3, S. 271 - 287.<br />
201
SCHOTT, Dietmar (1998): Zwischen Sulky <strong>und</strong> Baskets. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFF-<br />
RATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin:<br />
Sportverlag. S. 37 - 48.<br />
SCHREIBER-RIETIG, Bianca (1994): Vergangenheitsbewältigung <strong>und</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>. In:<br />
HACKFORTH, Josef/FISCHER, Christoph [Hg.]: ABC des <strong>Sportjournalismus</strong>. München:<br />
Ölschläger. S. 150 - 161.<br />
SCHÜTZ, Hans-Peter (1996): Was kann die Opus-Methode den Zeitungsmachern sagen?<br />
In: Ifra Zeitungstechnik Jg. unbekannt 1996, Heft 2, S. 1 <strong>–</strong> 4.<br />
SCHÜTZ, Walter J. (2005a): Deutsche Tagespresse 2004. In: Media Perspektiven 36. Jg.<br />
2005, Heft 5, S. 205 - 232.<br />
SCHÜTZ, Walter J. (2005b). Redaktionelle <strong>und</strong> verlegerische Struktur der deutschen Tagespresse.<br />
In: Media Perspektiven 36. Jg. 2005, Heft 5, S. 233 - 242.<br />
SCHULTZ JÖRGENSEN, Sören (2002): Industry or independence? Survey of the Scandinavian<br />
sports press. In: Mandag Morgen 14. Jg. 2005, Special Print November 2002 (8.<br />
November 2005). Zugriff: 6. November 2006.<br />
.<br />
SCHULTZ JÖRGENSEN, Sören (2005): The World’s Best Advertising Agency. The Sport<br />
Press. In: Mandag Morgen 17. Jg. 2005, Heft 37 (31. Oktober 2005). Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 2. November 2006. S. 1 - 6.<br />
.<br />
SCHULZ, Eike (1995): Der Hauptsport in der Tageszeitung. Die Publizistische Einheit in<br />
Deutschland. Deutsche Sporthochschule Köln: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
SCHULZ, Eike (2000): TV contra Print. Sage & Schreibe Werkstatt: Sportberichterstattung.<br />
In: Journalist 50. Jg. 2000. Nr. 9, S.14.<br />
SCHULZ, Peter (2008): Tore, Titel <strong>und</strong> Rekorde. Interview mit Thomas Horky. Veröffentlichungsdatum:<br />
1. April 2008. Zugriff: 11. April 2008.<br />
.<br />
SCHULZ, Winfried [Hg.] (1970): Der Inhalt der Zeitungen. Eine Inhaltsanalyse der deutschen<br />
Tagespresse in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland (1967). Mit Quellentexten früher Inhaltsanalysen<br />
in Amerika, Frankreich <strong>und</strong> Deutschland. Düsseldorf: Rheinisch-Bergische<br />
Druckerei- <strong>und</strong> Verlags-Gesellschaft.<br />
SCHUMACHER, Heinz (1998): Stets die Nase <strong>im</strong> Wind. In: HACKFORTH, Josef/SCHAFF-<br />
RATH, Michael [Hg.]: Ein Blick zurück nach vorn. Sportjournalisten erinnern sich. Berlin:<br />
Sportverlag. S. 187 - 200.<br />
SCHUMACHER, Werner (2007): Homepage der Firma Bechtle Graphische Betriebe <strong>und</strong><br />
Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG. Verlagshaus der Eßlinger Zeitung. Veröffentlichungsdatum:<br />
unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
SCHWIER, Jürgen (2000): Sport als populäre Kultur. Sport, Medien <strong>und</strong> Cultural Studies.<br />
Hamburg: Czwalina.<br />
202
SCHWIER, Jürgen (2002): Die Welt zu Gast bei Fre<strong>und</strong>en. Fußball, nationale Identität <strong>und</strong><br />
der Standort Deutschland. In: SCHWIER, Jürgen/LEGGEWIE, Claus [Hg.]: Wettbewerbsspiele.<br />
Die Inszenierung von Sport <strong>und</strong> Politik in den Medien. Frankfurt am Main:<br />
Campus. 79 - 104.<br />
SCHWIER, Jürgen/LEGGWIE, Claus (2002): Medienfußball <strong>und</strong> Medienpolitik. Zwei Seiten<br />
einer Medaille. In: SCHWIER, Jürgen/LEGGEWIE, Claus [Hg.]: Wettbewerbsspiele. Die<br />
Inszenierung von Sport <strong>und</strong> Politik in den Medien. Frankfurt am Main: Campus. S. 7 - 19.<br />
SCHWIER, Jürgen (2004): Aus dem Abseits in Netz. Online-Aktivitäten von Fußballfans. In:<br />
FREI, Peter/KÖRNER, SWEN [Hg.]: Sport <strong>–</strong> Medien <strong>–</strong> Kultur. Sankt Augustin: Academia.<br />
S. 120 - 138.<br />
SEIFART, Horst (1980): Zur Kritik am (Sport-)Journalismus. In: Leistungssport 10. Jg. 1980,<br />
Heft 1, S. 61 - 64.<br />
SEIFART, Horst (1988): Die Dramaturgie einer Sportsendung. In: HOFFMANN-RIEM, Wolfgang<br />
[Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung. Baden-Baden: Nomos.<br />
S. 130 - 136.<br />
SEITZ, Norbert (2004): Was symbolisiert das W<strong>und</strong>er von Bern? In: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte.<br />
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament Jg. unbekannt 2004, Nr. 26,<br />
S. 3 - 6.<br />
SEIWERT-FAUTI, Udo (2006): Eigentor. Aufbegehren gegen den Maulkorb. In: Cut 10. Jg.<br />
2006, Heft 3. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 4. November 2006.<br />
.<br />
SÖLTER, Friedhelm (1999): Mit einem Hauch von gewollter Provinzialität. Veröffentlichungsdatum:<br />
1. Dezember 1999. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
STEFFNY, Manfred (1978): Auf Du <strong>und</strong> Du? Sportler <strong>und</strong> Sportjournalisten. In: HACK-<br />
FORTH, Josef/WEISCHENBERG, Siegfried [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Bad Homburg:<br />
L<strong>im</strong>pert. S. 206 - 214.<br />
STIEHLER, Hans-Jörg (1999): Mediensport als Unterhaltung. Eine Skizze oder: Allgemeinplätze<br />
zu einer aktuellen Medienkultur. Vortrag. Arbeitspapier. Universität Leipzig.<br />
STIEHLER, Hans-Jörg (2003): Riskante Spiele. Unterhaltung <strong>und</strong> Unterhaltungserleben <strong>im</strong><br />
Mediensport. In: FRÜH, Werner/STIEHLER, Hans-Jörg [Hg.]: Theorie der Unterhaltung.<br />
Ein interdisziplinärer Diskurs. Köln: Herbert von Halem Verlag. S. 160 - 181.<br />
STIEHLER, Hans-Jörg/MARR, Mirko (2001): Das Ende der Ausreden. Mediale Diskurse zum<br />
Scheitern <strong>im</strong> Sport. In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER, Walter/GERHARDS, Maria [Hg.]:<br />
Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-Baden: Nomos. S. 111 - 131.<br />
STOLLENWERK, Hans J. (1996): Sport <strong>–</strong> Zuschauer <strong>–</strong> Medien. Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer.<br />
STRATEN, Walter M. (2005): Ein journalistisches Tor. Der Rücktritt von Rudi Völler aus Sicht<br />
der BILD-Zeitung. In: HORKY, Thomas [Hg.]: Erfahrungsberichte <strong>und</strong> Studien zur Fußball-Europameisterschaft.<br />
Hamburg: Horky. S. 31 - 34.<br />
STRAUSS, Bernd (1994): Orientierungen von Sportzuschauern. In: Psychologie <strong>und</strong> Sport 8.<br />
Jg. unbekannt, Heft 1, S. 19 - 25.<br />
203
STRAUSS, Bernd (1996): Über die Identifikation von Zuschauertypen. In: MESSING, Manfred/LAMES,<br />
Martin [Hg.]: Zur Sozialfigur des Sportzuschauers. Niedernhausen: Schors.<br />
S. 187 - 205.<br />
STRAUSS, Bernd (2002): Zuschauer <strong>und</strong> Mediensport. In: SCHWIER, Jürgen [Hg.]: Mediensport.<br />
Ein einführendes Handbuch. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. S.<br />
151 - 172.<br />
STRAUSS, Bernd/MÖLLER, Jens (1994a): Merkmale der Situation als Moderatorvariable<br />
selbstwerterhöhende <strong>und</strong> selbstwertschützende Attributionen in der Sportberichterstattung.<br />
In: ALFERMANN, Dorothee/SCHEID, Volker [Hg.]: Psychologische Aspekte von<br />
Sport <strong>und</strong> Bewegung in Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation. Köln: bps. S. 242 - 247.<br />
STRAUSS, Bernd/MÖLLER, Jens (1994b): Leistungszuschreibungen von Sportjournalisten<br />
an Athleten aus den alten <strong>und</strong> neuen B<strong>und</strong>esländern. In: ALFERMANN, Dorothee/SCHEID,<br />
Volker [Hg.]: Psychologische Aspekte von Sport <strong>und</strong> Bewegung in Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation. Köln: bps. S. 248 - 252.<br />
STRAUSS, Bernd/MÖLLER, Jens (1996): Sprache in der Sportberichterstattung. Leistungserklärungen<br />
von Sportjournalisten während der Fernsehlivekommentierung. In: Medienpsychologie<br />
8. Jg. 1996, Heft 1, S. 34 - 48.<br />
STREITENBERGER, Kerstin/PENSHORN, Susanne (2005): Mit Konzept aus der Krise (?).<br />
Die redaktionellen Strategien der Neuen Westfälischen <strong>und</strong> Hessischen/Niedersächsischen<br />
Allgemeinen. Universität Leipzig: Unveröffentlichte Diplomarbeit.<br />
SUNDERMEYER, Olaf (2007): Testlauf für 2008. In: Journalist 57. Jg. 2007, Nr. 10,<br />
S. 12 - 16.<br />
SUSSEBACH, Henning (2006): Von nun an per Sie. In: Die Zeit 61. Jg. 2006, Nr. 5 (26. Januar<br />
2006). Zugriff: 4. November 2006. www.zeit.de/2006/05/Sport_2fSu_a7ebach_05>.<br />
SVZ (2007): Homepage. Veröffentlichungsdatum: unbekannt. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
TENNERT, Falk (2006): Die St<strong>und</strong>e der Verlierer. Attributionsprozesse zum Ergebnis der<br />
B<strong>und</strong>estagswahl 2002 in den Medien <strong>und</strong> be<strong>im</strong> Publikum. Hochschule für Film <strong>und</strong><br />
Fernsehen Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg: Dissertation. Veröffentlichungsdatum:<br />
5. März 2006. Zugriff: 17. September 2007.<br />
.<br />
TEWES, Günter (1991): Kritik der Sportberichterstattung. Der Sport in der Tageszeitung<br />
zwischen Bildungs-Journalismus, Unterhaltungs-Journalismus <strong>und</strong> 1:0-Berichterstattung.<br />
Eine empirische Untersuchung. Düsseldorf: ohne Verlag.<br />
THOMAS, Jobst (1988): Denn sie leben ja voneinander. Analyse von Sport-Interviews <strong>im</strong><br />
Zweiten Deutschen Fernsehen <strong>und</strong> <strong>im</strong> Fernsehen der DDR. Frankfurt am Main: Lang.<br />
TROSIEN, Gerhard/DINKEL, Michael (1999): Wechselseitige Beziehungen in den Sport- <strong>und</strong><br />
Medienentwicklungen. In: TROSIEN, Gerhard/DINKEL, Michael [Hg.]: Verkaufen Medien<br />
die Sportwirklichkeit? Aachen: Meyer <strong>und</strong> Meyer. S. 11 - 44.<br />
UENK, Renate, LAARMANN, Susanne (1992): Medium Zeitung. Vergleichende Darstellung<br />
<strong>und</strong> Analyse von Werbeträgern. Gesellschaft für Zeitungsmarketing mbH [Hg.]. Frankfurt:<br />
Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung.<br />
204
VDS (1995): Ehrenkodex des Verbandes der Sportjournalisten. Veröffentlichungsdatum:14.<br />
August 1995. Zugriff: 9. Juli 2007.<br />
.<br />
VDS (2005): Über uns. Veröffentlichungsdatum: 2005 (genaues Datum unbekannt). Zugriff:<br />
9. Juli 2007. .<br />
VOM STEIN, Artur (1988): Die Sportmedienspirale. Oder: Spitzensportler <strong>im</strong> Wirkungszentrum<br />
der Massenmedien. In: Hackforth, Josef [Hg.]: Sportmedien & Mediensport. Wirkungen<br />
<strong>–</strong> Nutzung <strong>–</strong> Inhalte der Sportberichterstattung. Berlin: Vistas. S. 37 - 55.<br />
VON WIESE, Leopold (1933): System der Allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen<br />
Prozessen <strong>und</strong> sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre). München <strong>und</strong><br />
Leipzig: Duncker & Humblot.<br />
VOSS, Jochen (2005): <strong>Sportjournalismus</strong> unter der Lupe. B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung:<br />
Dossier Fußball-WM 2006. Veröffentlichungsdatum: 12. Dezember 2005. Zugriff:<br />
30. Oktober 2006. .<br />
VOSS, Jochen (2006): Marler Tage der Fernsehkultur über das R<strong>und</strong>e <strong>im</strong> Eckigen. Veröffentlichungsdatum:<br />
7. April 2006. Zugriff: 30. Oktober 2006.<br />
.<br />
WALKER, Ewald (1983): Lokale Sportberichterstattung in der Tageszeitung. Oder: Woher<br />
kommt die Schlagseite? In: DIGEL, Helmut [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Berichterstattung. Reinbek:<br />
Rowohlt. S. 157 - 167.<br />
WALLISCH, Gianluca (1995): Journalistische Qualität. Definitionen <strong>–</strong> Modelle <strong>–</strong> Kritik. Konstanz:<br />
UVK.<br />
WALTHER, Katy (2006): Die Hoffnung stirbt zuletzt. In: Medium Magazin 21. Jg. 2006, Heft<br />
6, S. 58 - 59.<br />
WEHRLE, Thomas (2001): <strong>Sportjournalismus</strong> <strong>und</strong> Moral. Oder: Dichtung <strong>und</strong> Wahrheit in<br />
der ballorientierten Unterhaltungsindustrie des 21. Jahrh<strong>und</strong>erts. In: ROTERS, Gunnar/KLINGLER,<br />
Walter/GERHARDS, Maria [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Sportrezeption. Baden-<br />
Baden: Nomos. S. 111 - 131.<br />
WEINER, Bernard (1988): Motivationspsychologie. München, Weinhe<strong>im</strong>.<br />
WEINREICH, Jens (2004): Bunte Storys über Olympia. In: Message 6. Jg. 2004, Heft 3,<br />
S. 16 - 21.<br />
WEINREICH, Jens (2005): Die Promoter des Sports. In: Message 7. Jg. 2005, Heft 2,<br />
S. 37 - 42.<br />
WEINREICH, Jens (2006): WM-Wahnsinn vor dem Anpfiff. In: Message 8. Jg. 2006, Heft 2,<br />
S. 10 - 13.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried (1976): Die Außenseiter der Redaktion. Struktur, Funktion <strong>und</strong><br />
Bedingungen des <strong>Sportjournalismus</strong>. Bochum: Brockmeyer.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried (1978): Sport <strong>und</strong> Druckmedien. In: HACKFORTH, Josef/<br />
WEISCHENBERG, Siegfried [Hg.]: Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Bad Homburg: L<strong>im</strong>pert.<br />
S. 12 - 19.<br />
205
WEISCHENBERG, Siegfried (1988): <strong>Sportjournalismus</strong> zwischen Mode <strong>und</strong> Methode. In:<br />
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang [Hg.]: Neue Medienstrukturen <strong>–</strong> neue Sportberichterstattung.<br />
Baden-Baden: Nomos. S. 66 - 89.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried (1992): Die Verantwortung des Beobachters. Moderne Medienethik<br />
aus der Perspektive einer konstruktivistischen Systemtheorie. In: R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong><br />
Fernsehen 40. Jg. 1992, Heft 4, S. 507 - 527.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried (1994): Annäherungen an die Außenseiter. Theoretische Einsichten<br />
<strong>und</strong> vergleichende empirische Bef<strong>und</strong>e zu Wandlungsprozessen <strong>im</strong> <strong>Sportjournalismus</strong>.<br />
In: Publizistik 39. Jg. 1994, Heft 4, S. 428 - 452.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried (2005): Der Schein trügt. In: Die Zeit 60. Jg. 2005, Nr. 41<br />
(6. Oktober 2005). Zugriff: 4. November 2006.<br />
.<br />
WEISCHENBERG, Siegfried/ MALIK, Maja/SCHOLL, Armin (2006): Journalismus in<br />
Deutschland 2005. In: Media Perspektiven 37. Jg. 2006, Heft 7, S. 346 - 361.<br />
WEISS, Ottmar (1991): Mediensport als sozialer Ersatz. In. Medienpsychologie 3. Jg. 1991,<br />
Heft 4., S. 316 - 327.<br />
WERNECKEN, Jens (2000): Wir <strong>und</strong> die anderen. Nationale Stereotypen <strong>im</strong> Kontext des<br />
Mediensports. Berlin: Vistas.<br />
WERNIG, Margret (1985): Sport <strong>und</strong> Massenmedien. Düsseldorf: Bagel.<br />
WILKE, Jürgen (2003): Zur Geschichte der journalistischen Qualität. In: BUCHER, Hans-<br />
Jürgen/ALTMEPPEN, Klaus-Dieter [Hg.]: Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Gr<strong>und</strong>lagen <strong>–</strong><br />
D<strong>im</strong>ensionen <strong>–</strong> Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 35 - 54.<br />
WILKE, Jürgen (2002): Pressegeschichte. In: NOELLE-NEUMANN, Elisabeth/SCHULZ,<br />
Winfried/WILKE, Jürgen [Hg.]: Das Fischer Lexikon. Publizistik Massenkommunikation.<br />
Frankfurt am Main: S. Fischer. S. 460 - 492.<br />
WILKESMANN, Uwe (2006): Auf der Bank schmeckt das Weißbier noch besser! In: PR Magazin<br />
37. Jg. 2006, Heft 7, S. 36.<br />
WIPPER, Herdin (2003): Sportpresse unter Druck. Die Entwicklung der Fußballberichterstattung<br />
in den b<strong>und</strong>esdeutschen Printmedien. Eine komparative Studie am Beispiel der<br />
Fußball-Weltmeisterschaften 1990 <strong>und</strong> 1998. Dissertation. Veröffentlichungsdatum:<br />
2. September 2003. Zugriff: 1. November 2006.<br />
.<br />
WYSS, Vinzenz (2003): Journalistische Qualität <strong>und</strong> Qualitätsmanagement. In: BUCHER,<br />
Hans-Jürgen/ALTMEPPEN, Klaus-Dieter [Hg.]: Qualität <strong>im</strong> Journalismus. Gr<strong>und</strong>lagen <strong>–</strong><br />
D<strong>im</strong>ensionen <strong>–</strong> Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 127 - 145.<br />
ZOERNER, Hendrik (2005): DJV begrüßt Untersuchung. Pressemitteilung. Veröffentlichungsdatum:<br />
6. Oktober 2005. Zugriff: 28. Oktober 2006.<br />
.<br />
ZUBAYR, Camille/GERHARD, Heinz (2002): Fußball-WM 2002. Ein Fernsehhighlight aus<br />
Sicht der Zuschauer. In: Media Perspektiven 33. Jg. 2002, Heft 7, S. 308 - 313.<br />
206
ZUBAYR, Camille/GERHARD, Heinz (2004): Die Fußball-Europameisterschaft 2004 <strong>im</strong><br />
Fernsehen. In: Media Perspektiven 35. Jg. 2004, Heft 9, S. 421 - 425.<br />
ZUBAYR, Camille/GEESE, Stefan/GERHARD, Heinz (2004): Olympia 2004 <strong>im</strong> Fernsehen.<br />
In: Media Perspektiven 35. Jg. 2004, Heft 10, S. 466 - 471.<br />
207
9.5 Selbständigkeitserklärung<br />
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit in allen Teilen selbständig verfasst<br />
<strong>und</strong> keine anderen als die angegebenen Quellen <strong>und</strong> Hilfsmittel (einschließlich elektroni-<br />
scher Medien <strong>und</strong> Online-Quellen) benutzt habe. Alle wörtlich oder sinngemäß übernomme-<br />
nen Textstellen habe ich als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Arbeit wurde bisher<br />
keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.<br />
Name: Sebastian A. Reichert<br />
Matrikelnummer: 87 62 056<br />
Leipzig, 18. April 2008<br />
Sebastian A. Reichert<br />
208