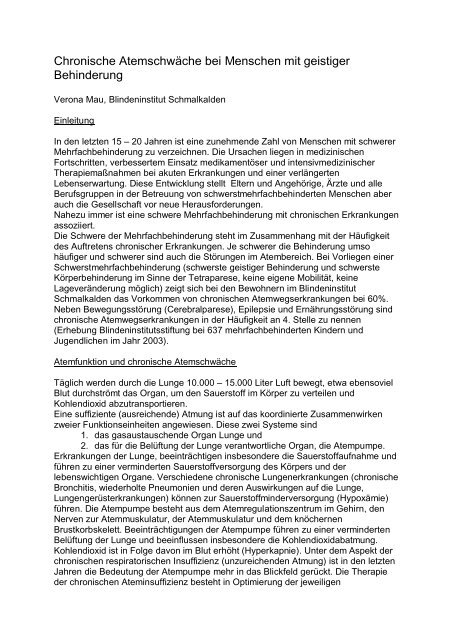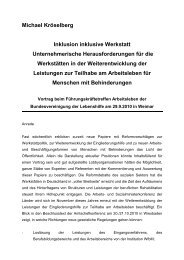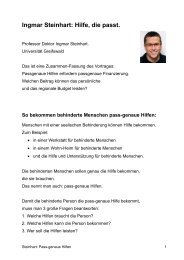Beitrag Frau Mau (pdf - 19.4 KB)
Beitrag Frau Mau (pdf - 19.4 KB)
Beitrag Frau Mau (pdf - 19.4 KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Chronische Atemschwäche bei Menschen mit geistiger<br />
Behinderung<br />
Verona <strong>Mau</strong>, Blindeninstitut Schmalkalden<br />
Einleitung<br />
In den letzten 15 – 20 Jahren ist eine zunehmende Zahl von Menschen mit schwerer<br />
Mehrfachbehinderung zu verzeichnen. Die Ursachen liegen in medizinischen<br />
Fortschritten, verbessertem Einsatz medikamentöser und intensivmedizinischer<br />
Therapiemaßnahmen bei akuten Erkrankungen und einer verlängerten<br />
Lebenserwartung. Diese Entwicklung stellt Eltern und Angehörige, Ärzte und alle<br />
Berufsgruppen in der Betreuung von schwerstmehrfachbehinderten Menschen aber<br />
auch die Gesellschaft vor neue Herausforderungen.<br />
Nahezu immer ist eine schwere Mehrfachbehinderung mit chronischen Erkrankungen<br />
assoziiert.<br />
Die Schwere der Mehrfachbehinderung steht im Zusammenhang mit der Häufigkeit<br />
des Auftretens chronischer Erkrankungen. Je schwerer die Behinderung umso<br />
häufiger und schwerer sind auch die Störungen im Atembereich. Bei Vorliegen einer<br />
Schwerstmehrfachbehinderung (schwerste geistiger Behinderung und schwerste<br />
Körperbehinderung im Sinne der Tetraparese, keine eigene Mobilität, keine<br />
Lageveränderung möglich) zeigt sich bei den Bewohnern im Blindeninstitut<br />
Schmalkalden das Vorkommen von chronischen Atemwegserkrankungen bei 60%.<br />
Neben Bewegungsstörung (Cerebralparese), Epilepsie und Ernährungsstörung sind<br />
chronische Atemwegserkrankungen in der Häufigkeit an 4. Stelle zu nennen<br />
(Erhebung Blindeninstitutsstiftung bei 637 mehrfachbehinderten Kindern und<br />
Jugendlichen im Jahr 2003).<br />
Atemfunktion und chronische Atemschwäche<br />
Täglich werden durch die Lunge 10.000 – 15.000 Liter Luft bewegt, etwa ebensoviel<br />
Blut durchströmt das Organ, um den Sauerstoff im Körper zu verteilen und<br />
Kohlendioxid abzutransportieren.<br />
Eine suffiziente (ausreichende) Atmung ist auf das koordinierte Zusammenwirken<br />
zweier Funktionseinheiten angewiesen. Diese zwei Systeme sind<br />
1. das gasaustauschende Organ Lunge und<br />
2. das für die Belüftung der Lunge verantwortliche Organ, die Atempumpe.<br />
Erkrankungen der Lunge, beeinträchtigen insbesondere die Sauerstoffaufnahme und<br />
führen zu einer verminderten Sauerstoffversorgung des Körpers und der<br />
lebenswichtigen Organe. Verschiedene chronische Lungenerkrankungen (chronische<br />
Bronchitis, wiederholte Pneumonien und deren Auswirkungen auf die Lunge,<br />
Lungengerüsterkrankungen) können zur Sauerstoffminderversorgung (Hypoxämie)<br />
führen. Die Atempumpe besteht aus dem Atemregulationszentrum im Gehirn, den<br />
Nerven zur Atemmuskulatur, der Atemmuskulatur und dem knöchernen<br />
Brustkorbskelett. Beeinträchtigungen der Atempumpe führen zu einer verminderten<br />
Belüftung der Lunge und beeinflussen insbesondere die Kohlendioxidabatmung.<br />
Kohlendioxid ist in Folge davon im Blut erhöht (Hyperkapnie). Unter dem Aspekt der<br />
chronischen respiratorischen Insuffizienz (unzureichenden Atmung) ist in den letzten<br />
Jahren die Bedeutung der Atempumpe mehr in das Blickfeld gerückt. Die Therapie<br />
der chronischen Ateminsuffizienz besteht in Optimierung der jeweiligen
Grunderkrankung sowie bei Gasaustauschstörungen in Sauerstoffgabe und bei<br />
Atempumpenstörungen in einer mechanischen Unterstützung der Atmung.<br />
Chronische Atemwegserkrankungen bei schwerer Mehrfachbehinderung<br />
Ursächlich liegen dem häufigen Auftreten von Atemwegserkrankungen bei Menschen<br />
mit geistiger Behinderung und schwerer Mehrfachbehinderung vielfältige<br />
Wechselwirkungen zu Grunde. Unter anderem spielen eine veränderte<br />
Atemmechanik und Atemfunktion bei Immobilität, erschwertes Abhusten und eine mit<br />
der schweren Bewegungsstörung häufig verbundene Koordinationsstörungen im<br />
Mund- und Rachenbereich eine Rolle. „Aussetzer“ der Atmung im Schlaf, Dysphagie<br />
(Schluckstörung) und Aspirationsgefahr (Gefahr des „Verschluckens“) sind die Folge<br />
und stellen äußerst belastende Situationen im Alltag dieser Menschen dar. Zusätzlich<br />
werden die Atemwege durch den Rückfluss von Mageninhalt und damit verbundene<br />
Aspirationen gefährdet. Eine erschwerte Atmung, z. B. durch starke Verschleimung<br />
mit „schnorchelnder“ Atmung, ist mit Angst und Stresserfahrung sowohl für die<br />
betroffenen schwerstmehrfachbehinderten Menschen als auch für die betreuenden<br />
Mitarbeiter verbunden. Atemstörungen sind in ganz besonderer Weise mit „vitaler<br />
Bedrohung“ verknüpft.<br />
Bei Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung ist das Zusammenwirken von<br />
chronischen Lungenerkrankungen (chronische Bronchitis, rezidivierende<br />
Aspirationspneumonien), besonders im Schlaf vorkommenden<br />
Atemregulationsstörungen sowie vorliegenden Wirbelsäulen- und<br />
Brustkorbdeformitäten die Ursache von schweren Störungsbildern, die zur<br />
Entwicklung einer Atemschwäche bzw. chronischen Ateminsuffizienz führen.<br />
Zeichen einer mangelhaften Atemfunktion zeigen sich in Auffälligkeiten der Atmung<br />
selbst mit Atemnot oder erhöhter Atemfrequenz, in Unruhe, erhöhter Herzfrequenz,<br />
gehäuften Atemwegsinfekten bis hin zu wiederholten Pneumonien, Gedeihstörung<br />
und verminderter Leistungsfähigkeit. Die Störungen der Atmung treten häufig zuerst<br />
im Schlaf auf und verhindern einen erholsamen Schlaf. Nächtliches Schwitzen und<br />
Tagesmüdigkeit sind zu beobachten. Bei deutlich erniedrigten Sauerstoffwerten im<br />
Blut zeigt sich eine Zyanose (bläuliche Verfärbung) der Haut. Deutlich erhöhte<br />
Kohlenstoffdioxidwerte sind mit zunehmender Bewusstseinstrübung verbunden und<br />
weisen auf die Erschöpfung der Atempumpe hin. Die Symptome beginnen bei<br />
Menschen mit geistiger Behinderung oft schleichend und sind durch die schwere<br />
Mehrfachbehinderung maskiert. So wird den Zeichen der beginnenden<br />
Ateminsuffizienz erst spät Beachtung geschenkt oder die Symptomatik wird als<br />
unveränderlich im Zusammenhang mit der schweren Mehrfachbehinderung<br />
hingenommen.<br />
Zur Diagnostik der chronischen Atemschwäche gehören die ausführliche Erhebung<br />
der Krankengeschichte und des Beschwerdebildes sowie die körperliche<br />
Untersuchung. Die Messung der Sauerstoffsättigung mittels Fingersensor gibt bereits<br />
einen guten Überblick zur Sauerstoffversorgung, sollte aber durch eine<br />
Blutgasanalyse ergänzt werden, um auch Kohlenstoffdioxid beurteilen zu können.<br />
Die Röntgenaufnahme des Thorax lässt oft keine differenzierte Beurteilung zu, da sie<br />
nicht unter Standardbedingengen angefertigt werden kann und Skoliosen der<br />
Wirbelsäule die Aussage erschweren. Wichtigste diagnostische Untersuchung ist die<br />
Polysomnografie (Schlafuntersuchung). Hier werden während des Schlafes<br />
verschieden Parameter (EEG, EKG, Atemfluss, Atembewegungen,
Sauerstoffsättigung u.a.) erfasst und kontinuierlich aufgezeichnet. Selbst bei<br />
schwerster Mehrfachbehinderung ist diese Untersuchung im Schlaflabor<br />
durchführbar, bedarf allerdings des Eingehens und Anpassens auf individuelle<br />
Besonderheiten bei schwerbehinderten Patienten.<br />
Bei Vorliegen einer chronischen Atemschwäche besteht die Therapie in der<br />
Therapieoptimierung der zugrunde liegenden Störung (Medikamente,<br />
Inhalationstherapie, Atemtherapie, Sekretmobilisation) und zusätzlich ggf. in<br />
Sauerstoffgabe oder Beatmungstherapie. Die Beatmungstherapie ist bei Menschen<br />
mit Muskelerkrankungen seit über 20 Jahren etabliert und wird heute meist als<br />
nichtinvasive Beatmung über eine Maske durchgeführt. Bei Menschen mit geistiger<br />
und mehrfacher Behinderung wirft diese Therapie viele Fragen auf und ist<br />
insbesondere wegen fehlender Kooperationsmöglichkeiten kritisch gesehen. Das<br />
folgende Fallbeispiel eines jungen Mannes mit schwerer Mehrfachbehinderung<br />
schildert den Einsatz von Beatmungstherapie.<br />
Falldarstellung<br />
A.P. ,22 Jahre alt, schwerst geistig und mehrfachbehindert, lebt in einer<br />
Wohneinrichtung für sehbehinderte mehrfachbehinderte Menschen.<br />
Ursache der Behinderung ist eine Virusinfektion während der Schwangerschaft und<br />
eine damit im Zusammenhangs stehende vorzeitige Geburt in der 32.<br />
Schwangerschaftswoche. Im Verlauf entwickelte sich eine schwere<br />
Bewegungsstörung (Cerebralparese mit Tetraspastik), eine Epilepsie und<br />
zunehmende Ernährungsprobleme. Im Alter von 14 Jahren erfolgte die Anlage einer<br />
Magensonde (PEG), die später in eine Darmsonde (PEJ) umgewandelt wurde. Im<br />
Rahmen der Cerebralparese entwickelte sich eine schwere Skoliose mit<br />
ausgeprägter Thoraxdeformierung. Atemwegserkrankungen (wiederholte<br />
Lungeninfekte) und nächtliche Atemstörungen (obstruktives Schlafapnoesyndrom)<br />
führten im Zusammenspiel mit der Skoliose im Alter von 21 Jahren zur chronischen<br />
Atemschwäche. A.P. zeigte Symptome der erschwerten Atmung, hatte eine erhöhte<br />
Herzfrequenz, schlief am Tage viele Stunden und reagierte kaum noch auf<br />
Angebote. Die Schlafuntersuchung (PSG) und Blutgasanalyse führten zur Diagnose<br />
einer schweren gemischten Atemstörung und zeigten als mögliche Therapieoption<br />
die nichtinvasive Beatmung mittels Gesichtsmaske auf. Im Zusammenhang mit der<br />
schweren Mehrfachbehinderung und fehlender Kooperationsmöglichkeiten wurde die<br />
Einleitung der Therapie zunächst zurückgestellt und für nicht durchführbar gehalten.<br />
A.P geriet in kurzer Zeit zunehmend in den Zustand der Kohlendioxidvergiftung<br />
(Hyperkapnie) mit Bewusstseinstrübung. In einer interdisziplinären Fallkonferenz<br />
wurde nochmals die Beatmungstherapie diskutiert und ein Beatmungsversuch<br />
vereinbart. A.P. tolerierte die Gesichtsmaske gut. Bereits nach einer Nacht<br />
Beatmungstherapie war er am Folgetag wieder wacher und zeigte Interesse an<br />
seinem Umfeld. Nach wenigen Tagen Beatmung normalisierten sich die<br />
Blutgaswerte. Die Entlassung aus der Klinik für Beatmungsmedizin war nach<br />
umfangreichen Vorbereitungen der Wohneinrichtung möglich. Seit 1 Jahr und 3<br />
Monaten wird bei A.P. jede Nacht die Beatmungsmaske angelegt. Sein Zustand hat<br />
sich sehr gut stabilisiert, Komplikationen oder Atemwegsinfekte traten nicht auf, tags<br />
har er eine ausreichende Eigenatmung, er verfolgt wach und aufmerksam die<br />
Geschehnisse in seiner Wohngruppe und kann die Schule besuchen. Etwa alle 14<br />
Tage verbringt A.P. ein Wochenende in seiner Familie und wird auch dort nachts<br />
beatmet.
Diskussion<br />
Bisher gibt es nur vereinzelt Fälle von Beatmung bei erwachsenen Menschen mit<br />
geistiger Behinderung und chronischer Atemschwäche. Jeder Fall bedarf einer<br />
individuellen Entscheidungsfindung. Fragen nach dem möglichen Wunsch der<br />
Betroffenen lassen sich nicht eindeutig beantworten. Ein vorsichtiges Annähern kann<br />
über die Beobachtung und Auseinandersetzung mit der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität gelingen. Der Gewinn an Lebenszufriedenheit durch Beatmung ist in<br />
Studien bei Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen untersucht (Bach, 1991;<br />
Paditz, 2003). Die Betroffenen fühlen sich durch die Beatmung weniger<br />
beeinträchtigt, als Eltern und Pflegepersonen vermuten. Insbesondere moderne<br />
technische Möglichkeiten der nichtinvasiven Beatmung mittels Nasen- oder<br />
Gesichtsmaske stellen eine mögliche Therapieoption auch für Menschen mit<br />
schweren Mehrfachbehinderungen dar.<br />
Die Verbesserung der Lebensqualität in dem Fallbeispiel zeigt sich unter anderem in:<br />
• Verminderung der Symptome der Ateminsuffizienz (Atemnot, Müdigkeit)<br />
• weniger bzw. keine akuten Atemwegserkrankungen<br />
• Gewichtszunahme (geringerer Kalorienbedarf durch Abnahme der Atemarbeit)<br />
• verbesserte Leistungsfähigkeit (Interesse am Wohngruppenalltag,<br />
emotionales Mitschwingen, Teilnahme am Unterricht) und Lebensfreude<br />
• Zunahme der Lebenserwartung.<br />
Eine hohe Herausforderung stellt die Beatmungstherapie für Angehörige und /oder<br />
Mitarbeiter der Förder- und Wohneinrichtungen dar. Voraussetzungen für eine<br />
gelingende Beatmung bei Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung sind<br />
interdisziplinäre Vernetzung, Zeit, Empathie, koordinierte Vorbereitung und<br />
begleitendes Beatmungsmanagement (Technikservice ständig erreichbar,<br />
regelmäßige ärztliche Untersuchung mit monatlichen Blutgaskontrollen, halbjährliche<br />
Kontrolle im Beatmungszentrum) sowie gesicherte fachliche Betreuung und<br />
Finanzierung.<br />
Wünschenswert ist eine Sensibilisierung aller Verantwortlichen in der<br />
Gesundheitssorge bei Menschen mit geistiger und schwerer Mehrfachbehinderung<br />
für das Thema chronischer Atemwegserkrankungen. Es bedarf der frühzeitigen<br />
Risikoerkennung einer sich entwickelnden chronischen Atemschwäche und des<br />
Bemühens um Therapieoptimierung, inklusive regelmäßiger Atemtherapie. Eine<br />
maschinelle Atemunterstützung sollte auch bei Menschen mit geistiger und schwerer<br />
Mehrfachbehinderung als mögliche Therapieoption geprüft werden und nicht von<br />
vornherein ausgeschlossen werden.<br />
Lit.:<br />
Bach JR u.a. (1991) Life satisfaction of individuals with Duchenne musculatur<br />
dystrophy using long-term mechanical ventilatory support. M J Phys Med Rehabil 70:<br />
129 - 135<br />
Mellies U u.a. (2003) Progrediente neuromuskuläre Erkrankungen. Chronisches<br />
Atemmuskelversagen und schlafbezogene Atmungsstörungen. Kinderheilkunde Bd<br />
151
Mellies U u.a. (2003) Nichtinvasive Beatmung bei neuromuskulären Erkrankungen.<br />
Kinderheilkunde Bd 151<br />
Mellies U u.a. (2008) Kinder mit chronischer respiratorischer Insuffizienz und<br />
Langzeitbeatmung. In Zernikow B Palliativversorgung. Springer Verlag 2008: 366 -<br />
377<br />
Paditz E u.a. (2003) Lebensqualität unter intermittierender Selbstbeatmung.<br />
Kinderheilkunde Bd 151<br />
Winterholler M (2007) Häusliche Beatmung bei neuromuskulären Erkrankungen.<br />
Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Heft 1 2007