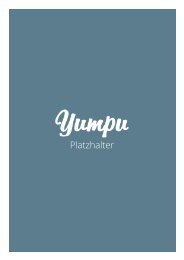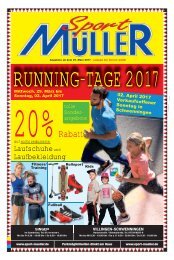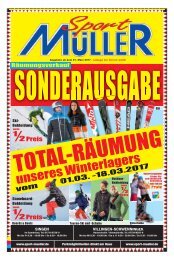Schwehr Gartenbau 2019
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bild: BGL<br />
AUSGABE <strong>2019</strong><br />
M A G A Z I N RUND UM DIE GARTENGESTALTUNG
Ü B E R U N S 19<br />
Bilder: sinnbildli.ch Sauter/LGS Lahr (Thomas, 2) · LGS Nagold (Susanne, 1)<br />
Seit 1963 gestaltet Garten- und Landschaftsbau<br />
<strong>Schwehr</strong> in Engen und Umgebung Privatgärten<br />
und öffentliche Grünanlagen. <strong>Schwehr</strong> ist Mitglied im<br />
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.<br />
und hat sich am nördlichen Bodenseeufer, im Landkreis<br />
Konstanz, im Hegau, in Tuttlingen und Villingen-Schwenningen<br />
einen Namen für anspruchsvolle Projekte im<br />
Garten- und Landschaftsbau gemacht.<br />
Neue Trends in der Gartengestaltung setzt Garten-<br />
und Landschaftsbau <strong>Schwehr</strong> mit einem Team aus hoch<br />
Richard-Stocker-Straße 3, 78234 Engen | Fon 07733 8302 |<br />
qualifizierten Land schaftsgärtnerinnen und -gärtnern<br />
hand werklich gekonnt um. Im Haus- und Privatgarten<br />
reicht das Leistungsspektrum von Schwimmteichen und<br />
Naturpools über We ge, Sitzplätze, Terrassen sowie Natursteinmauern<br />
bis hin zu Beleuchtungskonzepten. Auch<br />
beim Unterhalt von Gärten ist Garten- und Landschaftsbau<br />
<strong>Schwehr</strong> ein kompetenter Partner: Rasenpflege,<br />
Baumpflege mit Kletterseiltechnik, Pflege von Blüh- und<br />
Grünpflanzen gehören zum Service-Programm. Garten-<br />
und Landschaftsbau <strong>Schwehr</strong> verfügt über fundiertes<br />
info@garten-schwehr.de<br />
Wissen, wenn es um ökologische Aspekte wie Regenwassermanagement,<br />
Dach- und Fassadenbegrünung geht.<br />
Die Mitarbeitenden zeichnet neben umfangreichen botanischen<br />
Kenntnissen ein routinierter Umgang mit Materialien<br />
wie Natursteinen, Betonwerksteinen und Holz aus.
2<br />
EDITORIAL<br />
Ein Garten und eine Bibliothek – an<br />
dem, was für Cicero zum Glück<br />
ge hörte, hat sich auch nach mehr als 2000 Jahren<br />
nichts geändert. Ein Stuhl im Grünen und ein gutes<br />
Buch – so kann man je nach Lektüre entspannte, gefühlvolle<br />
oder aufregende Wochenenden verbringen.<br />
An heißen Tagen kann es einem dabei ganz schön<br />
warm werden. »Tropentage« mit Temperaturen von 30<br />
Grad und mehr erleben wir immer häufiger. Ein üppig<br />
bepflanzter Garten, in dem vielleicht noch ein Quellstein<br />
oder Teich für Abkühlung sorgt, ist dann wie eine<br />
kleine Klimaanlage – mit dem richtigen Sonnenschutz<br />
wird es perfekt. Gute Schattenspender sind auch Bäume.<br />
Dazu muss der Garten gar nicht übermäßig groß<br />
sein. Es gibt viele attraktive Hausbäume, die sich auch<br />
für kleine Flächen eignen. Einige lernen Sie in diesen<br />
GartenVisionen kennen.<br />
Die Kehrseite der Hitzetage sind sehr starke Regenfälle.<br />
Auch sie kommen immer häufiger vor. Gut, wenn<br />
das Wasser dann in lockeren Böden und Beeten versickern<br />
kann, statt den Kanal zu belasten. Sammelt man<br />
es in einer Zisterne, kann man es zur Gartenbewässerung<br />
nutzen.<br />
In den neuen GartenVisionen finden Sie viele Tipps,<br />
wie Ihr Garten auch bei Wetterextremen eine gemäßigte<br />
Klimazone bleibt. Wir unterstützen Sie dabei jederzeit<br />
gerne mit Gestaltungsideen!<br />
Viel Spaß beim Stöbern und Träumen wünscht<br />
Ihnen<br />
Hast du einen<br />
GARTEN<br />
und eine Bibliothek,<br />
dann hast du alles, was du brauchst. [ CICERO ]<br />
Ingo <strong>Schwehr</strong> & Team<br />
Bild: sinnbildli.ch/Thomas im Park der Gärten
INHALT<br />
3<br />
P F L A N Z E N<br />
DUFTE SACHE 4<br />
G E S T A L T U N G<br />
WASSERWÄNDE 6<br />
Ö K O L O G I E<br />
WASSER SAMMELN 8<br />
G E S T A L T U N G<br />
LIEBLINGSPLÄTZE 9<br />
B E S C H A T T U N G<br />
SEGEL SETZEN 12<br />
G E H Ö L Z E<br />
GARTENBÄUME 14<br />
E S S B A R<br />
„HIGH“DELBEEREN 16<br />
H E R Z L i CH<br />
WiLLKOMMEN<br />
K O C H B A R<br />
BLAUER KARTOFFELSALAT · TIRAMICOTTA 17<br />
W I S S E N S W E R T E S<br />
GRÜNES NETZWERK 18<br />
I M P R E S S U M<br />
T E X T E . B I L D E R . G R A F I K .<br />
Redaktion, Organisation, Konzeption, Texte*: Susanne Wannags<br />
Kreation, Art Director, Layout: Thomas Pichler • Kontakt: Straußbergstr. 11, 87484 Nesselwang<br />
Tel. 08361 446060 oder 0831 69726544 · www.sinnbildlich.net · mail@sinnbildlich.net<br />
Druck: Schirmer Medien GmbH, Ulm<br />
*) Ausnahmen: Pflanzentext, Seite 4 und Rezepte, Seite 17<br />
Bilder: sinnbildlich/Pichler bei Haarmann; Miniaturabbildungen: Siehe auf den jeweiligen Seiten der Originalbilder<br />
Alle Stiche bzw. Illustrationen: ©Dover Publications, New York
4 PFLANZEN<br />
DUFTE SACHE<br />
Hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken –<br />
damit der Garten ein rundum sinnliches Erlebnis ist,<br />
gehören Duftpflanzen unbedingt dazu.<br />
m Küchengarten verströmen Kräuter, Würzstauden<br />
und Kleingehölze ihren aromatischen<br />
I<br />
Geruch. An sonnigen Tagen duftet es noch intensiver,<br />
weil die ätherischen Öle sich durch die<br />
Wärme entfalten. Kräuter wie Lavendel, Rosmarin,<br />
Thymian, Oregano, Salbei, Minze, Melisse<br />
sind nur dieser wärmeliebenden Pflanze.<br />
Die Liste ist lang und jeder, der gerne kocht,<br />
weiß, wie wichtig die un terschiedlichen Aromen<br />
für die Küche sind. Um so schöner, wenn man<br />
sie mit vollen Händen ern ten kann. Ernten oder<br />
einfach streicheln – einige Kräuter sind so genannte<br />
»Berührungsdufter« und danken die<br />
Streichel einheit mit ihrem Wohlgeruch. Dazu<br />
gehören zum Beispiel Zi tro nenmelisse und<br />
Minze.<br />
Unter den Duftpflanzen gibt es ferner solche,<br />
die während ihrer Blüte den ge samten<br />
Gar ten mit ihrem Duft füllen – man denke an<br />
den Blauregen oder in südlichen Gefilden den<br />
Echten Jasmin. Aber auch viele Lilien, Pfingstrosen<br />
und nicht zuletzt na tür lich auch viele<br />
Rosensorten verströmen einen be tö renden<br />
Duft. Und dann gibt es die Pflanzen, die einen<br />
mit ihrem Duft überraschen, wenn<br />
wir ihnen näher kommen. Die eleganten<br />
Blü ten rispen der Silberkerze,<br />
die Trug dolden des Mädesüß, viele<br />
Tag lilien und Phloxe oder gar das eher unspektakuläre<br />
Tautropfengras, das einen<br />
intensiven Duft nach Koriander verströmt.<br />
Erkundet man seinen Garten<br />
der Nase nach, eröffnet sich einem<br />
meist eine noch nicht ge kannte Di mension.<br />
Wie bei allen Düf ten gilt auch bei Pflanzen<br />
düften, dass die Geruchs wahr nehmung<br />
von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.<br />
Manche lie ben moschusartig schwere Düfte,<br />
anderen ist diese Nuance zuwider. So auch<br />
der »Raubtierkäfiggeruch« der Kaiserkrone –<br />
als Parfüm sicherlich un denk bar, aber im<br />
Garten ist er so unmittelbar mit dem Frühling<br />
verknüpft, dass man ihn einfach mö gen muss.<br />
Überhaupt um hüllt uns der Frühling reich mit<br />
Blütendüften. Schon die ersten Frühjahrsboten<br />
– die Winterlinge und Schneeglöckchen<br />
– verkünden mit ihrem Duft das Ende des Win<br />
1
5<br />
2<br />
ters. Viele der frühjahrsblühenden<br />
Zwie <br />
bel gewächse haben<br />
einen ausge spro che <br />
nen Wohl duft – man<br />
denke an Narzissen, Hyazinthen,<br />
Tulpen und Maiglöckchen.<br />
Neben duf ten den Stauden<br />
und Zwie belpflanzen gibt es natürlich<br />
auch Ge hölze mit duftenden Blüten, wie<br />
den Bo dnant, Schnee ball, Zaubernuss<br />
und Flie der. Manche Pflanzen haben<br />
sich auf die Be stäu bung durch nachtschwärmende<br />
Insekten einge stellt. Um<br />
diese anzulocken, sind ihre Blüten nicht<br />
nur meist heller und strahlender in der Farbe,<br />
sondern sie verströmen einen Duft, den<br />
auch wir als be tö rend wahrnehmen – man<br />
denke an das Garten geiß blatt, die Nachtkerze<br />
oder die Mondviolen. Nahe der Terrasse<br />
gepflanzt, kann man so den Sommer abend<br />
im süßen Duft verbringen. Probieren Sie es<br />
aus – wir wünschen sinnliche Genüsse!<br />
Text und Bilder: Hannah Nußbaumer<br />
3<br />
6<br />
1 Iris barbata ‚Serenity Prayer‘<br />
2 Paeonia tenuifolia ,Plena’<br />
3 Dianthus plumarius<br />
4 Rosa ,Sternenflor’<br />
5 Hemerocallis ,Sweet Tanja’<br />
6 Phlox subulata ,Bavarian’<br />
5<br />
4<br />
7<br />
1 Die Schokoladen-Kosmee riecht nach Zartbitterschokolade.<br />
2 Viele Phloxe duften lieblich.<br />
3 Der typische „Raubtiergeruch“ der Kaiserkrone gehört einfach zum Frühling dazu!<br />
4 Honigsüßes Aroma verströmen die Silberkerzen.<br />
5 Minze – ob im Topf oder im Beet – ist schon wegen des frisch-würzigen Geruchs ein Muss!<br />
6 Der Bodnant-Schneeball betört im zeitigen Frühjahr mit seinem Duft.<br />
7 Lavendel – ein Duftklassiker!
6<br />
GESTALTUNG<br />
Z<br />
WASSERWÄNDE<br />
ier- und Schwimmteiche, Brunnen und Quellsteine<br />
– in vielen Gärten bringt eines oder<br />
auch mehrere dieser Elemente Erfrischung. Obwohl<br />
optisch attraktiv, führen Wasserwände in privaten<br />
Gärten noch ein Nischendasein. Häufiger<br />
sind sie in Innenräumen zu finden. Dabei sind die<br />
Wände vielseitig einsetzbar: Sie können eine bestehende<br />
Wasseranlage, beispielsweise ein Wasserbecken<br />
ergänzen, entfalten ihre Wirkung aber auch<br />
als Einzelstücke. Aus Edelstahl oder Stein gefertigt<br />
schützen sie außerdem als Sichtschutz vor neugierigen<br />
Blicken.<br />
Technisches Herzstück einer Wasserwand ist<br />
die Pumpentechnik. Während die Lautstärke der<br />
Pumpgeräusche im Innenraum ein wichtiges Auswahlkriterium<br />
ist, spielt sie im Außenbereich eine<br />
eher untergeordnete Rolle. Aber auch im Freien<br />
gilt: je leiser, desto besser. Viele Pumpenhersteller<br />
haben ihre Geräte auf Leistung, weniger auf Laufruhe<br />
optimiert. Daher sollte man unbedingt genau<br />
hinhören, bevor man sich für eine Wasserwand beziehungsweise<br />
einen Pumpentyp entscheidet.<br />
1 Die Anordnung der Steine bringt das Wasser in Bewegung.<br />
Wasser gehört für viele Gartenbesitzer zum Wohlfühlen dazu.<br />
Inmitten der Vielfalt an Wasseranlagen führen Wasserwände<br />
noch ein Nischendasein.<br />
Die Wasserwände können an einer Wand befestigt<br />
werden oder frei stehen. Das A und O bei frei stehenden<br />
Objekten ist ein solides Fundament. Trifft Wind<br />
auf eine zwei mal zwei Meter hohe Wand, sollten die<br />
Kräfte nicht unterschätzt werden. Im Zweifel sollte<br />
man besser einen Statiker zu Rate ziehen.<br />
Das Funktionsprinzip einer Wasserwand ist im Innen-<br />
wie Außenbereich gleich: Aus einem Becken wird<br />
möglichst elektrolytfreies, also kalkfreies Wasser in<br />
ein Überlaufreservoir an den oberen Rand der Wasserwand<br />
gepumpt und fließt von dort über die Vorderseite<br />
der Flutfläche wieder nach unten in das Becken.<br />
Die Flutfläche kann aus verschiedensten Materialien<br />
gefertigt sein: Naturstein, Kunststein, Glas, Spiegelglas<br />
oder Metall – denkbar ist vieles. Vorsicht ist mit<br />
Weichgestein geboten, da das elektrolytfreie Wasser<br />
es mit der Zeit angreifen kann. Das Fließmuster hängt<br />
vom Muster der Flutfläche ab. Auf Glaswänden fließt<br />
das Wasser sehr gleichmäßig nach unten, Steinplatten<br />
werden in der Regel gerillt, so dass sich kleine<br />
Wellen bilden. Deren Größe und Geschwindigkeit lassen<br />
sich mit Hilfe der Pumpeneinstellung steuern.<br />
2 Blanker Edelstahl reflektiert das Licht und lässt das Wasser leuchten. Die Wände lassen sich gut mit Wasserspeiern kombinieren.<br />
3 Je nach Fließgeschwindigkeit entstehen auf Glas- und Metallwänden unterschiedliche Fließmuster.<br />
4 Eine Wasserinszenierung der besonderen Art ist der Regenvorhang, der wie ein erfrischender Schauer im Garten wirkt.<br />
5 Hier verbirgt sich die schlichte Edelstahl- Wasserwand hinter einem filigranen Gitter aus patinierter Bronze.<br />
Bilder: ©Nivet J./Adobe Stock (1); sinnbildlich.net/Susanne: LGS Nagold (2), Keradesign, Hirrlingen (3); Forster Garten- und Landschaftsbau (4);<br />
Clive Nichols /www.davidharber.com (5)<br />
1<br />
2
7<br />
3<br />
4<br />
5
8 ÖKOLOGIE<br />
WASSER SAMMELN<br />
Ob man nun an den vom<br />
Menschen verursachten<br />
Klima wandel glaubt oder nicht:<br />
die Wetter extreme nehmen zu.<br />
Wohin mit dem Wasser, das<br />
bei Starkregen im Übermaß<br />
kommt und bei Trockenheit<br />
dringend gebraucht wird?<br />
Wasser ist für Mensch, Tier und<br />
Pflanzen lebensnotwendig. Eigentlich<br />
sollte man sich über jeden Regentropfen<br />
freuen. Wenn bei Regenfällen jedoch Keller<br />
überschwemmt und Straßen überflutet werden, hat<br />
die Freude über das wertvolle Nass schnell ein Ende.<br />
In Deutschland gibt es immer mehr heiße, trockene Tage,<br />
aber auch immer stärkere Niederschläge, die im<br />
ausgetrockneten Erdreich nicht mehr versickern,<br />
sondern oberflächlich abfließen.<br />
Niederschläge sammeln, Kanäle entlasten<br />
und genug Wasser für trockene Tage zur<br />
Verfügung haben – mit seinem Garten kann<br />
man einen kleinen Beitrag zum intelligenten<br />
Wassermanagement leisten.<br />
Eine Renaissance erlebt hier die gute alte<br />
Regentonne, die dank modernem Design<br />
mittlerweile nicht mehr wie ein Fremdkörper<br />
im Garten wirkt. Zisternen leisten die Speicherarbeit<br />
unterirdisch und damit unsichtbar.<br />
Dort wird das Wasser gesammelt und<br />
steht an trockenen Tagen für die Gartenbewässerung<br />
zur Verfügung. Auch die Toilettenspülung<br />
lässt sich mit Niederschlagswasser<br />
betreiben. Lassen Sie sich bei der Regenwassernutzung<br />
und der Wahl der Zisterne beraten,<br />
z.B. von Ihrem Experten für Garten- und Landschaft.<br />
Dachbegrünungen sind eine weitere Möglichkeit,<br />
Wasser zu speichern. Auf einer<br />
begrünten Dachfläche ist die Verdunstung<br />
hoch – nur wenig Wasser läuft<br />
direkt in die Dachrinne. Die Begrünung<br />
reduziert die Wärmerückstrahlung<br />
und bei der Verdunstung kühlt<br />
sich die umgebende Luft ab. Auf<br />
dem Dach gespeichertes Wasser<br />
lässt sich ebenfalls zur Gartenbewässerung<br />
nutzen. Übrigens: Jede<br />
begrünte Fläche hilft – auch das<br />
Dach des Müllhäuschens oder<br />
Carports!<br />
Bild: sinnbildlich.net
GESTALTUNG<br />
9<br />
LiEBLiNGSPLÄTZE<br />
Eine Terrasse mit verschiebbaren Sitzmöbeln –<br />
so sieht der klassische Gartensitzplatz aus.<br />
Doch Möbel müssen nicht immer mobil sein.
10<br />
1<br />
2<br />
Lust auf abwechslungsreiche Ausblicke und Sitzgelegenheiten auch<br />
abseits der Terrasse? Das lässt sich schon bei der Gartenplanung berücksichtigen.<br />
Ein Beckenrand, eine höhere Beet einfassung, eine Mauer,<br />
Treppenstufen – alles kann so angelegt werden, dass es sich mit ein<br />
paar Kissen und Decken schnell zum Sitzplatz umfunktionieren lässt. Ein<br />
Vorteil der Bauwerke aus Holz und Stein gegenüber den herkömm lichen<br />
Gartenmöbeln: Bei Regen müssen keine schweren Polster verstaut<br />
werden und im Winter keine Tische, Stühle und Sofas im Keller oder unter<br />
Planen überwintern.<br />
In gut geplanten Gärten eröffnen sich immer wieder neue Blick winkel.<br />
Doch was hilft der schönste Blick, wenn man ihn nur im Vorbeigehen<br />
genießen kann? Warum nicht ein Beet erhöhen und bei der Einfassung<br />
einige Sitzflächen einplanen? Warum in die Mauer nicht gleich eine Bank<br />
einlassen oder an einer Stelle die oberste Steinlage mit einer hölzernen<br />
Sitzfläche ersetzen? Die gepflasterte Terrasse lässt sich gut mit<br />
dem einen oder anderen fertig gekauften<br />
oder selbst konstruierten<br />
Stein quader kombinieren, der je<br />
nach Bedarf als Ablage oder als<br />
Sitzplatz dient. Und eine Mauer<br />
kann als Rückenlehne für ebenfalls<br />
gemauerte Bänke genutzt<br />
werden. Der Phantasie sind hier<br />
keine Grenzen gesetzt.<br />
Überall wo es Höhenunterschiede<br />
gibt, gibt es Möglichkeiten, mit<br />
ihnen zu spielen. Alles flach? Auch<br />
ten lassen sich interessante Perspektiven<br />
schaffen. Eine tiefergelegte<br />
Fläche mit einer Feuerschale<br />
bestückt und mit einer Holzstufe<br />
umrandet, kann schnell zum<br />
Lieblingsgrillplatz für gesellige<br />
Tref fen mit Familie und Freunden<br />
werden.
3<br />
11<br />
5<br />
4<br />
4<br />
Seite 9 Unikat: Sitzbank aus Beton mit passgenau angefertigten Polsterelementen.<br />
1 Viel Liege- und Sitzfläche bieten Holzdecks auf unterschiedlichen Ebenen.<br />
2 „Festgemauert in der Erden...“, hier sogar fest einbetoniert ist die Bank, die mit Polstern zum Kuschelplatz wird.<br />
3 Höhenunterschiede bieten viele Möglichkeiten für Sitz- und Liegeplätze, die sich immer neu dekorieren lassen.<br />
4 Hier wird die Beetumrandung zur Rückenlehne. So schafft man Sitzgelegenheiten auch auf kleinem Raum.<br />
5 Füße ins Wasser oder Blick in den Garten: die Sitzmauer am Beckenrand erlaubt beides.<br />
Bilder: ©Antonina Vincent/stock.adobe.com (Seite 9); Gartenkultur, Bern (1); ©tisomboon//stock.adobe.com (2);<br />
sinnbildlich/Thomas für Uihlein (3) und Messner Gärten (5), ©cycreation/stock.adobe.com (4)
12<br />
BESCHATTUNG<br />
SEGEL SETZEN<br />
1<br />
An heißen Tagen ist Schatten hochwillkommen. Wo Bäume nicht vorhanden sind, muss man auf künstliche<br />
Dächer zurückgreifen. Sonnensegel und Sonnendächer sind flexible Alternativen zu Markisen.<br />
ie Geschichte der Sonnensegel reicht nachweislich bis in die<br />
D römische Antike zurück. So beschattete eine ringförmige Segeltuch-Plane<br />
– Velarium genannt – das Kolosseum in Rom. Um<br />
so erstaunlicher ist es, dass Sonnensegel als Schattenspender<br />
im Garten lange Zeit so gut wie gar nicht vorhanden waren. Das<br />
änderte sich vor etwa zwei Jahrzehnten. Die Segel als einfach zu<br />
befestigende Beschattungslösung, bei der keine klobigen Markisen-Kassetten<br />
an Hauswänden und unter Balkonen befestigt werden<br />
mussten, eroberten die Gärten. Für Wintergärten und Pergolen<br />
gibt es Sonnendächer, also viereckige Stoffbahnen, die an<br />
der Decke befestigt werden. Ganz so einfach ist es mit der Befestigung<br />
allerdings nicht, was der Vielfalt an unterschiedlichen<br />
Fassaden geschuldet ist, die es heutzutage gibt. Das erfordert<br />
genaue Kenntnis in Sachen Befestigung, da mit nichts beschädigt<br />
wird und keine Kältebrücken entstehen.<br />
Wo es keine Befestigungsmöglichkeit am Haus gibt, kann man<br />
Masten in den Boden einschrauben oder betonieren – diese Flexibilität<br />
unterscheidet das Sonnensegel von einer Markise. Was<br />
Wind angeht, halten Segel viel aus. Trotzdem sollte dort, wo der<br />
Wind kräftiger weht – beispielsweise auf dem Dach – sicherheitshalber<br />
ein Statiker zu Rate gezogen werden, um keine unliebsamen<br />
Überraschungen zu erleben. Qualitativ hochwertige Se gel<br />
1<br />
verfügen über eine Klemme, die sich auto matisch öffnet, wenn<br />
ein gefährlich starke Böe kommt – das schützt Segeltuch und die<br />
Befestigungskonstruktion.<br />
Segel gibt es in unterschiedlichsten Farben und Formen –<br />
dreieckig, viereckig, rauten-, trapez- oder drachenförmig. Ebenso<br />
viel fältig ist die Ausstattung: Von einfachen Segeln, die von<br />
Hand aufgespannt werden geht es über mechanisch aufrollbare<br />
Segel bis zur vollautomatischen Variante. Auch Lichtdurchlässigkeit,<br />
Winddurchlässigkeit und Regenschutz variieren. Das macht<br />
die Auswahl zwar nicht leicht, sicher ist aber, dass es für jede<br />
Situation die passende Beschattungslösung gibt.
13<br />
2<br />
3<br />
1 Das Stoffdach taucht die Terrasse in sanftes Licht.<br />
2 Da auf Dächern hohe Windgeschwindigkeiten entstehen können,<br />
sollten Sonnensegel vom Fachmann geplant und befestigt werden.<br />
3 Sonnensegel gibt es in vielen unterschiedlichen Farben und Formen.<br />
4 Mit Sonnensegeln lassen sich auch kleine Flächen überdachen.<br />
5 Bei Stoffen unbedingt auf gute UV-Beständigkeit achten.<br />
Bilder: Carolin Tietz (1); Soliday Sonnensegel by Weisenfeld (2 –4), Evi Pelzer (5)<br />
4<br />
5
14<br />
GEHÖLZE<br />
2 3<br />
GARTENBÄUME<br />
Bei der Entscheidung für einen Baum im Privatgarten greift man oft ohne<br />
große Überlegungen auf das Altbewährte und Altbekannte wie Kugel-Ahorn<br />
oder Kugel-Trompetenbaum zurück. Gerade die Auswahl eines Hausbaumes<br />
bietet jedoch die Chance, dem Grundstück ein individuelles Flair zu verleihen.<br />
1<br />
Eine kompakte,<br />
kugelförmige<br />
Krone bi l det die<br />
Blu men-Esche Fraxinus<br />
ornus<br />
‘Mezek’<br />
aus. Die als<br />
trockentolerant<br />
und<br />
kalkverträglich<br />
geltende Gehölzart<br />
zeichnet<br />
sich durch einen<br />
gleichmäßigen<br />
Wuchs aus. Attraktive weiße Blütenris pen, die an dem älteren<br />
Gehölz aus gebildet werden, sowie eine je nach<br />
Jahresver lauf mehr oder we niger intensiv auftretende, orange-<br />
braune Herbstfärbung runden ihren gelungenen Auftritt ab. Wer es<br />
naturnah möchte, dem sei der Kugel-Feldahorn Acer campestre<br />
‘Nanum’ empfohlen. Dieser muntere Geselle wird von Vögeln als Nistplatz<br />
geliebt. Zwar etwas struppig im Aussehen, besitzt dieser ökologisch wertvolle<br />
Kugelbaum durch seine intensive Blüten- und Fruchtausbildung sowie<br />
durch seine attraktive Herbstfärbung viele Vorzüge. Leider neigt er ein<br />
wenig zu Gallmilbenbefall. Auch auf Blüten muss man im Kugelbaum-Sortiment<br />
nicht verzichten. Die Kugel-Steppenkirsche Prunus x eminens ‘Umbraculifera’<br />
ist ein ausgesprochen attraktiver Blütenbaum, der im Herbst durch<br />
seine gelb-orange Herbstfärbung zusätzlich überzeugt. Der hitze- und<br />
trockenheits resistente Baum sollte allerdings auf nicht zu schweren Böden<br />
eingesetzt werden, da ansonsten Pilzbefall droht.<br />
Der Inbegriff des Frühlings ist der goldgelbe Austrieb der Säulenbuche<br />
Fagus sylvatica ‘Dawyk Gold’. Mit Leichtigkeit beginnt dieser Baum das<br />
Gartenjahr und nimmt sich im weiteren Verlauf durch die Vergrünung seiner<br />
Blätter etwas zurück. Wer einen Säulenbaum mit auffälliger Blüte sucht, dem<br />
sei die Traubenkirsche Prunus padus ‘Schloss Tiefurt’ empfohlen. Straff auf
15<br />
4 5<br />
recht vom Wuchs, fällt dieser Kleinbaum im Frühjahr durch seine stark<br />
duftenden, weißen Blütentrauben auf. Der Baum verlangt einen frischen<br />
bis feuchten Boden, unter trockenen Bedingungen wird das Laub sehr<br />
früh abgeworfen. Wesentlich anspruchsloser, dennoch attraktiv ist die<br />
Säulenform der Thüringischen Mehlbeere (Sorbus x thuringiaca<br />
‘Fastigiata’). Neben ihrem schmalen Wuchs, der attraktiven Blüten- und<br />
Fruchtausbildung zeichnet sie sich durch eine gelbe bis orange-rote<br />
Herbstfärbung aus. Frosthärte, Trockenheits- und Hitzeresistenz ergänzen<br />
ihre Vorzüge.<br />
Ein weißes Blütenmeer im Frühjahr und eine orange-rote Herbstfärbung<br />
bringt die anmutige Tokyo-Kirsche Prunus yedoensis hervor. Ebenfalls<br />
eine weiße Blüte und eine attraktive gelb-orangene Herbstfärbung<br />
besitzt die Spiegelrinden-Kirsche Prunus x schmittii. Sie besticht zusätzlich<br />
mit einer prächtigen mahagonifarbenen Spiegelrinde. Durch den<br />
schmal kegelförmigen Wuchs passt dieses Gehölz in nahezu jeden Hausgarten.<br />
Auch die Amur-Kirsche Prunus maackii ist aufgrund der sehr dekorativen<br />
goldbraunen Rinde, der attraktiven<br />
weißen Blüte und der auffallenden rötlich-gelben<br />
Herbstfärbung ein idealer Hausbaum. Ähnlich<br />
gute Eigenschaften besitzt die Scharlach<br />
Kirsche Prunus sargentii ‘Rancho’, die durch ih re<br />
rosafarbenen Blüten einen weiteren Farbaspekt mit<br />
einbringt. Neben den Prunus-Arten finden sich jedoch<br />
auch im Ebereschen-Sortiment zahlreiche<br />
Arten, die neben einer schönen Blüte im Frühjahr weitere<br />
attraktive Merkmale besitzen. Überaus schön ist die<br />
Mahagoni-Eberesche Sorbus commixta ‘Serotina’. Neben<br />
der herrlichen Blüte zeichnet sich diese Gehölzart durch eine<br />
spektakuläre, orangerote Herbstfärbung aus. Auch die Ebereschen-Sorte<br />
‘Dodong’ begeistert neben ihren großen, weißen Blütendolden<br />
mit einer prächtigen scharlachroten Herbstfärbung.<br />
Text+Bilder: Dr. Gerd Reidenbach, Lehr- und Versuchsanstalt <strong>Gartenbau</strong> Erfurt<br />
6<br />
1 Säule mit auffälliger Blüte:<br />
die Trauben kirsche Prunus<br />
padus ‘Schloss Tiefurt’.<br />
2 Spektakulär im Herbst:<br />
Mahagoni-Eber esche<br />
Sorbus commixta ‘Serotina.’<br />
3 Kompakte Kugel: die Blumen-Esche<br />
Fraxinus Meczek.<br />
4 Weißes Blütenmeer:<br />
Tokyo-Kirsche<br />
Prunus yedoensis.<br />
5 Naturnah: Kugel-Feldahorn<br />
Acer campestre ‘Nanum’.<br />
6 Nach goldgelbem Austrieb<br />
im Frühling angenehm<br />
zurückhaltend: Fagus<br />
sylvatica ‘Dawyk Gold’.
16<br />
ESSBAR<br />
„HiGH“DELBEEREN<br />
Die süßen blauen Beeren lieben es sauer — das müssen Gartenbesitzer beachten, wenn sie Heidelbeeren pflanzen wollen.<br />
Wald, Moor und gerne halbschattig – das<br />
ist die Umgebung, die wilde Heidelbeeren,<br />
auch bekannt als Blaubeeren, lieben.<br />
Entsprechend muss auch das Beet im Garten<br />
vorbereitet werden. Kalkhaltigen Boden mögen<br />
die Pflanzen gar nicht. Die Sträucher der<br />
Kultur-Heidelbeere, die in Gärtnereien und Gartencentern<br />
erhältlich sind, stammen von der Amerikanischen<br />
Blaubeere und deren Kreuzungen ab.<br />
Mittlerweile gibt es mehr als zehn, von denen sich<br />
rund ein Drittel gut für Privatgärten eignet. Kultur-<br />
Heidelbeeren erkennt man am weißen Fruchtfleisch<br />
– und an den relativ sauberen Händen<br />
beim Pflücken.<br />
An ihren natürlichen Standorten werden Heidelbeersträucher<br />
zehn bis 60 Zentimeter hoch,<br />
die Kulturheidelbeeren können es durchaus auf<br />
stattliche drei bis vier Meter bringen. Klein oder<br />
groß: die Sträucher brauchen Platz, da die Wurzeln<br />
sich flach im Boden ausbreiten. Pro Pflanze<br />
sollte man eine Pflanzgrube von 60 Zentimetern<br />
Tiefe und einem Meter Durchmesser ausheben.<br />
Heidelbeeren mögen sauren Boden mit einem pH-<br />
Wert zwischen 3,5 und 4,5. Im Garten sind diese<br />
Böden fast nicht vorhanden. Umso wichtiger<br />
ist entsprechendes Substrat – zum Beispiel<br />
Rhododendronerde – das in die Pflanzgrube<br />
gefüllt wird. Je nährstoffärmer der Boden,<br />
desto besser. Hier empfiehlt sich ein<br />
Gemisch aus Sand mit organischem Material,<br />
zum Beispiel Nadelstreu, Laub und<br />
Rindenmulch. Achtung: Setzt man Heidelbeeren<br />
zu tief ein, können die Wurzeln aufgrund<br />
von Sauerstoffmangel absterben.<br />
Heidelbeeren sind zwar selbstfruchtend,<br />
trotzdem empfiehlt es sich, mindestens zwei<br />
verschiedene Sorten zu pflanzen – das erhöht<br />
den Ertrag. Wenn der Boden optimal vorbereitet<br />
wurde, sollte man auch auf den Kalkgehalt des<br />
Gießwassers achten und entweder Regenwasser<br />
oder kalkarmes Wasser verwenden.<br />
Nach drei bis vier Jahren tut es der Blaubeere<br />
gut, wenn man sie schneidet. Alte Triebe werden<br />
ausgelichtet. An den einjährigen Seitenzweigen<br />
wachsen die Heidelbeeren am üppigsten, daher<br />
kann man verzweigte Triebe knapp über dem einjährigen<br />
Trieb abschneiden.<br />
Je nach Sorte beginnt die Erntezeit Anfang<br />
Juli und endet Anfang September. Heidelbeeren<br />
reifen an einem Strauch über mehrere<br />
Wochen. Wer frühe und späte Sorten mischt, kann<br />
monatelang naschen. Die Beeren lassen sich von<br />
Hand pflücken oder mit einem sogenannten Heidelbeerkamm<br />
abernten und halten dann im Kühlschrank<br />
etwa eine Woche. Friert man sie ein,<br />
hat man länger etwas davon. Dazu die Beeren<br />
waschen, Stiele entfernen und trocknen lassen.<br />
I N F O b o x<br />
BLAUBEEREN<br />
• Allgemeines<br />
Wilde Heidelbeeren färben Finger,<br />
Zunge und Zähne blau. Das liegt an<br />
den Anthocyanen. Sie gehören zu<br />
den Flavonoiden. Diese Antioxidantien<br />
schützen Zellen vor schädlichen freien<br />
Radikalen. In den Kulturheidel beeren<br />
stecken — wenn auch in geringerer<br />
Menge — ebenfalls Anthocyane.<br />
• Gesundheit (Nährwerte und Vitamine)<br />
Große Mengen an Vitamin C,<br />
A, B, E und Beta-Carotin.<br />
• Gesundheitliche Wirkung<br />
Entzündungshemmend; gut für das<br />
Immun- und das Herz-Kreislauf-<br />
System; sollen sich positiv auf die<br />
Gedächtnisleistung auswirken.<br />
Nebeneinander auf einem flachen Teller oder<br />
Tablett verteilen und zwei bis drei Stunden ins<br />
Gefrierfach stecken. Anschließend in Gefrierbeutel<br />
abfüllen.<br />
Hintergrund/Bild: ©Alexei Sokolenko/Adobe Stock; Andreas Kern/pixelio.de kl. Bild: Andreas Kern/p©pixelio.de
BLAUER KARTOFFELSALAT<br />
MIT PILZ-VINAIGRETTE<br />
Rezept: Bettina Matthaei/Bild: Wolfgang Schardt<br />
Einkaufszettel – für 4 Personen<br />
8oo g blaue Kartoffeln (z.B. »Blauer Schwede«)<br />
Salz / Schwarzer Pfeffer<br />
3oo g Pfifferlinge<br />
4 dünne Frühlingszwiebeln<br />
1oo ml kräftige Gemüsebrühe<br />
1 EL Apfelessig<br />
2 EL Sherryessig<br />
1 ½ EL trockener Sherry (nach Belieben)<br />
2 EL Olivenöl<br />
1oo g Blaubeeren<br />
1 EL Trüffelöl (ersatzweise geröstetes Haselnussöl)<br />
Die Rezepte wurden den Büchern<br />
»Gemüse kann auch anders« und<br />
»Partyrezepte« mit freundlicher Genehmigung<br />
des Verlagshauses GRÄFE&UNZER entnommen.<br />
1Die Kartoffeln waschen und mit der Schale in<br />
Salzwasser zugedeckt in 20–25 Minuten gar kochen<br />
(am besten schon am Vortag). Abgießen, pellen,<br />
in ca. ½ cm dicke Scheiben schneiden und auf vier<br />
Tellern anrichten. Kartoffeln salzen und pfeffern.<br />
Die Pfifferlinge trocken putzen und je nach Größe<br />
längs halbieren, vierteln oder ganz lassen. Die<br />
2<br />
Frühlingszwiebeln putzen und waschen. Weiße Teile<br />
hacken, grüne in Ringe schneiden. Die Brühe mit beiden<br />
Essigsorten und dem Sherry mischen..<br />
Das Zwiebelweiß im Öl 1–2 Minuten andünsten,<br />
3 Pilze dazugeben und bei größerer Hitze unter<br />
häufigem Rühren 4–5 Minuten braten, salzen und<br />
pfeffern. Die Hälfte des Zwiebelgrüns dazugeben und<br />
1 Minute mitbraten. Alles mit der Brühe-Essig-Mischung<br />
ablöschen, aufkochen und etwas einkochen<br />
lassen. Die Brühe mit den Pilzen heiß über die Kartoffelscheiben<br />
geben und bei Zimmertemperatur mind.<br />
30 Min. durchziehen lassen.<br />
Dann die Blaubeeren waschen und abtropfen lassen.<br />
Die Salate mit dem Trüffelöl beträufeln und<br />
4<br />
mit dem restlichen Zwiebelgrün und den Blaubeeren<br />
be streuen.<br />
MARTIN KINTRUP<br />
PARTYREZEPTE<br />
Nichts wie ran ans Büfett!<br />
KÜCHENRATGEBER<br />
1Die Sahne in einen Topf geben und langsam zum<br />
Kochen bringen, dann offen bei schwacher bis<br />
mittlerer Hitze in 5 Min. einkochen lassen. In der Zwischenzeit<br />
den Espresso brühen.<br />
2<br />
Die Sahne vom Herd nehmen. Zucker, Vanillezucker,<br />
Mascarpone, Espresso, Zitronensaft<br />
und eine Prise Salz unterrühren. Zum Aromatisieren<br />
nach Belieben einige Tropfen Bittermandelaroma unter<br />
rühren oder ein wenig Tonkabohne in die Sahne-<br />
Mascarpone-Masse reiben. Diese anschließend 6–8<br />
Minuten abkühlen lassen. Inzwischen die Gelatine in<br />
kaltem Wasser einweichen.<br />
3Die Blaubeeren waschen und in einem Sieb abtropfen<br />
lassen. Auf 12 Dessertgläser (à 150 ml)<br />
verteilen. Die Gelatine ausdrücken und unter Rühren<br />
in der Sahne-Mascarpone-Masse auflösen. Dann jeweils<br />
etwas von der Masse vorsichtig auf die Blaubeeren<br />
gießen. Auf Zimmertemperatur abkühlen<br />
lassen, anschließend zugedeckt mind. 4 Std. kühl<br />
stellen, bis die Tiramicotta geliert ist.<br />
4Die Amarettini portionsweise im Blitzhacker fein<br />
mahlen. Amarettinibrösel vor dem Servieren<br />
gleich mäßig auf der Tiramicotta verteilen.<br />
KOCHBAR 17<br />
TIRAMICOTTA<br />
MIT BLAUBEEREN<br />
Einkaufszettel – für 12 Personen<br />
8oo g Sahne<br />
2oo ml Espresso (frisch gebrüht)<br />
15o g Zucker<br />
4 Packungen Bourbon-Vanillezucker<br />
5oo g Mascarpone<br />
2 TL Zitronensaft<br />
Salz<br />
Bittermandelaroma (ersatzweise Tonkabohne, nach<br />
Belieben)<br />
12 Blatt weiße Gelatine<br />
125 g Blaubeeren<br />
2oo g Amarettini<br />
Rezept: Martin Kintrup; Bild: Anke Schütz<br />
Mit kostenloser App zum<br />
Sammeln Ihrer Lieblingsrezepte
18 WISSENSWERTES<br />
GRÜNES<br />
NETZWERK<br />
Sprechen die Bäume miteinander, wenn die Blätter rauschen? Pflanzen kommunizieren tatsächlich – für uns allerdings unhörbar.<br />
Forschungen belegen, dass Pflanzen kommunizieren:<br />
mit Hilfe chemischer und elektrischer<br />
Signale. So werden mit Duftstoffen Insekten angelockt,<br />
um die Bestäubung sicherzustellen. In<br />
den Chemiebaukasten wird auch gegriffen, wenn<br />
es um die Abwehr unerwünschter Besucher geht.<br />
Dabei gibt es verschiedene Strategien: Schädlinge<br />
werden damit entweder vertrieben oder deren<br />
Fressfeinde angelockt. Oftmals warnen Pflanzen<br />
mit Hilfe abgesonderter Duftmoleküle andere Verwandte<br />
in der Umgebung, die wiederum die Produktion<br />
eigener Duft- und/oder Abwehrstoffe erhöhen<br />
– so formiert sich Widerstand.<br />
Bereits 150 Jahre alt ist die Entdeckung,<br />
dass Pflanzen auch über elektrische Signale<br />
kommunizieren. 1873 entdeckte Sir John Scott<br />
Burdon-Sanderson, dass elektrische Impulse im<br />
Spiel sind, wenn die Venusfliegenfalle ihre Fangblätter<br />
zuklappt. Doch erst seit weniger als einem<br />
Jahrzehnt wird diese Art der Kommunikation näher<br />
untersucht. Wieder einmal waren es Forscher<br />
des Max-Planck-Institutes für Chemische Ökologie,<br />
diesmal mit Kollegen der Universität Gießen,<br />
die entdeckten, dass einige Zeit, nachdem sie bei<br />
einigen Versuchspflanzen die Blätter verletzt und<br />
im wahrsten Sinne des Wortes Salz in die Wunde<br />
gestreut hatten, ein elektrischer Impuls gemessen<br />
werden konnte. Diese Reaktion wird Aktionspotenzial<br />
genannt.<br />
Das Aktionspotenzial gibt es nur bei erregbaren<br />
Zellen, also beispielsweise bei Mensch und<br />
Tier. Spannung, die sich in Zellen aufbaut wird als<br />
elektrischer Impuls von Nervenzelle zu Nervenzelle<br />
weitergegeben. Relativ neu ist die Erkenntnis,<br />
dass das auch bei Pflanzen möglich ist.<br />
Auch Wurzeln dienen der Kommunikation.<br />
Über sie werden Signale abgegeben und an benachbarte<br />
Pflanzen weitergeleitet. Über das Wurzelsystem<br />
können sich verwandte Pflanzen sogar<br />
erkennen und dehnen an den Standorten ihre Wurzeln<br />
weniger weit aus, wo ein Familienmitglied in<br />
der Nähe steht. Wenn das Wurzelwerk nicht ausreicht,<br />
um eine Information an benachbarte Pflanzen<br />
weiterzugeben, werden Helfer hinzugezogen:<br />
Pilze. Deren Fäden stehen mit dem pflanzlichen<br />
Wurzelsystem in Verbindung. Die Symbiose aus<br />
Wurzeln und Pilzen wird als Mykhorizza bezeichnet.<br />
Entdeckt wurde diese symbiotische Beziehung<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts.<br />
Pilze, die Pflanzenwurzeln mit Nährstoffen<br />
und Wasser versorgen und im Gegenzug die für<br />
sie notwendigen Kohlenhydrate erhalten, gibt es<br />
allerdings schon seit 400 Millionen Jahren. Einige<br />
Wissenschaftler nehmen nun an, dass das Pilzgeflecht<br />
auch der Weitergabe von Informationen<br />
dient – und nennen es in Anlehnung an das Internet<br />
Wood Wide Web. Wie ein dichtes Leitungsnetzwerk<br />
ziehen sich die Mykorrhiza durch den<br />
Boden und geben Informationen in Form chemischer<br />
Botenstoffe weiter.<br />
Bild: ©lassedesignen/stock.adobe.com
KONTAKT<br />
Mit VERGNÜGEN<br />
Ihren GARTEN<br />
GENIESSEN.<br />
Richard-Stocker-Straße 3, 78234 Engen<br />
Fon 07733 8302<br />
info@garten-schwehr.de<br />
www.garten-schwehr.de<br />
Bild: ©Robert Kneschke · stock.adobe.com