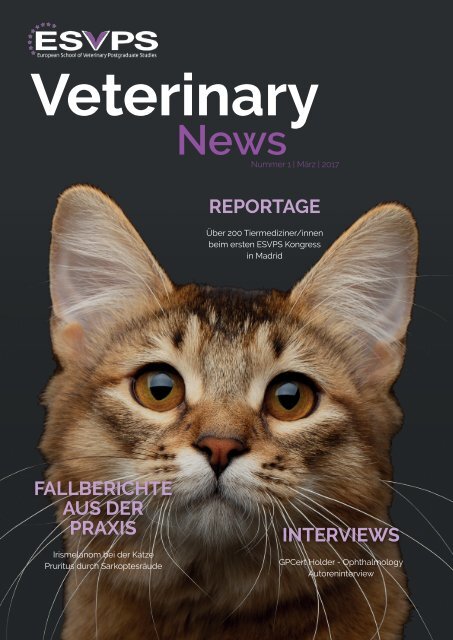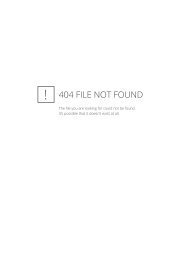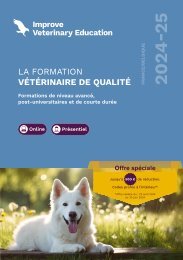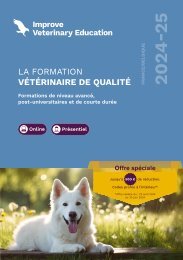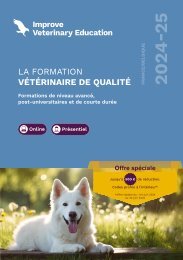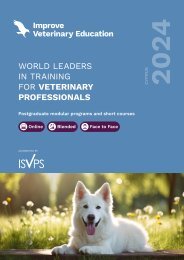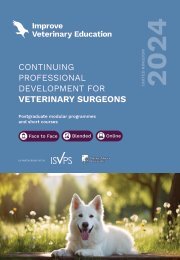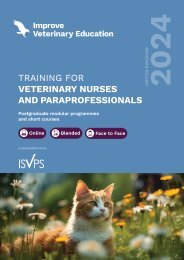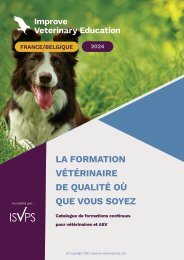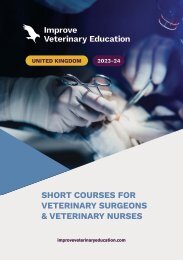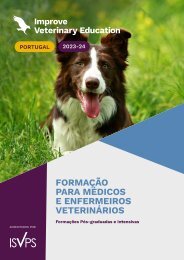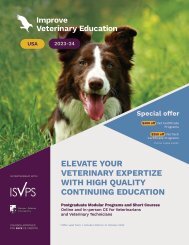ISVPS_Veterinary_News_DE_1Edition
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Veterinary</strong><br />
<strong>News</strong><br />
Nummer 1 | März | 2017<br />
REPORTAGE<br />
Über 200 Tiermediziner/innen<br />
beim ersten ESVPS Kongress<br />
in Madrid<br />
FALLBERICHTE<br />
AUS <strong>DE</strong>R<br />
PRAXIS<br />
Irismelanom bei der Katze<br />
Pruritus durch Sarkoptesräude<br />
INTERVIEWS<br />
GPCert Holder - Ophthalmology<br />
Autoreninterview
Das beste Material,<br />
der richtige Knoten<br />
für den perfekten<br />
Sitz Ihrer Naht<br />
Wir präsentieren<br />
Die hohe Kunst<br />
des Nahtmaterials<br />
Premilene ®<br />
Novosyn ®<br />
Monosyn ®<br />
MonoPlus ®<br />
Fadenaufbau:<br />
monofil<br />
Fadenaufbau:<br />
geflochten<br />
Fadenaufbau:<br />
monofil<br />
Fadenaufbau:<br />
monofil<br />
Material:<br />
Polypropylen<br />
Material: Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)<br />
Material:<br />
Glykonat<br />
Material:<br />
Poly-p-dioxanon<br />
VET_20151001<br />
Beschichtung:<br />
keine<br />
USP: 10/0 – 1<br />
Farben:<br />
blau<br />
Beschichtung:<br />
USP: 8/0 – 2<br />
Farben:<br />
violett<br />
Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65)<br />
Calciumstearat<br />
Beschichtung: keine<br />
USP: 6/0 – 1<br />
Farben<br />
violett, ungefärbt<br />
Beschichtung: keine<br />
USP: 7/0 – 2<br />
Farben:<br />
violett<br />
Nicht resorbierbar<br />
Resorbierbar<br />
Resorbierbar<br />
Resorbierbar<br />
Photos : Getty Images • Création : studio<br />
Indikationen<br />
• Hautverschluss<br />
• Hernien<br />
• Dentalchirurgie<br />
Reißkraftverlust: 21 Tage 50 %<br />
Materialresorption: ca. 56 – 70 Tage<br />
Indikationen<br />
• Gynäkologie, Urologie, Ophthalmologie<br />
• Bauchwandverschluss<br />
• Ligaturen<br />
Reißkraftverlust: 14 Tage 50 %<br />
Materialresorption: ca. 60 – 90 Tage<br />
Indikationen<br />
• Haut, Schleimhaut<br />
• Magen-Darm<br />
• Sub- und Intrakutan<br />
Reißkraftverlust: 35 Tage 50 %<br />
Materialresorption: ca. 180 – 210 Tage<br />
Indikationen<br />
• Orthopädie<br />
• Gynäkologie, Urologie<br />
• Bauchwandverschluss
1<br />
2<br />
Inhalt<br />
Editorial 04<br />
Vorstellung der ESVPS 06<br />
3<br />
Aktuelles<br />
Verbreitung invasiver Arten<br />
Tier des Jahres 2017<br />
Neuer Impfstoff entwickelt<br />
Aktualisierung der Impfleitlinien<br />
4<br />
Reportage<br />
ESVPS Konferenz Madrid 2016<br />
5<br />
Interview<br />
GPCert Holder: Ophthalmology<br />
6<br />
Fallberichte aus der Praxis<br />
Pruritus bei einem 3 jährigen Boder Collie Mischling durch Sarkoptesräude<br />
Irismelanom bei einer 6 Jahre alten Europäisch Kurzhaar Katze<br />
7<br />
Expertenecke<br />
Verhaltensmedizinerin Sabine Schroll über die Freude am Beruf<br />
Fütterungsarten bei Katzen<br />
8<br />
Wissenschaftliche Veröffentlichungen<br />
Single Port Zugangstechnik bei minimalinvasiver Ovariohysterektomie<br />
Akzeptanz und therapeutische Effekte von Nierendiäten bei Katzen<br />
07<br />
07<br />
08<br />
08<br />
09<br />
11<br />
13<br />
17<br />
23<br />
24<br />
26<br />
26
Aktuelles<br />
Einjährige<br />
Fortbildungsprogramme<br />
GPCert programmes<br />
2017<br />
<strong>DE</strong>UTSCHLAND<br />
INNERE MEDIZIN <strong>DE</strong>R KLEINTIERE<br />
KLEINTIERCHIRURGIE<br />
FAST-TRACK KLEINTIERCHIRURGIE<br />
<strong>DE</strong>RMATOLOGIE<br />
KATZENMEDIZIN<br />
ULTRASCHALL BEIM KLEINTIER<br />
KLEINTIER-PHYSIOTHERAPIE<br />
PHYSIOTHERAPIE FÜR TFA<br />
ANÄSTHESIE FÜR TFA<br />
Akkreditiert von:<br />
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Die Registrierung ist einfach...<br />
Rufen Sie uns an<br />
(+49) (0) 32-221 090 047<br />
Schreiben Sie uns<br />
info.de@improveinternational.com<br />
Besuchen Sie<br />
unsere Homepage<br />
www.improveinternational.com<br />
ESVPS
Editorial<br />
Gudrun Neidenbach<br />
Tatjana Maier-Wentz<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen!<br />
Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen online Magazins „ESVPS <strong>Veterinary</strong> <strong>News</strong>“ zu präsentieren! Die ESVPS<br />
als britische non-profit Organisation sieht sich dem veterinärmedizinischen Praktiker eng verbunden. Durch Kooperationen mit<br />
Fortbildungsanbietern, Akkreditierung von Kursprogrammen und Evaluierung entsprechender Prüfungen zum Erhalt internationaler<br />
Zertifikate, hat das Gremium die Förderung kontinuierlicher Wissenserweiterung in der Tiermedizin zum obersten Ziel<br />
erklärt.<br />
Dieses neue Format wird nun ebenfalls mit 4 Ausgaben pro Jahr dazu beitragen, die Kommunikation in unserer Gemeinschaft<br />
interessierter Kollegen und Kolleginnen zu verbessern und dient dazu, hilfreiche Netzwerkstrukturen weiter auszubauen.<br />
Finden Sie auf den folgenden Seiten interessante Neuigkeiten und Fakten aus der Tiermedizin, wissenschaftliche Artikel und<br />
Veröffentlichungen, sowie nicht zuletzt Wissenswertes rund um die ESVPS. Ein besonderes Highlight sind ausgewählte Fallberichte<br />
unserer Prüfungskandidaten aus dem deutschsprachigen Raum, mit spannenden Einblicken in Praxisalltag und Behandlungsstrategien!<br />
In diesem Heft erwarten Sie Fallberichte aus der Dermatologie und Ophthalmologie, die Praxisnähe wissenschaftlich aufgearbeitet<br />
schildern. Unsere Expertenmeinung liefert die Verhaltensmedizinerin Sabine Schroll (Dipl. Tzt.), international bekannte<br />
Referentin zum Katzenverhalten.<br />
Als redaktionelles Team begleiten Sie Gudrun Neidenbach, ESVPS Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Kandidaten aus<br />
Deutschland, Österreich und der Schweiz, und Tatjana Maier-Wentz, praktische Tierärztin und freiberufliche Editorin. Wir freuen<br />
uns jederzeit über Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in dieser Ausgabe!<br />
04
Sheffield (UK) designed,<br />
proudly engineered for vets by vets<br />
Vi are world leaders in <strong>Veterinary</strong> Arthrodesis Plate design<br />
36 different pantarsal arthrodesis plate designs and 7 different intertarsal arthrodesis plate designs in stock<br />
Take advantage of our long established custom plate service<br />
To request Vi’s 2017 catalogue call +44 (0)114 258 8530 or email info@vetinst.com<br />
www.vetinst.com <strong>Veterinary</strong> Instrumentation is a company
Vorstellung der ESVPS<br />
Willkommen der ESVPS<br />
Ursprünglich in England gegründet, wird die ESVPS inzwischen weltweit zunehmend präsenter. Auch im deutschsprachigen<br />
Raum erhöht sich die Zahl der durch die ESVPS verliehenen Zertifikate beständig.<br />
Doch wer steht hinter der European School of <strong>Veterinary</strong> Postgraduate Studies? Gegründet wurde die Organisation im Jahr<br />
2003, von Tierärzten, denen ein Mangel an Zusatzqualifikationen für praktizierende Tiermediziner/innen aufgefallen war. Üblicherweise<br />
schlugen Veterinäre/innen direkt im Anschluss an die Universität den Weg weiterführender Karriere ein, und verzichteten<br />
dafür erst einmal auf die Selbstständigkeit. Wollten Praktiker/innen, die fest in Berufs- und Familienleben stehen eigene<br />
Schwerpunktinteressen mit anerkanntem Abschluss nachweislich vertiefen, so waren ihre Möglichkeiten sehr begrenzt.<br />
Das Bestreben, hier etwas zum Vorteil praktizierender Kollegen/innen zu verändern, führte zur Entstehung des Gremiums, das<br />
sich seither mit der Akkreditierung passender Kursprogramme unterschiedlicher Anbieter befasst. Weltweit werden entsprechende<br />
Abschlussprüfungen zu solchen Programmen koordiniert und die Anforderungen für den Zertifikatserhalt evaluiert.<br />
Augenblicklich verleiht die ESVPS entsprechend persönlicher Vorbildung und Berufsstand das General Practitioners Certificate<br />
und das General Practitioner Advanced Certificate für Veterinärmediziner/innen nach unterschiedlichen Schwerpunktfortbildungen,<br />
sowie die <strong>Veterinary</strong> Technician Certificates für tiermedizinische Fachangestellte.<br />
Die Anforderungen um ein Zertifikat der ESVPS zu erhalten variieren, ihnen allen gemein ist jedoch, dass ein Kursprogramm mit<br />
akkreditiertem Inhalt besucht, oder eine äquivalente Fortbildung nachgewiesen werden muss. Außerdem muss mindestens ein<br />
Fallbericht nach den festen Kriterien der ESVPS verfasst werden, und ein Multiple Choice Examen positiv abgelegt werden.<br />
Ein Direktorengremium leitet die ESVPS und wird von der Prüfungskommission internationaler Spezialisten sowie der Akkreditierungskommission<br />
unterstützt. In Großbritannien ist die Zusammenarbeit mit der Harper Adams University sehr eng, was das<br />
GPCert für viele zu einem ersten Schritt zu einer weiteren Karriere über PgC (Postgraduate Certificate) und Master macht.<br />
Internationale Karrierewege nach Einstieg mit einem GPCert oder in weiterer Folge einem GPAdvCert einzuschlagen ist durchaus<br />
möglich. Eine steigende Nachfrage zeigt auch hier den Bedarf unterschiedlicher Stufen erreichbarer Zusatzqualifikationen<br />
unter Veterinärmediziner/innen an.<br />
Im deutschsprachigen Raum ist Gudrun Neidenbach Ihre Ansprechpartnerin für alle Belange rund um die ESVPS, akkredierte<br />
Kursprogramme und Prüfungsmöglichkeiten. Kontaktieren Sie sie jederzeit gerne persönlich unter gudrunneidenbach@esvps.org<br />
und informieren Sie sich zu Ihrem individuellen Anliegen!<br />
Sie finden uns online unter www.esvps.org und auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder twitter , oder<br />
lernen Sie uns auf einem Kongress persönlich kennen!<br />
06<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Aktuelles<br />
Verbreitung invasiver Arten<br />
Aktuell wird die Einschleppung von Vektoren und damit verbunden, gefährlicher<br />
Krankheitserreger, immer wieder diskutiert. Krankheitsbilder,<br />
die noch in vielen Lehrbüchern als „im ausschließlich Mittelmeerraum<br />
vorkommend“ aufgeführt sind, gehören vielerorts zum Praxisalltag.<br />
Eine Kooperation von Forschern des Senckenberg, der Universität Oldenburg<br />
und der Universität Wien haben die Erklärung der Ausbreitung<br />
invasiver Arten anhand globaler Handelsströme mittels eines Computermodells<br />
untersucht und verblüffende Muster gefunden.<br />
Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />
https://vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/Wie-weitreisen-invasive-Arten.html<br />
Das Tier des Jahres 2017 – Die Haselmaus<br />
Jedes Jahr wird von der Deutschen Wildtierstiftung gemeinsam mit der<br />
Schutzgemeinschaft deutsches Wild ein Tier des Jahres ernannt. Im<br />
neuen Jahr fiel die Wahl auf ein knopfäugiges kleines Pelzwesen, das<br />
im Augenblick in tiefem Schlaf liegt: die Haselmaus. Mit der Ernennung<br />
zum Tier des Jahres soll sich mehr Aufmerksamkeit auf die wachsende<br />
Gefährung dieser scheuen Vertreterin der Familie der Bilche richten.<br />
Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />
https://vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/Haselmaus-<br />
Tier-des-Jahres-2017.html<br />
ESVPS<br />
07
Aktuelles<br />
Rekombinante inaktivierte Tollwutviren mit<br />
Staupe-Glykoproteinen schützen gegen beide<br />
Erreger<br />
Ein neuer inaktivierter Impfstoff, der gegen Staupe und Tollwut schützt,<br />
minimiert Risiken einer Erkrankung durch aktive Lebendimpfstoffe, wie<br />
sie aktuell vorwiegend auf dem Markt sind und erhöht die Temperaturstabilität<br />
der Impfstoffe. Forscher des Paul-Ehrlich-Instituts konnten<br />
durch Anwendung gentechnischer Veränderungen eine Impfstoffkombination<br />
herstellen, die gegen Staupe und Tollwut schützt.<br />
Lesen Sie den gesamten Artikel hier:<br />
https://vet-magazin.com/wissenschaft/kleintiermedizin/Tollwut-<br />
Staupe-Impfung.html<br />
Impfleitlinien aktualisiert<br />
Im Dezember 2016 veröffentlichte die StIKoVet (ständige Impfkommission<br />
Veterinärmedizin) die 4. Auflage der Leitlinie zur Impfung von Kleintieren.<br />
Impfschemata sind immer wieder Gegenstand von Expertendiskussionen,<br />
da sie beständig von Faktoren wie neuen wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen, Weiterentwicklung von Impfstoffen oder Verbreitung<br />
von Krankheitserregern beeinflusst sind.<br />
Eine Impfung bleibt jedoch die wichtigste Maßnahme zur Prävention<br />
von Infektionskrankheiten, für das Einzeltier genau wie für ganze Populationen.<br />
Oft sind internationale Vergleiche der Impfempfehlungen sehr<br />
abweichend und eine allgemeine Richtlinie, die den aktuellen Wissenstand<br />
berücksichtigt, ist gefragt.<br />
Lesen Sie mehr unter:<br />
https://www.fli.de/de/kommissionen/stiko-vet/empfehlungen/<br />
Mit freundlicher Unterstützung<br />
des VET-MAGAZINs<br />
https://vet-magazin.com/<br />
08<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Ein absolutes<br />
Highlight bildete<br />
der Auftakt einer<br />
Kongressreihe der<br />
ESVPS im sonnigen<br />
Madrid! Wir als<br />
Organisatoren sind<br />
sehr stolz, unsere<br />
Rolle als Botschafter<br />
kontinuierlicher<br />
Wissenserweiterung<br />
so umfassend erfüllen<br />
zu können.<br />
Umfassendes Informationsmaterial zur Begrüßung<br />
Willkommen zum ersten ESVPS Kongress in Madrid!<br />
Die European School of <strong>Veterinary</strong> Postgraduate Studies ist<br />
bestrebt, Tiermedizinern/innen auf internationaler Ebene Möglichkeiten<br />
zu hochqualitativer Fortbildung zu bieten, die sich gut<br />
in den Alltag eines Praktikers eingliedern lassen.<br />
Um das umfangreiche Angebot weiter zu vervollständigen, fand<br />
am 23. und 24 September 2016 der erste ESVPS Kongress in<br />
Madrid, Spanien statt. Auf dem Gelände des Faunia Naturparks<br />
trafen sich knapp 250 Kleintiermediziner/innen, um zwei Tage<br />
ganz im Zeichen der Kleintierchirurgie und Inneren Medizin zu<br />
verbringen. Im Vordergrund stand dabei in erster Linie der Wis-<br />
ESVPS<br />
09
Reportage<br />
senstransfer, aber auch die Etablierung von Netzwerken in einer<br />
Gemeinschaft von allen an kontinuierlicher Wissenserweiterung<br />
interessierten Kollegen und Kolleginnen.<br />
International anerkannte Experten vermittelten zwei Tage lang<br />
neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Praxisanwendungen<br />
aus verschiedenen Themengebieten wie Onkologie,<br />
Dermatologie und Kardiologie. Interaktive Fallbesprechungen<br />
mit Beteiligung des Auditoriums belebten die Vorträge auf sehr<br />
ansprechende Art, wie durch Feedbacks der Teilnehmenden<br />
bestätigt wurde. Chirurgische Aspekte konzentrierten sich auf<br />
die Traumatologie, die den Zuhörer/innen sehr praxisnah und in<br />
vielfältigen Zusammenhängen vermittelt wurde.<br />
Durch die naturnahe Lage des Kongressortes kam neben dem<br />
Zuwachs an Fachwissen und dem kollegialen Austausch auch<br />
die Entspannung in geselliger Atmosphäre nicht zu kurz. Auch<br />
für das leibliche Wohl wurde nicht nur beim Galadinner zur Kongresseröffnung<br />
bestens gesorgt.<br />
Die Organisation oblag der ESVPS, die mit Unterstützung von<br />
Improve International und 5m Publishing diese Kongresstage zu<br />
einem besonderen fachlichen Highlight avancieren ließen.<br />
Besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren von Merial, sowie<br />
Dechra, Vetoquinol, SCIL, und Blau Chirurgische Instrumente,<br />
genau wie den Fachverlagen der Assissi Gruppe und Multimedica,<br />
die durch die Vorstellung ihrer Produkte und vielfältige<br />
Präsentationen neuer Angebote das Kongresserlebnis für die<br />
Besucher abrundeten.<br />
Nach dem Erfolg dieser Premiere kann die ESVPS die zahlreichen<br />
Nachfragen spanischer Kollegen nach der erwarteten<br />
Fortsetzung inzwischen mit einem konkreten Datum beantworten<br />
– wir freuen uns bereits, viele interessierte Veterinärmediziner/innen<br />
am 6. und 7. Oktober 2017 als ESVPS Kongressteilnehmer<br />
begrüßen zu dürfen!<br />
Geselligkeit unter Kollegen stärkt die Motivation!<br />
Spannende Vorträge anerkannter Experten – aus der Praxis für die Praxis!<br />
Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren Partnern<br />
10<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Interview<br />
Interview<br />
GPCert Holder –<br />
Ophthalmology<br />
FAKTEN<br />
NAME Tatjana Maier-Wentz<br />
ALTER 32<br />
GEOGRAPHISCHE LOKALISATION Süddeutschland, Schwarzwald-Baar<br />
PRAXISSTRUKTUR Kleintierpraxis<br />
INTERESSENGEBIETE Kleintiermedizin, speziell Ophthalmologie, Orthopädie<br />
Unsere erste Interviewpartnerin ist auch gleich meine Kollegin, Frau Mag. Tatjana Maier-<br />
Wentz. Sie hat nach einem Studium in Wien bereits einige Jahre Berufserfahrung in der<br />
Kleintierpraxis gesammelt, ist 32 Jahre alt und arbeitet aktuell in Baden-Württemberg im<br />
Schwarzwald- Baar Kreis.<br />
Ihre Schwerpunktinteressen sind die Ophthalmologie und die Orthopädie.<br />
Was hat Sie dazu bewogen, die Fortbildungsreihe von<br />
Improve International zu besuchen?<br />
Als ich mich informierte, welche Möglichkeiten es gibt, mein<br />
Fachwissen gezielt in der Ophthalmologie zu vertiefen, bin ich<br />
auf die Kurse von Improve International gestoßen. Da ich bisher<br />
nur Positives zu den vermittelten Inhalten gehört hatte und die<br />
modulare Struktur mich angesprochen hat, habe ich mich dafür<br />
entschieden. Besonders interessant fand ich auch die Möglichkeit<br />
durch eine Abschlussprüfung ein internationales Zertifikat<br />
zu erhalten.<br />
Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?<br />
Ja, unbedingt. Der Wissenszuwachs ist enorm, ich konnte vieles,<br />
das ich in den Fortbildungsmodulen erlernt hatte, direkt in<br />
den Praxisalltag übernehmen und erfolgreich anwenden. Durch<br />
das Lernen auf die Prüfung der ESVPS habe ich mich nochmal<br />
eingehender auch mit den wissenschaftlichen Hintergründen<br />
befasst und als Erfolgsbeweis das General Practitioner Certificate<br />
erhalten. Das eingehende Beschäftigen mit ophthalmologischen<br />
Fällen hat den Spaß am Beruf noch mal spürbar erhöht.<br />
ESVPS<br />
11
Interview<br />
Ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn ich einen Fall behandle, der nicht sofort eine<br />
ersichtliche Lösung hat. Ich muss mich damit eingehender ausei nandersetzen und kann<br />
Gelerntes erfolgreich anwenden. Wenn meine Behandlungsstrategie dann erfolgreich ist,<br />
vermittelt mir das ein wirklich gutes Gefühl.<br />
Dass bei dem Druck, unter dem man als Veterinärmediziner<br />
oft steht, genau diese Freude am Beruf nicht zu<br />
kurz kommt, ist wirklich wichtig. Worauf freuen Sie sich<br />
besonders, wenn Sie morgens in die Praxis kommen?<br />
Ja, wenn ich mich mir diese Freude nicht erhalten könnte, wäre<br />
der Job wirklich sehr anstrengend. Ich freue mich ehrlich gesagt<br />
immer, wenn ich einen Fall behandle, der nicht sofort eine ersichtliche<br />
Lösung hat. Ich muss mich damit eingehender auseinandersetzen<br />
und kann Gelerntes erfolgreich anwenden. Wenn<br />
meine Behandlungsstrategie dann erfolgreich ist, vermittelt mir<br />
das ein wirklich gutes Gefühl. Dann ist auch der Kontakt mit den<br />
Patientenbesitzern sehr viel entspannter, ich kann mehr Sicherheit<br />
vermitteln und bin souveräner. Denn mir macht der Kontakt<br />
mit vielen unterschiedlichen Menschen wirklich Spaß! Der Umgang<br />
mit den Patienten selbst ist ja oft ein angenehmer.<br />
Diese beschriebene Selbstsicherheit ist auch ein interessanter<br />
Punkt. Welches Erfolgserlebnis lässt Sie denn<br />
immer noch stolz lächeln, wenn Sie daran denken?<br />
Ich hatte diesen Fall, ein Schäferhund, der anamnestisch bereits<br />
3 Monate lang wegen eines „roten, trüben Auges“ vorbehandelt<br />
war. Aufgrund meiner neuen Kenntnisse konnte ich eine<br />
Schäferhundekeratitis diagnostizieren und erfolgreich behandeln.<br />
Das ist mir besonders auch wegen der Dankbarkeit des<br />
Besitzer im Gedächtnis geblieben – und weil ich so stolz darauf<br />
bin, die Lebensqualität des Hundes wieder erhöht zu haben.<br />
Sie würden also sagen, die Vertiefungsfortbildung zur<br />
Ophthalmologie zu besuchen, hat Ihr Verhalten in der<br />
Praxis verändert?<br />
Ja, dieses Gefühl habe ich wirklich. Ich kann Patientenbesitzern<br />
gegenüber sicherer auftreten, meine Vorschläge klar formulieren.<br />
Ich kann ein breiteres Spektrum an Differentialdiagnosen<br />
aufstellen, um dann die weitere Diagnostik selbst strukturierter<br />
anzugehen und durchzuführen. Das Lernen auf die Prüfung hat<br />
mich „gezwungen“ mich intensiv mit den Inhalten der Fortbildung<br />
auseinander zu setzen. Ein GPCert zur erhalten war für<br />
mich dann die Bestätigung, dass ich auf diesem Gebiet tatsächlich<br />
umfangreicheres Wissen als vorher vorweisen kann.<br />
Das freut mich ehrlich zu hören! Ich wünsche Ihnen noch viel<br />
Erfolg und vor allem Spaß mit Ihrem erworbenen Wissen, und<br />
bedanke mich für Ihre Zeit zu diesem Interview!<br />
12<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Fallberichte aus der Praxis<br />
Pruritus bei einem 3-jährigen<br />
Border Collie Mischling durch<br />
Sarkoptesräude<br />
Von Tierärztin Nora Frank<br />
Dieser Fallbericht beschreibt einen dreijährigen Border Collie Mischlingsrüden mit einer Sarkoptesräude, der im Rahmen<br />
der Hautsprechstunde vorgestellt wurde. Bei dieser hochgradig ansteckenden parasitären Hauterkrankung handelt<br />
es sich um die Infektion mit Sarcoptes scabiei (varietas (var.) canis), der sogenannten Grabmilbe. Sie stellt sich klinisch<br />
durch hochgradigen Pruritus und einem typischen Verteilungsmuster der Exkoriationen an Ohren (Ohrränder),<br />
Knochenvorsprüngen (lateral Ellbogen, Sprunggelenk) sowie die ventralen Aspekte von Brust und Abdomen dar.<br />
Der vorgestellte Patient wurde vor etwa einem halben Jahr vom Haustierarzt hinsichtlich einer Allergie aufgearbeitet<br />
und vorbehandelt mit Oclacitinib (Apoquel® 16 mg 2 x tgl 1 Tablette) und seit drei Monaten zusätzlich mit einer Spezifischen<br />
Immuntherapie (SIT), was jedoch ohne Erfolg verlief und zu einer Verschlimmerung der Symptomatik führte. Die<br />
klinische Verdachtsdiagnose Sarkoptesräude wurde durch den positiven Pinna- Pedal- Reflex bestärkt und während<br />
der diagnostischen Therapie mit Moxidectin (Advocate® 400, 2,5 - 4 mg/kg Moxidectin und 10 - 16 mg/kg Imidacloprid,<br />
Firma Bayer) bestätigt. Zu Beginn der Therapie zeigte der Patient verstärkten Juckreiz, welcher sich im Laufe der<br />
Behandlung innerhalb von zwei Monaten vollständig reduzierte. Auf eine systemische Kortikosteroid-Therapie wurde<br />
verzichtet, da die Diagnose im Hautgeschabsel definitiv nicht gestellt werden konnte und nur so eine schnelle Beurteilung<br />
der diagnostischen Therapie möglich war. Auch die Behandlung mit Apoquel® und der SIT wurde abgesetzt.<br />
Einleitung<br />
Pruritus ist eine unangenehme Empfindung, die das Bedürfnis hervorruft zu kratzen,<br />
lecken, beißen oder scheuern (Miller et al., 2013). Hierfür kommen viele Ursachen in-<br />
Frage. Die Sarkoptesräude wird durch eine wirtsunspezifische, hochgradig kontagiöse<br />
Milbe verursacht und zählt zu einer der wichtigsten Differentialdiagnosen von juckenden<br />
Hauterkrankungen beim Hund.<br />
Die Erkrankung ist ein stetiges Problem von unterschiedlicher Frequenz und ist charakterisiert<br />
durch den starken Juckreiz. Aber auch Fälle von lokalisierter Räude, sowie<br />
symptomlosen Trägertieren sind beschrieben.<br />
Anamnese<br />
Vorgestellt wurde ein drei Jahre alter kastrierter Border Collie Mischling, der seit ungefähr<br />
sechs Monaten ausgeprägten Juckreiz zeigte.<br />
Der Hund war zuvor nicht im Ausland und lebte bis vor einem Jahr auf einem Bauernhof<br />
und wurde laut Besitzer wegen seiner unruhigen Art abgegeben. Die jetzige Besitzerin<br />
beschreibt ihn als ein Energiebündel, der sich schlecht konzentrieren kann.<br />
Sie besucht regelmäßig die Hundeschule und stellt seitdem eine Verbesserung des<br />
Verhaltens fest, ist aber sehr beunruhigt wegen des starken Juckreizes und der erfolglosen<br />
Behandlung des Haustierarztes. In einer tierärztlichen Vorbehandlung wurde<br />
von dem behandelnden Haustierarzt ein Allergiescreening mit anschließender Einzelallergenbestimmung<br />
der Firma I<strong>DE</strong>XX, Ludwigsburg durchgeführt. Das Ergebnis zeigte<br />
eine positive Antikörperreaktion auf Milben und Schimmelpilze, insbesondere auf Dermatophagoides<br />
farinae (DF) mit 2789 ELISA absorbance units (EAU). Auch weitere<br />
Milben und einzelne Gräser zeigten eine<br />
Antikörper Reaktion von 200-300 EAU<br />
(Referenzwert > 150 sind als positiv zu<br />
werten). Daraufhin wurde eine Spezifische<br />
Immuntherapie eingeleitet und der<br />
Hund unter Oclacitinib (Apoquel® 16<br />
mg, 2 x täglich 1 Tablette, Firma Zoetis)<br />
gesetzt. Die Verschlimmerung der Symptomatik<br />
beschreibt die Besitzerin durch<br />
zusätzliches Schlecken und Knabbern<br />
der Gliedmaßen auch in der Nacht. Den<br />
Schweregrad stufte sie auf einer Juckreizskala<br />
bei „acht von zehn“ ein. Auch<br />
fallen ihr vermehrt die Hautveränderungen<br />
an Ohren und Ellbogen auf.<br />
Im letzten Jahr hatte keine Futterumstellung<br />
stattgefunden. Der Hund ist regelmäßig<br />
geimpft gegen Parvovirose,<br />
Staupe, Hepatitis, Parainfluenza, Leptospirose<br />
und Tollwut (SHPPiLT®, Firma<br />
MSD). Die letzte Entwurmung mittels<br />
Milbemax® (12,5mg Milbemycon oxime,<br />
125 mg Praziquantel, Firma Novartis) ist<br />
ESVPS<br />
13
Fallberichte aus der Praxis<br />
länger als vier Monate her. Eine Ektoparasiten<br />
Behandlung wurde durch die Besitzerin<br />
im letzten Jahr nicht durchgeführt.<br />
Klinische Befunde<br />
Der Rüde präsentierte sich während der<br />
gesamten Untersuchungszeit als ein sehr<br />
aufgeregter und unsicherer Hund. Seine<br />
nervöse, hektische Art erschwerte den<br />
klinischen Untersuchungsgang, insbesondere<br />
die Auskultation.<br />
Der Ernährungs– und Pflegezustand lag<br />
in der Norm. Sein Gewicht betrug zum<br />
Zeitpunkt der Erstvorstellung 30,2 kg.<br />
Die Körpertemperatur lag bei 38,8 C. Die<br />
Maulschleimhaut war blassrosa, die kapillare<br />
Füllungszeit prompt. Alle tastbaren<br />
Lymphknoten waren unauffällig. Die Herzfrequenz<br />
war im annähernd ruhigen<br />
Zustand um 100 Schläge/ Minute. Die<br />
Herztöne waren gut abgesetzt und ohne<br />
pathologische Nebengeräusche. Die Atemfrequenz<br />
wurde nicht ausgezählt, da<br />
der Hund hochfrequent hechelte.<br />
Im Rahmen der dermatologischen Untersuchung<br />
konnte der Pinna- Pedal- Reflex<br />
durch leichtes Reiben an der Henryschen<br />
Tasche ausgelöst werden. Bei diesem<br />
Reflex reibt man den Ohrrand zwischen<br />
Zeigefinger und Daumen. Wird dabei ein<br />
Kratzreflex beim Hund ausgelöst, gilt dies<br />
als Indiz für das Vorliegen einer Sarkoptesräude.<br />
Die äußeren Pinnae zeigten eine großflächige<br />
Hypotrichose sowie eine trockene,<br />
leicht schuppige Haut. Am linken Ohr<br />
konnte man zudem eine Hyperkeratose<br />
am Ohrrand mit Krusten und Schuppen<br />
feststellen.<br />
Das gesamte Haarkleid war stumpf und<br />
glanzlos. An beiden Ellbogen, lateral nach<br />
distal ziehend, waren verkrustete Papeln<br />
zu finden. Am ventralen Abdomen sowie<br />
anden Sprunggelenken zeigte sich eine<br />
Hypotrichose mit erythematösen Papeln.<br />
Diagnostische Verfahren<br />
14<br />
Als erstes wurden mehrere oberflächliche<br />
Hautgeschabsel an Stellen mit verkrusteten<br />
Papeln und am Ohrrand entnommen.<br />
Dazu wurde eine stumpfe Skalpell-Klinge<br />
(Carbon Steel Scalpel, Braun Aesculap<br />
AG & Co KG, Tuttlingen), die zuvor mit<br />
Paraffinöl benetzt wurde, verwendet.<br />
Anschließend wurden größere Areale in<br />
Richtung Haarwachstum geschabt, um<br />
die Wahrscheinlichkeit eines positiven<br />
Geschabsels zu erhöhen. Das gewonnene<br />
Material wurde mit Paraffinöl auf einen<br />
Objektträger (Objektträger Elka, Glaswarenfabrik<br />
Karl Hecht, Sondheim) gestrichen<br />
und mit einem Deckglas abgedeckt.<br />
Das Präparat wurde nativ unter dem<br />
Mikroskop (Olympus CH-2, Firma Olypmus<br />
D GmbH, Hamburg) mit der 10 x und<br />
anschließend mit der 40 x Vergrößerung<br />
vollständig mäanderförmig auf Milben<br />
untersucht. Es wurden weder adulte Milben<br />
noch deren Eier oder Kotpartikel gefunden.<br />
Ebenso wie die Technik ist auch die<br />
Auswahl der Lokalisation entscheidend,<br />
um die Diagnose der Sarkoptesräude<br />
durch Hautgeschabsel stellen zu können.<br />
Dabei sucht man an veränderten Bereichen<br />
verkrustete Papeln auf und entnimmt<br />
dort ein Geschabsel sowie an den<br />
Ohrrändern. Ein negatives Geschabsel<br />
schließt die Diagnose jedoch nicht aus,<br />
da trotz starken Veränderungen die Milbenanzahl<br />
sehr gering sein kann.<br />
Des Weiteren wurde die Untersuchung<br />
von einigen tiefen Hautgeschabseln zum<br />
Ausschluss einer Demodikose durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse waren negativ.<br />
Zusätzlich wurde eine serologische Untersuchung<br />
auf IgG-Antikörper (AK) gegen<br />
Sarkoptes Milben eingeleitet und im<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Fallberichte aus der Praxis<br />
Hinblick auf eine mögliche diagnostische<br />
Therapie sollte der MDR1 Gendefekt ausgeschlossen<br />
werden, da es sich um einen<br />
Border Collie Mischling mit Prädisposition<br />
handelte. Hierfür wurden dem Hund<br />
2 ml Blut aus der Vena cephalica mit einer<br />
22 G –Nadel (Sterican Kanülen 22 G x 1/<br />
2 0,7 x 40, Firma Braun) entnommen.<br />
Die Serum Blutprobe für den AK Test<br />
wurde in dem Fremdlabor Vet-med-Labor<br />
I<strong>DE</strong>XX, Ludwigsburg untersucht. Das Ergebnis<br />
war ein Antikörper Titer von 18 TE<br />
(Normwert < 10,0). Ein Wert von > 15 ist<br />
laut dem Labor als positiver Befund zu<br />
werten.<br />
Die EDTA Blutprobe für den Gentest wurde<br />
in das externe Labor Laboklin, Bad<br />
Kissingen geschickt. Das Ergebnis war<br />
der Genotyp N/N (+/+). Somit handelte es<br />
sich nicht um den Träger der ursächlichen<br />
Mutation.<br />
Diagnose<br />
Der erhöhte Antikörper-Titer gab im Zusammenhang<br />
mit der klinischen Symptomatik<br />
einen Hinweis auf eine Infektion mit<br />
Sarkoptes Milben.<br />
Eine eindeutige Diagnosestellung vor<br />
Therapiebeginn ist nur möglich, wenn in<br />
den Hautgeschabseln Milben oder deren<br />
Eier nachgewiesen werden können.<br />
Da die Anzahl von Milben trotz massiver<br />
Veränderung der Haut gering sein kann,<br />
ist der direkte Nachweis selten möglich,<br />
so auch im beschriebenen Fall.<br />
Durch die erfolgreiche diagnostische<br />
Therapie konnte die Diagnose Sarkoptesräude<br />
letztendlich gestellt werden.<br />
Behandlung<br />
Der Hund erhielt Moxidectin (Advocate®<br />
2,5% Moxidectin und 10 % Imidacloprid,<br />
Firma Bayer) dreimal im Abstand von zwei<br />
Wochen, welches als Spot – On auf den<br />
Nacken des Hundes aufgetragen wurde.<br />
Bei der Therapie von Sarkoptesräude<br />
gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.<br />
Sowohl systemisch als auch<br />
lokal durch akarizide Waschungen (Curtis<br />
2004). Eine Waschung war bei diesem<br />
Hund auf Grund seines panischen Verhaltens<br />
und der mangelnden Besitzer- Compliance<br />
nicht geeignet. Eine verlässliche<br />
Alternative in der systemischen Behandlung<br />
bietet Ivermectin. Da es in Deutschland<br />
für diese Indikation nicht zugelassen<br />
ist und dafür die Zustimmung des<br />
Besitzers benötigt wird, welche wegen<br />
ESVPS<br />
der möglichen Nebenwirkungen nicht<br />
erteilt wurde, konnte auf dieses Medikament<br />
nicht zurückgegriffen werden.<br />
Zusätzlich wurde auf das häusliche Umfeld<br />
des Hundes geachtet und im Sinne<br />
der Behandlung in die Therapie mit einbezogen.<br />
So wurde neben der gründlichen<br />
Reinigung der Wohnungseinrichtung<br />
(Schlafplatz, Teppich, Spielzeug) der Besitzerin<br />
ein Umgebungsspray mit dem<br />
Wirkstoffen Permethrin und Pyriproxyfen<br />
(Indorex Spray® Permethrin 1.600mg,<br />
Pyriproxyfen 30 mg. Firma Virbac) ausgehändigt.<br />
Der Heilungsverlauf wird bei korrekter<br />
Behandlung prognostisch als sehr günstig<br />
angesehen.<br />
Verlauf und Ergebnisse<br />
In den ersten Tagen nach Applikation<br />
verstärkte sich der Juckreiz des Hundes<br />
laut Besitzerin dramatisch. Ob ein Zusammenhang<br />
zwischen dem Absterben<br />
der Milben bestand oder die Verschlimmerung<br />
mit dem Absetzten von Apoquel®<br />
zu tun hatte, konnte man zu diesem<br />
Zeitpunkt noch nicht einschätzen.<br />
Eine systemische Kortikosteroid Therapie<br />
wurde kurzzeitig in Erwägung gezogen.<br />
Da sich allerdings bereits nach zehn Tagen<br />
die Verschlimmerung einstellte, wurde<br />
darauf verzichtet, um einen objektiven<br />
Erfolg der diagnostischen Therapie einschätzen<br />
zu können.<br />
Bereits nach fünf Wochen bewertete die<br />
Besitzerin den Juckreiz mit dem Schweregrad<br />
„zwei von zehn“. Der Pinna-Pedal-<br />
Reflex war bei dieser Nachuntersuchung<br />
bereits nicht mehr auszulösen. In der<br />
siebten Woche war eine deutliche Besserung<br />
der Exkoriationen zu sehen. Die<br />
Haare an den Pinnae waren vollständig<br />
nachgewachsen. Allgemein war die Haut<br />
noch sehr trocken. Zur Verbesserung der<br />
Hautbarriere wurde ein Lipidkomplex Essential<br />
6® (Selectavet) topisch appliziert.<br />
Nach neun Wochen waren alopezische<br />
Hautstellen nicht mehr nachvollziehbar.<br />
Auch der Juckreiz war vollständig abgeklungen.<br />
Laut Besitzerin zeigt sich der<br />
Hund allgemein deutlich ruhiger und konzentrierter.<br />
In Situationen wie im Behandlungszimmer<br />
war das nicht zu erkennen,<br />
ist aber durchaus nachvollziehbar, da so<br />
ein starker Pruritus wie bei Sakroptes<br />
auch mit Wesensveränderungen einhergeht.<br />
15<br />
Diskussion<br />
Der Parasit Sarcoptes scabiei ist eine<br />
pathogene Milbe, die sowohl beim Menschen<br />
als auch beim Tier auftritt. Sie lebt<br />
im Stratum corneum der Haut ihres Wirtes<br />
(Head et al. 1990) und ist taxonomisch<br />
in die Klasse der Arachnida und<br />
die Familie der Sarcoptidae (Krätzmilben)<br />
einzuordnen (Burgess 1994, McCarthy et<br />
al. 2004).<br />
Sie stellt eine der häufigsten Ursachen für<br />
plötzlich einhergehenden Juckreiz beim<br />
Hund dar. Die Infektion erfolgt über direkten<br />
Kontakt. Da Füchse häufig betroffen<br />
sind, besteht ein erhöhtes Risiko für<br />
Jagdhunde sowie für Hunde, die sich viel<br />
in der Natur und im Wald aufhalten. Die<br />
Infektion ist eine Zoonose, so können<br />
sich Menschen bei befallenen Hunden<br />
und Wildtieren anstecken. In der Anamnese<br />
könnte die Frage, ob der Patientenbesitzer<br />
auch mit betroffen ist, einen<br />
zusätzlichen Hinweis auf eine mögliche<br />
Sarkoptesinfektion geben. Dabei kommt<br />
es bei den betroffenen Menschen meist<br />
im Bereich des Rumpfes oder der Oberarme<br />
zu stark juckenden Papeln, die<br />
ohne Therapie abheilen, da der Parasit<br />
auf der Haut des Menschen schnell abstirbt<br />
und sich nicht vermehren kann (Jasmin<br />
et al 2005).<br />
Aufgrund der hohen Infektionsgefahr,<br />
sollten betroffene Tiere isoliert werden.<br />
Lässt sich der Kontakt nicht vermeiden,<br />
etwa bei im selben Haushalt lebenden<br />
Hunden, müssen diese nach gleichem<br />
Schema mitbehandelt werden.<br />
Der gesamte Lebenszyklus dieser Milbe<br />
läuft auf dem Wirt ab. In der Umgebung<br />
überleben die verschiedenen Entwicklungsstadien<br />
nur kurze Zeit (2-6 Tage<br />
bei 25 C). Trotzdem können Nymphen<br />
und weibliche Tiere bei niedrigen Temperaturen<br />
und hoher Feuchtigkeit bis zu drei<br />
Wochen überleben und zu Reinfektionen<br />
führen (Jasmin et al 2005).<br />
Die Infektion erfolgt über direkten Kontakt<br />
und mit der Übertragung eines begatteten<br />
Weibchens, das sich bei Erstkontakt<br />
sofort in das Stratum corneum der Haut<br />
einbohrt. In einem Zeitraum von vier bis<br />
sechs Wochen findet in diesen Bohrgängen<br />
die Eiablage statt.<br />
Nach etwa drei bis vier Tagen schlüpfen<br />
aus den Eiern Larven, die an die Hautoberfläche<br />
dringen und nach etwa 9-14<br />
(Männchen) bzw. 12-21 (Weibchen) Tagen<br />
die Geschlechtsreife erlangen (Ro-
Fallberichte aus der Praxis<br />
bert-Koch-Institut 2000). Alle Stadien penetrieren<br />
die intakte Epidermis durch die<br />
Sekretion von Verdauungsenzymen und<br />
die anschließende Ingestion (McCarthy<br />
et al. 2004). Dieser Lebenszyklus ist<br />
erklärend für die Primärläsionen (erythematöse<br />
und verkrustete Papeln) an bevorzugten<br />
Lebensräumen der Milben, wie<br />
den Ohren und Knochenvorsprünge.<br />
Der bei dem vorgestellten Hund sehr ausgeprägte<br />
Pruritus lässt sich durch eine<br />
Überempfindlichkeitsreaktion erklären,<br />
bei der schon eine sehr geringe Anzahl an<br />
Parasiten ausreicht. Folglich zeigten sich<br />
die Pinnae alopezisch sowie ausgeprägte<br />
Exkoriationen an Ellbogen und Sprunggelenken.<br />
Die Hypotrichose an dem<br />
ventralen Abdomen und den Sprunggelenken<br />
ist durch extensives Schlecken<br />
selbstinduziert.<br />
Der von der Besitzerin geschilderte verstärkte<br />
Juckreiz durch zusätzliches Lecken<br />
in der Nacht, wird durch die verstärkte<br />
Grabtätigkeit der Milben, bedingt<br />
durch die Bettwärme, ausgelöst (Roos et<br />
al 2001).<br />
Da die typischen Sekundärläsionen oft<br />
erst mit zunehmendem Juckreiz zu erkennen<br />
sind, ist es umso wichtiger bei<br />
jedem pruristischen Patienten eine parasitäre<br />
Erkrankung auszuschließen, bevor<br />
eine ausführliche Allergieabklärung in Betracht<br />
gezogen wird.<br />
Im vorliegenden Fall wurde als erstes ein<br />
serologisches Allergiescreening durchgeführt<br />
und auf Grund einer stark erhöhten<br />
Antikörper Reaktion bei Dermatophagoides<br />
farinae (Df) von einer Hausstaubmilbenallergie<br />
ausgegangen.<br />
Was nicht hinterfragt wurde, ist die mögliche<br />
Kreuzreaktion zwischen Sarkoptes<br />
und Dermatophagoides farinae. Der indirekte<br />
Milbennachweis durch einen Antikörper<br />
Titer muss kritisch interpretiert<br />
werden. So setzt eine positive Reaktion<br />
voraus, dass die Infestation mindestens<br />
zwei bis vier Wochen zurück liegt. Ebenso<br />
kann es zu falsch positiven Ergebnissen<br />
durch eine Kreuzreaktion mit Df<br />
kommen und nach erfolgreicher Therapie<br />
kann ein positiver Antikörper Titer noch<br />
bis zu sechs Monaten nachweisbar sein.<br />
Curtis (2001) kam zu dem Schluss,<br />
dass serologische Untersuchungen die<br />
herkömmlichen Untersuchungsmethoden,<br />
wie die Entnahme von Hautgeschabseln,<br />
nicht ersetzen können, sondern bei<br />
negativen Befunden als Methode hinzugezogen<br />
werden sollten.<br />
Im vorliegenden Fall ist der erhöhte AK Titer<br />
im Zusammenhang mit der klinischen<br />
Ausprägung aussagekräftig gewesen.<br />
Würde man eine atopische Dermatitis<br />
erwarten, so ist davon auszugehen, dass<br />
mit der Behandlung mit Apoquel® und einer<br />
SIT zumindest eine Besserung eingetroffen<br />
wäre. Dies konnte im vorliegenden<br />
Fall jedoch nicht belegt werden.<br />
Der positive Pinna-Pedal Reflex bei dem<br />
Hund bestärkte den erhöhten AK Titer.<br />
Dieser Test hat eine Spezifität von 93 %<br />
und eine Sensitivität von 82 % (Mueller<br />
und Bettenay 2001). Dieser klinische Test<br />
eignet sich auch gut zur Therapiekontrolle.<br />
So kann dieser bereits nach vier<br />
Wochen reduziert ausfallen oder negativ<br />
sein.<br />
Es wurde schnell eine diagnostische Therapie<br />
eingeleitet. Die Therapie gestaltet<br />
sich abhängig von der Wahl des Medikamentes<br />
in der Regel sehr verlässlich und<br />
mehr oder weniger praktikabel. Therapeutisch<br />
kommen zugelassene Spot-On<br />
Präparate mit Moxidectin oder Selamectin<br />
infrage, die dreimalig in 14-tägigem<br />
Abstand appliziert werden. Alternativ<br />
können bei sehr jungen Welpen Fibronil<br />
Spray lokal appliziert und bei adulten<br />
Tieren akarizide Lösungen wie Amitraz<br />
einmal wöchentlich angewandt werden<br />
(Curtis 2004).<br />
Auch die systemische Behandlung mit<br />
Ivermectin zwei- bis dreimal im Abstand<br />
von etwa zehn Tagen gilt als gut wirksam<br />
(Jasmin et al 2005). Dies ist aber für diese<br />
Indikation in Deutschland nicht zugelassen.<br />
Bei der Therapie von Rassen mit einem<br />
möglichen MDR 1 Defekt empfiehlt<br />
es sich, dies vorher zu verifizieren und<br />
den Besitzer dementsprechend aufzuklären.<br />
Bei dem vorgestellten Hund lag kein<br />
MDR1 Gen Defekt vor und es wurde die<br />
Therapie mit Moxidectin gewählt, was innerhalb<br />
von zwei Monaten zu einer vollständigen<br />
Heilung führte.<br />
In der Kleintierpraxis werden häufig Hunde<br />
mit pruriginösen Hauterkrankungen<br />
vorgestellt. Der vorliegende Patient zeigt,<br />
dass in jedem Fall ein systematischer Zugang<br />
wichtig ist. Auch wenn man nicht<br />
bei jedem Fall ohne viele diagnostische<br />
Untersuchungen so schnell zu einer Verdachtsdiagnose<br />
kommt, sollte bei jeglichem<br />
Hinweis auf eine Sarkoptesräude<br />
schnell eine diagnostische Therapie du<br />
chgeführt werden.<br />
16<br />
Literaturliste<br />
· BURGESS, I. (1994): Sarcoptes scabiei and<br />
Scabies. Advanced Parasitology 33, S. 235-<br />
292<br />
· CURTIS, C. F. (2001): Evaluation of a commercially<br />
available enzyme-linked immunosorbant<br />
assay for the diagnosis of canine sarcoptic<br />
mange. <strong>Veterinary</strong> Record 148 (8) S. 238-239<br />
· CURTIS, C.F. (2004): Current trends in the<br />
treatment of Sarcoptes, Cheyletiella and Otodectes<br />
mite infestations in dogs and cats. <strong>Veterinary</strong><br />
Dermatology 15 S.108-110<br />
· HEAD, S. E., E. M. MACDONALD, A. EWERT<br />
und P. APISARNTHANARAX (1990): Sarcoptes<br />
scabiei in Histopathologic Sections of Skin in<br />
Human Scabies. Arch. Dermatology 126 (11),<br />
S. 1475-1476<br />
· JASMIN, P. (2006) Sarkoptesräude, Klinisches<br />
Handbuch der Dermatologie des Hundes,<br />
2ed Edition, Jasmin, P., Hannover, M&H<br />
Schaper, S. 25-30<br />
· MUELLER, R., BETTENAY, S., SHIPTONE,<br />
M. (2001) Value of the pinnalpedal reflex in the<br />
diagnosis of canine scabies. The <strong>Veterinary</strong> record.<br />
Band 148 (20) S. 621–623<br />
· MCCARTHY, J. S., KEMP, D.J, WALTON, S.F.<br />
und CURRIE, B.J. (2004): Scabies more than<br />
just an irritation. Postgraduate Medical. Journal.<br />
80 (945)<br />
S. 382-387<br />
· MUELLER, W., GRIFFIN, C., CAMPBELL, K.<br />
(2013), Structure and Function of the Skin. In:<br />
Small Animal Dermatology, 7th Edition (Mueller,<br />
C., Kirks) St. Louis, Missouri, S.1-56<br />
· ROBERT-KOCH-INSTITUT (2000): Krätzmilbenbefall<br />
(Skabies) - Erkennung, Behandlung<br />
und Verhütung. Merkblatt für Ärzte. 43 , S. 550-<br />
554<br />
· ROOS, T. C., M. ALAM, S. ROOS, H. F. MERK<br />
und D. R. BICKERS (2001): Pharmacotherapy<br />
of ectoparasitic infections. Drugs. 61 (8), S.<br />
1067-1088<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Fallberichte aus der Praxis<br />
Irismelanom bei einer 6 Jahre<br />
alten Europäisch Kurzhaar<br />
Katze<br />
Von Dr. med. vet. Susanne Friembichler<br />
In der allgemeinen Ambulanz wurde eine adulte Katze wegen Verfärbungen der Iris des linken Auges vorgestellt. Die<br />
Untersuchung des Auges ergab den Verdacht eines Irismelanoms. Der Patient wurde klinisch untersucht, eine Blutuntersuchung<br />
und eine sonographische Untersuchung des Abdomens wurden durchgeführt, ebenso wurden Thoraxröntgen<br />
angefertigt. Kurze Zeit später wurde der Patient zur Enukleation, also zur operativen Entfernung des betroffenen<br />
Auges vorgestellt. Operation und postoperativer Verlauf waren unauffällig. Die pathohistologische Untersuchung des<br />
Auges ergab die Diagnose „Melanom der Iris“.<br />
Das feline diffuse Irismelanom (FDIM) ist<br />
die häufigste primäre Neoplasie des Katzenauges<br />
(Schäffer und Gordon 1993).<br />
Bei Katzen metastasieren Irismelanome<br />
im Gegensatz zu Hunden häufiger (Bellhorn<br />
und Henkind 1970; Bertoy und andere<br />
1988). Metastasen finden sich eher<br />
im Abdomen als in der Lunge (Dubielzig<br />
und andere 2010).<br />
Kalishman und andere (1998) beschreiben,<br />
dass eine frühzeitige Enukleation,<br />
wenn der Tumor auf die Iris begrenzt ist,<br />
die Überlebensrate der Patienten verbessert.<br />
Anamnese<br />
Die 6 Jahre alte Katze (Europäisch Kurzhaar,<br />
weiblich, kastriert, 4 kg KGW<br />
[Körpergewicht]) wurde in der allgemeinen<br />
Sprechstunde vorgestellt. Seit zirka<br />
4 Monaten beobachteten die Besitzer,<br />
dass ein Auge der Katze dunkler und<br />
fleckig wurde. Im Internet haben die Besitzer<br />
gelesen, dass dies ein Hinweis auf<br />
einen Tumor sein kann. Da sie vor kurzem<br />
eine Katze mit der Diagnose Krebs verloren<br />
haben machten sie sich nun Sorgen<br />
und wollten den Patienten untersuchen<br />
lassen.<br />
Die Katze war seit der achten Lebenswoche<br />
in Besitz. Sie war unregelmäßig gegen<br />
Katzenschnupfen und Katzenseuche<br />
geimpft und wurde ausschließlich in der<br />
Wohnung gehalten.<br />
Die Katze hatte bis zu diesem Zeitpunkt<br />
keine Erkrankungen, deshalb sahen die<br />
ESVPS<br />
Besitzer von Tierarztbesuchen außer zum<br />
Zweck der Kastration und der Impfungen<br />
ab.<br />
Klinische Befunde<br />
Die allgemeine Untersuchung des Patienten<br />
wurde angelehnt an die Richtlinien<br />
der klinischen Propädeutik der Haus- und<br />
Heimtiere (Baumgartner 2009) durchgeführt<br />
und zeigte keine Auffälligkeiten.<br />
Die Katze präsentierte sich im Untersuchungsraum<br />
ruhig und aufmerksam, die<br />
Körperhaltung war der Tierart entsprechend,<br />
der Ernährungszustand gut.<br />
Das Fell war glatt und glänzend, die Hautoberfläche<br />
ohne Besonderheiten (oB),<br />
die Hautelastizität erhalten, die Hauttemperatur<br />
oB.<br />
Die innere Körpertemperatur betrug rektal<br />
gemessen 38,4°C.<br />
Die Katze hatte eine Pulsfrequenz von<br />
160 Schlägen pro Minute, der Puls war<br />
kräftig, regelmäßig, gleichmäßig, die Arterie<br />
femoralis war gut gefüllt und gut<br />
gespannt.<br />
Die Atemfrequenz der Katze betrug 20<br />
Atemzüge pro Minute mit kostoabdominalem<br />
Atmungstyp, Auskultation von<br />
Herz und Lunge war oB.<br />
Augenumgebung, Ohren, Nase und<br />
Maulhöhle zeigten keine Auffälligkeiten,<br />
die sichtbaren Schleimhäute waren blassrosa,<br />
die Kapillarfüllungszeit war physiologisch<br />
mit < 2 Sekunden.<br />
Die tastbaren Lymphknoten waren oB.<br />
Die Abdomenpalpation war unauffällig,<br />
17<br />
das Abdomen war weich und durchtastbar.<br />
Die Augenuntersuchung ergab folgende<br />
Befunde:<br />
Die Sehproben waren beidseits positiv,<br />
die Drohantwort war auslösbar, Blendreflex<br />
und Lidreflex oB.<br />
Der direkte Pupillarreflex war beidseits<br />
prompt und vollständig, der indirekte Pupillarreflex<br />
war beidseits vorhanden.<br />
Bei der vergleichenden Distanzbetrachtung<br />
der Augen fiel auf, dass im Vergleich<br />
zum rechten Auge die Iris des<br />
linken Auges dunkler erschien.<br />
Am rechten Auge wurden keine pathologischen<br />
Befunde erhoben.<br />
Folgende Befunde beziehen sich auf das<br />
linke Auge. Die Augenumgebung war wie<br />
bereits genannt oB.<br />
Die Lidspalte war oB, der Bulbus der Tierart<br />
entsprechend. Lider, Bindehaut und<br />
Sklera waren oB. Die Pupille war mittelweit<br />
und symmetrisch. Die Hornhaut<br />
war glatt, glänzend, eben und durchsichtig,<br />
sie war physiologisch gewölbt und<br />
von physiologischer Dicke. Die vordere<br />
Augenkammer und der Kammerwinkel<br />
waren ohne Besonderheiten.<br />
Bei der Untersuchung der Irisoberfläche<br />
fiel eine flache, diffuse Pigmentierung<br />
auf. Das Irisrelief war erhalten.<br />
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt<br />
schon mangelnder Patientenkooperation<br />
musste auf eine Messung des intraokularen<br />
Druckes mittels Schiötz Tonometer<br />
verzichtet werden.
Fallberichte aus der Praxis<br />
Weiterführende Diagnostik<br />
Am Tag der Erstvorstellung wurde eine Blutuntersuchung im Haus durchgeführt. Zur<br />
Erstellung des Blutbildes wurde das Gerät Vet ABC der Firma SCIL verwendet. Die<br />
Anzahl der weißen und roten Blutzellen, Hämoglobinwert, Hämatokrit und Thrombozytenzahl<br />
befanden sich im Normbereich (siehe auch Anhang Abbildung I):<br />
Weiße Blutzellen<br />
Rote Blutzellen<br />
Hämoglobin<br />
Hämatokrit<br />
Thrombozyten<br />
Glukose<br />
Harnstoff<br />
Kreatinin<br />
Phosphor<br />
Kalzium<br />
Gesamtprotein<br />
Albumin<br />
Globuline<br />
BLUTCHEMIE<br />
Alanin-Aminotransferase<br />
Alkalische Phosphatase<br />
Gamma-Glutamyl-Transferase<br />
Gesamtbilirubin<br />
Cholesterin<br />
Amylase<br />
Lipase<br />
Natrium<br />
Kalium<br />
Chlorid<br />
BLUTBILD<br />
ERGEBNIS<br />
ERGEBNIS<br />
5,72 10³/mm³<br />
8,72 106/mm³<br />
9,43 g/dl<br />
45,09%<br />
252 10³/mm³<br />
124 mg/dL<br />
24 mg/dL<br />
2 mg/dL<br />
4,2 mg/dL<br />
10,2 mg/dL<br />
6,9 g/dL<br />
3,6 g/dL<br />
3,3 g/dL<br />
43 U/L<br />
41 U/L<br />
< 0 U/L<br />
0,2 mg/dL<br />
125 mg/dL<br />
1132 U/L<br />
230 U/L<br />
165 mmol/L<br />
3,7 mmol/L<br />
111 mmol/L<br />
REFERENZBEREICH<br />
REFERENZBEREICH<br />
18<br />
5 -11 10³/mm³<br />
5 - 10 106/mm³<br />
8 - 17 g/dl<br />
27 - 47 %<br />
180 - 430 10³/mm³<br />
Die blutchemische Untersuchung der Organparameter zeigte bis auf einen unwesentlich<br />
verringerten Chloridwert keine Auffälligkeiten (siehe auch Anhang Abbildung I), untersucht<br />
wurde mit dem Gerät Catalyst DX der Firma I<strong>DE</strong>XX:<br />
74-159 mg/dL<br />
16-36 mg/dL<br />
0,8-2,4 mg/dL<br />
3,1-7,5 mg/dL<br />
7,8-11,3 mg/dL<br />
5,7-8,9 g/dL<br />
2,2-4,0 g/dL<br />
2,8-5,1 g/dL<br />
12-130 U/L<br />
14-111 U/L<br />
0-4 U/L<br />
0-0,9 mg/dL<br />
65-225 mg/dL<br />
500-1500 U/L<br />
100-1400 U/L<br />
150-165 mmol/L<br />
3,5-5,8 mmol/L<br />
112-129 mmol/L<br />
Da Irismelanome in die Mandibularlymphknoten metastasieren können wurde der linke<br />
Mandibularlymphknoten mit einer Kanüle (Terumo® Agani Needle, 23Gx1“) punktiert<br />
und das gewonnene Material direkt in der Klinik zytologisch untersucht, indem es auf<br />
einen Objektträger aufgetragen, mittels Schnellfärbung (Diff-Quick Färbeset, Medion<br />
Diagnostics AG, Düdingen, Schweiz) gefärbt und mikroskopisch untersucht wurde. Im<br />
untersuchten Lymphknotenaspirat fanden sich keine Melanozyten, somit lieferte es<br />
keinen Hinweis auf eine Infiltration des Lymphknotens.<br />
Um potentielle Metastasen in der Lunge zu detektieren wurden Lungenröntgen in 2<br />
Ebenen angefertigt, die Lunge stellte sich metastasenfrei dar (siehe Anhang Abbildung<br />
II). Das weitere Tumorscreening beinhaltete eine sonographische Untersuchung des<br />
Abdomens mit speziellem Augenmerk auf die Leber. Der Patient war am Tag der Untersuchung<br />
nicht nüchtern, durch die starke Magenfüllung waren nicht alle Leberbereiche<br />
einsehbar, weshalb mit den Besitzern besprochen wurde, die Ultraschalluntersuchung<br />
dieses Organs zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Das restliche Abdomen<br />
stellte sich oB dar.<br />
Diagnose<br />
Differentialdiagnostisch kamen Irisnävi<br />
(gutartige Verfärbungen der Irisoberfläche)<br />
oder ein Irismelanom in Frage. Aufgrund<br />
der Anamnese (progressive Verfärbung<br />
der Iris innerhalb weniger Monate)<br />
und der klinischen Befunde wurde die<br />
Verdachtsdiagnose eines felinen diffusen<br />
Irismelanoms (FDIM) ohne derzeit erkennbare<br />
Metastasierung in den Mandibularlymphknoten,<br />
den Bauchraum oder die<br />
Lunge ausgesprochen.<br />
Behandlung<br />
Bereits am Tag der Erstvorstellung<br />
entschieden sich die Besitzer für eine<br />
Enukleation des betroffenen Auges.<br />
Aufgrund der erhobenen Befunde der<br />
Allgemeinen Untersuchung, der Blutuntersuchung<br />
und der bildgebenden Verfahren<br />
wurde der Patient in ASA (American<br />
Society of Anesthesiologists) Stufe<br />
II eingestuft und ein Operationstermin<br />
vereinbart.<br />
12 Tage nach der Erstvorstellung wurde<br />
der Patient zur Enukleation vorgestellt.<br />
Die klinische Untersuchung am Operationstag<br />
war unauffällig, die Pigmentierung<br />
des Auges ist innerhalb dieser<br />
Zeit dunkler und dichter geworden. Nach<br />
der Ultraschallkontrolle der Leber, die<br />
ein unauffälliges sonographisches Bild<br />
zeigte, wurde der Patient für die Narkose<br />
vorbereitet.<br />
Nach Setzen einer Venenverweilkanüle<br />
(VasoVet 22G x 1“; 0,9 x 25 mm; 36 ml/<br />
min; Firma Braun) in die rechte Vena<br />
cephalica wurde die Katze mit 0,08 ml<br />
Butorphanol (Alvegesic® vet. 10 mg/<br />
ml, Alvetra u. Werfft, Dosierung 0,2 mg/<br />
kg KGW) intravenös prämediziert. Als<br />
präemptive Analgesie erhielt der Patient<br />
0,4 ml Meloxicam subkutan (Metacam®<br />
2 mg/ml Injektionslösung für Katzen,<br />
Boehringer Ingelheim) das entspricht<br />
0,2 mg/kg KGW. Als Antibiotikum wurde<br />
schon zum Zeitpunkt der Prämedikation<br />
0,4 ml Cefovecin (Convenia® 80 mg/ml;<br />
Zoetis; 8 mg/kg KGW) subkutan verabreicht,<br />
da im Vorfeld abgeklärt wurde, dass<br />
die Besitzer der Katze keine Tabletten<br />
eingeben können und somit eine postoperative<br />
antibiotische Abdeckung nicht<br />
gewährleistet werden konnte. Convenia®<br />
hat eine Depotwirkung über 14 Tage.<br />
Die Narkose wurde intravenös mit Propofol<br />
(Propofol®- Lipuro 10 mg/ml, B.<br />
Braun Melsungen AG) eingeleitet. Um<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Fallberichte aus der Praxis<br />
ESVPS<br />
den Patienten in einen intubationsfähigen<br />
Zustand zu versetzen waren 2 ml (5 mg/<br />
kg KGW) notwendig. Der Patient wurde<br />
orotracheal intubiert (Endotrachealtubus<br />
Firma Rüsch, Innendurchmesser 4.0 mm)<br />
und die Narkose wurde als Inhalationsnarkose<br />
(halbgeschlossenes Rückatemsystem)<br />
mit Isofluran (Vetflurane® 1000<br />
mg/g, Virbac; inspiratorisches Isofluran<br />
1,0) in Sauerstoff (Flussrate 0,8 Liter/Minute)<br />
fortgesetzt.<br />
Da es während dieses Eingriffes durch<br />
den sogenannten okulokardialen Reflex<br />
durch den Zug an den Augenmuskeln zu<br />
einem massiven Herzfrequenzabfall kommen<br />
kann, wurden 0,32 ml Atropin (Atropinsulfat<br />
B. Braun 0,5 mg/ml; 0,04 mg/<br />
kg KGW) zur intravenösen Gabe im Falle<br />
einer plötzlichen Bradykardie als Notfallmedikament<br />
griffbereit vorbereitet.<br />
Auf eine Lokalanästhesie in Form eines<br />
retrobulbären Blockes wurde verzichtet,<br />
da in der Klinik kein Lidokain mit Sperrkörper<br />
verfügbar war.<br />
Nach Rasur und Reinigung (0,5 % Polividon<br />
Jod, Betaisodona® Lösung, Mundipharm)<br />
des Operationsfeldes wurde<br />
der Augapfel mit einer an die laterale<br />
Enukleation angelehnten Technik entfernt.<br />
Nach einer lateralen Kanthotomie<br />
von ca. 5 mm Länge wurden die Augenlider<br />
von lateral nach medial mit einer<br />
gebogenen Metzenbaumschere entfernt<br />
(Schnittführung in etwa 5 mm vom Lidrand<br />
entfernt), im Anschluss wurde der<br />
mediale Kanthus entfernt. Die Nickhaut<br />
wurde vorverlagert und entfernt, ebenso<br />
die verbliebene palpebrale Konjunktiva.<br />
Im Anschluss wurde entlang des Bulbus<br />
mit einer gebogenen Metzenbaumschere<br />
in die Tiefe dissektiert, und der mit einer<br />
Allis Klemme fixierte Bulbus von den<br />
Augenmuskeln getrennt. Zuletzt wurde<br />
der Sehnerv durchtrennt und der Bulbus<br />
konnte in toto entfernt werden. Das<br />
in der Orbita verbliebene Muskelgewebe<br />
wurde mit einem Polyglactin 910 Faden<br />
(PGLA2CN, 24 mm, 3/8 reverse cutting)<br />
der Stärke USP 3/0 fortlaufend zu einer<br />
dichten Muskelplatte vernäht. Die Unterhaut<br />
wurde mit PGLA2CN 4/0 fortlaufend<br />
vernäht, abschließend wurde die Haut<br />
mit PGLA2CN 4/0 mit Einzelknopfnähten<br />
verschlossen. Die Operationsdauer betrug<br />
35 Minuten.<br />
Der Patient wurde während der Narkose<br />
mittels EKG, Kapnographie und Pulsoxymetrie<br />
überwacht. Der Patient war stabil<br />
in Narkose, mit einer durchschnittlichen<br />
Herzfrequenz von 100 Schlägen pro Minute,<br />
einer durchschnittlichen Atemfrequenz<br />
von 20 Atemzügen pro Minute,<br />
einer Sauerstoffsättigung von 100%<br />
während der ganzen Narkosedauer und<br />
einem durchschnittlichen endexspiratorischen<br />
CO2 von 40 mmHg. Es kam zu<br />
keiner Komplikation im Sinne einer Reflex-Bradykardie.<br />
Während des Eingriffes<br />
erhielt der Patient eine intravenöse Infusion<br />
(Sterofundin Infusionslösung 1/1 E,<br />
B. Braun Melsungen) mit einer Flussrate<br />
von 40 Milliliter pro Stunde. Als postoperative<br />
Analgesie erhielt der Patient 0,13<br />
ml Buprenorphin (Bupaq® Multidose 0,3<br />
mg/ml, Injektionslösung für Hunde und<br />
Katzen, Firma Richter Pharma AG; Dosierung:<br />
10μg/kg KGW) intravenös.<br />
Die Aufwachphase verlief ruhig und<br />
unkompliziert, der Patient konnte 10 Minuten<br />
nach Narkoseende extubiert werden.<br />
Nachdem die Katze wach und ansprechbar<br />
war, wurde ihr ein Halskragen<br />
zum Schutz der Operationswunde aufgesetzt,<br />
der gut toleriert wurde.<br />
Der entfernte Augapfel wurde zur pathohistologischen<br />
Untersuchung in eine externe<br />
Praxis für Tierpathologie eingesandt.<br />
Auf Wunsch der Besitzer blieb der Patient<br />
2 Tage postoperativ in der Klinik, da sie<br />
meinten, mit eventuellen, meist unproblematischen<br />
Nachblutungen aus der<br />
Naht nicht zurechtzukommen. Die tägliche<br />
klinische Untersuchung ergab keine<br />
Auffälligkeiten, es kam zu keinen Nachblutungen.<br />
Als Analgesie erhielt der Patient<br />
einmal täglich 0,4 ml Meloxicam oral<br />
(Metacam® 0,5 mg/ml Suspension zum<br />
Eingeben für Katzen, 0,05 mg/kg KGW).<br />
Nach 2 Tagen wurde der Patient in häusliche<br />
Pflege entlassen. Die Besitzer wurden<br />
instruiert, der Katze für weitere 5<br />
Tage einmal täglich Meloxicam oral zu<br />
verabreichen. Der Halskragen sollte bis<br />
zur Nahtentfernung getragen werden.<br />
Verlauf und Ergebnisse<br />
10 Tage nach Entlassung, also 12 Tage<br />
postoperativ, wurde der Patient zur Nahtentfernung<br />
in der Klinik vorgestellt.<br />
Durch 2 Telefonate während dieses Zeitraums<br />
war schon bekannt, dass der<br />
Patient zuhause keine Probleme hatte,<br />
die Medikamenteneingabe problemlos<br />
funktionierte und der Halskragen über<br />
diesen Zeitraum gut toleriert wurde.<br />
Die Wunde präsentierte sich in einem guten<br />
Zustand, es bestanden keine Rötungen<br />
oder Schwellungen, die Nähte waren<br />
in situ und wurden entfernt.<br />
Bei der Nahtentfernung wurde mit den<br />
19<br />
Besitzern auch der pathohistologische<br />
Befund besprochen, die Diagnose lautet:<br />
Melanom der Iris. Der zytologische Befund<br />
lautet wie folgt: „Der Radiärschnitt<br />
durch Iris und Ziliarkörper zeigt im Bereich<br />
der Irishinterseite eine Zunahme an<br />
gut differenzierten schwach pigmenthältigen<br />
bräunlichen Melanozyten im Irisstroma;<br />
mitotische Aktivität ist nicht sichtbar;<br />
der Ziliarkörper und der Kammerwinkel<br />
sind unauffällig.“ Die Dignität wurde als<br />
„gering maligne“, die Prognose als „gut“<br />
eingestuft. (siehe Anhang Abbildung III)<br />
Diskussion<br />
Bereits 1993 wurde das „Feline okuläre<br />
Melanom“ von Schäffer und Gordon als<br />
die häufigste okuläre Neoplasie des Katzenauges<br />
angesprochen. Auch im Jahr<br />
2010 wurden Fallzahlen zu dieser Tumorart<br />
geliefert. Die Auswertung der Datenbank<br />
des Comparative Ocular Pathology<br />
Laboratory of Wisconsin (COPLOW) mit<br />
Präsentation der Ergebnisse in „<strong>Veterinary</strong><br />
Ocular Pathology a comparative review“<br />
(Dubielzig und andere 2010) zeigte<br />
folgendes: 1358 Fälle von felinem diffusem<br />
Irismelanom (FDIM) finden sich in<br />
der Datenbank von COPLOW, das sind<br />
50% aller eingesandten felinen Tumore<br />
und 26 % der felinen Bulbi.<br />
Aufgrund der Häufigkeit und potentieller<br />
Malignität des Tumors stellen das anfangs<br />
inhomogene Erscheinungsbild und die nicht<br />
vorhersehbare Tumorprogression die<br />
behandelnden Tierärzte oft vor Probleme<br />
bezüglich der idealen Behandlung.<br />
Der vorgestellte Patient hatte ein Alter<br />
von 6 Jahren, Irismelanome treten laut<br />
Literatur eher bei älteren Katzen auf. Die<br />
Patienten, deren Augen zur Auswertung<br />
an das pathologische Institut in Wisconsin<br />
(COPLOW) geschickt wurden, hatten<br />
im Schnitt ein Alter von 9,4 Jahren (Dubielzig<br />
und andere 2010). Patnaik und<br />
Mooney (1988) sprechen von einem<br />
durchschnittlichen Alter von 11 Jahren.<br />
Nicht nur aufgrund des Alters wurden bereits<br />
vor der Untersuchung des Patienten<br />
Differentialdiagnosen zum Vorstellungsgrund<br />
„Auge wird dunkler“ erstellt. Diese<br />
beinhalteten neben dem FDIM benigne<br />
Pigmentflecken, entzündliche Prozesse<br />
der Uvea und uveale Zysten. Aufgrund<br />
der Anamnese und Untersuchung erhärtete<br />
sich der Verdacht eines Irismelanoms.<br />
Initial stellen sich Irismelanome als dunkle,<br />
flache, lokal begrenzte Punkte an
Fallberichte aus der Praxis<br />
der Irisvorderfläche dar, die schwer von<br />
gutartigen Nävi oder einer Alterspigmentierung<br />
zu unterscheiden sind (Martin<br />
2013). Die einzelnen Punkte können<br />
sich ausdehnen und zu fleckigen Veränderungen<br />
führen, es kann sich auch die<br />
Zahl der pigmentierten Stellen erhöhen.<br />
Außerdem kann es zu einer Dickenzunahme<br />
der Iris kommen und/oder das Irisrelief<br />
kann sich verändern.<br />
Durch die Dickenzunahme der Iris können<br />
sich die Pupillenform und die Beweglichkeit,<br />
sprich die Fähigkeit zu Miose<br />
und Mydriase verändern (Stiles 2013).<br />
Die Zeitspanne, in der die genannten<br />
Veränderungen auftreten, ist sehr variabel,<br />
wobei zeitliche Angaben von wenigen<br />
Monaten bis mehreren Jahren<br />
genannt werden (Stiles 2013). Bei dem<br />
Patienten im Fallbericht kam es innerhalb<br />
der 12 Tage zwischen Erstvorstellung und<br />
Operationstermin zu einer flächigen Vergrößerung<br />
der Pigmentierung, auch die<br />
Besitzer haben in den Monaten vor der<br />
Erstvorstellung bereits Veränderungen<br />
beobachtet.<br />
Komplikationen direkt am Auge durch nicht<br />
oder zu spät behandelte Irismelanome<br />
stellen therapieresistente Uveitiden und<br />
das sekundäre Glaukom dar. Zu einem<br />
Glaukom kann es durch Abschwemmung<br />
von Zellen in den Kammerwinkel und dadurch<br />
zu dessen Verschluss kommen.<br />
Wenn bereits ein sekundäres Glaukom<br />
vorhanden ist, muss die Erkrankung als<br />
fortgeschritten angesehen werden (Stiles<br />
2013). Bei dem Patienten dieses Fallberichtes<br />
konnten keine Zellen in der vorderen<br />
Augenkammer dargestellt werden,<br />
der Kammerwinkel stellte sich oB dar.<br />
Der Augendruck wurde nicht gemessen.<br />
Irismelanome können metastasieren, als<br />
Zielorgane von Metastasen werden die<br />
Bauchorgane – speziell die Leber – und<br />
die Lunge genannt (Stiles 2013). Ebenso<br />
können Metastasen in den Lymphknoten<br />
(Mandibular- und Submandibularlymphknoten)<br />
nachgewiesen werden (Patnaik<br />
und Mooney 1988). Diese Studie aus<br />
dem Jahr 1988 spricht auch von einer<br />
Metastasierungsrate von 63%. Metastasen<br />
können auch 1 bis 3 Jahre nach der<br />
Enukleation auftreten (Stiles 2013).<br />
Der behandelte Patient zeigte zum Zeitpunkt<br />
der Vorstellung keine Metastasen<br />
im Mandibularlymphknoten und keinen<br />
Hinweis auf Metastasen in Lunge und<br />
Bauchraum.<br />
Nicht jede Pigmentveränderung der Iris<br />
bei Katzen stellt ein malignes Melanom<br />
dar. Wie schon beschrieben können<br />
sich Pigmentveränderungen über Monate<br />
bis Jahre verändern. Sie können das<br />
Irisstroma und den Klammerwinkel bzw.<br />
den skleralen Venenplexus erreichen,<br />
wodurch Metastasen verbreitet werden.<br />
Solange die Pigmentflecke nur die Irisoberfläche<br />
betreffen, wird von vielen Autoren<br />
eine Beobachtung des Verlaufes<br />
empfohlen. Eine Entfernung der Pigmentflecken<br />
mittels Laserablation, ähnlich wie<br />
bei Hunden eingesetzt, stellt eine Behandlungsoption<br />
dar (Stiles 2013), allerdings<br />
liegen hier noch keine kontrollierten<br />
Studien vor (Miller 2013). Beachten muss<br />
man auch, dass potentiell maligne Zellen<br />
durch diese Behandlung in die vordere<br />
Augenkammer abgeschwemmt werden<br />
können.<br />
Die Therapie der Wahl stellt die Enukleation<br />
dar, allerdings gibt es aufgrund der<br />
bisher genannten Punkte keine klaren Angaben<br />
bezüglich des idealen Zeitpunktes.<br />
Kalishman und andere (1998) streichen<br />
heraus, dass eine frühzeitige Enukleation<br />
die Überlebensrate der Patienten erhöht.<br />
Miller (2013) nennt folgende Kriterien für<br />
die Enukleation eines Auges mit progressiver<br />
Irispigmentierung: erkennbare Dickenzunahme<br />
des Irisstromas, Verziehen<br />
der Pupille und/oder Beeinträchtigung<br />
der Pupillenmotorik, Beteiligung des Ziliarkörpers,<br />
Ausbreitung in die Sklera, das<br />
Bestehen eines sekundären Glaukoms<br />
oder eine therapieresistente Uveitis.<br />
Die Besitzer des Patienten in diesem<br />
Fallbericht entschieden sich für eine frühzeitige<br />
Enukleation, da sie erst unlängst<br />
eine Katze durch eine Krebserkrankung<br />
verloren haben. Aufgrund der unvorhersehbaren<br />
Tumorprogression sprach nichts<br />
gegen die zeitnahe Enukleation. Eine<br />
jährliche Kontrolle des Patienten wegen<br />
der Gefahr von später auftretenden Metastasen<br />
wurde den Besitzern empfohlen.<br />
Literaturliste<br />
· BAUMGARTNER, W. (2009) Allgemeiner klinischer<br />
Untersuchungsgang. Kapitel 4 in Klinische<br />
Propädeutik der Haus- und Heimtiere.<br />
7. Auflage (Baumgartner, W.) Stuttgart, Parey<br />
in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH &<br />
Co.KG Verlag Seite 41 – 195<br />
· BELLHORN, R., HENKIND, P. (1970) Intraocular<br />
malignant melanoma in domestic cats.<br />
Journal of Small Animal Practice 10 631 – 637<br />
· BERTOY, R., BRIGHTMAN, A., REGAN, K.<br />
20<br />
(1988) Intraocular melanoma with multiple metastases<br />
in a cat. Journal of the American <strong>Veterinary</strong><br />
Medical Association 192 87 – 89<br />
· DUBIELZIG, R., KETRING, K., MCLELLAN,G.,<br />
ALBERT, D. (2010) The Uvea. Chapter 9 in <strong>Veterinary</strong><br />
Ocular pathology a comparative review<br />
1st edition, (Dubielzig, R., Ketring, K., McLellan,<br />
G., Albert, D.) Edinburgh, London, New<br />
York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney,<br />
Toronto Saunders Elsevier Limited. pp 245 –<br />
322<br />
· KALISHMAN, J., CHAPPELL, R., FLOOD, L.,<br />
DUBIELZIG, R. (1998) A matched observational<br />
study of survival in cats with enucleation<br />
due to diffuse iris melanoma <strong>Veterinary</strong><br />
Ophthalmology 1 25 – 29<br />
· MARTIN, C.L. (2013) Anterior Uvea and Anterior<br />
Chamber. Chapter 11 in Ophthalmic disease<br />
in <strong>Veterinary</strong> Medicine 3rd Impression<br />
(Martin, C. L.) London, Manson Publishing Ltd<br />
pp 298 – 336<br />
· MILLER, P.E. (2013) Uvea. Chapter 11 in<br />
Slatter´s Fundamentals of <strong>Veterinary</strong> Ophthalmology<br />
fifth edition (Maggs, D.J., Miller, P. E.,<br />
Ofri, R.) St. Louis, Saunders Elsevier Inc. pp<br />
220 – 246<br />
· PATNAIK, A. K., MOONEY, S. (1988) Feline<br />
melanoma: a comparative study of ocular, oral,<br />
and dermal neoplasms. <strong>Veterinary</strong> Pathology<br />
25 105 – 112<br />
· SCHÄFFER, E.H., GORDON, S. (1993) Das<br />
feline okuläre Melanom. Tierärztliche Praxis 21<br />
255 – 264<br />
· STILES, J. (2013) Feline Ophthalmology<br />
Chapter 27 in <strong>Veterinary</strong> Ophthalmology, fifth<br />
edition (Gelatt, K.N., Gilger, B.C., Kern, T.J.:<br />
Editors) John Wiley & Sons, Inc. pp 1477 –<br />
1560<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Fallberichte aus der Praxis<br />
Anhang<br />
Abbildung I: Organprofil und Blutbild<br />
GLU: Glukose; BUN: Harnstoff; CREA: Kreatinin; PHOS: Phosphor; CA: Kalzium; TP:<br />
Gesamtprotein; ALB: Albumin; GLOB: Globulin; ALT: Alanin-Aminotransferase; ALKP:<br />
Alkalische Phosphatase ; GGT: Gamma-Glutamyl-Transferase; TBIL: Gesamtbilirubin;<br />
CHOL: Cholesterin; AMYL: Amylase; LIPA: Lipase; Na: Natrium; K: Kalium; Cl: Chlorid;<br />
Osm Calc: Serumosmolarität<br />
WBC: white blood cells; RBC: red blood cells; HGB: Hämoglobin; HCT: Hämatokrit;<br />
PLT: Thrombozyten<br />
Abbildung II: Thoraxröntgen Abbildung II: Thoraxröntgen<br />
Aufnahme II: ventrodorsaler Strahlengang<br />
ESVPS<br />
21
Fallberichte aus der Praxis<br />
Abbildung III: Befund Histologie<br />
VET 14 2.0 05/2015/A-D<br />
Endoskopische Aufnahmen von Dr. Tim McCarthy<br />
Otitis: ein häufiges Problem<br />
KARL STORZ: die einzigartige Lösung<br />
• Unübertroffene optische Qualität<br />
• Endoskope und Zubehör vollständig autoklavierbar<br />
• Leistungsstarkes, präzises Saug- und Spülsystem<br />
• Einfache digitale Aufzeichnung von Standbildern/Videos<br />
KARL STORZ GmbH & Co. KG, Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Germany, www.karlstorz.com<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Expert´s Expertenecke article<br />
Dipl. Tzt. Sabine Schroll, Verhaltensmedizinerin<br />
Ein zentraler Punkt in der Philosphie der ESVPS ist, den eigenen Interessenschwerpunkten<br />
zu folgen und sich gezielt weiterzubilden, um Fachkenntnis, aber auch Freude am<br />
alltäglichen Berufshandwerk immer weiter auszubauen.<br />
Daher haben wir auch unsere Verhaltensexpertin gebeten, ein wenig von sich zu erzählen,<br />
und ihr diese Frage gestellt:<br />
Wodurch bleibt Ihre Begeisterung für die<br />
Verhaltensmedizin erhalten?<br />
Ganz vorrangig ist das sicher die immer noch erhaltene grosse<br />
Liebe zum Beruf und das Interesse, die Beziehungen zwischen<br />
Menschen und ihren Katzen, Hunden, sowie deren Lebensqualität<br />
zu verbessern. Zahlreiche Probleme sind ja auf<br />
Missverständnisse zwischen zwei Arten ohne gleiche Sprache<br />
zurückzuführen und in der verhaltensmedizinischen Konsultation<br />
versuche ich eine Mediations- und Dolmetscherrolle für<br />
meine Patienten einzunehmen.<br />
Dann natürlich sind es die für jeden Fall immer wieder neu zu<br />
entdeckenden Lösungsansätze, Ideen und individuellen kreativen<br />
Einfälle, die es braucht, um ein an sich fachlich simples<br />
Problem für diese spezielle Familie in ihrem Lebenskontext<br />
erfolgreich zu lösen. Es gibt auch nach all den Jahren und Erfahrungen<br />
immer noch so viele neue Dinge zu entdecken!<br />
Die Schnittstelle zwischen körperlichen und psychischen<br />
Störungen wird in den letzten Jahren immer deutlicher und<br />
als Tierärztin finde ich es natürlich ausgesprochen spannend,<br />
diese Verbindungsstellen zu suchen, die Diagnostik auch<br />
durch den Aspekt der ethologischen Anamnese zu erweitern.<br />
Dazu gehört für mich auch die permanente Verfeinerung im<br />
Umgang mit den Patienten selbst, die Suche nach mehr Kooperation<br />
und weniger Angst beim Tierarzt. Es ist einfach so<br />
viel schöner, Katzen und Hunde, die nicht gestresst sind, zu<br />
untersuchen, als sich eine Untersuchung und Behandlung zu<br />
erzwingen. Es gibt noch so viel zu tun …<br />
Und nicht zuletzt ist es der ausreichende geistige Freiraum,<br />
die Zeiten des Alleinseins, draussen in der Natur, die ich mir<br />
nehme, um die Empathie und Freude nicht zu verlieren – oder<br />
nach besonders anstrengenden Phasen wiederzugewinnen.<br />
ESVPS<br />
23
Expert´s Expertenecke article<br />
Experten Ecke<br />
Heute<br />
Von Verhaltensmedizinerin Dipl. Tzt. Sabine Schroll<br />
Sie wollen unsichere Besitzer fundiert beraten?<br />
Hier einige Tipps der Katzenexpertin Sabine Schroll (Dipl. Tzt) dazu!<br />
Das Interesse von Katzenbesitzern an optimaler Fütterung ist gross und in beinahe<br />
jeder Routinevisite kann diese Frage angesprochen werden – sei es der unerfahrene<br />
Besitzer mit der jungen Katze, die dringende Gewichtsreduktion des übergewichtigen<br />
kastrierten Katers im mittleren Alter oder die sensible Katze mit wiederkehrendem<br />
Erbrechen.<br />
Während für den Besitzer vor allem die Fragen nach bester Zusammensetzung,<br />
Trocken-oder Feuchtfutter, Freiheit von bestimmten Inhaltsstoffen im Mittelpunkt<br />
des Interesses steht, gibt es auch andere<br />
Faktoren für katzengerechte Fütterung.<br />
Nicht nur das WAS ist für die Qualität der<br />
Katzenfütterung entscheidend, sondern<br />
auch das WIE.<br />
Zahlreiche körperliche und Verhaltensprobleme<br />
lassen sich auf nicht katzengerechte<br />
Fütterungsstrategien zurückführen.<br />
Dazu gehören:<br />
• Übergewicht<br />
• Erbrechen nach dem Fressen<br />
• Ständiges Betteln<br />
• Frühmorgendliche Aktivität<br />
und Aufwecken des Besitzers<br />
• Probleme im Mehrkatzen-Haushalt<br />
• Unsauberkeit<br />
• Harnmarkieren<br />
Cat Pyramid – einfaches mobiles Futterspielzeug für Anfängerkatzen<br />
24<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
Expert´s Expertenecke article<br />
Sunnyboy hat das NoBowl Feeding System sofort begriffen<br />
Spielesammlung – auch bei Futterspielzeugen ist Abwechslung sinnvoll<br />
Einfaches Fummelbrett für Katzen – Futter sehen und riechen erleichtert den Einstieg ins Activity<br />
Feeding.<br />
Pipolino – ein mobiler Futterspender, der Trockenfutter zum Arbeitsessen macht.<br />
Katzen bevorzugen 5-20 sehr kleine Mahlzeiten (rund 15-30g)<br />
über Tag und Nacht verteilt.<br />
Zu lange Fütterungsintervalle lösen chronischen Stress durch<br />
Hunger aus. Zu grosse Mahlzeiten verursachen Erbrechen und<br />
Übergewicht. Permanenter einfacher Zugang zu Futter ist jedoch<br />
auch eine wichtige Ursache für Übergewicht.<br />
Ein Lösungsansatz ist, der Katze zwar ständigen Zugang zu Futter<br />
zu gewähren, ihn aber durch einen gewissen körperlichen<br />
und kognitiven Einsatz anspruchsvoller und zeitaufwendiger zu<br />
gestalten.<br />
Auch Fleisch in grösseren Stücken erhöht den Zeitaufwand beim Fressen<br />
Sie interessieren sich für dieses Thema, und möchten es weiter vertiefen?<br />
Stöbern Sie in diesen Literaturtipps dazu!<br />
www.foodpuzzlesforcats.com<br />
www.katzenfummelbrett.ch<br />
• L MS DANTAS M M <strong>DE</strong>LGADO,I JOHNSON, CA T Buffington<br />
Food puzzles For cats Feeding for physical and emotional wellbeing,<br />
Journal of Feline Medicine and Surgery (2016) 18, 723–732<br />
ESVPS<br />
25
Wissenschaftliche Veröffentlichungen<br />
Anwendung der Single-Port Zugangstechnik bei der<br />
Ovariohysterektomie von Hunden<br />
Sánchez-Margallo, FM., Tapia-Araya, A., Díaz-Güemes, I.<br />
Laparsokopische Ovariohysterketomien,<br />
deren Zugang<br />
durch nur eine Öffnung in der<br />
Bauchdecke erfolgt, wurden<br />
bei neun ausgewählten<br />
Hündinnen durchgeführt. Die<br />
Operationstechnik und die<br />
Ergebnisse wurden ausführlich<br />
beschrieben.<br />
Ein Multiport Instrument<br />
(SILS Port, Covidien, USA)<br />
wurde in der Umbilikalregion<br />
durch eine einzelne 3cm lange<br />
Inzision so platziert, dass<br />
drei Kanülen eingeführt werden<br />
konnten. Die laparoskopische<br />
Ovariohysterektomie<br />
wurde mittels eines 5-mm<br />
Dichtungsinstrumentes, einer<br />
5-mm Greifzange und<br />
eines 5-mm 30° Laparoskops<br />
durchgeführt. Die durchschnittliche<br />
Operationszeit betrug<br />
52.66±15.20 Minuten und<br />
die durchschnittliche Schnittlänge<br />
der Hautinzision<br />
betrug 3.09±0.20 cm.<br />
In einem der neun untersuchten<br />
Fälle musste die OP<br />
mittels Single-Port Technik<br />
aufgrund eines Ovarialtumors<br />
abgebrochen werden,<br />
die Fortführung der Ovariohysterketomie<br />
erfolgte hier<br />
unter Anwendung einer Multiport<br />
Laparoskopie, mit der<br />
Einführung eines zusätzlichen<br />
5-mm Trokars. In den<br />
restlichen Fällen traten keine<br />
chirurgischen Komplikationen<br />
auf, der intraoperative<br />
Blutverlust blieb bei allen<br />
Tieren gering.<br />
Die größten Einschränkungen<br />
der geschilderten Technik<br />
bestehen im ungewollten<br />
Zusammentreffen der<br />
einzelnen Instrumente und<br />
in der verminderten Triangulationsfähigkeit.<br />
Die beschriebene<br />
Kombination frei<br />
beweglicher Instrumente ermöglichen<br />
bessere Triangulation<br />
im chirurgischen Feld<br />
und gezieltere Präparation.<br />
Bei allen Tieren erfolgte bis<br />
zu einem Monat Post-OP die<br />
vollständige Wundheilung.<br />
Die vorliegenden Daten zeigen,<br />
dass die Ovariohysterektomie,<br />
durchgeführt mit<br />
einem single- port Zugang,<br />
bei Hunden technisch anwendbar<br />
ist. Dabei minimiert<br />
die einzelne Inzision das abdominale<br />
Trauma, und erzielt<br />
gute kosmetische Ergebnisse.<br />
Sánchez-Margallo, FM., Tapia-Araya, A.,<br />
Díaz-Güemes, I.<br />
(2015) Preliminary application of a<br />
single-port access technique for laparoscopic<br />
ovariohysterectomy in dogs<br />
<strong>Veterinary</strong> Record Open 2: e000153. doi:<br />
10.1136/vetreco-2015-000153<br />
http://vetrecordopen.bmj.com/<br />
content/2/2/e000153<br />
Akzeptanz und therapeutische Effekte von Nierendiäten bei<br />
Hauskatzen mit chronischen Nierenerkrankungen<br />
Nierendiäten werden eingesetzt,<br />
um die Therapie chronischer<br />
Nierenerkrankungen<br />
bei Hunden und Katzen zu<br />
unterstützen. Ihre Wirksamkeit<br />
kann aber durch die<br />
Schwierigkeit der Umstellung<br />
der Tiere auf die Diäten<br />
stark eingeschränkt werden.<br />
In einer prospektiven Studie<br />
wurden Hauskatzen mit<br />
zuvor nicht diagnostizierten<br />
Nierenerkrankungen (Einteilungen<br />
nach den Kategorien<br />
der International Renal Interest<br />
Society: 20 Katzen der<br />
Gruppe IRIS 1, 61 Katzen der<br />
Gruppe IRIS 2, 14 Tiere der<br />
Gruppe IRIS 3 und 4, 33 Tiere<br />
klassifiziert mit erhöhtem<br />
Risiko einer chronischen<br />
Nierenerkrankung) auf eine<br />
Nierendiät umgestellt. Nierenfunktionsparameter<br />
wurden<br />
erfasst und die Besitzer<br />
beantworteten ein Jahr lang<br />
Fragebögen über ihr Tier.<br />
Bis auf acht Katzen (120/128,<br />
94 Prozent) stellten sich alle<br />
erfolgreich auf die Nierendiät<br />
um. Meistens mochten<br />
die Katzen das Futter mäßig<br />
bis außerordentlich gern (89<br />
Prozent), fraßen mindestens<br />
die Hälfte (73 Prozent)<br />
und waren mittelmäßig bis<br />
außerordentlich begeistert,<br />
während sie fraßen (68<br />
Prozent). Vereinzelt lehnten<br />
die Katzen das Futter ab (2<br />
Prozent) oder verweigerten<br />
es gänzlich (1 Prozent). Die<br />
Nierenfunktionsparameter<br />
veränderten sich bei als IRIS<br />
1 und 2 klassifizierten Katzen<br />
nicht, bei den IRIS 3/4 Katzen<br />
veränderten sie sich geringgradig.<br />
In allen Gruppen<br />
verbesserte sich die Lebensqualität<br />
laut Einschätzung<br />
der Besitzer anfangs auffällig<br />
und blieb dann stabil. Das<br />
durchschnittliche Körpergewicht<br />
veränderte sich bei<br />
den Katzen mit chronischen<br />
Fritsch, DA., Jewell, <strong>DE</strong>.<br />
Nierenerkrankungen nicht.<br />
Schlussfolgerung: Die meisten<br />
Katzen mit chronischen<br />
Nierenerkrankungen stellen<br />
sich erfolgreich auf eine<br />
Nierendiät um. Die Ergebnisse<br />
unterstützen ebenfalls<br />
frühere Studien, dass<br />
Nierendiäten helfen können,<br />
Katzen mit chronischen Nierenerkrankungen<br />
zu stabilisieren.<br />
Fritsch, DA., Jewell, <strong>DE</strong>.<br />
(2015) Acceptance and effects of a therapeutic<br />
renal food in pet cats with chronic<br />
kidney disease<br />
<strong>Veterinary</strong> Record Open 2: e000128. doi:<br />
10.1136/vetreco-2015-000128<br />
http://vetrecordopen.bmj.com/<br />
content/2/2/e000128<br />
26<br />
<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong> 1
scil. Partner der Tierärzte!<br />
Labor • Ultraschall • Digitales Röntgen • Lasermedizin • CT & MRT • ATF-Fortbildung • Service<br />
In-House<br />
Labordiagnostik<br />
Schnelldiagnostik Ultraschall<br />
Chirurgie &<br />
Aufbereitung<br />
Beratung & Service<br />
CT & MRT<br />
Lasermedizin ATF-Fortbildungen<br />
Digitales Röntgen<br />
NEU bei scil<br />
Dentalröntgen<br />
Diodenlaser<br />
Klinische Chemie<br />
Blutgase<br />
Sprechen Sie uns an!<br />
www.scilvet.de<br />
kostenlose scil App<br />
für Android und iOS
Einladung!<br />
Abendsymposium der Kleintiermedizin<br />
Start einer Symposienreihe mit wechselnden Schwerpunkten<br />
AUFTAKT<br />
24. Juni 2017 zu Orthopädischer Chirurgie und Schmerzmanagement<br />
Profitieren Sie bei einer fachlichen Soiree von den Vorteilen einer Gemeinschaft zum kollegialen Austausch<br />
bei stetigem Zuwachs von Fachwissen!<br />
Unsere Vortragenden Dr. Heidi Reich (DR. MED. VET, RESI<strong>DE</strong>NT ECVAA) und Dr. Nikola Katic<br />
(DR. MED. VET. DIPL. ECVS) gestalten einen Abend zur orthopädischen Chirurgie mit geselligem Ausklang!<br />
PROGRAMM<br />
ERÖFFNUNG IM SEMINARZENTRUM B. BRAUN AB 15: 30 UHR<br />
16:00 Uhr Begrüßungseiscreme<br />
16:30 Uhr – 17:30 Uhr Planung von Frakturbehandlung und chirurgische Therapieansätze (Dr. Nikola Katic)<br />
17: 30 Uhr Snackpause mit Sektempfang<br />
18:00 Uhr – 19: 00 Uhr Perioperatives Schmerzmanagement (Dr. Heidi Reich)<br />
Ab 19: 00 Uhr Diskussion und Geselligkeit<br />
Bildungsstunden werden bei der Tierärztekammer angesucht.<br />
ANMELDUNG<br />
erfolgt online unter www.vets4vets.at<br />
Wir erlauben uns, eine symbolische Anmeldegebühr von 10 Euro pro Person zu erheben.<br />
Die Summe wird einem gemeinnützigen Zweck gespendet.<br />
Veranstaltungsort Seminarzentrum B. Braun<br />
Genießen Sie moderne Seminartechnik und entspannte Pausen auf der Sonnenterrasse!<br />
B. Braun Austria GmbH<br />
Otto-Braun- Straße 3-5<br />
2344 Maria Enzersdorf<br />
KONTAKT<strong>DE</strong>TAILS<br />
Gudrun Neidenbach<br />
gudrun.neidenbach@improveinternational.com<br />
Mobile: +43(0) (650)2508961<br />
Christoph Dungl<br />
christoph.dungl@bbraun.com<br />
Mobile: +43 (0) (676) 88541 191<br />
Organisatoren<br />
Sponsoren
Impressum ESVPS<strong>Veterinary</strong><strong>News</strong><br />
E.S.V.P.S.<br />
Alexandra House Whittingham Drive Wroughton Swindon Wiltshire SN4 0QJ United Kingdom<br />
Co. Registration 4675737<br />
Kontaktdetails<br />
gudrunneidenbach@esvps.org<br />
deutsch@esvps.org<br />
Editorial<br />
editorial@esvpsconference.org<br />
5m Publishing<br />
5m Enterprises, Ltd., Benchmark House, 8 Smithy Wood Drive, Sheffield, S35 1QN, England<br />
5m Enterprises Inc., Suite 4120, CBoT, 141 West Jackson Boulevard, Chicago, IL, 60604-2900, USA<br />
Co. Registration 3332321<br />
VAT No. 100 1348 86<br />
A Benchmark Holdings Plc. Company<br />
Co. Registration 4675737<br />
Kontaktdetails<br />
deutsch@esvps.org<br />
Editorial<br />
editorial@esvpsconference.org<br />
Der Herausgeber kann keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte von Fremdanbietern übernehmen
<strong>Veterinary</strong><br />
<strong>News</strong>