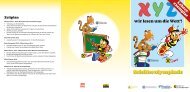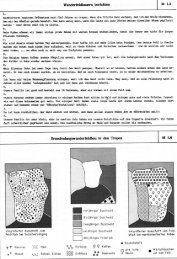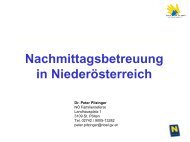erde, boden - Schule.at
erde, boden - Schule.at
erde, boden - Schule.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/1
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
BIOLOGIE: ERDE, BODEN................................................................................ 3<br />
Klasse 4A .............................................................................................................. 4<br />
1.1 Vorwort ...................................................................................................................... 5<br />
1.2 Allgemeines zum Boden ............................................................................................ 6<br />
1.3 Bodentypen............................................................................................................... 10<br />
1.4 Bodenarten ............................................................................................................... 15<br />
1.5 Bodentiere ................................................................................................................ 19<br />
1.6 Mikroorganismen im Boden..................................................................................... 28<br />
1.7 Tabu-Spiel zum Thema Boden................................................................................. 33<br />
1.8 Bodenbiologische Versuche..................................................................................... 33<br />
Klasse 4C............................................................................................................. 40<br />
1.9 Vorwort .................................................................................................................... 41<br />
1.10 Allgemeines zum Thema Boden .............................................................................. 42<br />
1.11 Bodentypen............................................................................................................... 45<br />
1.12 Bodenarten ............................................................................................................... 51<br />
1.13 Bodentiere ................................................................................................................ 54<br />
1.14 Mikroorganismen im Boden..................................................................................... 61<br />
1.15 Tabu-Spiel zum Thema Boden................................................................................. 65<br />
1.16 Bodenbiologische Versuche..................................................................................... 65<br />
1.17 Antworten zu den Rätselfragen................................................................................ 72<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/2
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
BIOLOGIE: ERDE, BODEN<br />
Klassen: 4A + 4C<br />
betreut von: Mag. Uschi Jung<br />
Gruppeneinteilung: 4-5 SchülerInnen/Gruppe<br />
Themen: 1. Definition und Bildung des Bodens, Bodenprofil , Bodenbestandteile,<br />
Bedeutung für den Menschen (Liter<strong>at</strong>urzit<strong>at</strong>e), Titelbl<strong>at</strong>t (ERDE)<br />
2. Bodentypen (Braun-, Schwarz-, Bleich<strong>erde</strong> (Podsol), Gebirgsböden): Abb.,<br />
Unterschiede, Vorkommen<br />
3. Bodenarten (Sand- Lehm, Ton): unterschiedl. Eigenschaften<br />
Salz- und N-reiche Böden und Zeigerpflanzen<br />
4. ökologischer Kreislauf im Boden (Destruenten,…): Abb., Bedeutung<br />
Mikroorganismen, Pilze: wie viele, welche, Abb.<br />
5.(+6.) Bodentiere: Aufbau, Lebensweise, Bedeutung, Besonderheiten,<br />
Abbildungen, Zeichnungen<br />
• Ringelwürmer: Regenwurm<br />
• Krebstiere: Asseln<br />
• Tausendfüßer<br />
• Schnecken<br />
• Insekten und deren Larven<br />
• Grabende Säuger,…<br />
LITERATURSUCHE!! Bücher, Zeitschriften, Abbildungen und Internetausdrucke<br />
(genaue Adresse + D<strong>at</strong>um angeben!!!)<br />
Aufgaben für jede Gruppe:<br />
• Versuche (bereits im NWP/Boden gemacht) + Fotos<br />
• Text für Projektzeitung (mit Quellenangaben, Abbildungen,<br />
Rätsel (+ Auflösung))<br />
• Plak<strong>at</strong> (wenig GROßE Schrift und viele GROßE Abbildungen!!!!)<br />
• Spiel (mind. 8 Tabukarten/Gruppe)<br />
• Präsent<strong>at</strong>ion (Schüler- Eltern- Direktor- Lehrer)<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/3
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Klasse 4A<br />
ERDE<br />
4A<br />
http://hypersoil.uni-muenster.de/0/06.htm<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/4
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.1 Vorwort<br />
Dieses Projekt war für uns alle eine große<br />
Herausforderung. Ich betreute die Klassen 4A<br />
und 4C zum Thema „Erde“.<br />
Schon im Oktober machten wir im Rahmen des<br />
N<strong>at</strong>urwissenschaftlichen Praktikums (NWP) in<br />
Gruppen Versuche zum Thema Boden. Dabei<br />
wurden Protokolle und Fotos angefertigt.<br />
Besonders die Beobachtungen der Bodentiere<br />
im Binokular und Mikroskop erfreuten sich<br />
großer Beliebtheit. (Es wurden alle im<br />
Biologiesaal ausgekommenen Spinnen, Insekten<br />
und Regenwürmer wieder eingefangen und in<br />
ihren Lebensraum zurückgebracht!)<br />
Mitte Jänner, nach der Einteilung der<br />
Gruppen, begannen wir mit der<br />
Liter<strong>at</strong>ursuche in Bibliotheken, zu<br />
Hause und im Internet. Kollege Zangl<br />
erstellte uns netterweise eine Seite im<br />
Schulintranet, wo wir unsere D<strong>at</strong>en in<br />
verschiedene Verzeichnisse stellen<br />
konnten. Wir verbrachten einige<br />
Stunden im EDV-Saal, wo wir<br />
Internetrecherchen durchführten,<br />
Texte tippten, Abbildungen ausdruckten und gegen abgestürzte Computer,<br />
verlorene D<strong>at</strong>en und nicht funktionierende Drucker kämpften.<br />
Während ein Teil der SchülerInnen an der<br />
Projektzeitung arbeitete, erstellten andere<br />
Zeichnungen und Texte für die Plak<strong>at</strong>e oder<br />
Rätsel zur ihrem Themenbereich und fertigten<br />
Karten für das „Boden-Tabuspiel“ an. Auch<br />
Powerpoint-Präsent<strong>at</strong>ionen oder Vorlagen für<br />
Farbfolien zur Präsent<strong>at</strong>ion der Ergebnisse<br />
wurden hergestellt.<br />
Alles in Allem waren es sehr zeitintensive, aber<br />
produktive Wochen, in denen wir einiges<br />
bezüglich „Erde“, Inform<strong>at</strong>ionsbeschaffung<br />
und –verarbeitung, sowie Präsent<strong>at</strong>ion profitiert<br />
haben.<br />
Februar, 2005 Mag. Ursula Jung<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/5
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.2 Allgemeines zum Boden<br />
Der Boden - Basis allen Lebens:<br />
Der Boden ist unsere unverzichtbare Grundlage. Er ist so fundamental, dass<br />
wir ohne ihn nicht überleben können. Wenn jemand glaubt, den Boden<br />
"besitzen" zu können, wenn jemand sagt, die Sonne gehöre ihm ...<br />
Der Boden ist ein Geschenk der N<strong>at</strong>ur, wie Luft, die wir <strong>at</strong>men, oder das<br />
Wasser, das unseren Durst stillt. (S<strong>at</strong>ish Kumar, Journalist aus Kenia)<br />
Der Boden ist für die Menschheit sehr<br />
wichtig. Er ist schließlich das, worauf man<br />
herumtrampelt und den man mit Häusern und<br />
Straßen versiegelt. Unsere Böden sind, man kann es<br />
nicht deutlich genug sagen, die Basis allen Lebens,<br />
denn die Nahrung dieser Welt kommt aus dem Boden.<br />
An der Basis des Lebens steht die Photosynthese der grünen Pflanzen. Dieser<br />
Prozess erzeugt pflanzliche Stärke und Sauerstoff zum Atmen.<br />
Milch, Käse, Joghurt, Eier, Fleisch usw. sind zwar tierisch Produkte, doch auch<br />
Tiere leben von pflanzlichen Gewächsen.<br />
Böden regeln nicht nur die n<strong>at</strong>ürlichen Kreisläufe organischer und mineralischer<br />
Stoffe. Wie ein riesiger Filter reinigt der Boden das Wasser. Jeder Stoff, der<br />
irgendwann die Luft oder das Wasser belastet, landet früher oder später im<br />
Boden.<br />
Man kann den Boden – im Gegens<strong>at</strong>z zu Wasser und Luft – nicht reinigen.<br />
Quelle: http://members.vol.<strong>at</strong>/roemer/2000/roe_0009.htm<br />
Was ist Boden?<br />
Boden ist die äußerste Schicht der Erdkruste, die durch Lebewesen geprägt<br />
wird. Im Boden findet ein reger Austausch von Stoffen und Energie zwischen<br />
Luft, Wasser und Gestein st<strong>at</strong>t. Als Teil des Ökosystems nimmt der Boden eine<br />
Schlüsselstellung in lokalen und globalen Stoffkreisläufen ein.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/6
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Entstehung des Bodens:<br />
Boden besteht aus festen Bestandteilen, aus Wasser und aus Luft. Er entsteht<br />
durch sehr langsam ablaufende Prozesse. Unter dem Einfluss von Klima und von<br />
Lebewesen verwittert das Gestein; die mineralischen Teile w<strong>erde</strong>n verändert,<br />
mit organischen Stoffen angereichert und neu zusammengefügt. Das Bodenleben,<br />
d.h. Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, wandelt dieses Gemisch in ein Gefüge<br />
aus Krümeln und<br />
durchgehend verbundenen Hohlräumen um. Steine, Sand, Schluff, Ton und<br />
Humus bilden das Gerüst des Bodens.<br />
Die Erfüllung einer Funktion ist nicht möglich, wenn (zu) kleine Teile eines<br />
Bodens betrachtet w<strong>erde</strong>n. Es ist eine minimale Menge, bzw. Mächtigkeit und/<br />
oder Fläche an n<strong>at</strong>ürlichem Boden notwendig, um einer Funktion gerecht zu<br />
w<strong>erde</strong>n. Es ist schwierig, das Ausmaß der Einhaltung oder auch der Störung von<br />
Funktionen wahrzunehmen; dies ist letztlich auch nicht messbar.<br />
Böden als komplexe, horizontal geschichtete und vielfältig strukturierte<br />
N<strong>at</strong>urkörper (s. Bodenkörper) sind im Wesentlichen das Produkt der Aktivität<br />
zahlreicher Lebewesen. Diese Bodenorganismen sind auf den Boden als<br />
Lebensraum angewiesen.<br />
"Eine Handvoll Erde"<br />
"In einer Handvoll guten<br />
Humus<strong>boden</strong>s gibt es<br />
weitaus mehr<br />
Lebewesen als<br />
Menschen auf der Erde.<br />
Das Trockengewicht all<br />
dieser Bakterien und<br />
Pilze, Einzeller,<br />
Würmer, Spinnen und<br />
Insekten summiert sich<br />
pro Hektar auf rund 5<br />
Tonnen ..."<br />
(STERN-Report "Rettet den<br />
Boden", 1985, S.20)<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/7
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Lebensraum Boden:<br />
Den Lebewesen stehen grundsätzlich drei verschiedene Lebensräume zur<br />
Verfügung, die durch verschiedene Phasen der M<strong>at</strong>erie gekennzeichnet sind: die<br />
Atmosphäre (gasförmig), die Hydrosphäre (flüssig) und die Lithosphäre (fest).<br />
An der Grenzschicht zwischen Atmosphäre und Lithosphäre h<strong>at</strong> sich durch<br />
physikalische, chemische, klim<strong>at</strong>ische und biologische Vermischungs- und<br />
Umwandlungsprozesse ein weiterer Lebensraum entwickelt, der Boden bzw. die<br />
Pedosphäre. Hier mischen sich die drei Phasen Luft, Wasser und Gestein.<br />
Durch verschiedene Prozesse der Bodenbildung und Bodenentwicklung entsteht<br />
ein kleinräumig unterschiedlich strukturierter Bodenkörper. Er besteht aus<br />
Gesteinsresten (mineralische Substanz), Humus, Luft und Wasser und ist von<br />
zahlreichen Gängen und Poren durchzogen. Den Lebewesen im Boden, den so<br />
genannten Bodenorganismen, steht damit ein äußerst vielfältiges, kleinräumig<br />
stark differenziertes Substr<strong>at</strong> zur Verfügung, das sie unterschiedlich nutzen<br />
und maßgeblich mitgestalten.<br />
Bodenprofil:<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/8
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
An ihren Lebensraum sind die Bodenorganismen in mehrfacher Hinsicht<br />
angepasst. Die meisten Bodenorganismen sind typische Hohlraum- und<br />
Oberflächenbewohner, d.h. sie besiedeln die engen Poren zwischen den festen<br />
Bodenpartikeln und deren Oberflächen. Hier ernähren sie sich überwiegend von<br />
der abgestorbenen organischen Substanz, die sie abbauen und umwandeln.<br />
Durch intensive Interaktionsprozesse zwischen Bodenkörper, Bodenlösung und<br />
Bodenorganismen unterliegt die Pedosphäre einem permanenten<br />
Entwicklungsprozess. Gleichzeitig bildet sie die Grundlage für die Entwicklung<br />
der terrestrischen Ökosysteme (Landökosysteme wie z.B. Wälder).<br />
"Im Gegens<strong>at</strong>z zur Atmosphäre oder zu Gewässern ist der Boden als<br />
"Festkörper" wenig beweglich und durchmischt sich nur langsam. Dies führt<br />
dazu, dass in Böden sehr kleinräumige Strukturen über besonders lange Zeiten<br />
bestehen können. Durch die vielen Poren und Gänge, welche hauptsächlich auf<br />
das Wachstum von Pflanzenwurzeln und die Bewegung von Tieren zurückzuführen<br />
sind, entstehen große Oberflächen, und durch die unterschiedliche Größe dieser<br />
Strukturen eine Vielzahl von ökologischen Nischen mit sehr verschiedenen<br />
physikalisch-chemischen Bedingungen. Diese Nischen können von zahlreichen<br />
unterschiedlich spezialisierten Lebewesen besiedelt w<strong>erde</strong>n."<br />
(SCHMID/ SCHELSKE 1997, S.60)<br />
Bodenbestandteile:<br />
Böden sind insgesamt gesehen sehr komplexe und komplizierte Gebilde und<br />
bedecken in unterschiedlichster Ausprägung und Mächtigkeit die Erde.<br />
Grundsätzlich bestehen sie jedoch alle aus vier unterschiedlichen Bestandteilen<br />
(s. Abb.), nämlich den:<br />
• Mineralischen Bestandteilen, die zusammen die mineralische Substanz<br />
bilden;<br />
• Organischen Bestandteilen, die zusammen als organische Substanz<br />
bezeichnet w<strong>erde</strong>n;<br />
• Bodenwasser;<br />
• Bodenluft.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/9
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Zusammensetzung des Bodens<br />
SCHROEDER, D. (1992), S. 13/36<br />
Auf Grund der Mischung fester, flüssiger und gasförmiger Bestandteile wird<br />
Boden auch als Drei-Phasen-System bezeichnet. Die Vielfalt der Böden basiert<br />
auf unterschiedlichen Strukturen dieses Drei-Phasen-Systems hinsichtlich<br />
Menge, Zusammensetzung, Verteilung und Qualität der verschiedenen<br />
Bestandteile.<br />
1.3 Bodentypen<br />
Quelle: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/06.htm<br />
Team „Boden allgemein“: Daphne Karoh, K<strong>at</strong>harina<br />
Nemluwil, Daniel Prostrednik, Theda Schwölberger<br />
, Susanne Zimmel<br />
Die Bodenhorizonte können in unterschiedlichster Ausprägung, Kombin<strong>at</strong>ion und<br />
Abfolge auftreten. Auch in ihrer Mächtigkeit variieren sie erheblich. Während<br />
diese beim Gebirgsrasen nur wenige Zentimeter beträgt, erreicht sie im<br />
Laubwald eine Dicke von einem halben Meter und mehr.<br />
Aus der charakteristischer Abfolge und Ausprägung der Bodenhorizonte ergibt<br />
sich das Bodenprofil eines jeweiligen Bodens. Böden mit ähnlichem Bodenprofil<br />
weisen einen ähnlichen Entwicklungsstand auf und w<strong>erde</strong>n zu einem bestimmten<br />
Bodentyp zusammengefasst.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/10
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
In der deutschen Bodensystem<strong>at</strong>ik w<strong>erde</strong>n die verschiedenen Bodentypen<br />
Bodenklassen zugeordnet. Beispielweise bilden die Bodentypen Ranker, Rendzina,<br />
Regosol und Pararendzina sowie die jeweiligen Subtypen die Klasse der Ah/C-<br />
Böden (ohne Steppenböden). Oder: Die Braun<strong>erde</strong> und ihre Subtypen bilden die<br />
Klasse der Braun<strong>erde</strong>n. Die Bodenklassen wiederum sind Teil einer<br />
übergeordneten Bodenklassifik<strong>at</strong>ion. In Deutschland erfolgt die Einteilung der<br />
Böden in folgende K<strong>at</strong>egorien: Abteilungen, Klassen, Bodentypen, Subtypen,<br />
Varietäten und Bodenformen.<br />
In Abhängigkeit vom Ausgangsgestein, von Relief und Klima, den Lebewesen in<br />
und auf dem Boden sowie der Zeitdauer der Einwirkung <strong>boden</strong>bildender Prozesse<br />
entsteht an jedem Standort ein ganz bestimmter Bodentyp.<br />
Quelle: www.hypersoil.uni-muenster.de<br />
Schwarz<strong>erde</strong>-Böden<br />
Schwarz<strong>erde</strong>böden<br />
besitzen die höchste<br />
Fruchtbarkeit, was sich in<br />
den höchsten Ackerzahlen<br />
ausdrückt. Sie stellen eine<br />
bis zu 80 Zentimeter<br />
dicke dunkelbraune bis<br />
schwarze Humusschicht<br />
dar. Böden dieses Typs<br />
finden sich in der<br />
Lößregion zwischen<br />
Hildesheim und<br />
Magdeburg, in der Kölner<br />
Bucht und in Rheinhessen.<br />
Hier sind sie aus dem Löß entstanden, das ist ein lockerer, kalkhaltiger,<br />
tiefgründiger Lehm, den Winde der Nacheiszeit in manchen Gegenden<br />
zusammengeweht haben.<br />
Braun<strong>erde</strong><br />
Die Braun<strong>erde</strong>n gehören zu den typischen Böden der Mittelbreiten und sind<br />
durch eine große Vari<strong>at</strong>ionsbreite des Ausgangsgesteins gekennzeichnet. Aus<br />
diesem Grund erstrecken sie sich nur selten über große zusammenhängende<br />
Areale. Wie alle mitteleuropäischen Böden sind auch die Braun<strong>erde</strong>n junge,<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/11
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
nacheiszeitliche Bildungen.<br />
Sie haben sich oftmals aus<br />
Rankern oder Rendzinen<br />
entwickelt. Ihre<br />
Profiltiefe beträgt bis zu<br />
1,5 m.<br />
Charakteristische<br />
<strong>boden</strong>bildende Prozesse<br />
sind die Verbraunung<br />
durch Freisetzen von Eisen<br />
mit anschließender Bildung<br />
von Fe-Oxiden und Fe-<br />
Hybriden sowie die<br />
Tonmineralneubildung.<br />
Beide Prozesse laufen auch im Ah-Horizont ab, w<strong>erde</strong>n dort jedoch durch die<br />
dunkle Farbe des Humus üb<strong>erde</strong>ckt. Der typische braune, verlehmte Bv-Horizont<br />
besitzt durch noch nicht zersetzte Gesteinsbrocken Nährstoffreserven und<br />
geht ohne scharfe Grenze in den C-Horizont über.<br />
Braun<strong>erde</strong>n über Basalt oder Geschiebelehm sind nährstoff- und humusreich,<br />
schwach sauer bis neutral, gut durchlüftet und durchfeuchtet und haben ein<br />
hohes Produktionspotenzial. Über Granit oder Sand bilden sich hingegen saure<br />
und basenarme, grobkörnige, modrige, mit günstigerem Wasserhaushalt<br />
versehene Formen, die aber durch Düngung verbesserbar sind.<br />
Gley<br />
Die Parabraun<strong>erde</strong>n (Fahl<strong>erde</strong>n) entwickeln sich in den feuchten Mittelbreiten<br />
entweder unmittelbar aus Rankern bzw. Rendzinen oder aus Schwarz<strong>erde</strong>n bzw.<br />
basenreichen Braun<strong>erde</strong>n, wenn durch Auswaschung von Kalk und leichte<br />
Versauerung eine<br />
Lessivierung<br />
(Tonverlagerung)<br />
ermöglicht wird.<br />
Ausgangsgesteine sind<br />
oftmals nicht zu saure,<br />
feinkörnige, meist lockere<br />
Substr<strong>at</strong>e wie Löss oder<br />
Geschiebemergel. Der<br />
großflächig verbreitete<br />
Boden ist von N<strong>at</strong>ur aus<br />
ein Laubwaldstandort.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/12
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Aus der reichlich anfallenden Streu bildet sich durch ein vielfältiges und<br />
intensives Bodenleben ein mächtiger Ah-Horizont mit Mull als Humusform aus.<br />
Durch den abwärts gerichteten Stoffstrom erfolgt nach und nach eine<br />
Auswaschung von Tonmineralen aus dem dadurch heller (fahl) w<strong>erde</strong>nden Al–<br />
Horizont in den Unter<strong>boden</strong>. In dem durch Mineralverwitterung bereits<br />
verbraunten Unter<strong>boden</strong> führt die Tonanreicherung zu einer noch stärkeren<br />
Dunkelfärbung. Ah- und Al-Horizont können bis 0,5 m, das gesamte Bodenprofil<br />
bis zu mehreren Metern mächtig w<strong>erde</strong>n.<br />
Hoher Restmineralgehalt, viel Humus, austauschstarke Dreischichttonminerale<br />
und eine günstige Bodenstruktur machen Parabraun<strong>erde</strong>n zu tiefgründigen,<br />
ertragreichen und leicht zu bearbeitenden Ackerböden. Sie w<strong>erde</strong>n in<br />
Mitteleuropa z.T. seit über 1000 Jahren landwirtschaftlich genutzt. Bei<br />
ungenügender Bodenbedeckung neigen sie zur Erosion und das Befahren mit zu<br />
schwerem Gerät führt zur Verdichtung und Verminderung der günstigen<br />
Eigenschaften.<br />
Pseudogley-Böden haben einen fahlgrau gefärbten Ober<strong>boden</strong> mit braunen<br />
Rostflecken und bis zu erbsengroßen Körnchen aus Eisen- und Manganmineralen.<br />
Der Unter<strong>boden</strong> weist eine<br />
charakteristische rotbraune<br />
und schwärzlichegraue<br />
Marmorierung auf. Sie<br />
entstehen, wenn der Abfluss<br />
des Regenwassers gestört ist,<br />
etwa durch eine<br />
undurchlässige Tonschicht.<br />
Staunasse Pseudogleye sind<br />
ziemlich unfruchtbar: Bei<br />
Regen ertrinken die Pflanzen<br />
im sauerstoffarmem Wasser,<br />
zudem leiden sie unter der schlechten Durchlüftung dieses verdichteten Bodens.<br />
Bild: Pseudogley: http://www.eduhi.<strong>at</strong>/webimg/pseudogley-druck.jpg<br />
Podsol (aus dem russischen: „Boden unter Asche des Lagerfeuers") heißt ein<br />
aschgrauer, vor allem im kühlen, regnerischen Klima Norddeutschlands<br />
verbreiteter Typ. Wo der schützende Wald abgeholzt wurde, wusch das<br />
Regenwasser Tonteilchen und Eisensalze in die unteren Bodenschichten: Der<br />
Ober<strong>boden</strong> unter einer dünnen, meist versauerten Humusschicht blich aus und<br />
färbte sich blassgrau (Bleichhorizont: Ae). Die rotbraunen Eisensalze haben sich<br />
im Unter<strong>boden</strong> gesammelt und verkleben ihn zu zementhartem „Ortsstein", den<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/13
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
die Pflanzen- wurzeln nicht durchstoßen können. Böden dieser Art sind sehr arm<br />
an Nährstoffen. Wir finden sie zum Beispiel in der Lüneburger Heide.<br />
Kalkdüngung, intensive Humuspflege, Aufbrechen des Ortsteins und eventuelle<br />
Bewässerung machen aber auch diesen Boden ackerbaulich nutzbar.<br />
Ranker<br />
Der Ranker (österreichische Bezeichnung für Steilhang) ist ebenso wie die<br />
Rendzina ein gesteins- und reliefabhängiger Boden. Er besitzt auch einen<br />
deutlichen Ah-Horizont, liegt aber im Gegens<strong>at</strong>z dazu auf einem sauren, quarz-<br />
und silik<strong>at</strong>reichen Ausgangsgestein (Sand, Granit, Gneis). Ein B-Horizont fehlt,<br />
und infolge seiner geringen Profilmächtigkeit ist er für Pflanzen schlecht<br />
durchwurzelbar.<br />
Ranker kommen häufig in den feuchtkühlen Mittelgebirgen der Mittleren Breiten<br />
vor, bisweilen aber auch in der Tundra. An beiden Wuchsorten fördert häufiger<br />
Frostwechsel durch Frostsprengung die Vergrusung. Aufgrund der deutlich<br />
geringeren chemischen Verwitterungsprozesse verläuft die Verlehmung durch<br />
Tonmineralbildung hingegen sehr langsam ab und die Humifizierung des<br />
organischen M<strong>at</strong>erials im Ober<strong>boden</strong> ist meist unvollständig.<br />
Geringer Ton- und Humusgehalt sowie mangelnde Kalkanteile erlauben selbst im<br />
Ah-Horizont kaum die Bildung von Ton-Humus-Komplexen. Die<br />
Austauschkapazität ist daher ebenso wie der Nährstoffnachschub aus dem<br />
basenarmen Ausgangsgestein sehr gering. Während die mangelnde Verlehmung<br />
eine ausreichende Speicherung von Wasser im Boden verhindert, ist die<br />
Durchlüftung gut.<br />
Rendzina<br />
Rendzina-Böden entstehen auf Kalkgestein. Unter einer nur zehn bis 20<br />
Zentimeter dicken braunen tonigen Humusschicht (intensiv durchwurzelter Ah-<br />
Horizont) beginnt gleich das feste, weiße Gestein, und auch der Humus ist meist<br />
reich an Steinen. Wenn ein Boden dieses Typs gepflügt wird, kr<strong>at</strong>zt der Pflug an<br />
den Steinen und es entsteht ein raschelndes Geräusch. Diesen „Raschel<strong>boden</strong>"<br />
(vom polnischen „rzedzic" = rascheln) finden wir in Deutschland hauptsächlich<br />
auf der Schwäbischen Alb.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/14
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Häufig reicht die Fein<strong>erde</strong> selbst für einen Waldbestand nicht aus. Viele<br />
Rendzinen tragen kalkliebende Trockenrasen oder w<strong>erde</strong>n als wenig ergiebige<br />
Weiden genutzt. Bei zu starker Beweidung vor allem durch Schafe kommt es<br />
schnell zu Erosionsprozessen und damit einhergehend zur Entblößung des<br />
anstehenden Gesteins (Karstregionen, Mittelmeerländer). Erst bei sehr langer<br />
Entwicklungszeit kann sich bei einer Rendzina ein Bv-Horizont ausbilden. Dabei<br />
geht die Rendzina langsam in Kalkbraunlehm (Terra fusca) über. Unter<br />
mediterranen Klimabedingungen entwickelt sich aus der Rendzina die sog. Terra<br />
rossa (Rot<strong>erde</strong>). Auch sie besitzt einen geringmächtigen Ah-Horizont. Ihr<br />
Unter<strong>boden</strong> ist in der Regel durch die Entstehung von Häm<strong>at</strong>it im trocken-heißen<br />
Klima intensiv rot gefärbt<br />
Quellen: http://www.bauernhof.net/lexikon/lex_b/<strong>boden</strong>typen.htm 27.01.2005<br />
http://www.agrar.hu-berlin.de/pflanzenbau/<strong>boden</strong>k/<strong>boden</strong>typen/<strong>boden</strong>typen.htm<br />
Team „Bodentypen“: M<strong>at</strong>hias Richter, Jürgen Suchomel, M<strong>at</strong>thias Teuschl<br />
1.4 Bodenarten<br />
Böden lassen sich nach der Korngrößenzusammensetzung ihrer mineralischen<br />
Substanz in verschiedene Bodenarten einteilen. Allgemein unterscheidet man<br />
zwischen den Kornfraktionen des Grob<strong>boden</strong>s (Korndurchmesser > 2 mm) und<br />
denen des Fein<strong>boden</strong>s (Korndurchmesser < 2 mm). Die genaue Einteilung und<br />
Bezeichnung der Korn-Fraktionen sind in der nachfolgenden Tabelle<br />
übersichtlich zusammengestellt.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/15
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Einteilung und Bezeichnung der Korn-Fraktionen<br />
Je nach Korngröße des Fein<strong>boden</strong>s unterscheidet man 3 Bodenarten: Sand (S),<br />
Schluff (U) und Ton (T). Normalerweise sind die Korngrößenklassen im Boden<br />
gemischt, wobei die dominierende Fraktion namensgebend ist, z.B. sandiger Ton<br />
(sT) oder schluffiger Sand (uS). Hinzu kommt Lehm als "vierte" Bodenart, die<br />
eine Mittelstellung zwischen Sand, Schluff und Ton einnimmt.<br />
Quelle: www.hypersoil.uni-muenster.de<br />
Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Haupt<strong>boden</strong>arten:<br />
Quelle: http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/images/<strong>boden</strong>arten.gif; 31.01.2005<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/16
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Sand<strong>boden</strong>:<br />
Sand<strong>boden</strong> h<strong>at</strong> einen sehr hohen Sandanteil mit einer Korngröße von 0.02 – 2 mm.<br />
Diese Böden enthalten wenig Wasser, weil es einfach durch den Untergrund<br />
sickert und dadurch auch einen sehr geringen Nährsalzgehalt h<strong>at</strong>.<br />
Sandböden sind "leichte" Böden. Sie haben eine extrem lockere Struktur. Sie<br />
können weder Wasser noch Nährstoffe gut speichern. Daher trocknen sie sehr<br />
rasch aus. Pflanzen verdursten oder verhungern. Sandböden kann man<br />
verbessern, indem man beim Umgraben viel organische Substanz (Kompost,<br />
Humus) einarbeitet. Dieser wirkt wie ein Schwamm, der Wasser und Nährstoffe<br />
speichert und langsam abgibt. Allerdings sollte diese Behandlung jedes Jahr<br />
erfolgen, denn erst im Laufe der Zeit kann der Bodenhaushalt verbessert<br />
w<strong>erde</strong>n.<br />
Lehm<strong>boden</strong>:<br />
Da bei Lehm<strong>boden</strong> der Sandanteil größer als der Anteil kleinerer<br />
Bodenbestandteile ist, wirkt sich das Vorteilhaft auf die Kombin<strong>at</strong>ion der<br />
Korngröße aus. Im Gegens<strong>at</strong>z zum Sand<strong>boden</strong> speichert er Wasser und erhält<br />
Nährsalze. Auß<strong>erde</strong>m bietet er vielen Bodenorganismen gute Lebensbedingungen.<br />
Ton<strong>boden</strong>:<br />
Hoher Tongehalt das heißt, eine Korngröße die kleiner als 0.02 mm ist. Er ist<br />
schlecht durchlüftet, schwer zu bearbeiten und lässt kaum Wasser einsickern.<br />
Jedoch ist die Speicherfähigkeit von Wasser und Nährsalz sehr hoch.<br />
Tonböden w<strong>erde</strong>n landläufig als "schwere Erde" bezeichnet. Sie sind nass und<br />
klebrig. Im Frühjahr dauert es lange, bis die Erde trocknet und sich erwärmt.<br />
Ist es zu nass im Boden, so leiden die Pflanzenwurzeln an Sauerstoffmangel.<br />
Auch eine Düngung mit Gartengips (Kalziumsulf<strong>at</strong>, in Gartencentern zu erhalten)<br />
unterstützt die Behandlung.<br />
Quelle: Driza und Cholewa: Leben und Umwelt Band 3,1992<br />
Im Gelände kann man die Bodenart mit Hilfe der "Fingerprobe" (siehe<br />
<strong>boden</strong>biologische Versuche) schätzen.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/17
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Qualität der einzelnen Bodenarten<br />
Körnung und Bodenart stehen in enger Beziehung zum Wasser-, Luft- und<br />
Nährstoffhaushalt. Darüber hinaus beeinflussen sie die Durchwurzelung und<br />
Bearbeitbarkeit des Bodens. Gemeinsam mit anderen Faktoren bestimmen<br />
Körnung und Bodenart die Fruchtbarkeit des Bodens.<br />
Die unterschiedlichen Korngrößen spielen eine wichtige Rolle für die Art und<br />
Nutzung des Bodens: ein lehmiger Ton<strong>boden</strong> h<strong>at</strong> zum Beispiel ein hohes Wasserhaltevermögen.<br />
Dies wirkt sich dann auf die Bearbeitungs -und Nutzungsart<br />
aus.<br />
Die unten stehende Zusammenstellung stellt in vereinfachter Weise die wesentlichen<br />
Eigenschaften der drei Haupt<strong>boden</strong>arten dar.<br />
Eigenschaften Sand<strong>boden</strong> Lehm<strong>boden</strong> Ton<strong>boden</strong><br />
Körnung<br />
Einseitige Körnungs-<br />
struktur (Sand, kaum<br />
Fein<strong>erde</strong>anteil)<br />
Ausgeglichene<br />
Kör-<br />
numgsstruktur<br />
(Sand-<br />
Schluff-Ton-<br />
Anteile)<br />
Wasserführung Gut Gut Schlecht<br />
Wasserhaltung Gering Hoch<br />
Durchlüftung<br />
Sehr gut durch<br />
hohes<br />
Gut:optimales<br />
Poren-<br />
Einseitige Körnungs-<br />
struktur<br />
(Ton-Schluff-Anteile)<br />
Sehr hoch, bedingt<br />
verfügbar<br />
Schlecht<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/18
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Humus- und<br />
Nähr-<br />
stoffgehalt<br />
Bearbeitbarkeit<br />
Wachstum<br />
Porenvolumen volumen bei<br />
Krümel-<br />
gefüge<br />
Humusanteil oft<br />
hoch,<br />
aber schlechte Hu-<br />
musqualität; Nähr-<br />
stoffgehalt oft gering<br />
Leicht bearbeitbar<br />
für Maschinen und<br />
Hand<br />
Gute Durchwurzel-<br />
barkeit, aber nur<br />
Standort für an-<br />
spruchslose Arten<br />
Meist hoher<br />
Nährstoffgehalt<br />
Leicht bearbeitbar<br />
Gute<br />
Durchwurzel-<br />
barkeit, guter<br />
Stand-<br />
ort für<br />
Kulturpflanzen<br />
(Weizen, Hack-<br />
früchte)<br />
Quelle: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/03/img/06_2.gif, 27.1.05<br />
Meist hoher<br />
Nährstoffgehalt<br />
Schwer bearbeitbar, mit<br />
Maschinen oft nicht<br />
befahrbar<br />
Schlechte Durch-<br />
wurzelbarkeit, meist<br />
Wiesen und Weiden<br />
Team „Bodenarten“: Benjamin Haas, Nikolas Hajnovic, M<strong>at</strong>thias Heumesser,<br />
Peter Jakubec, Lukas Stanek<br />
1.5 Bodentiere<br />
Definition:<br />
Tiere, die zeitweise oder immer im Boden leben und den Bodenzustand<br />
verändern. Sie durchwühlen und belüften den Boden, oder düngen ihn durch ihren<br />
Kot.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/19
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abb. 1.: Bodenlebewesen (Anzahl) pro 0,3 m 3<br />
Abb. 2.: Größenverhältnisse der Bodenlebewesen (beachte den logarithmischen<br />
Maßstab)<br />
Weichtiere (Mollusca)<br />
Schnecken (Gastropoda)<br />
Schnecken sind die artenreichste und einzige Klasse der Weichtiere (Mollusken),<br />
die auch am Land vorkommen. Man trifft sie auf sehr verschiedenen Böden an.<br />
Allerdings kann man nur wenige Landschnecken, die die Streu- und obersten<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/20
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bodenschichten bewohnen, als echte Bodentiere betrachten und sie brauchen<br />
ausreichende Feuchtigkeitsverhältnisse. Prinzipiell können die Schnecken in<br />
Lungen- und Kiemenschnecken unterschieden w<strong>erde</strong>n, sowie in Gehäuse- und<br />
Nacktschnecken. Die meisten Schneckenarten ernähren sich von pflanzlichen und<br />
abgestorbene organischen Substanzen, vereinzelt aber auch räuberisch von<br />
anderen Schnecken und Regenwürmern. Sie beteiligen sich an der Zerkleinerung<br />
und Umwandlung der organischen Substanz, binden mit dem von ihnen<br />
abgesonderten Schleim Bodenpartikel und können zur Verbesserung der<br />
Bodenstruktur beitragen. Für die Besiedlung des Bodens spielen sein Kalkgehalt,<br />
die Struktur des Bodenkörpers und das vorherrschende Mikroklima eine<br />
entscheidende Rolle.<br />
Ringelwürmer (Annelida)<br />
Enchrytäen/Borstenwürmer<br />
Enchyträen w<strong>erde</strong>n vereinzelt auch als „Weißwürmer“ oder Borstenwürmer<br />
bezeichnet und gehören wie die Regenwürmer zum Stamm der Ringel- oder<br />
Gliederwürmer (Annelida). Beide Familien sind Vertreter der Wenigborster und<br />
gehören zur Klasse der Gürtelwürmer. Sie können bis zu 50 mm lang w<strong>erde</strong>n, sind<br />
rel<strong>at</strong>iv zarthäutig, weiß bis gelblich gefärbt und oft mehr oder weniger stark<br />
transparent. Sie erreichen in der Regel ein Lebensalter von 2 - 9 Mon<strong>at</strong>en,<br />
manchmal auch ein Jahr und länger. Die Entwicklung vom Ei bis zum<br />
geschlechtsreifen Tier dauert etwa 5 - 7 Wochen.<br />
Gegens<strong>at</strong>z zu den meisten Regenwürmern können sich Enchyträen nicht durch<br />
den Boden „fressen“, sondern sich nur durch bestehende Gänge und Hohlräume<br />
bewegen. Sie besiedeln die Streuauflage und den oberen humusreichen<br />
Mineral<strong>boden</strong>. Sie ernähren sich von Bakterien, Pilzen, abgestorbener<br />
organischer Substanz und vom angereicherten Mineral<strong>boden</strong>. Aufgrund ihrer<br />
hohen Stoffwechselaktivität spielen sie eine wichtige Rolle für die<br />
Zersetzungsprozesse im Boden. An sauren Standorten gehören sie zu den<br />
wichtigsten Humusbildnern. Da sie sehr empfindlich auf anthropogene<br />
Belastungsfaktoren (z.B. Pestizide und Umweltchemikalien) reagieren, eignen sie<br />
sich auch als Indik<strong>at</strong>ororganismen.<br />
Regenwürmer<br />
Regenwürmer erreichen im ausgewachsenen Zustand eine Länge von<br />
mindestens 4 cm und Breite von mehr als 2 mm. Sie sind in der<br />
Regel stärker pigmentiert und meist rötlich oder fleischfarben<br />
gefärbt. Bei der Besiedlung des Bodenkörpers lassen sich drei<br />
Lebensformtypen unterscheiden: Streuformen, Tiefgräber und<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/21
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Mineral<strong>boden</strong>formen. Die Streuformen leben in der humusreichen<br />
Bodenauflageschicht und ernähren sich von Falllaub, Pflanzenresten, Holzresten<br />
oder Kompost. Die Tiefgräber legen tief in den Boden reichende Röhren und<br />
Gangsysteme an und kommen zur Nahrungsaufnahme in der Regel an die<br />
Bodenoberfläche. Sie bevorzugen gerbstoffarme und stärker angerottete<br />
Blätter. Die Mineral<strong>boden</strong>bewohner dagegen leben in tieferen Bodenschichten<br />
und ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenwurzeln, verrotteter organischer<br />
Substanz, die sie mit dem Mineral<strong>boden</strong> zusammen aufnehmen, Algen und<br />
Mikroorganismen.<br />
Bei der Nahrungssuche nehmen die Regenwürmer immer auch mehr oder weniger<br />
große Anteile mineralischer Bodensubstanz auf, die bei der Darmpassage mit<br />
organischen Verdauungsrückständen angereichert, vermischt und als fruchtbare<br />
Erde wieder ausgeschieden wird. Durch ihre grabende und wühlende Tätigkeit<br />
tragen sie maßgeblich zur Lockerung, Durchmischung und Strukturentwicklung<br />
des Bodenkörpers bei. Ihre Aktivität schafft neue Lebensräume für andere<br />
Organismengruppen, insbesondere Bakterien und Strahlenpilze. Darüber hinaus<br />
spielen sie eine tragende Rolle bei der Zersetzung und Humifizierung der<br />
organischen Substanz im Boden und tragen so wesentlich zur<br />
Bodenfruchtbarkeit bei<br />
Gliederfüßer (Arthropoden)<br />
Als Bodenarthropoden w<strong>erde</strong>n die Gliederfüßer bezeichnet, die im Boden und auf<br />
der Bodenoberfläche leben. Sie repräsentieren den<br />
arten- und individuenreichsten Tierstamm im Boden<br />
und haben einen großen Formenreichtum mit äußerst<br />
vielfältigen Angepasstheiten an die speziellen<br />
Lebensbedingungen im Boden entwickelt (s. Abb 3.).<br />
Besonders häufig vertretene Ordnungen w<strong>erde</strong>n<br />
nachfolgend ausführlicher beschrieben, z.B.: Milben<br />
und Springschwänze, die aufgrund ihrer geringen<br />
Körpergröße (Ø < 2 mm) auch als Mikroarthropoden<br />
bezeichnet w<strong>erde</strong>n, sowie Asseln, Tausendfüßer, Käfer<br />
und Zweiflügler.<br />
Abb 3.: Typische Vertreter der Bodenarthropoden.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/22
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1. Webspinne 5. Raubmilbe 9. Doppelfüßer<br />
2. Afterskorpion 6. Hornmilbe 10. Springschwanz<br />
3. Weberknecht 7. Assel 11. Käfer +Larve (a + b)<br />
4. parasitische Milbe 8. Hundertfüßer 12. Zweigflüglerlarven (a + b)<br />
Klasse: Krebse (Crustacea)<br />
Asseln sind die einzige Ordnung der Krebstiere, die echte Landformen<br />
entwickelt haben. Sie sind auf rel<strong>at</strong>iv hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen und<br />
bevorzugen feuchte Standorte mit geringer Beleuchtungsintensität. Sie<br />
erreichen eine durchschnittliche Größe von 3 - 20 mm. Asseln meiden<br />
landwirtschaftlich genutzte Böden ebenso wie saure Böden und kommen<br />
vorwiegend im oberflächennahen Bereich lockerer, grobporenreicher und<br />
kalkhaltiger Böden vor. Ihre Raumansprüche sind rel<strong>at</strong>iv gering, so dass sie auch<br />
unter Steinen und in der Nähe von Häusern leben können. Sie ernähren sich von<br />
Pilzen, Falllaub, verrottenden Pflanzenresten, Spinneneiern, Insektenkadavern<br />
und Vogelkot. Zusätzlich fressen sie ihren eigenen Kot mehrmals wieder auf,<br />
wodurch dieser besser aufgeschlossen und weiter verdaut wird. Dadurch<br />
beteiligen sie sich an der Zersetzung der organischen Substanz im Boden.<br />
Klasse: Tausendfüßer (Myriapoda)<br />
Sie haben eine langgestreckte Körperform und bestehen aus mehreren<br />
Körperringen, die unterschiedlich viele Laufbeine tragen. Sie gehören zur<br />
räuberischen Makrofauna des Bodens<br />
Sie ernähren sich überwiegend von weichhäutigen Tieren wie z.B.<br />
Springschwänzen, Enchyträen und kleineren Regenwürmen. Sie sind<br />
Feuchtlufttiere, die humusreiche und wenig verdichtete Waldböden bevorzugen.<br />
Die Untergruppe der Doppelfüßer ernährt sich überwiegend von Laubstreu und<br />
vermoderndem Holz. Als Primärzersetzer tragen sie zum Aufschluss des<br />
Bestandsabfalles (Laub, Pflanzenreste etc.) bei und spielen damit eine wichtige<br />
Rolle im Stoffkreislauf. Sie zeigen ähnliche ökologische Verhaltensweisen wie die<br />
Asseln.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/23
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Klasse: Insekten (Hexapoda)<br />
Springschwänze sind flugunfähige Insekten. Sie sind die am häufigsten<br />
vorkommenden Vertreter der Insekten. Wie die Milben sind sie an fast allen<br />
Standorten vertreten, besonders arten- und individuenreich in den Streu- und<br />
Humusschichten des Bodens. Springschwänze w<strong>erde</strong>n maximal bis 6 mm lang.<br />
Aufgrund ihrer zarten Körperhülle sind sie stark austrocknungsgefährdet und an<br />
ausreichende Feuchtigkeitsverhältnisse gebunden. Sie ernähren sich vor allem<br />
von abgestorbenen Pflanzenteilen unterschiedlichen Rottegrades, aber auch von<br />
lebendem Pflanzengewebe, und spielen als Primärzersetzer eine wichtige Rolle<br />
bei der Zerkleinerung und Aufbereitung des Bestandsabfalles (Laub und andere<br />
Pflanzenreste).<br />
Käfer sind die artenreichste Insektenordnung. Ein großer Teil der Käferarten<br />
lebt zumindest partiell auf dem Boden, z.T. auch im Boden. Ihre Lebensweise ist<br />
unterschiedlich. Viele Arten leben räuberisch, eine große Zahl von Arten ernährt<br />
sich aber auch von Pflanzenm<strong>at</strong>erial oder von Aas und Kot. Die einheimischen<br />
Käferarten leben überwiegend an der Bodenoberfläche und können grabend mehr<br />
oder weniger tief in den Boden eindringen, sind aber nicht an diesen Lebensraum<br />
gebunden. Viele Arten haben aber <strong>boden</strong>gebundene Larvenstadien.<br />
Die permanent <strong>boden</strong>lebenden Käferarten sind mengenmäßig und im hinsichtlich<br />
ihrer Auswirkungen auf den Boden weniger bedeutsam als die Käferarten, die an<br />
der Bodenoberfläche leben oder nur im Larvenstadium den Bodenkörper<br />
besiedeln. Sie sind in der Regel kleiner als 5 mm, rel<strong>at</strong>iv schmal und weisen<br />
verkürzte oder reduzierte Beine, Fühler und Flügel auf, zeigen also deutliche<br />
Angepasstheiten an das Bodenlückensystem.<br />
Bei vielen Käferarten sind die Larvenstadien <strong>boden</strong>bewohnend. Hier sind<br />
besonders die als Drahtwürmer bezeichneten Larven der Schnellkäfer und die<br />
als Engerlinge bezeichneten Larven der Bl<strong>at</strong>thornkäfer zu nennen, zu denen z.B.<br />
Maikäfer, Dungkäfer und Mistkäfer gehören. Aufgrund ihrer sehr<br />
unterschiedlichen Lebensweise sind Käfer insgesamt gesehen an verschiedenen<br />
Umlagerungs-, Anreicherungs- und Zersetzungsprozessen im Boden beteiligt.<br />
Zweiflügler sind Fluginsekten, die nur das Larvenstadium im Boden verbringen.<br />
Die <strong>boden</strong>bewohnenden Zweiflüglerlarven (= Maden) sind wurmförmig und<br />
w<strong>erde</strong>n bis zu 60 mm lang. Die einzelnen Arten unterscheiden sich hinsichtlich<br />
Größe, Färbung, Oberflächenstruktur und Entwicklung der Körperanhänge. Sie<br />
leben vorwiegend in den Streu- und oberen humusreichen Bodenschichten. Da sie<br />
eine zarte Oberflächenhaut und einen weichen Körper besitzen, sind sie auf<br />
ausreichend Bodenfeuchtigkeit und ein entsprechend lockeres Bodengefüge<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/24
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
angewiesen. Sie ernähren sich überwiegend saprophag von abgestorbenen<br />
Pflanzenresten und anderen organischen Substanzen, vereinzelt aber auch<br />
räuberisch von anderen Insekten(-larven) oder Schnecken. Von besonderer<br />
Bedeutung sind die Haarmücken- und Schnakenlarven, die stark an der<br />
Zersetzung von Falllaub und Totholz beteiligt sind.<br />
Wirbeltiere (Vertebr<strong>at</strong>a)<br />
Nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe leben nur wenige Arten aus dem Stamm der<br />
Wirbeltiere im Boden. Sie lassen sich hinsichtlich ihrer Bindung an den<br />
Lebensraum in periodische, temporäre und permanente Bodentiere<br />
differenzieren.<br />
Die temporären Bodentierarten verbringen nur eine Phase ihres Lebenszyklus im<br />
Boden, z.B. Eidechsen-, Schlangen- und Lurcharten (Reptilien und Amphibien), die<br />
im Boden überwintern. Zu den periodischen Bodentierarten, die den Boden nur<br />
partiell für bestimmte Funktionen nutzen, z.B. um dort ihre Nester und Bauten<br />
anzulegen, gehören Vertreter der Säugetiere wie Mäuse, Kaninchen,<br />
Feldhamster, Spitzmäuse und der Dachs.<br />
Überwiegend permanent im Boden leben nur Wühlmäuse<br />
und Maulwürfe. Mit seinem walzenförmigen Körper,<br />
kurzen Fell und seinen zu „Grabschaufeln“ umgebildeten<br />
Vorderbeinen ist der Maulwurf besonders gut an das<br />
Leben im Boden angepasst. Maulwürfe ernähren sich von<br />
Insekten, Regenwürmern, kleineren Mäusen und anderen tierischen Organismen.<br />
Wühlmäuse dagegen sind Pflanzenfresser, die gerne die Wurzeln abnagen und so<br />
große Schäden anrichten können.<br />
Sowohl Maulwürfe als auch Wühlmäuse tragen duch ihre Grab- und<br />
Wühltätigkeit bei der Anlage ausgedehnter Gangsysteme im Boden dazu bei,<br />
dass der Bodenkörper stark durchmischt, gelockert und durchlüftet wird. Sie<br />
wirken also maßgeblich an der Entwicklung der Bodenstruktur mit. Ihre<br />
Exkremente w<strong>erde</strong>n von Sekundärzersetzern als Nahrungsgrundlage genutzt.<br />
Tabelle 1: System<strong>at</strong>ische Übersicht der Bodentiere<br />
Rundwürmer (Nem<strong>at</strong>helminthes)<br />
Fadenwürmer (Nem<strong>at</strong>oda)<br />
Rädertierchen (Rot<strong>at</strong>oria)<br />
Weichtiere (Mollusca)<br />
Schnecken (Gastropoda)<br />
Ringelwürmer (Annelida)<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/25
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1. Enchyträen/ Borstenwürmer (Enchytraeidae)<br />
2. Regenwürmer (Lumbricidae) - z.B. Mistwurm, gemeiner Regenwurm<br />
Gliederfüßer (Arthropoden)<br />
Klasse: Spinnentiere (Arachnida)<br />
1. Webspinnen (Aranae)<br />
2. Afterskorpione (Pseudoscorpiones)<br />
3. Weberknechte (Opiliones)<br />
4. Milben (Acari)<br />
Klasse: Krebse (Crustacea)<br />
Asseln (Isopoda)<br />
Klasse: Tausendfüßer (Myriapoda)<br />
1. Hundertfüßer (Chilopoda) - z.B. Erdläufer, Steinkriecher<br />
2. Doppelfüßer (Diplopoda) - z.B. Schnurfüßer, Saftkugler<br />
3. Wenigfüßer (Pauropoda)<br />
4. Zwergfüßer (Symphyla)<br />
Klasse: Insekten (Hexapoda)<br />
1. Doppelschwänze (Diplura)<br />
2. Beintastler (Protura)<br />
3. Springschwänze (Collembola)<br />
4. Felsenspringer (Archaeogn<strong>at</strong>ha)<br />
5. Ohrwürmer (Dermaptera)<br />
6. Schaben(-artige) (Bl<strong>at</strong>toidea)<br />
7. Langfühlerschrecken (Ensifera) - z.B. Wald- und Feldgrillen<br />
8. Schnabelkerfe (Hemiptera) – z.B. Erdwanzen<br />
9. Hafte (Planipennia) - z.B. Ameisenlöwe<br />
10. Käfer (Coleptera)<br />
11. Hautflügler (Hymenoptera)<br />
12. Köcherfliegen (Trichoptera)<br />
13. Schmetterlinge (Lepidoptera)<br />
14. Schnabelfliegen (Mecoptera)<br />
15. Zweiflügler (Diptera) - z.B. Schnaken, Pilzmücken, Waffenfliegen<br />
Wirbeltiere (Vertebr<strong>at</strong>a)<br />
1. Lurche (Amphibia)<br />
2. Kriechtiere (Reptilia)<br />
3. Säugetiere (Mammalia) - z.B. Maulwurf, Spitzmaus<br />
Quellen: http://hypersoil.uni-muenster.de<br />
Bodenfauna:<br />
Die Gesamtheit der Bodentiere wird als Bodenfauna bezeichnet. Sie setzt sich<br />
aus verschiedenen Tierarten zusammen, die sich durch eine geringe Körpergröße<br />
auszeichnen.<br />
Hinsichtlich ihrer Körpergröße wird die Bodenfauna in 4 Gruppen untergliedert:<br />
Mikrofauna:; Körperdurchmesser < 0,2 mmArten: Einzeller und kleine<br />
Fadenwürmer<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/26
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Mesofauna:; Körperdurchmesser 0,2-2 mmArten: Rädertiere, Fadenwürmer,<br />
Strudelwürmer, Milben, Springschwänze<br />
Makrofauna:; Körperdurchmesser 2-20 mmArten: Enchyträen, Regenwürmer,<br />
Schnecken, Spinnen, Asseln, Tausendfüßer, Insekten und Insektenlarven<br />
verschiedener Ordnungen<br />
Megafauna:; Körperdurchmesser > 20 mmArten: verschiedene Wirbeltierarten,<br />
z.B. Lurche, Reptilien, Insektenfresser (u.a. Maulwurf, Spitzmäuse), Nagetiere<br />
(u.a. Mäuse)<br />
Insgesamt beträgt der Anteil der Bodentiere an der Gesamtmasse der<br />
Bodenorganismen (=Edaphon) etwa 20 %, wobei der Anteil des Edaphon an der<br />
organischen Gesamtsubstanz des Bodens ca. nur bei 5-7 %. (siehe Abb. 4)<br />
Abb.4: Edaphon und Bodenfauna:<br />
Mengenanteile der Bodenfauna am Edaphon und Gewichtsanteile der verschiedenen<br />
Bodentiergruppen<br />
(Abb. verändert nach DUNGER 1964, S. 10 und BRAUNS 1968, S. 61).<br />
Voraussetzung für ein reichhaltiges Bodenleben und eine vielfältige<br />
Bodentierwelt ist ein locker strukturierter Bodenkörper mit vielen Hohlräumen<br />
(grobporenreiches Porenvolumen), ein ausreichender Gehalt an abbaubaren<br />
Bestandsabfällen (Laubstreu) und ein ausgeglichenes Bodenklima (Wärme,<br />
Feuchtigkeit und Durchlüftung). Eine arten- und individuenreiche Gemeinschaft<br />
von Bodentieren ihrerseits trägt zu einer permanenten Durchmischung des<br />
Bodens und beschleunigten Streuabbaus bei, was die mikrobielle Zersetzung der<br />
organischen Substanz und Anreicherung des Mineral<strong>boden</strong>s mit Ton-Humus-<br />
Komplexen fördert.<br />
Quelle: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/07.htm<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/27
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abb. 5: Hauptzersetzer:<br />
Team „Bodentiere“: Stefan Dietrichstein, Vroni Palme, Johannes Raab,<br />
Roland Scholz<br />
1.6 Mikroorganismen im Boden<br />
Bedeutung im Ökosystem:<br />
Die Lebewesen in einem Ökosystem w<strong>erde</strong>n je nach ihrer Funktion in drei<br />
Klassen eingeteilt:<br />
Produzenten, Konsumenten und Destruenten/Reduzenten.<br />
• Produzenten (Erzeuger)<br />
Die Produzenten wandeln Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie<br />
(Photosynthese) in Biomasse (organische Substanz) um. Zu diesen<br />
Umwandlungsprozess sind nur Pflanzen und bestimmte Bakterien fähig. Die<br />
Produzenten stellen somit ein wichtiges Glied im Energie- und Stoffkreislauf des<br />
Ökosystems dar.<br />
• Konsumenten (Verbraucher)<br />
Alle Konsumenten (Tiere und Menschen) sind direkt oder indirekt auf die<br />
Produktion von Biomasse angewiesen. Die Pflanzenfresser (Herbivoren) ernähren<br />
sich direkt von der organischen Substanz, die Fleischfresser (Carnivoren)<br />
wiederum ernähren sich von den Herbivoren oder anderen Carnivoren.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/28
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
• Destruenten (Zersetzer)<br />
Destruenten (Regenwürmer, Asseln, Springschwänze etc.) zerkleinern und<br />
verdauen organische Substanz, die in den Mineral<strong>boden</strong> eingearbeitet wird.<br />
• Reduzenten (Mineralisierer)<br />
Die Reduzenten (Pilze und Bakterien) zerlegen die teilzersetzte Biomasse der<br />
Destruenten in ihre anorganischen Ausgangsstoffe (wie z.B. Magnesium, Calcium,<br />
Phosphor), die von den Produzenten wieder aufgenommen w<strong>erde</strong>n.<br />
Zersetzer und Mineralisierer sind zur Aufrechterhaltung der Stoffkreisläufe<br />
und der Energieflüsse in einem Ökosystem unentbehrlich<br />
http://www.wald-rlp.de/oekosys/images/kreilau.gif<br />
Humifizierung<br />
Wenn ein abgestorbenes Bl<strong>at</strong>t zu Boden fällt, wird es zunächst von unzähligen<br />
Organismen wie beispielsweise Springschwänzen und Asseln zerkleinert. Dadurch<br />
entstehen neue Besiedlungsmöglichkeiten für Bakterien und Pilze.<br />
Bis ein einziges Bl<strong>at</strong>t wieder vollständig in Humus umgewandelt worden ist, wird<br />
es mehrfach gefressen. Was der Eine verdaut, ist für den Nächsten das<br />
gefundene Fressen. Kleinere und größere Bodenlebewesen sowie<br />
Mikroorganismen stehen in einer Wechselbeziehung miteinander. Das Ergebnis<br />
ist die Anreicherung von Huminstoffen in den oberen Bodenschichten. Der<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/29
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Prozess wird als Humifizierung bezeichnet und die im Boden enthaltenen<br />
Huminstoffe geben ihm seine charakteristische, dunkle Farbe.<br />
An Huminstoffe sind wiederum Mineral- und Nährstoffe gebunden, die für das<br />
Pflanzenwachstum nützlich sind. Durch die Bindung an die Huminstoffe sind sie<br />
meist nicht direkt für die Pflanzen verfügbar. Die Freisetzung erfolgt durch die<br />
verlinken auf "Was ist Humus" der organischen Substanz. Das heißt, es handelt<br />
es sich um den vollständigen Abbau durch Mikroorganismen zu CO2 und H2O,<br />
wobei gleichzeitig die Mineral- und Nährstoffe freigesetzt w<strong>erde</strong>n.<br />
Mikroorganismen im Boden:<br />
Springschwänze (Collembolae)<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/30
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Fadenwürmer<br />
Sind eine sehr artenreiche Klasse und gehören mit 10-1000 Individuen pro g<br />
Boden zur zweithäufigsten Tiergruppe im Boden. Die meisten der<br />
Bodenbewohnenden Arten sind nur 0.5 bis 2mm lang, sehr dünn und häufig<br />
farblos.<br />
Sie besiedeln den dünnen Wasserfilm auf oder zwischen den Bodenpartikeln, in<br />
dem sie sich überwiegend schlängelnd fortbewegen, und können mit dem<br />
Sickerwasser in tiefere Bodenschichten verfrachtet w<strong>erde</strong>n.<br />
Hinsichtlich ihrer Lebens- und Ernährungsweise zeigen die im Boden<br />
vorkommenden Arten eine große Bandbreite. Die im so genannten frei lebenden<br />
Fadenwürmer ernähren sich überwiegend von Mikroorganismen (Bakterien, Pilze,<br />
Algen), die sie mit den sich zersetzenden organischen Substanzen (= Detritus)<br />
aufnehmen, zum Teil auch räuberisch von Einzellern und kleineren Artgenossen.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/31
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Eine andere Gruppe bilden die parasitischen Fadenwürmer, die an Pilzmyzelien<br />
und Pflanzenwurzeln schmarotzen.<br />
Quelle: http://www.vhe.de/index.php?id=279<br />
Bodenuntersuchungen<br />
Eine Möglichkeit ist eine Untersuchung der<br />
Bodenlebewesen im Wald mit Hilfe einer<br />
speziellen Appar<strong>at</strong>ur, genannt Berlese-<br />
Trichter (siehe Abb. links).<br />
Dazu benötigt man einen Erlenmeyer-Kolben;<br />
frische Erdproben; ein Küchensieb, dessen<br />
Maschenweite nicht größer als 3 mm ist; eine<br />
Lampe, einen Trichter.<br />
Wenn die Berlese-Appar<strong>at</strong>ur aufgebaut ist,<br />
gibt man in das Sieb vorsichtig ca. 150 ml<br />
frische Erde, aus der alle größeren<br />
Lebewesen entfernt wurden. Nachdem das<br />
Sieb in den Trichter<br />
eingehängt worden ist, wird die Lampe<br />
eingeschaltet.<br />
Die im Becherglas gelandeten Lebewesen<br />
w<strong>erde</strong>n anschließend bestimmt, ausgezählt und verschiedenen Gruppen<br />
zugeordnet. Durch den Vergleich von Bodenproben, die an verschiedenen Stellen<br />
entnommen worden sind, können Aussagen über die Qualität des Bodens gemacht<br />
w<strong>erde</strong>n.<br />
Wasser<br />
(Weiteres siehe <strong>boden</strong>biologische Versuche)<br />
Zusammengestellt vom Team:<br />
Laurids Binder, Georg Leitgeb, David Petutschnig, Benedikt Pirstitz<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/32
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.7 Tabu-Spiel zum Thema Boden<br />
Jede Gruppe fertigte zu ihrem Thema Tabukarten an. Auf jeder Karte steht ein<br />
Begriff, der so beschrieben w<strong>erde</strong>n muss, dass ihn die Mitspieler err<strong>at</strong>en<br />
können. Unter diesem Wort befinden sich 2-3 Tabuworte, die in der Erklärung<br />
nicht vorkommen dürfen.<br />
Jene Gruppe die in einer bestimmten Zeit die meisten Begriffe errät, h<strong>at</strong><br />
gewonnen. Ein lustiges Spiel, das wir nach der Präsent<strong>at</strong>ion spielen w<strong>erde</strong>n, um<br />
alle Fachworte zu wiederholen.<br />
1.8 Bodenbiologische Versuche<br />
Wir führten die Versuche schon im Oktober durch, da im Winter der Boden<br />
gefroren ist und kaum Bodenlebewesen zu beobachten sind. Die SchülerInnen<br />
bekamen im Rahmen des NWP (N<strong>at</strong>urwissenschaftliches Praktikum), wo jeweils<br />
die Hälfte der Klasse eine Doppelstunde in Gruppen arbeitet, folgende<br />
Arbeitsaufträge (Protokoll x):<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/33
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/34
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/35
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Fingerprobe<br />
Wir sollten unsere Bodenprobe zwischen<br />
den Fingern reiben und feststellen, ob der<br />
Boden feinkörnig, klebrig oder gut<br />
formbar ist. Weiters stellten wir die<br />
Farbe fest. Wir trugen unsere Ergebnisse<br />
in einer Tabelle an der Tafel ein, dann<br />
notierten wir alles im Protokoll. Die<br />
Ergebnisse sieht man in der<br />
untenstehenden Tabelle (Vergleich versch.<br />
Böden).<br />
Kalkgehalt im Boden<br />
Wir geben einige Sandkörnchen auf ein<br />
Glasgefäß und tropfen dann mit einer<br />
Pipette 2 Tropfen verdünnte Salzsäure<br />
(HCI) darauf. (Aufbrausen: CO2 aus dem<br />
Kalk (Ca CO3) wird frei)<br />
Ergebnis: Wir haben beobachtet, dass die Sandkörnchen mit der Salzsäure nicht<br />
im Glasgefäß aufschäumen. Daraus können wir schließen, dass die Mischung<br />
w eniger als 1% Carbon<strong>at</strong> enthält.<br />
Kein Aufbrausen: < 1 % Carbon<strong>at</strong><br />
Schwaches Aufbrausen: 1-2 % Carbon<strong>at</strong><br />
Starkes, kurzes Aufbrausen:3-4 %<br />
Carbon<strong>at</strong><br />
Starkes, langes Aufbrausen:> 5<br />
%Carbon<strong>at</strong><br />
Vergleich verschiedener Böden<br />
Wir haben einen weiteren Versuch<br />
gemacht, bei dem wir<br />
verschiedene Böden verglichen<br />
haben.<br />
(siehe Tabelle darunter)<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/36
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Boden Farbe,<br />
Körnung,<br />
Geruch<br />
Sand grobkörnig,<br />
wenig Geruch,<br />
grau<br />
Wald<strong>boden</strong> Klein, körnig,<br />
Lehm<br />
dunkelbraun –<br />
schwarz<br />
rötlich,<br />
leichter<br />
Geruch,<br />
feinkörnig<br />
Formbarkeit,<br />
Klebrigkeit<br />
Wasseraufnahme<br />
(in ml)<br />
Durchfluss<br />
zeit<br />
Kalkgehalt<br />
zerbröckelt 40 ml 1,15 min < 1 % (reiner<br />
Quarz)<br />
Wenig > 25 ml 1,3 min 0 % Humus<br />
Wenig 75 ml 5,3 min 5%<br />
Schlussfolgerungen: Wir haben gesehen, dass Humus keinen Kalkgehalt h<strong>at</strong>, da<br />
er hpsl. aus organischer Substanz (zersetzte Teile von toten Lebewesen)<br />
besteht.<br />
Quarzsand enthält ebenfalls keinen Kalk. Weiters haben wir erkannt, dass im<br />
Wald<strong>boden</strong> der Humusgehalt sehr hoch ist (� schwarzer Boden) und er<br />
v erschieden große Bestandteile (z.B. Holzstückchen, Laub, etc.) enthält.<br />
Wasseraufnahme und Durchflussvermögen von Böden:<br />
Wir haben verschiedene Bodenarten in einen Trichter mit Filterpapier gegeben<br />
und danach 100 ml Wasser hinein gefüllt.<br />
Das Ergebnis war, dass<br />
bei dem grobkörnigen<br />
Boden das Wasser<br />
schneller durchkam und<br />
bei den anderen (z.B.:<br />
Sand, usw.) das Wasser<br />
später in das<br />
Auffanggefäß kam. Das<br />
heißt, je dichter der<br />
Boden ist, desto<br />
weniger Wasser kommt<br />
durch.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/37
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ergebnisse:<br />
SANDBODEN: ist sehr grobkörnig und h<strong>at</strong> keinen Geruch. man kann ihn<br />
zerbröckeln. Die Wassseraufnahme in ml ist: 40ml, die Durchflusszeit: 1.15 min<br />
und h<strong>at</strong> daher ein rel. schlechtes Wasserhaltevermögen: schlecht geeignet für<br />
Felder.<br />
WALDBODEN:ist feinkörnig und man kann ihn nicht gut verformen.<br />
Wasseraufnahme in ml: 2.5ml (sollte viel höher sein!)<br />
Durchflusszeit :1.2 min<br />
Der Versuch funktionierte<br />
nicht gut, da das Wasser<br />
wegen der groben<br />
Bodenbestandteile entlang<br />
des Trichters hinunterlief<br />
LEHMBODEN: ist<br />
feinkörnig und man kann ihn<br />
nicht gut verformen.<br />
Wasseraufnahme in ml:<br />
75ml,Durchflusszeit : 5 min<br />
43 sec.<br />
Hohe Wasseraufnahmefähigkeit<br />
Versuche zu größeren Bodentieren:<br />
In dem Fach NWP (NATURWISENSCHAFTLICHES PRAKTIKUM) haben wir mit<br />
mehreren Tieren kleine Experimente gemacht.<br />
Wir haben in einem Versuch einen<br />
Regenwurm auf ein Tablett gelegt<br />
und um ihn herum Essig geschüttet,<br />
dann haben wir gewartet, bis der<br />
Regenwurm versucht, über den Essig<br />
zu kriechen. Sobald der Regenwurm<br />
den Essig berührte, blieb der<br />
Regenwurm schlagartig stehen und<br />
wir konnten beobachten, dass sich<br />
der Kopf des Regenwurms etwas<br />
krümmte. Der Regenwurm besitzt<br />
am Kopf einfache Sinneszellen, mit<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/38
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
denen er verschiedene Reize (z.B. den scharfen Geruch von Essig) wahrnehmen<br />
kann.<br />
Ebenfalls haben wir die Bewegung eines Regenwurmes beobachtet. Bei der<br />
Bewegung schiebt der Regenwurm seine vorderen Ringglieder nach vorne und<br />
zieht die hinteren Glieder nach. Durch mehrmaliges Wiederholen des Vorganges<br />
entsteht die Bewegung des Regenwurmes.<br />
Auf Papier entsteht ein kr<strong>at</strong>zendes Geräusch, welches von den Chitinborsten, die<br />
sich auf der Haut des Regenwurmes befinden.<br />
Mit dem Binokular haben wir kleinere Tiere beobachtet, wie Asseln, Würmer,<br />
Schnurfüßer, Nacktschnecken, Spinnen, Wanzen,........ .<br />
Wir mussten uns aber beeilen, da die Tiere sonst wegen der Hitze der Lampe<br />
gestorben wären.<br />
Mikroorganismen im Mikroskop<br />
betrachtet. Wir konnten<br />
Folgendes beobachten: Amöben,<br />
die sich mit Scheinfüßchen<br />
fortbewegen, Springschwänze<br />
(mit Sprunggabel am Bauch),<br />
Fadenwürmer und Pilzfäden.<br />
Beobachtung von Bodenmikroorganismen:<br />
Wir verwendeten einen Berlesetrichter<br />
(Beschreibung siehe Kapitel 5.6.<br />
Mikroorganismen im Boden), um die kleinen<br />
Lebewesen aus der Erde zu holen. Sie fielen in<br />
das Becherglas mit Wasser. Von dort konnten<br />
wir sie mit etwas Flüssigkeit mit Hilfe einer<br />
Pipette auf einen Objektträger bringen.<br />
Anschließend wurden die lebendigen<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/39
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Klasse 4C<br />
http://www.schule.<strong>at</strong>/dl/<strong>boden</strong>.jpg: 27.01.2005<br />
ERDE<br />
4C<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/40
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.9 Vorwort<br />
Dieses Projekt war für uns alle eine große<br />
Herausforderung. Ich betreute die Klassen 4A<br />
und 4C zum Thema „Erde“.<br />
Schon im Oktober machten wir im Rahmen des<br />
N<strong>at</strong>urwissenschaftlichen Praktikums (NWP) in<br />
Gruppen Versuche zum Thema Boden. Dabei<br />
wurden Protokolle und Fotos angefertigt.<br />
Besonders die Beobachtungen der Bodentiere<br />
im Binokular und Mikroskop erfreuten sich<br />
großer Beliebtheit. (Es wurden alle im<br />
Biologiesaal ausgekommenen Spinnen, Insekten<br />
und Regenwürmer wieder eingefangen und in<br />
ihren Lebensraum zurückgebracht!)<br />
Mitte Jänner, nach der Einteilung der<br />
Gruppen, begannen wir mit der<br />
Liter<strong>at</strong>ursuche in Bibliotheken, zu<br />
Hause und im Internet. Kollege Zangl<br />
erstellte uns netterweise eine Seite im<br />
Schulintranet, wo wir unsere D<strong>at</strong>en in<br />
verschiedene Verzeichnisse stellen<br />
konnten. Wir verbrachten einige<br />
Stunden im EDV-Saal, wo wir<br />
Internetrecherchen durchführten,<br />
Texte tippten, Abbildungen ausdruckten und gegen abgestürzte Computer,<br />
verlorene D<strong>at</strong>en und nicht funktionierende Drucker kämpften.<br />
Während ein Teil der SchülerInnen an der<br />
Projektzeitung arbeitete, erstellten andere<br />
Zeichnungen und Texte für die Plak<strong>at</strong>e oder<br />
Rätsel zur ihrem Themenbereich und fertigten<br />
Karten für das „Boden-Tabuspiel“ an. Auch<br />
Powerpoint-Präsent<strong>at</strong>ionen oder Vorlagen für<br />
Farbfolien zur Präsent<strong>at</strong>ion der Ergebnisse<br />
wurden hergestellt.<br />
Alles in Allem waren es sehr zeitintensive, aber<br />
produktive Wochen, in denen wir einiges<br />
bezüglich „Erde“, Inform<strong>at</strong>ionsbeschaffung<br />
und –verarbeitung, sowie Präsent<strong>at</strong>ion profitiert<br />
haben.<br />
Februar, 2005 Mag. Ursula Jung<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/41
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.10 Allgemeines zum Thema Boden<br />
Bodendefinition:<br />
Der Boden besteht aus drei Hauptschichten: Ober<strong>boden</strong>, Unter<strong>boden</strong> und<br />
Untergrund.<br />
Der Ober<strong>boden</strong> enthält eine Art Hohlraumsystem und besteht aus besonderem<br />
Humus, der durch schnelles zersetzen viele Mineralien frei lässt. Auß<strong>erde</strong>m<br />
besteht der Ober<strong>boden</strong> aus 50%Wasser und Bodenluft.<br />
Quelle: http://www.effner.de/<strong>boden</strong>/alle%20Bilder/<strong>boden</strong>/Bodenhorizonte.jpg<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/42
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Boden als Lebensraum:<br />
Die Lebewesen können sich in verschiedenen Lebensräumen aufhalten:<br />
Atmosphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre. Durch Vermischungs- und<br />
Umwandlungsprozessen zwischen Atmosphäre und Lithosphäre entsteht der<br />
Boden bzw. Pedosphäre. Auß<strong>erde</strong>m ist die Pedosphäre Entwicklungsprozessen<br />
ausgesetzt und es entstehen terrestrische Ökosysteme. In der Pedosphäre<br />
mischen sich Luft, Wasser und Gestein.<br />
Der Boden besteht aus Gesteinsresten, Humus, Luft und Wasser. Die<br />
Bodenorganismen nutzen ihn und gestalten ihn mit. Die Bodenorganismen sind<br />
Holraum- und Oberflächenbewohner und ernähren sich hauptsächlich von<br />
abgestorbenen organischen Substanzen.<br />
Bodenbestandteile:<br />
Der Boden ist die oberste Verwitterungsschicht, die ständig Veränderungen<br />
unterworfen ist. (Bodendynamik)<br />
Der überwiegende Anteil der festen Bodensubstanz bildet mineralische<br />
Bestandteile. Der Boden stammt von den festen und lockeren Gestein einen der<br />
Erdoberfläche und Mineralien. Silik<strong>at</strong>reiche Erstarrungs- und<br />
Umwandlungsgesteine kommen zu 25% ( Erdkruste 95% )<br />
vor, Sedimente hingegen sind zu 75% vertreten.( Erdkruste 5%) Auß<strong>erde</strong>m<br />
stammen vier wichtige Pflanzennährelemente aus dem mineralischen<br />
Bestandteilen des Bodens, nämlich Calcium, Kalium, Mangan und Eisen.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/43
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bodenminerale und Gesteine unterliegen mechanischen und chemischen<br />
Einflüssen und Veränderungen, welche an die Bodenbildung beteiligt sind. Als<br />
Folge dessen entstehen die charakteristischen Farben der Mineralkörper<br />
verschiderner Bodentypen.<br />
Organische Bestandteile sind eine Stickstoffquelle, welche die<br />
Nährstoffelemente Schwefel und Phosphor liefert, die Wasser-, Luft- und<br />
Wärmehaushalt des Bodens beeinflussen. Die Bodenorganismen verarbeiten die<br />
tierischen und pflanzlichen Reste weiter, deshalb nennt man sie auch<br />
Konsumenten. Sie sind besonderst wichtig, da sie organische Substanzen<br />
verwandelt, welche dann wieder von Pflanzen aufgenommen w<strong>erde</strong>n. (Kreislauf<br />
der Stoffe)<br />
Quellen Köhler Mandl:Organismus und Umwelt (für die 5. Klasse der AHS)<br />
Keberreiter Schulbuch.Verlagsgesellschaft m.b.H.& Co. Kg, Wien 1989<br />
http://www.hvitfeldt.educ.goteborg.se/geoeco/gruppe8/bopro.html<br />
Bodenluft ≠ normale Luft:<br />
Bodenluft enthält weniger Sauerstoff, welcher auch nicht so schnell ersetzbar<br />
ist. Aber er enthält mehr Kohlensäure, CO2 und die Luftfeuchtigkeit ist höher.<br />
Man spricht von Boden<strong>at</strong>mung, wenn <strong>at</strong>mosphärische Luft und Bodenluft<br />
vermischt w<strong>erde</strong>n. Doch geschieht dies nicht n<strong>at</strong>urgemäß, so schadet es der<br />
Bodenfauna und auch den Pflanzen. Wie viel Luft ein Boden h<strong>at</strong>, hängt von der<br />
Größe der Bodenporen und von der Art des Bodens ab.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/44
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gefährdung des Bodens durch den Menschen<br />
Der Boden ist die Überschicht aus Vermoderungsstoffen, Humus und<br />
Verwitterung Gestein. Der Übergang zwischen der unbelebten Erdkruste und der<br />
belebten Welt. Die Heim<strong>at</strong> vieler Lebewesen, die als Pflanzenfresser, Räuber<br />
und Zersetzer arbeiten. Die Chemiefabrik, die Mineralien und tote Lebewesen zu<br />
Humus und Mineralsalzen verwandelt und so den Kreislauf der Stoffe<br />
ermöglicht. Die Grundlagen des Lebens - heute gefährdet durch den<br />
leichtfertigen Umgang des Menschen mit der N<strong>at</strong>ur(Ausbeutung, Verbauung,<br />
Verschmutzung und Gift)<br />
Die Ursachen, dass der bebaubare Boden der Welt in ca. 20 Jahren zu 2/3<br />
zerstört sein wird, sind:<br />
1) Ausbreitung der Städte und Siedlungen<br />
2) Es w<strong>erde</strong>n Kulturpflanzen angebaut, die dem Boden sehr viel<br />
Nährstoffe entziehen.<br />
3) Straßen- und Autobahnbau<br />
4) Fremdenverkehrseinrichtungen (Hotels, Sportanlagen,<br />
Parkplätze...)<br />
5) übermäßige landwirtschaftliche Nutzung<br />
6) Trockenlegung von Feuchtgebieten<br />
7) Rodung der Wälder<br />
8) Vergiftung durch neg<strong>at</strong>ive Umwelteinflüsse<br />
Quelle: Seewald Aichhorn: Biologie heute3.Salzburger Jugendverlag 1991<br />
Team “Boden allgemein”: Theresa Bock, Martha Perovic, Julia Schott, Lisa<br />
Weinstock<br />
1.11 Bodentypen<br />
Aus der charakteristischer Abfolge und Ausprägung der Bodenhorizonte ergibt<br />
sich das Bodenprofil eines jeweiligen Bodens. Böden mit ähnlichem Bodenprofil<br />
weisen einen ähnlichen Entwicklungsstand auf und w<strong>erde</strong>n zu einem bestimmten<br />
Bodentyp zusammengefasst. In Abhängigkeit vom Ausgangsgestein, von Relief<br />
und Klima, den Lebewesen in und auf dem Boden sowie der Zeitdauer der<br />
Einwirkung <strong>boden</strong>bildender Prozesse entsteht an jedem Standort ein ganz<br />
bestimmter Bodentyp. Hier w<strong>erde</strong>n einige für Mitteleuropa typische Bodentypen<br />
aufgezählt:<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/45
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Braun<strong>erde</strong><br />
Vorkommen: Im klim<strong>at</strong>ischen feuchteren Alpenvorland finden wir Braun<strong>erde</strong> mit<br />
einem Ausgeprägten B-Horizont.<br />
Dieser Boden ist typisch für Laubwälder, da diese eine leichtzersetzbare Streu<br />
haben. Die dort vorhandenen Lebewesen können die Streu sehr schnell<br />
Zersetzen, d.h., dass nur wenig Ablagerungen auf dem Boden vorhanden sind<br />
1. Schicht: 10 – 20 cm dunkler<br />
Humus<br />
2. Schicht: braungelb, Steine/ Lehm<br />
3. Schicht: hellerer Boden<br />
Schwarz<strong>erde</strong> (russisch: Tschernosem)<br />
Im trockenen Osten Österreichs h<strong>at</strong> sich auf Löss<br />
die fruchtbare Schwarz<strong>erde</strong> entwickelt. der A -<br />
Horizont ist in der obersten Schichten wegen des<br />
hohen Humusgehaltes schwarzbraun und wird nach<br />
unten zu etwas heller liegt direkt dem<br />
Muttergestein , dem Löß auf den der B-Horizont<br />
fehlt nennt man AC-Böden.<br />
Der Schwarz<strong>boden</strong> ist ein echter Steppen<strong>boden</strong>,<br />
der sich nur im regenarmen Steppenklima<br />
entwickelt. Wenn sich in dem Bereich das Klima<br />
ändert, würden sich auch die Böden weiter<br />
entwickeln und einen B-Horizont ausbilden.<br />
Schwarz<strong>erde</strong>-Profil, Foto: Prof. Dr. Klaus Mueller<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/46
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bleich<strong>erde</strong> (=Podsol)<br />
Der Name Podsol stammt aus dem russischen und bedeutet “Asche-Boden”. Eine<br />
alte Bezeichnung für Podsol ist der Begriff “Bleich<strong>erde</strong>.<br />
In kühl-gemäßigten, niederschlagsreichen Gebieten treffen wir auf Granit und<br />
Gneis (Wald- und Mühlviertel) die nicht sehr fruchtbare Bleich<strong>erde</strong> an.<br />
Podsole entstehen in Gebieten mit hohem Niederschlag und verhältnismäßig<br />
niederen Temper<strong>at</strong>uren. Die Ausgangsgesteine sind oft calcium- und<br />
magnesiumarm und leicht durchlässig, wie etwa Sande oder verwitterte<br />
Sandsteine.<br />
Podsole enstehen oft auch unter einer Veget<strong>at</strong>ion, die nährstoffarme<br />
Rückstände bildet und so eine Rohhumusdecke fördert. Typische Veget<strong>at</strong>ion<br />
über Podsol sind Nadelhölzer oder Heidekraut (Scheffer, Schachtschabel, 1992,<br />
S. 419).<br />
Podsolierungsprozess<br />
1. Schicht: Rohhumusauflage<br />
2. Schicht: Humus<br />
3. Schicht: Sand<strong>boden</strong><br />
4. Schicht: Braunschwarzer<br />
Eisenhumus, rel<strong>at</strong>iv dicht, kaum<br />
durchwurzelbar<br />
5. Schicht: Rostgelber Sand<br />
Unter diesen Bedingungen tritt eine Versauerung des Bodens ein und die<br />
Lebensbedingungen für Mikroben verschlechtern sich derart, dass eine nur eine<br />
unvollständige Zersetzung der anfallen (Nadel-) Streu st<strong>at</strong>tfindet.<br />
Gleichzeitig w<strong>erde</strong>n durch verschiedene chemische Reaktionen Aluminium und<br />
Eisen freigesetzt und durch Sickerwasser in den Unter<strong>boden</strong> verlagert. Wenn<br />
die Metalle im Unter<strong>boden</strong> durch Austrocknung oder Ausfällung verhärten,<br />
bilden sich Ort<strong>erde</strong>n oder stark verhärtete Ortsteine aus, die das<br />
Pflanzenwachstum stark beeinträchtigen können. Podsole entwickeln sich meist<br />
sekundär aus Braun<strong>erde</strong>n oder Parabraun<strong>erde</strong>n. In weiten Gebieten<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/47
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Norddeutschlands wurde der Prozess der Podsolierung aber durch die Rodung<br />
des ursprünglichen Laubwaldes und die Wiederaufforstung mit Nadelhölzern<br />
gefördert<br />
Podsole sind landwirtschaftlich nur beschränkt und unter Verwendung von<br />
Düngern und künstlicher Bewässerung nutzbar. Orsteinhorizonte wirken sich<br />
umso ungünstiger auf das Pflanzenwachstum aus, je näher sie an der Oberfläche<br />
liegen und müssen dann aufgebrochen w<strong>erde</strong>n (Scheffer, Schachtschabel, 1992,<br />
S. 378).<br />
Heute kann man jedoch, die früher als unkultivierbar angesehen Podsole durch<br />
Düngung und vor allem durch die Erhöhung des pH-Wertes rel<strong>at</strong>iv gut nutzen.<br />
Sie müssen jedoch künstlich bewässert w<strong>erde</strong>n, da Podsole sehr trockene Böden<br />
sind. Diese Eigenschaft ist auf das grobkörnige und leicht wasserdurchlässige<br />
Substr<strong>at</strong> und das anstehende meist grobporige Ausgangsgestein (C-Horizont)<br />
zurückzuführen, Künstliche Bewässerung ist zur Kultivierung dieser Böden<br />
deshalb unabdingbar (Scheffer, Schachtschabel, 1992, S. 419).<br />
Pseudogley: Dieser Boden ist ein typischer Marsch<strong>boden</strong>. Er kommt zwar nicht<br />
im Wald vor, dennoch kann man hier sehr gut erkennen, wo das Wasser seine<br />
Wege bahnt. ( ähnlich wie Braun<strong>erde</strong> )<br />
Untere Schicht: gelb-braune Flecken -<br />
Eisen lagert sich ab.<br />
graue Bahnen zwischen den<br />
Eisenablagerungen: Wege des Wassers.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/48
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gley<br />
Der Gley ( russisch: „sumpfiger Boden“) gehört zu den sogenannten<br />
hydromorphen, d.h. vom Bodenwasser<br />
beeinflussten, Böden. Als Grundwasserböden<br />
zeichnen sich Gleye durch einen dauernd<br />
hochstehenden Wasserstand aus,<br />
der bis zum Ah-Horizont heranreichen kann.<br />
Der humose, meist kalkarme Ah-<br />
Horizont ist in der Regel nur 20-30 cm<br />
mächtig. Durch intensive chemische<br />
Verwitterung ist der in der Regel mächtige<br />
Unter<strong>boden</strong> ton- und lehmreich. Dieser<br />
wird nicht – wie ansonsten üblich - als B-<br />
Horizont bezeichnet, sondern als G-<br />
Horizont.<br />
Im ständig durchnässten<br />
Grundwasserbereich w<strong>erde</strong>n wegen<br />
Sauerstoffmangels die rostfarbigen Eisen-<br />
und Manganhydroxide zu löslichen zweiwertigen Fe- und Mn-Oxiden reduziert.<br />
Sie w<strong>erde</strong>n im darüber liegenden Schwankungsbereich des Grundwassers durch<br />
Luftzufuhr als fleckige Bänder wieder ausgeschieden. Diese Fleckigkeit des<br />
Oxid<strong>at</strong>ionshorizontes (Go) wird im darunter liegenden Reduktionshorizont (Gr)<br />
von gleichmäßig grün-blau-grauen Schichten abgelöst, die die Farben der<br />
reduzierten Fe- und Mn-Verbindungen anzeigen.<br />
Gleye besitzen auf Grund des hohen Tongehaltes zwar eine hohe<br />
Austauschkapazität, bilden bei Trockenheit aber tiefe Trockenrisse und sind bei<br />
Feuchte schwer zu bearbeiten. Die Grundwasserproblem<strong>at</strong>ik, die hohe Mobilität<br />
der im Grundwasser gelösten Nährstoffe, der eingeschränkte Wurzelraum und<br />
die langsame Erwärmung machen Gleye ackerbaulich kaum nutzbar<br />
Rendzina<br />
Dieser Boden weist als Ausgangsgestein Kalkstein, Dolmit, Mergl oder Gips auf.<br />
die Bezeichnung sammt aus dem Polnischen Rentina :rauscher<strong>boden</strong> . die<br />
Profilbildung ist wenig entwickelt. Rendzinen sind bei geniger Mächtigkeit des<br />
Ob<strong>erde</strong>bs Trockene Standorte und haben für die Landwirtschaft nur einen<br />
rel<strong>at</strong>iv geringen Wert . In tiefgründigen Form stellen sie jedoch gute<br />
Ackerböden dar .<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/49
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ranker (AC-Boden)<br />
Der Ranker (österreichische Bezeichnung für Steilhang) ist ebenso wie die<br />
Rendzina ein gesteins- und reliefabhängiger Boden. Er besitzt auch einen<br />
deutlichen Ah-Horizont, liegt aber im Gegens<strong>at</strong>z dazu auf einem sauren, quarz-<br />
und silik<strong>at</strong>reichen Ausgangsgestein (Sand, Granit, Gneis). Ein B-Horizont fehlt,<br />
und infolge seiner geringen Profilmächtigkeit ist er für Pflanzen schlecht<br />
durchwurzelbar.<br />
Ranker kommen häufig in den feuchtkühlen<br />
Mittelgebirgen der Mittleren Breiten vor,<br />
bisweilen aber auch in der Tundra. An beiden<br />
Wuchsorten fördert häufiger Frostwechsel<br />
durch Frostsprengung die Vergrusung.<br />
Aufgrund der deutlich geringeren chemischen<br />
Verwitterungsprozesse verläuft die<br />
Verlehmung durch Tonmineralbildung hingegen<br />
sehr langsam ab und die Humifizierung des<br />
organischen M<strong>at</strong>erials im Ober<strong>boden</strong> ist meist<br />
unvollständig.<br />
Geringer Ton- und Humusgehalt sowie<br />
mangelnde Kalkanteile erlauben selbst im Ah-<br />
Horizont kaum die Bildung von Ton-Humus-<br />
Komplexen. Die Austauschkapazität ist daher<br />
ebenso wie der Nährstoffnachschub aus dem<br />
basenarmen Ausgangsgestein sehr gering. Während die mangelnde Verlehmung<br />
eine ausreichende Speicherung von Wasser im Boden verhindert, ist die<br />
Durchlüftung gut.<br />
Ranker-Profil<br />
Foto: Prof. Dr. Klaus Mueller<br />
Quellen:<br />
http://www.hvitfeldt.educ.goteborg.se/geoeco/gruppe8/bopro.html<br />
Driza & Cholewa Leben und Unwelt, Band3. 1997<br />
http://www.susanne-schwaab.de/Boden/Podsol/podsol.html, (04.02.2005)<br />
Quelle: http://hypersoil.uni-muenster.de/0/04/07/01.htm (4.2. 2005)<br />
Verlag Gustav Swobada & Bruder Wien : Biologie mit Geologie Teil 1. 1990<br />
Team „Bodentypen“: Berlakovich Marie, Bern<strong>at</strong>h Valentina, Cui Kaidi, Kaminska Weronika, Pamela Rupp<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/50
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.12 Bodenarten<br />
Bodengefüge<br />
Als Bodengefüge oder Bodenstruktur wird die räumliche Anordnung<br />
der unregelmäßig geformten festen mineralischen und organischen<br />
Bodenbestandteile bezeichnet, durch die das ganze Bodenvolumen in<br />
das Volumen der festen Bodensubstanz, das sogenannte<br />
Substanzvolumen und in das Porenvolumen differenziert wird.<br />
Substanzvolumen und Porenvolumen des Bodens<br />
Abhängig von der Bodenart, dem Gehalt an organischer Substanz, der Tätigkeit<br />
der Bodenorganismen (z.B. Bioturb<strong>at</strong>ion) sowie von Art und Grad der<br />
Zusammenlagerung von mineralischen und organischen Boden-komponenten (s.<br />
Gefüge-Formen und ihre Entstehung) zeigen die verschiedenen Böden sehr<br />
unterschiedliche Aufteilungen des Bodenvolumens.<br />
Quelle: www.hypersoil.uni-muenster.de<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/51
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bodenarten:<br />
Der Boden ist sehr grobkörnig, besitzt große Hohlräume, h<strong>at</strong> daher große<br />
Wasser- und Luftdurchlässigkeit die die Wasserkapazität verringert.<br />
Kommt in verschiedensten Regionen vor.<br />
Der Boden ist eher feinkörnig, formbar und luftdurchlässig. Seine<br />
Wasserspeicherkapazität ist aufgrund der kleinen Zwischenräume eher<br />
mittelmäßig.<br />
Kommt meist auf Feldern vor.<br />
Dieser Boden ist krümelig, sehr locker, kaum formbar und h<strong>at</strong> unterschiedlich<br />
große Zwischenräume. Noch dazu ist er verklebt, h<strong>at</strong> eine große<br />
Luftdurchlässigkeit und h<strong>at</strong>, guten Wasserspeicherkapazität<br />
Kommt im Wald vor.<br />
Der Wald<strong>boden</strong><br />
Der W. ist ein rel<strong>at</strong>iv n<strong>at</strong>urnahes Bodensystem, da es in der Regel nicht oder nur<br />
selten bearbeitet oder gedüngt wurde. In vielen Wäldern Mitteleuropas wurden<br />
allerdings seit dem Mittelalter bis ins 19. Jh. Dem Wald Laubstreu oder Plaggen<br />
entnommen, was Nährstoffentzug und (Bodenversauerung) zur Folge h<strong>at</strong>te.<br />
Der Boden ist die Schaltstelle für den Stoffkreislauf in Wäldern. Er filtert und<br />
speichert Wasser, ist gleichzeitig Raum für Bodenorganismen und Wurzelraum<br />
für Pflanzen. Das Wurzelsystem verankert die Bäume im Substr<strong>at</strong> und versorgt<br />
die oberirdischen Dinge mit Wasser und Nährstoffen. Wie man hier an dem<br />
Beispiel der Symbiose zwischen Pilz und Boden sieht:<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/52
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Quelle: Biologie heute 2G (s.Textende)<br />
Ohne die im Boden enthaltenen Nährelemente würden die Pflanzen des Waldes<br />
nicht existieren können. Wenn diese nicht ausreichend vorhanden sind, weisen<br />
Pflanzen bereits Mangelerscheinungen auf. Ein großer Teil der Nährstoffe<br />
entsteht durch Verwitterung aus umgewandeltem Ausgangsgestein, der kleinere<br />
Teil durch Niederschläge, stickstoffbindene Bakterien, Düngung und<br />
Grundwasser. Bei den Hauptnährelementen für Pflanzen handelt es sich um<br />
Stickstoff (N), Phosphor (P), Schwefel (S), Kalium (K), Calcium (Ca), Magnesium<br />
(M) , sowie verschiedenen Spurenelementen.<br />
Dadurch, dass nicht alle Nährelemente im Bodenwasser gelöst sind – dies ist nur<br />
ein geringer Teil, der andere ist am festen Boden gebunden – können sie auch<br />
nicht alle auf einmal verbraucht w<strong>erde</strong>n. So bleibt immer ein Vorr<strong>at</strong> erhalten.<br />
Wichtig für die Nährstoffverfügbarkeit ist der pH-Wert des Bodens. So ist z.B.<br />
der Podsol<strong>boden</strong> (russ.: Asche<strong>boden</strong>) ein sehr saurer Boden. Er kommt sehr<br />
häufig in Nord- und Zentraleuropa vor. Dort wo das Regenwasser den Stamm<br />
hinabläuft, ist der pH-Wert sehr niedrig.<br />
Schadstoffe aus der Luft gefährden den Wald<strong>boden</strong>. Aufgrund der großen<br />
Oberfläche der Bäume gelangt 4x soviel Schwefel und 3x soviel Stickstoff in<br />
den Boden wie in die Wiesen.<br />
Erst in den letzten Jahrzehnten erfolgten Düngungs- und Kalkungsmaßnahmen,<br />
hauptsächlich um den Eintrag von Säuren durch die Luftverschmutzung mit<br />
Stickoxiden und Schwefeldioxid zu kompensieren. In manchen Regionen wie zum<br />
Beispiel in Schweden ist der pH-Wert des Wald<strong>boden</strong>s bereits auf Werte um<br />
3,5 pH abgesunken (Saurer Regen).<br />
Die Versauerung bewirkt die Freisetzung von Aluminium-(Zellgift)- und<br />
Schwermetallionen und mindert die Organismentätigkeit mit der Folge, dass sich<br />
die Intensität des Abbaus des Laubstreus verringert, Humus langsamer gebildet<br />
wird und die Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe abnimmt.<br />
Waldböden unterliegen vor allem unter Nadelhölzern einem n<strong>at</strong>ürlichen Prozess<br />
der Versauerung mit der Neigung zur Podsolierung (siehe Bodentypen).<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/53
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Waldböden tropischer Breiten unterliegen wegen ungünstiger<br />
Bindungsverhältnisse zwischen Nährstoffen und Tonmineralien in starkem<br />
Ausmaß der Nährstoffauswaschung. Im Falle der Rodung verlieren diese Böden<br />
daher aufgrund mangelnder Nährstoffnachlieferung durch Laubfall schnell ihre<br />
Fruchtbarkeit (Regenwald).<br />
Quellen: http://www.hvitfeldt.educ.goteborg.se/geoeco/gruppe8/bopro.html, 27.1.2005<br />
http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBsonstiges/Wald<strong>boden</strong>.php, 27.1.2005<br />
Team „Bodenarten“: Bertram Gruber, Kevin Hochwarter, David Rauscher, Thomas Retschek, Mario Samija<br />
1.13 Bodentiere<br />
Allgemeines:<br />
13% aller europäischen Tierarten<br />
leben im Wald<strong>boden</strong>. Auf 25g<br />
diesen Substr<strong>at</strong>es kommen ca. 4<br />
Milliarden solcher<br />
Mikroorganismen. Die wichtigsten<br />
Bodenbewohner sind jedoch<br />
bestimmte Pilze und Bakterien.<br />
Deren Aufgabe ist es Bl<strong>at</strong>tstreu<br />
und kleine Äste zu zersetzen und<br />
in Nährstoffe für die Bäume und<br />
Pflanzen umzuwandeln. Dieser<br />
Vorgang geschieht in den<br />
unterschiedlichen Wäldern unterschiedlich schnell. Während die Bl<strong>at</strong>tstreu von<br />
Laubbäumen sehr schnell zersetzt wird (ca. 1 Jahr), dauert es bei Nadeln fast<br />
doppelt so lang.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/54
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Tierart Anzahl<br />
Regenwürmer 1 000<br />
Enchyträen 100 000<br />
Fadenwürmer 20 000 000<br />
Milben 100 000<br />
Springschwänze 700 000<br />
Quelle: http://www.hvitfeldt.educ.goteborg.se/geoeco/gruppe8/bopro.html<br />
Bedeutung der Bodentiere für die Bodenentwicklung:<br />
Bodentiere spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des<br />
Bodenkörpers (strukturprägende Funktion), Beschleunigung des Abbaus der<br />
organischen Substanz (Steuerungsfunktion) und sie sind Anzeiger für bestimmte<br />
Bodenqualitäten (Indik<strong>at</strong>orfunktion).<br />
Strukturprägende Funktion:<br />
Durch graben und wühlen wird der Boden gelockert, durchgemischt und<br />
durchgelüftet, dies reichert den Mineral<strong>boden</strong> mit Ton- Humus- Komplexen an<br />
und erhöht somit seine Wasserkapazität. Besonders Regenwürmer verbessern<br />
die Struktur des Bodens.<br />
Steuerungsfunktion:<br />
Bodentiere sind zwar für die Zersetzung und Humifizierung von abgestorbenen<br />
organischen Substanzen nicht nötig, jedoch fördern sie durch mechanische<br />
Zerkleinerung und Aufschlussleistungen bei der Verdauung den mikrobiellen<br />
Abbau, der ohne sie viel langsamer vor sich gehen würde und es entstünde eine<br />
schlechtere Humusform.<br />
Indik<strong>at</strong>orfunktion:<br />
Die Leistungen bei der Verbesserung der physikalischen Bodeneigenschaften,<br />
also der strukturprägenden Funktion sowie bei der Zerkleinerung der Abfälle<br />
hängen von den abiotischen, biotischen und anthropogenen Einflüssen vor Ort ab.<br />
Diese Standortbedingungen bestimmen die Bodenfauna und –flora und die<br />
jeweilige Aktivität im Boden.<br />
Das Leistungsspektrum ist je nach Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme der<br />
verschiedenen Bodentierarten anders, aber auch die Fortbewegungsweise, sowie<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/55
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
die verschiedenen Formen von Zerkleinerung, Verdauung und Ausscheidung der<br />
Nahrungspartikeln sind von großer Bedeutung.<br />
Der Regenwurm<br />
Bei uns gibt es etwa 35 verschiedene Regenwurmarten. Regenwürmer können, je<br />
nach pH-Wert des Bodens, von 40 g/m2 bis 400 g/m2 vorkommen. Regenwürmer<br />
erreichen im ausgewachsenen Zustand eine Größe von ungefähr 4 cm und eine<br />
Breite von ca. 2mm. Sie sind in der Regel stark pigmentiert und sind meist<br />
rötlich oder fleischfarben gefärbt.<br />
Der Boden entsteht durch Verwitterung aus dem Gestein (Muttergestein).<br />
Pflanzen, die ihn besiedeln, sterben ab, w<strong>erde</strong>n von Organismen zersetzt und<br />
bilden den Humus, eine nährstoffreiche Substanz, die als oberste Bodenschicht<br />
aufliegt und für die Bodenfruchtbarkeit von großer Bedeutung ist. Die Zahl der<br />
Bodenorganismen in einem fruchtbaren Boden ist demnach sehr hoch. Der<br />
Regenwurm h<strong>at</strong> großen Anteil an der Fruchtbarkeit des Bodens. Er lebt in seinen<br />
weit verzweigten Gängen, die bis in eine Tiefe von 2m reichen, lockert dadurch<br />
den Boden auf und sorgt auch für dessen gute Durchlüftung. Weiters kann das<br />
Regenwasser tief in die aufgelockerte Erde dringen, wodurch eine intensive<br />
Durchfeuchtung des Bodens gesichert ist, die im Sommer auch während längerer<br />
Trockenperioden ausreicht.<br />
Die Asseln<br />
Asseln sind die einzigen landbewohnenden Krebse. In Deutschland gibt es 50<br />
verschiedene Arten. Sie sind 3-20mm groß und bevorzugen hohe<br />
Luftfeuchtigkeit und feuchte Böden mit geringer Lichteinstrahlung. Sie leben in<br />
lockeren, grobporenreichen und kalkhaltigen Böden, aber auch unter Steinen und<br />
in der Nähe von Häusern. Sie ernähren sich von Pilzen, Falllaub, verrottenden<br />
Pflanzenresten, Spinneneiern, Insektenkadaver, totes Holz, Vogelkot und ihren<br />
eigenen Kot. Sie können starken landwirtschaftlichen Schaden anrichten, aber<br />
auch die Bodenfruchtbarkeit enorm fördern. Es leben etwa 50 – 200 Tiere pro<br />
m² Bodenausschnitt (ca. 30 cm tief).<br />
Die Tausendfüßer<br />
Tausendfüßer vertreten wie die Insekten, eine <strong>boden</strong>biologisch wichtige Gruppe,<br />
die Gliederfüßer. Sie haben eine lang gestreckte Körperform und beinhalten<br />
Körperringe, die unterschiedlich viele Laufbeine tragen, z.B. Hundertfüßer,<br />
Doppelfüßer, Wenigfüßer, und Zwergfüßer. Aufgrund ihrer zahlreichen Beine<br />
bewegen sich diese Tiere nur langsam durch wellenförmige Bewegungen der<br />
Beine entlang des Körpers fort. Heutige Tausendfüßer erreichen Längen von 0,2<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/56
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
bis 23 cm. Ein in Thüringen gefundener Riesentausendfüßer, der vor etwa 296<br />
Mio. Jahren lebte war über 2 m groß. Tausendfüßer besitzen eine Schutzmantel<br />
aus Chitin, mit Kalkeinlagerungen (außer einigen kleinen Arten), 2 Punktaugen, 1<br />
Paar Oberkiefer, 2 kurze Fühler und (bei den meisten Arten) Stinkdrüsen, deren<br />
Absonderungen räuberische Insekten abstoßen u. sogar töten. Sie halten sich an<br />
dunklen, feuchten Orten auf und ernähren sich von zersetztem Pflanzenm<strong>at</strong>erial.<br />
Während des Wachstums häuten sie sich. Sie können 1 bis 7 Jahre alt w<strong>erde</strong>n.<br />
Schnecken<br />
Schnecken sind die artenreichste und einzige Klasse der Weichtiere (Mollusken),<br />
die auch am Land vorkommt. Sie sind auf verschiedenen Böden anzutreffen, aber<br />
nur wenige Landschnecken, die die Streu- und obersten Bodenschichten<br />
bewohnen, können als echte Bodentiere betrachtet w<strong>erde</strong>n. Für die Besiedlung<br />
des Bodens spielen sein Kalkgehalt, die Struktur des Bodenkörpers, das<br />
vorherrschende Mikroklima und die Feuchtigkeitsverhältnisse eine<br />
entscheidende Rolle. System<strong>at</strong>isch lassen sich Schecken in Lungen- und<br />
Kiemenschnecken differenzieren. Die Landschnecken sind bis auf wenige<br />
Ausnahmen Lungenschnecken. Weiterhin kann man die Arten in Gehäuse- und<br />
Nacktschnecken unterteilen. Letztere haben das Gehäuse weitgehend oder<br />
vollständig reduziert. Die meisten Schneckenarten ernähren sich von Pflanzen,<br />
(Schimmel-) Pilzen und/oder abgestorbener organischer Substanz, vereinzelt<br />
aber auch räuberisch von anderen Schnecken und Regenwürmern. Sie beteiligen<br />
sich an der Zerkleinerung und Umwandlung der organischen Substanz, binden mit<br />
ihrem abgesonderten Schleim Bodenpartikel und verbessern die Bodenstruktur.<br />
Eine sehr enge Bindung an das Bodenleben zeigt die Landlungenschnecke. Sie<br />
entwickelt ein dünnwandiges, lang gestrecktes und transparentes Gehäuse und<br />
lebt ausschließlich im Boden. Hier kommt sie in Tiefen bis zu 40 cm, zum Teil<br />
auch bis 1 m vor. Sie ernährt sich überwiegend von Schimmelpilzen und nutzt<br />
Regenwurmgänge und große Bodenporen, um in den Bodenkörper vorzudringen.<br />
Insekten und deren Larven<br />
Insekten:<br />
Sie bilden mit 800 000 entdeckten Arten, die weltweit verbreitet sind, die<br />
größte und abgesehen von den Weichtieren, die höchst entwickelte Klasse im<br />
Tierreich. Die Minderheit der Insektenarten, die in organisierten Gruppen leben,<br />
bildet sich aus 800 Wespenarten, 500 Bienenarten, Ameisen und Termiten. Im<br />
Erscheinungsbild sind Insekten sehr verschieden, jedoch sind bestimmte<br />
körperliche Merkmale gleich. Wie zum Beispiel der Kopf, auf dem zwei Antennen<br />
oder Fühler, auf denen manchmal die Geruchs- und Tastsinnorgane sind, ein Paar<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/57
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Oberkiefer oder Mandibeln,die zum Ergreifen und Zerbeißen der Nahrung<br />
dienen, ein Paar Unterkiefer oder Maxillen, das Labium (oder Unterlippe), das<br />
ebenfalls ein Paar Taster trägt. Auch die Brust trägt meistens 3 Beinpaare, die<br />
jeweils an einem anderen Brustsegment sind. Diese Segmente heißen von vorne<br />
nach hinten: Prothorax, Mesothorax und Met<strong>at</strong>horax. Oder dem Hinterleib, der<br />
aus zehn oder elf Segmenten besteht. Am letzten liegt der After, und am<br />
achten oder neunten liegen die Geschlechtsorgen. Das weibliche<br />
Geschlechtsorgan, der Eiablageappar<strong>at</strong>, ist zu einem Stachel, Dorn oder Bohrer<br />
umgewandelt. Insekten haben kein Innenskelett sondern ein Außenskelett<br />
(Exoskelett), das durch Einlagerungen von Farbstoffen und Verknüpfungen von<br />
Eiweißen in der äußeren Körperschicht, aber nicht an Gelenken entsteht. Die<br />
meisten Tiere dieser Art <strong>at</strong>men mit Tracheen, nur wenige durch eine Diffusion<br />
über die Körperwand. Das Blutgefäßsystem der Insekten ist einfach, da der<br />
gesamte Körper mit Blut gefüllt ist und das Herz eine Röhre mit offenen Enden<br />
ist, die am Rücken entlang läuft und durch zusammenziehen das Blut durch den<br />
Körper fließt. Der Verdauungskanal ist meistens in Vorderdarm, Mitteldarm<br />
(oder Magen), indem der größte Teil der Verdauung st<strong>at</strong>tfindet, und Hinterdarm<br />
gegliedert. Das Zentrum des Nervensystems liegt im Nervenstrang, der mit<br />
einem Nervenknoten oder mit einem Paar Ganglien versehen ist. Drei Ganglien<br />
bilden das Gehirn an welches Reize der Augen oder der Fühler gesendet w<strong>erde</strong>n.<br />
Augen, Hörorgane, Tastsinnesorgane, Geruchssinnensorgane und<br />
Geschmacksinnesorgane sind die Sinnesorgane der Insekten. Die Fortpflanzung<br />
dieser Tierklasse ist sehr verschieden. Die Honigbienenkönigin produziert im<br />
Jahr Tausende Eier, obgleich die Drohnen kurz nach der Paarung sterben, bei<br />
den Eintagsfliegen sterben beide nach kurzer Zeit, die Käfer paaren sich<br />
mehrmals und bei einigen Insekten gibt es die Jungfernzeugung, also<br />
unbefruchtete Eier aus denen ein Insekt entsteht. Auch die Entwicklung der<br />
Eier variiert sehr stark, da manche lebendgebärend sind, die Larvalentwicklung<br />
findet im Weibchenst<strong>at</strong>t und bei der Geburt erfolgt die Verpuppung, jedoch<br />
schlüpfen die meisten außerhalb des elterlichen Körpers.<br />
Larven:<br />
Mit Larven bezeichnet man Jungstadien von Insekten, die im Laufe ihrer<br />
Entwicklung eine vollkommene Metamorphose durchmachen. Larven haben fast<br />
keine Ähnlichkeiten mit ihren Eltern, jedoch w<strong>erde</strong>n die die den Insekten ähnlich<br />
sehen als Nymphen bezeichnet, von denen manche sogar Kiemen haben. Larven<br />
von Käfern nennt man Maden oder Engerlinge, die von Fliegen nennt man Maden<br />
und von Schmetterlingen Raupen. Junge jeglicher Tiere, die wenige Nährstoffe<br />
enthalten, die nach dem Embryostadium schlüpfen und sich noch Umwandeln<br />
müssen bevor sie den erwachsenen Tieren ähneln nennt man auch Larven. Die<br />
Larvalstadien von wasserlebenden Wirbellosen w<strong>erde</strong>n als Erwachsene<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/58
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
sesshafte, frei schwimmende Tiere. Bei Saugwürmern gibt es mehrere<br />
Larvalstadien die als Miracidium bezeichnet w<strong>erde</strong>n. Die Larven von<br />
Fadenwürmern und Nem<strong>at</strong>oden leben oft in anderen Tieren und entwickeln sich in<br />
den Körpern ihrer Wirte. Eine Larvenform der Wirbeltiere sind die Kaulquappen<br />
der Frösche. Die Larven von Wirbellosen sehr viele Krankheiten wie zum Beispiel<br />
Hakenwurmkrankheit oder die Elefantiasis.<br />
Quellen:<br />
1. Microsoft R Encarta R Enzyklopädie 2003 (die zwei R sind eingekreist)<br />
2. http://www.das-tierlexikon.de/maulwuerfe.htm<br />
3. http://www.der-<strong>boden</strong>-lebt.nrw.de/fas<strong>boden</strong>/lebewes/regenw/rw_00.htm<br />
4. http://www.der-<strong>boden</strong>-lebt.nrw.de/fas<strong>boden</strong>/lebewes/krebs.htm<br />
5. http://www.das-tierlexikon.de/dachse.htm<br />
Maulwürfe:<br />
Maulwürfe, Familie kleiner, grabender Insektenfresser. Sie zeichnen sich<br />
durch eine rüsselartig verlängerte Schnauze, rückgebildete Augen sowie<br />
einen gedrungenen Körper mit kurzen Beinen aus. Die Vorderbeine<br />
sind durch lange, kräftige Krallen zu Grabschaufeln umgebildet.<br />
Maulwürfe sind in Europa, Asien und Nordamerika verbreitet. Sie leben in<br />
unterirdischen, selbst gegrabenen Gängen mit mehreren Kammern, die sie<br />
in regelmäßigen Abständen nach Regenwürmern und Insektenlarven absuchen.<br />
Durch die intensive Grabtätigkeit entstehen aufgeworfene Erdhügel<br />
(Maulwurfshügel) an der Bodenoberfläche.<br />
Der Europäische Maulwurf kommt in ganz Europa außer<br />
Island, Skandinavien, Irland und Spanien vor. Er besiedelt offenes<br />
Kulturland, aber auch Waldlichtungen. Unser Maulwurf erreicht eine<br />
Kopfrumpflänge von 11 bis 17 Zentimetern, er wiegt maximal 120 Gramm. Im<br />
Mai w<strong>erde</strong>n nach einer Tragzeit von 35 bis 42 Tagen in einer Nestkammer<br />
in der Regel drei bis vier (maximal neun) Junge geboren, die zwei Mon<strong>at</strong>e<br />
gesäugt w<strong>erde</strong>n.<br />
System<strong>at</strong>ische Einordnung: Maulwürfe bilden die Familie Talpidae der<br />
Ordnung Insectivora. Die wissenschaftliche Bezeichnung des Europäischen<br />
Maulwurfes lautet Talpa europaea und die des Sternmulls Condylura<br />
crist<strong>at</strong>a.<br />
Quelle: Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie 2003. © 1993-2002 Microsoft Corpor<strong>at</strong>ion. Alle Rechte<br />
vorbehalten.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/59
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Elfchen:<br />
1. schwarz<br />
wie die Nacht<br />
ich finde es grauslich<br />
Asseln<br />
2. schleimig<br />
wie Pudding<br />
ich trag sie nicht gerne<br />
Schnecken<br />
3. lang<br />
wie ein Tausendfüßer<br />
ich halte sie nicht gerne<br />
Regenwürmer<br />
4. tief<br />
wie der Erd<strong>boden</strong><br />
ich folge ihnen nicht<br />
Tausendfüßer<br />
5. klein<br />
wie eine Larve.<br />
ich fange sie<br />
Kaulquappen<br />
Rätselfragen/ Bodentiere:<br />
1.)Wie lang können Regenwürmer w<strong>erde</strong>n?<br />
2.)Wie tief kann der Regenwurm in die Erde eindringen?<br />
3.)Was fressen Asseln?<br />
4.)Was für eine Tierart sind Asseln?<br />
5.)Wie lang war der Tausendfüßer, der vor 296 Mio. Jahren lebte?<br />
6.)Häuten sich Tausendfüßer?<br />
7.)Atmen Schnecken mit Kiemen oder mit Lungen?<br />
8.)Sind Schnecken Pflanzen- oder Fleischfresser?<br />
9.)Nenne eine Larvenform der Wirbeltiere<br />
10.)Wie heißt die Entwicklung der Insektenlarven?<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/60
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Masterfrage: Wieviele Regenwürmer braucht man für ein Sprigseil, das 1,60 m<br />
lang w<strong>erde</strong>n soll?<br />
(Auflösung siehe 5.9)<br />
Team „Bodentiere“: Isabella Brauch, Jenny Panzenböck, Ariane<br />
Schmelzenbart, Elisabeth Steffl, Anna Widhalm, Carina Weiß<br />
1.14 Mikroorganismen im Boden<br />
Destruenten:<br />
Destruenten sind die „Zersetzer“ im Boden. Sie wandeln organische Substanz<br />
(tote Pflanzen und Tiere) in Nährstoffe, die im Humus enthalten sind, um. Zu<br />
den Destruenten gehören: Milben, Bakterien u.a. Einzeller, Pilze, u.s.w.<br />
Milben<br />
Merkmale:<br />
• von den über 15.000 Milbenarten leben etwa<br />
die Hälfte im Boden<br />
• zwischen 100.000 und 400.000 pro<br />
Quadr<strong>at</strong>meter.<br />
• langgestreckte, stark abgepl<strong>at</strong>tete runde<br />
spinnenartige Tiere<br />
• Sie ernähren sich überwiegend von Pflanzenresten, fressen aber auch<br />
gern Bakterien, Pilze, Algen oder Kot.<br />
• Einige sind jagende Räuber.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/61
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bakterien<br />
Vielzahl von Bakterienarten: Bakterien<br />
sind mikroskopisch kleine, einzellige<br />
Lebewesen, die neben den Pflanzen und<br />
Tieren eine besondere Gruppe bilden. Sie<br />
vermehren sich durch Zweiteilung. Es<br />
gibt rund 6.000 bekannte<br />
Bakterienarten.<br />
mögliche Form:<br />
• stäbchenförmig (z. B. Bazillen)<br />
• kugelförmig (Kokken)<br />
• kommaförmig (Vibrionen)<br />
• spiralförmig (Spirillen)<br />
• spezielle Formen wie z. B.<br />
Spirochäten<br />
Bakterien gibt es überall in Luft, Erde<br />
und Wasser, in Menschen, Tieren und Pflanzen. Viele Bakterien können bei<br />
Nahrungsmangel, Trockenheit, Hitze oder Kälte widerstandsfähige Dauerformen<br />
(Sporen oder Kapseln) bilden und zum Teil Jahre ohne Nahrung überleben.<br />
Schädliche Bakterien:<br />
Bakterien w<strong>erde</strong>n durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Atemluft), durch<br />
Berührung von Menschen oder Tieren übertragen. So sind Tiere häufig<br />
Bakterienüberträger. Großen Schaden richten die Nahrungsmittel v<strong>erde</strong>rbenden<br />
Bakterien an. Da die meisten Bakterien vom Abbau organischer Stoffe leben,<br />
findet man sie häufig an Nahrungsmitteln, die durch das Bakterienwachstum<br />
"v<strong>erde</strong>rben".<br />
N ützliche Bakterien:<br />
Es gibt aber auch nützliche Bakterien, zum Beispiel die Mehrheit der Boden und<br />
Gewässerbakterien. Sie besorgen den biologischen Abbau der abgestorbenen<br />
tierischen und pflanzlichen Substanzen durch Fäulnis und Gärung (zymogene<br />
Bakterien) zu anorganischen Substanzen, also die Remineralisierung organischen<br />
M<strong>at</strong>erials. Durch diese Bakterien w<strong>erde</strong>n die Kohlenstoff-, Stickstoff-,<br />
Schwefel- und Phosphorkreisläufe innerhalb der N<strong>at</strong>ur in Funktion gehalten.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/62
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Die Amöbe, ein Einzeller<br />
Einzeller zählen zu den Kleinstlebewesen, den Mikroorganismen. Ihr Körper<br />
besteht aus einer einzigen<br />
Zelle. Dennoch besitzen sie alles, was Lebewesen<br />
ausmacht:<br />
Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung und Reizbarkeit. Diese<br />
Leistung erbringen einzelne Zellbestandteile, die Organellen. Organe, die aus<br />
verschiedenen Geweben bestehen, haben Einzeller nicht.<br />
Die Amöbe ist ein Einzeller. Mit ihrer Größe von rund 0,5 mm ist sie für uns mit<br />
dem bloßen Auge gerade noch erkennbar. Unter den einzelligen Lebewesen ist sie<br />
allerdings ein Riese.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/63
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Lebensraum<br />
Die<br />
meisten Arten unter den Amöben leben im Schlamm, auf Pflanzen oder<br />
Steinen unserer<br />
stehenden Gewässer. Nur wenige können im freien Wasser<br />
schwimmen.<br />
Gestalt<br />
Der Körper der<br />
Amöbe ist von einer dünnen Zellmembran umgeben. Das darunter<br />
liegende Zellplasma ist klar und dickflüssig. Es wird als Außenplasma bezeichnet.<br />
Das Zellplasma im Innern der Zelle, das Innenplasma, ist trübe und dünnflüssig.<br />
Es enthält zahlreiche Körnchen sowie Tröpfchen. Die Amöbe ändert fortwährend<br />
ihre Gestalt. Immer wieder bilden sich neue Fortsätze. Man bezeichnet sie als<br />
Scheinfüßchen. Aus diesem Grund wird die Amöbe auch Wechseltier genannt.<br />
Fortbewegung<br />
Die<br />
Scheinfüßchen bewegen die Amöbe vorwärts: Das Außenplasma wölbt sich<br />
vor, das Innenplasma<br />
strömt nach. Ein neues Scheinfüßchen entsteht. Der Rest<br />
der Zelle wird nachgezogen, alte Scheinfüßchen bilden sich zurück. Hinten und<br />
vorne gibt es bei der Amöbe nicht.<br />
Ernährung und Verdauung<br />
Stoßen<br />
Amöben auf Nahrung, umfließen sie diese von allen Seiten. Schließlich ist<br />
die Beute völlig vom Zellplasma<br />
umhüllt- Eine Nahrungsvakuole h<strong>at</strong> sich gebildet.<br />
In ihr wird die Nahrung verdaut. Die Nährstoffe gelangen ins Zellplasma. Die<br />
unverdaulichen Reste bleiben beim Weiterfließen liegen.<br />
Fortpflanzung<br />
H<strong>at</strong><br />
die Amöbe eine bestimmte Größe erreicht, teilt sie sich. Zuerst teilt sich<br />
der Zellkern in zwei gleiche Tochterkerne, dann schnürt sich das Zellplasma in<br />
der Mitte durch. Aus einer Amöbe sind durch ungeschlechtliche Vermehrung<br />
zwei neue Tiere geworden.<br />
Team „Boden-Mikroorganismen“:<br />
Güley<br />
Dolunay, Lukas Kaiser, Philip Kaspar,<br />
Georg Luif,<br />
Nicolas<br />
Nowak<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/64
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.15 Tabu-Spiel zum Thema Boden<br />
Als wir mit den Plak<strong>at</strong>en fertig waren, wollten wir uns mit einem Spiel vergnügen.<br />
Alle Gruppen h<strong>at</strong>ten bereits Tabukarten zum Thema Boden angefertigt. (Anm:<br />
Diese Karten enthalten einen Begriff, der den Mitspielern erklärt w<strong>erde</strong>n muss<br />
und zwei weitere Tabu-Worte darunter, die in der Erklärung nicht vorkommen<br />
dürfen).<br />
Wir entschlossen uns, Burschen gegen Mädchen zu spielen, da die Burschen die<br />
Meinung h<strong>at</strong>ten, sicher zu gewinnen. Am Anfang sah es schlecht für die Mädchen<br />
aus, denn h<strong>at</strong>ten so schwierige Begriffe wie „Bodenprofil“ und „Löss“. Die<br />
Burschen bekamen leichte Worte wie z.B. „Assel“ oder „Regenwurm. Am Schluss<br />
holten die Mädchen auf und gewannen mit einem kleinen Vorsprung.<br />
1.16 Bodenbiologische Versuche<br />
Weronika Kaminska<br />
Wir führten die Versuche schon im Oktober durch, da im Winter der Boden<br />
gefroren ist und kaum Bodenlebewesen zu beobachten sind. Die SchülerInnen<br />
bekamen im Rahmen des NWP (N<strong>at</strong>urwissenschaftliches Praktikum), wo jeweils<br />
die Hälfte der Klasse eine Doppelstunde in Gruppen arbeitet, folgende<br />
Arbeitsaufträge (siehe Protokoll x):<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/65
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/66
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/67
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Versuchsbeschreibung zur Beschaffenheit der Böden:<br />
Ich testete den<br />
Wald<strong>boden</strong>. Zuerst gab ich wenig<br />
Wasser in die Erde hinein, um<br />
Verschiedenes an ihr auszutesten.<br />
Ich tauchte meine Finger in die<br />
Erde. Da spürte ich, dass sie<br />
grobkörnig war. Dann versuchte ich<br />
sie zu formen, aber das ging schwer<br />
bis gar nicht. Denn sie war weder<br />
klebrig noch formbar, was ich<br />
eigentlich nicht erwartet habe. Die<br />
Farbe der Erde was schwarz bis<br />
dunkelbraun, da<br />
sie viel Humus<br />
enthält. Interessant fand ich<br />
die Bestandteile<br />
der<br />
Erde, denn sie besteht aus<br />
Bl<strong>at</strong>tteilen,<br />
verschiedengroßen<br />
Holzstückchen,<br />
Humus und kleine Organismen,<br />
die dort leben.<br />
Lehm<strong>boden</strong><br />
Ich musste den Lehm<strong>boden</strong> untersuchen. Seine Farbe ist khaki. Wenn er nass ist<br />
beginnt er sofort zu kleben und ich kann ihn sehr gut formen und er fühlt sich an<br />
wie sehr dickes Mus. Er ist körnig und riecht nach nix. Wenn er eintrocknet<br />
hinterlässt er eine dicke Kruste die schwer runtergeht. Es h<strong>at</strong> mir sehr viel Spaß<br />
gemacht diesen Boden zu untersuchen.<br />
Sand<strong>boden</strong>versuch<br />
Im Praktikum haben wir einen Auftrag von der Frau Prof. Jung bekommen, drei<br />
Bodentypen zu untersuchen. Ich habe den Sand<strong>boden</strong> erforscht und<br />
festgestellt, dass er nach nassen Blättern roch und die Farbe gelb h<strong>at</strong>te. Als ich<br />
hinein griff, spürte ich den grobkörnigen Sand.<br />
Nun versuchte ich ihn zu formen, aber es lies sich schlecht formen, so stellte ich<br />
fest, dass er überhaupt nicht m<strong>at</strong>schig war. Im Unterschied zum Wald<strong>boden</strong> ist<br />
der Sand<strong>boden</strong> heller, weil er keinen Humus enthält. Der Sand<strong>boden</strong> ist wenig<br />
klebrig und zerfällt leicht, wenn man ihn formen will.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/68
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Untersuchung auf den Kalkgehalt im Boden:<br />
Wir bestimmten<br />
den Kalkgehalt von<br />
verschiedenen Böden.<br />
Wir legten ein<br />
paar Körnchen Boden auf ein<br />
Glassch älchen und tropften dann mit<br />
einer Pipette 2 Tropfen verdünnte<br />
Salzsäure (HCl) darauf. Beim<br />
Lehm<strong>boden</strong> brauste<br />
es am meisten,<br />
da CO2 aus dem Kalk [CaCO3] frei<br />
wurde. Bei dem Wald<strong>boden</strong><br />
sah man<br />
kein Aufbrausen,<br />
da er<br />
hauptsächlich aus organischen<br />
Substanzen besteht.<br />
Beim<br />
Sand<strong>boden</strong><br />
sahen wir auch keine<br />
Wirkung, da er aus reinen<br />
Quarzkörnern besteht.<br />
Versuchsbeschreibung zum<br />
Durchflussvermögen<br />
von Böden:<br />
Zuerst<br />
mussten wir Filterpapier in einen Blumentopf legen und diesen mit<br />
unserer Bodenprobe<br />
füllen. Danach gossen wir 100 ml Wasser auf die<br />
Bodenprobe und gaben es auf<br />
ein Auffanggefäß. Danach<br />
stoppten wir, wann der erste<br />
und der letzte Tropfen<br />
Wasser<br />
würde.<br />
heraus kommen<br />
Beim Lehm<strong>boden</strong> kam auf<br />
Grund seiner n<strong>at</strong>ürlichen<br />
Wasser-aufnahmefähigkeit<br />
und der T<strong>at</strong>sache, dass wir<br />
unsere Bodenprobe sehr fest<br />
gedrückt h<strong>at</strong>ten, längere Zeit kein Tropfen Wasser heraus.<br />
Beim Wald<strong>boden</strong> kamen von 100 ml nur 50 ml heraus. Er h<strong>at</strong> ein rel. hohes<br />
Wasserhaltevermögen, daher können hier Wasserliebende Pflanzen leben.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/69
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Beim Sand<strong>boden</strong> stellten wir ein sehr hohes Durchflussvermögen<br />
fest, da von<br />
den<br />
100 ml, 75 ml wieder heraus kamen. Diese Böden sind daher ziemlich<br />
trocken.<br />
Versuche mit größeren Bodentieren:<br />
1) M<strong>at</strong>erialien: Papier, Regenwurm<br />
Wir haben einen Regenwurm auf ein Bl<strong>at</strong>t<br />
Papier gelegt und ihn beobachtet. Jedes<br />
Mal,<br />
wenn er sich bewegt h<strong>at</strong>, konnten wir ein<br />
kr<strong>at</strong>ziges Geräusch hören. Wenn sich<br />
ein<br />
Regenwurm fortbewegen will, zieht er zuerst<br />
die Ringmuskeln zusammen, wodurch er lang<br />
und dünn wird, und kontrahiert dann seine<br />
Längsmuskeln, um kurz und dick zu w<strong>erde</strong>n.<br />
Die Borsten, die dem Regenwurm bei der<br />
Fortbewegung helfen,<br />
erzeugen das<br />
kr<strong>at</strong>zende<br />
Geräusch.<br />
2) M<strong>at</strong>erialien: Tablett, Essig, Reg enwurm<br />
Wir haben auf einem Tablett einen Kreis<br />
aus Essig gezogen, in dessen Mitte wir dann<br />
den Regenwurm<br />
gelegt haben. Zuerst ist<br />
der Regenwurm auf das Essig zu gekrochen,<br />
dann h<strong>at</strong> er sich aufgerichtet und ist<br />
wieder davon gekrochen. Der Regenwurm<br />
besitzt einfache<br />
Sinneszellen, mit denen<br />
der Regenwurm Gerüche (Essig), hell und<br />
dunkel wahrnehmen kann.<br />
3) Binokular, Petrischalen,<br />
Bodentiere<br />
Wir haben folgende<br />
Bodentiere im Binokular<br />
(Stereolupe) beobachtet: Hausspinne,<br />
Streifenwanze, Hain-schnirkelschnecke,<br />
Rote Wegschnecke, Schnurfüßer, Asseln,..<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/70
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bodentiere flüchten von Wärme, Licht und<br />
Trockenheit nach unten, und fallen durch<br />
den Trichter in das Auffanggefäß. Nach<br />
einiger Zeit mit einer Pipette 1 Tropfen<br />
Wasser und Mikros auf den Objektträger –<br />
Deckglas<br />
darauf und danach im<br />
Mikroskop<br />
anschauen:<br />
wir konnten folgende<br />
Lebewesen seh en:Springschwänze,<br />
Fadenwürmer,<br />
Milben, Einzeller, Pilzfäden<br />
(Hyphen)<br />
Bestimmen von Bodentieren<br />
und Mikroorganismen<br />
mit Bestimmungsbüchern<br />
und Abbildungen<br />
Beobachtung von Bodenmikroorganismen:<br />
Herausholen von Tieren aus dem<br />
Wald<strong>boden</strong> mit Hilfe des<br />
Berlesetrichters.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/71
8. Projektwettbewerb des VCÖ „Feuer, Wasser, Erde, Luft – Umwelt, Technik @ Chemie“<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.17 Antworten zu den Rätselfragen<br />
Antworten zu den Rätselfragen/Bodentiere :<br />
1.) Bis zu 4 cm<br />
2.) Bis zu 2 m tief<br />
3.)Pilze, Falllaub, Spinneneier, Insektenlarven, totes Holz, verrottete<br />
Pflanzenreste<br />
4.)Krebstiere<br />
5.)Über 2 m lang<br />
6.) Ja, während des Wachstums<br />
7.) Es gibt Kiemen- oder Lungenschnecken<br />
8.) Beides<br />
9.) Die Kaulquappen (Frösche)<br />
10.) Metamorphose<br />
Antwort für die Masterfrage<br />
Ein Regenwurm wird bis zu 4 cm lang, deshalb braucht man 40 Regenwürmer um<br />
ein Springseil, das 1,60 m lang sein soll zu bilden.<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Lise Meitner Realgymnasium 2004/05<br />
3/72